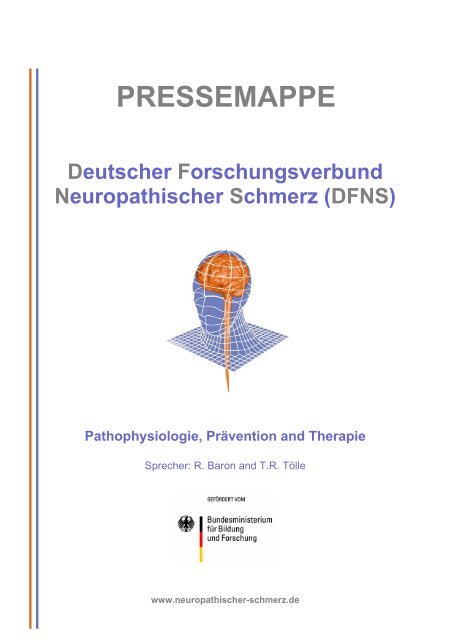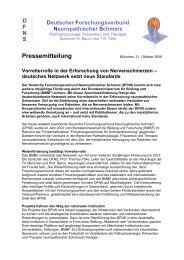PRESSEMAPPE - Neurologische Klinik und Poliklinik - TUM
PRESSEMAPPE - Neurologische Klinik und Poliklinik - TUM
PRESSEMAPPE - Neurologische Klinik und Poliklinik - TUM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>PRESSEMAPPE</strong><br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Neuropathischer Schmerz (DFNS)<br />
Pathophysiologie, Prävention and Therapie<br />
Sprecher: R. Baron and T.R. Tölle<br />
www.neuropathischer-schmerz.de
2<br />
INHALT<br />
Hintergr<strong>und</strong>informationen (S. 3 – 13)<br />
Auszug aus ausgewählten Publikationen (S. 14 – 17)<br />
CVs (S. 18 – 23)<br />
Ansprechpartner (S. 24 – 25)
3<br />
H I N T E R G R U N D I N F O R M A T I O N E N<br />
―<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz
4<br />
D<br />
F<br />
N<br />
S<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Neuropathischer Schmerz<br />
Pathophysiologie, Prävention <strong>und</strong> Therapie<br />
Sprecher: R. Baron <strong>und</strong> T.R. Tölle<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz (DFNS)<br />
Der Deutsche Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz (DFNS) wird seit 2002 im<br />
Rahmen der Fördermaßnahme "Forschungsverbünde für Schmerzforschung" durch das<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF) gefördert. Ziel des DFNS ist, die<br />
medizinische Versorgung von Patienten mit Nervenscherzen gr<strong>und</strong>legend zu verbessern.<br />
Die Aufgaben umfassen, die Mechanismen bei der Entstehung neuropathischer Schmerzen<br />
besser zu verstehen (Pathophysiologie), die Chronifizierung von Schmerzen durch ein frühes<br />
Eingreifen zu verhindern (Prävention) <strong>und</strong> die therapeutischen Möglichkeiten wesentlich zu<br />
verbessern (Therapie). Alle Projekte des DFNS sind darauf ausgerichtet, den klinischwissenschaftlichen<br />
Leitgedanken, dass jeder einzelne Schmerzmechanismus eine<br />
spezifische Therapie erfordert, die so genannte mechanismen-orientierte Therapie, in<br />
konkrete <strong>und</strong> zeitnah klinisch anwendbare Ergebnisse umzusetzen. Der DFNS vereinigt<br />
deutschlandweit auf dem Gebiet des neuropathischen Schmerzes alle wichtigen<br />
Institutionen, wissenschaftlichen Autoritäten sowie medizinischen Disziplinen <strong>und</strong> bündelt<br />
damit die vorhandene Expertise in der Patienten- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen-orientierten<br />
Schmerzforschung. Die beiden Sprecher des DFNS sind Prof. Ralf Baron, Kiel, <strong>und</strong> Prof.<br />
Thomas R. Tölle, München.<br />
Wichtige Forschungsstrategien <strong>und</strong> Aufgaben des DFNS sind:<br />
• Entwicklung einer Datensammlung von Patienten mit unterschiedlichen<br />
neuropathischen Schmerzbildern, die genaue quantitative Veränderungen der<br />
Hautsensibilität sowie psychologische Hintergründe einschließt.<br />
• Untersuchung pathophysiologischer Mechanismen, die die Entstehung <strong>und</strong><br />
Aufrechterhaltung der verschiedenen neuropathischen Schmerzbilder bedingen.<br />
• Untersuchung neuer <strong>und</strong> die Auswertung bereits verfügbarer Behandlungsstrategien.
5<br />
Projekte des DFNS<br />
Das zentrale, integrative Netzwerkprojekt ist der Aufbau einer Datenbank zu<br />
neuropathischem Schmerz. Diese Datenbank umfasst genaue quantitative Veränderungen<br />
der Hautsensibilität sowie psychologische Hintergründe von Patienten mit unterschiedlichen<br />
neuropathischen Schmerzbildern. Mitte 2007 enthielt die Datenbank r<strong>und</strong> 1200 Einträge von<br />
Patientendaten sowie etwa 180 Einträge eines ges<strong>und</strong>en Probandenkollektivs als<br />
Kontrollpatienten (Normdatenbank). Alle Verb<strong>und</strong>teilnehmer pflegen dabei vom DFNS genau<br />
definierte Patientendaten ein, die folgende Parameter einschließen: spezifische<br />
Schmerzsymptomatik, die mittels Quantitativ Sensorischer Testung (QST) erfasst wird, sowie<br />
sozioökonomische, psychosoziale <strong>und</strong> psychologische Hintergründe. Wichtiges Ziel zur<br />
Anwendung der QST-Testbatterie war die Entwicklung <strong>und</strong> Anwendung eines<br />
standardisierten Protokolls (Rolke R, Baron R, Maier C, Tölle TR, Treede RD et al. (2006) Quantitative Sensory<br />
Testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): Standardized Protocol and Reference Values. Pain<br />
123(3):231-243). Hierzu wurden die Mitarbeiter in zehn Zentren standardisiert ausgebildet<br />
(Mainz). Die auf diese Weise etablierte Datenbank liefert die Möglichkeit, die gewonnen<br />
Patientendaten mit denen des ges<strong>und</strong>en Probandenkollektivs zu vergleichen <strong>und</strong> so genaue<br />
Kriterien festzulegen, ab wann neuropathischer Schmerz vorliegt.<br />
Darüber hinaus wird eine Blut- <strong>und</strong> DNA-Bank erstellt, die es erlaubt, genetische Ursachen<br />
für die Entwicklung einer chronifizierten neuropathischen Schmerzkarriere sowie das<br />
verminderte Ansprechen auf bestimmte pharmakologische Behandlungen zu untersuchen.<br />
Die Koordination der Daten erfolgt durch ein zentrales Datenmanagementsystem QUAST<br />
(QUAlitätssicherung in der SchmerzTherapie), das gleichzeitig die Qualitätssicherung<br />
ermöglicht. Mit den Patientendaten lassen sich außerdem Kostenanalysen <strong>und</strong><br />
Symptombeschreibungen der jeweiligen Krankheit entwickeln sowie die Häufigkeit zusätzlich<br />
auftretender psychischer Erkrankungen feststellen.<br />
Gleichzeitig dienen diese Daten zur Beschreibung von Patientenmerkmalen <strong>und</strong> zur<br />
Einteilung in Patientengruppen, die in Studien zur primären <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>ären Prävention der<br />
Schmerzchronifizierung eingeschlossen werden können. In diesen Präventionsstudien wird<br />
die Effektivität von verschiedenen Substanzen in der Verhinderung <strong>und</strong> Behandlung<br />
chronischer Schmerzen untersucht. Darüber hinaus bietet die zentrale Datenbank den<br />
Zugang zu Patienten, die in speziellen Verb<strong>und</strong>projekten ausführlicher untersucht werden<br />
können. In diesem Rahmen haben sich drei themenspezifische Untergruppen formiert.
6<br />
Integrative Verb<strong>und</strong>projekte des DFNS:<br />
• Datensammlung neuropathischer Schmerz<br />
• Primärprävention neuropathischer Schmerzen<br />
• Sek<strong>und</strong>ärprävention neuropathischer Schmerzen<br />
• Aufbau einer Blut- <strong>und</strong> DNA-Bank<br />
• Validierung der Quantitativ Sensorischen Testung (QST) als klinischem Instrument<br />
zur Untersuchung neurobiologischer Mechanismen bei neuropathischem Schmerz<br />
Spezielle Verb<strong>und</strong>projekte des DFNS:<br />
• Pathophysiologische Mechanismen nach Kompression, Degeneration <strong>und</strong><br />
Regeneration peripherer Nerven<br />
• Zentrale Integration der Schmerzverarbeitung<br />
• Physiologische <strong>und</strong> psychologische Einflüsse auf die kortikale Reorganisation: Das<br />
komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS)
Zentren des DFNS<br />
7
8<br />
Beteiligte Fachdisziplinen<br />
• Neurologie<br />
• Anästhesie<br />
• Psychologie<br />
• Pharmakologie<br />
• Physiologie<br />
• Nuklearmedizin<br />
• Neuroradiologie<br />
• Neurochirurgie<br />
• Allgemeinmedizin<br />
• Interdisziplinäre Schmerzambulanzen<br />
Die einzelnen Projekte basieren ganz wesentlich auf einer b<strong>und</strong>esweit einheitlich<br />
durchzuführenden Untersuchung <strong>und</strong> Rekrutierung von Patienten mit neuropathischen<br />
Schmerzen. Die zentrale Geschäftsstelle des DFNS sichert dabei die Koordination der<br />
einzelnen Netzwerkprojekte sowie den Daten- <strong>und</strong> Informationstransfer innerhalb des<br />
Verb<strong>und</strong>es.<br />
Weiterführenden Informationen zu den Zentren, Teilnehmern <strong>und</strong> einzelnen Projekten des<br />
DFNS sind auf der Website des DFNS unter www.neuropathischer-schmerz.de abrufbar.<br />
Ausblick<br />
Durch die Integration von Gr<strong>und</strong>lagenwissenschaft, klinischer Forschung <strong>und</strong><br />
Therapiestudien wird der DFNS das Verständnis der Entstehungsmechanismen<br />
neuropathischer Schmerzen wesentlich weiterentwickeln <strong>und</strong> die Therapieoptionen dieser<br />
schweren chronischen Schmerzzustände erheblich verbessern. Das Ziel ist, die Entwicklung<br />
von chronischen neuropathischen Schmerzen durch ein frühes Eingreifen zu verhindern oder<br />
bereits chronifizierte Schmerzen durch eine differenzierte Kombination verschiedener<br />
Behandlungsstrategien zu beheben. Da die am DFNS beteiligten Zentren über ganz<br />
Deutschland verteilt sind, wird ein problemloser Transfer der neuen Erkenntnisse in die<br />
klinische Praxis der Ärzteschaft im gesamten Land garantiert.
9<br />
Mechanismen-orientierte Therapie<br />
Für eine gute Therapie ist eine korrekte Klassifikation des neuropathischen<br />
Schmerzsyndroms unerlässlich. Bislang basierte die Klassifikation ausschließlich auf der<br />
verursachenden Gr<strong>und</strong>erkrankung.<br />
Einen entscheidenden Wandel der Sichtweise hat hier folgende Erkenntnis eingeleitet:<br />
Einerseits berichten viele Patienten von exakt identischen Schmerzformen, z.B. brennende<br />
Dauerschmerzen oder Schmerzen bei leichter Berührung der Haut (Allodynie), obwohl sie an<br />
ursächlich völlig unterschiedlichen Erkrankungen leiden. Andererseits können sie jedoch<br />
auch bei gleicher Gr<strong>und</strong>erkrankung ganz unterschiedliche Symptome zeigen.<br />
Dementsprechend ist es sinnvoller, sich bei der Behandlung nicht auf die Gr<strong>und</strong>erkrankung<br />
zu konzentrieren, sondern jede einzelne Schmerzform <strong>und</strong> damit jeden einzelnen<br />
Schmerzmechanismus isoliert mit geeigneten Medikamenten anzugehen. Diese neue Idee<br />
wird als „mechanismen-orientierte Therapie“ bezeichnet <strong>und</strong> ist heutzutage international als<br />
bahnbrechende Innovation der Schmerzforschung anerkannt. Viele der im Deutschen<br />
Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz beteiligten Wissenschaftler haben<br />
maßgeblichen Anteil an der Entwicklung dieses Konzeptes.
10<br />
Quantitativ Sensorische Testung (QST)<br />
Die QST ist ein Untersuchungsverfahren, das eine genaue klinische Analyse der<br />
schmerzhaften Symptome von Patienten, die an neuropathischen Schmerzen leiden,<br />
ermöglicht. Gr<strong>und</strong>lage der QST ist die bei Patienten mit neuropathischem Schmerz<br />
charakteristisch veränderte Sensibilität, die z.B. häufig mit brennenden Spontanschmerzen<br />
<strong>und</strong> einschießenden Schmerzattacken einhergeht. Die genaue Analyse dieser Symptome<br />
liefert ein individuelles sensorisches Profil. Dieses erlaubt wiederum Rückschlüsse auf die<br />
jeweiligen, den Beschwerden zugr<strong>und</strong>e liegenden biologischen Mechanismen <strong>und</strong> damit die<br />
Ursachen der Schmerzen. Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage soll künftig eine gezielte <strong>und</strong> auf den<br />
einzelnen Patienten zugeschnittene Therapie möglich werden.<br />
Der Deutsche Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz (DFNS) konnte das QST-<br />
Verfahren durch Entwicklung <strong>und</strong> Anwendung eines standardisierten Protokolls optimieren<br />
(Rolke R et al. (2006) Quantitative Sensory Testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS):<br />
Standardized Protocol and Reference Values. Pain 123(3):231-243). Mithilfe eines ges<strong>und</strong>en<br />
Probandenkollektivs konnten zudem für jeden Test standardisierte Normwerte ermittelt<br />
werden. Der Vergleich der einzelnen QST-Messwerte mit den Normwerten erlaubt Aussagen<br />
darüber, ob neuropathischer Schmerz <strong>und</strong> welche Schmerzformen hier genau vorliegen.<br />
Die standardisierte QST-Testbatterie des DFNS geht den neuropathischen Schmerzen mit 7<br />
Tests, bei denen insgesamt 13 Parameter erfasst werden, auf den Gr<strong>und</strong>. Die Messungen<br />
für ein betroffenes Körperareal beanspruchen etwa 30 Minuten. Zur Kontrolle wird eine QST-<br />
Messung des gleichen Areals der entsprechenden ges<strong>und</strong>en Körperseite durchgeführt. Die<br />
Anwendungen erfolgen ausschließlich auf der Haut:<br />
1) Mit Hilfe einer Thermode (Peltier-Element) werden<br />
computergesteuerte Temperaturreize verabreicht <strong>und</strong> folgende<br />
Eigenschaften des Temperaturempfindens gemessen:<br />
o die Warm- <strong>und</strong> Kalt-Detektionsschwellen<br />
(Wahrnehmungsschwelle für warme <strong>und</strong> kalte Reize),<br />
o das Thermisch Sensorische Limen (Fähigkeit wechselnde<br />
warme <strong>und</strong> kalte Reize voneinander zu unterscheiden),<br />
o die paradoxe Hitzeempfindung (kalte Reize werden als heiß<br />
empf<strong>und</strong>en) sowie<br />
o die Schwellen für Kälte- <strong>und</strong> Hitzeschmerz.<br />
Thermische QST-Testung<br />
2) Mittels so genannter von Frey Haare (dünne Nylonfilamente)<br />
wird die Schwelle für Berührungswahrnehmung (taktile<br />
Detektionsschwelle) getestet.<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit v. Frey Nylonfilament
11<br />
3) Die mechanische Schmerzschwelle wird mittels Pinprick –<br />
Untersuchung erfasst. Beim Pinprick-Verfahren werden<br />
„Nadelreize“ mit Hilfe stumpfer Nadeln verabreicht. Die stumpfen<br />
Nadeln könne durch ihr variables Gewicht unterschiedliche<br />
Reizempfindungen bis hin zu einem spitzen pieksenden<br />
Schmerz erzeugen. Die Haut wird dabei nicht verletzt.<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit Pinprick<br />
4) Weiterhin werden die mechanische Schmerzsensitivität<br />
(Pinprick Hyperalgesie) <strong>und</strong> die dynamisch mechanische<br />
Allodynie (leichte Berührungsreize werden als schmerzhaft<br />
empf<strong>und</strong>en) bestimmt:<br />
o Mittels Pinprick-Untersuchung wird die Antwortkurve der<br />
Schmerzsensitivität auf Nadelreize bestimmt. Der Proband<br />
beurteilt dabei die Schmerzhaftigkeit der einzelnen<br />
Nadelreize auf einer Skala von 0-100.<br />
o Die Allodynie wird nach dem gleichen Schema untersucht,<br />
doch soll der Proband hier bewegte Berührungsreize mittels<br />
Wattebausch, Q-Tip oder Pinsel, die beim Ges<strong>und</strong>en keinen<br />
Schmerz auslösen, auf die jeweilige Schmerzintensität hin<br />
beurteilen.<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit Wattebausch zur<br />
Bestimmung der Allodynie<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit Pinsel zur Bestimmung<br />
der Allodynie<br />
5) Die Untersuchung von Veränderungen des zentralen<br />
Nervensystems, die zu einer anhaltenden Schmerzverstärkung<br />
führen – so genanntes Wind-up-Phänomen – erfolgt ebenfalls<br />
mittels Pinprick-Verfahren: Der Proband bewertet die<br />
Schmerzintensität eines einzelnen Nadelreizes auf einer Skala<br />
von 0-100 <strong>und</strong> vergleicht diese mit der einer Serie von 10<br />
Nadelreizen hintereinander.<br />
6) Die Bestimmung der Vibrationsschwelle<br />
(Wahrnehmungsschwelle für Vibration) erfolgt mit einer<br />
standardisierten Stimmgabel. Der Test ermöglicht, Störungen<br />
des Tastsinns aufzudecken.<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit Stimmgabel<br />
7) Die Druckschmerzschwelle wird mit Hilfe eines<br />
Druckalgometers gemessen. Damit lässt sich eine<br />
Überempfindlichkeit gegen stumpfen Druck bestimmen.<br />
Mechanische QST-Testung<br />
mit Druckalgometer
12<br />
Neuropathischer Schmerz<br />
Nach der Definition der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (IASP)<br />
spricht man von neuropathischem Schmerz, wenn eine Läsion oder Dysfunktion des<br />
zentralen oder peripheren Nervensystems die Ursache der Schmerzen darstellt.<br />
Umgangssprachlich werden neuropathische Schmerzen auch als "Nervenschmerzen"<br />
bezeichnet. Neuropathische Schmerzen sind meist chronisch. Patienten, die an<br />
neuropathischen Schmerzen leiden, weisen eine charakteristisch veränderte Sensibilität auf.<br />
Diese äußert sich häufig in brennenden Spontanschmerzen <strong>und</strong> einschießenden<br />
Schmerzattacken. Generell können sowohl negative sensorische Phänomene (sensible<br />
Ausfälle) als auch positive (Missempfindungen, z.B. Parästhesie, oder Überempfindlichkeit<br />
auf Reize, z.B. Allodynie) entstehen.<br />
In Deutschland leiden etwa 6 Prozent der Bevölkerung an neuropathischen Schmerzen.<br />
Circa 20 Prozent aller Patienten, die wegen Schmerzen eine schmerztherapeutische<br />
Spezialeinrichtung aufsuchen, leiden unter ungenügend therapierten neuropathischen<br />
Schmerzen. Studien belegen, dass etwa ein Fünftel aller Patienten die operiert wurden,<br />
langanhaltend, zum Teil lebenslang unter Nervenschmerzen leiden. Dabei können diese<br />
Schmerzen nach einem „leichten“ Eingriff genauso chronifizieren wie nach einem<br />
„schweren“.<br />
Zu den neuropathischen Schmerzen zählen z.B. Phantomschmerzen. 60 Prozent aller<br />
Menschen, denen Gliedmaßen amputiert wurden, sind davon betroffen. Neben den<br />
unerträglichen Schmerzen müssen sie zusätzlich mit dem Unverständnis ihrer Umgebung<br />
zurechtkommen: „Wie kann denn ein Bein schmerzen, das gar nicht mehr da ist“. Neue<br />
Studienergebnisse belegen, dass Nervenschmerzen bei 8 Prozent der Patienten mit<br />
Schlaganfällen, 20 Prozent der Diabetiker, 28 Prozent der Patienten mit Multipler Sklerose,<br />
ca. 33 Prozent der Patienten mit Tumorschmerzen, 37 Prozent der Patienten mit<br />
Rückenschmerzen <strong>und</strong> 67 Prozent der Patienten mit Rückenmarksverletzung vorkommen.<br />
Weitere Ursachen neuropathischer Schmerzen sind beispielsweise Alkoholmissbrauch,<br />
Chemotherapie <strong>und</strong> virale Erkrankungen wie die Gürtelrose.<br />
Im Verlauf der Beschwerden suchen Patienten mit neuropathischen Schmerzen über einen<br />
Zeitraum von zehn Jahren im Durchschnitt acht verschiedene Ärzte auf <strong>und</strong> sind während<br />
dieser Zeit für 72 Tage stationär im Krankenhaus untergebracht. Eine neue Erhebung aus<br />
den USA ergab, dass sich unter den Neurologen nur 30 Prozent in der Lage sahen,<br />
neuropathische Schmerzen sicher zu diagnostizieren. Nur 20 Prozent kannten eine adäquate<br />
Therapie.
13<br />
Chronischer Schmerz<br />
Laut einer europäischen Schmerzstudie (Pain in Europe Survey) leiden etwa 17 Prozent der<br />
deutschen Bevölkerung an chronischen Schmerzen, das entspricht knapp 14 Millionen<br />
Betroffenen. Bei 600.000 bis 800.000 dieser Patienten liegt ein schwer zu therapierendes<br />
Schmerzsyndrom vor: Der Schmerz hat sich verselbständigt <strong>und</strong> ist zu einer eigenständigen<br />
Krankheit, der Schmerzkrankheit, geworden. Nach einer weit verbreiteten Definition spricht<br />
man von chronischem Schmerz, wenn er länger als sechs Monate andauert oder immer<br />
wiederkehrt. Eine 1997 von der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) durchgeführte<br />
Untersuchung in acht Metropolen der Erde ergab, dass 30 Prozent aller Patienten, die eine<br />
Allgemeinarztpraxis aufgesucht hatten, im zurückliegenden Jahr mindestens sechs Monate<br />
lang an Schmerzen gelitten hatten. Chronischer Schmerz ist also eine Volkskrankheit.<br />
Trotzdem ist die Versorgung eines erheblichen Teils der Betroffenen bis heute nicht<br />
optimal. Schmerzen beeinträchtigen oft ganz erheblich das Verrichten alltäglicher Dinge.<br />
Zum Teil kann der Beruf nicht mehr ausgeübt werden, aber auch Freizeitbeschäftigungen,<br />
Partnerschaften oder Fre<strong>und</strong>schaften werden vernachlässigt. Die Folgen sind Isolation,<br />
Resignation, Verlust der Lebensfreude <strong>und</strong> Depression. Viele Betroffene begehen aus<br />
Verzweiflung Selbstmord: Mindestens 17 Prozent aller geklärten Selbstmorde wurden<br />
aufgr<strong>und</strong> chronischer Schmerzen verübt. Neben diesen enormen psychosozialen Folgen für<br />
den Einzelnen, verursacht der chronische Schmerz auch enorme Kosten für das<br />
Ges<strong>und</strong>heitssystem. Die Kosten für medizinische Leistungen <strong>und</strong> Arbeitsausfälle sowie<br />
Frühberentungen sind zu einem volkswirtschaftlichen Faktor geworden, der sich in kaum zu<br />
überblickenden Milliardensummen bewegt. Allein schmerzbedingte Arbeitsausfälle<br />
verursachen schätzungsweise Kosten von r<strong>und</strong> 20 Milliarden Euro pro Jahr.<br />
Die meisten Patienten mit chronischen Schmerzen werden in allgemeinärztlichen,<br />
internistischen <strong>und</strong> orthopädischen Praxen versorgt. Für die Mehrzahl der Betroffenen mag<br />
diese Behandlung ausreichend sein. Doch die 600.000 bis 800.000 Menschen mit schwer<br />
therapierbaren Schmerzen benötigen eine interdisziplinäre Behandlung an spezialisierten<br />
Schmerzzentren in Krankenhäusern <strong>und</strong> Praxen. Davon existieren zur Zeit in Deutschland<br />
aber nur etwa 400. Und diese können nach Einschätzungen von Experten den Bedarf<br />
lediglich zu einem Bruchteil decken.<br />
Von den klinischen Krankheitsbildern, die sich bei chronischen Schmerzpatienten zeigen,<br />
sind Kopf- <strong>und</strong> Rückenschmerzen die häufigsten. An dritter Stelle stehen neuropathische<br />
Schmerzen, die damit auch eine ges<strong>und</strong>heitspolitische Relevanz haben.
14<br />
Auszug aus ausgewählten<br />
P U B L I K A T I O N E N<br />
―<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz
18<br />
C U R R I C U L U M<br />
V I T A E<br />
―<br />
der Sprecher des<br />
Deutschen Forschungsverb<strong>und</strong>es Neuropathischer Schmerz
19<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Prof. Dr. med. Ralf Baron<br />
WISSENSCHAFTLICHER WERDEGANG<br />
1979 – 1986 Studium der Humanmedizin an der Christian-Albrechts-<br />
Universität Kiel<br />
1986 – 1988 Wissenschaftlicher Angestellter am Physiologischen Institut,<br />
Christian-Albrechts-Universität Kiel<br />
(experimentelle Neurophysiologie)<br />
1987 Promotion (summa cum laude)<br />
1988 – 1995 Wissenschaftlicher Assistent an der <strong>Klinik</strong> für Neurologie <strong>und</strong><br />
Psychiatrie, Christian-Albrechts-Universität Kiel<br />
1994 Facharzt für Neurologie<br />
Februar 1995<br />
Seit April 1995<br />
Seit 1996<br />
Habilitation für Neurologie<br />
Oberarzt an der <strong>Klinik</strong> für Neurologie, Christian-Albrechts-<br />
Universität Kiel<br />
Leitender Oberarzt der <strong>Klinik</strong> für Neurologie, Christian-<br />
Albrechts-Universität Kiel<br />
1998 Visiting Professor of Neurology an der University of California,<br />
San Francisco, USA (Prof. Dr. H. L. Fields)<br />
Seit 1999<br />
Stellvertretender Direktor der <strong>Klinik</strong> für Neurologie, Christian-<br />
Albrechts-Universität Kiel
20<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Prof. Dr. med. Ralf Baron<br />
Februar 2000<br />
Oktober 2001<br />
August 2004<br />
Ernennung zum außerplanmäßigen Professor<br />
C3-Professor an der <strong>Klinik</strong> für Neurologie, Christian-Albrechts-<br />
Universität Kiel<br />
Leiter der Sektion „<strong>Neurologische</strong> Schmerzforschung <strong>und</strong><br />
Therapie“, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus<br />
Kiel<br />
WISSENSCHAFTLICHE SCHWERPUNKTE<br />
• Pathophysiologie<br />
• Elektrophysiologie<br />
• <strong>Klinik</strong> <strong>und</strong> Therapie von Erkrankungen des autonomen<br />
Systems<br />
• <strong>Klinik</strong> <strong>und</strong> Therapie peripherer Neuropathien <strong>und</strong><br />
neuropathischer Schmerzsyndrome sowie anderer<br />
Schmerzsyndrome<br />
• Funktionelle Bildgebung (fMRI, MEG) bei experimentellen<br />
<strong>und</strong> neuropathischen Schmerzsyndromen<br />
AUSZEICHNUNGEN<br />
1993 Förderpreis für Schmerzforschung der „Deutschen Gesellschaft<br />
zum Studium des Schmerzes“ (DGSS)<br />
2001 Heinrich Pette Preis der<br />
„Deutschen <strong>Neurologische</strong>n Gesellschaft“<br />
2003 Deutscher Schmerzpreis<br />
2003 Sertürner Preis<br />
MITGLIEDSCHAFTEN<br />
1999 – 2002 Committee on Research (International Association for the<br />
Study of Pain, IASP)
21<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Prof. Dr. med. Ralf Baron<br />
Seit 1996<br />
Seit 1996<br />
Seit 1996<br />
Seit 1998<br />
Beirat Arbeitskreis Autonomes Nervensystem<br />
(Deutsche <strong>Neurologische</strong> Gesellschaft)<br />
Forschungskommission (Deutsche Gesellschaft zum<br />
Studium des Schmerzes)<br />
Vorstand der „Special Interest Group“ der IASP<br />
– Sympathetic Nervous System and Pain<br />
Beirat des Arbeitskreises Schmerz (Deutsche <strong>Neurologische</strong><br />
Gesellschaft)<br />
1999 - 2004 Generalsekretär (Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für<br />
Schmerztherapie, DIVS)<br />
Seit 2005<br />
Beirat der „Special Interest Group" der IASP<br />
Neuropathic Pain
22<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thomas R. Tölle<br />
Professor Thomas R. Tölle, ausgebildeter Neurologe <strong>und</strong> Psychologe, hat verschiedene<br />
Positionen an der <strong>Neurologische</strong>n <strong>Klinik</strong> der Technischen Universität München inne: Er ist<br />
Facharzt für Neurologie, Oberarzt in der <strong>Klinik</strong>, Geschäftsführender Oberarzt des Zentrums<br />
für Interdisziplinäre Schmerztherapie sowie Extraordinarius für Neurologie. Zum<br />
außerplanmäßigen Professor für medizinische Psychologie <strong>und</strong> Neurobiologie wurde Herr<br />
Tölle von der Ludwig-Maximilians-Universität München ernannt.<br />
Herr Professor Tölle absolvierte das Studium der Medizin <strong>und</strong> Psychologie an den<br />
Universitäten Bochum, Frankfurt, Düsseldorf <strong>und</strong> München. Er promovierte zum Dr. rer. nat.<br />
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität in Düsseldorf. Seinen medizinischen<br />
Doktorgrad erhielt er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit Arbeiten, die er<br />
in der Gr<strong>und</strong>lagenforschung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie zu Themen der<br />
Chronifizierung von Schmerzen durchführte. In dieser Zeit absolvierte er wissenschaftliche<br />
Auslandsaufenthalte am Institut für Histologie, Universität Porto, Portugal <strong>und</strong> am MRC,<br />
Cambridge, England in der Abteilung für Neurobiologie. Nach klinischer Tätigkeit am Max-<br />
Planck-Institut für Psychiatrie wechselte er 1995 an die <strong>Neurologische</strong> <strong>Klinik</strong> der<br />
Technischen Universität München <strong>und</strong> baute eine interdisziplinäre Forschungsgruppe für<br />
klinische <strong>und</strong> experimentelle Schmerzforschung mit Schwerpunkten zu neurobiologischen<br />
Mechanismen neuronaler Plastizität bei Schmerz, pharmakologischer Behandlung <strong>und</strong><br />
zentraler Bildgebung mit fMRI (funktionelle Magnetresonanz-Tomographie) <strong>und</strong> PET<br />
(Positronen-Emissions-Tomographie) auf.
23<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thomas R. Tölle<br />
Herr Professor Tölle ist Mitglied verschiedener nationaler <strong>und</strong> internationaler Gesellschaften<br />
auf den Gebieten Neurologie <strong>und</strong> Schmerz. Als ehemaliger Vizepräsident ist er im Beirat der<br />
Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS), deren Jahreskongress er<br />
1999 in München leitete. Im Auftrag des B<strong>und</strong>esministeriums für Bildung <strong>und</strong> Forschung<br />
(BMBF) ist er Sprecher des Deutschen Forschungsverb<strong>und</strong>es Neuropathischer Schmerz<br />
(DFNS). Er hat eine Vielzahl von Fachartikeln, Reviews <strong>und</strong> Buchkapiteln veröffentlicht, ist<br />
international unter anderem Mitglied im Editorial Board der Fachzeitschrift Pain <strong>und</strong> Tutor für<br />
die Alexander-von-Humboldt-Stiftung.
24<br />
A N S P R E C H P A R T N E R<br />
―<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong> Neuropathischer Schmerz
D<br />
F<br />
N<br />
S<br />
25<br />
Deutscher Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Neuropathischer Schmerz<br />
Pathophysiologie, Prävention <strong>und</strong> Therapie<br />
Sprecher: R. Baron <strong>und</strong> T.R. Tölle<br />
Sprecher des DFNS<br />
Prof. Dr. med. Ralf Baron<br />
Sektion für <strong>Neurologische</strong> Schmerzforschung <strong>und</strong> -therapie<br />
<strong>Klinik</strong> für Neurologie<br />
Campus Kiel<br />
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein<br />
Haus 41, Arnold-Heller-Straße 3<br />
24105 Kiel<br />
Tel.: +49-431-597-8504<br />
Fax: +49-431-597-8530<br />
e-mail: r.baron@neurologie.uni-kiel.de<br />
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thomas R. Tölle, Dipl. Psych.<br />
<strong>Neurologische</strong> <strong>Klinik</strong> <strong>und</strong> <strong>Poliklinik</strong> im Neuro-Kopf-Zentrum<br />
<strong>Klinik</strong>um rechts der Isar der Technischen Universität München<br />
Ismaninger Str. 22<br />
81675 München<br />
Tel.: +49-89-4140-4658<br />
Fax: +49-89-4140-4659<br />
e-mail: toelle@lrz.tum.de<br />
Pressekontakt DFNS:<br />
Vedrana Romanovic<br />
Geschäftsstelle DFNS<br />
<strong>Neurologische</strong> <strong>Klinik</strong> <strong>und</strong> <strong>Poliklinik</strong> im Neuro-Kopf-Zentrum<br />
<strong>Klinik</strong>um rechts der Isar der Technischen Universität München<br />
Ismaninger Str. 22<br />
81675 München<br />
Tel.: +49-89-4140-4628<br />
Fax: +49-89-4140-4659<br />
e-mail: romanovic@lrz.tum.de