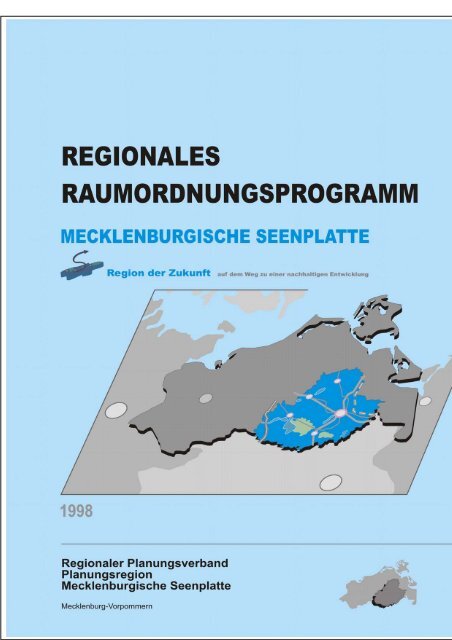Teil I ÜBERFACHLICHE ZIELE und Begründungen 1 ...
Teil I ÜBERFACHLICHE ZIELE und Begründungen 1 ...
Teil I ÜBERFACHLICHE ZIELE und Begründungen 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Achsen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
REGIONALES RAUMORDNUNGSPROGRAMM<br />
MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE<br />
1998
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Regionaler Planungsverband der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte<br />
Geschäftsstelle: c<br />
/o Amt für Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung Mecklenburgische<br />
Seenplatte<br />
Postanschrift: Behördenzentrum, Postfach 2108, 17011 Neubrandenburg<br />
Hausanschrift: Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg, � 0395-380 29 73,<br />
Fax 0395-380 29 70<br />
Bearbeitung:<br />
Amt für Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte<br />
Kartographie:<br />
Amt für Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte;<br />
IfGDV - Institut für Geodatenverarbeitung, Hinrichshagen � 03834-594724,<br />
Fax 03834-594725<br />
Technische Herstellung:<br />
Broschüre: Obotritendruck GmbH Schwerin<br />
Karte (M 1 : 100 000): Abel Druck KG Dortm<strong>und</strong><br />
Diese Broschüre ist ein Sonderdruck des Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblattes des Landes<br />
Mecklenburg-Vorpommern vom 22. Juli 1998.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Vorwort<br />
Vorwort<br />
Mit der Festsetzung als Landesverordnung liegt nun das Regionale Raumordnungsprogramm als ein<br />
verbindliches Planzielwerk für eine raumordnerisch abgestimmte Entwicklung der Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte vor.<br />
Die Folgen der Verwirklichung der deutschen Einheit, die Vollendung des europäischen<br />
Binnenmarktes <strong>und</strong> die Öffnung der europäischen Gemeinschaft nach Osteuropa, die Bewältigung<br />
des wirtschaftlichen Strukturwandels, die Sicherung der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen sowie eine<br />
sinnvolle Steuerung der verschiedenen, oft miteinander divergierenden Raumansprüche sind<br />
Herausforderungen, die ein aufeinander abgestimmtes Handeln der Kommunen <strong>und</strong> Kreise auf<br />
regionaler Ebene erfordern.<br />
Das Programm enthält hierzu umfassende Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Ziele für die Beurteilung von<br />
kommunalen Bauleitplänen <strong>und</strong> von raumbezogenen Planungen <strong>und</strong> Vorhaben anderer öffentlicher<br />
Planungsträger. Es soll aber auch privaten Investoren <strong>und</strong> Bauherren eine Orientierung für ihre<br />
Standortentscheidungen in der Region bieten <strong>und</strong> zum effektiven Einsatz von öffentlichen Mitteln<br />
beitragen. Das Programm stellt somit ein wichtiges formelles Instrument für die nachhaltige Entwicklung<br />
unserer Region dar.<br />
Seine Wirkung wird das Programm insbesondere durch die Umsetzung konkreter Projekte entfalten.<br />
Um diese notwendige Umsetzungsarbeit vor Ort stärken zu können, hat der Regionale Planungsverband<br />
mit Unterstützung des Amtes für Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung darauf hingewirkt, daß<br />
unsere Planungsregion Modellregion des B<strong>und</strong>es zur Erprobung des projektorientierten Prozesses<br />
„Regionalkonferenz“ wurde. Erste konkrete Ergebnisse haben sich bereits in kurzer Zeit eingestellt.<br />
Mit diesem Instrument „Regionalkonferenz“ konnte sich die Planungsregion Mecklenburgische<br />
Seenplatte erfolgreich für den b<strong>und</strong>esweiten Wettbewerb „Regionen der Zukunft“ qualifizieren <strong>und</strong><br />
erhielt das Prädikat „Region der Zukunft - auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung“.<br />
Durch die transnationale Zusammenarbeit mit ähnlich strukturierten Regionen im Ostseeraum (in<br />
Schweden, Polen <strong>und</strong> Lettland) trägt der Regionale Planungsverband zum internationalen Austausch<br />
über die umsetzungsorientierte Regionalentwicklung bei <strong>und</strong> sorgt dafür, daß die Region aktiv an<br />
der Entwicklung des Ostseeraumes teilnimmt.<br />
Um das Regionale Raumordnungsprogramm auch mittels dieser Initiativen mit Leben zu erfüllen, ist<br />
weiterhin die verstärkte Mitwirkung aller regionalen Akteure (Bürgermeister <strong>und</strong><br />
Gemeindevertreter, Unternehmer, Vereine, Verbände etc.) <strong>und</strong> deren Unterstützung durch die<br />
Vertreter der kommunalen <strong>und</strong> kreislichen Verwaltungen, durch das Amt für Raumordnung <strong>und</strong><br />
Landesplanung sowie durch die weiteren Ressorts der Landesregierung in dem Prozeß<br />
„Regionalkonferenz“ notwendig.<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm wird sich insbesondere auf Gr<strong>und</strong> des weiter anhaltenden<br />
Strukturwandels in der Region immer wieder geänderten Anforderungen neu stellen müssen <strong>und</strong><br />
neue Aufgaben <strong>und</strong> Probleme im Rahmen der Fortschreibung zu lösen haben. Das liegt in der Natur<br />
der Sache. Denn: Planung ist ein Prozeß!<br />
Neubrandenburg, den 22.7.1998<br />
Gert Schultz<br />
Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes<br />
Mecklenburgische Seenplatte<br />
5
6<br />
Inhalt RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
Einführung 11<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze 14<br />
Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen 14<br />
Planungsraum 14<br />
Planungsinhalt <strong>und</strong> Verbindlichkeit 14<br />
Regionale Entwicklungsgr<strong>und</strong>sätze 15<br />
Bevölkerung 18<br />
Bevölkerungsentwicklung gesamt 18<br />
Wanderungen (Zu- <strong>und</strong> Wegzüge) 20<br />
Natürliche Bevölkerungsentwicklung 22<br />
Altersstruktur 22<br />
Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2010 23<br />
Arbeitsmarkt 24<br />
TEIL I <strong>ÜBERFACHLICHE</strong> <strong>ZIELE</strong> <strong>und</strong> <strong>Begründungen</strong> 29<br />
1. Raumkategorien 29<br />
1.1 Ordnungsraum Neubrandenburg 29<br />
1.2 Ländliche Räume 30<br />
2. Zentrale Orte 33<br />
2.1 Allgemeine Ziele 33<br />
2.2 Zentralörtliche Gliederung 34<br />
3. Achsen 37<br />
3.1 Überregionale Achsen 37<br />
3.2 Innerregionale Achsen 38
RROP Mecklenburgische Seenplatte Inhalt<br />
TEIL II FACHLICHE <strong>ZIELE</strong> <strong>und</strong> <strong>Begründungen</strong> 39<br />
4. Natur <strong>und</strong> Landschaft 39<br />
4.1 Allgemeine Ziele 39<br />
4.2 Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen 40<br />
4.2.1 Boden 40<br />
4.2.2 Wasser 42<br />
4.2.3 Luft / Klima 45<br />
4.2.4 Wald 46<br />
4.2.5 Pflanzen- <strong>und</strong> Tierwelt / Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz 48<br />
4.3 Landschaft / Landschaftsentwicklung 49<br />
4.4 Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume 51<br />
5. Siedlungswesen 55<br />
5.1 Siedlungsstruktur 55<br />
5.1.1 Allgemeine siedlungsstrukturelle Entwicklung 55<br />
5.1.2 Siedlungsentwicklung in zentralen Orten 56<br />
5.1.3 Siedlungsentwicklung in Gemeinden ohne zentrale Bedeutung 56<br />
5.1.4 Schwerpunkte der Siedlungstätigkeit im Ordnungsraum Neubrandenburg 57<br />
5.1.5 Siedlungsbezogene Freiraumsicherung 58<br />
5.2 Stadt- <strong>und</strong> Dorfentwicklung 60<br />
5.2.1 Allgemeines 60<br />
5.2.2 Stadtentwicklung 62<br />
5.2.3 Dorfentwicklung 63<br />
5.3 Wohnungswesen 65<br />
5.4 Gewerbliche Siedlungsentwicklung 67<br />
5.4.1 Regional bedeutsame Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe 69<br />
5.4.2 Standorte für produzierendes Gewerbe <strong>und</strong> Dienstleistungen in den<br />
Ländlichen Zentralorten <strong>und</strong> Gemeinden ohne zentrale Bedeutung 70<br />
5.5 Einzel- <strong>und</strong> Großhandelseinrichtungen 71<br />
5.5.1 Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelseinrichtungen 71<br />
5.5.2 Standorte für Großhandelseinrichtungen (funktioneller Großhandel) 71<br />
7
8<br />
Inhalt RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
6. Wirtschaft 73<br />
6.1 Allgemeines 73<br />
6.2 Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Fischerei 74<br />
6.2.1 Landwirtschaft 74<br />
6.2.2 Forstwirtschaft 78<br />
6.2.3 Fischerei 79<br />
6.3 Rohstoffsicherung <strong>und</strong> -gewinnung 80<br />
6.3.1 Sicherung 80<br />
6.3.2 Gewinnung 84<br />
6.3.3 Renaturierung <strong>und</strong> Rekultivierung 87<br />
6.4 Produzierendes Gewerbe 89<br />
6.5 Handel, Handwerk <strong>und</strong> private Dienstleistungen 91<br />
6.5.1 Einzelhandel 91<br />
6.5.2 Handwerk <strong>und</strong> private Dienstleistungen 93<br />
7. Tourismus <strong>und</strong> Naherholung 95<br />
7.1 Allgemeines 95<br />
7.2 Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung 96<br />
7.2.1 Tourismusschwerpunkträume 97<br />
7.2.2 Tourismusentwicklungsräume 100<br />
7.2.3 Tourismus im Bereich von Großschutzgebieten <strong>und</strong><br />
historischen Kulturlandschaften 101<br />
7.3 Städte- <strong>und</strong> Kulturtourismus 102<br />
7.4 Gewässerbezogene Tourismusformen 105<br />
7.5 Rad-, Reit- <strong>und</strong> Wandertourismus 107<br />
7.6 Touristische Anlagen 108<br />
7.6.1 Freizeitwohnanlagen, Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze 108<br />
7.6.2 Größere Freizeit- <strong>und</strong> Beherbergungsanlagen 110<br />
7.7 Naherholung 114<br />
8. Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur 115
RROP Mecklenburgische Seenplatte Inhalt<br />
8.1 Ges<strong>und</strong>heitswesen 115<br />
8.1.1 Stationäre ärztliche Versorgung 115<br />
8.1.2 Ambulante ärztliche Versorgung 116<br />
8.2 Soziale Dienste <strong>und</strong> Einrichtungen 116<br />
8.2.1 Altenbetreuung 117<br />
8.2.2 Behindertenbetreuung 117<br />
8.2.3 Sozialstationen <strong>und</strong> soziale Beratungsdienste 118<br />
8.2.4 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen 119<br />
8.3 Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungswesen 119<br />
8.3.1 Kindertagesbetreuung 119<br />
8.3.2 Allgemeinbildende Schulen 120<br />
8.3.3 Förderschulen 122<br />
8.3.4 Berufsbildungseinrichtungen 123<br />
8.3.5 Einrichtungen der Weiterbildung 123<br />
8.4 Hochschulen <strong>und</strong> Forschungseinrichtungen 124<br />
8.5 Jugendhilfe 125<br />
8.6 Sport 126<br />
8.7 Kultur 127<br />
8.8 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 128<br />
9. Verkehr 131<br />
9.1 Allgemeines 131<br />
9.2 Öffentlicher Personenverkehr 133<br />
9.3 Schienenverkehr 136<br />
9.4 Straßenverkehr 139<br />
9.5 Binnenschiffahrt <strong>und</strong> Häfen 144<br />
9.6 Luftverkehr 145<br />
10. Sonstige technische Infrastruktur 147<br />
10.1 Kommunikation 147<br />
10.2 Wasserwirtschaft 149<br />
10.2.1 Wasserversorgung 149<br />
10.2.2 Abwasserbeseitigung 151<br />
10.3 Energieversorgung 153<br />
9
10<br />
Inhalt RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
10.3.1 Allgemeines 153<br />
10.3.2 Stromversorgung 154<br />
10.3.3 Gasversorgung 154<br />
10.3.4 Nutzung regenerativer Energien 155<br />
10.4 Abfallwirtschaft 158<br />
10.5 Immissionsschutz 160<br />
11. Verteidigung <strong>und</strong> Konversion 163<br />
11.1 Verteidigung 163<br />
11.2 Konversion 164<br />
Anhang 167<br />
Anlage 1:<br />
Erläuterungen <strong>und</strong> Definitionen zum zentralörtlichen System in Mecklenburg-<br />
Vorpommern (auszugsweise nachrichtliche Übernahme von 2.1 LROP) 169<br />
Anlage 2:<br />
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete <strong>und</strong> Naturparke in der<br />
Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte (Stand: Dezember 1996) 172<br />
Anlage 3:<br />
Bergbauberechtigungen mit Übersichtskarte (Stand: 19.11.1996) 175<br />
(nachrichtliche Übernahme vom Bergamt Strals<strong>und</strong>)<br />
Tabellen<br />
Nr. Titel<br />
Seite<br />
1 Bevölkerungsentwicklung von 1989 bis 1996 19<br />
2 Faktoren der Bevölkerungsentwicklung von 1990 bis 1996 (in %) 20<br />
3 Wanderungsgewinne <strong>und</strong> Wanderungsverluste von 1990 bis 1996 21<br />
4 Wanderungssalden je 1.000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung nach<br />
Altersgruppen 1990 bis 1996 21<br />
5 Lebendgeborenen- bzw. Gestorbenenüberschüsse von 1990 bis 1996 22<br />
6 Relationen von ausgewählten Altersgruppen 1989 <strong>und</strong> 1996 <strong>und</strong> Entwicklung in<br />
diesem Zeitraum 23<br />
7 Regionale Bevölkerungsvorausberechnung M-V 2010 für
RROP Mecklenburgische Seenplatte Inhalt<br />
die Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte 24<br />
8 Entwicklung der Relationen der Bevölkerung nach Altersgruppen<br />
von 1995 bis 2010 (in %) 24<br />
9 Erwerbstätige am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern 1989 <strong>und</strong> 1996<br />
nach Wirtschaftsbereichen (Jahresdurchschnittsberechnungen) 25<br />
10 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (31.12.1996) 25<br />
11 Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 1990 bis 1997 26<br />
12 Zentrale Orte <strong>und</strong> ihre Verflechtungsbereiche in der Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte (EW 31.12.1996) 35<br />
13 Anzahl der Siedlungen nach Größenklassen (Stand: 1996) 55<br />
14 Grünzäsuren 59<br />
15 Landwirtschaftliche Strukturdaten nach Landkreisen (Stand: August 1996) 75<br />
16 Waldanteil in % (Stand: 1996) 79<br />
17 Bergbauliche Tätigkeiten in den Landkreisen <strong>und</strong> in der Stadt Neubrandenburg<br />
(Stand: Dezember 1995) 81<br />
18 Vorranggebiete Rohstoffsicherung 82<br />
19 Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung 83<br />
20 Standorte der Steine <strong>und</strong> Erden verarbeitenden Industrie nach Branchen 91<br />
21 Krankenhausplan 1997 116<br />
22 Allgemeinbildende Schulen im Schuljahr 1996/97 121<br />
23 Prognose zur Entwicklung der Personen im Schulalter nach Schulbereichen<br />
der Jahre 1994 bis 2010 (ohne Wanderung, ger<strong>und</strong>ete Zahlen) 121<br />
24 Ehemals militärisch genutzte Flächen (Konversionsflächen) 165<br />
Abbildungen<br />
Nr. Titel<br />
Seite<br />
1 Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte (Übersicht) 13<br />
2 Altersaufbau der Bevölkerung am 31.12.1996 in der Planungsregion 27<br />
3 Entwicklung der Bevölkerung seit 1985 in der Planungsregion 28<br />
4 Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion seit September 1990 28<br />
5 Relative Häufigkeiten der Ackerzahlen in der Planungsregion (in %) 76<br />
6 Entwicklung der Personen im Schulalter nach Schulbereichen<br />
der Jahre 1994 bis 2010 (ohne Wanderung, ger<strong>und</strong>ete Zahlen) 122<br />
11
12<br />
Inhalt RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Karten<br />
Karte des Regionalen Raumordnungsprogramms (M 1 : 100 000) siehe Kartentasche<br />
Erläuterungskarten<br />
Nr. Titel<br />
zwischen Seite<br />
1 Bevölkerungsdichte nach Gemeinden 28/29<br />
2 Raumkategorien 32/33<br />
3 Zentrale Orte <strong>und</strong> ihre Verflechtungsbereiche 36/37<br />
4 Naturraumeinheiten 54/55<br />
5 Oberflächengewässer 54/55<br />
6 Unzerschnittene <strong>und</strong> störungsarme Räume 54/55<br />
7 Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege 54/55<br />
8 Regionale Verteilung der Ackerzahlen 94/95<br />
9 Waldmehrungsgebiete 94/95<br />
10 Tourismus <strong>und</strong> Naherholung 114/115<br />
11 Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur 130/131<br />
12 Funktionales Straßennetz 146/147<br />
13 Technische Infrastruktur 162/163<br />
14 Konversionsflächen 166/167<br />
Abkürzungen:<br />
LROP Erstes Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern<br />
RROP Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte<br />
GVOBl. M-V Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblatt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
AmtsBl. M-V Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern<br />
BGBl. I B<strong>und</strong>esgesetzblatt <strong>Teil</strong> I<br />
Gbl. DDR Gesetzblatt der DDR<br />
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
RROP Mecklenburgische Seenplatte Einführung<br />
Einführung<br />
Der Regionale Planungsverband hat auf seiner Verbandsversammlung am 10. Dezember<br />
1993 die Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes für die Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte beschlossen (Beschluß 5/93) <strong>und</strong> das Amt für Raumordnung<br />
<strong>und</strong> Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte nach § 9 Abs. 1 Landesplanungsgesetz<br />
vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes<br />
vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), mit der Erarbeitung beauftragt.<br />
Als Entwurf wurde das Regionale Raumordnungsprogramm in der Sitzung der<br />
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes am 23. Juni 1995 beschlossen<br />
(Beschluß 5/95). Dieser Entwurf hat als Gr<strong>und</strong>lage für das Beteiligungsverfahren gemäß §<br />
9 Abs. 3 Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), gedient. An der<br />
Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms wurden 249 Gemeinden <strong>und</strong> 3<br />
Landkreise sowie 76 sonstige öffentliche Planungsträger beteiligt.<br />
Der Entwurf wurde entsprechend den Anregungen <strong>und</strong> Bedenken aus dem Beteiligungsverfahren<br />
überarbeitet <strong>und</strong> in der Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes<br />
am 22. April 1997 abschließend diskutiert <strong>und</strong> als Regionales Raumordnungsprogramm<br />
beschlossen (Beschluß VV2/97).<br />
Mit der Landesverordnung über das Regionale Raumordnungsprogramm vom 22. Juli 1998<br />
(GVOBl. M-V S. 644) wurde das vorliegende Raumordnungsprogramm gemäß § 9 Abs. 3<br />
Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch<br />
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), für verbindlich erklärt.<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm stellt ein fachübergreifendes Planwerk für die<br />
räumliche Entwicklung der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte dar. Es soll dazu<br />
beitragen, die vorhandenen regionalen Potentiale zu erhalten, zu stärken <strong>und</strong> für die nachhaltige<br />
Entwicklung der Region optimal zu nutzen. Dazu legt das Programm in<br />
Ausformung <strong>und</strong> Konkretisierung des Ersten Landesraumordnungsprogramms<br />
Mecklenburg-Vorpommern ein Gr<strong>und</strong>gerüst für die Entwicklung der Raum- <strong>und</strong><br />
Siedlungsstruktur fest, weist Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete sowie Vorsorgeräume aus <strong>und</strong><br />
nimmt räumliche Funktionszuweisungen sowie regional bedeutsame Einzelfestlegungen<br />
vor.<br />
Die Planungsregion umfaßt eine Fläche von 5.810 km 2. Davon sind 60,8 %<br />
Landwirtschaftsfläche, 23,1 % Waldfläche <strong>und</strong> 8,7 % Wasserfläche (Stand 1996). Ihre Lage<br />
im südöstlichen <strong>Teil</strong> des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellt sich als peripher zur<br />
Landeshauptstadt Schwerin (150 km) sowie zu den nächsten größeren Städten <strong>und</strong><br />
Ballungsräumen Rostock (100 km), Berlin (140 km), Stettin (100 km), Lübeck (210 km)<br />
<strong>und</strong> Hamburg (230 km) dar. Innerhalb des Küstenlandes Mecklenburg-Vorpommern nimmt<br />
die Region eine Binnenlage ein. Ihre nördlichen <strong>Teil</strong>räume liegen 30 km <strong>und</strong> mehr von der<br />
Küste entfernt. Aus den südlichen <strong>Teil</strong>räumen beträgt die Entfernung zur Küste 100 km <strong>und</strong><br />
13
14<br />
Einführung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
mehr. Als angrenzende Planungsregionen befinden sich im Nordosten die Region<br />
Vorpommern, im Nordwesten die Region Mittleres Mecklenburg/Rostock <strong>und</strong> im Westen<br />
die Region Westmecklenburg. Südlich grenzt das Land Brandenburg an.<br />
Im nordöstlichen <strong>Teil</strong> der Planungsregion dominieren flachwellige Gr<strong>und</strong>moränen mit<br />
lehmigen Böden als offene Agrarlandschaften. Der südliche <strong>und</strong> der westliche <strong>Teil</strong> der<br />
Region ist als kuppige Endmoränen- <strong>und</strong> Beckenlandschaft (Malchiner- <strong>und</strong><br />
Tollensebecken) mit südlich angrenzenden flachwelligen Sandern durch eine reiche<br />
Naturraumausstattung mit zahllosen miteinander verb<strong>und</strong>enen Seen <strong>und</strong> Fließgewässern<br />
<strong>und</strong> großräumigen Waldbeständen sowie durch wertvolle Kulturlandschaften geprägt. Nach<br />
diesem Landschaftsraum wurde die Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte benannt.<br />
Mit Stand des Jahres 1996 nehmen 37,5 % der Gesamtfläche der Planungsregion<br />
Schutzgebiete für Natur <strong>und</strong> Landschaft (Müritz-Nationalpark, Naturparke,<br />
Naturschutzgebiete <strong>und</strong> Landschaftsschutzgebiete) ein.<br />
Die Planungsregion weist im Vergleich zum Landesdurchschnitt <strong>und</strong> zu anderen Regionen<br />
in Deutschland eine äußerst geringe Bevölkerungsdichte von nur 58 Einwohnern/km 2 auf,<br />
darunter im Durchschnitt der Landgemeinden 23 Einwohner/km 2. Die Siedlungsstruktur ist<br />
durch eine Vielzahl von kleinen Siedlungseinheiten mit weniger als 50 Einwohnern (51 %<br />
aller Siedlungen) <strong>und</strong> nur 4 Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern gekennzeichnet (siehe<br />
Programmsatz 5.1.1). Das einzige Oberzentrum in der Region stellt mit 77.312 Einwohnern<br />
die Stadt Neubrandenburg dar, gefolgt von der Stadt Neustrelitz als Mittelzentrum mit<br />
24.363 Einwohnern (Stand: 31.12.1997). Entsprechend gering ist die Tragfähigkeit <strong>und</strong><br />
Leistungskraft dieser flächenhaften Siedlungsstruktur.<br />
Die wirtschaftliche Situation in der Planungsregion ist - wie insgesamt in den neuen<br />
B<strong>und</strong>esländern - durch eine tiefgreifende Strukturanpassung an das marktwirtschaftliche<br />
System geprägt.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Einführung<br />
Abbildung 1:<br />
Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte (Übersicht)<br />
Planungsregion gesamt:<br />
Bevölkerung: 334.100 Einwohner (= 18,5 % der Gesamtbevölkerung des Landes)<br />
Fläche: 5.810 km 2 (= 25,1 % der Gesamtfläche des Landes)<br />
Ø Bevölkerungsdichte: 58 Einwohner/km 2 (Land: 78 Einwohner/km 2)<br />
Anzahl der Gemeinden: 249 (= 23,2 % aller Gemeinden des Landes)<br />
Stand: 31.12.1997<br />
15
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm ist auf der Gr<strong>und</strong>lage des Landesplanungsgesetzes<br />
vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes<br />
vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), <strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage der Richtlinie des<br />
Wirtschaftsministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsbehörde)<br />
zur Ausarbeitung <strong>und</strong> Aufstellung Regionaler Raumordnungsprogramme in der Fassung<br />
vom 8. Juni 1993, ergänzt <strong>und</strong> geändert am 18. Mai 1994, sowie durch das Ministerium für<br />
Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsbehörde)<br />
ergänzt <strong>und</strong> geändert am 14. Juli 1995, aufgestellt. Gemäß § 8 Abs. 1<br />
Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch<br />
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), wurde das Regionale<br />
Raumordnungsprogramm aus dem Ersten Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-<br />
Vorpommern in der durch die Landesverordnung vom 16. Juli 1993 (GVOBl. M-V S. 733)<br />
für verbindlich erklärten Fassung entwickelt. Bei der Aufstellung des Programms wurde der<br />
bereits aktuell verfügbare Arbeitsstand des Landesamtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur<br />
Mecklenburg-Vorpommern am "Ersten Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan für die<br />
Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte" berücksichtigt, soweit dessen Inhalt bereits<br />
den dafür erforderlichen regionalspezifischen Konkretheitsgrad besitzt.<br />
Planungsraum<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm umfaßt als Planungsraum die gesamte Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte. Zu dieser Region gehören gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4<br />
Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch<br />
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), die Landkreise Demmin,<br />
Mecklenburg-Strelitz, Müritz <strong>und</strong> die kreisfreie Stadt Neubrandenburg (siehe Abbildung 1).<br />
Planungsinhalt <strong>und</strong> Verbindlichkeit<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm legt in Text <strong>und</strong> Karte (M 1 : 100 000) Ziele fest,<br />
die entsprechend § 4 Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388),<br />
zur räumlichen Entwicklung der Region dienen sollen. Text <strong>und</strong> Karte sind gemeinsam<br />
Bestandteil des Regionalen Raumordnungsprogramms.<br />
Die Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms in den <strong>Teil</strong>en I <strong>und</strong> II sind nach der<br />
Verbindlichkeitserklärung gemäß § 9 Landesplanungsgesetz vom 31. März 1992 (GVOBl.<br />
M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl.<br />
M-V S. 388), verbindliche Ziele der Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung. Sie sind von allen<br />
Behörden <strong>und</strong> öffentlichen Planungsträgern sowie von allen Körperschaften, Anstalten <strong>und</strong><br />
Stiftungen des öffentlichen Rechts bei raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong><br />
Maßnahmen zu beachten (§ 5 Abs. 1 LPlG), soweit sie räumlich <strong>und</strong> sachlich hinreichend<br />
16
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
konkrete Aussagen treffen. Entsprechendes gilt für die Bauleitpläne, die gemäß § 1 Abs. 4<br />
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S.<br />
2141) den Zielen anzupassen sind.<br />
Zeitpunkt <strong>und</strong> Umfang der Verwirklichung der Planungen <strong>und</strong> Maßnahmen unterliegen<br />
nicht den Zielsetzungen der Regionalplanung. Sofern hierfür öffentliche Mittel in Anspruch<br />
genommen werden, bemessen sie sich nach der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.<br />
Die <strong>Begründungen</strong> zu den Zielen <strong>und</strong> Erläuterungskarten nehmen an der Verbindlichkeit<br />
des Regionalen Raumordnungsprogramms nicht teil. Ebenso nehmen die Kapitel<br />
„Einführung“ <strong>und</strong> „Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze“ sowie die Anlagen im Anhang nicht an<br />
der Verbindlichkeit teil <strong>und</strong> besitzen nur erläuternden bzw. beschreibenden Charakter.<br />
Die Karte (M 1 : 100 000) nimmt entsprechend den Zielen an der Verbindlichkeit des<br />
Regionalen Raumordnungsprogramms teil. In ihr werden keine parzellenscharfen Aussagen<br />
gemacht. Die gewählten Planzeichen sind, soweit sie nicht Bestandsdarstellungen oder<br />
nachrichtliche Übernahmen rechtlich fixierter Abgrenzungen sind, maßstabsabhängige<br />
Signaturen für bestimmte regionalplanerische Zielsetzungen.<br />
Das Regionale Raumordnungsprogramm legt die anzustrebende räumliche Entwicklung der<br />
Region für einen langfristigen Zeitraum von ca. 10 Jahren fest. Es gilt solange, bis eine<br />
Änderung zur Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für verbindlich<br />
erklärt wird.<br />
Regionale Entwicklungsgr<strong>und</strong>sätze<br />
Ausgehend von den Gr<strong>und</strong>sätzen der Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung gemäß § 2 Landesplanungsgesetz<br />
vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2<br />
des Gesetzes vom 27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), hat der Regionale Planungsverband<br />
der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte der regionsspezifischen Ausformung<br />
des Programms die folgenden regionalen Entwicklungsgr<strong>und</strong>sätze zugr<strong>und</strong>egelegt:<br />
1. Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen zur Entwicklung der Region sind so zu gestalten,<br />
daß sie dazu beitragen, die vorhandenen naturräumlichen, siedlungsstrukturellen,<br />
wirtschaftlichen, sozialen <strong>und</strong> kulturellen Potentiale in den einzelnen <strong>Teil</strong>räumen zu sichern<br />
<strong>und</strong> zu entwickeln sowie der Abwanderung aus den einzelnen <strong>Teil</strong>räumen<br />
entgegenzuwirken. Dabei sollen die einzelnen <strong>Teil</strong>räume der Region unter<br />
Berücksichtigung ökologischer Belange je nach Eignung <strong>und</strong> Leistungsfähigkeit so<br />
entwickelt werden, daß sich ihre spezifischen Funktionen <strong>und</strong> Strukturen möglichst<br />
gegenseitig ergänzen <strong>und</strong> ausgleichen sowie zu einem bestmöglichen Leistungsaustausch in<br />
der Region führen.<br />
2. Die Wirtschaft soll nachhaltig gestärkt <strong>und</strong> der Strukturwandel so unterstützt werden,<br />
daß die Region möglichst schnell ein hohes wirtschaftliches Niveau erreicht. Durch<br />
geeignete infrastrukturelle <strong>und</strong> durch offensive unternehmensbezogene Maßnahmen soll der<br />
17
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Aufbau einer regionalen durchmischten Unternehmens- <strong>und</strong> Wirtschaftsstruktur -<br />
insbesondere unter Berücksichtigung kleiner <strong>und</strong> mittelständischer Unternehmen - mit<br />
einem entsprechend ausgeglichenen Arbeitsmarkt <strong>und</strong> überregionalen Absatzmärkten<br />
(Exportbasis) unterstützt werden.<br />
3. Die Landwirtschaft soll flächendeckend als wichtiger wettbewerbsfähiger Wirtschaftszweig<br />
erhalten <strong>und</strong> weiterentwickelt werden. Die Erzeugung, Verarbeitung <strong>und</strong> Vermarktung<br />
der landwirtschaftlichen Produkte soll in angemessenem Umfang regionalisiert<br />
werden.<br />
Der Erhalt der Kulturlandschaft ist durch fachgerechte Landbewirtschaftung zu sichern.<br />
Monostrukturierte <strong>und</strong> landschaftlich ausgeräumte Flächen sollen durch geeignete landschaftspflegerische<br />
Maßnahmen wieder mit Landschaftselementen angereichert werden. Für<br />
die Landwirtschaft ungeeignete Flächen sollen zum <strong>Teil</strong> zur Erhöhung des Waldanteils<br />
<strong>und</strong>/oder zur Ergänzung des Biotopverb<strong>und</strong>systems dienen.<br />
4. Die für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung geeigneten Räume, insbesondere das Großseengebiet,<br />
die Kleinseenplatte, die Feldberger Seenlandschaft, die Mecklenburgische Schweiz,<br />
das Tollensegebiet <strong>und</strong> die Brohmer Berge, sollen für landschaftsgeb<strong>und</strong>ene Tourismus-<br />
<strong>und</strong> Erholungsfunktionen erhalten <strong>und</strong> umweltverträglich ausgestaltet werden. Dabei sollen<br />
die zu entwickelnden Tourismusformen im Einklang mit dem Charakter des jeweiligen<br />
Gebietes stehen. In den Gemeinden <strong>und</strong> Städten der Eignungsräume soll als Gr<strong>und</strong>lage für<br />
private unternehmerische Aktivitäten im Tourismusgewerbe eine qualitativ hochwertige<br />
Infrastruktur bereitgestellt werden. Der Zugang zu den Seen, Flüssen <strong>und</strong> anderen<br />
attraktiven Landschaftsteilen soll für die Allgemeinheit freigehalten oder nach Möglichkeit<br />
wieder eröffnet werden.<br />
5. Schutz, Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen sind zur Erhaltung<br />
einer ges<strong>und</strong>en Umwelt <strong>und</strong> eines funktionsfähigen Naturhaushalts zu sichern. Dies gilt insbesondere<br />
für die Reinhaltung von Luft, Boden <strong>und</strong> Wasser sowie für die Erhaltung der<br />
Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, vor allem der in ihrem Bestand bedrohten Arten. Naturgüter sind<br />
sparsam <strong>und</strong> schonend nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit in Anspruch zu nehmen. Das<br />
Gleichgewicht von Naturhaushalt <strong>und</strong> Klima soll nicht nachteilig verändert werden. Bereits<br />
eingetretene Schäden sind, soweit möglich, zu beseitigen. Das gilt auch für die Seensanierung<br />
<strong>und</strong> die Beseitigung militärischer Altlasten. Die großen zusammenhängenden <strong>und</strong><br />
störungsarmen Landschaftsräume im Sander-, Seen- <strong>und</strong> Endmoränenbereich einschließlich<br />
der großen Flußtalmoore sollen als Lebensräume mit zentraler Bedeutung für den Schutz<br />
störungsempfindlicher Tierarten erhalten werden. Die Vielfalt, Eigenart <strong>und</strong> Schönheit der<br />
einzelnen Landschaftsräume in der Region soll nachhaltig gesichert werden.<br />
6. Verkehrs- <strong>und</strong> Kommunikationseinrichtungen sollen so ausgebaut <strong>und</strong> bei Bedarf neu gebaut<br />
werden, daß die Region durch leistungsfähige Verbindungen erschlossen <strong>und</strong> mit benachbarten<br />
Regionen <strong>und</strong> Ländern verb<strong>und</strong>en wird. Insbesondere ist die Anbindung der<br />
Region an die Ballungsräume Berlin <strong>und</strong> Hamburg sowie ihre Transitfunktion zwischen<br />
Skandinavien <strong>und</strong> dem südeuropäischen Raum <strong>und</strong> zwischen Ost- <strong>und</strong> Westeuropa zu<br />
stärken. Dabei sind Beeinträchtigungen der Umwelt möglichst gering zu halten <strong>und</strong> auszugleichen.<br />
Insbesondere der Erhalt der weitgehend noch unzerschnittenen Landschaftsräume<br />
18
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
ist zu berücksichtigen. Der öffentliche Personennahverkehr <strong>und</strong> der schienengeb<strong>und</strong>ene<br />
Güterverkehr sollen vorrangig entwickelt werden.<br />
7. Die Tragfähigkeit <strong>und</strong> Leistungskraft der flächenhaften Siedlungsstruktur soll durch die<br />
Stärkung <strong>und</strong> Entwicklung des Netzes zentraler Orte verbessert werden. Die zentralen Orte<br />
der Region sollen als Mittelpunkte des wirtschaftlichen, sozialen <strong>und</strong> kulturellen Lebens gestärkt<br />
<strong>und</strong> entwickelt werden. In ihnen sollen der Bevölkerung in angemessener Entfernung<br />
überörtliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge zugänglich sein. Die Siedlungstätigkeit soll<br />
im Rahmen der zentralörtlich gegliederten Siedlungsstruktur erfolgen <strong>und</strong> der jeweiligen<br />
Lage, Größe, Struktur <strong>und</strong> Ausstattung der Gemeinden angemessen sein. Der Zersiedlung<br />
der Landschaft ist entgegenzuwirken.<br />
8. Flächeninanspruchnahme <strong>und</strong> Bebauung sollen so angeordnet werden, daß die Ursprünglichkeit<br />
<strong>und</strong> der Charakter der offenen Agrar- <strong>und</strong> Flußniederungslandschaften im<br />
Norden <strong>und</strong> der kleinteilig strukturierten Seenlandschaften im Süden sowie ihrer Städte <strong>und</strong><br />
Dörfer gewahrt bleiben <strong>und</strong> Beeinträchtigungen vermieden oder beseitigt werden. Kennzeichnende<br />
Ortsbilder sollen erhalten oder wiederhergestellt werden. Die landestypischen<br />
Alleen in der Region sollen erhalten <strong>und</strong> entwickelt werden.<br />
9. Siedlungsgeschichtlich <strong>und</strong> kulturhistorisch bedeutende Bauwerke <strong>und</strong> Ensembles, wie<br />
z.B. Schloßanlagen, Gutshäuser, Mühlen, Feldsteinscheunen, Dorfschmieden sollen unter<br />
Schonung ihrer wertvollen Bausubstanz mit Funktionen ausgestattet werden, die ihre<br />
Sanierung <strong>und</strong> dauernde Erhaltung ermöglichen. Auf eine sinnvolle Nutzung leerstehender<br />
oder ungenügend genutzter Baudenkmale soll hingewirkt werden. Auf die Erhaltung von<br />
Natur- <strong>und</strong> Bodendenkmalen ist zu achten.<br />
10. Wälder sollen nach Lage, Ausdehnung <strong>und</strong> Art geschützt <strong>und</strong> so erhalten werden, daß<br />
sie Klima <strong>und</strong> Wasserhaushalt günstig beeinflussen, ihre natürlichen Schutz- <strong>und</strong> Nutzfunktionen<br />
erfüllen <strong>und</strong> der Bevölkerung als Erholungsgebiete zugänglich sind.<br />
Insbesondere die pleistozänen Buchenmischwälder sind im Bereich der Endmoräne zu<br />
erhalten <strong>und</strong> auf weitere dafür geeignete Standorte in der Region auszudehnen. In den<br />
waldarmen nördlichen <strong>Teil</strong>räumen der Region ist eine Ausdehnung von Wäldern <strong>und</strong><br />
Gehölzen anzustreben, wobei die ökologischen Landschaftsfunktionen <strong>und</strong> das<br />
charakteristische Landschaftsbild zu beachten sind.<br />
11. Die in der Region vorhandenen Bodenschätze sollen zur Sicherung der Rohstoffversorgung<br />
dienen. Bei der Erk<strong>und</strong>ung <strong>und</strong> Gewinnung von Rohstoffen ist der jeweiligen<br />
Funktion des Gebietes insbesondere als Natur- <strong>und</strong> Landschaftsraum <strong>und</strong> als Raum für<br />
Tourismus <strong>und</strong> Erholung unter Beachtung des Siedlungswesens, der verkehrlichen Situation<br />
<strong>und</strong> der bereits vorhandenen Belastungen Rechnung zu tragen. Abbau- <strong>und</strong> damit im<br />
Zusammenhang stehende Ablagerungsflächen sind sukzessiv einer ökologisch vertretbaren<br />
<strong>und</strong> landschaftsverträglichen Nachfolgenutzung zuzuführen.<br />
12. In allen <strong>Teil</strong>räumen der Region sollen die Voraussetzungen für eine versorgungssichere,<br />
umweltverträgliche, preiswerte <strong>und</strong> rationelle Energieversorgung geschaffen werden. Dabei<br />
19
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
sollen alle Möglichkeiten der Energieeinsparung sowie der Nutzung regenerativer Energien<br />
berücksichtigt werden.<br />
13. Abfallvermeidung hat Vorrang vor Verwertung, Verwertung vor Deponierung <strong>und</strong><br />
anderen Arten der Entsorgung. Nicht vermeidbare Abfälle sind so zu verwerten bzw. zu<br />
entsorgen, daß das Wohl der Allgemeinheit so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.<br />
Bevölkerung<br />
Die Planungsregion gliedert sich in 249 Gemeinden mit insgesamt 780 Ortsteilen (einschließlich<br />
der kleinräumlichen Gliederung der Stadt Neubrandenburg).<br />
Am 31. Dezember 1996 lebten 335.613 Einwohner in der Planungsregion. Das entspricht<br />
18,5 % der Bevölkerung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Bevölkerungsdichte<br />
von durchschnittlich 58 Einwohner/km 2 (siehe auch Erläuterungskarte 1) liegt die<br />
Region innerhalb der 97 Raumordnungsregionen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland an<br />
drittletzter Stelle. Im Vergleich dazu leben im Land Mecklenburg-Vorpommern auf 1 km 2<br />
durchschnittlich 78 Einwohner bzw. in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland durchschnittlich<br />
225 Einwohner.<br />
Die demographische Entwicklung in der Planungsregion seit der Wende im Jahre 1989<br />
spiegelt die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen wider. Die besseren Verdienstmöglichkeiten<br />
im Westen Deutschlands, die mit dem wirtschaftlichen Umbau<br />
einhergehende Arbeitslosigkeit sowie die allgemeine soziale Verunsicherung haben eine<br />
starke Abwanderung vor allem in die westlichen B<strong>und</strong>esländer bewirkt.<br />
In den Jahren 1990 bis 1996 betrug der negative Wanderungssaldo für die Planungsregion<br />
insgesamt 15.259 Personen; von diesen waren ca. 76 % jünger als 30 Jahre. Zugleich setzte<br />
ein dramatischer Geburtenrückgang ein. Im Jahre 1996 wurde nur noch 40 % der Anzahl<br />
der Geburten von 1989 erreicht. Die demographischen Reproduktionsbedingungen haben<br />
sich damit drastisch verschlechtert.<br />
Ein weiterer Bevölkerungsrückgang ist entsprechend der Regionalen Bevölkerungsvorausberechnung<br />
M-V 2010 des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt<br />
Mecklenburg-Vorpommern vom Dezember 1996 bis zum Jahr 2010 absehbar. Um diesen<br />
sich fortsetzenden Rückgang so gering wie möglich zu halten, ist es erforderlich, durch<br />
B<strong>und</strong>, Land, Kommunen <strong>und</strong> Privatinitiativen stabile Arbeitsplätze zu schaffen, die<br />
Erwerbsmöglichkeiten in der Region zu verbessern <strong>und</strong> die vorhandene Arbeitslosigkeit<br />
abzubauen.<br />
Bevölkerungsentwicklung gesamt<br />
Bis Ende 1988 war die Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen der heutigen Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte insgesamt relativ stabil. Die Zahl der Geborenen lag<br />
zum <strong>Teil</strong> wesentlich über der Zahl der Gestorbenen. Dieser Lebendgeborenenüberschuß<br />
20
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
war durchschnittlich höher als die jährlichen Wanderungsverluste, so daß bis zu diesem<br />
Zeitpunkt Bevölkerungszunahmen auftraten. Dabei kam es innerhalb der Region zu<br />
unterschiedlichen Entwicklungsprozessen. Während die damalige Bezirksstadt<br />
Neubrandenburg seit 1975 in Folge zentraler <strong>und</strong> bezirklicher Beschlüsse zur Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Wohnungsbauentwicklung ihre Bevölkerungszahl um ca. 26.500 EW auf über 90.000<br />
EW erhöhte, ging im gleichen Zeitraum in den Landkreisen insgesamt die Zahl der<br />
Einwohner um fast 17.000 EW zurück. In vielen Landgemeinden gab es neben<br />
Wanderungsverlusten auch schon zu dieser Zeit Sterbeüberschüsse. Demgegenüber sind die<br />
demographischen Prozesse seit dem Jahre 1989 insgesamt durch einen relativ starken<br />
Bevölkerungsrückgang charakterisiert. Von Anfang 1989 bis Ende 1996 sank die<br />
Bevölkerungszahl in der Planungsregion um 7,6 % (Mecklenburg-Vorpommern: 7,3 %)<br />
bzw. um fast 28.000 Einwohner. Das ist weit mehr als die Einwohnerzahl der zweitgrößten<br />
Stadt der Region, Neustrelitz.<br />
Der Einwohnerrückgang vollzog sich von Anfang 1989 bis Ende 1996 nach Kreisen unterschiedlich<br />
(siehe Tabelle 1). Die relativ günstige Einwohnerentwicklung im Landkreis<br />
Mecklenburg-Strelitz mit einem Rückgang von nur 2,5 % resultiert aus der Nähe zur Stadt<br />
Neubrandenburg <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen verstärkten Siedlungstätigkeit in ihrem<br />
Umland. Unter anderem als Folge der Suburbanisierung ist der Einwohnerrückgang in der<br />
Stadt Neubrandenburg fünfmal so groß (- 12,6 %) wie im Landkreis Mecklenburg-Strelitz.<br />
Tabelle 1:<br />
Bevölkerungsentwicklung von 1989 bis 1996<br />
Kreisfreie Stadt <strong>und</strong> Einwohner Einwohner Veränderung 1996 gegenüber1988<br />
Landkreise<br />
31.12.1988 31.12.1996 (absolut)<br />
(in %)<br />
Neubrandenburg, Stadt 90.471 79.041 - 11.430 - 12,6<br />
Demmin 107.113 98.630 - 8.483 - 7,9<br />
Mecklenburg - Strelitz 89.719 87.484 - 2.235 - 2,5<br />
Müritz 76.062 70.458 - 5.604 - 7,4<br />
Planungsregion 363.365 335.613 - 27.752 - 7,6<br />
Meckl.-Vorpommmern 1.960.891 1.817.196 - 143.695 - 7,3<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Differenziertere Untersuchungen liegen mit Beginn des Jahres 1990 bis 1996 vor (siehe<br />
Tabelle 2). Während die prozentuale Entwicklung der Bevölkerung durch Geburten <strong>und</strong><br />
Sterbefälle (hier bezogen auf die Bevölkerung vom 31.12.1989) im wesentlichen in der<br />
Planungsregion ausgeglichen war, gab es beim Wanderungsverlust eine größere Differenzierung.<br />
Die relativ geringe Anzahl der Gestorbenen in der Stadt Neubrandenburg ist<br />
altersstrukturell bedingt. 1996 betrug der Anteil der über 65jährigen an der Bevölkerung<br />
hier 9,5 %, in der Planungsregion 12,5 % <strong>und</strong> in Mecklenburg-Vorpommern 12,8 %.<br />
21
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Tabelle 2:<br />
Faktoren der Bevölkerungsentwicklung von 1990 bis 1996 (in %)<br />
Kreisfreie Stadt <strong>und</strong> Landkreise Geburten Gestorbene Wanderungs- Veränderung<br />
saldo gesamt<br />
Neubrandenburg, Stadt 4,1 4,3 - 12,9 - 13,1<br />
Demmin 4,6 8,6 - 2,8 - 6,9<br />
Mecklenburg-Strelitz 4,7 8,4 2,2 - 1,4<br />
Müritz 4,6 7,7 - 3,3 - 6,4<br />
Planungsregion 4,5 7,3 - 4,2 - 7,0<br />
Gemeinden mit EW-Zunahme 5,4 8,4 18,9 15,9<br />
Gemeinden mit EW-Abnahme 4,4 7,1 - 7,4 - 10,1<br />
Ordnungsraum Neubrandenburg 4,3 4,6 - 7,8 - 8,2<br />
dav. Gemeinden mit Ew.-Zunahme 5,4 7,5 34,7 32,6<br />
dav. Gemeinden mit Ew.-Abnahme 4,1 4,3 - 13,0 - 13,1<br />
Mecklenburg - Vorpommern 4,5 7,2 - 3,9 - 6,7<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Von den 249 Gemeinden der Planungsregion hatten in den Jahren 1990 bis 1996 78<br />
Gemeinden eine Einwohnerzunahme von durchschnittlich 15,9 % <strong>und</strong> 170 Gemeinden eine<br />
Einwohnerabnahme von durchschnittlich 10,1 % (bei einer Gemeinde blieb die Anzahl der<br />
Einwohner konstant).<br />
Der Ordnungsraum Neubrandenburg umfaßt 20 Gemeinden. Davon hatten im Zeitraum von<br />
Januar 1990 bis Dezember 1996 16 Gemeinden eine Einwohnerzunahme von durchschnittlich<br />
32,6 %. Extremwerte in der Einwohnerzunahme wiesen die Gemeinden<br />
Wulkenzin, Neuenkirchen <strong>und</strong> Trollenhagen mit Zunahmen von 84,0 % bis 158,9 % auf,<br />
die Gemeinde Woggersin sogar mit einer Zunahme von 541 %. Insgesamt hatten diese 4<br />
Gemeinden in den Jahren 1990 bis 1996 eine Zunahme von 2.115 Einwohnern.<br />
Wanderungen (Zu- <strong>und</strong> Wegzüge)<br />
Über 60 % des Bevölkerungsrückganges der Region zwischen 1990 <strong>und</strong> 1996 resultiert aus<br />
Wanderungsverlusten. In diesem Zeitraum betrug der negative Wanderungssaldo 15.259<br />
Personen. Das heißt, die Zahl der Wegzüge übertraf die der Zuzüge um diese Summe.<br />
Dabei gab es sowohl in den einzelnen Jahren <strong>und</strong> auch zwischen den Landkreisen <strong>und</strong> der<br />
kreisfreien Stadt Neubrandenburg Unterschiede (siehe Tabellen 3 <strong>und</strong> 4). Während der<br />
Wanderungsverlust in den Landkreisen <strong>und</strong> der kreisfreien Stadt Neubrandenburg 1990 bis<br />
1992 pro 1.000 Einwohner etwa gleich hoch war, setzte jedoch in den Landkreisen der<br />
Region mit dem Jahr 1994 eine Trendwende ein, die einen Wanderungsgewinn zur Folge<br />
hatte. Der Wanderungsverlust der Stadt Neubrandenburg ist dagegen nach wie vor beträchtlich<br />
<strong>und</strong> vor allem eine Folge der Suburbanisierung.<br />
22
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Tabelle 3:<br />
Wanderungsgewinne <strong>und</strong> Wanderungsverluste von 1990 bis 1996<br />
Kreisfreie Stadt<br />
<strong>und</strong> Landkreise<br />
Wanderungsgewinn (+) bzw. Wanderungsverlust (-)<br />
je 1.000 Einwohner<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />
Neubrandenburg, Stadt - 24,5 - 16,3 - 1,5 - 23,1 - 31,2 - 24,7 - 17,1<br />
Demmin - 21,4 - 12,3 - 0,5 - 0,8 + 3,2 + 1,5 + 1,8<br />
Mecklenburg-Strelitz - 20,8 - 11,6 - 1,5 + 2,6 + 21,3 + 14,5 + 19,3<br />
Müritz - 22,0 - 16,2 - 3,1 - 1,4 + 3,6 + 1,8 + 4,0<br />
Planungsregion - 22,2 - 13,9 - 1,5 - 5,7 - 0,8 - 1,5 + 2,3<br />
Meckl. - Vorpommern - 21,8 - 12,7 - 3,5 - 2,9 - 0,1 + 0,1 + 0,9<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Im Zeitraum 1990 bis 1996 betrug der Anteil der Gruppe der unter 25jährigen Personen<br />
etwa 60 % des Wanderungssaldos. Die 25- bis 30jährigen waren zu 16 % vertreten, so daß<br />
mehr als 3 /4 des Wanderungssaldos die demographisch aktivste Gruppe betraf, die damit für<br />
die Reproduktion der Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist. Das hat unmittelbare Auswirkungen<br />
auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahrzehnte.<br />
Tabelle 4:<br />
Wanderungssalden je 1.000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung nach<br />
Altersgruppen 1990 bis 1996<br />
Altersgruppen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />
< 18 Jahre - 4,8 - 4,0 - 0,5 - 2,0 - 0,1 - 0,1 + 1,2<br />
18 < 25 Jahre - 7,5 - 5,8 - 1,5 - 2,3 - 1,5 - 1,6 - 1,7<br />
25 < 30 Jahre - 4,2 - 1,9 - 0,2 - 0,6 - 0,2 - 0,2 + 0,4<br />
30 < 50 Jahre - 6,0 - 2,4 + 0,2 - 0,9 - 0,5 + 0,2 + 1,5<br />
50 < 65 Jahre - 0,7 - 0,5 + 0,2 0,0 + 0,1 + 0,2 + 0,5<br />
> 65 Jahre - 0,2 - 0,3 0,0 0,0 + 0,1 + 0,1 + 0,5<br />
Planungsregion - 23,3 - 14,8 - 1,9 - 5,7 - 0,8 - 1,5 + 2,3<br />
Meckl.-Vorpommern - 22,0 - 12,9 - 3,5 - 2,9 - 0,1 + 0,1 + 0,9<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Von 1990 bis 1992 treten gegenüber der Tabelle 3 geringfügige Differenzen auf, da auf<br />
Gr<strong>und</strong> der Staatsgebietsveränderung keine korrigierten Zahlen für diesen Zeitraum vorliegen.<br />
Im wesentlichen ist zwischen der Planungsregion <strong>und</strong> dem Land Mecklenburg-<br />
Vorpommern eine fast gleichlaufende Entwicklung mit einer abnehmenden Tendenz vor<br />
allem in den jüngeren Altersgruppen seit 1990 festzustellen. Differenzen zwischen der<br />
23
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Planungsregion gesamt <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern sind aus dem geringeren<br />
Außenwanderungsgewinn in der Planungsregion zu erklären.<br />
Natürliche Bevölkerungsentwicklung<br />
Die Abwanderung gerade jüngerer Menschen beeinflußt auch die Zahl der Geburten<br />
erheblich. Der schon in den 80er Jahren einsetzende Geburtenrückgang hat sich seit dem<br />
Jahr 1990 drastisch verstärkt. Wurden 1990 in der Region noch 4.417 Kinder geboren, ging<br />
die Zahl der Geburten auf 2.049 im Jahre 1996 zurück. Im gleichen Zeitraum sank auch die<br />
Zahl der Sterbefälle von 4.234 auf 3.489. Dieser hohe Gestorbenenüberschuß in der Region<br />
(siehe Tabelle 5) trug verstärkt zum weiteren Rückgang der Bevölkerung bei. Es verschärft<br />
sich die Gefahr einer Überalterung der Bevölkerung, was Auswirkungen auf viele Bereiche<br />
der Gesellschaft haben wird.<br />
Im Jahr 1995 zeichnete sich jedoch eine Trendwende ab. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte<br />
sich die Zahl der Geburten um 11,9 % <strong>und</strong> die der Sterbefälle ging um 8,0 % zurück. Der<br />
Sterbefallüberschuß verringerte sich dadurch um 23,7 %. Diese Tendenz setzte sich 1996<br />
fort (gegenüber 1995: Geburtenanstieg um 11,1%, Verringerung des<br />
Sterbefallüberschusses<br />
um 10 %).<br />
Tabelle 5:<br />
Lebendgeborenen- bzw. Gestorbenenüberschüsse von 1990 bis 1996<br />
Kreisfreie Stadt <strong>und</strong><br />
Landkreise<br />
24<br />
Überschuß der Lebendgeborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) je 1.000<br />
Einwohner<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />
Neubrandenburg, Stadt + 5,8 + 0,4 - 0,7 - 1,6 - 3,2 - 1,7 - 1,0<br />
Demmin - 2,4 - 6,5 - 6,7 - 7,3 - 7,5 - 6,4 - 5,7<br />
Mecklenburg-Strelitz - 0,6 - 5,7 - 5,6 - 7,4 - 7,4 - 5,8 - 5,6<br />
Müritz - 0,5 - 4,6 - 5,7 - 6,8 - 6,4 - 4,6 - 4,3<br />
Planungsregion + 0,5 - 4,1 - 4,7 - 5,8 - 6,2 - 4,7 - 4,3<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
+ 0,6 - 4,1 - 5,1 - 5,5 - 5,9 - 5,1 - 4,1<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Altersstruktur<br />
Die natürlichen <strong>und</strong> räumlichen Bevölkerungsbewegungen der zurückliegenden Jahre<br />
hatten auch unmittelbare Auswirkungen auf die Altersstruktur der Einwohner der Region<br />
(siehe Tabelle 6). Bemerkenswert ist dabei vor allem der Rückgang der Kinder unter 5<br />
Jahren. In dieser Gruppe war als Ergebnis der rückläufigen Geburtenentwicklung innerhalb<br />
von nur 7 Jahren ein Rückgang um über 60 % zu verzeichnen.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Tabelle 6:<br />
Relationen von ausgewählten Altersgruppen 1989 <strong>und</strong> 1996 <strong>und</strong> Entwicklung in<br />
diesem Zeitraum<br />
Altersgruppen 31.12.1989<br />
Anteil in %<br />
31.12.1996<br />
Anteil in %<br />
0 - ### 5 Jahre 7,3 2,9 36,3<br />
5 - ### 10 Jahre 7,8 6,5 77,3<br />
10 - ### 15 Jahre 7,3 8,0 101,2<br />
15 - ### 20 Jahre 6,4 8,0 117,2<br />
20 - ### 30 Jahre 16,5 11,8 66,5<br />
30 - ### 45 Jahre 20,8 25,9 115,9<br />
1989 - 1996<br />
Entwicklung in %<br />
45 - ### 65 Jahre 23,6 24,4 96,0<br />
### 65 Jahre 10,3 12,5 113,2<br />
Insgesamt 100,0 100,0 93,0<br />
Quellen: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
unter Verwendung von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Bezirksstelle Neubrandenburg<br />
Die Alterspyramide der Regionsbevölkerung des Jahres 1996 gleicht dem Altersaufbau der<br />
anderen Regionen des Landes <strong>und</strong> zeigt insgesamt 4 Einschnitte (Abbildung 2):<br />
### Geburtenausfall im 1. Weltkrieg,<br />
### Geburtenausfall Ende des 2. Weltkrieges,<br />
### „Pillenknick“ Anfang der 70er Jahre,<br />
### Geburtenrückgang seit dem Jahr 1990.<br />
Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2010<br />
Die Bevölkerung der Region wird bis zum Jahr 2000 <strong>und</strong> danach weiter zurückgehen. Diese<br />
Tendenz zeigt auch die Regionale Bevölkerungsvorausberechnung M-V 2010 des<br />
Ministeriums für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt Mecklenburg-Vorpommern vom<br />
Dezember 1996 (siehe Tabelle 7).<br />
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Lebendgeborene abzüglich Gestorbene) wird um<br />
15.270 Personen (-4,5 %) rückläufig sein. Dabei sieht die Prognose eine relativ<br />
optimistische Geburtenentwicklung vor (Zunahme der Summe der altersspezifischen<br />
Geburtenziffer von 821,9 auf 1.444 im Jahr 2010). Die zu erwartenden<br />
Binnenwanderungsverluste bis zum Jahr 2010 werden durch Außenwanderungsgewinne<br />
kompensiert, die zu einem positiven Saldo von insgesamt 1.933 Personen (+ 0,6 %) führen<br />
können, wenn die Annahmen entsprechend eintreffen.<br />
25
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Tabelle 7:<br />
Regionale Bevölkerungsvorausberechnung M-V 2010 für die Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte<br />
1995 2000 2005 2010<br />
Bevölkerung am 31.12. 336.276 329.117 325.003 322.939<br />
Bevölkerungsverlust<br />
bezogen auf 1994:<br />
- Einwohner (absolut)<br />
-<br />
7.159<br />
11.273<br />
13.337<br />
- Einwohner (%)<br />
-<br />
2,1<br />
3,4<br />
4,0<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Wanderungsverluste <strong>und</strong> die stark zurückgegangenen Geburtenzahlen seit Anfang der 90er<br />
Jahre haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Altersstruktur der Bevölkerung in der<br />
Planungsregion. Die Relationen verschieben sich bis zum Jahr 2010 zu Lasten der unter<br />
20jährigen erheblich (siehe Tabelle 8). Der Prozeß der Alterung der Bevölkerung (Zunahme<br />
der über 60jährigen) wird für lange Zeit zum stabilen Trend werden. Die demographischen<br />
Wellen in der Altersstruktur haben erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach<br />
infrastrukturellen Einrichtungen <strong>und</strong> Dienstleistungen vor allem in solchen Bereichen, die<br />
eng mit der Bevölkerungsentwicklung gekoppelt sind.<br />
Tabelle 8:<br />
Entwicklung der Relationen der Bevölkerung nach Altersgruppen von 1995 bis 2010<br />
(in %)<br />
Altersgruppe 1995 2000 2005 2010<br />
< 20 Jahre 25,9 21,7 17,9 15,7<br />
20 - < 60 Jahre 56,1 56,8 59,7 61,7<br />
dar. 20 - 60 Jahre 18,0 21,5 22,4 22,6<br />
Quelle: Ministerium für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
Arbeitsmarkt<br />
Die Planungsregion wies seit 1989, wie alle Regionen der neuen B<strong>und</strong>esländer, bei der<br />
Anzahl der Arbeitsplätze eine stark sinkende Tendenz auf. Überschlägige Berechnungen<br />
zeigen, daß sich die Zahl der Erwerbstätigen, die in der Region berufstätig sind, zwischen<br />
den Jahren 1989 <strong>und</strong> 1996 um über 55.000 Erwerbstätige auf ca. 65 % des<br />
Ausgangsniveaus verringerte. Dieser Rückgang entspricht etwa dem des Landes<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Vergleichbare Zahlen für die Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen liegen für die<br />
Planungsregion nicht vor, so daß aus der Erwerbstätigenentwicklung des Landes Analogien<br />
zu ziehen sind (siehe Tabelle 9).<br />
26
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Tabelle 9:<br />
Erwerbstätige am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern 1989 <strong>und</strong> 1996 nach<br />
Wirtschaftsbereichen (Jahresdurchschnittsberechnungen)<br />
Wirtschaftsbereiche<br />
Erwerbstätige in 1.000<br />
1989 1996 1989 - 1996<br />
abs. % abs. % Entwicklung in %<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Fischerei 219,3 18,8 38,2 5,0 17,4<br />
Produzierendes Gewerbe 341,2 29,2 224,5 29,6 65,8<br />
Handel, Verkehr <strong>und</strong> Nachrichten 208,6 17,9 133,3 17,6 63,9<br />
Sonstige unternehmerische Dienstleistungen 71,9 6,1 154,4 20,4 214,7<br />
Staat, priv. Haushalte, Organis.o.Erwerbszw. 327,4 28,0 208,3 27,4 63,6<br />
Erwerbstätige insgesamt 1.168,5 100,0 758,7 100,0 64,9<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern<br />
Es dominieren in der kreisfreien Stadt Neubrandenburg <strong>und</strong> in den 3 Landkreisen der<br />
Planungsregion mit Stand vom 31. Dezember 1996 eindeutig die übrigen Wirtschaftsbereiche.<br />
Das trifft auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern zu (siehe Tabelle 10). In<br />
der Stadt Neubrandenburg sind mehr als 50 % der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten in diesen Bereichen tätig.<br />
Tabelle 10:<br />
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* nach Wirtschaftsbereichen (31.12.1996)<br />
Kreisfreie Stadt<br />
<strong>und</strong> Landkreise<br />
gesamt<br />
Land- <strong>und</strong><br />
Forstwirtschaft,<br />
Fischerei<br />
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen<br />
produzierendes<br />
Gewerbe<br />
Handel,<br />
Verkehr <strong>und</strong><br />
Nachrichten<br />
übrige Wirtschaftsbereiche<br />
absolut % absolut % absolut % absolut %<br />
Neubrandenburg, Stadt 41.620 241 0,6 9.992 24,0 7.805 18,7 23.582 56,7<br />
Demmin 27.600 2.551 9,3 10.787 39,1 4.867 17,6 9.395 34,0<br />
Mecklenburg-Strelitz 26.055 1.975 7,6 8.090 31,0 4.625 17,8 11.365 43,6<br />
Müritz 23.401 1.503 6,4 8.523 36,4 3.738 16,0 9.637 41,2<br />
Planungsregion 118.676 6.270 5,3 37.392 31,5 21.035 17,7 53.979 45,5<br />
Meckl.-Vorpommern 626.243 26.110 4,2 194.150 31,0 114.638 18,3 291.345 46,5<br />
* ohne Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Beamte <strong>und</strong> geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern<br />
Auch für die Planungsregion hatte vor allem die stark rückläufige Arbeitskräfteentwicklung<br />
in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe <strong>und</strong> im öffentlichen Dienst gravierende<br />
Folgen für den Arbeitsmarkt <strong>und</strong> beeinflußte die Arbeitslosenentwicklung ganz erheblich.<br />
Seit 1990 stieg die Zahl der Arbeitslosen an. Die Zahlen der registrierten Arbeitslosen<br />
nahmen in der Planungsregion folgende Entwicklung:<br />
27
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
abelle 11:<br />
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 1990 bis 1997<br />
Stichtag Arbeitslose (absolut) Arbeitslosenquote (%) Arbeitslosenquote (%)<br />
Planungsregion Planungsregion Meckl. - Vorpommern<br />
30.09.1990 12.031 6,3 6,2<br />
31.12.1990 16.827 8,8 8,7<br />
31.12.1991 28.689 15,0 13,8<br />
31.12.1992 31.125 18,9 15,7<br />
31.12.1993 30.039 18,3 17,6<br />
31.12.1994 26.209 16,7 14,7<br />
31.12.1995 26.923 17,6 17,4<br />
31.12.1996 30.274 19,6 17,3<br />
31.12.1997 36.745 23,6 20,5<br />
Quelle: Arbeitsamt Neubrandenburg<br />
Die Arbeitslosenquote erhöhte sich seit September 1990 von 6,3 % bis zum 31. Dezember<br />
1997 auf 23,6 % (siehe auch Abbildung 4).<br />
Die Region ist neben der Planungsregion Vorpommern gegenwärtig das Gebiet mit der<br />
höchsten Arbeitslosenquote in der gesamten B<strong>und</strong>esrepublik. Die Quote schwankte Ende<br />
des Jahres 1997 zwischen 18,4 % (kreisfreie Stadt Neubrandenburg) <strong>und</strong> 27,7 % (Landkreis<br />
Demmin). Der Anteil der Frauen an der Arbeitslosigkeit ist mit 56,2 % deutlich überproportioniert.<br />
Arbeitsmarktpolitische Instrumente, wie<br />
• Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,<br />
• Maßnahmen nach § 249 h,<br />
• berufliche Fortbildung <strong>und</strong> Umschulung,<br />
• Altersübergangsregelungen,<br />
• Vorruhestandsregelung,<br />
umfassen ca. 15-20 % der möglichen Erwerbstätigen <strong>und</strong> entlasten damit den ersten<br />
Arbeitsmarkt erheblich. Nur durch diesen massiven Einsatz <strong>und</strong> die Gewährung<br />
umfangreicher finanzieller Leistungen konnte der soziale Abstieg breiter<br />
Bevölkerungsschichten verhindert werden.<br />
Die Arbeitslosigkeit ist das sozial <strong>und</strong> wirtschaftlich bedeutendste Problem in der strukturschwachen<br />
Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte. Nur durch die Schaffung<br />
dauerhaft wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze wird es möglich sein, der verstärkten Abwanderung<br />
der wirtschaftlich leistungsfähigen <strong>und</strong> demographisch aktiven Bevölkerung<br />
wirksam zu begegnen.<br />
28
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Abbildung 2:<br />
Altersaufbau der Bevölkerung am 31.12.1996 in der Planungsregion<br />
29
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern<br />
Abbildung 3:<br />
Entwicklung der Bevölkerung seit 1985 in der Planungsregion<br />
30<br />
EW<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
-2000<br />
-4000<br />
-6000<br />
-8000<br />
-10000<br />
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96<br />
Geburten<br />
Sterbefälle<br />
natürl. Saldo<br />
Wanderungssaldo<br />
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Gr<strong>und</strong>lage von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-<br />
Vorpommern <strong>und</strong> der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Bezirksstelle Neubrandenburg<br />
Abbildung 4:<br />
Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion seit September 1990<br />
%<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
RROP Mecklenburgische Seenplatte Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>sätze<br />
Quelle: Arbeitsamt Neubrandenburg<br />
31
32<br />
Raumkategorie RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
1. Raumkategorien<br />
1.1 Ordnungsraum Neubrandenburg<br />
<strong>Teil</strong> I<br />
<strong>ÜBERFACHLICHE</strong> <strong>ZIELE</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Begründungen</strong><br />
(1) Die Stadt Neubrandenburg als Kernstadt <strong>und</strong> deren Umlandgemeinden Alt Rehse,<br />
Blankenhof, Burg Stargard, Cölpin, Glienke, Groß Nemerow, Holldorf, Mallin, Neddemin,<br />
Neuenkirchen, Neverin, Pragsdorf, Sponholz, Staven, Trollenhagen, Warlin, Woggersin,<br />
Wulkenzin <strong>und</strong> Zirzow bilden zusammen den Ordnungsraum Neubrandenburg. Zwischen<br />
diesen Gemeinden sind raumbedeutsame Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen von<br />
überörtlicher Bedeutung besonders intensiv abzustimmen.<br />
(2) Durch geeignete Ordnungsmaßnahmen sind insbesondere eine Zersiedelung des<br />
Stadtumlandes zu verhindern, ausreichend Freiräume zu erhalten <strong>und</strong> die<br />
Beeinträchtigungen durch den Rohstoffabbau in verträglichen Grenzen zu halten bzw. zu<br />
reduzieren.<br />
Begründung<br />
zu 1.1(1):<br />
Die Abgrenzung des Ordnungsraumes konkretisiert die Ausweisung im LROP. Dieser Raum ist durch<br />
besonders intensive tägliche Arbeits-, Bildungs- <strong>und</strong> Einkaufspendlerverflechtungen zwischen der Stadt<br />
Neubrandenburg als Kerngebiet des Ordnungsraumes <strong>und</strong> ihren Umlandgemeinden gekennzeichnet. Auf<br />
Gr<strong>und</strong> der vielfachen Stadt-Umland-Beziehungen bedarf es insbesondere hinsichtlich der Siedlungsflächen-<br />
<strong>und</strong> Infrastrukturplanung sowie der Trägerschaft öffentlicher Einrichtungen einer intensiven Abstimmung<br />
zwischen den Gemeinden im Ordnungsraum.<br />
zu 1.1(2):<br />
Ein funktionsfähiger Ordnungsraum ist Voraussetzung für die Entwicklung der Stadt Neubrandenburg zu<br />
einem starken Versorgungs- <strong>und</strong> Wirtschaftszentrum, auf welches das Stadtumland <strong>und</strong> die gesamte Region<br />
angewiesen sind. Ordnenden Maßnahmen kommt dabei besondere Bedeutung zu, um nachteilige Folgen des<br />
Suburbanisierungsprozesses wie unter anderem die Entstehung eines unstrukturierten "Siedlungsbreis" mit<br />
übermäßigen Pendlerströmen <strong>und</strong> Verkehrsbelastungen, die Zerstörung von stadtnahen Erholungsflächen <strong>und</strong><br />
erhaltenswerten Landschaftsbereichen sowie erhöhte Folgekosten durch zusätzlichen Infrastrukturbedarf zu<br />
verhindern. Ebenso erfordert die hohe Konzentration von Bergwerksfeldern im Ordnungsraum einen erhöhten<br />
Ordnungsbedarf, um die bereits vorhandenen negativen Auswirkungen durch den Abbau <strong>und</strong> Transport der<br />
Rohstoffe zu reduzieren <strong>und</strong> weitere Beeinträchtigungen zu verhindern.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Raumkategorien<br />
Für den Ordnungsraum gelten gr<strong>und</strong>sätzlich auch die sonstigen Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms.<br />
1.2 Ländliche Räume<br />
(1) Auf Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen zur Stärkung der Landwirtschaft ist insbesondere in den<br />
überwiegend landwirtschaftlich geprägten <strong>Teil</strong>räumen der Region hinzuwirken.<br />
(2) Auf Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus ist vorrangig in den <strong>Teil</strong>räumen<br />
der Region mit besonderer natürlicher Eignung für den Tourismus hinzuwirken.<br />
Die Tourismusfunktion störende Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen sind in diesen Räumen zu<br />
vermeiden.<br />
(3) Vorrangig in den zentralen Orten sind auch außerlandwirtschaftliche Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsplätze<br />
zu schaffen bzw. zu sichern.<br />
(4) Für die Versorgung der Bevölkerung sind vorrangig in den zentralen Orten notwendige<br />
Infrastruktureinrichtungen zu erhalten bzw. auszubauen. Insbesondere in Gebieten, in<br />
welchen stationäre Einrichtungen keine ausreichende Versorgung gewährleisten können,<br />
sollen ergänzend mobile Einrichtungen eine wohnortnahe Versorgung gewährleisten.<br />
Begründung<br />
Gemäß 1.2(1) LROP sind alle außerhalb des Ordnungsraumes liegenden Gebiete als ländliche Räume definiert.<br />
Diese Räume sollen als gleichwertige <strong>und</strong> eigenständige Lebensräume unter Wahrung der ländlichen<br />
<strong>und</strong> landschaftstypischen Eigenarten entwickelt werden (siehe 1.2(2) LROP). Dazu sollen unter anderem<br />
folgende Ziele verfolgt werden:<br />
- Nutzung der flächengeb<strong>und</strong>enen Wirtschaftspotentiale (Land- u. Forstwirtschaft, Tourismus, Rohstoffgewinnung),<br />
- Schaffung möglichst vielfältiger Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsplätze insbesondere an zentralen Orten,<br />
- Schaffung bzw. Sicherung von privaten <strong>und</strong> öffentlichen Dienstleistungen vorrangig an geeigneten<br />
zentralen Orten <strong>und</strong><br />
- Verbesserung der Verkehrserschließung (siehe 1.2(3) bis (6) LROP).<br />
Die unter Programmsatz 1.2 aufgeführten <strong>und</strong> im folgenden begründeten Ziele dienen der weiteren regionsspezifischen<br />
Untersetzung dieser Zielvorgaben für die ländlichen Räume.<br />
zu 1.2(1):<br />
Die in der Erläuterungskarte 2 als "überwiegend landwirtschaftlich geprägt" dargestellten <strong>Teil</strong>räume sind auf<br />
Gr<strong>und</strong> ihres hohen Anteils an Ackerflächen <strong>und</strong> ihrer geringeren landschaftlichen Eignung für eine<br />
touristische Nutzung insbesondere auf die Landwirtschaft als flächengeb<strong>und</strong>enes Wirtschaftspotential angewiesen.<br />
Vor allem in den zentrenfernen Gebieten mit nur geringen nichtlandwirtschaftlichen Beschäfti-<br />
33
34<br />
Raumkategorie RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
gungsalternativen stellt die Landwirtschaft einen bedeutenden Beschäftigungsfaktor dar <strong>und</strong> dient als stabilisierendes<br />
Element in den ländlichen Räumen.<br />
zu 1.2(2):<br />
Die in der Erläuterungskarte 2 als "Räume mit besonderer natürlicher Eignung für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung"<br />
dargestellten <strong>Teil</strong>räume (siehe auch Programmsatz 7.2 <strong>und</strong> Erläuterungskarte 10) sind auf Gr<strong>und</strong> ihrer<br />
reichen naturräumlichen Ausstattung mit Seen <strong>und</strong> Wäldern besonders geeignet für die Entwicklung des<br />
Tourismus. Die Nutzung der ebenfalls in diesen <strong>Teil</strong>räumen vorhandenen Potentiale insbesondere der<br />
Forstwirtschaft <strong>und</strong> der Rohstoffgewinnung erfordern eine gründliche Abwägung <strong>und</strong> Abstimmung mit den<br />
Belangen der Tourismusentwicklung. Besonders der landschaftsbezogene Tourismus reagiert empfindlich auf<br />
störende Umwelteinflüsse am Urlaubsort. Störende Vorhaben können leicht zu einem Imageverlust der<br />
Region als "heile Urlaubswelt" führen <strong>und</strong> die touristische Entwicklung massiv beeinträchtigen. Ebenso kann<br />
die touristische Nutzung selbst nur entsprechend den Erfordernissen des Naturschutzes <strong>und</strong> der Belastbarkeit<br />
der Landschaft entwickelt werden, um die Attraktivität der Landschaft dauerhaft zu erhalten.<br />
zu 1.2(3):<br />
Zur Verbesserung der Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen in den ländlichen Räumen müssen unter anderem<br />
angesichts des Strukturwandels in der Landwirtschaft <strong>und</strong> der klimatisch bedingten saisonalen Beschränkung<br />
des Tourismusgewerbes auch sonstige möglichst vielfältige Erwerbsmöglichkeiten <strong>und</strong> dafür geeignete<br />
Qualifizierungsangebote in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen <strong>und</strong> -branchen geschaffen werden.<br />
Geeignete Ansatzpunkte für die Schaffung zusätzlicher nichtlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze sind durch<br />
deren Agglomerationsvorteile bevorzugt die zentralen Orte.<br />
zu 1.2(4):<br />
Wichtig zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den ländlichen Räumen ist ein ausgewogenes Angebot<br />
an möglichst wohnortnahen Infrastruktureinrichtungen. Bedingt durch die geringe Bevölkerungsdichte <strong>und</strong><br />
altersstrukturelle Verschiebungen stellt sich die Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen in den ländlichen<br />
Räumen als Problem dar. Als geeignetes Instrument zur Sicherstellung einer ausgewogenen Versorgung<br />
bietet sich das Konzept der zentralen Orte an. Besondere Bedeutung kommt dabei den Ländlichen<br />
Zentralorten als Stützpunkten der Versorgung in der Fläche zu. Ergänzend können mobile Versorgungssysteme<br />
zur Deckung des Gr<strong>und</strong>bedarfs in unterversorgten Gebieten beitragen.<br />
Für die ländlichen Räume gelten gr<strong>und</strong>sätzlich auch die sonstigen Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Raumkategorien<br />
35
36<br />
Raumkategorie RROP Mecklenburgische Seenplatte
RROP Mecklenburgische Seenplatte Zentrale Orte<br />
2. Zentrale Orte<br />
2.1 Allgemeine Ziele<br />
(1) Als wirtschaftliche, soziale <strong>und</strong> kulturelle Zentren ihrer Verflechtungsbereiche<br />
(Einzugsbereiche) sollen zentrale Orte so entwickelt werden, daß sie räumliche<br />
Schwerpunkte der Wirtschaftsentwicklung <strong>und</strong> Siedlungstätigkeit bilden.<br />
(2) Zentrale Orte sind ihrer Einstufung entsprechend so auszubauen, daß sie eine flächendeckende<br />
Versorgung der Bevölkerung im jeweiligen Verflechtungsbereich mit Dienstleistungen<br />
<strong>und</strong> Gütern des täglichen, des gehobenen <strong>und</strong> des speziellen höheren Bedarfs<br />
gewährleisten.<br />
(3) Es ist darauf hinzuwirken, daß vorrangig in zentralen Orten ein an deren Einstufung<br />
orientiertes Angebot an dauerhaften Arbeitsplätzen geschaffen wird. Die dazu notwendige<br />
Infrastruktur soll entsprechend ausgebaut werden.<br />
Begründung<br />
Die räumliche Konzentration von Einrichtungen der öffentlichen <strong>und</strong> privatwirtschaftlichen Infrastruktur auf<br />
zentrale Orte gewährleistet deren wirtschaftliche Tragfähigkeit. Insbesondere durch die Bündelung von<br />
Versorgungs-, Bildungs-, Sozialeinrichtungen, Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsstätten auf ausgewählte Standorte ist, vor<br />
allem in den ländlichen Räumen, ein effektiver Einsatz öffentlicher Mittel zum Ausbau von Infrastruktur<br />
möglich. Daraus resultiert eine Verbesserung der Lebensqualität, auch im Umland der zentralen Orte, was<br />
einer potentiellen Abwanderung der Bevölkerung, vor allem aus den dünn besiedelten ländlichen Räumen,<br />
entgegenwirkt.<br />
Die Auswahl <strong>und</strong> Einstufung der zentralen Orte erfolgte unter raumordnungspolitischen Gesichtspunkten auf<br />
der Basis landesgültiger Kriterien. Hauptkriterium zur Einstufung von Gemeinden in das zentralörtliche<br />
Gliederungssystem als zentrale Orte ist deren Tragfähigkeit, die über die Einwohnerzahl des zentralen Ortes<br />
<strong>und</strong> des Verflechtungsbereiches bestimmt wurde.<br />
Infrastrukturelle Ausstattung, Verwaltungsfunktionen, räumliche Lage, Verkehrsanbindung, Erreichbarkeit,<br />
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie kulturhistorische Bedeutung waren unter anderem weitere<br />
Faktoren für die Eignung eines Ortes, über den eigenen Bedarf hinaus Aufgaben für die Bevölkerung des<br />
Verflechtungsbereiches zu übernehmen <strong>und</strong> gleichzeitig Entwicklungsimpulse zu geben. Wichtig ist, daß die<br />
Umlandfunktionen entsprechend den funktionsteiligen Beziehungen schrittweise unter Beachtung der<br />
Erreichbarkeit der zentralörtlichen Einrichtungen, der Einwohnerzahlen im Verflechtungsbereich, des<br />
regionalen Arbeitsplatzangebotes <strong>und</strong> der Pendlerbeziehungen ausgebaut werden.<br />
Im Land Mecklenburg-Vorpommern <strong>und</strong> somit auch in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte<br />
werden die zentralen Orte wie folgt gegliedert:<br />
- Oberzentren,<br />
- Mittelzentren,<br />
- Mittelzentren mit <strong>Teil</strong>funktionen,<br />
- Unterzentren,<br />
- Ländliche Zentralorte.<br />
37
38<br />
Zentrale Orte RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Entsprechend der zentralörtlichen Einstufung werden zentralen Orten Verflechtungsbereiche als<br />
- Oberbereiche,<br />
- Mittelbereiche,<br />
- Nahbereiche<br />
zugeordnet. Zentrale Orte höherer Stufe erfüllen jeweils die Funktionen der zentralen Orte niedrigerer Stufe<br />
mit.<br />
2.2 Zentralörtliche Gliederung<br />
(1) Gemäß LROP sind als zentrale Orte für Ober- <strong>und</strong> Mittelbereiche festgelegt:<br />
- Oberzentrum Neubrandenburg<br />
- Mittelzentren Demmin, Neustrelitz, Waren (Müritz)<br />
- Mittelzentrum mit <strong>Teil</strong>funktionen Malchin<br />
(2) Als zentrale Orte der Nahbereichsstufe werden festgelegt:<br />
- Unterzentren Altentreptow, Burg Stargard, Feldberg, Friedland,<br />
Jarmen, Loitz, Malchow, Mirow,<br />
Reuterstadt Stavenhagen, Röbel/Müritz,Woldegk<br />
- Ländliche Zentralorte Borrentin, Burow, Dargun, Möllenhagen,<br />
Moltzow, Neukalen, Penzlin, Rechlin, Rosenow,<br />
Tützpatz, Wesenberg, Wredenhagen<br />
(3) Das Oberzentrum Neubrandenburg hat die oberzentrale Versorgung seines gesamten<br />
Verflechtungsbereiches zu gewährleisten. Dazu ist eine Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen,<br />
die eine angemessene Erreichbarkeit aus allen <strong>Teil</strong>en des Oberbereiches, auch über<br />
die Planungsregionsgrenze hinaus, ermöglicht.<br />
Begründung<br />
Die zentralen Orte höherer Zentralität sind nachrichtlich aus dem LROP übernommen. Demnach setzt sich der<br />
Oberbereich des Oberzentrums Neubrandenburg aus folgenden <strong>Teil</strong>räumen zusammen: Landkreis Demmin<br />
(ohne ehemaliger Kreis Demmin), Landkreis Mecklenburg-Strelitz, Landkreis Müritz, Landkreis Uecker-<br />
Randow <strong>und</strong> kreisfreie Stadt Neubrandenburg. Der Oberbereich ist folglich nicht mit den Grenzen der<br />
Planungsregion identisch. Er umfaßt auch die Mittelbereiche Pasewalk <strong>und</strong> Ueckermünde der Planungsregion<br />
Vorpommern, was Abstimmungen zur oberzentralen Versorgung mit dem zuständigen Regionalen<br />
Planungsverband erfordert.<br />
Die zentralen Orte der Nahbereichsstufe sind entsprechend den Kriterien in 2.1.4 LROP festgesetzt.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Zentrale Orte<br />
In der Planungsregion ist mit der Ausweisung von 1 Oberzentrum, 3 Mittelzentren, 1 Mittelzentrum mit<br />
<strong>Teil</strong>funktionen, 11 Unterzentren <strong>und</strong> 12 Ländlichen Zentralorten eine ausreichende Dichte ober-, mittel- <strong>und</strong><br />
nahbereichsbezogener Zentren vorhanden. Insgesamt leben 68,6 % der Bevölkerung der Region in zentralen<br />
Orten. Die räumliche Zuordnung von Verflechtungsbereichen soll gewährleisten, daß in allen <strong>Teil</strong>en der<br />
Region gleichwertige Lebensbedingungen ausgestaltet werden können <strong>und</strong> die Versorgung der Bevölkerung<br />
in zumutbarer Entfernung flächendeckend gesichert ist (siehe Tabelle 12 <strong>und</strong> Erläuterungskarte 3).<br />
Tabelle 12:<br />
Zentrale Orte <strong>und</strong> ihre Verflechtungsbereiche in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte<br />
(EW-Stand: 31.12.1996)<br />
Name Status EW im EW im EW im EW im Gemeinden des Nahbereiches<br />
ZO OB MB NB<br />
Neubranden- OZ 79.041 383.335 145.851 89.431 Blankenhof, Breesen, Cölpin, Eichhorst,<br />
burg<br />
Glienke, Neddemin, Neubrandenburg,<br />
Neuenkirchen, Neverin, Pinnow, Pragsdorf,<br />
Sadelkow, Sponholz, Staven, Trollenhagen,<br />
Warlin, Woggersin, Wulkenzin, Zirzow<br />
Altentreptow UZ 7.146 10.272 Altentreptow, Grapzow, Grischow, Groß<br />
Teetzleben, Siedenbollentin, Werder<br />
Friedland UZ 7.853 12.989 Beseritz, Brohm, Brunn, Friedland,<br />
Genzkow, Jatzke, Kotelow, Salow,<br />
Schwanbeck, Schwichtenberg, Wittenborn<br />
Woldegk UZ 3.326 8.833 Göhren, Grauenhagen, Groß Daberkow,<br />
Groß Miltzow, Helpt, Hinrichshagen,<br />
Kreckow, Kublank, Mildenitz, Neetzka,<br />
Pasenow, Petersdorf, Rehberg,<br />
Schönbeck,Schönhausen, Voigtsdorf,<br />
Woldegk<br />
Burg Stargard UZ 4.246 8.396 Ballin, Burg Stargard, Cammin, Dewitz,<br />
Groß Nemerow, Holldorf, Leppin, Neu<br />
Käbelich, Teschendorf<br />
Burow LZO 1.363 3.866 Bartow, Breest, Burow, Gnevkow,<br />
Golchen, Gültz<br />
Penzlin LZO 2.701 5.156 Alt Rehse, Groß Flotow, Groß Vielen,<br />
Klein Lukow, Krukow, Lapitz, Mallin,<br />
Marihn, Mollenstorf, Penzlin, Puchow<br />
Rosenow LZO 1.319 3.171 Briggow, Knorrendorf, Mölln, Rosenow<br />
Tützpatz LZO 842 3.737 Altenhagen, Kriesow, Pripsleben, Reinberg,<br />
Röckwitz, Tützpatz, Wildberg, Wolde<br />
Demmin MZ 14.430 41.568 19.135 Beestland, Demmin, Hohenbrünzow,<br />
Hohenmocker, Kletzin, Nossendorf,<br />
Quitzerow, Sanzkow, Siedenbrünzow,<br />
Teusin, Upost, Utzedel, Warrenzin,<br />
Wotenick<br />
Jarmen UZ 3.198 9.620 Alt Tellin, Bentzin, Daberkow, Jarmen,<br />
Kartlow, Kruckow, Plötz, Schmarsow,<br />
Tutow, Völschow<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
Fortsetzung von Tabelle 12:<br />
39
40<br />
Zentrale Orte RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Name Status EW im EW im EW im EW im Gemeinden des Nahbereiches<br />
ZO OB MB NB<br />
Loitz UZ 4.711 7.782 Düvier, Görmin, Loitz, Sassen, Trantow,<br />
Wüstenfelde<br />
Borrentin LZO 358 5.031 Beggerow, Borrentin, Gnevezow,<br />
Hohenbollentin, Lindenberg, Meesiger,<br />
Metschow, Neu Kentzlin, Sarow,<br />
Schönfeld, Sommersdorf, Verchen<br />
Neustrelitz MZ 24.544 48.614 28.728 Blumenholz, Carpin, Dabelow, Godendorf,<br />
Hohenzieritz, Klein Vielen, Neustrelitz,<br />
Rödlin-Thurow, Wokuhl<br />
Mirow UZ 4.014 8.083 Diemitz, Kratzeburg, Lärz, Mirow,<br />
Roggentin, Schwarz, Userin, Wustrow<br />
Feldberg UZ 2.769 8.208 Blankensee, Bredenfelde, Conow, Dolgen,<br />
Feldberg, Grünow, Lichtenberg,<br />
Lüttenhagen, Möllenbeck, Watzkendorf<br />
Wesenberg LZO 3.071 3.595 Priepert, Strasen, Wesenberg<br />
Waren MZ 22.281 64.197 26.502 Alt Schönau, Groß Gievitz, Hinrichs-<br />
(Müritz)<br />
hagen, Kargow, Klink, Lansen, Schloen,<br />
Torgelow am See, Vielist, Waren (Müritz)<br />
Malchow UZ 7.801 12.064 Adamshoffnung, Alt Schwerin, Göhren-<br />
Lebbin, Grüssow, Kogel, Lexow,<br />
Malchow, Nossentiner Hütte, Penkow,<br />
Rogeez, Satow, Silz, Walow, Zislow<br />
Röbel/Müritz UZ 5.987 9.007 Bollewick, Bütow, Gotthun, Groß Kelle,<br />
Leizen, Ludorf, Minzow, Röbel/Müritz,<br />
Sietow<br />
Möllenhagen LZO 2.267 4.726 Ankershagen, Groß Dratow, Groß Plasten,<br />
Möllenhagen, Varchentin<br />
Moltzow LZO 420 4.726 Grabowhöfe, Hohen Wangelin, Jabel,<br />
Klocksin, Lupendorf, Moltzow, Neu Gaarz,<br />
Schwinkendorf, Vollrathsruhe<br />
Rechlin LZO 2.239 3.487 Buchholz, Priborn, Rechlin, Vipperow<br />
Wredenhagen LZO 577 3.534 Altenhof, Fincken, Grabow-Below,<br />
Jaebetz, Kambs, Kieve, Massow, Melz,<br />
Stuer, Wredenhagen, Zepkow,<br />
Malchin MT 9.235 35.383 14.358 Basedow, Duckow, Faulenrost, Gielow,<br />
Kummerow, Malchin, Remplin<br />
Reuterstadt UZ 8.019 12.331 Bredenfelde, Grammentin, Grischow,<br />
Stavenhagen<br />
Gülzow, Ivenack, Jürgenstorf, Kittendorf,<br />
Reuterstadt Stavenhagen, Ritzerow,<br />
Zettemin<br />
Dargun LZO 4.020 5.407 Brudersdorf, Dargun, Stubbendorf,<br />
Zarnekow<br />
Neukalen LZO 2.496 3.287 Gorschendorf, Neukalen, Wagun<br />
Abkürzungen:<br />
OZ: Oberzentrum ZO: Zentraler Ort<br />
MZ: Mittelzentrum OB: Oberbereich (Verflechtungsbereich des OZ)<br />
MT: Mittelzentum mit <strong>Teil</strong>funktionen MB: Mittelbereich (Verflechtungsbereich der MZ bzw. des MT)<br />
UZ: Unterzentrum NB: Nahbereich (Verflechtungsbereich der UZ <strong>und</strong> LZO)<br />
LZO: Ländlicher Zentralort
RROP Mecklenburgische Seenplatte Achsen<br />
3. Achsen<br />
3.1 Überregionale Achsen<br />
(1) Vorrangig im Verlauf der Achsen soll sich der Leistungsaustausch zwischen den <strong>Teil</strong>räumen<br />
bzw. Städten des Landes vollziehen. Die davon ausgehenden Entwicklungsimpulse<br />
sollen vor allem in den im Zuge der Achsen liegenden zentralen Orte wirksam werden <strong>und</strong><br />
dadurch auch deren Umland stärken.<br />
(2) Überregionale Achsen verbinden die <strong>Teil</strong>räume des Landes untereinander sowie mit<br />
wichtigen Zentren außerhalb des Landes. Überregionale Achsen, die durch die Planungsregion<br />
führen, sind gemäß 2.2(2) LROP:<br />
a) (Lübeck) - Schwerin - Güstrow - Neubrandenburg - Pasewalk - (Stettin)<br />
b) (Hamburg) - Boizenburg/Hagenow/Ludwigslust - Parchim - Waren (Müritz) -<br />
Neubrandenburg sowie (Wittstock) - Neustrelitz - Neubrandenburg<br />
c) (Skandinavien/Baltikum) - Sassnitz - Greifswald/Demmin - Neubrandenburg -<br />
Neustrelitz - (Berlin)<br />
d) (Skandinavien) - Rostock - Güstrow - (Berlin)<br />
(3) Der Verlauf der überregionalen Achsen folgt gemäß 2.2(3) LROP wichtigen Eisenbahnlinien<br />
<strong>und</strong> dem großräumigen funktionalen Straßennetz.<br />
(4) Im Zuge der überregionalen Achsen sind leistungsfähige Verkehrswege <strong>und</strong> eine attraktive<br />
Verkehrsbedienung zu schaffen bzw. zu sichern. Die geplante Autobahn A 20 soll<br />
Verbindungsfunktionen im Verlauf der Achsen a) <strong>und</strong> c) wahrnehmen.<br />
Begründung<br />
Die überregionalen Achsen sind nachrichtlich aus dem 2.2(2) LROP übernommen. Sie sind auf eine Verbindungsfunktion<br />
zwischen den eingeb<strong>und</strong>enen Zentren ausgerichtet. Entwicklungsimpulse sind vor allem in<br />
Orten an leistungsfähigen Verkehrswegen bzw. an Schnittstellen von verschiedenen Verkehrssystemen<br />
(Schiene/Straße) zu erwarten. Im Ordnungsraum Neubrandenburg trägt die Bündelung der Bandinfrastruktur,<br />
insbesondere der Straßen <strong>und</strong> Bahntrassen, zur geordneten Siedlungsentwicklung bei. Großräumig ist jedoch<br />
eine solche Bündelung nur in manchen Achsen gegeben <strong>und</strong> auch nicht überall anzustreben. Der<br />
Achsenverlauf richtet sich dann vorrangig nach den leistungsfähigen Straßen, Verknüpfungen mit der Bahn in<br />
den zentralen Orten sind aber auch eingeb<strong>und</strong>en. Vor allem im Zuge der Achsen besteht die Möglichkeit, daß<br />
öffentlicher Personenverkehr <strong>und</strong> Güterverkehr auf der Schiene den Individual- <strong>und</strong> Lkw-Verkehr wirksam<br />
<strong>und</strong> umweltentlastend ergänzen.<br />
41
42<br />
Achsen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
3.2 Innerregionale Achsen<br />
(1) Die innerregionalen Achsen ergänzen die überregionalen Achsen. Sie sollen den<br />
regionalen <strong>und</strong> damit mittelbar auch den überregionalen Leistungsaustausch der zentralen<br />
Orte, vorrangig der Mittelzentren, unter Einbeziehung möglichst vieler zentraler Orte der<br />
Nahbereichstufe stärken. In ihrem Verlauf ist die Verkehrsinfrastruktur entsprechend auszubauen.<br />
Insbesondere ist die Verkehrsbedienung im ÖPNV aber auch im Güterverkehr entsprechend<br />
zu verbessern.<br />
(2) Innerregionale Achsen sind:<br />
a) Neubrandenburg - Friedland - (Anklam)<br />
b) Neubrandenburg - Friedland - (Ferdinandshof) - (Ueckermünde)<br />
c) Neubrandenburg - Woldegk - (Prenzlau)<br />
d) Waren (Müritz) - Malchin/Reuterstadt Stavenhagen - Demmin<br />
e) Neustrelitz - Woldegk - (Pasewalk)<br />
f) (Rostock) - Demmin - Jarmen - (Anklam/Wolgast)<br />
g) Waren (Müritz) - (Teterow)<br />
Begründung<br />
Innerregionale Achsen orientieren sich an der Bandinfrastruktur <strong>und</strong> den zentralen Orten <strong>und</strong> weisen am<br />
Achsenendpunkt zumindest ein Mittelzentrum mit <strong>Teil</strong>funktionen aus.<br />
Die innerregionalen Achsen fördern die Entwicklungs- <strong>und</strong> Ausbaufähigkeit der zentralen Orte <strong>und</strong> tragen zur<br />
Optimierung der Wirksamkeit raumbedeutsamer Investitionen bei. Sie verbinden direkt Ober- <strong>und</strong><br />
Mittelzentren sowie Mittelzentren mit <strong>Teil</strong>funktionen miteinander, sofern diese nicht schon durch überregionale<br />
Achsen verb<strong>und</strong>en sind. Letztere haben innerhalb der Planungsregion ebenfalls die Funktion<br />
innerregionaler Achsen.<br />
Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen verkehrlichen Rahmenbedingungen wird der Verlauf der innerregionalen<br />
Achsen ausschließlich durch das Vorhandensein von leistungsfähigen, ausbauwürdigen Straßensystemen<br />
bestimmt. Sie folgen den regionalen Straßen der Verbindungsstufen III <strong>und</strong> II, sofern sie nicht<br />
überregionale Achsen darstellen (siehe Programmsatz 9.4).
RROP Mecklenburgische Seenplatte Achsen<br />
43
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
4. Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
4.1 Allgemeine Ziele<br />
44<br />
<strong>Teil</strong> II<br />
FACHLICHE <strong>ZIELE</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Begründungen</strong><br />
(1) Die nachhaltige Nutzung der Naturgüter sowie der Schutz der heimischen Tier- <strong>und</strong><br />
Pflanzenarten in ihren Lebensräumen als Bestandteile eines funktionsfähigen<br />
Naturhaushaltes sind als unverzichtbare Voraussetzungen für die Erhaltung der<br />
Lebensgr<strong>und</strong>lagen der Menschen zu sichern. Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ist<br />
im besiedelten <strong>und</strong> unbesiedelten Bereich zu erhalten bzw. wiederherzustellen. In<br />
bestimmten <strong>Teil</strong>räumen ist die freie Entwicklung naturnaher <strong>und</strong> natürlicher Ökosysteme zu<br />
gewährleisten.<br />
(2) Die regionstypische Eigenart, Vielfalt <strong>und</strong> Schönheit von Natur <strong>und</strong> Landschaft ist zu<br />
bewahren, zu pflegen <strong>und</strong> zu entwickeln. Dazu sollen differenzierte Nutzungen auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der natürlichen Bedingungen <strong>und</strong> der landschaftsökologischen Potentiale der<br />
Naturraumeinheiten erfolgen sowie die regionstypischen Ökosysteme bzw. Biotope, auch in<br />
Verb<strong>und</strong>strukturen, erhalten <strong>und</strong> entwickelt werden.<br />
(3) Der Landschaftsverbrauch ist durch Vermeidung von Zersiedlungen <strong>und</strong> Bündelung von<br />
Maßnahmen der technischen Infrastruktur, vorrangig durch Nutzung vorhandener Standorte<br />
<strong>und</strong> Trassen des Verkehrswesens <strong>und</strong> der Energiewirtschaft, zu minimieren. Landschaftsräume<br />
hoher Umweltqualität sind dauerhaft zu sichern.<br />
Begründung<br />
zu 4.1(1):<br />
Die Nutzung der Naturgüter nach dem Nachhaltigkeitsprinzip sowie der Schutz der heimischen Tier- <strong>und</strong><br />
Pflanzenarten tragen wesentlich zur Stabilisierung <strong>und</strong> Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
bei. Das Prinzip der Nachhaltigkeit bedeutet dabei die erhaltende Nutzung der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
durch den Menschen bzw. den langfristigen <strong>und</strong> umfassenden Substanzerhalt der natürlichen<br />
Produktionspotentiale in quantitativer <strong>und</strong> qualitativer Hinsicht.<br />
Die Planungsregion weist auf Gr<strong>und</strong> ihrer reichen naturräumlichen Ausstattung mit zahlreichen Seen, Flüssen,<br />
Wäldern <strong>und</strong> offenen Agrarlandschaften nicht nur schöne Landschaftskulissen, sondern zugleich besonders<br />
vielfältige <strong>und</strong> sensible großräumige Ökosysteme auf. Sie sind unverwechselbares Merkmal der Region <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>lage aller wichtigen Lebens- <strong>und</strong> Wirtschaftsfunktionen. Um ihre Funktionsfähigkeit langfristig zu
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
erhalten, ist es notwendig, Eingriffe auf ihre ökologischen <strong>und</strong> landschaftlichen Auswirkungen hin zu prüfen<br />
<strong>und</strong> vorhandene Beeinträchtigungen von Natur <strong>und</strong> Landschaft möglichst zu beseitigen.<br />
zu 4.1(2):<br />
Die Landschaft der Planungsregion wird vorrangig geprägt durch die Naturraumeinheiten der glazialen Serie<br />
in der Abfolge (siehe auch Erläuterungskarte 4):<br />
- Gr<strong>und</strong>moräne,<br />
- große Becken <strong>und</strong> Flußtäler,<br />
- Endmoräne,<br />
- Sander-Seengebiet.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der hierdurch gegebenen unterschiedlichen natürlichen Ausstattung <strong>und</strong> Potentialeigenschaften<br />
sowie der Belastbarkeit sind ökologisch angepaßte Nutzungsformen <strong>und</strong> Schutzziele in der Region als<br />
- Räume mit Intensivnutzungen,<br />
- Räume mit extensiv zu entwickelnden Nutzungen,<br />
- Räume mit naturnahen Nutzungen <strong>und</strong><br />
- Räume mit völligem Nutzungsverzicht<br />
anzustreben.<br />
Ausgehend von diesen differenzierten Naturraumeigenschaften mit angepaßten Nutzungen ist langfristig anzustreben,<br />
die typische Eigenart, Schönheit <strong>und</strong> Vielfalt in der Planungsregion zu bewahren <strong>und</strong> zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> Widersprüche zwischen Ökologie <strong>und</strong> Ökonomie abzubauen.<br />
zu 4.1(3):<br />
In der Planungsregion befinden sich noch große, zusammenhängende Landschaftsräume, die insbesondere auf<br />
Gr<strong>und</strong> ihrer geringen Belastung durch Störungen <strong>und</strong> Zerschneidungen eine hohe Umweltqualität bezüglich<br />
der Ruhe <strong>und</strong> Luftreinheit, des Landschaftsbildes <strong>und</strong> ihres Besatzes mit seltenen <strong>und</strong> vom Aussterben<br />
bedrohten Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten aufweisen (siehe Erläuterungskarte 6). Durch die dauerhafte Sicherung<br />
dieser Landschaftsräume wird auch ein wesentliches Potential für die nachhaltige Entwicklung eines<br />
umweltschonenden, landschaftsgeb<strong>und</strong>enen Tourismus erhalten.<br />
4.2 Natürliche Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
4.2.1 Boden<br />
(1) Der Verbrauch von Boden, unter anderem durch Überbauung, Bodenversiegelung <strong>und</strong><br />
Abgrabung, soll auf Gr<strong>und</strong> seiner Unersetzbarkeit möglichst gering gehalten werden. Der<br />
Schutz des Bodens in seiner natürlichen Fruchtbarkeit, vor allem gegenüber<br />
Beeinträchtigungen wie Bodenerosion, Strukturschäden <strong>und</strong> Schadstoffkontaminationen, ist<br />
zu gewährleisten.<br />
45
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(2) Die natürlichen Standorteigenschaften der Böden sollen in der Region für differenzierte<br />
Landnutzungsformen sowie für die Erhaltung der Vielfalt der Landschaft <strong>und</strong> der Lebensräume<br />
gesichert <strong>und</strong> entwickelt werden.<br />
Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit sollen insbesondere für eine umweltverträgliche,<br />
standortgerechte landwirtschaftliche Produktion genutzt werden.<br />
Böden mit geringer natürlicher Ertragsfähigkeit sollen extensiv genutzt werden <strong>und</strong> soweit<br />
möglich zur Erhaltung <strong>und</strong> Pflege von Sonderstandorten (z.B. Moore, Heiden, sonstige<br />
Trocken- <strong>und</strong> Magerstandorte) vorgehalten werden.<br />
Tiefgründige Moorstandorte, die ihre Funktionen für den Wasser-, Boden- <strong>und</strong> Klimaschutz<br />
nicht mehr erfüllen, sollen unter Berücksichtigung der aktuellen Nutzung <strong>und</strong> entsprechend<br />
der Degradierung mit geeigneten Maßnahmen langfristig saniert werden.<br />
(3) Belastete Böden sind zu erfassen, die davon ausgehende Gefährdung ist abzugrenzen,<br />
<strong>und</strong> danach sollen die notwendigen Sicherungs- <strong>und</strong> Sanierungsarbeiten durchgeführt<br />
werden. Eine Änderung der Nutzungsart von Flächen mit nicht sanierten Böden ist in der<br />
Regel auszuschließen, es sei denn, die Änderung der Nutzungsart führt zu einem Abbau der<br />
Belastung bzw. zu einer Aufwertung der Böden.<br />
Begründung<br />
zu 4.2.1(1):<br />
Der Boden in seiner kulturfähigen Form ist eines der wertvollsten Naturgüter, er spielt eine besondere Rolle<br />
im Naturhaushalt, zur generellen Erhaltung des Lebens <strong>und</strong> für die Wirtschaft. Er ist nicht vermehrbar.<br />
Dem übermäßigen Entzug von Bodenflächen durch Überbauungen, Abgrabungen <strong>und</strong> Versiegelungen muß<br />
deshalb konsequent entgegengewirkt werden. Es ist eine schonende <strong>und</strong> auf dauerhafte Erhaltung der<br />
Fruchtbarkeit ausgerichtete Bodennutzung erforderlich.<br />
In der Region stellen vor allem Bodenabtragungen durch Wind <strong>und</strong> Wasser, Schäden durch Bodenverdichtungen,<br />
negative Humusbilanz, Schadstofftransporte <strong>und</strong> -ablagerungen über die Luft, Biozid- <strong>und</strong><br />
Nährstoffanreicherungen (mit Auswirkungen auf die Gewässer- bzw. Nahrungsqualität) sowie Eingriffe in<br />
den Boden-Wasserhaushalt Probleme dar, denen durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken ist.<br />
zu 4.2.1(2):<br />
Die Eigenschaften der Böden sind auf Gr<strong>und</strong> des Reliefs, der Substrate, des Wasser- <strong>und</strong> Nährstoffregimes<br />
entsprechend der Landschaftsentstehung in der Region sehr heterogen (siehe Erläuterungskarte 4).<br />
Die natürliche Vielfalt der Standorteigenschaften ist die Gr<strong>und</strong>lage für die Vielfalt der Arten <strong>und</strong> Lebensräume<br />
sowie für wichtige Funktionen des Naturhaushaltes. Deshalb soll die Bodennutzung so angelegt sein,<br />
daß die natürliche Standortvielfalt erhalten bleibt.<br />
Durch eine umweltverträgliche, standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung, die aufgr<strong>und</strong> der Rahmenbedingungen<br />
in sehr unterschiedlichen Intensitätsstufen erfolgt, kann diese Vielfalt erhalten werden. Dies<br />
schließt eine intensive landwirtschaftliche Nutzung der Moore aufgr<strong>und</strong> der irreversiblen Schädigung der<br />
46
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
Bodenstruktur <strong>und</strong> der erheblichen Freisetzung von Stickstoff <strong>und</strong> Kohlendioxid aus. Ist die Moordegradierung<br />
bereits fortgeschritten, kann nur durch entsprechende Maßnahmen die Wiederherstellung der<br />
Funktionsfähigkeit des Moorkörpers erreicht werden. In der Karte (M 1 : 100 000) sind tiefgründige Moorstandorte<br />
dargestellt (siehe auch Programmsatz 4.4(1) <strong>und</strong> (2)).<br />
zu 4.2.1(3):<br />
Kontaminierte Böden treten in der Region vor allem in Form von Flächen nicht genutzter bzw. nicht dem<br />
Stand der Technik entsprechenden landwirtschaftlichen Produktionsanlagen, Abwasserverwertungsflächen,<br />
Industriealtlasten sowie militärischen Hinterlassenschaften auf. Eine Schädigung des Bodens läßt sich in der<br />
Regel nicht wieder vollständig rückgängig machen. Nur mit großem Kostenaufwand können die am stärksten<br />
belasteten oberen Bodenschichten abgetragen <strong>und</strong> umgelagert werden. Eine Umnutzung von Flächen mit<br />
belasteten Böden könnte zu einer Gefährdung der Umwelt führen <strong>und</strong> unabsehbare Schäden nach sich ziehen.<br />
4.2.2 Wasser<br />
(1) Die Gewässer sollen als wichtige Bestandteile des Naturhaushaltes sowie als Lebens-<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftsgr<strong>und</strong>lage quantitativ <strong>und</strong> qualitativ geschützt, schonend genutzt <strong>und</strong> in<br />
ihrem natürlichen oder naturnahen Zustand erhalten werden bzw. in einem angemessenen<br />
Zeitraum wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden. Ökologisch sensible<br />
Gewässerbereiche sollen vorrangig als Ruhe- <strong>und</strong> Rückzugsraum für Pflanzen <strong>und</strong> Tiere<br />
dienen <strong>und</strong> von störenden Nutzungen möglichst freigehalten werden.<br />
Gravierende Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes durch Eingriffe in das Oberflächen-<br />
<strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>wasser, auch in ihren wechselseitigen Beziehungen, sind auszuschließen.<br />
(2) Die Fließ- <strong>und</strong> Standgewässer in der Region sollen mit möglichst hoher Wassergüte<br />
erhalten <strong>und</strong> gepflegt werden. Die Stoffeinträge sind zu reduzieren, insbesondere bei den<br />
Standgewässern ist eine weitere Eutrophierung zu vermeiden. Langfristig soll für alle<br />
Fließgewässer mindestens die Beschaffenheitsklasse 2 erreicht werden.<br />
(3) Natürliche Überschwemmungsgebiete in den Flußtälern <strong>und</strong> Niedermoorgebieten sollen<br />
erhalten bzw. bei gestörten Verhältnissen in ihren ökologischen Funktionen möglichst<br />
wieder hergestellt werden.<br />
Insbesondere für Moore ist ein natürliches Wasserregime anzustreben. Eine intensive landwirtschaftliche<br />
Nutzung <strong>und</strong> die Errichtung baulicher Anlagen auf Moorstandorten sollen<br />
vermieden werden.<br />
Große <strong>Teil</strong>e der Flußtalmoore, die neben dem Arten- <strong>und</strong> Biotopschutz vielfältige<br />
Funktionen für die Schutzgüter Wasser, Boden <strong>und</strong> Klima übernehmen, sollen in den<br />
Bereichen, wo diese Funktionen gestört sind, mit geeigneten Maßnahmen langfristig saniert<br />
werden.<br />
47
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(4) Der Schutz der Uferzonen vor Überbauungen, Abgrabungen <strong>und</strong> sonstigen Beeinträchtigungen<br />
ist zu sichern. Bei der Unterhaltung, dem Bau <strong>und</strong> der Betreibung von notwendigen<br />
baulichen Anlagen in, an, unter <strong>und</strong> über Gewässern ist die Erhaltung des natürlichen<br />
Erscheinungsbildes <strong>und</strong> der ökologischen Funktionen der Gewässer <strong>und</strong> ihrer Ufer<br />
zu beachten. Dazu gehört auch die Sicherung bzw. Wiederherstellung der Passierbarkeit der<br />
Gewässer für wandernde aquatische Tierarten.<br />
(5) Die Renaturierung hydromeliorativ geschädigter Landschaften ist anzustreben. Dazu<br />
sollen insbesondere Sölle, Bäche <strong>und</strong> weitere Feuchtbiotope erhalten bzw. in ihren ökologischen<br />
Wirkungen wieder hergestellt werden.<br />
(6) Das Gr<strong>und</strong>wasser soll hinsichtlich Qualität <strong>und</strong> mengenmäßiger Verfügbarkeit flächendeckend<br />
geschützt <strong>und</strong> sparsam in Anspruch genommen werden. Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen<br />
<strong>und</strong> Nutzungen einschließlich Versiegelungen, die die Neubildungsraten überfordern, sind<br />
zur Vermeidung von Schädigungen des Gesamtwasserhaushaltes auszuschließen.<br />
Begründung<br />
zu 4.2.2(1):<br />
Der Schutz <strong>und</strong> die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen, sowohl in jedweder Einzelform als auch im<br />
komplexen Wirkungsgefüge als Wasserhaushalt, ist ein gr<strong>und</strong>legendes Ziel der ökologischen Vorsorge. In der<br />
Planungsregion stellen Seen, Flüsse <strong>und</strong> große Feuchtgebiete einschließlich beachtlicher Gr<strong>und</strong>wasservorräte<br />
eine wichtige Basis des naturräumlichen Potentials dar. Der quantitative Schutzaspekt der Gewässer ist<br />
insbesondere bei regionsübergreifenden Maßnahmen zur Wasserdargebotsaufhöhung (Bilanzstützung) in die<br />
Müritz-Elde-Wasserstraße <strong>und</strong> die Havelwasserstraße von Bedeutung.<br />
Oberflächengewässer <strong>und</strong> oberer Gr<strong>und</strong>wasserleiter stehen in enger hydrologischer Verflechtung. Eingriffe in<br />
ein aquatisches Ökosystem können sich deshalb mit starken negativen Folgen auf andere Ökosysteme sowie<br />
auf den gesamten Naturhaushalt <strong>und</strong> damit auch auf wichtige Raumnutzungen auswirken.<br />
zu 4.2.2(2):<br />
Eine gute Wasserbeschaffenheit, vor allem der Seen, bestimmt ihre Nutzungsfähigkeit. Sie erfordert die<br />
Minimierung anthropogener Störwirkungen bzw. die Erhaltung ökologischer Selbstregulationskräfte.<br />
Die Seen <strong>und</strong> Flüsse der Region sind vor allem durch punktuelle Schadstoffeinträge im Bereich der<br />
Siedlungen (ungenügend gereinigte Abwässer) <strong>und</strong> flächenhafte Stoffumlagerungen von landwirtschaftlichen<br />
Flächen (Überdüngung, Schädlingsbekämpfungsmittel) sowie Fischintensivhaltungen (Aquakulturen) in<br />
erheblichem Maße eutrophiert <strong>und</strong> in ihrem Selbstreinigungsvermögen stark überfordert (siehe Erläuterungskarte<br />
5).<br />
Damit werden die von Natur aus günstigen Voraussetzungen für Tourismus <strong>und</strong> Wasserwirtschaft, die Seenfischerei<br />
sowie der Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz eingeschränkt. Wichtige Maßnahmen der Gegensteuerung sind<br />
deshalb schnell greifende Entsorgungssysteme der Kommunen nach dem Stand der Technik <strong>und</strong> umweltschonende<br />
landwirtschaftliche Produktionsmethoden.<br />
Bei der Sanierung der Gewässer, insbesondere der Seen, ist es wichtig, daß zunächst die Sanierung der<br />
Einzugsgebiete erfolgt, um die Ursachen der Gewässerverschmutzung abzustellen <strong>und</strong> dadurch eine nachhaltige<br />
Verbesserung der Gewässer zu erreichen.<br />
48
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
zu 4.2.2(3):<br />
Die Erhaltung natürlicher Überschwemmungsgebiete in den Flußtälern <strong>und</strong> Niederungen ist zur Gewährleistung<br />
eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes sowie zur Erhaltung der Niedermoorstandorte <strong>und</strong> Auen<br />
einschließlich des Artenschutzes von großer landschaftsökologischer Bedeutung in der Region. Durch Eindeichungen,<br />
Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen, Überbauungen <strong>und</strong> Intensivnutzungen (Ackerbau, Intensivgrünland)<br />
größerer Niedermoorgebiete erfolgten in der Vergangenheit bereits empfindliche Eingriffe mit ungünstigen<br />
ökologischen Auswirkungen (Moorsackungen, Hochwasserzunahme, Eutrophierung der Gewässer).<br />
Die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit setzt vor allem eine Regeneration des Moorkörpers voraus, was<br />
nur über die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserstands- <strong>und</strong> Abflußregimes, einhergehend mit der<br />
Extensivierung oder Auflassung der landwirtschaftlichen Nutzung, zu gewährleisten ist. Nur intakte Moore<br />
können ihre Funktion zum Schutz des Bodens, der Gewässer, des Klimas <strong>und</strong> des Naturschutzes erfüllen<br />
(siehe auch Programmsatz 4.4.(1) <strong>und</strong> (2)). Die tiefgründigen Moorstandorte sind in der Karte<br />
(M 1 : 100 000) dargestellt.<br />
Die Errichtung baulicher Anlagen auf Moorböden erfordert eine hinreichende Wasserabsenkung mit allen<br />
genannten Konsequenzen des Torfabbaus <strong>und</strong> der Freisetzung von Stickstoff <strong>und</strong> Kohlendioxid <strong>und</strong> bedeutet<br />
damit mehr als auf jedem anderen Standort eine schwerwiegende Schädigung des Naturhaushalts.<br />
zu 4.2.2(4):<br />
Die natürlichen <strong>und</strong> naturnahen Uferrandstreifen, insbesondere diejenigen mit Ufergehölz <strong>und</strong> Wasserpflanzenbesatz,<br />
sind auf Gr<strong>und</strong> ihrer ökologischen Funktion für das biologische Selbstreinigungsvermögen<br />
des Wassers <strong>und</strong> für den Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz als Laich- <strong>und</strong> Ruheplätze für Fische <strong>und</strong> Lebensraum einer<br />
vielfältigen Uferlebensgemeinschaft, unter anderem bestehend aus Muscheln, Krebsen <strong>und</strong> Kleinlebewesen<br />
sowie zahlreichen Vögeln <strong>und</strong> Säugetieren wie Biber <strong>und</strong> Fischotter, hochwertige Naturraumelemente.<br />
Überbauungen sind deshalb gemäß § 7 des Ersten Gesetzes zum Naturschutz im Land Mecklenburg-<br />
Vorpommern vom 10. Januar 1992 (GVOBl. M-V S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom<br />
25. September 1997 (GVOBl. M-V S. 502), nur in Ausnahmefällen zulässig.<br />
Auch bei notwendigen wasserwirtschaftlichen oder gewässerbezogenen touristischen baulichen Anlagen sind<br />
die ökologischen Funktionen der Gewässer <strong>und</strong> ihrer Ufer gemäß § 61 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt geändert durch § 15 Absatz 4 Satz<br />
2 des Gesetzes vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zu beachten.<br />
zu 4.2.2(5):<br />
Sölle, Bäche, Moore <strong>und</strong> auch kleinere Feuchtgebiete haben wichtige Regulationsfunktionen für den Wasserhaushalt<br />
sowie als Rückzugsstandorte für viele Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten <strong>und</strong> bereichern das Landschaftsbild.<br />
Durch Großflächenwirtschaft <strong>und</strong> Melioration wurden vor allem die Ackerflächen im nördlichen Gr<strong>und</strong>moränenbereich<br />
der Region stark ausgeräumt. In diesen Räumen sind Renaturierungsmaßnahmen unumgänglich.<br />
Überörtliche Landschaftsplanungen können hierbei wichtige Informationen <strong>und</strong> Entscheidungshilfen<br />
liefern.<br />
zu 4.2.2(6):<br />
Gr<strong>und</strong>wasser ist die wichtigste Ressource für die Trinkwasserversorgung des Menschen. In der Region erfolgt<br />
die Trinkwasserversorgung ausschließlich aus dem Gr<strong>und</strong>wasser, das in mehreren Stockwerken, vom<br />
Pleistozän bis in das Tertiär, in ausreichender Menge naturgegeben vorhanden ist. Die dauerhafte Verfügbarkeit<br />
in Menge <strong>und</strong> Qualität kann jedoch durch überhöhte Entnahmemengen, Entzug von Versickerungsflächen<br />
für die Gr<strong>und</strong>wasserneubildung (Flächenversiegelungen), unzweckmäßige Aufforstungen, Freilegung<br />
49
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
des Gr<strong>und</strong>wassers durch Kiesabbau <strong>und</strong> durch Schadstoffeinträge (Nährstoffe <strong>und</strong> Biozide), vor allem auf<br />
Gr<strong>und</strong> unsachgemäßer, ökologisch nicht angepaßter Landwirtschaft <strong>und</strong> Entsorgung, gefährdet werden.<br />
Ein wirksamer <strong>und</strong> dauerhafter Schutz vor Schadstoffeinsickerungen ist nur großräumig unter Berücksichtigung<br />
der geologischen Strukturen <strong>und</strong> der Einzugsgebiete zu gewährleisten. Der Schutz größerer ungedeckter<br />
Gr<strong>und</strong>wasserleiter, vor allem in Sander- <strong>und</strong> Moorgebieten, kommt gleichzeitig dem Seenschutz zugute bzw.<br />
ist mit diesem im Zusammenhang zu betrachten <strong>und</strong> zu betreiben.<br />
In der Vergangenheit mußten bereits viele Wasserfassungen vor allem des oberen Gr<strong>und</strong>wasserleiters im<br />
Sanderbereich auf Gr<strong>und</strong> von Nitratanreicherungen stillgelegt werden.<br />
4.2.3 Luft / Klima<br />
(1) Die natürlichen Voraussetzungen zur Erhaltung <strong>und</strong> Verbesserung der lokalen Klimaverhältnisse<br />
in der Region sowie der Lufthygiene sollen bei allen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong><br />
Maßnahmen berücksichtigt werden.<br />
(2) Bei der Inanspruchnahme von Flächen für Bebauungen <strong>und</strong> Verkehrsanlagen sollen<br />
Beeinträchtigungen klimatischer Ausgleichsleistungen, insbesondere der<br />
Luftaustauschbedingungen, vermieden werden.<br />
(3) Die Belastung der Luft mit Schadstoffen einschließlich Staub <strong>und</strong> Lärm soll<br />
insbesondere in den Siedlungsbereichen vermindert bzw. möglichst gering gehalten<br />
werden. Die Großschutzgebiete <strong>und</strong> die Räume mit besonderer natürlicher Eignung für<br />
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung sollen vorrangig als großräumige Zonen hoher Luftreinheit<br />
<strong>und</strong> Ruhe in der Region gesichert werden.<br />
Begründung<br />
zu 4.2.3(1):<br />
Die Region verfügt über günstige klimatische <strong>und</strong> lufthygienische Voraussetzungen, die wichtig für bestimmte<br />
Wirtschaftszweige (z.B. Tourismus) <strong>und</strong> für den Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz sind. Zur Erhaltung dieser Situation<br />
<strong>und</strong> Verbesserung des Bio- bzw. Lokalklimas sind die Wälder, vor allem als großflächige Bestände,<br />
Feldgehölze aller Art <strong>und</strong> Feuchtgebiete in der Agrarflur, die Oberflächengewässer <strong>und</strong> innerörtlichen<br />
Grünbestände als klimatische Regulationsfaktoren von großer Bedeutung. Durch ein ausgewogenes<br />
Wirkungsgefüge dieser Landschaftselemente können die Verhältnisse zur Luftregeneration (Frischluftentstehung<br />
<strong>und</strong> -versorgung, Luftreinhaltung <strong>und</strong> Staubausfilterung einschließlich Lärmschutz) <strong>und</strong> zum Schutz<br />
vor speziellen klimatischen Schadwirkungen (Sturm) günstig beeinflußt werden.<br />
Besondere Bedeutung zur Verbesserung des Lokalklimas in der Region kommt der stärkeren Begrünung der<br />
ausgeräumten Agrargebiete, vor allem in den Gr<strong>und</strong>moränengebieten, durch Aufforstungsmaßnahmen,<br />
Schaffung von Windschutzsystemen sowie Straßen- <strong>und</strong> Ortsbegrünungen zu.<br />
zu 4.2.3(2):<br />
Durch Bauwerke <strong>und</strong> Verkehrsanlagen, vor allem in Hanglagen <strong>und</strong> Flußtälern, können starke klimatische<br />
Beeinträchtigungen entstehen, wie z.B. Hinderung des Kaltluftabflusses zu Neutralisationsflächen (Seen) <strong>und</strong><br />
Abriegelung von Frischluftschneisen.<br />
50
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
Vor allem im Bereich größerer Siedlungen ist auf ungehinderte Luftaustauschbedingungen durch entsprechende<br />
Freiraumschutzsysteme (z.B. Parkanlagen, Grünzüge, Grünzäsuren, sonstige Schutzgebiete) zu<br />
achten.<br />
zu 4.2.3(3):<br />
Luftschadstoffe schädigen die Ges<strong>und</strong>heit des Menschen <strong>und</strong> die gesamte Natur, insbesondere die regional<br />
wichtigen Vegetationsbestände wie Wälder <strong>und</strong> Moore sowie die Oberflächengewässer.<br />
Neben der weltweiten Luftbelastung bestehen Schwerpunkte vor allem durch regionale Verursacher in den<br />
Städten (Winter-Hausbrand, Großfeuerungsanlagen, Verkehr) im Bereich stark belasteter Straßen sowie bei<br />
Großanlagen der Tierproduktion (Ammoniak, Güllewirtschaft).<br />
Die Region zeichnet sich insgesamt durch relativ hohe Luftreinheit aus. Im Bereich des Verkehrswesens<br />
müssen jedoch durch Verkehrsverminderung <strong>und</strong> Verkehrsberuhigungen Negativeffekte sowohl in den<br />
Siedlungen als auch in der freien Landschaft vermieden werden.<br />
Die von Luftschadstoffen <strong>und</strong> Lärm weitgehend freien Landschaftsräume, vor allem im Bereich der Seen-<br />
Sanderzone <strong>und</strong> großen Wälder, bilden ein wertvolles Entwicklungspotential für die Region (Tourismus,<br />
Natur- <strong>und</strong> Gewässerschutz). Diese Räume sind deshalb vor gravierenden Immissionsschäden, wie sie durch<br />
Verkehrstrassen <strong>und</strong> belastende Produktionsanlagen entstehen können, zu bewahren.<br />
4.2.4 Wald<br />
(1) Der Wald ist als regional bedeutendes Landschaftselement für den Naturhaushalt, für<br />
die Wirtschaft <strong>und</strong> als Basis der Erholungsfunktionen zu erhalten, zu pflegen <strong>und</strong><br />
flächenmäßig zu mehren.<br />
Die besondere Bedeutung der großen, geschlossenen Waldgebiete im Seen- <strong>und</strong> Sanderbereich<br />
für den Klima- <strong>und</strong> Wasserhaushalt ist bei allen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong><br />
Maßnahmen zu berücksichtigen.<br />
(2) Die Bewirtschaftung <strong>und</strong> die Neubegründung von Wald soll nach den Prinzipien einer<br />
naturnahen Waldbewirtschaftung erfolgen. Es sind ökologisch angepaßte, nachhaltige Wirtschaftsformen<br />
mit Erhöhung des Laubholzanteils <strong>und</strong> Bevorzugung heimischer Baumarten<br />
anzustreben.<br />
Die pleistozänen, naturnahen Buchenmischwälder in der Region sind zu schützen <strong>und</strong> die<br />
Ausbildung naturnaher, ökologisch wirksamer Waldränder ist zu fördern. Die großflächigen<br />
Kiefernmonokulturen, insbesondere im Sanderbereich, sind langfristig in ökologisch<br />
stabilere Mischbestände umzuwandeln.<br />
51
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(3) Bei der Erhöhung des Waldanteils an der Gesamtfläche der Region sollen großräumige,<br />
flurschützende Verb<strong>und</strong>strukturen angestrebt werden.<br />
(4) Gefährdungen, Beeinträchtigungen <strong>und</strong> Eingriffe in vorhandene Waldbestände sind zu<br />
vermeiden bzw. zu minimieren.<br />
Für eine Umnutzung sollen Waldflächen nur dann <strong>und</strong> in unbedingt notwendigem Umfang<br />
in Anspruch genommen werden, wenn andere geeignete Flächen nicht vorhanden sind.<br />
Rodungen sind durch Ersatzaufforstungen, insbesondere in waldarmen Räumen,<br />
auszugleichen.<br />
Begründung<br />
zu 4.2.4(1):<br />
Der Wald ist aufgr<strong>und</strong> seiner hervorgehobenen Bedeutung vor allem als Lebensraum für einheimische Tiere<br />
<strong>und</strong> Pflanzen, für das Klima <strong>und</strong> die Reinhaltung der Luft, den Lärm- <strong>und</strong> Bodenschutz, für den Wasserhaushalt<br />
<strong>und</strong> das Landschaftsbild als umweltfre<strong>und</strong>licher Rohstofflieferant <strong>und</strong> für Erholungszwecke in seiner<br />
Funktion <strong>und</strong> räumlichen Verteilung zu sichern <strong>und</strong> durch eine entsprechende naturnahe Waldbewirtschaftung<br />
zu pflegen.<br />
zu 4.2.4(2):<br />
Naturnahe Wälder erfüllen am besten die Aufgaben einer dauerhaften Rohholzerzeugung bei gleichzeitiger<br />
Sicherung der ökologischen <strong>und</strong> sozialen Leistungen. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung ist überwiegend<br />
gekennzeichnet durch:<br />
- wesentliche Erhöhung des Laubholzanteils,<br />
- Bevorzugung einheimischer Baumarten, standortgerechte Baumartenwahl,<br />
- Anstrebung gemischter <strong>und</strong> mehrstufiger Bestände,<br />
- Förderung der Naturverjüngung <strong>und</strong> Vermeidung großflächiger Kahlschläge,<br />
- Verlängerung der Umtriebszeiten mit Belassung eines ausreichenden Altholz- <strong>und</strong> Totholzanteils,<br />
- Nutzung nicht über den natürlichen Zuwachs hinaus <strong>und</strong><br />
- Wildbestandsregulierung auf ein Niveau, welches eine natürliche Waldverjüngung gewährleistet.<br />
Waldränder <strong>und</strong> ihre Übergangszone in die offene Feldmark haben eine große Bedeutung für das Landschaftsbild,<br />
die Erholung sowie als Lebensraum, Rückzugs- <strong>und</strong> Äsungsbereich wildlebender Tiere. Waldränder<br />
dienen der Sturmsicherung des intakten natürlichen Waldbestandes (siehe auch Programmsatz<br />
6.2.2(1)).<br />
Naturnahe Buchenmischwälder sind vor allem noch im Bereich der Endmoränen <strong>und</strong> reliktmäßig auch in den<br />
Gr<strong>und</strong>moränen vorhanden. Sie sind auf Gr<strong>und</strong> ihres hohen landschaftsökologischen Wertes <strong>und</strong> als regional<br />
typisches Landschaftselement von großer Bedeutung.<br />
Die großflächigen Kiefernreinbestände im Sander-Seenbereich stellen größtenteils jüngere, strukturarme<br />
„Stangenhölzer“ dar. Diese haben durch relative ökologische Instabilität (Gefährdungen durch Luftschadstoffe,<br />
Waldbrand, Sturm, Schädlingsmassenentwicklungen) eine geminderte Bedeutung für den Artenschutz<br />
<strong>und</strong> eine eingeschränkte Erholungsqualität. Deshalb sollen sie langfristig nach den standörtlichen<br />
Gegebenheiten in Laub-Nadel-Mischbestockungen umgewandelt werden (siehe auch Programmsatz 6.2.2).<br />
zu 4.2.4(3):<br />
52
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
Durch die Berücksichtigung großräumiger, flurschützender Verb<strong>und</strong>strukturen bei Aufforstungen zur Erhöhung<br />
des Waldanteils gemäß Programmsatz 6.2.2(3) kann ein effektiver Beitrag zu Schutz-, Klima- <strong>und</strong><br />
Wasserhaushaltsleistungen sowie zum Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz geleistet werden. Die Waldmehrung kann<br />
nicht willkürlich erfolgen, sondern muß von den naturräumlichen <strong>und</strong> standörtlichen Gegebenheiten (Relief,<br />
Bodengüte, Wasserverhältnisse, Lokalklima) ausgehen.<br />
zu 4.2.4(4):<br />
Waldrodungen können vor allem durch den Bedarf an Siedlungsflächen, Verkehrsanlagen sowie durch Kies-<br />
<strong>und</strong> Sandabbau ausgelöst werden. Die Verpflichtung zum Ausgleich der Umwandlung von Wald in andere<br />
Nutzungsarten durch Ersatzaufforstungen ist in § 15 Absatz 5 Landeswaldgesetz in der Fassung vom 8. Februar<br />
1993 (GVOBl. M-V S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. September 1997<br />
(GVOBl. M-V S. 502), verankert. Bei der Auswahl der Flächen für Ersatzaufforstungen sollten unter anderem<br />
auch ökologische Vorteilswirkungen berücksichtigt werden (z.B. Erhöhung des Waldanteils in waldarmen<br />
Gebieten).<br />
4.2.5 Pflanzen- <strong>und</strong> Tierwelt / Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz<br />
(1) Die typischen Ökosysteme der Region sollen so geschützt, gepflegt <strong>und</strong> entwickelt<br />
werden, daß die charakteristischen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten in dauerhaft überlebensfähigen<br />
Gesellschaften <strong>und</strong> Populationen bestehen können.<br />
(2) In den Naturräumen sind die typischen Ökosysteme so zu schützen, zu pflegen <strong>und</strong> zu<br />
entwickeln, daß darin die charakteristischen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten sowie deren<br />
Gesellschaften in langfristig überlebensfähigen Populationen bestehen können. Hierzu<br />
sollen auch Biotopverb<strong>und</strong>systeme aufgebaut <strong>und</strong> die bestehenden großräumigen<br />
Verb<strong>und</strong>systeme gesichert werden.<br />
(3) Die Rast- <strong>und</strong> Nahrungsplätze durchziehender Vogelarten sollen durch entsprechende<br />
Nutzungen <strong>und</strong> Bewirtschaftungsformen gesichert werden.<br />
Begründung<br />
zu 4.2.5(1):<br />
Die Region besitzt eine hervorragende Artenausstattung sowie großflächige <strong>und</strong> zusammenhängende<br />
Landschaftsräume mit großer Bedeutung für den Biotop- <strong>und</strong> Artenschutz. Insbesondere zeichnen sich die<br />
Seenplatte <strong>und</strong> die Endmoränen durch eine besonders hohe <strong>und</strong> regionsspezifische Artenvielfalt aus (z.B.<br />
Schrei-, Fisch- <strong>und</strong> Seeadler, Kranich, Schwarzstorch, Rothalstaucher, Zwergtaucher, Mittelspecht, Rothirsch,<br />
Fischotter, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Kreuzotter, verschiedene Orchideenarten).<br />
Durch Besiedlung, Tourismus, Verkehrswegebau, industrielle <strong>und</strong> landwirtschaftliche Nutzung mit Schadstoffanreicherungen<br />
<strong>und</strong> starken Eingriffen in die Landschaftsstrukturen sowie Landschaftszerschneidungen<br />
werden die natürlichen <strong>und</strong> kulturgeprägten Ökosysteme eingeschränkt, überformt oder gestört, was zu einem<br />
erheblichen Rückgang zahlreicher Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten führte. Zum <strong>Teil</strong> hat die Populationsstärke einiger<br />
Arten so weit abgenommen, daß die Gefahr des Aussterbens besteht. Einige Arten sind bereits ausgestorben.<br />
53
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Dauerhaft kann die heimische Pflanzen- <strong>und</strong> Tierwelt nur geschützt werden, wenn ihre Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
nicht weiter zerstört werden bzw. Beeinträchtigungen ausreichend ausgeglichen werden. Geeignete Maßnahmen<br />
dazu sind unter anderem:<br />
- die Entwicklung großflächiger, alle typischen Ökosysteme umfassenden Schutzgebiete,<br />
- die Erhaltung bzw. Renaturierung der Gewässer <strong>und</strong> Feuchtgebiete,<br />
- die Erhaltung <strong>und</strong> naturnahe Entwicklung der Wälder,<br />
- die Renaturierung <strong>und</strong> Strukturverbesserung der Landwirtschaftsflächen (durch Pflege bzw.<br />
Neubegründung von Feldgehölzen, Rainen <strong>und</strong> Randstreifen, Kleingewässern, Wiederherstellung<br />
natürlicher Wasserverhältnisse, Extensivierung).<br />
Vor allem durch die Entwicklung <strong>und</strong> Sicherung von raumwirksamen Biotopverb<strong>und</strong>systemen, aufbauend auf<br />
den bestehenden Schutzgebieten, Flußtalmooren <strong>und</strong> sonstigen Flächenbiotopen, muß zukünftig ein verbesserter<br />
Artenschutz angestrebt werden. Solche ökologischen Verb<strong>und</strong>strukturen stellen eine nur gemeinschaftlich<br />
zu lösende Zukunftsaufgabe durch Raumordnung <strong>und</strong> Landschaftsplanung zur gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
ökologischen Verbesserung der agrarisch geprägten Situation in der Region dar (siehe hierzu Entschließung<br />
der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 27. November 1992, B<strong>und</strong>esministerium für Raumordnung,<br />
Bauwesen <strong>und</strong> Städtebau). Gemäß dieser Entschließung soll 15 % der nicht für Siedlungsfläche genutzten<br />
Fläche für den Aufbau eines ökologischen Verb<strong>und</strong>systems landesplanerisch gesichert werden, das zu einem<br />
b<strong>und</strong>es-, landes- <strong>und</strong> regionalweiten ökologischen Netz verknüpft werden soll.<br />
zu 4.2.5(2):<br />
Die wichtigste Maßnahme des Artenschutzes ist die Erhaltung geeigneter Lebensräume. Neben den natürlichen<br />
Lebensräumen (z.B. Wälder, Oberflächengewässer, Moore) entstanden kulturlandschaftlich geprägte<br />
Lebensräume, die wesentlich zur Artenvielfalt der Landschaft beitragen (z.B. Heiden <strong>und</strong> Hutungen, Waldmäntel,<br />
Magerrasen, Zwergstrauchheiden, Ackerwildkrautgesellschaften, Gehölzstrukturen in der Ackerlandschaft).<br />
Ihr Erhalt setzt die Fortsetzung traditioneller Landnutzungsformen auf ausreichenden Flächen<br />
voraus bzw. erfordert besondere Pflegemaßnahmen.<br />
Der Artenschutz allgemein <strong>und</strong> besonders der Schutz bedrohter <strong>und</strong> empfindlicher Arten kann nicht allein auf<br />
Schutzgebiete beschränkt bleiben. Für eine Vielzahl gefährdeter Arten ist das Nebeneinander verschiedener<br />
natürlicher <strong>und</strong> nutzungsbedingter, miteinander vernetzter Lebensräume überlebensnotwendig. Nur durch<br />
einen umfassenden Schutz sowie die Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der gesamten Landschaft können die Ziele des<br />
Artenschutzes erreicht werden <strong>und</strong> die in der Region vorhandene Artenvielfalt bewahrt werden.<br />
zu 4.2.5(3):<br />
Die Rastplätze besitzen auch im internationalen Rahmen eine zentrale Bedeutung für den Schutz wandernder<br />
Vogelarten (vor allem Wildgänse, Limikolenarten, Kraniche, Schwäne). Diese Plätze dienen als Äsungs- <strong>und</strong><br />
Mauserplätze, zur Erholung <strong>und</strong> Auffrischung der Energiereserven <strong>und</strong> zur Überwinterung von Zugvögeln.<br />
Die Planungsregion ist ein international bedeutsamer Schwerpunkt des Vogelzuges. Die Seen <strong>und</strong><br />
umgebenden Agrarflächen bilden beim Rast- <strong>und</strong> Zuggeschehen eine funktionale Einheit.<br />
Herausragende Gebiete für den Vogelzug in der Region sind die Mecklenburgische Schweiz, die Großseenlandschaft,<br />
die Kleinseenlandschaft, das Peenetal, das Gebiet um die Lieps, der Galenbecker See <strong>und</strong> die<br />
Feldberger Seenlandschaft.<br />
Durch übermäßige Beunruhigung <strong>und</strong> großflächige Nutzungsänderungen können die Brut- <strong>und</strong> Rastgebiete<br />
gefährdet werden.<br />
54
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
4.3 Landschaft / Landschaftsentwicklung<br />
(1) Die typischen Landschaftsstrukturen der Region sollen in ihrer natürlichen Leistungskraft,<br />
in ihrem ökologischen Wirkungsgefüge sowie in ihrer Eigenart, Vielfalt <strong>und</strong><br />
Schönheit erhalten <strong>und</strong> entwickelt werden. Insbesondere soll das charakteristische<br />
Landschaftsbild weitgehend erhalten <strong>und</strong> vor Überprägung durch Zersiedlungen,<br />
Bebauungen <strong>und</strong> technische Eingriffe aller Art bewahrt werden.<br />
(2) Zur Sicherung der ökologischen Funktion des Naturhaushaltes <strong>und</strong> eines regionstypischen<br />
Landschaftsbildes sollen große unzerschnittene <strong>und</strong> störungsarme Räume in der<br />
Regel erhalten werden.<br />
(3) Nutzer <strong>und</strong> Bewirtschafter der Landschaft sollen flächendeckend durch natur- <strong>und</strong> landschaftsgerechte<br />
Nutzungsformen zur Bewahrung, Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der Kulturlandschaft<br />
beitragen. Schwerpunkte der Landschaftspflege in der Region sollen neben den<br />
Agrar- <strong>und</strong> Waldgebieten vor allem die großen Feuchtbereiche <strong>und</strong> nährstoffarmen<br />
Standorte bzw. Trockenstandorte sein.<br />
Begründung<br />
zu 4.3(1):<br />
Die naturräumlich typischen Landschaftsstrukturen <strong>und</strong> ihr ungestörtes ökologisches Wirkungsgefüge stellen<br />
die Basis für den Lebensraum- <strong>und</strong> Artenschutz sowie für alle Raumnutzungen dar. Auch das Landschaftsbild<br />
wird vor allem durch die naturgegebenen Strukturen geprägt, gleichzeitig reflektiert es jedoch auch die<br />
kulturhistorische Entwicklung <strong>und</strong> die Landnutzung in der Region (siehe Erläuterungskarte 4).<br />
Schutz, Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der Landschaft müssen deshalb sowohl im Sinne des Ressourcen- <strong>und</strong><br />
Artenschutzes als auch im Sinne der Landschaftsästhetik komplex betrachtet werden. Großräumige Überprägungen<br />
der Landschaft, wie sie zum <strong>Teil</strong> in der Vergangenheit durch landschaftsstörende Bebauungen,<br />
falsche Standortwahl <strong>und</strong> ökologisch unzweckmäßige Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft erfolgten, schaden dem typischen,<br />
über Jahrh<strong>und</strong>erte gewachsenem Landschaftsbild der Region.<br />
In der Planungsregion können folgende Naturraumeinheiten unterschieden werden (siehe Erläuterungs-<br />
karte 4):<br />
- die flachwelligen Gr<strong>und</strong>moränen mit besseren ertragsreichen Böden,<br />
- die reliefgeprägten Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Endmoränengebiete <strong>und</strong> großen Becken mit einer reichen Naturraumausstattung<br />
<strong>und</strong> landschaftlichen Strukturvielfalt,<br />
- die großen Flußtäler <strong>und</strong> Niedermoorgebiete <strong>und</strong><br />
- der Sander-Seenbereich mit leichten Böden <strong>und</strong> hohem Waldanteil.<br />
zu 4.3(2):<br />
Die Erhaltung großräumiger, weitgehend unzerschnittener <strong>und</strong> störungsarmer Räume ist auf Gr<strong>und</strong> der geringen<br />
Besiedlung, Industrialisierung <strong>und</strong> Verkehrserschließung sowie der Flächennutzung vor allem im Bereich<br />
der Seenplatte <strong>und</strong> großen Waldgebiete gegeben <strong>und</strong> von großer Bedeutung für den internationalen<br />
Artenschutz (z.B. Überleben störempfindlicher Arten wie Adler, Kranich, Schwarzstorch, Fischotter), für<br />
55
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Wasserhaushalt <strong>und</strong> Klimaausgleich (z.B. Erhaltung der Luftreinheit) sowie für den Tourismus. Die Großschutzgebiete<br />
(Müritz-Nationalpark, Naturparke Nossentiner-Schwinzer Heide, Feldberger Seenlandschaft<br />
sowie Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong> Kummerower See) können hierbei als Gebiete mit herausragender<br />
naturräumlicher Ausstattung betrachtet werden, die auch auf benachbarte Räume ausstrahlen.<br />
Die unzerschnittenen <strong>und</strong> störungsarmen Räume in der Planungsregion sind in der Erläuterungskarte 6<br />
dargestellt. Die Sicherung dieser ökologischen Ausgleichsräume als unzerschnittene <strong>und</strong> störungsarme Räume<br />
ist insbesondere bei bandartigen verkehrlichen <strong>und</strong> infrastrukturellen Planungen, Maßnahmen <strong>und</strong> Vorhaben<br />
mit Trennwirkung zu beachten.<br />
zu 4.3(3):<br />
Eine flächendeckende Landbewirtschaftung beinhaltet die Nutzung des Bodens außerhalb bebauter Flächen<br />
(einschließlich der Nutzungsformen Wald, Brache <strong>und</strong> gewollte Sukzession). Eine flächendeckende Landbewirtschaftung<br />
dient dem Erhalt <strong>und</strong> der Pflege der Kulturlandschaft. Sie sichert die Einhaltung der Stoffkreisläufe<br />
(z.B. bei der Gülleverwertung) <strong>und</strong> ist Gr<strong>und</strong>lage für eine tourismusfördernde landschaftsästhetische<br />
Ausstrahlung der Region. Ebenso gewährleistet eine flächendeckende Landbewirtschaftung die Sicherung<br />
<strong>und</strong> Weiterentwicklung des Wirtschaftszweiges Landwirtschaft. Für die ökologisch verträgliche Nutzung,<br />
Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der Landschaft ist eine gesicherte Existenz der land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlichen<br />
Unternehmen als Hauptnutzer der freien Landschaft eine wesentliche Voraussetzung.<br />
Aufgabe der Landschaftspflege in der Region ist es auch, die Erholungseignung der Landschaft zu bewahren,<br />
zu entwickeln bzw. wieder herzustellen. Durch die Landschaftspflege sind zukünftig neue Arbeitsplätze zu<br />
schaffen.<br />
Neben der zielgerichteten Pflege <strong>und</strong> Entwicklung der flächenmäßig größeren Agrar- <strong>und</strong> Forstgebiete einschließlich<br />
Oberflächengewässer sind spezielle Pflegemaßnahmen für Halbkulturstandorte erforderlich<br />
(Feuchtgrünland, Hutungen, Heidegebiete, Mager- <strong>und</strong> Trockenstandorte mit besonderer Artenausstattung auf<br />
Gr<strong>und</strong> der Kulturlandschaftsentwicklung).<br />
4.4 Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume<br />
(1) Als Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege sind<br />
- der Müritz-Nationalpark,<br />
- die Naturschutzgebiete,<br />
- die einstweilig gesicherten <strong>und</strong> geplanten Naturschutzgebiete,<br />
- die geschützten Biotope (auch in den Bereichen der tiefgründigen Moorstandorte),<br />
- die Naturdenkmale<br />
zu sichern <strong>und</strong> zu schützen.<br />
In diesen Gebieten haben Belange von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege gegenüber allen<br />
anderen Nutzungsanforderungen Vorrang. Alle raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen müssen mit den Zielen des Naturschutzes vereinbar sein.<br />
(2) Als Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege sind<br />
56
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
- die Naturparke,<br />
- die Landschaftsschutzgebiete,<br />
- die geschützten Landschaftsbestandteile,<br />
- die Biotopkomplexbereiche mit überwiegendem Anteil der in Programmsatz 4.4(1)<br />
aufgeführten Biotope,<br />
- die einstweilig gesicherten <strong>und</strong> geplanten Schutzgebiete, soweit sie nicht bereits unter<br />
Programmsatz 4.4(1) erfaßt sind,<br />
- die tiefgründigen Moorstandorte<br />
zu sichern <strong>und</strong> zu schützen.<br />
In diesen Räumen sind raumbedeutsame Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen unter<br />
beson-derer Berücksichtigung der Belange von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
abzuwägen <strong>und</strong> abzustimmen.<br />
Begründung<br />
zu 4.4 (1) <strong>und</strong> (2):<br />
Die Schutzgebietskategorien wurden entsprechend ihrer Bedeutung als Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume<br />
für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege in der Karte (M 1 : 100 000) festgesetzt (siehe hierzu auch Erläuterungskarte<br />
7). Durch die Festsetzung dieser Gebiete <strong>und</strong> Räume soll sichergestellt werden, daß sie langfristig<br />
ihre Funktionen für den Naturhaushalt, für den Ökosystem- <strong>und</strong> Artenschutz, zur Erhaltung des<br />
Landschaftsbildes sowie für die Tourismusentwicklung erfüllen können. Der Flächenanteil der Vorranggebiete<br />
<strong>und</strong> Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege an der Gesamtregion beträgt ca. 52 %.<br />
In der Regel sind Ortslagen nicht Bestandteil der Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume Naturschutz <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege. Näheres wird in den entsprechenden Schutzverordnungen geregelt. Bei der zeichnerischen<br />
Darstellung sind sie innerhalb großer Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Nationalpark) nur<br />
auf Gr<strong>und</strong> der Maßstäblichkeit nicht ausgegrenzt.<br />
Die "Europäischen Vogelschutzgebiete" <strong>und</strong> "Feuchtgebiete gemäß Ramsarkonvention" wurden nicht dargestellt,<br />
da sie von anderen Schutzkategorien überlagert werden. Hierzu zählen der Müritz-Nationalpark, die<br />
Naturschutzgebiete Galenbecker See <strong>und</strong> Großer Schwerin, der Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide, das<br />
Landschaftsschutzgebiet Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong> Kummerower See, das Peene- <strong>und</strong> Trebeltal, die<br />
teilweise zugleich Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete sind.<br />
Zu den Vorranggebieten Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege zählen:<br />
- Müritz-Nationalpark<br />
Der Müritz-Nationalpark besteht aus den zwei <strong>Teil</strong>flächen Müritz <strong>und</strong> Serrahn. Er stellt auf Gr<strong>und</strong> seiner<br />
weitgehend ursprünglichen natürlichen Ausstattung mit einzigartigen Ökosystemen, insbesondere den Gewässer-,<br />
Moor-, Wald- <strong>und</strong> Grünlandkomplexen, sowie mit einer Vielfalt an standorttypischen <strong>und</strong> gefährdeten<br />
Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten auf einer Gesamtfläche von 319 km 2 ein herausragendes Großschutzgebiet von<br />
internationaler Bedeutung <strong>und</strong> mit großer Imagewirkung für die Region dar. Seine Pflege <strong>und</strong> Entwicklung<br />
wird durch einen entsprechenden Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungsplan geregelt. (Dieser Plan befand sich im Jahre<br />
1998 noch in Aufstellung.)<br />
57
Natur <strong>und</strong> Landschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Die Festsetzung des Nationalparks für eine Vorrangnutzung von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege soll die<br />
Bauleitplanung der berührten Gemeinden im Sinn der Eigenentwicklung nicht behindern (siehe Programmsatz<br />
5.1.3).<br />
- Naturschutzgebiete<br />
Der Bestand an Naturschutzgebieten (Bestand, einstweilige Sicherung <strong>und</strong> im Rechtsetzungsverfahren) in der<br />
Region umfaßt mit Stand Dezember 1996 63 Gebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 16.864 ha (siehe<br />
Anhang, Anlage 2). Das entspricht 2,9 % der Gesamtfläche der Planungsregion. Das Netz der Naturschutzgebiete<br />
stellt eine wichtige Gr<strong>und</strong>lage für den Lebensraum- <strong>und</strong> Artenschutz, insbesondere für gefährdete<br />
bzw. vom Aussterben bedrohte Arten, in der Region dar <strong>und</strong> ist Basis zukünftiger regionaler Vernetzungsstrategien.<br />
Regionstypisch in Form der Naturschutzgebiete ist der Schutz von naturnahen Wäldern, limnologisch<br />
wertvollen bzw. für den Artenschutz wichtigen Gewässern, Moor- <strong>und</strong> sonstigen Feuchtgebieten,<br />
Trocken- <strong>und</strong> Magerstandorten bzw. die Sicherung komplexer Schutzgebiete.<br />
- geschützte Biotope, Naturdenkmale<br />
Ebenfalls zu den Vorranggebieten Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege zählen die gemäß § 2 Erstes Gesetz<br />
zum Naturschutz im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 10. Januar 1992 (GVOBl. M-V S. 3), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. September 1997 (GVOBl. M-V S. 502), geschützten Biotope <strong>und</strong><br />
Naturdenkmale (z.B. Moore, Sölle, Oser, Trocken- <strong>und</strong> Magerrasen, Feldgehölze, Findlinge). Sie sind aus<br />
Gründen der Maßstäblichkeit in der Karte (M 1 : 100 000) nicht dargestellt.<br />
Die großen Flußtalmoore in der Region sind auf Gr<strong>und</strong> ihrer herausgehobenen Bedeutung für den weltweiten<br />
Ökosystemschutz (Verhinderung weiterer gravierender Gewässereutrophierungen im Sinn der Ostseekonvention,<br />
Ozon- bzw. Klimaschutz), für den Bodenschutz <strong>und</strong> für die Sicherung des Wasserhaushaltes<br />
sowie für den Lebensraum- <strong>und</strong> Artenschutz in großen <strong>Teil</strong>en als Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
eingestuft (siehe auch Programmsätze 4.2.1(2), 4.2.2(3) <strong>und</strong> 4.2.5 sowie Karte M 1 : 100 000).<br />
Größtenteils besteht bei den Mooren ein "Mehrfachschutz" durch mehrere gleichzeitig wirkende Schutzkategorien<br />
(Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, EU-Vogelschutzgebiet). <strong>Teil</strong>weise sind Einzelbereiche<br />
der Moore durch Wasserentzug, Moorsackungen <strong>und</strong> Intensivnutzungen bereits stärker degradiert, so daß<br />
für diese Bereiche langfristige Renaturierungsmaßnahmen erforderlich sind (siehe auch Programmsatz<br />
4.2.1(2) <strong>und</strong> 4.2.2(3) sowie Karte M 1: 100 000). Für den Schutz des eigentlichen Moorkörpers ist die Einbeziehung<br />
der hydrologisch wichtigen Hangzonen von großer Bedeutung (Schichtwasser zur Speisung der<br />
Moore).<br />
Als Ausgleich für eventuell auftretende Härten der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe sind Anpassungsmaßnahmen<br />
in Form von langfristigen Grünlandextensivierungsprogrammen in Verbindung mit Ausgleichszahlungen<br />
anzustreben (Abstimmungen zwischen Naturschutzstellen <strong>und</strong> Landwirtschaft bezüglich der<br />
Gestaltung des jährlichen Wasserregimes <strong>und</strong> Festlegung von Zeitdauer, Art <strong>und</strong> Intensität der Nutzungen,<br />
z.B. Termine für Mahd <strong>und</strong> Auftrieb, Besatzstärke <strong>und</strong> -dichte).<br />
Zu den Vorsorgeräumen Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege zählen:<br />
- Landschaftsschutzgebiete <strong>und</strong> Naturparke<br />
Es bestehen mit Stand Dezember 1996 in der Planungsregion 22 Landschaftsschutzgebiete mit einer Fläche<br />
von ca. 179.406 ha. Das entspricht 30,9 % der Gesamtfläche der Planungsregion (siehe Anhang, Anlage 2).<br />
Naturparke sind Großschutzgebiete, die überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind<br />
- mit Ausnahme der ausgegrenzten Ortslagen - <strong>und</strong> sowohl dem Naturschutz als auch dem Tourismus <strong>und</strong> der<br />
nachhaltigen Ressourcennutzung dienen. Ziel ist die Sicherung, Weiterentwicklung <strong>und</strong> Pflege von historisch<br />
entstandenen, ländlich geprägten Kulturlandschaften.<br />
58
RROP Mecklenburgische Seenplatte Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
Für die Entwicklung des im Bereich des in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte liegenden <strong>Teil</strong>s<br />
des Naturparks Nossentiner-Schwinzer Heide hat die Regeneration der Moore <strong>und</strong> Gewässer, die Umwandlung<br />
der Kiefernforste in Mischwaldbestände sowie die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
vorrangige Bedeutung. Primäre Schutzziele im Naturpark Feldberger Seenlandschaft sind die Sanierung<br />
einiger Seen, die Erhöhung des Laubwaldanteils sowie die Pflege von Trockenrasen <strong>und</strong> Moorwiesen. Der<br />
Naturpark Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong> Kummerower See, der zum <strong>Teil</strong> im Bereich der Planungsregion<br />
Mecklenburgische Seenplatte liegt, soll dem Erhalt <strong>und</strong> der Entwicklung dieser Jungmoränenlandschaft mit<br />
ihrer reichhaltigen Naturausstattung <strong>und</strong> kulturhistorischen Bedeutung dienen. Dabei ist es wichtig, daß auf<br />
die einheitliche Entwicklung der Naturparke über Verwaltungsgrenzen hinweg geachtet wird.<br />
Die oben genannten Naturparke umfassen zusammen ca. 83.465 ha. Das entspricht 14,4 % der Gesamtfläche<br />
der Planungsregion.<br />
- Biotopkomplexbereiche<br />
Die Biotopkomplexbereiche wurden als Vorsorgeräume Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege auf Gr<strong>und</strong> eines<br />
hohen Anteils von Biotopen im Sinne von § 2 Erstes Gesetz zum Naturschutz im Land Mecklenburg-<br />
Vorpommern vom 10. Januar 1992 (GVOBl. M-V S.3), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 5. Mai 1994<br />
(GVOBl. M-V S. 566), mit noch großer Strukturvielfalt <strong>und</strong> Naturnähe, ihrer Bedeutung für den Arten- <strong>und</strong><br />
Lebensraumschutz, ihren Werten für den Boden- <strong>und</strong> Gewässerschutz sowie für das Landschaftsbild auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Biotypenkartierung des Landesamtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur M-V ausgewiesen. Sie können im<br />
Zusammenspiel mit anderen Landschaftselementen zur Entwicklung von ökologischen Verb<strong>und</strong>systemen<br />
beitragen (siehe auch Programmsatz 4.2.5(1)).<br />
Bei den Biotopkomplexen handelt es sich um gebietliche Häufungen von Einzelbiotopen außerhalb von<br />
Schutzgebieten (ökologisch wertvolle Standorte in Monokulturwäldern, kleinere Wälder, Trocken- <strong>und</strong><br />
Magerstandorte sowie Bäche <strong>und</strong> kleinere Feuchtgebiete vor allem in der Agrarflur), die als Einzelstandorte<br />
auf Gr<strong>und</strong> der Maßstäblichkeit der Karte (M 1 : 100 000) nicht darstellbar sind.<br />
Ein größerer Raum wurde südlich der Brohmer Berge mit Anschluß an den Naturpark Feldberger Seenlandschaft<br />
ausgewiesen, der als besonders wertvoll hinsichtlich seiner landschaftsökologischen Qualität gilt.<br />
Diese Räume sind in diesem Sinn nicht als Schutzgebiete zu betrachten, sondern bei Planungen, Vorhaben<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen in der freien Landschaft sollen die gegebenen wertvollen Landschaftselemente bei Abwägungen<br />
besonders berücksichtigt werden.<br />
- tiefgründige Moorstandorte (Vorsorgeraum)<br />
Die Flußtalmoore der Datze sowie des Großen <strong>und</strong> des Kleinen Landgrabens gelten ebenfalls als Vorsorgeräume.<br />
Sie wurden entgegen den Vorschlägen des zugr<strong>und</strong>eliegenden Arbeitsstandes am Gutachtlichen<br />
Landschaftsrahmenplan, der eine Vorrangstellung (Moorschutz) vorsieht, nach Abwägungen im Regionalen<br />
Planungsverband als Vorsorgeräume eingestuft, da in weiten <strong>Teil</strong>en durch Melioration <strong>und</strong> landwirtschaftliche<br />
Intensivbewirtschaftung starke Moordegradierungen zu verzeichnen sind, die vorerst eine Einstufung als<br />
Vorranggebiete Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege nicht rechtfertigen. Langfristig sollten jedoch Renaturierungsmaßnahmen<br />
erfolgen, so daß zu späterem Zeitpunkt eine erneute Prüfung zur Festsetzung als<br />
Moorschutzgebiet mit Vorrangstatus erfolgen kann (siehe auch Programmsatz 4.2.1(2) <strong>und</strong> 4.2.2(3)). Die<br />
tiefgründigen Moorstandorte sind in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellt.<br />
59
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
5. Siedlungswesen<br />
5.1 Siedlungsstruktur<br />
5.1.1 Allgemeine siedlungsstrukturelle Entwicklung<br />
Die gewachsene, dezentrale Siedlungsstruktur ist in ihren Gr<strong>und</strong>zügen zu erhalten <strong>und</strong> unter<br />
Stärkung der zentralen Orte sowie unter Wahrung der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen entsprechend<br />
den Bedürfnissen von Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft weiter zu entwickeln.<br />
Begründung<br />
Die Siedlungsstruktur in der Region ist durch eine große Anzahl kleiner Siedlungen <strong>und</strong> nur wenige größere<br />
Zentren, die inselartig in den insgesamt als "ländlich" zu kategorisierenden <strong>und</strong> dünn besiedelten Raum<br />
eingestreut sind, gekennzeichnet.<br />
Tabelle 13:<br />
Anzahl der Siedlungen nach Größenklassen (Stand: 1996)<br />
60<br />
Größenklasse (Einwohner) Anzahl der Siedlungen<br />
> 50.000 1<br />
10.000 - < 50.000 3<br />
5.000 - < 10.000 6<br />
2.000 - < 5.000 13<br />
< 2.000 1.065<br />
Von den insgesamt 1.088 Siedlungen - verteilt auf 249 Gemeinden - stellen nur 4 Siedlungen Zentren mit<br />
mehr als 10.000 Einwohnern dar (Neubrandenburg mit 79.041 EW, Neustrelitz mit 24.544 EW, Waren<br />
(Müritz) mit 22.281 EW, Demmin mit 14.430 EW). Weitere 6 Städte weisen Einwohnergrößen zwischen<br />
6.000 <strong>und</strong> 9.200 Einwohner auf (Altentreptow, Friedland, Malchin, Malchow, Röbel/Müritz, Reuterstadt<br />
Stavenhagen); 10 Städte (Burg Stargard, Dargun, Feldberg, Jarmen, Loitz, Mirow, Neukalen, Penzlin,<br />
Wesenberg, Woldegk) <strong>und</strong> 3 Gemeinden (Möllenhagen, Rechlin, Tutow) verfügen über 2.300 bis 4.700<br />
Einwohner (EW-Stand: 31.12.1996).<br />
Entsprechend gering ist der Verstädterungsgrad, gemessen als Anteil aller Einwohner in Prozent, die in<br />
Kommunen mit einer Größe von über 2.000 Einwohnern leben. Er beträgt in der Planungsregion nur 65,5 %<br />
gegenüber 93 % in der gesamten B<strong>und</strong>esrepublik.<br />
95 % der Siedlungen (1.034 von gesamt 1.088 Siedlungen) weisen weniger als 500 Einwohner auf. Davon<br />
haben 555 Siedlungen (51 % aller Siedlungen) sogar weniger als 50 Einwohner.<br />
Um diese flächenhafte Siedlungsstruktur als raumprägenden Bestandteil gemäß 4.1(1) LROP zu erhalten <strong>und</strong><br />
weiter zu entwickeln, kommt dem mehrstufigen System der zentralen Orte entsprechend RROP, <strong>Teil</strong> I,<br />
Kapitel 2 besondere Bedeutung zu. Durch die Stärkung <strong>und</strong> Entwicklung der zentralen Orte zu wirtschaftlich,<br />
sozial <strong>und</strong> kulturell attraktiven Zentren wird die Tragfähigkeit <strong>und</strong> Leistungskraft der Siedlungsstruktur<br />
insgesamt gestärkt <strong>und</strong> somit ein wesentlicher Beitrag für die Verbesserung der Lebens- <strong>und</strong><br />
Arbeitsbedingungen in der Region geleistet.
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
Die Siedlungsflächen sind mit Stand vom 31. März 1997 in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellt. Die genaue<br />
Abgrenzung der Siedlungsflächen <strong>und</strong> die Feststellung der Innen- <strong>und</strong> Außenbereichsgrenzen gemäß §§ 34<br />
<strong>und</strong> 35 Baugesetzbuch erfolgt im Rahmen von kommunalen Satzungen.<br />
5.1.2 Siedlungsentwicklung in zentralen Orten<br />
Eine Siedlungstätigkeit, die über die Eigenentwicklung einer Gemeinde hinausgeht, ist<br />
schwerpunktmäßig in den zentralen Orten zulässig. Dabei ist deren jeweilige zentralörtliche<br />
Einstufung zu beachten.<br />
Begründung<br />
Während die Eigenentwicklung nach Programmsatz 5.1.3 gr<strong>und</strong>sätzlich allen Gemeinden zusteht, soll die<br />
darüber hinausgehende Siedlungsentwicklung gemäß 4.1(3) LROP zur Stärkung der zentralen Orte beitragen.<br />
Die Konzentration von Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsstätten in den zentralen Orten trägt zur wirtschaftlichen Stärkung<br />
<strong>und</strong> zur besseren Auslastung der vorhandenen oder geplanten Infrastruktureinrichtungen bei. Zugleich wird<br />
die Bereitstellung überörtlicher Versorgungseinrichtungen in allen <strong>Teil</strong>räumen der Region erleichtert, wobei<br />
der Stärkung der Ländlichen Zentralorte als Stützpunkte einer wirtschaftlich tragfähigen Siedlungstätigkeit für<br />
die Versorgung in der Fläche besondere Bedeutung zukommt.<br />
5.1.3 Siedlungsentwicklung in Gemeinden ohne zentrale Bedeutung<br />
In den Gemeinden, die nicht als zentrale Orte ausgewiesen sind, soll sich die<br />
Siedlungstätigkeit an deren Eigenentwicklung orientieren.<br />
Begründung<br />
Durch die Beschränkung der Siedlungstätigkeit in Gemeinden ohne zentrale Bedeutung auf deren Eigenbedarf<br />
soll eine unorganische, disperse, landschaftszersiedelnde <strong>und</strong> die zentralen Orte schwächende Siedlungstätigkeit<br />
vermieden werden. Die Eigenentwicklung einer Gemeinde ist wie folgt definiert:<br />
Eigenentwicklung ist eine Flächen- oder Kapazitätsentwicklung, die sich im allgemeinen auf den Bedarf der<br />
vorhandenen Bevölkerung im Ort bezieht. Zur Eigenentwicklung gehört nicht der Bedarf, der durch unangemessene<br />
Wanderungsgewinne verursacht wird. Im Rahmen der Eigenentwicklung müssen die allgemeinen<br />
Ansprüche an eine quantitative <strong>und</strong> qualitative Wohnraumversorgung (Fläche <strong>und</strong> Ausstattung) erfüllt<br />
werden. Im gewerblichen Siedlungsbereich gilt dies in der Regel für die Neuansiedlung von Betrieben, die der<br />
örtlichen Gr<strong>und</strong>versorgung mit Waren <strong>und</strong> Dienstleistungen dienen (Einzelhandel, Handwerk), sowie für<br />
Betriebserweiterungen ortsansässiger Betriebe <strong>und</strong> die Ansiedlung von Betrieben, die an besondere<br />
Standortbedingungen geb<strong>und</strong>en sind (z.B. Rohstoffvorkommen).<br />
Zur Eigenentwicklung gehören in diesem Rahmen auch Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen, die zu einer städtebaulich<br />
geordneten Entwicklung <strong>und</strong> Sanierung der Gemeinde beitragen (insbesondere gemäß Programmsätze<br />
5.2.1(1) <strong>und</strong> 5.2.3(1)).<br />
61
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
5.1.4 Schwerpunkte der Siedlungstätigkeit im Ordnungsraum Neubrandenburg<br />
(1) Die Siedlungstätigkeit im Ordnungsraum Neubrandenburg ist schwerpunktmäßig auf<br />
das Oberzentrum Neubrandenburg zu konzentrieren.<br />
(2) Zur Deckung des Wohnraumbedarfs im Ordnungsraum Neubrandenburg soll vorrangig<br />
in der Stadt Neubrandenburg Wohnungsneubau unter Nutzung der vorhandenen Nachverdichtungspotentiale<br />
<strong>und</strong> bereits geplanten Standorte realisiert werden.<br />
(3) Die Stadt Burg Stargard soll in ihren Funktionen für Naherholung <strong>und</strong> Kulturtourismus<br />
gestärkt werden.<br />
(4) Zur Sicherung des Verkehrsflughafens Neubrandenburg sind die Bauschutzbereiche in<br />
dessen Umfeld einzuhalten.<br />
Begründung<br />
zu 5.1.4(1):<br />
Die Abgrenzung des Ordnungsraumes Neubrandenburg ist dem Programmsatz 1.1 zu entnehmen.<br />
Der seit der Wiedervereinigung sich vollziehende Suburbanisierungsprozeß insbesondere in Form der Auslagerung<br />
von Wohnfunktion in das Umland hat bis zum Jahr 1997 bereits Dimensionen angenommen, die eine<br />
gemeinsame raumverträgliche Steuerung dieses Prozesses zwischen der Stadt Neubrandenburg <strong>und</strong> den<br />
Umlandgemeinden des Ordnungsraumes dringend erforderlich machen.<br />
Die Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die Kernstadt Neubrandenburg sowie die Lenkung des<br />
zusätzlichen Siedlungsflächenbedarfs auf die benachbarten Zentralorte Altentreptow, Friedland <strong>und</strong> Penzlin<br />
reduziert den Siedlungsdruck auf das Umland <strong>und</strong> berücksichtigt die vorhandenen Strukturen. Dadurch wird<br />
entsprechend Programmsatz 1.1(2) eine Zersiedlung des Umlandes verhindert <strong>und</strong> die dauerhafte Tragfähigkeit<br />
der Infrastruktur in den Zentralorten gesichert.<br />
zu 5.1.4(2):<br />
Mit Stand vom 31. Oktober 1995 sind im Ordnungsraum Wohnbauflächen für ein Wohnungsangebot von r<strong>und</strong><br />
5.000 Wohneinheiten landesplanerisch genehmigt. Diesem bereits durch Planungen gesichertem Angebot<br />
steht im Jahr 2000 eine prognostizierte Wohnungsnachfrage von 2.000 bis 2.400 Wohneinheiten gegenüber.<br />
Bis zum Jahr 2000 ergibt sich aus heutiger Sicht für den Ordnungsraum ein Wohnungsüberangebot von 2.600<br />
bis 3.000 Wohneinheiten (siehe: Empirica-Studie „Szenarien zur Wohnungsbedarfs- <strong>und</strong> Wohnbaulandentwicklung<br />
im Ordnungsraum Neubrandenburg für die Jahre 2000, 2005 <strong>und</strong> 2010“, erstellt im<br />
Auftrag des Regionalen Planungsverbandes, Februar 1996). Dieses Wohnungsüberangebot stellt einen<br />
Kostendämpfungsfaktor für den Wohnungsmarkt dar <strong>und</strong> dient der Absicherung eines differenzierten<br />
Wohnungsangebotes. Zur Vermeidung negativer siedlungsstruktureller Auswirkungen bedarf das Wohnungsüberangebot<br />
in Form von Standortreserven allerdings einer Begrenzung. Es ist deshalb dringend geboten,<br />
die in der Stadt Neubrandenburg vorhandenen <strong>und</strong> bereits in Planung befindlichen Standortpotentiale<br />
im Wohnungsbau mit Priorität zu realisieren. Insgesamt verfügt die Stadt Neubrandenburg mit Stand vom 31.<br />
Oktober 1995 über Flächenreserven für ca. 4.200 Wohneinheiten.<br />
62
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
Um unter anderem mögliche finanzielle Risiken für die Gemeinden auszuschließen, sollten diese für sich<br />
prüfen, ob sie die Realisierung bereits genehmigter Standorte zurückstellen oder zumindest zeitlich strecken<br />
können.<br />
zu 5.1.4(3):<br />
Das Unterzentrum Stadt Burg Stargard stellte bereits in den ersten Jahren nach der Wende einen Siedlungsschwerpunkt<br />
im Ordnungsraum dar. An die Stelle der bisherigen Stadterweiterung sollte nun vorrangig eine<br />
bestandsorientierte Siedlungsentwicklung treten, um die vorhandenen lokalen Potentiale für Naherholung<br />
sowie für Kulturtourismus (siehe Programmsatz 7.3) zu schützen <strong>und</strong> zu entwickeln. Die Stadt Burg Stargard<br />
verfügt mit ihrer Höhenburganlage <strong>und</strong> ihrer Altstadt über wertvolle städtebauliche Potentiale. Durch ihre<br />
Lage am südlichen Ende des Lindetals stellt sie ein attraktives Nahausflugsziel für die Stadt Neubrandenburg<br />
dar.<br />
zu 5.1.4(4):<br />
Insbesondere in den Gemeinden im Umfeld des Verkehrsflughafens Neubrandenburg (Trollenhagen,<br />
Neuenkirchen, Neverin) sind bei Bauvorhaben die baulichen Restriktionen bezüglich der zulässigen Bauhöhen<br />
<strong>und</strong> zum Schutz gegen Fluglärm zu berücksichtigen (siehe auch Karte (M 1 : 100 000) <strong>und</strong> Programmsatz<br />
10.5(2)).<br />
5.1.5 Siedlungsbezogene Freiraumsicherung<br />
(1) Die in der Karte (M 1 : 100 000) festgesetzten Grünzäsuren sind gr<strong>und</strong>sätzlich von<br />
Besiedlung freizuhalten.<br />
(2) Innerörtliche Grünflächen <strong>und</strong> Freiräume sind in ausreichendem Maße zu erhalten, zu<br />
entwickeln <strong>und</strong> zu erweitern. Sie sollen untereinander <strong>und</strong> mit der freien Landschaft verb<strong>und</strong>en<br />
werden. Sie sollen so gestaltet werden, daß sie als Lebensraum für eine artenreiche<br />
heimische Flora <strong>und</strong> Fauna geeignet sind, klimaverbessernd wirken <strong>und</strong> eine hohe Aufenthaltsqualität<br />
für die siedlungsnahe Erholung aufweisen.<br />
Begründung<br />
zu 5.1.5(1):<br />
Zur Gliederung der Siedlungsstruktur <strong>und</strong> zum Schutz der Natur <strong>und</strong> Landschaft sind neben den im<br />
Programmsatz 4.4 festgesetzten Restriktionsflächen zusätzlich siedlungsbezogene Freiräume ausgewiesen, die<br />
einem besonderen Siedlungsdruck ausgesetzt sind <strong>und</strong> dadurch in ihren Freiraumfunktionen, wie z.B.:<br />
- Trennung größerer Siedlungskörper,<br />
- Erhalt des Klimas <strong>und</strong> der Luftreinheit,<br />
- Sicherung wertvoller Lebensräume für Pflanzen <strong>und</strong> Tierwelt,<br />
- Erhaltung charakteristischer Landschaftsbilder <strong>und</strong><br />
- siedlungsnahe Erholung<br />
gefährdet sind.<br />
63
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Die Grünzäsuren sind zeichnerisch in schematischer Form festgesetzt. Die weitere Ausformung <strong>und</strong> die<br />
genaue Abgrenzung gegen die Siedlungsgebiete erfolgt im Rahmen der Bauleitplanung.<br />
Diese Räume sollen gr<strong>und</strong>sätzlich von Besiedlung freigehalten werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen<br />
können standortgeb<strong>und</strong>ene Anlagen, wie land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe, technische Infrastruktur <strong>und</strong><br />
Anlagen für siedlungsnahe Erholung/Freizeit/Sport zugelassen werden, soweit die Funktionen der Grünzäsur<br />
dadurch nicht in Frage gestellt werden. Gr<strong>und</strong>sätzlich sollten in diesen Fällen Umweltverträglichkeitsprüfungen<br />
durchgeführt werden.<br />
Tabelle 14:<br />
Grünzäsuren<br />
Lage der Grünzäsur Landschaftsraum Derzeitige<br />
Nutzung<br />
Ordnungsraum<br />
Tollenseniederung Streuwiesen,<br />
Rostocker Str.-Hopfenburg<br />
Kleingärten<br />
Ordnungsraum<br />
Broda - Neuendorf<br />
Ordnungsraum<br />
Datzeberg - Hellfeld<br />
Ordnungsraum<br />
Neuendorf - Wulkenzin<br />
Ordnungsraum<br />
Fünfeichen - Bargensdorf<br />
Ordnungsraum<br />
Burg Stargard - Bargensdorf<br />
Altentreptow - Klatzow<br />
64<br />
Wichtigste Funktionen<br />
Luftaustausch, Naturschutz<br />
(aquatischer Verb<strong>und</strong>),<br />
Siedlungszäsur<br />
Siedlungszäsur, Naturschutz<br />
westl. Höhenrücken Landwirtschaft,<br />
des Tollensebeckens Schlehenhecke<br />
Der Werder Wald, Ödland,<br />
Kleingärten<br />
Siedlungszäsur, Biotopverb<strong>und</strong><br />
westl. Höhenrücken<br />
des Tollensebeckens<br />
Landwirtschaft Siedlungszäsur, Landschaftsbild<br />
Höhenrücken Landwirtschaft, Siedlungszäsur, Naturschutz<br />
zwischen<br />
zum <strong>Teil</strong> Ödland <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Tollensebecken <strong>und</strong><br />
Lindetal<br />
(Biotopverb<strong>und</strong>), Erholung<br />
südwestl. Randbereich<br />
des Lindetals<br />
Landwirtschaft Siedlungszäsur<br />
westlicher Rand der<br />
Tollenseniederung<br />
Landwirtschaft,<br />
z.T. Ödland,<br />
Streuwiesen<br />
Siedlungszäsur, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Klink - Müritzhotel Müritz-Westufer Landwirtschaft Siedlungszäsur, Freiraumverb<strong>und</strong><br />
zwischen Müritz <strong>und</strong><br />
Kölpinsee<br />
Loitz - Schwinge Verbindung Peeneniederung<br />
-<br />
Ibitzgraben<br />
Mirow - Mirowdorf Kleinseenlandschaft/<br />
Seenkette zwischen<br />
Leppin- <strong>und</strong> Vilzsee<br />
Rechlin - Vietzen Kleine Müritz -<br />
Sumpfsee<br />
Röbel/Müritz - Bollewick Tiefe Wiese -<br />
Wackstower See<br />
Röbel/Müritz -<br />
Marienfelde<br />
Gorschendorf - Salem Westufer<br />
Reuterstadt Stavenhagen -<br />
Pribbenow<br />
Streuwiesen Naturschutz <strong>und</strong> Landschafts-<br />
pflege, Luftaustausch,<br />
Streuwiesen,<br />
Gewässer<br />
Siedlungszäsur<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege,<br />
Luftaustausch,<br />
Siedlungszäsur<br />
Streuwiese Siedlungszäsur, Naturschutz<br />
Streuwiesen Siedlungszäsur, Naturschutz <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege<br />
Müritz/Binnenseeufer Landwirtschaft,<br />
Camping<br />
Siedlungszäsur<br />
Kummerower See<br />
Landwirtschaft Siedlungszäsur, Landschaftsbild<br />
Pribbenower Holz Forstwirtschaft Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege,<br />
Trinkwasserbildung,<br />
Siedlungszäsur
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
zu 5.1.5(2):<br />
Innerörtliche Grünflächen <strong>und</strong> Freiräume gliedern die Bauflächen <strong>und</strong> erfüllen wichtige Ausgleichsfunktionen<br />
gegenüber überbauten Flächen. Sie sind für die Wohn- <strong>und</strong> Lebensqualität <strong>und</strong> für die Erholung im<br />
Siedlungsbereich von entscheidender Bedeutung. Die Verbindung der einzelnen Grünflächen <strong>und</strong> Freiräume<br />
untereinander <strong>und</strong> mit der freien Landschaft fördert die Austauschbeziehungen zwischen den einzelnen <strong>Teil</strong>-<br />
Ökosystemen <strong>und</strong> trägt dadurch zur Aufrechterhaltung ihres ökologischen Gleichgewichts bei. Der<br />
Landschaftsplan stellt ein geeignetes fachliches Instrument zum Schutz, zur Pflege <strong>und</strong> zur Entwicklung von<br />
Natur <strong>und</strong> Landschaft auf lokaler Ebene dar. Insbesondere in den Gemeinden im Vorfeld des Müritz-<br />
Nationalparks <strong>und</strong> im Bereich der Naturparke kommt diesem Instrument besondere Bedeutung zu.<br />
5.2 Stadt- <strong>und</strong> Dorfentwicklung<br />
5.2.1 Allgemeines<br />
(1) Die überwiegende Siedlungstätigkeit soll sich am vorhandenen Siedlungsbestand orientieren.<br />
Dabei sind neue Standorte im Zuge der baulichen Entwicklung des Ortes unter Beachtung<br />
der jeweils spezifischen Siedlungsform <strong>und</strong> -funktion sowie unter ökologischen<br />
Aspekten behutsam in bzw. an den Bestand zu integrieren. Die Entstehung neuer <strong>und</strong> die<br />
Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen <strong>und</strong> Streubebauungen sind zu vermeiden.<br />
(2) Bei Neubaumaßnahmen sowie bei Modernisierungs- <strong>und</strong> Instandsetzungsmaßnahmen<br />
soll zum Schutz von Leben <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> zum Schutz der Umwelt auf die Verwendung<br />
von konstruktiv <strong>und</strong> ökologisch sinnvollen <strong>und</strong> verträglichen Materialien hingewirkt<br />
werden.<br />
Begründung<br />
zu 5.2.1(1):<br />
Mit der Orientierung der Siedlungstätigkeit auf den vorhandenen Bestand durch geeignete Erneuerungs- <strong>und</strong><br />
Sanierungsmaßnahmen <strong>und</strong> durch behutsames Integrieren neuer Wohn- <strong>und</strong> Siedlungsvorhaben wird ein<br />
wesentlicher Beitrag zur ökologischen, ökonomischen <strong>und</strong> soziokulturellen Vitalisierung der Städte <strong>und</strong><br />
Dörfer geleistet. Diesem Ziel liegen im wesentlichen folgende Erkenntnisse zugr<strong>und</strong>e:<br />
- In allen Städten <strong>und</strong> Dörfern der Region besteht ein hoher Instandsetzungs- <strong>und</strong> Sanierungsbedarf.<br />
- Im Siedlungsbestand existieren vielfach Flächenpotentiale in Form von Leerständen, Gewerbebrachen <strong>und</strong><br />
Baulücken, die durch geeignete Maßnahmen des Flächenrecyclings (z.B. durch Nach- <strong>und</strong>/oder<br />
Umnutzung) sowie der Nachverdichtung genutzt werden können.<br />
Durch das Ziel einer bestandsorientierten, ökologischen <strong>und</strong> ökonomischen Revitalisierung der Städte <strong>und</strong><br />
Dörfer werden auch folgende Ziele aus dem LROP bekräftigt:<br />
- Erhalt <strong>und</strong> Weiterentwicklung der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur gemäß 4.1(1) LROP,<br />
65
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
- Bestandsverbesserungen <strong>und</strong> -aufwertungen gemäß 4.2(2) LROP,<br />
- Reduzierung des Landschaftsverbrauchs sowie<br />
- bessere <strong>und</strong> dauerhafte Auslastung der vorhandenen technischen <strong>und</strong> sozialen Infrastruktur gemäß<br />
4.1(2) LROP.<br />
Um bei neuen Wohn- <strong>und</strong> Siedlungsvorhaben eine hohe städtebauliche Qualität zu erlangen, sind auch<br />
grünordnerische Belange von Bedeutung. Dabei steht den Kommunen insbesondere § 9 Abs.1 Nr. 15, 20 <strong>und</strong><br />
25 Baugesetzbuch zur Verfügung.<br />
Die Siedlungsstruktur in der Region weist bereits eine Vielzahl kleiner Splittersiedlungen <strong>und</strong><br />
Streubebauungen im Sinn des § 35 Baugesetzbuch auf. Eine weitere Entstehung neuer oder die Erweiterung<br />
vorhandener solcher Siedlungsformen würde zu einer zusätzlichen Zersiedlung der Landschaft <strong>und</strong> einer<br />
unorganischen Siedlungsstruktur führen. Dabei sind Splittersiedlungen <strong>und</strong> Streubebauungen von Ortsteilen,<br />
auf deren jeweils zusammenhängende Bebauung sich die Regelung des § 34 Baugesetzbuch bezieht, zu<br />
unterscheiden.<br />
zu 5.2.1(2):<br />
Durch die Verwendung von konstruktiv <strong>und</strong> ökologisch sinnvollen <strong>und</strong> verträglichen Materialien bei Bauvorhaben<br />
wird unter anderem ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor ges<strong>und</strong>heitsschädigenden Baustoffen geleistet<br />
<strong>und</strong> ein verantwortungsbewußter Umgang mit der Umwelt praktiziert. Dazu zählen z.B. die Vermeidung<br />
von chemischem Holzschutz durch konstruktiv wettergeschützte Holzverbauung, die Verwendung von<br />
Holzfenstern <strong>und</strong> Holztüren statt Alu-Kunststoffenstern <strong>und</strong> Türen, die Verwendung von einheimischen<br />
Hölzern statt Tropenholz, die Verwendung von Naturfasern statt Kunststoffen, keine Verwendung von<br />
asbesthaltigen Erzeugnissen, die Rückbesinnung auf traditionelle Bauweisen aus Lehm, Holz, Feldsteinen<br />
usw..<br />
Den Kommunen sind unter anderem folgende Handlungsmöglichkeiten zur Einflußnahme auf die Materialwahl<br />
gegeben: Bei kommunalem Gebäudebestand können in der kommunalen Ausschreibungs-, Vergabe- <strong>und</strong><br />
Beschaffungspraxis umweltverträgliche Materialien vorgeschrieben werden. Für Wohnungsbaugesellschaften<br />
mit kommunaler Beteiligung können entsprechende kommunale Richtlinien erlassen werden. Öffentliche<br />
Stellen können somit auch einen Beitrag zu einer Verankerung von ökologischen Kenntnissen bei den lokalen<br />
Handwerkern, Lieferanten <strong>und</strong> Planungsbeteiligten leisten. Bei privatem Gebäudebestand kann durch<br />
entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen (z.B. gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 Baugesetzbuch), durch die<br />
Festsetzung entsprechender Kriterien zur Ausreichung von Fördermitteln bei kommunalen<br />
Förderprogrammen, bei Sanierungen nach § 136 ff. Baugesetzbuch (Formulierung der Sanierungsziele <strong>und</strong><br />
entsprechende Modernisierungsvereinbarungen mit den förderwürdigen Eigentümern) oder im Rahmen von<br />
Dorferneuerungsprogrammen sowie durch entsprechende Informationen Einfluß ausgeübt werden.<br />
66
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
5.2.2 Stadtentwicklung<br />
(1) Die Funktion, Struktur <strong>und</strong> Gestalt der Städte in der Region ist zu verbessern. Dabei<br />
sind soziale, ökologische, städtebauliche, denkmalpflegerische, historische <strong>und</strong> wirtschaftliche<br />
Aspekte zu berücksichtigen. Insbesondere folgende Ziele sind zu verfolgen <strong>und</strong><br />
aufeinander abzustimmen:<br />
- Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Stadtzentren als attraktive, funktional vielfältige<br />
Erlebnisräume insbesondere unter Berücksichtigung der Dienstleistungsfunktionen,<br />
speziell<br />
des Einzelhandels, des verarbeitenden Gewerbes <strong>und</strong> Handwerks, der Wohnfunktion, der<br />
Freizeitnutzung <strong>und</strong> der Kunst <strong>und</strong> Kultur,<br />
- Ergänzung von monofunktionalen Stadtgebieten durch Mischung mit anderen<br />
verträglichen<br />
Funktionen,<br />
- Erhalt <strong>und</strong> Stärkung der Wohnfunktion in der Stadt <strong>und</strong> Verbesserung des Wohnumfeldes,<br />
insbesondere in hochverdichteten Stadtgebieten,<br />
- Verbesserung der verkehrlichen Situation (Verkehrsverlagerung <strong>und</strong> -beruhigung,<br />
Ordnung des ruhenden Verkehrs, Schaffung eines attraktiven Systems des öffentlichen<br />
Personennah- verkehrs usw.),<br />
- Erhalt <strong>und</strong> Verbesserung der Stadtstruktur <strong>und</strong> Stadtgestalt,<br />
- Reaktivierung bzw. Revitalisierung von Leerständen <strong>und</strong> Brachflächen sowie Neuordnung<br />
von unter- <strong>und</strong> kümmergenutzten Flächen,<br />
- Erhalt <strong>und</strong> Verbesserung der Freiraumstruktur, Einbeziehung natürlicher Gegebenheiten<br />
in<br />
die Stadtgestalt.<br />
(2) Die kultur- <strong>und</strong> bauhistorisch bedeutenden Stadtstrukturen, städtebaulichen Ensembles<br />
<strong>und</strong> Einzelbauwerke sind unter Berücksichtigung von denkmalpflegerischen <strong>und</strong> städtebaulichen<br />
Aspekten zu erhalten.<br />
Begründung<br />
zu 5.2.2(1):<br />
Alle Städte in der Region weisen ein hohes Maß an städtebaulichen Mißständen auf. Dazu zählen insbesondere:<br />
- schlechte Bausubstanz,<br />
- Wohnumfeldmängel,<br />
- Funktionsverluste mit der Folge von Leerständen, Brachflächen, Unter- <strong>und</strong> Kümmernutzungen etc.,<br />
- Probleme mit dem fließenden <strong>und</strong> ruhenden Verkehr sowie<br />
67
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
- Defizite in der Stadtgestalt bzw. im Stadtbild.<br />
Durch geeignete Entwicklungs-, Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen, die im Kontext einer<br />
qualitativen Stadtentwicklung stehen, können diese Mißstände mittel- bis langfristig beseitigt werden <strong>und</strong><br />
damit wesentlich zu einer Attraktivitätssteigerung der Städte beitragen.<br />
Bei dem Einsatz von Städtebauförderungsmitteln sollte auf einen integrierten Einsatz mit anderen Förderprogrammen<br />
geachtet werden. Dadurch wird ein effektiverer Einsatz der Förderinstrumentarien erreicht.<br />
Durch die Orientierung städtebaulicher Aufwertungsstandards an den Bedürfnissen der von den Erneuerungsmaßnahmen<br />
aktuell betroffenen Bewohner <strong>und</strong> Gewerbetreibenden <strong>und</strong> durch deren Einbeziehung in<br />
den Planungs- <strong>und</strong> Entscheidungsprozeß können negative Effekte von Erneuerungsmaßnahmen, wie z.B.<br />
finanzielle Überforderung, Zerstörung von gewachsenen Nachbarschaften, Verdrängung der angestammten<br />
Bewohnerschaft usw., auf ein sozialverträgliches Maß reduziert bzw. vermieden werden.<br />
Die Stadt als ökologisches Gefüge bzw. Organismus erfordert die Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei<br />
ihrer Erneuerung bzw. Entwicklung. Eine abgestimmte Standortpolitik, das Zurückdrängen des motorisierten<br />
Individualverkehrs aus den Innenstädten, der Ausbau der städtischen Infrastruktur für Fußgänger <strong>und</strong><br />
Radfahrer, die Nutzung brachliegender Flächen, das ökologische Bauen, die Wohnumfeldverbesserungen <strong>und</strong><br />
die Hausbegrünung sind nur einige Handlungsfelder für eine ökologische Stadt. Ökologische<br />
Stadtentwicklung <strong>und</strong> Stadterneuerung bedeutet vor allem die fach(ämter)übergreifende Anwendung von<br />
Umweltaspekten als zentrale Prüfkriterien bei allen kommunalen - insbesondere räumlichen - Planungen,<br />
Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen sowie Genehmigungsverfahren.<br />
zu 5.2.2(2):<br />
Der Erhalt von historisch wertvollen Stadtgr<strong>und</strong>rissen, wie z.B. der barocke Stadtgr<strong>und</strong>riß von Neustrelitz<br />
(von der UNESCO geführtes Flächendenkmal) oder die ringförmige Altstadtstruktur von Altentreptow <strong>und</strong><br />
Neukalen sowie Erhalt, Sanierung <strong>und</strong> Instandsetzung von historisch bedeutenden Bauwerken ist eine<br />
kulturelle Verpflichtung gegenüber den folgenden Generationen <strong>und</strong> leistet einen wesentlichen Beitrag zur<br />
Attraktivitätssteigerung sowie zur Belebung des Städte- <strong>und</strong> Kulturtourismus (siehe Programmsatz 7.3).<br />
Bei denkmalgeschützten Bauten <strong>und</strong> Anlagen ist insbesondere auch deren Umgebung gemäß § 2 Ab. 3<br />
Denkmalschutzgesetz vom 30. November 1993 (GVOBl. M-V S. 975), zuletzt geändert durch Artikel 9 des<br />
Gesetzes vom 25. August 1997 (GVOBl. M-V S. 502), mit zu berücksichtigen (siehe auch Programmsatz 8.8).<br />
5.2.3 Dorfentwicklung<br />
(1) Durch Maßnahmen der Dorferneuerung <strong>und</strong> städtebaulichen Dorfsanierung sollen die<br />
Dörfer in der Region in ihrer wirtschaftlichen, sozialen <strong>und</strong> kulturellen Entwicklung unterstützt<br />
<strong>und</strong> gestärkt werden. Dabei sind insbesondere folgende Ziele zu verfolgen <strong>und</strong><br />
aufeinander abzustimmen:<br />
- Erhalt <strong>und</strong> gegebenenfalls Wiederherstellung der historisch gewachsenen Dorfform <strong>und</strong><br />
-gestalt sowie der landschaftstypischen <strong>und</strong> dorfbildprägenden Werte als<br />
unverwechselbare Elemente der Kulturlandschaft unter Beachtung der Belange von<br />
Denkmalschutz <strong>und</strong><br />
-pflege,<br />
- Harmonische Randausbildung des Dorfes bei Beachtung einer dörflich geprägten<br />
Silhouette,<br />
68
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
- Umnutzung brachliegender Flächen ehemaliger landwirtschaftlicher Produktionsanlagen<br />
für die Dorfentwicklung,<br />
- Bewahrung des dörflichen Lebensraumes vor städtischen Überformungen,<br />
- Verbesserung <strong>und</strong> Sicherung der Arbeitsplatzsituation sowie der Produktions- <strong>und</strong><br />
Arbeitsbedingungen für die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft,<br />
- Verbesserung <strong>und</strong> Sicherung des Wohnumfeldes,<br />
- Verbesserung der Erholungsfunktion insbesondere in den Tourismusschwerpunkträumen<br />
(siehe Programmsatz 7.2.1),<br />
- Verbesserung der ökologischen Situation.<br />
(2) Geeignete Maßnahmen der Dorfentwicklung sollen vorrangig in folgenden besonders<br />
schwach entwickelten Ländlichen Zentralorten zu deren Stärkung ergriffen werden:<br />
Tützpatz, Borrentin (Landkreis Demmin) <strong>und</strong> Moltzow (Landkreis Müritz).<br />
(3) Im Rahmen von Maßnahmen zur Dorfentwicklung soll auf die Durchführung von<br />
Modellvorhaben hingewirkt werden, in welchen möglichst übertragbare Lösungsansätze<br />
insbesondere für die Bewältigung des landwirtschaftlichen Strukturwandels in Gemeinden<br />
der rein agrarisch geprägten <strong>Teil</strong>räume der Region, für die Umstrukturierung ehemals<br />
landwirtschaftlich geprägter Gemeinden in den Eignungsräumen für Tourismus <strong>und</strong><br />
Naherholung zu attraktiven ländlichen Tourismusorten sowie für die angepaßte touristische<br />
Entwicklung der Gemeinden im Bereich von Großschutzgebieten <strong>und</strong> in historischen<br />
Kulturlandschaften aufgezeigt werden.<br />
Begründung<br />
zu 5.2.3(1):<br />
Alle Dörfer in der Region weisen einen hohen Erneuerungsbedarf auf. Handlungsbedarf besteht insbesondere<br />
in folgenden Problemfeldern:<br />
- schlechte Bausubstanz,<br />
- Defizite des Dorfbildes bzw. Überformung historischer Dorfstrukturen,<br />
- Funktionsverluste insbesondere durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft mit der Folge<br />
von Leerständen.<br />
Die verfügbaren Dorferneuerungsprogramme sollen im Kontext einer integrierten Dorfentwicklungsplanung<br />
verwendet werden, um durch bauliche Erneuerungsmaßnahmen Synergieeffekte im soziokulturellen <strong>und</strong> beschäftigungspolitischen<br />
Bereich zu erzielen. In der direkten Einbeziehung der betroffenen Dorfbewohner als<br />
eigentliche Akteure von Dorferneuerungsprojekten wird ein geeignetes Mittel zur Stärkung der Identität der<br />
Bewohner mit ihrem Dorf gesehen. Abwanderungen kann dadurch entgegengewirkt werden. Für eine solche<br />
integrierte Dorfentwicklung ist eine ressortübergreifende Koordinierung <strong>und</strong> Vergabe von öffentlichen<br />
Mitteln dienlich.<br />
Die jeweils siedlungs- <strong>und</strong> agrarhistorisch bedingten Dorfformen, wie z.B. das regionstypische Anger- <strong>und</strong><br />
Gutsdorf, sollen in ihrer Struktur <strong>und</strong> in ihren charakteristischen Gestaltungs- <strong>und</strong> Stilelementen bei Erneuerungsmaßnahmen<br />
im Bestand sowie im Neubaubereich erhalten bleiben <strong>und</strong> dauerhaft erlebbar sein.<br />
Dadurch wird unter anderem ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung einer eigenen regionsspezifischen Identität<br />
geleistet.<br />
Mit der Möglichkeit der Aufstellung von Satzungen haben die Gemeinden ein geeignetes Instrument in der<br />
Hand, um die historisch gewachsenen Werte in ihren Dörfern vor erneuten Überbauungen mit ortsfremden<br />
Gestaltungselementen oder austauschbarer Architektur, z.B. in Form von nicht angepaßten Fertighaus-<br />
69
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
modellen sowie unmaßstäblichen Eingriffen in vorhandene dorfbildprägende Gebäude, zu bewahren. Darüber<br />
hinaus kann durch die entsprechende Ausgestaltung von Förderprogrammen auf die Verwendung von<br />
regionstypischen Baumaterialien hingewirkt werden.<br />
Durch teilweisen Rückbau <strong>und</strong>/oder Nachbesserungen bei dorfuntypischen <strong>und</strong> städtebaulich schlecht integrierten<br />
Bauten im Bestand, durch eine behutsame Umnutzung von leerstehenden, ungenutzten, aber dorfbildprägenden<br />
Gebäuden <strong>und</strong> Scheunen, durch die Pflege <strong>und</strong> Reparatur von landschafts- <strong>und</strong> dorfbildprägenden<br />
Elementen, wie z.B. Dorfangern, Feldsteinpflastern, Feldsteinmauern, Alleen, Kopfweiden, Streuobstwiesen,<br />
Wildgehölzhecken, können die Dörfer wesentlich aufgewertet werden <strong>und</strong> ihre Attraktivität für<br />
Aktivitäten im Landwirtschafts-, Dienstleistungs- (z.B. Tourismus) <strong>und</strong> Wohnbereich verbessern.<br />
zu 5.2.3(2):<br />
Diese Gemeinden stellen schwache Ländliche Zentralorte dar. Geeignete Maßnahmen der Dorferneuerung<br />
können einen wesentlichen Beitrag zur notwendigen Stärkung der zentralörtlichen Funktion dieser Gemeinden<br />
leisten.<br />
zu 5.2.3(3):<br />
Durch die modellhafte Dorferneuerung im Sinn einer integrierten Dorfentwicklung in ausgewählten<br />
Gemeinden, die für die dörfliche Situation in der Region typisch sind, können Erfahrungen in der Dorferneuerung<br />
gesammelt werden <strong>und</strong> für Erneuerungsmaßnahmen in anderen Gemeinden genutzt werden.<br />
5.3 Wohnungswesen<br />
(1) Zur Deckung des Wohnraumbedarfs soll ausreichend Wohnbauland bereitgestellt<br />
werden. Dabei ist der Wohnungsbau bedarfsorientiert in allen <strong>Teil</strong>bereichen des<br />
Wohnungsmarktes durch städtebaulich <strong>und</strong> sozial verträgliche Maßnahmen im<br />
Gebäudebestand sowie im Wohnungsneubau zu unterstützen <strong>und</strong> zu verstärken.<br />
(2) Um den Landschaftsverbrauch für Wohnungsneubau möglichst gering zu halten, ist<br />
unter Berücksichtigung der städtebaulichen <strong>und</strong> sozialen Verträglichkeit auf eine<br />
innerörtliche Aktivierung aller Möglichkeiten wie Inanspruchnahme brachliegender<br />
ungenutzter oder teilgenutzter Standorte, Baulückenschließung, Umnutzung von Gebäuden,<br />
Dachgeschoßausbau usw. zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum hinzuwirken.<br />
(3) Zur Sicherung <strong>und</strong> Schaffung bezahlbarer Wohnungen soll im Wohnungsbau auf komplexe<br />
Lösungsansätze hingewirkt werden. Dabei sind alle denkbaren Möglichkeiten einer<br />
Kostenreduzierung zu prüfen. Das betrifft sowohl die planerische Vorbereitung, die Baulandbereitstellung,<br />
die Erschließung, die technischen <strong>und</strong> konstruktiven Gebäudelösungen<br />
als auch Bewirtschaftungsfragen. Bei allen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im<br />
Wohnungsbau sind soziale, ökologische sowie städtebaulich-gestalterische <strong>und</strong><br />
städtebaulich-funktionelle Anforderungen zu sichern.<br />
(4) Eine soziale Mischung innerhalb der einzelnen Wohngebiete ist insbesondere durch die<br />
Ausweisung von Wohnbauflächen für verschiedene Wohnungsgrößen <strong>und</strong> Wohnformen<br />
sowie den Bau von Wohnungen unterschiedlicher Eigentumsformen anzustreben.<br />
70
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
(5) In Bereichen mit verdichteten Siedlungsstrukturen - insbesondere in den Großwohnsiedlungen<br />
- sollen Freiflächen erhalten <strong>und</strong> verstärkt Maßnahmen zur Verbesserung des<br />
Wohnumfeldes <strong>und</strong> zur Modernisierung <strong>und</strong> Sanierung der Wohnblöcke ergriffen werden.<br />
Dabei sollen familiengerechte <strong>und</strong> preisgünstige Wohnungen erhalten <strong>und</strong> geschaffen<br />
werden. Durch wohngebietsbezogene Handels- <strong>und</strong> Dienstleistungseinrichtungen,<br />
Erholungs- <strong>und</strong> Freizeitmöglichkeiten sind die Gebiete funktionell zu komplettieren.<br />
Begründung<br />
zu 5.3(1):<br />
Trotz weiteren Rückgangs der Bevölkerung in der Region (siehe Abschnitt "Bevölkerung") kann zumindest<br />
bis zum Jahr 2010 von einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum, speziell in den Städten <strong>und</strong> in deren Umland,<br />
ausgegangen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Nachfrager nach Wohnungen Haushalte sind.<br />
Entsprechend treten abwanderungsbedingte Leerstände nur dann auf, wenn alle Mitglieder des Haushaltes<br />
abwandern. Die Nachfrage resultiert aus verschiedenen Komponenten:<br />
- Aus der strukturellen Zusammensetzung <strong>und</strong> aus dem baulichen Zustand des Wohnungsbestandes resultiert<br />
ein hoher Ersatzbedarf.<br />
- Der Anteil der Bevölkerung, der sich in der Haushalts- <strong>und</strong> Familiengründungsphase befindet, nimmt bis<br />
zum Jahr 2010 zu (siehe Abschnitt "Bevölkerung", Tabelle 8).<br />
- Durch Zuwanderer von Außen <strong>und</strong> durch Binnenwanderungen wird zusätzlich Wohnraum nachgefragt.<br />
- Der Wohnflächenverbrauch pro Einwohner steigt durch:<br />
• Zunahme von Einpersonenhaushalten auf Gr<strong>und</strong> eines zunehmend sinkenden Alters bei der Gründung<br />
des Ersthaushaltes <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> anhaltend hoher Trennungsraten von partnerschaftlichen Lebens- <strong>und</strong><br />
Wohngemeinschaften,<br />
• Einkommensbedingt steigende Wohnansprüche (die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner lag<br />
in der Region im Jahre 1990 bei 26 m 2 <strong>und</strong> im Jahre 1995 bei 29 m 2 ).<br />
- Die Zunahme des Anteils an über 60jährigen an der Gesamtbevölkerung der Region führt zu einem<br />
steigenden Bedarf an alten- <strong>und</strong> pflegegerechten Wohnformen <strong>und</strong> zu kleineren Haushalten.<br />
- Durch die mit dem Ausbau der Fachhochschule Neubrandenburg steigenden Studentenzahlen wird in der<br />
Stadt Neubrandenburg zusätzlich preiswerter Wohnraum nachgefragt.<br />
Bei der Bereitstellung von Wohnbauland sind vorwiegend solche Standorte geeignet, die auch eine gute<br />
ÖPNV-Anbindung entsprechend den Programmsätzen 9.2(1) bis 9.2(5) ermöglichen (zur Situation der<br />
Wohnbaulandbereitstellung im Ordnungsraum Neubrandenburg siehe Programmsatz 5.1.4(2)).<br />
zu 5.3(2):<br />
Die deutliche Trennung von Siedlungskörpern <strong>und</strong> freier Landschaft bzw. die geringe Zersiedlung des unmittelbaren<br />
Stadtumlandes stellt einen hohen ökologischen <strong>und</strong> landschaftsästhetischen Wert dar, der er-<br />
71
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
haltenswert ist. Durch die konsequente erneute Nutzung von innerstädtischen Flächenreserven kann die<br />
Grenze zwischen Siedlungsfläche <strong>und</strong> freier Landschaft zu Gunsten des Freiraums erhalten werden.<br />
zu 5.3(3):<br />
Die Sicherung eines differenzierten Wohnungsangebotes bedarf der Erstellung von bezahlbaren Wohnungen<br />
für alle sozialen Schichten in unterschiedlichen Wohn- <strong>und</strong> Bewirtschaftungsformen einschließlich der<br />
Schaffung von Wohneigentum. Dazu gehören auch neue gemeinschaftliche Wohnformen in Verbindung mit<br />
innovativen Ansätzen im Wohnungsbau. Das Problem, kostengünstig zu bauen, ist nur erfolgreich zu lösen,<br />
wenn technische Lösungen, Wohnstandards, Gr<strong>und</strong>stückskosten, Erschließungsparameter, Bauorganisation,<br />
Finanzierung <strong>und</strong> soziale Aspekte im Zusammenhang gesehen werden. Eine aussichtsreiche Strategie ist das<br />
Prinzip "Einfach bauen - selber bauen". Die Voraussetzungen dafür sind:<br />
- einfache städtebauliche, architektonische <strong>und</strong> konstruktive Lösungen (z.B. Wohnungen in Form von<br />
kleinen, überschaubaren Siedlungen mit geringer Baudichte <strong>und</strong> sparsamen Erschließungssystemen),<br />
- eine zeitlich straffe Bauorganisation, die gleichzeitig möglichst viel Eigenarbeit ermöglicht,<br />
- Vergabe von kostengünstigen kommunalen Baugr<strong>und</strong>stücken im Erbbaurecht,<br />
- die Bereitstellung von öffentlichen Wohnungsbaufördermitteln.<br />
zu 5.3(4):<br />
Bei allen wohnungspolitischen Maßnahmen ist besonderer Wert auf eine ausgewogene Sozialstruktur zu<br />
legen. Sozialräumliche Differenzierungsprozesse, die durch ein einseitiges <strong>und</strong> mangelhaftes Wohnungsangebot<br />
in den einzelnen städtischen <strong>Teil</strong>räumen ausgelöst werden, führen zu einseitigen räumlichen Konzentrationen<br />
von Bevölkerungsgruppen gleicher Einkommensgruppen <strong>und</strong> Haushaltstypen. Unausgewogene Bevölkerungs-<br />
<strong>und</strong> Sozialstrukturen ziehen nachteilige <strong>und</strong> unausgeglichene Nachfragespitzen nach sozialen<br />
Infrastruktureinrichtungen nach sich. Zur Erhaltung einer stabilen <strong>und</strong> möglichst vielfältigen Sozialstruktur<br />
können Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung <strong>und</strong> des Wohnungsneubaus (Mischung verschiedener<br />
Wohnungsgrößen <strong>und</strong> Wohnformen, z.B.: Eigenheim, Eigentumswohnung, Mietwohnung, altengerechte,<br />
behindertengerechte, familiengerechte Wohnung) sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes<br />
führen.<br />
zu 5.3(5):<br />
In dicht bebauten Gebieten - insbesondere mit Bauten der Wohnungsbauserie 70 - werden die Ansprüche der<br />
Bewohner an die Wohnqualität <strong>und</strong> an das Wohnumfeld in der Regel nur unzureichend erfüllt. Einkommensstarke<br />
Bewohnerschichten reagieren darauf zunehmend mit Abwanderung aus diesen Gebieten. Dies<br />
führt zu einem zusätzlichen Bedarf an Wohnbauland <strong>und</strong> zu einer zunehmenden sozialen Entmischung. Durch<br />
Verbesserungen des Wohnumfeldes sowie durch sozial verträgliche Modernisierungs- <strong>und</strong><br />
Sanierungsmaßnahmen kann diesen Prozessen entgegengewirkt werden. Auf Erfahrungen aus Modellvorhaben<br />
des B<strong>und</strong>es kann dabei zurückgegriffen werden.<br />
5.4 Gewerbliche Siedlungsentwicklung<br />
(1) Als eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung <strong>und</strong> Sicherung von Arbeitsstätten<br />
sollen in der Region quantitativ <strong>und</strong> qualitativ ausreichend Flächen für die unterschiedlichen<br />
<strong>Teil</strong>bereiche wirtschaftlicher Aktivitäten angebotsorientiert vorbereitet <strong>und</strong><br />
bedarfsorientiert erschlossen werden. Vorrangig sind dabei brachliegende, unter-, kümmer-<br />
<strong>und</strong> fehlgenutzte Flächen zu reaktivieren.<br />
72
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
Bei der Dimensionierung von Flächen für Industrie, Gewerbe, Handel <strong>und</strong> Verwaltung sind<br />
insbesondere die zentralörtlichen Funktionen der Gemeinde, die räumlichen <strong>und</strong> infrastrukturellen<br />
Voraussetzungen des Standortes <strong>und</strong> die Zuordnung zu Wohngebieten zu<br />
berücksichtigen.<br />
(2) In den landschaftlich attraktiven Tourismusschwerpunkträumen sind bei der Gewerbeflächenplanung<br />
neben den siedlungsstrukturellen Belangen auch die ökologischen <strong>und</strong><br />
baulich-gestalterischen Belange sorgfältig abzuwägen. Emissionsstarke Betriebstypen,<br />
welche die Erholungsfunktion beeinträchtigen, sind in diesen Gebieten auszuschließen.<br />
Begründung<br />
zu 5.4(1):<br />
Wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region ist die Bereitstellung von<br />
Flächen für die unterschiedlichen <strong>Teil</strong>bereiche wirtschaftlicher Aktivitäten.<br />
Dabei kommt dem Oberzentrum sowie den Mittel- <strong>und</strong> Unterzentren als Anbietern von qualitativ relativ<br />
hochwertigen Standorten besondere Bedeutung zu. Auf Gr<strong>und</strong> ihrer Agglomerationsvorteile (wie z.B. relativ<br />
gute verkehrliche Erreichbarkeit, hohe technische Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit eines qualifizierten<br />
Arbeitskräftepotentials, Fühlungs- <strong>und</strong> Kooperationsvorteile) weisen diese zentralen Orte die regional<br />
günstigsten Standortpotentiale für Betriebe des sek<strong>und</strong>ären <strong>und</strong> tertiären Sektors auf.<br />
Es gibt in der Region ein insgesamt ausreichendes, planungsrechtlich gesichertes <strong>und</strong> größtenteils<br />
ansiedlungbereites Angebot an Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeflächen. Mit Stand des Jahres 1996 verfügt die Region<br />
über ca. 1.970 ha Gewerbeflächen.<br />
78 % aller bauleitplanerisch festgesetzten Gewerbeflächen in der Region sind in den Ober-, Mittel- <strong>und</strong><br />
Unterzentren angesiedelt. Noch 5 % der Gewerbeflächen befinden sich in den Ländlichen Zentralorten <strong>und</strong><br />
nur 17 % in Gemeinden ohne zentrale Bedeutung. Damit unterstützt die bisherige Ausweisungspraxis von<br />
Gewerbeflächen das raumordnerische Ziel einer Konzentration von Arbeitsstätten in den zentralen Orten.<br />
R<strong>und</strong> 31 % (ca. 620 ha) der Gewerbeflächen stellen alte Standorte dar, die seit dem Jahr 1989 noch nicht neu<br />
überplant wurden (B-Plan bzw. V+E-Plan) <strong>und</strong> größtenteils brachliegen oder nur kümmergenutzt werden.<br />
Dabei handelt es sich zum <strong>Teil</strong> um Flächenpotentiale in zentraler Lage mit guten verkehrlichen Anbindungen<br />
<strong>und</strong> geringen Nutzungsbeschränkungen. Eine Reaktivierung dieser Altstandorte zur gewerblichen<br />
Wiedernutzung sollte - sofern hinsichtlich des städtebaulichen Gesamtflächenmanagements bzw. der<br />
Flächennutzungsplanung verträglich - trotz der damit verb<strong>und</strong>enen Probleme <strong>und</strong> schwer kalkulierbaren<br />
Risiken mit dem Ziel eines geordneten Städtebaus <strong>und</strong> eines möglichst sparsamen Landverbrauchs vorrangig<br />
betrieben werden.<br />
Ebenfalls mit dem Ziel eines sparsamen Landverbrauchs sollten die nach § 17 der Baunutzungsverordnung in<br />
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des<br />
Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466), möglichen Obergrenzen für Gewerbegebiete (GE) <strong>und</strong><br />
Industriegebiete (GI) so weit wie möglich ausgenutzt werden.<br />
zu 5.4(2):<br />
Aus Gründen eines ökologisch <strong>und</strong> sozial verträglichen Städtebaus ist bei der Gewerbeflächenausweisung<br />
neben rein quantitativen Festsetzungen auch auf qualitative Festsetzungen zu achten. Insbesondere eine<br />
attraktive Freiflächengestaltung leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Beschäftigten <strong>und</strong><br />
73
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
wirkt imageverbessernd. Vor allem bei Gewerbeflächen in Randlagen von Siedlungsbereichen ist auf eine<br />
ausreichende Abgrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin zu achten. Im Rahmen der kommunalen<br />
Planungshoheit gilt für die rechtsverbindliche Festsetzung von grünordnerischen Belangen § 9 Abs. 1 Nr. 15,<br />
20 <strong>und</strong> 25 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. 2141).<br />
Besonders in den landschaftlich attraktiven Tourismusschwerpunkträumen sind geeignete qualitative<br />
Festsetzungen auch zur Sicherung der touristischen Entwicklung von Bedeutung.<br />
5.4.1 Regional bedeutsame Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe<br />
Regionale Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe werden ausgewiesen, um die Nachfrage<br />
nach Gewerbeflächen befriedigen <strong>und</strong> entsprechende Aktivitäten dort hinlenken zu<br />
können. Diese Schwerpunkte sollen überwiegend für Betriebe des produzierenden<br />
Gewerbes reserviert bleiben. Dort sind sowohl die Ansiedlungsbedingungen für größere<br />
Betriebe vorzuhalten als auch deren Entfaltungsbedingungen (Stabilisierung <strong>und</strong> Expansion<br />
bestehender Gewerbebetriebe) zu sichern.<br />
Auf diesen Gewerbeflächen sind - mit Ausnahme des produktionsbezogenen Einzelhandels<br />
- Einzelhandelsbetriebe auszuschließen.<br />
Die regionalen Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe sind folgende in der Karte<br />
(M 1 : 100 000) als gewerblich genutzte Siedlungsfläche dargestellten Flächen:<br />
74<br />
Altentreptow/B 96 Ost<br />
Demmin/Meyenkrebs<br />
Friedland/Anklamer Straße<br />
Jarmen/Anklamer Straße<br />
Loitz/Gewerbe- <strong>und</strong> Industriegebiet<br />
Malchin/Altes Industriegebiet an B<strong>und</strong>eswasserstraße<br />
Malchow/Nord<br />
Neubrandenburg/Warliner Straße/Ihlenfelder Straße<br />
Neubrandenburg/Weitin (Neubrapharm)<br />
Neustrelitz/Gewerbe- <strong>und</strong> Industriegebiet „Neuer Schlachthof“<br />
Neustrelitz/Wesenberger Chaussee<br />
Reuterstadt Stavenhagen/Basepohler Schlag<br />
Trollenhagen/Hellfeld I<br />
Waren (Müritz)/West<br />
Woldegk/Mühlengr<strong>und</strong>
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
Begründung<br />
Trotz der quantitativ ausreichenden Potentiale an Gewerbeflächen kann es bei Nachfragen zu Engpässen<br />
kommen, weil Standortanforderungen nicht erfüllt werden können bzw. geeignete Standorte durch großflächige<br />
Handelseinrichtungen blockiert sind. Besonders Betriebe der<br />
- Gr<strong>und</strong>stoff- <strong>und</strong> Produktionsgüterindustrie (z.B. Holzverarbeitung, Baustoffindustrie),<br />
- Investitions- <strong>und</strong> Verbrauchsgüterindustrie mit Schwergewicht in Maschinenbau, Fahrzeugbau, Metallbau,<br />
- Nahrungs- <strong>und</strong> Genußmittelindustrie<br />
stellen hohe differenzierte Standortanforderungen.<br />
Um im Wettbewerb mit anderen Regionen <strong>und</strong> Ländern bestehen zu können <strong>und</strong> solche Nachfragerbetriebe<br />
langfristig an die Region binden zu können, ist es notwendig, gezielt Standorte in wenigen attraktiven<br />
Schwerpunkten anbieten zu können. Dabei ist darauf zu achten, daß nicht durch eine inflationäre Ausweisung<br />
das Angebot zersplittert <strong>und</strong> eine nicht mehr vertretbare interkommunale Konkurrenzsituation hervorgerufen<br />
wird.<br />
Die genannten Schwerpunkte von regionaler Bedeutung entsprechen zum <strong>Teil</strong> bereits folgenden Kriterien<br />
oder werden diese Kriterien kurz- bis mittelfristig erfüllen <strong>und</strong> weisen damit eine attraktive Standortqualität<br />
auf:<br />
- große zusammenhängende ebene Flächen über 10 ha mit Erweiterungsmöglichkeiten,<br />
- Nähe zu einem Autobahnanschluß (A 19, geplante A 20) oder einer überregional bedeutsamen<br />
B<strong>und</strong>esstraße (B 104, B 96, B 192, B 194, B 198) ohne Ortsdurchfahrten <strong>und</strong>/oder einer<br />
Schienenanbindung,<br />
- möglichst großes Arbeitskräftepotential in guter verkehrlicher Erreichbarkeit,<br />
- attraktive Wohnstandorte im Einzugsbereich mit entsprechendem kulturellen <strong>und</strong><br />
infrastrukturellen Angebot, insbesondere weiterführenden Schulen,<br />
- hochwertige technische Infrastruktur (Ver- <strong>und</strong> Entsorgung).<br />
Bei der Ausweisung der Flächen in den Flächennutzungsplänen ist eine Bewertung nach diesen Kriterien<br />
vorzunehmen. Im Rahmen des kommunalen Gewerbeflächenmanagements sowie der Bauleitplanung (insbesondere<br />
unter Anwendung des § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung) ist der Vorrang dieser Flächen für verarbeitendes<br />
Gewerbe zu sichern. Hierfür können als städtebauliche Gründe die Knappheit an Flächen, die für<br />
das produzierende <strong>und</strong> verarbeitende Gewerbe geeignet sind, geltend gemacht werden. Durch den Ausschluß<br />
von Einzelhandelsbetrieben mit Ausnahme des produktionsbezogenen Einzelhandels wird unter anderem<br />
gesichert, daß das produzierende <strong>und</strong> verarbeitende Gewerbe nicht durch einen Preiswettbewerb mit dem<br />
Einzelhandel vertrieben wird.<br />
5.4.2 Standorte für produzierendes Gewerbe <strong>und</strong> Dienstleistungen in den Ländlichen<br />
Zentralorten <strong>und</strong> Gemeinden ohne zentrale Bedeutung<br />
Auch in den Gemeinden, in denen keine Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe ausgewiesen<br />
sind, hat die gewerbliche Entwicklung geordnet zu erfolgen.<br />
Im Rahmen einer zwischengemeindlichen Zusammenarbeit sind in der Regel in den<br />
Ländlichen Zentralorten an dafür geeigneten Standorten die für den Zentralort selbst sowie<br />
für die in seinem Verflechtungsbereich liegenden Gemeinden benötigten Gewerbeflächen<br />
zu konzentrieren.<br />
75
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Begründung<br />
Auch Betriebe, die handwerklich strukturiert sind <strong>und</strong> vorwiegend örtliche Bedürfnisse abdecken, sind auf<br />
Arbeitsweisen <strong>und</strong> Produktionstechniken angewiesen, die besondere infrastrukturelle <strong>und</strong> städtebauliche Anforderungen<br />
an den Standort stellen. Durch die gemeinsame Erschließung solcher Standorte im Rahmen einer<br />
zwischengemeindlichen Zusammenarbeit kann die Standortqualität am effektivsten optimiert werden <strong>und</strong><br />
können dadurch dauerhaft Arbeitsplätze gesichert werden.<br />
Die günstigsten Rahmenbedingungen für die Ausweisung gemeinsamer Gewerbeflächen von lokaler Bedeutung<br />
weisen in der Regel die Ländlichen Zentralorte auf.<br />
5.5 Einzel- <strong>und</strong> Großhandelseinrichtungen<br />
5.5.1 Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelseinrichtungen<br />
Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind bedarfsorientiert in Abhängigkeit von der<br />
regionalen Kaufkraft gr<strong>und</strong>sätzlich in den zentralen Orten anzusiedeln. Dabei sind sie nur<br />
dann zulässig, wenn sie insbesondere<br />
- die Funktionsfähigkeit von integrierten Einzelhandelsstandorten der berührten zentralen<br />
Orte nicht gefährden,<br />
- nach Größe <strong>und</strong> Sortiment in einem angemessenen Verhältnis zur Größe <strong>und</strong> zentralörtlichen<br />
Bedeutung des Standortes <strong>und</strong> seines Verflechtungsbereichs stehen,<br />
- sowohl verkehrlich als auch städtebaulich integriert sind,<br />
- die Innenstadt in ihrer Funktions- <strong>und</strong> Entwicklungsfähigkeit nicht negativ beeinflußt.<br />
Begründung<br />
Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind Betriebe mit einer Verkaufsfläche ab 700 m 2 . Dazu gehören<br />
Verbrauchermärkte, Warenhäuser, Kaufhäuser, Selbstbedienungswarenhäuser, Supermärkte, Möbelmärkte,<br />
Baumärkte, Auto- <strong>und</strong> Gartencenter, Hobby- <strong>und</strong> Do-it-Yourself-Center <strong>und</strong> dergleichen. Eine differenzierte<br />
Abwägung ist bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dringend notwendig, um die<br />
wohnortnahe Versorgung zu sichern <strong>und</strong> die Attraktivität der Innenstädte zu stärken. Andernfalls führen<br />
überdimensionierte Einzelhandelseinrichtungen mit innenstadtrelevanten Warensortimenten in Stadtrandlage<br />
oder „auf der grünen Wiese“ dazu, daß sich ein Handel in den Ortszentren nicht entwickeln kann <strong>und</strong> nicht<br />
motorisierte Verbraucher sich nur unter unzumutbaren Belastungen versorgen können. Unnötige<br />
Verkehrsbelastungen <strong>und</strong> „tote“ Zentren sind die Folge. Bereits die meisten größeren Zentren der Region<br />
verfügen über Einzelhandelsgutachten als Entscheidungs- <strong>und</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lage. Diese sollten auf<br />
kommunaler Ebene als Fachpläne „Einzelhandel“ auch entsprechend instrumentalisiert <strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
(Siehe auch 5.5.3(2) <strong>und</strong> (3) LROP sowie den Erlaß über „Großflächige Einzelhandelseinrichtungen in der<br />
Landesplanung, der Bauleitplanung <strong>und</strong> den Baugenehmigungsverfahren“ vom 4.7.1995 des Ministeriums für<br />
Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt, Amtsblatt M-V 1995, Nr. 28, S. 607).<br />
76
RROP Mecklenburgische Seenplatte Siedlungswesen<br />
5.5.2 Standorte für Großhandelseinrichtungen (funktioneller Großhandel)<br />
(1) Großhandelseinrichtungen sind in der Regel nur an Standorten mit direkter Anbindung<br />
an das überregionale Straßennetz zulässig.<br />
(2) Die Ansiedlung von Großhandelseinrichtungen darf die Funktion des Einzelhandels<br />
nicht gefährden.<br />
Begründung<br />
zu 5.5.2(1):<br />
Großhandelseinrichtungen ziehen viel Verkehr an. Standorte mit direkter Anbindung an das überregionale<br />
Straßennetz (Straßen der Funktionsstufen I <strong>und</strong> II gemäß 8.4(3) LROP) stellen verkehrlich die günstigsten<br />
Standorte dar.<br />
zu 5.5.2(2):<br />
Der Großhandel im funktionellen Sinn ist die wirtschaftliche Tätigkeit des Umsatzes, der Beschaffung <strong>und</strong> des<br />
Absatzes von Handelswaren <strong>und</strong> sonstigen Leistungen an Wiederverkäufer, Weiterverarbeiter, gewerbliche<br />
Verwender oder Großverbraucher. Negative Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur können dennoch<br />
auftreten, da Warenabgaben auch an den Endverbraucher durch Gewerbeanzeige möglich sind. Deshalb ist<br />
auch bei der Ansiedlung von Großhandelseinrichtungen eine differenzierte Abwägung entsprechend<br />
Programmsatz 5.5.1 (Begründung) notwendig <strong>und</strong> in der Konsequenz der Einzelhandel durch die Festsetzung<br />
"Funktioneller Großhandel" in der Bauleitplanung auszuschließen.<br />
77
Siedlungswesen RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
78
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
6. Wirtschaft<br />
6.1 Allgemeines<br />
(1) Zur Schaffung guter Standortbedingungen für die Ansiedlung von Industrie- <strong>und</strong><br />
Gewerbebetrieben sind bevorzugt die bereits vorhandenen <strong>und</strong> ausbaufähigen<br />
wirtschaftlichen, technischen <strong>und</strong> sozialen Infrastrukturen in den zentralen Orten zu nutzen.<br />
(2) Das Fachkräftepotential <strong>und</strong> die in der Region vorhandenen Einrichtungen für<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung sind als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor zu nutzen<br />
sowie nachhaltig zu sichern <strong>und</strong> zu stärken.<br />
(3) Auf eine möglichst vielfältige <strong>und</strong> ausgewogene Branchen-, Arbeitsplatz- <strong>und</strong> Betriebsgrößenstruktur<br />
ist hinzuwirken. Der Bildung einseitiger wirtschaftlicher Strukturen in den<br />
einzelnen <strong>Teil</strong>räumen der Region ist entgegenzuwirken.<br />
Begründung<br />
zu 6.1(1):<br />
Die in den zentralen Orten gr<strong>und</strong>sätzlich mögliche stärkere Siedlungstätigkeit <strong>und</strong> ihre infrastrukturelle<br />
Ausstattung sind wesentliche Standortvoraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Betriebliche Anforderungen<br />
können hier in der Regel mit einem geringeren Aufwand für den Infrastrukturausbau erfüllt<br />
werden. Die zentralen Orte stellen entsprechend ihrer Eignung für eine gezielte gewerbliche Entwicklung im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Förderschwerpunktorte<br />
für Investitionszuschüsse zum Ausbau wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen dar.<br />
zu 6.1(2):<br />
Die fachliche <strong>und</strong> organisatorische Qualifikation der Arbeitskräfte stellt ein bedeutendes Wirtschaftspotential<br />
dar. Zur Gewährleistung eines möglichst breitgefächerten Arbeitskräftepotentials ist die regionale Infrastruktur<br />
im Bildungs- <strong>und</strong> Berufsbildungsbereich dringend zu sichern <strong>und</strong> zu entwickeln. Ein wichtiges <strong>und</strong><br />
ausbaufähiges Bildungs- <strong>und</strong> Forschungspotential stellt die Fachhochschule Neubrandenburg dar. Ebenfalls<br />
im Oberzentrum Neubrandenburg sind private Unternehmen des Bereiches Forschung <strong>und</strong> Entwicklung angesiedelt,<br />
deren Innovationspotential für die Region genutzt werden sollte. Neben der Akquirierung von Betrieben<br />
<strong>und</strong> der Schaffung technischer Infrastrukturen gehen insbesondere von Maßnahmen zur Förderung des<br />
Innovationspotentials <strong>und</strong> entsprechender Beratungsdienste wesentliche Impulse für eine endogene regionale<br />
Wirtschaftsentwicklung aus.<br />
zu 6.1(3):<br />
Die Region verfügt über wertvolle Potentiale <strong>und</strong> Ressourcen zur Entwicklung des Nahrungsgütergewerbes,<br />
der Holzverarbeitung, der Baustoffindustrie, des Stahl- <strong>und</strong> Leichtmetallbaus, des Maschinen- <strong>und</strong> Fahrzeugbaus,<br />
der Elektrotechnik <strong>und</strong> der Tourismuswirtschaft. Dabei ist die Erzeugung von hochwertigen <strong>und</strong><br />
innovativen Produkten <strong>und</strong> die Schaffung eines qualifizierten <strong>und</strong> leistungsfähigen Dienstleistungssektors<br />
79
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
angesichts des internationalen Wettbewerbsdrucks für die Konkurrenzfähigkeit der Region entscheidend. Eine<br />
teilräumlich <strong>und</strong> lokal ausgewogene Entwicklung dieser Potentiale ist wichtig, um einer passiven Sanierung<br />
einzelner <strong>Teil</strong>räume <strong>und</strong> Gemeinden entgegenzuwirken.<br />
Eine regional <strong>und</strong> lokal differenzierte Branchen- <strong>und</strong> ausgewogene Betriebsgrößenstruktur gewährleistet eine<br />
relativ stabile, gegenüber rezessiven Phasen weniger empfindliche, wirtschaftliche Entwicklung der Region.<br />
Dadurch werden auch die Möglichkeiten bei der Auswahl des Arbeitsplatzes erweitert <strong>und</strong> die Sicherheit der<br />
Arbeitsplätze insgesamt erhöht.<br />
Die regionale Wirtschaft befindet sich seit der Wende in einem dynamischen, noch weiter anhaltenden Umstrukturierungsprozeß,<br />
der insbesondere durch Veränderungen in der Branchenstrukturentwicklung gekennzeichnet<br />
ist. Dabei ist anzunehmen, daß sich die Branchenstruktur in der Region längerfristig an die<br />
Branchenstrukturen in Vergleichsregionen der Alt-B<strong>und</strong>esländer annähern wird. Entsprechend wird sich die<br />
Verteilungsstruktur der Beschäftigten wie folgt ändern:<br />
- Abnahme des Anteils der in der Landwirtschaft Beschäftigten,<br />
- Zunahme des Anteils der im verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten,<br />
- Zunahme des Anteils der im Handel <strong>und</strong> in privaten Dienstleistungen Beschäftigten.<br />
Durch ein ausreichendes Angebot an betrieblichen <strong>und</strong> überbetrieblichen Ausbildungs-, Fortbildungs- <strong>und</strong><br />
Umschulungsmaßnahmen kann ein Beitrag zur Verbesserung der Branchenstruktur geleistet werden. Insbesondere<br />
für aus der Landwirtschaft ausscheidende Arbeitskräfte sollten bedarfsorientierte Umschulungs-<br />
<strong>und</strong> Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden.<br />
6.2 Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Fischerei<br />
6.2.1 Landwirtschaft<br />
(1) Die Landwirtschaft <strong>und</strong> das Ernährungsgewerbe sind unabhängig von Rechtsform <strong>und</strong><br />
Betriebsgröße als leistungsfähige regionstypische Wirtschaftszweige zu sichern <strong>und</strong> weiterzuentwickeln.<br />
Sie sollen dazu beitragen, daß hochwertige Lebensmittel <strong>und</strong> Rohstoffe erzeugt,<br />
die Kulturlandschaft bewahrt <strong>und</strong> landwirtschaftliche Betriebe als Gr<strong>und</strong>element der<br />
ländlichen Siedlungsstruktur <strong>und</strong> der ländlichen Räume erhalten werden.<br />
(2) Zur Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln <strong>und</strong> der Industrie mit<br />
Rohstoffen soll zu einem möglichst hohen Anteil aus der Region beigetragen werden. Die<br />
Erzeugung, Verarbeitung <strong>und</strong> Vermarktung sind in angemessenem Umfang zu regionalisieren.<br />
(3) Die Funktionsfähigkeit des Bodens ist durch eine umweltverträgliche <strong>und</strong> standortgerechte<br />
Bewirtschaftung zu sichern bzw. wieder herzustellen.<br />
(4) Die landwirtschaftlich gut geeigneten Böden sollen insbesondere für die Landwirtschaft<br />
genutzt werden. Konkurrierende Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen (unter anderem<br />
Siedlungsentwicklung, Verkehr, Rohstoffabbau) sind auf das notwendige Maß zu beschränken<br />
<strong>und</strong> so anzusiedeln, daß eine ökonomische landwirtschaftliche Bodennutzung, einschließlich<br />
der tierischen Veredelung, weiter möglich ist.<br />
80
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
(5) Die Kulturlandschaft ist durch umweltverträgliche, standortgerechte landwirtschaftliche<br />
Nutzung zu erhalten.<br />
(6) Flächengeb<strong>und</strong>ene zusätzliche Erwerbsalternativen in Bereichen wie Landschaftspflege,<br />
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe <strong>und</strong> pharmakologischer Gr<strong>und</strong>stoffe sollen erschlossen<br />
werden. Der Tourismus soll als weitere Erwerbsmöglichkeit zur Erhaltung der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe beitragen.<br />
(7) Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen der Landwirtschaft sollen zur Erhaltung <strong>und</strong> Gestaltung<br />
der ländlichen Räume als attraktive <strong>und</strong> funktionsfähige Lebens- <strong>und</strong> Siedlungsräume<br />
beitragen.<br />
(8) Lehre, Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung sowie Forschung im Bereich Landwirtschaft, Landschaftspflege<br />
<strong>und</strong> Lebensmitteltechnologie sind für die Entwicklung der Landwirtschaft in<br />
der Region zu erhalten, zu nutzen <strong>und</strong> entsprechend zu unterstützen.<br />
Begründung<br />
zu 6.2.1(1):<br />
Die Planungsregion ist durch die Landwirtschaft als traditioneller <strong>und</strong> tragfähiger Wirtschaftszweig geprägt.<br />
Die Landwirtschaft hat eine Schlüsselfunktion für die Erhaltung der ländlichen Räume <strong>und</strong> der Kulturlandschaft<br />
sowie für weitere wichtige Wirtschaftsbereiche. Sie trägt wesentlich zum Image der Region bei.<br />
Mit Stand des Jahres 1996 bewirtschafteten 1.126 Landwirtschaftsbetriebe ca. 316.145 ha landwirtschaftlich<br />
genutzte Fläche. Die landwirtschaftlichen Betriebe weisen eine günstige Unternehmensstruktur auf (siehe<br />
Tabelle 15).<br />
Tabelle 15:<br />
Landwirtschaftliche Strukturdaten nach Landkreisen (Stand: August 1996)<br />
Landkreis durchschnittliche landwirtschaftliche landwirtschaftlich durchschnittl. Be-<br />
Ackerzahl Unternehmen genutzte Fläche in ha triebsgröße in ha<br />
Demmin 41 471 ca. 137.471 292<br />
Mecklenburg-Strelitz 37 347 ca. 97.367 280<br />
Müritz 35 308 ca. 81.307 264<br />
Planungsregion<br />
.<br />
1.126 ca. 316.145 280<br />
Quellen: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Statistisches Jahrbuch 1996; Auswertung<br />
der Bodenschätzung - praktische Anleitung - Institut für Landwirtschaft Hohenzieritz, o.J.<br />
Somit besteht eine gute Ausgangssituation für die weitere Stabilisierung <strong>und</strong> Entwicklung der Landwirtschaft.<br />
Neben den regionalen Absatzmöglichkeiten müssen überregionale <strong>und</strong> internationale Märkte für die in der<br />
Region erzeugten Produkte geschaffen <strong>und</strong> erhalten werden.<br />
Die Bindung von Arbeitskräften einschließlich der sozialen Komponente <strong>und</strong> die Kulturlandschaftspflege<br />
kann zu der dringend notwendigen Erhöhung der Lebensqualität in den ländlichen Räumen führen.<br />
81
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 6.2.1(2):<br />
In der Region sind günstige Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Produktion (Verarbeitungsstandorte,<br />
Betriebsstrukturen) gegeben. Der bestehende regionale Markt bietet jedoch nur geringe Absatzmöglichkeiten<br />
für die in der Region erzeugten Produkte. Durch den Aufbau einer regionalen Vermarktung der Produkte<br />
kann der Weg vom Erzeuger zum Verbraucher attraktiv, transparent <strong>und</strong> rentabel gestaltet werden.<br />
Dadurch wird ein Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen, ges<strong>und</strong>en Lebensmitteln geleistet<br />
(mögliche Kontrolle durch den Endverbraucher) <strong>und</strong> landwirtschaftliche Strukturen können sich stabilisieren.<br />
Dazu soll die Nutzung der in den Städten <strong>und</strong> Gemeinden vorhandenen Markt- <strong>und</strong> Gewerbeflächen<br />
für die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte beitragen (Landmärkte).<br />
Die in der Region vorhandenen Verarbeitungskapazitäten müssen zu einem höchstmöglichen Anteil mit<br />
regional erzeugten Produkten ausgelastet werden. Dazu ist eine quantitative Angleichung der regionalen Erzeugung<br />
an die vorhandenen Verarbeitungskapazitäten notwendig. So können positive wirtschaftliche Effekte<br />
für die Region erzielt werden.<br />
zu 6.2.1(3):<br />
Die umweltverträgliche, standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung ist Voraussetzung für die langfristige<br />
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, die Sicherung des Wasserhaushaltes, eine strukturierte Feldflur <strong>und</strong> die<br />
Gewährleistung eines intakten Naturhaushaltes. Dies stellt die Gr<strong>und</strong>lage für die Erzeugung ges<strong>und</strong>er<br />
Lebensmittel, die Entwicklung des Tourismus <strong>und</strong> das Bestehen der Kulturlandschaft dar. Eine umweltverträgliche,<br />
standortgerechte Landwirtschaft umfaßt:<br />
- Anwendung allgemein gültiger agrarwissenschaftlicher Erkenntnisse,<br />
- Schutz von Natur <strong>und</strong> Umwelt,<br />
- schonende Nutzung der Ressourcen,<br />
- Wirtschaftlichkeit,<br />
- Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.<br />
zu 6.2.1(4):<br />
In der Karte (M 1 : 100 000) sind entsprechend 5.2.1(3) LROP Räume mit einer Ackerzahl über 40 als Räume<br />
mit besonderer natürlicher Eignung für die Landwirtschaft ausgewiesen. Der landwirtschaftliche Bodenfonds<br />
in der Planungsregion ist aus Abbildung 5 ersichtlich.<br />
Abbildung 5: Relative Häufigkeiten der Ackerzahlen in der Planungsregion (in %)<br />
82
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
3%<br />
unter<br />
18<br />
6%<br />
8%<br />
14%<br />
19%<br />
25%<br />
23%<br />
18-22 23-27 28-33 34-38 39-43 44-49 50 60 70 80 90 100<br />
AZ<br />
2%<br />
0% 0% 0% 0% 0%<br />
Quelle: Auswertung der Bodenschätzung - praktische Anleitung - Institut für Landwirtschaft Hohenzieritz,<br />
o.J.<br />
In der Erläuterungskarte 8 ist die regionale Verteilung der Ackerzahlen im Durchschnitt der Gemeinden<br />
dargestellt. Der ausgewiesene Flächenanteil mit einer Ackerzahl über 40 beträgt ca. 47 % der gesamten<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche der Planungsregion. Insbesondere in diesen Räumen ist auf Gr<strong>und</strong> der<br />
natürlichen Eignung der Böden für die Landbewirtschaftung, einschließlich einer flächengeb<strong>und</strong>enen Tierhaltung,<br />
ein sparsamer Umgang mit diesen Böden notwendig, damit der Wirtschaftszweig Landwirtschaft<br />
einschließlich der Erschließung neuer Standorte für Tierhaltung gesichert <strong>und</strong> weiterentwickelt werden kann.<br />
zu 6.2.1(5):<br />
Die Landschaft mit ihrer Schönheit <strong>und</strong> Einzigartigkeit ist ein Charakteristikum für die Planungsregion. Um<br />
die Attraktivität der Region zu erhalten <strong>und</strong> zu erhöhen, ist ein sinnvolles Verbinden von Landschaftspflege<br />
<strong>und</strong> landwirtschaftlicher Nutzung notwendig. Nur eine nachhaltig landwirtschaftlich genutzte Landschaft kann<br />
auf Dauer den Ansprüchen an eine Kulturlandschaft gerecht werden. Der tierartengeb<strong>und</strong>enen Landschaftspflege<br />
kommt hierbei aus ökologischer <strong>und</strong> wirtschaftlicher Sicht besondere Bedeutung zu, da sonst bei<br />
dem im Jahr 1996 durchschnittlich zu geringen Viehbesatz in der Planungsregion die vorhandene Grünlandfläche<br />
nicht mehr vollständig bewirtschaftet werden kann. Durch geeignete agrarpolitische Aktivitäten können<br />
negative Konzentrationseffekte durch landschaftsprägende Flächenstillegung vermieden werden <strong>und</strong> so der<br />
Charakter der Kulturlandschaft als Basis einer touristischen Entwicklung <strong>und</strong> die Ertragsfähigkeit des Bodens<br />
erhalten werden.<br />
zu 6.2.1(6):<br />
In der Planungsregion ist in den Jahren 1991 bis 1996 die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten rapide<br />
zurückgegangen. Dennoch verringerte sich das durchschnittliche Familieneinkommen der Landwirte. Eine<br />
Verbesserung dieser Situation kann durch eine Erweiterung des Leistungsangebotes der Landwirte erfolgen.<br />
Auf dem Gebiet der nicht marktgängigen Leistungen, insbesondere der Erhaltung <strong>und</strong> Pflege der Kulturlandschaft,<br />
lassen sich für viele Arbeiten Mechanisierungsmittel nutzen, über die der Landwirt ohnehin verfügt.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> dieser maschinellen Voraussetzungen können Landwirte zusätzlich in den Bereichen Landschaftspflege,<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Kommunaldienst wirksam werden. Die Akzeptanz, landschaftspflegerische<br />
Arbeiten im weitesten Sinn als gesellschaftlich notwendige, zu vergütende Leistung zu bewerten, sollte erhalten<br />
bzw. konsequent aufgebaut werden.<br />
Die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe <strong>und</strong> pharmakologischer Gr<strong>und</strong>stoffe könnte eine weitere Erwerbsalternative<br />
darstellen.<br />
Das Tourismusgewerbe stellt ebenfalls eine zusätzliche Erwerbsquelle für Landwirte dar (z.B. "Urlaub auf<br />
dem Lande", siehe Programmsatz 7.1(2)).<br />
83
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 6.2.1(7):<br />
Landwirtschaftliche Strukturen bestehen vorrangig in den ländlichen Räumen, die mehr als 93 % des Gebietes<br />
der Planungsregion ausmachen. Landwirte sind damit überwiegende Nutzer der Flächen. Daraus ergibt sich<br />
der Anspruch an die Landwirtschaft, einen Beitrag zur Gestaltung der ländlichen Räume als Lebensraum der<br />
dort ansässigen Bevölkerung zu leisten.<br />
Dieser Anspruch bezieht sich nicht nur auf die bauliche Entwicklung, sondern sollte sich auch auf solche<br />
Bereiche erstrecken, die zu sozialen Bindungen <strong>und</strong> zur Identifikation der Bevölkerung mit den ländlichen<br />
Räumen beitragen. Die Flurbereinigung stellt dazu ein wichtiges Instrument dar. Sie wirkt auf<br />
- die Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Betrieben,<br />
- die Erneuerung der Dörfer <strong>und</strong> Feldfluren,<br />
- bessere <strong>und</strong> gesündere Lebens-, Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen,<br />
- die Erhaltung <strong>und</strong> Gestaltung der Kulturlandschaft sowie<br />
- die Sicherung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes<br />
hin.<br />
Um die Entwicklungschancen der landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene dörfliche<br />
Prägung zu erhalten, sind planungsrechtliche Möglichkeiten zu nutzen.<br />
Für die Erhaltung <strong>und</strong> Gestaltung auch von landwirtschaftlich geprägten Gemeinden <strong>und</strong> Ortsteilen stehen<br />
Förderprogramme zur Verfügung. Die Effizienz der Förderung sollte durch eine entsprechende räumliche<br />
Bündelung mehrerer Programme weiter erhöht werden (siehe Programmsatz 5.2.3).<br />
zu 6.2.1(8):<br />
Mit dem Fachhochschulstandort Neubrandenburg hat die Planungsregion eine Bildungseinrichtung unter<br />
anderem auch für die Fachbereiche Agrarwirtschaft, Landschaftspflege <strong>und</strong> Lebensmitteltechnologie. Des<br />
weiteren bestehen Forschungseinrichtungen an den Universitäten in Rostock <strong>und</strong> Greifswald, die Landesforschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft <strong>und</strong> Fischerei in Güstrow-Gülzow, das Forschungsinstitut für die Biologie<br />
landwirtschaftlicher Nutztiere in Dummerstorf, die B<strong>und</strong>esanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen<br />
in Groß Lüsewitz sowie die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in Güstrow-Gülzow. Diese<br />
Potentiale stellen wertvolle Forschungs- <strong>und</strong> Wissensressourcen dar, die insbesondere für notwendige Innovationen<br />
in der Landwirtschaft <strong>und</strong> dem Ernährungsgewerbe von Nutzen sind.<br />
6.2.2 Forstwirtschaft<br />
(1) Die Wälder sind entsprechend den Gr<strong>und</strong>sätzen einer naturnahen Forstwirtschaft zu erhalten<br />
<strong>und</strong> zu bewirtschaften, so daß die Nutz-, Schutz- <strong>und</strong> Erholungsfunktionen gesichert<br />
werden.<br />
(2) Durch die nachhaltige Sicherung stabiler Holzerträge soll die Entwicklung <strong>und</strong> Versorgung<br />
vor allem der regionalen Holzindustrie gewährleistet werden.<br />
(3) Zur Erhöhung des Waldanteils an der Gesamtfläche der Region sollen geeignete<br />
Flächen entsprechend den örtlichen Bedingungen mit standortgerechten Gehölzen unter<br />
Beachtung der Belange von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege sowie der Landwirtschaft<br />
84
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
neu aufgeforstet werden. Insbesondere betrifft das die waldarmen Gebiete im Norden der<br />
Region.<br />
Begründung<br />
zu 6.2.2(1):<br />
Durch eine naturnahe Forstwirtschaft kann der Wald unter Bewahrung seiner Funktion für den Naturhaushalt<br />
<strong>und</strong> die Erholung als umweltfre<strong>und</strong>licher Rohstofflieferant nachhaltig genutzt werden.<br />
Stufig aufgebaute Waldränder dienen insbesondere der Sturmsicherung des Waldbestandes. Zur Wahrung der<br />
oben genannten Funktionen sind Waldränder in einem Abstand von mindestens 50 m von baulichen Anlagen<br />
freizuhalten (gemäß Landeswaldgesetz in der Fassung vom 8. Februar 1993 (GVOBl. M-V S. 90), zuletzt<br />
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. September 1997 (GVOBl. M-V S. 502)). Eine Ausnahme<br />
bilden Solitärbauten insbesondere der Ver- <strong>und</strong> Entsorgung.<br />
Als wirtschaftliches <strong>und</strong> darüber hinaus auch ökologisches Problem stellen sich die großen Kiefernreinbestände<br />
mittlerer Altersklassen in den Sandergebieten dar, die einer intensiven Pflege <strong>und</strong> effektiven Nutzung<br />
bzw. Verarbeitung in der Region bedürfen.<br />
zu 6.2.2(2):<br />
Die Wertigkeit der vorhandenen Waldbestände wird durch geeignete waldbauliche Kultur- <strong>und</strong> Schutzmaßnahmen<br />
erhöht. Ausgewogene Bestände bezüglich Alter <strong>und</strong> Holzart werden so den vielfältigen Funktionen<br />
des Waldes gerecht <strong>und</strong> ermöglichen eine bedarfsorientierte Angebotspalette. Durch eine Verarbeitung vor<br />
Ort werden Transportwege eingespart, Arbeitskräfte geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> die Wälder als natürliches Potential für<br />
den Erhalt <strong>und</strong> die Entwicklung der regionalen Holzindustrie genutzt.<br />
zu 6.2.2(3):<br />
Der Waldanteil in der Planungsregion liegt bei 23,1 % <strong>und</strong> soll erhöht werden. Die angestrebte Waldmehrung<br />
dient der Ausgewogenheit des Naturhaushaltes <strong>und</strong> der Sicherung der Holzerträge. Sie stellt eine Alternative<br />
zur Flächenstillegung dar <strong>und</strong> dient der landschaftsästhetischen <strong>und</strong> landeskulturellen Aufwertung der<br />
Landschaft. In Tabelle 16 ist der Waldanteil der Planungsregion aufgezeigt.<br />
Tabelle 16:<br />
Waldanteil in % (Stand: 1996)<br />
Kreisfreie Stadt <strong>und</strong> Landkreise Waldanteil<br />
Neubrandenburg, Stadt 9,8 %<br />
Demmin 13,7 %<br />
Mecklenburg-Strelitz 30,1 %<br />
Müritz 25,7 %<br />
Planungsregion 23,1%<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Statistisches Jahrbuch 1997<br />
Anzustreben ist eine Waldmehrung durch standortgerechte Baumarten. Dabei sind die Belange der Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> des Naturschutzes zu beachten. Vorrangig sind großflächige Waldneubegründungen im Sinne<br />
des Waldverb<strong>und</strong>systems anzustreben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Beachtung landschaftsästhetischer<br />
Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> die Berücksichtigung <strong>und</strong> Rekultivierung kulturhistorischer Fragmente, um eine im weitesten<br />
Sinne ansprechende Landschaft zu bewahren <strong>und</strong> zu entwickeln. Waldneubegründungen bzw. Waldmehrungen<br />
sollten möglichst im Landkreis Demmin vorgenommen werden. Dieser Kreis gehört mit einer Wald-<br />
85
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
fläche von 263 km 2 , bezogen auf eine Kreisfläche von 1.921 km 2 , zu den waldärmsten Regionen in<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Gesetzlich geschützte Biotope <strong>und</strong> ökologisch wertvolle Offenlandschaften sind von der Erstaufforstung auszunehmen.<br />
Für die Standortwahl bei Vorhaben zur Waldmehrung stellt die Erläuterungskarte 9 eine forstfachliche<br />
Gr<strong>und</strong>lage des Landesamtes für Forstplanung Schwerin dar, die jedoch im konkreten Einzelfall noch einer<br />
Abstimmung mit raumordnerischen sowie insbesondere mit naturschutzfachlichen <strong>und</strong> landwirtschaftlichen<br />
Belangen bedarf.<br />
6.2.3 Fischerei<br />
(1) Die Fischerei soll als Wirtschaftszweig erhalten <strong>und</strong> weiterentwickelt werden. Die<br />
Verarbeitung <strong>und</strong> Vermarktung der Fische soll weitestgehend in der Region erfolgen.<br />
(2) Für das Fischereigewerbe sollen die notwendigen räumlichen Bedingungen,<br />
insbesondere bei Maßnahmen der Uferbebauung <strong>und</strong> des Bootsverkehrs, gesichert werden.<br />
(3) Bei der Gewässernutzung sind die Belange des Naturschutzes, des Tourismus <strong>und</strong> der<br />
Naherholung zu berücksichtigen. Insbesondere bei der Käfighaltung in natürlichen Gewässern<br />
sind Beeinträchtigungen zu minimieren.<br />
Begründung<br />
zu 6.2.3(1) <strong>und</strong> (2):<br />
In der Planungsregion werden mit Stand des Jahres 1996 ca. 36.337 ha Seenfläche gewerblich genutzt <strong>und</strong><br />
von 22 Fischereibetrieben bewirtschaftet. Der Anteil an der Gesamtwasserfläche der Planungsregion beträgt<br />
ca. 71,5 %.<br />
Die Binnenfischereibetriebe sind über die Erzeugung hinaus mit Veredelungs- <strong>und</strong> Direktvermarktungsstrukturen<br />
(Landmärkte, Gastronomie) vernetzt. Dadurch können sowohl regionstypische, hochwertige<br />
Nahrungsmittel erzeugt werden als auch die Gewässerhege gesichert werden. Des weiteren wird damit ein<br />
Beitrag zur regionsspezifischen Entwicklung des Tourismus <strong>und</strong> der Landschaftspflege geleistet.<br />
zu 6.2.3(3):<br />
In der Planungsregion unterliegt der Hauptteil der Gewässer der Nutzung durch das Fischereigewerbe. Da die<br />
Gewässer auch ein wichtiges ökologisches <strong>und</strong> touristisches Potential darstellen, müssen die Belange des<br />
Naturschutzes <strong>und</strong> der Erholung bei der Nutzung als Fischgewässer geprüft <strong>und</strong> beachtet werden.<br />
6.3 Rohstoffsicherung <strong>und</strong> -gewinnung<br />
6.3.1 Sicherung<br />
86
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
(1) Bodenschätze, insbesondere oberflächennahe Bodenschätze, sollen auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
einer umfassenden Erk<strong>und</strong>ung für die regionale <strong>und</strong> überregionale Rohstoffversorgung gesichert<br />
werden.<br />
(2) In den in der Karte (M 1 : 100 000) als Vorranggebiete der Rohstoffsicherung ausgewiesenen<br />
Lagerstätten ist der Rohstoffgewinnung gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungen<br />
der Vorrang zu geben. Abbauverhindernde Nutzungen sind auf diesen Flächen auszuschließen.<br />
(3) Die in der Karte (M 1 : 100 000) als Vorsorgegebiete der Rohstoffsicherung<br />
ausgewiesenen Lagerstätten dienen der langfristigen Sicherung oberflächennaher Rohstoffe.<br />
Abbauverhindernde Nutzungen sollen auf diesen Flächen in der Regel ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Gewinnungsvorhaben in Vorsorgegebieten sind einem Abwägungsprozeß zwischen raumordnerischen<br />
<strong>und</strong> landesplanerischen Gr<strong>und</strong>sätzen <strong>und</strong> Zielen sowie rohstoffwirtschaftlichen<br />
Erfordernissen zu unterziehen.<br />
Begründung<br />
zu 6.3.1(1):<br />
In der Planungsregion befinden sich Kiese, Sande, Quarzsande <strong>und</strong> Tone als Bodenschätze von besonderer<br />
Bedeutung. 39,1 % der bekannten Kiessandvorräte <strong>und</strong> 26,6 % der Sandvorräte sowie 33,2 % der Tonlagerstätten<br />
Mecklenburg-Vorpommerns sind in der Region lokalisiert. Dementsprechend intensiv sind die bergbaulichen<br />
Aktivitäten (siehe Tabelle 17).<br />
Tabelle 17:<br />
Bergbauliche Tätigkeiten in den Landkreisen <strong>und</strong> in der Stadt Neubrandenburg<br />
(Stand: Dezember 1995)<br />
Bergbauberechtigungen zur<br />
Gewinnung (ha) gesamt<br />
----------------------------------------<br />
davon -BWE<br />
-Bewilligungen<br />
-gr<strong>und</strong>eigene Rechte<br />
Gewinnungsrechte für betriebene<br />
Tagebaue mit Hauptbetriebsplänen<br />
(ha) gesamt<br />
----------------------------------------<br />
LandkreisD<br />
emmin<br />
1051,51<br />
------------<br />
697,73<br />
313,31<br />
40,47<br />
Landkreis<br />
Meckl.-Strelitz<br />
1975,75<br />
------------------<br />
1584,76<br />
331,77<br />
59,22<br />
Landkreis<br />
Müritz<br />
2234,08<br />
------------<br />
1661,22<br />
566,17<br />
6,69<br />
Stadt<br />
Neubrandenburg<br />
359,38<br />
------------------<br />
302,05<br />
18,28<br />
39,05<br />
Planungsreg.<br />
gesamt<br />
5620,72<br />
--------------<br />
4245,76<br />
1229,53<br />
145,43<br />
379,43 491,82 644,70 359,38 1875,33<br />
------------ ------------------ ------------ ------------------ ------------davon<br />
Flächenzuwachs 1995 (ha)<br />
wiedernutzbargemachte Fläche<br />
79,24 31,05 21,08 5,38 136,75<br />
1995 (ha)<br />
Quelle: Bergamt Strals<strong>und</strong><br />
3,80 10,37 3,20<br />
3,25 20,62<br />
87
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
In der Planungsregion befinden sich 53 zugelassene Tagebaue (Kies, Sand, Ton) mit einer aktiven Tagebaufläche<br />
von ca. 510 ha. Der natürliche Reichtum an Bodenschätzen in der Planungsregion <strong>und</strong> deren Sicherung<br />
ist Voraussetzung für die Entwicklung der Rohstoffwirtschaft <strong>und</strong> der Bauindustrie sowie deren nachgelagerten<br />
Bereiche (siehe Programmsatz 6.4(7)). Auf Gr<strong>und</strong> dieser guten Ressourcensituation in der Planungsregion<br />
ergibt sich ein bedeutender Standortvorteil im Hinblick auf die verarbeitende Industrie.<br />
Um eine Sicherung <strong>und</strong> Ordnung der Lagerstätten zu gewährleisten, ist die Kenntnis potentieller Lagerstätten<br />
Voraussetzung. Aus diesem Gr<strong>und</strong> sollte eine lagerstättengeologische Landesuntersuchung vorgenommen<br />
werden.<br />
zu 6.3.1(2) <strong>und</strong> (3):<br />
Mit den in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebieten Rohstoffsicherung wird<br />
den Erfordernissen der Sicherung <strong>und</strong> Gewinnung heimischer Rohstoffe gemäß § 2 Nr. 11 Landesplanungsgesetz<br />
vom 31. März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom<br />
27. April 1998 (GVOBl. M-V S. 388), Rechnung getragen <strong>und</strong> das landesplanerische Ziel der Sicherung von<br />
Gebieten mit abbauwürdigen Rohstoffen (siehe 5.3(1) LROP) regionalspezifisch untersetzt <strong>und</strong> räumlich<br />
konkretisiert.<br />
Als Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung wurden Gebiete ausgewiesen, bei denen es sich nach<br />
Einschätzung des Geologischen Landesamtes um abbauwürdige Rohstoffvorkommen handelt. Die Abbauwürdigkeit<br />
wurde unter anderem aus rohstoff- <strong>und</strong> wirtschaftsgeologischen Faktoren wie geologischer<br />
Untersuchungsstand, Rohstoffmenge <strong>und</strong> -qualität, Abraum-Nutzschicht-Verhältnis, Lagerungs- <strong>und</strong> Abbaubedingungen,<br />
bergwirtschaftlich-bergtechnischer Untersuchungsstand, Abbau- <strong>und</strong> Bedarfssituation abgeleitet.<br />
Sie kann entsprechend dem wachsenden Kenntnisstand über das Ressourcenpotential der Planungsregion,<br />
technisch-technologischen Entwicklungen <strong>und</strong> Veränderungen des Marktes Schwankungen unterworfen sein.<br />
Vorranggebiete Rohstoffsicherung (siehe Tabelle 18) sind solche abbauwürdigen Berechtigungsfelder (mit<br />
beantragter oder vorliegender Bewilligung, Bergwerkseigentum, Felder mit gr<strong>und</strong>eigenen Bodenschätzen), in<br />
denen aus raumordnerischer Sicht andere Nutzungsansprüche gegenüber der Gewinnung von Rohstoffen<br />
zurücktreten. Die raumordnerische Abwägung der verschiedenen Belange zugunsten der Rohstoffsicherung<br />
<strong>und</strong> -gewinnung hat bereits stattgef<strong>und</strong>en. Unberührt davon bleibt die Überprüfung der Abbauvorhaben nach<br />
den im Einzelfall gebotenen Genehmigungsverfahren. In diesen Verfahren können dann die Ziele des Regionalen<br />
Raumordnungsprogramms durch Maßgaben rechtswirksam abgesichert werden.<br />
Tabelle 18:<br />
Vorranggebiete Rohstoffsicherung<br />
Kiessandlagerstätten mit Flächenkorrektur Tonlagerstätten mit Flächenkorrektur<br />
1. Basedow West 22. Altentreptow Ost �<br />
2. Demmin Siebeneichen 23. Friedland �<br />
3. Erlenkamp 24. Hildebrandshagen<br />
4. Hallalit NordOst<br />
5. Hohenmin<br />
Hohenmin/Erweiterung<br />
6. Jabel NordOst<br />
Jabel Ost<br />
7. Kargow Unterdorf<br />
� 25. Woldegk �<br />
8. Klocksin Blücherhof �<br />
9. Langhagen Feld 1 �<br />
10. Liepen<br />
11. Malchow<br />
�<br />
12. Möllenhagen Rethwisch �<br />
13. Müssentin<br />
Müssentin West<br />
�<br />
88
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
14. Müssentin SüdWest<br />
15. Neubrandenburg Fritscheshof �<br />
16. Ramelow �<br />
17. Schossow<br />
18. Sponholz<br />
19. Thurow Rödlin<br />
20. Wackstow<br />
21. Zarrenthin<br />
Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung (siehe Tabelle 19) sind solche abbauwürdigen Berechtigungsfelder (mit<br />
beantragter oder vorliegender Bewilligung, Bergwerkseigentum, Felder mit gr<strong>und</strong>eigenen Bodenschätzen <strong>und</strong><br />
solche Erlaubnisfelder, die bereits als abbauwürdig eingeschätzt worden sind), in denen der Sicherung von<br />
Rohstoffen bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen eine besondere Bedeutung beigemessen<br />
wird. Raumordnerische Überprüfungen für Abbauvorhaben in Vorsorgegebieten Rohstoffsicherung<br />
sind jedoch noch erforderlich, bei denen die Bedeutung der Rohstoffgewinnung gegen andere - möglicherweise<br />
vorrangige - Nutzungsansprüche <strong>und</strong> gegen Ordnungsgesichtspunkte (z.B. Vermeidung von<br />
Häufungsgebieten entsprechend Programmsatz 6.3.2(5)) im Einzelfall abzuwägen ist.<br />
Tabelle 19:<br />
Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung<br />
Kiessandlagerstätten mit Flächenkorrektur Tonlagerstätten mit Flächenkorrektur<br />
1. Bassow SüdWest 23. Gramelow<br />
2. Groß Dratow Süd � 24. Loickenzin �<br />
3. Hallalit Süd � 25. Möllenhagen Nord �<br />
4. Hohen Wangelin Liepen � 26. Möllenhagen Ost<br />
5. Klocksin Blücherhof NO1 � 27. Mölllenhagen West �<br />
6. Kotzow<br />
7. Kreuzbruchhof<br />
28. Warbende<br />
8. Küssow West<br />
9. Lebbin West<br />
10. Müssentin SW Erweiterung<br />
�<br />
11. Malchow NordWest<br />
Malchow NordWest I<br />
Malchow NordWest II<br />
12. Sanzkow Ost<br />
13. Schwarz West<br />
�<br />
14. Sophienhof Nord 2<br />
15. Steinwalde<br />
16. Steinwalde Ost<br />
17. Wackstow NordWest<br />
�<br />
18. Waren Schwenzin<br />
19. Warlin<br />
Warlin 2<br />
�<br />
20. Warlin Süd �<br />
89
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
21. Wildkuhl Nord<br />
22. Woggersin Tannenberg<br />
Die Bewilligungsfelder Adolphseck, Basedow Ost, Duckow NordWest, Friedland NordOst, Hagenow Süd,<br />
Klein Vielist, Klocksin Blücherhof NO 2, Koldenhof, Neubrandenburg Hinterste Mühle Ost, Neubrandenburg<br />
Spargelberg Nord, Neubrandenburg Steepenweg Ost, Neukalen Ost, Neustrelitz Süd, Starsow,<br />
Treuen/Schwinge <strong>und</strong> Weltzin, die Erlaubnisfelder Liepen NordWest, Neubrandenburg Hinterste Mühle<br />
SüdOst <strong>und</strong> Treuen Süd sowie die Bergwerkseigentumsflächen Adamshoffnung, Carwitz Thomsdorf, Hallalit<br />
NordWest, Neubrandenburg Hinterste Mühle, Neubrandenburg Spargelberg, Neubrandenburg Steepenweg,<br />
Neukalen, Neustrelitz Kiefernheide, Sandhagen, Stuer Nordfeld <strong>und</strong> Stuer Westfeld wurden nicht als<br />
Vorrang- oder Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung ausgewiesen, da anderen raumordnerischen Belangen, die<br />
einer Gewinnung in diesen Feldern entgegenstehen, auf Dauer ein eindeutiger Vorrang eingeräumt wird<br />
(Forstwirtschaft, Siedlungsentwicklung/Stadtentwicklung, Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege,<br />
Bodendenkmalschutz, Tourismus).<br />
Auch wurden solche Bewilligungsfelder <strong>und</strong> Bergwerkseigentumsflächen von der Ausweisung ausgenommen,<br />
für die eine Sicherung aus raumordnerischer Sicht nicht erforderlich ist (keine Abbauwürdigkeit, lokale<br />
Bedeutung, fortgeschrittener Auskiesungsstand).<br />
Bergwerkseigentumsflächen sind in der Regel zugleich Baubeschränkungsgebiete im Sinne von §§ 107-109<br />
des B<strong>und</strong>esberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 1310), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes<br />
vom 18. Juni 1997 (BGBl. I 1430). Dies gilt auch für Flächen, die hier von der Ausweisung als Vorrang- oder<br />
Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung ausgenommen wurden.<br />
Zum <strong>Teil</strong> waren bei der Ausweisung der Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete Flächenkorrekturen an den ihnen<br />
zugr<strong>und</strong>e liegenden Berechtigungsfeldern notwendig, um bereits im Rahmen der Erarbeitung des RROP erkennbare<br />
wesentliche Nutzungskonflikte auszuräumen.<br />
Außerhalb der Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete ist die Gewinnung von Rohstoffen möglich, jedoch kommt der<br />
Gewinnung hier bei der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen aus raumordnerischer Sicht keine<br />
besondere Bedeutung zu (siehe bergrechtlicher Verfahrensstand im Anhang, Anlage 3).<br />
Die ausgewiesenen Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung in der Planungsregion enthalten<br />
geschätzte geologische Vorräte an Kiesen, Kiessanden <strong>und</strong> Sanden von insgesamt ca. 230 Mio. t (Stand<br />
1996). Erfahrungsgemäß beträgt der Jahresbedarf an Kies/Sand im langfristigen Mittel weniger als 10<br />
Tonnen/Einwohner <strong>und</strong> Jahr. Damit kann, auch unter Verzicht auf raumordnerisch problematische Lagerstätten,<br />
bereits von einer langfristig bedarfsgerechten Sicherung dieser Bodenschätze in der Planungsregion<br />
ausgegangen werden. Darüber hinaus existieren in der Planungsregion weitere höffige Gebiete, deren Erk<strong>und</strong>ung<br />
fortschreitet <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lage der Ausweisung weiterer Vorrang- <strong>und</strong> Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung<br />
im Rahmen der Fortschreibung des RROP sein kann.<br />
Für die Ausweisung der Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgegebiete Rohstoffsicherung wurden Beiträge des Geologischen<br />
Landesamtes, des Bergamtes <strong>und</strong> der "Gutachterliche Abbaurahmenplan Mecklenburgische Seenplatte"<br />
(DURTEC GmbH 1994) genutzt.<br />
6.3.2 Gewinnung<br />
(1) Bodenschätze in bestehenden Tagebauaufschlüssen sind gegenüber Neuaufschlüssen<br />
vorrangig abzubauen, wenn dem keine anderen Belange entgegenstehen.<br />
(2) Ein Abbau von Bodenschätzen ist innerhalb der in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellten<br />
Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege auszuschließen.<br />
90
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
(3) Ein Abbau von Bodenschätzen soll innerhalb der in der Karte (M 1 : 100 000)<br />
dargestellten Tourismusschwerpunkträume <strong>und</strong> im Wald nicht erfolgen.<br />
(4) Ein Abbau von Bodenschätzen ist innerhalb der in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellten<br />
Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege sowie Tourismusentwicklungsräume<br />
möglichst zu vermeiden oder auf die Vereinbarkeit mit den Funktionen dieser<br />
Räume auszurichten.<br />
(5) In Gebieten mit großräumigen Rohstoffvorkommen, insbesondere<br />
- zwischen Demmin <strong>und</strong> Jarmen (Gebiet zwischen der Peene, der B<strong>und</strong>esstraße 96 <strong>und</strong> der<br />
Landstraße 271),<br />
- um Hohen Wangelin-Hallalit (Gebiet nördlich der Linie Malkwitz - Alt Gaarz, zwischen<br />
der Kreisstraße Müritz 2, der B<strong>und</strong>esstraße 108 <strong>und</strong> der Planungsregionsgrenze),<br />
- um Möllenhagen (im Umkreis von circa 5 km) <strong>und</strong><br />
- nördlich von Neustrelitz (Gebiet zwischen der Bahnlinie Neubrandenburg - Neustrelitz,<br />
der B<strong>und</strong>esstraße 193, der Landesstraße 34 <strong>und</strong> der Kreisstraße Mecklenburg-Strelitz 18)<br />
ist eine Häufung aktiver Tagebaue auszuschließen. Der Abbau der Rohstoffe in benachbarten<br />
Tagebauen soll zeitlich gestaffelt erfolgen.<br />
(6) Im Ordnungsraum Neubrandenburg ist der Abbau von Bodenschätzen auf das bereits<br />
bewilligte Maß zu beschränken.<br />
(7) Der Umgang <strong>und</strong> die Verwendung von oberflächennahen Bodenschätzen soll sparsam<br />
<strong>und</strong> entsprechend ihrer jeweiligen Qualität erfolgen. Ersatzstoffe sind soweit wie möglich<br />
zu nutzen.<br />
(8) Beim Rohstoffabbau ist auf eine möglichst vollständige Ausbeutung der Lagerstätte<br />
unter Beachtung der fachlichen Belange, insbesondere der bergrechtlichen <strong>und</strong> wasserwirtschaftlichen<br />
Belange, hinzuwirken.<br />
(9) Das Abbaugeschehen <strong>und</strong> der Abtransport der Rohstoffe sollen so erfolgen, daß die geordnete<br />
Siedlungsentwicklung <strong>und</strong> die Wohnqualität nicht beeinträchtigt werden.<br />
Begründung<br />
zu 6.3.2(1):<br />
Die vorhandenen Tagebaue stellen bereits Eingriffe in gegebene Raumnutzungen dar. Durch die vorrangige<br />
Ausbeutung <strong>und</strong> fortlaufende Renaturierung bzw. Rekultivierung dieser Tagebaue werden diese Eingriffe<br />
kurz- bis mittelfristig ausgeglichen. Neue Aufschlüsse können vermieden <strong>und</strong> so die Anzahl der Tagebaue<br />
reduziert werden. Dagegen würden Neuaufschlüsse bei gleicher absatzbestimmter Fördermenge die Anzahl<br />
der Tagebaue erhöhen <strong>und</strong> zu einer Verlangsamung der Flächenbereitstellung für die Renaturierung bzw.<br />
Rekultivierung führen. Negative Effekte durch die Konzentration von aktiven Tagebauen können somit vermieden<br />
werden.<br />
91
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Über Jahre offengelassene Tagebaue (keine Gewinnungsarbeiten) können sich zu wertvollen Lebensräumen<br />
entwickelt haben oder als Deponie genutzt worden sein bzw. genutzt werden. In diesen Fällen sind die Belange<br />
aus Sicht des Naturschutzes <strong>und</strong> der Landschaftspflege sowie abfallwirtschaftliche Belange mit rohstoffwirtschaftlichen<br />
Erfordernissen abzuwägen. Diese Abwägung kann nicht stattfinden, wenn der Tagebau<br />
nur vorübergehend stillgelegt worden ist.<br />
zu 6.3.2(2):<br />
In Vorranggebieten für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege ist der Abbau von Bodenschätzen ausgeschlossen,<br />
da in diesen Räumen der Naturschutz <strong>und</strong> die Landschaftspflege gegenüber allen anderen Nutzungsanforderungen<br />
- <strong>und</strong> somit auch gegenüber Abbauvorhaben - Vorrang hat <strong>und</strong> Abbauvorhaben mit dem diesen<br />
Räumen jeweils zugr<strong>und</strong>eliegendem Schutzzweck unvereinbar sind (siehe Programmsatz 4.4(1)).<br />
zu 6.3.2(3):<br />
Tourismusschwerpunkträume (siehe Programmsatz 7.2.1) stellen die landschaftlich attraktivsten Bereiche der<br />
Planungsregion dar, in denen die Belange des Tourismus gegenüber den Belangen anderer Wirtschaftszweige<br />
besonderes Gewicht haben. Sie verfügen größtenteils über bereits vorhandene touristische Angebote. Ein<br />
Abbau von Bodenschätzen in diesen <strong>Teil</strong>räumen würde entwicklungshemmend auf das Fremdenverkehrsgewerbe<br />
wirken, die Eignung als attraktives Tourismusgebiet mindern <strong>und</strong> die besondere tourismuswirtschaftliche<br />
Bedeutung dieser <strong>Teil</strong>räume gefährden.<br />
Durch den Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen in Wald werden Waldbestände gerodet. Sie würden<br />
auch im Falle der Wiederaufforstung oder der Aufforstung auf Ersatzflächen zumindest der gegenwärtigen<br />
Generation nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Planungsregion verfügt - ebenso wie das Land Mecklenburg-Vorpommern<br />
insgesamt - nur über einen geringen Anteil an Wald, so daß dessen Erhalt <strong>und</strong> Mehrung<br />
ein besonderes öffentliches Interesse darstellt (siehe Programmsatz 6.2.2(3)). Da in der Planungsregion ausreichend<br />
Vorräte von Kiesen, Sanden <strong>und</strong> Tonen außerhalb von Wald zur Rohstoffsicherung <strong>und</strong> Rohstoffversorgung<br />
zur Verfügung stehen (siehe Programmsatz 6.3.1), ist die Notwendigkeit einer Umwandlung der<br />
für den Abbau vorgesehenen Waldfläche gemäß § 15 Absatz 4 Landeswaldgesetz in der Fassung vom 8. Februar<br />
1993 (GVOBl. M-V S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. September 1997<br />
(GVOBl. M-V S. 502), nur in dem abzuwägenden Ausnahmefall gerechtfertigt, wenn es sich bei dem<br />
Bodenschatz um einen in der Region selten vorkommenden, wirtschaftlich bedeutenden Rohstoff handelt <strong>und</strong><br />
der Eingriff entsprechend § 15 Absatz 5 Landeswaldgesetz ausgeglichen werden kann.<br />
zu 6.3.2(4):<br />
Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege (siehe Programmsatz 4.4(2)) haben eine besondere<br />
Bedeutung für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege. Entsprechend sind die Belange des Naturschutzes <strong>und</strong> der<br />
Landschaftspflege bei der Abwägung <strong>und</strong> Abstimmung mit Abbauvorhaben besonders zu berücksichtigen <strong>und</strong><br />
das Abbauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem jeweiligen Schutzzweck hin zu prüfen bzw. bei<br />
Feststellung der Unvereinbarkeit zu versagen. Die in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellten Vorsorgeräume<br />
für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege weisen größtenteils einen Schutzstatus als Naturpark oder Landschaftsschutzgebiet<br />
auf. Die Zulässigkeit bzw. der Ausschluß von Abgrabungen in diesen Gebieten wird im<br />
Einzelnen durch Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungspläne bzw. durch Verordnungen geregelt.<br />
Die als Tourismusentwicklungsräume ausgewiesenen <strong>Teil</strong>räume sind für eine touristische Entwicklung geeignet<br />
<strong>und</strong> verfügen bereits zum <strong>Teil</strong> über entsprechende Ansätze zur Entwicklung einer touristischen Infrastruktur<br />
(siehe Programmsatz 7.2.2). Ein Abbau von Bodenschätzen soll möglichst nur außerhalb dieser Eignungsräume<br />
vorgenommen werden, um die angestrebte touristische Entwicklung nicht zu gefährden, oder so<br />
ausgerichtet werden, daß das Abbauvorhaben mit der angestrebten <strong>und</strong> bereits vorhandenen touristischen<br />
Entwicklung in diesen Räumen vereinbar ist.<br />
92
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
zu 6.3.2(5):<br />
Durch eine Häufung aktiver Tagebaue potenzieren sich die Beeinträchtigungen, die mit einem Rohstoffabbau<br />
einhergehen. Die Dauer des Eingriffs wird verlängert <strong>und</strong> der Zeitpunkt des Ausgleichs bzw. der abgeschlossenen<br />
Renaturierung bzw. Rekultivierung wird verzögert. Eine Häufung können bereits 2 nebeneinanderliegende,<br />
nicht zwingend angrenzende Tagebaue darstellen.<br />
Die zeitliche Staffelung des Abbaus trägt wesentlich zur Minimierung der Beeinträchtigungen bei. Zeitliche<br />
Staffelung bedeutet, daß ein Tagebau erst zugelassen wird, wenn benachbarte bereits zugelassene Tagebaue<br />
zu etwa 70 - 80 % ausgebeutet <strong>und</strong> wieder renaturiert bzw. rekultiviert wurden.<br />
zu 6.3.2(6):<br />
Aufgr<strong>und</strong> der im Ordnungsraum Neubrandenburg vorhandenen Tagebaue <strong>und</strong> bewilligten Abbauvorhaben<br />
kann von einer langfristig bedarfsgerechten Sicherung oberflächennaher Bodenschätze ausgegangen werden.<br />
Weitere Tagebaue würden zu zusätzlichen Flächenblockierungen führen <strong>und</strong> sich mit ihren Lärm- <strong>und</strong><br />
Staubemissionen sowie zusätzlichen Verkehrsbelastungen negativ auf die Entwicklung der Stadt <strong>und</strong> ihres<br />
Umlandes auswirken. Das Ziel der Schaffung <strong>und</strong> Sicherung eines starken <strong>und</strong> attraktiven Oberzentrums<br />
Neubrandenburg würde dadurch gefährdet werden (siehe auch Programmsatz 1.1).<br />
zu 6.3.2(7):<br />
Die Kiese, Sande <strong>und</strong> Tone sind naturgemäß begrenzt. Durch die der jeweiligen Qualität entsprechenden<br />
materialgerechten Verwendung dieser Rohstoffe wird ein wesentlicher Beitrag zu einem ressourcenschonenden<br />
Umgang geleistet <strong>und</strong> Tagebaue auf ein notwendiges Maß beschränkt. Dazu trägt auch der Einsatz von<br />
Ersatzstoffen (z.B. Betonrecyclingmaterial als Schüttgut) bei.<br />
zu 6.3.2(8):<br />
Tagebaue führen durch den Flächenentzug zu Veränderungen in Natur <strong>und</strong> Landschaft. Um den Flächenverbrauch<br />
zu minimieren <strong>und</strong> die Zahl der Eingriffe zu verringern, sollen die Rohstoffe in den jeweiligen Tagebauen<br />
vollständig abgebaut werden, soweit dem andere fachliche Belange nicht entgegenstehen. Auf Gr<strong>und</strong><br />
der geologischen Gegebenheiten in der Planungsregion sind wasserwirtschaftliche Belange von besonderer<br />
Bedeutung (siehe Programmsatz 6.3.3(1)).<br />
zu 6.3.2(9):<br />
Das Abbaugeschehen in Tagebauen ist in der Regel mit Lärm, Staub, Verkehrsbelastung durch Schwertransporte<br />
<strong>und</strong> Beeinträchtigung des Landschaftsbildes <strong>und</strong> des Erholungswertes als negative Folgen für die Umgebung<br />
verb<strong>und</strong>en. In der Nähe <strong>und</strong> im Bereich von Siedlungen können diese Auswirkungen zu unzulässigen<br />
Beeinträchtigungen einer geordneten Entwicklung führen. Dem muß durch entsprechende Abstandsregelungen,<br />
Verkehrsführungen <strong>und</strong> weitere geeignete Maßnahmen Rechnung getragen werden.<br />
Zum Erhalt der Wohnqualität ist bereits zum Zeitpunkt der Aufsuchung die Unverträglichkeit zwischen vorhandenen<br />
Wohngebieten <strong>und</strong> angrenzendem potentiellen Tagebau geltend zu machen. Um Nutzungskonflikte<br />
zu vermeiden, sind Wohngebiete <strong>und</strong> Tagebaue in ihrer Ausschließlichkeit zu beurteilen.<br />
Die Belange des Verkehrs, bezogen auf die Rohstofftransporte, sind beim Abbau von Bodenschätzen besonders<br />
zu beachten. Dabei sollten insbesondere Ortsdurchfahrten in der Regel vermieden <strong>und</strong> Transportwege<br />
93
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
unter Beachtung des Ausbauzustandes der vorhandenen Straßen festgelegt werden. Alternativen wie Verschiffung<br />
oder Bahntransport sind in jedem Fall zu prüfen <strong>und</strong> zu bevorzugen.<br />
6.3.3 Renaturierung <strong>und</strong> Rekultivierung<br />
(1) Eine frühestmöglich beginnende <strong>und</strong> fortlaufende Renaturierung oder Rekultivierung<br />
der Tagebaue ist zu garantieren. Dabei sind die Abbauflächen unter Berücksichtigung der<br />
naturräumlichen Gegebenheiten, der bereits vorhandenen Raumnutzungen in der<br />
Umgebung sowie der Sicherungs- <strong>und</strong> Eignungsziele in Räumen mit Sicherungs- <strong>und</strong><br />
Eignungscharakter zu renaturieren oder zu rekultivieren. Die Abbauflächen sollen, wenn<br />
möglich, in die ursprüngliche Nutzung zurückgeführt werden. Durch Naßabbau<br />
verbleibende Flächen sollen die Ausnahme darstellen.<br />
(2) Die Renaturierung <strong>und</strong> Rekultivierung von Tagebauen im Ordnungsraum Neubrandenburg<br />
soll dessen Attraktivität steigern <strong>und</strong> die geordnete Siedlungsentwicklung<br />
unterstützen.<br />
(3) Für räumlich benachbarte Einzelvorhaben sind gemeinsame<br />
Wiedernutzbarmachungskonzeptionen zu erarbeiten.<br />
Begründung<br />
zu 6.3.3(1):<br />
Mit „Renaturierung“ sind alle Wiederherrichtungsmaßnahmen, die der Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen<br />
im weitesten Sinne dienen (gestalterischer Naturschutz) bezeichnet. „Rekultivierung“ im engeren<br />
Sinne bezeichnet dagegen die Rückführung einer Abbaufläche in land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche, aber auch<br />
fischereiwirtschaftliche Nutzung oder Erholungsnutzung.<br />
Der Abbau von Rohstoffen verursacht Eingriffe in Natur <strong>und</strong> Landschaft. Flächen werden ihrer ursprünglichen<br />
Funktion entzogen. Der frühestmögliche Beginn <strong>und</strong> die sukzessive Weiterführung von Renaturierungs-<br />
bzw. Rekultivierungsmaßnahmen auf bereits abgebauten <strong>Teil</strong>flächen leisten einen wesentlichen Beitrag<br />
zur Einhaltung der Ziele in den Programmsätzen 4.1, 4.2.1 <strong>und</strong> 4.3 sowie zur Beachtung der naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffsregelung.<br />
Die Art der Renaturierung bzw. Rekultivierung wird insbesondere durch folgende Kriterien bestimmt, die<br />
geeignet sind, die von einer Nachfolgenutzung ausgehenden Konflikte zu begrenzen <strong>und</strong> zur räumlichen<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Landschaftsgestaltung beizutragen:<br />
- naturräumliche Gegebenheiten des Abbaustandortes, wie z.B. Gr<strong>und</strong>wasserstand, Geländeformation usw.,<br />
- bereits vorhandene Raumnutzungen wie z.B. landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gewerbliche<br />
Nutzung in der Umgebung der Abbaufläche sowie<br />
- die räumliche Lage, insbesondere in Räumen mit Sicherungs- <strong>und</strong> Eignungscharakter (z.B. Vorranggebiete<br />
<strong>und</strong> Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege, Tourismusschwerpunkträume <strong>und</strong><br />
Tourismusentwicklungsräume, Räume mit besonderer natürlicher Eignung für die Landwirtschaft).<br />
Durch ein Anstreben der ursprünglichen Nutzung, wenn dies insbesondere unter ökologischen Aspekten<br />
sinnvoll ist, kann das vorhandene Landschaftsgefüge bzw. die gewachsene Kulturlandschaft erhalten werden.<br />
94
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
Der Anteil der Rohstoffgewinnung im Naßschnitt sollte so gering wie möglich gehalten werden. Die geologische<br />
Situation in der Planungsregion bedingt eine hohe Empfindlichkeit des oberen Gr<strong>und</strong>wasserleiters<br />
vor allem im Sandergebiet. Durch die Naßbaggerung <strong>und</strong> die Nachnutzung in Form eines Sees wird dieser<br />
Gr<strong>und</strong>wasserleiter in der Regel freigelegt, was zu einer Gefährdung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden<br />
Trinkwasservorräte führt. Um solche Gefährdungen zu vermeiden, sollen durch Naßabbau verbleibende<br />
Flächen die Ausnahme darstellen. Eine intensive fischereiliche Nutzung der verbleibenden Wasserflächen<br />
sollte in jedem Fall vermieden werden.<br />
zu 6.3.3(2):<br />
Im Ordnungsraum Neubrandenburg befindet sich eine Vielzahl von aktiven Tagebauen. Die Art der Wiedernutzbarmachung<br />
dieser Tagebaue hat entscheidenden Einfluß auf die Funktionsfähigkeit <strong>und</strong> Attraktivität des<br />
Ordnungsraumes (siehe auch Programmsatz 1.1).<br />
zu 6.3.3(3):<br />
Bedingt durch die geologischen Gegebenheiten kommt es zur Konzentration von bergbaulichen Aktivitäten<br />
(zur Zeit in den Bereichen Hohen Wangelin - Hallalit, östlich von Demmin <strong>und</strong> um Neubrandenburg). Ausgehend<br />
vom B<strong>und</strong>esberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I 1310), zuletzt geändert durch Artikel 3 des<br />
Gesetzes vom 18. Juni 1997 (BGBl. I 1430), ist jeder Betreiber verpflichtet, ein Wiedernutzbarmachungskonzept<br />
zu erstellen. Bereits bei zwei benachbarten Abbauflächen potenzieren sich die Beeinträchtigungen<br />
durch die betriebenen Tagebaue. Deshalb sollen für benachbarte Tagebaue gemeinsame, aufeinander abgestimmte<br />
Wiedernutzbarmachungskonzepte erstellt werden. Die von den Tagebauen ausgehenden Beeinträchtigungen<br />
jeglicher Art können auf diese Weise verringert werden, so daß eine geordnete räumliche Entwicklung<br />
gesichert werden kann. Vorhandene Landschaftspläne sollen prinzipiell in Wiedernutzbarmachungskonzepten<br />
Beachtung finden.<br />
6.4 Produzierendes Gewerbe<br />
(1) Betrieben des produzierenden Gewerbes sollen entsprechend ihrer spezifischen Flächenbedarfe<br />
die im Rahmen der gewerblichen Siedlungsentwicklung gemäß Programmsatz 5.4<br />
vorgehaltenen Gewerbeflächen angeboten werden.<br />
(2) Insbesondere in den regional bedeutsamen Schwerpunkten für produzierendes Gewerbe<br />
ist auf einen möglichst hohen Arbeitsplatzbesatz <strong>und</strong> auf eine produktionsbezogene<br />
Nutzung der gewerblichen Flächen hinzuwirken.<br />
(3) Für flächenextensive Betriebe mit niedriger Arbeitsplatzdichte <strong>und</strong> schwach ausgeprägtem<br />
Kontaktbedarf zu ober- <strong>und</strong> mittelzentralen Einrichtungen bzw. Leistungen sollen Gewerbeflächen<br />
vorgehalten werden, die sich außerhalb des Oberzentrums Neubrandenburg<br />
sowie außerhalb der Mittelzentren befinden, wenn an diesen Standorten keine dafür<br />
geeigneten Flächen vorgehalten werden können.<br />
95
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(4) Für die Verarbeitung <strong>und</strong> Veredelung von heimischen Produkten der Landwirtschaft,<br />
Forstwirtschaft <strong>und</strong> Fischerei sollen wettbewerbsfähige Betriebe des Nahrungs- <strong>und</strong> Genußmittelgewerbes<br />
<strong>und</strong> des holzverarbeitenden Gewerbes vorzugsweise in den zentralen Orten<br />
angesiedelt bzw. gestärkt werden.<br />
(5) Im Einzelfall sollen für gewerbliche Nutzungen, die auf Gr<strong>und</strong> besonderer<br />
Standortanforderungen nicht innerhalb zusammenhängender Siedlungsflächen angesiedelt<br />
werden können, Möglichkeiten der Ansiedlung an bedarfsgerechten Standorten vorgesehen<br />
werden.<br />
(6) Die Zuordnung <strong>und</strong> Verwendung der Gewerbestandorte <strong>und</strong> -flächen soll dazu beitragen,<br />
den Technologietransfer zu erleichtern <strong>und</strong> das Innovationspotential vor allem der kleinen<br />
<strong>und</strong> mittleren Betriebe zu aktivieren.<br />
(7) Die in der Region vorhandenen Potentiale zur Entwicklung des Gr<strong>und</strong>stoff- <strong>und</strong><br />
Produktionsgütergewerbes, wie die Gewinnung <strong>und</strong> Verarbeitung von Steinen <strong>und</strong> Erden<br />
<strong>und</strong> die Erzeugung <strong>und</strong> Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen, sollen unter<br />
Beachtung der Belange von Natur <strong>und</strong> Landschaft, der Siedlungsentwicklung <strong>und</strong> der<br />
Tourismusentwicklung genutzt <strong>und</strong> entwickelt werden. Dabei ist auf eine Veredelung der<br />
Gr<strong>und</strong>stoffe <strong>und</strong> Produktionsgüter in der Region hinzuwirken.<br />
Begründung<br />
zu 6.4(1):<br />
Viele Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes sind auf spezifische Flächenbedarfe bzw. Standortvoraussetzungen<br />
angewiesen. Eine bedarfsspezifische Bereitstellung <strong>und</strong> vor allem auch eine standortgerechte<br />
Verwendung von Gewerbeflächen sind als wichtige "harte" Standortfaktoren entscheidende Rahmenbedingungen<br />
für die regionale Wirtschaftsentwicklung.<br />
zu 6.4(2):<br />
Die regional bedeutsamen Schwerpunkte für produzierendes Gewerbe sind entsprechend Programmsatz 5.4.1<br />
ausgewiesen. Vor allem diese Standorte stellen auf Gr<strong>und</strong> ihrer konfliktarmen Eigenschaften <strong>und</strong> Lagevorteile<br />
ein kostbares Potential für die Entwicklung des produzierenden Gewerbes in der Region dar. Entsprechend<br />
muß auch mit diesem nicht beliebig vermehrbaren Flächenpotential im Sinn eines verantwortungsvollen <strong>und</strong><br />
sorgfältigen regionalen <strong>und</strong> gemeindlichen Gewerbeflächenmanagements umgegangen werden.<br />
zu 6.4(3):<br />
Das begrenzte Flächenpotential, das im Oberzentrum Neubrandenburg, in den Mittelzentren Demmin,<br />
Neustrelitz <strong>und</strong> Waren (Müritz) sowie im Mittelzentrum mit <strong>Teil</strong>funktionen Malchin für gewerbliche Zwecke<br />
aktiviert werden kann, sollte zur Bedarfsdeckung standortadäquater oder standortabhängiger Produktionen<br />
vorgehalten werden <strong>und</strong> nicht durch die Ansiedlung von Betrieben erschwert werden, die gemessen an ihrem<br />
hohen Flächenverbrauch nur einen geringen Beitrag zum Beschäftigungsangebot leisten <strong>und</strong> deren<br />
Standortanforderungen auch an anderer Stelle noch angemessen erfüllt werden könnten. Dazu zählen z.B.<br />
großflächige Anlagen der Lagerhaltung <strong>und</strong> des überregionalen Güterumschlages (Logistikzentren).<br />
96
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
zu 6.4(4):<br />
Um insbesondere die landwirtschaftlichen Potentiale der Region zu nutzen <strong>und</strong> die Landwirtschaft zu stärken,<br />
ist es auf Gr<strong>und</strong> des erheblichen internationalen Wettbewerbs in den Nahrungsmittelbranchen erforderlich, auf<br />
die Herstellung hochwertiger Nahrungsgüter <strong>und</strong> heimischer Spezialitäten hinzuwirken <strong>und</strong> Vermarktungsstrategien<br />
sowie Marktnischen aufzuzeigen (siehe auch 5.4.3 LROP).<br />
zu 6.4(5):<br />
Für bestimmte gewerbliche Nutzungen kommen z.B. aus Gründen des Umweltschutzes, des Katastrophenschutzes<br />
oder wegen spezifischer Anforderungen an die Verkehrsanbindung Standorte innerhalb zusammenhängender<br />
Siedlungsflächen nicht in Betracht. In diesen Fällen können Flächen für gewerbliche Nutzungen<br />
oder Sondernutzungen auch an geeigneten siedlungsfernen Standorten vorgesehen werden.<br />
zu 6.4(6):<br />
Bei der Umsetzung neuer technologischer Erkenntnisse <strong>und</strong> bei der Erschließung zusätzlicher Nachfragefelder<br />
<strong>und</strong> Anwendungsbereiche bedürfen kleinere <strong>und</strong> mittlere Betriebe in besonderem Maß der Unterstützung<br />
durch die öffentliche Hand. Neben deren fachlichen Aufgaben, der Beratung <strong>und</strong> Informationsvermittlung,<br />
kommt dabei auch die Berücksichtigung des spezifischen Flächen- <strong>und</strong> Standortbedarfs innovativer oder<br />
zukunftsorientierter Vorhaben mittelständischer Betriebe in Betracht.<br />
zu 6.4(7):<br />
Die Region verfügt über quantitativ <strong>und</strong> qualitativ geeignete Potentiale in Form von Kiesen, (Spezial-)<br />
Sanden, hochwertigen Tonen, Acker- <strong>und</strong> Waldflächen für die Erzeugung <strong>und</strong> Verarbeitung von nachwachsenden<br />
Rohstoffen. Diese Ressourcen sind zum <strong>Teil</strong> erst zu einem geringen Grad erschlossen <strong>und</strong><br />
werden bisher überwiegend nur auf lokalen Märkten abgesetzt. Durch die Veredelung dieser Ressourcen in<br />
der Region zu hochwertigen Halbfertig- <strong>und</strong> Fertigprodukten kann die Transportkostenabhängigkeit reduziert<br />
werden <strong>und</strong> somit die aus der peripheren Lage der Region zu überregionalen Absatzmärkten resultierenden<br />
Nachteile abgeschwächt werden.<br />
Im Bereich der Steine <strong>und</strong> Erden verarbeitenden Industrie verfügt die Region mit Stand des Jahres 1996 bereits<br />
über 18 Transportbetonwerke, 5 Werke zur Herstellung von Betonerzeugnissen, 8 Asphaltmischwerke, 2<br />
Keramikwerke <strong>und</strong> 4 Kalksandsteinwerke (siehe Tabelle 20).<br />
Tabelle 20:<br />
Standorte der Steine <strong>und</strong> Erden verarbeitenden Industrie nach Branchen<br />
Branche Ort<br />
Transportbetonwerke Röbel/Müritz, Neustrelitz, Rödlin, Waren (Müritz),<br />
Jabel, Möllenhagen, Reuterstadt Stavenhagen,<br />
Malchin, Demmin, Zarrenthin, Jarmen,<br />
Altentreptow, Neubrandenburg (5 Werke),<br />
Bargensdorf<br />
Herstellung von Betonerzeugnissen Möllenhagen, Hohen Wangelin, Kargow, Demmin,<br />
Jarmen<br />
Asphaltmischwerke Demmin, Weitin, Neddemin, Malchow, Sponholz,<br />
Basedow, Neustrelitz, Dargun<br />
keramische Industrie Woldegk, Altentreptow, Friedland in Planung<br />
97
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Kalksandsteinwerke Demmin - Siebeneichen, Neubrandenburg,<br />
Möllenhagen, Hohen Wangelin<br />
Trockenmörtelwerk Möllenhagen, Hohen Wangelin<br />
Stand: 31.12.1996<br />
Quelle: Gutachterlicher Abbaurahmenplan DURTEC GmbH 1994 <strong>und</strong> eigene Erhebung<br />
6.5 Handel, Handwerk <strong>und</strong> private Dienstleistungen<br />
6.5.1 Einzelhandel<br />
(1) Auf ausreichende Einzelhandelseinrichtungen zur Deckung des kurzfristigen täglichen<br />
Bedarfs, insbesondere an Nahrungs- <strong>und</strong> Genußmitteln (örtlicher Bedarf), soll in allen Gemeinden<br />
hingewirkt werden. Eine darüber hinausgehende Errichtung oder Erweiterung von<br />
Einzelhandelsbetrieben ist nur zulässig, wenn dadurch die Funktionsfähigkeit der zentralen<br />
Orte im Einzugsbereich dieser Betriebe nicht beeinträchtigt wird.<br />
Die Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelseinrichtungen in den zentralen Orten<br />
soll zur Stärkung dieser Orte beitragen <strong>und</strong> die Deckung des überörtlichen Bedarfs<br />
innerhalb des jeweiligen Verflechtungsbereichs ermöglichen. Dabei darf die<br />
Funktionsfähigkeit anderer zentraler Orte nicht beeinträchtigt werden.<br />
Die zentralen Orte sollen die Versorgung der Bevölkerung ihres jeweiligen Nahbereichs mit<br />
Waren zumindest des Gr<strong>und</strong>bedarfs wahrnehmen. Das Oberzentrum Neubrandenburg, die<br />
Mittelzentren Demmin, Neustrelitz <strong>und</strong> Waren (Müritz) sowie das Mittelzentrum mit <strong>Teil</strong>funktionen<br />
Malchin sollen darüber hinaus die Versorgung der Bevölkerung ihres jeweiligen<br />
Ober- bzw. Mittelbereichs mit Waren des gehobenen <strong>und</strong> spezialisierten Bedarfs ermöglichen.<br />
(2) Der innerstädtische Einzelhandel ist durch geeignete Maßnahmen des Städtebaus <strong>und</strong><br />
der Stadtentwicklung zu stärken. Die Innenstädte sind - unter Wahrung ihrer übrigen<br />
Aufgaben - als Hauptgeschäftszentren mit einem konzentrierten <strong>und</strong> konkurrierenden<br />
Warenangebot zu entwickeln.<br />
Begründung<br />
zu 6.5.1(1):<br />
Die Schaffung <strong>und</strong> Sicherung einer bedarfsorientierten Versorgungsstruktur auf der Basis des zentralörtlichen<br />
Systems (siehe Programmsatz 2.1(2)) gewährleistet Warenangebote in zumutbarer Entfernung. Soweit<br />
Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung über tragfähige Einzugsbereiche für Einzelhandelsgeschäfte<br />
verfügen, sollen diese zumindest eine verbrauchernahe Versorgung der ansässigen Bevölkerung mit Waren<br />
des kurzfristigen, täglichen Bedarfs, insbesondere mit Nahrungs- <strong>und</strong> Genußmitteln, ermöglichen. Zur<br />
Deckung des ortsnahen täglichen Bedarfs in den abgelegenen <strong>und</strong> dünnbesiedelten ländlichen <strong>Teil</strong>räumen der<br />
Region können auch mobile Dienste <strong>und</strong>/oder Alternativen zum herkömmlichen Laden (z.B. "Nach-<br />
98
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
barschaftsläden") beitragen. Allerdings sind für den Ausbau von Einzelhandelseinrichtungen in einer Gemeinde<br />
dort Grenzen zu ziehen, wo die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte <strong>und</strong>/oder die verbrauchernahe<br />
Versorgung der Bevölkerung mit Waren des kurzfristigen täglichen Bedarfs im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsbetriebe<br />
beeinträchtigt würden.<br />
zu 6.5.1(2):<br />
Die Existenz eines möglichst vielfältigen Spektrums von innerstädtischen (Fach-)Einzelhandelsgeschäften ist<br />
entscheidend für die Schaffung von attraktiven <strong>und</strong> belebten Innenstädten <strong>und</strong> dient der Bewahrung ihrer<br />
originären Funktion als Handelszentrum <strong>und</strong> Marktplatz. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit<br />
innenstadtrelevanten Warensortimenten an der Peripherie der Städte ziehen aus den Innenstädten Kaufkraft ab<br />
<strong>und</strong> gefährden dadurch den innerstädtischen (Fach-)Einzelhandel. Insbesondere der Facheinzelhandel ist auch<br />
aus beschäftigungspolitischen Gründen zu erhalten <strong>und</strong> zu stärken, da er gegenüber den großflächigen<br />
Einzelhandelseinrichtungen mehr qualifizierte Arbeitsplätze anbietet <strong>und</strong> Lehrstellen schafft. Um den Konzentrationsprozeß<br />
im Einzelhandel nicht durch einen weiteren Flächenzuwachs der Großbetriebsformen zu<br />
stärken <strong>und</strong> um dem mittelständischen Facheinzelhandel Entwicklungschancen zu lassen, ist es erforderlich,<br />
die hierfür geeigneten rechtlichen <strong>und</strong> planerischen Instrumente zielgerichtet einzusetzen (siehe auch Programmsatz<br />
5.5.1).<br />
6.5.2 Handwerk <strong>und</strong> private Dienstleistungen<br />
(1) Die Ansiedlung <strong>und</strong> Weiterentwicklung von Handwerksbetrieben soll bedarfsorientiert<br />
unterstützt werden. Bei städtebaulichen Maßnahmen sind genügend Flächen für das Handwerk<br />
vorzusehen. Standorte für kleinere Handwerksbetriebe sind insbesondere auch in städtebaulich<br />
integrierten Ortslagen vorzusehen.<br />
(2) Auf ein räumlich ausgewogenes Angebot von Dienstleistungen, insbesondere der Banken,<br />
Versicherungen <strong>und</strong> freien Berufe, ist hinzuwirken. In den ländlichen Gemeinden<br />
sollen die an zentralen Orten angebotenen Leistungen durch mobile Dienste ergänzt<br />
werden, soweit damit eine kostengünstige <strong>und</strong> ortsnahe Deckung des Gr<strong>und</strong>bedarfs möglich<br />
ist.<br />
Begründung<br />
99
Wirtschaft RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 6.5.2(1):<br />
Das Ziel entspricht 5.5.2(1) LROP. Ein regionales Beispiel für die Berücksichtigung von Aspekten des<br />
Handwerks bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen stellt z.B. der Handwerkerhof im Sanierungsgebiet der<br />
Neubrandenburger Innenstadt (Neutorstraße) dar.<br />
zu 6.5.2(2):<br />
Das Ziel entspricht 5.5.2(2) LROP. Der Begriff "private Dienstleistungen" ist hier als Abgrenzung gegenüber<br />
den Dienstleistungen der öffentlichen Hand definiert <strong>und</strong> umfaßt die gewerblichen Dienstleistungen, das<br />
Dienstleistungshandwerk <strong>und</strong> die Dienstleistungen der freien Berufe. Ein räumlich ausgewogenes Angebot<br />
dieser Dienstleistungen hat neben der Befriedigung des privaten Bedarfs auch als <strong>Teil</strong> der wirtschaftsnahen<br />
Infrastruktur Bedeutung für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.<br />
100
RROP Mecklenburgische Seenplatte Wirtschaft<br />
101
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
7. Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
7.1 Allgemeines<br />
(1) Das Fremdenverkehrsgewerbe soll als Wirtschaftszweig zur Schaffung <strong>und</strong> Sicherung<br />
von Arbeitsplätzen <strong>und</strong> Erwerbsmöglichkeiten entwickelt werden.<br />
(2) Die naturräumlichen Gegebenheiten <strong>und</strong> die kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten in<br />
ihrer regionstypischen Ausprägung sollen entsprechend ihrer Eignung insbesondere für<br />
landschaftsgeb<strong>und</strong>ene <strong>und</strong> umweltverträgliche Tourismusangebote genutzt <strong>und</strong> dauerhaft<br />
für die touristische Entwicklung erhalten werden.<br />
(3) In den Räumen mit besonderer natürlicher Eignung für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung soll<br />
die Tourismusfunktion durch Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen möglichst nicht beeinträchtigt<br />
werden. Dazu zählen auch Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen der Tourismusentwicklung selbst,<br />
sofern sie die natürliche Eignung der Räume <strong>und</strong> die nachhaltige Sicherung der Tourismusfunktion<br />
gefährden.<br />
(4) Insbesondere im Bereich der Städte <strong>und</strong> Dörfer sollen in Ergänzung zu den landschaftsgeb<strong>und</strong>enen<br />
Erholungsformen attraktive anlagengeb<strong>und</strong>ene touristische Angebote geschaffen<br />
werden. Diese Angebote sollen vor allem in den Räumen mit besonderer natürlicher<br />
Eignung für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung möglichst zur Verlängerung der Tourismussaison<br />
beitragen.<br />
Begründung<br />
zu 7.1(1):<br />
In der Planungsregion herrscht unter anderem auf Gr<strong>und</strong> des wirtschaftlichen Strukturwandels eine hohe<br />
Arbeitslosigkeit (siehe Abschnitt "Arbeitsmarkt"). Durch die Entwicklung des Fremdenverkehrs können neue<br />
Arbeitsplätze <strong>und</strong> zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten auch in den ländlichen Räumen geschaffen werden.<br />
zu 7.1(2):<br />
Die großräumigen, naturnahen, seen- <strong>und</strong> waldreichen Becken-, Endmoränen- <strong>und</strong> Sanderlandschaften <strong>und</strong><br />
die kulturhistorischen Werte der Planungsregion stellen eine wertvolle Basis für eine langfristig stabile<br />
Fremdenverkehrswirtschaft dar. Allerdings muß der Tourismus auf Gr<strong>und</strong> der hohen naturräumlichen Sensibilität<br />
der größtenteils naturnahen Landschaftsräume in einer "sanften", umweltverträglichen Form entwickelt<br />
werden, um die touristische Attraktivität der Region dauerhaft erhalten zu können.<br />
Landschaftsgeb<strong>und</strong>ene Tourismusangebote sind solche touristischen Ausbaumaßnahmen <strong>und</strong> Vorhaben, die<br />
auf die landschaftliche Attraktivität sowie auf die natürlichen Gegebenheiten der Region angewiesen sind <strong>und</strong><br />
nicht auf Gr<strong>und</strong> einer hohen Eigenattraktivität weitgehend regionsungeb<strong>und</strong>en sind.<br />
102
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Umweltverträgliche Tourismusangebote sind solche touristischen Ausbaumaßnahmen <strong>und</strong> Vorhaben, die<br />
mindestens nach folgenden Prinzipien geplant <strong>und</strong> umgesetzt werden:<br />
- Die natürlichen Gegebenheiten setzen den Rahmen für die touristische Ausbauplanung.<br />
- Bei den Ausbaumaßnahmen werden die einzelnen touristischen Angebotssektoren nicht isoliert voneinander<br />
entwickelt sondern unter ständiger Überprüfung ihres Zusammenwirkens, um eine möglichst ausbalancierte<br />
touristische Entwicklung zu gewährleisten.<br />
- Vor dem Bau neuer Einrichtungen sollten die Ausbau-, Modernisierungs- <strong>und</strong> Verbesserungsmöglich-keiten<br />
bestehender Einrichtungen sowie touristische Nachfolgenutzungsmöglichkeiten brach liegender<br />
Siedlungsflächen geprüft werden (siehe auch Programmsatz 5.2.1(1)).<br />
Durch die den einzelnen Landschaften (siehe Programmsatz 7.2) angepaßte differenzierte touristische Ausgestaltung<br />
kann deren Unverwechselbarkeit gegenüber anderen Erholungsregionen dauerhaft erhalten <strong>und</strong><br />
insbesondere für naturerlebnis- <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsorientierte Zielgruppen ein attraktives Angebot in Form von<br />
wasserbezogenen Aktivitäten (insbesondere Wasserwandern), (Rad-)Wandern, "Urlaub auf dem Lande",<br />
Kuren usw. (siehe Programmsätze 7.2.1(2), 7.4, 7.5) geschaffen werden.<br />
zu 7.1(3):<br />
Die attraktive Natur <strong>und</strong> Landschaft stellt die Basis für die Entwicklung des Fremdenverkehrsgewerbes dar.<br />
Deshalb ist insbesondere in den Räumen mit besonderer natürlicher Eignung für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
(siehe Programmsatz 7.2) bei allen Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen auf deren Verträglichkeit mit den<br />
landschaftsgeb<strong>und</strong>enen Erholungsfunktionen zu achten. Auch der Tourismus selbst kann negative Auswirkungen<br />
auf Natur <strong>und</strong> Landschaft haben, wenn die touristische Infrastruktur <strong>und</strong> Erschließung quantitativ <strong>und</strong><br />
qualitativ den naturräumlichen Bedingungen sowie dem Orts- <strong>und</strong> Landschaftsbild nicht angepaßt sind.<br />
zu 7.1(4):<br />
Als „anlagengeb<strong>und</strong>en“ wird diejenige tourismusrelevante Infrastruktur bezeichnet, die sowohl gewerbliche<br />
Investitionen als auch öffentliche Infrastruktur des Fremdenverkehrs beinhaltet. Zu den gewerblichen Einrichtungen<br />
gehören beispielsweise Hotelkomplexe, Ferienhausanlagen <strong>und</strong> Ferienwohnungen. Öffentliche<br />
Infrastruktureinrichtungen umfassen u.a. Radwanderwege, Wasserwanderrastplätze <strong>und</strong> freizeitsportliche<br />
Nebenanlagen. Natürliche Gegebenheiten wie Wanderwege oder Badestellen an natürlichen Gewässern zählen<br />
jedoch genauso wenig dazu wie personelle Infrastruktur.<br />
Durch die Anbindung anlagengeb<strong>und</strong>ener Tourismusinfrastruktur an geeignete bestehende Siedlungen wird<br />
die freie Landschaft geschont, das bestehende Infrastruktursystem ausgenutzt <strong>und</strong> ein wesentlicher Beitrag zur<br />
Stadt- <strong>und</strong> Dorferneuerung geleistet. Dadurch kann zugleich für die Bevölkerung vor Ort - unter Vermeidung<br />
von unnötigem Verkehr - ein attraktives Freizeitangebot geschaffen werden <strong>und</strong> somit die Auslastung der<br />
Anlagen <strong>und</strong> Einrichtungen erhöht werden. Besonders Freizeiteinrichtungen mit saisonverlängernder Wirkung<br />
sind angesichts der kurzen Sommer-Sonnen-Periode fremdenverkehrswirtschaftlich bedeutend. Für die<br />
Feststellung der gr<strong>und</strong>sätzlichen Eignung der jeweiligen Siedlung als Standort für den Ausbau anlagengeb<strong>und</strong>ener<br />
Tourismusinfrastruktur sind insbesondere folgende Kriterien zu prüfen: räumliche Lage,<br />
verkehrliche Anbindung, Verträglichkeit mit der Siedlungsentwicklung.<br />
7.2 Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Die folgenden <strong>Teil</strong>räume der Planungsregion weisen eine besondere natürliche Eignung für<br />
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung auf <strong>und</strong> werden deshalb in der Karte (M 1 : 100 000) als<br />
Tourismusschwerpunkträume bzw. Tourismusentwicklungsräume ausgewiesen:<br />
- Die Mecklenburgische Seenplatte<br />
mit den Großseen Müritz, Kölpinsee, Fleesensee <strong>und</strong> Plauer See<br />
(grenzüberschreitend zur Planungsregion Westmecklenburg),<br />
103
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
mit der Kleinseenplatte <strong>und</strong> mit der Feldberger Seenlandschaft<br />
(beide grenzüberschreitend zum Land Brandenburg)<br />
- Die Mecklenburgische Schweiz<br />
mit dem Kummerower <strong>und</strong> Malchiner See<br />
(grenzüberschreitend zur Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock)<br />
- Das Tollensegebiet<br />
(Umland der Stadt Neubrandenburg mit dem Tollensesee, Landschaft nördlich von<br />
Altentreptow)<br />
- Die Brohmer Berge<br />
(grenzüberschreitend zur Ueckermünder Heide bzw. Boddenküste; Planungsregion Vorpommern)<br />
Begründung<br />
Die Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung entsprechen 6.1(7) LROP mit Ausnahme der Flußtalmoore der<br />
Tollense <strong>und</strong> der Trebel. Sie wurden regionsspezifisch untersetzt. Die Flußtalmoore der Tollense <strong>und</strong> der<br />
Trebel haben vorrangig ökologische Bedeutung <strong>und</strong> sind auch entsprechend 6.2(5) LROP "in nur sehr begrenztem<br />
Maße <strong>und</strong> unter Beachtung der Belange von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege für Erholung"<br />
nutzbar.<br />
Die Abgrenzung der Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung erfolgte großräumig nach linearen Landschaftselementen<br />
entlang von naturräumlichen Grenzen, Verkehrstrassen <strong>und</strong> administrativen Grenzen. Dabei<br />
wurden folgende Eignungskriterien zugr<strong>und</strong>egelegt:<br />
- naturräumliche Ausstattung bzw. Eignung<br />
(Flächenbedeckung mit Gewässern <strong>und</strong> Wald, Reliefenergie, landschaftliche Vielfalt <strong>und</strong> Attraktivität,<br />
Naturnähe einschließlich Ruhe <strong>und</strong> Luftreinheit, bioklimatische Eignung, Aufwertungsmöglichkeiten<br />
landwirtschaftlich geprägter Gebiete),<br />
- Ansätze vorhandenen Fremdenverkehrs,<br />
- kulturhistorische Ausstattung <strong>und</strong> Sehenswürdigkeiten (Bau-, Boden- <strong>und</strong> Naturdenkmale, Schlösser,<br />
Burgen, Parks, Kirchen, Museen, Stadtanlagen u.a.),<br />
- siedlungs- <strong>und</strong> infrastrukturelle Gr<strong>und</strong>ausstattung<br />
(vorhandene Siedlungskerne, Verkehrserschließung, Energie- <strong>und</strong> wasserwirtschaftliche Versorgung).<br />
In der Karte (M 1 : 100 000) sind die Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung differenziert nach Tourismusschwerpunkträumen<br />
(siehe Programmsatz 7.2.1) <strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräumen (siehe Programmsatz<br />
7.2.2) dargestellt (siehe auch Erläuterungskarte 10).<br />
7.2.1 Tourismusschwerpunkträume<br />
(1) Von den <strong>Teil</strong>räumen der Planungsregion mit besonderer natürlicher Eignung für Tourismus<br />
<strong>und</strong> Naherholung stellen die in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen Räume<br />
- im Großseengebiet,<br />
- im Kleinseengebiet,<br />
104
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
- in der Feldberger Seenlandschaft,<br />
- in der Mecklenburgischen Schweiz <strong>und</strong><br />
- im Gebiet des Tollensesees<br />
Tourismusschwerpunkträume dar. In diesen Räumen kommt der Tourismusentwicklung besondere<br />
wirtschaftliche Bedeutung zu. Entsprechend haben in den Tourismusschwerpunkträumen<br />
Belange des Tourismus gegenüber den Belangen anderer Wirtschaftszweige besonderes<br />
Gewicht. Dabei ist der Tourismus so zu entwickeln <strong>und</strong> zu ordnen, daß landschaftlich<br />
<strong>und</strong> ökologisch sensible Gebiete geschont werden. In den Tourismusschwerpunkträumen<br />
soll eine attraktive touristische Infrastruktur vorrangig im Bereich von bestehenden<br />
Siedlungen ausgebaut werden. Der Tourismus soll dabei gleichzeitig zur Stärkung<br />
insbesondere der Städte <strong>und</strong> Dörfer beitragen. Insbesondere die Städte in den<br />
Tourismusschwerpunkträumen sollen als Fremdenverkehrszentren entwickelt werden.<br />
(2) Vorrangig in folgenden Orten der Tourismusschwerpunkträume sollen Formen des<br />
Ges<strong>und</strong>heitstourismus wie ges<strong>und</strong>heitsorientierte Erholungsaufenthalte <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
der medizinischen Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation mit möglichst saisonverlängernder Wirkung<br />
aufeinander abgestimmt entwickelt werden:<br />
- Feldberg,<br />
- Malchow,<br />
- Mirow,<br />
- Wesenberg,<br />
- Waren (Müritz),<br />
- Klink,<br />
- Röbel/Müritz sowie<br />
- Alt Schwerin <strong>und</strong> Bad Stuer,<br />
beide in enger Abstimmung mit Malchow <strong>und</strong> Plau am See.<br />
(3) Die Thermalwasservorkommen in der Planungsregion sollen unter Berücksichtigung<br />
insbesondere ökologischer Aspekte entsprechend ihrer Eignung für die Vorsorge- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationsmedizin genutzt werden.<br />
Begründung<br />
zu 7.2.1(1):<br />
Die in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen Tourismusschwerpunkträume stellen die landschaftlich<br />
attraktivsten - <strong>und</strong> dadurch auch tourismuswirtschaftlich bedeutendsten - Bereiche in Nähe der Seen dar. Die<br />
Tourismusfunktionen umschließen in diesen Räumen größtenteils Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege <strong>und</strong> überlagern sich größtenteils mit den Vorsorgeräumen für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege.<br />
Bereits heute werden diese Räume von Urlaubern <strong>und</strong> Erholungssuchenden zum <strong>Teil</strong> stark<br />
frequentiert. Auch schon vor der Wende wurden sie als Erholungsgebiete genutzt. Entsprechend verfügen sie<br />
über touristische Einrichtungen im Beherbergungs- <strong>und</strong> Gastronomiebereich (Hotels, Ferienheime, Campingplätze,<br />
private Zimmervermietung usw.) aus der Zeit vor der Wende, die jedoch größtenteils nicht mehr<br />
den gestiegenen Qualitäts- bzw. Komfortansprüchen der Urlauber gerecht werden <strong>und</strong> zum <strong>Teil</strong> entwicklungshemmend<br />
wirken. Unter anderem aus diesen Gründen erfordert die Entwicklung des Tourismus in<br />
den Tourismusschwerpunkträumen einen erhöhten Ordnungsbedarf.<br />
105
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
In den Tourismusschwerpunkträumen ist die Anbindung von Freizeit- <strong>und</strong> Erholungseinrichtungen an bestehende<br />
Städte <strong>und</strong> Dörfer (siehe auch Programmsatz 7.1(4)) wegen der landschaftlichen Attraktivität <strong>und</strong><br />
ökologischen Sensibilität dieser Räume von besonderer Bedeutung <strong>und</strong> trägt wesentlich zur Schonung <strong>und</strong><br />
Erhaltung dieses Naturraumpotentials bei. Dadurch kann auch ein direkter Beitrag zur Stärkung der Städte<br />
<strong>und</strong> Dörfer geleistet werden. Zur Klärung, in welcher städtebaulich sinnvollen <strong>und</strong> verträglichen Art <strong>und</strong><br />
Weise die bauliche <strong>und</strong>/oder verkehrliche sowie sonstige erforderliche infrastrukturelle Anbindung von Freizeit-<br />
<strong>und</strong> Erholungseinrichtungen in bzw. an die jeweilige Stadt bzw. das jeweilige Dorf geschaffen werden<br />
kann, bieten die verschiedenen bauleitplanerischen Instrumentarien auf kommunaler Ebene geeignete Gestaltungs-<br />
<strong>und</strong> Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen. Dabei kommt den Städten in bzw. am Rande der Tourismusschwerpunkträume<br />
auf Gr<strong>und</strong> ihrer wirtschaftlichen <strong>und</strong> infrastrukturellen Standortgunst für die Entwicklung<br />
eines vielfältigen konsumtiven Freizeit- <strong>und</strong> Unterhaltungsangebots die Funktion von Fremdenverkehrszentren<br />
zu.<br />
Die Dörfer weisen durch ihre attraktive Lage in den Tourismusschwerpunkträumen günstige Bedingungen für<br />
die Entwicklung zu ländlichen Erholungsorten mit entsprechend dem dörflichen Charakter angepaßten<br />
touristischen Einrichtungen auf (Pensionen, Ferienhäuser, Landgasthöfe, Campingplätze, Badestellen,<br />
Bootsanlegestellen für das Wasserwandern sowie für kleinere Sportboote, Bootsverleih, Reitmöglichkeiten,<br />
Fahrradverleih <strong>und</strong> -service).<br />
Auch eine ökologisch angepaßte Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft sowie Fischerei ist der Tourismusentwicklung<br />
förderlich, insbesondere wenn damit Angebote zum Selber- bzw. Mitmachen ("Urlaub auf dem Lande") geschaffen<br />
werden. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Pflege <strong>und</strong> Erhaltung des Naturraumes, der die<br />
Basis der touristischen Entwicklung darstellt, geleistet.<br />
zu 7.2.1(2):<br />
Mit ihrer reichen Naturraumausstattung <strong>und</strong> ihrer sauberen Luft verfügen die Tourismusschwerpunkträume<br />
der Planungsregion (siehe Programmsatz 7.2) über günstige Ausgangsbedingungen für die Entwicklung eines<br />
Ges<strong>und</strong>heitstourismus. Im Freizeitverhalten der Leistungsgesellschaft hat die aktive Erholung (sich bewegen,<br />
sich fit machen, "Ges<strong>und</strong>heit tanken") in einer heilen Umwelt als Gegenbild zum Alltagsstreß <strong>und</strong> der<br />
täglichen Konfrontation mit Umweltbelastungen eine wesentliche Bedeutung. Um diese wachsende Zielgruppe<br />
für die Planungsregion zu gewinnen, ist die Schaffung von entsprechenden Einrichtungen <strong>und</strong> Angeboten<br />
notwendig. Dadurch kann auch ein wesentlicher Beitrag zur Saisonverlängerung bzw. zu einem ganzjährigen<br />
Tourismusbetrieb geleistet werden.<br />
Die oben genannten Orte liegen in den Tourismusschwerpunkträumen (siehe Programmsatz 7.2.1(1)). Sie<br />
weisen insbesondere durch ihre landschaftlich bevorzugte Lage <strong>und</strong> ihren jeweiligen Ortscharakter günstige<br />
Rahmenbedingungen für den Ausbau von geeigneten Erholungseinrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitstourismus auf.<br />
Die Orte Feldberg, Klink <strong>und</strong> Röbel/Müritz sind aus diesen Gründen gemäß der Bekanntmachung des<br />
Sozialministeriums vom 12. März 1998 - IX 314 b - (AmtsBl. M-V 1998 S. 413) anerkannte Erholungsorte<br />
nach §§ 1, 5 des Kurortgesetzes vom 24. Februar 1993 (GVOBl. M-V 1993 S. 109, 300).<br />
Darüber hinaus weisen Bad Stuer als ehemalige Kaltwasserheilanstalt mit den Quellen des Plauer Sees <strong>und</strong><br />
der Lage an dessen Südende sowie Alt Schwerin am Nordufer des Plauer Sees geeignete Potentiale auf, die in<br />
enger Abstimmung mit den anderen Gemeinden am Plauer See, insbesondere mit der Stadt Malchow <strong>und</strong> der<br />
als Luftkurort anerkannten Stadt Plau am See (Planungsregion Westmecklenburg), entwicklungsfähig sind.<br />
Ebenfalls weisen die Städte Malchow, Mirow <strong>und</strong> Wesenberg durch ihre landschaftliche Lage zwischen<br />
Fleesensee <strong>und</strong> Plauer See (Malchow) bzw. am Müritz-Havel-Kanal (Mirow, Wesenberg) <strong>und</strong> ihrem jeweiligen<br />
Ortscharakter, der in Malchow vor allem durch die Insellage der Altstadt <strong>und</strong> die Klosteranlage bzw. in<br />
Mirow durch die Schloßinsel geprägt ist, günstige Bedingungen auf. Auch die Stadt Waren (Müritz) verfügt<br />
durch ihre Lage am Ufer der Müritz <strong>und</strong> ihre bereits erschlossenen Thermalwasservorkommen über günstige<br />
106
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Rahmenbedingungen zur Entwicklung des Ges<strong>und</strong>heitstourismus. Als traditioneller Fremdenverkehrsort<br />
verfolgt die Stadt Waren (Müritz) derzeit das Ziel, sich zum Luftkurort zu entwickeln.<br />
zu 7.2.1(3):<br />
Die Region verfügt in Tiefen zwischen 1000 <strong>und</strong> 2500 m über Thermalwasser, das in Neubrandenburg <strong>und</strong><br />
Waren (Müritz) bereits seit dem Jahr 1984 zur Energiegewinnung genutzt wird. Entsprechend ihrer ortsspezifischen<br />
Mineralisation stellt es auch ein bedeutendes Potential für eine balneologische Nutzung dar. Für<br />
die Erschließung dieses Potentials sind insbesondere technische, biologisch-medizinische, ökologische <strong>und</strong><br />
wirtschaftliche Voruntersuchungen notwendig.<br />
7.2.2 Tourismusentwicklungsräume<br />
In den in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen Tourismusentwicklungsräumen soll der<br />
Tourismus vorrangig durch die Schaffung von touristischen Angeboten in bzw. in Anbindung<br />
an Siedlungen entwickelt werden. Geeignete Maßnahmen zur Tourismusentwicklung<br />
sollen möglichst zur Erschließung <strong>und</strong> Aufwertung der Landschaft beitragen. Zu<br />
den Tourismusentwicklungsräumen gehören auch die Ortslagen der Gemeinden im Müritz-<br />
Nationalpark.<br />
Begründung<br />
Die Tourismusentwicklungsräume ziehen im Gegensatz zu den Tourismusschwerpunkträumen derzeit noch<br />
weniger Urlauber an. Im Bereich der Naturparke <strong>und</strong> historischen Kulturlandschaften um den Malchiner See<br />
<strong>und</strong> um Hohenzieritz stellen die Tourismusentwicklungsräume Eignungsräume für landschaftsgeb<strong>und</strong>ene<br />
Erholung dar (siehe Programmsätze 7.2.3(2) <strong>und</strong> 7.2.3(3)). Außerhalb des Müritz-Nationalparks, der<br />
Naturparke <strong>und</strong> historischen Kulturlandschaften weisen die Tourismusentwicklungsräume durch ihre Nähe zu<br />
landschaftlich besonders attraktiven Gebieten <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> der dort in der Regel konfliktärmeren<br />
Naturraumausstattung günstige Voraussetzungen für flächenintensivere touristische Ausbau- <strong>und</strong> Erschließungsmaßnahmen<br />
(z.B. Golfplatzanlagen) auf.<br />
Die Ortslagen der Gemeinden im Müritz-Nationalpark konnten aus Gründen des Maßstabes in der Karte (M 1<br />
: 100 000) nicht als Tourismusentwicklungsräume dargestellt werden. Sie gehören jedoch ebenfalls zu dieser<br />
Raumkategorie. Gemäß der Verordnung über die Festsetzung des Müritz-Nationalparkes vom 12. September<br />
1990 (Gbl. DDR Sonderdruck Nr. 1468), geändert durch Verordnung vom 20. November 1992 (GVOBl. M-V<br />
1993 S. 9), sind die Ortslagen ausgegrenzt <strong>und</strong> unterliegen somit nicht den darin enthaltenen Ge- <strong>und</strong><br />
Verboten.<br />
Auch in den Tourismusentwicklungsräumen ist Programmsatz 7.1(4) zu berücksichtigen. Durch die Lenkung<br />
von touristischen Ausbauvorhaben auf die bestehenden Siedlungsbereiche wird ein wesentlicher Beitrag zur<br />
Dorferneuerung geleistet <strong>und</strong> nicht zusätzlich freie Landschaft zersiedelt.<br />
Durch die Erschließung der Landschaft mit (Rad-)Wanderwegen <strong>und</strong> Reitwegen sowie durch geeignete<br />
landschaftspflegerische Maßnahmen kann die Attraktivität der Tourismusentwicklungsräume für landschaftsgeb<strong>und</strong>ene<br />
Erholungsformen wesentlich gestärkt werden.<br />
107
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
7.2.3 Tourismus im Bereich von Großschutzgebieten <strong>und</strong> historischen Kulturlandschaften<br />
(1) Der Müritz-Nationalpark soll in seinen ökologisch weniger sensiblen Bereichen durch<br />
geeignete Einrichtungen <strong>und</strong> Formen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Besucherlenkung für<br />
die ruhige, landschaftsgeb<strong>und</strong>ene Erholung <strong>und</strong> naturk<strong>und</strong>liche Bildung der Besucher erschlossen<br />
werden, soweit dies sein Schutzzweck zuläßt. Anlagengeb<strong>und</strong>ene Erholungseinrichtungen<br />
sind nur in den bestehenden, außerhalb der Nationalparkgrenze liegenden,<br />
Siedlungsbereichen oder in Anbindung daran zulässig.<br />
(2) Die Naturparke sollen außerhalb der Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
für die landschaftsgeb<strong>und</strong>ene Erholung <strong>und</strong> naturk<strong>und</strong>liche Bildung der Besucher<br />
erschlossen werden, soweit dies der jeweilige Schutzzweck zuläßt. Anlagengeb<strong>und</strong>ene Erholungseinrichtungen<br />
sollen vorrangig innerhalb der bestehenden Siedlungsbereiche oder in<br />
Anbindung daran geschaffen werden.<br />
(3) Im Bereich der kulturhistorisch bedeutsamen Beckenlandschaften um den Malchiner<br />
See <strong>und</strong> um Hohenzieritz sollen die Tourismusentwicklungsräume als großräumig gestaltete<br />
Parklandschaften unter besonderer Beachtung <strong>und</strong> Sicherung der gegebenen Landschaftsstruktur<br />
für ruhige, landschaftsbezogene Erholungsformen entwickelt werden.<br />
Begründung<br />
zu 7.2.3(1) <strong>und</strong> (2):<br />
Der Müritz-Nationalpark <strong>und</strong> die Naturparke Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong> Kummerower See, Nossentiner-<br />
Schwinzer Heide <strong>und</strong> Feldberger Seenlandschaft wurden als großräumige Schutzgebiete im Sinne von §§ 14<br />
<strong>und</strong> 16 B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. S.889),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. August 1997 (BGBl. I 2081), durch entsprechende<br />
Schutzverordnungen festgesetzt <strong>und</strong> unterliegen gesonderten Schutz-, Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen.<br />
Der Nationalpark <strong>und</strong> die Naturparke sind repräsentative Landschaftsausschnitte innerhalb der Seenplatte. Sie<br />
wirken mit ihren großräumigen Schutzzonen als Regenerationsräume der schutzwürdigen Pflanzen- <strong>und</strong><br />
Tierwelt innerhalb der Planungsregion. Sie sind damit ein wichtiges "Gütezeichen" hoher Umweltqualität.<br />
Deshalb ist in den Naturparken <strong>und</strong> dem Nationalpark eine umweltverträgliche Lenkung des Tourismus in<br />
landschaftsgeb<strong>und</strong>enen Formen im Sinne des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes notwendig. Hierfür sollten unter<br />
anderem Zonierungskonzepte (Kernzonen, Pflegezonen, Randzonen) entwickelt werden <strong>und</strong> markierte<br />
Wegesysteme zur Lenkung der Besucherströme geschaffen werden. Durch eine aktive, angebotsorientierte<br />
Lenkung der Besucher können Gebiete mit strengem Schutzstatus (Naturschutzgebiete <strong>und</strong> sonstige ökologisch<br />
sehr sensible Kernbereiche) wirksam geschützt werden. Insbesondere in den Großschutzgebieten muß<br />
die ökologische Belastbarkeit den Rahmen für die touristische Ausbauplanung setzen, um die Naturschutzziele<br />
nicht zu gefährden. Deshalb sind neben Zonierungs- <strong>und</strong> Erschließungskonzepten auch fachlich f<strong>und</strong>ierte<br />
Aussagen zur naturverträglichen Quantität <strong>und</strong> Qualität der touristischen Einrichtungen <strong>und</strong> Angebote<br />
notwendig.<br />
108
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Von einer touristischen Nutzung ausgenommen sind die Naturschutzgebiete, um deren Vorrangfunktion für<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege entsprechend Programmsatz 4.4(1) nicht zu gefährden. Nach B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz<br />
zeichnet sich die Schutzkategorie „Naturpark“ auch durch ihre Eignung als Erholungsgebiet<br />
aus.<br />
Der Naturpark Feldberger Seenlandschaft grenzt an den im Land Brandenburg in Aufstellung befindlichen<br />
Naturpark Uckermärkische Seenlandschaft an. Eine enge Kooperation zwischen den beiden Naturparken ist<br />
vorgesehen. Die beiden Naturparke Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong> Kummerower See sowie Nossentiner-<br />
Schwinzer Heide bestehen grenzüberschreitend zu den Planungsregionen Mittleres Mecklenburg/Rostock <strong>und</strong><br />
Westmecklenburg.<br />
Der Müritz-Nationalpark ist in der Karte (M 1 : 100 000) in seiner gesamten Abgrenzung als Vorranggebiet<br />
für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege dargestellt (siehe Programmsatz 4.4.(1)), um den nach § 14 B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz<br />
rechtsverbindlichen, originären Naturschutzcharakter nicht durch konkurrierende Raumfunktionen<br />
zu gefährden. Die bestehenden Ortslagen in diesem Gebiet sind gemäß der Verordnung über die<br />
Festsetzung des Müritz-Nationalparkes vom 12. September 1990 (Gbl. DDR Sonderdruck Nr. 1468), geändert<br />
durch Verordnung vom 20. November 1992 (GVOBl. M-V 1993 S. 9), ausgegrenzt <strong>und</strong> unterliegen damit<br />
nicht den darin enthaltenen Ge- <strong>und</strong> Verboten. Sie gehören zu den Tourismusentwicklungsräumen (siehe<br />
Programmsatz 7.2.2). Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 12. März 1987 (BGBl. S.889), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.<br />
August 1997 (BGBl. I 2081) sollen Nationalparke der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es<br />
der Schutzzweck erlaubt. Dieser Regelung des B<strong>und</strong>es ist mit § 5 Abs. 1 Nr. 3 <strong>und</strong> 4 der Verordnung über die<br />
Festsetzung des Müritz-Nationalparkes vom 12. September 1990 (Gbl. DDR Sonderdruck Nr. 1468), geändert<br />
durch Verordnung vom 20. November 1992 (GVOBl. M-V 1993 S. 9), Rechnung getragen. Danach ist es im<br />
Nationalpark geboten, "durch geeignete Maßnahmen der Verkehrs- <strong>und</strong> Besucherlenkung den Ruhecharakter<br />
des Gebietes insgesamt stärker auszuprägen" <strong>und</strong> "der Öffentlichkeit den Nationalpark für Bildung <strong>und</strong><br />
Erholung durch geeignete Einrichtungen <strong>und</strong> Formen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Besucherlenkung zu<br />
erschließen, soweit es der Schutzzweck erlaubt". Entsprechend § 5 Abs. 2 der Verordnung wird zur<br />
Umsetzung dieser Gebote unter anderem zur Zeit (im Jahr 1998) vom Nationalparkamt ein Pflege- <strong>und</strong><br />
Entwicklungsplan erstellt <strong>und</strong> das seit Inkrafttreten der Verordnung am 1. Oktober 1990 gültige Zonierungskonzept<br />
überarbeitet.<br />
zu 7.2.3(3):<br />
Die Beckenlandschaften um den Malchiner See <strong>und</strong> um Hohenzieritz stellen kulturhistorisch einmalige <strong>und</strong><br />
landschaftsästhetisch wertvolle, größtenteils unter Landschaftsschutz stehende Räume dar, die als großräumige<br />
Parklandschaften in früheren Jahrh<strong>und</strong>erten geschaffen wurden. Mit ihren Schlössern, Herrenhäusern,<br />
Burgen, Klosteranlagen <strong>und</strong> Parkanlagen verfügen sie über ein wertvolles Potential für ruhige <strong>und</strong><br />
landschaftsbezogene Tourismusformen.<br />
Die Beckenlandschaft um den Malchiner See ist grenzüberschreitend zur Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock.<br />
Die Naturparke <strong>und</strong> historisch wertvollen Kulturlandschaften sind in der Erläuterungskarte 10 dargestellt.<br />
7.3 Städte- <strong>und</strong> Kulturtourismus<br />
(1) Vorrangig in den Städten Neubrandenburg <strong>und</strong> Neustrelitz sollen Funktionen des<br />
Kulturtourismus erhalten <strong>und</strong> weiter ausgebaut werden.<br />
109
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(2) In den übrigen Städten <strong>und</strong> Dörfern der Planungsregion mit kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten<br />
sowie kulturellen Einrichtungen <strong>und</strong> Initiativen sollen diese Potentiale für geeignete<br />
Formen des Kulturtourismus erschlossen <strong>und</strong> angeboten werden.<br />
Begründung<br />
zu 7.3(1):<br />
Durch die Entwicklung des Kulturtourismus in der Planungsregion können zusätzlich zu den Zielgruppen für<br />
natur- <strong>und</strong> landschaftsgeb<strong>und</strong>ene Tourismusformen auch kulturell interessierte Zielgruppen bzw. Zielgruppen<br />
aus dem Bereich des Tagungs- <strong>und</strong> Bildungstourismus für die Region gewonnen werden. Ein attraktiv<br />
gestalteter Kulturtourismus bietet darüber hinaus dem "Naturtouristen" Alternativen <strong>und</strong> kann zu dessen<br />
längerer Verweildauer insbesondere an Schlechtwettertagen beitragen. Ferner wirkt diese Tourismusform<br />
saisonverlängernd. Die Städte Neubrandenburg <strong>und</strong> Neustrelitz verfügen auf Gr<strong>und</strong> ihrer Einwohnergröße,<br />
ihrer wirtschaftlichen Situation <strong>und</strong> ihrer verkehrlichen Anbindung über die günstigsten Rahmenbedingungen<br />
zur Entwicklung des Kulturtourismus in der Planungsregion. Sie können dabei auf folgenden bereits<br />
vorhandenen Potentialen aufbauen:<br />
Neubrandenburg verfügt an historischen Sehenswürdigkeiten über eine der wenigen noch vollständig erhaltenen<br />
mittelalterlichen Stadtbefestigungen <strong>und</strong> weitere Bauten der Backsteingotik (Marienkirche, Kloster).<br />
Das rekonstruierte <strong>und</strong> wieder bespielte älteste Schauspielhaus des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die<br />
Philharmonie, die Kunstsammlung, die Museen zur Geschichte der Stadt <strong>und</strong> der Region (Stadtmuseum,<br />
Regionalmuseum), Kinos, Konzerte <strong>und</strong> Aufführungen sind wichtige <strong>und</strong> bereits vorhandene Angebote, die<br />
für die kulturtouristische Entwicklung der Region genutzt werden können. Darüber hinaus vermittelt das<br />
Zentrum Bildende Kunst künstlerische Angebote in der Region. In der nahen Umgebung liegt Burg Stargard<br />
(mittelalterlich bedeutende, älteste Höhenburg in Mecklenburg-Vorpommern).<br />
Neustrelitz verfügt an Sehenswürdigkeiten über Reste der ehemaligen Residenz des Großherzogtums<br />
Mecklenburg-Strelitz (Schloßkirche, Orangerie, Theaterbauten) <strong>und</strong> die einzigartig noch vollständig erhaltene<br />
barocke Stadtanlage mit ihren historischen Bauten <strong>und</strong> der Parkanlage. An kulturellen Einrichtungen sind<br />
bereits das Theater, die Tanzkompanie, das Kino <strong>und</strong> die zur Kulturstätte umgenutzte Alte Kachelofenfabrik<br />
mit Kino <strong>und</strong> Galerie vorhanden.<br />
zu 7.3(2):<br />
Neben Neubrandenburg <strong>und</strong> Neustrelitz sind in vielen anderen Städten <strong>und</strong> Dörfern der Planungsregion<br />
kulturelle <strong>und</strong>/oder kulturhistorische Potentiale vorhanden, die kulturtouristisch erschlossen <strong>und</strong> regional<br />
sowie überregional angeboten werden können, wie z.B.:<br />
im Landkreis Demmin:<br />
Altentreptow Petrikirche (dreischiffige Hallenkirche), St.-Jürgen-Kapelle, Demminer Tor,<br />
Neubrandenburger Tor, "Großer Stein" am Klosterberg<br />
Basedow Schloß mit Terrakotten, Dorfkirche mit Chor <strong>und</strong> Turm aus dem 13.Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
<strong>und</strong> Orgel aus vorbachscher Zeit<br />
Breest Burganlage an der Tollense im Ortsteil Klempenow<br />
Daberkow Gutshaus mit Parkanlage im Ortsteil Wietzow<br />
Dargun Ruinen des Zisterzienserklosters, Schloßruine, Reste einer großslawischen Burg,<br />
Stadtkirche mit spätgotischem Schnitzaltar (15.Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Demmin Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung mit Pulverturm <strong>und</strong> Luisentor,<br />
Fachwerkhäuser am Kirchhof, Pfarrkirche St. Bartholomäus (gotischer<br />
Ziegelbau aus dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert), Kreisheimatmuseum<br />
Görmin/Sassen/Trantow Großsteingräber an der Schwinge (Dolmenlandschaft)<br />
Gültz Gutshaus mit Parkanlage<br />
110
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Ivenack "Park der 1000jährigen Eichen", Schloß mit Parkanlage, Marstall, Orangerie <strong>und</strong><br />
Gartenhaus, Klosterkirche<br />
Kittendorf Schloß im Tudorstil mit englischer Parkanlage<br />
Kummerow Dorfkirche, barockes Schloß<br />
Loitz Stadttor, dreischiffige Hallenkirche St. Marien, Heimatstube<br />
Malchin spätgotische Backsteinbasilika (1397), Fangelturm, Steintor, Reste der<br />
Stadtmauer<br />
Neukalen Stadtstruktur (ringförmig um den Marktplatz angelegte Gassen), malerisches<br />
Gassenpanorama, spätgotische Pfarrkirche<br />
Remplin Reste der barocken Schloßanlage, Torturm, wertvolle Parkanlage von<br />
Lenné, Gutskirche mit quadratischem Gr<strong>und</strong>riß<br />
Reuterstadt Stavenhagen Barockschloß, Pfarrkirche, Fritz-Reuter-Literaturmuseum im alten Rathaus<br />
Tützpatz barockes Schloß, spätgotische Dorfkirche<br />
Zettemin Gutsanlage im Halbr<strong>und</strong> angeordnet, gotische Dorfkirche<br />
im Landkreis Mecklenburg-Strelitz:<br />
Blankensee Ortsteil Wanzka: Reste des Zisterzienserinnenklosters, einschiffige<br />
Backsteinkirche (erbaut 1290)<br />
Blumenholz barockes Herrenhaus <strong>und</strong> Dorfkirche mit achteckigem Gr<strong>und</strong>riß im Ortsteil<br />
Prillwitz<br />
Burg Stargard Höhenburg, ehemalige Münzprägeanstalt, Heimatmuseum, Marie-Hager-<br />
Ausstellung (mecklenburgische Landschaftsmalerin), Pfarrkirche St. Johannes<br />
Diemitz Fleether Wassermühle<br />
Dolgen spätgotische R<strong>und</strong>kirche<br />
Feldberg Reste des Walls <strong>und</strong> der Burganlage auf dem Schloßberg, Heimatstube,<br />
Hans Fallada-Haus <strong>und</strong> Gedenkstätte im Ortsteil Carwitz<br />
Friedland Heimatmuseum, Neubrandenburger Tor, Anklamer Tor, Fangelturm, Reste der<br />
Nikolaikirche, Pfarrkirche St. Marien mit Garnweberchor<br />
Groß Miltzow spätgotische Dorfkirche im Ortsteil Holzendorf<br />
Groß Nemerow Museum im "Spritzenhaus"<br />
Hohenzieritz Schloßanlage mit Landschaftspark, Dorfschmiede-Museum, Liepser Schlößchen<br />
Weisdin<br />
Lichtenberg Lennépark im Ortsteil Krummbeck, Sommergalerie<br />
Mirow Schloßanlage mit Kavaliershaus <strong>und</strong> "unterem Schloß"<br />
Woldegk Windmühlen, Mühlenmuseum<br />
Wesenberg Burgreste, spätgotische Pfarrkirche mit verschiedenen Gewölbearten<br />
Zirzow Mühle im Malliner Bachtal<br />
im Landkreis Müritz:<br />
Alt Rhese Dorfanlage mit Fachwerkhäusern<br />
Alt Schwerin Agrarhistorisches Museum, schmiedeeisernes Torgitter (erhielt Sonderpreis auf<br />
Weltausstellung 1893), alte Dorfschule, Gutsschmiede, altes Gutshaus,<br />
Tagelöhnerkate, Windmühle<br />
Ankershagen frühgotische Feldsteinkirche (13.Jahrh<strong>und</strong>ert), Gutshaus auf Resten einer<br />
Wasserburg, Pastorat mit Heinrich-Schliemann-Museum<br />
Bollewick große Feldsteinscheune (125 m lang, 34 m breit), erbaut 1880<br />
Finken klassizistische Kirche (Ende 18.Jahrh<strong>und</strong>ert), einzigartige R<strong>und</strong>scheune<br />
Göhren-Lebbin Schloß (Hotel) mit weitläufiger Gartenanlage<br />
Groß Gievitz frühgotische Feldsteinkirche<br />
Grabow-Below KZ-Museum <strong>und</strong> Gutshaus im Ortsteil Below, Gedenkstätte im Belower Wald,<br />
Kirche im Ortsteil Grabow<br />
Groß Plasten neobarockes Schloß (Hotel)<br />
Klein Lukow Herrenhaus mit Fachwerkkavaliershäusern<br />
Klink Schloß, Fachwerkwachhaus<br />
Klocksin Gutsanlage <strong>und</strong> dendrologischer Park im Ortsteil Blücherhof<br />
111
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Ludorf barockes Gutshaus mit Landschaftspark, einzigartige Dorfkirche mit achteckigem<br />
Gr<strong>und</strong>riß<br />
Lupendorf Renaissanceschloß im Ortsteil Ulrichshusen<br />
Malchow Klosteranlage, Insellage der Altstadt, Drehbrücke<br />
Mallin Schloß im historistischen Stil (errichtet 1891), Nachbildung eines Slawendorfes<br />
im Ortsteil Passentin<br />
Penzlin Reste der mittelalterlichen Stadtmauer, Burg mit Hexenkeller, Pfarrkirche<br />
St. Marien, Johann-Heinrich-Voß-Gedenkstätte, Grabpyramide <strong>und</strong> Obelisk zur<br />
erstmaligen Aufhebung der Leibeigenschaft in Mecklenburg im Ortsteil Werder<br />
Röbel/Müritz Eisenbahnmuseum mit historischen Dampf- <strong>und</strong> Diesellokomotiven, einzige<br />
betriebsfähige Schlepptenderdampflokomotive in M-V; Synagoge 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
in Fachwerk-Ständerbauweise<br />
Schloen Kirche (13. Jahrh<strong>und</strong>ert) mit behauenen Steinen aus slawischer Zeit im Ortsteil<br />
Alt Schloen<br />
Stuer Dorfkirche von 1750, Burgruine<br />
Torgelow am See Schloß<br />
Varchentin Schloß im Tudorstil, Lennépark, Dorfkirche (13. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Vollrathsruhe Schloß mit Park <strong>und</strong> Mausoleum (18. <strong>und</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert), große Anzahl<br />
bronzezeitlicher Hügelgräber um Klein Luckow, Kerngebiet der mitteleuropäischen<br />
Bronzezeit, Bodendenkmal der altslawischen Höhenburg<br />
am Ohgang-See, Reste von Glashütten (18. Jahrh<strong>und</strong>ert), Schloß Grubenhagen<br />
(Burganlage), Hallalit: längstes Landarbeiterhaus Norddeutschlands in Feldsteinbauweise,<br />
Kirch Grubenhagen: Dorfensemble in Feldsteinbauweise, Dorfkirche<br />
(13. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Waren (Müritz) Alter Markt, Neuer Markt mit Löwenapotheke, Aquarium, Alte Feuerwache,<br />
Speicheranlagen am Hafen<br />
Wredenhagen Reste einer mittelalterlichen R<strong>und</strong>hausburg<br />
Auch die sogenannte städtische Kunst <strong>und</strong> Kultur läßt sich in den ländlichen Räumen inszenieren. Sie ist kein<br />
ausschließliches Privileg der Stadt. Gerade ein ländliches Ambiente kann die vermeintlich großstädtische<br />
Kunst <strong>und</strong> Kultur spannend <strong>und</strong> interessant machen.<br />
7.4 Gewässerbezogene Tourismusformen<br />
(1) Gewässerbezogene Tourismusformen, insbesondere das Wasserwandern, sind unter<br />
Schonung von ökologisch sensiblen Gewässerbereichen möglichst naturverträglich zu entwickeln.<br />
(2) Insbesondere an den zentralen Orten entlang der B<strong>und</strong>eswasserstraßen (Obere Havelwasserstraße,<br />
Müritz-Havel-Wasserstraße im Bereich der größeren Seen, Peene) sowie bei<br />
Malchin (Dahmer Kanal) sind ausreichend Liegeplätze mit Ver- <strong>und</strong> Entsorgungsmöglichkeiten<br />
auch für größere Sport- <strong>und</strong> Freizeitboote zu schaffen. Darüber hinaus sind<br />
für diese Boote an geeigneten Uferbereichen möglichst in Anbindung an Siedlungen<br />
Anlegemöglichkeiten vorzusehen.<br />
112
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
(3) Für das Wasserwandern mit kleineren Sportbooten sind auch entlang der Wasserwege<br />
im Bereich der naturnahen Oberläufe der kleinen Flußseen an geeigneten Gewässer- <strong>und</strong><br />
Uferabschnitten möglichst in Anbindung an Ortslagen ausreichend<br />
Beherbergungsmöglichkeiten bzw. Camping- oder Rastplätze mit hygienisch <strong>und</strong><br />
umwelttechnisch ordnungsgemäßen Ver- <strong>und</strong> Entsorgungseinrichtungen zu schaffen bzw.<br />
zu sichern.<br />
(4) Die Fahrgastschiffahrt soll erhalten werden <strong>und</strong> zu einem touristisch attraktiven Beförderungssystem<br />
ausgebaut werden. Beim Ausbau der Häfen <strong>und</strong> Anlegestellen sind die<br />
Belange der Fahrgastschiffahrt zu berücksichtigen.<br />
Begründung<br />
zu 7.4(1):<br />
Das reichhaltige Angebot an Seen <strong>und</strong> Flüssen in der Planungsregion stellt insbesondere für Wasserwanderer<br />
ein Paradies dar, das bereits heute in den Sommermonaten stark frequentiert wird. Eine naturverträgliche<br />
Lenkung des gewässerbezogenen Tourismus ist dringend erforderlich, um dieses Fluß-Seen-System auch<br />
langfristig touristisch attraktiv zu erhalten <strong>und</strong> im Einklang mit den Belangen des Naturschutzes zu nutzen.<br />
zu 7.4(2):<br />
Die großen Seen einschließlich der B<strong>und</strong>eswasserstraßen mit Anbindung über die Havel nach Berlin, der Elde<br />
bzw. Elbe an die Nordsee <strong>und</strong> der Peene an die Ostsee eröffnen attraktive Möglichkeiten für nationalen <strong>und</strong><br />
internationalen Bootstourismus insbesondere für größere Sport- <strong>und</strong> Freizeitboote. Die an diesen<br />
Wasserwegen liegenden Städte weisen in der Regel günstige städtebauliche <strong>und</strong> infrastrukturelle Voraussetzungen<br />
für den Ausbau entsprechender Boots- <strong>und</strong> Yachthäfen mit speziellen Marinafunktionen auf, die<br />
sonst außerhalb dieser Städte zu Lasten der Natur <strong>und</strong> Landschaft neu geschaffen werden müßten. Durch die<br />
Schaffung eines ausreichend dichten Netzes von Anlegestellen <strong>und</strong> Wasserwanderrastplätzen an ökologisch<br />
belastbaren Uferbereichen möglichst in Anbindung an Ortslagen wird zu einer naturverträglichen Lenkung<br />
des Bootstourismus beigetragen (Vermeidung von "wilden" Anlege- <strong>und</strong> Raststellen) <strong>und</strong> den Orten ein<br />
wesentliches Tourismuspotential erschlossen.<br />
zu 7.4(3):<br />
Die kleineren Verb<strong>und</strong>seen <strong>und</strong> Wasserläufe, insbesondere im Bereich von Mirow <strong>und</strong> Wesenberg, sind zur<br />
Schaffung von Wasserwandersystemen für kleinere Sportboote (Faltboote <strong>und</strong> Kanus) besonders geeignet.<br />
Allerdings kann der Wasserwandertourismus ein wesentlicher Störfaktor für die Natur sein, da die kleinen<br />
Kanus <strong>und</strong> Faltboote auch noch in die entlegendsten Gewässerbereiche, die in der Regel wichtige Rückzugsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Habitate für störungsempfindliche Tierarten darstellen, vordringen können. Eine naturverträgliche<br />
Lenkung des Wasserwanderns ist insbesondere durch ein ausreichendes Angebot an Einsetzstellen<br />
<strong>und</strong> Camping- oder Rastplätzen an geeigneten Gewässer- <strong>und</strong> Uferabschnitten möglich. Geeignet sind<br />
Gewässer- <strong>und</strong> Uferabschnitte unter anderem dann, wenn sie ökologisch belastbar sind <strong>und</strong> die Standorte<br />
landseitig über befahrbare Straßen oder Wege an Ortslagen angeb<strong>und</strong>en sind.<br />
zu 7.4(4):<br />
113
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Die Fahrgastschiffahrt stellt besonders für weniger eigenaktive Erholungssuchende <strong>und</strong> in Verbindung mit<br />
dem Wandertourismus ein wichtiges Element der touristischen Infrastruktur dar.<br />
7.5 Rad-, Reit- <strong>und</strong> Wandertourismus<br />
(1)Vorrangig in den Räumen für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung soll ein (Rad)-Wanderwegesystem<br />
nach folgenden Kriterien ausgebaut werden:<br />
- Nutzung bereits vorhandener, geeigneter Wege (auch Mehrfachnutzung),<br />
- Gewährleistung der überregionalen <strong>und</strong> regionalen Anbindung (Vernetzung),<br />
- Schonung ökologisch sensibler Bereiche,<br />
- landschaftlich attraktive Routenwahl mit touristisch interessanten Zielpunkten.<br />
(2) Für den Reittourismus sollen in Verbindung mit Reiterhöfen <strong>und</strong><br />
Reitsportmöglichkeiten unter Schonung von Natur <strong>und</strong> Landschaft Reitwege ausgewiesen<br />
werden.<br />
Begründung<br />
zu 7.5(1):<br />
Die Räume für Tourismus <strong>und</strong> Naherholung (siehe Programmsatz 7.2) weisen mit ihren attraktiven Landschaften<br />
<strong>und</strong> ihrer reichen Naturraumausstattung reizvolle Wandergebiete auf. Besonders die Radwanderer<br />
stellen eine fremdenverkehrswirtschaftlich lukrative Zielgruppe dar, die durch den Ausbau eines attraktiven<br />
Radwegesystems <strong>und</strong> zielgruppenorientiert angepaßter Beherbergungsmöglichkeiten für die Region gewonnen<br />
werden kann. Durch die Beachtung der oben genannten Kriterien wird zu einem effektiven <strong>und</strong> umweltverträglichen<br />
Ausbau des (Rad-)Wanderwegesystems beigetragen. Das Kriterium der Mehrfachnutzung<br />
kann insbesondere erreicht werden, wenn bei Maßnahmen im ländlichen Wegebau auf einen Ausbaustandard<br />
geachtet wird, der eine Mitnutzung als Radwanderweg ermöglicht. Zur attraktiven Routenwahl können<br />
insbesondere themenbezogene R<strong>und</strong>wanderwege entlang von naturk<strong>und</strong>lichen, kulturhistorischen <strong>und</strong><br />
kulturellen Sehenswürdigkeiten beitragen.<br />
zu 7.5(2):<br />
Die Region weist auf Gr<strong>und</strong> ihres ländlichen Charakters mit gutsherrschaftlichen Zeugnissen (Schlösser,<br />
Gutsanlagen, Parklandschaften) <strong>und</strong> ihrer Tradition in der Pferdezucht <strong>und</strong> -haltung ("Mecklenburger Brand")<br />
günstige Potentiale für die Schaffung von Reiturlaubangeboten auf. Durch das Ausweisen von Reitwegen<br />
werden sowohl die bestehenden Fuß- <strong>und</strong> Radwanderwege geschont als auch Schäden in der freien Natur<br />
(Trittschäden, Beunruhigung von Wild) vermieden.<br />
114
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
7.6 Touristische Anlagen<br />
7.6.1 Freizeitwohnanlagen, Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze<br />
(1) Zur Schaffung eines vielfältigen <strong>und</strong> ausreichenden Beherbergungsangebotes soll auch<br />
die Bereitstellung von Ferienhäusern <strong>und</strong> Ferienwohnungen beitragen. Bei der<br />
standörtlichen Einordnung <strong>und</strong> der Errichtung von Freizeitwohnanlagen sind insbesondere<br />
folgende Kriterien zu beachten:<br />
- Berücksichtigung der Belange von Natur-, Umweltschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege,<br />
- in der Regel Lage innerhalb bebauter Ortslagen bzw. in Anbindung daran,<br />
- angemessenes Verhältnis der vorgesehenen Bebauung zur Größe, Ausstattung <strong>und</strong><br />
Leistungsfähigkeit des Ortes sowie baulich-gestalterische Integration in das bestehende<br />
Orts- <strong>und</strong> Landschaftsbild,<br />
- ordnungsgemäße Abwasser- <strong>und</strong> Abfallbeseitigung sowie Wasserversorgung,<br />
- freier Zugang des Ufers für die Öffentlichkeit.<br />
Bestehende Freizeitwohnanlagen sind auf diese Kriterien hin zu überprüfen <strong>und</strong> entsprechend<br />
nachzubessern <strong>und</strong>/oder rückzubauen oder, wo möglich, zu verlagern.<br />
Die Umnutzung von Freizeitwohnanlagen als Dauerwohnstätten ist nur zulässig, wenn dadurch<br />
zu einer geordneten Siedlungsentwicklung beigetragen wird.<br />
(2) Zur Schaffung eines vielfältigen <strong>und</strong> ausreichenden Beherbergungsangebotes sollen<br />
auch Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze beitragen. Bei der standörtlichen Einordnung <strong>und</strong><br />
Errichtung solcher Plätze sind insbesondere folgende Kriterien zu beachten:<br />
- baulich-gestalterische Integration in das bestehende Landschaftsbild,<br />
- vorhandene verkehrliche Anbindung,<br />
- ordnungsgemäße Abwasser- <strong>und</strong> Abfallbeseitigung sowie Wasserversorgung,<br />
- Angebot ausreichender Stellplatzkapazitäten für einen wechselnden Personenkreis auf<br />
Plätzen innerhalb der Tourismusschwerpunkträume.<br />
Bestehende Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze sind auf diese Kriterien hin zu überprüfen <strong>und</strong><br />
entsprechend nachzubessern <strong>und</strong>/oder rückzubauen oder, wo möglich, zu verlagern.<br />
115
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(3) Überwiegend eigengenutzte Freizeitwohnanlagen <strong>und</strong> reine Dauercamping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze<br />
sollen in der Regel nicht in den Tourismusschwerpunkträumen ausgewiesen<br />
werden.<br />
Begründung<br />
zu 7.6.1(1) <strong>und</strong> (2):<br />
Freizeitwohnanlagen sind Ferien- <strong>und</strong> Wochenendhäuser sowie entsprechende Wohnungen, die entweder<br />
überwiegend <strong>und</strong> auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen oder überwiegend<br />
eigengenutzt werden (siehe Begründung zu 6.4(1) LROP). Die Einrichtung <strong>und</strong> der Betrieb von Freizeitwohnanlagen,<br />
Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätzen bringen häufig stärkere Belastungen für den Naturhaushalt<br />
<strong>und</strong> das Landschaftsbild mit sich. Dies gilt in besonderem Maße in den für die Erholung besonders attraktiven<br />
Tourismusschwerpunkträumen mit einer größtenteils sensiblen Naturraumausstattung (siehe Programmsatz<br />
7.2.1). Deshalb ist die Berücksichtigung der Belange von Natur-, Umweltschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege bei<br />
solchen touristischen Ausbaumaßnahmen letztlich auch für den dauerhaften Erhalt der touristischen Eignung<br />
der einzelnen <strong>Teil</strong>räume von besonderer Bedeutung.<br />
Eine besonders sorgfältige Abstimmung solcher Anlagen mit der Größe, Ausstattung <strong>und</strong> Leistungsfähigkeit<br />
des Standorts ist geboten, weil große Anlagen, aber auch die Konzentration von Einzelvorhaben, die Wohn-<br />
<strong>und</strong> Erholungsqualität des Standorts beeinträchtigen können <strong>und</strong> bei den Infrastruktureinrichtungen trotz nur<br />
periodischer Inanspruchnahme eine Auslegung auf Spitzenbelastungen erforderlich ist, die überproportionale<br />
Mehrkosten nach sich zieht. Auch bei der Schaffung von touristischer Infrastruktur ist wichtig, daß neben den<br />
Ansprüchen der Gäste die Gestaltung eines funktionsfähigen Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsraumes für die im Ort<br />
ansässige Bevölkerung berücksichtigt wird <strong>und</strong> die Entstehung einseitiger, krisenanfälliger Wirtschaftsstrukturen<br />
vermieden wird.<br />
Die Errichtung von Freizeitwohnanlagen sowie von Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätzen in der freien Landschaft<br />
würde zu einer Zersiedlung der Landschaft führen <strong>und</strong> ihre Erholungsfunktion nachteilig beeinflussen. Die<br />
Anlagen sollen daher - unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte - innerhalb der im Zusammenhang<br />
bebauten Ortslagen bzw. in Anbindung daran errichtet werden (siehe auch Programmsatz 7.1(4)). Dafür<br />
sprechen auch Gesichtspunkte der Ver- <strong>und</strong> Entsorgung.<br />
Innerhalb der Orte stehen oft auch Altbauten zur Verfügung, die sich bei entsprechender Umnutzung für die<br />
Nutzung als Freizeitwohngelegenheiten eignen. Dies sollte auch deshalb angestrebt werden, weil es dazu<br />
beiträgt, die historisch gewachsenen Ortsbilder zu erhalten <strong>und</strong> aufzuwerten.<br />
Für Camping- <strong>und</strong> Rastplätze, insbesondere im Zusammenhang mit dem Wasserwandern, sind die Uferzonen<br />
von Gewässern besonders attraktiv, sie sind aber auch ökologisch empfindliche Bereiche. Es sollte daher<br />
sichergestellt werden, daß ein ausreichender Abstand zum Ufer freigehalten wird bzw. ökologisch negative<br />
Beeinflussungen der Ufer vermieden werden.<br />
Insbesondere in den landschaftlich attraktiven Gebieten ist ein hoher Anteil von Freizeitwohnanlagen in Form<br />
von Ferien- <strong>und</strong> Wochenendhäusern, Gartenlauben <strong>und</strong> (Dauer-)Campingeinrichtungen vorhanden. Häufig<br />
wurden die Anlagen in der freien Landschaft <strong>und</strong> dort in ökologisch sensiblen Bereichen, wie z.B. Uferzonen,<br />
errichtet. Die Ver- <strong>und</strong> besonders die Entsorgung entsprechen häufig nicht den hygienisch- umwelttechnisch<br />
gebotenen Standards. Vor allem in Gebieten, die durch eine starke Anhäufung solcher Anlagen belastet sind,<br />
ist dadurch unter anderem auch deren Erholungsfunktion stark eingeschränkt. Durch die Überplanung solcher<br />
116
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Bereiche kann Nachbesserung, Rückbau oder Verlagerung solcher Anlagen möglich werden, was zur<br />
Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine touristische Entwicklung in den Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong><br />
Tourismusentwicklungsräumen beiträgt.<br />
Die Zweckbestimmung von Freizeitwohnanlagen gemäß § 10 Baunutzungsverordnung ist auf die Erholung<br />
ausgerichtet. Eine Nutzung als Dauerwohnstätte stellt eine unzulässige Nutzungsänderung dar, weil das Haus<br />
bzw. die Wohnung dann nicht mehr nur der Erholung dienen würde <strong>und</strong> die Eigenart des Gebietes gefährdet<br />
würde (siehe auch § 15 Abs. 1 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar<br />
1990 (BGBl. I 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I 466)). Für<br />
eine Umnutzung ist in jedem Falle die genehmigungspflichtige, baurechtliche Umwidmung der Fläche<br />
erforderlich.<br />
zu 7.6.1(3):<br />
Eigengenutzte Freizeitwohnanlagen sind Einrichtungen, die überwiegend einem festen Personenkreis zur<br />
Erholungssuche zur Verfügung stehen. Reine Dauercamping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze sind Plätze, die ausschließlich<br />
einem festen Personenkreis zur Erholungssuche zur Verfügung stehen. Um in den tourismuswirtschaftlich<br />
besonders attraktiven Tourismusschwerpunkträumen mit einem begrenzten Flächenfonds <strong>und</strong><br />
naturräumlich begrenzten Belastungsvermögen ausreichend Potentiale für die Erholung der Allgemeinheit,<br />
insbesondere für die touristische Erholung zu sichern, soll die Nachfrage nach eigengenutzten Freizeitwohnanlagen<br />
<strong>und</strong> reinen Dauercampingplätzen in <strong>Teil</strong>räume außerhalb der Tourismusschwerpunkträume gelenkt<br />
werden, die von geringerer Bedeutung für die Erholung der Allgemeinheit sind.<br />
7.6.2 Größere Freizeit- <strong>und</strong> Beherbergungsanlagen<br />
(1) Für größere Beherbergungseinrichtungen, größere Sport- <strong>und</strong> Freizeitanlagen, große<br />
Ferienzentren <strong>und</strong> Freizeitparks sowie größere Golfplatzanlagen sind gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
raumordnerische Einzelfallabwägungen erforderlich.<br />
(2) Standorte für größere Beherbergungseinrichtungen <strong>und</strong> größere Sport- <strong>und</strong> Freizeitanlagen<br />
sollen vorrangig in bzw. in Anbindung an Städte <strong>und</strong> Dörfer vorgehalten werden <strong>und</strong><br />
zur Schaffung eines vielfältigen touristischen Angebotes beitragen. Dabei sind insbesondere<br />
folgende Kriterien zu beachten:<br />
- längerfristige Wirtschaftlichkeit,<br />
- Verträglichkeit mit der Siedlungsentwicklung,<br />
- gute verkehrliche Anbindung,<br />
- Sicherung der Ver- <strong>und</strong> Entsorgung,<br />
- städtebaulich bzw. landschaftlich angepaßte Gestaltung.<br />
(3) Bei Ansiedlungsvorhaben von großen Ferienzentren <strong>und</strong> Freizeitparks sind<br />
insbesondere folgende Kriterien zu beachten:<br />
- Ausschluß von Überschneidungen zwischen freizeitparkbezogenen Angeboten<br />
bzw. Attraktionen mit stadttypischen Kultur- <strong>und</strong> Freizeitangeboten (z.B. Theater, Kino),<br />
117
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
- mögliche Integration in bestehende Konzepte <strong>und</strong> Leitvorstellungen zur Tourismusentwicklung,<br />
- gute Anbindung an das überregionale Straßennetz,<br />
- stadt- <strong>und</strong> landschaftsverträgliche Gestaltung.<br />
Nicht zulässig als Standorte für große Ferienzentren <strong>und</strong> Freizeitparks sind die Vorranggebiete<br />
für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege. In den Vorsorgeräumen für Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege sind sie im Einzelfall, nach Prüfung der Raum- <strong>und</strong><br />
Umweltverträglichkeit, zulässig.<br />
(4) Standorte für Golfplätze sind vorrangig in ökologisch verarmten Kulturlandschaften mit<br />
überwiegender Ackernutzung zulässig.<br />
Nur bedingt zulässig als Standorte für Golfplätze sind:<br />
- Landschaftsschutzgebiete, wenn die landschaftlichen Gegebenheiten eine besondere<br />
Berücksichtigung finden <strong>und</strong> der Schutzzweck des jeweiligen Schutzgebietes<br />
gewährleistet bleibt,<br />
- Gebiete mit ökologisch <strong>und</strong> landschaftlich wertvollen oder gering belastbaren Flächen,<br />
wenn diese von geringer Größe sind <strong>und</strong> in den Golfplatz ohne Beeinträchtigungen beim<br />
Bau, durch den Spielbetrieb oder durch ständige Pflegemaßnahmen integriert werden<br />
können.<br />
Nicht zulässig als Standorte für Golfplätze sind:<br />
- der Müritz-Nationalpark <strong>und</strong> die weiteren Vorranggebiete für Naturschutz <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege,<br />
- Gebiete mit einem hohen Anteil an ökologisch <strong>und</strong> landschaftlich wertvollen oder gering<br />
belastbaren Flächen, wie Naturdenkmale, Feucht- <strong>und</strong> Trockenstandorte, Gebiete mit einer<br />
Anhäufung von Biotopen gemäß § 2 Erstes Gesetz zum Naturschutz im Land<br />
Mecklenburg-Vorpommern vom 10. Januar 1992 (GVOBl. M-V S.3), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. September 1997 (GVOBl. M-V S. 502),<br />
Lebensräume mit seltenen störempfindlichen Tierarten sowie struktur- <strong>und</strong> artenreiche<br />
Waldbestände,<br />
- Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung der Allgemeinheit, wie<br />
Uferbereiche an Seen.<br />
Die verkehrliche Anbindung an das überregionale Straßennetz sowie die ordnungsgemäße<br />
Ver- <strong>und</strong> Entsorgung der Golfplatzanlage ist zu sichern. Insbesondere in den Tourismusschwerpunkträumen<br />
ist die Zugänglichkeit <strong>und</strong> Mitbenutzung von Golfplatzstandorten für<br />
die Allgemeinheit z.B. durch die Anlage <strong>und</strong> Erhaltung von Wanderwegen zu<br />
gewährleisten.<br />
Begründung<br />
zu 7.6.2(1):<br />
118
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
Gemäß Erlaß des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt vom 6. Mai 1996 zur Definition von<br />
großen Einrichtungen für die Ferien- <strong>und</strong> Fremdenbeherbergung <strong>und</strong> großen Freizeitanlagen entsprechend § 1<br />
Nr.15 der Raumordnungsverordnung (AmtsBl. M-V Nr. 23 S. 529) stellen „Hotelanlagen mit mehr als 400<br />
Betten“ <strong>und</strong> „Ferienhausanlagen mit mehr als 100 Wohneinheiten“ sowie „Camping- <strong>und</strong> Mobilheimplätze<br />
mit mehr als 200 Stellplätzen“ größere Beherbergungseinrichtungen dar, für die in der Regel<br />
Raumordnungsverfahren durchzuführen sind. „Bei ökologisch sensiblen Standorten kann auch unterhalb der<br />
genannten Schwellenwerte ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Hingegen kann bei Vorhaben,<br />
die eine Nach- <strong>und</strong> Umnutzung von Altstandorten vorsehen, auch bei einer Überschreitung der Werte von<br />
einem Raumordnungsverfahren abgesehen werden. Die Entscheidung über die Durchführung eines<br />
Raumordnungsverfahrens trifft die Landesplanungsbehörde nach § 17 Abs. 3 Landesplanungsgesetz“ vom 31.<br />
März 1992 (GVOBl. M-V S. 242), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 1998<br />
(GVOBl. M-V S. 388). (Zitate: Erlaß des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt vom 6. Mai<br />
1996 zur Definition von großen Einrichtungen für die Ferien- <strong>und</strong> Fremdenbeherbergung <strong>und</strong> großen<br />
Freizeitanlagen entsprechend § 1 Nr.15 der Raumordnungsverordnung ( Amtsbl. M-V Nr. 23 S. 529).)<br />
Größere Sport- <strong>und</strong> Freizeitanlagen sind u. a. große Sportanlagenkomplexe, Freizeitbäder, Thermen <strong>und</strong> anderes<br />
mehr mit einem großen Tagesgästeaufkommen <strong>und</strong> mit überregionaler Bedeutung sowie große Freizeit-<br />
<strong>und</strong> „Sportboothäfen mit mehr als 200 Liegeplätzen“ (siehe auch: Erlaß des Ministeriums für Bau,<br />
Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt vom 6. Mai 1996, wie oben).<br />
Auf Gr<strong>und</strong> des hohen Anteils ökologisch sensibler Räume (siehe Programmsätze 4.4 <strong>und</strong> Begründung zu<br />
7.2.1(1)) sind in der Planungsregion in der Regel auch bei Vorhaben mit Kapazitäten, die wesentlich unterhalb<br />
der oben genannten Werte liegen, raumordnerische Einzelfallabwägungen erforderlich.<br />
Große Ferienzentren sind in der Regel durch sehr großflächige Ferienhauskomplexe mit einer großen<br />
Zentralanlage, meist mit einem sogenannten subtropischen Schwimmparadies, <strong>und</strong> anderen Sport- sowie<br />
Konsum- <strong>und</strong> Restaurationsangeboten gekennzeichnet. Sie erfordern in der Regel Flächengrößen von 20 bis<br />
30 ha <strong>und</strong> mehr.<br />
Freizeitparks sind großflächige Freizeit- <strong>und</strong> Vergnügungsanlagen mit einer Fläche von mindestens 10 ha<br />
<strong>und</strong>/oder einer jährlichen Besucherzahl von mindestens 100.000 Personen. Die Anlagen verfügen über<br />
unterschiedliche stationäre Vergnügungseinrichtungen (z.B. Fahrgeschäfte, Themenwelten, Ausstellungsobjekte,<br />
Spielplätze, Tiergehege, Shows, Revuen ) sowie ergänzende Gastronomieeinrichtungen, die sowohl<br />
als "indoor-" als auch als "outdoor-Anlage" betrieben werden. Für den Besuch wird eine Eintrittsgebühr<br />
erhoben. Auf Gr<strong>und</strong> ihrer Autok<strong>und</strong>enorientierung benötigen diese Anlagen große Parkplatzflächen.<br />
Von den Golfplatzarten Pitch- <strong>und</strong> Putt-Platz (Übungsplatz), Par-3-Platz (Kurzplatz mit 3er Bahnen), Executive<br />
Course (Kurzplatz) <strong>und</strong> Public-Golfplatz (verkürzte Bahnen) sowie Standardplatz <strong>und</strong> Meisterschaftsplatz<br />
stellen die beiden zuletzt genannten Golfplatzarten mit einem golftechnischen Flächenbedarf (Flächen<br />
für das Golfspiel, die Übungs- <strong>und</strong> Infrastruktureinrichtungen sowie die notwendigen Abstandsflächen) von<br />
ca. 60 <strong>und</strong> mehr Hektar sowie eine räumliche Konzentration von kleineren Golfplatzarten größere Golfplatzanlagen<br />
dar.<br />
Um den vielfältigen überörtlichen Auswirkungen auf den Verkehr, die Umwelt, das zentralörtliche System,<br />
die Siedlungsentwicklung <strong>und</strong> das Siedlungs- <strong>und</strong> Landschaftsbild solcher touristischen Großvorhaben gerecht<br />
zu werden, sind raumordnerische Einzelfallabwägungen erforderlich.<br />
zu 7.6.2(2):<br />
Größeren Sport- <strong>und</strong> Freizeitanlagen in Verbindung mit einem quantitativ <strong>und</strong> qualitativ ausreichenden Beherbergungsangebot<br />
kommt durch ihre saisonverlängernde Wirkung für die Fremdenverkehrswirtschaft besondere<br />
Bedeutung zu. Sie sollen deshalb vorrangig in den Tourismusschwerpunkträumen angesiedelt<br />
werden. Durch die Ansiedlung solcher Einrichtungen in bzw. in Anbindung insbesondere an die Städte kann<br />
das bestehende Infrastruktursystem ausgenutzt werden, auch für die Stadtbevölkerung ein attraktives Freizeit-<br />
119
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
<strong>und</strong> Erholungsangebot vor Ort bereitgestellt werden <strong>und</strong> dadurch die Auslastung solcher Anlagen ohne<br />
zusätzliches Verkehrsaufkommen erhöht werden.<br />
In den Genehmigungsverfahren ist von den oben aufgeführten Kriterien auch die längerfristige Wirtschaftlichkeit<br />
solcher Anlagen <strong>und</strong> Einrichtungen zu prüfen, da sich deren Einkommens- <strong>und</strong> Arbeitsplatzeffekte<br />
in einer längerfristigen Perspektive für den kommunalen Haushalt als Zuschußbetriebe mit erheblichen<br />
Folgekosten erweisen können.<br />
Insbesondere Hallen- <strong>und</strong> Freibäder sowie größere Sportanlagen <strong>und</strong> Sporthallen gehören gemäß <strong>Begründungen</strong><br />
zu 2.1.2 <strong>und</strong> zu 2.1.3 LROP zur Regelausstattung von Ober- <strong>und</strong> Mittelzentren. Bei solchen Anlagen<br />
kann es zu Überschneidungen <strong>und</strong> Konkurrenzen zwischen diesen zentralörtlichen Regelausstattungen <strong>und</strong><br />
entsprechenden touristischen Anlagen außerhalb von zentralen Orten kommen. Deshalb sollten die Planungen<br />
<strong>und</strong> Betreiberkonzepte solcher Anlagen auch zwischen der Standortgemeinde <strong>und</strong> den Ober- bzw.<br />
Mittelzentren abgestimmt werden, um die Verträglichkeit mit dem zentralörtlichen System zu gewährleisten.<br />
zu 7.6.2(3):<br />
Die Anlage <strong>und</strong> der Betrieb großer Ferienzentren <strong>und</strong> Freizeitparks (siehe Definitionen in Begründung zu<br />
Programmsatz 7.6.2(1)) haben erhebliche ökologische Auswirkungen, die sich nicht allein auf den Standort<br />
der Anlagen beschränken (siehe Sander/Koch, Ökologische Bewertung großflächiger Ferienparks, in: ILS<br />
Schriften, 75/1993, S.52 ff):<br />
Anlagebedingte Auswirkungen:<br />
- hohe Flächeninanspruchnahme,<br />
- Zerschneidungs- <strong>und</strong> Trenneffekte für zusammenhängende Landschaftsteile/Biotope,<br />
- Verdichtung <strong>und</strong> Versiegelung des Oberbodens durch Gebäude, Wegeflächen, befestigte (Sport-)Plätze <strong>und</strong><br />
Wasserflächen (bei künstlicher Abdichtung durch Folien),<br />
- Veränderung des Bodenreliefs,<br />
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (insbesondere bei Hang- <strong>und</strong> Kuppenlagen).<br />
Betriebsbedingte Auswirkungen:<br />
- Ressourcenverbrauch (Energie, Wasser, Rohstoffe),<br />
- Erzeugung von Abfällen, Abwasser <strong>und</strong> Abluft,<br />
- Verkehrsaufkommen durch nahezu vollständige Kfz-Orientierung mit hohem Energieverbrauch, hoher<br />
Schadstoffproduktion <strong>und</strong> Lärmbelästigung der Wohnbevölkerung an den Zufahrtsstraßen,<br />
- Störung der Natur <strong>und</strong> Landschaft durch Feriengäste innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Anlage,<br />
- Schäden durch Tritt <strong>und</strong> Eutrophierung (abhängig von der Nutzerfrequenz),<br />
- Beunruhigung der Tierwelt (bereits durch einzelne Störungen, z.B. Spaziergänger, möglich).<br />
Während bei den anlagenbedingten Auswirkungen an Standorten mit geringer ökologischer Wertigkeit durch<br />
kompensatorische Maßnahmen eine aus ökologischer Sicht näherungsweise ausgeglichene Bilanz erreichbar<br />
ist, lassen sich die betriebsbedingten Auswirkungen zwar minimieren aber nicht ausgleichen. Deshalb<br />
kommen Standorte in Vorranggebieten für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege gr<strong>und</strong>sätzlich nicht in Betracht.<br />
Nur in Ausnahmefällen können Landschaftsschutzgebiete <strong>und</strong> vergleichbare <strong>Teil</strong>gebiete von Naturparken als<br />
Standorte in Betracht kommen, wenn der Schutzzweck nicht in Frage gestellt wird <strong>und</strong> die landschaftlichen<br />
Gegebenheiten eine besondere Berücksichtigung finden. (Siehe: Entschließung der Ministerkonferenz für<br />
Raumordnung "Großflächige Freizeiteinrichtungen in der Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung" vom 14.<br />
Februar 1992.) Voraussetzung für die Genehmigung ist, daß für das von baulichen Anlagen betroffene Gebiet<br />
eine Aufhebung des Schutzes als Landschaftsschutzgebiet erfolgt.<br />
zu 7.6.2(4):<br />
Golfplatzanlagen können insbesondere auf Gr<strong>und</strong> ihrer Flächeninanspruchnahme (ca. 40 bis zum <strong>Teil</strong> über<br />
120 Hektar) <strong>und</strong> ihres Pflegeaufwandes (Dünge- <strong>und</strong> Spritzmitteleinsatz) zu Beeinträchtigungen der Natur<br />
(Boden, Wasser) <strong>und</strong> der Erholungsfunktion des betroffenen Gebietes (Zugänglichkeit für die Allgemeinheit)<br />
führen. Durch die Einordnung von Golfplätzen auf ökologisch ausgeräumten Ackerflächen landwirtschaftlich<br />
120
RROP Mecklenburgische Seenplatte Tourismus <strong>und</strong> Naherholung<br />
geringerer Bonität können diese Räume landschaftlich aufgewertet werden <strong>und</strong> ökologisch sensible Räume<br />
geschützt werden. Die als nur bedingt zulässig aufgeführten Landschaftsbereiche erfordern eine gründliche<br />
Einzelfallprüfung zur Feststellung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens an dem vorgesehenen Standort.<br />
Die als nicht zulässig aufgeführten Bereiche würden in jedem Falle durch die Anlage <strong>und</strong> den Betrieb eines<br />
Golfplatzes nachteilig verändert <strong>und</strong> ihren Schutzcharakter für Natur <strong>und</strong> Landschaft oder Erholungscharakter<br />
für die Allgemeinheit verlieren.<br />
7.7 Naherholung<br />
(1) Für die ortsansässige Bevölkerung, insbesondere im Umland der größeren Städte, sind<br />
nach Bedarf in dafür landschaftlich geeigneten Gebieten Möglichkeiten der Naherholung<br />
vorzuhalten.<br />
(2) Im Umland von größeren Siedlungen, die einen hohen Anteil an Geschoßwohnungsbauten<br />
aufweisen, sind siedlungsnah an geeigneten Standorten bedarfsorientiert für die örtliche<br />
Wohnbevölkerung Flächen für Kleingartenanlagen im Sinne des B<strong>und</strong>eskleingartengesetzes<br />
vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes<br />
vom 18. August 1997 (BGBl. I 2081), vorzuhalten. Dabei sind Beeinträchtigungen<br />
der Landschaft <strong>und</strong> des Stadtbildes zu vermeiden bzw. im Bestand durch geeignete<br />
Maßnahmen zu minimieren.<br />
Begründung<br />
zu 7.7(1):<br />
Naherholungseinrichtungen steigern die Lebensqualität insbesondere für die Stadtbevölkerung. Auch außerhalb<br />
der landschaftlich attraktiven Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong> -entwicklungsräume sind naturräumliche<br />
Potentiale, wie z.B. kleine Seen <strong>und</strong> Gewässer, Stromtäler, Wälder <strong>und</strong> Parks vorhanden, die für Naherholungsfunktionen<br />
gesichert <strong>und</strong> entwickelt werden können.<br />
zu 7.7(2):<br />
Kleingartenanlagen gemäß B<strong>und</strong>eskleingartengesetz vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. August 1997 (BGBl. I 2081), sind für die wohnortnahe Erholung (auch<br />
nach Feierabend) geeignete Einrichtungen, die insbesondere in Städten mit hohem Anteil an<br />
Geschoßwohnungsbauten <strong>und</strong> einem wenig attraktiven Wohnumfeld Ausgleichsfunktionen haben. In der<br />
Planungsregion trifft dies vorrangig auf das Oberzentrum Neubrandenburg sowie die Mittel- <strong>und</strong> Unterzentren<br />
zu. Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Landschafts- <strong>und</strong> Stadtbildes stellen unter anderem<br />
Abgrünungen besonders in den Randbereichen <strong>und</strong> der Rückbau von Kleingartenparzellen in Streulagen dar.<br />
121
Tourismus <strong>und</strong> Naherholung RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
122
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
8. Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
8.1 Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
In allen <strong>Teil</strong>en der Region soll eine leistungsfähige <strong>und</strong> bürgernahe Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge für<br />
die Bevölkerung in zumutbarer Entfernung gewährleistet werden. Die Einrichtungen des<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesens sind in ihrer fachlichen Gliederung, ihren Größenordnungen <strong>und</strong> ihrer<br />
räumlichen Verteilung aufeinander <strong>und</strong> auf das Netz der zentralen Orte abzustimmen.<br />
Begründung<br />
Das Ges<strong>und</strong>heitswesen gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Einrichtungen tragen<br />
maßgeblich dazu bei, gleichwertige Lebensbedingungen herzustellen. Durch die Schaffung eines abgestuften,<br />
bedarfsorientiert gegliederten Systems leistungsfähiger <strong>und</strong> wirtschaftlicher Einrichtungen soll jedem Bürger<br />
eine ausreichende <strong>und</strong> bedarfsgerechte ges<strong>und</strong>heitliche Versorgung möglich sein.<br />
8.1.1 Stationäre ärztliche Versorgung<br />
Die stationäre, teilstationäre sowie vor- <strong>und</strong> nachstationäre medizinische Versorgung der<br />
Bevölkerung soll durch ein abgestuftes, bedarfsorientiert gegliedertes System leistungsfähiger<br />
Krankenhäuser sichergestellt werden. Dabei ist die Herausbildung der Trägervielfalt<br />
zu beachten. Standorte für Krankenhäuser sind in der Regel Ober- <strong>und</strong> Mittelzentren in<br />
Ausnahmefällen auch Unterzentren.<br />
Begründung<br />
Eine möglichst gleichwertige stationäre medizinische Versorgung der Bevölkerung setzt voraus, daß jedem<br />
Bürger im Bedarfsfall in angemessener Entfernung eine entsprechende stationäre Behandlung gewährt wird.<br />
Dieses Ziel ist durch ein funktional abgestuftes Netz möglichst gleichwertig verteilter, einander ergänzender<br />
Krankenhäuser zu erreichen. Der Krankenhausplan für den Planungszeitraum bis 1997 bildet die Gr<strong>und</strong>lage<br />
für die Entwicklung einer bürgernahen, bedarfsorientierten <strong>und</strong> medizinisch leistungsfähigen stationären<br />
Versorgung in der Region. Die stationäre Versorgung durch Krankenhäuser in der Region ist 1997 gemäß<br />
Erlaß des Sozialministers des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 8. Dezember 1992 (AmtsBl. M-V S.<br />
1555) wie folgt vorgesehen:<br />
123
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Tabelle 21:<br />
Krankenhausplan 1997<br />
Bestand 31.12.1996 Planung 31.12.1997<br />
Standort (Name, Art des Trägers) Fachabteilungen Betten Fachabteilungen Betten<br />
OZ Neubrandenburg (Klinikum, fg) 13 1003 16 1.075<br />
MZ Demmin (Kreiskrankenhaus, ö) 6 266 5 255<br />
MZ Neustrelitz (DRK-Krankenhaus, fg) 5 206 5 228<br />
MZ Waren (Müritz)<br />
}<br />
}<br />
UZ Röbel/Müritz (Müritzklinikum, fg) } 8*<br />
405* } 10*<br />
526*<br />
MZ Waren (Müritz) (Interdisziplinäres<br />
Therapiezentrum „Amsee“, p)<br />
1 136 1 60<br />
MT Malchin (Kreiskrankenhaus, fg) 4 198 3 100<br />
UZ Altentreptow (Kreiskrankenhaus, ö) 2 102 2 120<br />
*Gemeinsames Krankenhaus mit den Standorten Waren (Müritz) <strong>und</strong> Röbel/Müritz unter einer Trägerschaft<br />
Abkürzungen: ö = öffentlicher, fg = freigemeinnütziger, p = privater Träger<br />
Quellen: 31.12.1996: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern<br />
31.12.1997: Erlaß des Sozialministers des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 8. Dezember<br />
1992 (AmtsBl. M-V S. 1555)<br />
8.1.2 Ambulante ärztliche Versorgung<br />
Es ist darauf hinzuwirken, daß eine bedarfsorientierte <strong>und</strong> ausgewogene ambulante ärztliche<br />
Versorgung der Bevölkerung in allen <strong>Teil</strong>räumen der Region durch Ärztehäuser, Fachambulanzen,<br />
Allgemeinärzte, Zahnärzte, Diagnose- <strong>und</strong> Therapieeinrichtungen sowie Apotheken<br />
sichergestellt wird. Diese Einrichtungen sind in der Regel in den zentralen Orten vorzuhalten.<br />
Begründung<br />
Eine ausgewogene bürgernahe ambulante ärztliche <strong>und</strong> zahnärztliche Versorgung ist für die Schaffung<br />
gleichwertiger Versorgungsbedingungen in allen <strong>Teil</strong>räumen der Planungsregion von Bedeutung.<br />
8.2 Soziale Dienste <strong>und</strong> Einrichtungen<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste der sozialen Versorgung sollen bedarfsorientiert so auf- <strong>und</strong><br />
ausgebaut werden, daß eine ausgewogene Versorgung der Bevölkerung gewährleistet wird.<br />
Standorte für Sozialeinrichtungen sollen in der Regel zentrale Orte sein.<br />
Begründung<br />
Um eine bedarfsgerechte bürgernahe Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Diensten <strong>und</strong> Einrichtungen in<br />
allen <strong>Teil</strong>räumen der Region sicherstellen zu können, ist die gute Erreichbarkeit derartiger Einrichtungen<br />
erforderlich. Diese ist an den zentralen Orten gewährleistet.<br />
124
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
8.2.1 Altenbetreuung<br />
(1) Der Auf- <strong>und</strong> Ausbau eines dezentralen Angebotes der stationären, teilstationären, ambulanten<br />
<strong>und</strong> offenen Altenarbeit in zumutbarer Entfernung, wie Altenbegegnungs- <strong>und</strong><br />
Altenberatungsstellen, Essen-, Reinigungs-, Hauspflege- <strong>und</strong> Hilfsdienste sowie Mittagstische<br />
ist sicherzustellen. Zur Erhaltung der Selbständigkeit älterer, pflegebedürftiger Menschen<br />
sind schrittweise Einrichtungen der Tages- <strong>und</strong> Kurzzeitpflege als dezentrales wohngebietsnahes<br />
Angebot zu schaffen.<br />
(2) Für die Verbesserung der Betreuung in Altenwohn-, Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen sind die<br />
in der Region bestehenden Einrichtungen durch geeignete Erneuerungsmaßnahmen<br />
qualitativ aufzuwerten <strong>und</strong> dem zeitgemäßen Standard anzupassen.<br />
Begründung<br />
zu 8.2.1(1) <strong>und</strong> (2):<br />
Mit einem Versorgungsgrad von 70,7 Plätzen je 10.000 Einwohner (Land M-V: 73,3 Plätze) besteht in der<br />
Planungsregion im Jahr 1995 ein quantitativ ausreichendes Angebot an Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimplätzen.<br />
Allerdings müssen die Defizite in der Ausstattung der Heime durch Sanierung, Modernisierung <strong>und</strong> Neubau<br />
bei Aufgabe einiger Standorte verbessert werden.<br />
Vorrangiges sozialpolitisches Ziel ist es, solche Bedingungen zu schaffen, die es alten Menschen gestatten,<br />
solange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Durch den Ausbau der offenen Hilfen <strong>und</strong> ein<br />
dezentrales Angebot von Einrichtungen der Altenhilfe, durch altersgerechten Wohnungsbau sowie betreutes<br />
Wohnen mit sozialen Diensten kann die Selbständigkeit der alten Menschen in ihrem angestammten<br />
Lebensraum möglichst lange erhalten bleiben.<br />
Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung - also ein starker Anstieg der über 60jährigen - <strong>und</strong> der<br />
Ausbau der sonstigen Angebote der Altenhilfe werden den zukünftigen Bedarf an Heimplätzen maßgeblich<br />
bestimmen.<br />
8.2.2 Behindertenbetreuung<br />
(1) Die Bedürfnisse der Behinderten sind bei allen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
entsprechend zu berücksichtigen. In der Region sind Arbeitsplätze für Behinderte zu schaffen,<br />
die vorzugsweise auf zentrale Orte zu konzentrieren sind. In Gemeinden ohne zentralörtliche<br />
Bedeutung sind bedarfsorientiert auch Einrichtungen der Behindertenhilfe zu erhalten<br />
bzw. zu schaffen.<br />
(2) Bei der Absicherung der Wohnbedürfnisse der Menschen mit Behinderung sollen entsprechend<br />
dem Grad der Behinderung die verschiedenen Wohnformen zur Verfügung gestellt<br />
werden. Das beinhaltet sowohl Wohnheime, die den Werkstätten zugeordnet sind, den<br />
125
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Aufbau von betreuten Wohnangeboten als ergänzende Wohnform zu den Wohnheimen als<br />
auch weitere differenzierte Wohnangebote.<br />
Begründung<br />
zu 8.2.2(1) <strong>und</strong> (2):<br />
Jeder Behinderte sollte die Möglichkeit erhalten, einer seiner Behinderung angepaßten Tätigkeit nachgehen<br />
<strong>und</strong> eine Wohnung nutzen zu können, die seinen Möglichkeiten <strong>und</strong> Bedürfnissen Rechnung trägt. Die Vorhaltung<br />
geschützter Arbeitsplätze in Betrieben <strong>und</strong> von Wohnungen in den Städten <strong>und</strong> Dörfern leistet einen<br />
bedeutenden Beitrag zur Eingliederung der Behinderten in das gesellschaftliche Leben <strong>und</strong> trägt mit zu einem<br />
weitgehend eigenbestimmten Leben von Behinderten bei.<br />
8.2.3 Sozialstationen <strong>und</strong> soziale Beratungsdienste<br />
(1) Pflegerische Dienste in der Haus-, Familien-, Alten- <strong>und</strong> Krankenpflege sind flächendeckend<br />
anzubieten. Das Netz der Sozialstationen <strong>und</strong> der weiteren Hilfsangebote ist qualitativ<br />
aufzuwerten <strong>und</strong> bedarfsorientiert zu sichern, gegebenenfalls auszubauen.<br />
(2) Die Beratungsstellen sollen bedarfsabhängig so ausgebaut <strong>und</strong> ergänzt werden, daß insbesondere<br />
folgende Beratungsfelder mit einer fachlichen Besetzung in zumutbarer Entfernung<br />
erreichbar sind:<br />
- Erziehungs- <strong>und</strong> Jugendberatung,<br />
- Ehe-, Familien- <strong>und</strong> Lebensberatung,<br />
- Beratung für Schwangerschaftsfragen,<br />
- Beratung für Behinderte, Suchtgefährdete <strong>und</strong> -kranke,<br />
- Schuldnerberatungsstellen,<br />
- Beratungsstellen für ausländische Mitbürger.<br />
Diese Einrichtungen sind in der Regel in den zentralen Orten vorzuhalten.<br />
Begründung<br />
zu 8.2.3(1):<br />
Zu den sozialen Diensten gehören vorrangig ambulante Krankenpflege, ambulante Altenpflege sowie Haus-<br />
<strong>und</strong> Familienpflege. Sie werden von privaten Pflegediensten <strong>und</strong> Sozialstationen als Koordinierungsstellen für<br />
alle Bürger angeboten. Die Standorte sollten so gewählt werden, daß eine wohnortnahe Versorgung erfolgen<br />
kann. Beratungsstellen sollen helfen, auftretende Probleme zu bewältigen.<br />
zu 8.2.3(2):<br />
126
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
Soziale Beratungsdienste gewinnen zunehmend an Bedeutung. Damit sie entsprechend genutzt werden können,<br />
sollen sie für jedermann in zumutbarer Entfernung zum Wohnort liegen <strong>und</strong> auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
erreicht werden können.<br />
8.2.4 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen<br />
Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen sind bedarfsgerecht zu erhalten <strong>und</strong> qualitativ<br />
zu verbessern. Geeignete Standorte sind vor allem Kur- <strong>und</strong> Erholungsorte mit dem Ziel<br />
ihrer Stärkung durch saisonverlängernde Einrichtungen.<br />
Begründung<br />
Im 1. Halbjahr 1997 verfügte die Planungsregion über eine stationäre Rehabilitationsklinik (Standort:<br />
Malchow). Solche Kliniken stellen, sofern sie über ausreichende Versorgungsverträge verfügen, einen stabilisierenden<br />
Wirtschaftsfaktor dar <strong>und</strong> sind saisonunabhängig.<br />
Ambulante Versorgungs- <strong>und</strong> Rehabilitationseinrichtungen, vor allem in Form von Suchtberatungs- <strong>und</strong><br />
Suchtnachsorgestellen, sowie Entwöhnungseinrichtungen für langjährig chronisch kranke Alkoholiker befinden<br />
sich in der Mehrzahl der zentralen Orte sowie in weiteren Gemeinden.<br />
8.3 Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungswesen<br />
Der Bevölkerung der Planungsregion sind in allen <strong>Teil</strong>räumen <strong>und</strong> für alle Bevölkerungsgruppen<br />
hochwertige <strong>und</strong> hinreichend differenzierte Möglichkeiten zur Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
in zumutbarer Entfernung zur Verfügung zu stellen. Sie sind an den jeweiligen Bildungsbedarf<br />
<strong>und</strong> an Veränderungen der Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialstruktur anzupassen.<br />
Begründung<br />
Ausreichende Bildungseinrichtungen, die von der vorschulischen Erziehung über allgemeinbildende Schulen<br />
(einschließlich Förderschulen), berufsbildende Schulen, Hochschulen bis zur Erwachsenenqualifizierung<br />
reichen, sind eine Voraussetzung für gleichwertige Lebensbedingungen in allen <strong>Teil</strong>en des Landes. Jeder<br />
Bürger muß die Möglichkeit erhalten, eine seinen Fähigkeiten, Neigungen <strong>und</strong> Interessen entsprechende<br />
Bildung zu realisieren.<br />
8.3.1 Kindertagesbetreuung<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste der Kindertagesbetreuung bzw. differenzierte Angebote im<br />
Elementarbereich sind auch bei niedrigen Geburtenraten bedarfsgerecht <strong>und</strong> in zumutbarer<br />
Entfernung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr <strong>und</strong> für Schüler bis zum Ende der<br />
Gr<strong>und</strong>schule <strong>und</strong> in begründeten Ausnahmefällen bis zum Ende der Orientierungsstufe<br />
sicherzustellen sowie ausreichend auszustatten.<br />
127
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Begründung<br />
Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung <strong>und</strong> auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen<br />
<strong>und</strong> gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zur Verwirklichung dieses Gr<strong>und</strong>satzes tragen Kindereinrichtungen<br />
<strong>und</strong> andere Angebote der Kindertagesförderung familienergänzend bei.<br />
Für Kinder im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, in der Regel 6./7. Lebensjahr,<br />
besteht ein Rechtsanspruch gegen die Wohnsitzgemeinde auf einen Platz in einem Kindergarten. Mit dem<br />
Einverständnis der Personensorgeberechtigten kann dieser auch durch Tagespflegestellen gemäß des Ersten<br />
Ausführungsgesetzes zum Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfegesetz vom 19. Mai 1992 (GVOBl. M-V S. 270), zuletzt<br />
geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 1995 (GVOBl. M-V S. 603), erfüllt werden.<br />
8.3.2 Allgemeinbildende Schulen<br />
(1) Das vorhandene Schulnetz ist weiterhin bedarfsgerecht zu gestalten. Es soll den neuen<br />
strukturellen <strong>und</strong> qualitativen Anforderungen an das Schulwesen schrittweise angepaßt<br />
werden. Trotz zurückgehender Schülerzahlen ist ein differenziertes <strong>und</strong> gut erreichbares<br />
Bildungsangebot bereitzuhalten. Unvertretbar lange Schulwege sind zu vermeiden. Die<br />
räumliche Verteilung ist auf die zentralörtliche Gliederung auszurichten.<br />
(2) Gr<strong>und</strong>schulen sollen zumindest in allen zentralen Orten zu Verfügung stehen. Gr<strong>und</strong>schulstandorte<br />
in Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung sollen, soweit sie in ihrem jeweiligen<br />
Einzugsbereich über die erforderliche Schüleranzahl verfügen, erhalten bleiben.<br />
(3) Haupt- <strong>und</strong> Realschulen sollen in Oberzentren, Mittelzentren <strong>und</strong> Mittelzentren mit<br />
<strong>Teil</strong>funktionen vorhanden sein. In Abhängigkeit von der Größe des Einzugsbereiches <strong>und</strong><br />
dem damit verb<strong>und</strong>enen Schüleraufkommen können Unterzentren <strong>und</strong> Ländliche<br />
Zentralorte, in Ausnahmefällen auch Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung, Standorte<br />
für Haupt- <strong>und</strong> Realschulen oder kombinierte Systeme sein.<br />
(4) Standorte für Gymnasien sind in der Regel Ober- <strong>und</strong> Mittelzentren. Bedarfsorientiert<br />
kommen auch ausgewählte Unterzentren in Betracht, wenn die jeweiligen Einzugsbereiche<br />
die erforderlichen Schülerzahlen sicherstellen.<br />
Begründung<br />
zu 8.3.2(1):<br />
Die allgemeinbildenden Schulen sind die tragenden Säulen des Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungswesens. Die angestrebten<br />
gleichwertig günstigen Lebensbedingungen erfordern ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot in<br />
allen <strong>Teil</strong>räumen der Region, welches durch das gegliederte Schulsystem ermöglicht werden soll. Alle<br />
Schularten sollen nach Möglichkeit eine ausgewogene Verbreitung erfahren.<br />
zu 8.3.2(2) - (4):<br />
128
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
Am 1. September 1996 gab es in der Planungsregion insgesamt 179 allgemeinbildende Schulen (siehe Tabelle<br />
22) mit 54.375 Schülern. Von diesen Schülern wurden ca. 24,5 % an Gymnasien bzw. an Gesamtschulen mit<br />
gymnasialer Oberstufe unterrichtet.<br />
Tabelle 22:<br />
Allgemeinbildende Schulen im Schuljahr 1996/97<br />
Gr<strong>und</strong>schule 65<br />
Gr<strong>und</strong>schule mit Orientierungsstufe 2<br />
Hauptschule mit Gr<strong>und</strong>schulteil 2<br />
Realschule (gesamt)<br />
davon<br />
67<br />
Realschule<br />
9<br />
Realschule mit Gr<strong>und</strong>schule<br />
6<br />
Verb<strong>und</strong>ene Haupt- <strong>und</strong> Realschule<br />
Verb<strong>und</strong>ene Haupt- <strong>und</strong> Realschule<br />
21<br />
mit Gr<strong>und</strong>schule<br />
31<br />
Gymnasium 19<br />
Integrierte Gesamtschule<br />
3<br />
darunter mit gymnasialer Oberstufe<br />
2<br />
Kooperative Gesamtschule<br />
4<br />
darunter mit gymnasialer Oberstufe<br />
1<br />
Förderschule<br />
Stand: 1.9.1996<br />
17<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern<br />
Diesen hohen Anteil an allgemeinbildenden Schulen im gegliederten System in den nächsten 10 bis 15 Jahren<br />
zu erhalten, erscheint angesichts der absehbaren demographischen Entwicklung als sehr problematisch. Bis<br />
zum Jahr 2010 wird sich nach Berechnungen des Amtes für Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung<br />
Mecklenburgische Seenplatte die Anzahl der Personen im Schulalter in ausgewählten Jahrgängen etwa wie<br />
folgt entwickeln (siehe Tabelle 23 <strong>und</strong> Abbildung 6):<br />
Tabelle 23:<br />
Prognose zur Entwicklung der Personen im Schulalter nach Schulbereichen der Jahre 1994 bis 2010<br />
(ohne Wanderung, ger<strong>und</strong>ete Zahlen)<br />
Schulbereiche 1994 2000 2005 2010<br />
Primarbereich<br />
(1.-4. Klasse)<br />
21.750 11.000 7.000 7.000<br />
Sek<strong>und</strong>arbereich I<br />
(5.-10.Klasse)<br />
34.000 31.600 17.500 10.450<br />
Sek<strong>und</strong>arbereich II<br />
(11.-12.Klasse)<br />
10.300 11.150 10.600 3.900<br />
Quelle: Eigene Berechnung auf der Gr<strong>und</strong>lage von Daten des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
129
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Abbildung 6:<br />
Entwicklung der Personen im Schulalter nach Schulbereichen der Jahre 1994 bis 2010<br />
(ohne Wanderung, ger<strong>und</strong>ete Zahlen)<br />
Quelle: Eigene Berechnung auf der Gr<strong>und</strong>lage von Daten des Statistischen Landesamtes M-V<br />
Die Anzahl der Personen im Schulalter wird im Zeitraum 1994 bis 2010 differenziert nach Bildungsbereichen<br />
<strong>und</strong> zeitlich versetzt um ca. 62 - 70 % zurückgehen. Dieser demographischen Entwicklung muß in den<br />
Schulentwicklungsplänen der Landkreise <strong>und</strong> der kreisfreien Stadt Neubrandenburg, vor allem in Hinblick auf<br />
Organisationsformen <strong>und</strong> Standortverteilung der allgemeinbildenden Schulen, Rechnung getragen werden.<br />
8.3.3 Förderschulen<br />
(1) Behinderte Kinder <strong>und</strong> Jugendliche sollen in der Planungsregion eine ihnen<br />
angemessene sonderpädagogische Förderung in möglichst allen Schularten erhalten.<br />
(2) Förderschulen sollen innerhalb ihrer unterschiedlich großen Einzugsgebiete ihre Standorte<br />
vorrangig in den zentralen Orten haben. An Förderschulen für Seh-, Hör- <strong>und</strong> Körperbehinderte<br />
sowie für bestimmte Sprachbehinderungen, deren Schüler aus dem gesamten<br />
B<strong>und</strong>esland kommen, sind Internate vorzuhalten.<br />
Begründung<br />
zu 8.3.3(1) <strong>und</strong> (2):<br />
130
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
Entsprechend § 36 Abs. 1 Schulgesetz vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 216), zuletzt geändert durch<br />
Artikel 11 des Gesetzes vom 25. September 1997 (GVOBl. M-V S. 502), werden Schüler mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf, die im gemeinsamen Unterricht nicht hinreichend gefördert werden können, in Förderschulen<br />
unterrichtet. Förderschulen sind in ihrer pädagogischen Arbeit auf den individuellen Förderbedarf<br />
der Schüler ausgerichtet. Damit wird das Recht der behinderten Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen auf eine ihren<br />
persönlichen Möglichkeiten entsprechende Bildung <strong>und</strong> Erziehung gesichert. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ist<br />
derjenige Lernort zu wählen, der auf bestmögliche Weise den Förderungsbedürfnissen sowie der Selbstfindung<br />
<strong>und</strong> Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gerecht wird <strong>und</strong> auf die gesellschaftliche<br />
Eingliederung sowie auf die beruflichen Anforderungen vorbereiten kann. Dies sollte möglichst wohnortnah<br />
erfolgen. Die Einlösung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht nur an Förderschulen geb<strong>und</strong>en,<br />
ihm kann auch an anderen allgemeinbildenden Schulen entsprochen werden.<br />
Das vorhandene Netz entspricht dem gegenwärtigen Bedarf. In der Planungsregion gibt es mit Stand vom 1.<br />
September 1996 insgesamt 17 Förderschulen mit 2.408 Schülern (4,4 % aller Schüler der Region).<br />
8.3.4 Berufsbildungseinrichtungen<br />
Die Einrichtungen des beruflichen Bildungswesens sollen in ihrer fachlichen Gliederung<br />
<strong>und</strong> räumlichen Verteilung so gefestigt, ausgebaut <strong>und</strong> aufeinander abgestimmt werden, daß<br />
nach Möglichkeit jedem die seinen Berufswünschen entsprechenden Einrichtungen zur<br />
Ausbildung, Fortbildung <strong>und</strong> Umschulung zur Verfügung stehen. Als Kernstück der<br />
beruflichen Bildung ist die Berufsausbildung im Rahmen des dualen Berufsbildungssystems<br />
in Betrieben <strong>und</strong> Berufsschulen zu sichern. Standorte für berufliche Schulen sind in der<br />
Regel Ober- <strong>und</strong> Mittelzentren. In die arbeitsteilige Kooperation der beruflichen Schulen<br />
zur Erfüllung der unterschiedlichen Bildungsaufträge sind die überbetrieblichen<br />
Berufsbildungsstätten einzubeziehen.<br />
Begründung<br />
Die Zahl der Schulabgänger, die für eine berufliche Ausbildung in Frage kommen, wird bis zum Jahr 2005<br />
etwa konstant bleiben. Im Oberzentrum <strong>und</strong> in den Mittelzentren sowie im Unterzentrum Malchow sind mit<br />
Stand vom 6. November 1996 10 öffentliche berufliche Schulen <strong>und</strong> 3 Schulen in freier Trägerschaft mit<br />
insgesamt 13.794 Schülern vorhanden. Die fachliche Profilierung <strong>und</strong> arbeitsteilige Kooperation der längerfristigen<br />
Standorte beruflicher Schulen sowie die Konzentration auf deren Ausbau, einschließlich des Abbaus<br />
unwirtschaftlicher Nebenstellen, ist für die Sicherung eines qualifizierten <strong>und</strong> vielseitigen Berufsausbildungsangebots<br />
in der Region wichtig.<br />
Berufliche Schulen in freier Trägerschaft können das Bildungsangebot ergänzen.<br />
Für ein differenziertes, den fachlichen Erfordernissen entsprechendes <strong>und</strong> in der Region ausreichendes Ausbildungsangebot<br />
werden bedarfsgerecht weitere Bildungsgänge eingerichtet. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen<br />
für die Förderung <strong>und</strong> Ausbildungsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher weiter zu verbessern.<br />
Besondere Bedeutung für die Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung im öffentlichen Dienst hat darüber hinaus die Landespolizeischule<br />
in Neustrelitz als zentrale Bildungsstätte der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern.<br />
8.3.5 Einrichtungen der Weiterbildung<br />
131
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Zur Anpassung an die laufenden Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie zur Verbesserung<br />
der beruflichen Mobilität ist ein ausreichend breites Angebot der beruflichen<br />
Weiterbildung, aber auch der allgemeinen <strong>und</strong> politischen Weiterbildung anzustreben, das<br />
von anerkannten Einrichtungen in kommunaler wie freier Trägerschaft bereitgestellt<br />
werden kann. Standorte für Einrichtungen der Weiterbildung sind in der Regel Ober-,<br />
Mittel- <strong>und</strong> Unterzentren. Weiterbildungseinrichtungen haben gemäß Weiterbildungsgesetz<br />
vom 28. April 1994 (GVOBl. M-V S. 555), zuletzt geändert durch § 20 des Gesetzes vom<br />
17. Juli 1995 (GVOBl. M-V S. 332), gleichrangig allgemeine, politische <strong>und</strong> berufliche<br />
Weiterbildungsaufgaben zu erfüllen.<br />
Begründung<br />
Weiterbildung ist ein eigenständiger, mit Schule, Hochschule <strong>und</strong> Berufsausbildung gleichberechtigter <strong>Teil</strong><br />
des Bildungswesens <strong>und</strong> leistet einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktförderung. Die Weiterbildungseinrichtungen<br />
richten ihre Maßnahmen auch auf die Gruppe der Arbeitslosen oder von der Arbeitslosigkeit bedrohten<br />
Erwerbstätigen. Weiterbildung kann darüber hinaus die kulturelle <strong>und</strong> soziale Integration fördern. Die<br />
anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung in kommunaler wie freier Trägerschaft tragen dazu bei, daß<br />
allen Bewohnern der Region Weiterbildungseinrichtungen in zumutbarer Entfernung zur Verfügung stehen.<br />
Die acht Volkshochschulen mit ihren Arbeitsstellen (Altentreptow, Demmin, Friedland, Malchin,<br />
Neubrandenburg, Neustrelitz, Röbel/Müritz, Waren (Müritz)) sollen ein flächendeckendes Angebot gewährleisten.<br />
Sie schaffen sowohl Möglichkeiten für die berufliche Weiterbildung, die Anpassungsfortbildung <strong>und</strong><br />
zum Nachholen von Schulabschlüssen als auch Bildungsmöglichkeiten im Freizeitbereich. Trotz sinkender<br />
Gesamtbevölkerung ist ein Höchstmaß an Angebotsdifferenziertheit aufrechtzuerhalten.<br />
8.4 Hochschulen <strong>und</strong> Forschungseinrichtungen<br />
(1) Die im Oberzentrum vorhandene Fachhochschule Neubrandenburg soll als<br />
Hochschuleinrichtung der Planungsregion erhalten <strong>und</strong> ihr Ausbildungsprofil ausgebaut<br />
werden.<br />
(2) Weitere Forschungseinrichtungen sollen vorrangig im Oberzentrum sowie in den<br />
Mittelzentren geschaffen, erhalten <strong>und</strong> ausgebaut werden.<br />
(3) Die Versorgung mit universitären Studienplätzen sollte vorrangig durch die Ernst-<br />
Moritz-Universität Greifswald erfolgen, die dicht an der nordöstlichen Regionsgrenze liegt.<br />
Ihre Kapazitäten sind entsprechend den Bedürfnissen auch dieser Region auszubauen.<br />
zu 8.4(1):<br />
Die Fachhochschule Neubrandenburg ist die derzeit einzige Hochschuleinrichtung in der Planungsregion. In<br />
ihr waren zum Wintersemester 1996/97 1.320 Studenten eingeschrieben. Es werden 7 Studiengänge angeboten<br />
(Agrarwirtschaft, Bauingenieurwesen, Landespflege, Lebensmitteltechnologie, Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Soziale Arbeit <strong>und</strong> Vermessungswesen). Der erforderliche weitere Ausbau auch der materiell-technischen<br />
Basis <strong>und</strong> die Erweiterung des Ausbildungsprofils trägt zur Imageverbesserung des Oberzentrums <strong>und</strong> der<br />
gesamten Region bei.<br />
132
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
Die Fachhochschule erfüllt über ihre eigentliche bildungspolitische Aufgabe hinaus auch wichtige strukturpolitische<br />
Funktionen. So gehen von ihr nicht unbedeutende erwerbsstrukturelle Effekte <strong>und</strong> darüber hinaus<br />
Impulse auf die langfristige regionale wirtschaftliche <strong>und</strong> kulturelle Entwicklung aus.<br />
zu 8.4(2):<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Technologieeinrichtungen wie z.B. die Fachhochschule Neubrandenburg, das Zentrum für<br />
Lebensmitteltechnologie, das Technologie,- Innovations- <strong>und</strong> Gründerzentrum Neubrandenburg (TIG) oder<br />
die Fernerk<strong>und</strong>ungsstation Neustrelitz als Außenstelle des Fernerk<strong>und</strong>ungsdatenzentrums Pfaffenhofen der<br />
Deutschen Forschungsanstalt für Luft- <strong>und</strong> Raumfahrt e.V. sind für die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere<br />
für die Arbeitsmarktstruktur der Region von großer Bedeutung (siehe auch Programmsatz 6.1(2)).<br />
Ein Bauinformations- <strong>und</strong> -technologiezentrum am Standort Neustrelitz ist mit Stand 1998 in Planung. Ebenso<br />
befindet sich am Standort Teterow (außerhalb der Planungsregion) ein biomedizinisches Technikum mit Stand<br />
1998 in Planung.<br />
zu 8.4(3):<br />
Derzeit kommt 1/5 der Studenten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität aus der Region Mecklenburgische<br />
Seenplatte. Das Spektrum Rechts- <strong>und</strong> Wirtschaftswissenschaft, Theologie, Medizin, Naturwissenschaften,<br />
Sprach- <strong>und</strong> Kulturwissenschaften, Psychologie <strong>und</strong> Sozialwissenschaften ergänzt das Angebot der Fachhochschule<br />
Neubrandenburg qualitativ <strong>und</strong> quantitativ. Absolventen <strong>und</strong> Forschungsdienstleistungen der<br />
Universität stehen dem Arbeitsmarkt <strong>und</strong> der Region selbst zur Verfügung <strong>und</strong> werden aufgr<strong>und</strong> räumlicher<br />
Nähe <strong>und</strong> finanzieller Vorteile zunehmend von Einrichtungen der Region genutzt<br />
Darüber hinaus ist auch der Ausbau der Kooperation mit der Universität Rostock, den Fachhochschulen,<br />
außerhochschulischen Einrichtungen, Technologiezentren <strong>und</strong> -transfereinrichtungen sowie weiteren Forschungseinrichtungen<br />
des Landes von Bedeutung.<br />
8.5 Jugendhilfe<br />
Die Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste sollen so geplant werden, daß Kontakte in der Familie <strong>und</strong><br />
im sozialen Umfeld erhalten <strong>und</strong> gepflegt werden können. Entsprechende Einrichtungen<br />
sollen in zentralen Orten <strong>und</strong> entsprechend den Erfordernissen auch in anderen Gemeinden<br />
vorhanden sein. Art <strong>und</strong> Größe der Einrichtungen sollen der Zentralitätsstufe des Ortes<br />
bzw. den örtlichen Erfordernissen entsprechen. Es ist ein möglichst vielfältiges <strong>und</strong><br />
aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen zu schaffen. Dazu gehören:<br />
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutz, Angebote zur<br />
Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung von Kindertageseinrichtungen,<br />
Tagespflege, Hilfe zur Erziehung (Heime etc.).<br />
Begründung<br />
Die Lage der Jugendlichen wird durch mehr Freizeit <strong>und</strong> größere finanzielle Möglichkeiten auf der einen<br />
Seite, Probleme am Lehrstellen- <strong>und</strong> Arbeitsmarkt auf der anderen Seite bestimmt. Dementsprechend müssen<br />
Freizeit- <strong>und</strong> Bildungseinrichtungen bzw. -angebote sowie Beratungsdienste in allen <strong>Teil</strong>en der Region auf-,<br />
ausgebaut <strong>und</strong> qualitativ verbessert werden. Die in der Region für die Jugend zur Zeit vorhandenen<br />
soziokulturellen Einrichtungen, die zum <strong>Teil</strong> durch Entlassung aus kommunaler Trägerschaft von Schließung<br />
bedroht sind, reichen bei weitem nicht aus.<br />
133
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Jugenhilfe unterstützt die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag <strong>und</strong> will Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen das Hineinwachsen<br />
in die Gesellschaft erleichtern. Sie unterstützt bei Konflikten zwischen Eltern <strong>und</strong> ihren Kindern,<br />
wenn ein Elternteil ausfällt, bei Trennung <strong>und</strong> Scheidung <strong>und</strong> bei Benachteiligung von jungen Menschen.<br />
Jugendhilfe sorgt für einen gleichmäßigen dezentralen, sozialorientierten Aufbau von Einrichtungen <strong>und</strong><br />
Diensten wie insbesondere<br />
- Heimen <strong>und</strong> betreuten Wohnformen,<br />
- Jugendhilfestationen mit einem flexiblen Hilfeangebot,<br />
- Erziehungsberatungsstellen,<br />
- Familienbildungsstätten,<br />
- Trennungs- <strong>und</strong> Scheidungsberatungsstellen,<br />
- Familienberatungsstellen,<br />
- Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen,<br />
- Notaufnahmestellen für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche.<br />
Der Gesetzgeber hat die Jugendämter verpflichtet, erforderliche <strong>und</strong> geeignete Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste<br />
rechtzeitig <strong>und</strong> ausreichend zur Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung der früheren geburtenreichen<br />
Jahrgänge der Heranwachsenden in Mecklenburg-Vorpommern besteht für diese Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste<br />
ein sehr hoher Bedarf.<br />
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist ein Rechtsanspruch auf geeignete <strong>und</strong> notwendige Hilfe gesetzlich<br />
verankert. Für Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfestationen wird von einem Mindestbedarf von durchschnittlich einer<br />
Einrichtung für 25.000 Einwohner ausgegangen.<br />
8.6 Sport<br />
(1) In allen <strong>Teil</strong>räumen der Planungsregion sollen zur Förderung von Breiten- <strong>und</strong> Leistungssport<br />
<strong>und</strong> zur Entwicklung des Freizeitsports Sporteinrichtungen vorgehalten werden.<br />
Das Netz der Sportanlagen soll weiter ausgebaut werden.<br />
(2) Spiel- <strong>und</strong> Sportstätten sollen in allen zentralen Orten der Nahbereichsebene vorhanden<br />
sein. Größere Sportplatzanlagen, Dreifachsporthallen mit Zuschauerkapazität sowie Hallen-<br />
<strong>und</strong> Freibäder sollen an geeigneten Standorten vorrangig in den Mittelzentren <strong>und</strong> Mittelzentren<br />
mit <strong>Teil</strong>funktionen vorgehalten werden.<br />
(3) Das Oberzentrum soll zumindest über ein Sportstadion, eine Großsporthalle <strong>und</strong> eine<br />
Großschwimmhalle verfügen.<br />
(4) Die vorhandenen <strong>und</strong> zu schaffenden wohnungsnahen Sport- <strong>und</strong> Spielanlagen sollen<br />
möglichst für den Schulsport, den Breitensport sowie die Freizeitgestaltung vielfältig<br />
genutzt werden können.<br />
Begründung<br />
zu 8.6(1) bis (4):<br />
134
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
Der Sport bildet besonders auf Gr<strong>und</strong> seiner erzieherischen, ges<strong>und</strong>heitsfördernden, bildenden <strong>und</strong> sozialen<br />
Funktion einen bedeutsamen Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Sportanlagen sind ein wichtiger Bestandteil<br />
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Beim Bau von Sporteinrichtungen ist eine Mehrfachnutzung anzustreben,<br />
um somit beispielsweise auch im Schulsport neue Impulse zu setzen. Erstrebenswert ist daher die<br />
räumliche Nähe zwischen Sportanlagen <strong>und</strong> Schulstandorten.<br />
8.7 Kultur<br />
(1) Das kulturelle Angebot in der Region soll gesichert <strong>und</strong> weiterentwickelt werden. Als<br />
Voraussetzung dafür sollen in den zentralen Orten der Region die vorhandenen kulturellen<br />
Einrichtungen erhalten <strong>und</strong> ausgebaut werden.<br />
(2) Die vorhandenen Museen sollen in ihrem Bestand gesichert <strong>und</strong> weiter ausgebaut werden.<br />
Auf die Neueinrichtung von Museen soll dem Bedarf entsprechend hingewirkt werden.<br />
(3) Die Musikpflege soll durch den Erhalt der in der Region vorhandenen Musikschulen gestärkt<br />
werden.<br />
(4) Die überregional ausstrahlenden kulturellen Einrichtungen sollen erhalten <strong>und</strong> für das<br />
Image der Region noch besser genutzt werden.<br />
(5) Bibliotheken als Kultur- <strong>und</strong> Bildungseinrichtungen mit umfassender Literatur- <strong>und</strong> Informationsdienstleistung<br />
sollen bestehen bleiben. Der Einsatz von Fahrbibliotheken soll<br />
verstärkt werden.<br />
(6) Die kulturelle Heimatpflege <strong>und</strong> die Alltagskultur sollen gefördert werden.<br />
Begründung<br />
zu 8.7(1):<br />
Eine intakte kulturelle Infrastruktur ist Voraussetzung, um die Attraktivität der Region <strong>und</strong> jeder einzelnen<br />
Kommune zu steigern. Sie ist eine Bedingung bei der Ansiedlung von Industrie-, Wirtschafts- <strong>und</strong> Dienstleistungsunternehmen.<br />
In der Planungsregion bestehen materielle Gr<strong>und</strong>lagen für ein vielfältiges kulturelles<br />
Leben, das auch zur Identifikation der Bürger mit ihrer Landschaft, ihrer Stadt, ihres Dorfes beiträgt. Diese<br />
sind auch für die Weiterentwicklung des Tourismus in der Region zu nutzen.<br />
135
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 8.7(2):<br />
Die Museen, Heimatstuben <strong>und</strong> Galerien der Region, vor allem in den zentralen Orten <strong>und</strong> Tourismusschwerpunkt-<br />
<strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräumen, üben wichtige Funktionen für die kulturelle Identifikation<br />
<strong>und</strong> Traditionspflege aus.<br />
zu 8.7(3):<br />
Musikschulen befinden sich in Altentreptow, Malchin, Neubrandenburg, Neustrelitz <strong>und</strong> Waren (Müritz). In<br />
anderen Städten befinden sich Außenstellen. Sie sind eine Gr<strong>und</strong>lage für eine solide musikalische Ausbildung<br />
<strong>und</strong> machen einen festen Bestandteil der Jugendkulturarbeit in den Zentren <strong>und</strong> der gesamten Region aus.<br />
zu 8.7(4):<br />
Zur überregionalen Ausstrahlungskraft tragen unter anderem solche Einrichtungen wie das Landestheater<br />
Mecklenburg Strelitz, die Philharmonie Neubrandenburg, die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz <strong>und</strong> das<br />
Kammertheater Neubrandenburg bei. Für alle kulturellen Aktivitäten <strong>und</strong> Einrichtungen der Region gilt, daß<br />
sie nur durch kommunale <strong>und</strong> staatliche Unterstützung stabilisiert <strong>und</strong> weiterentwickelt werden können.<br />
zu 8.7(5):<br />
Bibliotheken befinden sich in allen zentralen Orten <strong>und</strong> bilden dort eine kulturelle Begegnungsstätte. Der<br />
Einsatz von Fahrbibliotheken ermöglicht eine breite Versorgung der Bevölkerung außerhalb der zentralen<br />
Orte.<br />
zu 8.7(6):<br />
Vereine, Verbände soziokulturelle Initiativen <strong>und</strong> Einrichtungen bieten ein vielfältiges kulturelles Angebot<br />
<strong>und</strong> schaffen eine Identifikation der Bürger mit der Heimatkultur <strong>und</strong> Kulturgeschichte der Region. Durch die<br />
Heimatkulturarbeit <strong>und</strong> die Soziokultur werden die Zeugnisse der Vergangenheit bewahrt <strong>und</strong> die soziale <strong>und</strong><br />
kulturelle Verb<strong>und</strong>enheit mit der Region gefördert.<br />
8.8 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />
(1) Denkmale von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volksk<strong>und</strong>licher oder<br />
wissenschaftlicher Bedeutung sollen geschützt, erhalten <strong>und</strong> gepflegt werden. Dabei ist<br />
auch die Schutzwürdigkeit der näheren Umgebung zu berücksichtigen.<br />
(2) Denkmalpflegerisch bedeutende bauliche Anlagen sollen unter Schonung ihrer<br />
wertvollen Bausubstanz mit Funktionen ausgestattet werden, die ihre Sanierung <strong>und</strong><br />
dauernde Erhaltung ermöglichen. Auf eine sinnvolle Nutzung leerstehender oder<br />
ungenügend genutzter Baudenkmale soll hingewirkt werden.<br />
136
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
(3) Auf eine Einbindung von Bodendenkmalen in Tourismus- <strong>und</strong> Naherholungsgebiete,<br />
Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume für Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege sowie in innerörtliche<br />
Freiräume soll hingewirkt werden.<br />
Begründung<br />
zu 8.8(1):<br />
In der Planungsregion besteht ein großer Reichtum an kulturellen <strong>und</strong> historischen Denkmalen. Diese sind<br />
größtenteils bereits als schutzwürdige Objekte im Sinne des Denkmalschutzgesetzes erfaßt. Die Denkmale<br />
bedürfen zu ihrem Erhalt aufwendiger Pflegemaßnahmen. Dieser Aufwand ist unter anderem dadurch gerechtfertigt,<br />
daß mit den Denkmalen attraktive Anziehungspunkte geschaffen <strong>und</strong> erhalten werden, die sowohl<br />
für die touristische Entwicklung der Region (siehe Programmsatz 7.3.1) als auch insgesamt für die<br />
Aufwertung der ländlich geprägten Region als Lebens- <strong>und</strong> Kulturraum von Bedeutung sind. Da Denkmale<br />
immer auch in einen spezifischen städtebaulichen oder landschaftlichen Kontext eingeb<strong>und</strong>en sind, der bedeutend<br />
für ihre Wirkung sein kann, ist auch deren Umgebung gemäß § 2 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz vom<br />
30. November 1993 (GVOBl. M-V S. 975), zuletzt geändert am 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 13), mit zu<br />
berücksichtigen.<br />
zu 8.8(2):<br />
Mangelndes wirtschaftliches Interesse <strong>und</strong>/oder fehlendes Kapital erschwert oder verhindert zumeist den Erhalt<br />
bedeutender baulicher Anlagen. Es bedarf deshalb im Rahmen der kommunalen Gesamtentwicklung besonderer<br />
Anstrengungen, um die historisch wertvolle Bausubstanz mit solchen Funktionen zu versehen, die<br />
ihre denkmalpflegerische Sanierung <strong>und</strong> dauernde Erhaltung ermöglichen. Die sinnvolle Nutzung leerstehender<br />
oder ungenügend genutzter Baudenkmale schafft vielfach die Voraussetzungen zu deren dauernder<br />
Erhaltung. Dadurch können auch die mit der Pflege <strong>und</strong> dem Erhalt verb<strong>und</strong>enen finanziellen Aufwendungen<br />
verringert werden (siehe auch Programmsatz 5.2.2(2)).<br />
zu 8.8(3):<br />
Bodendenkmale werden insbesondere durch unwiderrufliche Eingriffe im Rahmen der Siedlungstätigkeit, des<br />
Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur oder auch landwirtschaftlicher <strong>und</strong> bergbaulicher Maßnahmen in ihrem<br />
Bestand bedroht. Durch die Einbindung in Gebiete, die auf Gr<strong>und</strong> ihrer besonderen Funktion über den<br />
bestehenden Zustand hinaus auch langfristig möglichst keinen nachhaltigen Veränderungen unterzogen<br />
werden sollen, kann der Bestand der Bodendenkmale zumindest teilweise gesichert werden. Eine Einbeziehung<br />
in solche Gebiete bei flächenbezogenen Planungen wie z.B. der Bauleitplanung oder auch der Flurbereinigung<br />
ist daher sorgfältig zu prüfen. In geeigneten Fällen können Bodendenkmale auch durch Gr<strong>und</strong>erwerb<br />
durch die öffentliche Hand gesichert werden.<br />
137
Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
138
RROP Mecklenburgische Seenplatte Soziale <strong>und</strong> kulturelle Infrastruktur<br />
139
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
9. Verkehr<br />
9.1 Allgemeines<br />
(1) Als eine Gr<strong>und</strong>voraussetzung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion<br />
ist die Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Das gesamte Verkehrssystem soll so entwickelt<br />
werden, daß es den unterschiedlichen raum- <strong>und</strong> siedlungsstrukturellen Anforderungen<br />
hinsichtlich Verbindung <strong>und</strong> Erschließung gerecht wird.<br />
Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur ist auf einen optimalen Leistungsaustausch sowohl<br />
innerhalb der Region als auch überregional auszurichten.<br />
(2) Für die innerregionale Erschließung ist angesichts der dispersen Siedlungsstruktur die<br />
Sicherung der Erreichbarkeit, insbesondere des Oberzentrums Neubrandenburg sowie der<br />
zentralen Orte untereinander <strong>und</strong> aus ihren Nahbereichen, von Bedeutung. Die einzelnen<br />
Verkehrsnetze sind darauf abzustimmen <strong>und</strong> gegebenenfalls zu ergänzen.<br />
(3) Überregional von besonderer Bedeutung ist die Anbindung der Planungsregion, insbesondere<br />
des Oberzentrums Neubrandenburg <strong>und</strong> der Mittelzentren Neustrelitz, Demmin<br />
<strong>und</strong> Waren (Müritz) sowie des Mittelzentrums mit <strong>Teil</strong>funktionen Malchin, an die anderen<br />
Oberzentren in Mecklenburg-Vorpommern sowie an die Ballungsräume Berlin, Hamburg,<br />
Lübeck <strong>und</strong> Stettin.<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der überregionalen Anbindung betreffen vor allem den Ausbau:<br />
• der Nord-Süd-Verkehrsverbindung (Rügen) - (Strals<strong>und</strong>) - Demmin - Neubrandenburg<br />
- Neustrelitz - (Berlin),<br />
• der Verkehrsverbindung nach Südwesten (in RichtungHannover/Ruhrgebiet),<br />
• der Ost-West-Verbindungen (Stettin) - (Pasewalk) - (Strasburg) - Neubrandenburg -<br />
(Rostock) sowie<br />
• Neubrandenburg - Waren (Müritz) - (Schwerin) - (Lübeck) - (Hamburg).<br />
(4) Bei der Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur in der Planungsregion ist durch Maßnahmen<br />
zur Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung sowie zur Reduzierung von Lärm-<br />
<strong>und</strong> Schadstoffemissionen darauf hinzuwirken, daß die Umweltbelastungen durch den<br />
Verkehr reduziert werden <strong>und</strong> durch sorgfältige Trassenwahl eine sparsame <strong>und</strong> schonende<br />
Flächeninanspruchnahme erfolgt.<br />
Standortentscheidungen sind unter Berücksichtigung der Verkehrsinfrastruktur zu treffen,<br />
um unnötiges Verkehrsaufkommen zu vermeiden bzw. das entstehende<br />
Verkehrsaufkommen so gering wie möglich zu halten.<br />
140
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
(5) Das Verkehrswesen in der Planungsregion soll effektiv gestaltet werden durch die<br />
Kombination <strong>und</strong> Kooperation verschiedener Verkehrsträger <strong>und</strong> ihre Verknüpfung mittels<br />
Schnittstellen wie z.B. Logistikzentren, Park- <strong>und</strong> Ride-Anlagen, Bike- <strong>und</strong> Ride-Anlagen.<br />
(6) Auf den überregionalen <strong>und</strong> innerregionalen Achsen der Planungsregion ist eine<br />
attraktive Verkehrsbedienung sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr zu<br />
sichern.<br />
Begründung<br />
zu 9.1(1):<br />
In der hochmobilen Gesellschaft kommt der überregionalen sowie der regionalen Verkehrsinfrastruktur besondere<br />
Bedeutung zu. Über ein ausgewogenes Angebot an Verkehrsmitteln <strong>und</strong> Verkehrswegen wird dem<br />
steigenden Mobilitätsbedürfnis von Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft entsprochen. Ebenso steigen die qualitativen<br />
Anforderungen von Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft an das Verkehrssystem hinsichtlich Schnelligkeit, Flexibilität<br />
<strong>und</strong> Zuverlässigkeit. Angesichts des auch zukünftig absehbaren ansteigenden Verkehrsaufkommens ist für die<br />
Planungsregion ein leistungsfähiges, kostengünstiges sowie wenig umweltbelastendes Verkehrssystem<br />
erforderlich.<br />
zu 9.1(2):<br />
Mit der Realisierung dieses Zieles wird der Bevölkerung der Zugang zu Arbeitsstätten, Einrichtungen der<br />
sozialen <strong>und</strong> kulturellen Infrastruktur, Dienstleistungseinrichtungen sowie Freizeit- <strong>und</strong> Erholungseinrichtungen<br />
ermöglicht. Gerade in den dünn besiedelten ländlichen Räumen der Planungsregion kommt der<br />
Erreichbarkeit der zentralen Orte <strong>und</strong> somit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge durch alle <strong>Teil</strong>e der Bevölkerung<br />
große Bedeutung zu.<br />
zu 9.1(3):<br />
Durch ihre Lage im Ostteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommt der Planungsregion im Hinblick<br />
auf den europäischen Markt eine Transitfunktion zwischen Skandinavien <strong>und</strong> dem süddeutschen/südeuropäischen<br />
Raum sowie zwischen Ost- <strong>und</strong> Westeuropa zu. Mit dem Ausbau der Nord-Süd-Verkehrsverbindung<br />
(Strals<strong>und</strong>) - Demmin - Neubrandenburg - (Berlin) können Entwicklungspotentiale aus der Achse<br />
Skandinavien - Berlin - südliche B<strong>und</strong>esländer genutzt werden. Der Ausbau der Ost-West-Verkehrsverbindung<br />
(Stettin) - (Pasewalk) - (Strasburg) - Neubrandenburg - (Rostock) - (Lübeck) - (Hamburg) führt<br />
vor allem zu einem Anschluß der Planungsregion an die wichtigsten Nord- <strong>und</strong> Ostseehäfen.<br />
Die gegenwärtig vorhandene Anbindung der Stadt Neubrandenburg an die überregionalen Verkehrsnetze<br />
entspricht nicht den Erfordernissen eines Oberzentrums. Die genannten Maßnahmen tragen mit zu einer<br />
Verbesserung der Lagegunst <strong>und</strong> der Erreichbarkeit sowohl der Stadt als auch der gesamten Region bei.<br />
Da der <strong>Teil</strong>raum des ehemaligen Kreises Demmin dem oberzentralen Verflechtungsbereich Strals<strong>und</strong>/<br />
Greifswald zugehört (siehe Programmsatz 2.2), ist für diesen Bereich der Planungsregion die verkehrliche<br />
Anbindung auch an Greifswald von besonderer Bedeutung.<br />
141
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 9.1(4):<br />
Die Planungsregion zeichnet sich durch eine hohe Umweltqualität aus. Mittels gezielter Maßnahmen zur<br />
Verringerung der Belastungen von Natur <strong>und</strong> Landschaft durch den Verkehr, wie beispielsweise Bündelung<br />
des Verkehrs auf möglichst wenige, aber leistungsfähige Trassen mit dem Aufbau eines funktionalen<br />
Straßennetzes, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs in Verbindung mit der Förderung des<br />
ÖPNV <strong>und</strong> des Radverkehrs, Erhalt großer unzerschnittener <strong>und</strong> störungsarmer Landschaftsräume <strong>und</strong> gezielte<br />
Verkehrsberuhigung, unterstützt das Verkehrswesen die Erhaltung dieser Umweltqualität.<br />
Wohngebiete, Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebiete, Einzelhandelsgebiete <strong>und</strong> Erholungs- <strong>und</strong> Freizeiteinrichtungen<br />
erzeugen unterschiedliche Verkehrsbelastungen. Somit haben Festlegungen der Flächennutzung direkten<br />
Einfluß auf das zu erwartende Verkehrsaufkommen.<br />
Die Verknüpfung räumlicher Funktionen <strong>und</strong> die gezielte standörtliche Zuordnung dieser Funktionen trägt<br />
dazu bei, das Verkehrsaufkommen <strong>und</strong> den Flächenverbrauch für Verkehrsflächen sowie die Belastungen<br />
durch Lärm <strong>und</strong> Schadstoffemissionen gering zu halten.<br />
zu 9.1(5):<br />
Bei Einbeziehung der oben genannten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Um- <strong>und</strong> Ausbau der vorhandenen<br />
Verkehrswege können Effektivität <strong>und</strong> Leistungsfähigkeit des Verkehrswesens in der Planungsregion<br />
erhöht werden.<br />
zu 9.1(6):<br />
Die wichtigsten Straßenverbindungen <strong>und</strong> Eisenbahnlinien liegen den überregionalen <strong>und</strong> innerregionalen<br />
Achsen zugr<strong>und</strong>e. Diese sind auf die Verbindungsfunktion zwischen den eingeb<strong>und</strong>enen Zentren ausgerichtet.<br />
Im Zuge der Achsen besteht die Möglichkeit der wirksamen <strong>und</strong> umweltentlastenden Bündelung <strong>und</strong><br />
Ergänzung von öffentlichem Personenverkehr, motorisiertem Individualverkehr <strong>und</strong> Güterverkehr auf Schiene<br />
<strong>und</strong> Straße.<br />
9.2 Öffentlicher Personenverkehr<br />
(1) Der öffentliche Personenverkehr soll in der Planungsregion als eine Alternative zum<br />
Individualverkehr entwickelt werden.<br />
(2) Der öffentliche Personennahverkehr soll die Erreichbarkeit der zentralen Orte als Entwicklungsschwerpunkte<br />
<strong>und</strong> Konzentrationspunkte der Versorgungs-, Bildungs- <strong>und</strong><br />
Sozialeinrichtungen sowie der Arbeitsstätten sichern.<br />
Linienführung <strong>und</strong> Bedienung des öffentlichen Personennahverkehrs sind in der Planungsregion<br />
so zu entwickeln <strong>und</strong> auszurichten, daß die zentralen Orte untereinander <strong>und</strong> von<br />
ihren Verflechtungsbereichen her in zumutbarem Zeitaufwand <strong>und</strong> mit angemessenem<br />
Beförderungskomfort zu erreichen sind.<br />
142
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
(3) Der öffentliche Personennahverkehr bedarf einer deutlichen Qualitätserhöhung.<br />
(4) In den größeren Städten, vor allem im Oberzentrum Neubrandenburg <strong>und</strong> den Mittelzentren<br />
der Planungsregion, soll dem öffentlichen Personennahverkehr nach Möglichkeit<br />
eine Vorrangfunktion im innerstädtischen Verkehr eingeräumt werden.<br />
(5) In den ländlichen Räumen soll eine Mindestbedienung im öffentlichen Personennahverkehr<br />
gewährleistet werden, um der Bevölkerung möglichst gleichwertige Mobilitätsangebote<br />
zur Verbindung der Wohnstandorte mit den zentralen Orten, Schulen,<br />
Arbeitsstätten <strong>und</strong> Erholungsräumen zu bieten.<br />
In den nachfragearmen ländlichen Räumen sind alternative Bedienungsformen als<br />
Ergänzung zum Linienverkehr zur Sicherung eines akzeptablen <strong>und</strong> zugleich wirtschaftlich<br />
tragfähigen ÖPNV-Angebotes anzustreben.<br />
Ebenso sind Möglichkeiten zu einer Mehrfachnutzung des ÖPNV durch Kombination mit<br />
dem Angebot weiterer infrastruktureller Dienstleistungen zu erproben <strong>und</strong> - falls machbar -<br />
einzuführen.<br />
Begründung<br />
zu 9.2(1):<br />
In der Planungsregion ist der Bus das wichtigste Verkehrsmittel im öffentlichen Personenverkehr. Im<br />
Zeitraum 1996/97 wurden in der Planungsregion im ÖPNV ca. 160 Buslinien mit einer Netzlänge von ca.<br />
4.500 km befahren.<br />
Bei einer Liniendichte von ca. 0,8 km/km 2 sind etwa 99 % der Bevölkerung der Planungsregion an den<br />
öffentlichen Busverkehr angeschlossen. Dabei gibt es jedoch große Differenzen bei der Anzahl der Busverbindungen<br />
auf den verschiedenen Linien. Diese liegen zwischen mehrmals täglich <strong>und</strong> einmal wöchentlich.<br />
Die gegenwärtige Situation ist gekennzeichnet durch eine mit hohen Zuwachsraten steigende Motorisierung<br />
<strong>und</strong> weiter zurückgehende Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel. Die Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel<br />
<strong>und</strong> damit die Effizienz der Nahverkehrsbetriebe sind rückläufig. Die Gefahr von Angebotseinschränkungen<br />
<strong>und</strong> damit eine Verschlechterung der ÖPNV-Bedienungsqualität zeichnen sich ab. Öffentliche<br />
Verkehrsmittel sind jedoch eine vernünftige, sichere <strong>und</strong> umweltgerechte Alternative zum motorisierten<br />
Individualverkehr. Je mehr Autofahrer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, desto stärker verringern sich<br />
Abgas- <strong>und</strong> Lärmbelastungen. Busse <strong>und</strong> Bahnen haben einen geringeren Primärenergieverbrauch als Pkw<br />
<strong>und</strong> tragen somit zur Einsparung von Energie bei. Desweiteren sind Busse <strong>und</strong> Bahnen sichere Verkehrsmittel.<br />
Um den öffentlichen Personenverkehr als wichtige Alternative zum Individualverkehr insbesondere zur<br />
Sicherung der Daseinsvorsorge für die nichtmotorisierten Bevölkerungsteile zu entwickeln, ist er bedarfsgerecht,<br />
flexibel <strong>und</strong> wettbewerbsfähig zu gestalten.<br />
zu 9.2(2):<br />
Zentrale Orte bilden das wirtschaftliche, soziale <strong>und</strong> kulturelle Zentrum ihres Verflechtungsbereiches, für das<br />
sie, in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Einstufung, bestimmte Versorgungsaufgaben zu übernehmen haben.<br />
Es ist zu gewährleisten, daß die in den zentralen Orten vorhandenen Dienstleistungs- <strong>und</strong> Infrastruktureinrichtungen<br />
für alle <strong>Teil</strong>e der Bevölkerung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.<br />
143
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 9.2(3):<br />
In den ländlichen Räumen sind Fahrgastrückgänge insbesondere durch die Konkurrenz des privaten Pkw zu<br />
verzeichnen. In den Städten bleibt der ÖPNV immer häufiger im Stau stehen <strong>und</strong> verliert dadurch an<br />
Attraktivität. Pünktlichkeit <strong>und</strong> Anschlußsicherung können nicht mehr gewährleistet werden. Tariferhöhungen<br />
ohne gleichzeitige Serviceverbesserungen führen zu weiteren Fahrgastverlusten. Durch den Ausbau, die<br />
Qualitätserhöhung <strong>und</strong> attraktive Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs kann bei Beibehaltung der<br />
Mobilität der Bevölkerung eine Verringerung der Verkehrsbelastungen erreicht werden. Dies führt zur<br />
Verbesserung der Verkehrssituation in den stärker verdichteten Räumen sowie zur umweltgerechten Gestaltung<br />
der Verkehrssituation in den dünn besiedelten ländlichen Räumen <strong>und</strong> in den Städten. Geeignete<br />
Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität <strong>und</strong> Attraktivität des ÖPNV sind:<br />
- Bedienung der Achsen im regionalen Busverkehr durch Schnellbuslinien mit einer begrenzten Zahl von<br />
Zwischenhalten,<br />
- Taktverkehr auf den Strecken im Verlauf von überregionalen Achsen,<br />
- höhere Reisegeschwindigkeiten,<br />
- möglichst umsteigefreie Verbindungen bzw. unmittelbare Anschlüsse bei Umsteigenotwendigkeit,<br />
- Abstimmung der Fahrpläne <strong>und</strong> des Haltestellennetzes zwischen den einzelnen Verkehrsträgern,<br />
insbesondere auch zwischen Schiene <strong>und</strong> Straße, durch Schaffung benutzerfre<strong>und</strong>licher<br />
Umstiegsmöglichkeiten <strong>und</strong> Wegeverkürzungen zwischen Busverkehr <strong>und</strong> Schiene,<br />
- Erarbeitung einer Haltestellenkonzeption,<br />
- Realisierung verkehrlicher Kooperation mit vereinheitlichtem Tarifsystem,<br />
- kostengünstige Tarife,<br />
- Abstimmung der Fahrpläne des Regionalverkehrs auf überregionale Fahrpläne,<br />
- attraktive Fahrzeuge <strong>und</strong> Haltestellen bzw. Bahnhöfe, alten- <strong>und</strong> behindertengerechter Ausbau,<br />
- Erweiterung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere in Naherholungsgebieten,<br />
an Sonn- <strong>und</strong> Feiertagen bzw. in Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong> -entwicklungsräumen während der Saison,<br />
- mehr Komfort <strong>und</strong> Service.<br />
zu 9.2(4):<br />
Der Umfang des motorisierten Individualverkehrs in den Innenstädten größerer Zentren ist auf ein vernünftiges,<br />
umwelt- <strong>und</strong> sozialverträgliches Maß zu beschränken. Dies ist notwendig zur Entlastung der Innenstädte<br />
von Autokolonnen, zur Verringerung der vom Verkehr ausgehenden Emissionen sowie zum Erhalt der<br />
gewachsenen historischen Stadtkerne. Eine Bevorzugung des öffentlichen Personennahverkehrs (insbesondere<br />
dort, wo es mit wenig Aufwand sinnvoll erscheint) im Zusammenhang mit einer Attraktivitätssteigerung der<br />
Verkehrsangebote in den Innenstadtbereichen führt infolge der zu erwartenden stärkeren Inanspruchnahme<br />
öffentlicher Verkehrsmittel zur Entlastung der Innenstädte von den Verkehrsbelastungen des motorisierten<br />
Individualverkehrs. Durch Führung von Nahverkehrstrassen durch die Stadtzentren, Verknüpfung einzelner<br />
Verkehrsträger <strong>und</strong> Beförderungsangebote in Verbindung mit dem motorisierten Individualverkehr,<br />
Einrichtung gesonderter Busspuren sowie weitere Maßnahmen zur Bevorrechtigung öffentlicher<br />
Verkehrsmittel können Verkehrsbehinderungen des ÖPNV abgebaut werden. Der öffentliche Personennahverkehr<br />
gewinnt durch regelmäßigen, störungsfreien <strong>und</strong> zügigen Fahrtablauf an Attraktivität.<br />
zu 9.2(5):<br />
Entsprechend dem Gr<strong>und</strong>satz der Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen<br />
in allen <strong>Teil</strong>räumen des Landes ist es angesichts der dispersen Siedlungsstruktur in der Planungsregion<br />
von besonderer Bedeutung, auch für die in schwächer besiedelten Gebieten der ländlichen Räume<br />
lebenden Menschen ein Mindestangebot an Leistungen des öffentlichen Verkehrs im Sinne der Daseinsvorsorge,<br />
insbesondere für die nichtmotorisierten Bevölkerungsteile, zu sichern.<br />
144
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
Der notwendige Umfang des Mindestangebotes ist in den ländlichen Räumen differenziert zu betrachten.<br />
Dazu sind im Rahmen regionaler Verkehrskonzepte detaillierte Untersuchungen durchzuführen.<br />
In den ländlichen Räumen der Planungsregion, in denen nur ein geringes Verkehrsaufkommen für den<br />
öffentlichen Nahverkehr vorhanden ist, sind neben dem Einsatz kleinerer Busse alternative Transportmöglichkeiten<br />
notwendig, um Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Als Ergänzung bzw. Zubringer zu öffentlichen<br />
Nahverkehrsmitteln sind beispielsweise individuelle Fahrgemeinschaften, Bürgerbusse oder Anruf-Sammel-<br />
Taxi denkbar. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Auslastung des ÖPNV besteht in der Mehrfachnutzung. So<br />
wäre z.B. im Rahmen regionaler Verkehrskonzepte zu untersuchen, welche Möglichkeiten zur Übernahme<br />
von Diensten der Post, Kurierdiensten oder anderen Versorgungsleistungen, die in den schwach besiedelten<br />
ländlichen Räumen in anderer Form kaum zu erhalten sind, durch die Betreiber des ÖPNV realisierbar sind.<br />
9.3 Schienenverkehr<br />
(1) Das Schienennetz der Planungsregion ist soweit wie möglich in seinem Bestand zu erhalten<br />
<strong>und</strong> zu modernisieren. Ebenso ist ein auf das System der zentralen Orte<br />
abgestimmtes Netz an Zugangsstellen für den Personen- <strong>und</strong> Güterverkehr zu erhalten.<br />
(2) Durch Angebotsverbesserungen im Personen- <strong>und</strong> Güterverkehr entsprechend den Verkehrsbedürfnissen<br />
sind sowohl gute Fernverkehrsverbindungen als auch eine<br />
bedarfsgerechte innerregionale Bedienung zu gewährleisten. Dazu gehören auch günstige<br />
Verknüpfungsmöglichkeiten der einzelnen Verkehrsträger untereinander, insbesondere<br />
zwischen Straße <strong>und</strong> Schiene, sowie Anschlüsse zwischen Fern-, Regional- <strong>und</strong><br />
Nahverkehr. Damit ist einer weiteren übermäßigen Zunahme des Straßenverkehrs<br />
entgegenzuwirken.<br />
(3) Entsprechend LROP sind folgende Hauptstrecken in der Planungsregion zu sichern <strong>und</strong><br />
hinsichtlich ihrer Infrastruktur sowie des Verkehrsangebotes qualitativ aufzuwerten:<br />
• (Rostock) - Waren (Müritz) - Neustrelitz - (Berlin),<br />
• (Strals<strong>und</strong>) - Demmin - Neubrandenburg - Neustrelitz - (Berlin),<br />
• (Hamburg) - (Schwerin) - (Bützow) - Malchin - Neubrandenburg - (Strasburg) -<br />
(Pasewalk) - (Stettin).<br />
Dabei kommt der Verbesserung der Anbindung des Oberzentrums Neubrandenburg besondere<br />
Priorität zu.<br />
(4) Folgende Nebenstrecken sind in ihrem Bestand in Abhängigkeit von ihrer Bedeutung<br />
für Wirtschaft, Personenverkehr <strong>und</strong> Tourismus möglichst zu erhalten:<br />
• Neustrelitz - Mirow - (Wittstock),<br />
• Waren (Müritz) - Malchow - (Karow) - (Ludwigslust),<br />
• Neubrandenburg - Friedland,<br />
• Neustrelitz - Feldberg,<br />
• (Ganzlin) - Röbel/Müritz,<br />
• Waren (Müritz) - Malchin,<br />
• Dargun - Malchin,<br />
145
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
• Toitz - Rustow - Loitz,<br />
• Mirow-Rechlin,<br />
• Demmin-Tutow.<br />
(5) Die Attraktivität des Schienenpersonenverkehrs ist in der Planungsregion weiter zu<br />
erhöhen. Dazu gehören die Einbeziehung in das Netz schneller Qualitätszüge des<br />
Fernverkehrs sowie die kurzfristige Einführung von Taktverkehren im Rahmen der<br />
stufenweisen Realisierung des Integralen Taktfahrplanes (IT).<br />
Die Strecke (Strals<strong>und</strong>) - Demmin - Neubrandenburg - Neustrelitz - (Berlin) ist in das Netz<br />
schneller Qualitätszüge des Fernverkehrs mit Halt im Oberzentrum Neubrandenburg sowie<br />
in den Mittelzentren Demmin <strong>und</strong> Neustrelitz einzubeziehen.<br />
Die Strecke (Rostock) - Waren (Müritz) - Neustrelitz - (Berlin) ist in das Netz schneller<br />
Qualitätszüge des Fernverkehrs mit Halt in den Mittelzentren Neustrelitz <strong>und</strong> Waren<br />
(Müritz) einzubeziehen.<br />
Die Strecke (Schwerin) - (Bützow) - Malchin - Neubrandenburg - (Pasewalk) - (Stettin) ist<br />
in das Schienenpersonen-Nahverkehrsnetz <strong>und</strong> gegebenenfalls in das Schienenpersonen-<br />
Fernverkehrsnetz einzubeziehen.<br />
Die Erreichbarkeit der zentralen Orte, insbesondere des Oberzentrums Neubrandenburg <strong>und</strong><br />
der Mittelzentren, ist durch eine angemessene Anzahl von Zughalten bei einem stabilen Angebot<br />
an Verkehrsverbindungen zu gewährleisten.<br />
(6) Schienengleiche Wegeübergänge sind insbesondere an den Strecken, die für höhere Geschwindigkeiten<br />
ausgebaut werden, zu beseitigen. Dazu gehören folgende Wegeübergänge:<br />
• Reuterstadt Stavenhagen: B 194<br />
• Bahnhof Kleeth: B 104<br />
• Bahnhof Sponholz: B 197<br />
• Waren (Müritz): B 108<br />
• Demmin: B 110<br />
• Burg Stargard: LIO 56<br />
• Neubrandenburg: Sponholzer Straße<br />
(7) Im Oberzentrum Neubrandenburg oder ersatzweise in einem der Mittelzentren der<br />
Planungsregion soll ein Frachtzentrum für Stück- <strong>und</strong> Expreßgut errichtet werden. Der<br />
Containerumschlagplatz im Raum Neubrandenburg ist zu erhalten.<br />
Begründung<br />
zu 9.3(1):<br />
Das Schienennetz der Planungsregion weist eine Länge von ca. 425 km auf. Davon sind gegenwärtig ca. 165<br />
km elektrifiziert.<br />
146
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
Die Planungsregion weist ca. 0,07 km Haupt- <strong>und</strong> Nebenbahnen je km 2 Fläche auf. Damit gehört sie zu den<br />
Gebieten aller B<strong>und</strong>esländer mit der geringsten Netzdichte.<br />
Das Schienennetz stellt dennoch einen wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur der Planungsregion dar. Auf<br />
Gr<strong>und</strong> des derzeitigen Zustandes des Streckennetzes der Eisenbahn, der gekennzeichnet ist durch einen hohen<br />
Verschleißgrad <strong>und</strong> zahlreiche schienengleiche Wegeübergänge, sind Maßnahmen zur Sanierung <strong>und</strong> zum<br />
Ausbau des Netzes dringend erforderlich. Die Stillegung einzelner Bahnstrecken, die Einstellung des<br />
Personenverkehrs auf den Schienenstrecken <strong>und</strong> der weitere Abbau des Leistungsangebotes sind möglichst zu<br />
vermeiden. Dazu ist es notwendig, eine Konzeption zum Erhalt des Netzes <strong>und</strong> der Zugangsstellen zu<br />
erarbeiten.<br />
Im Rahmen der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs sollten die Kreise ihre Möglichkeiten<br />
nutzen, um ihre Vorstellungen zum Erhalt der einzelnen Strecken sowie zum Erhalt <strong>und</strong> zur Wiedereinrichtung<br />
bestimmter Haltepunkte <strong>und</strong> Zugangsstellen zum Schienennetz einzubringen.<br />
zu 9.3(2):<br />
Mitentscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region ist die Qualität des Angebotes auf<br />
dem Schienennetz. Mit der Verbesserung des Angebotes werden Voraussetzungen geschaffen für die Verlagerung<br />
des Verkehrs von der Straße auf die Schiene.<br />
zu 9.3(3):<br />
Als unverzichtbarer <strong>Teil</strong> des Verkehrssystems hat der Schienenverkehr für die Anbindung der Planungsregion<br />
an die Nachbarregionen <strong>und</strong> benachbarte Länder große Bedeutung. Notwendig sind vor allem Ausbaumaßnahmen<br />
zur Erhöhung der Leitgeschwindigkeiten <strong>und</strong> insbesondere an der Strecke (Lübeck) -<br />
(Bützow) - Malchin - Neubrandenburg - (Strasburg) - (Pasewalk) - (Stettin) ein möglichst zweigleisiger Ausbau<br />
<strong>und</strong> die Elektrifizierung.<br />
zu 9.3(4):<br />
Das innerregionale Schienennetz muß mit zu einer guten Verbindung der zentralen Orte untereinander sowie<br />
der zentralen Orte in ihren Einzugsbereichen beitragen. Es sind Untersuchungen, Machbarkeitsstudien <strong>und</strong> in<br />
der Folge Modellversuche zur zukünftig möglichen Nutzung dieser Strecken unter Berücksichtigung aller<br />
Potentiale zur Erhöhung des Fahrgastaufkommens <strong>und</strong> des Transportgüteraufkommens sowie der<br />
raumstrukturellen Bedeutung der jeweiligen Bahnstrecke erforderlich. Dabei sind auch mögliche private<br />
Nutzungen oder Betreibung im Rahmen von Vereinen oder Zweckverbänden zu berücksichtigen.<br />
Einige der genannten Strecken sind bereits stillgelegt, die übrigen werden mit Nahverkehrszügen bedient. Mit<br />
dem Erhalt des Schienennetzes auch bei derzeitig nicht mehr befahrenen Strecken bleibt zumindest die<br />
Chance einer späteren Reaktivierung dieser Strecken erhalten.<br />
zu 9.3(5):<br />
Zur Entwicklung einer bedarfsgerechten <strong>und</strong> möglichst wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Einzugsbereich<br />
der zentralen Orte innerhalb der Planungsregion sowie zur Verbesserung der Anbindung der zentralen<br />
Orte der Planungsregion, insbesondere des Oberzentrums Neubrandenburg <strong>und</strong> der Mittelzentren, an benachbarte<br />
Regionen <strong>und</strong> deren zentrale Orte, ist die stärkere Einbeziehung des Schienenpersonenverkehrs als<br />
Alternative <strong>und</strong> Ergänzung zum Individualverkehr sowie als Ergänzung zum öffentlichen Busverkehr erforderlich.<br />
Vor allem für das Oberzentrum Neubrandenburg <strong>und</strong> die Mittelzentren Neustrelitz <strong>und</strong> Waren<br />
(Müritz) als Fremdenverkehrsschwerpunkte ist eine Anbindung an das Netz schneller Qualitätszüge des<br />
Fernverkehrs von hoher Bedeutung. Das Ziel, die Strecke (Strals<strong>und</strong>) - Demmin - Neubrandenburg -<br />
147
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Neustrelitz - (Berlin) in das Netz schneller Qualitätszüge mit Halt in Neubrandenburg einzubeziehen, bedeutet<br />
nach Vorstellung des Regionalen Planungsverbandes, die heutige IC-Qualität anzubieten, um der oberzentralen<br />
Funktion der Stadt Neubrandenburg gerecht zu werden. Für die Strecke (Warnemünde/Rostock) -<br />
(Berlin) über Neustrelitz ist ein Halt der Züge heutiger IC-Qualität in Neustrelitz vorzusehen.<br />
Gegenwärtig werden durch die Deutsche Bahn AG auf der Strecke (Rostock) - Neustrelitz - (Berlin)<br />
InterRegio-Verbindungen mit Halten in Waren (Müritz) <strong>und</strong> Neustrelitz angeboten. Auf der Strecke<br />
(Strals<strong>und</strong>) - Neubrandenburg - Neustrelitz - (Berlin) werden InterRegio-Verbindungen mit Halten in<br />
Neubrandenburg <strong>und</strong> Neustrelitz angeboten.<br />
Mit der Realisierung eines integralen Taktfahrplanes, der mindestens zweistündliche Verbindungen in jede<br />
Richtung herstellt <strong>und</strong> durch Vernetzungen in den Knotenbahnhöfen kurze Umsteigezeiten <strong>und</strong> die Verknüpfung<br />
zwischen Fern- <strong>und</strong> Nahverkehr gewährleistet, kann eine bedeutende Qualitätssteigerung im<br />
Schienenpersonenverkehr erreicht werden.<br />
zu 9.3(6):<br />
Die Beseitigung schienengleicher Überwege trägt sowohl zur Erhöhung der Verkehrssicherheit als auch zur<br />
Erhöhung der Durchlaßfähigkeit <strong>und</strong> zur Verringerung der Fahrzeiten bei.<br />
zu 9.3(7):<br />
Diese Maßnahmen dienen der Verbesserung des Angebotes für den Gütertransport per Schiene <strong>und</strong> tragen zu<br />
einer Verlagerung des Straßengütertransportes auf die Schiene bei. Insbesondere das Oberzentrum bzw.<br />
ersatzweise die Mittelzentren der Planungsregion bieten von ihrer infrastrukturellen Ausstattung her günstige<br />
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Frachtzentrums. Im Oberzentrum Neubrandenburg ist bereits ein<br />
Containerumschlagplatz vorhanden, für dessen Erweiterung ausreichend Flächen zur Verfügung stehen.<br />
9.4 Straßenverkehr<br />
(1) Für die weitere Entwicklung des Straßennetzes der Planungsregion sind vor allem der<br />
Ausbau wichtiger B<strong>und</strong>esstraßen, aber auch Landes-, Kreis-, Stadt- <strong>und</strong> Gemeindestraßen,<br />
der Bau von Ortsumgehungen <strong>und</strong> der Ausbau stark frequentierter Ortsdurchfahrten sowie<br />
die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen, darunter insbesondere schienengleicher<br />
Wegeübergänge, erforderlich.<br />
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> im Interesse der Schonung der Umwelt sind die<br />
dazu erforderlichen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen auf die in der Karte<br />
(M 1 : 100 000) dargestellte funktionale Gliederung des Straßennetzes auszurichten.<br />
(2) Das Straßennetz der Planungsregion ist entsprechend den Erfordernissen zu ergänzen<br />
<strong>und</strong> auszubauen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verbesserung der Anbindung der<br />
Region in westliche Richtung nach Hamburg, in südwestliche Richtung (über die A 24)<br />
148
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
nach Hannover <strong>und</strong> Braunschweig <strong>und</strong> in südliche Richtung an die B<strong>und</strong>eshauptstadt Berlin<br />
<strong>und</strong> damit an weitere Regionen der B<strong>und</strong>esrepublik.<br />
Eine gute Erreichbarkeit der Wirtschaftsstandorte, der Tourismusschwerpunkträume <strong>und</strong><br />
Tourismusentwicklungsräume der Planungsregion sowie die Anbindung der ländlichen<br />
Räume an die Straßen mit regionaler <strong>und</strong> überregionaler Bedeutung sind zu gewährleisten.<br />
Straßenneubau ist vorrangig im überregionalen Straßennetz erforderlich:<br />
- Der Bau der A 20 ist erforderlich, um die Standortfaktoren der Planungsregion zu<br />
verbessern <strong>und</strong> insbesondere für das Oberzentrum Neubrandenburg eine leistungsfähige<br />
Straßenanbindung zu schaffen. Gleichzeitig sind die Zubringerstrecken zur Autobahn<br />
auszubauen.<br />
- Es ist die Schaffung einer leistungsfähigen Anbindung an die A 24 Berlin - Hamburg im<br />
Bereich Mirow - (Wittstock) erforderlich.<br />
- Der Ausbau der B 96 im Abschnitt Neustrelitz - Neubrandenburg ist dringend<br />
erforderlich.<br />
Dabei sind die Möglichkeiten für einen vierstreifigen Ausbau offenzuhalten.<br />
Ferner soll bei dem Erfordernis der Schaffung eines B<strong>und</strong>esautobahnanschlusses zwischen<br />
Röbel/Müritz <strong>und</strong> Wittstock diese Anschlußstelle im Bereich der Gemeinde Grabow-Below<br />
liegen.<br />
(3) Folgende Maßnahmen zum Um- <strong>und</strong> Ausbau des Straßennetzes mit großräumiger <strong>und</strong><br />
überregionaler Bedeutung sind zu realisieren:<br />
- an Straßen der Funktionsstufe I:<br />
B<strong>und</strong>esstraße 96:<br />
Ausbau zur großräumigen Fernstraßenverbindung von der Landesgrenze nach<br />
Brandenburg<br />
bis zur Anschlußstelle Neubrandenburg-Nord an die A 20 mit Ortsumgehungen in<br />
- Neubrandenburg ( in Verbindung mit B 104)<br />
- Neustrelitz / Strelitz Alt<br />
- Usadel<br />
- Weisdin<br />
B<strong>und</strong>esstraße 104:<br />
im Abschnitt Regionsgrenze bei Remplin bis Abzweig B 197 bei Sponholz:<br />
- Beseitigung schienengleicher Wegeübergang Kleeth<br />
B<strong>und</strong>esstraße 197:<br />
im Abschnitt vom Abzweig B 104 bis zur Anschlußstelle Neubrandenburg-Ost an die A<br />
20:<br />
- Ausbau zur großräumigen Straßenverbindung als leistungsfähiger Zubringer zur A 20<br />
149
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
- an Straßen der Funktionsstufe II:<br />
B<strong>und</strong>esstraße 96:<br />
im Bereich Anschlußstelle Neubrandenburg-Nord an die A 20 bis zur Regionsgrenze bei<br />
Jarmen:<br />
- Ausbau zur überregionalen Fernstraßenverbindung, wobei die Leistungsfähigkeit als<br />
großräumige Straßenverbindung bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der A 20 zu<br />
gewährleisten ist<br />
- Ortsumgehung Völschow in Abstimmung mit dem Bau der A 20<br />
B<strong>und</strong>esstraße 104:<br />
im Abschnitt Abzweig B 197 bei Sponholz bis zur Regionsgrenze bei Mildenitz:<br />
- Ausbau zur überregionalen Straßenverbindung, wobei die Leistungsfähigkeit als<br />
großräumige Straßenverbindung bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der A 20 zu<br />
gewährleisten ist<br />
B<strong>und</strong>esstraße 110:<br />
- Ausbau der B 110<br />
- Ortsumgehung Dargun<br />
- Ortsumgehung Jarmen<br />
- Ortsumgehung Demmin<br />
- Beseitigung schienengleicher Wegeübergang Demmin<br />
B<strong>und</strong>esstraße 192:<br />
- Ausbau der B 192<br />
- Ortsumgehung Penzlin<br />
- Ortsumgehung Klein Plasten<br />
- Ortsumgehung Waren (Müritz)<br />
B<strong>und</strong>esstraße 193:<br />
- Ausbau der B 193<br />
B<strong>und</strong>esstraße 194:<br />
- Ortsumgehung Loitz<br />
- Beseitigung schienengleicher Wegeübergang Reuterstadt Stavenhagen<br />
B<strong>und</strong>esstraße 197<br />
ab Abzweigstelle Neubrandenburg-Ost an die A 20 bis zur Regionsgrenze bei Friedland:<br />
- Ausbau der B 197<br />
- Ortsumgehung Friedland<br />
B<strong>und</strong>esstraße 198:<br />
- Ausbau der Abschnitte Mirow - Neustrelitz, Zinow - Carpin <strong>und</strong> Bredenfelde -<br />
Canzow<br />
- Ortsumgehung Mirow<br />
- Ortsumgehung Bredenfelde<br />
Landesstraßen:<br />
- Ausbau der Landesstraße 271 von Demmin bis zum Anschluß an die B 96 bei Burow<br />
- Ortsumgehung Neukalen im Zuge der L 20<br />
Die vorgesehenen Maßnahmen sind entsprechend ihrer Priorität zu realisieren.<br />
150
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
(4) Die innerregionale Erschließung ist vorrangig über Straßen der Funktionsstufen III <strong>und</strong><br />
IV zu sichern. Erforderliche Ausbaumaßnahmen sind entsprechend der funktionalen Einstufung<br />
der jeweiligen Straße vorzunehmen.<br />
Eine Nutzung regionaler Straßenverbindungen durch überregionalen Verkehr ist vor allem<br />
durch verkehrslenkende Maßnahmen zu vermeiden.<br />
(5) Das Radwegenetz in der Planungsregion ist für den Berufs-, Einkaufs- <strong>und</strong> Schülerverkehr<br />
sowie für Tourismus <strong>und</strong> Erholung weiter auszubauen.<br />
In den Städten soll verstärkt die Erweiterung des Radwegenetzes entsprechend den Anforderungen<br />
des werktäglichen Radverkehrs durch die Errichtung von Fahrradwegen<br />
entlang der Straßen <strong>und</strong> unter Einbeziehung von Grünanlagen erfolgen.<br />
Außerhalb der Städte soll insbesondere in den Tourismusschwerpunkträumen <strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräumen<br />
das Netz der Radwege weiter ausgebaut <strong>und</strong> ein<br />
zusammenhängendes regionales Radwegenetz in Verbindung mit den überregionalen<br />
Radwanderrouten errichtet werden. Außerhalb der Siedlungen sind dabei nach Möglichkeit<br />
bestehende Wege zu nutzen bzw. die Radwege parallel zu vorhandenen Straßen zu führen.<br />
In den Tourismusschwerpunkträumen <strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräumen ist das<br />
Radfahren mittels Führung der Radwege durch landschaftlich reizvolle Gebiete <strong>und</strong><br />
Anbindung an Sehenswürdigkeiten <strong>und</strong> weitere touristische Ziele attraktiv zu gestalten.<br />
Belange der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes <strong>und</strong> der Landschaftspflege<br />
sind dabei zu beachten.<br />
Begründung<br />
zu 9.4(1):<br />
Die Planungsregion verfügt gegenwärtig über ca. 42 km B<strong>und</strong>esautobahn, ca. 525 km B<strong>und</strong>esstraßen, ca. 628<br />
km Landesstraßen, ca. 910 km Kreisstraßen, ca. 465 km Stadtstraßen <strong>und</strong> ca. 700 km Gemeindestraßen.<br />
Zur funktionalen Gliederung des Straßennetzes wird aus der zentralörtlichen Gliederung eine hierarchische<br />
Einstufung des Straßennetzes in Abschnitte mit unterschiedlicher Verbindungsbedeutung abgeleitet. Straßen<br />
der Verbindungsfunktionsstufe I sind großräumige Verbindungen zwischen Oberzentren. Straßen der Verbindungsfunktionsstufe<br />
II sind vorrangig Verbindungen von Mittelzentren zum Oberzentrum, Verbindungen<br />
zwischen Mittelzentren oder Anbindungen von Mittelzentren an Straßen der Verbindungsfunktionsstufe I. Die<br />
Straßen der Funktionsstufen I <strong>und</strong> II werden mit dem LROP festgesetzt.<br />
Straßen der Verbindungsfunktionsstufe III sind Verbindungen von Unterzentren bzw. Ländlichen Zentralorten<br />
zu Mittelzentren, Verbindungen zwischen benachbarten Unterzentren bzw. Ländlichen Zentralorten bzw. die<br />
Anbindung dieser Zentren an Straßen der Funktionsstufe II oder höher.<br />
Straßen der Verbindungsfunktionsstufe IV sind vorrangig flächenerschließende Verbindungen zur Anbindung<br />
von Gemeinden ohne zentrale Funktionen untereinander bzw. Anbindung dieser Gemeinden an Straßen der<br />
Verbindungsfunktionsstufe III <strong>und</strong> höher.<br />
151
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Straßen der Funktionsstufen III <strong>und</strong> IV werden mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm festgesetzt<br />
(siehe auch Erläuterungskarte 12).<br />
Im Netz der B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesstraßen der Region sind bisher auf freier Strecke noch keine Abschnitte<br />
zweibahnig ausgebaut. Im Netz der Straßen der Funktionsstufen I bis III befinden sich 34 schienengleiche<br />
Wegeübergänge, die sich ebenfalls verkehrsbehindernd <strong>und</strong> verkehrsgefährdend auswirken. Ein Ausbau<br />
dieser Straßen <strong>und</strong> die Entschärfung von Unfallschwerpunkten durch straßenbauliche Maßnahmen trägt zur<br />
Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Zahlreiche Ortsdurchfahrten im Verlauf von Straßen der Funktionsstufen<br />
I bis III, insbesondere in Orten höherer Zentralität wie Neubrandenburg, Neustrelitz, Waren (Müritz),<br />
Demmin, Malchin, aber auch in Landgemeinden, behindern wegen ihres unzureichenden Ausbauzustandes<br />
sowohl den durchgehenden wie auch den innerörtlichen Kraftfahrzeugverkehr <strong>und</strong> den Fußgängerverkehr<br />
erheblich. Stadtstraßen mehrerer Städte, auf denen sich innerstädtischer <strong>und</strong> überörtlicher Verkehr überlagern,<br />
haben bereits auch außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Der Motorisierungsgrad<br />
wird weiter ansteigen. Ortsumgehungen tragen zur Entlastung der Innenstädte bei.<br />
Ein Ausbau des Straßennetzes unter Beachtung der Funktionalität des jeweiligen Netzteiles berücksichtigt die<br />
Erreichbarkeit der Infrastruktur- <strong>und</strong> Erholungseinrichtungen <strong>und</strong> die Standortgunst der Betriebe. Es wird eine<br />
sinnvolle Verkehrserschließung der bebauten <strong>und</strong> anderweitig genutzten Gebiete ermöglicht. Die<br />
Ausbaumaßnahmen im Straßennetz können auf das unbedingt notwendige Mindestmaß eingegrenzt werden<br />
ohne Effektivitätsverluste oder Einschränkung der Mobilität. Der Landschaftsverbrauch wird minimiert.<br />
Damit finden die Notwendigkeit der Schonung der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> die Begrenztheit der<br />
Ressourcen Berücksichtigung.<br />
zu 9.4(2):<br />
Mit ca. 0,4 km überörtliche Straßen je km 2 Fläche weist die Planungsregion eine geringe Straßennetzdichte im<br />
Vergleich mit anderen Regionen <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esländern auf. Zur Qualitätsverbesserung sind zahlreiche<br />
Maßnahmen zum Erhalt <strong>und</strong> Ausbau des Straßennetzes erforderlich. Dies betrifft insbesondere die normgerechte<br />
Herstellung der Fahrbahnen <strong>und</strong> Nebenanlagen sowie die Erneuerung von Brücken. Zustandsverbesserungen<br />
sind sowohl für die Hauptverkehrsstraßen als auch für das für die Qualität der Verkehrserschließung<br />
insbesondere in den ländlichen Räumen maßgebende untergeordnete Straßennetz erforderlich.<br />
Mit dem geplanten Bau der B<strong>und</strong>esautobahn 20 wird sich die überregionale Straßenanbindung der Region,<br />
insbesondere auch des Oberzentrums Neubrandenburg, zu den nordwestdeutschen B<strong>und</strong>esländern <strong>und</strong> Westeuropa,<br />
nach Berlin, zu den süddeutschen B<strong>und</strong>esländern <strong>und</strong> nach Südeuropa, nach Polen <strong>und</strong> zu den osteuropäischen<br />
Ländern sowie über Sassnitz in den skandinavischen Raum verbessern. Unabdingbar dafür ist<br />
jedoch ein gleichzeitiger Ausbau der Zubringerstrecken zur Autobahn. Dazu gehören auch Ortsumgehungen.<br />
Von gleichrangiger Bedeutung wie der Bau der A 20 ist der Ausbau der Ost-West- sowie Nord-Süd-Trassen<br />
im Zuge der vorhandenen B<strong>und</strong>esstraßen, darunter der vierstreifige Ausbau der B 96 auch im Abschnitt<br />
Neustrelitz - Neubrandenburg über die im B<strong>und</strong>esverkehrswegeplan enthaltenen Maßnahmen hinaus, sowie<br />
die entscheidende Verbesserung der Anbindung an das Autobahndreieck Wittstock im Zuge der B 198 <strong>und</strong><br />
des <strong>Teil</strong>abschnittes Mirow - Wittstock mit Schaffung einer Verkehrslösung für die Ortslage Schwarz, die den<br />
touristischen Entwicklungszielen der Gemeinde Rechnung trägt.<br />
Sollte aus b<strong>und</strong>eshoheitlicher Sicht die Schaffung eines Autobahnanschlusses im Bereich zwischen<br />
Röbel/Müritz <strong>und</strong> Wittstock erforderlich sein, so sollte dieser unter Nutzung des vorhandenen Brückenbauwerkes<br />
im Zuge der Verbindungsstraße Grabow-Below im Landkreis Müritz errichtet werden. Dieser Autobahnanschluß<br />
würde zur Verbesserung der Bedingungen für die Betriebsdienste im Autobahnabschnitt<br />
Röbel/Müritz - Wittstock <strong>und</strong> zur verbesserten Erschließung der umliegenden Gemeinden <strong>und</strong> des <strong>Teil</strong>raumes<br />
südlich der Müritz beitragen. Priorität hat aber weiterhin die Schaffung der Anbindung Mirow - (Wittstock)<br />
an die A 24 (siehe Programmsatz 3.1(2)). Die Schaffung der Anschlußstelle würde Höherstufungen im<br />
untergeordneten Straßennetz bei den Zubringerstraßen zur Folge haben.<br />
152
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
zu 9.4(3):<br />
Diese Maßnahmen ergeben sich aus dem B<strong>und</strong>esverkehrswegeplan einschließlich Maßnahmen des weiteren<br />
Bedarfes, Festlegungen im LROP sowie dem Straßenentwicklungsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern, Dezember 1992). Änderungen <strong>und</strong> Ergänzungen<br />
auch in bezug auf die funktionale Einstufung bestimmter Straßenabschnitte sind unter anderem im Zusammenhang<br />
mit der weiteren planerischen Vorbereitung der B<strong>und</strong>esautobahn 20 erforderlich. Diese sind in<br />
bezug auf die Verbindungsfunktionsstufen I <strong>und</strong> II bei der Fortschreibung des LROP zu beachten.<br />
Über die genannten Maßnahmen hinaus besteht die Notwendigkeit des Baus weiterer Ortsumgehungen bzw.<br />
des städtebaulich verträglichen Ausbaus der Ortsdurchfahrten in Städten wie z.B. Altentreptow, Burg<br />
Stargard, Malchin <strong>und</strong> Reuterstadt Stavenhagen.<br />
zu 9.4(4):<br />
Mit dem Ausbau des innerregionalen Straßennetzes in Abhängigkeit von der jeweiligen Verbindungsfunktionsstufe<br />
kann eine gute Erreichbarkeit der Siedlungen, Wirtschafts- <strong>und</strong> Erholungsstandorte der Planungsregion<br />
gewährleistet werden. Priorität haben dabei die Straßen mit der höchsten Verkehrsbelegung. Die<br />
Ausbauparameter sind der jeweiligen Verbindungsfunktionsstufe anzupassen, um eine sinnvolle Verkehrserschließung<br />
der bebauten <strong>und</strong> anderweitig genutzten Gebiete zu ermöglichen <strong>und</strong> die Ausbaumaßnahmen auf<br />
ein unbedingt notwendiges Mindestmaß zur Minimierung des Landschaftsverbrauches einzugrenzen. Maßnahmen<br />
des ländlichen Wegebaus können mit zu einer Verbesserung der Verbindung einzelner Siedlungen<br />
untereinander beitragen.<br />
zu 9.4(5):<br />
Der Radverkehr als umweltfre<strong>und</strong>liche, flächensparende <strong>und</strong> leicht verfügbare Verkehrsart sowohl für tägliche<br />
Wege als auch für Freizeitaktivitäten ist durch die Errichtung sicherer, attraktiver Radwegeverbindungen<br />
zu fördern (siehe auch Programmsatz 7.5(1)).<br />
Insbesondere in innerstädtischen Bereichen ist mit der Bereitstellung sicherer Radwegeverbindungen eine<br />
wirksame Reduzierung des Autoverkehrs möglich.<br />
Die Radfahrer sind auf allen Straßen einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt. Durch Trennung des Radverkehrs<br />
vom motorisierten Verkehr wird eine sichere Wegeführung gewährleistet.<br />
Die Einbeziehung vorhandener Wege ins Radwegenetz sowie die Beachtung der Belange von Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege dienen der Erhaltung des Naturraumes <strong>und</strong> des Freizeitwertes der Landschaft der<br />
Planungsregion.<br />
Zur Verringerung der durch den Straßenverkehr verursachten Emissionen ist die Benutzung umweltfre<strong>und</strong>licher<br />
Verkehrsmittel sowohl für die täglichen Wege als auch für Freizeitaktivitäten erforderlich. Dazu trägt<br />
die attraktive Gestaltung der Möglichkeiten für den Radverkehr in den Städten <strong>und</strong> ländlichen Gemeinden,<br />
insbesondere auch in den Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong> -entwicklungsräumen, bei.<br />
9.5 Binnenschiffahrt <strong>und</strong> Häfen<br />
153
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(1) Die Nutzbarkeit der Binnenwasserstraßen der Planungsregion ist überwiegend für die<br />
Fahrgastschiffahrt, den Sportbootverkehr <strong>und</strong> den Wasserwandertourismus zu entwickeln.<br />
Dabei soll bei stark wachsendem Sportbootverkehr für ökologisch sensible Bereiche eine<br />
Einschränkung der Benutzung von Motorbooten angestrebt werden.<br />
Bei der Entwicklung von Wasserwandertourismus <strong>und</strong> Sportbootverkehr sind die Belange<br />
von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege besonders zu beachten.<br />
(2) Durch eine Entwicklung <strong>und</strong> Stärkung der Binnenschiffahrt auf der Peene sollen Güterverkehre<br />
von der Straße auf den Wasserweg verlagert werden. Der Ausbau bzw. die Umstrukturierung<br />
kommunaler Häfen ist anzustreben.<br />
Begründung<br />
zu 9.5(1):<br />
Die Planungsregion verfügt über ca. 210 km Schiffahrtswege. Davon haben nur ca. 70 km der Peene-<br />
Wasserstraße, die in Malchin beginnt, Bedeutung für den Güterverkehr.<br />
Die übrigen Schiffahrtswege im Bereich der Elde-Müritz-Havel-Wasserstraße sowie der Müritz-Havel- <strong>und</strong><br />
Obere-Havel-Wasserstraße haben vor allem Bedeutung für den Fahrgast- <strong>und</strong> Sportbootverkehr, insbesondere<br />
auch durch ihre Lage in den Tourismusschwerpunkträumen <strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräumen der<br />
Planungsregion (siehe Programmsatz 7.4). Die Einschränkung des Motorsportverkehrs trägt zum Natur- <strong>und</strong><br />
Umweltschutz bei.<br />
zu 9.5(2):<br />
Die Peene ist von Malchin bis zu ihrer Mündung eine B<strong>und</strong>eswasserstraße. Ihre mittlere Wassertiefe beträgt<br />
von Malchin bis Demmin ca. 2,5 m. Die Befahrbarkeit der Peene regelt sich nach der geltenden Schiffahrtsordnung<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Die Schiffbarkeit ist durch Erhaltung der erforderlichen Tauchtiefen zu sichern.<br />
Vorhandene Häfen wie in Malchin, Demmin, Loitz <strong>und</strong> Jarmen können auf Gr<strong>und</strong> ihrer günstigen Lage an<br />
einer B<strong>und</strong>eswasserstraße <strong>und</strong> deren Verbindung zur Ostsee <strong>und</strong> Oder wieder größere wirtschaftliche Bedeutung<br />
erlangen. Ihr Ausbau könnte die Nutzung der Wasserstraße sowohl zur Beförderung von Gütern als auch<br />
zum Erhalt <strong>und</strong> zur Entwicklung der Fahrgastschiffahrt im Interesse einer touristischen Entwicklung positiv<br />
beeinflussen. Fahrwasserbeschränkungen der Peene können sich negativ auf die Hafenentwicklung auswirken.<br />
Das Umschlaggeschehen wird von Gütern mit hoher Transportkostenintensität bestimmt. Die Kostenvorteile<br />
größerer Schiffseinheiten müssen genutzt werden<br />
9.6 Luftverkehr<br />
(1) Der Ausbau des Verkehrsflughafens Neubrandenburg als Regionalflugplatz, insbesondere<br />
für Charter- <strong>und</strong> Privatflüge, ist im Interesse der weiteren wirtschaftlichen<br />
154
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
Entwicklung der Planungsregion entsprechend den Möglichkeiten <strong>und</strong> Erfordernissen<br />
voranzutreiben.<br />
Ein weiteres Potential zum Ausbau des Luftverkehrs ist die Nutzung des Verkehrslandeplatzes<br />
Rechlin-Lärz <strong>und</strong> der Flugplatzanlage Tutow.<br />
(2) Bei der Bereitstellung von Angeboten für Luftsportarten sind vorrangig die Belange des<br />
Umwelt- <strong>und</strong> Naturschutzes zu beachten. Insbesondere eine zusätzliche Lärmbelästigung<br />
der Bevölkerung ist so gering wie möglich zu halten.<br />
Begründung<br />
zu 9.6(1):<br />
Der Verkehrsflughafen Neubrandenburg verbessert mit den angebotenen Charter- <strong>und</strong> Geschäftsflügen die<br />
überregionale Erreichbarkeit der Planungsregion <strong>und</strong> trägt damit zu einer Standortaufwertung bei. Die<br />
technische Ausstattung ermöglicht auch kontinuierliche Linienflüge <strong>und</strong> direkte Auslandsflüge.<br />
Der ehemals militärisch genutzte Flugplatz Rechlin-Lärz wird gegenwärtig als Verkehrslandeplatz genutzt.<br />
Der ehemals militärisch genutzte Flugplatz Tutow ist in der Karte (M 1 : 100 000) als Konversionsfläche<br />
dargestellt (siehe auch Programmsatz 11.2). Das B<strong>und</strong>esverteidigungsministerium hat mit Schreiben vom 30.<br />
März 1995 die Entwidmung dieses Flugplatzes bekanntgegeben. Damit besteht Tutow rechtlich nicht mehr als<br />
Flugplatz. Zur Wiederinbetriebnahme bedürfte es eines neuen luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens.<br />
Ein Ausbau bzw. eine Erweiterung des Verkehrslandeplatzes Rechlin-Lärz oder der Flugplatzanlage Tutow<br />
erfordern einen erhöhten Abstimmungsbedarf innerhalb der Planungsregion, um genügend Potentiale für den<br />
Betrieb des Verkehrsflughafens Neubrandenburg zu erhalten <strong>und</strong> diesen in seiner Funktion nicht zu<br />
gefährden.<br />
In der Karte (M 1 : 100 000) sind die Bauschutzbereiche des Verkehrsflughafens Neubrandenburg, des<br />
Verkehrslandeplatzes Rechlin-Lärz sowie des Sonderlandeplatzes Schmoldow (soweit die Planungsregion<br />
davon berührt wird) nachrichtlich dargestellt. Innerhalb dieser Bauschutzbereiche gelten bestimmte Bauhöhenbeschränkungen<br />
gemäß Luftverkehrsgesetz.<br />
zu 9.6(2):<br />
Ein Angebot an Luftsportarten (z.B. Ballon-, Drachen-, Ultraleichtflug) kann die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung<br />
bereichern <strong>und</strong> stellt in Gebieten mit Langzeit- <strong>und</strong> Ferienerholung einen Anziehungspunkt dar.<br />
Fluglärm <strong>und</strong> Schadstoffemissionen sind dabei so gering wie möglich zu halten.<br />
Neben dem Verkehrsflughafen Neubrandenburg werden der Verkehrslandeplatz Rechlin-Lärz, der Sonderlandeplatz<br />
Waren-Vielist <strong>und</strong> der Sonderlandeplatz für Ultraleichtflugzeuge Roggenhagen derzeitig schon<br />
luftsportlich genutzt.<br />
155
Verkehr RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
156
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
10. Sonstige technische Infrastruktur<br />
10.1 Kommunikation<br />
(1) In der Planungsregion ist ein dem Stand der Technik entsprechender, bedarfsorientierter<br />
Auf- <strong>und</strong> Ausbau von Kommunikationseinrichtungen anzustreben.<br />
(2) Das Telefonnetz soll so ausgebaut werden, daß eine möglichst hohe Versorgungsdichte<br />
erreicht wird.<br />
Fernverbindungen sollen vorrangig durch digitale Fernvermittlungsstellen über Glasfaserkabel<br />
<strong>und</strong> mit digitaler Übertragungstechnik oder über digitale Richtfunkstrecken<br />
hergestellt werden. Ortsverbindungen sollen vorrangig über Kabelnetze hergestellt werden.<br />
Mobilfunkdienste sind weiter aus- bzw. aufzubauen. Dabei sind der Bau <strong>und</strong> die Nutzung<br />
von Antennenträgern so weit wie möglich zu koordinieren.<br />
Um den Anforderungen der Wirtschaft zu entsprechen, ist ein möglichst flächendeckender<br />
Aufbau von Text- <strong>und</strong> Datendiensten anzustreben.<br />
(3) Beim Auf- <strong>und</strong> Ausbau von Kommunikationseinrichtungen sowie der erforderlichen<br />
Netze sind die Erfordernisse von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege, Städtebau sowie<br />
Denkmalschutz zu beachten.<br />
(4) Zur Verbesserung der Versorgung mit Fernseh- <strong>und</strong> Hörfunkprogrammen ist in der<br />
Planungsregion ein möglichst umfassender Anschluß der Haushalte an die<br />
Breitbandverkabelung anzustreben.<br />
(5) Bestehende Richtfunkstrecken sind zu sichern. Dafür gegebenenfalls erforderliche Bauhöhenbeschränkungen<br />
sind im Rahmen der Bauleitplanung festzusetzen.<br />
Bei der Planung von Richtfunkstrecken ist vor Festlegung des Streckenverlaufes eine<br />
Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen erforderlich.<br />
Begründung<br />
zu 10.1(1):<br />
Die flächendeckende Verfügbarkeit einer modernen Kommunikationsinfrastruktur ist eine wesentliche<br />
Voraussetzung für eine effektive wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion. Dies macht auch die<br />
157
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
steigende Nachfrage nach schnellen <strong>und</strong> flexiblen Sprech- <strong>und</strong> Datenverbindungen deutlich. Über den Einsatz<br />
der modernen Kommunikationsinfrastruktur lassen sich verkehrliche Standortnachteile teilweise kompensieren.<br />
Voraussetzung dafür ist jedoch die gleichwertige Verfügbarkeit dieser Einrichtungen in allen<br />
<strong>Teil</strong>en der Planungsregion.<br />
zu 10.1(2):<br />
Die Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur unterliegt der marktwirtschaftlichen Entwicklung <strong>und</strong> ist<br />
planerisch kaum beeinflußbar.<br />
Die Planungsregion wird fernmeldetechnisch über den Fernmeldeamtsbereich Neubrandenburg versorgt. Dem<br />
Fernmeldeamtsbereich Neubrandenburg gehören neben den Kreisen der Planungsregion auch der Landkreis<br />
Uecker- Randow sowie die ehemaligen Landkreise Teterow, Anklam <strong>und</strong> Wolgast an. Durch den Ausbau des<br />
Telekommunikationsnetzes in Mecklenburg-Vorpommern können nun sämtliche Telekommunikationsdienstleistungen<br />
<strong>und</strong> -produkte in allen Ortsnetzen angeboten werden.<br />
Auch ein weiterer Ausbau der öffentlichen Telefonanschlüsse ist vorgesehen. Dabei sollen zunächst vorrangig<br />
solche Gebiete berücksichtigt werden, in denen das Telefonnetz noch nicht bedarfsgerecht erweitert werden<br />
konnte.<br />
Der Aufbau des Kommunikationsnetzes erfolgt mit digitaler Technik. Fernverbindungen werden vorrangig<br />
über digitale Richtfunkverbindungen oder Glasfaserkabel realisiert. In den nächsten Jahren ist vorrangig der<br />
weitere Ausbau <strong>und</strong> die Modernisierung der Ortsvermittlungsstellen sowie der Ortsnetze vorgesehen. Die<br />
örtlichen Netze werden über ein umfangreiches Kabelnetz hergestellt. Auch dabei wird in Zukunft zunehmend<br />
Glasfasertechnik eingesetzt werden. Mit der Errichtung der neuen Technik wird das Angebot an<br />
Telekommunikationsdiensten in der Planungsregion weiter zunehmen.<br />
Seit 1990 erfolgte ein Aufbau der Mobilfunkdienste in der Planungsregion. Auch dabei wurde modernste<br />
Technik eingeführt. Mobilfunk trägt zur Beseitigung von Engpässen in der Telefonversorgung mit bei.<br />
Mit der Erweiterung der Mobilfunkdienste wird der Bau weiterer Antennenträger in der Planungsregion<br />
erforderlich. Damit verb<strong>und</strong>en sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Lebensräume<br />
von Vogelarten. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist eine koordinierte Planung <strong>und</strong> gemeinsame Nutzung von bereits<br />
vorhandenen <strong>und</strong> geplanten Antennenträgern aller Bedarfsträger so weit wie möglich erforderlich.<br />
Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion ist ebenfalls eine moderne Datenkommunikation<br />
unerläßlich. Der Datex-J-Dienst steht in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend zur Verfügung. Im<br />
Oberzentrum Neubrandenburg befindet sich dafür eine Btx-Vermittlungsstelle. In der Planungsregion befinden<br />
sich 19 Datenumsetzerstellen. Datex-J bietet Mitteilungs- <strong>und</strong> Informationsdienste sowie Möglichkeiten<br />
für die Übertragung kleiner Datenmengen. Weitere Möglichkeiten der Datenkommunikation stehen mit<br />
dem ISDN sowie dem Euro-ISDN zur Verfügung. Diese ermöglichen die Übertragung von Sprache, Bild,<br />
Text <strong>und</strong> Daten parallel <strong>und</strong> mit hohen Geschwindigkeiten. Neubrandenburg ist der Standort einer<br />
Datenvermittlungsstelle.<br />
zu 10.1(3):<br />
Beim Auf- <strong>und</strong> Ausbau von Kommunikationseinrichtungen <strong>und</strong> der erforderlichen Netze stellen insbesondere<br />
die Antennenträger bedeutende Eingriffe in das Stadt- bzw. Landschaftsbild dar. Innerhalb der Städte bzw.<br />
Siedlungen ist der Einfluß geplanter Baumaßnahmen auf das Ortsbild unter Berücksichtigung der Belange von<br />
Städtebau <strong>und</strong> Denkmalschutz zu beachten, außerhalb der Siedlungen sind die Belange des Naturschutzes <strong>und</strong><br />
der Landschaftspflege von besonderer Bedeutung.<br />
158
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
zu 10.1(4):<br />
In ausgewählten Ortsnetzen der Planungsregion werden Breitbandverteilnetze ausgebaut, die eine größere<br />
Vielfalt <strong>und</strong> optimale Qualität an Fernseh- <strong>und</strong> Hörfunkprogrammen bieten. Dies betrifft unter anderem das<br />
Oberzentrum Neubrandenburg sowie die Mittelzentren Neustrelitz <strong>und</strong> Waren (Müritz).<br />
zu 10.1(5):<br />
Richtfunkverbindungen haben eine große Bedeutung im Hinblick auf eine schnelle <strong>und</strong> flexible Erweiterung<br />
der Telefonverbindungen. Zur Gewährleistung einer optimalen Funktionsfähigkeit dieser Verbindungen ist die<br />
Verbindungslinie zwischen Sende- <strong>und</strong> Empfangsantenne von Hindernissen freizuhalten. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
sind bei allen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen die Belange der Richtfunkbetreiber <strong>und</strong> die Ziele der<br />
Regional- <strong>und</strong> Bauleitplanung aufeinander abzustimmen.<br />
10.2 Wasserwirtschaft<br />
10.2.1 Wasserversorgung<br />
(1) Die Wasserversorgung ist so auszubauen, daß die Deckung des Trinkwasserbedarfes in<br />
allen <strong>Teil</strong>en der Planungsregion gewährleistet ist. Maßnahmen, die zu einem sparsamen<br />
Ver-brauch der Ressource Trinkwasser beitragen, sollen unterstützt werden.<br />
(2) Der Sicherung <strong>und</strong> Nutzung verbrauchsnaher Wasservorkommen soll der Vorzug vor<br />
der Erschließung neuer Wasservorkommen in entfernt liegenden Räumen gegeben werden.<br />
(3) Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sind die vorhandenen Netze <strong>und</strong><br />
Anlagen, soweit sie nicht den Erfordernissen entsprechen, zu sanieren <strong>und</strong> zu<br />
rekonstruieren.<br />
(4) In Vorranggebieten Trinkwassersicherung müssen alle raumbedeutsamen Planungen,<br />
Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen mit dem Trinkwasserschutz vereinbar sein.<br />
(5) In Vorsorgeräumen Trinkwassersicherung sollen alle raumbedeutsamen Planungen,<br />
Vor-haben <strong>und</strong> Maßnahmen so abgestimmt sein, daß diese Gebiete in ihrer besonderen<br />
Bedeutung für den Trinkwasserschutz nicht beeinträchtigt werden.<br />
159
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Begründung<br />
zu 10.2.1(1):<br />
Der Anschlußgrad an Wasserversorgungsanlagen der Wasser- <strong>und</strong> Abwasserzweckverbände bzw. Stadtwerke<br />
in der Planungsregion hat mit durchschnittlich ca. 98 bis 99 % einen sehr guten Stand erreicht. Eine weitere<br />
Erhöhung des Anschlußgrades wird aus wirtschaftlichen Gründen kaum noch möglich sein. Die noch<br />
bestehenden Einzelwasserversorgungsanlagen dienen vorrangig zur Wasserversorgung einzelner Gehöfte oder<br />
Wohnplätze in den sehr dünn besiedelten ländlichen Räumen. Einbußen in Qualität <strong>und</strong> Quantität der<br />
Wasserversorgung dürfen auch zukünftig nicht zugelassen werden. Ein sparsamer Verbrauch der knappen<br />
Ressource Trinkwasser trägt zu ihrem Schutz hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit <strong>und</strong> Qualität bei.<br />
zu 10.2.1(2):<br />
Die gegenwärtig in der Planungsregion zur Nutzung erschlossenen Gr<strong>und</strong>wasservorräte entsprechen sowohl<br />
qualitativ als auch quantitativ den Anforderungen <strong>und</strong> den gesetzlichen Bestimmungen. Ausgehend vom<br />
derzeitigen Kenntnisstand bei der Erk<strong>und</strong>ung der Gr<strong>und</strong>wasservorräte ist absehbar, daß auch zukünftig <strong>und</strong><br />
bei steigendem Bedarf die Versorgung mit Trinkwasser aus den regionalen, bisher ungenutzten Vorkommen<br />
abgesichert werden kann. Bei der Erschließung neuer Wassergewinnungsgebiete sind die jeweils dem zukünftigen<br />
Verbraucher nächstgelegenen Wasservorkommen zu nutzen, um die erforderlichen Eingriffe in<br />
Natur <strong>und</strong> Landschaft <strong>und</strong> die erforderlichen Aufwendungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.<br />
zu 10.2.1(3):<br />
Gegenwärtig erfolgt die Trinkwasserversorgung in der Planungsregion aus einer Vielzahl zentraler Anlagen.<br />
Der bauliche Zustand der Anlagen <strong>und</strong> Netze entspricht in vielen Fällen nicht den Anforderungen <strong>und</strong> dem<br />
Stand der Technik. Es besteht ein hoher Rekonstruktions- <strong>und</strong> Sanierungsbedarf. Weiterhin gehen Bestrebungen<br />
der Träger der öffentlichen Wasserversorgung dahin, die Anzahl der Wasserwerke zukünftig auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage von Wasserversorgungskonzeptionen zu reduzieren.<br />
zu 10.2.1(4):<br />
In der Planungsregion wird Trinkwasser gr<strong>und</strong>sätzlich aus dem Gr<strong>und</strong>wasser gewonnen. Deshalb gebührt<br />
diesem ein besonderer Schutz.<br />
Entsprechend dem LROP liegen den Vorranggebieten Trinkwassersicherung die Trinkwasserschutzzonen I<br />
bis III der jeweiligen Wasserfassung zugr<strong>und</strong>e. Die Vorranggebiete Trinkwassersicherung entsprechen der<br />
jeweiligen räumlichen Abgrenzung der Trinkwasserschutzzonen.<br />
Zur Vermeidung von Verunreinigungen oder sonstigen Beeinträchtigungen des Gr<strong>und</strong>wasserleiters im Interesse<br />
des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere im Interesse der Ges<strong>und</strong>heit der Bevölkerung <strong>und</strong> des Erhaltes<br />
des Gr<strong>und</strong>wassers als Bestandteil des Naturhaushaltes, sind für die Trinkwasserschutzzonen Verbote<br />
<strong>und</strong> Nutzungsbeschränkungen festgelegt, die den entsprechenden Schutzverordnungen zu entnehmen sind.<br />
zu 10.2.1(5):<br />
In der Planungsregion liegen den Vorsorgeräumen Trinkwassersicherung erk<strong>und</strong>ete, für die zukünftige<br />
Wasserversorgung bedeutsame Trinkwasserressourcen zugr<strong>und</strong>e. Dies sind im einzelnen ein Erweiterungsgebiet<br />
für die Wasserfassung II Neubrandenburg-Datzetal, ein Wassergewinnungsgebiet für die Stadt Fried-<br />
160
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
land im Raum Genzkow sowie erk<strong>und</strong>ete Gebiete in den Landkreisen Demmin <strong>und</strong> Müritz. In diesen Räumen<br />
sind Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen mit den Belangen des Trinkwasserschutzes in Übereinstimmung<br />
zu bringen.<br />
Für die Planungsregion sind weitere gr<strong>und</strong>wasserhöffige Gebiete mit nachgewiesenen Gr<strong>und</strong>wasservorräten<br />
bekannt. Diese bilden eine gute Gr<strong>und</strong>lage für die Ausweisung weiterer Vorsorgeräume in Abhängigkeit von<br />
den durch die Versorgungsunternehmen zu erarbeitenden Wasserversorgungskonzeptionen.<br />
10.2.2 Abwasserbeseitigung<br />
(1) Das anfallende Abwasser ist so zu beseitigen, daß eine Beeinträchtigung des Wohles der<br />
Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung <strong>und</strong> eine<br />
Verunreinigung des Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Oberflächenwassers, vermieden wird.<br />
(2) Das Abwasser soll in allen <strong>Teil</strong>en der Planungsregion in Abwasserreinigungsanlagen,<br />
die der jeweiligen örtlichen Situation anzupassen sind, behandelt werden. Insbesondere in<br />
dichter besiedelten Bereichen, in Vorranggebieten Trinkwassersicherung, in Tourismusschwerpunkträumen<br />
sowie in Gebieten mit besonderer industrieller <strong>und</strong> gewerblicher<br />
Belastung soll die Reinigung des Abwassers in zentralen Abwasserreinigungsanlagen<br />
erfolgen. In den dünn besiedelten ländlichen Räumen sind vorrangig Einzellösungen mit<br />
kleineren Anlagen unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik anzustreben.<br />
(3) Niederschlagswasser soll so weit wie möglich am Anfallsort versickert <strong>und</strong> nur dann gesammelt<br />
<strong>und</strong> abgeleitet werden, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert.<br />
(4) Die anfallenden Klärschlämme sind vorrangig einer umweltverträglichen Verwertung<br />
zuzuführen. Wenn das nicht möglich ist, muß eine unschädliche Ablagerung gewährleistet<br />
sein.<br />
Begründung<br />
zu 10.2.2(1):<br />
In der Planungsregion besteht dringender Handlungsbedarf zur Schaffung von Abwasserreinigungsanlagen<br />
sowohl für kommunale als auch für gewerbliche <strong>und</strong> industrielle Schmutzwässer. Zur Gewährleistung der<br />
Entsorgungssicherheit, zur Erhöhung der Reinigungsleistung <strong>und</strong> zur Verbesserung der Gewässergüte sollen<br />
die Abwasserreinigungsanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (bzw. bei Abwasser<br />
besonderer Herkunftsbereiche mit gefährlichen Stoffen nach dem Stand der Technik) errichtet bzw. umgerüstet<br />
werden. Der Neu- <strong>und</strong> Ausbau von Abwasseranlagen soll dazu beitragen, für alle Fließgewässer mindestens<br />
die Gewässergüteklasse 2 zu erreichen, den Eintrag von Schadstoffen in Seen, Boddengewässer <strong>und</strong><br />
rückstaubeeinflußte Gewässer zu reduzieren, die Einträge in Nord- <strong>und</strong> Ostsee zu vermindern <strong>und</strong> das<br />
Gr<strong>und</strong>wasser als vorrangige Trinkwasserquelle zu schützen. Dazu muß die gegenwärtige Gewässerbelastung<br />
161
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
weiter vermindert werden. Bestehende Abwasserbehandlungsanlagen entsprechen in ihrer Reinigungsleistung<br />
in vielen Fällen nicht den Anforderungen einer umweltverträglichen Abwasserentsorgung <strong>und</strong> des Gewässerschutzes.<br />
zu 10.2.2(2):<br />
In der Planungsregion ist eine flächendeckende Umsetzung der gesetzlichen Mindestanforderungen zur Abwasserreinigung<br />
zum Schutz der natürlichen Wasservorkommen vor gefährlichen Verunreinigungen durch<br />
schadstoffhaltige Einleitungen durchzusetzen. Dazu ist die Sanierung einer großen Anzahl der vorhandenen<br />
sowie die Errichtung neuer Abwasserbehandlungsanlagen erforderlich. Für die Sanierung vorhandener <strong>und</strong><br />
die Errichtung neuer Abwasseranlagen sind unter anderem Fristen gemäß der Richtlinie des Rates der<br />
Europäischen Gemeinschaft über Behandlung kommunaler Abwässer vom 21. Mai 1991 (91/271/EWG) zu<br />
beachten.<br />
Besondere Sorgfalt bei der schadlosen Abwasserbeseitigung ist im Bereich der Seenplatte <strong>und</strong> der Großschutzgebiete<br />
unter anderem zur Sicherung der Tourismuspotentiale <strong>und</strong> der internationalen Naturschutzaufgaben<br />
erforderlich. Mit der Reduzierung der Abwasserfrachten wird die Umsetzung internationaler Vereinbarungen<br />
zum Schutz der Ost- <strong>und</strong> Nordsee unterstützt, in deren Einzugsgebiet sich der Planungsraum<br />
befindet.<br />
Für das jeweils anzuwendende Abwasserbehandlungsverfahren sowie die Größe des zu wählenden Entsorgungsgebietes<br />
sollte neben der Erreichung der Zielvorgaben für den Gewässerschutz die kostengünstigste<br />
Lösung als Maßstab für die Errichtung <strong>und</strong> den Betrieb der Anlage gelten. In den ländlichen Räumen mit<br />
geringer Bevölkerungsdichte können Einzellösungen über kleine Kläranlagen oder Kleinkläranlagen zweckmäßig<br />
sein. Dabei gibt es bereits Beispiele für alternative Lösungsmöglichkeiten, wie z.B. Pflanzenkläranlagen.<br />
Die in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellten überörtlich bedeutsamen Kläranlagen sind in der Regel solche<br />
Anlagen, in denen das Abwasser mehrerer Gemeinden behandelt wird.<br />
zu 10.2.2(3):<br />
In Baugebieten ist der natürliche Weg des Regenwassers auf Gr<strong>und</strong> der oftmals sehr hohen Versiegelungsgrade<br />
gestört. Konventionelle Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung zielen darauf ab, das anfallende<br />
Niederschlagswasser möglichst schnell <strong>und</strong> restlos aus den Siedlungsbereichen abzuleiten. Damit werden die<br />
Gr<strong>und</strong>wasserneubildung gestört <strong>und</strong> die Oberflächengewässer sowohl qualitativ als auch quantitativ belastet.<br />
Geeignete Maßnahmen zur Versickerung des Regenwassers am Ort des Anfalls stellen eine ökologisch sinnvolle<br />
Alternative dar. Sie tragen ebenfalls dazu bei, den Aufwand für zentrale Maßnahmen zur Regenwasserbeseitigung,<br />
insbesondere für den Bau großer Kanäle <strong>und</strong> Regenwasserbehandlungsanlagen, zu<br />
mindern. Die Möglichkeiten <strong>und</strong> technischen Lösungen für innovative Maßnahmen sind dabei abhängig von<br />
der jeweiligen Siedlungsstruktur <strong>und</strong> den örtlichen hydrologischen sowie Boden- <strong>und</strong> Gefälleverhältnissen.<br />
zu 10.2.2(4):<br />
Die Beseitigung von Klärschlamm erfolgte in der Planungsregion bisher vorrangig über landwirtschaftliche<br />
Verwertung. Die Akzeptanz seiner landwirtschaftlichen Verwertung ist jedoch gering. Hinsichtlich des<br />
Klärschlammes sollte darauf orientiert werden, die Belastung mit Schadstoffen insbesondere durch eine gezielte<br />
Einflußnahme auf industrielle <strong>und</strong> gewerbliche Indirekteinleiter weiter zu verringern. Mit der Inbetriebnahme<br />
von Kläranlagen muß die Behandlung <strong>und</strong> Verwertung von Klärschlamm gesichert sein.<br />
162
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
10.3 Energieversorgung<br />
10.3.1 Allgemeines<br />
(1) In allen <strong>Teil</strong>en der Planungsregion sollen die Verbraucher sicher, preiswert <strong>und</strong> möglichst<br />
umweltschonend mit Energie versorgt werden. Es ist auf die zuverlässige Bereitstellung<br />
eines breitgefächerten <strong>und</strong> kostengünstigen Energieangebotes zu orientieren. Verbrauch<br />
<strong>und</strong> Erzeugung von Energie sollen besonders durch eine rationelle <strong>und</strong> sparsame<br />
Energieanwendung beeinflußt werden. Zunehmend sind regenerative Energiequellen zu<br />
nutzen.<br />
(2) Zur Erhaltung bzw. Erhöhung der Versorgungssicherheit sind die vorhandenen Netze<br />
<strong>und</strong> Anlagen, soweit sie nicht den Erfordernissen entsprechen, zu rekonstruieren bzw. zu<br />
erneuern <strong>und</strong> entsprechend dem Bedarf zu erweitern. Dabei sind sowohl wirtschaftliche Belange<br />
als auch Belange von Umwelt- <strong>und</strong> Naturschutz zu beachten. Durch Parallelführung<br />
<strong>und</strong> Nutzung vorhandener Trassen sowie durch Bündelung von Trassen sind der Landschaftsverbrauch<br />
sowie Beeinträchtigungen von Natur <strong>und</strong> Landschaft zu minimieren.<br />
Begründung<br />
zu 10.3.1(1):<br />
Gr<strong>und</strong>voraussetzung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion ist ein jederzeit verfügbares,<br />
differenziertes Energieangebot. Der Einsatz von Energie ist verb<strong>und</strong>en mit Umweltbelastungen, z.B.<br />
durch Emissionen, Abwärme oder Eingriffe in Natur <strong>und</strong> Landschaft. Eine möglichst hohe Ausnutzung der<br />
eingesetzten Primärenergieträger hat einen positiven Einfluß auf die regionale Emissions- bzw. Immissionssituation.<br />
Der Einsatz neuer Technologien, wie z.B. die Kraft-Wärme-Kopplung, sowie eine Energieträgersubstitution<br />
beispielsweise auf regenerative Energieträger tragen ebenfalls zur Umweltschonung bei. Zur Gewährleistung<br />
einer effektiven Energieerzeugung, -verteilung <strong>und</strong> -verwendung ist die Erstellung von Energiekonzepten<br />
für die Kreise bzw. Kommunen vorteilhaft.<br />
zu 10.3.1(2):<br />
Mit der Bündelung von Versorgungsleitungen sowie der Rekonstruktion unter Beibehaltung der vorhandenen<br />
Trasse kann der Flächenverbrauch minimiert sowie die weitere Zerschneidung der Landschaft vermieden <strong>und</strong><br />
damit zum Umweltschutz beigetragen werden.<br />
163
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
10.3.2 Stromversorgung<br />
(1) Die Stromversorgung in der Planungsregion ist entsprechend dem Bedarf für Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> Wirtschaft auch durch Einbeziehung alternativer Stromerzeugungsanlagen<br />
abzusichern.<br />
(2) Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sind das vorhandene Hoch- <strong>und</strong> Mittelspannungsnetz<br />
zu rekonstruieren bzw. weiter aus- <strong>und</strong> aufzubauen.<br />
Begründung<br />
zu 10.3.2(1):<br />
In der Planungsregion sind große Stromerzeugungsanlagen nicht vorhanden. Deshalb wird auch zukünftig ein<br />
großer Anteil des benötigten Stromes über das überregionale Verb<strong>und</strong>netz bezogen werden. Allerdings wird<br />
auch mit zunehmendem Anteil durch den Betrieb alternativer Anlagen, insbesondere von Windkraftanlagen,<br />
in der Planungsregion Strom erzeugt werden.<br />
zu 10.3.2(2):<br />
Das in der Planungsregion vorhandene Leitungsnetz im Hoch- <strong>und</strong> Mittelspannungsbereich genügt prinzipiell<br />
den Anforderungen zur Versorgung der Region mit Elektroenergie. Beeinträchtigungen der Netzstabilität<br />
ergeben sich vor allem aus dem hohen Verschleißgrad des Mittelspannungsnetzes, dem relativ hohen<br />
Freileitungsanteil <strong>und</strong> dem fehlenden Ringschluß im 110-kV-Netz. Folgende Maßnahmen sind zur Stabilisierung<br />
der Versorgung vorgesehen:<br />
- Rekonstruktion 110 kV-Leitung Neustrelitz - (Fürstenberg),<br />
- Rekonstruktion 110 kV-Leitung (Güstrow) - Waren (Müritz),<br />
- Rekonstruktion 110 kV-Leitung Neustrelitz - Waren (Müritz),<br />
- Neubau 110 kV-Leitung Malchin - Altentreptow - Weitin.<br />
Die Errichtung weiterer Hochspannungsleitungen oder Umspannwerke wird möglicherweise mit dem Aufbau<br />
großer Windenergieanlagen erforderlich.<br />
10.3.3 Gasversorgung<br />
164
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
In der Planungsregion soll die Versorgung mit Erdgas entsprechend dem Bedarf für Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> Wirtschaft weiter ausgebaut werden. In den bereits an die Erdgasversorgung angeschlossenen<br />
Gebieten soll die Anschlußdichte weiter erhöht werden. Von den bisher nicht<br />
an die Erdgasversorgung angeschlossenen Gemeinden sollen zukünftig vorrangig größere<br />
Orte, die in Nähe der Ferngasleitungen gelegen sind, an das Versorgungsnetz angeschlossen<br />
werden.<br />
Begründung<br />
In der Planungsregion wurde die Umstellung der Gasversorgung von Stadt- auf Erdgas bereits abgeschlossen.<br />
Erdgas ist hinsichtlich der Emissionen, die bei seiner Verbrennung entstehen, der umweltschonendste fossile<br />
Brennstoff. Verbrennungsvorgänge lassen sich so steuern, daß die dabei entstehenden Schadstoffe in engen<br />
Grenzen gehalten werden können. Die Bereitstellung dieses kostengünstigen <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>lichen<br />
Energieträgers bietet günstige Voraussetzungen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion.<br />
Gegenwärtig erfolgt die Versorgung der Planungsregion mit Erdgas aus dem überregionalen Netz der<br />
Verb<strong>und</strong>netz-Gas AG über die Ostmecklenburgische Gasversorgung Neubrandenburg GmbH an die<br />
Endverbraucher bzw. die Stadtwerke.<br />
Die Planungsregion hat im Vergleich mit den anderen Planungsregionen des Landes eine relativ geringe<br />
Gasversorgungsdichte. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit soll eine zukünftige Erweiterung der<br />
Erdgasversorgung vorrangig durch die Erhöhung der Anschlußdichte in bereits versorgten Gebieten <strong>und</strong> den<br />
weiteren Anschluß von größeren Orten in der Nähe der vorhandenen Ferngasleitungen erfolgen. Die weitere<br />
flächenmäßige Erschließung der Planungsregion ist auf Gr<strong>und</strong> der geringen Bevölkerungsdichte abhängig von<br />
der weiteren gewerblichen Entwicklung der Gemeinden.<br />
10.3.4 Nutzung regenerativer Energien<br />
(1) Die Nutzung der in der Planungsregion vorhandenen natürlichen Ressourcen zur Erzeugung<br />
von Energie soll schrittweise in Ergänzung zur Nutzung herkömmlicher Energieträger<br />
ausgebaut werden.<br />
(2) Eine natur- <strong>und</strong> landschaftsverträgliche Nutzung günstiger Windverhältnisse zur<br />
Energieerzeugung ist anzustreben.<br />
Die Errichtung von Windenergieanlagen ist auf die in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen<br />
Eignungsräume für Windenergieanlagen zu beschränken. Außerhalb dieser<br />
Eignungsräume sind Windenergieanlagen nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig.<br />
Planungen <strong>und</strong> Maßnahmen in den Eignungsräumen sollen die ausgewiesene Funktion<br />
möglichst nicht beeinträchtigen.<br />
Der Rückbau von endgültig außer Betrieb gesetzten Windenergieanlagen ist zu gewährleisten.<br />
165
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(3) Die in der Planungsregion vorhandenen Potentiale zur Nutzung der Geothermie sind<br />
auch zukünftig weiter auszuschöpfen.<br />
(4) Die Nutzung von Biogas, Deponiegas <strong>und</strong> nachwachsenden Rohstoffen soll auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage vorhandener Erkenntnisse <strong>und</strong> technischer Verfahren entsprechend den gegebenen<br />
Möglichkeiten weiter vorangetrieben werden.<br />
(5) Auf die Nutzung der Sonnenenergie in der Planungsregion soll durch geeignete<br />
Wissensvermittlung <strong>und</strong> durch die Realisierung von Demonstrationsprojekten hingewirkt<br />
werden.<br />
(6) Im Rahmen einer umwelt- <strong>und</strong> ressourcenschonenden Energieerzeugung ist die Nutzung<br />
von Wasserkraft weiter voranzutreiben.<br />
Begründung<br />
zu 10.3.4(1):<br />
Die Nutzung fossiler Energieträger ist verb<strong>und</strong>en mit starken <strong>und</strong> weiter ansteigenden Umweltbelastungen.<br />
Dies zeigt sich insbesondere an den sich ankündigenden Veränderungen des Weltklimas <strong>und</strong> den sich daraus<br />
ergebenden bedrohlichen Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche. Ihr Einsatz ist deshalb in den nächsten<br />
Jahren weiter zu reduzieren. Regenerative Energieträger dagegen sind umweltverträglich, klimarelevante<br />
Emissionen fallen bei ihrer Umwandlung kaum an. Die in der Planungsregion zur Verfügung stehenden<br />
Potentiale an regenerativen Energieträgern sind vor allem Sonne, Wind, Biomasse <strong>und</strong> Geothermie. Ihr Anteil<br />
an der Energieerzeugung ist bisher gering, da ihre Anwendung gegenwärtig in vielen Fällen noch nicht<br />
wirtschaftlich genug ist. Insbesondere wegen der bereits genannten Umweltaspekte sollte ihr Anteil an der<br />
Energieerzeugung im Einklang mit der Entwicklung der Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen jedoch weiter<br />
erhöht werden.<br />
zu 10.3.4(2):<br />
Die Planungsregion verfügt über wirtschaftlich relevante Windenergiepotentiale. Diese sollen einer natur- <strong>und</strong><br />
landschaftsverträglichen Nutzung zugeführt werden.<br />
Die konzentrierte Ansiedlung von Windenergieanlagen in den in der Karte (M 1 : 100 000) ausgewiesenen<br />
Eignungsräumen soll Nutzungskonflikte mit den Belangen des Naturschutzes, des Tourismus <strong>und</strong> der Naherholung<br />
vermindern <strong>und</strong> eine technische Überformung der Landschaft verhindern. Darüber hinaus beschleunigt<br />
die Zusammenfassung von Windparks an konfliktarmen Standorten die Genehmigungsverfahren<br />
<strong>und</strong> reduziert den Erschließungsaufwand.<br />
Die in der Planungsregion ausgewiesenen Eignungsräume umfassen insgesamt eine Fläche von ca. 21 km².<br />
Die Ausweisung der Eignungsräume für Windenergieanlagen erfolgte auf der Gr<strong>und</strong>lage von Fachgutachten<br />
nach landesweit einheitlichen Kriterien, die von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern festgesetzt<br />
wurden. Es wurden folgende Ausschlußkriterien entsprechend der Definition einer landesweiten Analyse <strong>und</strong><br />
Bewertung der Landschaftspotentiale in Mecklenburg-Vorpommern angesetzt:<br />
- mittlere bis sehr hohe Bewertung des Landschaftsbildes (mit Ausnahme von Räumen, die erhebliche lokale<br />
Vorbelastungen aufweisen oder in denen die Errichtung von Windenergieanlagen nur geringe visuelle<br />
Fernwirkungen entfalten würde),<br />
- mittlere bis sehr hohe Bewertung des Arten- <strong>und</strong> Lebensraumpotentials,<br />
- Gebiete mit hoher bis sehr hoher Dichte ziehender Vögel (Zone A).<br />
166
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
(Quelle: Gutachten zur Ausweisung von Eignungsräumen für Windenergienutzung in den Regionalen<br />
Raumordnungsprogrammen mit dem <strong>Teil</strong>beitrag: Fachgutachten „Windenergienutzung <strong>und</strong> Naturschutz -<br />
Darstellung des Konfliktpotentials aus der Sicht des Naturschutzes <strong>und</strong> der Landschaftspflege“, I.L.N.<br />
GREIFSWALD 1996, erstellt im Auftrag der Ministerien für Landwirtschaft <strong>und</strong> Naturschutz sowie Bau,<br />
Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern.)<br />
Des weiteren wurden die Abstandsempfehlungen entsprechend den "Hinweisen zur Aufstellung von Bauleitplänen<br />
<strong>und</strong> Satzungen über Vorhaben- <strong>und</strong> Erschließungspläne für Windkraftanlagen" (AmtsBl. M-V Nr.<br />
2/1996) sowie eine technische <strong>und</strong> wirtschaftliche Bewertung der verfügbaren Windpotentiale berücksichtigt.<br />
(Quelle: Gutachten zur Ausweisung von Eignungsräumen für Windenergienutzung in den Regionalen<br />
Raumordnungsprogrammen mit dem <strong>Teil</strong>beitrag: Fachgutachten „Windpotential- <strong>und</strong> Flächenanalyse -<br />
Ermittlung <strong>und</strong> Abschätzung des technischen Ertragspotentials“, WIND-consult 1996, erstellt im Auftrag der<br />
Ministerien für Landwirtschaft <strong>und</strong> Naturschutz sowie Bau, Landesentwicklung <strong>und</strong> Umwelt des Landes<br />
Mecklenburg-Vorpommern.)<br />
Die Berücksichtigung exakter Abstandserfordernisse innerhalb der Eignungsräume erfolgt im Rahmen der<br />
konkreten Vorhabensplanung.<br />
Das oben genannte Ziel gilt für alle raumbedeutsamen Vorhaben. Von einer Raumbedeutsamkeit wird im<br />
allgemeinen bei einer Errichtung von drei oder mehr Einzelanlagen oder einer Leistung von mehr als 300<br />
Kilowatt an einem Standort ausgegangen. Auch bereits bei der Errichtung von einer Einzelanlage wird im<br />
allgemeinen von einem raumbedeutsamen Vorhaben ausgegangen, wenn es sich dabei um einen hervorgehobenen<br />
Standort oder um einen Standort in einem landschaftlich besonders wertvollen Raum handelt.<br />
Ausnahmen können neben den gesetzlich ohnehin nicht von der Ausschlußwirkung betroffenen Vorhaben<br />
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch für Einzelanlagen, die objektbezogen zur überwiegenden Eigenversorgung<br />
dienen (z.B. für die Versorgung von Kläranlagen <strong>und</strong> Schöpfwerken), zugelassen werden, wenn<br />
öffentliche Belange nicht entgegenstehen <strong>und</strong> die ausreichende Erschließung gesichert ist.<br />
zu 10.3.4(3):<br />
In der Planungsregion werden bereits geothermische Ressourcen genutzt. Im Mittelzentrum Waren (Müritz)<br />
werden seit 1984 im Wohngebiet Papenberg ca. 1.000 Wohneinheiten mit Erdwärme beheizt. Die geothermische<br />
Heizzentrale hat eine installierte Leistung von 5 MW. Auch im Oberzentrum Neubrandenburg<br />
arbeitet eine geothermische Heizzentrale zur Versorgung von Wohnungen mit Wärme. Diese hat eine installierte<br />
Leistung von 10 MW. Die geothermischen Heizzentralen tragen mit dazu bei, daß die Luft weniger<br />
mit Schadstoffen belastet wird.<br />
zu 10.3.4(4):<br />
Für die Nutzung von Biogas <strong>und</strong> nachwachsenden Rohstoffen als Energieträger besitzt die Planungsregion<br />
gute Voraussetzungen. Der umweltverträgliche Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur energetischen<br />
Verwertung kann sich zu einer Einkommensquelle in der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft entwickeln.<br />
zu 10.3.4(5):<br />
Über Möglichkeiten zur Nutzung der Sonnenenergie liegen im In- <strong>und</strong> Ausland bereits vielfältige praktische<br />
Erfahrungen vor. Durch geeignete Wissensvermittlung sowie durch die Realisierung von geeigneten Demonstrationsprojekten<br />
kann ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung der Sonnenenergienutzung in der Region<br />
geleistet werden.<br />
zu 10.3.4(6):<br />
167
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Die Wasserkraft kann in Ergänzung zu herkömmlichen Energieträgern als Energiequelle zur Stromerzeugung<br />
genutzt werden. Sie ist eine der am wenigsten umweltbelastenden Energiequellen. In der Planungsregion gibt<br />
es 30 ehemals genutzte Wasserkraftstandorte mit einem Leistungspotential von ca. 450 kW (Quelle:<br />
Regionalatlas Erneuerbare Energie Mecklenburgische Seenplatte, Informations- <strong>und</strong> Kontaktstelle -<br />
energieplus- am Technologiezentrum Neubrandenburg 1995).<br />
10.4 Abfallwirtschaft<br />
(1) In der Planungsregion soll eine moderne, effektive <strong>und</strong> umweltverträgliche Abfallwirtschaft<br />
aufgebaut werden, die die Entsorgungssicherheit für die Bevölkerung <strong>und</strong> die Wirtschaft<br />
nach dem Stand der Technik gewährleistet <strong>und</strong> folgenden Prinzipien entspricht:<br />
- Vorrang der Abfallvermeidung/-minimierung vor stofflicher Verwertung,<br />
- umweltgerechte Zurückführung geeigneter Abfälle in den Stoffkreislauf,<br />
- umweltgerechte Behandlung stofflich nicht verwertbarer Abfälle vor ihrer Ablagerung,<br />
- umweltgerechte Ablagerung nicht weiter zu behandelnder Restabfälle.<br />
(2) Wiederverwertbare Stoffe sind getrennt zu erfassen, in einer Recyclingindustrie zu verwerten<br />
<strong>und</strong> umweltverträglich in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Biologisch abbaubare<br />
Abfälle sind getrennt zu erfassen <strong>und</strong> einer Verwertung z.B. zur Bodenverbesserung zuzuführen.<br />
Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch) sind aufzubereiten <strong>und</strong><br />
soweit wie möglich wieder als Baustoffe einzusetzen. Klärschlamm ist, soweit möglich, zu<br />
verwerten, im übrigen umweltverträglich zu entsorgen. Sonderabfälle sind getrennt zu erfassen,<br />
zu verwerten bzw. sachgerecht zu entsorgen.<br />
(3) Nicht vermeidbare <strong>und</strong> nicht verwertbare Abfälle sind umweltverträglich nach dem<br />
Stand der Technik zu entsorgen. Geeignete Räume oder Standorte für<br />
Abfallentsorgungsanlagen sind entsprechend dem zukünftigen Bedarf langfristig für diese<br />
Nutzung zu sichern. Deponien, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, sind<br />
umzurüsten bzw. zu schließen. Vor einer Deponierung sind durch Vorbehandlung<br />
Schadstoffgehalt <strong>und</strong> Volumen der Restabfallmengen weitestgehend zu reduzieren.<br />
(4) Altstandorte der Planungsregion sind, soweit dies möglich ist, einer nutzungsbezogenen<br />
Sanierung zuzuführen.<br />
Begründung<br />
168
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
zu 10.4(1):<br />
Die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften der Planungsregion haben sich zur Gewährleistung der<br />
Entsorgungssicherheit für Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft in der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs-<br />
<strong>und</strong> Deponie GmbH zusammengeschlossen. Des weiteren gehört dieser Gesellschaft der Landkreis<br />
Uecker-Randow an. Der Zusammenschluß in diesem Verband soll der Errichtung, Betreibung <strong>und</strong><br />
Unterhaltung einer modernen Abfallwirtschaft auf der Gr<strong>und</strong>lage einer optimalen Umweltverträglichkeit <strong>und</strong><br />
Wirtschaftlichkeit dienen.<br />
Eine moderne Abfallwirtschaft muß sich auf eine abfallarme Produktion, einen abfallreduzierten Verbrauch<br />
von Wirtschaftsgütern, eine maximale stoffliche Verwertung verbleibender Abfälle durch getrennte Wertstofferfassung<br />
<strong>und</strong> -verwertung, eine Reduzierung der Schadstoffe der Restabfälle sowie umweltverträgliche<br />
Deponierung stützen können. Dabei muß im Interesse des Schutzes der Menschen <strong>und</strong> der Umwelt sichergestellt<br />
werden, daß die nach dem Stand der Technik besten Verfahren zur Anwendung kommen.<br />
zu 10.4(2):<br />
Die wachsenden Anforderungen an die Abfallwirtschaft zum Schutz der natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong><br />
zum sparsamen Umgang mit Ressourcen erfordern eine dringende Reduzierung der anfallenden Abfallmengen<br />
sowie eine Wiederverwendung der im Abfall enthaltenen recyclefähigen Stoffe, wenn dies energetisch <strong>und</strong><br />
ökologisch sinnvoll ist. Die Errichtung von Recyclinganlagen ist außerdem eine sinnvolle Maßnahme zur<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen.<br />
Folgendes Aufkommen an festen Siedlungsabfällen war im Jahr 1996 in der Planungsregion zu verzeichnen:<br />
- Hausmüll ca. 79.073 t<br />
- hausmüllähnliche Gewerbeabfälle ca. 18.774 t<br />
- Sperrmüll ca. 26.283 t<br />
(Quelle: Daten zur Abfallwirtschaft, Landesamt für Umwelt <strong>und</strong> Natur Mecklenburg-Vorpommern, Heft 1/97)<br />
Über getrennte Erfassungssysteme <strong>und</strong> Abfallsortierung können die anfallenden Abfallmengen reduziert <strong>und</strong><br />
ein Großteil der im Abfall enthaltenen Wertstoffe ausgesondert <strong>und</strong> über Recyclingverfahren in den Stoffkreislauf<br />
zurückgeführt werden.<br />
Folgendes Wertstoffaufkommen wurde in den Kreisen der Planungsregion im Jahr 1996 erzielt:<br />
- Papier, Pappe, Karton ca. 24.989 t<br />
- Glas ca. 12.178 t<br />
- Leichtverpackungen ca. 6.347 t<br />
(Quelle: Daten zur Abfallwirtschaft, Landesamt für Umwelt <strong>und</strong> Natur Mecklenburg-Vorpommern, Heft 1/97)<br />
Hausmüll enthält durchschnittlich einen Anteil von ca. 30 % an organischen Abfällen. Durch die getrennte<br />
Erfassung dieses organischen Anteils <strong>und</strong> eine anschließende Kompostierung kann eine wesentliche Reduzierung<br />
des Hausmülls <strong>und</strong> der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle erreicht werden. Eine Voraussetzung dafür<br />
ist jedoch die mögliche Vermarktung des Kompostes.<br />
Das Abfallwirtschafts- <strong>und</strong> Altlastengesetz für Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V S. 43) fordert die stoffliche Verwertung von unbelasteten<br />
Bauabfällen. Dafür sind die erforderlichen Verwertungskapazitäten zu schaffen.<br />
Klärschlamm ist der bei der Behandlung von Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen einschließlich zugehöriger<br />
Anlagen zur weitergehenden Abwasserreinigung anfallende Schlamm, auch entwässert oder getrocknet<br />
oder in sonstiger Form behandelt.<br />
169
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Entsprechend den Ausführungen in der Begründung zu 10.2.2(4) sollte hinsichtlich des Klärschlammes auf<br />
eine Verringerung der Belastung mit Schadstoffen orientiert werden, um eine umweltverträgliche Verwertung<br />
gewährleisten zu können. Klärschlämme, die nicht in den Anwendungsbereich der Klärschlammverordnung<br />
fallen oder die darin festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, unterliegen den Bestimmungen des<br />
Abfallwirtschafts- <strong>und</strong> Altlastengesetzes <strong>und</strong> sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.<br />
zu 10.4(3):<br />
Selbst bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten für Vermeidung <strong>und</strong> Verwertung von Abfällen werden auch in<br />
Zukunft Abfälle auf Dauer umweltverträglich abgelagert werden müssen. Zur langfristigen Gewährleistung<br />
der Entsorgungssicherheit muß dazu ausreichend Deponieraum vorhanden sein, der nach dem Stand der<br />
Technik zu errichten <strong>und</strong> zu betreiben ist.<br />
Nach dem verbindlichen "Verfahren zur Standortsuche für Deponien in Mecklenburg-Vorpommern"<br />
(Wirtschaftsministerium <strong>und</strong> Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern vom 30.September 1992) wurde<br />
für das Gebiet der OVVD-GmbH eine Weißflächenkartierung durchgeführt, in deren Ergebnis mögliche<br />
Deponiestandorte ermittelt wurden. Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit wird auf dem in dem<br />
Verfahren ermittelten <strong>und</strong> in der Karte (M 1 : 100 000) dargestellten Vorzugsstandort in der Gemeinde<br />
Rosenow (Landkreis Demmin) eine Verbandsdeponie für eine Laufzeit von ca. 20 Jahren errichtet.<br />
Von den gegenwärtig in der Planungsregion vorhandenen Deponien entsprechen nur die Deponien Lindenhof<br />
(2. Bauabschnitt) <strong>und</strong> Freidorf dem Standard nach TA Siedlungsabfall <strong>und</strong> sind bis zur Erschöpfung des<br />
Restvolumens nutzbar (siehe: „Erläuterungen <strong>und</strong> Planungsgr<strong>und</strong>lagen zu der Verordnung über den<br />
Abfallentsorgungsplan M-V“, AmtsBl. M-V Nr. 43/1996).<br />
zu 10.4(4):<br />
Altstandorte sind Gr<strong>und</strong>stücke stillgelegter Standorte, Anlagen oder sonstiger Flächen, in oder auf denen mit<br />
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde, insbesondere im Rahmen industrieller oder sonstiger<br />
gewerblicher Tätigkeit (Abfallwirtschafts- <strong>und</strong> Altlastengesetz für Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung<br />
der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V S. 43)).<br />
Entsprechend den Erfordernissen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung <strong>und</strong> eines möglichst sparsamen<br />
Landverbrauches sollten die Altstandorte, insbesondere solche in zentraler Lage mit guter verkehrlicher<br />
Anbindung <strong>und</strong> geringen Nutzungsbeschränkungen, zur gewerblichen Wiedernutzung reaktiviert<br />
werden (siehe dazu auch Programmsatz 5.4(1)).<br />
10.5 Immissionsschutz<br />
(1) Zur Vorsorge gegen Lärmbelästigungen <strong>und</strong> Luftverunreinigungen sind in der<br />
Planungsregion konkurrierende Nutzungen einander so zuzuordnen, daß schädliche<br />
Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.<br />
(2) Alle raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen sollen so ausgerichtet<br />
werden, daß unvermeidbare Lärmquellen zu einer möglichst geringen Belastung für die<br />
Bevölkerung <strong>und</strong> die Umwelt werden.<br />
170
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
Begründung<br />
zu 10.5(1):<br />
Als schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 B<strong>und</strong>es-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.<br />
Juli 1995 (BGBl. I S. 930), solche Immissionen zu sehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind,<br />
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft<br />
herbeizuführen. Gr<strong>und</strong>sätzlich sollen alle Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen darauf ausgerichtet werden,<br />
daß schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, nicht hervorgerufen<br />
werden.<br />
zu 10.5(2):<br />
Lärmbelästigungen bilden häufig die Ursache für eine verminderte Lebensqualität der Bevölkerung. Mit der<br />
Wahl von geeigneten Standorten für potentielle Lärmemittenten lassen sich die zu erwartenden Belastungen<br />
minimieren.<br />
Besondere Bedeutung kommt in der Planungsregion dem Schutz vor den Lärmemissionen des Verkehrsflughafens<br />
Neubrandenburg zu (siehe auch Programmsatz 5.1.4(4)). Für diesen liegen bisher keine entsprechend<br />
dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. Mai 1971 (BGBl. I S.282), zuletzt geändert durch § 4 Abs. 1<br />
Nr. 9 des Gesetzes vom 25. September 1990 (BGBl. I S. 2106) festgesetzten Lärmschutzbereiche vor. Zur<br />
Sicherung der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit des Flugplatzes sowie zur Berücksichtigung der Anforderungen<br />
an ges<strong>und</strong>e Arbeits- <strong>und</strong> Lebensbedingungen in der Bauleitplanung der umliegenden Gemeinden<br />
ist jedoch eine fachgerechte Berücksichtigung der vom Flugbetrieb ausgehenden Lärmemissionen erforderlich.<br />
Bis zum Vorliegen gesetzlich festgesetzter Lärmschutzbereiche ist deshalb das "Gutachten zur<br />
Empfehlung von Lärmschutzbereichen für den Flugplatz Neubrandenburg-Trollenhagen" des Hygiene-<br />
Institutes Neustrelitz vom 25. September 1992, das im Auftrag des Innenministeriums Mecklenburg-<br />
Vorpommern erarbeitet wurde, im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten. Daraus ergeben sich folgende<br />
Bauverbote <strong>und</strong> -beschränkungen:<br />
- Im gesamten Lärmschutzbereich (Schutzzone I <strong>und</strong> II) dürfen Krankenhäuser, Altenheime,<br />
Erholungsheime, Schulen <strong>und</strong> ähnliche Einrichtungen nicht errichtet werden.<br />
- In der Schutzzone I dürfen keine Wohnungen errichtet werden (Ausnahme Wohnungen im Bestand,<br />
Wohnungen für Aufsichts- <strong>und</strong> Bereitschaftspersonal <strong>und</strong> B<strong>und</strong>eswehrangehörige).<br />
- Zulässige Bauten sind mit dem entsprechend erforderlichen Schallschutz auszurüsten.<br />
(Quelle: Gutachten zur Empfehlung von Lärmschutzbereichen für den Flugplatz Neubrandenburg-Trollenhagen,<br />
Hygiene-Institut Neustrelitz vom 25. September 1992)<br />
Des weiteren sind beim Verkehrsflughafen Neubrandenburg die Bauhöhenbeschränkungen des militärischen<br />
Bauschutzbereiches des B<strong>und</strong>esministeriums für Verteidigung vom 22. Februar 1996 zu beachten. Diese sind<br />
in der Karte M (1 : 100 000) dargestellt.<br />
Auch beim Verkehrslandeplatz Rechlin-Lärz, dessen Bauschutzbereich ebenfalls in der Karte (M 1 : 100 000)<br />
dargestellt ist, <strong>und</strong> bei gegebenenfalls weiteren Landeplätzen ist entsprechenden Maßnahmen zum Schutz vor<br />
Lärm ausreichend Beachtung zu schenken.<br />
171
Sonstige technische Infrastruktur RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
172
RROP Mecklenburgische Seenplatte Sonstige technische Infrastruktur<br />
173
Verteidigung <strong>und</strong> Konversion RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
11. Verteidigung <strong>und</strong> Konversion<br />
11.1 Verteidigung<br />
(1) Die Belange des zivilen Schutzes <strong>und</strong> der militärischen Verteidigung sind bei der Erhaltung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung raumbedeutsamer Strukturen zu berücksichtigen. Dabei sollen sie<br />
sich so weit wie möglich in das vorhandene Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialgefüge einordnen sowie<br />
den Belangen von Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege <strong>und</strong> einer geordneten<br />
Siedlungsentwicklung gerecht werden.<br />
(2) Standorte neu anzusiedelnder Verteidigungseinrichtungen sollen so gewählt werden,<br />
daß sie mit ihren wirtschaftlichen Impulsen, mit den baulichen <strong>und</strong> sonstigen<br />
infrastrukturellen (Folge-)maßnahmen insbesondere zur Stärkung der ländlichen Räume,<br />
zur Verbesserung der Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen der dort ansässigen Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> zur Gestaltung des Landschafts- <strong>und</strong> Ortsbildes beitragen. Dabei soll die<br />
Wiederverwendbarkeit von ehemals militärisch genutzten Standorten vorrangig geprüft<br />
werden, sofern für diese noch keine zivilen Nachnutzungen bestehen. Alle Vorranggebiete<br />
<strong>und</strong> Vorsorgeräume sowie die Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong> Tourismusentwicklungsräume<br />
sollen möglichst von größeren militärischen Anlagen freigehalten werden.<br />
(3) Auf die Verlagerung großflächiger, extensiv genutzter militärischer Einrichtungen aus<br />
dem Oberzentrum Neubrandenburg in das Umland soll hingewirkt werden.<br />
Begründung<br />
zu 11.1(1):<br />
Die sicherheitspolitischen Aufgaben des B<strong>und</strong>es machen die Bereitstellung <strong>und</strong> Erhaltung einer ausreichenden<br />
Zahl von Verteidigungsanlagen in der Region erforderlich. Deshalb sind die Belange der Verteidigung bei<br />
raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Maßnahmen zu berücksichtigen. Da Verteidigungsanlagen<br />
zumeist große Flächen in Anspruch nehmen, ist eine umfassende Koordination <strong>und</strong> Abstimmung der verschiedenen<br />
Belange notwendig. Durch die sorgfältige Einordnung von Verteidigungsvorhaben in die gegebene<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialstruktur <strong>und</strong> Abstimmung, insbesondere mit den Belangen des Naturschutzes<br />
<strong>und</strong> der Landschaftspflege sowie der Siedlungsentwicklung, kann die Integration solcher Anlagen erleichtert<br />
werden.<br />
zu 11.1(2):<br />
Der Bau von Truppenunterkünften <strong>und</strong> dazugehörigen Dienstwohnungen für Soldaten ist auf Gr<strong>und</strong> der<br />
hierdurch erforderlich werdenden infrastrukturellen Maßnahmen wie Neu- <strong>und</strong> Ausbau von Versorgungsanlagen,<br />
von Sportstätten <strong>und</strong> kulturellen Einrichtungen geeignet, auch die zivile Infrastruktur der Standortgemeinden<br />
zu verbessern. Neben einer Belebung der Bauwirtschaft werden auch die Schaffung <strong>und</strong> Sicherung<br />
ziviler Arbeitsplätze erreicht. Damit die Verbesserung der Infrastruktur <strong>und</strong> des Arbeitsplatzangebots einem<br />
möglichst großen Bevölkerungskreis zugute kommt, bieten sich zentrale Orte in den ländlichen Räumen als<br />
geeignete Standorte an. Da sich eine vollständige harmonische Einfügung größerer militärischer Anlagen<br />
(z.B. Flugplätze, Truppenübungsplätze <strong>und</strong> unter Umständen auch Standortübungsplätze) in das Landschafts-<br />
<strong>und</strong> Ortsbild <strong>und</strong> ein völliger Ausschluß von Emissionen (Lärm, Staub, Abgase) häufig nicht erreichen lassen,<br />
174
RROP Mecklenburgische Seenplatte Verteidigung <strong>und</strong> Konversion<br />
ist die Freihaltung der Vorranggebiete <strong>und</strong> Vorsorgeräume, insbesondere für Naturschutz <strong>und</strong><br />
Landschaftspflege, sowie für den Trinkwasserschutz <strong>und</strong> die Freihaltung der Tourismusschwerpunkt- <strong>und</strong><br />
Tourismusentwicklungsräume von solchen Anlagen nötig. Durch die Wiedernutzung heute brachliegender<br />
militärischer Anlagen <strong>und</strong> Einrichtungen wird ein wesentlicher Beitrag zum Flächenrecycling <strong>und</strong> zur<br />
Schonung der freien Landschaft geleistet.<br />
zu 11.1(3):<br />
Die großflächigen, extensiv genutzten militärischen Anlagen auf dem Territorium der Stadt Neubrandenburg<br />
stehen, insbesondere in Form des Standortübungsplatzes Fünfeichen, der geordneten städtebaulichen<br />
Entwicklung zu einem funktionsfähigen <strong>und</strong> attraktiven Oberzentrum teilweise entgegen. Deshalb ist im<br />
Einzelfall zu prüfen, ob eine Konzentration an vorhandenen Standorten bzw. eine Verlegung dieser Einrichtungen<br />
in das Umland sinnvoll ist.<br />
11.2 Konversion<br />
(1) Die Auflösung dauernd entbehrlicher militärischer Liegenschaften sowie Standortveränderungen<br />
von Verteidigungseinrichtungen sollen bei Berücksichtigung der militärischen<br />
oder zivilen Notwendigkeit mit dem Ziel der Minimierung wirtschaftlicher Nachteile für<br />
die Region <strong>und</strong> den betroffenen <strong>Teil</strong>raum erfolgen.<br />
(2) Konversionsflächen sind auf Altlasten <strong>und</strong> davon ausgehende Gefährdungen hin zu<br />
untersuchen <strong>und</strong> zu erfassen. Unmittelbare Gefahren für Leib <strong>und</strong> Leben <strong>und</strong> für lebenswichtige<br />
Ressourcen sind unverzüglich zu beseitigen. Altlasten, die Belange von Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege sowie das Ortsbild beeinträchtigen, sollen unter Berücksichtigung<br />
von möglichen Nachnutzungen saniert werden.<br />
(3) Die Nachnutzung dauernd entbehrlicher militärischer Liegenschaften soll den differenzierten<br />
Ansprüchen des raumordnerischen Gesamtrahmens gerecht werden. Insbesondere in<br />
den ländlichen Räumen sollen Nachnutzungen an geeigneten siedlungsnahen Standorten zur<br />
Verbesserung der Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialstruktur sowie der Infrastruktur beitragen. In<br />
Räumen mit Sicherungs- <strong>und</strong> Eignungscharakter sollen Flächen ehemaliger militärischer<br />
Liegenschaften in ihrer weiteren Verwendung den Sicherungs- <strong>und</strong> Eignungszielen entsprechen.<br />
Begründung<br />
zu 11.2(1):<br />
Die Auflösung dauernd entbehrlicher militärischer Liegenschaften sowie Standortveränderungen von Verteidigungseinrichtungen<br />
haben gr<strong>und</strong>sätzlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft <strong>und</strong> das Sozialgefüge des<br />
davon berührten <strong>Teil</strong>raumes bzw. der Region. Diese sind umso gravierender, je einseitiger das Wirtschaftsgeschehen<br />
auf die Militärpräsenz ausgerichtet ist <strong>und</strong> von dieser abhängig ist. Bei der Entscheidung<br />
über den Abzug von Truppen <strong>und</strong> dessen Zeitplan sind deshalb insbesondere die lokale <strong>und</strong> regionale<br />
Arbeitsmarktsituation zu berücksichtigen <strong>und</strong> geeignete wirtschaftliche Umstrukturierungsmaßnahmen<br />
langfristig vor der endgültigen Auflösung zu fördern, um die wirtschaftlichen <strong>und</strong> sozialen Negativeffekte zu<br />
minimieren.<br />
175
Verteidigung <strong>und</strong> Konversion RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
zu 11.2(2):<br />
Ehemals militärisch genutzte Liegenschaften stellen generell Altlastenverdachtsstandorte dar. Um den Grad<br />
der Gefährdung für den Menschen <strong>und</strong> die Umwelt festzustellen <strong>und</strong> frühzeitig geeignete Sanierungsmaßnahmen<br />
ergreifen zu können, sind gr<strong>und</strong>sätzlich alle militärischen Altanlagen von vor dem Jahr 1989 auf ihre<br />
Umweltbelastungen hin zu untersuchen. Dabei können Umweltbelastungen sowohl in Form von Boden- <strong>und</strong><br />
Gewässer- bzw. Gr<strong>und</strong>wasserkontaminationen durch Öle, Kerosin (Flugplätze), Munition, chemische <strong>und</strong><br />
radioaktive Kampfstoffe <strong>und</strong> ähnlichem als auch in Form von Bauwerken, die das Orts- <strong>und</strong> Landschaftsbild<br />
beeinträchtigen, auftreten. Durch die Berücksichtigung der potentiellen Nachnutzungsart (siehe Programmsatz<br />
11.2(3)) können bereits bei der Sanierung unnötige Mehrkosten vermieden werden.<br />
zu 11.2(3):<br />
Durch raumordnerisch abgestimmte, zielkonforme Nachnutzungskonzeptionen, die auf den vorhandenen<br />
Raumpotentialen aufbauen <strong>und</strong> Nutzungskonflikte ausräumen bzw. vermeiden, kann ein wesentlicher Beitrag<br />
zur Stärkung der Region <strong>und</strong> ihrer <strong>Teil</strong>räume geleistet werden. Die Konversionsflächen der in der Region<br />
dominierenden ehemaligen GUS-Standorte mit einer Größe von über 5 Hektar sind in Tabelle 24 aufgeführt<br />
sowie in der Karte (M 1 : 100 000) <strong>und</strong> der Erläuterungskarte 14 dargestellt. Die Nummerierungen in der<br />
Erläuterungskarte 14 beziehen sich auf Tabelle 24, Spalte 1.<br />
Tabelle 24:<br />
Ehemals militärisch genutzte Flächen (Konversionsflächen)<br />
lfd. Nr. Ort/Landkreis Größe ha<br />
1 Tutow / Demmin 564,7<br />
2 Priborn / Müritz 11,2<br />
3 Lärz / Müritz 349,0<br />
4 Lärz / Müritz 186,3<br />
5 Lärz / Müritz 14,6<br />
6 Rechlin / Müritz 53,3<br />
7 Rechlin / Müritz 7,0<br />
8 Rechlin / Müritz 7,5<br />
9 Wokuhl / MST 324,2<br />
10 Speck / Müritz + Granzin / MST 2.942,6<br />
11 Neustrelitz - B193 / MST 169,6<br />
12 Neustrelitz - B193 / MST 67,4<br />
13 Neustrelitz - B96 / MST 20,6<br />
14 Neustrelitz - B96 / MST 18,8<br />
15 Neustrelitz - B96 Süd / MST 8,4<br />
16 Neustrelitz - Richtung Userin / MST 8,6<br />
17 Neustrelitz - Süd/West / MST 72,7<br />
18 Neustrelitz - Süd/West / MST 31,3<br />
19 Strelitz Alt / MST 23,3<br />
20 Fürstensee / MST 164,0<br />
21 Neustrelitz - B193 / MST 725,0<br />
Abkürzungen: MST = Mecklenburg-Strelitz<br />
Quellen: Eigene Erhebung, Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
176
RROP Mecklenburgische Seenplatte Verteidigung <strong>und</strong> Konversion<br />
177
Verteidigung <strong>und</strong> Konversion RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
178
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
Anhang<br />
Anlage 1:<br />
Erläuterungen <strong>und</strong> Definitionen zum zentralörtlichen System<br />
in Mecklenburg-Vorpommern<br />
(auszugsweise nachrichtliche Übernahme von 2.1 LROP)<br />
Anlage 2:<br />
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete <strong>und</strong> Naturparke<br />
in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte (Stand: Dezember 1996)<br />
Anlage 3:<br />
Bergbauberechtigungen mit Übersichtskarte (Stand: 19.11.1996)<br />
(nachrichtliche Übernahme vom Bergamt Strals<strong>und</strong>)<br />
179
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
180
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
Anlage 1:<br />
Erläuterungen <strong>und</strong> Definitionen zum zentralörtlichen System<br />
in Mecklenburg-Vorpommern (auszugsweise nachrichtliche Übernahme von 2.1 LROP)<br />
2.1.2 Oberzentren<br />
(1) Oberzentren sollen so entwickelt werden, daß sie für die Bevölkerung ihres Oberbereiches<br />
Einrichtungen des spezialisierten höheren Bedarfs vorhalten. Sie sind so auszubauen,<br />
daß sie Entwicklungsimpulse auf das Umland ausstrahlen.<br />
Begründung<br />
zu 1: Oberzentren sind großräumig bedeutsame Standorte für Industrie- <strong>und</strong> Dienstleistungsbetriebe <strong>und</strong><br />
halten Arbeitsplätze auch für die Bevölkerung des Umlandes vor. Oberzentren weisen in der Regel mehr als<br />
100.000 Einwohner im zentralen Ort auf <strong>und</strong> sind aus dem zugeordneten Oberbereich mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
in ca. 90 Minuten zu erreichen.<br />
Die Regelausstattung von Oberzentren ist ausgerichtet vor allem auf<br />
- Hochschule (Universität bzw. Fachhochschule),<br />
- Bibliothek (Anschluß an den überregionalen Leihverkehr),<br />
- Krankenhaus,<br />
- Museum bzw. Kunstsammlung (unter hauptberuflicher Leitung),<br />
- Theater bzw. Konzertbau (regelmäßig bespielt),<br />
- Mehrzweckhalle (ab 1.000 Sitzplätzen),<br />
- Sportstadion (ab 15.000 Plätzen),<br />
- Großsporthalle (ab 3.000 Plätzen),<br />
- Großschwimmhalle (mit Eignung für überregionale Veranstaltungen),<br />
- Großkauf-/Warenhaus,<br />
- Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungseinrichtungen (mit möglichst vollständig spezialisierter Differenzierung),<br />
- größere Einrichtungen des Bank-/Kredit-/Versicherungswesens,<br />
- Behörden mittlerer bzw. höherer Verwaltungsebene,<br />
- Gerichte höherer bzw. mittlerer Instanz,<br />
- Hotel (ab ca. 200 Fremdenbetten <strong>und</strong> mit Konferenz- <strong>und</strong> Tagungseinrichtungen),<br />
- Eisenbahn-Anschluß mit InterCity/InterRegio-Halt,<br />
- breitgefächertes Angebot hochwertiger Arbeitsplätze,<br />
- vielfältiges <strong>und</strong> hochqualifiziertes Arbeitskräftepotential.<br />
2.1.3 Mittelzentren<br />
(1) Mittelzentren sollen die Bevölkerung ihres Mittelbereiches mit Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
des gehobenen Bedarfs versorgen. Sie bilden nach den Oberzentren die wichtigsten<br />
räumlichen Entwicklungsschwerpunkte <strong>und</strong> sollen so ausgebaut werden, daß auch sie<br />
dazu beitragen, in den ländlichen Räumen gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen.<br />
181
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
(2) Um die Bevölkerung in allen <strong>Teil</strong>en des Landes mit Einrichtungen zur Deckung des gehobenen<br />
Bedarfs in zumutbarer Entfernung versorgen zu können, werden für<br />
Mittelbereiche, in denen kein vollständig ausgebautes Mittelzentrum vorhanden ist,<br />
Mittelzentren mit <strong>Teil</strong>funktionen festgelegt. Mittelzentren mit <strong>Teil</strong>funktionen sollen<br />
mittelzentrale Einrichtungen bedarfsorientiert vorhalten.<br />
Begründung<br />
zu 1: Bei Mittelzentren wird von mehr als 20.000 Einwohnern, zumindest jedoch 15.000 Einwohnern, im<br />
zentralen Ort <strong>und</strong> mindestens 40.000 Einwohnern im Mittelbereich ausgegangen. Mittelzentren werden<br />
Mittelbereiche zugeordnet, aus denen das jeweilige Zentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln in bis zu ca. 60<br />
Minuten erreichbar ist. Die Regelausstattung von Mittelzentren umfaßt im wesentlichen<br />
- Gymnasium (sonstige zur allgemeinen Hochschulreife führende Schule),<br />
- berufsbildende Schule,<br />
- Sonderschule,<br />
- Einrichtung der Erwachsenenbildung (Volkshochschule etc.),<br />
- öffentliche Bücherei,<br />
- Krankenhaus,<br />
- Fachärzte,<br />
- größere Sportanlage,<br />
- Sporthalle (mit Zuschauerkapazitäten),<br />
- Hallen- <strong>und</strong> Freibad,<br />
- größeres städtebaulich integriertes Einkaufszentrum,<br />
- Großhandelseinrichtungen,<br />
- vielschichtige Handwerksbetriebe,<br />
- größere Kreditinstitute,<br />
- direkten Anschluß an das B<strong>und</strong>esfernstraßennetz,<br />
- Anbindung an das Eisenbahnnetz (Eilzug-Halt, möglichst InterRegio-Halt).<br />
zu 2: Mittelzentren mit <strong>Teil</strong>funktionen weisen im zentralen Ort mindestens 10.000 Einwohner, im Mittelbereich<br />
mindestens 30.000 Einwohner auf. Der Umfang der mittelzentralen Ausstattung richtet sich nach der<br />
Tragfähigkeit <strong>und</strong> der Funktionsteilung mit benachbarten zentralen Orten gleicher oder höherer Funktionsstufe.<br />
2.1.4 Zentrale Orte der Nahbereichsstufe<br />
(1) Zentrale Orte der Nahbereichsstufe sind Unterzentren <strong>und</strong> Ländliche Zentralorte <strong>und</strong><br />
werden mit ihren Nahbereichen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen unter Beachtung<br />
der landeseinheitlichen Abgrenzungskriterien flächendeckend festgelegt.<br />
(2) Unterzentren <strong>und</strong> Ländliche Zentralorte sollen so entwickelt werden, daß sie eine angemessene<br />
Versorgung der Bevölkerung des zugeordneten Nahbereichs mit Einrichtungen zur<br />
Deckung des allgemeinen täglichen Bedarfs gewährleisten können.<br />
Begründung<br />
182
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
zu 1: Unterzentren haben eine Wohnbevölkerung von mindestens 4.000 Einwohnern im zentralen Ort <strong>und</strong><br />
8.000 Einwohnern in dessen Nahbereich <strong>und</strong> verfügen über kleinstädtisches Gepräge. In raumordnerisch<br />
begründeten Einzelfällen kann die Mindesteinwohnerzahl im zentralen Ort, nicht jedoch im Nahbereich,<br />
unterschritten werden. Ländliche Zentralorte haben in ihrem Nahbereich in der Regel mindestens 3.500 Einwohner,<br />
in begründeten Ausnahmen mindestens 3.000 Einwohner. Die Mindesteinwohnerzahl im zentralen<br />
Ort beträgt 1.000. Diese Zahl kann unterschritten werden, wenn aus siedlungsstrukturellen Gründen die<br />
Ausweisung eines Nahbereiches erforderlich ist <strong>und</strong> dieser mindestens 3.500 Einwohner umfaßt, dort jedoch<br />
kein geeigneter Ort der genannten Mindestgröße vorhanden ist. Aus dem Verflechtungsbereich sind zentrale<br />
Orte der Nahbereichsstufe in maximal 20 bis 30 Minuten erreichbar<br />
zu 2: Unterzentren <strong>und</strong> Ländliche Zentralorte halten Einrichtungen der Gr<strong>und</strong>versorgung zur Deckung des<br />
allgemeinen täglichen Bedarfs für die Bevölkerung des Nahbereichs vor. Als Regelausstattung ist bei zentralen<br />
Orten der Nahbereichsstufe auszugehen von<br />
- Sitz der Amtsverwaltung,<br />
- Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschule,<br />
- Spiel- <strong>und</strong> Sportstätten,<br />
- Einrichtungen der Kinderbetreuung,<br />
- Einrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitswesens (Arzt, Apotheke),<br />
- Einzelhandelseinrichtungen,<br />
- Handwerks-/Dienstleistungsbetrieben,<br />
- Bedienung mit öffentlichem Nahverkehr.<br />
Unterzentren haben gegenüber Ländlichen Zentralorten eine deutlich umfangreichere Ausstattung, die häufig<br />
auch Gymnasien <strong>und</strong> höherwertige Ges<strong>und</strong>heitseinrichtungen umfaßt.<br />
183
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Anlage 2:<br />
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete <strong>und</strong> Naturparke<br />
in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte (Stand: Dezember 1996)<br />
Naturschutzgebiete (Bestand, einstweilig gesichert <strong>und</strong> im Rechtsetzungsverfahren):<br />
lfd. Nr. Name Größe in ha Landkreis bzw. kreisfreie Stadt<br />
1. Barschmoor 30 Müritz<br />
2. Beseritzer Torfwiesen 20 Mecklenburg-Strelitz<br />
3. Birkbuschwiesen 130 Neubrandenburg, Stadt<br />
4. Blüchersches Bruch <strong>und</strong> Mittelplan 164 Müritz<br />
5. Brückentinsee 247 Mecklenburg-Strelitz<br />
6. Comthureyer Berg 10 Mecklenburg-Strelitz<br />
7. Conower Werder 45 Mecklenburg-Strelitz<br />
8. Damerower Werder 642 Müritz<br />
9. Devener Holz 24 Demmin<br />
10. Drewitzer See mit Lübowsee <strong>und</strong><br />
1.455 Müritz<br />
184<br />
Dreiersee<br />
11. Eichhorst im Schönbecker Wald 34 Mecklenburg-Strelitz<br />
12. Feldberger Hütte 473 Mecklenburg-Strelitz<br />
13. Feuchtgebiet Waidmannslust 178 Demmin, Mecklenburg-Strelitz<br />
14. Galenbecker See 1.885 Mecklenburg-Strelitz / Uecker-Randow<br />
15. Großer Schwerin mit Steinhorn 320 Müritz<br />
16. Gr<strong>und</strong>loser See bei Ahrensberg 44 Mecklenburg-Strelitz<br />
17. Hauptmannsberg 42 Mecklenburg-Strelitz<br />
18. Heilige Hallen 66 Mecklenburg-Strelitz<br />
19. Hellberge 48 Mecklenburg-Strelitz<br />
20. Hellgr<strong>und</strong> 21 Müritz<br />
21. Hinrichshagen 1.344 Mecklenburg-Strelitz<br />
22. Kalk-Zwischenmoor Wendischhagen 48 Demmin<br />
23. Kalkhorst 78 Mecklenburg-Strelitz<br />
24. Keetzseen 330 Mecklenburg-Strelitz<br />
25. Klein Vielener See 162 Mecklenburg-Strelitz/ Müritz<br />
26. Kleppelshagen 300 Mecklenburg-Strelitz / Uecker-Randow<br />
27. Kronwald 104 Demmin<br />
28. Krüselinsee <strong>und</strong> Mechowseen 500 Mecklenburg-Strelitz<br />
29. Kuckssee <strong>und</strong> Lapitzer See 110 Müritz<br />
30. Kulowseen 235 Mecklenburg-Strelitz<br />
31. Landgrabenwiesen bei Werder 100 Demmin<br />
32. Lauenhagener See 103 Mecklenburg-Strelitz / Uecker-Randow<br />
33. Luisenhofer Teiche 35 Mecklenburg-Strelitz<br />
34. Mirower Holm 58 Mecklenburg-Strelitz<br />
35. Mittelsee bei Langwitz 15 Müritz<br />
36. Mönchsee 245 Müritz<br />
37. Moorwiesen bei Neukalen 250 Demmin<br />
38. Müritzsteilufer bei Rechlin 210 Müritz<br />
39. Nonnenbachtal 60 Mecklenburg-Strelitz
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
40. Nonnenhof 958 Neubrandenburg, Stadt / Mecklenburg-<br />
Strelitz / Müritz<br />
41. Nordufer des Plauer Sees 631 Müritz / Parchim<br />
42. Nordufer Plätlinsee 304 Mecklenburg-Strelitz<br />
43. Obere Nebelseen 508 Müritz<br />
Fortsetzung Naturschutzgebiete:<br />
lfd. Nr. Name Größe in ha Landkreis bzw. kreisfreie Stadt<br />
44. Ostpeene 50 Demmin<br />
45. Ostufer Tiefwar.-Falkenhäger Bruch 110 Müritz<br />
46. Putzarer See <strong>und</strong> Erweiterung 420 Mecklenburg-Strelitz / Ostvorpommern<br />
47. Rothes Moor bei Wesenberg 150 Mecklenburg-Strelitz<br />
48. Rühlower Os 24 Mecklenburg-Strelitz<br />
49. Sandugkensee 67 Mecklenburg-Strelitz<br />
50. Schlavenkensee 610 Mecklenburg-Strelitz<br />
51. Schmaler Luzin 340 Mecklenburg-Strelitz<br />
52. Schwingetal <strong>und</strong> Peenewiesen bei<br />
Trantow<br />
580 Demmin<br />
53. Seen u. Bruchlandschaft südlich<br />
774 Müritz<br />
Alt Gaarz<br />
54. Sprockfitz 26 Mecklenburg-Strelitz<br />
55. Stauchmoräne nördlich Remplin 150 Demmin<br />
56. Torfstiche Stuer 50 Müritz<br />
57. Wallberge u. Kreidescholle bei Alt<br />
22 Demmin<br />
Gatschow<br />
58. Wumm- <strong>und</strong> Twernsee 134 Müritz<br />
59. Wüste <strong>und</strong> Glase 346 Müritz / Güstrow<br />
60. Zahrensee bei Dabelow 10 Mecklenburg-Strelitz<br />
61. Zerrinsee bei Qualzow 100 Mecklenburg-Strelitz<br />
62. Ziemenbachtal 175 Mecklenburg-Strelitz<br />
63. Zippelower Bachtal 160 Mecklenburg-Strelitz<br />
Landschaftsschutzgebiete:<br />
lfd. Nr. Name Größe in ha Landkreis bzw. kreisfreie Stadt<br />
1. Augraben bei Buschmühl 400 Demmin<br />
2. Brohmer Berge 7.700 Mecklenburg-Strelitz<br />
3. Feldberger Seenlandschaft 30.000 Mecklenburg-Strelitz<br />
4. Goldbach-Tollensetal bei Altentrept. 480 Demmin<br />
5. Havelquellseen Kratzeburg 911 Müritz / Mecklenburg-Strelitz<br />
6. Ivenacker Tiergarten 350 Demmin<br />
7. Kastorfer See 294 Demmin<br />
8. Kleinseenplatte Neustrelitz 18.530 Mecklenburg-Strelitz<br />
9. Lindetal bei Neubrandenburg 510 Neubrandenburg, Stadt / Meckl.-Strelitz<br />
10. Malliner Wasser 50 Mecklenburg-Strelitz<br />
11. Malliner Bachtal <strong>und</strong> Seenkette 121 Neubrandenburg, Stadt<br />
12. Malliner Bachtal <strong>und</strong> Seenkette 1.750 Müritz<br />
13. Mecklenburger Großseenland 40.000 Müritz<br />
14. Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong><br />
Kummerower See, gesamt:<br />
67.350 Demmin / Müritz / Güstrow<br />
Anteil in der Planungsregion:<br />
36.400 Demmin / Müritz<br />
15. Müritz-Seen-Park 3.670 Müritz / Mecklenburg-Strelitz<br />
16. Nossentiner-Schwinzer Heide, ges.: 36.500 Müritz / Güstrow / Parchim<br />
Anteil in der Planungsregion:<br />
11.065 Müritz<br />
185
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
17. Tollense-Becken 9.833 Neubr., Stadt / Meckl.-Strelitz / Müritz<br />
18. Tollenseniederung 2.692 Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz<br />
19. Tollensetal 3.100 Demmin<br />
20. Torgelower See 3.340 Müritz<br />
21. Trebeltal 5.010 Demmin<br />
22. Unteres Peenetal 3.200 Demmin<br />
Naturparke:<br />
lfd. Nr. Name Größe in ha Landkreis bzw. kreisfreie Stadt<br />
1. Feldberger Seenlandschaft 36.000 Mecklenburg-Strelitz<br />
2. Mecklenburgische Schweiz <strong>und</strong><br />
Kummerower See, gesamt:<br />
186<br />
Anteil in der Planungsregion:<br />
67.350<br />
36.400<br />
3. Nossentiner-Schwinzer Heide, gesamt:<br />
Anteil in der Planungsregion: 36.500<br />
11.065<br />
Demmin / Müritz / Güstrow<br />
Demmin / Müritz<br />
Müritz / Güstrow / Parchim<br />
Müritz
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
Anlage 3:<br />
Bergbauberechtigungen mit Übersichtskarte (Stand: 19.11.1996)<br />
(nachrichtliche Übernahme vom Bergamt Strals<strong>und</strong>)<br />
Landkreis Demmin<br />
Feldname Rohstoff Status Raumordnerische Kategorie<br />
Alt Tellin KS Erlaubnis<br />
Altentreptow Ost Ton BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Basedow Ost KS B/B<br />
Basedow West (Langer Berg) KS B/A Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Beestland KS Erlaubnis<br />
Brook/Alt Tellin KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Brook/Hohenbüssow QS B/B<br />
Burow KS Erlaubnis<br />
Damerow Nordwest KS Erlaubnis<br />
Dargun Flur 1 KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Demmin Siebeneichen QS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Duckow NordWest QS B/B<br />
Gielow KS B/B<br />
Johannenhöhe QS B/B<br />
Karnitz 2 KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Klein Teetzleben KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Lebbin Nord KS B/B<br />
Lebbin Nord 2 KS B/B<br />
Lebbin West KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Loickenzin Ton BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Müssentin KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Müssentin SE Erweiterung KS Erlaubnis<br />
Müssentin SüdWest KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Müssentin SW Erweiterung KS Erlaubnis Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Müssentin West KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Neukalen KS BWE<br />
Neukalen Ost KS B/B<br />
Neukalen West KS Erlaubnis<br />
Neukalen/Schlakendorf Ton BWE<br />
Sanzkow Ost KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Sassen Südost KS Erlaubnis<br />
Schlackendorf KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Schossow KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Siedenbollentin KS Erlaubnis<br />
Tentzerow SpS Erlaubnis<br />
Tentzerow Sand gr<strong>und</strong>eigen<br />
Teusin KS Erlaubnis<br />
Teusin Nordost QS B/B<br />
Törpin Flur 1/127 KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Treuen KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Treuen Süd KS B/B<br />
Treuen Süd KS Erlaubnis<br />
Treuen/Schwinge KS B/B<br />
Weltzin KS B/B<br />
187
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Zarrenthin KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Landkreis Mecklenburg-Strelitz<br />
Feldname Rohstoff Status Raumordnerische Kategorie<br />
Adolphseck KS B/B<br />
Bassow Kanzleiberg KS Erlaubnis<br />
Bassow SüdWest KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Cammin Nordost Sand B/B<br />
Cammin Nordost KS Erlaubnis<br />
Carwitz Thomsdorf KS BWE<br />
Friedland Ton BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Friedland NordOst Torf B/B<br />
Göhren Ton BWE<br />
Gramelow Ton Aufsuchung Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Hildebrandshagen Ton BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Hohenmin KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Hohenmin/Erweiterung KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Klein Daberkow KS Erlaubnis<br />
Koldenhof KS B/B<br />
Krappmühle Sand gr<strong>und</strong>eigen<br />
Kreuzbruchhof KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Kreuzbruchhof KS Erlaubnis<br />
Küssow West KS BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Lübbersdorf West KS Erlaubnis<br />
Luisenhof KS Erlaubnis<br />
Mildenitz KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Neuenkirchen Süd KS Erlaubnis<br />
Neustrelitz Kiefernheide QS BWE<br />
Neustrelitz Süd KS B/B<br />
Pasenow Südwest KS Erlaubnis<br />
Petersdorf 2 QS Erlaubnis<br />
Ramelow KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Sandhagen KS BWE<br />
Sandhagen West KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Sophienhof Nord 2 KS Erlaubnis Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Sponholz Sand B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Sponholz West KS Erlaubnis<br />
Starsow KS B/B<br />
Starsow KS Erlaubnis<br />
Steinwalde KS BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Steinwalde Ost KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Thurow Rödlin KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Warbende Ton Aufsuchung Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Warlin Sand gr<strong>und</strong>eigen Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Warlin 1 KS Erlaubnis<br />
Warlin 2 Sand B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Warlin Süd KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Woggersin Tannenberg QS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Woldegk Ton BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
188
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
Landkreis Müritz<br />
Feldname Rohstoff Status Raumordnerische Kategorie<br />
Adamshoffnung KS BWE<br />
Erlenkamp KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Grabowhöfe KS gr<strong>und</strong>eigen<br />
Groß Dratow Süd KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Hagenow Süd KS B/B<br />
Hallalit 3 KS Erlaubnis<br />
Hallalit NordOst KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Hallalit NordWest KS BWE<br />
Hallalit Süd KS BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Hohen Wangelin Liepen KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Jabel NordOst KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Jabel Ost KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Kargow KS Erlaubnis<br />
Kargow Unterdorf KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Klein Vielist KS B/B<br />
Klocksin Blücherhof NO 1 KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Klocksin Blücherhof KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Kotzow KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Langhagen Feld 1 KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Liepen KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Liepen NordWest KS Erlaubnis<br />
Malchow KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Malchow Nordwest KS B/A Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Malchow Nordwest I KS Erlaubnis Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Malchow Nordwest II KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Möllenhagen Nord Ton Erlaubnis Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Möllenhagen Ost Ton BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Möllenhagen West Ton BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Möllenhagen Rethwisch KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Schwarz I KS B/B<br />
Schwarz II Mühlenberg KS B/B<br />
Schwarz West KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Stuer Nordfeld KS BWE<br />
Stuer Westfeld KS BWE<br />
Vipperower Heide KS BWE<br />
Wackstow KS B/B Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Wackstow NordWest KS Erlaubnis Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Waren Schwenzin KS BWE Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Wendorf-Bocksee KS B/B<br />
Wildkuhl Nord KS B/B Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung<br />
Wildkuhl Nord KS Erlaubnis<br />
189
Anhang RROP Mecklenburgische Seenplatte<br />
Stadt Neubrandenburg<br />
Feldname Rohstoff Status Raumordnerische Kategorie<br />
Neubrandenburg Fritscheshof KS BWE Vorranggebiet Rohstoffsicherung<br />
Neubrandenburg Hinterste<br />
Mühle<br />
KS BWE<br />
Neubrandenburg Hinterste<br />
Mühle Ost<br />
KS B/B<br />
Neubrandenburg Spargelberg KS BWE<br />
Neubrandenburg Spargelberg<br />
Nord<br />
KS B/B<br />
Neubrandenburg Steepenweg KS BWE<br />
Neubrandenburg Steepenweg<br />
Ost<br />
KS B/B<br />
Abkürzungen:<br />
B/A - Bewilligung altes Recht<br />
B/B - Bewilligung neues Recht<br />
B/V - Versagung der Bewilligung<br />
BWE - Bergwerkseigentum<br />
KS - Kiessand<br />
QS - Quarzsand<br />
SpS - Spezialsand<br />
190
RROP Mecklenburgische Seenplatte Anhang<br />
191