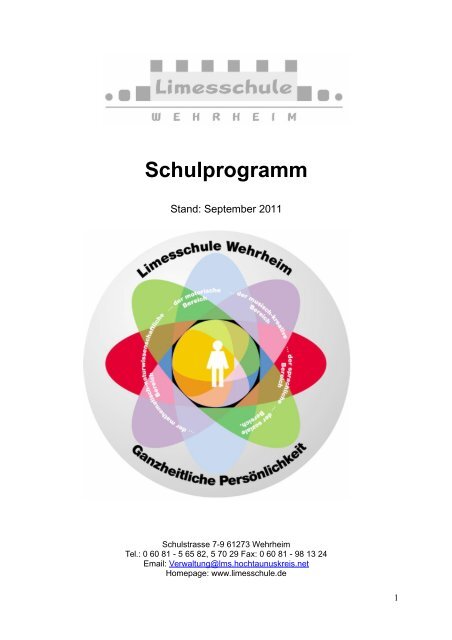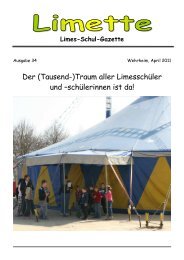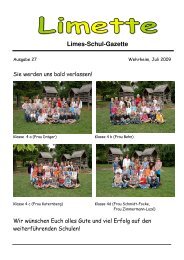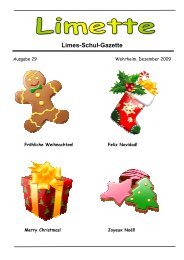5.2 Kooperation Limesschule
5.2 Kooperation Limesschule
5.2 Kooperation Limesschule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schulprogramm<br />
Stand: September 2011<br />
Schulstrasse 7-9 61273 Wehrheim<br />
Tel.: 0 60 81 - 5 65 82, 5 70 29 Fax: 0 60 81 - 98 13 24<br />
Email: Verwaltung@lms.hochtaunuskreis.net<br />
Homepage: www.limesschule.de<br />
1
Gliederung<br />
Die Präambel<br />
1 Das Leitbild: Ganzheitliche Persönlichkeit S. 05<br />
2 Die Vorstellung und Begründung der Persönlichkeitsbereiche S. 06<br />
2.1 Mathematisch-naturwissenschaftlicher Bereich<br />
2.2 Motorischer Bereich<br />
2.3 Musisch-kreativer Bereich<br />
2.4 Sprachlicher Bereich<br />
2.5 Sozialer Bereich<br />
3 Die Ziele S. 11<br />
3.1 Effektivität des Lernens erhöhen<br />
3.2 Zu Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit erziehen<br />
3.3 Zu tolerantem Umgang miteinander anhalten<br />
4 Die Maßnahmen zu den einzelnen Persönlichkeitsbereichen S. 15<br />
4.1 Maßnahmen im mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Persönlichkeitsbereich<br />
4.2 Maßnahmen im motorischen Persönlichkeitsbereich –<br />
Bewegungsangebote<br />
4.2.1 im Sportunterricht<br />
4.2.2 im Unterricht<br />
4.2.3 in den Pausen<br />
4.2.4 Zusätzliche Bewegungsangebote<br />
4.3 Maßnahmen im musisch-kreativen Persönlichkeitsbereich<br />
4.4 Maßnahmen im sprachlichen Persönlichkeitsbereich -<br />
Lese- und Sprachförderung<br />
4.4.1 Maßnahmen bezüglich der deutschen Sprache<br />
4.4.2 Maßnahmen bezüglich der Leseförderung<br />
4.4.3 Maßnahmen bezüglich der Fremdsprachen<br />
4.4.4 Methodentraining<br />
4.5 Maßnahmen zur Entwicklung sozialer Kompetenz<br />
5 <strong>Kooperation</strong> mit anderen Institutionen S. 31<br />
5.1 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Kindertagesstätten<br />
<strong>5.2</strong> <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Beratungs- und Förderzentrum<br />
5.3 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Verein Schulacker e.V.<br />
5.4 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Saalburg<br />
5.5 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Schülerbetreuung<br />
5.6 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – weiterführende Schulen<br />
6 Die Bestandsaufnahme – Schuljahr 2010/2011 S. 38<br />
2
7 Anhang S. 40<br />
Anlage 1 Erziehungsvereinbarung<br />
Anlage 2 Schulordnung der <strong>Limesschule</strong><br />
Anlage 3 Unterrichts- und Pausenzeiten<br />
Anlage 4 Vertretungskonzept der <strong>Limesschule</strong><br />
Anlage 5 Konzept der Vorklasse<br />
Anlage 6 Konzept der Schülerbibliothek<br />
Anlage 7 IT-Konzept<br />
Anlage 8 Förderkonzept<br />
Anlage 9 Methodencurriculum<br />
Anlage 10 Elternmitarbeit<br />
Anlage 11 Schulwegsicherungsplan<br />
Anlage 12 Konzept zur Gesundheitserziehung<br />
3
Die Präambel<br />
An unserer Schule wollen wir<br />
die Ganzheitliche ganzheitliche Persönlichkeit<br />
jedes einzelnen Schülers fördern.<br />
Dies geschieht, indem wir unseren Kindern ein individuelles Lernen<br />
mit „Kopf, Herz und Hand“ ermöglichen.<br />
Unter diesem Leitbild erachten wir folgende Persönlichkeitsbereiche, den<br />
mathematisch-naturwissenschaftlichen,<br />
motorischen,<br />
musisch-kreativen,<br />
sprachlichen und<br />
sozialen<br />
als besonders wichtig.<br />
Diese Bereiche können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, da sie sich<br />
wechselseitig beeinflussen und aufeinander wirken.<br />
Die Umsetzung unseres Leitbildes soll für die Schüler die<br />
Grundlage für ein selbstbewusstes, verantwortungsvolles<br />
und aktives Leben in unserer Gesellschaft bilden.<br />
4
1 Das Leitbild: Ganzheitliche Persönlichkeit<br />
Sozialer<br />
Bereich<br />
Sprachlicher<br />
Bereich<br />
Mit der Förderung der fünf Bereiche der Persönlichkeit werden unterschiedliche<br />
Unterrichtsziele verfolgt. Zur Zielerreichung werden unterschiedliche Maßnahmen<br />
durchgeführt. Dabei bleibt der Leitgedanke<br />
Förderung der ganzheitlichen Persönlichkeit des Schülers<br />
stets als übergeordnetes Ziel bestehen.<br />
Mathematischnaturwissenschaftlicher<br />
Bereich<br />
Ganzheitliche<br />
Persönlichkeit<br />
Musischkreativer<br />
Bereich<br />
Motorischer<br />
Bereich<br />
5
2 Die Vorstellung und Begründung der<br />
Persönlichkeitsbereiche<br />
2.1 Der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich<br />
Die vermittelten Erfahrungen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichs<br />
der Persönlichkeit ermöglichen es den Kindern Verknüpfungen und Strukturen auszubilden,<br />
die sie in die Lage versetzen, ihre Umwelt zu erfassen und ihren Alltag zu<br />
bewältigen.<br />
Aus diesem Grund sollen die Schüler elementare Erfahrungen der Zeit, des Raums,<br />
der Mengenvorstellungen sowie der Zahl- und Lagebeziehung machen.<br />
• Wir wollen Sachrechnen und Größen thematisieren, damit sich die Kinder<br />
im handelnden Umgang mit Situationen des täglichen Lebens bewähren.<br />
• Wir wollen Mengen und Zahlen sowie Orientierung im Zahlenraum und<br />
Zahlvorstellungen zu Themen im Unterricht machen, damit durch das Beherrschen<br />
der Grundrechenarten operatorische Fähigkeiten entwickelt<br />
werden.<br />
• Wir wollen die Kinder mit Geometrie vertraut machen, damit sie in spielerischer<br />
Form Erfahrungen machen, die die räumliche Wahrnehmung schulen.<br />
• Wir wollen ebenso den naturwissenschaftlichen Bereich im Unterrichtsalltag<br />
thematisieren, damit die Schülerinnen und Schüler zum bewussten<br />
Umgang mit sowie zum Verständnis der Natur erzogen werden.<br />
• Wir wollen den Kindern ihr Umfeld in den historischen und geographischen<br />
Bezügen näher bringen.<br />
6
2.2 Der motorische Bereich<br />
Wir wollen eine „Bewegte Schule“, damit den Kindern durch vielfältige Bewegungserfahrungen<br />
die notwendigen Voraussetzungen für eine harmonische und ganzheitliche<br />
Entwicklung geboten werden, da Jungen und Mädchen nicht nur über visuelles<br />
und auditives Aufnehmen und „kopfbestimmtes“ Bewältigen von Aufgaben lernen,<br />
sondern ganz besonders durch körperlich-sinnliche und handlungsorientierte Erfahrungsmöglichkeiten.<br />
Bewegung erfüllt durch das Auseinandersetzen, Erschließen, Gestalten und<br />
Verändern der Umwelt wichtige Aufgaben der geistigen, körperlichen und sozialen<br />
Entwicklung.<br />
• Zur geistigen Entwicklung:<br />
Zum Lernen benötigt das Kind gut funktionierende Bewegungs- und Wahrnehmungssysteme<br />
als notwendige Voraussetzung, um Lerninhalte aufzunehmen,<br />
unterscheiden, vergleichen und verstehen zu können. Zum Beispiel werden<br />
durch die Bewegung verschiedene Gehirnregionen aktiviert sowie Nervenübertragungsstellen<br />
(Synapsen) in bestimmten Hirnregionen vermehrt.<br />
• Zur körperlichen Entwicklung:<br />
Vielfältige Bewegungs- und Körpererfahrungen tragen dem Bewegungsdrang<br />
der Kinder Rechnung, fördern die Freude an der Bewegung, verhindern Bewegungsdefizite<br />
und/oder beugen ihnen vor.<br />
• Zur sozialen Entwicklung:<br />
Kinder drücken sich und ihre Gefühle durch Bewegung aus. Häufig ist Bewegung<br />
die erste Reaktion auf ein besonders intensives Gefühl. Bewegungsangebote<br />
und Bewegungsspiele beinhalten zahlreiche Situationen, die es<br />
erforderlich machen, dass Kinder sich mit sich beziehungsweise ihren<br />
Spielpartnern auseinandersetzen, Konflikte lösen, Rollen übernehmen,<br />
Spielregeln aushandeln und anerkennen.<br />
Somit erschließt Bewegung die Welt (instrumentelle Funktion), ermöglicht eine intensive<br />
Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit Geräten und Materialien (explorative<br />
Funktion), erschließt nachhaltige Körpererfahrungen (impressive Funktion) und eröffnet<br />
den Zugang zu anderen Menschen (kommunikative Funktion).<br />
7
2.3 Der musisch-kreative Bereich<br />
Der musisch-kreative Bereich ist ein wichtiger Baustein zur Entfaltung der individuellen<br />
Persönlichkeit.<br />
Wir wollen die Kinder in diesem Bereich besonders fördern, damit<br />
• alle Sinne geschult werden und die Wahrnehmungsfähigkeit gesteigert<br />
wird,<br />
• Kreativität entwickelt wird,<br />
• sich das Kind als schöpferisches Individuum erfährt,<br />
• das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen gesteigert werden, wodurch<br />
die Kinder emotionale Stabilität erlangen,<br />
• entsprechend der kindlichen Entwicklungsphasen abstrahierende Denkprozesse<br />
eingeleitet werden,<br />
• die soziale Kompetenz gefördert wird (Rücksichtnahme, Toleranz, <strong>Kooperation</strong>sfähigkeit,<br />
Einfühlungsvermögen),<br />
• die Kinder ihre vielfältigen Umwelterfahrungen besser verarbeiten können<br />
und<br />
• die Kommunikation angeregt wird.<br />
8
2.4 Der sprachliche Bereich<br />
Die Sprache bildet die Grundlage der Kommunikation, des Zusammenlebens und der<br />
Welterschließung.<br />
Sprache dient der Entfaltung der Persönlichkeit und ermöglicht ihre individuelle Ausdrucksfähigkeit.<br />
Neben dem Erwerb der Kulturtechniken wollen wir den sprachlichen Bereich fördern,<br />
damit<br />
• Kinder angemessen rezeptiv und produktiv kommunizieren können<br />
• Kinder ihre eigene Meinung formulieren können<br />
• Kinder Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse ausdrücken, andere verstehen<br />
und auf sie eingehen können<br />
• eine wesentliche Grundlage des Lernens geschaffen wird<br />
• Erkenntnisse ermöglicht werden und<br />
• Kreativität gefördert wird<br />
Weiterhin sollen den Kindern erste Erfahrungen bezüglich einer Fremdsprache<br />
(Englisch, Französisch) und deren verbale Anwendung ermöglicht werden.<br />
9
2.5 Der soziale Bereich<br />
Die Akzeptanz der Persönlichkeit bildet die Grundlage für das soziale Miteinander.<br />
Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen tolerantem Umgang und sozialen<br />
Fähigkeiten. Tolerantes Miteinander fördert die soziale Entwicklung des Menschen,<br />
die sozialen Fähigkeiten wiederum bedingen eine toleranten Umgang.<br />
Wir wollen in der Schule die verschiedenen Persönlichkeiten in ihrer Andersartigkeit<br />
annehmen, damit<br />
• die Voraussetzungen für angstfreies, freudiges Lernen geschaffen werden<br />
und dadurch das Selbstwertgefühl der Schüler gestärkt wird<br />
• Motivation zum Lernen entsteht<br />
• Kinder sich akzeptiert fühlen sowie<br />
• das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Kommunikation der Schüler<br />
untereinander intensiver und positiver wird<br />
10
3 Die Ziele<br />
Zur Erreichung des übergeordneten Zieles<br />
„Die Entwicklung der ganzheitlichen Persönlichkeit“<br />
haben wir exemplarisch drei Hauptziele ausgewählt.<br />
3.1 Die Effektivität des Lernens erhöhen<br />
3.2 Erziehung zu Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit<br />
3.3 Toleranter Umgang miteinander<br />
11
3.1 Die Effektivität des Lernens erhöhen<br />
Mit dem Ziel, die Effektivität des Lernens zu erhöhen, wollen wir an<br />
unserer Schule den Unterricht öffnen.<br />
Dies geschieht, indem wir<br />
• individuelle Lernvoraussetzungen beachten<br />
• Möglichkeiten zur Differenzierung schaffen<br />
• die Eigenverantwortung der Schüler unterstützen<br />
• Teamfähigkeit fördern<br />
• die eigenen Erfahrungen der Schüler einfließen lassen<br />
• die Schule nach innen öffnen:<br />
zum Beispiel während einzelner Projekte klassen- und jahrgangsübergreifende<br />
Gruppen bilden<br />
• die Schule nach außen öffnen, z.B. Langzeitprojekt „Am Bügel“<br />
Durch die Maßnahme „Öffnung des Unterrichts“ kann differenzierter auf die Voraussetzungen<br />
der Kinder eingegangen und ein Lernen mit allen Sinnen ermöglicht werden.<br />
Dies dient der Entwicklung der Persönlichkeit.<br />
3.1.1 Methodentraining<br />
Schülerinnen und Schüler für eigenverantwortliches und selbständiges Lernen zu<br />
qualifizieren, ist Ziel des Unterrichts. Daher ist es wichtig, ihnen Kenntnisse von<br />
unterschiedlichen Lernmethoden zu vermitteln und diese im Unterricht anzuwenden.<br />
Außerdem gilt es die Kommunikations- und <strong>Kooperation</strong>sfähigkeit zu fördern.<br />
In einer gemeinsamen Fortbildung zur „Erweiterung der Methodenkompetenz in der<br />
Grundschule“ haben Kolleginnen ein Methodencurriculum erarbeitet, das verbindlich<br />
in allen Jahrgängen umgesetzt wird.<br />
12
3.2 Die Erziehung zu Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit<br />
Wir wollen an unserer Schule alle Schüler zur Selbstständigkeit und<br />
Selbsttätigkeit erziehen.<br />
Dies erreichen wir, indem wir<br />
• vielfältige Materialien bereitstellen<br />
• unterschiedliche Arbeitstechniken nach dem entsprechenden<br />
Methodencurriculum der Schule einüben (siehe Anlage 10)<br />
• Lernen lernen<br />
• verschiedene Sozialformen einüben<br />
- Einzelarbeit<br />
- Partnerarbeit<br />
- Gruppenarbeit<br />
- Gemeinschaftsarbeit<br />
• die Schüler befähigen, anderen zu helfen<br />
• gemeinsam mit den Schülern Strategien zur Konfliktlösung entwickeln<br />
• uns als Lehrer zurücknehmen<br />
• Sachprobleme<br />
- gemeinsam diskutieren und Lösungen entwickeln<br />
- Lösungsvorschläge annehmen und weiterführen<br />
- entdeckendes Lernen und handlungsorientiertes Lernen einsetzen<br />
- Themenvorschläge der Schüler aufnehmen<br />
• Verschiedene Medien nutzen und hinterfragen<br />
Das Ziel „Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit“ fördert die Leistungsbereitschaft<br />
und stärkt das Selbstwertgefühl. Dadurch wird die Entwicklung der Persönlichkeit<br />
entscheidend unterstützt.<br />
13
3.3 Toleranter Umgang miteinander<br />
Wir wollen im Schulalltag und im Unterricht tolerant miteinander umgehen.<br />
Dies verwirklichen wir, indem wir<br />
• Regeln gemeinsam aufstellen<br />
- Klassenregeln<br />
- Schulordnung<br />
- Pausenordnung<br />
- Sporthallenregelung<br />
- Spielregeln<br />
• lernen, mit Verhaltensauffälligkeiten differenziert umzugehen<br />
• adäquat auf individuelle Probleme einzelner Schüler reagieren zum<br />
Beispiel<br />
• - bei unruhigen Kindern<br />
- Kindern in besonderen Situationen<br />
- aggressiven Kindern<br />
- zurückgezogenen Kindern<br />
• an ausgewählten Themen den toleranten Umgang miteinander schulen<br />
• die Erwartungen und Ansprüche an einzelne Schüler individuell ausrichten<br />
(bezogen auf das Leistungsvermögen sowie das Verhalten)<br />
• vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten „mit Kopf, Herz und Hand“ anbieten<br />
Das Ziel „Toleranter Umgang miteinander“ soll auf allen Ebenen des Schullebens<br />
bewusst gehalten werden. Ihre Umsetzung fließt in die Maßnahmen mit ein. Es wirkt<br />
sich maßgebend auf die Entwicklung der Persönlichkeit aus.<br />
14
4 Die Maßnahmen zu den einzelnen<br />
Persönlichkeitsbereichen<br />
Die Verwirklichung der drei ausgewählten Ziele erarbeiten wir durch verschiedene<br />
Maßnahmen, die wir exemplarisch mit unterschiedlichen Beispielen verdeutlichen<br />
wollen.<br />
4.1 Maßnahmen im mathematischnaturwissenschaftlichen<br />
Persönlichkeitsbereich<br />
Mit folgenden Maßnahmen fördern wir den mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Bereich der Persönlichkeit:<br />
Sachrechnen<br />
Die Kinder sollen<br />
• Lösungsstrategien für Sachaufgaben erarbeiten und nutzen.<br />
• Unternehmungen planen, indem sie<br />
- Kosten<br />
- Wegstrecken<br />
- Fahrzeiten<br />
berechnen<br />
• Einkäufe durchführen können, indem sie<br />
- Gesamt-/Einzelpreise berechnen<br />
- Gewichte und Inhalte kennen und diese Maße anwenden können<br />
• organisatorische Dinge, die die Schule betreffen, planen und berechnen<br />
können, indem sie<br />
- Kosten<br />
- Klassenstärken<br />
- Fragen zur Schulbücherei bearbeiten<br />
• Sachaufgaben zu laufenden Projekten lösen, indem sie<br />
- beim Projekt „Bügel“ an Berechnungen teilhaben (Preise von Pflanzen<br />
und Saatgut / Flächenberechnungen für Pflanzungen /...)<br />
- z. B. beim Projekt „Frühling“ an mathematischen Fragestellungen<br />
mitarbeiten (Kosten für Saatgut und Töpfe für Aussaat/...).<br />
• Sachaufgaben zum Sachunterricht lösen können, indem sie:<br />
- Wasser- / Stromverbrauch berechnen<br />
- ökonomische Themen bearbeiten (Ladegewicht / Einkaufspreis /<br />
Verkaufspreis / Gewinn)<br />
Größen<br />
Die Kinder sollen den laufenden Umgang mit<br />
• Geld üben, indem sie z. B. mit Spielgeld einkaufen<br />
15
• Längen üben, indem sie z. B. mit unterschiedlichen Methoden messen<br />
• Zeit üben, indem sie<br />
- Uhr / Kalender lesen<br />
- Zeitspannen berechnen<br />
• Gewichten üben, indem sie mit unterschiedlichen Methoden und Maßen<br />
messen<br />
• Hohlmaße üben, was z. B. durch das Erproben von Umfüllen geschehen<br />
kann<br />
Mengen und Zahlen<br />
Die Beherrschung des Umgangs mit Zahlen und Mengen soll für Kinder möglich<br />
werden, indem sie<br />
• Grundrechenarten einüben und anwenden<br />
• die mathematischen Zusammenhänge erfassen und kreativ einsetzen<br />
können<br />
Orientierung im Zahlenraum<br />
Die Kinder sollen Zahlenvorstellungen entwickeln und sich im jeweiligen Zahlenraum<br />
orientieren können, indem sie<br />
• im Zahlenraum bis 20 (Vorklasse bis 10) mit realen Gegenständen<br />
handelnd umgehen<br />
• in größeren Zahlenräumen mit Hilfe von z. B. Zahlenstrahl und<br />
Hunderterfeld die symbolhafte Darstellung und Übertragung von<br />
mathematischen Aufgaben üben<br />
Geometrie<br />
In allen Jahrgangsstufen sollen die Kinder geometrische Grunderfahrungen sammeln<br />
und ihre Raumvorstellung entwickeln.<br />
Die geometrischen Themen verteilen sich wie folgt auf die Vorklasse und die Klassen<br />
1 bis 4:<br />
Vorklasse und 1./2. Schuljahr:<br />
• Geometrische Grundformen (Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck)<br />
• Geometrische Körper (Quader, Würfel, Kugel, Zylinder)<br />
• Muster, Ornamente, Parkettierungen<br />
• Lagebeziehungen (links, rechts, vor, hinter, oben, unten)<br />
• Achsensymmetrie (Falten, Schneiden, Spiegeln)<br />
• Zeichnen mit dem Lineal<br />
Im 3. und 4. Jahrgang werden die geometrischen Grunderfahrungen der ersten<br />
beiden Schuljahre aufgegriffen, vertieft, erweitert und teilweise ergänzt.<br />
16
3./4. Schuljahr:<br />
• Geometrische Grundformen (hinzu kommen kann das Parallelogramm)<br />
• Geometrische Körper (Kegel, Pyramide)<br />
• Fläche und Umfang<br />
• Zeichnen mit Geodreieck und Zirkel<br />
• Lagebeziehungen (senkrecht, waagerecht, parallel, rechtwinklig)<br />
• Baupläne (Seitenansichten, Grundrisse, Planquadrate)<br />
• Maßstab<br />
Im Rahmen des Geometrieunterrichtes sollen folgende Fachbegriffe einheitlich<br />
eingeführt werden:<br />
• Ecke, Kante, Fläche, Seitenlänge<br />
• Flächeninhalt, Umfang<br />
• Gerade, Strecke, Strahl, Punkt<br />
• Mittelpunkt, Radius, Durchmesser, Kreislinie<br />
• Diagonale, Winkel (rechter, spitzer, stumpfer)<br />
• senkrecht, waagerecht, parallel<br />
Mögliche Projekte im Bereich der Geometrie können sein:<br />
• der Bau von Geobrettern oder Somawürfeln<br />
• Besuch des Mathematikums in Gießen<br />
Naturwissenschaftlicher Bereich<br />
Dieser Bereich ist mit dem Sachunterricht eng verknüpft und beinhaltet<br />
• Biologie<br />
• Physik<br />
• Chemie (weniger)<br />
Die Kinder sammeln Erfahrungen im Bereich der Biologie, indem sie über<br />
• Tiere, Pflanzen, Umwelt praktisch und handelnd Kenntnisse erwerben<br />
• die Entstehung neuen Lebens Wissen erarbeiten und den toleranten<br />
Umgang mit diesem Thema erlernen<br />
Im Bereich Biologie bietet sich das Schulgelände als Lernort mit verschiedensten<br />
Aktivitäten an:<br />
• Der Schulhof als Erlebniswelt<br />
• Mögliche Aktivitäten:<br />
• Anpflanzung und Pflege des Schulgeländes (Zwiebeln, Knollen, Stauden,<br />
Sträucher, Gräser …)<br />
• Aktionswoche im Frühjahr und Herbst<br />
• Bauen von Sitzgelegenheiten aus Holz<br />
• Konstruktion eines Tipis aus Weidenruten<br />
• Anlegen eines Barfußpfades<br />
• Konstruktion und Bepflanzung einer Kräuterschnecke<br />
17
Ein weiterer Lernort für den Bereich Biologie ist gegeben in Form des Schulackers<br />
„Bügel“:<br />
• Der Schulacker<br />
Der Schulacker bietet für die Kinder eine einzigartige Gelegenheit, den Lebensraum<br />
Feld und Wiese im Jahresablauf aktiv kennenzulernen. Dieser Lernort wird also als<br />
„Klassenzimmer im Grünen“ genutzt.<br />
Dabei werden die einzelnen Aktionen durch Experten des BUND und NABU sowie<br />
von Herrn Bauer Etzel angeleitet und begleitet.<br />
Im Sachunterricht werden die Einsätze auf dem Bügel vorbereitet und<br />
anschließend die praktischen Erfahrungen der Kinder im Unterricht vertieft und<br />
erweitert.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte der praktischen Einsätze auf dem Acker sind:<br />
• die Pflege des Ackers<br />
• Kenntnisse über und praktischer Umgang mit Gartengeräten<br />
• die Aussaat von Getreide wie zu früheren Zeiten<br />
• Einblicke in die Dreifelderwirtschaft<br />
• das Setzen von Kartoffeln und die Kartoffelernte<br />
• der Kartoffelkäfer als Schädling<br />
• das Pflanzen oder Stecken von anderen Gemüsearten<br />
• das Beobachten von Tieren im Blütenstreifen des Ackers (Insekten)<br />
Beobachtungsmöglichkeiten auf der Wiese mit ihren Biotopen sind:<br />
• das Stein- und Holzbiotop als Lebensraum für Tiere<br />
• die Wildhecke als Lebensraum für Tiere und Pflanzen<br />
• Singvögel und Raubvögel der Umgebung<br />
Übergeordnete Ziele sind die Einsicht in die Bedeutung der Erhaltung natürlicher<br />
Lebensräume für heimische Tiere und Pflanzen sowie die persönliche Erfahrung,<br />
etwas für den Schutz der Natur und der Lebensräume aktiv tun zu können, z.B. in<br />
den Jugendgruppen des BUND und des NABU.<br />
18
Jahresplanung „Bügel“<br />
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
VK Bügel-<br />
1<br />
Einführung,<br />
Getreideaussaat<br />
(letzte<br />
April-<br />
Woche)<br />
2 Kartoffeln<br />
setzen<br />
(erste<br />
Maiwoche)<br />
Pflege des Ackers,<br />
Kartoffelkäfer<br />
(je nach Befall VK- 3.<br />
Klasse)<br />
SU:<br />
Getreide:<br />
Arten,<br />
Ernte,<br />
Verwertung<br />
SU:<br />
Wiese: Beschreibung,<br />
Untersuchung,<br />
Bestimmung<br />
3 Kartoffelernte,Kartoffelprojekt,<br />
SU<br />
4<br />
BUND: Jahresverlauf auf dem Bügel erleben (Frühling, Sommer, Herbst, Winter)<br />
NABU: Pflegemaßnahmen im Frühjahr (Bäume und Sträucher)<br />
Lebensräume auf dem Bügel: Steinbiotop, Insektenhotel<br />
Bau und Anbringung mehrerer Nistkästen durch Schüler der <strong>Limesschule</strong><br />
Hof Etzel: Bewirtschaftung des Ackers unter landwirtschaftlichen Aspekten (Saat, Saatgut, Pflege, Ernte)<br />
19<br />
Erntedankfest<br />
am<br />
3.10.,<br />
Kartoffelfeuer
Die Kinder sammeln Erfahrungen im Bereich der Physik, indem sie<br />
• physikalische Grunderfahrungen praktisch und handelnd sammeln<br />
(Themen z.B. Luft, Wasser, Strom, Magnete, Wetter)<br />
• technische Grunderfahrungen praktisch und handelnd im Umgang mit<br />
verschiedenen Konstruktionsmaterialien erwerben<br />
(Themen z.B. Fahrzeuge konstruieren, Maschinen zur Kraftübertragung sowie<br />
Brücken bauen)<br />
Material: Fischertechnik, Lego, Bauklötze, Pappe und Papier u.v.m.<br />
Gesellschaftspolitischer und sozial-kultureller Bereich des Sachunterrichts<br />
• Die geografische Lage der <strong>Limesschule</strong> in unmittelbarer Nähe zum<br />
Römerkastell Saalburg und zum Verlauf des Limes ermöglicht den Kindern<br />
fundierte Einblicke in die Geschichte der Römer.<br />
• Exkursionen zu Lernorten außerhalb der Schule und das Gespräch mit<br />
Experten in verschiedenen Fachgebieten erweitern und vertiefen den<br />
Erfahrungsschatz der Kinder und sind daher zu unterstützen.<br />
• In Zusammenarbeit mit den Museumspädagogen der Saalburg erhalten die<br />
Kinder der 4. Klassen durch den Besuch des Römerkastells und die<br />
Durchführung eines Projektes eine konkrete Vorstellung von der Lebensweise<br />
zur Zeit der Römer.<br />
20
4.2 Maßnahmen im motorischen Persönlichkeitsbereich -<br />
Bewegungsangebote<br />
Mit dem Angebot vielfältiger Bewegungsmöglichkeiten sollen alle fünf Bereiche der<br />
Persönlichkeit gefördert werden. Sie werden durch verschiedene Maßnahmen in<br />
folgenden Handlungsbereichen erfolgen:<br />
4.2.1 Im Sportunterricht<br />
Spielen<br />
Innerhalb dieses Handlungsbereiches sollen die Kinder die Grundtechniken im<br />
Umgang mit dem Ball (Werfen, Fangen, Rollen, Prellen, Schießen, Führen,<br />
Schlagen) erlernen sowie Spieltaktiken und –techniken angemessen einsetzen. Die<br />
Kinder sollen in Gruppen- und Mannschaftsspielen im Umgang mit unterschiedlichen<br />
Materialien und Spielgeräten ein breites Spielrepertoire erwerben.<br />
Turnen<br />
An verschiedenen Spiel- und Klettergeräten sollen die Kinder Grundtechniken der<br />
Alltagsmotorik Klimmen, Klettern, Steigen, Balancieren, Rollen, Laufen und Springen,<br />
Stützen und Schwingen in spielerischen Situationen erproben und erweitern. Im<br />
Bereich der Bewegungsformen Rollen, Laufen und Springen, Stützen und Schwingen<br />
sollen die Kinder auch zunehmend einfache Bewegungsaufgaben und erste<br />
turnerische Kunstfertigkeiten erwerben.<br />
Rhythmische Bewegungen und Tanzen<br />
Die Schüler sollen in unterschiedlichen Bewegungssituationen und im Umgang mit<br />
verschiedenen Klein- und Handgeräten ihre körperliche Ausdrucksfähigkeit erweitern<br />
sowie unterschiedliche Bewegungselemente und Grundbewegungsformen kennen<br />
lernen. In Verbindung von Bewegung und Musik sollen die Kinder vielfältige<br />
Bewegungselemente in Spielliedern, Tanzspielen und Tänzen umsetzen und dabei<br />
die verschiedenen Fassungen, Aufstellungen, Figuren und Bewegungsformen<br />
kennen lernen.<br />
Laufen – Springen – Werfen<br />
Die Schüler sollen in vielfältigen Spiel- und Übungsstationen ihr Bewegungskönnen<br />
im Laufen, Springen und Werfen erproben und erweitern. Dabei sollen sie ihre<br />
motorischen Grundeigenschaften (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit,<br />
Bewegungskoordination) verbessern. Des weiteren sollen die Kinder die Bedeutung<br />
bestimmter Lauf-, Sprung- und Wurftechniken in ihrer Grobform kennen lernen.<br />
21
Rollen – Gleiten – Fahren<br />
Die Schüller sollen ein Gefühl für Balance und Gleichgewicht entwickeln und dieses<br />
verbessern sowie ihre koordinativen Fähigkeiten erweitern. Dabei erproben die<br />
Kinder im spielerischen, experimentierenden und angeleiteten Umgang mit Roll-,<br />
Gleit- und Fahrgeräten die Möglichkeiten des Fortbewegens, des Lenkens, des<br />
Steuerns und des Transportierens.<br />
Schwimmen<br />
Die Schüler sollen unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitlichen und räumlichen<br />
Bedingungen sowie der individuellen Voraussetzungen die drei unterschiedlichen<br />
Anforderungsniveaus (1. Wassergewöhnung, 2. Erlernen einer Schwimmart, 3.<br />
Springen und Tauchen) ausbauen, beziehungsweise das jeweils nächst höhere<br />
Niveau anstreben. Des weiteren sollen die Kinder auch die wichtigsten Baderegeln<br />
kennen lernen.<br />
4.2.2 Im Unterricht<br />
• themenbezogen z.B.<br />
- Laufdiktat<br />
- Gedicht mit Bewegungen gestalten<br />
- szenisches Spielen<br />
- Hüpfen auf der Hundertertafel<br />
- Silben klatschen<br />
• in Bewegungspausen z.B.<br />
- Spiele<br />
- Lieder<br />
– Fingerspiele<br />
• durch die Organisation verschiedener Arbeitsformen z.B.<br />
- Stationen<br />
- Wochenplan<br />
- Sitzkreis<br />
4.2.3 In den Pausen<br />
Zum Beispiel durch<br />
• Spiel- und Klettergeräte<br />
• Hickelkästchen<br />
• Freigelände<br />
• Funcourt<br />
22
4.2.4 Zusätzliche Bewegungsangebote<br />
In regelmäßigen bzw. unregelmäßigen Zeitabständen finden immer wiederkehrende<br />
sportliche Veranstaltungen statt. Dazu gehören:<br />
• Bundesjugendspiele<br />
• Spieletag 1. Schuljahr und Vorklasse<br />
• Fußballturnier<br />
• Schnuppertage in verschiedenen Sportarten in <strong>Kooperation</strong> mit Vereinen<br />
• Spiel- und Sportfeste<br />
• Arbeitsgemeinschaften<br />
• Benefizläufe<br />
23
4.3 Maßnahmen im musisch-kreativen<br />
Persönlichkeitsbereich<br />
Folgende Maßnahmen sollen den musisch-kreativen Bereich der Persönlichkeit<br />
fördern:<br />
Entwicklung der sinnlichen Wahrnehmung<br />
• Hörerfahrungen machen<br />
• Klanggeschichten gestalten (instrumental und vokal)<br />
• Rhythmisch-musikalische Erfahrungen machen (Tanz und<br />
Körperinstrumente)<br />
• Instrumente kennen lernen und spielen<br />
• Liedschatz erwerben<br />
• kennen lernen von und Umgang mit verschiedenen Materialien (Natur- und<br />
industriell gefertigte Materialien)<br />
• kennen lernen und Umgang mit Werkzeugen<br />
• Förderung der psychomotorischen Erfahrungen<br />
• Förderung der sinnlichen Wahrnehmung<br />
• Entwicklung und Förderung von Farbempfinden<br />
Entwicklung der Kreativität<br />
• Klanggeschichten gestalten (instrumental und vokal)<br />
• kennen lernen und Ausübung von verschiedensten gestalterischen<br />
Techniken<br />
• Themenbezogene Umsetzung eigener Vorstellungen<br />
• Förderung der psychomotorischen Erfahrungen<br />
• Förderung der sinnlichen Wahrnehmung<br />
• Bildbetrachtung, Auseinandersetzung mit Kunstwerken und Medien<br />
• Sprache in Bilder umsetzen<br />
Kulturerfahrungen<br />
• kennen lernen von Musikeinrichtungen<br />
• Chor, Aufführungen<br />
• Besuch von Museen (Maler kennen lernen)<br />
• eigene Werke ausstellen<br />
• Bildbetrachtung, Auseinandersetzung mit Kunstwerken und Medien<br />
24
Gestalterische Erfahrungen<br />
• Klanggeschichten gestalten (instrumental und vokal)<br />
• Rhythmisch-musikalische Erfahrungen machen (Tanz und<br />
Körperinstrumente)<br />
• Chor, Aufführungen<br />
• Instrumentenbau<br />
• Themenbezogene Umsetzung eigener Vorstellungen<br />
• Entwicklung und Förderung von Farbempfinden<br />
• Grundzüge der Farbenlehre kennen lernen<br />
• Besuch von Museen (Maler kennen lernen)<br />
• eigene Werke ausstellen<br />
• Bildbetrachtung, Auseinandersetzung mit Kunstwerken und Medien<br />
• Sprache in Bilder umsetzen<br />
Technische Erfahrungen<br />
• Instrumente kennen lernen und spielen<br />
• musiktheoretische Kenntnisse erwerben (Noten)<br />
• Instrumentenbau<br />
• kennen lernen von und Umgang mit verschiedensten Materialien (Natur-<br />
und industriell gefertigte Materialien)<br />
• kennen lernen von und Umgang mit Werkzeugen<br />
• kennen lernen und Ausübung von verschiedensten gestalterischen<br />
Techniken<br />
• Grundzüge der Farbenlehre kennen lernen<br />
Um die einzelnen Punkte im Bereich „Maßnahmen im musisch – kreativen<br />
Persönlichkeitsbereich“ umzusetzen, finden bereits folgende Aktionen statt:<br />
• Chorkonzerte 3. und 4. Schuljahr<br />
• Hauskonzerte der 2. bis 4. Klassen „Pizzicato“<br />
• Einschulungsfeier<br />
• Verabschiedung 4. Schuljahr<br />
• Auftritte anlässlich besonderer Aktivitäten (z.B. Weihnachtscafé des<br />
Fördervereins)<br />
• Schulfest ( jedes zweite Jahr)<br />
• Projektwoche (jedes zweite Jahr), themengebunden oder frei wählbare<br />
Themen<br />
• Projekte im Jahrgang<br />
• Theateraufführungen in einzelnen Klassen<br />
• besondere Projekte zur künstlerischen Ausgestaltung des Neubaus<br />
25
4.4 Maßnahmen im sprachlichen Persönlichkeitsbereich -<br />
Lese- und Sprachförderung<br />
4.4.1 Maßnahmen bezüglich der deutschen Sprache<br />
Der sprachliche Bereich der ganzheitlichen Persönlichkeit wird durch Maßnahmen<br />
der Lese- und Sprachförderung entwickelt.<br />
Dies verwirklichen wir<br />
• im Deutschunterricht durch<br />
- Sprachreflexion und Rechtschreibung<br />
- erzählen und Geschichten schreiben<br />
- lesen<br />
• im Unterricht in allen Fächern.<br />
4.4.2 Maßnahmen bezüglich der Leseförderung<br />
Ziele des Lesens:<br />
1. Unterhaltung<br />
2. Informationsbeschaffung.<br />
In der <strong>Limesschule</strong> wurde ein Lesekonzept erarbeitet, das folgende Bereiche der<br />
Leseförderung beinhaltet:<br />
1. Diagnose<br />
mittels verschiedener Testverfahren durch die Leseberaterin<br />
2. Förderung<br />
anhand eines individuell erstellten Förderplanes<br />
3. Ergebnissicherung<br />
Überprüfung der Lernfortschritte durch die Lehrkraft<br />
4. Motivation<br />
– Klassenlektüren<br />
– jährlicher Vorlesetag „Große lesen für Kleine“<br />
– Schulbibliothek<br />
– Büchermarkt<br />
– Lesenachmittage/Lesenächte<br />
– Bücherboxen<br />
– Klassenbücherei<br />
– öffentliche Büchereien<br />
– Vorschlagsliste altersgemäßer Literatur<br />
– Zugang zum Internetprogramm „Antolin“<br />
26
4.4.3 Maßnahmen bezüglich der Fremdsprachen<br />
Im dritten und vierten Schuljahr bietet die <strong>Limesschule</strong> neben Englisch auch<br />
Französisch als Fremdsprache an. Am Ende des zweiten Schuljahres werden<br />
Schnupperstunden in Englisch sowie in Französisch im Klassenverband abgehalten.<br />
Danach erfolgt die Wahl der Sprache für zwei Jahre. Der Unterricht erfolgt in zwei<br />
Wochenstunden.<br />
Ziele des Fremdsprachenunterrichts:<br />
• Freude und Motivation für das Lernen und die Verwendung der neuen<br />
Sprache zu wecken und längerfristig aufrechtzuerhalten<br />
• Zugang zu einer teilweisen fremden Kultur ermöglichen<br />
• das Interesse und das Verständnis gegenüber der anderen Kultur sowie deren<br />
Lebensgewohnheiten entwickeln<br />
• Stärkung der Toleranz und Weltoffenheit als Grundlage für ein<br />
verständnisvolles Miteinander<br />
Der Fremdsprachenunterricht setzt sich aus den Fertigkeitsbereichen<br />
zusammen:<br />
• Hören und Verstehen<br />
• Sprechen, Lesen und Verstehen<br />
• Schreiben<br />
Einen wichtigen Stellenwert beim Vermitteln der Fremdsprache nehmen ein:<br />
• motorische Übungen<br />
• Spiele<br />
• Reime, Lieder<br />
• Geschichten<br />
• authentische Materialien, die sich am Alltagsleben der Kinder orientieren<br />
• landeskundliche Aspekte<br />
27
4.5 Maßnahmen zur Entwicklung sozialer Kompetenz<br />
Die Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen unterstützen wir mit folgenden<br />
Maßnahmen:<br />
Erziehungsvereinbarungen<br />
Zwischen Lehrern, Eltern und Kindern bestehen Erziehungsvereinbarungen, die allen<br />
zur Kenntnis gebracht wurde. Die Elternbeiräte erläutern jährlich verschiedene<br />
Aspekte dieser Vereinbarung an den Elternabenden der einzelnen Klassen.<br />
Annehmen der Persönlichkeit<br />
Informationen über:<br />
• andere Kulturen<br />
• anderes Aussehen<br />
• andere Lebensgewohnheiten<br />
• andere Sprachen<br />
• andere Religionen<br />
• Behinderungen<br />
Kinder stark machen<br />
• die Stärken der Kinder hervorheben<br />
• als Lehrer das vorleben, was wir von den Schülern erwarten<br />
• Schüler ernst nehmen<br />
• Schüler dürfen „nein“ sagen<br />
• Fehler machen dürfen<br />
• andere Meinungen vertreten<br />
• Verhalten in Streitsituationen trainieren<br />
• von eigenen Erlebnissen berichten<br />
• eigene Fähigkeiten einbringen<br />
Programm „Faustlos“<br />
• Zur Förderung der sozialen Kompetenz wird im Sachunterricht das Programm<br />
„Faustlos“ durchgeführt.<br />
• „Faustlos“ ist ein Curriculum zur Prävention von aggressivem und<br />
gewaltbereitem Verhalten bei Kindern in der Grundschule.<br />
• „Faustlos“ vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten in folgenden Bereichen:<br />
- Empathie<br />
- Impulskontrolle<br />
- Umgang mit Ärger und Wut<br />
28
Patenklassen<br />
Zur Erleichterung des Übergangs vom Kindergarten zu Schule übernehmen Schüler<br />
der 3./4. Klassen Patenschaften für Schulanfänger der Vorklasse und 1. Klassen.<br />
• Sie sind Spielpartner in den Pausen, Ansprechpartner bei Fragen und<br />
Problemen und helfen bei der Orientierung im Schulgebäude<br />
• Gemeinsame Projekte, wie z.B. „Große lesen für Kleine“<br />
• Ziele für die älteren Schüler:<br />
- Übernehmen von Verantwortung<br />
- Förderung des Empathievermögens<br />
• Ziele für die jüngeren Schüler:<br />
- Stärkung des Selbstvertrauens in der neuen Umgebung<br />
- schnelleres Zurechtfinden in der neuen Schule und dadurch Erhöhung<br />
der Selbstständigkeit.<br />
Veranstaltungen<br />
Durch folgende Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten fördern wir den<br />
sozialen Bereich der ganzheitlichen Persönlichkeit. Diese vielfältigen Aktivitäten<br />
finden in <strong>Kooperation</strong> mit den Eltern statt.<br />
• regelmäßige Veranstaltungen<br />
- Projektwoche<br />
- Theaterbesuche<br />
- Chorprogramme<br />
- Instrumentalkonzert „Pizzicato“<br />
- Sportfeste<br />
- Schulfeste<br />
- Bundesjugendspiele<br />
- <strong>Kooperation</strong> Vorschulgruppen und 1. Klassen/ Vorklasse<br />
- Besuche im Wald mit dem Förster im 2. Schuljahr und Waldtage der<br />
Vorklasse<br />
- Besuch im Hessenpark im 3. Schuljahr<br />
- Römerprojekt im 4. Schuljahr<br />
- Klassenfeste<br />
- Klassenfahrten<br />
- Bundesjugendspiele<br />
• außerordentliche Veranstaltungen<br />
- Leseherbst (Autorenlesungen / Lesewettbewerb)<br />
- Theateraufführungen (Schülertheater / professionelle Theater)<br />
- Chorkonzert für Eltern<br />
- Klassenfahrten<br />
- Ausflüge; Wanderungen; Museumsbesuche<br />
- Mathematische Mitmachausstellung „Mini-Mathematikum“<br />
- Zirkusprojekt aller Klassen<br />
- Hörspielprojekt<br />
- Schulkinowochen<br />
- Kinderuni<br />
29
• Unterrichtsprojekte<br />
- auf dem Bauernhof<br />
- im Rathaus<br />
- im Stadttormuseum<br />
- in Kirchen<br />
- in der Bücherei<br />
- bei der Feuerwehr<br />
- naturkundliche Führungen<br />
- in den Wald mit dem Förster<br />
- zum Biotop mit Vertreter des Naturschutzbundes<br />
- Schnupperstunden für die Vorschulkinder<br />
30
5 <strong>Kooperation</strong> mit anderen Institutionen<br />
5.1 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Kindertagesstätten<br />
• Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans im Bereich Gesundheit<br />
Projekt „Gesunde Ernährung“ unter Beteiligung des Tandems<br />
• Erleichterung des Übergangs für die Schulanfänger von der<br />
Kindertagesstätte in die Grundschule<br />
Gestaltung der Zusammenarbeit vor Schuleintritt<br />
• regelmäßige Treffen der Leitungsteams der sechs Wehrheimer<br />
Kindertagesstätten mit der Vorklassenleiterin, den Lehrerinnen der<br />
jeweiligen 1. Klassen und der Schulleiterin (zweimal jährlich)<br />
• Austausch über einzelne Schüler vor und nach Schuleintritt (bei<br />
Zustimmung der Eltern)<br />
• Bildung eines Steuerungsteams zur Festlegung der Themen sowie der<br />
Vorbereitung einzelner Projekte<br />
Kindertagesstätten und Schulen vereinbaren Maßnahmen zum Training der<br />
• Selbstkompetenz<br />
• Sozialkompetenz<br />
• Lernkompetenz<br />
31
<strong>5.2</strong> <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Beratungs- und<br />
Förderzentrum der Heinrich-Kielhorn-Schule<br />
Die Zusammenarbeit mit dem Beratungs- und Förderzentrum der Heinrich-Kielhorn-<br />
Schule besteht seit dem Schuljahr 2006/07. Der Schwerpunkt liegt auf der<br />
präventiven Förderung und wird in der Vorklasse verwirklicht.<br />
Bewegungsförderung (Psychomotorik)<br />
• therapeutische Bewegungs- und Koordinationsförderung<br />
• Ausbildung der Muskulatur<br />
• Förderung der Grob- und Feinmotorik<br />
• Förderung der sozialen Kompetenz<br />
32
5.3 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Verein Schulacker e.V.<br />
Die Mitglieder des Schulackervereins und das Kollegium der <strong>Limesschule</strong> verfolgen<br />
das Ziel bei den Schülerinnen und Schülern<br />
• „die Einsicht in die Bedeutung der Erhaltung natürlicher Lebensräume für<br />
heimische Tiere und Pflanzen sowie die persönliche Erfahrung, etwas für den<br />
Schutz der Natur und der Lebensräume aktiv tun zu können“.<br />
Die Lehrkräfte erhalten aktive Unterstützung bei der Durchführung des Projektes mit<br />
den Klassen in den Bereichen:<br />
• Vorbereitung des Ackerbodens<br />
• Bereitstellung des Saatgutes und der Pflanzen<br />
• fachliche Unterstützung<br />
• Pflege der Pflanzen mit landwirtschaftlichen Geräten.<br />
33
5.4 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Saalburg<br />
Die Kinder sollen die Kultur der Römer und den historischen Hintergrund kennen<br />
lernen sowie Auswirkungen dieser Kultur bis in die Gegenwart erfahren.<br />
Die örtlichen Nähe zum Weltkulturerbe „Saalburg“ und der Name der Schule sind im<br />
alltäglichen Erleben der Kinder präsent.<br />
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex „Saalburg“ erfolgt in<br />
allen fünf Bereichen des Leitbildes unseres Schulprogramms.<br />
Die Methodenkompetenz wird am Thema „Saalburg“ erweitert.<br />
Die <strong>Kooperation</strong> mit Museumspädagogen der Saalburg ermöglicht den Kindern ein<br />
Lernen an einem außerschulischen Lernort unter Anleitung von Experten.<br />
Aufgrund der Bedeutung des genannten Themenkreises wurde die „Saalburg“ als<br />
Schwerpunkt im Fortbildungsplan aufgenommen.<br />
Gleichzeitig mit der unterrichtlichen Erarbeitung erfolgt die kreative Gestaltung einer<br />
Themenwand im Schulgebäude. Diese Themenwand soll so angelegt werden, dass<br />
sie in den kommenden Jahren von verschiedenen Klassen immer wieder umgestaltet<br />
werden kann.<br />
Eine Zusammenarbeit mit dem Saalburgmuseum findet statt, wechselnde Leihgaben<br />
als Ausstellungsstücke wurden der <strong>Limesschule</strong> bereits zugesagt.<br />
Folgende Aktionen werden in Klasse 4 durchgeführt:<br />
• Besuch der Saalburg mit museumspädagogischer Führung<br />
• Einführung in das Projekt durch eine Museumspädagogin<br />
• handlungsorientierte Projekttage zum Thema Römer<br />
• ausführliche Unterrichtseinheit im Sachunterricht<br />
34
5.5 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – Schülerbetreuung<br />
Die Schülerbetreuung ist im Neubau der <strong>Limesschule</strong> untergebracht. Träger der<br />
Schülerbetreuung ist die Gemeinde Wehrheim.<br />
Folgender Austausch findet statt<br />
• regelmäßige Treffen zwischen der Schulleitung und der Leitung der<br />
Schülerbetreuung<br />
• Austausch zwischen Lehrkräften und Betreuerinnen zu Absprachen über die<br />
Erledigung von Hausaufgaben<br />
• Austausch zwischen Lehrkräften und Betreuerinnen zu Absprachen<br />
hinsichtlich individueller Unterstützung einzelner Kinder<br />
• Austausch zwischen Lehrkräften und Betreuerinnen hinsichtlich des<br />
Verhaltens einzelner Schüler und daraus abzuleitende Vorgehensweisen<br />
35
5.6 <strong>Kooperation</strong> <strong>Limesschule</strong> – weiterführende Schulen<br />
Innerhalb des Schulbezirkes im Hochtaunuskreis finde mit den weiterführenden<br />
Schulen regelmäßige Treffen statt zu folgenden Themen:<br />
• Informationsabend über die Bildungsgänge ab Klasse 5<br />
• Treffen zur Vorbereitung der Klasseneinteilung im Jahrgang 5<br />
• Austausch zwischen den Lehrkräften des 4. und 5. Jahrgangs<br />
36
6 Die Bestandsaufnahme - Schuljahr 2011/12<br />
6.1 Vorstellung der Schule<br />
Die <strong>Limesschule</strong> ist die Grundschule der Gemeinde Wehrheim, zu der die Ortsteile<br />
Obernhain, Pfaffenwiesbach, Friedrichsthal und Saalburgsiedlung gehören.<br />
Zurzeit werden 400 Kinder (davon 190 Fahrschüler) unterrichtet:<br />
• in der Vorklasse 1 Klasse 16 Kinder<br />
• in der Jahrgangsstufe 1 4 Klassen 92 Kinder<br />
• in der Jahrgangsstufe 2 5 Klassen 101 Kinder<br />
• in der Jahrgangsstufe 3 5 Klassen 107 Kinder<br />
• in der Jahrgangsstufe 4 4 Klassen 84Kinder.<br />
Ambulante Maßnahmen erfolgen im Sprachheil- und Lernhilfe- sowie im<br />
Erziehungshilfebereich.<br />
6.2 Räumliche Situation<br />
Der Erweiterungsbau sowie der Umbau des Hauptgebäudes wurden im Sommer<br />
2007 abgeschlossen.<br />
Es stehen nun<br />
• 19 Klassenräume<br />
• 6 Gruppenräume<br />
• ein Computerraum<br />
• ein Werkraum<br />
• eine Aula / Musikraum<br />
• eine Schülerbücherei<br />
• ein Musikraum<br />
• ein Filmraum<br />
• eine Sporthalle<br />
zur Verfügung.<br />
Angegliedert an die Unterrichtsräume befinden sich die vier Räume der<br />
Schülerbetreuung mit Intensivräumen und einer Mensa, die für Veranstaltungen auch<br />
als Aula genutzt werden kann.<br />
37
6.3 Kollegium<br />
Zurzeit unterrichten 28 Lehrkräfte, davon eine Sozialpädagogin, ein Pfarrer, eine<br />
Pastoralreferentin und sowie eine Förderschullehrerin und ein Förderschullehrer, an<br />
der <strong>Limesschule</strong>.<br />
Frau Evelyn Baldt Klassenlehrerin 1b<br />
Frau Petra Banhardt Klassenlehrerin 2a<br />
Frau Ursula Behn Klassenlehrerin 3b<br />
Frau Monika Bernard Klassenlehrerin 1c<br />
Frau Julia Bredemeier Klassenlehrerin 4b<br />
Frau Lindsay Darcheville Austauschlehrerin - Französisch<br />
Frau Ursula Dräger Klassenlehrerin 3d<br />
Frau Hannelore Fröhlich Abordnung von der ARS – Französisch<br />
Frau Beate Görg-Reifenberg Pastoralreferentin<br />
Frau Bettina Hergett Konrektorin, Klassenlehrerin 3a<br />
Frau Waltraud Hilligen Klassenlehrerin 2d<br />
Frau Katja Illing Klassenlehrerin 2e<br />
Frau Beate Katernberg Klassenlehrerin 4d<br />
Frau Anja Kempff Klassenlehrerin 1d<br />
Frau Christina Kersten Klassenlehrerin 2c<br />
Frau Ingrid Kitzmüller Klassenlehrerin 2b<br />
Frau Marion Körle Lehrerin<br />
Herr Pfarrer Laux Pfarrer der Gemeinde Wehrheim<br />
Frau Judith Matthey Klassenlehrerin 4c<br />
Frau Britta Pulte Klassenlehrerin 3e<br />
Frau Maria Rückforth Rektorin<br />
Frau Simone Schell Förderschullehrerin<br />
38
Frau Marianne Schmidt-Focke Klassenlehrerin 1a<br />
Frau Kathrin Schnalle Mobile Vertretungsreserve<br />
Frau Simone Schroers-Blumer Leiterin der Vorklasse<br />
Herr Reinhard Strauß Förderschullehrer<br />
Frau Beate Westphal-v.Irmer Klassenlehrerin 4a<br />
Frau Anke Ziegler Klassenlehrerin 4c<br />
6.4 Sekretariat: Frau Anja Birkenfeld<br />
6.5 Hausmeister: Herr Rudolf Karaus<br />
6.6 Schülerbetreuung: Leiterin Frau Borgia Portsteffen<br />
Die Schülerbetreuung wird von der Gemeinde Wehrheim unterhalten und ist im<br />
Neubau der <strong>Limesschule</strong> untergebracht.<br />
200 Kinder sind dort angemeldet, davon nehmen 70 - 90 Kinder ein Mittagessen ein.<br />
Die Zeiten der Schülerbetreuung liegen zwischen 7.30 – 16.30 Uhr. Das<br />
Betreuungsangebot kann flexibel gebucht werden.<br />
39
7 Anhang<br />
Anlage 1 Erziehungsvereinbarung<br />
Anlage 2 Schulordnung der <strong>Limesschule</strong><br />
Anlage 3 Unterrichts- und Pausenzeiten<br />
Anlage 4 Vertretungskonzept der <strong>Limesschule</strong><br />
Anlage 5 Konzept der Vorklasse<br />
Anlage 6 Konzept der Schülerbibliothek<br />
Anlage 7 IT-Konzept<br />
Anlage 8 Förderkonzept<br />
Anlage 9 Methodencurriculum<br />
Anlage 10 Elternmitarbeit<br />
Anlage 11 Schulwegssicherungsplan<br />
40
Anlage 1 Erziehungsvereinbarungen<br />
Erziehungsvereinbarungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern der<br />
<strong>Limesschule</strong> Wehrheim<br />
Schüler, Lehrer und Eltern bilden die Schulgemeinschaft der <strong>Limesschule</strong> Wehrheim.<br />
Wir alle tragen dazu bei, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen, die sich aus dem<br />
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ergeben und die wir im Einzelnen in<br />
unserem Schulprogramm formuliert haben.<br />
Schüler<br />
Lehrer Eltern<br />
Zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele schließen wir diese Vereinbarungen ab,<br />
die für das Miteinander in der schulischen Gemeinschaft verbindlich sein soll.<br />
Wir alle, Schüler, Lehrer und Eltern, verpflichten uns,<br />
• miteinander ehrlich, respektvoll, höflich und verständnisvoll umzugehen,<br />
• auftretende Probleme in einer offenen Gesprächsatmosphäre zeitnah zu<br />
lösen,<br />
• die Schulordnung, das Schulprogramm, diese Erziehungsvereinbarung und<br />
alle im Einzelfall getroffenen Vereinbarungen einzuhalten,<br />
• gemeinsam dafür zu sorgen, dass Gewalt in all ihren Erscheinungsformen ein<br />
absolutes Tabu an unserer Schule ist,<br />
• uns ganz bewusst Zeit für die positive Gestaltung der schulischen Gemeinschaft<br />
zu nehmen.<br />
41
Wir Lehrer verpflichten uns,<br />
• unser Handeln stets an unserem Auftrag zur Vermittlung von Bildung und zur<br />
Mitverantwortung bei der Erziehung der Schüler zu orientieren,<br />
• die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Schüler wahrzunehmen und zu<br />
respektieren und auf dieser Grundlage die Schüler in ihrer Entwicklung<br />
bestmöglich zu unterstützen,<br />
• durch Offenheit in der Kommunikation unser Handeln transparent zu machen<br />
und dadurch Vertrauen aufzubauen,<br />
• ganz bewusst Werte zu vermitteln, die die Grundlage für unser Miteinander in<br />
der Schulgemeinschaft bilden.<br />
Wir Eltern verpflichten uns,<br />
• Interesse an der schulischen Entwicklung unserer Kinder zu zeigen und ihre<br />
schulischen Aktivitäten zu unterstützen,<br />
• nicht aus den Augen zu verlieren, dass es primär unsere Aufgabe ist, unsere<br />
Kinder zu erziehen,<br />
• den Kontakt zur Schule zu suchen, Angebote der Schule wahrzunehmen und<br />
aktiv die bestehenden Möglichkeiten der Elternmitwirkung zu nutzen,<br />
• dafür zu sorgen, dass unsere Kinder regelmäßig und pünktlich in der Schule<br />
erscheinen, die Hausaufgaben anfertigen und die erforderlichen Materialien in<br />
ordentlichem Zustand zur Schule mitbringen.<br />
Wir Schüler verpflichten uns,<br />
• Mitschülern, Lehrern und Eltern offen, höflich, respektvoll und tolerant gegenüberzutreten,<br />
• im Unterricht aktiv und konstruktiv mitzumachen, die Hausaufgaben pünktlich<br />
und vollständig anzufertigen und alle erforderlichen Lernmaterialien<br />
mitzubringen,<br />
• unsere Mitschüler durch unser Verhalten nicht beim Lernen zu stören,<br />
• das Eigentum an Sachen der Mitschüler und der Schule zu achten und die<br />
Einrichtungen der Schule pfleglich zu behandeln.<br />
42
Unser Verhalten als Schülerinnen und Schüler der <strong>Limesschule</strong><br />
• Wir verhalten uns zu unseren Mitschülern, Lehrern und Eltern<br />
höflich, rücksichtsvoll, freundlich und ehrlich.<br />
• Wir stören unsere Mitschüler im Unterricht nicht.<br />
• Wir arbeiten im Unterricht mit, passen auf und melden uns.<br />
• Wir erledigen jeden Tag unsere Hausaufgaben vollständig.<br />
• Wir bringen alle Materialien (z. B. Bücher, Schere, Kleber…),<br />
die wir brauchen mit und behandeln diese ordentlich.<br />
• Wir behandeln Sachen (z. B. Tische, Bücher, Spiele…),<br />
die der Schule oder anderen Kindern gehören, pfleglich.<br />
Anlage 2 Schulordnung der <strong>Limesschule</strong><br />
43
Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um<br />
Wir respektieren einander, sind freundlich zueinander und helfen uns gegenseitig.<br />
Wir gehen offen und ehrlich miteinander um und nehmen aufeinander Rücksicht.<br />
Keiner darf belästigt, eingeschüchtert, bedroht oder ausgegrenzt werden. Niemand<br />
darf wegsehen, wenn dies geschieht.<br />
Spott und böse Worte tun weh und können sehr verletzen.<br />
Wir vermeiden Ärger und versuchen, Streitereien und Konflikte ohne Gewalt zu<br />
lösen.<br />
Wir achten den anderen und sein Eigentum und nehmen nichts, ohne vorher gefragt<br />
zu haben.<br />
In der Pause:<br />
Wir betreten und verlassen das Schulgebäude langsam, in Ruhe und ohne<br />
Rempelei.<br />
Auf dem Fun-Court dürfen nur die 3. und 4. Klassen nach Plan spielen.<br />
Wenn die rote Fahne hängt, spielen wir nur auf dem gepflasterten Schulhof, weil wir<br />
sonst die Wiese zertreten und viel Schmutz ins Schulgebäude tragen.<br />
Wir wollen niemanden verletzen, werfen daher keine Steine oder Schneebälle und<br />
spielen nicht mit Stöcken.<br />
Die Lehrer/ Lehrerinnen stehen als Ansprechpartner bereit und helfen bei Bedarf.<br />
In den Pausen und während des Unterrichts bleiben wir auf dem Schulgelände.<br />
In den Regenpausen halten wir uns in der Klasse auf und beschäftigen uns ruhig.<br />
Hier gelten dann die Klassenregeln.<br />
In der Turnhalle:<br />
Die Turnhalle betreten wir nur mit unserem Lehrer.<br />
Wir tragen geeignete Sportkleidung und keinen Schmuck, damit wir uns nicht<br />
verletzen.<br />
An den Geräten turnen wir nur, wenn ein Lehrer es erlaubt hat.<br />
Auf dem Schulweg:<br />
44
Wir benutzen den sicheren Schulweg, den uns unsere Eltern gezeigt haben.<br />
Wir kommen so rechtzeitig, dass der Unterricht pünktlich beginnen kann.<br />
Ab dem Schultor gehen wir selbstständig, ohne unsere Eltern in die Schule.<br />
Die Fahrt mit dem Bus:<br />
Wenn wir mit dem Bus nach Hause fahren, stellen wir uns ohne Drängeln auf dem<br />
Schulhof auf.<br />
Wir steigen erst in den Bus ein, wenn die Lehrkraft dies erlaubt.<br />
Im Bus setzen wir uns.<br />
Wir halten unsere Schule sauber und in Ordnung<br />
Wir verschmutzen und zerstören nichts, bekritzeln keine Wände und Tische, damit<br />
wir in schön gestalteter und ordentlicher Umgebung konzentriert lernen können.<br />
Damit nichts verloren geht, halten wir Ordnung und hängen z.B. unsere Jacken an<br />
die Kleiderhaken und stellen die Schuhe ins Regal.<br />
Das Schulgebäude ist kein Spielplatz.<br />
Um uns und andere nicht zu gefährden, ist das Toben, Ball spielen,<br />
Herunterrutschen vom Treppengeländer sowie das Herunterwerfen von<br />
Gegenständen (Turnbeutel, Schulranzen…) nicht erlaubt.<br />
Auf den Toiletten halten wir uns so kurz wie möglich auf. Wir hinterlassen die Toilette<br />
immer so, wie wir sie gerne vorfinden würden – also sauber und ordentlich.<br />
Mit unserem Lernmaterial gehen wir sorgsam um. Wir möchten ja auch keine<br />
verschmutzten oder zerrissenen Bücher übernehmen.<br />
Die Bücherei besuchen wir nur, um uns Bücher auszuleihen oder dort zu lesen.<br />
In unserer Schule sind jeden Tag viele Menschen. Damit wir uns alle wohl fühlen und<br />
in Ruhe lernen können, gibt es diese Schulordnung, die für die Schüler und<br />
Erwachsenen unserer Schule gilt.<br />
Stand: Juni 2006<br />
Sehr geehrte Eltern,<br />
45
itte lesen Sie die Schulordnung mit Ihrem Kind aufmerksam und geben Sie den<br />
Rücklauf beim Klassenlehrer ab.<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Ich habe die Schulordnung gelesen und erkenne sie an:<br />
(Name) (Datum)<br />
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)<br />
(Unterschrift des Kindes)<br />
46
Anlage 3 Unterrichts- und Pausenzeiten<br />
Zeiten Stunden und Pausen Gong<br />
7.45 – 8.00 Gleitzeit 7.45<br />
8.00<br />
8.00 – 8.45 1. Stunde<br />
8.45 – 8.50 Pause 8.45<br />
8.50 – 9.35 2. Stunde<br />
9.35 – 9.55 Hofpause 9.55<br />
9.55 – 10.40 3. Stunde<br />
10.40 – 11.25 4. Stunde<br />
11.25 – 11.40 Hofpause 11.40<br />
11.40 – 12.25 5. Stunde<br />
12.25 – 12.30 Pause 12.30<br />
12.30 – 13.15 6. Stunde 13.15<br />
47
Anlage 4 Vertretungskonzept der <strong>Limesschule</strong><br />
Kurzfristige Vertretungen:<br />
• Zusammenlegung der Förderkurse<br />
• Vertretungskräfte im Rahmen der „Verlässlichen Schule“<br />
• Aufteilung der Klasse<br />
(Ausnahmen: Vorklasse, erstes Schuljahr)<br />
• Zusammenlegung zweier Klassen im Sportunterricht<br />
• Beaufsichtigung einer zweiten Klasse<br />
Langfristige Vertretungen:<br />
• Übernahme der gesamten Wochenstunden in den Hauptfächern durch eine<br />
kontinuierlich eingesetzte Fachkraft des Kollegiums<br />
• zusätzlich bezahlte Mehrarbeitstunden (durch Teilzeitkräfte des Kollegiums)<br />
• Zuweisung einer Vertretungskraft durch das Staatliche Schulamt<br />
Umgang mit „Verlässlicher Schule“<br />
• Kriterien für die Auswahl einer Vertretungskraft<br />
- Lehrkräfte in Altersteilzeit<br />
- pensionierte Lehrkräfte<br />
- Lehramtsstudenten<br />
- Übungsleiter, Fachbereich Sport<br />
- Personen mit pädagogischer Ausbildung<br />
- Personen mit fachspezifischer Ausrichtung<br />
• Kriterien für die Unterrichtsabdeckung<br />
- Vertretung in den Hauptfächern durch ausgebildete Lehrkräfte<br />
- Abdeckung des Sportunterrichts durch Übungsleiter,<br />
- schuleigene Lehrkräfte übernehmen zu vertretenden Unterricht<br />
- Im Notfall: Einsatz in einer Klasse nach Anleitung einer Lehrkraft aus<br />
den Parallelklassen<br />
48
Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf des Vertretungsunterrichtes:<br />
• vorhandene Materialien können von den Schülern selbstständig benutzt<br />
werden, z.B. Logico oder LÜK<br />
• Lernkarteien, Übungshefte, Arbeitsblätter im Einsatz<br />
• Lehrbericht, Stundenplan, Klassenliste, Liste der Betreuungs-/Buskinder liegt<br />
im Klassenraum<br />
• Kopiervorlagen zu den aktuellen Themen der einzelnen Fächer aller<br />
Jahrgänge liegen im Kopierraum bereit<br />
• Kollegen stehen als feste Ansprechpartner im Vertretungsfall zur Verfügung<br />
49
Anlage 5 Konzept der Vorklasse<br />
Allgemeine Ziele<br />
• Individuelle Förderung der Kinder, so dass sie in der Jahrgangsstufe 1<br />
erfolgreich mitarbeiten können<br />
• Entwicklungsförderung des Kindes in seiner Gesamtpersönlichkeit<br />
• Erfassung des individuellen Lern- und Entwicklungsstandes<br />
• ganzheitlicher Einsatz – Lernen mit allen Sinnen<br />
• Wechsel von Spiel- und Arbeitsphasen sollen motivieren<br />
Aufgaben<br />
• Unterstützung besonderer Fähig- und Fertigkeiten<br />
• Weiterentwicklung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein<br />
• Förderung des Sozialverhaltens<br />
• Trainieren von Ausdauer und Konzentration<br />
• Verbesserung der Grob- und Feinmotorik<br />
• Erweiterung der Sprachkompetenz<br />
• Förderung der Kommunikationsfähigkeit<br />
• Aufarbeitung von Entwicklungsrückständen<br />
• Einwirkung auf Gesamtpersönlichkeit<br />
(kognitiv, sozial, emotional, psychisch und motorisch)<br />
• Schulung der Sinneswahrnehmung<br />
• Aufbau von Zahlen- und Mengenverständnis<br />
50
Anlage 6 Konzept der Schülerbibliothek<br />
Die Schulbücherei wird ehrenamtlich von zur Zeit 10 Müttern geführt. Sie ist täglich in<br />
der ersten großen Pause von 9.25 Uhr bis 9.55 Uhr geöffnet.<br />
Die Kinder bekommen bei uns die Möglichkeit kostenlos Bücher auszuleihen. Sie<br />
lernen selbständig, in einem überschaubaren Rahmen mit Strukturen einer<br />
Bibliothek umzugehen. Unser Angebot soll die Schüler sowohl für ihre Freizeit, als<br />
auch zur Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff mit Lesematerial versorgen.<br />
Gleichzeitig bieten wir den Schülern die Möglichkeit, sich mit ihren Mitschülern über<br />
Leseerfahrungen und –gewohnheiten auszutauschen.<br />
Allgemeine Ziele<br />
• Begleiten der Schüler bei der Entwicklung ihrer Lesefähigkeit. Jedem Schüler<br />
soll seinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend Lesestoff zur Verfügung<br />
gestellt werden<br />
• Wecken und Fördern der Lesebegeisterung<br />
• Förderung der Medienkompetenz<br />
• Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung<br />
• Einführung in Bibliotheksstrukturen im Klassenverband<br />
Vorklasse und Klassenstufe 1<br />
Gleich zu Beginn ihrer Schulzeit werden die Schüler im Klassenverband spielerisch<br />
in die grundlegenden Strukturen der Schulbücherei (insbesondere Ausleihe und<br />
Buchangebot) eingeführt. Auf diese Weise werden Hemmschwellen und<br />
Unsicherheiten abgebaut. Durch ein sehr breites Angebot an Erstleser-Büchern<br />
verschiedenster Schwierigkeitsstufen wird der Prozess des Lesenlernens begleitet.<br />
Klassenstufe 2 bis 3<br />
Die Schüler lernen im Klassenverband die Bibliotheksstruktur kennen. Sie sollen in<br />
die Lage versetzt werden, selbstständig Lesematerial nach ihren Fähigkeiten und<br />
Interessen zu finden. Auch in den Abteilungen „Sachbücher“ und „fremdsprachige<br />
Bücher“ können die Schüler parallel oder ergänzend zum Unterricht Lesematerial<br />
finden. Die Bücherei wird nun auch zur Informationsquelle.<br />
Klassenstufe 4<br />
Die Schüler der vierten Klassen können auf freiwilliger Basis den<br />
Bibliotheksführerschein erwerben. Ihr Wissen über die Bibliotheksstrukturen können<br />
sie dann als Büchereihelfer einbringen. Ebenso können sie ihre Leseerfahrung an<br />
jüngere Schüler weitergeben und diesen beratend bei der Buchauswahl zur Seite<br />
stehen.<br />
Die Schüler sind am Ende ihrer Grundschulzeit in der Lage auch andere, ihnen nicht<br />
51
vertraute, Bibliotheken zu nutzen.<br />
Buchangebot<br />
In der Schulbücherei findet sich ein breites Angebot an Lesematerial für die<br />
Altersgruppe der 6- bis 10-jährigen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den<br />
Büchern für Leseanfänger. Diese sollen in jedem Stadium des Lesenlernens<br />
genügend Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer Fertigkeiten bekommen.<br />
Gleichzeitig sind wir bestrebt, auch sehr guten und Viellesern der höheren<br />
Klassenstufen ein reichhaltiges, altersgemäßes Angebot zur Verfügung zu stellen.<br />
Sachbücher sind den Interessen der Schüler entsprechend und zu Themen des<br />
Sachunterrichts vorhanden. Parallel zum Fremdsprachenunterricht in der 3. und 4.<br />
Klassenstufe sind in der Bücherei einfache fremdsprachige Bücher und auch<br />
Hörbücher vorhanden. Der Buchbestand wird in Zusammenarbeit mit Lehrern,<br />
Schülern und Eltern regelmäßig erweitert und aktualisiert.<br />
Antolin<br />
Die Schüler der <strong>Limesschule</strong> werden im Rahmen des Unterrichts in das<br />
Internetportal Antolin eingeführt. In der Schülerbücherei sind die Titel, welche im<br />
Antolin gelistet sind, gekennzeichnet.<br />
Finanzierung<br />
Die Schulbücherei wird aus Spendengeldern durch den Förderverein der<br />
<strong>Limesschule</strong> finanziert. Zweimal im Jahr bieten wir Eltern die Möglichkeit der<br />
Schulbücherei als Buchpaten ausgewählte Bücher zu spenden. Auch Spenden gut<br />
erhaltener Bücher oder Geldspenden werden von uns gerne angenommen.<br />
52
Anlage 7 IT-Konzept<br />
Ausstattung der Hardware:<br />
In den Klassenräumen des 3. und 4. Jahrgangs stehen zwischen einem und vier<br />
Rechner für die Differenzierungsphasen während des Unterrichts zu Verfügung.<br />
Seit Dezember 2007 ist der Computerfachraum mit 13 Rechnern ausgestattet.<br />
Bei Nutzung des Raumes durch die gesamte Klasse können je zwei Kinder an einem<br />
Rechner Lernprogramme nutzen oder im Internet recherchieren.<br />
Alle Arbeitsplätze sind über ein schulinternes Netzwerk miteinander verbunden.<br />
Ausstattung mit Software<br />
Wir möchten unseren Schülern ein modernes, multimediales Lernen ermöglichen.<br />
Dafür nutzen wir folgende Programme:<br />
• Alfons<br />
• Blitzrechnen<br />
• Löwenzahn<br />
• Lernwerkstatt<br />
• Schreiblabor<br />
• Mathematikus<br />
Die Kinder sollen Grundkenntnisse erwerben in folgenden Bereichen:<br />
• Das Kennen lernen des PCs und seiner Ausstattung<br />
- Was gehört zu einem Computer?<br />
- die wichtigsten Tasten der Tastatur<br />
• Texte schreiben und gestalten mit dem Programm WORD<br />
- Texte mit verschiedenen Schriften schreiben<br />
- Texte drucken und speichern<br />
- Zeichnen mit WORD<br />
- Bilder und Zeichnungen in Texte einfügen<br />
• Bilder und Zeichnungen erstellen und bearbeiten mit dem Programm PAINT<br />
- Wie zeichne ich eigene Bilder?<br />
- Wie verändere ich Bilder?<br />
(z.B. „Bilder“ ausmalen am Computer)<br />
- Drucken von eigenen Bildern<br />
- Arbeiten mit einer Malkartei<br />
• Kennen lernen und Nutzen des Internets als Informations- und<br />
Kommunikationsmedium<br />
- Was ist eigentlich das Internet?<br />
- Wozu braucht man das Internet?<br />
- Suchmaschinen kennen und benutzen lernen<br />
- Kennenlernen verschiedener Kinderseiten<br />
53
Auch verschiedene Lernsoftware sollen die Kinder nutzen lernen. Es stehen den<br />
Kindern Programme zu den verschiedenen Fächern zur Verfügung ( z.B.<br />
Blitzrechnen, Mathematikus, Ratten raten, Lernwerkstatt, Schreiblabor, ABC der<br />
Tiere usw.)<br />
Die PCs im PC-Raum und in den Klassen werden in verschiedenen Unterrichtssituationen<br />
eingesetzt:<br />
- in offenen Unterrichtssituationen und Freiarbeitsphasen<br />
- während der Wochenplanarbeit<br />
- im Rahmen von Projekten<br />
- im Förderunterricht sowie<br />
- im Fachunterricht<br />
• genutzt werden kann der Computerraum<br />
- zur Informationsbeschaffung z.B. für Sachunterrichtsthemen oder im<br />
Rahmen von Projekten ( mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet)<br />
- zur Nutzung des Internets als Kommunikationsmedium<br />
- als Nachschlagewerk (Internet, Lexika etc. )<br />
- zur Erstellung, Veränderung und zum Drucken von Texten<br />
- zum Üben des Umgangs mit Mal- und Grafikprogrammen und<br />
- zum Einsatz von vielfältiger Lernsoftware in allen Lernbereichen und<br />
Jahrgangsstufen<br />
54
Anlage 8 Förderkonzept<br />
Der Fachlehrer und die Förderlehrkraft stellen gemeinsam die Förderpläne der zu<br />
fördernden Kinder auf und informieren die Eltern.<br />
Es erfolgt eine halbjährliche Abstimmung über Fortführung der Förderpläne in den<br />
Klassenkonferenzen.<br />
Im Bedarfsfall erstellt der Klassenlehrer eine Beratungsanforderung an die<br />
Förderschullehrkraft hinsichtlich<br />
• Erziehungshilfe<br />
• Lernhilfe<br />
• Sprachheilförderung<br />
Für die Kinder der Vorklasse und des 1. Schuljahres können Förderkurse zu<br />
folgenden Bereichen angeboten werden:<br />
• Psychomotorik (Vorklasse)<br />
• Sportförderunterricht durch Kollegen mit entsprechender Zusatzqualifikation<br />
(1. Klassen)<br />
• Förderunterricht im Bereich Sprache und Wahrnehmung in der Vorklasse<br />
Nach Möglichkeit werden klassenübergreifende Förderkurse für Kleingruppen im<br />
Bereich:<br />
• LRS<br />
• Mathematik<br />
• Lesen<br />
angeboten.<br />
Der Nachteilsausgleich wird entsprechend der VOLRR auf Antrag der<br />
Erziehungsberechtigten nach Abstimmung durch die Klassenkonferenz für eine<br />
Dauer von einem halben Jahr gewährt.<br />
55
Anlage 9<br />
1<br />
VKL<br />
Methodencurriculum 2011/12<br />
<strong>Limesschule</strong><br />
Training 1 Training 2 Training 3 Training 4 Training 5<br />
09.09.2011 04.11.2011 27.01.2012 16.03.2012 11.0<strong>5.2</strong>012<br />
Schulranzen &<br />
Mäppchencheck<br />
(+ Abheften)<br />
2 Heftseite gestalten<br />
3<br />
4<br />
Markieren 1<br />
Textarbeit und<br />
Randbemerkungen<br />
(Wesentliches finden)<br />
Freies Sprechen und<br />
Erzählen<br />
Anmalen<br />
(Freies Malen)<br />
Umgang mit dem<br />
Lineal:<br />
unterstreichen,<br />
messen, Spalten<br />
zeichnen …<br />
Miteinander reden<br />
Gruppenarbeit<br />
planen und<br />
gestalten (Fahrplan /<br />
Rollenverteilung)<br />
Schneiden & Kleben<br />
(Werkzeuge,<br />
Bastelmäppchen)<br />
Aktives Zuhören<br />
Visualisieren<br />
Piktogramme/<br />
Skizzen/Schaubilder<br />
(Maldiktat, Sachaufgaben,<br />
SU …)<br />
Lernplakate<br />
gestalten<br />
(Referat)<br />
Nonverbale<br />
Kommunikation<br />
Oberbegriffe /<br />
Unterbegriffe<br />
(Clustern, Mind map)<br />
Soziale Fertigkeiten<br />
üben /<br />
Gruppenerfahrungen<br />
reflektieren<br />
Ordnung am Arbeitsplatz<br />
und in der Klasse<br />
Gruppenprozesse kritisch<br />
sichten –<br />
Gruppenerfahrungen<br />
reflektieren / Regeln<br />
erstellen<br />
Gedächtnislandkarten<br />
(Mind map)<br />
Markieren 2 Lernkarten erstellen<br />
(Fragen zum Text stellen)<br />
Verbindliche Trainingstage (5) für das Schuljahr 2011/12 lt. Abstimmung in der Dienstversammlung am 17.08.2011<br />
56
Anlage 10 Elternmitarbeit<br />
Die Mitarbeit der Eltern findet in folgenden Gremien statt:<br />
• dem Elternbeirat<br />
• der Schulkonferenz<br />
• im Förderverein<br />
• im Schulackerverein e.V.<br />
• in der Redaktion der Schulzeitung<br />
• in der Schülerbibliothek<br />
Bei vielen Aktivitäten innerhalb der Klassen unterstützen engagierte Eltern die<br />
Lehrerinnen, z.B. bei Klassenfesten, Klassenfahrten, den Bundesjugendspielen und<br />
vielem mehr.<br />
57
Anlage 11 Schulwegsicherungsplan<br />
Der Schulwegsicherungsplan wurde im Schuljahr 2006/07 in der Schulkonferenz<br />
unter Beteiligung der Gemeinde Wehrheim und Vertretern der Verkehrspolizei<br />
Usingen erstellt.<br />
58
Anlage 12 Konzept zur Gesundheitserziehung<br />
Maßnahmen zur Gesundheitserziehung finden in verschiedenen Bereichen statt<br />
(Bewegung, Ernährung, Bildungs- und Erziehungsplan).<br />
63