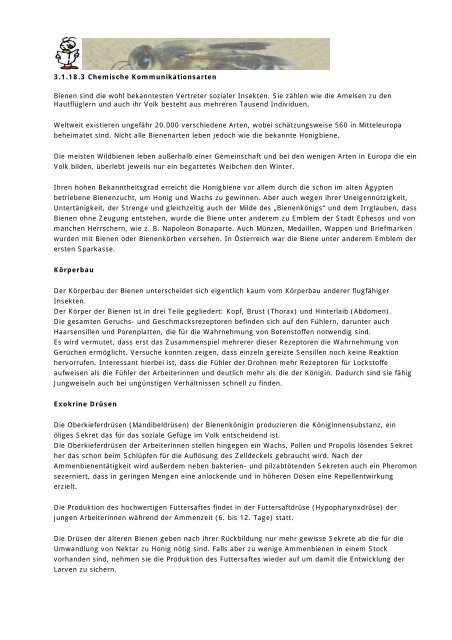3.1.18.3 Chemische Kommunikationsarten ... - Imkerhof Salzburg
3.1.18.3 Chemische Kommunikationsarten ... - Imkerhof Salzburg
3.1.18.3 Chemische Kommunikationsarten ... - Imkerhof Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>3.1.18.3</strong> <strong>Chemische</strong> <strong>Kommunikationsarten</strong><br />
Bienen sind die wohl bekanntesten Vertreter sozialer Insekten. Sie zählen wie die Ameisen zu den<br />
Hautflüglern und auch ihr Volk besteht aus mehreren Tausend Individuen.<br />
Weltweit existieren ungefähr 20.000 verschiedene Arten, wobei schätzungsweise 560 in Mitteleuropa<br />
beheimatet sind. Nicht alle Bienenarten leben jedoch wie die bekannte Honigbiene.<br />
Die meisten Wildbienen leben außerhalb einer Gemeinschaft und bei den wenigen Arten in Europa die ein<br />
Volk bilden, überlebt jeweils nur ein begattetes Weibchen den Winter.<br />
Ihren hohen Bekanntheitsgrad erreicht die Honigbiene vor allem durch die schon im alten Ägypten<br />
betriebene Bienenzucht, um Honig und Wachs zu gewinnen. Aber auch wegen ihrer Uneigennützigkeit,<br />
Untertänigkeit, der Strenge und gleichzeitig auch der Milde des „Bienenkönigs“ und dem Irrglauben, dass<br />
Bienen ohne Zeugung entstehen, wurde die Biene unter anderem zu Emblem der Stadt Ephesos und von<br />
manchen Herrschern, wie z. B. Napoleon Bonaparte. Auch Münzen, Medaillen, Wappen und Briefmarken<br />
wurden mit Bienen oder Bienenkörben versehen. In Österreich war die Biene unter anderem Emblem der<br />
ersten Sparkasse.<br />
Körperbau<br />
Der Körperbau der Bienen unterscheidet sich eigentlich kaum vom Körperbau anderer flugfähiger<br />
Insekten.<br />
Der Körper der Bienen ist in drei Teile gegliedert: Kopf, Brust (Thorax) und Hinterlaib (Abdomen).<br />
Die gesamten Geruchs- und Geschmacksrezeptoren befinden sich auf den Fühlern, darunter auch<br />
Haarsensillen und Porenplatten, die für die Wahrnehmung von Botenstoffen notwendig sind.<br />
Es wird vermutet, dass erst das Zusammenspiel mehrerer dieser Rezeptoren die Wahrnehmung von<br />
Gerüchen ermöglicht. Versuche konnten zeigen, dass einzeln gereizte Sensillen noch keine Reaktion<br />
hervorrufen. Interessant hierbei ist, dass die Fühler der Drohnen mehr Rezeptoren für Lockstoffe<br />
aufweisen als die Fühler der Arbeiterinnen und deutlich mehr als die der Königin. Dadurch sind sie fähig<br />
Jungweiseln auch bei ungünstigen Verhältnissen schnell zu finden.<br />
Exokrine Drüsen<br />
Die Oberkieferdrüsen (Mandibeldrüsen) der Bienenkönigin produzieren die Königinnensubstanz, ein<br />
öliges Sekret das für das soziale Gefüge im Volk entscheidend ist.<br />
Die Oberkieferdrüsen der Arbeiterinnen stellen hingegen ein Wachs, Pollen und Propolis lösendes Sekret<br />
her das schon beim Schlüpfen für die Auflösung des Zelldeckels gebraucht wird. Nach der<br />
Ammenbienentätigkeit wird außerdem neben bakterien- und pilzabtötenden Sekreten auch ein Pheromon<br />
sezerniert, dass in geringen Mengen eine anlockende und in höheren Dosen eine Repellentwirkung<br />
erzielt.<br />
Die Produktion des hochwertigen Futtersaftes findet in der Futtersaftdrüse (Hypopharynxdrüse) der<br />
jungen Arbeiterinnen während der Ammenzeit (6. bis 12. Tage) statt.<br />
Die Drüsen der älteren Bienen geben nach ihrer Rückbildung nur mehr gewisse Sekrete ab die für die<br />
Umwandlung von Nektar zu Honig nötig sind. Falls aber zu wenige Ammenbienen in einem Stock<br />
vorhanden sind, nehmen sie die Produktion des Futtersaftes wieder auf um damit die Entwicklung der<br />
Larven zu sichern.
Die in der Unterlippe mündenden Speichel- oder Labialdrüsen der Arbeiterinnen befinden sich vor dem<br />
Gehirn und sondern zwei verschiedene Sekrete ab. Die hergestellten Sekrete werden mit Wachs<br />
vermischt zum Bau der Waben benötigt, während die zum Lösen von Zucker und kandiertem Honig<br />
benützte Substanz in den in der Brust gelegenen Drüsen hergestellt und auf der Brutzelle aufgetragen<br />
wird. Die Labialdrüsen der Larve sind für die Produktion des Spinnsekretes zuständig, aus dem der<br />
Kokon gesponnen wird. Wofür die Labialdrüsen der Königin und der Drohnen zuständig sind, ist noch<br />
weitgehend unklar. Die Fußdrüsen, die auch als Anharndt´sche Drüsen oder Tarsaldrüsen bezeichnet<br />
werden, liegen im letzten Gliedes des Fußes. Sie scheiden ein Sekret aus, das durch den beinhalteten<br />
Wachsgehalt die Haftung des Haftlappens auf dem Untergrund verbessert. Zusätzlich zu diesem Vorteil<br />
kommen darin auch Pheromone vor, die unter anderem den Nesteingang markieren.<br />
Auf die Nassanoffdrüse, Tergittaschendrüse und die Koschefnikovsche Drüse werde ich unter den<br />
spezifischen Themenbereichen genauer eingehen.<br />
Weiters besitzt jede Biene auch Gift-, Wachs- und Geschlechts- und Schleimdrüsen.<br />
<strong>Chemische</strong> Kommunikation<br />
Die chemische Kommunikation ist für die Bienen ebenso wichtig wie für Ameisen.<br />
Interessant ist, dass Bienen – vermutlich durch chemische Reize – in der Lage sind, den<br />
Verwandtschaftsgrad der anderen im Stock lebenden Bienen und Larven abzuschätzen. Dies kann zu<br />
einer intensiveren Pflege der Vollschwestern und nah verwandten Weisellarven im Gegensatz zu den<br />
Halbschwestern (gemeinsame Mutter, verschiedene Väter) führen.<br />
Orientierung<br />
Obwohl Bienen in der Lage sind den Weg zu einer Futterquelle durch den Rund- oder Schwänzeltanz in<br />
Entfernung und Richtung genau zu beschreiben, verwenden sie auch chemische Botenstoffe um<br />
bestimmte Orte zu kennzeichnen. Die so genannten „Orientierungspheromone“ werden in den<br />
Nassanoffschen Drüsen gebildet, nach außen abgegeben und mit den Flügeln durch Fächeln verteilt. Am<br />
Flugloch dienen die Stoffe der sicheren Ankunft der heimkehrenden Bienen, während sie nach<br />
Markierung der Nektarquellen anderen Arbeiterinnen das Auffingen der Futterquellen erleichtern. Im<br />
Inneren des Stockes werden diese Pheromone ebenfalls verteilt.<br />
Von Zeit zu Zeit benutzen Bienen aber auch Wegmarkierungen. Um diese zu setzen landen sie in<br />
regelmäßigen Abständen auf festen Unterlagen. Dadurch bildet sich eine „Duftstraße“ zwischen Stock<br />
und Nahrungsquelle. Hierbei ist das „räumliche Riechen“ der Bienen die Vorraussetzung. Es bedeutet,<br />
dass sie in der Lage sind auch die Richtung des Duftes genau nachzuvollziehen.<br />
Alarmstoffe<br />
Die meisten der über 70 bisher entdeckten Substanzen die in Alarmpheromonen enthalten sind,<br />
entstammen den Mandibeldrüsen (Oberkieferdrüsen). Neben der reinen Alarmierung wird auch der<br />
Stoffwechsel erhöht und bei den Honigbienen ein Angriffsverhalten ausgelöst. Besonders Völker mit<br />
einer hohen Honigproduktion reagieren auf alle drei Eigenschaften dieser Pheromone stärker als jene mit<br />
einer niedrigeren. Ab einer gewissen Konzentration wirken sie als Repellens auf stockeigene Bienen.<br />
Ihre Produktion erfolgt verstärkt zum Beginn der Flugbienenzeit, das heißt wenn die Bienen im Frühjahr<br />
wieder beginnen auszufliegen.<br />
Die Witterung hat, neben den genetisch bedingten Unterschieden der verschiedenen Völker, Einfluss auf<br />
das Verteidigungsverhalten der heimischen Honigbienen. Die Verteidigungsbereitschaft steigt mit<br />
zunehmender Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit.
Vor Stürmen – Bienen nehmen die Luftdrucksenkung wahr – nimmt sie ebenfalls zu, wogegen der Sturm<br />
selbst durch die hohe Windgeschwindigkeit die Pheromonkonzentration in der Luft abschwächt und damit<br />
auch die Verteidigungsbereitschaft abnehmen lässt.<br />
Jungweiseln, das heißt die noch unbefruchteten Königinnen, geben manchmal (sofern sie in einem<br />
fremden Stock gesetzt werden) Stresspheromone ab, die ebenfalls zu den Alarmstoffen gezählt werden.<br />
Diese bewirken bei den Arbeiterinnen Aggressivität gegenüber der fremden Königin. Diese Hypothese ist<br />
aber noch durchaus umstritten.<br />
Die Verteilung der Alarmpheromone erfolgt durch so genanntes „Sterzeln“:<br />
Sexuallockstoffe<br />
Alle Substanzen, die in Sexualpheromonen enthalten sind werden in den Mandibeldrüsen der Weisel<br />
produziert. Bisher konnte man 32 verschiedene feststellen, wobei jede Einzelne einem bestimmten<br />
Zweck dient, sei es zur Anlockung von fliegenden Drohnen oder zur Förderung des<br />
Kopulationsverhaltens.<br />
Letzteres, natürlich nur in der Nähe der Weisel stattfindendes Verhalten, wird auch durch die von den<br />
Tergal- oder Tergittentaschendrüsen sezernierten Stoffe hervorgerufen.<br />
Bei der Gattung Apis wirken die Sexualpheromone interspezifisch.<br />
Königinnensubstanz<br />
Sie wird, wie der Name schon sagt, nur von der Königin ausgeschieden. Wie bereits beschrieben wird sie<br />
in den Mandibeldrüsen produziert. Ihre volle Wirkung erzielt sie nur, wenn sie ständig vom Hofstaat der<br />
Königin aufgenommen und im gesamten Stock verteilt wird.<br />
Die Königinnensubstanz verhindert den Bau von Weiselzellen und die Entwicklung der Eierstöcke der<br />
Arbeiterinnen. Des Weiteren hat sie auch eine lebensverlängernde Wirkung auf Arbeiterinnen, lockt die<br />
Jungbienen zur Pflege an und hält das Volk beim Schwärmen zusammen.<br />
In Zusammenhang mit der Königinnensubstanz sollte das Fußabdruckpheromon erwähnt werden.<br />
Dieses wird in den Tarsaldrüsen (Anhardt´schen Drüsen) der Königin produziert, also in jenen Drüsen,<br />
die bei den Arbeiterinnen für die Produktion der für die Markierung des Nesteinganges benötigten<br />
Pheromone sind. (siehe 3.1.2)<br />
Die von den Drüsen der Königin hergestellten Pheromone nehmen unter anderem Einfluss auf die<br />
Bildung von Weiselzellen und somit auch auf die Entwicklung von Jungweiseln.<br />
Wenn die Individuenanzahl eines Volkes stark zugenommen hat ist im Stock die Bewegungsfreiheit der<br />
Arbeiterinnen und auch der Königin stark eingeschränkt. Letztere hält sich in solchen Fällen vermehrt in<br />
der oberen Hälfte der Waben auf. Sobald dies der Fall sein sollte, beginnen die Arbeiterinnen in dem Bau<br />
von Weiselzellen in der unteren Hälfte des Stockes.<br />
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Königin auf ihren Wanderungen zweierlei Pheromone<br />
abgibt, wobei eines in den Tarsaldrüsen und das in der Mandibeldrüse hergestellt wird. Das Gemisch<br />
verhindert den Bau besagter Zellen.