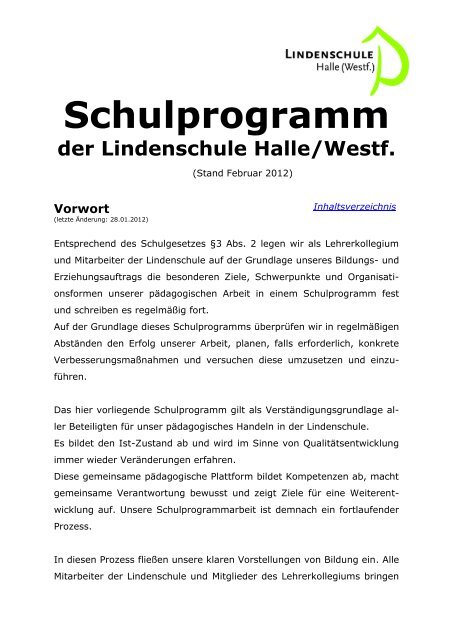schule - Lindenschule, Halle
schule - Lindenschule, Halle
schule - Lindenschule, Halle
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schulprogramm<br />
der Linden<strong>schule</strong> <strong>Halle</strong>/Westf.<br />
Vorwort<br />
(letzte Änderung: 28.01.2012)<br />
(Stand Februar 2012)<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Entsprechend des Schulgesetzes §3 Abs. 2 legen wir als Lehrerkollegium<br />
und Mitarbeiter der Linden<strong>schule</strong> auf der Grundlage unseres Bildungs- und<br />
Erziehungsauftrags die besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisati-<br />
onsformen unserer pädagogischen Arbeit in einem Schulprogramm fest<br />
und schreiben es regelmäßig fort.<br />
Auf der Grundlage dieses Schulprogramms überprüfen wir in regelmäßigen<br />
Abständen den Erfolg unserer Arbeit, planen, falls erforderlich, konkrete<br />
Verbesserungsmaßnahmen und versuchen diese umzusetzen und einzu-<br />
führen.<br />
Das hier vorliegende Schulprogramm gilt als Verständigungsgrundlage al-<br />
ler Beteiligten für unser pädagogisches Handeln in der Linden<strong>schule</strong>.<br />
Es bildet den Ist-Zustand ab und wird im Sinne von Qualitätsentwicklung<br />
immer wieder Veränderungen erfahren.<br />
Diese gemeinsame pädagogische Plattform bildet Kompetenzen ab, macht<br />
gemeinsame Verantwortung bewusst und zeigt Ziele für eine Weiterent-<br />
wicklung auf. Unsere Schulprogrammarbeit ist demnach ein fortlaufender<br />
Prozess.<br />
In diesen Prozess fließen unsere klaren Vorstellungen von Bildung ein. Alle<br />
Mitarbeiter der Linden<strong>schule</strong> und Mitglieder des Lehrerkollegiums bringen
ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Schwerpunkte mit ein und verste-<br />
hen sich als Gemeinschaft, die ihr eigenes hier vorliegendes Konzept ent-<br />
wickelt hat.<br />
Gemeinschaft erfordert auch Ordnung und Selbstdisziplin, sie impliziert<br />
Einigungsprozesse und Kompromisse. Daher bedeutet diese Gemeinschaft<br />
auch immer ein Stück Aufgabe von Freiheiten zugunsten des von uns allen<br />
gut geheißenen pädagogischen Handelns.<br />
Im Folgenden veröffentlichen wir auf unserer Homepage zentrale Aspekte<br />
unseres Schulprogramms. Aus Gründen des Umfangs und der Lesbarkeit<br />
verzichten wir hier auf eine Aufführung sämtlicher vorhandener Konzepte.<br />
Darüber hinaus verzichten wir auch auf diejenigen Aspekte, die Sie an an-<br />
derer Stelle auf unserer Schulhomepage erfahren können.<br />
Wenn Sie über diese Informationen hinaus Interesse an unserem (voll-<br />
ständigen) Schulprogramm oder an unserer Arbeit haben, setzen Sie sich<br />
gerne mit uns über unser Schulsekretariat oder über die bekannten Kon-<br />
taktdaten in Verbindung. Wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. Aus-<br />
führliche Schulprogramme sind im Sekretariat der Linden<strong>schule</strong> einsehbar.<br />
Anmerkungen zum Umgang mit dem Schulprogramm:<br />
Sie können unser (gekürztes) Schulprogramm hier als pdf-Datei herunter-<br />
laden. Innerhalb des Inhaltsverzeichnisses können Sie selbstständig navi-<br />
gieren und springen, indem Sie die einzelnen Menüpunkte anklicken.
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Die Linden<strong>schule</strong> stellt sich vor<br />
1.1 Die Lage<br />
1.2 Unsere Schülerinnen und Schüler<br />
1.3 Räumlichkeiten<br />
1.4 Der Schulhof<br />
1.5 Die Stundentafel<br />
1.6 Unterrichtszeiten an der Linden<strong>schule</strong><br />
2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Linden<strong>schule</strong><br />
3 Fördern, Fordern, Beurteilen<br />
3.1 Das Förderkonzept der Linden<strong>schule</strong><br />
3.2 Leistungsbewertung<br />
4 Pädagogische Konzepte<br />
5 Anfangsunterricht in der Schuleingangsphase<br />
6 Soziales Lernen<br />
6.1 Das Erziehungskonzept<br />
6.2 Regeln und Rituale an der LS<br />
7 Beratung<br />
7.1 Übergang Kita – Schule<br />
7.2 Übergang zur weiterführenden Schule<br />
7.3 Elternsprechzeiten<br />
7.4 Ansprechpartner für ratsuchende Eltern<br />
8 Schulleben<br />
9 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen<br />
10 Qualitätssicherung<br />
11 Steuergruppe zur Unterrichtsentwicklung<br />
12 Evaluation und Entwicklungsziele<br />
13 Impressum
1 Die Linden<strong>schule</strong> stellt sich vor<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Die Linden<strong>schule</strong> besteht seit 1973 und war in den Anfangsjahren in zwei<br />
Dependancen untergebracht. 1981 zogen die Kinder und das Kollegium in<br />
die Räumlichkeiten des „<strong>Halle</strong>r Schulzentrums an der Masch“ ein, welche<br />
sie sich bis zum Sommer 2006 mit der Real<strong>schule</strong> teilten.<br />
Anlässlich des 20jährigen Schuljubiläums im Jahre 2001 erhielt die ehe-<br />
malige Grund<strong>schule</strong> <strong>Halle</strong> West den neuen Namen Linden<strong>schule</strong>.<br />
Aus einer Fülle von Vorschlägen wählte eine Jury, bestehend aus Kindern,<br />
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, den Namen Linden<strong>schule</strong> aus.<br />
Er wurde einerseits favorisiert, weil die Linde das Wahrzeichen von <strong>Halle</strong><br />
ist, andererseits aber auch, weil die Symbolik des Baumes etwas von dem<br />
beinhaltet, was wir den Kindern mitgeben möchten:<br />
- Wurzeln haben oder verwurzelt sein<br />
- Halt und Schutz finden<br />
- wachsen und reifen<br />
- den Stürmen und dem Regen trotzen<br />
- sich der Sonne und Wärme erfreuen<br />
- der Wechselhaftigkeit des Lebens standhalten<br />
- Teil eines Ganzen sein<br />
Nicht zuletzt die herzförmigen Blätter, das lichte Laub der Linde, sowie der<br />
Aberglaube, dass sich Elfen und Kobolde unter ihr aufhalten, gaben für<br />
uns den Ausschlag.<br />
Nach dem Umzug der Linden<strong>schule</strong> im Jahr 2006 in die frisch renovierten<br />
Räume der ehemaligen Haupt<strong>schule</strong> <strong>Halle</strong>, in die Nähe der Innenstadt, in<br />
die Nähe des „<strong>Halle</strong>r Herzens“, hat unser Name immer mehr an Bedeu-<br />
tung gewonnen.
Als eine von vier Grund<strong>schule</strong>n in <strong>Halle</strong> sind wir glücklich, den Gedanken<br />
des <strong>Halle</strong>r Herzens in Verbindung mit dem Symbol der Lindenstadt in un-<br />
serem überarbeiteten Logo mit aufnehmen zu dürfen.<br />
1.1 Die Lage<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Der Standort der Linden<strong>schule</strong> ist seit dem Schuljahr 2006 / 2007 an der<br />
Bismarckstraße 8, unweit vom Stadtkern und in unmittelbarer Nachbar-<br />
schaft zur katholischen Herz-Jesu-Kirche.<br />
Das Lindenbad, in dem unser Schwimmunterricht stattfindet, ist fußläufig<br />
erreichbar.<br />
Die ehemaligen Schulbezirksgrenzen wurden im Schuljahr 2007 / 2008<br />
aufgehoben, d.h. alle Grund<strong>schule</strong>n stehen seitdem allen Kindern unab-<br />
hängig von ihrem jeweiligen Wohnstandort in <strong>Halle</strong> zur Verfügung. Die<br />
Anmeldesituation in den letzten Schuljahren hat jedoch ergeben, dass die<br />
Eltern in der Regel die wohnstandortnächste Schule für ihr Kind gewählt<br />
haben und damit dem pädagogischen Prinzip der Grund<strong>schule</strong> „kurze Bei-<br />
ne brauchen kurze Wege“ Rechnung getragen haben.<br />
Der neue Standort der Linden<strong>schule</strong> ermöglicht das fußläufige Erreichen<br />
vieler außerschulischer Lernorte und trägt damit zur Orientierung der<br />
Schülerinnen und Schüler in ihrem näheren Wohnumfeld bei. Auch der all-<br />
tägliche Kontakt zu den umliegenden Kindergärten, aus denen in der Re-<br />
gel ein Großteil unserer neuen Schulanfänger kommt, wird durch den neu-<br />
en Standort wesentlich erleichtert. Hemmschwellen und Fremdheitsgefüh-<br />
len kann somit im Vorfeld entgegengewirkt werden. Dazu trägt u. a. auch<br />
unser 2007 neu gestalteter Erlebnisschulhof bei, der als öffentlicher Spiel-
platz schon von vielen Kindergartenkindern vor der Schulzeit als Lebens-<br />
raum entdeckt und genutzt wird.<br />
1.2 Unsere Schülerinnen und Schüler<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Im Schuljahr 2011/2012 besuchen 304 Schülerinnen und Schüler die Lin-<br />
den<strong>schule</strong>. Sie werden in 12 Klassen unterrichtet, so dass es jeweils drei<br />
Klassen pro Jahrgang gibt.<br />
Unsere Kinder stammen zu ungefähr einem Drittel aus anderen Ländern<br />
wie der Türkei, Afghanistan, den GUS–Staaten, Polen, Italien, Malta, Grie-<br />
chenland und Pakistan.<br />
Dieser Vielfalt versuchen wir in unserem Schulleben zu entsprechen, und<br />
so prägt sie unter anderem auch unseren Anspruch an das soziale Mitei-<br />
nander und die Konzeption unserer Sprachkompetenzerweiterung.<br />
1.3 Räumlichkeiten<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Der Umzug der Linden<strong>schule</strong> in das ehemalige Gebäude der Haupt<strong>schule</strong><br />
<strong>Halle</strong> war in jeder Beziehung ein Gewinn für unsere Arbeit. Am bedeu-<br />
tendsten jedoch ist der Vorteil in Bezug auf die besondere räumliche Situ-<br />
ation einzuschätzen.<br />
Neben einer Schulküche, die es uns erlaubt, mit ganzen Klassen verschie-<br />
denste Unterrichtsprojekte anzugehen, haben wir die Möglichkeit, für je-<br />
den Jahrgang einen eigenen PC-Raum anzubieten, eine Schülerbücherei zu<br />
nutzen, die Aula als Musik- und Präsentationsraum zu verwenden und vie-<br />
les mehr. Außerdem verfügen wir über Fachräume für Sprachkompetenz-<br />
unterricht, Türkisch, Kunstunterricht und Kleingruppenarbeit. Diese Mög-<br />
lichkeiten werden im Schulalltag intensiv wahr genommen.<br />
Im Schuljahr 2008/ 2009 wurde der OGS-Bereich um eine Mensa, die<br />
gleichzeitig als Mehrzweckraum genutzt wird, und um einen Werkraum mit<br />
Tonbrennofen erweitert. Dieser steht im Vormittagsbereich natürlich eben-
so dem normalen Schulbetrieb zur Verfügung. Außerdem gibt es einen<br />
zweiten Werkraum mit entsprechenden Werkbänken und dazugehörigen<br />
Material- und Werkzeugschränken.<br />
Im Schuljahr 2010 / 2011 wurde der OGS und den Randstundenkindern<br />
zusätzlich die ehemalige Hausmeisterwohnung zur Verfügung gestellt und<br />
unseren Ansprüchen entsprechend hergerichtet.<br />
Mit Hilfe von vielen engagierten Menschen ist im Laufe der letzten Jahre<br />
auch im Außenbereich der Schule ein Lebensraum entstanden, der vielfäl-<br />
tige Bewegungsmöglichkeiten zulässt und als Spiel- und Erfahrungsraum<br />
für Kinder motivierend ist.<br />
Die Einfachsporthalle ist inzwischen komplett renoviert worden und wird<br />
außer im Schulvormittag auch intensiv als Bewegungsraum von der OGS<br />
genutzt. Außerhalb der Schulzeiten steht sie Vereinen oder anderen<br />
Sportgruppen zu Verfügung.<br />
1.4 Der Schulhof<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Die Planung und Gestaltung unseres Schulhofes wurde mit dem Schulträ-<br />
ger, der Schulpflegschaft und einiger in <strong>Halle</strong> ansässigen Sponsoren sowie<br />
der Eigeninitiative der Schülerschaft der Linden<strong>schule</strong> im Sommer 2007<br />
realisiert.<br />
Schon zum damaligen Zeitpunkt waren die Schwerpunkte bei der Planung<br />
auf die Aspekte der Gesundheits-, Bewegungs- und Umwelterziehung aus-<br />
gerichtet. So entstanden verschiedene Spielangebote mit unterschiedli-<br />
chem Aktivitätsgrad, die in der Gestaltung mit möglichst naturnahen Ma-<br />
terialien realisiert wurden. Auch die Auswahl eines Großspielgerätes unter-<br />
lag dieser Option. Die gesamte Spielfläche wurde mit unbehandelten<br />
Baumstämmen eingefasst die gleichzeitig als Sitzgelegenheit dienen.<br />
Auf unserer Schulhoffläche befinden sich außer der schon erwähnten Klet-<br />
terspinne und dem Großspielgerät ein aus Findlingen zusammengesetztes<br />
„grünes Klassenzimmer“, ein Senkgarten, eine Wippe, ein Weidentipi und
Balancierstangen sowie ein Fußballplatz mit Toren und zwei kleinen Sitz-<br />
tribünen.<br />
1.5 Die Stundentafel<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Die Ausbildungsordnung für die Grund<strong>schule</strong> (AO-GS) sieht die unten ab-<br />
gebildete Stundentafel vor. Demnach haben die Kinder in der Eingangs-<br />
stufe 21 bis 23 Unterrichtsstunden in der Woche. Der Englischunterricht<br />
beginnt in der ersten Klasse erst im zweiten Schulhalbjahr. Im ersten<br />
Schulhalbjahr werden diese Stunden an unserer Schule zur individuellen<br />
Förderung der Basiskompetenzen genutzt.<br />
In den dritten und vierten Klassen sind 26 bzw. 27 Unterrichtsstunden pro<br />
Woche vorgesehen.<br />
Je nach personeller Besetzung der Schule und der Planung der individuel-<br />
len Förderung können die maximalen Unterrichtszeiten erfüllt werden.<br />
Stundentafel<br />
Gesamtunterrichtszeit in Wochenstunden für die<br />
Schuleingangsphase (SEP)<br />
1. Jahr 2. Jahr 3. Klasse 4. Klasse<br />
21 – 22 22 - 23 25 - 26 26 - 27<br />
davon<br />
Deutsch, Sachunterricht,<br />
Mathematik, Förderunterricht 12 14-15 15-16<br />
Kunst, Musik 3-4 4 4<br />
Englisch 2 2 2<br />
Religionslehre 2 2 2<br />
Sport / Schwimmen 3 3 3<br />
Der Sportunterricht beinhaltet auch Schwimmunterricht, der laut Lehrer-<br />
konferenzbeschluss ab dem Schuljahr 09/10 nur in der dritten Klasse er-
teilt wird. Die Kinder der dritten Klassen haben dann eine Sportstunde in<br />
der Turnhalle und zwei Stunden Schwimmunterricht im Lindenbad.<br />
1.6 Unterrichtszeiten an der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Der Unterricht an der Linden<strong>schule</strong> beginnt um 7.50 Uhr. Das erste Klin-<br />
gelzeichen ertönt schon um 7.45 Uhr. Zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr<br />
werden die Kinder auf dem Schulhof ab 7.30 Uhr beaufsichtigt.<br />
Die letzte Unterrichtsstunde endet um 13.10 Uhr.<br />
In der nachstehenden Tabelle sind die Unterrichts- und Pausenzeiten im<br />
Einzelnen angegeben.<br />
1.Stunde 7.50 Uhr – 8.35 Uhr<br />
Pause 8.35 Uhr – 8.40 Uhr<br />
2. Stunde 8.40 Uhr – 9.25 Uhr<br />
Hofpause 9.25 Uhr - 9.40 Uhr<br />
Frühstückspause 9.40 Uhr – 9.50 Uhr<br />
3. Stunde 9.50 Uhr – 10.35 Uhr<br />
Pause 10.35 Uhr – 10.40 Uhr<br />
4. Stunde 10.40 Uhr – 11.25 Uhr<br />
Hofpause 11.25 Uhr – 11.35 Uhr<br />
5. Stunde 11.35 Uhr – 12.20 Uhr<br />
Pause 12.20 Uhr – 12.25 Uhr<br />
6. Stunde 12.25 Uhr - 13.10 Uhr
2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 01.02.2012)<br />
Das Lehrerkollegium der Linden<strong>schule</strong> besteht aktuell aus 22 Kolleginnen<br />
und Kollegen. Zu Ihnen gehören:<br />
Frau Sena Bakir<br />
Frau Silke Brockmann<br />
Frau Monika Drewel<br />
Herr Maik Evers (Rektor)<br />
Frau Anja Holtmann<br />
Frau Astrid Jewanski-Bohnmann<br />
Frau Sigrid Kirchmann<br />
Frau Stefanie Kombrink<br />
Frau Antje Lechtermann<br />
Frau Regina Möller<br />
Frau Carola Nauke<br />
Frau Julia Nelke<br />
Frau Inke Schaar<br />
Frau Astrid Scheer-Berghäuser<br />
Frau Uta Schlüpmann<br />
Frau Anke Schwittay<br />
Frau Karin Steinke<br />
Frau Yvonne Steinkröger<br />
Frau Sonja Trüggelmann<br />
Frau Britta Voßhans (Konrektorin)<br />
Frau Stephanie Wittenberg<br />
Frau Anne Waltrup<br />
Darüber hinaus gehören zum Team der Linden<strong>schule</strong> alle Mitarbeiterinnen<br />
der OGS bzw. der Randstunde:
Frau Sabine Brenker<br />
Frau Irmgard Freitag<br />
Frau Annett Hirschmann<br />
Frau Anke Horstmann (Leitung OGS / Frühbetreuung)<br />
Frau Irmtraud Husmann<br />
Frau Christa Kampmann<br />
Frau Margit Neumann<br />
Frau Marietta Niebuhr<br />
Frau Gerlinde Scholz<br />
Frau Heike Tesche (stellvertretende Leitung OGS / Frühbetreuung)<br />
Frau Anja Trias<br />
Frau Claudia Wienke unterstützt unsere Arbeit als Schulsozialarbeiterin.<br />
Das Sekretariat wird von Frau Gabriele Echterhoff betreut.<br />
Herr Ulrich Wagner kümmert sich als Hausmeister um alle anfallenden<br />
technischen Belange.<br />
Darüber hinaus betreut er auch unsere Reinigungskräfte:<br />
Frau Irina Meyer<br />
Frau Rosemarie Mrkwaskora<br />
Frau Olga Schiebert<br />
Neben diesen ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gibt es viele<br />
weitere Menschen, die sich in unser Schulleben einbringen und es berei-<br />
chern, dazu gehören neben unseren Eltern auch AG-Leiter, Praktikanten<br />
u.v.a.m..
3 Fördern, Fordern, Beurteilen<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist die zentra-<br />
le Leitidee des seit August 2006 gültigen Schulgesetzes in NRW. Bereits in<br />
Paragraf 1 Absatz 1 heißt es: „Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung - Jeder<br />
junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schuli-<br />
sche Bildung, Erziehung und individuelle Förderung.“ Damit ist die Verpflichtung für unsere<br />
Schule verbunden, alle Schüler unabhängig von ihrer ethnischen und sozi-<br />
alen Herkunft gleichermaßen zu fördern, sowohl besondere Begabungen<br />
als auch Lernschwierigkeiten in den Blick zu nehmen, als auch die beson-<br />
deren Bedürfnisse von Mädchen und Jungen.<br />
An der Linden<strong>schule</strong> sind verschiedene Förderkonzepte (siehe Konzepte)<br />
zu ausgewählten Lernbereichen entwickelt worden, die versuchen, die<br />
oben genannten Aspekte zu berücksichtigen.<br />
Fördern, Fordern und Beurteilen stehen in unmittelbarem Zusammenhang.<br />
Dieser Zusammenhang wird in den <strong>schule</strong>igenen Arbeitsplänen (siehe An-<br />
hang) und in den Absprachen deutlich, auf die sich das Kollegium, auf der<br />
Grundlage der gültigen Richtlinien und Lehrpläne und der zuständigen Ge-<br />
setze, geeinigt hat. Hier sind sowohl die Kompetenzerwartungen in den<br />
verschiedenen Lernbereichen, als auch Formen der Leistungsfeststellung<br />
(siehe Leistungskonzept) festgelegt. Weiterhin geben die <strong>schule</strong>igenen<br />
Textbausteine zum Zeugnisschreiben (siehe Anhang) Aufschluss darüber,<br />
wie die erreichten Kompetenzen in eine Zensur einfließen, d.h. zu beurtei-<br />
len sind. Die Überarbeitung dieses Konzeptes mit den Schwerpunkten<br />
Vergleichbarkeit, Dokumentation und Notenfindung sind Arbeitsschwer-<br />
punkte der Schule im Schuljahr 2010/2011.<br />
Der Dreiklang von Fördern, Fordern, Beurteilen muss demnach zwangsläu-<br />
fig in einer Evaluationsschleife enden, d.h. die entwickelten Textbausteine<br />
zum Zeugnisschreiben sind gleichzeitig Grundlage und Maßstab zum Er-<br />
stellen von individuellen Förderplänen (siehe Anhang) und für Beratungs-<br />
situationen mit Schülern und Eltern.
3.1 Das Förderkonzept der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 25.01.2012)<br />
Das Förderkonzept der Linden<strong>schule</strong> ist geprägt aus einer Mischung inne-<br />
rer und äußerer Differenzierungsmaßnahmen. Die fachliche Kompetenz,<br />
Teamabsprachen und Fortbildungen der Kolleginnen und Kollegen sorgen<br />
für Qualität und Differenzierung im Klassenverband.<br />
Ergänzend dazu prägen und unterstützen auch verschiedene Organisati-<br />
onsformen der äußeren Differenzierung den Unterricht. Die unten be-<br />
schriebene Organisationsform des Förderbandes ist nur eine davon, die<br />
allerdings ein Kernstück der Fördersituation in der Schuleingangsphase<br />
(SEP) ausmacht.<br />
Je nach Erfordernissen und personellen Ressourcen, gibt es aber auch<br />
Doppelbesetzungen im Unterricht, sowie Kleinstgruppenarbeit oder auch<br />
Einzelförderung.<br />
Die festgestellten Förderbedarfe der einzelnen Kinder werden regelmäßig<br />
in Förderplänen (siehe Anhang) beschrieben. Auf dieser Basis werden<br />
dann individuelle Fördermaßnahmen überlegt, die in den beschriebenen<br />
Fördersituationen münden.<br />
Förderung hört natürlich nach der Schuleingangsphase (SEP) nicht auf,<br />
sondern wird auch in Klasse 3 und 4 weitergeführt.<br />
In diesen Jahrgängen gibt es keine Förderbänder wie in der SEP, sondern<br />
der Förderunterricht findet im Klassenverband statt, bzw. in jahrgangsbe-<br />
zogenen Fördergruppen zu bestimmten Förderschwerpunkten, wie LRS<br />
oder Sprachkompetenzerweiterung für Kinder u.a. mit Migrationshinter-<br />
grund.<br />
Seit dem Schuljahr 2010/2011 hat die Lehrerkonferenz beschlossen, die<br />
ausgewiesenen Förderstunden als Teamstunden im Regelunterricht zu<br />
nutzen, um Förderung individueller gestalten zu können.<br />
Als zusätzliche Maßnahme zur Förderung rechenschwacher Kinder der 4.<br />
Klassen sind zur Zeit zwei Unterrichtsstunden fest im Stundenplan veran-
kert. Sie werden unterrichtet nach einem Konzept von Herrn Joseph Ken-<br />
nedy (www.crealern.de), einem Pädagogen aus Tuttlingen, der hierzu ein<br />
erfolgversprechendes Modell entworfen hat. Durch die Unterstützung des<br />
Schulvereins konnten hier Materialien angeschafft und das Modell erprobt<br />
werden. Ab Februar 2012 wird dieser Kurs auch in der SEP erprobt.<br />
Diagnose – Förderplan - Evaluation<br />
Unmittelbar nach der Schulanmeldung werden alle künftigen Schülerinnen<br />
und Schüler der Linden<strong>schule</strong> zu einem Eingangstest vor Schulbeginn ein-<br />
geladen. Dieser Eingangstest wird im Nachmittagsbereich von allen Lehr-<br />
kräften der Linden<strong>schule</strong> durchgeführt und endet in einer Beratung der<br />
Eltern über mögliche vorschulische Förderungen. Die Ergebnisse werden<br />
den künftigen Klassenlehrerinnen zur Verfügung gestellt, um sich auf die<br />
kommende Klasse vorbereiten zu können.<br />
In den ersten Schulwochen (spätestens bis zu den Herbstferien) werden<br />
die fachlichen (Deutsch, Mathematik), kognitiven und motorischen Kom-<br />
petenzen, sowie die Wahrnehmung und das Arbeitsverhalten der Kinder<br />
beobachtet oder durch Testverfahren festgehalten.<br />
Anhand dieser Ergebnisse und den Beobachtungen der unterrichtenden<br />
Kolleginnen und Kollegen werden für die Kinder Förderschwerpunkte und -<br />
inhalte überlegt und geeignete Fördermaßnahmen der inneren oder äuße-<br />
ren Differenzierung festgelegt.<br />
Regelmäßig überprüfen die Lehrkräfte die Effektivität und Durchführbar-<br />
keit der geplanten Maßnahmen und verändern sie bei Bedarf.<br />
Schuleingangsphase - Schwerpunkt Förderband<br />
In den ersten Schulwochen werden die Kinder im Klassenverband von den<br />
entsprechenden Fachlehrerinnen und Teamkolleginnen beobachtet und ihr<br />
Förderbedarf wird festgestellt. Da das Förderband aus fünf bis sechs Leh-<br />
rerinnen besteht, gehen zwei bis drei Lehrerinnen wechselweise als Team-
partner mit in die Klassen, um zu beobachten und um Einzel- oder Grup-<br />
pentestungen durchzuführen und zu unterstützen.<br />
Kurz vor den Herbstferien werden dann – hauptverantwortlich von den<br />
entsprechenden Fachlehrerinnen – die Fördergruppen festgelegt.<br />
In der SEP werden dazu u.a. verbindliche Testungen geschrieben. Im Fach<br />
Deutsch sind die die HSP (Hamburger-Schreib-Probe) umgewandelt auch<br />
auf unserer ReLv-Konzept (siehe 6.1 Lese-Rechtschreibkonzept), und die<br />
Online-Testung www.testen-und-foerdern.de des Klett Verlages, in denen<br />
erste Fähigkeiten (z.B. Anlaute hören, Wörter lesen, Schwingen, …) klas-<br />
senübergreifend gleich abgefragt werden. Im Fach Mathematik wird der<br />
Eingangstest zu unserem Mathelehrwerk Primo 1 durchgeführt.<br />
Wahlweise stehen den Förderbandgruppen drei Organisationsformen zur<br />
Verfügung. Welche Organisationsform gewählt wird, wird in einer der ers-<br />
ten Teamsitzungen der beteiligten Lehrerinnen festgelegt.<br />
Organisationsform 1:<br />
Es gibt drei „leistungsschwache“ Gruppen, eine mittelstarke und eine star-<br />
ke Gruppe. Die „leistungsschwachen“ Gruppen bestehen jeweils nur aus<br />
den Kindern einer Klasse und werden vom entsprechenden Fachlehrer un-<br />
terrichtet. Die beiden zusätzlichen Lehrer übernehmen die mittelstarke<br />
und starke Gruppe.<br />
Organisationsform 2:<br />
Die fünf Gruppen werden „hierarchisch“ von schwach nach stark klassen-<br />
übergreifend besetzt. Die Förderbandlehrer einigen sich, wer welche<br />
Gruppe übernimmt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die schwächste<br />
Gruppe möglichst klein gehalten wird.<br />
Organisationsform 3:<br />
Es gibt entsprechend der Klassen drei Stammgruppen, die vom Fach- bzw.<br />
Klassenlehrer unterrichtet werden. Die Spitzen der Klassen werden dann<br />
in einer schwächeren Aufbaugruppe zur Grundlagenlegung und in einer
esonders starken Gruppe zur Ausweitung der vorhandenen Kompetenzen<br />
zusammengefasst. Diese Form würde beispielsweise auch den Ausfall ei-<br />
nes Förderbandlehrers erleichtern.<br />
Inhaltliche Arbeit<br />
Schwerpunkte im Bereich Deutsch SEP<br />
Umgang mit der Anlauttabelle, Orientierung an der Anlauttabelle, Anlaute<br />
hören und zuordnen, Lautstellung, Wörter schreiben und schwingen, Sil-<br />
benverbindungen und Wörter lesen, Schwingen, sinnentnehmendes Lesen<br />
/ Lese-Mal-Blätter, aktuelle Grammatikthemen, Ganzschriften, Schreiben<br />
von Texten<br />
Schwerpunkte im Bereich Mathe SEP<br />
Zahlen-Mengen-Zuordnung bis 10, Zerlegen von Zahlen bis 10, Die Zah-<br />
lenreihe bis 10, Addition, Subtraktion und Ergänzen im Zahlenraum bis 10<br />
/ bis 20, Zahlenraumerweiterung (Hundertertafel, Zahlenstrahl), Addition<br />
und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 (und darüber hinaus), Multiplika-<br />
tion (Kleines Einmaleins), Division, Sachaufgaben, Knobelaufgaben<br />
Zur Organisation und Absprache werden innerhalb der Förderband-Teams<br />
werden regelmäßige Teambesprechungen angesetzt. Die Klassenlehrerin-<br />
nen sollten gemeinsam verbindliche Techniken absprechen z.B. Abschreib-<br />
technik (auf die Rückseite), Schwingtechnik (rot/blau) und diese den<br />
FöBa-Lehrerinnen mitteilen und erstellen Listen der Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer für die FöBa-Lehrerinnen. Innerhalb der Gruppen soll der<br />
Übergang zwischen den Gruppen fließend vonstattengehen. (Rücksprache<br />
FöBa-Lehrerinnen und Klassenleitung).<br />
Für das Förderband Deutsch und Mathe hat jedes Kind eine FöBa-Mappe<br />
(beide schwarz).
Um eine Konstanz des Förderbandes zu ermöglichen, soll im Vertretungs-<br />
fall die betroffene Förderbandgruppe auf die verbliebenen Förderband-<br />
gruppen aufgeteilt werden (siehe 9.1 Vertretungskonzept).<br />
3.2 Leistungsbewertung<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
(letzte Änderung:13.01.2012)<br />
Schülerinnen und Schüler an schulische Leistungsanforderungen und den<br />
produktiven Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit heranzuführen,<br />
ist eine wesentliche Aufgabe der Grund<strong>schule</strong>. Dabei ist sie einem päda-<br />
gogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das Leistungsanforderungen<br />
mit individueller Förderung verbindet. Für den Unterricht bedeutet dies,<br />
Leistungen nicht nur zu fordern, sondern sie vor allem auch zu ermögli-<br />
chen und zu fördern. Deshalb geht der Unterricht stets von den individuel-<br />
len Voraussetzungen der Kinder aus und leitet sie dazu an ihre Leistungs-<br />
fähigkeit zu erproben und weiter zu entwickeln.<br />
Grundlage der Leistungsbewertung sind die Festlegungen in der Verord-<br />
nung über den Ausbildungsgang in der Grund<strong>schule</strong> (AO-GS). Die Leis-<br />
tungsbewertung orientiert sich dabei grundsätzlich an den Kompetenzer-<br />
wartungen der Richtlinien und Lehrpläne und am erteilten Unterricht. Sie<br />
berücksichtigt auch die individuelle Lernentwicklung der einzelnen Kinder.<br />
In der Grund<strong>schule</strong> werden die Kinder auf die Beurteilung ihrer Leistungen<br />
allmählich vorbereitet. Dies beginnt in Klasse 1 und 2 (SEP) mit kurzen<br />
schriftlichen Übungen, die in Klasse 2 benotet werden können. In Klasse 3<br />
und 4 werden nur in den Fächern Deutsch und Mathematik schriftliche<br />
Klassenarbeiten geschrieben die benotet werden. Ab 2011/2012 werden<br />
(unbenotete) Klassenarbeiten auch im Fach Englisch. Die Leistungsfest-<br />
stellung misst sich an den Kompetenzerwartungen, die in den Richtlinien<br />
und Lehrplänen für die Grund<strong>schule</strong> festgelegt sind. Die Leistungsbewer-<br />
tung berücksichtigt auch die individuelle Lernentwicklung des einzelnen<br />
Kindes und ist die Grundlage für die weitere Förderung. Die Anzahl der
Arbeiten ist gesetzlich nicht festgelegt. Hier hat jedes Kollegium Gestal-<br />
tungsraum. Schriftliche Arbeiten erfassen im Übrigen immer nur einen<br />
Ausschnitt dessen, was Kinder leisten. Deshalb werden für das Zeugnis<br />
auch alle sonstigen Leistungen im jeweiligen Fach berücksichtigt.<br />
Um die Förderbedarfe und den Leistungsstand der Schülerinnen und Schü-<br />
ler transparent zu machen, werden in der Eingangsstufe für jedes Kind<br />
Förderpläne erstellt, in dem die erbrachten Leistungen und Fördermöglich-<br />
keiten sowie Absprachen mit Eltern, Mitarbeitern und Schülern notiert<br />
sind. Sie gelten als Gesprächsgrundlage für Elternsprechtage und am Ende<br />
des 1. und 2. Schuljahres als Basis zur Zeugniserstellung.<br />
Für die Klasse 1-3 werden zur Zeugniserstellung Textbausteine (siehe An-<br />
hang) benutzt, die die Vergleichbarkeit von Leistungen ermöglichen und<br />
für Transparenz hinsichtlich der verschiedenen grundlegenden Anforde-<br />
rungen und Kompetenzerwartungen sorgen.<br />
Beobachtete überfachliche Kompetenzen wie Arbeitstechniken und Sozial-<br />
kompetenz gehören ebenfalls zum Leistungsprofil jeden Schülers.<br />
Um jedes Kind noch genauer in Blick nehmen zu können und Leistungs-<br />
bewertung transparenter und vergleichbarer zu machen wird angestrebt,<br />
zum Abschluss jeder Unterrichtseinheit im Sachunterricht oder in den Ne-<br />
benfächern einen Leistungsfeststellungsbogen zu erstellen, in dem alle er-<br />
reichten Kompetenzerwartungen festgehalten und bewertet werden kön-<br />
nen (siehe Anhang).<br />
Grundlage dieser Bögen sind die vorher von der Fach- und Lehrerkonfe-<br />
renz festgelegten Kompetenzerwartungen am Ende der Unterrichtseinheit<br />
(siehe Arbeitspläne).<br />
Besonders in den 3. und 4. Klassen sind diese Leistungsfeststellungsbögen<br />
sinnvoll, da sie auch zu Eltern- und / oder Schülergesprächen herangezo-<br />
gen werden können, ähnlich wie die Förderpläne im 1. und 2. Schuljahr.
Anmerkung:<br />
Die Überarbeitung des Leistungskonzeptes / der Leistungsbewertung auf<br />
Grundlage der Kompetenzerwartungen der neuen Lehrpläne und Richtli-<br />
nien, sowie eine einheitliche Dokumentation für die Lehrerinnen, Eltern<br />
und Schüler ist ein Entwicklungsschwerpunkt der Linden<strong>schule</strong> für die<br />
Schuljahre 2010/2011 und 2011/2012. Daraus resultierend sind in dieser<br />
Zeit Leistungsbewertungsbögen für alle Nebenfächer entstanden. Seit De-<br />
zember 2012 befinden sich diese Bögen in einer ersten Erprobungsphase.<br />
Nach einer ersten Evaluation im Mai 2012 werden sie in der Schulpflegs-<br />
chaft vorgestellt und im Schuljahr 2012/13 erprobt um dann nach einer<br />
letzten Evaluation im Schulprogramm festgeschrieben werden zu können.<br />
Das Lehrerkollegium der Linden<strong>schule</strong> hat sich im Bereich der Leistungs-<br />
bewertung auf gemeinsame verpflichtende Leistungskontrollen in allen Fä-<br />
chern geeinigt. Darüber hinaus ist es den Jahrgangsteams freigestellt,<br />
weitere Maßnahmen zur Leistungsbewertung abzusprechen. Abgesproche-<br />
ne Lernzielkontrollen werden aus Gründen der Vergleichbarkeit in allen<br />
Klassen eines Jahrgangs gleich geschrieben. Von jeder verpflichtenden Ar-<br />
beit werden drei Arbeiten bei der Schulleitung abgegeben (jeweils die bes-<br />
te und schwächste Arbeit, sowie eine Arbeit, die dem Leistungsdurch-<br />
schnitt der Klasse entspricht). Eine Blankovorlage einer jeden Arbeit wird<br />
zur weiteren Verwendung im Kopierraum in vorbereitete Ordner zur weite-<br />
ren Verwendung abgeheftet.<br />
Die Bewertung schriftlicher Arbeiten orientiert sich an einer gemeinsamen,<br />
im Kollegium verabschiedeten Prozentrangliste. Nach Absprache im Jahr-<br />
gang ist es möglich, hiervon leicht abzuweichen. Grundsätzlich gilt aber<br />
für alle Bewertungen, dass sie innerhalb eines Jahrgangs abgesprochen<br />
und gleich sein müssen.<br />
Anmerkung: Nur in den Hauptfächern Deutsch und Mathe dürfen schriftli-<br />
che Arbeiten benotet werden. Unter kurzen schriftlichen Übungen in allen
Fächern sind entsprechend nur Punktangaben, kurze Kommentare oder<br />
auch gar keine Anmerkungen zu finden.<br />
4 Pädagogische Konzepte<br />
(letzte Änderung: 19.01.2012)<br />
Wie im Vorwort bereits erwähnt sind unsere Konzepte hier nicht in aller<br />
Ausführlichkeit aufgeführt, sondern nur namentlich erwähnt. Für genauere<br />
Informationen wenden Sie sich bitte an die Linden<strong>schule</strong>, das Lehrerkolle-<br />
gium oder an entsprechende MitarbeiterInnen. Ausführliche Schulpro-<br />
gramme mit Konzeptbeschreibungen sind im Sekretariat der Linden<strong>schule</strong><br />
einsehbar.<br />
Alle hier aufgeführten pädagogischen Konzepte sind gleichwertig, d.h. die<br />
Reihenfolge sagt nichts über ihre Wertigkeit aus.<br />
� Lese-Rechtschreibkonzept<br />
� Leseförderkonzept<br />
� Konzept zur Förderung der Sprachkompetenz<br />
� Medienkonzept<br />
� Förderung besonderer Begabungen<br />
� Teamarbeit<br />
� Vertretungskonzept<br />
� Ausbildung der LAA<br />
� Fortbildungskonzept der Linden<strong>schule</strong><br />
� Wettbewerbe<br />
� AG zum Sozialen Lernen – Deeskalationstraining<br />
� Schulsozialarbeit<br />
� Theaterpädagogisches Präventionsprogramm – Mein Körper gehört<br />
mir<br />
� u.a.m.
5 Anfangsunterricht in der Schuleingangsphase<br />
(SEP)<br />
(letzte Änderung: 25.1.2012)<br />
Der Anfangsunterricht in der Linden<strong>schule</strong> folgt der Idee eines integrativen<br />
und handlungsorientierten Unterrichts, der von Anfang an differenziert<br />
und individualisiert.<br />
Die Fächer Deutsch und Mathematik sind Schwerpunkte des Anfangsunter-<br />
richts, in denen u. a. wichtige Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und<br />
Rechnen (Mathematisieren) vermittelt werden. Alles Lernen benötigt die<br />
Sprache, so dass der Schriftspracherwerb, bzw. das Fach Deutsch einen<br />
besonderen Stellenwert hat und einer besonderen Beachtung bedarf.<br />
Der Unterricht ist von Anfang an nach bestimmten Ordnungs- bzw.<br />
Strukturmerkmalen organisiert. Sie umfassen im Wesentlichen folgende<br />
Aspekte:<br />
Zu 1:<br />
1. Regeln und Rituale<br />
2. Klassenraumgestaltung<br />
3. Arbeitstechniken<br />
4. Arbeitsformen / offene Unterrichtsformen<br />
5. Unterrichtsorganisation / Zeitplan /Rhythmus<br />
6. Dokumentation von Lernständen (Diagnostik)<br />
7. Individuelle Förderung<br />
Regeln und Rituale sind Grundpfeiler des menschlichen Zusammenle-<br />
bens und sind insofern unerlässlich zur Schaffung einer positiven Lernat-<br />
mosphäre als Grundlage für erfolgreiches Lernen. In jeder Klasse werden<br />
deshalb Absprachen getroffen über<br />
� Dienstplan (für die Übernahme von kleineren Aufgaben durch die<br />
Kinder)<br />
� Gesprächsregeln
� Klassenregeln<br />
� Schulregeln<br />
� Stundenplan als Tagesrhythmus<br />
Außerdem gibt es immer wiederkehrende Rituale, die den Schulalltag<br />
strukturieren. Dazu gehören:<br />
Zu 2:<br />
� Begrüßungsritual<br />
� Morgenkreis/Gesprächskreis<br />
� Feste/Feiern, Geburtstagsfeiern<br />
� Rituale zur Stressbewältigung /Stille- /Konzentrationsübungen<br />
Die Klassenraumgestaltung trägt als erstes sichtbares Zeichen wesent-<br />
lich zur Lernatmosphäre bei, in der ein positives Lernklima entstehen<br />
kann. Die individuelle Ausgestaltung sollte immer Bezug zum aktuellen<br />
Unterrichtsgeschehen haben, wenn möglich auch durch die Präsentation<br />
von Schülerarbeiten.<br />
Als Lernhilfe wird eine großformatige Anlauttabelle eingesetzt. Andere Vi-<br />
sualisierungs- /Präsentationsmöglichkeiten bestehen an den Pinnwänden,<br />
bzw. den Klemmleisten. Jeder Klassenraum ist mit verschiedenen Ablage-<br />
kästen und -fächern für jedes Kind ausgestattet. Diese sind in Regalen<br />
aufbewahrt, die ausreichend Platz bieten zur Präsentation von Unter-<br />
richtsmaterial, z.B. auch als Themenregale. In den ersten Klassen haben<br />
sich Buchstabentische bewährt. Wenn möglich werden Leseecken einge-<br />
richtet. Ein Holzkalender bietet den Kindern die Möglichkeit Wochentag,<br />
Monat, Datum und Jahreszeit spielerisch zu erfassen.<br />
In jedem Klassenraum ist ein „Tisch des Nachdenkens“ eingerichtet (Ford-<br />
Methode), was zum Erziehungskonzept der Schule gehört (siehe Erzie-<br />
hungskonzept).<br />
Eine klare Strukturierung der Unterrichtsmaterialien sowohl für jedes Kind<br />
als auch der <strong>schule</strong>igenen Materialien ermöglicht das Heranführen an selb-<br />
ständiges, selbstorganisiertes Lernen.
Das Präsentieren von Schülerarbeiten ist auf den Pinnwänden möglich und<br />
ist ein Zeichen der Wertschätzung der Leistungen der Kinder.<br />
Zu 3:<br />
Arbeitstechniken<br />
Silbenschwingen und -gehen sind grundlegende Techniken beim Schrift-<br />
spracherwerb, der damit gleichzeitig von Anfang an Rechtschreibunterricht<br />
ist (ReLv). Dazu gehört ebenso das Abhören von Lauten / Silben / Silben-<br />
königen.<br />
Kneten und Fühlen von Buchstaben/Zahlen verbindet verschiedene Lern-<br />
wege miteinander, ebenso das Schneiden, Falten und Kleben. Markieren<br />
und Notieren, sowie Abheften und Ablegen sind Grundfertigkeiten im Be-<br />
reich des selbständigen Arbeitens.<br />
Das Führen des Aufgaben- und/oder Mitteilungsheftes ist auch ein Schritt<br />
in das eigenverantwortliche Handeln.<br />
Zu 4:<br />
Arbeitsformen / Offene Unterrichtsformen<br />
Neben dem unvermeidbaren und auch sinnvollen Frontalunterricht, ist der<br />
Unterricht durch Einzel-/Partner- und Gruppenarbeit gestaltet.<br />
Der Tagesplan/Wochenplan sorgt für Transparenz und fördert u. a. das<br />
selbstorganisierte Lernen. Stationslauf und Lernwerkstatt als weitere of-<br />
fene Unterrichtsformen erfordern wie die anderen auch methodenimma-<br />
nente verschiedene Kontrollformen. Ausstellungen und Vorträge sind u.a.<br />
Formen der Evaluation von Schülerarbeiten. Der Einsatz von Freiarbeits-<br />
material ist zur individuellen Förderung unabdingbar. Außerdem ist der<br />
Schulvormittag geprägt durch Singen und Bewegen, als Formen der Ent-<br />
spannung bzw. Konzentrationsübung und Ganzkörpererfahrung. Zu den<br />
Formen der mündlichen Kommunikation gehören freies Erzählen, aktives
Zuhören, Vorlesen, lautes Vorlesen durch Schüler, sowie sich im Kreisge-<br />
spräch angemessen zu äußern.<br />
Zu 5:<br />
Unterrichtsorganisation / Zeitplan / Rhythmus<br />
Hinsichtlich der Unterrichtsorganisation/ Strukturierung des Schulall-<br />
tags ist jeder Klassenlehrer selbstverantwortlich dies zeitlich in Absprache<br />
mit seiner Klasse zu vereinbaren (Terminierung von Gesprächskreisen,<br />
Klassenrat etc.).<br />
Die Ritualisierung der Woche als wichtiges Strukturmerkmal ist Kon-<br />
sens und wird im Jahrgangsteam abgesprochen.<br />
Zu 6:<br />
Zur Dokumentation von Lernständen (Diagnostik) werden u.a. fol-<br />
gende Möglichkeiten genutzt:<br />
Deutsch<br />
Mathe<br />
Englisch<br />
- Schuleingangstest Klett (www.testen-und-foerdern.de)<br />
- Lernbeobachtungen nach Karibu<br />
- HSP mit ReLv-Auswertung � 10 Minuten (1 bzw. 2 mal jährlich)<br />
- Stolperwörterlesetest (ab Ende 1. Schuljahr)<br />
- Tagebuch<br />
- Schuleingangstest Klett (www.testen-und-foerdern.de)<br />
- LZK nach Primo � 30 bis 60 Minuten<br />
- Portfolio – Seiten „sunshine“
- Leistungsermittlung (LZK) „sunshine“<br />
Sachunterricht<br />
- Material<br />
- Mappenführung<br />
- mündliche Mitarbeit<br />
- Lernbeobachtungen zu erarbeiteten Themen<br />
- Gruppenpräsentation mit Hilfe von Plakaten<br />
- Planung, Durchführung und Reflexion von Experimenten<br />
Für jedes Kind wird entsprechend seiner Lernentwicklung ein Förderplan<br />
erstellt (siehe Anhang).<br />
Zu 7:<br />
Individuelle Förderung geschieht auf vielfältige Weise (siehe pädagogi-<br />
sche Konzepte):<br />
� Qualitative und quantitative Differenzierung im Klassenverband<br />
� Arbeit mit den verschiedenen PC-Lernprogrammen<br />
� Schülerbücherei zur Leseförderung<br />
� Leseeltern<br />
� Förderband<br />
� Teamsituationen (Doppelbesetzung)<br />
� Kleingruppenförderung<br />
� Einzelförderung<br />
� Teilnahme am Unterricht höherer Klassen<br />
Beratung / Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Bei den zweimal im Jahr angebotenen Elternsprechzeiten sind die für je-<br />
des Kind erstellten Förderpläne die Grundlage der Beratung über den<br />
Lern- und Leistungsstand des Kindes. Außerdem haben die Eltern jederzeit
die Möglichkeit die individuelle Sprechzeit der einzelnen KollegInnen wahr-<br />
zunehmen. Bei Bedarf werden Beratungsgespräche dokumentiert.<br />
Elternarbeit hat in der Linden<strong>schule</strong> einen hohen Stellenwert. Das beson-<br />
dere Engagement der Eltern im Schullalltag allgemein und auch in speziel-<br />
len Bereichen ist aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken (siehe<br />
auch Elternarbeit/Schulverein). Dazu gehört auch, dass sich Eltern in das<br />
Unterrichtsgeschehen aktiv mit einbringen. Besonders in den ersten bei-<br />
den Klassen hat sich das Modell der „Leseeltern“ sehr bewährt.<br />
Der Anfangsunterricht in Deutsch orientiert sich im Wesentlichen am<br />
Spracherfahrungsansatz. Um der Heterogenität der Kinder bezüglich ihrer<br />
Lernvoraussetzungen Rechnung zu tragen, ist es notwendig so individuell<br />
zu arbeiten, dass kein Kind über- oder unterfordert wird. Dabei ist zu be-<br />
rücksichtigen, dass Kinder unterschiedliche Lernformen brauchen und ver-<br />
schieden große Lernfortschritte machen. Deshalb sollten die Unterrichts-<br />
methoden der jeweiligen Klassensituation angepasst sein. Daraus ergeben<br />
sich folgende Konsequenzen zum Aufbau einer Schreib-Lesekultur:<br />
1. Schreiben entwickeln<br />
Unterrichtstexte, Texte zum Klassenleben, angeleitetes Schreiben,<br />
freies Schreiben<br />
2. Anregendes Lernumfeld schaffen<br />
Schreibgewohnheiten einführen<br />
Raum-Zeit-Material-Anregungen geben<br />
3. Methoden selbständigen Lernens anbahnen<br />
Texte planen, entwerfen, sich beraten<br />
Schreibhilfen beschaffen und nutzen<br />
Texte überarbeiten<br />
4. Grundlegende fachliche Kompetenzen vermitteln<br />
Schreibziel, Adressierung,
Planungsmöglichkeiten, Wortschatz und Wortwahl,<br />
Satzentwicklung<br />
Textberatung, Textüberarbeitung<br />
Diese Forderungen werden u.a. wie folgt mit Inhalt gefüllt:<br />
Als Medium zum Schriftspracherwerb erhalten die Schüler Karibu-Fibel,<br />
Arbeitshefte und Anlauttabelle. Zunächst werden die Vokale eingeführt.<br />
Gleichzeitig wird die Handhabung der Anlauttabelle mit spielerischen<br />
Übungen trainiert. Die Kinder lernen parallel dazu das Silbenschwingen<br />
nach der ReLv-Methode. Nach und nach versuchen die Schüler mit der An-<br />
lauttabelle für sie wichtige Wörter zu schreiben und zu lesen. Mit Hilfe von<br />
Fibel und Arbeitsheften werden die restlichen Buchstaben und erste Recht-<br />
schreibregeln erarbeitet. Buchstabenformen, Schreibrichtung und das<br />
Schreiben in einer Lineatur werden geübt. Erste Schreibversuche z. B. zu<br />
vorgelesenen Geschichten oder zu gemeinsamen Aktivitäten halten die<br />
Schüler in einem Geschichtenheft, im Tagebuch oder in anderer Form fest.<br />
Sie werden so an die kreative Auseinandersetzung mit Texten herange-<br />
führt.<br />
Zu den wichtigsten Methoden/Medien im Anfangsunterricht Deutsch ge-<br />
hören:<br />
� Abschreiben<br />
� Selbstdiktat<br />
� Nachspuren<br />
� Tagebuch schreiben<br />
� Freies Schreiben<br />
� Raketenlesen<br />
� Lesetagebuch schreiben<br />
� Arbeit mit der Anlauttabelle<br />
� ReLv als Rechtschreibmethode von Anfang an<br />
� Arbeit mit Anlautbildern<br />
� Verschiedene Fibeln als Lesestoff
� Kinderliteratur<br />
� Ganzschriften<br />
� Lese-Malblätter<br />
� Logico<br />
� Arbeit am PC („Lernwerkstatt“, „Antolin“ und andere Lernprogram-<br />
me)<br />
Auf der Grundlage des Vier-Säulen-Modells von Hans Brüggelmann verfol-<br />
gen wir die Verbindung der Elemente:<br />
1. Systematisches Einführen von Schriftelementen und Leseverfah-<br />
ren<br />
2. freies Schreiben eigener Texte<br />
3. Aufbau und der Sicherung eines Grundwortschatzes<br />
4. gemeinsames (Vor-) Lesen von Kinderliteratur.<br />
Alle vier Säulen basieren auf einem gemeinsamen Erlebnisrahmen, der<br />
geprägt ist durch gemeinsame Projekte, z. B.:<br />
� Ich/Du<br />
� Kinderliteratur<br />
� gemeinsame Erlebnisse: gemeinsame Ausflüge (z.B. in den Tierpark<br />
Olderdissen)<br />
� Kindertheater<br />
� Aufgreifen spezieller Kinderinteressen…<br />
Die Minimalanforderungen Ende Klasse 2 sind in den <strong>schule</strong>igenen Ar-<br />
beitsplänen (siehe Anhang) dokumentiert.<br />
Der Anfangsunterricht Mathematik orientiert sich analog zum Schrift-<br />
spracherwerbskonzept (Spracherfahrungsansatz) an den Lernvorausset-<br />
zungen, dem Vorwissen, welches die Kinder mitbringen. Dies erfordert im
Bereich Mathematik ebenfalls eine Offenheit in der Methodik, die von Prof.<br />
Christoph Selter in der „Blume“ – Prinzipien für den Mathematikunterricht<br />
wie folgt dargestellt wird:<br />
Das zentrale Anliegen/Ziel ist das Nutzen von Eigenproduktionen, dazu<br />
gehört:<br />
1. Aufgaben erfinden<br />
2. Aufgaben mit eigenen Strategien lösen<br />
3. Auffälligkeiten beschreiben und begründen<br />
4. Über den Lehr-/Lernprozess schreiben<br />
Voraussetzung für dieses Ziel ist die Beachtung des Schülerwissens<br />
und die Anbahnung der fortschreitenden Mathematisierung.<br />
Fortschreitende Mathematisierung bedeutet fortschreitende Schematisie-<br />
rung, dazu gehört:<br />
1. “Ganzheitliche“ Behandlung, d.h. Auseinandersetzung mit Kom-<br />
plexität<br />
2. Durchgehende Nutzung von Aufgaben mit Realitätsbezug (Brücke<br />
zwischen Schüler und Mathematik)<br />
3. Schüler entwickeln zunehmend effizientere und elegantere Re-<br />
chenwege<br />
4. Lehrer orientiert und regt an (zu Reflexion & Kommunikati-<br />
on/Kooperation)<br />
Entdeckendes Lernen ist ein Unterrichtsprinzip, welches sich durch<br />
alle Fachbereiche zieht und die Neugier und Motivation der SchülerInnen<br />
unterstützt.<br />
Üben ist ein unerlässliches Element, da nur so Wissenselemente oder Fer-<br />
tigkeiten angewandt und gefestigt oder auch automatisiert werden kön-<br />
nen. Dabei kann man übend entdecken oder auch entdeckend üben. Der<br />
Grad der Strukturierung der Übungsaufgaben ist entscheidend für die Ver-<br />
innerlichung der Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Die Ordnungs- und Strukturmerkmale des Anfangsunterrichts in Ma-<br />
thematik decken sich in vielen Teilen mit denen im Deutschunterricht,<br />
deshalb sind an dieser Stelle nur die fachspezifischen Besonderheiten er-<br />
wähnt.<br />
Zu den wichtigsten Methoden /Medien gehören:<br />
� Spielerischer Umgang mit Umweltmaterialien<br />
� Rollenspiele/Planspiele<br />
� Eigenproduktionen<br />
� Arbeitsblätter<br />
� Logico<br />
� Zahlenstrahl<br />
� Rechenrahmen<br />
� Wendeplättchen<br />
� Einspluseins-Tafel<br />
� Einmaleinstafel<br />
� Hunderterfeld, Hundertertafel<br />
� Geometrische Grundformen<br />
Zur Dokumentation von Lernständen, Diagnostik und Förderung<br />
werden vornehmlich verwandt:<br />
� Eingangstest<br />
� Beobachtungsbögen<br />
� Lernwerkstatt<br />
� Freiarbeitsmaterialien(Domino, Memory, Rechenpuzzle, Zahlenal-<br />
bum)<br />
� Förderband<br />
� differenzierte Arbeitsblätter<br />
� angemessene Sozialformen<br />
� Helfersystem
Die Minimalanforderungen am Ende des 2. Schuljahres sind in den<br />
schulinternen Arbeitsplänen (siehe Anhang) dokumentiert.<br />
6 Soziales Lernen<br />
(letzte Änderung: 24.1.2012)<br />
Auch in unserer Schule gehören Konflikte und Gewalt in ihren verschiede-<br />
nen Facetten, wie z.B. in Form von verbalen Grenzüberschreitungen, Mob-<br />
bing, körperlicher Gewalt, Ausgrenzung etc. zum Schulalltag – wenn auch<br />
nicht in einem so massiven Ausmaß, wie es in weiterführenden <strong>schule</strong>n<br />
der Fall ist.<br />
Sie beeinflussen nicht nur die Grundlagen des Zusammenlebens und<br />
-lernens, sonder wirken sich auch auf den Lernerfolg der Schüler aus,<br />
denn Lernen ist zwar von kognitiven Leistungen und Fähigkeiten abhän-<br />
gig, wird aber auch durch soziale Gegebenheiten beeinflusst.<br />
Soziales Lernen, eine verbesserte Kommunikation und der gewaltfreie<br />
Umgang mit Konflikten werden an unserer Institution als Grundlage für<br />
erfolgreichen Unterricht verstanden und nehmen somit Einfluss auf unsere<br />
Bildungs- und Erziehungsarbeit.<br />
Dieses zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen:<br />
Im ersten Jahrgang bilden soziale Themen den Schwerpunkt des klassen-<br />
gebundenen Religionsunterrichts. Vom 2. bis 4. Schuljahr stellen diese In-<br />
halte den Schwerpunkt im Religions- und religiösen Ersatzunterricht dar,<br />
der durch die jeweilige Fachlehrerin erteilt wird. Des Weiteren fließen so-<br />
ziale Themen immer wieder in den Deutsch- und Sachkundeunterricht mit<br />
ein.<br />
Da das Gelingen des sozialen Lernens auch an eine gute Zusammenarbeit<br />
zwischen Schule und Elternhaus gebunden ist, bieten wir die Eltern-AG in<br />
Kooperation mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Wienke an. Sie ist als<br />
gemeinsames Angebot von Schule und Eltern und als unterstützende Me-<br />
thode, die das soziale Lernen an der Linden<strong>schule</strong> mit Projekten Maßnah-<br />
men fördert, zu verstehen.
6.1 Erziehungskonzept der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Die Trainingsraummethode<br />
Bei der Trainingsraummethode, die auf dem in den USA entwickelten Ford<br />
- Programm basiert, geht es darum, die Eigenverantwortung von Schüle-<br />
rinnen und Schülern bei Störverhalten zu stärken. Wer den Unterricht<br />
stört, kann sich entscheiden, ob er im Klassenraum bleiben und sein Ver-<br />
halten ändern oder in den so genannten Trainingsraum gehen möchte.<br />
Dort finden Lernprozesse statt, indem der Trainingsraumlehrer mit dem<br />
entsprechenden Schüler das Störverhalten reflektiert, gemeinsam einen<br />
Plan erstellt, der zur Rückkehr in das Klassenzimmer berechtigt und der<br />
das neue Verhalten beschreibt, das der Schüler bereit ist zu zeigen.<br />
Des Weiteren geht es bei der Trainingsraummethode auch um ein Bündnis für<br />
Erziehung, an dem sowohl die Schüler, die Lehrer als auch die Eltern beteiligt<br />
sind. Die Elternmitarbeit stellt einen wichtigen Teil dieser Methode dar, denn El-<br />
tern haben nicht nur das Recht ihre Kinder zu erziehen, sondern auch die Pflicht<br />
dazu. Diese Pflicht wird von der Schule eingefordert.<br />
Die Trainingsraummethode in abgewandelter Form an der Linden<strong>schule</strong><br />
Um einen möglichst störungsfreien Unterricht erteilen zu können, war es dem<br />
Kollegium wichtig, den Schülerinnen und Schülern sowohl klare Regeln (s. u.) als<br />
auch klare Konsequenzen bei Nichteinhaltung vorzugeben. Nach der Teilnahme<br />
an einer kollegiumsinternen Fortbildung zur „Trainingraummethode“, entschloss<br />
sich die Lehrerschaft diese Methode an der Schule in abgewandelter Form in allen<br />
Klassen durchzuführen. Da es die personellen sowie räumlichen Voraussetzungen<br />
nicht zuließen, einen gesonderten Trainingsraum mit begleitender Trainingsraum-<br />
lehrerin zu installieren, wurde in jeder Klasse der „Tisch des Nachdenkens einge-<br />
richtet“. An diesen begibt sich ein Schüler, der den Unterricht gestört hat und<br />
nicht einlenken möchte oder er hat bereits ein zweites Mal gestört. An dem Tisch<br />
findet der Schüler einen Protokollbogen vor, auf dem er …
1. …sein Störungsverhalten festhält,<br />
2. …angibt, wessen Rechte auf ruhigen Unterricht er verletzt hat,<br />
3. …einen Plan erstellt, wie er sein Verhalten verändern wird. Hierbei helfen<br />
ihm Symbolkarten, die ein angemessenes Verhalten darstellen.<br />
Der Plan wird sowohl vom Schüler als auch von der Lehrkraft, die letztendlich<br />
entscheidet, ob der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen kann, unterschrie-<br />
ben. Sollte der Schüler sich weigern, diesen Tisch aufzusuchen bzw. musste der<br />
Schüler sich bereits häufiger an diesen Tisch begeben, werden die Eltern zu ei-<br />
nem Gespräch in die Schule gebeten.<br />
Der folgende Ablaufplan verdeutlicht,<br />
wann Schüler sich an den „Tisch des<br />
Nachdenkens“ begeben müssen:<br />
Das Kollegium hat sich auf 4 gemeinsame Regeln geeinigt, die von allen Schülern<br />
der Linden<strong>schule</strong> einzuhalten sind:<br />
1. Regel: Ich melde mich.
2. Regel: Ich bin leise und höre zu.<br />
3. Regel: Ich bleibe auf meinem Platz sitzen.<br />
4. Regel: Ich schaue nach vorn und beteilige<br />
mich am Unterricht.
Abb.: Vertrag “Tisch des Nachdenkens“ zwischen SchülerIn und Lehrer<br />
Schulregeln<br />
In jedem Klassenraum hängen die Schulregeln für alle Kinder deutlich sichtbar<br />
aus. Außerdem erhält jedes Kind zu Beginn seiner Schulzeit dieses Regelhaus,<br />
das es mit seinen Eltern zusammen lesen, besprechen und unterschreiben muss.
Abb.: Das „Regelhaus“ der Linden<strong>schule</strong><br />
Bei leichten Regelverstößen muss das Kind die entsprechende Regel abschreiben.<br />
Bei gröberen Verstößen muss es mit einem Spielverbot in der Pause rechen oder<br />
Gedanken zum Regelverstoß aufschreiben. Bei schwerwiegenden Verstößen be-<br />
kommt das Kind eine „Grüne Karte“ mit nach Hause, auf der sein Regelverstoß<br />
festgehalten wird. Die Eltern müssen mit ihrem Kind gemeinsam die Regeln be-<br />
sprechen und die Karte unterschrieben mit zur Schule geben.
Name:________________________ __<br />
Ich habe die Schulregeln nicht beachtet und muss<br />
sie daher mit meinen Eltern lesen und besprechen.<br />
Abb.: „Grüne Karte“ zum Regelhaus der Linden<strong>schule</strong><br />
Der Klassenrat<br />
Datum Regelverstoß Elternunterschrift<br />
Eine Klasse bildet den gemeinsamen Klassenrat. Dieser dient zur gruppen- und<br />
klassenbezogenen Entscheidungsfindung sowie Konfliktlösung und fördert demo-<br />
kratische Entscheidungsprozesse.<br />
Beteiligung ist keine Altersfrage: Schon ab der ersten Klasse profitieren<br />
Kinder, wenn sie mitreden dürfen. Dabei sitzen alle Schülerinnen und<br />
Schüler der Klasse einmal wöchentlich zusammen und besprechen aktuelle<br />
Themen, die sie beschäftigen: Freundschaft, Umgang mit Konflikten, Re-<br />
geln im Unterricht, Feste und vieles mehr.<br />
Neben der Schulung von Kommunikations- und Sozialkompetenz ist der<br />
Klassenrat ein gutes Mittel, um den Klassengeist zu fördern.
Der Klassenrat sollte regelmäßig zur gleichen Zeit am gleichen Ort tagen, um<br />
Kontinuität zu sichern und die Ernsthaftigkeit des Vorgehens zu bestärken.<br />
Kinder lernen:<br />
� sich zuzuhören,<br />
� gegensätzliche Standpunkte zu bedenken,<br />
� andere Menschen als gleichwertig zu betrachten und<br />
� konstruktiv mit Problemen umzugehen.<br />
In den Klassen kann es ein Klassenratsbuch oder einen Kummerkasten geben.<br />
Hier können die Kinder akute Probleme und Anliegen eintragen,<br />
bzw. einwerfen. Auf diese Weise verschaffen sich die Kinder Luft über ihren<br />
momentanen Ärger und können sich im Anschluss meistens besser auf den Un-<br />
terricht konzentrieren.<br />
Bis zum Klassenrat vergeht oft etwas Zeit und kleinere Ärgernisse haben sich<br />
meist schon erledigt. Durch die regelmäßigen Treffen können sich die Kinder si-<br />
cher sein, dass im Klassenrat ungeklärte Probleme gewaltfrei und sorgfältig be-<br />
sprochen werden.<br />
Diese Grundstrukturen werden eingehalten, die Durchführung variiert von Klasse<br />
zu Klasse.<br />
6.2 Regeln und Rituale an der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 24.01.2012)<br />
Nach dem Umzug der Linden<strong>schule</strong> in das heutige Gebäude war es erfor-<br />
derlich erneut über Regeln in der neuen räumlichen Situation nachzuden-<br />
ken. So ist auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem neuen Gebäude<br />
die Überarbeitung des Regelhauses erfolgt (siehe Anhang).<br />
Das Regelhaus beinhaltet „allgemeine Regeln“, „Regeln im Klassenraum“,<br />
„Regeln im Umgang miteinander“, „Regeln auf dem Pausenhof“, die von<br />
den Eltern durch ihre Unterschrift akzeptiert werden. Gleichzeitig lösen die
Eltern mit ihrer Unterschrift ihre Verpflichtung zur Erziehungspartnerschaft<br />
mit Schule ein.<br />
In jeder Klassengemeinschaft werden diese Regeln mit den Kindern ein-<br />
gehend besprochen und auch die Konsequenzen bei Regelverstößen. Hilf-<br />
reich ist dabei auch die weiter unten beschriebene Ford- Methode, bzw.<br />
Trainingsraummethode.<br />
Für alle verbindlich ist darüber hinaus die „Stillezeichen-Regel“.<br />
Sie besagt:<br />
1. Das Zeichen muss beachtet werden:<br />
Immer!<br />
Sofort!<br />
Von allen!<br />
2. Wenn das Zeichen von der Lehrerin/ dem Lehrer angewendet wird<br />
♦ lege ich alles sofort aus der Hand und mache das Zeichen mit<br />
♦ höre ich auf zu reden<br />
♦ wende ich mich zu der Lehrerin / dem Lehrer und höre<br />
aufmerksam zu.<br />
Da unsere Kinder u. a. auch lernen sollen selbstverantwortlich mit den ih-<br />
nen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten umzugehen, werden soge-<br />
nannte Klassendienste vergeben, die jeder Schüler im Verlauf des Schul-<br />
jahres übernimmt. (s. Anhang: Verlassen des Klassenzimmers nach Schul-<br />
schluss)<br />
Auch der Schulhof als Lebensraum wird von den Kindern zusammen mit<br />
dem Hausmeister zu festgelegten Zeiten von Müll gesäubert.<br />
Da es einige Überschneidungszeiten hinsichtlich der Zeiten des Schulvor-<br />
mittags gibt und der Betreuungszeiten in der Randstunde, bzw. OGS, ist
erforderlich auch hier einheitliche Regeln aufzustellen, die allen Beteiligten<br />
bekannt sind und auch beachtet werden.<br />
Die Nutzung des Schulhofes in gemeinsamen Aufsichtszeiten steht da als<br />
besondere Situation im Mittelpunkt. (s. Anhang: Regeln in der OGS)<br />
Das Verankern von Ritualen gibt dem Schulleben für die Kinder leicht an-<br />
wendbare Strukturen, die sie schnell verinnerlichen können. Rituale ver-<br />
mitteln darüber hinaus Sicherheit hinsichtlich der eigenen Handlungsfä-<br />
higkeit und fördern somit die Entwicklung eines gesunden Selbstwertge-<br />
fühls und der Selbstsicherheit.<br />
Der Morgenkreis zu Beginn einer Schulwoche oder der Klassenrat zum Ab-<br />
schluss sind in vielen Klassen bereits verankert und bieten hervorragende<br />
Möglichkeiten zur Anwendung von allgemein gültigen Gesprächs- und Ver-<br />
haltensregeln.<br />
Kinder werden in dieser Situation ernst genommen und haben die Mög-<br />
lichkeit auf ihre Weise zu einer positiven Lernatmosphäre beizutragen.<br />
7 Beratung<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrer und Lehrerinnen der Linden-<br />
<strong>schule</strong> gehören auch die Information und die Beratung der Schüler und<br />
Schülerinnen sowie ihrer Erziehungsberechtigten (vgl. ADO - Allgemeine<br />
Dienstordnung §8). Die Lehrerinnen geben auf Wunsch in einem persönli-<br />
chen Gespräch Auskunft über den Leistungsstand und informieren und be-<br />
raten bei Bedarf in allen schulischen Angelegenheiten, v.a. bei den Über-<br />
gängen (vgl. SchulG – Schulgesetz §44). Neben den halbjährlichen Eltern-<br />
sprechtagen bietet jede Lehrkraft wöchentliche Sprechzeiten an, die man<br />
u.a. im Sekretariat erfragen kann.
Wenn die Notwendigkeit besteht Arbeit unsere Lehrkräfte auch mit außer-<br />
schulischen Partnern wie z.B. der schulpsychologischen Bratungsstelle zu-<br />
sammen.<br />
Die Beratungsgespräche an der Linden<strong>schule</strong> finden grundsätzlich außer-<br />
halb der Unterrichtsverpflichtung der entsprechenden Lehrkraft statt<br />
7.1 Übergang Kita – Schule /Einschulung<br />
(letzte Änderung: 25.01.2011)<br />
Die Beratung der Schulanfänger beginnt mit einem Elternabend für die<br />
4jährigen ungefähr zwei Jahre vor der Schulanmeldung. Dieser Eltern-<br />
abend, an dem auch erste Fragen gestellt werden können, wird gemein-<br />
sam mit den Kitas Herz-Jesu, Beckmanns Hof, Paulskamp, Wischkamp und<br />
dem Waldkindergarten durchgeführt und thematisiert das Lernverhalten<br />
und mögliche Fördermaßnahmen für die Kinder, sowie eine Einführung in<br />
die einige Monate später folgenden Delfin4-Testungen. Dieser Elternabend<br />
findet zeitgleich an allen <strong>Halle</strong>r Grund<strong>schule</strong>n statt.<br />
Auf Grundlage der Schuleingangsdiagnostik findet für die Eltern unserer<br />
Schulanfänger ein weiteres Beratungsgespräch kurz nach der Schulanmel-<br />
dung statt.<br />
Auf einem Elternabend vor dem ersten Schultag werden alle Eltern der<br />
neuen Schulanfänger über die wichtigsten Aspekte des Schullebens infor-<br />
miert.<br />
Durch einen Hospitationsbesuch der noch Kindergartenkinder in ihrer zu-<br />
künftigen Schule, bekommen diese einen ersten Eindruck vom Schulvor-<br />
mittag. Sie verbringen zusammen mit den Kindern der ersten Klassen eine<br />
Unterrichtsstunde und eine Hofpause.<br />
Seit dem Schuljahr 2001/2002 habe wir Paten für unsere I-Männchen und<br />
I-Frauchen. Jedes Kind aus dem 4. Schuljahr kümmert sich um sein Pa-
tenkind aus dem 1. Schuljahr. Erste Kontakte haben die Großen schon in<br />
den Sommerferien zu den Kleinen aufgenommen, indem sie sich mit ei-<br />
nem Brief bei ihnen vorgestellt haben. Die Paten helfen den Schulanfän-<br />
gern in den ersten Wochen sich in der Schule und auf dem Schulhof zu-<br />
rechtzufinden. Neben der Orientierung im neuen Lebensumfeld leisten die<br />
Paten aber auch wertvolle Hilfe im Unterrichtsalltag, z.B. bei gemeinsa-<br />
men Ausflügen oder anderen Unterrichtsprojekten.<br />
Die Einschulung beginnt am ersten Tag nach den Sommerferien mit einem<br />
ökumenischen Gottesdienst in der Herz-Jesu Kirche. Geschwisterkinder<br />
können während des Gottesdienstes in den Räumlichkeiten der OGS in der<br />
Linden<strong>schule</strong> betreut werden.<br />
Am zweiten Schultag werden die neuen Schulanfänger mit einer Einschu-<br />
lungsfeier in der Turnhalle begrüßt, die die „Paten“ für unsere Schulan-<br />
fänger gestalten. Während die neuen Schulkinder im Anschluss an die Fei-<br />
er mit ihren Klassenlehrerinnen für ca. eine halbe Stunde in ihren Klassen-<br />
raum gehen und ihre erste Unterrichtsstunde erleben, werden die neuen<br />
Eltern und Angehörigen unserer „I-Männchen und I-Frauchen“ mit Kaffee<br />
und Plätzchen in der Mensa der OGS von Eltern der 2. Jahrgänge in Zu-<br />
sammenarbeit mit dem Schulverein bewirtet.<br />
Ein möglicher Kennlernnachmittag im ersten Schulhalbjahr gibt Eltern,<br />
Kindern und Lehrerinnen die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit Schule<br />
auszutauschen und sich näher kennen zu lernen.<br />
Der Übergang mit den Kitas soll in den kommenden Jahren noch weiter<br />
ausgebaut werden. Unter der vorbehaltlichen Zustimmung der Eltern wer-<br />
den mit den Kitas seitens der Schulleitung, der Klassenlehrerinnen oder<br />
der Schulsozialarbeiterin Übergangsgespräche geführt, um Probleme auf-<br />
zufangen und begonnene Fördermaßnahmen weiterführen zu können. Da-<br />
zu hat sich beispielsweise der Arbeitskreis „Förderung der Sprachkompe-<br />
tenz“ unter der Leitung des Bildungsbüros des Kreises Gütersloh auf ein-
heitliche Förderpläne und Förderbausteine geeinigt, die in der Kita begon-<br />
nen und durch die Grund<strong>schule</strong> weitergeführt werden sollen.<br />
7.2 Übergang in die weiterführenden Schulen<br />
(letzte Änderung: 25.01.2011)<br />
Für die Eltern der SchülerInnen der vierten Klassen bemühen wir uns eine<br />
möglichst umfangreiche Beratung hinsichtlich des Übergangs in die weiter-<br />
führende Schule zu leisten.<br />
Ein Elternabend im November jeden Jahres, in Zusammenarbeit mit der<br />
Grund<strong>schule</strong> Gartnisch und den Vertretern der weiterführenden Schulen,<br />
soll zunächst über das Schulsystem allgemein und die verschiedenen Mög-<br />
lichkeiten in der Sekundarstufe Aufschluss geben.<br />
Anschließend folgen individuelle Beratungsgespräche mit Klassen- und<br />
Fachlehrerinnen, die den jeweiligen Leistungstand der einzelnen Kinder<br />
klären sollen und eventuell auch schon Hinweise auf den weiteren sinnvol-<br />
len Schulbesuch geben.<br />
In einem zweiten Beratungsgespräch am Ende des ersten Schulhalbjahres<br />
im vierten Schuljahr wird dann die Schulformempfehlung auf der Grundla-<br />
ge der Klassenkonferenz mit den Eltern besprochen und dokumentiert. Die<br />
Dokumentation jeden einzelnen Beratungsgesprächs ist per Gesetz gere-<br />
gelt. Es gibt dafür ein sehr praktikables Formular an der Linden<strong>schule</strong>.<br />
Mit vereinzelten Schulen finden darüber hinaus Übergabegespräche bzw.<br />
Erprobungsstufenkonferenzen statt, die den Kindern das Ankommen in der<br />
neuen Schulform erleichtern soll. In diese Gespräche sollen Künftig auch<br />
die Kontakte zwischen den Schulsozialarbeitern eingebunden werden.<br />
Im Bereich der Sprachkompetenzförderung findet im Frühjahr 2011 eine<br />
erste Konferenz der Sprachförderer der Linden<strong>schule</strong>, der Peter-Korschak-<br />
Schule (HS <strong>Halle</strong>) und der Real<strong>schule</strong> <strong>Halle</strong> statt, mit dem Ziel – ähnlich<br />
wie im Bereich des Übergangs Kita / Linden<strong>schule</strong> – die Sprachförderung<br />
einheitlich zu konzipieren (u.a. Testverfahren) und zu dokumentieren (u.a.
Förderpläne), um auch hier eine bruchlose Lernbiographie zu gewährleis-<br />
ten.<br />
7.3 Elternsprechzeiten<br />
(letzte Änderung: 25.01.2011)<br />
Halbjährliche Beratungsgespräche<br />
Zweimal im Jahresverlauf bieten die Klassenlehrerinnen und Fachlehrerin-<br />
nen Beratungsgespräche an, früher als Elternsprechtage bekannt. Seit der<br />
Änderung des Schulgesetzes dürfen Beratungsgespräche nur noch in der<br />
unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Die Anmeldung zu diesen Sprechtagen<br />
ist ungefähr zwei Wochen vor den eigentlichen Terminen und läuft ver-<br />
antwortlich über die Klassenlehrerin.<br />
Freie Lehrersprechstunden<br />
Damit alle Eltern einen für sie günstigen Beratungstermin wahrnehmen<br />
können, haben wir zusätzlich Lehrersprechstunden eingerichtet, zu denen<br />
man sich über das Sekretariat anmelden kann. Die Sprechstundenzeiten<br />
der Lehrerinnen werden an die Kinder verteilt, stehen auf der Homepage<br />
der Linden<strong>schule</strong> (www.linden<strong>schule</strong>-halle.de) und hängen im Sekretariat<br />
oder im Klassenzimmer (schwarzes Brett) aus.<br />
Natürlich stehen Ihnen alle Lehrerinnen und Lehrer auch während des lau-<br />
fenden Schuljahres zur individuellen Beratung über die Schullaufbahn Ih-<br />
res Kindes zur Verfügung.<br />
Dokumentation der Elternberatung /Protokolle<br />
Um das jeweilige Anliegen, bzw. den Beratungsbedarf auch im Nachhinein<br />
nachvollziehen zu können fertigen wir kurze Dokumentationen in Form<br />
von Protokollen der Beratungssituation an. Dies verhindert Missverständ-<br />
nisse und macht den Verlauf einer Beratungssituation auch über einen<br />
längeren Zeitraum transparent.<br />
7.4 Ansprechpartner für ratsuchende Eltern
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Als erster Ansprechpartner neben der Klassenlehrerin stehen wir Ihnen als<br />
Schulleitung zur Verfügung.<br />
Darüber hinaus steht Ihnen sowohl die Schulpflegschaft (Vorsitzender Herr<br />
Jörg Eggers) als auch der Schulverein (Vorsitzende Frau Carmen Dworrak)<br />
und das gesamte Kollegium und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der<br />
Linden<strong>schule</strong> mit Rat und Tat zur Seite.<br />
Seit dem Schuljahr 2009 / 2010 ist Frau Claudia Wienke mit einer halben<br />
Stelle als Schulsozialarbeiterin an der Linden<strong>schule</strong> tätig (siehe 8.4 Schul-<br />
sozialarbeit). Ihr Aufgabengebiet ist u.a. auch Elternberatung in schwieri-<br />
gen Situationen sowie im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes.<br />
Die Stadt <strong>Halle</strong> gibt jährlich einen aktuellen Elternberater heraus unter<br />
dem Titel „Kinder, Kinder“, dort finden Sie alle Ansprechpartner die in der<br />
Stadt und auch im Kreis tätig sind. Frau Claudia Wienke wird auch hier<br />
Hilfestellung leisten können, um die richtigen Ansprechpartner herauszu-<br />
finden.<br />
Weitere Ansprechpartner mit denen wir von der Schulseite aus zusam-<br />
menarbeiten und die Ihnen Rat bieten können sind:<br />
- die Bildungs- und Schulberatungsstelle des Kreises Gütersloh<br />
Herzebrockerstr. 140, 33334 Gütersloh<br />
Tel. 05241-822199<br />
- die Evangelische Erziehungs- und Beratungsstelle<br />
Lettow – Vorbeck – Str. 11, 33790 <strong>Halle</strong>/Westf.<br />
Tel 05201-18470<br />
- die Gleichstellungsstelle der Stadt <strong>Halle</strong>
Ravensberger Str. 1, 33790 <strong>Halle</strong>/Westf.<br />
Tel. 05201-183181<br />
- das Jugendamt (Regionalstelle Nord)<br />
Graebestr. 24, 33790 <strong>Halle</strong>/Westf.<br />
Tel. 05201-183232<br />
- Wendepunkt – Beratungsstelle bei sexuellem Missbrauch<br />
Schulstr. 22, 33330 Gütersloh<br />
Tel. 05241-822115<br />
- Bildungsbüro des Kreises Gütersloh<br />
Herzebrockerstr. 140, 33334 Gütersloh<br />
Tel. 05241-851507<br />
8 Schulleben<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Feste und andere Aktivitäten<br />
Feste und Feiern sind wesentlicher Bestandteil unseres Schullebens. Sie<br />
fördern das Miteinander aller, das Erleben von Schulgemeinschaft.<br />
Unsere „großen“ Feste und Projekte werden in einem 4-Jahres-Rhythmus<br />
durchgeführt, damit jedes Kind diese einmal in seiner Grundschulzeit erle-<br />
ben kann.<br />
Dazu gehören:<br />
- ein Schulfest<br />
- eine „kleine“ Projektwoche ohne Präsentationstag<br />
- ein Spiel- und Sportfest<br />
- eine „große“ Projektwoche mit Präsentationstag zum Thema Zirkus<br />
Im Schuljahr 2008 / 2009 wurde beschlossen alle zwei Jahre eine Lese-<br />
projektwoche durchzuführen.
Darüber hinaus gibt es jahreszeitliche Feiern im Rahmen der Schulge-<br />
meinschaft, die von allen SchülerInnen vorbereitet werden und an denen<br />
die SchülerInnen und LehrerInnen teilnehmen. Am letzten Tag vor den<br />
Herbst- und den Osterferien tragen die Kinder Lieder, Gedichte, szeni-<br />
sches Spiel usw. vor, was aus dem Unterricht erwachsen ist.<br />
In der Adventszeit findet ein Nikolaussingen statt, was u. a. auch mit einer<br />
Spende des Schulvereins an jedes Kind, nämlich einem Stutenkerl ver-<br />
bunden ist.<br />
Die Gestaltung der Einschulungsfeier für die neuen Schulanfänger und der<br />
Abschiedsfeier für die 4-Klässler sind besondere Herausforderungen für<br />
die Kinder, da sie hier in Zusammenarbeit mit ihren KlassenlehrerInnen<br />
für die Planung und Organisation verantwortlich sind. Die Einschulungsfei-<br />
er wird von den dritten Schuljahren, den künftigen Paten vorbereitet, ihre<br />
Abschiedsfeier gestalten die vierten Klassen selber. Ein Abschiedsge-<br />
schenk wird – nach Absprache – von den Patenklassen im 1. Jahrgang<br />
vorbereitet.<br />
Sowohl für die Schulanfänger als auch für die Schulabgänger bereiten wir<br />
einen Schulgottesdienst vor um sie auf ihren neuen Lebensabschnitt vor-<br />
zubereiten.<br />
Zum festen Bestandteil des Schullebens gehören auch die ökumenischen<br />
Gottesdienste zur Einschulung, zum Abschluss der Grundschulzeit und zu<br />
Weihnachten.<br />
Außerdem finden häufig zu verschiedensten Anlässen klasseninterne Feste<br />
statt.<br />
Die Schülerbücherei kann an jedem Dienstag und Freitag von allen Kin-<br />
dern zu festgelegten Zeiten besucht werden.<br />
Am Schuljahresende findet in der OGS ein Tag der offenen Tür statt.<br />
Gleichzeitig ist dies der Tag des jährlich veranstalteten Kinderflohmarktes.<br />
Flohmarkt, Nikolausmarkt, Ranzenparty und Karnevalsfeier (Konfetti-<br />
alarm) sind Veranstaltungen die federführend vom Schulverein organisiert
sind, bei denen sich alle Eltern beteiligen können und so etwas zum Schul-<br />
leben beitragen.<br />
Im 6-Wochen-Rhythmus organisiert der Elternrat der OGS das „Elternca-<br />
fe“. Zu verschiedenen Themen werden Vorträge gehalten (Hausaufgaben,<br />
Geschwisterkinder, Kindeswohlgefährdung, Mediennutzung, …), Erfahrun-<br />
gen gesammelt und ausgetauscht. Immer wieder werden auch gemeinsa-<br />
me Eltern–Kind-Aktionen geplant und durchgeführt wie z.B. Erste-Hilfe-<br />
Kurse. Die aktuellen Termine und Inhalte können in der OGS nachgefragt<br />
oder auf unserer Homepage eingesehen werden.<br />
Außerschulische Lernorte<br />
Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern immer und überall.<br />
Manche Zusammenhänge werden dadurch schneller und umfänglicher<br />
ganzheitlich erfahren. Deshalb sind die unten aufgeführten außerschuli-<br />
schen Lernorte nicht nur eine wertvolle Bereicherung im Sinne von Vertie-<br />
fung von Gelerntem. Sie ermöglichen das Lernen mit allen Sinnen, gemäß<br />
unserem alten Schulmotto: „Nur wer mit allen Sinnen lernt wird das<br />
Leben meistern.“<br />
Untenstehend sind die z.Z. am häufigsten besuchten außerschulischen<br />
Lernorte benannt:<br />
� Tierpark Olderdissen<br />
� Osnabrücker /Rheiner Zoo<br />
� Sparrenburg in Bielefeld / Ravensburg in Borgholzhausen<br />
� Historisches Museum / Bauernhausmuseum in Bielefeld<br />
� Steinzeitmuseum in Oerlinghausen<br />
� Schachtschleuse und Wasserstraßenkreuz in Minden<br />
� Museum und für Kindheits- und Jungendwerke bedeutender Künstler<br />
in <strong>Halle</strong><br />
� Freilichtmuseum Detmold<br />
� Gebäude der ev., kath. Kirchen und der Moschee in <strong>Halle</strong><br />
� Schloss Tatenhausen
� Rathaus, Polizeiwache, Feuerwehr, Klärwerk, Wasserwerk in <strong>Halle</strong><br />
� Stadtbücherei <strong>Halle</strong><br />
� Weiterführende Schulen (Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte,<br />
Lernangebote, TeutoLab im KGH, usw.)<br />
� Theater Gütersloh und Bielefeld<br />
� Universität Bielefeld (Ausstellungen, Lernangebote für Grundschüler)<br />
� Historisches Museum in Bielefeld<br />
� …<br />
Klassenfahrten<br />
Klassenfahrten (= Schulwanderungen und Schulwanderfahrten) sind eine<br />
wichtige Bereicherung des Schulalltags, und somit verbindliche Schulver-<br />
anstaltungen. Es besteht kein Wahlrecht zwischen Unterricht und Klassen-<br />
fahrt. In besonderen Ausnahmefällen können die Erziehungsberechtigten<br />
bei der Schulleitung einen schriftlich begründeten Antrag auf Befreiung<br />
von der generellen Teilnahmeverpflichtung stellen.<br />
Das Kind besucht dann den Unterricht in einer anderen Klasse.<br />
Mehrtätige Klassenfahrten werden an der Linden<strong>schule</strong> regelmäßig am En-<br />
de der 3. oder am Anfang der 4. Klasse durchgeführt. Über das Ziel der<br />
Klassenfahrt entscheidet die Elternpflegschaftsversammlung nach Vor-<br />
schlag der Klassenlehrerin. Die letzten Ziele unserer Klassenfahrten lagen<br />
in Himmighausen, in Dümmerlohausen am Dümmer und in Bad Bentheim.<br />
Über unser Schulleben gibt es auf unserer Homepage<br />
www.linden<strong>schule</strong>-halle.de ausführliche Informationen und Eindrücke.<br />
9 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Um die umfassenden Aufgaben erfüllen zu können, die an Schule und Leh-<br />
rer, Schulentwicklung und Qualitätssicherung, Bildung und Erziehung ge-<br />
stellt werden, arbeiten wir, je nach situativer Gegebenheit, mit vielen
verschiedenen Institutionen zusammen. Die wichtigsten sind hier aufge-<br />
führt:<br />
- Grund<strong>schule</strong>n in <strong>Halle</strong> (GS Gartnisch, GS Künsebeck, GS Hörste)<br />
- Weiterführende Schulen (v.a. Peter-Korschak-Schule <strong>Halle</strong>, Real-<br />
<strong>schule</strong> <strong>Halle</strong>, Kreisgymnasium <strong>Halle</strong>, Peter-August-Böckstiegel-<br />
Schule Gesamt<strong>schule</strong> Werther)<br />
- Förder<strong>schule</strong>n (Gerhart-Hauptmann-Schule <strong>Halle</strong>, Erich-Kästner-<br />
Schule Harsewinkel, Regenbogen<strong>schule</strong> Gütersloh)<br />
- Kindergärten (v.a. Kita Herz-Jesu, Kita Beckmanns Hof, Kita<br />
Paulskamp, Waldkindergarten)<br />
- Ev. Und kath. Kirchengemeinde <strong>Halle</strong><br />
- AWO – Kreisverband Gütersloh<br />
- Schul- und Bildungsberatungsstelle Gütersloh<br />
- Erziehungsberatungsstelle<br />
- Bildungsbüro des Kreises Gütersloh<br />
- Schulamt des Kreises Gütersloh<br />
- u.v.a.m.<br />
10 Qualitätssicherung<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Im Rahmen von Lehrer- und Fachkonferenzen, in pädagogischen Ganz-<br />
tagskonferenzen oder in Steuergruppen wird fortwährend an einzelnen<br />
pädagogischen Konzepten, sowie an Arbeitsplänen und anderen Bereichen<br />
zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität der Linden<strong>schule</strong> gear-<br />
beitet, sodass diese als Handwerkszeug immer wieder den aktuellen pä-<br />
dagogischen Erfordernissen angepasst werden.<br />
Dazu ist ein ausreichendes Maß an Fortbildung notwendig, was z. T. durch<br />
schulinterne Fortbildungen für das ganze Kollegium erreicht wird, aber<br />
auch durch individuelle Fortbildungen einzelner Kolleginnen und Kollegen.
Die Zusammenschau von aktuellen Gegebenheiten im Schulleben, bei den<br />
Schülern, dem Kollegium, den Eltern, sowie die Bereitschaft sich immer<br />
wieder, auf der Basis von neueren Erkenntnissen, um ein Optimum an<br />
Entwicklung zu bemühen, entspricht unserem Gedanken der Qualitätssi-<br />
cherung.<br />
In diesem Sinne verkörpert Schule, mit all ihren Beteiligten, eine lernende<br />
Organisation und arbeitet stets daran die Qualität der Arbeitsbedingungen<br />
für alle an Schule Beteiligten zu optimieren.<br />
11 Steuergruppe zur Unterrichtsentwicklung an<br />
der Linden<strong>schule</strong><br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
In der Fachwelt besteht schon lange Einvernehmen darüber, dass nachhal-<br />
tige Erfolge in der Schul- und Unterrichtsentwicklung vor allem dann ge-<br />
lingen, wenn die einzelne Schule diesen Prozess über eine eigens qualifi-<br />
zierte Steuergruppe initiiert, begleitet und evaluiert.<br />
Daher haben wir uns dazu entschieden, beauftragt durch einen Lehrerkon-<br />
ferenzbeschluss vom 23.02.2011, eine Steuergruppe einzurichten, die im<br />
Schuljahr 2011/2012 mit der Steuergruppenausbildung durch die Hoch-<br />
<strong>schule</strong> Ostwestfalen-Lippe ihre Arbeit aufnehmen wird. Dieser schulischen<br />
Steuergruppe werden neben Herrn Evers als Vertreter der Schulleitung,<br />
Frau Kombrink, Frau Nelke und Frau Nauke angehören.<br />
Die Fortbildung der Steuergruppenmitglieder bezieht sich auf die Bereiche<br />
1. Rolle und Aufgaben der Steuergruppe<br />
2. Planungsgrundlagen / Projektmanagement<br />
3. Zielformulierung / Projektmanagement<br />
4. Moderation / Präsentation<br />
5. Teamentwicklung<br />
6. Information / Kommunikation<br />
7. Konfliktmanagement<br />
8. Qualitätsarbeit / Evaluation,
die verteilt auf 11 Termine in eineinviertel Jahren bearbeitet werden sol-<br />
len.<br />
Als erstes Schulentwicklungsvorhaben, welches auch in der Fortbildung in<br />
Angriff genommen werden soll, hat sich die Steuergruppe den Bereich<br />
„Kooperative Lernformen“ aus der aktuellen Agenda der Linden<strong>schule</strong> her-<br />
ausgesucht.<br />
12 Evaluation und Entwicklungsziele<br />
(letzte Änderung: 29.11.2011)<br />
Qualitätssicherung, Evaluation und Entwicklungsziele sind untrennbar mit-<br />
einander verbunden.<br />
Im Rahmen der Leseprojektwoche 2008 haben wir u. a. erste Schritte ei-<br />
ner internen Evaluation gewagt, die Eltern- und Schülermeinungen, bzw. –<br />
erfahrungen mit einbezog.<br />
Wir haben geschaut, in wieweit unsere Ziele, die Lesemotivation und die<br />
Lesefertigkeiten zu steigern durch dieses Projekt verwirklicht werden<br />
konnten.<br />
Gestärkt durch diese Erfahrungen haben wir uns im Schuljahr 2009 / 2010<br />
daran gewagt, eine große Fragenbogenaktion zur allgemeinen Schulzu-<br />
friedenheit zu starten und sowohl Schülerinnen und Schüler, als auch die<br />
Elternschaft, das Lehrerkollegium und die übrigen Mitarbeiter anonym zu<br />
befragen. Der Rücklauf war enorm. Die Ergebnisse haben uns den Rücken<br />
gestärkt und gleichzeitig Arbeitsschwerpunkte aufgezeigt. Diese Arbeits-<br />
schwerpunkte für die nächsten Jahre wurden, vorbereitend von der Leh-<br />
rerkonferenz, in der Schulkonferenz konkretisiert und festgelegt.<br />
Arbeitsschwerpunkte seit dem Schuljahr 2010 / 2011
- Fertigstellung eines einheitlichen Konzeptes zur Leistungsfeststel-<br />
lung und –dokumentation schwerpunktmäßig für die Nebenfächer<br />
- Ausweitung der Kenntnisse in der ersten Hilfe / Erstelle eines<br />
Sicherheitskonzeptes<br />
- Individuelle Förderung (v.a. leistungsstarker Kinder): Erste Mo-<br />
delle auch einer äußeren Differenzierung für besonders begabte Kin-<br />
der in Mathematik und Dyskalkulieker werden bereits im Schuljahr<br />
2010/2011 erprobt. Ein weiterer Schwerpunkt werden Fortbildungen<br />
im Bereich der kooperativen und entdeckenden Lernformen darstel-<br />
len.<br />
- Teambildung im Kollegium<br />
- Soziales Lernen / Gewaltprävention<br />
All diese Arbeitsschwerpunkte sind sehr komplexe Bereiche. Um ihren Er-<br />
folg zu sichern macht es keinen Sinn, alle Felder parallel zu bearbeiten.<br />
Neue Erkenntnisse finden jederzeit Einstieg in unsere alltägliche schulische<br />
Arbeit.<br />
Sicherheitskonzept <br />
Leistungskonzept<br />
Individuelle<br />
Förderung<br />
Kooperative<br />
Lernformen<br />
Arbeitsplan<br />
Schuljahr 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16<br />
Teamentwicklung <br />
Gewaltprävention<br />
Dyskalkulie
Mathe plus<br />
Leitbild<br />
Inklusion<br />
Bewegungskiste<br />
(OGS/LS)<br />
Abb.: Zeitleiste zur Weiterentwicklung des Schulprogramms der Linden<strong>schule</strong><br />
Die o.g. Schwerpunkte versuchen wir aber nacheinander in aller Ruhe,<br />
fundiert und ergebnissichernd für unseren Bildungs- und Erziehungsauf-<br />
trag zu nutzen.<br />
In dem Bestreben die gute Arbeit an der Linden<strong>schule</strong> zu sichern bzw. zu<br />
verbessern und um unsere Erfahrungen im Bereich der Evaluation auszu-<br />
bauen, evaluieren wir seit dem Jahr 2010/2011 eine Auswahl an Veran-<br />
staltungen und Aktionen.<br />
Evaluationen seit 2011<br />
Februar 2011: Evaluation der Förderpläne durch die Lehrerinnen der<br />
SEP<br />
Ergebnis: Die Förderpläne sind überarbeitet worden und<br />
befinden sich in der erneuten Erprobung.<br />
März 2011: Evaluation des Informationsabends für die Eltern der<br />
4jährigen (AW mit Grafstat 4 im Anhang)<br />
Ergebnis: Sehr zufriedenstellende Veranstaltung in Ko-<br />
operation mit den Kindertagesstätten, die in dieser über-<br />
arbeiteten Form weitergeführt werden soll<br />
März 2011: Evaluation der Leseprojektwoche durch das Lehrerkolle-<br />
gium (AW mit Grafstatt 4 im Anhang)<br />
September 2011:Evaluation des Sommerleseclubs durch die Schülerinnen<br />
und Schüler der Linden<strong>schule</strong><br />
Oktober 2011: Evaluation zur Teamentwicklung im Kollegium
13 Impressum<br />
(letzte Änderung am 01.02.2012)<br />
Evaluation der Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ (Eltern-<br />
befragung)<br />
Das gesamte Kollegium der Linden<strong>schule</strong>, die (pädagogischen) Mitarbeiter<br />
und die Elternschaft in ihren Mitwirkungsgremien hat sich auf Konferen-<br />
zen, Studientagen, Fortbildungen, in Teamsitzungen, Fachkonferenzen<br />
und in der täglichen Arbeit mit der Erstellung unseres Schulprogramms<br />
auseinander gesetzt und schreibt dieses fortwährend weiter.<br />
Zum Lehrerkollegium gehören:<br />
Frau Suna Bakir, Frau Silke Brockmann, Frau Monika Drewel, Herr Maik<br />
Evers, Frau Anja Holtmann, Frau Astrid Jewanski-Bohnmann, Frau<br />
Sigrid Kirchmann, Frau Stefanie Kombrink, Frau Antje Lechtermann,<br />
Frau Regina Möller, Frau Carola Nauke, Frau Julia Nelke, Frau Inke<br />
Schaar, Frau Astrid Scheer-Berghäuser, Frau Uta Schlüpmann, Frau<br />
Anke Schwittay, Frau Karin Steinke, Frau Yvonne Steinkröger, Frau<br />
Sonja Trüggelmann, Frau Britta Voßhans, Frau Anne Waltrup, Frau Ste-<br />
phanie Wittenberg<br />
Zur Betreuung in der Offenen Ganztags<strong>schule</strong> bzw. Randstundenbetreu-<br />
ung gehören:<br />
Frau Sabine Brenker, Frau Irmgard Freitag, Frau Annett Hirschmann,<br />
Frau Anke Horstmann, Frau Irmtraud Husmann, Frau Christa Kamp-<br />
mann, Frau Margit Neumann, Frau Marietta Niebuhr, Frau Heike Te-<br />
sche, Frau Anja Trias<br />
Weitere, den Schulalltag und das Schulprogramm gestaltende Mitarbeiter<br />
an der Linden<strong>schule</strong> sind: Frau Gabriele Echterhoff, Herr Ulrich Wagner,<br />
Frau Claudia Wienke
Die Elternschaft wird in der Schulkonferenz vertreten durch:<br />
Herrn Jörg Eggers, Frau Catherine Kisker, Herr Torsten Kröner, Herr<br />
Axel Reimers, Frau Petra Schiller, Frau Elke Zebrowski