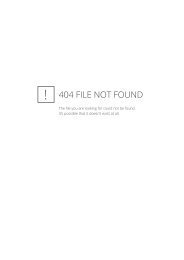Schulprogramm der Lenzenbergschule - Stand 2010/2011
Schulprogramm der Lenzenbergschule - Stand 2010/2011
Schulprogramm der Lenzenbergschule - Stand 2010/2011
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung<br />
von Schule und Unterricht<br />
Letzte Protokollierung: Februar <strong>2011</strong><br />
Letzte Evaluierung: Dezember <strong>2010</strong><br />
<strong>Schulprogramm</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................... 0<br />
Gesamtüberblick ...................................................................................................................... 1<br />
Vorwort .................................................................................................................................... V<br />
Schulportrait ............................................................................................................................ S<br />
Schüler ........................................................................................................................... S-1<br />
Eltern .............................................................................................................................. S-1<br />
Lehrerkollegium .............................................................................................................. S-1<br />
Personal ......................................................................................................................... S-1<br />
Betreuung ..................................................................................................................... S-1<br />
Schulkonferenz ............................................................................................................... S-2<br />
Der För<strong>der</strong>verein ............................................................................................................. S-2<br />
Schulgebäude und Außenanlage .................................................................................... S-2<br />
Leitbild ..................................................................................................................................... L<br />
Bildungs- und Erziehungsziele ........................................................................................ L-1<br />
In Hinblick auf unsere Schülerinnen und Schüler ....................................................... L-1<br />
In Hinblick auf unser Kollegium ................................................................................. L-3<br />
In Hinblick auf die Eltern ............................................................................................ L-3<br />
Unterrichtsziele ............................................................................................................... L-4<br />
Das <strong>Schulprogramm</strong> und seine Entwicklungsbereiche .............................................................. E<br />
Überblick ....................................................................................................................... E-0<br />
Kommunikation und ihre Wege innerhalb <strong>der</strong> Schule / Transparenz ............................. E1-1<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer .................................................... E2-1<br />
Schulordnung ....................................................................................................... E2-13<br />
Unterrichtsorganisation ................................................................................................. E3-1<br />
Weiterentwicklung von Unterricht .................................................................................. E4-1<br />
Schuleigene Rahmenpläne / Kerncurricula .................................................................... E5-1<br />
Deutsch .................................................................................................................. E5-1<br />
Mathematik ............................................................................................................ E5-3<br />
Sachunterricht ........................................................................................................ E5-8<br />
Musik ................................................................................................................... E5-13<br />
Ästhetische Bildung: Kunst, Werken, Textiles Gestalten ........................................ E5-15<br />
Sport .................................................................................................................... E5-22<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule ....................................................................... E6-1<br />
Übergang zur weiterführenden Schule .......................................................................... E7-1<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er .............................................. E8-1<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule -<br />
Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens ................................................. E9-1<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan ................................................................ E10-1<br />
Anhänge .................................................................................................................................. A<br />
Inhaltsverzeichnis 0
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Gesamtüberblick 1
Vorwort<br />
Eine Begriffsklärung<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Wie definiert man heute Schulqualität?<br />
Fend, ein deutscher Pädagoge und Vordenker <strong>der</strong> Schulqualitätsdiskussion, <strong>der</strong> bereits seit den<br />
70er Jahren an Schuluntersuchungen im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen arbeitet,<br />
hat sich sehr intensiv mit Schulqualität und mit dem Begriff <strong>der</strong> „guten Schule“<br />
auseinan<strong>der</strong>gesetzt.<br />
War er wie seine Kollegen noch vor dreißig Jahren überzeugt, dass „gute Schule“ die Summe<br />
von guten Lehrpersonen, von lernwilligen Schülerinnen und Schülern sowie von kulturell<br />
bedeutsamen Inhalten ausmache, so rücken in den darauf folgenden bildungspolitischen<br />
Diskussionen die schulischen Strukturen in den Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Schulqualität ist demnach mehr als Schülerleistung.<br />
Qualität kann jedoch wegen ihres normativen Gehaltes und ihrer zentral vorschreibenden<br />
Funktion nicht objektiv definiert werden.<br />
Qualitätsnormen für die Schule werden von <strong>der</strong> konkreten Einzelschule erstellt, und zwar in<br />
Relation zu den allgemeinen Normen und im Zusammenhang mit dem von <strong>der</strong> Schule erstellten<br />
Leitbild. In diesem wird Schule als Lebens-, Begegnungs- und Gestaltungsraum definiert und<br />
ist somit mehr als nur Unterricht.<br />
Zentraler Bezugspunkt ist die För<strong>der</strong>ung und Entwicklung <strong>der</strong> gesamten Persönlichkeit des<br />
Schülers.<br />
Das <strong>Schulprogramm</strong> dient <strong>der</strong> Qualitätsentwicklung von Schule und beschreibt Schule und<br />
Unterricht in ihrem dauerhaften Entwicklungsprozess („lernende Organisation“).<br />
Die Erstellung eines <strong>Schulprogramm</strong>s als Steuerungsinstrumentarium für die schulische Arbeit<br />
ist in Hessen gesetzlich verpflichtend (§ 3 HSCHG).<br />
Die Schule legt auf <strong>der</strong> Basis einer Bestandsaufnahme, <strong>der</strong> Analyse und kritischen Einschätzung<br />
ihrer eigenen Praxis und ihrer Voraussetzungen die Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit fest.<br />
Im <strong>Schulprogramm</strong> befindet sich die Bestandsaufnahme vor allem unter Schulportrait.<br />
Die Analyse und kritische Einschätzung wird interne Evaluation genannt und findet z.B. am<br />
Pädagogischen Tag – „<strong>Schulprogramm</strong>arbeit“ statt.<br />
Ziele und Schwerpunkte werden als Entwicklungsbereiche und Entwicklungsziele mit ihren<br />
einzelnen Projekten beschrieben.<br />
Das <strong>Schulprogramm</strong> ist somit vorrangig ein Instrument für das Kollegium, um zu überprüfen, an<br />
welchen Projekten und mit welchem Erfolg im Rahmen <strong>der</strong> Schulentwicklung gearbeitet wird<br />
und ob die Implementierung im Schulalltag stattgefunden hat.<br />
Die Evaluation dient <strong>der</strong> Entscheidung über die Weiterarbeit an dem gleichen o<strong>der</strong> einem<br />
weiteren Projekt. Ziel dieser Selbstevaluation ist die umfassende, regelmäßige und<br />
systematische Überprüfung von Tätigkeiten und Ergebnissen.<br />
Die einzelnen Projekte sind so anzulegen,<br />
- dass eine Zeitspanne vorgegeben wird, aber kein Zeitdruck entsteht.<br />
- dass Transparenz gewährleistet wird durch Arbeit im Team und in guter Kommunikation.<br />
Das Kollegium trifft jährlich eine Auswahl von Projekten mit kurzfristigen, mittelfristigen und<br />
langfristigen Perspektiven.<br />
Diese Projekte werden fortlaufend von Jahr zu Jahr im <strong>Schulprogramm</strong> formuliert und machen<br />
somit als Bestandteil <strong>der</strong> Arbeitskultur unserer Pädagoginnen auch nach außen den Arbeits-<br />
und Entwicklungsstand <strong>der</strong> Schule transparent.<br />
Die <strong>Schulprogramm</strong>arbeit geht weit über das Tagesgeschäft des Unterrichtens hinaus und hat<br />
zur Folge, dass das gesamte Kollegium motiviert und zukunftsorientiert zum Wohle <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler und in gegenseitiger Wertschätzung miteinan<strong>der</strong> arbeitet. Es wird bei<br />
höherem Zeit- und Energieaufwand eine Verbesserung <strong>der</strong> Zufriedenheit aller erreicht.<br />
Vorwort V
Schulportrait<br />
Schüler<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Unsere 178 Schüler sind Jungen und Mädchen aus den Ortschaften Nie<strong>der</strong>- und<br />
Oberseelbach sowie Engenhahn.<br />
Sie sind in <strong>der</strong> Regel zwischen 6 und 10 Jahre alt.<br />
Eltern<br />
Die Eltern beteiligen sich rege an unserem Schulleben<br />
� in gemeinsamen Gesprächen mit den Lehrern<br />
� an Elternabenden<br />
� im Klassenelternbeirat<br />
� im Schulelternbeirat<br />
� in <strong>der</strong> Schulkonferenz<br />
� in <strong>der</strong> Gesamtkonferenz<br />
� an Fortbildungsveranstaltungen unserer Schule<br />
� an Vorbereitungen und Durchführungen von Festen<br />
� an Projekten im Unterricht<br />
� im Elternnotdienst (Unterrichtsgarantie plus)<br />
Lehrerkollegium<br />
Es besteht aus <strong>der</strong> Schulleiterin und weiteren 9 Kolleginnen, ergänzt durch den evangelischen<br />
Pfarrer und <strong>der</strong> katholischen Gemein<strong>der</strong>eferentin.<br />
Personal<br />
Eine Sekretärin, die gleichzeitig Hausmeisterin ist<br />
Ein Hausmeistergehilfe<br />
Betreuung<br />
Seit Sommer 2000 bietet <strong>der</strong> „För<strong>der</strong>verein <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> – Grundschule<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach e.V.“ eine Schülerbetreuung außerhalb <strong>der</strong> Unterrichtszeit von 7.15 Uhr bis<br />
13.30 Uhr an. Seit April <strong>2010</strong> erweitert sich die Betreuungszeit von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr.<br />
Konzept <strong>der</strong> pädagogischen Mittagsbetreuung: siehe Anhang. Die Betreuungszeiten werden<br />
jeweils an den Stundenplan angepasst. Der Schulträger hat innerhalb des Schulgebäudes<br />
Räumlichkeiten geschaffen.<br />
Interessierte Eltern melden ihre Kin<strong>der</strong> gegen einen monatlichen Beitrag (z.Zt. 30,00 € plus<br />
1,00 € Mitgliedsbeitrag) beim För<strong>der</strong>verein an. Bei Eltern, die mehrere Kin<strong>der</strong> an <strong>der</strong><br />
<strong>Lenzenbergschule</strong> haben, wird für das zweite Kind nur <strong>der</strong> halbe Beitrag erhoben.<br />
In Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Schule leiten 8 pädagogische Fachkräfte, die vom För<strong>der</strong>verein<br />
angestellt sind, eigenständig die Schülerbetreuung. In den Betreuungszeiten können sich die<br />
Schüler kreativ und motorisch betätigen. Die Fachkräfte greifen hierbei die Bedürfnisse und<br />
Interessen <strong>der</strong> Schüler auf.<br />
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung wird in dieser Zeit angeboten.<br />
Schulportrait S-1
Schulkonferenz<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Siehe Hessisches Schulgesetz. Sie besteht aus fünf Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Elternschaft, fünf<br />
Kolleginnen und <strong>der</strong> Schulleiterin. Sie findet im Jahr je nach Bedarf ein- bis zweimal statt.<br />
Der För<strong>der</strong>verein<br />
Siehe Satzung vom 23.3.01 (im Anhang)<br />
Mit den Aufgaben<br />
[…]<br />
a) die Betreuung <strong>der</strong> Grundschüler<br />
b) die zur Verfügungstellung von Mitteln für die Beschaffung von zusätzlichem Arbeits- und<br />
Lehrmaterial<br />
c) <strong>der</strong> Kontakt zwischen Elternhaus und Schule<br />
d) die finanzielle Unterstützung von hilfsbedürftigen Schülern bei kulturellen Veranstaltungen<br />
und Tagesausflügen u.s.w.<br />
Schulgebäude und Außenanlage<br />
Schulgebäude<br />
Schulgebäude<br />
Bis 1970 bestand die Schule aus 2 Klassenräumen, einer für 1. bis 3. Schuljahr und einer für<br />
4. bis 6. Schuljahr.<br />
1970 erfolgte <strong>der</strong> schulische Zusammenschluss <strong>der</strong> Gemeinden Nie<strong>der</strong>seelbach – Engenhahn<br />
– Oberseelbach – Lenzhahn. Es wurden 4 Klassen gebildet (einzügig).<br />
Für die fehlenden Klassenräume wurde ein Pavillon mit 2 Klassenräumen, unterteilt von einem<br />
Lehrerzimmer in <strong>der</strong> Mitte, erstellt.<br />
Bis 1991 war die Schülerzahl so angewachsen, dass noch zwei Klassen gebildet werden<br />
mussten. Der Rheingau-Taunus-Kreis mietete dafür 1 Klassenraum in <strong>der</strong> Lenzenberghalle<br />
und 1 Klassenraum im ev. Gemeindehaus. Auf die Dauer war dies aber kein Zustand und <strong>der</strong><br />
Kreis beschloss, einen Anbau an das Schulgebäude, zumal die Schülerzahlen im Steigen<br />
waren.<br />
Nach Fertigstellung des Anbaus am 17.08.1992 verfügt die Schule nun über 8 Klassenräume,<br />
2 Mehrzweckräume, die als Küche, Werkraum und für Film- und Videovorführungen genutzt<br />
werden, und großzügige Flure (gut geeignet für klassenübergreifenden und offenen<br />
Unterricht).<br />
Im Obergeschoss kann <strong>der</strong> Mehrzweckraum durch Entfernen <strong>der</strong> Trennwand in eine Aula<br />
umgewandelt werden. Dieser verfügt über eine transportable Bühne und Scheinwerfer und<br />
wird u. a. für Schulfeiern und Theateraufführungen genutzt.<br />
1999 konnte <strong>der</strong> Raum, <strong>der</strong> für den Hausmeister gedacht war, als Computerraum umgebaut<br />
werden. Der Raum ist mit 7 PCs bestückt, die in den Unterricht einbezogen werden.<br />
Für den Sportunterricht steht zum ausschließlichen Gebrauch am Vormittag die unmittelbar an<br />
das Schulgelände grenzende Lenzenberghalle zur Verfügung.<br />
Die bis März 2000 extern genutzte 3-Zimmer Wohnung steht <strong>der</strong> Schule nun zur Verfügung.<br />
Hier wird ein Raum für die Bertreuung eingerichtet, sowie ein Raum für Lehr- und Lernmittel<br />
und eine Möglichkeit für Elterngespräche u. Ä.<br />
� Evaluation 2005<br />
Umbaumaßnahmen in den Betreuungsräumen und im Treppenhaus zur Sicherung des ersten<br />
und zweiten Fluchtweges<br />
Schulportrait S-2
� Evaluation 2006<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Sanierung des Altbaus, da die Kellerwände nass waren.<br />
- Dachdeckerarbeiten<br />
- Drainageverlegung auf <strong>der</strong> Schulhofseite<br />
- Reinigung des Entwässerungssystems unter dem Schulhof<br />
� Neue Wasserzuleitung, da zuvor noch Bleirohre lagen<br />
� Überarbeitung <strong>der</strong> Alarmanlage, da <strong>der</strong> warnende Klang zuvor zu leise war. Anbringung<br />
zusätzlicher Alarmmel<strong>der</strong> in Fluren und zwei Klassen.<br />
� Einbau von Feuerschutztüren im Werkraum/Küche und im Klassenraum Simon<br />
� Erweiterung des Lehrmittelraumes durch Umbaumaßnahmen im ehemaligen Dusch- und<br />
WC-Raum, so dass dort die neu angeschafften Karten- und Posteraufhängevorrichtungen<br />
aufgestellt werden können.<br />
� Alle Klassenräume wurden ehrenamtlich durch Eltern und Klassenlehrerinnen in den<br />
Sommer- und Herbstferien gestrichen<br />
� Planung für 2007/08<br />
� Optimale Platzierung <strong>der</strong> Kartenaufhängevorrichtungen durch Simon/Feuerbaum<br />
� sowie Sichtung und Überarbeitung des bisherigen und neuen Kartenmaterials (Trettin/Simon<br />
und Knapp/Wirtz), sodass eine<br />
� übersichtliche Anordnung innerhalb <strong>der</strong> Karten- und Postergestelle (Trettin/Feuerbaum)<br />
möglich wird.<br />
� Weitere Drainageverlegung an den übrigen Kelleraußenwänden ist notwendig und wird vom<br />
Kreis in die Wege geleitet.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
� Karten- sowie Posteraufhängungen wurden im Kartenraum optimiert.<br />
� Drainageverlegung am hinteren Haus wurde vom Kreis noch nicht in Angriff genommen.<br />
Herr Paff wurde im März darauf noch einmal hingewiesen<br />
� Schulgong und PA-Anlage wurde überarbeitet. Es ertönt <strong>der</strong> Schulgong am Ende je<strong>der</strong><br />
Pause.<br />
� Die drei Linden auf dem Schulhof erhielten einen größeren Baumschnitt zur Sicherheit und<br />
als Baum erhaltende Maßnahme.<br />
� Planung für 2008/09<br />
� Erneuerung <strong>der</strong> Klappläden an den Fenstern des alten Schulgebäudes<br />
� Sanierung <strong>der</strong> verletzten Hausfassade<br />
� Erneuerung <strong>der</strong> gebrochenen Terracottastufen am Schulhauseingang<br />
� Sanierung des Küchen-Werkraumes sowie Neumöblierung mit Hilfe von Sponsorengel<strong>der</strong>n<br />
und Eigenleistungen<br />
� Einbau einer schalldichten Türe im Rektorat<br />
� Ergänzung <strong>der</strong> bemalten Flusssteine vor <strong>der</strong> Hausfront durch eine Schenkung <strong>der</strong> Familie<br />
Schnei<strong>der</strong> aus Engenhahn – Aktion engagierter Eltern holt die Steine zur Schule<br />
Schulportrait S-3
� Evaluation 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Hausfassade wurde saniert<br />
� Terracottastufen wurden ausgetauscht<br />
� Küchen-Werkraum wurde saniert, mit neuen Möbeln versehen und somit auch zum<br />
Mensabereich erklärt<br />
- Die neue größere Küchenzeile im L-Format wurde eingebaut<br />
- Neu hinzu kam eine Spülmaschine und zwei Dunstabzugshauben mit Entlüftung nach<br />
Außen<br />
- Ausstattung <strong>der</strong> Küchenschränke mit neuem Geschirr, Besteck und Töpfen sowie einem<br />
elektrischen Zerkleinerungsstab<br />
- Neue verschließbare Werkschränke und Regalschränke mit enorm vergrößertem<br />
Fassungsvermögen und guten Lager- und Trocknungsmöglichkeiten von Schülerwerken<br />
- Überarbeitung (Abhobeln, Schmirgeln, Lackieren) <strong>der</strong> Werktische<br />
- Erneuerung <strong>der</strong> Esstische in farblicher Abstimmung zur Küchenzeile<br />
- Neue einheitliche Bestuhlung: 15 Hocker dunkelbraun, 15 Hocker hellgrün<br />
Somit entstand ein lichter, einheitlich gestalteter Raum, <strong>der</strong> auch zum Feiern einlädt.<br />
� Schalldichte Türe im Rektorat wurde eingebaut<br />
� Flusssteine <strong>der</strong> Familie Schnei<strong>der</strong> wurden zur Schule transportiert<br />
� Erneuerung des Heizungskellerfensters<br />
� Trockenlegung des Requisitenkellers<br />
� Überprüfung des Heizungssystems<br />
� Probeweise Verlegung zweier automatisch regulieren<strong>der</strong> Raumthermostate zur besseren<br />
Regulierung aller Klassentemperaturen, da einige Klassen überheizt waren.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
� Seit Oktober <strong>2010</strong> wurde die <strong>Lenzenbergschule</strong> ins Landesprogramm „Ganztägig<br />
lernende Schule“ aufgenommen. Dieses Programm („PÄM“: Pädagogische<br />
Mittagsbetreuung) startete drei Jahre früher als erwartet, da wir bereit waren für eine<br />
„abgesprungene“ Schule im Rheingau „einzuspringen“. Hiermit kommen wir dem<br />
zunehmenden Wunsch <strong>der</strong> Elternschaft nach ganztägigem Lernen und Betreut sein ihrer<br />
Kin<strong>der</strong> sehr entgegen.<br />
Die multifunktionale Raumnutzung im Rahmen <strong>der</strong> „Pädagogischen Mittagsbetreuung“<br />
erfolgt zur großen Zufriedenheit aller Beteiligten. Zusätzliche Anbauten werden nicht<br />
gefor<strong>der</strong>t.<br />
Landrat Albers sowie Schulamtseiter des Rheingau-Taunus-Kreises Herr Schardt loben das<br />
Konzept <strong>der</strong> „Ganztägig lernenden Schule“, das den Schülern und Eltern eine große<br />
Transparenz <strong>der</strong> Lernbereiche am Mittag und Nachmittag durch die „Regenbogenwand“ vor<br />
dem Sekretariat gewährt und gleichzeitig die finanzielle Lage des Kreises berücksichtigt bei<br />
<strong>der</strong> flexiblen Nutzung <strong>der</strong> bestehenden Klassen- und Fachräume.<br />
� Der Unterrichtsbeginn wurde ab Februar <strong>2011</strong> um eine dreiviertel Stunde von 7.30 Uhr auf<br />
8.15 Uhr verschoben, somit auch die Schulgongeinstellung. Zusätzlich ertönt nun auch <strong>der</strong><br />
Gong nach <strong>der</strong> 5. Stunde um 12.40 Uhr (im Winter um 12.38 wegen des aufwendigeren<br />
Ankleidens <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>).<br />
� Die Regelung <strong>der</strong> Klassenraumtemperaturen hat sich verbessert durch die Verlegung <strong>der</strong><br />
Raumthermostate.<br />
� Anschaffung weiterer 10 Hocker für den Mensabereich, da sich die Schülerzahlen beim<br />
gemeinsamen Mittagessen im Rahmen <strong>der</strong> „PÄM“ erhöht haben.<br />
� Erneuerung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>rahmen im Treppenhaus zur Ausstellung <strong>der</strong> Schülerwerke.<br />
� Ausstattung des Sekretariates und des Rektorates mit einer neuen Telefonanlage.<br />
Schulportrait S-4
� Planung für <strong>2011</strong>/12<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Austausch <strong>der</strong> Waschbecken und Armaturen in allen 8 Klassenzimmern. Sie sollten größer,<br />
tiefer und dadurch funktionaler werden, und die Armaturen den Wasserstrahl so ins Becken<br />
ergießen, dass es weniger spritzt.<br />
� Anbringung von 3 Außenrollos in den beiden Klassenräumen links vom Haupteingang, da<br />
diese nun intensiver im Mittags- und Nachmittagsbereich genutzt werden und im Sommer<br />
sich durch die Sonneneinstrahlung aus Süden und Westen sehr aufheizen.<br />
� Reparaturen am Sonnensegel <strong>der</strong> Glaskuppel.<br />
� Erneuerung des Rollomotors im Mensa-/Werkbereich.<br />
� Überprüfung <strong>der</strong> elektrischen Leitungen im Küchenbereich, um evt. eine zweite<br />
Spülmaschine anzuschaffen.<br />
� Schulleitung und Schulelternbeirat sammeln Informationen über die Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Überwachung von Raumluftqualität durch ein entsprechendes Gerät in den Klassen. Die<br />
Erfahrung in den letzten sehr kalten Wintern brachte die Erkenntnis, dass mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit nicht genug in den Räumen gelüftet wird und somit <strong>der</strong> Sauerstoffgehalt<br />
zu niedrig wird. Das Signal eines entsprechenden Gerätes könnte Schüler und Lehrer an<br />
ausreichendes Lüften erinnern. Erste Recherchen <strong>der</strong> Schulleiterin im Internet weisen darauf<br />
hin, dass ein Einbau lediglich ein Einstecken in die Steckdose bedeutet und etwa ein<br />
Kostenaufwand von 200 € pro Klasse erfor<strong>der</strong>lich wird. Der Schulelternbeirat schlägt vor,<br />
versuchsweise dann mit nur einer Klasse zu beginnen, um die Wirkung und Funktionalität<br />
des Gerätes erst einmal zu überprüfen.<br />
Außenanlage<br />
Außenanlage<br />
Für die Gestaltung des Schulhofes waren nach Fertigstellung des Anbaus nur noch begrenzte<br />
Mittel vorhanden, die für die nötigsten Umgestaltungen verwendet wurden. Die Wiese neben<br />
dem Schulgebäude wurde durch eine wassergebundene Decke ersetzt und mit 2<br />
Spielgeräten versehen. Hinter dem Schulgebäude wurde eine Wiese für die Nutzung als<br />
Bolzplatz angelegt.<br />
Auf dem Schulgelände befinden sich weiterhin:<br />
1 wetterfeste Tischtennisplatte<br />
2 Sitzgruppen (2 Tische und 4 Bänke)<br />
1 Balancierbalken<br />
3 lange Sitzbänke<br />
7 Stelzen am Hang<br />
1 Kletterrampe mit Seil<br />
Durch zahlreiche Spenden aus Elternschaft, Vereinen, Politik und Wirtschaft waren diese<br />
Anschaffungen möglich.<br />
Von Eltern wurde <strong>der</strong> Schulhof mit Spielfeldmarkierungen und verschiedenen Hickelhäuschen<br />
versehen.<br />
Zukünftige Planung:<br />
Da die wassergebundene Decke auf dem Schulhof durch Regen ausgewaschen und von<br />
tiefen Rinnen durchzogen ist, was Verletzungsgefahren birgt, soll die Fläche im nächsten Jahr<br />
gepflastert werden.<br />
Schulportrait S-5
� Evaluation 2003-05<br />
Ergänzung folgen<strong>der</strong> Spielgeräte:<br />
� Kletterhaus<br />
� Klettergerüst<br />
� Wackelsteg<br />
� Planung für 2006<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Fallschutzän<strong>der</strong>ung unter dem Klettergerüst: Entfernung <strong>der</strong> Kieselsteine, Anbringung von<br />
Fallschutzmatten<br />
� Evaluation 2006<br />
Durchführung <strong>der</strong> Verlegung <strong>der</strong> Fallschutzmatten unter dem Klettergerüst, nachdem <strong>der</strong><br />
Sponsorenlauf die fehlenden Gel<strong>der</strong> einbrachte.<br />
Die Fallschutzmatten haben sich bewährt. Der Schulhof ist sauberer, <strong>der</strong> Kehrdienst sowie <strong>der</strong><br />
Hausmeister haben hier weniger zu tun. Die Schüler sind bei Rangeleien und Stürzen weniger<br />
gefährdet.<br />
� Planung für 2007/08<br />
Auch in <strong>der</strong> Umgebung des Kletterhauses sollen die Kieselsteine entfernt werden und<br />
Fallschutzmatten verlegt werden. Übrig gebliebene Fallschutzmatten (vom Klettergerüst) wurden<br />
zurückgegeben gegen Gutschein von etwa 800 Euro. Weitere 2000 Euro bewilligte <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>verein für eine möglichst preisgünstige Verlegung unter eventueller Mitbeteiligung von<br />
Eltern. Die freiwillige Feuerwehr Nie<strong>der</strong>seelbach entfernte schon eine große Wurzel, als<br />
Vorbereitung zur Verlegung von Fallschutzmatten.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
� Fallschutzmatten wurden ums Kletterhaus verlegt<br />
� Über dem Wackelsteg erhielten die Kronen <strong>der</strong> Linden einen Baumschnitt.<br />
� Ein Teil des Schulhofzaunes und <strong>der</strong> Hainbuchenhecke wurde erneuert<br />
� Evaluation 2009/10<br />
� Instandhaltung von Kletterhaus, Klettergerüst und Wackelsteg durch Erneuerung einzelner<br />
verschlissener Elemente<br />
� Sicherung des Hanges unterhalb des Kletterhauses<br />
� Erneuerung des Zaunes neben dem Kletterhaus oberhalb des Hanges<br />
Schulportrait S-6
� Planung <strong>2010</strong><br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Sanierung des Hanges neben <strong>der</strong> Treppe und dem Laufsteg zur Turnhalle, sodass kein<br />
Erdreich mehr abrutschen kann und gartenbauliche Fahrgerätschaften die hintere Wiese gut<br />
erreichen können.<br />
� Erweiterung <strong>der</strong> Bushaltestelle aufs Schulgelände durch Versetzung des Zaunes nach innen<br />
und Aufhebung des Drängelgitters mit dem Ziel:<br />
- Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> weiterführenden Schule sollen mehr Aufstellfläche<br />
bekommen, da <strong>der</strong> Bürgersteig viel zu schmal ist<br />
- Dadurch kein Blockieren <strong>der</strong> Eingänge zum Schulhof für Schüler und Lehrer unserer<br />
Schule<br />
� Wir erbaten uns beim Kreis die Verlegung des Buseinstiegs frem<strong>der</strong> Schüler. Eine<br />
Probehaltestelle wurde nach einigen Beratungsgesprächen <strong>der</strong> Schulleiterin mit Vertretern<br />
<strong>der</strong> RMV, <strong>der</strong> ORN, <strong>der</strong> Polizei, <strong>der</strong> Feuerwehr und <strong>der</strong> Kreisverwaltung für gut befunden,<br />
für einige Wochen in <strong>der</strong> Nähe des Spielplatzeingangs eingerichtet und brachte aus unserer<br />
Sicht auch den gewünschten Erfolg. Durch ein Anwohnerveto wurde diese Lösung jedoch<br />
wie<strong>der</strong> aufgehoben.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
� Die Sanierung des Hanges neben <strong>der</strong> Treppe erfolgte durch Aufbringung von Beton.<br />
� Die Holzrampe zwischen Schulhof und Eingangsbereich <strong>der</strong> Sporthalle wurde erneuert.<br />
� Die Bushaltestelle wurde nach Plan verän<strong>der</strong>t. Die Vergrößerung <strong>der</strong> Aufstellfläche <strong>der</strong><br />
Schüler hat sich bewährt. Alle Erwartungen an die Verän<strong>der</strong>ung haben sich erfüllt.<br />
� Die Naturparkbänke unter den Linden wurden durch Fa. Reuter aus Waldems erneuert. Es<br />
handelt sich um Eichenbänke mit Kunststoffpfosten, die ins Erdreich eingebracht wurden.<br />
� Planung für <strong>2011</strong>/12<br />
Überarbeitung des Hanges zwischen Schulhof und Sporthalle, um das Erdreich um die Bäume<br />
zu erhöhen und gleichzeitig abzufangen.<br />
Schulportrait S-7
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Schulportrait S-8
Leitbild<br />
Bildungs- und Erziehungsziele<br />
Unsere Schule soll ein Ort sein, in welchem<br />
� sich je<strong>der</strong> angenommen fühlt und<br />
� sich je<strong>der</strong> angstfrei einbringen kann.<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Um den umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrag zu erfüllen, müssen die wichtigsten<br />
Zielsetzungen von Schule und Elternhaus gemeinsam getragen werden.<br />
Schülerinnen und Schüler<br />
Im Hinblick auf unsere Schülerinnen und Schüler<br />
Als unser Hauptziel sehen wir die Persönlichkeitsentfaltung unserer Kin<strong>der</strong> an, d. h.,<br />
wir wollen unsere Einzelentscheidungen daran orientieren, dass<br />
� das Selbstvertrauen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> erhalten bleibt und geför<strong>der</strong>t wird<br />
� Leistungsbereitschaft und Lernfreude unterstützt werden<br />
� Urteils- und Gemeinschaftsfähigkeit ausgebaut werden<br />
� Schüler/innen erfahren, das ihre Arbeitsbeiträge und -ergebnisse eine eigene<br />
Wertigkeit haben<br />
� Schüler/innen ihre Stärken positiv einsetzen und mit ihren Schwächen umgehen<br />
können<br />
� Verantwortung für die Natur / Umwelt und den eigenen Körper übernommen werden<br />
kann<br />
Die wichtigsten Voraussetzungen um diese Ziele zu erreichen sind für uns:<br />
Wir bringen unseren Kin<strong>der</strong>n Vertrauen entgegen, sehen sie also positiv.<br />
Wir trauen ihnen etwas zu, nehmen sie also ernst.<br />
Das bedeutet auch, dass wir (Lehrer /Eltern)<br />
� die vier Grundschuljahre als ein wichtiges Bindeglied zwischen den<br />
vorschulischen Erfahrungen und <strong>der</strong> unterschiedlichen Ausgangs- und<br />
Interessenlage des einzelnen Kindes und den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> weiterführenden<br />
Schulen sowie des Erwachsenwerdens begreifen<br />
� unseren Kin<strong>der</strong>n angemessene Fortschritte ermöglichen und sie in je<strong>der</strong><br />
Weise gemeinsam unterstützen<br />
� uns auf dem Weg <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu Selbständigkeit und Mündigkeit Stück für Stück<br />
zurücknehmen.<br />
Das Verfolgen unserer Ziele wird durch die Überschaubarkeit unserer Schule und die<br />
fehlende Anonymität erleichtert:<br />
Je<strong>der</strong> sollte sich im positiven Sinne persönlich beachtet,<br />
persönlich geachtet,<br />
persönlich gefor<strong>der</strong>t,<br />
persönlich verantwortlich fühlen.<br />
Leitbild L-1
Schülerinnen und Schüler<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Wichtige Teilziele zur För<strong>der</strong>ung des Sozial- und Lernverhaltens sind für uns:<br />
Sozialverhalten<br />
Verantwortung für eigenes Verhalten übernehmen:<br />
� Aufbau von Einsicht (Ursache – Folge) und Wie<strong>der</strong>gutmachung<br />
� „Strafe“, soweit nötig, als logische Konsequenz erfahren<br />
� die Notwendigkeit von Regeln erkennen können<br />
� mit Feiräumen umgehen können („offene“ Schule)<br />
� eigene Interessen angemessen vertreten können<br />
Wir-Gefühl entwickeln:<br />
� gegenseitige Achtung entwickeln, Rücksicht nehmen<br />
� sich für an<strong>der</strong>e einsetzen können<br />
� hilfsbereit sein, trösten und Mut machen können<br />
� An<strong>der</strong>sartigkeit tolerieren, nicht ausgrenzen<br />
� Strategien zur Konfliktbewältigung entwickeln<br />
� Teamfähigkeit entwickeln, miteinan<strong>der</strong> lernen können<br />
in <strong>der</strong> Klassen- und Schulgemeinschaft mitwirken können:<br />
� Kreisgespräche (Klassenrat) als Möglichkeit zum Ansprechen und<br />
Regeln von Problemen erfahren<br />
� eigene Bedürfnisse und die <strong>der</strong> Gemeinschaft in <strong>der</strong> Schulordnung (siehe Anhang)<br />
erkennen können und diese einhalten wollen<br />
� Verantwortung für an<strong>der</strong>e übernehmen: Klassendienste, Klassensprecher,<br />
Pausen- und Hofdienste, Türdienst, Patenklassen<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Paten über den ersten Schultag hinaus:<br />
o Einführung Hof, Gebäude, Schulregeln<br />
o Vorlesestunden (P liest PK vor, später umgekehrt)<br />
o Gemeinsame Sport-/Spielstunde und ähnliches<br />
� Eigentum von Schule und Mitschüler/innen achten<br />
Lernverhalten<br />
� selbständiges und selbstbestimmtes Lernen anbahnen<br />
� Neugierde und Motivation erhalten und entwickeln<br />
� durch verschiedene Unterrichtsmethoden, differenzierte För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
individuelle Lernentwicklung in Gang setzen<br />
� sinnliche Aufnahmefähigkeit intensivieren<br />
� unmittelbare Erfahrungen (handeln<strong>der</strong> Umgang) im schulischen und außer-<br />
schulischen Bereich ermöglichen<br />
� Kreativität (eigene Denk- und Gestaltungsprozesse) för<strong>der</strong>n<br />
� vielfältige Sprecherfahrungen anbieten.<br />
� Ordnung, Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft, Zielstrebigkeit und Arbeits-<br />
ruhe im schulischen und häuslichen Bereich entwickeln und einfor<strong>der</strong>n<br />
Leitbild L-2
Kollegium Eltern<br />
Im Hinblick auf unser Kollegium<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Für eine pädagogisch erfolgreiche Arbeit, die motivierend für die Schüler/innen,<br />
transparent für <strong>der</strong>en Eltern und informativ und richtungweisend für die jetzigen und<br />
zukünftigen Pädagogen und Pädagoginnen an unserer Schule sein soll, halten wir es für<br />
grundsätzlich wichtig, dass ein Konsens in <strong>der</strong> gemeinsamen pädagogischen<br />
Verantwortung besteht.<br />
Für die erfolgreiche Arbeit im Kollegium ist es wichtig, dass<br />
� <strong>der</strong> Umgang miteinan<strong>der</strong> geprägt ist von Höflichkeit, Sachlichkeit und<br />
Hilfsbereitschaft<br />
� kontroverse Ansichten als Bereicherung verstanden werden<br />
� die pädagogische Freiheit eines jeden gewahrt bleiben muss<br />
� Toleranz geübt werden sollte bei verschiedenen Lehr- und Lernmethoden<br />
� Offenheit besteht bei Meinungsverschiedenheiten<br />
� Absprachen und Beschlüsse eingehalten werden<br />
� die Aufgabenverteilung innerhalb des Kollegiums einvernehmlich geschieht<br />
� eine rege Kommunikation auch über die Pädagogik hinaus gepflegt wird, denn nur<br />
so lassen sich die Qualitäten eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin besser<br />
kennen lernen<br />
� das Kollegium dafür sorgt, dass die Schule ein angenehmer Aufenthaltsort ist<br />
� die einzelnen Lehrerinnen sich als Lernbegleiter ihrer Schüler/innen verstehen und<br />
diese in ihrem individuellen Lernprozess begleitend unterstützen und för<strong>der</strong>n, so<br />
dass alle unsere Schüler die vereinbarten Kernkompetenzen erlangen.<br />
Ein Merkmal unserer Schule ist die Überschaubarkeit, die es uns ermöglicht, einen<br />
intensiven pädagogischen Austausch zu pflegen und viele Einzelfragen auf dem „kurzen<br />
Weg“ zu regeln. Tragendes Element unserer Arbeit ist das ehrliche pädagogische<br />
Bemühen jedes Einzelnen auf seine persönliche Art und die grundsätzliche Akzeptanz<br />
dieses Bemühens durch die Kolleginnen und Kollegen.<br />
Im regelmäßigen wöchentlichen Austausch am Freitagmorgen, dem sogenannten<br />
„Briefing“, informieren sich die Kolleginnen und die Schulleiterin gegenseitig und zeitnah<br />
über wichtige Ereignisse, eventuelle Sorgen und aktuelle Probleme. Hier hat sich ein<br />
Unterstützungssystem aller Beteiligten entwickelt, auf das niemand mehr verzichten<br />
möchte. Hier werden Pläne für die Gesamtkonferenz und die Jahresplanung<br />
geschmiedet. Hier findet <strong>der</strong> entscheidende zeitnahe Informationsaustausch zwischen<br />
Gedanken des Schulelternbeirats und <strong>der</strong> Elternbeiräte über die Schulleiterin, <strong>der</strong><br />
Klassen, <strong>der</strong> Lehrerinnen und <strong>der</strong> Schulleiterin selbst statt.<br />
Im Hinblick auf die Eltern<br />
Die positive Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist nur dann gewährleistet, wenn <strong>der</strong><br />
Erziehungsauftrag seitens <strong>der</strong> Schule und des Elternhauses erfüllt wird.<br />
Das heißt auch, dass<br />
� die Eltern den Lehrkräften mit einem positiven Grundvertrauen gegenüberstehen<br />
� bei Unklarheiten ein offener Dialog gesucht wird<br />
� die Eltern dafür sorgen, dass die Kin<strong>der</strong> gewissenhaft und ungestört ihre<br />
Hausaufgaben erledigen können und ausgeruht zur Schule kommen<br />
� das notwendige Arbeitsmaterial rechtzeitig vorhanden ist<br />
� die Eltern ihr Interesse an <strong>der</strong> Schule bekunden, indem sie sich bei Festen und<br />
Veranstaltungen einbringen<br />
Leitbild L-3
Eltern<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Eine weitere wichtige Säule <strong>der</strong> erfolgreichen pädagogischen Arbeit ist ein<br />
vertrauensvoller, freundlicher und informativer Umgang mit den Eltern. Das beinhaltet:<br />
� Transparenz von Lerninhalten, Lehrmethoden und Leistungsbewertung<br />
� regelmäßig stattfindende Elterabende<br />
� individuelle Informationsgespräche über den Leistungsstand des betreffenden Kindes<br />
in regelmäßigen Abständen<br />
� Gesprächsbereitschaft in den im Stundenplan verankerten Lehrersprechstunden<br />
nach Voranmeldung<br />
� Informationen beim Übergang in eine weiterführende Schule<br />
� gemeinsame Beobachtung <strong>der</strong> Lernfortschritte des Kindes und Annahme<br />
pädagogischer Hilfestellungen<br />
� gemeinsame Kontrolle bei dem pfleglichen Umgang mit Schuleigentum<br />
Die Professionalität von Schule in ihrer pädagogischen, psychologischen und<br />
didaktischen Kompetenz muss gewahrt bleiben und es sollten klare Grenzen zwischen<br />
Lehrer- und Elternarbeit beachtet werden.<br />
Unterrichtsziele<br />
Inhalte<br />
� Inhalte sind das, was in den einzelnen Fächern gelernt wird.<br />
� Die Lehrpläne bestimmen die Inhalte des Unterrichts in den einzelnen Jahrgangsstufen.<br />
� Daraus entwickelt unsere Schule den schuleigenen Rahmenplan, den es gilt im Unterricht zu<br />
konkretisieren.<br />
Methoden und Formen des Unterrichts<br />
� Sie dienen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> individuellen Leistungsentwicklung, <strong>der</strong> Eigenverantwortung<br />
und <strong>der</strong> Selbständigkeitserziehung und sollen den einzelnen Schülern mit ihren beson<strong>der</strong>en<br />
Fähigkeiten und Begabungen gerecht werden.<br />
� Dazu gehören in vielfältiger Anwendung<br />
� Frontalunterricht – Unterrichtsgespräch<br />
� Einzelarbeit – Stillarbeit<br />
� Arbeit am PC<br />
� Partnerarbeit<br />
� Gruppen- und Teamarbeit<br />
� Tagesplanarbeit<br />
� Wochenplanarbeit<br />
� Stationsarbeit<br />
� im Klassenunterricht,<br />
� Jahrgangsunterricht<br />
� und jahrgangsübergreifen<strong>der</strong> Unterricht (z. B. Wahlpflichtunterricht unserer so genannten<br />
AGs)<br />
� Projekte und Projektwochen<br />
Die Vermittlung <strong>der</strong> Lerninhalte soll mit den best möglichen Anschauungs- und Lernmaterialien<br />
unter dem Gesichtspunkt des Lernens mit allen Sinnen stattfinden.<br />
Das Ziel <strong>der</strong> nahen Zukunft wird sein, die Lerninhalte zu verknüpfen mit dem zu erarbeitenden<br />
Kerncurriculum unserer Schule. Dieses Kerncurriculum wird die zu erreichenden<br />
übergeordneten Kernkompetenzen unserer Schüler/innen als auch die Kernkompetenzen in den<br />
Fächern Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch beschreiben.<br />
Leitbild L-4
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Das <strong>Schulprogramm</strong> und seine Entwicklungsbereiche E0
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Kommunikation und ihre Wege innerhalb <strong>der</strong><br />
Schule / Transparenz<br />
Analyse des Kommunikationsbedarfs<br />
und <strong>der</strong> Kommunikationsstruktur, die zeigt,<br />
� wie komplex das Miteinan<strong>der</strong> ist,<br />
� wie zentral die Rolle <strong>der</strong> Schulleiterin und des Sekretariates ist,<br />
� wie bedeutend die Weitergabe von Information <strong>der</strong> Schulleiterin an die entsprechenden<br />
Gremien ist<br />
� und somit das Fundament ist für ein demokratisches Verständnis von Schulleitung und<br />
Schulleben<br />
Die Analyse macht uns deutlich, dass unser Kollegium mehr Gesprächsgelegenheiten mit<br />
<strong>der</strong> Schulleiterin benötigt um die vielen aktuellen Informationen zeitnah mit allen Kollegen<br />
auszutauschen.<br />
Grundschulrektoren<br />
des RTK<br />
Personalrat<br />
2 Kin<strong>der</strong>gärten<br />
(Engenhahn,<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach)<br />
Abwesenheitsvertreterin<br />
Vorsitz<br />
För<strong>der</strong>verein<br />
Vereine + Organisationen<br />
Schüler und<br />
Klassensprecher<br />
BFZ-Lehrer<br />
Benachbarte<br />
Grundschulen<br />
(Neuhof, Ndh.)<br />
Staatliches<br />
Schulamt mit<br />
Schulrätin<br />
Sprachheillehrerin<br />
Rektorin<br />
Sekretariat<br />
Kollegium<br />
Kreisverwaltung<br />
mit Hr. Schardt<br />
Schulpsychologischer<br />
Dienst<br />
Kommunikationsstruktur<br />
Weiterführende<br />
Schulen (bes.<br />
Theißtalschule)<br />
Betreuungsleitung<br />
2 Kirchengemeinden<br />
Schulelternbeirat<br />
Elternbeiräte<br />
Elternnotdienst<br />
AP: Dr. Scheele<br />
und weitere<br />
Kin<strong>der</strong>ärzte<br />
Busunter-nehmen<br />
RMV/ORN<br />
Kommunikation und ihre Wege innerhalb <strong>der</strong> Schule / Transparenz E1-1<br />
Eltern<br />
Konsequenz aus dieser Analyse: Einrichtung des wöchentlichen „Briefings“<br />
Das Briefing ist eine wöchentliche Kurzkonferenz, in <strong>der</strong> Schulleiterin und Kolleginnen<br />
- sich gegenseitig über Aktionen und Nachrichten informieren,<br />
- sich beraten können<br />
- und kurzfristig Entscheidungen treffen können.<br />
Es findet freitags von 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr statt. Start: September 04
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Evaluation 2005<br />
- Weitergabe von Informationen Schulleiter Lehrer<br />
- Kollegen beginnen mit ihren Anliegen<br />
- Vorherige Sichtung <strong>der</strong> Meldungen, damit je<strong>der</strong> zu Wort kommen kann<br />
- Die Schulleitung protokolliert die Ergebnisse<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Evaluation 2006<br />
Das Briefing hat sich als Mittel <strong>der</strong> zeitnahen Kommunikation untereinan<strong>der</strong> und als Mittel <strong>der</strong><br />
Transparenz von Schulorganisation und Schulleitung sehr bewährt.<br />
Die Schulleiterin legte Protokollbücher <strong>der</strong> Jahre 04, 05, 06 und 07 an.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Die Schulleiterin führte Anfang 2007 das Jahresgespräch mit ihren Kolleginnen ein.<br />
Innerhalb einiger Wochen führte sie mit allen Kolleginnen Zielvereinbarungs- und<br />
Evaluationsgespräche durch. Der Schulleiterin liegt dabei am Herzen, ihre Wertschätzung ihren<br />
Kolleginnen gegenüber auszudrücken. Diese Jahresgespräche wurden von allen Beteiligten als<br />
angenehm, wohltuend und nützlich empfunden.<br />
Einrichtung <strong>der</strong> „Ideenbörse“ Sept. 04<br />
Eine Pinnwand, die sich im Lehrerzimmer befindet, nimmt die Ideen und Vorschläge <strong>der</strong><br />
Schulleitung, des Kollegiums sowie <strong>der</strong> Elternvertreter auf. Diese Vorschläge werden nach<br />
Beschluss <strong>der</strong> Gesamtkonferenz o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schulkonferenz ins <strong>Schulprogramm</strong><br />
aufgenommen.<br />
� Evaluation 2005<br />
Viele Vorschläge fanden auf diese Weise Eingang ins <strong>Schulprogramm</strong>:<br />
- Unsere Schule soll einen Namen bekommen<br />
- Neues Zeugnisformular<br />
- Neuer Briefkopf<br />
- Entscheidung: Neues Mathematikbuch<br />
- Kriterien für unser neues Mathematikbuch<br />
- Training für die Paten <strong>der</strong> 1.-Klässler mit einem Streitschlichterprogramm (Herr Hölzel)<br />
- „Run<strong>der</strong> Tisch“- Gespräch<br />
Thema: Verschmutzung des Schulhofs<br />
Beteiligte: Vorsitzende des Elternbeirats, des För<strong>der</strong>vereins, des Elternvereins,<br />
Ortsvorsteher Nie<strong>der</strong>seelbach, Bürgermeister Nie<strong>der</strong>nhausen,<br />
Schulamtsleiter Bad Schwalbach, Personalrätin, Schulleiterin<br />
- Die Ideenbörse wird zurzeit wenig genutzt, da das Kollegium bereits an vielen Projekten<br />
Arbeitet und Ideen verwirklicht<br />
� Planung für 2006<br />
1. Erweiterung <strong>der</strong> Kommunikationskompetenz/Gesprächsführung <strong>der</strong> Lehrer untereinan<strong>der</strong>,<br />
mit Schülern und Eltern<br />
2. Schulkonferenzmitglie<strong>der</strong> werden zu Elternbeiratssitzungen eingeladen<br />
3. Programmgespräche nach Neuwahl des Schulelternbeirates<br />
Beteiligte: Schulelternbeiräte, Schulleiterin, Personalrätin<br />
Kommunikation und ihre Wege innerhalb <strong>der</strong> Schule / Transparenz E1-2
� Evaluation 2006<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
zu 1. Eine Fortbildung zur Erweiterung <strong>der</strong> Kommunikationskompetenz und Gesprächsführung<br />
fand mit Frau Olowson an 2 Nachmittagen in Kooperation mit dem Kollegium <strong>der</strong> Sonnenschule<br />
in Neuhof statt. Die Kollegien waren sehr mit diesen Veranstaltungen zufrieden und wünschen<br />
sich eine Fortsetzung in späteren Jahren.<br />
zu 3. Die Einführung <strong>der</strong> Programmgespräche wurden erweitert und finden zu Beginn jeden<br />
Schuljahres mit dem Elternbeirat, seinem Stellvertreter, <strong>der</strong> Schulleiterin und <strong>der</strong> Personalrätin<br />
statt, so dass durch die entstehende Transparenz und gemeinsame Planung Zufriedenheit aller<br />
Beteiligten und Erfolg bei den zu lösenden Problemen gesichert wurde.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
� Um die Kommunikation <strong>der</strong> Elternbeiräte, des Schulelterbeirates, <strong>der</strong> Eltern untereinan<strong>der</strong><br />
zu verbessern und den regen Austausch zwischen Eltern und Schule zu intensivieren,<br />
vereinbaren Schulleiterin und Schulelternbeiratsvorsitzen<strong>der</strong> Herr Haese die<br />
Schulelternbeiratssitzung mindestens zweimal im Schulhalbjahr die<br />
Schulelternbeiratssitzung abzuhalten.<br />
� Die Elternbeiräte sollten an den Elternabenden <strong>der</strong> jeweiligen Klassen in einem etablierten<br />
Tagesordnungspunkt regelmäßig von den Schulelternbeiratssitzungen berichten.<br />
� In einem innerschulischen Prozess und mit Hilfe einer Supervision, mehrer<br />
Zielvereinbarungsgespräche mit dem Personalrat und <strong>der</strong> Sekretärin, mit einer<br />
Hausmitteilung verän<strong>der</strong>t die Schulleitung innerhalb des Schulpersonals durch Klärung und<br />
Abgrenzung <strong>der</strong> Kompetenzbereiche die Kommunikations- und Machtstrukturen.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
� Es finden mindestens zweimal im Schulhalbjahr Schulelternbeiratssitzungen statt.<br />
� Per E-Mails steht <strong>der</strong> Elternbeiratsvorsitzende Herr Haese im regen Kontakt mit den<br />
Klassenelternbeiräten.<br />
� Der E-Mail-Kontakt zwischen Schulleitung und Vorsitzenden des Elternbeirates und dieser<br />
wie<strong>der</strong>um mit den jeweiligen Klassenbeiräten vergrößert die Transparenz <strong>der</strong> anstehenden<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> zu treffenden Entscheidungen.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Elternbeiräte <strong>der</strong> Klassen informieren per E-mail zeitnah ihre Eltern durch Übersendung des<br />
Protokolls <strong>der</strong> Schulelternbeiratssitzung.<br />
� Planung <strong>2011</strong>/12<br />
Abfrage <strong>der</strong> Elternschaft, ob diese „Informationsbahn“ bei allen Elternbeiräten funktioniert hat<br />
und auch alle Eltern erreicht werden konnten.<br />
Kommunikation und ihre Wege innerhalb <strong>der</strong> Schule / Transparenz E1-3
<strong>Stand</strong> 2003/04<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und<br />
Lehrer<br />
1. Entwicklungsziel: Gewährleistung <strong>der</strong> Sicherheit in den Gebäuden und <strong>der</strong> Turnhalle<br />
Projekt 1 Überprüfung <strong>der</strong> Sicherheit (Okt.03 ) durch Schulleiterin mit Schul- und<br />
Sportamtsleiter<br />
Projekt 2 Reparatur an Geräten und Innenräumen <strong>der</strong> Halle (Okt. 03 – Okt. 04)<br />
Projekt 3 Sicherung <strong>der</strong> Giftstoffe<br />
� Evaluation 2005<br />
Es zeigt sich, dass <strong>der</strong> Hausmeisterraum weiter umfunktioniert werden muss, da dieser<br />
Bereich gleichzeitig Durchgang zu den Betreuungsräumen ist.<br />
� Evaluation 2006<br />
- Stahlregal und die Stahlschränke wurden neu platziert und um einen weiteren<br />
abschließbaren Stahlschrank aus dem Werkraum ergänzt, sodass gefährliche Substanzen<br />
nun dort eingeschlossen werden und gleichzeitig ein gefälligerer Eindruck dieses Raumes<br />
entsteht.<br />
- Ein neues Wasserbecken wurde montiert. Dinge fanden eine neue Anordnung und<br />
werden zum Teil im Keller aufbewahrt.<br />
- Darüber hinaus wurde eine Neuorganisation <strong>der</strong> Aufbewahrungssysteme auch in an<strong>der</strong>en<br />
Räumen notwendig, um eine bessere Schul- und Unterrichtsorganisation zu ermöglichen<br />
- Engoben für das Arbeiten mit Ton fanden im neu platzierten Werkraumschrank eine<br />
sicherere Aufbewahrung.<br />
- Der Papierschubschrank fand seinen neuen und besser zugänglichen Platz im Sekretariat<br />
unter <strong>der</strong> Schneidemaschine und dem Laminiergerät.<br />
- Ein Jalousieschrank wurde über den Kreis organisiert und im Treppenhaus des<br />
Untergeschosses aufgestellt, um Fundsachen aufzunehmen.<br />
- Ein weiterer Jalousieschrank wurde im Arztzimmer aufgestellt, um von Lehrern<br />
auszuleihende Schulbuchexemplare aufzunehmen.<br />
- Das Aufbewahrungssystem im Sekretariat wurde ergänzt, so dass weitere Akten und<br />
Materialien für den Vertretungsunterricht in <strong>der</strong> Nähe des Fotokopierers funktional<br />
aufbewahrt werden können.<br />
- Die Lehrerpostfächer fanden dadurch auch einen neuen <strong>Stand</strong>ort.<br />
- Jede Klasse bekam ein Pantoffelregal (ermöglicht durch ehrenamtliche Arbeit von Vätern<br />
und Großvätern).<br />
� Planung 2008<br />
Neuanschaffung von verschließbaren Werkraumschränken mit erhöhtem Fassungsvermögen,<br />
um die sehr alten unverschließbaren Schränke und Regale abzulösen und mehr Stauraum zu<br />
schaffen. Ideal wäre ebenfalls die Anschaffung einer neuen funktional optimierten Küche in<br />
farblicher Anpassung an die neuen Werkraumschränke, um den multifunktionalen Raum (ideal<br />
auch beim Feiern) sowohl verschönernd als auch effektiver zu gestalten.<br />
Trocknungsregale für Kunstblätter sollen hier o<strong>der</strong> in den Klassenräumen angeschafft werden.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-1
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2004/05 <strong>Stand</strong> April 2008<br />
<strong>Stand</strong> 2004/05<br />
� Evaluation 2007/08<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Drei Trocknungsregale wurden für jede Etage angeschafft<br />
� Herr Paff (Kreis) machte mit Schulleitung und Herrn Schroe<strong>der</strong> (Schreiner und Vater) eine<br />
Ortsbegehung im Küchen-Werkraum und nahm die möglichen Pläne <strong>der</strong> Umbaumaßnahen<br />
auf, um sie zu genehmigen.<br />
� Herr Schroe<strong>der</strong> ist mit <strong>der</strong> Erstellung eines Kostenvoranschlages betraut<br />
� Frau Simon stellt im Mai beim Kreis den Antrag auf Genehmigung von Kreisgel<strong>der</strong>n<br />
� Evaluation 2009/10<br />
� Neugestaltung <strong>der</strong> Küche und des Werkraums durch Einbau einer neuen Küche, neuer<br />
Werkschränke, Überarbeitung <strong>der</strong> Werktische und Anschaffung neuer größerer Esstische<br />
und einheitlicher Sitzhocker in ausreichen<strong>der</strong> Anzahl. Somit entstand darüber hinaus ein<br />
multifunktionaler Raum, <strong>der</strong> zum Feiern dienen kann und <strong>der</strong> Mensabeköstigung mit<br />
steigenden Schülerzahlen gerecht wird.<br />
� Neugestaltung des Sekretariates sowie des Kopierraumes mit dem Ziel<br />
- Durch neue Aufbewahrungssystem den Stauraum zu vergrößern und optimaler zu ordnen<br />
- Die Arbeitsabläufe sowie den Datenschutz zu verbessern<br />
- Den Arbeitsbereich <strong>der</strong> Sekretärin sowie den Unterrichtsvorbereitungsbereich <strong>der</strong> Lehrer<br />
zu optimieren<br />
Projekt 4 Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Betreuungsräume, Sicherung des 1. Fluchtweges, Erstellung eines<br />
2.Fluchtweges<br />
Antragstellung: Okt. 03<br />
Fertigstellung: Sept. 05<br />
2. Entwicklungsziel: Gewährleistung <strong>der</strong> Sicherheit auf dem Schulhof und Reduzierung<br />
aggressiven Verhaltens <strong>der</strong> Schüler durch eine Schulhofgestaltung, die mehr<br />
Beschäftigung und Spielmöglichkeiten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> sowie mehr Sicherheit beim Spiel<br />
gewährt<br />
Projekt 1 Begehung des Schulhofs mit Vertretern des Garten- und Sportamtes <strong>der</strong><br />
Gemeinde und des Sport- und Schulamtes <strong>der</strong> Kreisverwaltung<br />
Projekt 2 Sponsorensuche<br />
Projekt 3 Umplazierung des Kletterhäuschens<br />
Projekt 4 Sichtung <strong>der</strong> Kataloge, Auswahl und Bestellung des multifunktionalen<br />
Klettergerüstes<br />
Projekt 5 Anschaffung eines Wackelsteges – ein weitere Spiel- und Balanciermöglichkeit<br />
Projekt 6 Schaffung neuer Spielanreize durch Bemalung des Schulhofes<br />
Projekt 7 Das Aufmalen von Begrenzungsmarkierungen des Schulhofes wird zur Sicherheit<br />
<strong>der</strong> Schüler vorgenommen. Sie signalisieren den Schülern die Sicherheitsgrenze.<br />
2008: Erneuerung <strong>der</strong> Begrenzungsmarkierungen<br />
Projekt 8 Beschneiden <strong>der</strong> Hecken und Sträucher<br />
Projekt 9 Erstellung einer verbindlichen Pausenregelung (Apr. 04), die allen Schülern - vor<br />
allem den neuen - bewusst gemacht werden soll.<br />
2008: Einführung eine Gongs am Ende <strong>der</strong> Pausen<br />
Projekt 10 Gewährleistung <strong>der</strong> Aufsicht in allen Teilen des Schulhofs durch wechselnde<br />
Präsenz zweier Lehrer<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-2
<strong>Stand</strong> 2004/05<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
3. Entwicklungsziel: Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong> Sicherheit durch Sauberkeit des Schulhofes<br />
und <strong>der</strong> Sicherheit des Jugendclubs in den Kellerräumen <strong>der</strong> Schule<br />
Die Notwendigkeit dieses Entwicklungszieles ergab sich aus einer seit vielen Jahren<br />
bestehenden Problematik, die mit den bisherigen Bemühungen nicht behoben werden<br />
konnte.<br />
Eine dieser Bemühungen war die Bereitstellung von Kellerräumen unserer Schule, um<br />
dadurch den Aufbau eines Jugendclubs in Nie<strong>der</strong>seelbach zu ermöglichen.<br />
Damit verbunden war die Hoffnung, eine positive Entwicklung auf dem Schulgelände in<br />
Gang zu setzen. Sie wurde lei<strong>der</strong> nicht bestätigt.<br />
Vielmehr führten gravierende Verunreinigungen des Schulgeländes sowie Beschädigungen<br />
von Außenanlagen und Gebäude, die außerhalb <strong>der</strong> Schulzeit stattfanden, zu einer<br />
Mehrarbeit für die Hausmeisterin und die Schüler, welche den Hofdienst versehen, sowie zu<br />
zusätzlichen Kosten für die Kreisverwaltung in Bad Schwalbach.<br />
Außerdem stand die Lehrerschaft vor dem Problem, wie Erziehungsziele (z.B.<br />
verantwortlicher Umgang mit <strong>der</strong> Umwelt) glaubhaft an ihre Schüler herangetragen werden<br />
können, wenn sie immer wie<strong>der</strong> das Gegenteil direkt erleben.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e waren aber die häufig über das gesamte Schulhofgelände verteilten Scherben<br />
sowie Flaschen und Alkoholreste ein großes Gefährdungspotential für die Schüler.<br />
Schulleitung, Kollegium, Elternschaft und Schulträger standen deshalb vor <strong>der</strong><br />
Notwendigkeit, vor allen Dingen auch aus ihrer Fürsorgepflicht heraus, ihre bisherigen<br />
Bemühungen zu intensivieren.<br />
Unsere Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:<br />
Projekt 1 Begehung des Schulhofes, <strong>der</strong> Kellerräume, <strong>der</strong> Jugendclubräume und ihrer<br />
Fluchtwege (mit dem Kreisbrandschutzinspektor)<br />
Problemfel<strong>der</strong>, die <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung bedürfen, werden benannt (mit <strong>der</strong><br />
Jugendclubleiterin)<br />
Information über die Auflagen, die vor allem die Fluchtwege und die<br />
Sicherheitsbestimmungen betreffen<br />
Projekt 2 Veranlassung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen im Jugendclubkeller<br />
� Flurräumungen<br />
� Erneuerung <strong>der</strong> Türen und Schließanlagen<br />
� Erteilung des Rauchverbotes in allen Räumlichkeiten<br />
Projekt 3 Die Kreisverwaltung veranlasst das Anbringen von Verbotsschil<strong>der</strong>n auf dem<br />
Schulhof, die die Nutzung auf den Schulbetrieb beschränkt und verweist auf die<br />
Selbstverständlichkeit <strong>der</strong> rechtlichen Lage, die das Versicherungsrecht<br />
beschreibt.<br />
Die Kreisverwaltung weist die Schulleitung ausdrücklich auf ihren Auftrag hin, in<br />
ihrem Sinne Sorge und Verantwortung zu tragen.<br />
Projekt 4 Einberufung eines „Runden – Tisch“ – Gespräches (Sommer 04)<br />
� um nach effektiveren Wirkungsweisen zu suchen<br />
� Beteiligte: Schulleiterin<br />
Personalrätin<br />
Beide Vorsitzende des Elternbeirates<br />
Vertreterin des Elternvereins<br />
Vorsitzende des Jugendclubs<br />
Ortsvorsteher Nie<strong>der</strong>seelbachs<br />
Bürgermeister Nie<strong>der</strong>nhausens<br />
Schulamtsleiter Bad Schwalbachs<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-3
<strong>Stand</strong> 2004/05<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Ergebnis:<br />
� Scherben, Kippen, Alkoholreste gefährden die Kin<strong>der</strong> und können nicht geduldet<br />
werden<br />
� Gespräche mit den auf dem Schulhof sich versammelnden Personen suchen, vor<br />
allem am Abend<br />
o die Elternvertreter<br />
o die Schulleitung<br />
o die Nachbarn<br />
o <strong>der</strong> neue Jugendpfleger<br />
� Verschmutzung zum Thema des Ortsbeirates und an<strong>der</strong>er Verantwortlicher<br />
machen<br />
� Bitte an alle Eltern, den Kin<strong>der</strong>n den großen Spielplatz „schmackhaft“ zu machen<br />
� Um den Schulhof am Nachmittag den Kin<strong>der</strong>n zu öffnen, bedarf es eines Antrages<br />
<strong>der</strong> Gemeinde, wodurch die Versicherungsverantwortung an die Gemeinde fiele<br />
� Die Gemeinde zeigte bisher aus finanziellen Gründen kein Interesse an <strong>der</strong><br />
Übernahme <strong>der</strong> Nutzung<br />
� Das Grundstück gehört in die Verantwortung des Kreises Bad Schwalbach und<br />
steht nur dem Schulbetrieb und seinen Gästen solange Aufsicht anwesend ist zur<br />
Verfügung<br />
� Auf „Störenfriede“ müssen Jugendliche in erster Linie selbst reagieren und bei<br />
Eskalation Namen nennen (man kennt sich).<br />
Projekt 5 Vortrag <strong>der</strong> Jugendpolizei (Herr Kürtell) im Jugendclub<br />
� Evaluation Herbst 2004<br />
Die Verschmutzung hält an. Die bisherigen Maßnahmen zeigen keine Wirkung. Die<br />
Tischtennisplatte, eine ehemalige Spende des „Elternvereins“ des Ortes, ist<br />
Anziehungspunkt interessierter Kin<strong>der</strong> und Jugendlicher und Argument zur weiteren<br />
Benutzung am Nachmittag und Abend.<br />
Die Verursacher <strong>der</strong> Verschmutzung und Gefährdungen werden nicht genannt.<br />
Projekt 6 Information <strong>der</strong> Polizei und <strong>der</strong> Öffentlichkeit „Es wird am Nachmittag und am<br />
Abend auf dem Schulhof gedealt“<br />
Projekt 7 Elternbeirat for<strong>der</strong>t in einer Pressemitteilung die Politiker <strong>der</strong> Gemeinde auf, einen<br />
geeigneteren Treffpunkt für Jugendliche zu suchen<br />
Projekt 8 Schulleitung weist bei Ortsbegehung in Nie<strong>der</strong>seelbach erneut auf die<br />
Jugendproblematik hin (Juli 05)<br />
Sie<br />
� bittet um Aufstellung einer weiteren Tischtennisplatte an einem Ort für die<br />
Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen<br />
� stellt fest, dass das Freizeitgelände „Sportplatz“ ein attraktives<br />
Beachvolleyballfeld hat, aber keine Tischtennisplatte.<br />
� stellt die Frage: Kann das Volleyballfeld von <strong>der</strong> Jugend genutzt werden o<strong>der</strong><br />
muss man Vereinsmitglied sein? (Noch unbeantwortet)<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-4
� Evaluation 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Nur wenige Jugendliche reagieren auf die persönlichen Gespräche und Bitten <strong>der</strong><br />
Schulleiterin.<br />
� Die Schulleiterin bat den Ortsvorsteher um Unterstützung in ihrem Bitten<br />
� Der Jugendpfleger will sich an abendlichen Gesprächen beteiligen<br />
� Die Polizei versichert, über einen längeren Zeitraum Streife zu fahren.<br />
� Der Jugendclub wird wie<strong>der</strong>holt für längere Zeit geschlossen. (Ab Juli 2005 geschlossen)<br />
� Nach den Sommerferien 2005 zeigt sich eine Verbesserung <strong>der</strong> Lage auf dem Schulhof,<br />
jedoch kommt es zu starken Verschmutzungen vor dem Eingang zur Sporthalle, die die<br />
Sportler nicht zu verantworten haben. Auch hier wird die Schulleitung ein „Run<strong>der</strong>-Tisch“ –<br />
Gespräch mit Gemeindevertretern und Sportverein im Januar 06 veranlassen.<br />
� Evaluation 2006/2007<br />
- Der Jugendclub blieb geschlossen und wurde am 11.02.2007 wie<strong>der</strong> geöffnet, vorerst nur am<br />
Sonntagnachmittag für Jugendliche bis 14 Jahre. Eine Betreuerin wurde eingestellt.<br />
- Viele Gespräche fanden wie geplant statt.<br />
- Die Situation auf dem Schulhof verbesserte sich leicht.<br />
Eine erneute heftige Verschmutzung sowohl vor dem Eingang des Jugendkellers als auch <strong>der</strong><br />
Lenzenberghalle veranlassten die Schulleiterin in Kooperation mit <strong>der</strong> Vorsitzenden des<br />
Elternvereins, des Schul- und Sportamtleiters in Bad Schwalbach sowie des Bürgermeisters<br />
von Nie<strong>der</strong>nhausen ein Hausverbot schriftlich an 6 jugendliche männliche Personen des Ortes<br />
zu erteilen. Aufenthaltsbereich ist jetzt die terassenähnliche Nische vor dem PC-Raum. Frau<br />
Simon machte den Schulträger darauf aufmerksam (22.02.2007) die Glaskonstruktion und die<br />
PCs könnten in Gefahr sein. Sie bat Herrn Schardt erneut um die Sicherung des<br />
Schulgrundstückes durch einen Zaun.<br />
� Evaluation 2007/2008<br />
� Frau Simon lässt einen Kostenvoranschlag für eine erweiterte Umzäunung erstellen.<br />
Demnach belaufen sich die Kosten auf etwa 20 000 €.<br />
� Die komplette Einzäunung wird vom Schulträger sowie vom Landrat Herrn Albers abgelehnt,<br />
da die Kosten zu hoch sind.<br />
� Herr Albers veranlasst eine Begehung mit einem Elektriker, um möglicherweise die<br />
Außenbeleuchtung zu verbessern o<strong>der</strong> eine Kamera zu installieren.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Aus Kostengründen konnte nur eine Kameraattrappe installiert werden.<br />
Eine komplette Umzäunung des Schulgrundstückes wurde aus Kostengründen<br />
(Kostenvoranschlag 20 000 Euro) abgelehnt.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Die Kameraattrappe scheint zu wirken.<br />
Vereinzelt müssen jedoch noch fremde Schüler energisch gebeten werden, das Grundstück<br />
(vor allem die Wiesenflächen hinterm Schulhaus) zu verlassen.<br />
Durch den Ganztagsbetrieb bis 17.30 Uhr ist das Schulareal für Fremde zumindest am<br />
Nachmittag nicht mehr so interessant.<br />
Veranstaltungen in <strong>der</strong> Lenzenberghalle am Wochenende stellen jedoch weiterhin eine Gefahr<br />
für die Sauberkeit und Sicherheit unseres Schulhofes und Schulgebäudes dar.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-5
<strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> 2004/05<br />
4. Entwicklungsziel: Reduzierung aggressiven Verhaltens bei Schülern<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Die Lehrerinnen machten vor allem in den letzten zwei Jahren die Beobachtung, dass viele<br />
<strong>der</strong> neuen männlichen Erstklässler wenig soziale Kompetenz, d.h. vor allem wenig<br />
Einfühlungsvermögen in ihr Gegenüber zeigen.<br />
Folgende Projekte entwickelten sich daraus:<br />
Arbeit mit den Eltern<br />
Projekt 1: Vortragsabend mit Herrn Hölzel (Dipl.Psych. <strong>der</strong> Jugend- und<br />
Familienberatungsstelle Idstein) für interessierte Eltern unserer Schule und<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gärten (Feb. 04)<br />
Themen: Definition von Aggression<br />
Die Ursache von Gewalt<br />
Die Rolle des männlichen Vorbilds in <strong>der</strong> Erziehung eines Jungen<br />
Lerntheorien<br />
Erziehungsziele und ihre Auswirkungen<br />
� Evaluation 2004<br />
Rege Beteiligung und große Zufriedenheit aller Beteiligten<br />
Wünsche nach einem Workshop zum Thema „Erziehungsziele“ und zur Fortsetzung des<br />
Vortrages werden von vielen Eltern bekundet.<br />
Eine Anmeldungsliste durch die Schulleiterin organisiert.<br />
Projekt 2: Elternworkshop mit Herrn Hölzel (Mai 04)<br />
� Evaluation 2004<br />
Über einen Zeitraum von einem halben Jahr trifft sich eine Gruppe von 12 Eltern einmal<br />
wöchentlich mit Herrn Hölzel in den Räumen <strong>der</strong> Beratungsstelle.<br />
� Evaluation 2006<br />
Die Zusammenarbeit mit Herrn Hölzel wird durch die Schulleiterin weiter fortgesetzt.<br />
Sie entwickelte mit ihm das Schlichterprogramm weiter für die zukünftigen Paten <strong>der</strong> neuen 1-<br />
Klässler, wenn diese sich im Frühsommer noch in <strong>der</strong> 3. Klasse befinden. Das erarbeitete<br />
Material (Arbeitsblätter und Overheadfolien), basierend auf Erfahrungen mit „Faustlos“, befindet<br />
sich bei <strong>der</strong> Schulleiterin und kann mit o<strong>der</strong> ohne Unterstützung durch Herrn Hölzel<br />
Verwendung im vorbereitenden Unterricht finden.<br />
Projekt 3: Fortsetzung des Vortragabends (Juni 04)<br />
Projekt 4: Run<strong>der</strong>-Tisch-Gespräche<br />
Eltern und Schüler mit ungelösten und schwerwiegen<strong>der</strong>en Konflikten<br />
beleuchten und lösen gemeinsam diese unter <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ation <strong>der</strong><br />
Schulleiterin. Die Klassenlehrerin, Fachleute des BFZ o<strong>der</strong> des<br />
Schulpsychologischen Dienstes werden gegebenenfalls hinzugezogen.<br />
� Evaluation 2005<br />
Diese Gespräche för<strong>der</strong>n das gegenseitige Verständnis und Vertrauen und haben, auch wenn<br />
sie gelegentlich nach einem gewissen Zeitraum fortgesetzt werden müssen, guten Erfolg.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-6
<strong>Stand</strong> 2006<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Das aggressive Verhalten bei Schülern ist extrem zurückgegangen.<br />
Nur noch vereinzelte Jungen zeigen wenig soziale Kompetenz im Miteinan<strong>der</strong> auf dem Schulhof<br />
o<strong>der</strong> in den Klassen, vor allem zugezogene Jungen aus an<strong>der</strong>en Schulstandorten.<br />
Sehr erfolgreich waren neben den Konfliktlösungsgesprächen <strong>der</strong> Lehrerinnen mit den Schülern<br />
die Elternarbeit, aber auch die Etablierung des Yogaunterrichts im Wahlpflichtbereich <strong>der</strong> 3. und<br />
4. Klassen, die Patenschaften <strong>der</strong> 4.-Klässler mit den 1.-Klässlern und die zeitnahen<br />
Schülerkonferenzen <strong>der</strong> Schulleiterin mit den betroffenen Schülern nach Konflikten<br />
untereinan<strong>der</strong> auf dem Schulhof. Die betroffenen Schüler schätzen diese Form <strong>der</strong><br />
Konfliktlösung durch die intensive Zuwendung <strong>der</strong> Schulleiterin und die dadurch entstehende<br />
Wertschätzung aller Beteiligten sehr.<br />
5. Entwicklungsziel: Sicherung des Schulweges<br />
Unter Mitwirkung des Polizeihauptkommissars Herrn Schnei<strong>der</strong> entstand die Empfehlung für<br />
den sichersten Schulweg im Schuljahr 2005/06.<br />
Am ersten Elternabend <strong>der</strong> kommenden 1. Schuljahre werden die Eltern darauf aufmerksam<br />
gemacht.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Kartenmaterial dazu wird am Elterninformationsbrett aufgehängt.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
� Der Busbetrieb ist seit Beginn des Schuljahres 07/08 sehr unzuverlässig.<br />
� Pannen, zu spät kommen, überhöhte Geschwindigkeiten, an <strong>der</strong> Schule vorbeifahren, ohne<br />
Licht im Winter fahren wurden durch die Schulleiterin beanstandet.<br />
� Es folgte ein Gespräch zwischen Schulleitung, dem Leiter <strong>der</strong> ORN Herrn Jede und dem<br />
verantwortlichem Herrn beim Kreis Herrn Junghans.<br />
� Ergebnis: Uns wird das Versprechen gegeben, dass sich die Situation nach gewissen<br />
Anlaufschwierigkeiten <strong>der</strong> Busnetzerweiterung verbessern wird. Zukünftige Beschwerden<br />
werden bei <strong>der</strong> Schulleiterin gesammelt. Dabei ist darauf zu achten, dass Ort, Datum,<br />
Uhrzeit und Busnummer genannt werden.<br />
� Die Schulleiterin bittet, auf Anregung Dasbacher Eltern, um zusätzlichen Busverkehr<br />
zwischen Dasbach und Nie<strong>der</strong>seelbach (zur 1. Stunde um 7.30 Uhr, zur 2. Stunde um 8.15<br />
Uhr und nach <strong>der</strong> 5. Stunde um 11.50 Uhr). Einen Bus um ca. 8.00 Uhr ab Dasbach<br />
würden sicherlich auch die vielen Schüler <strong>der</strong> Taunussteiner Schulen nutzen können. Denn<br />
zur Zeit gibt es nur einen einzigen Bus morgens ab Dasbach um 7.00 Uhr.<br />
� Ergebnis: Ab Schuljahresbeginn 08/09 o<strong>der</strong> Dezember 08 entsteht möglicherweise eine<br />
verbesserte Anbindung für ein Schuljahr.<br />
� Frau Simon informierte die Herren über die Verlängerung <strong>der</strong> Betreuungszeiten ab 1.3.08,<br />
mit <strong>der</strong> Bitte, Busse nach 15.30 Uhr ab <strong>der</strong> Schule fahren zu lassen. Es besteht schon ein<br />
stündlicher Busverkehr nach Engenhahn und Oberseelbach ab <strong>der</strong> Haltestelle Engenhahner<br />
Straße. Fahrplanän<strong>der</strong>ungswünsche sind bis zum 30.3. o<strong>der</strong> 2. Dezemberwochenende bei<br />
Herrn Junghans anzumelden.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Busse fahren weiterhin um 15.30 Uhr nicht von <strong>der</strong> Schule son<strong>der</strong>n ab Haltestelle<br />
Engenhahnerstraße, da nur wenige Schüler zu dieser Zeit Fahrschüler sind.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-7
Busfahrplan <strong>2011</strong><br />
Unterrichtsbeginn 07:30 Uhr<br />
ab Engenhahn Wildpark 07:10 Uhr<br />
ab Engenhahn Dorf 07:16 Uhr<br />
an Schule 07:22 Uhr<br />
ab Oberseelbach 07:12 Uhr<br />
an Schule 07:17 Uhr<br />
Unterrichtsbeginn 08:15 Uhr<br />
1 Bus für Oberseelbach und Engenhahn<br />
ab Oberseelbach 07:50 Uhr<br />
ab Engenhahn Wildpark 07:59 Uhr<br />
ab Engenhahn Dorf 08:04 Uhr<br />
an Schule 08:11 Uhr<br />
Unterrichtsende 10:50 Uhr<br />
1 Bus für Oberseelbach und Engenhahn (fährt ab sofort Mo bis Fr)<br />
ab Schule 10:56 Uhr<br />
an Engenhahn Dorf 11:00 Uhr<br />
an Engenhahn Wildpark 11:03 Uhr<br />
an Oberseelbach 11:13 Uhr<br />
Unterrichtsende 11:50 Uhr<br />
1 Bus für Oberseelbach und Engenhahn<br />
ab Schule 11:56 Uhr<br />
an Engenhahn Dorf 12:00 Uhr<br />
an Engenhahn Wildpark 12:03 Uhr<br />
an Oberseelbach 12:13 Uhr<br />
Unterrichtsende 12:35 Uhr<br />
ab Schule nach Engenhahn 12:46 Uhr<br />
an Engenhahn Dorf 12:50 Uhr<br />
an Engenhahn Wildpark 12:54 Uhr<br />
ab Schule nach Oberseelbach 12:46 Uhr<br />
an Oberseelbach 12:51 Uhr<br />
Unterrichts- und Betreuungsende ab 13:30 Uhr<br />
ab Schule nach Engenhahn 13:45 Uhr<br />
an Engenhahn Dorf 13:49 Uhr<br />
an Engenhahn Wildpark 13:53 Uhr<br />
ab Schule nach Oberseelbach 13:35 Uhr<br />
an Oberseelbach 13:40 Uhr<br />
ab Schule nach Engenhahn 15:51 Uhr<br />
an Engenhahn Dorf 15:53 Uhr<br />
an Engenhahn Wildpark 15:59 Uhr<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-8
Kartenmaterial: Der sichere Schulweg<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-9
Kartenmaterial: Der sichere Schulweg<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-10
<strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
Programme und Aktionen für die Schüler<br />
Projekt 1: Schülerwochenendseminar in den Räumen unserer Schule<br />
Thema: Wie gehe ich mit Gewalt um?<br />
� Evaluation 2004<br />
Rege Beteiligung von mehr als 50 Schüler/innen<br />
Zufriedenheit befragter Schüler<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 2: Sichtung, Auswahl und Erstellung einer Empfehlungsliste von DVDs und<br />
Videos für den Unterricht (Elternbeiräte und Schulleiterin)<br />
Projekt 3: Joga an unserer Schule im Rahmen <strong>der</strong> „AGs“<br />
� Evaluation 2005<br />
Die Mitfinanzierung durch Subventionen <strong>der</strong> Kreisverwaltung ( „Antiaggressionsgel<strong>der</strong>“) in<br />
Verbindung mit Elternbeiträgen machen das Engagement einer ausgebildeten Jogalehrerin<br />
möglich. Sie arbeitet mit einem sehr vielseitigen Unterrichtskonzept auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> eigenen<br />
Körperwahrnehmung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>.<br />
Die zunehmende Kompetenz einzelner Jogaschüler in Eigen- und Fremdwahrnehmung wirkt<br />
sich positiv auf ihr Sozialverhalten sowie aller Schüler aus.<br />
Einzelne Eltern belegen selbst Jogakurse für sich und ihre Kin<strong>der</strong>.<br />
Die Gruppen wechseln nun zum 3. Mal nach jeweils einem Schulhalbjahr und sind sehr<br />
zufrieden. Sollten die Subventionen gekürzt werden, hat sich <strong>der</strong> För<strong>der</strong>verein bereit erklärt,<br />
diese Kosten zu übernehmen, um Joga an unserer Schule weiterhin unterrichten zu können.<br />
� Evaluation 2006<br />
Die Subventionen <strong>der</strong> Kreisverwaltung gibt es noch. Der För<strong>der</strong>verein unterstützt weiterhin die<br />
Kosten für die Jogalehrerin. Ihr Einsatz in den sogenannten „AGs“, dem<br />
jahrgangsübergreifenden Wahlpflichtunterricht, wird nach wie vor von allen Gremien<br />
befürwortet.<br />
� Planung für 2008/09<br />
� Wochenendseminar für Schülerinnen und Schüler sowie begleiten<strong>der</strong> Elternabend zum<br />
Thema „Gewaltprävention und Selbstbehauptung“ als Kommunikations- und<br />
Verhaltenstraining sowie Schulung des Machbarkeitsgefühls und Stärkung <strong>der</strong><br />
Selbstsicherheit. Dieses Seminar gilt <strong>der</strong> Prävention, vor allem für Schüler, die in die<br />
weiterführende Schule wechseln. Denn unsere Schüler zeigen zur Zeit ein gutes<br />
Sozialverhalten, das durch vorschulische Erziehung im Elternhaus und in den Kin<strong>der</strong>gärten<br />
angelegt wurde und ein immerwährendes prinzipeilles Erziehungsziel unseres Lehrer- und<br />
Betreuungsteams ist.<br />
� Organisationsbeginn etwa April 08 durch Frau Schnei<strong>der</strong> (Engenhahner<br />
Kin<strong>der</strong>gartenelternbeirat) mit „Balance“<br />
� Antiaggressionsgel<strong>der</strong> des Kreises werden weiterhin für den Jogakurs in <strong>der</strong> Wahlpflicht-AG<br />
verwendet<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-11
<strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
Projekt 4: Ein Sandsack für Schüler zum Abreagieren<br />
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Auf Empfehlung Herrn Hölzels und <strong>der</strong> Befürwortung <strong>der</strong> Elterbeiräte erfolgt<br />
die Anschaffung eines Sandsackes sowie zweier Boxhandschuhe, um<br />
wütenden, erbosten Schülern ein Abreagieren zu ermöglichen. Diese<br />
Methode wird verknüpft mit <strong>der</strong> Belehrung, dass keine Wut an einem<br />
Menschen abreagiert werden und somit niemandem Gewalt (noch nicht mal<br />
verbal) angetan werden darf. Die Wut muss aber aus dem Menschen heraus<br />
und abreagiert werden.<br />
� Einführung und Vorstellung des Sandsackes mit Gebrauchsanweisungen<br />
sowie Belehrungen über den Umgang mit <strong>der</strong> eignen Kraft duch einen<br />
Psychocoach und ehemaligen Polizeikommissar.<br />
� Beschlussfassung zur Regelung des Einsatzes<br />
o nur <strong>der</strong> jeweilige Klassenlehrer entscheidet über einen<br />
eventuellen Einsatz des Sackes für seine Schüler<br />
o Der Klassenlehrer beaufsichtigt den Einsatz<br />
o Rücksicht auf ausliegende Werke und Materialien muss<br />
gewährleistet sein<br />
o Der Einsatz erfolgt freiwillig und ohne Zuschauer. Maximal zwei<br />
Kin<strong>der</strong> befinden sich im Raum. Die Boxhandschuhe werden im<br />
Raum an- und ausgezogen, um Kraftmeiereien zu unterbinden.<br />
o Wird <strong>der</strong> Werkraum unterrichtlich genutzt (Kochen, Werken,<br />
Stationenlernen usw.) kommt <strong>der</strong> Boxsack nicht zum Einsatz.<br />
o Der an <strong>der</strong> Fensterfront sich befindende Sack wird bei Einsatz in<br />
den Raum gezogen (Sicherheitsabstand!) und danach<br />
zurückgestellt und verhängt.<br />
Vor allem einzelne Schüler, die von Frau Simon unterrichtet werden, erhalten nach Bedarf<br />
Gelegenheit, in <strong>der</strong> großen Pause o<strong>der</strong> während <strong>der</strong> Stationsarbeit den Boxsack zu benutzen.<br />
Die Schüler betreten zu zweit den Raum. Ein Assistent gibt dem Boxenden Hilfestellung.<br />
Projekt 5: Schlichterprogramm (Juni 05)<br />
Es handelt sich um ein zweistündiges Unterrichtsprogramm zur Vorbereitung<br />
<strong>der</strong> zukünftigen Patenkin<strong>der</strong> <strong>der</strong> kommenden Erstklässler.<br />
Im Juni werden in den beiden 3. Klassen jeweils eine Doppelstunde mit<br />
Herrn Hölzel und <strong>der</strong> Klassenlehrerin dazu gehalten.<br />
Themen:<br />
� Als ich in die Schule kam<br />
� Wann wird es mir warm ums Herz<br />
� Unser Tier mit großem Herzen – die Giraffe<br />
� Wie wir Gefühle und Bitten im Streit in <strong>der</strong> Giraffensprache<br />
ausdrücken können (gewaltfreie Kommunikation)<br />
� Evaluation 2005<br />
Die Kin<strong>der</strong> empfanden den Unterricht wohltuend und hilfreich.<br />
Es gab innerhalb <strong>der</strong> ersten 3 Monate nach <strong>der</strong> Einschulung keine Klagen.<br />
Das gemeinsam mit <strong>der</strong> Schulleitung erarbeitete Konzept bleibt an <strong>der</strong> Schule und kann in<br />
Zukunft auch ohne Herrn Hölzel durchgeführt werden.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-12
<strong>Stand</strong> Juli 2002<br />
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Wir wendeten das Schlichterprogramm unter Vermittlung durch Herrn Hölzel an. Durch das<br />
Erscheinen eines Mannes aus einer außerschulischen Institution bekommt diese<br />
Antiaggressionskampagne einen beson<strong>der</strong>en Stellenwert bei den Schülerinnen und vor allem<br />
den Schülern.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Da Herr Hölzel nun pensioniert ist, übernehmen die Klassenlehrer die Aufgabe, die<br />
Schüler/innen auf ihre Aufgabe als Paten und Streitschlichter gegen Ende <strong>der</strong> 3. Klasse<br />
vorzubereiten. Das von ihm und <strong>der</strong> Schulleiterin erarbeitete Programm steht den Lehrerinnen<br />
zur Verfügung.<br />
Schulordnung<br />
In dieser Schule kannst du:<br />
� Kin<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Erwachsene treffen und kennen lernen<br />
� mit Kin<strong>der</strong>n und Erwachsenen reden, spielen und arbeiten - gemeinsam etwas planen und<br />
durchführen<br />
� Neues lernen<br />
� zuschauen, was an<strong>der</strong>e tun<br />
� etwas Wichtiges o<strong>der</strong> Schönes erleben<br />
� dich wohl fühlen<br />
Dazu sind auf jeden Fall wichtig:<br />
� Kin<strong>der</strong>, die freundlich sind,<br />
� Erwachsene, die Zeit für Kin<strong>der</strong> haben und ihnen zuhören,<br />
� Räume, die gemütlich sind,<br />
� Regeln, die eingehalten werden,<br />
Es ist wichtig, dass wir den Alltag unserer Schule so einrichten,<br />
� dass alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sich wohl fühlen<br />
� es gerecht zugeht<br />
� die Schwächeren geschützt werden<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-13
<strong>Stand</strong> Juli 2002-2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Um die Sicherheit Aller zu gewährleisten, müssen sich die Schüler an die folgenden<br />
Regeln halten<br />
1. Nimm Rücksicht auf an<strong>der</strong>e!<br />
2. Niemand darf beim Lernen gestört werden. Die Gruppen müssen während <strong>der</strong><br />
Unterrichtszeit ungestört arbeiten können, deshalb wird niemand in dieser Zeit<br />
herumtoben.<br />
3. Während <strong>der</strong> Unterrichtszeit verlässt kein Kind ohne Erlaubnis das Schulgelände.<br />
4. Die Notausgänge werden nur im Notfall benutzt.<br />
5. In unserer Schule können wir uns nur wohl fühlen,<br />
- wenn Papier und Abfälle in den Mülleimer kommen,<br />
- wenn die Schulmöbel und Wände sauber bleiben,<br />
- wenn die Jacken, Schirme und Turnbeutel an den Haken hängen.<br />
6. Die Gruppen hinterlassen die Räume, in denen sie gearbeitet haben, aufgeräumt und<br />
sauber ausgefegt. Die Stühle stehen auf dem Tisch. So können wir den Frauen, die die<br />
Schule saubermachen, ein wenig helfen.<br />
7. Da wir etwas für unsere Umwelt tun wollen, sortieren wir beson<strong>der</strong>s sorgfältig den Müll.<br />
Papier gehört in den dafür vorgesehenen Papierkorb. Verpackungen (auch leere<br />
Jogurtbecher) werfen wir in den gelben Sack.<br />
8. In den Toiletten gehen wir sorgfältig mit den Papierrollen um, sodass keine Toiletten<br />
verstopfen. Mit <strong>der</strong> Toilettentür ist sachgemäß umzugehen.<br />
9. Da die Schulbücher im nächsten Jahr von an<strong>der</strong>en Kin<strong>der</strong>n benutzt werden sollen,<br />
gehen wir beson<strong>der</strong>s sorgfältig damit um.<br />
10. Frische Luft und Bewegung tun allen Kin<strong>der</strong>n gut, deshalb gehen wir in <strong>der</strong><br />
Pause alle zum Spielen auf den Schulhof.<br />
11. Da wir auch unseren Schulhof sauber halten wollen, werfen wir Abfalle in die Mülltonne<br />
o<strong>der</strong> die Abfallkörbe.<br />
12. Wenn wir in den Pausen zwischen den Büschen spielen, schadet das den Pflanzen. Wir<br />
nehmen deshalb Rücksicht und spielen auf den Spielflächen.<br />
13. Mit Steinen, Stöcken, Schneebällen o<strong>der</strong> harten Bällen können wir Mitschüler verletzen.<br />
Deshalb wollen wir damit nicht werfen.<br />
14. Beim Fußballspielen könnten wir versehentlich jemanden umrennen. Wir spielen deshalb<br />
auf dem Schulhof nicht Fußball.<br />
15. Um den Turnhallenboden nicht zu verschmutzen, betreten wir die Turnhalle nur mit<br />
Turnschuhen.<br />
16. Um Verletzungen zu vermeiden, betreten wir die Turnhalle immer erst nach <strong>der</strong> Lehrerin<br />
o<strong>der</strong> dem Lehrer. Nur mit ihnen zusammen bauen wir Geräte auf und benutzen sie.<br />
17. In den Umklei<strong>der</strong>äumen ziehen wir uns leise und zügig um, dann haben wir mehr Zeit<br />
zum Turnen.<br />
Sicherheit und Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler und Lehrer E2-14
<strong>Stand</strong> Juli 2002 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
Entwicklungsbereich: Unterrichtsorganisation<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Aus dem Leitbild haben sich folgende Aspekte für die Organisation unseres Unterrichts<br />
ergeben:<br />
� Eine hauseigene Schulordnung regelt das Zusammenleben an unserer Schule<br />
(Siehe E2-6 und E2-7)<br />
� Die Klassenlehrerinnen führen die Klassen, wenn möglich, 4 Jahre lang<br />
� Evaluation 2005<br />
Möglichst viele Fächer erteilt die Klassenlehrerin, um flexibel mit dem Zeitmanagement, <strong>der</strong><br />
Fächerverteilung und den Arbeitsmethoden umzugehen. Dies lässt über Phasen verteilt eine<br />
unterschiedliche Gewichtung <strong>der</strong> Fächer zu. Eine intensive Beobachtung, Betreuung und<br />
För<strong>der</strong>ung jedes einzelnen Schülers ist somit gewährt. Das Unterrichten einer o<strong>der</strong> mehrer<br />
Personen erweitert die Sichtweise auf das Kind und seine Beurteilung aus einer an<strong>der</strong>en<br />
Perspektive.<br />
� Durch das Abstellen <strong>der</strong> Schulklingel können die Unterrichtsstunden flexibel und ohne<br />
Störung gestaltet werden<br />
� Evaluation 2005<br />
Es hat sich in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> letzten Jahre bewährt.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Um Lehrern und Schülern, vor allem <strong>der</strong> Hofaufsicht das Ende <strong>der</strong> Pause zu signalisieren,<br />
wurde <strong>der</strong> Schulgong seit 2008 aktiviert.<br />
Auch am Ende <strong>der</strong> 5. Stunde gongt es um 12.40 Uhr (im Winter um 12.38 Uhr), um<br />
sicherzustellen, dass alle betroffenen Schüler pünktlich ihren Bus erreichen.<br />
� In die Pausenregelung (siehe E3-2) sind die tägliche Bewegungszeit und die 3.<br />
Sportstunde eingebaut<br />
� Während <strong>der</strong> Pausen gibt es den „Hofdienst“ und den „Türdienst“<br />
Schüler bekommen bei diesen Aufgaben Verantwortung für ihre Schule und Mitschüler<br />
übertragen. Im Hofdienst sammeln sie Abfälle auf und fegen in den Bereichen <strong>der</strong> Spielgeräte.<br />
Der Türdienst, jeweils 2 Schüler einer 4. Klasse, gewährleistet, dass nur Schüler, die zur Toilette<br />
müssen, das Schulgebäude betreten. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Schüler unter<br />
Aufsicht bleiben.<br />
� In den Frühlings- und Sommermonaten werden <strong>der</strong> Spiel- und Bolzplatz nahe <strong>der</strong> Schule in<br />
die Aktivitäten mit einbezogen<br />
� Den Schülerinnen und Schülern stehen in den Pausen Spielgeräte zur Verfügung, sowie<br />
zwei Völkerballfel<strong>der</strong>, die auch für an<strong>der</strong>e Spiele genutzt werden können (Ball über die<br />
Schnur).<br />
� Für Regenpausen werden im Haus Spiele bereitgestellt.<br />
Unterrichtsorganisation E3-1
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Pausenregelung auf dem Schulhof<br />
1. Aufsicht<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Die Lehrer verlassen als Letzte den Klassenraum und auch die Lerninsel, so dass<br />
sicher gestellt ist, dass alle Schüler draußen sind.<br />
� Jeweils 2 Lehrkräfte gewährleisten durch wechselnde Präsenz die Aufsicht in allen<br />
Teilen des Schulhofes.<br />
� Bei Pausenende steht ein Lehrer an <strong>der</strong> Eingangstür und <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e achtet auf die<br />
letzten Schüler.<br />
2. Achtung<br />
� Die Wiese hinter <strong>der</strong> Turnhalle wird nicht benutzt.<br />
� Die kleine Wiese vor <strong>der</strong> Halle und <strong>der</strong> Hang sind Spielflächen, jedoch nicht die<br />
Abfangsteine unterhalb des Spielhauses.<br />
� Die weißen Linien auf dem Boden vor <strong>der</strong> Treppe in Richtung Jugendclub, vor <strong>der</strong><br />
großen Wiese hinter dem Schulhaus und an <strong>der</strong> letzten Stufe <strong>der</strong> breiten Treppe in<br />
Richtung Straße signalisieren den Schülern die Sicherheitsgrenze. Hier heißt es<br />
„STOP“.<br />
� Fällt ein Ball auf die Straße, holt ihn nur ein 4.-Klässler mit Information einer Aufsicht.<br />
Denn Bürgersteig und Straße dürfen normalerweise nicht betreten werden.<br />
� Zweige, Blätter und Blüten von Büschen und Bäumen nicht abreißen.<br />
� Nicht über die bemalten Steine und Befestigungssteine an <strong>der</strong> Hauswand laufen.<br />
� Nur Softbälle fürs Spielen benutzen.<br />
Kein Fußballspielen, auch nicht mit Softbällen, da die Spieler zu schnell werden und<br />
die Gefahr des „Umrempelns“ bei <strong>der</strong> Menge <strong>der</strong> Schüler zu groß ist.<br />
Kein Steine- und Schneeballwerfen.<br />
� Der Hofdienst macht auch den Kehrdienst, dabei sich bitte abwechseln.<br />
� Wenn es draußen nass ist:<br />
Keine Wiese o<strong>der</strong> Lehmboden mehr betreten, da sonst das Schulhaus zu sehr<br />
verschmutzt.<br />
� Eine Aufsichtsperson kann bei trockenem Wetter veranlassen, während <strong>der</strong> großen<br />
Pause auf den Spiel- o<strong>der</strong> Bolzplatz zu gehen.<br />
Bleiben dann nur einige Schüler auf dem Schulhof übrig, bittet die 2. Aufsicht diese<br />
auch den Schulhof zu verlassen, um dann sowohl den Spiel- als auch den Bolzplatz<br />
nutzen zu können und zu beaufsichtigen.<br />
3. Maßnahmen bei Nichtbefolgung <strong>der</strong> Regelung<br />
� Gespräch – Verwarnung – Entschuldigung<br />
� Schüler auf eine Bank o<strong>der</strong> neben die Aufsicht<br />
� Auszeit vor den Wänden <strong>der</strong> Eingangshalle<br />
� Zum Klassenlehrer, <strong>der</strong> über eine beson<strong>der</strong>e Maßnahme verfügt, Aufenthaltsort:<br />
„Glasübergang“<br />
� Wie<strong>der</strong>gutmachungsarbeit, z.B.: Aufsatz und/o<strong>der</strong> Bild mit dem Thema: „Dieses<br />
Kind ist jetzt traurig, weil …“<br />
4. Türdienst<br />
� Nur die Mädchen- und Jungentoiletten unten benutzen.<br />
� Einzelne Kin<strong>der</strong> o<strong>der</strong> ein Junge und ein Mädchen nur zur Toilette lassen.<br />
� Nicht für Kleidung, Spielzeug o<strong>der</strong> Essen ins Gebäude gehen lassen.<br />
� Diese Dinge auch nicht zur Aufbewahrung geben lassen.<br />
Unterrichtsorganisation E3-2
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Evaluation 2005<br />
Die Pausenregelungen haben sich in <strong>der</strong> Praxis bewährt.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Die Pausen beendet ab 1.4.08 ein Gong.<br />
Projektwochen, Wahlpflichtunterricht<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� In unregelmäßigen Abständen finden jahrgangsübergreifende Projektwochen statt.<br />
� Jahrgangsübergreifend werden im 3. und 4. Schuljahr 2 Wahlpflichtstunden, die so<br />
genannten AGs, angeboten.(z.B. Kochen, Theater, Nähen, Tonarbeiten, Seidenmalerei,<br />
Sport, Musik, Computer)<br />
� Evaluation 2004<br />
Erweiterung des Angebotes mit Joga durch angestellte außerschulische Lehrkraft.<br />
� Evaluation 2005<br />
� Erweiterung des Angebotes mit Spanisch und Tanzen durch die ehrenamtliche Mitarbeit<br />
zweier Mütter.<br />
� Erweiterung des Angebotes mit Sport und Zirkus durch eine neue Kollegin.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
� Spanisch konnte weiter erteilt werden, während Tanzen fortfiel.<br />
� Infolge <strong>der</strong> durch das Schulamt veranlassten Abordnung und trotz <strong>der</strong> ergebnislosen<br />
Auflehnung sowie den konstruktiven Bemühungen <strong>der</strong> Schulleiterin verloren wir unsere<br />
einzige Sportlehrerin Frau Grosser und konnten somit auch das Sportangebot nicht<br />
aufrechterhalten.<br />
� Die ersatzweise etablierte Fußball - AG des 1. Schulhalbjahres 06/07, für die wir anfänglich<br />
den ehrenamtlich arbeitenden ortsansässigen Jugend-Fußballtrainer gewinnen konnten,<br />
konnte lei<strong>der</strong> durch die Verän<strong>der</strong>ung in seinem beruflichen Werdegang nicht weiter geführt<br />
werden. Wir danken Frau von Bargen mit ihrem großen - auch ehrenamtlichen –<br />
Engagement für unsere Schule, die mit ihrem Einsatz die Fortsetzung <strong>der</strong> Fußball -AG bis<br />
zum Ende des 1. Schulhalbjahres ermöglichte.<br />
� Da durch die Abordnung Frau Grossers und die Beurlaubung Frau Minges ab Mitte Januar<br />
07 weniger Lehrerstunden <strong>der</strong> Schule durch das Schulamt zugewiesen werden, muss auch<br />
<strong>der</strong> Chor wegfallen.<br />
� Mit einem musikalischen Angebot durch Frau Gamer in den Wahlpflichtstunden versuchen<br />
wir den Verlust des Chors aufzufangen. In Zusammenarbeit mit Frau Trettin entsteht ein<br />
Musical, nachdem zuvor die Schüler <strong>der</strong> Jahrgänge 3 und 4 nach ihrem Interesse für ein<br />
Musical durch eine Umfrage interviewt wurden.<br />
� Um den Wahlpflichtunterricht, <strong>der</strong> <strong>der</strong> Schule das so prägende musische Profil gibt, mit<br />
seiner kleinen Gruppenstärke zu erhalten, suchen Kolleginnen und Schulleiterin kompetente,<br />
vor allem ehrenamtlich tätige Eltern, Großeltern o<strong>der</strong> auch an<strong>der</strong>e Personen aus dem<br />
Umfeld <strong>der</strong> Schule.<br />
� Die Schulleiterin wird versuchen, die neue Tanzschule Nie<strong>der</strong>nhausens „Dance-Emotion“ für<br />
Aktionen in unserer Schule zu gewinnen.<br />
Unterrichtsorganisation E3-3
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Um bei Ausflügen, Informationen mit Schulleiterin, Sekretärin und/o<strong>der</strong> Eltern bei<br />
eventuellen unvorhergesehenen Ereignissen austauschen zu können, nehmen Kolleginnen<br />
ihr Privathandy mit und tragen sich in ein neu eingeführtes Ausflugsbuch im Sekretariat ein.<br />
� Durch den Aktionstag „Rund ums Buch“ konnte mit den eingenommenen Gel<strong>der</strong>n die<br />
Schulbibliothek um einige neue und interessante Bücher erweitert werden.<br />
� Eine Liste wurde erstellt und in die Bücherei gehängt, aus <strong>der</strong> zu entnehmen ist, welche<br />
Bücher auf http://www.antolin.de wie<strong>der</strong>zufinden und zu bearbeiten sind.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
„Rund ums Buch“ hieß die Projektwoche im Dezember 07, die ihren Höhepunkt im<br />
Präsentationstag an einem Samstag hatte, mit Lesungen aus eigenen in <strong>der</strong> Woche<br />
entstandenen Büchern und mit Ausstellungs- und Aktionsstationen in allen Klassen zu den<br />
erarbeiteten Projekten. Zu Besuch war ebenfalls <strong>der</strong> Buchillustrator Herr Rothe, <strong>der</strong><br />
Einblicke in seine Arbeit mit dem Buch gab.<br />
� Evaluation 08/09<br />
� In Klasse 4 <strong>der</strong> Frau Wirtz entsteht eine Schach- AG, geleitet von Herrn Udo Hipler,<br />
Großvater eines Schülers. 10 Schüler/innen nehmen daran mit großem Interesse teil.<br />
� Herr Hipler, ein passionierter Schachspieler, ehemaliger Lufthansakapitän, engagiert sich<br />
hervorragend, auch durch eigene Fortbildungen seinerseits und Spende von 10<br />
Schachbrettern mit entsprechenden Figuren.<br />
� Die Schulleitung organisiert einen Laptop, um notwendige Anschauung projizieren zu<br />
können.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
� Die seit Jahren etablierte „Yoga-AG“ im Wahlpflichtunterricht mit Frau Mollnow ist bei<br />
Schüler/innen sehr beliebt. Ihr Unterricht geht sehr auf das Befinden <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ein und<br />
zeichnet sich durch eine große Methodenvielfalt aus.<br />
Aggressives Verhalten <strong>der</strong> Schüler/innen in <strong>der</strong> Pausenzeit und im Unterricht sind kaum<br />
noch vorhanden.<br />
� Herr Hipler bietet Schach nun Ehrenamtlich im Wahlpflichtunterricht <strong>der</strong> 3. und 4. Klassen<br />
an.<br />
� Wir konnten weitere ehrenamtliche Mitarbeiter für den Wahlpflichtunterricht gewinnen<br />
� Frau Vera Kreis – Chemische Versuche<br />
� Herr Ulrich Nowack – Elektronik<br />
� Spanisch findet nach vielen Jahren nicht mehr statt.<br />
� Tanzen von Frau Wallwitz übernimmt Frau Simon.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Im Sommer <strong>2010</strong> fanden die Geo-Projektwoche und <strong>der</strong> große Geo-Projekttag mit <strong>der</strong> Uni<br />
Frankfurt und <strong>der</strong> Unterstützung vieler Dozenten statt.<br />
Unterrichtsorganisation E3-4
<strong>Stand</strong> 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2004/05<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Die Schulbibliothek umfasst ca. 1000 Bücher. Die Schüler/innen können diese Bücher<br />
kostenlos ausleihen. Zusätzlich gibt es, vor allem während des Anfangsunterrichts, in<br />
einzelnen Klassen eine Klassenbibliothek.<br />
� Lerninseln: Durch die Anordnung <strong>der</strong> Klassenräume um einen gemeinsamen Innenhof,<br />
kann <strong>der</strong> Unterrichtsraum erweitert werden. Das Arbeiten an unterschiedlichen Lerninhalten<br />
(innere Differenzierung des Unterrichts) zur gleichen Zeit wird ermöglicht, vor allem beim<br />
Einsatz raumgreifen<strong>der</strong> Materialien.<br />
Die Lerninseln sind Treffpunkt klassen- und jahrgangübergreifenden Unterrichtens.<br />
� Der Stundenplan wird durch die Schulleiterin unter Vorgaben <strong>der</strong> vom Schulamt in<br />
Wiesbaden zugeteilten Lehrerstunden und <strong>der</strong> Stundentafel (siehe unten) unter<br />
Berücksichtigung von Lehrerwünschen und räumlichen Gegebenheiten aufgestellt.<br />
Stundentafel für die Grundschule<br />
Für den Unterricht in <strong>der</strong> Grundschule gilt folgende Stundentafel<br />
Unterrichtsfächer Jahrgangsstufen/<br />
Stundenzahl<br />
Summen<br />
1 2 3 4<br />
Religion 2 2 2 2 8<br />
Deutsch 6 6 5 5 22<br />
Sachunterricht 2 2 4 4 12<br />
Mathematik 5 5 5 5 20<br />
Kunst, Werken/Textiles Gestalten,<br />
Musik<br />
3 3 4 4 14<br />
Sport 3 3 3 3 12<br />
Einführung in eine Fremdsprache - - 2 2 4<br />
Schülerstunden 21 21 25 25 90<br />
Zusätzliche Stunden nach § 7 Abs. 4 2 2 2 2 8<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Stundentafel für die Grundschule<br />
(1) Weicht eine Schule mit pädagogischer Begründung von <strong>der</strong> Organisation ab, indem<br />
beispielsweise die Dauer <strong>der</strong> Unterrichtsstunden o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Pausen verän<strong>der</strong>t wird, ist darauf zu<br />
achten, dass auch diese Schulen genau so viel Unterrichtszeit anzubieten haben, wie in <strong>der</strong><br />
Stundentafel an Schülerstunden zu 45 Minuten vorgesehen ist.<br />
(2) Die Angaben <strong>der</strong> Wochenstundenanteile für das erste und zweite Schuljahr legen einen<br />
zeitlichen Rahmen Fest. Die Schule gestaltet unter Beachtung des Lehrplans sowie <strong>der</strong><br />
Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler die zeitliche Dauer und den<br />
Wechsel <strong>der</strong> Fächer. Die Möglichkeiten einer fachübergreifenden Unterrichtsgestaltung sind zu<br />
nutzen. Die Dauer <strong>der</strong> Pausen darf die in § 1 Abs. 3 (GVBI) genannte Zeit überschreiten.<br />
Unterrichtsorganisation E3-5
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Durch geringere Lehrerzuweisungsstunden kann nur 1 zusätzliche För<strong>der</strong>stunde pro<br />
Jahrgang nach §7 Abs. 4 erteilt werden. Wir bedauern diese Regelung sehr, da pro Klasse<br />
somit nur sinnvoll 4 Schüler einmal pro Woche zusätzlich, vor allem in Deutsch,<br />
klassenübergreifend geför<strong>der</strong>t werden.<br />
Durch die Abordnung unserer einzigen Sportlehrerin Frau Grosser zur Grundschule Auf <strong>der</strong><br />
Au wurden die Sportlehrer Herr Weigel am Donnerstag mit 6 Stunden und Frau Neumann<br />
am Freitag mit 4 Stunden von dort zu uns abgeordnet. Das bedeutete für die<br />
Stundenplanung ein zusätzliches Korsett. Nach Verhandlungen mit dem Kreis Bad<br />
Schwalbach konnte ein zusätzlicher Bus am Donnerstag nach <strong>der</strong> 4. Stunde eingesetzt<br />
werden, um bestimmten Lerngruppen zu dieser Zeit frei geben zu können.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
� Frau Grosser, Herr Weigel und Frau Neumann verließen auf Anweisung des Schulamtes<br />
lei<strong>der</strong> unsere Schule.<br />
� Ab 1.2.08 kam Frau Grit Hölzel in unser Kollegium und unterrichtet vor allem Sport.<br />
� Ab 7.4.08 unterrichtet Frau Birgit Vogels als Ersatz für Frau Judith Kottmann, ehemals<br />
Honecker, die sich für ihre Elternzeit beurlauben ließ.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Vom 4.5.09 bis 1.7.09 unterrichtete Frau Corinna Berg als Ersatz für Frau Vogels, die auf<br />
eigenen Wunsch nach Düsseldorf versetzt wurde. Frau Berg erhielt einen befristeten BAT-<br />
Vertrag. Ab 1.8.09 unterrichtet Frau Esther Hinz mit befristetem BAT-Vertrag bis 1.7.<strong>2010</strong>,<br />
da Frau Corinna Berg eine Konrektorenstelle in Wiesbaden - Biebrich annahm.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Frau Esther Hinz verbleibt bis auf weiteres mit ihrem BAT-Vertrag.<br />
Frau Monika Schleuter-Buchholz kommt an unsere Schule und übernimmt ein 1. Schuljahr.<br />
Wir erhalten aus Frankreich kommend Frau Christine Merkel für unser Ganztagsprogramm<br />
des Landes Hessen, denn ab Oktober <strong>2010</strong> wird die <strong>Lenzenbergschule</strong> ins<br />
Landesprogramm „Ganztägig lernende Schule“ aufgenommen.<br />
Dieses Programm („PÄM“: Pädagogische Mittagsbetreung) startet drei Jahre früher als<br />
erwartet, da wir bereit waren für eine „abgesprungene“ Schule im Rheingau „einzuspringen“.<br />
Hiermit kommen wir dem zunehmenden Wunsch <strong>der</strong> Elternschaft nach ganztägigem Lernen<br />
und Betreut sein ihrer Kin<strong>der</strong> sehr entgegen.<br />
Im Folgenden ist das Konzept <strong>der</strong> Mittagsbetreuung unserer Schule dargestellt. Es wurde in<br />
Kooperation von Schulleiterin und <strong>der</strong> neu ernannten Koordinatorin für das<br />
Ganztagsprogramm Frau Anke Gamer entwickelt. In Zusammenarbeit und Abstimmung mit<br />
dem För<strong>der</strong>verein entstand ein Ganztagsprogramm, das mit dem Vormittag und den<br />
Betreuungszeiten des För<strong>der</strong>vereins eng verflochten wurde. Täglich von 7.00 Uhr bis 17.30<br />
Uhr können Kin<strong>der</strong> unsere Schule besuchen, ein warmes Mittagessen erhalten und an<br />
interessanten Projekten aus Musik, Kunst, Sport und Naturwissenschaften teilnehmen.<br />
Unterrichtsorganisation E3-6
Konzeptentwicklung: „Ganztätig lernen“ im Landesprogramm<br />
Ganztagskonzept vom 26.8.<strong>2010</strong>:<br />
Geld<br />
Geld<br />
Kreis<br />
För<strong>der</strong>vereine<br />
Land Hessen<br />
Geld und Erzieherinnen<br />
Pädagogische<br />
Mittagsbetreuung<br />
Landesprogramm:<br />
Ganztagsschule nach Maß<br />
Lehrerstellen<br />
Schulämter<br />
Schule<br />
Lehrer<br />
Konzept und<br />
Lehrerstunden<br />
Das Land bietet zwei Möglichkeiten:<br />
1. Eine volle Lehrerstelle (29 Std.)<br />
2. ½ Lehrerstelle plus Geld<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 1<br />
Konzept Mittagsbetreuung<br />
26.08.<strong>2010</strong><br />
Schule im Landesprogramm:<br />
Ganztagsprogramm nach Maß<br />
Konzept <strong>der</strong> Schulleitung<br />
Ziel<br />
Konzept Mittagsbetreuung<br />
<strong>Lenzenbergschule</strong><br />
� Entwicklung eines Gesamtkonzepts<br />
mit Verzahnung von Vormittag und<br />
Nachmittag<br />
� Rhythmisierter Tag (Biorhythmus<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>)<br />
� Nachhaltiges, wirklichkeitsnahes<br />
Lernen mit allen Sinnen<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 5<br />
Fächerübergreifendes<br />
Lernen im<br />
Komplexunterricht<br />
� Einsatz guter (neuer) Lernformen<br />
� Erweiterung von Sach-, Sozial-,<br />
Methodenkompetenz<br />
�Methodenvielfalt<br />
�Projekte, Exkursionen,<br />
an<strong>der</strong>e Lernorte<br />
�Kooperationspartner<br />
(Spezialkenntnisse)<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 7<br />
3<br />
Zitate aus <strong>der</strong> Homepage des HKM zum Landesprogramm:<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Schulen mit pädagogischer Mittagsbetreuung bieten<br />
an mindestens drei Wochentagen bis 14.30 Uhr<br />
Hausaufgabenbetreuung, För<strong>der</strong>maßnahmen sowie<br />
erweiterte Angebote im Wahl- und Freizeitbereich an.<br />
� Das konkrete pädagogische Konzept entwickelt die<br />
Schule selbst.<br />
� Die Schulen entscheiden über den Einsatz dieser<br />
Mittel für Honorarkräfte, Materialien und<br />
Dienstleistungen.<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 2<br />
Zur Zeit:<br />
� Schule mit hortähnlicher Betreuung<br />
Zukunft:<br />
� Schule in erweiterter<br />
Verantwortung mit pädagogischer<br />
Mittagsbetreuung an mindestens<br />
drei Tagen<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 4<br />
Rhythmisierung<br />
� Stressregulation durch Wechsel<br />
zwischen<br />
Anspannung/Konzentration und<br />
Freizeit<br />
�Abbau von Überfor<strong>der</strong>ung<br />
�Abbau von Bewegungsmangel<br />
�Aufbau von Bewegung/<br />
Wahrnehmungsschulung/<br />
Entspannung<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 6<br />
Qualität des Unterrichts<br />
� Lehrer<br />
Vielfältige u.<br />
anspruchsvolle<br />
Freizeitangebote<br />
� ErzieherInnen<br />
Spezialkenntnisse<br />
� Außerschulische Partner<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 8<br />
Unterrichtsorganisation E3-7
Voraussetzung<br />
� Lehrer, Erzieher und außersch.<br />
Partner verstehen sich als Partner.<br />
� Sie beziehen sich gegenseitig in<br />
ihre Tätigkeiten ein.<br />
� Die pädagogische Leitung wird von<br />
<strong>der</strong> Schulleitung ausgeübt.<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 9<br />
Vorschlag: Wochenübersicht<br />
Zeit<br />
7:15 - Frühbetreuung Frühbetreuung Frühbetreuung Frühbetreuung Frühbetreuung<br />
8:15<br />
1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h<br />
1./2. Std.-<br />
5./6. Std.<br />
Unterricht Unterricht Unterricht<br />
Unterricht<br />
Unterricht<br />
(5.)<br />
6. Std<br />
12:35 -<br />
13:30<br />
13:30<br />
-<br />
15:00<br />
15:00<br />
-<br />
16:30<br />
16:30 -<br />
17:30<br />
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
Betreuung Betreuung Betreuung<br />
2 Pers. 1,0 h 2 Pers. 2,0 h 2 Pers. 1,0 h 2 Pers. 1,0 h 2 Pers. 1,0 h<br />
Wirtz Merkel Wirtz<br />
Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause<br />
Mittagspause<br />
2 Pers. 1,0 h 2 Pers. 1,0 h 2 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h<br />
Hinz<br />
Hinz<br />
Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv<br />
Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl.<br />
Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl.<br />
2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h<br />
Merkel Merkel Merkel Merkel<br />
Merkel<br />
Projekte<br />
und<br />
Tagesthema<br />
Tagesthema Tagesthema<br />
Projekte<br />
und<br />
Tagesthema<br />
2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h 2 Pers. 1,5 h<br />
Merkel Merkel/Gamer<br />
Merkel<br />
Experte Experte Experte<br />
Betreuung Betreuung Betreuung Betreuung<br />
Betreuung Betreuung<br />
Projekte<br />
und<br />
Tagesthema<br />
Betreuung<br />
1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h 1 Pers. 1,0 h<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 11<br />
Einwahlzettel<br />
Zeit<br />
7:15 -<br />
8:15<br />
1./2. Std.-<br />
5./6. Std.<br />
5. Std<br />
11:55 -<br />
12:40<br />
6. Std.<br />
12:35 -<br />
13:30<br />
bis 14:00<br />
14:00<br />
-<br />
15:00<br />
15:00<br />
-<br />
16:30<br />
16:30 -<br />
17:30<br />
Fazit<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Regelmäßige gemeinsame Gesamtkonferenzen<br />
sind unbedingt notwendig<br />
� Beteiligt sind:<br />
- Lehrer<br />
- För<strong>der</strong>verein<br />
- Außerschulische Partner<br />
- Elternbeirat<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 10<br />
<strong>Lenzenbergschule</strong><br />
Konzept:<br />
Pädagogische<br />
Mittagsbetreuung<br />
Ist keine Rechtspeson, d.h.:<br />
1. Kein Geld einnehmen,<br />
verwalten o<strong>der</strong><br />
ausgeben<br />
2. Keine Verträge<br />
abschließen<br />
För<strong>der</strong>verein<br />
bestehende<br />
Mittagsbetreuung<br />
Ist eine Rechtspeson, d.h.:<br />
1. Kann Geld einnehmen,<br />
verwalten o<strong>der</strong><br />
ausgeben<br />
2. Kann Verträge<br />
abschließen<br />
Wäre wünschenswert, wenn <strong>der</strong> För<strong>der</strong>verein <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
1. Für die Schule die Verträge abschließt.<br />
2. Die vom Kreis weitergereichten Gel<strong>der</strong> verwaltet, d.h. Personal und Material bezahlt.<br />
3. Ein die Lücken füllendes Betreuungskonzept anbietet und verwaltet.<br />
4. Weiterhin die Spendengel<strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> verwaltet und im Sinne <strong>der</strong><br />
Schulgemeinde einsetzt.<br />
5. Die Schule in vollem Umfang und durch regelmäßige Absprachen unterstützt.<br />
26.08.<strong>2010</strong> Konzept Mittagsbetreuung <strong>Lenzenbergschule</strong> 12<br />
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
Frühbetreuung<br />
Unterricht<br />
Frühbetreuung<br />
Betreuung Betreuung<br />
Betreuung<br />
Unterricht Unterricht<br />
Betreuung<br />
Betreuung Betreuung<br />
Frühbetreuung Frühbetreuung<br />
Unterricht<br />
Betreuung<br />
Essen Essen Essen Essen<br />
Mittagspause und Essen Mittagspause und Essen Mittagspause und Essen Mittagspause und Essen<br />
Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv Hausaufgaben-intensiv<br />
Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl. Hausaufgaben 1./2. Kl.<br />
Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl. Hausaufgaben 3./4. Kl.<br />
Französisch II<br />
Bewegen und Gestalten<br />
TT:kreatives Gestalten<br />
physik. Experimente<br />
TT: Spieleolympiade<br />
Ballsport<br />
Computer<br />
TT: Kunterbuntes aus<br />
und mit Zeitungen<br />
Sägen<br />
Frühlingserwachen<br />
Atelier f. kl. Künstler<br />
TT: Rund um Musik<br />
Betreuung Betreuung Betreuung Betreuung<br />
grau unterlegt sind die kostenfreien Angebote "Ganztägig Lernen";<br />
gelb unterlegt sind kostenpflichtige Betreuungsangebote des För<strong>der</strong>vereins.<br />
Frühbetreuung<br />
Unterricht<br />
Betreuung<br />
Betreuung Betreuung<br />
Essen<br />
Mittagspause und Essen<br />
Hausaufgaben-intensiv<br />
Hausaufgaben 1./2. Kl.<br />
Hausaufgaben 3./4. Kl.<br />
TT: Bewegung mit Spaß<br />
Betreuung<br />
Unterrichtsorganisation E3-8
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Unterrichtsorganisation im Fach Religion<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Im 1. und 2. Schuljahr wird <strong>der</strong> Religionsunterricht konfessionsübergreifend unterrichtet. Dies<br />
geschieht mit <strong>der</strong> Zustimmung <strong>der</strong> betroffenen Lehrkräfte, des Schulamtes, <strong>der</strong><br />
religionspädagogische Institute bei<strong>der</strong> Glaubensrichtungen, sowie <strong>der</strong> Elternschaft.<br />
Diese Zustimmung wird jährlich neu erteilt.<br />
Das gravierende Ungleichgewicht <strong>der</strong> Anzahl von evangelischen und katholischen Schülern<br />
macht eine solche Regelung erfor<strong>der</strong>lich. Geschähe dies nicht, müssten zusätzliche Gruppen in<br />
evangelischer Religion gebildet werden, was zu Lasten dringend benötigter, an<strong>der</strong>er<br />
Unterrichts-/Lehrerstunden gehen würde.<br />
Im 3. und 4.Schuljahr wird <strong>der</strong> Religionsunterricht konfessionell getrennt erteilt.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Im erst Halbjahr des Schuljahres 06/07 lag die Anzahl <strong>der</strong> evangelischen Schüler in den<br />
Jahrgängen 3 und 4 über 30, sodass die Gruppen geteilt werden mussten und je<strong>der</strong> ev.<br />
Schüler nur eine Wochenstunde Religion erhielt. Diese Regelung war im Beson<strong>der</strong>en<br />
deshalb unbefriedigend, da die ev. Religionsschüler, die alternativ nicht am kath. Unterricht<br />
teilnehmen durften o<strong>der</strong> später zum Unterricht kommen konnten, vor den Klassenräumen<br />
betreut werden mussten.<br />
Zähe Verhandlungen mit dem Schulamt und eine gute Zusammenarbeit <strong>der</strong> Schulleiterin mit<br />
dem Leiter des religionspädagogischen Amtes Herrn Jungblut führten schließlich zum<br />
Abschluss eines BAT-Vertrages mit Frau Hennig, einer sich in Ausbildung befindlichen ev.<br />
Religionslehrerin aus Nie<strong>der</strong>nhausen. Sie unterrichtet mit Beginn des 2. Halbjahres 06/07<br />
parallel zu Pfarrer Kratz 4 Unterrichtsstunden in den Jahrgängen 3 und 4.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Frau Ulrike Hennig unterrichtet nur noch 2 Stunden. Herr Pfarrer Kratz trat ihr 2 Stunden ab<br />
und unterrichtet selbst somit nur noch 2 Stunden, da sich die evangelischen Schülerzahlen<br />
in Klasse 3 sich normalisiert haben und für die 4. Klasse keine weitere Doppelbesetzung<br />
durch das Schulamt (Fr. Niggemann) gewährt wurde.<br />
Das hat zur Folge, dass die Lerngruppe in Klasse 4 geteilt wird und jeweils nur eine Stunde<br />
ev. Religion erteilt wird.<br />
� Planung für 2008/09<br />
Da mit Beginn des Schuljahres 08/09 mindestens 4,5 Lehrerwochenstunden fehlen werden,<br />
wünschen wir diese Stunden von Frau Hennig erteilen zu lassen.<br />
� Evaluation und Planung 2009/10/11<br />
Pfarrer Kratz wurde im September 2009 pensioniert. Frau Ulrike Hennig übernahm seine<br />
Stundenanteile und unterrichtet nunmehr 6 Stunden evangelische Religion.<br />
Ab Frühjahr <strong>2010</strong> erwartet die Gemeinde den neuen Pfarrer Herr Michael Koch, <strong>der</strong> die<br />
Jugendarbeit <strong>der</strong> Gemeinde aufbauen möchte. Ab Schuljahr 10/11 soll er den ev.<br />
Religionsunterricht <strong>der</strong> Klassen 3 und 4 wie<strong>der</strong> übernehmen.<br />
Wir hoffen, Frau Hennig mit 4 Stunden in den Klassen 1a, 1b, 2a und 2b ev.<br />
Religionsunterricht erteilen lassen zu können. Frau Annette Klose ließ sich zur katholischen<br />
Religionslehrerin ausbilden. Wir hoffen, sie parallel zu Frau Hennig beschäftigen zu können<br />
Unterrichtsorganisation E3-9
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Pfarrer Michael Koch übernimmt den ev. Religionsunterricht in den Schuljahren 3 und 4.<br />
Frau Ulrike Hennig unterrichtet 2 Wstd. ev. Religion in Klasse 2a.<br />
Elternnotdienst:<br />
Um eine Unterrichtsgarantie zu gewährleisten, wurde <strong>der</strong> Elternnotdienst eingerichtet. Bei<br />
Abwesenheit von Lehrern werden Eltern, die sich dazu bereiterklärt haben, eingesetzt. Die<br />
Eltern beaufsichtigen die Schüler bei <strong>der</strong> Erledigung <strong>der</strong> vom Lehrer vorbereiteten Aufgabe.<br />
� Evaluation 2004<br />
Dieser Notdienst hat sich in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> letzten Jahre sehr bewährt. Vor allem engagierte<br />
Mütter unterstützen unsre Schule damit sehr. Das Kollegium und die Elternschaft sind<br />
dankbar, auf diese Weise eine uneingeschränkte Unterrichtszeit gewährleistet zu sehen.<br />
Eltern haben aus rechtlichen Gründen nicht die Aufsichtspflicht über die Lerngruppe.<br />
Sie wird von einer Lehrkraft <strong>der</strong> Nachbarklasse übernommen. Deshalb sind beide<br />
benachbarten Klassentüren offen zu halten.<br />
� Evaluation 2005<br />
Mit je<strong>der</strong> neuen Einschulung bemühen sich die Klassenlehrer an den Elternabenden, neue<br />
hilfsbereite Eltern in die Elternnotdienstliste aufzunehmen. Diese Liste wird bei <strong>der</strong> Erstellung<br />
des Vertretungsplanes durch die Schulleiterin und das Sekretariat eingesetzt.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Maßgabe des Hessischen Kultusministeriums, „Unterrichtsgarantie plus“<br />
genannt, werden in den kommenden Jahren neue Gesichtspunkte des<br />
Vertretungsunterrichtes zu berücksichtigen sein.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
„Unterrichtsgarantie plus“ ist mit großem verwaltungstechnischem Aufwand an unserer<br />
Schule eingeführt. In Zusammenarbeit mit zwei weiteren kleinen benachbarten<br />
Grundschulen suchten wir per Zeitungsartikel im Wiesbadener Kurier nach qualifizierten<br />
Lehrern mit 1. und 2. Staatsexamen. Unsere „U+“- Liste ist ausreichend mit Studenten <strong>der</strong><br />
Pädagogik, Lehrerinnen und Erzieherinnen gefüllt. In Übereinstimmung mit dem<br />
Schulelternbeirat und <strong>der</strong> Schulkonferenz erschien es uns jedoch wichtig und<br />
organisatorisch notwendig, den ehrenamtlichen Elternnotdienst zu erhalten. Der Herbst<br />
2006 bestätigte unsere Annahme, dass bei höherem Krankenstand unsere „U+“- Gel<strong>der</strong><br />
schnell verbraucht waren und wir auf die ehrenamtliche Mitarbeit <strong>der</strong> „Notdiensteltern“<br />
zurückgreifen mussten.<br />
Ein für den Vertretungsunterricht hilfreiches Formblatt mit Hinweisen und Empfehlungen<br />
wurde für die Vertretungskräfte von uns erstellt und jedem ausgehändigt.<br />
Ordner mit Arbeitsblättern werden zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsblätter sind nach<br />
Jahrgängen und nach den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde im Sekretariat in<br />
einem Regal in <strong>der</strong> Nähe des Fotokopierers vor allem für den Vertretungsunterricht<br />
bereitgestellt.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
„Unterrichtsgarantie plus“ (U-plus) hat sich an unserer Schule bewährt, vor allem durch den<br />
Einsatz <strong>der</strong> Erzieherinnen Frau Klose und Frau Trapp.<br />
Unterrichtsorganisation E3-10
� Evaluation 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Frau Annette Klose und Frau Brigitte Trapp haben sich als U-plus-Kräfte weiterhin sehr<br />
bewährt.<br />
� Frau Klose erwarb durch eine mehrjährige Fortbildung die Befähigung katholischen<br />
Religionsunterricht zu erteilen.<br />
� Evaluation <strong>2011</strong><br />
Wir konnten die U-plus-Liste (Verlässliche Schule) um drei weitere Personen erweitern.<br />
Unterrichtsorganisation E3-11
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Entwicklungsbereich: Weiterentwicklung von Unterricht<br />
Schulschrift<br />
In allen Klassen wird Vereinfachte Ausgangsschrift geschrieben.<br />
Durchführung <strong>der</strong> Orientierungsarbeiten in Klasse 3<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Schon während <strong>der</strong> Erprobungszeit dieser Arbeiten in den Jahren 03 und 04 nimmt<br />
unsere Schule an den Orientierungsarbeiten teil. Die Orientierungsarbeiten dienen uns<br />
Lehrern als Informationsquelle über<br />
� den Leistungsstand unserer Schüler<br />
� in Mathematik – Denken und Rechnen, Lösen geometrischer Aufgabenstellungen<br />
� und in Deutsch – Rechtschreibung, Lesekompetenz, Ausdrucksfähigkeit<br />
� mögliche Defizite<br />
Somit können im verbleibenden 4. Grundschuljahr im Fall von Defiziten Problemfel<strong>der</strong><br />
entsprechend bearbeitet werden.<br />
Erste Durchführung <strong>der</strong> offiziellen Orientierungsarbeiten Mai 05.<br />
Qualitätsentwicklung im Deutschunterricht durch die Anschaffung eines Lese-<br />
Sprachbuches in den Jahrgängen 2, 3 und 4.<br />
� Bestellung von Probeexemplaren<br />
� Sichtung <strong>der</strong> Probeexemplare<br />
� Erstellung eines Kriterienkataloges<br />
� Auswahl<br />
� 1.Vorstellung und Aussprache /Beschlussfassung: Piri, Verlag: Klett<br />
� 2. Bestellung<br />
� Einsatz im Unterricht mit Beginn des Schuljahres 04/05<br />
� Evaluation 2006<br />
Das Kollegium ist mit seiner Entscheidung zufrieden.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Die Erarbeitung des deutschen Wortschatzes mit dem „Igelheft“ wurde infrage gestellt, in<br />
einer Arbeitsgruppe nach Alternativen gesucht mit dem Ergebnis den Einsatz des Igelheftes<br />
beizubehalten. Ergänzt werden sollen diese Übungen durch zusätzliche spezielle<br />
Rechtschreibthemen. Es entsteht eine Diktatsammlung mit zusätzlichen Hinweisen zur<br />
Wortschatzerarbeitung und individualisierten Diktatvorbereitung für die Schuljahre 2, 3, und<br />
4., die im Sekretariat allen Kolleginnen zugänglich ist.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
� Probeweise wird zur Erarbeitung des Wortschatzes das Igelheft ersetzt durch:<br />
„Richtig schreiben – Geschichten zum Grundwortschatz“ von Westermann, und zwar in den<br />
Jahrgängen 2 und 3.<br />
� Der Jahrgang 4 wird mit dem Igelheft Nr. 4 seinen bisherigen Lehrgang beenden.<br />
� In den Jahrgängen 2 bis 4: Anschaffung des Lese-/Sprachbuchs „Jojo“, Verlag: Cornelsen<br />
� Anschaffung <strong>der</strong> Wörterbücher „LOLLI POP“, Verlag Cornelsen, für die Jahrgänge 2 und 3<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-1
Planung für 2008/09<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Ab April 08 etabliert sich ein jahrgangsübergreifen<strong>der</strong> Arbeitskreis „Anfangsunterricht“ mit<br />
folgenden Entwicklungs- und Teilzielen:<br />
� Erweiterung, Schulung, Verbesserung <strong>der</strong> phonematischen Bewusstheit, die in den<br />
Kin<strong>der</strong>gärten mit dem „Würzburger Programm“ Teil 1 begonnen hat.<br />
� Arbeit mit dem „Würzburger Programm“ Teil 2 in Klasse 1 vor und/o<strong>der</strong> während des<br />
Schreib- und Leselernprozesses<br />
� Schulung <strong>der</strong> Feinmotorik (Material- und Projektsammlung auch unter dem Aspekt <strong>der</strong><br />
Binnendifferenzierung dazu hat bereits in 07/08 begonnen.)<br />
� Weiterentwicklung <strong>der</strong> visuellen Wahrnehmung, vor allem bei Schülern mit<br />
Teilleistungsstörungen und Entwicklungsdefiziten. (Material- und Projektsammlung auch<br />
unter dem Aspekt <strong>der</strong> Binnendifferenzierung dazu hat bereits in 07/08 begonnen.)<br />
� Gemeinsame Unterrichtvorbereitungen, Absprachen, Austausch und Schwerpunktbildung in<br />
Jahrgangsteams und jahrgangsübergreifenden Teams<br />
� Erstellung von Lern- und För<strong>der</strong>kisten (Material- und Projektsammlung)<br />
� Entwicklung differenzierter Lernangebote zur individuellen För<strong>der</strong>ung<br />
� Einführung von standardisierten Lernstandserhebungen , beginnend im Anfangsunterricht<br />
mit ILEA, auch fürs 2. Schuljahr geeignet, gefolgt von evtl. Bielefel<strong>der</strong> Programm,<br />
Mildenberger Programm, HSP= Hamburger Schreibprobe und auch Leseprobe als lern<br />
begleitende Diagnostik. (Nicht standardisierte Lernstandserhebungen werden zum Teil<br />
schon von den Kolleginnen durchgeführt.)<br />
� Unterstützung im Anfangsunterricht durch Studenten <strong>der</strong> Fachhochschule Fresenius aus<br />
den Fachbereichen Logopädie und Ergotherapie (Erste Kontaktgespräche mit <strong>der</strong><br />
Hochschuldekanin durch Schulleiterin im Januar und März 2008), evtl. auch <strong>der</strong> Universität<br />
Frankfurt für Studenten, die eine praxisorientierte Seminar- o<strong>der</strong> Hausarbeit anfertigen<br />
wollen.<br />
� Intensivierung <strong>der</strong> Kooperation mit den Kin<strong>der</strong>gärten Engenhahn und Nie<strong>der</strong>seelbach mit<br />
dem Ziel:<br />
� Informationsaustausch über die neuen Schüler mit ihren Auffälligkeiten,<br />
Entwicklungsverzögerungen, Therapien, den bisherigen Ergebnissen <strong>der</strong> Elternarbeit, <strong>der</strong><br />
Schuleingangsdiagnose im September und des Schnuppertages im Mai<br />
� Gemeinsame Betrachtung des großen Schwerpunktes einer vorschulischen Erziehung in<br />
den Bereichen <strong>der</strong> phonematischen Bewusstheit, Feinmotorik und visuellen Wahrnehmung<br />
als etablierter Tagesordnungspunkt <strong>der</strong> Schulleiterin <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> am Elternabend<br />
im Kin<strong>der</strong>garten vor <strong>der</strong> „Schlaumeierzeit“, dem letzten Kin<strong>der</strong>gartenjahr vor <strong>der</strong><br />
Einschulung. (Infragestellung des Namens „Schlaumeier“ ?)<br />
� Gemeinsames Vorsprechen beim Bürgermeister Döring, um die neue große Belastung<br />
durch die Krippen-Aufgabe zu beschreiben (Aufnahme von Kin<strong>der</strong>n ab 2 Jahre, 15 Kin<strong>der</strong><br />
pro 1,5 Personal) und zu erreichen, dass mehr Zeit den Erziehern bleibt für eine intensivere,<br />
innovative Vorschularbeit in den Bereichen phonematische Bewusstheit, Feinmotorik und<br />
visuelle Wahrnehmung.<br />
� Pädagogischer Tag: Freitag, den 28.11.08, Thema: Psychomotorische Lernmaterialien mit<br />
ihrem Lerntherapeutischen Hintergrund in Oberursel<br />
� Möglicherweise sich anschließendes Projekt mit Eltern zur gemeinsamen Herstellung von<br />
psychomotorischen Lernmaterialien.<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-2
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
� Evaluation 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Die erhoffte Zusammenarbeit und Unterstützung im Anfangsunterricht durch Studenten <strong>der</strong><br />
Fachhochschule Fresenius in Idstein kam lei<strong>der</strong> nicht zustande.<br />
� Es entstand jedoch reger Gedankenaustausch und Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Goethe-<br />
Lehrerakademie <strong>der</strong> Universität Frankfurt.<br />
- Kooperationsgespräche <strong>der</strong> Schulleiterin mit dem Geschäftsführer und Dozenten<br />
Prof. Dr. Büttner<br />
- Lernstandserhebung <strong>der</strong> Lesegeschwindigkeit (in Absprache mit den Eltern) unserer<br />
Schüler/innen in den Jahrgängen 2-4 durch eine Studentin <strong>der</strong> Psychologie im Rahmen<br />
ihrer Diplomarbeit (Januar 09)<br />
� Weitere Anschaffungen von Arbeitsmaterialien, Themenkisten und Anschauungsmaterialien<br />
für den Unterricht wurden getätigt, um vor allem im mathematischen und sprachlichen<br />
Bereich individuell för<strong>der</strong>n zu können.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Kooperation mit Frau Prof. Dr. Krajewski <strong>der</strong> Goethe- Universität Frankfurt zur<br />
Früherkennung und Prophylaxe von Dyskalkulie im Anfangsunterricht.<br />
Dazu gehörte die Schulung des gesamten Kollegiums durch Frau Prof. Dr. Krajewski.<br />
Für die beiden 1. Klassen erhalten wir jeweils einen Mathekoffer, <strong>der</strong> in Zusammenarbeit mit<br />
<strong>der</strong> Dozentin und dem Cornelsen-Verlag entstand. Diese Anschauungsmaterialien<br />
verbleiben als Schenkung an unserer Schule.<br />
Qualitätsentwicklung im Sachunterricht<br />
� Die Römer<br />
� Der Wald<br />
� Das Mittelalter<br />
Anschauungsmaterialien und Bücher werden gesammelt und bestellt, in großen<br />
Plastikbehältern im Lehrmittelraum zur Verfügung gestellt.<br />
� Anschaffung von Atlanten im Klassensatz<br />
� Anschaffung von Deutschlandkarten pro Klasse<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Neuanschaffungen von Kartenmaterial und Aufhängevorrichtung im eigens dafür erweiterten<br />
Lehrmittelraum:<br />
- Deutschland<br />
- Europa<br />
- Die Welt mit ihren Län<strong>der</strong>n<br />
- Nie<strong>der</strong>nhausen<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Ergänzung: Flughafen als großes unlaminiertes Poster<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-3
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2002<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Wir tätigten folgende Anschaffungen:<br />
- Karte: Hessen Politisch<br />
- Grundschulatlanten: „Hessen“, Verlag: Klett<br />
- Experimentierkästen: -Chemie, Elektronik, Schwimmen und Sinken<br />
- Ergänzungen <strong>der</strong> CVK-Kästen<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Wir tätigten folgende Anschaffungen:<br />
- Ein großes Skelett<br />
- Ein Torso<br />
� Planung <strong>2011</strong><br />
Anschaffungen:<br />
Erneuerung/Ergänzungen: Magnetkoffer<br />
Stromkoffer<br />
Qualitätsentwicklung im Kunstunterricht<br />
- Sichtung und Überarbeitung <strong>der</strong> Poster-Kunstsammlung<br />
- Beschaffung einer großen Sammelmappe für den Lehrmittelraum<br />
� Planung 2007<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Die Poster-Kunstsammlung wird noch einmal gesichtet und Poster werden überprüft, ob sie<br />
evt. laminiert und/o<strong>der</strong> eine Aufhängevorrichtung erhalten, um zum schnellen und<br />
übersichtlichen Zugriff bereit zu sein. Die Kunstsammelmappe erhält aus Styropor o<strong>der</strong> Karton<br />
Zwischenwände, damit die verbleibenden Poster nicht in sich zusammenfallen und sich wellen.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Die wertvollsten Poster wurden mit einer Halterung versehen und in einem neuen<br />
Haltegestell im Kartenraum aufgehängt.<br />
Einsatz neuer Medien im Unterricht<br />
Als ersten Schwerpunkt <strong>der</strong> Weiterentwicklung unserer schulischen Arbeit haben wir die<br />
Arbeit mit dem Computer gewählt.<br />
� Der PC ist aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Er nimmt auch im<br />
Spielwarensektor bereits einen großen Raum ein.<br />
� PC-Kenntnisse gehören in vielen Arbeitsbereichen zum Berufsbild<br />
� Viele Kin<strong>der</strong> lernen den PC nur als Spielgerät kennen. Die Schülerinnen und Schüler<br />
sollten den PC frühzeitig auch als Arbeitsmittel kennen lernen und ihn bewusst für ihre<br />
Zwecke nutzen (zur Textverarbeitung und zum Üben)<br />
� Der PC ist nur ein Bestandteil <strong>der</strong> Grundschularbeit<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-4
<strong>Stand</strong> Juli 2002<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Vor sechs Jahren haben wir begonnen, das neue Medium in die schulische Arbeit zu<br />
integrieren. Mittlerweile verfügt die Schule über einen Computerraum in dem sich 4 Rechner<br />
<strong>der</strong> neueren Generation mit Internetanschluss, sowie drei Rechner ohne Internet-Anschluss<br />
befinden. In jedem Klassenraum befinden sich darüber hinaus zwei Computer und ein<br />
Drucker, die zum Üben und För<strong>der</strong>n eingesetzt werden können. Die Benutzeroberfläche ist<br />
auf allen Rechnern vereinheitlicht worden. Es bestehen Regeln zur Benutzung. Ein Katalog<br />
über die an <strong>der</strong> Schule vorhandene Software liegt vor.<br />
Ziele<br />
1. Angestrebt wird eine gleichwertige Ausstattung in allen Klassen, wenn möglich soll <strong>der</strong><br />
Bestand noch aufgestockt werden. Dazu sollen angesprochen werden:<br />
� Kreis als Schulträger<br />
� Sponsoren aus <strong>der</strong> Wirtschaft (Banken etc.)<br />
� För<strong>der</strong>verein <strong>der</strong> Schule<br />
� Elternverein Nie<strong>der</strong>seelbach<br />
2. Jede Lehrkraft soll befähigt werden, das Textverarbeitungsprogramm „Microsoft Word“<br />
zu beherrschen und im Laufe <strong>der</strong> Grundschulzeit an die Kin<strong>der</strong> weiter zu geben. Zwei<br />
Kolleginnen werden in den Sommerferien 2002 an einer Fortbildungsmaßnahme<br />
teilnehmen und dann als Multiplikatoren bei schulinternen Fortbildungen dienen. Bis<br />
Weihnachten 2002 sollen alle Lehrkräfte sich im Programm Word auskennen.<br />
Am Ende des 4.Schuljahres gibt jedes Kind durch geeignete Textbeiträge, die es am PC<br />
erstellt, zu erkennen, dass es die Grundzüge <strong>der</strong> Textverarbeitung beherrscht.<br />
Die Lehrerin, die sich um PC- und Softwarepflege kümmert, soll Entlastungsstunden<br />
erhalten.<br />
� Evaluation 2005<br />
2003 nahmen mehrere Kollegen, <strong>der</strong> Schulleiter und die Sekretärin unter an<strong>der</strong>em am<br />
mehrtägigen Intel ® Fortbildungskurs teil.<br />
Ergänzende Ausstattung aller PCs mit Lernsoftware (2003)<br />
Entlastungsstunden werden ab 2004 nicht mehr genehmigt.<br />
� Evaluation 2006<br />
Sowohl die Sekretärin als auch die Schulleiterin nahmen an mehreren ganztägigen und<br />
mehrstündigen LUSD-Schulungen teil.<br />
Unsere Datenschutzbeauftragte erhielt mehrstündige Schulungen.<br />
Unsere Schule nahm an dem Projekt „Schule ans Netz“ teil und erhielt vom Kreis 30 neue PCs<br />
und Monitore sowie passende Tische und Drehstühle. Der Computerraum erhielt 8 PCs mit<br />
Flachbildschirmen, die Klassen jeweils 2 PCs mit normalen Bildschirmen. Die übrigen befinden<br />
sich neben Sekretariat und Büro <strong>der</strong> Schulleiterin für För<strong>der</strong>möglichkeiten im Lehrmittelraum, im<br />
Werkraum und im Lehrerzimmer.<br />
Die PCs von Sekretariat und Schulleiterbüro wurden miteinan<strong>der</strong> vernetzt und erhielten DSL-<br />
Anschluss, um die LUSD-Daten unserer Schule auf den zentralen Rechner des<br />
Kultusministeriums Hessens in Wiesbaden übermitteln zu können.<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-5
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> April 2008<br />
Schulen ans Netz<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Versorgung aller Klassen mit 2 PCs auf entsprechenden Arbeitstischen einschließlich<br />
Internetanschluss, sowie Anschluss <strong>der</strong> PCs des Computerraums ans Internet. Ausstattung<br />
des Computerraums mit Flachbildschirmen und neuen Stühlen.<br />
Beantragt: Februar 2005<br />
Genehmigt: Juni 2005<br />
Ausführung: Oktober bis Dezember 2005<br />
Medienkonzept<br />
Ausstattung <strong>der</strong> Schule<br />
30 vernetzte PCs in den gesamten Schulräumen<br />
� 2 vernetzte PCs in jedem Klassenraum ,<br />
� 2 PCs im Differenzierungsraum/Lehrmittelraum,<br />
� 1 PC im Werkraum<br />
Einsatz des PCs im Unterricht<br />
Während des „Werkstattunterrichts“ und <strong>der</strong> „Wochenplanarbeit“ als Arbeitsstation mit Lernprogrammen<br />
Zur Differenzierung und individuellen För<strong>der</strong>ung<br />
Als „Nachschlagewerk“ und Informationsquelle<br />
Zur Präsentation beim Schülervortrag<br />
Als Schreibmaschine<br />
Als kreatives Gestaltungsmittel<br />
Einsatz im För<strong>der</strong>unterricht<br />
Zur Motivation steigernden individuellen För<strong>der</strong>ung vor allem in den Fächern Deutsch – Rechtschreibung,<br />
Deutsch – Lesen und Mathematik<br />
Einsatz im zweistündigen Wahlpflichtunterricht als so genannte „PC-AG“<br />
Neben an<strong>der</strong>en „AG“-Angeboten können sich die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> Jahrgänge 3 und 4 - jedes<br />
Schulhalbjahr wechselnd - in die so genannte „PC-AG“ einwählen.<br />
Folgende Kompetenzen<br />
erwerben die Schülerinnen und Schüler je nach Jahrgang und Lehrerfähigkeit:<br />
� Richtiges Starten und Beenden des Computerprogramms<br />
� Umgang mit <strong>der</strong> Maus<br />
� Umgang mit <strong>der</strong> Tastatur (Buchstaben, Klein-, Großschreibung, Leertaste, Löschtaste, Zeilenwechsel)<br />
� Regeleinhaltung bei <strong>der</strong> Benutzung eines Computers<br />
� Arbeiten mit Lernprogrammen, z.B. Budenberg, Lernwerkstatt, Sy-la-bo, Schreiblabor usw.<br />
� Schreiben und Versenden sowie Drucken von e-mails innerhalb <strong>der</strong> eigenen und <strong>der</strong> Parallelklasse mit Hilfe<br />
des Programms Schreiblabor<br />
� Speichern auf Diskette, die in <strong>der</strong> Schule bleibt<br />
� Wie<strong>der</strong> finden <strong>der</strong> gespeicherten Dateien<br />
� Drucken<br />
� Schreiben eigener Texte am PC – erste Schritte in Word: Symbol- und Menüleiste, Schriften, Schriftgröße,<br />
Farbe, Formatieren, einfügen von Bil<strong>der</strong>n und Fotos<br />
� Bedienen <strong>der</strong> schuleigenen Digitalkamera<br />
� Malen mit Paint: Symbol- und Menüleiste<br />
� Umgang mit <strong>der</strong> Bildbearbeitungssoftware Pixel Maxx<br />
� Speichern auf Festplatte unter Lanis – wie<strong>der</strong> finden und öffnen <strong>der</strong> gespeicherten Dateien<br />
� Informationsentnahme aus dem Internet (Aufsuchen vorgegebner Kin<strong>der</strong>seiten, Eingeben von Suchbegriffen)<br />
� Schreiben und gestalten eigener Texte am PC<br />
� Herstellen von „Büchern“<br />
� Verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet im Bewusstsein <strong>der</strong> Gefahren – Thema eines Elternabends<br />
� Evt. Erstellen einer multimedialen Präsentation und Brennen auf CD-Rom<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-6
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
� Evaluation 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Ein Computerkurs kann im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts auf Grund <strong>der</strong><br />
Lehrerversorgung nicht mehr erteilt werden.<br />
Herr Michael Klodt, Vater eines Schülers, bietet jedoch ehrenamtlich im Schuljahr 09/10 eine<br />
Computer-AG für 10 Schüler aus den Jahrgängen 3 und 4 an.<br />
Konzeption des Kurses siehe Anhang<br />
� Planung <strong>2010</strong>/11<br />
EDV-Kurs zur Arbeit mit unserer Homepage für unsere interessierten Kolleginnen durch<br />
Herrn Klodt.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />
Das Kollegium nahm mit regem Interesse an dem EDV-Kurs des Herrn Klodt teil.<br />
Frau Lygia Teubner übernimmt mit diesem Schuljahr die Betreuung unserer Homepage in<br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Schulleiterin Monika Simon und <strong>der</strong> Koordinatorin für „PÄM“ Frau Anke<br />
Gamer.<br />
Auswahl eines neuen Mathematikwerks sowie neuer Anschauungsmaterialien für die Hand<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> im Mathematikunterricht<br />
Während <strong>der</strong> letzten Jahre und <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> beiden Probedurchgänge <strong>der</strong><br />
Orientierungsarbeiten stellt das Kollegium fest, dass das alte Mathebuch nur den<br />
Grundanfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Rahmenpläne entspricht. Realitätsbezug, Vermittlung von<br />
Problemlösungsstrategien sowie Anfor<strong>der</strong>ungen an das selbstständige Denken fehlten in<br />
weiten Bereichen.<br />
Außerdem stellt das Kollegium fest, dass bei <strong>der</strong> Vermittlung einzelner mathematischer<br />
Phänomene die Schüler mehr Anschauung und praktisches Üben mit geeigneten<br />
Materialien und Unterrichtsmitteln benötigen.<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-7
<strong>Stand</strong> Juli 2004/05 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Projektphasenplan<br />
Phase I<br />
Arbeitspaket 1<br />
� Probeexemplare <strong>der</strong> Mathematikbücher<br />
bei den<br />
Verlagen bestellen<br />
� Kriterienkatalog für den<br />
Bücherbewertungsbogen<br />
Ab sofort<br />
Bis 15.12.2004<br />
� Evaluation 2005<br />
Arbeitspaket 2<br />
� Mathematikbücher im<br />
laufenden Unterricht testen<br />
Ab sofort<br />
Bis Juni 2005<br />
Lernen mit allen Sinnen<br />
Im Mathematikunterricht <strong>der</strong> Grundschule<br />
Arbeitspaket 3<br />
� altes Lernmaterial sichten<br />
� Ergänzungsvorschläge<br />
aufschreiben<br />
Ab sofort<br />
Bis 15.12.2004<br />
Phase II<br />
a) Gesamtkonferenz<br />
Vorstellung mit Aussprache / Beschlussfassung über Anschaffung<br />
neuer Materialien<br />
bis 15.01.2005<br />
b) Bestellung<br />
bis 16.06.2005<br />
Phase III<br />
Einigung über Organisation / Verwaltung des Materials<br />
bis Ende Februar<br />
Phase IV<br />
Gesamtkonferenz Juli 2005<br />
Auswertung <strong>der</strong> Bewertungsbögen<br />
� Beschlussfassung zur Anschaffung des Mathematikbuches „Zahlenreise“ in<br />
den Jahrgängen 2-4. Das alte Mathematikbuch wird für Übungszwecke<br />
hinzugenommen<br />
Phase V<br />
Implementierung im Unterricht Mathematiklehrer<br />
Phase VI<br />
Evaluation nach ½ Jahr (Klassenbucheintragungen – zum Gebrauch <strong>der</strong> Materialien im Unterricht)<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Arbeitspaket 4<br />
� Kataloge sichten<br />
� Bestellung von Material<br />
vorbereiten (Vorschläge)<br />
� Ansichtsmaterial beschaffen<br />
(über Verlage)<br />
� Material ausprobieren<br />
Ab sofort<br />
Bis 15.12.2004<br />
Die Umstellung auf das neue Mathebuch mit seinen gehobenen Ansprüchen verursacht<br />
einigen Schülern in Klasse 4 ungewohnte Schwierigkeiten. Der Einsatz <strong>der</strong> Materialien<br />
bereichert den Unterricht. Weitere Materialien werden geor<strong>der</strong>t.<br />
Vom Kollegium aufgestellter Kriterienkatalog für die Auswahl des Mathematikbuches<br />
Optik<br />
● Bil<strong>der</strong><br />
○ im Zusammenhang mit Rechenoperation<br />
○ regen zum Erzählen an<br />
○ ästhetisch, liebevoll<br />
● Symbolische Darstellungen<br />
○ wie<strong>der</strong>kehrend<br />
○ jedem gut verständlich<br />
○ Erklärung bei <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> Rechenoperation<br />
○ im beson<strong>der</strong>en mathematische Hürden gut dargestellt<br />
● Struktur des Seitenaufbaus<br />
○ ruhiger Ausdruck<br />
○ nicht überladen<br />
○ Schriftgröße<br />
○ Zeilenabstand<br />
Haptik<br />
● robustes Papier<br />
● Format handlich<br />
● im Ranzen findbar<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-8
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
� Evaluation 07/08<br />
Inhalt<br />
● sinnvolle, aufeinan<strong>der</strong> aufbauende Reihenfolge<br />
● kleinschrittige Einführung (z.B. <strong>der</strong> Zahlenräume)<br />
● schrittweise Erweiterung<br />
● mathematische Hürden gut erklärt<br />
● Rechengeschichten aus dem Lebensbereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
● Geometrie kommt ausreichend vor<br />
● Denkaufgaben<br />
● offene Aufgabenstellungen / Sachaufgaben<br />
● viele Übungsformen im Arbeitsheft<br />
● fächerübergreifende Aspekte<br />
● Lehrerhandbuch<br />
○ ausreichende Hilfen im Lehrerhandbuch<br />
○ Lehrerhandbuch hat Testvorlagen<br />
○ Testvorlage besteht aus Fundamentum und Additum<br />
Methode<br />
● Selbstkontrolle<br />
● Steigerung des Anspruchs<br />
● Differenzierung für starke und schwache Schüler<br />
● Handlungs- und Erfahrungsorientierung<br />
● Bei Sachaufgaben und Rechengeschichten:<br />
○ Hinführung zu Lösungsstrategien<br />
○ Handlungs-, Skizzen- und Textarbeit<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
„Denken und Rechnen“, Vlg. Westermann, löst probeweise das Mathematikbuch<br />
„Zahlenreise“ in einzelnen Klassen ab, da Unzufriedenheiten <strong>der</strong> Mathematiklehrerinnen<br />
zunehmen.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Einführung von “Denken und Rechnen“ mit Arbeitsheften in den Jahrgängen 2-4.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Ergänzung <strong>der</strong> Anschauungsmaterialien für den Unterricht und die Hand <strong>der</strong> Schüler/innen:<br />
- Geometriemodelle<br />
- Schüttelboxen<br />
- Körper und Netze<br />
- Zum Bruchrechnen<br />
- Magnetscheiben<br />
- Uhren<br />
- Waagen und Gewichte<br />
Weiterentwicklung von Unterricht E4-9
Deutsch - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Schuleigene Rahmenpläne / Kerncurricula<br />
Deutsch<br />
Die Schülerinnen und Schüler sollen folgende Inhalte bearbeiten und weitgehend beherrschen<br />
1. Texte verfassen<br />
Erzählende Texte:<br />
� Schluss einer Geschichte finden<br />
� Nacherzählung schreiben<br />
� Phantasiegeschichte schreiben<br />
� Reizwortgeschichten schreiben<br />
� Bildgeschichten schreiben<br />
� Briefe schreiben<br />
� Verwenden formaler Aspekte (z.B. Einleitung/Hauptteil/Ende, Zeitform, verschiedene<br />
Satzanfänge)<br />
Informative Texte, z.B.:<br />
� Bericht (z.B. über Ereignisse, Buchinhalte,…)<br />
� Vorgangsbeschreibung (z.B. Bastelanleitungen, Kochrezepte)<br />
� Einladungen<br />
2. Grammatik<br />
Wortarten bestimmen:<br />
� Verb (Tuwort)<br />
� Nomen / Substantiv (Namenwort)<br />
� 4 Fälle des Nomens<br />
� Bestimmte und unbestimmte Artikel<br />
(Begleiter)<br />
� Adjektiv (Wiewort)<br />
� Personalpronomen (Fürwort)<br />
� Präposition (Verhältniswort)<br />
Satzglie<strong>der</strong> bestimmen:<br />
� Subjekt<br />
� Prädikat<br />
� Ergänzungen (Dativ- und<br />
Akkusativobjekt, adverbiale<br />
Bestimmung des Ortes, <strong>der</strong> Zeit, <strong>der</strong><br />
Art und Weise und des Grundes)<br />
Zeiten des Verbs:<br />
� Gegenwart – Präsens<br />
� Vergangenheit – Präteritum<br />
� Vollendete Gegenwart – Perfekt<br />
� Zukunft – Futur I<br />
Satzarten:<br />
� Aussagesatz<br />
� Auffor<strong>der</strong>ungssatz<br />
� Ausrufesatz<br />
� Fragesatz<br />
� Einfache Satzverbindungen<br />
(Konjunktionen)<br />
Satzzeichen:<br />
� Punkt<br />
� Komma (Aufzählungen, dass, weil,<br />
wenn, …)<br />
� Fragezeichen<br />
� Ausrufezeichen<br />
� Doppelpunkt<br />
Schuleigene Rahmenpläne Deutsch E5-1
Deutsch - <strong>Stand</strong> 2002<br />
3. Rechtschreibung<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Grundwortschatz „Für Diktate üben“, 2.-4.Klasse, Westermann Verlag<br />
Erweitertes Wortschatztraining (Wortfel<strong>der</strong>, Wortfamilien, Zusammensetzungen)<br />
Arbeit mit dem Wörterbuch<br />
Sensibilisierung für Rechtschreibphänomene, z.B.:<br />
� lange und kurze Vokale<br />
� Dehnungen (ie, ieh, aa, Dehnungs - h)<br />
� Umlaute (eu, äu)<br />
� Substantivierung von Verben<br />
� Endungen (nis, ung)<br />
� Substantivierung von Adjektiven<br />
� Endungen (heit, keit)<br />
� Auslaute (d <strong>der</strong> t) (g o<strong>der</strong> k) durch Ableitungen z.B. Hand - Hände<br />
� Anlaute B o<strong>der</strong> P; G o<strong>der</strong> K; W o<strong>der</strong> F o<strong>der</strong> V<br />
� Silbentrennung<br />
� „dass“ im Nebensatz<br />
� Verkleinerungsformen<br />
� Wörtliche Rede – Drei mögliche Stellungen des Begleitsatzes<br />
� Kommaregeln bei wörtlicher Rede und Aufzählungen<br />
4. Mündlicher Bereich<br />
� Sich an Gruppen- Kreisgesprächen beteiligen<br />
� Gesprächsregeln vereinbaren und einhalten<br />
� Verschiedene Sprachhandlungen ausführen, z.B.<br />
o Arbeitsergebnisse vortragen<br />
o Unterrichtsvorhaben mitplanen<br />
o Sachinformationen geben<br />
o Erzählen<br />
o Vorschläge machen<br />
o Auf an<strong>der</strong>e Redebeiträge eingehen<br />
o Sich in an<strong>der</strong>e hineinversetzen und Anteilnahme ausdrücken<br />
o Gefühle und Probleme verbalisieren und Lösungsvorschläge finden<br />
o Unterschiedliche Meinungen austauschen<br />
� Kleine Spielrollen übernehmen<br />
� Gedichte vortragen<br />
� Kurzreferate halten<br />
5. Umgang mit Texten<br />
� Flüssig und sinnbetont lesen und vorlesen<br />
� Leseinteresse wecken durch Nutzung <strong>der</strong> Klassen-, Schul- und Gemeindebücherei<br />
� Vorstellen eigener Lieblingsbücher<br />
� Textgruppen und Textformen kennen lernen (z.B. Märchen, Fabeln, Sagen,<br />
Erzählungen, Gedichte, Sachtexte, etc.)<br />
� Texte verstehen, verän<strong>der</strong>n, fortsetzen<br />
� Zu Textinhalten Stellung nehmen<br />
� Zu Unterrichtsinhalten passende Texte finden und verwenden<br />
Schuleigene Rahmenpläne Deutsch E5-2
Mathematik - <strong>Stand</strong> 2002 Mathematik - am Ende <strong>der</strong> Klasse 2 - <strong>Stand</strong> 2002<br />
Mathematik<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Am Ende des 2. bzw. 4. Schuljahres sollten die Schüler in Mathematik folgende Fähigkeiten,<br />
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben. (Orientierung am Rahmenplan Grundschule 1995)<br />
Die Schüler sollen wissen, können, in <strong>der</strong> Lage sein…<br />
am Ende <strong>der</strong> Klasse 2<br />
1. Mengen und Zahlen<br />
1.1. Zahlen bis 100 sicher lesen<br />
1.2. stellengerecht schreiben H,Z.E<br />
1.3. eine klare Größenvorstellung entwickeln, z.B. durch grafische Darstellung, zerlegen in<br />
Zehner, Einer<br />
1.4. Zahlen vergleichen<br />
1.5. folgende Zahleneigenschaften kennen: gerade, ungerade, teilbar durch<br />
1.6. Zahlbeziehungen bestimmen: kleiner, teilbar, das Doppelte, die Hälfte, Vorgänger,<br />
Nachfolger, Nachbarzehner benennen<br />
1.7. Zahlen als Kardinalzahl, ,Ordnungszahl Operatorzahl, Maßzahl, Codierungszahl<br />
verwenden<br />
2. Addieren und Subtrahieren<br />
2.1. das 1 x 1 konkret handelnd, dann gedächtnismäßig ausfuhren im Zahlenraum bis 100<br />
2.2. die Grundaufgaben und Gleichungsform (plus, minus, gleich, + , - , = und in Operatorform<br />
( + , - ) darstellen<br />
2.3. Nachbar-, Tausch- und Umkehraufgaben anwenden<br />
2.4. komplexe Aufgaben in Teilschritte zerlegen, Lösungsmöglichkeiten selbst finden und<br />
übersichtlich darstellen<br />
3. Multiplizieren und Dividieren<br />
3.1. einstellige Zahlen multiplizieren<br />
3.2. die Division als Aufteilen und Verteilen und Umkehroperationen <strong>der</strong> Multiplikation<br />
anwenden<br />
3.3. die Gleichungs- und Operatorschreibweise anwenden (Sprechweise: mal, geteilt durch,<br />
gleich<br />
3.4. Divisionsaufgaben mit Rest lösen z.B. 13:4=3 R1<br />
3.5. das kleine Einmaleins bis zur Mitte des 3. Schuljahres: gedächtismäßig beherrschen<br />
(Einmaleins-Pass)<br />
4. Sachrechnen<br />
4.1. in Situationen o<strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>n Sachverhalte erkennen, darstellen, Aufgaben ableiten u.<br />
lösen<br />
4.2. zu Daten o<strong>der</strong> Zahlaufgaben Rechengeschichten erfinden<br />
4.3. einfache (dreigliedrige) Sachaufgaben nach dem Schema "Frage-Rechnung-Antwort"<br />
lösen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Mathematik E5-3
Mathematik - am Ende <strong>der</strong> Klasse 2 - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
5. Größen Längen Zeit Gewichte Hohlmaße<br />
die Geldsorten und den Wert von Mengen und Geldschemen kennen, sie einwechseln und<br />
Geldbeträge bestimmen und darstellen<br />
5.1. bis 100 € mit ganzen Beträgen rechnen<br />
eine realistische Preisvorstellung entwickeln<br />
5.2. - eine Größenvorstellung entwickeln<br />
- Dinge vergleichen, ordnen, schätzen, genau messen<br />
- die Begriffe Höhe, Breite, Tiefe verstehen und anwenden<br />
- die Längeneinheiten m, cm kennen und damit rechnen<br />
5.3. - Zeiteinheiten und <strong>der</strong>en Zusammenhänge erkennen (Tag, Woche, Monat, Jahr)<br />
- das Datum lesen und schreiben<br />
- die Uhrzeit ablesen, einstellen und notieren bis auf volle 5 Minuten<br />
5.4. - Gegenstände mit Händen wiegen<br />
- Gewichtsteine fühlen und mit realen Dingen vergleichen<br />
- die Begriffe "ist schwerer als, ist leichter als" verstehen und anwenden<br />
6. Geometrie<br />
6.1. Lagebezeichnungen<br />
- Orientierungsspiele, Konstruktionsspiele ausführen<br />
6.2. Eigenschaften von Gegenständen, geometrischen Figuren und Körpern<br />
- die Körperformen Würfel, Qua<strong>der</strong>, Zylin<strong>der</strong>, Kegel, Pyramide, Kugel kennen lernen<br />
- die Flächenformen Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis kennen lernen<br />
- nach Eigenschaften sortieren und Oberbegriffe finden<br />
6.3. Muster, Ornamente, Achsensymmetrie<br />
- Muster erkennen und beschreiben<br />
- Muster und Ornamente selbst herstellen<br />
- Unterschiede bei Original- und Spiegelbil<strong>der</strong>n erkennen<br />
6.4. Fläche und Umfang von Figuren<br />
- geometrische Figuren mit Stäbchen legen und Flächen mit Plättchen auslegen<br />
6.5. Umgang mit Zeichengeräten<br />
- einfache Figuren mit Schablone und Lineal zeichnen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Mathematik E5-4
Mathematik - am Ende <strong>der</strong> Klasse 4 - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
am Ende <strong>der</strong> Klasse 4<br />
1. Mengen und Zahlen<br />
1.1. Zahlen bis zur Million sicher lesen u. schreiben<br />
1.2. stellengerecht schreiben M,HT,ZT,T,H,Z,E<br />
1.3. eine klare Größenvorstellung entwickeln, z.B. durch grafische Darstellung, Fel<strong>der</strong>,<br />
Millimeterpapier<br />
1.4. Nachbarzahlen: Tausen<strong>der</strong>, Zehn- und Hun<strong>der</strong>ttausen<strong>der</strong> im Zahlenstrahl darstellen<br />
1.5. Umrechnungen unter Verwendung von Tausen<strong>der</strong>maßen: kg, g, km, m, cm, mm<br />
1.6. Zahlen runden, in Tabellen und Schaubil<strong>der</strong>n darstellen und lesen<br />
Zusatz: römische Zahlen<br />
2. Addieren und Subtrahieren<br />
2.1. Erweiterter Zahlenraum bis Million kennen und anwenden<br />
2.2. schriftliche Addition und Subtraktion mit 2 Übergängen<br />
2.3. Bei Subtraktion das Ergänzungsverfahren anwenden<br />
Folgende Sprechweise: zuerst 6 bis 8, dann 6+2 = 8<br />
2.4. Ergebnisse abschätzen, überschlagsmäßig rechnen runden und prüfen<br />
3. Multiplizieren und Dividieren<br />
3.1. Multiplikationsaufgaben mit mehrstelligen Zahlen, Divisionsaufgaben mit einstelligen<br />
Zahlen lösen.<br />
3.2. komplexe Aufgaben u. Teilschritte auflösen und übersichtlich darstellen<br />
3.3. das schriftliche Rechenverfahren für das Multipliplizieren und Dividieren beherrschen<br />
3.4. die Ergebnisse abschätzen, Überschlags- und Kontrollrechnungen anwenden<br />
Zusatz: Divisionsaufgaben mit 2-stelligen Dividenden lösen, den Quotienten als<br />
Dezimalzahl berechnen<br />
4. Sachrechnen<br />
4.1. Texte analysieren<br />
4.2. notwendige u. überflüssige Informationen unterscheiden u. fehlende Informationen<br />
beschaffen.<br />
4.3. unterschiedliche Lösungswege finden und übersichtlich darstellen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Mathematik E5-5
Mathematik - am Ende <strong>der</strong> Klasse 4 - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
5. Größen Längen Zeit Gewichte Hohlmaße<br />
die Geldsorten und den Wert von Mengen und Geldschemen kennen, sie einwechseln und<br />
Geldbeträge bestimmen und darstellen<br />
5.1. bis mindestens 1.000 € in Kommaschreibweise und unterschiedlichen Formen<br />
rechnen, sowie realistische Preisvorstellungen entwickeln<br />
5.2. - typische Gegenstände kennen im Maß von ca. 10m, 100m, 1km<br />
- die Längeneinheiten km-m, m-cm , cm-mm, kennen und Umwandlungen durchführen<br />
- Längenangaben in unterschiedlicher Form aufschreiben (Kommaschreibweise bei mcm<br />
)<br />
- Bruchteile des Meters angeben (1/4 m, 1/2 m)<br />
- anband von Tabellen und Landkarten mit Längen rechnen<br />
- nach vorgegebenem Maßstab Längen bestimmen und Strecken zeichnen<br />
5.3. - eine sichere Vorstellung von Zeitpunkt und Zeitspanne gewinnen<br />
- die Uhrzeit bis auf Minuten genau lesen und schreiben<br />
- Bruchteile <strong>der</strong> Stunden bestimmen (Viertelstunde, Halbestunde, Dreiviertelstunde)<br />
- Abkürzungen (s, min, h) kennen<br />
- Zeitspannen messen, ermitteln, berechnen, umwandeln in benachbarte Zeiteinheiten<br />
Operatordarstellung: 7.15 Uhr + 3 Std. = 10.15 Uhr<br />
- Fahrpläne und Programme lesen<br />
5.4. - eine Größenvorstellung entwickeln<br />
- Gewichtseinheiten und ihre Beziehungen kennen (t, kg, g)<br />
- mit Gewichten rechnen<br />
- Gewichte schätzen und wiegen<br />
5.5. - sichere Kenntnisse im Bereich Volumen haben<br />
- Liter und Milliliter (l, ml) kennen und ihre Beziehungen<br />
- das Fassungsvermögen von Gefäßen schätzen und messen<br />
Zusatz: an<strong>der</strong>e Volumenangaben wie cl, dl suchen und klären.<br />
6. Geometrie<br />
6.1. Lagebezeichnungen<br />
- räumliche Beziehungen erkennen, beschreiben, darstellen<br />
- die Begriffe „parallel, lotrecht, waagerecht, senkrecht“ kennen und verwenden<br />
6.2. Eigenschaften von Gegenständen, geometrischen Figuren und Körpern<br />
- die geometrischen Begriffe Punkt, Seite, Seitenlänge , Winkel, Fläche, Ecke, Kante<br />
kennen lernen und verwenden<br />
- Modelle und Netze von Würfeln und Qua<strong>der</strong>n herstellen<br />
6.3. Muster, Ornamente, Achsensymmetrie<br />
- Muster, Ornamente erkennen, beschreiben, selbst herstellen<br />
- achsensymmetrische Formen erkennen, herstellen und Symmetrieachsen einzeichnen<br />
6.4. Fläche und Umfang von Figuren<br />
- die Anzahl von Quadraten und Dreiecken bestimmen die zum Auslegen von Flächen<br />
benötigt werden<br />
- den Begriff Umfang kennen und bei Quadrat, Rechteck und Dreieck berechnen<br />
6.5. Umgang mit Zeichengeräten<br />
- mit Lineal und Geodreieck sachgerecht umgehen<br />
- Geraden, Strahlen, rechte Winkel und parallele Linien zeichnen<br />
- Strecken zeichnen und ausmessen<br />
- mit Hilfe geeigneter Gegenstände Kreise zeichnen Zusatz: Zirkeleinsatz<br />
Schuleigene Rahmenpläne Mathematik E5-6
Mathematik – Für alle - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Für alle:<br />
7. Lateinische Begriffe, die die Schüler verstehen und anwenden können sollen<br />
Addition – addieren – Summe<br />
Subtraktion – subtrahieren – Differenz<br />
Multiplikation – multiplizieren – Produkt<br />
Division – dividieren – Quotient<br />
Schuleigene Rahmenpläne Mathematik E5-7
Sachunterricht - <strong>Stand</strong> 2002<br />
Sachunterricht<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Aus diesem Rahmenplan, <strong>der</strong> 12 umfangreiche Lernfel<strong>der</strong> beinhaltet, wählen die Lehrkräfte<br />
einzelne Themenbereiche für ihren Unterricht aus. Jedem Lehrer ist es möglich, diese<br />
unterschiedlich zu gewichten sowie weitere Bereiche hinzuzufügen. Somit wird je<strong>der</strong> Lehrkraft,<br />
vor allem <strong>der</strong>jenigen ohne spezielle Fachausbildung genügend Spielraum und zugleich<br />
Anregung für ihren Unterricht geschaffen.<br />
1. Zusammenleben<br />
2. Öffentliches Leben<br />
3. Spiele und Freizeit<br />
4. Arbeit<br />
5. Technik<br />
6. Raum<br />
7. Zeit<br />
8. Naturphänomene<br />
9. Wasser<br />
10. Pflanzen<br />
11. Tiere<br />
12. Körper<br />
In Verbindung mit den inhaltlichen Zielen <strong>der</strong> Lernfel<strong>der</strong> verfolgt <strong>der</strong> SU den Aufbau fachlicher<br />
Qualifikation<br />
� Mit an<strong>der</strong>en umzugehen<br />
� Sich in Zeit und Raum zu orientieren<br />
� Beobachten<br />
� Vergleichen, unterscheiden, messen<br />
� Experimentieren, untersuchen, konstruieren<br />
� Probleme lösen und kritisch denken<br />
� Informationen sammeln, ordnen, weitergeben<br />
� Planen, projektieren<br />
Als fächerübergreifende Aufgabengebiete kommen verbindlich hinzu:<br />
� Gesundheitserziehung<br />
� Sexualerziehung<br />
� Medienerziehung<br />
� Friedens- und Rechtserziehung<br />
� Umwelterziehung<br />
� Verkehrserziehung<br />
� Kulturelle Praxis - Darstellendes Spiel<br />
An unserer Schule wird im 1.Schuljahr <strong>der</strong> SU nicht geson<strong>der</strong>t ausgewiesen son<strong>der</strong>n wird mit<br />
Deutsch, Mathematik, ästhetischer Bildung, Sport und Religion verbunden. Themen, die im<br />
1.Schuljahr nicht behandelt wurden, sollten im 2.Schuljahr abgedeckt werden.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sachunterricht E5-8
Sachunterricht - 2.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
2.Schuljahr<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Zusammenleben<br />
� Regeln und Rituale in <strong>der</strong> Klasse /Schule<br />
� Feste "Dienste einrichten"<br />
� Gesprächsregeln erarbeiten und einhalten<br />
� Möglichkeiten suchen, Konflikte gewaltfrei zu lösen<br />
� In Klassenangelegenheiten Mehrheitsentscheidungen herbeiführen und akzeptieren<br />
2. Öffentliches Leben<br />
� Alle Räume <strong>der</strong> Schule kennen lernen (Bücherei, Musikraum, Werkraum,<br />
Heizungsraum, Keller)<br />
� Informationsflächen schaffen (z .B. Pinnwände)<br />
3. Spielen und Freizeit<br />
� Spielecken einrichten<br />
� Bekanntmachen mit neuen und alten Spielen<br />
� Evtl. Spielnachmittag veranstalten<br />
� Schulhof als Spielraum erschließen<br />
� Beim Schulfest o<strong>der</strong> Aufnahme <strong>der</strong> Schulneulinge o<strong>der</strong> Elternabend ein<br />
darstellendes Spiel vorführen<br />
4. Arbeit<br />
� Interessante Berufe darstellen, gegebenenfalls jemanden einladen in die Schule<br />
� Selbst ein Produkt herstellen (z.B. Apfelbrei) und den Arbeitsablauf dokumentieren<br />
� Über die Verteilung <strong>der</strong> Arbeit Zuhause sprechen<br />
� Feste Arbeitseinteilung für die Kin<strong>der</strong> (aufräumen, Tisch abwischen, spülen, fegen,<br />
Müll wegbringen, Tafel putzen, etc.)<br />
5. Technik<br />
� mit strukturiertem und unstrukturiertem Arbeitsmaterial Bauwerke schaffen<br />
� Rä<strong>der</strong>fahrzeuge bauen und ihre Rollfähigkeit überprüfen<br />
� Stromquellen und -verbraucher, elektrische Geräte in Schule und Haushalt suchen<br />
(Wirkungsweise und Gefahren)<br />
� Spielerische Erfahrungen mit Wind-, Wasser- und Sonnenkraft sammeln<br />
6. Raum<br />
� Das Schulgebäude, Schulweg erkunden<br />
� Spiele zur Orientierung im Raum<br />
� Pflanzen auf dem Schulgelände und näheren Umgebung sammeln und auf einen<br />
Plan aufkleben<br />
7. Lernfeld Zeit<br />
� Tagesablauf, Wochentage, Monatsnamen kennen<br />
� Einen Geburtstagskalen<strong>der</strong> und Jahresuhr basteln<br />
� Verschiedene Uhren lesen lernen<br />
� Pflanzen längere Zeit beobachten<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sachunterricht E5-9
Sachunterricht - 2.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
8. Lernfeld Naturphänomene<br />
� Sonnenstand, helle und dunkle Stunden unterscheiden<br />
� Über Gewitter, Unwetter, Naturkatastrophen sprechen<br />
� Windrä<strong>der</strong> basteln<br />
� Mit Temperaturmessgeräten umgehen<br />
� Den Umgang mit Werkzeugen für verschiedene Materialien üben<br />
� Mit unterschiedlichen Materialien bauen<br />
� Wirkungsweise von Magneten kennen lernen<br />
9. Wasser<br />
� Im und am Wasser Spielen<br />
� Gebastelte Schiffe zum Schwimmen bringen<br />
� Wasser als Lebensmittel kennen lernen<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
10. Tiere<br />
� Einen Bauernhof besuchen und den Besuch mit Bil<strong>der</strong>n und Text dokumentieren<br />
� Körpersprache von Hund und Katze vergleichen und verstehen<br />
� Lebewesen auf Wiese, am Bach usw. beobachten<br />
11. Pflanzen<br />
� Keimversuche von Bohnen Kresse usw.<br />
� Blätter und Bäume und Früchte zuordnen<br />
� Obstbäume und Früchte erkennen<br />
� Zimmerpflanzen kennen und pflegen<br />
12. Körper<br />
� Erfahrungen mit allen Sinnen machen<br />
� In regelmäßigen Abständen Größe und Gewicht überprüfen<br />
� Über Zähne und Zahnpflege Bescheid wissen<br />
� Wissen, wie man sich vor Krankheiten schützen kann<br />
� Sexualerziehung<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sachunterricht E5-10
Sachunterricht - 3./4.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
3./4. Schuljahr<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Lernfeld Zusammenleben<br />
� Klassensprecher wählen, Verantwortlichkeiten absprechen<br />
� Mit an<strong>der</strong>en Klassen Absprachen und Entscheidungen treffen<br />
� Briefwechsel mit an<strong>der</strong>en Schulklassen führen<br />
� Herausfinden, wie Kin<strong>der</strong> in an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n spielen, lernen wohnen feiern usw.<br />
2. öffentliches Leben<br />
� Eine Schülerzeitung herausgeben<br />
� Öffentliche Einrichtungen besuchen (Feuerwehr, Post, Klärwerk, Müllkippe,<br />
Gemeindeverwaltung)<br />
� Probleme <strong>der</strong> Müllentstehung, -vermeidung und -entsorgung kennen und Lösungen<br />
finden<br />
� Sich an öffentlichen Veranstaltungen beteiligen (Weihnachtsmarkt, Schulfest,<br />
Altenfeier usw.)<br />
� Aufgaben <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung kennen<br />
3. Spielen und Freizeit<br />
� Spiele für Kin<strong>der</strong>geburtstag kennen lernen.<br />
� Spiele selbst erfinden<br />
� An<strong>der</strong>e Klassen zu Spielen einladen<br />
� Das eigene Fernsehverhalten dokumentieren und untersuchen<br />
4. Arbeit<br />
� eine Produktionsstätte o<strong>der</strong> Betrieb besuchen (Hartmann, Ebenhoch usw.)<br />
� einen Arbeitsablauf heute/früher vergleichen (Getreideernte, Arbeit des Bäckers)<br />
� Arbeiten im Haushalt, in <strong>der</strong> Klasse, in <strong>der</strong> Schule erfassen und dokumentieren<br />
5. Technik<br />
� Bauen mit Papier und Pappe so, dass Stabilität erreicht wird<br />
� Türme, Brücken in Skelettbauweise<br />
� Eine Kugelbahn herstellen<br />
� Stromkreise herstellen, Haus beleuchten, einen Kran, ein Auto mit Batterie<br />
betreiben.<br />
� Bremsen, Antrieb und Beleuchtung <strong>der</strong> Fahrrä<strong>der</strong> erkennen<br />
6. Raum<br />
� Geländespiele durchführen<br />
� Himmelsrichtung kennen<br />
� nach Kompass orientieren,<br />
� Gezielte Wetterbeobachtungen durchführen<br />
� Unterrichtsgänge mit Hilfe von Karten durchführen<br />
� Alle Ortsteile von Nie<strong>der</strong>nhausen kennen<br />
� Das Rhein-Main-Gebiet als Wirtschaftsmittelpunkt kennen<br />
� Hessen als Bundesland im topografischen Überblick kennen<br />
� Die an<strong>der</strong>en deutschen Bundeslän<strong>der</strong> kennen (Einsatz PC)<br />
7. Zeit<br />
� Schule früher und heute<br />
� Mit Zeit umgehen (z.B. Zeitleisten erstellen)<br />
� Die Römer im Taunus<br />
� Ritterzeit (Leben im Mittelalter)<br />
� Die Zeit <strong>der</strong> Dinosaurier<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sachunterricht E5-11
Sachunterricht - 3./4.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
8. Naturphänomene<br />
� Messgeräte für Wetterstation herstellen<br />
� Wetterkarte/Wetterberichte lesen/erstellen<br />
� Windkraft als Antrieb kennen<br />
� Zustandsarten des Wassers erfahren<br />
� Brennbare Stoffe beschreiben (z.B. Kerze) Die Geschichte des Feuers in Erfahrung<br />
bringen<br />
9. Wasser<br />
� Versuche zur Oberflächenspannung und Kapillarwirkung<br />
� Schwimmen und Sinken, Verdunsten<br />
� Ursachen für Wasserverschmutzung zusammentragen<br />
� Wasserversorgung in Nie<strong>der</strong>seelbach (Besuch des Hochbehälters)<br />
� Wasserversorgung (Besichtigung eines Klärwerkes in Nie<strong>der</strong>nhausen o<strong>der</strong> Wi-<br />
Auringen)<br />
� Möglichkeiten kennen lernen um Wasser zu sparen<br />
10. Tiere<br />
� Entwicklung einer Raupe beobachten und dokumentieren<br />
� Tiere unserer Wäl<strong>der</strong> kennen lernen<br />
� Sich über Haustiere genau informieren<br />
� Nisthilfen bauen<br />
11. Pflanzen<br />
� Auf dem Schulgelände beobachten, wieviele verschiedene Pflanzen und Bäume<br />
vorkommen und <strong>der</strong>en Namen feststellen<br />
� Das Schulbeet bestellen<br />
� Wiesenblumen kennen lernen<br />
� Laub- und Nadelbäume unserer Wäl<strong>der</strong> kennen lernen<br />
� Den Wald als wichtigen Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Mensch erfahren (evtl.<br />
mit einem Förster begehen)<br />
� Topfpflanzen in <strong>der</strong> Klasse kennen und pflegen<br />
12. Körper<br />
� Wichtige Körperorgane kennen lernen<br />
� Sexualerziehung<br />
� Training unserer Sinne<br />
� Ein gesundes Frühstück herstellen und ausprobieren<br />
� Unfallverhütungsmaßnahmen kennen lernen (Erste Hilfe)<br />
� Gefahren von Drogen, Alkohol, Nikotin (Zigaretten)<br />
� Verantwortungsvoller Umgang mit Medikamenten<br />
� Den Inhalt einer Schulapotheke besprechen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sachunterricht E5-12
Musik - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Musik<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Klasse 1 und 2<br />
Singen von Lie<strong>der</strong>n passend zu <strong>der</strong> jeweiligen Tages- o<strong>der</strong> Jahreszeit, zu kirchlichen und<br />
weltlichen Festen.<br />
Die Lie<strong>der</strong> können im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts auch thematisch auf die<br />
Unterrichtsinhalte abgestimmt sein.<br />
Gestalten von Lie<strong>der</strong>n durch Bewegung, Spiel o<strong>der</strong> instrumentale Begleitung (Rhythmik-Set ist<br />
in den 1. und 2. Klassen vorhanden).<br />
Benutzen körpereigener Instrumente (klatschen, stampfen, patschen, schnipsen) zur<br />
Liedbegleitung.<br />
Durch Tänze erfahren die Schüler Freude an <strong>der</strong> Bewegung zur Musik.<br />
Klasse 3 und 4<br />
Die Inhalte des Musikunterrichts <strong>der</strong> 1. und 2. Klasse setzen sich in <strong>der</strong> 3. und 4. Klasse fort.<br />
Weiterhin bleibt das Singen wichtiger Bestandteil des Musikunterrichts.<br />
Dazu kommen folgende Themen:<br />
� Allerlei Musikinstrumente<br />
Kennen lernen von Musikinstrumenten anhand von Bil<strong>der</strong>n und durch Höreindrücke.<br />
Hören von passenden Musikstücken aus <strong>der</strong> Musikliteratur. Wie<strong>der</strong> erkennen des<br />
Instrumentenklangs.<br />
Vorschlag: Tonerzeugung besprechen: Wann klingen Töne hoch, wann klingen sie tief?<br />
Beispiel: Die Gitarre klingt hoch, wenn die schwingende Saite kurz, dünn o<strong>der</strong> klein ist.<br />
Sie klingt tief, wenn die schwingende Saite lang, dick o<strong>der</strong> groß ist.<br />
Der Resonanzkörper verstärkt den Klang.<br />
� Musik hören<br />
Musik und Geräusche in unterschiedlichen Lautstärken hören. Laute und leise Teile in <strong>der</strong><br />
Musik erkennen.<br />
� Einführung in die traditionelle Notation<br />
Zeichen für Tonhöhen, Tondauer und Lautstärke einführen und möglichst im handelnden<br />
Umgang mit einem Instrument erklären und vertiefen.<br />
Im handelnden Umgang mit Lie<strong>der</strong>n und Instrumentalstücken die Elemente Tempo, Metrum,<br />
Rhythmus und Takt kennen lernen.<br />
Vorschläge:<br />
Tempo: Mit körpereigenen Instrumenten schnelle und langsame Tempi spielen.<br />
Metrum: Lie<strong>der</strong> mit dem Gleichschlag (Metrum) begleiten.<br />
Rhythmus: Rhythmusbausteine mit Körperinstrumenten spielen.<br />
Takt: Lie<strong>der</strong> in unterschiedlichen Taktarten kennen lernen.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Musik E5-13
Musik - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Hier noch einige Vorschläge für weitere Themen:<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Bereich „Unsere Stimme als Instrument“<br />
o Die Ausdrucksmöglichkeiten <strong>der</strong> Stimme durch Laut- und Sprachexperimente bewusst<br />
machen.<br />
o Tierstimmen, Musikinstrumente, Umweltgeräusche imitieren<br />
o Texte mit unterschiedlichem Ausdruck gestalten (fächerübergreifend zu Deutsch)<br />
o Beim Singen auf eine lockere, entkrampfte Stimme (kein Schreien) und eine gut<br />
verständliche Aussprache achten.<br />
o Stimmen an<strong>der</strong>er Menschen kennen lernen:<br />
Beispiele:<br />
- Unterschiede zwischen Kin<strong>der</strong>- und Erwachsenenstimmen hören<br />
- Hohe und tiefe Stimmen unterscheiden (Tonräume)<br />
- Frauen- und Männerstimmen unterscheiden<br />
- Chöre in unterschiedlicher Besetzung kennen lernen: Frauenchor, Männerchor,<br />
Kin<strong>der</strong>chor, kleine o<strong>der</strong> große Chöre<br />
� Bereich: „Umgang mit Elementarinstrumenten“<br />
o Herstellen einfacher Instrumente<br />
Beispiele:<br />
- Rasseln aus Joghurtbechern<br />
- Trommeln aus mit Le<strong>der</strong> überzogenen Blechdosen<br />
- Mit selbstgebauten Instrumenten o<strong>der</strong> Elementarinstrumenten Klanggeschichten<br />
o<strong>der</strong> Lie<strong>der</strong> begleiten.<br />
� Bereich „Klanggeschichten“<br />
o Verklanglichen von Texten mit <strong>der</strong> Stimme und (o<strong>der</strong>) mit Elementarinstrumenten.<br />
Beispiel: Das Gedicht “Die Tulpe” von Josef Guggenmoos mit<br />
Elementarinstrumenten verklanglichen.<br />
o Programmatische Musik hören und mit Elementarinstrumenten eigene<br />
Gestaltungsversuche unternehmen.<br />
Beispiel: Zum Thema “Gewitter” Beethovens 5. Sinfonie hören.<br />
Mit Elementarinstrumenten ein Gewitter darstellen.<br />
� Bereich „Gefühle und Stimmungen“<br />
o Erleben, dass Musik Stimmungen und Gefühle ausdrücken kann.<br />
o Diese Stimmungen beschreiben o<strong>der</strong> bildlich festhalten.<br />
� Bereich „Spielpläne und Formverläufe“<br />
o Erfahren, dass Musik geglie<strong>der</strong>t ist, und aus mehreren Teilen bestehen kann.<br />
o Die Fähigkeit entwickeln, die Struktur einer Musik zu erfassen und umzusetzen.<br />
Beispiel: Den wie<strong>der</strong>kehrenden Teil beim Rondo erkennen und mit einer bestimmten<br />
Bewegung verdeutlichen.<br />
o In Musikbeispielen auf den Einsatz <strong>der</strong> Gestaltungsmittel achten (Wie<strong>der</strong>holung,<br />
Gegensatz, Verän<strong>der</strong>ung).<br />
� Bereich „Komponistenbil<strong>der</strong>“<br />
Durch die Beschäftigung mit dem Leben und Werk bedeuten<strong>der</strong> Komponisten aus<br />
unterschiedlichen Epochen entwickelt sich ein Verständnis für die in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
geschaffene Musik.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Musik E5-14
Ästhetische Bildung - <strong>Stand</strong> 2003<br />
Schuleigener Rahmenplan „Ästhetische Bildung: Kunst“<br />
Fachbereiche - schulinterne Umsetzung<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Unter dem Lernbereich „Ästhetische Bildung: Kunst“ sind die Zielsetzungen <strong>der</strong> Fächer Kunst,<br />
Werken und Textilgestaltung zusammengefasst.<br />
Um die Eigenständigkeit <strong>der</strong> drei Fachaspekte herauszustellen, wurden trotz zahlreicher<br />
Verknüpfungen spezielle Aufgabenkataloge erarbeitet.<br />
Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen von zwei beziehungsweise drei Unterrichtsstunden (je<br />
nach Jahrgangsstufe) ist inhaltlich so zu gestalten, dass alle drei Aspekte vom ersten Schuljahr<br />
an angemessen berücksichtigt werden.<br />
Zusätzlich wird im Rahmen des <strong>Schulprogramm</strong>s im 3. und 4. Schuljahr jahrgangsübergreifend<br />
sowohl eine Arbeitsgruppe im textilen als auch im plastischen Bereich angeboten, soweit dies<br />
aus personellen Gründen möglich ist.<br />
Gerade <strong>der</strong> Aspekt Werken kann auch bei vielen Themen in den Sachunterricht eingebunden<br />
werden.<br />
Darüber hinaus lässt sich <strong>der</strong> Lernbereich „Ästhetische Bildung: Kunst“ beson<strong>der</strong>s gut auch in<br />
fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben, in den Projektunterricht sowie in Klassen- und<br />
Schulfeste integrieren.<br />
Rahmenbedingungen<br />
Jede Lehrkraft erhält für die Anschaffung von Arbeitsmaterial einen schülerzahlabhängigen<br />
Geldbetrag zur Verfügung gestellt, soweit dies im Rahmen <strong>der</strong> Gesamtausgaben <strong>der</strong> Schule<br />
möglich ist. Zusätzlich muss auf die Klassenkasse zurückgegriffen werden.<br />
Die im Bereich „Werken“ aufgeführten Arbeiten machen in <strong>der</strong> Regel einen Unterricht im<br />
Werkraum notwendig. Dieser ist mit Werkbänken für 12 Kin<strong>der</strong> sowie mit Werkzeug für Papier-,<br />
Holz- und plastische Arbeiten (Ton, Speckstein) ausgerüstet. Darüber hinaus sind die<br />
notwendigen Werkzeuge für Linolschnitt vorhanden.<br />
Sowohl das Platzangebot, die geringen handwerklichen Vorerfahrungen <strong>der</strong> Schüler als auch<br />
die Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsmaßnahmen machen es unmöglich, mit <strong>der</strong> gesamten Klasse zu<br />
arbeiten. Somit ist eine Differenzierung dahingehend erfor<strong>der</strong>lich, dass Teile <strong>der</strong> Klasse im<br />
Werkraum (an Küchentischen) o<strong>der</strong> im Flur mit an<strong>der</strong>en Aufgaben beschäftigt werden. Sinnvoll<br />
ist es auch, in diesem Bereich auf Elternhilfe zurückzugreifen.<br />
Auf die im Rahmenplan angeführte Möglichkeit, Klassen zu halbieren, kann nur bei<br />
entsprechenden stundenplantechnischen Möglichkeiten zurückgegriffen werden.<br />
Für die Lehrkräfte stehen eine gut sortierte Fachbücherei sowie Kunstdrucke und Folien zur<br />
Kunstbetrachtung zur Verfügung.<br />
Inhalte/fachliche Qualifikationen<br />
Fachimmanente Qualifikationen sollen in Synthese mit einer Thematik vermittelt werden, die sich<br />
an ästhetisch relevanten Erfahrungsbereichen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> orientiert.<br />
Schwerpunktmäßig geht es im 1./2. Schuljahr um das Erlernen grundlegen<strong>der</strong> Techniken und<br />
den Umgang mit einfachen Werkzeugen sowie unterschiedlichen Materialien.<br />
Im 3./4. Schuljahr erproben dagegen die Schülerinnen/Schüler schwierige Techniken, werden<br />
mit Farblehre, Formgestaltung und <strong>der</strong> Arbeitsweise spezieller Werkzeuge vertraut gemacht und<br />
zur differenzierten Gestaltung angehalten.<br />
Reflexion über den Arbeitsprozess und das Ergebnis sowie die Einbeziehung von Kunstwerken<br />
ist Bestandteil des Kunst-, TG- und Werkunterrichts in allen Schuljahren.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Kunst E5-15
Ästhetische Bildung - <strong>Stand</strong> 2002 Kunst - 1./2.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
Verbindlichkeit<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Der nachfolgende Aufgabenkatalog ist nur insoweit verbindlich, dass laut RRL S. 198 einmal im<br />
1./2. Schuljahr und einmal im 3./4. Schuljahr in jedem <strong>der</strong> angeführten sieben Themenbereiche<br />
(Ich und an<strong>der</strong>e, Natur und Umwelt usw.) gearbeitet werden soll.<br />
Ebenso verbindlich ist, dass im Laufe <strong>der</strong> Grundschulzeit in allen zehn Qualifikationsbereichen<br />
(Malen, Zeichnen, Textiles Gestalten usw.) fachliche Fähigkeiten erworben werden. Mindestens<br />
sollen im 1./2. Schuljahr und 3./4. Schuljahr jeweils sieben <strong>der</strong> angeführten zehn Bereiche<br />
abgedeckt werden.<br />
Jedem Lehrer ist es aber möglich, Themenbereiche unterschiedlich zu gewichten sowie weitere<br />
Bereiche und Qualifikationen einzubringen. Es ist also genügend Spielraum für die spezielle<br />
Klassensituation vorhanden (RRL S. 183).<br />
Die angeführten Themen des nachfolgenden Aufgabenkatalogs haben lediglich<br />
Beispielcharakter. Da viele Lehrkräfte diese Fächer jedoch ohne spezielle Ausbildung<br />
unterrichten, wurde eine ausreichende Aufgabensammlung bereitgestellt.<br />
Bewertung<br />
Bei <strong>der</strong> Bewertung ist <strong>der</strong> Entwicklungs- und Erfahrungshorizont jedes Schülers zu<br />
berücksichtigen. Die Leistungsbeurteilung soll dabei vorrangig die Freude am Gestalten erhalten<br />
und stimulierend wirken. Von einer Benotung je<strong>der</strong> einzelnen Arbeit wird abgeraten (RRL<br />
S.178/177).<br />
Kunst<br />
1./2. Schuljahr<br />
Techniken<br />
� Malen mit Wasserfarben, Plakafarben, Stoffmalfarben, Glasmalfarben, Fingerfarben etc.<br />
� Zeichnen mit Bleistift, Buntstift, Filzstift, Wachsstift, Kreide etc.<br />
� Collagen aus Buntpapier, Transparentpapier, Seidenpapier, Zeitungspapier, Werbebeilagen<br />
� Drucken mit Kartoffeln, Korken, Pappkanten, Holzstempeln, unterschiedlichem Material<br />
Themen<br />
1. Bereich: Ich und an<strong>der</strong>e<br />
o Ich gehe mit meiner Laterne<br />
o Selbstportrait am ersten Schultag<br />
o Bescherung am Heiligabend<br />
o Schornsteinfeger<br />
o Schneemann<br />
o Ich stehe unter <strong>der</strong> Dusche<br />
o "Ich" -Plakat<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Kunst E5-16
Kunst - 1./2.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
2. Bereich: Essen und Trinken<br />
o Der Vielfraß<br />
o Obstkorb<br />
o Geburtstagstorte<br />
o Der gedeckte Tisch<br />
o Mein Lieblingsessen<br />
o Rieseneisbecher<br />
3. Bereich: Kleidung, Verkleidung, Schmuck<br />
o Mein Faschingskostüm<br />
o Clownsgesicht<br />
o Schwellkopf<br />
4. Bereich: Spiele, Spielzeug<br />
o Mein Lieblingsspielzeug<br />
o Turm aus bunten Steinen<br />
o Puzzle<br />
o Teddybär<br />
5. Bereich: Geschichten, Märchen, Comics<br />
o Dornröschenschloss<br />
o Die hlg. drei Könige<br />
o Prinzessin auf <strong>der</strong> Erbse<br />
o Hexe aus "Hänsel und Gretel"<br />
o Prinzessin im Ballkleid<br />
o Sterntaler<br />
6. Bereich: Medien<br />
o Meine Lieblingssendung<br />
7. Bereich: Natur, Umwelt<br />
o Untier<br />
o Riesenelefant<br />
o Igel in seiner Höhle<br />
o Pilzfamilie im Wald<br />
o Paradiesvogel<br />
o Schmetterling<br />
o Ameisen auf dem Waldboden<br />
o Blühende Topfpflanze<br />
o Schnecke<br />
o Eule<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Kunstbetrachtung<br />
Nur bei direktem Bezug zur Eigenproduktion durch die Technik o<strong>der</strong> den Bildgegenstand. Z.B.<br />
vergleichende Betrachtungen von Kin<strong>der</strong>- und Familiendarstellungen, Stillleben aus<br />
verschiedenen Epochen.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Kunst E5-17
Kunst – 3./4.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
3. /4. Schuljahr<br />
Techniken<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Wie 1./2. Schuljahr, außerdem:<br />
� Malen in Nass-inNass-Technik, Wachs-Sgraffito, Marmorieren, Reservetechnik<br />
� Zeichnen mit Kohle, Tusche, Wachskreide, Stoffmalstiften, Füller u. Killer, Scherenschnitt,<br />
Zeichnen nach <strong>der</strong> Natur<br />
� Collagen: Verfremdung von Prospektmaterial, Mosaiktechniken<br />
� Drucken: Frottagen, Schablonendruck, Linoldruck, Kaltnadelradierung, Klappdruck,<br />
"Siebdruck".<br />
Themen<br />
1. Bereich: Ich und an<strong>der</strong>e<br />
o Meine Freundin und ich<br />
o Ich stehe vor dem Spiegel<br />
o Dame im Eiscafe<br />
o Eiskunstläufer auf dem See<br />
o Spaziergang im Regen<br />
o Ein Star verän<strong>der</strong>t sein Gesicht<br />
2. Bereich: Essen und Trinken<br />
o Mein Lieblingsessen steht auf dem Tisch<br />
o Die Gemüsefrau<br />
o Obstkorb<br />
o Einkaufsnetz<br />
o Plätzchenteller<br />
o Einladungen od. Tischkarten<br />
o Schalen und Gefäße (Stillleben)<br />
3. Bereich: Geschichten, Märchen, Comics<br />
o Rattenfänger von Hameln<br />
o Kampf <strong>der</strong> Riesen<br />
o Der fliegende Robert<br />
o Märchen-Leporello<br />
o Dagobert sitzt auf seinem Geldhaufen<br />
o Gespensterschloss<br />
4. Bereich: Kleidung, Verkleidung, Schmuck<br />
o Indianer mit Kopfschmuck<br />
o Kaiser mit seiner Krone<br />
o Vornehme Dame hat ihren Schmuck angelegt<br />
5. Bereich: Spiele, Spielzeug<br />
o Kasper<br />
o Hampelmann<br />
o Roboter<br />
o Memory<br />
o Fabelwesen<br />
o Fahrzeug aus <strong>der</strong> Zukunft<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Kunst E5-18
Kunst – 3./4.Schuljahr - <strong>Stand</strong> 2002<br />
6. Bereich: Medien<br />
o Illustrationen<br />
o Litfasssäule<br />
o Plakatwand<br />
7. Bereich: Natur, Umwelt<br />
o Rieseninsekt<br />
o Mandelblütenzweig<br />
o Dorf von oben<br />
o Wrack auf dem Meeresboden<br />
o Spinne im Netz<br />
Kunstbetrachtung<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Räumliche Darstellung in <strong>der</strong> Malerei (Landschaften aus verschiedenen Epochen)<br />
Beispiele für die Verwendung von Farbkontrasten<br />
� Optische Farbmischung (Pointilismus)<br />
� Mode in <strong>der</strong> bildenden Kunst<br />
� Naturalismus<br />
� Verfremdungen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Kunst E5-19
Werken - <strong>Stand</strong> 2002<br />
Werken<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Als Grundlage für das Arbeiten im 3. und 4. Schuljahr sind folgende Werktechniken im Laufe<br />
des 1. und 2. Schuljahres einzuführen:<br />
Mit Papier falten, kneten, mit Ton modellieren, erster Umgang mit Hammer und Säge.<br />
Die folgenden Vorschläge für das 3. und 4. Schuljahr sind beson<strong>der</strong>s den Bereichen Ich und<br />
an<strong>der</strong>e - Natur und Umwelt - Spiele/Spielzeug/Schmuck - Geschichten/Märchen - Essen und<br />
Trinken zuzuordnen.<br />
Technik und Material Werkarbeit<br />
Modellieren<br />
mit Ton<br />
freies Modellieren<br />
Aufbautechnik<br />
Plattentechnik<br />
mit Pappmaché<br />
Sägen, raspeln, feilen,<br />
bohren, schnitzen,<br />
glätten<br />
mit Holz<br />
(Sperrholz, Asthölzer,<br />
Rundhölzer. Leisten aller<br />
Art)<br />
Ritzen, drucken<br />
mit Linoleum<br />
mit Karton<br />
mit Styropor<br />
Falten, knicken und<br />
konstruieren<br />
mit Papier<br />
Echsen, Mäuse, Schnecken,<br />
Kacheln, Schalen, Reliefs,<br />
Ketten aus Kugeln<br />
Tiere, Hexen, Drachen,<br />
Saurier, Sparschwein, Kopf,<br />
Masken<br />
Igel, Hampelfiguren,<br />
Fabeltiere, einfaches Puzzle,<br />
Schlangen<br />
Gruß karten,<br />
Geschenkpapier,<br />
Einladungen, Tischkarten<br />
Hubschrauber. Schiff,<br />
Drachen<br />
Werkzeuge weiteres<br />
Material<br />
Modellierhölzer<br />
Kuchenrolle<br />
Luftballon, Hasenstallgitter,<br />
Kleister, Zeitung,<br />
Dispersionsfarbe<br />
alle Werkzeuge zur<br />
Bearbeitung von Holz.<br />
Laubsägewerkzeuge.<br />
Schmirgelpapier, Nägel.<br />
Schrauben, Holzleim<br />
Schnittwerkzeuge.<br />
Linolschnittwerkzeuge .<br />
Gummiwalze, Glasplatte.<br />
entsprechende Druckfarben<br />
Schere. Lineal. Klebstoff<br />
Filzstifte<br />
Freies Gestalten mit wertlosem Material und Naturmaterial Dabei können alle gelernten<br />
Techniken angewandt werden.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Werken E5-20
Textiles Gestalten - <strong>Stand</strong> 2002<br />
Textiles Gestalten<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Als Grundlage für das Arbeiten im 3. und 4. Schuljahr sind folgende textile Techniken im Laufe<br />
des 1. und 2. Schuljahres einzuführen:<br />
Stoff schneiden, Umgang mit Nadel und Faden, Schnüre drehen und flechten,<br />
Stoffverbindung mit Vorstichen, Knoten herstellen<br />
Die folgenden Fachziele sind beson<strong>der</strong>s den Bereichen Kleidung/Verkleidung/Schmuck – Ich<br />
und an<strong>der</strong>e – Natur/Umwelt – Spiele/Spielzeug zuzuordnen.<br />
3./4. Schuljahr<br />
Technik Textilarbeit Material/Werkzeug<br />
Weben<br />
(Kette spannen, Leinenbindung,<br />
freies Weben)<br />
Knüpfen von Fransen<br />
Sticken<br />
(verschiedene Stickstiche,<br />
Musterbildung)<br />
Nähen<br />
(Verbinden und Applizieren,<br />
Vor-, Stepp-, Überwendlings-,<br />
Schlingstich)<br />
Knopf annähen<br />
Häkeln<br />
(Anfangsschline, Luftmasche,<br />
feste Masche)<br />
Stoffgestaltung<br />
(Bedrucken, Batiken,<br />
Seidenmalerei)<br />
Freies Gestalten mit textilem<br />
Material<br />
Wandbehang, Hängematte für<br />
Spielfigur, Mobile aus<br />
Bastscheiben<br />
Stickkarten, Kreuzstichbild<br />
(z.B. Schiff), Indianertasche<br />
Nikolaussäckchen, einfache,<br />
ausgestopfte Tiere, Wandbild<br />
Luftmaschenbil<strong>der</strong>,<br />
Schlafsack für Spielfigur,<br />
Brustbeutel<br />
T-Shirt o<strong>der</strong> Stoffbeutel<br />
bedrucken, Tücher,<br />
Raumdekoration, Kissenhüllen<br />
gestalten<br />
Spiel- (Stock-)figuren,<br />
Textilarbeiten im Rahmen von<br />
Projekten<br />
Webrahmen, Wollreste,<br />
Pappe, Bast und an<strong>der</strong>e<br />
Materialien, Stopfnadel,<br />
Schere<br />
Perlgarn, Sticknadel,<br />
Stickstoffe, Schere,<br />
Demonstartionsrahmen<br />
Filz, Rupfen, Le<strong>der</strong>, Stoffreste,<br />
Sticknadel, Nähnadel, Stickund<br />
Nähgarn, Knöpfe, Schere<br />
Häkelnadel (ung. Nr. 4),<br />
Baumwollgarn, Schere,<br />
Stopfnadel<br />
Helle Baumwollshirts,<br />
Baumwoll- und Seidenstoffe,<br />
Baumwollrohlinge,<br />
entsprechende Stofffarben<br />
und Zubehör<br />
Stoff- und Wollreste,<br />
verschiedene an<strong>der</strong>e<br />
Materialien<br />
Schuleigene Rahmenpläne Ästhetische Bildung: Textiles Gestalten E5-21
Sport - Spielen-Lernen - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Sport<br />
Lernbereich: Spielen-Lernen<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr 4. Schuljahr<br />
I. Spiele ohne Gerät<br />
- Feuer, Wasser, Blitz,…<br />
- Zitrone<br />
- Ochs am Berg<br />
- Wer hat Angst vor dem<br />
- Seeungeheuer ?<br />
- Verzaubern<br />
- Linienfangen<br />
II. Erlernen <strong>der</strong> Grund-<br />
Techniken<br />
- Werfen<br />
- Fangen<br />
- Rollen<br />
- Prellen<br />
III. Spiele mit dem Ball<br />
- Haltet das Feld frei!<br />
- Zweierball/Viererball<br />
- Jägerball<br />
1)Je<strong>der</strong> hat einen Ball<br />
2) Drei Jäger mit Ball<br />
I. Spiele ohne Gerät<br />
- 6-Tage-Rennen<br />
- Tag und Nacht<br />
- Kettenfangen<br />
- Laufwettkämpfe<br />
- Staffeln<br />
- Schattenlauf /Roboter-<br />
Spiel<br />
- Brückenwächter<br />
Und alle Spiele aus Kl.1!<br />
II. Festigen <strong>der</strong> Grund-<br />
Techniken<br />
- Werfen<br />
- Fangen<br />
- Rollen<br />
- Prellen<br />
- Erlernen <strong>der</strong><br />
Grundtechniken:<br />
1) Ballführen mit dem<br />
Fuß<br />
2) Schießen<br />
III. Spiele mit dem Ball<br />
- Wettwan<strong>der</strong>ball<br />
- Wurf- und<br />
Schießwettkämpfe auf<br />
Ziele<br />
- Jägerball<br />
- Viererball<br />
- Völkerball<br />
- Kastenball (Vorform<br />
des Basketball)<br />
I. Spiele ohne Gerät<br />
- Komm mit, lauf weg!<br />
- Tigerfangen<br />
- Krankenhaus<br />
- Nummernwettlauf<br />
Und alle Spiele aus Kl. 1 und<br />
2!<br />
II. Festigen <strong>der</strong> Grund-<br />
Techniken<br />
- siehe Auflistung 2.<br />
Schuljahr<br />
III. Spiele mit dem Ball<br />
- Ball über die Schnur<br />
- Drei-Fel<strong>der</strong>-Ball<br />
- Vier-Fel<strong>der</strong>-Ball<br />
- Brennball<br />
- Passen und Stoppen<br />
mit Hockeyschlägern<br />
- Minigolf<br />
I. Spiele ohne Gerät<br />
nach Wunsch alle Spiele <strong>der</strong><br />
vergangenen Schuljahre<br />
- Goofy o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Wahrnehmungsspiele<br />
- Kooperationsspiele<br />
II. Festigen <strong>der</strong> Grund-<br />
Techniken<br />
- Erlernen des<br />
Druckpasses<br />
(Basketball)<br />
III. Spiele mit dem Ball<br />
- Rückschlagspiele:<br />
1) Indiaka<br />
2) Badminton<br />
3) Family-Tennis<br />
- Mattenvölkerball<br />
- Korbball als Vorform<br />
des Basketball<br />
- Mini-Hockey<br />
- Hase und Eichhörnchen<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sport E5-22
Lernbereich: Turnen<br />
Turnen erteilt nur <strong>der</strong> Fachlehrer.<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Schuljahr 2.Schuljahr 3. Schuljahr 4.Schuljahr<br />
Bodenturnen:<br />
- Verschiedene<br />
Rollerfahrungen sammeln<br />
- (- um Quer- und<br />
Längsachse,<br />
- mit und ohne Gerätehilfen)<br />
- Erlernen <strong>der</strong> Rolle vorwärts<br />
Langbank / Sprungbrett / Kasten:<br />
- Aufknien, Aufhocken /<br />
Auflaufen /Überspringen <strong>der</strong><br />
Langbank<br />
- Hockwende über die<br />
Langbank<br />
- Auflaufen aus dem Anlauf,<br />
beidbeiniger Absprung auf<br />
zweiteiligen Kasten<br />
- Aufknien / Aufhocken auf<br />
zweiteiligen Kasten<br />
Stützbarren:<br />
- Balancieren auf den Holmen<br />
(mit Hilfe)<br />
- Durchwinden<br />
Reck / Stufenbarren:<br />
Stange/ Holm brusthoch<br />
- Durchwinden<br />
- Hangeln / Schwingen im<br />
Langhang<br />
- Aufstützen, Vorform des<br />
Felgabzug<br />
Langbank / Schwebebalken:<br />
- Balancieren vorwärts/<br />
rückwärts/ seitwärts/ über<br />
Hin<strong>der</strong>nisse/ durch<br />
Hin<strong>der</strong>nisse (stabile<br />
Unterstützungsfläche)<br />
- Wackelsteg und Rollbank<br />
(als labile<br />
Unterstützungsfläche) wie<br />
oben<br />
- dabei Gegenstände tragen<br />
- Hüpfen<br />
Sport - Turnen - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Bodenturnen:<br />
- Rolle vorwärts in Verbindung<br />
mit Strecksprung<br />
- Zappelhandstand<br />
- Vorübungen für das Rad<br />
(Zauberschnüre, Langbank)<br />
Langbank / Rheuterbrett / Kasten:<br />
- sicherer beidbeiniger Absprung<br />
vom Rheuterbrett<br />
- Hockwende über die Langbank<br />
- Aufknien/Aufhocken auf<br />
zweiteiligen / dreiteiligen<br />
Kasten<br />
- Strecksprung ab<br />
Stützbarren:<br />
Balance- und Stützübungen<br />
Reck / Stufenbarren:<br />
Stange / Holm brusthoch<br />
- Aufstützen, Felgabzug in<br />
Feinform<br />
- Felgunterschwung in Grobform<br />
- Felgaufschwung mit Lehrerhilfe<br />
in Grobform<br />
Langbank / Schwebebalken:<br />
- Balancieren vorwärts/<br />
rückwärts/ seitwärts/ unter<br />
Hinzunahme gymnastischer<br />
Kleingeräte<br />
- Gehen und Drehen im<br />
Ballenstand<br />
- Drehungen in <strong>der</strong> Hocke<br />
- Hüpfen<br />
Bodenturnen:<br />
- Zappelhandstand<br />
- Aufschwingen in den<br />
Handstand ( mit<br />
Geländehilfe/ Schülerhilfe)<br />
- Grobform des Rades<br />
Kasten (dreiteilig/quer):<br />
- Aufknien<br />
- Aufhocken, Strecksprung<br />
- Durchhocken (Sprunghocke)<br />
Stützbarren:<br />
- Stützübungen<br />
- Schwingen, Aufgrätschen<br />
- Grätschsitz- Einschwingen<br />
zum Schwingen in den Stütz<br />
Reck/ Stufenbarren:<br />
Stange/ Holm brusthoch<br />
- Aufstützen, Felgabzug<br />
- Felgunterschwung über ein<br />
Seil<br />
- Felgaufschwung und Mühle<br />
als Diff. für Leistungsstarke<br />
Langbank / Schwebebalken:<br />
- sicher gehen, Hin<strong>der</strong>nisse<br />
überwinden<br />
- <strong>Stand</strong>drehung auf dem<br />
Ballen<br />
- Strecksprünge als Abgang<br />
- Kleine<br />
Bewegungsverbindungen<br />
selbst erfinden<br />
Bodenturnen:<br />
- Handstand mit<br />
Schülerhife, als Diff. für<br />
Leistungsstarke mit<br />
Abrollen<br />
- Rad (Hand, Hand, Fuß,<br />
Fuß), evtl. in <strong>der</strong> Feinform<br />
Kasten (drei- bis vierteilig, quer):<br />
- Aufhocken, Strecksprung<br />
- Hockwende<br />
- Durchhocken<br />
(Sprunghocke)<br />
Stützbarren:<br />
- Stützlaufen<br />
- Schwingen vorwärts und<br />
rückwärts für<br />
Leistungsstarke<br />
- Aufgrätschen<br />
Reck/ Stufenbarren:<br />
Stange/ Holm brusthoch<br />
- Aufstützen, Felgabzug<br />
- Felgunterschwung über<br />
ein Seil<br />
- Felgaufschwung und<br />
Mühle als Diff.<br />
Langbank / Schwebebalken:<br />
- sicher gehen und laufen<br />
- halbe Drehung in <strong>der</strong><br />
Hocke<br />
- Pferdchensprung<br />
- Strecksprung als Abgang<br />
Für alle Jahrgänge gilt:<br />
Nach Möglichkeit verbinden wir verschiedene Geräte miteinan<strong>der</strong> zu Arrangements o<strong>der</strong><br />
Parcours, um während <strong>der</strong> Sportstunden möglichst viele verschiedene Bewegungsformen<br />
anzubieten und so Bewegungsvielfalt zu schaffen. Dazu nutzen wir auch die Klettergeräte<br />
(Sprossenwand und Kletterleiter) sowie Stangen, Taue und Ringe in Verbindung mit dem<br />
Trapez. Daran schaukeln, schwingen, klettern und hangeln die Schüler. Außerdem springen sie<br />
nie<strong>der</strong> (Mutsprünge).<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sport E5-23
Sport - Sich-Rhythmisch-Bewegen und Tanzen - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Lernbereich: Sich-Rhythmisch-Bewegen und Tanzen<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. und 2. Schuljahr 3. und 4. Schuljahr<br />
- Zu rhythmischer Begleitung o<strong>der</strong> Musik verschiedene<br />
Bewegungsmöglichkeiten finden(alleine, mit Partner und<br />
in <strong>der</strong> Gruppe)<br />
- den eigenen Körper in Anspannung und Entspannung<br />
erfahren (Phantasiereisen, Massagen (z.B. Pizza backen),<br />
Kooperations- und Vertrauensspiele)<br />
- Roboterspiel, Figuren nachgehen<br />
- Explorativer Umgang mit rhythmischen Kleingeräten Ball,<br />
Seil, Band und Reifen in offenen Unterrichtssituationen<br />
(Freispiel)<br />
Sich mit Handgeräten rhythmisch bewegen<br />
Ball: den Ball im Gehen sicher werfen und fangen, prellen,<br />
einan<strong>der</strong> zuwerfen und fangen, zurollen und aufnehmen,<br />
Ballkunststücke erproben<br />
Reifen: den Reifen zwirbeln, vorwärts rollen, im<br />
Schlusssprung durch den eiernden Reifen springen, ihn<br />
einem Partner zurollen, Hula-Hop spielen<br />
Seil: über das pendelnde Seil springen, Seil über Kopf<br />
schwingen und durchspringen (schnell und langsam,<br />
mit/ohne Zwischensprung, als Diff. über Kreuz schwingen),<br />
in das große Schwungseil ein- und auslaufen, im großen<br />
Schwungseil springen, dazu Sprüche kennenlernen (z.B.:<br />
Teddybär, ABC)<br />
Band: schöne Bandzeichnungen erfinden und <strong>der</strong> Gruppe<br />
vorstellen, Schwingen des Bandes nach vorgegebenen<br />
Bewegungen in <strong>der</strong> Gruppe zu Musik<br />
Tanzen<br />
- zu Kin<strong>der</strong>musik von D. Jöcker , Trio Kunterbunt o<strong>der</strong> F.<br />
Vahle einen Tanz lernen (z.B.: Sternenfänger,<br />
Katzentatzentanz)<br />
- Siehe 1. und 2. Schuljahr<br />
Sich mit Handgeräten rhythmisch bewegen<br />
Ball: den Ball rechts, links, beidhändig, im Laufen und<br />
Springen, im <strong>Stand</strong>, im Sitzen und Liegen prellen können,<br />
alle bekannten Bewegungsformen mit dem Ball kombinieren<br />
(Bewegungskomposition)<br />
Reifen: wie 1./2. Schuljahr , Plastikreifen hochwerfen und<br />
fangen, Bewegungskompositionen erfinden<br />
Seil: allein/ mit Partner in einem Seil springen, im großen<br />
Schwungseil auch mit an<strong>der</strong>en gleichzeitig springen,<br />
springen im Rhythmus <strong>der</strong> Musik<br />
Band: Geschicklichkeitsübungen durchführen,<br />
Bewegungskompositionen erfinden<br />
Tanzen<br />
- Roch´n Roll Grundschritt erlernen, zu aktueller Musik<br />
einen eigenen Tanz erfinden (evtl. mit Videoclip-Hilfe)<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sport E5-24
Sport - Laufen-Springen-Werfen - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Lernbereich: Laufen - Springen - Werfen<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr 4. Schuljahr<br />
Laufen:<br />
- unterschiedliche<br />
Lauftempi<br />
- Laufen vorwärts,<br />
rückwärts, seitwärts,<br />
ohne/ mit Partner/ in <strong>der</strong><br />
Gruppe<br />
- Laufen auf<br />
unterschiedlichen<br />
Untergründen (auch<br />
Wald, Sand)<br />
- 3-Minuten-Lauf<br />
- Zeitschätzläufe<br />
- Umkehrstaffeln mit<br />
Handabschlag (40m-<br />
Sprint)<br />
- Im Lauf Hin<strong>der</strong>nissen<br />
ausweichen und<br />
Hin<strong>der</strong>nisse (z. B.:<br />
Zauberschnüre,<br />
Medizinbälle, Turnmatten)<br />
überlaufen<br />
- Im Laufen Herzschlag,<br />
Atmung, Schwitzen,<br />
Ermüdung wahrnehmen<br />
und erfahren<br />
Werfen:<br />
- Wurfspiele spielen (z.B.<br />
Jägerball, Gefängnisball)<br />
- Mit unterschiedlichen<br />
Bällen und<br />
Gegenständen (z.B.:<br />
Frisbees, Ringen,<br />
Tennisbällen) ein- und<br />
beidhändig hoch und<br />
weit werfen<br />
- Aus dem <strong>Stand</strong>, dem<br />
Gehen, mit Anlauf werfen<br />
- Zielwerfen<br />
- Über eine Leine, in einen<br />
Korb, durch einen Reifen<br />
werfen<br />
Springen:<br />
- Überspringen von<br />
niedrigen Hin<strong>der</strong>nissen in<br />
Höhe und Weite aus dem<br />
Lauf (einbeinig) und aus<br />
dem <strong>Stand</strong><br />
- In die Tiefe springen<br />
- Im Sprung einen hoch<br />
gelegenen Punkt<br />
berühren/ sich etwas<br />
holen<br />
- Hüpfspiele (z.B.<br />
Gummitwist) spielen<br />
Lauf:<br />
wie im 1. Schuljahr und<br />
zusätzlich :<br />
- 5-Minuten-Lauf<br />
- Hopserlauf<br />
- Pendelstaffeln mit<br />
Übergabe von<br />
Gegenständen<br />
Werfen:<br />
wie 1. Schuljahr<br />
Springen:<br />
Wie 1. Schuljahr<br />
Lauf:<br />
wie 1. und 2 Schuljahr und<br />
zusätzlich:<br />
- Lauftempi variieren,<br />
dabei<br />
- Unterschied Sprint und<br />
Dauerlauf besprechen<br />
- 8-Minuten-Lauf<br />
- Sprint über 50 Meter<br />
- Grobform des Tiefstarts<br />
erklären und mit Sprint<br />
kombinieren<br />
Werfen:<br />
wie 1. Schuljahr und<br />
zusätzlich:<br />
- Grobform des<br />
Schlagballwurfs erlernen<br />
- Dabei möglichst mit<br />
Anlauf werfen (Dreier-<br />
Rhythmus)<br />
Springen:<br />
Wie 1. Schuljahr und<br />
zusätzlich:<br />
- bewusster Einsatz des<br />
Sprungbeins beim<br />
Weitsprung<br />
- Grobform des<br />
Schrittweitsprungs und<br />
des Schersprunges<br />
erlernen (z.B. mit Hilfe<br />
<strong>der</strong> Zauberschnur)<br />
Lauf:<br />
Wie 1.,2.und 3.Schuljahrund<br />
zusätzlich<br />
- 10-Minuten-Lauf<br />
- Steigerungsläufe<br />
- Vertiefung des Tiefstarts<br />
- Hin<strong>der</strong>nisse (z.B.<br />
Bananenkisten)<br />
überlaufen<br />
Werfen:<br />
Wie 1.-3.Schuljahr und<br />
zusätzlich:<br />
- Wurftechnik beim<br />
Schlagballweitwurf<br />
verfeinern<br />
Springen:<br />
Wie 1.-3.Schuljahr<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sport E5-25
Sport - Rollen-Gleiten-Fahren - <strong>Stand</strong> 2005 Sport - Schwimmen-Lernen - <strong>Stand</strong> 2005<br />
Lernbereich: Rollen - Gleiten – Fahren<br />
1. und 2. Schuljahr 3. und 4. Schuljahr<br />
Rollen:<br />
- mit Pedalo und Rollbrett fahren<br />
- dabei die wichtigsten Sicherheitsregeln erlernen und<br />
beachten lernen<br />
- mit dem Rollbrett etwas transportieren<br />
- sich auf dem Rollbrett ziehen und schieben lassen<br />
- den Rollbrettführerschein erwerben<br />
Gleiten:<br />
- bei Frost Schlitterbahnen anlegen<br />
- im Winter rodeln gehen<br />
Lernbereich: Schwimmen<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Rollen:<br />
Wie 1. und 2. Schuljahr und zusätzlich:<br />
- Schüler bringen Skateboards mit, Anschwung nehmen,<br />
Abspringen und Stoppen lernen<br />
Gleiten:<br />
Wie im 1. und 2. Schuljahr<br />
Fahren:<br />
- mit Fahrrä<strong>der</strong>n im Rahmen <strong>der</strong> Verkehrsschule fahren und<br />
den Fahrradführerschein erwerben<br />
Seit diesem Schuljahr 2005 / 2006 ist das nächstgelegene Schwimmbad in Idstein lei<strong>der</strong> wegen<br />
Umbauarbeiten geschlossen. Da dies voraussichtlich bis 2007 so sein wird, kann so lange kein<br />
Schwimmunterricht erteilt werden. Ist die Renovierung abgeschlossen, findet <strong>der</strong><br />
Schwimmunterricht wie<strong>der</strong> an zwei Unterrichtsstunden pro Woche statt. Dafür fällt dann <strong>der</strong><br />
Sportunterricht aus und die vorangehend beschriebenen Unterrichtsinhalte werden im 3. und 4.<br />
Schuljahr nur verkürzt erteilt.<br />
1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr 4. Schuljahr<br />
Je nach Lernvoraussetzungen <strong>der</strong> Schüler werden folgende<br />
Unterrichtsinhalte vermittelt:<br />
Wassergewöhnung:<br />
-Spiele mit Partner und Gruppe (z.B. Verkehrsschutzfrau, Haltet das Feld<br />
frei, aus dem Sportunterricht bekannte Fangspiele)<br />
- im Wasser Hin<strong>der</strong>nisse überwinden<br />
- Tauchen im hüft- und brusttiefen Wasser<br />
- Vom Beckenrand ins brusttiefe Wasser springen<br />
- sich mit Hilfe des Partners aufs Wasser legen<br />
- Gleiten in Bauch- und Rückenlage<br />
� Evaluation und Planung <strong>2010</strong>/11<br />
Erlernen des Brustschwimmens (brusttiefes Wasser):<br />
-Ausformung <strong>der</strong> Grobform, Bewegung mit <strong>der</strong> Atmung koordinieren<br />
Ausdauerschulung des Brustschwimmens (Schwimmertiefe) :<br />
- 25 m schwimmen, Sprünge fußwärts vom Beckenrand und vom<br />
Startblock<br />
- Tief- und Streckentauchen<br />
- das Seepferdchen erwerben<br />
- um die Wette schwimmen<br />
- Sprunghöhe steigern (1m-Brett, 3m-Brett)<br />
- Streckentauchen üben (8-10m)<br />
- Rückenschwimmen anbahnen<br />
- Staffelschwimmen<br />
- Ba<strong>der</strong>egeln<br />
Abzeichen:<br />
- Seepferdchen<br />
- DJS Bronze und Silber (je nach Lernvoraussetzungen)<br />
Das Ziel <strong>der</strong> nahen Zukunft wird sein, die Rahmenpläne zu verknüpfen mit dem zu<br />
erarbeitenden Kerncurriculum unserer Schule. Dieses Kerncurriculum wird die zu erreichenden<br />
übergeordneten Kernkompetenzen unserer Schüler/innen als auch die Kernkompetenzen in den<br />
Fächern Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch beschreiben. Die Erarbeitung werden<br />
wir in Kooperation mit <strong>der</strong> benachbarten Grundschulstufe <strong>der</strong> Theißtalschule vornehmen.<br />
Schuleigene Rahmenpläne Sport E5-26
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule<br />
- Am Schulanmeldetag führen 2 Lehrkräfte ein kurzes Gespräch mit den Schulanfängern<br />
zur vorläufigen Feststellung <strong>der</strong> Schulreife.<br />
- Es folgt die schulärztliche Untersuchung<br />
- Im Mai findet ein Kennenlerntag in <strong>der</strong> Schule statt (8-10 Kin<strong>der</strong>, 2 Lehrkräfte).<br />
Eventuelle Auffälligkeiten werden notiert und ggf. mit den Eltern besprochen.<br />
- Vor <strong>der</strong> Einteilung <strong>der</strong> Klassen wird Rücksprache mit den Erzieherinnen im Kin<strong>der</strong>garten<br />
gehalten.<br />
- Kurz vor den Sommerferien findet <strong>der</strong> erste Elternabend statt.<br />
- Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> 4. Schuljahre übernehmen Patenschaften für die Neuanfänger, erster<br />
brieflicher Kontakt kurz vor den Sommerferien.<br />
- Am 1. Schultag findet in <strong>der</strong> Johanneskirche Nie<strong>der</strong>seelbach ein ökumenischer<br />
Schulgottesdienst statt.<br />
- Einschulungsfeier im Festsaal mit einigen Darbietungen <strong>der</strong> älteren Schülerinnen und<br />
Schüler.<br />
- Die wartenden Eltern werden mit Getränken versorgt.<br />
Entwicklungsziel: Überarbeitung des Einschulungsverfahrens und Entwicklung eines<br />
neuen Konzeptes (im Verlauf des Jahres von September bis Juli)<br />
Projekt 1: Formulierung des Formblattes zur Anmeldung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
Projekt 2: Neue Formulierung <strong>der</strong> Einladung zum ersten Elternabend<br />
Projekt 3: Planung des Elternabends in <strong>der</strong> Schule im September mit Erzieherinnen und<br />
Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen als Multiplikatoren, sowie <strong>der</strong> Vorschullehrerin Fr. Heinz<br />
und <strong>der</strong> Sprachheillehrerin Fr. Nuss.<br />
� Evaluation 2005<br />
Neuentwicklung des Konzeptes mit Methodik und Arbeitsfolien sowie<br />
Arbeitspapieren<br />
Schulleiterin und die beiden Lehrerinnen <strong>der</strong> jetzigen 1. Klassen leiten den<br />
Elternabend.<br />
Ziel: - Information <strong>der</strong> Eltern über den Ablauf des Einschulungsverfahrens<br />
- Gemeinsame Erarbeitung <strong>der</strong> Kriterien für Schulfähigkeit<br />
Der Ablauf des Einschulungsverfahrens wird für die Eltern transparenter gemacht mit den Zielen<br />
- Abbau von Angst<br />
- Abbau von Vorurteilen<br />
- Hilfestellung bei Entwicklungsverzögerungen<br />
- Optimierung <strong>der</strong> Fertigkeiten, die ein Schulkind benötigt<br />
Die Eltern reagierten positiv.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-1
<strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 4: Planung <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose im September<br />
Künftige Erstklässler und „Kannkin<strong>der</strong>“ werden in Einzelinterviews ( Dauer etwa<br />
30 Min.) beobachtet. Der Schwerpunkt liegt bei <strong>der</strong> Beobachtung und<br />
Beurteilung des Entwicklungsstandes <strong>der</strong> sprachlichen Fähigkeiten. Diese haben<br />
das Ziel, bei auffälligen Entwicklungsverzögerungen die Eltern frühzeitig darauf<br />
aufmerksam machen zu können und um eine geeignete Frühför<strong>der</strong>ung<br />
einzuleiten.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Der Ablauf des Einschulungsverfahrens hat sich bewährt.<br />
Die Eltern sind zufrieden.<br />
Projekt 5: Gemeinsame Erarbeitung <strong>der</strong> Kriterien für Schulfähigkeit – das Fundament des<br />
Lernens und Denkens / grundlegende Fähigkeiten<br />
1. Wahrnehmung – optisch – akustisches Fokussieren<br />
2. Konzentration aufs Wesentliche – Filterproblematik<br />
3. Gedächtnisleistung (Kurz- und Langzeitspeicherung)<br />
4. Wortschatz (ausreichend)<br />
5. Grob- und Feinmotorik,<br />
6. Raum- Lagewahrnehmung<br />
7. Prozesse in Ruhe und Sorgfalt zu Ende bringen (Ausdauer)<br />
8. Gutes Sozialverhalten und Gruppenfähigkeit (Einfühlungsvermögen und<br />
Regelverhalten<br />
� Evaluation 2005<br />
Beobachtungsverfahren für einzuschulende Kin<strong>der</strong> nach diesen Kriterien haben sich bewährt.<br />
Ein weiterer überprüfen<strong>der</strong> Rückblick erfolgt am Ende des ersten Schuljahres, um die Diagnose<br />
zu validieren.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Die Validierung <strong>der</strong> Diagnose fällt vereinzelt den Kolleginnen schwer.<br />
Beobachtungen im Bereich <strong>der</strong> optischen sowie akustischen Wahrnehmung sowie <strong>der</strong> Raum-<br />
Lagewahrnehmung, <strong>der</strong> Grob- und Feinmotorik werden im späteren Unterricht bestätigt. Vor<br />
allem die Beobachtungen bei <strong>der</strong> optisch-graphomotorischen Differenzierung gaben den Eltern<br />
wichtige Hinweise, um sie auf eine mögliche Entwicklungsverzögerung in <strong>der</strong> Raum-<br />
Lagewahrnehmung aufmerksam zu machen und evtl. eine Ergotherapie in Angriff zu nehmen.<br />
Einige Beobachtungen bestätigten die Tatsache, dass sich das Kind schon in Ergotherapie<br />
befand. Die Auffälligkeiten bei <strong>der</strong> phonematisch-akkustischen Differenzierung und <strong>der</strong><br />
kinästhetsich-artikulatorische Differenzierung gaben sichere Hinweise auf die Notwendigkeit von<br />
logopädischem Therapiebedarf. Die Beobachtungen <strong>der</strong> rhythmischen Differenzierung lassen<br />
sich im späteren Unterricht sehr gut bestätigen. Schwerer fällt <strong>der</strong> Vergleich <strong>der</strong> Beobachtungen<br />
von Konzentrationsfähigkeit aufs Wesentliche, Gedächtnisleistung im Kurz- und<br />
Langzeitspeicher sowie <strong>der</strong> Ausdauer.<br />
Die Informationen über gutes Sozialverhalten und Gruppenfähigkeit, erhalten wir zuverlässig vor<br />
allem in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen des Kin<strong>der</strong>gartens.<br />
Sinnvoll wäre ebenfalls ein Vergleich <strong>der</strong> Diagnosen nach dem 2. Schuljahr.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-2
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Organisation <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Planung <strong>der</strong> Beteiligten: Schulleiterin, Sekretärin, die beiden Kolleginnen <strong>der</strong> beiden<br />
zukünftigen ersten Klassen und zwei Kolleginnen<br />
2. Planung des Ortes: Rektorat, Sekretariat, Klassenraum<br />
3. Planung <strong>der</strong> Zeit: Vormittag und Nachmittag an zwei aufeinan<strong>der</strong> folgenden Tagen<br />
4. Planung <strong>der</strong> Inhalte, <strong>der</strong> Methoden, <strong>der</strong> Materialien und des Ablaufs<br />
Beobachtung und Beurteilung <strong>der</strong><br />
1. Grob- und Feinmotorik<br />
2. Optisch- graphomotorischen Differenzierung<br />
3. Phonematisch- akkustischen Differenzierung<br />
4. Kinästhetisch- artikulatorischen Differenzierung<br />
5. des Wortschatzes<br />
6. des Sprachverstehens und des Sprachgedächtnisses<br />
7. <strong>der</strong> rhythmischen Differenzierung<br />
8. <strong>der</strong> Mengenerfassung<br />
5. Organisation <strong>der</strong> Materialien<br />
6. Erstellung von Beobachtungs- und Protokollbögen<br />
7. Planung <strong>der</strong> persönlichen Einzelgespräche <strong>der</strong> Schulleiterin mit den Eltern<br />
entwicklungsauffälliger Kin<strong>der</strong> mit dem Ziel <strong>der</strong> Initiation eines Frühför<strong>der</strong>programmes<br />
unter Mitwirkung des Kin<strong>der</strong>arztes, falls dies noch nicht geschehen ist.<br />
8. Planung <strong>der</strong> Rückmeldung <strong>der</strong> Beobachtungen <strong>der</strong> Schulleitung an die<br />
entsprechenden Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen<br />
� Evaluation 2005<br />
Einzelgespräche finden alle persönlich statt, da die Elternschaft eine telefonische Mitteilung über<br />
ein für sie so gravierendes Problem für unangemessen hielt. Für die Durchführung werden bei<br />
Bedarf Kolleginnen, die an <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose beteiligt waren, mit einbezogen.<br />
Bei geringfügigen Auffälligkeiten wird nur <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>garten informiert.<br />
Wir stellen fest, dass die Vorklasse in ihrer Bedeutung für die Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> nicht<br />
genügend erkannt wird. Die Kin<strong>der</strong>gärten werden gebeten auf eine stärkere Akzeptanz bei den<br />
Eltern hinzuwirken.<br />
� Evaluation 2006<br />
Bei den durchweg guten Beobachtungen sowohl bei den Pflicht- als auch den Kann-Kin<strong>der</strong>n,<br />
entschied die Schulleitung, einen <strong>Stand</strong>ardbrief an die Eltern zu verschicken, mit dem Hinweis,<br />
dass die endgültige Entscheidung über Schulfähigkeit am Schnuppertag im Mai gefällt wird. In<br />
Telefonaten mit den beiden Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen betonte die Schulleiterin noch einmal die<br />
zufriedenstellenden Beobachtungen mit <strong>der</strong> Bitte um Weiterleitung an die Eltern. Wir machen<br />
die von uns empfohlene Einführung des Würzburger Programms in den Kin<strong>der</strong>gärten für die<br />
gute Entwicklung mitverantwortlich.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-3
� Planung 2007<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Überarbeitung <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose am Pädagogischen Tag im November 2008, um<br />
noch gezielter die Entwicklungsrückstände <strong>der</strong> zukünftigen Schüler aufzudecken und sie im<br />
Vorschuljahr durch beson<strong>der</strong>es Training ( in Rücksprache auch mit den Kin<strong>der</strong>gärten)<br />
aufzuholen.<br />
� Evaluation 2008<br />
Die Überarbeitung <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose im September fand planmäßig statt.<br />
Die Beobachtungszeitspanne <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose im September wird pro Kind jetzt auf<br />
30 Min. erhöht, so dass ein persönliches Gespräch <strong>der</strong> Schulleiterin mit den Eltern im Anschluss<br />
an unsere Beobachtungen geführt werden kann.<br />
Schulleiterin und Kolleginnen <strong>der</strong> aktuellen ersten Klassen führen mit den<br />
Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen im Zeitraum Oktober/November ein Kooperationsgespräch mit dem Ziel<br />
- Beobachtungen über die künftigen Schüler auszutauschen<br />
- Auf Entwicklungsdefizite o<strong>der</strong> mögliche Wahrnehmungsschwächen aufmerksam zu machen<br />
- Erfahrungs- und Beobachtungsaustausch <strong>der</strong> Klassenlehrerinnen mit den<br />
Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen zu den Kin<strong>der</strong>n <strong>der</strong> aktuellen ersten Klassen, eine wichtige<br />
Rückmeldung an die Kin<strong>der</strong>gartenteams und ihre gestellten Prognosen<br />
� Evaluation 2009<br />
Das persönliche Gespräch <strong>der</strong> Schulleiterin mit den Eltern bewährt sich sehr. Ein Austausch<br />
über beobachtete Entwicklungsverzögerungen und evtl. Therapien ist sehr hilfreich und wird von<br />
den Eltern dankbar angenommen.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong><br />
Das Schulamt beschließt, den Schuleingangsdiagnosetermin in den März vorzuverlegen, damit<br />
Schüler mit diagnostizierten Defiziten früher gezielt geför<strong>der</strong>t werden können. Dies hat zur Folge,<br />
dass wir die Inhalte unserer Beobachtungen dem jüngeren Alter <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> anpassen müssen.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-4
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
In Kooperation mit den Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>nhausens, vor allem <strong>der</strong>er aus Engenhahn und<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach, und mit <strong>der</strong> Theißthalschule entsteht ein gemeinsamer Übergabebogen vom<br />
Kin<strong>der</strong>garten zur Schule. (Siehe Anhang)<br />
Wir führen die „Märzdiagnose“ mit davor liegendem einführenden Elternabend durch, behalten<br />
aber die Septemberdiagnose bei, die wir weiterhin als sehr hilfreich für die Beobachtung <strong>der</strong><br />
Lern- und Persönlichkeitsentwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und die dazu gehörende Elternberatung<br />
halten.<br />
Wir nehmen teil an einem Forschungsprojekt <strong>der</strong> Goethe-Universität Frankfurt unter Leitung von<br />
Frau Prof. Dr. Helga Kelle und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Dipl. Päd. Anna<br />
Schweda mit dem Titel „Einschulungsverfahren, Eingangsdiagnostiken und<br />
Bildungsentscheidungen im Kontext des Strukturwandels des Übergangs in die Grundschule“.<br />
In diesem bei <strong>der</strong> Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragten Projekt werden die<br />
Einschulungsverfahren, die vielfältigen Methoden <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnostik an Grundschulen<br />
sowie die Prozessierung von Bildungsentscheidungen vor dem Schuleintritt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
erforscht.<br />
„Vor dem Hintergrund des Strukturwandels von Elementar- und Primarbereich in allen<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n sowie des Konsenses über die Notwendigkeit <strong>der</strong> vorschulischen För<strong>der</strong>ung<br />
und <strong>der</strong> Absenkung von Rückstellungsquoten stellt das Vorhaben die Frage, wie die bisher<br />
übliche Eingangsselektion hin zu differenzierten Bildungsentscheidungen vor und am<br />
Schulbeginn transformiert wird.“ (Prof. Dr. Kelle)<br />
Beobachtend und analysierend nehmen mit Zustimmung <strong>der</strong> Schulkonferenz und <strong>der</strong><br />
betroffenen Elternschaft Frau Prof. Kelle sowie Frau Schweda an allen Sequenzen <strong>der</strong><br />
Schuleingangsdiagnose teil.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-5
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Schulärztliche Untersuchung<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Terminierung des Untersuchungszeitraums <strong>der</strong> Schulärztin Frau Heinze möglichst im<br />
Februar<br />
Schnuppertag<br />
1. Planung des Schnuppertages im Mai<br />
Anfang Mai wird eine Unterrichtssituation den Kin<strong>der</strong>n geboten, um einen Eindruck von<br />
Schule und Unterricht zu bekommen. Dieser Unterricht dient aber auch den Lehrerinnen, die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zur Schulfähigkeit hin erneut unter dem Gesichtspunkt <strong>der</strong><br />
Gruppenfähigkeit und des Sozialverhaltens zu beobachten.<br />
2. Planung <strong>der</strong> Zeit<br />
An einem Dienstag von 11.00 – 13.00 Uhr<br />
3. Der Beteiligten<br />
Einzuschulende Kin<strong>der</strong> sowie Kannkin<strong>der</strong> in 4 Gruppen mit jeweiligem Symbol aufgeteilt.<br />
Informationen aus <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnose und den Kin<strong>der</strong>gartenbeobachtungen<br />
werden berücksichtigt.<br />
Jeweils 2 Kolleginnen sind einer Gruppe zugeordnet. Die Kolleginnen, die im September<br />
beobachteten, sind jetzt im Unterricht <strong>der</strong> gleichen Kin<strong>der</strong>.<br />
4. Planung und Erarbeitung <strong>der</strong> Inhalte, <strong>der</strong> Methode, <strong>der</strong> Organisation und des Ablaufs,<br />
<strong>der</strong> Arbeitsblätter und Beobachtungsbögen<br />
5. Planung <strong>der</strong> Elterngespräche<br />
In den kommenden Tagen informiert die Schulleiterin die Eltern <strong>der</strong> „Kannkin<strong>der</strong>“ sowie die<br />
Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen über die wichtigsten Beobachtungen <strong>der</strong> Kolleginnen.<br />
Hospitation <strong>der</strong> Einzuschulenden im Unterricht <strong>der</strong> 3. Klassen<br />
Der Unterricht <strong>der</strong> zukünftigen Patenkin<strong>der</strong> dieser Schüler wird von den Klassenlehrerinnen<br />
so vorbereitet, sodass ein gemeinsamer Deutsch- und Matheunterricht in 1 o<strong>der</strong> 2<br />
Unterrichtsstunden an 2 unterschiedlichen Tagen für jeweils einen Kin<strong>der</strong>garten abgehalten<br />
wird.<br />
- Terminabsprachen: Schulleiterin mit den Kin<strong>der</strong>gartenleitungen<br />
� Evaluation 2009<br />
Ablauf und Inhalte des Schnuppertages wurden am Pädagogischen Tag im November 2008<br />
korrigiert, mit dem Ziel, präzisere Aussagen über Fähigkeiten und Fertigkeiten <strong>der</strong> zukünftigen<br />
Schüler treffen zu können.<br />
Umbenennung des „Schnuppertages“ in „Kennenlerntag“.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-6
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Einschulungsvorbereitungen an unserer Schule<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
1. Evt. Wünsche und Vorschläge <strong>der</strong> Eltern zur Eingruppierung ihrer Kin<strong>der</strong> in die<br />
Klassenverbände werden an die Kin<strong>der</strong>gartenleitungen gegeben<br />
2. Zusammenstellung <strong>der</strong> beiden Lerngruppen durch die Schulleiterin<br />
3. Elternabend kurz vor den Sommerferien<br />
Stehempfang in <strong>der</strong> Aula mit Ansprache <strong>der</strong> Schulleiterin<br />
Die Rede enthält einen Wunsch nach Mitgliedsbeitritt <strong>der</strong> Eltern zum För<strong>der</strong>verein unserer<br />
Schule, Verteilung <strong>der</strong> Beitrittserklärungen<br />
3.1. Vorstellung <strong>der</strong> Vorsitzenden des För<strong>der</strong>vereins<br />
3.2. Bekanntgabe <strong>der</strong> Klasseneinteilung<br />
3.3. Vorstellung <strong>der</strong> Klassenlehrerinnen<br />
4. Elternabend mit den Klassenlehrerinnen in den Klassenräumen<br />
4.1. Informationen <strong>der</strong> Eltern über Organisatorisches<br />
4.1.1. Materialliste<br />
4.1.2. evt. Erstellung einer Rundrufliste<br />
4.1.3. Einsammeln von Brezelgeld (Einschulungstag)<br />
4.1.4. Einsammeln von Geld fürs Lenzenberg-T-Shirt sowie<br />
4.1.5. Größenbestellung fürs T-Shirt<br />
5. Vorbereitung <strong>der</strong> Namensschil<strong>der</strong> <strong>der</strong> Erstklässler durch die Paten in den 4. Klassen<br />
und ihren Klassenlehrerinnen<br />
6. Planung <strong>der</strong> Einschulungsfeier<br />
am 2. Schultag nach den Sommerferien<br />
9.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in <strong>der</strong> Kirche Nie<strong>der</strong>seelbach<br />
9.45 Uhr Empfang <strong>der</strong> Schüler durch ihre Paten am Schuleingang<br />
Übergabe des Namensschildes sowie des Lenzenberg-T-Shirts und Begleitung<br />
<strong>der</strong> in die Klassenräume<br />
10.00 Uhr Offizieller Empfang <strong>der</strong> Eltern und Schüler durch die Schulleiterin<br />
Feier unter Mitwirkung <strong>der</strong> 2. Klassen<br />
10.30 Uhr Schüler gehen in die Klassen und erhalten ihren ersten kleinen Unterricht mit<br />
ihrer Klassenlehrerin und eine traditionelle Brezel<br />
11.00 Uhr Voraussichtliches Ende des ersten Schultages<br />
Kooperation Schule – Kin<strong>der</strong>gärten<br />
Regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen Schule und Kin<strong>der</strong>gärten durch<br />
� Treffen mit den Erzieherinnen<br />
o nach Schuleingangsdiagnose<br />
o nach Schnuppertag<br />
o nach den ersten Monaten des 1. Schuljahres<br />
� Einladung zum ersten Elternabend<br />
� Berücksichtigung <strong>der</strong> Erfahrungen und Beobachtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gärten . Diese haben<br />
Auswirkungen auf die Zusammensetzung <strong>der</strong> zu bildenden Klassen.<br />
� Kooperation und Angleichung <strong>der</strong> Konzepte <strong>der</strong> beiden Kin<strong>der</strong>gärten<br />
� Gedankenaustausch aller Erzieherinnen und Grundschulleiterinnen Nie<strong>der</strong>nhausens im<br />
Rahmen einer Fortbildung (2003 sowie 2004)<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-7
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Auf Grund <strong>der</strong> Gespräche mit den Eltern, den Erzieherinnen und den Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen,<br />
sowie <strong>der</strong> Kolleginnen, die alle an den Einschulungsvorbereitungen und Diagnoseverfahren<br />
beteiligt sind, können wir sagen, dass <strong>der</strong> Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Grundschule zur<br />
allgemeinen Zufriedenheit erfolgt. Vor allem die informellen Besuche <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gärten bei<br />
beson<strong>der</strong>en Feierlichkeiten und Darbietungen unserer Schule sowie das Besuchen <strong>der</strong><br />
zukünftigen Paten in ihren Klassen und das Erlebnis des gemeinsamen Unterrichts machen den<br />
Kin<strong>der</strong>n die Schule vertraut und erfüllen sie mit Zuversicht und Erwartungsfreude.<br />
Wir freuen uns, dass die Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>seelbachs und Engenhahns auf unsere<br />
Empfehlung hin im Jahre 2006 das Würzburger Programm einführten, um die Entwicklung und<br />
die Kompetenz <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> individuell zu beobachten und beschreiben und för<strong>der</strong>n zu können.<br />
Die an<strong>der</strong>en Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>nhausens folgten diesem Beispiel.<br />
� Planung 2007/08<br />
Wie kann <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>garten darauf einwirken, dass die zukünftigen Schüler in <strong>der</strong> großen<br />
Lerngruppe sich bei frontalen Erklärungen und Einführungen in die unterrichtliche Thematik<br />
aufmerksam zuhören, beobachten und mitdenken. Denn wir beobachten nachlassende<br />
Fähigkeiten <strong>der</strong> Schüler, sich durch den Lehrer angesprochen zu fühlen, wenn dieser vor <strong>der</strong><br />
Lerngruppe allen etwas erklärt o<strong>der</strong> vormacht, was Schüler später selbst an ihrem Platz<br />
nachvollziehen sollen.<br />
Ist es möglich<br />
- ähnliche Situationen schon im Kin<strong>der</strong>garten zu schaffen<br />
- Aufträge nennen und erfüllen zu lassen als vorbereitende Übungen<br />
- Aufträge nennen und erfüllen zu lassen auch im Elternhaus<br />
- Vormachen und Nachmachen üben<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Im Kooperationsgespräch (Januar 2008) mit den Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen, <strong>der</strong> Schulleiterin und<br />
<strong>der</strong> jetzigen 1.Klasslehrerin wurden die oben genannten Punkte besprochen.<br />
Die Arbeit mit dem Würzburger Programm Teil 1 zeigt im Anfangsunterricht seine positive<br />
Wirkung, vor allem die phonematische Bewusstheit <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler hat sich<br />
verbessert.<br />
� Planung 2008/09<br />
- Intensivierung <strong>der</strong> Kooperation mit den Kin<strong>der</strong>gärten Engenhahn und Nie<strong>der</strong>seelbach mit<br />
dem Ziel:<br />
- Informationsaustausch über die neuen Schüler mit ihren Auffälligkeiten,<br />
Entwicklungsverzögerungen, Therapien, den bisherigen Ergebnissen <strong>der</strong> Elternarbeit, <strong>der</strong><br />
Schuleingangsdiagnose im September und des Schnuppertages im Mai<br />
- Gemeinsame Betrachtung des großen Schwerpunktes einer vorschulischen Erziehung in<br />
den Bereichen <strong>der</strong> phonematischen Bewusstheit, Feinmotorik und visuellen Wahrnehmung<br />
als etablierter Tagesordnungspunkt <strong>der</strong> Schulleiterin <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> am Elternabend<br />
im Kin<strong>der</strong>garten vor <strong>der</strong> „Schlaumeierzeit“, dem letzten Kin<strong>der</strong>gartenjahr vor <strong>der</strong><br />
Einschulung. (Infragestellung des Namens „Schlaumeier“ ?)<br />
- Gemeinsames Vorsprechen beim Bürgermeister Döring, um die neue große Belastung<br />
durch die Krippen-Aufgabe zu beschreiben (Aufnahme von Kin<strong>der</strong>n ab 2 Jahre, 15 Kin<strong>der</strong><br />
pro 1,5 Personal) und zu erreichen, dass mehr Zeit den Erziehern bleibt für eine intensivere,<br />
innovative Vorschularbeit in den Bereichen phonematische Bewusstheit, Feinmotorik und<br />
visuelle Wahrnehmung.<br />
- Pädagogischer Tag: Freitag, den 28.11.08, Thema: Psychomotorische Lernmaterialien mit<br />
ihrem Lerntherapeutischen Hintergrund in Oberursel<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-8
� Evaluation 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Die Planungsziele von 08/09 wurden größtenteils erreicht.<br />
Die Kooperation mit den Kin<strong>der</strong>gärten läuft sehr vertrauensvoll und erfolgreich in guter<br />
Arbeitsatmosphäre.<br />
Da es vereinzelt doch zu Enttäuschungen von Eltern bezüglich <strong>der</strong> Eingruppierung ihrer Kin<strong>der</strong><br />
in die Klassenverbände kam, wird die Schulleiterin die Klasseneinteilungen nur mit Hilfe <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>garten-Informationen über soziologische, psychische und kognitive Kompetenzen und<br />
Bedingungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> treffen und auf die Vorschläge <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gartenleitungen eingehen<br />
ohne die Wünsche <strong>der</strong> Eltern einzuholen.<br />
Durch die Einführung von Krippenplätzen in den Kin<strong>der</strong>gärten von Nie<strong>der</strong>seelbach und<br />
Engenhahn gelangen die Erzieherinnen in die Situation, die weniger Zuwendung für die größeren<br />
Kin<strong>der</strong> zur Folge hat.<br />
Unsere Hoffnung auf erhöhte individuelle Zuwendung und somit För<strong>der</strong>ung einzelner Kin<strong>der</strong> mit<br />
Entwicklungsverzögerungen schwindet.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
In Kooperation mit den Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>nhausens, vor allem <strong>der</strong>er aus Engenhahn und<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach, und mit <strong>der</strong> Theißthalschule entsteht ein gemeinsamer Übergabebogen vom<br />
Kin<strong>der</strong>garten zur Schule. (Siehe Anhang)<br />
� Planung <strong>2011</strong><br />
Die Evaluationskonferenzen mit den Kin<strong>der</strong>gartenleiterinnen im Dezember sollten ergänzt<br />
werden durch die Möglichkeit <strong>der</strong> Hospitationen <strong>der</strong> Erzieherinnen in unserem<br />
Anfangsunterricht, um noch deutlicher wahrnehmen zu können, welchen Anfor<strong>der</strong>ungen die<br />
Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> neuen Schulwelt und im Unterricht begegnen. Unser Wunsch ist, dass die Kin<strong>der</strong><br />
im letzten Kin<strong>der</strong>gartenjahr gezielter Kompetenzen erlangen, die für die Mitarbeit im<br />
einführenden Frontalunterricht und für die anschließende eigene und selbständige<br />
Arbeitsorganisation notwendig sind.<br />
Übergang vom Kin<strong>der</strong>garten zur Schule E6-9
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Entwicklungsbereich: Übergang zur weiterführenden Schule<br />
Übergang von Klasse 4 nach 5<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Viele Kin<strong>der</strong> besuchen nach <strong>der</strong> Klasse 4 die Theißtalschule in Nie<strong>der</strong>nhausen. Um den<br />
Übergang gleitend zu gestalten, wurden einige vorbereitende Maßnahmen vereinbart. Bisher<br />
konnten die Vereinbarungen seitens <strong>der</strong> weiterführenden Schule noch nicht in vollem<br />
Umfang eingehalten werden. Zukünftig soll aber weiterhin versucht werden, auf die Erfüllung<br />
<strong>der</strong> Absprachen größeren Wert zu legen. Dazu zählen:<br />
1. Besuche <strong>der</strong> zukünftigen Klassenlehrer/innen in den 4. Schuljahren vor den<br />
Sommerferien mit Gelegenheit zum Gespräch mit den Grundschullehrerinnen.<br />
2. Besuch <strong>der</strong> Viertklässler in <strong>der</strong> Theißtalschule mit <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> Teilnahme am<br />
Unterricht.<br />
3. Übergabegespräche zwischen den betreffenden Lehrern/innen kurz vor o<strong>der</strong> nach den<br />
Sommerferien (z. B. Regeln, Arbeitsmethoden, Grundwortschatz, Probleme)<br />
4. Einladung <strong>der</strong> Kolleginnen und Kollegen <strong>der</strong> aufnehmenden Schule zum Gespräch über<br />
die Schüler/innen im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz.<br />
5. Das erste Diktat im 5. Schuljahr soll eng an den bekannten Grundwortschatz angelehnt<br />
sein.<br />
6. Eine Abstimmung mit <strong>der</strong> Theißtalschule über Inhalte und Arbeitsformen wird<br />
angestrebt, war aber wegen personeller Verän<strong>der</strong>ungen dort bisher noch nicht möglich.<br />
� Evaluation 2005<br />
1., 2. und 3. ließen sich nicht verwirklichen.<br />
4., 5. und 6. werden mit Erfolg durchgeführt.<br />
Die Auflösung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>stufe, die Umwandlung in eine Additive Gesamtschule, die<br />
Verkürzung <strong>der</strong> Gymnasialzeit auf 8 Jahre machen ab dem Schuljahr 05/06 eine noch<br />
engere Kooperation notwendig. Deshalb finden folgende Projekte statt:<br />
Projekt 1: Absprachen und Vereinbarungen wurden Anfang des Schuljahres 03/04 getroffen<br />
bezüglich <strong>der</strong> zu erreichenden Lernziele an unserer Grundschule in den Fächern<br />
� Deutsch<br />
� Englisch<br />
Projekt 2: Planung erneuter Absprachen <strong>der</strong> Fachlehrerinnen <strong>der</strong> Grundschule und des<br />
Gymnasiums sowie <strong>der</strong> Realschule in den Fächern<br />
� Deutsch<br />
� Englisch<br />
� Mathematik<br />
Projekt 3: Evaluationsgespäche <strong>der</strong> Klassenlehrer <strong>der</strong> Theißtalschule mit unseren ehemaligen 2<br />
Klassenlehrerinnen<br />
Erfahrungen über den Schulerfolg im ersten Schuljahr an <strong>der</strong> weiterführenden<br />
Schule werden den ehemaligen Klassenlehrerinnen mitgeteilt<br />
Projekt 4: Teilnahme <strong>der</strong> Schulleiterin sowie einzelner Kolleginnen an Elternabenden <strong>der</strong><br />
Theißtalschule, die den Schuleinstieg und das <strong>Schulprogramm</strong> zum Inhalt haben<br />
Projekt 5: Teilnahme <strong>der</strong> Schulleiterin sowie einzelner Kolleginnen an Schulfesten und Tag <strong>der</strong><br />
offenen Tür, um persönliche Rücksprache mit den ehemaligen Schülern zu führen<br />
und um ihre Darbietungen anschauern zu können.<br />
Übergang zur weiterführenden Schule E7-1
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 6: Informationsveranstaltungen durch Herrn Brühl (Schulleiter Theißtalschule)<br />
� in <strong>der</strong> Schulkonferenz (2004)<br />
� an einem Elternabend für die 4. Klassen (September 2005)<br />
� Evaluation 2005<br />
Alle Treffen waren gut vorbereitet.<br />
Die Gespräche waren ergiebig.<br />
Informationen über Schüler waren detailliert und bestätigten unsere Beurteilungen.<br />
Alle Veranstaltungen sollten beibehalten werden.<br />
� Planung für 2006<br />
Informationen über Schulerfolg <strong>der</strong> Schüler auch nach einem Jahr erneut einholen.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Die Informationen wurden eingeholt. Die Gespräche haben wie<strong>der</strong> stattgefunden.<br />
Die Theißtalschule hat sich den Eltern <strong>der</strong> 4. Klassen wie<strong>der</strong> vorgestellt. Der Schulleiter Herr<br />
Brühl sprach weiterhin von erfolgreichen Schülern in den jeweilig gewählten Schulzweigen. Frau<br />
Simon äußerte den Wunsch unseres Kollegiums, ein Feed-back über unsere abgegebenen<br />
Schüler noch einmal nach etwa einem Jahr zu bekommen. Denn diese Aussagen würden wir<br />
als noch fundierter erachten.<br />
Die 4. Klassen werden im Februar 07 die Theißtalschule, als weiterführende Schule unseres<br />
Ortes, wie<strong>der</strong> einen ganzen Vormittag besuchen.<br />
Frau Simon schlug Frau Rösing vor, die beiden Grundschul- Englischlehrer zur Theißtalschule<br />
einzuladen, um das mit G8 bedingte engere Englischpensum durch einen an den Grundschulen<br />
gemeinsam erarbeiteten Grundwortschatz zu entlasten.<br />
Frau Simon knüpfte im Januar 07 Kontakte mit dem Privatgymnasium in Nie<strong>der</strong>nhausen-<br />
Königshofen und führte Gespräche mit <strong>der</strong> Direktorin Frau Dr. B. Konrad und dem<br />
För<strong>der</strong>vereinsvorsitzenden.<br />
Frau Dr. B. Konrad wird zukünftig ebenfalls auf dem Informationsabend für die weiterführenden<br />
Schulen ihr Privatgymnasium vorstellen können.<br />
� Evaluation 2008<br />
Unser Kooperationspartner <strong>der</strong> Eingangsstufe <strong>der</strong> Theißtalschule Frau Rösing steht durch ihren<br />
Schulwechsel uns lei<strong>der</strong> nicht mehr zur Verfügung.<br />
Ihre Aufgabe übernimmt Frau Fischer-Schulz<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Der Informationsaustausch zwischen Theißtalschule und <strong>Lenzenbergschule</strong> erfolgte wie in den<br />
Jahren zuvor unter den Schulleitern und den Klassenlehrern bei<strong>der</strong> Schulen (nach einem Jahr<br />
des Schulwechsels) und ergab ein gutes Feedback.<br />
Die Rückmeldungen <strong>der</strong> Theißtalschule über die Englisch-, Deutsch- und Mathematikkenntnisse<br />
unserer Grundschüler sind sehr zufriedenstellend. Vor allem die Gymnasialschüler fallen auf<br />
durch ihre fundierten Kenntnisse und Kompetenzen.<br />
Die Informationsveranstaltung an <strong>der</strong> Theißtalschule im November 2009 vermittelte den Eltern<br />
unserer Viertklässler gute Einblicke in die Schulorganisation, das pädagogische Konzept <strong>der</strong><br />
drei Schulformen sowie die Möglichkeit <strong>der</strong> Einrichtung einer Sportklasse.<br />
Übergang zur weiterführenden Schule E7-2
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Gerne führen ehemalige Schüler/innen ihre Schulpraktika an unserer Schule durch. Ehemalige<br />
Schüler kommen in Scharen zu ihren ehemaligen Klassenlehrerinnen, um ihren „Girlsday“<br />
abzuhalten. Dies sind für beide Seiten gute Gelegenheiten, um Erfahrungen auszutauschen und<br />
für die Lehrerinnen neueste Informationen über den Lernerfolg an <strong>der</strong> weiterführenden Schule<br />
zu erhalten.<br />
Übergang zur weiterführenden Schule E7-3
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und<br />
För<strong>der</strong>er<br />
Praktikanten/Referendare<br />
Im Schuljahr 1998/99 wurde eine Referendarin aufgenommen, in den Schuljahren<br />
1999/2000 und 2000/2001 wurden zusätzlich je drei Praktikantinnen aufgenommen. Auch<br />
zukünftig will die Schule Studenten aufnehmen, jedoch entscheidet die Gesamtkonferenz<br />
von Jahr zu Jahr neu, ob Praktikanten o<strong>der</strong> Praktikantinnen aufgenommen werden sollen.<br />
Teilnahme <strong>der</strong> Eltern am Unterricht<br />
Bei verschiedenen Unterrichtsvorhaben werden Eltern mit einbezogen:<br />
- als Helfer und zweite Aufsicht, z. B. beim Plätzchenbacken, bei Ausflügen,<br />
Theaterbesuchen usw.<br />
- als Fachleute, die über ihre Berufe o<strong>der</strong> einzelne Unterrichtsthemen berichten<br />
(Haltung beson<strong>der</strong>er Tiere, Ärzte informieren über medizinische Sachverhalte usw.)<br />
- als Aufsichtführende 1)<br />
im Rahmen des Elternnotdienstes bei Erkrankung bzw.<br />
Abwesenheit einer Lehrkraft (Eltern übernehmen von Lehrkräften vorbereiteten<br />
Unterricht und betreuen die Schüler allein nach einem festgelegten Notdienstplan)<br />
� Evaluation 2005<br />
1) Aufsichtspflicht bei Vertretungsunterricht durch den Elternnotdienst hat die Lehrkraft des<br />
benachbarten Klassenraums. Daher dürfen beide Klassenräume nicht verschlossen sein.<br />
� Evaluation 2006<br />
Trotz <strong>der</strong> Einführung von Unterrichtsgarantie Plus bleibt das Ehrenamt des Elternnotdienstes<br />
erhalten. Er hat sich bewährt, vor allem, da die „U+“Gel<strong>der</strong> schon Anfang November verbraucht<br />
waren.<br />
Fachleute verschiedener Berufsgruppen bringen ihr Wissen als Ergänzung<br />
zur Unterrichtsvorbereitung <strong>der</strong> Lehrkraft ein, u.a.<br />
� Polizei – Der sichere Schulweg(1. Schulj.), Radfahrprüfung (4. Schulj.)<br />
� Johanniter (Erste Hilfe Kurs, 4. Schulj.)<br />
� Ernährungsberaterin – Gesunde Ernährung (3. Schulj.)<br />
� Zahnärztin – Zahnpflege (1. und 3. Schulj.)<br />
� private Musikschulen:<br />
- musikalische Früherziehung mit Frau Mosch<br />
- konzertiertes Flöten mit Frau Elisabeth Wollitz<br />
� Sport- und Turnverein<br />
� Elternverein<br />
- Second-Hand-Verkauf in unseren Schulräumen<br />
- Nikolausfeier mit Rentier auf dem Schulhof<br />
� Handwerkbetriebe<br />
- die zum Teil als Sponsoren auftreten<br />
� Frau Brigitte Mollnow, die als Yoga-Lehrerin im Wahlpflichtunterricht (AGs) sich engagiert<br />
und durch den För<strong>der</strong>verein mitfinanziert wird<br />
� Ehrenamtliche Mitarbeiter im Unterricht<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er E8-1
<strong>Stand</strong> <strong>2011</strong> <strong>Stand</strong> April 2008 <strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2009/10 <strong>Stand</strong> <strong>2011</strong> <strong>Stand</strong> 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Ehrenamtlich engagieren sich Angehörige <strong>der</strong> Schüler mit ihren fachlichen Kompetenzen<br />
und unterrichten in den sogenannten AGs:<br />
- Chemie: Frau Vera Kreis<br />
- Elektronik: Herr Ulrich Nowack<br />
- Schach: Herr Udo Hipler<br />
- Computer: Herr Michael Klodt<br />
- Tanzen: Frau Daniela Wallwitz (bis 09)<br />
- Spanisch: Frau Patrizia Wegenast (bis 08)<br />
- Kochen: Frau Almut Martinez und Frau Regina Suckow<br />
Kooperation mit außerschulischen Vereinen<br />
Kontaktaufnahme mit dem Seniorenheim Nie<strong>der</strong>nhausen im Januar 2008.<br />
Ziel: Teilnahme unserer Schüler am Frühlingsfest mit musikalischen Darbietungen einzelner<br />
Klassen und <strong>der</strong> Musical- Wahlpflicht-AG<br />
Wir freuen uns über eine gute und bereichernde Kooperation mit allen Vereinen unserer<br />
Ortsteile<br />
- Chor und Notenhopser<br />
- Schule und Turnverein<br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Schutzgemeinschaft Deutscher Wald<br />
Tag des Baumes (April 2009)<br />
Dieses Fest wurde veranstaltet in Kooperation mit <strong>der</strong> Schutzgemeinschaft Deutscher Wald<br />
(SDW) e.V., Bonn. Unser Ansprechpartner war Herr Sabiel.<br />
Jedes Jahr feiert Deutschland seit 1952 (vom ehem. Bundespräsidenten Theodor Heuss im<br />
Bonner Hofgarten ins Leben gerufen) den Tag des Baumes.<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> SDW ist:<br />
- Waldschutz<br />
- Information <strong>der</strong> Öffentlichkeit über Wald<br />
- Waldpädagogik<br />
In diesem Zusammenhang pflanzen <strong>der</strong> Landrat Herr Albers, <strong>der</strong> Bürgermeister Herr Döring,<br />
<strong>der</strong> Förster Herr Faber und Herr Sabiel einen Bergahorn in unseren Schulgarten.<br />
Dieses Fest wurde feierlich umrahmt von Chorgesängen unserer Schüler, von Waldhorn-<br />
sowie Alphorndarbietungen in Begleitung von Elisabeth Wollitz und ihrer Ziehharmonika.<br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Goethe-Lehrer-Akademie <strong>der</strong> Universität Frankfurt<br />
- Besuch <strong>der</strong> Schulleiterin beim Geschäftsführer Prof. Dr. Büttner<br />
- Gedankenaustausch und Zielvereinbarungen einer Kooperation<br />
- Gemeinsamer Konsens: Entwicklung <strong>der</strong> phonematischen Bewusstheit als<br />
wesentliches Fundament des Schriftspracherwerbs<br />
- Ermittlung <strong>der</strong> Lesegeschwindigkeit unserer Schüler (im ahmen einer Diplomarbeit)<br />
- Rückmeldung <strong>der</strong> ausgewerteten Ergebnisse<br />
Teilnahme am Mathematik-Projekt von Frau Prof. Dr. Krajewski (Goethe Universität<br />
Frankfurt) zur Prophylaxe von Dyskalkulie und individueller För<strong>der</strong>ung im Anfangsunterricht.<br />
Kooperation mit <strong>der</strong> Geologischen Fakultät <strong>der</strong> Universität Frankfurt<br />
- Konzeptentwicklung für eine Geo- Projektwoche im Juni <strong>2010</strong><br />
- Konzeptentwicklung für eine Lehrerfortbildung dazu im März <strong>2010</strong><br />
- Konzeptentwicklung für eine Geo- Projekttag mit Schülern und Eltern sowie Ehemaligen<br />
Teilnahme an Wettbewerben<br />
- Mein Schulsong – Hessischer Rundfunk<br />
- Unser Elternengagement – Stiftungen<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er E8-2
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> Juli 2002<br />
<strong>Stand</strong> 2009/10<br />
� Planung <strong>2011</strong><br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Teilnahme am Forschungspojekt <strong>der</strong> Goethe-Universität Frankfurt unter Leitung von Frau Prof.<br />
Dr. Helga Kelle und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Dipl. Päd. Anna Schweda mit<br />
dem Titel „Einschulungsverfahren, Eingangsdiagnostiken und Bildungsentscheidungen im<br />
Kontext des Strukturwandels des Übergangs in die Grundschule“.<br />
In diesem bei <strong>der</strong> Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragten Projekt werden die<br />
Einschulungsverfahren, die vielfältigen Methoden <strong>der</strong> Schuleingangsdiagnostik an Grundschulen<br />
sowie die Prozessierung von Bildungsentscheidungen vor dem Schuleintritt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
erforscht.<br />
„Vor dem Hintergrund des Strukturwandels von Elementar- und Primarbereich in allen<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n sowie des Konsenses über die Notwendigkeit <strong>der</strong> vorschulischen För<strong>der</strong>ung<br />
und <strong>der</strong> Absenkung von Rückstellungsquoten stellt das Vorhaben die Frage, wie die bisher<br />
übliche Eingangsselektion hin zu differenzierten Bildungsentscheidungen vor und am<br />
Schulbeginn transformiert wird.“ (Prof. Dr. Kelle)<br />
Beobachtend und analysierend nehmen mit Zustimmung <strong>der</strong> Schulkonferenz und <strong>der</strong><br />
betroffenen Elternschaft Frau Prof. Kelle sowie Frau Schweda an allen Sequenzen <strong>der</strong><br />
Schuleingangsdiagnose teil.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Pressemitteilungen<br />
- Mitteilungen auf <strong>der</strong> Homepage<br />
- <strong>Schulprogramm</strong><br />
Besuch außerschulischer Lernorte<br />
Im Rahmen des Unterrichts werden regelmäßig außerschulische Lernorte aufgesucht, u. a.<br />
- Bäckerei<br />
- Ortsansässige Firmen (Hartmann, Druckerei Ebenhoch)<br />
- Försterei<br />
- Imker<br />
- Sehenswürdigkeiten <strong>der</strong> näheren Umgebung (Saalburg, Hessenpark, Museen, Opelzoo)<br />
- Büchereien<br />
- Kläranlage Taunusstein/Nie<strong>der</strong>nhausen<br />
- ortansässige Landwirte<br />
- Backes in Oberseelbach<br />
- Wildschweingehege Oberseelbach<br />
- Wiesbadener Staatstheater<br />
- Mainzer Staatstheater<br />
- Wiesbadener Museen<br />
- Mainzer Museen<br />
- Frankfurter Museen<br />
- Veranstaltungen als Wettkampf in verschiedenen Orten des Rheingau-Taunus-Kreises,<br />
z.B. „Ball über die Schnur“<br />
- Zirkusprojekt <strong>der</strong> Theißtalschule im Autal<br />
- Busschule mit den Verkehrsbetrieben <strong>der</strong> ORN<br />
� Planung <strong>2010</strong><br />
Geologische Beobachtungen Rund um unsere Dörfer zwischen Schule, Streuobstwiesen<br />
und Lenzenberg mit <strong>der</strong> Goethe Universität Frankfurt, Geologische Fakultät, BUND<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er E8-3
<strong>Stand</strong> 2009/10<br />
För<strong>der</strong>verein<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Unsere Schule bietet eine Betreuung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> in den unterrichtsfreien Stunden zwischen<br />
7.00 und 17.30 Uhr an. Träger des Betreuungsangebotes ist <strong>der</strong> För<strong>der</strong>verein <strong>der</strong><br />
Grundschule Nie<strong>der</strong>seelbach e.V., <strong>der</strong> durch die Initiative interessierter Eltern im August<br />
2000 gegründet worden ist. Den Kin<strong>der</strong>n steht während <strong>der</strong> Bertreuung, die in den Räumen<br />
<strong>der</strong> Grundschule stattfindet, ein reiches Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten (Werken,<br />
Sport, Spiele, etc) sowie Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Sie<br />
werden von sechs fachlich geschulten, vom Verein angestellten Kräften betreut, welche <strong>der</strong><br />
Aufsicht des Schulleiters unterstehen.<br />
Satzung und Konzept <strong>der</strong> pädagogischen Mittagsbetreuung: Siehe Anhang<br />
� Evaluation 2007/08<br />
- Neuwahl <strong>der</strong> För<strong>der</strong>vereinsvorsitzenden:<br />
Herr Klaus Klein, 1. Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Frau Andrea Brohm, 2. Vorsitzende<br />
- Erste große Aufgabe; Verlängerung <strong>der</strong> Betreuungszeit bis 15.30 Uhr, dazu<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlungen mit Anwesenheit <strong>der</strong> Schulleiterin im Januar und Februar<br />
- Erstellung und Verteilung von Erhebungsbögen an die Eltern, um den Bedarf an<br />
Betreuungszeit und somit <strong>der</strong> Betreuungskosten entsprechend <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>anzahl zu<br />
ermitteln (Die beiden Vorsitzenden mit Schulleiterin in beraten<strong>der</strong> Funktion)<br />
- Suche nach zusätzlichem Betreuungspersonal (Zeitungsannonce s.o.) mit <strong>der</strong> Maßgabe,<br />
eine möglichst gute Hausaufgabenbetreuung zu gewährleisten.<br />
- Die Wahl fällt auf Frau Trapp und Frau Maurer neben dem bisherigen Personal: Frau Frauke<br />
von Barken, Frau Annette Klose, Frau Oberthür<br />
- Erweiterung des Betreuungsangebotes bis um 15.30 Uhr<br />
- Täglicher Mittagstisch<br />
- Tägliche Hausaufgabenbetreuung<br />
- Zusätzliche Raumnutzung: Die beiden Klassenräume Trettin und Küchen-Werkraum nach<br />
<strong>der</strong> 6. Stunde<br />
- Infos über diese Erweiterung durch:<br />
Elternbriefe<br />
Zeitungsartikel vor dem Schnuppertag im Mai<br />
Auf <strong>der</strong> Homepage<br />
- Beantragung von Kreis-För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong>n<br />
- Gewinnung neuer För<strong>der</strong>vereinsmitglie<strong>der</strong> im Einschulungsprozess jeden Schuljahres<br />
� Evaluation 2008<br />
Der För<strong>der</strong>verein verän<strong>der</strong>t seine Satzung (siehe Anhang)<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er E8-4
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2009/10<br />
� Evaluation 2009<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Erstellung eines Betreuungskonzeptes<br />
� Darin enthalten ist eine Verlängerung <strong>der</strong> Betreuungszeit bis 15.30 Uhr sowie die Ausgabe<br />
eines Mittagessens.<br />
� Der För<strong>der</strong>verein erhält auf Grund seines Konzeptes För<strong>der</strong>gel<strong>der</strong> des Kreises in Höhe von<br />
20 000 Euro.<br />
� Entwicklung des För<strong>der</strong>vereinslogos <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> in Anlehnung an das<br />
Lenzenberg-Schullogo.<br />
� Mitglie<strong>der</strong>werbung erfolgt auf dem Schulfest 2009, verstärkt durch den Verkauf <strong>der</strong><br />
Schlüsselanhänger mit Lenzi<br />
� Evaluation <strong>2010</strong><br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>werbung bleiben hinter den Erwartungen zurück. Bei Einschulung<br />
<strong>der</strong> neuen Schüler muss weiterhin intensiver um Mitglie<strong>der</strong> geworben werden.<br />
Seit Oktober <strong>2010</strong> wurde die <strong>Lenzenbergschule</strong> ins Landesprogramm „Ganztägig lernende<br />
Schule“ aufgenommen. Dieses Programm („PÄM“: Pädagogische Mittagsbetreung) startete<br />
drei Jahre früher als erwartet, da wir bereit waren für eine „abgesprungene“ Schule im Rheingau<br />
„einzuspringen“. Hiermit kommen wir dem zunehmenden Wunsch <strong>der</strong> Elternschaft nach<br />
ganztägigem Lernen und Betreut sein ihrer Kin<strong>der</strong> sehr entgegen.<br />
Das Konzept <strong>der</strong> Mittagsbetreuung unserer Schule wurde in Kooperation von Schulleiterin und<br />
<strong>der</strong> neu ernannten Koordinatorin für das Ganztagsprogramm Frau Anke Gamer entwickelt.<br />
In Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem För<strong>der</strong>verein entstand ein Ganztagsprogramm,<br />
das mit dem Vormittag und den Betreuungszeiten des För<strong>der</strong>vereins eng verflochten wurde.<br />
Täglich von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr können Kin<strong>der</strong> unsere Schule besuchen, ein warmes<br />
Mittagessen erhalten und an interessanten Projekten aus Musik, Kunst, Sport und<br />
Naturwissenschaften teilnehmen. Es gibt Zeiten intensiven Übens und Festigens des Lernstoffes<br />
vom Vormittag, aber auch Zeiten des freien Spielens und <strong>der</strong> Entspannung.<br />
� Planung <strong>2011</strong><br />
Die Schulleiterin wird auf die Vereine <strong>der</strong> umgebenden Ortschaften zugehen, um mögliche<br />
Kooperationen für den Nachmittag anzubahnen. In diesem Zusammenhang wünschen wir uns<br />
auch eine häufigere Nutzung <strong>der</strong> anliegenden Lenzenberghalle als Sporthalle.<br />
Dank den Freunden und För<strong>der</strong>ern unserer Schule für ihr Engagement<br />
Hier sprechen die Schulleitung und das Kollegium einen großen Dank allen Mitwirkenden<br />
aus, ohne die unsere Schule nicht das sein könnte, was sie ist: Ein Ort voller Lebendigkeit,<br />
mit großer Wertschätzung jedes Beteiligten, mit großer Freude am Miteinan<strong>der</strong> und natürlich<br />
mit überzeugtem Engagement fürs Lernen.<br />
Dank den Eltern, die durch die Sponsorenläufe <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> im Sommer 2006 etwa 6000 €<br />
und im Sommer 2009 etwa 4000 € <strong>der</strong> Schule einbrachten. Dadurch wurde die<br />
Neugestaltung des Schulhofes und des Lernumfeldes <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ermöglicht.<br />
Dank an Frau Juliane Schnei<strong>der</strong>, die den Lenzi für unsere T-Shirts und das Buch „Lenzi und<br />
seine Freunde“ entwarf.<br />
Öffnung <strong>der</strong> Schule nach außen / Freunde und För<strong>der</strong>er E8-5
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule -<br />
Intensivierung und Fortführung des guten<br />
Schullebens<br />
Feste und Feiern<br />
Es finden immer wie<strong>der</strong>kehrende Feste und Feiern statt, darunter:<br />
- Gestaltung <strong>der</strong> vorweihnachtlichen Zeit<br />
o Gemeinsames Adventssingen und Musizieren im Treppenhaus an jedem<br />
Montagmorgen vor dem Unterricht<br />
o Nikolaus besucht die Klassen, die Besuch wünschen<br />
o Weihnachtsfeier mit allen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften <strong>der</strong><br />
Schule<br />
- Schul- bzw. Sommerfest und Ähnliches<br />
- Einschulungsfeier für die Erstklässler<br />
- Klassenfeste zu verschiedenen Themen (z. B. Weihnachtsfeier, Herbstfest, ABC-Fest<br />
usw.)<br />
- Sportfest/Bundesjugendspiele<br />
Projekt 1: Verabschiedungsfeier des Schulleiters Franz Morhard (Juli 2003)<br />
Projekt 2: Amtseinführung <strong>der</strong> neuen Schulleiterin Monika Simon (September 2003)<br />
Projekt 3: Einweihung des neuen Klettergerüstes (Januar 2004)<br />
Projekt 4: Musical „Ritter Rost hat Geburtstag“ (2004)<br />
Projekt 5: Weihnachtsflohmarkt (2004)<br />
Projekt 6: Würdigung <strong>der</strong> Sieger <strong>der</strong> Bundesjugendspiele und Überreichung <strong>der</strong><br />
Ehrenurkunden durch einen kleinen Festakt vor <strong>der</strong> Schulgemeinde auf dem<br />
Schulhof<br />
Projekt 7: Würdigung <strong>der</strong> Mannschaftssieger und Teilnehmer außerschulischer<br />
Wettkämpfe durch Aushang <strong>der</strong> Urkunde im Treppenhaus<br />
Projekt 8: Würdigung <strong>der</strong> AG-Ergebnisse durch Präsentationen<br />
Die Theater-AG führt halbjährlich ein Theaterstück für die gesamte Schülerschaft<br />
auf<br />
Projekt 9: Würdigung beson<strong>der</strong>er Projekte durch Präsentationen<br />
Projekt 10: Ausstellungen im Schulgebäude<br />
Projekt 11: Darbietungen vor <strong>der</strong> Schulgemeinde<br />
� Tanz auf dem Schulhof nach <strong>der</strong> großen Pause<br />
� Flötenkurse machen ein Treppenhaus- o<strong>der</strong> Hofkonzert<br />
Projekt 12: Die Mittelpunktgrundschule Nie<strong>der</strong>seelbach bekommt den Namen<br />
„<strong>Lenzenbergschule</strong> – Grundschule Nie<strong>der</strong>seelbach“<br />
� Entwurf eines Logos<br />
� Anfertigung des neuen Briefkopfes<br />
� Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zeugnisformulare<br />
� Tauffest – Erster Teil: Besteigung des Lenzenbergs (Juli 2005)<br />
� Entwurf eines Lenzenberg-T-Shirts<br />
� Herstellung eines Schulnamensschildes<br />
� Tauffest – Zweiter Teil: Urkundenübergabe durch den Landrat (September<br />
2005)<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-1
<strong>Stand</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Unser Schullogo<br />
� Unser För<strong>der</strong>vereinslogo<br />
� Schulsong <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
Refrain:<br />
Wir sind die Schüler, die Schüler am Lenzenberg,<br />
leben und lernen gern hier.<br />
Fröhlich erfahren „Das Leben ist wun<strong>der</strong>bar!“<br />
möcht ich gemeinsam mit dir.<br />
Jeden Morgen kommen wir ganz früh in unsre Schule,<br />
zu Fuß, mit Bus, und Papa mir noch froh zum Abschied winkt.<br />
In Häusern, Dörfern um den Berg verlassen wir die Betten,<br />
gespannt was dieser neue Tag so alles mit sich bringt.<br />
Refrain:<br />
Wir sind die Schüler, …….<br />
Wir freuen uns auf Lesen, Schreiben, Malen und auf Rechnen,<br />
auch wenn es einmal schwierig für so manchen von uns ist.<br />
Entdecken unsre Welt mit ihrer Schönheit, ihren Dingen<br />
und hoffen, dass die Lehrerin die Pause nicht vergisst.<br />
Refrain:<br />
Wir sind die Schüler, …….<br />
Wir singen, tanzen, lachen laut.<br />
Wir grübeln bis <strong>der</strong> Schädel raucht,<br />
sind froh, wenn wir die Lösung seh´n<br />
und wie<strong>der</strong> dann nach Hause geh´n.<br />
Refrain:<br />
Wir sind die Schüler, …….<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-2
2005 <strong>Stand</strong> 2006<br />
<strong>Stand</strong> 2009<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 13: Beschaffung einer Beschallungsanlage für Theater, Feste und Feierlichkeiten im<br />
Innen- und Außenbereich (z.B. Schulhof, Sportplatz)<br />
Projekt 14: 1. Sponsorenlauf <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
Unter großem Engagement <strong>der</strong> Schüler und Eltern fand unter <strong>der</strong> Leitung von<br />
Frau Grosser und Frau Simon <strong>der</strong> erste Sponsorenlauf im Sommer statt.<br />
Ziel <strong>der</strong> Veranstaltung: Einnahme von Sponsorengel<strong>der</strong>n, um die<br />
Fallschutzmatten unter dem Klettergerüst fachmännisch verlegen zu lassen.<br />
Ergebnis: ~5000 € , dank <strong>der</strong> großen Spendenfreundlichkeit <strong>der</strong> Eltern unserer<br />
Schüler, viel Freude und Spaß von Groß und Klein, mit verursacht durch die gute<br />
Unterhaltung und Musikuntermalung eines professionellen Entertainers sowie <strong>der</strong><br />
Versteigerung einer Heißluftballonfahrt.<br />
Projekt 15: Feierliche Begleitung <strong>der</strong> Fußballweltmeisterschaft 2006<br />
� Schulleitung kauft alle Flaggen <strong>der</strong> beteiligten Nationen über Internet.<br />
� Hausmeisterin lässt 6 Fahnenhalterungen an den Dachgaubenfenstern<br />
anbringen.<br />
� Bis zu 6 Flaggen werden täglich entsprechend <strong>der</strong> am Tag spielenden<br />
Mannschaften gehisst.<br />
In <strong>der</strong> Eingangshalle und im Treppenhaus auf dem Weg zur Betreuung hängt<br />
eine Weltkarte, auf <strong>der</strong> die an <strong>der</strong> Weltmeisterschaft teilnehmenden Nationen<br />
durch ihre Flagge gekennzeichnet sind. Auf diese Weise lernen die Schüler<br />
die Flaggen den Län<strong>der</strong>n zuzuordnen und wissen somit gleichzeitig, wo<br />
dieses Land in <strong>der</strong> Welt zu finden ist.<br />
� Den Abschluss <strong>der</strong> Weltmeisterschaft feierten wir alle gemeinsam auf dem<br />
Schulhof, indem die Siegerehrung hier noch einmal nachempfunden wurde.<br />
Dazu wurden alle Fahnen von den Schülern zu einem großen Kreis getragen,<br />
aus dem dann die Siegerfahnen feierlich in die Mitte gerufen wurden. Wichtig<br />
war uns dabei den Hinweis zu geben, dass wir uns mit den Siegern freuen<br />
und ihnen applaudieren, auch wenn Deutschland nur den dritten Platz<br />
erhalten hat.<br />
Projekt 16: Aktionstag rund ums Buch<br />
In Zusammenarbeit mit dem Hexenbuchladen in Idstein, dem För<strong>der</strong>verein,<br />
dessen Idee es war, und <strong>der</strong> Elternschaft entstand an einem<br />
Samstagnachmittag in <strong>der</strong> Vorweihnachtszeit ein zum Lesen anregen<strong>der</strong><br />
Aktionstag mit<br />
� Buchausstellung<br />
� Buchbestellungsaufträgen<br />
� einem Detektivsraum zum entdecken und rätseln und staunen<br />
� einem Bastelraum für Lesezeichen<br />
� mit einem Erlös, mit dem die Schülerbücherei aufgestockt wurde<br />
Projekt 17: Feierliche Einweihung des neu gestalteten multifunktionalen Raumes (12.1.09)<br />
mit<br />
� neuen Werkschränken<br />
� neuer Küche<br />
� neuer Bestuhlung<br />
� neuen Tischen<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-3
<strong>Stand</strong> 2009 <strong>Stand</strong> <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 18: Tag des Baumes (24.4.09)<br />
� mit musikalischen Beiträgen <strong>der</strong> Schule mit Alphorn und Jagdhorn<br />
� Einpflanzung des Bergahorns (Baum des Jahres 2009) in unseren<br />
Schulgarten<br />
Projekt 19: Sponsorenlauf (6.6.09) genannt „Lenziman 09“ mit Schulfest als Spielefest mit<br />
einem Ertrag von etwa 4000 €<br />
Die <strong>Lenzenbergschule</strong> bekommt ein Maskottchen, den „Lenzi“. Er wird am<br />
6.6.09 aus <strong>der</strong> Taufe gehoben<br />
Verabschiedungsfeier von Pfarrer Kratz innerhalb eines Abschiedsgottesdienstes am<br />
10.7.09 in unserer Aula sowie in einem großen Festakt <strong>der</strong> gesamten Gemeinde in <strong>der</strong><br />
Lenzenberghalle am 23.9.09<br />
Projekt 20: Teilnahme an einem Wettbewerb des Hessischen Rundfunks „Dein Schulsong“<br />
� Aufnahme des Gesangs zu unserem Playback am 5.11.09<br />
� Zusendung an HR 2 am 10.11.09<br />
Projekt 21: Am 3.12.09: Tag <strong>der</strong> Ronja zu Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ - ein<br />
Projekt, in dem die Klassen sich gestalterisch auf den Theaterbesuch im<br />
Wiesbadener Staatstheater vorbereiten<br />
Zwischen Unterricht und Theaterbesuch stärken sich alle Schüler an einem<br />
gemeinsamen Pizza-Buffet.<br />
Sie vergleichen den Buchtext, den Film und das Theaterstück miteinan<strong>der</strong>.<br />
Projekt 22: Geoprojekttag 19.06.10 im Zusammenhang mit Geo-Projektwoche<br />
14. - 19.06.10 - in Zusammenarbeit mit Fachdozenten<br />
- Dr. Rainer Dambeck, Geowissenschaften / Geographie, Geozentrum<br />
Riedberg, Goethe-Universität Frankfurt,<br />
- Udith Jördens, Geo-Agentur, Geowissenschaften/ Geographie<br />
Altenhöferallee 1, Frankfurt<br />
- Dr. Renate Rabenstein, Abt. Paläoanthropologie und Messelforschung,<br />
Senckenberganlage 25, Frankfurt<br />
- Prof. Dr. Karl-Josef Sabel, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie,<br />
Wiesbaden<br />
- Dr. Alexan<strong>der</strong> Stahr, Agentur für Mediendienstleistungen, Taunusstein<br />
- Frau Luzi Pingen, Waldpädagogin des Hessen-Forst, Forstamt Wiesbaden-<br />
Chaussehaus<br />
- Herr Alexan<strong>der</strong> Weis, Förster des Hessen-Forst, Forstamt Wiesbaden-<br />
Chaussehaus<br />
- Herr Wolfgang Jost, NABU, Nie<strong>der</strong>nhausen-Oberjosbach<br />
- Frau Sabine Best, Vorstand „Streuobstwiesen“ Nie<strong>der</strong>nhausen-<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach<br />
Die Konzeptentwicklung entstand im Geozentrum Riedberg in Kooperation von<br />
Schulleiterin Monika Simon und Dr. Rainer Dambeck.<br />
Der anschließende Konzeptentwurf von Dr. Rainer Dambeck gilt dem<br />
Lehrerkollegium in seiner vorbereitenden Fortbildung mit Dr. Dambeck als<br />
Vorlage und Orientierung bei <strong>der</strong> Entscheidung für das Machbare im Lernniveau<br />
eines Grundschülers.<br />
Konzeptentwurf im Anhang<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-4
<strong>Stand</strong> <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Stand</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Materialien, die für die Geowoche und den Geotag zur Verfügung gestellt werden<br />
von:<br />
Dr. Stahr: Geopfad-Poster: Erdentstehung/ Kontinente<br />
Prof. Dr. Sabel: Geokarte: Lössböden und an<strong>der</strong>e Böden im Idsteiner Land<br />
Eine Bohrstange<br />
Dr. Dambeck: Eimer mit Löss<br />
Eimer mit Bimsbrocken vom Laachersee<br />
Drei Bohrstangen<br />
Kontinentalpuzzle<br />
Fotos vergangener Landschaften<br />
Geokarten: Drift <strong>der</strong> Kontinente<br />
Versuchsanordnung zur Gebirgsfaltung<br />
Becherlupen<br />
Frau Jördens: Gesteinssammlungen<br />
Fossilien<br />
Herr Racky, Ortsvorsteher Oberjosbach:<br />
Gesteinssammlung aus dem Rathaus<br />
Versteinerungen<br />
Abdrücke<br />
Herr Gumbrecht, Ortvorsteher Nie<strong>der</strong>seelbach:<br />
Fotos und Bücher <strong>der</strong> Chronik Nie<strong>der</strong>seelbachs<br />
Herr Bröckel, MSC Köhlerei Ehlhalten:<br />
Informations- und Anschauungsmaterial zur Köhlerei in<br />
Ehlhalten<br />
Dr. Rabenstein: Fossile Funde <strong>der</strong> Grube Messel<br />
Videos zur Entstehung fossiler Funde<br />
Projekt 23: Februar <strong>2011</strong>: Zwei Konzerte mit dem Lie<strong>der</strong>macher Olaf Schechten aus Kiel<br />
Seine Lie<strong>der</strong> erzählen aus dem Leben <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Die lustigen Reime seiner<br />
Liedtexte stärken die phonematische Bewusstheit seines jungen begeisterten<br />
Publikums.<br />
Fahrten und Wan<strong>der</strong>tage<br />
- Dreitägige Klassenfahrt Ende 3. /Anfang 4. Schuljahr<br />
- Abschlussfahrt 4. Schuljahr (Tagesfahrt)<br />
- Wan<strong>der</strong>tage<br />
- Besuch des Weihnachtsmärchens mit allen Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> Schule<br />
� Evaluation 2005<br />
Wir formulieren neu:<br />
Es besteht die Möglichkeit zu einer mehrtägigen Klassenfahrt und einer Abschlussfahrt.<br />
Schulhomepage<br />
- Erstellung und Betreuung einer Webseite für die Schule durch den Vater einer Schülerin<br />
- http://www.lenzenbergschule.de<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-5
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Die Homepage wurde sehr professionell, d.h. sehr informativ, gut strukturiert und ästhetisch<br />
erstellt und wird auch durch Herrn Klodt aktuell gehalten. Dort stellt sich unsere Schule vor mit<br />
ihren Lehrern, Angestellten und dem För<strong>der</strong>verein, mit den Dokumenten über die pädagogische<br />
Arbeit, dem <strong>Schulprogramm</strong> sowie dem schuleigenen Lesekonzept.<br />
Es erscheinen dort auch zur Freude unserer Schüler Berichte und Fotos beson<strong>der</strong>er, aktueller<br />
schulischer Veranstaltungen und Ereignisse.<br />
� Planung 2007/08<br />
PC-Kurs erhält die Möglichkeit, die Homepage zu bearbeiten.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Laut unserer Umfrage ist nicht jedes Elternteil und je<strong>der</strong> Lehrer mit <strong>der</strong> Veröffentlichung von<br />
Abbildungen seines Kindes und seiner Person auf <strong>der</strong> Homepage einverstanden. Zu<br />
veröffentlichendes Fotomaterial ist auf diese Personen hin zu überprüfen. Zu Beginn des<br />
Einschulungsprozesses bittet die Schulleitung in einem dazu entwickelten Formular die Eltern<br />
um Veröffentlichungsgenehmigung. Beim Fotografieren ist darauf zu achten, dass nicht einzelne<br />
Personen, son<strong>der</strong>n die Aktion und das Ereignis im Mittelpunkt stehen und deshalb<br />
Personengruppen in einem gewissen Umfeld agierend abgebildet werden.<br />
� Evaluation 2009/10<br />
Herr Michael Klodt, Vater eines Schülers, betreut noch für ein weiteres Schuljahr bis Sommer<br />
<strong>2010</strong> unsere Homepage und gibt sein Wissen ehrenamtlich an Schüler <strong>der</strong> 3. und 4. Klassen in<br />
einer PC-AG weiter.<br />
Die Fotogalerie unserer Homepage erfreut sich großer Beliebtheit. Fotos unserer<br />
Veranstaltungen sind dort zu finden und von den Schülern und ihrer Familien herunterzuladen.<br />
Durch die ausführliche Darstellung unserer Schule wurde Frau Esther Hinz von <strong>der</strong> Qualität<br />
unserer Schule überzeugt und arbeitet seit dem Schuljahr 09/10 als Lehrerin an unserer Schule.<br />
� Planung <strong>2010</strong><br />
Fortbildung einzelner Lehrerinnen mit Herrn Klodt, um die Homepage von <strong>der</strong> Schule aus<br />
bearbeiten zu können.<br />
� Evaluation <strong>2010</strong>/11<br />
Die Fortbildung fand unter reger Beteiligung unseres Kollegiums statt.<br />
Wir verabschieden uns mit dieser Veranstaltung von <strong>der</strong> ehrenamtlichen Mitarbeit und großen<br />
Unterstützung Herrn Klodts. Wir danken ihm sehr für sein großes Engagement.<br />
Frau Teubner, Mutter einer Schülerin, übernimmt die Pflege unserer Homepage und<br />
überarbeitet sie, sodass ein großartiges Werk entsteht. Wir danken ihr sehr dafür.<br />
Beeindruckend sind neben den gut erreichbaren, informativen Texten <strong>der</strong> ästhetische,<br />
überschaubare Aufbau nach einem zuvor erarbeiteten Konzept und die ansprechenden<br />
Illustrationen, die in Kooperation mit Frau Anke Gamer entstanden.<br />
Identifikationsmöglichkeiten mit unserer Schule - Intensivierung und Fortführung des guten Schullebens E9-6
2002 2004 <strong>Stand</strong> 2002-05 <strong>Stand</strong> Juli 2002 <strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> 2009<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Entwicklungsbereich: Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan<br />
Alle Schüler<br />
Frühenglisch wird im 3. und 4. Schuljahr je 1 Wochenstunde unterrichtet.<br />
Frühenglisch wird im 3. und 4. Schuljahr je 2 Wochenstunden unterrichtet.<br />
PC<br />
Lern- und Textverarbeitungsprogramme unterstützen die Motivation und För<strong>der</strong>ung aller<br />
Schüler während offener Arbeitsformen (z.B. Wochenplanarbeit) im Unterricht.<br />
Siehe Weiterentwicklung von Unterricht - „Einsatz neuer Medien im Unterricht“ - E4-2<br />
Erste Hilfe Kurs in den 4. Klassen<br />
Die Schüler erlernen die Grundzüge <strong>der</strong> Ersten Hilfe wie z.B. Hilfe holen, Notruf absetzen,<br />
Lebenszeichen erkennen, Zuwendung geben und die stabile Seitenlage.<br />
Die Kosten des Kurses tragen die Eltern.<br />
Dauer: An 3 Tagen in einer Woche jeweils 1 Doppelstunde<br />
� Evaluation 2005<br />
Die Gesamtkonferenz und <strong>der</strong> neu gewählte Schulelternbeirat sprechen sich für das weitere<br />
Stattfinden des Kurses aus. Das Lehrpersonal <strong>der</strong> Johanniter ist im Unterrichten von<br />
Kin<strong>der</strong>n sehr erfahren. Das Interesse <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist groß und es macht ihnen viel Spaß.<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Sozialen Kompetenzen<br />
In den letzten Jahren erhöhen sich die Streitigkeiten und Konflikte zwischen den Schülern,<br />
sowohl auf dem Schulhof, als auch in den Klassen, sodass sich das Kollegium eine stärkere<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sozialen Kompetenzen seitens <strong>der</strong> Schüler wünscht.<br />
Projekt 1:<br />
2 Wochenendseminare für die Schüler wurden in den Räumen unserer Schule zum<br />
Thema „Aggression“ durchgeführt.<br />
Organisation: 2 Mitarbeiter <strong>der</strong> Jugend- und Familienberatungsstelle Idstein, Schüler in 2<br />
Gruppen mit Klassenstärke<br />
� Evaluation 2004<br />
Rege Beteiligung und Zufriedenheit befragter Schüler mit diesem Programm<br />
Wie<strong>der</strong>holung des Wochenendseminars „Aggression – Stärkung <strong>der</strong> Persönlichkeit“. Die<br />
Beteiligung war wie<strong>der</strong> recht hoch, so dass wie<strong>der</strong> zwei Gruppen gebildet werden<br />
konnten.<br />
� Evaluation 2009<br />
Befragte Teilnehmer waren erneut zufrieden mit diesem Projekt.<br />
Projekt 2:<br />
Sichtung, Auswahl und Erstellung einer Empfehlungsliste von DVDs und Videos<br />
Organisation und Durchführung: Elternbeiräte und Schulleiterin<br />
Spende eines Vaters: DVD-Player für den Medienschrank des Mehrzweckraums<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-1
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2009<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 3: Schlichterprogramm<br />
Es handelt sich um ein zweistündiges Unterrichtsprogramm zur Vorbereitung <strong>der</strong><br />
zukünftigen Patenkin<strong>der</strong> <strong>der</strong> kommenden Erstklässler.<br />
Im Juni werden in den beiden 3. Klassen jeweils eine Doppelstunde mit Hrn. Hölzel und<br />
<strong>der</strong> Klassenlehrerin dazu gehalten.<br />
Da Herr Hölzel pensioniert wurde, bereiten die Klassenlehrerinnen die 3. Klassen im<br />
Sommer ihre Schüler auf ihre Patenschaftsaufgaben nach <strong>der</strong> Einschulung vor.<br />
Entwicklung eines Konzeptes zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lesekompetenz<br />
Projekt: Lesekompetenz sichern und steigern<br />
Über Lesekompetenz verfügen bedeutet „die Fähigkeit des Lesers Texte zu verstehen,<br />
zu nutzen und über sie zu reflektieren, um das eigene Wissen und Potential<br />
weiterzuentwickeln.“<br />
Um Lesekompetenz zu erlangen müssen die Schüler über ein bestimmtes Maß an<br />
Lesestrategien, die die Lesefertigkeit betreffen und Leseverstehensstrategien, die<br />
den Sinn eines Textes erschließen, verfügen. Im Laufe ihrer Grundschulzeit müssen die<br />
Schüler also Handlungskonzepte zum Erreichen von Lesekompetenz erwerben.<br />
In den folgenden Ausführungen wird eine Bestandsaufnahme vorgenommen welches<br />
Handlungskonzept bereits vorhanden ist. In <strong>der</strong> Evaluation werden<br />
Überarbeitungsvorschläge gemacht und falls erfor<strong>der</strong>lich, nach neuen Entwicklungen<br />
gesucht.<br />
Lesestrategien, die die Lesefertigkeit betreffen<br />
Nach dem Erlernen <strong>der</strong> Lesetechnik, die weitgehend von <strong>der</strong> jeweiligen Fibelkonzeption<br />
o<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en Methodik wie z.B. Lesen durch Schreiben o<strong>der</strong> Eigenfibel (je<strong>der</strong><br />
Lehrer wählt an unserer Schule seine eigene Vorgehensweise aus) abhängig ist, wird in<br />
allen Schuljahren eine Steigerung des Lesetempos und eine Verfeinerung <strong>der</strong><br />
Lesetechnik anhand von geeigneten Lesestrategien angestrebt.<br />
Lesestrategien:<br />
� Augenbewegungstraining<br />
� Blickspanne erweitern<br />
� Blitzlesen<br />
� Übungen zur Strukturerfassung<br />
� Übungen zum genauen, verlangsamten Lesen<br />
� Planung 2006/2007<br />
Einsatz von Diagnoseverfahren zur Ermittlung des Lernstandes, daraus resultierend eine<br />
Konkretisierung <strong>der</strong> Schwierigkeiten bei schwachen Lesern und Erstellung eines<br />
Therapiebedarfes (visuell, auditiv) und eines För<strong>der</strong>planes, Suchen nach geeigneten<br />
Programmen.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-2
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Evaluation 2006<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Der Pädagogische Tag<br />
- entwickelte das Lesekonzept weiter (siehe schuleigenes Lesekonzept),<br />
- sichtete Diagnose- und För<strong>der</strong>materialien, vor allem För<strong>der</strong>materialien des Finkenverlags<br />
und unserer PC-Lernprogramme zur individuellen För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lesekompetenz,<br />
- wählte informelles Diagnoseverfahren aus,<br />
- wandte PC- Lernprogramme an,<br />
- traf die Auswahl eines För<strong>der</strong>planmodells, mit dessen Hilfe die notwendigen För<strong>der</strong>pläne<br />
erstellt und dokumentiert werden.<br />
� Planung 2007/08<br />
- Anschaffung von „Logiko“-System und Lernkarteien zur Erweiterung <strong>der</strong> Lesekompetenz<br />
- Überarbeitung und Entwicklung des För<strong>der</strong>konzeptes Deutsch, vor allem Lesen und<br />
Rechtschreibung in den Jahrgängen 1 und 2 sowie 3 und 4 für den binnen differenzierten<br />
Unterricht und die För<strong>der</strong>stunde einzelner<br />
- Interne Fortbildung für Budenberg-Lernprogramm sowie „SY-LA-BO“<br />
Folgende Leseverstehensstrategien werden teilweise schon im 1. Schuljahr, aufbauend<br />
aber vom 2. bis 4. Schuljahr eingesetzt, wobei dies in Klasse 2 und 3 ganz<br />
systematisch geschieht, um im 4. Schuljahr dann teilweise verinnerlicht und<br />
automatisiert eine Erschließung von Texten zu ermöglichen.<br />
Die Leseverstehensstrategien sind Basis für die Lesekompetenz. Je<strong>der</strong> Text hat einen<br />
textspezifischen Leseplan d.h., die Leseverstehensstrategien müssen dem jeweiligen<br />
Text angepasst werden.<br />
� Bedeutungen von unbekannten Begriffen aus <strong>der</strong> Wort- Satz und Textebene<br />
erschließen (wenn nötig im Lexikon nachschlagen)<br />
� Unbekannte Textpassagen aus dem Kontext erschließen<br />
� Textinhalte sich bildlich vorstellen (Kopfkino)<br />
� Schlüsselwörter suchen und markieren<br />
� Den wichtigsten Satz in jedem Abschnitt markieren<br />
� Informationen aus dem Text mündlich wie<strong>der</strong>geben<br />
� Wesentliche Textaussagen durch Fragen zum Text herausfinden, durch den Lehrer<br />
formulierte Fragen, vom Schüler formulierte Fragen<br />
� Unwichtige Textaussagen streichen<br />
� Bil<strong>der</strong> zum Text o<strong>der</strong> einzelnen Textpassagen malen<br />
� Spielszenen zum Text erfinden<br />
� Beispiele finden, ähnliche Situationen beschreiben<br />
� Die „Botschaft“ des Autors erkennen<br />
� Vorhersagen über das Thema, die weitere Handlung o<strong>der</strong> die Struktur des Textes<br />
treffen. Eine eigene Meinung zum Text bilden<br />
� Schlussfolgerungen ziehen und begründen mündlich und schriftlich<br />
� Fremde Gestalten und Lebensweisen hinterfragen<br />
� Handlungsweisen hinterfragen<br />
� Informationen aus dem Text auf vergleichbare Sachverhalte und<br />
Handlungssituationen beziehen<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-3
� Planung 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Weitere Strategien finden, Lesekarteien anschaffen, die Leseverstehensstrategien trainieren,<br />
Diagnoseinstrumente finden, die den Lernstand feststellen.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Als Diagnoseinstrumente dienen nicht standardisierte Tests aus dem Werk: „Attraktive<br />
Grundschule: Jedes Kind for<strong>der</strong>n und för<strong>der</strong>n“, Raabe, Berlin und dem Orthografikus,<br />
Finkenverlag<br />
� Evaluation 2008/09<br />
Einführung standardisierter Tests in allen Jahrgängen:<br />
In Mathematik: Individuelle Lernstandsanalysen, ILeA,<br />
In Deutsch: Individuelle Lernstandsanalysen, ILeA,<br />
des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) <strong>2010</strong>. Das LISUM ist<br />
eine gemeinsame Einrichtung <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> Berlin und Brandenburg im Geschäftsbereich des<br />
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS).<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-4
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Frau Ahrens-Drath, Frankfurt stellt <strong>der</strong> Schulleitung auf ihre Weise Lesestrategien und ihre<br />
praktische Umsetzung vor.<br />
1. Tabelle<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-5
2. Literatur<br />
3. Unterrichtsmaterial<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Die Schulleitung begann eine Unterrichtsmaterialsammlung für das Kollegium mit Leseübungen<br />
zu allen Kompetenzstufen und mit differenziertem Anspruchsniveau. Siehe Ordnerregal im<br />
Sekretariat.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-6
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Planung 07/08 sowie 08/09<br />
Die Arbeitsgruppe „Anfangsunterricht“ bereitet vor und überprüft verschiedene<br />
standardisierte Tests im Laufe des Unterrichts in 08 und 09.<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Sich mit dem geschriebenen Wort überhaupt zu befassen, setzt ein großes Maß an<br />
Lesemotivation voraus. Der Erwerb von Lesekompetenz ist also immer gekoppelt an das<br />
Vorhandensein von Lesemotivation. Sie muss für den Unterricht ständig überdacht und<br />
entwickelt werden. Je<strong>der</strong> Lehrer besitzt die Freiheit, die für ihn sinnvoll erscheinende Motivation<br />
auszuwählen und einzusetzen.<br />
Mögliche Formen:<br />
� Aktivitäten <strong>der</strong> Schülerbücherei (siehe geson<strong>der</strong>te Ausführungen)<br />
� Lesenacht<br />
� Lesenachmittag (Vorlesen mit anschließendem Quiz)<br />
� Vorstellen <strong>der</strong> Lieblingsbücher im Klassenverband<br />
� Lesen von Ganzschriften<br />
� “Vorlesekin<strong>der</strong>“ (Paten lesen Erstklassschülern vor)<br />
� Buchspende zum Geburtstag für die Klassenbücherei<br />
� Lesefest zu einem Autor<br />
� Autorenlesung<br />
� Planung 2006/2007<br />
Suche nach weiteren praktikablen Ideen, siehe auch Evaluation Schülerbücherei.<br />
Eine weitere Frage, die sich beim Erwerb von Lesekompetenz stellen muss ist: Wie<br />
werden die Schüler mit Texten vertraut gemacht, wo und wie sammeln sie<br />
Leseerfahrung?<br />
� Vorlesen von Kin<strong>der</strong>literatur von Klasse 1 an als festes Ritual<br />
� Lesen von Ganzschriften ab Ende Klasse 1<br />
� Orientierung in <strong>der</strong> Bücherei<br />
� Kennen lernen von Textgattungen (Märchen, Sagen, Fabeln, Lyrik)<br />
� Kennen lernen von Textarten (Sachtext, Tagebuch, Brief, Spielanleitungen,<br />
Bastelanleitungen, Kochrezept, Arbeitsanweisungen, Texte aus verschiedenen<br />
Erzählperspektiven heraus betrachten)<br />
� Planung 2006/2007<br />
Überprüfung:<br />
Ist <strong>der</strong> Büchereibesuch regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts? Werden Medien im<br />
Unterricht genutzt (Zeitung/ Internet)? Weiteres Suchen nach praktikablen Möglichkeiten.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-7
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Das Bearbeiten von Texten dient nur selten einem Selbstzweck, son<strong>der</strong>n verfolgt<br />
meistens einen kommunikativen Zweck, d.h. alle Schüler sollen das Ergebnis erfahren.<br />
Werden die Texte, die bearbeitet wurden also präsentiert (Textpräsentation) - und wie?<br />
� Bücher aus <strong>der</strong> Bücherei mündlich o<strong>der</strong> schriftlich vorstellen<br />
� Texte an <strong>der</strong> Pinnwand aushängen<br />
� Lieblingsbücher vorstellen und spannende, lustige Stellen daraus vorlesen<br />
� Vorleser präsentieren sich auf einem Lesethron<br />
� Erstellung eines Büchertisches mit den Lieblingsbüchern, Kin<strong>der</strong> leihen sich diese<br />
gegenseitig aus<br />
� Gedichte künstlerisch gestalten<br />
� Ein Lesetagebuch zu einer Ganzschrift erstellen<br />
� Vorstellen von Sachbüchern anhand von kleinen Referaten<br />
� Buch <strong>der</strong> Woche präsentieren und daraus vorlesen<br />
� Planung 2006/2007<br />
Nach neuen praktikablen Möglichkeiten suchen.<br />
Werden die Bausteine „Leseerfahrung, Lesemotivation, Texte präsentieren“ und<br />
letztendlich „Lesekompetenz“ in unserer und mit Hilfe unserer Bücherei für alle Schüler<br />
verwirklicht?<br />
1. Phase<br />
Sie bestand aus einer Bestandsaufnahme über den Bücherbestand und <strong>der</strong><br />
Funktionalität des Ausleihsystems <strong>der</strong> Bücherei.<br />
Der Bücherbestand wurde unter folgenden Fragestellungen überprüft:<br />
a) Verfügen wir über Bücher für alle Leseerfahrungsstufen<br />
b) für bestimmte Lesealter<br />
c) Verfügen wir über ein breites Spektrum an Interessengebieten bei den<br />
Sachbüchern? Weiterhin wurde überprüft, wie das Ausleih- und Rückgabesystem für<br />
die Schüler zu gestalten ist.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-8
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> 2006/2007<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
2. Phase<br />
Komplette Umgestaltung <strong>der</strong> Bücherei nach inhaltlichen und organisatorischen<br />
Gesichtspunkten.<br />
a) Organisatorisch: Optisch klarere Übersicht <strong>der</strong> Bücher für die ausleihenden Schüler,<br />
einfacheres Ausleih- und Rückgabesystem durch einen Briefkasten für die<br />
Ausleihkarten und eine Bücherkiste für die zurückgegebenen Bücher. Der Raum<br />
selbst wurde wohnlicher und gemütlicher gestaltet.<br />
b) Inhaltlich: Total veralterte Bücher und Bücher in einem schlechten Zustand wurden<br />
entsorgt. Erstellung von Bücherlisten und Kauf <strong>der</strong> Bücher aus Spendengel<strong>der</strong>n des<br />
För<strong>der</strong>vereines und von Privatpersonen. So wurden Sachbücher in Höhe von 450<br />
Euro, Bücher für das Lesealter von 9 bis 11 Jahren und Fortsetzung häufig<br />
gelesener Reihen wie Nick Nase, Kwiatkowski, Franz und Hexe Lily im Werte von<br />
400 Euro angeschafft. Eine Erweiterung des Buchangebotes wird weiter angestrebt.<br />
Zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lesemotivation wurden folgende Vorhaben umgesetzt:<br />
� Die neu erworbenen Sachbücher wurden den Schülern in einem ansprechenden<br />
Rahmen präsentiert, alle Klassen kamen eine Stunde, um in den Büchern zu<br />
schmökern.<br />
� Nach dem Erwerb von Büchern hauptsächlich für die 3. Und 4.Schuljahre wurden<br />
diese Bücher den Schülern durch Anlesen reizvoller Textstellen und kurzen<br />
Inhaltsangaben vorgestellt.<br />
� Für die 2. Und 3. Schuljahre wurden Protagonisten beliebter Reihen mit den<br />
dazugehörigen Büchern vorgestellt z.B. Nick Nase, Franz usw.<br />
� Vorlesen für die 1. Klassen, um die Wichtigkeit dieses Raumes zu demonstrieren<br />
� Von <strong>der</strong> 2. Klasse an(wenn gewünscht auch schon früher)Einweisung in die Bücherei<br />
und <strong>der</strong>en Ausleihsystem<br />
� Oftmals geht von den Büchern aus <strong>der</strong> Bücherei ein Impuls für den<br />
Literaturunterricht in <strong>der</strong> Klasse aus, so wurde z. B. „Kwiatkowski“ von Jürgen<br />
Banscherus zum Unterrichtsgegenstand<br />
� Leseprojekte zu einem bestimmten Autor, dazu wurden die Bücher aus <strong>der</strong> Bücherei<br />
ausgeliehen<br />
� Gestalten einer Lesenacht mit Büchern aus <strong>der</strong> Schülerbücherei<br />
� Lesenachmittage mit vorstellen eines neuen Buches, einem Büchereiquiz und<br />
anschließen<strong>der</strong> Ausleihe<br />
� Autorenlesung mit Achim Bröger<br />
� Planung 2006/2007<br />
Erarbeitung und Durchführung von weiteren Projekten.<br />
Projekt 1: Die Lehrer erhalten alle Zugang zu www.antolin.de .<br />
Teilweise erhielten Schüler verschiedener Jahrgänge die Möglichkeit, Bücher, die in<br />
www.antolin.de aufgeführt sind, z. T. auch in unserer Bücherei auszuleihen sind, per<br />
Fragenkatalog zu bearbeiten.<br />
Projekt 2: Autorenlesungen im April in Kooperation mit <strong>der</strong> Sonnenschule in Neuhof<br />
Wenn ein Projekt in <strong>der</strong> Bücherei durchgeführt wurde, war die Lesemotivation zwar da, das<br />
Ausleihen <strong>der</strong> Bücher auch kurzzeitig vorhanden, <strong>der</strong> Schritt zum dauerhaften Lesen bei allen<br />
Schülern ist allerdings nur bei wenigen Klassen zu beobachten.<br />
Wie könnte sich dies verän<strong>der</strong>n? Wie könnte die Vision <strong>der</strong> „lesenden Schule“ in die<br />
Realität umgesetzt werden?<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-9
<strong>2011</strong><br />
� Evaluation 2007/08<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
„Rund ums Buch“ hieß die Projektwoche im Dezember 07, die ihren Höhepunkt im<br />
Präsentationstag an einem Samstag hatte, mit Lesungen aus eigenen in <strong>der</strong> Woche<br />
entstandenen Büchern und mit Ausstellungs- und Aktionsstationen in allen Klassen zu den<br />
erarbeiteten Projekten. Zu Besuch war ebenfalls <strong>der</strong> Buchillustrator Herr Rothe, <strong>der</strong> Einblicke in<br />
seine Arbeit mit dem Buch gab.<br />
Überarbeitung und Entwicklung des För<strong>der</strong>konzeptes <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> im Hinblick auf<br />
„ganztägiges Lernen“ im Landesprogramm (Siehe Anlage)<br />
Schüler mit beson<strong>der</strong>en Interessen<br />
� Planung für 2006<br />
Einbeziehung <strong>der</strong> Eltern, Großeltern, Pensionäre sowie Fachkräfte mit ihren Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten<br />
� im Unterricht (Sachkunde, Text. Gestalten)<br />
� in Projekten<br />
� bei Unterrichtsgängen<br />
� in Projektwochen<br />
� im Wahlpflichtunterricht (AGs)<br />
� in <strong>der</strong> Werkstatt<br />
Ein guter Weg wird <strong>der</strong> Aufbau einer Werkstatt z.B. Fahrrad- o<strong>der</strong> Holz- o<strong>der</strong> Computerwerkstatt<br />
sein. Ein Kellerraum wurde dafür bereits geräumt und bereitgestellt. Großeltern,<br />
Pensionäre, etc. sollen als Leiter gesucht werden<br />
Computerprogramme zur individuellen und differenzierten För<strong>der</strong>ung während des Unterrichts.<br />
Der Internetanschluss und die Ausstattung aller Klassen mit 2 neuen PCs macht dies ab<br />
Dezember 2005 möglich.<br />
Eine Schreibwerkstatt wird ab 2006 aufgebaut um sie flexibel im Unterricht aller Klassen zu<br />
nutzen.<br />
Der Chor findet einmal wöchentlich jahrgangsübergreifend in den Jahrgängen 3 und 4<br />
zusätzlich zum Unterricht statt.<br />
In den Räumen unsere Schule findet an mehreren Nachmittagen musikalische Bildung auf<br />
privater Basis statt. Zielgruppe ist in erster Linie die interessierte Schülerschaft unserer Schule.<br />
� Evaluation 2006/07<br />
Die Einbeziehung <strong>der</strong> Eltern und Großeltern in den Unterricht, in Projekte, in Unterrichtsgänge<br />
und den Wahlpflichtunterricht bis hin zur ehrenamtlichen Unterrichtsvertretung sind zu einem<br />
festen Bestandteil und zur freudigen Bereicherung unserer Schule geworden.<br />
Projektwoche ist in Planung.<br />
Schüler arbeiten seit 2006 regelmäßig an den PC-Programmen in den Klassen, oft in<br />
Kombination mit denen des PC-Raumes.<br />
Pädagogen des BFZ arbeiten mit ihren Schülern im Lehrmittelraum ebenfalls mit den vernetzten<br />
PCs.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-10
<strong>Stand</strong> 2008/09 <strong>Stand</strong> 2008/09 <strong>Stand</strong> <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Im 2. Halbjahr 06/07 kann <strong>der</strong> Schulchor durch die Beurlaubung von Frau Minge lei<strong>der</strong> nicht<br />
mehr stattfinden. Der Wahlpflichtbereich „Musical“ macht ein ausgleichendes Angebot, ebenfalls<br />
die vier musikalischen Nachmittagsangebote an unserer Schule, wovon 2 neu eingerichtet<br />
wurden.<br />
Am Ende des Schuljahres 06/07 wurde erfolgreich das Musical „Sockensuchmaschine“ zur<br />
Aufführung gebracht. Es entstand aus dem Zusammenschluss <strong>der</strong> Wahlpflicht-AG-Arbeit <strong>der</strong><br />
Gruppe Theater und Musik von Frau Trettin und Frau Gamer sowie <strong>der</strong> Musiklehrerin Frau<br />
Minge und ihren Schülerinnen und Schülern.<br />
� Evaluation 2007/08<br />
„Die phantastischen Abenteuer des kleinen Drachen Qualmi“ heißt das Musical <strong>der</strong> Wahlpflicht-<br />
AG, das wie<strong>der</strong> im Team-Teaching von Frau Axinia Trettin und Frau Anke Gamer entsteht und<br />
am Ende dieses Schuljahres ein Höhepunkt unseres Schullebens darstellen wird.<br />
Zusätzlich zum Unterricht wird interessierten Schülern einer 4. Klasse eine Schach -AG unter<br />
ehrenamtlicher Leitung von Herrn Udo Hipler angeboten.<br />
� Evaluation 2009<br />
Schüler und Schülerinnen sind sehr begeistert von diesem Unterricht und erhalten am Ende<br />
des Kurses ein Schach-Diplom.<br />
Drei Schüler treten in den Idsteiner Schachclub ein.<br />
Herr Udo Hipler konnte dazu gewonnen werden, seine Schach -AG im Rahmen des<br />
Wahlpflichtunterrichts <strong>der</strong> 3. und 4. Klassen wie<strong>der</strong> anzubieten.<br />
Zusätzlich zum regulären Unterricht wird interessierten Schülern eine PC-AG mit Herrn Michael<br />
Klodt freitags vor dem Unterricht angeboten.<br />
Im Rahmen unserer nun ganztägig lernenden Schule überarbeiten wir unser För<strong>der</strong>konzept.<br />
Im Fokus ist<br />
- <strong>der</strong> Lehrer in seiner Rolle als Lernbegleiter, Beobachter und Diagnostiker im individuellen<br />
Lernprozess des Kindes,<br />
- die Unterrichtsorganisation am Tagesanfang<br />
- die Anschauungs- und Lernmaterialien in <strong>der</strong> Hand <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
- die Qualität und das Quantum <strong>der</strong> Übungs- und Wie<strong>der</strong>holungszeit <strong>der</strong> sogenannten<br />
Hausaufgabenzeit<br />
Interessierten Schülern/innen bieten wir am Nachmittag im Rahmen <strong>der</strong> ganztägig lernenden<br />
Schule (PÄM – Pädagogische Mittagsbetreuung) interessante Projekte aus Musik, Kunst, Sport<br />
und Naturwissenschaften an. Es gibt Zeiten intensiven Übens und Festigens des Lernstoffes<br />
vom Vormittag, aber auch Zeiten des freien Spielens und <strong>der</strong> Entspannung.<br />
Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts am Dienstag bieten wir folgende Kurse den 3. und 4.<br />
Klassen an:<br />
Musical -AG<br />
Plastisches Gestalten<br />
Yoga und Bewegung<br />
Kochen<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-11
<strong>Stand</strong> Juli 2004/05<br />
� Planung <strong>2011</strong>/12<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Yoga mit Frau Mollnow wird im Rahmen des PÄM als Projekt am Nachmittag angeboten. Durch<br />
die Verschiebung unserer Unterrichtszeiten kann Frau Mollnow keine zwei Stunden mehr in<br />
Folge im AG-Bereich unterrichten.<br />
Ballsport wird von Herrn Daniel Knuerchen sowohl im Wahlpflichtunterricht als Ballsport -AG als<br />
auch am Nachmittag in zwei Projekten erteilt werden, einmal für die Jahrgänge 1 und 2 sowie<br />
für die Jahrgänge 3 und 4.<br />
Schwache Schüler<br />
Früherkennung bei Teilleistungs- und Wahrnehmungsauffälligkeiten,<br />
Sprachentwicklungsverzögerungen sowie an<strong>der</strong>er Problemfel<strong>der</strong><br />
Projekt 1: Zusammenarbeit mit den Kin<strong>der</strong>gärten<br />
Früherkennung dort und Einbeziehung <strong>der</strong> Frühför<strong>der</strong>stelle und <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>ärzte<br />
Projekt 2: Sprachheillehrerin Fr. Nuss<br />
� hospitiert in den 1. Klassen, um Sprachentwicklungsverzögerungen zu<br />
entdecken<br />
� erteilt einzelnen Kin<strong>der</strong>n gezielten Sprachför<strong>der</strong>unterricht<br />
� führt Beratungsgespräche mit Klassenlehrerinnen<br />
� führt Organisations- Koordinations- und Beratungsgespräche mit <strong>der</strong><br />
Schulleitung<br />
Projekt 3: Mitarbeiterinnen des BFZ = Beratungs- und För<strong>der</strong>zentrum in Idstein<br />
� hospitieren in den Klassen, um die Klassenlehrer bei <strong>der</strong> Diagnose von<br />
Ursachen für Lernschwierigkeiten zu unterstützen<br />
� för<strong>der</strong>n in Einzel- o<strong>der</strong> Kleingruppenunterricht nach Antrag <strong>der</strong><br />
Klassenlehrerin sowie Wunsch o<strong>der</strong> Einverständnis <strong>der</strong> Eltern<br />
�<br />
Projekt 4: Zusammenarbeit von Schulleitung und Klassenlehrerinnen mit Fr. Dipl.<br />
Psych. Eunike-Morell (Schulpsychologischer Dienst) durch<br />
� Beratungsgespräche mit den Lehrerinnen<br />
� Hospitationen in den Klassen<br />
� Elterngespräche<br />
� Run<strong>der</strong> Tisch Gespräche<br />
Projekt 5: Zusammenarbeit von Schulleitung und Klassenlehrerinnen mit Fr.<br />
Löffler-Ebing ( Schulleiterin <strong>der</strong> Schule für Kranke in Wiesbaden) in<br />
beson<strong>der</strong>s<br />
schwierigen Fällen durch<br />
� Beratungsgespräche mit den Lehrerinnen<br />
� Hospitationen in den Klassen<br />
� Elterngespräche<br />
� Run<strong>der</strong> Tisch Gespräche<br />
Projekt 6: Kooperation mit <strong>der</strong> Vorschulleiterin Fr. Thorwart in <strong>der</strong> Theißtalschule<br />
Nie<strong>der</strong>nhausen durch<br />
� regelmäßige Gespräche zwischen Schulleitung und Vorschulleiterin<br />
� Einbeziehung in die Elternabende<br />
Projekt 7: Kooperation <strong>der</strong> Schulleiterin mit den Kin<strong>der</strong>ärzten<br />
� Dr. Scheele Nie<strong>der</strong>nhausen<br />
� Dr. Schraut Nie<strong>der</strong>nhausen<br />
� Dr. Schranz Naurod<br />
� Dr. Pfeifer Taunusstein<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-12
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
� Planung ab 2006<br />
Bildung von Kursen in den kommenden Jahren<br />
� LRS<br />
� Lesekompetenzför<strong>der</strong>ung<br />
� Mathematikför<strong>der</strong>kurs<br />
� Evaluation 2007<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Zu unserem großen Bedauern kann wegen fehlen<strong>der</strong> Lehrerstunden nur jeweils eine<br />
jahrgangsübergreifende För<strong>der</strong>stunde für rechtschreib- und leseschwache Schüler erteilt<br />
werden.<br />
� Evaluation 08/09 sowie 09/10<br />
Rechtschreib- und leseschwache Schüler erhalten jahrgangsübergreifend eine För<strong>der</strong>stunde.<br />
Jahrgangsübergreifend können auch rechenschwache Schüler mit einer Stunde geför<strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
Die jahrgangsbezogenen Inhalte und die zu erzielenden Basiskompetenzen sind während<br />
pädagogischer Konferenzen in Bearbeitung.<br />
� Planung <strong>2010</strong><br />
Die Klassen 1a mit Frau Doris Wirtz und 1b mit Frau Iris Minge nehmen teil an einem<br />
Forschungsprojekt <strong>der</strong> Goethe-Universität Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen<br />
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) zur Prävention von Rechenschwäche.<br />
� Evaluation <strong>2011</strong><br />
Das Mathematik-Projekt von Frau Prof. Dr. Krajewski (Goethe- Universität Frankfurt, Institut für<br />
Psychologie) und Frau Dipl.-Psychologin Nadja Olyai zur „Prävention von<br />
Rechenschwierigkeiten durch För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Mengen-Zahlen Kompetenz im Anfangsunterricht“<br />
geht im März <strong>2011</strong> seinem Ende entgegen. Wir erwarten Rückmeldungen <strong>der</strong> Goethe<br />
Universität.<br />
Der mit Genehmigung des HKM von Frau Prof. Dr. Krajewski entwickelte Mathematik-Koffer<br />
wird nun im Anfangsunterricht <strong>der</strong> beiden neuen ersten Klassen eingesetzt.<br />
Lehrer<br />
Der Fortbildungsbedarf des Kollegiums entwickelt sich ebenfalls prozesshaft aus den<br />
Erfahrungen im Schulalltag, aus <strong>der</strong> Evaluation unserer bisherigen Projekte und wird gemeinsam<br />
auf <strong>der</strong> Gesamtkonferenz festgehalten, geplant und beschlossen. Für die Organisation und die<br />
Information über Fortbildungsveranstaltungen fühlt sich die Schulleiterin in beson<strong>der</strong>em Maße<br />
angesprochen. Letztendlich verantwortlich für ihre Weiterbildung ist jedoch jede einzelne<br />
Kollegin selbst. Sie dokumentiert ihre Fortbildung in einem so genannten Portfolio, das zur<br />
Grundlage <strong>der</strong> zukünftigen Jahresgespräche dient. Diese Gespräche sind ein Mittel <strong>der</strong><br />
Unterstützung je<strong>der</strong> einzelnen Lehrerin in ihrer pädagogischen Arbeit in Zusammenarbeit und<br />
Beratung mit <strong>der</strong> Schulleiterin, vor allem ein Mittel <strong>der</strong> gegenseitigen Wertschätzung und auf<br />
keinem Fall ein Beurteilungsgespräch.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-13
<strong>Stand</strong> Juli 2005 <strong>2010</strong><br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
Neue Medien in <strong>der</strong> Schule<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Siehe Weiterentwicklung von Unterricht - „Einsatz neuer Medien im Unterricht“ - E4-4<br />
Intel - Lehrgang in Taunusstein: Sekretärin, Schulleiterin und einige Kolleginnen 2003<br />
LUSD - Lehrgänge in Marburg: Sekretärin, Schulleiterin und Abwesenheitsvertretung 2004<br />
Lanis - Fortbildung in Taunusstein: Schulleiterin und Medienbeauftragte 2005<br />
Homepage bearbeiten - Lehrgang in <strong>der</strong> Schule: Kollegium und Schulleiterin <strong>2010</strong><br />
� Evaluation 2005<br />
Die Beteiligten nahmen erfolgreich an den Lehrgängen teil und sind weiterhin an Fortbildung<br />
interessiert, da weiterer Ausbildungsbedarf existiert.<br />
Da unsere Schule im Dezember in allen Klassen und in dem neu ausgestalteten PC- Raum<br />
mit Internetanschluss und einer gemeinsamen Vernetzung aller PC ausgestattet werden, wird<br />
eine weitere Lanis- Ausbildung für alle Kolleginnen im Jahr 2006 sicherlich durch den Kreis Bad<br />
Schwalbach angeboten.<br />
Fortbildung einzelner Kolleginnen in ihren Fachbereichen<br />
Musik – Einzelveranstaltungen, Wochenendseminare, Kurse über ein Jahr<br />
Englisch – Kurs über ein Jahr<br />
Sport – Einzelveranstaltungen, Wochendseminare<br />
� Evaluation 2005<br />
Die Kolleginnen informieren in Gesamtkonferenzen o<strong>der</strong> Einzelgesprächen über ihre neuen<br />
Erfahrungen und dienen somit als Multiplikatoren für das gesamte Kollegium<br />
� Evaluation 2006/07<br />
- LUSD- Lehrgänge <strong>der</strong> Sekretärin und Schulleiterin in Idstein und Camberg<br />
- Lehrgänge <strong>der</strong> Datenschutzbeauftragten<br />
- Mehrtägiger Lehrgang des gesamten Kollegiums in Kooperation mit <strong>der</strong> Grundschule in<br />
Neuhof zum Thema Kommunikationskompetenz ( Frau Anke Olowson)<br />
- Mehrtägige Staffel über 1 ½ Jahre zum Thema „Anfangsunterricht“ für die Lehrerinnen <strong>der</strong><br />
ersten Klassen<br />
- Musikseminare<br />
- Schulung <strong>der</strong> Schulleiterin durch das begleitende Konzept „Rhein-Mainer 04“ zweimal im<br />
Jahr<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Fortbildungen einzelner Kolleginnen, die ihr Knowhow ins Kollegium implementieren werden.<br />
- Mathematik: Kompetenzstufen, gute Aufgaben, Dyskalkulie<br />
- Deutsch: För<strong>der</strong>konzept-Weiterentwicklung<br />
- Sport: Bewegungsför<strong>der</strong>ung<br />
- Supervisionen<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-14
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
2007 2008 <strong>Stand</strong> Juli 2005 2006<br />
� Planung <strong>2010</strong><br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
- Geologische Bedingungen des kulturellen Lebens um Nie<strong>der</strong>seelbach in alten Zeiten und<br />
heute, <strong>Lenzenbergschule</strong>, Dozenten <strong>der</strong> Goethe-Universität, Geologisches Institut<br />
- Prävention von Rechenschwäche, Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit dem<br />
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)<br />
Fortbildung <strong>der</strong> Schulleiterin<br />
Vortrag D. Scheele: Teilleistungsstörungen bei Grundschulkin<strong>der</strong>n, 2003<br />
Vorträge in <strong>der</strong> Universität Marburg: Teilleistungsstörungen, LRS und Dyskalkulie, 2004<br />
4 Tagungen über jeweils 3 Tage in Kassel: Qualifizierung für Leitungsaufgaben – Hessisches<br />
Landesinstitut für Pädagogik 2003/2004<br />
Fortbildung Schulleiter Rhein-Main 04<br />
1. Entwicklung von Kommunikationskompetenz<br />
2. Übergang zur weiterführenden Schule<br />
3. Erstellung von Stundenplänen<br />
4. Montessorimaterialien und ihr Einsatz im Unterricht<br />
5. <strong>Schulprogramm</strong>, Portfolio, Jahresgespräche<br />
6. Schulinspektion, 07<br />
7. För<strong>der</strong>pläne, 07<br />
8. Nachteilsausgleich, 07<br />
9. Interne Evaluation, 08<br />
Fortbildung im Rahmen <strong>der</strong> Schulleiterdienstversammlungen<br />
� Leistungsbeurteilung<br />
� Lesekompetenz<br />
� Auditive und visuelle Wahrnehmungsstörungen<br />
� Erweiterung <strong>der</strong> Kommunikationskompetenz, Erstellung von und Umgang mit den<br />
För<strong>der</strong>plänen, Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5, Oranienschule Wiesbaden,<br />
Frau Barbara Knoblauch, 12.5.06<br />
� Bildungsoffensive Städel, Frankfurter Städel, 10.6.06<br />
� Bildungsstandards – Ziele, Inhalte, Aufbau und Ansätze <strong>der</strong> Implementation von<br />
Bildungsstandards, Staatl. Schulamt, Dr. Siegried Uhl, 7.7.06<br />
� Mathematisches Lernen in <strong>der</strong> ersten Klasse, Staatl. Schulamt, Frau Kirchhoff<br />
(Ballance)<br />
� Fortbildungsplanung – <strong>Stand</strong>ortbestimmung, Anregungen, Klärung, Staatl.<br />
Schulamt, Frau Ronte-Rasch, 17.11.06<br />
� Die Bedeutung von Führung von Schulleitung, Interessenverband Hessischer<br />
Schulleiterinnen und Schulleiterinnen IHS, Hanau, 5.10.06<br />
� Bedeutung von Schulleitung und ihre zukünftige Entwicklung, Prof. Dr. Heinz S.<br />
Rosenbusch, Leiter <strong>der</strong> Forschungsstelle für Schulentwicklung und<br />
Schulmanagement an <strong>der</strong> Otto-Friedrich-Universität Bamberg<br />
� Lernen und Führen, Eckhard Nordhofen<br />
� Erkenntnisse übers Lernen aus <strong>der</strong> Gehirnforschung, Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer<br />
� Die Bedeutung von Führung, Wilfried Becker, Direktor des Gallus Theater Frankfurt<br />
� Fortbildungsplanung – <strong>Stand</strong>ortbestimmung, Anregungen, Klärung, Staatl. Schulamt<br />
17.11.06<br />
� Qualifizierung von Grundschullehrkräften als zuständige Lehrkraft für den<br />
Arbeitsbereich „För<strong>der</strong>ung von Schülerinnen und Schülern beim<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-15
2006<br />
2007 2008 2008/09<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Schriftspracherwerb“, Staatl. Schulamt, Fortbildungsreihe ab dem 27.11.06 über ein<br />
Jahr<br />
� Sensomotorische Grundlagen, Frau Ambrosi<br />
� Übergang Kiga-GS, Frau Karasch<br />
� Grundlagen Mathematik, Frau Titgemeyer<br />
� Konzeptionelle Überlegungen für das 1. Schuljahr, Frau Lenz<br />
� För<strong>der</strong>ung im Mathematikunterricht, Frau Kirchhoff<br />
� Kooperation mit dem BFZ, Frau Keck<br />
� Handlungsstrategien bei ADHS, Frau Raschendorfer<br />
� Mathematisches Lernen in <strong>der</strong> 1. Klasse, Frau Titgemeyer<br />
� För<strong>der</strong>pläne, Unterrichtsgaranie Plus – Verlässliche Schule, Hardtwaldschule<br />
Seulberg, Frau Charlotte Dreschert, AfL,8.12.06<br />
� Musik und Bewegung, Theodor-Litt-Schule, Wochenendseminar 15.9. bis 17.9.06<br />
� Reflexion über Schulinspektion am Fallbeispiel <strong>der</strong> Grundschule in Wiesbaden-<br />
Naurod, Gerhard Olschewski, 16.3.07<br />
� Geleitete Schule – Lea<strong>der</strong>ship, Prof. Dubs, emeritierter Dekan <strong>der</strong> Universität<br />
St.Gallen, Rheinhardswald-Schule, Kassel, 3.5.07<br />
� Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht, Staatl. Schulamt, Barbara von Ende,<br />
23.5.07<br />
� Dyskalkulie, Dipl.- Psychologin Ulrike Meiss, 31.5.07<br />
� Handlungsstrategien bei ADHS, Staatl. Schulamt 07<br />
� Sensomotorische Grundlagen, Staatl. Schulamt 07<br />
� Übergang Kin<strong>der</strong>garten-Grundschule, Staatl. Schulamt 07<br />
� Grundlagen Schriftspracherwerb, Staatl. Schulamt 07<br />
� Grundlagen und För<strong>der</strong>möglichkeiten Mathematik, Staatl. Schulamt 07<br />
� Konzeptionelle Überlegungen für das erste Schuljahr, Staatl. Schulamt 07<br />
� Kooperation mit dem Beratungs- und För<strong>der</strong>zentrum, Staatl. Schulamt 07<br />
� IT-Konzept und Raumgestaltung, Staatl. Schulamt 07<br />
� Schreibanlässe und –projekte von Anfang an, Staatl. Schulamt 07<br />
� Erstlesen im Hinblick auf das Strategische Ziel II, Staatl. Schulamt 07<br />
� Schulleiter/in als Vertragspartner, Schulrecht,Vertragsabschlüsse, Interessenverband<br />
Hessischer Schulleiterinnen und Schulleiter IHS, Dr. Bott, HKM, 12.6.07<br />
� Musik und Bewegung, Instrumentenbau, Michelstadt – Theodor-Litt-Schule,<br />
Wochendendseminar 14.9. bis 16.9.07<br />
� Einführung in die Arbeit mit För<strong>der</strong>plänen, Modellregion, 19.9.07<br />
� Nachteilsausgleich, Dipl.-Psychologin Ulrike Meiss, 21.9.07<br />
� Neurobiologische Grundlagen des Lernens, Michael Fritz-Geschäftsführer des<br />
Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen, Dr. Katrin Hille.<br />
Forschungsleitung ZNL, Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Gesamtleitung ZNL, 2.10.07<br />
� Wahrnehmungs- und Blickfunktionen aus neurobiologischer Sicht, Prof. Manfred<br />
Spitzer, 3.12.07<br />
� Kompetenzbereiche <strong>der</strong> Mathematik, Modellregion, Fortbildungsreihe über ein Jahr<br />
ab 27.2.08<br />
� Individuelle För<strong>der</strong>ung – Modellregion, Fortbildungsreihe über ein Jahr ab 5.3.08<br />
� Individuell för<strong>der</strong>n – lernen begleiten 6.6.08 in <strong>der</strong> Fachhochschule Wiesbaden<br />
� Aufgabenformate und Lernumgebung im Mathematikunterricht <strong>der</strong> Grundschule<br />
4.11.08<br />
� 23.01.09 Schulweite Unterrichtsentwicklung- kompakt, Prof. em. Dr. Hans-Günther<br />
Rolff, Uni Dortmund, Institut für Schulentwicklungsforschung<br />
� 8.11.08 Legasthenie und Dyskalkulie, Philipps-Universität Marburg<br />
� 28.11.08 LRS -Diagnose und För<strong>der</strong>möglichkeiten im Unterricht – Grundlagen und<br />
Basisqualifikationen<br />
� 10.03.09 Primus inter Pares und die Macht, Arbeitskreis Schule/Wirtschaft,<br />
Wiesbaden<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-16
<strong>Stand</strong> 2008/09 <strong>Stand</strong> <strong>2010</strong>/11<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005 2006/2007<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� 17.03.09 Schulleitung in <strong>der</strong> eigenverantwortlichen Schule, Friedberg<br />
- Unterrichtsentwicklung, Prof. em. Dr. Hans-Günther Rolff<br />
- Personalmanagement, Klaus-Dieter Poelke<br />
- Budget, Dr. Frank Meetz<br />
- Schulentwicklung, Projekt- und Changemanagement, Prof. Dr. Gasch<br />
� 12.9.09 Chemie im Grundschulalter, Frau Carina-Maren Hesse<br />
� 21.04.09: Leitung von Schule – Aktuelle Themen aus <strong>der</strong> Schulleitungspraxis, Frau<br />
Liane Seibert, AfL Schloss Heiligenberg<br />
� März 09 Wissenschaftliche Forschung an <strong>der</strong> Grundschule, Prof. Büttner, Uni<br />
Frankfurt<br />
� März 09 Ermittlung <strong>der</strong> Lesegeschwindigkeit in den vier Grundschuljahren<br />
� Juni 09 Konzeptentwicklung für Projektwoche sowie Projekttag Juni <strong>2010</strong>, Dr.<br />
Dambeck, Uni Frankfurt, Geologisches Institut<br />
� 18.01.10, Einführung für Kunstlehrende in <strong>der</strong> Ausstellung <strong>der</strong> Schirn- Kunsthalle<br />
Frankfurt: Eberhard Havekost. Retina<br />
� 04.03.10: Kin<strong>der</strong>schutz und Kindeswohlgefährdung, Frau P. Zimmermann<br />
� 18.03.10: Kulturlandschaft – Irreversibler Umweltschaden o<strong>der</strong> schützenswertes<br />
Erbe? Eine landschaftsökologische Zeitreise mit Perspektive, Dr. Rainer Dambeck,<br />
Goethe Universität Frankfurt<br />
� 21.03.10, Prävention von Rechenschwierigkeiten durch För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Mengen-<br />
Zahlen Kompetenz im Anfangsunterricht“<br />
� 21.06.10: Auftakt für neu aufgenommene Schulen im „Ganztagsprogramm nach<br />
Maß“ im Schuljahr 10/11, Serviceagentur „Ganztätig lernen“ Hessen,<br />
Landessportbund Hessen e..v. Frankfurt, u.a. Vortrag: Prof. Olaf-Axel Burow,<br />
Universität Kassel<br />
� 29./30.11.10, Erste-Hilfe-Training – Lehrer, ASB , Hr. Jetzoreck<br />
� Januar <strong>2011</strong>: Weiterentwicklung des För<strong>der</strong>konzeptes <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> in<br />
Hinblick auf unserer ganztägig lernende Schule, Frau Anke Olafson, Montessori-<br />
Pädagogin und Montessori-Ausbil<strong>der</strong>in, <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
Fortbildungsveranstaltungen für das gesamte Kollegium<br />
� Einzelveranstaltung im Museum Wiesbaden: Der Expressionist Jawlensky-<br />
Besichtigung <strong>der</strong> Ausstellung, Experimente mit Materialien und Techniken als<br />
Vorbereitung für den Kunstunterricht an <strong>der</strong> Grundschule<br />
� Planung : Febr. 2006<br />
Einzelveranstaltung im Glasstudio Derix Taunusstein: Glas als Werkstoff in seiner<br />
Transparenz und Leuchtkraft, Besichtigung <strong>der</strong> Werkstätten, Experimentelle<br />
Erfahrungen mit Materialien und Techniken als Vorbereitung für den Kunstunterricht<br />
� Der Besuch im Glasstudio Derix erfolgte planmäßig im Februar 06.<br />
� Erarbeitung von Lesekompetenz för<strong>der</strong>nden Unterrichtsmethoden und informellen<br />
Diagnoseverfahren sowie Sichtung von Lehr- und Lernmitteln im Zusammenarbeit<br />
mit dem Finkenverlag, Doris Wirtz, <strong>Lenzenbergschule</strong>, 1.12.06<br />
� Entwicklung des schuleigenen För<strong>der</strong>konzeptes, Monika Simon, <strong>Lenzenbergschule</strong>,<br />
30.11.07<br />
� Evaluation 2005<br />
Es besteht Fortbildungsbedarf in den nächsten Jahren in den Bereichen<br />
� LRS: Diagnose und Erstellung eines För<strong>der</strong>konzepts<br />
� Diagnose Lesekompetenz 1,2,3<br />
� Erstellung eines För<strong>der</strong>konzepts Lesekompetenz<br />
� Diagnose Dyskalkulie<br />
� Erstellung eines För<strong>der</strong>konzepts Mathe für Schwache<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-17
2009/10<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2005 2008 <strong>2010</strong><br />
� Evaluation 2006/07<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Folgende Fortbildungen sind erfolgt:<br />
- Diagnose von LRS<br />
- Seminare zur Lesekompetenz<br />
- Auswahl von Diagnosebögen zur Lesekompetenz<br />
- In Planung März 2007: Diagnose Dyskalkulie (Frau Meiss) in Kooperation mit Kollegium in<br />
Neuhof<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Diagnose Dyskalkulie erfolgte planmäßig im März 07 an unserer Schule.<br />
� 28.11.08 - För<strong>der</strong>ung von Schülern durch Psychomotorik<br />
- LRS- Diagnose und För<strong>der</strong>möglichkeiten im Unterricht<br />
� 18.03.10 Detaillierte Konzepterarbeitung für Projektwoche/Projekttag <strong>2010</strong><br />
„Geologische Beschaffenheit unserer Umgebung und ihre Auswirkung<br />
auf Berufsbil<strong>der</strong> und Kultur unseres Umfeldes in vergangenen Jahren bis<br />
heute, Dr. Dambeck, Uni Frankfurt, Geologisches Institut“<br />
Fortbildungsveranstaltungen in Kooperation mit an<strong>der</strong>en Schulen und Institutionen<br />
� mit Kollegium <strong>der</strong> Theißtalschule Nie<strong>der</strong>nhausen und Sonnenschule in Neuhof<br />
Vortrag <strong>der</strong> Mitarbeiterin des Prof. Fischer <strong>der</strong> Medizinischen Fakultät in Freiburg –<br />
„Blicklabor“<br />
� Erste Hilfe Kurs für die Lehrerkollegien Nie<strong>der</strong>seelbach und Neuhof in 3<br />
Fortbildungsveranstaltungen (26.2., 4.3.,15.3.04) - abwechselnd in den beiden<br />
Schulen (<strong>2010</strong>: Auffrischungskurs)<br />
� Lehrerfortbildungsreihe in Kooperation mit Neuhof<br />
Referentin: Fr Dipl. Psych. Jung (Sozialpädriatrisches Zentrum <strong>der</strong> HSK in<br />
Wiesbaden)<br />
02.03.2005: Konfliktlösungsstrategien bei Problemen zwischen Eltern und Lehrern<br />
09.03.2005: Lern- und Wahrnehmungsauffälligkeiten<br />
16.03.2005: Diagnostik – Möglichkeiten für Lehrer<br />
� Erweiterung <strong>der</strong> Kommunikationskompetenz<br />
Planung: Vorträge und Workshops: 20. und 27. März 2006<br />
� Planung: Mai 2008<br />
Experimenteller Umgang mit Techniken und Materialien für Farbwirkungen auf Papier<br />
� 9.06.08 Künstlerisches Arbeiten mit Kin<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Grundschule – Experimentelles<br />
Zeichnen, Techniken und Materialien für Farbwirkungen, <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
� 4.11.08 Aufgabenformate und Lernumgebung im Mathematik-Unterricht <strong>der</strong><br />
Grundschule, Theißtalschule<br />
� Planung <strong>2010</strong>: Geologische Bedingungen des kulturellen Lebens um<br />
Nie<strong>der</strong>seelbach in alten Zeiten und heute, <strong>Lenzenbergschule</strong>, Dozenten <strong>der</strong> Goethe-<br />
Universität, Geologisches Institut<br />
� Planung <strong>2010</strong>: Prävention von Rechenschwäche, Goethe-Universität in<br />
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische<br />
Forschung (DIPF)<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-18
<strong>Stand</strong> Juli 2005 2009/10<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Kooperation im Sinne gegenseitiger Unterstützung und Weiterbildung mit an<strong>der</strong>en<br />
Institutionen und Schulen<br />
� Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>nhausens zur Absprache des Vorschulprogramms 2004<br />
� Kin<strong>der</strong>gärten Nie<strong>der</strong>seelbach und Engenhahn<br />
� Jugendhilfe 2003<br />
o Koordinations- und Fachgespräche <strong>der</strong> Schulleiterin mit Fr. Blaes<br />
o Fr. Blaes in <strong>der</strong> Gesamtkonferenz (Nov. 03)<br />
o Themen: -- Kontaktaufnahme zum Jugendamt<br />
o Verfahren bei Alkoholismus<br />
o Bei Verdacht auf Missbrauch<br />
� Jugend- und Familienberatungsstelle Idstein<br />
o 3 Vorträge mit Herrn Hölzel 2003/ 2004<br />
o Workshops für Eltern 2003/2004<br />
o 2 Schüler- Wochenendkurse 2004<br />
� Amtsärztin Fr. Heinze<br />
� Kin<strong>der</strong>ärzte <strong>der</strong> Schüler<br />
� Beratungs- und För<strong>der</strong>zentrum Idstein an <strong>der</strong> Max-Kirmse-Schule (BFZ):<br />
Mitarbeiterinnen des BFZ<br />
o hospitieren in den Klassen, um die Klassenlehrer bei <strong>der</strong> Diagnose von<br />
Ursachen für Lernschwierigkeiten zu unterstützen und<br />
o för<strong>der</strong>n in Einzel- o<strong>der</strong> Kleingruppenunterricht nach Antrag <strong>der</strong><br />
Klassenlehrerin sowie Wunsch o<strong>der</strong> Einverständnis <strong>der</strong> Eltern<br />
� Sprachheillehrerin Fr. Nuss<br />
o hospitiert in den 1. Klassen, um Sprachentwicklungsverzögerungen zu<br />
entdecken<br />
o erteilt einzelnen Kin<strong>der</strong>n gezielten Sprachför<strong>der</strong>unterricht<br />
o führt Beratungsgespräche mit Klassenlehrerinnen<br />
o führt Organisations- Koordinations- und Beratungsgespräche mit <strong>der</strong><br />
Schulleitung<br />
� Schulpsychologischer Dienst Fr. Eunike-Morell<br />
o Beratungsgespräche mit den Lehrerinnen<br />
o Hospitationen in den Klassen<br />
o Elterngespräche<br />
o Run<strong>der</strong> Tisch Gespräche<br />
� Schule für Kranke (in beson<strong>der</strong>s schwierigen Fällen) Fr. Löffler-Ebing<br />
o Beratungsgespräche mit den Lehrerinnen<br />
o Hospitationen in den Klassen<br />
o Elterngespräche<br />
o Run<strong>der</strong> Tisch Gespräche<br />
� Vorschulleiterin Fr. Julia Thorwarth<br />
� Grundschulen Nie<strong>der</strong>nhausen, Idstein, Wallrabenstein, Neuhof<br />
� Dr. Dambeck, Goethe – Universität Frankfurt, Institut für Geologie<br />
� Pof. Dr. Büttner, Goethe – Lehrer – Akademie <strong>der</strong> Universität Frankfurt<br />
� Prof. Dr. Karl Josef Sabel, Geologiedirektor am Hessischen Landesamt für Umwelt<br />
und Geologie<br />
� Deutscher Wald e. V. , Herr Sabiel<br />
� BUND, Arno Müller, Eppstein<br />
� Streuobstwiesen, Wulf Schnei<strong>der</strong>, Oberjosbach<br />
� MB - Baumdienste, Eppstein<br />
� Herrn Kurt Faber, Revierleiter <strong>der</strong> Revierförsterei Nie<strong>der</strong>nhausen, Eppstein<br />
� Herrn Manfred Racky, Beisitzer und Vorstand des Vereins für Heimat- und<br />
Kulturpflege Oberjosbach, Nie<strong>der</strong>nhausen<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-19
2009/10<br />
<strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2004 <strong>Stand</strong> Juli 2004<br />
Eltern<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
� Dr. Alexan<strong>der</strong> Stahr, Nie<strong>der</strong>nhausen, („Geologie und Landschaft von Oberjosbach<br />
und Umgebung – Entstehung des Taunus, Landschaftsformung, Gesteine und<br />
Böden“)<br />
Aus den Beobachtungen <strong>der</strong> Lehrerinnen in den letzten zwei Jahren, dass viele <strong>der</strong> neuen<br />
männlichen Erstklässler wenig Erfahrung in gewaltfreier Konfliktlösung haben, entstanden<br />
folgende Projekte:<br />
Projekt 1: Abend und Vortrag mit Hrn. Hölzel (Jugend- und Familienberatungsstelle<br />
Idstein) für Eltern unserer Schule und <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gärten (Feb. 04)<br />
Themen:<br />
� Definition von Aggression<br />
� Die Ursachen von Gewalt<br />
� Die Rolle des männlichen Vorbilds in <strong>der</strong> Erziehung eines Jungen<br />
� Lerntheorien<br />
� Erziehungsziele und ihre Auswirkungen<br />
� Evaluation 2004<br />
Rege Beteiligung und große Zufriedenheit<br />
Projekt 2: Elternworkshop mit Hrn. Hölzel (Mai 04)<br />
Über den Zeitraum von einem halben Jahr trifft sich eine Gruppe von maximal 12 Eltern in<br />
den Räumen <strong>der</strong> Beratungsstelle.<br />
Organisation: Fr. Simon durch Auslegung einer Liste an voraus gegangenem Elternabend<br />
� Evaluation 2004<br />
Rege Beteiligung<br />
Projekt 3: Ein weiterer Abend mit Hrn. Hölzel (Juni 04)<br />
Themen: Wie zuvor als Fortsetzung<br />
� Evaluation 2004<br />
� In den beiden Schulhalbjahren 04/05 liefen 2 Kurse sehr erfolgreich.<br />
� Fr. Mollnow erarbeitete ein sehr vielseitiges Unterrichtskonzept auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> eigenen<br />
Körperwahrnehmung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>.<br />
� Die befragten Schüler zeigten große Zufriedenheit.<br />
� Die zunehmende Kompetenz <strong>der</strong> Jogaschüler in Eigen- und Fremdwahrnehmung wirkt sich<br />
positiv auf ihr Sozialverhalten sowie aller Schüler aus.<br />
� Eltern belegen selbst Jogakurse für sich und ihre Kin<strong>der</strong>.<br />
� Evaluation 2006<br />
wie 2004<br />
� Evaluation 2009/<strong>2010</strong><br />
Joga bei Frau Brigitte Mollnow ist weiterhin sehr beliebt bei den Schülern und besteht weiterhin<br />
als Wahlpflichtkurs in den Jahrgängen 3 und 4.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-20
<strong>Stand</strong> Juli 2005<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Projekt 4: Sichtung, Auswahl und Erstellung einer Empfehlungsliste von DVDs und<br />
Videos<br />
Organisation und Durchführung: Elternbeiräte, Schulleiterin<br />
Projekt 5: Spende eines DVD-Players durch einen Vater<br />
Projekt 6: Hinweise am Eltern-Info-Brett zu<br />
� ADS<br />
� Dyskalkulie<br />
� Diagnose von Hochbegabten<br />
� Beratung in Erziehungsfragen<br />
� Bewegungsför<strong>der</strong>ung<br />
� Kulturelle Angebote<br />
� Ferien- und Freizeitangebote<br />
� Evaluation 2006<br />
Aushangsthemen am Elternbrett wurden ergänzt durch Hinweise zu den Themen:<br />
- Musikalische Erziehung am Nachmittag<br />
- Unsere Wahlpflichtfächer <strong>der</strong> sogenannten AGs<br />
- Homepage <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong><br />
- Der sichere Schulweg<br />
- Pausenregelung<br />
- Schulordnung<br />
� Evaluation 2007/08<br />
Der För<strong>der</strong>verein wirbt bei allen Eltern für den Beitritt ab 1€ Beitragszahlung im Monat.<br />
� Evaluation 2009/<strong>2010</strong><br />
Der För<strong>der</strong>verein wirbt weiterhin für Mitglie<strong>der</strong>. Durch die Werbeaktion während des Schulfestes<br />
2009 sind einige Eltern als För<strong>der</strong>er <strong>der</strong> Schule beigetreten. Die erwartete Beitrittsanzahl an<br />
Eltern wurde bei Weitem jedoch nicht erreicht.<br />
Der Schlüsselanhänger des Lenzis war großer Werbeträger, da er zur Beitrittserklärung<br />
dazugegeben wurde.<br />
Die Entwicklung eines Werbeprospektes, das die Aufgaben und Ziele des För<strong>der</strong>vereins <strong>der</strong><br />
<strong>Lenzenbergschule</strong> anschaulich zeigt, wäre ratsam. Dieser Flyer sollte zu Beginn des<br />
Schuleintritts verteilt werden und jedem Elternteil ans Herz gelegt werden, Mitglied des<br />
För<strong>der</strong>vereins zu werden. Um vor allem die zunehmenden finanziellen Probleme einzelner<br />
Schüler auffangen zu können, wäre eine Vergrößerung <strong>der</strong> Einnahmen des För<strong>der</strong>vereins<br />
notwendig.<br />
Schulinterner Fortbildungs- und För<strong>der</strong>plan E10-21
Anhänge<br />
Ⅰ Konzept „Ganztägig Lernen“ im Landesprogramm<br />
Ⅱ Überarbeitung und Entwicklung des För<strong>der</strong>konzeptes im Hinblick auf<br />
„Ganztägig Lernen“ im Landesprogramm<br />
Ⅲ Lesekonzept<br />
Ⅳ Medienkonzept<br />
Ⅴ Konzeptentwurf des Geo-Projekttages<br />
Ⅵ Konzept <strong>der</strong> Homepage<br />
Ⅶ Übergabebogen Kin<strong>der</strong>garten – Grundschule<br />
Ⅷ Hygieneplan<br />
Ⅸ Satzung des För<strong>der</strong>vereins<br />
Ⅹ Bericht zur Inspektion <strong>der</strong> <strong>Lenzenbergschule</strong> im Mai 2007<br />
<strong>Schulprogramm</strong><br />
Alle Anhänge sind auf Nachfrage bei <strong>der</strong> Schulleitung einzusehen.<br />
Die Anhänge sind <strong>der</strong> digitalen Form des <strong>Schulprogramm</strong>s nicht beigefügt. Die<br />
gedruckten Exemplare hingegen enthalten sämtliche Anhänge. Sie können bei <strong>der</strong><br />
Schulleitung auf Nachfrage eingesehen werden.<br />
Anhänge A