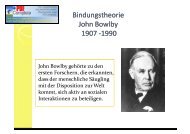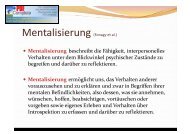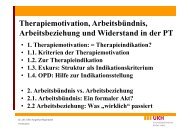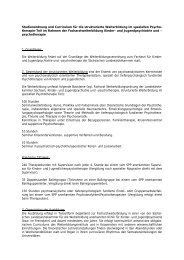Intersubjektive Partizipation: Bewegungen des ... - Thomas Brotzler
Intersubjektive Partizipation: Bewegungen des ... - Thomas Brotzler
Intersubjektive Partizipation: Bewegungen des ... - Thomas Brotzler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
STEIN BRÅTEN<br />
<strong>Intersubjektive</strong> <strong>Partizipation</strong>: <strong>Bewegungen</strong> <strong>des</strong> virtuellen<br />
Anderen bei Säuglingen und Erwachsenen<br />
Übersicht: Im Gegensatz zur Tradition Piagets, die für die kindliche Entwicklung<br />
einen egozentrischen Ausgangspunkt unterstellt, werden Beispiele dafür gezeigt,<br />
wie Neugeborene ihre Betreuer nachahmen und in einen Protodialog mit ihnen<br />
eintreten und wie Kleinkinder (11 Monate und älter) prosoziale Verhaltensweisen<br />
erkennen lassen. Dies wird unter dem Gesichtspunkt eines Mechanismus<br />
erklärt, in dem ein virtueller Anderer – wahrscheinlich mit Unterstützung von<br />
Spiegelneuronen – eine alterozentrische <strong>Partizipation</strong> an den <strong>Bewegungen</strong> <strong>des</strong><br />
anderen ermöglicht. Der Kreislauf <strong>des</strong> Nachspielens von Betreuung und Misshandlung<br />
wird mit dem Lernen durch Beteiligung <strong>des</strong> virtuellen Anderen erklärt –<br />
einer Fähigkeit, die bei Autismus und postpartaler Depression teilweise blockiert<br />
ist, normalerweise jedoch intersubjektive Fähigkeiten höherer Ordnung begünstigt.<br />
Schlüsselwörter: Einfühlung; alterozentrische <strong>Partizipation</strong>; primäre Intersubjektivität;<br />
Spiegelneuronen<br />
Einleitung: Über Neugeborene<br />
Katharina und ihre Mutter. Die elf Tage alte Katharina tritt mit ihrer fürsorglichen<br />
Mutter in ein Wechselspiel ein, das an einen Tanz erinnert. Es findet<br />
seinen Ausdruck in ihrem ganzen Körper und in einer beiderseits geteilten<br />
Gefühlsgemeinschaft (aufgezeichnet vom Autor 1990).<br />
Naseeria und ihr Vater. Naseeria, die zwölf Wochen zu früh geboren wurde,<br />
wird im Alter von sechs Wochen vom Vater in einer »Känguruposition«<br />
gehalten und tritt mit ihm in ein schönes Duett ein. Fast unhörbar wiederholt<br />
sie »aaa« zwischen den leisen, sanften »AAA«-Lauten <strong>des</strong> Vaters, sodass<br />
sich die Abfolge aaa … AAA … aaa … AAA … aaa … AAA … aaa« ergibt<br />
(aufgezeichnet von van Rees & de Leeuw 1987).<br />
Die meisten Eltern und Betreuer haben es schon erlebt: Bereits in den ersten<br />
Lebensmonaten hat es den Anschein, als würde das Baby sie in einem<br />
fein abgestimmten Wechselspiel ergänzen, indem beide Seiten auf Gesten<br />
und Gesichtsausdrücke eingehen und sie verfolgen. Schon in den ersten<br />
Wochen nach der Geburt können Mutter und Kind eine solche Koordination<br />
der Gesichtsausdrücke und <strong>Bewegungen</strong> herstellen und eine Art<br />
* Bei der Redaktion eingegangen am 11. 4. 2011.<br />
Psyche – Z Psychoanal 65, 2011, 832–861 www.psyche.de<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 833<br />
Rundtanz der einander vervollständigenden, verwobenen Körperbewegungen<br />
aufführen.<br />
Die Eindrücke von Eltern und Betreuern, die einen gegenseitigen Kontakt<br />
mit dem Baby als »Gesprächspartner« erleben, lange bevor die Sprache<br />
ins Spiel kommt, wurden in jüngster Zeit auch durch Laboruntersuchungen<br />
bestätigt. Wenn Eltern oder Betreuer beispielsweise am Wickeltisch<br />
mit dem Baby in Kontakt treten – und wenn sie nicht gestresst sind oder<br />
unter Zeitdruck stehen –, erleben sie häufig ein Wechselspiel, das an einen<br />
Tanz oder einen Dialog erinnert. Betrachten wir beispielsweise einmal die<br />
Schnappschüsse von dem elf Tage alten Mädchen auf dem Wickeltisch mit<br />
der Mutter (Abb. 1). Man erkennt tanzartige <strong>Bewegungen</strong> in einem Wechselspiel,<br />
in dem das Neugeborene seinen ganzen Körper in eine wechselseitige<br />
Gefühlsbeziehung einbringt.<br />
Aber solche subjektiven Erlebnisse und phänomenologischen Beschreibungen<br />
vertragen sich nicht mit den traditionellen Theorien der kindlichen<br />
Entwicklung, die während großer Teile <strong>des</strong> vergangenen Jahrhunderts die<br />
Oberhand hatten. Ihre Grundlagen gehen auf die Arbeiten von Freud und<br />
Piaget vom Anfang <strong>des</strong> letzten Jahrhunderts zurück. Sigmund Freud<br />
(1911b) glaubte anfangs, Säuglinge seien von der Kommunikation mit<br />
anderen abgeschnitten; die gleiche Vorstellung vertraten Mahler, Pine &<br />
Bergman (1978 [1975]) noch im letzten Viertel <strong>des</strong> Jahrhunderts: Sie sprachen<br />
vom »normalen Autismus während der ersten Wochen«. 1 Freud<br />
hatte großen Einfluss auf Piaget (1983 [1926]), nach <strong>des</strong>sen Ansicht<br />
das Kind lernen muss, sich von seiner anfänglichen »Egozentrizität« zu<br />
»dezentrieren«. Nach dieser theoretischen Position ist wechselseitige<br />
Kommunikation im Säuglingsalter wie in Abb. 1 ausgeschlossen; dort<br />
erkennen wir, wie die zueinander passenden Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen<br />
<strong>des</strong> elf Tage alten Mädchens und seiner Mutter auf gegenseitige<br />
Einstimmung schließen lassen. Bevor ich 1990 dieses Wechselspiel<br />
aufzeichnete, gab es bereits bahnbrechende Berichte über ein solches<br />
Wechselspiel in Form einer »Protokonversation«, die Mary Catherine<br />
Bateson (1975) und Colwyn Trevarthen (1974) an sechs bis acht Wochen<br />
alten Säuglingen beobachtet hatten. Danach fertigten van Rees & de<br />
Leeuw (1987) Videoaufnahmen der sechs Wochen alten Naseeria an, die<br />
bereits in der Lage war, in ein Duett mit ihrem Vater einzutreten.<br />
1 Die frühe Verbindung zwischen Mutter und Säugling wird in dieser Tradition mit einer biologischen<br />
Metapher als »Symbiose« bezeichnet, wobei die Mutter sich in einer »autistischen<br />
Umlaufbahn« um das Baby befindet (vgl. Mahler, Pine & Bergman 1978 [1975]).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
834 STEIN BRÅTEN<br />
Abb. 1: Katharina (11 Tage alt) auf dem Wickeltisch in einem aufeinander abgestimmten,<br />
tanzartigen Wechselspiel mit ihrer Mutter (Bråten 2004a [1998], S. 29; 2002, S. 275)<br />
An dem in Abb. 1 wiedergegebenen Wechselspiel ist nichts Besonderes<br />
oder Ungewöhnliches. Die meisten Säuglinge sind sogar schon in der ersten<br />
Stunde nach der Geburt zu einer Art Kommunikation bereit und bemühen<br />
sich aktiv darum. Steht die Mutter für einen solchen engen Kontakt<br />
nicht zur Verfügung, können andere – Männer oder Frauen – an ihre<br />
Stelle treten; das Neugeborene sucht dann auch nach ihren Gesichtern.<br />
Ein weiterer Beleg für eine solche frühzeitige Kontaktbereitschaft ist die<br />
Tatsache, dass Neugeborene die Gesichtsausdrücke von Erwachsenen,<br />
mit denen sie in Kontakt kommen, nachahmen können (Kugiumutzakis<br />
1985, 1998; Meltzoff & Moore 1983). Wie kommt es dazu?<br />
Wir können annehmen, dass sich Katharina und ihre Mutter sowie Naseeria<br />
und ihr Vater im Kreislauf einer dyadischen Struktur befinden, in<br />
der sie einander unmittelbar spüren können. Die Muster <strong>des</strong> gegenseitigen<br />
Lächelns, Anschauens und Duetts sind nicht das Ergebnis der Versuche<br />
zweier monadischer Mitwirkender, einen Einklang herzustellen. Aber<br />
welche operationalen und organisatorischen Merkmale <strong>des</strong> sich ständig<br />
wandelnden Geistes sind vorstellbar, die ein solches dyadisches Zusammenwirken<br />
mit anderen schon von Geburt an und bei den meisten von<br />
uns während <strong>des</strong> ganzen Lebens ermöglichen?<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 835<br />
Der Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen wirkt schon bei Neugeborenen<br />
Ein Weg zu einer Antwort eröffnet sich, wenn man das Gehirn <strong>des</strong> Neugeborenen<br />
als selbstorganisieren<strong>des</strong> System betrachtet, das sich im unmittelbaren<br />
wechselseitigen Umgang mit anderen ständig neu erschafft und<br />
wandelt. Im Rahmen dieses Erklärungsansatzes wurde die Vorstellung<br />
von einem inneren, primären Gemeinschaftsprozess (und Raum zur Dialogbildung)<br />
formuliert, der als »virtueller Anderer« bezeichnet wurde; er<br />
lädt dazu ein und lässt zu, dass er von tatsächlichen Anderen ersetzt wird,<br />
und man geht davon aus, dass er eine Eigenschaft der Operationsschaltkreise<br />
ist, durch die der Geist sich neu erschafft und wandelt. Schon früher<br />
habe ich den Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen auf der Grundlage meiner<br />
empirischen Untersuchungen und Computersimulationen der Kommunikation<br />
so beschrieben:<br />
»Im Geist <strong>des</strong> Säuglings gibt es schon bei der Geburt einen virtuellen Anderen,<br />
der zum Vollzug durch tatsächliche Andere in der gefühlten unmittelbaren<br />
Umgebung einlädt und ihn zulässt. Der normale, sich entwickelnde<br />
und lernende Geist erschafft sich also neu und wandelt sich als selbstorganisierende<br />
Dyade: einerseits im Selbst-Umgang mit dem virtuellen Anderen<br />
und andererseits im Umgang mit tatsächlichen Anderen, die den Raum<br />
der Gemeinschaft mit dem virtuellen Anderen ausfüllen und beeinflussen<br />
und damit in gegenwärtiger Unmittelbarkeit direkt gefühlt werden« (Bråten<br />
1993, S. 26). 2<br />
Der Begriff »virtuell« bezeichnet in diesem Zusammenhang den ursprünglichen,<br />
unspezifischen inneren Anderen, eine Ergänzung zum körperlichen<br />
Selbst und etwas anderes als tatsächliche Andere und ihre Repräsentationen.<br />
Dieser innere, virtuelle Andere kann nun in (Proto-)Dialoghandlungen<br />
durch einen bestimmten, vorhandenen, tatsächlichen Anderen ersetzt<br />
werden oder ihn ersetzen. Und dies, ohne dass sich die Handlungscharakteristik<br />
der sich selbst organisierenden Dyade verändert. Der Mechanismus<br />
<strong>des</strong> virtuellen Anderen beinhaltet demnach eine angeborene, unspezifisch-gemeinschaftliche<br />
Sichtweise, die die Perspektive <strong>des</strong> körperlichen<br />
Selbst um die Leistungsfähigkeit (virtus) der Sichtweise <strong>des</strong> tatsächlichen<br />
Anderen ergänzt; daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass er die Alterozeption<br />
und die alterozentrische Spiegelung ermöglicht, wobei er vermutlich<br />
vom System der Spiegelneuronen, auf das ich später zu sprechen<br />
kommen werde, unterstützt wird.<br />
2 Meine Definition für den Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen wird auch von Grotstein<br />
(2003, S. 15) zitiert.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
836 STEIN BRÅTEN<br />
Empfindung <strong>des</strong> tatsächlichen Anderen im Vorstellungsmodus<br />
der gefühlten Unmittelbarkeit<br />
Wenn man beispielsweise Naseeria einen solchen dyadischen Schaltkreis<br />
mit einem virtuellen Anderen zuschreiben kann, wird ihr Umgang mit<br />
dem Vater in gefühlter Unmittelbarkeit möglich, ohne dass es eines qualitativen<br />
Sprungs bedürfte (wenn er den Platz ihres virtuellen Anderen einnimmt).<br />
Die dyadischen Schaltkreise in beiden verwandeln sich in einen<br />
(Proto-)Dialog-Schaltkreis, der sie beide als tatsächliche Beteiligte einschließt,<br />
die sich gegenseitig in präsentationaler Unmittelbarkeit spüren.<br />
Das Gleiche gilt für Katharina und ihre Mutter. Wenn der tatsächliche<br />
Andere den gemeinschaftlichen Raum <strong>des</strong> virtuellen Anderen ausfüllt,<br />
wird der tatsächliche Andere im doppelten Sinn <strong>des</strong> Begriffs »fühlen« gefühlt.<br />
Erstens wird der tatsächliche Andere unmittelbar gespürt und in<br />
präsentationaler Unmittelbarkeit gefühlt, und zwar nicht durch re-präsentationale<br />
Mittelbarkeit, sondern weil der virtuelle Andere in dem Handlungskreislauf<br />
ersetzt wird. Und zweitens werden affektive Vitalitätsgefühle<br />
im Sinn von »Vitalitätsaffekten«, wie Stern (1999) sie nennt, in den<br />
Beteiligten geweckt und von ihnen geteilt. Sie unterscheiden sich von Gefühlen<br />
und ihrem Ausdruck, den man mit einzelnen Kategorien wie<br />
»Freude«, »Überraschung«, »Abscheu«, »Wut« usw. beschreiben kann.<br />
Den Modus der unmittelbaren Vitalitätsempfindung bezeichne ich auf<br />
Englisch als »the presentational mode of felt immediacy«, das heißt als<br />
›unmittelbare Einfühlung‹ 3. Wenn zwei Beteiligte sich wechselseitig unmittelbar<br />
einfühlen, füllt jeder den Raum <strong>des</strong> virtuellen Gefährten <strong>des</strong> anderen<br />
aus, und man kann sagen: Sie beteiligen sich an intersubjektiver Gemeinsamkeit.<br />
Nachahmung bei Neugeborenen<br />
Wie in experimentellen Studien dokumentiert wurde, ahmen Säuglinge<br />
schon in den ersten Wochen nach der Geburt verschiedene Gesten nach:<br />
das Herausstrecken der Zunge, <strong>Bewegungen</strong> der Augenbrauen, die Drehung<br />
<strong>des</strong> Kopfes, Fingerbewegungen, Gesten zum Ausdruck von Überraschung,<br />
Freude und Langeweile sowie stimmliche Äußerungen (Vokale).<br />
Vielleicht am eindringlichsten sind die Videoaufnahmen von Kugiumutzakis<br />
(1985, 1998) aus Heraklion (Kreta) von 1983: Sie zeigen, wie Neugeborene<br />
schon in der ersten Stunde nach der Geburt genau die Gesichts-<br />
3 Im Original deutsch [A.d.Ü.]<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 837<br />
Abb. 2 (links): Ein neu geborenes Mädchen (20 Minuten alt) in Heraklion (Kreta) sieht, wie<br />
Kugiumutzakis (1985, 1998) den Mund weit öffnet, und ahmt ihn dann nach. (Rechts) Zuhörer<br />
öffnen unwillkürlich den Mund ein wenig, wenn sie damit rechnen, dass der Säugling<br />
eine Nachahmungsreaktion zeigt.<br />
bewegungen ihres Gegenübers beobachten, um dann mit Nachahmung zu<br />
reagieren und ganz ähnliche Gesichtsbewegungen auszuführen – unter anderem<br />
strecken sie die Zunge heraus und öffnen den Mund weit.<br />
Abb. 2 macht deutlich, wie der Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen<br />
sowohl bei Neugeborenen als auch bei Erwachsenen wirksam werden<br />
kann. Beim Neugeborenen füllt Kugiumutzakis mit seinen Gesichtsbewegungen<br />
den Raum der intersubjektiven Gemeinsamkeit, und das Mädchen<br />
fühlt sich veranlasst, den Mund auf alterozeptive Weise zu öffnen (um<br />
einen Begriff von Trevarthen [1986] zu verwenden) und so die Nachahmung<br />
zu vervollständigen. Oder, wie Kugiumutzakis es formuliert:<br />
»Die Erkennung <strong>des</strong> Gegenübers als tatsächlicher Anderer im Gemeinsamkeitsraum<br />
<strong>des</strong> Babys (Bråten 1988a, 1988b, 1992, 1993, 1994) ruft das Vergnügen<br />
oder die Freude über das Zusammensein hervor. Das Gegenüber<br />
regt Blicke, Gehör und Geist <strong>des</strong> Babys an. […] Die Aufforderung durch<br />
den Erwachsenen wurde erkannt und angenommen, die intersubjektive Erwartung<br />
wurde bestätigt, der Raum <strong>des</strong> virtuellen Anderen [beim Neugeborenen]<br />
wurde durch ein freundliches, reales, ähnliches Wesen ausgefüllt.<br />
Das Spiel <strong>des</strong> potenziellen Teilens hat begonnen und muss vollständig abgeschlossen<br />
werden« (Kugiumutzakis 1998, S. 79).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
838 STEIN BRÅTEN<br />
Alterozentrische <strong>Partizipation</strong><br />
Wenn ich Videoaufzeichnungen von Kugiumutzakis – beispielsweise<br />
einen Clip, in dem er einem 20 Minuten alten Mädchen seinen weit geöffneten<br />
Mund zeigt und das Baby sich daranmacht, ihn nachzuahmen<br />
(wie in Abb. 2) – bei einem Vortrag zeige, öffnen manche Zuhörer unwillkürlich<br />
den Mund und zeigen so ihre virtuelle <strong>Partizipation</strong> an dem, was<br />
das Neugeborene tun will. Im Publikum handelt es sich dabei nicht um<br />
imitieren<strong>des</strong> Nachspielen, sondern um ein Voraus- oder Mitspielen: Die<br />
Menschen im Publikum öffnen den Mund zur gleichen Zeit wie das kleine<br />
Mädchen oder ein wenig früher – als wollten sie der Kleinen helfen, die<br />
schwierige Leistung zu vollbringen. Sie sind sich genau bewusst, was das<br />
kleine Mädchen vorhat, und öffnen unwillkürlich den Mund, bevor es ihr<br />
gelingt. Wenn ich dann an das Rednerpult zurückkehre und darauf hinweise,<br />
was einige Zuhörer gerade getan haben, bricht Gelächter aus und<br />
ihnen wird bewusst, was ihre Mundbewegungen bedeuten. Ihr Mechanismus<br />
<strong>des</strong> virtuellen Anderen hat sie in die Lage versetzt, sich wie ein virtueller<br />
Miturheber der Vorbereitung <strong>des</strong> Neugeborenen auf die Nachahmung<br />
zu fühlen; dies hat dann dazu geführt, dass sie unwillkürlich den<br />
Mund öffneten, ohne dass es ihnen bewusst war.<br />
Dies macht die alterozentrische <strong>Partizipation</strong> deutlich – diesen Begriff<br />
verwende ich (Bråten 1998b, 2002, 2003a, 2003b, 2009) für die auf den anderen<br />
zentrierte Wahrnehmung und Spiegelung von <strong>Bewegungen</strong>. Die alterozentrische<br />
<strong>Partizipation</strong> ist die genaue Umkehr der Wahrnehmung anderer<br />
aus egozentrischer Sicht; sie umfasst die empathische Fähigkeit, sich<br />
mit dem Anderen in Form eines virtuellen Beteiligten zu identifizieren, was<br />
zum Mitspielen oder gemeinsamen Erleben veranlasst, als würde es sich im<br />
körperlichen Zentrum <strong>des</strong> Anderen abspielen. Ich definiere die alterozentrische<br />
<strong>Partizipation</strong> also als die virtuelle Beteiligung <strong>des</strong> Ego am Handeln<br />
<strong>des</strong> Anderen, als wäre das Ego ein virtueller Miturheber der Handlung<br />
oder als würde es virtuell vom Standpunkt <strong>des</strong> Anderen an die Hand genommen.<br />
Dies zeigt sich manchmal unwillkürlich ganz offen, etwa wenn<br />
man ein Bein hebt, während man einem Hochspringer zusieht, oder wenn<br />
man den Mund öffnet, während man einem anderen etwas zu essen in den<br />
Mund steckt (und es unterscheidet sich vom Einnehmen einer Sichtweise,<br />
die durch die begriffliche Repräsentationen anderer vermittelt wird). 4 Stern<br />
4 Eine solche virtuelle Beteiligung an den Handlungen eines Anderen fiel schon Adam<br />
Smith (2010 [1759]) auf: Er berichtet, wie sich die Zuschauer einer französischen Revuetänzerin<br />
entsprechend den Tanzbewegungen wiegten.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 839<br />
(2005, S. 247) hält das, was ich als »alterozentrische <strong>Partizipation</strong>« bezeichnet<br />
habe, für »die basale intersubjektive Fähigkeit, durch die Nachahmung,<br />
Empathie, emotionale Ansteckung und Identifizierung ermöglicht<br />
werden«. Und das, so könnte man hinzufügen, ist noch nicht alles:<br />
Wenn wir nicht nur zusehen, wie ein anderer etwas ausführt, sondern uns<br />
auch wünschen, dass der andere mit seiner Tätigkeit Erfolg hat, zeigen wir<br />
unsere virtuelle Teilnahme an den Bemühungen <strong>des</strong> anderen durch begleitende<br />
Muskelbewegungen, als wären wir der Miturheber der Tätigkeit <strong>des</strong><br />
anderen; Beispiele sind auch hier die Reaktion <strong>des</strong> Publikums, wenn das<br />
Neugeborene sich auf die Nachahmung vorbereitet (Abb. 2), oder die Betreuungsperson,<br />
die unwillkürlich den Mund öffnet, wenn der Patient das<br />
Gleiche tut, um die angebotene Nahrung aufzunehmen. Ein solcher Widerhall<br />
von <strong>Bewegungen</strong> ist Eibl-Eibesfeldt (1997), der den Begriff »Mit-<br />
<strong>Bewegungen</strong>« benutzt, und mir unabhängig voneinander bei Säuglingen<br />
aufgefallen, die ihre Betreuer füttern: Sie öffnen unwillkürlich den Mund,<br />
wenn der Empfänger das Gleiche tut, um das Essen anzunehmen – und genauso<br />
machen es oftmals auch Erwachsene, die ein Kind füttern.<br />
Sehr deutlich wird dies in Abb. 3. <strong>Thomas</strong>, ein Junge aus Norwegen, ist<br />
ein knappes Jahr alt. Als seine Schwester ihn fütterte, bat ich sie, den Löffel<br />
mit dem Essen vor ihn hinzulegen – ich wollte wissen, was er tun würde.<br />
Erwartungsgemäß griff er nach dem Löffel und hob ihn unbeholfen an ihren<br />
Mund. Als es aber um das süße Dessert ging, behielt er den Löffel für sich –<br />
einige andere Babys allerdings, die ich in ähnlichen Situationen filmte, erwiderten<br />
auch hier die Fütterung durch die Betreuungsperson und teilten<br />
auch das süße Dessert oder den Saft mit ihr. <strong>Thomas</strong> zeigt hier aber noch<br />
eine andere Leistung: Wenn er seiner Schwester den Löffel in den Mund<br />
steckt, öffnet er auch selbst den Mund, als würde er sich virtuell an ihrer<br />
Nahrungsaufnahme beteiligen. Das Gleiche tun wir oftmals auch als Erwachsene,<br />
wenn wir jemanden füttern – wir öffnen unwillkürlich den<br />
Mund, wenn dieser den Mund aufmacht, um die Nahrung zu sich zu nehmen.<br />
5 Eine solche teilnehmende Wahrnehmung der <strong>Bewegungen</strong> anderer ist<br />
5 Wie der Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen *A funktioniert, wenn <strong>Thomas</strong> von seiner<br />
Schwester das Füttern mit dem Löffel lernt und teilnehmend wahrnimmt, wie seine<br />
Schwester das Essen zu sich nimmt, lässt sich jetzt auch mit symbolischer Logik ausdrücken.<br />
E.f sei die manuell ausgeführte Handlung <strong>des</strong> Fütterns und E.e die Bewegung <strong>des</strong><br />
Mun<strong>des</strong>, der die Nahrung aufnimmt. *A.*f und *A.*e kennzeichnen die alterozentrierte<br />
<strong>Partizipation</strong> <strong>des</strong> Fütternden und <strong>des</strong> Empfängers der Nahrung; an beidem ist *A, der<br />
Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen, beteiligt. Dann kann man die alterozentrierte<br />
<strong>Partizipation</strong> der Betreuerin an der Nahrungsaufnahme durch <strong>Thomas</strong> und den Prozess,<br />
in dem <strong>Thomas</strong> durch seine alterozentrierte <strong>Partizipation</strong> an der Fütterungshandlung der<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
840 STEIN BRÅTEN<br />
Bestandteil der Alterozentrizität – <strong>des</strong> genauen Gegenteils von Egozentrizität<br />
– und wird durch den Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen ermöglicht,<br />
der parallel zur Ausführung <strong>des</strong> Fütterns wirksam wird und sie ergänzt.<br />
In dem folgenden, von Anna Freud berichteten Beispiel stellt ein Mädchen<br />
seine Fähigkeit unter Beweis, die eigene körperzentrierte Position<br />
und die egoistischen Bedürfnisse hinter sich zu lassen:<br />
»Rose (19 Monate) sitzt bei Tisch und trinkt Kakao. Edith (17 Monate) kletterte<br />
hinauf und will ihr den Becher vom Mund wegzuziehen. Rose sieht sie<br />
erstaunt an, dreht dann den Becher um und hält ihn so, dass Edith davon<br />
trinken kann« (A. Freud & Burlingham 1987 [1973], S. 911).<br />
Roses Reaktion auf Ediths unbeholfenen Versuch, an den Kakao zu kommen,<br />
ist nicht nur wegen ihrer altruistischen Handlungsweise aufschlussreich<br />
– sie hilft Edith, Kakao zu trinken, und verzichtet selbst darauf –,<br />
sondern auch, weil sie den Becher angesichts der Körperhaltung von Edith<br />
herumdreht. Indem sie den Becher so stellt, dass Edith aus Ediths Position<br />
heraus – die ihrer eigenen entgegengesetzt ist – trinken kann, stellt sie die<br />
Fähigkeit unter Beweis, ihre eigene, körperzentrierte Sichtweise aufzugeben.<br />
Mit ihrer alterozentrischen <strong>Partizipation</strong> leistet sie für Edith eine Proto-<br />
Fürsorge; gelernt hat Rose diese Spiegelung – das Umdrehen <strong>des</strong> Bechers –<br />
wahrscheinlich dadurch, dass sie selbst von ihren Betreuerinnen gefüttert<br />
wurde.<br />
Mutmaßliche neurosoziale Grundlagen für den Mechanismus<br />
<strong>des</strong> virtuellen Anderen<br />
Die Entdeckung der Spiegelneuronen<br />
Ungefähr zur gleichen Zeit, als ich die Erwartung äußerte, dass man die<br />
neurophysiologischen Grundlagen solcher Leistungen in Form »neuronaler<br />
Betreuerin lernt, und auch die Tatsache, dass er die Nahrungsaufnahme durch sie erwidert<br />
und spiegelt, folgendermaßen formulieren: Betreuerin (E.f; *A.*e) und lernender<br />
Säugling (E.e; *A.*f) => erwidernder Säugling (E.f; *A.*e). Das heißt: Da die Betreuerin<br />
den Säugling füttert und gleichzeitig an seiner Nahrungsaufnahme Anteil nimmt, löst<br />
sie im Säugling sowohl die Nahrungsaufnahme als auch die virtuelle Beteiligung an der<br />
Fütterungshandlung aus, als wäre der Säugling ein virtueller Miturheber der Fütterung.<br />
Die dabei zurückbleibende, aus der Bewegung stammende Erinnerung veranlasst den<br />
Säugling – wenn er den Löffel selbst in die Hand nehmen darf –, die Betreuerin auf ganz<br />
ähnliche Weise zu füttern. Begleitet wird der Vorgang durch die virtuelle Beteiligung <strong>des</strong><br />
Säuglings am Akt der Nahrungsaufnahme durch die Betreuerin (vgl. Bråten 2002,<br />
S. 290f.; 2007b, S. 134f.).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 841<br />
Abb. 3: <strong>Thomas</strong> (11 3⁄4 Monate alt) erwidert die Fütterung durch die Schwester<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
842 STEIN BRÅTEN<br />
Systeme und vielleicht sogar Neuronen entdecken werde, die für alterozentrische<br />
Wahrnehmung sensibilisiert sind« (Bråten 1998b, 2000 [1997]),<br />
wurde über die Entdeckung eines Spiegelsystems im menschlichen Gehirn<br />
berichtet (Rizzolatti et al. 1999; Rizzolatti, Graighero & Fadiga 2002;<br />
Rizzolatti & Arbib 1998; Ferrari & Gallese 2007 [2004]; Fadiga 2000;<br />
Fogassi et al. 2005). Prämotorische Spiegelneuronen geben Impulse ab,<br />
wenn wir sehen, wie ein anderer eine Handlung ausführt, oder wenn wir<br />
selbst die gleiche Handlung ausführen (beispielsweise nach einem Stück<br />
Nahrung greifen). Entdeckt wurden die Spiegelneuronen ursprünglich von<br />
Giacomo Rizzolatti und seinen Mitarbeitern an Makaken: Dort werden<br />
die Zellen aktiv, wenn der Affe zusieht, wie der Versuchsleiter nach einem<br />
Stück Nahrung greift, oder wenn der Affe selbst das Stück in die Hand<br />
nimmt. Wie sich durch weitere Experimente herausstellte, gibt es ein solches<br />
System auch im Gehirn <strong>des</strong> Menschen, und zwar im so genannten<br />
Broca-Zentrum (das nicht nur dem Sprechen dient, sondern offenbar auch<br />
bei der Ausführung und Vorstellung von Handbewegungen sowie bei Aufgaben,<br />
in denen die Hand im Geist gedreht wird, aktiv wird). Mit dem<br />
Nachweis solcher Spiegelneuronensysteme, mit denen eine Übereinstimmung<br />
zwischen einer beobachteten Handlung und einer ähnlichen, innerlich<br />
erzeugten Handlung beim Beobachter hergestellt werden kann,<br />
greifen Rizzolatti & Arbib (1998) auf Libermans (1993) Theorie der motorischen<br />
Sprachwahrnehmung zurück, die eine enge Verbindung zwischen<br />
der Produktion und Wahrnehmung von Sprache postuliert. Dies steht im<br />
Einklang mit meiner Darstellung <strong>des</strong> Gesprächsmodells (Bråten 1974,<br />
2002), wonach der Zuhörer am Produktionsprozess <strong>des</strong> Sprechers teilnimmt;<br />
das wiederum setzt die Mitwirkung eines solchen Spiegelsystems<br />
voraus, welches die alterozentrische <strong>Partizipation</strong> <strong>des</strong> Zuhörers an den<br />
Prozessen beim Sprecher unterstützt, was sich darin zeigt, dass der Zuhörer<br />
Sätze vervollständigt (Beispiele in Bråten 2009, S. 251ff.).<br />
Schmerzneuronen<br />
Neben dem System der Spiegelneuronen 6 spricht auch ein weiterer neurobiologischer<br />
Befund für den Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen: die<br />
Entdeckung der so genannten Schmerzneuronen, die im Cortex cingulatus<br />
unseres Gehirns aktiv sind. Dies erkennt man in Abb. 4 an den Reak-<br />
6 Vgl. Bråten & Gallese (2004) zu Folgerungen, die sich aus den Spiegelneuronensystemen<br />
für soziale Kognition und Intersubjektivität ergeben. Vgl. auch Stamenov & Gallese<br />
(2002) und Bråten (2007a).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 843<br />
Abb. 4: Ein Beispiel für gemeinsame Schmerzverarbeitung und die Spiegelungswirkung<br />
beim Griff nach der Hand. Die Zeichnung ist eine abgewandelte Version einer Abbildung,<br />
die ursprünglich in Bråten (2009, S. 258) erschien.<br />
tionen der Frau auf die Schmerzen <strong>des</strong> Mädchens. Wenn wir Schmerzen<br />
empfinden oder mit Empathie (Einfühlung) die Schmerzen eines anderen<br />
beobachten, werden die Schmerzneuronen im anterioren (vorderen) Teil<br />
<strong>des</strong> Cortex cingulatus aktiv (kleine Kreuze in der schematischen Zeichnung<br />
<strong>des</strong> Gehirns der Frau). Dies zeigte sich durch Untersuchung einzelner<br />
Neuronen an manchen Patienten, über die unter anderem Hutchinson<br />
et al. (1999) berichteten, und unterstützt wurde der Befund durch funktionelle<br />
MRI-Untersuchung an normalen, in der Entwicklung befindlichen<br />
Kindern durch Decety, Michalska & Akitsuki (2008). Neben der Aktivierung<br />
der Schmerzneuronen bei der Frau ruft wahrscheinlich auch die Bewegung<br />
<strong>des</strong> Mädchens, das nach seiner eigenen, schmerzenden Hand<br />
greift, einen Widerhall in den Rindenarealen der Frau hervor, die über das<br />
oben beschriebene System der Spiegelneuronen an ihrer motorischen<br />
Steuerung mitwirken. Die Aktivierung der Spiegelneuronen führt wahrscheinlich<br />
dazu, dass die Frau ihre eigenen Arm- und Handmuskeln spürt,<br />
während sie dem Mädchen zusieht, und das wiederum führt dazu, dass<br />
die Frau nach der Hand <strong>des</strong> Mädchens greift.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
844 STEIN BRÅTEN<br />
Wenn sie dann mit ihrer eigenen Hand nach der schmerzenden Hand<br />
<strong>des</strong> Mädchens greift, verschiebt sich der Bezugsrahmen von der Beteiligung<br />
<strong>des</strong> virtuellen Anderen an der Greifbewegung <strong>des</strong> Mädchens zu der<br />
vom Ego ausgeführten eigenen Greifbewegung. Dies können wir unter<br />
dem Gesichtspunkt <strong>des</strong> Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen *A folgendermaßen<br />
beschreiben:<br />
F.s sei das tatsächliche Schmerzgefühl <strong>des</strong> Mädchens und *A.*s das Gefühl,<br />
mit dem die Frau über ihren Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen an den<br />
Schmerzen <strong>des</strong> Mädchens teilhat. E.g bezeichnet den tatsächlichen Griff nach<br />
der Hand und *A.*g den gespiegelten Griff nach der Hand, der bei der Frau<br />
durch die Wahrnehmung der tatsächlichen Greifbewegung <strong>des</strong> Mädchens ausgelöst<br />
wird. Die in der Zeichnung dargestellte Situation kann man dann folgendermaßen<br />
beschreiben:<br />
Mädchen (F.s & E.g) und Frau (*A.*s & *A.*g) verursachen bei der Frau<br />
(E.g)<br />
Wenn das Mädchen, das Schmerzen hat (F.s), nach seiner Hand greift (E.g),<br />
hat die Frau nicht nur Teil an den Schmerzen (*A.*s), sondern die Greifbewegung<br />
<strong>des</strong> Mädchens aktiviert bei der Frau über Spiegelneuronen den<br />
Greif-Widerhall (*A.*g); das wiederum veranlasst die Frau, die Hand auszustrecken<br />
(E.g) und nach der schmerzenden Hand <strong>des</strong> Mädchens zu greifen<br />
(vgl. Bråten 2002, S. 290f.; 2007b, S. 134f., sowie Fußnote 4).<br />
Der Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs von Fürsorge und Misshandlung<br />
Dezentrierung in der Stammesgeschichte<br />
Im Gegensatz zu Piagets Behauptung, die Egozentrizität werde im Laufe<br />
der Ontogenie dezentriert, machen die zuvor gezeigten Bilder von Säuglingen<br />
deutlich, dass eine solche Dezentrierung bereits in der Phylogenese<br />
stattgefunden haben muss. In Anspielung auf jene kritische Evolutionsphase,<br />
in der die Homininenmütter sich den aufrechten Gang zu eigen<br />
machten und ihre Säuglinge den Vorteil in Form von Schutz und Belehrung<br />
verloren, <strong>des</strong>sen sich die Primatensäuglinge erfreuten, solange sie<br />
sich an den Rücken klammern konnten, habe ich folgende Vermutung<br />
formuliert: Bevor die Babyschlingen (vielleicht von Müttern der Spezies<br />
Homo erectus) erfunden wurden, wären die Hominidenarten vom Aussterben<br />
bedroht gewesen, wenn ihre kleinen Nachkommen, die sie auf<br />
dem Erdboden absetzen mussten, nicht in der Lage gewesen wären, zuzuhören,<br />
allein zurechtzukommen und sich durch altero-(mutter-)zentrierte<br />
<strong>Partizipation</strong> von Angesicht zu Angesicht aus der Entfernung versorgen<br />
zu lassen (Bråten 2004b; vgl. dazu Falk 2004)<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 845<br />
Im Gegensatz zu Schimpansenjungen, die auf dem Rücken der Mutter<br />
reiten und so ihre Wahrnehmung ohne jede Spiegelung und Umkehrung<br />
teilen können, war die Dezentrierung mit dem Erlernen der Fähigkeit, in<br />
Gegenüberposition zurechtzukommen und durch Blickkontakt zu lernen,<br />
wahrscheinlich für die Säuglinge der Homininen von entscheidender Bedeutung,<br />
und es führte zur Entstehung ihrer Fähigkeit zur altero-(mutter-)zentrierten<br />
<strong>Partizipation</strong>, die ausschließlich der menschlichen Spezies eigen ist. 7<br />
Ursachen prosozialen und sogar altruistischen Verhaltens bei Kleinkindern<br />
Diese grundlegende intersubjektive Fähigkeit macht, wie Stern erklärt,<br />
Nachahmung, Empathie und Identifikation möglich. Und das ist noch<br />
nicht alles: Auf dem Weg über empathische Identifikation dürfte sie auch<br />
dazu beitragen, bei Säuglingen prosoziale Verhaltensweisen und bei Kleinkindern<br />
sogar altruistisches Verhalten auszulösen (vgl. Beispiele in Bråten<br />
1996a, b; Whiting & Edwards 1988: Zahn-Waxler, Radke-Yarrow & King<br />
1979). Wie gesagt: Durch die angeborene Fähigkeit zur virtuellen, alterozentrischen<br />
<strong>Partizipation</strong> an Kummer oder gefühlten Bedürfnissen eines<br />
Gegenüber, die wie aus dem Zentrum <strong>des</strong> Patienten selbst heraus wahrgenommen<br />
werden, ergibt sich im Kind eine natürliche Neigung, Besorgnis<br />
zu empfinden und manchmal zu versuchen, dem Gegenüber – unter Umständen<br />
sogar zum eigenen Nachteil – zu helfen, wenn Situation und motorische<br />
Fähigkeiten es zulassen (Bråten 2000b).<br />
Zahn-Waxler, Radke-Yarrow & King (1979) berichteten beispielsweise über<br />
prosoziale Verhaltensweisen bei Kindern, die noch keine zwei Jahre alt waren:<br />
7 Deshalb fiel Dornes (2002, S. 313) mit seinen »offenen Fragen« zum virtuellen Anderen<br />
offenbar einem Missverständnis zum Opfer: Er reduzierte sie auf Fragen nach »angeborenen<br />
(interaktiven) Erwartungen« und behauptet, solche müssten auch im Tierreich<br />
gelten. Zunächst einmal lautet das Schlüsselwort hier nicht »Erwartungen«, sondern<br />
»<strong>Bewegungen</strong>«. Zweitens besteht ein entscheidender Unterschied zwischen uns und den<br />
Schimpansen, unseren engsten Verwandten unter den Primaten, im Fehlen eines längeren<br />
Blickkontakts bei den Schimpansen (worauf Bruner 1996, S. 163, unter Bezugnahme<br />
auf Savage-Rumbaugh et al. 1993 hinweist). Das Gleiche habe auch ich festgestellt, als ich<br />
zehn Jahre lang die Interaktionen zwischen Säuglingen und Erwachsenen bei Menschen<br />
und Schimpansen (in einem Zoo und Tierpark in Südnorwegen) verglich. Eine gewisse<br />
Form <strong>des</strong> kulturellen Lernens findet auch bei Schimpansen statt – sie lernen zum Beispiel,<br />
wie man einen Stock benutzt, um Honig aus einem Baumstamm zu ziehen –, aber<br />
dabei handelt es sich sicher nicht um jene einzigartige Form <strong>des</strong> Lernens von Angesicht<br />
zu Angesicht, das sich in den Interaktionen zwischen menschlichen Säuglingen und Erwachsenen<br />
zeigt. Entsprechend findet auch nicht die für den Blickkontakt nötige Spiegelungsumkehr<br />
statt (vgl. Bråten 2009, S. 120–125).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
846 STEIN BRÅTEN<br />
Sie reagierten und versuchten zu helfen, wenn sie den Eindruck hatten, dass<br />
ein Geschwister oder Elternteil Schmerzen litt. In einer Episode reagierte die<br />
18 Monate alte Julia auf ein weinen<strong>des</strong> Baby, indem sie es am Kopf tätschelte,<br />
Kekse anbot und, wenn gar nichts half, die Mutter dazuholte. Wie Rheingold<br />
& Emery (1986, S. 76) deutlich machen, können Kinder schon in geringerem<br />
Alter und gegenüber vielfältigen Empfängern Fürsorge anbieten, auch<br />
gegenüber Puppen, die sie selbst mit Leben erfüllen. Ein anderes Beispiel<br />
stammt aus meinen eigenen Aufzeichnungen: Die knapp zwölf Monate alte<br />
Oda sitzt auf dem Schoß ihres Vaters und wird von der Mutter mit einem Löffel<br />
gefüttert. Hin und wieder darf sie den Löffel selbst in die Hand nehmen;<br />
dann füttert sie umgekehrt die Mutter und lässt sie sogar aus ihrer Saftflasche<br />
trinken. Was Oda noch vor dem ersten Geburtstag und Rose im zweiten Lebensjahr<br />
mit dem Teilen <strong>des</strong> Kakaos tut, mag Wissenschaftlern, die Verhalten<br />
unter dem Gesichtspunkt <strong>des</strong> kurz- oder langfristigen Nutzens für rationale<br />
Akteure betrachten, rätselhaft erscheinen.<br />
Grundlagen für den Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs<br />
Versorgungssituationen mögen nach einseitigen Tätigkeiten aussehen,<br />
man muss sie aber als Handlungen auf Gegenseitigkeit neu definieren: Der<br />
Säugling beteiligt sich an dem, was der Betreuer tut, und lernt gerade bei<br />
dieser Betreuung durch alterozentrische <strong>Partizipation</strong>. Dies steht im Einklang<br />
mit Studienergebnissen, wonach die Qualität der Versorgung mit<br />
darüber bestimmt, wie Kinder gegenüber anderen, die in Notlagen sind,<br />
reagieren: Stammen sie aus einem fürsorglichen Umfeld, werden sie anderen<br />
Kindern, die etwas brauchen oder Kummer haben, wahrscheinlich<br />
helfen und sie zu trösten versuchen (Berk 1989; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow<br />
& King 1979). Ich habe dafür folgende Erklärung: Die Fürsorge, die<br />
der Säugling mit Hilfe der alterozentrischen <strong>Partizipation</strong> häufig erlebt,<br />
bietet die Grundlage für einen Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs einer gleichartigen<br />
Versorgung gegenüber anderen Kindern, die etwas brauchen oder<br />
Kummer haben. Wenn der Säugling in Form einer gegenseitigen, gefühlten<br />
Unmittelbarkeit häufig eine sensible Betreuung erlebt, wird damit die<br />
Grundlage für den gegenseitigen Nachvollzug einer ähnlichen Fürsorge<br />
gegenüber anderen, bedürftigen oder bekümmerten Kindern gelegt.<br />
Auch Misshandlung kann einen Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs in Gang setzen<br />
Bei den Erlebnissen mit Betreuern muss es sich natürlich nicht immer um<br />
die Erfahrung von Fürsorge, Trost und Halten (in Winnicotts Sinn) handeln.<br />
Von Eltern, Betreuern und anderen können auch verschiedene Formen<br />
der schweren Misshandlung kommen. Wenn sensible Betreuung<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 847<br />
einen Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs in Gang setzt, sollte man damit rechnen,<br />
dass Misshandlungserlebnisse im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung<br />
manchmal ebenfalls zu einem Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs führen.<br />
Ein Kind, das zum Opfer von Misshandlungen wird, ist nicht nur gezwungen,<br />
die Opferrolle zu durchleben, sondern es hat auch das Gefühl,<br />
an den Misshandlungstaten teilzunehmen, und es hat teil an den Vitalitätskonturen,<br />
in denen sich die Art der Misshandlung und die Gefühle, die dahinter<br />
stehen, widerspiegeln. Aufgrund einer solchen alterozentrischen<br />
<strong>Partizipation</strong> erlebt das Opfer unter Umständen nicht nur das Leiden,<br />
sondern auch die Mitwirkung an den Körperbewegungen und Gefühlen<br />
<strong>des</strong> Misshandlers. In dem Opfer bleibt damit eine nachdrückliche körperliche<br />
und emotionale Erinnerung zurück, und damit steigt die Wahrscheinlichkeit<br />
für einen Kreislauf der nachvollzogenen Misshandlung in<br />
Beziehungen unter Gleichaltrigen oder gegenüber jüngeren Kindern; dieser<br />
ergibt sich im weiteren Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung aus den<br />
aus Bewegung erwachsenen Erinnerungen daran, dass man virtuell an den<br />
Misshandlungen durch den tatsächlichen Anderen teilgenommen hat,<br />
während das körperliche Ich <strong>des</strong> Opfers zu leiden hatte.<br />
Empirische Belege: Misshandelte Kleinkinder misshandeln häufiger<br />
als andere auch selbst, und viele Erwachsene, die Kinder misshandeln,<br />
wurden in ihrer Kindheit selbst misshandelt<br />
Bevor die Abwehrmechanismen einsetzen, ist das misshandelte Kind also<br />
nicht nur das Opfer der Misshandlung, sondern es nimmt als Mitvollzieher<br />
der Misshandlung an den verletzenden Taten teil, womit sich einer von<br />
mehreren Wegen zu einer größeren Wahrscheinlichkeit eröffnet, dass ein<br />
Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs der Misshandlung gegenüber anderen potentiellen<br />
Opfern in Gang kommt. 8<br />
Aus dem oben Gesagten folgt, dass Kinder, deren Versorgung oder<br />
elterliche Fürsorge durch Härte, Strafen, Missachtung oder Gewalt geprägt<br />
war, gegenüber gleichaltrigen oder jüngeren Kindern, die in Not<br />
sind, häufiger mit Angst, Wut oder sogar Angriffen reagieren als Kinder<br />
8 Es muss nicht zu einem Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs von Misshandlungen kommen; dem<br />
Opfer stehen auch andere Wege offen, z.B., sich von dem misshandelten Körper zu distanzieren<br />
oder das körperliche Ich vom virtuellen Anderen zu trennen, sodass beide unterschiedliche<br />
Wege gehen. Ebenso lässt sich der Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs von Misshandlungen<br />
verhindern, wenn die Fähigkeit <strong>des</strong> früheren Opfers zur alterozentrierten<br />
<strong>Partizipation</strong> im Verhältnis zu anderen Opfern nicht »abgeschaltet« wird und wenn das<br />
Streben nach Schmerzen nicht zur Motivation geworden ist.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
848 STEIN BRÅTEN<br />
mit einem anderen Erfahrungshintergrund. In diese Richtung weisen auch<br />
empirische Studien. George & Main (1979) beobachteten, wie misshandelte<br />
Kleinkinder andere Kinder misshandelten, und machten damit einen<br />
Teufelskreis im Hinblick auf die frühen Auswirkungen der Fürsorgequalität<br />
deutlich. Man konnte beobachten, wie schwer misshandelte Kleinkinder<br />
in Tagesstätten mit Angst oder Aggression auf andere, bekümmerte<br />
Kinder reagierten, und im zweiten Lebensjahr vollzogen sie bereits das<br />
gewalttätige Verhalten ihrer Eltern nach. Bei manchen Kleinkindern, die<br />
misshandelt worden waren, konnte man nie einen offenkundigen Ausdruck<br />
der Besorgnis um andere bekümmerte Kinder beobachten. Manchmal<br />
quälten sie das andere Kind sogar, bis es zu weinen begann, um es<br />
dann lächelnd mechanisch zu tätscheln oder zu versuchen, das weinende<br />
Kind zu beruhigen (Harris 1992 [1989]; George & Main 1979).<br />
Die Tragödie kindlicher Misshandlungsopfer besteht also in einem doppelten<br />
Teufelskreis. Sie sind nicht nur in ihrem eigenen Leben der vollständigen<br />
emotionalen Qualität beraubt, sondern durch einen Kreislauf <strong>des</strong><br />
Nachvollzugs bewegungsbedingter Erinnerungen an die Misshandlung<br />
werden manche von ihnen im weiteren Verlauf ihrer Persönlichkeitsentwicklung<br />
wahrscheinlich auch dazu getrieben, andere gleichermaßen der<br />
Lebensqualität zu berauben. Dies gilt allerdings sicher nicht für alle Opfer;<br />
viele von ihnen schlagen auch andere Wege ein, etwa den der Dissoziation,<br />
das heißt, sie trennen das körperliche Ich vom virtuellen Anderen <strong>des</strong><br />
Opfers, und beide nehmen einen unterschiedlichen Verlauf. Wenn die aus<br />
der Bewegung erwachsenden Erinnerungen an die als Kind erlittene Misshandlung<br />
ans Licht gebracht werden, erkennen manche Misshandler auch<br />
im erwachsenen Alter, dass bei ihnen ein Fall <strong>des</strong> Nachvollzugskreislaufes<br />
vorliegt.<br />
Wie im Fall <strong>des</strong> Nachvollzugskreislaufes der Fürsorge, so ist auch hier<br />
keine begriffliche oder verbale »Erinnerung« erforderlich, damit Misshandlungserlebnisse<br />
in der gefühlten Unmittelbarkeit zum Nachvollzug<br />
führen. Männer und Frauen, die im Säuglingsalter oder in der frühen<br />
Kindheit zu Opfern von Inzest und Missbrauch wurden und bei denen im<br />
Erwachsenenalter eine Krise ausbricht, erkennen unter Umständen sogar<br />
als Erstes, dass sie Opfer waren. Aber während das Missbrauchserlebnis<br />
nicht in Form begrifflicher Erinnerungen repräsentiert wird, ist das Kind<br />
sicher auf sehr tiefgreifende Weise betroffen. Deshalb ist der zusammengesetzte<br />
Begriff »Erinnerung aus <strong>Bewegungen</strong> heraus« – Fogel (2004)<br />
spricht von teilnehmenden Erinnerungen – nützlich zur Bezeichnung der<br />
Gefühlserlebnisse und Erinnerungen daran, wie man sich mit den <strong>Bewegungen</strong><br />
<strong>des</strong> Anderen bewegt hat – Erinnerungen, die dem Säugling das<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 849<br />
Gefühl vermitteln, an der Bewegung und den damit verbundenen Emotionen<br />
teilzuhaben. Diese »Erinnerung aus Bewegung heraus« (in dem sich<br />
die Doppelbedeutung der gefühlsmäßigen und körperlichen Bewegung<br />
widerspiegelt) ist etwas anderes als die begriffliche Erinnerung höherer<br />
Ordnung, und sie wird auf unbeschreibliche Weise von Missbrauchsbewegungen<br />
beeinflusst, die als mitbegangen gefühlt werden; damit steigt die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass sich später in der Persönlichkeitsentwicklung ein<br />
Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs der zuvor gefühlten, mitvollzogenen <strong>Bewegungen</strong><br />
ausbildet. Diese Form <strong>des</strong> Lernens ist mit den klassischen Lerntheorien<br />
nicht zu erklären; sie sagen nur etwas darüber aus, wie man aus<br />
der Tatsache, dass man misshandelt wurde, lernt, zum Opfer zu werden<br />
und Opfer zu bleiben. 9<br />
Über mehrere Generationen einer Familie. – Manchmal erstrecken sich<br />
solche Teufelskreise <strong>des</strong> Nachvollzugs in einer Familie über mehrere Generationen<br />
(vgl. Cabassi 2007; Cabassi & Zini 2004, S. 103–112, 118ff.).<br />
Aber manchmal verwandelt sich ein Teufelskreis auch in eine kreative Spirale<br />
zwischen Ich und anderen, die über die tragischen Erlebnissen hinaus<br />
führt; manchmal lässt sich der Kreislauf auch durch Beratung oder Psychotherapie<br />
durchbrechen. 10<br />
9 In seinem Artikel über den virtuellen Anderen weist Dornes (2002) auf Zusammenhänge<br />
zwischen dem oben erwähnten Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzuges von Misshandlungen und<br />
den psychoanalytischen Vorstellungen von einer »Identifizierung mit dem Aggressor«<br />
oder einer »Identifikation mit dem Introjekt« hin; wie er aber betont, folgt aus dem hier<br />
gegebenen Bericht eine Art »Identifizierung auf einem sub-symbolischen, körpernahen<br />
Niveau ohne symbolische Repräsentanzen«: »[Bråtens] Theorie folgt der Intuition<br />
Freuds (1920g), dass der Wiederholungszwang letztlich ein biologisch fundiertes Phänomen<br />
ist, auch wenn er hier nicht im To<strong>des</strong>trieb, sondern eher in einer Art Resonanztheorie<br />
verankert wird« (Dornes 2002, S. 319; vgl. auch Dornes 2006, S. 100). Ja, der Unterschied<br />
liegt in der Verankerung im Lebensmechanismus <strong>des</strong> Widerhalls <strong>des</strong> virtuellen<br />
Anderen. Dies bedeutet virtuelle Beteiligung in einem enger gefassten Sinn, die Beteiligung<br />
an der gefühlten Unmittelbarkeit der <strong>Bewegungen</strong> <strong>des</strong> Misshandlers, als wäre man<br />
Miturheber; am Ende bleibt beim Opfer auch keine begriffliche, sondern eine körperliche<br />
Erinnerung, die den Kreislauf <strong>des</strong> Nachvollzugs in Gang setzen kann. Wie Dornes<br />
deutlich macht, wurde der Nachvollzug der Misshandlung oben mit den gleichen lebensspendenden<br />
Mechanismen erklärt, die bei Kindern auch in der Proto-Fürsorge und dem<br />
Nachvollzug der von ihnen erlebten Betreuung wirksam sind.<br />
10 Siehe auch den Fall Livio in Cabassi (2007): Dieser vollzieht gegenüber Gleichaltrigen<br />
die gewalttätigen Spielereien seines Vaters nach, bis der Teufelskreis durch erfolgreiche<br />
Beratung durchbrochen wird.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
850 STEIN BRÅTEN<br />
Wenn die Fähigkeit <strong>des</strong> virtuellen Anderen blockiert ist:<br />
Autismus und postpartale Depression<br />
Autismus: ein Defekt <strong>des</strong> Spiegelsystems<br />
Wie zuvor erwähnt, wird ein heutiger Säugling durch die phylogenetische<br />
Anpassung <strong>des</strong> Spiegelneuronensystems auf dem Weg über die Dezentrierung<br />
in die Lage versetzt, die Wahrnehmungsspiegelung umzukehren:<br />
Er wechselt von der Sichtweise <strong>des</strong> alterozentrischen Beteiligten, der die<br />
Handlungsweise <strong>des</strong> Vorbilds wahrnimmt, als würde er sie von <strong>des</strong>sen Zentrum<br />
aus erleben, zu einem im eigenen Körper zentrierten Orientierungsrahmen,<br />
der für die Ausführung <strong>des</strong> nachahmenden Nachvollzugs notwendig<br />
ist (Bråten 1998b, 2002; Billard & Arbib 2002). Während normale<br />
Kinder kraft der alterozentrischen Wahrnehmung das Gleiche tun können<br />
wie ihr Gegenüber, haben autistische Kinder in solchen Situationen Probleme,<br />
obwohl sie die Aufforderung »Mach das gleiche wie ich« verstehen<br />
und ihr nachkommen. Hebt das Gegenüber beispielsweise die Arme, vergleicht<br />
der Autist, der nicht zur alterozentrischen Spiegelung in der Lage ist,<br />
unter Umständen die Handflächen <strong>des</strong> Gegenübers mit den eigenen Händen<br />
und hebt dann die Arme mit einwärts gekehrten Handflächen (Bråten<br />
1998b; Ohta 1987; Whiten & Brown 1998). In der zweiten Auflage ihres Buches<br />
Children with Autism beziehen sich Trevarthen et al. (1998, S. 59) auf<br />
meine Vermutung, wonach zum Autismus ein Versagen <strong>des</strong> Mechanismus<br />
der alterozentrischen Handlungsweise gehört, was sich in Fehlern bei der<br />
Kartierung von Körper zu Körper widerspiegelt. Nach ihrer Vermutung<br />
»ist Autismus ein Zustand, in dem das betroffene Individuum nicht über<br />
wirksame Motivrepräsentationen für den ›virtuellen Anderen‹ verfügt«<br />
(Trevarthen et al. 1998, S. 60).<br />
Ramachandran & Oberman (2006) erforschten die Zusammenhänge zwischen<br />
Autismus und dem Spiegelneuronensystem und prägten die Formulierung<br />
von den »zerbrochenen Spiegeln«. Dazu gibt es einen einfachen,<br />
aber aufschlussreichen Test: Wenn normale Kinder willkürlich ihre Muskeln<br />
bewegen – beispielsweise durch Öffnen und Schließen der Faust –<br />
und dann zusehen, wie ein anderer das gleiche tut, geben die Motoneuronen<br />
<strong>des</strong> prämotorischen Cortex in beiden Fällen Impulse ab; Unterschiede<br />
gibt es aber in der Frequenz der Gehirnwellen: Sie ist vor den Muskelbewegungen<br />
größer und sinkt sowohl während der Muskelbewegung selbst<br />
als auch beim Anblick eines anderen, der die Bewegung ausführt. Stellt<br />
man die gleichen Messungen bei Kindern mit Autismus an, beobachtet<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 851<br />
man eine Abweichung: Bei ihnen sind die Mu-Wellen nicht unterdrückt,<br />
wenn sie einen anderen Menschen oder die Videoaufnahme eines Menschen<br />
sehen, der die Hand öffnet und schließt (Ramachandran & Oberman<br />
2006, S. 42). Mit anderen Worten: Hier ist an der Wahrnehmung <strong>des</strong>sen,<br />
was der andere mit seiner Hand tut, kein virtueller Anderer beteiligt.<br />
Würde eine alterozentrische <strong>Partizipation</strong> stattfinden, müsste man im<br />
Elektroenzephalogramm (EEG) eine Unterdrückung der Mu-Welle beobachten,<br />
wie sie sich bei Kontrollpersonen ohne Autismus einstellt. Dass<br />
ein System der zerbrochenen Spiegel ein Merkmal <strong>des</strong> autistischen Spektrums<br />
ist, kann man also – wie vorausgesagt (Bråten 1994; 1998b, 2002) –<br />
als gegeben betrachten. Im Zusammenhang mit dem beim Autismus auftretenden<br />
Identifikationsdefizit weist Hobson (2007) darauf hin, dass<br />
»es […] beim Erlebnis <strong>des</strong> Teilens in Episoden <strong>des</strong> Teilens sowohl einen auf<br />
den anderen zentralisierten Bestandteil als auch eine Ich-zentrierte Komponente<br />
gibt; die auf die andere Person zentrierte Komponente ergibt sich aufgrund<br />
der spezifisch menschlichen Neigung, die Einstellungen <strong>des</strong> Anderen<br />
aus Sicht <strong>des</strong> im Körper <strong>des</strong> Anderen verankerten Standpunkts wahrzunehmen<br />
und zu unterstellen. Dieses Bild ähnelt stark dem von Bråten (1998),<br />
der einen ›virtuellen Anderen‹ als Ergänzung zum körperlichen Ich postuliert<br />
[…] und die Ansicht vertritt, dass Personen mit Autismus nicht die<br />
›daraus entstehende sozio-emotionale Kultivierung der Perspektiven anderer‹<br />
besitzen, wie sie bei der inneren Teilnahme gefühlt werden« (Hobson<br />
2007, S. 270).<br />
Genau diese Fähigkeit zur alterozentrischen <strong>Partizipation</strong> am Anderen ist<br />
durch eine ausschließlich Ich-zentrierte Art blockiert, andere von außen<br />
zu beobachten, was jede Art von Empathie oder Einfühlung verhindert.<br />
Postpartale Depression<br />
Ich möchte mich jetzt Fällen zuwenden, in denen die Fähigkeit <strong>des</strong> virtuellen<br />
Anderen zur alterozentrischen <strong>Partizipation</strong> vorübergehend durch<br />
die Ich-Zentriertheit blockiert ist, die bei der postpartalen Depression ausgelöst<br />
wird. Lynne Murray (1991, S. 228f.) weist in einem Artikel über<br />
die Intersubjektivität von Säuglingen und Kindern postpartal depressiver<br />
Frauen darauf hin, dass eine frühzeitige Interaktion zwischen Mutter und<br />
Säugling durch die Depression erheblich beeinträchtigt sein kann: »Statt<br />
der Beschäftigung mit dem Säugling, durch die die Mutter in der Erfahrung<br />
<strong>des</strong> Säuglings den Platz <strong>des</strong> ›virtuellen Anderen‹ einnehmen und damit<br />
eine ergänzende Form der Reaktionsfähigkeit vermitteln kann, dominieren<br />
im Bewusstsein der depressiven Frau zuallererst ihre eigenen<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
852 STEIN BRÅTEN<br />
Besorgnisse und Bedürfnisse.« Das Postulat <strong>des</strong> virtuellen Anderen formuliert<br />
Murray so:<br />
»Bråten vertritt die Ansicht, dass die Voraussetzung für Intersubjektivität<br />
in der von ihrem Wesen her dyadischen Organisation <strong>des</strong> Einzelnen<br />
besteht. Nach seiner Vorstellung gibt es im zentralen Nervensystem <strong>des</strong><br />
Neugeborenen besondere Schaltkreise, die das sofortige Mit-Dasein eines<br />
ergänzenden Beteiligten verursachen, den er als ›virtuellen Anderen‹ bezeichnet<br />
und <strong>des</strong>sen Platz ein tatsächlicher Anderer einnehmen kann.<br />
Der virtuelle Andere ist nicht nur die operative Voraussetzung für Intersubjektivität,<br />
sondern eine ›gefühlte Perspektive‹, ein noch nicht realisiertes<br />
Anderssein, das durch den tatsächlichen Anderen, der im Kreislauf <strong>des</strong> Dialoges<br />
seinen Platz einnimmt, realisiert wird« (Murray 1991, S. 221).<br />
Murray stellt im Weiteren Verbindungen her zwischen Implikationen <strong>des</strong><br />
Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen und Arbeiten von Winnicott und<br />
auch der Ansicht von Bion (2002 [1962]), wonach sich ein Säugling dann,<br />
wenn Mutter und Säugling aufeinander eingestimmt sind, so verhält, dass<br />
eine projizierte Identifikation ein normales Phänomen ist: das Erleben <strong>des</strong><br />
Säuglings wird auf den tatsächlichen Anderen »projiziert« oder so gefühlt,<br />
als wäre es in ihm zuhause (Murray 1991, S. 222). 11<br />
Das Muster <strong>des</strong> vollkommenen zeitlichen Ablaufs und der Abwechslung,<br />
die von Wissenschaftlern in der Beziehung zwischen Mutter und Säugling<br />
dokumentiert wurden, werden, wie Murray betont, als natürliche Gesetzmäßigkeiten<br />
einer allerdings asymmetrischen Dialogorganisation konzi-<br />
11 In seinem Buch Die Seele <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> widmet Martin Dornes (2006) dem virtuellen Anderen<br />
ein ganzes Kapitel, und er stellt auch einen Zusammenhang zwischen Folgerungen<br />
aus dem virtuellen Anderen und Bions Theorie her: »Nahe an Bråtens Theorie liegt Bions<br />
Idee, der Säugling habe eine angeborene Präkonzeption von der Brust, wenn man Brust<br />
als Metapher für Objekt oder Objektbeziehung versteht. Auch seine Idee von Präkonzeptionen,<br />
die auf Realisierungen treffen müssen, um Konzeption zu werden […], weist<br />
eine fast verblüffende Übereinstimmung mit Bråtens Gedanken auf, auch wenn die Terminologie<br />
eine andere ist« (S. 88). Wie in den Abbildungen 1, 2 und 3 deutlich wird, ist<br />
keine Brust und kein Objekt im Spiel, sondern es geht um das Gegenüber der Gesichter in<br />
Beziehungen zwischen Subjekten. Wenn Dornes (2002, S. 312; 2006, S. 89) infrage stellt,<br />
ob eine solche neue Terminologie notwendig ist, kann man auf den entscheidenden Unterschied<br />
hinweisen: auf der einen Seite Bions angeblich »angeborene Schemata vom Objekt<br />
(›Brust‹)«, auf der anderen die unentbehrliche Subjekt-Subjekt-Gemeinsamkeit im<br />
Blickkontakt, die durch den virtuellen Anderen <strong>des</strong> Säuglings möglich wird. Dies räumt<br />
auch Dornes (2006, S. 98) teilweise ein: Er vergleicht meine Betonung »einer körperlichen<br />
Simulation der Bewegung, in welcher der Säugling sich fühlt«, mit der von Merleau-Ponty<br />
betonten »Zwischenleiblichkeit«. Außerdem zeigt sich Bion nach Angaben von Lipgar &<br />
Pines (2003, S. 238) »nicht sehr beeindruckt von der Empathie«, den Mechanismus <strong>des</strong><br />
virtuellen Anderen hält er aber für eine entscheidende Voraussetzung der Einfühlung.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 853<br />
piert, die ihre eigenen, unter operationellen Gesichtspunkten definierten<br />
Schaltkreise vervollständigt. Durch Mütter mit postpartaler Depression<br />
wird dieses Wechselspiel jedoch gestört, weil sie zur Selbstzentriertheit neigen<br />
und den Säugling mehr oder weniger als Objekt behandeln.<br />
Therapeutische Anleitung für eine Mutter mit postpartaler Depression: ein Beispiel<br />
In einer Studie, in der depressive Mütter sich unter Anleitung viele Aufnahmen<br />
von sich selbst und ihren Neugeborenen ansahen, konnten Vik & Bråten<br />
(2009, S. 1–14) Fälle belegen, in denen einige Mütter unter Video-Anleitung<br />
durch Vik ihre Selbstzentriertheit hinter sich lassen konnten. In einem dieser<br />
Fälle handelte es sich um eine Flüchtlingsmutter, die anfangs kaum flüstern<br />
konnte, sich fast vollständig selbstzentriert in sich selbst zurückzog und ihr<br />
Neugeborenes fast wie ein Päckchen behandelte, das sie von einem Zimmer<br />
ins andere trug. Als der Therapeut sie im ersten Gespräch fragte, was ihr in<br />
der Beziehung zu ihrem Sohn am schwierigsten vorkam, konnte sie nur mit<br />
Mühe flüstern: »Er kennt mich nicht.« Dieses widerwillige Eingeständnis<br />
kennzeichnet einen seltsamen Augenblick, in Sterns Begriffen einen entscheidenden<br />
Gegenwartsmoment <strong>des</strong> »kairos«. Dann sah sie sich aber zusammen<br />
mit dem Therapeuten Videoaufnahmen von sich und ihrem Baby an, die zur<br />
Gemeinschaft aufforderten, während der Therapeut entsprechend der Methode<br />
von Marte Meo (2002) darauf achtete, negative Episoden der Missachtung<br />
und Distanziertheit nicht zu kommentieren, sondern nur Bemerkungen<br />
zu Episoden zu machen, die eine stärkere Teilnahme der Mutter versprachen.<br />
Daraufhin zeigte die Mutter nach und nach größeres Interesse an den Vorgängen<br />
auf dem Bildschirm. Plötzlich, während einer späteren Sitzung, kam dann<br />
in der Begegnung mit dem Therapeuten ein entscheidender Augenblick; er<br />
wurde daran deutlich, dass die Mutter aus ihrem selbstzentrierten Zustand<br />
ausbrach und die Worte <strong>des</strong> Therapeuten vervollständigte:<br />
»Therapeut: Und dann sagen Sie: ›Vielleicht hat er Hunger.‹<br />
Mutter: [nickt]<br />
Therapeut: Und Sie sind nicht ganz … es sieht nicht aus, als wären Sie<br />
ganz …<br />
Mutter: sicher.<br />
Therapeut: sicher« (Vik & Bråten 2009, S 294).<br />
Die Mutter geht hier über ihren selbstzentrierten Zustand hinaus und lässt alterozentrische<br />
<strong>Partizipation</strong> an den Worten <strong>des</strong> Therapeuten erkennen: Sie<br />
vervollständigt seine Äußerung, als wäre die Mutter eine Miturheberin oder<br />
als spräche sie aus der Sicht <strong>des</strong> Therapeuten (in dem Gesprächsauszug oben<br />
durch kursive Schrift gekennzeichnet). Gemeinsam erleben sie einen »Augenblick<br />
der Begegnung«, wie Stern (2005, 2007) es nennt; dieser ist definiert als<br />
gegenwärtiger Augenblick einer gegenseitigen, alterozentrischen <strong>Partizipation</strong>,<br />
in dem zwei Partner ein gemeinsames Krisenlösungserlebnis schaffen<br />
und erleben, das durch einen vorangegangenen Jetzt-Moment erzeugt wurde.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
854 STEIN BRÅTEN<br />
Von nun an wird die Mutter in ihrem Gespräch mit dem Therapeuten mehr<br />
Lebhaftigkeit und eine stärkere Beteiligung erkennen lassen, was sich auch in<br />
ihrer gesteigerten Sensibilität und dem häufigeren Ausdruck von Zuwendung<br />
in Verhältnis zum Baby widerspiegelt. Damit hatte sich die Qualität <strong>des</strong> Wechselspiels<br />
zwischen Säugling und erwachsener Frau verbessert.<br />
Als die Mutter den Satz <strong>des</strong> Therapeuten vervollständigte, manifestierte<br />
sich darin ihre alterozentrische <strong>Partizipation</strong> an dem, was der Therapeut sagen<br />
wollte – ein Hinweis, dass ihre Fähigkeit zur sympathischen Identifikation im<br />
Wiedererwachen begriffen war, und das wiederum war von Bedeutung für ihr<br />
Wechselspiel mit dem Säugling.<br />
Schlussbemerkungen: Schichten der intersubjektiven Einstimmung<br />
und Vollzug in der Persönlichkeitsentwicklung<br />
In diesem Artikel habe ich die Ursprünge und Grundlagen der (prä-)verbalen<br />
Intersubjektivität im Licht neuer Befunde aus den letzten vier Jahrzehnten<br />
untersucht; dazu gehörten die Entdeckung der Spiegelneuronen<br />
sowie der Nachweis von Intersubjektivität und alterozentrischer <strong>Partizipation</strong><br />
bei Säuglingen. Als genaue Umkehrung der Wahrnehmung <strong>des</strong><br />
Anderen – <strong>des</strong> Vorbilds oder <strong>des</strong> Gegenübers – aus egozentrischer Sicht<br />
umfasst alterozentrische <strong>Partizipation</strong> die empathische Fähigkeit, sich mit<br />
dem Anderen nach Art eines virtuellen Beteiligten zu identifizieren, der<br />
gegenwärtige Augenblicke <strong>des</strong> gemeinsamen Vollzugs oder der geteilten<br />
Erfahrungen hervorruft, als befände er sich im körperlichen Zentrum <strong>des</strong><br />
Anderen (vgl. Bråten 1998b, 2007a; Stern 2005, 2007, 2010).<br />
In den letzten vier Jahrzehnten sind neue Befunde der Säuglingsforschung,<br />
mit denen die Fähigkeit zu intersubjektiver Einstimmung von Geburt<br />
an nachgewiesen wurde, an die Stelle früherer theoretischer Vorstellungen<br />
getreten, wonach Säuglinge nichtsozial und egozentrisch sind; wie<br />
wir heute wissen, sind Säuglinge zu zwischenmenschlicher Gemeinsamkeit<br />
in der Lage und lernen durch alterozentrische <strong>Partizipation</strong>, die durch<br />
den Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen möglich wird. In der neuen Einleitung<br />
von Die Lebenserfahrung <strong>des</strong> Säuglings erklärt Daniel Stern, die<br />
Befunde aus jüngster Zeit<br />
»lassen vermuten, dass der Säugling wahrscheinlich von Beginn <strong>des</strong> Lebens<br />
an die Fähigkeit für die ›altero-zentrische <strong>Partizipation</strong>‹ (Bråten 1998) besitzt,<br />
die von Trevarthen (1979) lange Zeit als ›primäre Intersubjektivität‹<br />
bezeichnet wurde« (Stern 2010, S. XII).<br />
Heute können wir auf der Grundlage empirischer Befunde aus den letzten<br />
vier Jahrzehnten in der Entwicklung je<strong>des</strong> Menschen verschiedene Schich-<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 855<br />
ten der intersubjektiven Einstimmung unterscheiden; diese erwachsen aus<br />
den Grundlagen der Säuglings-Intersubjektivität, die Trevarthen (1979) als<br />
Erster definieren konnte und die sowohl auf den nachahmenden Nachvollzug<br />
und das Lernen im Säuglingsalter als auch auf die Schritte von der<br />
verkörperten Simulation von Handlungen bis zur Simulation geistiger<br />
Vorgänge neues Licht werfen. Solche Schritte sind mit diesen Schichten<br />
der intersubjektiven Einstimmung verbunden, die bereits bei der Geburt<br />
wirksam sind und sich während <strong>des</strong> ganzen Lebens fortsetzen; sie unterstützen<br />
dann die Ebenen höherer Ordnung, darunter sowohl die sekundäre,<br />
die von Trevarthen & Hubley (1978) definiert wurde, als auch die<br />
tertiäre, von Bråten & Trevarthen (2000, 2007) definierte Schicht:<br />
1. Primäre intersubjektive Einstimmung in einem gegenseitigen Subjekt-Subjekt-Format<br />
der Protokonversation und zwischenmenschlichen<br />
Gemeinsamkeit zeigt sich in den ersten Tagen, Wochen und Monaten <strong>des</strong><br />
Lebens; sie weist auf die gegenseitige Spiegelung und alterozentrische <strong>Partizipation</strong><br />
hin, die in den Berichten am Anfang sowie in den Abbildungen 1<br />
und 2 deutlich gemacht wurden; wie wir feststellen können, setzt sie sich<br />
als dauerhafte operative Schicht (die allerdings beim Autismus gestört ist)<br />
während <strong>des</strong> ganzen Lebens fort und unterstützt auch die folgenden<br />
Schichten höherer Ordnung.<br />
2. Sekundäre intersubjektive Einstimmung in Dreiecksform (Subjekt-<br />
Subjekt-Objekt) umfasst gemeinsame Aufmerksamkeit und alterozentrische<br />
<strong>Partizipation</strong> in den objektorientierten <strong>Bewegungen</strong> der beiden Beteiligten,<br />
wie man sie in den Abb. 3 und 4 erkennt. Dies beginnt zwischen<br />
dem sechsten und neunten Lebensmonat mit der gemeinschaftlichen Nutzung<br />
von Objekten als gemeinsame emotionale Bezugspunkte und mit<br />
dem nachahmenden Lernen durch alterozentrische <strong>Partizipation</strong> an <strong>Bewegungen</strong><br />
zur Handhabung von Objekten; dies begünstigt einen Kreislauf<br />
<strong>des</strong> Nachvollzugs: Lernen durch Nachahmung bei der Manipulation von<br />
Gegenständen und beim Nachspielen der Handlungen <strong>des</strong> Betreuers.<br />
Noch früher, im Alter von 4 bis 12 Monaten, entfaltet sich das von Winnicott<br />
(1974 [1953]) nachgewiesene, neu geschaffene Wechselspiel mit den<br />
Eltern, wobei eine Puppe, ein Daumen, ein Stück Stoff oder ein anderes<br />
»Übergangsobjekt« Verwendung findet, das vom virtuellen Anderen <strong>des</strong><br />
Säuglings so betrachtet wird, als wäre es mit Leben erfüllt. 12<br />
12 Winnicott vergleicht dies mit der Art, wie Erwachsene eine Leinwand, Ballettschuhe<br />
oder andere Gegenstände als Hilfsmittel für ihren kreativen Ausdruck verwenden. Man<br />
kann auch eine Verbindung zu dem problemverarbeitenden Selbstdialog herstellen, den<br />
Piaget als »egozentrisches Sprechen« bezeichnete. Er rechnete damit, dass es im Schul-<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
856 STEIN BRÅTEN<br />
3. Tertiäres intersubjektives Verständnis im Gespräch und beim erzählenden<br />
Sprechen umfasst Prädikation und ein Gespür für das verbale oder<br />
erzählende Selbst und den Anderen in der symbolischen Kommunikation<br />
erster Ordnung (von etwa 18 bis 24 Monate). Das Verständnis zweiter<br />
Ordnung für geistige Vorgänge und Gefühle eines Anderen (Theorie oder<br />
Simulation <strong>des</strong> Mentalen von 3 bis 6 Jahre) ermöglicht das Einnehmen verschiedener<br />
Blickwinkel und die emotionale Aufnahme sogar bei fiktiven<br />
Anderen (Harris 1998), aber auch die Simulation <strong>des</strong> Mentalen eines Gesprächspartners,<br />
die ihren Ausdruck im Vervollständigen der Sätze <strong>des</strong><br />
Sprechers durch den Zuhörer findet (Bråten 1974, 2002, 2009, S. 273–294;<br />
vgl. die Beispiele in de Beauvoir 1983 [1981], wiedergegeben in Bråten<br />
2009, S. 251ff.).<br />
Wenn die Partner in einem Gespräch durch Vervollständigen von Sätzen<br />
zeigen, dass sie durch alterozentrische <strong>Partizipation</strong> am Sprechakt <strong>des</strong> Anderen<br />
gegenseitig die Vorgänge ergänzen, als wären sie Miturheber, schaffen<br />
sie bis zu einem gewissen Grade eine Parallele zu Prozessen niedrigerer<br />
Ordnung, die sich bereits in früheren Stadien der Persönlichkeitsentwicklung<br />
gezeigt haben, etwa wenn Säuglinge sich alterozentriert an den Handlungen<br />
der Betreuungsperson beteiligen, als hätte man sie vom Standpunkt<br />
<strong>des</strong> Betreuers aus an die Hand genommen und als wären sie<br />
Miturheber der Betreuung.<br />
Wichtig ist hier also, dass solche Leistungen höherer Ordnung durch<br />
Fähigkeiten und Kompetenzen unterstützt werden, die sich in Schichten<br />
niedrigerer Ordnung entfalten. Diese Schichten sind während <strong>des</strong> ganzen<br />
Lebens wirksam und hilfreich. Wie man an den Abbildungen und Beispielen<br />
erkennt, ist der Mechanismus <strong>des</strong> virtuellen Anderen auf allen diesen Ebenen<br />
der Intersubjektivität aktiv. Auf der primären Ebene (1) spielt sich die<br />
in Abb. 1 verdeutlichte gegenseitige Spiegelung ab, aber auch der Spiegel-<br />
Widerhall und die alterozentrische <strong>Partizipation</strong>, die durch Gesten und <strong>Bewegungen</strong><br />
<strong>des</strong> Anderen ausgelöst werden; dies erkennt man in Abb. 2: Das<br />
Neugeborene bereitet sich darauf vor, den Anderen nachzuahmen, und die<br />
Zuhörer öffnen unwillkürlich den Mund. Auf der objektorientierten zweiten<br />
Ebene (2) finden wir den Spiegel-Widerhall, der beim Fütternden –<br />
Erwachsenen oder Säugling – zum Öffnen <strong>des</strong> Mun<strong>des</strong> führt, wenn der Patient<br />
wie in Abb. 3 den Mund öffnet, um Nahrung zu sich zu nehmen. In<br />
alter verschwindet; wie Vygotskij (1969 [1934]) aber nachweisen konnte, setzt es sich<br />
auch später fort. Über viele solche Beispiele für Privatgespräche bei Kindern und Erwachsenen,<br />
an denen das körperliche Ich und der virtuelle Andere beteiligt sind, berichtet<br />
Bråten (2009, S. 216–223).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 857<br />
Abb. 4 erkennt man nicht nur die Aktivierung der Schmerzneuronen bei<br />
der Frau, sondern durch den Griff <strong>des</strong> Mädchens nach der schmerzenden<br />
Hand wird bei der Frau auch der Spiegel-Widerhall ausgelöst. Auf der tertiären<br />
Ebene (III) schließlich zeigt die depressive Mutter, die Sätze <strong>des</strong> Therapeuten<br />
vervollständigt, wie eine solche alterozentrische <strong>Partizipation</strong> ihre<br />
vorherige Selbstzentriertheit überwinden kann. In Sterns (2010) Begriffen<br />
ist dies ein Moment der Begegnung: ein »Moment der alterozentrischen<br />
<strong>Partizipation</strong>, in dem beide Partner ein gemeinsames Erleben schaffen und<br />
durchlaufen«, was das intersubjektive Feld zwischen ihnen erweitert.<br />
Kontakt: Prof. Dr. Stein Bråten, Holmenveien 68, 0376 Oslo, Norwegen.<br />
E-Mail: stein.braten@sosiologi.uio.no<br />
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel, Kerpen<br />
LITERATUR<br />
Aarts, M. (2002 [2000]): Marte Meo. Ein Handbuch. Übers. K. Roloff. Harderwijk (Aarts<br />
Productions).<br />
Bateson, M.C. (1975): Mother-infant exchanges: The epigenesis of conversational interaction.<br />
Ann N Y Acad Sci 263, 101–113.<br />
Beauvoir, S. de (1983 [1981]): Die Zeremonie <strong>des</strong> Abschieds und Gespräche mit Jean-Paul<br />
Sartre, August – September 1974. Übers. U. Aumülller u.E. Moldenhauer. Reinbek bei<br />
Hamburg (Rowohlt).<br />
Berk, L.E. (1989): Child Development. Boston (Allyn and Bacon).<br />
Billard, A. & Arbib, M. (2002): Mirror neurons and the neural basis for learning by imitation:<br />
Computational modelling. In: Stamenov, M.I. & Gallese, V. (Hg.), 343–352.<br />
Bion, W.R. (2002 [1962]): Eine Theorie <strong>des</strong> Denkens. In: Spillius, E.B. (Hg.): Melanie<br />
Klein heute. Bd. 1: Beiträge zur Theorie. Übers. E. Vorspohl. 3. Aufl. Stuttgart (Klett-<br />
Cotta), 225–235.<br />
Bråten, S. (1974): Coding simulation circuits during symbolic interaction. In: Proceedings<br />
of the 7th International Congress on Cybernetics, 1973. Namur (Association Internationale<br />
de Cybernétique), 327–336.<br />
– (1988a [1986]): Between dialogical mind and monological reason. Postulating the virtual<br />
other. In: Campanella, M. (Hg.): Between Rationality and Cognition. Turin, Geneva<br />
(Meynier), 205–236.<br />
– (1988b): Dialogic mind: The infant and the adult in protoconversation. In: Carvallo,<br />
M.E. (Hg.): Nature, Cognition, and System, I. Dordrecht (Kluwer), 187–205.<br />
– (1992): The virtual other in infants’ minds and social feelings. In: Wold, A.H. (Hg.): The<br />
Dialogical Alternative. Towards a Theory of Language and Mind. Oslo (Scandinavian<br />
UP), 77–97.<br />
– (1993): Infant attachment and self-organization in light of this thesis: Born with the other<br />
in mind. In: Gomnaes, I.L. & Osborne, E. (Hg.): Making Links, How Children Learn.<br />
Oslo (Yrkeslitteratur), 25–38.<br />
– (1994): Self-other connection in the imitating infant and in the dyad: The companion space<br />
theorem. In: Symposium Pre-proceedings on Intersubjective Communication and Emotion<br />
in Ontogeny. The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, August 1994.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
858 STEIN BRÅTEN<br />
– (1996a): When toddlers provide care: Infants’ ›companion space‹. Childhood 3, 449–465.<br />
– (1996b): Infants demonstrate that care-giving is reciprocal. Centre for Advanced Study<br />
Newsletter, No. 2 (November), 2.<br />
– (Hg.) (1998a): Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge<br />
(Cambridge UP).<br />
– (1998b): Infant learning by altercentric participation: the reverse of egocentric observation<br />
in autism. In: Ders. (Hg.) (1998a), 105–124.<br />
– (2000a): Modellmakt og altersentriske spedbarn. Essays on Dialogue in Infant & Adult.<br />
Bergen (Sigma).<br />
– (2000b [1997]): What enables infants to give care? Prosociality and learning by altercentric<br />
participation. In: Ders. (2000a), 231–243 (online: www.stein-braten.com/p00042.htm).<br />
– (2002): Altercentric perception by infants and adults in dialogue: Ego’s virtual participation<br />
in alter’s complementary act. In: Stamenov, M.I. & Gallese, V. (Hg.), 273–294.<br />
– (2003a): Participant perception of others’ acts. Virtual otherness in infants and adults.<br />
Culture & Psychology 9, 261–276.<br />
– (2003b): Beteiligte Spiegelung. Alterzentrische Lernprozesse in der Kleinkindentwicklung<br />
und der Evolution. In: Wenzel, U., Bretzinger, B. & Holz, K. (Hg.): Subjekte und Gesellschaft.<br />
Zur Konstitution von Sozialität. Weilerswist (Velbrück Wissenschaft), 139–216.<br />
– (2004a [1998]): Kommunikasjon og samspill – fra fødsel til alderdom [Communication<br />
and Interplay – From Birth to Old Age]. 2. Aufl. Oslo (Universitetsforlaget).<br />
– (2004b): Hominin infant decentration hypothesis: Mirror neurons system adapted to<br />
subserve mother-centered participation. Commenary. Behav Brain Sci 27, 508–509.<br />
– (Hg.) (2007a): On Being Moved: From Mirror Neurons to Empathy. Philadelphia, Amsterdam<br />
(Benjamins).<br />
– (2007b): Altercentric infants and adults: On the origins and manifestations of participant<br />
perception of others’ acts and utterances. In: Ders. (Hg.) (2007a), 111–135.<br />
– (2009): The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech. Amsterdam,<br />
Philadelphia (Benjamins).<br />
– & Gallese, V. (2004): On mirror neurons systems implications for social cognition and<br />
intersubjectivity. [Interview by L.T. Westlye and T. Weinholdt]. Impuls 58 (3), 97–107.<br />
– & Trevarthen, C. (2000): Beginnings of cultural learning. In: Bråten (2000a), 213–218<br />
(online: www.stein-braten.com/p00034.htm).<br />
– & – (2007): Prologue: from infant intersubjectivity and participant movements to simulation<br />
and conversation. In: Bråten, S. (Hg.) (2007a), 21–33.<br />
Bruner, J. (1996): The Culture of Education. Cambridge/Mass. (Harvard UP).<br />
Cabassi, A. (2007): Family disseminate archives: Intergenerational transmission and psychotherapy<br />
in light of Braten’s and Stern’s theories. In: Bråten, S. (Hg.) (2007a),<br />
255–265.<br />
– & Zini, M.T. (2004): L’assistente sociale e lo psicologo. Rome (Carocci Faber).<br />
Decety, J., Michalska, K.J. & Akitsuki, Y. (2008): Who caused the pain? An fMRI investigation<br />
of empathy and intentionality in children. Neuropsychologia 46, 2607–2614.<br />
Dornes, M. (2002): Der virtuelle Andere. Aspekte vorsprachlicher Intersubjektivität. Forum<br />
Psychoanal 18, 303–331.<br />
– (2006): Die Seele <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>. Entstehung und Entwicklung. Frankfurt/M. (Fischer).<br />
Eibl-Eibesfeldt, I. (1997): Die Biologie <strong>des</strong> menschlichen Verhaltens. Weyarn (Seehamer<br />
Verlag).<br />
Fadiga, L. (2000): Electrophysiological approaches to motor representations in humans. In:<br />
Gallese, V. & Stamenov, M. (Hg.): Preproceedings of the Symposium Mirror Neurons<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 859<br />
and the Evolution of Brain and Language. Hanse Wissenschaftskolleg, Delmenhorst,<br />
5.–8. 7. 2000, 9.<br />
Falk, D. (2004): The »putting the baby down« hypothesis: Bipedalism, babbling, and baby<br />
slings. Behav Brain Sci 27, 526–534.<br />
Ferrari, P.F. & Gallese, V. (2007 [2004]): Mirror neurons and intersubjectivity. In: Bråten, S.<br />
(Hg.) (2007a), 73–87.<br />
Fogassi, L., Ferrari, P.F., Chersi, E., Gieserich, B., Rozzi, S. & Rizzolatti, G. (2005): Parietal<br />
lobe: From action organization to intention understanding. Science 308, 662–667.<br />
Fogel, A. (2004): Remembering infancy: Accessing our earliest experiences. In: Bremner,<br />
G. & Slater, A. (Hg.): Theories of Infant Development. Cambridge (Blackwell), 204–230.<br />
Freud, A. & Burlingham, D. (1987 [1973]): Anstaltskinder. Berichte aus den Kriegskinderheimen<br />
»Hampstead Nurseries« 1933–1945. Übers. der Monatsberichte: M. Schröter.<br />
Die Schriften der Anna Freud, Bd. 3. Frankfurt/M. (Fischer).<br />
Freud, S. (1911b): Formulierungen über die zwei Prinzipien <strong>des</strong> psychischen Geschehens.<br />
GW 8, 230–238.<br />
– (1920g): Jenseits <strong>des</strong> Lustprinzips. GW 13, 1–69.<br />
George, C. & Main, M. (1979): Social interaction of young abused children: Approach,<br />
avoidance and aggression. Child Dev 50, 306–318.<br />
Grotstein, J. (2003): Introduction. Early Bion. In: Lipgar, R.M. & Pines, M. (Hg.), 9–25.<br />
Harris, P.L. (1992 [1989]): Das Kind und die Gefühle. Wie sich das Verständnis für die anderen<br />
Menschen entwickelt. Übers. M. Wengenroth. Bern (Huber).<br />
– (1998): Fictional absorption: emotional responses to make-believe. In: Bråten, S. (Hg.)<br />
(1998a), 336–353.<br />
Hobson, P. (2007): Communicative depth: Soundings from developmental psychopathology.<br />
Infant Behav Dev 30, 267–277.<br />
Hutchison, W.D., Davis, K.D., Lozano, A.M., Takser, R.R. & Dostrovsky, J.O. (1999):<br />
Pain-related neurons in the human cingulate cortex. Nat Neurosci 2, 403–405.<br />
Kugiumutzakis, G. (1985): The origin, development and function of the early infant imitation.<br />
Diss., Dept. of Psychology, University of Uppsala.<br />
– (1998): Neonatal imitation in the intersubjective companion space. In: Bråten, S. (Hg.)<br />
(1998a), 63–88.<br />
Liberman, A.M. (1993): Somme assumptions about speech and how they changed. Haskin<br />
Laboratories Status Report 113, 1–32.<br />
Lipgear, R.M. & Pines, M. (Hg.) (2003): Roots: Origins and Context of Bion’s Contribution<br />
to Theory and Practice. (Building on Bion). London, New York (Kingsley).<br />
Mahler, M.S., Pine, F. & Bergman, A. (1978 [1975]): Die psychische Geburt <strong>des</strong> Menschen.<br />
Symbiose und Individuation. Übers. H. Weller. Frankfurt/M. (Fischer).<br />
Meltzoff, A.N. & Moore, M.K. (1983): Newborn infants imitate adult facial gestures. Child<br />
Dev 54, 702–709.<br />
Merleau-Ponty, M. (1966 [1945]): Phäomenologie der Wahrnehmung. Übers. R. Boehm.<br />
Berlin (de Gruyter).<br />
Murray, L. (1991): Intersubjectivity, object relations theory, and empirical evidences from<br />
mother-infant interactions. Infant Ment Health J 12, 219–232.<br />
Ohta, M. (1987): Cognitive disorders of infantile autism. J Autism Dev Disord 17, 45–62.<br />
Papastathopoulos, S. & Kugiumutzakis, G. (2007): The intersubjectivity of imagination:<br />
The special case of imaginary companions. In: Bråten, S. (Hg.) (2007a), 217–233.<br />
Piaget, J. (1983 [1926]): Sprechen und Denken <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong>. Übers. N. Stöber. Frankfurt/M,<br />
Berlin, Wien (Ullstein).<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
860 STEIN BRÅTEN<br />
Ramachandran, V.S. & Oberman, L.M. (2006): Broken mirrors: A theory of autism. Scientific<br />
American 295 (5), 38–45.<br />
Rees, S. van & Leeuw, R. de (1987): Born Too Soon: The Kangaroo Method With Premature<br />
Babies. Video. Stichting Lichaamstaal (Gesellschaft für Körpersprache), Heuthuysen<br />
(Niederlande), www.stichtinglichaamstaal.nl.<br />
Rheingold, H.J. & Emery, G.N. (1986): The nurturant acts of very young children. In: Olweus,<br />
D., Block, J. & Radke-Yarrow, M. (Hg.): Development of Antisocial and Prosocial<br />
Behavior. Orlando (Academic Press), 75–96.<br />
Rizzolatti, G. & Arbib, M. (1998): Language within our grasp. Trends Neurosci 21,<br />
188–193.<br />
–, Graighero, L., & Fadiga, L. (2002): The mirror system in humans. In: Stamenov, M. &<br />
Gallese, V. (Hg.), 37–59.<br />
–, Fadiga, L., Fogassi, L. & Gallese, V. (1999): Resonance behaviors and mirror neurons.<br />
Arch Ital Biol 137, 85–100.<br />
Savage-Rumbaugh, E.S., Murphy, J., Sevcik, R.A., Brakke, K.E., Williams, S.L. & Rumbaugh,<br />
D.M. (1993): Language comprehension in ape and child. Monogr Soc Res Child<br />
Dev 58 (3–4), 1–222.<br />
Smith, A. (2010 [1759]): Theorie der ethischen Gefühle. Auf der Grundlage der Übers. von<br />
W. Eckstein neu hg. von H.D. Brandt. Hamburg (Meiner).<br />
Stamenov, M. & Gallese, V. (Hg.) (2002): Mirror Neurons and the Evolution of Brain and<br />
Language. Amsterdam, Philadelphia (Benjamins).<br />
Stern, D.N. (1999): Vitality contours: The temporal contour of feelings as a basic unit for<br />
constructing the infant’s social experience. In: Rochat, P. (Hg.): Early Social Cognition:<br />
Understanding Others in the First Year of Life. London (Erlbaum), 67–80.<br />
– (2005 [2004]): Der Gegenwartsmoment. Veränderungsprozesse in Psychoanalyse, Psychotherapie<br />
und Alltag. Übers. E. Vorspohl. Frankfurt/M. (Bran<strong>des</strong> & Apsel).<br />
– (2007): Applying developmental and neuroscience findings on other-centred participation<br />
to the process of change in psychotherapy. In: Bråten, S. (Hg.) (2007a), 35–47.<br />
– (2010 [2000]): Neue Einleitung <strong>des</strong> Autors. In: Ders.: Die Lebenserfahrung <strong>des</strong> Säuglings.<br />
10. Aufl. Übers. W. Krege, bearb. von E. Vorspohl. Stuttgart (Klett-Cotta), I–XXXIX.<br />
Trevarthen, C. (1974): Conversations with a two-month-old. New Scientist 2, 230–235.<br />
– (1979): Communication and cooperation in early infancy: A <strong>des</strong>cription of primary<br />
intersubjectivity. In: Bullowa, M. (Hg.): Before Speech: The Beginning of Interpersonal<br />
Communication. Cambridge (Cambridge UP), 227–270.<br />
– (1986): Development of intersubjective motor control in infants. In: Wade, M.G. &<br />
Whiting, H.T.A. (Hg.): Motor Development. Dordrecht (Nijhoff), 209–261.<br />
– & Hubley, P. (1978): Secondary intersubjectivity. In: Lock, A. (Hg.): Action, Gesture<br />
and Symbol: The Emergence of Language. London (Academic Press), 183–199.<br />
–, Aitken, K.J., Papoudi, D. & Robarts, J.Z. (1998 [1996]): Children with Autism:<br />
Diagnosis and Interventions to Meet their Needs. 2. Aufl. London (Kingsley).<br />
Vik, K. & Bråten, S. (2009): Video interaction guidance inviting transcendance of postpartum<br />
depressed mothers’ self-centered state and holding behavior. Infant Ment Health<br />
J 30, 287–300.<br />
Vygotksij, L.S. (1969 [1934]): Denken und Sprechen. Übers. G. Sewekow. Frankfurt/M.<br />
(Fischer).<br />
Whiten, A. & Brown, J.D. (1998): Imitation and the reading of other minds: perspectives<br />
from the study of autism, normal children and non-human primates. In: Bråten, S. (Hg.)<br />
(1998a), 260–280.<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Bezahlt von Kai von Klitzing (kai.vonklitzing@uniklinik-leipzig.de)<br />
INTERSUBJEKTIVE PARTIZIPATION 861<br />
Whiting, B.B. & Edwards, C.P. (1988): Children of Different Worlds. Cambridge (Harvard<br />
UP).<br />
Winnicott, D.W. (1974 [1953]): Übergangsobjekte und Übergangsphänomene. In: Ders.:<br />
Vom Spiel zur Kreativität. Übers. M. Ermann. Stuttgart (Klett-Cotta), 10–36.<br />
Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M. & King, R. (1979): Child rearing and children’s prosocial<br />
initiations towards victims in distress. Child Dev 50, 319–330.<br />
Summary<br />
Intersubjective participation: Virtual other movements in infants and adults. – In<br />
contrast to the egocentric point of departure for child development attributed by the<br />
Piagetian tradition, illustrations are given of newborns imitating and engaging in protodialogue<br />
with caregivers, and of prosocial behavior afforded by infants (11 months or<br />
older). An explanation is offered in terms of the virtual-other mechanism enabling<br />
altercentric participation in the other’s movements, and with the likely support of mirror<br />
neurons. Circular re-enactment of care and abuse is accounted for in terms of<br />
learning by virtual-other participation – a capacity that is partly blocked in autism and<br />
in postnatal depression, but which supports higher-order layers of intersubjective capacities<br />
in typical individuals.<br />
Keywords: »Einfühlung«; other-centred participation; primary intersubjectivity; mirror<br />
neurons<br />
Résumé<br />
Participation intersubjective: mouvements de l’autre virtuel chez les nourrissons et<br />
les adultes. – Contrairement à la tradition Piaget qui suppose un point de départ égocentrique<br />
pour le développement de l’enfant, ce texte donne <strong>des</strong> exemples montrant<br />
comment <strong>des</strong> nourrissons imitent ceux qui leur prodiguent <strong>des</strong> soins et entament un<br />
protodialogue avec ceux-ci et comment de jeunes enfants (11 mois et plus) présentent<br />
<strong>des</strong> formes de comportement protosociales. Ceci est expliqué selon un mécanisme,<br />
dans lequel l’autre virtuel – probablement avec le soutien de neurones miroir – permet<br />
une participation altérocentriste aux mouvements de l’autre. Le circuit de l’imitation<br />
du soin et de la maltraitance est expliqué par l’apprentissage grâce à la participation de<br />
l’autre virtuel – une capacité partiellement bloquée dans les cas d’autisme et de dépression<br />
post partale, mais favorisant <strong>des</strong> capacités intersubjectives supérieures chez les<br />
personnes normales.<br />
Mots clés: empathie; participation altérocentriste; intersubjectivité primaire; neurones<br />
miroir<br />
© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart