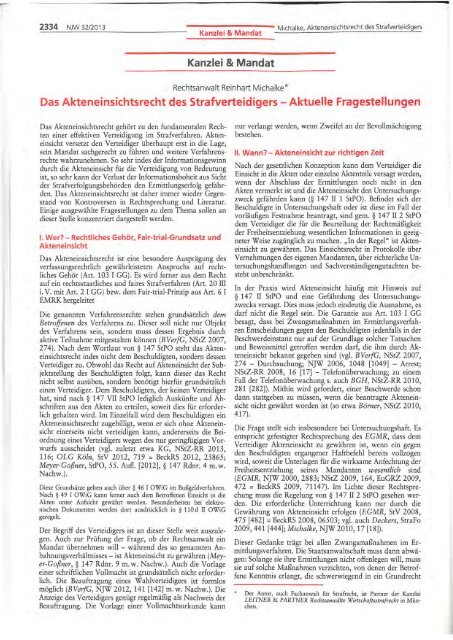Neue Juristische Wochenschrift NJW 2013, 2334 - Leitner & Partner
Neue Juristische Wochenschrift NJW 2013, 2334 - Leitner & Partner
Neue Juristische Wochenschrift NJW 2013, 2334 - Leitner & Partner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-2-=-3-=-3_4__<br />
N_JW_3_2_/2_0_1_::._3 _________---------- Michalke, Akteneinsichtsrecht des Strafverteidigers<br />
Kanzlei & Mandat<br />
Kanzlei & Mandat<br />
Rechtsanwalt Reinhart Michalke*<br />
Das Akteneinsichtsrecht des Strafverteidigers- Aktuelle Fragestellungen<br />
Das Akteneinsichtsrecht gehört zu den fundamentalen Rechten<br />
einer effektiven Verteidigung im Strafverfahren. Akteneinsicht<br />
versetzt den Verteidiger überhaupt erst in die Lage,<br />
sein Mandat sachgerecht zu führen und weitere Verfahrensrechte<br />
wahrzunehmen. So sehr indes der Informationsgewinn<br />
durch die Akteneinsicht für die Verteidigung von Bedeutung<br />
ist, so sehr kann der Verlust der Informationshoheit aus Sicht<br />
der Strafverfolgungsbehörden den Ermittlungserfolg gefährden.<br />
Das Akteneinsichtsrecht ist daher immer wieder Gegenstand<br />
von Kontroversen in Rechtsprechung und Literatur.<br />
Einige ausgewählte Fragestellungen zu dem Thema sollen an<br />
dieser Stelle konzentriert dargestellt werden.<br />
I. Wer- Rechtliches Gehör, Fair-trial-Grundsatz und<br />
Akteneinsicht<br />
Das Akteneinsichtsrecht ist eine besondere Ausprägung des<br />
verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches<br />
Gehör (Art. 103 I GG). Es wird ferner aus dem Recht<br />
auf ein rechtsstaatliches und faires Strafverfahren (Art. 20 III<br />
i. V. mit Art. 2 I GG) bzw. dem Fair-trial-Prinzip aus Art. 6 I<br />
EMRK hergeleitet<br />
Die genannten Verfahrensrechte stehen grundsätzlich dem<br />
Betroffenen des Verfahrens zu. Dieser soll nicht nur Objekt<br />
des Verfahrens sein, sondern muss dessen Ergebnis durch<br />
aktive Teilnahme mitgestalten können (BVerfG, NStZ 2007,<br />
274). Nach dem Wortlaut von§ 147 StPO steht das Akteileinsichtsrecht<br />
indes nicht dem Beschuldigten, sondern dessen<br />
Verteidiger zu. Obwohl das Recht auf Akteneinsicht der Subjektstellung<br />
des Beschuldigten folgt, kann dieser das Recht<br />
nicht selbst ausüben, sondern benötigt hierfür grundsätzlich<br />
einen Verteidiger. Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger<br />
hat, sind nach § 14 7 VII StPO lediglich Auskünfte und Abschriften<br />
aus den Akten zu erteilen, soweit dies für erforderlich<br />
gehalten wird. Im Einzelfall wird dem Beschuldigten ein<br />
Akteneinsichtsrecht zugebilligt, wenn er sich ohne Akteneinsicht<br />
einerseits nicht verteidigen kann, andererseits die Beiordnung<br />
eines Verteidigers wegen des nur geringfügigen Vorwurfs<br />
ausscheidet (vgl. zuletzt etwa KG, NStZ-RR <strong>2013</strong>,<br />
116; OLG Köln, StV 2012, 719 = BeckRS 2012, 23865;<br />
Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl. [2012], § 147 Rdnr. 4 m. w.<br />
Nachw.).<br />
Diese Grundsätze gelten auch über § 46 I OWiG im Bußgeldverfahren.<br />
Nach § 49 I OWiG kann ferner auch dem Betroffenen Einsicht in die<br />
Akten unter Aufsicht gewährt werden. Besonderheiten bei elektronischen<br />
Dokumenten werden dort ausdrücklich in § 110 d II OWiG<br />
geregelt.<br />
Der Begriff des Verteidigers ist an dieser Stelle weit auszulegen.<br />
Auch zur Prüfung der Frage, ob der Rechtsanwalt ein<br />
Mandat übernehmen will- während des so genannten Anbahnungsverhältnisses<br />
-ist Akteneinsicht zu gewähren (Meyer-Goßner,<br />
§ 147 Rdnr. 9 m. w. Nachw.). Auch die Vorlage<br />
einer schriftlichen Vollmacht ist grundsätzlich nicht erforderlich.<br />
Die Beauftragung eines Wahlverteidigers ist formlos<br />
möglich (BVer{G, N]W 2012, 141 [142] m. w. Nachw.). Die<br />
Anzeige des Verteidigers genügt regelmäßig als Nachweis der<br />
Beauftragung. Die Vorlage einer Vollmachtsurkunde kann<br />
nur verlangt werden, wenn Zweifel an der Bevollmächtigung<br />
bestehen.<br />
II. Wann- Akteneinsicht zur richtigen Zeit<br />
Nach der gesetzlichen Konzeption kann dem Verteidiger die<br />
Einsicht in die Akten oder einzelne Aktenteile versagt werden,<br />
wenn der Abschluss der Ermittlungen noch nicht in den<br />
Akten vermerkt ist und die Akteneinsicht den Untersuchungszweck<br />
gefährden kann (§ 147 II 1 StPO). Befindet sich der<br />
Beschuldigte in Untersuchungshaft oder ist diese im Fall der<br />
vorläufigen Festnahme beantragt, sind gern. § 147 II 2 StPO<br />
dem Verteidiger die für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit<br />
der Freiheitsentziehung wesentlichen Informationen in geeigneter<br />
Weise zugänglich zu machen. "In der Regel" ist Akteneinsicht<br />
zu gewähren. Das Einsichtsrecht in Protokolle über<br />
Vernehmungen des eigenen Mandanten, über richterliche Untersuchungshandlungen<br />
und Sachverständigengutachten besteht<br />
unbeschränkt.<br />
In der Praxis wird Akteneinsicht häufig tnit Hinweis auf<br />
§ 14 7 II StPO und eine Gefährdung des Untersuchungszwecks<br />
versagt. Dies muss jedoch eindeutig die Ausnahme, es<br />
darf nicht die Regel sein. Die Garantie aus Art. 103 I GG<br />
besagt, dass bei Zwangsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren<br />
Entscheidungen gegen den Beschuldigten jedenfalls in der<br />
Beschwerdeinstanz nur auf der Grundlage solcher Tatsachen<br />
und Beweismittel getroffen werden darf, die ihm durch Akteneinsicht<br />
bekannt gegeben sind (vgl. BVerfG, NStZ 2007,<br />
274 - Durchsuchung; <strong>NJW</strong> 2006, 1048 [1049] - Arrest;<br />
NStZ-RR 2008, 16 [17] - Telefonüberwachung; zu einem<br />
Fall der Telefonüberwachung s. auch BGH, NStZ-RR 2010,<br />
281 [282]). Mithin wird gefordert, einer Beschwerde schon<br />
dann stattgeben zu müssen, wenn die beantragte Akteneinsicht<br />
nicht gewährt worden ist (so etwa Börner, NStZ 2010,<br />
417).<br />
Die Frage stellt sich insbesondere bei Untersuchungshaft. Es<br />
entspricht gefestigter Rechtsprechung des EGMR, dass dem<br />
Verteidiger Akteneinsicht zu gewähren ist, wenn ein gegen<br />
den Beschuldigten ergangener Haftbefehl bereits vollzogen<br />
wird, soweit die Unterlagen für die wirksame Anfechtung der<br />
Freiheitsentziehung seines Mandanten wesentlich sind<br />
(EGMR, N]W 2000, 2883; NStZ 2009, 164, EuGRZ 2009,<br />
472 = BeckRS 2009, 71147). Im Lichte dieser Rechtsprechung<br />
muss die Regelung von § 14 7 II 2 StPO gesehen werden.<br />
Die erforderliche Unterrichtung kann nur durch die<br />
Gewährung von Akteneinsicht erfolgen (EGMR, StV 2008,<br />
475 [482] = BeckRS 2008, 06503; vgl. auch Deckers, StraFo<br />
2009, 441 [444]; Michalke, N]W 2010, 17 [18]).<br />
Dieser Gedanke trägt bei allen Zwangsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren.<br />
Die Staatsanwaltschaft muss dann abwägen:<br />
Solange sie ihre Ermittlungen nicht offenlegen will, muss<br />
sie auf solche Maßnahmen verzichten, von denen der Betroffene<br />
Kenntnis erlangt, die schwerwiegend in ein Grundrecht<br />
* Der Autor, auch Fachanwalt für Strafrecht, ist <strong>Partner</strong> der Kanzlei<br />
LEITNER & PARTNER Rechtsanwälte Wirtschaftsstrafrecht in München.
Michalke, Akteneinsichtsrecht des Strafverteidigers-----------<br />
<strong>NJW</strong> 32/<strong>2013</strong> 2335<br />
Kanzlei & Mandat ----------------<br />
eingreifen und daher im gerichtlichen Verfahren überprüft<br />
werden. Das BVerfG hat jedoch auch dargestellt, dass das<br />
Geheimhaltungsinteresse der Strafverfolgungsbehörden ein<br />
Grund sein kann, eine Entscheidung im Beschwerdeverfahren<br />
zu verzögern (BVerfG, NStZ 2007, 274). Nicht akzeptabel<br />
wird es hingegen sein, dass die Ermittlungsbehörden vorerst<br />
die erlangten Beweismittel auswerten und bis zum Abschluss<br />
ihrer Ermittlungen mit der Gewährung von Akteneinsicht<br />
zuwarten. Bei einer derartigen Verzögerung des Beschwerdeverfahrens<br />
wird über eine Untätigkeitsbeschwerde nachzudenken<br />
sein (vgl. Börner, NStZ 2010,417 [423 f.]) .<br />
Drängen die Ermittlungsbehörden nach dem Vollzug von<br />
Zwangsmaßnahmen darauf, ihre Ermittlungen auch weiterhin<br />
im Geheimen führen zu können, ist dies verstärkt für die<br />
Zeit vor Vollzug der Maßnahme zu erwarten. Die Frage<br />
etwa, ob ein Recht auf Akteneinsicht besteht, wenn gegen<br />
den Mandanten ein Haftbefehl beantragt oder erlassen, aber<br />
gerade noch nicht vollstreckt ist, ist hoch umstritten. In einer<br />
älteren Entscheidung lehnte das BVerfG ein Akteneinsichtsrecht<br />
ab (BVerfG, NStZ-RR 1998, 108; s. auch OLG München,<br />
NStZ-RR 2012, 317 L = BeckRS 2012, 14142). Es gibt<br />
aber gewichtige Stimmen, die ein Recht auf Akteneinsicht<br />
bejahen (Beulke/Witzigmann, NStZ 2011, 254 (257]; OLG<br />
Köln, StV 1998, 269 = BeckRS 1998, 02821; LG Aschaffenburg,<br />
StV 1997, 644; Lüderssen/]ahn, in: Löwe/Rosenberg,<br />
StPO, 26. Aufl. (2006ff.], § 147 Rdnr. 77), steht doch außer<br />
Zweifel, dass bereits der bloße Erlass eines Haftbefehls den<br />
Betroffenen beschwert. Andersherum verliert der Beschuldigte<br />
seinen Anspruch auf ein faires Verfahren und eine effektive<br />
Verteidigung nicht dadurch, dass er sich dem Verfahren nicht<br />
stellt (EGMR, <strong>NJW</strong> 1999, 2353 [2354]; Beulke/Witzigmann,<br />
NStZ 2011, 254 [258]). Mit anderen Worten: Es kann<br />
grundsätzlich von dem Betroffenen nicht erwartet werden,<br />
dass er sich zunächst inhaftieren lässt, bevor ihm die gegen<br />
ihn gerichteten Vorwürfe bekannt gemacht werden. Es bedarf<br />
vielmehr einer Abwägung im Einzelfall: Die Informationsund<br />
Verteidigungsinteressen des Betroffenen müssen mit dem<br />
Geheimhaltungsinteresse der Strafverfolgungsbehörden abgewogen<br />
werden. Ausgangspunkt der Überlegung muss die<br />
Frage sein, ob durch die Akteneinsicht der Erfolg der konkreten<br />
Zwangsmaßnahme gefährdet wäre.<br />
111. Was- Umfang des Akteneinsichtsrechts<br />
Nach§ 147 I StPO ist der Verteidiger befugt, die Akten, die<br />
dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhebung der<br />
Anklage vorzulegen wären, einzusehen und Beweisstücke zu<br />
besichtigen. Der eingangs beschriebenen Bedeutung der Akten<br />
für alle Beteiligten folgt der Grundsatz der Aktenvollständigkeit<br />
und -wahrheit. Die Akten müssen verlässlich aufzeigen,<br />
welche Ermittlungshandlungen mit welchem Ergebnis<br />
vorgenommen worden sind (Wohlers/Schlegel, NStZ 2010,<br />
486 [487]; Erb, in: Löwe/Rosenberg, § 163 Rdnr. 78; Meyer-Goßner,<br />
§ 163 Rdnr. 18).<br />
Die Rechtsprechung folgt dabei dem formellen Aktenbegriff Zur Ermittlungsakte<br />
gehören danach die von der Staatsanwaltschaft als entscheidungserheblich<br />
dem Gericht zu präsentierenden Unterlagen, die durch<br />
die Identität der Tat und des Täters konkretisiert werden (BGH, StV<br />
2010, 228 [229] = BeckRS 2009, 20293; BVerfGE 63, 45 = <strong>NJW</strong> 1983,<br />
1043). Das Problem ist, dass die Ermittlungsbehörden dazu neigen,<br />
insoweit die Begriffe "Beschuldigte" und "Täter" synonym zu verwenden.<br />
Erkenntnisse zu anderen potenziellen Tätern können aus der Ermittlungsakte<br />
herausgehalten werden. Die besseren Argumente sprechen<br />
daher wohl für den materiellen Aktenbegriff. Dieser umfasst Unterlagen,<br />
die tatbezogene Ermittlungen zur Überprüfung eines Gegenstands, eines<br />
Sachverhalts oder einer Person enthalten, die nicht zu den Beschuldigten<br />
gehört- so genannte Spurenakten (Wohlers/Schlegel, NStZ 2010, 486<br />
[490]). Wenn das Akteneinsichtsrecht eine vollständige Information<br />
über die im Ermittlungsverfahren zusammengetragenen Informationen<br />
gewähren soll, kann es nicht den Strafverfolgungsorganen obliegen,<br />
allein zu entscheiden, welche dieser Informationen verfahrens- und vor<br />
allem verteidigungsrelevant sind und welche nicht.<br />
Losgelöst von dieser Differenzierung besteht Einigkeit insoweit,<br />
dass Unterlagen, welchen eine allein innerdienstliche<br />
Bedeutung für die Behörden zukommt, nicht vom Aktenbegriff<br />
umfasst sind. Dies können etwa polizeiliche Arbeitsvermerke<br />
unter Bewertung der bisherigen Ermittlungsergebnisse<br />
oder sonstige rein interne polizeiliche Hilfs- oder Arbeitsmittel<br />
nebst entsprechenden Dateien sein. Keine Akten in<br />
diesem Sinne sind etwa auch die Handakten des Staatsanwalts,<br />
Notizen von Mitgliedern des Gerichts während der<br />
Hauptverhandlung oder die so genannten Senatshefte (BGH,<br />
StV 2010, 228 [229] = BeckRS 2009, 20293). In dieser Entscheidung<br />
hatte der BGH Anlass, darauf hinzuweisen, dass<br />
polizeiliche Auswertungen gewonnenen Beweismaterials, wie<br />
etwa Übersetzungen aufgezeichneter Telefonate, als solche<br />
selbst verfahrensrelevant und Aktenbestandteil sind. Hier<br />
verläuft die Grenze von reinen Bewertungen, die an eine derartige<br />
Auswertung anknüpfen können und rein polizeiinterne<br />
Arbeitsmittel sind. Das Akteneinsichtsrecht gewährt indes<br />
keinen Anspruch auf Herstellung bislang nicht existenter<br />
Unterlagen. Sind also etwa derartige Übersetzungen (noch)<br />
nicht vorhanden, schafft das Akteneinsichtsrecht keine<br />
Pflicht, sie anzufertigen.<br />
Über § 14 7 I StPO ist der Verteidiger auch berechtigt, Beweismittel<br />
zu besichtigen. Kopien von Beweismitteln, etwa<br />
Schriftstücke oder elektronisch gespeicherte Bild- oder Audiodateien,<br />
sind nach allgemeiner Meinung keine Beweisstücke,<br />
sondern Aktenbestandteil (OLG Stuttgart, <strong>NJW</strong> 2003,<br />
767; a. A. OLG Karlsruhe, <strong>NJW</strong> 2012,2742 m. ablehnender<br />
Anm. Meyer-Mews) . Dem Verteidiger ist daher im Rahmen<br />
seines Akteneinsichtsrechts regelmäßig eine Kopie der Dateien<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
IV. Wo- Geschäftsstelle, Mitnahme und<br />
Versendung<br />
Das Akteneinsichtsrecht nach § 14 7 StPO nimmt der Verteidiger<br />
nach dem Verständnis des (historischen) Gesetzgebers<br />
vor Ort bei der aktenführenden Stelle wahr. Nur auf<br />
Antrag sollen dem Verteidiger die Akten nach § 14 7 IV StPO<br />
mit Ausnahme der Beweisstücke zur Einsichtnahme mitgegeben<br />
werden, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen.<br />
In den meisten Fällen der alltäglichen Praxis braucht der<br />
Rechtsanwalt freilich nicht persönlich auf der Geschäftsstelle<br />
erscheinen. Während der ortsansässigen Kanzlei regelmäßig<br />
mitgeteilt wird, wo die Akten abgeholt werden können, werden<br />
dem auswärtigen Verteidiger die Akten zumeistperPost<br />
oder mit einem Kurierdienst übersandt. Völlig unproblematisch<br />
ist auch dieser Aspekt des Akteneinsichtsrechts nicht.<br />
Das BVerfG hat es zuletzt noch offengelassen, ob und gegebenenfalls<br />
unter welchen Voraussetzungen ein Verteidiger<br />
einen Anspruch auf Überlassung oder Übersendung der Akten<br />
hat (BVerfG, <strong>NJW</strong> 2012, 141 (142]). Es hat aber verdeutlicht,<br />
dass ein Verteidiger jedenfalls den Anspruch darauf<br />
hat, dass über seinen Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht<br />
und über deren Durchführung willkürfrei entschieden<br />
wird.<br />
V. Weitergabe- Mitteilung der Erkenntnisse an den<br />
Mandanten<br />
Der Verteidiger ist berechtigt und in der Regel verpflichtet,<br />
seinem Mandanten zu Verteidigungszwecken mitzuteilen,
2336 <strong>NJW</strong> 32/<strong>2013</strong><br />
Buchbesprechungen<br />
was er aus den Akten erfahren hat (zuletzt etwa OLG Frankfurt<br />
a. M., <strong>NJW</strong> <strong>2013</strong>, 1107 m. zutreffender Anm. König) .<br />
Ein Verbot der Weitergabe von Informationen für den Verteidiger<br />
soll indes dann anzunehmen sein, wenn eine Gefährdung<br />
des Untersuchungszwecks droht (Meyer-Goßner, § 14 7<br />
Rdnr. 21 m. w. Nachw.). Dies sei dann der Fall, wenn sich<br />
aus den Ermittlungsakten eine bevorstehende Durchsuchung<br />
der Wohnung des Beschuldigten oder ein staatsanwaltschaftlieber<br />
Antrag auf Erlass eines Haftbefehls ergebe. Nicht ausreichend<br />
ist sicher die jeder Gewährung von Akteneinsicht<br />
innewohnende theoretische Möglichkeit, der Beschuldigte<br />
könne die Information zur Verdunkelung des Sachverhalts<br />
nutzen (vgl. auch Donath!Mehle, <strong>NJW</strong> 2009, 1399).<br />
Die erwähnte Entscheidung des OLG Frankfurt a. M. verweist<br />
auf mögliche Strafbarkeitendes Verteidigers- hier nach<br />
§ 184 b StGB - und verkürzt so dessen Befugnis, seine Berechtigung<br />
und Verpflichtung zur Weitergabe der durch die<br />
Akteneinsicht erlangten Kenntnisse durch Aushändigung einer<br />
Aktenkopie umzusetzen, wie es in der Praxis regelmäßig<br />
geschieht (OLG Frankfurt a. M., <strong>NJW</strong> <strong>2013</strong>, 1107 m. ablehnender<br />
Anm. König) .<br />
VI. Fazit<br />
1. Das Akteneinsichtsrecht steht dem Verteidiger zu. Der<br />
Begriff des Verteidigers ist weit auszulegen. Die Vorlage<br />
einer schriftlichen Vollmacht ist grundsätzlich nicht erforderlich.<br />
2. Im Ermittlungsverfahren kann dem Verteidiger die Einsicht<br />
in die Akten versagt werden, wenn sie den Untersuchungszweck<br />
gefährden kann. Nachteilige Entscheidungen dürfen<br />
jedenfalls in der Beschwerdeinstanz nur auf der Grundlage<br />
solcher Tatsachen und Beweismittel getroffen werden, die<br />
durch Akteneinsicht bekannt gegeben sind.<br />
3. Der Verteidiger hat einen Anspruch darauf, dass über<br />
seinen Antrag auf Gewährung von Akteneinsicht durch Überlassung<br />
oder Übersendung der Akten willkürfrei entschieden<br />
wird.<br />
4. Der Verteidiger ist berechtigt und in der Regel verpflichtet,<br />
seinem Mandanten zu Verteidigungszwecken mitzuteilen,<br />
was er aus den Akten erfahren hat.<br />
•<br />
Buchbesprechungen<br />
Urheberrechtsgesetz. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz,<br />
Kunsturhebergesetz. Kommentar. Von Thomas Dreier und<br />
Gernot Schulze. 4. Auflage.- München, Beck <strong>2013</strong>. XX, 2156<br />
S., geb. Euro 149,-. ISBN: 978-3-406-62747-7.<br />
Nun ist er endlich da: Der neue "Dreier/Schulze". Die Neuauflage<br />
erscheint dieses Mal fünf Jahre nach der 3. Auflage und<br />
nicht mehr wie bisher im kaum noch zu bewältigenden Zwei<br />
Jahres-Turnus. Neu im Bearbeiterkreis ist Louisa Specht, die das<br />
KUG mitkommentiert. Das Seitenwachstum haben die Autoren<br />
dankenswerterweise auf maßvolle 150 Seiten begrenzt und dabei<br />
vor allem die Mühe auf sich genommen, den gesamten Text<br />
kritisch um ältere, entbehrliche Fundstellen zu kürzen. Der Kommentar<br />
orientiert sich vorrangig und entsprechend den Bedürfnissen<br />
der Praxis an der Rechtsprechung. Ehrfurcht gebührt den<br />
Autoren angesichts der Gründlichkeit, mit der sie nicht nur die<br />
Rechtsprechung der vergangeneu Jahre, sondern auch die wissenschaftliche<br />
Literatur (auch die Flut der urheberrechtliehen<br />
Dissertationen) ausgewertet und mit Augenmaß in den Kommentar<br />
übernommen haben. Zu berücksichtigen waren neben<br />
der aktuellen Rechtsprechung seit 2008 unter anderem das 6.<br />
UrhG ÄndG, das FGG-RG, die Richtlinie über verwaiste Werke.<br />
Vereinzelt konnten auch Entwicklungen nach dem offiziellen<br />
Redaktionsschluss im Dezember 2012 noch verarbeitet werden,<br />
so z. B. eine erste Kommentierung des neuen Leistungsschutzrechts<br />
für Presseverleger ( §§ 87 f-87 h UrhG) oder Metall aUf<br />
Metall II (BGH, WRP <strong>2013</strong>, 804).<br />
Grundlegend überarbeitet sind die Ausführungen zur Frage der<br />
Angemessenheit der Vergütung, zur Ausgestaltung des Auskunftsanspruchs<br />
sowie zur Störerhaftung der Internetdienstleister,<br />
die nach der neuen Ansicht des BGH auch auf unter Verletzung<br />
des Hausrechts angefertigte Fotos durch Dritte angewandt<br />
wird (vgl. BGH, GRUR <strong>2013</strong>, 623 -Preußische Gärten<br />
und Parkanlagen II), und insbesondere den Prüfungspflichten<br />
des mittelbaren Störers (§ 97 Rdnrn. 33 ff.). Zu begrüßen ist die<br />
notwendige, durchgängige Einbeziehung des EU-Rechts mit seinem<br />
zunehmenden Einfluss auf das Urheberrecht in den Kommentierungen,<br />
wie etwa das Verhältnis vom Urheberrecht zum<br />
EU-Kartellrecht. Zu Recht kritisiert Dreier, dass die praktischen<br />
Auswirkungen der Rechtewahrnehmung auf der Basis des digitalen<br />
Rechtemanagements (Creative Commons Lizenzen) nur<br />
kaum geklärt sind (Einl. Rdnr. 25). Erwähnung findet demnach<br />
auch die zunehmende Harmonisierung des urheberrechtliehen<br />
Werkbegriffs (vgl. § 2 Rdnr. 22). Für den Schu,tz von Computerprogrammen,<br />
Lichtbildwerken und Datenbanken verlangt der<br />
Gemeinschaftsgesetzgeber nur eine "eigene geistige Schöpfung" .<br />
Ob diese geringen Schutzanforderungen für alle Werkarten gelten<br />
sollen oder für bestimmte Werkarten eine höhere Individualität<br />
gefordert werden kann, ist bislang nicht abschließend geklärt.<br />
Wie bereits in der Vorauflage berücksichtigt der "Dreier/Schulze"<br />
die zunehmende Forderung der Internetgemeinde nach freiem<br />
Zugang zu Wissen. <strong>Neue</strong> Geschäftsmodelle, unter anderem<br />
Open Access Publishing, Open Source, Creative Commons und<br />
Science Commons werden kurz vorgestellt. Im Rahmen des<br />
Open Access Publishing greift Dreier zusätzlich die Forderung<br />
nach einem Zweitveröffentlichungsrecht des Urhebers auf (Einl.<br />
Rdnr. 25). Ob neue Formen des Internetrundfunks, z. B. das<br />
Webcasting und Simulcasting, der öffentlichen Zugänglichmachung<br />
gern. § 19 a UrhG oder dem Senderecht gern. § 20 UrhG<br />
unterfallen, wird überzeugend dargestellt (vgl. § 19 a UrhG<br />
Rdnr. 10).<br />
Der Kommentar hat drei wesentliche Vorteile: Er ist bemerkenswert<br />
aktuell, er ist handlich, und er überzeugt abermals durch<br />
präzise Knappheit, wissenschaftliche Tiefe und sprachliche Eleganz.<br />
Für die tägliche urheberrechtliche Arbeit ist er eine echte<br />
Bereicherung.<br />
Rechtsanwalt Dr. Lucas Elmenhorst, M. A. und<br />
Rechtsanwalt Dr. Pascal Decker, Berlin