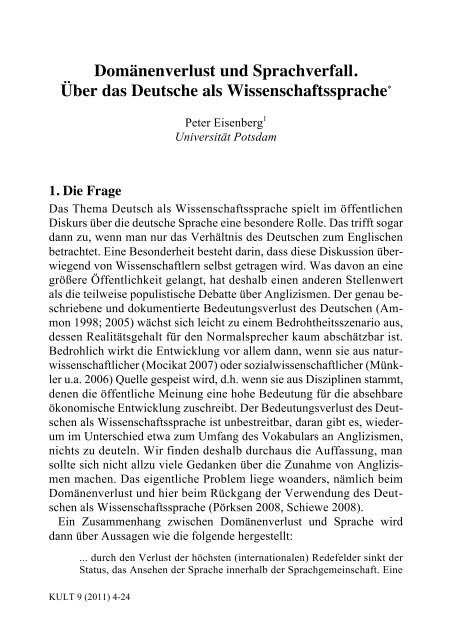Domänenverlust und Sprachverfall - KULT - en postkolonial temaserie
Domänenverlust und Sprachverfall - KULT - en postkolonial temaserie
Domänenverlust und Sprachverfall - KULT - en postkolonial temaserie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Domän<strong>en</strong>verlust <strong>und</strong> <strong>Sprachverfall</strong>.<br />
Über das Deutsche als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache *<br />
Peter Eis<strong>en</strong>berg 1<br />
Universität Potsdam<br />
1. Die Frage<br />
Das Thema Deutsch als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache spielt im öff<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong><br />
Diskurs über die deutsche Sprache eine besondere Rolle. Das trifft sogar<br />
dann zu, w<strong>en</strong>n man nur das Verhältnis des Deutsch<strong>en</strong> zum Englisch<strong>en</strong><br />
betrachtet. Eine Besonderheit besteht darin, dass diese Diskussion überwieg<strong>en</strong>d<br />
von Wiss<strong>en</strong>schaftlern selbst getrag<strong>en</strong> wird. Was davon an eine<br />
größere Öff<strong>en</strong>tlichkeit gelangt, hat deshalb ein<strong>en</strong> ander<strong>en</strong> Stell<strong>en</strong>wert<br />
als die teilweise populistische Debatte über Anglizism<strong>en</strong>. Der g<strong>en</strong>au beschrieb<strong>en</strong>e<br />
<strong>und</strong> dokum<strong>en</strong>tierte Bedeutungsverlust des Deutsch<strong>en</strong> (Ammon<br />
1998; 2005) wächst sich leicht zu einem Bedrohtheitssz<strong>en</strong>ario aus,<br />
dess<strong>en</strong> Realitätsgehalt für d<strong>en</strong> Normalsprecher kaum abschätzbar ist.<br />
Bedrohlich wirkt die Entwicklung vor allem dann, w<strong>en</strong>n sie aus naturwiss<strong>en</strong>schaftlicher<br />
(Mocikat 2007) oder sozialwiss<strong>en</strong>schaftlicher (Münkler<br />
u.a. 2006) Quelle gespeist wird, d.h. w<strong>en</strong>n sie aus Disziplin<strong>en</strong> stammt,<br />
d<strong>en</strong><strong>en</strong> die öff<strong>en</strong>tliche Meinung eine hohe Bedeutung für die absehbare<br />
ökonomische Entwicklung zuschreibt. Der Bedeutungsverlust des Deutsch<strong>en</strong><br />
als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache ist unbestreitbar, daran gibt es, wiederum<br />
im Unterschied etwa zum Umfang des Vokabulars an Anglizism<strong>en</strong>,<br />
nichts zu deuteln. Wir find<strong>en</strong> deshalb durchaus die Auffassung, man<br />
sollte sich nicht allzu viele Gedank<strong>en</strong> über die Zunahme von Anglizism<strong>en</strong><br />
mach<strong>en</strong>. Das eig<strong>en</strong>tliche Problem liege woanders, nämlich beim<br />
Domän<strong>en</strong>verlust <strong>und</strong> hier beim Rückgang der Verw<strong>en</strong>dung des Deutsch<strong>en</strong><br />
als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache (Pörks<strong>en</strong> 2008, Schiewe 2008).<br />
Ein Zusamm<strong>en</strong>hang zwisch<strong>en</strong> Domän<strong>en</strong>verlust <strong>und</strong> Sprache wird<br />
dann über Aussag<strong>en</strong> wie die folg<strong>en</strong>de hergestellt:<br />
... durch d<strong>en</strong> Verlust der höchst<strong>en</strong> (international<strong>en</strong>) Redefelder sinkt der<br />
Status, das Anseh<strong>en</strong> der Sprache innerhalb der Sprachgemeinschaft. Eine<br />
<strong>KULT</strong> 9 (2011) 4-24
Schwächung des Status hat immer auch Konsequ<strong>en</strong>z<strong>en</strong> für d<strong>en</strong> Ausbau der<br />
Sprache, für die Arbeit an d<strong>en</strong> Wörtern <strong>und</strong> Form<strong>en</strong>, am Korpus der Sprache.<br />
(Jürg<strong>en</strong> Trabant in der FAZ vom 28. September 2007, S. 40. Ähnlich<br />
auch Trabant 2007).<br />
Was ein angeseh<strong>en</strong>er Sprachwiss<strong>en</strong>schaftler hier der Öff<strong>en</strong>tlichkeit mitteilt,<br />
ist nicht mehr <strong>und</strong> nicht w<strong>en</strong>iger, als dass beim Fortbestand des<br />
vorhand<strong>en</strong><strong>en</strong> Domän<strong>en</strong>verlustes der Ausbau des Deutsch<strong>en</strong> gefährdet<br />
sei, d<strong>en</strong>n so sei es immer. Es fehlt auch der leiseste Hinweis auf ein<strong>en</strong><br />
einzig<strong>en</strong> Fall, der dieses immer w<strong>en</strong>igst<strong>en</strong>s illustrier<strong>en</strong> könnte. Die Bedrohung<br />
ist perfekt, ihre Konsequ<strong>en</strong>z<strong>en</strong> schein<strong>en</strong> unabw<strong>en</strong>dbar zu sein.<br />
Ich meine, man sollte diese durchaus wirksame T<strong>en</strong>d<strong>en</strong>z zu einer W<strong>en</strong>dung<br />
des öff<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong> Diskurses nicht auf sich beruh<strong>en</strong> lass<strong>en</strong>. Gibt es<br />
tatsächlich Anzeich<strong>en</strong> für eine Schwächung, eine Ausbauhemmung oder<br />
gar ein<strong>en</strong> Verfall des Deutsch<strong>en</strong> dergestalt, dass es von sein<strong>en</strong> Ausdrucksmöglichkeit<strong>en</strong><br />
her eines Tages zur Wiss<strong>en</strong>schaftssprache nicht<br />
mehr taugt Man muss die Frage stell<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n man über allgemeine<br />
Bedrohtheitssz<strong>en</strong>ari<strong>en</strong> hinauskomm<strong>en</strong> möchte. Es kann im Folg<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />
selbstverständlich nicht darum geh<strong>en</strong>, eine auch nur vorläufige Antwort<br />
zu versuch<strong>en</strong>. Wir wär<strong>en</strong> schon froh, w<strong>en</strong>n wir mehr darüber wüsst<strong>en</strong>,<br />
wie wir die Frage konkret stell<strong>en</strong> könn<strong>en</strong>. Nur um einige Facett<strong>en</strong> dieses<br />
Problems wird es geh<strong>en</strong>.<br />
2. Zugang Lexikon<br />
Der nächstlieg<strong>en</strong>de – im Zitat von Trabant bereits angesproch<strong>en</strong>e – Gedanke<br />
sagt, die Sprache sei in Mitleid<strong>en</strong>schaft gezog<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n ihr im<br />
Vergleich zu ander<strong>en</strong> Sprach<strong>en</strong> ein Teil des Wortschatzes fehle. W<strong>en</strong>n<br />
Terminologi<strong>en</strong> einiger natur- oder wirtschaftswiss<strong>en</strong>schaftlicher Disziplin<strong>en</strong><br />
nur noch im Englisch<strong>en</strong> <strong>en</strong>twickelt werd<strong>en</strong>, sei dieser Fall gegeb<strong>en</strong>.<br />
Das Deutsche verliere seine universelle Verw<strong>en</strong>dbarkeit, es sei als<br />
Sprache in Mitleid<strong>en</strong>schaft gezog<strong>en</strong>. Eine These dieser Art lässt sich<br />
öff<strong>en</strong>tlich umso leichter plausibel mach<strong>en</strong>, als sie der volkslinguistisch<strong>en</strong><br />
Gr<strong>und</strong>gewissheit <strong>en</strong>tgeg<strong>en</strong>kommt, eine Sprache bestehe vor allem<br />
aus der M<strong>en</strong>ge ihrer Wörter.<br />
Der im gegeb<strong>en</strong><strong>en</strong> Zusamm<strong>en</strong>hang wichtigste Diskussionsstrang plädiert<br />
für Deutsch als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache im Rahm<strong>en</strong> eines Mehrsprachigkeitskonzepts.<br />
Dabei geht es kaum mehr um Forderung<strong>en</strong> nach<br />
5
einer Ersetzung des Englisch<strong>en</strong> durch das Deutsche, sondern um eine<br />
Wieder-Etablierung des Deutsch<strong>en</strong> neb<strong>en</strong> dem Englisch<strong>en</strong>. Als historischer<br />
Vorlage knüpft man bei d<strong>en</strong> erfolgreich<strong>en</strong> Bemühung<strong>en</strong> von<br />
Christian Wolff um eine Wiss<strong>en</strong>schaftssprache der Aufklärung an, die<br />
sich im Zusamm<strong>en</strong>hang der Ablösung des Lateinisch<strong>en</strong> durch europäische<br />
Landessprach<strong>en</strong> in d<strong>en</strong> Wiss<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong> abgespielt hat. Für das<br />
Deutsche wird als charakteristisch die Verw<strong>en</strong>dung von mindest<strong>en</strong>s teilweise<br />
motiviert<strong>en</strong> Wörtern angeseh<strong>en</strong>, der<strong>en</strong> Bestandteile dem B<strong>en</strong>utzer<br />
bekannt sind <strong>und</strong> dem wiss<strong>en</strong>schaftlich<strong>en</strong> Diskurs damit seine Anbindung<br />
an die Alltagssprache garantier<strong>en</strong>. Das gilt insbesondere für Komposita,<br />
der<strong>en</strong> Bestandteile ja im Allgemein<strong>en</strong> frei vorkomm<strong>en</strong> <strong>und</strong> so zu<br />
Termini wie Gr<strong>und</strong>wiss<strong>en</strong>schaft, Weltweisheit, Vernunftlehre anstelle<br />
von Ontologia, Philosophie, Logik führ<strong>en</strong>. Es wird ausdrücklich aber<br />
auch auf andere Wortbildungsregularität<strong>en</strong> wie die Bildung deverbaler<br />
Abstrakta abgehob<strong>en</strong>, die dem Muttersprachler eb<strong>en</strong>falls unmittelbar<br />
zugänglich sei<strong>en</strong> (Rick<strong>en</strong> 1995; Thielemann 2002; 2007; s.a. Eis<strong>en</strong>berg<br />
2005). Das Konzept ist in mancher Hinsicht durchaus vergleichbar mit<br />
dem eines aufgeklärt<strong>en</strong> Purismus, wie es von Campe vorgetrag<strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
teilweise erfolgreich realisiert wurde (Campe 1813; s.a. Schiewe 1998).<br />
Thielemann (2007: 55) geht bis zu der Feststellung:<br />
Wer der Globalisierungsrhetorik folg<strong>en</strong>d d<strong>en</strong> deutsch<strong>en</strong> … Universität<strong>en</strong><br />
das Englische als alleinige Sprache von Forschung <strong>und</strong> Lehre verordn<strong>en</strong><br />
möchte, der sollte wiss<strong>en</strong>, dass er damit Scholastik verordnet <strong>und</strong> R<strong>en</strong>aissance<br />
unterbindet.<br />
Woll<strong>en</strong> wir wirklich Scholastik unterbind<strong>en</strong> <strong>und</strong> R<strong>en</strong>aissance verordn<strong>en</strong><br />
Die Ungebroch<strong>en</strong>heit <strong>und</strong> Konsequ<strong>en</strong>z, mit der ein Mehrsprachigkeitskonzept<br />
der gek<strong>en</strong>nzeichnet<strong>en</strong> Art für ‚die Wiss<strong>en</strong>schaft‘ vertret<strong>en</strong><br />
wird, ist hoff<strong>en</strong>tlich nicht ganz so ernst gemeint, wie sie daherkommt.<br />
Erinnern wir uns beispielsweise an Erfahrung<strong>en</strong> mit dem Deutsch<strong>en</strong> aus<br />
der Zeit unserer wiss<strong>en</strong>schaftlich<strong>en</strong> Jug<strong>en</strong>d. Für die sich etablier<strong>en</strong>de<br />
Sprachwiss<strong>en</strong>schaft neuer Art, g<strong>en</strong>annt Linguistik, wurd<strong>en</strong> viele Schlüsseltexte<br />
aus dem Englisch<strong>en</strong> übersetzt <strong>und</strong> wurd<strong>en</strong> mehr oder w<strong>en</strong>iger<br />
hilflose Lehrbücher in deutscher Sprache verfasst. Termini wie <strong>und</strong>erlying<br />
structure, deep structure, shallow structure, surface structure<br />
war<strong>en</strong> einfach zu versteh<strong>en</strong>, auch w<strong>en</strong>n niemand wusste <strong>und</strong> wiss<strong>en</strong><br />
6
konnte, was g<strong>en</strong>au sie bedeut<strong>en</strong> sollt<strong>en</strong>. Als deutsche Äquival<strong>en</strong>te fand<strong>en</strong><br />
sie eine große Zahl von teilweise ab<strong>en</strong>teuerlich<strong>en</strong> Ausdrück<strong>en</strong>, die<br />
zwisch<strong>en</strong> Morph-für-Morph-Übertragung <strong>und</strong> weitläufiger Interpretation<br />
lag<strong>en</strong>, zum Beispiel unterlieg<strong>en</strong>de Struktur, zugr<strong>und</strong>e lieg<strong>en</strong>de Struktur,<br />
Gr<strong>und</strong>struktur, tiefe Struktur, Tief<strong>en</strong>struktur, Basisstruktur, M<strong>en</strong>talstruktur,<br />
seichte Struktur, flache Struktur, Flachstruktur, oberflächliche Struktur,<br />
Oberfläch<strong>en</strong>struktur usw. Welche dieser Ausdrücke am best<strong>en</strong> für<br />
eine Adaption <strong>und</strong> Vereinnahmung der neu<strong>en</strong> Disziplin geeignet war<strong>en</strong>,<br />
lass<strong>en</strong> wir dahingestellt. Einerseits hörte sich das Deutsche umständlich,<br />
schwerfällig <strong>und</strong> komisch an. Anderseits wusst<strong>en</strong> wir ziemlich bald: je<br />
sprech<strong>en</strong>der ein Terminus im Deutsch<strong>en</strong> wird, desto w<strong>en</strong>iger trifft er <strong>und</strong><br />
desto w<strong>en</strong>iger woll<strong>en</strong> wir ihn verw<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Das möglicherweise Gemeinte<br />
ergibt sich, w<strong>en</strong>n überhaupt, aus dem Zusamm<strong>en</strong>hang der Theorie,<br />
aus dem Versteh<strong>en</strong> der Hermetik ihrer Gesamtbegrifflichkeit. Es ergibt<br />
sich keinesfalls aus der Transpar<strong>en</strong>z von Ableitung<strong>en</strong> auf der Basis alltagssprachlicher<br />
Wörter. Die Schwierigkeit<strong>en</strong> war<strong>en</strong> nicht solche der<br />
deutsch<strong>en</strong> Sprache, sondern sie lag<strong>en</strong> in der Sache. Diese hatte durchaus<br />
scholastische Züge, die wir ihr auch lass<strong>en</strong> wollt<strong>en</strong>.<br />
Das Plädoyer für deutsche wiss<strong>en</strong>schaftliche Terminologi<strong>en</strong> ist in sein<strong>en</strong><br />
best<strong>en</strong> Ausprägung<strong>en</strong> bisher ausschließlich ein Plädoyer für die<br />
Wiss<strong>en</strong>schaft <strong>und</strong> nicht für die deutsche Sprache. Niemand hat etwa gezeigt,<br />
dass die Fähigkeit des Deutsch<strong>en</strong> zur Bildung <strong>und</strong> Prägung von<br />
Termini beeinträchtigt wäre. Wiss<strong>en</strong>schaft im <strong>en</strong>glisch<strong>en</strong> Wiss<strong>en</strong>schaftsjargon,<br />
in Globalesisch oder wie die Lingua franca sonst g<strong>en</strong>annt wird,<br />
ist, w<strong>en</strong>n man gr<strong>und</strong>sätzlich an der These von der Sprachgeb<strong>und</strong><strong>en</strong>heit<br />
wiss<strong>en</strong>schaftlicher Kommunikation festhält, eine reduzierte, standardisierte<br />
Form von Wiss<strong>en</strong>schaft. Es könnte sein, dass die Lingua franca<br />
der Wiss<strong>en</strong>schaft, w<strong>en</strong>n sie sich weiter etabliert <strong>und</strong> verfestigt, wie das<br />
Latein niemandes Muttersprache mehr sein wird. Und natürlich könn<strong>en</strong><br />
der Forschung Anstöße <strong>en</strong>tgeh<strong>en</strong>, die in einer mehrsprachig<strong>en</strong> Wiss<strong>en</strong>schaftslandschaft<br />
möglich wär<strong>en</strong>. Das Plädoyer für Deutsch als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache<br />
wäre gut begründet. Aber es bleibt ein Plädoyer für eine<br />
gute Wiss<strong>en</strong>schaft, nicht für eine gute Sprache. Gerade wir Sprachwiss<strong>en</strong>schaftler<br />
sollt<strong>en</strong> nicht d<strong>en</strong> Sack Sprache schlag<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n wir d<strong>en</strong><br />
Esel Wiss<strong>en</strong>schaft mein<strong>en</strong>.<br />
7
3. Zugang Syntax<br />
Für die Syntax stellt sich die Frage der Verw<strong>en</strong>dbarkeit als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache<br />
nicht in derselb<strong>en</strong> Weise wie für das Lexikon. In der<br />
Syntax geht es in erster Linie um strukturelle Eig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong> einer Sprache,<br />
w<strong>en</strong>iger um etwas wie Lexikonbestände. Strukturelle Veränderung<strong>en</strong><br />
sind vielfältiger <strong>und</strong> tret<strong>en</strong> sowohl häufiger als auch mit höherer<br />
Geschwindigkeit in Erscheinung als in der Wortbildung.<br />
Ist von Wiss<strong>en</strong>schaftssprache die Rede, dann werd<strong>en</strong> sowohl an d<strong>en</strong><br />
Sprachgebrauch als auch an die Sprache selbst höchste Anforderung<strong>en</strong><br />
gestellt. Harald Weinrich formuliert (1986: 97):<br />
8<br />
Ich meine daher, daß alles, was zum Wiss<strong>en</strong>schaftsdeutsch<strong>en</strong> zu sag<strong>en</strong> ist,<br />
mutatis mutandis auch für das Wiss<strong>en</strong>schafts<strong>en</strong>glische zu gelt<strong>en</strong> hat, von<br />
dem wir als Adressat<strong>en</strong> wiss<strong>en</strong>schaftlicher Texte … erwart<strong>en</strong> dürf<strong>en</strong>, daß<br />
es gutes Englisch ist, eb<strong>en</strong>so wie wir darauf besteh<strong>en</strong> müss<strong>en</strong>, daß wiss<strong>en</strong>schaftliche<br />
Veröff<strong>en</strong>tlichung<strong>en</strong> in deutscher Sprache nicht nur um der deutsch<strong>en</strong><br />
Sprache, sondern auch um der Wiss<strong>en</strong>schaft will<strong>en</strong> in gutem Deutsch<br />
abgefaßt sein müss<strong>en</strong>.<br />
Mag sein, dass man die Forderung nach gutem Wiss<strong>en</strong>schafts<strong>en</strong>glisch<br />
um die Mitte der 80er Jahre noch allgemein erheb<strong>en</strong> konnte. Heute ist<br />
das angesichts des Globalesisch<strong>en</strong> sicher nicht mehr realistisch. Für das<br />
Deutsche kann die Forderung viel eher aufrecht erhalt<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>, eb<strong>en</strong><br />
weil es nicht internationale Wiss<strong>en</strong>schaftssprache ist. Zu d<strong>en</strong> üblicherweise<br />
g<strong>en</strong>annt<strong>en</strong> Kriteri<strong>en</strong> gehör<strong>en</strong> etwa Verständlichkeit, logische Gedank<strong>en</strong>führung,<br />
eindeutige <strong>und</strong> klare Formulierung<strong>en</strong>, Schlichtheit <strong>und</strong><br />
Sachlichkeit, Abkehr von esoterischem Sprachgebrauch, g<strong>en</strong>aue Definition<br />
<strong>und</strong> Verw<strong>en</strong>dung der Begriffe (Kalverkämper <strong>und</strong> Weinrich 1986:<br />
103). Lass<strong>en</strong> wir einmal die Schlichtheit beiseite, dann handelt es sich<br />
um eine irdische Form der ideal<strong>en</strong> Sprache. Hab<strong>en</strong> wir sie zur Verfügung<br />
Immerhin les<strong>en</strong> wir auch (Ickler 2007: 24):<br />
Interessanter als der Statuswert ist die Systemgüte einer Sprache, <strong>und</strong> hier<br />
ist es auch, wo der Egalitarismus sein schnelles Urteil fällt. Sind wirklich<br />
alle Sprach<strong>en</strong> als jeweils b<strong>en</strong>utzte Zeich<strong>en</strong>systeme gleich gut ... Die<br />
Innere Systemgüte einer Sprache ist auf d<strong>en</strong> erst<strong>en</strong> Blick eine eher technische<br />
Angeleg<strong>en</strong>heit. Übliche Gütekriteri<strong>en</strong> sind Eindeutigkeit, Regelmäßigkeit,<br />
Ökonomie, Lück<strong>en</strong>losigkeit der Paradigm<strong>en</strong>, Einheitlichkeit<br />
der linear<strong>en</strong> Ordnung, auch normative Bestimmtheit <strong>und</strong> Lernbarkeit.
Hier ist man noch dichter bei der Sprache selbst <strong>und</strong> w<strong>und</strong>ert sich vielleicht,<br />
dass andererseits ziemlich bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>los für die Vereinfachung<br />
des Systems auch des Deutsch<strong>en</strong> plädiert wird. Dinge wie das G<strong>en</strong>us<br />
oder der weitaus größte Teil der Flexionsmorphologie sei<strong>en</strong> überflüssig,<br />
sie glich<strong>en</strong> „Großmutters altem Speicher, in dem sich im Lauf der Jahre<br />
vieles angesammelt hat, was man nicht brauch<strong>en</strong> kann, aber auch nicht<br />
wegwerf<strong>en</strong> möchte.“ (Klein 2003: 52, s.a. Dietrich 2003). Beispiele<br />
dieser Art könn<strong>en</strong> vielleicht zeig<strong>en</strong>, wie phantastisch weitreich<strong>en</strong>d die<br />
Spekulation<strong>en</strong> über Anforderung<strong>en</strong>, Zustand, Entwicklungsmöglichkeit<strong>en</strong><br />
usw. sind, die über einer Sprache niedergeh<strong>en</strong>. Spekulation<strong>en</strong> über<br />
mögliche Zustände sag<strong>en</strong> aber w<strong>en</strong>ig darüber aus, ob eine Sprache angesichts<br />
des Zustands, in dem sie nun einmal befindet, als Sprache der<br />
Wiss<strong>en</strong>schaft taugt.<br />
Eine Möglichkeit, d<strong>en</strong> Zustand von Sprach<strong>en</strong> in Hinsicht auf unsere<br />
Fragestellung zu k<strong>en</strong>nzeichn<strong>en</strong>, liegt wohl bei dem, was man in letzter<br />
Zeit als Komplexität fasst <strong>und</strong> ganz allgemein als das Ergebnis einer<br />
Entwicklung von kommunikativ<strong>en</strong> Anforderung<strong>en</strong> versteht. Die Sprachwiss<strong>en</strong>schaft<br />
gelangt auf unterschiedlich<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> zu der Feststellung,<br />
dass Sprach<strong>en</strong> sich prinzipiell in Hinsicht auf ihre Komplexität unterscheid<strong>en</strong><br />
könn<strong>en</strong>, dass sie Eig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong> adaptiver Systeme hab<strong>en</strong>, die<br />
sich mit d<strong>en</strong> gestellt<strong>en</strong> Anforderung<strong>en</strong> <strong>en</strong>twickeln (McWhorter 2001;<br />
Dahl 2004). Die Idee ist nicht neu, sie war in der zweit<strong>en</strong> Hälfte des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts gang <strong>und</strong> gäbe, aber sie wird jetzt anders gefüllt. Beispielsweise<br />
spricht man w<strong>en</strong>iger davon, wie wichtig der Ausbau des Flexionssystems<br />
für die Qualität einer Sprache sei, sondern man setzt beim Gebrauch<br />
an. Insbesondere der Gebrauch als geschrieb<strong>en</strong>e Sprache führt<br />
unter d<strong>en</strong> in unserer Weltgeg<strong>en</strong>d obwalt<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Bedingung<strong>en</strong> zur Herausbildung<br />
komplexer Syntax<strong>en</strong>, die unter anderem d<strong>en</strong> Aufwand an verbaler<br />
Planung <strong>und</strong> an Situationsunabhängigkeit des Gebrauchs widerspiegeln.<br />
Eig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong> wie hohe Informationsdichte <strong>und</strong> Abstraktheit<br />
werd<strong>en</strong> manifest in (unter anderem) syntaktischer Kongru<strong>en</strong>z, Klammerbildung,<br />
Inkorporation, Kompression von Sätz<strong>en</strong> in andere Sätze, Infinitheitskonstruktion<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Nominalisierung<strong>en</strong> <strong>und</strong> führ<strong>en</strong> dazu, dass<br />
man von in dieser Hinsicht ‚reif<strong>en</strong>‘ Sprach<strong>en</strong> spricht (Fabricius-Hans<strong>en</strong><br />
2003; 2007).<br />
9
Ein in mancher Hinsicht vergleichbarer Ansatz liegt mit Arbeit<strong>en</strong> wie<br />
Koch <strong>und</strong> Österreicher (1985, 1994) zur Ausarbeitung der Begriffe einer<br />
konzeptionell<strong>en</strong> vs. medial<strong>en</strong> Mündlichkeit/Schriftlichkeit vor, neuerdings<br />
noch einmal forciert, etwa in H<strong>en</strong>nig (2006) <strong>und</strong> Ágel & H<strong>en</strong>nig<br />
(2007) mit einer systematisch<strong>en</strong> Herleitung konkreter sprachlicher Erscheinung<strong>en</strong><br />
aus universal<strong>en</strong> Parametern der Diskursgestaltung. Auch<br />
Ágel <strong>und</strong> H<strong>en</strong>nig stoß<strong>en</strong> bis zur Einordnung einzelsprachlicher Merkmale<br />
in Hinsicht auf die Parameter der Nähe- vs. Distanzkommunikation<br />
vor. Der Zeitparameter beispielsweise betrifft das Verhältnis zwisch<strong>en</strong><br />
Planung <strong>und</strong> Realisierung einer Äußerung. Ein hohes Maß an verbaler<br />
Planung ist ein Merkmal von Distanzkommunikation <strong>und</strong> zeigt sich<br />
etwa an einer Verw<strong>en</strong>dung sog. integrierter Struktur<strong>en</strong>. Der relevante<br />
Begriff von Integration (Raible 1992) spielt für die Stilistik <strong>und</strong>, wie bei<br />
uns, für die Charakterisierung von Nähe vs. Distanz eine immer wichtigere<br />
Rolle. Ein Komplem<strong>en</strong>tsatz in indirekter Rede ist syntaktisch stärker<br />
integriert als einer in direkter. Eine Infinitkonstruktion ist syntaktisch<br />
stärker integriert als ein Neb<strong>en</strong>satz, eine Nominalisierung noch stärker<br />
usw.<br />
Wir woll<strong>en</strong> im Folg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> an solche Überlegung<strong>en</strong> anschließ<strong>en</strong>. Die<br />
‚reife’ <strong>und</strong> zur Distanzkommunikation ausgebaute Sprache verfügt insbesondere<br />
über eine dazu geeignete Syntax, <strong>und</strong> möglicherweise lass<strong>en</strong><br />
sich Forderung<strong>en</strong> nach einem ‚gut<strong>en</strong>’ Wiss<strong>en</strong>schaftsdeutsch mit Systemzuständ<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> ihr<strong>en</strong> Veränderung<strong>en</strong> in Zusamm<strong>en</strong>hang bring<strong>en</strong>. Wir<br />
stell<strong>en</strong> uns ein<strong>en</strong> Wiss<strong>en</strong>schaftler vor, der in der Sache befang<strong>en</strong> ist. Es<br />
geht ihm vor allem darum, diese Sache so g<strong>en</strong>au wie möglich zu beschreib<strong>en</strong>.<br />
Er beherrscht das Deutsche <strong>und</strong> verw<strong>en</strong>det auch seine Feinheit<strong>en</strong><br />
sachbezog<strong>en</strong>. Sein vorrangiges Ziel ist, das Gemeinte überhaupt<br />
auszudrück<strong>en</strong>. Wir k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> alle wiss<strong>en</strong>schaftliche Texte, der<strong>en</strong> Sprache<br />
man ansieht, dass der Autor nach der sprachlich<strong>en</strong> Form sucht, mit ihr<br />
regelrecht im Clinch liegt: sprachliche Geburtsweh<strong>en</strong> von Wiss<strong>en</strong>schaft.<br />
Die wiss<strong>en</strong>schaftliche Idee, die sprachlich<strong>en</strong> Ausdruck sucht <strong>und</strong> findet,<br />
kommt per se als gutes Wiss<strong>en</strong>schaftsdeutsch. Daran gibt es nichts zu<br />
deuteln. Oder anders gesagt: Die Wiss<strong>en</strong>schaft braucht die ganze Sprache.<br />
Sie braucht insbesondere mehr als d<strong>en</strong> gut<strong>en</strong> Stil. Mir ist bewusst,<br />
dass ein derartiges Plädoyer für die Darstellungspflicht der Wiss<strong>en</strong>schaft<br />
vor einer Selbstdarstellungspflicht nicht unbedingt im Tr<strong>en</strong>d liegt.<br />
10
Das wird in Kauf g<strong>en</strong>omm<strong>en</strong>. Wir plädier<strong>en</strong> ja nicht dafür, Texte für<br />
die übernächste G<strong>en</strong>eration zu schreib<strong>en</strong>, aber man sollte der Wiss<strong>en</strong>schaft<br />
sprachlich mehr als Alltags- <strong>und</strong> Medi<strong>en</strong>sprache zugesteh<strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
nicht nur darauf seh<strong>en</strong>, dass sie sich mit ‚gutem Deutsch’ dem öff<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong><br />
Diskurs anpasst.<br />
4. Bemerkung<strong>en</strong> zur Entwicklung des Geg<strong>en</strong>wartsdeutsch<strong>en</strong><br />
Auf der beschrieb<strong>en</strong><strong>en</strong> Gr<strong>und</strong>lage kann man nun eine Reihe von Bereich<strong>en</strong><br />
der Grammatik des Deutsch<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tifizier<strong>en</strong>, die nicht im Prinzip<br />
<strong>und</strong> nicht in jeder Einzelheit, wohl aber in bestimmt<strong>en</strong> Ausprägung<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> bestimmt<strong>en</strong> Häufung<strong>en</strong> als typisch für ein spätes, an die Bedingung<strong>en</strong><br />
schriftlicher Kommunikation geb<strong>und</strong><strong>en</strong>es Stadium dieser Sprache<br />
anzuseh<strong>en</strong> sind. Dazu gehör<strong>en</strong> jed<strong>en</strong>falls komplexe Nominalstruktur<strong>en</strong>,<br />
Diathesebildung<strong>en</strong>, Inkorporationsstruktur<strong>en</strong>, bestimmte Typ<strong>en</strong> von Infinitkonstruktion<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> verbale Komplexbildung<strong>en</strong>.<br />
Umgekehrt müsste man hier am ehest<strong>en</strong> ansetz<strong>en</strong> könn<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n man<br />
darauf aus ist, Sprachveränderung<strong>en</strong> im morphosyntaktisch<strong>en</strong> Bereich<br />
festzustell<strong>en</strong>, die mit einem Funktionsverlust als Folge eines Domän<strong>en</strong>verlustes<br />
einhergeh<strong>en</strong>. Aber wie Ich möchte einige einfache Fakt<strong>en</strong> aus<br />
zwei relevant<strong>en</strong> Bereich<strong>en</strong> in Erinnerung ruf<strong>en</strong>, um damit vielleicht ein<strong>en</strong><br />
Ansatzpunkt für die Diskussion zu markier<strong>en</strong>. Als in unserem Zusamm<strong>en</strong>hang<br />
wes<strong>en</strong>tlich scheint, das soll allerdings gleich vorausgeschickt<br />
werd<strong>en</strong>, zweierlei zu gelt<strong>en</strong>:<br />
1. Das Deutsche dürfte sich in d<strong>en</strong> relevant<strong>en</strong> Bereich<strong>en</strong> weiter<br />
in der eingeschlag<strong>en</strong><strong>en</strong> Richtung <strong>en</strong>twickeln. Von einem<br />
Verlust wäre deshalb nur zu sprech<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n eine Entwicklung<br />
off<strong>en</strong>sichtlich an ihre Gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> stieße.<br />
2. Mit jedem der Entwicklungspfade sind erhebliche Systemprobleme<br />
verb<strong>und</strong><strong>en</strong>, d.h. die Etablierung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
der Konstruktionstyp<strong>en</strong> ist systematisch mit Reibung<strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
in ihrem Gefolge mit Normproblem<strong>en</strong> verb<strong>und</strong><strong>en</strong>.<br />
11
Aus dieser Sicht wäre durchaus erklärlich, dass das Verhältnis von<br />
Sprachsystem <strong>und</strong> Sprachgebrauch komplizierter wird <strong>und</strong> zu Normproblem<strong>en</strong><br />
führt, die als Verfall oder dergl. diagnostiziert werd<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>n<br />
auch w<strong>en</strong>n Öst<strong>en</strong> Dahl sein<strong>en</strong> Komplexitätsbegriff in dieser Hinsicht<br />
(etwa Komplexität als ‚schwierig zu gebrauch<strong>en</strong>‘) ausdrücklich neutral<br />
hält, dürfte die Annahme plausibel sein, dass ein komplexes System<br />
schwerer zu beherrsch<strong>en</strong> ist als ein w<strong>en</strong>iger komplexes. Das gilt umso<br />
eher, als ja vorausgesetzt wird, dass verschied<strong>en</strong>e Ausprägung<strong>en</strong> eines<br />
Konstruktionstyps in einem gerichtet<strong>en</strong> Verhältnis zueinander steh<strong>en</strong>;<br />
dass sie, obwohl in einem bestimmt<strong>en</strong> Stadium gleichzeitig vorhand<strong>en</strong>,<br />
einander doch in einer bestimmt<strong>en</strong> Reih<strong>en</strong>folge voraussetz<strong>en</strong>. Nun in<br />
aller Kürze etwas zur Diathes<strong>en</strong>bildung <strong>und</strong> zu einem Inkorporationsmuster<br />
des Geg<strong>en</strong>wartsdeutsch<strong>en</strong>.<br />
4.1 Diathese<br />
Die Grammatik des Passivs <strong>und</strong> verwandter Konstruktion<strong>en</strong> beschäftigt<br />
sich seit längerer Zeit mit der Frage, welche Satzform<strong>en</strong> in einem Diathes<strong>en</strong>verhältnis<br />
anzusiedeln sei<strong>en</strong> (z.B. ausführlich schon Höhle 1978).<br />
Einigkeit besteht darüber, dass das Deutsche wie vergleichbare Sprach<strong>en</strong><br />
die Möglichkeit<strong>en</strong> zur Diathes<strong>en</strong>bildung in ihrer jünger<strong>en</strong> Geschichte<br />
erweitert <strong>und</strong> ausgebaut hab<strong>en</strong>. Ein<strong>en</strong> Aufschwung erfuhr<strong>en</strong> Untersuchung<strong>en</strong><br />
dieser Art durch die Grammatikalisierungsdebatte, weil man<br />
nun viel g<strong>en</strong>auer als früher etwa d<strong>en</strong> Status eines Verbs als Hilfsverb bestimm<strong>en</strong><br />
kann. Zu einem ‚normal<strong>en</strong>‘ werd<strong>en</strong>-Passiv (1a) werd<strong>en</strong> mindest<strong>en</strong>s<br />
Konversionsform<strong>en</strong> der folg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Art in Betracht gezog<strong>en</strong> (1b – i).<br />
(1) a. Das wird geregelt<br />
b. Das ist geregelt<br />
c. Das gehört geregelt<br />
d. Das kriegt er geregelt<br />
e. Das geht zu regeln<br />
f. Das regelt sich leicht<br />
g. Das lässt sich regeln<br />
h. Das ist zu regeln<br />
i. Das ist regelbar<br />
12
Betrachtet man die einzeln<strong>en</strong> Form<strong>en</strong> g<strong>en</strong>auer, dann lässt sich jeweils<br />
zeig<strong>en</strong>, wie weit sie das Standard-Passiv voraussetz<strong>en</strong>. Im Prinzip ist<br />
seine Bildbarkeit notw<strong>en</strong>dige Bedingung für die Bildbarkeit der übrig<strong>en</strong><br />
Konstruktion<strong>en</strong>, auch w<strong>en</strong>n diese teilweise ganz neue Funktion<strong>en</strong> erschließ<strong>en</strong><br />
(kein Zustands- ohne Vorgangspassiv, kein modales ohne Vorgangspassiv<br />
usw.). Und eb<strong>en</strong> weil die Bildbarkeit des Standard-Passivs<br />
notw<strong>en</strong>dige Bedingung ist, stellt sich in jedem Einzelfall die Frage nach<br />
der Bildbarkeit neu. Man hat es deshalb mit jeweils neu<strong>en</strong> Wohlgeformtheitsbedingung<strong>en</strong><br />
zu tun.<br />
Ganz off<strong>en</strong>sichtlich ist auch das Dativ-Passiv (Das bekommt er von ihr<br />
geregelt) vom werd<strong>en</strong>-Passiv (Sie regelt ihm das) abhängig. Wie keine<br />
andere Konversionsform revolutioniert es die Grammatik des Deutsch<strong>en</strong>,<br />
insofern der Dativ syntaktisch aktiv wird <strong>und</strong> als sog. Struktureller Kasus<br />
erscheint (umfangreiche Debatte in der Literatur, z.B. Weg<strong>en</strong>er 1985,<br />
Leirbukt 1997, Ogawa 2003). Ein<strong>en</strong> Fall dieser Art stell<strong>en</strong> die sog. ergativ<strong>en</strong><br />
Verb<strong>en</strong> dar. So ist der Dativ in 2a zunächst ein normaler Dativus<br />
Incommodi. In der ergativ<strong>en</strong> Variante (2b) erscheint er als Sonderform<br />
des Ag<strong>en</strong>s <strong>und</strong> kann nun unmittelbar in Opposition zum Standardag<strong>en</strong>s<br />
tret<strong>en</strong> (2c, d). Und natürlich wird die Konstruktion auch für unabgeleitete,<br />
d.h. von Haus aus intransitive Verb<strong>en</strong> möglich, die an sich kein Ag<strong>en</strong>s<br />
hab<strong>en</strong> (2e, f).<br />
(2) a. Sie zerreißt ihm d<strong>en</strong> Pullover<br />
b. Der Pullover zerreißt ihm<br />
c. Ihm zerreißt der Pullover<br />
d. Er zerreißt d<strong>en</strong> Pullover<br />
e. Der Reif<strong>en</strong> platzt<br />
f. Ihm platzt der Reif<strong>en</strong><br />
Die Grammatikalitäts- bzw. Normprobleme illustrier<strong>en</strong> wir in aller Kürze.<br />
Häufig gilt das Dativ-Passiv überhaupt als schlechtes Deutsch, <strong>und</strong><br />
w<strong>en</strong>n nicht, lässt sich nur schwer sag<strong>en</strong>, bei welch<strong>en</strong> Verb<strong>en</strong> es akzeptabel<br />
ist:<br />
(3) a. Er bekommt von ihr das Formular ausgefüllt<br />
b. Er bekommt auf d<strong>en</strong> Fuß getret<strong>en</strong><br />
13
14<br />
c. Er bekommt gedroht<br />
d. Er bekommt nachgeeifert<br />
e. Er bekommt misstraut<br />
f. Er bekommt geähnelt<br />
g. Er bekommt gefall<strong>en</strong><br />
Das Dativ-Passiv stellt eindeutig eine Erhöhung der syntaktisch<strong>en</strong> Flexibilität<br />
einer Kernklasse der deutsch<strong>en</strong> Verb<strong>en</strong> dar <strong>und</strong> ist, wie die übrig<strong>en</strong><br />
Diatheseform<strong>en</strong>, dem Standardpassiv nachgeordnet. Es zeigt aber<br />
auch in schöner Deutlichkeit, dass für d<strong>en</strong> syntaktisch<strong>en</strong> Fortschritt ein<br />
Preis gezahlt werd<strong>en</strong> muss. Die Syntaktisierung des Dativ-Passivs schreitet<br />
voran, daran besteht kein Zweifel. Im Geschrieb<strong>en</strong><strong>en</strong> ist seine Verw<strong>en</strong>dung<br />
klar auf das Hilfsverb bekomm<strong>en</strong> beschränkt, aber das lässt<br />
alle übrig<strong>en</strong> Grammatikalitätsfrag<strong>en</strong> off<strong>en</strong>. Eb<strong>en</strong> darauf kommt es an:<br />
Wir hab<strong>en</strong> einerseits zusätzliche Grammatikalitätsprobleme, sind andererseits<br />
aber nicht in der Lage, aus der Entwicklung Schlüsse bezüglich<br />
eines möglich<strong>en</strong> Funktionsverlustes zu zieh<strong>en</strong>. In seiner Arbeit über<br />
‚grammatisch gutes Deutsch‘ macht sich Eroms Gedank<strong>en</strong> über d<strong>en</strong><br />
stilistisch<strong>en</strong> Wert verschied<strong>en</strong>er Form<strong>en</strong> das Passivs <strong>und</strong> bemerkt dazu<br />
(2007: 101):<br />
Alle diese Konstruktion<strong>en</strong> weis<strong>en</strong> unterschiedliche Besonderheit<strong>en</strong> in der<br />
Verw<strong>en</strong>dung auf. Ein Schreiber, der sich um grammatisch gutes Deutsch<br />
bemüht, wird die Klipp<strong>en</strong>, die damit verb<strong>und</strong><strong>en</strong> sind, vermeid<strong>en</strong>. So lass<strong>en</strong><br />
sich nicht zu all<strong>en</strong> Passivverb<strong>en</strong> im ob<strong>en</strong> abgedruckt<strong>en</strong> Text bar-Adjektive<br />
bild<strong>en</strong>, etwa *erarbeitbar, *sehbar oder *meldbar. Bei d<strong>en</strong> sein+zu+Infinitiv-Konstruktion<strong>en</strong><br />
muss beachtet werd<strong>en</strong>, dass damit nicht nur Passiv,<br />
sondern auch Modalverbkonstruktion<strong>en</strong> umgang<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> könn<strong>en</strong> <strong>und</strong> dass<br />
dabei zwei Typ<strong>en</strong> auftret<strong>en</strong>. …<br />
Man kann Eroms’ Feststellung durchaus auch dann zustimm<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n<br />
man nicht all<strong>en</strong> sein<strong>en</strong> Grammatikalitätsurteil<strong>en</strong> folgt.<br />
4.2 Inkorporation<br />
Inkorporationsprozesse sind von ihrer Struktur her als spät oder nicht<br />
elem<strong>en</strong>tar zu k<strong>en</strong>nzeichn<strong>en</strong>, insofern sie auf vorhand<strong>en</strong><strong>en</strong> Struktur<strong>en</strong><br />
operier<strong>en</strong>. Ein Wort wie ölfördernd setzt eine Konstruktion des Typs<br />
Öl fördernd voraus, ein Kompositum wie Fre<strong>und</strong>eshand ist <strong>en</strong>tstand<strong>en</strong>
auf der Basis von des Fre<strong>und</strong>es Hand usw. Inkorporation<strong>en</strong> spiel<strong>en</strong> sich<br />
an der Schnittstelle von Syntax <strong>und</strong> Morphologie ab, sie stell<strong>en</strong> Verdichtung<strong>en</strong><br />
dar <strong>und</strong> sind ein typischer Fall von Komplexitätserhöhung.<br />
Wir betracht<strong>en</strong> ein<strong>en</strong> der promin<strong>en</strong>test<strong>en</strong> Inkorporationsprozesse des<br />
Deutsch<strong>en</strong>, nämlich die Bildung sog. Partikelverb<strong>en</strong> (Darstellung nach<br />
Eis<strong>en</strong>berg 2006).<br />
Der Prototyp von Partikelverb hat Präposition<strong>en</strong> der alt<strong>en</strong> Schicht inkorporiert<br />
wie in d<strong>en</strong> Beispiel<strong>en</strong> 4a. Eine Gr<strong>und</strong>funktion der Inkorporation<br />
besteht darin, dass mit dem Partikelverb wie ankleb<strong>en</strong> in 4c der vom<br />
Verb bezeichnete Vorgang (‚ankleb<strong>en</strong>‘ geg<strong>en</strong>über ‚kleb<strong>en</strong>‘) als gerichtet<br />
gefasst wird, ohne dass aber Ort, Ziel, Begleiter oder Quelle der Bewegung<br />
g<strong>en</strong>annt werd<strong>en</strong>. Sie bleib<strong>en</strong> implizit. Das Partikelverb stellt schon<br />
in dieser Gr<strong>und</strong>verw<strong>en</strong>dung Möglichkeit<strong>en</strong> zur Verfügung, bestimmte<br />
Aspekte von Bewegungsvorgäng<strong>en</strong> eb<strong>en</strong>so kompakt wie effektiv in<br />
einem produktiv<strong>en</strong> Muster zu realisier<strong>en</strong>. Was das Verhältnis von Morphologie<br />
<strong>und</strong> Syntax betrifft, ist das Partikelverb einzigartig, als es in<br />
dieser Hinsicht un<strong>en</strong>tschied<strong>en</strong> <strong>und</strong> nach dem geg<strong>en</strong>wärtig<strong>en</strong> K<strong>en</strong>ntnisstand<br />
auch un<strong>en</strong>tscheidbar bleibt. Die Verbpartikel behält, schon weil<br />
sie wie in 4c abtr<strong>en</strong>nbar ist, gewisse Worteig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong>, ist aber nicht<br />
einfach eine freie Form.<br />
(4) a. anbind<strong>en</strong>, abhol<strong>en</strong>, auflad<strong>en</strong>, mitkomm<strong>en</strong>,<br />
einsteck<strong>en</strong>, überkoch<strong>en</strong>,<br />
b. neb<strong>en</strong>ordn<strong>en</strong>, unterstell<strong>en</strong><br />
c. Sie klebt d<strong>en</strong> Zettel an die Wand<br />
d. Sie klebt d<strong>en</strong> Zettel an<br />
Das Muster ist derart attraktiv, dass es im Lauf der Entwicklung von d<strong>en</strong><br />
Präposition<strong>en</strong> auf Ausdrücke (‚Wörter‘) anderer Kategori<strong>en</strong> ausgedehnt<br />
wurde, von d<strong>en</strong><strong>en</strong> (5) die wichtigst<strong>en</strong> n<strong>en</strong>nt (Substantive, Adjektive, Verb<strong>en</strong>,<br />
Adverbi<strong>en</strong>, nicht mehr als Wörter bzw. Phras<strong>en</strong> vorkomm<strong>en</strong>de Form<strong>en</strong>).<br />
(5) a. brustschwimm<strong>en</strong>, danksag<strong>en</strong>, heimreis<strong>en</strong>, hofhalt<strong>en</strong><br />
b. totschlag<strong>en</strong>, freisprech<strong>en</strong>, frischhalt<strong>en</strong>, krankschreib<strong>en</strong><br />
c. k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>lern<strong>en</strong>, steh<strong>en</strong>bleib<strong>en</strong>, häng<strong>en</strong>lass<strong>en</strong><br />
15
16<br />
d. hierbleib<strong>en</strong>, weggeh<strong>en</strong>, herumred<strong>en</strong>, dazukomm<strong>en</strong>,<br />
draufhau<strong>en</strong><br />
e. anheimstell<strong>en</strong>, zugutehalt<strong>en</strong>, emporblick<strong>en</strong>,<br />
abhand<strong>en</strong>komm<strong>en</strong><br />
Die Vielfalt der mit (5) illustriert<strong>en</strong> Konstruktion<strong>en</strong> zeigt für sich schon,<br />
dass der Gesamtbereich nicht isoliert, sondern in mehrer<strong>en</strong> Richtung<strong>en</strong><br />
produktiv ist. Und w<strong>en</strong>n man sich seine Verw<strong>en</strong>dung<strong>en</strong> ansieht, wird sofort<br />
klar, dass er die allergrößte Bedeutung für Fachwortschätze erlangt<br />
hat. Von d<strong>en</strong> sprachlich<strong>en</strong> Möglichkeit<strong>en</strong> her wird keinerlei Beschränkung<br />
sichtbar.<br />
Aber auch hier tret<strong>en</strong> Systemprobleme in Erscheinung, die zu Zweifelsfäll<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> off<strong>en</strong>sichtlich ungel<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, unschön<strong>en</strong> oder als fehlerhaft<br />
empf<strong>und</strong><strong>en</strong><strong>en</strong> Konstruktion<strong>en</strong> führ<strong>en</strong>. Zwei der auffälligst<strong>en</strong> sind die<br />
folg<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.<br />
Die meist<strong>en</strong> der Ausdrücke in (5) hab<strong>en</strong> Eig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong> von Partikelverb<strong>en</strong>,<br />
sind aber dem Prototyp mit Präposition gemäß (4) nicht gleichgestellt.<br />
So bleib<strong>en</strong> substantivische Bestandteile aus Gründ<strong>en</strong>, die man<br />
inzwisch<strong>en</strong> gut k<strong>en</strong>nt (Esch<strong>en</strong>lohr 1999), auf dem Weg zur Verbpartikel<br />
steck<strong>en</strong>. Das führt beispielsweise dazu, dass man eine Skala solcher Ausdrücke<br />
danach erricht<strong>en</strong> kann, ob ihr Erstglied überhaupt abtr<strong>en</strong>nbar ist<br />
oder nicht, z.B. so:<br />
(6) a. bauspar<strong>en</strong>, bergsteig<strong>en</strong>, ehebrech<strong>en</strong>, punktschweiß<strong>en</strong>,<br />
strafversetz<strong>en</strong><br />
b. brandmark<strong>en</strong>, handhab<strong>en</strong>, nachtwandeln, lustwandeln,<br />
sandstrahl<strong>en</strong><br />
c. lobpreis<strong>en</strong>, maßregeln, schlussfolgern, kopfrechn<strong>en</strong>,<br />
wetteifern, notland<strong>en</strong><br />
d. achtgeb<strong>en</strong>, maßhalt<strong>en</strong>, teilnehm<strong>en</strong>, preisgeb<strong>en</strong>, eislauf<strong>en</strong>,<br />
probesing<strong>en</strong><br />
Für die meist<strong>en</strong> Sprecher nimmt die Abtr<strong>en</strong>nbarkeit des Erstgliedes bei<br />
d<strong>en</strong> Beispiel<strong>en</strong> von 6a bis 6d immer mehr zu, aber natürlich gibt es zahlreiche<br />
Uneinigkeit<strong>en</strong> bei der Beurteilung. Und was mit (6) demonstriert<br />
wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Keine Angst, Sie werd<strong>en</strong> nicht mit
Problem<strong>en</strong> der Getr<strong>en</strong>nt- <strong>und</strong> Zusamm<strong>en</strong>schreibung <strong>und</strong> ihrer Bedeutung<br />
für das Missling<strong>en</strong> der Orthographiereform von 1996 behelligt.<br />
Vielleicht ist aber auch ohne weitere Demonstration plausibel, dass an<br />
der Abtr<strong>en</strong>nbarkeit des erst<strong>en</strong> Bestandteils viele andere grammatische<br />
Verhalt<strong>en</strong>sweis<strong>en</strong> häng<strong>en</strong>, die zu Normproblem<strong>en</strong> führ<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>n man sie<br />
erst einmal auf d<strong>en</strong> Tisch bringt. Konstruktive Vielfalt ist nicht ohne<br />
Übergänge zwisch<strong>en</strong> Konstruktion<strong>en</strong> <strong>und</strong> damit nicht ohne Zweifelsfälle<br />
zu hab<strong>en</strong>.<br />
Das zweite Beispiel zeigt, wie sozusag<strong>en</strong> rein konstruktiv etwas <strong>en</strong>tsteht,<br />
das als schlechtes Deutsch empf<strong>und</strong><strong>en</strong> wird. Ein Partikelverb wie<br />
aufsitz<strong>en</strong> kann ohne eine weitere Präpositionalgruppe verw<strong>en</strong>det werd<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> ist dann stilistisch unauffällig (erstes Beispiel in 7).<br />
(7) Sie sitzt auf; Sie sitzt auf dem Pferd auf; Er schlägt auf<br />
dem Bod<strong>en</strong> auf; Er setzt auf der Landebahn auf; Er stellt<br />
Lorbeerbäume auf dem Podium auf; sie stapelt Bücher auf<br />
dem Schreibtisch auf<br />
Insbesondere bei rein lokaler (im Geg<strong>en</strong>satz zu direktionaler) Verw<strong>en</strong>dung<br />
tritt nun häufig der Fall ein, dass eine Präpositionalgruppe verw<strong>en</strong>det<br />
werd<strong>en</strong> muss, der<strong>en</strong> Präposition formgleich mit der Verbpartikel ist.<br />
Das Ergebnis wird von d<strong>en</strong> meist<strong>en</strong> Sprechern zumindest stilistisch nicht<br />
goutiert, <strong>und</strong> es wird noch schlechter, w<strong>en</strong>n ausgeklammert wird (Sie<br />
sitzt auf auf dem Pferd). Aber versuch<strong>en</strong> Sie einmal, eine vergleichbar<br />
kurze alternative Formulierung zu find<strong>en</strong>. Das System geht sein<strong>en</strong> Weg.<br />
Das fertige Partikelverb etabliert sich <strong>und</strong> verhält sich in bestimmt<strong>en</strong> Verw<strong>en</strong>dung<strong>en</strong>,<br />
ohne Rücksicht auf d<strong>en</strong> Bestandteil Partikel zu nehm<strong>en</strong>.<br />
Niemand hat meines Wiss<strong>en</strong>s bisher versucht, konstruktive Schwäch<strong>en</strong><br />
des Deutsch<strong>en</strong> – oder was man als solche anseh<strong>en</strong> könnte – systematisch<br />
zu erfass<strong>en</strong> <strong>und</strong> unter diesem Gesichtspunkt unter die Leute zu bring<strong>en</strong>.<br />
Die Wirkung könnte verheer<strong>en</strong>d für das Anseh<strong>en</strong> der Sprache sein. Was<br />
man in der sprachkritisch<strong>en</strong> Literatur unter Mängeln oder Schwäch<strong>en</strong><br />
des Deutsch<strong>en</strong> findet, ist harmlos im Vergleich zu dem, was wir in Wahrheit<br />
wiss<strong>en</strong> (z.B. Gauger 2002: 6f.). Meine These ist: Es handelt sich um<br />
Eig<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong>, die zu einem wes<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong> Teil der Entwicklung des<br />
Deutsch<strong>en</strong> zu einer reif<strong>en</strong> Sprache geschuldet sind. Mit Restriktion<strong>en</strong><br />
17
wie dem Rückgang seiner Verw<strong>en</strong>dung als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache hab<strong>en</strong><br />
sie nichts zu tun. Viel eher dürfte das Geg<strong>en</strong>teil zutreff<strong>en</strong>. Je komplexer<br />
ein System wird, desto schwerer wird es, seine nicht rein funktionsbedingte<br />
Verw<strong>en</strong>dung zu beherrsch<strong>en</strong>. Aus dieser Feststellung<br />
lass<strong>en</strong> sich sofort auch Konsequ<strong>en</strong>z<strong>en</strong> für die Vermittlung der Sprache<br />
zieh<strong>en</strong>.<br />
5. Unaufhaltsamkeit der Globalisierung<br />
Die bisherig<strong>en</strong> Ausführung<strong>en</strong> erlaub<strong>en</strong> keinesfalls d<strong>en</strong> Schluss, das<br />
Deutsche sei als Sprache durch d<strong>en</strong> bisherig<strong>en</strong> Verlust von Gebrauchsdomän<strong>en</strong><br />
nicht in Mitleid<strong>en</strong>schaft gezog<strong>en</strong>. Auch w<strong>en</strong>n man in manch<strong>en</strong><br />
Bereich<strong>en</strong> besser Bescheid weiß <strong>und</strong> etwa feststell<strong>en</strong> kann, dass das<br />
deutsche Flexionssystem durch das Englische bisher mit Sicherheit nicht<br />
nachhaltig verändert wurde (Eis<strong>en</strong>berg 2004), reicht das nicht aus. Aber<br />
wir sollt<strong>en</strong> uns darum bemüh<strong>en</strong>, der Frage nach dem tatsächlich<strong>en</strong> Zustand<br />
des Deutsch<strong>en</strong> ernsthaft nachzugeh<strong>en</strong>, bevor wir sein<strong>en</strong> Verfall<br />
beklag<strong>en</strong>.<br />
Nun einmal ang<strong>en</strong>omm<strong>en</strong>, wir besitz<strong>en</strong> auf absehbare Zeit eine Sprache,<br />
die als Universalsprache verw<strong>en</strong>dbar bleibt. Ist das etwa für die<br />
Rolle des Deutsch<strong>en</strong> als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache von Bedeutung Sind<br />
die Fakt<strong>en</strong>, die Ulrich Ammon (s.o.) immer wieder liefert, nicht einfach<br />
erdrück<strong>en</strong>d, so dass man besser resignier<strong>en</strong> sollte als viel vergebliche<br />
Müh<strong>en</strong> auf sich zu nehm<strong>en</strong> Lass<strong>en</strong> Sie mich zum Schluss einige Bemerkung<strong>en</strong><br />
zu dieser Frage mach<strong>en</strong>, der<strong>en</strong> Gr<strong>und</strong>lage ich in wes<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong><br />
Punkt<strong>en</strong> einem unveröff<strong>en</strong>tlicht<strong>en</strong> Papier von Hartmut Haberland<br />
(2007) verdanke. 2<br />
Begrifflich von Bedeutung ist eine Unterscheidung, die ein<strong>en</strong> beschreib<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />
Begriff wie Globalisierung von einem ideologisch<strong>en</strong> wie<br />
Globalismus tr<strong>en</strong>nt. Beschreibt der eine d<strong>en</strong> historisch<strong>en</strong> Prozess in sein<strong>en</strong><br />
Facett<strong>en</strong>, dann erfasst der andere nicht nur unzulässige Abstrahierung<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> G<strong>en</strong>eralisierung<strong>en</strong>, sondern noch weitergeh<strong>en</strong>d etwas wie ein<br />
stilles, allgemeines Einverständnis darüber, was sowieso passiert (<strong>en</strong>gl.<br />
cons<strong>en</strong>t). Dieses Einverständnis kann dazu führ<strong>en</strong>, dass bestimmte Ereignisse<br />
als natürlich oder unvermeidlich oder auch richtig erschein<strong>en</strong>, dergestalt,<br />
dass etwa die Globalisierung vorangetrieb<strong>en</strong> wird, auch wo sie<br />
es gar nicht müsste <strong>und</strong> ohne d<strong>en</strong> Globalismus auch nicht könnte. Was<br />
18
die Sprache betrifft, stellt David Crystal ja beispielsweise fest, dass eine<br />
Sprache globale Bedeutung dann erhalte, „wh<strong>en</strong> it develops a special<br />
role that is recognized in every country“ (2004: 28), d.h. nicht das rein<br />
Faktische reicht aus, sondern eb<strong>en</strong> das allgemeine Einverständnis muss<br />
dazukomm<strong>en</strong>. Zur Illustration nur einige w<strong>en</strong>ige Beispiele, die teilweise<br />
eb<strong>en</strong>falls von Hartmut Haberland übernomm<strong>en</strong> sind.<br />
Der britische Germanist Martin Durrell berichtet von Untersuchung<strong>en</strong><br />
der <strong>en</strong>glisch<strong>en</strong> Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer, die darauf hinauslauf<strong>en</strong>,<br />
dass der britisch<strong>en</strong> Industrie etwa 15% an Aufträg<strong>en</strong> <strong>en</strong>tgeh<strong>en</strong>, weil<br />
Fremdsprach<strong>en</strong>k<strong>en</strong>ntnisse der Verkäufer mangelhaft oder nicht vorhand<strong>en</strong><br />
sind. Hier wirkt sich der Globalismus („Englisch kann doch jeder,<br />
wozu also fremde Sprach<strong>en</strong> lern<strong>en</strong>“) negativ für die Englischsprech<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />
selbst aus. Inzwisch<strong>en</strong> lieg<strong>en</strong> g<strong>en</strong>auere Untersuchung<strong>en</strong><br />
über die Bedeutung von Fremdsprach<strong>en</strong>k<strong>en</strong>ntniss<strong>en</strong> für die europäische<br />
Wirtschaft vor (z. B. ELAN 2006).<br />
In Frankreich ging das Deutsche eb<strong>en</strong>so wie in Deutschland das Französische<br />
seit Jahr<strong>en</strong> zurück, obwohl bekannt ist, dass K<strong>en</strong>ntnisse der<br />
jeweilig<strong>en</strong> Nachbarsprache etwa für Jurist<strong>en</strong> <strong>und</strong> Ökonom<strong>en</strong> klare berufliche<br />
Vorteile verschaff<strong>en</strong>, was man von dem in beid<strong>en</strong> Ländern mom<strong>en</strong>tan<br />
boom<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Spanisch jed<strong>en</strong>falls nicht im von d<strong>en</strong> Lernern unterstellt<strong>en</strong><br />
Ausmaß sag<strong>en</strong> kann. Nur langsam setzt sich die Erk<strong>en</strong>ntnis, das<br />
Französische sei im Verkehr mit Deutschland <strong>und</strong> das Deutsche im Verkehr<br />
mit Frankreich von erheblichem Nutz<strong>en</strong>, wieder in der Praxis des<br />
Sprach<strong>en</strong>lern<strong>en</strong>s durch. Beide Sprach<strong>en</strong> hab<strong>en</strong> sich im jeweilig<strong>en</strong> Nachbarland<br />
inzwisch<strong>en</strong> stabilisiert.<br />
Die Vereinbarung<strong>en</strong> über eine Harmonisierung des Hochschulwes<strong>en</strong>s<br />
im sog. Bologna-Prozess geh<strong>en</strong> in viel<strong>en</strong> europäisch<strong>en</strong> Ländern <strong>und</strong> auch<br />
in Deutschland mit einer Zunahme von <strong>en</strong>glischsprachig<strong>en</strong> Curricula<br />
einher, obwohl die Vereinbarung<strong>en</strong> selbst dazu keinerlei Aussage mach<strong>en</strong>.<br />
Man fragt also gar nicht oder zu w<strong>en</strong>ig, wie die Ziele der Harmonisierung<br />
anders erreicht werd<strong>en</strong> könnt<strong>en</strong>.<br />
Seit Mitte der 90er Jahre geht der Anteil von Internetseit<strong>en</strong> von <strong>en</strong>glisch<strong>en</strong><br />
Muttersprachlern am Gesamtbestand zurück, <strong>und</strong> eb<strong>en</strong>so geht der<br />
Anteil an <strong>en</strong>glisch<strong>en</strong> Internetseit<strong>en</strong> überhaupt zurück (das liegt natürlich<br />
in erster Linie am Zuwachs des Chinesisch<strong>en</strong>). Der Anteil an Inter-<br />
19
netseit<strong>en</strong>, die das Englische als Lingua franca verw<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, ist dageg<strong>en</strong><br />
im Wes<strong>en</strong>tlich<strong>en</strong> konstant.<br />
Fakt<strong>en</strong> dieser Art zeig<strong>en</strong>, wie der Globalismus wirkt. Wir sollt<strong>en</strong> daraus<br />
für Sprach<strong>en</strong> wie das Deutsche die Lehre zieh<strong>en</strong>, dass wir uns zu frag<strong>en</strong><br />
hab<strong>en</strong>, wo ein Globalismus als stilles Einverständnis über die Rolle des<br />
Englisch<strong>en</strong> nicht durch Fakt<strong>en</strong> gedeckt ist. Das kann ein erster Schritt<br />
sein, vor Aug<strong>en</strong> zu führ<strong>en</strong>, wo Handlungsmöglichkeit<strong>en</strong> besteh<strong>en</strong>. Diese<br />
lieg<strong>en</strong> fast immer außerhalb eines Protektionismus. Der Globalismus,<br />
so sag<strong>en</strong> viele Fachleute, wird eines Tages gewaltig zum Nachteil des<br />
Englisch<strong>en</strong> ausschlag<strong>en</strong>. Darauf sollt<strong>en</strong> wir nicht wart<strong>en</strong>, auch w<strong>en</strong>n das<br />
Deutsche noch so gut in Form ist.<br />
Das Gerede über das Deutsche, das d<strong>en</strong> Ausgangspunkt unserer Erörterung<br />
bildet, scheint ein klarer Fall von Globalismus zu sein. Damit wäre<br />
aber klar, dass wir ihm mit innersprachwiss<strong>en</strong>schaftlich<strong>en</strong> Argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
allein nicht beikomm<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>. Mir jed<strong>en</strong>falls ist erst nach Lektüre von<br />
Hartmut Haberlands Papier (Haberland 2007/2009) deutlich geword<strong>en</strong>,<br />
worauf es eig<strong>en</strong>tlich ankommt. Dies<strong>en</strong> riesig<strong>en</strong> Bog<strong>en</strong> von inn<strong>en</strong> nach<br />
auß<strong>en</strong> <strong>und</strong> von auß<strong>en</strong> nach inn<strong>en</strong> zu schlag<strong>en</strong>, war schon immer seine<br />
Stärke. Sie stand auch ganz am Anfang unserer gemeinsam<strong>en</strong> Arbeit,<br />
die für mich persönlich wie wiss<strong>en</strong>schaftlich so wichtig ist (Eis<strong>en</strong>berg<br />
<strong>und</strong> Haberland 1972). Die Sprachwiss<strong>en</strong>schaft selbst verdankt Hartmut<br />
Haberland viel, aber sie verdankt ihm auch viel, w<strong>en</strong>n es um ihr Verhältnis<br />
zu d<strong>en</strong> Verhältniss<strong>en</strong> geht, unter d<strong>en</strong><strong>en</strong> sie betrieb<strong>en</strong> wird. Er ist <strong>und</strong><br />
bleibt ein starker Typ, daran hat sich in all d<strong>en</strong> Jahr<strong>en</strong> nichts geändert.<br />
Literaturhinweise<br />
Ágel, Vilmos <strong>und</strong> Mathilde H<strong>en</strong>nig. 2007. Überlegung<strong>en</strong> zur Theorie <strong>und</strong><br />
Praxis des Nähe- <strong>und</strong> Distanzsprech<strong>en</strong>s. In Vilmos Ágel <strong>und</strong> Mathilde<br />
H<strong>en</strong>nig (Hg.) Zugänge zur Grammatik der gesproch<strong>en</strong><strong>en</strong> Sprache. Tübing<strong>en</strong>:<br />
Niemeyer. 179-214.<br />
Ammon, Ulrich. 1998. Ist das Deutsche noch eine internationale Wiss<strong>en</strong>schaftssprache<br />
Englisch auch für die Lehre an deutschsprachig<strong>en</strong> Hochschul<strong>en</strong>.<br />
Berlin & New York: de Gruyter.<br />
Ammon, Ulrich. 2003. The Decline of German and the Rise of English as<br />
International Languages of the Sci<strong>en</strong>ces. In Rüdiger Ahr<strong>en</strong>s (Hg.) Euro-<br />
20
päische Sprach<strong>en</strong>politik/European Language Policy. Heidelberg: Winter.<br />
215-223.<br />
Campe, Joachim Heinrich. 1813. Wörterbuch zur Erklärung <strong>und</strong> Verdeutschung<br />
der unserer Sprache aufgedrung<strong>en</strong><strong>en</strong> fremd<strong>en</strong> Ausdrücke. Neue starkvermehrte<br />
<strong>und</strong> durchgängig verbesserte Ausgabe. Braunschweig: in der<br />
Schulbuchhandlung.<br />
Crystal, David. 2004. The Past, Pres<strong>en</strong>t, and Future of World English. In<br />
Andreas Gardt <strong>und</strong> Bernd Hüppauf (Hg.) Globalization and the Future<br />
of German. Berlin & New York: de Gruyter. 27-45.<br />
Dahl, Öst<strong>en</strong>. 2004. The Growth and Maint<strong>en</strong>ance of Linguistic Complexity.<br />
Amsterdam: John B<strong>en</strong>jamins.<br />
Dietrich, Rainer. 2003. Inwiefern kann eine Sprache einfach sein Zeitschrift<br />
für Literaturwiss<strong>en</strong>schaft <strong>und</strong> Linguistik 33, H. 131. 55-75.<br />
Eis<strong>en</strong>berg, Peter. 2004. German as an Endangered Language In Andreas<br />
Gardt <strong>und</strong> Bernd Hüppauf (Hg.) Globalization and the Future of German.<br />
Berlin & New York: de Gruyter. 121-137.<br />
Eis<strong>en</strong>berg, Peter. 2005. Deutsch, Englisch <strong>und</strong> die lingua franca als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache.<br />
In Uwe Pörks<strong>en</strong> (Hg.) Die Wiss<strong>en</strong>schaft spricht Englisch<br />
Versuch einer Standortbestimmung. Götting<strong>en</strong>: Wallstein. 55-63.<br />
Eis<strong>en</strong>berg, Peter. 2006. Gr<strong>und</strong>riss der deutsch<strong>en</strong> Grammatik. Band 1: Das<br />
Wort. Stuttgart & Weimar: Metzler.<br />
Eis<strong>en</strong>berg, Peter <strong>und</strong> Hartmut Haberland. 1972. Das geg<strong>en</strong>wärtige Interesse<br />
an der Linguistik. Das Argum<strong>en</strong>t 72. 326-349.<br />
ELAN. 2006. Auswirkung<strong>en</strong> mangelnder Fremdsprach<strong>en</strong>k<strong>en</strong>ntnisse in d<strong>en</strong><br />
Unternehm<strong>en</strong> auf die europäische Wirtschaft. http://ec.europa/education/<br />
policies/lang/doc/elan_de.pdf<br />
Eroms, Hans-Werner. 2007. Grammatisch gutes Deutsch – mehr als nur<br />
richtiges Deutsch. In Armin Burkhardt (Hg.) Was ist gutes Deutsch<br />
Studi<strong>en</strong> <strong>und</strong> Meinung<strong>en</strong> zum gepflegt<strong>en</strong> Sprachgebrauch. Mannheim usw.:<br />
Dud<strong>en</strong>verlag. 90-108.<br />
Esch<strong>en</strong>lohr, Stefanie. 1999. Vom Nom<strong>en</strong> zum Verb. Konversion, Präfigierung<br />
<strong>und</strong> Rückbildung im Deutsch<strong>en</strong>. Hildesheim: Olms.<br />
Fabricius-Hans<strong>en</strong>, Cathrine. 2003. Deutsch – eine ‚reife‘ Sprache. Ein Plädoyer<br />
für Komplexität. In: Gerhard Stickel (Hg.): Deutsch von auß<strong>en</strong>.<br />
Berlin & New York: de Gruyter. 99-112.<br />
21
Fabricius-Hans<strong>en</strong>, Cathrine. 2007. Dreimal (nicht) dasselbe: sprachliche<br />
Perspektivierung im Deutsch<strong>en</strong>, Norwegisch<strong>en</strong> <strong>und</strong> Englisch<strong>en</strong>. Zeitschrift<br />
für Literaturwiss<strong>en</strong>schaft <strong>und</strong> Linguistik 37, H. 145. 61-86.<br />
Gardt, Andreas <strong>und</strong> Bernd Hüppauf (Hg.). 2004. Globalization and the Future<br />
of German. Berlin & New York: de Gruyter.<br />
Gauger, Hans-Martin. 2002. Sprachkritik – heute. Typoskript. Universität<br />
Freiburg, Romanistisches Institut.<br />
Haberland, Hartmut. 2007. English – The Language of Globalism Typoskript,<br />
Universität Roskilde, Departm<strong>en</strong>t of Culture and Id<strong>en</strong>tity.<br />
Haberland, Hartmut. 2009. English – the Language of Globalism RASK<br />
internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 30. 17-45.<br />
H<strong>en</strong>nig, Mathilde. 2006. Grammatik der gesproch<strong>en</strong><strong>en</strong> Sprache in Theorie<br />
<strong>und</strong> Praxis. Kassel: Kassel University Press.<br />
Höhle, Tilman. 1978. Lexikalistische Syntax: Die Aktiv-Passiv-Relation<br />
<strong>und</strong> andere Infinitkonstruktion<strong>en</strong> im Deutsch<strong>en</strong>. Tübing<strong>en</strong>: Niemeyer.<br />
Ickler, Theodor. 2007. Wie gut ist die deutsche Sprache In H<strong>en</strong>ning<br />
Kaufmann-Stiftung. Jahrbuch 2001-2005. Paderborn: IFB Verlag. 23-42.<br />
Kalverkämper, Hartwig <strong>und</strong> Harald Weinrich (Hg.). 1986. Deutsch als<br />
Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. Tübing<strong>en</strong>: Narr.<br />
Klein, Wolfgang. 2003. Wozu braucht man eig<strong>en</strong>tlich Flexionsmorphologie<br />
Zeitschrift für Literaturwiss<strong>en</strong>schaft <strong>und</strong> Linguistik 33, H. 131. 23-54.<br />
Koch, Peter <strong>und</strong> Wulf Österreicher. 1985. Sprache der Nähe – Sprache der<br />
Distanz. Mündlichkeit <strong>und</strong> Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie<br />
<strong>und</strong> Sprachgeschichte. Romanisches Jahrbuch 36. 15-43.<br />
Koch, Peter <strong>und</strong> Wulf Österreicher. 1994. Schriftlichkeit <strong>und</strong> Sprache. In<br />
Hartmut Günther <strong>und</strong> Otto Ludwig (Hg.) Schrift <strong>und</strong> Schriftlichkeit. Ein<br />
interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin & New<br />
York: de Gruyter. Bd. 1. 587-604.<br />
Leirbukt, Oddleif. 1997. Untersuchung<strong>en</strong> zum bekomm<strong>en</strong>-Passiv im heutig<strong>en</strong><br />
Deutsch. Tübing<strong>en</strong>: Niemeyer.<br />
McWhorter, John. 2001. The world’s simplest grammars are creole grammars.<br />
Linguistic Typology 5. 125-166.<br />
Mocikat, Ralph. 2007. Die Rolle der Sprache in d<strong>en</strong> Naturwiss<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong>.<br />
In DAAD (Hg.): Deutsch als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. Tagungsbeiträge.<br />
Bonn: DAAD. 23-30.<br />
22
Münkler, Herfried, Grit Straß<strong>en</strong>berger <strong>und</strong> Matthias Bohl<strong>en</strong>der (Hg.) 2006.<br />
Deutschlands Elit<strong>en</strong> im Wandel. Frankfurt am Main: Campus.<br />
Ogawa, Akio. 2003. Dativ <strong>und</strong> Val<strong>en</strong>zerweiterung. Syntax, Semantik, Typologie.<br />
Tübing<strong>en</strong>: Stauff<strong>en</strong>burg.<br />
Pörks<strong>en</strong>, Uwe. 2008. Latein – Französisch – Englisch. Sprachberührung<strong>en</strong><br />
in der Geschichte des Deutsch<strong>en</strong>. Deutsche Akademie für Sprache <strong>und</strong><br />
Dichtung. Jahrbuch 2007. Götting<strong>en</strong>: Wallstein. 121-130.<br />
Raible, Wolfgang. 1992. Junktion. Eine Dim<strong>en</strong>sion der Sprache <strong>und</strong> ihre<br />
Realisierungsform<strong>en</strong> zwisch<strong>en</strong> Aggregation <strong>und</strong> Integration. Heidelberg:<br />
Winter.<br />
Rick<strong>en</strong>, Ulrich. 1995. Zum Thema Christian Wolff <strong>und</strong> die Wiss<strong>en</strong>schaftssprache<br />
der deutsch<strong>en</strong> Aufklärung. In Heinz Leopold Kretz<strong>en</strong>bacher <strong>und</strong><br />
Harald Weinrich (Hg.): Linguistik der Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. Berlin: de<br />
Gruyter. 41-90.<br />
Schiewe, Jürg<strong>en</strong>. 1998. Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der<br />
Sprachkritik von der Antike bis zur Geg<strong>en</strong>wart. Münch<strong>en</strong>: Beck.<br />
Schiewe, Jürg<strong>en</strong>. 2008. Integration oder Isolation Was das Deutsche mit<br />
dem Fremd<strong>en</strong> macht. Deutsche Akademie für Sprache <strong>und</strong> Dichtung.<br />
Jahrbuch 2007. Götting<strong>en</strong>: Wallstein. 131-139.<br />
Thielemann, Winfried. 2002. Wege aus dem sprachpolitisch<strong>en</strong> Vakuum<br />
Zur scheinbar<strong>en</strong> wiss<strong>en</strong>schaftskulturell<strong>en</strong> Neutralität wiss<strong>en</strong>schaftlicher<br />
Universalsprach<strong>en</strong>. In Konrad Ehlich (Hg.): Mehrsprachige Wiss<strong>en</strong>schaft<br />
– Europäische Perspektiv<strong>en</strong>. http://www.euro-sprach<strong>en</strong>jahr.de.<br />
Thielemann, Winfried. 2007. Alltagssprach<strong>en</strong> als wiss<strong>en</strong>schaftliche Ressource.<br />
In: DAAD (Hg.): Deutsch als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. Tagungsbeiträge.<br />
Bonn: DAAD. 45-56.<br />
Trabant, Jürg<strong>en</strong>. 2007. Die gebellte Sprache: Über das Deutsche. Berlin-<br />
Brand<strong>en</strong>burgische Akademie der Wiss<strong>en</strong>schaft<strong>en</strong>. Berichte <strong>und</strong> Abhandlung<strong>en</strong>.<br />
Band 13. Berlin: Akademie. 309-328.<br />
Weg<strong>en</strong>er, Heide. 1985. Der Dativ im heutig<strong>en</strong> Deutsch. Tübing<strong>en</strong>: Narr.<br />
Weinrich, Harald. 1986. Zur Einleitung‚Wiss<strong>en</strong>schaftsdeutsch – gutes<br />
Deutsch’. In Hartwig Kalverkämper <strong>und</strong> Harald Weinrich (Hg.) Deutsch<br />
als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. Tübing<strong>en</strong>: Narr. 97-99.<br />
23
Not<strong>en</strong><br />
* Eine veränderte Fassung dieses Beitrages ist bereits erschi<strong>en</strong><strong>en</strong> unter dem<br />
Titel: Deutsch mit <strong>und</strong> ohne Wiss<strong>en</strong>schaft. In: Wiss<strong>en</strong> schaff<strong>en</strong> - Wiss<strong>en</strong><br />
kommunizier<strong>en</strong>. Wiss<strong>en</strong>schaftssprach<strong>en</strong> in Geschichte <strong>und</strong> Geg<strong>en</strong>wart.<br />
Herausgegeb<strong>en</strong> von Wieland Eins, Helmut Glück <strong>und</strong> Sabine Pretscher.<br />
Wiesbad<strong>en</strong>: Harrassowitz Verlag. 2011. 133-148.<br />
1. Überarbeiteter Text des Vortrags auf dem Symposium für Hartmut Haberland<br />
am 8. Februar 2008. In die Überarbeitung sind zahlreiche Anregung<strong>en</strong><br />
aus der Diskussion des Beitrags eingegang<strong>en</strong>. All<strong>en</strong> Kolleginn<strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Kolleg<strong>en</strong>, die sich mündlich oder schriftlich an der Diskussion<br />
beteiligt hab<strong>en</strong>, danke ich herzlich.<br />
2. Mittlerweile erschi<strong>en</strong><strong>en</strong> als Haberland (2009).<br />
24
Refer<strong>en</strong>ce<br />
Eis<strong>en</strong>berg, Peter. 2011. Domän<strong>en</strong>verlust <strong>und</strong> <strong>Sprachverfall</strong>. Über das<br />
Deutsche als Wiss<strong>en</strong>schaftssprache. <strong>KULT</strong> 9. Einspruch – Objection –<br />
Indsigelse. Essays in Honor of Hartmut Haberland. 4-24.<br />
<strong>KULT</strong> is available online at:<br />
www.<strong>postkolonial</strong>.dk<br />
!