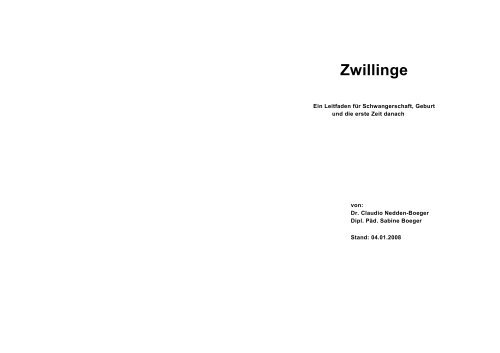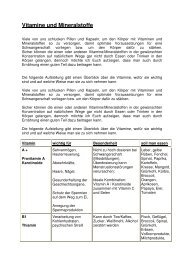Zwillinge - klein-putz
Zwillinge - klein-putz
Zwillinge - klein-putz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Zwillinge</strong><br />
Ein Leitfaden für Schwangerschaft, Geburt<br />
und die erste Zeit danach<br />
von:<br />
Dr. Claudio Nedden-Boeger<br />
Dipl. Päd. Sabine Boeger<br />
Stand: 04.01.2008
2a<br />
2b<br />
Inhalt<br />
Vorwort (4)<br />
Erstes Kapitel: Schwangerschaft (4)<br />
1. Entstehung von <strong>Zwillinge</strong>n (5)<br />
Eineiige <strong>Zwillinge</strong> • Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> • Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und <strong>Zwillinge</strong><br />
aus zweikernigen Eizellen • Wie sind die eigenen <strong>Zwillinge</strong> entstanden • Höhergradige<br />
Mehrlinge • Siamesische <strong>Zwillinge</strong> • Fruchtbarkeitsbehandlung und<br />
künstliche Befruchtung<br />
2. Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft (9)<br />
3. Bildung der Eihäute und Einnistung in die Gebärmutter (10)<br />
Eineiige <strong>Zwillinge</strong> • Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> • Höhergradige Mehrlingsschwangerschaften<br />
• Bedeutung der Klassifizierung<br />
4. Vorsorgeuntersuchungen, Mutterpass (12)<br />
5. Vorgeburtliche Diagnostik (14)<br />
6. Abtreibung einzelner Mehrlinge (18)<br />
Der Arzt ist kompetent für die Diagnose und Behandlung,<br />
die Patientin ist kompetent für ihr Wertesystem<br />
und verantwortlich für ihre Lebensgestaltung.<br />
Günter Virt<br />
7. Risiken und Komplikationen einer Mehrlingsschwangerschaft (19)<br />
Allgemeine Schwangerschaftsbeschwerden • Unzureichende Mutterkuchenfunktion<br />
(Plazentainsuffizienz) • Vorzeitige Wehen und Muttermundschwäche • Gestose,<br />
hypertensive Schwangerschaftserkrankung • Blasensprung • Besondere Störungen<br />
bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n • Fehlgeburt, Totgeburt<br />
8. Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung (30)<br />
9. Besorgungen während der Schwangerschaft (31)<br />
Anschaffungen • Ein Name für die Kinder • Vorbereitungen für einen vorzeitigen<br />
stationären Klinikaufenthalt • Anmeldung bei der Nachsorgehebamme • Bescheinigungen<br />
für das Mutterschaftsgeld • Arbeitslosengeld II / Sozialhilfe / BAföG •<br />
Bundesstiftung „Mutter und Kind“<br />
10. Endphase der Schwangerschaft (37)<br />
Stationäre Überwachung zum Ende der Schwangerschaft auch ohne besondere<br />
Komplikationen • Künstliche Einleitung der Geburt
3a<br />
3b<br />
Zweites Kapitel: Geburt und Wochenbett (42)<br />
1. Geburt (42)<br />
Geburtsort • Kaiserschnitt oder vaginale Geburt als Standard • Kaiserschnitt<br />
wegen besonderer Risiken oder Komplikationen • Geburtsverlauf bei Kaiserschnitt<br />
• Geburtsverlauf bei vaginaler Geburt • Kaiserschnitt für das zweite Kind<br />
2. Nach der Geburt (50)<br />
Zustand der Mutter • Zustand der Kinder<br />
3. Stillen (55)<br />
Stillen von Mehrlingen • Stillen nach Kaiserschnitt • Milchpumpe<br />
4. Erste Zeit daheim: Hilfe im Haushalt (60)<br />
Gesetzliche Krankenkasse • Jugendamt • Bundesstiftung „Mutter und Kind“ •<br />
Kirchen und Wohlfahrtsverbände • Au-pair • Steuerliche Anerkennung einer privaten<br />
Haushaltshilfe<br />
Fünftes Kapitel: Frühgeburt (80)<br />
1. Neugeborenen-Intensivmedizin (80)<br />
Künstliche Beatmung • „minimal handling“ • Weitere Entwicklung und Überwachung<br />
• Stillen von Frühgeborenen • Elterliche Zuwendung • Nach der Entlassung<br />
• Erfolglose Behandlung • Von vornherein nicht behandelbare Kinder • Einen<br />
Verlust verarbeiten<br />
2. Mögliche Spätfolgen einer Früh- oder Mangelgeburt (87)<br />
Zerebralparesen und psychomotorische Störungen • Lernschwierigkeiten und<br />
Minderbegabung • Seh- und Hörstörungen • Chronische Lungenerkrankung •<br />
Plötzlicher Kindstod<br />
3. Finanzielle Hilfen für Frühgeborene mit Entwicklungsverzögerungen und für behinderte<br />
Kinder (90)<br />
Drittes Kapitel: Säuglingsalter (66)<br />
1. Aktivitäten mit anderen Eltern und Kindern (66)<br />
2. Finanzielles (67)<br />
Elterngeld • Mutterschaftsgeld • Entbindungsgeld • Kindergeld • Weitere Förderungsmöglichkeiten<br />
• Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung • Kinderzuschlag,<br />
Arbeitslosengeld II und andere Sozialleistungen • Krankenversicherung<br />
für die Kinder • Mütter- und Väterkur<br />
3. Weitere Anschaffungen (73)<br />
Tragetuch, Kindertragen • Sportwagen und Buggy<br />
Ausblick (92)<br />
Anhang I: Medizinisches Wörterbuch und Glossar (93)<br />
Anhang II: Berechnung der Schwangerschaftswochen (99)<br />
Anhang III: Schema zur Bestimmung der Ein- oder Zweieiigkeit (100)<br />
Anhang IV: Adressen (101)<br />
Anhang V: Gesetzestexte (104)<br />
Anhang VI: Literaturhinweise (107)<br />
Anhang VII: Mehrlinge in anderen Sprachen (112)<br />
Viertes Kapitel: Familiensituation und weitere Entwicklung der Kinder im Säuglings-<br />
und Kleinkindalter (76)<br />
1. Allgemeine Entwicklungsverzögerung (76)<br />
2. Sprachentwicklung (77)<br />
3. Ältere Geschwister (78)<br />
4. Sozialverhalten der Kinder (79)
4a<br />
4b<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
Vorwort<br />
es freut uns, dass Sie sich für unseren Zwillings-Ratgeber interessieren.<br />
Sie lesen hier ein Buch, das Sie nicht im Buchladen gekauft, sondern als Textdatei<br />
aus dem Internet heruntergeladen haben. Vielleicht haben Sie den Ausdruck oder<br />
die Textdatei auch von einer befreundeten Familie erhalten.<br />
Sie haben dafür bisher nichts bezahlen müssen. Denn wir vertreiben dieses Buch<br />
nach dem Shareware-Prinzip: Wenn Ihnen der Ratgeber gefällt, bitten wir um ein <strong>klein</strong>es<br />
Autorenhonorar. Wenn er Ihnen nicht zusagt, brauchen Sie nichts zu zahlen.<br />
dem individuellen Rat Ihres Frauenarztes, der auch solche, möglicherweise<br />
nicht zwillingstypischen Besonderheiten Ihrer Schwangerschaft berücksichtigen<br />
kann, auf die dieses Buch nicht eingeht. Holen Sie in Zweifelsfällen die<br />
Meinung eines zweiten Arztes ein. Die Darstellungen dieses Buches dürfen<br />
nicht als individuelle Handlungsanweisungen oder -vorschläge missverstanden<br />
werden. Eine rechtliche Haftung hierfür müssen wir deshalb ausschließen.<br />
Dieses Buch wird etwa halbjährlich aktualisiert. Sie können die jeweils aktuelle<br />
Version unter www.zwillingsschwangerschaft.info downloaden.<br />
Und nun wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!<br />
Dr. Claudio Nedden-Boeger<br />
Dipl.-Päd. Sabine Boeger<br />
Bitte seien Sie so fair und denken an eine angemessene Anerkennung unserer<br />
Mühe, wenn Sie mit unserer Leistung zufrieden sind. Geben Sie soviel, wie Ihnen der<br />
Ratgeber wert ist, und wie es Ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. Unsere Empfehlung<br />
liegt bei 5,- bis 10,- EUR pro Leserfamilie; egal ob Sie den Text selbst aus dem Internet<br />
heruntergeladen oder von einer befreundeten Familie erhalten haben. Bitte überweisen<br />
Sie den Betrag an: Dr. Claudio Nedden-Boeger, Konto-Nr. 142921, Bankleitzahl<br />
360 605 91 (Sparda-Bank West eG) – bzw. für den EU-Zahlungsverkehr:<br />
IBAN: DE67 3606 0591 0000 1429 21, BIC: GENODED1SPE.<br />
Bitte beachten Sie außerdem unsere Nutzungsbedingungen:<br />
- Sie dürfen den Text kostenlos an andere Zwillingseltern weitergeben, jedoch<br />
nur in ungekürzter Version und mit unverändertem Inhalt. Auch diese Seite<br />
muss vollständig enthalten sein! Sie dürfen den Text jedoch nicht gegen<br />
Geld an andere Leser verkaufen.<br />
- Sie dürfen den Text nicht gewerblich nutzen oder anderweitig veröffentlichen,<br />
auch nicht auszugsweise. Der Inhalt des Ratgebers bleibt unser geistiges<br />
Eigentum und ist urheberrechtlich geschützt.<br />
- Dieses Buch ist in dem Bemühen verfasst, den aktuellen Stand der medizinischen<br />
Wissenschaft bis in eine bestimmte Tiefe richtig und vollständig und<br />
zugleich in verständlicher Sprache wiederzugeben. Gleichwohl kann dieser<br />
allgemein gehaltene Ratgeber niemals eine fachärztliche Beratung und<br />
Betreuung während der Schwangerschaft ersetzen. Folgen Sie deshalb immer
5a<br />
Erstes Kapitel: Schwangerschaft<br />
1. Entstehung von <strong>Zwillinge</strong>n<br />
Wahrscheinlich haben Sie dieses Buch in der Hand, weil Sie selbst <strong>Zwillinge</strong> erwarten.<br />
Vielleicht sogar Drillinge oder Vierlinge. Wie kam es dazu Warum nicht nur<br />
ein einzelnes Kind, wie es die meisten Frauen bekommen Ganz unterschiedliche<br />
Gründe kommen als Ursache für die Zwillingsentstehung in Betracht. Einige sind<br />
genetisch vorbestimmt, andere hängen von äußeren Einflüssen ab.<br />
Über die Entstehung eines Kindes wissen wir, dass sich nach dem Geschlechtsverkehr<br />
eine herangereifte Eizelle und ein männlicher Samenfaden vereinigen, in die<br />
Gebärmutter einnisten und zu einem Embryo fortentwickeln. Ähnlich beginnt auch die<br />
Zwillingsschwangerschaft, doch nimmt sie an einem bestimmten Punkt der Entwicklung<br />
gleich zu Beginn der Schwangerschaft einen abweichenden Verlauf. An welchem<br />
Punkt sich was genau ändert, hängt von der Art der Zwillingsentstehung ab. Es gibt<br />
vier unterschiedliche Entstehungsarten, von denen die klassischen „eineiigen“ und<br />
„zweieiigen“ <strong>Zwillinge</strong> am bekanntesten und zugleich mit Abstand am häufigsten sind.<br />
Daneben gibt es jedoch auch noch Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und solche aus zweikernigen<br />
Eizellen.<br />
a) Eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Eineiige <strong>Zwillinge</strong> entstehen zunächst genauso wie einzelne Kinder (Einlinge):<br />
Eine herangereifte Eizelle wird von einem Samen befruchtet. Bei Einlingen würde sich<br />
dann das befruchtete Ei in einem geschlossenen Verband weiterentwickeln. Bei eineiigen<br />
<strong>Zwillinge</strong>n jedoch teilt sich das Ei innerhalb der ersten dreizehn Tage nach der<br />
Befruchtung in zwei Teile, die sich fortan getrennt je zu einem Kind weiterentwickeln.<br />
Da beide Teile aus derselben Eizelle und demselben Samen entstanden sind, sind sie<br />
genetisch gleich, d.h. sie verfügen über dieselben Erbanlagen und haben deshalb immer<br />
auch dasselbe Geschlecht. Man bezeichnet diese <strong>Zwillinge</strong> als „eineiig“, weil sie<br />
aus einer einzigen befruchteten Eizelle hervorgegangen sind.<br />
Der Auslösungsmechanismus für die Zwillingsteilung ist bis heute ungeklärt; als<br />
Ursache vermutet man Normabweichungen im biochemischen Milieu der Gebärmutter.<br />
Es scheint außerdem, als werde die Entstehung eineiiger <strong>Zwillinge</strong> durch besonders<br />
lange Menstruationszyklen und durch eine besonders späte Befruchtung der Eizelle<br />
begünstigt. Man hat nämlich festgestellt, dass eineiige <strong>Zwillinge</strong> häufig bei Paaren auftreten,<br />
die natürliche Verhütungsmethoden anwenden, die also nur in der Zeit um den<br />
Eisprung auf unverhüteten Geschlechtsverkehr verzichten. Falls die Schwangerschaft<br />
dann trotzdem eintritt, findet die Befruchtung in aller Regel nach Beendigung der „Verhütungsphase“<br />
statt und liegt damit sehr spät im Menstruationszyklus.<br />
b) Zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n findet keine Teilung statt, sondern es reifen von vornherein<br />
zwei anstelle nur einer Eizelle innerhalb desselben Menstruationszyklus heran.<br />
Beide Eizellen entwickeln sich eigenständig, können von je einem männlichen Samenfaden<br />
befruchtet werden, sich in der Gebärmutter einnisten und zu je einem Kind heranreifen.<br />
Es handelt sich um zwei eigenständige Befruchtungsvorgänge, die nicht einmal auf<br />
demselben Geschlechtsakt beruhen müssen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong> von verschiedenen Vätern gezeugt wurden. Der Eisprung beider<br />
Eizellen und deren Befruchtung liegen jedoch immer in demselben Monatszyklus. Es<br />
kann also normalerweise nicht passieren, dass eine bereits schwangere Frau im nächsten<br />
Monatszyklus noch einmal eine Eizelle entwickelt, die wiederum befruchtet wird und<br />
sich ebenfalls einnistet mit einer Entwicklungsverzögerung von vier Wochen gegenüber<br />
dem ersten Embryo 1 .<br />
„Zweieiige“ <strong>Zwillinge</strong> bezeichnet man so, weil sie aus zwei verschiedenen Eizellen<br />
entstanden sind. Ihre Entwicklung verläuft vom ersten Augenblick an unabhängig voneinander.<br />
Obwohl die Kinder zur gleichen Zeit ausgetragen werden, sind sie zueinander<br />
ebenso verschieden wie gewöhnliche, nacheinander ausgetragene Geschwisterkinder.<br />
Die Wahrscheinlichkeit, ein gleich- oder verschiedengeschlechtliches Paar zu bekommen,<br />
ist bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n etwa gleich hoch.<br />
1 Eine solche „Überbefruchtung“ (Superfetation) ist im Tierreich allerdings möglich und wird<br />
vor allem bei Schweinen beobachtet sowie bei Raubkatzen. Bei Menschen kommt die Überbefruchtung<br />
normalerweise nicht vor; als extreme Ausnahme wurde allerdings im Jahre 2007 ein<br />
einzelfall in England dokumentiert.<br />
5b
6a<br />
6b<br />
Verschiedene Ursachen können die Entstehung zweieiiger <strong>Zwillinge</strong> begünstigen.<br />
Ein wichtiger Faktor ist die erbliche Veranlagung. Die Neigung zur gleichzeitigen<br />
Heranreifung mehrerer Eizellen wird an Frauen rezessiv vererbt. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
<strong>Zwillinge</strong> zu bekommen, ist also größer, wenn in der Familie der Mutter bereits<br />
<strong>Zwillinge</strong> vorgekommen sind. Manche sprechen auch dem werdenden Vater einen<br />
geringen erblichen Einfluss zu, doch geht man heute überwiegend davon aus, dass die<br />
Zwillingsentstehung ausschließlich von der mütterlichen Seite gesteuert wird.<br />
Global betrachtet bestehen erhebliche Unterschiede bei der Zwillingshäufigkeit.<br />
So bekommen Schwarzafrikanerinnen fünfmal häufiger zweieiige <strong>Zwillinge</strong> als ostasiatische<br />
Frauen. Europäerinnen haben im internationalen Vergleich eine mittlere Zwillingswahrscheinlichkeit<br />
– bei einem leichten Nord-Süd-Gefälle innerhalb Europas.<br />
Auch diese regionalen Unterschiede lassen sich mit der weitervererbten Veranlagung<br />
erklären. Die größte Zwillingshäufigkeit findet sich beim Volk der Yoruba in Nigeria.<br />
Bei diesen Frauen findet sich zugleich ein erhöhter Follitropinspiegel, weshalb man<br />
diese Substanz, die man auch als FSH (follikelstimulierendes Hormon) bezeichnet,<br />
bereits seit längerem mit der Zwillingsentstehung in Zusammenhang bringt. Letztlich<br />
geklärt sind die Zusammenhänge jedoch nicht. Eine neuere Untersuchung der Universität<br />
München hat einen Zusammenhang zwischen der Zwillingswahrscheinlichkeit<br />
und einer bestimmten Enzym-Mutation aufgezeigt. Danach soll eine Mutation des<br />
MTHFR 1 -Gens, welche in Asien häufig und in Afrika selten auftritt, die Zwillingsentstehung<br />
verhindern.<br />
Andere Faktoren sind dagegen nicht erblich vorbestimmt. Beispielsweise erhöht<br />
sich die Zwillingswahrscheinlichkeit mit dem Alter der Schwangeren. 35jährige Frauen<br />
bekommen annähernd viermal häufiger zweieiige <strong>Zwillinge</strong> als 18jährige; mit weiter<br />
zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit allerdings wieder ab.<br />
Auch die Anzahl der vorangegangenen Geburten ist von Bedeutung: Bei einer<br />
30jährigen Zweitgebärenden ist die Zwillingswahrscheinlichkeit höher als bei einer<br />
gleichaltrigen Erstgebärenden. Mit jeder weiteren Geburt steigt die Wahrscheinlichkeit<br />
einer Zwillingsschwangerschaft weiter an, bis sie nach sieben Geburten ihr Maximum<br />
erreicht. Auch das Ernährungsverhalten wird neuerdings in Verbindung mit der Zwillingswahrscheinlichkeit<br />
gebracht 2 .<br />
Und schließlich scheint das Absetzen der Verhütungspille einen Einfluss auszuüben:<br />
Im ersten Monat danach wurde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit festgestellt, zweieiige<br />
<strong>Zwillinge</strong> zu empfangen. Offenbar begünstigt die hormonelle Veränderung den<br />
Ausstoß mehrerer Eizellen; die ovulationshemmende Wirkung der Verhütungspille verkehrt<br />
sich sozusagen in ihr Gegenteil (sog. Rebound-Effekt). Nicht alle wissenschaftliche<br />
Untersuchungen bestätigen allerdings diesen Zusammenhang und deshalb ist die<br />
Frage unter Medizinern umstritten.<br />
1 Methylentetrahydrofolat-Reduktase<br />
2 Siehe im Einzelnen http://www.aerzteblatt-studieren.de/doc.aspdocId=102986.
7a<br />
c) Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen<br />
Neben den klassischen eineiigen und zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n existieren noch Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong><br />
und <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen. Hierbei handelt es<br />
sich um zwei weitere Entstehungsarten von <strong>Zwillinge</strong>n, die jedoch nur selten vorkommen.<br />
Sie wurden erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt und sind außerhalb der<br />
medizinischen Forschung kaum bekannt. Selbst in medizinischen Fachkreisen ist das<br />
Interesse an diesen Entstehungsarten nicht sehr groß, weil sich solche <strong>Zwillinge</strong> sowohl<br />
während als auch nach der Schwangerschaft kaum anders verhalten als zweieiige<br />
<strong>Zwillinge</strong>. Die Tatsache, dass es <strong>Zwillinge</strong> aus Polkörperchen und aus zweikernigen<br />
Eizellen überhaupt gibt, gehört eher in die Kategorie der medizinischen Kuriositäten<br />
und wird hier auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt.<br />
Zunächst also die Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong>. Um sie zu verstehen, muss man etwas<br />
ausholen. Ursprung des ungeborenen Lebens sind die in den weiblichen Eierstöcken<br />
bevorrateten Ureier (Oogonien). Diese müssen bei dem Eisprung und während ihrer<br />
Wanderung durch den Eileiter zunächst zwei Reifeteilungen vollziehen (Meiosen),<br />
bevor sie zu einer fertigen Eizelle (Oozyte) herangereift sind und von einem Samen<br />
befruchtet werden können. Bei diesen beiden Reifeteilungen wird je ein (wesentlich<br />
<strong>klein</strong>erer) Polar-Körper abgestoßen (sog. „Polkörperchen“), welcher die Erbinformationen<br />
zwar ebenfalls vollständig enthält, jedoch über so gut wie keinen versorgenden<br />
Zellleib verfügt und daher normalerweise nicht entwicklungsfähig ist. Die Polkörperchen<br />
lösen sich in der Gebärmutter auf oder sie werden ausgestoßen. In seltenen Fällen<br />
verteilt sich der Zellleib jedoch gleichmäßiger sowohl um die eigentliche Eizelle als<br />
auch um das Polkörperchen, so dass beide überlebensfähig sind und von je einem<br />
Samen befruchtet werden können. Die daraus entstehenden <strong>Zwillinge</strong> sind dann hinsichtlich<br />
ihrer mütterlichen Merkmale weitgehend erbgleich, da sie aus dem selben<br />
Urei stammen; hinsichtlich ihrer väterlichen Merkmale sind sie jedoch erbverschieden.<br />
Ursachen und Häufigkeit dieser Erscheinung sind noch weitgehend unerforscht.<br />
Während der Schwangerschaft verhalten sich Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> wie zweieiige<br />
<strong>Zwillinge</strong>. Auch sonst sind sie von zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n äußerlich nicht zu unterscheiden,<br />
weil sie – mit der väterlichen Erbsubstanz – letztlich unterschiedliche Erbmerkmale<br />
besitzen und damit völlig verschieden aussehen und auch verschiedengeschlechtlich<br />
sein können. Wird das Polkörperchen aus der zweiten Reifeteilung befruchtet,<br />
so haben die Kinder etwas mehr Ähnlichkeit, als wenn der Zwilling aus dem<br />
ersten Polkörperchen hervorgeht. Nur ein genetischer Test kann jedoch feststellen,<br />
dass die mütterliche Erbsubstanz tatsächlich aus demselben Urei stammt. Deshalb –<br />
und wegen ihres seltenen Auftretens – blieb diese Möglichkeit der Zwillingsentstehung<br />
lange Zeit unentdeckt. Für die Eltern und die Familie ändert sich durch die besondere<br />
Entstehungsart jedoch nichts: Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> stehen in ihrer Eigenart und in<br />
ihren Wesensmerkmalen zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n gleich. Deshalb werden wir sie in den<br />
weiteren Kapiteln dieses Buches auch nicht mehr besonders erwähnen, sondern sie wie<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong> behandeln.<br />
Dasselbe gilt für <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen, der letzten möglichen Entstehungsart.<br />
Hier finden sich innerhalb einer einzigen Eizelle ausnahmsweise zwei Zellkerne,<br />
die je von einem Samen befruchtet werden können. Wie solche Eizellen entstehen,<br />
ist noch nicht abschließend geklärt. Einerseits hält man es für möglich, dass sich<br />
bereits bei der Heranreifung der Eizelle in den Eierstöcken ausnahmsweise zwei Ureier<br />
(Oogonien) zu einem „Zwillingsfollikel“ zusammenfinden und anschließend zu einer<br />
einheitlichen Eizelle gemeinsam fortentwickeln. Andere Wissenschaftler sprechen davon,<br />
dass sich eine zunächst normal entwickelte Eizelle zwischen der ersten und der<br />
zweiten Reifeteilung zusätzlich noch einmal mitotisch teilt (also komplett verdoppelt).<br />
Strenggenommen entstehen also auch diese <strong>Zwillinge</strong> aus nur einem Ei. Der Unterschied<br />
zu den klassischen eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n besteht aber darin, dass die Zwillingsteilung<br />
nicht erst nach der Befruchtung stattfindet, sondern bereits vorher. Die beiden entstehenden<br />
Tochter-Eizellen werden von zwei verschiedenen Samen befruchtet und sind<br />
damit genetisch verschieden. Man nennt sie zum Teil „halbidentische <strong>Zwillinge</strong>“. Auch<br />
auf diese spezielle Art von <strong>Zwillinge</strong>n werden wir im Folgenden nicht mehr besonders<br />
eingehen, da sie in ihrer weiteren Entwicklung den zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n gleichen.<br />
d) Wie sind die eigenen <strong>Zwillinge</strong> entstanden<br />
Dass Ihre eigenen <strong>Zwillinge</strong> aus einer zweikernigen Eizelle oder aus einem fortentwickelten<br />
Polkörperchen entstanden sein könnten, ist sehr unwahrscheinlich, da das<br />
nur sehr selten vorkommt. Für eine realitätsnahe Betrachtung sollten Sie davon ausgehen,<br />
dass es sich entweder um eineiige oder um zweieiige <strong>Zwillinge</strong> handelt.<br />
Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> kommen in Europa doppelt bis dreimal so häufig vor wie eineiige<br />
<strong>Zwillinge</strong> (regional unterschiedlich). Welche dieser beiden Arten tatsächlich vorliegt,<br />
lässt sich manchmal schnell herausfinden: Verschiedengeschlechtliche <strong>Zwillinge</strong><br />
oder Kinder mit unterschiedlichen Blutgruppen sind zum Beispiel immer zweieiig. Denn<br />
7b
8a<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong> haben aufgrund ihrer genetischen Gleichheit immer dieselbe Blutgruppe<br />
und dasselbe Geschlecht 1 . Oft fehlen aber solche eindeutigen Unterscheidungsmerkmale,<br />
so dass man nach Aussehen, Entwicklungsparallelen und Verhaltensähnlichkeiten<br />
urteilen muss. Eineiige <strong>Zwillinge</strong> sind sich grundsätzlich ähnlicher als<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong>.<br />
Für diejenigen, die es genau wissen wollen, stehen exakte Untersuchungsmethoden<br />
zur Verfügung, die die Blutgruppen in ihren verschiedenen Systemen (einschließlich<br />
der Untergruppen, Varianten und Rh-Haplotypen) sowie die Erbinformation selbst<br />
(DNA) untersuchen. Wie aufwendig die Untersuchung durchgeführt werden muss,<br />
hängt davon ab, wann sich erstmals ein genetischer Unterschied zeigt, der die Eineiigkeit<br />
ausschließt. Solche Untersuchungen sind inzwischen nicht mehr so teuer (ab ca.<br />
150 EUR), werden von den Krankenkassen jedoch nur bei medizinischer Notwendigkeit<br />
übernommen, z.B. bei festgestellten Erbkrankheiten.<br />
Während der Schwangerschaft gibt es noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal<br />
ein- und zweieiiger <strong>Zwillinge</strong>, nämlich die Anzahl und Anordnung der Eihäute und der<br />
Mutterkuchen innerhalb der Gebärmutter. <strong>Zwillinge</strong> mit einer gemeinsamen äußeren<br />
Eihaut und gemeinsamem Mutterkuchen sind immer eineiig (s. im Einzelnen Seite 10).<br />
e) Höhergradige Mehrlinge<br />
Bei höhergradigen Mehrlingen 2 kann es sich ebenfalls um eineiige oder um mehreiige<br />
Kinder handeln. Auch eineiige Vierlinge oder Fünflinge sind möglich, wenn<br />
sich die befruchtete Eizelle entsprechend häufig teilt. Außerdem gibt es Mischformen,<br />
bei denen z.B. zwei Kinder aus einer geteilten Eizelle und das dritte aus einer weiteren<br />
befruchteten Eizelle stammen. Dann lag zu Beginn nur eine zweieiige Zwillingsschwangerschaft<br />
vor, bei der sich eines der befruchteten Eier später noch einmal ge-<br />
1 Von dieser Regel gibt es eine einzige, sehr seltene Ausnahme: das sog. „Ullrich-Turner-<br />
Syndrom“, das wir auf Seite 28 behandeln.<br />
2 Unter dem Begriff „höhergradige Mehrlinge“ verstehen wir Drillinge, Vierlinge usw. Die<br />
einfache Bezeichnung „Mehrlinge“ benutzen wir für die Gesamtheit aus <strong>Zwillinge</strong>n und höhergradigen<br />
Mehrlingen.<br />
teilt hat. Es entstehen dadurch zwei erbgleiche (eineiige) Geschwister und ein erbverschiedenes<br />
(mehreiiges) Kind.<br />
f) Siamesische <strong>Zwillinge</strong><br />
Bei Siamesischen <strong>Zwillinge</strong>n handelt es sich um eineiige <strong>Zwillinge</strong>, die sich erst<br />
später als 13 Tage nach der Befruchtung geteilt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Entwicklung<br />
der embryonalen Anlagen schon so weit fortgeschritten, dass die Teilung der<br />
Zellen nicht mehr vollständig verläuft. Es bilden sich zwei Individuen heraus, die an<br />
bestimmten Körperteilen, meist am Oberkörper, miteinander verwachsen bleiben und<br />
sich oft sogar ein oder mehrere innere Organe teilen – je nachdem, wie spät die Teilung<br />
stattfand und wie vollständig sie noch gelingen konnte. Sind alle lebenswichtigen Organe<br />
doppelt vorhanden, können Siamesische <strong>Zwillinge</strong> durch eine Operation voneinander<br />
getrennt werden und eigenständig weiterleben. Die meisten Siamesischen <strong>Zwillinge</strong><br />
versterben allerdings noch während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt.<br />
Der Begriff „Siamesischer Zwilling“ beruht auf den bekannt gewordenen <strong>Zwillinge</strong>n<br />
Chang und Eng, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Siam (jetziges Thailand)<br />
lebten und über sechzig Jahre alt wurden. Mediziner verwenden eher die Bezeichnung<br />
„Doppelmissbildung“ als „Siamesischer Zwilling“. Mit einer Wahrscheinlichkeit unter<br />
1:50.000 kommen Siamesische <strong>Zwillinge</strong> insgesamt recht selten vor.<br />
Wenn Ihre Frauenärztin oder Ihr Frauenarzt bei der Ultraschalluntersuchung eine<br />
Zwillingsschwangerschaft festgestellt hat, brauchen Sie sich in aller Regel keine Sorgen<br />
zu machen, dass es sich um Siamesische <strong>Zwillinge</strong> handeln könnte. Ihr Frauenarzt wird<br />
nämlich zwei voneinander getrennte Embryos wahrgenommen haben, während Siamesische<br />
<strong>Zwillinge</strong> zu diesem frühen Zeitpunkt noch wie ein einzelnes Kind aussehen würden.<br />
Wenn die Zeitungspresse gelegentlich von Siamesischen <strong>Zwillinge</strong>n berichtet, die<br />
erst im späten Verlauf der Schwangerschaft erkannt wurden, so handelt es sich dabei fast<br />
ausnahmslos um solche Schwangerschaften, von denen man bis zum Erkennen der Fehlbildung<br />
glaubte, es handle sich um eine gewöhnliche Einlingsschwangerschaft. Die<br />
betroffenen Eltern waren bis dahin also noch gar nicht mit der Zwillingssituation konfrontiert.<br />
Nur bei den seltenen monochorialen-monoamnialen Zwillingsschwangerschaften<br />
(s. unten, Seite 11) lässt sich nicht immer sofort ausschließen, dass die Kinder miteinander<br />
verbunden sind. Diese Schwangerschaften müssen aber aus anderen Gründen<br />
ohnehin sehr engmaschig überwacht werden.<br />
8b
9a<br />
g) Fruchtbarkeitsbehandlung und künstliche Befruchtung (Reproduktionstechniken)<br />
Bei einer künstlichen Befruchtung werden aus dem Körper der Frau Eizellen entnommen,<br />
mit Samen befruchtet und zwei Tage später in die Gebärmutter eingesetzt.<br />
Diese Prozedur hat allerdings nur eine etwa 30%ige Erfolgswahrscheinlichkeit, weil<br />
sich rd. 70% der eingesetzten Eizellen nicht in die Gebärmutter einnisten, sondern mit<br />
der nächsten Regelblutung ausgeschieden werden. Um die Erfolgschancen der Behandlung<br />
zu erhöhen, setzt man deshalb nicht nur eine Eizelle ein, sondern gleich mehrere 1 .<br />
Dabei lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass sich auch mehrere der eingesetzten<br />
Eizellen in die Gebärmutter einnisten könnten. Es entstehen dann <strong>Zwillinge</strong> oder sogar<br />
höhergradige Mehrlinge. Eine Obergrenze ist dadurch gesetzt, dass nach dem deutschen<br />
Embryonenschutzgesetz pro Eingriff höchstens drei befruchtete Eizellen oder<br />
Embryos eingesetzt werden dürfen. Allerdings können sich die eingesetzten Eizellen –<br />
wie jede gewöhnliche Eizelle – während der folgenden Tage noch einmal innerhalb der<br />
Gebärmutter eineiig teilen, wodurch es zu Vierlingen oder Fünflingen kommen kann.<br />
In vielen anderen Ländern gilt die Beschränkung auf höchstens drei Eizellen von<br />
vornherein nicht, so dass es dort bereits aufgrund der Anzahl der eingesetzten Eizellen<br />
zu hochgradigen Mehrlingsschwangerschaften kommen kann.<br />
schwangerschaften ist in Deutschland bereits auf 1:500 angestiegen; in anderen Ländern<br />
noch darüber hinaus. Vierlinge (natürliche Häufigkeit 1:600.000) und Fünflinge (natürliche<br />
Häufigkeit 1:52 Millionen) beruhen heutzutage ganz überwiegend auf Fruchtbarkeitsbehandlungen.<br />
2. Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft<br />
Mit dem Einzug der Ultraschallgeräte in die Frauenarztpraxen haben sich die Möglichkeiten<br />
einer frühzeitigen Erkennung der Zwillingsschwangerschaft entscheidend<br />
verbessert. Bereits bei der ersten Ultraschalluntersuchung, die zwischen dem Beginn der<br />
neunten bis zum Ende der 12. SSW 2 vorgesehen ist, sind alle Embryos und die zugehörigen<br />
Fruchtblasen selbst mit älteren, niedrigauflösendenden Geräten deutlich zu erkennen.<br />
Nur selten „versteckt“ sich ein Zwilling so geschickt, dass er selbst bei aufmerksamer<br />
Untersuchung des gesamten Gebärmutterraumes nicht entdeckt werden kann.<br />
9b<br />
Auch medikamentöse Fruchtbarkeitsbehandlungen bei der Frau (Hormontherapien)<br />
können zu Mehrlingsschwangerschaften führen, indem sie das gleichzeitige<br />
Heranreifen entsprechend vieler Eizellen fördern. Insgesamt führt etwa jede vierte<br />
erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung (künstliche Befruchtung oder Hormontherapie)<br />
zu einer Mehrlingsschwangerschaft.<br />
Dadurch hat sich der Anteil der Zwillingsschwangerschaften, der zuvor leicht<br />
rückläufig war, seit den achtziger Jahren wieder deutlich erhöht und wird voraussichtlich<br />
weiter steigen. Von allen derzeitigen Schwangerschaften ist bereits mehr als jede<br />
dreißigste eine Zwillingsschwangerschaft; dagegen betrug die natürliche Häufigkeit<br />
nur 1:85 (siehe Grafik Seite 6). Bei den Drillingsschwangerschaften hat sich deren<br />
Anzahl durch die Fruchtbarkeitsbehandlungen sogar verzwanzigfacht. Der ursprünglich<br />
recht geringe Anteil von circa einer Drillingsschwangerschaft auf 7.000 Einlings-<br />
Ultraschallbild: <strong>Zwillinge</strong> mitgetrennten Fruchtblasen<br />
in der 8. SSW (älteres, niedrigauflösendes Gerät)<br />
1 Zunehmend wird allerdings diskutiert, von der Einsetzung mehrerer Eizellen zur Vermeidung<br />
von Mehrlingsgeburten Abstand zu nehmen.<br />
2 SSW = Schwangerschaftswoche; zur Berechnung der SSW siehe Anhang II, Seite 99
10a<br />
Zu diesem Zeitpunkt ist der Zwillingsbefund aber noch nicht endgültig. Bis zum<br />
Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels wandeln sich viele Zwillingsschwangerschaften<br />
noch in eine Einlingsschwangerschaft um, indem einer der Embryos einfach<br />
„verschwindet“ (sog. spontane Reduktion). Von den Zwillingsschwangerschaften, die<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen festgestellt werden, verwandeln sich bis zu drei<br />
Viertel(!) vorzeitig in eine Einlingsschwangerschaft. Die spontane Reduktion gilt als<br />
eine natürliche Abwehrreaktion der Gebärmutter, die vor allem dazu dient, das Überleben<br />
des anderen Embryos zu sichern.<br />
Viele Eltern sind über das Verschwinden des Zwillings traurig, weil sie sich über<br />
das doppelte Glück schon gefreut hatten. Manche haben in der Vorfreude vielleicht<br />
sogar schon die ersten Anschaffungen getätigt. Um beides zu verhindern hat man Ärzten<br />
in der Vergangenheit dazu geraten, den Zwillingsbefund eine Zeit lang vor den<br />
Eltern geheim zu halten. Man wollte bei den Eltern nicht zu früh eine Erwartung aufbauen,<br />
die schon bald widerrufen werden muss. Wir persönlich halten diese Art der<br />
Verheimlichung allerdings für unangebracht und plädieren für ein offenes Patientengespräch,<br />
in dem die werdenden Eltern sowohl über den Zwillingsbefund als auch über<br />
die Möglichkeiten des nachträglichen Verschwindens vollständig und korrekt aufklärt<br />
werden, um ihnen dadurch einen verantwortlichen Umgang mit dieser Situation zu<br />
ermöglichen.<br />
3. Bildung der Eihäute und Einnistung in die Gebärmutter<br />
a) Eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Sofort nach der Befruchtung der Eizelle beginnt deren unaufhaltsame Vermehrung<br />
durch Zellteilung. Aus einer einzelnen Eizelle werden im Laufe der Schwangerschaft<br />
Abermillionen von Zellen, die schließlich den Menschen ausmachen. Am Ende<br />
der Schwangerschaft hat jede Zelle ihre durch den menschlichen „Bauplan“ festgelegte<br />
Funktion. Zu Beginn der Schwangerschaft sind es aber nach der ersten Teilung nur<br />
zwei, dann vier, dann acht Zellen, die zunächst einmal keinerlei innere Ordnung erkennen<br />
lassen. Erst etwa drei Tage nach der Befruchtung beginnen die Zellen sich zu<br />
spezialisieren und unterschiedliche Funktionen anzunehmen. Man spricht von einer<br />
ersten Zelldifferenzierung. Im Inneren des Gebildes entsteht eine Zellansammlung, die<br />
sich später zum eigentlichen Embryo entwickelt und Embryoblast genannt wird. Am<br />
äußeren Rand sammeln sich Zellen, die später den kindlichen Teil des Mutterkuchens<br />
und die äußere Eihaut ausbilden. Sie übernehmen also die ernährende Funktion und<br />
werden „Trophoblast“ genannt. Beide Zellgruppen bleiben über eine Brücke (sog. „Haftstiel“)<br />
miteinander verbunden, aus dem später die Nabelschnur entsteht. Diese funktionale<br />
Aufteilung in einen embryonalen und einen ernährenden Teil geschieht bei jeder<br />
Schwangerschaft, also auch bei Einlingsschwangerschaften, und hat mit der Zwillingsteilung<br />
zunächst einmal nichts zu tun.<br />
Embryoblast<br />
Trophoblast<br />
Nun besteht bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n die Besonderheit, dass sich die befruchtete<br />
Eizelle bzw. das aus ihr bereits entstandene Gebilde innerhalb von dreizehn Tagen nach<br />
der Befruchtung in zwei Teile teilt und es dadurch zu einer kompletten Verdopplung der<br />
Anlagen kommt. Es überlagern sich hier also zwei grundverschiedene Teilungsvorgänge:<br />
zum einen die funktionale Aufteilung der befruchteten Eizelle in den Embryo und den<br />
Mutterkuchen (Zelldifferenzierung), zum anderen die Zwillingsteilung als komplette<br />
Verdopplung aller Anlagen.<br />
Da die Zelldifferenzierung hin zu Embryo und Mutterkuchen an einem genau festgelegten<br />
Zeitpunkt stattfindet (drei Tage nach der Befruchtung), die Zwillingsteilung<br />
jedoch irgendwann beliebig zwischen dem ersten und dem dreizehnten Tag der Schwangerschaft,<br />
ist die Reihenfolge der Teilungsvorgänge nicht von vornherein festgelegt: Die<br />
Zwillingsteilung kann entweder vor oder nach der Zelldifferenzierung stattfinden. Von<br />
der Reihenfolge dieser beiden Teilungsereignisse hängt es nun ab, mit welchen Eihautund<br />
Mutterkuchenverhältnissen die <strong>Zwillinge</strong> aufwachsen.<br />
aa) Teilung bis zum dritten Tag: dichoriale <strong>Zwillinge</strong><br />
Findet die Zwillingsteilung vor dem dritten Schwangerschaftstag statt, so verdoppelt<br />
sich die befruchtete Eizelle komplett. Anschließend kommt es dann am dritten Tag<br />
zur Zelldifferenzierung, bei der beide Zwillingsgebilde je einen embryonalen und je<br />
10b
11a<br />
einen ernährenden Teil ausbilden. Jeder Embryo verfügt dann über einen eigenen Mutterkuchen<br />
und eine eigene äußere Eihaut. Man nennt diese Konstellation „dichorial“<br />
(bzw. dichorisch, dichoriatisch), zusammengesetzt aus der griechischen Vorsilbe „di“<br />
= zwei und dem Wort „chorion“ als Bezeichnung für die äußere kindliche Eihaut. Wir<br />
verwenden diesen medizinischen Begriff auch im Weiteren, da es keine prägnante<br />
deutsche Übersetzung gibt 1 .<br />
Plazenta<br />
Chorion<br />
Amnion<br />
dichorial<br />
oblast), jedoch nicht mehr der ernährende Teil (Trophoblast). Daraus folgt, dass für<br />
beide Embryos nur ein einziger Mutterkuchen vorhanden ist und beide <strong>Zwillinge</strong> innerhalb<br />
derselben äußeren Eihaut aufwachsen. Die Schwangerschaft wird deshalb als monochorial<br />
bezeichnet (griechisch „mono“ = eins; „chorion“ wiederum für die äußere<br />
Eihaut).<br />
Der weitere Verlauf der monochorialen Schwangerschaft kann wiederum zwei verschiedene<br />
Formen annehmen, je nachdem ob sich der Embryoblast vor oder nach dem<br />
siebten Tag teilt. Am siebten Tag der Schwangerschaft bildet sich nämlich die Amnionhöhle,<br />
die später um den Embryo herum die innere Eihaut bildet. Dasselbe Spiel wiederholt<br />
sich: Teilt sich der Embryo vor diesem Zeitpunkt, können beide neu entstandenen<br />
Embryos noch je eine eigene Amnionhöhle ausbilden. Teilt sich der Embryo erst später,<br />
was selten vorkommt (weniger als 2%), so wachsen beide <strong>Zwillinge</strong> innerhalb derselben<br />
Amnionhöhle auf. Die monochorialen Schwangerschaften werden daher noch einmal<br />
unterteilt in diamniale und monoamniale Schwangerschaften, je nachdem ob eine oder<br />
zwei innere Eihäute vorhanden sind („di“ = zwei, „mono“ = eins, „amnion“ = innere<br />
Eihaut).<br />
11b<br />
Nicht immer sind beide Mutterkuchen (Plazenten) so deutlich voneinander abgegrenzt<br />
wie in der schematischen Zeichnung; manchmal liegen sie so nah beieinander,<br />
dass sie an den Rändern miteinander verwachsen. Jedoch besteht der dichoriale Mutterkuchen<br />
immer aus zwei unabhängigen Hälften, die jeweils eines der Kinder versorgen.<br />
Der Anteil dichorialer Schwangerschaften unter den eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n beträgt<br />
etwa ein Drittel.<br />
bb) Teilung nach dem dritten Tag: monochoriale <strong>Zwillinge</strong><br />
Das Gegenteil zur dichorialen bildet die monochoriale Schwangerschaft: hier teilt<br />
sich das Ei nicht innerhalb der ersten drei Tage, sondern erst später. Die funktionale<br />
Aufteilung in einen embryonalen und einen ernährenden Teil ist dann bereits abgeschlossen.<br />
In diesem Stadium kann sich das Gebilde nicht mehr komplett durch eine<br />
Zwillingsteilung verdoppeln. Es teilt sich nur noch der embryonale Teil (Embry-<br />
1 Der Begriff „chorion“ wird ins Deutsche mit „Zottenhaut“ übersetzt; „dichorial“ bedeutet<br />
also wörtlich: „mit zwei Zottenhäuten“.<br />
monochorial-diamnial<br />
b) zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />
monochorial-monoamnial<br />
Bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n stellt sich die Frage der Eihautverhältnisse nicht, da sich<br />
beide befruchteten Eizellen unabhängig voneinander in die Gebärmutter einnisten. Beide<br />
Eizellen sind von Beginn an in der Lage, alle Anlagen für sich gesondert auszubilden.
12a<br />
Jeder Embryo verfügt über eine eigene innere und äußere Eihaut, eigenes Fruchtwasser<br />
und einen eigenen Mutterkuchen. Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> sind also immer dichorial.<br />
c) höhergradige Mehrlingsschwangerschaften<br />
Höhergradige Mehrlingsschwangerschaften können ebenfalls tri-, di- oder monochorial,<br />
und innerhalb der jeweiligen Chorien di- oder monoamnial ausgestaltet sein.<br />
Auch Mischformen können vorkommen. Bei Drillingen können beispielsweise zwei<br />
Kinder innerhalb einer gemeinsamen Amnionhöhle aufwachsen (Teilung nach dem<br />
siebten Tag), während das dritte über eine eigenständige äußere Eihaut (Chorion)<br />
verfügen mag und sogar genetisch verschieden sein kann (zweites befruchtetes Ei).<br />
mehr so gut erkennen. Man behilft sich dann, indem man den Übergang der Plazenten<br />
beider Kinder betrachtet 1 .<br />
Außerdem lassen sich aus dem Eihautbefund auch noch Rückschlüsse ziehen, ob es<br />
sich um ein- oder zweieiige <strong>Zwillinge</strong> handelt. Da monochoriale Schwangerschaften nur<br />
bei eineiigen Geschwistern möglich sind, kann man, wenn nur eine äußere Eihaut vorhanden<br />
ist, schon früh den sicheren Rückschluss auf eine eineiige Zwillingsschwangerschaft<br />
ziehen. Umgekehrt bedeutet das Vorliegen getrennter Eihäute, dass es sich zu<br />
90% um zweieiige Geschwister handelt. Sollte in der Frühschwangerschaft versäumt<br />
worden sein, die Eihautverhältnisse festzustellen, können erfahrene Hebammen dies<br />
auch noch aus der Nachgeburt bestimmen.<br />
12b<br />
4. Vorsorgeuntersuchungen, Mutterpass<br />
d) Bedeutung der Klassifizierung<br />
Die Klassifizierung der vorgefundenen Eihautverhältnisse als eine di- oder monochoriale,<br />
gegebenenfalls noch di- oder monoamniale Schwangerschaft ist ein wichtiges<br />
Kriterium für die weitere medizinische Vorsorge. Bestimmte Schwangerschaftskomplikationen<br />
können nämlich überhaupt nur bei monochorialen Eihautverhältnissen<br />
auftreten, einige Komplikationen sogar nur dann, wenn eine monochorialmonoamniale<br />
Schwangerschaft vorliegt. Letztere kommt glücklicherweise nur sehr<br />
selten vor, ist aber mit einem besonders hohen Risiko für die <strong>Zwillinge</strong> verbunden und<br />
muss deshalb in allen Phasen besonders genau überwacht werden. Um solche Risiken<br />
frühzeitig erkennen und gezielt beobachten zu können, sollen die Eihautverhältnisse<br />
möglichst frühzeitig durch den betreuenden Frauenarzt bestimmt und auch im Mutterpass<br />
dokumentiert werden. Bei der frühen ersten Ultraschalluntersuchung sind die<br />
Eihautverhältnisse meist gut zu erkennen. In dem Ultraschallbild auf Seite 9 sieht man<br />
zum Beispiel die deutlich voneinander getrennten Fruchtblasen einer dichorialen Zwillingsschwangerschaft<br />
mit den hell hervortretenden Eihäuten. Bei späteren Ultraschalluntersuchungen,<br />
wenn die Kinder größer geworden sind, lassen sind die Eihäute nicht<br />
Als Zwillingsschwangere werden Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gebeten<br />
– viel häufiger als Einlingsschwangere, für die während der gesamten Schwangerschaft<br />
nur zehn Vorsorgeuntersuchungen mit insgesamt drei Ultraschalluntersuchungen<br />
vorgesehen sind. In welchen Zeitabständen der Frauenarzt Sie sehen will, hängt von<br />
Ihrem Gesundheitszustand, der Entwicklung der Kinder, dem Zustand des Muttermundes<br />
und Gebärmutterhalses sowie von den festgestellten Eihautverhältnissen ab. Vor allem<br />
im letzten Schwangerschaftsdrittel werden Sie in immer kürzeren Abständen untersucht<br />
werden. Die intensivere Betreuung hat ihren Grund darin, dass bei Mehrlingsschwangerschaften<br />
einige spezielle Komplikationen auftreten können, denen man am besten begegnen<br />
kann, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Zum Ende der Schwangerschaft prüft<br />
der Frauenarzt vor allem, ob alle Kinder noch ausreichend versorgt sind und die Mutter<br />
nicht unter einer Schwangerschaftserkrankung leidet, da sonst die Geburt eingeleitet<br />
werden muss. Noch engmaschiger werden Drillings- und Vierlingsschwangere untersucht,<br />
denen im letzten Schwangerschaftsdrittel sogar ein stationärer Klinikaufenthalt<br />
empfohlen wird.<br />
1 Eine zipfelige Ausstülpung am Übergang der Mutterkuchen (Plazenten), die wie der griechische<br />
Buchstabe Lambda aussieht (Λ) spricht für dichoriale Eihautverhältnisse. Fehlt die Ausstülpung<br />
und sieht der Übergang eher spitzeckig wie der Buchstabe „T“ aus, so spricht dies für monochoriale<br />
Eihautverhältnisse
13a<br />
Nehmen Sie diese Vorsorgetermine gewissenhaft wahr, auch wenn sie während<br />
Ihrer Arbeitszeit liegen. Ihr Arbeitgeber muss Sie hierfür freistellen. Die Wahrnehmung<br />
der Vorsorgetermine ist unbedingt erforderlich, um die Entwicklung der Kinder<br />
kontinuierlich zu überwachen und im Falle eintretender Besonderheiten und Komplikationen<br />
rechtzeitig eingreifen zu können.<br />
Kinder gesondert dokumentiert, ebenso wie im späteren Verlauf der Schwangerschaft<br />
die CTG 2 - oder Dopplerbefunde 3 .<br />
13b<br />
Im Mutterpass wird die Mehrlingsschwangerschaft dokumentiert. Unter der Rubrik<br />
„Ultraschall-Untersuchungen“ wird bereits nach der ersten Untersuchung der Vermerk<br />
„V.a. Mehrlinge“ angekreuzt sein. Noch handelt es sich nur um einen „Verdacht“ auf<br />
Mehrlinge, da erst nach der 12. SSW mit einiger Gewissheit festgestellt werden kann,<br />
wie viele Embryos sich tatsächlich fortentwickeln. Schon bei der ersten Ultraschalluntersuchung<br />
sollte der Arzt jedoch nach Möglichkeit feststellen, welche Eihautverhältnisse<br />
vorliegen, da einige Schwangerschaftsrisiken hiervon abhängen. Der handschriftliche<br />
Zusatz „Gemini Diamniotisch Dichorial“ in unserem Beispiel bedeutet: <strong>Zwillinge</strong><br />
mit je einer eigenen inneren Eihaut (Amnion) und je einer eigenen äußeren Eihaut<br />
(Chorion) 1 .<br />
Bei den künftigen Ultraschalluntersuchungen findet sich anstelle der Rubrik „V.a.<br />
Mehrlinge“ nunmehr der Punkt „Einling“. Wird dieser Punkt verneint, zeigt das an,<br />
dass endgültig eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegt.<br />
Bei den Eintragungen im Gravidogramm wird die Kindslage für jedes Kind gesondert<br />
angegeben. Die Kinder werden mit römischen Ziffern nach der Reihenfolge<br />
bezeichnet, in der sie geboren würden, wenn jetzt die Geburt unmittelbar bevorstünde:<br />
Das Kind, welches am tiefsten im Becken liegt (unmittelbar vor dem Muttermund),<br />
erhält die Ziffer I, das zweite Kind die Ziffer II. Auch die Herztöne werden für beide<br />
In unserem eingekreisten Beispiel liegt also das untere<br />
Kind (I) in „SL“ = Schädellage (Kopf nach unten). Das Kind darüber (II) liegt in<br />
„BE“ = Beckenendlage (Becken nach unten). Die Herztöne beider Kinder sind in Ordnung.<br />
Die übrigen Eintragungen im Gravidogramm enthalten keine zwillingstypischen<br />
Besonderheiten.<br />
Um die jeweiligen Kinder auch in der gesprochenen Sprache eindeutig zu kennzeichnen,<br />
verwendet man eine Kombination aus der hypothetischen Geburtsreihenfolge<br />
und der aktuellen Kindslage. In der Fachsprache würde das untere Kind aus unserem<br />
Beispiel mit „erste Schädellage“ und das darüber liegende Kind mit „zweite Beckenendlage“<br />
bezeichnet. Auch alle schriftlichen Untersuchungen und Befunde (CTG, Biometrie<br />
1 In der demnächst erscheinenden überarbeiteten Fassung des Mutterpasses wird dafür sogar<br />
ein besonderes Ankreuzfeld zur Verfügung stehen.<br />
2 CTG = Herzton-Wehenschreiber<br />
3 „Doppler“ = Doppler-Ultraschall-Untersuchung
14a<br />
etc.) werden durch die Kennzeichen „I SL“ und „II BE“ (bzw. „II BEL“) dem jeweils<br />
untersuchten Kind eindeutig zugeordnet.<br />
5. Vorgeburtliche Diagnostik<br />
Zur kontinuierlichen Überwachung der Schwangerschaft dienen die regelmäßigen<br />
Blutuntersuchungen und Urinproben, das Abtasten des Bauches, die Ultraschalluntersuchung<br />
und später das CTG oder der Doppler-Ultraschall. Diese Maßnahmen informieren<br />
den Frauenarzt über den Verlauf der Schwangerschaft sowie das Gedeihen der<br />
Ungeborenen und ermöglichen es ihm, bedenklichen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken.<br />
Sie dienen damit dem Wohl der Schwangeren und dem Wohl der Kinder.<br />
Bestimmte Krankheitsbilder oder Behinderungen sind jedoch durch Chromosomen-Anomalien<br />
verursacht und liegen deshalb bereits zu Beginn der Schwangerschaft<br />
vor. Sie beruhen auf einer Schädigung des Erbgutes und lassen sich medizinisch nicht<br />
heilen, lediglich die Folgen lassen sich lindern. Zu den bekanntesten Schädigungen<br />
dieser Art gehören das Down-Syndrom (Trisomie 21, sog. „Mongolismus“) und der<br />
Spaltwirbel (spina bifida, sog. „offener Rücken“, eine Rückenmarksfehlbildung). Auch<br />
solche Schädigungen können im späteren Verlauf der Schwangerschaft durch Ultraschalluntersuchungen<br />
erkannt werden, wenn die äußerlich betroffenen Körperstellen<br />
des Kindes hinreichend herausgebildet sind. Mit den dadurch gewonnenen Untersuchungsergebnissen<br />
können die erforderlichen Maßnahmen frühzeitig geplant und unmittelbar<br />
nach der Geburt sofort veranlasst werden (z.B. eine Operation zum Verschluss<br />
des Spaltwirbels).<br />
Viele Eltern machen sich während der Schwangerschaft Gedanken, ob ihr(e)<br />
Kind(er) von einer solchen Behinderung betroffen sein könnten, und sehnen sich nach<br />
einer möglichst frühen Bestätigung, dass dieses nicht eintritt. Oft werden solche Sorgen<br />
auch von außen an die werdenden Eltern herangetragen. Manche Eltern sind von<br />
vornherein nicht bereit, ein behindertes Kind aufzuziehen, und würden die Schwangerschaft<br />
dann lieber abbrechen. Sie sind auf eine möglichst frühe Diagnose angewiesen,<br />
weil die körperliche und psychische Belastung eines Schwangerschaftsabbruchs mit<br />
zunehmender Schwangerschaftsdauer wächst.<br />
Embryos frühzeitig zu erkennen (vorgeburtliche genetische Diagnostik). Die Verfahren<br />
lassen sich methodisch in drei Gruppen unterteilen: (1) Untersuchung der kindlichen<br />
Zellen, (2) Untersuchung der mütterlichen Blutwerte, (3) Betrachtung des Kindes. Einen<br />
medizinischen Nutzen im Sinne besserer Heilungsmöglichkeiten haben diese Untersuchungen<br />
nicht; sie dienen nur der Information der Eltern.<br />
Grundsätzlich versprechen die Methoden der ersten Gruppe das genaueste Ergebnis,<br />
da hier das Erbgut der Ungeborenen unmittelbar untersucht wird. Sie sind allerdings<br />
zugleich auch am gefährlichsten durchzuführen, weil man entweder die Fruchtblase mit<br />
einer Hohlnadel durchstechen muss, um an die kindlichen Zellen heranzukommen, oder<br />
außerhalb der Fruchtblase an der Gebärmutterwand eine embryonale Gewebeprobe entnehmen<br />
muss. Solche Eingriffe bergen ein gewisses Infektionsrisiko und führen mit<br />
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zur anschließenden Fehlgeburt. Das Fehlgeburtsrisiko<br />
ist der Preis für die frühe genaue Information.<br />
Die Methoden der zweiten Gruppe (Untersuchung der mütterlichen Blutwerte) sind<br />
demgegenüber ungefährlich. Hintergrund dieser Untersuchungsmethoden ist, dass bestimmte<br />
Blutwerte der Mutter sich bei bestimmten genetischen Erkrankungen des Kindes<br />
verändern. Allerdings ist die Methode relativ ungenau, weil es auch noch andere Faktoren<br />
gibt, die dieselben Blutwerte verändern können.<br />
Die dritte Methode (Betrachtung des Kindes) bezieht sich auf die bildgebenden<br />
Verfahren, vor allem den Ultraschall. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt, weil in dem<br />
frühen Entwicklungsstadium der ersten Schwangerschaftswochen noch nicht die typischen<br />
äußerlichen Merkmale der Erkrankung ausgebildet sind. So ist bisher auch nur ein<br />
einziger optisch darstellbarer Nachweis anerkannt, nämlich eine vergrößerte Nackenfalte<br />
sowie eine Verzögerung der Nasenbeinverknöcherung bei Vorliegen eines Down-<br />
Syndroms. Da es sich hier jedoch nur um eine minimale Abweichung von nur wenigen<br />
Millimetern handelt, ist die Vermessung schwierig. Ihre Ergebnisse allein gelten als<br />
nicht hinreichend aussagekräftig, weshalb man die Ultraschallmethode in aller Regel<br />
nicht isoliert anwendet, sondern noch mit einer Untersuchung der mütterlichen Blutwerte<br />
kombiniert.<br />
Auf diesen unterschiedlichen Methoden basierend werden folgende fünf Einzelverfahren<br />
derzeit in Deutschland angeboten:<br />
14b<br />
Um dem Bedürfnis nach früher Gewissheit nachzukommen, wurden spezielle Untersuchungstechniken<br />
entwickelt, die dem Zweck dienen, genetische Schädigungen des
15a<br />
- die Chorion(zotten)biopsie (ab ca. 10.-12. SSW 1 )<br />
- der Triple-Test / Quadruple-Test (ca. 15.-18.SSW)<br />
- das Erst-Trimester-Screening (11.-14. SSW)<br />
- die Fruchtwasseruntersuchung (ca. 15.-20. SSW 2 )<br />
- die Nabelschnurpunktion (ab 19. SSW 3 ).<br />
Die frühest mögliche Untersuchung ist also die Chorionzottenbiopsie bzw. Chorionbiopsie.<br />
Hierbei wird entweder ein Kunststoffschlauch durch den Geburtskanal oder<br />
eine Kanüle (Hohlnadel) durch die Bauchdecke eingeführt und mittels Unterdruck eine<br />
Gewebeprobe aus den Zotten der äußeren Eihaut (Chorion) entnommen. Dabei handelt<br />
es sich um das embryonale Nährgewebe, das in die Schleimhaut der Gebärmutter einwächst<br />
und sich zum Mutterkuchen (Plazenta) herausbildet. Einige der möglichen<br />
Chromosomenstörungen (z.B. das Down-Syndrom) sowie bestimmte angeborene Stoffwechselerkrankungen<br />
können mit dieser Methode erkannt werden, nicht aber z.B. der<br />
„offene Rücken“. Die Chorionzottenbiopsie muss für jedes Kind gesondert durchgeführt<br />
werden, es sei denn, aufgrund des Eihautbefundes stünde bereits fest, dass es<br />
sich um eineiige <strong>Zwillinge</strong> handelt. Bei etwa 5% der Entnahmen passiert es dann allerdings,<br />
dass versehentlich zweimal die Zotten desselben Kindes abgesaugt werden,<br />
was eine Wiederholung der Prozedur erforderlich macht. Die Chorionzottenbiopsie ist<br />
insgesamt die gefährlichste aller Untersuchungsmethoden. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass die Chorionzottenbiopsie zu einer Fehlgeburt führt, wird für Zwillingsschwangerschaften<br />
mit bis zu acht Prozent(!) angegeben.<br />
Der sog. „Triple-Test“ (serum-screening) ist demgegenüber ein harmloser Bluttest,<br />
von dem keinerlei Gefahren für die Schwangerschaft ausgehen. Die gemessenen<br />
Blutwerte begründen oder entkräften den Verdacht einer Chromosomenschädigung.<br />
Geben die Blutwerte Grund zu der Besorgnis, dass eine Schädigung vorliegen könnte,<br />
so muss anschließend noch eine Fruchtwasseruntersuchung durchgeführt werden, um<br />
ein genaues Ergebnis zu erhalten. Da die Blutwerte nämlich außer durch Chromosomenschädigungen<br />
auch noch durch andere, unbedenkliche Faktoren verändert werden<br />
1 Z.T. auch noch früher möglich bei erheblich erhöhtem Schädigungsrisiko durch den Eingriff<br />
selbst.<br />
2 Seit einiger Zeit auch bereits ab der 11. SSW mit erheblich erhöhtem Fehlgeburtsrisiko.<br />
3 In Einzelfällen auch schon früher, ab ca. 15.SSW.<br />
können, schlägt der Triple-Test oft „Fehlalarm“. Vor allem bei Mehrlingen ergeben die<br />
Werte des Triple-Tests ein verfälschtes Bild, da die drei zu untersuchenden Substanzen<br />
aFP (alpha-Fetoprotein), hCG (human-Choriongonadotropin) und uE3 (freies Östriol)<br />
bei Mehrlingsschwangerschaften von vornherein in erhöhter Konzentration vorliegen.<br />
Der Triple-Test wurde daher bei Mehrlingsschwangerschaften lange Zeit als überhaupt<br />
nicht durchführbar angesehen. Erst nach und nach sind in Versuchsreihen aussagekräftige<br />
Vergleichswerte ermittelt worden, die die Durchführung des Triple-Tests zumindest<br />
bei <strong>Zwillinge</strong>n inzwischen möglich machen – wenn auch mit einer noch höheren Fehlerquote<br />
als bei Einlingen. Der Triple-Test führt nie zu einer letztlichen Gewissheit, sondern<br />
er ermittelt nur eine individuelle Wahrscheinlichkeit. Seit einiger Zeit wird sogar<br />
ein „Quadruple-Test“ angeboten, bei dem außer den drei herkömmlichen Substanzen<br />
auch noch die weitere Substanz „Inhibin A“ getestet wird, um die Treffsicherheit weiter<br />
zu erhöhen. Das Problem der höheren Fehlerquote bei Mehrlingsschwangerschaften wird<br />
dadurch jedoch nicht behoben.<br />
Das Erst-Trimester-Screening (Vermessung der Nackentransparenz und des Nasenbeins<br />
per Ultraschall) ist eine erst in der jüngeren Zeit entwickelte, sich jedoch zunehmend<br />
verbreitende Methode. Man hat festgestellt, dass bei Kindern mit Down-Syndrom,<br />
einigen anderen Chromosomenstörungen und einigen strukturellen Anomalien (Herzfehler<br />
u.ä.) in der Zeit zwischen der 11. und etwa der 14. SSW eine vergrößerte Nackenfalte<br />
im Ultraschall erkennbar ist. Sie rührt aus einer vermehrten Flüssigkeitsansammlung, die<br />
dort sonst nicht auftritt. Außerdem verzögert sich bei Kindern mit Down-Syndrom die<br />
Ausbildung des Nasenbeins. In der 10. bis 14. SSW „fehlt“ daher das Nasenbein im<br />
Ultraschall (Hypoplasie der Nase). Um diese minimalen Größenabweichungen messen<br />
zu können, bedarf es jedoch eines hochauflösenden Ultraschallgerätes, spezieller Berechnungssoftware<br />
und einiger Erfahrung. Kombiniert man die Ultraschallmethode mit<br />
einer zusätzlichen Untersuchung der Blutwerte „freies beta-hCG“ (eine Untereinheit des<br />
Hormons hCG), und „papp-A“ (schwangerschaftsassoziiertes Plasmaprotein A), so lässt<br />
sich bei Einlingen eine Trefferquote von über 90% erreichen 4 . Bei Mehrlingen liegt die<br />
4 Soweit jedenfalls die Theorie. In der Praxis mischen sich zu der anfänglichen Euphorie über<br />
diese Methode zunehmend auch kritische Stimmen. Denn selbst für geübte Ärzte ist es nicht einfach,<br />
die Nackenfalte und das Nasenbein im Ultraschallbild korrekt zu bewerten. Um die Verlässlichkeit<br />
bei der Beurteilung einmal zu hinterfragen, wurden in einer Studie der Universität Paris<br />
657 Ultraschallaufnahmen jeweils drei erfahrenen Untersuchern unabhängig voneinander zur<br />
Prüfung vorgelegt. Bei der Frage, ob ein Nasenbein zu erkennen sei, stimmten die Beurteilungen<br />
der Untersucher in jedem vierten Fall nicht überein. Schlimmer noch: Anschließend sollten die<br />
Untersucher 100 Ultraschall-Videos, die sie bereits begutachtet hatten, ein zweites Mal beurteilen.<br />
Hierbei wichen sie in jedem dritten Fall von ihrer eigenen früheren Beurteilung ab! Diese Unsi-<br />
15b
16a<br />
Trefferquote deutlich darunter, einerseits wegen zwillingsspezifischer Besonderheiten<br />
bei der Entwicklung der Nackenfalte, andererseits wegen der weniger eindeutigen<br />
Blutwerte. Erste Auswertungen berichten von einer Trefferquote um die 80%.<br />
Bei der Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) wird mithilfe einer Punktionsnadel<br />
durch die Bauchdecke hindurch Fruchtwasser aus den jeweiligen Fruchtblasen<br />
entnommen und auf Veränderungen der Erbsubstanz hin untersucht. Bei dichorialen<br />
<strong>Zwillinge</strong>n muss diese Prozedur für jedes Kind gesondert durchgeführt werden.<br />
Das vollständige Ergebnis liegt erst nach etwa zwei Wochen vor, weil zunächst eine<br />
Zellkultur mit kindlichen Zellen herangezüchtet werden muss. Mit einer Schnellmethode<br />
(sog. FISH-Test) kann man jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen bereits ein<br />
erstes Ergebnis erhalten, mit dem 90% der wichtigsten Chromosomenstörungen abgedeckt<br />
werden. Manchmal misslingt der Test allerdings auch komplett (methodische<br />
Versager), weil sich die Zellkultur nicht wie gewünscht heranzüchten lässt.<br />
Wie die Chorionzottenbiopsie bedeutet auch die Fruchtwasseruntersuchung einen<br />
erheblichen Eingriff in die Schwangerschaft. Neben der Gefahr einer Fehlgeburt oder<br />
Infektion, die allerdings nicht so hoch ist wie bei der Chorionzottenbiopsie, tritt hier<br />
noch die zusätzliche Gefahr einer mechanischen Verletzung des Kindes durch die<br />
Punktionsnadel selbst. Dieses Verletzungsrisiko wird zwar durch die gleichzeitige<br />
Ultraschallüberwachung minimiert, doch können bei Mehrlingen zusätzliche Risiken<br />
aus einer ungünstigen Lage der Kinder und durch eine erschwerte Überwachungsmöglichkeit<br />
entstehen, wenn sich verschiedene Kindsteile im Ultraschallbild überlappen.<br />
Ein weiteres Risiko besteht, wenn zur Kennzeichnung der zuerst punktierten Fruchtblase<br />
ein Farbstoff in das Fruchtwasser gespritzt wird, um bei der zweiten Entnahme<br />
feststellen zu können, ob eventuell versehentlich noch einmal dieselbe Fruchtblase<br />
angestochen wurde. Das früher verwendete Einfärbungsmittel Methylenblau ist bereits<br />
nicht mehr in Verwendung, weil seine Giftigkeit zu einer erhöhten Kindssterblichkeit<br />
beigetragen haben soll. Der derzeit gebräuchliche Farbstoff Indigokarmin steht dagegen<br />
im Verdacht, einen Dünndarmverschluss zu begünstigen; wissenschaftlich bewiesen<br />
ist ein solcher Zusammenhang allerdings noch nicht. Insgesamt geben die meisten<br />
Untersuchungen das Fehlgeburtsrisiko einer Fruchtwasseruntersuchung bei Mehrcherheiten<br />
bei der praktischen Durchführung des Verfahrens müssen bei der Verlässlichkeit der<br />
damit zu erzielenden Ergebnisse mit berücksichtigt werden.<br />
lingsschwangerschaften mit zwei bis vier Prozent an gegenüber bis zu einem Prozent bei<br />
Einlingsschwangerschaften 1 .<br />
Die erst ab der 19. SSW mögliche Nabelschnurpunktion (Chordozentese) gehört<br />
schon wegen ihres späten Zeitpunkts nicht mehr zu den Untersuchungsmethoden, die<br />
standardmäßig angeboten werden. Sie dient vor allem der endgültigen Abklärung, wenn<br />
die bereits durchgeführte Fruchtwasseruntersuchung einen unklaren Befund ergeben hat.<br />
Mittels einer Punktionsnadel wird durch die Bauchdecke der Schwangeren hindurch<br />
kindliches Blut aus der Nabelschnur entnommen und anschließend untersucht. Das Fehlgeburtsrisiko<br />
dieser Untersuchung entspricht etwa dem Risiko einer Fruchtwasseruntersuchung.<br />
Während im Ergebnis also der Triple-/Qaudruple-Test mit einer relativ hohen Fehlerquote<br />
behaftet ist, liegt in den genaueren Untersuchungsmethoden, die in den Mutterleib<br />
eingreifen (Chorionzottenbiopsie, Fruchtwasseruntersuchung, Nabelschnurpunktion),<br />
gerade bei Mehrlingen ein besonders hohes Fehlgeburts- und Schädigungsrisiko.<br />
Ungefährlich und einigermaßen treffsicher zugleich ist allein das Erst-Trimester-<br />
Screening, welches zunehmend Verbreitung findet, sich jedoch nur auf einige der möglichen<br />
Schädigungen bezieht, darunter allerdings das Down-Syndrom.<br />
Wegen des hohen Fehlgeburtsrisikos der genaueren Untersuchungsmethoden wird<br />
die vorgeburtliche Diagnostik nicht routinemäßig durchgeführt, sondern nur bei Vorliegen<br />
besonderer Verdachtsmomente nach entsprechendem Anraten des Arztes. Solche<br />
Verdachtsmomente können sich aus familiären Vorerkrankungen, aus dem Alter der<br />
Schwangeren und insbesondere aus den Ergebnissen der Ultraschall- und Blutwertuntersuchung<br />
ergeben. Lange Zeit wurde allen Schwangeren ab einem Alter von 35 Jahren –<br />
Zwillingsschwangeren sogar bereits ab 32 Jahren – routinemäßig eine Fruchtwasserun-<br />
1 Die Zahlen sind allerdings wohl deutlich zu optimistisch, worauf Prof. Kainer (in: Der Gynäkologe,<br />
Band 39 (2006), S. 854-859) hinweist. Denn das Fehlgeburtsrisiko hängt von der individuellen<br />
Erfahrung des Untersuchers ab. Die Daten zur Risikoeinschätzung stammen jedoch meist<br />
aus Zentren mit großer Erfahrung in Fruchtwasseruntersuchungen, wo die Fehlgeburtsrate entsprechend<br />
niedrig ist. Dagegen ist zu erwarten, dass die Fehlgeburtsrate in Zentren mit geringer<br />
Erfahrung deutlich höher liegt. Diese Daten werden aber zumeist nicht veröffentlicht und fließen<br />
deshalb nicht in die allgemeine Risikoabschätzung ein. Eine dieses berücksichtigende Studie der<br />
Alexandraklinik in Athen hat zuletzt Fehlgeburtsraten für Einlinge zwischen 2,5 und 5,1 % ergeben.<br />
Das könnte der Realität – auch in Deutschland – eher entsprechen. Dem gemäß noch höher<br />
anzusetzen wäre das Risiko bei <strong>Zwillinge</strong>n.<br />
16b
17a<br />
tersuchung nahegelegt 1 . Heute gilt das Alter nicht mehr als allein maßgeblich; besser<br />
errechnet man aus den Ergebnissen der ungefährlichen Untersuchungsmethoden im<br />
Zusammenspiel mit dem mütterlichen Alter ein individuelles Risikoprofil, auf das man<br />
die Entscheidung für oder gegen eine weitergehende Untersuchung stützt. Hierfür gibt<br />
es spezielle Berechnungsprogramme, über die entsprechend zertifizierte Frauenärzte<br />
verfügen.<br />
Alle diese Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik werfen indes auch Fragen<br />
der ethischen Bewertung auf. Sie hat zu tun mit der Frage nach der Planbarkeit von<br />
Wunschkindern. Mit den Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, der Abtreibung<br />
und auch der Reproduktionsmedizin ist es heute wie nie zuvor möglich, Geburten zu<br />
planen oder zu vermeiden. An diese Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten knüpft<br />
sich zunehmend auch eine besondere Erwartungshaltung an die Gesundheit und Entwicklung<br />
der Kinder. Mit den gegebenen Möglichkeiten der Frühdiagnostik und der<br />
Zulässigkeit eines darauffolgenden Schwangerschaftsabbruchs steigt der gesellschaftliche<br />
Druck, nur noch gesunde und leistungsfähige Kinder zur Welt zu bringen. Diese<br />
gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellt letztlich den Lebenswert und das Lebensrecht<br />
behinderter Menschen in Frage und wird deshalb nicht nur von den Behindertenverbänden<br />
beargwöhnt. Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe,<br />
kritisierte diese Tendenzen einmal als eine „Konsumenteneinstellung zum menschlichen<br />
Leben“.<br />
Auf jeden Fall sollte man die Angebote der genetischen Frühdiagnostik nicht als<br />
eine gesellschaftliche Verpflichtung missverstehen, sondern sich möglichst noch vor(!)<br />
1 Die Grenzziehung bei 35 Jahren war allerdings recht willkürlich. Sie hat keinen vernünftig<br />
medizinischen, sondern nur einen statistischen Hintergrund, noch dazu einen historischstatistischen:<br />
Vor 25 Jahren war es nach dem Stand der amerikanischen Geburtsmedizin so, dass<br />
ab der mütterlichen Altersschwelle von 35 Jahren das Risiko eines Down-Syndroms mindestens<br />
genauso hoch war wie das Risiko einer Fehlgeburt durch die Fruchtwasseruntersuchung. Und<br />
wenn die Risiken schon einmal gleich hoch waren, meinte man, der Frau besser das Fehlgeburtsrisiko<br />
als das Behinderungsrisiko zuzumuten. Damit trat ein einfaches statistisches Rechenexempel,<br />
welches zudem ein wenig an den Vergleich von Äpfeln mit Birnen erinnert, an<br />
die Stelle einer inhaltlich nachvollziehbaren oder gar ethisch begründeten Bewertung. Noch<br />
weniger einleuchtend ist die Herabsetzung der Altersschwelle bei Zwillingsschwangerschaften<br />
von 35 auf 32 Jahre: Zwar ist bei <strong>Zwillinge</strong>n das Risiko der Chromosomenerkrankung insofern<br />
verdoppelt, als beide Kinder je für sich das Risiko gesondert tragen. Aber es ist bei <strong>Zwillinge</strong>n<br />
doch auch das Untersuchungsrisiko mehr als verdoppelt! Wollte man die Äquivalenz von Erkrankungsrisiko<br />
und Fehlgeburtsrisiko aufrecht erhalten, so müsste man die Altersgrenze nicht<br />
niedriger, sondern höher ansetzen als bei Einlingen.<br />
einer solchen Untersuchung Gedanken darüber machen, ob man ein behindertes Kind<br />
tatsächlich abtreiben würde. Wenn man einen solchen Eingriff für sich ausschließt und<br />
bereit ist, auch ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, sollte man abwägen, ob allein<br />
die beschleunigte Gewissheit es rechtfertigt, die Risiken einer pränatalen Diagnostik<br />
einzugehen. Hierbei darf man nicht übersehen, dass das Fehlgeburtsrisiko nicht nur die<br />
tatsächlich behinderten Kinder trifft, sondern in den allermeisten Fällen solche Kinder,<br />
die völlig gesund zur Welt gekommen wären.<br />
Die Pränatale Diagnostik dient nicht, wie andere Vorsorgeuntersuchungen, dem<br />
Wohl des Kindes. (Thea Vogel)<br />
Sie dient nicht der Vermeidung einer Behinderung, sondern der Vermeidung einer<br />
Geburt. (nach Stephan Krone)<br />
In ihrem selektiven Ansatz liegt die vorgeburtliche Diagnostik jenseits des ärztlichen<br />
Heilauftrages. (Frankfurter Erklärung zur vorgeburtlichen Diagnostik)<br />
Entscheiden sich die Eltern für eine vorgeburtliche Diagnostik und wird dabei tatsächlich<br />
eine genetische Erkrankung des Ungeborenen festgestellt, so ist es für einen<br />
gewöhnlichen Schwangerschaftsabbruch mit Beratungsschein allerdings fast immer<br />
schon zu spät, denn dieser ist nur bis zwölf Wochen nach der Empfängnis (= etwa 14.<br />
SSW 2 ) zulässig. Später darf die Schwangerschaft nur noch abgebrochen werden, wenn<br />
dies „nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um ... die Gefahr einer schwerwiegenden<br />
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren<br />
abzuwenden“ (§ 218 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs [StGB]). Wenn die Erkenntnismöglichkeiten<br />
des Frauenarztes für die erforderlichen Feststellungen nicht ausreichen<br />
(etwa für die Beurteilung des „seelischen Gesundheitszustandes“), muss ein dafür zuständiger<br />
Facharzt hinzugezogen werden, der der Schwangeren bescheinigt, dass ihr das<br />
Austragen eines behinderten Kindes wegen erheblicher psychischer Beeinträchtigungen<br />
nicht zugemutet werden kann. Danach würde dann – sofern alle Mehrlinge betroffen<br />
sind – eine Geburt mit künstlichen Wehen eingeleitet, bei der die Kinder je nach erreichtem<br />
Entwicklungsstand entweder tot oder noch eine kurze Weile lebend geboren würden,<br />
um dann zu versterben. Ein Absaugen oder eine Ausschabung der Gebärmutter ist in<br />
diesem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft meist nicht mehr gefahrlos möglich.<br />
Ist dagegen nur ein einzelner Mehrling von der Krankheit betroffen, kommt eine<br />
2 zu Fragen der Berechnung von Schwangerschaftswochen siehe Angang II, Seite 99<br />
17b
18a<br />
selektive Abtreibung in Betracht, bei der die Schwangerschaft mit dem/den übrigen<br />
Ungeborenen fortgesetzt wird.<br />
6. Abtreibung einzelner Mehrlinge<br />
(Fetozid; Reduktion der Schwangerschaft)<br />
Medizinische Eingriffe, die die Weiterentwicklung einzelner Ungeborener gezielt<br />
beenden um die Schwangerschaft nur noch mit den übrigen Ungeborenen fortzusetzen,<br />
werden etwa seit den 80er Jahren durchgeführt. Man bezeichnet dies als eine Reduktion<br />
der Schwangerschaft oder auch als Fetozid. Solche Eingriffe werden aus unterschiedlichen<br />
Gründen durchgeführt:<br />
- Der bekannteste und ethisch am meisten umstrittene Grund: In der Gebärmutter<br />
wachsen mehr Embryos auf, als tatsächlich eine realistische<br />
Überlebenschance haben. Dann ist es aus medizinischer Sicht zu erwägen,<br />
die Schwangerschaft auf eine begrenzte Anzahl an Kindern zu reduzieren,<br />
um damit wenigstens einigen das Leben zu ermöglichen. Aufsehen<br />
erregte in 1996 die mit Achtlingen schwangere Mandy Allwood aus<br />
Großbritannien, die den Eingriff ablehnte, obwohl die Ärzte keine Chance<br />
sahen, alle Kinder auszutragen. Die Folge war, dass alle acht Ungeborenen<br />
durch Fehl- oder Totgeburt starben. Im medizinischen Alltag wird<br />
eine Reduktion der Schwangerschaft jedoch nicht erst bei Achtlingen,<br />
sondern bereits bei Fünflingen empfohlen, je nach Einzelfall auch schon<br />
bei Vierlingen. Diese Schwangerschaften werden dann auf eine Drillingsschwangerschaft<br />
hin reduziert. Drillinge selbst werden nur in besonders<br />
gelagerten Ausnahmefällen noch weiter reduziert. In jedem Fall muss hier<br />
eine individuelle Entscheidung getroffen werden, die auch den Körperbau<br />
und die Belastungsfähigkeit der Schwangeren berücksichtigt. Stellt sich<br />
im Laufe einer höhergradigen Mehrlingsschwangerschaft heraus, dass<br />
einzelne Kinder in ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung im Vergleich<br />
zu den übrigen Geschwistern deutlich unterentwickelt sind, so kann dieses<br />
Ungleichgewicht ebenfalls einen medizinischen Grund zur gezielten<br />
Reduktion der Schwangerschaft darstellen.<br />
- Eines von mehreren Ungeborenen leidet an einer bestimmten Krankheit,<br />
die durch eine Fruchtwasseruntersuchung o.ä. festgestellt wurde. Das<br />
kranke Kind kann dann isoliert abgetrieben werden.<br />
- Es liegt eine monochorial-monoamniale Zwillingsschwangerschaft vor.<br />
Aufgrund einer Vielzahl von Einzelrisiken, die nur bei diesen Eihautverhältnissen<br />
auftreten, liegt die statistische Wahrscheinlichkeit, beide<br />
Kinder lebend zu gebären, deutlich niedriger als bei allen anderen Schwangerschaften.<br />
Zum Teil wird daher angeraten, solche Schwangerschaften<br />
frühzeitig auf nur ein Kind zu reduzieren, um diesem bessere Entwicklungschancen<br />
einzuräumen.<br />
Wird gezielt ein bestimmtes Kind abgetrieben, weil es an einer Fehlbildung oder<br />
Erkrankung leidet, so bezeichnet man dies als selektive Reduktion. Wird dagegen ein<br />
beliebiges Kind abgetrieben, um die Gesamtanzahl zu verringern, spricht man von einer<br />
unselektiven Reduktion der Schwangerschaft. Zur Durchführung des Eingriffs stehen<br />
mehrere Methoden zur Verfügung.<br />
Nach der herkömmlichen Methode, die ab der 9. SSW möglich ist und auch noch<br />
bis nach der 20. SSW durchgeführt werden kann, wird mit einer Punktionsnadel Kaliumchlorid<br />
in den Blutkreislauf des ausgewählten Kindes gespritzt, woraufhin dieses abstirbt.<br />
Der Eingriff bedeutet allerdings auch für die übrigen Kinder immer eine Gefahr.<br />
Zunächst besteht die allgemeine Gefahr einer eingriffsbedingten Fehlgeburt, ähnlich wie<br />
bei der Fruchtwasseruntersuchung. Sodann besteht die Gefahr der gleichzeitigen Mitvergiftung<br />
eines anderen Kindes, wenn die Blutkreisläufe beider Kinder über eine Gefäßverbindung<br />
im Mutterkuchen miteinander verbunden waren. Um das zu verhindern, wird<br />
der Eingriff möglichst nicht an monochorialen <strong>Zwillinge</strong>n/Mehrlingen durchgeführt, wo<br />
Gefäßverbindungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auftreten. In diesen Fällen neigt<br />
man vielmehr dazu, die Nabelschnur des zur Abtötung ausgewählten Kindes abzubinden<br />
oder – eine neue Methode – durch den Beschuss mit Laserstrahlen oder durch Bipolarstrom<br />
zu verschließen.<br />
Als weiteres Risiko kommt hinzu, dass sich bei der anschließenden Resorption<br />
(Auflösung) des abgestorbenen Mehrlings Prostaglandin bildet, welches mit der Zeit<br />
eine Aufweichung des Muttermundes und damit eine vorzeitige Geburt bewirken kann.<br />
Und schließlich findet sich nach Durchführung einer Schwangerschaftsreduktion auch<br />
noch eine erhöhte Konzentration bestimmter Botenstoffe (Interleukine) in der Gebärmutter,<br />
von denen man ebenfalls annimmt, dass sie für die weitere Schwangerschaft eine<br />
Gefährdung darstellen, ohne jedoch den genauen Zusammenhang bisher zu kennen.<br />
Andererseits ist der Eingriff langfristig dazu geeignet, die Gefahr einer Frühgeburt<br />
erheblich zu verringern, weil die verbleibenden Kinder weniger Platz beanspruchen, als<br />
18b
19a<br />
wenn alle Ungeborenen weiter ausgetragen würden. In der Abwägung aller Gefährdungsmomente<br />
wird das Eingriffsrisiko ab Vierlingen für geringer gehalten als die mit<br />
dem Austragen aller Kinder verbundenen Schwangerschaftsgefahren.<br />
Eine weitere Methode ist das Absaugen einzelner Mehrlinge, bei der sie durch<br />
den Geburtskanal vollständig aus der Gebärmutter entfernt werden. Die Absaugmethode<br />
kann jedoch nur während der Frühschwangerschaft ab der 7./8. SSW bis etwa zur<br />
12. SSW durchgeführt werden. Daher eignet sie sich nicht für die selektive Abtreibung<br />
eines erkrankten Kindes, weil die Erkrankung in aller Regel noch nicht bis zu diesem<br />
frühen Zeitpunkt bekannt ist. Jedoch kann die Absaugmethode zur Verringerung der<br />
Anzahl der Kinder durchgeführt werden, wenn – vor allem nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung<br />
– frühzeitig gezielt auf eine höhergradige Mehrlingsschwangerschaft hin<br />
untersucht wird.<br />
7. Risiken und Komplikationen einer Mehrlingsschwangerschaft<br />
Zwillingsschwangerschaften werden in der Medizin als „Risikoschwangerschaften“<br />
eingestuft. Worin diese Risiken im Einzelnen liegen und was die biologischen<br />
und medizinischen Besonderheiten einer Zwillingsschwangerschaft ausmacht, ist<br />
Thema des folgenden Kapitels. Dabei wollen wir nicht schwarz malen, aber auch nicht<br />
schönreden. Die meisten der nachfolgend beschriebenen Risiken bedeuten dann keine<br />
ernstliche Gefahr, wenn die Lage schnell erkannt und die erforderlichen medizinischen<br />
Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. Auch deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig,<br />
über die körperlichen Veränderungen und deren Bedeutung möglichst genau informiert<br />
zu sein. Nach wie vor kommen die allermeisten <strong>Zwillinge</strong> gesund zur Welt,<br />
und auch Drillinge und Vierlinge haben sehr gute Chancen. Durch einen verantwortungsvollen<br />
Umgang mit der Situation lässt sich die Ausgangslage der eigenen Kinder<br />
entscheidend verbessern.<br />
a) Allgemeine Schwangerschaftsbeschwerden<br />
Jede Schwangerschaft bedeutet für den Körper der Schwangeren eine hormonelle<br />
Umstellung, einen höheren Verbrauch an Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen,<br />
sowie eine erhebliche Gewichtszunahme. Diese Veränderungen können zu körperlichen<br />
Beschwerden führen, die für sich genommen aber noch kein eigentliches Schwangerschaftsrisiko<br />
darstellen. Auch Einlingsschwangere leiden unter solchen Begleiterscheinungen,<br />
allerdings treten sie bei Mehrlingsschwangeren verstärkt auf.<br />
aa) Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft (Frühgestose)<br />
Eine häufige Begleiterscheinung der Frühschwangerschaft sind Übelkeit und Erbrechen,<br />
vor allem zwischen der 7. und der 12. SSW. Etwa jede fünfte Mehrlingsschwangere<br />
ist davon betroffen. Für viele Frauen sind dies – neben dem Ausbleiben der Monatsblutung<br />
– die ersten Anzeichen der begonnenen Schwangerschaft und oft ist das Vorliegen<br />
von Mehrlingen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Manchmal kann es<br />
helfen, noch im Bett, eine halbe Stunde vor dem Aufstehen, eine Kleinigkeit zu essen<br />
(z.B. Obst) oder etwas zu trinken. Außerdem wird empfohlen, lieber viele <strong>klein</strong>e anstatt<br />
wenige große Mahlzeiten zu sich zu nehmen.<br />
Allgemein wird für die Dauer der Schwangerschaft zu vitamin- und mineralstoffreicher<br />
Nahrung geraten; tierische Fette sollten Sie jedoch nur in Maßen zu sich nehmen.<br />
Dass rohes Fleisch (Tatar, Salami, nicht durchgebratene Hackbällchen oder Steaks)<br />
sowie Rohmilchkäse und rohe Eier (Cremes, Kuchen und Desserts wie z.B. Tiramisu)<br />
während der Schwangerschaft wegen der Gefahr von Toxoplasmoseerregern verboten<br />
sind, ist weithin bekannt. Weniger bekannt ist, dass diese Verbote auch noch in der<br />
Stillzeit gelten. Dasselbe gilt für das selbstverständliche Tabak- und Alkoholverbot. Die<br />
früher übliche Empfehlung, generell salzarm zu essen, entspricht nicht mehr dem aktuellen<br />
Stand der medizinischen Forschung. Man versprach sich davon eine vorbeugende<br />
Wirkung gegen Bluthochdruck, während man heute weiß, dass der schwangerschaftsbedingte<br />
Bluthochdruck nicht mit dem Salzkonsum in Verbindung steht. Von besonderen<br />
Entwässerungsdiäten (Reis- oder Obsttagen) sollten Sie während der Schwangerschaft<br />
absehen, es sei denn, der Frauenarzt würde sie ausdrücklich empfehlen. Der Verzehr von<br />
gekochtem oder gebratenem Fisch ist zu empfehlen, insbesondere fettreiche Sorten wie<br />
Hering, Makrele, Lachs und Thunfisch. Es ist erwiesen, dass das darin enthaltene Fischöl<br />
zur Vermeidung einer Frühgeburt beiträgt. Dagegen birgt roher Fisch wiederum eine<br />
gewisse Toxoplasmosegefahr. Fisch an sich ist zwar frei von Toxoplasmoseerregern, er<br />
kann jedoch bei der Verarbeitung und Zubereitung mit den Erregern verunreinigt werden.<br />
Meiden Sie daher Sushi, Räucherlachs, Matjes und marinierten Hering.<br />
19b
20a<br />
bb) Folsäure-, Jod- und Kalziummangel<br />
Die heranwachsenden Kinder benötigen zum Aufbau ihrer Körperzellen Folsäure<br />
– ein Vitamin, welches vor allem in Blattgemüse, Leber, Hefe und Milch enthalten ist.<br />
Bei der Schwangeren selbst kann es während der Schwangerschaft zu einem Folsäuremangel<br />
kommen, weil die Ungeborenen dem mütterlichen Körper die benötigte Folsäure<br />
entziehen. Allen Schwangeren (auch Einlingsschwangeren) wird daher die zusätzliche<br />
Einnahme von Folsäure in Tablettenform empfohlen. Für Mehrlingsschwangere<br />
gilt diese Empfehlung in besonderem Maße, da die Kinder gleich die mehrfache<br />
Menge an Folsäure verbrauchen. Es genügt jedoch auch hier die für Einlingsschwangere<br />
vorgesehene und vom Arzt verschriebene Dosis.<br />
Außerdem gilt Deutschland mit Ausnahme der Küstenregionen als Jodmangelgebiet,<br />
so dass fast alle hier Lebenden insoweit unterversorgt sind. Selbst bei Verwendung<br />
von jodiertem Speisesalz und mit häufigen Seefischgerichten lässt sich der Tagesbedarf<br />
kaum vollständig decken. Da in der Schwangerschaft zusätzliches Jod benötigt<br />
wird, verschreiben viele Ärzte vorbeugend Jodid-Tabletten.<br />
Schließlich benötigt der Körper auch noch zusätzliches Kalzium für den Aufbau<br />
des kindlichen Gewebes und des Mutterkuchens. Normalerweise genügen ein halber<br />
bis ein Liter Milch am Tag, um den Mehrbedarf einer Schwangeren abzudecken. Auch<br />
Kohlgemüse und manche Mineralwässer enthalten ausreichende Mengen an Kalzium.<br />
Manche Frauenärzte verschreiben bei Zwillingsschwangerschaften jedoch zusätzliche<br />
Kalziumpräparate.<br />
die vorbeugende Einnahme solcher Eisenpräparate, ohne dass konkrete Mangelerscheinungen<br />
erkennbar sind. Andernfalls kann man zur Vorbeugung eisenhaltige Säfte aus<br />
dem Reformhaus zu sich nehmen, die unter der Bezeichnung „Kräuterblut“, „Eisenblut“<br />
usw. angeboten werden. Auch Rote-Beete-Saft (ebenfalls im Reformhaus erhältlich)<br />
enthält Eisen.<br />
dd) Zunahme der Blutmenge, Blutdruckerniedrigung<br />
Zu Unterscheiden von der Blutarmut, die sich auf die Konzentration der Blutkörperchen<br />
im Blut bezieht, ist die Blutmenge insgesamt, die durch den mütterlichen Körperkreislauf<br />
zirkuliert. Die Blutmenge steigt im letzten Schwangerschaftsdrittel auf gut<br />
150 % des normalen Volumens an (bei Einlingsschwangerschaften nur auf gut 125 %),<br />
d.h. das mütterliche Herz pumpt das Anderthalbfache der normalen Blutmenge durch<br />
den Körper. Dieser Anstieg der Blutmenge ist für gesunde Schwangere problemlos zu<br />
bewältigen, stellt jedoch für herzkranke Frauen eine besondere Belastung dar, die mit<br />
den behandelnden Ärzten besprochen werden sollte.<br />
Trotz der Zunahme der Blutmenge kann es während der Schwangerschaft zu einer<br />
Erniedrigung des Blutdruckes kommen. Zu jeder Vorsorgeuntersuchung gehört deshalb<br />
auch eine Blutdruckmessung, die in den Mutterpass eingetragen wird.<br />
20b<br />
ee) Einengung durch die Gebärmutter<br />
cc) Blutarmut (Anämie)<br />
Die Blutarmut ist eine typische Begleiterscheinung von Schwangerschaften. Sie<br />
tritt bei Mehrlingsschwangerschaften mit einer ca. 35%igen Wahrscheinlichkeit besonders<br />
häufig auf. Es handelt sich um eine Abnahme der Konzentration an roten Blutkörperchen<br />
im Blut, wodurch sich der Sauerstofftransport durch das Blut verringert.<br />
Für die Schwangere macht sich das durch Müdigkeit, Leistungsabfall und im Extremfall<br />
durch Schocksymptome bemerkbar. Falls solche Beschwerden vorliegen oder<br />
wenn die regelmäßigen Blutuntersuchungen auf eine drohende Blutarmut hinweisen,<br />
verschreibt der Arzt Eisenpräparate, um eine vermehrte Produktion der roten Blutkörperchen<br />
anzuregen. Manche Ärzte empfehlen bei Mehrlingsschwangerschaften sogar<br />
Bei Mehrlingsschwangeren erreicht die Gebärmutter im Laufe der Zeit einen noch<br />
extremeren Umfang als bei Einlingsschwangeren; sie beinhaltet mit den Kindern, den<br />
Mutterkuchen und dem Fruchtwasser gleich ein Doppeltes oder Vielfaches. Bereits in<br />
der 32. SSW nimmt die Gebärmutter einer Zwillingsschwangeren denselben Platz ein<br />
wie bei Einlingsschwangeren unmittelbar vor der Geburt. Diese Vergrößerung der Gebärmutter<br />
macht sich äußerlich durch einen imposanten Bauchumfang bemerkbar, aber<br />
auch in der Bauchhöhle der Schwangeren beansprucht die Gebärmutter erheblich mehr<br />
Platz als üblich und schiebt alle anderen Organe etwas beiseite. Die eingeengten Verhältnisse<br />
können der Schwangeren vor allem gegen Ende der Schwangerschaft einige<br />
Beschwerden bereiten: Der Druck gegen das Zwerchfell verursacht Kurzatmigkeit bis<br />
hin zur Atemnot, der Druck gegen den Magen kann Sodbrennen bewirken, der Druck
21a<br />
gegen die Blase drängt häufig und manchmal sehr plötzlich auf die Toilette während<br />
der Druck gegen die Darmschlingen Verstopfung bereiten kann. Die meisten dieser<br />
Beschwerden, die keineswegs bei allen Schwangeren eintreten müssen, sind medizinisch<br />
harmlos. Wenn Sie unsicher sind oder die Beschwerden besonders stark auftreten<br />
oder lang anhalten, fragen Sie Ihren Arzt. Den Arzt benachrichtigen sollten Sie<br />
auch dann, wenn sich Ihre Harnausscheidung deutlich verringert und Sie den Drang<br />
zur Toilette längere Zeit überhaupt nicht verspüren oder keinen Urin mehr ablassen<br />
können. Dann können die Nieren- und Harnwege vom Platzmangel betroffen und abgeschnürt<br />
sein.<br />
Auch innerhalb der Gebärmutter herrscht Enge, was bei den Kindern bestimmte<br />
Fehlstellungen begünstigen kann. <strong>Zwillinge</strong> kommen gelegentlich mit einem Klumpfuß<br />
oder einem Hackenfuß zur Welt, der sich durch geeignete Behandlungsmaßnahmen<br />
im Laufe der Kindheit jedoch meist wieder vollständig zurückbildet. Auch kommt es<br />
vor, dass sich die Kopfform der Kinder den engen Verhältnissen anpasst; das hat jedoch<br />
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Hirnfunktionen.<br />
ff) Gewichtszunahme<br />
Schließlich führen Schwangerschaften zu einer vorübergehenden Gewichtszunahme.<br />
Zwillingsschwangere nehmen durchschnittlich 15 kg zu, das sind etwa 4 kg<br />
mehr als bei Einlingsschwangeren. Als Folge der Gewichtszunahme können sich<br />
Krampfadern bilden, denen man mit Stützstrümpfen vorbeugen kann. Auch Schwangerschaftsstreifen<br />
treten bei Zwillingsschwangeren stärker hervor.<br />
Während der Schwangerschaft werden die Kinder durch den Mutterkuchen (Plazenta)<br />
mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Der Mutterkuchen entnimmt dem mütterlichen<br />
Blutkreislauf die lebensnotwendigen Substanzen und leitet sie an den kindlichen<br />
Kreislauf weiter. Jedoch verfügt der Mutterkuchen nur über eine begrenzte Austauschkapazität,<br />
die sich bei Mehrlingsschwangerschaften nicht proportional zur Anzahl<br />
der Kinder vervielfältigt. Wenn der Mutterkuchen nicht genügend Nährstoffe<br />
bereitstellen kann, tritt eine Mangelversorgung ein. Aus diesem Grunde liegt das Geburtsgewicht<br />
von Mehrlingen meist deutlich unterhalb der Durchschnittswerte von Einlingen,<br />
selbst bei gleich langer Schwangerschaftsdauer. Häufig sind die Versorgungskapazitäten<br />
der Mutterkuchen auch ungleich auf die einzelnen Kinder verteilt, so dass der<br />
eine Zwilling ausreichend versorgt sein kann, während der andere unter einer Mangelsituation<br />
leidet. Dies kann bei der Geburt zu einer Gewichtsdifferenz zwischen den einzelnen<br />
Geschwistern von bis zu 1000 Gramm und in seltenen Fällen sogar noch darüber<br />
führen.<br />
Da der kindliche Nährstoffbedarf mit zunehmender Schwangerschaftsdauer steigt,<br />
kommt es zu einem verminderten Wachstum vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft.<br />
In dieser Phase bleiben <strong>Zwillinge</strong> in ihrer Organ-, Gewichts- und Längenentwicklung<br />
gegenüber Einlingen zurück. Während bis zur 32. SSW noch vier von fünf Mehrlingen<br />
ebenso schwer sind wie altersentsprechende Einlinge, erreicht von den bis zum<br />
Geburtstermin ausgetragenen <strong>Zwillinge</strong>n nur jeder zweite das für Einlinge normale Geburtsgewicht<br />
von über 3.000 Gramm. In den meisten Fällen bedeutet diese Minderversorgung<br />
jedoch keine unmittelbare Gefahr für die <strong>Zwillinge</strong>, vielmehr gleicht sich der<br />
Ernährungsmangel im Laufe der nachgeburtlichen Zeit wieder aus. Trotzdem ist es<br />
wichtig, dass der Frauenarzt die Gewichtszunahme und den Entwicklungsfortgang regelmäßig<br />
kontrolliert, da das Unterschreiten einer bestimmten Mindestversorgung zu<br />
ernsten Schäden führen kann. In solchen Fällen muss eine vorzeitige Einleitung der<br />
Geburt erwogen werden. Ist die Versorgungslage schwer einzuschätzen, kann eine stationäre<br />
Überwachung in der Klinik erforderlich sein, wo auch die kindlichen Herztöne<br />
regelmäßig kontrolliert werden und bei einer akuten Verschlechterung der Versorgungssituation<br />
sofort eingegriffen werden kann. Solange es medizinisch vertretbar ist, sollten<br />
die Ungeborenen natürlich im Mutterleib verbleiben, da sie sich bei ausreichender Versorgung<br />
dort am besten entwickeln.<br />
21b<br />
b) Unzureichende Mutterkuchenfunktion (Plazentainsuffizienz)<br />
c) Vorzeitige Wehen und Muttermundschwäche<br />
Da Mehrlinge mitsamt ihren Fruchtblasen und Mutterkuchen das vielfache Volumen<br />
eines einzelnen Kindes einnehmen, ist die Gebärmutter stark gedehnt. Sie ist prall<br />
gefüllt und ihre gespannte Außenwand übt einen mechanischen Pressdruck auf den Inhalt<br />
aus. Dieser Druck lastet auf dem Muttermund, der den „Ausgang“ zum Geburtskanal<br />
verschließt. Gleichzeitig ruht bei aufrechter Haltung der Schwangeren ein vielfaches<br />
Gewicht auf dem Muttermund, wodurch dieser zusätzlich belastet wird. Diese beiden<br />
Faktoren können dazu führen, dass der Gebärmutterverschluss vorzeitig nachgibt. Zu-
22a<br />
nächst erweicht der mit dem Muttermund verbundene Gebärmutterhals, sodann verkürzt<br />
er sich und schließlich öffnet sich der Muttermund. Dies nennt man eine „Muttermundsschwäche“.<br />
Außerdem kann die pralle Füllung der Gebärmutter auch vorzeitige Wehen anregen.<br />
Der mütterliche Körper (miss-)interpretiert die starken Dehnungen als das Reifezeichen<br />
eines ausgewachsenen Einlings, obwohl es sich in Wahrheit um unausgereifte<br />
Mehrlinge handelt. Die Wehen ihrerseits üben einen zusätzlichen Druck auf den Muttermund<br />
aus, der die Verkürzung des Gebärmutterhalses weiter beschleunigt.<br />
Beide Körperreaktionen, Verkürzung des Gebärmutterhalses und Einsetzen der<br />
Wehen, gehören zum natürlichen Verlauf jeder Schwangerschaft – allerdings erst kurz<br />
vor der Geburt. Bei Mehrlingen besteht die erhöhte Gefahr, dass dieses Verhalten zu<br />
früh eintritt, dass also der Körper der Schwangeren die Kinder eher gebären will, als<br />
diese tatsächlich ausgereift sind. Wenn sich eine solche Entwicklung abzeichnet, muss<br />
alles daran gesetzt werden, eine drohende Frühgeburt zu vermeiden und die Schwangerschaft<br />
möglichst lange, bestenfalls noch bis in die Nähe des errechneten Geburtstermins<br />
fortzusetzen.<br />
Dazu sind absolute Ruhe und eine möglichst liegende Position der Schwangeren<br />
erforderlich, damit der Muttermund möglichst entlastet ist. Am ehesten ist dies mit<br />
einem stationären Klinikaufenthalt zu gewährleisten, wo auch wehenhemmende Medikamente<br />
gegeben werden können.<br />
Bei der Verabreichung von wehenhemmenden Mitteln unterscheidet man zwischen<br />
Kurzeit- und Langzeitbehandlung. Die Kurzzeitbehandlung hat zum Ziel, die<br />
Geburt um 48 Stunden hinauszuzögern, um in dieser Zeit die Kinder noch optimal auf<br />
die Geburt vorzubereiten. Dazu gehört insbesondere die Lungenreifebehandlung. Der<br />
Schwangeren wird ein Kortisonpräparat (Kortikosteroid) gespritzt, welches über den<br />
Mutterkuchen in den kindlichen Kreislauf gelangt und dort die Bildung von Surfactant<br />
anregt – eine oberflächenaktive Substanz, die die Lungenbläschen beim ersten Einatmen<br />
nach der Geburt entfalten lässt. Kommt es dann zur Frühgeburt, können die Kinder<br />
möglichst von Anbeginn selbständig atmen und müssen nicht künstlich beatmet<br />
werden, was die weitere Behandlung erheblich erleichtert. Außerdem vermindert das<br />
Kortisonpräparat auch die Gefahr einer späteren Hirnblutung des Frühgeborenen. Die<br />
Lungenreifebehandlung wird durchgeführt, wenn sich die Schwangerschaft noch vor<br />
etwa der 35. SSW befindet. Danach ist sie nicht mehr erforderlich, weil die Kinder das<br />
Surfactant selbst gebildet haben.<br />
Eine Langzeitbehandlung mit wehenhemmenden Mitteln ist praktisch nur in<br />
Deutschland verbreitet. Ihr Nutzen ist umstritten, die Nebenwirkungen dagegen erheblich<br />
und die psychische Belastung für die Schwangere evident, weshalb in vielen anderen<br />
Ländern weitgehend darauf verzichtet wird. In Deutschland ist die Langzeitbehandlung<br />
gleichwohl eher die Regel als die Ausnahme. Ein gängiges Mittel für die Langzeitbehandlung<br />
ist das unter dem Handelsnamen Partusisten vertriebene Fenoterol, welches<br />
heute nur noch als Infusion verabreicht werden sollte, nachdem man weiß, dass es<br />
in Tablettenform weitgehend wirkungslos ist. Als Nebenwirkung verursacht das Medikament<br />
bei vielen Frauen einen Anstieg der Herzfrequenz (Herzrasen), welches wiederum<br />
mit Betablockern reguliert wird. Zwillingsschwangere erleiden durch Partusisten<br />
aufgrund ihrer besonderen Belastungssituation außerdem häufiger ein Lungenödem<br />
("Wasser in der Lunge"), was ebenfalls nicht hilfreich ist. Deutlich weniger Nebenwirkungen<br />
als Fenoterol hat die Substanz Atosiban (Handelsname: Tractosile ), welche für<br />
Zwillingsschwangere in aller Regel das Mittel der Wahl darstellt. Leider kommt die<br />
Substanz in der Praxis noch zu selten zum Einsatz, weil sie um ein Vielfaches teurer ist<br />
als Fenoterol. Auch Magnesiuminfusionen und -tabletten dienen der allgemeinen Muskelgewebe-Entspannung<br />
und haben damit ebenfalls eine wehenhemmende Wirkung. Sie<br />
kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn bereits Anzeichen einer Gestose vorliegen.<br />
Hatte der Frauenarzt bereits Eisenpräparate verschrieben, um die Bildung roter Blutkörperchen<br />
anzuregen, sollte man den Klinikarzt besonders darauf aufmerksam machen, da<br />
sich die Wirkung von Eisen- und Magnesiumpräparaten gegenseitig beeinflussen kann.<br />
Zunehmend Verbreitung findet die vorbeugende Verabreichung von Gestagenen (Progesteron)<br />
zur Verhinderung der Frühgeburt. Diese sollen die Gebärmutter auf hormoneller<br />
Basis ruhig stellen. Die Wirkung des Medikaments gilt – jedenfalls bei Einlingen –<br />
durch einige Studien als erwiesen, der genaue Wirkmechanismus ist indes noch unbekannt.<br />
Bei einer Muttermundsschwäche ohne merkliche vorzeitige Wehentätigkeit legen<br />
manche Kliniken eine sog. Zerklage an. Hierbei handelt es sich entweder um eine Naht<br />
oder um einen Kunststoffring (Pessar), mit deren Hilfe der Gebärmutterhals mechanisch<br />
umschlungen und verschlossen wird. Eine andere Methode ist das Vernähen oder Verkleben<br />
des Muttermundes selbst (sog. „totaler Muttermundsverschluss“). Der Nutzen<br />
solcher Maßnahmen ist unter Medizinern jedoch umstritten, weshalb viele Ärzte auf<br />
diese Behandlung verzichten. Gegen die Zerklage wird vorgebracht, dass sie den Beginn<br />
einer Geburt nicht wirklich aufhalten könne und ihre schwangerschaftsverlängernde<br />
Wirkung überschätzt werde, während der Eingriff seinerseits ein zusätzliches, vermeidbares<br />
Infektionsrisiko in sich berge. In Einzelfällen soll die Zerklage sogar das Gegen-<br />
22b
23a<br />
teil bewirkt, nämlich die Wehentätigkeit durch die mechanische Reizung angeregt und<br />
das Risiko einer vorzeitigen Geburt dadurch erhöht haben.<br />
Gebärmutter<br />
Zerklage<br />
Geburtskanal<br />
Ob es zu diesen medizinischen Maßnahmen kommen muss, hängt nicht nur vom<br />
Wachstum der Kinder und dem mütterlichen Körperbau ab, sondern auch von Ihrem<br />
Verhalten während der Schwangerschaft. Eine Muttermundsschwäche kann nämlich<br />
fast immer durch rechtzeitige konsequente Schonung verhindert oder zumindest hinausgezögert<br />
werden. Damit haben Sie als Schwangere es zu einem gewissen Teil auch<br />
selbst in der Hand, durch Anpassung Ihrer Lebensgewohnheiten eine Frühgeburt zu<br />
verhindern. Vermeiden Sie spätestens ab der zweiten Hälfte der Schwangerschaft<br />
sportliche Aktivitäten und andere körperliche Anstrengungen. Wenn Sie einem Beruf<br />
nachgehen, der Ihnen Stress verursacht oder Sie körperlich beansprucht, so sprechen<br />
Sie darüber mit Ihrem Frauenarzt. Er kann Ihnen Atteste ausstellen, die Ihrem Arbeitgeber<br />
bereits weit vor dem Beginn des Mutterschutzes verbieten, Sie mit bestimmten<br />
belastenden Tätigkeiten zu beschäftigen. Wenn es medizinisch erforderlich ist, kann<br />
der Frauenarzt sogar ein totales Beschäftigungsverbot aussprechen, an das sich der<br />
Arbeitgeber halten muss. Häufig bieten Frauenärzte dies ab etwa der 26. bis 30. SSW<br />
an. Nehmen Sie die Freistellung in Anspruch, auch wenn Sie sich noch „fit“ fühlen<br />
und die Belastungen als nicht so schlimm empfinden. Die Überbeanspruchung des<br />
Muttermundes kann man nämlich nicht spüren. Sie äußert sich erstmals mit dem vorzeitigen<br />
Beginn der Geburt, wenn es für schonende Maßnahmen bereits zu spät ist.<br />
Auch vorzeitige Wehen spürt man fast immer erst dann, wenn sie durch Schonung<br />
allein nicht mehr aufzuhalten sind. Reduzieren Sie daher in jedem Fall auch Ihre häusliche<br />
Belastung: Lassen Sie andere den Einkauf erledigen, vermeiden Sie Treppensteigen<br />
und anstrengende Putzarbeiten. Erledigen Sie soviel wie möglich im Sitzen. Machen Sie<br />
öfter eine Pause, in der Sie eine entspannte Position einnehmen, sich am besten sogar für<br />
eine Weile hinlegen. Eine leichte Seitenlage ist der ebenen Rückenlage vorzuziehen,<br />
weil die Gebärmutter sonst auf die darunter liegende Hohlvene drückt, was den Kreislauf<br />
erheblich beeinträchtigen kann.<br />
Wenn sich die notwendigen Schonungsmaßnahmen zuhause nicht ohne weiteres<br />
umsetzen lassen, kommt für Sie eventuell eine Schwangerschaftskur in Betracht. Die<br />
Schwangerschaftsbetreuung in der Form eines Kuraufenthalts war in der früheren DDR<br />
durchaus verbreitet, hat aber nach der Wende nur noch in der Form eines speziellen<br />
Kurheims für Risikoschwangere in Bad Saarow bei Berlin überdauert 1 . Informieren Sie<br />
sich z.B. auf der Webseite des Kurheims über das Angebot und fragen Sie Ihren Arzt, ob<br />
er den Kuraufenthalt befürwortet. Die Kosten der Kur werden von den gesetzlichen<br />
Krankenkassen übernommen bei einer üblichen Zuzahlung von 10,- EUR pro Tag. Nach<br />
Erreichen der Belastungsgrenze von 2% des Bruttojahreseinkommens können Sie sich<br />
von der Zuzahlungspflicht befreien lassen.<br />
Wenn Sie schon Kinder haben, dann bitten Sie so oft es geht andere Personen (z.B.<br />
Großeltern) um deren Betreuung. Wenn die Voraussetzungen für eine Fremdbetreuung<br />
nicht gegeben sind, beantragen Sie bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe. Nach<br />
§ 199 der Reichsversicherungsordnung (RVO) steht Ihnen eine Haushaltshilfe zu, wenn<br />
Ihnen wegen Schwangerschaft oder Entbindung die Weiterführung des Haushalts nicht<br />
möglich ist und eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen<br />
kann. Während eines Klinikaufenthalts gewähren die Krankenkassen eine Haushaltshilfe<br />
problemlos. Wenn Sie sich allerdings zuhause schonen wollen und dafür eine Haushaltshilfe<br />
benötigen, müssen Sie gegenüber der Krankenkasse darlegen können, dass es sich<br />
um einen „begründeten Ausnahmefall“ handelt. Aus unserer Sicht sollten Krankenkassen<br />
jedoch anstandslos anerkennen, dass es einen medizinisch begründeten Ausnahmefall<br />
darstellt, wenn die konsequente Schonung im häuslichen Umfeld entscheidend dazu<br />
beitragen kann, eine drohende Frühgeburt zu vermeiden. Fragen Sie Ihren Frauenarzt, ob<br />
auch er eine Haushaltshilfe für notwendig erachtet, und bitten Sie ihn um ein entsprechendes<br />
Attest. Am ehesten dürften die Krankenkassen bereit sein, eine Haushaltshilfe<br />
1 Haus an der Sonne, Lindenstr. 24, 15526 Bad Saarow, Tel. 033631-4370, Fax: 033631-43736;<br />
www.schwangerenkur.de; E-Mail: info@schwangerenkur.de.<br />
23b
24a<br />
zu finanzieren, wenn man ihnen vor Augen führen kann, dass die Alternative hierzu<br />
allein in der stationären Klinikaufnahme oder in einem Kuraufenthalt liegt, welche<br />
weit höhere Kosten verursachen würden.<br />
Planen Sie keinen Umzug während der Schwangerschaft, auch wenn Ihre bisherige<br />
Wohnung für den erwarteten Nachwuchs zu <strong>klein</strong> erscheint. Nicht nur das Ein- und<br />
Ausladen am Umzugstag selbst, sondern schon das Auf- und Abhängen von Regalen<br />
und Bildern, das Ein- und Auspacken des Hausrats in Umzugskisten sowie natürlich<br />
jegliche Renovierungsarbeit ist mit großen körperlichen Anstrengungen und meist<br />
auch mit einer gebeugten oder gestreckten Körperhaltung verbunden, die während der<br />
Schwangerschaft vermieden werden sollten. Bei Renovierungsarbeiten kommen Vergiftungsgefahren<br />
durch chemische Lösungsmittel in Farben u.ä. hinzu, auf die die<br />
Ungeborenen viel empfindlicher reagieren als der ausgewachsene Mensch. Selbst für<br />
diejenigen, die ein Umzugsunternehmen beauftragen, bleibt in der Regel ein gesundheitsbedenklicher<br />
Umfang an Vor- und Nacharbeit. Wenn sich ein Umzug unter keinen<br />
Umständen vermeiden lässt, sollten Sie ihn jedenfalls bis spätestens zur Mitte der<br />
Schwangerschaft abgeschlossen haben. Danach werden die Ungeborenen so schwer,<br />
dass die körperliche Anstrengung zu einer ernsten Belastung des Muttermundes wird<br />
und vorzeitige Wehen auslösen kann. Fragen Sie Ihren Frauenarzt, welche Belastung<br />
in Ihrer persönlichen Situation noch vertretbar ist.<br />
Beschränken Sie sich auch in Ihrem Sexualleben. Vermeiden Sie in der zweiten<br />
Schwangerschaftshälfte den Geschlechtsverkehr, und zwar aus zweierlei Gründen:<br />
Zum einen verursacht der eindringende Penis eine mechanische Reizung des Gebärmutterhalses<br />
und regt damit die Wehentätigkeit an. Zum anderen enthält die männliche<br />
Samenflüssigkeit Prostaglandine, die den Muttermund aufweichen können und zu<br />
dessen vorzeitiger Öffnung beitragen. Beide Effekte können eine Frühgeburt begünstigen.<br />
Besprechen Sie stattdessen miteinander, wie Sie Ihre geschlechtliche Beziehung<br />
auf andere Weise gestalten können, welche Formen des Liebesspiels für Sie in Betracht<br />
kommen, ohne dadurch eine Frühgeburt zu riskieren. Vermeiden Sie dabei auch<br />
eine starke Reizung der Brustwarzen, weil dadurch das wehenfördernde Hormon Oxytocin<br />
freigesetzt wird.<br />
Wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, eine Zeit lang auf den Geschlechtsverkehr<br />
ganz zu verzichten, sollten Sie zumindest Kondome benutzen, um die Samenflüssigkeit<br />
vom Muttermund fernzuhalten. Vermeiden Sie Stellungen, bei denen der Penis<br />
besonders tief eindringt. Am schonendsten sind Stellungen, bei denen die Partner seitlich<br />
nebeneinander liegen oder bei denen die Frau sich in den Vierfüßlerstand begibt<br />
und der Mann von hinten eindringt. Unter allen Umständen sollten Sie bei Blutungen aus<br />
der Scheide und bei Blutergüssen vom Geschlechtsverkehr absehen.<br />
Erwarten Sie Drillinge oder Vierlinge, so sind die genannten Schonungsmaßnahmen<br />
nicht erst ab der Schwangerschaftsmitte angesagt, sondern gleich zu Beginn. Das gilt<br />
auch für den Geschlechtsverkehr. Der Erfolg einer höhergradigen Mehrlingsschwangerschaft<br />
steht und fällt mit einer konsequenten Schonung des gesamten Körpers von Beginn<br />
an.<br />
Vorzeitige Wehen verspürt man übrigens, indem sich die Muskeln der Gebärmutter<br />
für einen Augenblick zusammenziehen. Der Bauch wird für einen Moment hart und<br />
entspannt sich dann wieder. Dieses Zusammenziehen ist nicht schmerzhaft und man<br />
muss manchmal sehr aufmerksam sein, um es überhaupt wahrzunehmen. Nicht jede<br />
Kontraktion dieser Art ist jedoch gleich ein Grund zur Besorgnis. Es gehört zum normalen<br />
Verlauf der Schwangerschaft, dass die Gebärmutter ihre Wehenfunktion schon einige<br />
Wochen vor dem Geburtstermin zu „trainieren“ beginnt. Bis zu zehn spürbare Wehen je<br />
24 Stunden gelten in diesem Rahmen als normal. Auch die Senkwehen, bei denen sich<br />
die Kinder einige Zeit vor der Geburt in den Beckeneingang verlagern und die man<br />
meist als ein Ziehen im Kreuz verspürt, gehören zum normalen Verlauf der Schwangerschaft<br />
und sind für sich genommen nicht gefährlich. Trotzdem sollten Sie Ihren Frauenarzt<br />
über alle verspürten Wehen informieren, damit er Ihre Wehentätigkeit gezielt mit<br />
einem CTG-Gerät überprüfen und mit einer Ultraschalluntersuchung kontrollieren kann,<br />
ob die Wehen bereits „muttermundswirksam“ sind, ob also der Pressdruck auf den Muttermund<br />
bereits eine Verkürzung des Gebärmutterhalses bewirkt.<br />
d) Gestose, hypertensive Schwangerschaftserkrankung<br />
Etwa jede vierte Mehrlingsschwangere erkrankt – meist zum Ende der Schwangerschaft<br />
– an einer Gestose. Dabei handelt es sich um eine mit Bluthochdruck verbundene<br />
Stoffwechselstörung, die in unterschiedlichen Schweregraden auftritt. Außer dem Namen<br />
„Gestose“ sind noch eine Reihe weiterer Bezeichnungen für diese Art Schwangerschaftserkrankung<br />
eingeführt:<br />
- Schwangerschaftsvergiftung (im Volksmund)<br />
- Schwangerschaftshochdruck (selten gebräuchlich)<br />
24b
25a<br />
- Gestose, EPH-Gestose, Spätgestose (geläufige Bezeichnung in den meisten<br />
Frauenarztpraxen)<br />
- Toxikose<br />
- Präeklampsie (ohne Krämpfe), Eklampsie (mit Krämpfen)<br />
- hypertensive Schwangerschaftserkrankung, Gestationshypertension,<br />
schwangerschaftsassoziierte Hypertension (derzeit herrschende Bezeichnungen<br />
in der medizinischen Fachliteratur).<br />
Die verschiedenen Benennungen beruhen auf unterschiedlichen Interpretationen<br />
der Krankheit und veranschaulichen zugleich, dass die medizinische Diskussion über<br />
deren Ursachen und Therapie noch nicht abgeschlossen ist.<br />
Nachgewiesen wird die Erkrankung durch einen erhöhten Eiweißanteil im Urin.<br />
Charakteristisch ist jedoch ein permanent ansteigender Blutdruck, der letztlich auch<br />
die Gefährlichkeit der Erkrankung ausmacht. Beide Messwerte werden deshalb bei<br />
jeder Vorsorgeuntersuchung überprüft. Ein drittes Erkennungsmerkmal sind Wassereinlagerungen,<br />
von denen die Erkrankung fast immer begleitet ist. Diese sind zunächst<br />
als geschwollene Knöchel, später auch als geschwollene Hände, Unterschenkel und als<br />
geschwollenes Gesicht wahrzunehmen. Wenn Sie solche Anzeichen bei sich feststellen,<br />
sollten Sie umgehend Ihren Frauenarzt aufsuchen, um den Blutdruck und den<br />
Eiweißgehalt Ihres Urins einmal außer der Reihe testen zu lassen.<br />
Bei schwerem Verlauf der Erkrankung können Krampfanfälle auftreten, die zu einer<br />
vorübergehenden Unterversorgung der Kinder führen und deshalb eine ernste Gefahr<br />
darstellen. Solche Krampfanfälle kündigen sich meist durch zunehmende Kopfschmerzen,<br />
eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes, äußerliche Unruhe, gesteigerte<br />
Reflexe, Schwindelgefühl, Flimmern oder Nebel vor den Augen, Ohrensausen,<br />
Bewusstseinseintrübung, Schmerzen in der Magengrube, Übelkeit oder Erbrechen und<br />
manchmal durch Hitzewallungen an. Wenn Sie solche Symptome feststellen und der<br />
Frauenarzt vielleicht sogar schon eine Neigung zur Gestose festgestellt hatte, müssen<br />
Sie sofort mit Ihrem Frauenarzt Rücksprache nehmen oder – falls dieser nicht erreichbar<br />
ist – die Geburtsklinik aufsuchen. Um einem so schwerwiegenden Krankheitsverlauf<br />
vorzubeugen, wird die einmal erkannte Gestose frühzeitig mit blutdrucksenkenden<br />
Mitteln und eiweiß- sowie kalorienreicher Ernährung behandelt. Bei drohenden<br />
Krampfanfällen wird außerdem – je nach dem erreichten Reifegrad der Kinder – eine<br />
vorzeitige Einleitung der Geburt erwogen.<br />
Eine seltenere Variante der Gestose ist das für Mutter und Kinder sehr gefährliche<br />
HELLP-Syndrom, das man in neun von zehn Fällen durch starke Schmerzen im rechten<br />
Oberbauch bemerkt, die bis in den Rücken ausstrahlen können. Die Ursachen des Syndroms,<br />
bei dem die Leberfunktion nachlässt und eine Gerinnungsstörung eintritt, sind<br />
noch unbekannt. Wird diese Erkrankung durch veränderte Blutwerte nachgewiesen,<br />
strebt man meist eine sofortige Entbindung an.<br />
Die Ursachen dieser Krankheitsbilder sind – wie gesagt – noch nicht ausreichend<br />
erforscht. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass das Auftreten der Erkrankung<br />
durch eine vorbeugende regelmäßige Einnahme von Acetylsalizylsäure (Aspirin ® ) in<br />
vielen Fällen vermindert werden kann. Frauen, die bereits bei früheren Schwangerschaften<br />
unter der Gestose gelitten haben, wird deshalb vorbeugend zur regelmäßigen Einnahme<br />
von niedrig dosiertem Aspirin ® ab der 12. SSW geraten. Bei Mehrlingsschwangeren,<br />
die fünfmal häufiger als Einlingsschwangere an einer Gestose erkranken, wird ebenfalls<br />
diskutiert, ob eine vorbeugende Gabe von Aspirin sinnvoll sein kann. Hierzu fehlen<br />
jedoch noch Fallstudien, weshalb die vorbeugende Aspirinbehandlung derzeit nicht<br />
standardmäßig durchgeführt wird. Wenn Sie das Thema interessiert, fragen Sie Ihren<br />
Frauenarzt danach. Kommen Sie aber bitte nicht auf den Gedanken, eigenmächtig eine<br />
vorbeugende Aspirinbehandlung vorzunehmen. Denn hierzu bedarf es der vorherigen<br />
Abklärung einiger Ausschlusskriterien (z.B. Nierenerkrankung, chronischer Bluthochdruck,<br />
Diabetes usw.) und außerdem einer speziellen Dosierung, die täglich nur etwa ein<br />
Zehntel bis ein Fünftel einer gewöhnlichen Kopfschmerztablette beträgt.<br />
e) Blasensprung<br />
Unter einem Blasensprung versteht man das vorzeitige Platzen der Fruchtblase. Als<br />
Schwangere stellen Sie fest, dass eine große Menge Fruchtwasser meist in einem<br />
Schwall, manchmal aber auch in einem kontinuierlichen Fluss oder in mehreren Portionen<br />
abgeht. Bei <strong>Zwillinge</strong>n kommt der vorzeitige Blasensprung anderthalb mal häufiger<br />
vor als bei Einlingen. Betroffen ist – wenn getrennte Fruchtblasen vorhanden sind –<br />
meist die Fruchtblase des vorn liegenden Kindes. Ein Blasensprung ist für sich genommen<br />
noch keine bedrohliche Situation. Trotzdem sollten Sie sofort die Geburtsklinik<br />
aufsuchen, da in aller Regel kurze Zeit später die Wehen einsetzen. Sollten die Wehen<br />
nicht einsetzen, muss eine künstliche Einleitung der Geburt erwogen werden, um Infektionen<br />
zu vermeiden. Sind die Kinder noch sehr <strong>klein</strong>, so wird vor der Geburt möglichst<br />
noch eine Lungenreifebehandlung durchgeführt. Einige Male ist es sogar schon gelun-<br />
25b
26a<br />
26b<br />
gen, das von der geplatzten Fruchtblase betroffene Kind allein zu gebären und die<br />
Schwangerschaft danach mit dem anderen Zwilling noch eine Zeit lang fortzusetzen.<br />
Diese Lösung empfiehlt sich aber nur, wenn die Fruchtblase schon sehr früh im Verlauf<br />
der Schwangerschaft platzt. Manchmal verschließen sich geplatzte Fruchtblasen<br />
übrigens auch wieder von selbst und das Fruchtwasser wird innerhalb kurzer Zeit<br />
nachgebildet. In jedem Fall ist aber eine ärztliche Kontrolle notwendig, auch wenn Sie<br />
keine weiteren Beeinträchtigungen verspüren.<br />
Gefäßverästelungen<br />
innerhalb der Plazenta<br />
Nabelschnur<br />
Kind II<br />
f) Besondere Komplikationen bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n<br />
Während die bis hierhin geschilderten Komplikationen grundsätzlich bei allen<br />
Zwillingsschwangerschaften auftreten können, kommen einige weitere Störungen nur<br />
bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n, andere nur bei monochorialen Eihautverhältnissen und wieder<br />
andere nur dann vor, wenn eineiige <strong>Zwillinge</strong> sich eine gemeinsame Fruchthöhle<br />
teilen (monochorial-monoamniale Eihautverhältnisse). Um die speziellen Risiken<br />
gezielt zu überwachen oder aber von vornherein ausschließen zu können, ist eine frühzeitige<br />
Bestimmung der vorliegenden Eihautverhältnisse erforderlich.<br />
aa) Gefäßverbindungen, Zwillingstransfusionssyndrom, akardischer Zwilling<br />
(betrifft: überwiegend eineiige <strong>Zwillinge</strong> mit monochorialen Eihautverhältnissen)<br />
Durch die Nabelschnüre führen Arterien und Venen, über die die Kinder versorgt<br />
werden. Sie münden in den Mutterkuchen (Plazenta), wo das zirkulierende Blut mit<br />
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Normalerweise sollten sich die Nabelschnurarterien<br />
und -venen der Kinder innerhalb der Mutterkuchen so verzweigen, dass<br />
für beide Kinder je ein getrennter Blutkreislauf besteht:<br />
Nabelschnur<br />
Kind I<br />
Nabelarterie<br />
Nabelvene<br />
Nabelarterie<br />
zum Kind II<br />
getrennte Blutkreisläufe ohne Gefäßverbindungen<br />
Bei neun von zehn monochorialen Schwangerschaften bilden sich jedoch innerhalb<br />
des gemeinsamen Mutterkuchens Kurzschlüsse zwischen den Kreisläufen der Kinder, so<br />
dass die Blutkreisläufe miteinander verbunden sind (Gefäßanastomosen). Hierbei können<br />
z.B. die Arterie des einen Kindes mit der Arterie des anderen Kindes oder auch mit<br />
dessen Vene oder zwei Venen untereinander verbunden sein. Je nach Konstellation der<br />
Gefäßverbindung müssen sich die <strong>Zwillinge</strong> die Blutzufuhr teilen oder der eine Zwilling<br />
wird ganz oder zum Teil über den anderen Zwilling mitversorgt. Dadurch entsteht ein<br />
sog. „dritter Kreislauf“.<br />
Gefäßverbindung<br />
Gefäßverbindung zwischen den Blutkreisläufen
27a<br />
Während man früher davon ausging, dass Gefäßverbindungen ausschließlich bei<br />
monochorialen <strong>Zwillinge</strong>n vorkommen, und zwar vor allem bei monochorialen diamnialen<br />
<strong>Zwillinge</strong>n, wurden inzwischen sehr vereinzelt auch dichoriale Schwangerschaften<br />
festgestellt, bei denen eine Gefäßverbindung zustande kam, nachdem sich die<br />
ursprünglich voneinander getrennten Mutterkuchen an ihren äußeren Enden miteinander<br />
verschmolzen hatten.<br />
Die meisten dieser Gefäßverbindungen sind harmlos und behindern die <strong>Zwillinge</strong><br />
nicht in ihrer Entwicklung. Es kann lediglich passieren, dass der zweite Zwilling nach<br />
der Geburt des ersten Zwillings durch die Gefäßverbindung und die bereits abgetrennte<br />
Nabelschnur des ersten Zwillings Blut verliert. Das lässt sich aber leicht verhindern,<br />
indem man die Nabelschnur des ersten Zwillings nicht nur in Richtung des Kindes,<br />
sondern zusätzlich auch noch in mütterlicher Richtung abbindet. Manche Ärzte erwägen<br />
bei erkennbaren Gefäßverbindungen auch von vornherein einen Kaiserschnitt.<br />
Wenn jedoch die Blutkreisläufe der <strong>Zwillinge</strong> durch eine Verbindung zwischen<br />
der Arterie des einen und der Vene des anderen Zwillings in ein Ungleichgewicht<br />
geraten, nimmt einer von ihnen die Funktionen eines Geberzwillings und der andere<br />
die Funktion eines Empfängerzwillings ein. Etwa 15% der monochorialen Zwillingsschwangerschaften<br />
zeigen dieses Phänomen, das man „Zwillings-<br />
Transfusionssyndrom“ nennt, weil es den äußeren Anschein hat, als wäre zwischen<br />
den <strong>Zwillinge</strong>n eine ständige Bluttransfusion angelegt. Der Empfängerzwilling leidet<br />
unter Bluthochdruck, Wassereinlagerungen und einer Überlastung der Herzfunktion,<br />
während sich bei dem Geberzwilling Blutarmut und ein Mangel an Körperflüssigkeit<br />
einstellen. Häufig steigt dann auch die Fruchtwassermenge bei dem Empfängerzwilling<br />
bis zur 30. SSW so stark an, dass es zu einer vorzeitigen Geburt kommen kann.<br />
Der Geberzwilling leidet dagegen unter einem Fruchtwassermangel. Beide <strong>Zwillinge</strong><br />
können zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Gewichtsunterschiede aufweisen.<br />
Um diese Folgen zu vermeiden, wurden zwei Behandlungsmethoden entwickelt,<br />
die das Zwillings-Transfusionssyndrom beheben oder wenigstens abschwächen. Zum<br />
einen kann man dem Empfängerzwilling Fruchtwasser aus seiner Fruchtblase entnehmen<br />
(sog. Entlastungspunktion). Das dient zunächst einmal der Beseitigung des Überdrucks<br />
und einer Verringerung der akuten Frühgeburtsgefahr. Manchmal bewirken die<br />
geänderten Druckverhältnisse sogar, dass der gefäßübergreifende Blutfluss selbst versiegt<br />
oder wenigstens nachlässt. Allerdings ist es in der Mehrzahl der Fälle notwendig,<br />
die nicht ganz ungefährliche Fruchtwasserentnahme in Abständen zu wiederholen. In<br />
extremen Fällen kann es darüber hinaus erforderlich sein, den Blutdruck beim Empfängerzwilling<br />
durch einen Aderlass zu senken, indem man die entsprechende Nabelschnur<br />
punktiert und dadurch etwas Blut abnimmt (Chordozentese).<br />
Eine zweite Behandlungsmöglichkeit besteht darin, die störenden Gefäßverbindungen<br />
innerhalb des Mutterkuchens mittels Laserstrahlen zu verschließen. Doch hängt es<br />
von der jeweiligen Konstellation und Lage der Gefäßverbindung ab, ob dieser Eingriff<br />
überhaupt möglich ist, und nur sehr wenige Kliniken sind auf die Durchführung dieser<br />
noch jungen Behandlungsmethode spezialisiert. Auch dieser Eingriff hat eine hohe<br />
Komplikationsrate und kann zum Tod eines oder beider Kinder führen. Jedoch bedeutet<br />
er bei schweren Erscheinungsformen des Transfusionssyndroms manchmal die einzige<br />
Chance, die Schwangerschaft überhaupt zu retten.<br />
Noch eine Steigerung des Zwillings-Transfusionssyndroms stellen die akardischen<br />
<strong>Zwillinge</strong> dar, wo die Gefäßverbindungen innerhalb des Mutterkuchens so geschaltet<br />
sind, dass der akardische Zwilling vollständig durch den anderen Zwilling mitversorgt<br />
wird. Dies hat zur Folge, dass sich der andere Zwilling – bis auf eine drohende Herzüberlastung<br />
– normal und gesund entwickelt, während der akardische Zwilling völlig<br />
zurückbleibt. Er ist zu keinem Zeitpunkt lebensfähig und hat in dieser Konstellation<br />
letztlich nur noch die Funktion, den Blutkreislauf des anderen Zwillings zu schließen.<br />
Man nimmt den akardischen Zwilling dadurch war, dass mit der Nachgeburt noch zusätzlich<br />
ein verkümmerter weiterer Körper ausgeschieden wird, der jedoch häufig nicht<br />
einmal auch nur die Ansätze eines Kopfes, der Arme usw. erkennen lässt. Das Vorkommen<br />
akardischer <strong>Zwillinge</strong> ist bei nur einer auf 5.000 Zwillingsschwangerschaften jedoch<br />
insgesamt recht gering.<br />
bb) Nabelschnurverwicklungen<br />
(betrifft: im Wesentlichen eineiige <strong>Zwillinge</strong> mit monochorial-monoamnialen Eihautverhältnissen)<br />
Bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n, die in denselben Eihäuten und in demselben Fruchtwasser<br />
aufwachsen, können sich die Nabelschnüre beider Kinder gegenseitig umschlingen und<br />
regelrecht verknoten. Durch solche Nabelschnurverwicklungen kann die Nabelschnurdurchblutung<br />
erheblich gestört und damit die Sauerstoff- und Nahrungsversorgung der<br />
Kinder lebensbedrohlich abgeschnürt werden. Hierbei handelt es sich zugleich um die<br />
häufigste vorgeburtliche Todesursache eineiiger monoamnialer <strong>Zwillinge</strong>. Man kann der<br />
Gefahr einer Nabelschnurverwicklung kaum wirksam begegnen, weil die Kindsbewe-<br />
27b
28a<br />
gungen im Mutterleib einschließlich kompletter Drehungen zum normalen Schwangerschaftsverlauf<br />
gehören und sich nicht abstellen lassen. Man kann nur die Schwangerschaft<br />
möglichst früh durch Kaiserschnitt beenden, bevor es zu einer lebensbedrohlichen<br />
Nabelschnurverwicklung kommt. Nach derzeitigem Diskussionsstand wird eine<br />
vorzeitige Geburt nach Vollendung der 32. SSW empfohlen, weil im späteren Verlauf<br />
der Schwangerschaft die Gefahren der Nabelschnurverwicklung denjenigen der Frühgeburt<br />
überwiegen. Leider ist die Wahrscheinlichkeit einer Nabelschnurverwicklung<br />
so groß, dass nur bei vier von zehn monoamnialen Schwangerschaften beide <strong>Zwillinge</strong><br />
lebend geboren werden. Da monoamniale Eihautverhältnisse jedoch nur einen geringen<br />
Anteil von 1-2% der eineiigen <strong>Zwillinge</strong> ausmachen, müssen nur wenige diese<br />
Komplikation fürchten.<br />
cc) Störungen bei der Zwillingsteilung<br />
(betrifft: alle eineiigen <strong>Zwillinge</strong>)<br />
Eineiige <strong>Zwillinge</strong> entstehen, das haben wir schon ausgeführt, durch Teilung der<br />
befruchteten Eizelle (bzw. des daraus bereits entstandenen Gebildes) in zwei identische<br />
Teile. Theoretisch sollten beide Teile danach über exakt dieselbe Erbinformation<br />
(DNA) verfügen, also über denselben genetischen Bauplan. Tatsächlich kommt es<br />
jedoch aufgrund verschiedener Störeinflüsse immer zu gewissen Abweichungen, die<br />
bis zu 1% aller Erbmerkmale ausmachen können. Daher weisen selbst eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
immer <strong>klein</strong>ere körperliche Unterschiede auf, anhand derer die Eltern sie auch<br />
von Anbeginn unterscheiden können: zum Beispiel ein bestimmtes Hautmal, eine andere<br />
Form der Ohrmuschel usw. Außerdem haben eineiige <strong>Zwillinge</strong> immer auch unterschiedliche<br />
Fingerabdrücke. Diese sind zwar in ihrem Grundmuster oft sehr ähnlich,<br />
jedoch unterscheiden sich die jeweiligen Anfänge, Enden, Unterbrechungen, Gabelungen<br />
und anderen „Störungen“ im Verlauf der einzelnen Fingerlinien, die für die Eindeutigkeit<br />
des Fingerabdrucks (und damit auch für kriminalistische Untersuchungen)<br />
letztlich entscheidend sind.<br />
Bei manchen Zwillingspaaren kann man ein weiteres Phänomen beobachten: die<br />
Spiegelbildlichkeit. Nicht alle eineiigen <strong>Zwillinge</strong> stellen eine Eins-zu-eins-Abbildung<br />
ihres Geschwisters dar; bei manchen <strong>Zwillinge</strong>n scheint vielmehr eine spiegelbildliche<br />
Abbildung vorzuliegen: Haarwirbel verlaufen in entgegengesetzte Richtung, ein Zwilling<br />
ist Rechts- und einer Linkshänder, Fehlstellungen im Gebiss sind spiegelbildlich<br />
angeordnet, eingewachsene Fußnägel sind bei einem Zwilling rechts, bei dem anderen<br />
links zu finden usw. Man geht davon aus, dass diese Spiegelbildlichkeit vor allem bei<br />
denjenigen <strong>Zwillinge</strong>n vorzufinden ist, die sich erst nach dem siebten Schwangerschaftstag<br />
geteilt haben (monoamniale <strong>Zwillinge</strong>). Demgegenüber soll eine frühe Teilung der<br />
befruchteten Eizelle vorwiegend zu identischen Abbildungen führen. Die Spiegelbildlichkeit<br />
beschränkt sich allerdings immer nur auf äußerliche Merkmale und führt nicht<br />
etwa dazu, dass auch die inneren Organe seitenverkehrt angeordnet wären. Das gibt es<br />
zwar auch (sog. situs inversus), kommt jedoch bei <strong>Zwillinge</strong>n nicht häufiger vor als bei<br />
Einlingen.<br />
In diesem Zusammenhang ist noch interessant, dass <strong>Zwillinge</strong> allgemein mit einer<br />
höheren Wahrscheinlichkeit Linkshänder werden, nämlich ungefähr jeder fünfte Zwilling,<br />
während die Linkshänder-Wahrscheinlichkeit bei Einlingen unter 10% liegt. Dieses<br />
Phänomen hat in der Vergangenheit die Theorie hervorgebracht, dass Linkshändigkeit<br />
überhaupt nur durch Zwillingsschwangerschaften entstehen könne, so dass alle Linkshänder-Einlinge<br />
der überlebende Teil einer ursprünglich angelegten Zwillingsschwangerschaft<br />
wären. Eine wissenschaftliche Bestätigung dieser Annahme hat es aber nicht<br />
gegeben.<br />
Die Zwillingsteilung ist also ein facettenreicher Vorgang, dessen Ergebnis nicht so<br />
exakt vorherzubestimmen ist, wie es vordergründig den Anschein hat. Sie ist zugleich<br />
ein sehr komplexer Vorgang, bei dem auch Störungen auftreten können, die zu krankhaften<br />
Veränderungen bei einem oder beiden <strong>Zwillinge</strong>n führen. Hierzu gehören z.B. der<br />
sog. Frosch- oder Krötenkopf (Anenzephalie), bestimmte Nierenfunktionsstörungen<br />
(Potter-Syndrom) und einige weitere Chromosomenanomalien. Solche Fehlbildungen<br />
können weder vorbeugend verhindert noch im Allgemeinen ärztlich geheilt werden,<br />
weshalb wir sie hier auch nur kurz erwähnen.<br />
Eine Kuriosität solcher Chromosomenanomalien sind verschiedengeschlechtliche<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong>, die man an sich nicht für möglich halten würde. Hier ist es ausgerechnet<br />
das Geschlechtschromosom, welches bei der Zwillingsteilung nicht vollständig<br />
übertragen wird. Um die Entstehung dieses Sonderfalls zu verstehen, muss man wissen,<br />
dass das Geschlecht eines Kindes durch die Kombination der elterlichen Geschlechtschromosome<br />
bestimmt wird: Die Mutter steuert immer ein X-Chromosom bei, der Vater<br />
ein X- oder ein Y-Chromosom. Eine XX-Kombination ergibt ein weibliches Kind, die<br />
XY-Kombination ein männliches. Verschiedengeschlechtliche eineiige <strong>Zwillinge</strong> sind<br />
nur möglich, wenn ursprünglich eine XY-Kombination (männlich) angelegt war und die<br />
Zwillingsteilung nicht vollständig funktioniert. Bei der Zwillingsteilung behält dann der<br />
eine Zwilling die ursprüngliche XY-Kombination, während der zweite Zwilling nur das<br />
28b
29a<br />
X-Chromosom aus der mütterlichen Erbanlage übertragen erhält, jedoch nicht das<br />
väterliche (Y-) Geschlechtschromosom. Der zweite Zwilling verfügt dann bei den<br />
geschlechtlichen Erbinformationen nur über einen reduzierten Chromosomensatz (sog.<br />
„Karotyp X0“ bzw. „Monosomie X“). Das eine vorhandene X-Chromosom ist in der<br />
Lage, die Funktionen des fehlenden zweiten Geschlechtschromosoms zu übernehmen,<br />
so dass der zweite Zwilling quasi wie bei einer XX-Kombination mit einem weiblichen<br />
Erscheinungsbild zur Welt kommt. Allerdings leidet diese Tochter – wegen des<br />
in Wahrheit fehlenden zweiten Chromosoms – unter dem sog. Ullrich-Turner-<br />
Syndrom, welches sich in einer Störung der weiteren geschlechtsorganischen Entwicklung,<br />
in Kleinwuchs und in möglichen Herzfehlern äußern kann, ansonsten aber eine<br />
normale Entwicklung ermöglicht und oft erst während der Pubertät erkannt wird. Verschiedengeschlechtliche<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong> sind jedoch extrem selten und bisher weltweit<br />
nur in ca. 20 Fällen nachgewiesen worden. Bekannt wurde das Ullrich-Turner-<br />
Syndrom auch nicht durch eineiige <strong>Zwillinge</strong>, sondern durch Einlinge, bei denen ein<br />
entsprechend unvollständiger Chromosomensatz durch eine Fehlentwicklung bei der<br />
Entstehung oder der Vereinigung von Samen und Eizelle entstehen kann.<br />
Insgesamt treten Chromosomenanomalien bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n doppelt bis<br />
dreimal so häufig auf wie bei Einlingen. Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> haben demgegenüber<br />
keine erhöhte Wahrscheinlichkeit krankhafter Chromosomenanomalien.<br />
g) Fehlgeburt, Totgeburt<br />
Zu den Wahrheiten einer Schwangerschaft gehören auch schicksalhafte Entwicklungen,<br />
die dazu führen, dass einige Kinder nicht lebend geboren werden können oder<br />
kurz nach der Geburt versterben. Aufgrund der aufgezeigten Risikofaktoren und infolge<br />
der damit einhergehenden Frühgeburtlichkeit liegt die Sterblichkeitsrate von <strong>Zwillinge</strong>n<br />
in der Perinatalphase (d.h. ab der 28. SSW bis zum 7. Tag nach der Entbindung)<br />
fünf bis achtmal höher als bei Einlingen. Sie ist damit aber glücklicherweise immer<br />
noch verhältnismäßig niedrig. Während vor 1975 noch bis zu 20% aller Mehrlinge in<br />
der Perinatalphase verstarben, konnte die Sterberate durch medizinische Fortschritte<br />
bis auf derzeit etwa 1% reduziert werden. Betrachtet man die höhergradigen Mehrlinge<br />
isoliert, liegt die Sterberate höher, wobei die durch künstliche Befruchtung erzeugten<br />
Kinder mehr als doppelt so häufig versterben wie natürlich gezeugte Kinder – vermutlich<br />
aus Gründen, deren Ursachen in der Befruchtungstechnik selbst liegen.<br />
Denjenigen Eltern, die davon betroffen sind, helfen statistische Betrachtungen jedoch<br />
wenig. Auch die wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis, dass die allermeisten<br />
Fehlgeburten nicht etwa von den Eltern verschuldet sind (z.B. durch Alkoholmissbrauch),<br />
sondern eine natürliche Körperreaktion auf eine erkannte Fehlentwicklung<br />
darstellen und oftmals dem biologischen Zweck dienen, Mutter und Kind vor weiterem<br />
Schaden zu bewahren, spendet keinen wirklichen Trost. Denn die meisten Eltern hatten<br />
zu ihren ungeborenen Kindern schon eine sehr intensive Beziehung und starke emotionale<br />
Bindung aufgebaut und empfinden jetzt tiefe Trauer.<br />
Der Tod trifft uns fast immer unvorbereitet. Es scheint so unfair, dass dieses<br />
unser Kind nie den Himmel und die Sonne sehen wird und das Erwachen der<br />
Natur im Frühling, dass wir es nicht in den Armen wiegen dürfen, dass wir<br />
nicht erleben dürfen, wie es heranwächst und seine Erfahrungen im Leben<br />
macht. Ein solcher Tod passt nicht in die Ordnung der Welt hinein: wir erwarten,<br />
dass Kinder ihre Eltern überleben. Mit unseren Kindern sterben Träume,<br />
Hoffnungen und Vorstellungen für unser weiteres Leben. Es stirbt ein Teil von<br />
uns. (Hannah Lothrop)<br />
Auf keinen Fall besteht Anlass, sich anderen gegenüber für Ihre Fehlgeburt zu<br />
schämen. Um das Geschehene für sich zu verarbeiten, ist ein Gesprächspartner von großer<br />
Bedeutung, dem man sich vertrauensvoll mitteilen kann. Das können die eigenen<br />
Eltern, der Partner, eine gute Freundin oder ein guter Freund, ein Pfarrer, ein Psychologe<br />
oder Mitglieder einer der im Anhang aufgeführten Selbsthilfegruppen sein.<br />
Für manche Eltern kann das unglückliche Ende der Schwangerschaft sogar den<br />
endgültigen Verlust einer ganzen Lebensperspektive bedeuten. Wer den Aufwand und<br />
die Anstrengungen der künstlichen Reproduktionstechniken auf sich genommen hatte,<br />
verliert mit der Fehlgeburt vielleicht die letzte Hoffnung auf eine Elternschaft. Die<br />
Trauer bezieht sich dann nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die freudigen Erwartungen<br />
an einen familiären Lebensentwurf, der durch die vermeintlich erfolgreiche<br />
Fruchtbarkeitsbehandlung nach langem Bangen und Hoffen endlich in greifbare Nähe<br />
gerückt war und nach der Fehlgeburt nun ferner denn je, wenn nicht unerreichbar erscheint.<br />
Die psychischen Auswirkungen solcher Misserfolge der Reproduktionsmedizin<br />
rücken erst allmählich in das Blickfeld von Psychologen und Beratungsstellen. Die<br />
Betreuung solcher Trauererlebnisse erfordert eine psychosoziale Professionalität, die die<br />
reproduktionsmedizinischen Institute selbst kaum leisten können. Wenn Sie eine solche<br />
Enttäuschung für sich zusätzlich verarbeiten müssen, wenden Sie sich daher am besten<br />
an den psychosozialen Dienst der Klinik, an eine Schwangerschaftsberatungsstelle oder<br />
29b
30a<br />
an eine andere Einrichtung, zu der Sie Vertrauen haben. Da das Thema erst vereinzelt<br />
aufbereitet und die verfügbaren Informationen nur verstreut zu erlangen sind, haben<br />
einige Betroffene sich zu Selbsthilfegruppen zusammengefunden; andere haben ihre<br />
persönlichen Erfahrungsberichte in Diskussionsforen des Internet veröffentlicht. Das<br />
Buch, das wir im Anhang als Literaturempfehlung aufgenommen haben, befragt betroffene<br />
Frauen und betont die psychosoziale Dimension der Unfruchtbarkeitsproblematik<br />
gegenüber einem einseitig medizinischen Behandlungsansatz.<br />
Mit dem Versterben eines Ungeborenen oder eines Neugeborenen können weiterhin<br />
einige Behördengänge und Formalitäten verbunden sein, über die man zumindest<br />
folgendes wissen sollte:<br />
- Als „Lebendgeburt“ bezeichnet man Kinder, die nach der Entbindung<br />
mindestens eines der drei maßgeblichen Lebenszeichen aufweisen: Herzschlag,<br />
natürliche Lungenatmung, Pulsieren der Nabelschnur. Auch wenn<br />
das Kind bald nach der Geburt verstirbt, gilt es doch rechtlich als ein e-<br />
xistierender Mensch. Das Kind muss daher beim Standesamt namentlich<br />
angemeldet werden, wo es in die Personenstandsbücher eingetragen wird<br />
und eine Geburts- und Sterbeurkunde ausgestellt werden. Manche Eltern<br />
betrachten die damit verbundenen Formalitäten als unangenehm; für viele<br />
Eltern ist es jedoch wichtig, dass ihr Kind auf diese Weise auch formell<br />
als ein vollwertiger Mensch anerkannt wird. Das Kind kann entweder im<br />
Familiengrab, im Reihengrab oder auf einem anonymen Grabfeld bestattet<br />
werden; man kann es auch der Klinik zu Forschungszwecken überlassen.<br />
Es entsteht der volle Anspruch auf Mutterschaftsgeld sowie für jeden<br />
angefangenen Lebensmonat des Kindes Anspruch auf Elterngeld. Wenn<br />
beide Kinder versterben, endet die bereits angetretene Elternzeit spätestens<br />
drei Wochen nach dem Tod des letzten Kindes. Anspruch auf Kindergeld<br />
besteht für jeden Kalendermonat, in dem das Kind an wenigstens<br />
einem Tag gelebt hat.<br />
- Als „totgeboren“ oder „in der Geburt verstorben“ bezeichnet man Kinder,<br />
die nach der Entbindung über keines der drei genannten Lebenszeichen<br />
verfügen, jedoch mit einem Gewicht von über 500 Gramm geboren werden.<br />
Totgeburten müssen ebenfalls dem Standesamt gemeldet werden und<br />
werden dort als solche eingetragen. Die Eltern können dem Kind einen<br />
Namen geben, der ebenfalls in die Personenstandsbücher eingetragen<br />
wird; eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. Über die Bestattung<br />
von Totgeborenen bestehen in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche<br />
Vorschriften 1 . Wird bei einer Mehrlingsschwangerschaft ein Kind lebend<br />
und eines tot geboren, gilt dies als Mehrlingsgeburt im Sinne der verlängerten<br />
Mutterschutzfristen.<br />
- Als „Fehlgeburt“ bezeichnet man Kinder, die über keines der drei genannten<br />
Lebenszeichen verfügen und mit einem Gewicht unter 500 Gramm zur<br />
Welt kommen. Fehlgeburten sind gegenüber dem Standesamt nicht meldepflichtig<br />
und können auch nicht in die Personenstandsbücher eingetragen<br />
werden. In einigen Bundesländern ist inzwischen das Recht verankert, auch<br />
diese Kinder bestatten zu lassen, was die Trauerarbeit erleichtern kann. Wo<br />
das Bestattungsrecht nicht allgemein zugestanden ist, kann man in der Regel<br />
eine Sondererlaubnis beantragen. Eine Pflicht zur Bestattung besteht<br />
keinem Bundesland.<br />
8. Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung<br />
Nahezu alle Geburtskliniken und auch andere Organisationen sowie freie Hebammen<br />
bieten Kurse unter dem Titel „Schwangerschaftsgymnastik“ und/oder „Geburtsvorbereitung“<br />
an. Grundsätzlich sollten bei der Schwangerschaftsgymnastik gymnastische<br />
Übungen im Vordergrund stehen, während Geburtsvorbereitungskurse den Geburtsablauf<br />
erklären, Atem- und Entspannungstechniken einüben und mental auf das Ereignis<br />
vorbereiten. Geburtsvorbereitungskurse in diesem Sinne sind gleichermaßen für werdende<br />
Väter geeignet und werden deshalb häufig auch als Partnerkurse angeboten.<br />
Die Kursinhalte der einzelnen Anbieter weichen jedoch stark voneinander ab. Tatsächlich<br />
orientieren sich die Kursinhalte nicht so sehr an der formalen Kursbezeichnung<br />
1 Die allgemeine Tendenz geht dahin, eine Bestattungspflicht ab 500 Gramm Geburtsgewicht<br />
vorzuschreiben; in einigen Bundesländern liegt die Grenze aber noch – wie früher üblich – bei<br />
1000 Gramm (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern). In den meisten Bundesländern<br />
ist auf Wunsch der Eltern auch unterhalb der festgelegten Gewichtsgrenzen eine Bestattung<br />
zulässig; in Bremen und Sachsen wird allerdings eine bestimmte Schwangerschaftsdauer<br />
(mindestens 12 Wochen) verlangt. Ausnahmegenehmigungen können in fast allen Bundesländern<br />
beantragt werden. In Hessen sind alle Fehl- oder Totgeburten nach Ablauf des sechsten Schwangerschaftsmonats<br />
bestattungspflichtig. In Niedersachsen beginnt die Bestattungspflicht bei 35 cm<br />
Körperlänge. Das ist ein Relikt aus der Zeit vor 1979, wo die Körperlänge von 35 cm auch personenstandsrechtlich<br />
als Fehlgeburtsgrenze galt.<br />
30b
31a<br />
als vielmehr an der Schwerpunktsetzung des jeweiligen Anbieters. So werden in „Geburtsvorbereitungs“-Kursen<br />
oft auch gymnastische Übungen angeleitet, während in<br />
„Schwangerschaftsgymnastik“-Kursen ebenso über den Geburtsablauf gesprochen und<br />
Atemtechniken eingeübt werden. Es kann sogar sein, dass der Geburtsvorbereitungskurs<br />
des einen Anbieters einen größeren Schwerpunkt auf gymnastische Übungen legt<br />
als der Schwangerschaftsgymnastikkurs des anderen Anbieters. Das Verwirrspiel der<br />
unterschiedlichen Kursbezeichnungen hat nämlich vor allem abrechnungstechnische<br />
Gründe gegenüber den Krankenkassen.<br />
Als Schwangere tut man deshalb gut daran, sich vor der Anmeldung zu einem solchen<br />
Kurs genau über dessen Inhalt und Schwerpunkt zu informieren. Liegt der<br />
Schwerpunkt des Kurses auf gymnastischen Übungen, so sollten Sie zuvor mit Ihrem<br />
Frauenarzt abklären, ob die Teilnahme für Sie sinnvoll ist. Der Frauenarzt muss den<br />
Zustand Ihres Muttermundes und das Risiko vorzeitiger Wehen beurteilen und wird<br />
Ihnen dann möglicherweise von der Teilnahme abraten. Kommen Ihnen während der<br />
Kursstunden Zweifel, ob einzelne Übungen zu anstrengend sein könnten, so verzichten<br />
Sie besser auf diese Übungen und gönnen sich eine Pause. Insbesondere Pressübungen<br />
können bei Zwillingsschwangeren vorzeitige Wehen auslösen.<br />
Die Teilnahme an einem wirklichen Geburtsvorbereitungskurs in dem eingangs<br />
bezeichneten Sinne ist aber in jedem Falle zu empfehlen und medizinisch völlig unbedenklich.<br />
Melden Sie sich rechtzeitig an und achten Sie auf einen nicht zu späten<br />
Kursbeginn. Oft fragen die Kursveranstalter nach dem errechneten Geburtstermin und<br />
stellen die Gruppen so zusammen, dass der Kurs kurz vor diesem Zeitpunkt endet.<br />
Mehrlingsschwangere verpassen dann häufig einen Teil des Kurses, weil deren Kinder<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich eher als zum errechneten Geburtstermin zur<br />
Welt kommen. Bemühen Sie sich deshalb um einen Kurs, der etwa einen Monat eher<br />
stattfindet als der für Ihren formal errechneten Geburtstermin an sich vorgesehene<br />
Kurs. Hebammen werden diesen Wunsch akzeptieren und vielfach sogar von sich aus<br />
den früheren Termin vorschlagen. Wenn allerdings die Kurse eines größeren Veranstalters<br />
nicht von der Hebamme selbst, sondern von einem Verwaltungsangestellten<br />
zusammengestellt werden, kann es passieren, dass er Ihren Wunsch zurückweist, weil<br />
er Anweisung hat, streng nach den errechneten Geburtsterminen vorzugehen. Um sich<br />
in solchen Fällen müßige Diskussionen zu ersparen, kann es ausnahmsweise gerechtfertigt<br />
sein, von vornherein einen falschen (um einen Monat vorverlegten) Geburtstermin<br />
anzugeben.<br />
9. Besorgungen während der Schwangerschaft<br />
a) Anschaffungen<br />
Die bevorstehende Geburt gibt Anlass zu einigen Anschaffungen. Selbst diejenigen<br />
Eltern, die schon ältere Kinder haben, müssen einiges hinzukaufen. Da die einzelnen<br />
Gegenstände zum Teil recht teuer sind, kann es sich empfehlen, das ein oder andere<br />
gebraucht zu kaufen. Hierzu werden von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und anderen<br />
Veranstaltern überall Baby-Gebrauchtbörsen organisiert, auf denen die Eltern älterer<br />
Kinder ihre nicht mehr benötigten Gegenstände feilbieten. Speziellen Zwillingsbedarf<br />
(insbesondere Zwillingskinderwagen) erhält man auf gesonderten Zwillingsflohmärkten,<br />
die jedoch seltener und nur in größeren Orten veranstaltet werden. Sie werden in der<br />
Regel von Zwillingsinitiativen organisiert, wo man auch die jeweiligen Termine erfragen<br />
kann. Ansonsten empfiehlt sich der Blick in die Kleinanzeigen der Tageszeitung<br />
bzw. in die örtlichen Anzeigenblätter, wo Zwillingskinderwagen ebenfalls angeboten<br />
werden. Sogar über die Internet-Auktionshäuser lassen sich Zwillingswagen ersteigern.<br />
Hinsichtlich des Zeitpunktes der Anschaffung sollten Sie berücksichtigen, dass<br />
während der Frühschwangerschaft noch keine letztendliche Gewissheit besteht, ob tatsächlich<br />
beide <strong>Zwillinge</strong> ausgetragen werden und nicht einer von beiden nachträglich<br />
noch verschwindet. Auch eine Fehlgeburt mit dem Verlust beider Kinder ist in dieser<br />
Phase noch möglich. Deshalb wird allgemein angeraten, im ersten Schwangerschaftsdrittel<br />
noch keine übertriebenen Geldausgaben zu tätigen. Wenn es dann später an konkrete<br />
Bestellungen geht, sollte man mit den jeweiligen Händlern (Möbelhäuser, Baby-<br />
Ausstatter) vereinbaren, dass die Kaufgegenstände erst nach der Geburt und nur in der<br />
Anzahl abgenommen werden müssen, wie die Kinder tatsächlich lebend zur Welt kommen.<br />
Die seriösen Häuser bieten solche Konditionen von sich aus an, so dass man im<br />
tragischen Falle einer Fehl- oder Totgeburt nicht auch noch auf seinen Anschaffungen<br />
sitzen bleibt.<br />
Zu lange warten sollte man mit den Anschaffungen allerdings auch nicht, da man<br />
damit rechnen muss, dass die Kinder erheblich früher als zum errechneten Geburtstermin<br />
zur Welt kommen. Vielleicht geht der Geburt sogar noch ein stationärer Klinikaufenthalt<br />
voraus, der die Einkaufsmöglichkeiten weiter einschränkt. Und schließlich muss man bei<br />
manchen Gegenständen (z.B. einigen Zwillingskinderwagen) mit erheblichen Lieferzeiten<br />
rechnen, die zwei Monate oder sogar länger betragen können.<br />
31b
32a<br />
Was im Einzelnen an Erstausstattung für Babys erforderlich ist, erfahren Sie in<br />
den gängigen Geburtsvorbereitungsbüchern und Schwangerschaftsbroschüren. Wir<br />
beschränken uns daher mit unseren Empfehlungen auf einige zwillingstypische Aspekte.<br />
lässt sich die Behaglichkeit einer Wiege auch im großen Kinderbett verwirklichen: Bettumrandungen<br />
(„Nestchen“) und ein Himmel aus gespannten Tüchern helfen dabei. Bei<br />
der Herrichtung der Betten muss man allerdings darauf achten, dass die Kinder auch<br />
nach einer eventuellen Drehung nicht durch Kissen usw. in ihrer Atmung behindert werden<br />
können.<br />
32b<br />
aa) Stillkissen<br />
Eine nützliche Anschaffung ist auf jeden Fall das Stillkissen. Das Stillkissen besitzt<br />
eine gebogene, fast bananenartige Form und ist mit Kunststoffkugeln oder Naturmaterialien<br />
gefüllt. Die Füllung ist so beschaffen, dass sich das Kissen leicht verformen<br />
lässt, unter Belastung jedoch nicht einsackt. Aufgrund dieser Eigenschaften<br />
kann man das Kissen auf dem Schoß herrichten und das Kind beim Stillen darauf ablegen.<br />
Will man <strong>Zwillinge</strong> rechts und links gleichzeitig stillen, ist ein Stillkissen unerlässlich.<br />
Aber auch schon vor der Geburt kann das Stillkissen gute Dienste leisten.<br />
Viele Zwillingsschwangere schätzen das Stillkissen als Rücken- oder Seitenstütze,<br />
wenn der Bauchumfang im letzten Schwangerschaftsdrittel eine zunehmende körperliche<br />
Belastung darstellt.<br />
bb) Kinderbetten<br />
Kinderbetten werden Sie auf Dauer für jedes Kind gesondert benötigen. In der<br />
Anfangsphase ist es zwar möglich, beide Kinder in ein Bett nebeneinander zu legen<br />
oder je eines an das Kopf- und an das Fußende. Die Kinder stören sich jedoch nur<br />
solange nicht, wie sie sich nicht drehen und ihre Position nicht verlassen können. Sobald<br />
sie dazu in der Lage sind – zumeist nach spätestens sechs Monaten – können sich<br />
die Kinder im Schlaf gegenseitig behindern und wecken, so dass spätestens dann je ein<br />
eigenes Bett erforderlich wird. Wenn Sie allerdings in räumlich beengten Verhältnissen<br />
wohnen und bald nach der Geburt einen Umzug planen, können Sie einstweilen<br />
auf ein zweites Kinderbett verzichten.<br />
Die meisten Kinderbetten der üblichen Größe 70 x 140 cm lassen sich später in<br />
ein sog. „Jugendbett“ bzw. „Juniorbett“ umbauen und damit bis zum Grundschulalter<br />
nutzen. Einen Stubenwagen oder eine Wiege braucht man dagegen nicht; aus ihrer<br />
<strong>klein</strong>en Liegefläche sind die Kinder schnell herausgewachsen. Mit etwas Kreativität<br />
cc) Zwillingskinderwagen<br />
Ein Kinderwagen wird erforderlich, sobald Sie zu Fuß eine Wegstrecke mit Ihren<br />
Kindern zurücklegen wollen. Praktisch kommt daher fast keine Familie um einen Kinderwagen<br />
herum. Bevor Sie sich konkrete Gedanken über die Anschaffung machen,<br />
sollten Sie sich vergegenwärtigen, dass Kinder in der Regel nicht länger als acht bis<br />
zehn, allerhöchstens zwölf Monate liegend in einem Kinderwagen verbringen. In der<br />
Folgezeit wollen sie sitzend durch die Umgebung gefahren werden, entweder im so<br />
genannten „Sportwagen“ bzw. „Karre“ (stabiles Modell mit fester Sitzfläche) oder im<br />
„Buggy“ (leichteres Modell mit geringerem Packmaß). Viele Kinderwagen sind so ausgestattet,<br />
dass sie von der Liegeposition in eine Sitzposition (Sportwagen) umgebaut<br />
werden können.<br />
Für <strong>Zwillinge</strong> sind verschiedene Modelle im Angebot, die einerseits technisch nicht<br />
so weit entwickelt, andererseits durchweg teurer sind als vergleichbare Modelle für<br />
Einlinge. Die Hersteller haben verschiedene Grundtypen und -konzepte entwickelt, von<br />
denen man das Passende für sich zunächst herausfinden sollte, bevor man die konkrete<br />
Prüfung der einzelnen Angebote angeht.<br />
Zunächst scheiden sich die Geister an der Frage, ob man <strong>Zwillinge</strong> besser nebeneinander<br />
oder hintereinander durch die Welt schiebt. Manche Modelle ermöglichen es<br />
sogar, die Kinder wahlweise neben- oder hintereinander zu positionieren (z.B. Inglesina);<br />
bei den meisten Kinderwagen ist die Anordnung jedoch fest vorgegeben. Nebeneinander<br />
hat bei vielen Modellen den Vorteil, dass beide Kinder wahlweise zunächst mit<br />
Blick zum schiebenden Elternteil und später in Frontrichtung ausgerichtet werden können,<br />
so dass sie ihren Entwicklungsphasen entsprechend jeweils dasjenige wahrnehmen,<br />
was ihrem Interesse entspricht. Dagegen bedeutet Hintereinander, dass die Kinder sich<br />
entweder gegenseitig ansehen oder aber wenigstens eines der Kinder auf die Rückwand<br />
des anderen Sitzes schaut. Manche Kinder lehnen sich dann zur Seite heraus, um mitzubekommen,<br />
was vorne passiert.
33a<br />
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist aber auch die persönliche Mobilität: Nebeneinander<br />
nimmt viel Platz in der Breite, Hintereinander braucht mehr Platz in der Länge.<br />
Informieren Sie sich über das Packmaß und prüfen Sie, ob der anvisierte Kinderwagen<br />
– sofern Sie über ein Auto verfügen – in Ihren Kofferraum passt. Wenn Sie dagegen<br />
z.B. als nicht berufstätige Mutter vorwiegend in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs<br />
sind, vermessen Sie den Einstiegsbereich des benutzten Verkehrsmittels und<br />
prüfen Sie daraufhin die Kinderwagen. Denken Sie auch an die Breite von Aufzugtüren<br />
zu den Bahnsteigen oder U-Bahnschächten, sowie an die Länge der Aufzüge, wenn<br />
Sie einen Wagen „hintereinander“ favorisieren. Dasselbe gilt für die Tore, Eingangstüren<br />
und Aufzüge, die Sie passieren müssen, um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu<br />
gelangen. Prüfen Sie außerdem die Maße des vorgesehenen Abstellplatzes und berücksichtigen<br />
Sie dabei, dass in Hausfluren und Gemeinschaftsräumen nicht immer alle<br />
Nachbarn und Vermieter mit dem von Ihnen ausgesuchten Abstellplatz einverstanden<br />
sind, so dass notfalls ein Ersatzplatz gefunden werden muss.<br />
Wenn ein Kinderwagen „nebeneinander“ in Betracht kommt, gibt es wiederum<br />
zwei Alternativen. Die klassische Variante verfügt über zwei getrennt aufgehängte<br />
Schalen, in denen jedes Kind für sich soviel Platz hat, wie Einlinge in ihren Einlingswagen.<br />
Der Vorteil dieser Wagen liegt vor allem darin, dass die Kinder in ihren festen<br />
Schalen komplett herausgehoben werden können, ohne dabei aufzuwachen. Früher<br />
erkannte man diese Wagen an ihrem Mittelgestänge mit je vorn und hinten einer gesonderten<br />
Achsaufhängung, insgesamt also sechs Rädergruppen (z.B. Peg-Pérego).<br />
Neuere Modelle kommen mit vierrädrigen Fahrgestellen aus (z.B. Inglesina). Die Wagen<br />
sind wegen ihrer getrennten Schalen entsprechend breit und passen oft nicht durch<br />
die normale Eingangstür (=80 cm).<br />
Demgegenüber erinnert eine andere, kompaktere Bauform eher an einen überbreiten<br />
Einzelkinderwagen (z.B. Emmaljunga, Urban-Jungle). Diese Kinderwagen sind<br />
schmaler und passen durch gewöhnliche Eingangstüren; auch sind sie insgesamt wendiger.<br />
Viele Wege lassen sich mit dem etwas schmaleren Wagen erheblich besser bewerkstelligen.<br />
Der Nachteil dieser Wagen liegt darin, dass die Kinder nicht in je einer<br />
eigenen Hartschale liegen, sondern in schmalen Tragetaschen, in denen sie weniger<br />
Platz haben und beim Herausheben leicht aufwachen. Außerdem ist es bei diesen Modellen<br />
manchmal nicht möglich, die Kinder wahlweise in beide Richtungen auszurichten.<br />
Diese Nachteile spielen aber nur im Liegealter eine Rolle. Spätestens ab dem<br />
Sitzalter kommt es auf beide Aspekte nicht mehr an, so dass jedenfalls von da an die<br />
schmaleren Wagen durchaus im Vorteil sind. Allerdings muss man sich bei diesen<br />
kompakten Modellen genau informieren, ob sie überhaupt umgebaut werden können<br />
und welche Zubehörteile man dafür ggf. noch benötigt, die im Kinderwagenpreis nicht<br />
enthalten sind.<br />
Wenn Sie Ihre Lebensgewohnheiten und Ihren Aktionsradius gedanklich mit den<br />
verschiedenen Bauarten durchgespielt haben, wird Ihnen das ein oder andere Konzept<br />
als am ehesten geeignet vorkommen. Erst dann sollten Sie daran gehen, sich für ein<br />
bestimmtes Modell zu entscheiden. Neben der allgemeinen Verarbeitung und dem angebotenen<br />
Zubehör (Regenplane, Sommer- und Wintersäcke) sollten Sie insbesondere auch<br />
die Qualität der Radaufhängung (Metall- oder Plastikausführung) und den Raddurchmesser<br />
prüfen: Ein großer Raddurchmesser gleicht Bodenunebenheiten wesentlich besser<br />
aus und verspricht dadurch einen erheblich besseren Fahrkomfort – für die Kinder<br />
wie auch für die schiebenden Eltern. Hochgewachsene Eltern sollten sich auch für die<br />
Höhe des Schiebebügels interessieren; bei manchen Modellen ist er sogar verstellbar.<br />
Und nicht zuletzt: Lassen Sie sich das Zusammenlegen und Aufbauen des Kinderwagens<br />
zeigen und probieren Sie es auch selbst einmal aus.<br />
Anderes Zubehör als das hier ausdrücklich genannte ist im Allgemeinen nicht erforderlich.<br />
Vor allem die zum Zudecken der Kinder angebotenen Daunenkissen und<br />
-bezüge gehören in die Kategorie der unnötigen Geldausgaben. Gewöhnliche Kopfkissen<br />
mit gewöhnlichen Kopfkissenbezügen, wie sie sich in jedem Haushalt finden, erledigen<br />
denselben Zweck. Lediglich Spannlaken und ggf. wasserdichte Unterlagen sollten Sie<br />
sich noch beschaffen, soweit sie für den Kinderwagen vorgesehen und nicht bereits im<br />
Zubehör enthalten sind. Sonnenschirme für den Kinderwagen sind nur bedingt praktikabel,<br />
weil die meisten Wege kurvig sind und die Sonnenschirme mit jeder neuen Fahrtrichtung<br />
immer wieder neu ausgerichtet werden müssen. Sie können allerdings eine<br />
Hilfe sein, wenn der Kinderwagen einmal für längere Zeit an einem Ort abgestellt wird.<br />
Am besten meidet man von vornherein die sommerliche Mittagshitze.<br />
Wenn die Auswahl an Zwillingskinderwagen in den Geschäften Ihrer Umgebung<br />
begrenzt ist und Sie ein Freund des elektronischen Versandhandels sind, können Sie sich<br />
bei den folgenden Spezialanbietern einmal umsehen:<br />
- „Zwillingsburg“ Annette Wulf,<br />
http://www.zwillingsburg.de.<br />
- „Mehrlingsshop“ Birgit Leeck,<br />
http://mehrlinge.com/Shop/Tipps/shopmichel_online/index.html<br />
33b
34a<br />
- „Petzy’s Zwillingsshop“ Marion von Gratkowski,<br />
http://www.zwillings-shop.de/twinshop2003<br />
- „Rasselfisch“ Gabriele Kiefer und Michaela Wieland GbR,<br />
http://www.rasselfisch.de<br />
Auch hier bekommen Sie jedoch nicht alle Modelle, da einige renommierte Hersteller<br />
es ablehnen, mit den Versandfirmen zusammenzuarbeiten. Prüfen Sie die Versandfirmen<br />
kritisch auf ihre Geschäftsbedingungen und lassen Sie sich nicht unbedacht<br />
auf überhöhte Anzahlungsbeträge bei der Reservierung ein. Dieser Tipp gilt<br />
natürlich gleichermaßen für die Vorbestellung im Fachhandel vor Ort.<br />
übrigens noch nichts erzählt; sie tauchte erstmals in den Geschäftsbedingungen auf der<br />
Rückseite der später zugesandten Auftragsbestätigung auf – neben anderen Fußangeln,<br />
etwa hinsichtlich der Garantie. Da wir mit diesen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden<br />
waren, die Inhaberin aber darauf bestand, kam die Bestellung letztlich nicht<br />
zustande. Trotzdem empfehlen wir einen Besuch des Geschäftes 1 , schon wegen der<br />
fachkundigen Beratung. Und wer will schon ausschließen, dass sich die Geschäftsbedingungen<br />
auf entsprechenden Druck der Verbraucher hin im Laufe der Zeit noch einmal<br />
verbessern<br />
34b<br />
ee) Kleidung und Spielsachen<br />
dd) Drillings- und Vierlingskinderwagen<br />
Einen Drillings- oder Vierlingswagen haben nur die allerwenigsten Babyausstatter<br />
in ihrer Ausstellung. Man ist deshalb ganz überwiegend auf Katalogbestellung<br />
angewiesen, was die Prüfung der oben genannten Auswahlkriterien erschwert. Qualität<br />
und Verarbeitung von Mehrlingswagen sind zum Teil erheblich schlechter als bei<br />
Einlingswagen, und das gelieferte Modell entspricht nicht immer den Vorstellungen,<br />
die man sich anhand der Katalogangaben gemacht hatte.<br />
Eine Drillingsmutter aus Hochheim war mit ihrem Katalog-Kinderwagen so unzufrieden,<br />
dass sie beschloss, ihre eigenen Vorstellungen umzusetzen und gemeinsam<br />
mit einem industriellen Hersteller einen neuen Mehrlingswagen zu entwickeln, der bis<br />
hin zum Vierlingswagen erweitert werden kann (jeweils zwei hintereinander und zwei<br />
nebeneinander). Für den Vertrieb ihres selbstentwickelten Wagens hat sie einen Verkaufsladen<br />
eingerichtet, in dem auch Kinderwagen anderer Hersteller zu Vergleichszwecken<br />
bereitstehen. Der Wagen aus ihrer eigenen Herstellung macht einen qualitativ<br />
hochwertigen und insgesamt gut durchdachten Eindruck, kostet jedoch einschließlich<br />
des üblichen Zubehörs – je nach Ausstattung – einen stolzen Preis von ca. 1.300,-<br />
EUR und mehr in der Zwillingsversion sowie nicht unter 1.500,- EUR in der Drillingsversion.<br />
Eine Galerie aus Geburtsanzeigen an den Wänden des Geschäftes zeugt<br />
von zufriedener Kundschaft.<br />
Wer hier bestellt, sollte allerdings auch wissen, dass er mit der verlangten Anzahlung<br />
von 60% des Kaufpreises einen gehörigen Teil am Insolvenzrisiko des Geschäftes<br />
trägt. Beim Verkaufsgespräch hatte man uns von dieser obligatorischen Anzahlung<br />
Je mehr Verwandtschaft Sie haben und je größer Ihr Freundeskreis ist, desto eher<br />
sollten Sie sich mit der Anschaffung von Kleidung und Spielsachen zurückhalten. Denn<br />
dies sind die beliebtesten Geburts- und Taufgeschenke. Meist empfiehlt es sich, vor der<br />
Geburt nur eine knapp bemessene Erstausstattung anzuschaffen, um erst nach dem Geschenkesegen<br />
die dann ggf. noch fehlenden Teile zu komplettieren.<br />
Auch hier stellt sich dann wieder die Frage, neu oder gebraucht zu kaufen. Ersteres<br />
erfordert ein gewisses finanzielles Polster, weil die meisten Kleidungsstücke wegen des<br />
rasanten Wachstums der Kinder einerseits und der wechselnden Jahreszeiten andererseits<br />
immer nur für relativ kurze Zeit im Gebrauch sind. Oft ergibt sich eine Gelegenheit,<br />
Babykleidung von anderen Eltern aus der Bekanntschaft auszuleihen. Dies kann<br />
eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten.<br />
Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kleidung stellt sich dann weiter die<br />
Frage, ob man <strong>Zwillinge</strong> gleich oder verschieden anziehen soll. Gleich gekleidete <strong>Zwillinge</strong><br />
ziehen eine noch höhere Aufmerksamkeit auf sich, weil jeder Passant Ihre Kinder<br />
nun auch außerhalb des Kinderwagens sofort als <strong>Zwillinge</strong> identifiziert. Ob Ihnen diese<br />
Publicity lieb ist, müssen Sie selbst entscheiden.<br />
Was bei Erwachsenen Entzücken hervorruft, kann für die Kinder allerdings zu<br />
Problemen bei der Identitätsfindung führen. Gleich gekleidete <strong>Zwillinge</strong> sehen in der<br />
1 Anschrift: Storchennest Ute Haßlinger, Am Gänsborn 13, 65239 Hochheim; Besichtigung und<br />
Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 06146-61699; Fax: 06146-4201; Internet:<br />
www.mehrlinge.de.
35a<br />
Person des anderen Zwillings ständig ihr eigenes Spiegelbild vor sich, von dem sie<br />
sich nur schwer abgrenzen können. So kann es kommen, dass ein Zwilling sich selbst<br />
als „Sonja“ und ihr Geschwister als „die andere Sonja“ bezeichnet. Zumindest hat das<br />
gleiche Outfit den Nachteil, dass selbst enge Freunde und Bekannte die Kinder noch<br />
schwerer auseinanderhalten können. Das hindert die individuelle Ansprache des einzelnen<br />
Kindes und fördert die undifferenzierte Behandlung der <strong>Zwillinge</strong> als eine<br />
homogene Einheit. Gerade diese fehlende Individualisierung der Zwillingskinder wird<br />
jedoch unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten als eine der Hauptschwierigkeiten<br />
bei der späteren Bewältigung eines eigenständigen Lebens angesehen. Pädagogen<br />
raten daher nicht nur zu verschiedener Kleidung und Frisur, sondern auch zu<br />
verschiedenen Aktivitäten, später beispielsweise zu unterschiedlichen Hobbys oder<br />
getrennten Ausflügen.<br />
Auch beim Spielzeug stellt sich die Frage, ob alles doppelt angeschafft werden<br />
soll. Das ist allerdings in der Anfangszeit weniger eine Frage der Individualisierung<br />
der Kinder als vielmehr ein Aspekt der Erziehung zum Teilen und zum miteinander<br />
spielen. Notfalls kann man von den besonders beliebten Spielsachen, um die sich die<br />
Kinder am meisten streiten, ein zweites Exemplar nachkaufen. Überdies steht fest:<br />
Wer jedes Teil nur einfach anschafft, kann den Kindern innerhalb eines vorgegebenen<br />
Ausgabenbudgets eine größere Vielfalt an unterschiedlichem Spielzeug ermöglichen.<br />
Großeltern, die gerne paarweise schenken möchten, kann man am leichtesten davon<br />
abbringen, indem man ihnen vorschlägt, gegenseitig ergänzende Spielsachen zu besorgen<br />
(anfangs z.B. unterschiedliche Greiflinge oder Plüschtiere, später ein Polizei- und<br />
ein Feuerwehrauto, verschiedene Bauernhoftiere, Musikinstrumente usw.). Im weiteren<br />
Verlauf der Kindheit kann man dann mit unterschiedlichen Spielsachen auf die<br />
individuellen Neigungen und Interessen der einzelnen Kinder eingehen und diese gezielt<br />
fördern.<br />
Etwas anderes gilt natürlich für die Fortbewegungsmittel wie z.B. Rutschauto<br />
(Bobby-Car ), Roller, Kettcar , Dreirad und Fahrrad: Solche Fahrzeuge wird man<br />
stets paarweise anschaffen, weil sie eine neue Spiel- und Erlebniswelt vor allem bei<br />
gleichzeitiger Benutzung durch beide Kinder eröffnen. Wer hier etwas Gebrauchtes<br />
sucht, kann ebenfalls auf den bereits erwähnten Zwillingsflohmärkten fündig werden.<br />
b) Ein Name für die Kinder<br />
Auch Namen für die Kinder müssen gefunden werden. Da der Name den Menschen<br />
nicht nur für die Dauer der Kindheit, sondern ein ganzes Leben lang begleitet, liegt in<br />
der Namensgebung eine große Verantwortung. Bei uns ist es üblich, dass die Eltern<br />
diese Verantwortung wahrnehmen und dem Kind den Namen geben. Andere Kulturen<br />
leben andere Traditionen: In Teilen Südeuropas beispielsweise steht es den Großeltern<br />
zu, den Namen der Enkel zu bestimmen. Naturvölker legen diese Verantwortung oft in<br />
die Hand des Stammesführers oder eines Schamanen.<br />
Die Kriterien, nach denen der Name ausgewählt wird, unterscheiden sich ebenso<br />
nach den verschiedenen Kulturkreisen. In vielen Traditionen spielt die inhaltliche Bedeutung<br />
des Namens eine Rolle: Mit dem Namen verbinden sich bestimmte Gedanken<br />
oder Erwartungen. Früher wurde deshalb der zweite Zwilling häufig Dorothea genannt,<br />
wenn er weiblich war. Der Name bedeutet übersetzt „Geschenk Gottes“ und spielt darauf<br />
an, dass vor der Einführung der Ultraschalluntersuchungen viele Eltern bis zur Geburt<br />
nichts von ihrer Zwillingsschwangerschaft wussten und sich nur auf ein Kind eingestellt<br />
hatten. Wenn dann nach der Geburt des ersten Kindes überraschend noch ein zweites<br />
geboren wurde, war das ein „Geschenk Gottes“, mit dem niemand gerechnet hatte.<br />
Heutzutage achten die meisten Eltern darauf, dass der Name vor allem schön klingt<br />
und zum Nachnamen passt. Manche Eltern meinen dann, <strong>Zwillinge</strong>n am ehesten gerecht<br />
zu werden, indem sie ihnen möglichst gleich klingende Namen geben. In einer wahllos<br />
aufgeschlagenen Tageszeitung fanden wir untereinander abgedruckt zwei Geburtsanzeigen<br />
von Zwillingspaaren: einmal „Tristan und Tizian“ sowie einmal „Fabian und Fabienne“.<br />
Solch ein Gleichklang ist eine Zeit lang gewiss ulkig, doch werden Sie Ihren<br />
Kindern damit auf Dauer keinen Gefallen tun. Denn die lautmalerischen Ähnlichkeiten<br />
behindern die individuelle Ansprache der Kinder. Die Kinder werden nicht einmal dann<br />
sicher wissen, wer von ihnen gemeint ist, wenn sie mit ihrem korrekten Namen gerufen<br />
werden. Frühe Spielkameraden, bis etwa zum Kindergartenalter, werden allein schon in<br />
ihren sprachlichen Fähigkeiten überfordert sein, solche Namen überhaupt zu differenzieren.<br />
Bei allem Respekt vor dem Anrecht aller Eltern, die Namen ihrer Kinder freiverantwortlich<br />
selbst zu bestimmen, erlauben wir uns daher doch den Rat, jedem Kind einen<br />
wirklich eigenen Namen zu geben. Ein unverwechselbarer Name für jedes Kind<br />
sollte erster Ausdruck unseres Bestrebens sein, <strong>Zwillinge</strong>n jedem nach seiner Art und<br />
nach seinen Fähigkeiten den Raum für eine eigenständige Entwicklung zu geben. För-<br />
35b
36a<br />
dern Sie die Individualität der Kinder, indem Sie sie dann auch möglichst oft mit ihren<br />
jeweiligen Namen ansprechen.<br />
c) Vorbereitungen für einen stationären Klinikaufenthalt<br />
Als Zwillingsschwangere, erst recht aber als Drillings- oder Vierlingsschwangere<br />
müssen Sie damit rechnen, bereits mehrere Wochen vor der Geburt stationär in eine<br />
Klinik aufgenommen zu werden (s. folgendes Kapitel). Die Einweisung zur stationären<br />
Behandlung kommt oft unvermittelt, weil z.B. der Frauenarzt im Ultraschallbild eine<br />
fortgeschrittene Muttermundsschwäche mit Verkürzung des Gebärmutterhalses feststellt,<br />
die Sie selbst nicht spüren konnten. Für einen solchen Fall sollten Sie rechtzeitig<br />
Vorkehrungen treffen, insbesondere wenn Sie schon Kinder haben und diese versorgt<br />
werden müssen. Fragen Sie rechtzeitig in Ihrer Verwandtschaft und im Freundeskreis,<br />
ob jemand ggf. zur vorübergehenden Aufnahme Ihrer Kinder bereit wäre.<br />
Wenn solche Möglichkeiten nicht gegeben sind, erkundigen Sie sich beim Jugendamt<br />
oder auf dem privaten Markt nach einer kurzfristig einzurichtenden Tagesbetreuung<br />
für Ihre Kinder.<br />
Wenn Ihre Kinder schon älter sind und Sie vor allem eine Haushaltshilfe benötigen,<br />
wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse. Die gesetzlichen Krankenkassen sind zur<br />
Gestellung einer Haushaltshilfe verpflichtet, wenn Ihnen wegen Schwangerschaft oder<br />
Entbindung die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist und eine andere im<br />
Haushalt lebende Person diesen nicht weiterführen kann. Falls die Krankenkasse aus<br />
personellen Gründen keine Haushaltshilfe stellen kann, müssen Sie sich (nach Absprache<br />
mit der Krankenkasse) selbst um eine Hilfe bemühen und können die Kosten von<br />
der Krankenkasse erstattet bekommen. Klären Sie diese Fragen frühzeitig mit der<br />
Krankenkasse, sobald Sie den Bedarf absehen können. Erkundigen Sie sich auch frühzeitig<br />
bei den Sozialstationen und den freien Anbietern von Familienpflege, wo entsprechende<br />
Kräfte zur Verfügung stehen. Wenn jemand aus Ihrer näheren Verwandtschaft<br />
den Haushalt weiterführt, erstattet die Krankenkasse nach vorheriger Absprache<br />
die erforderlichen Fahrtkosten sowie innerhalb gewisser Grenzen den Verdienstausfall<br />
der Hilfsperson. Seit 2004 muss allerdings für die Haushaltshilfe eine Zuzahlung geleistet<br />
werden; sie beträgt 10% der Kosten – mindestens jedoch 5 EUR und höchstens<br />
10 EUR pro Tag. Nach Erreichen der Belastungsgrenze von 2% des Bruttojahreseinkommens<br />
können Sie sich von der Zuzahlungspflicht befreien lassen.<br />
d) Anmeldung bei der Nachsorgehebamme<br />
Nach der Geburt verbleiben die meisten Mütter mit ihren Kindern noch eine Weile<br />
in der Klinik, auch wenn alles unproblematisch verläuft. In der sog. „Wöchnerinnenstation“<br />
kann man sich an die neue Situation gewöhnen, sich mit anderen Müttern austauschen<br />
und erhält praktische Unterstützung in der Babypflege, bis man nach einigen Tagen<br />
entlassen wird. Zuhause angekommen steht allen Müttern die häusliche Betreuung<br />
durch eine Nachsorgehebamme zu, die die gesundheitliche Entwicklung der Neugeborenen<br />
und der Mutter begleitet. Vor allem kümmert sie sich um die Pflege der Bauchnabel,<br />
sie prüft die ordnungsgemäße Rückbildung der Gebärmutter und gibt Anleitung und<br />
Hilfe bei Stillproblemen. Bis zum zehnten Tag nach der Geburt wird die Nachsorgehebamme<br />
von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Wenn ein besonderer Bedarf entsteht,<br />
den man bei Mehrlingen immer wird begründen können (Stillprobleme o.ä.),<br />
kommen bis zu acht weitere Besuche in den ersten acht Lebenswochen der Kinder hinzu.<br />
Die Nachsorgehebamme wird nicht von der Klinik gestellt, sondern man muss sich<br />
selbst darum bemühen. Die meisten Kliniken sowie die Anbieter von Geburtsvorbereitungskursen<br />
halten eine Adressenliste der freiberuflich tätigen Hebammen bereit, bei<br />
denen man sich zur Nachsorge anmelden kann. In einigen Regionen ist allerdings die<br />
Nachfrage erheblich größer als das Angebot, so dass es darauf ankommt, sich rechtzeitig<br />
anzumelden! Viele Hebammen machen ihren ersten Besuch bereits vor der Geburt und<br />
informieren sich über die Lage der Kinder, fragen nach der Absicht zu stillen, sehen sich<br />
daraufhin die Brüste an und werfen vielleicht bereits einen Blick auf die Babyausstattung.<br />
e) Bescheinigungen für das Mutterschaftsgeld<br />
Ab sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin erhalten Sie von Ihrem<br />
Frauenarzt eine Bescheinigung für das Mutterschaftsgeld und den Mutterschaftsurlaub.<br />
Diese Bescheinigungen benötigen Sie, um das Mutterschaftsgeld ausgezahlt zu erhalten,<br />
wenn Sie in einem Arbeitsverhältnis stehen, Leistungen vom Arbeitsamt beziehen oder<br />
als Selbstständige in der gesetzlichen Krankkasse freiwillig versichert sind. Reichen Sie<br />
eine der beiden Bescheinigungen bei Ihrer (gesetzlichen) Krankenkasse und die andere<br />
Bescheinigung bei Ihrem Arbeitgeber bzw. beim Arbeitsamt ein. Auch wenn Sie zu<br />
diesem Zeitpunkt schon krankgeschrieben sind, der Frauenarzt ein Beschäftigungsverbot<br />
36b
37a<br />
ausgesprochen hat oder Sie sogar stationär in der Klinik liegen, müssen Sie beide<br />
Bescheinigungen einreichen.<br />
eigenen Mitteln nicht bezahlen können, kann Ihnen hierfür eine einmalige Leistung des<br />
Sozialleistungsträgers zustehen. Setzen Sie sich mit dem Sozialleistungsträger in Verbindung,<br />
der Ihnen die einmalige Leistung entweder in der Form einer Geldleistung oder<br />
in Form einer Sachleistung (Warengutschein) erbringen kann.<br />
37b<br />
f) Arbeitslosengeld II / Sozialhilfe / BAföG<br />
Falls Sie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, steht Ihnen ab Beginn der<br />
13. SSW ein schwangerschaftsbedingter Mehrbedarf in Höhe von 17% des Regelsatzes<br />
zu. Darüber hinaus erhalten Sie eine einmalige Leistung für die Beschaffung von Umstandskleidung<br />
sowie eine weitere einmalige Leistung für die Erstausstattung Ihrer<br />
Kinder. Den Umfang dieser Leistungen legen die örtlich zuständigen Sozialleistungsträger<br />
jeweils im Benehmen mit den Wohlfahrtsverbänden fest. Erkundigen Sie sich<br />
bei Ihrem Sozialleistungsträger, welche Leistungen im Einzelnen gewährt werden.<br />
Eltern, die noch in der Ausbildung sind, haben ebenfalls einen Anspruch auf diese<br />
Leistungen. Denn das BAföG deckt nur den ausbildungsbedingten oder -geprägten<br />
Mehrbedarf ab. Der zusätzliche Bedarf, der durch die Schwangerschaft verursacht<br />
wird, begründet einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen nach dem SGB II, welcher<br />
bei dem für das Arbeitslosengeld II zuständigen Sozialleistungsträger geltend zu machen<br />
ist (nicht bei dem BAföG-Amt).<br />
Nach den gesetzlichen Regelungen sind die Umstandskleidung ab der 22. SSW zu<br />
gewähren und der Antrag auf die Baby-Erstausstattung ist ab der 27. SSW entgegenzunehmen.<br />
Viele Sozialleistungsträger gewähren die Leistungen entgegen den gesetzlichen<br />
Vorschriften jedoch erst später. Wenden Sie sich ggf. an eine Schwangerschaftsberatungsstelle,<br />
um Ihre gegebenen Ansprüche durchzusetzen. Ob neben der<br />
Kinderkleidung auch Kinderwagen und Kinderbetten als einmalige Leistung vom Sozialleistungsträger<br />
erbracht werden müssen, ist derzeit rechtlich umstritten.<br />
Informieren Sie sich beim Sozialleistungsträger auch darüber, wie für Sie Ihre<br />
neugeborenen Kinder das Sozialgeld (falls Sie selbst Leistungsempfänger sind) oder<br />
die Sozialhilfe (falls Sie selbst nicht Leistungsempfänger sind) beantragen können.<br />
Eine Erstausstattung für die Kinder können Sie unter Umständen sogar dann vom<br />
Sozialleistungsträger bekommen, wenn Sie ansonsten keine regelmäßigen Leistungen<br />
beziehen. Falls Ihre Einkünfte nur knapp oberhalb der sozialrechtlichen Einkommensgrenze<br />
liegen und Sie die Umstandsbekleidung oder die Erstausstattung aus Ihren<br />
g) Bundesstiftung „Mutter und Kind“<br />
Wenn Sie sich in einer finanziellen Notlage befinden und bestimmte Einkommensgrenzen<br />
nicht überschreiten, können Sie außerdem Hilfen bei der Bundesstiftung „Mutter<br />
und Kind – Stiftung zum Schutz des ungeborenen Lebens“ beantragen. Solche Anträge<br />
müssen grundsätzlich vor der Geburt gestellt werden. Sie werden vorrangig bearbeitet,<br />
wenn sie bis zur 20. SSW gestellt werden. Einen Überblick über die Förderungsmöglichkeiten<br />
für werdende Mehrlingseltern und die Antragsvoraussetzungen finden Sie<br />
unten auf den Seiten 63 und 69.<br />
10. Endphase der Schwangerschaft<br />
a) Stationäre Überwachung zum Ende der Schwangerschaft auch ohne besondere Komplikationen<br />
Im letzten Schwangerschaftsdrittel werden Sie vielleicht von Seiten Ihres Frauenarztes<br />
oder der Geburtsklinik mit dem Vorschlag konfrontiert, den Rest der Schwangerschaft<br />
nicht daheim zu verbringen, sondern stationär in der Geburtsklinik. Einige Mediziner<br />
sind nämlich der Ansicht, dass alle Zwillingsschwangeren routinemäßig ab einer<br />
bestimmten erreichten Schwangerschaftsdauer (z.B. ab der 28. SSW) zur stationären<br />
Überwachung in die Klinik eingewiesen werden sollten, selbst wenn die Schwangerschaft<br />
völlig komplikationslos verläuft. Sie verweisen darauf, dass sich das Frühgeburtsrisiko<br />
auf diese Weise vermindern lässt und andere Risiken und Komplikationen früher<br />
erkannt werden können.<br />
Andere Mediziner sprechen sich jedoch gegen eine routinemäßige Klinikeinweisung<br />
aus. Sie verweisen auf die psychischen und körperlichen Nachteile eines längeren<br />
Klinikaufenthaltes und stellen die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Außerdem<br />
sei erwiesen, dass sich die Ungeborenen in einem (schonend) bewegten Mutter-
38a<br />
leib besser entwickelten als bei fortwährender Bettruhe. Bei komplikationslos verlaufenden<br />
Schwangerschaften halten sie deshalb den Verbleib in der häuslichen Umgebung<br />
für den natürlicheren Umgang mit der Schwangerschaft, die ja schließlich keine<br />
„Krankheit“ sei.<br />
Wer hat nun recht<br />
Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es scheint, als würde hier ein alter<br />
Konflikt fortgesetzt, der zu tun hat mit dem Spannungsfeld zwischen möglichst<br />
natürlicher Schwangerschaft und Geburt auf der einen sowie medizinischer Kontrolle<br />
und professioneller Leitung des Geschehens auf der anderen Seite.<br />
Das hat folgenden Hintergrund: Seit Menschengedenken und in vielen Kulturen<br />
lag die Begleitung der Schwangerschaft und Geburt in den Händen erfahrener Frauen,<br />
die ihr Wissen von Generation zu Generation weitergaben. Geburt war ein privates<br />
Erleben, das von den weisen und erfahrenen Frauen mit den nötigen Handgriffen und<br />
Mitteln unterstützt, vor allem aber auch rituell begleitet wurde. Unsere moderne Gesellschaft<br />
setzte diese Tradition auf ihre Weise fort, indem sie die Tätigkeit dieser<br />
„erfahrenen Frauen“ im Berufsbild der Hebamme institutionalisiert und sozial absichert<br />
hat.<br />
Jedoch gingen Schulmediziner in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts daran,<br />
den medizinischen Aspekt der Schwangerschaft und des Geburtsgeschehens über alles<br />
andere hervorzuheben. Nichts sollte mehr dem Zufall und dem natürlichen Lauf der<br />
Dinge überlassen bleiben. Das führte am Ende dazu, dass alle Schwangeren (auch<br />
Einlingsschwangere!) zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Klinik einbestellt wurden,<br />
um die Geburt künstlich einzuleiten. Nicht das natürliche Einsetzen der Wehen sollte<br />
den Geburtstermin bestimmen, sondern medizinische Eingriffe brachten das Ereignis<br />
in Gang – zu dem als günstig ausersehenen Zeitpunkt. Man sprach – zu Recht – von<br />
einer „programmierten“ Geburt.<br />
Ende der sechziger Jahre, als auch andere gesellschaftliche Entwicklungen überdacht<br />
und in Frage gestellt wurden, begann allmählich eine Rückbesinnung auf die<br />
alten Werte. Grenzen der Schulmedizin wurden sichtbar, deren Konzepte hinterfragt<br />
und es gewannen andere Mediziner Gehör, die sich für einen sanfteren Umgang mit<br />
dem Geburtsereignis aussprachen. Viele Reglementarien der Schulmedizin wurden als<br />
gefühlskalt empfunden und nicht mehr hingenommen. Vorreiter dieser neuen Richtung<br />
der sanften Geburt waren die französischen Ärzte Frédérick Leboyer und Michel Odent.<br />
Heutzutage sind viele Ideen und Vorschläge von Leboyer und Odent in den meisten<br />
Geburtskliniken umgesetzt, z.B. die Anwesenheit des Partners bei der Geburt, eine harmonische<br />
Raumgestaltung und Atmosphäre (z.B. Musik), die Abkehr vom schmalen<br />
Kreißbett usw.<br />
Andere Entwicklungen sind jedoch nach wie vor – zum Teil sogar recht emotional –<br />
umstritten: Bei Einlingen zum Beispiel das Thema Hausgeburt, von der in Deutschland<br />
viele Mediziner vehement und geradezu verbissen abraten, während man in den Niederlanden<br />
sehr gute Erfahrungen damit macht (und auch mit einer anderen medizinischen<br />
Infrastruktur professioneller darauf eingerichtet ist).<br />
Die zu Beginn dargestellten und hier interessierenden unterschiedlichen Auffassungen<br />
zu der Frage, ob Zwillingsschwangerschaften ab einem bestimmten Zeitpunkt stationär<br />
in der Geburtsklinik überwacht werden sollten, gehören wohl auch eingeordnet in<br />
den Richtungsstreit zwischen sanfter, natürlicher Geburt auf der einen und schulmedizinisch<br />
konsequenter Überwachung auf der anderen Seite. Sie sind nicht mit „richtig“ oder<br />
„falsch“ zu bewerten, sondern unserer Meinung nach individuell mit den werdenden<br />
Eltern persönlich zu erarbeiten.<br />
Vergleichende Untersuchungen zwischen stationär eingewiesenen Zwillingsschwangeren<br />
und solchen, die bis zur Geburt im häuslichen Umfeld blieben, bestätigen<br />
den positiven Effekt der Krankenhausbetreuung. Danach sind die stationär überwachten<br />
Zwillingsschwangerschaften zahlenmäßig weniger häufig von Frühgeburtlichkeit,<br />
Krankheit und Neugeborenensterblichkeit betroffen. Solche statistischen Auswertungen<br />
sprechen für die Position derjenigen, die eine routinemäßige stationäre Aufnahme befürworten.<br />
Wenn man die Befürworter der stationären Aufnahme allerdings befragt, ob es nicht<br />
ebenso genügen würde, wenn die Schwangere zuhause bliebe, von anderen umsorgt<br />
würde, und sich dort den Tag über ausruht, so antworten viele, dass ein solcher Zustand<br />
wegen des vertrauten und angenehmeren Umfeldes an sich sogar noch besser wäre, nur<br />
dass man eben nicht überprüfen könne, ob die Schwangere die konsequente Schonung<br />
und Ruhe tatsächlich einhält. Allein deshalb könne man den Verbleib im häuslichen<br />
Umfeld nicht befürworten.<br />
38b
39a<br />
Solche Ausführungen entheben die Diskussion ihrer dogmatischen Schärfe und<br />
führen sie in einem wesentlichen Teilaspekt auf die rein organisatorische Frage zurück,<br />
ob und inwieweit es gelingen kann, die erforderliche Schonung und Ruhe zuhause<br />
tatsächlich zu ermöglichen und einzuhalten. Dazu muss die Haushaltsführung von<br />
anderen übernommen werden, ebenso wie die Versorgung bereits vorhandener Kinder.<br />
Selbstverständlich darf die Schwangere auch keiner Berufstätigkeit mehr nachgehen.<br />
Vor allem die Entlastung im Haushalt muss durch eine Haushaltshilfe oder durch verbindliche(!)<br />
Hilfsangebote von Verwandten oder Freunden eindeutig geregelt sein.<br />
Wenn diese Fragen geklärt sind, ist ein Verbleib zuhause medizinisch vertretbar.<br />
Wichtig bei einem Verbleib im häuslichen Umfeld ist dann allerdings eine engmaschige<br />
ambulante Überwachung der Schwangerschaft durch den Frauenarzt, so dass auch<br />
die Anfahrt dorthin für die Schwangere risikolos und ohne besondere Anstrengung zu<br />
bewerkstelligen sein muss. Hören Sie insgesamt in dieser Frage auf den Rat Ihres<br />
Frauenarztes, der den Zustand Ihres Muttermundes und das Ergebnis des CTG oder<br />
des Doppler-Ultraschalls bewerten muss, und ziehen Sie ggf. eine zweite Meinung<br />
zurate, indem Sie sich z.B. bei der vorgesehenen Geburtsklinik nach den dortigen<br />
Gepflogenheiten erkundigen.<br />
Ein weiterer Aspekt, der auch nicht unterschätzt werden sollte, ist das Gefühl der<br />
persönlichen Sicherheit. Wenn Sie sich unter stationärer Krankenhausüberwachung<br />
besser aufgehoben und sicherer fühlen, so nehmen Sie die dahingehenden Angebote<br />
wahr. Das ist allemal besser, als zuhause durch fortwährende Unsicherheit nicht wirklich<br />
zur Ruhe zu kommen. Teilen Sie Ihre Sorgen und Ängste, aber auch Ihre möglichen<br />
Konzepte für eine häusliche Entlastung dem Frauenarzt mit, wenn das Gespräch<br />
auf die stationäre Einweisung kommt. Entscheiden Sie sich dann für die Lösung, bei<br />
der Sie für sich und Ihre Kinder das beste Gefühl haben.<br />
Um Missverständnissen noch einmal vorzubeugen: Die widerstreitenden Sichtweisen<br />
beziehen sich ausschließlich auf den Fall einer bis dahin komplikationslosen<br />
Zwillingsschwangerschaft. Sobald besondere Komplikationen oder erhöhte Risiken<br />
vorliegen (z.B. vorzeitige Wehentätigkeit, Muttermundsschwäche, Mangelversorgung,<br />
Gestose), kann eine stationäre Aufnahme zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft<br />
erforderlich werden und steht dann medizinisch völlig außer Frage. Daher müssen<br />
Erforderlichkeit und Zeitpunkt einer stationären Aufnahme immer individuell mit dem<br />
behandelnden Arzt geklärt werden.<br />
Für Drillings- und Vierlingsschwangere gelten ohnehin andere Kriterien: Hier muss<br />
der Einzelfall genau geprüft und das Vorgehen insgesamt mit der Geburtsklinik abgestimmt<br />
werden. Selbst bei komplikationsloser Schwangerschaft muss man mit einer z.T.<br />
weiträumig vor dem Geburtstermin angesetzten stationären Aufnahme rechnen. Allerdings<br />
gehen die Empfehlungen über den richtigen Zeitpunkt der stationären Aufnahme<br />
auseinander: Während manche Kliniken z.B. für Vierlinge eine stationäre Betreuung erst<br />
ab der 27. SSW vorsehen, raten besonders vorsichtige Ärzte bereits bei Drillingen zu<br />
einer stationären Aufnahme spätestens mit der 24. SSW, was für viele Frauen einen<br />
immerhin zwei- bis dreimonatigen Klinikaufenthalt bedeutet. Andere Ärzte lassen bei<br />
Drillingen eine stationäre Aufnahme in der 30. SSW genügen. Auch hier stellt sich also<br />
wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel in Abwägung mit den häuslichen<br />
Möglichkeiten einer belastungsfreien und ruhevollen Umgebung. Eine auf den<br />
Einzelfall zugeschnittene Entscheidung wird neben den medizinischen Möglichkeiten<br />
und Erfordernissen auch die häusliche Situation der Schwangeren und das subjektive<br />
Sicherheitsempfinden der werdenden Eltern berücksichtigen.<br />
Manche Drillingsmütter berichten übrigens, dass ihnen die Erwartung, ab etwa der<br />
Mitte der zwanziger SSW die restliche Zeit in einer Klinik verbringen zu müssen, zu<br />
Beginn der Schwangerschaft eine erschreckende Vorstellung war, während sie sich im<br />
weiteren Verlauf der Schwangerschaft nicht nur an diesen Gedanken gewöhnten, sondern<br />
den Zeitpunkt der stationären Aufnahme sogar zunehmend herbeisehnten, weil die<br />
körperlichen Belastungen bis dahin in der häuslichen Umgebung bereits kaum noch zu<br />
ertragen waren. Auch nach der stationären Aufnahme wächst der Bauchumfang von Tag<br />
zu Tag, und die damit verbundenen Beschwerden nehmen immer weiter zu. Viele geraten<br />
an den Rand ihrer Belastungsgrenze, wenn der Tag und die Nacht durch Rückenschmerzen,<br />
Sodbrennen, Blasendruck, Verstopfung und Atemnot geprägt sind. Hinzu<br />
kommen vielleicht Wassereinlagerungen in der Lunge (Lungenödeme), die durch die<br />
wehenhemmenden Mittel verursacht sein können. In dieser Zeit drängt es manche<br />
Schwangeren danach, die Strapazen nun endlich durch einen vorzeitigen Kaiserschnitt<br />
zu beenden. Dadurch treten die mütterlichen Bedürfnisse allerdings in ein Spannungsfeld<br />
zu den Erfordernissen der Kinder, die sich – bei ausreichender Versorgung – nur im<br />
Mutterleib optimal entwickeln und mit jedem weiteren Tag der Schwangerschaft besser<br />
für das Leben außerhalb vorbereitet sind. Für sie ist jeder weitere ein gewonnener Tag,<br />
besonders wenn ein bedeutender weiterer Entwicklungsschritt noch erreicht werden<br />
kann. Ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für die Kinder ist zum Beispiel die vollständige<br />
Ausbildung der Atemorgane. Es bedeutet eine gewaltige Verbesserung ihrer<br />
gesundheitlichen Ausgangslage, wenn sie von Geburt an selbständig atmen können und<br />
nicht auf künstliche Beatmung angewiesen sind. Steht die Schwangerschaft vor der<br />
39b
40a<br />
Schwelle, wo dieser Erfolg erreicht werden kann, ist jeder einzelne weitere Schwangerschaftstag<br />
sehr wertvoll.<br />
b) Künstliche Einleitung der Geburt<br />
Bei <strong>Zwillinge</strong>n stellt sich dann im Weiteren die Frage nach dem „besten“ Geburtszeitpunkt.<br />
Statistische Untersuchungen haben ergeben, dass diejenigen <strong>Zwillinge</strong><br />
am gesündesten zur Welt kommen, die etwa am Ende der 37. SSW geboren werden.<br />
Einerseits ist dann die Frühgeborenenphase überwunden, so dass die Kinder weitgehend<br />
ausgereift zur Welt kommen; andererseits nimmt mit weiterer Dauer der<br />
Schwangerschaft das Risiko einer unzureichenden Mutterkuchenfunktion zu, was die<br />
Gefahr einer Mangelversorgung der Kinder erhöht. Außerdem steigt mit zunehmender<br />
Schwangerschaftsdauer auch die Wahrscheinlichkeit einer Gebärmutterüberdehnung<br />
infolge des übermäßigen Volumens der Kinder und der Fruchtblasen.<br />
spätestens nach der Vollendung von 38 SSW, manche auch schon nach 37 oder sogar 36<br />
vollendeten SSW.<br />
Es gibt allerdings auch Ärzte, die keinen festen Regelzeitpunkt für die Einleitung<br />
der Geburt vorsehen und eine Fortsetzung der Zwillingsschwangerschaft auch über 38<br />
vollendete SSW hinaus unterstützen. Sie sind jedoch eher in der Minderheit.<br />
Auch hier erklären sich die unterschiedlichen Standpunkte aus dem Spannungsfeld<br />
zwischen möglichst natürlicher Schwangerschaft und Geburt sowie unvermeidlicher<br />
medizinischer Leitung des Geschehens. Anhänger der klassischen Schulmedizin werden<br />
eher zu einem bestimmten Fixtermin neigen, während Befürworter einer sanften Geburtsleitung<br />
stärker den Aspekt des störenden Eingriffs in den natürlichen Prozess im<br />
Blick haben und einstweilen vielleicht nur regelmäßig prüfen, ob die Kinder noch ausreichend<br />
versorgt sind und es der Schwangeren gut geht.<br />
Folgen Sie den Empfehlungen Ihres Frauenarztes und dem Anraten der Geburtshelfer<br />
in der Klinik, die neben der konkreten Versorgungssituation der Kinder auch den<br />
Gesundheitszustand der Schwangeren (z.B. Gestosegefahr) beurteilen müssen. Solange<br />
von einer Einleitung der Geburt noch abgesehen wird, ist in dieser Endphase der<br />
Schwangerschaft unter allen Umständen eine besonders engmaschige (d.h. im Zweifel<br />
tägliche) Kontrolle der Versorgungslage der Kinder erforderlich. Die eigene Entscheidung<br />
für oder gegen eine künstliche Einleitung der Geburt muss daher auf jeden Fall in<br />
Abstimmung mit dem behandelnden Frauenarzt und den Geburtshelfern der Klinik getroffen<br />
werden, weil diese die regelmäßige Kontrolle sicherstellen müssen.<br />
40b<br />
Dass mit dem Erreichen der 38. SSW jedenfalls keine wehenhemmenden Vorsichtsmaßnahmen<br />
mehr veranlasst sind, dürfte sich aus dem Vorstehenden von selbst<br />
ergeben. Wehenhemmende Medikamente sollten daher allmählich reduziert werden und<br />
dann auslaufen, wohingegen ein plötzliches Absetzen der Medikamente im Allgemeinen<br />
nicht befürwortet wird. Wehenhemmende Schonungs- und Ruhemaßnahmen können<br />
allmählich aufgehoben werden – das alles freilich nach jeweiliger Absprache mit dem<br />
behandelnden Frauenarzt.<br />
Diese Zusammenhänge haben zu der Überlegung geführt, Zwillingsschwangerschaften<br />
nicht beliebig lang bis zum Einsetzen der natürlichen Wehen fortzusetzen,<br />
sondern sie spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt durch künstliche Einleitung der<br />
Geburt zu beenden. Viele Mediziner empfehlen eine Beendigung der Schwangerschaft<br />
Manchmal werden Geburten auch künstlich eingeleitet, um sicherzustellen, dass die<br />
Kinder während der Kernarbeitszeit kommen, wo die Klinik personell optimal besetzt<br />
ist. Solche Erwägungen sollten allerdings auf besondere Risikofälle beschränkt bleiben.
41a<br />
Ist die Entscheidung gefallen, die Geburt aus einem der genannten Gründe künstlich<br />
einzuleiten, so steht eine Reihe von Maßnahmen zur Verfügung, um die Wehentätigkeit<br />
in Gang zu setzen oder zu fördern:<br />
- Wehenfördernde Bewegungen: Dies ist wohl die natürlichste Methode,<br />
um die Wehentätigkeit anzuregen. Besonders wirksam ist das Treppensteigen,<br />
das man ansonsten während der Schwangerschaft möglichst vermeiden<br />
sollte. Außerdem kommen je nach den Gegebenheiten bestimmte<br />
gymnastische Übungen in Betracht, die jedoch fachkundig angeleitet werden<br />
sollten. Auch bei diesen Bewegungen sollte man immer Maß halten<br />
und sich nicht überanstrengen.<br />
- Geschlechtsverkehr: Die männliche Samenflüssigkeit enthält Prostaglandine,<br />
welche den Muttermund aufweichen und dadurch die Öffnung des<br />
Muttermundes erleichtern. Angesichts des inzwischen erreichten Bauchumfangs<br />
wird diese Möglichkeit jedoch von vielen Paaren als nicht mehr<br />
besonders praktisch und angenehm empfunden.<br />
- Einlegen einer Prostaglandintablette (bzw. –zäpfchen/-gel) vor den Muttermund:<br />
Prostaglandine werden auch künstlich hergestellt und können in<br />
der jeweiligen Verabreichungsform in die Scheide eingeführt werden.<br />
- Physikalische Methoden: In den Muttermund können Stifte oder ein Ballonkatheter<br />
eingeführt werden, um die Öffnung des Muttermundes zu beschleunigen.<br />
Der Ballonkatheter wird mit Kochsalzlösung gefüllt und übt<br />
dadurch einen inneren Druck auf den Muttermund aus.<br />
- Sprengen der Fruchtblase: Der Geburtshelfer bringt die Fruchtblase des<br />
vorn liegenden Kindes mit einem spitzen Gegenstand zum Platzen. Nachdem<br />
das Fruchtwasser abgegangen ist, beginnt die Gebärmutter meist innerhalb<br />
weniger Stunden von selbst mit der Wehentätigkeit.<br />
- Mechanische Aufweitung des Muttermundes: Ist der Muttermund bereits<br />
fingerdick geöffnet, kann der Geburtshelfer hineingreifen und ihn mit der<br />
kreisenden Bewegung eines Fingers weiter öffnen. Diese Prozedur kann<br />
recht schmerzhaft sein.<br />
Im Allgemeinen lässt sich die Wehentätigkeit bei Mehrlingsschwangeren relativ<br />
leicht stimulieren.<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Nun haben Sie das erste Kapitel des Buches bereits gelesen und<br />
schon vieles über die Besonderheiten der Zwillingsschwangerschaft erfahren.<br />
Wenn Sie den Ratgeber informativ finden, möchten wir Sie an<br />
dieser Stelle noch einmal bitten, unsere Mühe mit einem angemessenen<br />
Autorenhonorar anzuerkennen. Geben Sie soviel, wie Ihnen der Ratgeber<br />
wert ist. Unsere Empfehlung liegt bei 5,- bis 10,- EUR pro Leserfamilie;<br />
egal ob Sie den Text selbst aus dem Internet heruntergeladen oder von<br />
einer befreundeten Familie erhalten haben. Bitte überweisen Sie den Betrag<br />
an: Dr. Claudio Nedden-Boeger, Konto-Nr. 142921, Bankleitzahl<br />
360 605 91 (Sparda-Bank West eG) – bzw. für den EU-Zahlungsverkehr:<br />
IBAN: DE67360605910000142921, BIC: GENODED1SPE.<br />
41b<br />
- Wehentropf: Durch den Wehentropf wird dem Körper der Schwangeren<br />
das Hormon Oxytocin zugeführt, welches die Wehentätigkeit anregt. Zuvor<br />
wird häufig mit einem oxytocinhaltigen Nasenspray getestet, ob der<br />
Körper auf das Hormon anspricht, und wie die Ungeborenen auf die Belastung<br />
der Wehen reagieren. Anstelle einer äußerlichen Zuführung des<br />
Hormons kann man auch die körpereigene Produktion von Oxytocin anregen,<br />
indem man mit einer Milchpumpe an den Brüsten einen Saugreflex<br />
simuliert. Diese Methode ist in Deutschland jedoch nicht sehr verbreitet,<br />
sie wird vor allem in Israel praktiziert.
42a<br />
Zweites Kapitel: Geburt und Wochenbett<br />
1. Geburt<br />
a) Geburtsort<br />
Mit der Auswahl einer geeigneten Geburtsklinik sollte man sich beizeiten befassen.<br />
Dabei ist der Gedanke an eine Hausgeburt oder eine Geburt in einem der jetzt<br />
vielerorts entstehenden Geburtshäuser von vornherein zu verwerfen, da es sich bei<br />
Mehrlingsgeburten immer zumindest insofern um eine Risikogeburt handelt, als es<br />
jederzeit – sogar noch nach der vaginalen Geburt des ersten Kindes – erforderlich<br />
werden kann, innerhalb kürzester Zeit auf einen Kaiserschnitt umzuschwenken. Aus<br />
demselben Grunde sollte man sich bei der Auswahl der Klinik auch nicht von Gedanken<br />
an z.B. eine Unterwassergeburt leiten lassen, da diese für Mehrlinge ebenfalls<br />
nicht in Betracht kommen wird.<br />
Stehen aufgrund ihrer örtlichen Erreichbarkeit mehrere Kliniken zur Auswahl,<br />
sollte man sich zunächst über deren Schwerpunkte informieren. Einige Kliniken sind<br />
hochtechnisiert und verfügen über eine Neugeborenenintensivstation, andere legen den<br />
Schwerpunkt auf eine möglichst sanfte Geburt in angenehmer Umgebung. Wieder<br />
andere Kliniken mühen sich besonders um den Stillerfolg der Mütter und verfügen<br />
über speziell ausgebildete Still- und Laktationsberaterinnen 1 , die gerade für das Stillen<br />
von <strong>Zwillinge</strong>n und Drillingen sehr wertvolle Anleitung geben können. Besuchen Sie<br />
eine Informationsveranstaltung mit Kreißsaalbesichtigung, wie sie heutzutage von fast<br />
allen Geburtskliniken angeboten wird, und stellen Sie die Fragen, die Sie bewegen.<br />
Hinterfragen Sie die Anpreisungen, mit denen dort geworben wird. Seitdem werdende<br />
Eltern den Entbindungsort frei wählen dürfen, besteht ein großer Wettbewerb zwischen<br />
den Geburtskliniken, die auf möglichst hohe Belegzahlen und Geburtenziffern<br />
aus sind.<br />
Wenn sich also eine Klinik als besonders stillfreundlich anpreist – was alle Kliniken<br />
tun, weil es im Trend liegt –, so haken Sie nach: Fragen Sie, ob eine besonders<br />
1 zum Begriff s. unten, Seite 58<br />
ausgebildete Laktationsberaterin vorhanden ist, lassen Sie sich die elektrische Milchpumpe<br />
zeigen, fragen Sie, welche Maßnahmen bei einem auftretenden Milchstau ergriffen<br />
werden, ob Babys nach Bedarf oder nach einem festen Zeitplan gestillt werden, ob<br />
von Seiten des Pflegepersonals z.B. nachts eigenmächtig Tee gegeben wird, ob Anleitung<br />
und Material für ein evtl. erforderliches „Finger-Feeding“ 2 gegeben sind oder welche<br />
Techniken zur Vermeidung einer Saugverwirrung ansonsten praktiziert werden.<br />
Werfen Sie auch einen Blick in die Räumlichkeiten der Wöchnerinnenstation. Wenn Sie<br />
in den Kinderbettchen oder sonst allerorten Tee- und Milchfläschchen herumstehen<br />
sehen und Werbung für Baby-Fertignahrung aufgehängt ist, ist es mit der Stillfreundlichkeit<br />
des Hauses in der Praxis offenbar doch nicht so weit her. Bedenkenlos empfohlen<br />
werden können unter dem Blickwinkel der Stillfreundlichkeit nur die wenigen Kliniken,<br />
die nach den strengen BFHI-Prüfungskriterien der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) und der UNICEF als „stillfreundliches Krankenhaus“ anerkannt sind 3 .<br />
Wenn eine Klinik „rooming in“ anbietet, fragen Sie genau nach, was die Klinik<br />
darunter versteht. Fragen Sie gezielt nach, ob es auch bei <strong>Zwillinge</strong>n unterstützt wird,<br />
dass beide Kinder die Nacht bei der Mutter verbringen (sofern Sie dies wollen). Apropos<br />
„bei der Mutter“: Manche Kliniken bieten Familienzimmer an, in denen auch der Vater<br />
(gegen zusätzliches Entgelt) übernachten kann. Erkundigen Sie sich ggf. auch danach.<br />
Vergleichsweise schwer wird es Ihnen dagegen gelingen, die technische Einrichtung<br />
des Kreißsaals sachgerecht zu bewerten. Lassen Sie sich z.B. nicht von der Anpreisung<br />
blenden, man verfüge über spezielle „Zwillings“-CTG-Geräte. Diese Geräte, mit<br />
deren Hilfe die Herztöne von zwei Schallquellen gleichzeitig aufgezeichnet werden<br />
können, waren ursprünglich nicht einmal in erster Linie für <strong>Zwillinge</strong> gedacht, sondern<br />
um bei schwieriger Kindslage den Herzton eines einzelnen Kindes gleichzeitig von zwei<br />
verschiedenen Abhörstellen einzufangen, um dadurch den Empfang insgesamt zu<br />
verbessern und eine kontinuierliche Aufzeichnung zu erhalten. Für <strong>Zwillinge</strong> leisten<br />
zwei einzelne CTG-Geräte, auf denen jeweils der Herzton eines Kindes aufgezeichnet<br />
wird, ebenso gute Dienste. Wichtig ist allerdings, dass für Sie auch dann noch zwei<br />
CTG-Geräte ununterbrochen zur Verfügung stehen, wenn alle Kreißsäle belegt sind.<br />
2 (=„Finger-Fütterung“ zur Vermeidung einer Saugverwirrung), s. unten, Seite 54<br />
3<br />
Eine Liste dieser Kliniken finden Sie im Internet unter<br />
http://www.stillfreundlich.de/info_eltern/doc/adressen.pdf. (Österreich: http://www.stillen.at;<br />
Schweiz: http://www.allaiter.ch/de/bfhi/award.cfm).<br />
42b
43a<br />
Einige sicherheitsrelevante Aspekte können Sie jedoch erfragen, zum Beispiel die<br />
örtliche Lage des Kaiserschnitt-OP. Eine weite Wegstrecke zwischen Kreißsaal und<br />
OP, womöglich noch auf verschiedenen Etagen und nur über Aufzüge zu erreichen,<br />
kann im Ernstfall bereits ein Sicherheitsrisiko darstellen. Informieren Sie sich auch<br />
über die Dienstzeiten des für Sie relevanten Personals und über bestehende Kooperationen<br />
mit anderen Kliniken: Ist rund um die Uhr ein Anästhesist (Narkosearzt) im<br />
Haus Innerhalb welcher Zeit kann im Notfall ein Neonatologe (Arzt für Neugeborenenintensivmedizin)<br />
herbeigerufen werden<br />
Fragen Sie auch nach der Kaiserschnittrate für <strong>Zwillinge</strong>. Vor allem: Fragen Sie,<br />
ob für <strong>Zwillinge</strong> überhaupt eine natürliche (vaginale) Geburt angeboten wird. Es gibt<br />
Geburtskliniken, in denen die Kaiserschnittrate bei 100% liegt, d.h. es werden ausnahmslos<br />
alle <strong>Zwillinge</strong> per Kaiserschnitt geholt. Als Begründung wird meist angegeben,<br />
dies sei angeblich sicherer. In Wahrheit beruht die generelle Ablehnung natürlicher<br />
Zwillingsgeburten jedoch fast immer (auch) auf anderen Erwägungen, auf die wir<br />
im folgenden Kapitel näher eingehen.<br />
Wenn Sie besonderen Wert auf einen möglichst natürlichen Geburtsverlauf ohne<br />
wesentliche äußere Eingriffe legen (sog. „sanfte Geburt“), sollten Sie sich auf der<br />
Informationsveranstaltung z.B. darüber informieren, ob vor der Geburt ein Einlauf 1<br />
oder das Rasieren der Schamhaare 2 vorgesehen ist. Diese Fragen sind aufschlussreicher<br />
als etwa die häufig gestellte Frage nach der „Dammschnittrate“, da für einen<br />
Dammschnitt, mit dem Sie als Zwillingsgebärende ohnehin rechnen müssen, oftmals<br />
medizinische Gründe vorliegen. Was den Dammschnitt betrifft, ist es entscheidender,<br />
dass er anschließend gut vernäht wird, damit er schnell und komplikationslos verheilt.<br />
1 Bei jeder natürlichen Geburt übt das Kind im Geburtskanal einen mechanischen Druck auf<br />
den Dickdarm aus, der dazu führt, dass während der Geburt fast immer etwas Stuhlgang abgeht.<br />
Diesen Stuhlgang kann die Gebärende auch nicht zurückhalten. Der von vielen Kliniken durchgeführte<br />
Einlauf dient dazu, den Darm vor der Geburt künstlich zu entleeren. Das hat für die<br />
Geburtshelfer den Vorteil, dass sie mit dem Stuhlgang nichts zu tun bekommen, wird aber von<br />
der Frau in der Regel als körperlich unangenehm empfunden und kann Schamgefühle auslösen.<br />
Besondere Infektionsrisiken für das Neugeborene entstehen durch den Stuhlgang in der Regel<br />
nicht; er ist vielmehr – wie gesagt – ein Teil des natürlichen Geburtsverlaufs.<br />
2 Das Rasieren der Schamhaare – vor allem beim Kaiserschnitt, z.T. aber auch bei natürlicher<br />
Geburt – wird mit hygienischen Aspekten begründet. Der tatsächliche Nutzen dieser Maßnahme<br />
ist jedoch umstritten. Da vielen Frauen das Rasieren der Schamhaare unangenehm ist, wird in<br />
vielen Kliniken bereits darauf verzichtet.<br />
Manche größere Kliniken sind als sogenanntes „Perinatalzentrum“ ausgebaut und<br />
verfügen über eine unmittelbar angeschlossene Neugeborenenintensivstation, in der<br />
früh- oder krank geborene Kinder sofort nach der Geburt intensivmedizinisch betreut<br />
werden können. Andere Kliniken verfügen außer der geburtshilflichen Abteilung noch<br />
über eine allgemeine Kinderklinik, in der die Neugeborenen ebenfalls intensivmedizinisch<br />
behandelt werden können. Ob für die eigenen Kinder eine solche Intensivbehandlung<br />
notwendig wird, lässt sich vor der Geburt nicht verlässlich vorhersagen. Es haben<br />
sich jedoch bestimmte Erfahrungswerte herausgebildet, die sich an der erreichten<br />
Schwangerschaftswoche und dem voraussichtlichen Geburtsgewicht der Kinder orientieren.<br />
Danach ist es dringend anzuraten, von vornherein eine Klinik mit der Möglichkeit<br />
einer Intensivbehandlung auszuwählen, wenn sich die Geburt vor Vollendung der 34.<br />
SSW ankündigt oder aufgrund des Schwangerschaftsverlaufs und der Voruntersuchungen<br />
zu erwarten ist, dass wenigstens eines der Kinder bei der Geburt unter 2.000 Gramm<br />
wiegt oder sonst besondere Frühreifezeichen aufweist. Würden Sie bei dieser Ausgangslage<br />
in einer normalen Geburtsklinik ohne Neugeborenenintensivversorgung entbinden,<br />
so würden Sie riskieren, dass Ihr(e) Kind(er) nach der Geburt in eine andere Klinik mit<br />
Intensivmedizin verlegt werden müssen. Die Verlegung aber stellt eine zusätzliche gefährliche<br />
Belastung für Ihr Neugeborenes dar. Sie schafft auch weitere Probleme allein<br />
dadurch, dass Sie selbst und ggf. das andere, gesunde Kind weiterhin in der ursprünglichen<br />
Geburtsklinik liegen und das verlegte Kind nicht einmal besuchen können. Nur<br />
dann, wenn Sie mit so plötzlichen Geburtswehen konfrontiert werden, dass Sie die Intensivklinik<br />
vielleicht nicht mehr rechtzeitig erreichen könnten, sollten Sie sich auch mit<br />
unreifen Kindern zur nächstgelegenen Geburtsklinik begeben, damit dort entschieden<br />
werden kann, ob die Zeit bis zur Geburt noch für Ihre Verlegung ausreicht, oder ob die<br />
Kinder an Ort und Stelle geboren und dann verlegt werden müssen.<br />
Liegen jedoch das voraussichtliche Geburtsgewicht und der Entwicklungsstand beider<br />
Kinder im unkritischen Bereich, steht Ihnen die Wahl der Geburtsklinik frei. Manche<br />
Eltern entscheiden sich auch dann noch für eine Klinik mit angeschlossener Neugeborenenintensivstation,<br />
weil sie glauben, dort gegen alle Eventualitäten besser gewappnet zu<br />
sein. Andere Eltern sind froh, auf die hochtechnisierte Umgebung verzichten zu können,<br />
und legen ihren Schwerpunkt eher auf eine freundliche Geburtsatmosphäre und möglichst<br />
professionelle Stillanleitung. Wenn Sie bei den in Ihrem Umfeld gelegenen Kliniken<br />
an einer Kreißsaalbesichtigung teilgenommen haben, wird Ihnen der ein oder andere<br />
Aspekt wichtig geworden sein. Entscheiden Sie sich dann für die Klinik, bei der Sie sich<br />
unter der Geburt wohl und sicher fühlen. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, sollten Sie sich<br />
in der Klinik persönlich vorstellen und zur Geburt anmelden. Vielleicht wird man in der<br />
43b
44a<br />
Klinik bereits eine Ultraschallaufnahme oder ein CTG anfertigen, um sich ein Bild von<br />
dem erreichten Entwicklungsstand und von der Lage der Kinder zu machen.<br />
Leider kann man das voraussichtliche Geburtsgewicht der Kinder nicht über Wochen<br />
im Voraus bestimmen, denn dieses hängt vor allem von der Dauer der Schwangerschaft<br />
ab, die sich durch eintretende Muttermundsschwäche und vorzeitige Wehen<br />
noch verkürzen kann. Daher kann es auch passieren, dass Sie sich bereits für eine<br />
normale Geburtsklinik entschieden hatten, und nun doch unvorhergesehen in einer<br />
Klinik mit Intensivstation entbinden müssen. Denken Sie dann möglichst auch daran,<br />
eine bereits festgemachte Anmeldung in der ursprünglich ausgewählten Geburtsklinik<br />
mit einem kurzen Telefonanruf wieder rückgängig zu machen.<br />
Bei höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften ist die Auswahl der Geburtsklinik<br />
von vornherein stark eingeschränkt. Hier werden fast immer die Voraussetzungen<br />
vorliegen, unter denen eine Neugeborenenintensivstation zumindest bereitstehen sollte.<br />
Stellen Sie sich dem Perinatalzentrum als Drillings- oder Vierlingsschwangere<br />
bereits in der Frühschwangerschaft vor. Die Ärzte des Perinatalzentrums haben in der<br />
Betreuung höhergradiger Mehrlingsschwangerschaften mehr Erfahrung als die meisten<br />
niedergelassenen Frauenärzte, weshalb die Zentren es zunehmend befürworten, die<br />
Schwangerschaft bereits von Beginn an in Absprache und im Wechsel mit dem niedergelassenen<br />
Frauenarzt mitzubetreuen. Problematische Entwicklungen können dadurch<br />
manchmal eher erkannt und sachgerechter behandelt werden. Wenn eine solche „Parallelbehandlung“<br />
an Ihrem Wohnort nicht üblich ist, sollten Sie erwägen, sich für die<br />
Dauer der Schwangerschaft gezielt in die Behandlung eines niedergelassenen Frauenarztes<br />
zu begeben, der in der Betreuung von höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften<br />
erfahren und mit deren Besonderheiten vertraut ist.<br />
b) Kaiserschnitt oder vaginale Geburt als Standard<br />
Der natürliche Geburtsverlauf sieht es vor, dass ein Kind aufgrund von Wehen in<br />
den Geburtskanal und schließlich durch die Scheide tritt. Der Mediziner bezeichnet<br />
dies als „vaginale“ oder „spontane“ Geburt 1 . Den Gegensatz hierzu bildet der Kaiserschnitt,<br />
bei dem das Kind durch die Bauchdecke hindurch operativ entbunden wird.<br />
Die Schnittentbindung wird in der Medizinersprache als „sectio“ oder „abdominale Geburt“<br />
bezeichnet.<br />
Vaginale Zwillingsgeburten stellen im Vergleich zu vaginalen Einlingsgeburten eine<br />
größere Herausforderung für den Geburtshelfer dar. Denn bei der Geburt des ersten<br />
Kindes kann der Geburtshelfer seine Aufmerksamkeit nicht auf diesen Geburtsvorgang<br />
beschränken, sondern er muss zusätzlich noch die Versorgungslage des zweiten Kindes<br />
berücksichtigen. Außerdem kann man im vorhinein nie genau wissen, welche Geburtslage<br />
der zweite Zwilling nach der Geburt des ersten Kindes letztendlich einnimmt. Durch<br />
geübte Handgriffe im rechten Moment kann der Geburtshelfer die Lage des zweiten<br />
Zwillings noch gezielt beeinflussen und während der Geburt verändern. Solche Maßnahmen<br />
müssen vom Geburtshelfer sicher beherrscht werden. Wegen dieser und anderer<br />
Besonderheiten gelten Zwillingsgeburten als „Risikogeburten“ und werden deshalb im<br />
Allgemeinen nur unter der Leitung von erfahrenen Oberärzten durchgeführt. Auf diese<br />
Weise lässt sich die Gefahr, dass während der Geburt eine unbeherrschbare Situation<br />
eintritt, minimieren. Ein gewisses Restrisiko verbleibt allerdings, denn jede Geburt verläuft<br />
individuell mit ihrer jeweils eigenen Dynamik. Auch bei Einlingsgeburten lässt<br />
sich nicht jedes Risiko ausschließen. Das zu akzeptieren ist in unserem von Technisierung<br />
geprägten Zeitalter allerdings nicht mehr selbstverständlich.<br />
Da das verbleibende Restrisiko bei Zwillingsgeburten höher ist als bei Einlingsgeburten,<br />
ist der Gedanke aufgekommen, Zwillingsgeburten standardmäßig als Kaiserschnittgeburt<br />
durchzuführen. Denn der Kaiserschnitt schaltet alle denkbaren Komplikationen<br />
einer natürlichen Geburt mit einem Mal aus. Besonders im nachhinein, wenn es<br />
ausnahmsweise tatsächlich zu einem tragischen Geburtsverlauf gekommen ist, fällt es<br />
leicht anzuklagen, dass ein Kaiserschnitt dieses spezifische Geburtsrisiko umgangen<br />
hätte.<br />
Eine vergleichende Betrachtung von natürlicher Geburt und Kaiserschnitt darf allerdings<br />
nicht unterschlagen, dass jeder Kaiserschnitt erhebliche eigene Risiken birgt,<br />
vor allem für die Gebärende. Denn der Kaiserschnitt stellt immerhin eine große Bauchoperation<br />
dar mit Risiken wie Thrombosen, lebensgefährlichen Embolien, erheblichen<br />
Blutungen mit der möglichen Folge eines Gebärmutterverlustes, Infektionen, Störungen<br />
der Darmfunktion, Verletzungen der Harnblase, Wundheilungsstörungen, Gebärmutterrissen<br />
bei späteren Schwangerschaften sowie anderen Gefahren. Hinzu kommen die<br />
allgemeinen Narkoserisiken und in jedem Fall hinterlässt der Eingriff eine Schnittwunde.<br />
Zwar ist die Müttersterblichkeit bei Kaiserschnittentbindung in den letzten Jahrzehn-<br />
44b<br />
1 lateinisch „vagina“ = Scheide, „sua sponte“ = aus eigenem Antrieb
45a<br />
ten erheblich gesunken, sie wird aber noch immer mit rund zweieinhalb mal höher<br />
angegeben als bei vaginaler Entbindung.<br />
Dagegen ist die vaginale Geburt zwar mit Schmerzen verbunden, letztlich aber<br />
nahezu ohne Risiko für die Mutter. Selbst das geringe Risiko einer späteren Beckenboden-<br />
und Schließmuskelfunktionsstörung kann bei Zwillingsgeburten vernachlässigt<br />
werden, weil die Köpfchen von Zwillingskindern in aller Regel viel zu <strong>klein</strong> sind, um<br />
solche Schädigungen verursachen zu können.<br />
Für das Kind ist die vaginale Geburt vorteilhaft, weil bei dem Durchschreiten des<br />
Geburtskanals das Fruchtwasser aus der Lunge und aus den kindlichen Atemwegen<br />
gepresst wird, so dass vaginal geborene Kinder unmittelbar nach der Geburt selbständig<br />
atmen können. Demgegenüber kann es bei Kaiserschnittkindern zu einer „nassen<br />
Lunge“ (Flüssigkeitslunge) kommen mit z.T. ernsten Atemschwierigkeiten. Zumindest<br />
muss das restliche Fruchtwasser nach der Kaiserschnittgeburt durch die Nase abgesaugt<br />
werden. Das Absaugen hat jedoch wiederum den Nachteil, dass neben dem<br />
Fruchtwasser ungewollt auch die natürliche Schleimschicht mit wichtigen Abwehrstoffen<br />
abgesaugt wird. Manche Kaiserschnittkinder haben außerdem einen auffallend<br />
schlechteren Allgemeinzustand oder eine zu hohe Atemfrequenz. Als Ursachen hierfür<br />
vermutet man einerseits das der Mutter verabreichte Betäubungsmittel und andererseits<br />
das Fehlen der Stimulation, die mit der Geburtsanstrengung einer vaginalen Geburt<br />
verbunden wäre. In seltenen Fällen sind sogar schon Kinder durch das chirurgische<br />
Schnittmesser (Skalpell) verletzt worden, vor allem nach einem vorangegangenen<br />
Blasensprung.<br />
Verhaltensforscher des Andechser Max-Planck-Institutes wollen überdies noch<br />
herausgefunden haben, dass der Einfluss des Wehenhormons Oxytocin auf die Kinder<br />
eine wichtige Bedeutung habe für die Herstellung der Eltern-Kind-Bindung nach der<br />
Geburt. Auch dieser positive Einfluss entfällt bei einer Schnittentbindung.<br />
Und schließlich ist nachgewiesen, dass die Schnittentbindung eine erhebliche Gefahr<br />
für nachfolgende Schwangerschaften bedeutet: das kindliche Sterberisiko vor und<br />
während der Geburt steigt um ca. 50%.<br />
Eine Gegenüberstellung aller Vorteile und Risiken der verschiedenen Geburtsarten<br />
spricht daher im Allgemeinen auch bei <strong>Zwillinge</strong>n für die natürliche Geburt. Stand<br />
der medizinischen Wissenschaft ist es daher, dass die Tatsache einer Zwillingsschwangerschaft<br />
für sich genommen keinen Grund für einen geplanten Kaiserschnitt<br />
darstellt.<br />
Trotzdem gibt es Mediziner, die die Durchführung natürlicher Zwillingsgeburten<br />
grundsätzlich ablehnen und ausschließlich Kaiserschnitte durchführen.<br />
In manchen Perinatalzentren ist diese Einstellung nachvollziehbar, weil man dort<br />
schwerpunktmäßig mit besonderen Komplikationen und Risikosituationen zu tun hat, die<br />
eine vaginale Geburt regelmäßig ausschließen. Dann macht es durchaus Sinn, die medizinischen<br />
Fertigkeiten auf solche Spezialanforderungen zu konzentrieren.<br />
Bei manch anderen Medizinern ist die ablehnende Haltung gegenüber vaginalen<br />
Zwillingsgeburten jedoch weder durch eine anderweitige Spezialisierung noch in erster<br />
Linie aus der Sorge um das Wohl der Gebärenden und der Kinder begründet, sondern<br />
(zumindest auch) aus reinem Selbstschutz des Arztes. Denn über jeder Geburt schwebt<br />
das Damoklesschwert eines anschließenden ärztlichen Kunstfehlerprozesses, und in<br />
dieser Hinsicht sind vaginale Zwillingsgeburten für den Arzt erheblich riskanter als der<br />
Kaiserschnitt. Denn zum einen ist die natürliche Zwillingsgeburt schwieriger durchzuführen<br />
und verlangt besonderes Können. Häufiger als bei Einlingsgeburten kommt es zu<br />
kritischen Situationen, in denen der Arzt schnell eine richtige Entscheidung treffen und<br />
die richtigen Maßnahmen ergreifen muss. An diesen Maßstäben wird das ärztliche Handeln<br />
in der Nachschau auch beurteilt. Zum anderen besteht jedoch selbst dann die Gefahr<br />
einer haftungsrechtlichen Inanspruchnahme, wenn eine Geburt ohne Verschulden<br />
des Arztes misslang. Denn die Justiz ist schnell bei der Hand, dem Arzt im nachhinein<br />
vorzuhalten, er habe doch den Kaiserschnitt als Handlungsalternative in Betracht ziehen<br />
sollen. Manche Ärzte sehen darin für sich insgesamt ein zu hohes persönliches Haftungsrisiko,<br />
welches einzugehen sie nicht bereit sind.<br />
Demgegenüber bedeutet der Kaiserschnitt für den Arzt praktisch kein Haftungsrisiko.<br />
Denn die meisten Risiken des Kaiserschnitts gelten aufgrund ihrer besonderen Eigenart<br />
als unbeherrschbar und schicksalhaft und führen daher – auch wenn schlimme<br />
Folgen eintreten – im Allgemeinen nicht zu einer ärztlichen Haftung. Der Arzt ist also –<br />
anders als der Patient – bei einem Kaiserschnitt fast immer auf der „sicheren Seite“,<br />
sofern er ihn nur fachgerecht ausführt.<br />
Obgleich das Geburtsrisiko einer vaginalen Geburt also grundsätzlich geringer ist,<br />
ist das Haftungsrisiko des Arztes bei dieser Geburtsart höher. Dieser Zusammenhang hat<br />
vor allem in den Ländern, in denen die gerichtsüblichen Schmerzensgelder unermessli-<br />
45b
46a<br />
che Höhen erreichen, zu einem sprunghaften Anstieg der Kaiserschnittrate geführt. In<br />
den USA beispielsweise wurden bereits weit über 30% der Kinder (auch Einlinge!) mit<br />
einem geplanten Kaiserschnitt zur Welt gebracht, bevor dieser Prozentsatz in den<br />
letzten Jahren durch ein gezieltes Regierungsprogramm wieder etwas gesenkt werden<br />
konnte. Tatsächlich medizinisch gerechtfertigt sind nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation<br />
jedoch höchstens 10-15%. In Deutschland lag die Kaiserschnittrate<br />
im Jahre 2004 bei 29%, also doppelt so hoch wie medizinisch erforderlich. Jeder dritte(!)<br />
deutsche Geburtshelfer hat in einer Umfrage Ende der achtziger Jahre offen zugegeben,<br />
dass er aus Angst vor einem Kunstfehlerprozess großzügiger zum Kaiserschnitt<br />
greift, als es nach seiner medizinischen Überzeugung und seinem fachlichen<br />
Wissen erforderlich wäre 1 .<br />
Darüber hinaus werden noch weitere nicht medizinische Gründe vermutet, die dazu<br />
führen, dass häufiger als notwendig zum Kaiserschnitt angesetzt wird. Marie-<br />
Elisabeth Lange-Ernst, Pressesprecherin des Berufsverbandes der Frauenärzte, weiß<br />
beizutragen, dass „viele Mediziner es mögen, wenn die Kinder nicht nachts oder am<br />
Wochenende kommen, sondern vor dem errechneten Termin auf dem OP-Plan stehen“.<br />
Magdalene Weiß, die Präsidentin des Bundes deutscher Hebammen, bringt ins Spiel,<br />
dass ein Kaiserschnitt der Klinik rund das Doppelte an Einnahmen beschert gegenüber<br />
einer normalen Geburt.<br />
Leider haben steigende Kaiserschnittraten gleichzeitig zur Folge, dass das Wissen<br />
und die Erfahrung der Geburtshelfer in der Leitung natürlicher Zwillingsgeburten<br />
verloren gehen. Daher ist es ratsam, sich bei der Geburtsklinik vorab über die Kaiserschnittrate<br />
bei <strong>Zwillinge</strong>n zu erkundigen. Auf keinen Fall sollten Sie in einer solchen<br />
Klinik auf einer vaginalen Entbindung bestehen, in der <strong>Zwillinge</strong> ansonsten nur per<br />
Kaiserschnitt entbunden werden. Denn die Unerfahrenheit der dortigen Geburtshelfer<br />
mit natürlichen Zwillingsgeburten wäre dann ein wirklich ernst zu nehmendes Geburtsrisiko.<br />
c) Kaiserschnitt wegen besonderer Risiken oder Komplikationen<br />
Obgleich also die vaginale Geburt einem Kaiserschnitt grundsätzlich vorzuziehen<br />
ist, gibt es einige Fälle, in denen besondere medizinische Gründe einer vaginalen Entbindung<br />
entgegen stehen und es tatsächlich erforderlich wird, die Schwangerschaft mit<br />
einem Kaiserschnitt zu beenden:<br />
- Beckenendlage oder Querlage des vorn liegenden Kindes<br />
Wenn sich das vorn liegende Kind in Beckenendlage oder in Querlage einstellt, ist<br />
die vaginale Geburt nur sehr schwer oder überhaupt nicht möglich, so dass ein Kaiserschnitt<br />
erforderlich wird. Es gibt zwar unter den Geburtshelfern einige „Spezialisten<br />
für besonders schwierige Geburtslagen“, die auch in dieser Situation noch<br />
versuchen, ohne Kaiserschnitt auszukommen. Die Geburt aus Beckenendlage des<br />
vorn liegenden Kindes ist jedoch immer mit einem erhöhten Geburtsrisiko verbunden<br />
und kann deshalb nicht allgemein empfohlen werden. Wenn man es trotzdem<br />
versuchen will, ist strenge Voraussetzung für das Gelingen der vaginalen Geburt<br />
auf jeden Fall eine „komplikationslose“ Beckenendlage, d.h. ein passendes Geburtsgewicht<br />
der Kinder, möglichst eine bereits vorangegangene Schwangerschaft<br />
(so dass der Geburtskanal schon einmal geweitet war) und die Erfüllung noch weiterer<br />
Kriterien. Trotzdem raten wir davon ab, weil mit der Zwillingsschwangerschaft<br />
einerseits und der Beckenendlage andererseits letztlich mehrere Geburtsrisiken<br />
zusammentreffen, deren Beherrschung im Einzelfall auch eine Portion Glück<br />
erfordert.<br />
Dagegen ist die Lage des zweiten Kindes vergleichsweise unkritisch: Es kann relativ<br />
problemlos auch aus Beckenendlage vaginal geboren werden, da der Geburtskanal<br />
nach dem Durchschreiten des ersten Kindes bereits geweitet ist. Falls das zweite<br />
Kind in Querlage liegt, kann es nach der Geburt des ersten Kindes durch einen speziellen<br />
Handgriff des erfahrenen Geburtshelfers meist noch gedreht werden (sog.<br />
äußere Wendung). Nur wenn das zweite Kind mit einem Gewicht unter 2.000<br />
Gramm in Beckenendlage oder Querlage liegt, empfehlen viele Geburtshelfer auch<br />
hier den Kaiserschnitt.<br />
46b<br />
- Höhergradige Mehrlingsschwangerschaft.<br />
1 Zitiert nach H. Albrecht u.a., in: Der Frauenarzt, Band 7 (1989), S. 685-692<br />
Ab Vierlingen ist der Kaiserschnitt nach einhelliger Meinung unausweichlich, bei<br />
Drillingen ist die Frage umstritten. Die vaginale Geburt von Drillingen kommt jedenfalls<br />
nur nach komplikationsloser Schwangerschaft und bei Erreichen einer be-
47a<br />
47b<br />
stimmten Schwangerschaftsdauer in Betracht. In einer Einzelstudie der Pariser<br />
Universitätsklinik über 23 vaginale Drillingsgeburten erreichten diese Kinder –<br />
abgesehen von einem aufgetretenen Todesfall – einen durchschnittlich besseren<br />
Allgemeinzustand gegenüber Kaiserschnittkindern und bedurften anschließend<br />
auch nur einer erheblich kürzeren medizinischen Behandlung. In Deutschland ist<br />
die vaginale Drillingsgeburt jedoch nicht weit verbreitet, vielmehr wird in den<br />
meisten Kliniken auch bei komplikationslosen Schwangerschaften durchgehend<br />
der Kaiserschnitt gewählt. Damit sollte man sich dann auch abfinden, denn es<br />
fehlt den meisten Geburtshelfern zumindest die praktische Erfahrung, die für die<br />
gefahrlose Durchführung einer vaginalen Drillingsgeburt erforderlich wäre.<br />
- Frühgeburt.<br />
Kinder, die vor etwa der 34. SSW zur Welt kommen bzw. unter 1500 Gramm wiegen<br />
oder sonst besondere Unreifezeichen aufweisen, wurden ebenfalls per Kaiserschnitt<br />
geholt. Sie sind noch nicht ausreichend gestärkt, um die mit dem Durchschreiten<br />
des Geburtskanals verbundenen körperlichen Belastungen gefahrlos zu<br />
verkraften. Bei sehr <strong>klein</strong>en Kindern kann es vor allem zu Hirnblutungen kommen.<br />
Besonders gefährlich würde es, wenn ein Geburtsstillstand einträte und der<br />
Geburtshelfer den Kindern mittels Saugglocke, Geburtszange oder speziellen<br />
Handgriffen heraushelfen müsste. Zwar wird der Kaiserschnitt bei Einlings-<br />
Frühgeborenen seit einigen Jahren nicht mehr als strenges Dogma gehandhabt,<br />
sondern zunehmend einer jeweiligen Einzelfallentscheidung Raum gegeben. Dennoch<br />
empfiehlt es sich im allgemeinen nicht, das erhöhte Geburtsrisiko der Frühgeborenen<br />
noch mit weiteren Besonderheiten der Zwillingsgeburt zu überlagern.<br />
- Erhebliche Gewichtsunterschiede zwischen den Kindern, wenn das leichtere<br />
Kind vorn liegt.<br />
Wiegt der hintere Zwilling über 500 Gramm mehr als der vordere Zwilling (absoluter<br />
Gewichtsunterschied) oder übersteigt das Gewicht des hinteren Zwillings<br />
das des vorderen um ein Fünftel (relativer Gewichtsunterschied), so kann der hinten<br />
liegende Zwilling den Geburtsvorgang des vorderen Zwillings aufgrund seiner<br />
größeren Masse nachteilig beeinflussen. Auch für den hinteren Zwilling bestehen<br />
dann erhöhte Geburtsgefahren. Diese Konstellationen sind jedoch selten, weil bei<br />
erheblichen Gewichtsunterschieden fast immer der schwerere Zwilling vorn liegt.<br />
Wenn der hintere Zwilling schwerer ist und zusätzlich noch in Querlage oder in<br />
Beckenendlage liegt, wird ein Kaiserschnitt auch schon bei geringeren Gewichtsdifferenzen<br />
empfohlen.<br />
- In sich verkeilte <strong>Zwillinge</strong>.<br />
Hier behindern sich beide Kinder gegenseitig am Austritt durch den Muttermund.<br />
Diese Komplikation kommt nur sehr selten (circa bei einer von tausend Zwillingsgeburten)<br />
und fast ausschließlich bei eineiigen, monochorialen <strong>Zwillinge</strong>n vor.<br />
- Tiefer Sitz einer der Mutterkuchen (Plazenta praevia).<br />
Normalerweise nistet sich die befruchtete Eizelle im oberen Teil der Gebärmutter<br />
ein, so dass der Mutterkuchen am oberen Bereich der Gebärmutterwand anhaftet,<br />
genügend weit entfernt vom Muttermund. Aus verschiedenen Gründen – bei <strong>Zwillinge</strong>n<br />
häufiger als bei Einlingen – kann es jedoch dazu kommen, dass einer der<br />
Mutterkuchen sich in der Nähe des Muttermundes einnistet oder sich im Laufe der<br />
Schwangerschaft bis dahin ausdehnt. Bei der Geburt liegt der Mutterkuchen dann<br />
quasi vor dem Ausgang „im Weg“. Würde man das Kind auf natürliche Weise gebären,<br />
käme es während des Geburtsvorgangs zu einer vorzeitigen Ablösung des Mutterkuchens,<br />
was für die Mutter gefährliche Blutungen und für das Kind einen akuten<br />
Sauerstoffmangel bedeuten kann.<br />
- Gefäßverbindungen (Gefäßanastomosen) bei monochorialen eineiigen<br />
<strong>Zwillinge</strong>n.<br />
Dieser Fall ist oben auf Seite 26 angesprochen.<br />
Hinzu kommen die allgemeinen, nicht zwillingsspezifischen Indikationen für einen<br />
Kaiserschnitt, wie z.B. eine um den Hals geschlungene Nabelschnur, zu hoher Blutdruck<br />
(Gestose), eine diabetische Erkrankung der Mutter, vorzeitige Ablösung des Mutterkuchens<br />
von der Gebärmutter, Wehenschwäche unter der Geburt usw.<br />
Liegt eine der medizinischen Indikationen vor, so ist der Kaiserschnitt dringend zu<br />
empfehlen. Wenn wir im vorausgegangenen Kapitel darüber berichtet haben, dass mittlerweile<br />
viele Kaiserschnitte ohne zwingende medizinische Notwendigkeit durchgeführt<br />
werden, so darf dies natürlich nicht dazu führen, von Seiten der Patienten nunmehr jedweden<br />
Kaiserschnitt generell in Frage zu stellen. Wenn der Arzt den Kaiserschnitt für<br />
erforderlich hält, spricht vieles dafür, dass das auch tatsächlich so ist. Aber es muss<br />
Ihnen als Schwangere erlaubt sein, die Wunschvorstellung einer vaginalen Entbindung<br />
noch einmal ausdrücklich vorzubringen und den Arzt danach zu fragen, ob es in der<br />
konkreten Situation nicht ein gangbarer Weg wäre, die natürliche Geburt zunächst einmal<br />
zu versuchen. Wenn der Arzt dies verneint, sollten Sie ihm vertrauen und sich tunlichst<br />
an seine Empfehlung halten, da Sie selbst die Gefährlichkeit der Situation letztlich
48a<br />
nicht einschätzen können. Keinesfalls sollten Sie Ihre Einwilligung zum Kaiserschnitt<br />
verweigern, wenn der Arzt Ihnen von einer vaginalen Entbindung dringend abrät.<br />
Nun aber zum Schluss des Kapitels noch etwas Positives, denn <strong>Zwillinge</strong> haben<br />
im Zusammenhang mit Kaiserschnitt auch ihr Gutes: Eine der Komplikationen, die den<br />
Kaiserschnitt bei Einlingen mit am häufigsten verursacht, kommt bei <strong>Zwillinge</strong>n sozusagen<br />
nie vor: dass nämlich das mütterliche Becken für den Durchtritt des Köpfchens<br />
zu schmal ist.<br />
d) Geburtsverlauf bei Kaiserschnitt<br />
Wenn ein Kaiserschnitt aus einem der genannten Gründe ansteht, so stellt sich die<br />
Alternative, ihn entweder in Vollnarkose oder in regionaler Betäubung des Beckenraumes<br />
(Spinal- oder Periduralanästhesie) durchzuführen. Bei einer Vollnarkose geht<br />
ein Teil des verabreichten Betäubungsmittels in den kindlichen Blutkreislauf über, so<br />
dass die Kinder nach der Geburt bis zu mehreren Stunden schlaff und antriebslos sein<br />
können. Schon deshalb ist die regionale Betäubung aus medizinischer Sicht vorzuziehen.<br />
Außerdem hat die regionale Betäubung den Vorteil, dass die Mutter die ganze<br />
Zeit über wach bleibt und die Kinder, wenn sie nicht sofort medizinisch betreut werden<br />
müssen, gleich nach der Geburt zu Gesicht bekommt. Von einer regionalen Betäubung<br />
erholt man sich auch wesentlich schneller und sie ist insgesamt risikoärmer als<br />
die Vollnarkose. Sie wird deshalb zunehmend gewählt und in vielen Kliniken nur dann<br />
nicht in Betracht gezogen, wenn die Schwangere sich nicht mehr ausreichend beugen<br />
kann (was beim Anlegen der Anästhesie erforderlich ist) oder wenn die mit der regionalen<br />
Anästhesie verbundene Blutdrucksenkung für den Kreislauf schädlich wäre. In<br />
einigen Kliniken wird bei regionaler Anästhesie sogar die Anwesenheit des Partners<br />
während des Kaiserschnitts zugelassen, der dann Beistand leisten und sich später um<br />
die Kinder kümmern kann.<br />
Seien Sie dann im Operationssaal von vornherein auf eine gewisse Betriebsamkeit<br />
vorbereitet, wenn Geräte eingestellt, Operationsbestecke zurechtgelegt und letzte Absprachen<br />
getroffen werden. Lassen Sie sich auch von einer höheren Anzahl an Personen<br />
nicht aus der Ruhe bringen: Mit dem Operateur, dem Narkosearzt, den Assistenten<br />
und OP-Schwestern sowie je einem Ärzte- und Schwesternteam für jedes Kind können<br />
sich bei einer Vierlingsentbindung z.B. ohne weiteres zwanzig Personen und mehr<br />
einfinden.<br />
Wird der Kaiserschnitt nach der neueren und schonenderen MISGAV-LADACH-<br />
Methode durchgeführt, so ist er nach 15-25 Minuten beendet und Sie sind schon bald<br />
wieder auf dem Damm. Bei dieser Kaiserschnitt-Methode werden die Bauchdecke und<br />
das Muskelgewebe nicht mehr komplett mit dem Messer durchtrennt, sondern in weiten<br />
Teilen nur stumpf gedehnt. Nach der Operation müssen weniger Schichten genäht werden<br />
und die Schnittwunde verheilt erheblich schneller als bei der herkömmlichen Methode.<br />
Der Blutverlust ist geringer und es wird für den Eingriff nur etwa die halbe Zeit<br />
benötigt. Den medizinischen Vorteilen dieser Methode steht allerdings ein kosmetischer<br />
Nachteil gegenüber: Die zurückbleibende Operationsnarbe liegt etwas höher (oberhalb<br />
der Schamhaargrenze) und bleibt daher sichtbar. Neueste Operationsmethoden versuchen<br />
die Vorteile der MISGAV-LADACH-Methode mit einer möglichst tiefen Bauchdeckenöffnung<br />
zu verbinden, um damit dem kosmetischen Empfinden entgegenzukommen.<br />
Wendet die Klinik noch die herkömmliche Methode an (sog. „Pfannenstielschnitt“),<br />
dauert die Operation etwa doppelt so lange und heilt etwas langsamer.<br />
e) Geburtsverlauf bei vaginaler Geburt<br />
Wenn Sie eine vaginale Geburt anstreben und nicht ohnehin schon stationär in die<br />
Geburtsklinik aufgenommen sind, sollten Sie sich als Erstgebärende dorthin aufmachen,<br />
wenn die natürlichen Wehen im Abstand von etwa 10 Minuten zu spüren sind. Ab der<br />
zweiten Geburt soll die Klinik bereits bei 15-minütigem Wehenabstand aufgesucht werden,<br />
weil die Geburt dann oft schneller verläuft. Fragen Sie Ihren Frauenarzt, ob diese<br />
allgemeine Empfehlung auch für Ihre persönliche Situation zutrifft.<br />
Natürliche Zwillingsgeburten dauern in der Eröffnungsphase meist etwas länger als<br />
Einlingsgeburten, weil die Wehen infolge der Gebärmutterüberdehnung nicht so stark<br />
sind. Demgegenüber ist die Austreibungsphase oft kürzer, weil die Kinder im Allgemeinen<br />
<strong>klein</strong>er sind als Einlinge und leichter durch den Geburtskanal passen.<br />
Ansonsten unterscheiden sich Zwillingsgeburten nicht wesentlich von Einlingsgeburten<br />
– außer dass nach der Geburt des ersten Kindes anstelle der Nachgeburt noch ein<br />
zweites Kind ansteht. Das zweite Kind kommt meist innerhalb weniger Minuten, nach<br />
drei oder vier weiteren Wehen. Es verursacht in der Regel keine weiteren Beschwerden,<br />
da der Geburtskanal bereits weit geöffnet ist. Wenn die Gebärmutter vor der Geburt des<br />
48b
49a<br />
ersten Kindes stark überdehnt war, spüren Sie jetzt vielleicht zum ersten Mal die volle<br />
Energie und Kraft einer „richtigen“ Wehe.<br />
Manchmal muss der Versuch einer vaginalen Geburt allerdings abgebrochen und<br />
auf einen Kaiserschnitt umgeschwenkt werden. Grund hierfür ist meist ein Geburtsstillstand:<br />
Die Gebärmutter ist überdehnt und kann durch Zusammenziehen nicht mehr<br />
die erforderliche Kraft aufbringen, um den Muttermund zu öffnen bzw. die Kinder<br />
herauszupressen. Die dann erforderliche Änderung des Geburtsmodus bedeutet für<br />
viele Frauen eine Enttäuschung, ist aber medizinisch ohne Alternative.<br />
Wenn die Geburt bis zum Ende vaginal durchgeführt werden kann, was meistens<br />
der Fall ist, muss man mit einem Dammschnitt rechnen. Dabei geht es nicht in erster<br />
Linie darum, den Scheidendamm vor einem drohenden Dammriss zu bewahren, denn<br />
das würde bei den <strong>klein</strong>en Köpfchen der Zwillingskinder ohnehin nur selten passieren.<br />
Vielmehr erleichtert der Dammschnitt das Durchtreten der Köpfchen. Dadurch werden<br />
die ohnehin oft zierlichen Mehrlingskinder geschont, und vor allem dient dies der<br />
Beschleunigung der Geburt. Das ist wichtig, weil mit zunehmender Dauer der Presswehen<br />
für das zweite Kind die Gefahr einer Sauerstoffunterversorgung steigt.<br />
Ebenso wird es häufiger als bei Einlingen erforderlich, den Geburtsvorgang mithilfe<br />
einer Saugglocke oder Geburtszange zu beenden. Denn manchmal kann die überdehnte<br />
Gebärmutter nicht genügend Kraft aufbringen, um das Kind vollständig durch<br />
den Geburtskanal zu pressen, und zum Schutz des zweiten Kindes soll man hierfür<br />
auch nicht zuviel Zeit geben.<br />
Nach der Geburt ist es meistens nicht möglich, die Kinder auf den Bauch der<br />
Mutter zu legen und die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, sondern <strong>Zwillinge</strong> werden<br />
in aller Regel sofort abgenabelt und zum sog. „Reanimationstisch“ gebracht. Das<br />
bedeutet aber nicht automatisch, dass mit Ihren Kindern etwas nicht stimmt. Man will<br />
vor allem verhindern, dass die Kinder auf dem Bauch der Mutter zu viel Körperwärme<br />
verlieren. Denn <strong>Zwillinge</strong> haben in der Regel ein geringes Geburtsgewicht und verfügen<br />
nur über wenige Fettreserven. Die Körperoberfläche ist im Verhältnis zum Körpergewicht<br />
relativ groß, weshalb die Kinder übermäßig viel Wärme an die umgebende<br />
Luft abgeben. Auf dem Reanimationstisch sind sie durch eine spezielle Wärmelampe<br />
vor dem Auskühlen geschützt und können dann erst einmal bekleidet oder in warme<br />
Tücher eingewickelt werden, bevor die Eltern sie in die Arme nehmen.<br />
f) Kaiserschnitt für das zweite Kind<br />
In seltenen Fällen (weniger als 3% der Zwillingsgeburten) wird es sogar erforderlich,<br />
nach der vaginalen Geburt des ersten Zwillings noch auf einen Kaiserschnitt für<br />
den zweiten Zwilling umzuschwenken. Folgende Gründe können eine solche Entscheidung<br />
notwendig machen:<br />
- Armvorfall: Während der Geburt des ersten Kindes entsteht in der Gebärmutter<br />
ein leerer Raum, der das zweite Kind tiefer vor den Muttermund rutschen<br />
lässt. Dabei kann es passieren, dass ein Arm als vorderstes Teil des<br />
zweiten Kindes durch den Muttermund in den Geburtskanal gerät. In dieser<br />
Lage kann das zweite Kind nicht vaginal geboren werden.<br />
- Nabelschnurvorfall: Ebenso kann sich die Nabelschnur des zweiten Kindes<br />
vor den Muttermund legen. Auch in dieser Situation kann das zweite Kind<br />
zumeist nicht vaginal geboren werden.<br />
- Missglückte Wendung bei Beckenendlage und Querlage des zweiten Kindes:<br />
Ungünstige Geburtslagen des zweiten Zwillings können in den meisten<br />
Fällen durch geeignete Handgriffe während der Geburt des ersten Kindes<br />
hin zu einer Schädellage gedreht werden. Wenn das ausnahmsweise nicht<br />
gelingt, kann ein Kaiserschnitt erforderlich werden.<br />
- Verzögerung bei der Geburt des zweiten Kindes: Das zweite Kind sollte<br />
grundsätzlich möglichst bald nach dem ersten geboren werden. Denn mit<br />
der Geburt des ersten Kindes verringert sich die Größe der Gebärmutter.<br />
Auf diese veränderte Situation ist der Mutterkuchen des zweiten Kindes<br />
nicht eingerichtet; seine Haftung an die Gebärmutterwand kann nachlassen.<br />
Beträgt die Dauer zwischen den Geburten länger als etwa 10 bis 20 Minuten,<br />
wächst die Gefahr einer teilweisen oder sogar vollständigen Ablösung<br />
des Mutterkuchens von der Gebärmutterwand. Die Sauerstoffzufuhr vermindert<br />
sich und es kommt zu einem Säureanstieg im Blut des Kindes bis<br />
hin zum akuten Sauerstoffmangel. Ein längeres Zuwarten ist daher nur<br />
möglich, wenn und solange die Herztöne (CTG) des zweiten Kindes in<br />
Ordnung sind. Ansonsten muss das zweite Kind per Kaiserschnitt geholt<br />
werden.<br />
Wegen dieser möglichen Wendungen im Geburtsverlauf sollte man nicht nur in der<br />
Endphase der Geburt keine Speisen mehr zu sich nehmen, sondern darüber hinaus in<br />
Betracht ziehen, rechtzeitig eine PDA (Periduralanästhesie) legen zu lassen. Falls dann<br />
49b
50a<br />
ein Wechsel des Geburtsmodus erforderlich wird, kann die für den Kaiserschnitt erforderliche<br />
Betäubung durch die PDA vorgenommen werden, während ansonsten eine<br />
Vollnarkose notwendig wäre. Eine PDA zu diesem Zeitpunkt neu anzulegen ist wegen<br />
der gebotenen Eile zumeist nicht mehr möglich. Tritt unter der Geburt allerdings eine<br />
spontane Notfallsituation ein, so kann unter Umständen nicht einmal eine bereits angelegte<br />
PDA verwendet werden, weil die Wirkung des Betäubungsmittels erst nach etwa<br />
20 Minuten einsetzt 1 . In solchen Fällen besteht keine Alternative zur Vollnarkose, die<br />
praktisch ohne nennenswerte Zeitverzögerung durchgeführt werden kann.<br />
2. Nach der Geburt<br />
a) Zustand der Mutter<br />
An den Zustand der Mutter wird nach der Geburt im Allgemeinen nicht so viel<br />
gedacht wie an die Kinder, obwohl sie mit der Schwangerschaft und der Geburt eine<br />
enorme Anstrengung gemeistert hat. Um dies zu würdigen, erwähnen wir die Mutter<br />
zuerst.<br />
Die Mutter gebiert noch die Nachgeburt und ein eventueller Dammschnitt wird<br />
genäht, ohne dass dies nach all der Anstrengung noch nennenswert belastet: Freude<br />
und Erleichterung, es geschafft zu haben, werden überwiegen. Der weitere Gang der<br />
Dinge unterscheidet sich – was das Medizinische betrifft – von Einlingsgeburten nur<br />
noch in wenigen Einzelheiten:<br />
aa) Atonische Nachblutung<br />
Es kommt bei Zwillingsschwangerschaften leicht zu einer Überbeanspruchung der<br />
Gebärmutter bis hin zu einer regelrechten Überdehnung während der Schwangerschaft.<br />
Nach der Geburt kann dies dazu führen, dass die Gebärmutter erschlafft und sich nicht<br />
1 Das schmerzlindernde Mittel, welches gewöhnlich unter der Geburt eingesetzt wird, ist für<br />
die Durchführung einer Kaiserschnittoperation nicht ausreichend. Hierzu muss ein anderes,<br />
hochwirksames Betäubungsmittel verabreicht werden, dessen Wirkung sich erst allmählich<br />
aufbaut.<br />
mehr vollständig zusammenziehen kann, wie es sonst geschieht. Das Zusammenziehen<br />
der Gebärmutter ist aber erforderlich, um den Mutterkuchen von der Gebärmutterwand<br />
zu lösen und ihn nachzugebären, sowie anschließend die Gefäßverbindungen zu verschließen,<br />
die den Mutterkuchen mit Nährstoffen und Blutsauerstoff versorgt haben. Ist<br />
die Gebärmutter nicht mehr in der Lage, sich vollständig zusammenzuziehen, so kann es<br />
an der Nahtstelle des Mutterkuchens (Plazentahaftfläche) zu Blutungen kommen. Das<br />
Blut sammelt sich eine Weile in der Gebärmutter, um sich dann in einem Schwall zu<br />
entleeren. Solche Nachblutungen stellten in früheren Zeiten eine ernste Gefahr und häufige<br />
Todesursache für die Mutter dar, während sie heutzutage in den allermeisten Fällen<br />
schnell und sicher durch entsprechende Infusionen und Medikamente gestoppt werden<br />
können. Die Menge an verlorenem Blut sieht oft gewaltiger aus, als sie tatsächlich ist;<br />
nur in seltenen Extremfällen ist eine zusätzliche Versorgung mit Blutkonserven nötig.<br />
Um solchen Nachblutungen von vornherein vorzubeugen, wird Zwillingsmüttern entweder<br />
noch während der Geburt (nach dem Austritt des zweiten Köpfchens) oder sofort<br />
nach der Geburt ein weiteres hochdosiertes Wehenmittel (Oxytocin) gegeben, um die<br />
Gebärmutter zum Zusammenziehen noch einmal besonders anzuregen. Damit lassen sich<br />
Nachblutungen in fast allen Fällen vermeiden. Ein Blutverlust von bis zu einem halben<br />
Liter ist bei Geburten übrigens völlig normal und gilt noch nicht als komplikationshafte<br />
„Nachblutung“ im medizinischen Sinne.<br />
bb) Gesundheitlicher Allgemeinzustand<br />
Frauen, die Mehrlinge ausgetragen haben, haben eine außergewöhnliche Schwangerschaft<br />
hinter sich, die den Körper für eine geraume Zeit übermäßig belastet hat. Nach<br />
der Geburt täte eigentlich eine Phase der Erholung ganz gut. Leider wird sie nicht gewährt.<br />
Im Gegenteil: Zwillingsmütter haben noch weniger Zeit und Ruhe für sich und<br />
ihre körperliche Wiederherstellung als andere Mütter, weil die Kinder gleich ein Mehrfaches<br />
an Aufmerksamkeit einfordern und an Pflegeaufwand verursachen. Diese fortgesetzte<br />
Dauerbelastung führt manche Mütter mit der Zeit an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.<br />
Eine unmittelbare gesundheitliche Folge dieser Dauerbelastung können psychosomatische<br />
Erkrankungen und auch eine allgemeine Schwächung des Immunsystems sein.<br />
Eine empirische Mehrlingsstudie von Jutta Jäger hat ergeben, dass die dort befragten<br />
Drillings- und Vierlingsmütter hauptsächlich an Magenschmerzen, Schwächeanfällen,<br />
Gelenk- und Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne litten. Aber auch<br />
ständige Erkältungen oder eingerissene Haut können äußerliche Anzeichen dafür sein,<br />
50b
51a<br />
dass der Körper ausgelaugt ist. Da die Hauptursache dieser Leiden in der täglichen<br />
Überanstrengung liegt, die sich nur in engen Grenzen reduzieren lässt, sollten Sie für<br />
sich zumindest Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen. Auch wenn<br />
die Versuchung groß ist, sich aus zeitlichen Gründen nur mit einem Imbiss zu begnügen,<br />
sollten Sie ausreichend frisches Obst, Gemüse und Salat zu sich nehmen, um<br />
wenigstens mit einem geregelten Vitaminhaushalt die körpereigenen Abwehrstoffe zu<br />
mobilisieren. Versuchen Sie mit Ihrem Partner zu verabreden, dass beiden je ein Tag<br />
der Woche für sich zum Ausspannen und zur Erholung zusteht, während der andere für<br />
die Kinder allein zuständig ist. Vaters Kindertag gelingt übrigens dann am besten,<br />
wenn alle Beteiligten akzeptieren können, dass auch er seinen eigenen Stil und Umgang<br />
mit den Kindern entwickeln darf. Das setzt auf Seiten der Mutter voraus, auch<br />
Abweichungen vom gewöhnlichen Tagesablauf und Handling zuzulassen! Die Kinder<br />
können die unterschiedliche Handhabung durch Vater und Mutter schnell zuordnen<br />
und stellen sich meist recht problemlos auf die jeweilige Betreuungsperson ein.<br />
cc) Nachgeburtliche Depressionen<br />
Weithin bekannt ist das Phänomen der „Heultage“ (auch „baby blues“ genannt),<br />
drei bis fünf Tage nach der Geburt: Ungefähr zwei Drittel aller Mütter (auch der Einlingsmütter)<br />
verfallen für kurze Zeit in Traurigkeit, Weinerlichkeit oder ähnliche negative<br />
Gefühlsstimmungen. Diese leichten Formen von Wochenbettdepressionen werden<br />
auf hormonelle Umstellungen nach der Geburt zurückgeführt, sind völlig normal<br />
und müssen nicht behandelt werden.<br />
Davon zu unterscheiden sind jedoch schwerere Formen einer depressiven Verstimmung,<br />
die über einen längeren Zeitraum anhalten und von denen insgesamt deutlich<br />
weniger Mütter betroffen sind. Sie können sich durch Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit,<br />
übermäßige Ängstlichkeit um die Gesundheit der Babys, fortwährende<br />
Selbstvorwürfe und äußerliche Abstumpfung bis hin zu massiven Schlafstörungen und<br />
sogar Wahnvorstellungen bemerkbar machen. Obwohl immerhin jede achte (auch<br />
Einlings-) Mutter davon betroffen ist, ist das Thema vergleichsweise Tabu. Eher fühlt<br />
man sich schuldig, nicht dem gesellschaftlichen Bild einer „glücklichen Mutter“ zu<br />
entsprechen, was die Unzufriedenheit mit sich selbst noch weiter verstärkt. Anhaltende<br />
depressive Verstimmungen bis hin zu massiven Depressionen sind jedoch ernst zu<br />
nehmende Krankheitserscheinungen, die unter Umständen auch einer medikamentösen<br />
Behandlung bedürfen. Behalten Sie solche Schwierigkeiten deshalb nicht für sich,<br />
sondern sprechen Sie Ihren Frauenarzt darauf an. Für eine erste Selbsteinschätzung wurde<br />
die Edinburgh-Skala entwickelt, die Sie unter http://www.schatten-und-licht.de<br />
downloaden können. Unter dieser Internet-Adresse erhalten Sie auch zahlreiche weitere<br />
Informationen rund um das Thema Wochenbettdepression.<br />
Mehrlingseltern (auch Väter) sind häufiger von depressiven Verstimmungen betroffen<br />
als Einlingseltern. Jutta Jäger erklärt diesen Zusammenhang mit einem Zusammentreffen<br />
von körperlicher Überanstrengung (Schlafmangel und Erschöpfung) mit gleichzeitiger<br />
psychischer Belastung (Isolation, Zukunftsängste und Frustration sowie Schuldgefühle,<br />
nicht allen Kindern gerecht werden zu können). Hinzu kommen vielleicht enttäuschte<br />
Erwartungen, wenn man sich das Leben mit Kindern ganz anders vorgestellt<br />
hatte. Auch die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die man während der Schwangerschaft<br />
selbst bekam, wird jetzt fast nur noch den Kindern zuteil.<br />
Damit es nicht soweit kommt, sollte man seinen Alltag beizeiten reflektieren und<br />
sich bemühen, ihn möglichst harmonisch zu gestalten, seinen Schlafmangel zu begrenzen<br />
und Kontakte aufrecht halten oder neu knüpfen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche<br />
Aufklärung hat eine Broschüre über Erwartungen und Bedürfnisse in der anstrengenden<br />
Zeit nach der Geburt herausgegeben mit einer Reihe hilfreicher Anregungen, um<br />
sich einen eigenen Standpunkt und ein ausgeglichenes Privatleben innerhalb der Familienstruktur<br />
zu erarbeiten 1 . Wenn man das Gefühl hat, dass einem der ganze Aufwand<br />
über den Kopf wächst und man meint, die Lage nicht mehr im Griff zu haben, kann ein<br />
klärendes Gespräch mit einer psychologisch geschulten Beraterin helfen, den eigenen<br />
Standpunkt wiederzufinden.<br />
b) Zustand der Kinder<br />
Die Kinder sind nach der Geburt von einem auf den anderen Moment auf sich gestellt:<br />
Die Trennung von der Nabelschnur bedeutet innerhalb von Sekunden eine vollkommene<br />
Umstellung der Sauerstoff- und Nahrungszufuhr. Haut und Haare erfahren<br />
zum ersten Mal den Zustand der Trockenheit, Ohren und Nase werden frei von Flüssig-<br />
1 Die kostenlose Broschüre „Die erste Zeit zu dritt“ kann bestellt werden bei der Bundeszentrale<br />
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), D-51101 Köln; http://www.bzga.de; E-Mail:<br />
order@bzga.de oder direkt heruntergeladen werden unter<br />
http://www.bzga.de/botmed_13640000.html.<br />
51b
52a<br />
keit und nehmen zum ersten Mal Gerüche und ungedämpfte Klänge wahr. Der Körper<br />
ist von der eingeengten Embryonalhaltung befreit und erfährt die Wirkungen der<br />
Schwerkraft.<br />
Auf diese Veränderungen werden die Kinder während der Schwangerschaft an<br />
sich gut vorbereitet. <strong>Zwillinge</strong> sind optimal gerüstet, wenn sie bis zur 38. SSW voll<br />
ausgetragen sind. Viele <strong>Zwillinge</strong> erreichen diese Schwangerschaftsdauer jedoch nicht<br />
und sind auch schon während der Schwangerschaft nicht immer optimal versorgt. Die<br />
Folge ist eine Früh- oder Mangelgeburtlichkeit, die die Anpassung an das Leben außerhalb<br />
der Gebärmutter erschweren kann.<br />
<strong>Zwillinge</strong> sind von solchen Startschwierigkeiten, die für sich genommen keinen<br />
Grund zur Besorgnis darstellen, häufiger betroffen als Einlinge; besonders häufig der<br />
zweite Zwilling. Oft genügt es jedoch schon, wenn das Neugeborene für wenige Minuten<br />
in eine Umgebung mit erhöhter Sauerstoffkonzentration gebracht wird, und schon der<br />
zweite und dritte APGAR-Wert (5 bzw. 10 Minuten nach der Geburt) lassen eine deutliche<br />
Besserung erkennen. Manchmal muss das Kind dann noch eine Zeit lang beobachtet<br />
werden. Längerfristige Behandlungen sind jedoch im Wesentlichen nur bei Frühgeborenen<br />
erforderlich.<br />
52b<br />
bb) Gewichtsdifferenz<br />
aa) Lebensfrische nach der Geburt<br />
Um den Zustand des Neugeborenen nach einem einheitlichen Schema zu erfassen,<br />
wird in allen Kliniken genau eine Minute nach der Geburt der erste von insgesamt drei<br />
sog. APGAR-Tests 1 durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Bewertungsschema<br />
aus fünf Einzelkriterien, die die Lebensfrische eines Neugeborenen unter verschiedenen<br />
Aspekten kennzeichnen. Geprüft werden Atmung, Puls, Muskelspannung, Hautfarbe<br />
und bestimmte Reflexe. Für jedes der fünf Einzelkriterien werden 0 bis 2 Punkte<br />
vergeben, so dass insgesamt maximal 10 Punkte erreicht werden können. Ergebniswerte<br />
unter 8 Punkten bedeuten in der Regel einen Beobachtungsbedarf, Werte unter 5<br />
Punkten einen dringenden Behandlungsbedarf.<br />
Liegen die Werte im unteren Bereich, bezeichnet man diesen Zustand als<br />
„Asphyxie“ (griechisch: „Aufhören des Pulsschlages“). Dieser Oberbegriff steht für<br />
eine Reihe von Merkmalen, die das Neugeborene nach der Geburt nicht als lebensfrisch,<br />
sondern als bedroht erscheinen lassen. Meist handelt es sich dabei um eine<br />
Übersäuerung des Blutes (Azidose), die durch eine verminderte Sauerstoffzufuhr vor<br />
oder während der Geburt verursacht wurde, oder um einen akuten Sauerstoffmangel<br />
(Hypoxie), der im Extremfall bis zum Herz-Kreislauf-Sillstand führen kann.<br />
1 Die Bezeichnung geht zurück auf die Anästhesistin Virginia Apgar, die das Bewertungsschema<br />
1953 erstmals vorschlug.<br />
Vielleicht hat sich auch eine frühere Vermutung des Frauenarztes bestätigt, dass die<br />
Kinder mit einem deutlichen Gewichtsunterschied zur Welt kommen. Sie erscheinen uns<br />
dann sehr ungleich und selbst eineiige <strong>Zwillinge</strong> sind nicht ohne weiteres als solche zu<br />
erkennen. Verantwortlich für solche Wachstumsunterschiede ist fast immer die unterschiedliche<br />
Versorgungslage der Kinder innerhalb der Gebärmutter. Mit der Zeit wächst<br />
sich die Gewichtsdifferenz jedoch wieder aus und die Kinder gleichen sich an.<br />
Größere Gewichtsunterschiede können sich allerdings auch in einer unterschiedlichen<br />
medizinischen Verfassung der Kinder niederschlagen. Das <strong>klein</strong>ere Kind benötigt<br />
vielleicht noch eine besondere medizinische Betreuung, während das größere Kind mit<br />
der Mutter auf der normalen Wöchnerinnenstation verbleiben kann. Unter diesen ungleichen<br />
Bedingungen ist es schwierig, jedem Kind in seiner jeweiligen Situation gerecht zu<br />
werden. Besonders schwierig wird es, wenn die Mutter in einer normalen Geburtsklinik<br />
entbunden hatte und dort mit einem Kind noch untergebracht ist, während das andere<br />
Kind in eine Neugeborenenintensivstation verlegt werden musste. Einlingsmütter könnten<br />
sich um eine möglichst schnelle Entlassung aus der Geburtsklinik bemühen, um ihr<br />
Neugeborenes auf der Intensivstation zu besuchen, zu pflegen und zu stillen. Sie als<br />
Zwillingsmutter sind jedoch noch für ein weiteres Kind verantwortlich, dem es gut täte,<br />
noch einige Tage mit Ihnen auf der Wöchnerinnenstation zu verbringen. Einige Kliniken<br />
bieten in dieser Situation an, die Mutter und das gesunde Kind ebenfalls zu verlegen,<br />
damit die Familie unter einem Dach beisammen ist und das behandlungsbedürftige Kind<br />
regelmäßig von der Mutter besucht werden kann. Andere Kliniken unterstützen zumindest<br />
den Transport von abgepumpter Muttermilch, damit das verlegte Kind damit gefüttert<br />
werden kann. Der elterliche Kontakt zu dem verlegten Kind beschränkt sich dann<br />
jedoch auf den Vater – keine glückliche Situation für die Mutter.
53a<br />
53b<br />
Ein wahrhafter Spagat wird erforderlich, wenn die Mutter und das gesundere<br />
Kind aus dem Krankenhaus bereits entlassen sind, während das andere Kind noch<br />
immer in klinischer Behandlung oder unter klinischer Beobachtung ist. Dann ist man<br />
nämlich mit der Betreuung des gesunden Kindes ganz auf sich gestellt und zusätzlich<br />
ist noch der Haushalt zu versorgen. Wenn außerdem noch das andere Kind in der Klinik<br />
regelmäßig besucht werden soll, lässt sich diese Situation beinahe nur noch meistern,<br />
indem der Partner seinen Jahresurlaub nimmt und mit seiner vollen Zeit und<br />
Kraft der Familie zur Verfügung steht. Bitten Sie auch Freunde und Verwandte oder<br />
vielleicht Ihre Nachbarn um Mithilfe.<br />
Rita Haberkorn 1 beschönigt die verschiedenen Ausgangsbedingungen beider Kinder<br />
zugleich als eine Chance, von Beginn an zu jedem Kind eine eigenständige und<br />
unverwechselbare Beziehung aufzunehmen. Das mag im Kern wohl zutreffen, doch<br />
werden Sie diesen Aspekt frühestens nach einiger Zeit als gewinnbringend für sich<br />
entdecken, wenn sich die Anstrengungen der ersten Wochen in der Rückschau schon<br />
ein wenig verklärt haben.<br />
cc) Frühchen<br />
Die Frage, ob ein Kind als „Frühchen“ zur Welt gekommen ist, kann man aus<br />
zwei Blickwinkeln betrachten: Zum einen nach allgemein formalen Kategorien und<br />
zum anderen anhand des konkreten Gesundheitszustandes und der Behandlungsbedürftigkeit<br />
des einzelnen Kindes.<br />
Nach den formalen Kategorien gilt ein Kind als Frühgeborenes, wenn es vor der<br />
Vollendung der 37. SSW geboren wird. Für rund die Hälfte der <strong>Zwillinge</strong> (52%) trifft<br />
dieses formale Kriterium zu:<br />
Den „Frühgeborenen“ formal gleichgestellt sind<br />
- die sog. „Mangelgeborenen“, die ein Geburtsgewicht von 2.500 Gramm<br />
nicht überschreiten, und<br />
- die „unreif Geborenen“, die noch nicht bis zur Geburtsreife entwickelt sind.<br />
Die meisten Mehrlinge fallen in mindestens eine der formalen Frühgeburts- und<br />
Mangelkategorien und gelten deshalb rechtlich und medizinisch formal als Frühgeborene.<br />
Ein Geburtsgewicht von über 2.500 Gramm – die formale Mangelgeburtsgrenze –<br />
erreicht nicht einmal jedes zweite Zwillingsbaby. Drillinge erreichen selten ein Geburtsgewicht<br />
von 2.000 Gramm oder darüber.<br />
Das sagt inhaltlich über den Gesundheitszustand des einzelnen Kindes jedoch wenig<br />
aus. Denn die formalen Einteilungen beruhen auf einer allgemeinen Empfehlung der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die für Einlinge entwickelt wurde. Sie ist für<br />
Mehrlinge nur bedingt aussagekräftig. Einigkeit besteht zum Beispiel darin, dass die<br />
formale WHO-Grenze für Mangelgeborene (2.500 Gramm) bei Mehrlingen auf 2.400<br />
Gramm oder noch niedriger herabzusetzen ist, da Mehrlinge in dieser Gewichtsklasse<br />
durchweg reifer entwickelt sind als Einlinge mit demselben Geburtsgewicht. Auch die<br />
formale Frühgeburtsgrenze von vollendeten 37 SSW ist für Zwillingsschwangerschaften<br />
nicht ganz sachgerecht, da die optimale Tragzeit einer Zwillingsschwangerschaft von<br />
vornherein nur 38 Wochen beträgt, also zwei Wochen weniger als bei Einlingen.<br />
1 in: <strong>Zwillinge</strong> – Was Eltern und Pädagogen wissen müssen (s. Literaturliste Anhang VI).
54a<br />
Allemal wichtiger als die exakte Austragungsdauer und das Geburtsgewicht sind<br />
der erreichte Reifegrad und die Vitalfunktionen der Kinder. Der Reifegrad (Entwicklungsstand)<br />
von Mehrlingen liegt im allgemeinen deutlich höher als bei Einlingen von<br />
gleicher Austragungsdauer und gleichem Geburtsgewicht. Deshalb müssen selbst<br />
Mehrlinge mit einem Geburtsgewicht unter 2.000 Gramm – einer weiteren kritischen<br />
Grenze – nicht in jedem Fall intensivmedizinisch betreut werden, während dies für<br />
Einlinge derselben Gewichtsklasse fast unumgänglich ist.<br />
Trotz dieser relativierenden Zusammenhänge gehört die Frühchenproblematik zu<br />
den charakteristischen Begleiterscheinungen der Mehrlingsschwangerschaft. Viele<br />
Kinder müssen nach der Geburt noch beobachtet oder behandelt werden. Welche Maßnahmen<br />
im Einzelnen erforderlich sind, richtet sich nach dem jeweils erreichten Reifegrad<br />
der Kinder.<br />
aaa) Wärmebett, Inkubator<br />
Leichtgewichtige Kinder verfügen unter der Haut nicht über so viele Fettreserven<br />
wie Kinder mit normalem Geburtsgewicht. Daher fällt es ihnen in den ersten Lebenstagen<br />
schwerer, die eigene Körpertemperatur konstant zu halten, und sie verbrauchen<br />
hierfür übermäßig viel Körperenergie. Um das Kind bei der Aufrechterhaltung der<br />
Körpertemperatur zu unterstützen und die kindlichen Energiereserven zu schonen,<br />
wird im Wärmebett Energie von außen zugeführt. Das Wärmebett ist ein zu den Seiten<br />
hin umrandetes Kinderbett mit einer elektrisch beheizbaren Matratze. Kinder, die im<br />
Wärmebett liegen, geben weniger Wärmeenergie nach außen ab als Kinder in normalen<br />
Betten. Mehrlinge werden meistens gemeinsam in ein Wärmebett gelegt, damit sie<br />
die Nähe ihrer Geschwister spüren. Die Stimulation durch die Bewegungsanreize des<br />
anderen Kindes fördert erwiesenermaßen die weitere Entwicklung. Deshalb wird der<br />
andere Zwilling manchmal auch nur zum Zwecke der „Gesellschaft“ dazu gelegt, obwohl<br />
er selbst gar nicht auf das Wärmebett angewiesen wäre.<br />
Eine noch gleichmäßigere Wärmeumgebung lässt sich mit dem Inkubator herstellen.<br />
Der Inkubator (Volksmund: „Brutkasten“) ist ein nach allen Seiten und auch nach<br />
oben hin umschlossener Raum aus Glas- oder Plexiglaswänden. Er verfügt über eine<br />
eigene Luftzufuhr, mit der sich das Raumklima nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit,<br />
Sauerstoffkonzentration usw. gradgenau einstellen lässt, um dadurch optimale Umweltbedingungen<br />
für das Kind herzustellen.<br />
bbb) Gewichtsverlust, Zufüttern<br />
In den ersten Lebenstagen nehmen Neugeborene normalerweise keine nennenswerten<br />
Mengen an Nahrung zu sich, denn die mütterliche Brust beginnt erst allmählich mit<br />
der Milchproduktion. Zunächst kommen wenige Tropfen Vormilch und erst nach einigen<br />
Tagen fließt die reife Muttermilch. Man sagt: die Milch „schießt ein“. Angestoßen wird<br />
die Milchproduktion durch die hormonellen Veränderungen bei der Geburt sowie durch<br />
die ersten Saugversuche der Neugeborenen, die an der Brustwarze einen Reflex auslösen,<br />
der die Milchbildung stimuliert.<br />
Normal entwickelte Neugeborene können diese ersten Tage ohne Nahrungsaufnahme<br />
gut überstehen und nehmen während dieser Zeit bis zu zehn Prozent ihres Geburtsgewichtes<br />
ab. Bei besonders leichtgewichtigen Neugeborenen möchte man den Gewichtsverlust<br />
jedoch vermeiden und möglichst bald eine Zunahme der Körpermasse<br />
erreichen, da diese Kinder über nicht so viele Energie- und Fettreserven verfügen. Sie<br />
werden daher zum Teil bereits unmittelbar nach der Geburt mit handelsüblicher Babynahrung<br />
(hypoallergener Anfangsnahrung) zugefüttert. Ganz verhindern lässt sich die<br />
Gewichtsabnahme allerdings nicht, weil der kindliche Körper noch nicht darauf eingerichtet<br />
ist, größere Nahrungsmengen in Körperenergie umzusetzen.<br />
Bei sehr <strong>klein</strong>en Frühgeborenen kann die Messung des Körpergewichtes außerdem<br />
noch durch Wassereinlagerungen verfälscht sein. Die Wassereinlagerungen erhöhen das<br />
gemessene Körpergewicht, obwohl sie weder zur Körpermuskulatur noch zu den Fettund<br />
Energiereserven beitragen. Eine Gewichtsabnahme von bis zu 20% nach der Geburt<br />
bedeutet daher bei sehr <strong>klein</strong>en Frühgeborenen oft nur den Verlust des eingelagerten<br />
Wassers, was nicht bedrohlich ist, sondern die weitere Entwicklung und Behandlung<br />
sogar eher noch erleichtert.<br />
Manchmal ist das Zufüttern mit einer Traubenzuckerlösung (Glukose) oder Babynahrung<br />
auch deshalb erforderlich, weil der Blutzuckerwert des Neugeborenen zu stark<br />
abfällt. Besonders leichte (und interessanterweise auch besonders schwere) Neugeborene<br />
sind dafür außerordentlich anfällig. Bei diesen Kindern wird der Blutzuckerwert daher<br />
bereits im Kreißsaal und meist auch danach noch überprüft. Der Abfall des Blutzuckerwertes<br />
ist aber nicht zu verwechseln mit einer „echten“ Zuckerkrankheit, da sie nur in<br />
den ersten Tagen nach der Geburt auftritt und sich der Blutzuckerwert danach von selbst<br />
reguliert.<br />
54b
55a<br />
Wenn das Kind später noch gestillt werden soll, sollte man beim Zufüttern kein<br />
Fläschchen benutzen. Denn durch den Sauger eines Fläschchens würde das Kind viel<br />
zu leicht an die Nahrung gelangen. Von Natur aus verfügen Babys über einen angeborenen<br />
Saugreflex, der sie dazu veranlasst, angestrengt an der Brust zu saugen, um den<br />
Milchfluss in Gang zu setzen. Wenn das Baby aber die Erfahrung macht, dass die<br />
Nahrung bereits fließt, wenn man nur leicht an der Flasche nuckelt, so verliert sich<br />
innerhalb kurzer Zeit der angeborene Saugreflex und das Kind ist nicht mehr in der<br />
Lage, kräftig an der mütterlichen Brust zu saugen. Dieser Effekt wird als „Saugverwirrung“<br />
oder „Stillverwirrung“ bezeichnet und führt dazu, dass das Kind später nur noch<br />
mit großen Schwierigkeiten gestillt werden kann.<br />
Um eine Saugverwirrung zu vermeiden, führt man die Nahrung mit der Finger-<br />
Feeding-Methode zu („Finger-Fütterung“). Dabei hält man gleichzeitig einen Finger in<br />
den Mund des Kindes wie auch einen dünnen Silikonschlauch, der an eine mit Nahrung<br />
gefüllte Einmalspritze angeschlossen ist. Immer wenn das Kind stark an dem<br />
Finger saugt (und nur dann!), befördert man mit der Spritze etwas Nahrung durch den<br />
Schlauch in den Mund des Kindes. Dadurch erhält sich bei dem Kind das Bewusstsein<br />
um den Zusammenhang zwischen kräftigem Saugen und Nahrungszufluss, so dass das<br />
Kind später noch erfolgreich an die Brust angelegt werden kann. Neben der Finger-<br />
Feeding-Methode gibt es noch weitere Techniken zur Vermeidung einer Saugverwirrung,<br />
z.B. Löffelfütterung, Becherfütterung, Brusternährungsset usw. Jedoch dürfte die<br />
Finger-Feeding-Methode am effektivsten sein, weil man den Milchfluss genau auf die<br />
am Finger verspürte „Saugleistung“ des Kindes abstimmen kann. Sogar längere Zeiträume<br />
lassen sich mit dieser Methode gut überbrücken. In unserer eigenen Familie<br />
konnte der <strong>klein</strong>ere Zwilling noch nach einem Finger-Feeding von sechs Wochen(!)<br />
zum ersten Mal erfolgreich an die Brust angelegt werden und wurde danach sechs<br />
Monate lang voll gestillt.<br />
Kinder, die zu schwach sind, jegliche Nahrung selbständig aufzunehmen, müssen<br />
allerdings vorübergehend mit einer Magensonde künstlich ernährt werden. Auch über<br />
die Magensonde, die meist durch die Nase eingeführt wird, kann man Muttermilch<br />
verfüttern. Je nach Dauer der Ernährung über die Magensonde kann das Stillen auch<br />
danach noch gelingen. In der Übergangszeit ist es möglich, eine Nahrungssonde so an<br />
der Brust zu befestigen, dass das Kind an der Brust saugen lernt, jedoch gleichzeitig<br />
über die Sonde seine Nahrung bezieht (sog. „Zufüttern an der Brust“).<br />
ccc) Sehr <strong>klein</strong>e Frühgeborene<br />
Alle bis hierhin genannten Maßnahmen können prinzipiell in den meisten Geburtskliniken<br />
durchgeführt werden. Eine Verlegung der Kinder auf eine spezielle Neugeborenenintensivstation<br />
ist nur erforderlich, wenn sich der Zustand verschlechtert oder wenn<br />
die Klinik personell oder nach ihrer Sachausstattung nicht darauf eingerichtet ist, die<br />
notwendige Versorgung dauerhaft aufrecht zu erhalten.<br />
Allerdings muss man bei höhergradigen Mehrlingen sowie bei Komplikationen in<br />
der Zwillingsschwangerschaft auch damit rechnen, dass die Kinder bereits weit vor Ablauf<br />
der normalen Austragungsdauer geboren werden und dann sehr <strong>klein</strong> sind. Diese<br />
Kinder müssen in einer Neugeborenenintensivstation medizinisch betreut werden. Mit<br />
den dadurch aufgeworfenen Sonderfragen befassen wir uns gezielt noch einmal im fünften<br />
Kapitel am Ende dieses Buches.<br />
3. Stillen<br />
a) Stillen von Mehrlingen<br />
„Kann man <strong>Zwillinge</strong> überhaupt stillen Reicht die Milch denn dafür aus“ – So<br />
lauten häufig gestellte Fragen, die zugleich das uns eingeprägte Misstrauen gegenüber<br />
Urfunktionen einfachster Naturmechanismen offenbaren. Natürlich kann man <strong>Zwillinge</strong><br />
stillen und die Milch reicht auch dafür aus. Die Brust ist einem ausgeklügelten System<br />
von Angebot und Nachfrage unterworfen und passt die Milchproduktion dem jeweiligen<br />
Bedarf an. Wenn die Milch bei einer Stillmahlzeit einmal nicht ausreicht, interpretiert<br />
der mütterliche Organismus das weitere Saugen an der leeren Brust als eine Aufforderung,<br />
die Milchproduktion zu erhöhen. Wenn umgekehrt die Brust nicht leer getrunken<br />
wird, so produziert sie beim nächsten Mal weniger Milch. Es ist also immer so viel<br />
Milch in den Brüsten vorhanden, wie tatsächlich benötigt wird. Daher sind die Brüste<br />
auch ohne weiteres in der Lage, <strong>Zwillinge</strong> zu versorgen: Der Saugreiz beider Kinder<br />
bewirkt automatisch eine entsprechend erhöhte Milchproduktion.<br />
Das Stillen von <strong>Zwillinge</strong>n ist aber nicht nur möglich, es ist zu deren Gesundheit<br />
auch sehr wichtig. Muttermilch ist die beste Nahrung für Neugeborene, weil sie den<br />
Immunschutz der Kinder aufbauen hilft, optimal verdaut werden kann und eine minimale<br />
Stoffwechselbelastung darstellt. Mit diesen Eigenschaften kann sie durch keine künstli-<br />
55b
56a<br />
che Nahrung gleichwertig ersetzt werden. Das ist allgemein anerkannt und es ist den<br />
Herstellern von Babynahrung sogar verboten, ihre eigenen Produkte als gleichwertig<br />
oder höher anzupreisen als die Muttermilch. Kinder, die nicht gestillt werden, sind<br />
allgemein krankheits- und allergieanfälliger. <strong>Zwillinge</strong> haben das Stillen allein schon<br />
wegen ihres geringeren Geburtsgewichtes besonders nötig. Aufgrund ihrer Kleinheit<br />
sind sie von Natur aus anfälliger für Infektionen und verfügen zugleich über weniger<br />
Körperreserven, um diese zu verkraften. <strong>Zwillinge</strong> sind auch nach der Geburt noch<br />
einem höheren Risiko ausgesetzt als Einlinge. Deshalb ist es für sie besonders wichtig,<br />
ihr Immunsystem mit den Abwehrstoffen der Muttermilch zu stärken. Und nicht zuletzt<br />
tun Sie auch für sich selbst etwas Gutes: Durch Stillen reduzieren Sie sowohl Ihr<br />
späteres Brustkrebsrisiko als auch die Wahrscheinlichkeit einer Altersdiabetes.<br />
Unbestritten ist das Stillen von <strong>Zwillinge</strong>n allerdings zum einen aufwendiger als<br />
das Stillen von Einlingen und zum anderen auch momentan eine größere körperliche<br />
Belastung für die Mutter. Als stillende Mutter sollten Sie sich gesund und vitaminreich<br />
ernähren, da ein erheblicher Teil der aufgenommenen Nahrung in die Bildung von<br />
Muttermilch umgesetzt wird und Ihnen selbst sonst die Nährstoffe und Vitamine fehlen.<br />
Auch der Kalorienbedarf steigt pro Kind um bis zu 1/3 an, weshalb Diäten zur<br />
Gewichtsabnahme in der Stillzeit nicht angebracht sind. Außerdem sollten Sie auf<br />
ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten: Trinken Sie, wann immer Sie Durst haben,<br />
und stellen Sie sich auch beim Stillen immer ein Glas zu trinken bereit. Spezielle Stilltees,<br />
die Sie in der Apotheke oder in Naturkostläden bekommen, regen die Milchbildung<br />
sogar noch besonders an.<br />
aa) Parallele Stillzeiten einstellen<br />
Wenn die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten kommen, so ist dies ein Missstand,<br />
den Sie zu Ihrem eigenen Schutz möglichst schnell abstellen sollten. Wenn ein Zwilling<br />
hungrig ist, während der andere noch schläft, so halten Sie den ersten noch eine<br />
Weile hin und wecken Sie den anderen behutsam, um dann beide gleichzeitig bzw.<br />
kurz hintereinander zu stillen. So stellen sich im Lauf der Zeit parallele Stillzeiten ein.<br />
Machen Sie sich kein schlechtes Gewissen, wenn Sie in Stillfibeln lesen, dass Kinder<br />
besser trinken würden, wenn sie von sich aus kommen. Das stimmt zwar an sich und<br />
man sollte das Wecken der Kinder deshalb auch nicht zur Gewohnheit machen. Doch<br />
wenn es um die Angleichung der Stillzeiten geht, sind Sie als Zwillingseltern in einer<br />
besonderen Situation. Es entspricht Ihrer Verantwortung gegenüber sich selbst und den<br />
Kindern, dafür zu sorgen, dass Sie zur Nachtzeit wenigstens ein Minimum an durchgehendem<br />
Schlaf bekommen. Ihr Körper ist dringend darauf angewiesen. Kein Elternteil<br />
ist über eine längere Zeitdauer in der Lage, alle anderthalb Stunden aufzustehen, um<br />
jeweils einen der beiden <strong>Zwillinge</strong> zu stillen und zu wickeln. Wenn es Ihnen nicht gelingt,<br />
die Stillzeiten der Kinder anzugleichen, um dann beide Kinder gleichzeitig bzw.<br />
unmittelbar hintereinander zu versorgen und Ihre eigenen Schlafphasen damit auf wenigstens<br />
drei Stunden auszudehnen, so fehlt Ihnen sehr bald die körperliche und psychische<br />
Kraft, den Anforderungen des Elternalltags gerecht zu werden, worunter alle Familienmitglieder<br />
zu leiden hätten. Nur ganz ausnahmsweise sollte man daher auf zeitversetzte<br />
Stillzeiten Rücksicht nehmen, z.B. wenn ein Kind erkrankt ist.<br />
bb) Gleichzeitig an beiden Brüsten stillen<br />
Für <strong>Zwillinge</strong> gibt es verschiedene Stilltechniken. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,<br />
<strong>Zwillinge</strong> entweder gleichzeitig an beiden Brüsten oder nacheinander zu stillen.<br />
Gleichzeitiges Stillen hat – neben der Zeitersparnis – vor allem den Vorteil, dass noch<br />
mehr von den Hormonen Prolaktin und Oxytocin freigesetzt werden, die bei der Mutter<br />
die Milchbildung und den Milchspendereflex auslösen. Es bedarf jedoch ein wenig Ü-<br />
bung, um beide Kinder in die richtige Position zu bringen. Außerdem sind solche Stillpositionen<br />
nicht möglich, bei denen sich die Kinder ins Gehege kommen. Fast immer ist<br />
auch eine weitere Hilfsperson erforderlich, die die Kinder anreicht und abnimmt. Aus<br />
diesen Gründen entscheiden sich die meisten Frauen dafür, nacheinander zu stillen, was<br />
außerdem für diesen Moment einen intensiveren Kontakt zu dem einzelnen Kind ermöglicht.<br />
Wenn man die Kinder nacheinander stillt, darf man dem ersten Kind nur eine Brust<br />
geben und muss die zweite Brust komplett für den zweiten Zwilling lassen. Denn im<br />
Laufe einer Stillmahlzeit ändert sich die Milch in ihrer Zusammensetzung. Zu Beginn<br />
bildet die Brust eine dünnflüssige Milch, die den Durst des Kindes stillen soll (sog.<br />
„Vordermilch“). Erst danach wird die Milch sämiger und enthält nun die Nährstoffe, die<br />
das Kind sättigen (sog. „Hintermilch“). Würden Sie dem ersten Kind beide Brüste geben,<br />
bekäme es von beiden Brüsten nur die dünnflüssige Vordermilch, während für den<br />
zweiten Zwilling aus beiden Brüsten nur noch die nährstoffreiche Hintermilch übrig<br />
wäre, die jedoch seinen Durst nicht löscht. Jeder Zwilling muss daher zunächst die<br />
Chance bekommen, an einer „frischen“ Brust zu saugen, um etwas von der dünnflüssigeren<br />
Milch für den Durst abzubekommen. Nur wenn ein Kind schon satt ist und das ande-<br />
56b
57a<br />
re noch Hunger hat, obwohl seine Brust schon leer ist, dürfen Sie ihm die „Reste“ aus<br />
der anderen Brust noch anbieten.<br />
cc) Jedes Kind stets an dieselbe Brust<br />
Entweder kann man jedem Kind immer dieselbe Brust geben, oder man kann die<br />
Seiten in einem bestimmten Turnus wechseln – z.B. bei jeder neuen Mahlzeit oder<br />
aber im Tagesrhythmus. Was besser ist, ist eine Frage des Einzelfalls. Sind beide<br />
Brüste gleich produktiv und saugen beide Kinder etwa gleich stark, so kann man gut<br />
jedem Kind seine eigene Brust dauerhaft zuteilen. Jede Brust kann dann die Milchproduktion<br />
den jeweiligen Bedürfnissen des ihr zugeordneten Kindes anpassen. Saugen<br />
beide Kinder jedoch unterschiedlich stark, vor allem bei erheblichen Gewichtsunterschieden<br />
der Kinder, kann es sich empfehlen, die Seiten regelmäßig zu wechseln,<br />
damit das stärker saugende Kind beide Seiten gleichmäßig zur Milchproduktion anregt.<br />
Wie gesagt soll der Seitenwechsel allerdings nicht während einer Stillmahlzeit<br />
durchgeführt werden, sondern immer erst mit dem Beginn einer neuen Mahlzeit.<br />
Produzieren die Brüste unterschiedlich viel Milch, kann man wie folgt verfahren:<br />
Zunächst lässt man den schwächeren Zwilling an der produktiveren und leichtgängigen<br />
Brust trinken. Wenn dieses Kind satt ist, lässt man den stärkeren Zwilling zunächst<br />
an der anderen, schwergängigen Brust trinken und legt ihn danach, wenn diese<br />
leergetrunken ist, zusätzlich noch einmal an die andere Brust an, an der der schwächere<br />
Zwilling zuerst getrunken hatte. So erhält der schwächere Zwilling immer die bestmögliche<br />
Versorgung aus der leichtgängigen Brust und gleichzeitig ist gewährleistet,<br />
dass beide Brüste vollständig geleert und mit dem stärkeren Saugreiz des kräftigeren<br />
Zwillings angeregt sind.<br />
Es verbietet sich hier allerdings jeder schematische Ratschlag, der nicht auch auf<br />
Ihre individuelle Situation eingeht. Probieren Sie selbst aus, welches Kind an welcher<br />
Seite den besten Erfolg erzielt, und ob Ihre Kinder oder Sie selbst von einem gelegentlichen<br />
Seitenwechsel profitieren. Wenn Sie einen Rhythmus gefunden haben, mit dem<br />
beide Kinder und Sie selbst gut zurechtkommen, so lassen Sie sich von niemandem<br />
und von keiner gut gemeinten Stillanleitung ohne zwingenden Grund überreden, an<br />
Ihren eingespielten Gewohnheiten etwas zu ändern.<br />
dd) Wunde Brustwarzen<br />
Wenn Sie Ihre <strong>Zwillinge</strong> stillen, so ist die mechanische Beanspruchung Ihrer<br />
Brustwarzen besonders hoch, weil zwei Kinder doppelt soviel saugen wie eines. Entsprechend<br />
steigt die Gefahr, dass die Brustwarzen wund werden. Wunde oder rissige<br />
Brustwarzen treten vor allem auf, wenn die Kinder falsch angelegt werden. Die Brust<br />
muss immer genügend weit in den Mund des Kindes eingeführt werden, damit das Kind<br />
nicht nur an der Warze nuckelt, sondern an der Brust selbst. Das ist bei <strong>Zwillinge</strong>n nicht<br />
immer ganz einfach, weil ihre Münder manchmal noch zu <strong>klein</strong> sind, um den ganzen<br />
Brustansatz (Warzenhof) zu umschließen. Beim Entfernen des Kindes von der Brust<br />
muss sein Mund immer erst von der Seite mit einem <strong>klein</strong>en Finger geöffnet werden,<br />
damit sich der Unterdruck löst und das Kind beim Ablegen nicht an der Brustwarze<br />
zieht. Wenn man diese Regeln beachtet, kann man wunde Brustwarzen weitgehend vermeiden.<br />
Schonen Sie die Brustwarzen auch dadurch, dass Sie das Stillen pro Kind in der<br />
ersten Zeit nicht über 10 Minuten hinaus ausdehnen. Nach dieser Dauer hat das Kind<br />
seinen Durst und Hunger gestillt. Wenn das Kind dennoch weiter saugt, nuckelt es nur<br />
noch an Ihrer Brust wie an einem Schnuller, ohne dabei jedoch weitere Nahrung zu sich<br />
zu nehmen.<br />
Wunde Brustwarzen können mit lanolinhaltigen Cremes leicht behandelt werden.<br />
Wenn Sie die wunden Brüste beim Stillen schmerzen, sollten Sie auch einen Wechsel<br />
der Stillposition erwägen. Oft lässt sich die Reizung dadurch auf eine andere, bisher<br />
nicht so beanspruchte Stelle verlagern. Die Brustwarze wird immer dort am stärksten<br />
gereizt, wo der Unterkiefer des Kindes liegt.<br />
ee) Wachstumsschübe<br />
Während der Stillphase bekommen die Kinder dreimal einen Wachstumsschub, für<br />
den sie von einem auf den anderen Tag erheblich mehr Milch benötigen als zuvor. Der<br />
erste Wachstumsschub liegt etwa am zehnten Lebenstag, der zweite Wachstumsschub in<br />
der sechsten Lebenswoche und der dritte Wachstumsschub im dritten oder vierten Lebensmonat.<br />
Auf den plötzlichen Mehrbedarf muss sich die Brust erst einstellen, so dass<br />
für eine kurze Übergangszeit etwas häufiger gestillt werden muss als gewöhnlich (etwa<br />
alle ein bis zwei Stunden). Nach zwei bis drei Tagen haben sich die Brüste an die neue<br />
Situation angepasst und ihre Produktion erhöht, so dass sich die normalen Stillzeiten<br />
wieder einstellen. Auch diese Phase ist ganz normal und trifft ebenso jede Einlingsmut-<br />
57b
58a<br />
ter. Sie ist kein Anlass für ein Zufüttern – im Gegenteil: jedes Zufüttern stört das Zusammenspiel<br />
von Angebot und Nachfrage. Der wachstumsbedingte Mehrbedarf sollte<br />
nicht dahingehend missverstanden werden, dass die Milch jetzt „für die <strong>Zwillinge</strong><br />
nicht mehr reicht“. Wenn Sie dennoch Bedenken haben, ob die Milch noch für die<br />
Versorgung Ihrer Kinder ausreicht, sollten Sie mit dem Kinderarzt, der Hebamme oder<br />
einer Stillberaterin darüber sprechen.<br />
ff) Stillberatung<br />
Überhaupt ist das „A und O“ des erfolgreichen Stillens von <strong>Zwillinge</strong>n eine qualifizierte<br />
praktische Stillanleitung, die durch kein Buch, auch nicht mit noch so detailgetreuen<br />
Abbildungen, ersetzt werden kann. Zu einer solchen Stillberatung führen verschiedene<br />
Wege:<br />
Die erste Anleitung zum Stillen erhalten Sie in der Geburtsklinik, in der Sie entbunden<br />
haben. In einem stillfreundlichen Krankenhaus wird man Ihnen die für Sie<br />
geeigneten Stillpositionen zeigen. Sie erlernen dort die notwendigen Handgriffe und<br />
Sie werden angeleitet, auf welche Einzelheiten Sie achten müssen.<br />
Allerdings bestehen in den einzelnen Kliniken große Unterschiede, was die Qualität<br />
der Stillberatung und das diesbezügliche Engagement der Schwestern und Hebammen<br />
betrifft. Das liegt nicht nur an den Schwestern und Hebammen selbst, sondern vor<br />
allem an den Vorgaben der Klinikleitung. Denn von dort müssen nicht nur die entsprechenden<br />
Fortbildungen ermöglicht, sondern auch die Zeiten der Stillberatung in den<br />
Dienstplan eingestellt werden, was konkret bedeutet, dass die dafür zuständigen Personen<br />
während der Stillberatung von den übrigen Tätigkeiten freizustellen sind. Eine<br />
gute Stillberatung erweist sich für die Klinik als ein nicht unerheblicher Kostenfaktor,<br />
dem kein unmittelbares Äquivalent auf der Einnahmenseite gegenübersteht. Da nicht<br />
alle Kliniken zu diesen Ausgaben bereit sind, fällt die Stillberatung und –begleitung in<br />
der Praxis oft dürftig aus. Da passiert es dann schnell, dass niemand gerade Zeit hat,<br />
dass keine ausgereiften Konzepte bei der Hand sind und bei <strong>klein</strong>sten Schwierigkeiten<br />
gleich zum Abstillen geraten wird.<br />
Der eigene Stillerfolg hängt deshalb stark von der Auswahl der Geburtsklinik ab.<br />
Besonders qualifizierte Beratung und Hilfestellung können Sie dort erwarten, wo eine<br />
spezielle Stillberaterin sich für Sie Zeit nimmt oder sogar eine professionell ausgebildete<br />
Laktationsberaterin beschäftigt ist. Letztere verfügen über ein IBCLC-Examen,<br />
welches nur von Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im medizinischsozialen<br />
Bereich und hinreichender Praxiserfahrung in der Stillberatung erworben werden<br />
kann. Damit setzt das IBCLC-Examen einen Qualitätsstandard, der eine sachkundige<br />
Beratung garantiert. Da Sie als Zwillingsmutter beim Stillen von vornherein einen Sonderfall<br />
darstellen, kann Ihnen eine solche besondere Sachkunde sehr zugute kommen.<br />
Auch nach der Entlassung aus der Geburtsklinik können Sie noch auf die Hilfe einer<br />
Laktationsberaterin zurückgreifen, denn viele von ihnen sind auch freiberuflich tätig.<br />
Die Anschrift der nächst erreichbaren Laktationsberaterin kann beim Bund Deutscher<br />
Laktationsberater e.V. erfragt werden (Kontaktadresse s. Anhang). Viele Laktationsberaterinnen<br />
bieten neben regelmäßigen Stilltreffen auch individuelle Hausbesuche an, die<br />
freilich nicht kostenlos sind. Da erst wenige Krankenkassen bereit sind, diese Kosten zu<br />
übernehmen, muss man sie im Zweifel selbst tragen. Wenn Ihnen das Stillen etwas Wert<br />
ist, handelt es sich auf jeden Fall um eine sinnvolle und gut angelegte Ausgabe.<br />
Ansonsten sind die Nachsorgehebammen nach der Entlassung aus der Klinik dafür<br />
zuständig, sich um eventuelle Stillprobleme zu kümmern. Nicht alle Nachsorgehebammen<br />
sind jedoch mit den Besonderheiten des Stillens von <strong>Zwillinge</strong>n eng vertraut.<br />
Einige weitere Gruppierungen, wie z.B. die La Leche Liga oder der Arbeitskreis<br />
Freier Stillgruppen, fördern das Stillen aus privater Initiative und bieten neben Stillgruppen<br />
und Broschüren auch persönliche Beratung an – zum Teil allerdings nur telefonisch.<br />
Abgesehen davon, dass einer telefonischen Beratung schon durch das Übertragungsmedium<br />
naheliegende Grenzen gesetzt sind, hängt die fachliche Qualität dieser<br />
Beratung in hohem Maße von der persönlichen Erfahrung der jeweiligen Beraterin ab.<br />
Die Beratung ist im Allgemeinen durchaus eine gute Hilfe im Zusammenhang mit häufig<br />
auftretenden Fragen wie z.B. der Heilung von wunden Brustwarzen, sinnvoller Dauer<br />
und Häufigkeit der Stillzeiten, rechtem Zeitpunkt für die Einführung von Beikost, Problemen<br />
des Abstillens usw. Nicht alle Beraterinnen haben jedoch nennenswerte Erfahrungen<br />
mit dem Stillen von <strong>Zwillinge</strong>n und sind mit den sich hieraus speziell ergebenden<br />
Fragen, insbesondere mit praktischer Stillanleitung, manchmal überfordert. Die Stillgruppe<br />
als solche ist aber gleichwohl auch für Zwillingseltern eine sinnvolle Einrichtung,<br />
weil <strong>Zwillinge</strong> zu haben ja nicht bedeutet, vor den Stillproblemen der Einlingseltern<br />
gefeit zu sein und von deren Erfahrungen und Erfolgsrezepten nicht auch profitieren<br />
zu können. Abgesehen davon tut es manchmal gut zu wissen, dass es in der Welt des<br />
Stillens noch manch andere Probleme gibt, von denen man selbst einmal nicht betroffen<br />
ist.<br />
58b
59a<br />
Vereinzelt haben Zwillingsmütter auch ihre eigenen Stillerfahrungen niedergeschrieben,<br />
um anderen Müttern Mut zu machen und noch ein paar Tipps mitzugeben;<br />
vgl. zum Beispiel www.sc-bertsch.de/stefanie.<br />
gg) Stillen von Drillingen und Vierlingen<br />
Der Mechanismus der erhöhten Milchproduktion aufgrund des stärker angeregten<br />
Milchfluss-Reflexes funktioniert in den allermeisten Fällen auch noch bei Drillingen,<br />
so dass auch diese grundsätzlich voll gestillt werden können. Hier stellt sich natürlich<br />
unter einem ganz anderen Aspekt die Frage der Handhabung, da nämlich eine Brust<br />
weniger vorhanden ist als Kinder daran trinken wollen, und es kann nur individuelle<br />
Lösungen geben. Eine Drillingsmutter hat z.B. mit Erfolg zunächst den Schwächsten<br />
an der ersten Brust gestillt, dann ein anderes Geschwister an der zweiten Brust, und<br />
darauffolgend in einem „zweiten Durchgang“ das dritte Kind zunächst an der ersten<br />
und dann an der zweiten Brust. Sie hat dabei die Erfahrung gemacht, dass ihre Brüste<br />
sich auf diese Prozedur einstellten und das zuletzt gestillte Kind bei jeder Brust einen<br />
regelrechten zweiten Milchfluss-Reflex auslöste, so dass auch dieses noch einmal in<br />
den Genuss von durstlöschender und sättigender Milch kam.<br />
Eine andere Drillingsmutter hat einem Kind die linke, einem die rechte Brust gegeben<br />
und dem dritten die Flasche; das Ganze in einem dauernden Rotationssystem, so<br />
dass jedes Kind im Wechsel zweimal die Brust und einmal die Flasche bekam. Glücklicherweise<br />
kam es bei keinem Kind zu einer Saugverwirrung.<br />
Das Mehrlingsbuch von Elisabeth Bryan berichtet von einer Drillingsmutter, die<br />
zwei Kinder an ihren Brüsten gestillt und zwischen den Stillmahlzeiten dann noch<br />
einmal abgepumpt hat, um damit bei der nächsten Mahlzeit das dritte Kind zu füttern.<br />
Diese Prozedur erfordert natürlich einen enormen Zeitaufwand und eine bewundernswerte<br />
Energie der Mutter.<br />
Ebenso denkbar wäre es, die vorhandene Milch abzupumpen, auf alle drei Kinder<br />
zu verteilen und anschließend mit handelsüblicher Babynahrung nachzufüttern. Allerdings<br />
sind Brüste, an denen die Kinder unmittelbar saugen, weitaus produktiver als<br />
künstlich abgepumpte Brüste, weil die Saugbewegung der Kinder durch eine mechanische<br />
Milchpumpe nicht vollständig simuliert werden kann. Aus dem selben Grund<br />
lässt sich der Milchfluss allein mit einer Milchpumpe auch nicht über einen sehr langen<br />
Zeitraum aufrecht erhalten, so dass der als Dauerlösung gedachte Griff zur Milchpumpe<br />
in den meisten Fällen zugleich ein Abstillen auf Raten bedeutet.<br />
Bei Vierlingen und noch höhergradigen Mehrlingen erreicht der Milchbedarf der<br />
Kinder allerdings im Laufe der Zeit eine Größenordnung, die von den Brüsten nicht<br />
ohne weiteres mehr bewältigt werden kann. Das heißt aber nicht, dass man auf Stillen<br />
ganz verzichten muss. Zunächst kann man die Neugeborenen ohne weiteres mit Muttermilch<br />
versorgen, da in der Anfangszeit schon wenige Milliliter genügen. Gerade die<br />
gelbliche Vormilch, das Kolostrum, enthält besonders viele Abwehrstoffe und sollte<br />
daher allen Kindern zugute kommen, auch wenn es sich scheinbar nur um einen verschwindend<br />
<strong>klein</strong>en Tropfen handelt. Denn das kindliche Immunsystem ist in der Lage,<br />
mithilfe der einmal zugeführten Abwehrstoffe eigene Antikörper zu bilden und dadurch<br />
einen eigenen Immunschutz selbständig aufzubauen. Dabei kommt es entscheidend darauf<br />
an, dass die Abwehrstoffe überhaupt einmal das Kind erreichen, während die zugeführte<br />
Menge letztlich von untergeordneter Bedeutung ist. In der Folgezeit hängen die<br />
Möglichkeiten des Stillens dann in hohem Maße von der häuslichen Situation und Organisation<br />
ab, bis nach einiger Zeit und laufend steigendem Milchbedarf irgendwann die<br />
Leistungsgrenzen der Brust erreicht sind und man um ein Zufüttern nicht mehr herumkommt.<br />
Was immer Sie ausprobieren: Machen Sie das Stillen nicht zur Qual. So unbestreitbar<br />
gesund das Stillen für die Kinder ist und so sehr es deren körperliche Entwicklung<br />
fördert, ist es für alle Beteiligten auf Dauer nur dann ein Gewinn, wenn auch die Mutter<br />
beim Stillen wirklich zufrieden ist. Eine Mutter muss ihr Kind beim Stillen anlächeln<br />
können!<br />
b) Stillen nach Kaiserschnitt<br />
Auch nach einem Kaiserschnitt ist das Stillen grundsätzlich möglich 1 . Einige Stillpositionen<br />
sind allerdings zu Beginn noch nicht möglich, weil die Schnittwunde Ihnen<br />
Schmerzen bereitet, wenn Sie die Kinder auf Ihrem Bauch ablegen. Für das Stillen nach<br />
einem Kaiserschnitt gibt es deshalb besondere Stillpositionen, die Ihnen in der Klinik<br />
1 s. hierzu die Broschüre „Kaiserschnitt und Stillen“ der Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen<br />
e.V.; Bezugsquelle im Anschriftenteil des Anhangs<br />
59b
60a<br />
gezeigt werden. Auch beim Anlegen werden Sie Hilfe brauchen, weil Sie Ihre Bauchmuskeln<br />
noch nicht sofort wieder voll einsetzen können.<br />
c) Milchpumpe<br />
Wenn Ihre Kinder noch zu <strong>klein</strong> sind, um kräftig genug an der Brust zu saugen,<br />
oder wenn ein Kind noch in der Klinik liegt und die Milch dorthin transportiert werden<br />
muss, benötigen Sie eine Milchpumpe, um die Milch abzupumpen. Elektrische Pumpen<br />
für den Heimgebrauch können Sie in einigen Apotheken anmieten; Handpumpen<br />
sind dagegen unbrauchbar. Die meisten Krankenkassen zahlen die Mietkosten, wenn<br />
der Arzt die medizinische Notwendigkeit einer Milchpumpe bescheinigt; trotzdem<br />
empfiehlt es sich, mit der Krankenkasse vorher Rücksprache zu nehmen. Bei der Abholung<br />
der Milchpumpe müssen Sie meistens eine Kaution hinterlegen, die Sie bei<br />
Rückgabe zurück erhalten. Außerdem müssen Sie auf eigene Kosten ein Abpump-Set<br />
für sich kaufen, welches alle Teile enthält, die mit der Milch unmittelbar in Berührung<br />
kommen. Nur wenige Krankenkassen sind bereit, auch diese Kosten zu übernehmen.<br />
Das Abpump-Set gibt es entweder als einfaches Abpump-Set (für eine Brust) oder als<br />
Doppel-Pump-Set, mit dem man beide Brüste gleichzeitig abpumpen kann. Das Doppel-Pump-Set<br />
ist zwar etwas teurer, bedeutet letztlich aber eine erhebliche Zeitersparnis,<br />
zumal die Brüste alle zwei bis drei Stunden abgepumpt werden sollten. Da nämlich<br />
die Pumpe nicht soviel Milch absaugen kann wie ein Kind trinken würde, sollte<br />
man häufiger abpumpen, als die Kinder trinken, um den Milchfluss in Gang zu halten.<br />
Das gilt auch dann, wenn damit letztlich mehr Milch abgepumpt wird, als an die Kinder<br />
später verfüttert werden kann. Wenn Sie nachts aus dem Schlaf aufwachen, sollten<br />
Sie auch diese Gelegenheit zum Abpumpen nutzen. Einen Wecker sollten Sie sich<br />
deswegen allerdings nicht stellen, weil jede (zusätzliche) Schlafunterbrechung auf<br />
Kosten Ihrer eigenen Gesundheit und körperlichen Ausdauer geht.<br />
Beachten Sie unbedingt, dass alle Teile, die mit der Milch in Berührung kommen,<br />
vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch gereinigt und ausgekocht<br />
werden müssen, um sie keimfrei zu halten. Füttern Sie die Kinder nach Möglichkeit<br />
nicht mit einem Fläschchen, sondern nach der Finger-Feeding-Methode, damit der<br />
Saugreflex erhalten bleibt (s. oben, Seite 54).<br />
Beginnen Sie mit dem Abpumpen möglichst sofort nach der Geburt, damit die<br />
Milch einschießt. Am Anfang werden Sie nur <strong>klein</strong>ste Mengen auffangen können.<br />
Auch hiervon ist jeder einzelne Tropfen wichtig, weil es sich um die für die Immunabwehr<br />
so wichtige Vormilch handelt. Wenn Sie die Milch transportieren müssen (z.B. in<br />
die Klinik), so achten Sie auf eine ununterbrochene Kühlkette. Verwenden Sie für die<br />
Aufbewahrung möglichst keine Glasbehälter und schütten Sie die Milch möglichst nicht<br />
zwischen verschiedenen Gefäßen um. Bei Kühlschranktemperatur hält sich die Muttermilch<br />
18 bis 24 Stunden.<br />
Auch wenn Ihre Kinder so <strong>klein</strong> sind, dass sie auf der Intensivstation intravenös<br />
(durch einen Infusionsschlauch) ernährt werden müssen, sollten Sie regelmäßig abpumpen,<br />
damit der Milchspendereflex erhalten bleibt. Sie können die Milch dann für eine<br />
gewisse Zeit einfrieren und später an Ihre Kinder verfüttern. Das Einfrieren sollte möglichst<br />
bald nach dem Abpumpen geschehen, um den Anteil der Fremdkeime <strong>klein</strong> zu<br />
halten. Nach dem Auftauen muss die Milch sofort verbraucht werden. Das Auftauen<br />
selbst geschieht am besten in einem nicht zu heißen Wasserbad, keinesfalls jedoch in der<br />
Mikrowelle.<br />
4. Erste Zeit daheim: Hilfe im Haushalt<br />
Wenn Sie und die Kinder aus der Klinik entlassen sind, hat sich Ihr Alltag verändert.<br />
Ihre Kinder werden Ihr Herz erobert haben: der Gesichtsausdruck und jede ihrer<br />
Regungen sind für sich ein großartiges Erlebnis und laden ein, ihnen stundenlang zuzuschauen<br />
und sie zärtlich zu liebkosen. Sie haben wahrhaft doppeltes Glück.<br />
Zugleich werden Sie aber feststellen, dass die Beschäftigung mit den Kindern viel<br />
Zeit einnimmt – allein schon für das Stillen und Wickeln, Waschen und Anziehen. Zur<br />
freien Verfügung verbleiben Ihnen fast nur noch die Schlafzeiten der Kinder. Verbringen<br />
Sie diese Zeit nicht ausschließlich mit Hausarbeit. Versuchen Sie sich Freiräume<br />
schaffen, um selbst einmal aufzuatmen und dem eigenen, oft übernächtigten Körper eine<br />
kurze Ruhe zu gönnen. Nehmen Sie deshalb alle angebotene Hilfe an, die Sie von der<br />
Hausarbeit entlastet. Spannen Sie Großeltern, Tanten und Onkel, Freunde und liebe<br />
Nachbarn für sich ein. Bitten Sie sie, vielleicht einmal Staub zu saugen, eine warme<br />
Mahlzeit mitzubringen oder die Wäsche aufzuhängen. Besuchern, die Ihre Kinder sehen<br />
wollen, können Sie bei der Verabredung gleich eine Einkaufsliste mit auf den Weg geben.<br />
60b
61a<br />
Viele Eltern machen allerdings die Erfahrung, dass diese Freundschaftsdienste<br />
schon nach wenigen Wochen einschlafen und man danach doch auf sich allein gestellt<br />
ist. Bis dahin sind Sie vielleicht schon dazu übergegangen, den Haushalt auf das Wesentliche<br />
zu konzentrieren: nicht jedes Regal muss jede Woche abgestaubt, nicht jedes<br />
Kleidungsstück unbedingt gebügelt werden. Manchmal hilft das Anlegen einer Liste,<br />
die anstehenden Arbeiten strukturierter und effektiver zu erledigen. Auch die Anschaffung<br />
einer Spülmaschine entlastet bei der Hausarbeit.<br />
Einfacher wäre alles natürlich mit einer festen Haushaltshilfe. Unter bestimmten<br />
Umständen finden sich Kostenträger, die eine solche Hilfe zur Verfügung stellen.<br />
Verschiedene Anlaufstellen kommen für eine Anfrage in Betracht.<br />
a) Gesetzliche Krankenkasse<br />
Krankenkassen müssen eine kostenlose Haushaltshilfe gewähren, wenn die dafür<br />
geltenden Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Ein solcher Rechtsanspruch kann sich<br />
entweder unmittelbar aus dem Gesetz ergeben oder aus den Satzungsbestimmungen<br />
der jeweiligen Krankenkasse. Ein gesetzlich festgeschriebener Anspruch, den alle<br />
Krankenkassen erfüllen müssen, besteht jedoch nur dann, wenn sich die den Haushalt<br />
führende Person im Krankenhaus, in einer Reha-Maßnahme, in Kur oder in häuslicher<br />
Krankenpflege befindet – also in Fällen der gesundheitlichen Verhinderung. Darüber<br />
hinaus liegt es im eigenen Ermessen der Krankenkassen, in ihren Satzungsbestimmungen<br />
weitere Fälle festlegen, in denen eine Haushaltshilfe gewährt werden kann. Da die<br />
einzelnen Kassen diesen Handlungsrahmen unterschiedlich ausfüllen, besteht unter<br />
den Krankenkassen eine durchaus unterschiedliche Handhabung.<br />
Einige Satzungen sehen die Möglichkeit vor, innerhalb der ersten sechs Wochen<br />
nach der Geburt eine Haushaltshilfe zu bewilligen – vor allem, wenn die Mutter von<br />
der Geburt noch nicht vollständig erholt ist. Allerdings ist gerade diese erste Phase für<br />
die meisten Familien auch ohne fremde Hilfe noch ganz gut zu bewältigen: Die meisten<br />
Väter nehmen einen Teil ihres Jahresurlaubs, Verwandte und Freunde bieten ihre<br />
Unterstützung an. Erst allmählich ebbt die Hilfsbereitschaft ab, der Vater muss wieder<br />
in seinen Beruf und die Kinderbetreuung liegt von nun an – in den meisten Familien –<br />
allein bei der Mutter. Erst jetzt beginnt die Phase, in der die regelmäßige Unterstützung<br />
durch eine fremde Hilfe eine große Entlastung bedeuten könnte. Viele Familien<br />
wünschten sich daher eine Haushaltshilfe nicht für die ersten sechs Wochen, sondern<br />
eine dauerhafte Hilfe für wenigstens ein halbes oder ein ganzes Jahr – sei es auch nur<br />
mit einer geringen Anzahl an Wochenstunden.<br />
In diesem Punkt reagieren die meisten Krankenkassen jedoch abweisend. Für Zwillingseltern<br />
ist eine dauerhafte Haushaltshilfe praktisch unerreichbar. Selbst Drillingseltern<br />
haben bei den meisten Kassen nur dann eine Chance, wenn entweder noch weitere<br />
(ältere) Kinder zu versorgen sind oder wenn die Mutter durch eine zusätzliche außergewöhnliche<br />
Belastung überfordert ist, zum Beispiel durch die regelmäßige Teilnahme an<br />
einer ärztlich verordneten Krankengymnastik mit einem der Kinder oder an einem Förderkreis<br />
für Frühchen oder durch die ernste Behinderung eines Kindes. Ansonsten wird<br />
eine Haushaltshilfe nur dann gewährt, wenn die häusliche Lage so angespannt ist, dass<br />
der Hausarzt der Mutter einen drohenden Nervenzusammenbruch oder Suizidgefahr<br />
attestiert.<br />
Bei Vierlingen sollte man eigentlich schon deshalb eine großzügige Handhabung<br />
erwarten, weil es davon nicht so viele gibt und die Kosten demzufolge nicht übermäßig<br />
ins Gewicht fallen können. Trotzdem haben uns Vierlingseltern berichtet, dass ihre<br />
Krankenkasse den Wunsch nach einer Haushaltshilfe zurückwies, weil die Schwangerschaft<br />
auf eine Fruchtbarkeitsbehandlung zurückzuführen sei und man seine Lage damit<br />
selbst „verschuldet“ habe.<br />
Wird die Haushaltshilfe gewährt, so muss eine Zuzahlung geleistet werden; sie beträgt<br />
10% der Kosten – mindestens jedoch 5 EUR und höchstens 10 EUR pro Tag. Nach<br />
Erreichen der Belastungsgrenze von 2% des Bruttojahreseinkommens können Sie sich<br />
von der Zuzahlungspflicht befreien lassen.<br />
Besonderheiten bestehen noch für Landwirte. Hier bezeichnet das Gesetz die Mutterschaft<br />
ausdrücklich als einen der Fälle, für die die Satzung eine Haushaltshilfe vorsehen<br />
soll. Das liegt an den besonderen Anforderungen, die die Führung des landwirtschaftlichen<br />
Familienbetriebes traditionell an alle Familienmitglieder einschließlich der<br />
Mutter stellt. Als Mitglied einer landwirtschaftlichen Krankenkasse sollten Sie sich<br />
daher auch dann nach den für Sie geltenden Anspruchsvoraussetzungen erkundigen,<br />
wenn Sie „nur“ <strong>Zwillinge</strong> haben. Neben der landwirtschaftlichen Krankenkasse kennt<br />
außerdem auch die landwirtschaftliche Rentenversicherung einen Anspruch auf Betriebs-<br />
und Haushaltshilfe, jedoch nur bis zu 12 Wochen nach der Geburt und nur dann,<br />
wenn die Krankenkasse die Hilfe nicht gewährt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer landwirtschaftlichen<br />
Rentenversicherung nach den derzeit gültigen Bewilligungsrichtlinien, die<br />
61b
62a<br />
jeweils von der Vertreterversammlung des Gesamtverbandes der landwirtschaftlichen<br />
Alterskassen einheitlich beschlossen werden.<br />
b) Jugendamt<br />
Eine weitere Institution, bei der Sie eine Hilfe beantragen können, ist das Jugendamt.<br />
Das Jugendamt gewährt die Hilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
(KJHG). Dieses Gesetz kennt drei Vorschriften, nach denen eine Hilfe gewährt werden<br />
kann, nämlich § 20 (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen), § 23<br />
(Tagespflege) und § 27 (Hilfe zur Erziehung).<br />
Die Hilfe nach § 20 KJHG bezieht sich auf die Fälle, in denen die Haupterziehungsperson<br />
aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen komplett ausfällt.<br />
Das sind allerdings überwiegend dieselben Fälle, in denen auch die Krankenkasse<br />
schon verpflichtet ist, eine Haushaltshilfe zu gewähren. Da die Hilfe der Krankenkasse<br />
Vorrang hat vor der Hilfe des Jugendamtes, ist die praktische Bedeutung des<br />
§ 20 KJHG in diesem Zusammenhang eher gering. Nur wenn keine Mitgliedschaft in<br />
einer Krankenkasse besteht oder wenn ein Verhinderungsgrund vorliegt, für den die<br />
Krankenkasse nicht eintritt, kommt der Hilfe nach § 20 KJHG eine eigenständige Bedeutung<br />
zu. Allerdings gewährt § 20 KJHG niemals eine dauernde Unterstützung,<br />
sondern nur eine vorübergehende Hilfe für den kurzen Zeitraum der Verhinderung.<br />
Für Ihre Situation wie geschaffen ist dagegen § 23 KJHG (Tagespflege), wo es<br />
heißt:<br />
„Zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren,<br />
kann auch eine Person vermittelt werden, die das Kind für einen<br />
Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten<br />
betreut (Tagespflegeperson)“.<br />
Allerdings hat die Vorschrift den Nachteil, dass sie keinen verbindlichen Rechtsanspruch<br />
gewährt – sie ist letztlich nicht mehr als ein Programm. Das Nähere über den<br />
Inhalt und den Umfang der Leistungen regelt das jeweilige Landesrecht, so dass die<br />
Anwendung der Vorschrift in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausfällt 1 .<br />
Aber selbst innerhalb desselben Bundeslandes räumen die Vorschriften den Jugendämtern<br />
einen Ermessensspielraum ein, den diese – auch in Abhängigkeit von der kommunalen<br />
Haushaltslage – unterschiedlich nutzen. Nur das Ermessen des einzelnen Sachbearbeiters<br />
ist dann oftmals nicht mehr groß: Eine Fülle von Verwaltungsvorschriften engt<br />
ihn bei der Auslegung der Vorschrift und der Bewilligung der Hilfe ein. In vielen Orten<br />
ist dem Sachbearbeiter die Bewilligung einer Hilfe nach § 23 KJHG praktisch nur erlaubt,<br />
wenn sie dem Jugendamt keine Kosten verursacht, wenn man die Hilfe also selbst<br />
bezahlt. Die konkrete „Leistung“ des Jugendamtes besteht dann lediglich in der Hilfestellung<br />
bei der Auswahl einer geeigneten Pflegeperson und ggf. in Fortbildungsangeboten<br />
für die Tagesmutter. Trotzdem sollte man sich beim örtlichen Jugendamt erkundigen.<br />
Einige Städte gewähren eine kostenlose Tagesmutter bei besonders geringem Einkommen,<br />
andere Städte bezahlen die Tagesmutter und verlangen dann einen einkommensabhängigen<br />
Elternbeitrag. Dieser Beitrag liegt im Allgemeinen unterhalb der tatsächlichen<br />
Kosten einer Tagesmutter, zumal die Jugendämter in einigen Bundesländern für Geschwisterkinder<br />
keinen zusätzlichen Beitrag erheben. Allerdings kennen viele Jugendämter<br />
als Tagesbetreuung für die Kleinsten nur die „Tagespflegefamilie“, zu der man die<br />
Kinder bringt, und können Anfragen nach einer „Tagespflegeperson“, die ins eigene<br />
Haus kommt (sog. Kinderfrau), nicht bedienen, obwohl sie dem Gesetz nach auch für<br />
diese anerkannte Form der Kinder- und Jugendhilfe die Planungs- und Gesamtverantwortung<br />
tragen. Auf jeden Fall haben Sie gegenüber dem Jugendamt einen gesetzlich<br />
festgeschriebenen Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Tagespflege (§ 23 Abs. 2<br />
KJHG), den Sie durchaus wahrnehmen sollten, um sich über die örtlichen Voraussetzungen<br />
und Gegebenheiten zu informieren.<br />
Einfacher ist es manchmal, eine Hilfe über § 27 KJHG zu bekommen (sog. „Hilfe<br />
zur Erziehung“). Diese Vorschrift gewährt einen verbindlichen Rechtsanspruch, so dass<br />
das Jugendamt eine Hilfe gewähren muss, sofern die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.<br />
Zwar passt die Vorschrift nicht ganz auf Ihre Situation: Bei der Hilfe zur Erziehung<br />
geht es vorrangig nicht um Entlastung bei der Hausarbeit und Babypflege, sondern um<br />
die Behebung von Erziehungsdefiziten, d.h. um schwer erziehbare Kinder und verwahr-<br />
62b<br />
1 Einen Überblick über die verschiedenen Landesbestimmungen enthält die Broschüre „Kinder<br />
in Tageseinrichtungen und Tagespflege“, kostenlos zu beziehen beim Bundesministerium für<br />
Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Broschürenstelle –, Postfach 20 15 51, 53145 Bonn, Tel.<br />
0180-5329329; E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de bzw. download unter<br />
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=4236.html.
63a<br />
loste Familienverhältnisse. Trotzdem tun sich manche Jugendämter leichter diese Hilfe<br />
zu gewähren, als eine „Hilfe zur Tagespflege“ nach § 23 KJHG.<br />
Voraussetzung für eine solche sozialpädagogische Familienhilfe ist in jedem Fall<br />
ein anerkannter Betreuungsbedarf. Vierlingseltern haben bei den Jugendämtern recht<br />
gute Chancen, einen Betreuungsbedarf anerkannt zu bekommen; bei Drillingen müssen<br />
z.T. wiederum weitere belastende Umstände hinzutreten. Meist muss man auch erläutern<br />
können, warum Großeltern, Nachbarn usw. die benötigte Hilfe nicht erbringen<br />
können.<br />
Oftmals hängt der Erfolg der Bemühungen um eine Hilfe auch davon ab, die örtlichen<br />
Richtlinien und den zuständigen Sachbearbeiter zu kennen. Interessierte Drillings-<br />
und Vierlingseltern sollten sich daher vorab bei den örtlichen Ansprechpartnern<br />
des ABC-Clubs oder bei den Sozialdiensten der Kirchen und Wohlfahrtsverbände über<br />
die örtlichen Besonderheiten informieren. Außerdem kann es – vor allem in <strong>klein</strong>eren<br />
Ortschaften – Wunder wirken, einen Kommunalpolitiker für sein Anliegen zu gewinnen.<br />
Wird eine Hilfe nach § 27 KJHG tatsächlich bewilligt, so liegt deren gesetzliche<br />
Aufgabe in der erzieherischen Pflege und Betreuung der Kinder, also nicht in der Hilfe<br />
im Haushalt. Dadurch entstehen schnell Reibungspunkte, weil die meisten Eltern ihre<br />
Kinder gern selbst versorgen und erziehen möchten, und sich lieber etwas Entlastung<br />
im Haushalt wünschten. Trotzdem kann auch eine solche Kraft eine gute Hilfe sein:<br />
als Betreuung zuhause, wenn man einen eigenen Arztbesuch vorhat oder Besorgungen<br />
erledigen muss, sowie als unterstützende Begleitung, wenn man mit den Kindern eine<br />
PEKiP-Gruppe, den Kinderarzt oder das Babyschwimmen aufsuchen will. Über den<br />
genauen Inhalt der zu erbringenden Hilfeleistung sollen sich die Beteiligten einigen<br />
und gemeinsam einen Hilfeplan aufstellen. Allerdings haben viele Eltern die Erfahrung<br />
gemacht, ihre Erziehungswünsche bei den Hilfskräften nicht ausreichend durchsetzen<br />
zu können – oft auch deshalb, weil nach einer unausgeschlafenen Nacht die<br />
Kraft für eine entsprechende Auseinandersetzung fehlt. Eine Mutter gab daher den<br />
Tipp, die Hilfskraft in solchen Fällen auf fünf Uhr morgens zu bestellen, um eine größere<br />
„Waffengleichheit“ in puncto Unausgeschlafenheit herzustellen.<br />
Auch im Rahmen einer Hilfe nach § 27 KJHG muss man übrigens damit rechnen,<br />
entsprechend seinen Einkommensverhältnissen vom Jugendamt zu einem finanziellen<br />
Beitrag herangezogen zu werden.<br />
c) Bundesstiftung „Mutter und Kind“<br />
Die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Stiftung zum Schutz des ungeborenen Lebens“<br />
wurde eingerichtet, um Schwangere in einer Notlage finanziell zu unterstützen.<br />
Dadurch soll vor allem erreicht werden, dass Frauen sich nicht aus finanziellen Gründen<br />
zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließen. Deshalb werden die Mittel der Bundesstiftung<br />
vorrangig an diejenigen vergeben, die sich während der ersten Schwangerschaftsmonate<br />
wegen einer Notlage an eine Schwangerschaftsberatungsstelle wenden.<br />
Zu den möglichen Leistungen der Bundesstiftung gehört auch die Finanzierung einer<br />
Haushaltshilfe bei Mehrlingsgeburten, und zwar bereits bei Zwillingsgeburten. Um<br />
die Stiftungsmittel erhalten zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:<br />
- Die Schwangere muss sich in einer finanziellen Notlage befinden. Dazu<br />
darf das Familieneinkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten,<br />
die sich an dem Anderthalbfachen der Sozialhilfe-Regelsätze orientieren<br />
zuzüglich angemessener Wohnkosten. Für Alleinstehende/Alleinerziehende<br />
gilt der zweifache Regelsatz eines Haushaltsvorstands, wiederum<br />
zuzüglich Wohnungskosten. Für werdende Mehrlingseltern gelten in einigen<br />
Bundesländern höhere Einkommensgrenzen; außerdem wird das Einkommen<br />
der Frau bei Mehrlingsschwangerschaften nicht voll berücksichtigt<br />
1 .<br />
- Es muss außerdem eine individuelle soziale Not- und Konfliktsituation vorliegen.<br />
Das Unterschreiten der Einkommensgrenzen allein reicht als Begründung<br />
einer Notlage nicht aus.<br />
- Der Antrag muss grundsätzlich vor der Geburt gestellt werden. Wenn man<br />
einen bereits fest vereinbarten Beratungstermin nicht mehr vor der Geburt<br />
wahrnehmen konnte (z.B. wegen plötzlicher Frühgeburt), genügt es, wenn<br />
der Erstkontakt zur Beratungsstelle noch während der Schwangerschaft erfolgte.<br />
Weisen Sie bei dem späteren Beratungsgespräch noch einmal auf<br />
den Zeitpunkt der ersten Kontaktaufnahme hin.<br />
1 Bei doppelverdienenden Mehrlingseltern wird nicht das (Doppel-)Einkommen aus dem Zeitraum<br />
vor der Antragstellung zugrundegelegt, sondern das Einkommen in den folgenden 12 Monaten,<br />
also in der Regel nicht das volle Einkommen der Frau.<br />
63b
64a<br />
64b<br />
- Vorrangig werden Anträge aufgenommen, die bis zur 20. SSW gestellt<br />
werden.<br />
- Bereits der erste Antrag sollte alle beanspruchten Hilfen (d.h. auch die<br />
Haushaltshilfe) umfassen, da Nachanträge nur im Ausnahmefall möglich<br />
sind (z.B. bei durchgreifender Veränderung der Lebenssituation).<br />
- Der Antrag kann nur bei der für den Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort<br />
zuständigen Vergabestelle gestellt werden.<br />
Zuständig für die Aufnahme der Anträge sind in einigen Bundesländern bestimmte<br />
kirchliche Stellen (z.B. Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland),<br />
in den übrigen Ländern spezielle Landesstiftungen (z.B. „Stiftung Familie in Not“<br />
o.ä.). Da allerdings nicht alle Beraterinnen in den Beratungsstellen regelmäßig mit<br />
Mehrlingen zu tun haben, sind ihnen die Sonderregelungen für Mehrlingsschwangerschaften<br />
nicht immer geläufig. Es kann Ihnen daher passieren, dass die Beraterin die<br />
Haushaltshilfe kategorisch mit der Begründung ablehnt, es könnten keine Leistungen<br />
der Bundesstiftung parallel zum Elterngeld gewährt werden. Dann sollten Sie auf § 4<br />
Absatz 1 der Vergaberichtlinien (letzter Halbsatz) hinweisen, wo ausdrücklich bestimmt<br />
ist, dass eine gleichzeitige Gewährung von Elterngeld und Stiftungsmitteln in<br />
Betracht kommt, wenn dies „mit Blick auf eine außergewöhnliche Belastungssituation<br />
besonders begründet ist“. Als Ausnahmesituation in diesem Sinne ist die Finanzierung<br />
einer Haushaltshilfe bei Mehrlingsgeburten ausdrücklich anerkannt. Bitten Sie die<br />
Beraterin, im Leitfaden zur Vergabe der Bundesstiftungsmittel gezielt nachzusehen. In<br />
den Leitfäden vieler Bundesländer (u.a. Nordrhein-Westfalen) ist die Finanzierung<br />
einer Haushaltshilfe bei Mehrlingsgeburten ausdrücklich als zulässige Hilfemöglichkeit<br />
erwähnt.<br />
Eine gute Adresse für Anfragen nach Hilfestellungen sind außerdem die kirchlichen<br />
Stellen (örtliche Kirchengemeinden, überörtliche Kirchenverbände, Diakonie und<br />
Caritas sowie der Sozialdienst katholischer Frauen und die evangelische Frauenhilfe),<br />
wie auch die freien Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Malteser Hilfsdienst,<br />
Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, Paritätischer Wohlfahrtsverband,<br />
Rotes Kreuz, SOS-Kinderdorf). Manche dieser Einrichtungen können eine Haushaltshilfe<br />
finanziell unterstützen, andere haben die Möglichkeit, eine Teilnehmerin an einem<br />
freiwilligen sozialen Jahr zu vermitteln. Ganz überwiegend besteht aber auch hier<br />
nur für höhergradige Mehrlingsfamilien Aussicht auf Erfolg.<br />
Manchmal hat man die Möglichkeit, für einige Wochen oder Monate eine/n Praktikanten/in<br />
aus einer hauswirtschaftlichen Qualifizierungsmaßnahme zu bekommen. Hierzu<br />
sollte man sich den Trägern solcher Maßnahmen als Praktikumstelle anbieten. Die<br />
Anschriften der Träger erfährt man beim Arbeitsamt.<br />
e) Au-pair<br />
Für manche Familien kommt vielleicht auch die Aufnahme eines Au-pair in Betracht.<br />
Au-pair bedeutet, eine junge Frau oder einen jungen Mann aus einem anderen<br />
Land für eine gewisse Zeit (in der Regel zehn bis zwölf Monate) in die Familie aufzunehmen.<br />
Das Au-pair hilft wöchentlich bis zu 30 Stunden bei der Hausarbeit und Kinderbetreuung.<br />
In der übrigen Zeit besucht das Au-pair einen Sprachkurs (Grundkenntnisse<br />
der Deutschen Sprache sind bereits vorhanden) und gestaltet seine Freizeit gemeinsam<br />
mit der Familie oder für sich allein. Die Familie gewährt dem Au-pair kostenlose<br />
Verpflegung und Unterkunft in einem eigenen Zimmer, Taschengeld in der Größenordnung<br />
von 200 EUR monatlich, Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr und zahlt<br />
dessen Krankenversicherung. Außerdem ist bei Au-pairs aus Übersee z.T. die Bezahlung<br />
der An- und Abreisekosten üblich. Vermittelt werden die Au-pairs durch besondere<br />
Vermittlungsstellen, deren Anschriften man beim Arbeitsamt erfragen kann. Insgesamt<br />
summieren sich die Kosten für ein Au-pair auf monatlich etwa 350-400 EUR (einschließlich<br />
der Vermittlung, jedoch ohne Unterkunft und Verpflegung sowie ggf. Anund<br />
Abreise).<br />
d) Kirchen und Wohlfahrtsverbände<br />
f) Steuerliche Anerkennung einer privaten Haushaltshilfe<br />
Wer eine Haushaltshilfe privat bezahlt, kann diese Kosten unter Umständen von der<br />
Einkommensteuer absetzen. Die Vorschriften hierüber ändern sich in immer kürzeren<br />
Abständen. Bis 1996 galt, dass Aufwendungen für eine Haushaltshilfe in Höhe von bis<br />
zu 12.000,- DM jährlich als Sonderausgaben anerkannt wurden, wenn mindestens zwei<br />
Kinder unter zehn Jahren oder eine hilfsbedürftige Person vorhanden waren. In der Zeit
65a<br />
zwischen 1997 und 2001 konnten bis zu 18.000,- DM jährlich als Sonderausgaben<br />
abgesetzt werden, unabhängig von minderjährigen Kindern.<br />
In 2002 konnten nur noch erwerbsbedingte Aufwendungen für die Kinderbetreuung<br />
steuerlich abgesetzt werden (z.B. Tagesmutter, Kindergartenbeitrag), jedoch nicht<br />
mehr die Hilfe bei der allgemeinen Haushaltsführung. Die Aufwendungen galten auch<br />
nicht mehr als Sonderausgaben, sondern als außergewöhnliche Belastung. Es konnte<br />
nur der Teil der Aufwendungen abgesetzt werden, der die Grenze der zumutbaren<br />
Belastung von 1.548 EUR je Kind überstieg. Die betreuten Kinder mussten unter 14<br />
Jahre alt und beide Elternteile mussten erwerbstätig sein (Ausnahme: Fälle der Behinderung).<br />
Der abzugsfähige Höchstbetrag seinerseits war auf 1.500,- EUR je Kind begrenzt.<br />
Wurde die Hilfskraft neben den Aufgaben der Kinderbetreuung auch zur allgemeinen<br />
Haushaltsführung eingesetzt, so mussten die Aufwendungen zeitanteilig<br />
aufgesplittet werden.<br />
Seit 2003 sind die Kosten einer Haushaltshilfe wie folgt absetzbar:<br />
- 10% der Kosten einer Haushaltshilfe, maximal jedoch 510 EUR im Jahr,<br />
sind absetzbar bei Beschäftigung einer Haushaltshilfe im sog. „Minijob“.<br />
Als „Minijob“ gelten Arbeitsverhältnisse bis zu einem Entgelt von 400<br />
EUR im Monat 1 , für die der Arbeitgeber pauschale Abgaben (Lohnsteuer<br />
und Sozialversicherung) in Höhe von insgesamt (nur) 12 Prozent abführen<br />
muss.<br />
- 20% der Kosten einer Haushaltshilfe, maximal jedoch 600 EUR im Jahr,<br />
sind absetzbar bei Beschäftigung einer Haushaltshilfe über eine Dienstleistungsagentur.<br />
- 12% der Kosten einer Haushaltshilfe, maximal jedoch 2.400 EUR im<br />
Jahr, sind absetzbar bei Beschäftigung einer Haushaltshilfe „auf Steuerkarte“,<br />
für die also die normalen Sozialabgaben und die Lohnsteuer abgeführt<br />
werden.<br />
Diese Regelungen gelten für alle Haushalte, also auch für Einlingsfamilien und<br />
sogar für Haushalte ohne Kinder 2 . Der organisatorische Aufwand, Lohn- und Kirchensteuer<br />
sowie die Sozialabgaben für eine Haushaltshilfe ordnungsgemäß abzuführen, wird<br />
übrigens häufig überschätzt. Dies vollzieht sich recht unkompliziert mit dem so genannten<br />
Haushaltsscheckverfahren. Die Minijob-Zentralen der Bundesknappschaft in Essen<br />
und Cottbus ziehen die 12% Steuern und Sozialabgaben automatisch vom Konto der<br />
Arbeitgeber ein und leiten die Anteile der Rentenkasse, der Krankenversicherung und<br />
des Finanzamtes an diese weiter. Einzelheiten zum Haushaltsscheckverfahren und auch<br />
zu den steuer- und versicherungsrechtlichen Fragen der übrigen Beschäftigungsformen<br />
erfahren Sie unter www.haushaltsscheck.de.<br />
Mehrlingseltern können versuchen, über die gesetzliche Neuregelung hinaus eventuell<br />
sogar eine allgemeine Haushaltshilfe als außergewöhnliche Belastung anerkannt zu<br />
bekommen. Ausgangspunkt hierfür ist ein Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg<br />
aus dem Jahre 1990 3 , also noch aus der Zeit vor Einführung der neuen Regelung. Das<br />
Finanzgericht erkennt darin eine Haushaltshilfe für Drillinge als allgemeine außergewöhnliche<br />
Belastung und als uneingeschränkt abzugsfähig an. Ob man sich auf dieses<br />
Urteil noch mit Erfolg berufen kann, nachdem der Gesetzgeber in der Zwischenzeit<br />
einige spezielle gesetzliche Regelungen zur steuerlichen Behandlung der Kinderbetreuung<br />
eingeführt und auch wieder aufgehoben hat, ist nicht sicher; einen Versuch aber ist<br />
es auf jeden Fall wert. Hat man dagegen „nur“ <strong>Zwillinge</strong>, sollte man noch weitere arbeits-<br />
und zeitaufwändige Erschwernisse vorbringen können, um seine Aussichten auf<br />
Anerkennung als außergewöhnliche Belastung zu verbessern (z.B. Frühchenproblematik,<br />
umfangreiche Krankengymnastik etc.). Denn „außergewöhnlich“ im steuerrechtlichen<br />
Sinne ist eine Belastung nur dann, wenn sie höher ist als bei der überwiegenden Zahl der<br />
Steuerpflichtigen gleicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse und<br />
auch das auslösende Ereignis ein „außergewöhnliches“ ist.<br />
65b<br />
1 Mit einigen Tricks (z.B. Erstattung der Fahrtkosten) lässt sich die Einkommensgrenze von<br />
400 EUR noch etwas nach oben strecken – Einzelheiten hierüber erfahren Sie in den gängigen<br />
Steuerratgebern oder beim Steuerberater.<br />
2 Anmerkung: Außerhalb dieser (von Kindern unabhängigen) Abzugsfähigkeit für Haushaltshilfen<br />
bleibt die bisherige Möglichkeit erhalten, sonstige Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter,<br />
Kindergarten) zu zwei Dritteln abzusetzen, wenn beide Elternteile berufstätig sind.<br />
3 Urteil vom 12.11.1990 – Az.: VII K 217/88.
66a<br />
Drittes Kapitel: Säuglingsalter<br />
1. Aktivitäten mit anderen Eltern und Kindern<br />
Wichtig aus unserer Sicht ist es, früh den Kontakt zu anderen jungen Familien zu<br />
pflegen. Das fördert den Erfahrungsaustausch der Eltern und erweitert die Erlebniswelt<br />
der Kinder. Überhaupt sollte man sich darum bemühen, mit den Kindern möglichst<br />
regelmäßig etwas zu unternehmen, spazieren zu gehen, Freunde zu besuchen –<br />
kurzum: das zu tun, was man allein (oder mit nur einem Kind) auch tun würde. Manche<br />
Zwillingseltern begeben sich vor lauter Hausarbeit und Babypflege in eine häusliche<br />
Isolation, weil sie sich nicht vorstellen können, wie sie die „Baby-Termine“ auch<br />
noch alle schaffen sollen. Bei fast allen Krabbelgruppen werden Sie jedoch aufgeschlossene<br />
Eltern kennen lernen, die auch einmal bereit sind, Ihnen ein Kind abzunehmen,<br />
es zu füttern, zu wickeln usw. Die Situation ist oft viel entspannter, als man<br />
es sich vorher vorstellt. Und wie wichtig sind solche Zusammentreffen als innerer<br />
Ausgleich und Abstand zum häuslichen Alltagsgeschehen! Am einfachsten gelingt der<br />
Aufbruch, wenn man zuhause ständig eine fertig gepackte Wickeltasche oder einen<br />
<strong>klein</strong>en Rucksack mit Windeln, Wischtüchern, Unterlage, Ersatzkleidung, ggf. Babynahrung<br />
oder –getränk und Schnuller, ein oder zwei Spielsachen und ggf. erforderliche<br />
Medikamente bereitstehen hat, die man nur noch greifen muss. Das spart Zeit und man<br />
vergisst auch weniger, als wenn man alles spontan einpacken müsste.<br />
Viele Möglichkeiten solcher Treffen gibt es: Stilltreffen einer örtlichen Stillgruppe,<br />
privat organisierte Krabbelgruppen mit Paaren, die Sie vielleicht im Geburtsvorbereitungskurs<br />
oder in der Geburtsklinik kennen gelernt haben, bis hin zu angeleiteten<br />
PEKiP-Gruppen und Babyschwimmen. Bei PEKiP-Kursen sollten Sie vorab klären, ob<br />
eine Begleitperson für beide <strong>Zwillinge</strong> genügt, oder ob die Kursleiterin Wert darauf<br />
legt, dass eine zweite Begleitperson mitkommt. Viele PEKiP-Kurse gewähren bei<br />
<strong>Zwillinge</strong>n auch einen Nachlass auf die zweite Kursgebühr. Das Babyschwimmen setzt<br />
dagegen immer eine eigene Begleitperson für jedes Kind voraus, da die Kinder im<br />
Wasser gestützt werden müssen. Hier lohnt es sich ebenfalls, nach einem Zwillingsrabatt<br />
zu fragen.<br />
Manche Eltern schließen sich auch einem der vielen Zwillingsclubs an, in denen<br />
man mit anderen Zwillingseltern und –familien in Kontakt kommt. Einen bundesweit<br />
arbeitenden Zwillingsverband gibt es allerdings nicht, sondern nur örtliche Zwillingsgruppen<br />
mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielsetzungen. Manche Zwillingsclubs<br />
treffen sich abends in geselliger Stammtischrunde, andere als Krabbelgruppe<br />
mitsamt den Kindern. Teilweise sind die Kinder der Mitgliedsfamilien jedoch von so<br />
unterschiedlichem Alter, dass deren Spielinteressen nicht unbedingt harmonieren. Bei<br />
den meisten Zwillingsclubs kann man praktische Informationen erhalten (z.B. welches<br />
Geschäft in der Umgebung die beste Auswahl an Zwillingswagen hat), zum Teil werden<br />
sogar umfangreiche Broschüren erstellt. Manche Clubs führen eine Gebrauchtbörse oder<br />
veranstalten spezielle Zwillingsflohmärkte. Einige Clubs bemühen sich auch um eine<br />
bessere Infrastruktur für Zwillingseltern, z.B. bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.<br />
Manche Clubs veranstalten ein Jahresfest. Das größte Treffen dieser Art findet im<br />
amerikanischen „Twinsburg“ (Ohio) statt, das sogar nach <strong>Zwillinge</strong>n benannt wurde. Bis<br />
zu 3.000 Zwillingspaare treffen sich jährlich in diesem Ort, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
von den eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n Moses und Aaron Wilcox gegründet wurde. Diese<br />
Brüder waren besonders „zwillingshaft“: Sie sahen gleich aus, waren Geschäftspartner,<br />
heirateten zwei Schwestern, hatten gleich viele Kinder, bekamen dieselbe Krankheit,<br />
starben am selben Tag und wurden im selben Grab begraben – natürlich in „Twinsburg“.<br />
Da fällt es nicht schwer sich auszumalen, wie sie den Amerikanern Pate stehen<br />
für das Zwillingsdasein schlechthin. Bei dem Festival sind alle Zwillingspaare jeweils<br />
gleich gekleidet, geschminkt, geschmückt und tragen dieselbe Frisur – das alles in der<br />
Hoffnung, bei dem Wettbewerb der „identischsten“ <strong>Zwillinge</strong> einen der vorderen Plätze<br />
zu belegen 1 .<br />
Ob man sich einem Zwillingsclub anschließen will, ist zum einen eine Frage der<br />
persönlichen Einstellung und hängt zum anderen natürlich auch von dem Zwillingsclub<br />
selbst ab, seinen Mitgliedern und seinem Programm. Abstand nehmen sollte man auf<br />
jeden Fall von solchen Treffs, die wir einmal als „Leidensclub“ bezeichnen wollen, wo<br />
alle Mitglieder sich nur ständig gegenseitig berichten, wie schwer sie es mit ihren <strong>Zwillinge</strong>n<br />
haben, und dass es ihnen noch schlechter geht als allen anderen. Dass <strong>Zwillinge</strong><br />
1 Auf die verschämte Frage eines zweieiigen Zwillingspaars, ob denn auch sie trotz ihres unterschiedlichen<br />
Aussehens auf dem Festival willkommen seien, antwortete der Veranstalter: Ja,<br />
natürlich, „...what's really fun is when the brother/sister sets show up in identical clothing anyways.“<br />
(besonders spaßig sei es sogar, wenn verschiedengeschlechtliche <strong>Zwillinge</strong> sich gleich<br />
angezogen präsentierten). Nun denn. Weitere Hinweise zur Stadt Twinsburg und zu dem Zwillingstreffen:<br />
http://www.twinsburg.com, http://www.twinsdays.org<br />
66b
67a<br />
am Anfang mehr Arbeit bedeuten als Einlinge, weiß jeder, und soll auch nicht geleugnet<br />
werden. Wer aber nicht gleichzeitig darüber berichten kann und will, dass <strong>Zwillinge</strong><br />
auch doppelte Freude bedeuten, setzt in seiner Wahrnehmung vielleicht die falschen<br />
Schwerpunkte. Jedenfalls haben wir Eltern kennen gelernt, die mehr durch das<br />
Zwillingstreffen selbst als durch ihre eigene Situation deprimiert wurden.<br />
Für höhergradige Mehrlinge (ab Drillingen) gibt es den bundesweit agierenden<br />
ABC-Club, der in den einzelnen Bundesländern ehrenamtliche Landesvertretungen<br />
eingerichtet hat und damit insgesamt einen höheren Organisationsgrad ereicht als die<br />
nur regional wirkenden Zwillingsclubs. Der ABC-Club versteht sich nicht in erster<br />
Linie als Dienstleister, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe. Er bietet Beratung durch<br />
andere Mehrlingseltern, Erfahrungsaustausch und regionale Stammtischrunden, aber<br />
auch z.B. Vermittlung gebrauchter Mehrlingskinderwagen. Bei jährlichen Familientreffen<br />
und auf gemeinsamen Familienfreizeiten pflegt man den Kontakt. Clubmitglieder<br />
erhalten vierteljährlich ein Mitteilungsblatt mit Berichten und Kleinanzeigen.<br />
Außerdem veranstaltet der Club Symposien, begleitet wissenschaftliche Forschungsvorhaben<br />
über Mehrlinge und bringt sich in die medizinische Diskussion ein, macht<br />
Verbesserungsvorschläge für die Begleitung von Mehrlingsschwangerschaften sowie<br />
für die Betreuung auf der Neugeborenenintensivstation. Der erfolgreichen Lobbyarbeit<br />
des Vereins ist es auch zu verdanken, dass das Elterngeld (früher: Erziehungsgeld) seit<br />
1989 nicht mehr pro Geburt, sondern für jedes geborene Kind extra gezahlt wurde,<br />
bzw. seit 2007 für jedes Mehrlingsgeschwister ein Zuschlag auf das Elterngeld in<br />
Höhe von 300 EUR monatlich erfolgt. Der ABC-Club ist auf jeden Fall eine engagierte<br />
und professionell arbeitende Interessenvertretung höhergradiger Mehrlingsfamilien,<br />
deren Einfluss man mit seiner Mitgliedschaft stärken kann.<br />
2. Finanzielles<br />
Zur Frage der staatlichen Förderung von Familien hat die Europäische Beobachtungsstelle<br />
für nationale Familienpolitiken, eine der EU-Kommission unterstellte Einrichtung,<br />
feststellen müssen, dass es in Deutschland eine zielgerichtete Familienpolitik<br />
schlechthin nicht gibt! In dieselbe Richtung stößt das Bundesverfassungsgericht, wenn<br />
es in seiner Entscheidung vom 10.11.1998 die deutsche Steuergesetzgebung als eine<br />
„Diskriminierung der ehelichen Erziehungsgemeinschaft“ tadelt. Auf den Punkt gebracht<br />
hat es Bundespräsident Köhler: „Wer Kinder hat, wird hierzulande tendenziell<br />
bestraft.“<br />
Dabei ist die finanzielle Entlastung der Familie nicht nur eine aus der Staatsverfassung<br />
gebotene Wohlfahrt, sondern gleichermaßen auch ein volkswirtschaftliches Gebot,<br />
denn keine Gesellschaft kann sich auf Dauer einen Bevölkerungsrückgang und die sich<br />
daraus ergebende Überalterung erlauben. Schon heute stellt die Bevölkerungsentwicklung<br />
in regelmäßigen Abständen erneut die Sicherheit der Renten zur Diskussion. Zu<br />
Recht hat das Bundesverfassungsgericht deshalb bereits mehrfach hervorgehoben: „Die<br />
Kinderbetreuung ist eine Leistung, die auch im Interesse der Gemeinschaft liegt und<br />
deren Anerkennung verlangt.“<br />
Bedenkt man, dass Eltern für die Versorgung jedes Kindes bis zum achtzehnten Lebensjahr<br />
durchschnittlich 370.000,- EUR aufwenden (bei Hinzurechnung des Lohnausfalls<br />
eines Elternteils sogar fast das Doppelte), so wird erkennbar, dass die staatlich<br />
gewährten Steuervorteile und Sozialleistungen diesen Aufwand nicht annähernd aufwiegen.<br />
Wer Mehrlinge erwartet, ist von den Kosten gleich mehrfach betroffen. Mehrlingsgeburten<br />
führen immer zu einer erheblichen Reduzierung der frei verfügbaren (also nicht<br />
zur täglichen Bedarfsdeckung benötigten) Mittel, und nicht selten bedeutet eine Mehrlingsgeburt<br />
selbst für verdienende Eltern den Gang zum Sozialamt.<br />
Diejenigen Leistungen, die Ihnen nach einer Mehrlingsgeburt zustehen, sollten Sie<br />
aber jedenfalls in Anspruch nehmen:<br />
a) Elterngeld<br />
Das staatliche Elterngeld wird abhängig von der Höhe des zuvor erzielten Einkommens<br />
gewährt. Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um monatlich je 300<br />
Euro für das zweite und jedes weitere Kind. Weitere Einzelheiten über das Elterngeld<br />
erfahren Sie in der Broschüre „Elterngeld und Elternzeit“ des Bundesfamilienministeriums,<br />
die unmittelbar dort bestellt werden kann 1 und außerdem bei den nachfolgend aufgeführten<br />
Elterngeldstellen erhältlich ist:<br />
Baden-Württemberg<br />
Landeskreditbank Karlsruhe<br />
1 Anschrift: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Alexanderplatz 6,<br />
1017 Berlin, Tel. 01888/555-0. Download der Broschüre unter<br />
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/publikationsliste,did=89272.html.<br />
67b
68a<br />
68b<br />
Bayern<br />
Berlin<br />
Brandenburg<br />
Bremen<br />
Hamburg<br />
Hessen<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Niedersachsen<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Saarland<br />
Sachsen<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Schleswig-Holstein<br />
Zentrum Bayern Familie und Soziales<br />
Bezirksamt (Jugendamt)<br />
Elterngeldstellen der Landkreise und kreisfreien<br />
Städte<br />
Amt für Soziale Dienste (Bremerhaven:<br />
Amt für Familie und Jugend)<br />
Bezirksamt (Einwohneramt)<br />
Amt für Versorgung und Soziales<br />
Landesamt für Gesundheit und Soziales,<br />
Abteilung Versorgungsamt<br />
Gemeinde der Stadt, vereinzelt Landkreis<br />
Kreise und kreisfreie Städte<br />
Jugendamt<br />
Landesamt für Soziales, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz<br />
Amt für Familie und Soziales<br />
Landesverwaltungsamt<br />
Außenstellen des Landesamtes für soziale<br />
Dienste<br />
Arbeitslos gemeldet sind. Ihnen gleichgestellt sind Bezieherinnen von Arbeitslosengeld I<br />
sowie Selbständige, die in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert sind.<br />
Der Leistungszeitraum beginnt sechs Wochen vor dem vorausberechneten Entbindungstermin<br />
und endet bei Mehrlingen zwölf Wochen nach dem tatsächlichen Entbindungstag.<br />
Das entspricht genau der Zeit des Mutterschutzes nach dem Mutterschutzgesetz.<br />
Um das Mutterschaftsgeld ausgezahlt zu erhalten, muss man der Krankenkasse eine<br />
ärztliche Bescheinigung über den voraussichtlichen Entbindungstermin einreichen. Die<br />
Bescheinigung darf frühestens eine Wochen vor Beginn der Mutterschutzfrist ausgestellt<br />
werden, also sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.<br />
Bei Frühgeburten verlängert sich die Bezugsdauer des Mutterschaftsgeldes noch<br />
einmal um den Zeitraum, der vor der Geburt nicht in Anspruch genommen werden konnte.<br />
Als Frühgeburten in diesem Zusammenhang gelten Kinder, die mit einem Geburtsgewicht<br />
von unter 2.500 Gramm zur Welt gekommen sind; bei Mehrlingen zählt das<br />
schwerste Kind. Dem gleichgesetzt werden Kinder, die wegen noch nicht voll ausgebildeter<br />
Reifezeichen oder wegen verfrühter Beendigung der Schwangerschaft einer wesentlich<br />
erweiterten Pflege bedürfen. Die Klinik stellt hierüber eine spezielle „Frühgeburtsbescheinigung“<br />
aus.<br />
Die Höhe des Mutterschaftsgeldes entspricht dem durchschnittlichen Nettoeinkommen<br />
der vorangegangenen drei Monate, wobei die Krankenkasse höchstens 13,- EUR pro<br />
Kalendertag zahlt und der Arbeitgeber den Restbetrag zuschießen muss (§ 14 Mutterschutzgesetz).<br />
Wird der Arbeitgeber zwischenzeitlich zahlungsunfähig, zahlt die Krankenkasse<br />
zusätzlich auch den Arbeitgeberzuschuss.<br />
Thüringen<br />
Jugendämter der Kreise und kreisfreien<br />
Städte<br />
Die Höhe des zu erwartenden Elterngeldes kann man sich übrigens vorab im Internet<br />
ausrechnen lassen: www.bmfsfj.de/elterngeldrechner.<br />
b) Mutterschaftsgeld<br />
Hiervon abweichend erhalten Arbeitnehmerinnen, die<br />
- privat krankenversichert sind,<br />
- gar nicht krankenversichert sind, oder<br />
- in einem „geringfügigen Beschäftigungsverhältnis“ stehen und nicht eigenständiges<br />
Pflichtmitglied in der gesetzlichen Krankenkasse mit Anspruch<br />
auf Krankengeld sind<br />
Das Mutterschaftsgeld gewähren die gesetzlichen Krankenkassen als Ersatz dafür,<br />
dass die Schwangere während der Mutterschutzfristen nicht arbeiten kann (und darf).<br />
Es wird deshalb nur den Frauen ausgezahlt, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder
69a<br />
ein Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungsamt 1 , jedoch beschränkt auf einen<br />
Höchstbetrag von insgesamt 210,- EUR. Zusätzlich erhalten auch diese Arbeitnehmerinnen<br />
den o.g. Arbeitgeberzuschuss, soweit ihr Einkommen den Satz von 13,- EUR<br />
pro Kalendertag übersteigt.<br />
Werdende Mütter, die BAföG beziehen, erhalten die Ausbildungsförderung vor<br />
und nach der Geburt für die Dauer von bis zu drei Monaten ausgezahlt, ohne an der<br />
Ausbildung teilnehmen zu müssen. Dauert die Unterbrechung länger, muss eine Beurlaubung<br />
beantragt werden, während der das BAföG nicht ausgezahlt wird. Die Förderungshöchstdauer<br />
wird aufgrund der Schwangerschaft auf Antrag um bis zu ein Semester<br />
verlängert, allerdings nur, wenn Sie nicht (über die drei Monate hinaus) beurlaubt<br />
waren.<br />
c) Entbindungsgeld<br />
Das frühere Entbindungsgeld von 77,- EUR für Frauen, die Mitglied in der gesetzlichen<br />
Krankenversicherung sind, ohne einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld zu<br />
haben, ist mit der Gesundheitsreform zum 1.1.2004 gestrichen; ebenso inzwischen das<br />
Mutterschaftsgeld für Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II.<br />
Beihilfeberechtigte Beamtinnen erhalten jedoch ein Entbindungsgeld oder einen<br />
Zuschuss für die Säuglings- und Kinderausstattung nach den Beihilfevorschriften des<br />
jeweiligen Bundeslandes. Ist der Ehemann beihilfeberechtigt, erhält er denselben Zuschuss;<br />
insgesamt wird er jedoch nur einmal ausgezahlt.<br />
Wehr- und Zivildienstleistende erhalten nach dem Unterhaltssicherungsgesetz eine<br />
Beihilfe für die Erstausstattung in Höhe von 127,82 EUR pro Kind. Der „krumme“<br />
Betrag erklärt sich aus der Umrechnung von früher 250,- DM.<br />
1 Anschrift: Bundesversicherungsamt (Mutterschaftsgeldstelle), Friedrich-Ebert-Allee 38,<br />
53113 Bonn, Tel. 0228/619-1888, Fax: 0228/619-1877, http://www.bundesversicherungsamt.de,<br />
EMail: mutterschaftsgeldstelle@bundesversicherungsamt.de<br />
d) Kindergeld<br />
Das Kindergeld bzw. den steuerlichen Kinder- und Betreuungsfreibetrag sowie den<br />
Kinderzuschlag für Geringverdienende erhalten Sie in der jeweils festgelegten Höhe.<br />
Besonderheiten für Mehrlinge gibt es hierbei nicht.<br />
e) Weitere Förderungsmöglichkeiten<br />
Neben diesen gesetzlich festgelegten Rechtsansprüchen existiert noch eine Vielzahl<br />
weiterer Töpfe bei öffentlichen und privaten Trägern, aus denen in Fällen der sozialen<br />
Not und bei außergewöhnlichen Belastungen weitere Mittel nach Ermessensentscheidung<br />
vergeben werden können. Hierzu gehört auch die bereits erwähnte Bundesstiftung<br />
„Mutter und Kind“, die für Mehrlingseltern erhöhte Förderungsmöglichkeiten vorsieht<br />
(z.B. auch für Umstandskleidung). Die katholische Kirche sowie die evangelischen Landeskirchen<br />
verwalten darüber hinaus eigene Härtefonds mit ähnlicher Zielsetzung. Manche<br />
Bundesländer haben spezielle Landesstiftungen eingerichtet, die neben der Verteilung<br />
der Bundesstiftungsmittel auch noch über einen eigenen Etat verfügen. Deren Mittel<br />
werden überwiegend von den Jugendämtern verwaltet und verteilt, ebenso wie die<br />
Mittel einiger kommunaler Stiftungen („Wöchnerinnenstiftung“ o.ä.), die daneben noch<br />
existieren können. Einige Bundesländer zahlen bei höhergradigen Mehrlingsgeburten<br />
sogar ein „Begrüßungsgeld“ unabhängig vom Einkommen der Eltern; in anderen Bundesländern<br />
übernehmen die Ministerpräsidenten eine „Ehrenpatenschaft“, die mit finanziellen<br />
Zuwendungen verbunden ist. Die einzelnen Förderungsmöglichkeiten sind regional<br />
sehr unterschiedlich und ändern sich ständig, weshalb man sich zum gegebenen<br />
Zeitpunkt jeweils aktuell beraten lassen sollte. Eine umfassende Beratung erhalten Sie<br />
bei den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Denn diese Stellen haben den konkreten<br />
gesetzlichen Auftrag, denjenigen Frauen, die eine Abtreibung ihrer Schwangerschaft<br />
erwägen, alle finanziellen Möglichkeiten aufzuzeigen, um eine soziale Notlage<br />
aufzufangen. In vielen Städten sind die kirchlichen Beratungsstellen besonders gut in<br />
diese Richtung informiert. Für die kirchlich verwalteten Fonds prüfen sie außerdem die<br />
Förderungsvoraussetzungen und versehen die Anträge mit einer eigenen Stellungnahme;<br />
zu anderen Förderungsmöglichkeiten erteilen sie die erforderlichen Informationen und<br />
helfen im Bedarfsfall bei der Antragstellung. Um in einer solchen Beratungsstelle eine<br />
Beratung zu erhalten, muss man übrigens nicht vorspiegeln, man befinde sich in einem<br />
Abtreibungskonflikt. Die meisten Beratungsstellen beraten ebenso gern diejenigen<br />
Schwangeren, die sich für ihre Kinder bereits fest entschieden haben. Auch nach der<br />
69b
70a<br />
Geburt kann man sich an diese Stellen noch wenden, wenngleich manche Förderungsmöglichkeiten<br />
dann nicht mehr greifen.<br />
Eine Zeitlang galt es noch als „Geheimtipp“, die Hersteller von Windeln und Babynahrung<br />
um ein <strong>klein</strong>es Sponsoring für die eigenen Mehrlinge zu bitten. Inzwischen<br />
haben jedoch so viele Mehrlingseltern davon Gebrauch gemacht, dass nur noch wenige<br />
Hersteller darauf anspringen. Bei angespannten finanziellen Verhältnissen – und solchen<br />
Familien sollte man das Feld vielleicht auch überlassen – kann sich eine verbindlich<br />
vorgebrachte Anfrage im Einzelfall aber immer noch lohnen.<br />
Manche Hersteller suchen gelegentlich sogar Testfamilien, um die Praxistauglichkeit<br />
und Marktfähigkeit neuer Produkte auszuprobieren. Durch solche Lieferungen<br />
kann man einiges Geld sparen; im Gegenzug muss man allerdings etwas Zeit für die<br />
abzufassenden Testberichte aufbringen. Voraussetzung für die Annahme als Testfamilie<br />
ist in der Regel, dass man in der näheren Umgebung der Herstellerfirma (bzw.<br />
deren Entwicklungsabteilung) wohnt.<br />
Als Allerletztes besteht für besonders notleidende Familien noch die Möglichkeit,<br />
sich unmittelbar an den Bundespräsidenten zu wenden 1 . Der Bundespräsident verfügt<br />
über einen Unterstützungsfonds, aus dem er zur Linderung besonderer Notlagen einmalige<br />
finanzielle Hilfen gewähren kann. Neben einer wirtschaftlichen Notlage muss<br />
auch eine besondere, schicksalsbedingte Belastung der Lebensumstände nachgewiesen<br />
werden. Damit sind außergewöhnliche Schicksalsschläge wie zum Beispiel das plötzliche<br />
Versterben eines Elternteils gemeint; Armut allein genügt nicht. Außerdem müssen<br />
alle gesetzlichen Hilfen bereits ausgeschöpft sein. Das Bundespräsidialamt lässt<br />
das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch eine örtliche Sozialbehörde oder eine<br />
anerkannte Beratungsstelle überprüfen.<br />
f) Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung<br />
In der gesetzlichen Rentenversicherung werden für jedes Kind drei Jahre Kindererziehungszeiten<br />
(bei <strong>Zwillinge</strong>n also sechs Jahre) als Beitragszeit berücksichtigt.<br />
Diese Beitragszeit beginnt mit dem Monat nach der Geburt und endet sechs Jahre<br />
darauf. Grundsätzlich wird die Kindererziehungszeit der Mutter gutgeschrieben; gemeinsam<br />
erziehende Eltern können die Zeiten jedoch untereinander aufteilen. Die Erklärung<br />
über die Aufteilung der Erziehungszeiten muss spätestens zwei Monate nach dem<br />
Zeitpunkt abgegeben werden, für den die Änderung erstmals wirken soll.<br />
Die Kindererziehungszeiten wirken sich bei der Rente genau so aus, als ob Sie gearbeitet<br />
hätten. Nicht erforderlich ist, dass Sie vorher beitragspflichtig gearbeitet haben.<br />
Gutgeschrieben wird Ihnen das fiktive Einkommen eines Durchschnittsverdieners, gleich<br />
ob Sie selbst vorher ein geringeres oder ein höheres Einkommen hatten.<br />
Darüber hinaus wird die Mutterschutzfrist (einschließlich der Mehrlings- und Frühchenverlängerung)<br />
als rentenrechtliche „Anrechnungszeit“ berücksichtigt, sofern die<br />
Mutter bei Beginn des Mutterschutzes in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis<br />
stand.<br />
Schließlich gilt noch der weitere Zeitraum bis zum zehnten Geburtstag des jüngsten<br />
Kindes als rentenrechtliche „Berücksichtigungszeit“ für den erziehenden Elternteil. Das<br />
bedeutet, dass für diese Zeiten zwar keine rentenrechtlichen Entgeltpunkte gutgeschrieben<br />
wurden, so dass sie den Rentenanspruch im Ergebnis nicht erhöhten, dass jedoch<br />
diese Zeiten bei der 35jährigen Rentenwartezeit angerechnet wurden. Mit Inkrafttreten<br />
der am 26.1.2001 beschlossenen Rentenreform hat die Kinderberücksichtigungszeit<br />
außerdem noch eine weitere Funktion bekommen: Wenn der erziehende Elternteil während<br />
der Berücksichtigungszeiten einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht, wird nicht nur<br />
sein tatsächlich erzieltes Einkommen bei der Rentenversicherung gutgeschrieben, sondern<br />
das Anderthalbfache dessen. Wenn also z.B. eine teilzeitbeschäftigte Mutter 60%<br />
von dem verdient, was das Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten ausmacht, wird<br />
dies rentenrechtlich so gewertet, als hätte sie 90 % des Durchschnittseinkommens aller<br />
Beschäftigten erzielt 2 . Der Rentenbeitrag (also der Lohnabzug) erhöht sich dadurch<br />
natürlich nicht. Für Mehrlinge gibt es hier allerdings – nach wie vor – keine besondere<br />
Vergünstigung.<br />
Normalerweise teilt die städtische Meldebehörde Ihrer Rentenversicherung die Geburt<br />
der Kinder mit, so dass die Anrechnungszeiten während der Mutterschutzfrist auto-<br />
70b<br />
1 Anschrift: Bundespräsidialamt, 11010 Berlin<br />
2 Die fiktive Aufwertung des Einkommens findet ihre Obergrenze mit dem Erreichen des vollen<br />
Durchschnittseinkommens aller Beschäftigten; darüber hinausragende Einkommen werden nicht<br />
aufgestockt.
71a<br />
matisch berücksichtigt werden und Sie nichts weiter unternehmen müssen. Einige<br />
Wochen nach der Geburt erhalten Sie darüber auch eine Bestätigung von der Rentenversicherung.<br />
Um auch die Beitrags- und Berücksichtigungszeiten anerkannt zu bekommen,<br />
müssen Sie einen Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten stellen.<br />
Dafür ist ein spezielles Antragsformular vorgesehen, welches Sie bei der Rentenversicherung<br />
anfordern können. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Beitrags-, Anrechnungs-<br />
und Berücksichtigungszeiten für Sie korrekt verbucht sind, können Sie bei der<br />
Rentenversicherung einen „Versicherungsverlauf“ anfordern und bei Unstimmigkeiten<br />
einen „Antrag auf Kontenklärung“ stellen.<br />
g) Kinderzuschlag, Arbeitslosengeld II und andere Sozialleistungen<br />
Mit der Geburt Ihrer Kinder ändern sich die Berechnungsgrundlagen für viele allgemeine<br />
Sozialleistungen, allen voran das Wohngeld, das Arbeitslosengeld II und die<br />
Sozialhilfe. Wer ohnehin bereits eine dieser Leistungsarten bezieht, muss die Kinder<br />
lediglich nachmelden.<br />
Einige Familien kommen jedoch erst durch die Kinder in den Bereich der sozialrechtlichen<br />
Bedürftigkeit, weil das vorhandene Einkommen zwar bisher ausreichte,<br />
jedoch nicht mehr den zusätzlichen Bedarf der Kinder abdeckt. Früher wurde in diesen<br />
Fällen „ergänzende Sozialhilfe“ gewährt. Mit dem Inkrafttreten von Hartz-IV wurden<br />
diese Hilfestrukturen geändert:<br />
Familien mit geringem Einkommen müssen zunächst Wohngeld beantragen. Zuständig<br />
ist die Wohngeldstelle der Gemeinde-, Stadt-, Kreis- oder Amtsverwaltung. Ob<br />
Sie wohngeldberechtigt sind, richtet sich nach der Höhe des Familieneinkommens und<br />
nach der Anzahl der Familienmitglieder, also auch nach der Anzahl der Kinder. Viele<br />
Familien werden mit der Geburt ihrer <strong>Zwillinge</strong> erstmals wohngeldberechtigt. Erkundigen<br />
Sie sich bei der Wohngeldstelle nach den einzelnen Anspruchsvoraussetzungen.<br />
Auch die Empfänger von Arbeitslosengeld I können Wohngeld erhalten.<br />
Reichen das Familieneinkommen und das Wohngeld zusammengerechnet noch<br />
nicht aus, um den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten, besteht für die Dauer von<br />
höchstens drei Jahren ein Anspruch auf Gewährung eines Kinderzuschlags. Der Kinderzuschlag<br />
ist eine Art Erhöhung des Kindesgeldes. Bis zu 140 EUR können monatlich<br />
pro Kind zusätzlich gewährt werden. Zuständig ist die Familienkasse, die auch das<br />
Kindergeld auszahlt.<br />
Reicht das Familieneinkommen zusammen mit dem Wohngeld und dem Kinderzuschlag<br />
noch immer nicht aus, um den Bedarf der Familie zu decken, so treten das Wohngeld<br />
und der Kinderzuschlag außer Kraft und es besteht stattdessen ein Anspruch auf<br />
Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Angehörige nach den Regelungen des Arbeitslosengeld<br />
II (SGB II). Das Sozialgeld deckt den gesamten Bedarf ab, so dass daneben nicht<br />
zusätzlich Wohngeld oder Kinderzuschlag gewährt werden kann.<br />
Eltern, die noch in der Ausbildung sind, sollten wissen, dass für die Kinder ein eigener<br />
Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht, der nicht an die Sozialleistungsberechtigung<br />
der Eltern geknüpft ist. Daher können Kinder von Schülern und Studierenden<br />
auch dann Sozialgeld bekommen, wenn die Eltern bereits dem Grunde nach<br />
(wegen des Vorrangs des BAföG) keinen eigenen Anspruch auf Sozialleistungen nach<br />
dem SGB II haben. Vorrangig ist jedoch auch hier zu prüfen, ob der zusätzliche Bedarf<br />
eventuell bereits durch den BAföG-Kinderzuschlag von 113 EUR für das erste und 85<br />
EUR für jedes weitere Kind aufgefangen wird.<br />
Außer den sozialrechtlichen Ansprüchen zur Deckung des Lebensunterhalts sind<br />
noch eine Reihe weiterer Sozialleistungen an die Anzahl der Kinder gekoppelt, z.B. die<br />
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Auch Wohnberechtigungsscheine werden<br />
in Abhängigkeit von der Zahl der Kinder ausgestellt. Wenn Ihnen von einem Gericht in<br />
einem Rechtsstreit Prozesskostenhilfe mit Ratenzahlung bewilligt wurde, sollten Sie<br />
ebenfalls dort Ihre neugeborenen Kinder nachmelden und eine Neufestsetzung der Raten<br />
beantragen; diese können sich erniedrigen oder sogar ganz entfallen.<br />
Wehr- und Zivildienstleistende erhalten Unterhalt für die Kinder nach dem Unterhaltssicherungsgesetz;<br />
die Höhe des Unterhalts hängt von dem Nettoeinkommen ab,<br />
welches der Dienstpflichtige vor dem Wehr-/Zivildienst erzielt hatte.<br />
h) Krankenversicherung für die Kinder<br />
Zu den Dingen, die nach der Geburt eines Kindes geregelt werden müssen, gehört<br />
auch die Aufnahme des Neugeborenen in eine Krankenversicherung. Besonders bei<br />
Frühgeborenen gewinnt diese Frage schnell an Bedeutung, da bereits die Behandlung in<br />
71b
72a<br />
der Neugeborenenintensivstation recht kostspielig ist. Um zu verhindern, dass man<br />
diese Kosten am Ende selbst bezahlen muss, sollte man die Frage der Krankenversicherung<br />
der Kinder rechtzeitig regeln.<br />
Die Geburt selbst wird noch über die Krankenkasse der Mutter abgerechnet. Der<br />
Geburt zugerechnet wird außerdem die medizinische Erstversorgung der gesund geborenen<br />
Kinder sowie die Unterbringung und Versorgung von Mutter und Kind in einer<br />
normalen Wöchnerinnenstation bis zu sechs Tagen nach der Geburt. Diese Leistungen<br />
werden, auch soweit sie an den Kindern erbracht werden, über die Krankenkasse der<br />
Mutter abgerechnet. Alle weiteren Maßnahmen, vor allem die Behandlung eines kranken<br />
Neugeborenen sowie die Behandlung in einer Neugeborenenintensivstation, fallen<br />
jedoch bereits auf das Konto des Kindes. Soll eine Krankenkasse diese Kosten übernehmen,<br />
so muss das Kind selbst Mitglied dieser Krankenkasse werden bzw. über die<br />
Eltern mitversichert (familienversichert) sein.<br />
aa) Gesetzliche Krankenkasse<br />
Sind beide Eltern Mitglied in derselben gesetzlichen Krankenkasse, werden die<br />
Kinder mit ihrer Geburt automatisch (kostenlos) familienversichert. Sind die Eltern<br />
Mitglied in verschiedenem gesetzlichen Krankenkassen, können sie wählen, ob die<br />
Kinder entweder in der Krankenkasse des Vaters oder in der Krankenkasse der Mutter<br />
familienversichert werden sollen.<br />
Ist dagegen nur ein Elternteil gesetzlich krankenversichert und übersteigt das Einkommen<br />
des anderen Elternteils die Beitragsbemessungsgrenze, können die Kinder<br />
nicht in der gesetzlichen Krankenkasse kostenlos familienversichert werden. Sie müssen<br />
entweder privat versichert werden oder (gegen Beitragszahlung) in einem besonderen<br />
Tarif der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert werden. Meist wird der<br />
Elternteil, der die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, privat krankenversichert sein,<br />
so dass es sich empfiehlt, die Kinder bei dieser Versicherung nachzumelden. Wenn<br />
dieser Elternteil allerdings zum Beispiel in einer ausländischen Krankenkasse oder<br />
überhaupt nicht krankenversichert ist, müssten die Kinder für sich allein selbständig<br />
versichert werden.<br />
bb) Private Krankenversicherung<br />
Ist ein Elternteil privat krankenversichert, kann das Kind dort nachgemeldet werden.<br />
Für die Nachmeldung von Kindern bestehen bestimmte Fristen. Gemäß § 2 Abs. 2<br />
der Musterbedingungen (MB/KK 94) 1 muss die Nachmeldung spätestens zwei Monate<br />
nach dem Tage der Geburt erfolgen. Beachten Sie aber, dass sich die Tarifbestimmungen<br />
Ihrer Krankenkasse nicht unbedingt an die Musterbedingung halten müssen und fragen<br />
Sie bei Ihrer Versicherung vorsichtshalber nach, welche Frist Sie konkret zu beachten<br />
haben. Da ein Anspruch auf Nachversicherung nur besteht, wenn die Nachmeldefristen<br />
eingehalten sind, sollte man die Nachmeldung entweder per Einschreiben schicken oder<br />
persönlich in der Geschäftsstelle der Versicherung gegen Empfangsquittung abgeben.<br />
Wird die Frist überschritten, können Sie nur noch auf Kulanz der Versicherung hoffen.<br />
Der Versicherungsschutz für nachgemeldete Kinder ist seinem Umfang nach durch<br />
den Versicherungsschutz des Elternteils begrenzt, d.h. man kann die Kinder nicht mit<br />
einem weitergehenden Versicherungsschutz nachmelden, als man ihn für sich selbst bei<br />
der Versicherung abgeschlossen hat. Die Nachmeldung setzt voraus, dass der Elternteil<br />
selbst mindestens seit drei Monaten vor der Geburt bei dem Versicherer versichert ist<br />
(§ 2 Abs. 2 der Musterbedingungen MB/KK 94). Daher sollten Sie Ihre private Krankenversicherung<br />
vor der Geburt nicht unbedacht wechseln, ohne sich genau zu vergewissern,<br />
zu welchen Bedingungen die Kinder nachversichert werden können.<br />
Meldet man das Kind in einer privaten Krankenversicherung an, ohne dass ein Elternteil<br />
dort versichert ist, so muss man vor der Aufnahme in die Versicherung nicht nur<br />
mit einer Gesundheitsprüfung, sondern auch mit Wartezeiten rechnen – für Frühgeborene<br />
eine denkbar schlechte Ausgangslage. Als Ausweg bleiben dann nur die freiwilligen<br />
Tarife der gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
Beihilfeberechtigte Beamte erhalten für die Kinder ab der Geburt die gesetzliche<br />
Beihilfe und müssen deshalb nur den fehlenden Anteil durch die private Versicherung<br />
1 Musterbedingungen nennt man die von der Versicherungswirtschaft gemeinschaftlich erarbeiteten<br />
und allgemein genehmigten Vertragsmuster, die von den meisten Versicherungen als Versicherungsbedingungen<br />
zugrundegelegt und nur in einzelnen Punkten durch besondere Zusatzklauseln<br />
ergänzt werden. Zur Prüfung Ihres eigenen Versicherungsschutzes müssen Sie jeweils die für<br />
Sie persönlich geltenden Versicherungsbedingungen zugrundelegen, die u.U. von den Musterbedingungen<br />
abweichen können. Informieren Sie sich bei der Krankenversicherung, welche Bedingungen<br />
für Ihren Vertrag gelten.<br />
72b
73a<br />
abdecken. In den meisten Bundesländern erhöht sich bei zwei minderjährigen Kindern<br />
außerdem auch der Beihilfesatz des Beamten selbst, so dass man den ergänzenden<br />
Privatversicherungsschutz für sich selbst ebenfalls reduzieren kann.<br />
cc) Auslandsreiseversicherung<br />
Wenn Sie für sich zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen<br />
haben, denken Sie daran, Ihre Kinder auch dort gesondert nachzumelden. Erst dann<br />
sind die Kinder nämlich in den Versicherungsschutz einbezogen. Auch bei dieser Versicherung<br />
bestehen besondere Nachmeldefristen, die bei manchen Versicherungen<br />
zwei Monate, bei manchen jedoch nur einen Monat betragen. Diese Fristen verpasst<br />
man schnell, weil die wenigsten Eltern unmittelbar nach der Geburt gleich die nächste<br />
Auslandsreise im Sinn haben.<br />
der im Müttergenesungswerk zusammengeschlossenen Wohlfahrtsverbände oder einer<br />
anderen zugelassenen Einrichtung um einen Kurplatz bemühen. Einer besonderen Bewilligung<br />
durch die Krankenkasse bedarf die Kur seit dem 1. April 2007 nicht mehr. Die<br />
Krankenkassen verpflichtet, die Kur komplett zu finanzieren; lediglich die gesetzliche<br />
Zuzahlung von 10,- EUR pro Tag – wie bei einem Krankenhausaufenthalt – muss man<br />
selbst beisteuern. Nach Erreichen der Belastungsgrenze von 2% des Bruttojahreseinkommens<br />
können Sie sich von der Zuzahlungspflicht befreien lassen. Der Regelaufenthalt<br />
beträgt drei Wochen und kann nur in Extremfällen verlängert werden. Frühestens<br />
nach vier Jahren kann die Kur wiederholt werden – nur in Ausnahmefällen schon eher.<br />
Für die Betreuung der daheim gebliebenen Kinder unter 12 Jahren kommt die Krankenkasse<br />
auf; bei behinderten Kindern entfällt diese Altersgrenze. Nähere Informationen<br />
erteilt das Müttergenesungswerk (Bergstr. 63, 10115 Berlin, Tel. 030-330029-0 Fax<br />
0911-330029-20; http://www.muettergenesungswerk.de) oder einer der ihm angeschlossenen<br />
Wohlfahrtsverbände: Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und Paritätischer<br />
Wohlfahrtsverband.<br />
73b<br />
i) Mütter- und Väterkur<br />
Zu den staatlichen Sachleistungen für Familien gehören schließlich noch die Mütter-<br />
und Väterkuren für denjenigen Elternteil, der die Erziehungsaufgabe wahrnimmt.<br />
Sie werden begrifflich unterteilt in Vorsorgekuren, die eine bevorstehende Erkrankung<br />
der Mutter / des Vaters verhindern sollen, und Genesungskuren, die nach einer eingetretenen<br />
Erkrankung der Rehabilitation dienen. Ziel der Mütter-/Väterkuren ist die<br />
Stärkung in Körper und Geist. Daher werden Bäder und Massagen, die der körperlichen<br />
Entspannung und Gesundheit dienen, begleitet von Angeboten zur psychosozialen<br />
Bewältigung der häuslichen Belastungssituation in Einzel- und Gruppengesprächen.<br />
Die Kuren werden entweder als reine Mütter-/Väterkur oder als Mutter-Kind-Kur<br />
/ Vater-Kind-Kur angeboten. Nur wenige Kurheime sind jedoch auf Kinder unter drei<br />
Jahren eingerichtet. Um eine Genesungskur (Rehabilitationskur) beantragen zu können,<br />
muss eine mit der mütterlichen/väterlichen Belastung zusammenhängende Erkrankung<br />
vorausgegangen sein; bei der Vorsorgekur muss der Arzt attestieren, dass<br />
die Kur erforderlich ist, um eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit<br />
zu einer Erkrankung führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährung der gesundheitlichen<br />
Entwicklung des Kindes entgegenzuwirken. Sodann muss man sich bei einem<br />
3. Weitere Anschaffungen<br />
a) Tragetuch, Kindertragen<br />
Da der Zwillingskinderwagen aufgrund seiner Abmessungen nicht überall praktikabel<br />
ist, suchen viele Eltern im Laufe der Zeit nach Mobilitätsalternativen. In den ersten<br />
Monaten kommt das Tragetuch in Betracht, das meist vor den Bauch gebunden wird.<br />
Das Tragen von Kindern in einem Tuch hat eine lange Tradition und erlebt seit einigen<br />
Jahren eine Renaissance, während Kritiker behaupten, es könne der Wirbelsäule und<br />
Rückenmuskulatur des Kindes schaden. Pro und Kontra streiten darüber, ob das Tragetuch<br />
die vorgeburtliche Haltung in gesunder Weise nachempfindet oder ob es den kindlichen<br />
Knochenbau unnatürlich krümmt. Falls man sich für Tragetücher entscheidet, setzt<br />
das für jedes Kind je einen gesonderten Träger voraus. Wenn Mutter oder Vater allein<br />
unterwegs sind, scheidet das Tragetuch also von vornherein aus – es sei denn, man wollte<br />
das Tragetuch mit einem Einlingskinderwagen kombinieren.<br />
Eine einfallsreiche und schneiderisch begabte Mutter wollte das Problem lösen, indem<br />
sie einen Doppeltragesack aus Jeansstoff entwarf, worin beide Kinder nebeneinander<br />
Platz hatten. Die Nähanleitung dafür ist in dem Zwillingsbuch von M. v. Gratkowski<br />
abgedruckt. Leider bietet der Doppeltragesack jedoch seitlich nicht so viel Halt wie ein
74a<br />
Tragetuch, so dass die Kinder darin eher eine sitzende Position einnehmen, in der<br />
Kopf und Oberkörper auf der Wirbelsäule ruhen. Gerade diese Haltung soll aber so<br />
lange vermieden werden – darin sind sich Orthopäden einig –, bis die Kinder sich<br />
selbständig aufrecht hinsetzen können. Dieser Entwicklungsschritt wird aber im Allgemeinen<br />
erst zwischen dem achten und dem zwölften Lebensmonat erreicht, also in<br />
einer Zeit, für die der Doppeltragesack schon nicht mehr konzipiert ist. In der Zeit<br />
davor fehlt dem Kind die erforderliche Rückenmuskulatur, so dass der noch unfertige<br />
Knochenbau die mit der aufrechten Sitzposition verbundene Belastung allein abfangen<br />
muss. Diese Gewichtsüberlastung kann zu dauerhaften Schäden führen, die sich auch<br />
durch spätere therapeutische Maßnahmen nicht mehr ausgleichen lassen. Daher müssen<br />
wir von dem Gebrauch dieser auf den ersten Blick sehr einfallsreichen Lösung<br />
eher abraten und verzichten deshalb auch auf einen Abdruck der Nähanleitung.<br />
Etwas besser gelöst ist die Rückenhaltung bei dem inzwischen käuflich zu erwerbenden<br />
Doppeltragesack von Weego . Aber auch hier sitzen die einzelnen Kinder<br />
nicht – wie bei Einlingstragetaschen – symmetrisch vor dem Bauch, sondern schräg<br />
angewinkelt, wodurch sich eine leicht ungleichmäßige Belastung des kindlichen Körpers<br />
ergibt. Deshalb sollte man auch diesen Tragesack nicht umjubeln, sondern ihn<br />
allenfalls als eine Notlösung begreifen.<br />
Haben die Kinder dann einmal das Sitzalter erreicht, bieten sich Rückentragen<br />
(„Kiepen“, „Kraxen“) als weitere Transportmöglichkeit an – freilich wiederum nur ein<br />
Kind je Träger. Diese Rückentragen werden von verschiedenen Herstellern in unterschiedlicher<br />
Qualität und Ausstattung angeboten. Für anspruchsvollere Modelle sollte<br />
man sich nicht nur in den Babymärkten, sondern auch und vor allem bei den Outdoorund<br />
Trekkingausrüstern bzw. in den Wanderabteilungen größerer Sportgeschäfte umsehen.<br />
Fast alle namhaften Rucksackhersteller haben auch Rückentragen im Programm,<br />
die allerdings nicht nur im Tragekomfort, sondern auch im Preis einem guten<br />
Wanderrucksack gleichkommen. Vor allem bei Spaziergängen, Wanderungen und<br />
allgemein im Gelände, aber auch beim Treppensteigen, auf schmalen Bürgersteigen<br />
oder auf unebener Fläche erweisen sich die Rückentragen gegenüber einem Kinderwagen<br />
als überlegen. Die Hauptanwendung für die Rückentragen liegt daher für die meisten<br />
Familien in der gemeinsamen Freizeitgestaltung und im Urlaub. Vor allem im<br />
Ausland können die unterschiedlichen baulichen Standards sowie ungewohnte Verkehrsregelungen<br />
das Fortkommen mit einem Zwillingskinderwagen zur Geduldsprobe<br />
werden lassen. Übrigens gestatten es die meisten Fluggesellschaften, Rückentragen<br />
mit in die Kabine zu nehmen, so dass die Kinder damit bis in das Flugzeug und anschließend<br />
sofort wieder von dort in die Flughalle getragen werden können.<br />
b) Sportwagen und Buggy<br />
Wie gesagt: Nach zehn bis zwölf, manchmal auch schon nach acht Monaten, können<br />
sich Ihre Kinder selbständig hinsetzen. Meist wird ihnen das Liegen im Kinderwagen<br />
dann auch langweilig und sie wollen lieber aufrecht sitzend wahrnehmen, was um<br />
sie herum vor sich geht. Damit steht der Umbau des Kinderwagens an: Viele Modelle<br />
lassen sich mit wenigen Handgriffen so herrichten, dass aus der Liegestätte ein Sitzabteil<br />
wird.<br />
Falls sich Ihr Kinderwagen nicht umbauen lässt, er allmählich aus dem Leim geht<br />
oder wenn Ihnen der Wagen mit der Zeit einfach zu sperrig geworden ist, erwägen Sie<br />
vielleicht die Anschaffung eines neuen Modells. Jetzt können Sie sich gut für eines der<br />
kompakten Modelle entscheiden, die nur für die Sitzposition hergerichtet sind und sich<br />
nicht umbauen lassen. Man unterteilt zwischen Sportwagen und Buggy, wobei der<br />
schwerere Sportwagen („Karre“) sich durch eine stabilere Bauweise, eine feste Sitzfläche<br />
und größere Räder auszeichnet, während die leichteren Buggys im Allgemeinen eine<br />
geringere Formstabilität aufweisen, die Sitzfläche aus Stoff gespannt ist und die Räder<br />
recht <strong>klein</strong> sind. Mit diesen Eigenschaften erreichen Buggys allerdings ein erstaunlich<br />
geringes Packmaß, zumal sie nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite zusammengefaltet<br />
werden können.<br />
Beide Wagentypen gibt es auch für <strong>Zwillinge</strong>: den Sportwagen wiederum nebeneinander<br />
oder hintereinander, den reinen Buggy wohl nur nebeneinander. Von manchen<br />
Herstellern kann man sogar zwei einzelne Buggys bekommen, die sich durch Schienen<br />
miteinander verbinden lassen. Das ist insofern praktisch, als man bei gemeinsamen Unternehmungen<br />
die Kinder aufteilen kann, oder auch allein einmal mit einem Kind im<br />
Buggy und einem in der Rückentrage losziehen kann. Allerdings weisen die mit Schienen<br />
verbundenen Buggys systembedingt eine noch geringere Formstabilität auf als die<br />
fest verbunden Typen und sind zudem auch nicht so lange haltbar, weil die Verbindungsstangen<br />
mechanisch stark beansprucht werden.<br />
Auch die in Mode gekommenen „Jogger“-Modelle, die nicht auf vier <strong>klein</strong>en, sondern<br />
auf drei großen Rädern fahren und über eine Handbremse verfügen, gibt es für<br />
74b
75a<br />
75b<br />
Mehrlinge – zum Beispiel den original Baby-Jogger 1 oder den Mountain Terrain Buggy<br />
2 für <strong>Zwillinge</strong> und Drillinge nebeneinander oder die Modelle der Firma Runabout<br />
für <strong>Zwillinge</strong>, Drillinge und sogar Vierlinge hintereinander 3 . Andere Hersteller dieses<br />
unaufhaltsam wachsenden Marktes haben zumindest ein Modell für <strong>Zwillinge</strong> im Angebot<br />
(z.B. TFK, aic, Marco usw.).<br />
Eine Alternative zu den reinen Kinderwagen sind Fahrrad-Kinderanhänger, die<br />
sich mit wenigen Handgriffen in einen Kinderwagen umbauen lassen. Wenn Sie viel<br />
mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind diese Wagen vielleicht ideal. Für den Transport<br />
im Auto sind sie allerdings eher schlecht geeignet, da sie sich nur bedingt zusammenpacken<br />
lassen und viel Platz wegnehmen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrradhändler<br />
oder verschaffen Sie sich einen ersten Überblick auf den Internetseiten der Versandfirmen,<br />
z.B.:<br />
Ratgeber wert ist. Unsere Empfehlung liegt bei 5,- bis 10,- EUR pro Leserfamilie;<br />
egal ob Sie den Text selbst aus dem Internet heruntergeladen oder<br />
von einer befreundeten Familie erhalten haben. Bitte überweisen Sie den<br />
Betrag an: Dr. Claudio Nedden-Boeger, Konto-Nr. 142921, Bankleitzahl<br />
360 605 91 (Sparda-Bank West eG) – bzw. für den EU-Zahlungsverkehr:<br />
IBAN: DE67 3606 0591 0000 1429 21, BIC: GENODED1SPE.<br />
- http://www.zweipluszwei.com<br />
- http://www.bikeshop2000.de/Kinderanhanger/kinderanhanger.html<br />
- http://www.bavariabike.de<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Nun haben Sie drei Kapitel des Buches gelesen und schon vieles über<br />
die Zwillingsschwangerschaft, die Zwillingsgeburt und das Leben mit<br />
<strong>Zwillinge</strong>n erfahren. Sie werden sich vorstellen können, dass das Zusammentragen<br />
dieser Informationen eine Menge Arbeit bedeutet hat. Wenn Sie<br />
den Ratgeber informativ finden, möchten wir Sie an dieser Stelle ein letztes<br />
Mal bitten, unsere Mühe mit einem angemessenen Autorenhonorar<br />
anzuerkennen. Damit ermutigen Sie uns auch, dieses Projekt im Interesse<br />
weiterer Zwillingseltern fortzuführen. Geben Sie soviel, wie Ihnen der<br />
1 Infos und Händlernachweis unter http://www.babyjogger.com (); erhältlich außerdem bei<br />
Mehrlingsshop Birgit Leeck, http://mehrlinge.com/Shop/Tipps/shopmichel_online/index.html.<br />
2 Erhältlich z.B. bei Mehrlingsshop Birgit Leeck,<br />
http://mehrlinge.com/Shop/Tipps/shopmichel_online/index.html.<br />
3 Erhältlich z.B. bei Mehrlingsshop Birgit Leeck,<br />
http://mehrlinge.com/Shop/Tipps/shopmichel_online/index.html
76a<br />
Viertes Kapitel: Familiensituation und weitere Entwicklung<br />
der Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter<br />
1. Allgemeine Entwicklungsverzögerung<br />
Die geistige und körperliche Entwicklung von <strong>Zwillinge</strong>n ist gegenüber anderen<br />
Kindern im Allgemeinen etwas verzögert. Meist lernen sie etwas später als andere<br />
Kinder, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen, zu sitzen, zu krabbeln, zu laufen<br />
und zu sprechen. Im Laufe der Zeit verlieren sich diese Entwicklungsunterschiede,<br />
wenngleich es immerhin etwa zehn Jahre dauert, bis sich keine erkennbaren Unterschiede<br />
zu den Einlingskindern mehr nachweisen lassen.<br />
Diese Entwicklungsverzögerung ist jedoch nicht problematisch, weil sie keine<br />
bleibenden Schäden oder Nachteile hinterlässt. Überhaupt nehmen wir den Entwicklungsfortschritt<br />
nur deshalb als „verzögert“ wahr, weil der Vergleich von <strong>Zwillinge</strong>n<br />
mit Einlingen von vornherein hinkt. Die statistischen Normen zur altersgerechten<br />
Kindsentwicklung orientieren sich an der großen Masse der zum errechneten Geburtstermin<br />
komplikationslos geborenen Einlinge. Dieser Vergleichsgruppe gehören Ihre<br />
Kinder jedoch nicht an und sie werden ihr auch niemals angehören. Mehrlinge haben<br />
ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Geschwindigkeit, die wir ihnen nicht streitig<br />
machen sollten. Vergleichen Sie den Entwicklungsstand Ihrer Kinder daher nicht mit<br />
Einlingen. Leider gibt es viele Mütter- und Elternkreise, die geradezu eine Rangliste<br />
nach dem jeweils erreichten Entwicklungsstand der Kinder aufstellen. Für die Ranguntersten<br />
ist das oft belastend und vielleicht auch verletzend; manche Eltern machen sich<br />
sogar Sorgen um eine mögliche Behinderung Ihres Kindes. Man sollte den vergleichenden<br />
Bewertungen daher mit einer gehörigen Portion Gelassenheit gegenübertreten<br />
und sich möglichst nicht daran beteiligen. Freuen Sie sich vielmehr über das soziale<br />
Miteinander Ihrer Kinder, das ihnen kein Einling streitig machen kann.<br />
Manche Eltern tun sich allerdings schwer, Entwicklungsunterschiede der <strong>Zwillinge</strong><br />
untereinander zuzulassen. Wegen des gleichen Alters und der gleichen Abstammung<br />
neigt man bei <strong>Zwillinge</strong>n besonders dazu, sie miteinander zu vergleichen und<br />
die bestehenden Unterschiede bei dem einen als Entwicklungsfortschritt und bei dem<br />
anderen als Entwicklungsdefizit zu bewerten. Auch untereinander sollte man ihnen<br />
jedoch ihr eigenes Entwicklungstempo zugestehen. Bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n liegt<br />
das auf der Hand, wegen ihrer genetischen Verschiedenheit. Sie sind sich nicht ähnlicher<br />
als andere Geschwister und können sich ebenso unterschiedlich entwickeln. Aber auch<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong> müssen sich nicht parallel entwickeln: Sie sind sich zwar genetisch<br />
sehr ähnlich, doch leben auch sie seit Anbeginn ihre eigene Geschichte. Schon in der<br />
Gebärmutter sind sie unterschiedlich gut versorgt und verbringen die Zeit in ihrer eigenen<br />
Haltung und Lage – bis dann auch das Geburtserleben selbst auf den ersten Zwilling<br />
anders einwirkt als auf den zweiten. Nach der Geburt können sich unterschiedliche Erkrankungen,<br />
Verletzungen und Heilungsprozesse auf den Entwicklungsfortschritt der<br />
Kinder auswirken. Daher können auch eineiige <strong>Zwillinge</strong> erhebliche Entwicklungsdifferenzen<br />
aufweisen, vor allem bei einer unterschiedlichen vorgeburtlichen Versorgungssituation.<br />
Die meisten feststellbaren Entwicklungsverzögerungen von <strong>Zwillinge</strong>n beruhen auf<br />
ihrer Früh- oder Mangelgeburtlichkeit. Stellt man ihnen als Vergleichsgruppe nicht die<br />
termingerecht geborenen Einlinge gegenüber, sondern Einlings-Frühchen mit entsprechender<br />
Geburtsreife, so kann man im weiteren Entwicklungsgang keinen signifikanten<br />
Unterschied mehr feststellen. Damit ist die Frage der Entwicklungsverzögerung in einem<br />
wesentlichen Punkt kein spezifisches Mehrlingsproblem, sondern ein Problem der frühen<br />
Geburt und der unzureichenden Versorgungslage in der Gebärmutter.<br />
Um den Entwicklungstand eines Frühgeborenen medizinisch und heilpädagogisch<br />
richtig beurteilen zu können, darf man ohnehin nicht das tatsächliche Alter des Kindes<br />
zugrundelegen, sondern man muss vom „korrigierten Alter“ ausgehen: Man zählt also<br />
nicht ab dem Tag der tatsächlichen Geburt, sondern erst ab dem vorhergesagten (errechneten)<br />
Geburtstermin. Fachlich kompetent für die Beurteilung des Entwicklungsfortschritts<br />
Ihrer Kinder sind letztlich nur die Kinderärzte und die im Bereich der Früherkennung<br />
und Frühförderung tätigen Kräfte. Sie als Eltern können einen wichtigen Beitrag<br />
zur Früherkennung leisten, indem Sie die Verhaltensweisen Ihrer Kinder aufmerksam<br />
beobachten und bei Untersuchungen darüber berichten. Wenn Sie besondere Auffälligkeiten<br />
bei Ihren Kindern feststellen, sprechen Sie den Kinderarzt auch außerhalb der<br />
Vorsorgeuntersuchungen darauf an.<br />
Neben der Früh- und Mangelgeburtlichkeit kommt als weitere Ursache für eine<br />
Entwicklungsverzögerung vor allem eine angespannte Familiensituation in Betracht:<br />
Überforderte und ausgelaugte Zwillingseltern haben nicht mehr die nötige Energie, um<br />
den Kindern die altersgerechte Zuwendung und Einzelförderung entgegenzubringen. Im<br />
Extremfall können solche Überforderungssituationen sogar zu Vernachlässigungen und<br />
Kindesmisshandlungen ausarten, die bei <strong>Zwillinge</strong>n tatsächlich häufiger vorkommen als<br />
76b
77a<br />
bei Einlingen. Solchen Entwicklungen sollte man unter allen Umständen frühzeitig<br />
entgegenwirken. Allein deshalb schon ist es wichtig, innerhalb der Familie für ein<br />
möglichst harmonisches häusliches Umfeld zu sorgen, Hilfe anzunehmen, Kontakte<br />
nach außen zu halten und sich gegenseitig zu entlasten. Wenn es den Eltern gut geht,<br />
geht es meistens auch den Kindern gut.<br />
2. Sprachentwicklung<br />
Wenn andere Kinder allmählich beginnen, die Worte der Erwachsenen nachzusprechen,<br />
entwickeln viele <strong>Zwillinge</strong> eine eigenständige Zwillingssprache, mit der sie<br />
sich untereinander verständigen. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Kinder für einzelne<br />
Gegenstände bestimmte Worte erfinden, die der Umwelt fremd sind, wie zum<br />
Beispiel „lütla“ für „Flugzeug“. Das tun auch Einlinge. Bei <strong>Zwillinge</strong>n liegt die Besonderheit<br />
darin, dass sie eine komplette Sprache mit einem eigenen vollständigen<br />
Wortschatz erschaffen, mit dem sie sich untereinander umfassend verständigen können.<br />
Leider ist diese Sprache auf das jeweilige Zwillingspaar beschränkt und Außenstehende<br />
haben keinen sprachlichen Zugang. Das gilt nicht nur für Freunde, Verwandte<br />
und andere Kinder, sondern oft auch für die Eltern, die zwar die Bedeutung einiger<br />
Begriffe nach und nach erraten, jedoch nicht wirklich mit den Kindern sprechen können.<br />
Im Laufe der Zeit verliert sich die Zwillingssprache und wird durch die Muttersprache<br />
abgelöst. Bis es soweit ist, kann jedoch einige Zeit vergehen. Einige <strong>Zwillinge</strong><br />
beginnen sogar erst im Kindergartenalter, sich der Muttersprache zu bedienen; Grund<br />
zur Besorgnis besteht deswegen nicht.<br />
Zum Teil ist vorgeschlagen worden, den Kindern die Erwachsenensprache frühzeitig<br />
aufzuzwingen, indem man ihnen Getränke, Mahlzeiten oder Spielsachen vorenthält,<br />
bis das Kind sie mit der richtigen Bezeichnung benannt hat. Solche Methoden<br />
sind allerdings fragwürdig. Sinnvoll ist es jedoch, den Kindern die richtigen Begriffe<br />
immer wieder vorzusagen, um sie an die normale Sprache zu gewöhnen.<br />
Einige wissenschaftliche Untersuchungen haben sich mit der Zwillingssprache<br />
befasst und herausgefunden, dass die verwendeten Silben und Laute, zum Teil sogar<br />
komplette Wortstämme, der jeweiligen Muttersprache entlehnt sind. Zwillingskinder<br />
von deutschsprachigen Eltern klingen also phonetisch wie deutsch sprechende Kinder,<br />
nur dass niemand die einzelnen Worte verstehen kann. Dagegen würde sich die Zwillingssprache<br />
von Kindern chinesischer Eltern für unsere Ohren eher wie eine fernöstliche<br />
Sprache anhören. Während diese Erkenntnis allerdings fast schon banal ist und von<br />
allen betroffenen Eltern schnell nachvollzogen werden kann, hat man darüber hinaus<br />
herausgefunden, dass die Zwillingssprache auf einer völlig eigenständigen Grammatik<br />
beruht, die keinerlei Anbindung an die Grammatik der jeweiligen Erwachsenensprache<br />
hat. Dieser erstaunliche Umstand ist wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass es<br />
uns Erwachsenen so schwer fällt, die Sprache der Kinder nachzuvollziehen.<br />
Das Phänomen der Zwillingssprache ist bei den einzelnen Zwillingspaaren unterschiedlich<br />
stark ausgeprägt. Manche Kinder beherrschen ausschließlich ihre Zwillingssprache<br />
und sagen ansonsten vielleicht nur noch die Worte „Mama“ und „Papa“ aus<br />
unserer Sprache. Demgegenüber pflegen andere Kinder nur einen geringen Sonderwortschatz<br />
und sprechen ansonsten normal. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung<br />
sind noch nicht abschließend geklärt. Vielleicht hängt es von der jeweiligen Familiensituation<br />
und den innerfamiliären Beziehungsstrukturen ab, von wem die Kinder die<br />
Sprache am ehesten übernehmen (Theorie der soziologischen Aspekte des Spracherwerbs).<br />
Je mehr sich die <strong>Zwillinge</strong> tagsüber allein miteinander, ohne Anregung von<br />
außen beschäftigen und dadurch sozusagen in ihrer Zweiergemeinschaft „isoliert“ aufwachsen,<br />
desto eher werden sie sich untereinander Vorbild bei den ersten Sprechübungen<br />
sein.<br />
Allerdings vermag dieses Modell nicht zu erklären, weshalb viele <strong>Zwillinge</strong> überhaupt<br />
keine Zwillingssprache entwickeln, obwohl auch sie ohne Zweifel die meiste Zeit<br />
des Tages miteinander verbringen. Vielleicht kommt es deshalb zusätzlich darauf an, ob<br />
die <strong>Zwillinge</strong> ihre einzelnen Entwicklungsschübe entweder parallel oder aber zeitversetzt<br />
vollziehen. Die Entwicklung einer Zwillingssprache könnte nämlich einen übereinstimmenden<br />
Entwicklungstand voraussetzen, auf dessen Basis die Kinder mit gleichen<br />
Artikulations- und Assoziationsfähigkeiten eine übereinstimmende Sprache abstimmen<br />
und anwenden. Demgegenüber könnte es der Ausbildung einer Zwillingssprache entgegenstehen,<br />
wenn die Kinder die Fähigkeit zum Sprechen erst nacheinander ausbilden.<br />
Der weiter entwickelte Zwilling würde dann womöglich eher den Sprechkontakt zu den<br />
Eltern suchen, deren Sprache annehmen und sie später an den Nachzügler weitergeben.<br />
Statistisch betrachtet entwickeln eineiige <strong>Zwillinge</strong> häufiger eine Eigensprache als<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong>, und innerhalb der Gruppe der zweieiigen <strong>Zwillinge</strong> sind die verschiedengeschlechtlichen<br />
am ehesten betroffen. Für diese unterschiedliche Häufigkeitsverteilung<br />
findet allerdings keines der bisherigen Erklärungsmodelle eine schlüssige<br />
Begründung, namentlich was den Unterschied zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen<br />
zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n betrifft.<br />
77b
78a<br />
Aber auch wenn <strong>Zwillinge</strong> keine eigene Zwillingssprache entwickeln, kann sich<br />
deren Spracherwerb gegenüber Einlingen um durchschnittlich ein halbes Jahr verzögern.<br />
Über die Gründe hierfür ist viel spekuliert worden – bis hin zu der Vermutung,<br />
dass die mit der Babypflege ausgelasteten Eltern überhaupt nicht mehr dazu kämen,<br />
mit den Kindern noch zu sprechen. Mindestens ebenso naheliegend ist allerdings die<br />
Annahme, dass <strong>Zwillinge</strong> untereinander neben der Wortsprache noch eine ausgefeilte<br />
Zeichen- und Gestensprache entwickeln, die ihnen eine Kommunikation auch außerhalb<br />
der Wortsprache ermöglicht und diese eine Zeit lang in den Hintergrund drängt.<br />
Forschern ist außerdem noch aufgefallen, dass sich Sprachstil und Sprachinhalte unterscheiden:<br />
<strong>Zwillinge</strong> stellen weniger Fragen als Einlinge und ihre Sprache befasst<br />
sich anteilig weniger mit Planen und Träumen, nimmt dafür eher Bezug auf konkrete<br />
und gefühlsbetonte Dinge.<br />
Am besten können Sie die Sprachentwicklung Ihrer Kinder fördern, indem Sie<br />
möglichst viel mit Ihren Kindern reden. Sprechen Sie möglichst nicht in einer künstlich<br />
verniedlichten Babysprache, sondern in vollständigen Sätzen mit normalem Tonfall.<br />
3. Ältere Geschwister<br />
Die Ankunft eines jüngeren Geschwisters bedeutet eine Veränderung der Familiensituation<br />
und damit für die älteren Geschwisterkinder immer auch eine Veränderung<br />
ihrer äußeren Rahmenbedingungen. Generell, also auch bei Einlingen, hat der Familienzuwachs<br />
einen Verlust der ungeteilten elterlichen Zuwendung zur Folge, an den sich<br />
das Geschwisterkind erst allmählich gewöhnen muss. Nicht einmal mehr in den Ruhepausen<br />
der Neugeborenen sind die übernächtigten Eltern noch frei verfügbar, sondern<br />
benötigen ihrerseits Ruhe und Entspannung. Vom älteren Geschwisterkind verlangt die<br />
Situation eine Zurückhaltung und Genügsamkeit, die seinem kindlichen Wesen nicht<br />
unbedingt entspricht. Es fühlt sich zurückgesetzt und ist mit der Zuschreibung des<br />
Attributes „älteres Geschwister“, was zugleich „einsichtiges Geschwister“ impliziert,<br />
einstweilen überfordert: schließlich ist es selbst ja noch ein <strong>klein</strong>es Kind.<br />
Wenn es sich bei den Neuankömmlingen dann auch noch um <strong>Zwillinge</strong> handelt,<br />
muss das ältere Geschwister zusätzlich ertragen, wie ausgerechnet diese Winzlinge im<br />
Mittelpunkt eines allgemeinen Interesses stehen. Nur wenige Passanten widerstehen<br />
der Versuchung, einen Blick in einen vorbeiziehenden Zwillingskinderwagen zu werfen,<br />
und man wird sogar überall darauf angesprochen. Die Geburt von Drillingen wirft in<br />
<strong>klein</strong>eren Orten sogar schon mal die Zeitung auf den Plan. Fremde Leute erinnern sich<br />
an irgendeine Bekanntschaft mit Ihnen und werden plötzlich zu „Freunden“ – freilich<br />
nicht um zu helfen, sondern um auch einmal Drillinge zu sehen.<br />
Für die älteren Geschwister bedeutet der Rummel um die Mehrlinge eine nur<br />
schwer zu ertragende Entthronung. Sie verstehen nicht, was die besondere Faszination<br />
der Neugeborenen ausmacht, die nicht nur Freude und Verwandte, sondern sogar wildfremde<br />
Menschen in den Bann zieht. Vor allem versteht das Geschwisterkind nicht,<br />
weshalb es selbst über diese Anziehungskraft und Ausstrahlung nicht verfügt. Solche<br />
Empfindungen können regelrechte Minderwertigkeitskomplexe auslösen.<br />
Manche Kinder reagieren auf diese Umwälzungen, indem sie sich völlig zurückziehen<br />
und zum Teil sogar wieder rückentwickeln. Geschwister nässen wieder ein oder<br />
beginnen sogar zu stottern; ältere Kinder verschlechtern sich in ihren schulischen Leistungen<br />
oder werden in ihrem Sozialverhalten auffällig. Dies geschieht nicht, um die<br />
Eltern zu ärgern oder zusätzlich zu belasten, sondern ist meistens ein Hilfeschrei nach<br />
etwas Zuwendung und Aufmerksamkeit.<br />
Versuchen Sie daher, Ihre Zuwendung möglichst gerecht auf die Kinder zu verteilen.<br />
„Gerecht“ meint dabei nicht, dass jedem Kind die gleiche Zeit zustehen soll. Aber<br />
jedes Kind soll ein angemessenes Zeitfenster verbindlich für sich beanspruchen können.<br />
Legen Sie für sich selbst und in Absprache mit dem Geschwisterkind Zeiträume fest, in<br />
denen Sie nur ihm zur Verfügung stehen. Diese Zeiten müssen Sie dann auch konsequent<br />
einhalten, selbst wenn die Neugeborenen quengeln. Es steigert das Selbstwertgefühl des<br />
Geschwisterkindes, wenn zu seinen Gunsten auch die Babys einmal warten müssen.<br />
Wenn Sie das Spiel mit dem Geschwisterkind wegen der Babys doch einmal unterbrechen<br />
müssen, vereinbaren Sie sofort verbindliche Nachholzeiten, die Sie – möglichst<br />
noch am selben Tag – ebenfalls gewissenhaft wahrnehmen. Binden Sie die älteren Geschwister<br />
nach Möglichkeit auch in die Betreuung und Beaufsichtigung der Babys ein –<br />
dadurch stärken Sie deren Verantwortungsbewusstsein und Selbstwertgefühl. Erklären<br />
Sie den Verwandten und Bekannten, wie wichtig es ist, auch den älteren Einlingsgeschwistern<br />
noch den ihnen zustehenden Teil an Aufmerksamkeit entgegenzubringen.<br />
Wenn von Ihren <strong>Zwillinge</strong>n Fotos gemacht werden, können Sie z.B. darum bitten, dass<br />
auch das ältere Geschwisterkind entsprechend häufig abgelichtet wird.<br />
78b
79a<br />
4. Sozialverhalten der Kinder<br />
An sozialen Kompetenzen haben Ihre Kinder den gleichaltrigen Einlingen mit der<br />
Zeit einiges voraus. Von Geburt an haben sie lernen müssen, miteinander zu teilen:<br />
vermutlich das Kinderzimmer, die meisten Spielsachen und vor allem Ihre elterliche<br />
Aufmerksamkeit und Zuwendung. Als Eltern können Sie das Sozialverhalten Ihrer<br />
<strong>Zwillinge</strong> sogar noch fördern, indem Sie z.B. nicht immer jedem Kind seine eigene<br />
Ration aushändigen, sondern einem Kind zwei Kekse geben mit der Bitte, dem Zwillingsgeschwister<br />
einen davon abzugeben. Das funktioniert dann meistens auch beim<br />
Teilen mit anderen Kindern. Die meisten Einlinge lernen dagegen erst im Kindergarten,<br />
miteinander zu teilen und sich zu arrangieren.<br />
Außerdem haben Ihre Kinder gelernt zu warten und sich in eine Reihenfolge einfügen.<br />
Sie kennen es von <strong>klein</strong> auf, nicht sofort als erste bedient zu werden, sondern<br />
sich zu gedulden, bis sie an der Reihe sind. Diese Fähigkeit fehlt vielen Einzelkindern,<br />
die beim Anziehen, Füttern, Baden usw. bisher niemanden vorlassen mussten.<br />
Selbst gegenüber Einlingsgeschwisterpaaren sind <strong>Zwillinge</strong> im Vorteil, denn sie<br />
haben keine Altershierarchie. Die Geschwisterbeziehung startet auf der Basis einer<br />
gleichaltrigen Partnerschaft, in der kein Kind einen unüberwindbaren Entwicklungsvorsprung<br />
mitbringt. Aufgrund ihres gleichen Entwicklungsstandes haben sie ähnliche<br />
Interessen, die das Zwillingsgeschwister zum Mitmachen anregen und so ein gemeinsames<br />
Spiel auf gleicher Ebene zustande kommen lassen. Konkret bedeutet dies für die<br />
meisten Eltern zugleich eine große Entlastung, weil <strong>Zwillinge</strong> bereits ab dem Krabbelalter<br />
für eine erheblich längere Zeit in der Lage sind, sich miteinander zu beschäftigen.<br />
Gönnen Sie den Kindern ihr gemeinsames Spiel, lassen Sie sie dabei ungestört und<br />
genießen Sie Ihre Freiräume. Umso intensiver können Sie sich wieder mit ihnen beschäftigen,<br />
wenn das gemeinsame Spiel nicht mehr funktioniert. Auch wenn die Kinder<br />
streiten, müssen Sie nicht immer sofort dazwischengehen. Anders als bei verschiedenaltrigen<br />
Einlingsgeschwistern gibt es unter den <strong>Zwillinge</strong>n meist keine so großen<br />
körperlichen Überlegenheiten, die uns dazu aufriefen, dem Schwächeren ständigen<br />
Schutz und Beistand zu leisten. <strong>Zwillinge</strong> müssen lernen, ihre Konflikte untereinander<br />
auszutragen, und meist ist der Streit auch nur von kurzer Dauer. Wenn Sie den <strong>Zwillinge</strong>n<br />
Raum geben, ihre Angelegenheiten untereinander zu regeln, erziehen Sie sie<br />
damit zur Eigenständigkeit. Nur wenn der Streit gar kein Ende nimmt, sollte man nach<br />
einer gewissen Zeit eingreifen, und auch ernstliche Verletzungen, wie z.B. Bisswunden,<br />
sollte man nicht durchgehen lassen.<br />
Umgekehrt haben es <strong>Zwillinge</strong> manchmal schwerer, den Kontakt zu anderen Kindern<br />
aufzunehmen und sich in eine größere Gruppe zu integrieren. Um einer Isolation in<br />
der Zwillingsbeziehung frühzeitig vorzubeugen, sollte man den Kontakt zu anderen<br />
Kindern daher schon im Säuglings- und Kleinkindalter pflegen. Nehmen Sie an Krabbelgruppen,<br />
Babyschwimmen und Kinderturnen teil und besuchen Sie häufig den Spielplatz.<br />
Im Kindesalter schlüpfen viele Zwillingspaare in die Rollen eines „Außenministers“<br />
und eines „Innenministers“, wobei der „Außenminister“ bei allen Kontakten mit<br />
anderen Kindern (und Erwachsenen) im Vordergrund steht und sich als eloquent und<br />
aufgeschlossen präsentiert, während der „Innenminister“ im Außenkontakt ein eher<br />
verschlossenes und kontaktscheues Wesen darstellt, in der Zweierbeziehung der <strong>Zwillinge</strong><br />
untereinander jedoch eindeutig dominiert.<br />
Im Kindergarten besteht weiterhin die Gefahr, dass die <strong>Zwillinge</strong> in ihrer Zweisamkeit<br />
für sich bleiben; in der Schule kann es passieren, dass ein dominanter Zwilling den<br />
Lernerfolg des anderen behindert. Eigene vollwertige (d.h. nicht vom Zwillingsgeschwister<br />
abhängige) Beziehungsstrukturen zu anderen Kindern und erwachsenen Personen<br />
bauen sie häufig erst dann auf, wenn sie für eine geraume Weile voneinander getrennt<br />
werden – sei es durch den Besuch unterschiedlicher Kindergartengruppen, unterschiedlicher<br />
Schulklassen oder sogar durch eine getrennte (verschiedenzeitige) Einschulung.<br />
Unterstützen Sie auf jeden Fall den Aufbau getrennter Freundeskreise und nehmen<br />
Sie den anderen Kindergarteneltern frühzeitig die Scheu davor, nur einen Ihrer <strong>Zwillinge</strong><br />
isoliert als Spielkameraden einzuladen.<br />
Viele Pädagogen empfehlen, <strong>Zwillinge</strong> wenigstens eine Zeit lang in getrennte<br />
Gruppen und Schulklassen zu geben, damit sie sich individuell entfalten und eigene<br />
soziale Kontakte und Freundschaften aufbauen können. Solch eine Trennung kommt<br />
vielen Eltern (und erst recht allen Außenstehenden) als eine harte Zumutung vor, fördert<br />
jedoch den letztlich unausweichlichen Trennungsprozess, der die nachfolgenden Lebensabschnitte<br />
erheblich erleichtert.<br />
79b
80a<br />
80b<br />
Fünftes Kapitel: Frühgeburt<br />
Gewichtsgrenze wie auch die Mindestdauer der Tragzeit im Mutterleib aus medizinischer<br />
Sicht noch einmal deutlich senken lassen.<br />
Im fünften Kapitel wollen wir uns noch einmal gesondert mit dem Problem der<br />
Frühgeburtlichkeit befassen, denn gut ein Drittel der <strong>Zwillinge</strong> und fast alle höhergradigen<br />
Mehrlinge kommen vor der vollendeten 37. SSW zur Welt.<br />
1. Neugeborenen-Intensivmedizin<br />
Viele der zu früh geborenen Kinder müssen lediglich einige Tage in der Klinik<br />
beobachtet werden. Einige Kinder werden allerdings so weit vor dem errechneten<br />
Geburtstermin oder so unreif geboren, dass sie in einer Neugeborenen-Intensivstation<br />
behandelt werden müssen.<br />
Dem medizinischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte ist es zu verdanken,<br />
dass auch diese Kinder inzwischen eine sehr gute Überlebenschance haben. Galt es<br />
noch in den siebziger Jahren als nahezu aussichtslos, ein Kind von unter 1000 Gramm<br />
am Leben zu erhalten, so ist dies heute beinahe schon Routine. Kinder, die nach der<br />
29. SSW geboren werden, haben bereits eine über 90%ige Chance zu überleben und<br />
sich völlig gesund zu entwickeln. Selbst Kinder aus der 24. SSW haben eine weit ü-<br />
berwiegende Überlebenschance; erst bei etwa der 22. SSW liegt derzeit die absolute<br />
Untergrenze der unbedingt erforderlichen Austragungsdauer. Diese Erfolge wurden<br />
vor allem dadurch ermöglicht, dass es Ende der 80er Jahre gelang, ein Verfahren zur<br />
künstlichen Herstellung des für die Entfaltung der Lungenbläschen erforderlichen<br />
Surfactant zu entwickeln. In den 90er Jahren wurde dann die Ernährung der Extrem-<br />
Frühchen durch geeignete Lösungen und Emulsionen optimiert.<br />
Das <strong>klein</strong>ste Frühchen, das jemals auf diese Weise erfolgreich aufgepäppelt wurde,<br />
wog bei der Geburt lediglich 244 Gramm. Um solche Erfolge zu erzielen, bedarf es<br />
allerdings extremer medizinischer und technischer Anstrengungen, die auf die Eltern<br />
oftmals sehr bedrückend wirken. Japanische Forscher sind sogar darum bemüht, einen<br />
Weg zu finden, die Fruchtwasserumgebung der Gebärmutter künstlich zu simulieren<br />
und Frühchen darin aufwachsen zu lassen. Mit solchen Verfahren, die sich zunehmend<br />
allerdings auch einer ethischen Diskussion stellen müssen, dürften sich die untere<br />
a) Künstliche Beatmung<br />
Eine künstliche Beatmung ist erforderlich, wenn ein Kind nicht in der Lage ist,<br />
selbständig zu atmen (sog. Atemnotsyndrom). Kinder, die vor der vollendeten 28. SSW<br />
zur Welt kommen, müssen nahezu ausnahmslos künstlich beatmet werden; die Hälfte<br />
davon sogar länger als zwei Wochen. Bei den später geborenen Kindern nimmt der Anteil<br />
künstlicher Beatmungen kontinuierlich ab, bis sie zwischen der 32. und 36. SSW bei<br />
25 % und nach der 36. SSW immerhin noch bei etwa 15 % liegt.<br />
Verursacht werden die Atemschwierigkeiten meist dadurch, dass sich die Lungenbläschen<br />
nicht richtig entfalten können, weil ihnen das oberflächenaktive Surfactant<br />
fehlt. Diese körpereigene Substanz bildet sich in ausreichender Menge erst am Ende der<br />
Schwangerschaft (nach der 34. SSW). Wenn sich die drohende Frühgeburt schon während<br />
der Schwangerschaft abzeichnet, kann man die Lungenreifung noch im Mutterleib<br />
beschleunigen, indem man der Mutter ein bestimmtes Kortisonpräparat (Kortikosteroid)<br />
verabreicht. Das Kortison regt die Bildung von Surfactant im kindlichen Körper an.<br />
Nach der Geburt kann man die Atemnot behandeln, indem man künstliches Surfactant<br />
durch die Atemwege unmittelbar in die Lunge gibt. Bereits nach kurzer Zeit erreicht<br />
man damit eine deutlich verbesserte Sauerstoffaufnahme und schon nach wenigen Stunden<br />
ist der Behandlungserfolg auch im Röntgenbild erkennbar: Der ursprünglich weiße<br />
Bereich (Lunge mit geringer Oberfläche) erscheint nach erfolgreicher Behandlung<br />
schwarz (Lunge mit großer Oberfläche).<br />
Bei besonders <strong>klein</strong>en Frühchen können allerdings noch weitere Atmungsprobleme<br />
hinzukommen, z.B. dass das Atemzentrum im Hirnstamm noch nicht ausgereift ist und<br />
das Kind die Atemfunktion noch nicht koordinieren kann. Außerdem kann dem Kind die<br />
Kraft fehlen, den Brustkorb zu heben und zu senken, und auch der Brustkorb selbst ist<br />
vielleicht noch nicht in sich gefestigt, so dass er beim Ausatmen regelrecht einfällt.<br />
Diese Kinder müssen so lange mit einem Beatmungsgerät künstlich beatmet werden, bis<br />
die Lunge ihre Tätigkeit selbständig ausüben kann.<br />
Sind die schwerwiegenden Atemprobleme behoben oder liegen von vornherein nur<br />
leichtere Atemschwierigkeiten vor, so genügt es, die weitere Heranreifung der Atemor-
81a<br />
gane durch einen ständigen Gegenluftstrom zu unterstützen (nasaler CPAP). Dabei<br />
wird über eines oder beide Nasenlöcher kontinuierlich Luft eingeströmt, die das Kind<br />
selbständig einatmet. Der Gegenluftstrom erleichtert das Einatmen, wodurch das Kind<br />
ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, und erschwert das Ausatmen, was die<br />
Brustmuskulatur stärkt. Zugleich wird dadurch verhindert, dass der Luftdruck innerhalb<br />
der Lunge beim Ausatmen so stark abfällt, dass die Lungenbläschen in den entlegeneren<br />
Verzweigungen der Lungenflügel zusammenfallen.<br />
Während dieser Maßnahmen werden Atmung und Blutsauerstoff permanent durch<br />
einen Monitor überwacht. Denn bei vielen Frühchen sind die Steuerungsfunktionen<br />
des Atemzentrums noch nicht voll ausgereift: Die Kinder „vergessen“ schlicht zu<br />
atmen. Der Monitor reagiert auf solche Atemausfälle (Apnoen) mit einem akustischen<br />
Alarm und meist genügt schon eine <strong>klein</strong>e Stimulation (z.B. Kitzeln an den Füßen),<br />
um die Atmung wieder in Gang zu setzen. Manchmal kann aber auch eine medikamentöse<br />
Behandlung oder der erneute Anschluss an das Beatmungsgerät notwendig werden.<br />
Nach längerer Beatmung über mehrere Wochen leiden manche Kinder unter einer<br />
chronischen Lungenerkrankung, die man als bronchopulmonale Dysplasie („Umbaulunge“/„Beatmungslunge“)<br />
bezeichnet. Es handelt sich um eine krankhafte Versteifung<br />
der Lungen und Bronchien aufgrund von Bindegewebswucherungen. Die Lunge kann<br />
sich nicht mehr so stark ausdehnen und den Sauerstoff nicht mehr so gut aufnehmen.<br />
Die davon betroffenen Kinder benötigen zum Teil auch nach der Entlassung aus der<br />
Frühchenstation noch eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr, bis sich ihre Lungen ausreichend<br />
entwickelt bzw. regeneriert haben. Das kann bis zu einem Jahr und noch darüber<br />
hinaus dauern.<br />
Anschließend besteht das erhöhte Risiko einer RS-Virus-Infektion. Das RS-Virus<br />
ist weit verbreitet und normalerweise harmlos; fast alle Kinder infizieren sich daran<br />
innerhalb der ersten zwei Lebensjahre. Bei Kindern mit bronchopulmonaler Dysplasie<br />
besteht jedoch die erhöhte Gefahr eines schwerwiegenden Krankheitsverlaufs mit<br />
ernsten Atemwegserkrankungen bis hin zur Lungenentzündung oder Pseudokrupp-<br />
Erkrankung. Daher wird den an bronchopulmonaler Dysplasie erkrankten Kindern zu<br />
einer vorbeugenden Impfung (Immunisierung) gegen das RS-Virus geraten, die je fünf<br />
Mal in monatlichen Abständen im ersten Winter und ggf. noch fünf Mal im zweiten<br />
Winter verabreicht wird. Da der Impfstoff Palivizumab (Synagis ) jedoch sehr teuer<br />
ist (pro Kind über 4.000 EUR je Impfsaison), zögern viele Ärzte, ihn von sich aus zu<br />
verschreiben. Fragen Sie deshalb gezielt bei Ihrem Kinderarzt nach, ob eine solche<br />
Impfung für Ihr Kind sinnvoll ist. Inzwischen sollten alle Kinderärzte den seit 1999<br />
zugelassenen Impfstoff kennen. Falls nicht: Bitten Sie ihn, sich mit den hierzu ergangenen<br />
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie zu befassen<br />
1 oder sich bei der Herstellerfirma Abbott danach zu erkundigen.<br />
Um unnötige Atemwegsinfektionen von Ihren Kindern fernzuhalten, sollten Sie außerdem<br />
das volle Wartezimmer beim Kinderarzt mit den dort kursierenden Krankheitserregern<br />
meiden. Bitten Sie den Kinderarzt unter Hinweis auf die Nachwirkungen der<br />
bronchopulmonalen Dysplasie darum, Ihnen Termine außerhalb der üblichen Sprechstunden<br />
zu geben oder Sie als erste Patienten zu Beginn der Sprechstunde sofort ins<br />
Behandlungszimmer vorzulassen.<br />
b) „minimal handling“<br />
Ein Grundanliegen der Behandlung auf der Frühgeborenenstation ist es, die medizinischen<br />
Eingriffe auf das absolut Notwendige zu beschränken und das Kind ansonsten<br />
weitmöglichst in Ruhe zu lassen („minimal handling“). Das hat zwei Gründe:<br />
Zum einen löst jeder äußere Eingriff bei dem Frühchen Stresssymptome aus, die<br />
den Puls und den Blutdruck ansteigen lassen. Durch den höheren Blutdruck können feine<br />
Äderchen im Gehirn platzen, was zu gefährlichen Hirnblutungen führen kann. Bei ausgewachsenen<br />
Menschen und auch bei reifen Neugeborenen besteht diese Gefahr nicht,<br />
weil sie in der Lage sind, diese Druckunterschiede durch eine Art Schleusensystem abzufangen,<br />
indem die Hirnarterien durch Muskelanspannung künstlich verengt werden.<br />
Diese Fähigkeit besitzen Frühchen, die vor etwa der 32. SSW geboren werden, jedoch<br />
noch nicht, so dass die Blutdruckunterschiede bis in die feinen Verästelungen des Endhirns<br />
durchschlagen und dort die Blutgefäße beschädigen können. Vor allem innerhalb<br />
der ersten drei Lebenstage besteht eine erhöhte Gefahr. Danach hat das hirnorganische<br />
Durchblutungssystem allmählich die Fähigkeit der Durchblutungsregulierung entwickelt,<br />
so dass die Gefahr einer stressbedingten Hirnblutung abnimmt.<br />
1 s. http://www.dgpi.de/pdf/Leitlinie_Palivizumab_27Okt2006.pdf. Für Österreich gelten die<br />
Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde:<br />
http://www.docs4you.at/Content.Node/OEGKJ/Konsensuspapiere/empfehlungen_zur_respiratory_<br />
syncytial_virus_prophylaxe_bei.php.<br />
81b
82a<br />
Zum anderen bemüht man sich aus Gründen des Infektionsschutzes, invasive Eingriffe<br />
möglichst zu vermeiden. Unter „invasiven“ Eingriffen versteht man alle medizinischen<br />
Maßnahmen, die in den Körper eindringen (z.B. Nadelstich zur Blutabnahme,<br />
Anlegen eines Katheters etc.). Alle invasiven Eingriffe bergen die Gefahr, dass Krankheitserreger<br />
durch die Hautöffnung eindringen und eine Infektion verursachen. Da die<br />
Frühgeborenen noch nicht über die erforderlichen Abwehrkräfte verfügen, können<br />
selbst banale Infekte mit allgegenwärtigen Erregern zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung<br />
führen, die sofort mit Antibiotika behandelt werden muss.<br />
Daher werden möglichst viele Messungen und Behandlungen ohne invasiven Eingriff<br />
in den Körper durchgeführt:<br />
- Mit einem Pulsoxymeter wird der Sauerstoffgehalt des Blutes an einer<br />
Hand oder an einem Fuß gemessen. Dabei werden die Blutgefäße mit einer<br />
Lichtquelle durchleuchtet, so dass dem Neugeborenen für diese Messung<br />
kein Blut entnommen werden muss. Außerdem misst das Gerät den<br />
Herzschlag (Puls).<br />
- Die Nahrungszufuhr (Glukose, Eiweiß, Vitamine und Fettemulsionen) erfolgt<br />
in den ersten Tagen durch einen Nabelkatheter über die Nabelschnur,<br />
um zusätzliche Einstiche in der Anfangszeit zu vermeiden. Erst<br />
wenn diese Art der Nahrungszufuhr nicht mehr möglich ist, wird eine Infusion<br />
gelegt. Auch die erforderlichen Blutentnahmen können in der Anfangszeit<br />
über den Nabelkatheter entnommen werden.<br />
Für manche Eltern bedeutet das minimal handling eine große innere Anspannung,<br />
wenn sie ihr Neugeborenes in womöglich schlechtem Zustand hilflos liegen sehen, und<br />
sich innerlich fragen, warum denn niemand etwas tut für das Kind. Sie sollten dem<br />
„Nichtstun“ in dieser Situation vertrauen. Der Zustand eines Frühchens kann sich<br />
innerhalb nur weniger Stunden rapide ändern – auch zum Guten. Lassen Sie sich von<br />
den Ärzten und Schwestern der Station erklären, welche Maßnahmen ergriffen wurden<br />
und welchen Behandlungserfolg oder Entwicklungsfortschritt man sich davon verspricht.<br />
Die weitere Gesundung und Entwicklung Ihres Kindes muss dann vor allem<br />
aus seiner körpereigenen Energie heraus geleistet werden. Die ärztliche Kunst kann<br />
dies nicht ersetzen, sondern nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen.<br />
c) Weitere Entwicklung und Überwachung<br />
Wenn die erste schwierige Zeit überstanden ist, kommt in aller Regel erst einmal<br />
etwas Ruhe in den Alltag. Dabei wollen wir die denkbaren Behandlungskomplikationen,<br />
mögliche Infektionen, Organerkrankungen und andere Rückschläge einmal außen vor<br />
lassen, weil sie das Thema dieses Buches sprengen würden. Die im Anhang empfohlenen<br />
Bücher zum Thema Frühgeburt behandeln auch diese Fragen.<br />
Viele Frühchen benötigen im weiteren Verlauf der Behandlung allerdings eine Bluttransfusion.<br />
Bei den bis zur vollendeten 28. SSW Geborenen betrifft das praktisch alle<br />
Kinder, weil allein schon die für Untersuchungszwecke entnommenen winzigen Blutproben<br />
dem Körper in ihrer Gesamtheit soviel Blut entziehen, dass eine Auffüllung der<br />
Blutmenge erforderlich wird. Bei den später geborenen Kindern hängt es von den jeweils<br />
ergriffenen Behandlungsmaßnahmen und vom Zustand des Kindes ab, ob eine<br />
Bluttransfusion erforderlich wird. Einige Kinder benötigen eine Bluttransfusion sogar<br />
unabhängig von etwaigen Blutentnahmen, weil das blutbildende System noch nicht in<br />
der Lage ist, ausreichend viele rote Blutkörperchen nachzubilden, so dass es im Laufe<br />
der Zeit zu einer Blutanämie kommt. Von den zwischen der vollendeten 28. SSW und<br />
der 31. SSW geborenen Kindern sind insgesamt ca. 40 % auf eine Bluttransfusion angewiesen,<br />
aus der Gruppe der später Geborenen sind es noch ca. 15%. Als Blutspender<br />
kommen grundsätzlich auch die Eltern in Betracht, wenn sich die Blutgruppen untereinander<br />
vertragen. Falls Sie Wert darauf legen, das Blut selbst zu spenden, sollten Sie das<br />
Klinikpersonal rechtzeitig darauf ansprechen.<br />
Wenn Ihr Kind dann auf dem Weg der Besserung ist, sollte es bald auch seine erste<br />
normale Nahrung über den Mund zu sich nehmen. Das ist wichtig, um den Magen-Darm-<br />
Trakt zu aktivieren, vor allem die Darmenzyme. Mit Abstand am besten geeignet ist<br />
Muttermilch, die Sie vorher abpumpen. Besprechen Sie mit dem Klinikpersonal, inwieweit<br />
Sie bei der Fütterung schon mitwirken und diese später ganz übernehmen können.<br />
d) Stillen von Frühgeborenen<br />
Bei Frühgeborenen muss je nach dem erreichten Entwicklungsstand mit dem Klinikpersonal<br />
besprochen werden, ob die Kinder schon an die Brust angelegt werden können<br />
oder ob sie abgepumpte Milch erhalten. Bei <strong>klein</strong>en Frühchen ist der Mund oft noch<br />
zu <strong>klein</strong>, um die Brustwarze und den Warzenhof vollständig aufzunehmen. Hier gibt es<br />
82b
83a<br />
bestimmte Techniken, die Brustwarze vorzuformen und das Kinn des Kindes beim<br />
Saugen zu stützen. Hilfsreich ist es, wenn man von einer qualifizierten Still- oder<br />
Laktationsberaterin dabei unterstützt wird. Wo eine solche Fachkraft fehlt, verfügen<br />
die Stationsschwestern meist über entsprechende Grundkenntnisse. Nach dem Stillen<br />
sollte die Brust zusätzlich noch mit einer Milchpumpe abgesaugt werden, damit der<br />
Milchflussreflex angeregt bleibt. Das Saugen der Frühchen selbst ist dafür in der Anfangszeit<br />
oft noch zu schwach.<br />
Abgepumpte Milch wird mit der Finger-Feeding-Methode verfüttert, damit keine<br />
Saugverwirrung entsteht (s. Seite 54). Frühchen, die noch nicht schlucken können,<br />
erhalten die Milch über eine Magensonde. Gerade die noch schwachen Frühchen benötigen<br />
die Vormilch und die Muttermilch besonders dringend für den Aufbau ihrer<br />
Immunabwehr.<br />
e) Elterliche Zuwendung<br />
Die Bedeutung der elterlichen Zuwendung für die Entwicklung der Frühchen ist<br />
lange Zeit unterschätzt worden. Noch bis vor wenigen Jahren wurden Frühgeborene in<br />
ihren Inkubatoren, angeschlossen an Infusionen, Beatmungsgeräte und Monitore, ohne<br />
persönliche Zuwendung Tag und Nacht allein gelassen. Eltern war der Zutritt im Interesse<br />
einer möglichst keimfreien Umgebung nur hinter Glasscheiben erlaubt; bestenfalls<br />
durften sie ihr Neugeborenes einmal mit sterilen Handschuhen durch oberarmdicke<br />
Öffnungen des Inkubators berühren.<br />
Inzwischen hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht nur eine professionelle<br />
medizinische Versorgung, sondern ebenso die intensive Zuwendung der<br />
Eltern und ein enger Körperkontakt sehr wichtige Faktoren für das gute Gedeihen der<br />
Frühchen sind. Frühchen, die elterliche Geborgenheit erfahren, wachsen schneller und<br />
mit weniger Komplikationen heran als Kinder ohne intensive Zuwendung. Deshalb<br />
wird mittlerweile in nahezu allen Neugeborenenintensivstationen die sog. Känguru-<br />
Methode praktiziert, bei der die Frühchen mitsamt ihrer Verkabelung eine geraume<br />
Zeit auf den unbekleideten Oberkörper der Mutter oder des Vaters gelegt werden. Im<br />
unmittelbaren Hautkontakt spüren sie die elterliche Wärme und die Bewegungen des<br />
elterlichen Herzschlages, der sie im Mutterleib als ständiges Pochen begleitet hatte.<br />
Um einen möglichst nachhaltigen Kontakt zu ermöglichen, sind in den meisten Kliniken<br />
für die Eltern großzügige Besuchszeiten eingerichtet. Nur bei den sehr <strong>klein</strong>en<br />
Frühchen sollte man sich in den aller ersten Tagen nach der Geburt mit einer allzu forschen<br />
Kontaktaufnahme noch etwas zurückhalten, um nicht durch eine unglückliche<br />
Bewegung Stresssymptome auszulösen und damit die Gefahr einer Hirnblutung zu erhöhen.<br />
Doch nicht nur der direkte Körperkontakt, sondern allein schon das Hören der mütterlichen<br />
Stimme hat einen positiven Einfluss, weil das Kind diese Schallwellen bereits<br />
im Mutterleib wahrnehmen konnte und nun wiedererkennt. Viele Kliniken bieten deshalb<br />
an, das Frühchen in den Zeiten Ihrer Abwesenheit mit Sprachkassetten zu beschallen,<br />
auf der die Mutter eigene Texte oder Lieder aufnimmt 1 . Gerade Eltern von Mehrlingen,<br />
die ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung gleich auf mehrere Neugeborene verteilen<br />
müssen, sollten von dieser Möglichkeit ergänzend Gebrauch machen.<br />
In jedem Fall ist die Situation eines in der Intensivstation liegenden Frühchens auch<br />
und besonders für die Eltern eine harte Probe. Die veröffentlichten Erfahrungsberichte<br />
zeugen von einer wirklichen Überforderung der Eltern, die kaum auch nur körperlich in<br />
der Lage sind, die Herausforderungen dieser Lebensphase zu bewältigen, geschweige<br />
denn Zeit finden für eine innere Aufarbeitung dieser Erlebnisse. Allein der organisatorische<br />
Aufwand der täglichen Besuche in der Klinik ist kaum zu schaffen, vor allem wenn<br />
andere Mehrlingsgeschwister bereits nach Hause entlassen sind. An eine entspannte<br />
Zuwendung im Sinne der Känguru-Methode, wie sie dem Kind eigentlich gut tun würde,<br />
ist kaum zu denken. Zusätzlich müssen Fahrdienste für die abgepumpte Muttermilch<br />
organisiert werden, die vielleicht zu anderen Zeiten eintreffen muss, als die Besuche<br />
geplant sind. Von Behördengängen, Arztbesuchen mit einem bereits entlassenen Säugling<br />
und natürlich den Alltagsbesorgungen einmal ganz zu schweigen, ebenso zu<br />
schweigen von möglichen älteren Geschwisterkindern, die auch noch versorgt und betreut<br />
werden müssen. Zu allem tritt noch eine enorme psychische Belastung, das eigene<br />
Kind, auf das man sich ganz anders gefreut hatte, nun mit Kabeln und Schläuchen an<br />
vielerlei medizinisches Gerät angeschlossen in der Intensivstation vorzufinden. Flackernde<br />
und piepsende Monitore, die Sicherheit schaffen sollen, machen Eltern eher<br />
Angst. Die hohe Raumtemperatur, die erdrückende Enge zwischen den Inkubatoren, eine<br />
große Unruhe, dazu vielleicht Schwierigkeiten, die eigenen Kinder zwischen all den<br />
anderen wiederzufinden und sie womöglich nicht einmal sofort wiederzuerkennen, wenn<br />
1 Weitere Einzelheiten hierzu und praktische Anleitung finden Sie in der Broschüre „Frühgeborene<br />
und ihre Eltern in der Klinik“, die der Verein „Das Frühgeborene Kind e.V.“ herausgibt<br />
(Bestelladresse im Anschriftenteil des Anhangs).<br />
83b
84a<br />
Teile des Gesichtes durch Pflaster und Schläuche bedeckt sind, tragen zu einer Atmosphäre<br />
der bedrückten Hilflosigkeit bei, auf die kaum jemand vorbereitet ist. Sogar<br />
von Eltern, die selbst Kinderarzt und Neugeborenenmediziner waren, wird berichtet,<br />
dass sie in der Situation ihres eigenen intensivbehandelten Kindes völlig hilflos dastanden<br />
und zu keinem geordneten Gedanken fähig waren. Um welches meiner Kinder<br />
soll ich mich zuerst kümmern Warum liegen sie denn so weit auseinander Was kann<br />
ich hier überhaupt tun – Erst allmählich beginnt man sich an diesen Raum zu gewöhnen,<br />
vor allem, wenn die Behandlung Fortschritte erzielt.<br />
Wann immer Sie Fragen haben, gehen Sie auf das Pflegepersonal zu. Wenn die<br />
angeschlossenen Apparate Sie beängstigen, erfragen Sie deren genaue Funktion. Zu<br />
den Aufgaben des Pflegepersonals in diesen Abteilungen gehört es auch, die Sorgen<br />
der Eltern in allen Dingen ernst zu nehmen und Rede und Antwort zu stehen, sooft Sie<br />
darum bitten. Wenn Sie sich darüber hinaus noch für medizinisches Hintergrundwissen<br />
interessieren, können Sie auf spezielle Sachbücher zum Thema Frühgeburt zurückgreifen,<br />
in denen die medizinischen Geräte und die üblichen Behandlungsmethoden detailliert<br />
beschrieben sind.<br />
Doch auch mit noch so viel Wissen um die einzelnen Abläufe bleibt es ein Wechselbad<br />
der Gefühle, wenn sich der Zustand des Kindes innerhalb weniger Stunden<br />
sprunghaft verbessert, aber auch immer wieder verschlechtern kann. Manche Eltern<br />
neigen dann dazu, ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung ungleich auf die Kinder zu<br />
verteilen. Manche bevorzugen das gesundere Kind, weil es mehr Freude und Bestätigung<br />
vermittelt, während andere Eltern fast nur noch mit dem schwächeren Zwilling<br />
befasst sind, um dessen Entwicklung möglichst intensiv zu fördern. In dieser Situation<br />
können auch Schuldgefühle gegenüber dem zurückgesetzten Kind aufkommen, die<br />
schnell dazu führen, dass man sich noch mehr Anstrengung auferlegt, um auch diesem<br />
Kind noch besser gerecht zu werden. Bevor Sie sich jedoch völlig verausgaben, sollten<br />
Sie das Gespräch mit einer erfahrenen Person suchen, die Ihre Familiensituation einmal<br />
als Außenstehender betrachtet – zum Beispiel ein Mitarbeiter des sozialen Dienstes<br />
der Klinik. Ein offener Gedankenaustausch kann den hohen Erwartungsdruck, der<br />
auf Ihnen lastet, auffangen. Aufgrund seiner Erfahrungen mit solchen Situationen kann<br />
der Mitarbeiter Ihnen Wege aufzeigen, sich Entlastungsmöglichkeiten und Ressourcen<br />
zu erschließen.<br />
f) Nach der Entlassung<br />
Mit der Entlassung aus der Neugeborenenklinik ist der Zeitpunkt gekommen, auf<br />
den alle Beteiligten tage- oder sogar wochenlang hingearbeitet haben. Endlich zuhause<br />
angekommen, eröffnet sich dem Kind eine völlig neue Welt: Eine ruhige, behagliche<br />
und eher gedämpft gestaltete Umgebung tritt an die Stelle der geräuschvollen und hell<br />
erleuchteten Kulisse der Apparatemedizin. Zugleich bedeutet aber das plötzliche Ende<br />
der optischen und akustischen Reizüberflutung eine erhebliche Umstellung für das Kind,<br />
ebenso der geänderte Tagesrhythmus. Diese Veränderungen haben zur Folge, dass viele<br />
Frühchen in der ersten Zeit nach ihrer Entlassung leicht irritierbar, wechselhaft in ihrer<br />
Stimmungslage und z.T. unausgeglichen sind. Manche Frühchen reagieren auch auf die<br />
Ansprache und Berührung der Eltern zunächst ganz anders als auf der Frühchenstation.<br />
In dieser Phase kann ein Kontakt zu anderen Frühchen-Eltern hilfreich sein, die<br />
sich in vielen Orten zu Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen haben. Im Austausch<br />
mit anderen Betroffenen sowie im Gespräch mit „erfahrenen“ Frühchen-Eltern können<br />
Sie einiges über die typischen Verhaltensmuster und Eigenarten von Frühgeborenen<br />
erfahren und gewinnen dadurch größere Sicherheit im Umgang mit Ihren eigenen Kindern.<br />
Nehmen Sie auch die professionellen Beratungsangebote der Frühchenklinik, einer<br />
pädagogischen Frühförderstelle oder eines sozialpädiatrischen Zentrums in Anspruch,<br />
um in Ergänzung zu den Therapievorschlägen Ihres Kinderarztes einen Überblick über<br />
die für Ihre konkrete Situation vorgesehenen Frühförderungsmöglichkeiten zu erhalten.<br />
Viele wertvolle Hinweise zum Umgang mit Frühgeborenen daheim, auch zu Fragen<br />
der Ernährung und zum Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung, finden Sie in der Broschüre<br />
„Frühgeborene nach der Entlassung“, die Sie beim Bundesverband „Das Frühgeborene<br />
Kind e.V.“ bestellen können. (Bestelladresse im Anschriftenteil des Anhangs)<br />
g) Erfolglose Behandlung<br />
Nur sehr wenige Kinder sind es, bei denen alle Anstrengungen vergeblich erscheinen,<br />
wo sich der Zustand des Kindes über einen längeren Zeitraum nicht bessern will<br />
und jede durchgeführte Behandlung immer weitere Komplikationen und neue Maßnahmen<br />
nach sich zieht. Vor allem bei den sehr <strong>klein</strong>en Frühchen kommen solche Kettenreaktionen<br />
vor, und jede weitere Behandlung mindert nicht nur das Zutrauen in die Lebenskraft<br />
des Kindes, sondern steigert zugleich die Sorge um das Zurückbleiben geisti-<br />
84b
85a<br />
85b<br />
ger und körperlicher Behinderungen. Wenn schon eine Vielzahl von Operationen<br />
durchgeführt wurde und ein durchgreifender Erfolg in weiter Ferne bleibt, wenn Organe<br />
versagen und transplantiert werden sollen, das Kind vielleicht schon von der Dialyse<br />
abhängt, werden die Grenzen der Medizin erkennbar und betroffenen Eltern stellt<br />
sich die Frage: wie <strong>klein</strong> ist zu <strong>klein</strong><br />
Manchmal sind es auch die Ärzte, die ihre weiteren Behandlungsvorschläge nicht<br />
mehr mit dem vollen Brustton der inneren Überzeugung vorbringen und vielleicht auf<br />
diese Weise ihre Bereitschaft signalisieren, auch für ein grundsätzliches Gespräch über<br />
den Sinn einer Fortführung der Behandlung bereit zu stehen. Wenn es mit der Zeit zur<br />
bitteren Gewissheit wird, dass das Kind die Klinik trotz aller medizinischen Anstrengungen<br />
nicht lebend verlassen wird, kann der Gedanke aufkommen, die weitere Behandlung<br />
einzustellen und das Kind würdevoll sterben zu lassen. Für manche Eltern ist<br />
die Schwelle für solche Erwägungen sogar dann schon erreicht, wenn das Kind nur<br />
noch mit schweren Behinderungen zu retten wäre.<br />
Gedacht ist dabei natürlich nicht an eine aktive Sterbehilfe, die die lebenserhaltenden<br />
Systeme abstellt. Es geht hier um passive Sterbehilfe, die darauf verzichtet,<br />
auch noch das Äußerste an medizinischen Anstrengungen zur weiteren Lebenserhaltung<br />
und –verlängerung zu unternehmen, vielmehr sich darauf beschränkt, nur noch<br />
die Grundversorgung des Kindes unter Verabreichung schmerzlindernder Medikamente<br />
aufrecht zu erhalten, um damit dem „natürlichen“ Verlauf seinen Weg zu geben.<br />
„Die Medizin zieht sich taktvoll zurück“, wie es eine betroffene Mutter einmal ausdrückte.<br />
aus den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung<br />
vom 11.09.1998:<br />
„Bei Neugeborenen mit schwersten Fehlbildungen oder schweren<br />
Stoffwechselstörungen, bei denen keine Aussicht auf Heilung oder Besserung<br />
besteht, kann nach hinreichender Diagnostik und im Einvernehmen<br />
mit den Eltern eine lebenserhaltende Behandlung, die ausgefallene<br />
oder ungenügende Vitalfunktion ersetzt, unterlassen oder nicht weitergeführt<br />
werden. Gleiches gilt für extrem unreife Kinder, deren unausweichliches<br />
Sterben abzusehen ist und für Neugeborene, die schwerste Zerstörungen<br />
des Gehirns erlitten haben. Eine weniger schwere Schädigung ist<br />
kein Grund zur Vorenthaltung oder zum Abbruch lebenserhaltender<br />
Maßnahmen, auch dann nicht, wenn Eltern dies fordern. Ein offensichtlicher<br />
Sterbevorgang soll nicht durch lebenserhaltende Therapie künstlich<br />
in die Länge gezogen werden. Alle diesbezüglichen Entscheidungen<br />
müssen individuell erarbeitet werden. Wie bei Erwachsenen gibt es keine<br />
Ausnahmen von der Pflicht zu leidensmindernder Behandlung, auch nicht<br />
bei unreifen Frühgeborenen.“<br />
dagegen aus dem Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung Lebenshilfe<br />
für geistig Behinderte e.V.:<br />
„Behinderte Menschen haben ein uneingeschränktes Lebensrecht.<br />
Wer z.B. versucht, Säuglinge wegen ihrer Schädigung oder Behinderung<br />
das Recht auf Leben abzusprechen, verstößt gegen das Gebot der Verfassung,<br />
das jedem ein Recht auf Leben garantiert (Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes).“<br />
Vor eine solche Entscheidung gestellt zu sein, gehört sicher zu den schwierigsten<br />
Momenten überhaupt. Die Entscheidung ist auch deshalb so schwer, weil sie innerhalb<br />
eines überschaubaren Zeitraums getroffen werden muss, und die Eltern doch das ganze<br />
Leben lang begleiten kann. Kann man überhaupt verantworten, über Leben und Tod<br />
seines Kindes zu entscheiden Andererseits: Handelt es sich denn wirklich um eine Entscheidung<br />
über Leben und Tod des Kindes, oder doch eher um das Akzeptieren einer<br />
Konsequenz, die die Natur von vornherein so bestimmt hatte Pauschale Antworten und<br />
allgemeine Empfehlungen für diese Situation gibt es nicht. Im Gespräch miteinander,<br />
mit Freunden und Verwandten, mit Seelsorgern und dem Arzt müssen Sie als Eltern für<br />
sich einen Standpunkt erarbeiten.<br />
Es gibt Eltern, die in dieser Situation alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft<br />
haben, und im Nachhinein, obwohl sie in einer harmonischen und glücklichen<br />
Familie leben, ihrem schwerstbehinderten Kind angesichts der vielen Widrigkeiten auch<br />
ein friedliches Einschlafen gegönnt hätten. Andere haben sich gegen weitere Behandlungen<br />
ausgesprochen und machen sich ein Leben lang Vorwürfe, nicht alles für ihr<br />
Kind versucht zu haben.<br />
Rechtlich gesehen liegt die Entscheidung in Ihrer Hand. Solange Sie dies wünschen,<br />
ist der Arzt zur Durchführung aller erdenklichen lebenserhaltenden und –<br />
verlängernden Maßnahmen verpflichtet. Der Arzt kann daher nicht gegen Ihren Willen<br />
entscheiden, die weitere Behandlung einzustellen. Umgekehrt ist jedoch für jede zusätzliche<br />
Operation erneut Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich. Daher können Sie
86a<br />
die weitere Behandlung stoppen, indem Sie Ihre Einwilligung verweigern. Einwilligungen,<br />
die Sie bereits erteilt haben, können Sie jederzeit widerrufen. Ohne Ihre Einwilligung<br />
darf der Arzt grundsätzlich keine Operation (und auch keine Bluttransfusion)<br />
an Ihrem Kind durchführen. Hiervon gibt es nur zwei Ausnahmen: Zum einen die<br />
Notoperation, wenn zur Lebensrettung ein sofortiger Eingriff notwendig ist und die<br />
Eltern ihre Zustimmung nicht rechtzeitig erteilen können, und zum anderen, wenn das<br />
Vormundschaftsgericht Ihre Zustimmung ersetzt. Das Vormundschaftsgericht ersetzt<br />
die Zustimmung der Eltern, wenn es der Überzeugung ist, dass deren Entscheidung<br />
nicht von einer verantwortlichen Interessen- und Güterabwägung getragen ist. Die<br />
Einschaltung des Vormundschaftsgerichtes geht vom Arzt aus, wenn er die Entscheidung<br />
der Eltern aufgrund seiner eigenen Abwägung der Erfolgs- und Heilungschancen<br />
für nicht verantwortbar hält. Ob dieser formale Weg tatsächlich beschritten wird,<br />
hängt allerdings auch von der jeweiligen Klinik ab; hier besteht durchaus eine unterschiedliche<br />
Handhabung. Zunehmend wird der Wille der Eltern grundsätzlich akzeptiert.<br />
Trotzdem sollten Sie Ihre etwaigen Bedenken gegen eine Weiterbehandlung<br />
rechtzeitig gegenüber dem Arzt vorbringen und ihn in Ihre Überlegungen einbeziehen.<br />
Es kann ja immerhin auch sein, dass Sie den Zustand des Kindes und die Erfolgsaussichten<br />
der Behandlung unrichtig einschätzen.<br />
h) Von vornherein nicht behandelbare Kinder<br />
Schließlich gibt es auch noch einen Bereich, in dem Kinder zwar als „Lebendgeburt“<br />
gelten, weil sie mindestens eines der drei maßgeblichen Lebenszeichen aufweisen<br />
(Herzschlag, natürliche Lungenatmung, Pulsieren der Nabelschnur), jedoch nach<br />
dem derzeitigen Stand der medizinischen Technik mit keinerlei Aussicht auf Erfolg<br />
behandelt werden können. Eine von den Medizinerverbänden der berührten Fachrichtungen<br />
eingesetzte Ethikkommission 1 hat Empfehlungen erarbeitet, wann man von<br />
einer Behandlung der Kinder absehen und stattdessen einer einfühlsamen Sterbebegleitung<br />
Raum geben soll:<br />
- Bei Kindern, die vor der vollendeten 22. SSW geboren werden, wird keine<br />
intensive medizinische Behandlung empfohlen, weil nach dem derzeitigen<br />
Stand der Medizin keine realistische Überlebenschance besteht.<br />
- Bei Geburt in der 23. oder 24. SSW liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
zwischen 10% und 50%. Von den Überlebenden dieser Gruppe tragen 20-<br />
30% schwere körperliche und geistige Behinderungen. Hier soll das weitere<br />
Vorgehen mit den Eltern besprochen werden.<br />
- Kommen die Kinder nach der vollendeten 24. SSW zur Welt, bestehen hinreichend<br />
gute Aussichten, sie am Leben zu erhalten und auch ohne größere<br />
Beeinträchtigungen aufzuziehen. Bei diesen Kindern wird die erforderliche<br />
Erstbehandlung, wenn sie Erfolg verspricht, im Zweifel auch gegen den<br />
Willen der Eltern durchgeführt (Notfallbehandlung und lebenserhaltende<br />
Maßnahmen).<br />
i) Einen Verlust verarbeiten<br />
Trauer ist das ganz natürliche Gefühl, wenn wir jemanden verlieren, der uns<br />
lieb war. Sie ist eine starke Energie, die uns krank machen kann oder aber uns<br />
hilft, wieder heil zu werden.<br />
Trauer findet immer einen Ausdruck, auch wenn wir sie daran hindern wollen.<br />
(nach Hannah Lothrop)<br />
Der Tod des eigenen Kindes, auch wenn es nicht sehr lange gelebt hat, geht besonders<br />
nah. Erste Empfindungen sind, das Geschehene nicht wahrhaben zu wollen, ein<br />
entrücktes Erleben des Alltags, gefühlsmäßige Betäubtheit und quälende Fragen nach<br />
dem „Warum“. Man ist gelähmt in seinem Handeln, neigt zur Verdrängung. Psychologen<br />
raten dazu, das Trauergefühl anzunehmen und nicht zu verdrängen, den Abschied bewusst<br />
zu erleben, sich der Situation zu stellen und sie auf diese Weise für sich zu verarbeiten.<br />
86b<br />
Aber wann<br />
1 Beteiligt waren: Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Deutsche Gesellschaft<br />
für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin<br />
sowie die Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin.<br />
Als Zwillingseltern haben Sie noch ein weiteres, lebendes Neugeborenes, das sich<br />
wie alle Neugeborenen auf Ihr fröhliches Lächeln, ein liebevolles Streicheln, ein ausge-
87a<br />
lassenes Spiel freut. Die Situation verlangt eine innerliche Zerrissenheit, die es Ihnen<br />
kaum ermöglicht, sich auch nur auf eine der beiden Erlebniswelten mit ganzem Herzen<br />
einzulassen.<br />
Versuchen Sie trotzdem Zeit zu finden, von Ihrem verstorbenen Kind bewusst<br />
Abschied zu nehmen, möglichst in Ruhe und in einer stillen Umgebung. Das Kind zu<br />
sehen, es zu berühren und in den Arm zu nehmen wird schmerzhaft sein. Doch sind<br />
diese Momente unwiederbringlich, und viele Eltern sind im nachhinein froh, den intensiven<br />
Kontakt noch einmal gehabt und in ihre Erinnerungen aufgenommen zu haben.<br />
Formulieren Sie Ihre Wünsche so früh Sie können, bevor die Krankenhausroutine<br />
in Gang kommt und ihre Fakten schafft. Wenn das Kind schon weggebracht worden<br />
ist, bitten Sie das Klinikpersonal, es noch einmal sehen zu können. Haben Sie auch<br />
den Mut, die anwesenden Personen zu bitten, den Raum zu verlassen, wenn Sie mit<br />
Ihrem Kind eine Weile allein sein wollen. Die meisten Ärzte und Schwestern sind für<br />
die Bedeutung einer bewussten Abschiednahme ausreichend sensibilisiert. Wo das<br />
nicht der Fall ist, kostet es leider manchmal doppelte Kraft, sich auch noch gegen<br />
solche Widerstände durchsetzen zu müssen.<br />
Ältere Geschwisterkinder sollte man nach Möglichkeit in den Abschied mit einbeziehen.<br />
Sie fühlen sich dann nicht ausgeschlossen, wie sie auch von den Vorgängen<br />
der Schwangerschaft nicht ausgeschlossen waren, und das Geschehen wird für sie<br />
greifbar. Kinder ab ca. 10 Jahren haben bereits eine recht wirklichkeitsnahe Vorstellung<br />
von der Bedeutung des Todes und können damit verständig umgehen, aber auch<br />
Kindern ab zwei Jahren kann es aufgrund ihrer unbefangen Art im Umgang mit Verstorbenen<br />
schon gelingen, in positiver Erinnerung an das erwartete Geschwister Abschied<br />
zu nehmen. Besonders für junge Kinder ist auch der körperliche Kontakt zu<br />
dem Verstorbenen wichtig, sie wollen es gern streicheln und festhalten. Vielleicht<br />
bringen sie sogar ein persönliches Geschenk. Oftmals sind Kinder nicht so sehr durch<br />
das tote Neugeborene wie durch das veränderte Verhalten der Erwachsenen verunsichert.<br />
Vielen Eltern wird es im Laufe der Zeit außerdem wichtig, ein Foto von ihrem<br />
verstorbenen Kind zu haben. Vielleicht möchte auch das überlebende Zwillingsgeschwister<br />
später einmal ein Bild sehen. Machen Sie deshalb selbst ein Foto, wenn<br />
nicht die Klinik oder der Bestattungsunternehmer dafür sorgt.<br />
Um das Geschehene für sich selbst zu verarbeiten, ist wiederum ein vertraulicher<br />
Gesprächspartner von unschätzbarem Wert: der Partner, Freunde und Verwandte oder<br />
institutionalisierte Hilfe. Erwarten Sie keinen fließenden Übergang zum Alltag. Trauer<br />
ist ein langwieriger Prozess, den man nicht künstlich beschleunigen kann. Um in dieser<br />
schwierigen Zeit eine erste Orientierung zu finden, können wir das sehr einfühlsam<br />
geschriebene Buch von Hannah Lothrop empfehlen (s. Literaturhinweise im Anhang).<br />
2. Mögliche Spätfolgen einer Früh- oder Mangelgeburt<br />
Wie sich ein früh- oder mangelgeborenes Kind weiter entwickelt, ob es völlig gesund<br />
wird oder ob die ersten Startschwierigkeiten ihre Spuren hinterlassen, kann in den<br />
allermeisten Fällen nicht sofort nach der Geburt, sondern erst einige Zeit später gesagt<br />
werden – oft sogar erst nach einigen Wochen oder Monaten. Diese Zeit der Ungewissheit<br />
ist für viele Eltern nur schwer auszuhalten, fast schwerer noch als die feste Gewissheit<br />
einer bestimmten Beeinträchtigung:<br />
Sich an etwas festhalten können, einen Namen für die Befürchtungen, für das<br />
Ungewisse haben, das ist oft der erste Boden unter den Füßen. Von dieser Plattform<br />
aus werden Eltern wieder handlungsfähig. (Barbara Felber-Suter)<br />
Zum Glück erwiesen sich die meisten Befürchtungen als letztlich unbegründet.<br />
Frühchen über 1500 Gramm Geburtsgewicht entwickeln sich fast immer ohne bleibende<br />
Beeinträchtigungen. Von den Frühchen unter 1500 Gramm Geburtsgewicht gedeihen<br />
über 80%, unter 1000 Gramm immerhin noch drei Viertel der Kinder ohne behandlungsbedürftige<br />
Entwicklungsstörungen. Stark einschränkende Behinderungen verbleiben nur<br />
bei 7% der Kinder unter 1000 Gramm Geburtsgewicht. Ansonsten sind Frühgeborene,<br />
nachdem sie einmal aus der Klinik entlassen sind, gegenüber allgemeinen Erkrankungen<br />
(Infektionen etc.) nicht anfälliger als andere Kinder und leiden nicht mehr als andere<br />
Kinder unter seelisch-geistigen Beeinträchtigungen. Auch in Größe und Kopfumfang<br />
holen sie allmählich auf, bis spätestens nach der Pubertät jeder Unterschied zu den termingerecht<br />
geborenen Kindern völlig verschwindet.<br />
Bei einigen wenigen Kindern verbleiben allerdings dauerhafte Beeinträchtigungen,<br />
in erster Linie bei den sehr <strong>klein</strong>en Frühgeborenen und nach besonderen Komplikationen.<br />
Viele Dauerschäden sind auf Hirnblutungen zurückzuführen, die bei den sehr unreifen<br />
Kindern vor allem durch Stresssymptome in den ersten Lebenstagen ausgelöst werden.<br />
Aber auch nach einer Hirnblutung gibt es keine allgemein feststehenden Prognosen,<br />
sondern es kommt auf deren Schweregrad sowie auf mögliche Folgekomplikationen an.<br />
87b
88a<br />
Wenn wir im Folgenden auf einzelne Spätfolgen gesondert eingehen, so sind wir<br />
uns der darin liegenden Gefahr bewusst, diejenigen Eltern zu verängstigen, die die<br />
Geburt noch vor sich haben. Das ist aber keineswegs unsere Absicht und wäre auch<br />
sachlich ungerechtfertigt, weil selbst von den aller<strong>klein</strong>sten Frühgeborenen immer<br />
noch die Mehrzahl ohne bleibende Dauerschäden aufwächst. Vielleicht kann das Wissen<br />
um die möglichen Folgen jedoch zu einem weiteren Ansporn werden, die Frühgeburt<br />
durch konsequente Schonung möglichst zu vermeiden. Denjenigen aber, die von<br />
den Folgen einer Frühgeburt tatsächlich betroffen sind, wollen wir vor allem mitteilen,<br />
dass viele der gefürchteten Spätfolgen durch medizinische und heilpädagogische Maßnahmen<br />
behandelt werden können und unterschiedliche Programme der Frühförderung<br />
imstande sind, die Entwicklungsdefizite auffangen.<br />
a) Zerebralparesen und psychomotorische Störungen<br />
Manche Kinder leiden unter einer Störung des Zentralen Nervensystems, die die<br />
Steuerung und Koordination der Bewegungsmuster einschränkt. Verallgemeinernd<br />
werden sie oft als „spastische Lähmung“ bezeichnet, was aber nur für einen Teil der<br />
Zerebralparesen die korrekte Bezeichnung ist. Die Behandlung erfolgt – je nach Typ<br />
der Erkrankung – durch Krankengymnastik, wobei zwei unterschiedliche Behandlungsformen<br />
vorherrschen: Die Methode nach Vaclav Vojta und das Konzept der Eheleute<br />
Berta und Karel Bobath. Bei der Vojta-Methode wird versucht, durch Auslösung<br />
bestimmter Reflexe die dadurch aufgerufenen Bewegungsmuster in das zentrale Nervensystem<br />
einzuprogrammieren, damit das Kind diese später bewusst einsetzen kann.<br />
Die Therapie wirkt gewaltsam, weil sie das Kind zu Körperhaltungen zwingt, die es<br />
sonst nicht einnehmen würde. Oft äußern die Kinder durch Schreien ihr Missfallen an<br />
dieser zum Teil recht schmerzhaften Behandlung. Nach entsprechender Anleitung<br />
kann sie jedoch auch zuhause problemlos durchgeführt werden.<br />
Das Bobath-Konzept wirkt demgegenüber sanfter, indem es sich den nicht normalen<br />
Bewegungsmustern maßvoll widersetzt und die erwünschten Bewegungen behutsam<br />
unterstützt. Krankengymnastische Übungen trainieren die Fähigkeit, das Gleichgewicht<br />
zu halten und in verschiedenen Positionen Haltungskontrolle auszuüben, wozu<br />
eine Beherrschung der Muskelspannung erforderlich ist. Ergotherapeutische Übungen<br />
machen das Kind handlungsfähig, indem sie die Körperwahrnehmung und Bewegungsplanung<br />
fördern, Selbstvertrauen vermitteln und die Handfunktionen ansprechen.<br />
Auch das Bobath-Konzept lässt sich zuhause verwirklichen. Es erfordert jedoch mehr<br />
Zeit und Aufmerksamkeit, weil es nicht aus bestimmten, abzuarbeitenden Übungen besteht,<br />
sondern die Gesamtheit der Bewegungsabläufe des Kindes im Blick hat, die über<br />
den ganzen Tag hinweg angeleitet und unterstützt werden sollen. Ihr Kinderarzt wird<br />
Ihnen je nach Art der vorliegenden Bewegungs- oder Koordinationsstörung die eine oder<br />
andere Behandlungsform anempfehlen.<br />
b) Lernschwierigkeiten und Minderbegabung<br />
Manchmal treten Lernschwierigkeiten oder eine intellektuelle Minderbegabung auf<br />
(vor allem bei Kindern unter 1000 Gramm Geburtsgewicht), teilweise in Begleitung von<br />
Zerebralparesen. Spezielle Frühförderprogramme können solche Defizite auffangen. Die<br />
nach dem Konzept von Maria Montessori geführten Kindergärten und das von ihr entwickelte<br />
spezielle Montessori-Material sind beispielsweise darauf angelegt, schon im Vorschulalter<br />
durch unterschiedliche Sinneserfahrungen in Farbe und Form kombinatorische<br />
Denkleistungen zu vermitteln und damit Begabungen zu fördern, die den späteren Einstieg<br />
in die Schule erleichtern. Aber auch außerhalb dieser speziellen Kindergärten steht<br />
eine Anzahl sprach-, musik-, und ergotherapeutischer Angebote zur Verfügung, mit<br />
denen eine eventuelle Minderbegabung gezielt gefördert werden kann 1 . Sprachliche<br />
Entwicklungsstörungen können durch logopädische Förderangebote aufgefangen werden.<br />
Ein ganz wesentlicher Gesundungsfaktor, vor allem für die geistige Entwicklung,<br />
ist jedoch die Geborgenheit der häuslichen Umgebung und eine liebevolle Eltern-Kind-<br />
Beziehung. Anhaltendes seelisches Gleichgewicht und innere Zufriedenheit prägen noch<br />
stärker als die zeitlich beschränkten Eingriffe der medizinischen Behandlung und können<br />
selbst mittelschwere Entwicklungsstörungen auf Dauer vollständig kompensieren.<br />
Bereits nach dem zweiten Lebensjahr ist der Entwicklungs- und Intelligenzquotient<br />
1 Eine Auflistung aller Frühförderstellen in Deutschland enthält die Broschüre „Einrichtungen<br />
und Stellen der Frühförderung in der Bundesrepublik Deutschland“, die Sie kostenlos beim Bundesministerium<br />
für Gesundheit, Am Propsthof 78a, 53123 Bonn, Tel. 01888-4410, Fax: 01888-<br />
4414900; http://www.bmg.bund.de/ bestellen oder unter<br />
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_599776/SharedDocs/Publikationen/Einrichtungen_20und_20<br />
Stellen_20der_20Fr_C3_BChf_C3_B6rderung_20in_20der_20Bundesrepublik_20Deutschland_20_28<br />
Training_29,param=.html__nnn=true downloaden können.<br />
88b
89a<br />
eines durchschnittlichen Frühgeborenen stärker durch soziale Faktoren geprägt als<br />
durch die gehirnorganischen Gegebenheiten im Zeitpunkt der Geburt.<br />
wie z.B. Bronchitis, Infekte und Lungenentzündungen, auf die wir bereits hingewiesen<br />
hatten.<br />
89b<br />
c) Seh- und Hörstörungen<br />
Einige Kinder erleiden bestimmte Seh- oder Hörstörungen, von denen die meisten<br />
nicht im Sinne eines echten Heilerfolges behandelbar sind, sondern nur mit Hilfsmitteln<br />
(Brille, Hörgerät) ausgeglichen werden. Eine komplette Erblindung ist jedoch<br />
relativ selten und nur bei besonders <strong>klein</strong>en Frühchen zu befürchten. Ursache des Augenleidens<br />
ist eine spezielle Netzhauterkrankung (Retinopathie), die überhaupt nur bei<br />
Frühchen mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm – vor allem bei künstlich<br />
beatmeten Frühchen – vorkommt und in schweren Fällen zu einer Netzhautablösung<br />
führen kann. Als Ursache für das Krankheitsbild gilt die durch das Einsetzen der Lungenatmung<br />
verursachte Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks zu einem Zeitpunkt, in<br />
dem der Netzhautkreislauf des Frühgeborenen noch nicht ausgereift ist. Um den Sauerstoffpartialdruck<br />
nicht übermäßig ansteigen zu lassen, muss bei der künstlichen<br />
Beatmung eine Überdosierung des Beatmungssauerstoffs vermieden werden, was mit<br />
den modernen Beatmungsgeräten und Meßmethoden auch gut gelingt. Gleichwohl<br />
lässt sich das Risiko einer Netzhautbeeinträchtigung nicht völlig ausschließen, da<br />
selbst Frühgeborene, die nicht künstlich beatmet werden, davon betroffen sein können.<br />
In ihren Entwicklungsstadien kann die Netzhauterkrankung durch Laseranwendungen<br />
und andere Maßnahmen gut behandelt werden. Daher gehören regelmäßige Kontrollen<br />
durch den Augenarzt zum Standardprogramm einer Frühgeborenenstation.<br />
d) Chronische Lungenerkrankung<br />
Langwährende künstliche Beatmungen können zu einer chronischen Lungenerkrankung<br />
führen (bronchopulmonale Dysplasie, s. Seite 81). Die damit verbundene<br />
Versteifung der Lunge bildet sich nach der Beendigung der Beatmung allmählich wieder<br />
zurück, so dass das Kind wieder freier atmen kann. Oft erreicht die Lungenkapazität<br />
allerdings nicht mehr das normale Ausmaß, so dass die Leistungsfähigkeit der Lunge<br />
und damit die körperliche Belastbarkeit des Kindes eingeschränkt bleiben. Auch<br />
ermüdet das Kind eher, weil das Einatmen mehr Kraft erfordert. Hinzu kommt eine<br />
gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber allgemein verbreiteten Lungenerkrankungen<br />
e) Plötzlicher Kindstod<br />
Eine weitere mögliche Spätfolge der Frühgeburt ist der plötzliche Kindstod (Säuglingstod,<br />
Krippentod, SIDS). In Deutschland stirbt daran etwa einer von 2.000 Säuglingen,<br />
vor allem zwischen dem zweiten und dem sechsten Lebensmonat, gelegentlich noch<br />
bis zum zwölften Lebensmonat. Der plötzliche Kindstod ist auch deshalb so tückisch,<br />
weil er sich durch nichts ankündigt und uns immer unvorbereitet trifft. Kinder, die eben<br />
noch gesund und munter waren, wachen aus ihrem Schlaf nicht mehr auf. Die genauen<br />
Ursachen hierfür sind bis heute unbekannt.<br />
Bekannt sind allerdings bestimmte Risikofaktoren, bei deren Vorliegen der plötzliche<br />
Kindstod häufiger auftritt. Zu den Risikokindern gehören auch Mehrlinge und Frühgeborene,<br />
bei denen der plötzliche Kindstod nachweislich häufiger vorkommt als bei den<br />
zum Termin geborenen Einlingen. Das soll Sie allerdings nicht in unnötige Unruhe versetzen,<br />
denn der plötzliche Kindstod ist auch für Frühchen und Mehrlinge immer noch<br />
ein seltenes Ereignis. Allerdings sollten Sie besonders darauf achten, dass nicht noch<br />
weitere Risikofaktoren hinzutreten. Denn je mehr Risiken zusammentreffen, desto höher<br />
ist letztlich die konkrete Gefahr. Zu den weiteren Faktoren, die Sie beeinflussen können,<br />
gehören insbesondere:<br />
- Rauchen: Sorgen Sie dafür, dass niemals in Gegenwart Ihrer Kinder geraucht<br />
wird und dass sich Ihre Kinder nicht in Räumen aufhalten, in denen<br />
vorher geraucht wurde. Für die Mutter gilt während der Schwangerschaft<br />
und der Stillzeit ohnehin Rauchverbot, gleich in welchen Räumen. Das<br />
Rauchen der Mutter oder das Rauchen von anderen Personen in Gegenwart<br />
des Kindes erhöht das Risiko eines Kindstods um das achtfache.<br />
- Überhitzung: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht überhitzt wird. Raumtemperaturen<br />
von 16-18° Celsius sind als Schlaftemperatur auch für Babys<br />
völlig ausreichend und angemessen. Tagsüber zum Spielen genügen normale<br />
Raumtemperaturen. Nur Kinder mit bestimmten Lungenerkrankungen<br />
und solche, die unter der Haut noch nicht genug wärmespeicherndes Fettgewebe<br />
aufgebaut haben (in der Regel Kinder unter 2.500 Gramm), benötigen<br />
im Allgemeinen noch zusätzliche äußere Wärme. Fragen Sie Ihren
90a<br />
90b<br />
Kinderarzt, welche Raumtemperatur für Ihre Kinder ausreichend und angemessen<br />
ist. Vermeiden Sie auch zu dicke Kleidung sowie Hitzestaus im<br />
Kinderwagen oder im Auto. Legen Sie das Kind nicht neben eine Heizung<br />
oder in die pralle Sonne. Bei Fieber sollen Kinder – anders als Erwachsene<br />
– nicht zu dick eingepackt werden, damit die Körperhitze entweichen<br />
kann. Fragen Sie auch hierzu Ihren Kinderarzt.<br />
- Bauchlage: Vermeiden Sie es, Ihre Kinder in Bauchlage schlafen zu legen.<br />
Sie wird mit dem plötzlichen Kindstod in Zusammenhang gebracht,<br />
weil die meisten verstorbenen Kinder in Bauchlage aufgefunden wurden.<br />
Besser sind Rücken- oder Seitenlage. Die Rückenlage beugt dem Kindstod<br />
am besten vor, birgt aber ihrerseits die Gefahr, dass die Kinder einmal<br />
an ihrem Erbrochenem ersticken könnten. Fragen Sie den Kinderarzt,<br />
welche Lage er empfiehlt.<br />
- Koffeinkonsum während der Schwangerschaft: Neuseeländische Forscher<br />
wollen herausgefunden haben, dass der Koffeinkonsum während der<br />
Schwangerschaft (Kaffee, Tee, Cola) das Risiko des plötzlichen Kindstods<br />
erhöht. Das Koffein behindere die vollständige Ausbildung des A-<br />
temzentrums.<br />
- Ablecken von Schnullern: Forscher aus Manchester haben bei 88% der<br />
verstorbenen Kinder ein bestimmtes Magenbakterium vorgefunden. Ein<br />
Zusammenhang mit dem Kindstod wird nicht ausgeschlossen. Man vermutet,<br />
dass die Bakterien durch den Speichel der Eltern übertragen werden,<br />
wenn diese den Schnuller ablecken, um ihn auf diese Weise zu „säubern“.<br />
Waschen Sie daher die Schnuller immer nur mit Wasser ab und<br />
stecken Sie sie nicht in den eigenen Mund. Das beugt außerdem auch einer<br />
Übertragung von Karies vor. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen<br />
beachten, ist der Gebrauch eines Schnullers grundsätzlich jedoch geeignet,<br />
die Gefahr eines plötzlichen Kindstodes zu vermindern.<br />
Folgende Positivfaktoren können die Gefahr des plötzlichen Kindstods außerdem<br />
mindern:<br />
- harte Matratze, kein Kopfkissen, kein dickes Bettzeug, kein großes Kuscheltier:<br />
Legen Sie Ihre Kinder auf eine harte, neu gekaufte Matratze.<br />
Die Matratze sollte vorher von keinem anderen Kind oder Erwachsenen<br />
benutzt worden sein. Ein Kopfkissen, dickes Bettzeug und alles, was<br />
entweder einen Wärmestau verursachen oder das Kind nach einer Lageveränderung<br />
beim Atmen behindern kann, ist gefährlich. Verwenden Sie<br />
lediglich möglichst einen Baby-Schlafsack und keine zusätzliche Decke; allenfalls<br />
anstelle des Schlafsacks eine dünne Decke, die nicht über den Kopf<br />
des Kindes rutschen kann. Wenn sich das Kind zwischen den Schulterblättern<br />
warm, aber nicht verschwitzt anfühlt, hat es die richtige Temperatur.<br />
- Stillen: Gestillte Kinder sind seltener von plötzlichem Kindstod betroffen<br />
als Flaschenkinder.<br />
- Übernachten im Schlafzimmer der Eltern: Statistisch gesehen tragen diejenigen<br />
Kinder das geringste Kindstod-Risiko, die im Schlafzimmer der Eltern<br />
übernachten, und zwar in ihrem eigenen Bettchen (nicht im Bett der<br />
Eltern und erst recht nicht auf dem gemeinsamen Sofa mit ihnen!).<br />
Kinder, bei denen auf der Frühgeborenenstation bereits Atemausfälle (Apnoen)<br />
festgestellt wurden, werden, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht, mit einem Heimmonitor<br />
nach Hause entlassen. Die Handhabung des Gerätes und was im Alarmausfall zu<br />
tun ist, wird Ihnen auf der Station erklärt.<br />
3. Finanzielle Hilfen für Frühgeborene mit Entwicklungsverzögerung und für behinderte<br />
Kinder<br />
Wenn eines Ihrer Kinder behindert oder mit einer starken Entwicklungsverzögerung<br />
zur Welt gekommen ist, bedeutet das nicht nur einen erheblichen Mehraufwand an<br />
Betreuung, sondern ebenso eine stärkere finanzielle Belastung der Eltern. Mit einigen<br />
staatlichen Leistungen versucht man, diese Mehrbelastung aufzufangen. Darüber sollte<br />
man zumindest Folgende wissen:<br />
Bei Vorliegen einer dauernden Krankheit oder Behinderung kommen Leistungen<br />
der Pflegeversicherung in Betracht. Sie werden entweder als Geldleistung (Pflegegeld)<br />
oder als Sachleistung in Form einer Pflegekraft erbracht. Sozialbedürftigen Personen<br />
gewährt das Sozialamt entsprechende Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Die<br />
Krankenkassen erbringen medizinische und therapeutische Leistungen zur Gesundung<br />
des Kindes, u.a. auch häusliche Kinderkrankenpflege.<br />
Das Finanzamt erkennt ab einem Grad der Behinderung von 25% die dadurch veranlassten<br />
Aufwendungen der Eltern als außergewöhnliche Belastung an. Wer seine
91a<br />
91b<br />
Mehraufwendungen nicht einzeln belegt, kann abgestufte Pauschbeträge in Anspruch<br />
nehmen. Ab einem Grad der Behinderung von 50% stellt das Versorgungsamt einen<br />
Schwerbehindertenausweis aus, der viele weitere Vergünstigungen gewährt – nicht nur<br />
im öffentlichen Personenverkehr, sondern auch in Freizeiteinrichtungen oder bei Veranstaltungen.<br />
Außerdem kann z.B. ein privater Behindertenparkplatz ausgewiesen<br />
werden.<br />
Viele Einzelheiten hierzu sind ausführlich dargestellt in der Broschüre „Finanzielle<br />
Hilfen für Frühgeborene und ihre Angehörigen“, die der Bundesverband „Das<br />
Frühgeborene Kind e.V.“ herausgibt (Bestelladresse im Anschriftenteil des Anhangs).<br />
Weitere Hinweise über steuerrechtliche Entlastungen finden Sie in der jährlich aktualisierten<br />
Broschüre „Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern“, die Sie<br />
unter http://www.bvkm.de/0-10/buecher,recht.html downloaden oder unmittelbar beim<br />
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Brehmstraße 5-7, 40239<br />
Düsseldorf, anfordern können (Stichwort: „Steuermerkblatt“; selbstadressierten und<br />
mit 0,55 EUR frankierten Rückumschlag im Format DIN A lang beilegen). Weitere<br />
Informationen des Verbandes finden Sie auch unter http://www.bvkm.de.
92a<br />
Ausblick<br />
Sind <strong>Zwillinge</strong> nun eine doppelte Freude oder eine doppelte Last<br />
Ohne Zweifel ersteres. Alle Vorfreude, die Sie mit Ihrem Kinderwunsch verbunden<br />
hatten, erfüllt sich doppelt: Vaters und Mutters Arme als vertrauter Schmuseplatz,<br />
einnehmendes Lächeln beim Stillen und Füttern, erste Streckversuche auf dem Wickeltisch,<br />
später entdeckungshungriges Krabbeln und stolze erste Schritte. Jedes liebevolle<br />
Wort, jedes Vorsingen und jede spielerische Anregung fruchten doppelt.<br />
Eine „doppelte Last“ sind <strong>Zwillinge</strong> dagegen erwiesenermaßen nicht. Untersuchungen<br />
haben ergeben, dass der Zeitaufwand im ersten Lebensjahr etwa um ein Drittel<br />
bis um die Hälfte gesteigert ist gegenüber Einlingseltern. Vieles erledigt sich in<br />
einem Aufwasch für beide Kinder gleichzeitig, z.B. der Einkauf von Windeln, die<br />
Zubereitung von Mahlzeiten, die Wartezeiten beim Kinderarzt, der Besuch der PEKiP-<br />
Gruppe, die spielerischen Anregungen usw. In Wahrheit haben Sie damit insgesamt<br />
erheblich weniger Aufwand als die vielen anderen Eltern, die zwei Einlinge nacheinander<br />
bekommen. Dort fällt der Aufwand nämlich tatsächlich doppelt an, wenngleich<br />
zeitversetzt. Auch eine Rückkehr in den Beruf ist nach der Geburt von <strong>Zwillinge</strong>n<br />
früher möglich als bei Inanspruchnahme von zwei Elternzeiten für einzeln geborene<br />
Kinder.<br />
Vieles ist also eine Frage der subjektiven Wahrnehmung und der inneren Einstellung.<br />
Stellen Sie die positiven Aspekte in den Vordergrund. Wer sich auf <strong>Zwillinge</strong><br />
freuen kann, wird sich auch über <strong>Zwillinge</strong> freuen können, wenn sie da sind. Wer<br />
dagegen nur Sorge um die viele Arbeit in sich trägt, wird die Zeit nach der Geburt<br />
auch unter diesem Vorzeichen wahrnehmen. Daher ist es von großem Vorteil, frühzeitig<br />
frohe und zufriedene Zwillingseltern kennen zu lernen, die voller Freude von einer<br />
innigen Beziehung zu ihren Kindern und mit schmunzelndem Lachen über all deren<br />
Schabernack berichten können. Halten Sie sich dagegen von solchen Bekannten besser<br />
fern, die nur als Miesepeter daherkommen und Ihnen die Vorfreude schon während der<br />
Schwangerschaft verderben.<br />
dass man neben der Kinderbetreuung zu nichts anderem mehr komme. Alle diese Autoren<br />
haben es immerhin bereits im Kleinkindalter ihrer <strong>Zwillinge</strong> fertig gebracht, Umfrageaktionen<br />
unter Zwillingseltern zu starten, ganze Bücher darüber zu schreiben und<br />
schließlich – teilweise sogar im Selbstverlag – zu veröffentlichen. So anstrengend und<br />
zermürbend, wie in den Büchern teilweise beschrieben, können deren <strong>Zwillinge</strong> dann ja<br />
wohl nicht gewesen sein – wie auch unsere eigenen <strong>Zwillinge</strong> nicht, die bei der ersten<br />
Fertigstellung dieses Buches nicht einmal zweieinhalb Jahre alt waren.<br />
Mit unserem Buch haben wir versucht, Ihnen den Start in das Leben mit <strong>Zwillinge</strong>n<br />
durch möglichst präzise Sachinformationen zu erleichtern. Wenn wir dabei auch die<br />
möglichen Komplikationen angesprochen haben, wollten wir Ihnen damit in erster Linie<br />
Handlungsstrategien zur Vermeidung einer Frühgeburt nahe bringen und selbst für den<br />
Fall einer Frühgeburt noch eine hoffnungsvolle Entwicklungsperspektive vermitteln. Die<br />
Augen vor den Gefahren zu verschließen, halten wir nicht für den richtigen Weg. Wissen,<br />
auch unangenehmes Wissen, bedeutet Macht, das Geschehen im positiven Sinne zu<br />
beeinflussen.<br />
Was die medizinischen Aspekte betrifft, ist es bei den allermeisten <strong>Zwillinge</strong>n so,<br />
dass die ein oder andere Komplikation im Laufe der Schwangerschaft tatsächlich eintritt,<br />
letztlich aber keine ernste Bedrohung für Sie und Ihre Kinder darstellt. Das gilt vor<br />
allem dann, wenn Sie die Vorsorgetermine regelmäßig wahrnehmen, sich ausreichend<br />
schonen und auf die Stimme Ihres Körpers achten. Genießen Sie deshalb die Zeit der<br />
Schwangerschaft und freuen Sie sich auf den erfrischenden Beginn eines neuen Lebensabschnitts<br />
mit zwei (oder noch mehr) <strong>klein</strong>en Menschlein, die Sie zur Welt gebracht<br />
haben. Seien Sie sicher, dass die beiden Ihr Leben tiefgreifend verändern werden. Und<br />
solange Sie ihnen offenherzig gegenübertreten, werden Sie sehr viel Freude daran haben.<br />
92b<br />
Das gilt ebenso für die Zwillingsliteratur. Manchmal kann man schon am Buchtitel<br />
erkennen, ob die Autoren ihre Elternschaft vorwiegend positiv erleben oder eher als<br />
Belastung empfinden. Lassen Sie sich von keinem Buchautor den Bären aufbinden,
93a<br />
93b<br />
Anhang I: Medizinisches Wörterbuch und Glossar<br />
Biometrie<br />
Vermessung der Körperlängen und des Kopfumfangs<br />
beim Ungeborenen<br />
Abort<br />
Fehlgeburt<br />
Bonding<br />
erster Eltern-Kind-Kontakt, der als besonders<br />
wichtig für den Aufbau einer Eltern-Kind-<br />
Beziehung gilt<br />
Abruptio<br />
Ablösung der Plazenta von der Gebärmutterinnenwand<br />
BPD<br />
Bronchopulmonale Dysplasie<br />
Alveolen<br />
Amnion<br />
Lungenbläschen<br />
innere kindliche Eihaut.<br />
Bradykardie<br />
Verlangsamung des Pulsschlags beim Frühgeborenen,<br />
oft im Zusammenhang mit einem Atemstillstand<br />
(Apnoe)<br />
Amniotomie<br />
künstliches Sprengen der Fruchtblase<br />
Amniozentese Fruchtwasseruntersuchung (mit Entnahme von<br />
Fruchtwasser)<br />
Anämie<br />
Anastomose<br />
Apnoe<br />
Asphyxie<br />
Blutarmut<br />
Verbindung zwischen Blutgefäßen<br />
Atemstillstand/-ausfall beim Frühgeborenen<br />
wörtlich „Pulslosigkeit“, = Zustand nach der Geburt,<br />
wenn das Kind durch Übersäuerung oder A-<br />
temnot nicht lebensfrisch erscheint<br />
Bronchopulmonale Dysplasie<br />
Cardiotocograph<br />
Cerclage<br />
Cervix...<br />
Chorion<br />
Chorionzottenbiopsie / Chorionbiopsie<br />
krankhafte Versteifung der Lungen und Bronchien<br />
bei Frühgeborenen, die längere Zeit beatmet wurden<br />
Herzton-Wehenschreiber (CTG)<br />
Zerklage<br />
Zervix...<br />
äußere kindliche Eihaut („Zottenhaut“)<br />
Entnahme einer Gewebeprobe aus der äußeren<br />
kindlichen Eihaut<br />
Astrup<br />
Blutgasanalyse aus entnommenem Blut<br />
Chordozentese<br />
Blutentnahme aus der Nabelschnur<br />
Atelektase<br />
Atemnot, die entsteht, wenn die Lungenbläschen<br />
sich nach der Geburt nicht entfalten<br />
CLD<br />
Chronic Lung Disease (chronische Lungenerkrankung)<br />
Bronchopulmonale Dysplasie<br />
Atrophie<br />
Ernährungsmangel (nachgeburtlich)<br />
CPAP<br />
ständiger Gegenluftstrom in die Atemwege (engl.<br />
continuous positive airway pressure)<br />
auditive Stimulation<br />
Beschallen eines Frühchens mit einer Sprachkassette<br />
CTG<br />
Herzton-Wehenschreiber (engl. cardiotocograph)
94a<br />
94b<br />
Cryptophasie<br />
eine von mehreren wissenschaftlichen Bezeichnungen<br />
für die von der Muttersprache abweichende<br />
Eigensprache der <strong>Zwillinge</strong><br />
Depressionszustand beim Neugeborenen: anderer Begriff für<br />
Asphyxie<br />
dystroph<br />
Eklampsie<br />
Embryo<br />
unterernährt (bezogen auf Alter, Größe und<br />
Schwangerschaftsdauer)<br />
Krampfanfall bei Gestose<br />
Bezeichnung des Ungeborenen bis zur 12. SSW<br />
diplazentär<br />
mit zwei getrennten Mutterkuchen<br />
Emesis<br />
Erbrechen in der Frühschwangerschaft<br />
diamnial<br />
dichorial<br />
mit je einer eigenen inneren Eihaut (Amnion) für<br />
jeden Embryo<br />
mit je einer eigenen äußeren Eihaut (Chorion) für<br />
jeden Embryo<br />
enterale Ernährung<br />
EPH-Gestose<br />
Ernährung durch den Magen- und Darmtrakt (selbständige<br />
Nahrungsaufnahme durch Schlucken oder<br />
Ernährung durch Magensonde)<br />
Gestose<br />
dizygot<br />
zweieiig<br />
Episiotomie<br />
Dammschnitt<br />
Doppler(-Ultraschall)<br />
Ductus arteriosus<br />
Der Doppler-Ultraschall ist ein besonderes Ultraschall-Verfahren,<br />
mit dem vor allem die Blutflüsse<br />
in der Nabelschnur, in den Hauptadern der Kinder<br />
sowie im Mutterkuchen farblich dargestellt werden<br />
können. Dadurch lässt sich die Versorgungslage<br />
der Kinder am Ende der Schwangerschaft beurteilen.<br />
Verbindung zwischen Lungen- und Körperschlagader,<br />
die den Lungenkreislauf des Ungeborenen<br />
überbrückt, welcher während der Schwangerschaft<br />
nicht benötigt wird. Mit dem ersten Atemzug des<br />
Neugeborenen schließt sich der Ductus, um den<br />
Lungenkreislauf in Gang zu setzen. Als „Offener<br />
Ductus“ (persistierender ductus) bezeichnet man<br />
eine Komplikation, bei der der Verschlussmechanismus<br />
nicht oder nicht vollständig funktioniert hat<br />
und die Blutverbindung nach wie vor besteht.<br />
eutroph<br />
Erythrozyten<br />
fetofetales Transfusionssyndrom<br />
Fetozid<br />
Fetus, Fötus<br />
FISH-Test<br />
Forcepsentbindung<br />
= innerhalb der normalen Gewichtserwartung (bezogen<br />
auf Alter, Größe und Schwangerschaftsdauer)<br />
rote Blutkörperchen<br />
Zwillingstransfusionssyndrom<br />
Abtreibung einzelner Mehrlinge<br />
Bezeichnung des Ungeborenen nach der 12. SSW<br />
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisation (Schnelltest zur<br />
Untersuchung des Fruchtwassers auf vorliegendes<br />
Down-Syndrom und auf andere Erbkrankheiten)<br />
Entbindung mit der Geburtszange<br />
Ductus botalli<br />
= Ductus arteriosus<br />
Gemini<br />
<strong>Zwillinge</strong>
95a<br />
95b<br />
Geminigravidität<br />
Zwillingsschwangerschaft<br />
eingespritzt und die befruchtete Eizelle anschließend<br />
in die Gebärmutter eingesetzt)<br />
Gestatio<br />
Schwangerschaft<br />
icterus neonatorum<br />
Neugeborenengelbsucht<br />
Gestationsalter<br />
Gestationshypertension<br />
(bisherige) Dauer der Schwangerschaft<br />
Gestose<br />
Idioglossie, Idiophrasie<br />
wissenschaftliche Bezeichnungen für die von der<br />
Muttersprache abweichende Eigensprache der<br />
<strong>Zwillinge</strong><br />
Gestose (EPH-Gestose)<br />
Glukose<br />
Schwangerschaftserkrankung mit Bluthochdruck,<br />
Eiweiß im Urin und Wassereinlagerungen<br />
Traubenzucker/Blutzucker<br />
Infektionen<br />
Infektionen bei Frühchen werden fast immer sofort<br />
mit Antibiotika behandelt. Sie sind gefürchtet, weil<br />
sie z.T. nur schwer erkennbar sind und die Kinder<br />
noch nicht über genügend Abwehrstoffe verfügen.<br />
Gravidität<br />
Hydrozephalus<br />
Hyperemesis<br />
Hyperthermie<br />
Hypertonie<br />
Hypoglykämie<br />
Hypothermie<br />
Hypotrophie<br />
Schwangerschaft<br />
Wasseransammlung in den Hirnkammern („Wasserkopf“)<br />
gesteigertes, dauerndes Erbrechen während der<br />
Frühschwangerschaft (häufiger als zehn Mal am<br />
Tag), welches zu einer Mangelernährung oder E-<br />
lektrolytstörung führen kann.<br />
erhöhte Körpertemperatur<br />
Bluthochdruck<br />
Mangel an Blutzucker<br />
erniedrigte Körpertemperatur<br />
vorgeburtliche Unterernährung/Mangelentwicklung<br />
Intubation künstliche Beatmung mit einem Beatmungsschlauch<br />
(Tubus)<br />
intra partum, intrapartual<br />
intrauterinär<br />
während der Geburt<br />
innerhalb der Gebärmutter<br />
IVF In-vitro-Fertilisation (künstliche Befruchtungstechnik:<br />
außerhalb der Gebärmutter werden Eizelle<br />
und Samen zueinander gebracht und die befruchtete<br />
Eizelle anschließend in die Gebärmutter eingesetzt)<br />
Kardiotokograph<br />
Lanugo<br />
Herzton-Wehenschreiber (CTG)<br />
lange Behaarung des Ungeborenen am ganzen<br />
Körper, die sich im weiteren Verlauf der Schwangerschaft<br />
verliert. Frühchen werden z.T. noch mit<br />
Lanugobehaarung geboren.<br />
Hypoxie<br />
ICSI<br />
Sauerstoffmangel<br />
Intracytoplasmatische Spermieninjektion (künstliche<br />
Befruchtungstechnik: einer entnommenen Eizelle<br />
wird außerhalb der Gebärmutter ein Samen<br />
Mangelgeborenes<br />
Mehrlinge<br />
Kind, das bezogen auf seine Schwangerschaftsdauer<br />
zu leicht (unterernährt) geboren wurde.<br />
in diesem Buch als Oberbegriff für <strong>Zwillinge</strong> und<br />
höhergradige Mehrlinge (Drillinge, Vierlinge usw.)
96a<br />
96b<br />
Mekonium<br />
Meningitis<br />
Meningomyelozele<br />
Menstruation<br />
verwendet<br />
erster Stuhlgang des Kindes („Kindspech“)<br />
Hirnhautentzündung<br />
häufigste Form des Spaltwirbels („offener Rücken“)<br />
Monatsblutung, Regelblutung<br />
Blutkörperchen entsteht und den die noch unreife<br />
Leber nicht sofort abbauen kann. Sie tritt bei<br />
leichtgewichtigen Neugeborenen häufiger auf und<br />
macht die Kinder vorübergehend träge. Die Behandlung<br />
erfolgt durch Fototherapie (Bestrahlung<br />
mit Blaulicht). Nur in Ausnahmefällen steigt der<br />
Bilirubinwert so stark an, dass eine medikamentöse<br />
Behandlung oder sogar ein Blutaustausch notwendig<br />
wird.<br />
monoamnial<br />
monochorial<br />
monozygot<br />
Morbus<br />
Mortalität<br />
natürliche Geburt<br />
mit nur einer inneren Eihaut (Amnion), die beide<br />
<strong>Zwillinge</strong> umschließt (nur bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n<br />
möglich)<br />
mit nur einer äußeren kindlichen Eihaut (Chorion),<br />
die beide <strong>Zwillinge</strong> umschließt (nur bei eineiigen<br />
<strong>Zwillinge</strong>n möglich)<br />
eineiig<br />
Krankheit<br />
Sterblichkeit<br />
Synonym für vaginale Geburt (durch die Scheide)<br />
– im Gegensatz zum Kaiserschnitt<br />
Nidation<br />
Ödem<br />
offener Ductus<br />
Oligurie<br />
OP<br />
Pädiater<br />
Pädiatrie<br />
parenterale Ernährung<br />
Einnistung in die Gebärmutter<br />
Geschwulst durch Wassereinlagerung<br />
Ductus arteriosus<br />
Verminderte Harnausscheidung<br />
Operationssaal<br />
Kinderarzt<br />
Kinderheilkunde<br />
Ernährung „an dem Magen- und Darmtrakt vorbei“.<br />
Damit gemeint ist die Ernährung durch eine<br />
intravenös verabreichte Infusion.<br />
NEC<br />
nekrotisierende Enterokolitis<br />
Neonatologie<br />
Neugeborenengelbsucht<br />
nekrotisierende Enterokolitis<br />
Darmerkrankung, bei der die Darmzellen absterben<br />
und die Darmschleimhaut durchlässig wird (schwere<br />
Komplikation bei <strong>klein</strong>en Frühchen)<br />
1. Medizin für Neugeborene,<br />
2. Neugeborenen(intensiv)station<br />
Ein an sich harmloser Anstieg der Bilirubinkonzentration<br />
im Blut, der durch den Zerfall roter<br />
PDA 1. Bei der Geburt: Periduralanästhesie (regionale<br />
Schmerzlinderung in der Beckenregion während<br />
der Geburt).<br />
PEKiP <br />
2. Beim Frühchen: Persistierender Ductus Arteriosus<br />
( Ductus arteriosus)<br />
Prager Eltern-Kind-Programm nach Jaroslav Koch:<br />
Spiel und Entwicklungsbegleitung im ersten Lebensjahr.
97a<br />
97b<br />
perinatal<br />
in der Geburtsphase (Zeitraum zwischen dem Ende<br />
der 28. SSW und dem siebten Tag nach der Geburt)<br />
post partum, postpartal,<br />
postpartual, postnatal<br />
nach der Geburt<br />
Perinatalzentrum<br />
örtlich zusammengefasste Geburts- und Neugeborenenklinik,<br />
bei der die Neugeborenen sofort nach<br />
der Geburt ohne nennenswerte Transportwege intensivmedizinisch<br />
behandelt werden können.<br />
PVL<br />
RDS<br />
periventrikuläre Leukomalazie<br />
Atemnotsyndrom beim Neugeborenen (engl. respiratory<br />
dystress syndrome)<br />
periphere Entbindung<br />
periventrikuläre Leukomalazie<br />
persistierender Ductus arteriosus<br />
Entbindung außerhalb eines Perinatalzentrums<br />
Hirnerkrankung, die häufig zu einer dauerhaften<br />
Bewegungseinschränkung und zu einer Störung der<br />
Sinnesorgane führt (schwere Komplikation bei<br />
<strong>klein</strong>en Frühchen)<br />
Ductus arteriosus<br />
RDS-Prophylaxe<br />
Reifezeichen<br />
Respirator<br />
Lungenreifebehandlung beim Ungeborenen durch<br />
Verabreichung eines Kortisonpräparats an die Mutter<br />
bestimmte Merkmale, an denen sich der Reifegrad<br />
(Entwicklungsstand) eines Kindes bestimmen lässt<br />
Beatmungsgerät<br />
Plazenta<br />
Mutterkuchen<br />
Retinopathie<br />
Netzhauterkrankung<br />
Plazentainsuffizienz<br />
unzureichende Mutterkuchenfunktion<br />
ROP<br />
Retinopathie (engl. retinopathy of prematurity)<br />
Pneumothorax<br />
Platzen der Lungenbläschen und Ausströmen der<br />
Beatmungsluft in den Brustraum (schwere Komplikation<br />
bei künstlich beatmeten Frühgeborenen)<br />
Polarkörper = Polkörperchen, siehe Seite 7<br />
Portio<br />
unterer Teil des Gebärmutterhalses, der in den Geburtskanal<br />
hineinragt<br />
RSV, RS-Virus Respiratory Syncytial Virus (siehe Seite 81)<br />
schwangerschaftsassozierte<br />
Hypertension<br />
Sectio (caesarea)<br />
Sonographie<br />
Gestose<br />
Kaiserschnitt<br />
Ultraschall-Untersuchung<br />
Präeklampsie<br />
Gestose, (noch) ohne Krampfanfall<br />
spina bifida<br />
Spaltwirbel (sog. „offener Rücken“)<br />
pränatal<br />
präpartal, präpartual<br />
Proteinurie<br />
vorgeburtlich<br />
(kurz) vor der Entbindung<br />
Eiweiß im Urin<br />
SSW<br />
Strabismus<br />
Schwangerschaftswoche (zu Fragen der Berechnung<br />
siehe Anhang II, Seite 99)<br />
Schielen
98a<br />
98b<br />
striae gravidarum<br />
Surfactant<br />
Tachykardie<br />
Schwangerschaftsstreifen<br />
oberflächenaktive Substanz, die das Zusammenfallen<br />
der Lungenbläschen verhindert (engl. surface<br />
active agent)<br />
Erhöhung der Pulsfrequenz<br />
Verstreichen der Zervix Laufende Verkürzung des Gebärmutterhalses.<br />
Wenn dieser vollständig verschwunden (verstrichen)<br />
ist, beginnt die allmähliche Öffnung des<br />
Muttermundes in der Eröffnungsphase der Geburt.<br />
Wachstumsdiskordanz<br />
unterschiedliches Wachstum (Gewicht) der Ungeborenen<br />
Tokolyse<br />
Tokolytika<br />
wehenhemmende Maßnahmen<br />
wehenhemmende Arzneimittel<br />
Trisomie 21 spezielle Chromosomenschädigung, die zum<br />
Down-Syndrom („Mongolismus“) führt<br />
Wachstumsretardierung<br />
Zerklage<br />
vermindertes Wachstum der Ungeborenen (meist<br />
durch Mangelversorgung verursacht)<br />
Gebärmutterhalsumschlingung (künstlicher Verschluss<br />
des Gebärmutterhals durch eine Naht oder<br />
einen Ringpessar)<br />
Tubus<br />
Umbaulunge<br />
Beatmungsschlauch, der durch die Nase in die<br />
Luftröhre gelegt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen<br />
wird<br />
bronchopulmonale Dysplasie<br />
Zervix<br />
Gebärmutterhals zwischen innerem und äußerem<br />
Muttermund<br />
Zervixinsuffizienz Verschlussschwäche der Gebärmutter, Muttermundsschwäche<br />
Uterus<br />
Gebärmutter<br />
Zygote<br />
befruchtete Eizelle<br />
v.e.<br />
Vakuumextraktion<br />
Vagina<br />
Scheide<br />
vaginal<br />
durch die Scheide<br />
Vakuumextraktion<br />
Entbindung mit der Saugglocke<br />
Varizen<br />
Krampfadern<br />
Vernix<br />
„Käseschmiere“, eine helle Schicht auf der Haut<br />
des Neugeborenen, die möglichst nicht abgewaschen<br />
wird, sondern in die Körperhaut einziehen<br />
soll.
99a<br />
99b<br />
Anhang II: Berechnung der Schwangerschaftswochen<br />
Nach dem Volksmund beträgt die Dauer einer Schwangerschaft neun Monate: Eine Frau, die kurz vor der Entbindung steht, ist „im neunten Monat“ schwanger. In der Medizin<br />
nimmt man jedoch eine präzisere Einteilung vor: Man rechnet nicht in Monaten, sondern in Schwangerschaftswochen (SSW). Sie werden auch nicht ab dem Zeitpunkt der Befruchtung<br />
gerechnet, sondern ab dem ersten Tag der letzten Menstruation vor der Schwangerschaft. Dieser Tag lässt sich nämlich leichter und exakter bestimmen als der Tag der Befruchtung.<br />
Da der Monatszyklus einer Frau durchschnittlich 28 Tage beträgt und die Befruchtung etwa in der Mitte des Monatszyklus stattfindet, befindet sich die Schwangere zum Zeitpunkt des<br />
wahren biologischen Beginns der Schwangerschaft bereits rechnerisch in der zweiten oder dritten Schwangerschaftswoche. So gerechnet dauert eine (Einlings-)Schwangerschaft<br />
durchschnittlich 40 Wochen. Das entspricht exakt 10 Mondmonaten (Lunarmonaten), die manchmal auch als Bemessungsgröße genannt werden.<br />
SSW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Mondmonat 1 2 3 4 5<br />
Volksmund nichts 1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5.<br />
Befruchtung<br />
SSW 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40<br />
Mondmonat 6 7 8 9 10<br />
Volksmund Monat 6. Monat 7. Monat 8. Monat 9. Monat<br />
Manchmal wird eine noch genauere Einteilung nach Tagen vorgenommen, insbesondere während eines stationären Klinikaufenthalts oder kurz vor der Geburt. Man spricht dann<br />
z.B. von „34 plus 5“, was bedeutet: Es sind 34 vollendete(!) Schwangerschaftswochen plus 5 weitere Tage zurückgelegt. Zwei Tage später sind dann 35 Wochen vollendet („35 plus<br />
0“), man befindet sich also am Beginn der 36. SSW.
100a<br />
Anhang III: Schema zur Bestimmung der Ein- oder Zweieiigkeit<br />
Haben beide <strong>Zwillinge</strong><br />
dasselbe Geschlecht<br />
nein<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />
ja<br />
Haben beide <strong>Zwillinge</strong><br />
dieselbe Blutgruppe<br />
nein<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />
ja / unbekannt<br />
Verfügte jedes Kind während<br />
der Schwangerschaft<br />
über eine eigene äußere<br />
Eihaut (Chorion)<br />
nein<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
ja<br />
unbekannt<br />
Wahrscheinlichkeit je nach Blutgruppe*:<br />
Blutgr. 0: zu 43 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. A: zu 40 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. B: zu 69 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. AB: zu 80 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
unbekannt: zu 22 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Wahrscheinlichkeit je nach Blutgruppe*:<br />
Blutgr. 0: zu 69 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. A: zu 67 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. B: zu 86 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
Blutgr. AB: zu 92 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
unbekannt: zu 46 % eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
* Bei der einfachen Blutgruppenbestimmung hängen die Wahrscheinlichkeiten weiter von der Blutgruppenkonstellation<br />
der Eltern ab, die hier unberücksichtigt bleiben muss.
101a<br />
101b<br />
ABC-Club e.V.<br />
Anhang IV: Adressen<br />
Bethlehemstr. 8, D-30451 Hannover<br />
Tel. 0511/2151945, Fax: 0511/2101431<br />
http://www.abc-club.de<br />
E-Mail: abc-club@t-online.de<br />
Der Verein versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe für höhergradige Mehrlingseltern<br />
(ab Drillingen). Er bietet Beratung, Erfahrungsaustausch in regionalen<br />
Stammtischrunden, Familientreffen und -freizeiten, aber auch z.B. Vermittlung<br />
gebrauchter Mehrlingskinderwagen. Clubmitglieder erhalten vierteljährlich<br />
ein Mitteilungsblatt mit Berichten und Kleinanzeigen.<br />
Entsprechend für die Schweiz:<br />
Schweizerischer Mehrlingsverein<br />
http://www.mehrlingsverein.ch<br />
E-Mail: kontakt@mehrlingsverein.ch<br />
Informationen über Hilfeleistungen in der Schweiz:<br />
c/o Erna Schär, Lilienweg 5, CH-9472 Grabs<br />
Tel. 081/7711271 oder 081/7711573<br />
http://www.unserbaby.ch/mehrlinge<br />
E-Mail: erna@zwillinge.ch<br />
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V.<br />
Speyerer Straße 5-7, D-60327 Frankfurt/M.<br />
Tel.: 069/58700990, Fax: 069/58700999<br />
http://www.fruehgeborene.de<br />
E-Mail: info@fruehgeborene.de<br />
Der Verband versteht sich als Dachorganisation von Elterninitiativen und Fördervereinen<br />
für Frühgeborene und kranke Neugeborene. Neben Adressen örtlicher<br />
Elterngruppen, einem Newsletter-Dienst und einem quartalsweise erscheinenden<br />
Mitteilungsblatt sind folgende Broschüren (zu je 2,50 EUR) erhältlich:<br />
- Frühgeborene in den ersten Lebenswochen<br />
- Frühgeborene nach der Entlassung<br />
- Entwicklungsprognose frühgeborener Kinder<br />
- Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik<br />
Berufsverband Deutscher Laktationsberaterinnen IBCLC e.V.<br />
Hildesheimer Straße 124 E, D-30880 Laatzen,<br />
Tel. 0511/87649860, Fax: 0511/87649868<br />
http://www.bdl-stillen.de<br />
E-Mail: sekretariat@bdl-stillen.de<br />
Berufsvereinigung der examinierten Laktationsberater/-innen mit IBCLC-<br />
Examen. Hier kann man die Anschrift der nächst erreichbaren Laktationsberaterin<br />
erfragen. Eine Liste aller examinierten Laktationsberaterinnen (IBCLC) mit<br />
jeweiligen Anschriften ist außerdem veröffentlicht unter<br />
http://www.stillen.de/we_stillen/daten/lb_karte.htm.<br />
Für Österreich:<br />
VSLÖ Verband der Still- und Laktationsberaterinnen Österreichs IBCLC<br />
Lindenstrasse 20, A-2362 Biedermannsdorf<br />
Tel./Fax: 02236/72336<br />
http://www.stillen.at<br />
E-Mail: info@stillen.at<br />
Für die Schweiz:<br />
Berufsverband Schweizerischer Stillberaterinnen IBCLC<br />
Postfach 686, CH-3000 Bern 25<br />
Tel. 041/6710173, Fax: 041/6710171<br />
http://www.stillen.ch<br />
E-Mail: office@stillen.ch
102a<br />
Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen e.V. - Bundesverband<br />
Bornheimer Straße 100, D-53119 Bonn<br />
Tel. 0228/3503871, Fax: 0228/3503872<br />
http://www.afs-stillen.de<br />
E-Mail: geschaeftsstelle@afs-stillen.de<br />
Die AFS wurde als loser Zusammenschluss einzelner Stillgruppen gegründet<br />
und bietet neben Broschüren und einem monatlichen Rundbrief vor allem<br />
Kontakt zu örtlichen Stillgruppen.<br />
La Leche Liga Deutschland e.V.<br />
Gesellenweg 13, D-32427 Minden,<br />
Tel. 0571/48946, Fax: 0571/4049480<br />
http://www.lalecheliga.de<br />
E-Mail: beratung@lalecheliga.de<br />
Die La Leche Liga Deutschland e.V. ist Teil einer weltweit tätigen Organisation,<br />
die sich für das Stillen einsetzt. Die deutsche Sektion vertreibt eine Reihe<br />
von Büchern und Broschüren zum Thema Stillen und berät telefonisch oder<br />
per e-Mail durch örtliche, ehrenamtliche Stillberaterinnen. Diese Beraterinnen<br />
veranstalten auch monatliche Stilltreffen und in einigen Orten werden Stillgruppen<br />
organisiert.<br />
La Leche Liga Schweiz:<br />
Postfach 197, CH-8053 Zürich<br />
Tel./Fax: 044/9401012<br />
www.stillberatung.ch<br />
E-Mail: info@stillberatung.ch<br />
La Leche Liga Österreich<br />
Kontaktadresse: Marion Thaler, Kaiserweg 10, A-6336 Langkampfen<br />
Tel. 05332/81290<br />
http://www.lalecheliga.at<br />
E-Mail: info@lalecheliga.at<br />
Initiative Regenbogen „Glücklose Schwangerschaft“ e.V.<br />
Hauptgeschäftsstelle, Adressenvermittlung und Broschürenversand:<br />
c/o Renate Dreier, Westring 100, D-33378 Rheda-Wiedenbrück,<br />
Tel. 05242/35297<br />
http://www.initiative-regenbogen.de<br />
E-Mail: HGST@initiative-regenbogen.de<br />
In Österreich:<br />
c/o Ulrike Kern, Zirkusgasse 28/9, A-1020 Wien,<br />
Tel./Fax +43-1-3191923<br />
http://www.glueckloseschwangerschaft.at<br />
E-Mail: u.kern@easycare.at, admin@glueckloseschwangerschaft.at<br />
102b<br />
Kontaktkreis für Eltern, die ihr Kind durch Fehlgeburt, Frühgeburt, Totgeburt<br />
oder kurz nach der Geburt verloren haben. Der Verein bietet neben Informationsbroschüren<br />
auch Einzel- und Gruppengespräche, vermittelt Adressen betroffener<br />
Eltern und setzt sich bei Regierung und Behörden für die personenstandsund<br />
bestattungsrechtliche Aufwertung Totgeborener ein.<br />
Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.<br />
Kapellener Str. 67a, D-47661 Issum,<br />
Tel. 02835/2628; Fax 02835/2945<br />
http://www.gestose-frauen.de<br />
E-Mail: info@gestose-frauen.de<br />
Der Verein bietet Beratung und Information zum Thema Gestose und HELLP-<br />
Syndrom, u.a. kostenpflichtige Broschüren mit Ernährungsplänen etc.<br />
Adressen weiterer, nicht zwillingsspezifischer Organisationen und Interessenverbände,<br />
die sich mit unterschiedlichen Fragen der Schwangerschaft, Familie und Erziehung<br />
befassen, finden Sie in der Broschüre „Familienverbände“, die Sie normalerweise<br />
bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Postfach 910152, 51071 Köln
103a<br />
103b<br />
(Tel. 0221-89920) bestellen können. Derzeit ist die Broschüre vergriffen, man kann sie<br />
kann aber noch als pdf-Datei unter www.bzga.de (Stichwort „Familienverbände“)<br />
downloaden.
104a<br />
104b<br />
Anhang V: Gesetzestexte<br />
II.<br />
Haushaltshilfe während der Schwangerschaft und bei der Entbindung<br />
§ 199 RVO (Reichsversicherungsordnung)<br />
I. Arbeitsrechtliche Beschäftigungsverbote<br />
§ 3 MuSchG (Mutterschutzgesetz)<br />
(1) Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem<br />
Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung<br />
gefährdet ist.<br />
(2) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung<br />
nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich<br />
bereit erklären; die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.<br />
Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen Schwangerschaft oder Entbindung<br />
die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist und eine andere im Haushalt<br />
lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann. § 38 Abs. 4 des Fünften Buches<br />
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.<br />
(§ 38 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch lautet: „Kann die Krankenkasse<br />
keine Haushaltshilfe stellen oder besteht Grund, davon abzusehen, sind den Versicherten<br />
die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe in angemessener Höhe zu erstatten.<br />
Für Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad werden keine Kosten erstattet;<br />
die Krankenkasse kann jedoch die erforderlichen Fahrkosten und den Verdienstausfall<br />
erstatten, wenn die Erstattung in einem angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine<br />
Ersatzkraft entstehenden Kosten steht.“)<br />
§ 6 MuSchG<br />
(1) Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten<br />
bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt<br />
werden. Bei Frühgeburten und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängern sich<br />
die Fristen nach Satz 1 zusätzlich um den Zeitraum der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2,<br />
der nicht in Anspruch genommen werden konnte. Beim Tod ihres Kindes kann die<br />
Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen ausnahmsweise schon vor Ablauf dieser Fristen,<br />
aber noch nicht in den ersten zwei Wochen nach der Entbindung, wieder beschäftigt<br />
werden, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie kann ihre Erklärung<br />
jederzeit widerrufen.<br />
(2) ...<br />
III. Mutterschaftsgeld<br />
§ 200 RVO (Reichsversicherungsordnung)<br />
(1) Weibliche Mitglieder, die bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld haben<br />
oder denen wegen der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes<br />
kein Arbeitsentgelt gezahlt wird, erhalten Mutterschaftsgeld.<br />
(2) Für Mitglieder, die bei Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes<br />
in einem Arbeitsverhältnis stehen oder in Heimarbeit beschäftigt sind<br />
oder deren Arbeitsverhältnis während ihrer Schwangerschaft oder der Schutzfrist nach §<br />
6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes nach Maßgabe von § 9 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes<br />
aufgelöst worden ist, wird als Mutterschaftsgeld das um die gesetzlichen Abzüge<br />
verminderte durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten<br />
Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes<br />
gezahlt. Es beträgt höchstens 13 Euro für den Kalendertag. Einmalig gezahltes<br />
Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Tage, an denen infolge<br />
von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder<br />
ein vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben außer Betracht. Ist danach eine<br />
Berechnung nicht möglich, ist das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt
105a<br />
einer gleichartig Beschäftigten zugrunde zu legen. Für Mitglieder, deren Arbeitsverhältnis<br />
während der Mutterschutzfristen vor oder nach der Geburt beginnt, wird das<br />
Mutterschaftsgeld von Beginn des Arbeitsverhältnisses an gezahlt. Übersteigt das<br />
Arbeitsentgelt 13 Euro kalendertäglich, wird der übersteigende Betrag vom Arbeitgeber<br />
oder vom Bund nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes gezahlt. Für andere<br />
Mitglieder wird das Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes gezahlt.<br />
(3) Das Mutterschaftsgeld wird für die letzten sechs Wochen vor der Entbindung,<br />
den Entbindungstag und für die ersten acht Wochen, bei Mehrlings- und Frühgeburten<br />
für die ersten zwölf Wochen nach der Entbindung gezahlt. Bei Frühgeburten und<br />
sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängert sich die Bezugsdauer um den Zeitraum,<br />
der nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes nicht in Anspruch genommen<br />
werden konnte. Für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes vor der Entbindung ist das<br />
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme maßgebend, in dem der mutmaßliche Tag<br />
der Entbindung angegeben ist. Das Zeugnis darf nicht früher als eine Woche vor Beginn<br />
der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes ausgestellt sein. Bei<br />
Geburten nach dem mutmaßlichen Tag der Entbindung verlängert sich die Bezugsdauer<br />
vor der Geburt entsprechend.<br />
(4) Der Anspruch auf Mutterschaftsgeld ruht, soweit und solange das Mitglied<br />
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erhält. Dies gilt nicht für<br />
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt.<br />
(Anmerkung: Für Landwirte gelten anstelle von § 200 RVO die weitgehend inhaltsgleichen<br />
Vorschriften des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte<br />
– KVLG)<br />
§ 13 MuSchG (Mutterschutzgesetz)<br />
(1) Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, erhalten für die<br />
Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 sowie für den Entbindungstag<br />
Mutterschaftsgeld nach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung oder des<br />
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte über das Mutterschaftsgeld.<br />
(2) Frauen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, erhalten,<br />
wenn sie bei Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 in einem Arbeitsverhältnis stehen<br />
oder in Heimarbeit beschäftigt sind, für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und<br />
105b<br />
des § 6 Abs. 1 sowie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes in<br />
entsprechender Anwendung der Vorschriften der Reichsversicherungsordnung über das<br />
Mutterschaftsgeld, höchstens jedoch insgesamt 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird<br />
diesen Frauen auf Antrag vom Bundesversicherungsamt gezahlt. Die Sätze 1 und 2 gelten<br />
für Frauen entsprechend, deren Arbeitsverhältnis während ihrer Schwangerschaft<br />
oder der Schutzfrist des § 6 Abs. 1 nach Maßgabe von § 9 Abs. 3 aufgelöst worden ist.<br />
(3) ...<br />
§ 14 MuSchG (Mutterschutzgesetz)<br />
(1) Frauen, die Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach § 200 Abs. 1, 2 Satz 1 bis 4<br />
und Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung, § 29 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes über die<br />
Krankenversicherung der Landwirte oder § 13 Abs. 2, 3 haben, erhalten während ihres<br />
bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und § 6<br />
Abs. 1 sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe des<br />
Unterschiedsbetrages zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten<br />
durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt. Das durchschnittliche kalendertägliche<br />
Arbeitsentgelt ist aus den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei<br />
wöchentlicher Abrechnung aus den letzten dreizehn abgerechneten Wochen vor Beginn<br />
der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 zu berechnen. Nicht nur vorübergehende Erhöhungen des<br />
Arbeitsentgeltes, die während der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 wirksam<br />
werden, sind ab diesem Zeitpunkt in die Berechnung einzubeziehen. Einmalig gezahltes<br />
Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Tage, an denen infolge<br />
von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder<br />
ein vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben außer Betracht. Zu berücksichtigen<br />
sind dauerhafte Verdienstkürzungen, die während oder nach Ablauf des Berechnungszeitraums<br />
eintreten und nicht auf einem mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot<br />
beruhen. Ist danach eine Berechnung nicht möglich, so ist das durchschnittliche<br />
kalendertägliche Arbeitsentgelt einer gleichartig Beschäftigten zugrunde zu legen.<br />
(2) Frauen, deren Arbeitsverhältnis während ihrer Schwangerschaft oder während<br />
der Schutzfrist des § 6 Abs. 1 nach Maßgabe von § 9 Abs. 3 aufgelöst worden ist, erhalten<br />
bis zum Ende dieser Schutzfrist den Zuschuss nach Absatz 1 zu Lasten des Bundes<br />
von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zuständigen Stelle.
106a<br />
106b<br />
(3) Absatz 2 gilt für den Zuschuss des Bundes entsprechend, wenn der Arbeitgeber<br />
wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne des § 183 Abs. 1 Satz 1 des Dritten<br />
Buches Sozialgesetzbuch seinen Zuschuss nach Absatz 1 nicht zahlen kann.<br />
(4) Der Zuschuss nach den Absätzen 1 bis 3 entfällt für die Zeit, in der Frauen die<br />
Elternzeit nach dem Bundeselternzeit- und Elternzeitgesetz in Anspruch nehmen oder<br />
in Anspruch genommen hätten, wenn deren Arbeitsverhältnis nicht während ihrer<br />
Schwangerschaft oder während der Schutzfrist des § 6 Abs. 1 vom Arbeitgeber zulässig<br />
aufgelöst worden wäre. Dies gilt nicht, soweit sie eine zulässige Teilzeitarbeit<br />
leisten.
107a<br />
107b<br />
Anhang VI: Literaturhinweise<br />
Die Autorin hinterfragt den Automatismus, mit dem Schwangere über 30<br />
zu genetischen Tests geradezu gedrängt werden. Das Buch erläutert die Techniken<br />
und Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik, um sich dann der Frage anzunehmen,<br />
wie die Betroffenen mit den Informationen umgehen können.<br />
(Anmerkung: In Einzelfällen stellen wir die aus unserer Sicht sinnvollen Bücher<br />
auch dann noch vor, wenn der – immer kurzlebiger werdende – Buchhandel sie nicht<br />
mehr vorhält. Meist können die Werke, neu oder gebraucht, in Antiquariaten erstanden<br />
werden (z.B. über www.amazon.de) oder sie sind in öffentlichen Büchereien verfügbar.)<br />
Schwangerschaft allgemein<br />
Ines Albrecht-Engel (Hrsg.):<br />
Geburtsvorbereitung – Entspannung und Balance; Massagen und Atemübungen;<br />
Mit Kurs für werdende Eltern, Reinbek 2006 [Rowohlt].<br />
Ein Klassiker zum Thema Geburtsvorbereitung, herausgegeben von der<br />
Vorsitzenden der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung e.V.<br />
Vorgeburtliche Diagnostik<br />
Stephan Krone:<br />
Das ungeborene Kind – Möglichkeiten und Grenzen vorgeburtlicher Untersuchungen,<br />
Stuttgart 1992 [trias]<br />
Das im Handel nicht mehr erhältliche Buch erörtert mögliche vorgeburtliche<br />
Schädigungen eines Kindes und stellt die Methoden und Risiken der<br />
pränatalen Diagnostik (nach dem damaligen Stand des medizinischen Fortschritts)<br />
auf sehr instruktive Weise vor.<br />
Claudia Fesch:<br />
Genetische Tests – Wie funktionieren sie und was sagen sie aus, Frankfurt<br />
2000 [Fischer Taschenbuch].<br />
Erziehungsratgeber<br />
Rita Haberkorn:<br />
<strong>Zwillinge</strong> – Was Eltern und Pädagogen wissen müssen, Reinbek 1996 [Rowohlt]<br />
Das Buch berichtet über die eigenen Erfahrungen der Autorin sowie vier<br />
weiterer Zwillingsfamilien und reflektiert dabei die Paarbeziehung der <strong>Zwillinge</strong><br />
untereinander ebenso wie das Beziehungsgeflecht zu Eltern und anderen Geschwisterkindern.<br />
Indem dadurch typische Besonderheiten der Zwillingskonstellation<br />
transparent werden, öffnen sich neue Sichtweisen auf die eigene Familiensituation.<br />
Obgleich im Buchhandel nicht mehr erhältlich, hat das Werk an<br />
Aktualität nicht verloren.<br />
Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth:<br />
Jedes Kind kann schlafen lernen. München 2007 [Gräfe & Unzer]<br />
Das Buch befasst sich allgemein mit den körperlichen und psychischen Ursachen<br />
kindlicher Einschlaf- und Durchschlafprobleme und war mit seinem<br />
Bewältigungskonzept schon vielen Eltern eine große Hilfe. Dagegen bringen die<br />
weiteren Bücher der Reihe („Jedes Kind kann Regeln lernen“, „Jedes Kind kann<br />
richtig essen“) keine wirklich neuen Erkenntnisse.<br />
Totgeburt und Fehlgeburt<br />
Hannah Lothrop:<br />
Gute Hoffnung – jähes Ende, München 2007 [Kösel]<br />
Der einfühlsam geschriebene Ratgeber gibt Hilfestellung bei Fehlgeburt,<br />
Totgeburt und Säuglingstod.
108a<br />
Angela Körner-Armbruster:<br />
Totgeburt weiblich – ein Abschied ohne Begrüßung, Tübingen 2005 [Attempto]<br />
Ein ergreifender Erfahrungsbericht über eine selbst erlebte Totgeburt,<br />
der die eigenen Sorgen und Erwartungen wie auch die Hilflosigkeit der Umgebung<br />
detailgetreu aufarbeitet. Die reflektierte Darstellung macht Abläufe<br />
transparent und deutet damit allgemeine Handlungsstrategien der Trauerbewältigung<br />
auch über den Einzelfall hinaus an, ohne damit jedoch den Anspruch<br />
eines Ratgebers zu begründen.<br />
Monika Fränznick, Karin Wieners:<br />
Ungewollte Kinderlosigkeit – Psychosoziale Folgen, Bewältigungsversuche<br />
und Dominanz der Medizin, Weinheim 2001 [Juventa]<br />
Das Buch ist zu empfehlen, wenn man Kinder nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung<br />
verloren hat.<br />
Frühgeburt<br />
Gerhard Jorch:<br />
Frühgeborene – Rat und Hilfe für betroffene Eltern, München, Stuttgart 2006<br />
[Urania]<br />
Das Buch befasst sich zunächst mit den Ursachen einer Frühgeburt und<br />
den zur Wahl stehenden Geburtsmodi, um dann die Situation auf einer Frühgeborenenintensivstation<br />
einschließlich der Apparate und die Behandlungsmethoden<br />
zu erläutern. Im weiteren informiert es über mögliche Komplikationen<br />
bei der Behandlung Frühgeborner und gibt allgemeine Einblicke in die<br />
Entwicklungsaussichten für Frühgeborene. Das Buch ist vom Bundesverband<br />
„Das frühgeborene Kind“ e.V. empfohlen und mit hoher ärztlicher Fachkompetenz<br />
verfasst, allerdings vielleicht nicht an allen Stellen mit derselben Einfühlsamkeit,<br />
wie sie persönlich betroffene Eltern hätten.<br />
108b<br />
Edith Müller-Rieckmann:<br />
Das frühgeborene Kind in seiner Entwicklung – Eine Elternberatung, München,<br />
Basel 2006 [Ernst Reinhardt]<br />
Das auf hohem fachlichem Niveau geschriebene Buch befasst sich mit der<br />
Beobachtung und Förderung der körperlichen und geistigen Entwicklung von<br />
Frühgeborenen. Förderungskonzepte werden besprochen und mit beispielhaften<br />
praktischen Übungen greifbar gemacht. Das gleichzeitig an die betroffenen Eltern<br />
wie auch an ein Fachpublikum aus Geburtshelfern, Kinderärzten Frühförderern<br />
gerichtete Werk findet in der Ansprache dieser doch sehr weit gefächerten<br />
Zielgruppen einen akzeptablen Kompromiss, der für die Eltern allerdings an einigen<br />
Stellen die Herausforderung bedeutet, einem nicht leicht lesbaren Text<br />
gegenüberzustehen. Die medizinische Behandlung auf der Frühchenstation (Neonatologie)<br />
gehört dagegen nicht zu den Schwerpunkten des Buches.<br />
Fachbücher<br />
Jutta Jäger:<br />
Psychosoziale, ökonomische und gesundheitliche Aspekte bei Familien mit höhergradigen<br />
Mehrlingen, Dissertation Frankfurt/M. 1994<br />
Empirische Studie über 110 Drillings- und Vierlingsfamilien.<br />
Barbara Felber-Suter / Kurt von Siebenthal:<br />
Mehrlinge – und plötzlich ist alles anders, Luzern 1997 [Edition SZH/SPC]. Im<br />
Buchhandel vergriffen; in Restbeständen noch beim ABC-Club erhältlich und<br />
ansonsten bei den antiquarischen Quellen.<br />
Das Buch wendet sich an Pädagogen, Therapeuten und Berater, die in ihren<br />
jeweiligen Berufen mit Mehrlingen zu tun haben.<br />
Tatsachenroman<br />
Darin Strauss:<br />
Chang und Eng – Die Siamesischen <strong>Zwillinge</strong>, München 2002 [Heyne Wilhelm].<br />
Nur noch antiquarisch erhältlich.
109a<br />
Fachaufsätze zu speziellen Themen<br />
vorgeburtliche Diagnostik:<br />
S. Uhrig u.a.:<br />
Humangenetische Beratung bei Mehrlingsschwangerschaften, in: Gynäkologisch-Geburtshilfliche<br />
Rundschau, Band 47 (2007), S. 9-13<br />
M. Haeusler:<br />
Geburtshilfliche Betreuung von Mehrlingsschwangerschaften bis zur 24.<br />
Schwangerschaftswoche – eine Übersicht, in: Gynäkologisch-Geburtshilfliche<br />
Rundschau, Band 47 (2007), S. 14-22<br />
G. Crombach u.a.:<br />
Spezielle Aspekte der nicht-invasiven und invasiven Pränataldiagnostik bei<br />
Mehrlingen, in: Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 218-228<br />
A. Geipel u.a.:<br />
Stellenwert der NT-Messung – Ist das Alter keine Indikation zur Amniozentese<br />
mehr, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Band 65 (2005), S. 636-638<br />
F. Krainer:<br />
Invasive und nichtinvasive fetale Chromosomenanalyse – Alternative und Ergänzung<br />
zur NT-Messung, in: Der Gynäkologe, Band 39 (2006), S. 854-860<br />
H. Hepp:<br />
Pränataldiagnostik – Eine Standortbestimmung, in: Der Gynäkologe, Band 39<br />
(2006), S. 861-869<br />
109b<br />
B. Tutschek u.a.:<br />
Diagnostik und Prognose von Mehrlingsgraviditäten im I. Trimenon, in: Der<br />
Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 209-217<br />
Zwillingstransfusionssyndrom:<br />
F. Bahlmann:<br />
Fetofetales Transfusionssyndrom, in: Der Gynäkologe, Band 37 (2004), S. 725-<br />
735<br />
E. Grischke u.a.:<br />
Zwillingsschwangerschaften mit feto-fetalem Transfusionssyndrom, in: Zeitschrift<br />
für Geburtshilfe und Perinatologie, Band 194 (1990), S. 17-21<br />
H. Plath u.a.:<br />
Diagnostik und Therapie zwillingsspezifischer Anomalien, in: Der Gynäkologe,<br />
Band 31 (1998), S. 229-244<br />
A. Scharf u.a.:<br />
Laser versus serielle Amniondrainage, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde,<br />
Band 62 (2002), S. 1016-1021<br />
Siamesische <strong>Zwillinge</strong>:<br />
H. Plath u.a.:<br />
Diagnostik und Therapie zwillingsspezifischer Anomalien, in: Der Gynäkologe,<br />
Band 31 (1998), S. 229-244<br />
Zwillingsteilung, Eihautverhältnisse:<br />
K. Bernischke:<br />
Klassifikation und Plazentationsverhältnisse bei der Mehrlingsgravidität, in:<br />
Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 198-202<br />
Reduktion der Schwangerschaft (Fetozid):<br />
R. Bollmann u.a.:<br />
Erfahrungen mit der nicht-selektiven Embryoreduktion und dem selektiven Fetozid,<br />
in: Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 254-260
110a<br />
H. Hepp:<br />
Höhergradige Mehrlingsgravidität – auch ein ethisches Problem medizinischen<br />
Fortschritts, in: Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 261-266<br />
Ärztliche Betreuung der Mehrlingsschwangerschaft:<br />
A. Bolte:<br />
Richtlinien zur Betreuung und Behandlung der Mehrlingsgravidität, in: A.<br />
Schindler u.a. (Hrsg.), Mehrlingsschwangerschaft, Mehrlingsgeburt. Der<br />
Frauenarzt, Gräfeling 1995, S. 69-73<br />
Medizinischer Nutzen und Risiken einer Zerklage:<br />
K. Vetter u.a.:<br />
Zervixinsuffizienz: operative Möglichkeiten, in: Der Gynäkologe, Band 34<br />
(2001), S. 726-731<br />
A. Strauss u.a.:<br />
Diagnostik und Prophylaxe der Cervixinsuffizienz in der Mehrlingsschwangerschaft,<br />
in: Gynäkologisch-Geburtshilfliche Rundschau, Band 43 (2003), S.<br />
91-97<br />
C. Wolf:<br />
Prophylaktische Cerklage: Keine Senkung der Frühgeburtlichkeit bei Risikokollektiv,<br />
in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Band 65 (2005), S. 6<br />
Ö. Kilavuz u.a.:<br />
Verhinderung von Spätaborten und Frühgeburten – Operative Möglichkeiten,<br />
in: Der Gynäkologe, Band 39 (2006), S. 311-322<br />
Gestose/Präeklampsie, vorbeugende Einnahme von Aspirin:<br />
110b<br />
W. Klockenbusch u.a.:<br />
Prävention der Präeklampsie mit Acetylsalizylsäure – eine kritische Analyse,<br />
in: Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie, Band 206 (2003), S. 125-130<br />
W.Klockenbusch u.a.:<br />
Aktuelle Therapieempfehlungen bei Präeklampsie, in: Gynäkologisch-<br />
Geburtshilfliche Rundschau, Band 47 (2007), S. 209-214<br />
Wahl des Geburtsmodus (vaginale Entbindung oder Kaiserschnitt):<br />
G. Hasenöhrl u.a.:<br />
Entbindung von Mehrlingen, insbesondere <strong>Zwillinge</strong>n, in: Gynäkologisch-<br />
Geburtshilfliche Rundschau, Band 47 (2007), S. 70-75<br />
W. Schröder:<br />
Leitung der Mehrlingsgeburt, in: Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 267-272<br />
M. Kühnert u.a.:<br />
Sectio caeserea: ein harmloser Eingriff aus mütterlicher Sicht, in: Geburtshilfe<br />
und Frauenheilkunde, Band 60 (2000), S. 354-361<br />
P. Husslein u.a.:<br />
Elektive Sektio vs. vaginale Geburt – ein Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe,<br />
in: Der Gynäkologe, Band 33 (2000), S. 849-856<br />
P. Hillemanns u.a.:<br />
Risiken bei Sectio caesarea und vaginaler Geburt, in: Der Gynäkologe, Band 33<br />
(2000), S. 872-881<br />
J. Schmolling u.a.:<br />
Harninkontinenz nach vaginaler Entbindung oder Sectio caeserea, in: Der Gynäkologe,<br />
Band 36 (2003), S. 1113-1115
111a<br />
111b<br />
Gegenüberstellung der herkömmlichen Kaiserschnittentbindung mit der<br />
neueren MISGAV-LADACH-Methode:<br />
E. Joura u.a.:<br />
Eine kritische Bewertung der Sektiotechnik nach Misgav-Ladach, in: Der Gynäkologe,<br />
Band 33 (2000), S. 298-302<br />
Gesundheits- und Entwicklungsprognose bei höhergradigen Mehrlingen:<br />
H. Mentzel:<br />
Neonatale Aspekte bei Mehrlingsgeburten, in: A. Schindler u.a. (Hrsg.),<br />
Mehrlingsschwangerschaft, Mehrlingsgeburt. Der Frauenarzt, Gräfeling 1995,<br />
S. 65-68<br />
A. Strauss u.a.:<br />
Höhergradige Mehrlinge – Perinatologische Herausforderung und Konsequenzen,<br />
in: Der Gynäkologe, Band 31 (1998), S. 275-282<br />
Gesundheits- und Entwicklungsprognose bei Frühgeborenen:<br />
D. Wolke u.a.:<br />
Entwicklungslangzeitfolgen bei ehemaligen, sehr unreifen Frühgeborenen –<br />
Bayerische Entwicklungsstudie, in: Monatsschrift für Kinderheilkunde, Band<br />
149 (2001), Supplement 1, S. 53-61<br />
J. Hentschel u.a.:<br />
Überlebenschancen und Langzeitprognose bei Geburt in der Grauzone der Lebensfähigkeit,<br />
in: Der Gynäkologe, Band 34 (2001), S. 679-707
112a<br />
112b<br />
Anhang VII<br />
Mehrlinge in anderen Sprachen (für den Urlaub):<br />
Deutsch Englisch Französisch Spanisch<br />
<strong>Zwillinge</strong> twins jumeaux (zwei Jungen, Pärchen<br />
oder allgemein <strong>Zwillinge</strong>)<br />
jumelle (zwei Mädchen)<br />
gemelos<br />
mellizos<br />
eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />
identical twins<br />
monozygotic twins<br />
jumeaux identiques<br />
vrais jumeaux<br />
gemelos univitelinos<br />
gemelos identicos<br />
zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />
non-identical twins<br />
fraternal twins<br />
dizygotic twins<br />
jumeaux non identiques<br />
faux jumeaux<br />
gemelos bivitelinos<br />
gemelos fraternos<br />
Drillinge triplets triplés<br />
trois jumeaux<br />
trillizos<br />
Vierlinge quadruplets quadruplés quatrillizos<br />
Fünflinge quintuplets quintuplés quintillizos<br />
Sechslinge sextuplets sextuplés sextillizos<br />
Siebenlinge septuplets septuplés septillizos<br />
Achtlinge octuplets octuplés octillizos<br />
(höhergradige) Mehrlinge<br />
multiples<br />
supertwins<br />
multiples<br />
múltiplos<br />
Frühgeborenes premature baby enfant prématuré prematuro<br />
Frühchen preemie préma