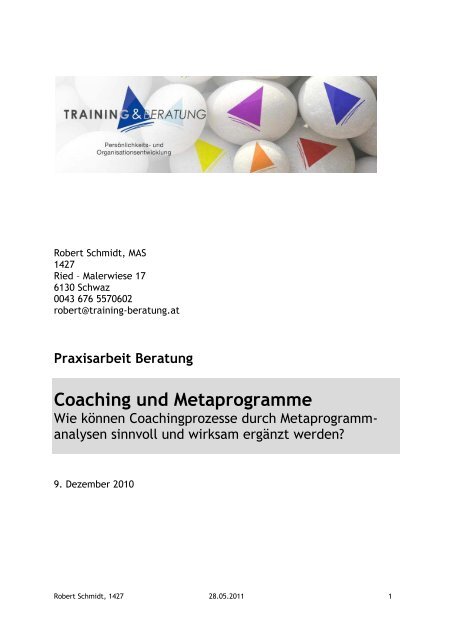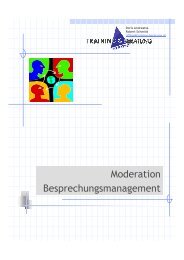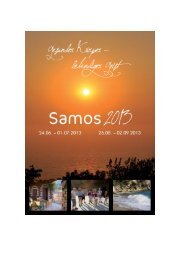Metaprogramme - Training & Beratung
Metaprogramme - Training & Beratung
Metaprogramme - Training & Beratung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Robert Schmidt, MAS<br />
1427<br />
Ried – Malerwiese 17<br />
6130 Schwaz<br />
0043 676 5570602<br />
robert@training-beratung.at<br />
Praxisarbeit <strong>Beratung</strong><br />
Coaching und <strong>Metaprogramme</strong><br />
Wie können Coachingprozesse durch Metaprogrammanalysen<br />
sinnvoll und wirksam ergänzt werden?<br />
9. Dezember 2010<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 1
Inhaltesverzeichnis<br />
Überblick und Ziele .................................................. 3<br />
<strong>Metaprogramme</strong>: Konzeptionelle Einführung ................. 5<br />
Entwicklung ..................................................................... 5<br />
Definition ....................................................................... 7<br />
Struktur und Inhalte ........................................................... 9<br />
Darstellung und Beschreibung .............................................. 10<br />
<strong>Beratung</strong> und Coaching ........................................... 15<br />
<strong>Beratung</strong> ....................................................................... 15<br />
Coaching....................................................................... 19<br />
Prozessmodell ............................................................. 19<br />
<strong>Metaprogramme</strong> und Veränderung ............................. 23<br />
<strong>Metaprogramme</strong> und Coaching .................................. 25<br />
Motivation und Erwartungen ............................................... 25<br />
Einbindung der Metaprogrammanalyse ................................... 26<br />
Praxisfall ...................................................................... 28<br />
Wesentlichen Punkte bisheriger Erfahrungen ........................... 37<br />
Kritische Reflexion ................................................ 39<br />
Literatur und Links ................................................ 44<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 2
Überblick und Ziele<br />
Ich möchte mit dieser Arbeit Menschen ansprechen, die sich für<br />
<strong>Beratung</strong> interessieren und ganz besonders fürs Coaching, eine<br />
<strong>Beratung</strong>sform, die sich auch über hohe Ziel-, Ressourcen und<br />
Lösungsorientierung definiert.<br />
Coaching ist für mich stark der <strong>Beratung</strong> von Führungskräften und<br />
Entscheidungsträgern in Organisationen zugeordnet. Die Themen und<br />
Erwartungen, die von diesen Zielgruppen angesprochen werden, sind<br />
auf den ersten Blick vielfältig, es geht häufig um Führung,<br />
Veränderung, Kommunikation und Interaktion, Motivation, Konflikt,<br />
Kooperation usw.<br />
Je klarer es gelingt, die Zielansätze herauszuarbeiten, desto mehr<br />
Gemeinsamkeiten zeichnen sich aus meiner Erfahrung in den<br />
Erwartungen und Zielen der KundInnen ab, so unterschiedlich die<br />
Themen und Kontexte vorab auch sind.<br />
Es geht in vielen Fällen grundsätzlich darum, ein anderes,<br />
erfolgversprechenderes, der Situation besser angepasstes Verhalten<br />
zeigen zu können und das rasch, sicher und konform mit sich selbst.<br />
Meinem Empfinden nach zieht sich die Vorstellung eines ge- und<br />
veränderten Verhaltens wie ein roter Faden durch das Thema Coaching,<br />
einerseits als Wunschvorstellung der KundInnen und zum anderen auch<br />
als Charakteristikum für den Coachingprozess, wenn es um Zielklarheit<br />
und Erfolgskriterien geht.<br />
Leider gibt es für die einfachen Fragen „Wie wird Verhalten gesteuert?“<br />
oder „Was muss ich denn tun, dass ich mich ab morgen in einer<br />
bestimmten Situation ganz anders verhalte?“ keine einfachen<br />
Antworten.<br />
Ich habe <strong>Metaprogramme</strong> (sorting styles, Denkpräferenzen) im Rahmen<br />
meiner ersten NLP-Ausbildung Ende der 80er Jahre als einen<br />
„verhaltenserklärenden“ und/oder „verhaltensbegründenden“ Baustein<br />
kennengelernt und in meine <strong>Beratung</strong>sarbeit in unterschiedlichen<br />
Variationen eingebaut.<br />
Ich werde in dieser Arbeit auf die Entwicklung der Erforschung der<br />
<strong>Metaprogramme</strong> kurz eingehen, den Coachingprozess aus meiner Sicht<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 3
darstellen und in der Folge zeigen, wie in diesem Rahmen<br />
Metaprogrammanalysen als Ergänzung und Erweiterung eingesetzt<br />
werden können.<br />
Ich gehe dabei davon aus, dass die Analyse der <strong>Metaprogramme</strong> ein<br />
nützliches Instrument sein kann, zusätzliche Blickwinkel zu eröffnen<br />
und weitere, nützliche Ansatzpunkte für Veränderungen anzubieten.<br />
Diese Elemente gehen als Angebote in den Dialog mit Coaching-<br />
KundInnen ein und werden dadurch laufend berücksichtig, abgestimmt<br />
und transparent gehalten, schon um nicht in die Falle einer nicht<br />
angebrachten Typologisierung und Pseudo-Psychologisierung zu tappen.<br />
Zur Analyse der <strong>Metaprogramme</strong> stehen unterschiedliche Verfahren zur<br />
Verfügung, von der strukturierten Erhebung im Coachinggespräch bis<br />
zur webbasierten Analyse mittels Identity Compass © .<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 4
<strong>Metaprogramme</strong>: Konzeptionelle Einführung<br />
Entwicklung<br />
Der Idee, Menschen über Kriterien des Verhaltens, Denkens oder<br />
Aussehens zu kategorisieren besteht schon lange.<br />
Menschen wurden in früheren Zeiten den Charakteristika der Elemente<br />
Erde, Luft, Wasser und Feure zugeordnet.<br />
Hypokrates und Galen leiteten aus der Qualität der Körpersäfte die<br />
eigenschaftstypischen Kategorien der Choleriker, Phlegmatiker,<br />
Melancholiker und Sanguiniker ab.<br />
Aus primär körperlichen Merkmalen entwickelte Kretschmer die<br />
Kategorien der Leptosomen, der Pykniker und der Athleten. Den<br />
Konstitutionstypen ordnete er charakteristische körperliche und<br />
psychische Eigenschaften zu.<br />
Eine wesentliche Grundlage zum Verständnis der <strong>Metaprogramme</strong> liegt<br />
in der vom Schweitzer Psychiater und Psychologen Carl-Gustav Jung<br />
(1875-1961) begründeten Persönlichkeitspsychologie, das von einem auf<br />
Wahrnehmungsfiltern basierenden Konzept ausgeht.<br />
Wellhöfer beschreibt die zentralen Aspekte folgendermaßen: „In Jungs<br />
Persönlichkeitspsychologie haben die psychischen Einstellungen und<br />
Funktionen einen bedeutsamen Stellenwert. Je nachdem, ob sich die<br />
Libido den Objekten der Umwelt oder der eigenen Person zuwendet,<br />
entsteht der extravertierte oder introvertierte Einstellungstyp. Beide<br />
Begriffe haben sich unabhängig von Jungs Persönlichkeitstypologie in<br />
der Psychologie durchgesetzt.<br />
Neben dem Einstellungstyp betont Jung noch die Existenz von vier<br />
psychischen Grundfunktionen, die unabhängig von Extraversion und<br />
Introversion auftreten. Es handelt sich bei ihnen um die rationalen<br />
Funktionen des Denkens und Fühlens sowie die irrationalen des<br />
Empfindens und der Intuition.“ (Wellhöfer 1990, S. 228)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 5
Jung befasste sich mit der Zuordnung einer Person zu bestimmten<br />
Typen, um die Persönlichkeit und damit auch das Verhalten zuordnen<br />
zu können. Menschen werden als Individuen gesehen, die in einigen<br />
Funktionen ihres Verhaltens Gemeinsamkeiten aufzeigen. Jedes<br />
Individuum hat eine Präferenz, Dinge auf gewisse Weise wahrzunehmen<br />
und zu beurteilen. Diese Vorstellung von Präferenzen bzw. Neigungen<br />
bildet die Grundlage von Jungs Typentheorie.<br />
Katharine Myers (1875 – 1968) und ihre Tochter Isabel Briggs Myers<br />
(1897 – 1980) zogen die Theorie Jungs bereits vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg in den USA zur Beschreibung von Persönlichkeitsunterschieden<br />
heran und entwickelten sie weiter.<br />
Neben den von Jung beschriebenen mentalen Funktionen, die für den<br />
bevorzugten psychischen Prozess des Wahrnehmens oder Entscheidens<br />
stehen, legten Myers und Briggs ihr Augenmerk auf die Orientierung<br />
dieser Prozesse in der Außenwelt und ergänzten so die Theorie.<br />
Auf diese Weise entstand ein Modell mit den insgesamt 16<br />
Persönlichkeitstypen des Myers-Briggs Type Indicator (M.B.T.I.).<br />
Die Typen werden in der Regel durch eine Kombination von 4<br />
Buchstaben, z. B. ENTJ, beschrieben. Durch die verschiedenen Typen<br />
ist es möglich, schnell und einfach Persönlichkeitsunterschiede zu<br />
erkennen und die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen zu<br />
erarbeiten. Nach der Überprüfung der Reliabilität und Validität des<br />
Instruments Anfang der 60er-Jahre wurde es offiziell für die<br />
Verwendung im akademischen Bereich von den Educational Testing<br />
Services freigegeben. ETS gilt als weltweit führender Anbieter im<br />
Bereich der Entwicklung von branchenüblichen Bewertungstools.<br />
Weitere Details entnehmen Sie bitte unter http://www.ets.org/.<br />
Die vier Präferenzen, die durch den MBTI darstellbar gemacht wurden,<br />
bilden die vier einfachen Meta-Programme.<br />
Diese grundlegenden <strong>Metaprogramme</strong> wurden von Leslie Cameron-<br />
Bandler erweitert. Sie unterschied circa 60 verschiedene Programme,<br />
die meisten entstammten einem klinischen Kontext.<br />
Ein Schüler von Cameron-Bandler, Rodger Bailey, übersetzte einige<br />
<strong>Metaprogramme</strong> in den Kontext Business und entwickelte das<br />
sogenannte Language and Behavior Profile (LAB-Profil). Dieses Profil<br />
baut auf 14 Meta-Programmen auf, welche in die beiden Kategorien<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 6
Motivation und Arbeitsstil unterteilt werden. Weitere Details dazu<br />
finden sich auf der Homepage von Evelyne Maaß und Karsten Ritschl<br />
(vgl. Spectrum Kommunikations<strong>Training</strong>, http://www.lab-profile.de/).<br />
Detailliert beschrieben wird das LAB-Profil auch von Shelle Rose<br />
Charvet (vgl. Charvet, 2010, S. 18 ff.).<br />
Definition<br />
Im Neurolinguistischen Programmieren (NLP) spielen <strong>Metaprogramme</strong><br />
eine wesentliche Rolle.<br />
Die folgenden Charakteristika sind dem Österreichischen NLP-Server<br />
entnommen, aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich die aus meiner<br />
Sicht wesentlichen Punkte zusammengefasst (vgl. Österreichischer NLP-<br />
Server, http://www.nlp.at/lexikon_neu/index.htm).<br />
<strong>Metaprogramme</strong> (Sorting Styles) sind personenspezifische<br />
Wahrnehmungsfilter, Muster personenspezifischer Wahrnehmung.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> sind die spezifischen Filter, die wir anwenden, wenn<br />
wir mit der Welt interagieren.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> bearbeiten, formen und gestalten jene Informationen<br />
aus der Außenwelt, denen wir es gestatten, nach innen zu gelangen.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> bearbeiten, formen und gestalten gleichzeitig jene<br />
Informationen, die beim Kommunizieren, im Handeln und Tun, von<br />
innen nach außen gelangen.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> sind wie eine Tür, durch die wir mit der Welt draußen<br />
agieren. Diese Tür hat die Macht, nur bestimmte Dinge passieren zu<br />
lassen. Es scheint so, als ob sie Teil unserer individuellen Natur wären,<br />
permanent und dauerhaft. Tatsächlich kann man sie verändern,<br />
ausgelöst durch innere oder äußere Einflüsse.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> beschreiben grundlegende Organisationsprinzipien,<br />
wie eine Person wahrnimmt und wie eine Person denkt.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> sind Programme über Programme. Sie existieren auf<br />
einer Meta-Ebene, d.h. sie werden nicht inhaltlich, sondern prozessoral<br />
beschrieben.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 7
Gundl Kutschera, österreichische Soziologin, Psychotherapeutin und<br />
klinische Psychologin, definiert <strong>Metaprogramme</strong> auf folgende Art und<br />
Weise:<br />
„Meta-Programme sind Filter- und Ordnungsmechanismen innerer<br />
Prozesse. Sie entscheiden, wie wir Information unbewusst ordnen und<br />
organisieren. Wir verzerren, streichen und generalisieren<br />
Informationen, weil unser Bewusstsein nur eine begrenzte Kapazität<br />
von Informationseinheiten aufnehmen kann.<br />
Meta-Programme bestimmen, wie wir die Welt, die wir mit unseren<br />
Sinnen wahrnehmen, betrachten. Sie bestimmen, auf was wir unsere<br />
Aufmerksamkeit und unser Interesse lenken, welche Information wir<br />
aufnehmen und welche nicht. Auch bei unseren Entscheidungsprozessen<br />
laufen unbewusste <strong>Metaprogramme</strong> ab.“ (Kutschera 1995, S.<br />
427 ff.)<br />
Coaching orientiert sich (wie andere <strong>Beratung</strong>sprozesse auch) am<br />
subjektiven Problem- und Erfolgverständnis der KundInnen. Coaches<br />
gestalten Lernprozesse auf dieser Grundlage auch indem sie neue<br />
Blickwinkel einbringen oder alternative Modelle anbieten.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> wirken ordnend und strukturierend, beeinflussen<br />
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Verhalten und Entscheidungen,<br />
scheinen also als Filterelemente und Elemente zur Fokuslenkung<br />
zugleich zu wirken. Aus genau diesen Überlegungen beschäftigen mich<br />
die <strong>Metaprogramme</strong>, seit ich dieses Modell kennen gelernt habe.<br />
Ich wollte diese Elemente im Coaching anbieten und als Lernfelder<br />
ansprechen. Zunächst als „Blickwinkel“, die den KundInnen nicht<br />
primär bewusst sind, in der Folge aber auch als konkrete Lernfelder.<br />
Bevor ich auf die Frage näher eingehe, wie ich versuche, das in der<br />
Praxis umzusetzen, möchte ich zunächst weitere Details zu den<br />
<strong>Metaprogramme</strong>n anbieten.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 8
Struktur und Inhalte<br />
Kutschera bietet eine mögliche Einteilung der <strong>Metaprogramme</strong> an, die<br />
aus meiner Sicht eine wesentliche Basis für das grundlegende<br />
Verständnis für die Arbeit mit Metaprogrammanalysen in der <strong>Beratung</strong><br />
bzw. im Coaching darstellt.<br />
Sie sieht die Strukturmuster für Gefühle als Basis für die späteren<br />
<strong>Metaprogramme</strong> an. Diese Strukturmuster definieren sich über folgende<br />
Elemente (vgl. Kutschera 1995, S. 429):<br />
Zeitrahmen<br />
Modalität<br />
Tempo<br />
Wert<br />
Orientierung<br />
Vergleich<br />
Intensität<br />
Beteiligung<br />
Gehört das Gefühl zu einer Situation in der<br />
a) Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft?<br />
b) In-Zeit, Zwischen-Zeit, Durch-Zeit?<br />
Welchen Spielraum gibt das Gefühl? Ist es ein Gefühl<br />
von Notwendigkeit, Sicherheit oder Wollen?<br />
Geschwindigkeit und Rhythmus der Emotion:<br />
langsam, mittelmäßig, schnell, gleichmäßig,<br />
ungleichmäßig usw.<br />
Das Kriterium, woran sich die Emotion orientiert und<br />
durch das Gefühl evaluiert und bewertet wird.<br />
Auf etwas zugehen, von etwas weggehen<br />
Ist der Test, wie eine Annäherung in Richtung des<br />
wünschenswerten Zieles wahrgenommen wird:<br />
a) was schon da ist<br />
b) was noch fehlt<br />
c) Skala<br />
Der relative Grad der emotionalen Kraft: niedrig,<br />
mittel, hoch<br />
Das Ausmaß von subjektiver persönlicher Kontrolle<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 9
Darstellung und Beschreibung<br />
Meiner Erfahrung nach ist die Beschreibung der <strong>Metaprogramme</strong> wie sie<br />
von Gundl Kutschera angeboten wurde eine wesentliche Grundlage zur<br />
Orientierung in <strong>Beratung</strong>sprozessen.<br />
Ich möchte deshalb an dieser Stelle die aus den Strukturmustern<br />
abgeleiteten <strong>Metaprogramme</strong> und einige ihrer Gedanken dazu<br />
auszugsweise anführen (vgl. Kutschera 1995, S. 431 ff.):<br />
„Kraftquelle<br />
Sind wir in Verbindung mit unserer inneren Kraftquelle, können wir<br />
unser Potential leben und sind geschützt, so dass destruktive Kritik uns<br />
nicht trifft und wir uns unseren Zielen entsprechend respektvoll und<br />
liebevoll verhalten können […].<br />
Werte<br />
Richtung, in die wir uns bewegen; Motivation. Werte geben an, ob<br />
Leute sich vorwiegend von etwas wegbewegen oder auf etwas zu […].<br />
Vergleich<br />
Ein weiteres „Organisations-Kriterium“ ist die Ausrichtung des<br />
Bewusstseins und der Wahrnehmung auf Dinge, die fehlen bzw. die da<br />
sind […].<br />
Beliefsysteme<br />
Beliefsysteme geben Rollenbilder und Regeln an, nach denen Werte<br />
gelebt werden. Sie bestimmen, was für uns Wirklichkeit ist, mit<br />
welchem Filter wir unser Umfeld betrachten. Beliefsysteme sind<br />
intensive Gefühle, die absolut bestimmend für Verhalten sind […].<br />
Die 5 Rollen im Arbeits- und Privatbereich<br />
In guten Beziehungen sind die folgenden fünf Rollen im Privat- und<br />
Arbeitsbereich klar vorhanden und klar unterschieden. Klare<br />
Wertvorstellungen, Rollenbilder und Verhaltensmöglichkeiten für jede<br />
dieser Rollen verhindern Schwierigkeiten, Schmerz, Verletzungen und<br />
erhöhen Resonanz und Lebensqualität:<br />
Individuum: Fühlen Sie sich frei, schön, wichtig? Und können Sie Ihre<br />
eigene Resonanz spüren?<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 10
Frau/Mann: Können Sie sich als Mann/Frau akzeptiert und wohl<br />
fühlen?<br />
Hierarchie: Können Sie bewusst Verantwortung (Schutzrahmen)<br />
übernehmen oder abgeben […]?<br />
Gleiche Ebene/spielen: Spielen heißt neugierig sein und entdecken.<br />
Gelingt es Ihnen in Ihrer Partnerschaft/Familie und in Teamarbeiten<br />
gemeinsam neugierig zu sein und zu entdecken?<br />
Umwelt/soziales Umfeld: Wie werden die Beziehungen mit der<br />
Nachbarschaft, mit der Natur, mit Freunden usw. gelebt?<br />
Eigenverantwortung – Fremdbestimmung<br />
Modalverben der Möglichkeiten oder der Notwendigkeiten.<br />
Modalwerben geben Informationen darüber, ob wir uns eher unter<br />
Druck (fremdbestimmt) fühlen oder das Gefühl haben,<br />
Wahlmöglichkeiten im Arbeitsbereich wie im Privatleben zu nutzen<br />
(eigenverantwortlich) […].<br />
Modalverben der<br />
Möglichkeit z. B. : können, dürfen, wollen<br />
Notwendigkeit z. B.: müssen, nicht dürfen, sollen<br />
Feedback - Referenz<br />
Eigenreferenz – Fremdreferenz: Orientierung nach eigenen Kriterien<br />
oder an den von anderen. Fremdbestimmte Personen benötigen<br />
dauernd Bestätigung, dagegen können eigenbestimmte Personen viel<br />
länger ohne Bestätigung arbeiten […].<br />
Sinneskanäle - Repräsentationssysteme<br />
Hier wird darauf geachtet, welche Sinneskanäle einer Person zur<br />
Verfügung stehen und welche eventuell fehlen. Um frei sein zu könne,<br />
brauchen wir alle Sinneskanäle.<br />
Visuell (sehen)<br />
Auditiv (hören)<br />
Kinästhetisch (Tastreize, Temperatur etc. spüren, Emotionen<br />
fühlen, Bewegung wahrnehmen)<br />
Olfaktorisch (riechen)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 11
Gustatorisch (schmecken)<br />
Problemlösung und Stress (dissoziiert/assoziiert)<br />
Hier ist entscheidend, ob wir in unseren Gefühlen gefangen sind oder<br />
die Möglichkeit haben, uns selbst in gegebenen Problemsituationen von<br />
einer Beobachterposition aus zu sehen […].<br />
Chunking<br />
Erfassen der Ganzheit und der Einzelteile. Dieses Meta-Programm ist<br />
die Fähigkeit, einerseits den großen Rahmen, den Überblick, das große<br />
Ziel im Auge zu haben (großer Chunk) und andererseits die<br />
Kleinigkeiten, Details, Grundbausteine, die kleinen Schritte<br />
wahrzunehmen (kleiner Chunk), aus denen die Ganzheit besteht[…].<br />
Differenziert werden folgende Ausprägungen:<br />
erst Rahmen – dann Details<br />
erst Einzelheiten – dann Rahmen<br />
nur Rahmen<br />
nur Einzelheiten<br />
Hierarchie von Interessen<br />
In welcher Reihenfolge ordnen Menschen die Wichtigkeit ihrer<br />
Interessen?<br />
Die Interessen werden nach Personen, Plätzen, Aktivität und<br />
Information geordnet.<br />
Wichtigkeit der Balance zwischen „selbst“/„anderen“<br />
Dieses Metaprogramm wird verständlich, wenn es um Fragen der<br />
Beziehungsgestaltung geht.<br />
„Fällt es Ihnen schwer oder leicht, Ihre eigenen Bedürfnisse und<br />
Wünsche anderen mitzuteilen? Haben Sie genug Zeit für sich selbst?“<br />
Differenziert werden die Positionen<br />
selbst<br />
andere<br />
beides<br />
Zeit speichern<br />
Wie wir Erinnerungen und zukünftige Ziele/Ereignisse speichern,<br />
scheint für unser Persönlichkeitsbild wesentlich mitentscheidend zu<br />
sein […].“<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 12
Zur besseren Übersicht sind die <strong>Metaprogramme</strong> und die<br />
korrespondierenden Fragen hier noch einmal zusammengefasst<br />
dargestellt:<br />
Fragen zur Auswertung von Meta-Programmen, Kutschera 1995<br />
Einteilung und Struktur von <strong>Metaprogramme</strong>n variieren je nach Autor.<br />
Für James und Woodsmall (vgl. James, Woodsmall 1994 S. 129 ff.)<br />
stellen <strong>Metaprogramme</strong> eines der internen Programme oder Filter dar,<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 13
die wir unbewusst benutzen, um zu unterscheiden, welchen Dingen wir<br />
Aufmerksamkeit schenken.<br />
Sie differenzieren zwischen einfachen und komplexen <strong>Metaprogramme</strong>n.<br />
Die einfachen <strong>Metaprogramme</strong> entsprechen den in Jungs Werken als<br />
Typen implizierten und in den Arbeiten zum MBTI von Isabel Briggs<br />
Myers` hinterlegten Präferenzen:<br />
Introvertierter Typus/extravertierter Typus<br />
Empfindungstypus/intuitiver Typus<br />
Denktypus/Fühltypus<br />
Beurteiler/Wahrnehmer-Präferenz<br />
Ergänzend dazu beschreiben sie ca. 20 komplexe <strong>Metaprogramme</strong>,<br />
wobei die Annahme besteht, dass die vier grundlegenden<br />
<strong>Metaprogramme</strong> durch ihr Zusammenspiel die komplexen<br />
<strong>Metaprogramme</strong> bilden.<br />
Die Erforschung der <strong>Metaprogramme</strong> hat in den letzten Jahren zu<br />
steigender Vielfalt, präziserer Strukturierung und genaueren,<br />
umfassenderen Werkzeugen zur Analyse der <strong>Metaprogramme</strong> geführt.<br />
PC- bzw. Internet-gestützte Analyseverfahren gewährleisten einen<br />
unkomplizierten Einsatz bereits im Vorfeld eines <strong>Beratung</strong>sprozesses.<br />
Ich möchte im nächsten Schritt auf das Thema <strong>Beratung</strong> eingehen und<br />
auf Coaching als eine spezielle <strong>Beratung</strong>sform.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 14
<strong>Beratung</strong> und Coaching<br />
<strong>Beratung</strong><br />
Die <strong>Beratung</strong>slandschaft ist weit gefächert, dementsprechend breit ist<br />
auch das Verständnis von <strong>Beratung</strong> im allgemeinen Sprachgebrauch.<br />
<strong>Beratung</strong> findet in ganz unterschiedlichen Bereichen Platz (Schule,<br />
Erziehung, Organisation, Beziehung, Geldanlage, Versicherung, IT,<br />
Steuer, Weiterbildung, Karriere, Beziehung, Erziehung usw.).<br />
Definitionsbedarf entsteht aus meiner Sicht aus der Notwendigkeit der<br />
Abgrenzung zwischen einzelnen <strong>Beratung</strong>sfeldern und vor allem in<br />
Bezug auf eine Grenzziehung zwischen <strong>Beratung</strong> und Therapie.<br />
Dietrich definiert <strong>Beratung</strong> folgendermaßen:<br />
„<strong>Beratung</strong> ist in ihrem Kern jene Form einer interventiven und<br />
präventiven helfenden Beziehung, in der ein Berater mittels<br />
sprachlicher Kommunikation und auf der Grundlage anregender und<br />
stützender Methoden innerhalb eines vergleichsweise kurzen<br />
Zeitraumes versucht, bei einem desorientierten, inadäquat belasteten<br />
oder entlasteten Klienten einen auf kognitiv-emotionale Einsicht<br />
fundierten aktiven Lernprozess in Gang zu bringen, in dessen Verlauf<br />
seine Selbsthilfebereitschaft, seine Selbsterneuerungs-fähigkeit und<br />
seine Handlungskompetenz verbessert werden können.“ (Brem-Gräser<br />
1993, S. 13)<br />
Mit dieser Definition werden wesentliche Punkte beraterischer<br />
Tätigkeit und Haltung vermittelt:<br />
<strong>Beratung</strong> zielt darauf ab, Lernprozesse zu initiieren.<br />
<strong>Beratung</strong> ist ein zeitlich begrenzter Prozess.<br />
Menschen besitzen die Fähigkeit zur Selbststeuerung und Selbsthilfe;<br />
es ist eine zentrale <strong>Beratung</strong>saufgabe, darauf aufzubauen und diese<br />
Kräfte zu mobilisieren.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 15
Veränderung kann grundsätzlich nur von KundInnen selbst<br />
herbeigeführt werden.<br />
Aufgabe des Beraters, der Beraterin dabei ist es, den Klienten dabei<br />
zu unterstützen und anzuregen, Vertrauen in seine eigenen<br />
Veränderungsmöglichkeiten zu entwickeln bzw. weiter auszubauen.<br />
Gerade weil <strong>Beratung</strong> in der Praxis sehr vielschichtig und<br />
vielfältig ist, gewinnt die Frage nach solchen „übergeordneten<br />
Gemeinsamkeiten“ an Bedeutung.<br />
In der Folge erscheint es dann einfacher, über differenzierte<br />
Blickwinkel wie Hintergrund, Zielsetzung, Haltung, Methodik usw. die<br />
besonderen Charakteristika unterschiedlicher <strong>Beratung</strong>sfelder<br />
herauszuarbeiten.<br />
Sonja Radatz bietet ein Modell an, das, ursprünglich von Ed Schein<br />
entwickelt, drei <strong>Beratung</strong>sform-Prototypen differenziert, die jeweils in<br />
der Haltung des Beraters, der Beraterin bzw. in den kundenseitigen<br />
Anforderungen an den <strong>Beratung</strong>sprozess zum Ausdruck kommen (vgl.<br />
Radatz 2000, S. 88 ff):<br />
<strong>Beratung</strong>sform…<br />
Expertenberatung<br />
Zentrale Anforderung…<br />
Nehmen Sie mir mein Problem von den<br />
Schultern und lösen Sie es!<br />
Arzt-Patienten-<strong>Beratung</strong> Sagen Sie mir, wo/was mein Problem<br />
ist, nehmen Sie es mir dann von<br />
meinen Schultern und lösen Sie es!<br />
Coaching-<strong>Beratung</strong><br />
Helfen Sie mir dabei, dass ich erkenne,<br />
wo mein Problem liegt und<br />
unterstützen Sie mich bei meinen<br />
daran angrenzenden Lösungsversuchen!<br />
<strong>Beratung</strong>sformen lassen sich auch bezogen auf ihre grundlegende<br />
Orientierung hin zuordnen.<br />
Michael Tomaschek (Österreichischer Coaching Dachverband 2000,<br />
http://www.coachingdachverband.at/index_html?sc=285980015)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 16
versucht, Personenzentrierung, Fach- und Organisationsorientierung als<br />
entsprechende Richtungen einzuführen und positioniert<br />
unterschiedliche <strong>Beratung</strong>sformen in dem so geschaffenen<br />
Koordinatensystem:<br />
Solche Zuordnungen bieten<br />
trotz einer gewissen<br />
Unschärfe praktische<br />
Anhalte für die Ziel- und<br />
Rollenklarheit in <strong>Beratung</strong>sprozessen.<br />
Positionierung von <strong>Beratung</strong>sformen: Tomaschek 2000<br />
Coaching nimmt als ziel-,<br />
lösungs- und ressourcenorientierte<br />
<strong>Beratung</strong>sform<br />
für Führungskräfte einen<br />
sehr zentralen Raum ein,<br />
zurückzuführen vielleicht<br />
auf einen breiten Themenansatz,<br />
der mit Führungsrollen<br />
verbunden ist.<br />
Auch Prozessmodelle sind in der <strong>Beratung</strong> häufig anzutreffen. Mögliche<br />
Nutzen dieser Modelle liegen in einem transparenten Arbeitsansatz,<br />
klaren Arbeitsschritten und einem evaluierbaren Abschluss von<br />
<strong>Beratung</strong>sprozessen.<br />
Schneider (vgl. Schneider 2001, S. 150) fasst grundlegende Modelle, wie<br />
das <strong>Beratung</strong>smodell nach G. und R. Lippitt oder das Phasenmodell<br />
nach Grinell übersichtlich zusammen.<br />
König und Vollmer (vgl. König & Vollmer 2002, S. 122 ff) haben<br />
folgende Einteilung vorgenommen:<br />
1. Orientierungsphase<br />
2. Klärungsphase<br />
3. Veränderungsphase<br />
4. Abschlussphase<br />
Diese Grundstruktur ist in der Praxis in unterschiedlichen Varianten<br />
anzutreffen.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 17
Die Orientierungsphase, hat das Ziel, eine gemeinsame Definition der<br />
<strong>Beratung</strong>ssituation festzulegen und den <strong>Beratung</strong>sprozess damit<br />
transparent zu machen.<br />
Die Ausgangssituation der <strong>Beratung</strong> (mit Fokus auf Prozessberatung)<br />
umfasst:<br />
die Ausgangslage, das „Problem“ des Kunden, der Kundin<br />
die Verantwortung des Kunden, der Kundin für die Lösung,<br />
die Darstellung der Beraterrolle,<br />
das Festlegen der Art der <strong>Beratung</strong>.<br />
Die anschließende Klärungsphase dient der detaillierteren Darstellung<br />
des Problems durch den Kunden, der Kundin.<br />
In dieser Phase werden auch bisherige Lösungsversuche, das bezogene<br />
Kontextsystem, vorhandene Ressourcen, Lösungsvorstellungen und<br />
deren Erfolgskriterien und weitere Parameter geklärt.<br />
In der Veränderungsphase geht es vorerst um die Entwicklung und<br />
Bewertung von konkreten Lösungsvarianten. In der Folge sind Kraft und<br />
Motivation für die geplante Änderung einerseits und zum anderen die<br />
Entwicklung konkreter Handlungsschritte in Richtung Veränderung die<br />
wesentlichen Themen.<br />
Die Abschlussphase zielt auf Ergebnissicherung. <strong>Beratung</strong> ist<br />
letztendlich auf den Veränderungswillen und die Veränderungsbereitschaft<br />
des Kunden, der Kundin angewiesen, transferunterstützende<br />
Vereinbarungen nehmen hier deshalb einen<br />
wesentlichen Raum ein.<br />
<strong>Beratung</strong> spielt sich auf einer klaren Handlungsebene ab.<br />
Nachvollziehbare Zeit-, Ziel- und Strukturbezüge machen <strong>Beratung</strong> aus<br />
und grenzen sie zudem auch von therapeutischen Interventionsformen<br />
ab.<br />
Unter bestimmten Rahmenbedingungen sind <strong>Beratung</strong>sprozesse<br />
Lernprozesse, dies gilt besonders für die Coaching-<strong>Beratung</strong>en im<br />
Verständis von Radatz in Verbindung mit einem handlungs- und<br />
leistungsorientierten Lernverständnis:<br />
„Die kurze Definition des Lernens kann heißen: Lernen ist die innere<br />
Organisation von Wissen und Fertigkeiten, die sich das Individuum in<br />
der Interaktion mit seiner Umwelt aneignet, um handlungs- und<br />
leistungsfähiger zu werden.“ (Kron 2009, S. 55)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 18
Je mehr „Hilfe zur Selbsthilfe“ als übergeordneter Ansatz in der<br />
<strong>Beratung</strong> gesehen wird, je mehr auch systemische Ansätze in die<br />
<strong>Beratung</strong> einfließen (die auf Rolle, Kontext Beziehung und<br />
Individualität der „Kundenwelt“ usw. achten), desto mehr gelingt es,<br />
im Sinn von Lernen relevante <strong>Beratung</strong>sprozesse zu entwickeln.<br />
Coaching<br />
Bei der Begleitung von Veränderungsprozessen kommt dem Coaching<br />
eine besondere Rolle zu. Coaching ist in meinem Verständnis u. a.<br />
charakterisiert durch folgende Punkte:<br />
Coaching ist ein interaktiver personenzentrierter <strong>Beratung</strong>s- und<br />
Begleitungsprozess primär bezogen auf den beruflichen Kontext.<br />
Dementsprechend dominieren im Coaching Arbeitswelt-bezogene,<br />
fachlich-sachliche und/oder psychologisch-soziodynamische Fragen<br />
bzw. Problemstellungen.<br />
Coaching findet auf einer tragfähigen Beziehungsbasis statt, die durch<br />
Freiwilligkeit, gegenseitigem Respektieren und Vertrauen begründet ist<br />
und eine gleichwertige Ebene des Kooperierens bedingt.<br />
Coaching zielt immer auch auf eine Förderung von Selbstreflexion und<br />
Selbstwahrnehmung ab und sucht nach ressourcen- und lösungsorientierten<br />
Kompetenzen, die gefördert und aktiviert werden können.<br />
Coaching ist lösungsorientiert und braucht daher evaluierbare Kriterien<br />
für das Erreichen konkreter Ziele. Coaching orientiert sich ganz eng am<br />
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. Unsere KundInnen sind einsatzfähig,<br />
arbeitsfähig und beziehungsfähig.<br />
Prozessmodell<br />
Ich gehe in meiner Arbeit von einem Coaching - Prozessmodell aus, das<br />
klar gegliedert und transparent darstellbar ist. Übergeordnet ist der<br />
Prozess in Anlauf-, Arbeits- und Abschlussphase geteilt, in der<br />
Arbeitsphase werden neun Stufen unterschieden.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 19
Das Bild der Treppe, das sich daraus ergibt, steht auch für klare<br />
Schritte, die zu gehen sind, um den Prozess gemeinsam erfolgreich zu<br />
gestalten.<br />
Auf den ersten Blick mag sich hier der Gedanke einer gewissen<br />
Überstrukturiertheit aufdrängen, die in der Praxis unter Umständen zu<br />
einschränkend und zu verbindlich sein könnte.<br />
Meiner Erfahrung nach ist dies dann nicht der Fall, wenn die Struktur<br />
auch dazu genutzt wird, den Coachingprozess gegenüber den Coachees<br />
transparent darzustellen. Ich skizziere die einzelnen Schritte beim<br />
Erstgespräch und beziehe mich in den Folgegesprächen immer wieder<br />
auf die einzelnen Phasen. Für die KundInnen entsteht dadurch ein<br />
nachvollziehbarer Arbeitsrahmen, den sie zum Beispiel dadurch aktiv<br />
nutzen, indem sie auf eine Phase ein besonderes Schwergewicht legen<br />
oder eine Phase als „erledigt“ für sich abhaken.<br />
Ziele und Inhalte der<br />
einzelnen Prozessschritte<br />
sind in der Folge kurz<br />
beschrieben.<br />
Die dabei angeführten<br />
Inhalte verstehen sich als<br />
mögliche Richtungen und<br />
Orientierungspunkte, die<br />
für die Prozessphasen<br />
charakteristisch sind.<br />
Schritte im Coachingprozess, Schmidt 2006<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 20
Arbeitsphase<br />
Anlaufphase<br />
Ein wesentliches Element dieser Phase ist der Erstkontakt bzw. das<br />
Erstgespräch. Primär geht es darum, Orientierung für beide Seiten zu<br />
schaffen und Informationen zu geben bzw. zu erhalten.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kontext und Bedarf des Kunden, der Kundin<br />
Die Themen und Ziele (Auftragsklärung)<br />
Frühere Lösungswege (erfolgreiche, erfolglose,<br />
problemerhaltende...)<br />
Das Gute am Ist-Zustand<br />
Der Weg zum Coach<br />
Die Rolle, Arbeitsweise, Werte und das Selbstverständnis des<br />
Coach<br />
Rahmen des Coachings (Dauer, Kosten, Organisation)<br />
Rapport und Wertschätzung gegenüber dem Anliegen und den bereits<br />
eingeleiteten Lösungsversuchen des Kunden sind zentrale<br />
Erfolgskriterien für die spätere Coaching-Beziehung.<br />
Kontakt aufnehmen<br />
Umfeld und Setting angenehm und professionell gestalten<br />
Ablauf des Coachingprozesses klären<br />
Rapport aufbauen<br />
Prozess warmlaufen lassen<br />
Orientierung schaffen<br />
Führung durch neutrale Fragen<br />
Situationsschilderung ermöglichen: Situation, Thema, Wunsch,<br />
Bedürfnis, Problem usw.<br />
Unterstützung zum Problemverständnis geben<br />
Probleme hinter dem Problem klären<br />
Das Gute am Problem entwickeln<br />
Klarheit fördern: Bilder, Metaphern, Symbole, Zeichnungen usw.<br />
Ziele klären<br />
Zusammenfassen, was da ist<br />
Bedürfnisse, Motive, Vorstellungen ansprechen<br />
Ziele und Metaziele klären<br />
Haltungsziele und Handlungsziele differenzieren<br />
Zielformulierung einleiten<br />
Zielqualität und Zielökologie überprüfen (Mindestkriterien)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 21
Abschlussphase<br />
Arbeitsphase<br />
Absicht stärken<br />
Klärung von Veränderungsbereitschaft<br />
Auf „Preise“ und Hindernisse achten<br />
Ins Ziel hineinführen (VAKOG, Bewegung, Haltung usw.)<br />
Ressourcen aufbauen und Lösungen entwickeln<br />
Ressourcen entwickeln und Stärken<br />
Konkrete Handlungen ableiten<br />
Umsetzung sichern<br />
Aktionsplan erarbeiten<br />
Schritte in die Praxis überleiten<br />
Abschließen<br />
Aktuellen Prozess zusammenfassen und evaluieren<br />
Einen Schritt in die Zukunft setzen<br />
Es wird für den Abschluss bereits zu Beginn des Coachings eine letzte<br />
Sitzung reserviert, in welcher der Gesamtprozess reflektiert und eine<br />
Bestandsaufnahme der erreichten Veränderungen gemacht wird.<br />
<br />
<br />
Rückblick, Anblick, Ausblick<br />
Evaluation Gesamtprozess<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 22
<strong>Metaprogramme</strong> und Veränderung<br />
Systemische Modelle der Veränderungsarbeit finden sich in ganz<br />
unterschiedlichen Schulen, von der Familientherapie Virginia Satirs<br />
über die Mailänder Schule bis hin zu lösungsfokussierter Kurztherapie<br />
und systemischer Aufstellungsarbeit.<br />
All diesen Verfahren liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass die Probleme<br />
der Coachees auf Wechselwirkungen basieren, die zwischen<br />
Systemelementen, Menschen, Persönlichkeitsanteilen, Erfahrungen,<br />
Zeitabschnitten usw. entstehen.<br />
James und Woodsmall beschreiben das Veränderungsmodell des NLP<br />
folgendermaßen (vgl. James, Woodsmall 1994, S. 111 ff.):<br />
Im NLP beschäftigen wir uns mit den „Inneren Prozessen“, „Inneren<br />
Zuständen“ und „Äußerem Verhalten“.<br />
Innere Prozesse stellen die von uns benutzten inneren Verarbeitungsstrategien<br />
dar, im wesentlichen das „WIE“ – wie wir etwas tun, was wir<br />
tun.<br />
Innere Zustände sind die Gefühlszustände, die ein Individuum erlebt<br />
und die das „Warum“ bewirken – warum wir etwas tun, was wir tun.<br />
Äußeres Verhalten stellt das „Was“ dar – was das Zusammenwirken von<br />
Inneren Prozessen und Inneren Zuständen hervorbringt.<br />
Wir verändern das „äußere Verhalten“ einer Person, indem wir ihre<br />
Physiologie verändern. Wir verändern ihre „Inneren Prozesse“ durch die<br />
Arbeit an Strategien. „Innere Zustände“ werden beeinflusst durch die<br />
Veränderung der Filter und durch Ankern“.<br />
<strong>Metaprogramme</strong> beeinflussen eigentlich alle drei Bereiche, besonders<br />
aber die „Inneren Zustände“. Sie bilden Ansatzpunkte für Veränderung.<br />
Gundl Kutschera (Kutschera 1995, S. 445) schreibt dazu: „Alle Meta-<br />
Programme können spezifisch trainiert, entwickelt und eingeübt<br />
werden. Werte und Beliefs können überprüft und gegebenenfalls<br />
verbessert, erweitert, bereinigt und neu gebildet werden.“<br />
Ein ergänzendes Modell zum besseren Verständnis der <strong>Metaprogramme</strong><br />
und zum Veränderungspotenzial, das darin enthalten sein kann , bilden<br />
die Logischen Ebenen von Robert Dilts (Dilts 1999, S. 198 ff.).<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 23
Das Modell der Logischen Ebenen beschreibt "Ebenen der Veränderung".<br />
Es liefert Informationen über den besten Punkt, an dem eine<br />
Veränderungsarbeit ansetzen kann. Die Logischen Ebenen dienen der<br />
Klärung, wo z.B. ein Problem, ein Ziel oder die eigene Mission<br />
angesiedelt ist. Die Veränderungsarbeit setzt dann in der Regel auf der<br />
nächst höheren Ebene an.<br />
Die Logischen Ebenen sind hierarchisch gegliederte Ebenen des<br />
Denkens, die sich wechselseitig beeinflussen.<br />
Die Funktion jeder Ebene ist es,<br />
die Information auf der<br />
darunterliegenden Ebene zu<br />
organisieren. Veränderungen auf<br />
einer höheren Ebene haben<br />
notwendigerweise auch<br />
Veränderungen auf darunterliegenden<br />
Ebenen zur Folge.<br />
Eine Änderung auf einer der<br />
Die Logischen Ebenen des NLP, Stumpf 1995<br />
unteren Ebene kann, muss aber<br />
nicht, die darüber liegenden Ebenen beeinflussen. Die Regeln, nach<br />
denen etwas auf einer bestimmten Ebene geändert wird, unterscheiden<br />
sich von jenen, nach denen auf einer anderen Ebene etwas geändert<br />
wird (vgl. NLPedia ,<br />
http://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Logische_Ebenen).<br />
Nach Arne Maus (vgl. Maus 2009, S. 38), er bezeichnet <strong>Metaprogramme</strong><br />
als Denkpräferenzen, sind <strong>Metaprogramme</strong> klar der Ebene der<br />
Überzeugungen und Werte zuzuordnen, also der Ebene 4 der o. a.<br />
Struktur der Logischen Ebenen.<br />
Maus geht davon aus, dass Überzeugungen (Glaube, Beliefs), Werte und<br />
Denkpräferenzen sich gegenseitig beeinflussen, indem die<br />
Denkpräferenzen eine „Art Kleber“ zwischen Werten und<br />
Überzeugungen bilden.<br />
Die Logischen Ebenen bieten für Coachingprozesse zusätzliche<br />
Möglichkeiten, Intention und auch Interventionen gut in einen<br />
transparenten Rahmen einzuordnen. Klar kommuniziert, erscheint es<br />
meiner Erfahrung nach für die Coachees nachvollziehbar und ebnet<br />
deshalb auch den Weg, mit Werten, Haltungen, Überzeugungen usw.<br />
arbeiten zu dürfen.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 24
<strong>Metaprogramme</strong> und Coaching<br />
Motivation und Erwartungen<br />
Das Bewusstmachen eigener <strong>Metaprogramme</strong> war für mich eine<br />
wichtige Erfahrung. Dabei ist es mir weniger um die absoluten<br />
Erkenntnisse gegangen („So ist es….“), mehr um weiterführende Fragen<br />
in Bezug auf die Verbindung der Metaprogrammstruktur mit den<br />
Anforderungen einer spezifischen Rolle.<br />
Ich bin dabei davon ausgegangen, dass meine eigene Rolle als Berater<br />
und Coach definierbare und beschreibbare Fähigkeiten und Fertigkeiten<br />
fordert, die von tiefer liegenden <strong>Metaprogramme</strong>n gestützt oder aber<br />
weniger gestützt werden. Mehr Klarheit über die zu Grunde liegenden<br />
<strong>Metaprogramme</strong> sollte also zu klareren Ansatzpunkten für<br />
Entwicklungs- und Lernschritte führen.<br />
Das Thema hat sich durch meine NLP-Ausbildungen gezogen mit<br />
grundsätzlich positiven Erfahrungen und ich habe dementsprechend<br />
begonnen, <strong>Metaprogramme</strong> in meine <strong>Beratung</strong>sarbeit verstärkt<br />
einzubeziehen.<br />
Für die Konzeptentwicklung waren folgende Fragen für mich von<br />
zentraler Bedeutung:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wie können <strong>Metaprogramme</strong> effizient erhoben und gemessen<br />
werden?<br />
Wie kann sichergestellt werden, dass sich der Kunde, die Kundin in<br />
dem Ergebnis wiederfindet, also einen Bezug zu seiner/ihrer<br />
Realität herstellt?<br />
Wie können die für einen Veränderungsprozess wichtigen<br />
<strong>Metaprogramme</strong> identifiziert werden?<br />
Wie trainierbar sind einzelne <strong>Metaprogramme</strong>?<br />
Wie kann ein Entwicklungsmodell ausschauen, das <strong>Metaprogramme</strong><br />
einbezieht und zugleich eine Verbindung zu anderen Rollenaspekten<br />
darstellt?<br />
Grundsätzlich ist es möglich, <strong>Metaprogramme</strong> über gezieltes Fragen zu<br />
erheben. Dabei sind Strukturen und Unterlagen hilfreich, wie<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 25
eispielsweise das Arbeitsblatt von Gundl Kutschera (vgl. Kutschera<br />
1995, S 506).<br />
Das Verfahren ist ziemlich zeitaufwendig und wahrscheinlich auch<br />
ziemlich fehleranfällig, auch wenn eine strukturierte Erhebung, wie<br />
beispielsweise das vorgeschlagene Arbeitsblatt verwendet wird.<br />
Ich bin deshalb recht schnell auf andere Verfahren ausgewichen und<br />
konnte dementsprechend Erfahrungen sammeln mit dem Language and<br />
Behavior (LAB-) Profil (vgl. Charvet 2010, S. 244) von Rodger Bailey<br />
oder dem Nautilus-Persönlichkeitskurs von Jay Arthur und Gregory<br />
Engel (vgl. Arthur, Engel 1995).<br />
Seit 2006 arbeite ich mit dem von Arne Maus entwickelten Identity<br />
Compass ® . Das softwaregestützte Profilsystem misst über 20<br />
Denkpräferenzen und vernetzt diese teilweise mit weiterführenden<br />
Modellen aus der Kommunikations- und Motivationspsychologie.<br />
Einbindung der Metaprogrammanalyse<br />
Meine konzeptionellen Überlegungen zum Lern- und<br />
Entwicklungsmodell das hinter einem Coachingprozess steht,<br />
beinhalten mehrere Orientierungspunkte, die in der nachfolgenden<br />
Grafik zusammengefasst sind.<br />
Orientierungen im Lern- und Entwicklungsprozess,<br />
Schmidt 2006<br />
Orientierung an der<br />
professionellen Rolle, wobei<br />
Verhalten und Identifikation im<br />
Vordergrund stehen. Die<br />
Rollenkriterien werden<br />
gemeinsam mit dem Kunden,<br />
der Kundin entwickelt und<br />
bilden einen Rahmen für den<br />
gesamten Coachingprozess. Der<br />
Begriff der Identifikation steht<br />
dabei für die subjektive<br />
„Innenkraft“ der Rolle.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 26
Orientierung an den wesentlichen Aufgaben und Arbeitsfeldern, die<br />
die Rolle ausmachen. Damit wird die Rolle in den wesentlichen<br />
Elementen differenzierter dargestellt. Häufig ist dies mit direkten<br />
Gewinnen für die Coachees verbunden, schon weil auch<br />
Erfolgskriterien, Außenerwartungen und eigene Blickwinkel klarer<br />
werden.<br />
Orientierung an Kompetenzen nach folgender Definition des<br />
Kompetenzbegriffs: „Kompetenzen sind aus dieser Sicht zunächst<br />
Kombinationen kognitiver, motivationaler oder sozialer Fähigkeiten<br />
oder Potentiale, wobei auch moralisch-ethische Komponenten eine<br />
wichtige Rolle spielen. Kompetenzen sind in ihrer jeweiligen<br />
Ausprägung in komplexe Handlungssysteme eingebettet und lassen sich<br />
daher nicht durch grundlegende kognitive Fähigkeiten oder einfache<br />
Fertigkeiten charakterisieren.“ (Lang-von Wins, Triebel 2006, S. 37).<br />
Kompetenzorientierung gewährleistet in diesem Zusammenhang auch<br />
eine klare Darstellung und transparente Reflexionsmöglichkeit von<br />
Lerninhalten. Als Grundstruktur ist das klassische Feldermodell mit<br />
Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen hinterlegt.<br />
Im Coachingprozess werden Veränderungsschritte nach Möglichkeit auf<br />
der Basis von Kompetenzen formuliert.<br />
Orientierung an Präferenzen: Gemeint ist damit die Berücksichtigung<br />
individueller Denkpräferenzen/<strong>Metaprogramme</strong>, die die KundInnen in<br />
ihre Berufsrolle einbringen und die eine wesentliche Grundlage von<br />
Ressourcen, Potentialen und individuellen Lernfeldern darstellen.<br />
Die Denkpräferenzen werden im Vorfeld mittels Identity Compass<br />
erhoben, die Auswertung mit dem Coachee besprochen und konkret<br />
immer dann herangezogen, wenn es im Coachinggespräch um<br />
Verhaltensänderung geht.<br />
Orientierung an aktivitäts- und umsetzungsorientierten<br />
<strong>Training</strong>smodellen: Hier geht es vor allem um die Frage, wie Lern- und<br />
Übungsphasen strukturiert werden können, damit sie möglichst<br />
erfolgversprechend ablaufen. In der Praxis kommt das zum Tragen,<br />
wenn kurze <strong>Training</strong>sphasen in einen Coachingprozess zu integrieren<br />
sind. Diese werden nach didaktischen Modellen wie z. B. dem<br />
Phasenmodell von Hoberg konzipiert und umgesetzt (vgl. Hoberg 2004,<br />
S. 181 ff.)<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 27
Die Berücksichtigung der <strong>Metaprogramme</strong> unterstützt den<br />
Coachingprozess auf mehreren Ebenen:<br />
Aus dem Ist-Profil können bezogen auf die Rolle des Coachees<br />
unterstützende Präferenzen abgeleitet werden, die sich im Coaching<br />
weiter entwickeln und ausbauen lassen. Damit verbunden ist eine<br />
Einsparung bzw. Verschiebung von <strong>Beratung</strong>szeit zu Gunsten von<br />
Ressourcenaufbau und Lösungsentwicklung.<br />
Abgeleitet von den Rollenkriterien kann ein Soll-Profil entwickelt<br />
werden, das in der Folge auch Präferenzdefizite aufzeigen kann. Daraus<br />
abgeleitet werden konkrete Entwicklungsschritte, die auf die<br />
erhobenen Defizite, also Lernfelder abzielen.<br />
Präferenzen sind rollenspezifisch und damit kontextabhängig. Gerade<br />
bei einschränkend erscheinenden Präferenzen kann dementsprechend<br />
rasch nach Kontexten gefragt werden, in denen diese Präferenzen<br />
erfolgreich eingesetzt werden. Damit liegt ein Veränderungsschritt<br />
nicht im Erlernen von Neuem, es geht mehr darum, Bekanntes von<br />
einer Rolle in eine andere zu übertragen.<br />
Kompetenzorientierte <strong>Training</strong>sphasen berücksichtigen die<br />
Präferenzen, indem Zielsetzungen und <strong>Training</strong>sinhalte auch für<br />
spezifische Denkpräferenzen formuliert und vereinbart werden.<br />
Praxisfall<br />
Meine Kundin, Frau D, arbeitet in der Verwaltung einer großen<br />
Pflegeorganisation. Durch Freiwerden der Position der<br />
Verwaltungsdirektorin kommt es zu einem Nachrücken von Frau D in<br />
diese Leitungsfunktion. Nach ca. acht Monaten in dieser Funktion ist<br />
Frau D knapp davor, die Position aufzugeben und begründet dies mit<br />
Überforderung, Stress aber auch mit fehlender Unterstützung von<br />
Seiten der MitarbeiterInnen, die sie übernommen hat. Frau D ist 45<br />
Jahre alt und alleinstehend.<br />
Die Organisation bietet die Möglichkeit, die Situation im Rahmen eines<br />
Coachingprozesses zu reflektieren und nach konstruktiven<br />
Möglichkeiten zu suchen, die Leitungsrolle erfolgreich zu füllen.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 28
Ein erstes Kennenlernen verläuft positiv, der Prozess wird abgesteckt<br />
und ein Identity Compass © Profil bereitgestellt. Die Ergebnisse liegen<br />
also vor der ersten Coachingsitzung vor.<br />
Die Auswertung umfasst ca. 30 Seiten, die wichtigsten Ergebnisse<br />
möchte ich hier zeigen, mit den damit verbundenen Überlegungen im<br />
Vorfeld des Coachingprozesses.<br />
Schnecke Denkpräferenzen: 1. Interview im Vorfeld<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 29
Die Abbildung zeigt die erhobenen Ergebnisse in Schneckenform.<br />
Stellt man sich eine Uhr vor, sind es die Präferenzausprägungen von<br />
12.00 – 15.00 Uhr, die primär zum Einsatz kommen. Wichtig ist in<br />
diesem Zusammenhang auch an die teilweise multipolare Ausprägung<br />
von <strong>Metaprogramme</strong>n zu denken, im ersten Viertel der Schnecke<br />
erscheint jeweils die ausgeprägte Polarität. Auf die wesentlichen<br />
Ergebnisse werde ich später detailliert eingehen.<br />
Der Nutzungswert liegt mit 68% im „grünen Bereich“. Die Nutzung gibt<br />
an, in welcher Stärke (Skala von 0 – 100%) sich die Pole der<br />
Denkpräferenzen ausprägen. Die Prozentzahl liegt mit 60 – 70% in der<br />
Norm; starke Abweichungen nach oben, also in Richtung 100% kommen<br />
beispielsweise zu Stande, wenn KundInnen beim Beantworten der<br />
Fragen stark aus einem Wunschbild heraus agieren.<br />
Der Präferenzwert zeigt den durchschnittlichen Unterschied zwischen<br />
den Polaritäten der gemessenen <strong>Metaprogramme</strong> bzw.<br />
Denkpräferenzen, 18% lassen auf eine Person schließen, die einen<br />
hohen Flexibilitätsgrad innerhalb der Denkpräferenzen hat.<br />
Ansatzpunkte für weitere Überlegungen bietet die detaillierte<br />
Darstellung der Denkpräferenzen. Diese sind in vier Gruppen<br />
gegliedert:<br />
Wahrnehmung<br />
Motivationsfaktoren<br />
Motivationsverarbeitung<br />
Informationsverarbeitung<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 30
Denkpräferenzen im Detail: 1. Interview im Vorfeld<br />
Für eine Erstbetrachtung sind nicht alle Denkpräferenzen von gleicher<br />
Bedeutung, ich bevorzuge eher einen rollenspezifischen Fokus und<br />
konzentriere mich in diesem Fall auf das Thema Führung.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 31
Damit ergeben sich Schwerpunkte in den Bereichen Sinneskanal,<br />
Primäres Interesse, Perspektive, Motiv, Richtung, Referenz,<br />
Planungstil, Vergleichsmodus, Erfolgsstrategie, Arbeitsorientierung,<br />
Primäre Aufmerksamkeit und Managementstil.<br />
Jetzt werden Stichworte und Fragen formuliert, die dann in den<br />
Coachingprozess einfließen.<br />
Wichtig ist dabei, sich klar zu machen, dass der IdentityCompass ®<br />
Auskunft gibt über die in beruflichen Rollen genutzten Denkpräferenzen<br />
und dementsprechend Menschen nicht generell typologisiert.<br />
Die Stichworte bzw. Fragen, die ich mir zur Vorbereitung notiert habe:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sinneskanäle flexibel (das ist immer dann gegeben, wenn die<br />
Unterschiede nicht mehr als 20% ausmachen), hoch im Fühlen: Wie<br />
wird das empfunden und wie stützt das die Führungsrolle? Wenn<br />
Fühlen hoch ausgeprägt ist, berichten KundInnen manchmal von<br />
verkürzter Kommunikation und Interaktion, weil beispielsweise<br />
negative Gefühle die Aufmerksamkeit für laufende Prozesse<br />
reduzieren.<br />
Primäres Interesse mit Schwerpunkten auf Menschen, Aktivität und<br />
Wissen: Wissen hinterfragen, steht dahinter eher Neugier oder ein<br />
Defizitempfinden?<br />
Perspektive flexibel (Unterschiede bis 20%-Punkte): Wie kann<br />
Dissoziation gelingen und wie wird das empfunden?<br />
Motive flexibel mit Tendenz zu Einfluss ist möglicherweise eine<br />
starke Ressource für die Führungsrolle. Wird das so empfunden?<br />
Referenz external höher ist anzusprechen; in vielen Fällen schafft<br />
das Abhängigkeiten, die sich negativ oder belastend auswirken<br />
können. Besonders in Führungsrollen kann das zu Abhängigkeiten<br />
führen, wenn beispielsweise MitarbeiterInnen zu stark für die eigene<br />
Orientierung herangezogen werden.<br />
Vergleichsmodus Ähnlichkeit: Könnte nützlich sein in Bezug auf<br />
Verwaltungsarbeit, weniger allerdings in Verbindung mit Führung<br />
Erfolgsstrategie und Arbeitsorientierung flexibel, auch das könnten<br />
wichtige Ressource sein<br />
Arbeitsstil Teamspieler und Primäre Aufmerksamkeit auf Fürsorge<br />
sind bemerkenswert; welches Bild von Führung steht dahinter?<br />
Managementstil hoch selbstreflektiv ist ebenfalls zu klären; das<br />
dahinter liegende Metaprogramm ist die Regelstruktur, also die Art<br />
und Weise, wie eigene Bedürfnisse mit Bedürfnissen anderer<br />
abgestimmt werden.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 32
Die ersten Coachingsitzungen waren der Orientierung und Zielfindung<br />
gewidmet. Ich konnte dabei eine kurze allgemeine Einführung in das<br />
Thema Denkpräferenzen vermitteln. Entsprechend meiner Vorbereitung<br />
konnte ich Schwerpunkte setzen und mit praktischen Erfahrungen von<br />
Frau D vernetzen.<br />
Frau D bestätigte die ausgeprägte Gefühlskomponente (Wahrnehmung)<br />
und berichtete auch von praktisch immer präsenten Gedanken<br />
(Managementstil selbstreflektiv), die eigentlich nie aufhören. Frau D<br />
sah sich nicht in der Lage, ein für sie akzeptables Bild von Führung zu<br />
skizzieren, es bestanden viele Unklarheiten in Richtung<br />
Verantwortlichkeit und Abgrenzung (Motiv, Referenz, Arbeitsstil,<br />
Primäre Aufmerksamkeit).<br />
Trotz aller Belastungen, die Frau D für mich signalisierte, habe ich den<br />
Eindruck gewonnen, dass Frau D ganz stark hinter der Organisation<br />
steht und vor allem hinter ihren MitarbeiterInnen.<br />
Klarere Zielansätze wurden in der dritten Arbeitsrunde formuliert und<br />
ab dann konsequent bearbeitet, auch mit einem hohen Anteil an<br />
Hausaufgaben und Kommunikation über Mail.<br />
Die wesentlichen Zielableitungen waren:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Genau Festlegung des eigenen Führungsverständnisses und auch der<br />
Grenzen von Führung.<br />
Entwicklung von selbst nachvollziehbaren Erfolgskriterien in der<br />
Führungsrolle.<br />
Kommunikation der erarbeiteten Führungskriterien mit allen<br />
MitarbeiterInnen<br />
Wahrnehmung trainieren mit Schwerpunkt auf den auditiven und<br />
visuellen Kanal.<br />
„Loslassen können“ - Dissoziation trainieren<br />
Zur Unterstützung der ersten beiden Ziele habe ich Frau D ein<br />
Grundkonzept eines Rollenbildes einer Führungskraft angeboten. In<br />
Rahmen von Hausaufgaben hat Frau D die wesentlichen Elemente<br />
(Definition von Führung, Führungskompetenzen, Erfolgskriterien,<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 33
Grenzen usw.) schrittweise formuliert und mit mir kommuniziert.<br />
Letzter Schritt dieser Aufgaben war es, die Ergebnisse auf die<br />
Organisation bzw. alle MitarbeiterInnen zu übertragen, indem<br />
Führungsverständnis und –grundsätze für das Qualitätsmanagementsystem<br />
der Organisation verabschiedet wurden.<br />
Die offene und interessierte Mitarbeit von Frau D hat es möglich<br />
gemacht, recht kreativ an das Wahrnehmungstraining und an das<br />
Thema Dissoziation heranzugehen. In diesem Zusammenhang sind Sehund<br />
Hörstunden entstanden, oder auch eine Phantasiereise, bei der<br />
Gedanken wie bunte Luftballons platzen durften.<br />
Gesamt wurden sechs Coachingsitzungen mit 14 Stunden innerhalb von<br />
zehn Monaten durchgeführt.<br />
Frau D hat beschlossen, die Position zu behalten. Sie beschreibt zum<br />
Prozessende nach wie vor „unter Druck“ zu stehen, allerdings spürbar<br />
reduziert. In diesen zehn Monaten konnte Frau D eine Reihe von<br />
Detailzielen im Organisations- und Führungsbereich ihrer Abteilung<br />
umsetzen, sie hat das Gefühl, die Funktion „besser“ im Griff zu haben<br />
und nicht mehr so ausgeliefert zu sein.<br />
Nach einer Pause von vier Monaten wurde ein weiterer Identity<br />
Compass © durchgeführt, einerseits aus reinem Interesse, wie und ob<br />
sich Veränderungen hier darstellen, zum anderen auch als Basis für<br />
weitere Aktivitäten.<br />
Die Ergebnisse stelle ich auf den Folgeseiten dar, wieder in Form der<br />
Schnecke und der detaillierten Übersicht:<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 34
Schnecke Denkpräferenzen: 2. Interview<br />
Die Schnecke zeigt weitgehend unveränderte Werte für Nutzung und<br />
Präferenz und eine geänderte Reihenfolge der Präferenzpolaritäten im<br />
ersten Viertel.<br />
Betrachtet man die Detaildarstellung, ergeben sich einige spannende<br />
Unterschiede:<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 35
Im Bereich Sinneskanal (alles flexibel) ist das Hören stark ausgebaut,<br />
die Referenz ist verändert (internal gestärkt), der Arbeitsstil ist<br />
verändert (Individualist gestärkt) und der Managementstil hat<br />
gewechselt.<br />
Denkpräferenzen im Detail: 2. Interview<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 36
Meine Gesprächsvorbereitung erfolgt wieder nach dem bereits<br />
geschilderten Ablauf, diesmal mit Fokus auf die Veränderungen:<br />
Stichworte und Fragen zur Vorbereitung:<br />
Sinneskanäle flexibel, Fühlen reduziert , Hören ausgebaut: Welche<br />
Unterschiede ergeben sich daraus im Alltag? Ist das auf die Übungen<br />
zurückzuführen (wurden diese fortgesetzt)?<br />
Perspektive auf Gegenüber ist höher, Beobachterperspektive leicht<br />
reduziert.<br />
Referenz: Internal höher, external leicht reduziert. Wie macht sich<br />
internale Referenz überhaupt bemerkbar? Wie wird sie gespürt?<br />
Arbeitsstil: Der Teamspieler ist reduziert, Individualist erhöht.<br />
Managementstil: Wechsel von Selbstreflektiv auf Managend<br />
Das Reflexionsgespräch dauert ca. eine Stunde. Frau D wirkt<br />
entspannter und gelassener. Ich melde ihr diesen Umstand zurück und<br />
sie bestätigt ihn. Sie erklärt auch, in ihrem Sinn „gut“ unterwegs zu<br />
sein. Besonders stolz sei sie auf ihre Lust zu delegieren, einerseits um<br />
sich selbst zu entlasten, zum anderen aber auch als Lernchance für<br />
bestimmte MitarbeiterInnen.<br />
Die Hör- und Sehstunden sind kein Thema mehr, das Gedankenspiel mit<br />
den Luftballons ist ein häufiges Ritual vor dem Einschlafen…<br />
Wesentlichen Punkte bisheriger Erfahrungen<br />
Meiner Erfahrung nach ist die die Analyse der <strong>Metaprogramme</strong>, wie sie<br />
mittels IdentityCompass ® möglich ist im Coaching nützlich und gut zu<br />
integrieren.<br />
Orientierung und Zielfindung lassen sich verkürzen, der Prozess kommt<br />
schneller auf den Punkt. Die Akzeptanz der Ergebnisse ist sehr hoch,<br />
die KundInnen finden sich in den Ergebnissen gut wieder, unterstützt<br />
wird dies auch durch die ausführliche Beschreibung der Auswertung.<br />
Veränderungsimpulse lassen sich damit zusätzlich auf der Ebene der<br />
<strong>Metaprogramme</strong> initiieren, dies ist eine wertvolle Ergänzung in<br />
Verbindung mit der Verhaltens- und Kompetenzebene.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 37
Die Trainierbarkeit einzelner <strong>Metaprogramme</strong> scheint gegeben, wenn<br />
auch nicht durchgehend und bei allen in gleicher Ausprägung. In diesem<br />
Bereich ist es sicher nötig, weiter gezielt Erfahrungen zu sammeln.<br />
Wichtig ist, den Coachee mit den Ergebnissen nicht „allein zu lassen“.<br />
Ich gebe Auswertungen grundsätzlich nicht ohne persönliches Gespräch<br />
aus der Hand. Wesentlich dabei ist es, besonders darüber zu<br />
informieren, dass es auf dieser Ebene kein „Gut“ oder „Schlecht“ gibt,<br />
dass Präferenzen eine starke Rollenspezifität haben und dass<br />
Präferenzen dementsprechend Rollenanforderungen stark oder eben<br />
weniger unterstützen können.<br />
Die Möglichkeit, Ergebnisse in ein übergeordnetes Modell einzuordnen,<br />
ist für die KundInnen sehr wichtig. Dies lässt sich einfach realisieren,<br />
etwa mit einem Rahmen, den die Logischen Ebenen nach R. Dilts<br />
anbieten. Dadurch werden nicht nur die Ergebniszuordnungen klar, es<br />
entsteht zugleich ein Arbeitsmodell, das sich durch den<br />
Coachingprozess durchzieht.<br />
Für eine reibungslose Arbeit mit den Coachees ist es Bedingung,<br />
Hintergrundwissen zu den einzelnen <strong>Metaprogramme</strong>n bzw.<br />
Denkpräferenzen rasch zur Hand zu haben.<br />
Dazu finden sich detaillierte Beschreibungen auch bei Arne Maus (Maus<br />
2009, S. 51 ff), ergänzt durch wertvolle Hinweise auf Metaprogramm-<br />
Kombinationen.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 38
Kritische Reflexion<br />
Coaching stellt seit mehreren Jahren einen wesentlichen Teil meiner<br />
<strong>Beratung</strong>sarbeit dar, dementsprechend hoch ist auch die Anzahl der<br />
Metaprogrammanalysen, die ich in diesem Rahmen durchführen konnte.<br />
Die Nachfrage nach Coaching nimmt meiner Erfahrung nach im Profitund<br />
Non-Profit-Bereich zu, auch TeilnehmerInnen an<br />
Weiterbildungsprogrammen nehmen diese Dienstleistung vermehrt in<br />
Anspruch, um Themen und Inhalte individuell für sich zu verstärken und<br />
effizienter in der Praxis umsetzen zu können.<br />
Ich positioniere Coaching sehr klar als <strong>Beratung</strong>sform für<br />
Führungskräfte und Entscheidungsträger, auch in Abgrenzung zu<br />
anderen <strong>Beratung</strong>sformen, die in der Lebens- und Sozialberatung und<br />
Unternehmensberatung gängig sind. Dabei fällt mir auf, dass KundInnen<br />
neben den „klassischen“ Erwartungen an Coachingprozesse wie<br />
kontextbezogene Standortbestimmung und Unterstützung in<br />
Veränderungsphasen inzwischen auch verstärkt Coaching als<br />
Reflexionsgelegenheit und Lernchance über die reine Verhaltensebene<br />
hinaus sehen. Berufs- und Organisationsrolle stehen nach wie vor im<br />
Zentrum, werden aber mehr und tiefer hinterfragt. Es geht auch nicht<br />
mehr so stark darum, sich für eine spezielle Situation ganz gezielt<br />
vorzubereiten, dafür mehr um Nachhaltigkeit im Sinn von „Lernen aus<br />
einer Situation“.<br />
Das Thema <strong>Metaprogramme</strong> passt gut in diese Entwicklung, weil es<br />
andere, zusätzliche Aspekte in einen Coachingprozess einbringt, die<br />
tiefer und über die Verhaltensebene hinausgehen.<br />
Aus eigener Erfahrung haben gezielte Fragen in die Ebene der<br />
<strong>Metaprogramme</strong> spannende Wirkungen, der Einsatz eines breiteren<br />
Instrumentariums, wie beispielsweise des LAB-Profiles verstärkt diese<br />
Wirkung, macht neugierig auf mehr und reizt zum Spielen auf dieser<br />
Ebene. So ist es zumindest mir gegangen und dementsprechend groß<br />
war mein Interesse am Identity Compass © und an der Möglichkeit,<br />
Ergebnisse PC-gestützt erheben zu können.<br />
Mein persönliches erstes Identity Compass © - Ergebnis stammt aus dem<br />
Jahr 2006 und war seinerzeit aus mehreren Gründen beeindruckend für<br />
mich:<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 39
Ich habe gute Ressourcen für die Bereiche Kommunikation und Führung<br />
entdeckt. Ich wurde auf eine mögliche Burn out – Strategie<br />
hingewiesen.<br />
Beides ist in guter Erinnerung, zumal sich die Burn out – Strategie in der<br />
Folge auch noch realisiert hat. Dementsprechend habe ich dann auch<br />
begonnen, dieses Instrument im Coaching verstärkt anzubieten, heute<br />
gibt es nur in Ausnahmefällen Coachingprozesse ohne Metaprogrammanalyse.<br />
Es hat sich im Laufe der Zeit eine Routine ergeben, die Analyse vorab,<br />
also ganz am Anfang des Coachingprozesses zu positionieren. Meine<br />
KundInnen akzeptieren diese Vorgangsweise sehr gut und sind für das<br />
Interview nach kurzer Einführung in den allermeisten Fällen bereit.<br />
Die Vorab-Betrachtung der Ergebnisse ist nützlich und fraglich zugleich,<br />
abhängig davon, wie sehr er gelingt, wirklich konkrete Punkte und<br />
Themen für den folgenden <strong>Beratung</strong>sprozess abzuleiten.<br />
Eine zu oberflächliche bzw. zu umfassende Analyse erzeugt unter<br />
Umständen Eindrücke und Bilder, die den Coachingprozess<br />
einschränken und unbeweglicher machen. Ich versuche<br />
dementsprechend, jeweils die Kombinationen von <strong>Metaprogramme</strong>n<br />
bzw. Denkpräferenzen herauszuarbeiten, die für eine bestimmte<br />
Rollenerfüllung relevant sein könnten. Dieses Verfahren ist subjektiv,<br />
auch wenn es sich auf Erfahrungswerte und Kombinatoriken stützt, auf<br />
die zum Beispiel Arne Maus (Maus 2009, S. 113 ff.) oder Ralph Köbler<br />
(Köbler 2009, S. 90 ff.) verweisen.<br />
Wenn es darum geht, die „richtigen“ <strong>Metaprogramme</strong> herauszufiltern,<br />
erscheint es mir auch wichtig, dies nicht grundsätzlich alleine zu tun,<br />
sondern ganz bewusst Ergebnisse und Erfahrungen mit anderen<br />
BeraterInnen, die ähnlich arbeiten auszutauschen und so den eigenen<br />
Blickwinkel breit genug zu halten. Eine wertvolle Übung im diesem<br />
Zusammenhang ist es, zu versuchen, aus Stellenbeschreibungen und<br />
Personalinseraten Kompetenzen und <strong>Metaprogramme</strong> abzuleiten und<br />
diese Ergebnisse dann zu diskutieren.<br />
Natürlich ist das Herausarbeiten der konkreten Punkte auch eine Art<br />
Vorselektion von Themen, so gesehen ist das eine Gratwanderung der<br />
ich mir bewusst bin und die ich hoffentlich gut gehe, indem ich die<br />
Ergebnisse mit den KundInnen ausführlich bespreche und immer wieder<br />
rückmelde und rückfrage. Dabei habe ich auch die Erfahrung gemacht,<br />
dass KundInnen vereinzelt auch zusätzliche Schwerpunkte für sich<br />
finden und setzen. Dies erfolgt häufig zwischen der ersten und zweiten<br />
Coachingsitzung und geht wohl auf den Umstand zurück, dass viele sich<br />
hier mit ihrem Ergebnis beschäftigen. Der Identity Compass © ist meiner<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 40
Ansicht nach sehr gut beschrieben, auch was die Inhalte der einzelnen<br />
<strong>Metaprogramme</strong> betrifft. Die KundInnen erhalten nicht nur ihr<br />
spezifisches Ergebnis, sondern auch die Gelegenheit, sich in die<br />
Charakteristika der gemessenen Denkpräferenzen einzulesen. Erfolgt<br />
dies, rundet das den Prozess zusätzlich ab.<br />
Ansprechen möchte ich in diesem Zusammenhang auch das<br />
verführerische Gefühl „Ich weiß etwas, was du nicht weißt….“<br />
Das war bei mir da und hat natürlich nichts mit dem ausgewählten<br />
Testverfahren, eher mit dem grundsätzlichen Einsatz solcher Analysen<br />
zu tun. Professionelle Supervision zu diesem Thema ist aus meiner<br />
Erfahrung nützlich, beispielsweise bei Leuten, die sehr viel Erfahrung<br />
haben im Einsatz von Tests. Aus solchen Supervisionen habe ich eine für<br />
mich sehr nützliche Aufgabe mitgenommen und zwar mir immer wieder<br />
eine klare Antwort auf folgende Fragen zu geben: „Was genau siehst du<br />
in einem Testergebnis? Sind das grundsätzlich Fragen, die du<br />
gemeinsam mit dem Kunden, der Kundin verfolgen und abklären<br />
möchtest, oder sind das Antworten, die du als gegeben hinnimmst?“<br />
Die Fähigkeit, Ergebnisse als Fragen in den Prozess hineingeben zu<br />
können, halte ich für sehr hilfreich und konstruktiv, zumal es ein<br />
wesentliches Erfolgskriterium für Coachingprozesse ist, die richtigen<br />
Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen.<br />
Fragen lassen sich elegant mit praktischen Beispiele und/oder<br />
Geschichten verbinden. Ich mache das ganz bewusst, schon um<br />
feststellen zu können, ob sich ein Coachee in den Ergebnissen gut<br />
wiederfindet.<br />
Das führt relativ häufig zur Gegenfrage: „Genau wie bei mir, woher<br />
wissen Sie das?“ Jetzt kommt es darauf an, die „Macht“, so das<br />
überhaupt der richtige Ausdruck in diesem Zusammenhang sein sollte,<br />
beim Instrument zu lassen und nicht als Berater, Beraterin zu<br />
übernehmen. Es muss einfach ganz klar sein, dass das Instrument in der<br />
Lage ist, unterbewusstere, gleichsam automatisch ablaufende<br />
Strukturen sichtbar zu machen.<br />
Eine Frage, die mich zusehends mehr beschäftigt hat mit der Rolle der<br />
<strong>Metaprogramme</strong> an sich zu tun. Sind <strong>Metaprogramme</strong> Filterelemente,<br />
Elemente der Fokuslenkung oder irgendwie beides zugleich? Diese<br />
Frage hängt für mich eng mit der Trainierbarkeit von <strong>Metaprogramme</strong>n<br />
zusammen und gerade darauf kommt es letztendlich an.<br />
Eine Filterung ist aus meiner Sicht eher ein passiver Vorgang, über die<br />
ausgeblendeten Inhalte lassen sich nur Vermutungen anstellen.<br />
Vergleichsweise dazu ist eine Fokuslenkung eher aktiv. Es lässt sich<br />
eine Aussage darüber treffen, welcher Blickwinkel gerade<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 41
eingenommen wird und der Blickwinkel lässt sich bewusst steuern.<br />
Bewegung entsteht dort, wo die Aufmerksamkeit liegt und wo dadurch<br />
Energie investiert wird.<br />
Im geschilderten Praxisfall scheint es gelungen zu sein, Aufmerksamkeit<br />
und Energie zum Beispiel auf die Wahrnehmungskanäle Hören und<br />
Sehen zu lenken, umgesetzt wurde dies mittels definierten Übungen.<br />
So gesehen spricht dies klar für die Variante <strong>Metaprogramme</strong> sind<br />
„Fokuslenker“, schon weil schwer denkbar ist, Aufmerksamkeit auf<br />
etwas zu lenken, was gar nicht da, weil „gefiltert“ ist.<br />
Nicht alle Fälle laufen so wie der berichtete Praxisfall. Vielleicht liegt<br />
das auch daran, dass letztendlich der Kunde, die Kundin bestimmt,<br />
worauf der Fokus gelenkt werden darf und worauf nicht.<br />
Frau D war das mit der Wahrnehmung ein echtes Anliegen, sie wollte<br />
diesen Mechanismus mit großem Engagement verändern. Selbst wenn<br />
die Annahme der Fokuslenkung zutreffend wäre, bliebe also die Frage<br />
offen, was konkret von außen für eine Motivierung konkret<br />
unternommen werden könnte.<br />
Die Trainierbarkeit vom <strong>Metaprogramme</strong>n ist ein weiterer wesentlicher<br />
Punkt. Gundl Kutschera (Kutschera 1995, S. 445) schreibt dazu: „ Jedes<br />
Meta-Programm ist in bestimmten Kontexten hilfreich. Deshalb ist es<br />
für die Eigenverantwortung und das Gefühl, Wahlmöglichkeiten zu<br />
besitzen sinnvoll, sich in allen Meta-Programmen bewegen zu können<br />
und dabei wählen zu können, welches im, Einzelfall am besten<br />
entspricht. Alle Meta-Programme können spezifisch trainiert,<br />
entwickelt und eingeübt werden.“<br />
Damit wäre dann in jedem Fall hohe Flexibilität in allen <strong>Metaprogramme</strong>n<br />
/ Denkpräferenzen das höchste, übergeordnete Lern- und<br />
Entwicklungsziel. Mir stellt sich hier nur die Frage, ob das auch für<br />
Coachingprozesse so Gültigkeit haben kann, wenn ich davon ausgehe,<br />
dass Coaching in jedem Fall einen hohen Kontextbezug aufweisen muss,<br />
wenn es aus der Sicht der KundInnen sinnvoll und erfolgversprechend<br />
sein will. Eben dieser Kontextbezug bedingt auch die sinnvolle<br />
Konzentration auf bestimmte <strong>Metaprogramme</strong>, als eine Grundlage für<br />
einen sinnvollen Coachingprozess, der ja eine bestimmte berufliche<br />
Rolle unterstützen soll und nicht darauf ausgelegt ist, Menschen in<br />
irgendeiner Form generalisierend besser und flexibler zu „machen“.<br />
Der Erfolg der Trainierbarkeit einzelner <strong>Metaprogramme</strong> ist meiner<br />
Erfahrung nach nicht in allen Fällen grundlegend gegeben. Dies kann<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 42
auf die vorgeschlagenen <strong>Training</strong>smethoden zurückzuführen sein, auf<br />
motivationale Aspekte der KundInnen oder andere Einflussgrößen.<br />
Ich sehe die Arbeit an <strong>Metaprogramme</strong>n im Coaching als Chance und als<br />
mögliches Lernfeld. Wenn es Coachees gelingt, das in ihrem Sinn<br />
aufzugreifen, anzupassen und zu verändern, halte ich das für<br />
grundsätzlich positiv. Zugleich ist die Stabilität von <strong>Metaprogramme</strong>n,<br />
wie sie von vielen Autoren beschrieben wird aus meiner Sicht zu<br />
respektieren, es kann also aus der KundInnensicht sehr sinnvoll sein,<br />
ein Lernangebot nicht zu nutzen.<br />
In diesem Zusammenhang sehe ich meine Verantwortlichkeit als Coach<br />
primär im Anbieten von möglichen Lern- und Entwicklungsfeldern und<br />
als solche verstehe ich auch die Arbeit mit <strong>Metaprogramme</strong>n, den<br />
Einsatz entsprechender Analyseinstrumente und ein entsprechend<br />
abgestimmtes <strong>Training</strong>sangebot.<br />
Was darüber hinausgeht, hat für mein Gefühl rasch die Anrüchigkeit<br />
von „Alles ist trainierbar und alles ist veränderbar!“ und das erscheint<br />
mir als ziemlich wirklichkeitsfremde und überzogene Haltung im<br />
Coaching.<br />
Die Nutzung von Angeboten liegt ganz klar in der Verantwortung der<br />
KundInnen und dort sollte sie auch bleiben.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 43
Literatur und Links<br />
Arthur, Jay & Engel, Gregory (1995):<br />
The NLP Personal Profile Guidebook<br />
Denver, Life Star<br />
Deutsche Ausgabe: Marwitz, Klaus & Bierbaum, Georg (1996)<br />
Brem-Gräser, Luitgard (1993):<br />
Handbuch der <strong>Beratung</strong> für helfende Berufe. Band 1.<br />
München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag<br />
Charvet, Shelle Rose (2010):<br />
Wort sei Dank. Von der Anwendung und Wirkung effektiver<br />
Sprachmuster. 5. Auflage.<br />
Paderborn: Jungfermann-Verlag<br />
Dilts, Robert B. (2003):<br />
Modeling mit NLP. Das <strong>Training</strong>shandbuch zum NLP-Modeling-Prozeß.<br />
2. Auflage.<br />
Paderborn: Jungfermann-Verlag<br />
Educational Testing Service, http://www.ets.org/<br />
(Stand 01.11.10, 13.00)<br />
Hoberg, Gerrit (2004):<br />
Vor Gruppen bestehen. <strong>Training</strong>s und Workshops erfolgreich<br />
gestalten. 4. Auflage.<br />
Bonn: Idee&Produkt Verlag<br />
James, Tad & Woodsmall, Wyatt (1994):<br />
Time Line. NLP-Konzepte zur Grundstruktur der Persönlichkeit.<br />
Paderborn: Jungfermann-Verlag<br />
Köbler, Ralph (2009):<br />
Neue Wege im Recruiting. Mehr Effektivität mit Gravesmodell und<br />
<strong>Metaprogramme</strong>n.<br />
Paderborn: Jungfermann-Verlag<br />
König, Eckhard & Vollmer, Gerda (2002):<br />
Systemische Organisationsberatung. Grundlagen und<br />
Methoden.<br />
Weinheim: Beltz Verlag<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 44
Kron, Friedrich W. (2009):<br />
Grundwissen Pädagogik. 7. Auflage.<br />
München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag<br />
Kutschera, Gundl (1995):<br />
Tanz zwischen Bewußt-sein und Unbewußt-sein. NLP-Arbeitsund<br />
Übungsbuch.<br />
Paderborn: Junfermann-Verlag<br />
Lang-von Wins, Thomas & Triebel, Claas (2006):<br />
Kompetenzorientierte Laufbahnberatung.<br />
Heidelberg: Springer Medizin Verlag<br />
Maaß, Evelyne & Ritschl, Karsten<br />
Spectrum Kommunikations<strong>Training</strong><br />
http://www.lab-profile.de/<br />
(Stand 04.08.10, 10:00)<br />
Maus, Arne H. (2009):<br />
Herausforderung Motivation. Denkpräferenzen und ihr<br />
Einfluss auf Engagement und Handeln im Beruf.<br />
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag<br />
Österreichischer NLP-Server<br />
http://www.nlp.at/lexikon_neu/index.htm<br />
(Stand 03.08.10, 16:00)<br />
Radatz, Sonja (2000):<br />
<strong>Beratung</strong> ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für<br />
Führungskräfte und BeraterInnen.<br />
Wien: Institut für Systemisches Coaching und <strong>Training</strong><br />
Schmidt, Robert (2006):<br />
Ausbildungsunterlagen Lehrgang FachtrainerInnenausbildung<br />
nach EN ISO 17024/ Internationale Kompetenzzertifizierung<br />
Schneider, Johann (2001):<br />
Supervidieren & beraten lernen. Praxiserfahrene Modelle zur<br />
Gestaltung von <strong>Beratung</strong>s- und Supervisionsprozessen.<br />
Paderborn: Jungfermann Verlag<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 45
Stumpf, Ralph<br />
NLPedia , die NLP Enzyklopädie<br />
http://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Logische_Ebenen<br />
(Stand 25.08.10, 1900 Uhr)<br />
Tomaschek, Michael (2000): Austrian coaching councel,<br />
http://www.coachingdachverband.at/index_html?sc=285<br />
980015<br />
(Stand 25.08.10, 19.30)<br />
Wellhöfer, Peter R. (1990):<br />
Grundstudium Allgemeine Psychologie.<br />
2., überarbeitete und erweiterte Auflage.<br />
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.<br />
Robert Schmidt, 1427 28.05.2011 46