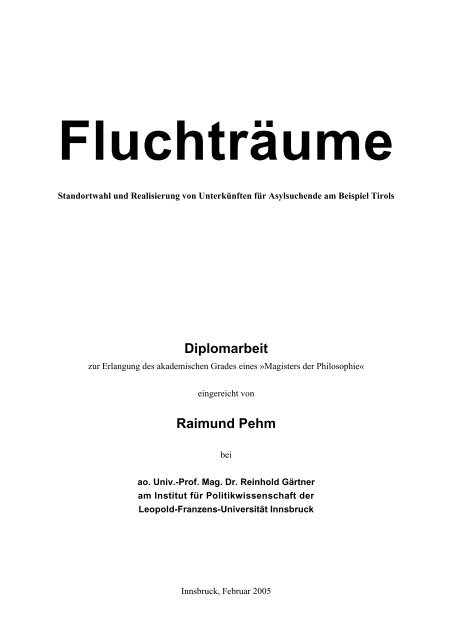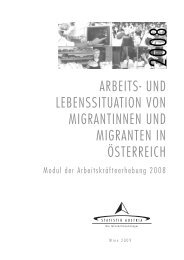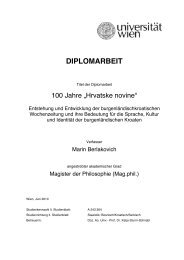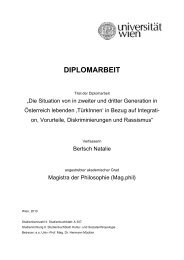Raimund Pehm - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Raimund Pehm - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Raimund Pehm - Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fluchträume<br />
Standortwahl und Realisierung von Unterkünften für Asylsuchende am Beispiel Tirols<br />
Diplomarbeit<br />
zur Erlangung des akademischen Grades eines »Magisters der Philosophie«<br />
eingereicht von<br />
<strong>Raimund</strong> <strong>Pehm</strong><br />
bei<br />
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhold Gärtner<br />
am Institut für Politikwissenschaft der<br />
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck<br />
Innsbruck, Februar 2005
Vorwort<br />
„Unser Land hat in der selbstlosen Aufnahme von Flüchtlingen eine große Tradition“, stellte<br />
die Tiroler Tageszeitung im Spätherbst 1979 mit einigem Stolz fest. 1 Eben war eine<br />
Flüchtlingsfamilie aus dem südostasiatischen Laos von einer Innsbrucker Pfarrgemeinde auf-<br />
genommen worden. Ihre Unterbringung in einer Privatwohnung war gesichert, Mitglieder der<br />
Gemeinde kümmerten sich um die Familie. Die Aktion war keineswegs ein Einzelfall: Öster-<br />
reichweit fanden damals im Rahmen eines „Pfarrpatenschaftsprogramms“ insgesamt 195<br />
Familien aus Südostasien in 158 Pfarren eine Bleibe. 2<br />
Mehr als 25 Jahre später ist die „selbstlose Aufnahme“ von Flüchtlingen auch in Tirol zum<br />
Gegenstand heftiger Diskussionen geworden. Im Mittelpunkt steht dabei seit geraumer Zeit<br />
die Suche nach Standorten für Sammelunterkünfte, damit verbunden auch die Art und Weise,<br />
in der die Realisierung dieser organisierten „Fluchträume“ erfolgt. Obwohl beide Bereiche bei<br />
der Aufnahme Asylsuchender von grundlegender Bedeutung sind, wurden sie von der For-<br />
schung, zumal der politikwissenschaftlichen, bislang kaum berücksichtigt. Die Wahl der<br />
Unterkunftsstandorte und die vielfältigen, oft überaus konfliktreichen Beziehungen zwischen<br />
den drei wichtigsten AkteurInnen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung – der öffentlichen<br />
Hand als „Unterkunftsgeberin“, den EigentümerInnen der jeweiligen Unterkunftsgebäude und<br />
den von einer Unterbringung in jedem Fall unmittelbar betroffenen Gemeinden – sollen mit<br />
dieser Arbeit am Beispiel Tirols nun einer grundlegenden Analyse unterzogen werden. 3 Die<br />
mediale Berichterstattung wie auch die persönlichen Erfahrungen des Verfassers während der<br />
Erhebungsphase zeigten, dass das Thema überaus konfliktträchtig, eine Auseinandersetzung<br />
damit daher eine durchaus heikle Angelegenheit ist. Eine ausführliche, möglichst detail-<br />
genaue, die regionalen und lokalen (politischen) Kontexte ebenso wie die verschiedenen<br />
Sichtweisen der AkteurInnen in breitem Umfang darstellende Untersuchung scheint daher<br />
dringend geboten.<br />
Im Rahmen einleitender Überlegungen werden in einem ersten Teil zunächst die Bedeutung<br />
der Wahl und der Realisierung von Unterkünften (im Folgenden meist kurz als „Standort-<br />
wahl“ bzw. „Standortrealisierung“ bezeichnet) bei der Aufnahme und Unterbringung Asyl-<br />
suchender dargestellt, ein Überblick über den Forschungsstand zum Thema gegeben sowie die<br />
methodische Vorgangsweise und der Forschungsprozess selbst kurz beleuchtet. Im zweiten<br />
Teil erfolgt eine Auseinandersetzung mit den konkreten Rahmenbedingungen in Tirol. Dabei<br />
wird das Augenmerk bewusst nicht nur auf die formale Zuständigkeit für die Unterbringung<br />
Asylsuchender gelegt, sondern auch auf politisch-strukturelle Aspekte sowie auf die öffent-<br />
liche Diskussion.<br />
1 Tiroler Tageszeitung 02.11.1979.<br />
2 Stanek 1985, 163.<br />
3 Nicht berücksichtigt werden dabei Unterbringungseinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.<br />
Eine erste Einrichtung für Angehörige dieser spezifischen Gruppe wurde in Tirol Mitte November 2004 eröffnet.<br />
2
Der dritte Teil widmet sich der Analyse der Konzepte und Strategien des Unterkunftsgebers in<br />
Theorie und Praxis. Zentral werden dabei vor allem die konkreten Erscheinungsformen der<br />
„Standortpolitik“ des Unterkunftsgebers sowohl auf Landes- als auch auf lokaler Ebene sein.<br />
Detaillierte Einzelfalldarstellungen der im Hauptuntersuchungszeitraum, dem zweiten Halb-<br />
jahr 2003, bestehenden Unterkünfte bilden die Grundlage der Analyse, die so gewonnenen<br />
Hypothesen werden in der Folge einer überblicksartigen Untersuchung der weiteren Ent-<br />
wicklungen im Gesamtjahr 2004 gegenübergestellt, sodass in einem vierten und abschließen-<br />
den Teil konkrete Aussagen über die Politik des Unterkunftsgebers im untersuchten Bereich<br />
sowie über mögliche oder tatsächliche Auswirkungen und Konsequenzen getroffen, in weite-<br />
rer Folge jedoch auch Empfehlungen für die Praxis gegeben werden können.<br />
Im Rahmen einer international agierenden unabhängigen Menschenrechtsorganisation war der<br />
Verfasser in der Vergangenheit jahrelang selbst als (Rechts-)Berater und Betreuer für Asyl-<br />
suchende tätig. Damit verbundene Erfahrungen und Kenntnisse in Theorie und Praxis stellten<br />
naturgemäß eine wichtige Basis bei der Erstellung dieser Arbeit dar.<br />
Zu danken hat der Verfasser zuallererst ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhold Gärtner, Inns-<br />
bruck, der als Betreuer dieser Arbeit in beeindruckendem Maße Geduld zeigte. Besonderer<br />
Dank gilt jedoch auch den folgenden (in alphabetischer Reihung genannten) Personen für ihre<br />
Unterstützung: Mag. a Ruth Baumgartner, Innsbruck; Falk F. Borsdorf, Innsbruck; Dr. Karl<br />
Geir, Matrei am Brenner; Mag. a Julia Kux, Innsbruck; Dr. Andreas Lederer, Innsbruck; Arzu<br />
Ok, Innsbruck; Fatih Öztürk, Innsbruck; Günther und Maria Theresia <strong>Pehm</strong>, Innsbruck;<br />
MMag. Peter Pfeifhofer, Innsbruck sowie Univ.-Doz. Mag. Dr. Horst Schreiber, Innsbruck.<br />
Dank ergeht schließlich an sämtliche Interview- und GesprächspartnerInnen, an die<br />
AmtsleiterInnen und SekretärInnen der im zweiten Halbjahr 2003 aufgesuchten Städte und<br />
Gemeinden sowie an die MitarbeiterInnen folgender Institutionen und Organisationen: Amt<br />
der Tiroler Landesregierung, Abt. Soziales (Flüchtlingskoordination), Innsbruck; arge<br />
schubhaft, Innsbruck; Caritas Integrationshaus, Innsbruck; Flüchtlingsstelle der Caritas der<br />
Diözese Innsbruck, Innsbruck; Teestube des Vereins für Obdachlose, Innsbruck sowie Tiroler<br />
Institut für Menschenrechte und Entwicklungspolitik, Innsbruck.<br />
Innsbruck, im Februar 2005 <strong>Raimund</strong> <strong>Pehm</strong><br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort.................................................................................................................................................................. 2<br />
Einleitende Überlegungen .................................................................................................................................... 8<br />
1 Raum, Macht und Differenz. Zur Bedeutung der Wahl des Unterkunftsstandorts<br />
bei der Unterbringung von Asylsuchenden............................................................................................... 9<br />
1.1 Raum als Konfiguration sozialer Beziehungen.................................................................................. 11<br />
1.2 Kurze Wege und ein anderes Verständnis von Mobilität................................................................... 14<br />
1.3 Mehr als ein Dach über dem Kopf: Die Versorgung von Asylsuchenden ......................................... 16<br />
1.3.1 Güter des täglichen Bedarfs...................................................................................................... 16<br />
1.3.2 Medizin und Gesundheit........................................................................................................... 17<br />
1.3.3 Psychosoziale, psychologische und psychotherapeutische Unterstützung und Betreuung....... 18<br />
1.3.4 Juristische Beratung und Betreuung ......................................................................................... 22<br />
1.3.5 Bildung ..................................................................................................................................... 23<br />
1.3.6 Freizeit und Sport ..................................................................................................................... 24<br />
1.4 Ressource oder Bedrohung? Die Rolle migrantischer Communities und Exilgemeinschaften.......... 25<br />
2 Akzeptanz, Duldung oder Ablehnung. Zur Bedeutung der Realisierung des Unterkunftsstandorts<br />
bei der Unterbringung von Asylsuchenden............................................................................................. 27<br />
3 Einige Anmerkungen zu Methodik und Forschungsprozess ................................................................. 29<br />
3.1 Qualitative Methoden als Entspannungshilfe: »I hab da so locker daherg’redet ...« ......................... 30<br />
3.2 Eine Gratwanderung: Objektivität versus Parteilichkeit .................................................................... 33<br />
Rahmenbedingungen .......................................................................................................................................... 34<br />
4 Von Zuständigkeiten und Unzuständigkeiten. Akteurinnen und Akteure<br />
bei der Wahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten für Asylsuchende ................................... 35<br />
4.1 Öffentliche UnterkunftsgeberInnen ................................................................................................... 35<br />
4.1.1 Der Bund als Unterkunftsgeber ................................................................................................ 35<br />
4.1.2 Das Land Tirol als Unterkunftsgeber ....................................................................................... 48<br />
4.1.3 Die Gemeinden als Unterkunftsgeberinnen.............................................................................. 57<br />
4.2 Private UnterkunftsgeberInnen .......................................................................................................... 58<br />
4.3 Obdachlose Asylsuchende: Akteurinnen und Akteure in eigener Sache............................................ 59<br />
4.4 Entwicklungstrends............................................................................................................................ 60<br />
4.4.1 Föderalisierung......................................................................................................................... 60<br />
4.4.2 Auslagerung.............................................................................................................................. 62<br />
5 »Tirol muss hilflos zuschauen.« Asylsuchende in der öffentlichen Diskussion .................................... 64<br />
5.1 Tirol als Opfer? Der Bedrohungsdiskurs ........................................................................................... 67<br />
5.2 »Tabus sachlich brechen.« Der Rechtfertigungsdiskurs (I) ............................................................... 74<br />
5.3 Wien ist schuld! Der Rechtfertigungsdiskurs (II) .............................................................................. 78<br />
5.4 »Asylland Österreich«: Der Rechtfertigungsdiskurs (III) .................................................................. 81<br />
5.5 Von der »Herbergssuche« dankbarer Familien: Der Mitleidsdiskurs ................................................ 82<br />
5.6 Mahnende Worte, Appelle und Forderungen: Der kritische Diskurs................................................. 85<br />
5.7 Ein Land in Panik: »Wer hat an der Uhr gedreht?« ........................................................................... 90<br />
4
Analyse................................................................................................................................................................. 94<br />
6 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Das zweite Halbjahr 2003 in Einzelfalldarstellungen............................................................................. 95<br />
6.1 Fieberbrunn: Mitten in Europa am Ende der Welt............................................................................. 96<br />
6.1.1 Die Gemeinde: Zwischen Knappenmusik und Pharmaindustrie .............................................. 96<br />
6.1.2 Der Standort: Leben und Arbeiten im »Schneeloch Tirols«..................................................... 97<br />
6.1.3 Die Standortwahl: »Und dann war’s eine politische Entscheidung ...«.................................. 100<br />
6.1.4 Die Standortrealisierung: »Wir sind natürlich nicht gefragt worden«.................................... 101<br />
6.1.5 Am »Ende der Welt«? Der Standort in der Diskussion .......................................................... 101<br />
6.1.6 Bewertung .............................................................................................................................. 104<br />
6.2 Götzens: Die Ruhe nach dem Sturm ................................................................................................ 107<br />
6.2.1 Die Gemeinde: »Zentrum des Glaubens«............................................................................... 107<br />
6.2.2 Der Standort: Leben im öffentlichen Raum............................................................................ 108<br />
6.2.3 Die Standortwahl: Quartier ist Quartier.................................................................................. 111<br />
6.2.4 Die Standortrealisierung: Ein Dorf im Aufruhr...................................................................... 111<br />
6.2.5 Ruhe nach dem Sturm: Der Standort in der Diskussion ......................................................... 113<br />
6.2.6 Bewertung .............................................................................................................................. 114<br />
6.3 Kössen: Leben im »Winkl«.............................................................................................................. 115<br />
6.3.1 Die Gemeinde: Eigenständigkeit im Grenzland ..................................................................... 116<br />
6.3.2 Der Standort: Ein »Einheimischenlokal« als Zwischenstation............................................... 117<br />
6.3.3 Die Standortwahl: Telefonieren ohne zu Zögern.................................................................... 119<br />
6.3.4 Die Standortrealisierung: »Machen wir das ganz offiziell« ................................................... 119<br />
6.3.5 Idyllisch isoliert? Der Standort in der Diskussion.................................................................. 121<br />
6.3.6 Bewertung .............................................................................................................................. 124<br />
6.4 Landeck: Wie man ein Weihnachtsmärchen schreibt ...................................................................... 125<br />
6.4.1 Die Gemeinde: Regionales Zentrum im Tiroler Oberland ..................................................... 125<br />
6.4.2 Der Standort: Im Zwischenland.............................................................................................. 126<br />
6.4.3 Die Standortwahl: Aufruf und Meldung................................................................................. 128<br />
6.4.4 Die Standortrealisierung: Herrn Hochstögers aussichtsloser Kampf gegen Weihnachten ..... 129<br />
6.4.5 Von Landeck lernen? Der Standort in der Diskussion............................................................ 132<br />
6.4.6 Bewertung .............................................................................................................................. 133<br />
6.5 Leutasch: Wald, Wild und Almen.................................................................................................... 135<br />
6.5.1 Die Gemeinde: »Das ganze Tal ist abgeschlossen und rundum geschützt« ........................... 135<br />
6.5.2 Der Standort: Übergangsort am Übergang ............................................................................. 137<br />
6.5.3 Die Standortwahl: »Dann hast du dein Haus wirklich durchgehend gut belegt«.................... 139<br />
6.5.4 Die Standortrealisierung: »Innerhalb von zwei, drei Tagen sind die da ...«........................... 139<br />
6.5.5 »... nicht mehr gesehen, seit ich das Haus jetzt so mach«: Der Standort in der Diskussion ... 140<br />
6.5.6 Bewertung .............................................................................................................................. 141<br />
6.6 Mötz: Pokerspiel mit einem Wallfahrtsort....................................................................................... 142<br />
6.6.1 Die Gemeinde: Im Zeichen Mariens....................................................................................... 142<br />
6.6.2 Der Standort: Wohnort Dorfgasthaus ..................................................................................... 143<br />
6.6.3 Die Standortwahl: Ein Gasthof in der Warteschleife............................................................. 145<br />
6.6.4 Die Standortrealisierung: »... und um neun haben wir müssen ja oder nein sagen!« ............. 145<br />
6.6.5 »Manche haben das sofort gut gefunden.« Der Standort in der Diskussion ........................... 146<br />
6.6.6 Bewertung .............................................................................................................................. 147<br />
6.7 Reith im Alpbachtal: Ein Tourismusort und seine ungeliebten Gäste.............................................. 148<br />
6.7.1 Die Gemeinde: Urlaub am Bauernhof .................................................................................... 148<br />
6.7.2 Der Standort: Warten auf den Gewerbepark........................................................................... 150<br />
5
6.7.3 Die Standortwahl: »Du hast keinen Nachbarn, der sich aufregen kann«................................ 153<br />
6.7.4 Die Standortrealisierung: Ländlicher Watschentanz .............................................................. 154<br />
6.7.5 Feueralarm als Zankapfel: Der Standort in der Diskussion .................................................... 155<br />
6.7.6 Bewertung .............................................................................................................................. 157<br />
6.8 Vils: Vom Leben im Milieu ............................................................................................................. 158<br />
6.8.1 Die Gemeinde: Asylrecht als Auszeichnung .......................................................................... 158<br />
6.8.2 Der Standort: Amor im Nadelöhr ........................................................................................... 160<br />
6.8.3 Die Standortwahl: »Es war ein leeres Gebäude ...«................................................................ 162<br />
6.8.4 Die Standortrealisierung: »Das hat sich eigentlich ganz schnell entwickelt«......................... 163<br />
6.8.5 Freiheitliche Attacken und bürgermeisterliche Reaktionen: Der Standort in der Diskussion 164<br />
6.8.6 Bewertung .............................................................................................................................. 165<br />
6.9 Volders: Dicke Luft in der Transitgemeinde.................................................................................... 167<br />
6.9.1 Die Gemeinde: Blockade oder Umfahrung?........................................................................... 167<br />
6.9.2 Der Standort: Draußen bei der Stachelburg............................................................................ 168<br />
6.9.3 Die Standortwahl: »Und das Land war froh ...« ..................................................................... 170<br />
6.9.4 Die Standortrealisierung: »Den Bürgermeister haben wir da nicht gefragt«.......................... 172<br />
6.9.5 »Wir haben sie lange genug gehabt«: Der Standort in der Diskussion................................... 172<br />
6.9.6 Bewertung .............................................................................................................................. 174<br />
7 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Vergleichende Analyse und Thesen ....................................................................................................... 176<br />
7.1 Die Wahl der Unterkunftsstandorte ................................................................................................. 176<br />
7.1.1 Die Standortsuche: Aufrufe und Appelle ............................................................................... 176<br />
7.1.2 Die Standortentscheidung: »Du hast keine Wahl« ................................................................. 177<br />
7.1.3 Standortmerkmal 1: Räumliche Lage ..................................................................................... 178<br />
7.1.4 Standortmerkmal 2: Räumliche und bauliche Integration ...................................................... 179<br />
7.1.5 Standortmerkmal 3: Mobilität ................................................................................................ 180<br />
7.1.6 Standortmerkmal 4: Versorgungslage .................................................................................... 180<br />
7.1.7 Standortmerkmal 5: Bauliche Ausführung, Gestalt und ursprüngliche Gebäudefunktion...... 183<br />
7.1.8 Standortmerkmal 6: Gemeinde- und Standortidentitäten ....................................................... 184<br />
7.1.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortwahl................... 185<br />
7.2 Die Realisierung der Unterkunftsstandorte...................................................................................... 187<br />
7.2.1 Die Rolle der Bürgermeister: Information, nicht Einbindung ................................................ 187<br />
7.2.2 Die Rolle der Bevölkerung: Weder Einbindung noch Information ........................................ 188<br />
7.2.3 Die Rolle der lokalen Eliten: Modellfall Kössen.................................................................... 188<br />
7.2.4 Die Zustimmung der Gemeinden: Überzeugungsarbeit, Überrumpelungstaktik<br />
oder politischer Druck? .......................................................................................................... 189<br />
7.2.5 Die Vorbereitung der Unterkunftsleitungen: »Sprung ins kalte Wasser«............................... 195<br />
7.2.6 Keine Konfliktprävention, keine professionelle Konfliktlösung ............................................ 196<br />
7.2.7 Die Startphase: Begleitung und Betreuung als Gemeindesache ............................................. 197<br />
7.2.8 Von Gegenseitigkeit keine Spur: Kommunales Defizitgeschäft Flüchtlingsaufnahme .......... 199<br />
7.2.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortrealisierung........ 202<br />
8 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Das Jahr 2004 im Überblick ................................................................................................................... 203<br />
8.1 Die Standorte ................................................................................................................................... 203<br />
8.2 Die Standortwahl ............................................................................................................................. 206<br />
8.2.1 Die Standortsuche: »Regelmäßig öffentliche Appelle durch die <strong>Medien</strong>«............................. 206<br />
8.2.2 Die Standortentscheidung: Aktive BesitzerInnen................................................................... 208<br />
8.2.3 Standortmerkmal 1: Räumliche Lage ..................................................................................... 209<br />
6
8.2.4 Standortmerkmal 2: Räumliche und bauliche Integration ...................................................... 212<br />
8.2.5 Standortmerkmal 3: Mobilität ................................................................................................ 213<br />
8.2.6 Standortmerkmal 4: Versorgungslage .................................................................................... 214<br />
8.2.7 Standortmerkmal 5: Bauliche Ausführung, Gestalt und ursprüngliche Gebäudefunktion...... 214<br />
8.2.8 Standortmerkmal 6: Gemeinde- und Standortidentitäten ....................................................... 215<br />
8.2.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortwahl................... 217<br />
8.3 Die Standortrealisierung .................................................................................................................. 218<br />
8.3.1 Die Rolle der Bürgermeister: Gemeinsame Basis, aber ......................................................... 218<br />
8.3.2 Die Rolle der Bevölkerung: Gerüchte statt Information......................................................... 221<br />
8.3.3 Die Rolle der lokalen Eliten: Kein Rückgriff auf Kössen ...................................................... 221<br />
8.3.4 Die Zustimmung der Gemeinden: Von »Zirkusaffen« und »notleidenden Familien«............ 222<br />
8.3.5 »Die Leute haben Angst.« Konfliktprävention und Konfliktlösung....................................... 226<br />
8.3.6 Die Vorbereitung der Unterkunftsleitungen: Positive Veränderungen................................... 227<br />
8.3.7 Die Startphase: Vermehrt Ansprechpartnerinnen vor Ort ...................................................... 228<br />
8.3.8 Die Unterbringung von Asylsuchenden: Nach wie vor ein kommunales Defizitgeschäft?.... 229<br />
8.3.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortrealisierung........ 230<br />
Schlussfolgerungen............................................................................................................................................ 231<br />
9 Rahmenbedingungen und Strukturmuster bei der Wahl und Realisierung<br />
von Unterkunftsstandorten. Diskussion und Resümee......................................................................... 232<br />
9.1 Signal für die Verantwortung von Staat und Gesellschaft:<br />
Unterbringung als Aufgabe der öffentlichen Hand ................................................................ 232<br />
9.2 Keine einheitliche Linie: Widersprüchliche Positionen der Landesregierung........................ 232<br />
9.3 Fachpolitik ohne Ziel: Kein Konzept, keine Leitlinien, keine Vorgaben ............................... 234<br />
9.4 »Do it yourself«: Politik als Aufgabe der Verwaltung ........................................................... 235<br />
9.5 Die Standortsuche: Appell als Strategie ................................................................................. 237<br />
9.6 Die Standortentscheidung: »Ich kann mir’s nicht aussuchen« ............................................... 238<br />
9.7 Die Verortung im Raum (I): Absonderung oder Heraushebung............................................. 240<br />
9.8 Die Verortung im Raum (II): Provisorien als Dauereinrichtungen......................................... 265<br />
9.9 Die Verortung im Raum (III): Vernachlässigte Gemeinde- und Standortidentitäten ............. 274<br />
9.10 Die Rolle der Gemeinden bei der Standortrealisierung: Statisten ohne klares Skript............. 275<br />
9.11 Mit Taktik zum Ziel: Wie man die Zustimmung der Gemeinden erreicht ............................. 278<br />
9.12 Eskalierende Konflikte: Keine Prävention, keine Lösung...................................................... 283<br />
9.13 Die Startphase: Zunehmende Professionalisierung ................................................................ 285<br />
9.14 Die Gemeinden und die Unterbringung von Asylsuchenden: Segregation oder Integration? 286<br />
9.15 Gibt es eine kommunale Flüchtlingspolitik? Anmerkungen zu einer »verbotenen« Frage .... 292<br />
9.16 Parteipolitik, Kirche und Honoratiorentum: Fragmentierung allerorten................................. 296<br />
9.17 »Verkehr, Asyl und Müll«. Die Unterbringung von Asylsuchenden als »Nimby-Projekt« ... 298<br />
10 Empfehlungen.......................................................................................................................................... 305<br />
Anhang............................................................................................................................................................... 308<br />
Abkürzungen....................................................................................................................................................... 309<br />
Literatur............................................................................................................................................................... 310<br />
7
Einleitende Überlegungen
1 Raum, Macht und Differenz. Zur Bedeutung der Wahl des Unterkunftsstandorts<br />
bei der Unterbringung von Asylsuchenden<br />
„Macht gestaltet Raum.“ 1 Tatsächlich? In dieser knappen Feststellung ist ein Zusammenhang<br />
angesprochen, auf den zuerst Georg Simmel in seinen Überlegungen zum Raum und den<br />
räumlichen Ordnungen der Gesellschaft mit Nachdruck hingewiesen hat. 2 Diesem Zusam-<br />
menhang wurde seither in den verschiedensten Bereichen forschend nachgespürt, der Fokus<br />
richtete sich dabei gewinnbringend insbesondere auf die Beziehungen zwischen zentralen und<br />
peripheren Räumen und, durchaus damit verbunden, zwischen „ingroups“ und „outgroups“,<br />
privilegierten Etablierten und marginalisierten AußenseiterInnen. Die in der Öffentlichkeit<br />
breit debattierte Thematik der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden wurde je-<br />
doch überraschenderweise bislang kaum vor dem Hintergrund der spannungsgeladenen Be-<br />
ziehung von Raum, Macht und Differenz untersucht – weder auf einer abstrakt-theoretischen<br />
noch auf einer konkret-empirischen Ebene. Seit Jahren ist die einschlägige Diskussion hier<br />
von Auseinandersetzungen um die zweifellos äußerst bedeutsamen Unterbringungsstandards<br />
geprägt, die Standorte der Unterkünfte, seien es nun Lager, heimähnliche Sammelunterkünfte<br />
oder kleinere Unterkunftseinheiten, werden dabei meist eher am Rande abgehandelt. Doch<br />
gerade die Standorte sind von zentraler Bedeutung: Während die Standards der Unterbringung<br />
– die Ausstattung der Gebäude, die Qualifikation des Beratungs- und Betreuungspersonals,<br />
der sogenannte Betreuungsschlüssel u.a.m. – grundsätzlich vergleichsweise leicht und jeder-<br />
zeit in die eine oder andere Richtung erhöht oder herabgesetzt werden können, ist eine derar-<br />
tige Adaptierung bei einmal gewählten und realisierten Unterkunftsstandorten praktisch aus-<br />
geschlossen. Sofern überhaupt möglich ist eine Änderung der grundlegenden Standorteigen-<br />
schaften – etwa der räumlichen Lage und der baulichen Gestalt des entsprechenden Gebäudes<br />
oder seiner Einbettung in einen spezifischen lokalen Kontext – nahezu ausnahmslos mit derart<br />
hohen Kosten verbunden, dass die Schließung zugunsten eines neu errichteten und besser ge-<br />
eigneten Standorts in jedem Fall geringere finanzielle Aufwendungen verspricht.<br />
Bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden kommt dem Standort der jeweili-<br />
gen Unterkunft also eine tatsächlich grundlegende Rolle zu: Mit der Verortung dieses<br />
„Fluchtraums“ werden zugleich die wesentlichsten Rahmenbedingungen geschaffen, die das<br />
Leben der dort untergebrachten Menschen, des – sofern vorhanden – mit ihnen arbeitenden<br />
Personals und der (auch hier gilt: sofern vorhanden) in der Nachbarschaft lebenden Bevölke-<br />
rung für längere Zeit, oft für viele Jahre bestimmen. Der Zusammenhang von Macht und<br />
Raum ist hier bereits offensichtlich: Die jeweiligen UnterkunftsgeberInnen treffen entspre-<br />
chend der Stoßrichtung ihrer ex- oder impliziten konzeptionellen Überlegungen (Standort-)<br />
Entscheidungen, aus denen unmittelbare verändernde Eingriffe in das Leben anderer Personen<br />
resultieren, das durch diese Interventionen unter Umständen sogar völlig neu strukturiert wird.<br />
1 Novy 2003a.<br />
2 Vgl. Simmel 1908.<br />
9
Ohne Zweifel handelt es sich dabei um originär politische Entscheidungen. Umso erstaun-<br />
licher scheint es, dass die Politikwissenschaft der Thematik bislang offenbar äußerst wenig<br />
Aufmerksamkeit zu widmen bereit war. Aufschlussreiche Arbeiten in unterschiedlichem Um-<br />
fang liegen jedoch auch aus anderen Disziplinen – vor allem aus den Bereichen der Geogra-<br />
phie, der Stadtplanung, der Architektur, der Psychologie, der Erziehungswissenschaften, der<br />
Soziologie und der Geschichtswissenschaft – nur vereinzelt vor. In der Mehrzahl wurden sie<br />
in der ersten Hälfte der 1990er oder früher verfasst, häufig nie publiziert oder in rasch ver-<br />
griffenen Kleinstauflagen gedruckt, entsprechend gerieten sie bald weitgehend in Vergessen-<br />
heit. Für Österreich und Deutschland (das hinsichtlich der politisch-strukturellen Rahmenbe-<br />
dingungen im flüchtlings- und asylpolitischen Bereich am ehesten mit der österreichischen<br />
Situation vergleichbar scheint) können letztlich nur zwei Regional- 3 und drei teils verglei-<br />
chende Gemeindestudien 4 angeführt werden, die sich in umfassenderer Weise mit der Stand-<br />
ortthematik befassen. Daneben liegen mehrere teils kürzere Arbeiten vor, die sich entweder<br />
einem bestimmten Teilbereich der Materie widmen 5 , vergleichend oder in Einzelfalldarstel-<br />
lungen und aus der Perspektive unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen bestimmte<br />
Unterkunftsformen untersuchen 6 oder den Blick auf andere Aspekte richten, jedoch am Rande<br />
auf die Thematik eingehen. 7 Als wenig ergiebig müssen letztlich vorliegende publizistische<br />
Arbeiten beurteilt werden: Der lockere journalistische Stil verhindert hier meist eine fundiertere<br />
inhaltliche Auseinandersetzung. 8<br />
Zwar wird in vielen dieser Arbeiten die politische Dimension der Thematik durchaus hervor-<br />
gehoben, es fällt jedoch auf, dass die standortpolitischen Überlegungen der jeweiligen Unter-<br />
kunftsgeberInnen – in der Regel handelt es sich um die öffentliche Hand – lediglich im Fall<br />
einer Studie aus dem Fachbereich Architektur 9 direkt erhoben, in die Untersuchung einbezo-<br />
gen und mit den in der Praxis feststellbaren Strukturmustern konfrontiert wurden. Der Zu-<br />
sammenhang zwischen den (politischen) AkteurInnen im Unterbringungssektor und der kon-<br />
kreten Manifestation ihrer Politik in Form der von ihnen ausgewählten und realisierten Unter-<br />
künfte für Asylsuchende bleibt so in der Regel eigenartig diffus, das Zustandekommen stand-<br />
ortpolitischer Muster unklar. Mit der vorliegenden Arbeit soll daher auch versucht werden,<br />
diese Lücke zumindest teilweise zu schließen. Gleichermaßen einleitend wie grundlegend soll<br />
in den folgenden Abschnitten dabei zunächst die Bedeutung des Standorts anhand mehrerer<br />
Aspekte aufgezeigt werden.<br />
3<br />
Vgl. Omairi 1991; FOKUS 1994.<br />
4<br />
Vgl. Carstens 1992; Brunner et al. 1994, 1998 und 2003; Thimmel 1994.<br />
5<br />
Vgl. etwa Balzer 1990; Fuchshofer 1994; Kuhn 1994; Müller et al. 2001.<br />
6<br />
Vgl. etwa Hennig et al. 1982; Wipfler 1986; Wojak 1993; Wischenbart 1995; Münker-Kramer/Gmeiner 2000;<br />
Dünnwald 2002.<br />
7<br />
Vgl. etwa Tedeschi 1996; Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001.<br />
8<br />
Vgl. exemplarisch Himmelbauer 1994, der seine Gemeindeportraits zudem nach parteipolitischen Gesichts-<br />
punkten auswählt.<br />
9 Vgl. Thimmel 1994.<br />
10
1.1 Raum als Konfiguration sozialer Beziehungen<br />
Raum, so die weit verbreitete Ansicht, ist gewissermaßen ein Gefäß – eine Sichtweise, welche<br />
Raum „auf einen »Container« reduziert, in dem bestimmte Merkmalsausprägungen und An-<br />
teilswerte gelagert sind“. 10 Aus dieser Perspektive erscheint Raum als „leeres Behältnis“ ohne<br />
jegliche Qualität. Ignoriert werden dabei freilich die vielfältigen Interdependenzen zwischen<br />
Raum und Gesellschaft und die sich an jedem Ort überlagernden globalen, nationalen, regio-<br />
nalen und lokalen Aspekte: „Wir leben nicht in einer Leere, innerhalb derer man Individuen<br />
und Dinge einfach situieren kann. Wir leben nicht innerhalb einer Leere, die nachträglich mit<br />
bunten Farben eingefärbt wird.“ 11 Der Raum, in dem wir lebten, so Foucault, sei vielmehr<br />
„mit Qualitäten aufgeladen“, vielleicht auch „von Phantasmen bevölkert“. 12 Folgt man<br />
Simmel, sind diese Qualitäten freilich nicht als von Raum oder Räumlichkeit erzeugte Fakto-<br />
ren zu verstehen: „Nicht der Raum, sondern die von der Seele her erfolgende Gliederung und<br />
Zusammenfassung seiner Teile hat gesellschaftliche Bedeutung.“ 13 Raum, so Simmel in einem<br />
treffenden Vergleich, „bleibt immer die an sich wirkungslose Form, in deren Modifikationen<br />
die realen Energien sich zwar offenbaren, aber nur, wie die Sprache Gedankenprozesse aus-<br />
drückt, die allerdings in Worten, aber nicht durch Worte verlaufen.“ 14 Raum ist demnach wie<br />
die Sprache gewissermaßen als Medium zu verstehen, mit dem alle gesellschaftlichen Bezie-<br />
hungen, Aktivitäten und Phänomene zum Ausdruck gebracht werden (können). In seinem<br />
„Exkurs über den Fremden“ kommt Simmel daher zum Schluss, das Verhältnis zum Raum sei<br />
nur „einerseits die Bedingung, andrerseits das Symbol der Verhältnisse zu Menschen“. 15 Der<br />
Raum, den Menschen einander zugestehen, die Nähe oder Distanz, auf die sie bestehen, die<br />
spezifischen Orte, die sie sich zuweisen, geben demnach entscheidend Auskunft über ihre<br />
Haltung zueinander – und damit natürlich auch über sie selbst. Wenn dem so ist, so kann die<br />
räumliche Organisation jedoch auch bewusst zur Strukturierung sozialer Beziehungen genutzt<br />
werden. Raum ist dann nicht nur als „kulturelle Konfiguration sozialer Beziehungen“ zu le-<br />
sen, die räumliche Organisation der Gesellschaft ist auch als integraler „Bestandteil der Her-<br />
stellung sozialer Verhältnisse und nicht bloß als ihr Ergebnis“ zu verstehen. 16 Das Räumliche<br />
und das Soziale sind damit letztlich untrennbar verbunden: Nicht nur der Raum ist sozial kon-<br />
struiert, das Soziale ist es auch räumlich, die räumlichen Ordnungen reflektieren und konsti-<br />
tuieren die sozialen Beziehungen. 17 Zentrum und Peripherie, Privilegierung und Marginalisie-<br />
rung sind immer aufeinander bezogen, es bestehen vielfältige Interdependenzen. Auch die<br />
sozialräumliche Polarisierung wird daher „produziert“, wie mit Novy formuliert werden kann:<br />
„Immer geht es explizit oder implizit um ein Gefälle von Macht, das sich in einer räumlichen<br />
10 Dangschat 1998, 26.<br />
11 Foucault 1990, 38.<br />
12 Ebd., 37.<br />
13 Simmel 1908, 461.<br />
14 Ebd., 460; Hervorhebungen im Original.<br />
15 Simmel 1908, 509.<br />
16 Nierhaus 1999, 20.<br />
17 Massey 1998, 254; Kuhlmann 2003a, 189.<br />
11
Hierarchie, die eine verfestigte soziale Beziehung darstellt, ausdrückt.“ 18 Diese räumlichen<br />
Hierarchien, Trennungen und Verbindungen sind „die Rollen und Mittel, mit denen Körper<br />
individuiert werden, um zu Subjekten [zu] werden“. 19 Struktur und Layout des Raumes „stel-<br />
len Information bereit und organisieren deren Zirkulation, und sie strukturieren den sozialen<br />
und regionalen Zugang zu Waren und Dienstleistungen“ – schlussendlich sorgen sie „für den<br />
Kontext, in dem soziale Gesetze und Erwartungen internalisiert oder zur Gewohnheit werden,<br />
um soziale Konformität sicherzustellen oder um soziale Marginalität in einer sicheren oder<br />
isolierten und umgrenzten Entfernung zu positionieren (Ghettoisierung).“ 20<br />
Diese besondere Qualität des Raumes kommt auch in der baulich-architektonischen Gestal-<br />
tung von Gebäuden zum Ausdruck. Die Architektur, so etwa Kuhlmann, „bot sich, neben der<br />
Kleidung, schon immer als geeignete Möglichkeit an, um soziale Differenzen zu akzentuieren<br />
oder Identitäten zu etablieren. Die Größe, der Schmuck und die Lage eines Gebäudes können<br />
in den meisten Fällen als verläßlicher Index für die Finanzkraft und gesellschaftliche Position<br />
seines Besitzers gelesen werden [...].“ 21 Es macht einen Unterschied, ob eine Familie in einem<br />
Einfamilienhaus, einer Mietswohnung, einem Wohnheim, Gasthaus oder Containerlager lebt<br />
– sowohl für die Familie selbst, als auch für Außenstehende. Die Architektur, so Kuhlmann,<br />
besitze jedoch noch weitere Qualitäten zur Etablierung von Differenz und Macht, wobei sie<br />
sich vor allem zweier Mechanismen bediene, um ihren Beitrag zur Konstruktion von sozialem<br />
Status, geschlechtlichen Rollen und sozialer Kontrolle zu leisten:<br />
„einmal die räumliche Separation von Individuen und Gruppen, um Kommunikation oder gemeinsame Handlungen<br />
zu untergraben, und zum anderen die Überwachung. Letztere betraf vor allem die visuelle Überwachung, um<br />
ein Machtverhältnis zwischen Individuen oder Gruppen zugunsten einer Elite einseitig zu verändern. Durch<br />
solche Strategien können mittels der Architektur Räume erschaffen werden, die dazu beitragen, ohnehin vorhandene<br />
soziale Unterscheidungen zu etablieren und Hierarchien in bezug auf Geschlecht, Rasse, Klasse oder Alter<br />
zu festigen.“ 22<br />
Wenn Architektur so zum Ausschluss bestimmter gesellschaftlicher Gruppen beitrage, so be-<br />
deute dies freilich noch nicht, dass „man Zäune oder Mauern errichten“ müsse, noch seien<br />
alle Ausschlussmechanismen notwendigerweise absichtlich geplant worden:<br />
„Bis zu einem gewissen Grade kann man der Architektur auch eine autonome Qualität der Restriktion und Diskriminierung<br />
unterstellen, die unabhängig von gesellschaftlichen Vorgaben besteht. Als Beispiel ließen sich etwa<br />
harmlose Treppenstufen anführen, die effektiv Fahrzeuge, Rollstuhlfahrer und Behinderte von Gebäuden oder<br />
Plätzen ausschließen, auch ohne daß dieses explizit von einer Gruppe erwünscht ist oder gar bewußt geplant<br />
wurde. In diesem Fall muß man davon ausgehen, daß der Ausschluß zwar funktioniert, aber daß es zufällige<br />
Faktoren waren, die zu dieser Konstruktion geführt haben.“ 23<br />
Freilich werden ähnliche, scheinbar zufällige Mechanismen zuweilen in der Stadtplanung<br />
eingesetzt, um „die Privilegien einer Gruppe auf Kosten einer anderen zu erhalten, ohne daß<br />
18<br />
Novy 2003b, 10.<br />
19<br />
Jormakka/Kuhlmann 2002, 15.<br />
20<br />
Ebd., 15f.<br />
21<br />
Kuhlmann 2003b, 13.<br />
22<br />
Ebd.<br />
23<br />
Kuhlmann 2003a, 197.<br />
12
es politisch zu offensichtlich ist“. 24 Wie in diesem Fall ist die Exklusion einer Gruppe auch in<br />
jenen Fällen nur scheinbar zufällig, in denen die eine Gruppe eine andere, hinsichtlich ihrer<br />
Machtressourcen unterlegene Gruppe in ein durch räumliche Separation und/oder Überwa-<br />
chung gekennzeichnetes Objekt einweist – der Einweisung geht ja in der Regel eine planvolle<br />
Entscheidung voraus.<br />
Ein weiterer Bereich ist hier schließlich noch zu benennen, an dem die oben skizzierte Quali-<br />
tät des Raumes deutlich wird: Jeder konkrete Ort weist eine spezifische Identität auf, einen<br />
„genius loci“. 25 Dieser ist dabei jedoch weder als „wesenhaft“ und statisch, noch als einheit-<br />
lich und homogen zu verstehen – hinter einer derartigen Sicht stünde, wie Massey formuliert,<br />
ein antiquiertes Verständnis von „place“ und „locality“ als „foci for a form of romanticized<br />
escapism from the real business of the world“. 26 „Der Raum, in dem wir leben, durch den wir<br />
aus uns herausgezogen werden, in dem sich die Erosion unseres Lebens, unserer Zeit und un-<br />
serer Geschichte abspielt, dieser Raum, der uns zernagt und auswäscht, ist selber auch ein<br />
heterogener Raum.“ 27 Was Foucault hier zum Ausdruck bringt, ist die vielfältige Gebrochen-<br />
heit der spezifischen Identität konkreter Orte, zu der das Verhältnis von Geschichte und Ge-<br />
genwart ebenso beiträgt wie die „Gemengelage von Beziehungen“ 28 sozialer, politischer, wirt-<br />
schaftlicher, kultureller und eben auch räumlicher Art der im Ort lebenden oder mit ihm in<br />
irgendeiner Verbindung stehenden Menschen. In Anlehnung an Massey kann daher im<br />
Grunde von „multiplen Ortsidentitäten“ gesprochen werden. 29 Diese können sowohl eine<br />
Quelle von Reichtum als auch von Konflikten darstellen – im einen Fall wäre wohl von einer<br />
„gefestigten“ Ortsidentität, einem Bündel verschiedener, mehr oder weniger zusammen-<br />
spielender Teilidentitäten zu sprechen, im anderen von einer Identität im Umbruch, welcher<br />
konfliktreich, vielleicht krisenhaft verläuft. Ein Blick auf diese Identitäten verspricht Einblick<br />
in die jeweilige lokale Deutungskultur, die Offenheit oder Geschlossenheit gegenüber dem<br />
24<br />
Ebd.<br />
25<br />
Vgl. Dangschat 2001, 9.<br />
26<br />
Massey 1998, 151.<br />
27<br />
Foucault 1990, 38.<br />
28<br />
Ebd.<br />
29<br />
Vgl. Massey 1998, 153. Die vielfach äußerst trennscharf vorgenommene Unterscheidung von Stadt und ländlichem<br />
Raum ist vor diesem Hintergrund nur vordergründig von entscheidender Bedeutung – Phänomene wie die<br />
„Stadtflucht“ der über eine höhere Bildung und ein entsprechendes Einkommen verfügenden Mittelschichtbevölkerung<br />
und der daraus resultierende Wandel mancher ländlicher Gemeinden zu partiell urbanisierten<br />
„Schlafgemeinden“ zeigen dies ebenso, wie der traditionell dörfliche Charakter mancher Stadtteile, der mit<br />
Bauernmärkten und ähnlichen Einrichtungen gerade in der jüngeren Vergangenheit vielfach sogar bewusst aktualisiert<br />
wurde. Auf einer grundlegenden Ebene sind freilich zumindest tendenziell, variierend mit der Größe<br />
oder Kleinheit einer Gemeinde und dem Grad der Zerstreutheit ihrer Besiedelung, nach wie vor sehr offensichtliche<br />
Unterschiede zu finden: Das leicht zu überblickende Dorf, in dem ein hohes Maß an (unumgänglicher)<br />
menschlicher Nähe meist zugleich ein hohes Maß an sozialer Kontrolle bedingt, steht als „Verdichtungszone<br />
sozialer Beziehungen“ (Fuchshofer 1994, 108) der relativen Anonymität urbaner Quartiere gegenüber – wenngleich<br />
auch diese auf Block- oder Hofebene häufig durch die Überschaubarkeit zwischenmenschlicher Beziehungen<br />
und den damit verbundenen hohen Grad an sozialer Kontrolle bestimmt sind.<br />
13
<strong>Neue</strong>n und von außen Kommenden, die lokale „Kultur der (Des-)Integration“ 30 – den, wie<br />
Dangschat in einer Erweiterung Bourdieus formuliert, „Habitus des Ortes“. 31<br />
Was ergibt sich aus diesen Überlegungen für die vorliegende Untersuchung? Folgt man der<br />
skizzierten Perspektive, so verspricht eine genaue Analyse der räumlichen Position von Un-<br />
terkünften für Asylsuchende, ihrer baulichen Ausführung und Gestaltung, ihrer ursprüng-<br />
lichen Funktion sowie ihrer Einbindung in die jeweils spezifische Umgebung nicht nur Auf-<br />
schluss über die konkrete Situation vor Ort und die dortige (Un-)Möglichkeit sozialer Bezie-<br />
hungen (die sich naturgemäß im Verhalten sowohl der untergebrachten Flüchtlinge als auch<br />
der im Umfeld lebenden Bevölkerung spiegelt), sondern darüber hinaus auch über das Ver-<br />
hältnis der aufnehmenden Gesellschaft zu den bei ihr asylsuchenden Menschen. Da es in der<br />
Praxis die Aufnehmenden sind, die über Ort und Art der Unterbringung der Aufgenommenen<br />
entscheiden, kann die spezifische Verortung und Gestaltung einer Unterkunft als Symbol für<br />
die Position angesehen werden, welche die „Einheimischen“ den asylsuchenden „Zugerei-<br />
sten“ zuschreiben und zuerkennen wollen.<br />
1.2 Kurze Wege und ein anderes Verständnis von Mobilität<br />
Wenden wir uns einer Ebene zu, auf der die Bedeutung des Standorts einer Unterkunft für die<br />
dort untergebrachten Asylsuchenden offensichtlicher wird. Asylsuchende haben in der Regel<br />
aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen, die ihr Leben strukturieren 32 , vor allem aber<br />
auch aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen spezifische Bedürfnisse. Aus dieser beinahe<br />
banalen Feststellung folgt, dass gerade an den Standorten organisierter Unterkünfte ein er-<br />
höhter Bedarf an durchaus konkret benennbaren Einrichtungen besteht. Gazić folgend kann<br />
dabei zwischen einem „biologischen“ und einem „psychosozialen“ Bereich unterschieden<br />
werden 33 : Ersterem ist die Befriedigung des Bedürfnisses nach physischem Überleben – etwa<br />
durch individuell verträgliche Nahrung in ausreichendem Umfang, eine adäquate medizini-<br />
sche bzw. gesundheitliche Versorgung, ausreichend Wohn- und Lebensraum u.ä.. – zuzuord-<br />
nen, zweiterer ist deutlich komplexer und umfasst insbesondere den Zugang zu sozialer und<br />
psychologischer bzw. psychotherapeutischer Betreuung, zu Bildungs-, Freizeit- und Kultur-<br />
einrichtungen und nicht zuletzt auch zu migrantischen Communities, Exil- und Religions-<br />
gemeinschaften. Einrichtungen zur rechtlichen Beratung und Betreuung von Asylsuchenden<br />
nehmen letztlich eine Zwischenposition ein. Entscheidend ist nun nicht das bloße Vorhanden-<br />
sein der betreffenden Einrichtungen, sondern ihre tatsächliche Nutzbarkeit und Zugänglich-<br />
30<br />
Dangschat 2001, 12.<br />
31<br />
Ebd.<br />
32<br />
Um exemplarisch drei davon zu nennen: das Asylverfahren mit seinen behördlichen „Einvernahmen“ und der<br />
folgenden, oft jahrelangen Wartezeit; die Aussichtslosigkeit, einen Arbeitsplatz zu finden, dafür eine Arbeitsgenehmigung<br />
zu erhalten und damit für den eigenen Lebensunterhalt sorgen und den Tag sinnvoll ausfüllen zu<br />
können; schließlich die hier thematisierte meist organisierte Unterbringung in Sammelunterkünften.<br />
33<br />
Vgl. Gazić 1999, 110.<br />
14
keit für Asylsuchende. Da diese im allgemeinen aufgrund ihrer finanziellen Lage – das mo-<br />
natliche „Taschengeld“, das in von der öffentlichen Hand organisierten Unterkünften lebende<br />
Flüchtlinge erhalten, betrug zuletzt gerade 40 Euro – nicht durch den Ankauf eines Privat-<br />
wagens oder ähnlichem selbst für ihre Mobilität sorgen können, sind sie auf den öffentlichen<br />
Nahverkehr angewiesen. Von besonderer Wichtigkeit ist hier nun einerseits eine möglichst<br />
unkomplizierte Verbindung in die Landeshauptstadt, in der nicht nur im Fall Tirols nahezu<br />
alle für Asylsuchende relevanten Institutionen und Organisationen konzentriert sind. Da die<br />
für eine Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anfallenden Kosten längere und damit teurere<br />
Fahrten in weiter entfernte Orte (sofern es sich nicht um refinanzierte Fahrten aufgrund be-<br />
hördlicher Vorladungen handelt) effektiv verhindern, sind Asylsuchende andererseits in be-<br />
sonderem Maße auf das Vorhandensein unterkunftsnaher Einrichtungen oder möglichst ko-<br />
stengünstiger (und also nur kürzere Distanzen überwinden müssende), häufig verkehrender<br />
öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen – oder anders formuliert: auf Unterkunftsstandorte, an<br />
denen der Zugang zu den erforderlichen Einrichtungen tatsächlich gewährleistet ist. Dies ver-<br />
bindet sie, wenn auch teils aus anderen Gründen, durchaus mit „ortsansässigen“ älteren Men-<br />
schen 34 , aber auch mit vielen Frauen 35 – Gruppen, für die bereits seit langem die „Stadt der<br />
kurzen Wege“ eingefordert wird.<br />
Diese kurzen Ausführungen machen bereits deutlich, dass das vorherrschende Verständnis<br />
von Mobilität, dessen Ausrichtung mit Bauhardt als „androzentrisch“ charakterisiert werden<br />
könnte, auf in organisierten Unterkünften lebende Asylsuchende nicht sinnvoll anwendbar ist:<br />
Im Hintergrund steht die Modellfigur des (männlichen) Pendlers zwischen Wohnung bzw.<br />
Haus und Arbeitsplatz. 36 Offenkundig berücksichtigt dieses Konzept, nicht nur im Hinblick<br />
auf die vom regulären Arbeitsmarkt in der Praxis weitgehend ausgeschlossene Gruppe der<br />
Asylsuchenden, nur einen schmalen Ausschnitt der Bedürfnisse und täglichen Gründe für<br />
Mobilität, bei der es mehrheitlich gerade nicht um das Zurücklegen großer Distanzen mit dem<br />
schnellsten aller möglichen Transportmittel geht – ein derart technokratisch-quantitativ ausge-<br />
richtetes Modell, „which merely calculates the amount of human tonnage that can be moved<br />
how far in how much time“ 37 , geht an den Erfordernissen des Alltags gerade auch Asyl-<br />
suchender letztlich vorbei. Mit Bauhardt ist hier daher für einen anderen Blick auf die Ver-<br />
kehrsinfrastruktur, für ein qualitatives Verständnis von Mobilität zu plädieren, das Raum und<br />
Zeit weniger als ökonomische Ressourcen und mehr als soziale Kategorien begreift: „This<br />
approach raises the issue reappropriating time and space as prerequisites for communication<br />
and an improvement of the quality of life [...].“ 38<br />
34 Vgl. Berktold 2002a und b.<br />
35 Vgl. Dörhöfer/Terlinden 1985; Bauhardt 2003.<br />
36 Vgl. Bauhardt 2003, 221.<br />
37 Ebd., 222f.<br />
38 Ebd., 222.<br />
15
1.3 Mehr als ein Dach über dem Kopf: Die Versorgung von Asylsuchenden<br />
Werfen wir nun einen Blick auf die Art der angesprochenen und für Asylsuchende bedeut-<br />
samen Einrichtungen. Der wichtigste und inhaltlich sehr breite Bereich ist hier der allgemei-<br />
nen Grundversorgung zuzuordnen. Als wesentliche Dimensionen können hier die Versorgung<br />
mit Gütern des täglichen Bedarfs, die medizinische Versorgung, die psychosoziale, psycholo-<br />
gische und psychotherapeutische Betreuung, der Zugang zu Bildung sowie zu Freizeit- und<br />
Sporteinrichtungen genannt werden. Warum sind diese Aspekte der Grundversorgung für<br />
Asylsuchende von besonderer Bedeutung?<br />
1.3.1 Güter des täglichen Bedarfs<br />
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, etwa mit Genuss- und Nahrungsmitteln<br />
oder Körperpflege- und ähnlichen Hygieneartikeln, scheint auf den ersten Blick eine nicht<br />
weiter erwähnenswerte Selbstverständlichkeit. So einfach ist es indessen nicht: Die klassische<br />
„Nahversorgung“ wird aufgrund der hinlänglich bekannten Konzentrationsprozesse, aber auch<br />
vor dem Hintergrund eines geänderten Mobilitäts- und Konsumverhaltens der Bevölkerung<br />
vor allem im ländlichen Raum seit geraumer Zeit immer seltener ihrem Namen wirklich ge-<br />
recht. Kleine wohnungsnahe AnbieterInnen geraten unter Druck und schließen zugunsten<br />
großer Einkaufszentren in zentralen Lagen. Peripher gelegene Gemeinden oder an den öffent-<br />
lichen Nahverkehr nur unzureichend angebundene Gebiete im „Sog“ regionaler Zentren sind<br />
daher häufig „Defiziträume“ der allgemeinen Grundversorgung. Sind Asylsuchende in sol-<br />
chen Gegenden untergebracht, so ergibt sich vor dem Hintergrund der bereits geschilderten<br />
(finanziellen) Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie sich zu bewegen haben, rasch ein ern-<br />
stes Versorgungsproblem. Doch auch allenfalls vorhandene unterkunftsnahe Nahversorgungs-<br />
einrichtungen decken meist nicht den Bedarf an Gütern aus der jeweiligen Herkunftsregion<br />
ab, die für Asylsuchende (wie für MigrantInnen im allgemeinen) vor allem in den ersten Mo-<br />
naten nach ihrer Ankunft im Aufnahmeland von besonderer Wichtigkeit sein können: Le-<br />
bensmittel, etwa Gewürze, die für den häufig eine völlig andere Ernährung gewohnten Körper<br />
verträglich sind 39 , mit deren Umgang man vertraut ist, die ein kleines Stück „Heimat“ in einer<br />
völlig neuen Umgebung bieten und damit zu gesundheitlichem Wohlbefinden und psychi-<br />
scher Stabilität beitragen können. Derartige Produkte sind meist nur in Betrieben der migran-<br />
tischen „Ergänzungsökonomie“ – Heckmann schlägt diesen Begriff angesichts des in<br />
Deutschland wie in Österreich weitestgehenden Fehlens vollständiger ethnischer Ökonomien<br />
vor, wie wir sie vor allem aus den Vereinigten Staaten kennen 40 – erhältlich, in beschränktem<br />
Ausmaß (und meist zu höheren Preisen) auch in freilich nicht trennscharf von diesen zu unter-<br />
scheidenden Betrieben der „Nischenökonomie“, deren Angebot sich vorrangig an der Nachfrage<br />
der Mehrheitsgesellschaft orientiert. 41<br />
39 Vor allem in der ersten Phase ihres Aufenthalts im Aufnahmeland leiden viele Asylsuchende aufgrund der<br />
ungewohnten Ernährung unter Magen- und Darmbeschwerden (vgl. etwa FOKUS 1994, 66).<br />
40 Vgl. Heckmann 1998, 33f.<br />
41 Ebd.<br />
16
1.3.2 Medizin und Gesundheit<br />
„Flucht macht krank“, resümiert Rauchfuss ebenso kurz wie prägnant. 42 In den meisten Fällen<br />
ist Flucht mit beträchtlichen körperlichen Strapazen verbunden. Entbehrung und Hunger, das<br />
Durchstehen unmittelbar lebensgefährdender Situationen, aber auch unzureichend oder falsch<br />
geheilte Verletzungen und Krankheiten, die keineswegs bereits vor der Flucht vorhanden ge-<br />
wesen sein müssen, bewirken einen schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustand von<br />
Flüchtlingen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. 43 Die Ergebnisse einer unter ande-<br />
rem von Tedeschi in den 1990ern in Vorarlberg durchgeführten Untersuchung des gesund-<br />
heitlichen Wohlbefindens der zum damaligen Zeitpunkt dort untergebrachten bosnischen<br />
Flüchtlinge und Asylsuchenden deuten daher auch auf ein beträchtliches Ausmaß an gesund-<br />
heitlichen Problemen der Betroffenen hin: Mehr als acht Prozent der Befragten gaben an,<br />
krank zu sein, über 35 Prozent führten gesundheitliche Beschwerden an. 44 Zwei von drei<br />
Asylsuchenden hatten sich im letzten halben Jahr in ärztliche Behandlung begeben, davon 31<br />
Prozent öfter als drei Mal. Dass über 62 Prozent angaben, ihre Beschwerden seien erst wäh-<br />
rend oder nach der Flucht aufgetreten 45 , bestätigt einerseits die als „Healthy-Migrant-Effect“<br />
bekannte Annahme, dass gesundheitlich geschwächte oder gar stärker erkrankte Arbeits-<br />
migrantInnen und Flüchtlinge meist nicht in der Lage seien, den beschwerlichen Weg nach<br />
Europa auf sich zu nehmen 46 , andererseits die langjährige Erfahrung einschlägig tätiger Bera-<br />
tungs- und Betreuungsorganisationen, dass die spezifische Unterkunfts- und Lebenssituation<br />
Asylsuchender im Aufnahmeland zu weiteren, teils massiven gesundheitlichen Beeinträchti-<br />
gungen führt. 47 Nicht von ungefähr kommt Rauchfuss daher zum Schluss, das Asylsuchende<br />
„aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge“ bedürften. 48 Die Art der<br />
gesundheitlichen Probleme Asylsuchender scheint sich, berücksichtigt man zunächst aus-<br />
schließlich manifest körperliche Beeinträchtigungen, dabei grundsätzlich zwar nicht auffällig<br />
von jener anderer Bevölkerungsgruppen zu unterscheiden, wie die Ergebnisse der wenigen<br />
vorliegenden Studien nahe legen. Dies kann freilich auch dahingehend gedeutet werden, dass<br />
die Mehrzahl der Ärztinnen und Ärzte nur sieht und diagnostiziert, was sie gewohnt ist. Die<br />
spezifischen Probleme, vermutet denn auch Junghanss, gingen im allgemeinen Gesundheits-<br />
versorgungssystem schlicht „durchs Netz, wenn wir nicht dafür sensibilisiert sind – was wir<br />
nicht sind“. 49 Die staatlicherseits organisierte Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden ist<br />
in ihrer gegenwärtigen Orientierung am Schutz der „einheimischen“ Bevölkerung vor mögli-<br />
42<br />
Rauchfuss 2001, 3.<br />
43<br />
Vgl. Glanzer 1998, 6; Schenk 2003.<br />
44<br />
Tedeschi 1996, 249.<br />
45<br />
Ebd., 250.<br />
46<br />
Vgl. Rauchfuss 2001, 3.<br />
47<br />
Vgl. etwa Wipfler 1986; FOKUS 1994; Ünal 1999; Groß 2000; Wirtgen 2000; Pflegerl/Fernández de la Hoz<br />
2001; Rauchfuss 2001; Kremla 2003.<br />
48<br />
Rauchfuss 2001, 9.<br />
49<br />
Junghanss 1999; ähnlich Groß 2000; Rauchfuss 2001.<br />
17
chen übertragbaren Krankheiten vorwiegend seuchenhygienisch ausgerichtet 50 und damit<br />
offenkundig kaum in der Lage, auf die spezifischen Erfordernisse angemessen zu reagieren.<br />
Nicht nur Asylsuchende, auch andere MigrantInnengruppen fühlen sich im System der Regel-<br />
versorgung entsprechend häufig nicht ernst genommen und vermeiden Arztbesuche oder ver-<br />
weigern, teils vor dem Hintergrund negativer Erfahrungen in ihren Herkunftsländern, ihnen<br />
unbekannte und nicht näher erläuterte Behandlungs- und Therapiemethoden. 51 Die Wichtig-<br />
keit eines problemlosen Zugangs zu aufmerksamen und aufgeschlossenen, im besten Fall in-<br />
terkulturell oder gar ethnomedizinisch kompetenten Ärztinnen und Ärzten, aber auch eine<br />
sorgfältige und funktionierende Einbindung in Gesundheitsvorsorgeprogramme ist vor diesem<br />
Hintergrund offensichtlich. 52 Spezialeinrichtungen für Asylsuchende und MigrantInnen sind –<br />
sofern sie nicht den psychologischen und psychotherapeutischen Bereich betreffen, auf den<br />
im Folgenden noch einzugehen sein wird – im Bereich der medizinischen Versorgung als<br />
kontraproduktiv zu werten: Mit Pammer ist darin eine „Klientelisierung“ und Individualisie-<br />
rung umfassenderer Problemlagen zu sehen, mit der eine letztlich künstlich geschaffene<br />
„Problemgruppe“ aus der Regelversorgung ausgeschlossen wird. 53<br />
1.3.3 Psychosoziale, psychologische und psychotherapeutische Unterstützung<br />
und Betreuung<br />
Der Ankunft von Asylsuchenden gehen meist mehr oder weniger starke Verfolgungs-, immer<br />
jedoch Flucht- und nachhaltige Verlusterfahrungen voraus. Friedrich charakterisiert den<br />
Verlust des „Heimes erster Ordnung“ daher als „tief einschneidendes Erlebnis für jeden Men-<br />
schen“ – zwar gebe es kein spezifisches Fluchtsyndrom, es gebe aber massive Kennzeichen,<br />
wie Menschen auf veränderte Lebens- und Umweltbedingungen reagierten:<br />
„Dazu gehört, daß Schlafstörungen auftreten, die Kinder einzunässen beginnen und daß sie ihr Verhalten ändern:<br />
ruhige Kinder laut werden, ehemals lebhafte Kinder extrem zurückgezogen. Angstsymptome, Depressionssymptome,<br />
Gereiztheitssymptome und körperliche Beschwerden, wie »ich mache mir Kopfzerbrechen über mein<br />
Leben und meine Zukunft« – daraus resultieren Kopfschmerzen. »Ich finde diese Form des Lebens zum Speiben«<br />
und ich komme zum Erbrechen. Ich reagiere mit dem Darm, weil »ich dieses Leben in Wirklichkeit als<br />
unerträglich empfinde« und deshalb Durchfälle entwickle. »Ich finde dieses Leben nicht verdaulich« und bekomme<br />
Magenbeschwerden.“ 54<br />
50<br />
Österreich unterscheidet sich diesbezüglich kaum von der deutschen Situation, für die u.a. Rauchfuss (2001, 7)<br />
eine derartige Ausrichtung konstatiert.<br />
51<br />
Vgl. Ünal 1999; Richter 2001; Mane 2004.<br />
52<br />
Sprachliche Verständigungsbarrieren können freilich auch hier eine qualifizierte Betreuung behindern oder gar<br />
verunmöglichen: Selbst in Kliniken wird nach wie vor immer wieder auf Kinder, andere Angehörige oder<br />
FreundInnen der PatientInnen oder auf Reinigungs- und Küchenpersonal als SprachmittlerInnen zurückgegriffen<br />
(Klocker 1996; Ünal 1999; Pammer 2000). Aus dieser Praxis resultieren häufig nicht nur Übersetzungsfehler<br />
oder -lücken mit teils äußerst bedenklichen Folgen (Ünal 1999; Salman 2002; Mane 2004), vor allem bei zu<br />
Übersetzungstätigkeiten herangezogenen Kindern sind auch nachhaltige destruktive Auswirkungen auf die<br />
Familienstruktur – v.a. die Eltern-Kind-Beziehung – zu erwarten, die eine Überforderung für alle Seiten darstellen<br />
(Klocker 1996). Dem könnte mittelfristig freilich nur mit dem Aufbau von für den medizinischen und psychologischen<br />
Bereich speziell qualifizierten Dolmetscherdiensten, vergleichbar etwa mit den diesbezüglichen<br />
Servicediensten am Ethno-Medizinischen Zentrum in Hannover oder am Zentrum für transkulturelle Medizin in<br />
München (vgl. Salman 2002), entgegengetreten werden.<br />
53<br />
Pammer 2000.<br />
54 Friedrich 1999, 24.<br />
18
Aufbauend auf den Erkenntnissen von Keilson wird allgemein zwischen einer „ersten trauma-<br />
tischen Sequenz“ – der sich abzeichnenden individuellen Bedrohung durch Verfolgung etwa<br />
in Form zunehmender Diskriminierungen, kriegsähnlicher Auseinandersetzungen etc. – und<br />
einer „zweiten traumatischen Sequenz“ unterschieden, die mit dem Beginn der direkten Ver-<br />
folgung des Einzelnen und seiner Familie einsetzt und die Flucht bis zur Ankunft im Auf-<br />
nahmeland umfaßt. 55 Eine von Derviškadić Jovanović/Mikuš Kos in den 1990ern durchge-<br />
führte Untersuchung minderjähriger Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina vermittelt einen<br />
Eindruck der quantitativen Bedeutung dieser zweiten Sequenz zuordenbarer traumatischer<br />
Erfahrungen in gewaltsam eskalierenden interethnischen Konflikten (vgl. Tab. 1): 18 Prozent<br />
der Minderjährigen waren demnach unmittelbar von Waffengewalt bedroht, wurden gefoltert<br />
oder vergewaltigt, 32 Prozent waren Granat- und anderem Beschuss und unmittelbarer Le-<br />
bensgefahr ausgesetzt, 23 Prozent erlebten Granat- und anderen Beschuss „not so close“. Im-<br />
merhin 15 Prozent der Betroffenen wurden während ihrer Flucht bedroht oder misshandelt.<br />
Tabelle 1: Traumatische Kriegserfahrungen minderjähriger Flüchtlinge<br />
aus Bosnien-Herzegowina<br />
War experience %<br />
Direct threat with gun, tortured, raped 18<br />
Exposed to shelling, shooting, direct life danger 32<br />
Experienced shelling, shooting not so close 23<br />
Threats and maltreatment during flight 15<br />
Not exposed to any war event 12<br />
Quelle: Derviškadić Jovanović/Mikuš Kos 1999, 196.<br />
Vor diesem Hintergrund mag es kaum verwundern, wenn die AutorInnen der angesprochenen<br />
Vorarlberger Studie in den 1990ern zum Schluss kamen, knapp jeder fünfte Flüchtling im Zu-<br />
fluchtsland Österreich stünde aufgrund „psychischer Beschwerden“ in ärztlicher oder psy-<br />
chologischer Behandlung. 56 Da davon auszugehen ist, dass keineswegs alle Asylsuchenden<br />
mit „psychischen Beschwerden“ deshalb auch fachliche Unterstützung suchen, liegt die An-<br />
nahme nahe, dass die Zahl der tatsächlich Betroffenen noch größer ist. Verschiedene Studien<br />
kamen in der jüngeren Vergangenheit zum Schluss, dass etwa jeder dritte bis vierte asyl-<br />
suchende Flüchtling als Folge von Foltererfahrungen oder Krieg an traumabedingten Störun-<br />
gen leidet 57 – eine schweizerische Studie ergab Anfang der 1990er Jahre gar, dass jeder vierte<br />
bereits asylberechtigte Flüchtling vor seiner Flucht systematisch gefoltert worden war. 58<br />
55 Marwitz 1997, 135; vgl. weiterführend Hans Keilson: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Deskriptivklinische<br />
und quantifizierend-statistische follow-up-Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen in den<br />
Niederlanden, Stuttgart: Enke 1979.<br />
56 Tedeschi 1996, 250.<br />
57 Vgl. Junghanss 1999; Wirtgen 2000; Koch 2001.<br />
58 Vgl. Hans-Rudolf Wicker: Die Sprache extremer Gewalt. Studie zur Situation von gefolterten Flüchtlingen in<br />
der Schweiz und zur Therapie von Folterfolgen im Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes, Bern: Institut<br />
für Ethnologie der Universität Bern, 1993 (unveröffentlicht; vgl. hierzu etwa Junghanss 1999).<br />
19
Es sind jedoch nicht nur die Gefolterten, Inhaftierten oder „Verschwundenen“ selbst, die<br />
durch die massiven physischen und psychischen Gewalterfahrungen traumatisiert werden: Die<br />
unmittelbaren Angehörigen der Betroffenen werden gewissermaßen „mittraumatisiert“, vor<br />
allem Kinder entwickeln in der Folge häufig Symptombilder, die jenen der direkt Gefolterten<br />
täuschend ähnlich sind. 59 Auch wenn die bedrohende Situation vorüber ist, hält die psychische<br />
und körperliche Reaktion bei vielen Menschen an – oft sogar jahr- oder jahrzehntelang und<br />
auch, wenn sie vom Ort der Traumatisierung tausende Kilometer entfernt sind. 60 Die trauma-<br />
tisierenden Ereignisse bleiben dann wie frische Wunden im Gedächtnis und werden ständig<br />
wieder reproduziert:<br />
„Sie tauchen nachts auf in Alpträumen, tagsüber in Gedanken und Bildern. Diese werden manchmal spontan<br />
oder im Gefolge irgendeines Alltagsereignisses, das an das Trauma erinnert, ausgelöst: Der Klang schwerer<br />
Schritte auf dem Flur im Wohnheim, ein spezieller Geruch, eine [sic!] Gesprächstermin bei Behörden oder beim<br />
Arzt, der den Betroffenen an die damalige Verhörsituation erinnert. Angstvoll tasten traumatisierte Menschen die<br />
Umgebung nach Bedrohungen ab [...] und versuchen, solche Situationen zu vermeiden. Sie verbleiben im Zustand<br />
innerer Anspannung und Erregtheit oder in einem Zustand der Erstarrung. Phasen von innerer Erregtheit<br />
können mit Phasen der Erstarrung wechseln, beide sind Ausdruck der Grundstimmung Angst. Die Angst ist oft<br />
gepaart mit dem Gefühl der Ausweglosigkeit, der Hoffnungslosigkeit.“ 61<br />
Die hier beschriebenen aus einer Traumatisierung resultierenden Symptome des Wiedererle-<br />
bens, Vermeidens und der anhaltenden Übererregung stellen eine zentrale Form der trauma-<br />
bedingten psychischen Reaktion dar, die unter dem Begriff der „posttraumatischen Belas-<br />
tungsstörung“ 62 auch in der öffentlichen Debatte um traumatisierte Asylsuchende mittlerweile<br />
im Zentrum der Aufmerksamkeit steht – eine Entwicklung, die teils durchaus kritisch als<br />
„Verengung der Diskussion“ bewertet wird, die den epidemiologischen Befunden nicht ent-<br />
spräche, denn:<br />
„Tatsache ist, dass Menschen auf traumatische Ereignisse auch mit einer ganzen Reihe anderer psychischer Störungen<br />
reagieren können, insbesondere Depression, Angst- und Panikstörungen, dissoziativen Störungen, Suchtkrankheiten,<br />
somatoformen Störungen, psychosomatischen Störungen und weitere können entweder einzeln oder<br />
in verschiedenen Kombinationen auftreten (Komorbidität).“ 63<br />
Rassistische Übergriffe und Diskriminierungserfahrungen, Demütigungen im Rahmen der<br />
spezifischen Lebenssituation als Asylsuchende, aber auch Nachrichten aus dem Heimatland<br />
und die Sorge um zurückgebliebene Verwandte und FreundInnen können in jedem Fall dazu<br />
beitragen, dass traumatische Erlebnisse aktualisiert werden und die Betroffenen innerlich<br />
nicht zur Ruhe kommen. Derartige Retraumatisierungen können letztlich auch zu einer Ver-<br />
stärkung und Ausweitung der Symptome führen. 64 Der Nachfluchtphase kommt daher auch<br />
59<br />
Wicker 1993, 265. Einführend zum Traumabegriff siehe u.a. Lueger-Schuster 2000; Koch 2001; Preitler 2004.<br />
60<br />
Vgl. Wicker 1993; Wenk-Ansohn 1996; Lueger-Schuster 2000; Koch 2001.<br />
61<br />
Wenk-Ansohn 1996, 92f; Hervorhebung im Original.<br />
62<br />
Einführend siehe u.a. Lueger-Schuster 2000; Koch 2001; Preitler 2004.<br />
63<br />
Koch 2001, 11.<br />
64<br />
Vgl. u.a. Wenk-Ansohn 1996, 96; Wirtgen 2000, 56; Ghaderi 2004, 82. FlüchtlingsbetreuerInnen berichten<br />
häufig, dass auch manche Asylsuchende, die zuvor keine psychischen Probleme zeigten, „durchdrehen“ würden,<br />
weil sie „die ewige Warterei, das Leben auf der Straße oder unter unwürdigen Bedingungen, die permanente<br />
Existenzangst aufgrund der Verweigerung elementarer Grundgüter (Bett, Essen, Krankenversicherung)“ nicht<br />
mehr ertragen könnten (Riedl 2001, 18).<br />
20
entscheidende Bedeutung für die seelische Gesundung oder ebene chronische Verfestigung<br />
der Erkrankung der Betroffenen zu, wie etwa Preitler verdeutlicht:<br />
„Kann nach dem Trauma schnell Sicherheit wiedergewonnen werden, gibt es einen Platz zum Trauern, Erzählen<br />
und Ausruhen, kann die notwendige Information eingeholt werden, um sich nicht mehr hilflos zu fühlen, wird<br />
dies entscheidend positiv für die weitere Entwicklung sein. [...] Dort wo aber Verfolgung und Unsicherheit weiter<br />
bestehen, wo Situationen wieder an die erlittene Gewalt erinnern, wo das Erlittene nicht geglaubt wird und in<br />
Frage gestellt wird, kann dies lebenslanges chronisches Leid endgültig verfestigen.“ 65<br />
Freilich ist es durchaus umstritten, ob eine intensive psychotherapeutische Betreuung trauma-<br />
tisierter Asylsuchender überhaupt möglich ist. Für Graessner etwa verbieten sich „tiefere und<br />
aufdeckende Behandlungen“ bei im Asylverfahren stehenden Flüchtlingen, deren Aufent-<br />
haltsstatus damit nicht gesichert ist, „aufgrund der Aktualität der Abschiebungsängste“, eine<br />
intensive Therapie müsse „den Exilierten mit sicherem Aufenthaltsstatus vorbehalten blei-<br />
ben“. 66 Für eine Therapie zumindest von extremtraumatisierten Asylsuchenden – die dann in<br />
jedem Fall auch die unterstützende Begleitung im Asylverfahren umfasst 67 – plädiert indessen<br />
auch er, schließlich seien die mittelfristigen Ergebnisse um so wirksamer, je früher die Be-<br />
handlung des Foltertraumas beginne, überdies sei es generell schwierig,<br />
„für Folterüberlebende eine angemessene und aufmerksame Behandlung im System der niedergelassenen<br />
Kassenärzte zu finden, denn Behandlung von Folterfolgen ist sehr zeitaufwendig und wegen der sprachlichen<br />
Probleme im Rahmen der Kassenpraxis kaum zu leisten. Die Auseinandersetzung mit Folter und gefolterten<br />
Menschen bedarf gezielter Stützung und Reflexion der Therapeuten in Selbsterfahrung und Supervision. Minimierung,<br />
Verleugnung, Vermeidung und Ausblendung sind oft menschliche Reaktionen auf geschilderte Foltererlebnisse.“<br />
68<br />
Ein Vergleich zweier schweizerischer Studien größeren Umfangs zeigt tatsächlich, dass bei<br />
der Konsultation von AllgemeinmedizinerInnen Foltererfahrungen Asylsuchender kaum ex-<br />
plizit zur Sprache kommen. 69 Mit Junghanss können hier vier Fragen gestellt werden:<br />
(1) Finden Folteropfer nicht den Weg in allgemeinmedizinische Praxen?<br />
(2) Finden sie den Weg doch, können aber ihre spezifischen Probleme nicht aussprechen?<br />
(3) Finden sie den Weg, sprechen ihre Probleme in der ihnen eigenen Weise aus, werden von Ärztin oder Arzt<br />
jedoch nicht verstanden?<br />
(4) Oder versteht sie die Ärztin bzw. der Arzt gar und kann – selbst überwältigt vom Gedanken, in ein Gespräch<br />
über Folter eintreten zu müssen – den Ball der Patientin oder des Patienten nicht aufnehmen? 70<br />
An diesen wenigen Fragen wird die Bedeutung des unkomplizierten Zugangs zu kompetenter<br />
psychosozialer Betreuung und in weiterer Folge zu in den Bereichen der interkulturellen Psy-<br />
65<br />
Preitler 2004, 15; vgl. Wirtgen 2000, 56. Derviškadić Jovanović/Mikuš Kos (1999, 201) schreiben dabei v.a.<br />
dem Schutz minderjähriger Flüchtlinge vor einer sekundären Traumatisierung im Aufnahmeland einen zentralen<br />
Stellenwert zu: „The prevention of secondary traumatisation [...] and the prevention of cumulative adversities are<br />
of tremendous importance for the mental health of traumatised children.“<br />
66<br />
Graessner 1996, 202.<br />
67<br />
Ebd., 203; Preitler 1996, 111.<br />
68<br />
Graessner 1996, 202f.<br />
69<br />
Vgl. Junghanss 1999; ähnlich David 2002.<br />
70<br />
Junghanss 1999. David (2002, 14f) konstatiert als Ergebnis jedenfalls „eine inadäquate medikamentöse Behandlung<br />
ohne traumaspezifischen Hintergrund“ und als Folgen „häufige Wechsel der Ärzte und nicht selten die<br />
Einweisung in eine Klinik zur stationären Behandlung“ – durch medizinische und psychodiagnostische Früherkennung<br />
könnten die daraus entstehenden hohen Kosten wenigstens vermindert werden.<br />
21
chotherapie oder der Ethnopsychoanalyse qualifizierten und erfahrenen PsychologInnen und<br />
PsychotherapeutInnen offensichtlich. 71<br />
1.3.4 Juristische Beratung und Betreuung<br />
Asylsuchende sind im Rahmen ihres Asylverfahrens mit der Materie das Asylrechts konfron-<br />
tiert, als sogenannte „Fremde“ im fremdenpolizeilichen Verfahren außerdem mit jener des<br />
Fremdenrechts. Eine beträchtliche Zahl an weiteren regionalen, nationalen, europa- sowie<br />
völkerrechtlichen Regelungen spielt eine bedeutende Rolle. Die teils äußerst komplizierte<br />
Rechtslage ist für die Betroffenen ohne qualifizierte juristische Beratung und Betreuung nicht<br />
annähernd verständlich. Eine einmalige Beratung an den Außenstellen des Bundesasylamts<br />
entspricht zwar den formalen Erfordernissen, nicht jedoch dem außerordentlichen Informa-<br />
tionsbedarf auf Seiten der Flüchtlinge. Das Leben in Unterkünften für Asylsuchende ist meist<br />
geprägt durch eine auffällige Beziehungslosigkeit, der allgemeine Verunsicherung und Desin-<br />
formation zugrunde liegt 72 ; die auf Gerüchten basierende Gesamtatmosphäre befördert vor<br />
allem das Misstrauen zwischen Flüchtlingen und Personal. Vor diesem Hintergrund verwun-<br />
dert es kaum, dass gerade der Kontakt mit unabhängigen juristischen BeraterInnen und Be-<br />
treuerInnen außerhalb der Unterkunft für viele Asylsuchende von derart zentraler Bedeutung<br />
ist, dass sie teils beträchtliche Strapazen auf sich nehmen, um an Informationen zu gelangen,<br />
die nicht innerhalb der Unterkünfte kursieren. BetreuerInnen berichten von KlientInnen, die –<br />
teils über mehrere Jahre hinweg – mindestens einmal wöchentlich die Beratungsstelle auf-<br />
suchten. 73 Dies verweist auf einige weitere bedeutsame Aspekte hinsichtlich des Zugangs zu<br />
Beratung und Betreuung außerhalb der Unterkunft:<br />
• Um die Beratungsstellen zu erreichen, müssen Asylsuchende selbst aktiv werden und ihr<br />
Leben selbst „in die Hand nehmen“, was ihnen in einem für sie zentralen Bereich, in dem<br />
sie ansonsten zur Gänze von der inhaltlich wie zeitlich unabsehbaren Entscheidung einer<br />
abstrakten und fernen Behörde abhängig sind, zumindest das Gefühl gibt, selbst etwas<br />
„tun“ zu können.<br />
• Die BeraterInnen und BetreuerInnen sind häufig der einzige Kontakt in die „Mehrheits-<br />
gesellschaft“ hinein, der Asylsuchenden jenseits der häufig stark hierarchisch geprägten<br />
Beziehung zum Unterkunftspersonal standortbedingt oder aus persönlichen Gründen<br />
möglich ist.<br />
• Über Beratungsstellen gelingt es Asylsuchenden vielfach, Kontakt zu räumlich weiter<br />
entfernten migrantischen oder religiösen Communities, zu Exilgemeinschaften oder auch<br />
71 Noch mehr als für den Bereich der Gesundheitsversorgung gilt dabei für die psychologische und psychotherapeutische<br />
Unterstützung, dass fachlich kompetente DolmetscherInnen zur Verfügung stehen müssen (vgl. hierzu<br />
etwa Preitler 1996, 115f; den Einsatz von DolmetscherInnen ablehnend Gazić 1999, 114f).<br />
72 Vgl. hierzu auch die Wahrnehmungen von Wischenbart 1995, 205; Karlegger 1996, 78.<br />
73 Interview Beratung/Betreuung 08, 05.06.2004 und 11, 13.11.2004.<br />
22
schlicht zu als vertrauenswürdig und aufmerksam erachteten Ärztinnen und Ärzten oder<br />
PsychologInnen aufzunehmen.<br />
1.3.5 Bildung<br />
Flüchtlinge und Asylsuchende messen der Bildung vor allem ihrer Kinder im allgemeinen<br />
einen herausragenden Stellenwert zu. Die quer durch die vergangenen Jahrzehnte geübte Pra-<br />
xis der Selbstorganisation von Bildungssystemen vor allem in Flüchtlingsgemeinschaften in<br />
den jeweiligen Krisenregionen zeigt dies in besonders augenfälliger Weise – wie die<br />
UNRWA etwa dokumentierte, boten palästinensische Flüchtlinge bereits unmittelbar nach<br />
dem ersten arabisch-israelischen Krieg 1948 an, eine Kürzung der Essensrationen hinzuneh-<br />
men, wenn mit den dadurch freiwerdenden Mitteln Bildungsmaßnahmen für ihre Kinder or-<br />
ganisiert würden. 74 Tatsächlich bedeutet ein früher Schulbesuch für Kinder nicht nur, Lesen<br />
und Schreiben lernen zu können: Der tägliche Unterricht, das regelmäßige Zusammentreffen<br />
mit AltersgenossInnen und LehrerInnen strukturiert ihren Tag auch auf sinnvolle Art. Schule<br />
ist für minderjährige Flüchtlinge daher ein Stück Stabilität in einer chaotischen Welt, sie bie-<br />
tet ihnen „in der Phase des radikalen Umbruchs ihres Lebens und tiefreichender Irritationen<br />
eine Anlaufstelle mit einer festen und kontinuierlichen Zeitstruktur und Bezugsgruppe und<br />
mit neuen (Lern-)Aufgaben“. 75 Der Unterricht hilft jedoch nicht nur bei der Tagesstrukturie-<br />
rung: Durch Malen, Zeichnen, Singen und Spielen erhalten die Kinder und Jugendlichen auch<br />
die Möglichkeit, ihre Erlebnisse auszudrücken und zu verarbeiten. Die Kontakte zu LehrerIn-<br />
nen und AltersgenossInnen, vor allem aber auch der Unterricht selbst bieten ihnen zudem<br />
Hilfe bei der Orientierung in der fremden Umgebung, ja: im völlig veränderten eigenen Le-<br />
ben. Neben der Stabilisierungsfunktion kommt der Schule daher auch eine Orientierungs-<br />
funktion zu. Schließlich kann Schule auch schlicht eine Chance darstellen, der meist als bela-<br />
stend empfundenen Situation in den Sammelunterkünften zu entrinnen – oder zum willkom-<br />
menen Ort des zeitweisen Ausstiegs aus einem ebenso erlebten familiären Umfeld werden, in<br />
dem die Gespräche fast ausschließlich um die verlorene Heimat, dort Erlebtes und dortige<br />
Ereignisse kreisen 76 oder teils schwerwiegende seelische Veränderungen der traumatisierten<br />
Eltern zu oft unerträglichen Situationen führen. 77 Schule ist, so kann daher mit Anderson resü-<br />
miert werden, „die »Rettungslinie« hin zu anderen sozialen Kontakten in der Mehrheitsgesell-<br />
schaft, aber auch zur Wissensaneignung und Qualifikation und letztlich zur psychischen<br />
Stabilisierung. Letzteres gilt gerade für Kinder, die durch die Fluchterlebnisse psychisch<br />
schwer belastet sind.“ 78<br />
74 Vgl. Jäger 2002, 3.<br />
75 Meinhardt 1997, 17.<br />
76 Vgl. hierzu Marwitz 1997, insbesondere 136.<br />
77 Vgl. Wirtgen 2000, 57.<br />
78 Anderson 2000, 46. Ähnlich auch Derviškadić Jovanović/Mikuš Kos (1999, 198), die der Schule die Rolle<br />
eines „extremely important protecting factor“ zusprechen.<br />
23
Schulen erfüllen jedoch letztlich auch für die Eltern der Kinder die Funktion „integrierender“<br />
Institutionen: Über sie werden unausgesprochene (mehrheits-)gesellschaftliche Erwartungs-<br />
haltungen kommuniziert, deren Kenntnis für das alltägliche Leben von erheblicher Bedeutung<br />
ist. 79 Zugleich schaffen Schulen konkrete Kontaktmöglichkeiten zu „einheimischen“ Eltern<br />
und damit in die Mehrheitsgesellschaft hinein. Doch auch für sich selbst schreiben erwach-<br />
sene Flüchtlinge im allgemeinen der Bildung einen hohen Stellenwert zu: Sie erscheint als<br />
einzig realistische Möglichkeit, dem mit dem Verlust der sozialen und beruflichen Veranke-<br />
rung im Herkunftsland in der Regel einhergehenden enormen Statusverlust und dem damit<br />
verbundenen sozialen Abstieg entgegenzuwirken. 80<br />
Der Zugang zu Bildungseinrichtungen ist für Asylsuchende aller Altersgruppen also von er-<br />
heblicher Bedeutung: Sie bieten einen geordneten und tagesstrukturierenden Rahmen, geben<br />
Orientierung und ermöglichen die Entwicklung konkreter Perspektiven. Fehlt dieser Zugang<br />
und konnte die Zeit des Asylverfahrens daher nicht für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
oder Nostrifizierungen genutzt werden (was gegenwärtig dem Regelfall entspricht 81 ), sind<br />
Flüchtlinge nach einer späteren Asylgewährung mit beträchtlichen Schwierigkeiten konfron-<br />
tiert: Die Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt wird vielfach zu einem überaus be-<br />
schwerlichen Projekt, da die Betroffenen oft im sprichwörtlichen Sinn den Anschluss verloren<br />
haben und ohne Unterstützung auch nicht mehr finden. 82<br />
1.3.6 Freizeit und Sport<br />
Der weitgehende Ausschluss vom regulären Arbeitsmarkt 83 bedeutet für Asylsuchende zu-<br />
nächst vor allem, ein „Übermaß“ an freier Zeit zur Verfügung zu haben. Da sich die räumli-<br />
che Situation in Sammelunterkünften in der Regel überaus beengt darstellt, sind Asyl-<br />
suchende auf den öffentlichen Raum angewiesen, um ihre Freizeit einigermaßen zufrieden-<br />
stellend verbringen zu können. Plätze oder Parkanlagen mit Bänken sind hier ebenso zu nen-<br />
nen, wie klassische Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen. Vor allem Parks nehmen dabei<br />
die Funktion eines „verlängerten Wohnzimmers“ 84 ein. Generell stellt sich das Nutzungs-<br />
verhalten dabei durchaus unterschiedlich nach Altersgruppen und Geschlecht dar 85 : Weibliche<br />
Jugendliche und Frauen treffen sich vor allem an Plätzen, die einerseits nicht allzu exponiert<br />
im Mittelpunkt stehen, von denen sie andererseits jedoch einen guten Überblick auf das Ge-<br />
schehen in der Umgebung haben. Erwachsene Männer versammeln sich dagegen gern an<br />
79 Vgl. Brunner et al. 2003.<br />
80 Vgl. Freithofer 2002; Reching 2003. Tedeschi (1996, 241) kam in seiner Studie über in den 1990er in Vorarlberg<br />
untergebrachte bosnische Flüchtlinge zum Ergebnis, dass die arbeitsuchenden Flüchtlinge in der Regel<br />
einen deutliche höheren Ausbildungsgrad aufwiesen als die zur gleichen Zeit arbeitslosen ArbeitsmigrantInnen,<br />
Flüchtlinge würden auf dem Arbeitsmarkt daher eher mit österreichischen Staatsangehörigen höherer Qualifikation<br />
konkurrieren.<br />
81 Freithofer 2002; Reching 2004.<br />
82 Vgl. hierzu etwa Schaupp 2004.<br />
83 Vgl. Fronek 2004a.<br />
84 Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001, 65.<br />
85 Vgl. Paravicini 2003, 70.<br />
24
zentralen Orten, um dort zu plaudern und dem öffentlichen Leben zuzuschauen, Burschen und<br />
männliche junge Erwachsene wiederum bevorzugen den Sportplatz oder für (Fuß-)Ballspiele<br />
nutzbare Rasenflächen, Mädchen nutzen derartige Rasenflächen durchaus auch, beanspruchen<br />
für sich jedoch meist weit weniger Raum. Zwar ist ohne Zweifel davon auszugehen, dass die-<br />
ses Verhalten über „institutionalisierte Genderismen“ gewissermaßen sozial konstruiert und<br />
nicht die Folge einer „natürlichen Geschlechterdifferenz“ ist 86 , an den praktischen Erschei-<br />
nungsformen ändert das zunächst indessen wenig.<br />
Eine Rolle spielt jedoch nicht nur die schlichte Existenz öffentlicher Plätze und Freizeitein-<br />
richtungen, sondern auch der Zugang zu ihnen – und ihre Ausführung. Hier zeigt sich, dass<br />
Frauen schlecht und unübersichtlich gestalteten, ungepflegt oder gar verwildert erscheinenden<br />
öffentlichen Raum deutlich weniger frequentieren als Männer, auch meiden sie weitere und<br />
wenig übersichtliche Zugangswege. 87 Tatsächlich vorgenommene Sicherheitsüberlegungen<br />
(die bei Mädchen offenbar tendenziell eine wichtigere Rolle spielen als bei älteren und alten<br />
Frauen) tragen dazu ebenso bei wie die mit einschlägigen Warnungen vor der Gefährlichkeit<br />
desolater Orte verbundene „soziale Produktion“ von Angst. 88 Das Vorhandensein von Spiel-<br />
plätzen und die leichte Erreichbarkeit stellen umgekehrt Attribute dar, welche eine höhere<br />
Frequentierung öffentlicher Plätze auch durch Frauen fördern. 89 Übersichtlichkeit, gute Sicht-<br />
barkeit, zentrale Lage und Spielmöglichkeiten, so kann daher resümiert werden, stellen we-<br />
sentliche Anforderungen an öffentliche Plätze nicht nur für Asylsuchende, sondern für alle<br />
NutzerInnen dar. Sind derartige Anlagen nicht vorhanden, bleiben vor allem Frauen, Kinder<br />
sowie ältere und alte Asylsuchende auf die Unterkunft selbst und deren Räumlichkeiten an-<br />
gewiesen, in denen sie ihre Zeit gewissermaßen „absitzen“ müssen.<br />
1.4 Ressource oder Bedrohung? Die Rolle migrantischer Communities<br />
und Exilgemeinschaften<br />
In der Diskussion um die Unterbringung von Asylsuchenden bislang häufig unberücksichtigt<br />
blieb ein weiterer, zumindest indirekt letztlich auch der Grundversorgung zuordenbarer Be-<br />
reich: die Rolle migrantischer Communities und Exilgemeinschaften. Insbesondere Politik<br />
und öffentliche Verwaltung schätzen die Bedeutung derartiger Netzwerke notorisch gering<br />
oder versuchen gar, ihrer Bildung aufgrund einer einseitigen Sicht auf Segregationsentwick-<br />
lungen gezielt gegenzusteuern. 90 Die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts „Multikulturel-<br />
les Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Bezügen“ vom Deutschen Jugendinstitut<br />
86<br />
Maihofer (2004, 36f) bietet für die vielfältigen Orte dieser Konstruktion ein besonders augenfälliges Beispiel,<br />
wenn sie auf die architektonische Gestaltung vieler Schulhöfe verweist: „Mit dem in der Mitte des Platzes aufgemalten<br />
Fußballfeld und den am Rande plazierten Turnstangen sind für alle Beteiligten – wie bei den Schildern<br />
an den Toilettentüren – klare geschlechtsspezifische Handlungsanweisungen verbunden.“<br />
87<br />
Vgl. Kallus 2003, 123f; Paravicini 2003, 60f.<br />
88<br />
Vgl. Kallus 2003, 123f.<br />
89<br />
Vgl. Paravicini 2003, 72.<br />
90<br />
Für eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Debatte vgl. Hanhörster 2001, v.a. 17-20.<br />
25
Ende der 1990er durchgeführten Erhebungen zeigen jedoch, dass gut organisierte Netzwerke<br />
von „Landsleuten“ Asylsuchenden effektiv und vergleichsweise rasch bei der Beschaffung<br />
von angemessenem Wohnraum außerhalb der „öffentlichen“ Sammelunterkünfte helfen kön-<br />
nen. 91 „Meine GesprächspartnerInnen“, schildert Anderson seine diesbezüglichen Erfahrun-<br />
gen aus dem Projekt, „erwähnten z.B. in diesem Zusammenhang afghanische Familien, da sie<br />
meistens aus der Mittelschicht stammen und die mittlerweile seit zwanzig Jahren andauernden<br />
Unruhen im Heimatland zur Bildung etablierter Exilgemeinschaften geführt hat“. Konkret<br />
hieße das,<br />
„dass Familien auf der Suche nach einer Wohnung auf Verwandtschaft oder Bekannten [sic!] mit fundiertem<br />
Wissen bezüglich der mitteleuropäischen Gepflogenheiten und auch der konkreten Mechanismen des Wohnungsmarktes<br />
zurückgreifen können. Der Zugang zu einem Netzwerk von Landsleuten als bestehender Flüchtlingsgemeinschaft<br />
mit entsprechenden Kenntnissen und Kontakten ist in diesem Zusammenhang entscheidend.<br />
Viele Gesprächspartner bestätigten, dass diese »ethnischen Netzwerke« von großer Bedeutung sind.“ 92<br />
Tatsächlich stellen migrantische Communities oder Exilgemeinschaften in nahezu allen Be-<br />
reichen des täglichen Lebens eine potentielle „Überlebenshilfe“ für Asylsuchende dar. Wie<br />
bei ArbeitsmigrantInnen bedeutet zunächst auch bei Flüchtlingen der Zugang zu diesen Netz-<br />
werken, dass sie nicht in eine ihnen völlig unbekannte Umgebung kommen, sondern Elemente<br />
des Vertrauten wiederfinden. Bereits die gemeinsame Sprache begünstigt einen vertrauens-<br />
vollen Austausch: „Leute mit derselben Sprache können etwa »zwischen den Zeilen lesen«<br />
und somit Nuancen der gemeinsamen Symbole und der Körpersprache deuten.“ 93 Communi-<br />
ties können daher gleichermaßen zur Orientierung wie auch zur Stabilisierung, Entlastung und<br />
Identitätssicherung beitragen und so, wie Heckmann formuliert, „bestimmte »praktische«,<br />
kognitive und emotive Anpassungshilfen“ 94 bieten. Häufig sind migrantische Organisationen<br />
und Netzwerke daher die erste Anlaufstelle für Asylsuchende, wenn es um die Empfehlung<br />
von vertrauenswürdigen Ärztinnen und Ärzten oder AnwältInnen, das Aufzeigen von Wegen<br />
durch den „Behördendschungel“, Hinweise auf ergänzungsökonomische Betriebe, die Be-<br />
schaffung von Informationen über die Herkunftsregion oder auch schlicht um die Organisa-<br />
tion eines vorübergehenden Schlafplatzes oder ein bisschen Geld geht.<br />
Über den Zugang zu Communities und Exilgemeinschaften kann also praktische Unter-<br />
stützung und Hilfe effektiv mobilisiert werden – da situationsangepasst, häufig sogar bedeu-<br />
tend effektiver, als durch die „Mehrheitsgesellschaft“. Dies kann nicht nur wesentlich zur In-<br />
tegration in den ungewohnten Alltag und daher auch zur Lebenszufriedenheit der Betroffenen<br />
beitragen: Durch den Rückgriff auf unterkunftsexterne Ressourcen kann auch eine partielle<br />
Entlastung des in den Unterkünften tätigen Personals erreicht werden. Freilich ist dabei in je-<br />
dem Fall zu berücksichtigen, dass die Anbindung an Communities und Exilgemeinschaften<br />
91 Vgl. Anderson 2000, 25; Berg 2000, 84; ähnlich bereits die Ergebnisse von Hanhörster 2001;<br />
Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001.<br />
92 Anderson 2000, 41.<br />
93 Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001, 51.<br />
94 Heckmann 1998, 35.<br />
26
nicht für alle Asylsuchenden gleichermaßen erstrebenswert ist. Aufgrund der vergleichsweise<br />
überschaubaren Größe migrantischer Gemeinschaften ist es in diesen relativ einfach, Infor-<br />
mationen über andere Angehörige der Gruppe zu erhalten: „Die soziale Kontrolle trägt zu<br />
einer zuverlässigen Kommunikation bei.“ 95 Die Exilgemeinschaft kann damit gerade für vor<br />
ihrer Flucht politisch aktive Asylsuchende – zumal für von anderen Exilierten als „Abtrün-<br />
nige“ erachtete – auch als Bedrohung erscheinen, weshalb sie die Betroffenen möglichst zu<br />
meiden versuchen. 96 Die Gegenwart von Landsleuten meiden manche Asylsuchende jedoch<br />
auch, weil diese sie an die erlittenen Verfolgungs- oder Kriegserfahrungen im Herkunftsland<br />
erinnern, wie das von Pflegerl und Fernández de la Hoz referierte Beispiel einer alleinerzie-<br />
henden Mutter aus Bosnien-Herzegowina zeigt:<br />
„Sie wollte mit niemandem mehr aus ihrem Land zusammen sein. [...] Und dass diese bosnische Familie da einziehen<br />
wollte ... Da rastet sie aus und schreit: »Nein, ich will nicht, mit keinem meiner Landsleute, nicht!« Und<br />
natürlich für diese bosnische Familie war das fürchterlich. Und sie hat gesagt: »Du, ich habe es nicht so gemeint,<br />
ich halte nur diesen Druck nicht mehr aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten.«“<br />
97<br />
Sofern der Zugang auf Freiwilligkeit beruht und keine institutionalisierte Verbindung mit den<br />
Unterkünften Asylsuchender besteht stellen migrantische Communities und Exilgemein-<br />
schaften also, so kann resümiert werden, eine zentrale und weitestgehend unterschätzte Res-<br />
source für Flüchtlinge dar.<br />
2 Akzeptanz, Duldung oder Ablehnung. Zur Bedeutung der Realisierung<br />
des Unterkunftsstandorts bei der Unterbringung von Asylsuchenden<br />
Als Anfang 1999 in ihrer Heimatgemeinde die ersten Gerüchte über die Unterbringung von<br />
Asylsuchenden im Ort aufgetaucht seien, so die eingangs bereits erwähnte Kärntner Trafikan-<br />
tin, habe dies niemand „so recht ernst“ genommen:<br />
„Keiner konnte sich vorstellen, dass zu uns – einen [sic!] Fremdenverkehrsort – Ausländer kommen sollten, noch<br />
dazu solche, die nicht zahlen, sondern auf unsere Kosten lebten. Niemand konnte sich vorstellen, wo sie untergebracht<br />
werden hätten können. Auch ich konnte mir nicht vorstellen, dass an dem Gerücht etwas Wahres dran<br />
sein sollte. Schließlich haben wir einen freiheitlichen Bürgermeister – und die Einstellung der FPÖ zu Ausländern,<br />
insbesondere Asylwerbern ist ja bekannt. Wie ich später erfuhr, hat die Gemeinde jedoch in so einem Fall<br />
nicht die alleinige Entscheidungsgewalt.“ 98<br />
Dann sei es jedoch plötzlich „Schlag auf Schlag“ gegangen:<br />
„Zuerst verdichteten sich die Gerüchte, es wurde über mögliche Unterkünfte diskutiert und eine erste diffuse<br />
Angst machte sich breit. Bei mir im Geschäft wurde länger und heftiger diskutiert als üblicherweise. Beinahe<br />
95 Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001, 51.<br />
96 So berichtete etwa eine Betreuerin im Rahmen der Erhebungen zur vorliegenden Arbeit vom Fall eines kurdischen<br />
Ehepaares, das in den 1990ern für den militärischen Arm der PKK tätig gewesen, während seiner Flucht<br />
aus der Partei ausgetreten und in der Folge von anderen exilierten Parteimitgliedern bedroht worden war (vgl.<br />
Interview Beratung/Betreuung 07, 30.01.2004).<br />
97 Zit. nach Pfleger/Fernández de la Hoz 2001, 55.<br />
98 Erian 2002, 61.<br />
27
jeder hatte irgendein Argument parat, warum die Asylwerber eine Katastrophe für uns wären, oder aber auch<br />
warum es unsere Pflicht sei, in dieser Zeit Flüchtlinge aufzunehmen.“ 99<br />
Schließlich sei jemand mit der Information in die Trafik gekommen, wo die „Fremden“ un-<br />
tergebracht werden sollten: in einer ehemaligen „Fremdenpension“, die zuletzt kaum ausgela-<br />
stet gewesen sei.<br />
„Als es endgültig feststand, dass wir Flüchtlinge bekämen, war es mit der Idylle im Ort grundlegend vorbei. [...]<br />
Dass diese Angelegenheit die Bewohner emotional außerordentlich stark berührte, bemerkte man an allem und<br />
jedem. Obwohl noch nicht ein einziger Flüchtling im Ort war und der Ankunftstag noch nicht einmal feststand,<br />
rüstete sich jeder auf seine Weise für das nahende Ungewisse. In meinem Geschäft sind pro Tag an die 100<br />
Kunden. Beinahe jeder hatte irgendetwas zu diesem Thema zu sagen.“ 100<br />
Schnell habe es ersten Widerstand gegen die „noch nicht vorhandenen Flüchtlinge“ gegeben,<br />
auffallend oft seien „Ausländer“ in einem Atemzug mit „irgendwelchen kriminellen Taten“<br />
genannt worden:<br />
„Es gab Mütter, die sich Sorgen um ihre Kinder machten. Einer bemerkte, dass man ab nun die Haustüre zusperren<br />
müsste. Wieder andere sorgten sich um unser Ansehen in der Umgebung. In jeder Bemerkung waren irgendwelche<br />
Ängste. Ich muss zugeben, dass auch ich nicht hellauf begeistert war, als ich hörte, dass Asylwerber<br />
kommen.“ 101<br />
Dieser durchaus spannende Bericht zeigt: Die nach getroffener Standortwahl vorgenommene<br />
Realisierung von Unterkünften für Asylsuchende ist ein Prozess, in dem es sowohl für die<br />
Bevölkerung der betroffenen Gemeinden als auch für die in der Folge dort untergebrachten<br />
Flüchtlinge um das kommunale „Alles“ geht: das tägliche Zusammenleben im eigenen Um-<br />
feld, das als Ort des Rückzugs und der Entspannung vorgestellt wird. Latent vorhandene Ver-<br />
unsicherung, Sorgen und Ängste innerhalb der Gemeinde können sich in diesem Prozess bün-<br />
deln, gegebenenfalls sogar gewaltsam eskalieren und regionale oder gar bundesweite Auf-<br />
merksamkeit erregen oder eben nicht, die Unterkunft kann in der Folge heftig und dauerhaft<br />
abgelehnt, geduldet oder auch akzeptiert werden. Gestaltung und Begleitung der Standortrea-<br />
lisierung kommt damit eine Rolle zu, die in ihrer Bedeutung für das Alltagsleben der Asyl-<br />
suchenden wie auch der ortsansässigen Bevölkerung, über die mediale Rezeption überdies für<br />
das gesellschaftliche Klima einer ganzen Region kaum unterschätzt werden kann.<br />
Unbeachtet im Hintergrund bleiben im zitierten Bericht indessen die eigentlichen AkteurIn-<br />
nen bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften, denen die Gestaltung und Begleitung<br />
obliegt: die öffentliche Hand als Unterkunftsgeberin, die BesitzerInnen des Unterkunftsge-<br />
bäudes und die Gemeinde, personifiziert in ihrem Bürgermeister. Politik, so scheint es, findet<br />
in diesem Minenfeld nicht statt. Diese Perspektive kommt nicht von ungefähr: Überraschen-<br />
derweise wurde der Prozess der Standortrealisierung zumindest von der deutschsprachigen<br />
Forschung bislang weitestgehend ausgeblendet. Liegt bereits, wie oben erläutert, zur Wahl der<br />
Unterkunftsstandorte nur eine äußerst geringe Zahl fundierter Analysen vor, so stellt sich die<br />
99 Ebd.<br />
100 Ebd., 62.<br />
101 Ebd., 63.<br />
28
diesbezügliche Situation bei der Errichtung der Unterkünfte derart trist dar, dass zweifellos<br />
von einem „blinden Fleck“ gesprochen werden muss. Lediglich eine in der ersten Hälfte der<br />
1990er im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und<br />
Soziales erstellte, im Eigenverlag publizierte und rasch wieder vergriffene Regionalstudie 102<br />
setzt sich äußerst praxisnah und durchaus detailliert mit der Materie auseinander, auch sie<br />
blendet dabei jedoch die Rolle der (politischen) AkteurInnen weitestgehend aus. Mit unter-<br />
schiedlichen Methoden im Ansatz beleuchtet oder auch nur am Rande gestreift werden Teil-<br />
bereiche des Errichtungsprozesses in einigen wenigen Einzelfalldarstellungen 103 , vergleichen-<br />
den Gemeindestudien 104 oder in Umfragen 105 , einige wenige fachspezifische <strong>Medien</strong> sprechen<br />
in unregelmäßigen Abständen Aspekte der Thematik im Rahmen von Reportagen oder Be-<br />
richten an. In einer Vielzahl an wissenschaftlichen und halbwissenschaftlichen Arbeiten wird<br />
das durchaus konfliktträchtige Politikfeld dagegen schlicht beiseitegeschoben. 106 Mit der vor-<br />
liegenden Arbeit soll vor diesem Hintergrund deshalb gerade auch der Bereich der Standort-<br />
realisierung einer grundlegenden Untersuchung unterzogen werden.<br />
3 Einige Anmerkungen zu Methodik und Forschungsprozess<br />
Aus den bisherigen Überlegungen ergeben sich für die Untersuchung mehrere forschungs-<br />
leitende Fragenkomplexe:<br />
• Verfügen die im Bereich der Unterbringung von Asylsuchenden zentralen AkteurInnen,<br />
d.h. die UnterkunftsgeberInnen, über explizite und also schriftlich festgehaltene, gegebe-<br />
nenfalls sogar verbindliche Konzepte und Strategien für die Wahl und Realisierung von<br />
Unterkünften? Wie sind diese – sofern vorhanden – gestaltet?<br />
• Sind im genannten Bereich in der Praxis, etwa anhand spezifischer Standorteigenschaften<br />
und -merkmale, konkrete Strukturmuster im Sinne impliziter, nicht offengelegter Kon-<br />
zepte und Strategien feststellbar, welche von den AkteurInnen bei der Wahl und Realisie-<br />
rung von Unterkunftsstandorten zur Anwendung gebracht werden? Wie stellen sich diese<br />
dar?<br />
• Besteht zwischen – falls vorhanden – expliziten und impliziten Konzepten und Mustern<br />
Übereinstimmung oder treten durch eine Konfrontation der Theorie mit der Praxis Unter-<br />
schiede zu Tage?<br />
102<br />
Vgl. FOKUS 1994.<br />
103<br />
Vgl. Balzer 1990; Gombos et al. 1992; Brunner et al. 1994; für eine relativ fundierte journalistische<br />
Einzelfalldarstellung vgl. Hörtner 1992.<br />
104<br />
Vgl. Brunner et al. 1998; 2003.<br />
105<br />
Vgl. Müller et al. 2001.<br />
106<br />
Siehe hierzu exemplarisch die soziologische Studie von Fuchshofer (1994) über „soziale Hilfspotentiale und<br />
dörfliche Problemlösungsressourcen zur Integration von Asylwerbern im ländlichen Raum“ – die Autorin widmet<br />
sich ausführlich der Darstellung privater HelferInnenkreise, geht in drei knappen Absätzen auf „lokale<br />
29
• Wie sind die standortpolitischen Muster vor dem Hintergrund der oben angestellten ein-<br />
leitenden Überlegungen zu interpretieren? Können daraus Schlussfolgerungen von prakti-<br />
scher Relevanz gezogen werden?<br />
Quer zu diesen Fragekomplexen liegt ein weiterer Bereich, der in der Analyse zu berücksich-<br />
tigen sein wird: Wie (re)agieren die von der Unterbringung Asylsuchender betroffenen<br />
AkteurInnen auf lokaler Ebene, d.h. die UnterkunftsbesitzerInnen, die Gemeinden und ihre<br />
BürgerInnen, im Prozess der Suche, Auswahl und Realisierung der Unterkunftsstandorte?<br />
3.1 Qualitative Methoden als Entspannungshilfe: »I hab da so locker daherg’redet ...«<br />
Angesichts der Breite des Untersuchungsfelds und der erwähnten limitierten Anzahl an bereits<br />
vorliegenden grundlegenden Analysen im Themenbereich lag es nahe, sich bei der methodi-<br />
schen Vorgangsweise dem hinlänglich bekannten Methodenstreit zu entziehen und auf eine<br />
Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden zurückzugreifen, um so<br />
möglichst viele Aspekte berücksichtigen zu können. 107 Entsprechend wurden die Forschungs-<br />
strategien für den Schwerpunkt der Untersuchung – die systematische und genaue Unter-<br />
suchung und Darstellung von im zweiten Halbjahr 2003 in Tirol bestehenden Sammelunter-<br />
künften für Asylsuchende – zwar vorrangig am qualitativen Paradigma ausgerichtet, zugleich<br />
wurden jedoch, um über den bloßen Abgleich ausgewählter Einzelfälle hinaus zu einem zu-<br />
mindest für die Untersuchungsregion verallgemeinerbaren Ergebnis zu gelangen, alle der<br />
während dieses Halbjahres betriebenen oder in Betrieb genommenen Standorte untersucht und<br />
einer vergleichenden Analyse unterzogen. Zur praktischen Überprüfung der daraus gewonne-<br />
nen Hypothesen wurden die im Jahr 2004 eingetretenen weiteren Entwicklungen kontinuier-<br />
lich beobachtet und in einer Überblicksanalyse dargestellt, der Vergleich von Einzelfall- und<br />
Überblicksanalyse ermöglichte so in einem abschließenden Schritt den Rückschluss auf<br />
Strukturmuster im untersuchten Bereich und die Diskussion aus den festgestellten Mustern<br />
resultierender Konsequenzen. Das Basismaterial für die Untersuchung – die Hypothesen wur-<br />
den, den Leitideen der grounded theory folgend 108 , im Untersuchungsverlauf kontinuierlich<br />
überprüft und modifiziert – setzte sich neben der im Anhang angeführten (Fach-)Literatur aus<br />
einem breiten Spektrum an Dokumenten und Quellen zusammen:<br />
• Transkripte, teils auch Gesprächsprotokolle sowie Postskripte problemzentrierter Interviews mit den rele-<br />
vanten VertreterInnen von Unterkunftsgeber und Kommunen sowie UnterkunftsbesitzerInnen oder -leiter-<br />
Innen;<br />
Honoratioren“, personifiziert in katholischem Pfarrer und Lehrer, ein und erwähnt eine mögliche Rolle von<br />
Landes- und Kommunalpolitik mit keinem Wort.<br />
107 Den Methodenstreit resümierend und eine Abwägung vornehmend vgl. u.a. Gerhard Hauck: Qualitative oder<br />
quantitative Sozialforschung – ist das die Frage?, in: Peripherie Nr. 57/58, 1995, 6-22.<br />
108 Weiterführend hierzu u.a. Barney G. Glaser/Anselm L. Strauss: Die Entdeckung gegenstandsbezogener Theorie:<br />
Eine Grundstrategie qualitativer Sozialforschung, in: Christel Hopf/Elmar Weingarten (Hg.): Qualitative<br />
Sozialforschung, Stuttgart: Klett-Cotta 1979, 91-111.<br />
30
• Gesprächsprotokolle, teils auch Gesprächsnotizen problemzentrierter ExpertInnengespräche sowie verein-<br />
zelt schriftliche Berichte von GesprächspartnerInnen aus dem Bereich der Beratung und Betreuung von<br />
Asylsuchenden;<br />
• Forschungsnotizen zu den genannten Interviews und Gesprächen;<br />
• systematisch ausgewertete Meldungen und Berichte des regionalen Leitmediums (Tiroler Tageszeitung) und<br />
einer überregionalen Qualitätszeitung mit eigener Tirol-Redaktion (Der Standard), außerdem Berichte und<br />
Reportagen regionaler oder lokaler Wochenzeitungen;<br />
• schriftliche Standortprofile der Unterkunftsstandorte, die jeweils im Rahmen eines Lokalaugenscheins er-<br />
stellt wurden;<br />
• Ergebnisse einer mittels stark strukturierten Fragebogens durchgeführten anonymen Befragung der (sofern<br />
vorhanden) UnterkunftsnachbarInnen und deren handschriftliche Anmerkungen auf dem Erhebungsblatt;<br />
• Karten- und Bildmaterial zu den Unterkunftsstandorten;<br />
• Kontextmaterial wie Ortschroniken, Heimatbücher und Homepages der Gemeinden und lokalen Tourismus-<br />
verbände, außerdem verschiedene Artefakte wie amtliche Mitteilungen einzelner Gemeinden oder Sitzungs-<br />
protokolle von Gemeinderatssitzungen.<br />
Die für die ExpertInnengespräche gewählte Methode des problemzentrierten Interviews 109 ,<br />
das mittels eines schwach strukturierten und den einzelnen GesprächspartnerInnen individuell<br />
angepassten Leitfadens durchgeführt wurde, erwies sich rasch als überaus geeignetes Instru-<br />
ment zur Informations- und Datenerhebung. In einzelnen Fällen genügte eine erzählgenerie-<br />
rende Frage zu Beginn des Interviews, um eine ausführliche und lebendige Schilderung zu<br />
initiieren, die dem Interview oft einen durchaus dauerhaften stark narrativen Charakter ver-<br />
lieh, in anderen Fällen waren regelmäßige, teils auch strukturierende Inputs des Interviewers<br />
nötig, um das Gespräch im Fluss zu halten. Insbesondere die Bürgermeister der systematisch<br />
untersuchten Gemeinden mussten jedoch zunächst vom Interviewer in ihrem Expertenstatus<br />
bestärkt werden, indem etwa explizit auf die Relevanz ihrer Perspektive für die wissenschaft-<br />
liche Arbeit hingewiesen wurde – in einigen Fällen zeigten diese GesprächspartnerInnen an-<br />
fänglich große Unsicherheit, ob sie dem „aus der Stadt“ angereisten Interviewer überhaupt<br />
etwas „Interessantes“ mitzuteilen hätten. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die Gesprä-<br />
che in der regionalen Umgangssprache geführt.<br />
Mit einer Ausnahme überwiegend skeptisch, teils sogar misstrauisch traten dem Interviewer<br />
die UnterkunftsbesitzerInnen gegenüber. Zwar wurde ein Gespräch in keinem Fall tatsächlich<br />
verweigert – auch hier war ein expliziter Hinweis auf den ExpertInnenstatus der Gesprächs-<br />
partnerInnen vielfach förderlich –, ihr Unbehagen war in einigen Fällen jedoch offensichtlich<br />
und dominierte die Gesprächssituation. Ein Zusammenhang mit der Art der Kontaktaufnahme<br />
(die Gespräche fanden meist nach vorheriger Ankündigung durch den Unterkunftsgeber, das<br />
Land Tirol, statt) ist zwar nicht auszuschließen, konkrete Anhaltspunkte dafür konnten jedoch<br />
nicht festgestellt werden.<br />
109 Einführend hierzu u.a. Siegfried Lamnek: Qualititative Sozialforschung. Band 2: Methoden und Techniken, 3.<br />
korrigierte Aufl., Weinheim: Psychologie Verlags Union 1995.<br />
31
Während die Autorisierung der mit dem Unterkunftsgeber geführten Interviews schnell und<br />
unbürokratisch erfolgte, versuchten mehr als die Hälfte der interviewten Bürgermeister zu-<br />
nächst, die Bestätigung der Transkripte hinauszuzögern – wohl nicht zuletzt vor dem Hinter-<br />
grund der in den ersten Märztagen 2004 in Tirol abgehaltenen Gemeinderatswahlen. Auch<br />
eine schließlich vom Interviewer gesetzte Frist, die knapp mehr als eine Woche nach dieser<br />
Wahl auslief, führte zu keiner Autorisierung mehr. Eine diesbezügliche Begründung unter-<br />
blieb auch auf Nachfrage des Interviewers nur in einem einzigen Fall, alle anderen dieser Ge-<br />
sprächspartnerInnen gaben zu verstehen, dass sie ihre Aussagen für „nicht herzeigbar“ hielten.<br />
So führte etwa ein Gemeindeoberhaupt auf telefonische Nachfrage aus: „I hab da offensicht-<br />
lich so viel Blödsinn g’redet, da bin i richtig derschrocken – wenn das jemand lest! Mir wär’<br />
lieber, Sie würden’s nit verwenden. I hab da so locker daherg’redet, des a bissl locker g’sehn<br />
...“ 110 In einem Fall ließ ein Bürgermeister am Telefon zunächst unaufgefordert wissen, er<br />
stünde zu seinen Aussagen, um im Anschluss vom Interviewer eine durch diesen vorzuneh-<br />
mende Überarbeitung des Transkripts zu fordern, er selbst könne das nicht. Auf die Frage, ob<br />
sich seine Unzufriedenheit auf die wortwörtliche Wiedergabe und damit die sprachliche Qua-<br />
lität oder auf den Inhalt beziehe, machte er deutlich, dass es ihm gerade um eine Überarbei-<br />
tung in inhaltlicher Hinsicht ginge: Der Interviewer solle, so der Bürgermeister, die von ihm<br />
getätigten Aussagen so umformulieren, dass sie „gut klingen“ würden. Nachdem der Inter-<br />
viewer seine diesbezügliche Ablehnung begründet hatte, hielt das Gemeindeoberhaupt trocken<br />
fest: „Dann lasch es ganz sein!“ 111 In einem weiteren Fall bot ein Bürgermeister an, über das<br />
Wochenende einen schriftlichen Fragenkatalog zu beantworten, was dann auch geschah.<br />
Die Begründung der Bürgermeister, ihre Ausführungen seien der Würde ihres Amtes nicht<br />
angemessen, kann durchaus als Hinweis darauf gewertet werden, dass im Rahmen des Inter-<br />
views tatsächlich jene Positionen dargestellt wurden, die auch innerhalb der Gemeinde (und in<br />
der Regel nur dort) zur Sprache gebracht wurden – für den Interviewer bestätigte dies nach-<br />
träglich den Eindruck, dass es in den Gesprächen gelungen war, eine entspannte und zwang-<br />
lose Atmosphäre zu schaffen, bei der auch durchaus brisante Aspekte zur Sprache kommen<br />
konnten. Tatsächlich begründete einer der Bürgermeister seine Verweigerung der Autorisie-<br />
rung damit, er sei offenbar „ins Plaudern“ geraten und habe dabei Dinge gesagt, die er so lieber<br />
nicht veröffentlicht wissen wolle. 112<br />
Aufgrund der fehlenden Autorisierung wurden die Transkripte der betreffenden Interviews für<br />
die vorliegende Untersuchung vollständig, d.h. auch hinsichtlich des Interviewdatums ano-<br />
nymisiert, offensichtliche Hinweise auf die betreffenden Gemeinden wurden entfernt. Hin-<br />
sichtlich des Privatnamens der GesprächspartnerInnen und damit nur teilweise anonymisiert<br />
wurden die Interviews mit den UnterkunftsbesitzerInnen und -leiterInnen 113 , einige der<br />
110 Interview Bürgermeister 05/2, 11.03.2004.<br />
111 Interview Bürgermeister 01/2, 12.03.2004.<br />
112 Interview Bürgermeister 02/2, 04.03.2004.<br />
113 Die betreffenden Gespräche werden im Folgenden als „Interview Unterkunftsleitung“ geführt.<br />
32
Betroffenen hatten dies explizit erbeten. In gleicher Weise wurden die Gespräche mit unab-<br />
hängigen BeraterInnen und BetreuerInnen 114 teilanonymisiert, hier wurde in einzelnen Fällen<br />
die Befürchtung geäußert, eine Namensnennung könne sich nachteilig auf die eigene Arbeit<br />
und damit letztlich auch auf die Position von KlientInnen insbesondere gegenüber der öffent-<br />
lichen Verwaltung auswirken.<br />
3.2 Eine Gratwanderung: Objektivität versus Parteilichkeit<br />
Auch diese Befürchtung weist darauf hin: Eine Untersuchung im Feld der Unterbringung von<br />
Asylsuchenden ist, wie sich während des gesamten Forschungsprozesses zeigte, eine Grat-<br />
wanderung – auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Die Fragmentierungen, ja:<br />
Verwerfungen stellen ein durchgängiges Charakteristikum dar: in der Landespolitik, wo die<br />
ressortzuständige Landesrätin wortreich beteuert, der Landeshauptmann stünde nun hinter der<br />
Unterbringung der Asylsuchenden, worüber sie „froh“ sei; wenige Monate später verkündete<br />
der Regierungschef einen „Asylstopp“ und forderte die Internierung von ihre Identität „ver-<br />
schleiernden“ Asylsuchenden in „besonderen Quartieren“. In der Kommunalpolitik, wo ein<br />
Bürgermeister wortreich beklagt, die vor Ort in einem Gasthof untergebrachten Flüchtlinge<br />
würden trotz eines diesbezüglichen Verbots und auf seine Initiative hin erfolgender Beschlag-<br />
nahmungen immer wieder Kaffeemaschinen und ähnliche Küchengeräte in ihren Zimmern<br />
betreiben – sein Amtsvorgänger erzählt wenig später begeistert, er organisiere für die Asyl-<br />
suchenden regelmäßig Kaffeemaschinen, um die Lebensqualität im Gebäude ein wenig zu<br />
verbessern, der Bedarf an den Geräten sei enorm. Verwerfungen schließlich auch unter zivil-<br />
gesellschaftlichen Organisationen und Social-Profit-Betrieben: Kooperation oder Konfronta-<br />
tion? Die „Guten“ und die „Bösen“ sind überall, letztere jedoch bekanntlich immer „die ande-<br />
ren“, am Ende verschwimmen die Grenzen. Ihm sei deutlich geworden, so Zepf in seiner be-<br />
reits in den 1980ern erstellten Analyse der „Flüchtlingshilfe“ in Deutschland, dass „die Asyl-<br />
problematik jeden, der sich mit der Lebenswelt der Flüchtlinge [...] auseinandersetzt, zur ei-<br />
genen, letztlich politischen Positionsbestimmung herausfordert. Den erhabenen Standpunkt<br />
des ausgewogenen, scheinbar neutralen Beobachters kann es m.E. bei der Asylpolitik nicht<br />
geben.“ 115 Für die Bereiche der Erarbeitung des wissenschaftlichen Vorverständnisses, des<br />
Forschungsdesigns und der Ergebnisinterpretation (keinesfalls jedoch für jenen der konkreten<br />
Datenerhebung) ist ihm wohl rechtzugeben: Zu glauben, man könne sich umstandslos eigener<br />
Überzeugungen oder gar, wie im Fall des Verfassers dieser Arbeit, konkreter Erfahrungen im<br />
Arbeitsfeld entledigen und – endlich! – ein objektives und abschließendes Urteil fällen, wäre<br />
mehr als vermessen. So bleibt nur ein stetes Bemühen um Ausgewogenheit, basierend auf<br />
einer ständigen, den gesamten Forschungsprozess begleitenden aufmerksamen und kritischen<br />
Reflexion der eigenen Wahrnehmungen und ex- wie impliziten Positionierungen.<br />
114 Die betreffenden Gespräche werden im Folgenden als „Interview Beratung/Betreuung“ geführt.<br />
115 Zepf 1986, 1.<br />
33
Rahmenbedingungen
4 Von Zuständigkeiten und Unzuständigkeiten. Akteurinnen und Akteure<br />
bei der Wahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten für Asylsuchende<br />
„Österreich hilft, wo Hilfe gebraucht wird“, so der Ende 2004 zurückgetretene Innenminister<br />
Ernst Strasser (ÖVP). Es sei ein Grundsatz der österreichischen Flüchtlingspolitik, „dass je-<br />
nen, die Hilfe brauchen, rasch, unbürokratisch und nachhaltig geholfen werden muss.“ 1 Die<br />
Aufnahme und „bestmögliche Integration“ von Flüchtlingen solle „im Idealfall in eine Win-<br />
win-Situation münden“: „Vielleicht stammt die österreichische Nobelpreisträgerin des Jahres<br />
2015 oder 2025 ursprünglich aus Afghanistan, vielleicht kommt Österreichs Top-Unterneh-<br />
mer 2020 aus dem Kamerun und vielleicht ist Österreichs erfolgreichster Polizist des Jahres<br />
2030 im Irak geboren.“ 2 Am Beginn solcher Traumkarrieren steht für Asylsuchende in jedem<br />
Fall die Unterbringung in einer organisierten Unterkunft. Als UnterkunftsgeberInnen können<br />
dabei grundsätzlich sowohl öffentliche als auch private AkteurInnen in Erscheinung treten.<br />
4.1 Öffentliche UnterkunftsgeberInnen<br />
Als öffentliche UnterkunftsgeberInnen kommen in Tirol wie im übrigen Österreich grund-<br />
sätzlich drei Ebenen in Frage: die Republik Österreich (der „Bund“), das Land Tirol sowie die<br />
279 Tiroler Gemeinden. Ihre Rolle als Akteurinnen und Akteure bei der Wahl und Realisie-<br />
rung von Unterkunftsstandorten wird im Folgenden zu klären sein.<br />
4.1.1 Der Bund als Unterkunftsgeber<br />
Die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Asylsuchenden war in Österreich jahr-<br />
zehntelang nicht gesetzlich geregelt. Bund und Länder vertraten daher die Auffassung, die<br />
jeweils andere Ebene müsse für den Lebensunterhalt von AsylwerberInnen aufkommen. 3 In<br />
Zeiten des Kalten Kriegs konnte der Bund dabei darauf bauen, dass die Länder bei der Un-<br />
terbringung der fast ausschließlich aus den sozialistischen Staaten Ost- und Südosteuropas<br />
stammenden Flüchtlinge schon ihren Beitrag leisten würden – auch die westösterreichischen. 4<br />
Die Asylpolitik diente auf allen Ebenen als „Mittel legitimatorischer Identitätsstiftung“ 5 : Mit<br />
1 Strasser 2004c, 14.<br />
2 Ebd., 20f.<br />
3 Den Hintergrund dieses Kompetenzkonfliktes bildete letztlich der Umstand, dass die österreichische Bundesverfassung<br />
keinen expliziten Kompetenztatbestand „Flüchtlingswesen“ enthält (vgl. L. Sperl 2004, 138f).<br />
4 So wurden etwa in Vorarlberg, wie Murber/Weber (2001) in einer historischen Studie – vergleichbare Arbeiten<br />
für Tirol liegen offenbar nicht vor – zeigen, während der ungarischen Revolution 1956 die mit drei Transporten<br />
eintreffenden 1.900 Flüchtlinge von Behörden und Bevölkerung herzlich begrüßt, ein eigenes „Komitee für die<br />
Ungarnhilfe“, dem fast alle karitativen und sozialen Einrichtungen sowie öffentlichen Körperschaften Vorarlbergs<br />
angehörten, koordinierte die Betreuungs- und Spendensammlungstätigkeiten im Land. Landtagspräsident<br />
Josef Feuerstein (ÖVP) gedachte in seiner Eröffnungsrede zur Landtagssitzung am 14. November „voll Dank<br />
und Anerkennung der Bereitwilligkeit zur Hilfeleistung im eigenen Land“ und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck,<br />
dass die „grausen Kämpfe bald ein Ende finden und dem armen ungarischen Volke die Sonne der Freiheit<br />
und des Friedens leuchten möge“ (Stenographische Sitzungsberichte des XVIII. Vorarlberger Landtages, 5.<br />
Sitzung am 14.11.1956, 1, zit. nach Murber/Weber 2001, 2).<br />
5 Volf 1995.<br />
35
der Aufnahme von Flüchtlingen aus den Staaten des „unfreien“ sozialistischen Ostens bekräf-<br />
tigte man die eigene Zugehörigkeit zur westlichen, „freien Welt“. In der zweiten Hälfte der<br />
1980er und endgültig mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verlor die Flüchtlingsaufnahme<br />
jedoch diese Funktion. Die ungeklärte Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern bei<br />
der Unterbringung der Asylsuchenden wurde nun zu einer ernsten Belastung.<br />
Die »Bundesbetreuung«<br />
Im Laufe des Jahres 1990 wurde unter Innenminister Franz Löschnak (SPÖ) daher eine um-<br />
fassende Neuordnung der gesetzlichen Lage im Asylbereich in Angriff genommen, als Ziel<br />
galt dabei ein „einheitlich konzipiertes, aus mehreren Teilschritten bestehendes Gesetzes-<br />
paket“ und ein dieses absichernder „breiter, österreichweiter Konsens“. 6 Im Rahmen eines in<br />
der Folge per Gesetz eingeführten besonderen öffentlichen Leistungssystems, der privatwirt-<br />
schaftlich 7 vollzogenen sogenannten „Bundesbetreuung“, oblagen Unterbringung, Verpfle-<br />
gung und Betreuung hilfsbedürftiger AsylwerberInnen ab 1991 grundsätzlich dem Bundes-<br />
ministerium für Inneres. 8 Das Gesetz schloss dabei allerdings dem Wortlaut nach einen<br />
Rechtsanspruch auf diese Unterstützung aus 9 – nach Einschätzung des UNHCR ein Umstand,<br />
der keineswegs als Ergebnis eines Versehens, sondern einer bewussten Willensentscheidung<br />
des Gesetzgebers zu verstehen war. 10 Erst 2003 wurde diese Bestimmung vom Obersten Ge-<br />
richtshof in zwei Urteilen dahingehend interpretiert, dass für AsylwerberInnen sehr wohl ein<br />
klagbarer Anspruch auf Leistungen aus der Bundesbetreuung bestünde, sofern keiner der ge-<br />
setzlich angeführten Ausschlussgründe vorliege. 11 Hatte sich das Ministerium nach dem ers-<br />
ten Urteil noch monatelang schlicht geweigert, seine Verwaltungspraxis entsprechend den<br />
höchstgerichtlichen Vorgaben zu ändern, wurden nach dem zweiten Urteil zumindest die zuletzt<br />
gültigen Richtlinien zurückgenommen. 12<br />
Bis zuletzt wurden durch das Ministerium zahlreiche Asylsuchende auf der Grundlage von<br />
Erlässen, mündlichen Weisungen oder Richtlinien von der Bundesbetreuung ausgeschlossen.<br />
Aus den zugänglichen Erlässen, aus mündlich abgegebenen Begründungen, aber auch aus der<br />
6 Löschnak 1993, 8.<br />
7 Zur Differenzierung zwischen hoheitlicher und privatwirtschaftlicher Ausgestaltung der Bundeskompetenzen<br />
siehe L. Sperl 2004, 142f; kritisch zum privatwirtschaftlichen Vollzug der Flüchtlingsunterbringung: Bürstmayr<br />
2003; Fronek 2003.<br />
8 § 1 des Bundesbetreuungsgesetzes (BBetrG 1992; BGBl. 1991/405). Die Hilfsbedürftigkeit wurde in § 2 der<br />
das BBetrG näher ausführenden Bundesbetreuungsverordnung (BBetrVO 1992; BGBl. 1992/31) definiert: Als<br />
hilfsbedürftig galt demnach, wer den Lebensunterhalt einschließlich der Unterbringung für sich und die mit ihm<br />
in Familiengemeinschaft lebenden Angehörigen aus eigenen Mitteln nicht oder nicht ausreichend bestreiten<br />
konnte (vgl. hierzu Huber et al. 1998, 53f; L. Sperl 2004, 150).<br />
9 Vgl. § 1 (3) BBetrG 1991. Die Entscheidung über die Aufnahme in die Bundesbetreuung erfolgte nicht in Bescheidform,<br />
von den Betroffenen konnte sie damit nicht bekämpft werden.<br />
10 Vgl. UNHCR 1996, 65.<br />
11 OGH 24.02.2003, 1 Ob 272/02k; OGH 27.08.2003, 9 Ob 71/03m; vgl. hierzu asylkoordination österreich<br />
2003; L. Sperl 2004, 141-145.<br />
12 Vgl. L. Sperl 2004.<br />
36
Ausschlusspraxis 13 schlossen BeobachterInnen im vergangenen Jahrzehnt auf eine beachtliche<br />
Bandbreite an Ausschlusskriterien, die nicht nur teilweise in sich widersprüchlich scheinen,<br />
sondern häufig auch im Widerspruch zu Bundesbetreuungsgesetz und -verordnung standen:<br />
• Herkunft aus bestimmten (und über die Jahre durchaus wechselnden) Staaten oder IGOs (etwa Europarat),<br />
• Aufenthalt in einem „sicheren Drittland“ vor der Einreise nach Österreich,<br />
• undokumentierte („illegale“) Einreise,<br />
• nicht ausreichend geklärt scheinende Identität,<br />
• Unglaubwürdigkeit hinsichtlich der Angaben der Fluchtgründe oder des Fluchtwegs,<br />
• nicht ausreichend geklärt scheinende Hilfsbedürftigkeit, etwa aufgrund „zu hoher“ Zahlungen an Schlepper<br />
oder wegen des Besitzes von teuer erscheinender Kleidung oder eines Mobiltelefons,<br />
• mangelnde „Erfolgsaussichten“ des Asylantrags,<br />
• Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Berufung gegen einen ablehnenden Asylbescheid,<br />
• Verhandlung des Asylantrags in der zweiten Instanz,<br />
• Neuverhandlung eines Asylantrags nach Aufhebung eines negativen Bescheids durch den Verwaltungs-<br />
oder Verfassungsgerichtshof,<br />
• Vorliegen einer Verpflichtungserklärung einer dritten Person,<br />
• Vorhandensein eines Anschlusssichtvermerks insbesondere für ein westeuropäisches Land,<br />
• allgemein widersprüchliche Angaben,<br />
• („Bereithalten“ zur) Schwarzarbeit,<br />
• Verdacht, eine strafbare Handlung begangen zu haben,<br />
• Verurteilung aufgrund des Begehens einer strafbaren Handlung. 14<br />
Statistiken legten in der jüngsten Vergangenheit überdies den Schluss nahe, dass bevorzugt<br />
Asylsuchende aus Ländern mit einer höheren Chance auf Zuerkennung von Asyl in die Bun-<br />
desbetreuung aufgenommen wurden, was durchaus als „Vorselektionsmechanismus“ 15 be-<br />
zeichnet werden kann. Unabhängige Institutionen und Organisationen kamen daher in den<br />
letzten zehn Jahren wiederholt zum Schluss, dass sich kaum mehr als 15 bis maximal dreißig<br />
Prozent der AsylwerberInnen tatsächlich in Bundesbetreuung befänden. 16 Da diese auch in<br />
Form von Teilleistungen gewährt werden konnte – in der Praxis bedeutete dies die aus-<br />
schließliche Gewährung der Krankenversicherung, was salopp als „OZOI“ („ohne Zimmer,<br />
ohne Inventar“) bezeichnet wurde 17 –, existierte überdies innerhalb der Gruppe der Bundes-<br />
betreuten eine Subgruppe, die nur ansatzweise in den Genuss der mit der Betreuung verbun-<br />
denen Leistungen kam. Die Aufnahmepraxis wurde daher wiederholt heftig kritisiert: Be-<br />
obachterInnen beurteilten die Aufnahmeentscheidung als reine Ermessensentscheidung der<br />
zuständigen BeamtInnen 18 , sprachen von einer „undurchsichtigen behördlichen Selektion“ 19 ,<br />
13 Die in Erlässen oder internen Weisungen formulierten oder real angewandten Kriterien wurden weder im<br />
BGBl. kundgemacht, noch auf Ersuchen mündlich mitgeteilt (vgl. UNHCR 1996, 66; Bednarzek 2001, 10).<br />
14 Vgl. Bodemar 1994, 659; Staudinger 1994, 38; Hennefeld 1995; UNHCR 1996; Wegscheider 1997, 103f;<br />
Huber et al. 1998, 54 ; Lichtenhofer 2000; Bednarzek 2001; L. Sperl 2004, 127 und 150. Nach Ansicht von<br />
Huber et al. (1998, 54) beruhten diese selektiven Exklusionen auf der rechtswidrigen Ableitung eines Ermessensspielraumes<br />
aus § 1 (3) BBetrG 1991 durch das Innenministerium.<br />
15 Knapp 1995a, 175; sinngemäß so auch UNHCR 1996, 55ff.<br />
16 Vgl. Bodemar 1994, 659; Knapp 1994, 45; Staudinger 1994, 38; Hennefeld 1995, 19; UNHCR 1996, 51;<br />
Knapp 1998b, 50; asylkoordination österreich 2000, 20; Lichtenhofer 2000, 4; Bednarzek 2001, 10; Knapp<br />
2001a, 49; Knapp 2002, 35f; asylkoordination österreich 2003, 6; Hannikainen 2004, 12; L. Sperl 2004, 125f.<br />
17 L. Sperl 2004, 129. Asylsuchende mit „OZOI-Status“ wurden in den offiziellen Statistiken als „privat wohn-<br />
haft“ angeführt (vgl. ebd.).<br />
18 Hannikainen 2004, 12f.<br />
19 Bednarzek 2001, 10.<br />
37
charakterisierten das System als „Lotteriespiel“ 20 , konstatierten eine „willkürliche, selektive<br />
und gesetzwidrige Aufnahmepraxis“ 21 oder schlicht den „Nichtvollzug“ 22 des Bundesbetreu-<br />
ungsgesetzes. Der UNHCR erkannte in der behördlichen Praxis eine planvolle und systemati-<br />
sche Vorgangsweise und kam zum Schluss, dass die Nichtaufnahme in die Betreuung „in der<br />
Praxis als Mittel zur Steuerung des Asylwerberzustroms eingesetzt wird“. 23<br />
Beim Vollzug der Bundesbetreuung konnte sich der Bund nach § 4 BBetrG 1992 privater,<br />
humanitärer oder kirchlicher Einrichtungen, Institutionen der freien Wohlfahrtspflege oder<br />
auch der Gemeinden bedienen. Eine Auslagerung der Betreuungsarbeit wurde jedoch erst ab<br />
Juli 2003 vorgenommen, als Unterbringung, Verpflegung und Betreuung in den Betreuungs-<br />
stellen des Bundes an den deutschen Business-Profit-Betrieb European Homecare (EHC)<br />
vergeben wurden. 24 Die Entscheidung über die Aufnahme in die Bundesbetreuung erfolgte<br />
formal ausschließlich in der zuständigen Abteilung des Innenministeriums in Wien, die Auf-<br />
nahme selbst in den Bundesbetreuungsstellen Bad Kreuzen, Mödling-Vorderbrühl, Thalham<br />
und Traiskirchen. 25 In der Praxis wurden die Aufnahmeentscheidung und die Zuweisung an<br />
eine Unterkunft jedoch auch durch das Bundesasylamt und seine Außenstellen getroffen bzw.<br />
durchgeführt: Obwohl diese über eine derartige Entscheidungskompetenz formal gar nicht<br />
verfügten 26 , wurde sie in Informationsblättern dem Amt vom Ministerium explizit zugespro-<br />
chen. 27 Mit dem sogenannten „Notquartier“ bestand für AsylwerberInnen ab 1998 eine beson-<br />
dere Unterbringungsform zur Überbrückung der Wartezeit bis zu ihrer ersten Einvernahme<br />
am Bundesasylamt und der damit einhergehenden Entscheidung über eine Aufnahme in die<br />
Bundesbetreuung. In der Praxis wurden damit Schlafplätze bezeichnet, die sich meist in Ein-<br />
richtungen der Bundesbetreuung befanden 28 und den betroffenen Asylsuchenden vom<br />
Bundesasylamt direkt zugewiesen werden konnten. Hygieneartikel, Kleidung oder Taschen-<br />
geld wurden im Rahmen dieser Unterbringungsform nicht gewährt; bis zum Herbst 2000 erfolgte<br />
von Bundesseite auch keine Anmeldung zur Krankenversicherung. 29<br />
Um die im Rahmen der Bundesbetreuung unterzubringenden Asylsuchenden einigermaßen<br />
gleichmäßig auf die Bundesländer verteilen zu können, hatte man eine Quotierung festgelegt,<br />
derzufolge in Tirol 4,36 Prozent der Asylsuchenden unterzubringen waren. 30 Den Vollzug der<br />
20 Glanzer 1997, 13.<br />
21 UNHCR 1996, 267.<br />
22 Wegscheider 1997, 104.<br />
23 UNHCR 1996, 67 ; ähnlich Hannikainen 2004, 15.<br />
24 Vgl. hierzu u.a. Schrettle 2003; L. Sperl 2004, 132ff.<br />
25 § 1 (2) BBetrVO; vgl. Huber et al. 1998, 55.<br />
26 Vgl. UNHCR 1996, 64 bzw. Anm. 135.<br />
27 Vgl. Bundesministerium für Inneres 1993. Etwa ab 1998 registrierten Beratungseinrichtungen bezüglich der<br />
Aufnahmeentscheidungen und Zuweisungen endgültig eine klare Kompetenzverschiebung hin zum Bundesasylamt<br />
und seinen Außenstellen (vgl. Knapp 1998a, 9).<br />
28 In Tirol v.a. die Unterkunft in Götzens (vgl. Caritas Flüchtlingsstelle 2003; zur Unterkunft s. Abschnitt 7.2).<br />
29 L. Sperl 2004, 127. Für das Notquartier boten weder BBetrG noch BBetrVO eine rechtliche Grundlage.<br />
30 Die übrigen Quoten: Niederösterreich 20,21 %, Wien 19,37 %, Oberösterreich 18,65 %, Steiermark 17,15 %,<br />
Kärnten 7,87 %, Salzburg 6,46 %, Burgenland 3,85 %, Vorarlberg 2,08 % (L. Sperl 2004, 141, Anm. 99).<br />
38
Bundesbetreuung übernahm in Tirol jedoch bereits 1993 das Land 31 , der Bund trat bei der<br />
Wahl und Realisierung von Unterkünften ab diesem Zeitpunkt daher hier nicht mehr in Er-<br />
scheinung.<br />
Die »Grundversorgung«<br />
Mit Inkrafttreten der sogenannten „Grundversorgungsvereinbarung“ 32 zwischen Bund und<br />
Ländern am 1. Mai 2004 wurde das System der Bundesbetreuung abgeschafft, die Zuständig-<br />
keiten für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung Asylsuchender wurden völlig neu<br />
geregelt. Auf Bundesseite verblieb im Unterbringungsbereich lediglich die Verantwortung für<br />
jene formal neugeschaffenen Betreuungseinrichtungen, in denen die Erstaufnahme der Asylsuchenden<br />
erfolgen soll und die entsprechend als „Erstaufnahmestellen“ bezeichnet werden. 33<br />
Bis Ende 2004 befand sich keine dieser Erstaufnahmestellen in Tirol, der Bund trat damit<br />
auch nach der Umstellung auf das neue Versorgungssystem im Land nicht als Unterkunftsge-<br />
ber in Erscheinung.<br />
Politisch-strukturelle Rahmenbedingungen<br />
Die Flüchtlings- und Asylpolitik des Bundes konnte sich daher – jenseits der Entscheidung<br />
über die Gewährung oder Verweigerung von Asyl – in den letzten zehn Jahren in Tirol nicht<br />
in einer konkreten Unterbringungspolitik des Bundes manifestieren. Auf die Unterbringungs-<br />
politik des Landes kommt dem Bund zwar kein unmittelbarer Einfluss zu 34 , tatsächlich be-<br />
steht jedoch in diesem Bereich ein breites Spektrum an indirekten Einflussfaktoren, welche<br />
die einschlägige Arbeit auf Landesebene teils erheblich erschweren können. Ohne den An-<br />
spruch auf Vollständigkeit zu erheben, können dabei für die jüngere Vergangenheit insbeson-<br />
dere sieben Faktoren als bedeutsam bezeichnet werden:<br />
1. Freiheitliche Regierungsbeteiligung: Die seit 4. Februar 2000 auf Bundesebene erstmals<br />
in einer Regierungskoalition mit der ÖVP verbundene FPÖ konnte paradoxerweise erst<br />
rund um die vorgezogenen Parlamentswahlen am 24. November 2002 und ihrem dabei er-<br />
folgten Absturz in der Gunst der WählerInnen (bei gleichzeitig erfolgtem Erdrutschsieg<br />
des Regierungspartners ÖVP) 35 die bereits zuvor von Oppositionsparteien und NGOs<br />
31 Siehe hierzu ausführlicher Abschnitt 4.1.2.<br />
32 Im vollständigen Wortlaut: Vereinbarung zwischen Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über<br />
gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber,<br />
Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare<br />
Menschen) in Österreich (BGBl. 2004/80).<br />
33 Art. 3 (1) Grundversorgungsvereinbarung; zu den Erstaufnahmestellen vgl. Schuler 2004. Nach Art. 3 (4)<br />
wurde dem Bund auch die allerdings nicht näher präzisierte „Schaffung von Vorsorgekapazitäten für die Bewältigung<br />
von Unterbringungsengpässen in den Ländern“ als Aufgabe zugeordnet.<br />
34 Der Landeshauptmann ist als Träger der mittelbaren Bundesverwaltung (als der er auch in Tirol mit dem Vollzug<br />
des ihm übertragenen Systems der Bundesbetreuung betraut war) in den diesbezüglichen Bereichen formal<br />
zwar an die Weisungen der Bundesregierung gebunden und dieser auch rechtlich verantwortlich, diese Verantwortlichkeit<br />
kann jedoch nur durch eine Anklage beim VfGH geltend gemacht werden, was, wie Weber (2004,<br />
79) anmerkt, „in der Praxis so gut wie nie vorkommt“ – in der Zweiten Republik kam es bislang nur zu einem<br />
einzigen Verfahren (ebd., Anm. 2).<br />
35 Vgl. Pelinka 2003; G. Sperl 2003.<br />
39
erwartete deutlich restriktivere Linie in der österreichischen Flüchtlings- und Asylpolitik<br />
durchsetzen. Obwohl die Freiheitliche Partei bereits lange zuvor Verschärfungen im Asyl-<br />
recht zu einem ihrer zentralen politischen Anliegen erklärt hatte, stellten noch Anfang<br />
2001 FlüchtlingsbetreuerInnen wie jene des Grazer ZEBRA erleichtert fest, die „großen<br />
Verschärfungen“ seien vorläufig ausgeblieben, eine „Kehrtwende“ durch die neue Regie-<br />
rung sei „bei den bestehenden Gesetzen und Grundsätzen auch nicht notwendig“ gewe-<br />
sen. 36 Parallel zu einer Annäherung der ÖVP-Führung an freiheitliche Positionen in<br />
wesentlichen gesellschaftspolitischen Fragen 37 zeichnete sich diese Kehrtwende indessen<br />
ab Herbst 2002 immer deutlicher ab; JournalistInnen verschiedener österreichischer Ta-<br />
geszeitungen resümierten schließlich, die christlich-sozialen Wurzeln der Volkspartei ver-<br />
kämen „zur Theorie in einer Praxis der Fremdenangst“ 38 , der bis Ende 2004 amtierende<br />
Innenminister Ernst Strasser besorge „die Geschäfte der FPÖ“ 39 , seine asylpolitischen<br />
Vorschläge hinterließen einen „eindeutig blauen Eindruck“ 40 , er versuche mit seinen<br />
„Asylideen“ gar, die FPÖ „rechts zu überholen“: „Sicherungsverwahrung nach abgeleis-<br />
teten Haftstrafen, Streichung des Zugangs zum Höchstgericht. Das könnte locker auch aus<br />
der blauen Küche kommen.“ 41 Bereits während des Wahlkampfs zur Parlamentswahl im<br />
Herbst 2002 hatte es der freiheitliche Bundesrat Wilhelm Grissemann durchaus ähnlich<br />
formuliert, als er im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Innsbruck erstaunt anmerkte:<br />
„Ich wundere mich über den Herrn Innenminister auch – dass er jetzt den freiheitlichen<br />
Standpunkt sogar noch an Härte und Tatkraft übertrifft, kann ich mir nur mit der National-<br />
ratswahl erklären.“ 42 Freiheitliche PolitikerInnen werteten Strassers vielfach als zu restrik-<br />
tiv kritisierte Asylpolitik freilich zugleich auch als lediglich vorgetäuscht: „Maulhelden-<br />
tum“, so etwa der Wiener FP-Vorsitzende Heinz-Christian Strache unmittelbar nach Strassers<br />
Rücktritt, „ist zu wenig.“ 43<br />
2. „Asylland“-Mythos ist Geschichte: Mit dem freiheitlichen Regierungseintritt erfolgte<br />
auch eine neue Akzentsetzung in der beinahe die gesamte Zweite Republik begleitenden<br />
Asylland-Rhetorik. Der ihr zugrundeliegende Mythos, Österreich sei ein traditionsreiches<br />
Asylland, dessen Bevölkerung immer wieder von <strong>Neue</strong>m ihre besondere Selbstlosigkeit<br />
unter Beweis gestellt habe und nach wie vor stelle, indem jeder, der „verfolgt, verjagt,<br />
vertrieben“ 44 worden sei, solidarisch mit offenen Armen empfangen werde, fußt überwie-<br />
gend auf der realen, gleichwohl jedoch bald vorübergehenden österreichischen Hilfsbereit-<br />
36 Einflüsse 2001.<br />
37 Vgl. G. Sperl 2003.<br />
38 Plaikner 2004.<br />
39 Kobenter 2003.<br />
40 Brickner 2004b.<br />
41 Schröder 2004.<br />
42 Grissemann, zit. nach R. <strong>Pehm</strong> 2002, 2.<br />
43 Strache, zit. nach Die Presse 11.12.2004.<br />
44 Stanek 1985. Stanek, als langjähriger Beamter des Innenministeriums bereits in der Nachkriegszeit mit dem<br />
Flüchtlingswesen befasst, lieferte mit seinem u.a. von Bruno Kreisky mit einem Geleitwort versehenen Buch –<br />
der ersten publizierten umfassenden Darstellung der österreichischen Asylpolitik der Zweiten Republik – gewissermaßen<br />
die „empirische Basis“ des Asylland-Mythos.<br />
40
schaft gegenüber den während der gescheiterten ungarischen Revolution 1956/57 nach<br />
Österreich geflohenen UngarInnen – ein Ereignis, das in mancher Hinsicht zweifellos als<br />
konstitutiv für die österreichische Identität gesehen werden kann. 45 Im Laufe der Zweiten<br />
Republik wurde der Mythos von den politischen Eliten des Landes rhetorisch gepflegt und<br />
zur österreichischen „Trademark“ ausgebaut 46 , wobei die „Galerie“ großer Momente<br />
österreichischer Hilfsbereitschaft um Brennpunkte der mittel- und südosteuropäischen Ge-<br />
schichte – vor allem den Prager Frühling 1968, die Auseinandersetzungen um die Charta<br />
77-Signatare in der Tschechoslowakei sowie die „Solidarność-Monate“ und die Verhän-<br />
gung des Kriegsrechts in Polen 1981/82 – erweitert werden konnte. Noch 1987 fand der<br />
Topos unter Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) Eingang in die Regierungserklärung 47 ,<br />
im Zuge der Kriege in Bosnien-Herzegowina und Kosovo wurde er erneut wortreich be-<br />
schworen. Wesentlich von der FPÖ forciert, änderte sich der Umgang mit dem Mythos<br />
nach dem Regierungswechsel im Jahr 2000. Das Asylland-Motiv wurde nun zu einem hi-<br />
storischen Bezugspunkt, wobei die Hilfsbereitschaft der Vergangenheit ausschließlich zur<br />
Rechtfertigung der Verweigerung von Flüchtlingsaufnahme in der Gegenwart herangezo-<br />
gen wurde. Österreich habe sich, so exemplarisch der erwähnte Bundesrat Grissemann,<br />
auch bei einer restriktiven Asylpolitik „wenig vorzuwerfen“, schließlich habe man ja<br />
schon in der Vergangenheit bewiesen, dass jene, die „wirklich politisch verfolgt“ seien,<br />
ohne weiteres aufgenommen würden – Grissemann bezog sich dabei auf die österreichi-<br />
sche Haltung während des Prager Frühlings 1968, vor allem jedoch auf das Jahr 1956,<br />
denn damals habe Österreich „Zehntausende innerhalb weniger Wochen integriert“, was<br />
eine „Meisterleistung der jungen Republik“ gewesen sei, die damit auch eine „Vorreiter-<br />
rolle“ in Europa übernommen habe. 48 Österreich, so der neue und unmissverständliche<br />
Akzent, habe bereits in der Vergangenheit genug geleistet, nun sollten andere Staaten ak-<br />
tiv werden – eine Rechtfertigungsstrategie, die zwar auch in den Jahrzehnten zuvor wie-<br />
derholt zur Anwendung gelangt war 49 , jedoch nie derart dominierend im Vordergrund gestanden<br />
hatte. 50<br />
45<br />
Vgl. Volf 1995; Rásky 1998. Kritisch zum Asylland-Topos vgl. u.a. Heiss/Rathkolb 1995, die Österreich als<br />
„Asylland wider Willen“ charakterisieren, und Volf 1995, der die interessengeleitete „Verwendung des Flüchtlings<br />
als politisches Symbol“ konstatiert.<br />
46<br />
Bundeskanzler Bruno Kreisky ließ etwa in seiner Amtszeit wiederholt und in jeweils nur leicht veränderter<br />
Formulierung wissen: „[...] was für die Schweiz das Rote Kreuz und für Schweden der Nobelpreis, das soll für<br />
Österreich seine Rolle als Asylland sein.“ (Salzburger Nachrichten 30.12.1981; in gleicher oder ähnlicher Form<br />
u.a. in Stanek 1985, 9; Beermann/Rosenmayr 1988, 481; Löschnak 1993, IX; Heiss/Rathkolb 1995, 13)<br />
47<br />
Vgl. Beermann/Rosenmayr 1988, 481.<br />
48<br />
Grissemann, zit. nach R. <strong>Pehm</strong> 2002, 2.<br />
49<br />
Vgl. etwa Zierer 1998, 156 und 180ff.<br />
50<br />
Auch im Innenministerium selbst zeigt sich diese Änderung in der Rhetorik. So flicht Mathias Vogl, unter<br />
Minister Strasser Leiter der Abt. III/1 (Legistik), in seine Ausführungen über die mit der Flüchtlingsaufnahme<br />
verbundene österreichische Tradition als „Asylland“ sachlich unrichtig die Aktion „Nachbar in Not“ ein, in<br />
deren Rahmen die <strong>ÖsterreicherInnen</strong> durch ihre Spenden „ein überwältigendes Zeichen der Hilfsbereitschaft“<br />
gesetzt hätten (Vogl 2002b, 82) – freilich nicht gegenüber jenen, die in Österreich um Asyl angesucht hatten,<br />
sondern gegenüber den in ihrem Herkunftsland verbliebenen Opfern von Krieg und Verfolgung. In die selbe<br />
Richtung gehen auch die Ausführungen Minister Strassers (2004c, 15), der im Anschluss an eine Skizze der<br />
„Asylland“-Tradition und die Betonung der gegenwärtigen österreichischen Hilfsbereitschaft „bei Krisenherden<br />
41
3. Führungsrolle bei Asylrechtsverschärfungen in Europa: Wurde noch 1995 von Beobach-<br />
terInnen festgestellt, dass sich bei der Asylgesetzgebung „österreichische Beamte und<br />
Nationalratsabgeordnete bemühten, möglichst »strenge« Kriterien zu formulieren – nicht<br />
nur als politische »home consumption«, sondern auch mit Blickrichtung auf die ange-<br />
strebte EU-Mitgliedschaft“ 51 , so nahm die österreichische Bundesregierung während des<br />
EU-Vorsitzes 1998 unter Kanzler Viktor Klima (SPÖ) erstmals bei Verschärfungen im<br />
Asylrecht eine europäische Führungsrolle ein: Ein Strategiepapier zur Neuordnung des eu-<br />
ropäischen Flüchtlingswesens, erarbeitet vom damaligen Sektionschef im Innenministe-<br />
rium Manfred Matzka, wurde sowohl von mit der Asylthematik befassten JuristInnen, als<br />
auch von zahlreichen NGOs und <strong>Medien</strong> als Infragestellung oder gar Einschränkung der<br />
Genfer Flüchtlingskonvention gewertet. 52 Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2000<br />
nahm schon bald der Innenminister selbst eine derartige Führungsrolle in Europa ein. Im<br />
Herbst 2002 – das Ministerium hatte mit der massenhaften Entlassung von Asylsuchenden<br />
aus dem Flüchtlingslager des Bundes in Traiskirchen begonnen – stellte die General-<br />
sekretärin des European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Kate Smart, daher fest,<br />
ein Vorgehen wie das österreichische habe es „in der gesamten EU noch nie gegeben“:<br />
„Österreich benimmt sich hier sehr modern – auf negative Art.“ 53 Ein Jahr später präsen-<br />
tierte UNHCR einen vergleichenden Bericht über die Asylpolitik der EU-Staaten, demzu-<br />
folge Österreich gemeinsam mit Griechenland das europäische Schlusslicht im Umgang<br />
mit Asylsuchenden bilde – Österreich, so UNHCR, profiliere sich auf dem „Brüsseler Par-<br />
kett“ zunehmend im „Herunterlizitieren von Flüchtlingsrechten“. 54 Wenig später berich-<br />
tete die Tageszeitung Die Presse aus Brüssel, Strassers europäische Amtskollegen seien<br />
„nicht gerade zart besaitete Gutmenschen, werken sie doch heftig an der Errichtung der<br />
»Festung Europa«. Doch die österreichischen Asylrechtspläne gehen selbst den in Flücht-<br />
lings- und Migrationsfragen wenig zimperlichen Innenministern zu weit.“ 55 Österreich, so<br />
urteilen Nowak/Tretter daher, gehöre heute „zu den Scharfmachern in Europa“. 56<br />
4. Zunahme rechtswidriger Maßnahmen: In den letzten Jahren konstatierten nicht nur NGOs<br />
und fachlich einschlägig qualifizierte JuristInnen, sondern auch zahlreiche <strong>Medien</strong> und<br />
aktive wie ehemalige PolitikerInnen aller Parteien im Bereich der Flüchtlings- und Asyl-<br />
in [sic!] und außerhalb Europas“ auf eine nun geänderte Situation hinweist: „Wir mussten etwa zur Kenntnis<br />
nehmen, dass von zehn Asylwerbern acht bis neun aus asylfremden Gründen zu uns kommen.“<br />
51<br />
Heiss/Rathkolb 1995, 12; Hervorhebung durch RP.<br />
52<br />
Vgl. hierzu Langthaler 1998.<br />
53<br />
Smart, zit. nach Der Standard 15.10.2002.<br />
54<br />
Der Standard 25.08.2003; Tiroler Tageszeitung 25.08.2003.<br />
55<br />
Die Presse 16.10.2003b. Ähnlich Der Standard 11.10.2003 („Das strengste Recht Europas“).<br />
56<br />
Nowak/Tretter 2004, 6. Tatsächlich war Minister Strasser zunehmend auch auf EU-Ebene führend für<br />
Verschärfungen eingetreten, etwa mit der Forderung nach einer Liste „sicherer Drittstaaten“ (vgl. Der Standard<br />
23.01.2004). Zuletzt hatte Strasser im Rahmen eines Arbeitstreffens („Austro-Baltic Security Summit“) im<br />
Herbst 2004 mit seinen Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen die Idee eines Auffanglagers für tschetschenische<br />
Flüchtlinge außerhalb der EU entwickelt. Herkunfts- (sic!), Transit- und Zielländer der Flüchtlinge,<br />
so Strasser, müssten planen, wie diesen geholfen werden könne, überdies habe man mit Lagern im Ausland gute<br />
Erfahrungen gemacht, etwa im Irak (vgl. Der Standard 16.09.2004; Tiroler Tageszeitung 16.09.2004b).<br />
42
politik auf Bundesebene eine deutliche Zunahme rechtlich problematischer und rechtswid-<br />
riger Maßnahmen, die im wesentlichen dem Innenministerium bzw. diesem untergeord-<br />
neten Behörden zugeordnet wurden. 57 Wiederholt wurde daher Minister Strasser<br />
vorgeworfen, er trete „das österreichische Recht mit den Füßen“. 58 Im Mittelpunkt der<br />
Kritik standen dabei unter anderem der bereits erwähnte Erlass von später durch den<br />
Obersten Gerichtshof gleich zwei Mal aufgehobenen Richtlinien 59 mit neuen Auf-<br />
nahmekriterien für Bundesbetreuung und Notquartier, mit denen die Entlassung zahlrei-<br />
cher Asylsuchender aus der Betreuung legitimiert wurde 60 , außerdem die rechtswidrige<br />
Verweigerung der Entgegennahme der Asylanträge von über siebzig tschetschenischen<br />
Asylsuchenden im Bezirk Gmünd und ihr anschließender Rücktransport in die Tschechi-<br />
sche Republik 61 , die Misshandlung eines georgischen Asylsuchenden im Flüchtlingslager<br />
des Bundes in Traiskirchen, die amnesty international erstmals seit Jahren von „Folterver-<br />
dacht“ sprechen ließ 62 sowie der Beschluss des nach Ansicht zahlreicher ExpertInnen ver-<br />
fassungswidrigen Asylgesetzes im Oktober 2003 63 , bei dessen Verabschiedung selbst ein-<br />
zelne ÖVP-Politiker vor einer „rechtlichen Blamage“ warnten 64 , das umgehend beim<br />
VfGH beeinsprucht und von diesem schließlich auch in Teilen aufgehoben wurde. 65 Be-<br />
reits in der Frage der ministeriellen Richtlinien zur Aufnahme in die Bundesbetreuung re-<br />
agierte Strasser erst nach der zweiten höchstgerichtlichen Verurteilung mit der Rück-<br />
nahme der Richtlinien, änderte jedoch nicht mehr die Aufnahmepraxis, was ihm den Vor-<br />
wurf eintrug, höchstgerichtliche Urteile zu „ignorieren“. 66 In der Folge wurden Teile der<br />
Richtlinien im Rahmen einer Novellierung des Bundesbetreuungsgesetzes in Gesetzesrang<br />
erhoben und so der Überprüfung durch die ordentlichen Gerichte entzogen 67 – das Höchst-<br />
gericht habe, so Christian Romanoski, damals Leiter der zuständigen Abteilung im<br />
57 So warnte etwa der ehemalige zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser, in seiner aktiven Zeit als Parlamentsabgeordneter<br />
lange Jahre Klubobmann der ÖVP, im Herbst 2003 anlässlich der anstehenden Asylgesetznovelle<br />
vor einer „zunehmenden Missachtung der Rechtsstaatlichkeit“, durch geplante Regelungen im Asylgesetz<br />
würden „Grundsätze der Rechtsordnung verletzt“ (Neisser, zit. nach Die Presse 20.10.2003).<br />
58 So etwa Wolfgang Machreich (2003) in der katholischen Wochenzeitung Die Furche.<br />
59 Im Wortlaut: Richtlinien des Innenministeriums für die Bundesbetreuung hilfsbedürftiger Asylwerber<br />
einschließlich der Aufnahme in das Notquartier; vgl. hierzu u.a. Gulis 2002; Sperl/Lukas 2002; Fronek 2003;<br />
Menschenrechtsbeirat 2003 und 2004; L. Sperl 2004; aus Ministeriumssicht: Vogl 2002a.<br />
60 Menschenrechtsbeirat 2003, 17; 2004, 11 und 23ff.<br />
61 Vgl. Der Standard 12.11.2003 und 20.11.2003; profil 2003; Rozumek 2003. Minister Strasser hielt gegenüber<br />
JournalistInnen fest, man werden auch künftig die Flüchtlinge „einladen, so wie jetzt in Gmünd, dass sie zurückgehen“<br />
(vgl. Meinhart 2003; Rozumek 2003; O-Ton zuletzt in ORF 10.12.2004).<br />
62 Vgl. Patzelt 2004.<br />
63 Vgl. Der Standard 21., 23. und 24.10.2003; Langthaler 2003b; Mayer 2003. amnesty international listete im<br />
Begutachtungsverfahren 10 Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), fünf Verstöße<br />
gegen die Genfer Konvention und fünf Verfassungsverstöße auf, weiters seien 28 Bestimmungen konventions-<br />
bzw. verfassungsrechtlich zumindest problematisch (Huber 2003, 13).<br />
64 So der niederösterreichische VP-Landtagsabgeordnete und Vizepräsident der Arbeiterkammer, Alfred<br />
Dirnberger (zit. nach Der Standard 23.10.2003). Es mache, so Dirnberger, „doch keinen Sinn, dem skandalösen<br />
Umgang Silvio Berlusconis mit Recht und Gerichten Konkurrenz zu machen“ (ebd.).<br />
65 Vgl. hierzu Kussbach 2004.<br />
66 So etwa Langthaler 2003a. Der stellvertretende Vorsitzende des Menschenrechtsbeirates, Bernd-Christian<br />
Funk, charakterisierte das Vorgehen des Innenministeriums als „hinhaltenden Abwehrkampf“ (Funk, zit. nach<br />
Der Standard 15.05.2003; vgl. hierzu auch Menschenrechtsbeirat 2004, 24).<br />
67 Vgl. Langthaler 2003b, 5f; Nowak/Tretter 2004, 6.<br />
43
Innenministerium, „entgegen dem Gesetzeswortlaut“ entschieden. 68 Nach der teilweisen<br />
Aufhebung des Asylgesetzes im Herbst 2004 kündigte Strasser gar an, auf seiner Position<br />
beharren zu wollen, über seinen Sprecher Johannes Rauch ließ der Minister verlauten,<br />
Österreich sei durch das Urteil des VfGH „für Fremde wieder attraktiver geworden“ und<br />
werde „monatlich zusätzlich mit 550 Asylwerbern belastet“. 69 Die von ihm gewünschten<br />
asylrechtlichen Neuregelungen wolle er nun in Verfassungsrang verabschieden lassen 70 –<br />
eine neuerliche Aufhebung durch den VfGH wäre so ausgeschlossen gewesen.<br />
5. Verlagerung der Verantwortung auf über- und untergeordnete Ebenen: Im Herbst 2001<br />
wurde die stark gestiegene Zahl obdachloser Asylsuchender in Österreich erstmals zum<br />
Thema der öffentlichen Diskussion. Die Vertreterin des UNHCR in Österreich, Karola<br />
Paul, machte auf die äußerst prekäre Situation der Betroffenen Ende November mit drasti-<br />
schen Worten aufmerksam: Man dürfe nicht warten, „bis der erste Flüchtling in der Nacht<br />
erfriert“, so Paul in einer Aussendung, die Politik sei gehalten sofort zu handeln. Es könne<br />
„nicht im Interesse Österreichs liegen, dass UNHCR Winterzelte und Kerosinöfen, wie sie<br />
in Pakistan zum Einsatz kommen, auch nach Österreich verlegen muss“. 71 Ab Spätsommer<br />
2002 kam es jedoch immer wieder zu massenhaften Entlassungen Asylsuchender aus dem<br />
Lager Traiskirchen, wobei sich das Innenministerium zunächst auf die erwähnten und<br />
später höchstgerichtlich aufgehobenen neuen Richtlinien berief. 72 Bereits kurz nach<br />
Inkrafttreten dieser Richtlinien hatte UNHCR-Vertreterin Karola Paul die Befürchtung ge-<br />
äußert, dass damit die Weiterwanderung Asylsuchender in andere europäische Länder ge-<br />
fördert würde: „Auf diese Weise verschlechtert sich nicht nur die humanitäre Lage von<br />
Asylsuchenden in Österreich dramatisch, sondern diese Vorgehensweise widerspricht<br />
auch den derzeitigen Plänen der Europäischen Union.“ 73 Minister Strasser beharrte auf den<br />
Entlassungen und rechtfertigte sie mit dem Argument, im Kosovo würden Schlepper damit<br />
werben, dass es „in Österreich Wirtschaftsasyl gebe – man also, wenn man einmal hier ist,<br />
auch bleiben kann und Arbeit bekommt“. 74 Wenn nichts unternommen würde, so Strasser<br />
gegenüber der Tageszeitung Die Presse, „gehen wir einer Vision entgegen aus sieben<br />
Millionen Österreichern, 15 Millionen Indern, 20 Millionen Chinesen“. 75 Hilfsorganisatio-<br />
nen begannen in der Folge, in und um Wien Notlager für obdachlose Asylsuchende einzu-<br />
richten. 76 Die für die betroffenen Asylsuchenden äußerst prekäre Situation änderte sich je-<br />
doch auch in den nächsten beiden Jahren nicht grundlegend 77 , weshalb sich in der Oster-<br />
68 Romanoski, zit. nach Der Standard 13.11.2003.<br />
69 Rauch, zit. nach Tiroler Tageszeitung 29.10.2004b.<br />
70 Vgl. Der Standard 26.11.2004.<br />
71 Paul, zit. nach UNHCR 21.11.2001.<br />
72 Vgl. u.a. Nowak/Tretter 2004; L. Sperl 2004.<br />
73 Paul, zit. nach UNHCR 23.09.2002.<br />
74 Strasser, zit. nach Die Presse 01.10.2002.<br />
75 Ebd.<br />
76 Vgl. Die Presse 08.10.2002. Minister Strasser kommentierte dies mit den Worten, „Dauernotlager“ seien nicht<br />
wünschenswert (ebd.).<br />
77 Zuletzt kündigte das Innenministerium im Herbst 2004 an, ab sofort an jedem Werktag 50 Asylsuchende aus<br />
dem Lager Traiskirchen zu entlassen und entließ umgehend die ersten 30 (vgl. Der Standard 15.10.2004).<br />
44
woche 2004 der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Lorenz Fritz, veranlasst sah,<br />
vor einer „Rufschädigung“ des Wirtschaftsstandorts Österreich zu warnen. 78 Die Politik<br />
des Innenministeriums wurde vielfach als Verlagerung und damit „Abschieben“ der Ver-<br />
antwortung auf die europäische bzw. die Länder- und Gemeindeebene gewertet. 79 Zu die-<br />
ser Sicht trug nicht zuletzt eine Weisung des Innenministers bei, keine Unterkünfte für<br />
Asylsuchende ohne Zustimmung der betroffenen BürgermeisterInnen zu realisieren 80 –<br />
eine Zustimmung, die formal zuvor nie erforderlich gewesen war. Damit lastete die Ver-<br />
antwortung für die Entscheidung über nahezu jede Unterkunftserrichtung plötzlich auf den<br />
Gemeindeführungen. Die „überzähligen“ Flüchtlinge, so eine journalistische Kommenta-<br />
torin diesbezüglich, würden „aus dem Lager Traiskirchen entsorgt und vom Bund an Län-<br />
der und Gemeinden ausgelobt wie verdorbene Ware, die allen im Weg ist und die keiner<br />
haben will“, und so „im Endeffekt an die Schwächsten weitergeschoben [...], die lokalen<br />
Bürgermeister“. 81 Gegenüber jenen Landesbehörden, die wie die Tiroler Administration<br />
den Vollzug der Bundesbetreuung in der ersten Hälfte der 1990er Jahre übernommen hat-<br />
ten und damit in ihrem Wirkungsbereich für die Unterkunftssuche verantwortlich waren,<br />
rechtfertigten viele BürgermeisterInnen, gedrängt von aufgebrachten BürgerInnen, ihre<br />
eine Flüchtlingsunterkunft ablehnende Haltung zunehmend mit Verweis auf die ministe-<br />
rielle Position und forderten die Berücksichtigung ihres Willens ein. Dies belastete wie-<br />
derum die Beziehungen zwischen dem Ministerium und den Ländern deutlich. Das<br />
Innenministerium, so etwa Ende 2003 der Flüchtlingsreferent der Steiermark, Günther<br />
Bauer, habe „durch einseitige Maßnahmen die Vertrauensbasis zu den Ländern massiv<br />
gestört“. 82<br />
6. Abschreckungssymbol Traiskirchen: Das Flüchtlingslager des Bundes in Traiskirchen –<br />
aufgrund seiner Geschichte in der Zweiten Republik vielfach als Symbol oder gar Syn-<br />
onym für die österreichische Flüchtlings- und Asylpolitik bezeichnet 83 und als „sensibler<br />
Spiegel“ für die „komplexen und widerspenstigen Beziehungen Österreichs gegenüber<br />
seinen Fremden“ charakterisiert 84 – entwickelte sich in den letzten Jahren zunehmend vom<br />
„Symbol der Hilfsbereitschaft“ zu einem gleichermaßen nach außen (auf Asylsuchende)<br />
wie nach innen (auf die österreichische Bevölkerung) wirkenden Abschreckungssymbol.<br />
Die teils heftig kritisierten Lebensbedingungen im Lager 85 eskalierten im Sommer 2003 in<br />
78<br />
Fritz, zit. nach Der Standard 08.04.2004. Das Büro des Innenministers ließ verlauten, man „freue“ sich über<br />
die Stellungnahme Fritz’ und mache darauf aufmerksam, „dass jedes Flüchtlingsquartier, das von der Industriellenvereinigung<br />
zur Verfügung gestellt wird, finanzielle Unterstützung“ erhalten werde (ebd.).<br />
79<br />
Vgl. UNHCR 23.09.2002; Meinhart 2003; Tiroler Tageszeitung 23.12.2003b.<br />
80<br />
Vgl. Der Standard 07.11.2003 und 10.11.2003; siehe auch Brickner 2003; Langthaler 2004a.<br />
81<br />
Coudenhove-Kalergi 2004.<br />
82<br />
Bauer 2003, 10. Ähnlich Bauers Tiroler Amtskollege, der davon sprach, Minister Strasser habe das Problem<br />
„auf die Bürgermeister verlagert“ und diese damit „im Stich gelassen“, die Entscheidung über die Realisierung<br />
einer Unterkunft bedeute „zu viel Druck“ für die BürgermeisterInnen (Tiroler Tageszeitung 23.12.2003a und b).<br />
83<br />
So u.a. Beermann/Rosenmayr 1988; Coudenhove-Kalergi 2004; Limberger/Rechling 2004; Sprenger 2004.<br />
84<br />
Wischenbart 1995, 208. Zur Geschichte des Areals vgl. ebd.; Brickner/Möseneder 2003.<br />
85<br />
Vgl. für die 1980er Jahre u.a. Wischenbart 1995; für die Zeit des Bundesbetreuungssystems u.a. Knapp 2001b;<br />
für das System der Grundversorgung u.a. Limberger/Rechling 2004 und Schuler 2004.<br />
45
einer Massenschlägerei, in deren Verlauf ein tschetschenischer Asylsuchender ums Leben<br />
kam – Gerald Hesztera, Sprecher des Bundeskriminalamts, charakterisierte in den <strong>Medien</strong><br />
die Schlägerei als Rauferei „wie auf dem Zeltfest [...] mit Fäusten und Tischhaxen“ und<br />
machte vor allem „die Hitze“ dafür verantwortlich 86 , der Juniorchef der Betreiberfirma<br />
EHC, Sascha Korte, äußerte sein Bedauern über den Vorfall, der „aber nicht zu verhin-<br />
dern“ gewesen sei, derartige Auseinandersetzungen kämen eben immer wieder vor, auch<br />
am Oktoberfest passiere so etwas. 87 Vor diesem Hintergrund begründeten BürgerInnen-<br />
initiativen, Kommunal-, Landes- und BundespolitikerInnen ihre kritische oder ablehnende<br />
Haltung gegenüber flüchtlingspolitischen Maßnahmen vor allem im Unterbringungsbereich<br />
in den letzten Jahren zunehmend damit, man wolle kein „zweites Traiskirchen“. 88<br />
7. Konfrontation mit Zivilgesellschaft: Innenminister Strasser übertreffe „alles bisher da<br />
Gewesene [sic!]“, und das sei „nicht gerade wenig“ gewesen, urteilte Anfang 2003 die<br />
Grazer Betreuungsorganisation ZEBRA und klagte: „Grippezeit, bevor der Frühling<br />
kommt und wir können aus fachlicher Sicht nur hoffen, dass es bald zu einer Gesundung<br />
der Asyl- und Migrationspolitik kommt, denn sonst leiden wir chronisch an Rassismus, an<br />
paranoider Sicherheitspolitik und an organisiertem Missmanagement“. 89 Die Journalistin<br />
Irene Brickner resümierte entsprechend einige Monate später kurz und bündig: „Strasser<br />
auf Konfrontationskurs mit Zivilgesellschaft“. 90 Tatsächlich verhielt sich der Minister<br />
gegenüber internationalen Organisationen wie dem UNHCR, österreichischen NGOs und<br />
kirchlichen Organisationen wiederholt erstaunlich provokativ. So rechtfertigte er etwa im<br />
September 2002 die bereits mehrfach erwähnten und später für rechtswidrig erklärten<br />
Bundesbetreuungsrichtlinien mit einer angeblich dahingehenden Forderung des UN-<br />
Hochkommissars Ruud Lubbers – die UNHCR-Vertreterin in Österreich protestierte um-<br />
gehend vehement, Lubbers habe so etwas „niemals gesagt“. 91 Neun Monate später<br />
argumentierte der Minister indessen erneut in dieser Weise: In einem für die Tiroler Ta-<br />
geszeitung verfassten Beitrag rechtfertigte er seine Asylpolitik mit einem angeblichen<br />
Lubbers-Zitat, das er sogar in Anführungszeichen setzte, blieb jedoch die Quelle schul-<br />
dig. 92 Nachdem die Caritas im Herbst 2003 in einer Kirche ein Notquartier für obdachlose<br />
86<br />
Hesztera, zit. nach Der Standard 11.08.2003. Hesztera sprach wenig später davon, die Schlägerei sei<br />
möglicherweise von tschetschenischen und moldawischen Asylsuchenden „organisiert“ worden (vgl.<br />
Brickner/Möseneder 2003).<br />
87<br />
Korte, zit. nach Der Standard 12.08.2003a. Der zuständige Innenminister Strasser konstatierte „eine neue<br />
Qualität von Aggression bei tschetschenischen Asylwerbern“ (Strasser, zit. nach Der Standard 12.08.2003b).<br />
Wie Wischenbart (1995, 204f) zeigt, kamen derartige Schlägereien mitsamt Todesfällen im Lager allerdings<br />
bereits früher vor, seinen Angaben zufolge wurden sie auch „gut dokumentiert“.<br />
88<br />
Vgl. u.a. Meinhart 2003; Tiroler Tageszeitung 10.05.2004, 04. und 05.10.2004; Der Standard 05.10.2004.<br />
89<br />
Gulis 2003a.<br />
90<br />
Brickner 2003.<br />
91<br />
Der Standard 28.09.2002.<br />
92<br />
Vgl. Strasser 2003: „Für die EU schlägt UNO-Flüchtlingskommissar Lubbers vor, »... dass alle Gruppen, die<br />
das Asylsystem missbrauchen, aussortiert werden. Anträge sollen schnell geprüft und Bewerber mit unberechtigten<br />
Ansprüchen sofort nach Hause geschickt werden. Berechtigte Bewerber würden zwischen den EU-Ländern<br />
aufgeteilt.« Die Asylgesetznovelle entspricht also nicht nur den europäischen Vorgaben, sondern auch den<br />
Vorstellungen des UNHCR.“<br />
46
Asylsuchende eingerichtet hatte, teilte Strasser mit, die Organisation solle „Quartiere für<br />
Flüchtlinge suchen, und nicht für die <strong>Medien</strong>“. 93 Im Frühjahr 2004 attackierte der Minister<br />
die Caritas erneut scharf: Die kirchliche Organisation hatte wegen Überfüllung ein Not-<br />
quartier für obdachlose Asylsuchende geschlossen und die Betroffenen zum Innenministe-<br />
rium geschickt, Strasser erklärte ihr Vorgehen für „menschenverachtend“ 94 , die Caritas<br />
würde „Unwahrheiten“ verbreiten, eine „politische Kampagne“ führen und dabei auch<br />
noch „Asylwerber als Geiseln“ nehmen. 95 Als schließlich Caritas-Präsident Franz Küberl<br />
nach der teilweisen Aufhebung des Asylgesetzes durch den VfGH die Änderungspläne des<br />
Innenministeriums als „riskante Novellierung einer schlechten Novelle“ bezeichnet und<br />
davor gewarnt hatte, Misstrauen gegenüber Asylsuchenden zur Gesetzesgrundlage zu<br />
machen, erklärte Strasser forsch: „Es ist mir völlig unverständlich, wie sich jetzt be-<br />
stimmte Personen als Verteidiger von straffälligen Asylwerbern aufspielen.“ 96 Neben<br />
derartigen verbalen Provokationen kam es im Herbst 2004 schließlich auch noch zu einem<br />
polizeilichen „Ermittlungsskandal“: Das Bundeskriminalamt hatte gegen zwei Mitglieder<br />
des Menschenrechtsbeirates, die im Asylrecht profilierten RechtsanwältInnen Georg<br />
Bürstmayr und Nadja Lorenz, wegen „Verdachts der Schlepperei“ und „Aufruf zum Un-<br />
gehorsam gegen Gesetze“ ermittelt, amnesty international konstatierte „klassische Ele-<br />
mente politischer Verfolgung“. 97 Etliche Eskalationen, so resümierte der Journalist<br />
Michael Fleischhacker nach Strassers Rücktritt durchaus treffend, „wären vermeidbar ge-<br />
wesen, hätte der Innenminister sich nicht dazu hinreißen lassen, Meinungsunterschiede<br />
und Interessengegensätze als Feindschaften zu inszenieren. (Dass sich auch die NGOs<br />
nicht immer durch ausufernde Sachlichkeit hervorgetan haben, sei der Fairness halber erwähnt.)“<br />
98<br />
Die genannten sieben Faktoren wirkten und wirken vor dem Hintergrund einer auf Bundes-<br />
ebene geführten „Asylmissbrauchsdebatte“, an der sich ab Herbst 2002 (und für seine verblei-<br />
bende Amtszeit) Minister Strasser federführend beteiligte. Strasser etablierte dabei, wie<br />
Brechelmacher in einer sprachwissenschaftlichen Analyse zeigt, in seinen Reden im Parla-<br />
ment und bei Presseterminen insbesondere die rhetorische Unterscheidung zwischen jenen,<br />
die Asyl „wirklich brauchen“ und denen daher „geholfen“ werden müsse und jenen, die „aus<br />
asylfremden Motiven zu uns kommen“ und „das Asylrecht missbrauchen“. 99 Erstere<br />
charakterisierte der Minister vorrangig als passiv und „in Not geraten“, letztere als aktiv han-<br />
delnd und bedrohlich:<br />
93<br />
Strasser, zit. nach Die Presse 16.10.2003a. Der liebe Gott, so Strasser weiter, „gehört nicht der Caritas!“<br />
94<br />
Strasser, zit. nach Der Standard 06.04.2004.<br />
95<br />
Strasser, zit. nach Die Presse 08.04.2004.<br />
96<br />
Strasser, zit. nach Der Standard 20.11.2004.<br />
97<br />
Der Standard 28.10.2004; 30.10.2004; s.a. Bisanz 2004. Die Ermittlungen gegen Lorenz stützten sich auf ein<br />
von ihr einer Tageszeitung gegebenes und ebendort publiziertes Interview, in dem sie die österreichische Asylpraxis<br />
kritisiert hatte (vgl. Lorenz 2004).<br />
98<br />
Fleischhacker 2004.<br />
99<br />
Vgl. exemplarisch u.a. Strasser 2003; 2004a, b und c; zuletzt in ORF 11.12.2004.<br />
47
„Positive Konnotierung geht in den Reden des Ministers einher mit der Darstellung eingeschränkt handlungsfähiger<br />
Menschen. Nicht Leistungsfähigkeit, Kraftanstrengung und Ausdauer, die zum Gelingen der Flucht beigetragen<br />
haben mögen, werden hervorgehoben, sondern Opferstatus und Passivität charakterisieren die »rechtmäßigen«<br />
AntragstellerInnen. [...] Im Gegensatz zu positiv konnotierten AntragstellerInnen stellt Minister Strasser<br />
die »Unrechtmäßigen« syntaktisch und semantisch in aktiver Rolle dar. Er schließt sie zu einer Gruppe zusammen,<br />
zu einer Gruppe von Handelnden, von gesetzeswidrig Handelnden. Er definiert diskursiv, d.h. durch sein<br />
Darüber-Sprechen, eine Gruppe mit den semantischen Merkmalen »aktiv« und »kriminell«. Während Strasser<br />
den Handlungsspielraum der »Rechtmäßigen« durch stereotype Wortwahl eingeschränkt darstellt, ordnet er [...]<br />
der anderen Gruppe zahlreiche Aktivitäten zu. Alle diese Aktivitäten sind negativ konnotiert. Die Vielfalt der<br />
zugesprochenen Handlungen lässt diese Gruppe real und präsent erscheinen. Ihre Beschreibung ist dicht und<br />
energievoll. Sie wird diskursiv in den Vordergrund geschoben.“ 100<br />
Strasser brachte mit dieser die bislang im öffentlichen Diskurs gängige Unterscheidung zwi-<br />
schen „echten“ und „unechten“ Flüchtlingen ersetzenden, inhaltlich jedoch gleichfalls äußerst<br />
vage gehaltenen Differenzierung eine (vor allem von freiheitlichen MandatarInnen rasch<br />
übernommene 101 ) neue Begründung restriktiver asylpolitischer und -rechtlicher Maßnahmen<br />
in die Missbrauchsdebatte ein: Strengere Regelungen und Praktiken, so die Argumentation,<br />
dienten nur dem Schutz jener, die Asyl „wirklich brauchen“ würden, man müsse also die<br />
„hilfsbedürftigen Flüchtlinge“ vor den das Asylrecht „missbrauchenden“ Zuwanderinnen,<br />
Zuwanderern und „Kriminellen“ schützen. Die Gruppe dieser „Missbrauchenden“ wurde in<br />
der Folge von KommentatorInnen aus Politik und <strong>Medien</strong>landschaft teils weiter 102 , teils<br />
enger 103 gefasst. Mit dem Wahlkampf zu den Parlamentswahlen im Jahr 2002 begann, so kann<br />
zusammenfassend resümiert werden, eine bundesweite, anhaltende und äußerst starke Polari-<br />
sierung in der öffentlichen Auseinandersetzung um die österreichische Asylpolitik, die jene<br />
unter Innenminister Löschnak in der ersten Hälfte der 1990er 104 nicht unbedingt in ihrer<br />
Schärfe 105 , jedoch in ihrer Breitenwirkung deutlich übertraf.<br />
4.1.2 Das Land Tirol als Unterkunftsgeber<br />
Das Land Tirol trat als Unterkunftsgeber für Asylsuchende bereits frühzeitig und zunächst<br />
durchaus ambitioniert in Erscheinung. Entsprechend sahen sich die verantwortlichen Regie-<br />
rungsmitglieder und Beamten noch bis ins Jahr 2004 hinein gewissermaßen als flüchtlings-<br />
100 Brechelmacher 2003, 8.<br />
101 So etwa durch den Nationalratsabgeordneten und späteren Staatssekretär Eduard Mainoni, der einforderte,<br />
„Kriminellen, die das Asylrecht missbrauchen, um in Österreich ihrer »Tätigkeit« nachzugehen, das Handwerk<br />
zu legen“ und sich zuversichtlich zeigte, dass dabei auch denjenigen, „die tatsächliche Asylgründe“ hätten, so<br />
„rasch und effektiv geholfen werden kann“ (Mainoni 2004).<br />
102 So etwa durch den Tiroler Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP), der nur Asylsuchende, die sich „unmittelbar<br />
nach Überschreiten der Grenze als Asylwerber deklarieren“, der ersten Gruppe zuordnete und forderte,<br />
alle anderen, v.a. straffällig gewordene Asylsuchende und Personen, „die ihre Identität nicht preisgeben“, unverzüglich<br />
abzuschieben oder in „Sonderverwahrung“ zu nehmen (van Staa, zit. nach Gerzabek 2004).<br />
103 So etwa in der Interpretation des Journalisten Michael Völker (2004), der in Strassers Unterscheidung eine<br />
„Unterscheidung zwischen tatsächlichen Asylwerbern und organisierten Serientätern, die aus dem Gefängnis<br />
heraus Asyl beantragen, um einer Abschiebung zu entgehen“, erkannte.<br />
104 Die Kritik an Löschnaks Asylpolitik gipfelte 1994 in einer Stellungnahme des UNHCR, in der dieser zum<br />
Schluss kam, Österreich könne nicht mehr generell als „sicheres Drittland“ gelten (vgl. Knapp 1995b, 18).<br />
105 So forderte etwa Anfang 1995 der Flüchtlingsberater Michael Genner (1995, 31) vehement Löschnaks Rücktritt:<br />
Aus Löschnaks Worten spreche „der Ungeist, der geradewegs nach Oberwart führte“, der Minister habe<br />
sich „längst aus der Gemeinschaft der anständigen Menschen ausgegrenzt. Sein Maß ist voll. Er muß fort.“<br />
48
und asylpolitische „Avantgarde“ 106 unter den österreichischen Bundesländern. Diese Vorstel-<br />
lung, der für die erste Hälfte der 1990er Jahre partiell durchaus eine gewisse Berechtigung<br />
zugesprochen werden kann 107 , war bereits Ende der 1990er mit der Realität kaum noch in<br />
Einklang zu bringen. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde sie indessen erst nach Inkraft-<br />
treten der „Grundversorgungsvereinbarung“ derart diskreditiert, dass der Unterkunftsgeber<br />
davon abrückte – bezüglich der vertragsgemäßen Bereitstellung von Unterbringungsplätzen<br />
war das Land in der Rangliste der österreichischen Bundesländer innerhalb kurzer Zeit regelrecht<br />
abgestürzt. 108<br />
»Bundesbetreuung« und »Landesbetreuung«<br />
Wie erwähnt hatte das Land Tirol bereits 1993 vom Bund den Vollzug der Bundesbetreuung<br />
übernommen – eine Übertragung für den Bereich eines Bundeslandes auf die Landeshaupt-<br />
leute und -verwaltungen war nach § 10 BBetrG 1992 ausdrücklich als Möglichkeit vorgese-<br />
hen, Tirol machte davon gemeinsam mit Kärnten und Vorarlberg Gebrauch 109 , bereits zuvor<br />
waren dem Burgenland und Wien nach derselben Bestimmung Bundesbetreuungsaufgaben<br />
übertragen worden. 110 Durch diese Übertragung wechselte die Zuständigkeit für die Vertre-<br />
tung des Bundes im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu den jeweiligen Landes-<br />
hauptleuten, die damit gewissermaßen zu direkten Stellvertretern des Bundes sowohl bei der<br />
Aufnahme von Asylsuchenden in die Bundesbetreuung als auch beim Abschluss von Verträgen<br />
mit UnterkunftsbesitzerInnen im Rahmen der Bundesbetreuung wurden. 111<br />
Alternativ zur Bundesbetreuung konnten in Tirol – wie in einigen anderen Bundesländern 112 –<br />
Asylsuchende in eine auf der Sozialhilfe basierende „Landesbetreuung“ aufgenommen wer-<br />
den. Die Sozialhilfe wurde dabei hauptsächlich in Form von Sachleistungen vergeben, wes-<br />
halb die Landesbetreuung grundsätzlich mit der Unterbringung in einer der eigens zu diesem<br />
Zweck organisierten Sammelunterkünfte des Landes gleichzusetzen war. Nur wer zumindest<br />
106<br />
So hielt etwa Landesrätin Christa Gangl in ihrer Beantwortung einer schriftlichen Anfrage im Tiroler Landtag<br />
Mitte 2003 mit unverkennbarem Stolz und offenkundig unter Anspielung auf das geplante bundesweite „Grundversorgungssystem“<br />
fest: „Das Bundesland Tirol hat bereits in den vergangenen Jahren eine Grundversorgung<br />
für die Asylwerber gehandhabt. Als einziges Bundesland Österreichs werden in Tirol mangels Kapazitäten in<br />
Gasthäusern vom Land Tirol unmittelbar zwei Heime mit erhöhten Betreuungskapazitäten geführt.“ (Anfragebeantwortung<br />
Gangl 2003, Punkt 12)<br />
107<br />
Etwa aufgrund des (2003 beseitigten) Rechtsanspruchs von Asylsuchenden auf Sozialhilfeleistungen, auf den<br />
im Folgenden noch zurückzukommen sein wird, oder aufgrund des für bosnische Kriegsflüchtlinge Mitte der<br />
1990er initiierten und zeitlich limitierten „Projekts Bürglkopf“ (vgl. Prock 1995; siehe hierzu auch 7.1.2).<br />
108<br />
Bereits Anfang Juni 2004 befand sich Tirol mit einem Minus von 40 Prozent bzw. 554 unterzubringenden<br />
Personen auf dem letzten Platz (vgl. Tiroler Tageszeitung 09.06.2004), trotzdem konstatierte Landeshauptmann<br />
van Staa noch ein „vorbildliches Tirol“, dass sich „mustergültig“ verhielte (zit. nach Tiroler Tageszeitung<br />
16.06.2004b). Anfang November war man mit einem Minus von 44 Prozent bzw. 1.238 unterzubringenden Personen<br />
erneut am letzten Platz angekommen (vgl. Tiroler Tageszeitung 05.11.2004).<br />
109<br />
Verordnung, mit der in den Ländern, Tirol und Vorarlberg Aufgaben der Bundesbetreuung dem Landeshauptmann<br />
übertragen werden (BGBl. 1993/71).<br />
110<br />
Verordnung, mit der im Land Burgenland Aufgaben der Bundesbetreuung dem Landeshauptmann übertragen<br />
werden (BGBl. 1992/411); Verordnung, mit der im Land Wien Aufgaben der Bundesbetreuung dem Landeshauptmann<br />
übertragen werden (BGBl. 1992/412).<br />
111<br />
Vgl. L. Sperl 2004, 149.<br />
112 Vgl. ebd., 134-138 und 158-170.<br />
49
sechzig Prozent des erforderlichen Lebensunterhalts selbst aufbringen konnte, wurde nicht in<br />
einer Sammelunterkunft untergebracht. 113 Die Aufnahme- und Entlassungspraxis gestaltete<br />
sich analog zu den skizzierten Praktiken bei der Bundesbetreuung aus Sicht verschiedener<br />
NGOs und kirchlicher Organisationen intransparent und oft willkürlich. 114<br />
Bis zur Novellierung des Tiroler Sozialhilfegesetzes (TirSHG) 115 im Frühjahr 2003 bestand<br />
für Flüchtlinge ein Rechtsanspruch auf Sozialhilfe, nicht zuletzt deshalb wurde die Situation<br />
von Asylsuchenden in Tirol lange Zeit durchaus positiv bewertet. 116 Mit der Gesetzesnovelle<br />
vom 26. März 2003 117 verschlechterte sich die Situation jedoch deutlich: Ein Rechtsanspruch<br />
auf Sozialhilfeleistungen besteht nun nur noch für österreichische und diesen gleichgestellte<br />
ausländische Staatsangehörige, AsylwerberInnen können (auf der Basis von Ermessensent-<br />
scheidungen) Leistungen der Sozialhilfe beziehen, die jedoch eingeschränkt werden können,<br />
wenn die BezieherInnen die „Aufrechterhaltung der Ordnung in einer Unterkunft durch ihr<br />
Verhalten fortgesetzt und nachhaltig“ gefährdeten. 118<br />
Die »Grundversorgung«<br />
Das mit 1. Mai 2004 die Landes- und Bundesbetreuung ersetzende System der „Grundversor-<br />
gung“ verlagerte die Zuständigkeit für die Unterbringung von Asylsuchenden (abgesehen von<br />
der vorübergehenden Unterbringung in einer der Erstaufnahmestellen) nun generell auf die<br />
Landesebene. Bereits im Dezember 2003 waren hinsichtlich der unterzubringenden Asyl-<br />
suchenden Bundesländerquoten vereinbart worden, Tirol hatte sich zur Aufnahme von rund<br />
8,4 Prozent der Flüchtlinge verpflichtet. 119 Als Voraussetzung für eine Unterbringung im<br />
Rahmen der „Grundversorgung“ wurde das Vorliegen von Hilfs- und Schutzbedürftigkeit bei<br />
„Fremden“ festgeschrieben – ein Rechtsanspruch der Betroffenen wurde, entgegen dem Inhalt<br />
der beiden höchstgerichtlichen Urteile aus dem Jahr 2003, erneut ausdrücklich ausgeschlos-<br />
sen. 120 Als hilfsbedürftig gilt nach dem Wortlaut der Grundversorgungsvereinbarung, „wer<br />
den Lebensbedarf für sich und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhalts-<br />
berechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln be-<br />
schaffen kann und ihn auch nicht oder nicht ausreichend von anderen Personen oder Einrich-<br />
tungen erhält“. 121 Als schutzbedürftig gelten nach der Vereinbarung<br />
113 Ebd., 136.<br />
114 Interviews Beratung/Betreuung 03, 28.08.2003; 04, 15.09.2003; 05, 06.10.2003 und 08, 05.06.2004.<br />
115 LGBl. 1973/105.<br />
116 So etwa L. Sperl (2004, 137) im Rückblick auf die Zeit bis zum Frühjahr 2003.<br />
117 LGBl. 2003/47.<br />
118 § 2a (1) und (2) bzw. § 2a (3) TirSHG.<br />
119 Der Standard 08.09.2004. Die Quoten der anderen Bundesländer wurden wie folgt festgelegt: Wien 19,3 %,<br />
Niederösterreich 19,2 %, Oberösterreich 17,1 %, Steiermark 14,7 %, Kärnten 7 %, Salzburg 6,4 %, Vorarlberg<br />
4,4 %, Burgenland 3,4 % (Girardi 2004, 10; Rundung durch RP).<br />
120 Art. 1 (5) Grundversorgungsvereinbarung.<br />
121 Art. 2 (1) Grundversorgungsvereinbarung. Der Inhalt des Begriffs „Hilfsbedürftigkeit“ geriet bereits im<br />
Herbst 2004 ins Zentrum politischer Auseinandersetzungen zwischen den Landeshauptleuten. Diese vereinbarten<br />
schließlich mit Innenminister Strasser, die Hilfsbedürftigkeit künftig nach einem bundesweit einheitlichen Maßstab<br />
zu beurteilen (vgl. Strasser 2004a). Der Vorschlag, bereits den Besitz eines Mobiltelefons als Grund für<br />
50
1. Fremde, die einen Asylantrag gestellt haben (Asylwerber), über den noch nicht rechtskräftig abgesprochen<br />
ist,<br />
2. Fremde ohne Aufenthaltsrecht, über deren Asylantrag rechtskräftig negativ abgesprochen wurde, die aus<br />
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind,<br />
3. Fremde mit Aufenthaltsrecht gemäß § 8 iVm § 15 AsylG, § 10 Abs. 4 FrG oder einer Verordnung gemäß §<br />
29 FrG,<br />
4. Fremde ohne Aufenthaltsrecht, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind,<br />
5. Fremde, die aufgrund der §§ 4, 4a, 5, 5a und 6 der Asylgesetznovelle 2003 [...] nach einer – wenn auch nicht<br />
rechtskräftigen – Entscheidung der Asylbehörde entweder in Schubhaft genommen werden können oder auf<br />
die die Bestimmungen des § 66 FrG anzuwenden sind oder deren vorübergehende Grundversorgung bis zur<br />
Effektuierung der Außerlandesbringung nach der Entscheidung der Asylbehörde von den Ländern<br />
sichergestellt ist und<br />
6. Fremde, denen ab 1. Mai 2004 Asyl in Österreich gewährt wird (Asylberechtigte), während der ersten vier<br />
Monate nach Asylgewährung. 122<br />
Die Aufgaben der Länder wurden in der Vereinbarung in neun Punkten festgeschrieben.<br />
Demnach haben die Länder unter anderem die vom Bund (etwa aus den Erstaufnahmestellen)<br />
zugewiesenen Asylsuchenden zu versorgen, über Aufnahme und Entlassung in die bzw. aus<br />
der Betreuung zu entscheiden und die zur Versorgung der Unterzubringenden erforderliche<br />
Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. 123 Erste Berichte von NGOs und karitativen<br />
Organisationen legen den Schluss nahe, dass sich in der Aufnahme- und insbesondere in der<br />
Entlassungspraxis, die in Tirol bislang weder einheitlich noch transparent – etwa in Form ei-<br />
ner einsehbaren Richtlinie – geregelt sind, in absehbarer Zeit ein ähnliches Spektrum an real<br />
praktizierten Ausschlusskriterien herausbilden wird, wie dies zuvor schon im Rahmen von<br />
Bundes- und Landesbetreuung geschehen war. 124 Die „Grundversorgung“ beinhaltet jeden-<br />
falls gemäß Art. 6 der Vereinbarung folgende Leistungen:<br />
1. Unterbringung in geeigneten Unterkünften unter Achtung der Menschenwürde und unter Beachtung der<br />
Familieneinheit,<br />
2. Versorgung mit angemessener Verpflegung,<br />
3. Gewährung eines monatlichen Taschengeldes für Personen in organisierten Unterkünften und für<br />
unbegleitete minderjährige Fremde, ausgenommen bei individueller Unterbringung [...], 125<br />
4. Sicherung der Krankenversorgung im Sinne des ASVG durch Bezahlung der Krankenversicherungsbeiträge,<br />
5. Gewährung allenfalls darüber hinausgehender notwendiger, durch die Krankenversicherung nicht abgedeckter<br />
Leistungen nach Einzelfallprüfung,<br />
6. Maßnahmen für pflegebedürftige Personen,<br />
7. Information, Beratung und soziale Betreuung der Fremden durch geeignetes Personal unter Einbeziehung<br />
von Dolmetschern zu deren Orientierung in Österreich und zur freiwilligen Rückkehr,<br />
8. Übernahme von Transportkosten bei Überstellungen und behördlichen Ladungen,<br />
9. Übernahme der für den Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten und Bereitstellung des Schulbedarfs für Schüler,<br />
10. Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufes im Bedarfsfall,<br />
11. Gewährung von Sach- oder Geldleistungen zur Erlangung der notwendigen Bekleidung,<br />
12. Kostenübernahme eines ortsüblichen Begräbnisses oder eines Rückführungsbetrages in derselben Höhe. 126<br />
Verweigerung oder Ausschluss aus der „Grundversorgung“ festzuschreiben (vgl. Der Standard 19.10.2004),<br />
setzte sich in den Verhandlungen über diesen Maßstab letztlich nur zum Teil durch: Zwar wurde keine aufzählende<br />
Liste von Gegenständen erstellt, deren Besitz von der „Grundversorgung“ ausschließt, jedoch ein „konsensuelles<br />
Resultat“ erzielt, wonach der Besitz eines Autos oder eines Mobiltelefons im Wert von etwa 500 Euro<br />
dem Kriterium der „Hilfsbedürftigkeit“ widersprechen würden (vgl. Der Standard 03.12.2004).<br />
122<br />
Art. 2 (1) Grundversorgungsvereinbarung.<br />
123<br />
Art. 4 (1) Grundversorgungsvereinbarung.<br />
124<br />
Interviews Beratung/Betreuung 08, 05.06.2004; 09, 18.08.2004 und 10, 13.11.2004.<br />
125<br />
Art. 9 Grundversorgungsvereinbarung legt das monatliche Taschengeld mit Euro 40,– fest (Anm. RP).<br />
126<br />
Art. 6 (1) Grundversorgungsvereinbarung. Wie das TirSHG enthält mit Art. 6 (3) auch die Grundversorgungsvereinbarung<br />
eine Bestimmung, wonach „Fremden, die die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer Unterkunft<br />
51
Wie schon im System der Bundesbetreuung ist es auch im Nachfolgesystem möglich, beim<br />
Vollzug auf die Dienste humanitärer, kirchlicher oder privater Einrichtungen oder von Institutionen<br />
der freien Wohlfahrtspflege zurückzugreifen. 127<br />
Politisch-strukturelle Rahmenbedingungen<br />
Das Land Tirol agiert als Unterkunftsgeber unter sehr spezifischen politisch-strukturellen<br />
Rahmenbedingungen, welche die politische Praxis im Unterbringungsbereich unmittelbar<br />
beeinflussen. Diese liegen teils in der Struktur des politischen Systems begründet, teils in den<br />
an verantwortlicher Stelle handelnden Personen, deren jeweiliger Handlungsspielraum freilich<br />
erneut in engem Zusammenhang mit der Struktur des Systems zu sehen ist. Vor allem fünf<br />
Einflussfaktoren sind hier hervorzuheben:<br />
1. Landesregierung als faktischer Gesetzgeber: Die Landesregierung als Organ der Verwal-<br />
tung (Exekutive) und das Landesparlament – der Landtag – als Organ der Gesetzgebung<br />
(Legislative) sind in Tirol in der Realität nicht entsprechend der Idee von der institutio-<br />
nellen Gewaltenteilung getrennt. Die Regierung beschließt, gestützt auf die Expertise der<br />
Landesverwaltung, also der Bürokratie, was der Landtag zu beschließen hat. Die Ent-<br />
scheidungen fallen damit im vorparlamentarischen Raum, der Landtag selbst macht sie le-<br />
diglich öffentlich und transparent. 128 Die Verflechtung von Exekutive und Legislative<br />
macht die Landesregierung damit zum faktischen Gesetzgeber. Dieses Grundmuster, das<br />
in der skizzierten Allgemeinheit keine Tiroler Besonderheit ist, sondern durchaus dem<br />
Standard parlamentarischen Regierens entspricht 129 , widerspricht freilich der Selbstdar-<br />
stellung des Landes Tirol, das gerade die (institutionelle) Gewaltenteilung zwischen Par-<br />
lament und Regierung als besonderes Charakteristikum hervorhebt. 130 Durch die traditio-<br />
nelle Asymmetrie des Tiroler Parteiensystems 131 wird die Rolle der Landesregierung als<br />
„Legislativ- und Exekutivorgan in einem“ und damit als faktischer Gesetzgeber jedoch<br />
deutlich verstärkt: Die seit 2003 mit der (an sich mit einer absoluten Mandatsmehrheit<br />
ausgestatteten) ÖVP über eine Koalitionsregierung mit ausgehöhltem Einstimmigkeits-<br />
prinzip verbundene zweitstärkste Partei des Landes, die SPÖ, trägt mit dieser Verbindung<br />
zu einer Schwächung der Parlamentsminderheit bei und schränkt damit auch die zeitliche<br />
Gewaltenteilung – die Trennung zwischen regierender Parlamentsmehrheit und kontrollie-<br />
render Opposition 132 – ein. „Der Landtag wird zur Farce“, klagte vor diesem Hintergrund<br />
Ende 2004 die Journalistin Anita Heubacher in der Tiroler Tageszeitung: „Der Mega-Ko-<br />
durch ihr Verhalten fortgesetzt und nachhaltig gefährden“, die Versorgung eingeschränkt oder eingestellt werden<br />
kann.<br />
127 Art. 4 (2) Grundversorgungsvereinbarung.<br />
128 Vgl. Pelinka 2004a, 10.<br />
129 Ebd.<br />
130 Vgl. AdTLR 2004 (Homepage), hier URL: .<br />
131 Vgl. Pelinka 1994 und 2004a; Achrainer/Hofinger 1999.<br />
132 In Tirol ist diese erst seit der Verfassungsnovelle von 1998 und dem damit verbundenen Wechsel vom Proporz-<br />
zum Majorzsystem gegeben (vgl. hierzu etwa Pelinka 1994 und 2004a).<br />
52
alition stehen nur noch die Grünen gegenüber. Sie halten die Oppositionspolitik hoch. Die<br />
Freiheitlichen erklären bereits, dass sie nicht so viele Anträge im Landtag stellen, weil<br />
diese ohnehin abgelehnt würden.“ Der Job der Abgeordneten bestünde „aus Handheben<br />
und Ja zu Beschlüssen sagen, die außerhalb des Landtages gefallen sind“, offenbar sehe so<br />
„Politik auf tirolerisch“ aus. 133<br />
2. Herausragende Position des Landeshauptmanns: Innerhalb der Landesregierung kommt<br />
dem Landeshauptmann eine herausragend starke Stellung zu. Er ist der „politische Angel-<br />
punkt der Landespolitik“ 134 : Als „Staatsoberhaupt“ des Landes vertritt er dieses gegenüber<br />
dem Bund, den anderen Bundesländern und, wenn auch in Grenzen, gegenüber dem Aus-<br />
land. Als Mitglied der Landesregierung ist er de jure zwar nur primus inter pares, er be-<br />
stimmt jedoch die Tagesordnung der Regierungssitzungen und führt innerhalb der Regie-<br />
rung den Vorsitz. Gemäß dem Bundes-Verfassungsgesetz fungiert der Landeshauptmann<br />
auf Landesebene jedoch auch als zentrales Organ der Bundesverwaltung, die durch ihn<br />
und die ihm unterstellten Landesbehörden ausgeübt wird. 135 Als Träger der mittelbaren<br />
Bundesverwaltung ist der Landeshauptmann gegenüber der Bundesregierung und den ein-<br />
zelnen BundesministerInnen der einzige Adressat von Weisungen, entsprechend ist er<br />
auch befugt, in diesem Bereich anderen Mitgliedern der Landesregierung Weisungen zu<br />
erteilen. 136 Aufgrund seiner starken Doppelstellung als Vollzugsorgan des Bundes und<br />
Spitzenpolitiker des Landes hat der Landeshauptmann großen Einfluss darauf, wie im<br />
Land Bundesgesetze vollzogen werden. 137 Weiter gestärkt wird seine Position innerhalb<br />
der Landesregierung durch den Umstand, dass ihm als Träger der Organisations- und Per-<br />
sonalgewalt über die Landesbehörden nahezu alle Verfügungsrechte über organisatorische<br />
Belange zukommen und er über den ihm unterstellten Landesamtsdirektor ressortübergrei-<br />
fend Rekrutierung und Karrieren der in der Landesverwaltung Beschäftigen kontrollieren<br />
kann. 138 Der Landeshauptmann ist damit „Herr über den gesamten inneren Dienst“: Durch<br />
Verfügungen oder Weisungen kann er diesen in seinem Sinne steuern und personell wie<br />
organisatorisch gestalten – auch hinsichtlich der Intensität der Aufgabenbesorgung in den<br />
einzelnen Bereichen der Landes- und mittelbaren Bundesverwaltung. 139 Die<br />
herausragende Position des Landeshauptmanns manifestiert sich im Bereich der<br />
Flüchtlings- und Asylpolitik nicht nur in der oben erwähnten Übertragung der Bundes-<br />
betreuungsagenden durch den Bund auf den Landeshauptmann und in der Aushandlung<br />
und Paktierung des Nachfolgesystems der „Grundversorgung“ nicht etwa durch das<br />
ressortzuständige Regierungsmitglied, sondern durch den Landeshauptmann, sondern auch<br />
133<br />
Heubacher 2004b.<br />
134<br />
Weber 2004, 78.<br />
135<br />
Art. 102 (1) B-VG; vgl. Weber 2004, 79.<br />
136<br />
Weber 2004, 79.<br />
137<br />
Ebd.<br />
138<br />
Ebd., 79f; zur Funktion des Landesamtsdirektors siehe ebd., 81f.<br />
139 Ebd., 80.<br />
53
in seinen die einschlägige Politik des Landes wie auch die öffentliche Diskussion in der<br />
Praxis wesentlich gestaltenden, wenn nicht gar steuernden (verbalen) Interventionen.<br />
3. Starke Position der Landesverwaltung: Das Verhältnis zwischen Landesregierung und<br />
Landesverwaltung – dem „Amt der Tiroler Landesregierung“ – ist in Tirol nur schwer<br />
nachvollziehbar, weshalb häufig ein „Mangel an Trennschärfe“ konstatiert wird. 140 Die<br />
daraus resultierende Unschärfe hinsichtlich der politischen Verantwortlichkeit liegt we-<br />
sentlich in einer deutlichen Abschwächung des Ressortprinzips begründet: In Tirol kon-<br />
trollieren die Mitglieder der Landesregierung eine, wie mit Pelinka angemerkt werden<br />
kann, „Buntheit von Kompetenzen, deren innerer Zusammenhang nicht oder kaum er-<br />
kennbar ist“. 141 Die heterogene Struktur der einzelnen Ressorts ist dabei keineswegs im-<br />
mer deckungsgleich mit der vergleichsweise konsistenten Struktur der Landesverwaltung,<br />
weshalb die Zuordenbarkeit der Gruppen und Abteilungen der Administration zu den je-<br />
weiligen Ressorts durch Mehrfachzuständigkeiten gekennzeichnet ist. 142 Dies erschwert<br />
naturgemäß die Durchschaubarkeit der Struktur, fördert darüber hinaus jedoch auch die<br />
Autonomie der Verwaltung gegenüber den einzelnen Regierungsmitgliedern – bis hin zu<br />
einer möglichen „partiellen Emanzipation der Verwaltung von der Politik“ 143 . Die Macht-<br />
position der Verwaltung basiert dabei inhaltlich insbesondere auf ihrer Informationsmacht:<br />
Die „Insider-Informationen“ der Administration sind für die Politik letztlich unverzicht-<br />
bar, weshalb ein System gegenseitiger Abhängigkeiten besteht. 144 Durch die<br />
Vorstandsfunktion und Personalgewalt ausschließlich des Landeshauptmanns über die<br />
Beamtenschaft wird die starke Position der Verwaltung gegenüber den jeweils ressortver-<br />
antwortlichen Regierungsmitgliedern zusätzlich gestützt, wie im Folgenden am Beispiel<br />
des Flüchtlingskoordinators gezeigt werden kann.<br />
4. Flüchtlingskoordinator als Dreh- und Angelpunkt: In der Flüchtlings- und Asylpolitik des<br />
Landes kommt dem auf Verwaltungsebene fachlich zuständigen Flüchtlingskoordinator<br />
faktisch die Rolle eines Dreh- und Angelpunktes zu. Als Leiter des Referats für Ambu-<br />
lante Dienste und Flüchtlingskoordination in der Abteilung Soziales der Landesverwal-<br />
tung tätig ist er grundsätzlich Soziallandesrätin Christa Gangl (SPÖ) unterstellt. Die Be-<br />
deutung des Koordinators entspringt indessen weniger seiner Doppelzuständigkeit für die<br />
Sozial- und Gesundheitssprengel und das Flüchtlingswesen, als der erwähnten generell<br />
starken Stellung der Verwaltung gegenüber den einzelnen Regierungsmitgliedern sowie<br />
der konkreten Person, welche die Position des Koordinators innehat und dabei den ihr zur<br />
Verfügung stehenden Spielraum zu nutzen versteht. Der gegenwärtige und bislang einzige<br />
140 So etwa Pelinka 2004a.<br />
141 Ebd., 16.<br />
142 Die Kompetenzverteilung innerhalb der Landesregierung reflektiert damit, so Pelinka (ebd., 18), nicht eine<br />
Ressortlogik, sondern eine „Logik des Kompetenzabtausches zwischen und innerhalb von Parteien“.<br />
143 Ebd., 25. Die einzelnen Regierungsmitglieder haben nach Judikatur des VfGH auch keinen Rechtsanspruch<br />
auf die Führung einer bestimmten Abteilung der Verwaltung: Geschäftsordnung und -einteilung werden vom<br />
Landeshauptmann (mit Zustimmung von Landes- und Bundesregierung) erlassen (Weber 2004, 77f).<br />
144 Vgl. hierzu ebd., 86-91.<br />
54
Koordinator Peter Logar, der, vom Österreichischen Bundesheer kommend 145 , diese Tätig-<br />
keit bereits seit Schaffung der Stelle im Jahr 1993 ausübt, hat im Laufe seiner Amtszeit<br />
wiederholt gezeigt, dass er diesen Spielraum nicht nur kennt, sondern auch zu nutzen ge-<br />
willt und imstande ist. Trotz wiederholter Forderungen der grünen Opposition im Landtag<br />
verzichtete Landesrätin Gangl im allgemeinen, gegenüber Logar von ihrem Weisungsrecht<br />
Gebrauch zu machen 146 – wohl nicht von ungefähr: Nachdem der Koordinator am Ende<br />
der medial vielbeachteten „Aktion Herbergssuche“ – einer von Innsbrucker NGOs und<br />
kirchlichen Gruppierungen organisierten Notschlafstelle für letztlich über vierzig obdach-<br />
lose Asylsuchende, die großteils zuvor aus verschiedenen Gründen aus der „Landes-<br />
betreuung“ entlassen worden waren 147 – wenige Tage vor Weihnachten 2002 von der<br />
Landesrätin in die Räumlichkeiten der Aktion einbestellt worden war, um dort unter den<br />
Augen der OrganisatorInnen die versammelten Flüchtlinge wieder in Unterkünfte des<br />
Landes aufzunehmen (was selbst nach Einschätzung eines Mitorganisators, Pater Johannes<br />
König, einer Bloßstellung des Koordinators nahe kam, der zuvor öffentlich kategorisch<br />
ausgeschlossen hatte, dass es in Tirol obdachlose Asylsuchende gäbe 148 ), reichte er<br />
postwendend beim Landesamtsdirektor seinen Rücktritt ein. „Unter diesen politischen<br />
Voraussetzungen ist es schwer, weiterzuarbeiten“, ließ der Koordinator noch am Weih-<br />
nachtstag über die Tiroler Tageszeitung verlauten und führte ergänzend auch massive<br />
Probleme mit georgischen Asylwerbern an. 149 Landeshauptmann van Staa, für die<br />
Beamtenschaft formal ja zuständig, stärkte dem Koordinator jedoch den Rücken: „Ich<br />
habe Logar gebeten, im Amt zu bleiben“, er verstehe die Verzweiflung Logars. 150 Landes-<br />
rätin Gangl waren mit diesem Manöver, an dem sie lediglich als „Zaungast“ teilhaben<br />
konnte, deutlich ihre Grenzen aufgezeigt, der Koordinator hatte dagegen seine relative<br />
Autonomie unter Beweis gestellt, indem er sowohl seine amtliche Stellung als auch seine<br />
(politische) Sicht der Thematik durch den Landeshauptmann persönlich absichern ließ.<br />
Neben dieser Machtdemonstration ist es dem Koordinator in seiner Amtszeit aber auch<br />
gelungen, sein Tätigkeitsfeld kontinuierlich auszuweiten und insbesondere integrations-<br />
und entwicklungspolitische Projekte zu übernehmen. 151 Seine starke Stellung manifestiert<br />
145 Logar hatte dort zuletzt die Unterbringung bosnischer Kriegsflüchtlinge in der Speckbacher-Kaserne in Hall<br />
in Tirol logistisch zu begleiten (vgl. Kasten „Zur Person“ in Logar 2001).<br />
146 Zu dieser Möglichkeit vgl. Weber 2004, 74ff.<br />
147 Vgl. hierzu Ralser 2003.<br />
148 König erinnert sich im Interview (24.10.2003, Z 69-73) wie folgt: „Und am Freitagnachmittag waren [sic!]<br />
dann der Termin, wo sie den [Flüchtlingskoordinator] Logar – und das muss man sich schon vorstellen, gell? Der<br />
war an dem Tag in Urlaub, es war Freitag, und um 16.00 Uhr – ein Landesbeamter! – hat sie ihn bestellt auf<br />
unseren Schreibtisch in der Cafeteria der Theologischen Fakultät [...], und sie ist dort drei Stunden danebengestanden<br />
und hat darauf ... darüber gewacht, dass keiner von den 42 weggeschickt wurde ...“<br />
149 Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.12.2002.<br />
150 van Staa, zit. nach ebd.<br />
151 Logar war bzw. ist Leiter des bis März 2005 EU-finanzierten EQUAL-Projekts „jobshop“ (vgl. Öggl 2003a<br />
und b) sowie der (entwicklungspolitischen) Partnerschaft des Landes Tirol mit der Gemeinde Indjija in der serbischen<br />
Provinz Vojvodina und mit der kosovarischen Region Podujevë (vgl. Logar 2001; Horst-Wundsam 2002;<br />
Tiroler Tageszeitung 14.03.2002, 13.05.2002, 30.11.2003; zuletzt u.a. Ascher 2004). 1995 war Logar trotz des<br />
Fehlens einer juristischen Ausbildung vorübergehend gar als Flüchtlingsberater des Bundes gemäß § 23 AsylG<br />
1991 im Gespräch (vgl. asylkoordination österreich 1995).<br />
55
sich dabei auch in einer für einen Angehörigen der Landesverwaltung beispiellosen<br />
kontinuierlichen <strong>Medien</strong>präsenz vor allem im lokalen und regionalen, zeitweise aber auch<br />
im überregionalem Bereich. 152 In den letzten Jahren nahm Logar dabei nicht nur zu<br />
Themen Stellung, die seinen unmittelbaren Arbeitsbereich als Flüchtlingskoordinator<br />
betrafen (etwa die von ihm mitverhandelte „Grundversorgungsvereinbarung“, die vor<br />
allem in der regionalen Tagespresse wie auch in der Landespolitik in den letzten Jahren<br />
forcierte Diskussion um „kriminelle Asylanten“ in regionalen Flüchtlingsunterkünften<br />
oder die Unterkunftssuche), sondern kommentierte als „Experte“ 153 unter anderem auch<br />
die Zahl der traumatisierten Asylsuchenden in Tirol 154 , die zu erwartenden Auswirkungen<br />
des mit 1. Mai 2004 in Kraft tretenden Asylgesetzes auf die Flüchtlingszahlen 155 , die<br />
Auswirkungen der Erweiterung der EU auf die Zahl der Asylsuchenden in Österreich 156<br />
sowie den „Missbrauch“ des Asylrechts in Österreich. 157 Im Gleichklang mit<br />
Landeshauptmann van Staa kritisierte Logar auch mehrfach die fehlende Möglichkeit,<br />
straffällig gewordene AsylwerberInnen bereits während ihres noch laufenden Asylverfah-<br />
rens abschieben zu können und forderte den Innenminister auf, diesbezügliche gesetzliche<br />
Regelungen zu schaffen. 158 Angesichts seiner öffentlichen Präsenz und Prominenz über-<br />
rascht es kaum, wenn Landesrätin Gangl den bemerkenswerten Spielraum des Beamten<br />
indirekt bestätigt, wenn sie vorsichtig formuliert, Logar verfüge als Flüchtlingskoordinator<br />
„über sehr viel Erfahrung [...], weil er das ja schon über zehn Jahre macht“ und habe<br />
„mein ganzes Vertrauen in dieser Hinsicht“. 159<br />
5. „Rote“ ressortzuständige Landesrätin im „schwarzen“ Tirol: Das für das Flüchtlingswe-<br />
sen zuständige Sozialressort ist eines der beiden sozialdemokratisch geleiteten Ressorts<br />
innerhalb der Tiroler Landesregierung. Vor dem Hintergrund der klaren Dominanz der<br />
christlich-konservativen ÖVP im Land spielt dies nach Einschätzung der zuständigen<br />
152<br />
Entsprechend ist Logar mittlerweile der wohl einzige Landesbeamte, dessen Name – wie bei höherrangigen<br />
PolitikerInnen und Prominenten – in Titeln regionaler Printmedien ohne jede weitere Erklärung genannt wird<br />
(vgl. zuletzt „Peter Logar mit dem Tode bedroht“, in: Tiroler Tageszeitung 09.11.2004, 10).<br />
153<br />
Tiroler Tageszeitung 02.05.1996; 04.11.2003.<br />
154<br />
Derzeit seien, so Logar Ende 2003, „von den 430 betreuten Asylwerben [sic!] zwei bis drei traumatisiert“<br />
(Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 23.12.2003a).<br />
155<br />
Bundesweit sei eine Verringerung „auf 30 Prozent“ zu erwarten (Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung<br />
04.11.2003).<br />
156<br />
Die Zahl der Asylsuchenden in Österreich, so der Koordinator Ende 2003, werde durch die Osterweiterung<br />
der EU bereits ab Mai 2004 sinken, weil Österreich damit zum „Binnenland“ würde und „damit schwerer für<br />
Migranten erreichbar“ werde (Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 23.12.2003b).<br />
157<br />
„86 Prozent stellen den Antrag aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, sind also keine Flüchtlinge im<br />
engeren Sinn. Das hat der Innenausschuss des Parlaments festgestellt, und das entspricht auch meiner Erfahrung<br />
in Tirol.“ (Logar, zit. nach ebd.; vgl. Tiroler Tageszeitung 04.11.2003)<br />
158<br />
So etwa in Tiroler Tageszeitung 24.08.2004a. Logar begründete dies damit, dass so der „Angst der Bevölkerung<br />
vor den Flüchtlingen“ entgegengetreten werden könne. Im Herbst 2004 kritisierte Logar generell die seines<br />
Erachtens zu geringe Zahl an Abschiebungen: „Seit Mai 2004 wurden aus Tirol sieben Leute abgeschoben. Es<br />
kamen jedoch 300 Fremde neu ins Land. Weitere 300 fielen in die Betreuungstätigkeit des Landes.“ (Logar, zit.<br />
nach Tiroler Tageszeitung 29.10.2004a) Problematisch sei v.a. die Verweildauer von „Fremden und Asylanten“:<br />
„Jeder weiß offenbar, dass er vier bis fünf Jahre bleiben kann.“ Logar resümierend: „Seit Omofuma sind Abschiebungen<br />
fast zum Erliegen gekommen.“ (ebd.)<br />
159<br />
Interview Gangl 09.02.2004, Z 7f.<br />
56
Landesrätin durchaus eine Rolle, wie sie im Interview verdeutlicht: Sie sei, so Gangl An-<br />
fang 2004, „sehr sehr froh“ über „eine eindeutige Aussage vom Landeshauptmann“ gewe-<br />
sen, dass Tirol die erforderlichen Unterbringungsplätze trotz möglicher Widerstände der<br />
Gemeinden jedenfalls bereitstellen werde, „weil wenn man eben auch weiß, dass ja alles<br />
auch politisch gesehen wird und ich halt eine rote Landesrätin bin und die Mehrheit in<br />
dem Land [...] halt schwarze Bürgermeister sind – kommt ja das auch noch dazu, und ...<br />
und da bin ich dann sehr froh“. 160 Unabhängig davon, ob die „rote“ Parteizugehörigkeit<br />
der Landesrätin in einem Land mit dauerhafter „schwarzer“ Mehrheit tatsächlich eine Ein-<br />
schränkung ihres politischen Handlungsspielraums bedeutet (was auch von regionalen<br />
<strong>Medien</strong> angenommen wird 161 ), ergibt sich diese Limitierung schon aus dem Umstand, dass<br />
Gangl offensichtlich in der Überzeugung agiert, in der Praxis nur über einen aus diesem<br />
Grund beschränkten Spielraum zu verfügen und eine „eindeutige Aussage vom Landes-<br />
hauptmann“ zur Unterstützung ihrer Positionen zu benötigen – eine Selbsteinschätzung,<br />
welche die von Achrainer/Hofinger für die Tiroler SPÖ im Hinblick auf die ÖVP konsta-<br />
tierte „Kaninchen-vor-der-Schlange-Haltung“ 162 zu untermauern scheint.<br />
Neben den bislang genannten Faktoren ist noch ein weiterer Aspekt als bestimmend für die<br />
Politik des Unterkunftsgebers zu nennen: Bereits seit geraumer Zeit wird auch in Tirol, teils<br />
eingebettet in die diesbezügliche bundesweite Debatte, teils jedoch von dieser entkoppelt eine<br />
klassische „Asylmissbrauchsdebatte“ geführt. Der Einfluss dieser von regionalen (Print-)Me-<br />
dien im Verein mit einer überschaubaren Anzahl an Landes- und KommunalpolitikerInnen<br />
sowie einzelnen Landesbeamten und hochrangigen Angehörigen des öffentlichen Sicherheits-<br />
apparates geführten Debatte auf die Wahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten kann<br />
nicht unterschätzt werden und zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sich VertreterInnen des Un-<br />
terkunftsgebers selbst immer wieder in die Debatte einbringen, indem sie diese teils bekämp-<br />
fen, teils jedoch auch federführend vorantreiben. Auf die Debatte wird im Folgenden daher<br />
noch gesondert einzugehen sein. 163<br />
4.1.3 Die Gemeinden als Unterkunftsgeberinnen<br />
Die Tiroler Gemeinden sind bislang bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchen-<br />
den nicht als selbständige Akteurinnen in Erscheinung getreten. Eine kommunale Unterkunft<br />
für Flüchtlinge besteht in keiner Gemeinde des Landes, die BürgermeisterInnen betonen<br />
(nicht nur in Tirol) auf Befragen meist, Aufnahme und Unterbringung stelle schlicht keine<br />
kommunale Aufgabe dar. Die passive Rolle der Kommunen in diesem Bereich ist einerseits<br />
160 Ebd., Z 204-207; zur erwähnten „Aussage“ des Landeshauptmannes vgl. Tiroler Tageszeitung 02.12.2003.<br />
161 So spricht die Journalistin Anita Heubacher (2004a) in der Tiroler Tageszeitung davon, Asylsuchende hätten<br />
in Tirol „zusätzliches Pech“, weil „die Thematik hierzulande in den Händen einer roten Landesrätin liegt. Dementsprechend<br />
fällt die Unterstützung der ÖVP aus. Geht etwas schief, verbrennt sich nur der kleine Koalitionspartner<br />
die Finger.“<br />
162 Achrainer/Hofinger 1999, 86.<br />
163 Siehe hierzu Abschnitt 5.<br />
57
vor dem Hintergrund eines traditionell passiven Umgangs der österreichischen Kommunen<br />
mit Migration zu sehen 164 , andererseits ist sie jedoch auch eine konkrete Folge der gesetzli-<br />
chen Lage: Den Gemeinden wurden in Österreich bislang keine Kompetenzen und Verant-<br />
wortlichkeiten bei der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung explizit zugeordnet. Der for-<br />
mal fehlenden Zuständigkeit steht auf Seiten der Gemeinden freilich ihre unmittelbare Betrof-<br />
fenheit gegenüber – allein schon aufgrund des banalen Umstands, dass es ja die Gemeinden<br />
sind, in denen Flüchtlinge untergebracht werden und in denen daher die alltägliche „Integra-<br />
tionsarbeit“ sowohl von der lokalen Bevölkerung als auch von den neu zugezogenen Asyl-<br />
suchenden zu leisten ist. In ihrer Rolle als Betroffene werden die Kommunen daher im Fol-<br />
genden jedenfalls zu berücksichtigen sein.<br />
4.2 Private UnterkunftsgeberInnen<br />
Auf dem Feld der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden sind in Tirol in den<br />
letzten Jahren private UnterkunftsgeberInnen weder in Form gewinnorientierter Firmen noch<br />
gemeinnütziger Organisationen in Erscheinung getreten. Jene Organisationen oder Gruppie-<br />
rungen mit sozialarbeiterischer oder karitativer Intention, die in der jüngeren Vergangenheit<br />
für einen beschränkten Zeitraum in eigenen Räumlichkeiten 165 oder jenen eines Kooperations-<br />
partners 166 Notschlafstellen für obdachlose Asylsuchende zur Verfügung stellten, können<br />
nicht als UnterkunftsgeberInnen im eigentlichen Sinn gelten. Das Österreichische Rote Kreuz,<br />
das in anderen Bundesländern bereits als (meist vorübergehender) Unterkunftsgeber in Er-<br />
scheinung getreten ist, stieg über seinen Tiroler Landesverband im ersten Halbjahr 2004 nicht<br />
in die Unterbringungs-, sondern lediglich in die Betreuungsarbeit in vom Land Tirol gestellten<br />
Unterkünften ein. 167<br />
Sonderfall »Caritas Integrationshaus«<br />
Einen Sonderfall stellt das in der Landeshauptstadt Innsbruck angesiedelte „Caritas Integra-<br />
tionshaus“ dar, das trotz des ähnlich lautenden Namens in keiner Weise mit dem Integrations-<br />
haus Wien verbunden ist. Die vom Verein „Caritashaus Gumppstraße“ getragene Einrich-<br />
tung 168 , die unter anderem einigen Asylsuchenden Unterkunft bietet, wird von ihrer Leitung<br />
offensiv im multikulturalistischen Mainstream positioniert, Geschäftsführer Jussuf Windi-<br />
scher spricht im Hinblick auf die BewohnerInnen und BesucherInnen von einer „Multikulti-<br />
Gesellschaft“, von der jeder auf irgend eine Weise profitiere. 169 Das romantisch-exotische<br />
Außenbild der Einrichtung, das vom Träger erfolgreich über den (von wortgewaltigen Kriti-<br />
164<br />
Vgl. Schoibl 1992.<br />
165<br />
So das „Projekt Warteraum“ des Innsbrucker Vereins Caritashaus Gumppstraße im Winter 2003/04 und die<br />
Notschlafstelle in der Teestube des Innsbrucker Vereins für Obdachlose im Frühjahr 2004.<br />
166<br />
So im Fall der bereits erwähnten „Aktion Herbergssuche“.<br />
167<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 04.05.2004 und 11.06.2004a; siehe auch Langthaler 2004b, 24.<br />
168<br />
Trotz seiner formalen Eigenständigkeit ist der Trägerverein mit der Caritas der Diözese Innsbruck verbunden<br />
(Interview Onay 10.03.2004).<br />
169<br />
Windischer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.09.2003.<br />
58
kern wie Zaimoğlu salopp als „Friede-Freude-Eierkuchen-Multikulti-Kulturbegegnungs-<br />
quatsch“ 170 charakterisierten) kulinarischen Aspekt kommuniziert wird 171 , lässt das Haus je-<br />
doch von vornherein zu einer relativ klar definierten Nische werden, die – jenseits einer<br />
Funktion als Notschlafstelle für obdachlose Flüchtlinge – nur von einem kleinen Teil der<br />
Asylsuchenden tatsächlich als Unterkunfts- oder gar Wohnort genutzt wird. Auf eine detail-<br />
liertere Untersuchung wird im folgenden daher verzichtet.<br />
Selbstorganisierte Privatunterkünfte<br />
Sonderfälle stellen letztlich auch jene Asylsuchenden dar, die weder in von der öffentlichen<br />
Hand noch von der Caritas organisierten privaten Unterkünften untergebracht sind und in den<br />
Statistiken des Landes Tirol unter dem Titel „restliche Asylwerber (privat untergebracht)“ ge-<br />
führt werden. Die Mitte November 2004 immerhin 442 Betroffenen 172 leben im Rahmen der<br />
„Grundversorgung“ in eigenen Wohnungen oder bei Verwandten oder FreundInnen 173 und<br />
verfügen damit über gängige Wohnmöglichkeiten. In dieser Untersuchung werden sie daher<br />
nicht weiter berücksichtigt.<br />
4.3 Obdachlose Asylsuchende: Akteurinnen und Akteure in eigener Sache<br />
Neben öffentlichen und privaten UnterkunftsgeberInnen wäre es bei einer Analyse der Stand-<br />
ortwahl und -realisierung von Flüchtlingsunterkünften durchaus berechtigt, auch obdachlose<br />
Asylsuchende zu berücksichtigen – gewissermaßen als Akteurinnen und Akteure „in eigener<br />
Sache“. 174 Ihre Existenz wurde nicht nur in Tirol lange Zeit nicht explizit benannt, auch von<br />
NGOs. Man ging gemeinhin davon aus, dass jene Asylsuchenden, die nicht in Bundesbetreu-<br />
ung aufgenommen wurden, in Unterkünften privater Organisationen, bei Verwandten oder<br />
Bekannten einen Schlafplatz finden würden und hielt bestenfalls vorsichtig (und letztlich be-<br />
schönigend) fest, dass „Statistiken des Bundesministeriums für Inneres zufolge lediglich etwa<br />
15 bis 20 % aller Asylwerber in die Bundesbetreuung aufgenommen“ 175 würden und die<br />
Nichtaufgenommenen „über keine Unterkunft – und damit über keine Zustelladresse – verfü-<br />
170 Zaimoğlu, zit. nach Abd El Farrag et al. 2000, 37.<br />
171 Das regionale Leitmedium berichtete etwa schwärmerisch von einem Besuch im hauseigenen „Dinnerclub“<br />
(„fremdländische Düfte durchziehen das ganze Haus, ein Stimmen- und Sprachengewirr, herzliches Lachen<br />
empfängt die Besucher“) und hielt anerkennend fest: „Sozial Schwache, Angehörige verschiedenster ethnischer<br />
Gruppen, Otto Normalbürger – für alle gibt es Platz. Weil Verständnis ein Mitbewohner ist.“ (Tiroler Tageszeitung<br />
24.09.2003)<br />
172 Vgl. Tiroler Tageszeitung 11.11.2004.<br />
173 Die „Grundversorgungsvereinbarung“ berücksichtigt diese Möglichkeit als sogenannte „individuelle Unterbringung“<br />
in Art. 9 mit eigenen Kostenhöchstsätzen.<br />
174 Der Begriff „Obdachlosigkeit“ wird hier jenem der „Wohnungslosigkeit“ vorgezogen, da er zur Charakterisierung<br />
der prekären Situation der Betroffenen geeigneter erscheint – Asylsuchende sind im eigentlichen Sinn<br />
des Wortes auch dann „wohnungslos“, wenn sie in Einrichtungen der öffentlichen Hand oder privater Organisationen<br />
Aufnahme gefunden haben, da sie dort in der Regel eben nicht über eine Wohnung, sondern lediglich<br />
über Unterkunft bzw. Obdach verfügen (zur Diskussion um die Begrifflichkeit vgl. u.a. Ludwig-Mayerhofer et<br />
al. 2001, 263ff).<br />
175 Staudinger 1994, 38.<br />
59
gen“ 176 . In Tirol lag die Zahl obdachloser Asylsuchender nach übereinstimmenden Schätzun-<br />
gen in den letzten Jahren konstant zwischen 25 und vierzig Personen. 177 Deren Überlegungen<br />
und Strategien hinsichtlich der „Standorte“ ihrer Schlafplätze näher zu beleuchten, würde den<br />
Rahmen dieser Arbeit freilich deutlich sprengen, weshalb hier eine Analyse unterbleiben<br />
muss. 178<br />
4.4 Entwicklungstrends<br />
Betrachtet man das vergangene Jahrzehnt, so lassen sich im Bereich der Unterbringungspoli-<br />
tik zwei Entwicklungen feststellen: Zum einen ist die Zeit nach 1990 durch eine zunehmende<br />
Föderalisierung dieses Politikfelds gekennzeichnet, zum anderen rückt die Auslagerung der<br />
Unterbringung an private DienstleisterInnen mehr und mehr auch bei großen und sehr großen<br />
Unterbringungseinheiten als reale Möglichkeit ins Blickfeld.<br />
4.4.1 Föderalisierung<br />
War in Österreich der Bereich der Migrations- und Integrationspolitik jahrzehntelang vor<br />
allem eine Frage der (auf Bundesebene geregelten) Arbeitsmarktpolitik, so kam es nach dem<br />
Zusammenbruch der sozialistischen Systeme Ost- und Südosteuropas zu einer Verschiebung<br />
sowohl im politischen Diskurs als auch bei der Regulierungskompetenz: Parallel zur zuneh-<br />
menden Koppelung von Migrations- und Sicherheitspolitik fand eine tendenzielle Kompe-<br />
tenzverlagerung von der Bundes- auf die Länderebene statt. 179 Dieser Trend zur Föderalisie-<br />
rung zeigte sich rasch auch im Bereich der Unterbringung von Asylsuchenden, wo er sich<br />
bereits im Anfang der 1990er geschaffenen System der Bundesbetreuung niederschlug: Das<br />
Bundesbetreuungsgesetz sah die Möglichkeit der Aufgaben- und Kompetenzübertragung für<br />
den Vollzugsbereich auf die Landesebene, konkret auf die Landeshauptleute als Träger der<br />
mittelbaren Bundesverwaltung vor. Schon 1992/93 machten, wie oben bereits erwähnt, einige<br />
der Länder von dieser Möglichkeit auch Gebrauch, in den Landesverwaltungen wurden nun<br />
eigene Referate oder Koordinationsstellen für das „Flüchtlingswesen“ eingerichtet, die teils<br />
das Unterbringungssystem des Bundes und die damit verbundenen Strategien übernahmen,<br />
teils wie in Tirol auch eigene Unterkünfte realisierten und damit eine (auf der Sozialhilfe ba-<br />
sierende) eigenständige Unterbringungspolitik betrieben. Parallel verlagerte sich in der Praxis<br />
auch die Zuweisung der Asylsuchenden an die Unterkünfte mehr und mehr auf Landesebene,<br />
wenngleich die Zuständigkeit bei Bundesbehörden verblieb: Etwa ab 1998 übernahmen die<br />
Außenstellen des Bundesasylamts in den Ländern – auch sie waren erst nach und nach ent-<br />
standen – faktisch vom zuvor zuständigen Innenministerium diese Aufgabe. Mit der im ersten<br />
176<br />
UNHCR 1996, 68.<br />
177<br />
Vgl. Der Standard 07.06.2002; Tiroler Tageszeitung 07.06.2003, 02.03.2004, 25.03.2004; Die Initiative 2003;<br />
Ralser 2003.<br />
178<br />
Eine parallel zu dieser Untersuchung vom Verfasser vorgenommene Erhebung und deren Ergebnisse werden<br />
an anderer Stelle in geeigneter Form zugänglich zu machen sein.<br />
179<br />
Vgl. Bauböck 2001, 255f.<br />
60
Halbjahr 2004 in Kraft getretenen (und zuvor von den Ländern teils vehement eingeforder-<br />
ten 180 ) „Grundversorgungsvereinbarung“ nach Art. 15a B-VG erfolgte die endgültige Verla-<br />
gerung der Unterbringungskompetenzen auf die Landesebene, im Verantwortungsbereich des<br />
Bundes verblieb lediglich die Zuständigkeit für die Erstaufnahmestellen. Bereits im Herbst<br />
2004 wurde jedoch auch eine Föderalisierung dieses Zuständigkeitsbereichs andiskutiert: Der<br />
Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) forderte derartige Stellen an den Staatsgren-<br />
zen, was vom Innenminister abgelehnt wurde, dieser schlug stattdessen die Errichtung von<br />
weiteren Erstaufnahmestellen in der Steiermark und in Tirol vor. Der Tiroler Landeshaupt-<br />
mann van Staa gab daraufhin zu verstehen, er wolle einer Stelle in seinem Land zustimmen,<br />
wenn „in jedem Bundesland ein solches Zentrum“ errichtet würde: „Hier sollen jene Asyl-<br />
werber aufgenommen werden, die im jeweiligen Bundesland die Grenze überschritten ha-<br />
ben.“ 181 Eine Fortsetzung des Trends zur Föderalisierung ist damit jedenfalls absehbar.<br />
Dass die Bundesregierung um eine Föderalisierung der Unterbringungspolitik bemüht ist, darf<br />
angesichts der kontrovers und teils überaus heftig geführten Debatten rund um die Problema-<br />
tik nicht verwundern – mit der Zuständigkeit für dieses Politikfeld verlagert sich auch die<br />
Verantwortung auf die Landesebene, als AdressatInnen von Kritik aller Art an der Unter-<br />
bringungspraxis fungieren somit vorrangig die Landesregierungen, was eine (politische) Ent-<br />
lastung insbesondere des zuständigen Innenministeriums zur Folge hat. Was macht es jedoch<br />
für die Länder attraktiv, gerade im Bereich der Unterbringung von Asylsuchenden Aufgaben<br />
und Kompetenzen zu übernehmen?<br />
Migrations- und Integrationspolitik ist in nationalstaatlichen Demokratien nicht nur von öko-<br />
nomischen Interessen geleitet, sondern in hohem Maße auch von der Art der Konstruktion<br />
einer „nationalen Identität“ geprägt, die notwendigerweise auf der Grenzziehung zwischen<br />
dem „Eigenen“ und dem „Fremden“ und der Definition beider Bereiche beruht. 182 Eine föde-<br />
rale Staatsverfassung, so kann mit Bauböck festgestellt werden, „multipliziert die Möglich-<br />
keiten identitätspolitischer Instrumentalisierung des Einwanderungsthemas. Für Regierungen<br />
und Parteien in den Gliedstaaten gibt es also Anreize, ihre besondere regionale Identität durch<br />
von der nationalen Einwanderungspolitik abweichende Akzente hervorzustreichen.“ 183 Die<br />
demokratische Legitimation der Landesregierungen sorgt zugleich auch dafür, dass sie „eher<br />
geneigt sind, regionale Traditionen und Identitäten zu respektieren als es die Zentralregierung<br />
ist.“ 184 Daneben ist freilich auch die Chance für LandespolitikerInnen als wesentlicher Anreiz<br />
zu werten, sich mit dem Versprechen einer besonders restriktiven (oder auch einer liberaleren)<br />
Migrations- und Integrationspolitik zu profilieren und bei den WählerInnen zu punkten.<br />
180 So etwa von der Tiroler Landesrätin Christa Gangl (vgl. Tiroler Tageszeitung 28.06.2003).<br />
181 van Staa, zit. nach Der Standard 06.10.2004 und Tiroler Tageszeitung 22.09.2004 bzw. 06.10.2004.<br />
182 Vgl. Appelt 2001; Reiterer 2001.<br />
183 Bauböck 2001, 252f.<br />
184 Ebd., 253.<br />
61
Für die kommunale Ebene können derartige Überlegungen nur bedingt gelten. Doch auch bei<br />
den Gemeinden ist, eingebettet in einen generellen und durchaus europaweit feststellbaren<br />
Aufgaben- und Kompetenzzuwachs 185 , im Unterbringungsbereich tendenziell eine Auswei-<br />
tung der Obliegenheiten feststellbar, auch wenn die Zuständigkeit für die Unterkunftswahl<br />
und -realisierung formal nach wie vor zur Gänze bei Bund und Ländern liegt. In Anlehnung<br />
an das oben erwähnte und von Innenminister Strasser noch für das System der Bundesbetreu-<br />
ung eingeführte Mitentscheidungsrecht der BürgermeisterInnen bei der Realisierung von Un-<br />
terkünften wurde von den Gemeinden wiederholt für das System der „Grundversorgung“ und<br />
auf Länderebene ein Mitspracherecht eingefordert 186 , mit einer im Frühjahr 2004 zwischen<br />
dem Innenministerium, VertreterInnen von Ländern und von Hilfsorganisationen sowie dem<br />
Österreichischen Gemeindebund verhandelten Sechs-Punkte-Vereinbarung liegt erstmals eine<br />
schriftliche Auflistung einiger kommunaler Aufgaben im Unterbringungsbereich vor. 187 Dass<br />
mit einem Mitspracherecht der Gemeinden auch deren Verantwortlichkeiten zunehmen wür-<br />
den, ist den BürgermeisterInnen dabei durchaus bewusst.<br />
Parallel zum konstatierten Föderalisierungstrend ist in der Unterbringungspolitik als Folge der<br />
Bestrebungen der EU-Mitgliedstaaten um eine Harmonisierung des Asylrechts auch ein klarer<br />
Trend zur Europäisierung erkennbar. Dieser zeigt sich einerseits im zunehmenden (und in der<br />
jüngsten Vergangenheit mäßigenden) Einfluss von EU-Recht und -Richtlinien 188 , andererseits<br />
jedoch auch in der zuletzt gerade von LandespolitikerInnen vehement erhobenen Forderung<br />
nach einer gesamteuropäischen Regelung der Flüchtlingsunterbringung. 189 Föderalisierungs-<br />
und Europäisierungstrend sind dabei nicht als gegenläufige Tendenzen zu werten, sondern<br />
vielmehr als sich ergänzende, teilweise sogar verstärkende Entwicklungslinien.<br />
4.4.2 Auslagerung<br />
Neben der Föderalisierung rückt zunehmend auch die (rechtlich bereits im System der Bun-<br />
desbetreuung zulässige 190 ) Auslagerung von Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von<br />
Asylsuchenden in den Vordergrund. Diese wurde in Österreich – was von KritikerInnen gerne<br />
übersehen wird – freilich schon seit den 1950er Jahren in durchaus bemerkenswertem Um-<br />
185<br />
Vgl. etwa Bußjäger 2004; Hink 2004.<br />
186<br />
Vgl. Gemeindebund 2004. Der diesbezügliche Textvorschlag des Österreichischen Gemeindebundes sah vor,<br />
dass Gemeinden „vor der Besiedlung eines Flüchtlingsquartiers um Zustimmung ersucht und in den Implementierungsprozess<br />
eingebunden“ werden (ebd.).<br />
187<br />
Die Vereinbarung sieht u.a. die Schaffung von „Strukturen für Informations-, Krisen- und Konfliktmanagement<br />
zwischen Betreuungsorganisation und Gemeinde“ vor, weiters sollen Regelungen gesucht werden, „dass<br />
für Gemeinden keine übermäßigen Kosten für die Betreuung von Kindern und alten Menschen entstehen“, auch<br />
sollen u.a. von den Gemeinden Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylsuchende zur Verfügung gestellt werden.<br />
Die Vereinbarung sieht daneben auch vor, dass bei „neu eingerichteten Quartieren“ die Zahl der untergebrachten<br />
Asylsuchenden „im Regelfall“ 10 % der Gemeindebevölkerung nicht übersteigen soll (ebd.).<br />
188<br />
Vgl. etwa die Richtlinie 2003/9/EG des Rates der Europäischen Union zur Festlegung von Mindestnormen für<br />
die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten.<br />
189<br />
So etwa wiederholt vom Tiroler Landeshauptmann van Staa (vgl. u.a. ÖVP Tirol 17.01.2003; Tiroler Tageszeitung<br />
21.08.2004a und 20.10.2004).<br />
190<br />
§ 4 BBetrG 1992; für die „Grundversorgung“: Art. 3 (5) und 4 (2) Grundversorgungsvereinbarung.<br />
62
fang praktiziert, denn auch das in Österreich traditionell bedeutsame System der Unterbrin-<br />
gung in privat betriebenen (und teils „stillgelegten“) Gasthöfen, Pensionen und Hotels ent-<br />
spricht einer derartigen Auslagerung, wenngleich „nur“ auf der Ebene vergleichsweise kleiner<br />
Einheiten. 191 Bereits seit längerem wurde überdies sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-<br />
ebene gerne auf die Dienste von NGOs, kirchlichen Organisationen oder überhaupt der Kir-<br />
chen zurückgegriffen 192 , bei etlichen Hilfsorganisationen kam es gerade in der jüngsten<br />
Vergangenheit zu einem rasanten Wachstum sowohl der Betreuungsstrukturen als auch der<br />
dafür von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mittel. 193 Mit der Vergabe der gro-<br />
ßen Unterbringungseinrichtungen und Lager des Bundes an den Business-Profit-Betrieb EHC<br />
erfolgte im Jahr 2003 daher letztlich ein durchaus der Logik des bisherigen Systems entspre-<br />
chender Schritt. Dieser stellt zugleich eine Anpassung an die Praxis anderer Staaten der EU<br />
dar, denn anders als in Österreich ist die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung Asylsuchender<br />
etwa im benachbarten Deutschland schon länger zumindest teilweise privatisiert. 194<br />
Die Auslagerung kann grundsätzlich auch als Schritt zur Professionalisierung gewertet wer-<br />
den: Gegenüber der Praxis der Unterbringung in Gasthöfen, Pensionen oder Hotels, in denen<br />
die Betreuungsarbeit durch die in der Regel dafür in keiner Weise qualifizierten Wirtinnen<br />
und Wirte erfolgt, besteht bei spezialisierten BetreiberInnen in deutlich höherem Ausmaß die<br />
Aussicht auf qualifizierte Betreuung, die – anders als im „Gasthofsystem“ – selbstverständlich<br />
auch zu entlohnen ist. Auch im Bereich der Arbeit mit Flüchtlingen zeigt sich damit die zu-<br />
nehmend „normale“, im Berufsspektrum akzeptierte Rolle Sozialer Arbeit. Für die Asyl-<br />
suchenden sinkt mit der zunehmenden Professionalisierung freilich auch die Chance auf per-<br />
sönlichen Kontakt zu und Familienanschluss bei den UnterkunftsleiterInnen und Wirtsleuten,<br />
die sich im besten Fall als „gute Menschen“ sehen, die das „Helfen“ als „moralische Ver-<br />
pflichtung“ gegenüber den „wirklich Schwachen“ empfinden – eine Motivation, die aus fachlicher<br />
Sicht freilich äußerst kritisch zu bewerten ist. 195<br />
191 Wie Dimmel (1999, 27) zeigt, gehört die Auslagerung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen an „freie WohlfahrtsträgerInnen“<br />
überdies bereits seit Ende der 1970er „zum materiell-rechtlichen Regelungsbestand und gebräuchlichen<br />
Instrument der Wohlfahrtsverwaltungen“.<br />
192 So berichtet etwa der am Innsbrucker Jesuitenkolleg tätige Pater Johannes König von behördlichen Zuweisungen<br />
von Asylsuchenden an das Kolleg, das über einen „winzigen Bereich für Notfälle [...] mit zwei kleinen<br />
Zimmern und einem Aufenthaltsbereich – so eine Art Wohnzimmer – mit Kochgelegenheit“ verfüge; die<br />
Flüchtlinge wurden im Kolleg im Rahmen des sogenannten „Notquartiers“ für teils über zehn Tage im Auftrag<br />
des Landes Tirol untergebracht, bis dieses Unterkunftsplätze in eigenen Einrichtungen gefunden hatte (Interview<br />
König 24.10.2003, Z 461-482). Andere NGOs und Social-Profit-Betriebe verfügten bereits im Rahmen des Bundesbetreuungssystems<br />
über Verträge mit dem Innenministerium, das Asylsuchende zur Unterbringung an die<br />
betroffenen Einrichtungen zuweisen konnte (vgl. Scharf 2003; Langthaler 2004b).<br />
193 Vgl. Langthaler 2004b. So übernahm etwa die Caritas der Erzdiözese Wien einen Großteil der Administration<br />
der „Grundversorgung“ des Bundeslandes, Mitte 2004 brachte sie in den acht eigenen Häusern ca. 900 Asylsuchende<br />
unter (vgl. ebd., 22).<br />
194 Im einschlägigen Markt nimmt EHC dabei die Position eines der größten Anbieter ein (vgl. Der Standard<br />
18.10.2002).<br />
195 Vgl. Schmidbauer 1977.<br />
63
Die Vergabe von Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Asylsuchenden an kirchli-<br />
che Organisationen, Social- oder Business-Profit-Betriebe kann vor diesem Hintergrund daher<br />
auch kaum als Beispiel für einen Rückzug des Staates und einen daraus resultierenden<br />
„Sozialabbau“ angeführt werden. Wie in anderen Bereichen der Sozialpolitik auch scheint es<br />
vielmehr sinnvoller, von einem Umbau des Sozialstaats zu sprechen, der Risiken und Gefah-<br />
ren ebenso bietet wie Chancen und konkrete Entwicklungsmöglichkeiten. 196 Der (Sozial-)<br />
Staat hat dabei mit Popp jedoch in jedem Fall weiterhin eine „Steuerungsfunktion für die<br />
präventive und reaktive Bearbeitung der sozialen Probleme“ einzunehmen. 197 Im Zentrum<br />
dieser Aufgabe müsste dabei nicht nur eine (gerade aufgrund der zwischen Politik und Social-<br />
Profit-Betrieben oder Hilfsorganisationen vielfach real existierenden unausgesprochenen<br />
Loyalitätsbindungen, parteipolitisch motivierten Subventionierungsflüsse und Lobby-Bil-<br />
dungen 198 ) sachlich gerechtfertigte und transparente Vergabe der auszulagernden Leistungen<br />
stehen, sondern auch ein wechselseitiges Verständnis als ArbeitspartnerInnen 199 und eine<br />
zugleich theoriegeleitete wie praxisrelevante, öffentlich nachvollziehbare Qualitätskontrolle.<br />
Vor allem Letzteres scheint ein Bereich zu sein, der sich bei vielen der mit der Unterbringung<br />
von Asylsuchenden befassten Bundes- und Landesverwaltungen noch in einem frühen Stadium<br />
der Aufbauphase befindet. 200<br />
5 »Tirol muss hilflos zuschauen.« Asylsuchende in der öffentlichen Diskussion<br />
„Österreich in Seenot“, konstatierte Schenk im Jahr 1995: Das Wasser habe sich zum „natio-<br />
nalen Massensymbol“ gemausert, wir säßen „im Boot und kämpfen gegen die Fluten und<br />
Ströme, oder wir bedienen die Schleusen unseres Staudammes.“ Gesichter und Lebensge-<br />
schichten würden in dieser „eingebildeten Wassermetaphorik“ schlicht ertrinken, übrig blie-<br />
ben anonyme Massen, die „höchstens zum Verschub“ taugten. 201 Schenk bezog sich auf die<br />
damals in Österreich geführte und durch derartige Motive bestimmte Debatte um einen angeblichen<br />
„Missbrauch“ von Asyl. 202<br />
196<br />
Vgl. Popp 2002, 28. Für eine grundlegende Abwägung von Nutzen und Risiken der Auslagerung sozialstaatlicher<br />
Leistungen siehe Dimmel 1999.<br />
197<br />
Popp 2003, 14.<br />
198<br />
Dimmel 1999, 29; siehe auch Weidenholzer 1999.<br />
199<br />
Vgl. Weidenholzer 1999.<br />
200<br />
So wurde etwa in Tirol bei den im landeseigenen Schloss Mentlberg in Innsbruck untergebrachten und vom<br />
Roten Kreuz betreuten Asylsuchenden ein Deutschkurs von Mitarbeiterinnen der Organisation selbst durchgeführt<br />
– eine Mitarbeiterin hatte vor ihrer Pensionierung als Hauptschullehrerin gearbeitet (Tiroler Tageszeitung<br />
11.06.2004a).<br />
201<br />
Schenk 1995, 13.<br />
202<br />
Der Begriff „Asylmissbrauch“ und seine Verwendung, das sei an dieser Stelle angemerkt, beruhen freilich<br />
letztlich selbst auf einem Missbrauch: Um Asyl missbrauchen zu können, müsste den Missbrauchenden zuvor<br />
Asyl gewährt worden sein. Asylsuchende, die erst um die Gewährung von Asyl angesucht haben, sind naturgemäß<br />
nicht in der Lage, Asyl zu „missbrauchen“. Asylberechtigte, die dazu in der Lage wären, sind jedoch nicht<br />
Gegenstand von Missbrauchsdebatten. Der Begriff ist daher, wie mit Gebauer et al. (1993) formuliert werden<br />
kann, eine denunziatorisch gebrauchte „politische Kampfvokabel“, die im Grunde inhaltsleer ist. Diese Inhalts-<br />
64
Als Rückseite der „Asylland-Medaille“ haben Asylmissbrauchsdebatten in Österreich, offen-<br />
bar anders als in Deutschland 203 , eine lange Tradition. Bereits die Aufnahme der Österreich<br />
meist nur als Transitland nutzenden jüdischen Flüchtlinge, Vertriebenen und Displaced Per-<br />
sons in der unmittelbaren Nachkriegszeit war von antisemitischen Ausfällen und teils hefti-<br />
gen Diskussionen über steigende Kriminalität geprägt 204 , wenngleich diese noch nicht unter<br />
dem expliziten Label des „Asylmissbrauchs“ stattfanden. Doch auch der Umgang mit den<br />
ungarischen Flüchtlingen des Jahres 1956 war nur anfänglich durch jene Hilfsbereitschaft der<br />
Bevölkerung gekennzeichnet, die bald zur „ewigen Fußnote“ 205 in den gängigen Beurteilun-<br />
gen der österreichischen Asylpolitik werden sollte. Spätestens Anfang Jänner 1957, als<br />
Innenminister Oskar Helmer (SPÖ) feststellte, Flüchtlinge hätten „auch Pflichten“, setzte eine<br />
von den Printmedien getragene Debatte ein, in der insbesondere darauf verwiesen wurde, dass<br />
Österreich seiner humanitären Verpflichtung ja eigentlich bereits im Fall der Weltkriegs-<br />
flüchtlinge nachgekommen sei. 206 Nun seien die Grenzen der Hilfsbereitschaft erreicht, zumal<br />
offenbar nicht nur „wirkliche politische Flüchtlinge“ nach Österreich gekommen seien, son-<br />
dern auch Leute, die das Asyl- und Gastrecht in Österreich auf Kosten der Allgemeinheit<br />
missbrauchen würden. Man gewähre, so hieß es, grundsätzlich jedem Asyl, außer es handle<br />
sich um „Kriminelle“. 207 Im weiteren Verlauf der Zweiten Republik wurde nahezu jeder der<br />
„Brennpunkte“ der österreichischen Asylpolitik 208 von einer neuen Missbrauchsdebatte be-<br />
gleitet, als zentrales Motiv fungierte dabei die im Topos des „kriminellen Asylanten“ ver-<br />
dichtete Verknüpfung von Asyl und Kriminalität. Gegen Ende der 1980er Jahre wurde der<br />
zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Debatten immer kürzer, rund um die Neuformulie-<br />
rung und -verortung der Politik der Inneren Sicherheit im Kontext der Immigrationskontrolle<br />
wurde der eingeführte Topos mehr und mehr mit jenem des „Illegalen“ als Personifikation der<br />
„illegalen“, d.h. undokumentierten Einreise gekoppelt. 209<br />
Inhaltlich mit den einschlägigen Missbrauchsdebatten auf Bundesebene zwar lose verbunden,<br />
von ihnen jedoch auch in vielerlei Hinsicht entkoppelt wird in Tirol seit mehreren Jahren eine<br />
regionale Form der Debatte geführt, an der zunächst vor allem ihre ständige Präsenz in der<br />
Öffentlichkeit auffällt. Zwar erfolgt sporadisch eine Variation der jeweils diskutierten Motive,<br />
die grundlegende Ausrichtung bleibt dabei jedoch stabil. Ihre spezifisch tirolische Färbung<br />
erhält die Debatte einerseits durch ihre direkte Anbindung an den lokalen „Schimpf- und<br />
leere ist freilich eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Vokabel, schafft sie doch jene Flexibilität,<br />
die eine nahezu unbegrenzte Anwendung des Begriffs ermöglicht.<br />
203<br />
Die erste große Asylmissbrauchsdebatte in der Bundesrepublik wird meist auf die Jahre zwischen 1976 und<br />
1980 datiert (vgl. etwa Meier-Braun 1981; Omairi 1991; Gebauer et al. 1993; Bade 2001).<br />
204<br />
Vgl. Albrich 1995.<br />
205<br />
Volf 1995; Rásky 1998.<br />
206<br />
Zierer 1998, 156.<br />
207<br />
Vgl. Zierer 1995, 169.<br />
208<br />
Vgl. hierzu die „offiziösen“ Auflistungen in Stanek 1985; Blecha 1987; Löschnak 1993; Strasser 2004c.<br />
209 Sohler 2000.<br />
65
Schmähklatsch“ 210 und die von dort bezogenen konkreten „Anlassfälle“ 211 , andererseits durch<br />
den Rückgriff auf ausgewählte Tirol-Klischees wie die „Wehrhaftigkeit“ und die gegen den<br />
„Wasserkopf“ Wien gerichtete „Eigenständigkeit“. Während Unterbrechungen der Debatte<br />
bereits seit geraumer Zeit nicht mehr feststellbar sind, schieben die führenden Beteiligten –<br />
die regionalen (Print-)<strong>Medien</strong> sowie eine beschränkte Zahl an Landes- und Kommunalpoliti-<br />
kerInnen, einzelne Landesbeamten und hochrangige Angehörige des öffentlichen Sicherheits-<br />
apparates – in unregelmäßigen Abständen kurze „Reflexionseinheiten“ ein, in deren Rahmen<br />
die Debatte selbst debattiert und ihr negativer Einfluss auf das gesellschaftliche und politische<br />
Klima im Land konstatiert wird. Parallel werden sporadisch den dominierenden klischeehaf-<br />
ten Negativbildern ebensolche Positivbilder entgegengestellt.<br />
Insbesondere über den die Debatte inhaltlich bestimmenden Bedrohungsdiskurs wurde in<br />
Tirol in der jüngsten Vergangenheit eine Sprachpraxis und ein mit dieser verbundenes Bild<br />
asylsuchender Menschen etabliert, das dem von Hallson so bezeichneten Typus des „plakati-<br />
ven Ausländers“ 212 entspricht: Asylsuchende wurden als außerhalb aller sozialen Schichten<br />
stehende prototypische „Ausländer“, als die „fremdartigsten Fremden“, in bestimmten Dis-<br />
kurssträngen gar als Feindbild schlechthin stilisiert – eine Situation, die jener Anfang der<br />
1990er gleicht, wo teils identische Formulierungen und Klischeebilder die einschlägigen Dis-<br />
kurse bestimmten. 213 Versteht man mit Matouschek/Wodak (und im Anschluss an Demirović)<br />
Diskurse als <strong>Medien</strong>, in denen Bedeutungen und Bedeutungskorrelationen, d.h. Ideologien<br />
durch Individuen produziert, reproduziert, transformiert und verschoben werden 214 , so wird<br />
rasch deutlich, dass hinter der Etablierung derartiger Bilder und Typen keineswegs nur die<br />
meist zwischen Paukboden, Stammtisch und Kleinformat verorteten „üblichen Verdächtigen“<br />
des österreichischen Rechtspopulismus stehen:<br />
„Gruppen stellen unbewußt und gemeinsam eine soziale Situation bzw. eine damit verbundene Sprachpraxis her,<br />
unter deren Kontrolle das Handeln des einzelnen steht. Die Bedingungen dieser politischen, sozialen, sprachlichen<br />
Praxis setzen sich quasi hinter dem Rücken der Subjekte durch, ohne daß die Akteure das Spiel durchschauen<br />
[...]. Das einzelne Subjekt wird derart zum Mitspieler in einem Spiel, dessen Regeln er nicht zu jedem<br />
Moment abstrahieren oder kritisch reflektieren kann.“ 215<br />
210 Zur Begrifflichkeit vgl. Elias/Scotson 1993.<br />
211 Aufgrund dieser Anbindung liegt es nahe, die regionale Debatte gewissermaßen als „missing link“ zwischen<br />
der bundesweiten Missbrauchsdebatte und dem lokalen Schimpf- und Schmähklatsch zu definieren. LandespolitikerInnen<br />
sowie in der Region fest verankerten BundespolitikerInnen, aber auch regionalen Leitmedien wäre<br />
dann die zentrale Rolle der MittlerInnen zuzuordnen, die auf den drei Ebenen für den wechselseitigen Austausch<br />
sorgen, wobei die nationale Ebene abstrakt-legitimierende (etwa politische Hintergründe, Zahlen- und Datenmaterial<br />
etc.), die lokale Ebene dagegen konkret-untermauernde Motive in die regionale Debatte einbringt.<br />
212 Hallson 1996, 278. Hallson selbst berücksichtigt die entscheidende Rolle einschlägiger Diskurse bei der Typisierung<br />
von Gruppen freilich kaum. Obwohl er sich u.a. auf die deutlich differenzierter argumentierenden<br />
Elias/Scotson (1993) bezieht, geht er vielmehr von der schlichten Existenz der von ihm konstatierten „Ausländertypen“<br />
(die er zurecht nur sekundär über die Staatsangehörigkeit definiert) aus und zeichnet ihre jeweils spezifische<br />
„Fremdheit“ tendenziell als von der „nichtfremden“, in ihrer Zusammensetzung letztlich unscharf bleibenden<br />
Gruppe der „alteingesessenen Einheimischen“ unabhängig bestehend.<br />
213 Vgl. hierzu Egger 1995; Matouschek/Wodak 1995. Diese Parallelen konstatierte zuletzt auch Wodak 2004.<br />
214 Demirović 1995, 139ff; Matouschek/Wodak 1995, 217.<br />
215 Matouschek/Wodak 1995, 217; vgl. Demirović 1995.<br />
66
„Die Bilder, die sich in unseren Köpfen eingefressen haben“, schließt Schenk aus diesem dif-<br />
fizilen Mechanismus, „sind Spiegel und Motor von Politik zugleich.“ 216 Wie auf der lokalen<br />
Ebene der „Schimpf- und Schmähklatsch“ funktionieren auf regionaler und nationaler Ebene<br />
die in der Asylmissbrauchsdebatte gebündelten Diskursstränge als teils bewusst konstruierte,<br />
teils aber auch durch wenig reflektierte Beteiligung am Diskurs ungewollt geförderte<br />
„Schranke der Integration“ 217 , mit der eine Etablierten-Außenseiter-Beziehung hergestellt und<br />
gefestigt wird.<br />
5.1 Tirol als Opfer? Der Bedrohungsdiskurs<br />
Im Zentrum wohl jeder Asylmissbrauchsdebatte steht ein Diskurs, mit dem Asylsuchende als<br />
Bedrohung konstruiert werden. Die Bedrohten sind dabei in jedem Fall die „Einheimischen“<br />
und ihr „Land“, im Fall der tirolischen Debatte jedoch auch jene Asylsuchenden, die – eine<br />
aus der bundesweiten Debatte übernommene rhetorische Figur – Asyl „wirklich brauchen“<br />
und die durch jene, die Asyl „missbrauchen“, zu Unrecht „in Verruf“ geraten würden. Für die<br />
vergangenen drei Jahre können im wesentlichen fünf zeitlich nacheinander in den Mittelpunkt<br />
der Debatte rückende, sich in einigen Fällen partiell überschneidende Motive festgestellt wer-<br />
den, die diesen Bedrohungsdiskurs inhaltlich konkretisieren und zugleich seine stetige Fort-<br />
setzung gewährleisten. Diese Motive sollen im Folgenden in ihren Grundzügen nachgezeich-<br />
net werden.<br />
»Unsere« Frauen in Gefahr: Der »HIV-infizierte Schwarzafrikaner«<br />
Im Jahr 2002 wurde zunächst der Fall eines in den regionalen <strong>Medien</strong> als „Oscar O.“ bezeich-<br />
neten afrikanischen Flüchtlings heftig diskutiert, dessen Asylantrag abgewiesen worden war,<br />
der jedoch nicht abgeschoben werden konnte, weshalb es sich aus Sicht der Presse um einen<br />
„Illegalen“ handelte. 218 Der Berichterstattung zufolge hatte der regelmäßig in einem Inns-<br />
brucker Fitnesscenter trainierende Mann trotz bereits zuvor diagnostizierter HIV-Infektion<br />
ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einigen „einheimischen“ Frauen gehabt, die er von der<br />
Infektion jedoch nicht informiert hatte. Für eine an eine Vielzahl diffuser Ängste gekoppelte,<br />
gleichermaßen rassistisch wie sexistisch geführte Missbrauchsdebatte erwies sich diese<br />
Konstellation rasch als ideal, ließen sich doch in der Figur des „Oscar O.“ mühelos die be-<br />
drohlichen Bilder des in der öffentlichen Diskussion ohnedies eher mit einer dunklen Haut-<br />
farbe assoziierten „Asylanten“ 219 , des „ungezügelte Natur“ personifizierenden und also sexu-<br />
ell äußert potenten (afrikanisch-)exotischen Mannes 220 sowie des besonders gefährlichen, weil<br />
216 Schenk 1995, 13.<br />
217 Elias/Scotson 1993, 174.<br />
218 Vgl. zuletzt Tiroler Tageszeitung 29.11.2002.<br />
219 Vgl. Schenk 1995, 13. Es scheint bemerkenswert, dass der Begriff „Asylant“ im allgemeinen Sprachgebrauch<br />
wie eine ethnisch-kulturelle Herkunftsbezeichnung verwendet wird. Konsequenterweise stellt ihn Beck (1996,<br />
319) daher auch in eine Reihe mit Begriffen wie „Zigeuner“, „Türke“, „Deutscher“, „Russe“ etc.: „Diesen (und<br />
anderen) Substantiven wohnt (gerade in der deutschen Sprache) eine essentialistische Schwere inne, welche die<br />
Unschärfen und Ambivalenzen, genauer: den sozialen und politischen Konstruktcharakter kultureller Identitäten,<br />
verschluckt und verschweigt.“<br />
220 Vgl. Ebermann 2003, 61f.<br />
67
heimtückischen Virenüberträgers 221 zu einer wahren Horrorgestalt verdichten. Die <strong>Medien</strong>-<br />
und Stammtischfigur „Oscar O.“ entwickelte bald ein Eigenleben, ihre Taten wurden nach der<br />
Methode der „Stillen Post“ teils geradezu grotesk überzeichnet. Nachdem bekannt geworden<br />
war, dass „Oscar O.“ auch noch zu Unrecht – er hatte zugleich in Innsbruck als Türsteher ge-<br />
arbeitet – insgesamt 12.519 Euro an Sozialhilfe bezogen hatte 222 , konzentrierte sich die<br />
Debatte mehr und mehr auf diesen unrechtmäßigen Sozialhilfebezug.<br />
»Unser« Sozialsystem in Gefahr: Sozialhilfeleistungen für »Illegale«<br />
Anfang November 2002 wusste der freiheitliche Bundesrat Grissemann im Rahmen einer<br />
Podiumsdiskussion über die österreichische Asylpolitik schließlich zu berichten, dass ein<br />
„HIV-infizierter Schwarzafrikaner“, der „50.000 Euro Sozialhilfe“ von Österreich erhalten<br />
habe, in Tirol wissentlich mehrere Frauen mit Aids angesteckt habe. 223 Gegen Ende des<br />
Monats griff der Innsbrucker Vizebürgermeister und Sozialstadtrat Eugen Sprenger das<br />
Thema des unrechtmäßigen Sozialhilfebezugs auf: Gemeinsam mit dem damaligen Leiter des<br />
Innsbrucker Sozialamts, Peter Brühwasser, und unter Hinweis auf den Fall „Oscar O.“ for-<br />
derte er im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz politische Maßnahmen gegen<br />
den „Missbrauch“ des Sozialsystems durch „Illegale“. 224 „Für mich sind das Kriminelle“, so<br />
der Vizebürgermeister erläuternd, „die sich durch das Vernichten ihrer Dokumente Sozialhilfe<br />
erschwindeln und die ihre Notlage selbstverschuldet herbeiführen.“ 225 In einem ersten Schritt<br />
habe er nun das Sozialamt angewiesen, die Sozialhilfe für „Illegale“ um die Hälfte zu kürzen:<br />
„Es gibt einen Passus im Sozialhilfegesetz, der eine Kürzung bei Selbstverschulden vor-<br />
sieht.“ 226 Der Vizebürgermeister musste freilich – nach mehrfachem Nachfragen durch anwe-<br />
sende JournalistInnen 227 – eingestehen, dass unter den knapp 2.700 SozialhilfebezieherInnen<br />
des Jahres 2002 gerade 68 AsylwerberInnen seien, von denen 64 einen korrekten Aufent-<br />
haltstitel hätten. Die übrigen vier Fälle wertete er als „Illegale“: „Zwei der Illegalen sitzen<br />
mittlerweile ein, einer ist untergetaucht, der andere verzogen.“ 228 Zum Zeitpunkt der Presse-<br />
konferenz habe damit „zufällig kein Illegaler Sozialhilfe erhalten“. 229 Sprenger forderte trotz-<br />
dem eine Novellierung des Tiroler Sozialhilfegesetzes und eine damit verbundene Beseiti-<br />
gung des in Tirol bislang vorhandenen Rechtsanspruchs auf Sozialhilfe unabhängig von<br />
221 Vgl. Schenk 1995.<br />
222 Krapf 2003, 13.<br />
223 Grissemann, zit. nach R. <strong>Pehm</strong> 2002, 2.<br />
224 Vgl. Der Standard 29.11.2002; Tiroler Tageszeitung 29.11.2002. Sprenger und Brühwasser waren kurz zuvor<br />
öffentlich unter Druck geraten, nachdem bekannt geworden war, dass das Innsbrucker Sozialamt seine KlientInnen<br />
eine Erklärung unterschreiben ließ, mit der Behörden, Ämter, Banken, karitative Vereine, Ärztinnen und<br />
Ärzte, DienstgeberInnen und „sonstige Personen“ von all ihren Verpflichtungen zur Wahrung von Amts- und<br />
Bankgeheimnis entbunden wurden. Sprenger als ressortzuständiger Stadtrat wurde von DatenschützerInnen<br />
massiv kritisiert und erhielt für den „Blankoscheck zum Spionieren“ (Der Standard 27.11.2002) den „Big<br />
Brother Award“, dessen Entgegennahme er jedoch ablehnte, indem er sich für unzuständig erklärte und zugleich<br />
die Notwendigkeit betonte, „den sozialen Missbrauch zu bekämpfen“ (Sprenger, zit. nach ebd.).<br />
225 Sprenger, zit. nach Prieth/Schlosser 2003.<br />
226 Sprenger, zit. nach Tiroler Tageszeitung 29.11.2002; vgl. Prieth/Schlosser 2003.<br />
227 Der Standard 29.11.2002; Tiroler Tageszeitung 30.11.2002; Prieth/Schlosser 2003.<br />
228 Sprenger, zit. nach Tiroler Tageszeitung 29.11.2002.<br />
229 Sprenger, zit. nach Der Standard 29.11.2002; vgl. Tiroler Tageszeitung 30.11.2002.<br />
68
Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus – um einen „Imageschaden“ von den Asylsuchen-<br />
den „fernzuhalten“. 230 Damit gab er der zuvor merkbar abgeflachten Debatte neuen Schwung<br />
und eine konkrete Richtung. Die „einheimischen“ Frauen wurden als Opfer durch das öster-<br />
reichische Sozialsystem und damit die steuerzahlende Gesamtbevölkerung abgelöst, die Be-<br />
drohung konnte wieder klar benannt werden, auch war ein (politischer) Weg vorgezeichnet,<br />
ihr entgegenzutreten. Wenig später machte sich Landeshauptmann Herwig van Staa das<br />
Thema zu eigen: In der Weihnachtsausgabe der Tiroler Tageszeitung identifizierte van Staa<br />
den Rechtsanspruch auf Sozialhilfe als Grund, warum Asylsuchende aus anderen Bundes-<br />
ländern nach Tirol kämen: Weil es diesen gebe, habe „ein regelrechter Flüchtlingstourismus<br />
in unser Land eingesetzt“ 231 , der nun „abgestellt“ werden müsse:<br />
„Österreich wird sich immer dafür einzusetzen haben, dass Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt<br />
werden, eine Zufluchtsstätte haben – dies ist das echte Asylanliegen. Aber wir können nicht die Menschen aus<br />
der ganzen Welt im kleinen Österreich aufnehmen. Und wir in Tirol können nicht alle Asylbewerber aufnehmen,<br />
die zu uns kommen, nur weil sie hier am meisten von allen Bundesländern bekommen.“ 232<br />
Mit seinen Äußerungen entwickelte der Landeshauptmann den Bedrohungsdiskurs zu einem<br />
Rechtfertigungsdiskurs weiter, den er – wie noch zu zeigen sein wird – zielstrebig vorantrieb.<br />
»Unsere« Sicherheit in Gefahr: Die »kriminellen Georgier«<br />
Bereits Anfang Dezember 2002 etablierte sich ein weiteres Motiv in der Missbrauchsdebatte<br />
und überlagerte die Sozialhilfethematik mehr und mehr. In der größten vom Land Tirol be-<br />
triebenen Unterkunft für Asylsuchende, dem Unterkunftskomplex am „Bürgl“ bei Fieber-<br />
brunn, war ein Konflikt eskaliert und zur Massenschlägerei mit mehreren Verletzten ausgear-<br />
tet, ein für die ländliche Gegend relativ großer Einsatz von Polizei und Rettung war erforder-<br />
lich gewesen. Der für die Unterkunft zuständige Flüchtlingskoordinator des Landes, Peter<br />
Logar, wies sogleich jede Schuld von sich und klagte, die gewalttätigen Asylsuchenden hätten<br />
an einem einzigen Abend „die Arbeit von Jahren zunichte gemacht“. 233 Als Schuldige machte<br />
man fünf georgische Flüchtlinge aus: Sie hätten sich täglich betrunken und sich dann wahllos<br />
Opfer gesucht, wie die Unterkunftsleiterin gegenüber der Tiroler Tageszeitung festhielt. 234<br />
Die Zeitung begnügte sich mit diesem Hinweis und verzichtete darauf, den Kontext des Vor-<br />
falls, etwa die höchst problematischen Eigenschaften des Unterkunftsstandortes 235 , die<br />
Ausstattung der Unterkunft oder die Zahl und Qualifikation der dort beschäftigten Betreuer-<br />
Innen zu thematisieren. Stattdessen begründete man den Gewaltausbruch ethnisch und resü-<br />
mierte die hervorstechenden Charakterzüge der als Asylsuchende in Tirol lebenden Georgier-<br />
230 Sprenger, zit. nach Tiroler Tageszeitung 29.11.2002.<br />
231 Tiroler Tageszeitung 24.12.2002.<br />
232 van Staa, zit. nach ÖVP Tirol 16.01.2003. Mit der durch den „Flüchtlingstourismus“ geänderten Situation sei<br />
leider auch ein Anstieg der Kleinkriminalität verbunden, so van Staa (ebd.), es gäbe auch Hinweise, dass der<br />
zunehmende Flüchtlingsstrom nach Tirol organisiert gewesen sei.<br />
233 Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 18.12.2002b.<br />
234 Ebd.<br />
235 Vgl. hierzu Abschnitt 7.1.<br />
69
Innen eher schlicht: „Alkohol und Prügel: Georgier sorgen für Ärger“. 236 „Georgier: Keine<br />
Abschiebung“ ergänzte das Blatt einen Tag später und erläuterte, dass die fünf als „Übeltäter“<br />
identifizierten Männer nicht abgeschoben werden könnten, da ihre Asylverfahren noch im<br />
Gang wären: „Und ein Asylverfahren kann dauern: Immerhin haben in erster Instanz abge-<br />
wiesene Asylwerber die Möglichkeit, gegen den Bescheid in zweiter Instanz Berufung einzu-<br />
legen. Wenn die 2. Instanz den ablehnenden Bescheid bestätigt, bleibt noch der Gang zum<br />
Verfassungsgerichtshof.“ 237 Am Folgetag wurde das Bild der gewalttätigen und „kriminellen“<br />
Georgier schließlich endgültig etabliert und zugleich um einen weiteren Aspekt ergänzt:<br />
„Georgier bringen viele Asylanten in Misskredit“. 238 Durch „kriminelle Handlungen“ würden<br />
vor allem Georgier und Weißrussen andere Asylsuchende „in Misskredit bringen“, wurde den<br />
LeserInnen erklärt: „Georgier kommen meist über die Slowakei nach Österreich, die Einreise<br />
über den sicheren Drittstaat ist ihnen aber schwer nachzuweisen. Sie beantragen Asyl und<br />
drängen aufgrund erhoffter Arbeitsmöglichkeiten nach Tirol. Vielfach werden sie straf-<br />
fällig.“ 239 Auch die Landesregierung schien dem Blatt angesichts des „Drängens“ der vielfach<br />
„Straffälligen“ auf verlorenem Posten: „Irgendwie dürfte das Land in diese Situation gestol-<br />
pert sein.“ 240 Als für Land, Leute und die „echten“ Asylsuchenden bedrohliche Figur war der<br />
meist georgische, in jedem Fall gewalttätige und kriminelle „Asylant“ nach dieser Artikelserie<br />
im Bedrohungsdiskurs fest verankert, der Topos glich dabei von Anfang an in wesentlichen<br />
Zügen jenem der „kriminellen Rumänen“, der Anfang der 1990er Jahre die bundesweite<br />
Asylmissbrauchsdebatte beherrschte. 241 Mit einschlägigen Titeln und teils mehreren Artikeln<br />
pro Tag blieb die Zeitung dem Thema in der Folge bis zum Frühsommer 2004 treu, auch im<br />
weiteren Verlauf des Jahres 2004 wurden regelmäßig entsprechende Meldungen und Berichte<br />
publiziert. 242<br />
236<br />
Tiroler Tageszeitung 18.12.2002a. Zur Fundierung dieser Diagnose bot man den „Russland-Experten“ (sic!)<br />
der Innsbrucker Kriminalpolizei, Heinz Dorn, auf, der sich auf Befragen als Anthropologe versuchte und konstatierte,<br />
die in Tirol lebenden georgischen Asylsuchenden neigten zum Alkohol, seien „aggressiv, vielfach kriminell<br />
und gewalttätig“ (Dorn, zit. nach ebd.). Etwa dreißig Georgier seien, so Dorn weiter, gegenwärtig in Innsbruck,<br />
„zahlreiche Laden- und Geldtaschendiebstähle dürften auf ihr Konto gehen“. Dies sei aber wohl erst der<br />
Anfang: „Es werden noch viel mehr kommen – bei den tristen Verhältnissen in ihrer Heimat durchaus verständlich.“<br />
(ebd.)<br />
237<br />
Tiroler Tageszeitung 19.12.2002.<br />
238<br />
Tiroler Tageszeitung 20.12.2002. Unter dem Artikel publizierte man einen Kommentar zum Thema (vgl.<br />
Nindler 2002), neben dem Artikel und von diesem nur durch eine schmale Linie getrennt zwei Fotos, auf denen<br />
PolizistInnen bei der Verpackung eines Messers zu sehen waren, das bei einem Bankraub als Tatwaffe gedient<br />
hatte. Der von einem Vorarlberger begangene Raub stand in keinem Zusammenhang mit den georgischen Asylsuchenden.<br />
239<br />
Ebd.<br />
240<br />
Ebd.<br />
241<br />
Vgl. hierzu Matouschek/Wodak 1995; Zierer 1998.<br />
242<br />
Für die Zeit zwischen Jahresbeginn 2003 und Juni 2004 vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 22.01.2003, 19<br />
(„Schlägerei im Innsbrucker Asylantenlager“); 25./26.01.2003, 12 („Wieder Ärger mit Georgiern: Vier verhaftet.<br />
Diebstähle in IVB-Bussen vor Klärung“; „Asylwerber waren Profidiebe. Erwachsene gaben sich als Jugendliche<br />
aus – Zu Haftstrafen verurteilt“); 08./09.02.2003, 12 („Moldawier aus Heim geworfen“); 28./29.05.2003, 15<br />
(„Asylant narrte Behörden“); 12.06.2003, 9 („Wieder Prügelei in Asylheim“); 13.06.2003, 9 („Georgier im<br />
Sozialamt festgenommen: Zweifache Morddrohung für Sozialhilfe“); 19.08.2003, 10 (Asylant wollte Sozialhilfe<br />
und drohte mit Tod“); 12.11.2003, 11 („Asylantenfehde mit Messer ausgetragen“); 24.02.2004, 10 („Sieben<br />
Georgier als Panzerknacker verhaftet“); 27./28.03.2004, 15 („Fünf Georgier waren vermutlich auf Diebestour“);<br />
29.03.2004, 10 („Streit mit Messer im Asylheim“); 02.04.2004, 12 („Messerattentat im Asylheim: Ein Jahr<br />
70
»Unsere« Kinder in Gefahr: Die »afrikanischen Drogendealer«<br />
Im Frühsommer überlagerte ein ähnlich geartetes Motiv das bereits eingeführte der „krimi-<br />
nellen Georgier“: Erstmals rückten – vor allem in Wien, aber auch in Graz bereits ein altbe-<br />
kannter Topos 243 – „afrikanische Drogendealer“ in den Mittelpunkt des Diskurses. Vorausge-<br />
gangen war dem eine Diskussion um zunehmende Vandalenakte im Innsbrucker Rapoldipark<br />
und, trotz fehlender Kausalverbindung daran anknüpfend, die Nutzung des Parks auch durch<br />
obdachlose sowie Drogen konsumierende und mit Drogen handelnde Menschen. Diese wur-<br />
den als latente Gefahr für die Innsbrucker Kinder identifiziert – sicherlich nicht völlig zu Un-<br />
recht, da der Park von den in der Umgebung wohnenden Kindern, aber auch von Kindergar-<br />
tengruppen und Schulklassen gerne genutzt wird und sowohl Eltern als auch LehrerInnen<br />
schon seit längerem berichtet hatten, dass spielende Kinder regelmäßig gebrauchtes Spritzbe-<br />
steck finden würden. Waren es zuvor „einheimische“ Männer und Frauen gewesen, über de-<br />
ren Vertreibung aus dem Park man immer wieder diskutierte, so wurde nun eine neue Gruppe<br />
als akute Bedrohung ausgemacht: Vor allem marokkanische und algerische Männer würden<br />
den Park für Geschäfte mit Drogen nutzen. Im August resümierte die Tiroler Tageszeitung<br />
schließlich besorgt, die Männer hätten sich den Drogenhandel im Park „unter den Nagel ge-<br />
rissen“, Innsbruck sei deshalb „ins Gerede gekommen“. 244 Von der Zeitung befragt wusste der<br />
Innsbrucker Polizeidirektor Thomas Angermair Näheres: Die betreffenden „Nordafrikaner“<br />
seien immer ohne Dokumente, wenn sie von der Polizei „aufgegriffen“ würden, „außerdem<br />
suchen sie dann sofort um Asyl an“. 245 Dieser an sich durchaus differenzierten Analyse –<br />
Angermair hatte ja betont, dass die Betroffenen straffällig würden, bevor auf sie der Begriff<br />
des Asylwerbers zutraf – folgte eine pauschale Forderung nach asylrechtlichen Verschärfun-<br />
gen im Hinblick auf Flüchtlinge, die „strafrechtlich in Erscheinung treten“ würden. 246 Im ein-<br />
schlägigen Bedrohungsdiskurs war das Motiv der um Asyl ansuchenden „afrikanischen Dro-<br />
gendealer“ nun rasch und in andernorts bereits bekannter Weise etabliert: Bereits am Folgetag<br />
konnte die Tageszeitung unter einem programmatischen Titel („Rapoldipark-Szene im Faden-<br />
kreuz“) ein Foto präsentieren, auf dem die Kontrolle einiger Männer mit dunkler Hautfarbe<br />
durch Polizisten zu sehen war, darunter zeigte ein Agenturfoto eine Überwachungskamera –<br />
der Innsbrucker Vizebürgermeister Sprenger hatte die Idee geäußert, den Park mit Hilfe von<br />
Videokameras überwachen zu lassen. 247 Erst im Oktober gab die Zeitung schließlich Entwar-<br />
nung: Im Park, der „zum stark frequentierten Drogen-Supermarkt“ verkommen sei, würde nun<br />
Ruhe einkehren, denn 13 mit Drogen handelnde Marokkaner, „die hier ihre Zelte aufgeschla-<br />
Haft“); 24./25.04.2004, 15 („Georgier stahlen aus Not“); 10.05.2004, 19 („Diebe rächen sich mit Psychoterror.<br />
Drogeriemarkt-Verkäuferinnen in Angst: Asylwerber drohen mit Mord und Vergewaltigung“); 13.05.2004, 12<br />
(„Asylwerber als diebische Elster“); 15./16.05.2004, 15 („Drei Asylwerber festgenommen“); 17.05.2004, 22<br />
(„Einbruchserie vor Klärung: Innsbrucker Polizisten nahmen drei moldawische Asylwerber fest“);<br />
22./23.05.2004, 13 („Asylwerber erwischte Überdosis Heroin“); 25.05.2004, 17 („Asylanten auf Einbruchstour“);<br />
01.06.2004, 11 („Georgier nach Panne in Haft“).<br />
243 Vgl. etwa Kampagne 2001; Johnston-Arthur 2002; Ebermann 2003.<br />
244<br />
Tiroler Tageszeitung 20.08.2004b.<br />
245<br />
Angermair, zit. nach ebd.<br />
246<br />
Ebd.<br />
247<br />
Tiroler Tageszeitung 21.08.2004b.<br />
71
gen haben, sitzen in Haft. Der Rest der Szene sucht wärmere Orte auf.“ 248 Diese Orte konnte<br />
das Blatt seinen LeserInnen bereits präsentieren: Ein „Drogenlokal“ im Innsbrucker Stadtteil<br />
Dreiheiligen sei „erste Adresse“ geworden – auf dem passenden Foto war wieder ein Mann<br />
mit dunkler Hautfarbe zu sehen, der von einem Kriminalpolizisten und einem Mitglied der<br />
polizeilichen Spezialeinheit „Cobra“ perlustriert wurde. 249<br />
»Unser« Land in Gefahr: »Busse voller Flüchtlinge«<br />
Rund um das Inkrafttreten der „Grundversorgungsvereinbarung“ im Mai 2004 erschien kurz-<br />
fristig ein neues Motiv im Bedrohungsdiskurs. Tirol war, wie an anderer Stelle bereits darge-<br />
legt, hinsichtlich der Bereitstellung von Quartieren für Asylsuchende innerhalb kurzer Zeit<br />
zum Schlusslicht unter den österreichischen Bundesländern geworden, die bestehenden Un-<br />
terkünfte des Landes waren rasch deutlich überbelegt. 250 Anfang Juni wies Innenminister<br />
Strasser zunächst darauf hin, dass die Bundesländer weitere Flüchtlinge aufzunehmen hät-<br />
ten 251 , nachdem das „säumige“ Tirol darauf kaum reagiert hatte, kündigte Strasser zur<br />
Monatsmitte an, fünfzig Asylsuchende per Bus nach Innsbruck zu schicken. 252 Landesrätin<br />
Gangl und Landeshauptmann van Staa protestierten heftig, die Tiroler Tageszeitung sprach<br />
davon, Tirol solle „mit Asylwerbern zwangsbeglückt werden“. 253 Im Blattinneren beruhigte<br />
die Zeitung ihre LeserInnen jedoch: Van Staa habe den Innenminister mit seinen Plänen „ab-<br />
blitzen“ lassen. 254 Doch bereits am Folgetag meldete das Blatt: „Tirol gibt bei Asyl nach:<br />
Anreise nächste Woche“. 255 Wegen der heftigen Proteste seien die Busse zwar ausgeblieben,<br />
dies jedoch nur vorläufig: „Denn Anfang nächster Woche muss Tirol zusätzliche Asylwerber<br />
aufnehmen.“ Nun mache das Ministerium Ernst, so die Zeitung am 19. Juni neuerlich:<br />
Strasser habe angekündigt, „Busse mit Asylwerbern“ zu schicken, die Zahl der Asylsuchen-<br />
den in Tirol dürfte damit „anschwellen“. Landesrätin Gangl sprach von „Drohgebärden“, die<br />
der Innenminister sein lassen solle. 256 Drei Tage später folgte indessen die Bestätigung:<br />
„Innenminister schickt 50 Asylwerber mit Bus“. 257 Für die Flüchtlinge müsse man „Notquar-<br />
tiere“ einrichten, überdies würden bereits für weitere 500 Personen Plätze gesucht. Am Fol-<br />
getag wurde Vollzug gemeldet: „50 Asylwerber in Tirol angekommen“. 258 Erneut hob das<br />
Blatt hervor, dass die Einrichtung von „Notquartieren“ erforderlich gewesen sei. Eine knappe<br />
Woche später folgte jedoch erneut eine Nachricht aus Wien: „Strasser will Busse schi-<br />
cken“. 259 Das von der Redaktion für die Meldung ausgewählte Zitat des Ministers klang<br />
248<br />
Tiroler Tageszeitung 22.10.2004.<br />
249<br />
Vgl. ebd.<br />
250<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 02.06.2004.<br />
251<br />
Tiroler Tageszeitung 03.06.2004.<br />
252<br />
Tiroler Tageszeitung 16.06.2004a.<br />
253<br />
Ebd.<br />
254<br />
Tiroler Tageszeitung 16.06.2004b.<br />
255<br />
Tiroler Tageszeitung 17.06.2004.<br />
256<br />
Tiroler Tageszeitung 19.06.2004.<br />
257<br />
Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
258<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 23.06.2004.<br />
259<br />
Tiroler Tageszeitung 29.06.2004.<br />
72
edrohlich: „Es kann jederzeit so weit sein.“ 260 Mit dem Motiv der aus dem Osten kommen-<br />
den und Tirol gewissermaßen überrollenden Busse gelang es einmal mehr, die aus Asylmiss-<br />
brauchsdebatten hinlänglich bekannte Flut- und Überschwemmungsmetaphorik regional zu<br />
adaptieren und in den Kontext des spezifisch tirolischen Bedrohungsszenarios der „Transit-<br />
lawine“ zu integrieren. Als Feindbild fungierte in diesem Fall freilich nicht die EU, im<br />
Gegenteil: Angesichts der „anrollenden Massen“ beschworen sowohl Landeshauptmann van<br />
Staa als auch regionale <strong>Medien</strong> mehrmals die gesamteuropäische Solidarität und forderten<br />
eine Lösung der Flüchtlingsunterbringung auf Unionsebene. 261<br />
HIV, Sozialhilfebetrug, Alkohol und Prügel, Drogen- und sonstige Kriminalität, „Illegalität“ –<br />
und immer noch werden ganze Busladungen weiterer Asylsuchender aus dem fernen Wien ins<br />
„Land im Gebirge“ geschickt. Angesichts dieser massiven Bedrohung erschien die Tiroler<br />
Tageszeitung im Herbst 2004 mit einem verzweifelten Aufmacher: „Asyl: Tirol muss hilflos<br />
zuschauen“. 262 Die „kriminellen Asylanten“ – letztlich ein Schlagwort, mit dem die<br />
Straffälligkeit von Asylsuchenden als nicht nur von strafrechtlichen, sondern auch von ande-<br />
ren „Normalitätsnormen“ abweichender Spezialfall dargestellt wird 263 – drohten Tirol offen-<br />
bar ins Chaos zu stürzen. Das Land und seine Leute waren zum Opfer einer globalisierten<br />
Welt geworden, deren negative Seiten die älplerische Idylle brutal zu überrollen, zumindest<br />
aber mit „Giften“, „Viren“, „Gewalttätigkeit“ und „Kriminalität“ unaufhaltsam zu zerstören<br />
drohten – eine altbekannte Metaphorik aus vergangenen Asylmissbrauchsdebatten. 264 Als<br />
plakative Boten der Globalisierung wurden Asylsuchende für den negativen Inhalt der über-<br />
brachten Botschaft verantwortlich gemacht und symbolisch bestraft. 265 Zugleich wurden die<br />
Betroffenen einem nur in Ansätzen existenten einheitlichen und solidarischen Europa gegen-<br />
übergestellt, von dessen Mitgliedern zuversichtlich angenommen wurde, dass sie angesichts<br />
der drohenden Gefahr schon „zusammenstehen“ würden. Derartige Bilder zeigen, dass die im<br />
Rahmen des Bedrohungsdiskurses zum wiederholten Male beschworenen und teils durchaus<br />
„traditionellen“ Feindbilder nicht einfach übernommen werden, sondern einzelne Elemente<br />
herausgegriffen und mit dem impliziten Ziel der Konstruktion eines europäischen Wir-Ge-<br />
fühls rekombiniert werden. 266 Eine solche „Identitätspanik“, die offensichtlich um das Phan-<br />
260<br />
Strasser, zit. nach ebd.<br />
261<br />
Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 21.08.2004a und 20.10.2004 sowie Reitan 2004.<br />
262<br />
Tiroler Tageszeitung 29.10.2004a.<br />
263<br />
Vgl. Pilgram 1992, 174f. Pilgram konstatiert dies u.a. für den verwandten Begriff der „Ausländerkriminalität“.<br />
264<br />
Vgl. Schenk 1995.<br />
265<br />
Vgl. Berghold 2002, 127f.<br />
266<br />
Vgl. Kreissl 1999. Kreissl fasst Asylsuchende gemeinsam mit anderen MigrantInnen, dem „islamischen Fundamentalismus“<br />
(welche Personen und Gruppen auch immer mit dem Begriff zusammengefasst werden) und der<br />
„organisierten Kriminalität“ daher auch zu einem „europäischen Feindbildtypus“ zusammen, dessen „Zugehörige“<br />
er als „European Folk Devils“ bezeichnet. Das so konstruierte und gegenüber dem nationalen „erweiterte“<br />
europäische Wir-Gefühl beruht damit neuerlich auf Exklusion – eine Entwicklung, aus der auf die von Hondrich<br />
(1996) postulierte „Nicht-Hintergehbarkeit“ von Wir-Gefühlen geschlossen werden könnte, die jedoch auch mit<br />
der „demokratischen Notwendigkeit der Grenzziehung“ begründet und zugleich kritisch reflektiert werden kann<br />
(Appelt 2001; Reiterer 2001).<br />
73
tasma einer lebenswichtigen, letztlich immer ethnisch-nationalen Eigenart bzw. „Essenz“<br />
kreist, die durch die Präsenz „zu vieler“ Zuwanderinnen und Zuwanderer zerstört würde, ist<br />
mit Berghold wohl zu einem wesentlichen Teil als Ergebnis von „massiven unbewussten Ver-<br />
schiebungsprozessen“ zu sehen:<br />
„Die sehr realen Gefährdungen der psychosozialen Identität – die aus dem akuten Risiko erwachsen, auf dem<br />
Markt in die zunehmenden Reihen der Überzähligen abgedrängt zu werden – können eher aus der bewussten<br />
Wahrnehmung ausgeblendet werden, wenn das Bedrohungsgefühl auf manifester Ebene an einem im Verhältnis<br />
dazu ausgesprochen nebensächlichen und harmlosen Problem „festgemacht“ wird. Die kurzfristige Erleichterung,<br />
die dieser Verschiebungsmechanismus bietet, wird freilich alsbald dadurch unterlaufen, dass die verdrängten<br />
Ängste nun ihr Ersatzobjekt mit geradezu ausufernden Bedrohungsfantasien aufladen und es derart ins Maßlose<br />
aufblähen.“ 267<br />
5.2 »Tabus sachlich brechen.« Der Rechtfertigungsdiskurs (I)<br />
Die über den Bedrohungsdiskurs stets von <strong>Neue</strong>m konstruierte Gefahr stellt die Grundlage für<br />
einen weiteren Diskursstrang dar, der als „Rechtfertigungsdiskurs“ bezeichnet werden kann.<br />
Ein erster Teil dieses Diskurses diente in der jüngsten Vergangenheit vorrangig der Rechtfer-<br />
tigung konkreter Forderungen oder Maßnahmen:<br />
• Beseitigung des Rechtsanspruchs auf Sozialhilfe für Asylsuchende: Aufbauend auf den<br />
Fall „Oscar O.“, die vom Innsbrucker Vizebürgermeister Sprenger deshalb verlangte Be-<br />
seitigung des bislang bestehenden Sozialhilferechtsanspruchs für Asylsuchende und seine<br />
eigene These, wegen dieses Anspruchs finde ein regelrechter „Flüchtlingstourismus“ nach<br />
Tirol statt, forderte Landeshauptmann van Staa Anfang 2003 die Beseitigung des Rechts-<br />
anspruchs im Wege einer Gesetzesnovelle. Da der Koalitionspartner der ÖVP, die Tiroler<br />
SPÖ, ein solches Ansinnen ablehnte, nutzte van Staa die sichtbar gewordene Differenz zur<br />
ersten Machtdemonstration seiner noch kurzen Amtszeit. 268 Er erklärte die Beseitigung<br />
des Rechtsanspruchs zur „Koalitionsfrage“, Regierungspartner SPÖ lenkte nach einem<br />
heftigen, aber kurzen Streit schließlich ein. 269 Der Flüchtlingskoordinator des Landes,<br />
Logar, machte sich van Staas Argumentation rasch zu eigen und konnte sie auch gleich<br />
mit Zahlenmaterial untermauern: Die Zahl der „Asyl-Touristen“ – nach van Staas und<br />
Logars Diktion Asylsuchende, die in einem anderen Bundesland ihren Asylantrag gestellt<br />
hatten und dann nach Tirol gezogen waren – habe bei „50 im letzten Jahr“ gelegen. 270 In<br />
der Debatte um die Gesetzesnovelle begründete der Sicherheitssprecher der Tiroler Volks-<br />
partei, Rudolf Warzilek, vor dem Tiroler Landtag die Notwendigkeit der Neuregelung<br />
schließlich mit dem „Rechtsempfinden der Bevölkerung“ und wies auf <strong>Medien</strong>berichte<br />
über Straftaten von Asylsuchenden und Auseinandersetzungen in deren Unterkünften<br />
267 Berghold 2004, 55.<br />
268 van Staa hatte nach längerem Tauziehen am 26. Oktober das Amt des Landeshauptmannes von Wendelin<br />
Weingartner übernommen (vgl. Gehler 2004, 267f).<br />
269 Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.01.2003.<br />
270 Logar, zit. nach ebd.; vgl. Der Standard 29.01.2003.<br />
74
hin. 271 Nach dem erfolgten Landtagsbeschluss resümierte der Bezirkshauptmann von<br />
Innsbruck-Land, Herbert Hauser, in der offiziellen Landeszeitung erleichtert in ähnlicher<br />
Weise: „Auffallend war, dass Asylanten bereits aus anderen Bundesländern zu uns<br />
gekommen sind, die noch keine Sozialhilfe und Flüchtlings-Status [sic!] bekommen<br />
hatten. Mit der Novellierung des Sozialhilfegesetzes geht es um die Beendigung des<br />
Tourismus vermeintlicher [sic!] Asylanten.“ 272<br />
• Abschiebung „krimineller“ Asylsuchender: Bereits unmittelbar nach dem Anlassfall für<br />
sein Auftreten in der Tiroler Asylmissbrauchsdebatte wurde der Topos der „kriminellen<br />
Georgier“ als Rechtfertigung für die Forderung nach einer sofortigen Abschiebung „kri-<br />
mineller“ Asylsuchender herangezogen. Nachdem die Sicherheitsdirektion des Landes der<br />
Tiroler Tageszeitung die Unmöglichkeit einer Abschiebung bei laufendem Asylverfahren<br />
erläutert hatte, erklärte der Journalist Peter Nindler in einem ebenso prägnant wie vielsa-<br />
gend überschriebenen Kommentar („Tabus sachlich brechen“) derartige rechtsstaatliche<br />
Formalitäten für überflüssig, weil sie die Bevölkerung „wohl auch nicht verstehen“ werde:<br />
Für „kriminelle Asylwerber“, so Nindler, dürfe ein „Landesverweis“ daher trotz laufender<br />
Asylverfahren „kein Tabu sein, sondern sollte als Teil einer nachvollziehbaren Asylpraxis<br />
verstanden werden.“ 273 Nindler verzichtete in seinem Appell zum Tabubruch auf eine<br />
Differenzierung zwischen straffällig gewordenen Asylsuchenden und um Asyl ansuchen-<br />
den „Straffälligen“, stattdessen fasste er diese höchst unterschiedlichen Gruppen in der be-<br />
reits eingeführten Figur des „kriminellen“ Asylsuchenden zusammen – eine sachlich nicht<br />
zu rechtfertigende Vereinfachung, die in der Folge trotzdem beibehalten wurde. Mitte<br />
Februar 2003 forderten die LeiterInnen einer landeseigenen Unterkunft mit Verweis auf<br />
die vorübergehend in ihrem Haus untergebrachten und bald wieder entlassenen „Georgier“<br />
in einem offenen Brief „Änderungen im Asylrecht“: Je nach Schwere eines Delikts müsse<br />
trotz laufendem Asylverfahren die „Rückführung ins Herkunftsland“ die „logische Konse-<br />
quenz“ sein. 274 Etwas weniger deutlich wurde der damalige Leiter der Innsbrucker<br />
Fremdenpolizei und spätere Polizeidirektor Angermair: Er forderte im März 2003 unter<br />
Hinweis auf „Personen mit krimineller Absicht, die sich in einem Asylverfahren befin-<br />
den“, die Möglichkeiten des „Asylmissbrauchs“ zu minimieren – „die Zeit drängt“, so der<br />
Beamte, außerdem „schaden schwarze Schafe den Ehrlichen“. 275 Relativ spät kam Ende<br />
271 Vgl. Der Standard 27.03.2003.<br />
272 Hauser, zit. nach Gerzabek 2003. Rainer Gerzabek, Redakteur des Blattes, behauptete ebendort gar: „Es hat<br />
sich herumgesprochen, dass in Tirol im österreichweiten Vergleich am meisten Sozialhilfe bezahlt wird. Es kann<br />
aber nicht sein, dass Flüchtlinge ihr Erstansuchen in der Steiermark oder in Niederösterreich stellen und dann zu<br />
uns weiterreisen, nur weil sie hier einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe haben.“ (ebd.) Wie zuvor schon der<br />
Innsbrucker Vizebürgermeister Sprenger (vgl. Tiroler Tageszeitung 29.11.2002) übersahen Gerzabek und Hauser<br />
freilich, dass ausgerechnet in der von Gerzabek angeführten Steiermark auch ein Rechtsanspruch auf Sozialhilfe<br />
oder – je nach Aufenthaltsdauer – auf im Umfang eingeschränkte Sozialhilfeleistungen für Asylsuchende bestand<br />
(vgl. hierzu L. Sperl 2004b, 163 und 166).<br />
273 Nindler 2002.<br />
274 Tiroler Tageszeitung 17.02.2003.<br />
275 Angermair, zit. nach Krapf 2003, 13.<br />
75
Juni 2004 auch Landeshauptmann van Staa auf diese Forderung zurück: Auf dem Tiroler<br />
Gemeindetag forderte er forsch, dass „kriminelle Asylwerber“ sofort „nach Hause<br />
geschickt werden“. 276 Im „Leserforum“ der Tiroler Tageszeitung zeigten sich einige<br />
LeserInnen begeistert: „Bravo, Herr Landeshauptmann! Endlich ein starkes, offenes Wort<br />
zu den kriminellen Asylanten ohne Papiere. Die bisherige Handhabung ist eine staatliche<br />
Aufforderung zur Selbstbedienung am Hab und Gut unserer Bürger!“ 277 Wenig später<br />
bekräftigte van Staa seine Forderung: Straffällig gewordene Asylwerber „sollen<br />
abgeschoben werden – und das mit letzter Konsequenz“. 278 Über die Tiroler Tageszeitung<br />
meldete sich schließlich auch Polizeidirektor Angermair – als Leiter der Fremdenpolizei<br />
hatte er sich zuvor schon frühzeitig den Ruf erworben, „der gewissenhafteste Vollstrecker<br />
zu sein, den die Stadt in der Nachkriegszeit erlebt hat“ 279 – zu Wort: Zwar sei der Anstieg<br />
der Zahl der Straftaten in Innsbruck „nicht mehr so hoch“ und auch die Aufklärungsrate<br />
sei gestiegen, ein wachsendes Problem seien aber jene illegal Eingereisten, die das<br />
Asylrecht missbrauchen würden, er hoffe deshalb, dass „alle Parteien einer Verschärfung<br />
der Asylbestimmungen zustimmen“. 280 Mit Verweis auf die im Innsbrucker Rapoldipark<br />
tätigen „Dealer aus Nordafrika“ verlieh er dieser Hoffnung wenig später nochmals<br />
Ausdruck, indem er unter einem von der Zeitung beigesteuerten und als Blattaufmacher<br />
geführten martialischen Titel („Härte gegen kriminelle Asylanten“) eine „massive<br />
Verschärfung der Gangart“ forderte: „Die müssen merken, dass wir es ernst meinen!“ 281<br />
Dem pflichtete auch Flüchtlingskoordinator Logar bei: Er forderte den Bund auf, Gesetze<br />
zu schaffen, um „kriminell gewordene Asylwerber“ ausweisen zu können. 282 Christian<br />
Bidner, als Leiter der Abteilung für Soziales im Amt der Tiroler Landesregierung Logars<br />
unmittelbarer Vorgesetzter, fürchtete in einem Kommentar für die Tiroler Tageszeitung<br />
nun gar um die Akzeptanz des österreichischen Rechtssystem bei der Bevölkerung, wenn<br />
die „Straffolgen für Menschen, die in unserer Republik um Asyl angesucht haben,<br />
geringer wären oder etwa strafbares Verhalten mit weniger Nachdruck verfolgt würde“:<br />
„Berichte über die missbräuchliche Beseitigung von Ausweisdokumenten durch Asylwerber, über das Stellen<br />
von »taktischen« Asylanträgen unmittelbar vor der Abschiebung oder über die Unmöglichkeit der gesetzmäßig<br />
vorgesehenen Abschiebung verurteilter Rechtsbrecher wegen der Verheimlichung ihrer Identität<br />
senken das Toleranzpotenzial und die Assimilationsbereitschaft [sic!] der Bevölkerung. [...] Das »rechtsstaatliche<br />
Immunsystem« und die dem Gleichheitsgrundsatz verpflichtete Justiz dürfen daher gerade in solchen<br />
Situationen keinerlei Schwäche zeigen, um den Kredit und die Akzeptanz des Systems nicht zu verlieren.“ 283<br />
276<br />
van Staa, zit. nach Der Standard 25.06.2004; vgl. Tiroler Tageszeitung 24.06.2004c.<br />
277<br />
Tiroler Tageszeitung 03.07.2004a.<br />
278<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 05.07.2004. Nachdem er Ende Juli mit Verweis auf Kritik an seinen<br />
Äußerungen zur Asylpolitik angekündigt hatte, künftig „leiser“ zu werden (Tiroler Tageszeitung 31.07.2004b),<br />
wiederholte van Staa seine Forderung ab dem Frühherbst erneut in regelmäßigen Abständen (vgl. u.a. Tiroler<br />
Tageszeitung 08.09.2004, 16.09.2004c, 21.09.2004a, 05.10.2004, 29.10.2004b, 19.11.2004; Gerzabek 2004).<br />
279<br />
Ladurner 1994, 28.<br />
280<br />
Angermair, zit. nach Tiroler Tageszeitung 14.08.2004a.<br />
281<br />
Angermair, zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.08.2004b.<br />
282<br />
Tiroler Tageszeitung 24.08.2004a.<br />
283<br />
Bidner 2004. Bemerkenswerterweise greift Bidner zur Illustration seiner These auf eine der völkischen<br />
Terminologie nahestehende Metaphorik zurück und präsentiert das Recht mit dem Begriff des „rechtsstaatlichen<br />
Immunsystems“ als System zur Abwehr von Krankheitserregern und Giften vom „gesunden Staats-“ bzw.<br />
76
Die Tiroler Tageszeitung schloss sich diesen Forderungen an: Mit Verweis auf eine<br />
„Drogenkriminalität“, die man „bisher nur aus anderen Städten kannte“, forderte Journalist<br />
Mario Zenhäusern ein „Gesamtpaket“, das „auch soziale und gesellschaftliche Aspekte be-<br />
rücksichtigt“. Zenhäusern sah diese Aspekte berücksichtigt, wenn „die Hauptursache für<br />
die Probleme“ beseitigt würde: „Die Novellierung des unzulänglichen Fremdengesetzes ist<br />
unbedingt notwendig, die schärfere Gangart im Umgang mit straffällig gewordenen Asylwerbern<br />
ein Gebot der Stunde.“ 284<br />
• Internierung von Asylsuchenden: Parallel zu seiner Forderung nach einer Abschiebung<br />
straffällig gewordener Asylsuchender brachte Landeshauptmann van Staa Ende Juni 2004<br />
auch eine Forderung in die Debatte ein, der wohl die Lektüre einer Meldung im deutschen<br />
Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorangegangen war. Dieses hatte Mitte Mai berichtet,<br />
dass der schweizerische Kanton Bern Asylsuchende, die keine Ausweispapiere besäßen, in<br />
einem Armeebunker auf dem 1.580 Meter hoch gelegenen Jaunpass unterbringen wolle –<br />
die Berner Polizeidirektorin Dora Andres hatte die Maßnahme gegenüber dem Magazin<br />
wenig zimperlich begründet: „Vielleicht sagen die uns, woher sie kommen, wenn es auf<br />
dem Jaunpass kalt ist und schneit.“ 285 Van Staa forderte nun auch für Österreich die Unter-<br />
bringung von Asylsuchenden, die „ohne Pass aufgegriffen werden“, in einem „Internie-<br />
rungsquartier“ 286 – „um Missbrauch zu vermeiden“. 287 Die in der Praxis äußerst vielfälti-<br />
gen Gründe, warum Asylsuchende über keinen Identitätsnachweis verfügen 288 , ließ van<br />
Staa dabei gänzlich unberücksichtigt, stattdessen unterstellte er pauschal allen Flüchtlin-<br />
gen ohne Reisedokumente, ihre Identität bewusst zu verschleiern. Im „Leserforum“ der<br />
Tiroler Tageszeitung pflichtete ein Leser van Staa trotzdem bei: Der Landeshauptmann<br />
habe schon recht, „wenn er meint, dass straffällig gewordene Flüchtlinge oder »Flücht-<br />
linge«, welche ihre Identität nicht preisgeben wollen und daher wahrscheinlich keine<br />
wirklichen Flüchtlinge sind, in überwachte Quartiere gebracht oder auch rasch wieder ab-<br />
geschoben werden sollen. Das ist das gute Recht unseres Staates.“ 289 Der Landtagsabge-<br />
ordnete Jakob Wolf, Sozialsprecher der Tiroler ÖVP, fand die Idee des Landeshauptmanns<br />
ebenfalls begrüßenswert: Sie sei inhaltlich voll zu unterstützen, überdies werde sie in<br />
Europa teils bereits umgesetzt. 290 Van Staa behielt seine Linie bei, am Rande einer Klau-<br />
sur seiner Partei führte er Anfang Juli nochmals aus, Asylsuchenden, „die ihre Identität<br />
Volkskörper“. Vor allem straffällig gewordene Asylsuchende, so muss daraus geschlossen werden, stellen in<br />
Bidners Perspektive die diesen Körper bedrohenden Viren und Gifte dar.<br />
284 Zenhäusern 2004b.<br />
285 Andres, zit. in Asylanten im Armeebunker 2004.<br />
286 van Staa, zit. nach Der Standard 25.06.2004.<br />
287 van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.06.2004c.<br />
288 So ist es etwa gerade bei schon längere Zeit politisch verfolgten Asylsuchenden äußerst wahrscheinlich, dass<br />
ihnen die Ausstellung von Reisedokumenten verweigert wurde, in zahlreichen ländlichen Regionen der Welt ist<br />
der Besitz eines Identitätsnachweises überdies nicht allgemein üblich, daneben können die Dokumente auch<br />
während der Flucht verloren gehen – nicht nur durch Unachtsamkeit, sondern auch durch die gängige Einziehung<br />
der Dokumente durch Schlepper.<br />
289 Tiroler Tageszeitung 03.07.2004b.<br />
290 Tiroler Tageszeitung 28.06.2004.<br />
77
verschleiern, sollen besondere Quartiere zur Verfügung gestellt werden, wo eine beson-<br />
dere Aufsicht erfolgt“ – schließlich könne ja auch jeder Österreicher in Beugehaft ge-<br />
nommen werden, wenn er sich vor einem Gericht weigere, wichtige Auskünfte zu ertei-<br />
len. 291 Auch nach der Sommerpause kam der Landeshauptmann regelmäßig auf seine For-<br />
derung zurück: Für Asylsuchende, die ihre Identität nicht preisgeben würden, forderte er<br />
eine „Sonderverwahrung“ 292 , denn diese hätten „das Recht auf Bewegung verwirkt“ 293 –<br />
im Dezember forderte er gar, dass Personen, „die ihre Identität nicht preisgeben“ wollten,<br />
„das Recht auf ein Asylverfahren verlieren“. 294<br />
• Obdachlosigkeit von Asylsuchenden: Spätestens ab 2003 diente der Topos der „kriminel-<br />
len Georgier“ auch der Legitimierung von Entlassungen Asylsuchender aus Unterkünften<br />
des Landes und der daraus häufig resultierenden Obdachlosigkeit Betroffener 295 – eine<br />
Rechtfertigung, die in einigen Fällen zwar durchaus nahe lag, jedoch an der dahinter-<br />
stehenden Problematik vorbeiging und von KritikerInnen daher (und teils gleichfalls an<br />
der Problematik vorbeigehend) als „Kriminalisierung“ abqualifiziert wurde. 296 Der auf<br />
Seiten der öffentlichen Hand zuständigen Landesrätin Gangl zufolge griff auch die rö-<br />
misch-katholische Kirche subtil auf den Topos zurück, um gegenüber der Politik ihre Ab-<br />
lehnung zu begründen, leerstehende Klöster und ähnliche kirchliche Gebäude in größerem<br />
Ausmaß zur Unterbringung von Asylsuchenden zu öffnen: Kirchenvertreter hätten ihr er-<br />
klärt, so Gangl, sie hätten Kunstschätze in ihren Räumlichkeiten und könnten daher keine<br />
Flüchtlinge aufnehmen. 297<br />
5.3 Wien ist schuld! Der Rechtfertigungsdiskurs (II)<br />
Nicht der Begründung von Forderungen oder Maßnahmen, sondern jener von Planungsfehlern<br />
und Unterlassungen diente ein zweiter Teil des Rechtfertigungsdiskurses. Im Zentrum stand<br />
dabei die „Grundversorgungsvereinbarung“ und die von Landeshauptmann van Staa mitver-<br />
handelte Tiroler Quote von rund 8,4 Prozent unterzubringenden Asylsuchenden. Der zustän-<br />
digen Landesrätin Gangl und dem auf Beamtenebene verantwortlichen Flüchtlingskoordinator<br />
war es nicht gelungen, zeitgerecht eine der vereinbarten Quote entsprechende Zahl an Unter-<br />
kunftsplätzen zu organisieren; die dafür verantwortlichen Planungs- und Managementfehler,<br />
291<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 05.07.2004.<br />
292<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 21.09.2004a; wortgleich in Tiroler Tageszeitung 05.10.2004 sowie<br />
Gerzabek 2004.<br />
293<br />
van Staa, zit. nach Der Standard 08.09.2004; vgl. Tiroler Tageszeitung 08.09.2004; ähnlich später auch der<br />
Innsbrucker Polizeidirektor Angermair, der mit Verweis auf die „nordafrikanischen Drogenhändler“ anmerkte,<br />
wichtig sei die Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Tiroler Tageszeitung 23.11.2004).<br />
294<br />
van Staa, zit. nach Gerzabek 2004.<br />
295<br />
Vgl. etwa Der Standard 07.06.2003; Tiroler Tageszeitung 07.06.2003, 10.01.2004; s.a. Anfragebeantwortung<br />
Gangl 2003; Interview Logar 10.10.2003, Z 27-34.<br />
296<br />
Vgl. etwa Ralser 2003, 41.<br />
297<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 11.10.2004b. Der Gangl unterstellte Flüchtlingskoordinator Logar hatte freilich in<br />
der Tiroler Tageszeitung bereits zu Weihnachten 2003 Verständnis für diese Position gezeigt: „Ich räume aber<br />
ein, dass die Unterbringung in Klöstern problematisch ist, wenn dort Kunstgegenstände aufbewahrt werden.“<br />
(Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 23.12.2003b)<br />
78
die sich bei einer vorausschauenden Arbeitsweise wohl hätten vermeiden lassen, führten dazu,<br />
dass Tirol innerhalb kürzester Zeit zum bundesweiten Schlusslicht hinsichtlich der bereitge-<br />
stellten Quartiere wurde.<br />
Nachdem Innenminister Strasser Anfang Juni 2004 vorsichtig angemerkt hatte, dass die Bun-<br />
desländer zur Erfüllung ihrer jeweiligen Quoten weitere Flüchtlinge aufzunehmen hätten 298 ,<br />
reagierte Landesrätin Gangl bereits gereizt: Die Tiroler Quote für die Aufnahme von „Asy-<br />
lanten“ sei mit 880 Personen bereits erfüllt. 299 Wenige Tage später kündigte Strasser jedoch<br />
an, Asylsuchende einfach nach Innsbruck zu schicken. Gangl und Landeshauptmann van Staa<br />
protestierten vehement, die Landesrätin nannte Strassers Ankündigung gar einen „Skan-<br />
dal“. 300 Gangl wie auch van Staa griffen nun auf eine bewährte Tiroler Rechtfertigungsstrate-<br />
gie zurück: Sie erklärten, Wien sei an der Misere schuld. „Jeden Tag gibt das Ministerium<br />
neue Zahlen bekannt“, klagte van Staa: „So wissen wir nicht, wie viele Quartiere es<br />
braucht.“ 301 Zuerst sei immer von 900 unterzubringenden Menschen die Rede gewesen, nun<br />
seien es aber 1.500 – eine Behauptung, der Strassers Sprecher Johannes Rauch sofort wider-<br />
sprach: Von einer fixen Zahl von 900 Personen wisse man nichts, „davon war nie die<br />
Rede“. 302 Der Landeshauptmann beharrte indessen auf seiner Position und ließ beinahe trotzig<br />
wissen: Anders als vom Ministerium dargestellt, habe Tirol die Quote bereits erfüllt, es liege<br />
also ein „mustergültiges Verhalten Tirols“ vor, außerdem könne er die „Grundversorgungs-<br />
vereinbarung“ mit dem Bund ja auch platzen lassen. 303 Landesrätin Gangl wiederum konsta-<br />
tierte nun ein „Zahlen-Tohuwabohu“ im Innenministerium, dort herrsche „Chaos“ 304 – im<br />
„Wasserkopf“ Wien, so das zwischen den Zeilen deutlich erkennbare beliebte Wien-Klischee,<br />
beherrsche man nicht einmal die Grundrechnungsarten. Der Flüchtlingskoordinator des Lan-<br />
des stand – obwohl selbst gebürtiger Wiener – Gangl zur Seite: Dass Tirol jetzt viel mehr<br />
Menschen aufzunehmen habe, sei auf eine „Fehleinschätzung“ der Wiener und Steirer zu-<br />
rückzuführen, denn diese Bundesländer seien „von einer niedrigeren Zahl von Asylwerbern<br />
ausgegangen“. 305 Die Landesrätin selbst ließ schließlich auch noch durchblicken, dass sie<br />
entsprechend der vielbeschworenen tirolischen „Wehrhaftigkeit“ durchaus zur Verteidigung<br />
ihres Land in der Lage sei und gab zu verstehen, dass sie sich an der unerwartet eröffneten<br />
Front auch bereits in die Schlacht geworfen habe: Erst nachdem sie „den Aufstand geprobt“<br />
habe, sei ihr vom Innenministerium in Wien mitgeteilt worden, dass Tirol noch 581 Unterkunftsplätze<br />
bereitzustellen habe. 306<br />
298 Tiroler Tageszeitung 03.06.2004.<br />
299 Tiroler Tageszeitung 09.06.2004.<br />
300 Tiroler Tageszeitung 16.06.2004a.<br />
301 van Staa, zit. nach ebd.<br />
302 Rauch, zit. nach Tiroler Tageszeitung 16.06.2004b.<br />
303 van Staa, zit. nach ebd.<br />
304 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 19.06.2004.<br />
305 Logar, zit. nach ebd.<br />
306 Gangl, zit. nach Der Standard 22.06.2004.<br />
79
Zumindest in der Öffentlichkeit erweckten van Staa wie auch Gangl dabei über Monate hin-<br />
weg den Eindruck, dass sie schlicht den Begriff der „Quote“ nicht recht verstanden hatten: Sie<br />
gingen offenbar von einer unveränderlichen absoluten Zahl aus. Auch nachdem das Ministe-<br />
rium auf dieses Missverständnis aufmerksam geworden war und Strassers Sprecher Rauch<br />
über die Tiroler Tageszeitung den begrifflichen Inhalt erläutert hatte 307 , behielten sie ihren<br />
falschen Quotenbegriff noch bei: Tirol hinke der Quote nur deshalb hinterher, so die Landes-<br />
rätin Mitte August, „weil der Bund jeden Tag neue Zahlen bekannt gibt“, man könne sich<br />
daher „auf nichts einstellen“. 308 Nachdem van Staa Ende Juli und unter einem Portrait And-<br />
reas Hofers sitzend angekündigt hatte, seine bisherige Linie zu ändern, „leiser und zurück-<br />
haltender“ zu werden und sich „auf ein Minimum“ zu reduzieren 309 , verhängte er im August<br />
vorübergehend gar jenen „Aufnahmestopp für Asylwerber“, den der freiheitliche Landes-<br />
obmann Willi Tilg kurz zuvor gefordert hatte 310 : Der Bund, so die neuerliche Begründung des<br />
Landeshauptmannes, nenne täglich neue Zahlen, diese Vorgangsweise sei „für Tirol nicht<br />
akzeptabel“. 311 Landesrätin Gangl hielt noch im Herbst 2004 hartnäckig am falschen Quoten-<br />
begriff fest. In einer Aussendung Mitte September klagte sie:<br />
„Es ist hinsichtlich der Quote weder Transparenz gegeben noch Planbarkeit möglich. Während man ursprünglich<br />
von einer Quote [sic!] von 900 unterzubringenden Menschen für Tirol ausgegangen war, sind es nunmehr rund<br />
2.000. Trotzdem wir immer mehr Menschen unterbringen, steigt die Zahl jener, die noch zu versorgen wären,<br />
stetig an. So kann es nicht weitergehen.“ 312<br />
In der ersten Oktoberhälfte forderte sie vom Bund gar eine Neuverhandlung – nicht etwa der<br />
absoluten Zahl der vom Land unterzubringenden Asylsuchenden, sondern der Quote. 313 Eine<br />
Fortsetzung des Streits wäre damit wohl unausweichlich gewesen.<br />
Wien ist schuld – der „Wasserkopf“ versucht, so der Unterton der tirolischen Wortspenden,<br />
die kreuzbraven ÄlplerInnen über den Tisch zu ziehen und ihnen eine größere Zahl an Asyl-<br />
suchenden unterzuschieben, als vereinbart. Da sind die alten Tiroler Reflexe rasch bei der<br />
Hand: Die „Eigenständigkeit“ wird beschworen (man sei ein geradezu mustergültiges Land<br />
und könne im übrigen auch ohne Wien ganz gut, vermutlich sogar noch viel besser), die<br />
„Wehrhaftigkeit“ aktualisiert (eine Landesrätin probt „den Aufstand“ gegen Wien), gängige<br />
Klischees von der zentralistischen und – horribile dictu! – urbanen „Bürokratenhochburg“ im<br />
„Osten“ werden gepflegt, in der nur „Tohuwabohu“ und „Chaos“ herrschten. Gänzlich un-<br />
307<br />
Die Quote sei nun einmal ein prozentueller Wert, weshalb es „logisch“ sei, dass sich die absoluten Zahlen<br />
täglich änderten, so Rauch: „Man kann nicht sagen, wie viele Asylwerber am nächsten Tag vor der Tür stehen.“<br />
(Rauch, zit. nach Tiroler Tageszeitung 16.06.2004b).<br />
308<br />
Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 17.08.2004; annähernd wortgleich auch in Tiroler Tageszeitung<br />
21.08.2004a, wo Gangl gar von „falschen Zahlen“ des Ministeriums spricht.<br />
309<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 31.07.2004b.<br />
310<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 19.08.2004b.<br />
311<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 21.08.2004a. Innenminister Strasser konterte gelassen: „Es ist jedem<br />
überlassen, hier Bemerkungen abzugeben. Vertrag ist Vertrag, die Länder sind selbstverständlich für die Quartiere<br />
zuständig.“ (Strasser, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.08.2004c)<br />
312<br />
Gangl, zit. nach AdTLR 20.09.2004.<br />
313 Vgl. Tiroler Tageszeitung 11.10.2004a.<br />
80
schuldig an der von gängigen Anti-Wien-Reflexen getragenen Diskussion 314 war freilich auch<br />
das Innenministerium nicht: Hinter den Auseinandersetzungen stand auch eine unterschied-<br />
liche Definition jener Gruppen, die in die „Grundversorgung“ aufgenommen werden sollten.<br />
Das Land Tirol vertrat die Ansicht, dass die als SozialhilfebezieherInnen ehemals in „Landes-<br />
betreuung“ befindlichen Asylsuchenden einfach in die Quote eingerechnet werden könnten 315 ,<br />
was der Bund jedoch ablehnte, handelte es sich bei der Quote doch um den Anteil an jenen<br />
Flüchtlingen, die sich vor Inkrafttreten der „Grundversorgungsvereinbarung“ in den aufzulö-<br />
senden Bundeseinrichtungen befunden hatten. Das Ministerium hatte die Entstehung dieses<br />
Missverständnisses letztlich selbst gefördert: Ende November 2003 legte Minister Strasser der<br />
Tiroler Landesregierung die Unterzeichnung der Vereinbarung ans Herz, indem er erklärte,<br />
das Land könne dadurch mit einer finanziellen „Ersparnis“ rechnen – mit dem Beschluss eines<br />
Aufteilungsschlüssels müsse der Bund auch sechzig Prozent jener Kosten tragen, die derzeit<br />
das Land trage. 316<br />
5.4 »Asylland Österreich«: Der Rechtfertigungsdiskurs (III)<br />
Ein dritter Teil des zur Rechtfertigung dienenden Diskursstranges sei, da an anderer Stelle<br />
bereits in wesentlichen Grundzügen dargestellt 317 , hier nur noch kurz erwähnt: der Mythos<br />
vom „Asylland Österreich“. Die vielzitierte österreichische „Hilfsbereitschaft“ diente auch in<br />
Tirol lange Zeit der Beschwörung einer großen „Tradition“ und damit letztlich der Festigung<br />
eines positiven Selbstbildes. Die auf Bundesebene ab dem Regierungswechsel Anfang 2002<br />
feststellbare zunehmende Nutzung der Asylland-Rhetorik zur Rechtfertigung politischer For-<br />
derungen mit dem Ziel der Einschränkung oder Verweigerung von (Hilfs-)Leistungen für<br />
Asylsuchende zeigt sich gleichfalls auch auf regionaler Ebene. Exemplarisch sei hier ein Bei-<br />
trag in der offiziellen Landeszeitung genannt, der die Forderungen von Landeshauptmann van<br />
Staa nach einer unverzüglichen Abschiebung „straffällig gewordener Asylwerber“ und einer<br />
„Sonderverwahrung“ von Personen, „die ihre Identität nicht preisgeben“ wollten, direkt mit<br />
dem österreichischen Asylland-Mythos verknüpft:<br />
„»Das sind wir unserer Bevölkerung und jenen Menschen schuldig, die als Flüchtlinge unsere Hilfe und ein<br />
rasches Asylverfahren brauchen. Denn durch die straffällig gewordenen Asylwerber werden auch die vielen<br />
schutz- und hilfsbedürftigen Asylwerber in ein schiefes Licht gerückt.« [...] Unser Landeshauptmann hat ein<br />
Herz für Flüchtlinge – so war Herwig van Staa als Jugendlicher bereits während der Ungarn-Krise 1956 als Betreuer<br />
tätig und hat auch bei der Tschechien-Krise [sic!] 1968 im Grenzbereich zu Österreich einen Beitrag für<br />
314 Dass sich Wien in Tirol auch in anderen Bereichen der Asylmissbrauchsdebatte hervorragend für von möglichen<br />
eigenen Versäumnissen ablenkende Schuldzuweisungen eignet, zeigte Flüchtlingskoordinator Logar Mitte<br />
August 2004, als er einen Vorschlag zur „Entschärfung“ der regionalen Diskussion um die Aufnahme von Asylsuchenden<br />
präsentierte: Dies könne nur gelingen, „wenn durch die Gesetzgebung des Bundes, [sic!] Flüchtlinge,<br />
die Gesetze brechen, sehr schnell außer Landes gebracht werden können“ (Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung<br />
24.08.2004a).<br />
315 So etwa Landeshauptmann van Staa im April 2004: „Rechnet man die Sozialhilfeempfänger dazu, haben wir<br />
die Quote sogar übererfüllt.“ (van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 14.04.2004a).<br />
316 Tiroler Tageszeitung 24.11.2003.<br />
317 Siehe Abschnitt 4.1.1.<br />
81
Flüchtlinge geleistet. Und in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Innsbruck hat er ein städtisches Heim für<br />
bosnische Flüchtlinge bereitgestellt.“ 318<br />
5.5 Von der »Herbergssuche« dankbarer Familien: Der Mitleidsdiskurs<br />
Teils in direkter Verbindung mit dem Rechtfertigungsdiskurs steht ein weiterer Diskursstrang<br />
der Asylmissbrauchsdebatte, der durch Motive aus dem Kontext von Mitleid und Mitgefühl<br />
bestimmt ist und daher als „Mitleidsdiskurs“ bezeichnet werden kann. Als beliebtestes Motiv<br />
vor allem der regionalen und lokalen <strong>Medien</strong> fungiert dabei ein Bild, das der renommierte<br />
Journalist Hans Rauscher bissig als „ranzige Journalistenpoesie“ 319 verspottet: die biblisch<br />
inspirierte „Herbergssuche“. Schon im September 2002 titelte die Tiroler Tageszeitung ange-<br />
sichts der zunehmenden Obdachlosigkeit von Asylsuchenden und im Hinblick auf die Versu-<br />
che der zuständigen Landesrätin, Unterkünfte zu organisieren: „Landesrätin auf Herbergs-<br />
suche“. 320 Die regionale Ausgabe des Kurier folgte Anfang November des Jahres: „240<br />
Flüchtlinge auf Herbergssuche“. 321 Zielstrebig griff in der Folge eine aus zivilgesellschaftli-<br />
chen und kirchlichen Organisationen bestehende Initiative das beliebte Motiv auf und machte<br />
es zur Trademark einer in der Weihnachtszeit 2002 zur Unterstützung obdachloser Asyl-<br />
suchender in Innsbruck eingerichteten Notschlafstelle: Die in einer Innsbrucker Kirche veran-<br />
staltete „Aktion Herbergssuche“ – äußerst professionell mit einem auf die Corporate Identity<br />
des „Unternehmens“ perfekt abgestimmten Plakat und einem ebensolchen Internetauftritt ver-<br />
sehen 322 und in der Folge auch in einem fundierten Buchbeitrag reflektiert 323 – verankerte den<br />
Begriff so nachhaltig im Diskurs, dass er endgültig zum Selbstläufer wurde. „Wer klopfet<br />
an?“ fragte etwa ein Innsbrucker Gratismagazin im Titel einer Reportage über Asylsuchende<br />
und zeigte sich weihnachtlich gestimmt, auch wenn gerade der März 2003 zu Ende ging.<br />
Damit die LeserInnen des Blattes die Bezugnahme auf das biblische Motiv auch ohne grund-<br />
legende Kenntnisse im Bereich des christlichen Liedgutes nachvollziehen konnten, illustrierte<br />
man die Reportage zusätzlich mit einem Foto der „Aktion Herbergssuche“. 324 Rechtzeitig zur<br />
Weihnachtszeit 2003 griff auch die Tiroler Tageszeitung wieder vermehrt auf das Motiv zu-<br />
rück. „Auf Herbergssuche“, konstatierte Journalist Helmut Wenzel bereits im Titel eines<br />
Kommentars über die zeitgerechte Eröffnung einer neuen Unterkunft unmittelbar vor dem<br />
Heiligen Abend. Die Unterkunft sei zu begrüßen, denn man missachte die Menschenrechte,<br />
wenn man „die Türen für Herbergssuchende verriegelt“. 325 Die Zeitung hatte den Begriff mitt-<br />
lerweile offenbar regelrecht internalisiert: In einem Interview mit Flüchtlingskoordinator<br />
Logar erkundigte sich eine Journalistin, wie denn die „Herbergssuche“ so verlaufe 326 , im<br />
318<br />
Gerzabek 2004.<br />
319<br />
Rauscher 2003.<br />
320<br />
Tiroler Tageszeitung 27.09.2002.<br />
321<br />
Kurier 09.11.2002.<br />
322<br />
Auch der URL war programmatisch gewählt: .<br />
323<br />
Vgl. Ralser 2003.<br />
324<br />
Vgl. Krapf 2003.<br />
325<br />
Wenzel 2003.<br />
326<br />
Tiroler Tageszeitung 23.12.2003b.<br />
82
April 2004 titelte man: „250 Flüchtlinge stehen vor der Tür“, die „Herbergssuche“, so der<br />
folgende Bericht, gestalte sich alles andere als einfach. 327 Journalistin Irene Rapp fasste ihre<br />
Analyse der Problematik bereits im Titel in mittlerweile bekannter Form zusammen: „Schwierige<br />
Herbergssuche“. 328<br />
Etwa ab dem Frühjahr 2004 wurde die biblische Metapher vermenschlicht und auch gleich<br />
visualisiert: Erstaunlich spät hatte die regionale <strong>Medien</strong>landschaft Familien mit Kindern als<br />
anrührendes Motiv entdeckt. Waren zuvor Flüchtlingskinder bestenfalls auf dem Arm von<br />
PolitikerInnen oder UnterkunftsleiterInnen aufgetaucht, so rückten jetzt ganze Familien in den<br />
Vordergrund. Auslöser war die zum Jahreswechsel 2003/04 erfolgte und bestens inszenierte<br />
Eröffnung der Landesunterkunft in der Landecker Kaifenau gewesen 329 , die von der Oberlän-<br />
der Rundschau mit durchaus einfühlsamen Hintergrundberichten und Portraits individueller<br />
Schicksale begleitet worden war. 330 Die zunächst in der Landecker Unterkunft untergebrach-<br />
ten Kinder Lawa, Lania und Falah aus dem Irak avancierten nun in der Tiroler Tageszeitung<br />
samt Kuscheltieren zu regionalen <strong>Medien</strong>stars: Ende April 2004 setzte man die drei erstmals<br />
großformatig (und ohne direkten Zusammenhang zum begleitenden Bericht) ins Bild 331 , Mitte<br />
August illustrierten sie, abermals ohne direkte Verbindung, einen weiteren Bericht 332 , ehe sie<br />
einen Monat später, nun in der neu eröffneten Unterkunft in Hall in Tirol untergebracht und<br />
mit Eltern und einem kürzlich geborenen Geschwisterchen, erneut auftauchten – diesmal ne-<br />
ben dem Foto einer alleinerziehenden Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die zufrieden vor ei-<br />
nem gedeckten Tisch standen. 333 Anfang Oktober war endlich auch der ORF auf die Vorzei-<br />
gefamilie aufmerksam geworden: Tochter Lawa sorgte in einer Reportage über die Haller<br />
Unterkunft für die Präsenz von mehr oder weniger zufriedenen Kinderstimmen. 334<br />
Es blieb freilich nicht nur bei Lawa, ihrer Familie und der erwähnten alleinerziehenden<br />
Mutter samt Tochter: Einen Bericht über eine eigentlich bereits geschlossene, jedoch kurz-<br />
fristig wieder reaktivierte Unterkunft in Volders illustrierte die Tiroler Tageszeitung Anfang<br />
Mai mit drei Buben sowie einer schwangeren Frau mit Baby auf dem Arm, der eine groß-<br />
mütterlich wirkende Rot-Kreuz-Helferin Bananen und Äpfel überreichte. „Schon für kleine<br />
Aufmerksamkeiten dankbar: Das sind [...] nicht nur die Kinder“, wusste das Blatt in der Bild-<br />
unterschrift zu berichten, die abgebildete Helferin würde sich – neben der Vitaminzufuhr –<br />
auch um andere „große und kleine Probleme“ kümmern, etwa das Organisieren von Spielzeug<br />
327 Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
328 Rapp 2004.<br />
329 Siehe hierzu 7.4.4.<br />
330 Vgl. Rundschau 16.12.2003; 23.12.2003a und b; 05.01.2004.<br />
331 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
332 Vgl. Tiroler Tageszeitung 17.08.2004.<br />
333 Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.09.2004b.<br />
334 Vgl. ORF 02.10.2004. Den Rückgriff auf Lawa und ihre Familie setzten regionale <strong>Medien</strong> im Jahr 2005 fort,<br />
vgl. etwa die Fotographie in Tiroler Tageszeitung 12.01.2005.<br />
83
und Umstandskleidung. 335 Bilder von Kindern, die an einem Deutschkurs teilnahmen oder<br />
von einem Neugeborenen samt Mutter (und politischer Prominenz) folgten. 336<br />
Mit Schenk können derartige Darstellungen letztlich als „Sozialkitsch von oben“ und „rhetori-<br />
scher Weihrauch“ charakterisiert werden: Von gewöhnlich durchaus gut situierten und wei-<br />
testgehend sorgenfrei lebenden Bevölkerungsgruppen wie PolitikerInnen, <strong>Medien</strong>vertreterIn-<br />
nen und ganz allgemein AkademikerInnen werden die photogenen Teile der Ärmeren und<br />
sozial Benachteiligten für Charity- und PR-Auftritte benutzt und zum „Objekt wertgetränkter<br />
Reden“ gemacht, „und das war’s dann auch schon“ – die Privatisierung sozialer Risiken wird<br />
teils aktiv unterstützt, „aber großartig ist, wie wir uns alle engagieren“. 337 Die solcherart<br />
benutzten „Opfer“ dürfen in ihrer „öffentlichen Isolationshaft die Moral der Privilegierten<br />
verewigen helfen“. 338 Die genannten Beispiele zeigen zugleich in aller Deutlichkeit, wie über<br />
den Mitleidsdiskurs ein Bild von Asylsuchenden gezeichnet wird, das diese als arme und<br />
hilflose, kindliche, letztlich unmündige und für jede noch so kleine Hilfeleistung dankbare<br />
Wesen konstruiert – eben als diejenigen, die Asyl „wirklich brauchen“ und denen daher im<br />
Unterschied zu den „Missbrauchenden“ dringend „geholfen“ werden muss. Der Mitleids-<br />
diskurs, der damit gewissermaßen die Rück- oder auch Vorderseite des Bedrohungsdiskurses<br />
darstellt, ist daher immer auch ein „Bevormundungsdiskurs“. 339 Entsprechend liegt es auf der<br />
Hand, dass es sich beim solcherart diskursiv hergestellten Zerrbild der gleichermaßen hilflo-<br />
sen wie dankbaren Asylsuchenden um eine relativ exakte Skizze jener Rolle handelt, die<br />
<strong>ÖsterreicherInnen</strong> aller Schichten und Generationen Flüchtlingen schon immer gerne zu-<br />
schrieben. 340 Dass mit dieser Rollenerwartung automatisch eine latente Geringschätzung<br />
verbunden ist, zeigt sich besonders deutlich an der Selbstverständlichkeit, mit der von Asyl-<br />
suchenden Dankbarkeit gerade auch für Unterkünfte erwartet wird, die österreichische Durch-<br />
schnittsbürgerInnen rundweg als unzumutbar ablehnen würden: Da wird etwa lobend erwähnt,<br />
dass eine freundliche Helferin Kranken auch einmal „einen Kaffe neben die Matratze“ stellen<br />
würde 341 (die zeitgerechte Organisation von Betten hielt der Unterkunftsgeber wohl für nicht<br />
erforderlich), oder es wird, wie von der Tiroler Tageszeitung anlässlich der Eröffnung der<br />
Haller Unterkunft und dem dortigen Einzug von Lawa und ihrer Familie erfreut in Balken-<br />
lettern festgehalten: „Für die Flüchtlinge ist alles wie neu“. 342 Für <strong>ÖsterreicherInnen</strong> wäre es<br />
das wohl eher nicht.<br />
335<br />
Tiroler Tageszeitung 04.05.2004.<br />
336<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 11.06.2004a; 24.08.2004b.<br />
337<br />
Schenk 2000, 57f.<br />
338<br />
Grünbein 1992, 115.<br />
339<br />
Vgl. Matouschek/Wodak 1995, 214.<br />
340<br />
Vgl. etwa ebd. 1995, 214f; Zierer 1995, 17; vgl. auch das negative Urteil des Ministerialbeamten Stanek<br />
(1985) über jene Asylsuchenden in den 1970er Jahren, die selbstbewusst auftraten und gegenüber den Behörden<br />
konkrete Verbesserungen ihrer Lebensverhältnisse einforderten.<br />
341<br />
Tiroler Tageszeitung 04.05.2004.<br />
342 Tiroler Tageszeitung 21.09.2004b.<br />
84
5.6 Mahnende Worte, Appelle und Forderungen: Der kritische Diskurs<br />
Neben den bisher genannten Diskurssträngen ist schließlich auch noch jener Teil der Asyl-<br />
missbrauchsdebatte zu nennen, der einen kritischen Ton in die Diskussionen einbringt. Dieser<br />
„kritische Diskurs“ wird von den daran beteiligten Personen und Gruppen sowohl hinsichtlich<br />
der angewandten Strategien als auch der damit verfolgten Ziele in äußerst unterschiedlicher<br />
Weise geführt. Daher soll im Folgenden zwischen den drei Bereichen der von <strong>Medien</strong>, Politik<br />
und Behörden eingebrachten Kritik, jener der römisch-katholischen Kirche und kirchennaher<br />
Gruppierungen 343 sowie jener von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterschieden<br />
werden.<br />
Kritik von <strong>Medien</strong>, Politik und Behörden: Beißt sich die Katze in den Schwanz?<br />
Dominiert wird der kritische Diskurs vorrangig von kurzen „Reflexionseinheiten“, in deren<br />
Rahmen von VertreterInnen der Bereiche <strong>Medien</strong>, Politik, Verwaltung und Polizei in unre-<br />
gelmäßigen Abständen negative Auswirkungen der Diskussionen auf die Haltung der Bevöl-<br />
kerung gegenüber Asylsuchenden konstatiert, damit verbundene wachsende Widerstände ge-<br />
gen die Unterbringung Asylsuchender in Tirol beklagt und die Differenzierung zwischen den<br />
wenigen das Asylrecht „missbrauchenden“ und der großen Mehrheit an „anständigen“ Asyl-<br />
suchenden eingemahnt werden. Dass damit ausgerechnet von selbst führend an der Debatte<br />
beteiligten Personen Debattenkritik geübt wird, erinnert zunächst an das Bild von der Katze,<br />
die sich in den eigenen Schwanz beißt. Tatsächlich ist dies jedoch nur scheinbar paradox:<br />
Aufrufe zu differenzierteren Urteilen und einer kritischeren Perspektive legen nahe, dass dies<br />
für die dazu Aufrufenden selbst geradezu eine Selbstverständlichkeit ist und dienen damit<br />
letztlich der Kommunikation eines positiven (Selbst-)Bildes nach außen, das auch mit dem<br />
„Volksempfinden“ argumentierten populistischen Forderungen nach möglichst restriktiven<br />
Maßnahmen gegen „Fremde“ eine sachlich-seriöse Aura verleiht. Der von federführend am<br />
Bedrohungsdiskurs beteiligten Personen geführte kritische Diskurs ist daher – ähnlich wie im<br />
Fall des Operierens mit Mitleidsmotiven – zu einem guten Teil nichts anderes, als ein ver-<br />
steckter Rechtfertigungsdiskurs.<br />
Vorsichtig kritisch zum Diskurs äußerte sich in der jüngsten Vergangenheit von den in Tirol<br />
aktiv daran Beteiligten zunächst der Flüchtlingskoordinator des Landes, Peter Logar. Die Zahl<br />
straffällig gewordener Asylsuchender betrage derzeit „zehn bis fünfzehn Personen“, so Logar<br />
im März 2003 zu einem Innsbrucker Gratismagazin, was ein sehr kleiner Prozentsatz sei.<br />
Durch „gewisse Teile“ kämen nun alle Flüchtlinge zum Handkuss und litten darunter. „Wir<br />
hatten während der Bosnienkrise 3.000 Personen in Tirol und die Kriminalität war de facto<br />
nicht existent.“ 344 „Die Öffentlichkeit scheint zuweilen ihre Schwierigkeiten mit der<br />
Differenzierung zwischen Illegalen, Asylwerbern, die sich auf Grund [sic!] ihres vorläufigen<br />
Aufenthaltsrechts rechtmäßig in Österreich befinden, und Kriminellen zu haben“, ergänzte<br />
343 Andere Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften waren im Diskurs in Tirol bislang nicht präsent.<br />
344 Logar, zit. nach Krapf 2003, 13.<br />
85
das Blatt kritisch: „Wie in vielen anderen Bereichen auch, machen Asylwerber vor allem dann<br />
Schlagzeilen, wenn es etwas Negatives zu berichten gibt.“ Tatsächlich mochte auch das Magazin<br />
selbst nicht darauf verzichten, dies gleich mit einer Fülle an Beispielen zu illustrieren. 345<br />
„Nur eine Handvoll der Asylwerber ist kriminell geworden“, ließ der Flüchtlingskoordinator<br />
ein Jahr später erneut wissen, und diese habe „für negatives Aufsehen gesorgt. Das wirkt sich<br />
auf alle Flüchtlinge negativ aus.“ 346 Nun war auch die Tiroler Tageszeitung um Differenzie-<br />
rung bemüht: Journalistin Irene Rapp eröffnete eine Debatte der Debatte und übte vom regio-<br />
nalen Leitmedium aus <strong>Medien</strong>kritik. In vielen Tiroler Gemeinden gäbe es Platz für jene Men-<br />
schen, die nach dem Inkrafttreten der „Grundversorgungsvereinbarung“ am 1. Mai „vor unse-<br />
rer Tür stehen werden“, so Rapp:<br />
„Viele Bürgermeister haben jedoch bereits vorher abwehrend die Hände gehoben – aus verständlichem Grund.<br />
Zu sehr brannten sich Schlagzeilen von Schlägereien in Heimen und Straftaten von Asylwerbern in das öffentliche<br />
Bewusstsein. Zur Angst vor dem Fremden hat sich die Angst um die Sicherheit gesellt. Dass von derzeit<br />
700 Flüchtlinge nur wenige auffällig geworden sind, wird gerne unter den Tisch gekehrt.“ 347<br />
Im August des Jahres fand auch Innsbrucks Polizeidirektor Angermair in der Tiroler Tages-<br />
zeitung mahnende Worte: Es sei davor zu warnen, alle Asylsuchenden in einen Topf zu wer-<br />
fen, denn „der Großteil ist nicht kriminell“. Die Situation in Innsbruck wolle er nicht als Be-<br />
sorgnis erregend einstufen: „Es wird weit mehr über die Kriminalität geredet als die Sicher-<br />
heit tatsächlich beeinträchtigt ist.“ 348 Angermair nutzte die Gelegenheit und sprach gleich<br />
selbst ausführlich über die Kriminalität: Seit gut vier Jahren steige die Kriminalitätsrate in<br />
Innsbruck nun schon an, der Wegfall der Grenzkontrollen habe zu einer „erhöhten Mobilität<br />
auch unter Kriminellen“ geführt und weil die an anderer Stelle bereits vorgestellten (nord-<br />
)afrikanischen Drogenhändler gerne Asylanträge stellten, seien mehr Möglichkeiten erforder-<br />
lich, gegen „straffällig gewordene Asylwerber“ vorzugehen. 349 Journalist Mario Zenhäusern<br />
schaffte es mühelos, den von ihm mitverfassten Beitrag zum kämpferisch übertitelten Auf-<br />
macher („Härte gegen kriminelle Asylanten“) zu erheben, zugleich jedoch auf der folgenden<br />
Seite die „Volksseele“ per Leitartikel einer kritischen Analyse zu unterziehen:<br />
„Das Thema Asylanten sorgt regelmäßig dafür, dass die Volksseele kocht. Mitunter sogar überkocht. Verantwortlich<br />
dafür sind in erster Linie Vorurteile wie jenes, das alle Asylanten faul und kriminell sind. Ganz abgesehen<br />
davon, dass Vorurteile in der Regel nie [sic!] stimmen, produzieren sie Ängste bei jenen, die sich nicht<br />
intensiv mit der Materie auseinander setzen. Von der Angst zur Ablehnung ist es dann nur noch ein kleiner<br />
Schritt.“ 350<br />
345<br />
Drei Asylsuchende, so das Blatt (ebd., 12f), wären jüngst festgenommen worden, die im Verdacht stünden, in<br />
eine Schule eingebrochen zu haben, zwei irakische Asylwerber und einige weitere „Raufbolde“ hätten sich erst<br />
kürzlich gegenseitig krankenhausreif geprügelt, auch habe der Trickdiebstahl seit Sommer letzten Jahres „rapide<br />
zugenommen“. Vor wenigen Tagen seien überdies ein Georgier und zwei Asylsuchende aus Moldawien wegen<br />
des Verdachts des Ladendiebstahls verhaftet worden, die Fremdenpolizei habe ja schon länger „eine Bande von<br />
Georgiern, Tschetschenen und Moldawiern im Visier, die – bisweilen auf Auftrag – bevorzugt hochpreisige<br />
Produkte beschaffen soll“. Daneben habe, ein Hinweis, der nicht fehlen durfte, auch der Fall „Oscar O.“ die<br />
Gemüter erregt.<br />
346<br />
Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
347<br />
Rapp 2004.<br />
348<br />
Angermair, zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.08.2004b.<br />
349 Ebd.<br />
350 Zenhäusern 2004c.<br />
86
Diesen Schritt konnte Zenhäusern in Tirol zwar nicht feststellen, wohl aber „Mauern aus<br />
Angst“. Diese seien jedoch „ungerecht“, denn: „Der überwiegende Teil der Menschen, die<br />
Jahr für Jahr an Österreichs Türen klopfen, ist nicht kriminell. Ganz im Gegenteil: Sie sind in<br />
unser Land gekommen, um vor kriminellen Machenschaften sicher zu sein. Nur ein kleiner<br />
Teil der Asylwerber kommt tatsächlich mit dem Gesetz in Konflikt. Aber das bringt die ganze<br />
Schicksalsgemeinschaft in Verruf.“ 351 Nachdem er zwischenzeitlich ausführlich über einen<br />
Bankraub und drei diesbezüglich verdächtigte moldawische Asylsuchende berichtet hatte 352 ,<br />
kritisierte der Journalist Mitte September erneut die „Volksseele“: „Asylwerber ist derzeit ein<br />
Synonym für Gauner. Auch in Tirol. Durch die Statistik lässt sich dieses Vorurteil aber nicht<br />
belegen.“ 353 Zenhäusern zitierte den Chef der Innsbrucker Kriminalpolizei, Gerhard Ditz, der<br />
eine „nationale Rangliste“ der TäterInnen für jene Straftaten präsentiert hatte, die von nicht-<br />
österreichischen StaatsbürgerInnen begangen worden waren: An der Spitze lagen demnach<br />
mit großem Abstand deutsche Staatsangehörige, gefolgt von türkischen, bosnischen und nie-<br />
derländischen. Ditz hatte daher von einer „kriminellen Gruppe“ unter den Asylsuchenden<br />
gesprochen, die „verschwindend klein“ sei. 354 In einem Kommentar hielt Zenhäusern entspre-<br />
chend fest:<br />
„Aus der vorliegenden Auflistung der Straftaten ließe sich vieles herauslesen. Etwa, dass die Deutschen die<br />
größte Gefahr für Hab und Gut sind. Oder dass jeder siebente Ausländer ein Gauner ist. Beides ist natürlich nicht<br />
wahr. Es ist aber auch nicht dasselbe, ob zehn Asylwerber an einem Einbruch beteiligt sind oder ob ein Asylwerber<br />
zehn Einbrüche verübt. In der Kriminalitätsstatistik ist das einerlei – unterm Strich sind das zehn Anzeigen.“<br />
355<br />
Dies seien Beispiele, die zeigten, „welch gefährliche Waffe die Statistiken sind“. Wer das<br />
wisse, so der Journalist, der gehe daher „vorsichtig mit dem Zahlenmaterial um. Zu groß ist<br />
die Gefahr, dass der Schuss nach hinten los geht.“ 356 Während Zenhäusern eher pauschal ein<br />
differenzierteres Urteil einforderte (und damit letztlich auch signalisierte, dass sich das an der<br />
Debatte eifrig beteiligende regionale Leitmedium diesbezüglich ohnehin auf der moralisch<br />
und politisch korrekten Seite befände), wies Chefredakteur Claus Reitan wenig später die<br />
Verantwortung gänzlich der Politik zu und nahm auch die Bevölkerung in Schutz: „Die Poli-<br />
tiker halten die meisten Österreicher für ausländerfeindlich“. Lösungen in der Frage der Un-<br />
terbringung von Asylsuchenden seien nämlich „mehr unter den Politikern als unter der Be-<br />
völkerung“ umstritten, die „für echte Notlagen Verständnis“ hätte. Die Politik mache „genügend<br />
Fehler, damit die Sache weiter schief läuft“. 357<br />
Die Bevölkerung nicht in Schutz nehmen mochte dagegen Flüchtlingskoordinator Logar:<br />
Problematisch sei, dass viele BürgerInnen den Eindruck hätten, dass „Asylanten“ generell<br />
351<br />
Ebd.<br />
352<br />
Tiroler Tageszeitung 10.09.2004.<br />
353<br />
Tiroler Tageszeitung 16.09.2004a.<br />
354<br />
Ditz, zit. nach ebd.<br />
355<br />
Zenhäusern 2004a.<br />
356<br />
Ebd.<br />
357<br />
Reitan 2004.<br />
87
„Kriminelle“ seien. Dies treffe aber nicht zu: „Nur ein harter Kern von 40 Kaukasiern be-<br />
schäftigt sei zwei Jahren die Exekutive. Diesbezüglich stiegen die Delikte jedoch von 145 im<br />
Jahr 2003 auf 652 im noch nicht vollendeten Jahr 2004.“ 358 Zuvor hatte der Koordinator ge-<br />
klagt, dass „Fremde“ kaum noch abgeschoben würden, jeder wisse inzwischen offenbar, dass<br />
er einige Jahre bleiben könne.<br />
»Mehr Mut zur Menschlichkeit«: Kirchliche und kirchennahe Kritik<br />
Deutlich weniger im kritischen Diskurs präsent sind die römisch-katholische Kirche, kirch-<br />
liche Organisationen und religiös bewegte oder so argumentierende Einzelpersonen. Ein be-<br />
trächtlicher Teil kritischer Statements aus diesem Spektrum appelliert an die christliche<br />
Nächstenliebe oder, nicht explizit christlich konnotiert, schlicht an Mitgefühl und Mensch-<br />
lichkeit, Verständnis und Güte. Dieser Bereich des kritischen Diskurses knüpft damit moti-<br />
visch unverkennbar an den Mitleidsdiskurs an. Exemplarisch kommt diese Form der Kritik<br />
etwa in einigen Briefen von LeserInnen an die Tiroler Tageszeitung zum Ausdruck, die von<br />
der Zeitung nach dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um den Rechtsanspruch Asyl-<br />
suchender auf Sozialhilfeleistungen Ende Jänner 2003 in ihrem „Leserforum“ publiziert wur-<br />
den. So forderte eine Leserin „mehr Mut zur Menschlichkeit“ ein und fragte sich, „ob ein<br />
christlichsozialer Politiker, ein Landeshauptmann vom Format eines Dr. van Staa, es notwen-<br />
dig hat, nach Wählerstimmen in einem bestimmten ideologischen Lager zu fischen, indem er<br />
den Ärmsten der Armen Rechte beschneidet“:<br />
„Kann er sich mit gutem Gewissen über die Not von Menschen hinwegsetzen, die gezwungen waren, ihre<br />
Heimat zu verlassen? [...] Kosten 10, 30 oder auch 50 Asylwerber mehr so viel, dass ein reiches Bundesland<br />
wirklich Angst haben muss? Ich frage mich, ob es eines Landeshauptmanns würdig ist, derartige rigide und populistische<br />
Maßnahmen zu setzen, die sehr viel Kraft kosten. All die Kraft könnte man auch positiv einbringen<br />
für Regelungen, die Menschen, die bis zu ihren Wurzeln, ihrer Heimat, alles verloren haben, ihr Selbstwertgefühl,<br />
ihre Würde und ihren Lebensmut zurückzugeben! Derartige Regelungen [...] stellen hohe Anforderungen<br />
– an Verständnis, Geduld, Menschlichkeit, Herzensgüte und vor allen Mut!“ 359<br />
Auch ein Mitinitiator der „Aktion Herbergssuche“, Pater Johannes König, meldete sich zu<br />
Wort: Er appellierte an den Landeshauptmann, dabei mitzuhelfen, dass „die paar Flüchtlinge,<br />
um die es tatsächlich geht, nicht auf die Straße im Kreis geschickt werden“. Es ginge „um<br />
Menschen, die es irgendwie bis zu uns geschafft haben, und zu allererst sollen sie erfahren,<br />
dass mit ihnen als Menschen umgegangen wird. Dann brauchen sie nicht stehlen gehen oder<br />
aus Hoffnungslosigkeit aggressiv werden.“ 360 Wie im Fall des Mitleidsdiskurses, so legen<br />
diese Ausführungen nahe, wird auch im christlich motivierten kritischen Diskurs zuweilen ein<br />
Bild Asylsuchender konstruiert, das diese als „unmündig“ zeigt – in diesem Fall derart un-<br />
mündig, dass ihnen nicht wie anderen erwachsenen Menschen zugemutet werden kann, für<br />
ihre Handlungen und deren Konsequenzen die volle Verantwortung übernehmen zu müssen.<br />
358 Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 29.10.2004a.<br />
359 Tiroler Tageszeitung 25.01.2003a.<br />
360 Tiroler Tageszeitung 25.01.2003b.<br />
88
Geradezu verständnisvoll-freundlich war der Charakter jener Appelle, die rund um die Ein-<br />
richtung der Notschlafstelle für obdachlose Asylsuchende im Saal des Innsbrucker Caritas-<br />
Integrationshauses von dessen Leiter, Jussuf Windischer, Ende 2003 an die Politik gerichtet<br />
wurden. „25 Leute unterzubringen“, so Windischer in Richtung der zuständigen Landesrätin,<br />
„ist das so ein Problem?“ 361 Landeshauptmann van Staa und der Innsbrucker Bürgermeisterin<br />
Zach legte der Leiter Maßnahmen zur Beseitigung der Obdachlosigkeit mit treuherzigen<br />
Worten nahe: „Bleibt der Saal leer, lade ich van Staa und Zach zum Essen ein.“ 362 Im lokalen<br />
Stadtblatt hielt Windischer schließlich in aller Schlichtheit fest: „Uns ist der Mensch wichtig<br />
– keiner darf erfrieren.“ 363 Ein wenig Mitgefühl mit den frierenden und notleidenden Men-<br />
schen, so die offenkundige Botschaft, wäre doch auch von der Politik, zumal der sich auf die<br />
katholische Soziallehre berufenden, zu erwarten.<br />
Menschenrechte und Professionalisierung: Zivilgesellschaftliche Kritik<br />
Anders als die christlich motivierten KritikerInnen treten zivilgesellschaftliche Netzwerke und<br />
Organisationen meist nicht mit Appellen an Moral und (Mit-)Gefühl in Erscheinung, sondern<br />
mit klar formulierten und oft detailliert begründeten Forderungen nach konkreten (Menschen-)<br />
Rechten und Verbesserungen. Häufig gelangt dabei das Mittel der künstlerischen Intervention<br />
im öffentlichen Raum zur Anwendung; das Sichtbarmachen von Armut und Rechtlosigkeit<br />
sowie das Eingreifen in jene Felder, in denen Bedeutungen gemacht und vermittelt werden 364 ,<br />
stehen entsprechend im Vordergrund. Im Diskurs sind diese Forderungen allerdings bislang<br />
eher Randerscheinungen – ein Umstand, der auf die äußerst kleinteilige und daher heterogene,<br />
teilweise regelrecht fragmentierte Struktur der „Szene“ zurückzuführen ist, der es so kaum<br />
gelingt, eine jenseits von aktionistischen Auftritten wahr- und ernstgenommene<br />
„Gegenmacht“ aufzubauen.<br />
In der für den Diskurs zentralen tagesaktuellen Berichterstattung ist zivilgesellschaftliche<br />
Kritik daher bislang vorrangig zu den „heiligen Zeiten“ der einschlägig arbeitenden Netz-<br />
werke und NGOs präsent, etwa am „Internationalen Tag des Flüchtlings“ am 20. Juni 365 oder<br />
im Rahmen des jeweils zu Jahresbeginn stattfindenden Innsbrucker „Integrationsballs“. 366<br />
Daneben wird sporadisch auch gesondert auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse reagiert,<br />
etwa auf die Obdachlosigkeit von Asylsuchenden 367 , die Beseitigung des Sozialhilferechtsan-<br />
361<br />
Windischer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 12.12.2003.<br />
362<br />
Windischer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 23.10.2003. Tatsächlich öffnete die Stadt Innsbruck über die<br />
Feiertage eine kommunale Herberge auch für Asylsuchende. Der Innsbrucker Caritas-Direktor Georg Schärmer<br />
reagierte begeistert und schloss sich, wenn auch etwas holprig, der herzlichen Stimmung an: „Die Bürgermeisterin<br />
zeigt nicht nur ein großes Herz, dem Füße und Hände gewachsen sind, sondern auch den nötigen Mut zum<br />
Handeln.“ (Schärmer, zit. nach Stadtblatt Innsbruck 07.01.2004)<br />
363<br />
Windischer, zit. nach Stadtblatt Innsbruck 29.12.2003.<br />
364<br />
Vgl. Schenk 2000, 64.<br />
365<br />
Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 20.06.2003; siehe auch Die Initiative 2003; Ralser 2003.<br />
366<br />
Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 08.01.2003 und 05.01.2004; Der Standard 12.01.2004.<br />
367<br />
So etwa im Rahmen der bereits mehrmals angesprochenen „Aktion Herbergssuche“.<br />
89
spruchs für Flüchtlinge 368 oder auf Pläne zur Errichtung eines Containerlagers für Asyl-<br />
suchende in Innsbruck. 369 Bei einem Vergleich der Berichterstattung wird allerdings rasch<br />
deutlich, dass die Präsenz konkreter zivilgesellschaftlicher Forderungen in der in Wien er-<br />
scheinenden Tageszeitung Der Standard jene im regionalen Leitmedium Tiroler Tageszeitung<br />
bei weitem übersteigt: Selbst bei zivilgesellschaftlichen Aktionen berichtet letztere bevorzugt<br />
auf der Ebene des Mitleidsdiskurses. 370<br />
Dem Bereich der zivilgesellschaftlichen Kritik zuzuordnen sind bislang auch einschlägige<br />
Statements von PolitikerInnen der Grünen, was vor dem Hintergrund der Entstehung der Par-<br />
tei aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen und der nach wie vor gepflegten<br />
Rekrutierungspraxis kaum überraschen kann. Die fraktionsintern für den Migrationsbereich<br />
zuständige grüne Landtagsabgeordnete Elisabeth Wiesmüller setzte sich in der jüngsten Ver-<br />
gangenheit teils vehement für zivilgesellschaftliche Forderungen und deren Richtschnur –<br />
individuelle Rechte – ein. Scharf kritisierte sie etwa nach dem Beschluss der Beseitigung des<br />
Sozialhilferechtsanspruchs durch die Landtagsmehrheit die relativierende Aussage der zu-<br />
ständigen Landesrätin, dass sich durch die neuen Bestimmungen ohnehin nichts ändern<br />
würde, weil man die Vollzugspraxis beibehalten wolle: „Durch die Einführung der Kann-Be-<br />
stimmung werden Asylwerber zu Bittstellern degradiert, die der Gnade und dem Wohlwollen<br />
einzelner Beamter ausgeliefert sind.“ 371 Wiederholt forderte Wiesmüller auch eine Professio-<br />
nalisierung der Flüchtlingsarbeit des Landes ein. 372 Forderte die Grün-Politikerin wie im<br />
Februar 2004 ein „Mindestmaß an Menschlichkeit“, so definierte sie dieses als konkreten<br />
„Anspruch auf ein Dach über dem Kopf, Verpflegung und medizinische Versorgung“ für jeden<br />
Flüchtling. 373<br />
5.7 Ein Land in Panik: »Wer hat an der Uhr gedreht?«<br />
Hervorstechendstes Charakteristikum einer Asylmissbrauchsdebatte ist, dass sie, wie Diner<br />
bereits Anfang der 1990er treffend bemerkte, keinesfalls in pragmatischer Absicht geführt<br />
wird, sondern als „Kontroverse um die letzten Dinge“. 374 Diner schreibt der Debatte daher<br />
auch das Potential zu, gleich ein ganzes Parteiensystem aus den Angeln zu heben und so die<br />
„parteienstaatliche Fundierung der Republik“ zu gefährden 375 – eine Einschätzung, die zumin-<br />
dest einen Eindruck von der Macht der Dynamiken gibt, die über Missbrauchsdebatten freige-<br />
setzt werden können. Tatsächlich hat die hier in den Grundzügen nachgezeichnete regionale<br />
„Dauerdebatte“ und die damit verbundene permanente Präsenz der Figur des überaus bedroh-<br />
lichen, weil letztlich „kriminellen Asylanten“ (und des diese Figur noch kenntlicher machen-<br />
368 Vgl. Der Standard 27.03.2003.<br />
369 Vgl. Der Standard 08.05.2004.<br />
370 Vgl. hierzu etwa Tiroler Tageszeitung 08.01.2003, 05.01.2004 und 07.06.2004.<br />
371 Wiesmüller, zit. nach Tiroler Tageszeitung 22.03.2003.<br />
372 Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 20.06.2003.<br />
373 Tiroler Tageszeitung 26.02.2004.<br />
374 Diner 1992, 76.<br />
375 Ebd.<br />
90
den „Gegenbilds“ der mitleiderregenden Flüchtlingsfamilie) in Tirol in der jüngsten Vergan-<br />
genheit ein Klima der imaginierten Angst und in der Folge der Ablehnung etabliert, das Asyl-<br />
suchende nicht nur zum Gegenstand der Zuschreibung gängiger Fremdstereotypen macht,<br />
sondern sie darüber hinaus zumindest partiell als Feindbild im Sinne Becks erscheinen lässt.<br />
Forderungen wie jene nach einer Abschiebung (eventuell sogar in den Verfolgerstaat) trotz<br />
laufendem Asylverfahren oder nach einer Internierung Asylsuchender in „besonderen Quar-<br />
tieren“ weisen deutlich in diese Richtung. 376 Dieses Klima manifestiert sich mittlerweile quer<br />
durch das Land in regelmäßigen Abständen und in teils grotesker Weise. Mit drei Beispielen<br />
soll dies für die Ebenen der Landespolitik, der Landeshauptstadt und der ländlichen Gemein-<br />
den – hier in Form einer Tourismusgemeinde, in der sich eine Unterkunft für Asylsuchende<br />
befindet – illustriert werden:<br />
• Achse Tirol – Kärnten: Das Land Tirol profilierte sich im asylpolitischen Bereich auf<br />
Bundesebene spätestens ab dem Winter 2002/03 und den zu dieser Zeit geführten Diskus-<br />
sionen rund um die Thematik der Sozialhilfe für Asylsuchende mehr und mehr als trei-<br />
bende Kraft hinter weiteren asylrechtlichen Verschärfungen. Neben der von Landes-<br />
hauptmann van Staa 2004 erhobenen Forderung nach einer Internierung Asylsuchender<br />
ohne Identitätsnachweis und seiner expliziten Unterstützung der Idee Innenminister<br />
Strassers, straffällig gewordene Asylsuchende nach Verbüßen ihrer Haft in „Sicherungs-<br />
haft“ zu nehmen 377 , zeigte sich dies in einem erstmals Mitte Juni dieses Jahres praktizier-<br />
ten politischen „Doppelpassspiel“ zwischen van Staa und dem Kärntner Landeshauptmann<br />
Jörg Haider, als beide gegenüber dem Bund mit einer einseitigen Lösung der „Grundver-<br />
sorgungsvereinbarung“ drohten. 378 Anfang September setzten van Staa und Haider<br />
gemeinsam eine „Sonderkonferenz“ der Landeshauptleute zum Streit um die Länderquo-<br />
ten durch. 379 Den von Haider im Rahmen dieser Konferenz erhobenen und gegen den<br />
Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) gerichteten Vorwurf, Wien hätte 6.000 „Ille-<br />
gale“ in das Versorgungssystem „hineingeschleust“ 380 , machte sich van Staa rasch zu<br />
eigen: Bereits zwei Tage nach der Konferenz sprach er davon, dass 8.000 Personen aus der<br />
Illegalität „aufgetaucht“ seien, nur deshalb sei die Zahl der unterzubringenden Asyl-<br />
suchenden so hoch. 381 Diese bislang „untergetauchten“ Flüchtlinge, so der Landeshaupt-<br />
376<br />
Feindbilder, so Beck (1996, 338f), seien „dramaturgisch gesteigerte und ins Legitime gewendete, kulturell<br />
erzeugte (verfügbare) Vorurteile und Fremdstereotype, die funktionalisiert werden für den Auf- und Ausbau des<br />
staatlichen Macht- und Militärapparats. Feindbilder – im Unterschied zu Fremdstereotypen und Rassenvorurteilen<br />
– ermöglichen eine Umwertung der Werte. Hier darf, muß (im Kriegsfall) getötet werden. Für Feindbilder<br />
gibt es keine Schlichtungsinstanz, kein Gericht. Feindbilder stellen eine zweite, neben-, außer-, ja gegendemokratische<br />
Legitimationsquelle des modernen (National-)Staates dar; diese gewinnt gerade mit den Schwierigkeiten<br />
demokratischer Konsensbildung für staatliche Akteure an Attraktivität.“<br />
377<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 20.11.2004.<br />
378<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 16.06.2004a: „Asylpläne bringen Länder in Rage: Van Staa und Haider drohen<br />
Innenminister“.<br />
379<br />
Der Standard 08.09.2004; vgl. Tiroler Tageszeitung 29.10.2004b.<br />
380<br />
Tiroler Tageszeitung 21.09.2004a.<br />
381<br />
Tiroler Tageszeitung 22.09.2004.<br />
91
mann knapp zwei Wochen später, „fallen unserer Meinung nach nicht in die Grundversor-<br />
gung“. 382 Im Spätherbst 2004 traten Tirol und Kärnten schließlich gemeinsam mit der<br />
Forderung nach einer Einschränkung der „Grundversorgung“ auf: Im Rahmen einer Lan-<br />
deshauptleutekonferenz forderte man eine Erschwerung der Gewährung von Mietbeihilfe<br />
für Asylsuchende, indem diese nur noch ausgezahlt werden solle, wenn ein vergebührter<br />
Mietvertrag vorliege – <strong>Medien</strong>berichten zufolge hätten durch eine derartige Maßnahme<br />
rund 10.000 der 26.000 im System der „Grundversorgung“ befindlichen Asylsuchenden<br />
kein Mietgeld mehr zu erwarten gehabt. 383<br />
• Das „Attentat“ von Innsbruck: In der zweiten Junihälfte des Jahres 2004 kam es im vorü-<br />
bergehend auch als Flüchtlingsunterkunft genutzten Schloss Mentlberg in Innsbruck zu<br />
einem Vorfall, der zu einem bemerkenswerten Großeinsatz der Polizei geführt hatte: Ein<br />
Zeiger der Uhr des durchaus baufälligen Schlossturmes war herunter- und neben einen<br />
Betreuer des Roten Kreuzes gefallen. „Wer hat an der Uhr gedreht?“, fragte die Tiroler<br />
Tageszeitung und berichtete besorgt:<br />
„Fiel der 30 Zentimeter lange und etwa ein halbes Kilo schwere Minutenzeiger des Flüchtlingsheims Mentlberg<br />
von selbst aus der Uhr und vor die Füße eines Rot-Kreuz-Betreuers? Oder hatte ein Unbekannter seine<br />
Hände im Spiel? Unfall oder Attentat? Sechs Funkstreifen rückten Montag gegen 20.20 Uhr aus, um dieser<br />
Frage auf den Grund zu gehen. [...] Das Ergebnis der Ermittlungen: Ob sich der Zeiger von selbst gelöst hat<br />
oder abmontiert und nach dem Betreuer geworfen wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Der Aufprall fünf<br />
Meter von der Hauswand entfernt neben dem Betreuer scheint auf ein Attentat hinzudeuten. Dass der Lack<br />
an der Befestigungsschraube unversehrt war, wird als Indiz für einen Unfall gewertet. Der massive Polizeieinsatz<br />
hatte aber einen weiteren Grund. Schon am Nachmittag hatte die Ankunft von mehreren Tschetschenen<br />
für Probleme im Flüchtlingsheim gesorgt. Zwei Familien weigerten sich, gemeinsam ein Zimmer zu<br />
belegen. [...] Als die Betreuer die Unterbringung in einem anderen Heim in Aussicht stellten, kam es zu<br />
Tumulten. Die übrigen Bewohner erklärten sich mit den Familien solidarisch und drohten mit einem Generalstreik.<br />
Zwei Funkstreifen-Besatzungen benötigten zwei Stunden, um die Situation zu beruhigen. Eine<br />
weitere Stunde nach dem Abrücken der Streifen fiel der Zeiger aus der Uhr. »Es war nicht ausgeschlossen,<br />
dass ein Zusammenhang, [sic!] zwischen den Ereignissen am Nachmittag und dem Zeiger gegeben ist«,<br />
nennt Sicherheitsdirektor Hans Ebenbichler den Hintergrund für den Großeinsatz.“ 384<br />
Abgesehen von der auf ein beträchtliches Defizit an Professionalität wie auch auf mangel-<br />
hafte Standards hindeutenden Vorgangsweise bei der versuchten Einquartierung gleich<br />
zweier tschetschenischer Familien in einem einzigen Zimmer, wo die mit ihrer Arbeit of-<br />
fenkundig heillos überforderten BetreuerInnen des Roten Kreuzes die Unterstützung aus-<br />
gerechnet der Polizei benötigten, weist dieses Beispiel in besonders deutlicher Weise auf<br />
die von blankem Misstrauen gegenüber Asylsuchenden gekennzeichnete und zu teils re-<br />
gelrecht panischen Reaktionen führende Grundstimmung in Tirol. Erst vor diesem Hinter-<br />
grund wird die an krause Verschwörungstheorien erinnernde Idee, ein Asylsuchender<br />
könne ein Attentat auf einen Betreuer des Roten Kreuzes ausgerechnet mit dem zu diesem<br />
Zweck zuvor mühsam vom Schlossturm abgeschraubten Minutenzeiger der Turmuhr<br />
verübt haben, zumindest annähernd nachvollziehbar.<br />
382 van Staa, zit. nach Der Standard 06.10.2004.<br />
383 Der Standard 03.12.2004.<br />
384 Tiroler Tageszeitung 24.06.2004b.<br />
92
• „Prostitution“ in Kössen: In der im äußersten Nordosten Tirols gelegenen Tourismusge-<br />
meinde Kössen, in der sich seit Herbst 2002 eine Flüchtlingsunterkunft der öffentlichen<br />
Hand befindet 385 , führte bald nach dem Bezug der Einrichtung ein Gerücht zu gemeinde-<br />
internen Diskussionen, die der örtliche Bürgermeister wie folgt schildert:<br />
„Es waren einmal drei Frauen da. [...] Die haben halt dann auch – ich hab sie nie so angetroffen, obwohl ich<br />
auch dann abends fallweise nach einer Sitzung ein bisschen unterwegs bin – haben sie halt, weil’s ja nicht<br />
verboten und auch nicht untersagt worden ist, ein bisschen unters Volk gemischt und waren einmal fallweise<br />
dann auf dem Weg, und die haben ... da ist dann eh auch sofort der Ruf aufgetaucht: Die baggern die Männer<br />
an. Das war ... oder auch umgekehrt: Die haben sich anbaggern lassen von Männern. Mein Gott, das hat sogar<br />
bis zu ... »Die machen da was Gewerbliches draus ...« – Ich muss sagen, ich bin doch ... wir sind nicht so<br />
groß, und ich hab doch mein Ohr sehr bei den Leuten, da trau ich mich fast so ein bisschen zu behaupten –<br />
aber alles erfrag ich jetzt auch wieder nicht! [lacht] –, aber da werden natürlich ... da ist also die ... die<br />
öffentliche Meinung sofort mit was äußerst Negativem da.“ 386<br />
Schon das Gerücht, zwei Asylwerberinnen würden sich prostituieren – in gewisser Weise<br />
eine explizit von erotischer Faszination geprägte Spielart des Motivs „Oscar O.“ – führte<br />
zu einer hektischen Reaktion der Gemeinde und einer ebensolchen der Landesverwaltung:<br />
„Aber da hat’s dann ein kurzes Telefonat [mit Flüchtlingskoordinator Peter Logar, Anm. RP] gegeben, und<br />
[...] das Ergebnis daraus war: Bevor überhaupt ein Problem nur auftaucht, hat er die sofort wo anders hingesetzt.<br />
[...] Also da hat man also gesehen, bevor da wieder was vom Negativen ins Positive herumgezogen<br />
werden muss, bevor überhaupt was Negatives ... hat er schon reagiert und hat gesagt: Nein, dann tun wir die<br />
wo anders hin.“ 387<br />
385 Siehe hierzu ausführlich Abschnitt 7.3.<br />
386 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 356-365.<br />
387 Ebd., Z 367-370.<br />
93
Analyse
6 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Das zweite Halbjahr 2003 in Einzelfalldarstellungen<br />
Die Frage der Wahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten für Asylsuchende ist in Tirol<br />
weder in Form von Gesetzen, Verordnungen oder Weisungen verbindlich geregelt, noch be-<br />
stehen unverbindliche Richtlinien, die bestimmte Auswahlkriterien und eine einheitliche Vor-<br />
gangsweise empfehlen und so einen gewissen Handlungsrahmen schaffen würden. Die zu-<br />
ständige Landesrätin Christa Gangl hält im Interview Anfang 2004 auf eine diesbezügliche<br />
Frage lediglich allgemein fest, das Land habe ja einen „gesetzlichen Auftrag“ 1 , in diesem<br />
Rahmen bewege sich natürlich auch der Flüchtlingskoordinator des Landes, Peter Logar, mit<br />
dem sie „regelmäßig Besprechungen“ habe und der „mein ganzes Vertrauen in dieser Hinsicht<br />
hat“. 2 Auch Logar selbst verneint die Frage nach Vorgaben, an die er sich bei der Auswahl<br />
und Realisierung von Unterkünften zu halten habe. Seine Vorgangsweise charakterisiert der<br />
Koordinator daher als „von Fall zu Fall verschieden“. 3<br />
Die mit 1. Mai 2004 erfolgte bundesweite Umstellung auf das neue Unterbringungs- und Be-<br />
treuungssystem der „Grundversorgung“ hat an dieser Situation letztlich nichts geändert: Im<br />
Unterschied zu einzelnen anderen Bundesländern 4 verzichtete man in Tirol auch nach Inkraft-<br />
treten der „Grundversorgungsvereinbarung“ darauf, zumindest den Entwurf eines eigenen<br />
„Grundversorgungs-“ oder „Flüchtlingsaufnahmegesetzes“ zu entwickeln, um so das neue<br />
System auf landesgesetzlicher Ebene näher auszuführen und an die regionalen Besonderheiten<br />
anzupassen.<br />
Aus dem Fehlen klar definierter und schriftlich festgehaltener, zumindest jedoch öffentlich<br />
verbalisierter Konzepte und Strategien bezüglich der Wahl und Realisierung von Unterkunfts-<br />
standorten kann nun freilich noch nicht geschlossen werden, dass handlungsleitende konzep-<br />
tionelle Vorstellungen in keiner Form vorliegen. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die<br />
in den letzten Jahren praktizierte Standortwahl bestimmte Strukturmuster aufweist und in der<br />
bislang praktizierten Vorgangsweise bei der Realisierung von Unterkünften bestimmte<br />
Handlungsmuster erkennbar sind, die letztlich auf eine zwar nicht schriftlich fixierte, gleich-<br />
wohl jedoch vorhandene standortpolitische Agenda schließen lassen. Dieser Frage soll im<br />
Folgenden zunächst in Form von detaillierten Einzelfalldarstellungen der neun im zweiten<br />
Halbjahr 2003 betriebenen Unterkunftsstandorte nachgegangen werden.<br />
1<br />
Gemeint ist jene Verordnung, mit welcher der Vollzug der „Bundesbetreuung“ vom Innenministerium dem<br />
Landeshauptmann übertragen und die mit 01.05.2004 durch die „Grundversorgungsvereinbarung“ ersetzt wurde.<br />
Die Verordnung (wie auch die sie ersetzende Vereinbarung) enthielt keinerlei Regelungen bezüglich der Wahl<br />
und Realisierung von Unterkunftsstandorten.<br />
2<br />
Interview Gangl 09.02.2004, Z. 8f. Zur Rolle der routinemäßigen Arbeitsgespräche zwischen LandesrätInnen<br />
und SpitzenbeamtInnen vgl. Weber 2004, 91.<br />
3<br />
Interview Logar 10.10.2004, Z 149 und 189f.<br />
4<br />
Vgl. Langthaler 2004a.<br />
95
6.1 Fieberbrunn: Mitten in Europa am Ende der Welt<br />
Mit 123 untergebrachten Asylsuchenden Ende Juni 2004 5 ist die Fieberbrunner Flüchtlings-<br />
unterkunft seit ihrer Eröffnung die größte der vom Land Tirol betriebenen Unterkünfte. Nach<br />
wie vor wird sie von der öffentlichen Hand selbst verwaltet und betreut.<br />
6.1.1 Die Gemeinde: Zwischen Knappenmusik und Pharmaindustrie<br />
Fieberbrunn, eine 4.280 EinwohnerInnen 6 zählende Marktgemeinde im Bezirk Kitzbühel,<br />
befindet sich auf 790 Meter Seehöhe in der heute vor allem vom Tourismus geprägten Piller-<br />
seeregion. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, nach der Fertigstellung der über Fieberbrunn<br />
führenden Eisenbahnverbindung von Wörgl nach Zell am See, entwickelte sich die Gemeinde<br />
zu einem touristischen Zentrum in der Region 7 , heute ist sie ein Tourismusmagnet im Bezirk. 8<br />
Das Leben in der teilweise an der Grenze zum Bundesland Salzburg gelegenen Gemeinde war<br />
jedoch – wie die Region überhaupt – über mehrere Jahrhunderte hinweg wesentlich vom<br />
Bergbau bestimmt. Insbesondere die Abbaugebiete rund um den Bürglkopf spielten noch bis<br />
Ende der 1970er Jahre eine bedeutende Rolle im österreichischen Magnesitabbau 9 , nach wie<br />
vor existiert ein Werk des RHI-Tochterunternehmens Veitsch-Radex in der benachbarten<br />
Grenzgemeinde Hochfilzen. Im vergangenen Jahrhundert entstand in Fieberbrunn mit der<br />
international tätigen Gebro Pharma, einem der führenden österreichischen Arzneimittel-<br />
hersteller mit rund 250 Beschäftigten, ein für die Gemeindegröße wie auch die verkehrsgeo-<br />
graphisch nicht sonderlich günstige Lage vergleichsweise großer Industriebetrieb. Damit er-<br />
folgte der Übergang von der agrarischen in die Dienstleistungsgesellschaft – in Tirol eher eine<br />
Besonderheit 10 – hier nicht direkt, sondern über den Umweg einer zumindest partiellen<br />
Industrialisierung. Mit einer Schuhfabrik und mehreren Betrieben im Schotterabbau und im<br />
Baugewerbe verfügt Fieberbrunn heute zwar über einige weitere mittelständische Unternehmen,<br />
gleichwohl ist die Gemeinde nach wie vor auch land- und forstwirtschaftlich geprägt. 11<br />
Die Zahl der BewohnerInnen, die zu einer außerhalb Fieberbrunns gelegenen Arbeitsstätte<br />
pendeln, ist jedoch trotz Tourismus, Landwirtschaft und Industrie höher als jene der „EinpendlerInnen“.<br />
12<br />
Fieberbrunn verfügt über ein zwar traditionell geprägtes, aber durchaus heterogenes Vereins-<br />
leben, das auf eine relativ gefestigte Gemeindeidentität schließen lässt: Neben dörflichen In-<br />
5<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
6<br />
Stand 31.12.2003 (vgl. AdTLR 2004). Die Daten zur Wohnbevölkerung in den übrigen untersuchten Gemeinden<br />
entstammen eben dieser Quelle.<br />
7<br />
Vgl. Köfler 1979, 197-203.<br />
8<br />
Mit 236.640 Nächtigungen im Winter und 195.694 Nächtigungen im Sommer 2003 nimmt Fieberbrunn diesbezüglich<br />
einen der vorderen Ränge im Bezirk Kitzbühel ein (AdTLR 2004).<br />
9<br />
Vgl. Mutschlechner 1979; Pirkl 1979.<br />
10 Vgl. Preglau 2004.<br />
11 Vgl. AdTLR 2004.<br />
12 Vgl. ebd.<br />
96
stitutionen wie der Knappenmusikkapelle, der obligaten Schützenkompanie oder den „Volks-<br />
tanzlern“ sind eine Reihe verschiedener Sportvereine (bis hin zum „Billardclub Saustall“) in<br />
der Gemeinde präsent. Ein Amateurfilmerclub sorgt für Fieberbrunner Teilnahmen an Film-<br />
wettbewerben, umgekehrt bringt der „Kulturbrunnen“ Veranstaltungen jenseits des traditio-<br />
nellen Repertoires ins Dorfleben ein. Mit dem sommerlichen, Jazz und Blues gewidmeten<br />
„Bourbon Street Festival“ ist der Ort überdies jährlich Schauplatz eines „urbanen“ Events.<br />
Traditionell geprägt, aber durchaus heterogen ist auch die politische Struktur Fieberbrunns:<br />
Bei den Gemeinderatswahlen Anfang März 2004 verlor die ÖVP-Liste des Bürgermeisters<br />
Herbert Grander ein Mandat, sie verfügt jedoch immer noch über beachtliche acht Mandate.<br />
Die mit ihr gekoppelte Liste „Alt und Jung für Fieberbrunn“ konnte ihre drei Mandate halten.<br />
Aufwärts ging es für die SPÖ, die nun drei Mandate hält und damit eines dazugewann, die mit<br />
ihr gekoppelte und nach dem gleichnamigen Ortsteil benannte „Liste Pfaffenschwendt“<br />
konnte ihren Prozentanteil leicht erhöhen, behielt jedoch ihre zwei Mandate. Erstmals ange-<br />
treten sind in Fieberbrunn die Grünen, die auf Anhieb einen Sitz im Gemeinderat erreichten,<br />
diesen verlassen musste hingegen die FPÖ, die gerade noch drei Prozent der Stimmen erhielt.<br />
Trotz der fast acht Prozent Verluste seiner Fraktion konnte Gemeindeoberhaupt Grander bei<br />
den Direktwahlen um das Bürgermeisteramt sein 80-Prozent-Ergebnis von 1998 halten.<br />
6.1.2 Der Standort: Leben und Arbeiten im »Schneeloch Tirols«<br />
Die Fieberbrunner Unterkunft befindet sich auf einem in 1.244 Meter Seehöhe gelegenen<br />
kleinen Hochplateau auf dem Ofenberg, der „Nordflanke“ des insgesamt 1.790 Meter hohen<br />
Bürglkopfs. Vom Dorfzentrum etwa neun Kilometer entfernt, kann das dem Ortsteil Trixlegg<br />
zugeordnete, fern jeder Besiedelung liegende Plateau nur über eine Richtung Hochfilzen füh-<br />
rende Nebenstraße erreicht werden, die ab dem noch im Tal und unmittelbar an der Gemein-<br />
degrenze gelegenen Gasthof Eiserne Hand 13 – dem letzten bewohnten Gebäude vor der Unter-<br />
kunft – nicht mehr asphaltiert ist, sondern als Forststraße in vielen Windungen gut 450<br />
Höhenmeter durch den Wald nach oben führt. Erst im Bereich des terrassenförmig angelegten<br />
Unterkunftsareals ist die Straße wieder asphaltiert, hier gibt es sogar eigene Straßenlampen.<br />
Der im Besitz der Firma Veitsch-Radex befindliche Gebäudekomplex 14 auf dem Gelände<br />
wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts ursprünglich als eines von zwei „Lagern“ 15 für die<br />
am „Bürgl“ tätigen Bergarbeiter errichtet, woran noch heute die Benennung des größeren der<br />
beiden Wohngebäude („Knappenhaus“) sowie eines Werkstättengebäudes („Zechenhaus“)<br />
erinnern. Auch eine zu den in Hochfilzen angesiedelten Magnesitwerken führende Material-<br />
13 Bedeutung und Herkunft dieses martialischen Namens sind nach Caramelle (1979, 290f) nicht näher bekannt.<br />
Bei der an einer Außenwand der beim Gasthof gelegenen Kapelle angebrachten und wohl namensstiftenden<br />
stilisierten „eisernen Hand“ schließt er auf die wenig kriegerische Funktion eines Wegweisers zu den in dieser<br />
Richtung gelegenen Bergbaurevieren.<br />
14 Vgl. Interview Grander 06.11.2003, Z 18f. Das Land Tirol hat die für die Flüchtlingsunterbringung nötigen<br />
Gebäude von diesem Unternehmen gepachtet (ebd.).<br />
15 Pirkl 1979, 431.<br />
97
seilbahn, mit welcher der gebrochene Rohmagnesit ins Tal geschafft wurde, weist auf die<br />
frühere Nutzung hin. Die Wohngebäude wurden indessen von den Bergarbeitern schon bald<br />
nach ihrer Errichtung nicht mehr als Unterkünfte genutzt, auch das in Nähe liegende Abbau-<br />
revier „Bürgl“ wurde in den 1970ern aufgegeben. 16 In der Folge wurde das Areal an das<br />
Österreichische Bundesheer vermietet, das dort etwa 25 Jahre lang ein „Ausbildungs- und<br />
Erholungsheim“ betrieb 17 , bevor in der ersten Hälfte der 1990er erstmals Flüchtlinge unterge-<br />
bracht wurden. Das „Flüchtlingsheim Bürglkopf“ – so der heutige Name – verfügt neben dem<br />
aufgrund der stufenförmigen Gestaltung des Areals je nach Perspektive zwei- bis dreistöcki-<br />
gen und als Wohngebäude dienenden „Knappenhaus“ (das auch mit einer Lehrküche ausges-<br />
tattet ist), einem an der Talseite des Knappenhauses errichteten einstöckigen Vorbau und dem<br />
gegenwärtig eine Kfz-Werkstatt 18 sowie die unterkunftseigenen Kleinbusse beherbergenden<br />
„Zechenhaus“ über ein weiteres, einstöckiges Wohngebäude. Einige kleinere Lager- und<br />
Werkstättengebäude werden nach wie vor von Veitsch-Radex genutzt. Alle Gebäude sind als<br />
schlichte Zweckbauten ausgeführt, nach einer Fassadensanierung in der jüngsten Vergangen-<br />
heit wirken sie jedoch durchaus freundlich. An der Bergseite des Areals befindet sich ein<br />
Schrottplatz mit mehreren Autowracks, in dessen nächster Umgebung offenbar auch Abfall<br />
verbrannt wird. 19<br />
Das gesamte Gelände ist von Wald umschlossen, aufgrund der terrassenförmigen Anlage hat<br />
man von der obersten Ebene eine beachtliche Fernsicht auf die Gebirgslandschaft. 20 Die am<br />
südlichen Ende steil aufragenden Felsen des Bürglkopfs bewirken im Frühjahr, Spätherbst<br />
und Winter, dass die Sonne mittags vom Berg verdeckt wird, das Areal daher im Schatten<br />
liegt und es vorübergehend empfindlich abkühlt.<br />
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Unterkunft aufgrund ihrer Lage nicht erreichbar.<br />
Würde man den Weg vom Ortszentrum zur Unterkunft zu Fuß zurücklegen wollen, wären<br />
zumindest zwei Stunden Wegzeit zu veranschlagen – allein vom Ortszentrum bis zum im Tal<br />
an der Zufahrt zur Unterkunft gelegenen Gasthof Eiserne Hand ist der Weg als in gut 45 Mi-<br />
16 Ebd.<br />
17 Interview Logar 10.10.2003, Z 493-498.<br />
18 Die Werkstatt bildete ursprünglich einen integralen Bestandteil des „Projekts Bürglkopf“ (vgl. Prock 1995), in<br />
dem zur Erleichterung eines beruflichen Wiedereinstiegs nach einer Rückkehr in ihre Heimat zunächst bosnische,<br />
Ende der 1990er auch kosovarische Kriegsflüchtlinge nach Absolvierung eines Maschinenbau- bzw.<br />
Metallbearbeitungskurses in Wattens (vgl. Logar 2001) alte und gebrauchte Fahrzeuge, Geräte und Maschinen<br />
instandsetzen und als Wiederaufbauhilfe nach Bosnien-Herzegowina bzw. in den Kosovo „mitnehmen“ konnten.<br />
Trotz der geänderten Rahmenbedingungen wurde nach dem Ende der beiden Kriege die Werkstatt des Flüchtlingsheims<br />
fortgeführt, die dabei (von Mai 2003 bis März 2005 auch im Rahmen des EQUAL-Projekts „jobshop“;<br />
vgl. Öggl 2003a) von ausgewählten Asylwerbern instandgesetzten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen<br />
werden überwiegend vom Land Tirol als „Entwicklungshilfe“ (vgl. Tiroler Tageszeitung 30.11.2003) in die<br />
kosovarische Region Podujevë und in die in der serbischen Provinz Vojvodina gelegene Kleinstadt Indjija vermittelt<br />
(vgl. Logar 2001; Horst-Wundsam 2002; Tiroler Tageszeitung 14.03.2002, 13.05.2002, 30.11.2003; zuletzt<br />
u.a. Ascher 2004).<br />
19 So etwa während des Lokalaugenscheins am 06.11.2003.<br />
20 Wohl deshalb wurde gegenüber dem Verfasser während der Recherchen immer wieder geäußert, „da oben“<br />
hätten es die untergebrachten Asylsuchenden „wenigstens schön“.<br />
98
nuten zu bewältigender „Wanderweg“ ausgeschrieben. 21 Bei Schneelage ist die Unterkunft<br />
nur erreichbar, wenn auf der Forststraße zuvor der Schnee geräumt wurde. Die dafür nötigen<br />
Fahrzeuge und Geräte sind in den Unterkunftswerkstätten selbst vorhanden. Wenn es schneit,<br />
dann aufgrund der Höhenlage meist reichlich – der erwähnte Gasthof Eiserne Hand wirbt en-<br />
thusiastisch: „Im Schneeloch Tirols wird im Winter Ihr Herz höher schlagen. Gesicherte Ab-<br />
fahrten bis ins Tal und das bis Ostern!“ 22 Tatsächlich berichteten Besucherinnen der Unterkunft<br />
im Jahr 2001, sie hätten noch am 23. April etwa 75 Zentimeter Schnee gemessen. 23<br />
Um Termine in der mehr als zwanzig Kilometer entfernten Bezirkshauptstadt Kitzbühel oder<br />
in der 115 Kilometer entfernten Landeshauptstadt wahrnehmen zu können, müssen die<br />
BewohnerInnen mit einem der beiden unterkunftseigenen Kleinbusse zum zwölf Kilometer<br />
entfernten und am entgegengesetzten Ende des Ortes liegenden Bahnhof gebracht werden. 24<br />
In gleicher Weise müssen schulpflichtige Kinder zur Schule und kleinere Kinder zum Kinder-<br />
garten gebracht und wieder abgeholt 25 , Arzt- oder Apothekenbesuche erledigt 26 und die nöti-<br />
gen Einkäufe für die Küche besorgt werden. Abgesehen von den vom Berufsförderungsinsti-<br />
tut (bfi) geleiteten und auf dem Areal der Unterkunft selbst stattfindenden Qualifizierungs-<br />
maßnahmen in den Bereichen Küche und Metallbearbeitung bzw. Maschinenbau gibt es im<br />
Umkreis keine weiteren Bildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene – Fieberbrunn<br />
verfügt über keine Volkshochschule, an der etwa ein Hauptschulabschluss o.ä. nachgemacht<br />
werden könnte. 27<br />
Für die Freizeitgestaltung – vor allem aufgrund der mehrheitlich erzwungenen Untätigkeit für<br />
AsylwerberInnen von einiger Bedeutung – stehen auf dem Unterkunftsgelände selbst ein um-<br />
zäunter Hartplatz, ein schlichter Volleyballplatz mit Rasenboden sowie ein Basketballkorb zur<br />
Verfügung. Ein Spielplatz mit zwei hölzernen Gestellen für Schaukeln 28 , eine Sandkiste sowie<br />
ein kleiner Grillplatz samt gemauertem Ofen ergänzen das Angebot. Auch mehrere größere<br />
asphaltierte Flächen und einige Wiesenstücke auf verschiedenen Ebenen des Geländes können<br />
etwa für Ballspiele genutzt werden; der das Areal umgebende Wald ist für Kinder als Spiel-<br />
stätte interessant. Die Nutzung von Freizeiteinrichtungen oder abendliches „Ausgehen“ im<br />
21<br />
Vgl. Kayed et al. 2002, 28.<br />
22<br />
Vgl. Gasthof Eiserne Hand 2004 (Homepage).<br />
23<br />
Interview Beratung/Betreuung 02, 28.05.2001.<br />
24<br />
Für die Fahrt mit den Kleinbussen haben die Asylsuchenden – anders als noch vor einigen Jahren (vgl. Interview<br />
Beratung/Betreuung 02, 28.05.2001) – nach Auskunft der Unterkunftsleiterin nichts zu bezahlen, ihr zufolge<br />
übernimmt das Land die entstehenden Kosten (Interview Unterkunftsleitung 05/1, 06.11.2003, Z 19-23).<br />
Die Bahnfahrt nach Innsbruck dauert zwischen eineinhalb und eindreiviertel Stunden.<br />
25<br />
Neben einem Kindergarten und drei Volksschulen befindet sich in der Gemeinde auch eine Hauptschule und<br />
ein Polytechnischer Lehrgang.<br />
26<br />
Fieberbrunn verfügt neben einer Apotheke über vier Allgemeinmediziner, einen Facharzt für Chirurgie und<br />
zwei Zahnärzte. Auch das Rote Kreuz ist mit einer Ortsstelle in der Gemeinde vertreten; Sozialeinrichtungen im<br />
engeren Sinn gibt es jedoch nicht.<br />
27<br />
Die im Rahmen des EQUAL-Projekts „jobshop“ angebotenen Deutschkurse für ausgewählte Asylsuchende<br />
fanden in der Bezirkshauptstadt Kitzbühel statt.<br />
28<br />
Die Schaukeln hingen zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheins nicht an den Gestellen.<br />
99
Tal ist aufgrund der Lage der Unterkunft naturgemäß mit beträchtlichen Schwierigkeiten ver-<br />
bunden. Einschlägige Angebote im Sportbereich sind überdies stark auf den internationalen<br />
Tourismus ausgerichtet, etwa eine Sommersportschule, die neben einem funpark vor allem<br />
ice-climbing, canyoning und rafting anbietet.<br />
Weniger international ist die Gemeinde in religiösen Angelegenheiten: Für geistlichen Bei-<br />
stand steht lediglich die römisch-katholische Pfarrkirche zur Verfügung, die – um der Tradition<br />
Genüge zu tun – „mit ihrer dominierenden Lage das kulturelle Zentrum der Gemeinde“ 29<br />
bildet. Fieberbrunn verfügt damit über keinerlei Kirchen, Gebetsräume oder religiöse Treff-<br />
punkte anderer Religionen. Diese Situation spiegelt sich auch auf dem Feld der sogenannten<br />
Ergänzungsökonomie: Weder im Gastronomie- noch im Einzelhandelsbereich sind in der<br />
Gemeinde einschlägige Betriebe vorhanden.<br />
6.1.3 Die Standortwahl: »Und dann war’s eine politische Entscheidung ...«<br />
Wie erwähnt wurde die Fieberbrunner Unterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen erst-<br />
mals in der ersten Hälfte der 1990er genutzt. Während des Bosnienkriegs suchte man auch in<br />
Tirol dringend Unterkunftsmöglichkeiten für im Rahmen einer eigenen Bund-Länder-Aktion<br />
zu beherbergende bosnische de facto-Flüchtlinge 30 , der diesbezügliche Bedarf war somit<br />
öffentlich bekannt. Flüchtlingskoordinator Logar schildert vor diesem Hintergrund den Pro-<br />
zess der Standortwahl im Interview als durchaus unkompliziert:<br />
„[...] ich hab angefangen 1993 zum Arbeiten, vor zehn Jahren, und da hat [man] angerufen, da war gerade die<br />
Bosnierkrise, wie man mich eingestellt hat, und hat gesagt: Ich könnte das Haus zur Verfügung haben und ich<br />
soll mir das einmal anschauen. Und ich hab mir das angeschaut, ich war zum ersten Mal da oben, und hab dann<br />
abwägen angefangen, Vor- und Nachteile. Weil es ist ein großes Haus, es ist aber abgelegen, es sind die ganzen<br />
Schneeräumungen und alles, was da dazukommt, nur: der Druck damals, wir haben damals so 3.000 Leute dagehabt,<br />
dass ich gesagt habe: Gut, ich nimm’s. Und das Bundesheer hat mir geholfen, es einzurichten.“ 31<br />
Damit waren in Fieberbrunn, so Bürgermeister Herbert Grander, plötzlich „bosnische Flücht-<br />
linge in Mengen“ anwesend. Das Zusammenleben – soweit bei der Lage der Unterkunft gege-<br />
ben – gestaltete sich jedoch relativ unkompliziert, wie Grander resümiert:<br />
„[Wir] haben eigentlich in dieser Phase nie ein Problem gehabt. Nicht? Das heißt also, diese Kinder sind integriert<br />
worden, haben da auch die Schule besucht, und waren eigentlich ... fast nie Beschwerden gehabt, muss ich<br />
sagen. Also, ganz schlecht gefallen kann’s ihnen nicht haben, weil es sind einige Familien sogar jetzt in Fieberbrunn<br />
geblieben.“ 32<br />
Nach einigen Jahren wurde die Unterkunft wieder geschlossen, bevor sie während des Kriegs<br />
im Kosovo Ende der 1990er für kosovarische Flüchtlinge reaktiviert wurde. 33 Mit dem Aus-<br />
29 Caramelle 1979, 249.<br />
30 Zur Aktion wie auch zum besonderen Status von de facto-Flüchtlingen vgl. Rieser 1995, 63ff; UNHCR 1996,<br />
58-61; Wegscheider 1997, 44f; Grbic et al. 1998.<br />
31 Interview Logar 10.10.2003, Z 498-505.<br />
32 Interview Grander 06.11.2003, Z 9-12.<br />
33 Vgl. Interview Logar 10.10.2003, Z 505f.<br />
100
laufen der diesbezüglichen Unterbringungsaktion stand erneut eine Schließung der Unterkunft<br />
im Raum, wie Flüchtlingskoordinator Logar schildert:<br />
„Dann ist wieder die Diskussion der Schließung gewesen, und das war ja so, das ist ja ein Umweltproblem, weil<br />
keine Kanalisation ist, da. Und jetzt ist die Entscheidung gewesen: Kanalisierung und Renovierung, weil es sind<br />
ja die Häuser aus den 60er Jahren, oder Auflassung. Und dann hat sich wieder das Rad von hinten gedreht, dann<br />
hat man nämlich gesagt: Was bringt der Bürglkopf allgemein [...] – man hat Plus und Minus zusammengezählt.<br />
Bürglkopf ist das einzige, wo du auch eine Werkstatt dabeihast, wo immer Arbeitsprojekte laufen, und man hat<br />
alle Minussachen zusammengezählt, und dann war’s eine politische Entscheidung, dass Bürglkopf renoviert wird<br />
und bleibt.“ 34<br />
Waren bis dahin immer nur (Kriegs-)Flüchtlinge aus einer bestimmten (europäischen) Region<br />
mit einer mehr oder weniger klaren Rückkehrperspektive auf dem Areal untergebracht, wur-<br />
den nun erstmals Asylsuchende aus den verschiedensten Teilen der Welt und ohne eine derar-<br />
tige Perspektive in den Gebäuden einquartiert.<br />
6.1.4 Die Standortrealisierung: »Wir sind natürlich nicht gefragt worden«<br />
Die Gemeinde wurde, so Bürgermeister Grander, in die Diskussion um die Schließung oder<br />
Weiternutzung nicht eingebunden: „Wir sind natürlich nicht gefragt worden, und ich bin auch<br />
nicht eingeladen worden bei den Verhandlungen zwischen der Firma Veitsch-Radex und dem<br />
Land Tirol.“ 35 Er habe lediglich gewusst, dass das Land „was gesucht“ habe. Das Land müsse<br />
zwar zweifellos „erste Anlaufstelle“ sein, „aber dann, bevor was passiert, [...] gehört die Ge-<br />
meinde informiert“. 36 Für Grander stellte die Weiternutzung des Geländes als Unterkunft je-<br />
doch letztlich „kein Neuland“ mehr da, wie er mit Verweis auf die Unterbringung der bosni-<br />
schen Flüchtlinge festhält. 37 Auch in der Gemeinde selbst wurde der Entschluss zur dauerhaf-<br />
ten Nutzung als Flüchtlingsunterkunft zur Kenntnis genommen: Einige BürgerInnen hätten<br />
zwar Sorgen geäußert, so Grander, Proteste habe es jedoch nie gegeben. 38 Freilich sieht er<br />
diesbezüglich eine Verbindung zur beträchtlichen Entfernung des Unterkunftsareals vom<br />
Ortszentrum: Die „Masse selber“ bewege sich nicht im Dorf, „wenn’s da herunten wär’, wär’s<br />
sicher ... wär’s sicher ein Problem. Sicher.“ 39<br />
6.1.5 Am »Ende der Welt«? Der Standort in der Diskussion<br />
Die auf dem Unterkunftsgelände am „Bürgl“ vorhandenen Werkstätten und die damit verbun-<br />
dene Möglichkeit der Durchführung von Qualifizierungs- bzw. Arbeitsprojekten stellen für<br />
den Flüchtlingskoordinator des Landes den entscheidenden Pluspunkt des Standorts dar. Die<br />
ressortzuständige Landesrätin Gangl – ihr wurde der Standort von ihrem Vorgänger Prock<br />
„vererbt“ – rückt im Interview dagegen zunächst einen anderen Aspekt in den Vordergrund:<br />
34<br />
Ebd., Z 506-513.<br />
35<br />
Interview Grander 06.11.2003, Z 18f.<br />
36<br />
Ebd., Z 224f.<br />
37<br />
Ebd., Z 7 und 14f.<br />
38<br />
Ebd., Z 150f.<br />
39<br />
Ebd., Z 85f bzw. 241.<br />
101
Die Unterkunft sei „das »Ende der Welt«, so hab ich’s empfunden da drin beim Besuch“. 40<br />
Gangl steht mit diesem Eindruck keineswegs allein da: Aufgrund seiner Lage wurde der<br />
Standort in den letzten Jahren wiederholt und teils vehement kritisiert, die dabei verwendeten<br />
Formulierungen entsprechen jener Gangls teils wörtlich. So wurde etwa das „weit abgelegene<br />
Heim“ gerügt 41 , die „völlige Isolation, ohne Bus und Bahnverbindung“ 42 bemängelt, die Um-<br />
gebung der Unterkunft als „verlassenes Gebiet“ 43 charakterisiert und – vom Leiter der Inns-<br />
brucker Stadtcaritas, Jussuf Windischer – bereits Mitte 2001 lakonisch angemerkt, die Flücht-<br />
linge wollten „in die Stadt, nicht ans Ende der Welt.“ 44 Windischer hatte zum damaligen Zeit-<br />
punkt eben einer nigerianischen Flüchtlingsfamilie ein Notquartier in Innsbruck organisiert,<br />
um ihr das „abgelegene Lager Fieberbrunn zu ersparen“, wie die Tiroler Tageszeitung ver-<br />
ständnisvoll festhielt. 45 Wiederholt wurde die Fieberbrunner Unterkunft aufgrund ihrer räum-<br />
lichen Lage auch als besonders offensichtliches Beispiel einer „Politik der Desintegration“<br />
angeführt. 46<br />
Verbunden mit der Lage wurde immer wieder auch die Größe der Unterkunft, die eine Eska-<br />
lation interner Konflikte fördere, kritisch kommentiert. In Form eines Standortvergleichs<br />
brachte im Gespräch der Bürgermeister der im selben Bezirk angesiedelten Gemeinde<br />
Kössen, in der sich ebenfalls eine Unterkunft befindet, diesen Aspekt auf den Punkt:<br />
„Weil der Bürglkopf ist ja derart im letzten Winkel. [...] Die fallen also da im Ort gar nicht auf. Gut, es ist eine<br />
größere Zahl. Die werden da oben natürlich dann viel mehr beschäftigt in Werkstätten und so weiter, was ich<br />
mitgekriegt hab. [...] Aber auf der anderen Seite ist natürlich dieser Lagerkoller dann viel eher ... oder die<br />
Schwelle ... [...] die sehen sich ganz von der Früh bis zum Abend. Bei uns kann einer ... ja, der geht einmal ins<br />
Dorf, geht dann wieder heim Mittagessen, und geht dann wieder ins Dorf und der ... der sieht die Gruppe nicht,<br />
die ihm nicht zu Gesicht steht, nicht? [...] Und da baut der die Aggression nicht so auf. Das ist natürlich schon<br />
ein Vorteil. Nur da oben kann er sich nicht hintern Baum hineinsetzen, wenn wer einen Wirbel macht Ich kenn<br />
das ja, weil ich immer ein bisschen Wandern gegangen bin da, früher.“ 47<br />
Ein unterkunftsinterner Konflikt mündete Ende 2002 in eine Massenschlägerei und forderte<br />
sieben teils erheblich Verletzte – die regionale Tagespresse berichtete entsetzt von einem<br />
„Kleinkrieg“, der „einen der größten Einsätze im Bezirk Kitzbühel“ ausgelöst habe. 48<br />
40 Interview Gangl 09.02.2004, Z 70f.<br />
41 ANAR Tirol 2001; ähnlich Unterlechner 2002, 15.<br />
42 Pletzer 2002, 5.<br />
43 Ebd.<br />
44 Tiroler Tageszeitung 20.06.2001.<br />
45 Ebd.<br />
46 So etwa Kayed et al. 2002, 28.<br />
47 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 373-385.<br />
48 Tiroler Tageszeitung 18.12.2002b. Die Gendarmerie in Kitzbühel, so der Bericht, habe „alle verfügbaren<br />
Patrouillen“ entsandt, das Rote Kreuz sei mit „acht Rettungsfahrzeugen, sieben Ärzten und 43 Sanitätern an Ort<br />
und Stelle“ gewesen, überdies habe die Feuerwehr St. Johann ihr „aufblasbares Katastrophenzelt“ bereitgestellt<br />
und auch die Bergrettung sei am Einsatz beteiligt gewesen. – Für den Flüchtlingskoordinator des Landes und in<br />
weiterer Folge auch die regionale Presse lag der Vorfall ausschließlich in der Persönlichkeitsstruktur einer<br />
Gruppe von Asylwerbern mit vor allem georgischer Staatsangehörigkeit begründet: Vor dem Einzug der Männer<br />
habe in der Unterkunft immer „Ruhe und Eintracht“ geherrscht (Tiroler Tageszeitung 18.12.2002a und b). Zur<br />
Rolle des Vorfalls im Rahmen der regionalen „Asylmissbrauchsdebatte“ vgl. Abschnitt 5.1.3.<br />
102
Bereits unter Gangls Vorgänger Prock hatte auch der UNHCR die „Abgeschiedenheit“ der<br />
Unterkunft als „problematisch“ bezeichnet, nachdem Koordinator Logar und Gangl im Okto-<br />
ber und Dezember 2002 trotzdem davon gesprochen hatten, Tirol sei für seine Flüchtlings-<br />
betreuung „von UNO-Stellen sogar gelobt“ worden, bekräftigte UNHCR diese Kritik. 49 Der<br />
Koordinator wischt dies im Interview indessen vom Tisch: „Der UNHCR war gar nie dort.“ 50<br />
Überdies wollten die am Standort untergebrachten Asylsuchenden gar nicht weg:<br />
„[...] so alle paar Monate ergibt sich irgendwas. Und dann sag ich zur Heimleitung: Wir könnten zwanzig Leut’<br />
nach Volders oder wo hinbringen. Und komischerweise treten immer Probleme auf, weil die Leute nur ganz<br />
selten wegwollen.“ 51<br />
Ähnlich sieht es die Unterkunftsleiterin: Zwar seien die Flüchtlinge „am Anfang“ schon „ein<br />
bisschen betroffen“ und reagierten mit Äußerungen wie „Oh mein Gott, so abgelegen ...“,<br />
aber später wollten sie „gar nicht mehr weg“. 52 Man könne zwar nicht, „wenn man jünger ist,<br />
einfach am Abend in die Disco gehen“, aber irgendwie ginge ja sogar das – „da tun sich halt<br />
ein paar zusammen und zahlen dann halt zwei, drei Euro fürs Taxi“. 53 Auch der Fieberbrunner<br />
Bürgermeister sieht die Entfernung der Unterkunft zum Dorf gelassen: Durch die beiden un-<br />
terkunftseigenen Kleinbusse seien die Flüchtlinge „verkehrstechnisch ganz gut verbunden“<br />
und würden „alle Stund’, glaub ich fast“, ins Tal fahren, „weil man sieht sie ja pausenlos hin-<br />
unter ins Dorf und wieder hinauf“. 54 Tatsächlich wird mit den Bussen täglich zwei- bis vier-<br />
mal ins Tal gefahren, dabei werden die Kinder zu Kindergarten und Schule gebracht und wie-<br />
der abgeholt sowie die BewohnerInnen der Unterkunft ins Dorf gebracht, damit sie Erledi-<br />
gungen vornehmen können. 55 Eigentlich, so die Unterkunftsleiterin resümierend, sei es „schon<br />
gut da heroben. Keine Probleme mit Nachbarn und so. Aber Ghetto ist das sicher keines.“ 56<br />
Von Asylsuchenden selbst wurde „da heroben“ in einigen Fällen tatsächlich als „gut“ wahr-<br />
genommen. So berichtet etwa eine Rechtsberaterin von einem Klienten, der nach seiner Ver-<br />
legung in die Volderer Unterkunft den dringenden Wunsch äußerte, so schnell als möglich<br />
wieder „back in the bush to my mama“ gebracht zu werden 57 – der Zusatz legt den Schluss<br />
nahe, dass er sein Verhältnis zur Fieberbrunner Unterkunftsleiterin als eine Art „Mutter-Sohn-<br />
Beziehung“ erlebt hatte, welches er nach seiner Verlegung vermisste, kann jedoch zugleich<br />
als deutlicher Hinweis auf verlorene Selbständigkeit und ein dadurch entstandenes Abhängig-<br />
keitsverhältnis gelesen werden.<br />
Deutlich häufiger sind indessen jene Berichte, in welchen die Lage der Unterkunft als belas-<br />
tend beschrieben wird. „Ich habe keine Beschäftigung, hier gibt es keine Bücherei, besonders<br />
49<br />
Vgl. Der Standard 20.12.2002.<br />
50<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 730.<br />
51<br />
Ebd., Z 749ff.<br />
52<br />
Interview Unterkunftsleitung 05/2, 06.11.2003.<br />
53<br />
Ebd.<br />
54<br />
Interview Grander 06.11.2003, Z 83-86.<br />
55<br />
Interview Unterkunftsleitung 05/1, 06.11.2003, Z 7-13.<br />
56<br />
Interview Unterkunftsleitung 05/2, 06.11.2003.<br />
57<br />
Interview Beratung/Betreuung 08, 05.06.2004.<br />
103
fachliche Bücher brauche ich“, hielt etwa ein afghanischer Asylwerber, vor seiner Flucht<br />
Universitätsprofessor in Kabul, 2001 fest. 58 Außer den MitarbeiterInnen der Unterkunft habe<br />
er hier noch niemanden kennen gelernt, obwohl er das gerne würde, „besonders wissenschaft-<br />
liche Leute“. 59 Auch andere Asylsuchende beklagten die Schwierigkeit der Kontaktaufnahme<br />
aufgrund der Lage der Unterkunft – und den Umstand, dass man kaum Besuch empfangen<br />
könne: „Wer kommt schon hierher zu Besuch.“ 60 Der Leiter einer anderen Unterkunft berich-<br />
tete am Rande des Interviews, nach Fieberbrunn wollten die bei ihm bislang untergebrachten<br />
Asylsuchenden „alle nicht hin“, Flüchtlinge, die zuvor am Fieberbrunner Standort unterge-<br />
bracht gewesen wären, hätten ihm gegenüber die Unterkunft unter Bezugnahme auf ihre Lage<br />
„auf dem Berg“ mit dem schlichten Ausruf kommentiert: „Da wohnt Gott!“ 61<br />
Wiederholt wurde – so die Auskunft mehrerer BesucherInnen wie auch unabhängiger Betreu-<br />
erInnen, meist in Hintergrundgesprächen – von Asylsuchenden eine Verlegung in die Unter-<br />
kunft explizit als „Strafmaßnahme“ und die Unterkunft selbst als „Strafkolonie“ bewertet. So<br />
berichtete etwa 2001 ein afghanischer Flüchtling gegenüber Besucherinnen, er sei von<br />
Volders nach Fieberbrunn „strafversetzt“ worden, nachdem er sich geweigert habe, als Ernte-<br />
helfer zu arbeiten – auf dem „Arbeitsschein“ sei stundenweise Entlohnung eingetragen gewe-<br />
sen, man habe ihm jedoch Akkordlohn bezahlen wollen. 62 Auch UnterkunftsleiterInnen und<br />
Bürgermeister berichten, dass in „ihren“ Unterkünften beherbergte Asylsuchende nach Konflikten<br />
rasch verlegt worden wären, einige benennen dabei explizit Fieberbrunn als Zielort. 63<br />
In der Gemeinde selbst sei es, so der lokale Bürgermeister, seit der Errichtung der Unterkunft<br />
zu keinen nennenswerten Konflikten gekommen, auch habe der Ruf der Gemeinde nicht ge-<br />
litten – eine Sorge, die gerade in touristisch geprägten Orten teils häufig artikuliert wird. Mit<br />
den zum Zeitpunkt des Interviews am Standort untergebrachten etwa achtzig Personen sei<br />
allerdings die Decke erreicht: „Wenn’s jetzt einmal hundert sind, ist’s auch völlig wurscht,<br />
aber, auf jeden Fall: Die Größe, die wir da haben, ist schon genug, weil sonst wird’s zuviel.“ 64<br />
6.1.6 Bewertung<br />
Der Standort am „Bürgl“ befindet sich in einer doppelten Randlage: Sowohl auf Landes- als<br />
auch auf Gemeindeebene liegt die Unterkunft im Grenzgebiet. Die isolierte Lage fern von<br />
besiedeltem Gebiet und ohne Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz verstärkt den Ein-<br />
druck der Absonderung und Marginalisierung. Mitten in Europa befindet sich die Unterkunft<br />
tatsächlich am „Ende der Welt“, wie von verschiedener Seite pointiert angemerkt wurde. Im<br />
Gemeindekontext stellt sie aufgrund ihrer Lage und Größe eindeutig einen Fremdkörper dar.<br />
58<br />
Vgl. Unterlechner 2002, 15.<br />
59<br />
Ebd., 16.<br />
60<br />
Vgl. Interview Beratung/Betreuung 02, 28.05.2001.<br />
61<br />
Interview Unterkunftsleitung 01/3, 30.10.2003.<br />
62<br />
Interview Beratung/Betreuung 02, 28.05.2001.<br />
63<br />
Vgl. u.a. Interviews Mühlberger 03.11.2003, Z 350f; Unterkunftsleitung 01/3, 30.10.2003.<br />
64<br />
Interview Grander 06.11.2003, Z 54ff bzw. Z 97f.<br />
104
In Verbindung mit einigen weiteren Standortmerkmalen ist sie daher nicht nur eindeutig als<br />
„Lager“ zu charakterisieren 65 , sie weist auch unverkennbar Züge einer „totalen Institution“ im<br />
Sinne Goffmans auf. 66 Da es den am Standort untergebrachten Asylsuchenden unmöglich ist,<br />
selbstbestimmt Kontakt zu nicht in der Unterkunft untergebrachten Menschen, insbesondere<br />
zur ortsansässigen Bevölkerung aufzunehmen und so allenfalls entstandene Bekanntschaften<br />
und Freundschaften auch zu pflegen, ist eine desintegrierende Wirkung evident. Der Verlust<br />
von Selbständigkeit und daraus resultierende Abhängigkeitsverhältnisse, die eine spätere<br />
(Re-)Integration deutlich erschweren, sind erfahrungsgemäß in vielen Fällen Folgeerscheinun-<br />
gen. 67 Der Fall des oben zitierten Flüchtlings ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel.<br />
Verbunden mit der isolierten Lage ist jedoch auch der Umstand, dass es sich um eine (für<br />
regionale Verhältnisse groß) Sammelunterkunft handelt, äußerst problematisch. Die unterge-<br />
brachten Personen haben keine Möglichkeit, das Gelände einfach zu verlassen, wenn ihnen<br />
„die Decke auf den Kopf“ fällt oder sie die anderen BewohnerInnen schlicht „nicht mehr se-<br />
hen“ können. Internen Konflikten wird bislang vorrangig über die Unterkunftsleiterin begeg-<br />
net, die nach eigenen Angaben vor allem das persönliche Gespräch sucht: „Ich rede halt ganz<br />
viel mit den Leuten – viel mit ihnen reden, dann geht alles besser.“ 68 Dass es seit dem Gewalt-<br />
ausbruch Ende 2002 bislang zu keiner weiteren Eskalation gekommen ist, dürfte daher auch<br />
vorrangig dem persönlichen (und teils ehrenamtlichen 69 ) Engagement der Unterkunftsleitung<br />
zuzuschreiben sein. Die aus der dargestellten Struktur des Standorts resultierenden Grenzen<br />
sozialarbeiterischer Betreuung können durch dieses Engagement freilich ebenso wenig kom-<br />
pensiert werden, wie durch eine ganztägige Anwesenheit der BetreuerInnen – auch während<br />
der Wochenenden –, welche bislang nicht gegeben ist: Nach innen zielende Maßnahmen sind<br />
naturgemäß von vornherein nicht geeignet, äußere Rahmenbedingungen zu verändern. In<br />
Fällen, wo eine Entspannung der Situation auf der Ebene des persönlichen Gesprächs nicht<br />
mehr gelingt, erfolgt gegenwärtig eine Intervention über das Belegungsmanagement, welche<br />
die zugrundeliegenden strukturellen Eigenheiten freilich erst recht unangetastet lässt: Die be-<br />
troffenen Personen werden in eine andere Unterkunft verlegt. Eine Gesamtschau der Berichte<br />
anderer UnterkunftsleiterInnen, aber auch Äußerungen von Bürgermeistern einiger der betrof-<br />
fenen Gemeinden sowie von MitarbeiterInnen unabhängiger Organisationen lassen allerdings<br />
den Schluss zu, dass der Standort am „Bürgl“ diesbezüglich häufig bereits das „Ende der<br />
Kette“ darstellt und Asylsuchende, die aufgrund von Konflikten aus anderen Unterkünften<br />
verlegt wurden, nach Schwierigkeiten in der Unterkunft am „Bürgl“ überhaupt aus dem Sys-<br />
tem der „Landesbetreuung“ bzw. der Grundversorgung entlassen werden. 70 Die kolportierte<br />
65<br />
Auch vom für die Unterkunft zuständigen Landesflüchtlingskoordinator selbst wurde der Lagerbegriff in der<br />
Vergangenheit auf die Unterkunft angewandt (vgl. etwa Logar 2001).<br />
66<br />
Vgl. Goffman 1973; siehe hierzu Abschnitt 10.7.<br />
67<br />
Vgl. Hennig et al. 1982; Wipfler 1986; Carstens 1992; Lueger-Schuster 1996a; Merkord 1996; siehe hierzu<br />
Abschnitt 10.7.<br />
68<br />
Interview Unterkunftsleitung 05/2, 06.11.2003.<br />
69<br />
Ebd.<br />
70<br />
Vgl. u.a. Interviews Mühlberger 03.11.2003; Unterkunftsleitung 01/2 und 06/1.<br />
105
Nutzung des Standorts im Sinne eines Disziplinierungsmittels scheint vor diesem Hintergrund<br />
nicht abwegig, unabhängig ihres Wahrheitsgehalts zeigt allein das Vorliegen derartiger Be-<br />
richte überdies, dass die Unterbringung in der Unterkunft offenkundig von manchen Flüchtlingen<br />
als „Bestrafung“ empfunden wird. 71<br />
Positiv hervorzuheben ist bei der Bewertung des Standorts das im Vergleich zu den anderen<br />
im Herbst 2003 analysierten Unterkünften beachtliche Angebot an Möglichkeiten zur Frei-<br />
zeitgestaltung insbesondere in Form sportlicher Betätigung. Vor allem für Kinder sind die<br />
größeren Asphalt- und Wiesenflächen gut bespielbar, der das Gelände umgebende Wald<br />
dürfte für sie einen besonders spannenden Spielort darstellen. Die Grillgelegenheit scheint<br />
auch eine Möglichkeit darzustellen, BesucherInnen zu motivieren, die Unterkunft aufzusu-<br />
chen – die Unterkunftsleiterin, die freilich selbst Fieberbrunnerin und im Gemeindeleben of-<br />
fenbar gut verankert ist, berichtete im Interview von einem sommerlichen Grillfest unter dem<br />
Motto „10 Jahre Bürglkopf“, bei dem annähernd hundert Leute „heraufgekommen“ seien. 72<br />
Bei der Standortwahl scheint im Fall der Unterkunft am „Bürgl“ das Vorhandensein von<br />
Werkstätten alle anderen Aspekte überlagert zu haben. Im Vordergrund stand damit ein nicht<br />
von der räumlichen Lage des Standorts, sondern von der (in beträchtlichem Ausmaß adaptier-<br />
baren) Gebäudeausstattung abhängiges Kriterium. Die zu erwartenden Auswirkungen der aus<br />
dieser Standortwahl resultierenden oben skizzierten Mängel auf die untergebrachten Personen<br />
scheinen in den Überlegungen eine allenfalls untergeordnete Rolle eingenommen zu haben:<br />
Die „abgelegene“ Lage des Standorts wird vom zuständigen Flüchtlingskoordinator des Lan-<br />
des lediglich in Verbindung mit den während des Winters unerlässlichen zahlreichen Schnee-<br />
räumungen als „Minuspunkt“ genannt, explizit erwähnt wird daneben nur die vor der Sanie-<br />
rung fehlende Kanalisation. Die Weiternutzung des Geländes nach dem Auslaufen des für<br />
bosnische Kriegsflüchtlinge initiierten und Ende der 1990er für kosovarische Kriegsflücht-<br />
linge reaktivierten „Projekts Bürglkopf“ in der bisherigen Weise trotz der grundlegend geän-<br />
derten Rahmenbedingungen – weder war nunmehr eine hinsichtlich der Herkunftsregion, der<br />
gemeinsamen Geschichte, Sprache, Traditionen und auch der Rückkehrperspektive in hohem<br />
Maße homogene Personengruppe untergebracht 73 , noch wurden die in den Werkstätten repa-<br />
rierten Fahrzeuge und Maschinen für die eigene Herkunftsregion instandgesetzt – geht, so<br />
muss geschlossen werden, letztlich an den Bedürfnissen der in jeder Hinsicht extrem hetero-<br />
genen Gruppe der Asylsuchenden größtenteils vorbei.<br />
Wie im Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde deutlich wurde, ist diese in die<br />
Standortentscheidung nicht nur nicht eingebunden, sondern offenbar auch nicht informiert<br />
71<br />
Zum Verhältnis von peripher oder extrem peripher gelegenen Unterkunftsstandorten und Verlegungen als<br />
Disziplinierungsmittel siehe Abschnitt 10.7.<br />
72<br />
Interview Unterkunftsleitung 05/2, 06.11.2003.<br />
73<br />
Zur praktischen Bedeutung dieser Homogenität bei der Organisation des täglichen Lebens und der Betreuung<br />
der Menschen am Beispiel der (ohne offiziellen Auftrag erfolgten) Betreuung von in Winterbach (Niederösterreich)<br />
untergebrachten kosovarischen Kriegsflüchtlingen vgl. Münker-Kramer/Gmeiner 2000.<br />
106
worden – Bürgermeister Grander wusste nur, dass das Land „was gesucht“ hatte. Dass es in<br />
der Folge nicht zu Konflikten mit der Gemeindebevölkerung kam, ist mit Grander wohl der<br />
großen räumlichen Distanz zwischen Unterkunft und Dorf zuzuschreiben.<br />
6.2 Götzens: Die Ruhe nach dem Sturm<br />
Bereits seit 1990 werden in Götzens Flüchtlinge beherbergt, Ende Juni 2004 waren sechzig<br />
Asylsuchende in der Gemeinde untergebracht. 74 Götzens ist damit der am längsten bestehende<br />
Unterkunftsstandort in Tirol.<br />
6.2.1 Die Gemeinde: »Zentrum des Glaubens«<br />
Götzens, eine 3.705 EinwohnerInnen zählende Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, liegt<br />
etwa neun Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt auf 868 Meter Seehöhe im westlichen<br />
Teil des sogenannten Mittelgebirges, eines terrassenähnlichen „Vorbergs“ mit zum Inntal hin<br />
abfallenden bewaldeten Hängen, auf dem sich eine weite und flache Landschaft befindet. 75<br />
Das Dorf ist – in den Worten Müllers – ein „Zentrum des Glaubens“ 76 : Die römisch-katholi-<br />
sche Pfarrkirche „zu den Heiligen Petrus und Paulus“, deren dem Kirchplatz zugewandtes<br />
Giebelfresko eine Allegorie der „im Kampf gegen den Unglauben bzw. das Böse siegreichen<br />
Kirche“ 77 zeigt, gilt als „Höhepunkt der Baukunst des tirolischen Spätbarocks“. 78 Die Kirche<br />
ist nicht zuletzt wegen des dort bestatteten und mittlerweile heiliggesprochenen Götzner<br />
Pfarrers Otto Neururer, der 1940 im nationalsozialistischen Konzentrationslager Buchenwald<br />
der Folter erlag, ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Auch als „Krippendorf“ ist Götzens profi-<br />
liert: Die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreichende Krippenbautradition bildet einen auch<br />
heute noch über die Gemeinde hinaus wirkenden Anziehungspunkt. Zugeständnisse an die<br />
Moderne macht man dabei offenkundig mit Augenmaß: „Der Brauch des »Krippeleschauens«<br />
wird für Auswärtige, die früher durch Mundpropaganda geleitet wurden, nun durch Tafeln mit<br />
der Aufschrift »Weihnachtskrippe« erleichtert.“ 79<br />
Lange Zeit war Götzens kaum touristisch geprägt, ein Umstand, der sich mit der Austragung<br />
der Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1964 jedoch deutlich ändern sollte: Der Ort ent-<br />
wickelte sich vom Bauerndorf zur Tourismusgemeinde und wird heute im Sommer wie im<br />
Winter gleichermaßen frequentiert. 80 Nach wie vor stellt die Landwirtschaft einen wichtigen<br />
Faktor dar, mit der zunehmenden Bedeutung als Tourismusdestination sind in den vergange-<br />
nen Jahrzehnten jedoch auch zahlreiche Handels- und Gewerbebetriebe entstanden, die mitt-<br />
74 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
75 Vgl. hierzu Mutschlechner 1988.<br />
76 Vgl. Müller 1988a.<br />
77 Caramelle 1988, 154.<br />
78 Müller 1988a, 124.<br />
79 Arnold-Öttl 1988, 179.<br />
80 Vgl. Müller 1988b, 88; im Jahr 2003 wurden in beiden Saisonen jeweils mehr als 43.000 Nächtigungen<br />
verzeichnet (AdTLR 2004).<br />
107
lerweile die lokale Wirtschaft bestimmen. 81 Trotz dieser Entwicklung ist Götzens jedoch auch<br />
heute noch eine PendlerInnengemeinde, die im „Sog“ Innsbrucks liegt. 82 Die Nähe Innsbrucks<br />
zeigt sich letztlich auch im dörflichen Alltag: Der urban geprägte Teil der Bevölkerung richtet<br />
seine Aktivitäten auf die Landeshauptstadt aus, entsprechend ist das dörfliche (Vereins-)Le-<br />
ben durch den sehr regen, traditionell orientierten Teil geprägt. Die Bandbreite der lokalen<br />
Vereine reicht dabei vom Braunvieh- und Schafzuchtverein über den „Tuiflverein“ und die<br />
Landjugend bis zum „Ski-Klub d’Schneevögel“, von den „Götzner Diandln“ über den<br />
Männergesangsverein bis zu Musikkapelle und Kirchenchor. Selbstverständlich sind auch die<br />
Schützen mit einer Kompanie vertreten, denn bei den Schlachten des Tiroler „Heldenjahres“<br />
1809 seien die Götzner „natürlich auch dabei“ gewesen, wie Baeck/Soucek stolz zu berichten<br />
wisse: „Man weiß, daß sie damals vier Mann im Kampf verloren haben“. 83<br />
Traditionell ist auch die politische Struktur in Götzens. Nach den Gemeinderatswahlen im<br />
März 2004 konnte Bürgermeister Hans Payr (ÖVP) die Mandatszahl seiner Liste gleich ver-<br />
dreifachen, er verfügt nun über neun Sitze im Gemeinderat. Ein Mandat verloren hat dagegen<br />
die Liste „Wir Götzner“, die nun ebenso wie die „Unabhängige Liste“ bei zwei Sitzen hält.<br />
Die SPÖ – in Götzens eine Kleinpartei – konnte ihr einziges Mandat halten, neu in den<br />
Gemeinderat eingezogen sind die Grünen. Verabschieden mussten sich dagegen die Freiheit-<br />
lichen: Die Liste um den Götzner Hotelier Günter Ellinger, von dem im Folgenden noch die<br />
Rede sein wird, verlor ihr einziges Mandat. Der erstaunliche Erfolg von Bürgermeister Payrs<br />
Liste wird bei einem Blick auf die Ergebnisse der Gemeinderatswahl von 1998 relativiert:<br />
Damals war Payr gegen seinen ÖVP-Parteifreund, den seit Jahrzehnten amtierenden Bürger-<br />
meister Werner Singer – auch auf ihn wird noch zurückzukommen sein – mit einer eigenen,<br />
provokant „Die <strong>Neue</strong> ÖVP“ genannten Liste angetreten. Bei den Bürgermeister-Direktwahlen<br />
schaffte es der hinter Singer liegende Payr in den zweiten Wahlgang, wo er völlig überra-<br />
schend mehr Stimmen als Singer erhielt und diesen als Gemeindeoberhaupt ablöste. Singer<br />
zog sich aus der Politik zurück, die „alte“ ÖVP trat 2004 nicht mehr an.<br />
6.2.2 Der Standort: Leben im öffentlichen Raum<br />
Die am Kirchplatz und damit unmittelbar im Zentrum der Gemeinde gelegene Götzner Unter-<br />
kunft befindet sich im Zwickel zweier wichtiger Straßen: In westlicher Richtung an der<br />
Unterkunft vorbei führt die Straße nach Birgitz und Axams, in nördlicher Richtung nach Völs<br />
und Innsbruck. In östlicher Richtung geht schräg gegenüber dem Unterkunftsgebäude eine<br />
weitere Straße nach Natters und Mutters vom Kirchplatz ab. Der Kirchplatz ist damit der<br />
Verkehrsknotenpunkt in Götzens, das Verkehrsaufkommen entsprechend hoch.<br />
81 Vgl. Müller 1988b, 87; AdTLR 2004.<br />
82 2001 standen 187 EinpendlerInnen nicht weniger als 1453 AuspendlerInnen gegenüber (AdTLR 2004).<br />
83 Baeck/Soucek 1988, 201.<br />
108
Der südlichen Seite der Unterkunft gegenüber liegt die räumlich etwas nach hinten versetzte<br />
Pfarrkirche samt dem ihr vorgelagerten Friedhof und dem Kirchplatz, an dessen westlichen<br />
Rand ein Kriegerdenkmal an die Götzner Gefallenen und Vermissten der Jahre 1797 bis 1810,<br />
des Ersten sowie des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ein Blick auf die weitere Nachbarschaft<br />
zeigt, dass sich auch in Götzens im Ortskern das in Tiroler Landgemeinden übliche „Trium-<br />
virat“ aus Pfarrkirche, Gemeindeamt und Zweigstelle der regional dominierenden Banken-<br />
kette findet: An die Nordseite der Unterkunft schließt das Bankhaus in Form eines modernen<br />
Neubaus an, dahinter folgt das Gemeindeamt, das nicht nur ein Gemeindezentrum samt ange-<br />
schlossenem Musikpavillon beherbergt, sondern auch ein Postamt. Die weiteren das Unter-<br />
kunftsgebäude umgebenden Häuser sind teils in desolatem Zustand, teils (wie das an der Ost-<br />
seite des Kirchplatzes stehende Gebäude des früheren „Altwirts“) vorbildlich sanierte Häuser<br />
in überwiegend traditionell-bäuerlicher Gestaltung. Sie beherbergen in den unteren Etagen<br />
Handels- und Gewerbebetriebe, sind jedoch in den oberen Stockwerken teils bewohnt, wobei<br />
ein Blick auf die Namensschilder vor allem auf BewohnerInnen mit migrantischem Hinter-<br />
grund schließen lässt. Eine Bushaltestelle unmittelbar neben der Unterkunft 84 und ein als<br />
Taxistandplatz ausgeschilderter improvisierter Parkplatz schräg hinter dem Unterkunfts-<br />
gebäude unterstreichen den Charakter der Umgebung als Verkehrsknotenpunkt.<br />
Die Unterkunft selbst befindet sich im Gasthof Neuwirt, einem großen, einschließlich des<br />
ausgebauten Dachgeschosses dreistöckigen Gebäude, das im 17. Jahrhundert als Bauernhaus<br />
errichtet und nach einem Umbau ab den 1920er Jahren als Gasthaus genutzt wurde. 85 Ende<br />
des Zweiten Weltkriegs musste der Gasthof zwischenzeitlich zur Beherbergung amerikani-<br />
scher, dann französischer Soldaten geräumt werden. 86 Als man Anfang der 1960er die Dorf-<br />
straßen erstmals asphaltierte und zum Teil auch gleich verbreiterte, wurde das Gebäude etwas<br />
nach Westen versetzt neu errichtet und bis zur Unterbringung der ersten Flüchtlinge 1990 als<br />
Gaststätte und Pension genutzt.<br />
Die straßenseitig gelegenen Süd- und Ostseiten des Hauses vermitteln heute einen relativ ge-<br />
pflegten Eindruck. Der Zugang zur Gaststube erfolgt nicht ummittelbar von der stark befahre-<br />
nen Straße her, sondern hinter einer von Sträuchern und Wildem Wein überwachsenen Mauer,<br />
die den Eingangsbereich so vom Straßenlärm und -schmutz ein wenig abschirmt. Die West-<br />
front des Hauses wies zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheins deutliche Bauschäden auf, ins-<br />
besondere bröckelte an zahlreichen Stellen der Putz ab. Ein Teil dieser Gebäudeseite war ein-<br />
gerüstet, ein Hinweis auf laufende Bauarbeiten fand sich jedoch nicht. Die Nordfront wie-<br />
derum verfügt auf der Höhe des ersten Stockwerks über eine größere Terrasse, unter der sich<br />
ein Garagen- oder Lagerraum befindet. Hier ist auch ein zweiter Eingang vorhanden, der nicht<br />
nur als Lieferanteneingang dient, sondern den BewohnerInnen des Gebäudes – der Eigen-<br />
84 Von hier aus kann die Landeshauptstadt Innsbruck in knapp 15 Minuten erreicht werden.<br />
85 Vgl. dazu die Fotographien in Baeck 1988a, 51, 55, 68 und 92.<br />
86 Vgl. Baeck 1988b, 66.<br />
109
tümerinnenfamilie ebenso wie den untergebrachten Asylsuchenden – den direkten Zugang zu<br />
den Zimmern ermöglicht. An der dem Kirchplatz zugewandten Südseite ist in den ersten bei-<br />
den Stockwerken jeweils ein Balkon vorhanden, im vorderen Bereich der Ostseite auf der<br />
Höhe des ersten Stockwerks eine kleine Terrasse. Von diesen aus kann der gesamte Kirch-<br />
platz überblickt werden. Da die Veranden damit dem Eingang zur Pfarrkirche, dem vorderen<br />
Teil des Friedhofs, dem Kriegerdenkmal mit den Ruhebänken sowie der Haltestelle der<br />
Richtung Innsbruck führenden Buslinie unmittelbar gegenüberliegen und auch die schräg ge-<br />
genüber befindlichen Betriebe – eine Bäckerei, ein Reisebüro und eine Bar – unmittelbar ein-<br />
sehbar sind, stellen sie einen exponierten „Logenplatz“ zum dörflichen Leben dar.<br />
Durch ihre Lage unmittelbar im Ortszentrum können von der Unterkunft aus alle Güter des<br />
täglichen Bedarfs und sogar Medikamente problemlos, weil auf dem Fußweg beschafft wer-<br />
den. 87 Im Bereich der für viele Asylsuchenden nicht unbedeutenden Ergänzungsökonomie<br />
stehen in Götzens allerdings, abgesehen von einem Imbisslokal, keine Einrichtungen zur Ver-<br />
fügung. In unmittelbarer Nähe zur Unterkunft befindet sich die Volksschule: Das Schulhaus<br />
liegt gleich hinter der Pfarrkirche. Über einen öffentlichen Kindergarten verfügt Götzens da-<br />
gegen nicht, der nahe der Unterkunft gelegene Privatkindergarten der „Tertiarschwestern“<br />
wird jedoch von der öffentlichen Hand unterstützt und dient damit faktisch als Gemeinde-<br />
kindergarten. 88 Mit der örtlichen Volkshochschule gibt es in Götzens auch eine Einrichtung<br />
der Erwachsenenbildung. 89 Wie in einem in Tirol angesiedelten „Zentrum des Glaubens“<br />
nicht anders zu erwarten, steht für geistlichen Beistand lediglich die römisch-katholische<br />
Kirche zur Verfügung. Gebetsstätten anderer Religionen sind damit auch als mögliche Treff-<br />
punkte nicht vorhanden.<br />
Mit Ausnahme einiger Bänke rund um das Kriegerdenkmal gibt es in der näheren Umgebung<br />
der Unterkunft keine öffentlichen Anlagen, die als Treffpunkt und Aufenthaltsort im öffentli-<br />
chen Raum genutzt werden könnten – der Gasthof verfügt aufgrund seiner zentralen Lage<br />
über keine Außenanlagen, der Platz vor dem nahen Gemeindezentrum und dem Musikpa-<br />
villon dient, so er nicht für Veranstaltungen genutzt wird, als Parkplatz. In einiger Entfernung<br />
vom Ortskern befindet sich das Götzner „Sportzentrum“, eine aus einem Tennisplatz und zwei<br />
Fußballfeldern bestehende moderne Anlage.<br />
87 Ein Supermarkt befindet sich in der Nähe, die örtliche Apotheke unmittelbar gegenüber der Unterkunft am<br />
Kirchplatz. Im Bereich der Gesundheitsversorgung praktizieren in Götzens überdies zwei Allgemeinmediziner<br />
und ein Zahnarzt.<br />
88 Vgl. Müller 1988b, 90. Eine Hauptschule ist im nahen Axams vorhanden.<br />
89 Hier wurde in der Vergangenheit auf Initiative des langjährigen Leiters und damaligen Bürgermeisters,<br />
Werner Singer, ein Deutschkurs für die im Ort untergebrachten Flüchtlinge organisiert. Wie Singer (der den<br />
Kurs selbst finanziert hatte) im Interview anmerkt, wurde der Kurs anfangs auch tatsächlich von mehr als dreißig<br />
Personen genutzt, schon bald sank die Zahl der TeilnehmerInnen aber auf fünf, in der Folge wurde kein weiterer<br />
Kurs mehr angeboten (Interview Singer 05.12.2003, Z 107-112).<br />
110
6.2.3 Die Standortwahl: Quartier ist Quartier<br />
Der Götzner Standort wurde, wie erwähnt, bereits im Juni 1990 eröffnet – als Unterkunft im<br />
Rahmen der Bundesbetreuung und damit auf Betreiben des Innenministeriums. Auch für<br />
Wahl und Realisierung des Standorts war zum damaligen Zeitpunkt noch das Ministerium<br />
zuständig: Die Stelle des Tiroler Landesflüchtlingskoordinators war noch nicht geschaffen,<br />
die Bundesbetreuungsverordnung noch nicht in Kraft. Für die große Zahl an Flüchtlingen, die<br />
im Zuge des vor allem in Rumänien gewaltsam verlaufenen Zusammenbruchs der kommunis-<br />
tischen Systeme Osteuropas über die durchlässig gewordenen Grenzen auch nach Österreich<br />
kamen, hatte der damalige Innenminister Franz Löschnak (SPÖ) nicht ausreichend Quartiere<br />
zur Hand. Die Mobilisierung weiterer Unterkünfte verlief äußerst schleppend, weshalb der<br />
Minister alle Bundesländer aufrief, sich verstärkt um die Aufnahme und Unterbringung Asyl-<br />
suchender zu bemühen und Quartiere bereitzustellen. Alois Partl (ÖVP), damals Tiroler Lan-<br />
deshauptmann, vereinbarte in der Folge mit Löschnak eine Zahl von 714 Flüchtlingen, die<br />
Tirol aufzunehmen hätte und richtete ein persönliches Schreiben an die Bürgermeister der<br />
Tiroler Gemeinden, in welchem er gleichfalls bat, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen oder<br />
wenigstens zu benennen. 90 Minister und Landeshauptmann standen also unter Druck, inhaltli-<br />
che Kriterien spielten entsprechend keine Rolle bei der Standortwahl: Quartier war Quartier.<br />
Löschnaks Aufruf und Partls Schreiben blieben indessen wenig erfolgreich: Bis Ende 1991<br />
war es gelungen, in Tirol ganze vier Standorte zu finden – einer davon in Götzens. 91<br />
6.2.4 Die Standortrealisierung: Ein Dorf im Aufruhr<br />
Zwei Personen, zwei Sichtweisen: Die Schaffung der Götzner Unterkunft schildern zwei<br />
maßgebliche Kommunalpolitiker im Rückblick unterschiedlich. Bürgermeister Hans Payr 92 ,<br />
damals bereits als Gemeinderat aktiv, stellt knapp fest: „Anlässlich der Krise in Rumänien im<br />
Jahre 1989/90 wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass der Gasthof Neuwirt Flücht-<br />
linge aufnehmen wird.“ 93 Anders der damalige Bürgermeister Werner Singer, der berichtet, er<br />
habe Löschnaks Aufruf und Partls Schreiben in den Gemeinderat eingebracht, worauf man<br />
noch vor der Schaffung der Unterkunft im Gasthof Neuwirt aktiv geworden sei:<br />
„Ich habe dem Gemeinderat dann dieses Schreiben vorgetragen und wir haben dann mehrheitlich beschlossen,<br />
im Gebäude des ehemaligen Sportzentrums das dortige Zwischengeschoss (es stand noch im Rohbau) zur Verfügung<br />
zu stellen. Nach Durchführung der Fertigstellungsarbeiten hätten dort eine oder zwei Familien einziehen<br />
können. Ich hab’ diesen Beschluss dann der Landesregierung mitgeteilt – und ich muss sagen: Eine Antwort auf<br />
dieses Schreiben hat die Gemeinde nie erhalten. Nach einiger Zeit erfuhr ich von Götzner Bürgern, dass beim<br />
Neuwirt Flüchtlinge einziehen! Ich habe vorher nichts gehört! Prompt am nächsten Tag habe ich erfahren: Die<br />
Flüchtlinge sind da!“ 94<br />
90 Vgl. Egger 1991, 142; Hörtner 1992, 5.<br />
91 Vgl. Kofler 1991, 3. Die anderen Standorte waren Gries am Brenner (siehe dazu Hörtner 1992), Hochfilzen<br />
(siehe dazu Kofler 1991; Himmelbauer 1994) und Volders (siehe dazu Steinkeller 1995; Pletzer 2002).<br />
92 Payr verweigerte die Autorisierung des Interviewtranskripts am 11.03.2004, bot jedoch an, in schriftlicher<br />
Form Stellung zu nehmen. In die Einzelfalldarstellung konnten daher lediglich allgemeine Wahrnehmungen zum<br />
Interview, wie sie im Postskript vom Interviewer festgehalten wurden (vgl. Interview Payr 05.12.2003), sowie<br />
Payrs schriftliche Stellungnahme (vgl. Interview Payr 12.03.2004) eingearbeitet werden.<br />
93 Ebd.<br />
94 Interview Singer 05.12.2003, Z 3-10.<br />
111
Unabhängig von der Diskussion im Gemeinderat hatte die Besitzerin des Gasthofs sich<br />
gegenüber dem Innenministerium bereit erklärt, das Gebäude als Unterkunft zur Verfügung<br />
zu stellen. Den privatrechtlichen Vertrag zwischen Ministerium und Wirtin, mit dem die Un-<br />
terbringung geregelt wurde, schloss man offenbar ab, ohne dass die Gemeinde durch Bund<br />
oder Land informiert worden wäre. Als im Juni 1990 die ersten Asylsuchenden eintrafen,<br />
herrschte im Ort daher helle Aufregung, wie Egger berichtet:<br />
„Über 200 Unterschriften belegten den Widerstand gegen die »Einquartierung« der Flüchtlinge. Die Wirtin des<br />
Gasthofes bekam in weiterer Folge anonyme Telephonanrufe, die mit »Hausanzünden« und »Scheibeneinschlagen«<br />
drohten, falls sie weiter diese »Schmarotzer« und »Wirtschaftsflüchtlinge« beherbergen sollte.“ 95<br />
Die angesprochene Wirtin, die den regulären Betrieb ihres Gasthofs nun vorläufig einstellte,<br />
bestätigt dies im Interview: „Da haben sie schon angerufen: »Wir werden euch in die Luft<br />
sprengen!« und so. Die Kinder haben sie mir auch hergeschlagen, im Schulbus.“ 96 Offen als<br />
Gegner der Unterkunft trat lautstark ein lokaler Hotelier auf: Der bereits erwähnte Günter<br />
Ellinger, neben seiner wirtschaftlichen Tätigkeit damals auch Handelskammerfunktionär,<br />
Vorstandsmitglied des lokalen Fremdenverkehrsverbands und seit kurzem Mitglied der FPÖ 97<br />
(und späterer freiheitlicher Gemeinderat) ließ über die Tiroler Tageszeitung verlauten:<br />
„Götzens hat eine der wohlhabendsten Bevölkerungen in Tirol und die höchste Akademikerquote. Ich halte es<br />
für eine Provokation, wenn man gegenüber der Kirche ein Flüchtlingslager einrichtet. Wir werden einfach überrannt.<br />
Wir wollen nicht, daß das eine Dauereinrichtung wird.“ 98<br />
Ellinger entfaltete derart rege Aktivitäten in seinem „Kampf“ gegen die Unterkunft, dass er<br />
indessen selbst Widerstand hervorrief, wie die Unterkunftsleiterin berichtet: „Der hat alle<br />
Tag’ ein anderes Flugblatt herausgegeben. Aber nach dem Ellinger haben Akademiker aus<br />
dem Ort da angerufen und zu mir gesagt: »Das kommt nicht von uns!«“ 99<br />
Die Unterbringung der Asylsuchenden, die der Wirtin zufolge ursprünglich nur für eine Zeit<br />
von drei Monaten vorgesehen war 100 , wurde bald zur Dauereinrichtung. Bürgermeister Payr<br />
hält fest: „Der Bevölkerung wurde damals erklärt, dass diese Flüchtlingsunterkunft nur vorü-<br />
bergehend (Rumänien und Bosnienkrise) besteht.“ Für ihn hatte die Unterkunft bis zum Ende<br />
des Kriegs in Bosnien-Herzegowina gewissermaßen „inoffiziellen“ Charakter: Der Gasthof<br />
95<br />
Egger 1991, 143. Völlig konträr zu den damaligen <strong>Medien</strong>berichten der Rückblick Singers: „Ich kann da mit<br />
reinem Gewissen sagen: Mich persönlich hat nicht ein Bürger angesprochen in der Art, dass er mir nahegelegt<br />
hätt’: »Du, tu was, ich will das nicht!« oder so oder so. Im Gegenteil: Ich bin angesprochen worden, dass sie<br />
gesagt haben: »Du, brauchst du das oder das für die Flüchtlinge? Ich hätt’ da eine Arbeit oder dort ...« [...] Es<br />
haben sich nur positive Stimme gemeldet, negative waren keine. Und ich tät’ auch das alles noch einmal [...].“<br />
(Interview Singer 05.12.2003, Z 155-169) Bürgermeister Payr hält sich diesbezüglich bedeckt – er differenziert<br />
zwischen Konflikten vor dem Eintreffen der ersten Flüchtlinge und jenen unmittelbar danach, wobei er auf letztere<br />
nicht eingeht: „Vor der Eröffnung kam es zu keinen Konflikten mit der Bevölkerung, weil diese davon<br />
nichts gewusst hat. Es kam zu verschiedenen Anfragen bei der Gemeinde.“ (Interview Payr 12.03.2004)<br />
96<br />
Interview Unterkunftsleitung 08/1, 05.12.2003.<br />
97<br />
Gärtner 1990.<br />
98<br />
Ellinger (in: Tiroler Tageszeitung 09.06.1990), zit. nach Gärtner 1991, 6.<br />
99<br />
Interview Unterkunftsleitung 08/1, 05.12.2003.<br />
100 Ebd.<br />
112
sei erst zu diesem Zeitpunkt und „ohne dass die Gemeinde davon in Kenntnis gesetzt wurde<br />
[...] zu einem offiziellen Flüchtlingsheim des Bundes installiert“ worden. 101<br />
6.2.5 Ruhe nach dem Sturm: Der Standort in der Diskussion<br />
Nach dem Aufruhr des Jahres 1990 kehrte in Götzens rasch wieder Ruhe ein. Der noch bis<br />
1998 amtierende Bürgermeister Singer dürfte dazu wohl wesentlich beigetragen haben: Er sah<br />
sich – so Singer im Interview – als eine Art Anlaufstelle gerade auch für die nur wenige Meter<br />
vom Gemeindeamt entfernt untergebrachten Flüchtlinge und engagierte sich mit einem Kreis<br />
von Götzner HelferInnen, indem er unter anderem wiederholt Kleidung beschaffte, Hygiene-<br />
artikel zur Verfügung stellte, Stadtpläne der Landeshauptstadt Innsbruck bereit stellte, klei-<br />
nere Hilfsarbeiten vermittelte, Weihnachtsfeiern für die Asylsuchenden – vor allem für die<br />
Kinder, die dabei kleine Weihnachtsgeschenke erhielten – veranstaltete und sogar eine Taufe<br />
für ein russisch-orthodoxes Kind organisierte. 102 FPÖ-Mandatar und Hotelier Ellinger arran-<br />
gierte sich auf seine Weise mit der Götzner Unterkunft. Singer berichtet, er habe von ihm<br />
bezüglich der Flüchtlinge später „nichts mehr gehört“ und ergänzt:<br />
„Der Ellinger beschäftigt laufend Flüchtlinge in seinem Betrieb, also so schlimm wird’s nicht sein. Und das war<br />
halt damals die Masche der Blauen. Da hat er gemeint, er muss da mitschwimmen. Also ich kenn keinen Betrieb<br />
in Götzens, der so stark mit Ausländern arbeitet wie der Ellinger. Und nicht nur, aber auch mit klassischen<br />
Flüchtlingen, also die da sind. Der hat längst schon Milch gegeben und sagt kein Wort mehr.“ 103<br />
Auch die Unterkunftsleiterin berichtet im Interview, es habe sich bald „alles beruhigt“: „Ich<br />
hab ja schon Situationen gehabt, dass die Leute gesagt haben: »Ja, hast du deine Flüchtlinge<br />
noch?«“ 104 NachbarInnen kommentieren die aktuelle Situation auf den im Herbst 2003 ausge-<br />
gebenen Fragebögen ähnlich gelassen: Die Asylsuchenden fielen nicht mehr weiter auf, hält<br />
etwa ein Mann fest, „das hat sich inzwischen alles eingespielt“. 105 Eine Nachbarin merkt aller-<br />
dings an, sie halte die Unterbringung in einem Gasthof für wenig sinnvoll: „Weil sie dort<br />
kaum Kontakte mit Einheimischen haben, leben sie auf einer eigenen Insel.“ 106 Vor wenigen<br />
Jahren hat der Gasthof wieder (wenngleich in eingeschränktem Ausmaß) den regulären Be-<br />
trieb aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheins waren einige Gäste in der<br />
Schankstube anwesend, die Atmosphäre wirkte allerdings stark familiär geprägt.<br />
101 Interview Payr 12.03.2004.<br />
102 Vgl. Interview Singer 05.12.2003. Auch Egger (1991, 144f) berichtet von Götzner BürgerInnen, die sich<br />
schon bald für die untergebrachten Flüchtlinge engagierten und konkrete Hilfe leisteten, indem sie für etwa<br />
Flüchtlingskinder private Deutschkurse organisierten oder gemeinsame Freizeitaktivitäten unternahmen. Singer<br />
und einige andere HelferInnen unterstützen die Unterkunftsleiterin bis heute ehrenamtlich.<br />
103 Interview Singer 05.12.2003, Z 150-154. Auch die Unterkunftsleiterin selbst berichtet davon, „Leute aus dem<br />
Dorf“ würden zur Unterkunft kommen und Flüchtlinge engagieren, „für Gartenarbeiten und so. Auch der Ellinger.“<br />
(Interview Unterkunftsleitung 08/1, 05.12.2003). Gärtner (1990, 14) hatte bereits im Juni 1990 berichtet,<br />
ein jugoslawischer Staatsangehöriger habe sich am 8. Juni des Jahres bei der Innsbrucker AusländerInnenberatungsstelle<br />
gemeldet und angegeben, dass er von Ellinger „für 205 Arbeitsstunden plus Feiertagsdienste öS<br />
5.600,– bekommen habe. Nachweislich weder bei der Sozialversicherung angemeldet noch mit einer – vom<br />
Arbeitgeber zu besorgenden – Beschäftigungsbewilligung.“<br />
104 Interview Unterkunftsleitung 08/1, 05.12.2003.<br />
105 Fragebogen 01, 2003, 4.<br />
106 Fragebogen 04, 2003, 4.<br />
113
Die Diskussionen rund um den Götzner Standort rissen in der Folgezeit allerdings nicht zur<br />
Gänze ab, blieben jedoch immer auf den Ort selbst und hier offenbar vor allem auf die<br />
Gemeindeführung beschränkt; von außerhalb der Gemeinde wurde zumindest die Lage des<br />
Standorts auch im weiteren Verlauf nicht in Frage gestellt. Unter Bürgermeister Payr, dem<br />
Nachfolger Singers, rückte die Gemeindeführung merklich von der Flüchtlingsunterbringung<br />
ab. 107 Die „offizielle Installierung“ der Unterkunft ohne vorherige Information der Gemeinde<br />
nach dem Ende des Kriegs in Bosnien-Herzegowina kommentiert Payr so:<br />
„Dieser Status ist bis heute aufrecht. Selbstverständlich hat es im Gemeinderat des öfteren Diskussionen darüber<br />
gegeben, ob der Standort im Zentrum von Götzens ideal ist. [...] Rückblickend kann gesagt werden, dass die<br />
Standortwahl im Zentrum von Götzens ungünstig war. Zufriedenstellend war lediglich, dass Flüchtlingen ein<br />
Bett zur Verfügung gestellt wurde.“ 108<br />
Sein Vorgänger Singer schildert ein durchaus nicht spannungsfreies Verhältnis zwischen<br />
Gemeindeführung und der Wirtin des Gasthofs. Diese wolle das Gebäude ausbauen, was ihr<br />
von der Gemeinde jedoch nicht bewilligt werde:<br />
„Wenn sie als ordentliche Mutter schaut, dass sie für die Kinder Wohnraum schafft und dann übergibt ... Sie baut<br />
nicht höher wie der Bestand [...] und trotzdem wird sie schikaniert! Es wird für die Kinder gebaut, aber nicht für<br />
die Flüchtlinge! [...] Ich weiß nicht, wo die im Gemeinderat leben? Weltfremd. Ja, jetzt musst du dir vorstellen<br />
[...] – im Gemeinderatsbeschluss haben sie detailliert angegeben, dass sie die Bewilligung wegen den Flüchtlingen<br />
nicht kriegt. [...] Die Bauordnung sieht solche Gründe nicht vor!“ 109<br />
Payr bleibt bei der Beurteilung des Verhältnisses zur Wirtin vorsichtig: VertreterInnen der<br />
Unterkunftsleitung, so der Bürgermeister, „halten keinen Kontakt zu uns“. 110<br />
6.2.6 Bewertung<br />
Die Götzner Unterkunft nimmt aufgrund ihrer Lage und Gestaltung am Kirchplatz eine domi-<br />
nierende Stellung ein. Der Gasthof bestimmt den öffentlichen Raum – und dieser den Gasthof.<br />
Ist bereits das Erdgeschoss des Gebäudes aufgrund der dort vorhandenen Gaststube als Teil<br />
des öffentlichen Lebens zu werten, so gilt dies für die dem Kirchplatz und den dort vorhande-<br />
nen öffentlichen Einrichtungen zugewandten Balkone erst recht: Wer sie betritt, betritt den<br />
öffentlichen Raum. Für die auf der anderen Gebäudeseite der benachbarten Bankfiliale zuge-<br />
wandte Terrasse gilt dies analog. Da ein Aufenthaltsraum in der Unterkunft nicht gegeben<br />
ist 111 und das Gebäude auch über keine Außenanlagen etwa in Form eines Gartens verfügt,<br />
bleibt außer dem Aufenthalt in den Zimmern tagsüber nur der Gang auf die Veranden oder zu<br />
den wenigen am Kirchplatz gelegenen Bänken. Unter diesen Umständen ist es nicht zu ver-<br />
hindern, dass die Grenze zwischen öffentlichem Raum und privatem (Wohn-)Raum der un-<br />
tergebrachten Asylsuchenden verschwimmt. Dass die Familie der Besitzerin gleichfalls im<br />
107 Vgl. Interviews Payr 05.12.2003; Singer 05.12.2003.<br />
108 Interview Payr 12.03.2004.<br />
109 Interview Singer 05.12.2003, Z 202-210.<br />
110 Interview Payr 12.03.2004.<br />
111 Ein für den regulären Betrieb nicht genutzter Gastraum im hinteren Bereich des Erdgeschosses dient lediglich<br />
als Arbeits- und für die Asylsuchenden auch als Essraum Die Flüchtlinge könnten, so die Wirtin, „auch vorne<br />
sein im Gastraum, aber das wollen sie selber nicht“ (Interview Unterkunftsleitung 08/1, 05.12.2003).<br />
114
Haus wohnt 112 , relativiert den „Auslagencharakter“ des Standorts keineswegs: Anders als bei<br />
den der Unterkunft zugewiesenen Asylsuchenden ist ihr Leben im Gebäude Resultat eigener<br />
(ökonomischer) Überlegungen und einer daraus resultierenden freien Entscheidung, auch ver-<br />
fügt die Familie tatsächlich über privaten Wohnraum.<br />
Mit Blick auf im Gasthof untergebrachte Kinder muss das lagebedingt völlige Fehlen bespiel-<br />
barer Außenanlagen und das Fehlen bespielbarer öffentlicher Flächen im unmittelbaren Um-<br />
feld als problematisch bewertet werden. Der zwischen der Westfront des Unterkunftsgebäudes<br />
und dem Nachbarhaus gelegene kleine Asphaltplatz ist zum Spiel nicht geeignet, da er von<br />
der vielbefahrenen Straße nicht abgetrennt ist. 113 Eine positiv zu bewertende Folge der Lage<br />
unmittelbar im Zentrum ist der völlig problemlose Zugang zur Busverbindung in die Landes-<br />
hauptstadt: Die Haltestelle befindet sich gegenüber der Südfront der Unterkunft, Innsbruck ist<br />
in einer knappen Viertelstunde erreichbar. Aufgrund der vergleichsweise geringen Distanz<br />
kann daher auch das fast vollständige Fehlen ergänzungsökonomischer Betriebe sowie von<br />
Treffpunkten migrantischer Communities kompensiert werden.<br />
Die Standortwahl, die im Fall der Götzner Unterkunft durch das 1990 auch in Tirol noch da-<br />
für zuständige Innenministerium erfolgte, orientierte sich offenkundig weniger an formalen<br />
und inhaltlichen Kriterien, sondern am Leitsatz „Quartier ist Quartier“. Entsprechend wurde<br />
der Standort an der betroffenen Gemeinde vorbei realisiert und weder Gemeindeführung noch<br />
die Bevölkerung informiert. Dass der damalige Bürgermeister den Einzug der Asylsuchenden<br />
erst von BürgerInnen erfuhr, überrascht zur Unterkunft ging, um sich mit eigenen Augen da-<br />
von zu überzeugen, und damit letztlich vor der Bevölkerung bloßgestellt worden war, stellt<br />
einen bemerkenswerten politischen Affront dar. Der folgende Aufruhr in der Gemeinde<br />
scheint vor diesem Hintergrund weniger erstaunlich, als der Umstand, dass der Bürgermeister<br />
sich im weiteren Verlauf immer wieder mit praktischen Unterstützungsmaßnahmen für die<br />
vor Ort untergebrachten Flüchtlinge einsetzte.<br />
6.3 Kössen: Leben im »Winkl«<br />
Mit der Beherbergung von „Fremden“ verdienen in Kössen schon lange zahlreiche Bewohner-<br />
Innen ihren Lebensunterhalt. Seit Herbst 2002 sind unter diesen „Fremden“ auch Asylsuchende<br />
– Ende Juni 2004 waren es dreißig. 114<br />
112 Vgl. ebd.<br />
113 Richtung Innsbruck, unweit der Gemeindegrenze, ist zwar ein Spielplatz vorhanden, es ist jedoch davon<br />
auszugehen, dass Eltern den Weg dorthin zumindest ihre kleineren Kinder nicht alleine zurücklegen lassen.<br />
114 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
115
6.3.1 Die Gemeinde: Eigenständigkeit im Grenzland<br />
Als regelrechten „Verkehrsknotenpunkt“ bezeichnet Guggenbichler im von ihm verfassten<br />
Heimatbuch die Gemeinde Kössen 115 – Heimatliebe, so müssen wir wohl daraus schließen,<br />
kann unter Umständen den Blick recht deutlich trüben. Denn Kössen, eine 4.122 Einwohner-<br />
Innen zählende Gemeinde im äußersten Nordosten Tirols, liegt in jeder Beziehung im<br />
„Winkl“ 116 : Abseits aller bedeutenden Verkehrswege und ohne Anschluss an das Eisenbahn-<br />
netz ist der Ort idyllisch zwischen Kaisergebirge und Chiemgauer Alpen gelegen, im Norden<br />
und Osten in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze und den deutschen Nachbargemeinden<br />
Schleching und Reit im Winkl. So verwundert es keineswegs, dass das „herrliche Kössener<br />
Landl“ (so der Heimatbuch-Verfasser immer wieder enthusiastisch) über einen recht be-<br />
schaulichen Charakter verfügt, der in Verbindung mit der teils wildromantischen Landschaft –<br />
dem großen Kapital des Ortes – und den zahlreichen Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung<br />
offenkundig die ideale Voraussetzung für einen äußerst beliebten Tourismusort darstellt.<br />
Die Lage im „Winkl“ zwang die auf 589 Meter Seehöhe gelegene Gemeinde von Anfang an,<br />
möglichst eigenständige Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Traditionell sind daher neben<br />
der Landwirtschaft (die mittlerweile mit Bioprodukten aus der Umgebung auf wöchentlichen<br />
Bauernmärkten bis nach Innsbruck hin präsent ist) auch Handwerk, Handel und Gewerbe von<br />
einiger Bedeutung. 117 Die zentrale wirtschaftliche Rolle nimmt mittlerweile jedoch der<br />
Tourismus ein: Kössen ist im Sommertourismus Spitzenreiter im Bezirk. 118 Die wirtschaft-<br />
liche Zugehörigkeit der Berufstätigen im Ort hat sich seit den 1960ern dementsprechend radi-<br />
kal gewandelt. 119 Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein prägen das Kössener Gemeinde-<br />
leben jedoch nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht: Im Bildungsbereich verfügt der Ort über<br />
ein für seine Größe bemerkenswertes Spektrum, das nur durch die oben skizzierte Lage er-<br />
klärbar scheint. Neben dem öffentlichen Kindergarten besteht mit dem „Sonnenhaus“ auch<br />
eine auf Vereinsbasis organisierte Kindergruppe, von den beiden Volksschulen wird eine als<br />
dreiklassige Kleinschule geführt, in der altersgemischt gelernt wird. Daneben bestehen auch<br />
eine Haupt-, eine Polytechnische und eine Erwachsenenschule. 120<br />
115<br />
Vgl. Guggenbichler 1991, 12.<br />
116<br />
Tatsächlich wird seit 1970 von den Tourismusverbänden der drei benachbarten Gemeinden Kössen, Schwendt<br />
und Walchsee zu Werbezwecken die Bezeichnung „Kaiserwinkl“ für die Region verwendet (vgl. Guggenbichler<br />
1991, 204).<br />
117<br />
Ein Werk des Tiroler Walkwaren-Erzeugers Giesswein ist heute jedoch der einzige industrieähnliche<br />
Kössener Betrieb.<br />
118<br />
2003 wurden über 348.000 Nächtigungen im Sommer und 270.969 Nächtigungen im Winter verzeichnet<br />
(Amt der Tiroler Landesregierung 2004), trotz dieser Zahlen ist Kössen allerdings eher eine PendlerInnengemeinde<br />
(vgl. ebd.).<br />
119<br />
Nach Guggenbichler (1991, 196) ist die Zahl der in Land- und Fortwirtschaft Beschäftigten von 510 (1961)<br />
auf 141 (1981) gesunken, die der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich dagegen von 221 auf 814 angestiegen.<br />
Kössen ist damit das Musterbeispiel einer Gemeinde, in welcher – wie meist in Tirol – der Übergang von der<br />
agrarischen in die Dienstleistungsgesellschaft erst spät, dann jedoch in raschem Tempo und ohne den Umweg<br />
über die Industrialisierung erfolgte (vgl. Preglau 2004).<br />
120<br />
Vgl. Gemeinde Kössen 2004 (Homepage).<br />
116
Während die Traditionsvereine unter teils markigen Bezeichnungen an eine bewegte Vergan-<br />
genheit zu erinnern suchen – „Landsturm 1809“ ist freilich trotz des kriegerischen Namens<br />
lediglich ein Trachtenverein – und die Schützenkompanie sicherheitshalber durch eine<br />
Schützengilde ergänzt wurde, leisten sich die KössenerInnen zwecks Ausgestaltung der<br />
Gegenwart eine beachtliche Zahl an Sportvereinen für ein Spektrum, das vom vergleichsweise<br />
banalen Schisport und Fußball über das Reiten und Trabrennfahren bis zum Taekwondo-<br />
Kämpfen, Sportfischen und sogar Hufeisen- und Plattenwerfen reicht. In einer Sportart hat es<br />
Kössen nach Einschätzung Guggenbichlers gar zur „europäischen Metropole“ gebracht: Die<br />
Gemeinde ist eine Pionierstätte des Hänge- und Paragleitersports. 121<br />
Die Kössener Politik wird von Listen dominiert, die es vermeiden, den Namen einer etablier-<br />
ten Partei als Bezeichnung zu nutzen. Bürgermeister Stefan Mühlberger trat bei den Gemein-<br />
deratswahlen Anfang 2004 mit der „Fortschrittlichen ArbeitnehmerInnen- und Bürgermeis-<br />
terliste“ an, einer Liste des Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB) der ÖVP. Zwar verlor<br />
die Liste über drei Prozent, sie konnte jedoch ihre vier Mandate halten. Die mit dem ÖAAB<br />
gekoppelte Liste „Wir für Alle – Wirtschaft und Arbeit“ gewann dagegen ein Mandat dazu<br />
und verfügt nun über fünf Sitze im Gemeinderat. Mit gleich drei Mandaten zog die unab-<br />
hängige „Eine Liste für Alle“ neu ein, die ÖVP-„Bauernliste“ hielt ihre zwei Mandate. In<br />
Kössen vergleichsweise stark ist die FPÖ: Gegenüber 1998 verlor sie zwar weit über sieben<br />
Prozent und zwei Mandate, im Gemeinderat bleibt sie jedoch mit 9,97 Prozent nach wie vor<br />
mit einem Sitz vertreten.<br />
6.3.2 Der Standort: Ein »Einheimischenlokal« als Zwischenstation<br />
Weder im Zentrum, noch völlig am Ortsrand: Die Kössener Unterkunft befindet sich im<br />
Ortsteil Waidach, der – wenn man aus westlicher Richtung von Kufstein über Niederndorf<br />
und Walchsee nach Kössen kommt – etwa zwei Kilometer vor dem Ortskern („Dorf“) liegt.<br />
Bis zu Letzterem ist das Gebiet durchgängig besiedelt, sodass die Umgebung der Unterkunft<br />
nicht den Eindruck macht, außerhalb der Gemeinde zu liegen.<br />
Wie in Götzens befindet sich die Unterkunft in einem Gasthof, der früher auch als Pension<br />
diente. Hier besteht jedoch der Gasthofbetrieb nach wie vor in annähernd vollem Umfang.<br />
Der „Brennerwirt“, 1875 von einem Branntweinbauer gegründet und in der Vergangenheit<br />
auch einige Zeit Spielstätte des lokalen Theatervereins 122 , ist nach Einschätzung des Kössener<br />
Bürgermeisters „so ein bisschen ein Einheimischenlokal, wo dann am Feierabend noch ein<br />
paar so ein Bier trinken gehen“. 123 Äußerlich ein typischer Tiroler Landgasthof in sehr gutem<br />
baulichen Zustand, verfügt das Gebäude einschließlich des ausgebauten Dachgeschosses über<br />
drei Stockwerke, die teils mit Holzbalkonen versehen sind. Eine gepflasterte Terrasse dient im<br />
121<br />
Vgl. Guggenbichler 1991, 204 und 304ff.<br />
122<br />
Ebd., 213.<br />
123<br />
Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 155f.<br />
117
Erdgeschoss als Gastgarten, ihr vorgelagert ist ein kleiner Spielplatz, der durchaus einladend<br />
wirkt. 124 Ergänzt wird das Ensemble durch einen Holzbrunnen und ein im Zwickel zweier<br />
Nebenstraßen gelegenes Rasendreieck mit ein paar kleinen Bäumen und einer Holzbank. Die<br />
hauseigenen Außenanlagen (neben Terrasse und Spielplatz auch ein Parkplatz hinter dem<br />
Haus) vermitteln allesamt einen sauberen und gepflegten Eindruck. Ein öffentlicher Post-<br />
kasten an der Straßenseite des Gasthofs lässt darauf schließen, dass der „Brennerwirt“ ein Ort<br />
ist, der von den BewohnerInnen der Umgebung selbstverständlich besucht und genutzt wird.<br />
Ein Blick auf die Nachbarschaft scheint dies zu bestätigen: Das Unterkunftsgebäude fügt sich<br />
harmonisch in die lockere Bebauung ein. Die benachbarten Einfamilienhäuser, die mehrheit-<br />
lich erst in der jüngeren Vergangenheit entstanden sein dürften, vermitteln einen offenen und<br />
freundlichen Eindruck. 125 Mit ihrer Errichtung hat sich die Gegend zum Wohngebiet entwi-<br />
ckelt, der einzige Wirtschaftsbetrieb, der noch größeren Raum einnimmt, ist ein gegenüber<br />
der Vorderfront der Unterkunft liegender Bauernhof, dessen Areal großteils als Holzlager<br />
dient. Mit einer an der Straßenseite dieses Lagers befindlichen Säge werden hier Baum-<br />
stämme zugeschnitten und für den Weitertransport vorbereitet. Wenige Meter von der West-<br />
front der Unterkunft entfernt fließt der Kohlenbach vorbei, dessen Ufer von Laubbäumen be-<br />
standen sind. Am westlichen Ufer führt ein Pfad kaum mehr als hundert Meter von der Unter-<br />
kunft entfernten „Alpengolfplatz Kaiserwinkl“, einem malerisch teils im Wald gelegenen 18-<br />
Loch-Platz. Felder betonen jenseits des Kohlenbachs den ländlichen Charakter des Gebiets.<br />
Die ins Kössener Zentrum bzw. Richtung Kufstein führende Bundesstraße ist gleichfalls etwa<br />
hundert Meter entfernt, entsprechend ist das Umfeld des „Brennerwirts“ verkehrsarm.<br />
Aufgrund der oben geschilderten lagebedingten Eigenständigkeit Kössens ist die Beschaffung<br />
von Gütern des täglichen Bedarfs ebenso ohne größere Schwierigkeiten möglich, wie die<br />
grundlegende gesundheitliche Versorgung. 126 Im Gemeindeleben scheint hier insbesondere<br />
die Ortsstelle des Roten Kreuzes eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen: Mitten im Zent-<br />
rum zwischen Gemeindeamt und Volksschule angesiedelt, erfüllt das Rotkreuz-Team nicht<br />
nur die klassischen Ortsstellenaufgaben wie Rettungs- und Krankentransporte, sondern ver-<br />
fügt auch über einen Gesundheits- und Sozialdienst vor allem für ältere und alte Menschen<br />
und ein eigenes Kriseninterventionsteam mit speziell ausgebildeten freiwilligen Mitarbeiter-<br />
Innen. 127 Kindergarten, Volks- und Hauptschule befinden sich im Zentrum oder in dessen<br />
124 Der Spielplatz umfasste zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheins über eine mit einem niedrigen Holzlattenzaun<br />
begrenzte Wiese, auf der sich ein Sandkasten, eine kleine Holzhütte mit verschiedenen Spielsachen, eine<br />
Rutsche, eine Wippe aus Holz sowie zwei Schaukeln befanden. Diese Spielmöglichkeiten waren alle in guten<br />
Zustand. Vor der Terrasse des Gasthofs stand überdies ein Tischtennistisch.<br />
125 Die nur abschnittsweise vorhandenen oder relativ niedrigen Zäune zwischen den Grundstücken – auch das<br />
unmittelbar neben dem Gasthof liegende Haus ist von diesem nur durch einen Gartenzaun mit eher symbolischem<br />
Charakter getrennt – tragen zu diesem Eindruck ebenso bei, wie die während des Lokalaugenscheins bei<br />
einigen Häusern vor den Haustüren stehenden Kinder- und Erwachsenenschuhe.<br />
126 Kössen verfügt über drei Allgemeinmediziner, zwei Zahnärzte sowie einen Physiotherapeuten.<br />
127 Vgl. Gemeinde Kössen 2004 (Homepage). Der dortigen ausführlichen Selbstdarstellung ist zu entnehmen,<br />
dass die Ortsstelle auch über eine eigene Sozialreferentin verfügt. Diese war auch in die Realisierung der Unterkunft<br />
eingebunden (siehe hierzu Abschnitt 7.3.4).<br />
118
unmittelbarer Umgebung, ebenso die öffentlich zugängliche Pfarr- und Gemeindebibliothek.<br />
In Kössen nicht vorhanden sind Gebetsstätten oder religiöse Treffpunkte jenseits der römisch-<br />
katholischen Pfarrkirche. Auch Betriebe, die der Ergänzungsökonomie zugeordnet werden<br />
könnten, gibt es in der Gemeinde nicht.<br />
In größerer Entfernung zur Unterkunft liegt ein Freibad („Waldbad“), die Distanz zum auch<br />
als Badesee genutzten und Richtung Kufstein gelegenen Walchsee beträgt bereits etwa zehn<br />
bis 15 Kilometer. Der See ist jedoch mit dem Bus erreichbar, etwa hundert Meter nordöstlich<br />
des „Brennerwirts“ befindet sich an der Kreuzung zur Bundesstraße eine Haltestelle der<br />
montags bis samstags von Kössen über Walchsee und Niederndorf nach Kufstein verkehren-<br />
den Buslinie. Um in die etwa 110 Kilometer entfernte Landeshauptstadt Innsbruck zu gelan-<br />
gen, muss man mit dieser Buslinie nach Kufstein fahren und dort in die Eisenbahn umstei-<br />
gen. 128 Ähnlich kompliziert ist die Fahrt in die Bezirkshauptstadt Kitzbühel: Die vorhandene<br />
direkte Busverbindung verkehrt nur selten, die Alternative ist die Fahrt mit der häufiger ver-<br />
kehrenden Direktverbindung nach St. Johann in Tirol und der dortige Umstieg in die Bahn. In<br />
beiden Fällen ist eine Fahrtzeit von mehr als einer Stunde zu veranschlagen.<br />
6.3.3 Die Standortwahl: Telefonieren ohne zu Zögern<br />
Ende September 2002 richtete Landesrätin Gangl über die Tiroler Tageszeitung einen emotio-<br />
nalen Appell insbesondere an Gastwirtinnen und -wirte sowie PrivatvermieterInnen. NGOs<br />
hatten zuvor kritisiert, dass immer mehr Asylsuchende in Tirol auf der Straße stünden. „Wir<br />
stehen fast ohnmächtig vor dieser Situation und sind permanent auf der Suche nach Unter-<br />
künften“, so Gangl: „Der Winter steht vor der Tür!“ 129 Die TirolerInnen, bat die Landesrätin,<br />
sollten dem Land Unterkünfte zur Unterbringung Asylsuchender vermieten. „Ich habe den<br />
Aufruf des Landes in der Zeitung gelesen“, so die Kössener Brennerwirtin knapp einen Monat<br />
später in der Tiroler Tageszeitung. Ohne zu Zögern habe sie zum Telefon gegriffen, zu ihrer<br />
Überraschung sei sie gleich mit Gangl verbunden worden. „Flüchtlingskoordinator Peter<br />
Logar hat sich dann unseren Betrieb angeschaut. Am Montag sind bereits die ersten Asylwerber<br />
eingezogen.“ 130<br />
6.3.4 Die Standortrealisierung: »Machen wir das ganz offiziell«<br />
Vor dem Eintreffen der Flüchtlinge am 21. Oktober wurde freilich auch Bürgermeister Stefan<br />
Mühlberger (ÖVP) vom Flüchtlingskoordinator des Landes informiert. Dieser, so Mühlberger<br />
im Interview, habe ihm mitgeteilt, dass sich der „Brennerwirt“ für die Unterbringung Asyl-<br />
suchender interessiere und ihn gefragt, was er dazu sage:<br />
„Dann sag ich: Ja bravo! [lacht] Jetzt ... [...] Er ist dann hergekommen und wir haben uns zusammengesetzt und<br />
er sagt, er sucht dringend Unterkünfte, weil er hat Leut’ wirklich auf der Straße in Innsbruck. Und dann hab ich<br />
128 Für die Fahrt nach Innsbruck sind gut zwei Stunden Fahrtzeit zu veranschlagen.<br />
129 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 27.09.2002.<br />
130 Zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.10.2002b.<br />
119
gesagt: Na, wenn ... bevor wir da eine aufschwappende Bevölkerungsstimmung zusammenkriegen, die wir dann<br />
irgendwo niederkämpfen müssen, machen wir das ganz offiziell. Ich hab dann einen Kreis eingeladen: Rotes<br />
Kreuz, Kirche, Tourismus, Gemeinde, Sozialreferentin der Gemeinde, wir haben uns da im Sitzungszimmer<br />
zusammengesetzt, da hab ich gesagt: Ein Wirt glaubt, er kann da mehr anzapfen, hat halt mehr Geschäft oder<br />
seine Existenz sichern, indem er das dem Land vermietet, es sind ungefähr dreißig Leute, maximal, was er Platz<br />
hat, und was tun wir, nicht? Wenn man das jetzt mit fadenscheinigen Argumenten abwürgen und sagen [würde]:<br />
Wir wollen das nicht, weil das dem Tourismus schädlich ist, das und das und das ist, ja – wenn das jeder tut,<br />
dann werden wir auch das Problem nicht lösen. Und ich sag: Wenn’s nicht größer ist – für dreißig Leut’ –, dann<br />
müsste es ein Ort vertragen.“ 131<br />
Dass die Laufzeit des ersten Unterbringungsvertrages zwischen Land und „Brennerwirt“ nur<br />
bis Mitte Dezember 2002 ging, weil über den Winter die Pension bereits ausgebucht gewesen<br />
sei, habe zur Beruhigung beigetragen – man wertete die Zeit als „Probephase“. Unter Führung<br />
des Bürgermeisters setzten die am runden Tisch beteiligten MeinungsbildnerInnen in der<br />
Folge auf Transparenz und beschlossen, die Bevölkerung und auch die Presse zu informieren,<br />
um von Anfang an zu signalisieren: „Nein, wir stehen schon hinter dem. [...] Also, weil wir in<br />
der Gemeinde der Meinung sind, es muss auch ein Tourismusort dreißig Flüchtlinge vertra-<br />
gen.“ 132 Ergebnis war ein positiver Bericht in der Tiroler Tageszeitung 133 und eine Ausgabe<br />
des zweiseitigen amtlichen Mitteilungsblattes Kössen informiert, in welchem sich Bür-<br />
germeister Mühlberger, Pfarrgemeinderat Karl Mitterer und die Sozialreferentin des lokalen<br />
Roten Kreuzes, Christine Sturm, sich auf einer vollen Seite in bemerkenswerter Offenheit an<br />
die Bevölkerung wandten:<br />
„Liebe Kössenerinnen und Kössener!<br />
Wir möchten Euch heute sozusagen aus »erster Hand« darüber informieren, dass durch das Land Tirol in Kössen<br />
befristet bis 15. Dezember 2002 ca. 25 Asylwerber im Gasthof Brennerwirt untergebracht werden.<br />
Um unnötige Negativstimmungen zu vermeiden wurde im Beisein des Herrn Pfarrers, Vertretung des Tourismusverbandes,<br />
Rotes Kreuz, Gendarmerie und Gemeindevertretung zusammen mit Herrn Peter Logar, Amt der<br />
Tiroler Landesregierung, eine Besprechung abgehalten. [...]<br />
Neben einigen Bedenken, die durchaus auch berechtigt sind, wurde grundsätzlich eine positive Stimmung aufgebracht<br />
und es sollten hier auch folgende Aspekte berücksichtigt werden:<br />
Die Unterbringung von Asylwerbern in Tirol stellt für das Land ein großes Problem dar und wenn sich<br />
diese Situation (wenn auch befristet) einer Gemeinde stellt, so soll nicht von vornherein mit konstruierten<br />
Problemen ein Unbehagen aufgebaut werden. Auch ein Tourismusort sollte sich dieser Herausforderung<br />
stellen und durch ein gewisses Maß an Toleranz und sozialer Einstellung die Anwesenheit von Menschen,<br />
die durch das Schicksal, politischen Wirren und Verfolgung schwer getroffenen sind, akzeptieren. Durch<br />
ein positives Entgegenkommen gegenüber diesen vorübergehenden Bewohnern von Kössen durch die<br />
ganze Bevölkerung kann vielleicht auch etwas »Heimat« vermittelt werden.<br />
In diesem Sinne bitten wir alle Kössenerinnen und Kössener um positive Kenntnisnahme und danken im Namen<br />
unserer vorübergehenden Gäste für die wohlwollende Einstellung.“ 134<br />
Die Gemeinde selbst informierte, so Bürgermeister Mühlberger, auch die NachbarInnen der<br />
Unterkunft „ein bisschen“ und forderte sie auf, „uns auch gleich [zu] informieren, wenn’s<br />
irgendwelche Probleme gibt“. 135 Am Ende der Wintersaison wurde klar, dass der „Brenner-<br />
wirt“ Interesse an einem längerfristigen Vertrag mit dem Unterkunftsgeber hatte:<br />
131<br />
Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 16-27.<br />
132<br />
Ebd., Z 33-36.<br />
133<br />
Siehe Tiroler Tageszeitung 24.10.2002b.<br />
134<br />
Mühlberger/Mitterer/Sturm, zit. in: Kössen informiert (8), Oktober 2002, 2. Hervorhebungen, grammatikalische<br />
und orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
135<br />
Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 40f.<br />
120
„[...] also mit März oder April hat mir der [Flüchtlingskoordinator] Logar dann gesagt, er will das weitermachen,<br />
weil’s soweit funktioniert hat, und dann hab ich gesagt, ihm: Wir haben eigentlich keine handfesten Argumente,<br />
um das aus der öffentlichen Sicht zu verhindern oder [...] abzulehnen, weil man kann nicht sagen: »Ja, wir wollen<br />
nicht, dass ein paar ... Andersfarbige sozusagen im Ort spazieren gehen, das wollen wir nicht!« – Ja, um<br />
Gottes Willen! Nein, und deswegen haben wir gesagt: Okay, dann ist’s so.“ 136<br />
Der Flüchtlingskoordinator nahm das pragmatische Vorgehen des Bürgermeisters erfreut zur<br />
Kenntnis: Mühlberger habe „das dann eigentlich sehr offensiv und aus meiner Sicht ziemlich<br />
positiv aufgenommen“. 137 Freilich, völlig konfliktfrei ging auch die Realisierung des Stand-<br />
orts Kössen nicht vonstatten, wie die Unterkunftsleiterin im Interview berichtet:<br />
„Haben Sie negative Rückmeldungen bekommen?<br />
Ja, um Gottes Willen!<br />
Von den Nachbarn auch, oder ...?<br />
Von den Nachbarn wenig. [...] Wenig, ja. Wenig. [...] Nein, das ist nicht so einfach. Die Leut’ ... Weil es sind ja<br />
auch Neger dabei, und da wollen die Leut’ einfach ... Abstand. [...] Die sind einfach anders eingestellt, und es ist<br />
ja so einfach – man liest jeden Tag in der Zeitung, man hört alle Tage: Da sind die Einbrüche – nur, nur, nur<br />
Ausländer, und sonst noch so ... Schlägereien, und Ding und ... [...]<br />
Aber Konflikte haben Sie jetzt dann jetzt wenigstens nicht mit [...] Leuten aus der Gemeinde [...]?<br />
Na ja, das war, aber das ist jetzt ...<br />
Aber es ist gewesen am Anfang?<br />
Ja ja. [...] Da haben sie schon in der Nacht angerufen!“ 138<br />
6.3.5 Idyllisch isoliert? Der Standort in der Diskussion<br />
„Wir leben in einer Landschaft“, so 1991 der damalige Kössener Bürgermeister und nunmeh-<br />
rige Landtagsabgeordnete Josef Hechenbichler (ÖVP), „die nach vielen Seiten Öffnungen hat<br />
und die den Blick in die Weite nicht verstellt; und offen sind auch die Menschen in unserem<br />
Dorf, die einerseits in einem sehr hohen Maße vorbehaltlos bereit sind, Zugezogene in die<br />
Dorfgemeinschaft aufzunehmen, und andererseits hat es immer wieder junge Kössener und<br />
Kössenerinnen in die weite Welt gezogen.“ 139 Hechenbichler hatte damals freilich wohl kaum<br />
an Flüchtlinge gedacht. Seitens der Gemeindeführung bemühte man sich jedoch anfänglich<br />
tatsächlich, den Asylsuchenden in Kössen den Start zu erleichtern und Konflikte zu minimie-<br />
ren. Die Gemeinde engagierte einen aus Gesundheitsgründen pensionierten Lehrer als<br />
„Kontaktmann“, wie Bürgermeister Mühlberger erzählt:<br />
„[...] der hat sich dann ein bisschen unterhalten, hat auch die Leut’ ein bisschen im Ort da einmal ... hat ihnen<br />
den Ort gezeigt, und dann haben wir auch ganz leichte Beschäftigungen [...] einrichten können, dass die Leut’<br />
ein bisschen was zu tun haben. So ... so Uferreinigungsaktionen und Radwege ... Das hat recht gut funktioniert,<br />
da haben wir eine Kleinigkeit von der Gemeinde dann als Taschengeld ausgeschüttet.“ 140<br />
Nach der zweiten Wintersaison, im Frühjahr 2003 habe sich diese Betreuung allerdings „nicht<br />
mehr aktivieren lassen“:<br />
136 Ebd., Z 64-68.<br />
137 Interview Logar 10.10.2003, Z 790f.<br />
138 Interview Unterkunftsleitung 03/1, Z 6-43; die Fragen des Interviewers sind kursiv gesetzt. Negative<br />
Rückmeldungen bekam die Wirtin rund um das Eintreffen der ersten Asylsuchenden auch von Gästen, ein Rückgang<br />
der BesucherInnenzahlen des Schankbetriebes war für sie jedoch nicht feststellbar.<br />
139 Hechenbichler 1991.<br />
140 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 50-54.<br />
121
„Es war [...] nicht ganz die ideale Besetzung. [...] Beziehungsweise die ... die Kontaktstelle zwischen Büro Logar<br />
und dem betroffenen Herrn, also der das gemacht hat, war nicht die idealste, sag’ ich jetzt einmal, und dann hat<br />
sich niemand sonst angeboten, dann hat man’s einmal versucht, ohne das zu machen, der hätte das ja gern wieder<br />
gemacht – ich hätt’s gut gefunden. Weil es sind ... Also ich würd’ sagen: Wenn Probleme auftauchen, würd’ ich<br />
sofort hergehen und sagen: Lieber Logar, da musst du mir einen her, der was vor Ort täglich ein bisschen Kontakte<br />
mit den Leuten hat, die ein bisschen besser im Griff hat – diese Kontaktstelle deckt jetzt sozusagen die<br />
Wirtin ein bisschen ab.“ 141<br />
Mühlberger sieht die Situation jedoch durchaus kritisch: Die Wirtin könne letztlich die Rolle<br />
einer Kontaktperson zwischen Gemeinde und Asylsuchenden nur teilweise erfüllen.<br />
„[...] grad jetzt so ein bisschen die ... die soziale Akzeptanz nach außen verbessert rüberzubringen wär’ ... so eine<br />
rechte Person – die jetzt natürlich nicht weiß Gott was kosten darf, eher so ein Anerkennungsbeitrag oder Abgeltung<br />
für Kilometer und so - wär’ schon gut. [...] Weil damit könnt’ man auch die Leut’ noch ein bisschen<br />
besser beschäftigen, schauen, wer ist für was geeignet ... [...] Das wär’ dann schon - wär’ eine gute Sache. Weil<br />
Innsbruck ist ja für uns relativ weit weg [...]. Aber es wär’ halt immer ... der ginge halt viel mehr auf die ein und<br />
könnte das nach außen, im Ort, viel besser vertreten.“ 142<br />
Was die Kössener Bevölkerung hinsichtlich der untergebrachten Flüchtlinge bewegt, weiß<br />
Mühlberger offenkundig recht genau. Er identifiziert – im ländlich-beschaulichen Kössen<br />
wenig überraschend – die Beschäftigungslosigkeit der AsylwerberInnen als zentrales Diskus-<br />
sionsthema und, damit verbunden, ihre Präsenz im öffentlichen Raum. Wenn dann auch noch<br />
einige der Asylsuchenden über ein Mobiltelefon verfügen, kollidiert dies für viele Kössener-<br />
Innen mit ihren Vorstellungen, wie Flüchtlinge zu sein hätten:<br />
„[...] es ergibt sich insgesamt auch durch die ... durchs gesamte Auftreten der Leute schon einige Diskussionen in<br />
der Öffentlichkeit. [...] Die haben fast alle ein Handy, die marschieren mit den digitalen herum, und da sagen sie:<br />
»Die haben einen Flüchtlingsstatus? Da müssen wir uns unterhalten ...« Das juckt die Leut’ bei uns schon ein<br />
bisschen. [...] Die treffen auch ... die Einheimischen treffen auch die in den Gasthäusern, nicht? Und reden auch<br />
mit denen. Und sagen: »Ja – wie gibt’s denn sowas?« [...] »Der kann ja nie ein Flüchtling sein!« Nicht? Ich<br />
mein’, da ist natürlich die vorschnelle Entscheidung aus ... ohne Kenntnis ... in Unkenntnis der ganzen Lage und<br />
der ganzen Dinge ist natürlich da sehr schnell bei der Hand und sagt: »Das ist ... So darf das nicht sein.«“ 143<br />
Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Unterkunft beherrscht dieser Aspekt die Diskus-<br />
sion. Während eine Nachbarin auf einem Fragebogen über ihre Erfahrungen, Meinungen und<br />
Sorgen hinsichtlich der Flüchtlinge gelassen feststellte, sie habe „die Tür genauso offen wie<br />
vorher“ 144 , beklagte sich eine andere Frau, sie fände es „nicht richtig, wenn man sich zuhause<br />
nicht mehr daheim fühlt (ständig wird man beobachtet)“. 145 Eine weitere Nachbarin bejahte,<br />
dass sie sich vor den Flüchtlingen fürchte und begründete dies so: Die AsylwerberInnen seien<br />
„hochnäsig u. grüßen nicht“, sie „sehen oft nicht vertrauenerweckend aus“ und seien „in Ge-<br />
schäften unverschämt u. drängen sich vor“. 146 Und weiter:<br />
„Meiner Meinung sollten die Flüchtlinge froh sein bei uns in Sicherheit zu sein u. uns nicht nach Strich u. Faden<br />
ausnützen. Man kommt sich als Arbeiter blöd vor wenn man nebenan sieht wie diese jungen Leute herum lungern<br />
abends ausgehen, Zigaretten u. Getränke kaufen. [...] Es gibt bei uns im Lande viele Menschen die nicht 3x<br />
141 Ebd., Z 285-294.<br />
142 Ebd., Z 301-313.<br />
143 Ebd., Z 210-227.<br />
144 Fragebogen 06, 2003, 4.<br />
145 Fragebogen 08, 2003, 4.<br />
146 Fragebogen 12, 2003, 3.<br />
122
täg zum gedeckten Tisch gehen können also sollte da gründlich ausgemistet u. abgeschoben werden!!!! bevor es<br />
zu spät ist.“ 147<br />
Die selbe Frau merkte freilich auch an, sie fände es besser, „in vielen Gemeinden nur ein paar<br />
[Flüchtlinge] zu haben“, denn: „Wenn nur wenige im Ort wären könnte man sie besser in-<br />
tegrieren oder in einer Familie aufnehmen.“ 148 Ein Nachbar kommentierte trocken: „Ich finde<br />
die Unterbringung der Wirtschaftsflüchtlinge bzw. Asylwerber bei uns nicht schlecht doch in<br />
einem Notfall Streit Rauferei ist mir persöhnlich die Polizei zu lange aus.“ 149 Die Klärung<br />
einer Frage war dem Mann jedoch ein Anliegen: „Wer bezahlt den Asylwerbern das Telefo-<br />
nieren (Handy) ich habe nämlich beobachtet dass teilweise sehr lange Gespräche geführt wer-<br />
den?“ 150 Um die Beschäftigungslosigkeit der Flüchtlinge zu verringern, hatte ein Nachbar<br />
eine aus seiner Sicht wohl äußerst effiziente Lösung parat. In unbeholfenem Deutsch schlug<br />
er vor: „Asylwerbern sollen in der Gemeinde für Säuberungsarbeiten u. ectra. eingeteilt werden<br />
können. Ohnedaß man Ihnen ein Taschengeld geben muß.“ 151<br />
Von außerhalb der Gemeinde wurde der Standort Kössen trotz seiner Lage im nordöstlichsten<br />
Winkel Tirols und der dort fehlenden Direktanbindung an die großen Verkehrswege oder we-<br />
nigstens an das Eisenbahnnetz seit seiner Realisierung kaum zur Diskussion gestellt. Kritisch<br />
kommentiert wird eher das Fehlen sinnvoller Beschäftigungsmöglichkeiten, das bei manchen<br />
NGOs den Eindruck entstehen lässt, die Asylsuchenden seien „idyllisch isoliert“ und würden<br />
daher schon bald nach Wegen suchen, den für sie relevanten Informations- und Beratungs-<br />
einrichtungen, vor allem aber Kontaktmöglichkeiten zu migrantischen Communities bzw.<br />
Exilgemeinschaften näher zu kommen – und dafür notfalls auch bereit sein, ein Leben in Ob-<br />
dachlosigkeit in Kauf zu nehmen. Der interimistische Leiter des Innsbrucker Caritas-Integra-<br />
tionshauses, Efendi Onay, wertet im Gespräch Kössen daher auch als Beispiel für eine Unter-<br />
bringungspolitik, die zur Obdachlosigkeit von Asylsuchenden beitragen würde – wenn „wer<br />
in Kössen untergebracht wird ... Da gibt’s nichts für sie zu tun, 20er verkaufen zum Beispiel<br />
als Geldquelle ist nicht möglich und so weiter.“ 152 „Kössen ist halt nicht der Nabel der Welt“,<br />
hielt Ende Juli 2004 diesbezüglich Eva-Maria Deschmann, Mitarbeiterin der Flüchtlingskoor-<br />
dinationsstelle des Landes, gegenüber der Tiroler Tageszeitung fest – eine in der Gemeinde<br />
untergebrachte Asylwerberin hatte zuvor mit Hungerstreik gedroht, sollten sie und ihr sechs-<br />
jähriger Sohn nicht in Innsbruck untergebracht werden: „Vielen ist es dort zu langweilig, des-<br />
halb wollen sie nach Innsbruck, weil sie glauben, dass es ihnen dort besser geht.“ 153 Die<br />
alleinerziehende Asylwerberin hatte ihre Drohung damit begründet, dass sich in Kössen nie-<br />
mand für sie interessiere, auch dürfe ihr Sohn „weder in den Kindergarten noch in die<br />
147 Ebd., 4; grammatikalische und orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
148 Ebd., 3; orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
149 Fragebogen 14, 2003, 4; grammatikalische und orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
150 Ebd.; grammatikalische und orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
151 Fragebogen 10, 2003, 4; grammatikalische und orthographische Fehler im Original vorhanden.<br />
152 Interview Onay 10.03.2004. Der 20er ist eine Innsbrucker Straßenzeitung.<br />
153 Deschmann, zit. nach Tiroler Tageszeitung 31.07.2004a.<br />
123
Schule“. 154 Zwar waren in der fraglichen Zeit ohnehin Schulferien, der Vorfall zeigt jedoch<br />
deutlich die besondere Belastung, die eine Unterbringung in peripheren Gegenden ohne unter-<br />
stützende Betreuung vor allem für alleinstehende (und -erziehende) Frauen darstellt.<br />
6.3.6 Bewertung<br />
Die Kössener Unterkunft fügt sich an ihrem Standort harmonisch in das sie umgebende<br />
Wohngebiet ein. Das Gebäude ist in sehr gutem Zustand, die Außenanlagen sind insbesondere<br />
für Kinder adäquat gestaltet. Für Kinder ist es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens<br />
überdies problemlos möglich, den nur wenige Meter entfernten Kohlenbach und die auf des-<br />
sen anderer Uferseite befindlichen Wiesen aufzusuchen. Problematischer ist die Situation für<br />
Erwachsene: Die Lage der Gemeinde fern der bedeutenderen Verkehrswege und vor allem<br />
des Eisenbahnnetzes macht eine Fahrt in die Landeshauptstadt Innsbruck, wo sich die für<br />
Asylsuchenden relevanten Institutionen und Organisationen befinden, zu einem schwierigen<br />
Unterfangen. Im näheren Umfeld von Kössen ist auch keine weitere größere Gemeinde oder<br />
Stadt problemlos etwa mit dem Fahrrad erreichbar, in der es der Ergänzungsökonomie zuor-<br />
denbare Läden oder Cafés und Kontaktmöglichkeiten zu migrantischen Communities gäbe.<br />
Da in Kössen für die untergebrachten Flüchtlinge – sieht man von möglichen Hilfsdiensten im<br />
Gasthof selbst ab, die naturgemäß nicht unproblematisch sind – auch jede sinnvolle Beschäf-<br />
tigungsmöglichkeit fehlt, bleibt den Erwachsenen nur das untätige Spazierengehen und He-<br />
rumsitzen rund um die Unterkunft oder im Ort. Das Leben der Betroffenen droht damit immer<br />
in eine „Isolation in der Idylle“ zu kippen. Die Ausführungen des Bürgermeisters der Ge-<br />
meinde zeigen, dass er sich dieser Problematik bewusst ist. Dass der anfänglich von der Ge-<br />
meinde engagierte „Kontaktmann“ für die Asylsuchenden seine Arbeit nicht weiterführen<br />
konnte, führte der Bürgermeister vorrangig auf Schwierigkeiten zwischen dem betreffenden<br />
Lehrer und der Flüchtlingskoordinationsstelle des Landes zurück – und auf die Unmöglich-<br />
keit, in Kössen geeigneten Ersatz zu finden.<br />
Wie schon in Götzens ging auch in Kössen der Standortwahl ein öffentlicher Aufruf insbe-<br />
sondere an Gastwirtinnen und -wirte voraus, Unterkünfte für Asylsuchende zur Verfügung zu<br />
stellen. Die Entscheidung für den Standort fiel seitens des Landes Tirol offenkundig sehr<br />
rasch; nachdem der Kössener Bürgermeister sich nicht grundsätzlich ablehnend geäußert<br />
hatte, stand der Realisierung nichts mehr im Wege. Der noch vor dem Eintreffen der ersten<br />
Flüchtlinge veranstaltete runde Tisch mit lokalen MeinungsbildnerInnen und Verantwor-<br />
tungsträgerInnen ging auf die Initiative Bürgermeister Mühlbergers zurück, das Land Tirol<br />
war durch seinen Flüchtlingskoordinator zwar in der Runde vertreten, hatte jedoch ursprüng-<br />
lich nichts dergleichen geplant. Mühlberger ging auch in der Folge besonnen vor und infor-<br />
mierte die Bevölkerung über das Ergebnis des Treffens und die positive Haltung der Gemein-<br />
deführung gegenüber der Flüchtlingsunterbringung per Postwurf. Mit der Einberufung des<br />
154 Ebd.<br />
124
unden Tischs und dem folgenden, allerdings vorübergehenden Engagement des erwähnten<br />
„Kontaktmannes“ der Gemeinde zeigte Mühlberger als erster Tiroler Bürgermeister seit Jah-<br />
ren zumindest in Ansätzen auf, dass Kommunen trotz ihrer formalen „Unzuständigkeit“ im<br />
Unterbringungsbereich durchaus über einen beachtlichen Handlungsspielraum verfügen, der<br />
gestaltendes Agieren zum Wohle aller vorübergehend oder dauerhaft in der Gemeinde leben-<br />
den Menschen ermöglicht.<br />
6.4 Landeck: Wie man ein Weihnachtsmärchen schreibt<br />
Mitte des 20. Jahrhunderts hatte Landeck schon zweimal eine große Zahl an Flüchtlingen not-<br />
dürftig untergebracht: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war auf dem Gelände der<br />
Landecker Kaserne ein Lager für Weltkriegsflüchtlinge, Vertriebene und Displaced Persons<br />
eingerichtet, das zunächst unter UNRRA- und später unter IRO-Verwaltung stand und in dem<br />
sich anfänglich rund 6.000 (!) InsassInnen befanden. 155 Nach der niedergeschlagenen ungari-<br />
schen Revolution im Jahre 1956 gelangten 330 ungarische Flüchtlinge nach Landeck, auch sie<br />
wurde im Lager untergebracht. 156 Erst zu Jahresende 2003 wurde Landeck wieder zum Stand-<br />
ort für eine größere Flüchtlingsunterkunft, im Juni 2004 waren in dem vom Land Tirol selbst<br />
geführten Haus bereits 64 Flüchtlinge untergebracht. 157<br />
6.4.1 Die Gemeinde: Regionales Zentrum im Tiroler Oberland<br />
Landeck, die 7.459 EinwohnerInnen zählende Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, ist eine<br />
Schöpfung der Jahrhundertwende: Die Stadt entstand erst im Jahr 1900 als Ergebnis des<br />
Zusammenschlusses der damit zu Ortsteilen gewordenen Dörfer Angedair und Perfuchs. 158<br />
Die auf 816 Meter Seehöhe gelegene Gemeinde liegt am Schnittpunkt zweier wichtiger Ver-<br />
kehrswege: der Nord-Süd-Alpentransversale von Ulm, Kempten und Füssen über Reutte und<br />
den Fernpass nach Landeck und weiter über den Reschenpass nach Meran, Bozen und Trient<br />
einerseits, der Ost-West-Verbindung von Kufstein und Innsbruck über den Arlberg nach<br />
Feldkirch, Dornbirn und Bregenz andererseits. Letztere ist seit dem Bau der Arlbergbahn,<br />
deren erste Teilstrecke von Innsbruck nach Landeck im Sommer 1883 eröffnet wurde, sowohl<br />
als Straßen- als auch Bahnverbindung von erheblicher Bedeutung.<br />
Der Bahnbau veränderte das heutige Landeck, das zuvor im geographischen Abseits gelegen<br />
hatte, nachhaltig: Zahlreiche der vorrangig aus dem Trentino stammenden Arbeiter ließen sich<br />
im Gemeindegebiet nieder 159 , das sich auch mehr und mehr zum Industriestandort ent-<br />
wickelte. Lange Zeit war Landeck in der Folge von zwei Industriebetrieben geprägt, die noch<br />
heute bestehen. Das frühere Carbidwerk (heute im Besitz der „Donau Chemie“) und das<br />
155<br />
Vgl. Stanek 1985, 217f; Eisterer 1991, 101-110; Spiss 1998, 234ff.<br />
156<br />
Wenzel 1998, 456.<br />
157<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
158<br />
Vgl. Zobl 1998a.<br />
159<br />
Vgl. Spiss 1998.<br />
125
Textilwerk sorgten jahrzehntelang für Arbeitsplätze, aber auch für starke Rauch- und Staub-<br />
belästigung. Der diesbezüglichen Kritik aus der Bevölkerung schlossen sich zunehmend auch<br />
TouristikerInnen an – die Stadt entwickelte sich schließlich mehr und mehr zu einem touristi-<br />
schen Reiseziel. 160 Landeck ist jedoch eine industriell geprägte Stadt geblieben, entsprechend<br />
stellt sie ein auch in ihrem Erscheinungsbild selbstbewusst wirkendes regionales Zentrum dar.<br />
Dazu trägt auch der Umstand bei, dass die Stadt über eine außerordentlich breitgefächerte<br />
Schullandschaft verfügt: Fünf Kindergärten stehen zur Verfügung, weiters drei Volksschulen,<br />
eine Haupt- und eine Polytechnische Schule, ein Gymnasium, eine Handelsschule und -aka-<br />
demie sowie mehrere Berufs- und Fachschulen. Den Erwachsenenbildungsbereich decken die<br />
Landecker Volkshochschule sowie das Berufsförderungsinstitut ab. Das Landecker Vereins-<br />
leben unterscheidet sich nicht von jenem vergleichbarer Städte und ist entsprechend breit ge-<br />
fächert. Auch im religiösen Bereich entspricht die Struktur einer Kleinstadt: Neben römisch-<br />
katholischen Kirchen ist in Landeck eine evangelische Pfarrkirche vorhanden, zwei mit<br />
MigrantInnenvereinen verbundene muslimische Gebetsstätten ergänzen das Spektrum.<br />
Politisch ist die Stadt mittlerweile von der SPÖ dominiert: Unter Bürgermeister Engelbert<br />
Stenico erreichte sie bei den Gemeinderatswahlen im März 2004 gleich zwölf Sitze im Stadt-<br />
rat, sie gewann damit gegenüber 1998 drei dazu. Die ÖVP ist in zwei Fraktionen gespalten:<br />
Als „Allgemeine Liste“ verlor sie zwei Mandate und hält nun bei fünf Sitzen, der mit ihr ge-<br />
koppelt angetretene ÖAAB konnte sein Mandat halten. Nur noch mit einem Sitz im Gemein-<br />
derat vertreten ist die FPÖ unter dem Apotheker Martin Hochstöger, von dem im Folgenden<br />
noch die Rede sein wird – bei den Wahlen im Jahr 1998 hatten die Freiheitlichen noch zwei<br />
Sitze im Stadtrat erreicht. Gemeindeoberhaupt Stenico wurde bei den Direktwahlen zum Bür-<br />
germeisteramt mit nahezu siebzig Prozent im ersten Wahlgang wiedergewählt – erst 1998 war<br />
es ihm mit einem Ergebnis von 55 Prozent gelungen, den bis dahin amtierenden ÖVP-Bür-<br />
germeister abzulösen.<br />
6.4.2 Der Standort: Im Zwischenland<br />
Die Landecker Unterkunft liegt in einem regelrechten „Zwischenland“: Sie befindet sich an<br />
einem Ort, der nur als „zwischen“ charakterisiert werden kann, und in einer Umgebung, deren<br />
Einrichtungen vor allem kurzen Zwischenaufenthalten dienen. Hier kommt man an, um mög-<br />
lichst schnell wieder abzufahren – und dazwischen hastig etwas zu erledigen oder einfach auf<br />
die Weiterfahrt zu warten. An der Nordseite des Unterkunftsgebäudes fließt der Inn vorbei, an<br />
der Südseite über jene Bundesstraße, die Landeck quer durch Tirol mit Kufstein verbindet, der<br />
Verkehr. Die Westseite blickt auf einen geschotterten Parkplatz am Innufer, an dessen Ende,<br />
kaum zwanzig Meter von der Unterkunft entfernt, ein Imbissstand kleine Mahlzeiten für „da-<br />
zwischen“ bietet. Die Straße hinauf in Richtung des gut zwei Kilometer entfernten Landecker<br />
Stadtzentrums liegt gerade noch in Sichtweite ein kleines Prüfzentrum des ARBÖ, auch<br />
160 Vgl. Wenzel 1998. Im Winter 2003 konnte Landeck knapp über 52.000 Nächtigungen verzeichnen, im Sommer<br />
des selben Jahres nahezu 72.000 (vgl. AdTLR 2004).<br />
126
dieses offenkundig eine Zwischenstation, die man schnell wieder verlässt. Auf der anderen<br />
Straßenseite zieht sich von hier bis hinunter zur Unterkunft das Areal des Landecker Bahn-<br />
hofs, das neben den umfangreichen Gleisanlagen auch einen sich über zumindest 300 Meter<br />
hinziehenden Parkplatz, einen Taxistandplatz, einige Bushaltestellen auf dem Bahnhofs-<br />
vorplatz, das Bahnhofsgebäude selbst und eine Verladestation unmittelbar gegenüber der Un-<br />
terkunft umfasst. Für einen Zwischenstopp geeignet ist auch die südöstlich gegenüber der<br />
Unterkunft liegende Tankstelle; das dahinter in östlicher Richtung anschließende Gewerbege-<br />
biet mit weiteren Tankstellen, einem Zollgebäude, mehreren Baufirmen und Fahrzeughänd-<br />
lern, einer großen Busgarage und verschiedenen kleineren Handels- und Gewerbebetrieben<br />
lädt gleichfalls kaum zu längerem Verweilen ein. Selbst die drei Wohnhäuser, die es in der<br />
Umgebung gibt, strahlen nur bedingt Wohnlichkeit aus: Ein größeres Haus im Besitz der<br />
Bundesbahn wird von dieser offenkundig zum Teil als Bürogebäude genutzt, die übrigen<br />
Räumlichkeiten dienen wohl als Dienstwohnungen; ein kleineres Haus direkt neben der Tank-<br />
stelle ist nur über das Tankstellengelände erreichbar; das einzige östlich der Unterkunft gele-<br />
gene kleine Haus zwängt sich wie diese zwischen Bundesstraße und Inn. Fels in der Brandung<br />
des Vorüberziehenden und -fließenden ist das Unterkunftsgebäude selbst, das als ehemaliges<br />
Gasthaus freilich erneut für vorübergehende Aufenthalte errichtet wurde.<br />
Der Gasthof Kaifenau, dessen Räumlichkeiten nun also Asylsuchenden als Zwischenstation<br />
dienen, entstand im Zuge des Baus der Arlbergbahn und lag zur damaligen Zeit wohl günstig,<br />
errichtete man doch hier, auf halbem Weg zwischen den Ortskernen der beiden Landecker<br />
Vorgängergemeinden und dem östlichen Nachbarort Zams, den schon vor der eigentlichen<br />
Gründung der Gemeinde so benannten Bahnhof Landeck. Bis zur neuen Grenzziehung durch<br />
die Nationalsozialisten im Jahr 1939 befand sich das Unterkunftsgebäude gar auf Gemeinde-<br />
gebiet des Nachbarortes Zams. 161 Auch heute noch ist die Stadtgrenze nah: Zams beginnt rund<br />
200 Meter hinter dem Gasthof. Die Kaifenau, so die ortsübliche Kurzbezeichung, wurde 1882<br />
im gleichnamigen und bereits 1651 gerodeten Augebiet am Inn erbaut, zwei Jahre später<br />
wurde sie erstmals als Gasthaus bezeichnet. 162 Östlich des Hauses hatte man damals auch das<br />
bereits erwähnte kleinere Gebäude – die „kleine Kaifenau“ – errichtet, die lange Zeit den Be-<br />
sitzern des Gasthauses als Wohnsitz diente. Die Kaifenau steht noch heute in ihrer ursprüng-<br />
lichen Form, lediglich ein Vorbau, der ursprünglich einen Tanzsaal beherbergt hatte, wurde<br />
um zwei Etagen aufgestockt. Von Anfang an war der Betrieb nicht sonderlich ertragreich,<br />
weshalb es bis in die 1950er häufig zu Besitzerwechseln kam. Unter einem Pächter, der den<br />
Gasthof 1986 übernommen hatte, verschaffte sich das Haus wohl erstmals einen „guten Ruf“,<br />
wie Zobl noch 1998 anmerkt. 163 Der Erfolg hielt indessen nicht bis ins 21. Jahrhundert an, das<br />
Gebäude stand bald leer.<br />
161 Vgl. Zobl 1998c, 270.<br />
162 Ebd.<br />
163 Ebd.<br />
127
Das Äußere der Kaifenau ist – in Anbetracht der direkt vorbeiführenden Bundesstraße und des<br />
nahen Bahnhofsgeländes – in recht gutem Zustand. Das Erscheinungsbild des architektonisch<br />
schlichten, aber durchaus ansprechenden, aufgrund des alten Eingangs unschwer als Wirts-<br />
haus erkennbaren Hauptgebäudes leidet jedoch deutlich unter dem erwähnten Vorbau, einem<br />
in beiden Stockwerken mit Balkonen versehenen Kasten von ausgesuchter Hässlichkeit. Mit<br />
der Errichtung des Vorbaus wanderte der alte straßenseitige Eingang vom dreistöckigen<br />
Hauptgebäude an die südwestliche Ecke des ehemaligen Tanzsaales. Diesem vorgelagert be-<br />
findet sich der terrassenähnliche frühere Gastgarten, der von einigen Laternen mit der übli-<br />
chen Bierreklame, einigen Blumentrögen und dem erwähnten geschotterten Parkplatz be-<br />
grenzt wird. Zu den Außenanlagen des Gasthofs gehören daneben auch ein an der Ostseite vor<br />
der „kleinen Kaifenau“ gelegener Stadel sowie ein zwischen diesem und an der Nordseite des<br />
Hauptgebäudes liegendes Wiesenstück, das zum Inn hin etwas abfällt, vom Fluss jedoch<br />
durch die mit Sträuchern und ein Bäumen bestandene Uferböschung getrennt ist.<br />
Der Verkehrslärm rund um die Unterkunft ist beträchtlich. Da sich das Haus in einer leichten<br />
Biegung der Bundesstraße befindet, beschleunigen die vorbeifahrenden Fahrzeuge etwa in der<br />
Mitte des Gebäudes. In ähnlicher Weise verursachen auch die auf dem Tankstellenareal an-<br />
und abfahrenden Autos einiges an Lärm. Erheblich zum Geräuschpegel bei trägt naturgemäß<br />
auch das Bahnhofsareal mit den hier rangierenden oder ein- und ausfahrenden Zügen sowie<br />
den am Vorplatz ankommenden und abfahrenden Bussen und Privatautos. Die Bahnhofsnähe<br />
der Kaifenau bedingt allerdings auch, dass die Bahnverbindung in die Landeshauptstadt „vor<br />
der Haustüre“ liegt. Von Landeck ins gut 75 Kilometer entfernte Innsbruck ist eine Fahrtzeit<br />
von etwa fünfzig Minuten bis eineinviertel Stunden zu veranschlagen. Freilich dürfte die<br />
Bahnfahrt für die untergebrachten Flüchtlinge kaum leistbar sein: Für ein reguläres Ticket<br />
nach Innsbruck und wieder zurück sind über 23 Euro zu entrichten. Der die Bundesstraße<br />
entlangführende Weg in das Landecker Stadtzentrum ist mit dem Fahrrad, zur Not auch zu<br />
Fuß zu bewältigen. Bei Einkäufen ist man aufgrund der Entfernung wohl auf die vorhandene<br />
Busverbindung der Landecker Verkehrsbetriebe angewiesen – im nahen Umfeld der Unter-<br />
kunft befinden sich mit Ausnahme der Tankstelle und einer Bäckerei im Bahnhofsgebäude<br />
keine Versorgungseinrichtungen für Güter des täglichen Bedarfs. Die medizinische Grundver-<br />
sorgung ist durch mehrere Ärztinnen und Ärzte und eine Psychotherapeutin gewährleistet, im<br />
Stadtzentrum ist auch eine Apotheke vorhanden, in der nahen Nachbargemeinde Zams ein<br />
Krankenhaus.<br />
6.4.3 Die Standortwahl: Aufruf und Meldung<br />
Auf die wiederholten Aufrufe des Landes Tirol, Räumlichkeiten für die Unterbringung von<br />
Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen, meldete sich Anfang Dezember 2003 auch der Be-<br />
sitzer der Kaifenau und bot das Haus an. 164 Das Land nahm das Angebot an und informierte<br />
164 Vgl. Rundschau 16.12.2003.<br />
128
den Landecker Bürgermeister Stenico. Dieser reagierte durchaus positiv: „Grundsätzlich ja,<br />
aber die Bedingungen müssen bekannt sein.“ 165 Um diese zu klären, traf man sich zu Ge-<br />
sprächen, vermied es jedoch vorerst, die Öffentlichkeit zu informieren.<br />
6.4.4 Die Standortrealisierung: Herrn Hochstögers aussichtsloser Kampf<br />
gegen Weihnachten<br />
Lange konnte das Vorhaben freilich nicht geheim gehalten werden. Die Reaktion auf das<br />
Durchsickern erster Details war ein öffentlicher Aufschrei. Die Tiroler Tageszeitung kom-<br />
mentierte: „Die Nachricht vom geplanten Landecker Asylheim hat wie eine Bombe ein-<br />
geschlagen.“ 166 Gerüchte machten die Runde, in Gasthäusern wurde spekuliert, in der Kaife-<br />
nau würden „80 Afghanen“ untergebracht. 167 Ein Landecker ÖGB-Funktionär, Luis Müller,<br />
meldete sich schließlich öffentlich zu Wort und drohte, die Vorgangsweise des Bürgermeis-<br />
ters koste diesem den Kopf. 168 Rasch entdeckte auch die lokale FPÖ-Fraktion das Thema für<br />
sich – und eröffnete mit ihrem Einstieg in die Diskussion das Musterbeispiel einer Auseinan-<br />
dersetzung um die öffentliche Meinung. Gemeinderat und Bezirksobmann Martin Hoch-<br />
stöger 169 , der sich im Landtagswahlkampf ein Jahr zuvor selbst als „quadratisch, praktisch,<br />
gut“ beschrieben hatte 170 , empörte sich, Bürgermeister Stenico habe den Gemeinderat über-<br />
gangen: „Er hat die Unterbringung für 30 Asylanten genehmigt, die anderen Fraktionen aber<br />
nicht informiert.“ 171 Hochstöger forderte, Stenico solle seine Genehmigung „sofort rück-<br />
gängig“ machen und verwies auf „kriminelle Taten“ von Asylsuchenden:<br />
„Ich erinnere an die von der FPÖ in den vergangenen Monaten aufgezeigten bedenklichen Zustände in den<br />
Asylheimen in Reutte [sic!] oder Fieberbrunn, den Vorfällen im Caritas Flüchtlingsheim [sic!] und in der<br />
Flüchtlingsstelle im Landhaus und den fast schon täglichen Berichten von kriminellen Taten von Asylanten in<br />
ganz Tirol. [...] Die Landeckerinnen und Landecker haben für diese unüberlegte und realitätsfremde Aktion des<br />
Bürgermeisters angesichts der drohenden Auswirkungen wenig Verständnis. [...] Landeck lebt vom Tourismus.<br />
Daher darf nicht fahrlässigerweise der Nährboden für die Gefährdung der Sicherheit geschaffen werden und die<br />
ansässige Bevölkerung und die Touristen beunruhigen.“ 172<br />
Stenico entgegnete, indem er Hochstöger „Panikmache“ vorwarf und erhielt dabei Unter-<br />
stützung von den beiden Landtagsabgeordneten des Bezirks, Anton Mattle (ÖVP) und Hans<br />
Peter Bock (SPÖ). 173 Doch Hochstöger legte nach: Der Bürgermeister handle „unmensch-<br />
lich“, hier werde „Mitmenschlichkeit in der Vorweihnachtszeit geheuchelt, ohne auf die Kon-<br />
165 Stenico, zit. nach ebd.<br />
166 Tiroler Tageszeitung 16.12.2003a.<br />
167 Vgl. Tiroler Tageszeitung 17.12.2003.<br />
168 Vgl. Tiroler Tageszeitung 16.12.2003a.<br />
169 Hochstöger, der auch Obmann des Freiheitlichen Akademikerverbandes in Tirol ist, führt die Landecker<br />
Apotheke in vierter Generation; sein Großvater Carl Hochstöger war SS-Unterscharführers und nach dem Anschluss<br />
Österreichs an das Deutsche Reich erster Landecker Bezirkshauptmann (vgl. dazu Spiss 1998, 225f; Zobl<br />
1998b, 250).<br />
170 Vgl. TIROL PANORAMA 1 (1), September 2003, 7.<br />
171 Hochstöger, zit. nach Tiroler Tageszeitung 16.12.2003a; vgl. FPÖ Landeck 15.12.2003a.<br />
172 FPÖ Landeck 15.12.2003a; grammatikalische Fehler im Original.<br />
173 Mattle hielt fest, zur Gastfreundschaft gehöre auch die Beherbergung, Bock ließ wissen: „Ich sehe es als<br />
Aufgabe wohlhabender Regionen, einen humanitären Beitrag zu leisten.“ (zit. nach Tiroler Tageszeitung<br />
16.12.2003a)<br />
129
sequenzen zu achten“. 174 Die Attacken des FP-Politikers sollten sich als Eigentor erweisen:<br />
Der Unterkunftsgeber, Bürgermeister Stenico und insbesondere die regionale Presse griffen<br />
den Hinweis auf Weihnachten auf. Stenico kontaktierte zunächst den ehemaligen Bürger-<br />
meister von Gries am Brenner, Andreas Hörtnagl. Dieser war 1990 einer der wenigen Tiroler<br />
Bürgermeister gewesen, der freiwillig Flüchtlinge in seiner Gemeinde aufgenommen hatte –<br />
zwei Jahre später wurde er nach zwölfjähriger Amtszeit abgewählt. 175 Wohl mit Blick auf die<br />
im März 2004 erfolgenden Gemeinderatswahlen bat der Landecker Bürgermeister den Grieser<br />
Altbürgermeister um Rat, wie Hörtnagl im Interview erzählt:<br />
„[...] der hat bei mir angerufen, wie er sich verhalten soll. [...] Also ... wie er sich in etwa verhalten soll, dass er<br />
halbwegs mit dieser Sache zurechtkommt, und ich hab ihm geraten, er soll sich ganz als einfacher Mitbürger,<br />
ganz gleich wie jeder andere Mitbürger auch, »nicht viel wissen«, sag ich jetzt einmal. Einfach: »Ich hab von<br />
dem erfahren, und die haben mir halt leid getan.« Fertig.“ 176<br />
Stenico folgte dem Rat nur teilweise. Gegenüber der regionalen Presse sprach er von einer<br />
„Verpflichtung zur Menschlichkeit“ und charakterisierte die Unterbringung als „eine Chance<br />
und Herausforderung für Landeck und seine Bevölkerung: Wir dürfen Flüchtlinge nicht weg-<br />
sperren und isolieren, sondern müssen auf sie zugehen.“ 177 Das Beispiel der Gemeinde<br />
Pfunds, einem Dorf mit etwa 2.000 EinwohnerInnen, solle Vorbild sein: In Pfunds wären in<br />
den 1990ern zeitweise bis zu siebzig bosnische Flüchtlinge untergebracht gewesen, das ganze<br />
Dorf habe sich um die Asylsuchenden gekümmert. Als Kronzeugen seiner Argumentation<br />
konnte Stenico auch gleich den damaligen Bürgermeister von Pfunds, Peter Schwienbacher,<br />
aufbieten: „Erfahrungen haben wir gute gemacht. Es ist menschlich bewusst geworden, dass<br />
man helfen kann, helfen muss. Die Bevölkerung war halt gefordert. [...] Wir hätten nochmal<br />
30 genommen.“ 178 Lokale und regionale <strong>Medien</strong> übernahmen den versöhnlichen Rückblick<br />
aus Pfunds und kombinierten ihn mit dem von FPÖ-Politiker Hochstöger angeregten (Vor-)<br />
Weihnachtsthema – in der Tiroler Tageszeitung stellte etwa Helmut Wenzel in einem auf das<br />
Herbergssuche-Motiv anspielenden Kommentar fest: „BM Stenico tritt für die humanitäre<br />
Einrichtung ein. Respekt. [...] Wer die Türen für Herbergssuchende verriegelt, missachtet<br />
Menschenrechte.“ 179<br />
Noch freilich war der Kampf um die öffentliche Meinung nicht entschieden: Das regionale<br />
Leitmedium schwankte nach wie vor zwischen den beiden Seiten. Als Hochstöger seine An-<br />
griffe noch einmal verschärfte und dabei insbesondere die Landecker ÖVP attackierte, der er<br />
eine „verantwortungslose und feige Politik“ vorwarf, stellte die Tiroler Tageszeitung die<br />
betreffende Pressemitteilung der FPÖ kurzerhand im unveränderten Volltext auf die eigene<br />
Internetseite – ohne Kommentar, als freiheitliches Produkt durch das Autorenkürzel „fpd“ nur<br />
174<br />
FPÖ Landeck 15.12.2003b; Tiroler Tageszeitung 16.12.2003a.<br />
175<br />
Vgl. Hörtner 1992.<br />
176<br />
Interview Hörtnagl 10.03.2004, Z 137-141.<br />
177<br />
Stenico, zit. nach Rundschau 16.12.2003.<br />
178<br />
Schwienbacher, zit. nach ebd.<br />
179 Wenzel 2003.<br />
130
für Insider erkennbar. 180 Hochstöger gab darin an: „Aus Kreisen der ÖVP weiß ich, dass man<br />
dort mit einer Stellungnahme abwartet, bis sich abzeichnet, wer sich in der öffentlichen Mei-<br />
nung durchsetzt. Hier wäre mehr Rückgrat dringend notwendig.“ 181 Er, Hochstöger, sehe<br />
seine Linie durch einen Brief der Kaufmannschaft von Landeck und Zams bestätigt: „Die<br />
Gewerbetreibenden sehen das geplante Asylheim ebenfalls sehr kritisch. Diese Bedenken<br />
sollte ein verantwortungsvoller Bürgermeister sehr ernst nehmen.“ 182<br />
Stenico schob nun ein Pressegespräch nach, für das offensichtlich jener runde Tisch als Vor-<br />
bild gedient hatte, der zuerst in Kössen vom dortigen Bürgermeister Mühlberger veranstaltet<br />
worden war. Neben Stenico selbst standen Stadtpfarrer Benedikt Kössler, Bezirkshauptmann<br />
Erwin Koler sowie der Flüchtlingskoordinator des Landes der lokalen und regionalen Presse<br />
Rede und Antwort. Stenico unterstrich, dass er hinter der Realisierung einer Unterkunft in<br />
Landeck stünde – wenn Gesetze zum Schutz der Menschenrechte nicht mit Leben erfüllt wür-<br />
den, wären sie nicht einmal das Papier wert, auf dem sie stünden. 183 Zugleich beherzigte er<br />
nun doch den Ratschlag Hörtnagls und hielt in aller Einfachheit fest: „Ich könnte es nicht ver-<br />
antworten, wenn ich um Hilfe gebeten werde, Nein zu sagen.“ 184 Das letztlich wohl entschei-<br />
dende Argument lieferte jedoch der Bezirkshauptmann: Er habe echte Probleme, zu verstehen,<br />
warum in der Adventzeit Herbergslieder aus den Geschäften klängen, wirklich hilfesuchende<br />
Menschen aber abgewiesen werden sollten. 185 Die Tiroler Tageszeitung meldete am Folgetag,<br />
nun sei eine Unterkunft für dreißig Asylsuchende „gesichert“ und titelte begeistert: „In Land-<br />
eck wird ein Weihnachtsmärchen war“. 186 Die weihnachtlichen Motive überlagerten die laute<br />
Kritik Hochstögers endgültig, die von der regionalen Presse nun ignoriert wurde. Der FPÖ-<br />
Politiker hatte seinen Kampf verloren – weniger gegen den Bürgermeister und die Unterkunft<br />
als gegen Weihnachten.<br />
Am 23. Dezember trafen die ersten AsylwerberInnen in Landeck ein, punktgenau am „Heili-<br />
gen Abend“ meldete die Tiroler Tageszeitung Vollzug:<br />
„Aus dem Bus stiegen neun Familien und vier Einzelpersonen: Mongolen, Iraker, Armenier sowie Montenegriner.<br />
Laut Flüchtlingskoordinator Peter Logar ist die Einquartierung ruhig und reibungslos verlaufen. BM<br />
Bertl Stenico bemerkte: »Ich bin stolz auf die Landecker, die in den vergangenen Tagen großes Verständnis<br />
gezeigt haben.«“ 187<br />
180<br />
Tiroler Tageszeitung 16.12.2003b; vgl. FPÖ Landeck 16.12.2003.<br />
181<br />
Hochstöger, zit. nach ebd.<br />
182<br />
Ebd.<br />
183<br />
Tiroler Tageszeitung 17.12.2003.<br />
184<br />
Stenico, zit. nach Rundschau 23.12.2003a.<br />
185<br />
Tiroler Tageszeitung 17.12.2003. Der Flüchtlingskoordinator des Landes resümiert über den runden Tisch im<br />
Interview knapp: „Es haben halt alle ihren Standpunkt dargelegt, aber nachdem für den Landecker Bürgermeister<br />
die Entscheidung festgestanden ist, haben die anderen halt ihre Unterstützung kundgetan und erläutert.“ (Interview<br />
Logar 15.03.2004)<br />
186<br />
Tiroler Tageszeitung 17.12.2003.<br />
187 Tiroler Tageszeitung 24.12.2003a.<br />
131
Zum Jahreswechsel sorgte die Oberländer Rundschau für die begleitende Berichterstattung<br />
auf lokaler Ebene: Sie porträtierte einige der in der Kaifenau untergebrachten Flüchtlinge und<br />
veranschaulichte deren Schicksale mit griffigen Zitaten 188 , rückte ein „Netzwerk an<br />
Hilfsbereiten“ ins rechte Licht und vergaß auch nicht, ein Spendenkonto zu erwähnen. 189<br />
6.4.5 Von Landeck lernen? Der Standort in der Diskussion<br />
Bürgermeister Stenico erhielt in der Folge von vielen Seiten Lob und Zustimmung, zahlreiche<br />
freiwillige HelferInnen meldeten sich. Auf dem in Innsbruck in der zweiten Jännerwoche<br />
2004 veranstalteten „Integrationsball“ wurde Stenico sogar mit einem der drei Preise „für<br />
Integration und Zivilcourage“ ausgezeichnet. 190 Der beginnende Wahlkampf um die am 7.<br />
März 2004 abgehaltenen Gemeinderatswahlen brachte jedoch schnell eine Wiederauflage der<br />
weihnachtlichen Diskussionen um den Standort in Landeck: FPÖ-Gemeinderat Hochstöger<br />
entschied sich, die Unterkunft in der Kaifenau zu seinem zentralen Thema zu machen. Nach-<br />
dem er sich in der verbal ausgetragenen Auseinandersetzung im Dezember nicht hatte durch-<br />
setzen können, versuchte er es diesmal mit der Kraft der Bilder: Das freiheitliche Wahlplakat<br />
zeigte die zwei besorgten Spitzenkandidaten mit Babys im Arm vor der durch einen Grenz-<br />
balken abgeschirmten Flüchtlingsunterkunft. 191 Auch für überregionale BeobachterInnen<br />
rückte damit eine Frage in den Mittelpunkt des Interesses: Würden sich am 7. März zum<br />
zweiten Mal nach 1992 „Flüchtlinge als Abwahlhelfer“ 192 erweisen, es eine „Asylanten-<br />
Niederlage“ 193 geben, wie nach der Abwahl des erwähnten Grieser Bürgermeisters Hörtnagl<br />
geschrieben wurde?<br />
Die Wahlen brachten eine eindrucksvolle Bestätigung für Stenico, der nicht nur mit der Land-<br />
ecker SPÖ gleich 13,6 Prozentpunkte zulegen konnte und zwölf der 19 Sitze im Gemeinderat<br />
eroberte, sondern auch bei der Bürgermeister-Direktwahl sein Ergebnis von 1998 um 14,3<br />
Prozentpunkte steigerte und beinahe siebzig Prozent der Stimmen erreichte. Die Tiroler<br />
Tageszeitung erklärte Landeck kurzerhand zum „roten Musterbezirk“ 194 , Alois Vahrner<br />
konstatierte in einem Kommentar ein „starkes Signal aus Landeck“ und hielt fest:<br />
„Am Sonntag haben die Landecker Wähler ihre Antwort auch zum Flüchtlingsthema gegeben. Die Freiheitlichen<br />
profitierten von ihrer Kampagne nicht, sondern wurden ganz im Gegenteil von zwei auf einen Gemeinderatssitz<br />
gestutzt. Stenico, der sich auch über die Stadtgrenzen hinaus als rote Personalreserve profiliert, siegte. Positiv,<br />
dass es sich politisch auszahlen kann, auch bei heiklen Themen statt Populismus Rückgrat zu zeigen.“ 195<br />
FPÖ-Politiker Hochstöger wurde hingegen harsch kritisiert: Die Freiheitlichen, so Vahrner,<br />
hätten versucht, „gegen das Asylheim massiv Stimmung zu machen – im jüngsten Wahlkampf<br />
188 Vgl. Rundschau 23.12.2003b („Too much problems“) und 05.01.2004 („Ich habe Angst“).<br />
189 Vgl. ebd.<br />
190 Vgl. Der Standard 12.01.2004.<br />
191 Vgl. Der Standard 10.03.2004.<br />
192 Hörtner 1992.<br />
193 Linde 1992.<br />
194 Tiroler Tageszeitung 09.03.2004.<br />
195 Vahrner 2004.<br />
132
auch mit einem jenseits der Geschmacksgrenze liegenden Asylanten-Stopp-Plakat“. 196 Auch<br />
die Wiener Tageszeitung Der Standard widmete sich dem Erfolg Stenicos und ließ diesen<br />
ausführlich zu Wort kommen. „Im Grunde seines Herzens“, so der Bürgermeister dort, habe<br />
er „schon negative Folgen bei der Wahl befürchtet“, aber selbst dann hätte er damit leben<br />
können: „Für mich war es eine richtige Entscheidung.“ Es sei für ihn auch „keine Überwin-<br />
dung“ gewesen, der Realisierung der Unterkunft zuzustimmen: „Das war eine reine Gewissensfrage.“<br />
197<br />
Als die Tiroler Tageszeitung Ende April 2004 einen „Zwischenbericht“ zur Situation in Land-<br />
eck lieferte, führte sie den Standort bereits als Modellfall an. Zwar seien die Proteste nicht<br />
ganz verstummt, doch gerate der Bürgermeister seit dem Eintreffen der ersten Asylsuchenden<br />
„immer wieder ins Staunen“: „Da kümmert sich der Fußballclub um Jugendliche aus aller<br />
Herren Länder, Privatpersonen geben Deutschunterricht oder helfen mit Kleidung aus.“ 198<br />
Stenico führe auch immer wieder klärende Gespräche mit „Kritikern“, denn:<br />
„»Wir alle tragen eine Urangst gegenüber dem Fremden in uns. Dazu kommt bei vielen die z.B. von der Politik<br />
geschürte Angst«, meint der Bürgermeister. So habe er im Vorfeld vor allem mit einem Vorurteil zu kämpfen<br />
gehabt: »Die stehlen und vergewaltigen« taten die Landecker ihre Ängste kund. Seitdem »die« da sind und die<br />
Einheimischen die Gesichter bzw. Schicksale dazu kennen, schaue es anders aus. »Denn eigentlich trägt jeder<br />
von uns das Urbedürfnis in sich zu helfen«, hat Stenico eine Antwort gefunden.“ 199<br />
„Landeck als Vorbild für andere Gemeinden?“, fragte das Blatt und klagte: „Weit gefehlt: Seit<br />
Monaten sucht das Land nach neuen Unterkünften für 250 zusätzliche Flüchtlinge, die ab Mai<br />
betreut werden müssen.“ 200 Zumindest in der Theorie wurde Landeck jedoch bald tatsächlich<br />
als Vorbild gehandelt – österreichweit. In einem Gastkommentar in der Tageszeitung Die<br />
Presse trat Politikwissenschafter Anton Pelinka Mitte Juni 2004 für eine „liberale, systemati-<br />
sche Flüchtlingspolitik“ ein und schlug dabei Landeck als Muster vor:<br />
„Es kommt nicht auf »die Politiker« an. Wenn diese Grund zur Annahme haben, dass eine den Asylwerbern<br />
gegenüber offene Politik nicht Stimmen kostet, sondern Stimmen bringt, werden sich Politiker anders verhalten.<br />
Wenn die Wählerinnen und Wähler eindeutige Signale aussenden, wird sich auch die Politik ändern. Vielleicht<br />
kann man von Landeck lernen: Der Bürgermeister dieser Tiroler Gemeinde hat 2004 souverän seine Wiederwahl<br />
erreicht, obwohl (weil?) er für eine besonders großzügige Aufnahme von Asylwerbern in seiner Gemeinde eingetreten<br />
ist. Schafft zwei, drei, viele Landecks!“ 201<br />
6.4.6 Bewertung<br />
Die Unterkunft in der Landecker Kaifenau befindet sich im Umfeld des Bahnhofs kaum 200<br />
Meter vor der östlichen Stadtgrenze. Das Gebiet liegt abseits der Wohnflächen gut zwei<br />
196<br />
Vahrner 2004. Auch die ÖVP, so Vahrner, habe „in dieser brisanten Frage eher halbherzig Position“ bezogen.<br />
197<br />
Stenico, zit. nach Der Standard 10.03.2004. Im Augenblick des Erfolgs vergaß Stenico auch seine Frau nicht<br />
– und Der Standard (ebd.) mit ihm: „Wie immer vor wichtigen Entscheidungen sei ihm [Stenico; Anm. RP] aber<br />
»ein Gespräch« wichtig gewesen: »Das mit meiner Gattin.« Sie habe gemeint, »wenn ich Nein sage, würde sie<br />
mich nicht mehr wieder erkennen«.“<br />
198<br />
Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
199<br />
Ebd.<br />
200<br />
Ebd.<br />
201<br />
Pelinka 2004b. Ähnlich Langthaler (2004a): Landeck habe gezeigt, „dass es auch anders geht“. Zuletzt als<br />
Vorbild hervorgehoben wurde die Stadt Anfang Oktober 2004 (vgl. Plaikner 2004).<br />
133
Kilometer vom Stadtzentrum entfernt zwischen einer Ausfallstraße mit starkem Verkehrsauf-<br />
kommen und dem Inn. Wegen dem Durchzugsverkehr, den an- und abfahrenden Fahrzeugen<br />
an einer der Unterkunft gegenüberliegenden Tankstelle und den ein- und ausfahrenden Zügen<br />
am Bahnhofsgelände ist der Geräuschpegel beträchtlich. In die eher triste Umgebung, die von<br />
Gewerbebauten, Parkplätzen, Asphalt, Schotter und Beton geprägt ist, fügt sich das Unter-<br />
kunftsgebäude nur über seine frühere Funktion als bahnhofsnahes Gasthaus ein, die nach wie<br />
vor an der architektonischen Gestaltung sowie an der einschlägigen Ausschilderung am Haus<br />
wie auch entlang der Straße erkennbar ist.<br />
Das Gebäude ist in passablem Zustand, die Außenanlagen jedoch für eine etwas raumgreifen-<br />
dere Freizeitgestaltung ungeeignet: Die zwischen Haus, Straße und Inn zur Verfügung ste-<br />
hende Rasenfläche umfasst nur wenige Quadratmeter. Der Parkplatz vor dem Haus ist, da von<br />
der Bundesstraße in keiner Weise baulich abgetrennt, überhaupt nicht bespielbar, der ehema-<br />
lige Gastgarten – von der Straße teilweise durch Blumentröge getrennt – nur eingeschränkt,<br />
sofern er nicht gleichfalls als Parkplatz genutzt wird. 202 Der Eingang an der südwestlichen<br />
Ecke des Hauses, der schräg auf die Straße hinausführt, ist zwar weniger gefährlich als der<br />
frühere straßenseitige Eingang, scheint jedoch insbesondere für Kinder nicht ohne Risiko:<br />
Straße und Eingangsbereich sind baulich kaum getrennt, einen diesen Namen tatsächlich ver-<br />
dienenden Gehsteig kann auch der etwas mehr als einen Meter breite und im Eingangsbereich<br />
annähernd auf Straßenniveau liegende Zwischenraum nicht ersetzen. Schlichtweg als gefähr-<br />
lich ist das Fehlen eines Schutzwegs über die Straße zu bewerten: Da es östlich der Unter-<br />
kunft keinen Gehsteig gibt, ist der bereits auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Zams lie-<br />
gende nächstgelegene Fußgängerstreifen nicht erreichbar, westlich der Unterkunft reicht nach<br />
dem zum Unterkunftsgebäude gehörigen Parkplatz die Straße überhaupt bis ans Innufer. Um<br />
den Gehsteig auf der anderen Straßenseite und den ebenfalls dort befindlichen Bahnhof samt<br />
den Bushaltestellen zu erreichen, muss die stark frequentierte Straße „einfach so“ überquert<br />
werden – vor allem für Kinder, Eltern mit Kinderwägen und ältere oder alte Menschen eine<br />
durchaus riskante Angelegenheit.<br />
Mit Ausnahme der Bahnhofsbäckerei und der Tankstelle fehlen in der nahen Umgebung der<br />
Unterkunft Versorgungseinrichtungen für Güter des täglichen Bedarfs, Einkäufe müssen da-<br />
her im Landecker Zentrum oder im Zentrum der Nachbargemeinde Zams erledigt werden.<br />
Insgesamt ist jedoch die Grundversorgung in diesem Bereich wie auch im medizinischen und<br />
im Bildungsbereich in Landeck als ausreichend gewährleistet zu werten. Der städtisch-indus-<br />
triellen Prägung des Ortes entsprechend stehen überdies neben den christlichen Kirchen auch<br />
zwei muslimische Gebetsstätten als migrantische Treffpunkte zur Verfügung.<br />
Der Standortwahl ging wie in Götzens und Kössen ein Aufruf des Landes Tirol voraus, Un-<br />
terkünfte für Asylsuchende zu Verfügung zu stellen. Auch hier erfolgte die Entscheidung des<br />
202 So etwa während des Lokalaugenscheins: Mitten im ehemaligen Gastgarten war ein Kleinbus abgestellt.<br />
134
Landes offenkundig sehr rasch für den Standort. Weniger geräuschlos verlief der Prozess der<br />
Standortrealisierung: Nachdem das Vorhaben an die Öffentlichkeit gedrungen war, kam es<br />
zunächst zu lautstarken Protesten. Eine offenkundig hervorragende Pressearbeit seitens des<br />
Landecker Bürgermeisters, die Bereitschaft der lokalen und regionalen Presse, das zuerst aus-<br />
gerechnet von einem FPÖ-Politiker angesprochene „Weihnachtsthema“ aufzugreifen sowie<br />
eine darauf abgestimmte organisatorische Punktlandung bei der Einquartierung der Flücht-<br />
linge seitens des Landesflüchtlingskoordinators trugen im Verein dazu bei, dass die anfäng-<br />
lich ausschließlich negativ geführte Standortdiskussion, welche die geplante Unterbringung<br />
der Asylsuchenden durchaus zu gefährden imstande war, letztlich zu einer nahezu perfekten<br />
Weihnachtsinszenierung umgewandelt werden konnte. Die Nachhaltigkeit der Wirkung dieser<br />
erfolgreichen Inszenierung – noch Mitte 2004 wurden ja sogar in der bundesweit erscheinen-<br />
den Presse „viele Landecks“ gefordert – ist zweifellos beachtlich.<br />
6.5 Leutasch: Wald, Wild und Almen<br />
Seit dem Jahr 1999 ist auch die Gemeinde Leutasch Standort einer Flüchtlingsunterkunft.<br />
Ende Juni 2004 waren im betreffenden Gebäude 38 Asylsuchende untergebracht. 203<br />
6.5.1 Die Gemeinde: »Das ganze Tal ist abgeschlossen und rundum geschützt«<br />
Mit mehr als 10.300 Hektar Fläche ist die Gemeinde Leutasch im Bezirk Innsbruck-Land<br />
zwar die drittgrößte Gemeinde, sie verfügt jedoch nur über 2.056 EinwohnerInnen. Die Lage<br />
des westlich von Seefeld im Grenzgebiet zu Deutschland gelegenen Dorfes mitten im Hoch-<br />
gebirge ist ein wesentlicher Grund für die vergleichsweise geringe Besiedelung. Die Leuta-<br />
scher Ortschronik vermittelt diesbezüglich ein anschauliches Bild:<br />
„Abseits unserer großen Verkehrswege, abseits der Straße von Mittenwald nach Innsbruck und der Straße im<br />
Oberinntal liegt das Leutaschtal. Wiesen füllen nahezu gänzlich die Ebene des Tales aus, umkränzt von Fichtenwäldern<br />
und schönen Lärchenbeständen, die sich steil hinaufziehen an den Hängen der umliegenden Berge bis<br />
zu den nackten Felsschrofen. Eine Schlucht mit einer bedeutenden Geländestufe sperrt das Tal nach Osten hin<br />
gegen Mittenwald ab, gegen Süden hin macht ein nahezu 600 Meter hoher Steilabfall zum Inntal den Weg<br />
schwierig; die Hohe Munde, ein mächtiger Ausläufer des Mieminger Gebirges, setzt jedem Ausdehnen ein konsequentes<br />
Halt entgegen. Im Westen türmen sich die Berge des Wettersteingebirges auf, und nur das verschwiegene<br />
Gaistal, die Fortsetzung des Leutaschtales nach Westen hin, führt über einen verhältnismäßig leichten<br />
Übergang, die Pestkapelle, hinüber ins Außerfern, nach Ehrwald. Im Osten stellt sich die Ahrnspitze anfänglich<br />
jedem Übergang entgegen, gegen Süden hin gelingt im bewaldeten Hauptdolomit der Übergang in den Sattel von<br />
Seefeld. Das ganze Tal ist somit abgeschlossen und rundum geschützt, verstärkt wird der Schutz durch die konsequente<br />
Entwässerungslinie der Leutascher Ache, die bis auf die Mündung in die Isar bei Mittenwald nur durch<br />
das Tal fließt.“ 204<br />
Das Leben „in der Leutasch“ – so die umgangssprachliche Bezeichnung der Gemeinde, die<br />
den „abgeschlossenen“ Charakter des Gebiets auch sprachlich erfasst – ist seit jeher von<br />
Land- und Forstwirtschaft und von der Jagd geprägt. „Wald, Wild und Almen als Teile der<br />
Siedlung Leutasch“ ist dementsprechend ein Kapitel der Ortschronik überschrieben – eines<br />
203 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
204 Olt 1990, 11.<br />
135
von dreien, was die Wichtigkeit der Begriffe für die Gemeinde verdeutlicht. Aufgrund ihres<br />
Waldreichtums war die Leutasch über mehrere Jahrhunderte ein bedeutender Holzlieferant für<br />
Tirol, zugleich war das Gebiet ein beliebtes Ziel für an Jagd und Fischerei Interessierte. 205<br />
Erst ab den 1950ern entwickelte sich nach und nach eine neue Perspektive: Die bis dahin „fast<br />
nur als bäuerliche Gemeinde“ 206 zu bezeichnende Ortschaft entdeckte den Tourismus und<br />
dieser sie, zu Wald, Wild und Almen trat der Berg als Kapital hinzu. Mit einem gewissen Un-<br />
behagen kommentiert die Ortschronik diese Entwicklung:<br />
„Der Fremdenverkehr nahm stetig zu, die landwirtschaftlichen Betriebe stetig ab. Im Jahre 1945 waren in den<br />
Ställen noch über 1200 Stück Rindvieh; die letzte Viehzählung 1989 ergab nur mehr 600 Stück; also die Hälfte<br />
weniger. Ob dies gut oder schlecht für unsere Gemeinde ist, wird wohl erst die Zukunft zeigen.“ 207<br />
Mittlerweile ist die Leutasch im Bezirk Innsbruck-Land einer der führenden Tourismusorte,<br />
abseits der Landwirtschaft ist der Ort indessen eine PendlerInnengemeinde. 208 Die Leutasch,<br />
das zeigt diese Entwicklung ebenso wie obiges Zitat, befindet sich jedenfalls mitten im Über-<br />
gang von der Agrar- in die Dienstleistungsgesellschaft und damit in einer schwierigen Um-<br />
bruchsphase, die sich auch in der Gemeindeidentität niederschlägt. Den Zumutungen der<br />
Globalisierungstendenzen hält man beharrlich die eigenen Traditionen entgegen, selbst wenn<br />
diese eher formalen Charakter aufweisen. Die BewohnerInnen sind – so die Selbstdarstellung<br />
des Ortes im Internet – „Muster der Bodenständigkeit“ geblieben, denn: „Schon im 13. und<br />
14. Jahrhundert tauchen die gleichen Namen auf, die wir heute im Leutascher Telefonbuch<br />
lesen.“ 209 Bürgermeister bleiben hier nicht nur außerordentlich lange im Amt, sie tragen über-<br />
dies mit Stolz den Namen ihres Hofes als Beinamen: Auf Alfons Rödlach („Krapf“), der sein<br />
Amt 1945 antrat, folgte 1962 Hans Geiger („Boder“), der erst 1986 Josef Klotz („Prantmer“)<br />
Platz machte. Bis zu den Gemeinderatswahlen im März 2004 blieb Klotz im Amt, um dann<br />
dem bisherigen Gemeindeamtsleiter Thomas Mößmer Platz zu machen. Mit ihm dürfte zu-<br />
mindest diese Tradition vorläufig beendet sein: Mößmer führt keinen Hof mehr, sondern ei-<br />
nen Tourismusbetrieb. Bei der Bürgermeister-Direktwahl stand ihm lediglich ein freiheitlicher<br />
Konkurrent gegenüber, der chancenlos blieb; bei der Gemeinderatswahl gewann Mößmer mit<br />
der Bürgermeisterliste gar zwei Mandate dazu und hält nun bei acht Sitzen. Klotz’ Sohn Sieg-<br />
ried erreichte mit einer „Zukunft für Leutasch“ genannten und erstmals angetretenen Liste aus<br />
dem Stand drei Sitze. Im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr stark ist in Leutasch die FPÖ,<br />
die als „Freie Liste“ zwei Mandate erreichte und gegen den landesweiten Trend ihre Stim-<br />
menzahl erhöhte – das Antreten unter einer weniger leicht der FPÖ zuordenbaren Bezeich-<br />
nung machte sich offenbar bezahlt: 1998 hatte die damalige „Freiheitliche Liste“ nur ein<br />
Mandat erreicht.<br />
205<br />
Vgl. ebd., 47-103; siehe auch die Selbstdarstellung in: Gemeinde Leutasch 2004 (Homepage).<br />
206<br />
Olt 1990, 183.<br />
207<br />
Ebd.<br />
208<br />
Mit 323.857 Nächtigungen im Winter und 254.738 im Sommer lag die Leutasch 2003 im Bezirk diesbezüglich<br />
hinter Neustift im Stubaital und dem benachbarten Seefeld auf dem dritten Platz (vgl. AdTLR 2004).<br />
209<br />
Gemeinde Leutasch 2004 (Homepage).<br />
136
Wie die Leutascher Politik ist auch das Vereinsleben traditionell ausgerichtet. Die Traditions-<br />
vereine von Schützenkompanie über „Schafer-“ und „Goaßerverein“ bis zu „D’ Wetterstoaner<br />
Schuachplattler“ werden durch einige Sportvereine ergänzt, ausgewählte Teile der Welt ins<br />
Tal holen lediglich ein „BMW-Club“ und der Kulturverein „Ars Cultus“, der sich dem freilich<br />
ziemlich naheliegenden und traditionskompatiblen Thema „Berg“ modern annähert.<br />
6.5.2 Der Standort: Übergangsort am Übergang<br />
Eben dort, wo in der Formulierung der Leutascher Ortschronik gegen Süden hin „im bewal-<br />
deten Hauptdolomit der Übergang in den Sattel von Seefeld“ gelingt 210 , befindet sich der<br />
Ortsteil Neuleutasch mit der Leutascher Flüchtlingsunterkunft. Das Gebiet, das ähnlich einem<br />
Pass zwischen dem zentralen Leutascher Ortsteil Kirchplatzl (1.133 Meter) und der Nachbar-<br />
gemeinde Seefeld (1.180 Meter) auf 1.217 Meter Seehöhe liegt, ist nur äußerst locker bebaut,<br />
liegt mitten im Wald und nahe der Gemeindegrenze. Bis nach dem Ersten Weltkrieg stand in<br />
der Gegend „weit und breit kein Haus“, wie die Ortschronik festhält: Erst um 1920 erwarb ein<br />
Bauer dort eine „moosige Wiese“, entwässerte und kultivierte sie, baute einen Bauernhof und<br />
einen Gasthof und legte so den Grundstein für die Siedlung. 211<br />
Der Gasthof Neuleutasch, der als Unterkunft dient, steht unmittelbar auf der „Passhöhe“ des<br />
Übergangs und direkt an der Straße. Entsprechend der Gebirgslage ist die Gegend im Winter<br />
schneereich, der Wirt des Gasthofs betreibt daher saisonal auch einen Schneeräumungsdienst.<br />
Der bauliche Zustand des zweistöckigen Gebäudes im Tiroler Stil ist äußerlich passabel 212 ,<br />
die Außenanlagen sind mit einem kleinen Spielplatz, einer winzigen Terrasse, einem asphal-<br />
tierten Vorplatz und einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen großen<br />
Gästeparkplatz für den an einer Durchzugsstraße liegenden Gastronomiebetrieb zweckmäßig.<br />
Der nach wie vor laufende reguläre Gasthausbetrieb hat sich seit der Flüchtlingsunterbringung<br />
allerdings auf niedrigem Niveau eingependelt.<br />
Auf dem Nachbargrundstück unmittelbar hinter der Unterkunft befindet sich ein großer Bau-<br />
ernhof, der auch als touristischer Beherbergungsbetrieb dient. Schräg hinter dem Gasthof sind<br />
weiters ein größeres, burgähnlich gestaltetes Privathaus und mehrere bereits im Wald liegende<br />
kleinere Häuschen und Hütten finden, die offenkundig nur als Wochenend- oder Ferienhäuser<br />
genutzt werden. Richtung Leutasch ist in geringer Entfernung außerdem ein größeres Holz-<br />
210 Olt 1990, 11.<br />
211 Ebd., 59.<br />
212 In den während des Lokalaugenscheins (05.12.2003) besichtigten und den Asylsuchenden als Aufenthaltsräume<br />
dienenden Gaststuben im Erdgeschoss waren hingegen an Wänden und Mobiliar teils beträchtliche Schäden<br />
feststellbar, die nach Darstellung des Wirtes auf die Nutzung durch die Flüchtlinge zurückzuführen seien.<br />
Gegen Ende des Lokalaugenscheins lagen auf dem der Straße zugewandten Vorplatz Hemden und andere<br />
Wäschestücke herum, die von Flüchtlingen offenkundig aus den Fenstern geworfen worden waren. In den<br />
verbleibenden dreißig Minuten des Besuches machte niemand Anstalten, die Kleidungsstücke aufzuheben.<br />
Äußerungen des Wirts über zahlreiche Konflikte mit den untergebrachten Asylsuchenden (vgl. Interview Unterkunftsleitung<br />
07/1, Z 114-118, 246-265, 284-299) lassen darauf schließen, dass derartige Vorkommnisse in der<br />
Unterkunft nicht ungewöhnlich sind.<br />
137
lager neben der Straße eingerichtet. Alle anderen Neuleutascher Häuser befinden sich bereits<br />
außerhalb der Sichtweite im Wald.<br />
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist zu Fuß nicht möglich, da es im nahen<br />
Umfeld keine diesbezügliche Einrichtung gibt. Der etwa fünf Kilometer entfernt liegende<br />
benachbarte Leutascher Ortsteil Weidach und der ein wenig weiter entfernte Ortskern sind<br />
von der Unterkunft aus problemlos nur mit dem Bus erreichbar: Die durch den Wald führende<br />
Straße führt kurvenreich teils steil bergab und ist im Winter immer wieder stark vereist, als<br />
Fußweg steht lediglich ein auch als solcher ausgeschilderter Wanderweg zur Verfügung, der<br />
in der Wintersaison als Langlaufloipe genutzt wird. Ähnliches gilt zwar auch für den Weg in<br />
die größere Nachbargemeinde Seefeld, aufgrund des dort breiteren Spektrums an Einrich-<br />
tungen kommt dieser jedoch für die untergebrachten Flüchtlinge trotzdem deutlich größere<br />
Bedeutung zu als der Leutasch. 213 Eine Haltestelle für die angesprochene Buslinie befindet<br />
sich unmittelbar vor dem Gasthof; die direkte Fahrt nach Innsbruck ist von hier aus allerdings<br />
nicht möglich. Um in die Landeshauptstadt zu gelangen, muss zunächst bis zum Seefelder<br />
Bahnhof gefahren werden, dort ist der Umstieg in den Zug oder einen anderen Bus möglich.<br />
Für die Fahrt ist die angesichts der nicht sonderlich großen Entfernung von knapp 34 Kilo-<br />
metern beachtliche Dauer von einer bis eineinhalb Stunden zu veranschlagen. In den Tages-<br />
randbereichen ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr gewährleis-<br />
tet. Das Fehlen von Gebetsstätten jenseits der römisch-katholischen Kirche, ergänzungsöko-<br />
nomischer Betriebe und Treffpunkten migrantischer Communities sowohl in der Leutasch als<br />
auch in Seefeld kann so nur eingeschränkt kompensiert werden.<br />
Zur Freizeitgestaltung stehen in der Unterkunft und ihrer Umgebung nur den Kindern pas-<br />
sende Möglichkeiten zur Verfügung. Der hauseigene kleine Spielplatz mit einer beträchtli-<br />
chen Anzahl an Spielgeräten scheint dabei weniger bespielt zu werden als der gegenüberlie-<br />
gende Parkplatz, der sich offenkundig hervorragend zum Radfahren eignet, und der dahinter-<br />
liegende Wald. Das „unten“ im Leutaschtal gelegene „Alpenbad“ – ein Hallenbad – dürfte<br />
dagegen weniger geeignet sein: Wie in Tirol durchaus üblich, wird hier zwischen „Einheimi-<br />
schen“ und „Fremden“ unterschieden, wobei die EU-konforme Variante dieser traditionellen<br />
Selbstbestätigungstechnik immerhin auch „Gästen mit Leutascher Gästekarte“ den mit fünf<br />
Euro nicht wirklich günstigen Tarif ermöglicht. 214<br />
213 Leutasch verfügt neben einem Kindergarten und einer Volksschule über keine weitere Bildungseinrichtung.<br />
Im Bereich der Gesundheitsversorgung stehen immerhin zwei Allgemeinmediziner zur Verfügung, auch hier ist<br />
jedoch davon auszugehen, dass von den Asylsuchenden (wie auch von vielen LeutascherInnen selbst) das benachbarte<br />
Seefeld aufgesucht wird.<br />
214 Vgl. Gemeinde Leutasch 2004 (Homepage).<br />
138
6.5.3 Die Standortwahl: »Dann hast du dein Haus wirklich durchgehend gut belegt«<br />
Anders als im Fall des „Brennerwirts“ in Kössen ging in der Leutasch der Initiative des Wirts<br />
zur Unterbringung in seinem Gasthof kein diesbezüglicher Aufruf voraus, wie er im Interview<br />
schildert:<br />
„Wir haben Zimmer gehabt mit Etagenduschen großteils, man hat’s alles schön hergerichtet gehabt, aber die Zeit<br />
war einfach vorbei für die Etagenduschen und ... das haben sie nicht gemocht – nicht mehr, die Leut’. Dann hat<br />
man gefragt: Was tut man jetzt? Jetzt hat man zwar die Zimmer schön beieinander, [...] aber da ist die meiste<br />
Zeit leer – das geht nicht. Zum Umbauen, dass man jetzt alles umbaut – die Saisonen sind nicht mehr so, das<br />
rentiert sich nicht mehr [...]. Dann hat man’s halt einmal eine Zeit leerstehen lassen, und irgendwie hat’s dann<br />
geheißen, dass in Götzens oben das Heim aufgelassen wird und hin und her, und dann hab ich gesagt: Weißt du<br />
was, sowas wär’ eigentlich was, weil – ist zwar sicher schwer verdientes Geld, aber dann hast du dein Haus<br />
wirklich durchgehend gut belegt.“ 215<br />
Nach einem Anruf im Innenministerium Mitte des Jahres 1999 sei er jedoch „irgendwie dann<br />
zur Landesregierung gekommen“, wo man ihm mitgeteilt hätte, es bestünde zur Zeit kein Be-<br />
darf an weiteren Unterkünften, man würde sich bei ihm im Fall des Falles jedoch melden.<br />
Eigentlich habe er schon gar nicht mehr an die Unterbringung gedacht, aber „einen Monat,<br />
zwei Monate drauf geht’s Telefon: Ob das noch aktuell ist? Hab ich gesagt: Ja, ja ...“ 216<br />
6.5.4 Die Standortrealisierung: »Innerhalb von zwei, drei Tagen sind die da ...«<br />
Nun, im September 1999, ging die Realisierung des neuen Unterkunftsstandorts durch das<br />
Land Tirol plötzlich überaus schnell, wie der Wirt berichtet: „Sie kommen vorbei, täten sich<br />
das anschauen – und innerhalb von zwei, drei Tagen dann ist der Bus hergefahren und dann<br />
sind die da ...“ 217 Der Gasthof Neuleutasch erhielt zunächst einen Halbjahresvertrag – als Ein-<br />
richtung der Bundesbetreuung, deren Administration dem Land Tirol oblag. 218 Der damalige<br />
Leutascher Bürgermeister Klotz 219 wurde nicht eingebunden, der Flüchtlingskoordinator des<br />
Landes setzte ihn lediglich vom Vorhaben des Landes in Kenntnis, Klotz leitete die Informa-<br />
tion an den Gemeinderat weiter, womit das Thema auf kommunalpolitischer Ebene bis auf<br />
weiteres abgehandelt war. 220 Der Wirt wurde zwar angehalten, gleichfalls die Gemeinde zu<br />
kontaktieren, zu diesem Zeitpunkt scheint Klotz jedoch bereits über die geplante Unterbrin-<br />
gung der Asylsuchenden informiert gewesen zu sein – der Bürgermeister habe einfach gesagt:<br />
„Ja, das ist euer Haus, mit dem könnt ihr tun, was ihr wollt!“ 221 Weniger gelassen reagierte<br />
215<br />
Interview Unterkunftsleitung 07/1, 05.12.2003, Z 5-16.<br />
216<br />
Ebd., Z 17-21.<br />
217<br />
Ebd., Z 21ff.<br />
218<br />
In der Praxis wurde seitens des Landes die Trennung zwischen Bundes- und Landeseinrichtungen zumindest<br />
im Leutascher Fall jedoch nie konsequent aufrecht erhalten, wie der Wirt noch vor Inkrafttreten der „Grundversorgungsvereinbarung“<br />
anmerkte: „Ich bin normal ein Bundesasylantenhaus, hab aber teilweise eben vom Land<br />
auch welche da, weil dann wieder Platzmangel gewesen ist, dann hat man wieder Leute aufgenommen ... [...] Für<br />
uns kommt es aufs gleiche hinaus ...“ (ebd., Z 40-44)<br />
219<br />
Klotz verweigerte die Autorisierung des Interviewtranskriptes am 12.03.2004. In die Einzelfalldarstellung<br />
konnten daher lediglich allgemeine Wahrnehmungen zum Interview, wie sie im Postskript vom Interviewer<br />
festgehalten wurden (vgl. Interview Klotz 05.12.2003), eingearbeitet werden.<br />
220<br />
Vgl. ebd.<br />
221<br />
Interview Unterkunftsleitung 07/1, 05.12.2003, Z 48f.<br />
139
auf das Vorhaben zunächst die ohnehin kaum vorhandene, freilich aber auch in keiner Weise<br />
vorab informierte Nachbarschaft:<br />
„[...] es sind schon Anrufe gewesen zuerst: »Asylantenheim? Da hätten wir auch Bescheid wissen müssen, ob<br />
wir das überhaupt genehmigen und so!« Dann hab’ ich schon auch gesagt: Ja ja, hab’ ich gesagt, du: »Was ich<br />
mit meinem Haus tu’, das wird dich jetzt aber gar nichts angehen!«“ 222<br />
Die Situation habe sich jedoch mittlerweile entspannt, die NachbarInnen hätten sich auf ihre<br />
Weise mit den Flüchtlingen arrangiert:<br />
„Und hetzigerweise hat sich das dann so geändert: Jetzt sind sie ein paar mal, auch wenn sie’s nicht zugeben,<br />
doch froh, dass sie da sind, weil ich seh’ sie oft: Dann laufen sie irgend daher, da hast du zwar nichts in der<br />
Hand, mir ist es auch wurscht, es ist ja gut, wenn sie ein bisschen eine Beschäftigung haben, aber in der<br />
Zwischenzeit – die, was am meisten geschumpfen haben, die kommen dann daher: »Ja, könntest du nicht<br />
Schneeschöpfen?« Oder: »Könntest du nicht da einmal den Kompost hinauftragen?« Auf einmal kennen sie sie<br />
dann. Und es ist dann natürlich wieder tragisch, wenn dann irgendetwas gestohlen wird oder wenn irgendetwas<br />
bekannt wird, auf einmal drehen sie den Kopf wieder weg, aber sobald sie irgendetwas brauchen, sind sie sowieso<br />
wieder alle da.“ 223<br />
6.5.5 »... nicht mehr gesehen, seit ich das Haus jetzt so mach«: Der Standort in der<br />
Diskussion<br />
Während der Standort in Leutasch von außerhalb der Gemeinde kaum zur Diskussion gestellt<br />
und auch von der Gemeindeführung nie kritisch diskutiert wurde – der bis März 2004 amtie-<br />
rende Bürgermeister Klotz hatte gegen die Unterkunft aufgrund ihrer Lage „draußen“ in<br />
Neuleutasch von Anfang an nichts einzuwenden gehabt 224 –, reagierten viele LeutascherInnen<br />
offenbar auf die Unterbringung der Flüchtlinge, indem sie einen Besuch des früher durchaus<br />
gutgehenden Gasthofs nun vermieden:<br />
„[..] die was halt fix da wohnen – wenn ich grad da hinauf schau: Die sind früher im Jahr, kann man sagen,<br />
zehnmal dagehockt, und der Mann ist am Abend auch zehnmal dagehockt, und jetzt sieht man sie halt wirklich<br />
im Sommer vielleicht zweimal auf der Terrasse ein Eis essen, aber dann ist’s ziemlich fertig. Unten in der Unterkelle,<br />
da ist’s richtig auffallend – da haben wir Pensionen gehabt, die sind grad in der Weihnachtszeit mit der<br />
ganzen ... mit der ganzen Pension heraufgekommen, und gefeiert und Gas gegeben, und die hat man überhaupt<br />
nicht mehr gesehen seit ich das Haus jetzt so mach! [...] Drei Häuser sind einmal sicher drin, die was regelmäßig<br />
gekommen sind, was gute Gäste gewesen sind, und von einem Tag auf den anderen sind sie ausgeblieben<br />
dann.“ 225<br />
Verantwortlich für das Ausbleiben der Gäste ist für den Wirt vorrangig negative Mundpropa-<br />
ganda auch in der Seefelder Bevölkerung: Die Leute würden sich etwa untereinander erzäh-<br />
len, dass die Gemeinde Seefeld (!) die Unterkunft gerne schließen würde, weil sie „halt so<br />
dagegen sind“, dass man sich während der Unterbringung tschetschenischer Flüchtlinge nicht<br />
mehr auf die Straße trauen habe können und in den Gasthof erst recht nicht und anderes<br />
mehr. 226 Allerdings räumt er auch Probleme im Haus selbst ein:<br />
222 Ebd., Z 53ff.<br />
223 Ebd., Z 55-63.<br />
224 Vgl. Interview Klotz 05.12.2003.<br />
225 Interview Unterkunftsleitung 07/1, 05.12.2003, Z 189-194. „Unterkelle“ ist der Flurname (und die Anschrift)<br />
eines benachbarten Gebiets.<br />
226 Ebd., Z 85-89.<br />
140
„Wir haben ja auch schon solche Fälle da gehabt, dass ... dass die Leut’ wegen Asylanten gegangen sind, weil –<br />
mein Gott, sicher sind das Einzelfälle – weil die auf einmal zu schreien angefangen haben und randalieren angefangen<br />
haben, und dann ist auf einmal ... haben wir die Gendarmerie gebraucht, dann ist die Rettung gekommen,<br />
dann sind die Leut’ aufgestanden – »Ja, nicht, dass uns da noch was passiert, auf einmal!« [...] Und sowas redet<br />
sich natürlich schon schnell herum.“ 227<br />
6.5.6 Bewertung<br />
Die Leutascher Unterkunft befindet sich durch ihre Lage auf dem passähnlichen Übergang<br />
nach Seefeld abseits der üblichen Wohngebiete. Aufgrund der kaum vorhandenen Nachbar-<br />
schaft und der nahen Gemeindegrenze ist die Umgebung als Randgebiet zu charakterisieren.<br />
Die Lage im Wald verstärkt den Eindruck von Absonderung und Isolation 228 , der durch die<br />
umständliche und in den Tagesrandbereichen weitgehend fehlende Busverbindung nach Inns-<br />
bruck kaum abgeschwächt werden kann. Die Hochgebirgslage bedingt, dass es am Standort<br />
im Winter auch ohne Schneelage äußerst kalt ist, die Straßen sind häufig vereist. Der Ortskern<br />
der Gemeinde Leutasch, wo sich Kindergarten und Volksschule befinden, ist einige Kilometer<br />
von der Unterkunft entfernt, der Schulweg für die Kinder nur mit dem Bus zu bewältigen.<br />
Kinderfreundschaften zu MitschülerInnen werden durch die Randlage der Unterkunft deutlich<br />
erschwert oder gar verunmöglicht. Aufgrund ihrer wenig ausgeprägten Infrastruktur ist davon<br />
auszugehen, dass die Gemeinde von den im Gasthof untergebrachten Asylsuchenden generell<br />
kaum aufgesucht wird, vielmehr nach kurzer Busfahrt die Einrichtungen des Nachbarortes<br />
Seefeld oder – nach einer längeren Busfahrt – der Landeshauptstadt Innsbruck genutzt wer-<br />
den.<br />
Das Unterkunftsgebäude ist im Außenbereich in akzeptablem Zustand, die Außenanlagen sind<br />
für Kinder adäquat gestaltet. Für Erwachsene bestehen dagegen keinerlei Möglichkeiten zur<br />
Freizeitgestaltung, die Situation ist für sie daher als äußerst problematisch zu bewerten. Die<br />
vom Wirt auf das Verhalten der Flüchtlinge zurückgeführten teils deutlich sichtbaren Schäden<br />
im Inneren des Gebäudes, seine Berichte über wiederholte Konflikte mit den Untergebrachten<br />
sowie die während des Lokalaugenscheins offenkundig von untergebrachten Asylsuchenden<br />
aus den Fenstern geworfenen Wäschestücke legen den Schluss nahe, dass er mit der Leitung<br />
der Unterkunft unter diesen Umständen deutlich überfordert ist.<br />
Standortwahl und -realisierung wurden vom Wirt selbst initiiert. Die ersten Flüchtlinge trafen<br />
in der Unterkunft für den in keiner Weise vorbereiteten Wirt offensichtlich überraschend<br />
schnell ein. Der Leutascher Bürgermeister wurde im Vorfeld von der Unterbringung in<br />
Kenntnis gesetzt, die Unterkunft blieb für ihn aufgrund der Lage außerhalb des Wohngebietes<br />
jedoch ein Randthema. Die wenigen NachbarInnen wurden über die neue Verwendung des<br />
Gasthofs nicht informiert, anfängliche Proteste beim Wirt ebbten bald ab – dass die Asyl-<br />
227 Ebd., Z 114-120.<br />
228 „In unserer Unterkunft in der Leutasch“, klagte Anfang Dezember 2004 ein von dort nach Innsbruck<br />
überstellter Flüchtling in der Tiroler Tageszeitung (03.12.2004), „haben wir ringsum nur Bäume gesehen.“<br />
141
suchenden sich für Gelegenheitsarbeiten heranziehen ließen, scheint dabei eine entscheidende<br />
Rolle gespielt zu haben.<br />
6.6 Mötz: Pokerspiel mit einem Wallfahrtsort<br />
Wenn Flüchtlinge in einem Wallfahrtsort untergebracht werden, dann hat das stilecht zu er-<br />
folgen – am besten in einem Gasthof, der das Kreuz gleich im Namen führt. Ende Juni 2004<br />
waren dort 29 Asylsuchende untergebracht. 229<br />
6.6.1 Die Gemeinde: Im Zeichen Mariens<br />
Das 1.235 EinwohnerInnen zählende Mötz im Oberinntaler Bezirk Imst liegt zwischen Grün-<br />
berg und Roter Wand einerseits und dem Locherboden andererseits in einem kleinen Tal, an<br />
dessen östlichem Rand eine Straße von der durch das Inntal verlaufenden Autobahn auf das<br />
Mieminger Plateau und weiter über den Holzleitensattel Richtung Fernpass und in den Bezirk<br />
Reutte führt. Aufgrund seiner Lage am Inn war Mötz früher ein wichtiger Ausgangspunkt für<br />
die Innflößerei: Von hier aus wurden die aus dem umliegenden Gebirge herangeschafften<br />
Baumstämme auf dem Fluss Richtung Innsbruck und Hall gebracht. 230 Mit dem Bau der Arl-<br />
bergbahn Ende des 19. Jahrhunderts verschwand die Flößerei als dominierender Wirtschafts-<br />
zweig, der Bergbau – bis 1920 stand in der Gegend um den Grünberg die „Erste oberinnthali-<br />
sche Cement-Fabrik“ 231 – erlangte nie herausragende Bedeutung. Durch den Bergbau wurde<br />
die Gemeinde jedoch immerhin zum Wallfahrtsort: 1740 wurde am Locherboden Überliefe-<br />
rungen zufolge ein Bergknappe verschüttet und, nachdem er die Aufstellung eines Maria-Hilf-<br />
Bildes gelobt hatte, nach drei Tagen gerettet. Die Stelle oberhalb von Mötz entwickelte sich in<br />
der Folge zum Marienwallfahrtsort, nachdem 1871 eine junge Frau an der Wallfahrtsstätte<br />
angeblich von einer schweren Krankheit geheilt worden war, wurde „Maria Locherboden“<br />
endgültig zum Anziehungspunkt für zahlreiche PilgerInnen. 232 Eine eigene Kirche auf der<br />
Kuppe des Locherbodens wurde errichtet, die nun – wie der damalige Tiroler Landeshaupt-<br />
mann Wendelin Weingartner in seinem Geleitwort für das 2001 erschienene „Wallfahrtsbuch“<br />
wenig stimmungsvoll, doch zutreffend festhielt – vielen AutofahrerInnen „durch ihre exponierte<br />
Lage gleichsam als Autobahnkirche“ auffällt. 233<br />
Die Wallfahrtsstätte am Locherboden wurde für Mötz identitätsstiftend, die Gemeinde selbst<br />
verfügt schließlich über keine nennenswerten Sehenswürdigkeiten. Bürgermeister Anton<br />
Reindl, der bis zu den Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2004 amtierte, formuliert entspre-<br />
chend stolz, die Mötzer Bevölkerung habe zur Errichtung der Kirche auf dem Locherboden<br />
seinerzeit „mit viel Fleiß und Einsatz“ beigetragen, mittlerweile sei „die Wallfahrt zu Maria<br />
229<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
230<br />
Vgl. Hörmann 2001, 12.<br />
231<br />
Ebd., 17.<br />
232<br />
Vgl. Hörmann 2001.<br />
233<br />
Weingartner, zit. nach ebd., 7.<br />
142
am Locherboden weitum bekannt und für viele Menschen ein wichtiger Zufluchtsort“. 234 Mit<br />
dem 1985 erfolgten Bau der auf das Mieminger Plateau führenden Umfahrungsstraße wurde<br />
jedoch nicht nur das Mötzer Dorfzentrum vom Durchzugsverkehr entlastet: Nun ist es den<br />
PilgerInnen möglich, am Ort vorbei direkt zur Wallfahrtsstätte zu fahren, die Gemeinde liegt<br />
damit trotz ihrer Nähe im Abseits. So überrascht es kaum, dass Mötz mittlerweile zu den we-<br />
nigen Tiroler Gemeinden zählt, in denen der Tourismus keine nennenswerte Rolle mehr<br />
spielt. 235 Da der Ort auch jenseits von Tourismus und Landwirtschaft über kein ausdifferen-<br />
ziertes Wirtschaftsleben verfügt, ist die Gemeinde heute eine klassische PendlerInnen-<br />
gemeinde im Sog der Bezirkshauptstadt Imst, des nahen regionalen Zentrums Telfs und der<br />
Landeshauptstadt. Zumindest im Bildungsbereich sind jedoch die grundlegenden Einrichtun-<br />
gen vorhanden: In Mötz gibt es sowohl einen Kindergarten als auch eine Volksschule, auch<br />
eine gemeinsam mit der Nachbargemeinde Silz betriebene kleine Erwachsenenschule ist in<br />
der Gemeinde zu finden.<br />
Mötz, so scheint es, hat als Gemeinde noch nicht wirklich ihren Platz im 21. Jahrhundert und<br />
eine damit verbundene Gemeindeidentität gefunden. Ein diesbezüglicher Umbruch kündigte<br />
sich möglicherweise auf politischer Ebene an: Die lokale Politik war noch im zweiten Halb-<br />
jahr 2003 deutlich von der ÖVP dominiert, Langzeitbürgermeister Anton Reindl hatte bei den<br />
Gemeinderatswahlen 1998 mit seiner sinnigerweise „Einheitsliste“ genannten ÖVP-Fraktion<br />
fast fünfzig Prozent der Stimmen erreicht und daher sieben Sitze im Gemeinderat beanspru-<br />
chen können. Im März 2004 trat Reindl nicht mehr an, seine Liste verlor mehr als 18 Prozent<br />
und erhielt nur noch vier Mandate. Die erstmals antretende Liste „Gemeinsam für Mötz“<br />
wurde mit fünf Mandaten gleich stärkste Kraft im Gemeinderat, ihr Spitzenkandidat Bernhard<br />
Krabacher schaffte im ersten Wahlgang mehr Stimmen als der Kandidat von Reindls Liste<br />
und wurde so neuer Bürgermeister. Die SPÖ erreichte in Mötz mit rund neun Prozent<br />
Stimmengewinn drei Sitze im Gemeinderat.<br />
6.6.2 Der Standort: Wohnort Dorfgasthaus<br />
Der Gasthof Kreuz, die Mötzer Flüchtlingsunterkunft, liegt als typischer Dorfgasthof unmit-<br />
telbar im Zentrum der Gemeinde. Südlich des Hauses hat in einer Entfernung von wenigen<br />
Schritten die regional dominierende Bankenkette eine kleine Filiale eingerichtet, auf der ande-<br />
ren Straßenseite und damit schräg unterhalb der Unterkunft liegt der Musikpavillon der<br />
Gemeinde, dem ein kleiner, einfacher aber durchaus schöner und gepflegter Park mit einigen<br />
Bänken vorgelagert ist. Westlich des Gasthofs befindet sich auf der anderen Seite der Straße<br />
eine größere Obstwiese. Nordwestlich in kaum zwanzig Meter Entfernung schließt bereits der<br />
Kirchplatz mit der Gemeindebibliothek, dem örtlichen Nahversorger sowie der Pfarrkirche<br />
„Maria Schnee“ samt Pfarramt und Friedhof an. Der Mötzer Ortskern ist ein Dorfzentrum,<br />
234 Reindl, zit. nach ebd., 9.<br />
235 Mit 543 Nächtigungen im Winter und 633 im Sommer 2003 weist Mötz mit deutlichem Abstand die geringste<br />
Zahl an Nächtigungen im gesamten Bezirk Imst auf (vgl. AdTLR 2004).<br />
143
wie es im Buche steht: Der Kirchplatz wird vom Dorfbrunnen dominiert, der unter einer alten<br />
Trauerweide steht, einige Holzbänke und Blumenkisten laden zum Verweilen ein.<br />
Private Nachbarhäuser befinden sich westlich sowie jenseits des hier vorbeifließenden<br />
Klammbachs östlich der Unterkunft, es handelt sich dabei überwiegend um Bauernhäuser<br />
oder Einfamilienhäuser im ländlichen Stil. Aufgrund seiner Größe und architektonischen<br />
Gestaltung dominiert der Gasthof seine unmittelbare Umgebung deutlich. Da Ausschank und<br />
Restaurantbetrieb im Erdgeschoss nach wie vor bestehen, dient das Haus auch für die Mötzer<br />
Bevölkerung als Treffpunkt – ein Umstand, der diese Dominanz unterstreicht. Das drei-<br />
stöckige Gebäude verfügt an der gegen Süden ausgerichteten Frontseite über einen einstöcki-<br />
gen Vorbau, der straßenseitig einen Balkon aufweist. Das Dach des Vorbaus bildet eine Ter-<br />
rasse beachtlichen Ausmaßes. Der dritte Stock des Hauptgebäudes ist gleichfalls mit einem<br />
Balkon versehen. Alles Leben, das sich an der Südfront des Hauses abspielt – insbesondere<br />
auf Terrasse und Balkonen, aber auch hinter den Fenstern, soweit keine blickdichten Vor-<br />
hänge vorgezogen sind – ist vom der gegenüberliegenden Bankfiliale vorgelagerten kleinen<br />
Parkplatz, der stark frequentiert wird, sowie von Park und Musikpavillon aus gut einsehbar.<br />
Vor dem Gasthof liegt zu ebener Erde unmittelbar an der Straße eine kleine Terrasse, die im<br />
Sommer als Gastgarten dient. An der Nordseite des Gasthofs befindet sich ein angebauter<br />
Stadel, dessen Aufschrift „Biker Treff“ auf eine diesbezügliche Verwendung hinweist. Ob-<br />
wohl der Gasthof an der Hauptstraße der Gemeinde liegt, ist das Verkehrsaufkommen, wie<br />
allgemein in Mötz seit dem Bau der Umfahrungsstraße auf das Mieminger Plateau, eher ge-<br />
ring. Das gesamte Unterkunftsgebäude ist im Stil eines größeren Landgasthauses gehalten, die<br />
Gestaltung entbehrt dabei jedoch der häufig anzutreffenden übertriebenen und kitschigen<br />
Ausschmückung der einschlägigen Stilelemente. Das Haus ist in Mötz durchaus traditions-<br />
reich, eine Vorgängerfamilie der heutigen Wirtsleute wurde in der Wallfahrtskirche am<br />
Locherboden auf einem Fresko gar als „Heilige Familie“ verewigt – die damalige Wirtin galt<br />
als besonders sozialer Mensch, der „für Arme und Fahrende stets eine Gratismahlzeit übrig“<br />
hatte, wie Hörmann zu berichten weiß. 236<br />
Der bauliche Zustand des Hauses ist an der zentralen Südfront einwandfrei, die übrigen Seiten<br />
weisen vereinzelt leichte Schäden auf. 237 An der dem Klammbach zugewandten Ostseite gibt<br />
es einen eigenen Eingang, der den Asylsuchenden den Zutritt zu den Zimmern unter Umge-<br />
hung der Schankstube ermöglicht, der Eingang wurde von den Wirtsleuten offenbar eigens zu<br />
diesem Zweck angelegt. 238 Die Außenanlagen des Gasthofs sind auf die große Terrasse über<br />
236 Hörmann 2001, 38; vgl. die diesbezüglichen Fotographien in ebd., 39.<br />
237 So fiel etwa während des Lokalaugenscheins (04.11.2003) an der straßenseitigen Westfront ein nur notdürftig<br />
von außen durch ein Tuch bedecktes zerbrochenes Fenster auf, der Zustand des Tuches legte den Schluss nahe,<br />
dass es bereits längere Zeit die Bruchstelle verdeckt hatte. An der Nord- und an der Ostseite war an einigen<br />
Stellen abbröckelnder Putz erkennbar.<br />
238 Vgl. Interview Reindl 04.11.2003.<br />
144
dem Vorbau sowie auf den schmalen, als Parkplatz dienenden Bereich zwischen Gebäude und<br />
Klammbach beschränkt. Der Gasthof verfügt damit im Außenbereich über keine Spielmög-<br />
lichkeiten für Kinder oder Erwachsene, in der nächsten Umgebung steht nur die Parkanlage<br />
vor dem Musikpavillon zur Verfügung, die allerdings kaum bespielt werden kann.<br />
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs kann über den erwähnten kleinen Lebens-<br />
mittelhändler erfolgen, der am Kirchplatz oberhalb der Unterkunft eine klassische Nahversor-<br />
gungseinrichtung betreibt. Auf dem Weg zur am Ortsrand liegenden Bahnhaltestelle, von der<br />
aus mit dem Zug die 38 Kilometer entfernte Landeshauptstadt direkt erreichbar ist 239 , liegt<br />
überdies die Filiale einer Drogeriekette. Volksschule und Kindergarten befinden sich zwar<br />
nicht direkt im Ortskern, sind jedoch auf dem Fußweg leicht erreichbar. Einrichtungen der<br />
Gesundheitsversorgung sind in Mötz in beschränktem Ausmaß vorhanden: Ein praktischer<br />
Arzt steht zur Verfügung, eine eigene Apotheke gibt es in der Gemeinde jedoch nicht. Aller-<br />
dings betreibt das Rote Kreuz am südwestlichen Dorfrand eine eigene Ortsstelle – diesbezüg-<br />
liche Hinweisschilder im ganze Ort legen die Annahme nahe, dass sie ein fester Bestandteil<br />
des Gemeindelebens ist.<br />
6.6.3 Die Standortwahl: Ein Gasthof in der Warteschleife<br />
Wie im Fall der Unterkünfte in Kössen und Landeck nahm auch in Mötz die Unterkunfts-<br />
leitung Kontakt mit dem Land Tirol auf, nachdem dieses über die regionale Presse insbeson-<br />
dere Gastwirtinnen und -wirte aufgerufen hatte, Räume für die Unterbringung von Asylsu-<br />
chenden zur Verfügung zu stellen. Die Mötzer Wirtin schildert ihre Beweggründe so:<br />
„Die Motivation war: Weil der Tourismus so schlecht geworden ist und kein Geschäft da war und kein Geld da<br />
ist, dass man das Zimmer umbauen kann, weil der Standard einfach zu gering ist. Und dann haben dann eben das<br />
in der Zeitung gelesen, oder uns hat ein Bekannter darauf aufmerksam gemacht. Dass man das machen könnte,<br />
oder? Und dann haben wir uns beim Land gemeldet.“ 240<br />
Der Flüchtlingskoordinator des Landes, Peter Logar, hatte zunächst jedoch offenbar keinen<br />
Bedarf – nachdem die Wirtsleute ihr Interesse an der Flüchtlingsunterbringung bekundet hat-<br />
ten, war „einmal lang, lang nichts“, weshalb man wieder Buchungen von TouristInnen an-<br />
nahm. Das Land hatte Mötz freilich bereits als Standort vorgemerkt.<br />
6.6.4 Die Standortrealisierung: »... und um neun haben wir müssen ja<br />
oder nein sagen!«<br />
Nach längerer Wartezeit ging im November 2002 plötzlich alles äußerst rasch, wie die Wirtin<br />
berichtet:<br />
„Und dann hat uns eben jemand angerufen vom Land und hat gesagt: Ja, wir kommen morgen, und ... und ... und<br />
sie hätten halt zwanzig Leut’, und die sollen wir halt nehmen. Nicht? Na, das war schon ein bisschen ... Dann<br />
hab ich gesagt: Ja, ich kann das nicht allein entscheiden, ich mein’: Wir sind ein Familienbetrieb, die ... die ...<br />
meine Schwiegereltern, der Mann und alles ... ich bin da hereingeheiratet und ... Das ist nicht so in einem Dorf,<br />
239 Auch die rund 20 Kilometer entfernte Bezirkshauptstadt Imst kann mit dem Zug direkt erreicht werden.<br />
240 Interview Unterkunftsleitung 04/1, 04.11.2003, Z 3-6.<br />
145
nicht? Ja, und was tun wir? Der Herr Logar ist um acht am Abend gekommen – und um neun haben wir müssen<br />
ja oder nein sagen! Und am nächsten Tag sind zwanzig Leut’ dagewesen! Das war schon ein bisschen ...“ 241<br />
Die Sache sei ein „Sprung ins kalte Wasser“ gewesen, denn das Haus musste nun innerhalb<br />
kürzester Zeit adaptiert werden:<br />
„Dann haben wir müssen eine Waschmaschine kaufen, weil da ... die brauchen ja eine Waschgelegenheit ... [...]<br />
Und die brauchen einen Aufenthaltsraum, weil wir wollten ja auch nicht, dass sie da unten mit den Tagesgästen<br />
zusammenkommen ... – man weiß ja am Anfang nicht, wie’s geht und alles. [...] Und die sind halt dann am<br />
nächsten Tag um fünf dagestanden, ja.“ 242<br />
Der Mötzer Bürgermeister Reindl wurde von der Errichtung der neuen Unterkunft erst wäh-<br />
rend ihres Bezugs informiert – für den Unterkunftsgeber ein durchaus riskantes Unterfangen.<br />
Reindl nahm die Sache jedoch gelassen 243 , er und der Mötzer Gemeinderat hatten keine<br />
grundsätzlichen Bedenken.<br />
6.6.5 »Manche haben das sofort gut gefunden.« Der Standort in der Diskussion<br />
Während der Standort in Mötz von außerhalb der Gemeinde öffentlich bislang nicht kritisch<br />
kommentiert wurde, diskutierte die Mötzer Bevölkerung zumindest anfangs die neue Unter-<br />
kunft durchaus kontrovers.„Manche haben das sofort gut gefunden“, erzählt die Wirtin im<br />
Interview, „und manche haben halt schon hinterm Rücken ... und nicht direkt ... Einer hat halt<br />
zu diesem Zeitpunkt dann gesagt: Er geht nicht mehr in dieses Haus herein.“ 244 Ein Nachbar<br />
habe gar gedroht: „Wenn einer von denen [Flüchtlingen] zu mir herüber kommt, dann nimm i<br />
a Schaufel und derschlag ihn!“ 245 Auch während der Untersuchung im zweiten Halbjahr 2003<br />
wurde von NachbarInnen teils harsche Ablehnung artikuliert – eine Nachbarin beklagte sich<br />
etwa auf dem ihr hinterlegten Fragebogen, dass die Untergebrachten „den ganzen Tag herum-<br />
spazieren, auf der Terrasse sitzen, wenn wir arbeiten und schwitzen“. Sie sollten lieber „nicht<br />
bei uns in Tirol“, sondern am besten in Lagern außerhalb Österreichs untergebracht werden,<br />
letztlich fürchte sie sich vor den Asylsuchenden sogar – die Begründung geriet der Schreiberin<br />
freilich etwas zweideutig: Die Asylwerber seien „manchmal außergew. Tüpen“. 246<br />
Offenbar aufgrund der öffentlichen Diskussionen um die Unterbringung der Asylsuchenden<br />
entschloss sich der Flüchtlingskoordinator des Landes, den kurze Zeit zuvor vom Kössener<br />
Bürgermeister Mühlberger einberufenen dortigen runden Tisch auch in Mötz zu versuchen.<br />
Der Mötzer Bürgermeister Reindl griff den Vorschlag auf, eine Gesprächsrunde mit Pfarrer,<br />
Rotem Kreuz, Schuldirektor und eben Reindl und Logar war die Folge. 247 Unabhängig von<br />
dieser Runde fand sich jedoch in der Bevölkerung rasch auch ein sehr aktiver HelferInnen-<br />
241 Ebd., Z 8-14.<br />
242 Ebd., Z 19-24.<br />
243 Vgl. Interview Reindl 04.11.2003.<br />
244 Interview Unterkunftsleitung 04/1, 04.11.2003, Z 28ff.<br />
245 Vgl. Interview Unterkunftsleitung 04/2, 04.11.2003.<br />
246 Fragebogen 21, 2003, 3f; orthographische Fehler im Original.<br />
247 Vgl. Interview Logar 10.10.2003, Z 793-798.<br />
146
kreis zusammen, einige Familien spendeten Geld und Kleidung, eine Weihnachtsfeier im<br />
Pfarrsaal wurde veranstaltet, zu welcher auch der Bürgermeister und seine Frau eingeladen<br />
wurden und auch erschienen. Einige HelferInnen kümmerten sich über diese Einzelaktionen<br />
hinaus um die untergebrachten Flüchtlinge, aber diese – so die Wirtin – „wollten das nicht.<br />
Und das ist dann eingeschlafen.“ 248<br />
6.6.6 Bewertung<br />
Das Unterkunftsgebäude nimmt in seiner Umgebung baulich wie auch durch seine Funktion<br />
als Dorfgasthaus eine klar dominierende Stellung ein, im kaum von auffälligen Gebäuden und<br />
Sehenswürdigkeiten geprägten Mötzer Dorfbild kommt ihm gewissermaßen die Rolle eines<br />
„Blickfangs“ zu. Wie der Gasthof selbst sind alle umliegenden Häuser und Einrichtungen<br />
diesseits des Klammbachs – Musikpavillon, Parkanlage, Bankhaus, Parkplatz, „Biker Treff“<br />
und Pfarramt – öffentlicher Natur und nicht bewohnt. Für die an der südlichen und damit der<br />
Parkanlage und Bankfiliale zugewandten Seite untergebrachten oder sich aufhaltenden<br />
Flüchtlinge bringt dies wie im Fall der Götzner Unterkunft ein Leben im öffentlichen Raum<br />
mit sich. Da jedoch im Unterschied zu Götzens die Gemeinde Mötz über ein sehr geringes<br />
Verkehrsaufkommen verfügt und vor der Unterkunft mit Ausnahme des Bankhauses auch<br />
keine weiteren stark frequentierten öffentlichen Einrichtungen vorhanden sind, reicht der<br />
Grad an „Öffentlichkeit“ nicht an jenen am Götzner Kirchplatz heran.<br />
Das Gebäude wirkt freundlich und durchaus einladend, durch den zweiten Eingang an der<br />
Ostseite sind die Asylsuchenden Flüchtlinge nicht gezwungen, durch den Schankraum zu ih-<br />
ren Zimmern zu gehen. Die hervorragende Erreichbarkeit des örtlichen Nahversorgers ist als<br />
großer Vorteil des Standorts zu werten, ebenso die gute Erreichbarkeit von Schule und Kin-<br />
dergarten, das Fehlen bespielbarer Außenanlagen für Kinder und Erwachsene auf dem Unter-<br />
kunftsareal und in dessen unmittelbarer Umgebung demgegenüber als auffälliger Mangel. Der<br />
wenige Schritte entfernte Park kann, da als Spielfläche ungeeignet, dieses Manko zwar nicht<br />
kompensieren, zumindest als Aufenthaltsort im Freien ist die Anlage jedoch geeignet. Durch<br />
die Bahnhaltestelle jenseits des Inn ist eine unkomplizierte Direktverbindung in die Landes-<br />
hauptstadt Innsbruck gegeben, der vor dem Hintergrund der wenig ausgeprägten Infrastruktur<br />
in Mötz erhebliche Bedeutung zukommt.<br />
Bei der Standortwahl wurde im Fall von Mötz offenbar auf eine eingehendere Überprüfung<br />
des Umfelds verzichtet, vielmehr scheinen ausschließlich Kapazitätsüberlegungen im Vorder-<br />
grund gestanden zu haben, wie die Art der Realisierung des Standorts nahe legt: Sie wurde<br />
geradezu überfallsartig vorgenommen – der Unterkunftsgeber hatte offenbar kurzfristig drin-<br />
gend Bedarf an weiteren Unterkunftsplätzen. Die erst zeitgleich mit dem Bezug der Unter-<br />
kunft durch die Flüchtlinge vorgenommene Information des Bürgermeisters hätte von diesem<br />
leicht als Brüskierung aufgefasst werden können, er nahm die Angelegenheit jedoch mit<br />
248 Interview Unterkunftsleitung 04/1, 04.11.2003, Z 44f.<br />
147
Humor. Die vergleichsweise geringen Proteste, welche die Errichtung der Unterkunft in der<br />
Gemeinde auslösten, sind vor diesem Hintergrund wohl vorrangig der gelassenen Reaktion<br />
des Bürgermeisters zuzuschreiben. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass das Land<br />
Tirol im Fall der Mötzer Unterkunft sowohl auf Ebene der politisch Verantwortlichen als auch<br />
auf exekutiver Ebene geradezu wagemutig vorgegangen ist und sowohl hinsichtlich der Re-<br />
aktion der Bevölkerung, als auch des Bürgermeisters und der Wirtsleute auffallend hoch „ge-<br />
pokert“ hat – eine politisch-administrative Bruchlandung wäre als Ergebnis der überstürzten<br />
Vorgangsweise durchaus möglich und keineswegs überraschend gewesen.<br />
6.7 Reith im Alpbachtal: Ein Tourismusort und seine ungeliebten Gäste<br />
83 Asylsuchende waren Ende Juni 2004 in der Unterkunft in Reith im Alpbachtal unterge-<br />
bracht. 249 Das Haus, vom Land Tirol seit der Eröffnung selbst verwaltet und betreut, gehört<br />
damit zu den größten Unterkünften des Landes.<br />
6.7.1 Die Gemeinde: Urlaub am Bauernhof<br />
„Europas schönstes Blumendorf“? Kein Zweifel: Eine Gemeinde, die sich selbst so be-<br />
wirbt 250 , ist eine klassische Tourismusgemeinde. Tatsächlich gibt es in Reith im Alpbachtal<br />
kein nennenswertes wirtschaftliches Leben jenseits der Beherbergungsbranche und der damit<br />
verbundenen Handels- und Gewerbebetriebe. 251 Die Industrie ist anderswo: im benachbarten<br />
Brixlegg vor allem in Form der Montanwerke und der Zentrale des Walkwaren-Herstellers<br />
Giesswein, im nahen Jenbach vor allem in Form der Jenbacher Werke, im bereits ein wenig<br />
weiter entfernten Kundl in Form der „Biochemie“. Entsprechend ist Reith eine PendlerInnen-<br />
gemeinde. Zugleich ist der Ort jedoch nach wie vor das, was er schon immer gewesen ist: Ein<br />
fest im Bäuerlichen verankertes Dorf. Tourismus und Landwirtschaft ergänzen und erhalten<br />
sich: Die Landwirtschaft sorgt für die Bewahrung der Kulturlandschaft und die von vielen<br />
TouristInnen geschätzte Kulisse aus Land und Leuten, die Zusatzeinnahmen aus dem Touris-<br />
mus ermöglichen vielen Bauern das Betreiben der Landwirtschaft. 252 Seit Anfang der 1980er<br />
kam es jedoch vor allem im Sommertourismus zu einem beträchtlichen Rückgang bei der<br />
„Fremdenverkehrsintensität“. 253 Die Gemeinde, nicht zuletzt dadurch finanziell unter Druck<br />
geraten, versucht daher gegenwärtig, ein Gewerbegebiet zu etablieren. Zugleich experimen-<br />
tiert man mit einer Konzentration auf den Bereich des familienfreundlichen Landurlaubs –<br />
249 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
250 Vgl. Gemeinde Reith im Alpbachtal 2004 (Homepage).<br />
251 Vgl. C. Hohlrieder 2003.<br />
252 Vgl. C. Hohlrieder 2003, 215. Die nach wie vor zentrale Bedeutung der Landwirtschaft für die Gemeinde<br />
zeigt sich deutlich im Umstand, dass in Reith die Zahl der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe jene der nichtlandwirtschaftlichen<br />
Arbeitsstätten übersteigt (vgl. AdTLR 2004).<br />
253 Vgl. C. Hohlrieder 2003, 155-168. Mit über 122.000 Nächtigungen im Winter 2003 und annähernd gleich<br />
vielen Nächtigungen im Sommer des gleichen Jahres ist Reith zwar noch immer ein zweisaisonaler Tourismusort,<br />
die Spitzenreiter des Bezirks, etwa Ellmau, Söll oder Wildschönau, sind hinsichtlich der Nächtigungszahlen<br />
mittlerweile jedoch außer Reichweite (vgl. AdTLR 2004).<br />
148
schon jetzt sieht man sich selbst als „das Familien-Paradies in Tirol“ 254 – unter zaghafter Ein-<br />
beziehung von Fitness- und Wellnessaspekten, paradoxerweise versucht man sich jedoch auch<br />
mit hochwertigen Kulturveranstaltungen, etwa Opernaufführungen, zu positionieren. 255 Eine<br />
klare Richtung ist nicht erkennbar, Reith hat seinen Platz im 21. Jahrhundert offenkundig<br />
noch nicht gefunden und scheint sich dementsprechend in einer schwierigen Umbruchsphase<br />
zu befinden.<br />
Im vordersten Teil des Alpbachtales hart an der Bezirksgrenze zwischen Kufstein, zu dem<br />
Reith gehört, und Schwaz gelegen, verfügt die heute 2.649 EinwohnerInnen zählende Ge-<br />
meinde über mehrere verstreut liegende Ortsteile. Da diese teils beträchtlich ins Alpbachtal<br />
hineinreichen, teils wie der Ortsteil St. Gertraudi noch im Inntal liegen, ist auch der Höhen-<br />
unterschied beträchtlich: St. Gertraudi etwa liegt auf 527 Meter Seehöhe, der Reither Ortskern<br />
dagegen auf 637, das dazwischen liegende Neudorf gar auf 661 Meter. Jenseits touristisch<br />
relevanter Einrichtungen hat sich in Reith bislang keine ausdifferenzierte Infrastruktur ent-<br />
wickelt. Die Reither Bevölkerung nutzt daher in verschiedenen Bereichen die Infrastruktur<br />
der Nachbargemeinden vor allem im Inn- und Zillertal, etwa jene von Brixlegg oder Strass im<br />
Zillertal. 256 Lediglich die Feuerwehr – ihr kam in der Diskussion um die Flüchtlingsunter-<br />
bringung in Reith zuletzt erhebliche Bedeutung zu, worauf noch näher einzugehen sein wird –<br />
verfügt mit zwei eigenständigen Standorten und zwei weiteren Gerätehäusern über ein bemer-<br />
kenswert stark ausgeprägtes Netz an Einrichtungen.<br />
Eher bäuerlich-traditionellen Charakter weist das Reither Vereinsleben auf – zwischen<br />
Bauerntheater, Schiessportverein, Schützenkompanie und Trachtenverein wirkt die Reither<br />
Damenfußballmannschaft geradezu avantgardistisch. In der lokalen Politik spiegelt sich die<br />
Gesellschaftsstruktur der Gemeinde in bemerkenswerter Form: Die im zweiten Halbjahr 2003<br />
dominierende Fraktion des bis zu den Gemeinderatswahlen im März 2004 amtierenden Bür-<br />
germeisters Günther Hohlrieder (ÖVP) bietet mit ihrer Listenbezeichnung einen umfassenden<br />
Querschnitt der Gemeindebevölkerung und nennt sich entsprechend schlicht „Arbeitnehmer,<br />
Pensionisten, Zimmervermieter, Arbeiter- und Angestelltenbund“. Seit 1998 hatte die Liste<br />
über sechs Sitze im Gemeinderat verfügt, nach dem Ausscheiden Hohlrieders aus der Politik<br />
verlor sie ein Mandat und – bei den Bürgermeister-Direktwahlen – überraschend auch den<br />
Posten des Gemeindeoberhaupts, der an den Spitzenkandidaten der in dieser Form erstmals<br />
angetretenen Liste „Für ein starkes Reith“, Johann Thaler, ging. Die „starken Reither“ verfü-<br />
gen nun gleichfalls über fünf Mandate, die Liste „Wirtschaft und Tourismus“ über vier, eine<br />
weitere und gleichfalls in dieser Form erstmals angetretene Liste „Gemeinsam für Reith“ über<br />
254 Vgl. Gemeinde Reith im Alpbachtal 2004 (Homepage).<br />
255 Vgl. C. Hohlrieder 2003.<br />
256 Dies lässt sich am Beispiel der Gesundheitsversorgung veranschaulichen: Reith verfügt zwar über einen<br />
Allgemeinmediziner und eine Zahnärztin, die nächste Apotheke befindet sich jedoch in Brixlegg. Im Bildungsbereich<br />
verfügt die Gemeinde neben einem Kindergarten und einer Volks- immerhin auch über eine Hauptschule,<br />
im Erwachsenenbildungsbereich müssen die ReitherInnen jedoch wieder auf Nachbargemeinden zurückgreifen,<br />
etwa auf die Volkshochschulen in Brixlegg und Jenbach.<br />
149
ein Mandat. SPÖ und FPÖ traten als Parteilisten nicht mehr zur Gemeinderatswahl an, beide<br />
hatten zuvor über je einen Sitz verfügt.<br />
6.7.2 Der Standort: Warten auf den Gewerbepark<br />
Die Unterkunft in Reith befindet sich am Rand des Ortsteils St. Gertraudi am Kreuzungspunkt<br />
der von Schlitters und Bruck im Zillertal kommenden Nebenstraße mit der von Strass hier die<br />
Zillerbrücke überquerenden und nach Brixlegg führenden Bundesstraße. Das Gebäude, das<br />
zuvor den Gasthof Landhaus beherbergte und entsprechend vom Betreiber, dem Land Tirol,<br />
heute als „Flüchtlingsheim Landhaus“ bezeichnet wird, liegt damit unmittelbar an der westli-<br />
chen Gemeindegrenze Reiths. Der Reither Ortskern ist von St. Gertraudi aus über eine von<br />
der Bundesstraße abzweigende und teils steil bergauf durch den Wald führende Nebenstraße<br />
erreichbar, die Entfernung von der Unterkunft beträgt etwa drei Kilometer.<br />
Das „Landhaus“ ist urkundlich erstmals im 18. Jahrhundert als Haus mit „Bierkeller, so ehe-<br />
mals ein Stollen war“, belegt, vermutlich ist es jedoch älteren Ursprungs. 257 Im 19. Jahrhun-<br />
dert verfügte das Wirtshaus über eine Kegelbahn und eine eigene Kapelle 258 , nach dem Zwei-<br />
ten Weltkrieg betrieb der Wirt zugleich eine Frächterei. 259 In den 1960ern wurde der Bau<br />
schließlich abgerissen und in seiner heutigen Form als eher schlichter Zweckbau neu errichtet.<br />
Die Umgebung ist geschichtsträchtig: Bis ins 17. Jahrhundert befand sich bei der alten<br />
Zillerbrücke und damit in Sichtweite ein „Hochgericht“ – eine Richtstätte für Hinrichtungen<br />
sowohl mit dem Galgen als auch „außerhalb des Stranges“ mit Verbrennungen, Enthaup-<br />
tungen, Räderungen und ähnlichem. 260 Während des Tiroler „Freiheitskampfes“ 1809 war die<br />
Gegend Schauplatz erbitterter Auseinandersetzungen: Die Schützen beschossen die Richtung<br />
Zillerbrücke vorrückenden bayerischen Truppen von den Felsen des Reither Kogels aus und<br />
brachten den Zug damit vorübergehend zum Stillstand. 261 Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein<br />
war St. Gertraudi auch eine bedeutende Station für die Innflößerei, entsprechend verfügte die<br />
kleine Ortschaft nicht nur über den jährlich veranstalteten größten Markt des Unterinntales,<br />
sondern auch über eine ganze Reihe an Wirtshäusern – das „Landhaus“ war eines davon. Im<br />
Ständestaat richteten die österreichischen Nationalsozialisten an der Mündung des Ziller in<br />
den Inn (und damit in Sichtweite des „Landhauses“) ein parteieigenes Arbeitslager ein, das<br />
den dort zum „freiwilligen Arbeitsdienst“ eingerückten Burschen und Männern „Zucht, Ord-<br />
nung und Einfügen in den Gemeinschaftsrahmen“ vermitteln sollte – die Freiwilligen legten<br />
257 Vgl. J. Pohl 1959, 142f. Pohl vermutet, dass am Standort früher Bergbau betrieben wurde und ein Knappenhaus<br />
dem Wirtshaus voranging (ebd.; siehe auch Reiter 1991, 134f).<br />
258 Vgl. Reiter 1991, 135f und das dort abgedruckte Aquarellbild von 1826. Die sogenannte „Landhauskapelle“<br />
steht heute etwa dreißig Meter vom Areal entfernt an der Straße Richtung Bruck als Gedenkkapelle für die 1809<br />
„für Gott, Kaiser und Vaterland“ gefallenen Reither, Alpbacher und Brucker Schützen (vgl. ebd., 67ff).<br />
259 Vgl. ebd., 136 und die dort abgedruckte Fotographie.<br />
260 Vgl. ebd., 50f.<br />
261 Vgl. J. Pohl 1959, 256; Reiter 1991, 55f.<br />
150
zwischen Juli 1933 und dem Frühjahr 1934 an beiden Zillerufern Schutzdämme an, was der<br />
Bevölkerung von St. Gertraudi naturgemäß nicht ungelegen kam. 262<br />
Lange Zeit war das Gebiet auch für den Bergbau von einiger Bedeutung. In der NS-Zeit ging<br />
das Abbaugebiet am Reither Kogel, dem „Hausberg“ der Gemeinde, gemeinsam mit der<br />
Brixlegger Kupferhütte in deutschen Besitz über, 1944 wurden Teile eines kriegswichtigen<br />
Chemiewerks zur unterirdischen Sicherung in die Stollen des Reviers verlegt. 263 Nach Kriegs-<br />
ende wurde am Kogel noch bis in die 1960er Schwerspat abgebaut. Ende der 1980er lief der<br />
Abbau vorübergehend wieder im Probebetrieb, wurde letztlich jedoch mangels Rentabilität<br />
nicht mehr aufgenommen. 264 Die teils bewaldeten Felsen des Reither Kogels ragen unmittel-<br />
bar hinter dem Unterkunftsgebäude senkrecht auf, das Areal ist daher durch Steinschlag ge-<br />
fährdet. 265 Das zweistöckige Gebäude, das in beiden Etagen durchgängig über Balkone ver-<br />
fügt, ist – da vor dem Bezug 2001 saniert – in gutem baulichen Zustand. Ihm vorgelagert liegt<br />
ein größerer asphaltierter Parkplatz, der durch ein mit Sträuchern bewachsenes Rondell samt<br />
Straßenlampe ein etwas ansprechenderes Äußeres erhält. Da in der Regel nur sehr wenige<br />
Fahrzeuge abgestellt sind, wird der Platz auch bespielt. An der östlichen Seite des Hauses<br />
befindet sich der ehemalige Gastgarten, der als solcher durch die noch vorhandenen Lampen<br />
samt Bierreklame erkennbar ist. Der Gastgarten ist im Unterschied zum Vorplatz überwie-<br />
gend geschottert, in seiner Mitte befinden sich vier große alte Laubbäume, zwischen denen<br />
ein Kiesbett mit einem kleinen und äußerst schlichten Spielplatz liegt. Das gesamte Areal ist<br />
von der jenseits des Vorplatzes verlaufenden Bundesstraße durch keinen Zaun oder derglei-<br />
chen abgetrennt, der teils mit Sträuchern bewachsene Rasenstreifen zwischen Areal und<br />
Straße steigt im unmittelbaren Kreuzungsbereich der Straße zu dieser hin jedoch an. Am Süd-<br />
ende des Geländes befinden sich zwei kleinere flache Garagengebäude, beide sind offenkun-<br />
dig Reste der erwähnten Frächterei. Die Außenanlagen der Unterkunft machen insgesamt ei-<br />
nen sauberen Eindruck.<br />
In östlicher Richtung schließt an das Unterkunftsareal das Werksgelände einer Naturstein-<br />
und Transportfirma an, bei der es sich um den einzigen „Nachbarn“ der Unterkunft handelt.<br />
Zwischen Werksgelände und Bundesstraße führt am Straßenrand ein Trampelpfad zur von<br />
262 Vgl. Reiter 1991, 139f. Das Lager diente den Nationalsozialisten als Schulungs- und Ausbildungszentrum, die<br />
Reiter (ebd.) zufolge dort durchgeführten Lichtbilderabende und Sprachkurse in Englisch, Französisch und Italienisch<br />
sollten wohl späteren Soldaten von Nutzen sein.<br />
263 Schreiber 1994, 87 bzw. 120f.<br />
264 Vgl. Reiter 1991, 94f; zum Bergbau im Gebiet siehe ausführlich ebd., 76-101 sowie C. Hohlrieder 2003, 184-<br />
191. Während C. Hohlrieder die Einstellung des Abbaus mit Ende der 1960er datiert, spricht Reiter gar davon,<br />
der Bergbau sei erst in den späten 1970ern eingestellt worden.<br />
265 Zum Zeitpunkt des Lokalaugenscheins (07.11.2003) waren auf dem Areal noch einige Felsbrocken zu sehen,<br />
die einige Zeit zuvor bei einem Steinschlag knapp neben dem Haus niedergegangen waren. Nach Auskunft der<br />
Unterkunftsleitung wurde dem Personal und den Flüchtlingen empfohlen, sich nicht im schmalen Bereich zwischen<br />
Gebäude und Felswand aufzuhalten, hier befindet sich allerdings der Lieferanteneingang, auf dessen Nutzung<br />
der Unterkunftsleitung zufolge nicht verzichtet werden kann (Interview Unterkunftsleitung 06/2,<br />
07.11.2003).<br />
151
hier aus nur zehn Meter entfernten Bushaltestelle Richtung Reith und Brixlegg 266 und weiter<br />
nach St. Gertraudi. Die ersten bewohnten Häuser des Ortsteils erreicht man nach gut 500<br />
Metern, Baumbestand, das Werksgelände und eine Wegkrümmung sorgen jedoch dafür, dass<br />
kein Sichtkontakt besteht. Ähnlich ist die Situation Richtung Bruck: Die Häuser von Gut<br />
Klausegg, mehrheitlich bereits zu Bruck gehörend, befinden sich in etwa 500 Meter Entfer-<br />
nung „ums Eck“, auch hier ist kein Sichtkontakt gegeben. Die ersten Häuser der westlich jen-<br />
seits des Ziller gelegenen Nachbarortes Strass sind von der Unterkunft etwa einen Kilometer<br />
entfernt, durch die Laubbäume der Zillerauen ist die Sicht nur im Winter gegeben.<br />
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Unterkunft, auf den Flächen zwischen Bundesstraße,<br />
Ziller und Inn, entsteht das Reither Gewerbegebiet, mit dem sich die Gemeinde ein „zusätz-<br />
liches Standbein an Gemeindeeinnahmen“ zu schaffen sucht, wie Christian Hohlrieder, Sohn<br />
des bis 2004 amtierenden Bürgermeisters, in seiner universitären Diplomarbeit erläutert. 267<br />
Das Gebiet ist nach Ansicht Hohlrieders dafür prädestiniert, schließlich sei es durch die Aus-<br />
weisung des Geländes „abseits der bestehenden Siedlungen gelungen, einen Nutzungskonflikt<br />
zwischen Wohnen und Industrie bzw. Gewerbe zu vermeiden“. 268 Ein einstöckiger Firmen-<br />
komplex stand Ende 2003 kurz vor der Fertigstellung. Die Ausführung des Gebäudes als mit<br />
einer Reihe von Laderampen versehener Flachbau beträchtlicher Größe lässt darauf schließen,<br />
dass das Gebiet in absehbarer Zeit einen klassischen Gewerbepark beherbergen wird.<br />
Für die Freizeitgestaltung stehen am Standort selbst im wesentlichen der große asphaltierte<br />
Vorplatz, der erwähnte schlichte Spielplatz – er umfasst lediglich zwei an Baumästen befes-<br />
tigte Schaukeln und eine im Kiesbett verankerte Ein-Personen-Wippe – sowie ein am Rand<br />
angebrachter Basketballkorb zur Verfügung. Ein im Zentrum von St. Gertraudi befindlicher<br />
Spielplatz wird von den Flüchtlingen nicht aufgesucht. 269 Entlang dem nahegelegenen Ziller<br />
führt ein Spazier- und Radwanderweg Richtung Schlitters ins Zillertal 270 , in Schlitters werden<br />
von den Asylsuchenden auch der dortige Fußballplatz und der Badesee genutzt. 271<br />
266 An der Haltestelle holt ein Schulbus auch die Kinder ab, die in die Reither Schule zu gehen haben. Eine<br />
Haltestelle der über Hall in Tirol direkt nach Innsbruck führenden Buslinie befindet sich auf der anderen<br />
Straßenseite.<br />
267 C. Hohlrieder 2003, 169.<br />
268 Ebd., 216.<br />
269 Die Proteste im Zuge der Standortrealisierung und das nach wie vor angespannte Verhältnis zur Gemeinde<br />
Reith – auf beides wird noch näher einzugehen sein – dürften dafür ein wesentlicher Grund sein. Seitens der<br />
Unterkunftsleitung wurde vielsagend angemerkt: „Ich müsste fast fragen: Welcher Spielplatz? Sämtliche Aktivitäten<br />
sind nach Strass ausgerichtet, Fußball, Spazieren, Joggen.“ (Interview Unterkunftsleitung 06/1,<br />
07.11.2003, Z 75f)<br />
270 Der Unterkunftsleitung zufolge nutzt die Betreuerin den Weg mit einer Gruppe weiblicher Flüchtlinge zum<br />
Laufen (ebd., Z 31ff).<br />
271 Die Benützung des Badesees in Schlitters ist für die Flüchtlinge kostenlos (vgl. ebd.). Der unweit des Reither<br />
Ortskerns gelegene Reither See wird dagegen nicht aufgesucht.<br />
152
In der Unterkunft selbst gibt es einen Schulungsraum, der nach Auskunft der Unterkunfts-<br />
leitung für Hausaufgabenbetreuung und Deutschkurse genutzt wird. 272 Aufgrund der direkten<br />
Busverbindung in die rund fünfzig Kilometer entfernte Landeshauptstadt 273 – die Fahrtzeit<br />
beträgt knapp eine Stunde und zwanzig Minuten – und der Nähe der größeren und teils indus-<br />
triell geprägten Orte Brixlegg und Jenbach kann das Fehlen regulärer Einrichtungen im Er-<br />
wachsenenbildungsbereich, aber auch von Gebetsstätten jenseits der römisch-katholischen<br />
Kirche, Betrieben der Ergänzungsökonomie und anderen als Treffpunkte von Exilgemein-<br />
schaften und MigrantInnen in Frage kommenden Einrichtungen einigermaßen kompensiert<br />
werden. Auch die in Reith wenig ausgeprägten Versorgungsstrukturen bei Gütern des tägli-<br />
chen Bedarfs und im Gesundheitsbereich können durch die Nutzung der Infrastruktur insbe-<br />
sondere von Strass, Brixlegg und Jenbach ausgeglichen werden.<br />
6.7.3 Die Standortwahl: »Du hast keinen Nachbarn, der sich aufregen kann«<br />
Als der Gasthof Landhaus in Reith 2001 zum Verkauf angeboten wurde, war das Land Tirol<br />
gerade auf der Suche nach einem Objekt für ein (neben der Fieberbrunner Unterkunft) zweites<br />
von der Flüchtlingskoordination selbst zu administrierendes „Heim“. Im Interview erläutert<br />
der Flüchtlingskoordinator des Landes knapp: „Zu wenig Unterkünfte, da hat man geschaut,<br />
wo kann man etwas ankaufen, und dann sind Angebote hereingekommen ... [...] Dann ist es<br />
einfach zum Ankauf von Reith [sic!] gekommen.“ 274 Der damalige Bürgermeister Hohlrieder<br />
272 Beides wird der Unterkunftsleitung zufolge v.a. ehrenamtlich von zwei Angehörigen einer evangelikalen<br />
Freikirche geleitet (vgl. ebd., Z 163f). Einer der beiden Männer war während des Lokalaugenscheins in der Unterkunft<br />
anwesend. Das Land Tirol scheint es nicht weiter zu stören, dass die in den „Bund Evangelikaler Gemeinden<br />
in Österreich“ (BEG) und in die international teams der gleichfalls evangelikalen „European Christian<br />
Mission“ integrierten Männer derartige Angebote in Tirol offenbar gezielt zu Missionstätigkeiten unter den<br />
Flüchtlingen nutzen – Dorninger (2003a) berichtet jedenfalls begeistert, in den zwei „Flüchtlingsheimen“ des<br />
Landes werde „sozusagen Weltmission vor der Haustüre“ betrieben und gibt einen Bericht des Missionars<br />
Werner Schobesberger – bei ihm handelt es sich allem Anschein nach um einen der beiden Männer – wieder, der<br />
als Arbeitsmethoden u.a. die „Organisation von Computer [sic!] für Flüchtlingsheime zur praktischen Lernhilfe<br />
(über Computer lernen Kinder und Erwachsene spielerisch: Deutsch, Mathematik, Englisch etc., zum anderen<br />
sind auch ein Bibel-Malprogramm und andere hochwertige Spiele zur Förderung der Kinder gespeichert)“ angibt,<br />
außerdem würde man „Jesus-Filme“ zeigen und Bibeln verteilen. Schobesberger begründet seine Tätigkeit<br />
damit, Gott habe ihn „durch Jesaja 58,7 in diesen Dienst gerufen“, hinter seinem Missionsteam stünden „Gemeinden<br />
und Einzelpersonen, die uns diese Arbeit durch ihre finanzielle Unterstützung möglich machen“. Ziel<br />
sei es, „dem Flüchtling mit der Liebe Jesu zu begegnen, sei es materiell [sic!] oder geistlich gesehen“, man wolle<br />
„ganz besonders gläubige Flüchtlinge auf ihrem Glaubensweg ermutigen und sie in den Gemeinden integrieren,<br />
was bis jetzt wunderbar funktioniert hat“ (zit. in: Dorninger 2003a). Entsprechend berichtet Dorninger (2003c)<br />
im Herbst 2003 zufrieden: „Ein gläubig gewordener Iraner, [sic!] besucht neben seiner Arbeit auch eine Bibelschule.“<br />
Zu Weihnachten 2002 sei man in der Reither Unterkunft „offiziell“ eingeladen gewesen, „für 80 Personen<br />
wurden Geschenke vorbereitet“, gemeinsam mit den Flüchtlingen Lieder gesungen – „die Lieder wurden<br />
übersetzt und so hörten viele das Evangelium, auch die Frau Landeshauptmann-Stellvertreter [sic!] und Mitarbeiter<br />
der Tiroler Landesregierung“ (Dorninger 2003b). Zufrieden resümiert Dorninger (2003c) daher in seinen<br />
Missionsberichten Ende 2003: „Kompetente Unterstützung seitens der Tiroler Landesregierung.“ Im Jahr 2004<br />
wurde diese Unterstützung noch konkreter: „Vielleicht entsteht ein neues einmaliges Missionsprojekt? Ein Zentrum<br />
für Flüchtlinge in Innsbruck, das von einer Christengemeinde unter Mithilfe von Familie Schobesberger<br />
verantwortet werden soll. Die Tiroler Landesregierung würde dieses Projekt sehr begrüßen und als Hauptmieter<br />
auch Mietzins bezahlen. [...] Wir wollen im Glauben darum beten und auf Gottes Weisung hören.“ (Dorninger<br />
2004)<br />
273 Die Fahrt in die Bezirkshauptstadt Kufstein ist komplizierter, aber kürzer: Hier muss ins benachbarte Brixlegg<br />
gefahren und dort in die Eisenbahn umgestiegen werden; für die Fahrt sind etwa 50 Minuten zu veranschlagen.<br />
274 Interview Logar 10.10.2003, Z 515-518.<br />
153
wurde erst kurz vor Vertragsabschluss verständigt. 275 Dem Land Tirol schien der ehemalige<br />
Gasthof gerade aufgrund seiner Lage ein geeigneter Standort. Für den Flüchtlingskoordinator<br />
sprachen „die ganzen Argumente bei St. Gertraudi“ für den Ankauf – „so, wie das liegt: Du<br />
hast keinen Nachbarn, der sich aufregen kann ...“ 276 Die Nachfolgerin des damals ressortzu-<br />
ständigen Landesrats Prock, Christa Gangl, ergänzt im Interview: „Das war immer ein re-<br />
nommiertes Gasthaus damals, kann ich mich gut erinnern, wo man oft auch die Wochenend-<br />
ausflüge dort dann ... Jetzt direkt am Eingang vom Zillertal in einer Tourismusregion – also<br />
da ist das [...] auch nicht so schlimm.“ 277<br />
6.7.4 Die Standortrealisierung: Ländlicher Watschentanz<br />
Konfliktfrei konnten Ankauf und Adaptierung des neuen Standortes indessen keineswegs ab-<br />
gewickelt werden. In der Gemeinde und insbesondere im betroffenen Ortsteil St. Gertraudi<br />
regte sich rasch Widerstand, dem der Unterkunftsgeber durch die Abhaltung von zwei Bürger-<br />
Innenversammlungen entgegenzutreten versuchte. Das Vorhaben führte jedoch zu keiner Be-<br />
ruhigung der Situation, sondern im Gegenteil zur Eskalation – der anwesende Flüchtlings-<br />
koordinator schildert im Rückblick:<br />
„[...] in St. Gertraudi ... zuerst einmal haben sie mir das Auto beschädigt, vor der Tür draußen ... Da werden<br />
Emotionen wach, das ist unwahrscheinlich [...]. Das Theater ist ja: Wenn du so eine Einladung machst, dann<br />
kommt jetzt die Gruppe hin, die ... es kommen Leut’, die dagegen sind, es kommen ja nicht die Befürworter hin.<br />
Und es werden dort Urängste ... also, es kommen Sachen aufs Tapet ... Da haben siebzigjährige Frauen sind auf<br />
einmal aufgesprungen, sie werden jetzt vergewaltigt, nicht? Ich hab noch nie einen Vergewaltigungsfall [gehabt],<br />
zum Glück, nicht? [...] das hat’s noch nie gegeben. Sie können jetzt nehmen ... beim St. Gertraudi-Heim,<br />
da geht ein Radweg, und: »Da kann jetzt niemand mehr Rad fahren!« – Der ist fünfzig Meter entfernt, der Ziller<br />
entlang. Hab ich gesagt: Ja, warum nicht? »Ja, weil da gehen jetzt ja überall Asylwerber spazieren.« [...] Da hat’s<br />
dort zum Beispiel ein junges Mädchen gegeben – das Nachbarhaus, das Nachbarhaus in St. Gertraudi. Nur: Dieses<br />
Nachbarhaus ist, wenn man Richtung Bruck hineinfährt, dreihundert Meter auf der linken Seite. Da kommt<br />
nie einer hin, weil die Leute gehen alle nach Strass, die paar hundert Meter. Und die hat gezittert am ganzen<br />
Körper und ist dortgestanden, also ... »jetzt werden die Leut’ immer vor der Tür stehen« und so ... Und dann hat<br />
mir eben der Hauptschuldirektor nachher gesagt, die hat bei [...] bei so einer Gruppe von amnesty früher mitgearbeitet.<br />
[...] Die ist wirklich so schlotternd mit Urängsten dagestanden, und das waren ganz wilde Stimmungen,<br />
und ...“ 278<br />
Wesentlich zur Eskalation dürfte wohl beigetragen haben, dass der Soziallandesrat und<br />
Landeshauptmannstellvertreter Prock – wie in Reith erzählt wird – offenkundig während einer<br />
der Versammlungen auf direkten Konfrontationskurs zu den anwesenden Gemeindevertreter-<br />
Innen (unter anderem Bürgermeister Hohlrieder) und BürgerInnen ging, als er ankündigte, das<br />
Land werde das ehemalige Gasthaus eben mit einer Gasthauskonzession führen, sollte die<br />
Gemeinde einer vorherigen Umwidmung nicht zustimmen. Flüchtlingskoordinator Logar,<br />
neben Prock Vertreter des Landes auf den Versammlungen, resümiert lakonisch: „Sie müssen<br />
sich vorstellen: Wir sind da nebeneinander gesessen und haben uns da fast unsere Watschen<br />
275 Hohlrieder verweigerte die Autorisierung des Interviewtranskriptes am 11.03.2004. In die Einzelfalldarstellung<br />
konnten daher lediglich allgemeine Wahrnehmungen zum Interview, wie sie im Postskript vom Interviewer<br />
festgehalten wurden (vgl. Interview G. Hohlrieder 07.11.2003), eingearbeitet werden.<br />
276 Interview Logar 10.10.2003, Z 421ff.<br />
277 Interview Gangl 09.02.2004, Z 77ff.<br />
278 Interview Logar 10.10.2003, Z 293-312.<br />
154
abgeholt.“ 279 Die Umwidmung wurde letztlich doch erreicht, den Ausschlag dafür gab wohl<br />
politischer Druck auf die unwillige Gemeinde. 280 Nach einer Investition von insgesamt 1,09<br />
Millionen Euro in Ankauf und Adaptierung des „Landhauses“ wurde dieses am 18. Oktober<br />
2001 von Prock und Logar eröffnet. Trotz der Konflikte im Vorfeld hielt Prock dabei stolz<br />
fest: „Das hier ist ein weiterer Mosaikstein in der sozialen Kulisse Tirols.“ 281 Der Flüchtlings-<br />
koordinator ortete nach der anfänglich aggressiven Gegnerschaft in der Bevölkerung „eine<br />
neutrale Stimmung“ und kündigte an: „Es wird an uns liegen, dieses Haus als offenes Haus zu<br />
führen.“ 282 Skeptisch blieb indessen der gleichfalls anwesende Bürgermeister Hohlrieder: „Ich<br />
bin schon zufrieden, wenn’s ein gutgehendes Nebeneinander gibt. Ob die Zeit reif für ein<br />
Miteinander ist, weiß ich nicht.“ 283<br />
6.7.5 Feueralarm als Zankapfel: Der Standort in der Diskussion<br />
„Wenn dem Gast aber das Gefühl vermittelt wird, nicht wirklich willkommen zu sein, nützt<br />
die schönste Landschaft wenig.“ 284 Bürgermeister Hohlrieders Sohn hält diesen klugen Satz in<br />
seiner Diplomarbeit, einer Art Reither Heimatbuch, fest – an die ungeliebten Gäste im „Land-<br />
haus“ dürfte er dabei wohl weniger gedacht haben. Die Ausführungen der dortigen Unter-<br />
kunftsleitung lassen darauf schließen, dass die Gemeindeführung nach der Eröffnung des<br />
Hauses bestrebt war, das vom Bürgermeister so bezeichnete „Nebeneinander“ keinesfalls zu<br />
einem „Miteinander“ werden zu lassen:<br />
„Leider existierten starke Widerstände zu Beginn unserer Arbeit. Im ersten Jahr, wie wir hier begonnen haben,<br />
sind unsere Kinder in Strass in die Schule gegangen ... [...] Wir haben uns ein paar Mal deswegen vorstellig<br />
gemacht auf der Gemeinde, Bürgermeister Hohlrieder hat gemeint, er würde sich darum kümmern, es tat sich<br />
leider nichts.“ 285<br />
Mitten im folgenden Schuljahr wurde der Unterkunftsleitung dann mitgeteilt, die Kinder hät-<br />
ten nun doch die Reither Schule zu besuchen. Ihre Aufnahme durch die dortigen LehrerInnen,<br />
hält die Unterkunftsleitung fest, hätte sich dann jedoch – völlig konträr zur Haltung der<br />
Gemeindeführung – sehr positiv gestaltet, die Kinder seien nun „ganz gut aufgehoben“. 286 Die<br />
Kontakte zur Gemeinde würden sich allerdings nach wie vor auf wenige Berührungen be-<br />
schränken, das Leben in der Unterkunft sei eher auf die Nachbargemeinde Strass ausgerichtet:<br />
„Die Leute spazieren dort hin, sie gehen ins Geschäft, in die Post, zum Telefonieren.“ 287 Auch<br />
Arztbesuche würden lieber in Strass erledigt – „der Arzt kümmert sich“, so die Führung des<br />
Hauses. 288 Im Unterschied zu Reith seien die Reaktionen aus Strass von Anfang an positiver<br />
279<br />
Ebd., Z 410f.<br />
280<br />
Dies berichten sowohl Reither BürgerInnen als auch BeraterInnen unabhängiger Organisationen (vgl. etwa<br />
Interview Beratung/Betreuung 04, 15.09.2003).<br />
281<br />
Prock, zit. nach Tiroler Tageszeitung 19.10.2001.<br />
282<br />
Logar, zit. nach ebd.<br />
283<br />
G. Hohlrieder, zit. nach ebd.<br />
284<br />
C. Hohlrieder 2003, 171.<br />
285<br />
Interview Unterkunftsleitung 06/1, 07.11.2003, Z 10-15.<br />
286 Ebd., Z 21-27.<br />
287 Ebd., Z 42f.<br />
288 Ebd., Z 56f; Hervorhebung im Original.<br />
155
gewesen, so hätten etwa gleich am Beginn „sehr rührige Frauen“ aus Strass Kontakt mit der<br />
Unterkunft aufgenommen und sich „mit Kuchenbacken, Keksen und Hilfsbereitschaft immer<br />
wieder und in jeder Art und Weise verdient gemacht“. 289 Im Winter kann von den Flücht-<br />
lingen nun sogar die Sporthalle der Strasser Schule zum Fußballspielen genutzt werden – „in<br />
Reith haben wir nie gefragt, weil der Bürgermeister von Anfang an abgeblockt hat“. 290 Gute<br />
Kontakte gäbe es auch in die östliche Nachbargemeinde Brixlegg:<br />
„Wir haben das Glück, dass in der Nähe der ... der Recyclinghof ist, mit dem arbeiten wir auch stark zusammen,<br />
unsere Flüchtlinge dürfen sich dort alte ... Fernseher, Radiogeräte, Kaffeemaschinen, Fahrräder, mittlerweile<br />
sind’s auch Garnituren, mit denen sie die Räumlichkeiten etwas verschönern, besorgen.“ 291<br />
Versuche der Unterkunftsleitung, die Beziehungen zur Gemeinde Reith zu verbessern, blieben<br />
auf der Ebene der Gemeindeführung wenig erfolgreich, gelangen aber zumindest bei Teilen<br />
der Bevölkerung:<br />
„Wir laden sehr viele Leute ein – den Bürgermeister, die Gemeindeangestellten [...], wir haben den Pfarrer eingeladen<br />
– die allerwenigsten kommen der Einladung nach. Umgekehrt schätzen jedoch jene Personen, wie Lehrer,<br />
Frauengruppe, Initiatoren von Kultur am Land und viele mehr unsere Einladung zu multikulturellen Treffen.<br />
Wir freuen uns, wenn sie mit uns, mit den Heimbewohnern ... feiern und wir versuchen auch dabei, Berührungsängste<br />
abzubauen. Also ... wir setzen immer wieder solche Aktionen ... Sommerfest, Weihnachten.“ 292<br />
Zu einem die Diskussionen in der Gemeindeführung rund um den Reither Standort dominie-<br />
renden Thema wurde schließlich das Brandmeldesystem der Unterkunft: Durch häufigen<br />
Feueralarm, der sich wiederholt als Fehlalarm herausstellte, sah die Gemeinde die Einsatzbe-<br />
reitschaft der Feuerwehr gefährdet. 293 Die Unterkunftsleitung bestätigt: Die Feuerwehr er-<br />
hielte tatsächlich häufig falsche Alarmmeldungen, die Gemeinde fühle sich dadurch stark<br />
belästigt:<br />
„Ein müßiges Thema. Wäre es noch ein Hotel, gäbe es die gleichen Auflagen: Brandmelder, Rauchmelder und<br />
so weiter und so fort. Grad heut’ haben wir uns drüber unterhalten, die Brandmelder sind hochsensibel eingestellt.<br />
Sie reagieren nicht unbedingt, wie wir ursprünglich gedacht [haben], wenn fünf, sechs Leute in einem<br />
kleinen Raum und rauchen und das Fenster nicht aufmachen, der Alarm schaltet sich ein, wenn Sie eine Tür fest<br />
zuschlagen [...] ... Oder, Alltäglichkeiten. Eine Frau steht mit dem Haarfön unter dem Rauchmelder, nimmt einen<br />
Haarspray und der Alarm fängt automatisch an zu ... [...] Wie gesagt, wäre es ein Hotelbetrieb, würden die Reaktionen<br />
sicher anders ausfallen. In diesem Fall wird es als mutwillige Ruhestörung angesehen ... [...] Also entweder<br />
man will nur das Negative sehen, dann wird man auch was Negatives finden.“ 294<br />
Die Unterkunftsleitung bewertet die Situation mittlerweile gelassen und setzt auf den Faktor<br />
Zeit:<br />
„Die Infrastruktur, d.h. der Handel profitiert von unseren Einkäufen, die Schule ist um eine Integrationslehrerin<br />
reicher. Der Bürgermeister ... [...] Wenn man sich mit den anderen Leuten unterhält, und durch das ... eben mit<br />
den Schulkindern haben wir jetzt einfach ein bisschen einen Kontakt zu den Lehrern und die haben gesagt:<br />
Lassen wir ihn reden ...“ 295<br />
289 Ebd., Z 65-68.<br />
290 Ebd., Z 318f.<br />
291 Ebd., Z 123-126.<br />
292 Ebd., Z 263-269.<br />
293 Vgl. Interview G. Hohlrieder 07.11.2003.<br />
294 Interview Unterkunftsleitung 06/1, 07.11.2003, Z 86-99; Hervorhebung im Original.<br />
295 Ebd., Z 140ff.<br />
156
Auch der Flüchtlingskoordinator des Landes wertet die Lage in Reith als inzwischen entspannt,<br />
es sei „eigentlich alles verpufft dort“. 296<br />
6.7.6 Bewertung<br />
Das „Flüchtlingsheim Landhaus“ befindet sich abseits der lokalen Wohngebiete im Zwickel<br />
zweier Straßen. Die nächsten Wohnhäuser sind zumindest einen halben Kilometer entfernt, es<br />
besteht kein Sichtkontakt. Die Lage unmittelbar an der Gemeindegrenze verstärkt den Ein-<br />
druck, dass das Haus „nicht dazugehört“ – ein Eindruck, der in der ablehnenden Haltung der<br />
Gemeindevertretung zur Unterkunft seine Entsprechung findet. Gegenüber dem Unterkunfts-<br />
areal entsteht gegenwärtig das Reither Gewerbegebiet, dessen Errichtung mit der hier mögli-<br />
chen Vermeidung eines Nutzungskonflikts zwischen Wohnen einerseits und Industrie bzw.<br />
Gewerbe andererseits argumentiert wird 297 – eben dieser Nutzungskonflikt steht damit der<br />
Unterkunft bevor. Das Unterkunftsgebäude ist als Zweckbau ausgeführt, aufgrund der vor<br />
dem Bezug vorgenommenen Sanierung macht es einen recht sauberen Eindruck. Die hinter<br />
der Unterkunft aufragenden Felsen des Reither Kogels stellen für das Areal offenbar eine la-<br />
tente Gefahr dar, die während des Lokalaugenscheins noch sichtbaren Reste eines Stein-<br />
schlags, der teils auf den allgemein zugänglichen schmalen Raum zwischen Gebäude und<br />
Berg niederging, sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Die Anweisungen an Perso-<br />
nal und BewohnerInnen der Unterkunft, sich eben nicht in diesem Bereich aufzuhalten, wur-<br />
den von der Unterkunftsleitung als nicht durchführbar bewertet, da sich der unerlässliche Lie-<br />
feranteneingang dort befindet. Ohne Sicherungsmaßnahmen ist überdies der Zugang in den<br />
besonders gefährdeten Zwischenraum jederzeit möglich, es kann damit kaum verhindert wer-<br />
den, dass er von Kindern als Spielfläche genutzt wird. Allgemein sind die Außenanlagen der<br />
Unterkunft sehr schlicht gestaltet.<br />
Abgesehen von Kindergarten und Schule werden die infrastrukturellen Einrichtungen der<br />
Gemeinde Reith kaum genutzt, insbesondere im Bereich der Freizeitgestaltung scheint sich<br />
aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen Gemeindeführung und Unterkunftsleitung<br />
bzw. -bewohnerInnen bei letzteren eine Art Vermeidungsverhalten entwickelt zu haben. Da<br />
jedoch alternative Einrichtungen in den Nachbargemeinden, vor allem in Brixlegg, Strass und<br />
Schlitters zur Verfügung stehen und auch genutzt werden können, bleibt dies letztlich ohne<br />
gravierende negative Konsequenzen. Freilich ist davon auszugehen, dass die Nutzungsmög-<br />
lichkeit dieser Einrichtungen ohne das Engagement der Unterkunftsleitung nicht gegeben<br />
wäre. Stünden weniger engagierte oder – wie im Fall der Unterbringung in Gasthöfen – keine<br />
BetreuerInnen zur Verfügung, wären die Flüchtlinge weitgehend isoliert. Vor dem Hinter-<br />
grund des Fehlens von Erwachsenenbildungseinrichtungen, der Ergänzungsökonomie zuor-<br />
denbaren Geschäften oder Cafés und anderen migrantischen Treffpunkten ist die in geringer<br />
296 Interview Logar 10.10.2003, Z 423.<br />
297 Vgl. C. Hohlrieder 2003, 216.<br />
157
Entfernung zur Unterkunft befindliche Haltestelle einer Buslinie, die direkt die Landeshaupt-<br />
stadt Innsbruck anfährt, positiv hervorzuheben.<br />
Die Standortwahl erfolgte im Fall der Reither Unterkunft letztlich aufgrund ihrer Lage außer-<br />
halb der Wohngebiete, die Verantwortlichen des Landes Tirol erwarteten sich dadurch offen-<br />
bar ein weitgehendes Ausblieben von Protesten gegen die Errichtung des Quartiers. Diese<br />
Erwartung sollte nicht erfüllt werden, die Standortrealisierung wurde gegen den lautstarken<br />
Widerstand einiger Gemeindepolitiker und der BewohnerInnen des Ortsteils St. Gertraudi<br />
regelrecht „durchgezogen“. Die im Zuge der Auseinandersetzungen veranstalteten und ohne<br />
Zuziehung professioneller MediatorInnen durchgeführten BürgerInnenversammlungen<br />
brachten keinerlei Entspannung der Situation, kolportierte Äußerungen des ressortzuständigen<br />
Landeshauptmannstellvertreters Prock – so sie denn tatsächlich getätigt wurden – trugen im<br />
Gegenteil zu einer weiteren Eskalation und nachhaltiger Verstimmung bei. Entsprechend war<br />
die Gemeinde offenbar nur unter politischen Druck bereit, der nötigen Umwidmung der<br />
Grundstücksfläche zuzustimmen. Da das Land Tirol das Unterkunftsareal angekauft hatte,<br />
konnten sich die Auseinandersetzungen zwischen Gemeinde und Betreiber bzw. Unterkunfts-<br />
personal in der Folge nicht mehr an grundsätzlichen Fragen entzünden. Die anfängliche Ein-<br />
schulung der Flüchtlingskinder im Nachbarort Strass legt jedoch den Schluss nahe, dass die<br />
Gemeinde zumindest im ersten Jahr den ihr verbleibenden Handlungsspielraum nutzte, um<br />
dem Haus die Existenz zu erschweren.<br />
6.8 Vils: Vom Leben im Milieu<br />
Bereits in den 1990ern beherbergte Vils Kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina. Im Jahr<br />
2002 wurde erstmals eine Unterkunft für Asylsuchende eingerichtet, Ende Juni 2004 waren<br />
dort sechzig Personen untergebracht. 298<br />
6.8.1 Die Gemeinde: Asylrecht als Auszeichnung<br />
Mit 1.648 EinwohnerInnen ist das auf 826 Meter Seehöhe gelegene Vils nur die viertgrößte<br />
Gemeinde des Bezirks Reutte – aber die einzige Stadt. Wie der gesamte, umgangssprachlich<br />
„Außerfern“ genannte Bezirk liegt das im äußersten Nordwesten Tirols befindliche Städtchen<br />
verkehrsgeographisch äußerst ungünstig: Auf der einzigen direkten Straßenverbindung in die<br />
Landeshauptstadt sind der im Winter aufgrund der Schneelage häufig gesperrte 1.209 Meter<br />
hohe Fernpass und der 1.126 Meter hohe Holzleitensattel zu bewältigen, ehe es hinab ins<br />
Inntal geht und nach gut 120 Kilometern Innsbruck erreicht wird. Die zahlreichen Übergänge,<br />
Anstiege und Gefälle der Strecke lassen den Weg schnell beschwerlich erscheinen, die Be-<br />
zeichnungen „Fernpass“ und „Außerfern“ fassen daher die Randlage – Keller spricht gar von<br />
Abgeschiedenheit 299 – des Bezirks auch sprachlich in treffender Weise. Um das Außerfern mit<br />
298 Vgl. Tiroler Tageszeitung 22.06.2004.<br />
299 Keller 1989, 17.<br />
158
der Eisenbahn zu erreichen, muss überhaupt auf deutsches Territorium ausgewichen werden:<br />
Die Bahnverbindung führt über Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen. Vor diesem Hinter-<br />
grund überrascht es kaum, dass die BewohnerInnen des Bezirks die dortige Lebensqualität<br />
eher kritisch beurteilen. Einer 2003 durchgeführten Umfrage zufolge mochten nur vier Pro-<br />
zent der Befragten die Lebensqualität als „sehr gut“ bewerten – dem Bezirk Schwaz, der nach<br />
Reutte das schlechteste Ergebnis erhielt, wurde von immerhin 15,2 Prozent seiner Bewohner-<br />
Innen „sehr gute“ Lebensqualität attestiert. 300<br />
Trotz der ungünstigen Lage wird das Außerfern von einer Nord-Süd-Alpentransversale<br />
durchquert, die von Ulm, Kempten und Füssen aus Deutschland kommend über den Fernpass,<br />
Landeck und den Reschenpass nach Meran in Südtirol und weiter nach Bozen und Trient<br />
führt. Dieser Straßenverbindung kommt im Zuge der Heranführung der von Ulm und Kemp-<br />
ten kommenden Autobahnstrecke an die österreichische Grenze bei Vils 301 und einem wohl<br />
damit in absehbarer Zeit beginnenden Ausbau der Fernpassroute 302 wachsende Bedeutung zu.<br />
Die Stadt Vils befindet sich unmittelbar neben der Strecke: Die nördlich gelegene deutsche<br />
Grenzstadt Füssen ist nur wenige Minuten entfernt.<br />
Neben dem Grenzübergang nach Füssen verfügt Vils in seiner nächsten Umgebung noch über<br />
eine zweite Grenzstation: In nordwestlicher Richtung ist, gleichfalls in wenigen Minuten, das<br />
deutsche Pfronten erreichbar. Die Vilser Stadtgrenze stellt damit an zwei Seiten zugleich die<br />
österreichische Staatsgrenze dar, eine dritte Seite wird durch die Tannheimer Berge gegen<br />
Süden hin abgeschlossen. Lediglich in südöstlicher Richtung ist durch eine Engstelle der Weg<br />
nach Reutte und damit in Richtung Fernpass und Inntal möglich.<br />
Vils verfügt außer im Bildungsbereich 303 über keine ausdifferenzierte Infrastruktur, die Stadt<br />
kann nicht einmal auf die Dienste einer eigenen Apotheke zurückgreifen. 304 Keine nennens-<br />
werte Rolle spielt in der Gemeinde der Tourismus 305 , die Wirtschaft ist eher von Gewerbe-<br />
und Industriebetrieben geprägt, wobei hier das Zementwerk und einige forstwirtschaftliche<br />
und im Holzbau tätige Unternehmen dominieren. Entsprechend der wenig heterogenen Wirt-<br />
schaftsstruktur ist Vils eine PendlerInnengemeinde. Das lokale Vereinsleben ist fest in der<br />
Tradition verankert, wie ein Ausschnitt zeigt: Schützen, Musikkapelle und Trachtenverein<br />
sorgen für die Brauchtumspflege, Jungbauern, Viehzuchtverein und Obst- und Gartenbau-<br />
verein für die landwirtschaftliche Fundierung. Der Katholische Frauenbund bringt den karita-<br />
300<br />
Vgl. Wirtschaft im Alpenraum 2003, 5. Weitere vier Prozent der befragten BewohnerInnen beurteilten im<br />
Bezirk Reutte die Lebensqualität als „nicht genügend“ – hier erhielt Reutte unter den Tiroler Bezirken den<br />
höchsten Wert (vgl. ebd.).<br />
301<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 05.08.2004. Geplant ist ein Abschluss der Arbeiten bis zum Jahr 2008.<br />
302<br />
Der Tiroler Verkehrslandesrat Ferdinand Eberle, selbst Außerferner, schlug bereits im Mai 2004 einen Ausbau<br />
in Form mehrerer kleinerer Tunnel oder Galerien anstelle der teuren „großen Tunnellösung“ vor (Tiroler<br />
Tageszeitung 05.05.2004).<br />
303<br />
In Vils bestehen neben dem Kindergarten und der Volksschule auch eine Hauptschule mit angeschlossener<br />
Bücherei und eine Erwachsenenschule.<br />
304<br />
In Vils praktiziert ein Allgemeinmediziner, über eine Ortsstelle des Roten Kreuzes verfügt die Stadt nicht.<br />
305<br />
2003 verbuchte die Stadt insgesamt nur etwas mehr als 11.500 Nächtigungen (vgl. AdTLR 2004).<br />
159
tiven Aspekt ein, Stockschützen- und Reitverein sowie der FC Vils komplettieren das Spekt-<br />
rum. In der Politik kommt Vils bereits seit einiger Zeit mit zwei Parteien aus, was auf eine<br />
relativ stabile Gemeindeidentität schließen lässt: Bei den im Frühjahr 2004 abgehaltenen Ge-<br />
meinderatswahlen erhielt die ÖVP souverän zehn Mandate, die SPÖ, die sich lieber gleich mit<br />
den „Parteiunabhängigen“ auf einer gemeinsamen Liste der Wahl stellte, erreichte gerade<br />
drei. Beide Parteien hatten bereits 1998 nahezu dasselbe Ergebnis erzielt. Im Herbst 2003<br />
amtierte – bereits seit mehreren Jahrzehnten – Otto Erd (ÖVP) als Bürgermeister, im März<br />
des Folgejahres zog er sich aus der Politik zurück, der ihm nachfolgende VP-Kandidat Rein-<br />
hard Walk war bei der Bürgermeister-Direktwahl ungefährdet.<br />
Historisch ist Vils mit einem Vorläufer des Asylrechts verbunden – ab dem 15. Jahrhundert<br />
stand der Stadtgemeinde das sogenannte Freiungs- oder Asylrecht zu. Wegen eines Verbre-<br />
chens verfolgte Personen konnten aufgrund dieses Rechts in Vils Zuflucht und Schutz vor<br />
Verfolgung, Verhaftung und Auslieferung finden:<br />
„Die Dauer dieser Sicherheit war auf Jahr und Tag beschränkt und diente wesentlich dazu, daß sich der Flüchtige<br />
mit dem Verletzten oder den Verwandten des Getöteten auf dem Rechtswege vergleichen konnte. Auch galt die<br />
Freiung nicht für gemeine Verbrecher, sondern nur für solche Personen, die in Überschreitung der Notwehr, zur<br />
Rächung einer Beleidigung oder sonst im Streithandel in Aufwallung des Gemüts jemanden verwundet oder<br />
getötet hatten, für sogenannte »redliche Totschläger«, wie das alte Recht bezeichnenderweise im Gegensatz zu<br />
Mördern aus Vorbedacht und Gewinnsucht sagte. Die Leute, die in eine solche Freiungsstätte flüchteten und sich<br />
dort aufhielten, mußten dafür dem dortigen Inhaber der Gerichtsbarkeit eine Vergütung in Geldeswert leisten.“ 306<br />
Das durch den Kaiser verliehene Asylrecht war für Vils eine besondere Auszeichnung: Die<br />
kleine Stadt war die einzige in Tirol, der es innerhalb ihres gesamten Mauerringes zustand,<br />
üblicherweise bestand dieses Sonderrecht lediglich in einzelnen Burgen, Klöstern oder Pfarr-<br />
höfen. 307 Das Symbol dieser Vilser Eigenart ist noch heute zu sehen: Ein mitten im Stadt-<br />
zentrum 308 aufgestelltes Steinkreuz bildete die Freistatt im eigentlichen Sinn. Das Vilser Asyl-<br />
recht wurde der mündlichen Überlieferung zufolge auch tatsächlich von vielen Personen in<br />
Anspruch genommen, erst unter Kaiser Josef II. wurde es schließlich aufgehoben. 309<br />
6.8.2 Der Standort: Amor im Nadelöhr<br />
Die Vilser Unterkunft befindet sich exakt in der erwähnten Engstelle, durch die der einzige<br />
Weg in den Bezirkshauptort Reutte führt. Etwa drei Kilometer vom Vilser Zentrum entfernt<br />
liegt der Gebäudekomplex zugleich unmittelbar an der südöstlichen Stadtgrenze, die entlang<br />
der Hauswand verläuft – ein der Wand vorgelagerter Anbau ist Kartierungen zufolge bereits<br />
Teil des kleinen Nachbardorfes Musau. Das Umfeld der Unterkunft hat aufgrund seiner Be-<br />
deutung für den alpenquerenden Verkehr den Charakter eines Nadelöhrs: Nicht weniger als<br />
vier teils stark befahrene Verkehrswege und ein Fluss zwängen sich durch die Engstelle. Un-<br />
306 Stolz 1927, 34.<br />
307 Ebd.<br />
308 Dem Steinkreuz gegenüber liegt heute das Hotel Grüner Baum.<br />
309 Stolz 1927, 35.<br />
160
mittelbar an der Vorderseite der Unterkunft vorbei und von dieser nur durch einen Gehsteig<br />
und einen schmalen Rasenstreifen getrennt führt die Landstraße nach Musau. Am der Unter-<br />
kunft gegenüberliegenden Straßenrand trennen ein zweiter Gehsteig und ein Maschendraht-<br />
zaun die Straße von der Außerfernbahn ab, hinter dieser wiederum führt ein erst in der jünge-<br />
ren Vergangenheit neu errichtetes Teilstück der Richtung Reutte bzw. Füssen führenden Bun-<br />
desstraße vorbei – die Straße ist Teil der über den Fernpass führenden Nord-Süd-Transversale<br />
und entsprechend stark befahren. Die Bundesstraße ist hier mit einer Lärmschutzwand verse-<br />
hen, die jedoch kurz nach der Unterkunft endet, der Straßenlärm ist daher beträchtlich. Neben<br />
der Bundesstraße fließt der Lech Richtung Füssen, zwischen ihm und der anderen Seite der<br />
Engstelle findet auch noch eine Nebenstraße Platz, die Vils und die östliche Nachbargemeinde<br />
Pinswang verbindet. In der unmittelbaren Umgebung der Unterkunft befinden sich keine<br />
weiteren Gebäude, Richtung Vils erreicht man nach etwa zwei Kilometern zunächst ein<br />
Firmengelände und den gleichfalls stark gewerblich genutzten Bahnhof, erst danach beginnt<br />
das eigentliche Wohngebiet. Die ersten Häuser des Fleckens Musau liegen etwa fünf Kilo-<br />
meter von der Unterkunft entfernt. In beiden Richtungen ist zu den nächsten Gebäuden kein<br />
Sichtkontakt gegeben.<br />
Der Gebäudekomplex der Unterkunft selbst umfasst das dreistöckige und unmittelbar an der<br />
Landstraße nach Musau liegende Haus des ehemaligen Gasthofs und Hotels Ulrichsbrücke 310 ,<br />
weiters einen an dessen südöstlicher Seite befindlichen ebenerdigen Anbau, in dem sich der<br />
vom Unterkunftsleiter betriebene Nachtklub „Amor“ befindet, sowie ein zweigeschossiges<br />
Haus hinter dem ehemaligen Gasthof. Dieses ist bereits teilweise in den anschließenden be-<br />
waldeten Hang des 1.002 Meter hohen Ranzen gebaut, der den Südrand der Engstelle bildet.<br />
Der Raum zwischen den beiden Häusern hat teils Laubencharakter, ist jedoch relativ schmal.<br />
Vor dem Nachtklub und damit auf der Musauer Seite des Gebäudekomplexes befinden sich<br />
eine kleine Terrasse und ein geschotterter Parkplatz. Der Holzlattenzaun, der den Großteil des<br />
Parkplatzes blickdicht von der Straße trennt und so wohl verhindern soll, dass die vor dem<br />
Nachtklub parkenden Wägen erkennbar sind, macht einen äußerst heruntergekommenen Ein-<br />
druck. Das an seinem südlichen Ende angebrachte Schild mit der Aufschrift „Varieté Amor“<br />
hängt nur noch teilweise in seiner Verankerung und ist zerbrochen. Die Unterbringung der<br />
Asylsuchenden erfolgt in den beiden Häusern, in einer Etage des an der Landstraße gelegenen<br />
ehemaligen Gasthofs haben auch der Unterkunftsleiter und die im Nachtklub beschäftigten<br />
Tänzerinnen ihre Quartiere. Die Gebäude, an denen keine gröberen Beschädigungen erkenn-<br />
bar sind, weisen architektonisch den landestypischen modernen Alpengasthof-Stil auf, der<br />
310 Der Gasthof trägt seinen Namen nach der ursprünglich hier über den Lech führenden Ulrichsbrücke, deren<br />
Benennung wiederum auf einen „Bruder Ulrich“ zurückgeht. Dieser hatte im 14. Jahrhundert in der kleinen<br />
Nachbargemeinde Musau gelebt und – wie Stolz (ebd., 49) zu berichten weiß – „zur Erbauung einer nach ihm<br />
benannten Kirche dortselbst Anlaß gegeben“. Der Gasthof selbst entstand wohl Mitte des 19. Jahrhunderts,<br />
nachdem sich auch in Vils im Zuge der Industrialisierung mehr und mehr Handels- anstelle der bislang dominierenden<br />
Handwerksbetriebe und des Hausgewerbes etabliert hatten. Stolz nennt ihn 1927 neben einigen anderen<br />
jedenfalls als Beispiel für diese Entwicklung (ebd., 54).<br />
161
Anbau des Nachtklubs ist ein schmuckloser Zweckbau. Das frühere Gasthofgebäude – seine<br />
ehemalige Funktion ist noch am branchenüblichen Leuchtschild erkennbar, an dem die Be-<br />
zeichnung „Gasthof“ mit Isolierband notdürftig überklebt wurde – ist straßenseitig sowie auf<br />
der Musau zugewandten Seite in allen drei Etagen mit Balkonen versehen, an der Vorderfront<br />
ist ein senkrechtes Leuchtschild angebracht, das in einschlägiger Farbgestaltung für den<br />
Nachtklub wirbt. Mit Ausnahme der zum Nachtklub gehörenden Terrasse und dem Parkplatz<br />
stehen auf dem Unterkunftsgelände keine nennenswerten Außenanlagen zur Verfügung. 311<br />
Direkt vor der Unterkunft befindet sich die Haltestelle einer Buslinie, die vom deutschen<br />
Pfronten in den Bezirkshauptort Reutte fährt. Richtung Musau in etwa 800 Meter Entfernung<br />
liegt auch eine Haltestelle der Außerfernbahn, mit der gleichfalls nach Reutte gefahren wer-<br />
den kann. Für die hier untergebrachten Flüchtlinge ist Innsbruck somit nicht direkt erreichbar:<br />
Die Bahnverbindung in die Landeshauptstadt führt, wie erwähnt, über deutsches Staatsgebiet<br />
und kann von Asylsuchenden daher nur „im Geheimen“ genutzt werden – mit dem Risiko,<br />
entdeckt, festgenommen und mit einem Aufenthaltsverbot belegt nach Österreich zurückge-<br />
schoben zu werden. Um nach Innsbruck zu gelangen, müssen beträchtliche Mühen in Kauf<br />
genommen werden: Auf der mindestens zweieinhalbstündigen Busfahrt muss zunächst in<br />
Reutte, nach Überquerung des Fernpasses noch einmal in Nassereith umgestiegen werden.<br />
Hin- und Rückfahrt am selben Tag sind aufgrund des in den Tagesrandbereichen mehr als<br />
lückenhaften öffentlichen Verkehrsnetzes kaum zu bewältigen.<br />
Zum Kindergarten- und Schulbesuch, Einkauf oder Arztbesuch im rund drei Kilometer ent-<br />
fernten Vilser Zentrum muss auf den Bus oder auf Fahrräder zurückgegriffen werden, da ab<br />
der Kreuzung von Land- und Bundesstraße etwa 500 Meter nach der Unterkunft und bis zum<br />
Vilser Bahnhof kein Fußweg zur Verfügung steht. Die wenig ausgeprägte Infrastruktur der<br />
Stadt legt jedoch nahe, in vielen Fällen gleich nach Reutte zu fahren: Der Bezirkshauptort<br />
verfügt nicht nur über Apotheke und Krankenhaus, sondern auch über ein breites Spektrum<br />
unterschiedlicher religiöser Gebetsstätten und Treffpunkte, mehrere MigrantInnenvereine<br />
sowie einen der Ergänzungsökonomie zuzuordnenden Lebensmittelladen.<br />
6.8.3 Die Standortwahl: »Es war ein leeres Gebäude ...«<br />
Auch im Fall der Vilser Unterkunft reagierte deren Leiter auf einen über die Tiroler Tages-<br />
zeitung verbreiteten Aufruf des Landes Tirol, Gasthäuser und ähnliche Gebäude zur Unter-<br />
bringung von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen:<br />
311 Terrasse und Parkplatz sind zur Freizeitgestaltung kaum verwendbar, v.a. das Bespielen des Parkplatzes ist<br />
aufgrund der im vorderen Bereich nicht vorhandenen, im hinteren Bereich teils desolaten Abtrennung zur Straße<br />
nicht ungefährlich. Auch der Raum zwischen den beiden Häusern dürfte aufgrund der Enge als Spielfläche kaum<br />
in Frage kommen, ein Tischfußballtisch war hier während des Lokalaugenscheins (31.10.2003) der einzige Hinweis<br />
auf eine diesbezügliche Nutzung.<br />
162
„Das ist reiner Zufall gewesen. Erstens ist durch den Umbau der Straße die Lage vom Gasthaus schlechter<br />
geworden. 312 [...] Und das heißt, es war ein leeres Gebäude – das erstens –, mit Schwierigkeiten, also das halt<br />
auszulasten. [...] Und dann ist in der Zeitung da vom Land, vom Herrn Logar, eben die Frage gewesen, ob man<br />
Flüchtlinge nimmt, und dass er Gasthäuser sucht und Gebäude sucht, wo man Flüchtlinge unterbringen könnte.<br />
[...] Und dann hab ich mich gemeldet und das hat eigentlich ... [...] Die haben ja was gebraucht ...“ 313<br />
6.8.4 Die Standortrealisierung: »Das hat sich eigentlich ganz schnell entwickelt«<br />
Aus Sicht des Unterkunftsleiters ging die Adaptierung des neuen Standorts, der im Juli 2002<br />
von den ersten Asylsuchenden bezogen wurde, relativ rasch: „Das hat sich eigentlich ganz<br />
schnell entwickelt.“ 314 Bürgermeister Erd wurde von der Bezirkshauptmannschaft informiert,<br />
wie er im Interview erzählt:<br />
„Ich hab ein Fax gekriegt von der Bezirkshauptmannschaft Reutte, und bin ... ist mir dann mitgeteilt worden,<br />
dass da [...] der Besitzer [...] sich bereit erklärt hätte, Flüchtlinge aufzunehmen. Und wenn irgendwo ich da was<br />
dagegen hätte, dann hätt’ ich mich müssen halt bei der Bezirkshauptmannschaft dazumal melden oder wehren<br />
dagegen.“ 315<br />
Erd hatte jedoch nichts dagegen einzuwenden:<br />
„Hab ich nicht gemacht, weil wir eigentlich in Vils mit Flüchtlingen nie schlechte Erfahrungen gemacht haben.<br />
Wir haben in den 90er Jahren da hier im Hotel Grüner Baum ein großes Flüchtlingslager gehabt mit circa 96<br />
Flüchtlingen dazumal, aus dem ehemaligen Jugoslawien, und da sind heute ungefähr noch – kann man sagen –<br />
fast 40, 50 Prozent noch da. [...] Die sind irgendwo ... Aber nicht mehr als Flüchtlinge, sondern die sind<br />
irgendwo integriert worden. Die haben da sich um eine Wohnung geschaut – manche haben Arbeit gekriegt –<br />
und leben halt heute da bei uns und sind eigentlich Bürger so wie wir. Eigentlich, es gibt da keine Probleme. Aus<br />
diesem Grund, dass ich als Bürgermeister da immer gute Erfahrungen gemacht hab, war das für mich eigentlich<br />
kein großes Problem in der Ulrichsbrücke.“ 316<br />
Neben den guten Erfahrungen mit den bosnischen Flüchtlingen in den 1990ern dürfte jedoch<br />
auch die Lage der Unterkunft abseits der Wohngebiete Erd bewogen haben, keinerlei Ein-<br />
wände zu erheben. Vom Großteil der Bevölkerung würde die Anwesenheit von Asylsuchen-<br />
den ja immer so schlimm dargestellt, überlegt er im Interview: „»Um Gottes Willen! Asylan-<br />
ten! Um Gottes Willen!« Ich mein’, es ist ... es ist so, das Haus ist natürlich jetzt zweieinhalb<br />
Kilometer von uns entfernt, wir ... wir kriegen da wenig mit [...].“ 317 Sorgen machte Erd<br />
anfänglich nur die durch die Standortwahl entstehende räumliche Kombination aus Flücht-<br />
lingsunterkunft und Nachtklub auf dem Unterkunftsareal:<br />
„Es sind ja viele junge Kerle dort unten, und ich mein’, wenn da ab und zu ... ich mein’ ja ab und zu, weil’s so<br />
ein paar Dinge gibt da unten, und wenn man das dann so beobachtet, immer da die Damen da im Sommer, wie’s<br />
halt war, die Tänzerinnen und so weiter, die Animierdamen, die sitzen da sehr ... freizügig gekleidet da herum,<br />
und die Kerle spazieren da den ganzen Tag da hin und her, haben keine Arbeit, die ... ich mein’, [...] das ist jetzt<br />
312 Vor der <strong>Neue</strong>rrichtung der Bundesstraße zwischen Außerfernbahn und Lech diente die an der Unterkunft<br />
vorbeiführende Straße Richtung Musau als Bundesstraße, das Haus lag als Gasthof und Hotel daher durchaus<br />
günstig, die früher zur Beherbergung bereit gehaltenen hundert Betten zeugen davon. Durch ihre <strong>Neue</strong>rrichtung<br />
geriet das Gebäude jedoch in den „toten Winkel“ der Bundesstraße: Fährt man nun von Reutte kommend Richtung<br />
Füssen oder Vils, ist man gezwungen, auf die Landstraße ab- und rund 500 Meter auf dieser zurückzufahren.<br />
(Anm. RP)<br />
313 Interview Unterkunftsleitung 02/1, 31.10.2003, Z 3-14.<br />
314 Ebd., Z 16.<br />
315 Interview Erd 31.10.2003, Z 5-9.<br />
316 Ebd., Z 11-20; Hervorhebung im Original.<br />
317 Ebd., Z 116ff.<br />
163
nicht grad so ... Wenn da mal was wäre, nicht? Da tät’ ich mich gar nicht wundern, eigentlich. Aber da hat’s bis<br />
jetzt eigentlich noch nie was gegeben, irgendwo.“ 318<br />
6.8.5 Freiheitliche Attacken und bürgermeisterliche Reaktionen:<br />
Der Standort in der Diskussion<br />
Wie in Kössen organisierte auch in Vils die Gemeinde für die Startphase einen „Kontakt-<br />
mann“: Ein Jurist und ehemaliger Bezirkshauptmannstellvertreter betreute die Untergebrach-<br />
ten „auch sprachlich“ und hat ihnen so „ein bisschen weitergeholfen“. 319 Nach einigen Dieb-<br />
stählen in der Gegend regte sich in der Bevölkerung jedoch Widerstand gegen die Unterkunft<br />
– die Asylsuchenden wurden für die Straftaten verantwortlich gemacht. Der Unterkunftsleiter<br />
ringt im Interview bei der Beschreibung der Proteste nach Worten:<br />
„Ja, am Anfang war’s ... ich mein’, es ist immer ... jeder ... Wie soll man sagen? Das Dorfleben, das ist kein<br />
Stadtleben, wo’s halt keinen interessiert. Am Anfang war’s schon bedrohend: Wir brauchen die da nicht und ...<br />
da kommt nur Scheiße daher und was soll das ... Ich muss sagen, am Anfang hat der Ort auch Schwierigkeiten<br />
gehabt, also ... weil ... ja, das alles neu war, also ... [...] Da ging’s halt so: Scheiß ... scheiß Russen, scheiß ... Ja,<br />
halt wie in jedem Dorf und auch manchmal in der Stadt, nur in der Stadt interessiert’s einen ... den Nachbarn,<br />
den nächsten Nachbarn nicht so.“ 320<br />
Im September 2002 griff schließlich der Reuttener FPÖ-Bezirksobmann Sieghart Jenewein<br />
die Vilser Proteste auf und verbreitete über eine Presseaussendung ein Trommelfeuer an ein-<br />
schlägigen Forderungen: „FPÖ: Kriminelle Asylanten sofort abschieben! Für FPÖ Reutte ist<br />
der Standort des Asylantenheims in Vils völlig ungeeignet! FPÖ kritisiert fehlende Informa-<br />
tion der Bürger und Verharmlosung der Kriminalität der Asylanten!“ 321 Jenewein kritisierte<br />
insbesondere die fehlende Information der Bevölkerung vor der Realisierung der Unterkunft:<br />
„Ohne die betroffenen Bürger zu informieren wurde eine derart folgenreiche Entscheidung<br />
getroffen. So darf mit den Bürgern nicht umgegangen werden.“ Im Haus herrsche mittlerweile<br />
offenbar eine „von Alkohol geprägte aggressive und gespannte Stimmung“, überdies seien<br />
anscheinend einige „Insassen“ an Hepatitis erkrankt. Der Standort sei „denkbar schlecht ge-<br />
eignet“, es solle daher ein geeigneterer Ort gesucht werden. 322 Jenewein blieb eine inhaltliche<br />
Präzisierung seiner Standortkritik freilich schuldig, erreichte jedoch immerhin einen mit sei-<br />
nem Foto versehenen Bericht in der Tiroler Tageszeitung am Folgetag 323 , wo Bezirkshaupt-<br />
mann Dietmar Schennach Hepatitis- und Tuberkulose-Erkrankungen bestätigte und zu den<br />
Diebstahlvorwürfen anmerkte:<br />
„Es handelt sich ausschließlich um Kleindelikte, nicht um schwere Vorfälle. Viele der Asylanten sehen Kleindiebstähle<br />
nicht als Delikt und haben ein anderes Rechtsverständnis. Wir haben versucht, Abschiebungen zu<br />
veranlassen, das ist derzeit [sic!] aber rechtlich nicht möglich. Die Bundesgesetzgebung lässt eine Abschiebung<br />
– auch bei gerichtlicher Verurteilung – nicht zu.“ 324<br />
318<br />
Ebd., Z 287-293.<br />
319<br />
Ebd., Z 57ff.<br />
320<br />
Interview Unterkunftsleitung 02/1, 31.10.2003, Z 25-33.<br />
321<br />
Vgl. FPÖ Reutte 10.09.2002.<br />
322<br />
Ebd.<br />
323<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 11.09.2002.<br />
324<br />
Schennach, zit. nach ebd.<br />
164
Bürgermeister Erd ging auf Jeneweins Attacken weniger ein als der Bezirkshauptmann, er<br />
maß den Berichten über die „kriminellen Asylanten“ generell weniger Bedeutung bei:<br />
„Ich hab dem eigentlich nicht den Glauben geschenkt, dann am Anfang, weil ich das weiß, dass das ja einfach<br />
ist, den Flüchtlingen immer die Schuld zuzuschieben, nicht? Weil das ist ja einfach. Nicht? Und es hat sich dann<br />
herausgestellt, dass das dann doch nur in Einzelfällen war und dass das andere eigentlich nicht Flüchtlinge waren,<br />
sondern andere Menschen.“ 325<br />
Erd reagierte jedoch, indem er die Bevölkerung in den Stadtsaal lud:<br />
„Es hat dann [...] so einen großen Aufklärungsabend gegeben, wo die Bevölkerung hat können daran teilnehmen,<br />
da war eigentlich der Stadtsaal ziemlich voll mit Leuten, und das Interesse war groß, und da war auch der Herr<br />
Logar dabei und verschiedene andere, von der Caritas und ... und eben auch der Bürgermeister und ... meine<br />
Wenigkeit also ... [...] und interessanterweise ist’s von da weg dann ruhig geworden, nicht? Also ... Es hat sich<br />
dann in der Bevölkerung kaum noch irgendwo ... so ... Es sind ganz selten nur Klagen gekommen.“ 326<br />
Die Diskussion blieb damit letztlich auf Gerüchte und Klischeebilder über die untergebrach-<br />
ten Asylsuchenden sowie auf deren angebliches oder tatsächliches Verhalten beschränkt, die<br />
Lage sowie die spezifischen Merkmale des Standorts wurden auch in der Folgezeit nie zum<br />
Gegenstand gezielter öffentlicher Kritik.<br />
6.8.6 Bewertung<br />
Der Vilser Unterkunftsstandort befindet sich wie die Fieberbrunner Unterkunft in einer dop-<br />
pelten Randlage: Das Haus liegt auf Landes- wie auf Gemeindeebene im Grenzgebiet und<br />
außer Sichtweite besiedelter Flächen. Wo im Fall der Unterkunft am „Bürgl“ die abgeschie-<br />
dene Gebirgslage den Eindruck der Absonderung und Marginalisierung verstärkt, geschieht<br />
dies beim Vilser Standort durch die Lage in der nordwestlichsten Ecke des Landes, ausge-<br />
rechnet im Nadelöhr Ulrichsbrücke, wo sich die Unterkunft den Platz mit gleich vier teils<br />
stark befahrenen Verkehrswegen und einem Fluss zu teilen hat. In Gesprächen mit Leitungs-<br />
personal anderer Unterkünfte wurde eine weitere Analogie zur Fieberbrunner Unterkunft<br />
deutlich: Auch Vils wurde wiederholt explizit als Zielort von Verlegungen benannt, wenn es<br />
in anderen Unterkünften zu Konflikten kam. 327 Damit steht auch im Fall von Vils eine<br />
Nutzung des Standorts und seiner spezifischen Merkmale im Sinne eines Disziplinierungs-<br />
mittels im Raum.<br />
Die generell schlechte Erreichbarkeit des Bezirks – für Asylsuchende durch den Umstand<br />
verstärkt, dass die Nutzung der über deutsches Staatsgebiet führenden Bahnverbindung nach<br />
Innsbruck unmöglich ist – macht eine Fahrt zu den für Flüchtlinge relevanten Institutionen<br />
und Organisationen in der Landeshauptstadt mindestens zu einem Tagesausflug. Durch die<br />
direkte Busverbindung vom Standort in den Bezirkshauptort Reutte sind jedoch zumindest die<br />
dort vorhandenen der Ergänzungsökonomie zuzuordnenden Einrichtungen sowie migrantische<br />
Treffpunkte und Gebetsstätten verschiedener Glaubensrichtungen erreichbar.<br />
325<br />
Interview Erd 31.10.2003, Z 31-34; Hervorhebungen im Original.<br />
326<br />
Ebd., Z 35-44.<br />
327<br />
Vgl. etwa Interviews Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 120-132 und 06/1, 07.11.2003, Z 144-147.<br />
165
Das Unterkunftsareal selbst erhält durch die mangelhafte Ausstattung mit zur Freizeitgestal-<br />
tung nutzbaren Außenanlagen einen relativ trostlosen Charakter. Die auch im näheren Umfeld<br />
fehlenden Anlagen und Spielmöglichkeiten für Kinder kann der relativ schmale Raum zwi-<br />
schen den beiden Unterkunftsgebäuden, der teils einer Laube gleicht und einigermaßen einla-<br />
dend wirkt, in keiner Weise ersetzen. Wenn sie nicht mit Fahrrad oder Bus das rund drei<br />
Kilometer entfernte Vilser Zentrum aufsuchen wollen, sind die untergebrachten Asylsuchen-<br />
den damit vor allem im Winter gezwungen, auch die Tageszeit in ihren Zimmern oder ge-<br />
meinsam in den Aufenthaltsräumen vor dem Fernseher zu verbringen. Während die Attacken<br />
des freiheitlichen Bezirksobmanns Jenewein gegen die von ihm in der Unterkunft vermuteten<br />
„kriminellen Asylanten“ wohl eher im Spektrum einschlägiger freiheitlicher Kritik an Flücht-<br />
lingsunterkünften zu verorten sind, scheint vor diesem Hintergrund sein Verweis auf die ge-<br />
spannte Stimmung in den Häusern daher nicht unberechtigt: Die relative Isolation der unter-<br />
gebrachten Asylsuchenden und der damit verbundene „Lagercharakter“ des Areals wirken<br />
zweifellos in ähnlicher Weise aggressionsfördernd, wie dies bereits im Fall des Standorts am<br />
„Bürgl“ konstatiert wurde. Tatsächlich ist es auch in der Vilser Unterkunft bereits zu blutig<br />
ausgetragenen Konflikten unter Flüchtlingen gekommen. 328<br />
Die räumliche Kombination der Unterkunft mit dem am selben Standort befindlichen Nacht-<br />
klub ist hinsichtlich ihrer Optik schlicht als verheerend zu beurteilen. Bei regionalen Presse-<br />
berichten über den Standort muss aus den publizierten Fotographien des Gebäudes aufgrund<br />
seiner einschlägigen Beschriftung geschlossen werden, in der Unterkunft werde ein Bordell<br />
geführt. 329 Der Standort in Vils führt so über die mediale Berichterstattung auf subtile Art zu<br />
einer Bestätigung jenes gerade auch in Tirol in den letzten Jahren häufig strapazierten<br />
Klischeebilds, das Asylsuchende mit dem „Milieu“ und der „Unterwelt“ in Verbindung<br />
bringt. Auch in Vils selbst ist eine Stigmatisierung vor allem der untergebrachten Kinder als<br />
„die vom Nachtklub“ aufgrund dieser Kombination kaum zu verhindern. Der Umstand, dass<br />
in der Stadt offenbar Unklarheit darüber herrscht, ob es sich bei jenen in den Unterkunfts-<br />
gebäuden lebenden Personen, die nicht AsylwerberInnen sind, um Betriebsfremde oder -an-<br />
gehörige des Etablissements handelt, muss zwangsläufig zu weiteren Gerüchten über das<br />
Leben auf dem Unterkunftsareal führen. 330<br />
Standortwahl und -realisierung wurden im Fall der Vilser Unterkunft vom Unterkunftsleiter<br />
selbst in Reaktion auf einen Aufruf des Landes Tirol initiiert. Standortmerkmale wie die feh-<br />
lenden bespielbaren Außenanlagen spielten bei der Entscheidung zur Realisierung offenbar<br />
keine Rolle, hingegen scheint die Entfernung zu den Wohngebieten wie im Fall des Standorts<br />
328 Vgl. Tiroler Tageszeitung 12.11.2003 und 02.04.2004.<br />
329 Vgl. hierzu etwa die Fotographien in Tiroler Tageszeitung 11.09.2002 und 13.11.2003.<br />
330 Während Bürgermeister Erd im Interview vorsichtig feststellt, in den Unterkunftsgebäuden lebten neben den<br />
Asylsuchenden weitere zehn Familien, die „auch Ausländer“ seien (Interview Erd 31.10.2003, Z 140-147), formuliert<br />
der Unterkunftsleiter selbst gewunden, die betreffenden Personen seien „Zugehörige, also [...] vom<br />
Haus“ und für die Flüchtlinge auch nur „kurzfristige Nachbarn“ (Interview Unterkunftsleitung 02/1, 31.10.2003,<br />
Z 44-49; vgl. Interview Unterkunftsleitung 02/2, 31.10.2003).<br />
166
in Reith im Alpbachtal einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung ausgeübt zu haben – der<br />
Vilser Bürgermeister merkte nicht umsonst an, man kriege bezüglich der Unterkunft „da<br />
wenig mit“. Die rasche Realisierung des Standorts dürfte Proteste der Bevölkerung zunächst<br />
verhindert haben, auf die wenige Monate nach Bezug der Unterkunft entstehenden Diskussio-<br />
nen reagierte Bürgermeister Erd mit dem im Stadtsaal veranstalteten und von ihm so bezeich-<br />
neten „Aufklärungsabend“ für die Bevölkerung, der offenbar erfolgreich war.<br />
6.9 Volders: Dicke Luft in der Transitgemeinde<br />
Bereits 1991 wurden im Volderer Ortsteil Kleinvolderberg Flüchtlinge untergebracht. Die<br />
desolate Unterkunft, die teils mehrere hundert Asylsuchende beherbergte, wurde nach langen<br />
Diskussionen im Juni 2001 geschlossen, die betroffenen Flüchtlinge an andere Standorte ver-<br />
legt. 331 Etwas mehr als ein Jahr später entstand wenige Meter neben der alten eine neue Unter-<br />
kunft, in der im zweiten Halbjahr 2003 rund dreißig Personen untergebracht waren. 332 Anfang<br />
März 2004 wurde vorübergehend auch die alte Unterkunft wieder reaktiviert.<br />
6.9.1 Die Gemeinde: Blockade oder Umfahrung?<br />
Die 4.236 EinwohnerInnen zählende Gemeinde Volders liegt zwischen Hall in Tirol und<br />
Wattens, sie gehört damit zum Bezirk Innsbruck-Land. Durch die unmittelbare Nähe zur<br />
Autobahn liegt die Gemeinde, wie eine Tageszeitung zuletzt anmerkte, „mitten in der Transit-<br />
hölle des Unterinntales“. 333 Beherrschendes Thema der lokalen Politik sind daher die negati-<br />
ven Auswirkungen des Verkehrs, insbesondere des „Ausweichverkehrs“, der vor allem aus<br />
Transitfahrten jener LKW besteht, die Fahrbeschränkungen oder -verbote auf der Autobahn<br />
mittels Nutzung der durch Volders führenden Bundesstraße umgehen. In der solcherart tran-<br />
sitgeplagten Gemeinde wird daher heftig diskutiert, welche Strategien eine möglichst rasche<br />
Lösung des Problems versprechen: die in Tirol beinahe schon Teil der Brauchtumspflege ge-<br />
wordenen Straßenblockaden, an denen sich auch Volders gern beteiligt 334 , eine Umfahrungs-<br />
straße oder ein auf den Ausweichverkehr ausgerichtetes lokales Fahrverbot – ein solches<br />
wurde im Juni 2004 erlassen. 335<br />
Volders ist eine klassische PendlerInnengemeinde, die von der Landwirtschaft geprägte lokale<br />
Wirtschaftsstruktur bietet wenig Arbeitsplätze. Die Gemeinde steht dabei insbesondere im<br />
„Sog“ der größeren und industriell geprägten Nachbargemeinde Wattens, aber auch der west-<br />
lich gelegenen Städte Hall und Innsbruck. Der Tourismus spielt nur im Sommer eine Rolle,<br />
mehrere Burgen und Schlösser in der Umgebung, die bekannte Barock- und Rokoko-Kirche<br />
331 Vgl. ANAR Tirol 2001; Tiroler Tageszeitung 20.06.2001; Pletzer 2002.<br />
332 Vgl. Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003. Bis Mitte November 2004 war die Zahl der<br />
untergebrachten Personen auf 55 angestiegen (Tiroler Tageszeitung 11.11.2004).<br />
333 Der Standard 26.08.2004.<br />
334 Zuletzt etwa an den Autobahnblockaden zu Ostern 2004 (vgl. ebd.).<br />
335 Vgl. ebd.; Tiroler Tageszeitung 01.03.2004a.<br />
167
St. Karl sowie die Nähe zur Stadt Hall dürften hierzu wohl wesentlich beitragen. Im Unter-<br />
schied zur Wirtschaft ist das Volderer Schulwesen bemerkenswert vielfältig: Neben einem<br />
öffentlichen Kindergarten und zwei Volksschulen gibt es auch eine Hauptschule, überdies<br />
wird am westlichen Ortsrand das Private Oberstufenrealgymnasium (PORG) St. Karl betrie-<br />
ben. Im Sozialbereich steht – für eine Landgemeinde eher ungewöhnlich – auch eine an sich<br />
typisch urbane Einrichtung zur Verfügung: Die im Ort befindliche „Zentrale“ von B.I.T. (Be-<br />
gleitung, Integration, Toleranz) bietet Sucht- und Sozialberatung und ist als Sozialeinrichtung<br />
für DrogenkonsumentInnen in Tirol allgemein profiliert.<br />
Auch die lokale Politik ist vergleichsweise vielfältig: Gleich sechs Listen bilden den Volderer<br />
Gemeinderat. Seit 1998 amtiert als Bürgermeister der Bankdirektor Max Harb (ÖVP), der<br />
sich damals erst im zweiten Wahlgang durchsetzen konnte. Bei den Gemeinderatswahlen im<br />
März 2004 konnte seine Fraktion ihren Stimmenanteil kaum erhöhen, nach wie vor verfügt<br />
Harbs „Gemeindeliste“ über sieben Mandate. Die unabhängige Liste „Gemeinsam für<br />
Volders“ hält nach dem Gewinn eines weiteren nun bei drei Mandaten, die Volderer SPÖ<br />
verlor gegenüber 1998 leicht, verfügt jedoch nach wie vor über zwei Sitze im Gemeinderat.<br />
Ihre Sitze verdreifachen konnte dagegen die Liste „Wir Volderer“, die nun bei drei Mandaten<br />
hält; die mit Harb gekoppelte Fraktion „Wirtschaft und Arbeit“ hält nach wie vor ein Mandat.<br />
Neu in den Gemeinderat ein zogen die Grünen, auch sie sind mit einem Sitz vertreten. Eine<br />
klare und gefestigte Gemeindeidentität ist – entsprechend der skizzierten heterogenen Struktur<br />
des Ortes – nicht erkennbar, lediglich im gemeinsamen Kampf gegen den Transit scheinen die<br />
verschiedenen Gruppierungen und Gruppen an einem Strang zu ziehen.<br />
6.9.2 Der Standort: Draußen bei der Stachelburg<br />
Der Volderer Unterkunftsstandort befindet sich etwa zwei Kilometer vom Ortszentrum ent-<br />
fernt am nordwestlichen Rand des Ortsteils Kleinvolderberg, wenige Meter vor der Gemein-<br />
degrenze zum benachbarten Tulfes. Das Areal in Hanglage am Südrand des Inntals ist nur von<br />
der Volderer Seite her zugänglich. Zweigt man im Tal zunächst von der Bundesstraße in<br />
Richtung des Servitenklosters und des PORG St. Karl ab, fährt an diesem vorbei und in der<br />
Folge einen schmalen, aber asphaltierten Zufahrtsweg bergauf, so erreicht man nach etwa<br />
einem Kilometer das Gelände des früheren Ansitzes Hauzenheim, der bereits Ende des 13.<br />
Jahrhunderts bewohnt war. 336 1602 wurde das Areal von einem Ernst von Stachelburg erwor-<br />
ben, dessen Name in Volders auch heute noch umgangssprachlich als Bezeichnung für eines<br />
der im Laufe der Zeit auf dem Gelände errichteten Gebäude fungiert. 337 Nach mehreren<br />
Besitzerwechseln erwarb 1889 das Benediktinerstift St. Peter zu Salzburg das Areal, auf dem<br />
nun das zuvor im nahen Servitenkloster bei der Kirche St. Karl angesiedelte „Knabenasyl“<br />
untergebracht wurde. 338 Ein Jahr später wurde wenige Meter unterhalb der Stachelburg ein<br />
336 S. Moser 1984, 49ff.<br />
337 Vgl. ebd.; Interview Harb 30.10.2003.<br />
338 H. Moser 1984, 132.<br />
168
neues Anstaltsgebäude fertiggestellt und zur Ausbildung der „elternlosen und verwahrlosten<br />
Knaben“ auch eine eigene Volksschule eingerichtet, ein Gymnasium folgte, das in den<br />
1930ern in eine Hauptschule umgewandelt und mit dem Anschluss Österreichs an das Deut-<br />
sche Reich 1938 überhaupt geschlossen werden musste. 339 Am Standort verblieb die erwähnte<br />
Anstalt, die in der NS-Zeit als „Gauheimstätte“ unter anderem für Kinder mit Behinderungen<br />
diente. 340 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, noch im Jahr 1945, richtete das Land Tirol<br />
das „Landeserziehungsheim Josefinum“ ein, in dem bis 1963 auch Kinder mit Behinderungen<br />
untergebracht wurden. 341 Der Pachtvertrag mit dem Benediktinerstift St. Peter besteht bis<br />
heute. Im ehemaligen Anstaltsgebäude entstand in den 1990ern ein Internat für die Schüler-<br />
Innen des PORG.<br />
Das gesamte Areal umfasst heute vier größere Gebäude auf zwei Ebenen. Auf der über den<br />
Zufahrtsweg zuerst erreichbaren unteren der beiden Ebenen befindet sich das erwähnte Inter-<br />
nat, das ab 2002 zugleich als Flüchtlingsunterkunft diente. Der unter Einrechnung des ausge-<br />
bauten Dachgeschosses vierstöckige Bau, dessen Äußeres nach wie vor deutlich als Anstalts-<br />
bau aus der Zeit der Jahrhundertwende erkennbar ist, verfügt über eine baulich gut erhaltene<br />
Vorderfront. Dieser vorgelagert ist ein Ensemble, das in seiner mondänen Gestaltung fast an<br />
den Eingangsbereich einer Kuranstalt erinnert: Auf einem Rasendreieck stehen vier Laub-<br />
bäume, unter denen sich verwitterte Holzbänke und einige geometrisch angeordnete Sträucher<br />
befinden und ein breiter Kiesweg zum Haustor führt. Anders als die zentrale Westfront des<br />
Gebäudes weisen vor allem ein Teil der Nordseite sowie die gesamte, etwas verwinkelte Ost-<br />
front teils gröbere Verfallserscheinungen auf, unter anderem sind einige Fensteröffnungen mit<br />
Brettern zugenagelt, an mehreren Stellen bröckelt der Putz ab. Dieser hintere Teil des Gebäu-<br />
des, der bei der Anfahrt auch als erster sichtbar ist, schien beim Lokalaugenschein leer zu<br />
stehen. Die Außenanlagen des Anstaltsgebäudes umfassen neben dem erwähnten Rasendrei-<br />
eck einige überdachte Autoabstellplätze an der Hangseite sowie ein von der dahinter an-<br />
schließenden Wiese durch einen beschädigten Holzzaun kaum getrenntes Rasenstück an der<br />
Ostseite. Die Pflege der Außenanlagen dürfte sich auf sporadisches Rasenmähen und Laub-<br />
rechen beschränken.<br />
Etwa hundert bis 150 Meter südwestlich und schräg oberhalb des Heims befindet sich der<br />
frühere Ansitz Hauzenheim mit der Stachelburg. Der Gebäudekomplex umfasst einen größe-<br />
ren Stadel, der offensichtlich vor nicht allzu langer Zeit saniert oder überhaupt neu errichtet<br />
wurde, die Stachelburg – ein dreistöckiges rechteckiges Gebäude mit erkennbaren Bau-<br />
schäden – sowie einen weiteren Bau, der sich aus zwei im rechten Winkel zueinander stehen-<br />
den zwei- bis dreistöckigen Gebäudeteilen zusammensetzt und sich baulich in katastrophalem<br />
Zustand befindet. Die Außenanlagen machen hier einen schmutzigen Eindruck, sie wurden<br />
339 Ebd., 132f.<br />
340 Vgl. Stöger 1998.<br />
341 H. Moser 1984, 133.<br />
169
offenkundig bereits seit Jahren nicht mehr gepflegt. Hier befand sich bis 2001 das vom Land<br />
Tirol betriebene „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“. Nach der lange geplanten Schließung<br />
sollten die Gebäude ursprünglich abgerissen und auf dem Areal die für eine „Fußballakade-<br />
mie“ nötigen Einrichtungen neu errichtet werden. Der Plan scheiterte, die Gebäude blieben<br />
stehen. Im März 2004 wurde die Unterkunft wieder eröffnet.<br />
Unterhalb des Areals führt in rund einem Kilometer Entfernung die Autobahn vorbei, der<br />
Straßenlärm ist, vor allem, durch vorbeifahrende LKW, beträchtlich und rings um das Haus<br />
stets präsent. In gleicher Richtung befindet sich nach der Autobahn und dem dahinter vorbei-<br />
fließenden Inn ein Gewerbegebiet, wo ebenfalls zahlreiche LKW unterwegs sind. Westlich<br />
schräg unterhalb des Areals liegt in 500 bis 800 Meter Entfernung ein Reitstall samt Bauern-<br />
hof und Restaurant, der bereits zur Gemeinde Tulfes gehört. Im Frühling, Sommer und Früh-<br />
herbst besteht aufgrund einiger Laubbäume nur eingeschränkter oder überhaupt kein Sicht-<br />
kontakt zu diesen Gebäuden. Östlich des auf der unteren Ebene des Areals liegenden An-<br />
staltsgebäudes sind in knapp 300 Meter Entfernung der Sportplatz des PORG St. Karl und der<br />
„Heldenfriedhof Bruggenwaldele“ zu finden, beide können vom Unterkunftsgelände aus nur<br />
über die dazwischenliegende Wiese erreicht werden. Zu dem noch etwas weiter östlich be-<br />
findlichen PORG besteht kein Sichtkontakt. Auf der Hangseite der Unterkunftsgebäude be-<br />
ginnt bereits nach wenigen Metern der Wald, an einigen Stellen wird auf dem Gelände aufge-<br />
forstet. Über bewohnte Nachbargebäude in Sichtweite verfügt das Areal damit nicht.<br />
An der oben erwähnten Abzweigung von der Bundesstraße beginnt auch ein Spazierweg ins<br />
Volderer Ortszentrum, hier sind einige Tisch-Bank-Kombinationen sowie ein schlichter<br />
Spielplatz vorhanden – das Unterkunftsareal verfügt selbst über keinen Spielplatz oder ähnli-<br />
ches. An der Bundesstraße befindet sich hier auch eine Bushaltestelle, von der aus direkt ins<br />
etwa 13 Kilometer entfernte Innsbruck gefahren werden kann. 342 Die Stadt Hall ist vom Ge-<br />
lände aus auch mit dem Fahrrad erreichbar, dort gibt es nicht nur die Filiale einer billigen<br />
Supermarktkette 343 , sondern auch der Ergänzungsökonomie zuordenbare Einzelhandels- und<br />
Gastronomiebetriebe, die in Volders selbst kaum vorhanden sind. Die Gesundheitsversorgung<br />
ist hingegen in der Gemeinde selbst gesichert: Mit einer Apotheke, einem Allgemeinmedizi-<br />
ner und einem Zahnarzt werden die grundlegendsten Bereiche abgedeckt.<br />
6.9.3 Die Standortwahl: »Und das Land war froh ...«<br />
Als die Unterkunft in Kleinvolderberg durch das damals zuständige Innenministerium 1991<br />
zum ersten Mal eingerichtet wurde, verursachte dies im Ort gehörige Unruhe. Der damalige<br />
Innenminister Löschnak kam schließlich nach Volders, wo er sich im Gasthof Jägerwirt den<br />
342 Für die Fahrt ist eine Dauer von rund einer halben Stunde zu veranschlagen.<br />
343 Der Leiter des SchülerInneninternats berichtet, dass die bei ihm untergebrachten Asylsuchenden auch tatsächlich<br />
mit dem Fahrrad zu diesem Supermarkt fahren würden, immer wieder würden Flüchtlinge mit dem Fahrrad<br />
auch weiter nach Innsbruck fahren (Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 218-220).<br />
170
Fragen der Bevölkerung stellte. Die Aufregung blieb, am 26. Juli 1992 wurde die Unterkunft<br />
gar Ziel eines Brandanschlags. 344 Leitung und Betreuung des Hauses wurden damals offen-<br />
kundig parteinah vergeben: Für den Erhalt war im Auftrag des Landes die in Tirol in der<br />
Flüchtlingsarbeit ansonsten kaum präsente und dem sozialdemokratischen Spektrum zuzuord-<br />
nende Volkshilfe verantwortlich 345 , der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) kümmerte<br />
sich nebenbei um die Vermittlung von Arbeitsplätzen. 346 Vor der Schließung im Jahr 2001<br />
war für das bald als desolat kritisierte „Heim“ ein altgedienter Innsbrucker SPÖ-Funktionär<br />
zuständig, der das Haus Berichten zufolge eher verfallen ließ. 347<br />
Ein Jahr nach der Schließung, im Herbst 2002, sah das im ehemaligen Anstaltsgebäude unter-<br />
halb der Stachelburg untergebrachte Internat des PORG St. Karl seinen Betrieb aufgrund sin-<br />
kender SchülerInnenzahlen gefährdet. Nach Lektüre eines der Aufrufe des Landes Tirol,<br />
Quartiere zur Unterbringung Asylsuchender zur Verfügung zu stellen, kam der Internatsleiter<br />
daher auf die Idee, ein leerstehendes Stockwerk des Hauses mit so zu belegen:<br />
„... damals war gerade das in ... Traiskirchen, wo ... wo der Innenminister das geschlossen hat, wo dann ... war<br />
dann der Aufruf von der Landesregierung in der ... in der Zeitung und überall, und dann haben wir uns gedacht:<br />
Ja, eigentlich könnten wir da das wieder machen – da sind sie alle ja auf der Straße gestanden, nicht? [...] Und<br />
wir haben uns gedacht: Na, bei uns ist in dem Sinn Platz, und ... und wenn man’s organisiert richtig und wenn eh<br />
genug Leut’ vorhanden sind ... [...] Und dann haben wir ... da haben wir das halt gemacht, nicht? Und das Land<br />
war froh, [...] dass das gegangen ist, und ... und wir haben ja in dem Sinn eine besondere Betreuung, weil wir ja<br />
in der Nacht auch da sind, nicht? Also sind da die Flüchtlinge in der Nacht auch betreut, nicht? [...] Wir haben ja<br />
einen Nachtdienst für die Schüler.“ 348<br />
Für die Unterkunftsleitung machte die Einquartierung Asylsuchender aus zwei weiteren<br />
Gründen Sinn: Zum einen hatten im Internat bereits in den 1990ern auch ausländische Studie-<br />
rende der Innsbrucker Universität gewohnt, was problemlos funktioniert habe. Das Haus sei<br />
daher „immer schon so ein multikulturelles Haus“ gewesen, nun habe man sich eben gesagt:<br />
„Da könnten wir wieder an das anschließen und da ... Flüchtlinge nehmen.“ 349 Zum anderen<br />
könne es kaum Konflikte mit der Volderer Bevölkerung geben:<br />
„Ich mein’, da gibt’s keine Nachbarschaft, deswegen ist auch das ideal da.[...] Da sind sie auch nicht zu sehen,<br />
da haben sie auch mit dem Dorf nichts zu tun – also Belastung in dem Sinn ist es für die Gemeinde überhaupt<br />
nicht [...]. Weil die gehen – wenn sie fortgehen, gehen sie da zur Bushaltestelle, eine Telefonzelle haben wir im<br />
Haus, und interessiert sind ... sind die Flüchtlinge nur [...] an Innsbruck.“ 350<br />
Der Vorschlag des Internats war freilich zunächst auf einen Zeitraum von zwei Jahren befris-<br />
tet: In dieser Zeit sollten die letzten zwei im Internat befindlichen Jahrgänge die Reifeprüfung<br />
344 Vgl. Rohrauer 1996, 250.<br />
345 Soziallandesrätin Gangl war von 1992 bis 2002 Präsidentin der Volkshilfe Tirol (vgl. SPÖ Tirol 22.10.2003).<br />
346 Vgl. Steinkeller 1995; Interview Beratung/Betreuung 01, 15.05.2001.<br />
347 Besucherinnen berichteten 2001 u.a. von verschimmelten Duschen und fehlenden Möglichkeiten, Lebensmittel<br />
kühl zu lagern, diese wären von den Flüchtlingen im Winter daher im Freien auf den Fenstersimsen gelagert<br />
worden wären; das Essen sei tiefgekühlt aus St. Pölten angeliefert worden. Der angesprochene Leiter vertrat<br />
gegenüber den Besucherinnen die Ansicht, eine „gute medizinische Versorgung“ der Asylsuchenden würde von<br />
diesen nur „ausgenutzt“ (Interview Beratung/Betreuung 01, 15.05.2001).<br />
348 Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 10-22.<br />
349 Ebd., Z 178-187.<br />
350 Ebd., Z 206-215.<br />
171
absolvieren, danach sollte es geschlossen werden. 351 Das Land Tirol nahm das Angebot trotz-<br />
dem dankbar an.<br />
6.9.4 Die Standortrealisierung: »Den Bürgermeister haben wir da nicht gefragt«<br />
Der Volderer Bürgermeister Harb 352 wurde von der neuerlichen Realisierung einer Unterkunft<br />
auf dem Areal nicht informiert. Der Unterkunftsleiter räumt im Interview ein: „Den Bürger-<br />
meister haben wir da nicht gefragt, muss ich gestehen ...“ 353 Auch das Land Tirol hielt es<br />
offenbar nicht für nötig, Harb zu benachrichtigen. Der Flüchtlingskoordinator des Landes<br />
kommentiert im Interview mit Bezug auf die Internatsleitung lediglich knapp: „Die haben das<br />
mit den Eltern abgeklärt, und jetzt sind Asylwerber drinnen [...].“ 354<br />
6.9.5 »Wir haben sie lange genug gehabt«: Der Standort in der Diskussion<br />
Die Gemeindevertretung erfuhr von der neuen Unterkunft über Umwege und fragte nach, wie<br />
viele Flüchtlinge denn untergebracht werden sollten. Die Unterkunftsleitung übermittelte in<br />
der Folge nachträglich ein Informationsschreiben, das allerdings keine Angaben über die Zahl<br />
der untergebrachten Asylsuchenden enthielt. 355 An die Reaktion der Gemeindevertretung erin-<br />
nert sich der Unterkunftsleiter gut: Man habe „die Antwort gekriegt, nein, die ... sie wollen<br />
das nicht! Sie haben jetzt jahrelang die Last getragen. Nicht? [...] Und sie wollen das auf kei-<br />
nen Fall mehr.“ 356 Die Flüchtlinge wurden trotzdem untergebracht, formal verfügte die Ge-<br />
meinde ja auch über keinerlei Mitspracherecht. Bürgermeister Harb fühlte sich offenkundig<br />
brüskiert, nach der Sommerpause des Gemeinderates warf er der Unterkunftsleitung im Sep-<br />
tember 2003 vor, „rein aus wirtschaftlichen Gründen“ nun „wieder Asylanten im Internat zu<br />
halten [sic!], um mit Zuschüssen des Landes über die Runden zu kommen“. 357 Die neuerliche<br />
Unterbringung Asylsuchender auf dem Areal war für ihn eine hinter seinem Rücken vorge-<br />
nommene Provokation des Internaterhaltervereins – schließlich habe ihm der Flüchtlings-<br />
koordinator des Landes „verbindlich zugesagt, dass mit Sommer des Jahres 2002 keine Asy-<br />
lanten im Heim Kleinvolderberg mehr untergebracht werden“. 358 Der Volderer Gemeinderat<br />
Thomas Lener von der mit Harbs Liste gekoppelten Fraktion „Wirtschaft und Arbeit“ er-<br />
gänzte bei einer Gemeinderatssitzung, Volders habe „auf dem Sektor »Unterbringung von<br />
Asylanten« seine Schuldigkeit bereits getan“. 359 Harb griff diese Formulierung auf, gegenüber<br />
der Tiroler Tageszeitung stellte er einen Tag später klar, in Volders keine Asylsuchenden<br />
351<br />
Ebd., Z 40ff.<br />
352<br />
Harb verweigerte die Autorisierung des Interviewtranskriptes am 04.03.2004 über den Gemeindeamtsleiter.<br />
In die Einzelfalldarstellung konnten daher lediglich allgemeine Wahrnehmungen zum Interview, wie sie im<br />
Postskript vom Interviewer festgehalten wurden (vgl. Interview Harb 30.10.2003), eingearbeitet werden.<br />
353<br />
Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 16.<br />
354<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 543f.<br />
355<br />
Vgl. Sitzungsprotokoll des Gemeinderates Volders vom 11.09.2003 (59. Sitzung), 15.<br />
356<br />
Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 67-70.<br />
357<br />
Sitzungsprotokoll des Gemeinderates Volders vom 11.09.2003 (59. Sitzung), 15.<br />
358 Ebd.<br />
359 Ebd., 16.<br />
172
mehr haben zu wollen: „Wir haben sie lange genug gehabt. Die Bevölkerung hat nie Probleme<br />
gemacht, aber es soll Perspektiven geben.“ 360<br />
Seitens des Landes Tirol, das den empörten Bürgermeister ja wie die Unterkunftsleitung nicht<br />
rechtzeitig und angemessen informiert hatte, reagierte man auf den ausbrechenden Konflikt,<br />
indem man versuchte, sich noch rechtzeitig aus dem „Schussfeld“ der Kritik zu bringen. Der<br />
Flüchtlingskoordinator beteuerte, er habe den Internatserhalterverein „auch auf die Gemeinde<br />
verwiesen“ 361 – das Versäumnis, so sollte die Botschaft wohl verstanden werden, sei einzig<br />
die Schuld der Unterkunftsleitung. Diese blieb jedoch gelassen:<br />
„Das Land hat damals auch gesagt, es kommen keine Flüchtlinge mehr, nicht? Zum Volderer Bürgermeister.<br />
Und wir hätten das jetzt unterlaufen. [...] Das sieht er so, und er ärgert sich recht, und ... und ... Aber auf der<br />
anderen Seite muss ich auch sagen: Sie waren auch noch nie da, gell? Und wie wir da mit ... mit zwanzig Schülern<br />
dagestanden sind, da hat uns auch niemand geholfen. [...] Da hätten wir zumachen müssen von heut’ auf<br />
morgen. Da haben wir von der Gemeinde auch nichts gekriegt, nicht? [...] Und ... Und für uns ist das wirtschaftlich<br />
interessant, muss ich auch zugeben, ehrlich. Abgesehen von [...] der Hilfe, die wir da haben geben können,<br />
nicht?“ 362<br />
Die Aussicht auf ein Ende der Flüchtlingsunterbringung im Sommer 2004 beruhigte die Situ-<br />
ation schließlich wieder. Das Land Tirol dachte jedoch bereits an eine Reaktivierung des im<br />
Bereich der Stachelburg angesiedelten ehemaligen Großquartiers: Die zuständige Landesrätin<br />
führte Anfang Februar 2004 im Interview aus, bei der Wiedereröffnung des alten Quartiers in<br />
Volders, „wo wir ja recht viele gehabt haben“, sei man „jetzt in Vorbereitung“, man habe dort<br />
ja schließlich gemerkt, dass die Unterbringung Asylsuchender „keine große Schwierigkeit“<br />
gewesen sei 363 – „die waren immer bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen“. 364 Gangl rechnete<br />
auch mit einer weiteren Einbindung des Internats:<br />
„Da ist daneben so ein Internat [...] und da gibt’s auch da mit der Verpflegung, und die haben sich schon bereit<br />
erklärt, sie würden das auch mit übernehmen können. Also hätten wir diese Sorge schon einmal geklärt. [...] Und<br />
dann sind gleich einmal ein paar Leut’ wirklich auch untergebracht, weil wir da sicher gleich fünfzig Plätze<br />
adaptieren könnten.“ 365<br />
Schon Anfang März war es soweit, das Land griff auf die Dienste des Roten Kreuzes zurück<br />
und eröffnete in den eigentlich schon zum Abriss freigegebenen Gebäuden wieder ein neues<br />
Sammelquartier. In dramatischem Tonfall berichtete die Tiroler Tageszeitung:<br />
360 Harb, zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.09.2003. Seine Ablehnung begründete Harb vorrangig mit Problemen,<br />
die es „unter anderem wegen Schwarzhandel“ gegeben habe (ebd.). Der Bürgermeister bezog sich mit<br />
diesem Vorwurf auf eine wechselnde Zahl alter Autos, die v.a. im Bereich um die Stachelburg abgestellt waren –<br />
ein Bereich, wo seit 2001 eigentlich keine Flüchtlinge mehr untergebracht wurden. Harbs Vorwurf entbehrte<br />
freilich jeder Grundlage, wie im Interview mit der Unterkunftsleitung schnell deutlich wurde: In den Gebäuden<br />
um die Stachelburg seien „noch vier oder fünf Leute von früher, die beim Land noch gearbeitet haben, die haben<br />
da eine Dienstwohnung vom Land, und die sind da noch drinnen. Unter anderem ein bulgarischer Autohändler.“<br />
Die betreffenden Personen seien nun schon zehn, zwölf Jahre dort: „Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun da<br />
oben. Nicht? Also man sieht, dass er überhaupt nie da war, der Bürgermeister.“ (Interview Unterkunftsleitung<br />
01/1, 30.10.2003, Z 53-66)<br />
361 Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.09.2003.<br />
362 Interview Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 70-81.<br />
363<br />
Interview Gangl 09.02.2004, Z 83-88.<br />
364<br />
Ebd., Z 198f.<br />
365<br />
Ebd., Z 210-216.<br />
173
„Der Hilferuf des Landes hatte das Rote Kreuz Anfang März erreicht. Dann ging alles schnell: Innerhalb von<br />
zwei Tagen wurden zwei Etagen im Landes-Flüchtlingsheim Kleinvolderberg notdürftig saniert. Am 15. März<br />
trafen die ersten Flüchtlinge ein – die sonst auf der Straße gestanden wären oder für die eine Zeltstadt hätte errichtet<br />
werden müssen.“ 366<br />
Ende Mai, so die Zeitung, würde die Unterkunft wieder geschlossen. Das Rote Kreuz leistete<br />
dem Land diesmal gewissermaßen mediale Schützenhilfe: Landesgeschäftsführer Franz Tichy<br />
ließ über die Tiroler Tageszeitung wissen, man befinde sich in einer „humanitären Notsitua-<br />
tion, in der das Rote Kreuz Nothilfe leistet“. 367 Bürgermeister Harb – diesmal informiert –<br />
blieb bei seinen im Herbst 2003 getroffenen Aussagen: Volders habe seine Aufgabe erfüllt,<br />
nun sollten andere Gemeinden Flüchtlinge unterbringen. 368 Tatsächlich wurde das „Heim“ im<br />
Mai geschlossen – und umgehend erneut mit Asylsuchenden belegt, da zu wenig Ersatzquar-<br />
tiere zur Verfügung standen. Im Juni 2004 war Volders so zur einzigen Gemeinde Tirols ge-<br />
worden, die gleich über zwei Unterkünfte verfügte.<br />
Während das in den 1990ern vom Land Tirol betriebene und 2001 geschlossene „Flüchtlings-<br />
heim Kleinvolderberg“ aufgrund seines desolaten Zustands wiederholt heftig auch von außer-<br />
halb der Gemeinde kritisiert worden war 369 , blieben die Diskussionen um die 2002 im Internat<br />
des PORG eingerichtete Unterkunft auf die Gemeinde selbst beschränkt. Auch die Wiederer-<br />
öffnung des alten „Flüchtlingsheims“ im März 2004 löste keine nennenswerten öffentlichen<br />
Diskussionen außerhalb der Gemeinde mehr aus – wohl aufgrund der letztlich falschen An-<br />
kündigung, bereits im Mai die Unterkunft endgültig zu schließen.<br />
6.9.6 Bewertung<br />
Das Unterkunftsareal in Volders liegt an der nordwestlichen Gemeindegrenze in deutlicher<br />
Entfernung zu den lokalen Wohngebieten. Zu den wenigen Nachbargebäuden – dem PORG<br />
St. Karl sowie einem bereits zur Nachbargemeinde Tulfes gehörenden Bauernhof samt Reit-<br />
stall – besteht kein oder nur eingeschränkter Sichtkontakt. Mit Ausnahme eines Stadels wei-<br />
sen alle auf dem Areal befindlichen Gebäude Verfallserscheinungen auf, vor allem die zur<br />
Unterbringung genutzten Häuser wirken mehr oder weniger desolat. Das reaktivierte „Flücht-<br />
lingsheim Kleinvolderberg“ gleicht einem Abrisshaus, dass das Gebäude bereits vor einigen<br />
Jahren tatsächlich abgerissen werden sollte, lässt darauf schließen, dass sowohl dem Besitzer<br />
als auch dem Pächter des Geländes die Baufälligkeit durchaus bewusst ist.<br />
Die Außenanlagen der Unterkunftsgebäude sind äußerst schlicht gehalten, ein Spielplatz steht<br />
nicht zur Verfügung. Lediglich die flachen Rasen- und Asphaltstücke rund um die in Hang-<br />
lage errichteten Gebäude können für (freilich nur wenig raumgreifende) Ballspiele und ähnli-<br />
ches problemlos genutzt werden. Für Erwachsene stehen im Außenbereich nicht einmal<br />
366<br />
Tiroler Tageszeitung 04.05.2004.<br />
367<br />
Zit. in ebd.<br />
368<br />
Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
369<br />
Zuletzt etwa ANAR Tirol 2001; Pletzer 2002.<br />
174
schlichte Tisch-Bank-Kombinationen zur Verfügung, die untergebrachten Flüchtlinge impro-<br />
visieren daher und stellen ausgemusterte Stühle neben die Hauswand, Blumenübertöpfe die-<br />
nen als Aschenbecher. Da auf dem Gelände im Unterschied zu anderen Standorten zumindest<br />
hinsichtlich der Außenanlagen entscheidende Verbesserungen ohne größeren Aufwand vor-<br />
genommen werden könnten, ist der aktuelle Zustand befremdlich – das Gelände wirkt so eher<br />
trostlos. Die etwa einen Kilometer entfernte Bushaltestelle an der Bundesstraße ermöglicht<br />
den Zustieg zu einer die Landeshauptstadt anfahrenden Buslinie; dass damit in vergleichs-<br />
weise kurzer Zeit nach Innsbruck gefahren werden kann, ist positiv hervorzuheben. Aufgrund<br />
der Nähe ist auch das Städtchen Hall mit dem Fahrrad erreichbar, was aufgrund des dort vor-<br />
handenen teils billigeren, teils ergänzungsökonomischen Angebotes vor allem für den<br />
Lebensmitteleinkauf von erheblicher Bedeutung ist.<br />
Dass das Land Tirol bereits seit langer Zeit Pächter des Geländes ist, spielte bei der Standort-<br />
wahl im Fall der Volderer Unterkunft offenkundig die entscheidende Rolle: Das Areal war<br />
damit jederzeit verfügbar. Der Verlauf der Diskussionen rund um die Standortrealisierung im<br />
Jahr 2002 und die diesbezüglichen Berichte der Unterkunftsleitung wie auch des Volderer<br />
Bürgermeisters legen den Schluss nahe, dass das Land Tirol – dem Bürgermeister im Wort<br />
stehend, auf dem Areal keine Unterkunft mehr zu errichten – die neuerliche Realisierung<br />
eines Unterbringungsstandortes lieber „hinter dem Rücken“ der Gemeindevertretung vollzog<br />
und aufgrund des „Zwischenlösungscharakters“ des Internats hoffte, dass die Gemeinde da-<br />
von erst gar nicht erfahren würde. Nachdem die Unterbringung in Volders öffentlich bekannt<br />
geworden war und Bürgermeister Harb vehement seine Ablehnung kundgetan hatte, gab das<br />
Land an, den Verein ohnehin „auf die Gemeinde verwiesen“ zu haben – und schob damit den<br />
„schwarzen Peter“ einfach der Unterkunftsleitung zu, deren Dienste es natürlich weiterhin<br />
gerne in Anspruch nahm. Diese politisch wie administrativ riskante Vorgangsweise blieb je-<br />
doch letztlich ohne Konsequenzen.<br />
Bei der Reaktivierung der 2001 geschlossenen Unterkunft im März 2004 wurde nicht mehr<br />
auf die Information des Bürgermeisters verzichtet. Der Betreuung der untergebrachten Asyl-<br />
suchenden durch das Rote Kreuz sowie der medial verbreiteten Katastrophenrhetorik des<br />
Landesgeschäftsführers der Organisation dürfte wohl der entscheidende Anteil am Ausbleiben<br />
lautstarker Proteste zukommen – „Nothilfe“ in einer „Notsituation“ ist eben auch von ge-<br />
wöhnlich eher forsch auftretenden Politikern nur schwer etwas entgegenzusetzen. Die vom<br />
Land Tirol bereits für Mai 2004 angekündigte Schließung des reaktivierten „Flüchtlingsheim<br />
Kleinvolderberg“ wurde allerdings nicht eingehalten<br />
175
7 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Vergleichende Analyse und Thesen<br />
Wenn wir nun die Darstellungen der einzelnen im Herbst und Winter 2003 existierenden<br />
Tiroler Unterkunftsstandorte einer zusammenfassenden und vergleichenden Analyse unter-<br />
ziehen, können wir uns mit Recht erste Erkenntnisse über allfällige nicht-explizite Struktur-<br />
muster in der Standortpolitik des Unterkunftsgebers erwarten. Zugleich sollte es möglich sein,<br />
ein klareres Bild von den Rollen zu gewinnen, welche die UnterkunftsbesitzerInnen, die<br />
Gemeinden und ihre BürgerInnen im Prozess von Suche, Auswahl und Realisierung von<br />
Unterkunftsstandorten einnehmen. 370<br />
7.1 Die Wahl der Unterkunftsstandorte<br />
Wenden wir uns zunächst der Wahl der Unterkunftsstandorte zu. Wie und nach welchen<br />
Kriterien erfolgt sie in der Praxis? Kann aus den Vorgangsweisen des Unterkunftsgebers, der<br />
Lage und baulichen Ausführung der neun Unterkünfte und ihrer Einbindung in die lokalen<br />
Kontexte auf ein standortpolitisches Muster geschlossen werden?<br />
7.1.1 Die Standortsuche: Aufrufe und Appelle<br />
Wie die öffentliche Hand in Tirol zu neuen Unterkünften kommt, wird bei einem Vergleich<br />
der neun Einzelfalldarstellungen rasch deutlich: In sieben von neun Fällen meldeten sich die<br />
BesitzerInnen eines Unterkunftsgebäudes, in der Regel Gastwirtinnen und -wirte, nach einem<br />
Aufruf, meist als Kurzmeldung oder im Rahmen eines Artikels durch die Tiroler Tageszeitung<br />
verbreitet, bei der zuständigen Stelle des Landes Tirol. 371 In einem weiteren Fall meldete sich<br />
ein Gastwirt ohne vorherigen Aufruf beim Innenministerium und wurde an das Land verwie-<br />
sen. Einzig im Fall der Unterkunft in Reith im Alpbachtal trat der Unterkunftsgeber entspre-<br />
chend seinem Wunsch, das Areal käuflich zu erwerben, selbst an den Anbieter heran. Die<br />
Eindeutigkeit dieses Musters ist nicht zufällig: Im Interview wertet der Flüchtlingskoordinator<br />
des Landes die Vorgangsweise, neue Unterkünfte über Aufrufe und Appelle in den regionalen<br />
<strong>Medien</strong> zu suchen, als letztlich einzige Möglichkeit, überhaupt an Standorte zu kommen. 372<br />
Eine Variation dieser Strategie erprobte die zuständige Landesrätin Gangl persönlich im<br />
Herbst 2002, als sie die Bezirkshauptmannschaften dazu aufrief, „ihren Beitrag zu leisten“<br />
370 In den folgenden Abschnitten sollen dabei in anonymisierter Form auch jene im Rahmen der Erhebung durchgeführten<br />
Interviews mit Bürgermeistern berücksichtigt und eingearbeitet werden, deren Autorisierung mit meist<br />
ähnlichen Argumenten zunächst längere Zeit verzögert und schließlich verweigert worden war (vgl. hierzu Abschnitt<br />
3).<br />
371 Im Fall der Götzner Unterkunft, die bereits 1990 und damit noch vor der Schaffung der Stelle des Flüchtlingskoordinators<br />
des Landes Tirol eingerichtet wurde, meldete sich die Wirtin beim damals noch zuständigen<br />
Innenministerium, im Fall des Fieberbrunner Standorts am „Bürgl“ wurde das Unterkunftsareal dem Flüchtlingskoordinator,<br />
der eben sein Amt angetreten hatte, angeboten, nachdem öffentlich bekannt geworden war,<br />
dass dieser dringend Unterkunftsstandorte suche.<br />
372 Vgl. Interview Logar 10.10.2003, Z 152ff und 224f.<br />
176
und Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. 373 AsylwerberInnen, so Gangl, sollten „auf alle<br />
Bezirke aufgeteilt“ werden. 374 Gangl versuchte damit offenkundig, die Zuständigkeit für die<br />
Unterbringung von Asylsuchenden auf eine gemeindenähere Ebene zu verlagern – eine Auf-<br />
gabenverteilung, die im benachbarten Deutschland in Form der Unterbringungszuständigkeit<br />
der Landkreise und kreisfreien Städte bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten gesetzlich veran-<br />
kert ist. 375 Der Vorstoß wies indessen ein eklatantes konzeptionelles Defizit auf: Die Landes-<br />
rätin richtete ihren Appell mit den Bezirkshauptmannschaften an (im Unterschied zu den<br />
deutschen Landkreisen) Landesbehörden, deren Vorstand letztlich der Landeshauptmann ist 376<br />
– die Zuständigkeit für die Standortsuche wäre damit beim Land Tirol verblieben, die Landes-<br />
rätin hatte gewissermaßen an die eigene Adresse appelliert.<br />
In keiner Weise aktiv in Erscheinung traten bei der Suche und Auswahl aller neun Standorte<br />
die Gemeinden selbst. Ein allfälliger kommunaler Handlungsspielraum in diesem Bereich, der<br />
etwa in Form eigener Standortvorschläge oder -angebote denkbar wäre, wurde daher im<br />
zweiten Halbjahr 2003 in keinem Fall auch nur ansatzweise erschlossen und erprobt.<br />
7.1.2 Die Standortentscheidung: »Du hast keine Wahl«<br />
Ebenfalls in keiner Weise aktiv in Erscheinung traten die Gemeinden bei der Standortent-<br />
scheidung. Auf den ersten Blick scheint diese ausschließlich vom Unterkunftsgeber, dem<br />
Land Tirol, getroffen zu werden, dem ja die Standortwahl obliegt. Die bei der Suche nach<br />
neuen Unterkünften praktizierte Strategie der öffentlichen Aufrufe legt jedoch eine differen-<br />
ziertere Sichtweise nahe. Stützt sich das Land allein auf das Prinzip von Aufruf und Meldung,<br />
so wird von jenen UnterkunftsbesitzerInnen, die an der Unterbringung Asylsuchender ihr<br />
Interesse bekunden, bereits eine Vorentscheidung getroffen: Noch bevor der Unterkunftsgeber<br />
über mögliche Standorte entscheidet, entscheiden die BesitzerInnen meist leerstehender Be-<br />
herbergungsbetriebe auf der Basis eigener Kosten-Nutzen-Überlegungen, über welche Stand-<br />
orte der Unterkunftsgeber entscheiden kann. Damit liegt der aktive Part formal zwar beim<br />
Unterkunftsgeber, dieser entscheidet jedoch nur vordergründig allein und unabhängig – tat-<br />
sächlich wird von den UnterkunftsbesitzerInnen eine Vorauswahl getroffen. Vor diesem Hin-<br />
tergrund überrascht es kaum, dass sich der für die Standortentscheidung formal zuständige<br />
Flüchtlingskoordinator des Landes selbst lediglich eine passive Rolle in der Entscheidungs-<br />
findung zuschreibt. Zwar gäbe es durchaus „Sachen“, wo er gesagt habe: „Das ist ungeeignet.<br />
Das geht nicht.“ Letztlich verfüge er jedoch über keinen Entscheidungsspielraum: „Du hast<br />
keine Wahl.“ 377<br />
373 Vgl. Tiroler Tageszeitung 24.10.2002a; Kurier 09.11.2002.<br />
374 Vgl. Tiroler Tageszeitung 24.10.2002a.<br />
375 Vgl. Zepf 1986, 58 und 70ff. Den Kommunen werden dabei wesentliche finanzielle Aufwendungen durch die<br />
jeweiligen Länder erstattet (vgl. Balzer 1990, 147).<br />
376 Vgl. Weber 2004, 82ff. Den Bezirken fehlt damit ein durch demokratische Wahlen bestelltes Organ, weshalb<br />
mit Pelinka/Rosenberger (2000, 217) durchaus von eigentlich „unpolitischen“ politischen Bezirken gesprochen<br />
werden kann.<br />
377 Interview Logar 10.10.2003, Z 248 bzw. 244.<br />
177
7.1.3 Standortmerkmal 1: Räumliche Lage<br />
Wenden wir uns nun den Merkmalen der vom Unterkunftsgeber realisierten Standorte zu. Für<br />
eine zusammenfassende Analyse ihrer räumlichen Lage ist es hilfreich, den Blick auf mehrere<br />
verschiedene Ebenen zu lenken: jene des Landes Tirol insgesamt, jene der neun betroffenen<br />
Gemeinden, in weiterer Folge jene der unmittelbaren Umgebung der jeweiligen Unterkunft<br />
und schließlich jene des Unterkunftsgebäudes selbst. Wenn wir zunächst die Lage der Stand-<br />
orte auf Landesebene betrachten, so zeigt sich rasch, dass die im zweiten Halbjahr 2003 be-<br />
triebenen Unterkünfte vorrangig in peripher oder sogar extrem peripher gelegenen Gebieten<br />
zu finden sind:<br />
• Vier der neun Standorte, konkret jene in Fieberbrunn, Kössen, Leutasch und Vils, befinden sich im Grenzgebiet<br />
zu einem Nachbarstaat oder zu einem anderen Bundesland. Damit liegt beinahe jede zweite Unterkunft<br />
an der Landesgrenze.<br />
• Keiner der neun Standorte befindet sich in Innsbruck, der einzigen großen Stadt des Landes.<br />
• Ein einziger von neun Standorten – die Unterkunft in Landeck – befindet sich in einer Bezirkshauptstadt und<br />
damit auch in einem regionalen Zentrum.<br />
• Von den verbleibenden acht Standorten befinden sich sieben in einer Entfernung von mehr als neun oder<br />
zehn Kilometern zum nächstgelegenen regionalen Zentrum.<br />
• Drei der neun Standorte befinden sich in mehr als hundert Kilometer Entfernung von der Landeshauptstadt<br />
Innsbruck, vier in einer Entfernung von mehr als 34 bis 75 Kilometern, nur zwei in einer Entfernung unter<br />
15 Kilometern.<br />
Im Ergebnis ist daher eine Absonderung der Unterkünfte von zentralen Räumen als deutlich<br />
dominierendes Lagemerkmal zu identifizieren. 378 Ein Blick auf die neun Gemeinden scheint<br />
dies zunächst auch für die kommunale Ebene zu bestätigen, denn:<br />
• Sechs der neun Standorte – konkret jene in Fieberbrunn, Landeck, Leutasch, Reith im Alpbachtal, Vils und<br />
Volders – befinden sich in geringer Entfernung zu oder sogar unmittelbar an den Gemeindegrenzen und in<br />
teils maximaler Entfernung zum Ortskern.<br />
• Bei der Hälfte dieser sechs Standorte ist eine „doppelte Randlage“ festzustellen: In Fieberbrunn, Leutasch<br />
und Vils befindet sich die Unterkunft sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene im Grenzgebiet bzw.<br />
unmittelbar an der Grenze.<br />
Betrachtet man die Lage der Unterkünfte auf Gemeindeebene, ist jedoch noch ein zweiter<br />
Aspekt feststellbar, der das bislang entstandene Bild wesentlich ergänzt und differenziert:<br />
• Zwei der neun Standorte – konkret die Unterkünfte in Götzens und Mötz – befinden sich unmittelbar im<br />
Ortszentrum.<br />
• Aufgrund ihrer Lage, Gestaltung und Funktion nehmen beide Unterkunftsgebäude im jeweiligen Ortskern<br />
eine räumlich dominierende Position ein, zugleich sind sie – aus den selben Gründen – selbst vom öffentlichen<br />
Raum dominiert, mehr noch: Sie sind Teil des öffentlichen Raums.<br />
Für diese beiden Unterkünfte ist somit eine Heraushebung aus der sie umgebenden Bebauung<br />
festzustellen. Der Überblick über die im zweiten Halbjahr 2003 vorhandenen neun Standorte<br />
zeigt damit: Alle Unterkünfte sind von den üblichen Siedlungsräumen und Wohnflächen ent-<br />
378 Auch die zu Jahresbeginn 2003 gescheiterte Realisierung einer Unterkunft in Arnbach (Bezirk Lienz) – auf<br />
diesen Fall wird weiter unten noch einmal zurückzukommen sein – weist dieses Merkmal auf: Der Standort<br />
befand sich unweit der italienischen Grenze.<br />
178
weder „abgesondert“ oder aus diesen „herausgehoben“. Als grundlegendes Strukturmuster ist<br />
daher ein Prinzip der „Absonderung oder Heraushebung“ zu konstatieren.<br />
7.1.4 Standortmerkmal 2: Räumliche und bauliche Integration<br />
Wendet man nun den Blick der unmittelbaren Umgebung der Unterkünfte zu, so begibt man<br />
sich in den Bereich der konkreten Manifestationen dieses Musters. Dabei stellt sich zunächst<br />
die Frage nach der Struktur der Umgebung, in der sich der Standort befindet:<br />
• Der Standort am „Bürgl“ in Fieberbrunn liegt abseits aller bewohnten oder auch nur gewerblich genutzten<br />
Gebiete auf einem Hochplateau mitten im Wald.<br />
• Die Unterkunft in Götzens liegt dagegen unmittelbar im Ortszentrum an der zentralen, stark frequentierten<br />
Straßenkreuzung. Die Umgebung ist ein Mischgebiet, die Nachbarhäuser werden vorrangig durch<br />
Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe genutzt, sind jedoch teilweise auch bewohnt.<br />
• Das Unterkunftsgebäude in Kössen befindet sich in einem locker bebauten Mischgebiet, das vorrangig bewohnt<br />
wird.<br />
• Der Standort in Landeck liegt im von Durchzugsverkehr, Parkplätzen, Gewerbe und Handel dominierten<br />
Bahnhofsgebiet, nur drei näheren Gebäude in der Umgebung werden zumindest teilweise bewohnt.<br />
• Der Standort in der Leutasch befindet sich in einem im Wald gelegenen äußerst verstreut bebauten Mischgebiet.<br />
Neben einer Gewerbefläche sind in der nahen Umgebung ein Bauernhof samt Pension, ein Einfamilienhaus<br />
sowie einige nur zeitweise genutzte Ferienhäuschen zu finden.<br />
• Die Unterkunft in Mötz liegt unmittelbar im Ortszentrum in einem Mischgebiet. Die Gebäude und Flächen<br />
der nahen Umgebung sind etwa zu gleichen Teilen dem Dienstleistungsbereich, der Landwirtschaft, unbebautem<br />
öffentlichem Raum und dem Wohnen zuzuordnen.<br />
• In Reith im Alpbachtal befindet sich die Unterkunft zwischen einer Straßenkreuzung und einer Felswand in<br />
einem entstehenden Gewerbegebiet. Im nahen Umfeld sind keine bewohnten Häuser vorhanden.<br />
• Der Standort in Vils befindet sich abseits sowohl der bewohnten als auch der gewerblich genutzten Flächen<br />
in einer Engstelle, durch die vier teils stark befahrene Verkehrswege und ein Fluss verlaufen.<br />
• Die Unterkunft in Volders liegt gleichfalls abseits der Wohngebiete in Hanglage am Waldrand, einige<br />
Flächen der Umgebung werden landwirtschaftlich genutzt. Zu einem etwas mehr als 300 Meter entfernten<br />
und aus Bauernhof, Reitstall und Restaurant bestehenden Gebäudekomplex besteht durch Baumbestand stark<br />
eingeschränkter Sichtkontakt, die Anlage ist von der Unterkunft aus nur über einen Umweg erreichbar. 379<br />
Vier Unterkünfte, so zeigt der Überblick, liegen in einem Mischgebiet, das jedoch nur in ei-<br />
nem Fall von Wohnhäusern dominiert wird. Die anderen fünf Standorte liegen abseits der<br />
üblichen Siedlungsflächen in Gewerbegebieten oder an stark frequentierten (Durchzugs-)<br />
Straßen, der Standort am „Bürgl“ gar isoliert auf einem von Wald umgebenen Hochplateau –<br />
in der deutschen öffentlichen Diskussion werden Unterkünfte in derartigen Lagen seit gerau-<br />
mer Zeit gerne als „Dschungelheime“ charakterisiert. 380 Keiner der Unterkunftsstandorte be-<br />
findet sich demnach in einem klassischen Wohngebiet. Asylsuchende, so ist daraus zu<br />
schließen, werden möglichst abseits der Wohnflächen der Bevölkerung untergebracht.<br />
379 Im Fall der Volderer Unterkunft sind auf dem Areal offenbar zeitweise auch einzelne Personen wohnhaft, die<br />
vom Pächter, dem Land Tirol, „Dienstwohnungen“ zur Verfügung gestellt bekommen (vgl. Interview Unterkunftsleitung<br />
01/1, 30.10.2003). Angesichts des desolaten Zustands des betroffenen Teils des Areals scheint es<br />
jedoch kaum realistisch, dass die entsprechenden „Wohnungen“ als regulärer und also dauerhafter Wohnraum<br />
deklariert und genutzt werden.<br />
380 Vgl. etwa Bild 25.05.2000; Jungle World 11.08.2004.<br />
179
7.1.5 Standortmerkmal 3: Mobilität<br />
Wie sieht es mit der Anbindung der Standorte an das öffentliche Verkehrsnetz aus? Die Ge-<br />
samtschau der Einzelfalldarstellungen ergibt hier folgendes Bild:<br />
• Acht der neun Standorte sind an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Lediglich der Standort am<br />
„Bürgl“ in Fieberbrunn verfügt über keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die dort untergebrachten<br />
Asylsuchenden müssen mit unterkunftseigenen Kleinbussen zum Bahnhof oder gleich direkt in die<br />
Bezirks- oder Landeshauptstadt gebracht werden.<br />
• Allerdings ist Innsbruck von drei Standorten, die ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen sind – es handelt<br />
sich dabei um die Unterkünfte in Kössen, Leutasch und Vils –, nicht direkt erreichbar. Eine Fahrt in die<br />
Landeshauptstadt ist hier teils mit erheblichem Zeit- und Planungsaufwand verbunden. Besonders deutlich<br />
ist dies im Fall des Standorts in Vils, wo die vergleichsweise unkomplizierte Bahnverbindung nach Innsbruck<br />
von den untergebrachten Asylsuchenden nicht genutzt werden kann, da sie über deutsches Staatsgebiet<br />
führt. Die betroffenen Personen müssen daher auf jeder Fahrt zweimal umsteigen; da Anschlussbusse insbesondere<br />
in den Tagesrandbereichen nur schwer erreichbar oder überhaupt nicht vorhanden sind, ist die Bewältigung<br />
von Hin- und Rückfahrt am selben Tag nicht nur eine Frage der sorgfältigen Planung, sondern<br />
auch des Glücks.<br />
• Der Bezirkshauptort bzw. die Bezirkshauptstadt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur von fünf Standorten<br />
aus direkt erreichbar – die Unterkunft in Landeck, die sich am Ortsrand der Bezirkshauptstadt selbst<br />
befindet, eingeschlossen. Von der Kössener Unterkunft aus ist die Bezirkshauptstadt Kitzbühel nur eingeschränkt<br />
direkt erreichbar, in der Regel muss in St. Johann in Tirol der Bus gewechselt oder in die Bahn umgestiegen<br />
werden. Vom Standort in Leutasch aus muss im benachbarten Seefeld der Bus gewechselt oder in<br />
die Bahn umgestiegen werden. Um vom Standort in Reith im Alpbachtal in die Bezirkshauptstadt Kufstein<br />
zu gelangen, muss im benachbarten Brixlegg in den Zug umgestiegen werden.<br />
Generell ist festzustellen, dass die Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher Verkehrsmittel vor<br />
allem in den Tagesrandbereichen und an den Wochenenden stark eingeschränkt oder wie im<br />
Fall von Kössen überhaupt nicht gegeben sind. Für auf den öffentlichen Nahverkehr angewie-<br />
sene Personen verringert dies die Mobilität teils erheblich, aufgrund ihrer überwiegenden<br />
Versorgung mit Sachmitteln verschärfen bei Asylsuchenden die teils beträchtlichen<br />
Nutzungskosten der Verkehrsmittel die Situation weiter. Hin- und Rückfahrt nach Innsbruck,<br />
etwa um dort eine unabhängige Rechtsberatungseinrichtung aufzusuchen, sind so für die in<br />
größerer Entfernung untergebrachten Flüchtlinge ohne zusätzliche Einkünfte zum offiziellen<br />
„Taschengeld“ praktisch nicht bezahlbar.<br />
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Mobilität der untergebrachten<br />
Asylsuchenden nur in eingeschränktem Ausmaß gegeben und daher für den Unterkunftsgeber<br />
im Rahmen der Standortwahl offenkundig kein Entscheidungskriterium ist. Aufgrund dahin-<br />
gehender Äußerungen von Asylsuchenden, unabhängigen BetreuerInnen, aber auch Bürger-<br />
meistern und UnterkunftsleiterInnen liegt die Annahme nahe, dass dies insbesondere im Fall<br />
der Unterkünfte am „Bürgl“ und in Vils, die über den öffentlichen Nahverkehr nicht oder nur<br />
mit großem Aufwand erreichbar sind, ein zwar nicht bewusst herbeigeführter, aber gezielt zur<br />
Disziplinierung „schwieriger“ Asylsuchender genutzter Umstand ist.<br />
7.1.6 Standortmerkmal 4: Versorgungslage<br />
Je peripherer ein Standort gelegen und je eingeschränkter die Mobilität der dort unterge-<br />
brachten Asylsuchenden, desto größer ist die Bedeutung von Grundversorgungseinrichtungen<br />
180
in den oben dargestellten Bereichen 381 im Umfeld der Unterkunft. Vergleicht man nun zu-<br />
nächst die neun Unterkunftsstandorte bezüglich der Versorgung mit Gütern des täglichen Be-<br />
darfs, so ergibt sich folgendes Bild:<br />
• An vier Standorten ist eine auf dem Fußweg erreichbare Nahversorgungseinrichtung in Form eines Lebensmittel-<br />
bzw. Gemischtwarenladens oder eines Supermarkts vorhanden. Im Fall des Standorts in Reith im<br />
Alpbachtal befindet sich die Einrichtung dabei in der Nachbargemeinde Strass im Zillertal.<br />
• An einem Standort ist die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs über Einrichtungen im Nahbereich<br />
der Unterkunft nur eingeschränkt gewährleistet: In Landeck gibt es im Umfeld der Unterkunft lediglich eine<br />
Bäckerei und eine Tankstelle.<br />
• An drei Standorten ist keine Nahversorgungseinrichtung vorhanden, die dieser Bezeichnung auch durch<br />
Nähe Rechnung tragen würde. Es sind jedoch adäquate Versorgungseinrichtungen im weiteren Umfeld zu<br />
finden, die mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können.<br />
• Vom Standort am „Bürgl“ in Fieberbrunn ist weder auf dem Fußweg noch mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln ein Lebensmittel- oder Gemischtwarenmarkt erreichbar. Die untergebrachten Asylsuchenden<br />
sind auf den Transport durch Kleinbusse des Unterkunftsgebers angewiesen.<br />
Die Situation im Bereich der medizinischen, sozialen und psychologischen bzw. psychothera-<br />
peutischen Versorgung stellt sich an den neun Standorten folgendermaßen dar:<br />
• Eine medizinische Grundversorgung ist an fünf Standorten durch das Vorhandensein zumindest einer Allgemeinmedizinerin<br />
bzw. eines Allgemeinmediziners und einer Apotheke innerhalb der Gemeinde gewährleistet,<br />
im Fall von Reith im Alpbachtal werden dabei in der Regel die kaum weiter als das Ortszentrum von der<br />
Unterkunft entfernten Einrichtungen der nahen Nachbargemeinden Brixlegg und Strass genutzt. An drei<br />
Standorten ist innerhalb der Gemeinde zwar zumindest eine allgemeinmedizinische ärztliche Praxis, nicht<br />
jedoch eine Apotheke vorhanden, im Fall von Mötz verfügt die Gemeinde jedoch zumindest über eine Ortsstelle<br />
des Roten Kreuzes. An einem Standort ist die medizinische Versorgung wie jene mit Gütern des täglichen<br />
Bedarfs nur möglich, wenn die untergebrachten Asylsuchenden mit Kleinbussen des Unterkunftsgebers<br />
zur ärztlichen Praxis oder zur Apotheke gebracht werden.<br />
• Im Bereich der sozialen Versorgung ist in keiner der neun Gemeinden eine auf die spezifischen Bedürfnisse<br />
von Asylsuchenden zugeschnittene Beratungs- oder Betreuungseinrichtung zu finden; alle in diesem Bereich<br />
arbeitenden Organisationen sind in der Landeshauptstadt Innsbruck aktiv. Die im weiteren Umfeld der<br />
meisten Unterkünfte vorhandenen Sozial- und Gesundheitssprengel stellen diesbezüglich bislang nur eine<br />
potentielle Anknüpfungsmöglichkeit dar, um für die Flüchtlingsbetreuung einschlägig qualifiziertes Personal<br />
in gemeindenahe Strukturen einzubinden.<br />
• Hinsichtlich der psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung ist die Situation ähnlich, lediglich<br />
in Landeck praktiziert eine Psychologin.<br />
Im Bildungsbereich ist die Situation an den neun Standorten zweifellos besser: Überall sind<br />
Kindergärten und Volksschulen innerhalb der Gemeinde vorhanden. 382 Allerdings sind sie nur<br />
in zwei Fällen problemlos auf dem Fußweg erreichbar, an fünf Standorten verkehrt entweder<br />
ein eigener Schulbus oder es müssen öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Kinder, die<br />
am „Bürgl“ in Fieberbrunn untergebracht sind, müssen mit den Kleinbussen des Unterkunfts-<br />
gebers ins Tal transportiert werden. Dies gilt auch für den Transport zu den Hauptschulen, die<br />
in sechs Gemeinden vor Ort, in drei weiteren Fällen in einer benachbarten Kommune vorhan-<br />
den sind. Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind in sechs Standortgemeinden zu finden,<br />
in der Regel handelt es sich dabei um Volkshoch- oder Erwachsenenschulen, nur in Landeck<br />
381 Vgl. Abschnitt 1.3.<br />
382 Die gute Versorgungslage im Kindergarten- und Volksschulbereich ist nicht zuletzt auf gezielte Investitionen<br />
gerade in Tiroler Landgemeinden in den letzten Jahren zurückzuführen (vgl. Berktold 2002a und b).<br />
181
ist auch ein Berufsförderungsinstitut vorhanden. An den verbleibenden drei Standorten muss<br />
jeweils eine Nachbargemeinde aufgesucht werden.<br />
Von erheblicher Bedeutung insbesondere für die in der Regel zur Untätigkeit gezwungenen<br />
erwachsenen Asylsuchenden sind leicht zugängliche Sport- und Freizeiteinrichtungen im un-<br />
mittelbaren Nahbereich. Ein Überblick ergibt hier ein eher ernüchterndes Bild 383 :<br />
• Lediglich an einem einzigen Standort, der Unterkunft am „Bürgl“, sind auf dem Unterkunftsareal selbst<br />
diesbezügliche Einrichtungen sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in ausreichend erscheinendem<br />
Umfang gegeben.<br />
• An einem weiteren Standort wären grundsätzlich problemlos adaptierbare Außenanlagen auf dem<br />
Unterkunftsareal vorhanden, sie sind jedoch mangels entsprechender Ausstattung und Gestaltung insbesondere<br />
für Erwachsene nur bedingt bespiel- bzw. nutzbar.<br />
• An vier Standorten sind auf dem Unterkunftsareal in verschiedenem Ausmaß (teils nur auf wenigen<br />
Quadratmetern Fläche) zumindest Spielmöglichkeiten für Kinder vorhanden, jedoch kaum oder keine Möglichkeiten<br />
zur Freizeitgestaltung für Erwachsene. Auch im Nahbereich sind keine derartigen Einrichtungen<br />
vorhanden. 384<br />
• Überhaupt keine nennenswerten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Außenbereich gibt es sowohl für<br />
Kinder als auch für Erwachsene an drei Standorten. In einem Fall sind derartige Einrichtungen auch im erweiterten<br />
Nahbereich auf dem Fußweg nicht erreichbar.<br />
An zwei Standorten sind die ohnehin nur in eingeschränktem Ausmaß vorhandenen Außen-<br />
anlagen für spielende Kinder teils regelrecht gefährlich: Die einzigen Flächen, auf denen zu-<br />
mindest theoretisch Platz für raumgreifendere Spiele wie Fangen, verschiedene Ballspiele<br />
oder Radfahren wäre, sind als Parkplätze von den unmittelbar entlang führenden und teils<br />
äußerst stark befahrenen Straßen baulich nicht getrennt.<br />
Die Versorgung im ergänzungsökonomischen Bereich sowie mögliche Anknüpfungspunkte<br />
an migrantische Communities, Exilgemeinschaften und religiöse Gebetsstätten jenseits der<br />
römisch-katholischen Kirche sind an den untersuchten Standorten nur im Fall der Unterkunft<br />
in der Bezirkshauptstadt Landeck gegeben. Vom Standort in Vils aus kann immerhin mit dem<br />
Bus ohne größere Schwierigkeiten der Bezirkshauptort Reutte angefahren werden, in dem<br />
diesbezügliche Einrichtungen zu finden sind, freilich entstehen für die betreffenden Asyl-<br />
suchenden bei regelmäßiger Nutzung dadurch erhebliche Fahrtkosten. Das selbe gilt für den<br />
Standort Götzens, von dem aus Innsbruck in vergleichsweise kurzer Zeit erreicht werden<br />
kann. Von der Volderer Unterkunft aus ist es möglich, mit dem Fahrrad in die nahe Stadt Hall<br />
in Tirol zu fahren, die gleichfalls über einschlägige Einrichtungen verfügt.<br />
383 Einrichtungen innerhalb der Unterkunftsgebäude selbst, etwa Spielzimmer, wurden (dem Fokus auf die<br />
Standortthematik entsprechend) im Rahmen der Untersuchung nicht berücksichtigt, da sie den grundsätzlich<br />
relativ problemlos veränderbaren unterkunftsinternen Standards und nicht den unveränderlichen Standorteigenschaften<br />
zuzuordnen sind.<br />
384 Das Beispiel des Standorts in Reith im Alpbachtal zeigt, dass hauptamtliches Betreuungspersonal, sofern<br />
vorhanden, hier die Nutzung von Einrichtungen in der weiteren Umgebung durch Kontaktaufnahme mit den<br />
jeweils Verantwortlichen relativ problemlos organisieren und auch erwirken kann, dass Flüchtlinge kostenpflichtige<br />
Einrichtungen, etwa Badeseen, bei freiem Eintritt nutzen können. Allerdings waren von den neun im<br />
Herbst 2003 betriebenen Standorten nur an den drei vom Land Tirol selbst geführten Unterkünften in<br />
Fieberbrunn, Landeck und Reith hauptamtliche BetreuerInnen beschäftigt.<br />
182
Zusammenfassend ist damit hinsichtlich der Versorgungslage festzustellen: Mit Ausnahme<br />
des Bildungsbereichs sind an den neun Standorten in allen Bereichen teils erhebliche Mängel<br />
hinsichtlich des Zugangs zu adäquaten Einrichtungen feststellbar. Hervorzuheben ist hier vor<br />
allem die Unterkunft am „Bürgl“ in Fieberbrunn, wo eine selbständige Versorgung durch die<br />
Asylsuchenden aufgrund der extrem peripheren Lage praktisch von vornherein ausgeschlos-<br />
sen ist. Eine möglichst umfassend gewährleistete Grundversorgung, so ist daraus zu schlie-<br />
ßen, stellt für den Unterkunftsgeber kein entscheidendes Kriterium bei der Standortwahl dar.<br />
7.1.7 Standortmerkmal 5: Bauliche Ausführung, Gestalt und ursprüngliche<br />
Gebäudefunktion<br />
Wenden wir uns nun den Unterkunftsgebäuden selbst zu. Hier fällt bei einem Vergleich der<br />
neun Standorte zunächst auf, dass als touristische Beherbergungsbetriebe und damit für Kurz-<br />
aufenthalte konzipierte und errichtete Gebäude das Spektrum dominieren: Sieben der neun<br />
Unterkunftsgebäude wurden ursprünglich als Gasthäuser mit jeweils angeschlossenem Pen-<br />
sionsbetrieb genutzt. Der Gebäudekomplex am „Bürgl“ in Fieberbrunn diente als (letztlich<br />
nur kurz genutzte) Unterkunft für Bergknappen, die Gebäude auf dem Unterkunftsareal in<br />
Volders als Schulhäuser, „Knabenasyl“ und „Jugendheim“. Keine einzige der neun Unter-<br />
künfte wurde für Wohnzwecke errichtet.<br />
In allen Unterkünften können zumindest fünfzig Personen untergebracht werden, in einigen<br />
mehr als hundert Personen. Auf dem Unterkunftsareal in Volders waren nach Angaben des<br />
lokalen Bürgermeisters in den 1990ern sogar mehrere hundert Personen untergebracht. Die<br />
Unterkünfte sind daher durchgängig als Sammelunterkünfte einzustufen, im Fall der größten<br />
Unterkunft am „Bürgl“ kann zweifellos von einem Lager gesprochen werden. Bei entspre-<br />
chender Belegung gilt dies mit den Unterkünften in Vils und Volders noch für zwei weitere<br />
Standorte, bei mäßiger Belegung können die meisten der Unterkünfte als „Lagerheime“ cha-<br />
rakterisiert werden – ein von Stöger kreierter Begriff, der die Kombination von Lager- und<br />
Wohnheimelementen treffend zum Ausdruck bringt. 385 Vor diesem Hintergrund liegt der<br />
Schluss nahe, dass eine Verwendung als Sammelunterkunft im Rahmen der Standortwahl ein<br />
entscheidendes Auswahlkriterium für den Unterkunftsgeber darstellt.<br />
Hinsichtlich der Integration der Unterkunftsgebäude in die (falls überhaupt vorhanden) umge-<br />
bende Bebauung kann nur im Fall der Kössener Unterkunft davon gesprochen werden, dass<br />
sich das Haus in die Bebauungsstruktur harmonisch und selbstverständlich einfügt. Das<br />
Äußere der neun Unterkünfte ist hinsichtlich des baulichen Zustands im Kössener Fall auch<br />
als sehr gut, in sieben weiteren als ausreichend bis gut zu bewerten – an den Standorten<br />
Fieberbrunn und Reith im Alpbachtal wurden und werden durch den Unterkunftsgeber lau-<br />
fend Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, was sicherlich zur Verbesserung der dortigen Situ-<br />
ation beitragen wird. Im Fall des Areals in Volders ist jedoch der bauliche Zustand der Ge-<br />
385 Vgl. Stöger 1998, 388.<br />
183
äude als schlecht, teils sogar als desolat zu bewerten, ein Teil dieser Gebäude sollte ur-<br />
sprünglich tatsächlich abgerissen werden.<br />
Aus der vergleichenden Analyse der Unterkunftsgebäude ist daher letztlich (nicht zuletzt vor<br />
dem Hintergrund des schon zuvor hinsichtlich der Lage der Standorte Festgestellten) zu<br />
schließen: Flüchtlinge wohnen nicht. Die zur Unterbringung genutzten Gebäude sind aus-<br />
nahmslos nicht zu Wohnzwecken konzipiert, befinden sich überwiegend abseits der Wohn-<br />
gebiete oder in lediglich in Ausnahmefällen durch Wohnhäuser dominierten Mischgebieten<br />
und drücken über ihre Größe und ihre ursprüngliche Funktion aus, dass sich Menschen in<br />
ihnen zeitlich beschränkt aufhalten. Da sich der Unterkunftsgeber offenbar durchaus bewusst<br />
ist, dass die Unterbringung Asylsuchendern für ihn eine dauerhafte Aufgabe darstellt – der<br />
Ankauf des Unterkunftsareals in Reith für diesen Zweck sowie die Sanierungsarbeiten auf<br />
dem gepachteten Areal am „Bürgl“ in Fieberbrunn zeigen dies deutlich –, muss konstatiert<br />
werden: Der Unterkunftsgeber richtet Dauereinrichtungen fast ausschließlich mit provisori-<br />
schem Charakter ein.<br />
7.1.8 Standortmerkmal 6: Gemeinde- und Standortidentitäten<br />
Wenden wir uns zuletzt einem Aspekt der Standortwahl zu, der bereits in mehrfacher Hinsicht<br />
auf den Bereich der Realisierung von Unterkünften verweist: den Identitäten der Gemeinden<br />
und der konkreten Standorte. Im Fall der neun während des zweiten Halbjahres 2003 vorhan-<br />
denen Unterkünfte ergibt sich hinsichtlich der Gemeindeidentitäten ein überaus heterogenes<br />
Bild:<br />
• Die Marktgemeinde Fieberbrunn versucht sich selbstbewusst und durchaus erfolgreich im Spagat zwischen<br />
dörflicher Tradition und urbanen Events. Sie präsentiert sich relativ gefestigt.<br />
• Der Wallfahrtsort Götzens ist stark traditionell orientiert, der urbane Teil der Bevölkerung richtet seine<br />
Aktivitäten jedoch vorwiegend auf das nahe Innsbruck aus.<br />
• Selbstbewusst und eigenständig zeigt sich Kössen, das in den dominierenden Bereichen Tourismus und<br />
Landwirtschaft seinen Platz im 21. Jahrhundert gefunden zu haben scheint und hier landesweit präsent ist.<br />
• Landeck wiederum ist kleinstädtisch-modern geprägt und tritt als regionales Zentrum mit durchaus zunehmend<br />
selbstbewusst auf.<br />
• In einer Umbruchsphase befindet sich dagegen die Leutasch, die nach wie vor stark agrarisch geprägt ist.<br />
Hier gelang es der Freiheitlichen Partei entgegen dem landesweiten Trend, ihre Mandatszahl im Gemeinderat<br />
zu erhöhen.<br />
• Wie die Leutasch mitten in einer schwierigen Zeit verunsichernder Veränderungen befindet sich auch Reith<br />
im Alpbachtal, wo gegenwärtig mit verschiedenen, sich teils widersprechenden Zukunftsentwürfen experimentiert<br />
wird.<br />
• Im Sog dreier Zentren, ohne klare Identität(en) und wohl am Beginn einer Umbruchsphase befindet sich der<br />
Wallfahrtsort Mötz.<br />
• Als traditionsreiche Kleinststadt in heimelig-stabiler Zweiparteienatmosphäre präsentiert sich dagegen das<br />
gewerblich und industriell geprägte Vils im Außerfern.<br />
• Völlig konträr dazu ist schließlich die äußerst heterogen strukturierte Gemeinde Volders, die lediglich im<br />
Kampf gegen den Transitverkehr geschlossen aufzutreten scheint.<br />
Ein bestimmtes Muster ist aus diesem kurzen Überblick nicht erkennbar: Unterkünfte werden<br />
sowohl in Gemeinden mit relativ gefestigten Identitäten und stabilem Selbstbewusstsein reali-<br />
184
siert als auch in Orten, die sich mitten in schwierigen Umbruchsphasen befinden und dabei<br />
durchaus konfliktreiche Versuche einer Neupositionierung unternehmen. Es liegt daher der<br />
Schluss nahe, dass die spezifischen Identitäten der Gemeinden für den Unterkunftsgeber<br />
keinerlei Rolle bei der Standortwahl und -realisierung spielen.<br />
Dies gilt gerade auch für den damit verbundenen Bereich der Gemeindegeschichte. Unter den<br />
neun Standorten fanden sich hier – obwohl eine gezielte Auswertung der Geschichte gar nicht<br />
vorgenommen wurde – hinsichtlich der Aufnahme und Unterbringung Asylsuchender sowohl<br />
positive wie negative Bezugspunkte. Am offensichtlichsten sind derartige Aspekte im Fall der<br />
Stadt Vils: Mit ihrem durch ein Steinkreuz symbolisierten mittelalterlichen Freiungs- und<br />
Asylrecht bietet sie einen Anknüpfungspunkt in geradezu idealtypischer Form, zumal das<br />
Kreuz noch heute im Stadtzentrum zugänglich ist und so auf vielfältige Arten gezielt in die<br />
Flüchtlingsaufnahme hätte eingebunden werden können. Weder vom Unterkunftsgeber noch<br />
von der Stadtgemeinde selbst wurde dieser Teil der Gemeindegeschichte jedoch thematisiert.<br />
Am Beispiel Vils kann damit zugleich verdeutlicht werden, dass eine Nichtberücksichtigung<br />
der Identitäten und Geschichte einer Gemeinde dazu führt, dass vorhandene positive Bezugs-<br />
punkte übersehen und damit verbundene Ressourcen, welche die Standortrealisierung er-<br />
leichtern könnten, nicht genutzt werden. Für negative Bezugspunkte, welche eine Unter-<br />
kunftserrichtung potentiell erschweren können, gilt dies umgekehrt genauso.<br />
Wie sieht es mit den Identitäten der konkreten Unterkunftsorte aus? Auch hier fanden sich an<br />
den neun Standorten mehrere positive wie negative Bezugspunkte. Das Unterkunftsgebäude<br />
in Mötz kann exemplarisch für in der Geschichte des Hauses vorhandene positive Bezugs-<br />
punkte angeführt werden, wurden doch eine frühere Wirtin und ihre Familie aufgrund ihrer<br />
sozialen Haltung gegenüber „Armen und Fahrenden“ als „Heilige Familie“ in der örtlichen<br />
Wallfahrtskirche verewigt. Umgekehrt bietet die Unterkunft in Vils geradezu den Musterfall<br />
eines mit negativen Bezugspunkten ausgestatteten Unterkunftsorts: Der Unterkunftsleiter be-<br />
treibt in einem Anbau einen Nachtklub, die einschlägige Beschilderung zieht sich quer über<br />
das Unterkunftsgebäude. Die zahlreichen und überdies äußerst offensichtlichen An-<br />
knüpfungsmöglichkeiten an das medial wie politisch häufig reproduzierte Klischeebild vom<br />
„kriminellen Asylanten“, die sich daraus ergeben, wurden vom Unterkunftsgeber schlicht<br />
nicht beachtet.<br />
7.1.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortwahl<br />
Wie lassen sich die Rollen der am Prozess der Standortwahl beteiligten Parteien Unterkunfts-<br />
geber, -besitzerInnen und Gemeinden zusammenfassend charakterisieren? Die Zuordnung auf<br />
einer Aktivitäts-Passivitäts-Skala ergibt hier ein klares Bild (vgl. Abb. 1):<br />
185
Abbildung 1: Rollen von Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden bei der Standortwahl<br />
Unterkunfts-<br />
besitzerInnen<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
Unterkunfts-<br />
geber<br />
Gemeinden<br />
(Bürgermeister)<br />
aktiv passiv<br />
Während die Gemeinden, personifiziert durch den jeweiligen Bürgermeister, bei der Wahl der<br />
Standorte durchgängig passiv bleiben, treten die UnterkunftsbesitzerInnen, in der Regel<br />
Gastwirtinnen und -wirte, fast ausnahmslos aktiv auf. Schon bei der Standortsuche ist offen-<br />
kundig, dass sie den offensiven Part übernehmen: Die Wirtinnen und Wirte kontaktieren von<br />
sich aus den Unterkunftsgeber und bieten diesem Unterbringungsplätze an, in einem Fall er-<br />
folgte dieses Angebot gar ohne vorherigen Aufruf durch den Unterkunftsgeber. Auch im Be-<br />
reich der Standortentscheidung erfolgt – wie gezeigt wurde – letztlich die Vorentscheidung<br />
durch die Wirtinnen und Wirte.<br />
Das Land Tirol tritt als Unterkunftsgeber bei der Standortwahl dagegen indifferent auf. Die<br />
auf politischer Ebene verantwortlichen Personen und Organe betreiben eine unverkennbar<br />
passive Politik. Ihrer Kernaufgabe – der Erarbeitung eines politischen Zielkatalogs sowie der<br />
Formulierung verbindlicher Vorgaben, zumindest jedoch unverbindlicher Richtlinien für die<br />
Administration – kommen sie in diesem Bereich bislang nicht nach, vielmehr scheinen sie<br />
sich aus dem Prozess regelrecht „ausgeklinkt“ zu haben. Die Landesverwaltung, insbesondere<br />
der fachlich zuständige Flüchtlingskoordinator, tritt mit der beschriebenen Strategie der<br />
öffentlichen Aufrufe nur am Beginn der Standortsuche agierend in Erscheinung. In weiterer<br />
Folge wird das Einlangen der Interessensbekundungen von Wirtinnen und Wirten abgewartet<br />
und auf diese reagiert, indem die Standorte besichtigt werden und aus dem Angebot ausge-<br />
wählt wird – sofern der Unterkunftsgeber nicht von vornherein das Gefühl hat, „keine Wahl“<br />
zu haben und daher gleich mit allen InteressentInnen einen Vertragsabschluss anstrebt. Weil<br />
klare Vorgaben der Legislative bzw. der Ressortführung fehlen, handelt die Administration<br />
dabei nach eigenen Angaben „von Fall zu Fall verschieden“, die Standortentscheidungen er-<br />
folgen dementsprechend wenig transparent, häufig sind sie durchaus widersprüchlich. 386 Die<br />
sich aus dieser Vorgehensweise ergebenden oben skizzierten standortpolitischen Muster und<br />
386 So merkte etwa der Flüchtlingskoordinator des Landes im Interview an, der nach massiven Protesten der<br />
Bevölkerung nicht realisierte Standort im Osttiroler Arnbach – von ihm wird noch die Rede sein – sei „eh ungeeignet“<br />
gewesen und begründete dies wie folgt: „Das Haus, das Gasthaus ist direkt an der Durchzugsstraße,<br />
wenn du bei der Tür hinausgehst, bist du auf der Hauptstraße, da sind schon zweimal LKW hineingefahren –<br />
wenn da Kinder oder was drinnen sind: Es gibt keinen Platz rundherum, nicht? [...] Schon von der Lage her ... da<br />
hab ich sagen müssen: Das geht nicht.“ (Interview Logar 10.10.2003, Z 251-254) Im Fall der bereits zuvor realisierten<br />
Unterkunft in Vils sowie bei der Ende 2003 realisierten Unterkunft in Landeck waren nahezu die selben<br />
Standortmerkmale freilich kein Hinderungsgrund für eine positive Entscheidung.<br />
186
Merkmale werden vom Unterkunftsgeber akzeptiert, teils, so scheint es, auch gezielt für an-<br />
dere Zwecke, etwa die Disziplinierung „schwieriger“ Personen, genutzt. Eine systematisch<br />
geplante und also gezielte Wahl von Unterkünften, welche die konstatierten Merkmale auf-<br />
weisen, ist angesichts des weder klar aktiven noch eindeutig passiven Vorgehens der Admi-<br />
nistration 387 nicht erkennbar, im Ergebnis scheint jedoch für die untersuchten Standorte das<br />
Urteil von Kayed et al., hier werde eine „Politik der Desintegration“ betrieben 388 , durchaus<br />
gerechtfertigt.<br />
7.2 Die Realisierung der Unterkunftsstandorte<br />
Wenden wir uns nun dem Bereich der Standortrealisierung zu. Mit welchen Strategien und<br />
Methoden verwirklicht der Unterkunftsgeber in den betroffenen Gemeinden neue Unter-<br />
künfte? Wer wird in diesen Prozess eingebunden, wer nicht? Und welche Funktion wird den<br />
jeweiligen Gemeinden in dieser Phase zugeschrieben bzw. schreiben diese sich selbst zu?<br />
7.2.1 Die Rolle der Bürgermeister: Information, nicht Einbindung<br />
Jene FunktionsträgerInnen, die auf kommunaler Ebene aufgrund ihres Amtes und ihrer demo-<br />
kratischen Legitimation für den Unterkunftsgeber die ersten AnsprechspartnerInnen darstel-<br />
len, sind die BürgermeisterInnen. Auch wenn ihnen formal aufgrund der üblichen privatrecht-<br />
lichen Verträge zwischen Unterkunftsgeber und UnterkunftsbesitzerIn keinerlei Mitsprache-<br />
recht zukommt, nehmen sie im Bereich der Standortrealisierung als „MeinungsmacherInnen“<br />
eine gewichtige Position ein. Ihre Interventionsmöglichkeiten reichen von der engagierten<br />
Unterstützung des Vorhabens über moderierende Vermittlung zwischen Unterkunftsgeber und<br />
Bevölkerung bis hin zur offensiven Ablehnung der Unterkunft. Die Wirkung ihres Handelns<br />
kann dabei weit über die Gemeinde hinaus reichen und unter Umständen, zuletzt etwa im Fall<br />
Landeck, bundesweite Reaktionen hervorrufen.<br />
Die Rolle, die das Land Tirol den Bürgermeistern bei der Realisierung neuer Unterkünfte zu-<br />
schreibt, ist eindeutig: Der Unterkunftsgeber informiert über seine Absicht, in der betroffenen<br />
Gemeinde eine Unterkunft einzurichten. Die diesbezügliche Entscheidung ist jedoch bereits<br />
gefallen, auch die nötigen Verhandlungen mit den UnterkunftsbesitzerInnen sind in der Regel<br />
abgeschlossen. Nur zwei der neun Bürgermeister gaben im Interview an, zumindest um ihre<br />
Meinung zu diesem Vorhaben gefragt worden zu sein. 389 Einige Bürgermeister betonten, sie<br />
387 Die von verschiedenen Seiten vorgenommene Charakterisierung der Tiroler Flüchtlingspolitik als lediglich<br />
„verwaltend“ und „administrierend“ (vgl. etwa Kayed et al. 2002; Pletzer 2002) ist daher für den untersuchten<br />
Bereich als durchaus zutreffend zu bewerten.<br />
388 Kayed et al.2002, 28.<br />
389 Vgl. Interviews Erd 31.10.2003; Mühlberger 03.11.2003. Erd gab allerdings an, nicht direkt von der zuständigen<br />
Flüchtlingskoordinationsstelle des Landes Tirol informiert worden zu sein, sondern von der Bezirkshauptmannschaft<br />
Reutte; Mühlberger stellte fest, er sei vom zuständigen Flüchtlingskoordinator telefonisch kontaktiert<br />
worden, habe mit ihm jedoch schon zuvor regelmäßig Kontakt wegen der Gründung eines lokalen und<br />
Sozial- und Gesundheitssprengels gehalten.<br />
187
seien lediglich „in Kenntnis gesetzt“ bzw. informiert worden 390 , ein Gemeindeoberhaupt<br />
strich heraus, „nicht gefragt“ worden zu sein. 391 Zwei weitere Bürgermeister gaben an, die<br />
Gemeinde sei nicht einmal informiert worden. 392 Die Strategie des Unterkunftsgebers in der<br />
Frage der Einbeziehung der Gemeinden kann damit in drei Worten zusammengefasst werden:<br />
Information, nicht Einbindung.<br />
7.2.2 Die Rolle der Bevölkerung: Weder Einbindung noch Information<br />
Welche Rolle kommt bei der Realisierung neuer Unterkünfte der Bevölkerung, insbesondere<br />
den AnwohnerInnen zu? Auch hier ergibt sich aus einem vergleichenden Überblick schnell<br />
ein klares Bild: Die Bevölkerung wird vom Unterkunftsgeber weder eingebunden noch infor-<br />
miert, dies bleibt weitestgehend der jeweiligen Gemeindeführung überlassen. Damit entsteht<br />
ein „Informationsvakuum“, das einen geradezu idealen Nährboden für Gerüchte aller Art<br />
bietet – während des zweiten Halbjahrs 2003 wurde dies etwa bei der Realisierung der Land-<br />
ecker Unterkunft deutlich. In einzelnen Fällen erkannten Bürgermeister dieses Vakuum recht-<br />
zeitig und versuchten, es durch gezielte Kontaktaufnahme mit den NachbarInnen der Unter-<br />
kunft oder auch der Gemeindebevölkerung insgesamt zu beseitigen 393 , an anderen Standorten<br />
reagierten die Bürgermeister auf sich häufende Gerüchte oder Vorwürfe. Ansonsten unter-<br />
blieb eine Information der Bevölkerung zur Gänze. Freilich gab es seitens des Unterkunfts-<br />
gebers in der Vergangenheit durchaus den Versuch, BürgerInnen im Rahmen von Versamm-<br />
lungen zu informieren. Der Versuch muss jedoch als gescheitert angesehen werden: Die Situ-<br />
ation entglitt den Vertretern des Landes völlig und eskalierte.<br />
7.2.3 Die Rolle der lokalen Eliten: Modellfall Kössen<br />
Offenkundig mit der bisherigen Vorgangsweise des Unterkunftsgebers nicht ganz zufrieden<br />
griff der Bürgermeister der Gemeinde Kössen, Stefan Mühlberger, im Herbst 2002 zur<br />
Selbsthilfe und berief kurzerhand einen „runden Tisch“ mit lokalen MeinungsbildnerInnen<br />
und dem für die Standortrealisierung zuständigen Flüchtlingskoordinator des Landes ein. Er-<br />
gebnis der Konferenz war eine schriftliche Mitteilung an die BürgerInnen, die im Gemeinde-<br />
blatt publiziert und vom Bürgermeister, einer Vertreterin der Ortsstelle des Roten Kreuzes<br />
und einem Vertreter des Pfarrgemeinderats unterzeichnet wurde. Mühlberger beschritt so ei-<br />
nen Mittelweg zwischen Information und Einbindung, dem vor allem symbolische Bedeutung<br />
zukommt: VertreterInnen wichtiger und anerkannter lokaler Institutionen und Organisationen<br />
– lokale „Eliten“ – beraten gemeinsam mit dem Unterkunftsgeber die Unterbringung Asyl-<br />
suchender und ihre Auswirkungen auf den Ort und signalisieren so, dass die Errichtung der<br />
390<br />
Vgl. Interviews Bürgermeister 01/1, 2003; 04/1, 2003; 05/1, 2003; so auch der Landecker Bürgermeister<br />
Stenico in Rundschau 16.12.2003.<br />
391<br />
Vgl. Interview Grander 06.11.2003.<br />
392<br />
Vgl. Interviews Bürgermeister 02/1, 2003 und Payr 12.03.2004. Im letztgenannten Fall ging es allerdings<br />
nicht um die Realisierung eines gänzlich neuen Standorts auf Gemeindegebiet, sondern um die Adaptierung der<br />
von bosnischen Kriegsflüchtlingen genutzten Unterkunft als dauerhafte Einrichtung für Asylsuchende.<br />
393<br />
Auf die betreffenden Beispiele wird weiter unten noch näher einzugehen sein.<br />
188
örtlichen Unterkunft wohlüberlegt und im Konsens erfolgt sei. Nach dem erfolgreichen<br />
Kössener Muster wurde diese lokale „Elitenkonferenz“ vom Unterkunftsgeber in der Folge<br />
auch in Mötz und in Landeck veranstaltet, allerdings in veränderter Form. Die Gratwanderung<br />
zwischen Information und Einbindung misslang daher in beiden Fällen: In Mötz fand das<br />
Treffen erst nach bereits erfolgter Standortrealisierung statt, in Landeck wurde die Zusam-<br />
menkunft gar als Pressekonferenz gestaltet und geriet zum zentralen Bestandteil der Inszenie-<br />
rung der Unterkunftseröffnung als „Weihnachtsmärchen“. Das Kössener Modell, das gerade<br />
nicht den Eindruck vermittelte, hier würde lediglich eine bereits vor einiger Zeit und an ande-<br />
rer Stelle getroffene Entscheidung öffentlich gemacht, ohne dass sich die versammelten Eliten<br />
ernsthaft mit den Auswirkungen auseinandergesetzt hätten, scheint dem Unterkunftsgeber<br />
letztlich nur bedingt brauchbar – auch in einer erweiterten Form, welche die Teilnahme des<br />
Bürgermeisters einer jener Gemeinden einschließt, in denen bereits Asylsuchende unterge-<br />
bracht werden. Der zuständige Flüchtlingskoordinator des Landes hält im Interview diesbe-<br />
züglich lapidar fest: „Wenn jemand überzeugt dagegen ist, oder die <strong>Medien</strong> dagegen sind,<br />
dann bringt das auch nichts.“ 394<br />
7.2.4 Die Zustimmung der Gemeinden: Überzeugungsarbeit, Überrumpelungstaktik<br />
oder politischer Druck?<br />
Ob Information des Bürgermeisters, Benachrichtigung der Bevölkerung oder „Elitenkon-<br />
ferenz“: Bei all dem ist erforderlich, dass die Gemeindeführung der Standortrealisierung zu-<br />
gestimmt oder diese zumindest stillschweigend akzeptiert und signalisiert hat, nichts gegen<br />
die geplante Unterkunft unternehmen zu wollen. Doch wie erreicht der Unterkunftsgeber<br />
diese Zustimmung? Abgesehen von der Möglichkeit, dass die Gemeindeführung von sich aus<br />
bereits beim Erstkontakt deutlich macht, keine Einwände gegen vorbringen zu wollen, reicht<br />
hier die Bandbreite möglicher Strategien von der Aufgabe des Vorhabens bei kommunalem<br />
Widerstand über argumentative Überzeugungsarbeit, die Vereinbarung von „Gegengeschäf-<br />
ten“ im Interesse beider Seiten oder „Drückermethoden“, mit denen der Gemeinde Zusagen<br />
gegeben werden, an deren Einhaltung jedoch nicht ernsthaft gedacht ist, bis hin zu politi-<br />
schem Druck auf die Gemeindeführung oder einer schlichten Überrumpelungstaktik.<br />
Aus den Ausführungen der Bürgermeister in den geführten Gesprächen wie auch in regiona-<br />
len <strong>Medien</strong> ist zu schließen, dass sich der Unterkunftsgeber bei der Realisierung neuer Unter-<br />
künfte vorrangig auf zwei der genannten Strategien beschränkt. Während in drei Fällen – an<br />
den Standorten Fieberbrunn, Kössen und Vils – die Bürgermeister aus jeweils unterschied-<br />
lichen Gründen von sich aus signalisierten, die Unterkunft nicht verhindern oder sie sogar<br />
unterstützen zu wollen, stellten gleich vier der neun Gemeindeoberhäupter teils selbstkritisch,<br />
teils enttäuscht, teils deutlich verärgert fest, es seien ihnen vom Unterkunftsgeber vor Reali-<br />
sierung des Standorts Zusicherungen gegeben worden, die dann nicht eingehalten worden<br />
wären. Oben bereits erwähnt wurden die diesbezüglichen öffentlichen Äußerungen des Bür-<br />
394 Interview Logar 15.03.2004.<br />
189
germeisters von Volders, der von einer persönlichen und verbindlichen Zusage des Unter-<br />
kunftsgebers berichtet, in Volders nach der Schließung des „Flüchtlingsheims Kleinvolder-<br />
berg“ keine Asylsuchenden mehr unterzubringen – schon ein Jahr später realisierte das Land<br />
auf dem Areal erneut eine Unterkunft, der Bürgermeister war davon erst gar nicht informiert<br />
worden. Ein anderer Bürgermeister berichtet im Interview, das Land Tirol habe in seiner Ge-<br />
meinde achtzig Asylsuchende unterbringen wollen. Man habe sich schließlich auf „maximal<br />
fünfzig“ geeinigt, er sei jedoch überzeugt, dass in der lokalen Unterkunft „mehr drin sind“. 395<br />
Natürlich werde man, so das Gemeindeoberhaupt, den Verstoß gegen die Vereinbarung nicht<br />
sofort „in die Zeitung geben“ und sagen: „Nein, das ist jetzt nicht, was ausgemacht ist!“, aber<br />
grundsätzlich hätte sich das Land an die Abmachung eigentlich zu halten. 396 Der Bürgermeis-<br />
ter führt außerdem die Zusicherung einer „Rundumbetreuung, also 24 Stunden“, für die<br />
untergebrachten Asylsuchenden an – diesbezüglich habe das Land die Gemeinde „schon im<br />
Stich gelassen“. 397 Auch hinsichtlich der in der Unterkunft lebenden Kinder ist dem<br />
Gemeindeoberhaupt eine Zusage erinnerlich, die nicht eingehalten worden wäre: „Sobald’s<br />
über drei sind wird unten eine eigene Betreuung eingerichtet ... [...] War halt letzten Endes<br />
auch nicht der Fall ...“ 398<br />
Regelrecht erbost zeigt sich im Gespräch ein weiterer Bürgermeister. Die Unterkunft in seiner<br />
Gemeinde – es handelt sich dabei um einen Gasthof – sei für fünfzig Personen zugelassen,<br />
wie bei einer im Hinblick auf Brandschutzmaßnahmen durchgeführten Überprüfung von<br />
Sachverständigen schon vor längerer Zeit festgestellt worden sei:<br />
„Und ich bin also dann draufgekommen, dass also grad am Anfang meiner [Amts-]Periode [...] diese Höchstanzahl<br />
immer wieder – und zwar permanent! – überschritten worden ist. [...] Also es waren dann meistens – jetzt<br />
sag ich einmal vorsichtig: zwischen sechzig und siebzig Flüchtlinge da. Und ich hab mich dann einmal mit<br />
meinem Anwalt in Verbindung gesetzt und hab gesagt: Das kann doch nicht so sein! Wir haben dann mehrere<br />
also Anzeigen an die Gewerbebehörde gemacht, mit null Erfolg, muss ich sagen. Bis es mir dann – oder der<br />
Gemeinde – zu blöd geworden ist, und wir haben dann auch den Bezirkshauptmann davon in Kenntnis gesetzt.<br />
Es hat dann ein gemeinsames Gespräch gegeben, mit dem [Flüchtlingskoordinator] Herrn Logar, mit mir, mit<br />
dem Bezirkshauptmann, [...] und der Bezirkshauptmann hat also dann klar die Gewerbebehörde beauftragt, man<br />
möge also diese Höchstanzahl laufend überprüfen. Na ja. [...] Ich reg mich also sicher nicht auf, wenn jetzt ein,<br />
zwei mehr oben sind, aber jetzt grad wieder vor circa zwei Wochen hab ich’s halt wieder mit der ... mit dem<br />
Meldeamt abgesprochen – waren halt wieder über sechzig.“ 399<br />
Er habe ja „schon mehrmals gedroht“, so der Bürgermeister, er werde künftig „einmal tat-<br />
sächlich hart einschreiten und einfach jetzt was über fünfzig ist – ja, es klingt zwar hart, aber:<br />
ausweisen lassen“. 400 Denn wenn in der Unterkunft etwas passiere, werde sonst jeder ihn da-<br />
für verantwortlich machen:<br />
395<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 183-186. Berichte der regionalen Tagespresse bestätigen diese Annahme<br />
sowohl für das zweite Halbjahr 2003 als auch für das Folgejahr.<br />
396<br />
Ebd., Z 188ff.<br />
397<br />
Ebd., Z 341ff.<br />
398<br />
Ebd., Z 388ff.<br />
399<br />
Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 42-54.<br />
400 Ebd., 65ff.<br />
190
„Der Blöde bin hundertprozentig ich! Das ist dann fix. Obwohl, Gott sei Dank, ich jetzt also lückenlos dokumentiere<br />
und immer wieder die ... also diese Leitungsbehörde und die Gewerbebehörde aufmerksam mache, dass<br />
mehr Leute dort schlafen, wie erlaubt sind. Ich mein’, ich versteh schon die [...] Besitzerin auch, ich mein’, sie<br />
erklärt mir das immer so: Das geht ruckzuck – da werden irgendwo fünf aufgegriffen, Flüchtlinge, von irgendwoher,<br />
und nirgends ist ein Platz, dann wird angerufen und da wissen sie, dass da ... dass da also über die<br />
Höchstzahl hinaus die Möglichkeit besteht. Also dann hab ich halt statt drei vier oder fünf drinnenliegen ... Und<br />
in solchen Notfällen wird das halt dann übernommen, und die bleiben dann halt dort. [...] Das stellt ein Riesenproblem<br />
dar. Ich mein’ ... Noch einmal: Ich hab dann nichts unternommen, da ... da bei den zuständigen Stellen<br />
beim Land, also da wär’ vehement zu urgieren ...“ 401<br />
Von einer anderen Zusage des Unterkunftsgebers, die dieser nicht eingehalten habe, berichtet<br />
verärgert der Bürgermeister einer vierten Gemeinde:<br />
„Die Voraussetzung ist diejenige gewesen, dass er hat damals behauptet – was in Wirklichkeit ja dann letztlich<br />
nicht gestimmt hat –, da wären persische Flüchtlinge, katholische Flüchtlinge, die von den Mullahs unten mit<br />
Leib und Leben bedroht wären, die warten da, also quasi auf einer Art Durchlauf, bis das Visum fertig ist, um<br />
nach Amerika auswandern zu können. Das war die Situation. In diesem Glauben ist man verblieben. Ich bis<br />
heute noch. Allerdings bin ich dann draufgekommen, dass da Russen dort waren, und die ... da hab ich einmal<br />
jetzt in der Tageszeitung einen Artikel gelesen, dass da ... da muss ... zum Teil gewesen sein, wo’s eine ganze<br />
Reihe von Handys und zusammengestohlene Sachen gefunden haben. [...] Von einem Russen war aber nie die<br />
Rede. Nur von solchen Leuten! Bitte – aber so weit kann’s ja nicht gehen!“ 402<br />
Mehrere Bürgermeister äußerten im Interview, dass sie in den Unterkünften in ihren Gemein-<br />
den möglichst Familien untergebracht wissen wollen. „Am liebsten ist mir, wenn Familien<br />
mit Kindern unten sind“, hielt etwa ein Gemeindeoberhaupt fest und begründete dies mit<br />
einem Vergleich:<br />
„[...] irgendwie sieht man schon einigermaßen, ist das jetzt eine Familie, die wirklich in ... in Schwierigkeiten<br />
war, oder sind ... oder sind das jetzt nur so junge Männer, die da ... halt aus ... nur aus wirtschaftlichen Gründen<br />
da sind oder ... oder meinen, wir haben da das Paradies oder ... Kriminelle ...“ 403<br />
Familien, so ist daraus zu schließen, werden in den Gemeinden eher akzeptiert als allein-<br />
stehende junge Männer. 404 Ein anderer Bürgermeister begründet dies damit, dass Familien<br />
weniger „Schwierigkeiten“ verursachen würden: „Seit die Familien da sind – mehrheitlich<br />
Familien, so muss ich sagen –, hör ich eigentlich fast nichts.“ 405 Auch wenn sich diese Wahr-<br />
nehmungen in keiner Weise mit jenen der UnterkunftsleiterInnen decken (einige Unter-<br />
kunftsleiterInnen klagten im Interview gerade über lautstarke familieninterne Konflikte und<br />
Konflikte zwischen verschiedenen Familien), erkannte der Unterkunftsgeber Ende 2003 die<br />
diesem Bürgermeisterwunsch zugrundeliegende Symbolkraft des Bildes „herbergssuchender<br />
Familien“: Bei der Realisierung des Standorts Landeck wurde explizit angekündigt, es wür-<br />
den vorwiegend Menschen „im Familienverband“ in die neue Unterkunft einziehen. 406 Aus<br />
den Berichten der lokalen und regionalen Presse ist zu schließen, dass es sich dabei um eine<br />
gezielte Inszenierung für die Startphase handelte, mit der unter Anknüpfung an den „Mit-<br />
401 Ebd., Z 79-89.<br />
402 Interview Bürgermeister 01/1, 2003, Z 10-20; Hervorhebungen im Original.<br />
403 Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 383 bzw. 604ff.<br />
404 So bereits die Erkenntnisse von Brunner et al. 1994 und 2003; Fuchshofer 1994.<br />
405 Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 269ff.<br />
406 Vgl. Rundschau 16.12.2003.<br />
191
leidsdiskurs“ 407 die Darstellung der Unterkunftseröffnung als „Weihnachtsmärchen“ unter-<br />
stützt werden sollte: Damit ausreichend Familien einziehen konnten, mussten diese aus ande-<br />
ren Unterkünften, unter anderem aus der Leutasch, eigens umgesiedelt werden. 408 Da die<br />
durchschnittliche Belegung einer Unterkunft nach allen Erfahrungen weder ausschließlich<br />
noch vorwiegend aus Familien besteht – dazu ist der Anteil der im Familienverband lebenden<br />
Flüchtlinge an der Gesamtzahl der Asylsuchenden schlicht zu gering – und überdies alle<br />
Bürgermeister möglichst Familien in ihren Gemeinden untergebracht wissen wollen, war trotz<br />
aller Inszenierung von vornherein absehbar, dass die Belegung der Landecker Unterkunft<br />
nicht lange aufrecht- und diesbezügliche Zusicherungen nur kurz einzuhalten sein würden.<br />
Von einer weiteren Strategie, die teils parallel mit den eben skizzierten Praktiken zur Anwen-<br />
dung gelangte, berichten gleich sechs der neun Bürgermeister: Sie fühlten sich mehr oder we-<br />
niger überrumpelt, weil sie aus ihrer Sicht vom Unterkunftsgeber zu spät informiert worden<br />
waren. „Wir sind zu spät eingebunden worden. Ja? Wir sind zu spät eingebunden worden“,<br />
hält etwa ein Bürgermeister mit Nachdruck fest – alles sei schon fixiert gewesen, das Land<br />
habe sich „halt im letzten Moment, wo man eigentlich nichts mehr machen hat können“, ge-<br />
meldet. 409 Er vermutet eine gezielte Taktik des Landes: „Ich glaub, da war auch eine be-<br />
stimmte Absicht, damit man das irgendwie nicht ... damit’s nicht aufgeschaukelt wird, aber<br />
man hat eigentlich dann das Gegenteil erreicht.“ 410 Ein anderer Bürgermeister spricht davon,<br />
die Unterkunft in seiner Gemeinde sei „still und heimlich“ realisiert worden: „Das hat dann<br />
schon Aufregung gegeben im Gemeinderat, aber im Endeffekt hat man’s dann halt einfach in<br />
dieser Form – also einfach so, wie’s war – akzeptiert. Man war zwar nicht einverstanden, hat<br />
aber auch dagegen nichts unternommen.“ 411 Der Bürgermeister einer dritten Gemeinde hält<br />
verärgert fest, von den Verhandlungen zwischen Unterkunftsgeber und -besitzer nicht ver-<br />
ständigt worden zu sein: „Ich bin überhaupt nicht. Bin überhaupt nicht informiert worden. [...]<br />
Also mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt [...].“ 412 Erst als die Realisierung<br />
des Standorts bereits fixiert gewesen sei, habe ihn der Flüchtlingskoordinator des Landes „in<br />
Kenntnis gesetzt“: „Jawoll, das ist die Situation, so, der [Besitzer] hat sich bemüht drum, hat<br />
sich angeboten, und sie sind heilfroh, dass sie noch eine Unterkunft haben, für derartige.<br />
Bitteschön, alles klar.“ 413<br />
Zwei Gemeindeoberhäupter stellten – wie oben kurz erwähnt – fest, überhaupt nicht infor-<br />
miert worden zu sein: In Fieberbrunn hielt Bürgermeister Grander fest, „natürlich nicht ge-<br />
407<br />
Vgl. hierzu Abschnitt 5.5.<br />
408<br />
Vgl. Rundschau 23.12.2003a. Der diesbezügliche Bericht der Oberländer Rundschau zitiert sogar den Leutascher<br />
Unterkunftsleiter, der einer aus seiner Unterkunft nach Landeck umgesiedelten Familie „nur das beste<br />
Zeugnis ausstellen“ wollte: „Das sind nette Leute, die von uns heraufkommen.“<br />
409<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 16f bzw. Z 74f.<br />
410<br />
Ebd., Z 17f.<br />
411<br />
Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 14-21.<br />
412<br />
Interview Bürgermeister 01/1, 2003, 28ff.<br />
413 Ebd., Z 47ff.<br />
192
fragt worden“ zu sein, man habe ihn auch nicht zu den Verhandlungen zwischen Unterkunfts-<br />
geber und -besitzer eingeladen. 414 Grander kritisiert das formal fehlende Mitspracherecht der<br />
Gemeindeführung:<br />
„Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hab ich auch keine Freude, dass die Gemeinden überhaupt kein Recht<br />
haben. Also, wenn ein Privater heut’ seine Lokalitäten dem Land Tirol verpachtet für Flüchtlinge, dann brauchen<br />
sie uns weder fragen noch was zu sagen oder so. Es passiert höchstwahrscheinlich nicht, weil so gescheit sind ja<br />
die Leut’ oben im Land auch, dass sie da die Gemeinden nicht ganz schockieren wollen.“ 415<br />
Auch ein weiterer Bürgermeister hält – im Unterschied zu Grander, der die unterbliebene In-<br />
formation gelassen nahm, sichtlich verärgert – fest: „Ich war nicht informiert. Und dann ha-<br />
ben wir gehört, über ... Leut’, dass da [...] Flüchtlinge sind [...].“ 416 Im Interview droht das<br />
Gemeindeoberhaupt erbost, gegen die Unterkunft „konkret was zu tun – was immer es ist“. Er<br />
sei zwar der Meinung, dass man die Leute nicht „vor den Kopf schlagen“ solle, „obwohl sie<br />
uns schon vor den Kopf geschlagen haben, weil sie selber haben radikal die Leut’ hereinge-<br />
nommen“, aber:<br />
„Wir werden natürlich jetzt hergehen und versuchen, da Überprüfungen zu machen, und die Überprüfungen<br />
werden sehr streng sein. [...] Gell? Und wenn da eine Kleinigkeit passiert, ist das Heim zu! [...] Da ist mir auch<br />
völlig egal, wer das ist. Das können Sie denen auch ruhig sagen! [...] Mir ist das gleich, weil ... mir ist das überhaupt<br />
kein Problem! Es werden mit Sicherheit Überprüfungen kommen.“ 417<br />
Nach Einschätzung des Vilser Bürgermeisters, der sich als eines von lediglich zwei Gemein-<br />
deoberhäuptern rechtzeitig und ausreichend informiert und eingebunden fühlte, stellt die Er-<br />
öffnung eines Unterkunftsstandortes ohne vorherige Information eine nicht akzeptable Brüs-<br />
kierung der Gemeindeführung dar:<br />
„Wenn man natürlich jetzt einen überhaupt nicht informiert – das tät’ ich schlecht finden, nicht? Gell. Dass der<br />
auf einmal aus den <strong>Medien</strong> erfahren muss oder irgendwo, oder schon wenn sie schon da sind – du, da sind heut’<br />
fünfzig Flüchtlinge eingezogen, und man weiß da nichts als Bürgermeister, dann ist man da irgendwo auch bloßgestellt<br />
irgendwo. [...] Weil das ja die ... die Bürger sofort fragen: Ja hast du das zugesagt, oder warst du da dagegen,<br />
oder ... Weil da wirst du ja gefragt!“ 418<br />
Annähernd in dieser Form bloßgestellt wurde jedoch noch ein weiterer Bürgermeister, der<br />
dies im Interview auch sehr anschaulich schildert:<br />
„Ich muss ganz ehrlich sagen: Das ist so schnell gegangen – ich war oben in Innsbruck, und da ruft mich die<br />
Landesrat Gangl an und ... und ... und hat ihr Anliegen halt gebracht: »Es kommen Flüchtlinge zum A., das<br />
haben wir soweit abgeschlossen ...« Und ich war in Innsbruck mit dem Auto auf dem Weg und ... und derweil<br />
sind sie schon dagewesen!“ 419<br />
414 Interview Grander 06.11.2003, Z 15f.<br />
415 Ebd., Z 202-206; Hervorhebung im Original.<br />
416 Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 134f.<br />
417 Ebd., Z 167f bzw. 170-178.<br />
418 Interview Erd 31.10.2003, Z 487-494.<br />
419 Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 107-110; die Unterkunftsbezeichnung wurde anonymisiert.<br />
193
Auch dieser Bürgermeister hatte den Eindruck, dass er vom Unterkunftsgeber mit Absicht<br />
nicht früher informiert wurde: „Sie werden schon Erfahrung haben, wie man die Leut’ überrascht,<br />
ein bisschen ... Sie werden’s schon haben.“ 420<br />
Insgesamt ergibt sich damit ein eindeutiges Bild: In sieben Gemeinden wurde das Vorhaben<br />
des Landes, einen neuen Unterkunftsstandort einzurichten, nicht von vornherein unterstützt<br />
oder zumindest ohne Einwände akzeptiert. Der Unterkunftsgeber erachtete es hier daher für<br />
nötig, sich um die Zustimmung der Gemeinden zu bemühen. In all diesen Fällen kam dabei<br />
eine von zwei Strategien zum Einsatz – oder gleich beide gemeinsam. An sechs Standorten<br />
wurde eine „Überrumpelungstaktik“ angewandt: Die betroffenen Bürgermeister fühlten sich<br />
teils zu spät informiert, teils berichteten sie, erst während oder nach der Eröffnung der Unter-<br />
kunft verständigt worden zu sein, in zwei Fällen unterblieb eine Information überhaupt. An<br />
fünf Standorten machte der Unterkunftsgeber offenbar taktische Zusagen, die ein Eingehen<br />
auf die spezifischen Wünsche der jeweiligen Bürgermeister hinsichtlich der Zahl, des Fami-<br />
lienstands oder der Betreuung der unterzubringenden Asylsuchenden suggerierten, in der<br />
Folge jedoch nicht eingehalten wurden oder von vornherein nicht realisierbar waren. Schenkt<br />
man den Schilderungen der betroffenen Bürgermeister Glauben, muss der Umgang mit man-<br />
chen Zusagen als geradezu unverfroren bezeichnet werden – in einzelnen Fällen scheint tat-<br />
sächlich eine gewisse Ähnlichkeit zu „Drückermethoden“ zu bestehen.<br />
Doch was geschieht, wenn beide Strategien erfolglos bleiben? Im Fall einer Gemeinde rea-<br />
gierte der Unterkunftsgeber auf diesen Umstand mit massivem politischen Druck. Bereits die<br />
Verständigung erfolgte nicht über den eigentlich zuständigen Flüchtlingskoordinator oder<br />
wenigstens das politisch verantwortliche Sozialressort der Landesregierung, sondern über den<br />
damals für Gemeindeangelegenheiten zuständigen Landesrat Konrad Streiter (ÖVP). Der<br />
Bürgermeister interpretierte dies als „Wink mit dem Zaunpfahl“:<br />
„Der [Landesrat Streiter] hat jetzt, sag ich ... Er hat zwar – und da will ich jetzt ihm auch keine Schuld nicht<br />
geben –, ihm hat man halt, weil er halt mit den Gemeinden immer zu tun hat, hat man halt geglaubt, der tut sich<br />
mit den Gemeinden leichter ... [...] Weil er hat ja auch den Topf, nicht? Wie ... Diesen Fülltopf, nicht? So wird’s<br />
ja letztendlich sein, nicht?“ 421<br />
Hätte die Gemeinde nicht doch noch der Realisierung einer Unterkunft im Ort zugestimmt, so<br />
der Bürgermeister, hätte sie wohl mit finanziellen Nachteilen rechnen müssen:<br />
„[...] wenn wir da nicht unt-... nicht ... zugestimmt hätten, trau ich mich offen sagen, hätten wir viele Nachteile<br />
gehabt. Wir sind keine reiche Gemeinde, nicht? [...] Dann ist man immer wieder angewiesen ... Wenn ich heute<br />
der Bürgermeister von B. bin, wo so viel Gewerbe ist, wo ... eine reiche Gemeinde ist, dann denk ich mir: Ja, die<br />
können mir gestohlen bleiben. Nicht?<br />
Hat’s da so Signale gegeben, politische?<br />
Ja, ja! [...] Wir hätten sicher Nachteile gehabt. [...] Also wir haben schon so Signale ... die sind dann schon von<br />
den Beamten ausgegangen ... [...] Inzwischen geht’s uns ja finanziell besser, weil wir Grundstücke verkauft<br />
420 Ebd., Z 139f.<br />
421 Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 31-35. Zu den realen Einflussmöglichkeiten des Landes auf die Politik<br />
der Gemeinden im Rahmen des sogenannten „grauen Finanzausgleichs“ vgl. Weber 2004, 86.<br />
194
haben, nicht? Und verkaufen haben müssen, nicht? Aber ... Ich mein’, wir haben [...] wenig Betriebe, dafür hab<br />
ich hundert Kilometer Gemeindestraße zu betreuen.“ 422<br />
Im Rückblick etwas verbittert resümiert das Gemeindeoberhaupt: „Ich mein’, wenn ich jetzt<br />
hergegangen wär’ als Bürgermeister und hätte bei der ... da gesagt: »Nein, Herr Landesrat:<br />
Nur über meine Leiche!« Ob wir’s dann letzten Endes verhindern hätten können – das sag ich<br />
jetzt einmal wertfrei – das ist ja ... das ist was anderes, ich glaub, dass wir’s nicht verhindern<br />
hätten können.“ 423<br />
Die vorrangig angewandten Strategien des Unterkunftsgebers, so kann hier abschließend fest-<br />
gestellt werden, sind offenkundig ausschließlich auf den kurzfristigen und unmittelbaren Er-<br />
folg ausgerichtet. Mittel- bis langfristig wird damit jedoch – dies wurde an den teils verärger-<br />
ten, teils verbitterten Aussagen der betroffenen Bürgermeister deutlich – auf lokaler Ebene<br />
„verbrannte Erde“ geschaffen.<br />
7.2.5 Die Vorbereitung der Unterkunftsleitungen: »Sprung ins kalte Wasser«<br />
Ähnlich wie die Bürgermeister mehrerer Gemeinden fühlten sich auch einige Gastwirtinnen<br />
und -wirte bei der Standortrealisierung vom Unterkunftsgeber „überrumpelt“. Eine Wirtin<br />
sprach gar von einem regelrechten „Sprung ins kalte Wasser“, der ihr zugemutet worden<br />
sei. 424 Dieses Vorgehen des Landes kann im Unterschied zum Umgang mit den Gemeindefüh-<br />
rungen jedoch kaum als taktisch motiviert gewertet werden – der Unterkunftsgeber kann dar-<br />
aus offenkundig keinerlei Vorteile ziehen – und wurde von den Unterkunftsleitungen auch<br />
nicht so empfunden. Ebenfalls kaum als Erklärung für die „Überrumpelung“ der Unter-<br />
kunftsleiterInnen in Frage kommt die Dringlichkeit, neue Unterkunftsplätze zu organisieren<br />
und damit verbundener massiver Zeitdruck auf Seiten des Landes: Gerade in jenen Fällen, wo<br />
sich die Unterkunftsleitungen besonders überrascht fühlten, verging zwischen ihren Inter-<br />
essensbekundungen und der tatsächlichen Realisierung des Standorts derart viel Zeit, dass<br />
selbst eine umfassende Vorbereitung der Leitungen zeitlich nicht die geringsten Schwierig-<br />
keiten bereitet hätte. 425 Das Vorgehen spiegelt, so muss daraus wohl geschlossen werden,<br />
schlicht die Geringschätzung der mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung verbunde-<br />
nen und von den UnterkunftsleiterInnen zu leistenden Arbeit. Diese Geringschätzung kommt<br />
nicht zuletzt auch darin zum Ausdruck, dass sich die Wirtinnen und Wirte keinem Auswahl-<br />
verfahren hinsichtlich ihrer Qualifikationen zu unterziehen haben – der Unterkunftsgeber be-<br />
zahlt damit letztlich für die „gut kontrollierte Versorgung und Aufbewahrung“ 426 der Flücht-<br />
422 Interview Bürgermeister 05/1, Z 253-274; der Name einer in der Nähe liegenden Gemeinde wurde anonymisiert,<br />
die Frage des Interviewers kursiv gesetzt.<br />
423 Ebd., Z 36ff.<br />
424 Interview Unterkunftsleitung 04/1, 04.11.2003, Z 17.<br />
425 Vgl. Interviews Unterkunftsleitung 04/1 und 04/2, 04.11.2003 sowie 07/1 und 07/2, 05.12.2003.<br />
426 Münker-Kramer/Gmeiner 2000, 294.<br />
195
linge, nicht für deren Betreuung. Von den übrigen österreichischen Bundesländern unterscheidet<br />
er sich darin freilich in keiner Weise. 427<br />
7.2.6 Keine Konfliktprävention, keine professionelle Konfliktlösung<br />
Wie aus den Einzelfalldarstellungen ersichtlich, kam es bei der Realisierung der im zweiten<br />
Halbjahr 2003 vorhandenen Standorte in einzelnen Fällen zu teils eskalierenden Konflikten<br />
mit den betroffenen Gemeinden oder der Bevölkerung. Bereits am Beginn des Realisierungs-<br />
prozesses konfliktvorbeugend agiert wurde – außer in Kössen, wo dies nicht etwa durch den<br />
Unterkunftsgeber, sondern durch die Gemeindeführung selbst erfolgte – in keinem Fall. Der<br />
Unterkunftsgeber überlässt die Prävention faktisch den Kommunen, diese ordnen sie jedoch<br />
nicht zu Unrecht seinem Aufgabenbereich zu, weshalb sie im Ergebnis unterbleibt.<br />
Wie agieren nun Unterkunftsgeber und Gemeinden, wenn es zu derart massivem Widerstand<br />
durch die unter Umständen in eigenen Initiativen zusammengeschlossenen BürgerInnen<br />
kommt, dass der Konflikt regional oder gar überregional Aufmerksamkeit erregt und vollends<br />
zu eskalieren droht? Im Fall der untersuchten Standorte kam es zuletzt in Reith im Alpbachtal<br />
zu einem derartigen Szenario. Der Bürgermeister machte zwar deutlich, dass er dem Vorha-<br />
ben des Landes eher ablehnend gegenüberstand, hielt sich jedoch öffentlich bedeckt. Der<br />
damals ressortzuständige Landeshauptmannstellvertreter Prock sowie der Flüchtlingskoordi-<br />
nator des Landes entschieden als Vertreter des Unterkunftsgebers, sich im Rahmen zweier<br />
BürgerInnenversammlungen persönlich den Fragen der Bevölkerung zu stellen. Berichte von<br />
Beteiligten machen deutlich, dass insbesondere Prock die aufgeheizte Stimmung in der Ge-<br />
meinde jedoch nicht etwa zu entspannen suchte, sondern im Gegenteil wesentlich zu ihrer<br />
Eskalation beitrug: Wie bereits in der diesbezüglichen Einzelfalldarstellung geschildert 428 ,<br />
kündigte er vor den anwesenden BürgerInnen an, den Standort auch gegen den Widerstand<br />
der Gemeinde realisieren zu wollen – wenn die Gemeinde das Areal des ehemaligen Gasthofs<br />
nicht wie gewünscht umwidmen sollte, werde man das Haus eben mit einer Gasthauskonzes-<br />
sion führen. Auf diese gleichermaßen trotzige wie provokante Ansage folgte wenig überra-<br />
schend ein Sturm der Entrüstung, der in seiner Heftigkeit wohl auch den Unterkunftsgeber<br />
selbst überraschte – einige BürgerInnen verschafften sich offenbar sogar durch die Beschädigung<br />
des am Versammlungsort abgestellten Autos des Flüchtlingskoordinators Luft. 429<br />
Erst gar nicht so weit kam es im Fall des kleinen Osttiroler Dorfes Arnbach, das noch auf<br />
Gemeindegebiet von Sillian unweit der österreichisch-italienischen Grenze liegt: Im ersten<br />
Halbjahr 2003 wurde dort bekannt, dass vom Land Tirol mit der Besitzerin eines leerstehen-<br />
den Gasthofs über die Realisierung einer Unterkunft verhandelt würde. Sofort bildete sich<br />
eine lokale BürgerInneninitiative, die in wenigen Tage beachtliche 400 Unterschriften gegen<br />
427 Vgl. ebd.; Gulis 2003b; Kremla 2003.<br />
428 Vgl. Abschnitt 7.7.4.<br />
429 Vgl. Interview Logar 10.10.2003.<br />
196
das Vorhaben sammelte. Der von aufgebrachten BürgerInnen kontaktierte Direktor eines 200-<br />
Betten-Hotels, Dieter Wurmböck, ließ über die Tiroler Tageszeitung wissen: „Das Asylanten-<br />
heim würde die touristische Weiterentwicklung der gesamten Region beeinträchtigen. Wir<br />
hatten schon bisher mit illegalen Grenzgängern massive Probleme. Die Diebstahl- und Ein-<br />
bruchserie im vergangenen Sommer hat viele Gäste stark verunsichert.“ 430 Der Obmann des<br />
Sillianer Pfarrgemeinderats, Peter Trojer, installierte auf seinem in der Nachbarschaft des<br />
Gasthofs liegenden Privatgrund gar eine Tafel mit der Aufschrift: „Wir setzen uns zur<br />
Wehr!!!“ 431 Er werde, so Trojer gegenüber einem Journalisten, als Nachbar „Kontakt zur Be-<br />
sitzerin aufnehmen und sie bitten, ihr Angebot, Flüchtlinge aufzunehmen, rückgängig zu ma-<br />
chen. Ich habe Verständnis für die Ängste der Dorfbewohner.“ 432 Wie sein Reither Amtskol-<br />
lege hielt sich der Sillianer Bürgermeister öffentlich bedeckt. Für den Unterkunftsgeber kam<br />
der massive Widerstand indessen offenbar völlig überraschend – der zuständige Flüchtlings-<br />
koordinator merkt im Interview an, er habe der Gebäudebesitzerin ja eigentlich nur zugesagt,<br />
er komme in den Ort, um sich das Haus anzusehen: „Ich war noch nicht einmal dort ... ich<br />
mein’: Irgendwer hat das an die Öffentlichkeit gebracht ...“ 433 Von der Realisierung des<br />
Standorts sah man in der Folge lieber ab.<br />
7.2.7 Die Startphase: Begleitung und Betreuung als Gemeindesache<br />
Abgeschlossen wird der Prozess der Standortrealisierung mit dem Bezug der Unterkunft<br />
durch die ersten Asylsuchenden. Die daran anschließenden ersten Wochen und Monate, ge-<br />
wissermaßen die „Startphase“ der Unterbringung, stellen eine besonders sensible Zeit dar:<br />
Hier kommt es zum in der Regel ersten Aufeinandertreffen der bereits zuvor ansässigen<br />
NachbarInnen und der nun hier untergebrachten Asylsuchenden im nachbarschaftlichen All-<br />
tag – für beide Seiten eine große Herausforderung. Erwartungen oder Vorurteile werden bes-<br />
tätigt oder widerlegt, das Zusammenleben „spielt sich ein“, wie es ein Nachbar der Götzner<br />
Unterkunft im Rückblick formuliert 434 , oder eben nicht. Konfliktvorbeugende und -vermit-<br />
telnde Nachbarschaftsarbeit ist in dieser Situation unerlässlich.<br />
Ein Beispiel aus der Gemeinde Kössen: Nachdem die ersten Asylsuchenden in der Unterkunft<br />
eingetroffen waren, beschwerten sich bald einige KössenerInnen über eine von ihnen glei-<br />
chermaßen unerwartete wie unerwünschte Form der Kontaktaufnahme durch Flüchtlinge. „Sie<br />
sind überall hingegangen und haben um Arbeit gefragt“, erzählt der Bürgermeister im Rück-<br />
blick: „Das ist den Leuten lästig gewesen.“ 435 Gerade in jenen Fällen, in denen wie in Kössen<br />
Asylsuchende in von Wirtinnen oder Wirten geführten Gasthöfen untergebracht werden, läuft<br />
die Startphase unter besonders problematischen Rahmenbedingungen ab: Aufgrund ihrer feh-<br />
430<br />
Wurmböck, zit. nach Tiroler Tageszeitung 06.02.2003.<br />
431<br />
Vgl. dazu die Fotographie im „Leserforum“ der Tiroler Tageszeitung vom 08./09.02.2003, 26.<br />
432<br />
Trojer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 06.02.2003.<br />
433<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 239ff.<br />
434<br />
Vgl. Fragebogen 01, 2003, 4.<br />
435<br />
Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 55f.<br />
197
lenden Qualifikation und Vorbereitung sind die Wirtsleute oft überfordert, für eine „Mit-<br />
betreuung“ allenfalls vorhandener NachbarInnen und des Kontakts zwischen eben diesen und<br />
den Flüchtlingen bleibt so gut wie keine Zeit. Eine Gesamtschau der Einzelfalldarstellungen<br />
zeigt jedoch, dass der Unterkunftsgeber bislang nur in den von ihm selbst betriebenen Unter-<br />
künften in Fieberbrunn, Landeck und Reith eine zumindest werk- und untertags tätige Betreu-<br />
ungsperson stellt. An den übrigen Standorten, nachts und an den Wochenenden aber auch an<br />
den drei genannten bleibt damit jede Form der Betreuung den Gemeinden überlassen, was<br />
mehrere Bürgermeister äußerst kritisch bewerteten. Offenkundig beeinflusst von Berichten<br />
der regionalen Tagespresse über „kriminelle Asylanten“ aus Georgien äußerte ein Gemeinde-<br />
oberhaupt vor allem Sorgen hinsichtlich der fehlenden Kontrolle bestimmter Asylsuchender:<br />
„[...] es sind ja offensichtlich tatsächlich Sachen passiert, also heuer war’s schon einmal schlimm, da haben wir<br />
so da Kaukasier dagehabt, die ... Aber da haben wir dann gesagt, die müssen sie uns wegtun, weil ... Also wie ich<br />
die gesehen hab – und ich hab da unsere Gendarmen da gesehen –, das sind so Bären gewesen, so einen Meter<br />
neunzig und ... sicher waren das so austrainierte Geheimdienstler oder Gauner ... Also wie ich die gesehen hab,<br />
hab ich mir gedacht: Na, heiliges Kreuz! [...] Also da – wenn’s da zu einem Zwischenfall kommt, dann haben<br />
unsere Gendarmen keine Chance, nicht?“ 436<br />
Für die Startphase hatte der Bürgermeister vor allem eines befürchtet:<br />
„Am meisten Angst hab ich gehabt – wie gesagt ja, das wär’s Schlimmste für einen Bürgermeister, dass irgendwie<br />
eine Vergewa... Vergewaltigung von einer Frau oder von einem Kind oder sowas wäre, nicht? Vor dem hab<br />
ich am meisten ...<br />
Das haben wir in Tirol aber noch nie gehabt.<br />
Ja ... Ich sag: Das sind ja meistens ... meistens sind’s ... sind’s eh Einheimische ... Aber ... Aber wehe, wenn ...<br />
wenn’s jetzt einer ... [...] Das muss ich aber auch verstehen, dass man sagt: Ja, das sind junge Männer, irgendwie<br />
werden sie das halt einmal ... müssen sie sich austoben ... Also das wär’ eigentlich das Schlimmste gewesen. Und<br />
das sind auch insgeheim die Befürchtungen speziell seitens der [...] weiblichen Bevölkerung, dass sie sich halt<br />
dann nicht mehr so getraut haben, da allein spazieren zu gehen, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert.“ 437<br />
Der Bürgermeister fühlte sich wegen der aus seiner Sicht unzureichenden Betreuung vom<br />
Unterkunftsgeber – wie bereits an anderer Stelle erwähnt – „im Stich gelassen“. 438 An zwei<br />
anderen Standorten griff die Gemeindeführung dagegen zur Selbsthilfe und organisierte auf<br />
kommunaler Ebene Begleiter für die Startphase: In Vils stand den Asylsuchenden eine Weile<br />
ein ehemaliger Bezirkshauptmannstellvertreter als „Kontaktmann“ zur Verfügung, der sie vor<br />
allem sprachlich ein wenig unterstützen sollte. In Kössen engagierte die Gemeinde einen pen-<br />
sionierten Lehrer, der mit den Flüchtlingen unter anderem Ortsrundgänge unternahm und ih-<br />
nen dabei Einrichtungen wie das Gemeindeamt, die lokale Polizei oder die Ortsstelle des Ro-<br />
ten Kreuzes vorstellte. Eine längerfristige Begleitung scheiterte allerdings: Nach Darstellung<br />
des Bürgermeisters funktionierte die Beziehung zwischen dem Begleiter und der Flüchtlings-<br />
koordinationsstelle des Landes nicht, eine andere Betreuungsperson konnte in der Gemeinde<br />
jedoch nicht gefunden werden. 439<br />
436<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 112-118.<br />
437<br />
Ebd., Z 324-337; die Frage des Interviewers ist kursiv gesetzt.<br />
438<br />
Ebd., Z 341ff.<br />
439<br />
Vgl. Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 285-294. Auch wenn natürlich nicht auszuschließen ist, dass das<br />
Scheitern der unterstützenden Begleitung in Kössen tatsächlich in persönlichen Animositäten zwischen dem<br />
Begleiter und dem Unterkunftsgeber begründet war, legen Berichte verschiedener zivilgesellschaftlicher und<br />
198
7.2.8 Von Gegenseitigkeit keine Spur:<br />
Kommunales Defizitgeschäft Flüchtlingsaufnahme<br />
Das Beispiel Kössen und die dort anfänglich von der Gemeinde organisierte Begleitung der<br />
Startphase zeigt bereits: Die Unterbringung von Asylsuchenden verursacht nicht nur für den<br />
Unterkunftsgeber, sondern trotz ihres formal fehlenden Mitspracherechts auch für die betrof-<br />
fenen Kommunen Kosten. Vor dem Hintergrund der zunehmend prekären finanziellen (und<br />
personellen) Lage vieler Gemeinden nicht nur in strukturschwachen Gebieten 440 ist daher ein<br />
Projekt wie die Realisierung einer Flüchtlingsunterkunft auch als kommunalpolitische<br />
Kosten-Nutzen-Frage zu sehen. Im Zuge der Erhebungen während des zweiten Halbjahrs<br />
2003 wurde rasch deutlich, dass die Unterbringung Asylsuchender letztlich für alle Gemein-<br />
den mit erhöhtem finanziellem Aufwand verbunden ist – Abgeltung bekäme man meist ja<br />
keine, so etwa der Kössener Bürgermeister, „also es bleibt halt bei uns finanziell ein bisschen<br />
was hängen oder personell“. 441 Als mit der Unterbringung verbundene „Grundkosten“ sind<br />
dabei vor allem die zusätzlichen Aufwendungen im Bereich des Meldewesens zu qualifizie-<br />
ren. So hielten etwa ein Bürgermeister und der von ihm eigens herbeigeholte Gemeindesek-<br />
retär im Gespräch fest, die Abwicklung der Meldeformalitäten sei „für uns ganz eine schöne<br />
administrative Belastung“ 442 :<br />
„B: [...] wir müssen’s ja genauso machen, wie wenn’s ein ...<br />
S: Ja ja ...<br />
B: ... ein Österreicher wär’. An- und Abmelden, nicht?<br />
S: Ja ... Also bei den meisten Leuten ist schon ein rechter Wechsel, nicht?<br />
B: Ja. Da ist halt eine ganz schöne Fluktuation, nicht? Das ist schon ... schon ein bisschen Arbeit.<br />
S: Ja ... Es ist sicher eine zusätzliche Arbeit. Wenn man ... wenn andere Leut’ so hin- und herwandern täten, das<br />
wär’ ordentlich ...“ 443<br />
Bürgermeister und Gemeindesekretär beziehen sich hier offensichtlich auf das Belegungsma-<br />
nagement des Unterkunftsgebers, in dessen Verantwortung die nicht zuletzt durch häufige<br />
Verlegungen Asylsuchender von einem Standort zum anderen verursachte „ganz schöne<br />
Fluktuation“ liegt. Diesen Aspekt unterstreicht auch der Bürgermeister einer anderen Ge-<br />
meinde: Wenn „natürlich da regelmäßig Austausch ist, oft wöchentlich zehn <strong>Neue</strong> kommen,<br />
zehn gehen, dann ist das schon für die Gemeinde, sag ich jetzt, ein [...] Mehraufwand, das<br />
ganze Meldeamt, ja. Dann oft auch die Identitätsfeststellung – na ja, ob das alles immer so<br />
kirchlicher Organisationen und Einzelpersonen nahe, dass der Unterkunftsgeber die Entwicklung persönlicher<br />
Beziehungen zwischen Begleiter und Flüchtlingen, damit verbunden dessen zunehmende „Parteilichkeit“ für die<br />
Asylsuchenden und letztlich die kritische „Einmischung“ eines Außenstehenden in die eigene Unterbringungs-<br />
und Betreuungspraxis fürchtete. So berichtet etwa Pletzer (2002, 5), als Psychotherapeutin in Innsbruck tätig, der<br />
Unterkunftsgeber habe sie im Vorfeld einiger Besuche in einer Unterkunft vor der Gefahr von „zu engen Bindungen<br />
an die Flüchtlinge“ gewarnt, „es könne dadurch zu Eifersuchtsszenen unter den Flüchtlingen kommen,<br />
und man wolle keine Unruhe erzeugen“.<br />
440 Vgl. Hink 2004; O. Pohl 2004.<br />
441 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 536f. Er sei daher auch „nicht gleich der, der was »ja« schreit“, wenn es<br />
um die Organisation etwa einer dauerhaften Vor-Ort-Betreuung der Flüchtlinge auf kommunaler Ebene ginge, so<br />
Mühlberger im Interview lachend – „jetzt als Gemeinde kann ich das fast nicht befürworten, weil das fällt ja auf<br />
die Gemeinde dann zurück“ (ebd., Z 533f).<br />
442 Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 664f.<br />
443 Gespräch zwischen Bürgermeister (B) und Gemeindesekretär (S) in ebd., Z 685-692.<br />
199
lupenrein abläuft, das wage ich zu bezweifeln.“ 444 Auf den „unheimlichen Wechsel“ bezieht<br />
sich im Interview auch der Vilser Bürgermeister. Dieser bedeute für die Stadt „unheimlich<br />
viel Mehrarbeit“:<br />
„Die sind ja nie lange da, nicht? Und dann sind sie wieder weg. Und dann kommen wieder andere ... [...] Und es<br />
ist ja so: Wenn da jetzt so fünf, sechs <strong>Neue</strong> kommen an einem Vormittag, dann dauert das oft zwei, drei Stunden,<br />
bis das ... Weil die können ja kein Wort Deutsch, und das ... Weil unsere Leut’ können ja auch nicht alle<br />
Sprachen, nicht? Und das ist oft sehr schwierig, da dann die ganzen Daten und alles irgendwo ... Weil die kommen<br />
ja mit null her, nicht? Mancher hat ... so ein Papier, aber ...“ 445<br />
Eine Sekretärin der Stadt befasse sich „eigentlich nur mit den Flüchtlingen“ – und sei da nun<br />
schon langsam spezialisiert, so der Bürgermeister lachend: „Sie kann schon viele Wörter von<br />
vielen, vielen Sprachen.“ 446<br />
Unmittelbare finanzielle Ausgaben entstehen den meisten Gemeinden durch Übernahme der<br />
Kindergartenbeiträge für Flüchtlingskinder. Der Unterkunftsgeber ginge, so die Darstellung<br />
mehrerer Bürgermeister, grundsätzlich davon aus, dass die Kommunen bei allenfalls am<br />
Standort untergebrachten Kindern auf die Einhebung der Kindergartenbeiträge verzichten<br />
würden. Das Ansinnen ist nur vordergründig eine ausschließlich finanzielle Frage, tatsächlich<br />
ist es von einiger kommunalpolitischer Brisanz, denn der Unterkunftsgeber bringt die Ge-<br />
meindeoberhäupter damit in eine „no-win-Situation“: Entscheiden sie sich für den Verzicht<br />
auf die Einhebung, drohen Proteste anderer, unter Umständen tatsächlich armer Eltern, die<br />
weiter den vollen Beitrag zu entrichten haben und sich nun benachteiligt fühlen. Beharrt die<br />
Gemeindeführung dagegen auf der Einhebung, droht eine Etikettierung als „unsozial“ und<br />
„kalt“ – von anderen GemeindebürgerInnen. Ein Bürgermeister entschied sich vor diesem<br />
Hintergrund, einen Verzicht auf die Einhebung kategorisch abzulehnen:<br />
„Das haben wir, die Gemeinde, das haben wir nicht gemacht, weil da ... da ... Dafür haben sie dann Sponsoren,<br />
oder hat’s dann ... Weil ... Weil da kriegt man dann einen Wirbel, weil es ist einer Arbeitnehmerfamilie – die<br />
Kindergartenbeiträge sind gar nicht so niedrig, wenn sie sagen: »Wir müssen zahlen, und denen ... denen ...«<br />
Also das haben wir gesagt: Nein! Das ... das ... Da geht’s einfach um ... ums Grundsätzliche, weil sie dann sagen:<br />
»Nein, also das ... das geht nicht.« Gell? »Wir müssen zahlen und das ist ...« [...] Es sind schon genug Familien<br />
in Tirol ... [...] Schon die Überlegung, ob sie jetzt eine Schiwoche fürs Kind oder einen Ausflug, ob sie sich das<br />
leisten können, wenn’s Auto kaputt ist oder die Waschmaschine – also ... es [...] schwimmen viele Leut’ nicht in<br />
Geld. Also daher kann man d auch nicht machen, dass man sagt: Nein, die brauchen nicht zu zahlen, aber da der<br />
– was weiß ich – Familienvater oder so, die müssen’s zahlen.“ 447<br />
Ein anderer Bürgermeister entschied, die Kosten für den Kindergartenbesuch zwar zu tragen,<br />
dazu jedoch möglichst nicht öffentlich Stellung zu nehmen – „weil ich muss ja auch vorsich-<br />
tig sein, [...] ich muss halt auch auf die Stimmung da im Kindergarten schauen, weil es gibt da<br />
auch einige, die sagen halt: »Warum zahlen wir, und die einen nicht?«“ 448<br />
444<br />
Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 256-259.<br />
445<br />
Interview Erd 31.10.2003, Z 76-84.<br />
446<br />
Ebd., Z 217.<br />
447<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, 691-405.<br />
448<br />
Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 144f.<br />
200
Weitere Kosten für die Kommunen entstehen in durchaus unterschiedlichen Bereichen: In<br />
einer Gemeinde holt der kommunale Schulbus mittlerweile auch die in der Unterkunft leben-<br />
den Kinder ab 449 , eine andere Gemeinde unterstützt die Anschaffung von Schulsachen und<br />
verschiedene Freizeitaktivitäten finanziell 450 , in einer dritten Gemeinde sorgen die örtliche<br />
Freiwillige Feuerwehr oder die Ortsstelle des Roten Kreuzes für den Transport der Asyl-<br />
suchenden zu den von der Bezirkshauptmannschaft geforderten regelmäßigen Gesundheits-<br />
untersuchungen – für den Bürgermeister der betreffenden Gemeinde eine Selbstverständlich-<br />
keit: „Da bist du doch verantwortlich einfach, nicht?“ 451 Nach dem Selbstmord eines in seiner<br />
Gemeinde untergebrachten Flüchtlings sorgte ein Bürgermeister gar für die Übernahme der<br />
Begräbniskosten auf dem Gemeindefriedhof. 452<br />
Dieser Überblick zeigt deutlich: Gemeinden dienen nicht lediglich als „Parkplatz“ für vorü-<br />
bergehend unterzubringende Asylsuchende. Faktisch gewinnen die Kommunen mit der Reali-<br />
sierung einer Unterkunft neue BürgerInnen – mit allen damit verbundenen Kosten. Diese<br />
neuen BürgerInnen brächten jedoch, so der frühere Götzner Bürgermeister Werner Singer,<br />
umgekehrt durchaus auch (materiellen) Nutzen. Seine Gemeinde habe dadurch „schon Millio-<br />
nen Schilling kassiert“:<br />
„Das klingt jetzt eigenartig, wenn ich das so sag. Ich begründe das: [...] Die Flüchtlinge sind als Hauptwohnsitz<br />
da gemeldet, weil sie sonst nirgends gemeldet sind, sie zählen bei der Volkszählung mit. Im 91er Jahr war<br />
Volkszählung, da waren siebzig Flüchtlinge da – und wir haben zehn Jahre für die Flüchtlinge Abgabenertragsanteile<br />
kassiert bis zum Geht-nicht-mehr.“ 453<br />
Tatsächlich ist die Höhe der Zuwendungen, die im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen<br />
Bund, Ländern und Gemeinden an letztere ergehen, über die Pro-Kopf-Ertragsanteile an die<br />
EinwohnerInnenzahl gekoppelt – auch der ehemalige Bürgermeister von Gries am Brenner,<br />
Andreas Hörtnagl, spricht daher davon, seine Gemeinde habe durch die Unterbringung von<br />
Flüchtlingen „bedeutend mehr Geld herausgekriegt, natürlich“. 454<br />
Der über den Finanzausgleich erreichbare finanzielle Nutzen ist für die Gemeinden freilich<br />
nicht kurz-, sondern mittel- bis langfristig erreichbar, überdies ist er in keiner Weise plan- und<br />
steuerbar: Sind während der Volkszählung wenige oder keine Asylsuchende untergebracht,<br />
steigen auch die Ertragsanteile kaum oder gar nicht. Dem stehen jedoch die schon mit Beginn<br />
der Unterbringung auftretenden Kosten gegenüber, wobei der Unterkunftsgeber – wie oben<br />
dargestellt – zusätzlich auch darauf drängt, dass auf die Einhebung formal von ihm an die<br />
Kommunen zu leistender Beiträge verzichtet wird. Die Aufnahme und Unterbringung Asyl-<br />
suchender ist, so scheint es, in Tirol daher gegenwärtig ein kommunales Defizitgeschäft.<br />
Dieser Aspekt wird vom Unterkunftsgeber im Rahmen der Standortsuche und -realisierung<br />
449 Vgl. Interview Bürgermeister 05/1, 2003.<br />
450 Vgl. Interviews Grander 06.11.2003; Unterkunftsleitung 05/1, 06.11.2003.<br />
451 Vgl. Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 375.<br />
452 Vgl. Interview Beratung/Betreuung 09, 18.08.2004.<br />
453 Interview Singer 05.12.2003, Z 126-130.<br />
454 Interview Hörtnagl 10.03.2004, Z 228f.<br />
201
offensichtlich zu wenig berücksichtigt. Dass das nüchterne Verhandeln über mögliche mate-<br />
rielle Vor- und Nachteile sowie allfällige Kompensationen jenseits floskelhafter Beschwö-<br />
rungsformeln über einen aus der Flüchtlingsunterbringung zu ziehenden ideellen Gewinn<br />
(etwa durch die vielzitierte „kulturelle Bereicherung“) durchaus erfolgversprechend wäre,<br />
deutete auch einer der neun Bürgermeister im Interview an: Zwei Jahre vor Realisierung der<br />
Unterkunft, so das Gemeindeoberhaupt, hätte es für das Unterkunftsgebäude einen Interes-<br />
senten gegeben, der darin gerne ein Bordell eingerichtet hätte. Dem Bürgermeister – er hatte<br />
zuvor davon berichtet, dass die Bevölkerung in der Umgebung der Unterkunft über eine Ab-<br />
wertung der Grundstücke und Häuser sowie eine Verschlechterung der Wohnqualität wegen<br />
der Asylsuchenden geklagt hätte, weil der Ruf der Gegend gelitten habe 455 – erschien das<br />
geplante Bordell als durchaus akzeptable Einrichtung, denn „das wär’ dann gehupft wie ge-<br />
sprungen gewesen ... Steuerlich, weil das mit den Flüchtlingen ...“ 456 Auch die in der Umge-<br />
bung wohnende Bevölkerung habe ihm gesagt: „Da wär’ uns lieber das Puff gewesen als da<br />
dieses ...“ 457 Die alte Volksweisheit, wonach Geld nicht „stinke“, scheint sich hier also zu<br />
bestätigen – ein Ansatzpunkt, den der Unterkunftsgeber bei der Standortrealisierung bislang<br />
unberücksichtigt ließ.<br />
7.2.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess<br />
der Standortrealisierung<br />
Wenn wir nun zusammenfassend die Rollen der am Prozess der Standortrealisierung beteilig-<br />
ten Parteien Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden charakterisieren, ergibt sich auf<br />
einer Aktivitäts-Passivitäts-Skala eine relativ klare Zuordnung (vgl. Abb. 2):<br />
Abbildung 2: Die Rollen von Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden<br />
bei der Standortrealisierung<br />
Unterkunfts-<br />
geber<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
Gemeinden<br />
(Bürgermeister)<br />
Unterkunfts-<br />
besitzerInnen<br />
aktiv passiv<br />
Anders als bei der Standortsuche und -wahl treten die UnterkunftsbesitzerInnen bei der Reali-<br />
sierung der Unterkünfte durchwegs passiv auf. Während sich die Gemeinden im Realisie-<br />
rungsprozess mehrheitlich indifferent zeigen und viele Bürgermeister – sofern sie überhaupt<br />
informiert wurden – eine klare Positionierung vermeiden, tritt das Land Tirol als Unterkunfts-<br />
455 Vgl. Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 228-231.<br />
456 Ebd., Z 91ff.<br />
457 Ebd., Z 95f.<br />
202
geber hier durchgängig aktiv auf. Diese Aktivität ergibt sich freilich aus der schon formal er-<br />
forderlichen Rollenverteilung: Nur der Unterkunftsgeber selbst kann entscheiden, wann er wo<br />
eine neue Unterkunft in Betrieb nimmt. Den übrigen Beteiligen gibt er damit im Realisie-<br />
rungsprozess nicht nur das Tempo vor, er entscheidet zusätzlich, welche der Beteiligten wann<br />
in welchem Ausmaß informiert oder gar eingebunden werden. Wie im Überblick deutlich<br />
wurde, agiert der Unterkunftsgeber hier mit einer teils bemerkenswerten Rücksichtslosigkeit,<br />
die im Ergebnis in einigen Fällen „verbrannte Erde“ hinterließ: Gleich mehrere Gemeinden<br />
fühlten sich regelrecht überrumpelt oder durch nicht eingehaltene Zusagen „über den Tisch<br />
gezogen“.<br />
Letztlich, so muss auch im Bereich der Realisierung neuer Unterkünfte festgestellt werden,<br />
wird die diesbezügliche Politik in Ermangelung verbindlicher Regelungen oder zumindest<br />
unverbindlicher Richtlinien durch die Verwaltungsebene gestaltet und formuliert. Die politi-<br />
sche Ebene, personifiziert im ressortzuständigen Mitglied der Landesregierung, beschränkte<br />
bei den untersuchten Standorten ihre Tätigkeit im wesentlichen auf die unterstützende Be-<br />
gleitung der Arbeit der Administration und steht dieser im Konfliktfall wie in Reith im Alp-<br />
bachtal notfalls auch als „Feuerwehr“ zur Verfügung.<br />
8 Standortwahl und Realisierung von Unterkunftsstandorten:<br />
Das Jahr 2004 im Überblick<br />
Können die eben festgestellten Standortmerkmale und standortpolitischen Praktiken tatsäch-<br />
lich als Strukturmuster gewertet werden? Anders gefragt: Wurden die konstatierten Muster in<br />
der Folgezeit weiter fortgeschrieben oder kam es zu Adaptierungen oder gar zu gänzlich<br />
neuen Entwicklungen in den untersuchten Bereichen? Eine überblicksartige Analyse der vom<br />
Unterkunftsgeber im gesamten Jahr 2004 bewusst oder unbewusst angewandten Kriterien und<br />
Strategien soll zur Klärung dieser Fragen beitragen.<br />
8.1 Die Standorte<br />
Neun Unterkünfte hatte das Land Tirol im zweiten Halbjahr 2003 betrieben oder, wie im Fall<br />
des Standorts in Landeck, kurz vor Jahreswechsel in Betrieb genommen. Im Lauf des Jahres<br />
2004 kam eine Reihe weiterer Standorte hinzu – nicht zuletzt aufgrund des dringenden Be-<br />
darfs an Unterbringungsplätzen im Zuge der Umstellung auf das System der „Grundversor-<br />
gung“. Im ersten Halbjahr 2004 wurden an folgenden Standorten Unterkünfte für Asyl-<br />
suchende realisiert:<br />
• Ehrwald: Die am Fuß der Zugspitze „auf gesunden 1.000 m“ – so der lokale Tourismus-<br />
verband 458 – gelegene und 2.638 EinwohnerInnen zählende Gemeinde befindet sich im<br />
458 Tourismusverband Ehrwald-Zugspitze 2004 (Homepage).<br />
203
Außerfern (Bezirk Reutte). Ehrwald, ein „typisches Tiroler Gebirgsdorf, das auf seine<br />
Tradition und seine herrliche Natur baut“ 459 , ist eine klassische Tourismusgemeinde: Mit<br />
mehr als 385.000 Nächtigungen im Jahr 2003 nimmt der Ort in diesem Bereich den<br />
zweiten Rang im Bezirk ein. 460<br />
• Erl: Das unmittelbar am Inn (und an der Grenze zu Deutschland) auf 476 Meter Höhe<br />
gelegene Dorf im äußersten Norden des Bezirks Kufstein zählt 1.408 EinwohnerInnen<br />
und verfügt über „schmucke Häuser und Erbhöfe, wie Kücken [sic!] um die Dorfkirche<br />
geschart“. 461 Als Standort der Erler „Passionsspiele“ ist die landwirtschaftlich dominierte<br />
Gemeinde zumindest während der Festspielzeit touristisch attraktiv, die Menschen im<br />
Dorf, so der lokale Tourismusverband, seien jedoch auch sonst „Gastgeber, denen man<br />
vertrauen kann“. 462 Erl ist eine typische PendlerInnengemeinde im Sog der Bezirkshaupt-<br />
stadt Kufstein.<br />
• Innsbruck-Mentlberg: Mit der Unterbringung von Asylsuchenden im landeseigenen<br />
Schloss Mentlberg am westlichen Rand des gleichnamigen Stadtteils (und der Stadt<br />
selbst) wurde mehr als ein Jahr nach der Schließung der nur vorübergehend betriebenen<br />
Unterkunft im „Hotel clima“ ein Standort in der Landeshauptstadt eröffnet.<br />
• Kirchberg: Das 5.120 EinwohnerInnen zählende Kirchberg im Bezirk Kitzbühel ist ein<br />
touristisches Zugpferd: Über 824.000 Nächtigungen im Jahr 2003 machten den Ort zu ei-<br />
ner der führenden Tourismusgemeinden Tirols und zum Spitzenreiter im Bezirk. 463 Die<br />
auf 837 Meter Seehöhe liegende Gemeinde befindet sich im Sog der Bezirkshauptstadt<br />
Kitzbühel und verfügt entsprechend über viele AuspendlerInnen.<br />
• Ried im Oberinntal: Die Kleingemeinde mit 1.295 EinwohnerInnen liegt südlich der Be-<br />
zirkshauptstadt Landeck auf 876 Meter Höhe. Unmittelbar an der Nord-Süd-Alpentrans-<br />
versale über Fern- und Reschenpass und etwa dreißig Kilometer vor letzterem gelegen, ist<br />
Ried ein touristisch durchaus erfolgreiches Dorf, das auch PendlerInnen aus der Umgebung<br />
anzieht. 464<br />
• Sankt Sigmund im Sellrain: Auf 1.646 Meter Höhe liegt der Ortsteil Haggen, in dem im<br />
Frühjahr 2004 die Unterkunft in St. Sigmund (Bezirk Innsbruck-Land) eröffnet wurde.<br />
Die winzige Gemeinde im Sellraintal – mit gerade 199 EinwohnerInnen gehört St.<br />
Sigmund zu den zehn kleinsten Gemeinden Tirols – liegt unweit des beliebten Schigebiets<br />
im Kühtai und ist daher auch touristisch nicht unattraktiv. Die wenigen EinwohnerInnen<br />
pendeln entsprechend auch kaum zu Arbeitsplätzen außerhalb des Ortes. 465<br />
459 Ebd.<br />
460 Vgl. AdTLR 2004.<br />
461 Ferienland Kufstein Infobüro Erl 2004 (Homepage).<br />
462 Ebd.<br />
463 Ebd.<br />
464 Ebd.<br />
465 Ebd.<br />
204
• Schwaz: Als Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im Unterinntal zählt das im Bergbau<br />
traditionsreiche Schwaz immerhin 12.359 EinwohnerInnen. Die Stadt sieht sich als „so-<br />
ziale“ Stadt: „Schwaz denkt an die »Schwachen«“, so eine Selbstdarstellung der Ge-<br />
meinde. 466 Touristisch ist Schwaz im Bezirk trotz renommierter Festivals im Bereich der<br />
„<strong>Neue</strong>n Musik“ nicht an führender Stelle präsent, als Standort von Gewerbe- und Indust-<br />
riebetrieben war die Stadt bislang aber durchaus erfolgreich.<br />
• Volders: Bereits im Rahmen der Einzelfalldarstellungen porträtiert wurde die im Tiroler<br />
Unterland gelegene Gemeinde Volders 467 , in der 2004 auch das frühere „Flüchtlingsheim<br />
Kleinvolderberg“ reaktiviert wurde.<br />
Die Unterkunft im Innsbrucker Stadtteil Mentlberg, das reaktivierte „Flüchtlingsheim Klein-<br />
volderberg“ in Volders sowie der Standort in der Kleinstgemeinde St. Sigmund im Sellrain<br />
wurden bald wieder geschlossen. <strong>Neue</strong> Unterkünfte wurden im Lauf des zweiten Halbjahrs<br />
2004 dagegen in den folgenden Gemeinden realisiert:<br />
• Hall in Tirol: Die 11.585 EinwohnerInnen zählende Stadt Hall, in der lange Zeit Salz<br />
abgebaut wurde, liegt unweit von Innsbruck. Wie die Landeshauptstadt übt auch Hall eine<br />
gewisse Sogwirkung auf die Umlandgemeinden aus, die Zahl der AuspendlerInnen über-<br />
wiegt entsprechend jene der EinpendlerInnen. 468 Das mittelalterliche Stadtbild macht Hall<br />
zu einem beliebten Ausflugsort insbesondere für TouristInnen.<br />
• Imst: 8.952 EinwohnerInnen zählt Imst, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im Tiroler<br />
Oberland. Die Stadt, die stolz auf den mit 84 Metern dritthöchsten Kirchturm Österreichs<br />
ist 469 , befindet sich an der Einmündung der Fernpassroute ins Inntal und stellt als Standort<br />
von Gewerbe- und kleineren Industriebetrieben eindeutig ein regionales Zentrum dar.<br />
• Innsbruck-Rossau: Einige Zeit nach der Schließung der im ersten Halbjahr 2004 eröffne-<br />
ten Unterkunft in Mentlberg wurde im als florierendes Wirtschaftszentrum bekannten<br />
Stadtteil Rossau im Osten Innsbrucks ein neuer Unterkunftskomplex errichtet.<br />
• Jenbach: Die im Bezirk Schwaz im Unterinntal gelegene Marktgemeinde Jenbach nimmt<br />
mit 6.733 EinwohnerInnen und mehreren, teils relativ großen Industriebetrieben in Teil-<br />
bereichen zunehmend eine Rolle als regionales Zentrum wahr. Mit dem Tourismus<br />
kommt Jenbach letztlich nur als Verkehrsknotenpunkt in Berührung: Südlich der Ge-<br />
meinde beginnt das Zillertal, nördlich liegt der Achensee, in beide Richtungen führen<br />
„Nostalgiebahnen“. Entsprechend betont die Gemeinde in ihrer Selbstdarstellung programmatisch:<br />
„Denkmalpflege ist hier Kulturpflege.“ 470<br />
466 Stadtgemeinde Schwaz 2004 (Homepage).<br />
467 Siehe hierzu Abschnitt 7.9.<br />
468 Vgl. AdTLR 2004.<br />
469 Vgl. Stadt Imst 2004 (Homepage).<br />
470 Marktgemeinde Jenbach 2004 (Homepage).<br />
205
• Lienz: Mit der auf 673 Meter Höhe gelegenen Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks<br />
wurde erstmals ein Standort in Osttirol realisiert. Lienz zählt 11.983 EinwohnerInnen und<br />
ist die mit Abstand größte Gemeinde Osttirols. Die Stadt betont ihre südliche Lage: Der<br />
Süden empfange Gäste „bereits mit Palmen auf dem Hauptplatz“, man brauche sich bei<br />
einem Besuch auch nicht „besonders stadtfein“ für „unser schmuckes Städtchen“ zu<br />
machen: „In Lienz pflegt man die legere Lebensart.“ 471<br />
• Scharnitz: Auf 964 Meter Seehöhe liegt Scharnitz, eine gerade 1.265 EinwohnerInnen<br />
zählende Kleingemeinde im Bezirk Innsbruck-Land direkt an der Grenze zu Deutschland.<br />
Die typische PendlerInnengemeinde ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen im<br />
Karwendelgebirge rund um den Isarursprung, als eigenständige Reisedestination ist sie in-<br />
dessen kaum bedeutend – in einer Selbstdarstellung bezeichnet man sich daher bescheiden<br />
als „unser Winterparadies in Tirol“. 472<br />
Insgesamt wurden damit nicht weniger als 14 Standorte in 13 Gemeinden neu realisiert, wei-<br />
tere – etwa in der Nachbarschaft des in der Innsbrucker Rossau errichteten Komplexes, in<br />
Kufstein oder in Matrei in Osttirol – wurden bereits ab Jahresmitte öffentlich diskutiert.<br />
8.2 Die Standortwahl<br />
„Quartiere zu finden, ist schwer“, merkte Landesrätin Gangl Mitte 2004 ebenso schlicht wie<br />
treffend an. 473 Tatsächlich erhöhte sich die Zahl der unterzubringenden Asylsuchenden mit<br />
dem neuen System der „Grundversorgung“ um mehr als das Doppelte – der Unterkunftsgeber<br />
stand also vor einer beachtlichen Herausforderung. Wie wurde diese im Bereich der Stand-<br />
ortwahl bewältigt?<br />
9.2.1 Die Standortsuche: »Regelmäßig öffentliche Appelle durch die <strong>Medien</strong>«<br />
Bei der Suche nach neuen Unterkunftsstandorten setzte das Land Tirol auf Kontinuität: Die<br />
im zweiten Halbjahr 2003 konstatierte Strategie behielt man auch 2004 bei. Der meist über<br />
regionale <strong>Medien</strong> verbreitete Appell, leere Gebäude an den Unterkunftsgeber zu melden, blieb<br />
praktisch das einzige Mittel der Standortsuche. Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs<br />
an Unterbringungsplätzen nahm man jedoch eine Diversifizierung dieser Strategie vor und<br />
setzte spätestens ab März des Jahres auch auf persönliche, teils in Briefform an die Tiroler<br />
BürgermeisterInnen übermittelte Aufrufe der zuständigen Landesrätin Gangl 474 oder des Lan-<br />
deshauptmanns van Staa. 475 Derartige Aufrufe ergingen außerdem an die römisch-katholische<br />
Kirche 476 und an das Bundesverteidigungsministerium 477 – Verteidigungsminister Günther<br />
471 Stadtgemeinde Lienz 2004 (Homepage).<br />
472 Gemeinde Scharnitz 2004 (Homepage); Hervorhebung durch RP.<br />
473 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.08.2004b.<br />
474 Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 03.03.2004 und 14.04.2004b; Stadtblatt Innsbruck 25.08.2004.<br />
475 Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 24.06.2004c.<br />
476 Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 14.04.2004a und b; 11.10.2004 a und b.<br />
477 Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 14.04.2004a und b; 21.08.2004a.<br />
206
Platter war zuvor selbst Mitglied der Tiroler Landesregierung gewesen, weshalb in den<br />
Appellen an ihn immer auch der Aufruf zur „solidarischen Hilfeleistung“ für „sein“ Bundes-<br />
land mitschwang. Da all diese Bitten nur in beschränktem Maße Erfolge zeitigten 478 , appel-<br />
lierte die Landesrätin schließlich an ihre KollegInnen in der Tiroler Landesregierung, insbe-<br />
sondere an Landesrätin Anna Hosp (ÖVP). 479 Hosp oblag die Zuständigkeit für in Landesbe-<br />
sitz befindliche leerstehende Gebäude, die Gangl zur Unterbringung Asylsuchender geeignet<br />
schienen.<br />
Ihre vorrangig auf regionale <strong>Medien</strong> gestützte Appell-Strategie bekräftigte Gangl in ihrer Be-<br />
antwortung einer schriftlichen Anfrage im Tiroler Landtag Ende Juli 2004. Die grüne Abge-<br />
ordnete Elisabeth Wiesmüller hatte von der Landesrätin eine Antwort auf die Frage erbeten,<br />
ob „tatsächlich alle Bürgermeister Tirols vom dringenden Bedarf nach Unterkünften für<br />
schutz- und hilfsbedürftige Fremde informiert“ worden wären. Gangl berief sich bemerkens-<br />
werterweise zunächst ausschließlich auf den Bundesinnenminister: „Durch den Herrn Innen-<br />
minister wurden alle Bürgermeister in Österreich über den dringenden Bedarf nach Unter-<br />
künften informiert und um Mithilfe ersucht.“ 480 In einer Ergänzung ihrer Beantwortung führte<br />
dies die Landesrätin etwas breiter aus:<br />
„Bereits vor der Gemeinderatswahl [am 07.03.2004; Anm. RP] wurden alle Bürgermeister informiert. Zudem<br />
erfolgten vor und nach der Gemeinderatswahl regelmäßig öffentliche Appelle durch die <strong>Medien</strong>[,] wodurch die<br />
Bürgermeister über den dringenden Bedarf informiert und um Mithilfe ersucht wurden. Durch das Innenministerium<br />
wurde ebenfalls ein entsprechender Aufruf getätigt.“ 481<br />
Zumindest die Bürgermeister einiger Bezirkshauptstädte konnten sich den ständigen Appellen<br />
der Landesrätin, aber auch dem steigenden Druck in ihren Gemeinden selbst zunehmend we-<br />
niger entziehen. Im Lauf des Jahres boten Imst 482 , Schwaz 483 und Lienz 484 Unterkünfte an, für<br />
das im Bezirk Innsbruck-Land gelegene regionale Zentrum Hall in Tirol erfolgte ein Angebot<br />
durch den sozialdemokratischen Vizebürgermeister Harald Schweighofer und gegen den<br />
Willen des christlichsozialen Bürgermeisters Leo Vonmetz. 485 Diesen vier Gemeinden, die<br />
478<br />
So klagte etwa der Flüchtlingskoordinator des Landes Anfang März 2004, nur fünf Tiroler Gemeinden hätten<br />
nach einem direkten Appell der Landesrätin an die BürgermeisterInnen Unterkünfte angeboten (Tiroler Tageszeitung<br />
03.03.2004; 08.05.2004); die Landesrätin selbst wiederum empörte sich wenig später, dass der Verteidigungsminister<br />
auf ihre Appelle nicht reagiere: „Was mich massiv ärgert, ist, dass trotz mehrmaliger Bitte um<br />
Hilfe an das Verteidigungsministerium bis dato nicht einmal eine Reaktion erfolgte. Ich stelle mir die Zusammenarbeit<br />
mit dem Bund in dieser Sachfrage wahrlich anders vor. Wenn es Kapazitäten gibt, muss ich das wissen!“<br />
(Gangl, zit. nach AdTLR 16.04.2004; ähnlich in Tiroler Tageszeitung 21.08.2004a, 08.05.2004)<br />
479<br />
Vgl. etwa Tiroler Tageszeitung 27.04.2004; 08.05.2004.<br />
480<br />
Anfragebeantwortung Gangl 2004a, Punkt 5.<br />
481<br />
Anfragebeantwortung Gangl 2004b.<br />
482<br />
Bürgermeister Gerhard Reheis (SPÖ) stellte ein Gebäude der aufgelassenen lokalen Kaserne zur Verfügung –<br />
„ein Anruf hat genügt“, so Landesrätin Gangl im Rückblick, „und Bürgermeister Gerhard Reheis hat sich der<br />
Sache angenommen.“ (Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.05.2004b)<br />
483<br />
Bürgermeister Hans Lintner (ÖVP) kündigte Anfang Mai 2004 persönlich an, „Asylanten bei uns aufzunehmen“<br />
und zu versuchen, diese „in eine gewisse Beschäftigung zu bringen, damit wir ihnen auch eine qaulitätsvolle<br />
[sic!] Zeit in Schwaz ermöglichen“ (Lintner, zit. nach ORF 01.05.2004).<br />
484<br />
Im Fall von Lienz, auf den noch zurückzukommen sein wird, ging das Land Tirol auf das Angebot von<br />
Bürgermeister Johannes Hibler (ÖVP) jedoch nicht ein (vgl. hierzu Tiroler Tageszeitung 13.05.2004c).<br />
485<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 14.05.2004; 21.05.2004; 24.06.2004a.<br />
207
damit vorgezeigt haben, dass es schon im Bereich der Standortsuche durchaus einen gewissen<br />
Handlungsspielraum der Kommunen gibt, stehen allerdings nicht weniger als zehn 2004 reali-<br />
sierte Standorte gegenüber, die nicht auf ein Gemeindeangebot zurückgingen – von einem<br />
Erfolg der Aufrufe und Appelle an die BürgermeisterInnen des Landes kann damit wohl kaum<br />
gesprochen werden. Insgesamt zeigt sich entsprechend der Diversifizierung der Strategie bei<br />
den 2004 realisierten Unterkunftsstandorten ein deutlich heterogeneres Bild hinsichtlich der<br />
auf einen Appell antwortenden BesitzerInnen als im Halbjahr zuvor: Sechs Standorte sind<br />
privaten BesitzerInnen – wie 2003 überwiegend Gastwirtinnen und -wirten – zuzuordnen, ein<br />
Standort der römisch-katholischen Kirche, eine vorübergehende und eine dauerhafte Unter-<br />
kunft dem Land Tirol (und damit der zuständigen Landesrätin Hosp) selbst. Eine weitere vo-<br />
rübergehende Unterkunft ist ein vom Land gepachtetes Abrisshaus – das reaktivierte ehema-<br />
lige „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“. Nur in den drei zuletzt genannten Fällen wurde die<br />
Appell-Strategie durchbrochen, was jedoch lediglich im Fall der vom zuständigen Ressort<br />
selbst neu errichteten Unterkunft auf einem landeseigenen Gelände im Innsbrucker Stadtteil<br />
Rossau zu einer mittel- bis längerfristig nutzbaren Unterkunft führte. Die eigenständige Pla-<br />
nung der ursprünglich als Lager in Containerbauweise vorgesehenen Rossauer Unterkunft<br />
stellte dabei nicht zuletzt eine Reaktion auf den ausbleibenden Erfolg der (trotzdem beibehal-<br />
tenen) Appell-Strategie dar, wie Landesrätin Gangl wenige Tage nach Inkrafttreten der<br />
„Grundversorgungsvereinbarung“ vor dem Hintergrund der rasch steigenden Zahl an unterzu-<br />
bringenden Asylsuchenden verdeutlichte: „Nachdem Aufrufe in der [sic!] Bevölkerung,<br />
Flüchtlingsquartiere bereitzustellen, fehlgeschlagen sind, mussten wir nach einer anderen<br />
Lösung suchen.“ 486<br />
Die Beschränkung auf diese Strategie wurde im Frühjahr 2004 erstmals innerhalb der Landes-<br />
regierung selbst kritisch hinterfragt: Gangls Regierungskollegin Hosp merkte an, dass „Briefe<br />
schreiben alleine“ bei der Suche nach neuen Unterkünften nicht ausreichen werde. Gangls<br />
Reaktion war freilich kein inhaltlicher Konter dieser Kritik, vielmehr richtete die empörte<br />
Landesrätin, wie oben bereits erwähnt, ihren Appell um Unterkünfte nun auch an Hosp. 487<br />
8.2.2 Die Standortentscheidung: Aktive BesitzerInnen<br />
Die passive Anlage der Standortsuche setzte sich im daran anschließenden Bereich von<br />
Standortwahl und -entscheidung auch 2004 fort: In zehn von 14 Fällen wurden einlangende<br />
Angebote von GebäudebesitzerInnen akzeptiert, die Standortwahl wurde in all diesen Fällen<br />
letztlich von den jeweiligen BesitzerInnen vorgenommen, die Standortentscheidung erfolgte<br />
zwar durch den Unterkunftsgeber, wurde jedoch durch die bereits skizzierte faktische Vor-<br />
auswahl in beträchtlicher Weise bereits vorweggenommen. Die vom Verteidigungsminis-<br />
terium angebotene Nutzung von Teilen der weiterhin als solche genutzten Kufsteiner Enrich-<br />
486 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 07.05.2004b.<br />
487 Vgl. Tiroler Tageszeitung 27.04.2004. Gangl warf Hosp dabei vor, diese „weigere“ sich, in landeseigenen<br />
Gebäuden trotz freier Plätze Asylsuchende unterzubringen (ebd.)<br />
208
Kaserne, die letztlich an den Adaptierungskosten scheiterte 488 , kann dieses Muster nur unter-<br />
streichen. Mit den Gemeinden Hall in Tirol, Imst und Schwaz waren unter den BesitzerInnen<br />
nun erstmals auch Kommunen, die selbst einen Unterkunftsort auswählten und damit letztlich<br />
auch die Standortentscheidung selbst trafen – in Hall wurden der ausgewählte Standort und<br />
mögliche Alternativen dabei teils äußerst kontrovers diskutiert 489 , auch in Schwaz prüfte die<br />
Gemeinde mehrere Alternativen. 490 Vom Unterkunftsgeber selbst aktiv gesucht und ausge-<br />
wählt wurden lediglich die provisorische Unterkunft in Innsbruck-Mentlberg, das gleichfalls<br />
provisorisch reaktivierte „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“, der Unterkunftskomplex in der<br />
Innsbrucker Rossau – all diese Standorte waren freilich bereits zuvor vom Land gepachtet<br />
oder sogar in Landesbesitz gewesen – sowie der Standort in Lienz. Im zuletzt genannten Fall<br />
hatte die Stadt Monate vorher die Unterbringung von „zwei bis drei Asylantenfamilien“ ange-<br />
boten, von Seiten des Landes hatte sich jedoch, wie Bürgermeister Hibler später festhielt,<br />
„niemand gemeldet“. 491 Der Flüchtlingskoordinator des Landes wandte sich schließlich nicht<br />
an die Stadtgemeinde, sondern an die Franziskanerprovinz als Eigentümerin eines ehemaligen<br />
Bildungshauses und ersuchte um eine Vermietung des Gebäudes, um dort bis zu fünfzig Asylsuchende<br />
unterbringen zu können. 492<br />
8.2.3 Standortmerkmal 1: Räumliche Lage<br />
Als grundlegendes standortpolitisches Strukturmuster, so wurde für die im zweiten Halbjahr<br />
2003 bestehenden Unterkünfte konstatiert, kann das Prinzip von „Absonderung oder Heraus-<br />
hebung“ auf Landes- und/oder auf kommunaler Ebene benannt werden. Bestätigen die stand-<br />
ortpolitischen Entwicklungen im Folgejahr 2004 dieses Muster oder muss es vielmehr als<br />
„Produkt des Zufalls“ verworfen werden? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Landes-<br />
ebene. Peripher oder extrem peripher gelegene Standorte wurden, so zeigt ein Überblick<br />
rasch, auch im Jahr 2004 realisiert, zugleich wurden jedoch vermehrt Unterkünfte auch in<br />
regionalen Zentren errichtet:<br />
• Drei der 14 neuen Standorte – jene in Ehrwald, Erl und Scharnitz – befinden sich im Grenzgebiet zum<br />
Nachbarstaat Deutschland, die betroffenen Gemeinden sind jeweils Grenzorte.<br />
• Zwei weitere Standorte – jene in Ried im Oberinntal und in St. Sigmund im Sellrain – sind sehr peripher<br />
oder gar extrem peripher gelegen: Die Unterkunft in der Kleingemeinde Ried befindet sich etwa auf halbem<br />
Weg zwischen der Bezirkshauptstadt Landeck und der Grenze zur Schweiz (einige Kilometer weiter südlich<br />
verläuft auch die Grenze zu Italien) im nicht an das Schienennetz angeschlossenen Oberinntal. Die letztlich<br />
vorübergehend betriebene Unterkunft im winzigen Hochgebirgsdorf St. Sigmund im südwestlich von Innsbruck<br />
ins Inntal mündenden Sellraintal liegt am Beginn des zerstreut bebauten Ortsteils Haggen kurz vor<br />
dem beliebten Schigebiet Kühtai auf 1.646 Meter Höhe. Das als „Eldorado für Wanderer und Tourengeher“<br />
493 geltende Almengebiet bietet, so das Urteil der Tiroler Tageszeitung, mit mehr als zwanzig<br />
„Dreitausendern“ und 25 „Zweitausendern“ geradezu „unendlich viele Möglichkeiten, einen aktiven Urlaub<br />
488<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 18.01.2005.<br />
489<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.05.2004; 11.06.2004; 15.06.2004; 18.06.2004.<br />
490<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 14.05.2004; 03.08.2004.<br />
491<br />
Hibler, zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.05.2004c.<br />
492<br />
Vgl. ebd.<br />
493<br />
Tiroler Tageszeitung 01.09.2004a.<br />
209
in frischer Luft zu genießen“, zudem liege oft „bis in den Frühsommer Schnee“. 494 Der „beschauliche Ort“<br />
St. Sigmund selbst, so die Zeitung in einem Portrait des Fleckens, sei „klein aber fein“:<br />
„Er liegt wie hingemalt an der Baumgrenze im Alpenrosengarten Tirols. Millionen roter Blüten erfreuen das<br />
Auge des Wanderers und lassen ihn in der pollenarmen Gegend Erholung finden. Die Forellen aus dem<br />
Waldteich schmecken selbst gefischt doppelt so gut und vom Wirt mit Mandeln zubereitet unvergleichlich.<br />
Die Pfarrkirche von St. Sigmund gilt wegen ihrer erhöhten malerischen Lage als Juwel und ist 1000 Jahre<br />
alt. Im Winter kommt der Rodelspaß auf einer beleuchteten Naturbahn nicht zu kurz.“ 495<br />
• Mit dem vorübergehend betriebenen Standort im Stadtteil Mentlberg und dem im zweiten Halbjahr dauerhaft<br />
eingerichteten Unterkunftskomplex in der Rossau wurden 2004 jedoch auch zwei Standorte in der Landeshauptstadt<br />
errichtet.<br />
• Vier der 14 Unterkünfte – jene in Hall in Tirol, Imst, Lienz und Schwaz – wurden in Bezirkshauptstädten<br />
oder regionalen Zentren realisiert. Mit der Unterkunft in Jenbach befindet sich zudem ein weiterer Standort<br />
in einer Gemeinde, die sich zumindest in einzelnen Bereichen mehr und mehr zu einem regionalen Zentrum<br />
entwickelt.<br />
• Mehr als zehn Kilometer von einem regionalen Zentrum entfernt liegen fünf Standorte 496 , von zweien der<br />
nicht in einem regionalen Zentrum gelegenen Unterkünfte – jenen in Jenbach und Kirchberg – sind in weniger<br />
als zehn Kilometern die entsprechenden Bezirkshauptstädte erreichbar.<br />
• Nicht mehr als zehn Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt ist der Standort in Hall in Tirol. Fünf<br />
Standorte sind von der Hauptstadt zwischen dreißig und siebzig Kilometer entfernt 497 , fünf weitere liegen<br />
von Innsbruck mehr als siebzig Kilometer entfernt 498 , darunter der Standort in Lienz, der sich in mehr als<br />
178 Kilometer Entfernung von der Landeshauptstadt befindet und damit die am weitesten von Innsbruck<br />
entfernte Unterkunft in Tirol ist.<br />
• Der Standort in der Osttiroler Bezirkshauptstadt stellt überhaupt einen Sonder- und Grenzfall dar: Der Bezirk<br />
Lienz grenzt nicht direkt an das Bundesland Tirol, das von dort aus nur über das benachbarte Bundesland<br />
Salzburg oder über Südtirol und damit Italien erreichbar ist. Die einzige Bahnverbindung verläuft über<br />
italienisches Territorium. Damit ist der Standort einerseits auf Landesebene klar als äußerst peripher gelegen<br />
zu werten, andererseits befindet er sich jedoch in einem regionalen Zentrum.<br />
Das für das zweite Halbjahr 2003 auf Landesebene konstatierte dominierende Lagemerkmal<br />
der Absonderung wurde 2004 somit in sechs von 14 Fällen klar durchbrochen, in einem ach-<br />
ten Fall wurde ein Standort in einer Gemeinde „auf dem Sprung“ zum regionalen Zentrum<br />
realisiert. Demgegenüber wurden erneut drei Unterkünfte im teils unmittelbaren Grenzgebiet<br />
errichtet, drei weitere Standorte in als sehr peripher oder gar extrem peripher zu bewertenden<br />
Lagen – hier wurde jedoch ein Standort in einer Bezirkshauptstadt realisiert. Die Absonde-<br />
rung von Unterkünften auf Landesebene ist damit bei den 2004 realisierten Unterkünften zwar<br />
nach wie vor feststellbar, jedoch nicht als klar dominierendes Lagemerkmal zu qualifizieren.<br />
Auch auf der Ebene der Gemeinden finden sich 2004 für die Absonderung neuerlich mehrere<br />
Beispiele. Exemplarisch kann hier einerseits die vorübergehend betriebene Unterkunft im<br />
Innsbrucker Stadtteil Mentlberg angeführt werden: Sie befindet sich unmittelbar an der süd-<br />
westlichen Stadtgrenze und ist von Wald und Wiesen umgeben – eine Lage, die jener der nur<br />
494<br />
Ebd. Ein Höhenwanderweg, so die Zeitung (ebd.), locke im Sommer, im Winter „punktet das Sellraintal mit<br />
einem reichen Angebot an teils lawinensicheren Skitouren“ – die beste Zeit dafür sei im Frühjahr: „Ab Ende<br />
Februar, wenn sich der Schnee gesetzt hat, die Höhen nicht mehr gar so grimmig kalt sind und wenn die Lawinengefahr<br />
zurückgegangen ist, dann wird es richtig pfundig auf den Hängen im Sellraintal.“<br />
495<br />
Tiroler Tageszeitung 01.09.2004b.<br />
496<br />
Konkret die Unterkünfte in Ehrwald (23 km), Erl (14 km), Ried im Oberinntal (15 km), St. Sigmund im Sellrain<br />
(30 km) und Scharnitz (32 km).<br />
497<br />
Hier sind die Standorte in Imst, Jenbach, St. Sigmund im Sellrain, Scharnitz und Schwaz zu nennen.<br />
498<br />
Es handelt sich dabei um die Standorte in Ehrwald, Erl, Kirchberg, Lienz und Ried im Oberinntal.<br />
210
wenige Meter voneinander entfernten Unterkünfte in Volders 499 gleicht. Ein Beispiel für eine<br />
in „doppelter Randlage“ befindliche Unterkunft ist der gleichfalls vorübergehend betriebene<br />
Standort in St. Sigmund im Sellrain: Die extrem periphere Lage der Gemeinde wird hier<br />
durch die ebenfalls äußerst periphere Lage des Standorts innerhalb des Gemeindegebiets – der<br />
Ortsteil Haggen liegt, von der Kerngemeinde räumlich getrennt, an der Gemeinde- wie auch<br />
an der Bezirksgrenze, die Unterkunft zusätzlich in einiger Entfernung vom Kern des Ortsteils<br />
– verstärkt.<br />
Für das zweite Halbjahr 2003 wurde auf der kommunalen Ebene ein zweites Muster festge-<br />
stellt, das gerade bei den zentral gelegenen Unterkünften in auffälliger Weise erkennbar war:<br />
die Heraushebung aus der näheren Umgebung. Die betreffenden Gebäude dominierten den sie<br />
umgebenden öffentlichen Raum in herausragender Weise und wurden zugleich selbst von<br />
diesem dominiert, im Ergebnis war ein Verschwimmen der Grenze zwischen öffentlichem<br />
und privatem Raum zu konstatierten. Lage, Gestaltung und (frühere) Funktion der jeweiligen<br />
Gebäude wurden dabei als die entscheidenden Faktoren identifiziert, aus denen sich diese<br />
spezifische Rolle innerhalb der Gemeinden ergab. Unter den 2004 realisierten Unterkünften<br />
finden sich neuerlich einige Beispiele für das Muster der Heraushebung. Der im ersten Halb-<br />
jahr realisierte Standort in Ehrwald befindet sich in einem unmittelbar an der stark befahrenen<br />
Hauptstraße gelegenen Gasthof mitten im Ort. Durch seine auffällige Gestaltung und seine<br />
Funktion dominiert das Gebäude die Umgebung deutlich. Das in der zweiten Jahreshälfte<br />
errichtete barackenähnliche Fertigteilhaus in der Innsbrucker Rossau befindet sich auf einer<br />
größeren Brachfläche und ist in seiner Ausführung und Funktion als einziges dauerhaft be-<br />
wohntes Objekt aus dem das Areal umgebenden Industrie- und Gewerbegebiet deutlich<br />
herausgehoben. Das zum Landesbauhof gehörige und (teils mit Hecken) umzäunte Gelände<br />
selbst ist von Baracken, Lagerhallen und ähnlichen Flachbauten dominiert, die unschwer als<br />
Gebäude des hier befindlichen Baubezirksamtes und der benachbarten Baustoffprüfstelle er-<br />
kennbar sind. 500 Eine klare Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum ist auch hier<br />
nur bedingt feststellbar. Der Fall der geplanten, jedoch letztlich gescheiterten Unterkunft in<br />
Kufstein scheint die Bedeutung des Lagemerkmals der „Heraushebung“ zu untermauern, han-<br />
delte es sich hier doch um eine nach wie vor betriebene Kaserne des Bundesheers, die als sol-<br />
che in ihrer Form und Funktion (und aufgrund der aufgestellten einschlägigen Werbetafeln)<br />
klar erkennbar und aus der Umgebung baulich gleichfalls eindeutig herausgehoben gewesen<br />
wäre – die Grenze zwischen öffentlichem und privatem, in diesem Fall heeresinternem Raum<br />
war hier jedoch durch einen rot-weiß-gestreiften Schranken und einen grün lackierten Zaun<br />
mehr als deutlich erkennbar, der „Privatraum“ damit als eigenen Gesetzen folgendes Territo-<br />
rium gekennzeichnet.<br />
499 Vgl. Abschnitt 7.9.<br />
500 Vgl. hierzu die Fotographien in Tiroler Tageszeitung 07.05.2004a; 17.05.2004; 03.06.2004.<br />
211
Wie sieht nun im Jahr 2004 das Verhältnis zwischen jenen Standorten aus, auf die eines der<br />
genannten Lagemerkmale auf einer der beiden Ebenen zutrifft, und jenen Unterkünften, die<br />
keines der Lagemerkmale aufweisen? Anders als im zweiten Halbjahr 2003 – alle neun in<br />
diesem Zeitraum betriebenen Unterkünfte wiesen eines der beiden (oder gleich beide) Merk-<br />
male auf – ist die Situation 2004 nicht mehr ganz so eindeutig. Mit der Unterkunft in Hall in<br />
Tirol, die sich auf Landes- wie auch auf kommunaler Ebene in zentraler bzw. zentrumsnaher<br />
Lage befindet, wurde zumindest ein Standort realisiert, der das Muster von „Absonderung<br />
oder Heraushebung“ auf allen Ebenen klar durchbricht – nicht auf Initiative des Unterkunfts-<br />
gebers, sondern nach einer gezielten Standortsuche des Haller Vizebürgermeisters Schweig-<br />
hofer. 501 In fünf weiteren Gemeinden ist eine eindeutige Zuordnung schwierig: Die Unter-<br />
künfte in Imst, Jenbach, Kirchberg, Lienz und Schwaz sind weder auf einer der beiden Ebe-<br />
nen eindeutig als „abgesondert“ oder als „herausgehoben“ qualifizierbar (das Beispiel der<br />
Bezirkshauptstadt Lienz im „abgesonderten“ gleichnamigen Bezirk zeigt dies exemplarisch),<br />
noch können sie wie der Haller Standort eindeutig als räumlich zentral oder zentrumsnah und<br />
in ihrer Gestaltung und Funktion sich weitgehend selbstverständlich und harmonisch in ihre<br />
Umgebung einfügend gewertet werden. Die Mehrheit der 2004 realisierten Standorte – bei-<br />
nahe sechzig Prozent – entspricht damit erneut dem standortpolitischen Strukturmuster der<br />
„Absonderung oder Heraushebung“.<br />
8.2.4 Standortmerkmal 2: Räumliche und bauliche Integration<br />
Asylsuchende würden in Tirol, so war für die im Herbst 2003 bestehenden Standorte oben<br />
konstatiert worden, möglichst abseits der Wohngebiete der ortsansässigen Bevölkerung unter-<br />
gebracht. Für die 2004 realisierten Unterkünfte ist dieses Merkmal nicht mehr in dieser Ein-<br />
deutigkeit gegeben: Zwar ist nach wie vor keine der Unterkünfte in einem klassischen Wohn-<br />
gebiet zu finden, jedoch wurden vermehrt Unterkünfte in Mischgebieten eingerichtet, etwa in<br />
den Gemeinden Ehrwald, Hall in Tirol, Imst oder Kirchberg. Klar abseits sowohl von Wohn-<br />
als auch von Mischgebieten wurden jedoch neuerlich vier Unterkünfte realisiert:<br />
• Die schlussendlich vorübergehend betriebene Unterkunft im oben bereits beschriebenen kleinen<br />
Hochgebirgsdorf St. Sigmund im Sellrain liegt in exponierter Lage auf der „Sonnenalm“ am hier die nördliche<br />
Talseite bildenden Haggener Sonnberg. Das Gebäude liegt sowohl von der Kerngemeinde St. Sigmund<br />
als auch vom Ortsteil Haggen räumlich separiert.<br />
• In der unmittelbaren Umgebung der gleichfalls vorübergehend betriebenen Unterkunft im Innsbrucker<br />
Stadtteil Mentlberg befinden sich nur Wald, Wiesen und einige Äcker, im weiteren Umfeld neben einer<br />
Bundesstraße, einem Tierheim und der als „Ziegelstadl“ bekannten lokalen Justizanstalt auch der Stadtteil<br />
Mentlberg.<br />
• Der Standort in der Innsbrucker Rossau liegt im lokalen Industrie- und Gewerbegebiet – die Gegend gilt als<br />
das „stärkste Wirtschaftsgebiet“ Tirols. 502<br />
• Der nur wenige Meter von der bereits 2003 bestehenden Unterkunft temporär reaktivierte zweite Standort in<br />
Volders wurde bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt. 503<br />
501 Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.05.2004.<br />
502 Vgl. Tiroler Tageszeitung 25.10.2004.<br />
503 Vgl. Abschnitt 7.9.<br />
212
Der Großteil der übrigen 2004 neu eingerichteten Unterkünfte liegt in zumindest teilweise<br />
bewohnten Mischgebieten, die in der Regel in Siedlungsrandbereichen zu finden sind, etwa<br />
der im Bahnhofsbereich am Westrand des Siedlungsgebietes liegende Standort in Kirchberg<br />
oder jener in der Gemeinde Ried im Oberinntal. Vereinzelt, etwa im Fall der direkt an der<br />
stark befahrenen Durchzugsstraße gelegenen Unterkunft in der Außerferner Gemeinde Ehr-<br />
wald oder in der Stadt Hall, sind die Unterkünfte jedoch auch in einem zentrumsnah gelege-<br />
nen Mischgebiet zu finden. Lediglich beim zuletzt genannten Standort wurde bei der Stand-<br />
ortwahl durch die Stadtgemeinde gezielt auf die Lage der Unterkunft geachtet: Der Haller<br />
Vizebürgermeister Schweighofer wollte die Asylsuchenden „bewusst nicht weit vom Zentrum<br />
entfernt unterbringen“. 504 Der Überblick zeigt: Auch 2004 wurden Asylsuchende nicht in<br />
klassischen Wohngebieten untergebracht, es dominierten teilweise auch zu Wohnzwecken<br />
genutzte Mischgebiete; in beinahe einem Drittel der Fälle wurden Unterkünfte abseits der<br />
Siedlungsgebiete eingerichtet.<br />
8.2.5 Standortmerkmal 3: Mobilität<br />
Hinsichtlich der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz – ein zentraler Aspekt, um Be-<br />
hörden-, Beratungs- oder Betreuungstermine in der Landes- oder Bezirkshauptstadt wahr-<br />
nehmen zu können oder auch migrantische Communities und ergänzungsökonomische Be-<br />
triebe zu erreichen – zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Herbst 2003: Alle realisierten<br />
Standorte sind mehr oder weniger an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, ein Standort<br />
allerdings nur zeitweise: Zur Unterkunft in St. Sigmund im Sellrain besteht nur während der<br />
Winter- und der Sommersaison eine Busverbindung, in der Zwischensaison kann der Standort<br />
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht verlassen werden. Selbst während der Saison ist die<br />
Verbindung überdies äußerst eingeschränkt: Im Winter verkehrt die Buslinie in die Landes-<br />
hauptstadt Innsbruck – zugleich die nächstgelegene größere Gemeinde – vier Mal am Tag, im<br />
Sommer lediglich zweimal. Für die dabei zu bewältigenden knapp dreißig Kilometer ist mit<br />
einer Fahrtzeit von einer vollen Stunde zu rechnen. Die Mobilität der in dieser Unterkunft<br />
lebenden Asylsuchenden ist damit jedenfalls weitestgehend unterbunden.<br />
Die Art der Anbindung erscheint bei den 2004 realisierten Unterkünften durchaus unter-<br />
schiedlich: An fünf Standorten ist keine Eisenbahnverbindung verfügbar oder für Asyl-<br />
suchende nicht nutzbar, um etwa in die Landeshauptstadt Innsbruck zu fahren. 505 Busverbin-<br />
dungen sind an allen Standorten vorhanden, die betreffenden Busse verkehren jedoch insbe-<br />
sondere in den Tagesrandbereichen teils äußerst selten oder wie im oben geschilderten Fall<br />
504 Schweighofer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 21.05.2004. Der Vizebürgermeister begründete dies anlässlich<br />
der offiziellen Eröffnung der Unterkunft wie folgt: „Hier können sehr leicht Kontakte mit der Bevölkerung geknüpft<br />
werden.“ (Schweighofer, zit. nach SPÖ Tirol 19.10.2004)<br />
505 Die Gemeinden Erl, Ried im Oberinntal und St. Sigmund im Sellrain sind nicht an das Schienennetz angeschlossen,<br />
die Bahnlinien von Ehrwald und Lienz führen über deutsches bzw. italienisches Staatsgebiet und<br />
können von Asylsuchenden daher nicht legal bereist werden.<br />
213
von St. Sigmund überhaupt nur saisonal. 506 Dem steht die mit insgesamt sechs Unterkünften<br />
deutlich gestiegene Anzahl der in regionalen Zentren oder gleich in der Landeshauptstadt ein-<br />
gerichteten Standorte gegenüber.<br />
8.2.6 Standortmerkmal 4: Versorgungslage<br />
Teils erhebliche Mängel wurden hinsichtlich der Versorgungslage bei den im zweiten Halb-<br />
jahr 2003 vorhandenen, systematisch untersuchten Standorten festgestellt. Wie stellt sich die<br />
Situation bei den 2004 neu errichten Unterkünften dar? An den Standorten in Hall in Tirol,<br />
Imst, Innsbruck, Lienz und Schwaz ist die Situation zweifellos als großteils ausreichend, teil-<br />
weise sogar als sehr gut zu bewerten – in beinahe allen Bereichen. Sieht man vom Zugang zu<br />
unabhängiger juristischer Beratung und Betreuung sowie zu psychologischer oder psychothe-<br />
rapeutischer Unterstützung ab, kann dies mit einigen Einschränkungen auch für die Unter-<br />
künfe in Jenbach und Kirchberg gelten. Dem stehen Standorte in teils schlecht versorgten<br />
Randlagen wie in Ried im Oberinntal oder Erl gegenüber. Die bereits mehrfach erwähnte<br />
Unterkunft in St. Sigmund im Sellrain ist hinsichtlich der Versorgungslage vergleichbar mit<br />
dem im Rahmen der Einzelfalldarstellungen untersuchten Standort am „Bürgl“ in<br />
Fieberbrunn: Hier ist eine Versorgung, die auch nur annähernd über Nahrung und Obdach<br />
hinausgeht, nicht gewährleistet – nicht umsonst gilt die hoch gelegene Kleinstgemeinde landesweit<br />
als Musterbeispiel eines „Defizitraumes“. 507<br />
Mit der Ende Juni 2004 in Innsbruck erfolgten Eröffnung eines vom Evangelischen Flücht-<br />
lingsdienst (EFDÖ) getragenen Zentrums für interkulturelle Psychotherapie („Ankyra“), das<br />
nicht zuletzt für Asylsuchende mit traumatisierenden Verfolgungs- und Fluchterfahrungen als<br />
koordinierende Anlaufstelle dient 508 , steht in Tirol erstmals eine Einrichtung zur interkulturell<br />
qualifizierten psychologischen und psychotherapeutischen Unterstützung bzw. zu deren Ver-<br />
mittlung zur Verfügung. Deren Erreichbarkeit ist für viele der in organisierten Unterkünften<br />
lebenden Asylsuchenden freilich nur bedingt gegeben: Aufgrund der teils außerordentlich<br />
großen Entfernung der Standorte sind Hin- und Rückfahrt selbst dann, wenn sie innerhalb<br />
eines Tages zu bewerkstelligen sind, für die Betroffenen kaum finanzierbar.<br />
8.2.7 Standortmerkmal 5: Bauliche Ausführung, Gestalt und ursprüngliche<br />
Gebäudefunktion<br />
Die detaillierte Analyse der im zweiten Halbjahr 2003 bestehenden Unterkünfte zeigte eine<br />
überaus deutliche Dominanz touristischer Beherbergungsbetriebe unter den zur Unterbrin-<br />
gung von Asylsuchenden genutzten Gebäuden. Mit den 2004 neu realisierten Standorten fand<br />
diesbezüglich gewissermaßen eine Diversifizierung statt, die Orientierung am konstatierten<br />
506<br />
Von den Gemeinden Ehrwald, Erl, Lienz und Ried im Oberinntal aus bestehen keine direkten Verbindungen<br />
nach Innsbruck.<br />
507<br />
So etwa Berktold 2002b, 13.<br />
508<br />
Vgl. tip 16.07.2004; Tiroler Tageszeitung 25.06.2004.<br />
214
Muster, Provisorien als Dauereinrichtungen zu nutzen, blieb jedoch bestehen. Klassische Be-<br />
herbergungsbetriebe wie der „Bayrische Hof“ in Ehrwald oder die „Sonnenalm“ in St. Sig-<br />
mund im Sellrain wurden durch Sonderbauten wie in Hall (Pflegeheim), Innsbruck-Mentlberg<br />
(Verwaltungsgebäude 509 und Schülerheim), Lienz (Kloster, zuletzt Bildungshaus), Ried im<br />
Oberinntal (Kloster) und Scharnitz (Bäckerei mit Wohnetagen) ergänzt. In Imst wurde das<br />
Kommandogebäude der aufgelassenen Verdroß-Kaserne zur Unterbringung herangezogen, im<br />
Innsbrucker Gewerbe- und Industriegebiet Rossau ein gebrauchtes Fertigteilhaus – es war be-<br />
reits in Bayern als Unterkunft für Asylsuchende in Verwendung gestanden – und damit ein<br />
auch formal der Kategorie „Provisorium“ zuordenbares Objekt 510 errichtet. Auch 2004 wurde<br />
damit kein einziger Standort realisiert, der zuvor gänzlich und dauerhaft zu Wohnzwecken<br />
errichtet worden war; Provisorien blieben vorherrschend. Weitere 2004 (noch) nicht reali-<br />
sierte, jedoch öffentlich diskutierte Standorte oder Ersatzlösungen für bestehende Unterkünfte<br />
unterstreichen diese Ausrichtung: In Kufstein war, wie an anderer Stelle erwähnt, die Nutzung<br />
der lokalen Enrich-Kaserne vorgesehen gewesen, schließlich jedoch an den Kosten der Adap-<br />
tierung gescheitert, in Innsbruck setzte man vorübergehend auf die Errichtung eines Contai-<br />
nerlagers anstelle des später realisierten Fertigteilhauses im Stadtteil Rossau – eine Idee, die<br />
man auch für die Stadt Schwaz und die Gemeinde Matrei in Osttirol in Erwägung zog. 511<br />
Wirft man einen genaueren Blick auf die im Gesamtjahr neu in Betrieb genommenen Unter-<br />
künfte, so zeigt sich deutlich eine weitere Tendenz: An den Standorten in Hall in Tirol, Imst,<br />
Innsbruck-Mentlberg, Ried im Oberinntal, Schwaz sowie im Fall der zweiten Unterkunft in<br />
Volders stellte die Unterbringung von vornherein lediglich eine zeitlich begrenzte<br />
„Zwischennutzung“ unterschiedlicher Dauer dar. Im Fall von Volders und Schwaz wurde<br />
dabei auf für den Abriss vorgesehene Gebäude zurückgegriffen 512 , in den übrigen Fällen kün-<br />
digte man bereits vor dem Bezug durch die ersten Asylsuchenden eine anderweitige Nutzung<br />
der Liegenschaften oder den Verkauf nach spätestens zwei Jahren an. 513<br />
Hinsichtlich der Unterbringungskapazitäten der einzelnen Standorte setzte der Unterkunftsge-<br />
ber wie schon 2003 vorrangig auf Großquartiere mit zumindest fünfzig Betten. Auch in klei-<br />
neren Quartieren für 15 bis dreißig Personen, die meist unter der Bezeichnung „Wohnheim“<br />
geführt wurden, ist eine höhere Belegungszahl meist durch Adaptierungen durchaus möglich.<br />
8.2.8 Standortmerkmal 6: Gemeinde- und Standortidentitäten<br />
„Ghetto-Weg ist falsch“, übertitelte der Journalist Frank Staud Anfang Mai 2004 seinen Leit-<br />
artikel für die Tiroler Tageszeitung. Eben war bekannt geworden, dass das Land Tirol im<br />
509<br />
Das Schloss hatte u.a. auch als Sitz des Arbeitsgaues XXXIII des nationalsozialistischen Reichsarbeitsdienstes<br />
fungiert (vgl. Schreiber 1994, 218).<br />
510<br />
Vgl. Thimmel 1994, 139.<br />
511<br />
Vgl. Gerzabek 2004; Tiroler Tageszeitung 14.01.2005.<br />
512<br />
Zu Volders: vgl. Abschnitt 7.9; zu Schwaz: vgl. Tiroler Tageszeitung 03.08.2004.<br />
513<br />
Vgl. tip 14.05.2004; Tiroler Tageszeitung 08.05.2004; 13.05.2004b; 21.05.2004.<br />
215
Innsbrucker Stadtteil Rossau ein Containerlager für Asylsuchende zu errichten beabsichtigte.<br />
Staud fand deutliche Worte:<br />
„Mülldeponie, Kläranlage, Bordell und Großraumdisco. Alle sind in der Rossau beheimatet. Der Innsbrucker<br />
Stadtteil gilt als Auffangbecken für Institutionen und Lokalitäten, die im Stadtzentrum verpönt sind. Die Rossau<br />
hat aber auch historisch belastete Bedeutung. Dort befand sich Hitlers Innsbrucker Konzentrationslager. Gerade<br />
die Innsbrucker Sozialdemokraten gedenken bis heute an diesem Ort der Gräueltaten der Nationalsozialisten.<br />
Dass in unmittelbarer Nähe ausgerechnet SPÖ-Landesrätin Christa Gangl ein Container-Dorf für Asylwerber<br />
errichten lässt, welches auch noch mit Stacheldraht eingezäunt wird, spricht nicht für die SPÖ-Powerfrau. Mit<br />
dieser Entscheidung lässt sie jegliches Fingerspitzengefühl vermissen.“ 514<br />
Die Rossau als Ort sei „eine krasse Fehlentscheidung“, so der Journalist: „Am Rand von<br />
Innsbruck haben die Asylwerber keine Chance, sich zu integrieren. Die Entstehung eines<br />
Ghettos ist unvermeidlich. Und das kann nicht im Sinne Tirols sein.“ 515 Tatsächlich hatte der<br />
öffentliche Unterkunftsgeber für das geplante Flüchtlingslager einen – wie von Staud ange-<br />
deutet – einen Standort mit Geschichte ausgewählt: Wenige Meter vom Areal entfernt war<br />
Anfang 1942 ein von der nationalsozialistischen Geheimen Staatspolizei („Gestapo“) geleite-<br />
tes und aus mit Stacheldraht umzäunten Holzbaracken bestehendes Straflager für „besonders<br />
störrische oder arbeitsflüchtige Italiener“ in Betrieb genommen worden – in einer Charakteri-<br />
sierung des als Innsbrucker „KZ“ bekannt gewordenen Lagers hielt das Rüstungskommando<br />
Innsbruck Anfang 1942 fest:<br />
„Das in der Reichenau bei Innsbruck von der Geheimen Staatspolizei geleitete Straflager hat einen Fassungsraum<br />
für 800 Personen. Es wurde jedoch bisher noch nie vollkommen besetzt. Das Lager dient vor allem der<br />
Arbeitserziehung für vertragsbrüchige in- und ausländische Arbeiter. Eine abschreckende Wirkung scheint bereits<br />
erzielt worden zu sein, da nach Eröffnung des Lagers der Zustrom vertragsbrüchiger italienischer Arbeiter<br />
gegen die Brennergrenze erheblich nachgelassen hat.“ 516<br />
Das Innsbrucker Lager hatte in der Tiroler Öffentlichkeit rasch einen hohen Bekanntheitsgrad<br />
erreicht, die dortigen Arbeits- und Lebensbedingungen wurden auch von sicherheitspolizeili-<br />
cher Seite als härter als in einem Konzentrationslager eingeschätzt. 517 Ab 1943 wurden ver-<br />
stärkt auch politische Häftlinge und Juden eingewiesen, den Hauptanteil stellten jedoch bis<br />
zuletzt zivile „Fremdarbeiter“ und Kriegsgefangene:<br />
„Sie waren schweren Mißhandlungen ausgesetzt, die nicht selten zum Tod führten. So starb etwa Alois Bosniak<br />
aus Radovici an den Erfrierungen, die er nach zehntägiger Bunkerhaft an den Füßen davongetragen hatte. Auch<br />
Hunde wurden auf die Häftlinge gesetzt. Stockprügel auf das entblößte Gesäß setzte es, wenn sie sich von Zivilisten<br />
außerhalb des Lagers Lebensmittel zustecken ließen. Andere Häftlinge wurden so lange mit Wasser übergossen,<br />
bis sie starben. Auch Russinnen, die sich vorübergehend im Lager aufhielten, wurden von der Wachmannschaft<br />
nackt ausgezogen und mit kaltem Wasser bespritzt. Selbst Minderjährige waren schweren Folterungen<br />
ausgesetzt. Im Dezember 1943 wurden sechs ausländische Arbeiter im Alter von 17 bis 18 Jahren erhängt,<br />
nur weil sie aus Hunger einen Wecken Brot und ein Glas Marmelade bei Aufräumarbeiten aus einem bombengeschädigten<br />
Haus entwendet hatten. Im Winter 1944/45 erschoß in der Reichenau die Gestapo vier Häftlinge, die<br />
zuvor schwer gefoltert worden waren. Noch im April 1945 wurden Russen im Lager gehängt.“ 518<br />
514 Staud 2004.<br />
515 Ebd.<br />
516 Rüstungskommando Innsbruck: Zehntagesbericht zum 20.01.1942, Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg, RW<br />
21-28/8, zit. nach Schreiber 1994, 115.<br />
517 Vgl. Schreiber 1994, 238.<br />
518 Ebd., 240f.<br />
216
Die Entscheidung des Landes, gut sechzig Jahre später hier ein Lager für Asylsuchende zu<br />
errichten, löste mancherorts Fassungslosigkeit aus. „Da ist man ganz einfach sprachlos ange-<br />
sichts der Kaltschnäuzigkeit der verantwortlichen Politiker“, merkte eine Leserin in der<br />
Tiroler Tageszeitung an. 519 Ein anderer Leser empörte sich: „Es ist eine Schande!“ 520<br />
Auch wenn letztlich kein Containerlager, sondern ein barackenähnliches Fertigteilhaus er-<br />
richtet wurde, zeigt das Beispiel mehr als deutlich: Den Identität(en) eines Standortes schreibt<br />
der Unterkunftsgeber bei der Wahl der Unterkunftsstandorte keinerlei Bedeutung zu. Positive<br />
Bezugspunkte aus Geschichte und Gegenwart werden nicht genutzt, negative übersehen oder<br />
ignoriert – die Reaktionen der regierenden Landtagsfraktionen auf oppositionelle Kritik legen<br />
hier eher Zweiteres nahe. 521 Die Realisierung von Unterkünften in den Gemeinden St.<br />
Sigmund im Sellrain und Scharnitz zeigt dies auch für den Teilbereich der Gemeindeiden-<br />
tität(en): Im einen Fall wurde ein weitgehend von der Außenwelt isoliertes 199-EinwohnerIn-<br />
nen-Hochgebirgsdorf gewählt, das vornehmlich als „Wanderparadies“ gilt, im anderen ein<br />
gesellschaftlich und politisch – gleich vier KandidatInnen traten zur jüngsten Wahl des Ge-<br />
meindeoberhaupts an – äußerst fragmentiertes Dorf, das sich auf der Suche nach einem Platz<br />
im 21. Jahrhundert befindet und die hierfür von den politischen Eliten angebotenen Wege<br />
einer zunehmenden Selbstisolation oder Öffnung überaus konfliktreich debattiert. 522<br />
8.2.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess der Standortwahl<br />
Ordnet man nun für den Bereich der Standortwahl die daran vorrangig beteiligten Parteien<br />
Unterkunftsgeber, UnterkunftsbesitzerInnen und Gemeinden auf einer Aktivitäts-Passivitäts-<br />
Skala ein, so ergibt sich gegenüber 2003 ein geringfügig verändertes Bild (vgl. Abb. 3):<br />
Abbildung 3: Rolle von Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden bei der Standortwahl<br />
Unterkunfts-<br />
besitzerInnen<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
Unterkunfts-<br />
geber<br />
Gemeinden<br />
(Bürgermeister)<br />
aktiv passiv<br />
519 Tiroler Tageszeitung 15.05.2004a.<br />
520 Tiroler Tageszeitung 15.05.2004b.<br />
521 Für Jakob Wolf, Sozialsprecher der ÖVP, stellte sich Kritik am geplanten Unterbringungsort als „billiger<br />
Populismus“ dar, von einer drohenden „Ghettoisierung“ könne keine Rede sein („Ich würde mich schämen, so<br />
einen Vergleich zu ziehen.“), der sozialdemokratische Klubobmann Ernst Pechlaner zeigte sich über die ablehnenden<br />
Worte „erschüttert“, insbesondere die Grünen würden die „Asyldebatte“ für „billige Schlagzeilen“ missbrauchen<br />
(zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.05.2004a).<br />
522 Bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2004 trat in der 1.265-EinwohnerInnen-Gemeinde u.a. auch eine<br />
„Liste FRAU“ erfolgreich an, deren Spitzenkandidatin als Ziel die „Einbringung weiblicher Sicht- und Denkweisen<br />
in alle Gemeindeangelegenheiten“ formulierte; demgegenüber kündigte der langjährige Bürgermeister an,<br />
„eine großzügige, weiträumige Umfahrung vom Gemeindegebiet Scharnitz, noch besser der gesamten Olympiaregion“<br />
(!) erwirken zu wollen (zit. nach Tiroler Tageszeitung 01.03.2004b).<br />
217
Auch 2004 waren es vor allen anderen die UnterkunftsbesitzerInnen (neben Gastwirtinnen<br />
und -wirten mittlerweile auch Privatpersonen und ein katholischer Orden), die bei der Stand-<br />
ortwahl aktiv in Erscheinung traten und beim Unterkunftsgeber ihre Gebäude zur Unterbrin-<br />
gung von Asylsuchenden anboten. In einzelnen Fällen waren derartige Angebote nun jedoch<br />
erstmals auch Gemeinden zuzuordnen, die damit – wie im Fall der Stadt Hall – die Standort-<br />
suche, -wahl und letztlich auch -entscheidung übernahmen. Der Unterkunftsgeber, das Land<br />
Tirol, behielt dagegen seine indifferente Vorgangsweise größtenteils bei: Nach wie vor ver-<br />
folgte er die oben skizzierte Appell-Strategie und trat damit nur in der ersten Phase der Stand-<br />
ortsuche dezidiert aktiv in Erscheinung. Für zwei auf eigene Initiative (und von vornherein<br />
nur vorübergehend) verwirklichte Objekte wurde gleich auf landeseigene bzw. vom Land<br />
gepachtete Gebäude zurückgegriffen, eine dritte Unterkunft auf einem landeseigenen Areal<br />
neu errichtet. Im Fall der Lienzer Unterkunft, deren Realisierung im Gebäude eines katholi-<br />
schen Ordens auf aktives Ersuchen des Landesflüchtlingskoordinators erfolgt war, hatte<br />
eigentlich bereits zuvor die Stadt von sich aus Unterbringungsplätze angeboten – ein Angebot,<br />
auf das nach Aussagen des Bürgermeisters jedoch nicht reagiert worden war. An der prakti-<br />
schen Organisation neuer Standorte beteiligte sich die ressortzuständige Landesrätin 2004<br />
deutlich stärker als zuvor, auf die Formulierung eines politischen Zielkatalogs und die Schaf-<br />
fung eines klaren, rechtsverbindlichen oder zumindest Richtliniencharakter aufweisenden<br />
Handlungsrahmens wurde jedoch weiterhin verzichtet. Im Ergebnis erscheint die Politik im<br />
Bereich der Standortwahl daher erneut vorrangig von der Administration formuliert und<br />
gestaltet.<br />
8.3 Die Standortrealisierung<br />
„Flüchtlinge spalten Orte“, titelte die Tiroler Tageszeitung in ihrem Jahresrückblick Ende<br />
2004. In einer Gemeinde habe es um eine geplante Unterkunft für Asylsuchende einen<br />
„Riesenwirbel“ gegeben, in einer anderen sei es zu Auseinandersetzungen zwischen verschie-<br />
denen Gemeinderatsfraktionen gekommen. 523 Doch wie stellt sich die Realisierung neuer<br />
Unterkunftsstandorte durch das Land Tirol insgesamt dar?<br />
9.3.1 Die Rolle der Bürgermeister: Gemeinsame Basis, aber ...<br />
Informiert, jedoch nicht eingebunden – so stellte sich hinsichtlich der Standortwahl und -reali-<br />
sierung im allgemeinen die Rolle der Bürgermeister jener Gemeinden dar, in denen im zwei-<br />
ten Halbjahr 2003 Unterkünfte für Asylsuchende bestanden. Auch im Folgejahr behielt der<br />
Unterkunftsgeber seine Praxis, die Gemeindeoberhäupter nach getroffener Standortentschei-<br />
dung von der bevorstehenden Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft zu informieren, ohne sie<br />
jedoch weiter einzubinden, weitgehend bei. Deutlich wurde dies etwa im Fall des zweiten<br />
Außerferner Standorts in Ehrwald sowie bei der Standortrealisierung in Scharnitz. Nachdem<br />
in der Tourismusgemeinde bereits längere Zeit Gerüchte über die Errichtung einer Unterkunft<br />
523 Tiroler Tageszeitung 31.12.2004.<br />
218
kursiert waren ging das Land Tirol auf ein Angebot des „Bayrischen Hofs“, die dortigen<br />
Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylsuchenden zu nutzen, ein. Die Tiroler Tageszei-<br />
tung meldete Mitte April: „Am Donnerstag beziehen 20 Asylwerber ein Gasthaus mitten in<br />
Ehrwald. [...] Die Verträge zwischen dem Land und der Wirtin stehen bereits. Obwohl die<br />
Gemeinde theoretisch keinen Einfluss auf die Entscheidung hat, kam es gestern Nachmittag<br />
noch zu einem Treffen zwischen Flüchtlingskoordinator Logar und Ehrwalds Dorfchef<br />
Thomas Schnitzer (SPÖ).“ 524 Der mit Logars Entscheidung konfrontierte Bürgermeister<br />
zeigte sich wenig begeistert, enthielt sich zunächst jedoch einer Stellungnahme. Logar dage-<br />
gen erläuterte der Zeitung: „Wir versuchen mit den Gemeinden eine gemeinsame Basis zu<br />
finden. Momentan drängt allerdings die Zeit, viele Asylwerber befinden sich noch in Not-<br />
unterkünften, für sie muss rasch eine passende Lösung gefunden werden.“ 525 Der „gemeinsa-<br />
men Basis“ schreibt der Unterkunftsgeber letztlich nachrangige Bedeutung zu, wie das Bei-<br />
spiel exemplarisch zeigt: Zum einen wurde sie vor dem Hintergrund des bereits abgeschlosse-<br />
nen Vertrags mit der Unterkunftsbesitzerin gesucht, der Bürgermeister war damit vor vollen-<br />
dete Tatsachen gestellt und konnte von vornherein nur noch in Fragen der Unterbringungs-<br />
standards und der Belegungszahl versuchen, Änderungen zu erwirken. Zum anderen baute<br />
Logar allfälligen Forderungen der Gemeinde gleich vor, indem er die Suche nach der „ge-<br />
meinsamen Basis“ lediglich als Versuch charakterisierte und darauf hinwies, dass dessen<br />
Scheitern an der Errichtung der Unterkunft nichts mehr ändern könne, schließlich dränge<br />
„momentan“ die Zeit.<br />
Wie in Ehrwald wurde auch in Scharnitz die Errichtung einer Unterkunft für Asylsuchende<br />
erst mit der Gebäudebesitzerin paktiert, bevor die Gemeinde offiziell informiert wurde. Die<br />
Eigentümerin hatte die ehemalige Bäckerei, die zuvor sechs Jahre lang leergestanden war,<br />
bereits mit dem Ziel einer Vermietung an das Land Tirol angekauft, wie sie gegenüber der<br />
Tiroler Tageszeitung einräumte – die Gemeinde habe dies ohnehin gewusst. 526 Landesrätin<br />
Gangl teilte die geplante Errichtung eigenen Angaben zufolge Anfang Juli der Vizebürger-<br />
meisterin der Gemeinde, Isabella Blaha, telefonisch mit, diese habe das Vorhaben begrüßt 527 –<br />
ein Umstand, den die Vizebürgermeisterin vehement bestritt. 528 Die Landesrätin kündigte<br />
daher an, sich mit Blaha, Bürgermeister Hubert Heiss und der Hauseigentümerin treffen zu<br />
wollen. 529 Einen Monat später hatte das Treffen zwar noch immer nicht stattgefunden, dafür<br />
hatte das Land Tirol bereits das Gebäudeinnere durch kleinere Umbauarbeiten adaptieren las-<br />
sen. „Die Hauseigentümerin hat eine Vereinbarung mit dem Land Tirol, dass dieses das Haus<br />
anmietet“, gab sich der Scharnitzer Bürgermeister Heiss geschlagen. Ihm wäre es lieber, wenn<br />
„gar keine“ AsylwerberInnen in die Gemeinde kämen, aber das Land werde das Gebäude<br />
524 Tiroler Tageszeitung 13.04.2004.<br />
525 Logar, zit. nach ebd.<br />
526 Vgl. Tiroler Tageszeitung 20.09.2004.<br />
527 Vgl. Tiroler Tageszeitung 19.08.2004a.<br />
528 Vgl. Tiroler Tageszeitung 20.08.2004a.<br />
529 Ebd.<br />
219
kaum leer stehen lassen. 530 Am 24. September meldete die Tiroler Tageszeitung schließlich:<br />
„Das geplante Flüchtlingsheim in Scharnitz ist nahezu fertig. Das Land plant Gespräche mit<br />
der Gemeindeführung.“ 531 Die Gemeinde, so Flüchtlingskoordinator Logar gegenüber der<br />
Zeitung bei einem Lokalaugenschein, verfüge über „keine Kompetenzen“ in der Frage der<br />
Unterkunft, dennoch würde man seitens des Landes nun Gespräche mit Bürgermeister Heiss<br />
führen: „Wir möchten die Gemeinde umfassend informieren.“ 532<br />
Ein beachtliches <strong>Medien</strong>echo löste der Fall der letztlich nicht realisierten Unterkunft in der<br />
Kufsteiner Enrich-Kaserne aus, deren partielle Nutzung dem Land Tirol vom Verteidigungs-<br />
ministerium angeboten worden war – als Reaktion auf die regelmäßigen diesbezüglichen<br />
Appelle von Landesrätin Gangl. Die Entscheidung, die Kaserne dem Land anzubieten, fiel auf<br />
Bundesebene und im Rahmen einer Klausur der ÖVP am 1. Oktober 2004 in St. Wolfgang –<br />
über die Köpfe sämtlicher Beteiligter hinweg. „Es hat uns noch niemand angerufen, daher<br />
werden wir auch nichts vorbereiten“, teilte Oberst Friedrich Scheibler für das regionale Mili-<br />
tärkommando interessierten <strong>Medien</strong> am Folgetag mit. Er halte die Meldung für ein „Tagesge-<br />
rücht“: „Die Kaserne ist voll.“ 533 Landesrätin Gangl zeigte sich dagegen „freudig überrascht“:<br />
„Wir sind über jedes Angebot froh.“ Das Militärkommando, so die Landesrätin am Freitag,<br />
werde ebenso wie der Kufsteiner Bürgermeister Herbert Marschitz (ÖVP) noch informiert –<br />
am Montag. 534 Tatsächlich wurde Marschitz vom Land Tirol erst nach dem Wochenende offi-<br />
ziell informiert, wie die Tiroler Tageszeitung recherchierte:<br />
„Am Freitagvormittag unterrichtete der Tiroler [sic!] Verteidigungsminister Günther Platter Landeshauptmann<br />
van Staa darüber, dass die Kufsteiner Kaserne für Asylwerber geöffnet werden soll. [...] Um 12.18 [Uhr] meldete<br />
die APA, dass Bundeskanzler Schüssel die Kasernen Kufstein und Steyr öffnen will. Zu diesem Zeitpunkt hatte<br />
LH van Staa den Kufsteiner Bürgermeister noch nicht informiert. [...] Erst am Freitagabend, zehn Minuten vor<br />
20 Uhr, informierte Verteidigungsminister Platter Kufsteins Bürgermeister Herbert Marschitz, dass er die Kaserne<br />
zur Verfügung stellen wolle. Alles weitere wisse LH Herwig van Staa. »Der war aber am Wochenende<br />
nicht erreichbar«, zürnt Marschitz, »ich bin mir vorgekommen wie ein Bittsteller.« Die Funkstille zwischen dem<br />
offiziellen Tirol und Kufstein dauerte das ganze Wochenende über an, und auch am Montag seien die Informationen<br />
noch mehr als spärlich geflossen.“ 535<br />
Der öffentliche Unterkunftsgeber, der an der Realisierung des Standortes noch bis Mitte<br />
Jänner 2005 arbeitete, ehe das Vorhaben aus Kostengründen aufgegeben wurde 536 , hatte es<br />
offenbar tagelang nicht für nötig erachtet, den Bürgermeister der Stadt zu informieren – im<br />
Unterschied zum dafür eindeutig unzuständigen Verteidigungsminister, der bei seinem Tele-<br />
fonat mit Marschitz jedoch letztlich nur auf die Tiroler Landesregierung verweisen konnte.<br />
Die Schuld für die Brüskierung der Stadtführung ordnete die zuständige Landesrätin am Ende<br />
530 Heiss, zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.09.2004.<br />
531 Tiroler Tageszeitung 24.09.2004.<br />
532 Logar, zit. nach ebd.<br />
533 Scheibler, zit. nach Die NEUE 02.10.2004.<br />
534 Gangl, zit. nach ebd.<br />
535 Tiroler Tageszeitung 06.10.2004, Kasten „Stockender Informationsfluss“.<br />
536 Vgl. Tiroler Tageszeitung 18.01.2005.<br />
220
nichtsdestotrotz dem Verteidigungsministerium in Wien zu: „Auch ich lehne die fehlende<br />
Informationspolitik des Ministeriums ab“, ließ sie über eine Aussendung wissen. 537<br />
Von vornherein ausgeschlossen war eine derartige Vorgangsweise letztlich selbst bei jenen<br />
Gemeinden nicht, die – teils nach einer dahingehenden und persönlich vorgetragenen Bitte der<br />
zuständigen Landesrätin – zumindest teilweise selbst aktiv geworden waren: Das oben bereits<br />
erwähnte Beispiel der Osttiroler Bezirkshauptstadt Lienz, deren Bürgermeister eigenen Anga-<br />
ben zufolge Quartiere für Asylsuchende angeboten hatte, ohne vom Unterkunftsgeber eine<br />
Antwort zu erhalten und Monate später aus der Tiroler Tageszeitung erfuhr, dass das Land<br />
bezüglich einer Unterkunftserrichtung nun mit einem katholischen Orden verhandle 538 , zeigt<br />
dies deutlich.<br />
8.3.2 Die Rolle der Bevölkerung: Gerüchte statt Information<br />
Keine Einbindung, keine Information: Auch 2004 blieb die Rolle der Bevölkerung in jenen<br />
Gemeinden, in denen neue Unterkunftsstandorte errichtet wurden, auf die nachträgliche<br />
Kenntnisnahme reduziert, sofern nicht die Gemeinden selbst die Information der BürgerInnen<br />
übernahmen. Und auch 2004 wurde das aus dieser Praxis resultierende Informationsvakuum<br />
letztlich mit Gerüchten gefüllt, die im Fall der Gemeinde Scharnitz in der Gründung einer<br />
zivilgesellschaftlichen „Interessensgemeinschaft“ gegen die Unterkunft gipfelten – auf deren<br />
Proteste wird im Folgenden noch zurückzukommen sein.<br />
8.3.3 Die Rolle der lokalen Eliten: Kein Rückgriff auf Kössen<br />
Auf das vom Kössener Bürgermeister Stefan Mühlberger 2002 in Eigeninitiative und durch-<br />
aus mit Erfolg erprobte Modell einer Konferenz lokaler Eliten griff der Unterkunftsgeber<br />
2004 nicht zurück. Auch die im Fall Landeck eingesetzte Adaption dieses Modells zur<br />
schlichten Pressekonferenz kam nur bei der Präsentation eines einzigen neuen Standorts zum<br />
Einsatz: In Imst stellten Landesrätin Gangl, Bürgermeister Reheis, der Flüchtlingskoordinator<br />
des Landes, der Imster Bezirkshauptmann <strong>Raimund</strong> Waldner sowie Stadtpfarrer Alois<br />
Oberhuber die auf dem Areal der ehemaligen Kaserne geplante Unterkunft öffentlich vor.<br />
Reheis betonte dabei den „humanitären Charakter“ der einstimmig erfolgten Entscheidung des<br />
Gemeinderats, ein Gebäude als Unterkunft für Asylsuchende zur Verfügung zu stellen:<br />
„Gerade in einer Zeit, in der überall von Krieg und Folter geredet wird, sollten wir nicht un-<br />
sere Türen verschließen. Es kommen Menschen zu uns, die Sachen erlebt haben, die wir uns<br />
wahrscheinlich gar nicht vorstellen können.“ 539 Bezirkshauptmann Waldner konnte dies<br />
offenbar durchaus und machte den Bürgermeister daher darauf aufmerksam, dass das Kasernenareal<br />
noch mit Stacheldraht eingezäunt sei, Reheis versprach die Entfernung. 540<br />
537 Gangl, zit. nach SPÖ Tirol 06.10.2004.<br />
538 Vgl. Tiroler Tageszeitung 13.05.2004c.<br />
539 Reheis, zit. nach Tiroler Tageszeitung 13.05.2004b.<br />
540 Ebd.<br />
221
8.3.4 Die Zustimmung der Gemeinden: Von »Zirkusaffen«<br />
und »notleidenden Familien«<br />
Die einstimmige Entscheidung des Imster Gemeinderats stellte 2004 nicht die einzige expli-<br />
zite Zustimmung einer Tiroler Gemeinde zur Unterbringung von Asylsuchenden dar: Auch in<br />
Lienz wurde die Aufnahme von Flüchtlingen von allen Gemeinderatsfraktionen befürwor-<br />
tet 541 , obwohl hier die Stadtführung zuvor vom Unterkunftsgeber mehr oder weniger „über-<br />
rumpelt“ worden war, hatte dieser doch trotz eines vorliegenden Gemeindeangebotes Ver-<br />
handlungen mit einem katholischen Orden vorgezogen.<br />
Gleich in mehreren Fällen fühlten sich jedoch auch 2004 Gemeindeführungen vom Unter-<br />
kunftsgeber getäuscht. Besonders offensichtlich wurde dies im Fall der Außerferner Ge-<br />
meinde Ehrwald: Hier ging man kurz vor der Eröffnung der Unterkunft davon aus, dass im<br />
dafür vorgesehenen Gasthof drei Flüchtlingsfamilien untergebracht würden – das Land Tirol<br />
hatte dies der Gemeinde gegenüber offenbar angedeutet. Wenige Tage vor dem Bezug des<br />
Gasthofs sprach die Tiroler Tageszeitung jedoch von zwanzig Flüchtlingen 542 , da im Gebäude<br />
noch erheblich mehr Betten zur Verfügung standen, forderten Bürgermeister Thomas<br />
Schnitzer und ein Vertreter des Tourismusverbandes, Ernst Mayer, vorsorglich eine „Höchst-<br />
grenze“ von 17 Personen. 543 Der Touristiker und der Bürgermeister fühlten sich vom Land<br />
Tirol übergangen, wie sie gegenüber der Tageszeitung verärgert anmerkten: „Wir haben im<br />
Rahmen der Gespräche mit den Verantwortlichen sehr negative Erfahrungen gemacht. Wir<br />
mussten trotz vereinbarter Gesprächstermine und anscheinend verhandelbarer Asylwerber-<br />
zahlen aus der Presse erfahren, dass die Anzahl der Personen, die Zusammensetzung sowie<br />
der Zeitpunkt der Zuteilung bereits fixiert sind.“ Nun stünde gar eine Unterbringung von vier-<br />
zig bis fünfzig Asylsuchenden im Raum: „Eine derart hohe Anzahl ist nicht vertretbar und<br />
Tourismustreibenden und der Bevölkerung nicht zuzumuten.“ Beide bemängelten überdies,<br />
dass es vor Ort „keine Infrastruktur für die Betreuung der Asylanten gibt und keine Sozial-<br />
arbeiter, Psychologen, Dolmetscher oder sonstige Experten ansässig sind, welche Anliegen,<br />
Probleme oder eine Konfliktbetreuung von Asylwerbern aber auch Einheimischen durchfüh-<br />
ren könnten.“ 544 Die Unterbringung von Asylsuchenden in der Gemeinde, befürchtete Touristiker<br />
Mayer, werde „negative Auswirkungen auf die gesamte Zugspitzregion“ haben. 545<br />
Knapp eine Woche später meldete die Tiroler Tageszeitung: „Eklat in Ehrwald: Während<br />
Gemeinde und TVB mit dem Flüchtlingskoordinator über 17 Asylanten verhandelten, zogen<br />
21 in den Bayrischen Hof ein.“ 546 Der Ehrwalder Bürgermeister und der Obmann des Touris-<br />
musverbandes, Hermann Oberreiter, erfuhren dies offenbar erst im Laufe einer von ihnen ab-<br />
541 Vgl. Tiroler Tageszeitung 24.06.2004a.<br />
542 Vgl. Tiroler Tageszeitung 13.04.2004.<br />
543 Vgl. Tiroler Tageszeitung 14.04.2004c.<br />
544 Mayer/Schnitzer, zit. nach ebd.<br />
545 Mayer, zit. nach ebd. Ehrwalder Touristiker initiierten daher eine Unterschriftensammlung gegen die Unterkunft,<br />
die jedoch von der Bevölkerung eher zurückhaltend aufgenommen wurde (Interview Beratung/Betreuung<br />
09, 18.08.2004).<br />
546 Tiroler Tageszeitung 23.04.2004<br />
222
gehaltenen Pressekonferenz. „Gestern haben wir noch mit dem Flüchtlingskoordinator Peter<br />
Logar über die Obergrenze von 17 Personen verhandelt. Jetzt erfahren wir, dass bereits 21<br />
Asylsuchende in Ehrwald einquartiert sind. Das war eine reine Scheinverhandlung“, empörte<br />
sich daher Oberreiter: „Das ist der Gipfel der Impertinenz. Ich komme mir vor wie ein<br />
Zirkusaffe.“ 547 Bürgermeister Schnitzer fühlte sich vom Flüchtlingskoordinator persönlich<br />
hintergangen und kündigte an: „Mit diesem Menschen werden wir nie mehr an einen [sic!]<br />
Tisch sitzen. Wir wurden jetzt dreimal eiskalt angelogen, das reicht!“ 548 Immer wieder habe<br />
man ihn beim Land auf Rückrufe vertröstet, die jedoch ausgeblieben seien, die Verantwortung<br />
für dieses „Desaster“ trage nun die zuständige Landesrätin Gangl. Man habe sich die Unter-<br />
bringung von 17 Asylsuchenden „abringen lassen“ und „guten Willen gezeigt“, jetzt sei damit<br />
aber Schluss, so der Bürgermeister drohend: „Für die Sicherheit von 17 Personen konnte ich<br />
die Verantwortung übernehmen, jetzt ist es nicht mehr möglich.“ Er wolle nun alle Möglich-<br />
keiten, feuerpolizeilich wie rechtlich, in vollem Rahmen ausschöpfen. 549 Der so massiv ange-<br />
griffene Flüchtlingskoordinator des Landes, Peter Logar, rechtfertigte sich kaum: „Das<br />
Innenministerium wollte alle 40 Betten im Bayrischen Hof belegen. Das habe ich abgewehrt.<br />
Wir mussten aber zehn Leute übernehmen. Dabei habe ich geschaut, dass es Familien-<br />
verbände sind.“ 550 Auch die Wirtin des Gasthofes habe überdies zu bedenken gegeben, dass<br />
der Betrieb bei weniger als zwanzig untergebrachten Personen „nicht zu führen“ sei. 551 Das<br />
Argument des Koordinators, er habe ohnehin versucht, gegenüber dem kurz vor Umstellung<br />
auf das neue Unterbringungssystem der „Grundversorgung“ zumindest noch partiell zuständi-<br />
gen Innenministerium die Interessen der Gemeinde zu wahren und die Belegung aller Betten<br />
„abgewehrt“, wurde freilich zwei Monate später von ihm selbst konterkariert: Ende Juni 2004<br />
machte der Ehrwalder Bürgermeister noch einmal seinem Ärger Luft. „Wir werden überhaupt<br />
nicht mehr gefragt. Wir hatten damals klare Rahmenbedingungen gesetzt, diese sind bei<br />
Weitem überschritten“, so Schnitzer. Ursprünglich seien 17 Asylsuchende für die Gemeinde<br />
vereinbart gewesen, gekommen seien 21 „und seit Dienstag hat sich die Anzahl fast verdop-<br />
pelt“. 552 Für die Verdoppelung der Belegungszahl war nun allein der Koordinator des Landes<br />
verantwortlich: Seit 1. Mai war im Rahmen des „Grundversorgungssystems“ für die Unter-<br />
bringung nun auch formal ausschließlich das Land zuständig.<br />
Die Auseinandersetzungen in Ehrwald konzentrierten sich auf die Zahl der dort unterge-<br />
brachten Asylsuchenden, die der Unterkunftsgeber aus Sicht der Gemeindeführung mit dem<br />
Ziel, dadurch die Zustimmung der Gemeinde zu erwirken oder wenigstens allzu laute Proteste<br />
zu verhindern, bewusst geringer angegeben hatte als von ihm tatsächlich geplant – ein Vor-<br />
wurf, der so bereits von mehreren Bürgermeistern jener Gemeinden geäußert worden war, in<br />
547 Oberreiter, zit. nach ebd.<br />
548 Schnitzer, zit. nach ebd.<br />
549 Ebd.<br />
550 Logar, zit. nach ebd.<br />
551 Ebd.<br />
552 Schnitzer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.06.2004a.<br />
223
denen im zweiten Halbjahr 2003 Unterkünfte bestanden hatten. Mehrmals tauchte im Fall<br />
Ehrwald jedoch auch jenes Element auf, das bei der Realisierung des Standorts in Landeck im<br />
Vordergrund gestanden hatte: die Ankündigung, ausschließlich oder zumindest mehrheitlich<br />
Flüchtlingsfamilien am Standort unterzubringen und die folgende tatsächliche Unterbringung<br />
von Familien in der unmittelbaren „Startphase“. War die Nutzung des bei Bürgermeistern wie<br />
Bevölkerung gleichermaßen beliebten Bilds der „herbergssuchenden Familien“ im Fall von<br />
Landeck Ende 2003 noch als einmalige weihnachtliche Inszenierung erschienen, so ent-<br />
wickelte sich daraus im Lauf des Jahres 2004 die dominierende Strategie, mit der die Zu-<br />
stimmung der jeweiligen Gemeinden erwirkt werden sollte und in der Regel auch konnte.<br />
Nicht nur in Ehrwald sondern auch bei einer ganzen Reihe weiterer Gemeinden rückte man<br />
bei aufkommenden Protesten, spätestens jedoch rechtzeitig zur Unterkunftseröffnung Fami-<br />
lien in den Vordergrund:<br />
• Bei der Eröffnung der vorübergehend betriebenen Unterkunft im Schloss Mentlberg in Innsbruck konnten<br />
regionale <strong>Medien</strong> Anfang Mai berichten, es würden vornehmlich „Familien aus Tschetschenien“ untergebracht<br />
– der Unterkunftsgeber vergaß nicht darauf hinzuweisen, dass man noch weitere Unterkunftsplätze<br />
für Asylsuchende benötige. 553<br />
• Im Rahmen der Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der geplanten Unterkunft auf dem Areal der<br />
ehemaligen Kaserne von Imst war es dem Flüchtlingskoordinator des Landes wichtig, auf die Unterbringung<br />
von Familien hinzuweisen. Die Tiroler Tageszeitung berichtete: „Konkret werden im alten Kommandogebäude<br />
in der stillgelegten Kaserne etwa 60 Personen für etwa zwei Jahre eine Unterkunft finden. Der<br />
Großteil davon sind Familien aus Tschetschenien, wie Flüchtlingskoordinator Logar erklärte.“ 554 Das Amt<br />
der Tiroler Landesregierung unterstrich dies nochmals in einer Pressemitteilung: Der Imster Bürgermeister<br />
habe zugesagt, sechzig Flüchtlinge aufzunehmen, „darunter vorwiegend Flüchtlingsfamilien“. 555 Bei der<br />
Eröffnung der Unterkunft Ende August meldete Landesrätin Gangl Vollzug: „62 Flüchtlinge – davon vorwiegend<br />
Flüchtlingsfamilien – finden nun [...] in Imst ein Zuhause“. 556 Die Betroffenen seien von der Unterkunft<br />
in Innsbruck-Mentlberg nach Imst verlegt worden.<br />
• Drei Flüchtlingsfamilien bezogen in der zweiten Maiwoche die Unterkunft in der Bezirkshauptstadt Schwaz.<br />
Bürgermeister Lintner kündigte an, man wolle den Männern unter den Betroffenen „eine gewisse Beschäftigung“<br />
anbieten, die Kinder sollten mit einer schulischen Sprachbetreuung gefördert werden. 557<br />
• Der Vizebürgermeister von Hall in Tirol, Schweighofer, gab Ende Mai die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien<br />
bekannt: Im „Annaheim“ sollten bis Ende 2006 Familien aus Tschetschenien und der Mongolei<br />
untergebracht werden. 558 Nach dem Bezug der Unterkunft konnte die Tiroler Tageszeitung berichten: „Wo<br />
vor kurzem noch Hammer und Säge den Ton angaben, schallt nun Kindergeschrei. Zahlreiche Kinderwägen<br />
stehen im Eingang. Dazwischen wuseln die Kleinen herum.“ 559 Der Unterkunftsgeber hatte dafür gesorgt,<br />
dass Familien aus anderen Unterkünften nach Hall verlegt worden waren – unter ihnen die Familie von<br />
Lawa, einer Schülerin, die bereits zur Eröffnung der Landecker Unterkunft mit ihren Eltern und Geschwistern<br />
aus der Leutasch in die Oberländer Bezirkshauptstadt verlegt worden war. 560 Landesrätin Gangl ließ anlässlich<br />
der offiziellen Eröffnung des Hauses über eine Aussendung verlauten, man habe in Hall nun „50<br />
553<br />
ORF 07.05.2004. Wie die Tiroler Tageszeitung später berichtete, waren unter den 85 Personen 37 Kinder<br />
gewesen (Tiroler Tageszeitung 11.06.2004).<br />
554<br />
Tiroler Tageszeitung 13.05.2004b.<br />
555<br />
AdTLR 14.05.2004; in der Folge wortident in Tiroler Tageszeitung 14.05.2004.<br />
556<br />
Gangl, zit. nach SPÖ Tirol 24.08.2004. Die Tiroler Tageszeitung konnte ihren LeserInnen ein dem Anlass<br />
entsprechendes Bild präsentieren: In der neuen Unterkunft hatte es bereits zum ersten Mal Nachwuchs gegeben,<br />
ein Foto zeigte den zwei Wochen zuvor geborenen „Imster“ mit seiner zufriedenen Mutter, einem stolzen Bürgermeister<br />
und einer geradezu selig wirkenden Landesrätin (vgl. Tiroler Tageszeitung 24.08.2004b).<br />
557<br />
ORF 01.05.2004; Tiroler Tageszeitung 14.05.2004.<br />
558<br />
Tiroler Tageszeitung 21.05.2004; vgl. Tiroler Tageszeitung 18.06.2004.<br />
559 Tiroler Tageszeitung 21.09.2004b.<br />
560 Vgl. hierzu Abschnitt 5.5.<br />
224
asylsuchende Menschen aus sieben verschiedenen Herkunftsländern untergebracht, darunter 26 Kinder aus<br />
insgesamt 12 Familien“. 561<br />
• Auf die Unterbringung von Familien achtete man auch in den Fällen von Kirchberg und Ried im Oberinntal:<br />
In erstgenannter Gemeinde wurden in einem Ferienhaus anfänglich zwei, im leerstehenden Kapuzinerkloster<br />
in Ried drei Familien einquartiert. 562<br />
• In Lienz hatte ursprünglich Bürgermeister Hibler die Unterbringung von zwei bis drei Familien angeboten,<br />
allerdings ohne Erfolg. Bereits Monate vor dem Bezug der dann vom Land Tirol realisierten Unterkunft in<br />
einem Ordensgebäude wurde vom Unterkunftsgeber jedoch angekündigt, „Tschetschenen, darunter 15 bis<br />
20 Kinder“, unterbringen zu wollen. 563 Beim Bezug des Gebäudes achtete das Land darauf, dass Familien im<br />
Vordergrund standen, entsprechend konnten regionale <strong>Medien</strong> die Ankunft von 59 Personen, darunter elf<br />
Familien mit insgesamt 33 Kindern, vermelden. 564 <strong>Medien</strong>berichten zufolge waren die Familien „mit Bussen<br />
von den Lagern Mentlberg und Kleinvolderberg nach Lienz gefahren“ worden. 565<br />
• Nachdem sich gegen die geplante Unterkunft in der kleinen Gemeinde Scharnitz zunehmend Widerstand<br />
formiert hatte, signalisierte das Land als Unterkunftsgeber, dass im Ort vorwiegend Familien mit Kindern<br />
untergebracht werden sollten. 566 Die Proteste verebbten jedoch keineswegs, Flüchtlingskoordinator Logar<br />
deutete daher gegenüber der Tiroler Tageszeitung an, dass vorerst möglicherweise nur eine einzige Familie<br />
nach Scharnitz kommen werde. 567 Der Koordinator war sich der Wirkung seiner Worte wohl mehr als bewusst<br />
gewesen: „Das würde die Scharnitzer schon beruhigen“, antwortete postwendend Angela Pfeifer,<br />
Vertreterin der gegen die Unterkunft gerichteten BürgerInneninitiative. 568<br />
• In Innsbruck wurde zur Jahresmitte die Errichtung einer Unterkunft im leerstehenden Schulungsheim der<br />
Landwirtschaftskammer überlegt – an die fünfzig Personen, „vornehmlich Familien“, könnten dort Unterkunft<br />
finden, wie Landesrätin Gangl erläuterte. 569 Ende Jänner 2005 wurde der Standort dann tatsächlich<br />
eröffnet: „Acht Familien mit 26 Kindern hauchen dem Schulungsheim [...] wieder Leben ein“, urteilte die<br />
Tiroler Tageszeitung, eine lokale Zeitung zeigte auf einem Foto Landesrätin Gangl und die Innsbrucker<br />
Bürgermeisterin Zach mit sechs Flüchtlingskindern. 570<br />
• Bei der Eröffnung des Unterkunftskomplexes im Stadtteil Rossau in Innsbruck standen Ende 2004 einmal<br />
mehr tschetschenische Flüchtlingsfamilien im Vordergrund, regionale und lokale <strong>Medien</strong> berichteten nach<br />
einer diesbezüglichen Aussendung der Landesverwaltung von 72 Asylsuchenden, darunter 14 Familien, für<br />
die der Bezug des Fertigteilhauses ein „großer Tag“ sei. 571<br />
• Auch die im Frühjahr 2004 reaktivierte Unterkunft im desolaten ehemaligen „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“<br />
in Volders wurde der Öffentlichkeit mit einem Bildbericht vorgestellt, der eine Mutter mit Kleinkind<br />
sowie drei spielende Buben zeigte. 572 Hier scheint die Initiative zum Bericht freilich vom ÖRK ausgegangen<br />
zu sein, dem die Betreuung der Asylsuchenden oblag.<br />
Der Überblick macht deutlich: Nahezu in allen im Lauf des Jahres 2004 eröffneten Unter-<br />
künften wurden zumindest zum Eröffnungszeitpunkt „vornehmlich“ Flüchtlingsfamilien<br />
untergebracht, was von den regionalen <strong>Medien</strong> eifrig rezipiert wurde. Auch wenn nicht davon<br />
auszugehen ist, dass jedem einzelnen der genannten Fälle tatsächlich taktische Überlegungen<br />
zugrunde lagen – der strategische Charakter der Vorgangsweise des Unterkunftsgebers ist sich<br />
561<br />
SPÖ Tirol 19.10.2004.<br />
562<br />
Interview Beratung/Betreuung 09, 18.08.2004.<br />
563<br />
Tiroler Tageszeitung 24.06.2004a.<br />
564<br />
Osttiroler Bote 15.09.2004; so auch Die NEUE 10.11.2004 anlässlich der offiziellen Eröffnung des Hauses.<br />
565<br />
Osttiroler Bote 15.09.2004.<br />
566<br />
Tiroler Tageszeitung 19.08.2004a.<br />
567<br />
Tiroler Tageszeitung 20.09.2004.<br />
568<br />
Pfeifer, zit. nach ebd.<br />
569<br />
Tiroler Tageszeitung 10.07.2004.<br />
570<br />
Tiroler Tageszeitung 26.01.2005; vgl. tip 28.01.2005.<br />
571<br />
Vgl. AdTLR 02.12.2004; Tiroler Tageszeitung 03.12.2004; tip 10.12.2004. Die 14 Familien verfügten laut<br />
Aussendung insgesamt freilich nur über 13 Kinder – wie man auf einem Foto im regionalen Leitmedium sehen<br />
konnte, waren von diesen überdies zumindest drei einer einzigen Familie zuzuordnen (vgl. Tiroler Tageszeitung<br />
03.12.2004). In der Unterkunft war damit das soziologisch interessante Phänomen einer kinderlosen Familie<br />
offenbar gleich mehrfach zu bestaunen.<br />
572<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 04.05.2004.<br />
225
nicht nur im Fall von Scharnitz ist er offensichtlich. Das Beispiel der gescheiterten Realisie-<br />
rung einer Unterkunft in der Bezirkshauptstadt Kufstein unterstreicht dies: Nachdem der<br />
Unterkunftsgeber die Stadtführung tagelang nicht vom Plan (die sogar in überregionalen<br />
<strong>Medien</strong> breit diskutiert worden waren) informiert hatte, in der lokalen Kaserne bis zu hundert<br />
Asylsuchende unterzubringen, versuchte Landesrätin Gangl, den über diese Vorgangsweise<br />
empörten Bürgermeister zu besänftigen. „Sie warb am Dienstag in Kufstein für Verständnis“,<br />
berichtete die Tiroler Tageszeitung, es gehe darum, sieben „notleidende Familien“ und damit<br />
insgesamt nicht hundert, sondern lediglich siebzig Asylsuchende unterzubringen. 573 Tatsäch-<br />
lich hatte Gangl, wie ihre Partei in einer Aussendung mitteilte, gezielt auf die bei allen Bür-<br />
germeisterInnen beliebten Familien gesetzt: „Da wir in anderen Orten bereits positive Erfah-<br />
rungen gemacht haben“, so die Landesrätin, „wollen wir auch hier versuchen, in erster Linie<br />
Familien mit Kindern unterzubringen. Mit einer solchen Personengruppe von etwa acht grö-<br />
ßeren Familien gibt es sicher keine Probleme und kein Gefährdungspotenzial.“ 574 Gangls Hin-<br />
weis zeigte sofort Wirkung: Schon am Folgetag ließ die Stadtführung verlauten, die Unter-<br />
bringung von sieben Familien sei „erträglich“, man überlege gar, sie in Wohnungen unterzubringen.<br />
575<br />
8.3.5 »Die Leute haben Angst.« Konfliktprävention und Konfliktlösung<br />
Der oben bereits ausführlich dargelegte Prozess der Standortrealisierung in Ehrwald zeigt<br />
bereits: Auch 2004 kam es im Zuge der Errichtung neuer Unterkünfte zu teils heftigen Kon-<br />
flikten mit den betroffenen Gemeinden. Neben Ehrwald war dies insbesondere in Scharnitz<br />
der Fall. Wie in Ehrwald führten hier Gerüchte zu heftigen Debatten in der Bevölkerung.<br />
Rasch bildete sich gegen die geplante Unterkunft eine „Interessensgemeinschaft“, die mit der<br />
Sammlung von Unterschriften begann – innerhalb einer Woche hatte ein Viertel der etwas<br />
mehr als 1.200 ScharnitzerInnen unterschrieben. 576 Die Unterkunftsbesitzerin, offenbar eine<br />
deutsche Staatsbürgerin, wurde als „ausländische Investorin“ bezeichnet, die sich nur an<br />
Scharnitz „bereichern“ wolle. 577 Vizebürgermeisterin Blaha stellte sich hinter die BürgerInnen<br />
und machte mit markigen Worten klar, dass „Asylanten in Scharnitz nicht willkommen ge-<br />
heißen“ würden, die Gemeinde sei als „Asylanten-Dorf“ nicht geeignet, man wisse überdies<br />
aus anderen Orten, „wie es ist, wenn sich in einem Ort Asylanten befinden“. 578 Die Gemeinde<br />
werde versuchen, die Unterkunft zu verhindern. „Die Leute haben Angst vor dem, was da auf<br />
uns zukommen soll“, führte Angela Pfeifer von der BürgerInneninitiative vor <strong>Medien</strong>-<br />
vertreterInnen aus, Bürgermeister Heiss und Landesrätin Gangl hätten die Unterschriften be-<br />
reits erhalten, der Bürgermeister sei aufgefordert worden, „alle politischen und persönlichen<br />
573 Tiroler Tageszeitung 06.10.2004.<br />
574 Gangl, zit. nach SPÖ Tirol 06.10.2004.<br />
575 Tiroler Tageszeitung 07.10.2004.<br />
576 Vgl. Tiroler Tageszeitung 19.08.2004a.<br />
577 Vgl. Tiroler Tageszeitung 20.09.2004.<br />
578 Blaha, zit. nach Tiroler Tageszeitung 14.08.2004b.<br />
226
Kräfte aufzuwenden, um den totalen Niedergang des Ortes abzuwenden“. 579 Die Tiroler<br />
Tageszeitung berichtete nun ausführlich über den Konflikt: Die Stimmung in der Gemeinde<br />
sei „aufgeheizt“, Betriebe fürchteten um ihr Geschäft, etwa der Wirt des der Unterkunft ge-<br />
genüberliegenden Gasthofs „Zur Blauen Traube“: Sollte das „Heim“ realisiert werden, werde<br />
er wohl Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, für den Tourismus sei die Unterkunft „sicher<br />
problematisch“, schließlich laufe das Geschäft schon jetzt nicht besonders gut. 580 Manfred<br />
Griesser, Betreiber eines Oldtimer-Geschäfts, ließ die Zeitung wissen: „Meine Versicherung<br />
hat mir Probleme angekündigt, sollte das Flüchtlingsheim kommen, und meine Kunden wer-<br />
den auch nicht begeistert sein.“ 581 Bürgermeister Heiss äußerte sich zuversichtlich, die Unter-<br />
kunft verhindern zu können: „So wie es jetzt ausschaut, ist das Projekt gestoppt.“ Eine hoch-<br />
rangige Landespolitikerin habe ihm dies versichert. 582 Landesrätin Gangl kündigte nun an,<br />
sich mit Heiss, Blaha und der Unterkunftsbesitzerin treffen zu wollen: Im Ort herrsche große<br />
Unsicherheit, es sei daher wichtig, dass einmal alle Fakten auf den Tisch kämen. 583 Zugleich<br />
warf Gangl jedoch der Vizebürgermeisterin vor, diese habe einen „Kurswechsel“ vorgenom-<br />
men, hätte sie doch Monate früher ihr gegenüber nichts gegen eine Unterkunft in der Ge-<br />
meinde einzuwenden gehabt. Blaha reagierte rasch: Sie habe „zu keiner Zeit ein Asylanten-<br />
heim in Scharnitz begrüßt“, der Landesrätin mangle es an „Realitätssinn in Flüchtlingsfragen“<br />
– sie solle sich vor Ort mit den Problemen in Scharnitz auseinandersetzen. 584 Das von Gangl<br />
angekündigte Gespräch fand nicht statt, trotz des eskalierenden Konflikts zog der Unter-<br />
kunftsgeber die Realisierung gegen den Willen der Gemeinde durch.<br />
In Ehrwald wie in Scharnitz wurden von Seiten des Unterkunftsgebers keinerlei konflikt-<br />
präventive Maßnahmen gesetzt. Die zahlreichen kursierenden Gerüchte – letztlich eine Folge<br />
der unklaren Informationslage und ein wesentlicher Konfliktmotor – wurden nicht durch eine<br />
gezielte, transparente und nachvollziehbare Informationspolitik zerstreut, sondern weitgehend<br />
ignoriert. Nachdem die Konflikte eskalierten, griff man weder auf professionelle Lösungs-<br />
techniken zurück, noch versuchte man pragmatisch, die lautesten KritikerInnen (die ja wie im<br />
Fall der Scharnitzer „Interessensgemeinschaft“ beachtliches Engagement an den Tag gelegt<br />
und sogar signalisiert hatten, eine geringe Zahl an Asylsuchenden durchaus akzeptieren zu<br />
wollen) einzubinden. Die Kommunikation über die <strong>Medien</strong> ersetzte die persönliche – eine<br />
Vorgangsweise, die auch im Fall von Kufstein beobachtet werden konnte.<br />
8.3.6 Die Vorbereitung der Unterkunftsleitungen: Positive Veränderungen<br />
Wie stellte sich die Vorbereitung der Unterkunftsleitungen 2004 dar? Hier war für die im<br />
Herbst 2003 bestehenden Unterkünfte eine Geringschätzung der mit der Flüchtlingsaufnahme<br />
579<br />
Pfeifer, zit. nach Tiroler Tageszeitung 19.08.2004a.<br />
580<br />
Ebd.<br />
581<br />
Griesser, zit. nach ebd.<br />
582<br />
Heiss, zit. nach ebd.<br />
583<br />
Ebd.<br />
584<br />
Blaha, zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.08.2004a.<br />
227
und -unterbringung verbundenen und von den LeiterInnen zu leistenden Arbeit konstatiert<br />
worden, die LeiterInnen hätten sich oft zu wenig vorbereitet und teils regelrecht „über-<br />
rumpelt“ gefühlt. Im Folgejahr, so scheint es, stellt sich die Situation zunehmend anders dar.<br />
Das Land Tirol ging mehr und mehr dazu über, die Betreuung neu realisierter, teils jedoch<br />
auch bereits bestehender Unterkünfte neu zu organisieren. So wurde etwa bei den vorüber-<br />
gehend betriebenen Unterkünften im ehemaligen „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“ und in<br />
Innsbruck-Mentlberg die Betreuung an das Rote Kreuz vergeben 585 , die Unterkunft in Schwaz<br />
wurde den LeiterInnen der landeseigenen Unterkunft im nicht allzu weit entfernten Reith im<br />
Alpbachtal unterstellt. 586 Auf diese Art „mitbetreut“ wurde auch der Standort in Ried im<br />
Oberinntal: Der Leiterin der Landecker Unterkunft wurde auch die Verantwortung für die in<br />
Ried untergebrachten Asylsuchenden übertragen. 587 Zumindest bei zwei neu realisierten<br />
Standorten übertrug man die Leitung Frauen, die zuvor eine andere Unterkunft geleitet hatten<br />
und nun „wechselten“: Die Leiterin der Haller Unterkunft hatte zuvor in Reith im Alpbachtal<br />
gearbeitet 588 , jene des Unterkunftskomplexes in der Innsbrucker Rossau Asylsuchende im<br />
Schülerheim Volders betreut. 589 Für andere Unterkünfte schrieb man Teilzeitstellen aus, meist<br />
stellte man in der Folge lokal verankerte Frauen als „Heimleiterinnen“ ein, etwa in Imst 590 ,<br />
Lienz 591 und zuletzt auch in Scharnitz. Die Leitung des Hauses in Scharnitz wurde in der Aus-<br />
schreibung dabei mit der „Betreuung, Information und soziale[n] Beratung“ jener Asyl-<br />
suchenden gekoppelt, die in der bereits bestehenden Unterkunft in der nahen Leutasch lebten.<br />
592<br />
8.3.7 Die Startphase: Vermehrt Ansprechpartnerinnen vor Ort<br />
Die mehr und mehr forcierte Praxis, für die Leitung der Unterkünfte und die Betreuung der<br />
dort lebenden Asylsuchenden eigenes Personal zu engagieren 593 , führte offensichtlich auch zu<br />
einer professionelleren Organisation der „Startphase“ neuer Unterkünfte, sofern diese nicht<br />
ohnehin wie im Fall der Stadt Hall in Tirol von führenden GemeindepolitikerInnen aktiv mit-<br />
getragen wurde. War es bei der Eröffnung des Standorts in Ehrwald noch zu Konflikten mit<br />
der Gemeinde gekommen, weil diese unter anderem eine gezielte Betreuung der Asyl-<br />
585<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 04.05.2004; 11.06.2004a.<br />
586<br />
Vgl. Tiroler Tageszeitung 02.06.2004.<br />
587<br />
Interview Beratung/Betreuung 09, 18.08.2004.<br />
588<br />
Vgl. SPÖ Tirol 19.10.2004.<br />
589<br />
Vgl. AdTLR 02.12.2004; tip 10.12.2004. Die „Heimleiterin“ übernahm Anfang 2005 zusätzlich die Leitung<br />
der neu eröffneten Unterkunft im ehemaligen Schulungsheim der Landwirtschaftskammer in Innsbruck (vgl. tip<br />
28.01.2005).<br />
590<br />
Vgl. SPÖ Tirol 24.08.2004.<br />
591<br />
Vgl. Osttiroler Bote 15.09.2004.<br />
592<br />
Stellenausschreibung in Die NEUE 19.01.2005, 19. Das Anforderungsprofil sah u.a. die österreichische<br />
Staatsangehörigkeit, „soziales Verständnis, soziale Kompetenz, Kontaktfreudigkeit“, organisatorische Fähigkeiten,<br />
Sprachkenntnisse in Englisch oder Französisch und möglichst auch „aus den Hauptherkunftsländern“ sowie<br />
eine „Sozialarbeiterausbildung bzw. Maturaniveau oder mehrjährige Erfahrung in einschlägiger Tätigkeit, vorzugsweise<br />
Migrationsbereich“, vor (ebd.).<br />
593<br />
Im Fall der letztlich nicht eingerichteten Unterkunft in der Kufsteiner Kaserne wurde dies sogar von vornherein<br />
öffentlich angekündigt (vgl. SPÖ Tirol 06.10.2004).<br />
228
suchenden vermisste 594 , so konnte nun mehr und mehr auf für den jeweiligen Standort eigens<br />
angestellte „Heimleiterinnen“, teils zusätzlich auf eigene Betreuerinnen verwiesen werden,<br />
die als Ansprechpartnerinnen vor Ort zur Verfügung standen und lokales Engagement koordi-<br />
nieren und bündeln konnten. Dies schlug sich nicht zuletzt in der örtlichen Berichterstattung<br />
nieder, wie das Beispiel Lienz zeigt: „Seit Montag sind die 59 Asylbewerber in Lienz“, be-<br />
richtete der Osttiroler Bote nach dem Bezug der Unterkunft. Die Flüchtlinge kämen „aus den<br />
unterschiedlichsten Bildungs- und Berufsschichten“:<br />
„Techniker und Ärzte sind genauso darunter wie Näherinnen. Laut Heimleiterin Janette Schneider, einer Slowakin,<br />
fühlen sich die Asylanten in Lienz sehr wohl. Das Entgegenkommen der Bevölkerung schätzen die<br />
Betreuerinnen sehr. Täglich kommen Unmengen an Kleider-, Bettwäsche- und Spielzeugspenden an. Die Unterstützung<br />
der Flüchtlinge erfolgt durch Taschengeld, Deutschkurse, Handarbeitskurse etc. Auch der Kontakt mit<br />
den Einheimischen wird gesucht: Die Kinder gehen bereits in die Schule, man bemüht sich um Gratis-Mitgliedschaften<br />
in diversen Sportvereinen. [...] Die Bevölkerung wird gebeten, ihnen entgegenzukommen. »Jeder kann<br />
einen kleinen Beitrag leisten. Zusammen wird es dann ein großer Beitrag«, sagt Dr. Elfie Greiter, Hauptschullehrerin<br />
und Betreuerin der Asylanten.“ 595<br />
Das Beispiel Scharnitz zeigt freilich, dass die Ausschreibung und Besetzung der „Heimleiter-<br />
Innen“-Stellen erst nach bereits erfolgter Realisierung des Standorts vorgenommen wird.<br />
8.3.8 Die Unterbringung von Asylsuchenden: Nach wie vor ein<br />
kommunales Defizitgeschäft?<br />
Können Gemeinden von der Flüchtlingsaufnahme profitieren oder überwiegen die dadurch<br />
entstehenden Kosten? Das Resümee der systematischen Untersuchung jener Unterkunfts-<br />
standorte, die im Herbst 2003 existierten, war hier eindeutig: Faktisch gewinnen die Kommu-<br />
nen mit der Unterbringung von Asylsuchenden neue BürgerInnen – mit allen damit verbunde-<br />
nen finanziellen Vor- und Nachteilen. Aus Sicht der Gemeindeführungen konnten die Vorteile<br />
die Kosten dabei nicht annähernd kompensieren. Auch 2004 erweisen sich die Abwicklung<br />
der teils durchaus aufwändigen Meldeformalitäten, aber auch erlassene Kindergartenbeiträge<br />
als kommunale „Fixkosten“, der Verzicht auf die Einhebung eines Mietbeitrages für ein in<br />
kommunalem Besitz stehendes Unterkunftsgebäude, Aufwendungen für zusätzliche Schul-<br />
bzw. Sprachbetreuung oder die punktuelle Förderung von Freizeitaktivitäten ergänzen in eini-<br />
gen Fällen das Spektrum. Dem standen nun jedoch nicht mehr nur mittel- bis längerfristig<br />
durch die Gemeinden zu lukrierende Pro-Kopf-Ertragsanteile im Rahmen des Finanzaus-<br />
gleichs gegenüber, sondern auch die seitens der Landesregierung verstärkt propagierte und<br />
von einigen Gemeinden tatsächlich genutzte Option, Asylsuchenden gegen ein „Taschengeld“<br />
die Verrichtung gemeinnütziger Tätigkeiten für die jeweilige Kommune zu übertragen. Unter<br />
anderem griff die Stadt Hall in Tirol auf diese Möglichkeit zurück: Vizebürgermeister<br />
Schweighofer berichtete Ende 2004, dass bereits 16 Asylsuchende gegen Bezahlung von drei<br />
594 Tatsächlich berichteten unabhängige BetreuerInnen schon bald, die Wirtin des zur Unterbringung genutzten<br />
Gasthofs sei mit der Betreuung „deutlich überfordert“ (Interview Beratung/Betreuung 09, 18.08.2004).<br />
595 Osttiroler Bote 15.09.2004.<br />
229
Euro pro Stunde gemeinnützige Hilfstätigkeiten für die Stadt verrichten würden. 596 Zweifellos<br />
zurecht betonte Schweighofer, dass damit auch ein „wichtiges Signal an die Bevölkerung“<br />
ausgesandt werde, dass Asylsuchende „bemüht sind und einen Beitrag zur Gemeinschaft<br />
leisten möchten“. 597 Zwar kann die Maßnahme für die betroffenen Flüchtlinge ein reguläres<br />
Arbeitsverhältnis in keiner Weise ersetzen, in den Gemeinden werden sie damit jedoch ten-<br />
denziell eher über ihre persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen wahrgenommen. Ihre Unter-<br />
bringung erscheint so weniger als „kommunales Defizitgeschäft“ und mehr als „Projekt auf<br />
Gegenseitigkeit“. Diese atmosphärische Veränderung wird ergänzt durch die zuvor skizzier-<br />
ten verstärkten Bemühungen des Unterkunftsgebers um eine Professionalisierung im Bereich<br />
der Unterkunftsleitung – eine Botschaft an die Gemeinden, dass Asylsuchende für die Dauer<br />
ihrer Asylverfahren nicht bloß auf kommunaler Ebene „geparkt“ werden, sondern ihre Unter-<br />
bringung und Betreuung eine gemeinsame Aufgabe aller Ebenen darstellt.<br />
8.3.9 Unterkunftsgeber, -besitzerInnen und Gemeinden im Prozess<br />
der Standortrealisierung<br />
Hinsichtlich der Rollen der am Prozess der Standortrealisierung beteiligten Parteien Unter-<br />
kunftsgeber, UnterkunftsbesitzerInnen und Gemeinden ergaben sich 2004, so kann hier ab-<br />
schließend resümiert werden, letztlich keine auffälligen Veränderungen. Nach wie vor treten<br />
in diesem Bereich die UnterkunftsbesitzerInnen passiv auf, die betroffenen Kommunen agie-<br />
ren insgesamt unentschlossen: In einigen Fällen beteiligten sich führende Gemeindepolitiker-<br />
Innen aktiv an der Realisierung der neuen Unterkünfte, in anderen agierten sie zunehmend<br />
ablehnend, meist versuchten sie jedoch, eine klare Positionierung möglichst lange zu vermei-<br />
den. Treibende Kraft bei der Realisierung neuer Unterkünfte ist der Unterkunftsgeber, der – in<br />
den Gemeinden Ehrwald und Scharnitz wurde dies besonders deutlich – tatsächlich „das<br />
Tempo vorgibt“ und bei Widerständen auf taktische Zusagen und strategische Inszenierungen<br />
setzt. Bei der durch diese Vorgangsweise in einigen Fällen auf kommunaler Seite entstandene<br />
Verbitterung setzt der Unterkunftsgeber seine Hoffnungen offenbar auf das Sprichwort, wo-<br />
nach die Zeit „alle Wunden“ heile.<br />
596 Vgl. Protokoll 2004, Blatt 5. Die Tätigkeiten im Ausmaß von bis zu zwanzig Stunden pro Woche werden<br />
werden in städtischen Einrichtungen wie am Bauhof oder in der Stadtgärtnerei oder in den Bereichen Pflege oder<br />
Küche im Altersheim „Haus am Stiftsgarten“ bzw. im „Annaheim“ geleistet (vgl. SPÖ Tirol 19.10.2004).<br />
597 Protokoll 2004, Blatt 5.<br />
230
Schlussfolgerungen
9 Rahmenbedingungen und Strukturmuster bei der Wahl und Realisierung<br />
von Unterkunftsstandorten. Diskussion und Resümee<br />
Wie ist nun zusammenfassend die Politik des Unterkunftsgebers hinsichtlich der Wahl und<br />
Realisierung von Unterkünften für Asylsuchende zu charakterisieren? Wie die Analyse zeigt,<br />
können tatsächlich nicht-explizite standortpolitische Strukturmuster festgestellt werden. Ihre<br />
Entstehung, aber auch mögliche oder tatsächliche Konsequenzen werden im Folgenden zu<br />
diskutieren sein.<br />
9.1 Signal für die Verantwortung von Staat und Gesellschaft:<br />
Unterbringung als Aufgabe der öffentlichen Hand<br />
Die Unterbringung von Asylsuchenden ist in Tirol ausschließlich Sache der öffentlichen<br />
Hand, Ansätze zur Privatisierung des Bereichs sind bislang entgegen dem allgemeinen Trend<br />
nicht erkennbar. Das Land Tirol signalisiert damit, dass die Aufnahme und Unterbringung im<br />
öffentlichen Interesse erfolgt und dafür auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung be-<br />
steht. Vor dem Hintergrund der mit Vehemenz geführten regionalen Asylmissbrauchsdebatte<br />
stellt dies eine Positionierung dar, die zweifellos zur Verhinderung einer Eskalation der Dis-<br />
kussion beiträgt. Den offenkundigen Vorteilen dieser Praxis sind jedoch – ohne an dieser<br />
Stelle eine weitergehende Abwägung von Nutzen und Risiken einer Auslagerung sozialer<br />
Dienste an Private vornehmen zu können – einige damit verbundene Gefahren gegenüberzu-<br />
stellen, etwa<br />
• die Ausdehnung der Arbeit der Verwaltung über die Tätigkeit des Verwaltens hinaus auf die operative<br />
Sozialplanung und Modellentwicklung sowie die konkrete Soziale Arbeit, ohne dass die dafür nötigen qualifizierten<br />
Fachkräfte zur Verfügung stehen;<br />
• die Organisation der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden nach verwaltungstechnischen anstatt<br />
fachlichen Gesichtspunkten;<br />
• die Bündelung von Planung, Durchführung, Kontrolle und Evaluation aller Maßnahmen auf einer (Verwaltungs-)Ebene<br />
oder gar in einer einzigen Person, die sich in der Folge zum dominierenden „Player“ im Politikfeld<br />
zu verselbständigen droht, welcher sich jeder demokratischen Kontrolle entzieht;<br />
• die „Versäulung“ des (sozial-)politisch-administrativen Systems im Fachbereich durch zunehmende, weil<br />
zeitsparende Nutzung des „kurzen Dienstwegs“ zu bereits persönlich bekannten und als „loyal“ eingeschätzten<br />
Personen und Institutionen sowie die damit zwangsläufig verbundene Praxis, Entscheidungen<br />
„oftmals durch Interventionen, Loyalitätsabgleich oder »bargaining«, also »Kuhhändel«“ herbeizuführen 1 ;<br />
• die Vertiefung der Gräben vor allem zu den kleineren unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen<br />
oder Social-Profit-Betrieben, denen die Administration aufgrund abnehmender Transparenz zunehmend als<br />
in sich geschlossener und nach eigenen Gesetzen agierender „Block“ erscheint, dessen kritische Kontrolle<br />
sie nun als „Lobby für die, die keine Lobby haben“, zu übernehmen suchen;<br />
• das Brachliegen von Ressourcen, über welche die häufig hochqualifizierten und -motivierten MitarbeiterInnen<br />
eben dieser Organisationen und Social-Profit-Betriebe meist verfügen.<br />
9.2 Keine einheitliche Linie: Widersprüchliche Positionen der Landesregierung<br />
Mit seinem Beharren auf der öffentlichen Zuständigkeit für die Unterbringung Asylsuchender<br />
hat das Land Tirol ein deutliches Signal ausgesandt. Diesem folgt indessen eine ambivalente<br />
1 Dimmel 1999, 29.<br />
232
inhaltliche Positionierung: Die Botschaften, die von VertreterInnen der Landesregierung im<br />
Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik vermittelt werden, ergeben insgesamt ein äußerst<br />
widersprüchliches Bild. Der Unterkunftsgeber spricht in diesem Politikfeld letztlich nicht mit<br />
einer Stimme, entsprechend ist eine eigenständige Tiroler Flüchtlingspolitik mit klarer Linie<br />
nicht erkennbar. Auf der einen Seite steht die ressortzuständige Landesrätin Christa Gangl,<br />
die konkrete inhaltliche Aussagen zwar möglichst vermeidet, jedoch den „sozialen“ und<br />
„humanitären“ Aspekt ihrer Arbeit unterstreicht, unermüdlich jene Gemeinden zu loben sucht,<br />
in denen neue Unterkünfte für Asylsuchende eingerichtet werden konnten 2 und auf der Suche<br />
nach weiteren Standorten an die „Menschlichkeit“ und „Hilfsbereitschaft“ der Bevölkerung<br />
gegenüber jenen appelliert, die nun wieder „Halt und Kraft“ finden müssten, „um sich eine<br />
neue Zukunft aufzubauen“. 3 Demgegenüber beteiligt sich Landeshauptmann Herwig van Staa<br />
– meist unterstützt vom Sozialsprecher der Tiroler VP, Jakob Wolf – federführend an der re-<br />
gionalen Asylmissbrauchsdebatte: Er bezog sich im Rahmen seiner öffentlichen Stellungnah-<br />
men zu asylpolitischen Fragen in der jüngeren Vergangenheit nahezu ausschließlich auf den<br />
Topos des „kriminellen Asylanten“, mit dem er Forderungen nach einer Verschärfung gesetzlicher<br />
Regelungen oder politisch-administrativer Maßnahmen rechtfertigte. 4<br />
Die Forderungen des Landeshauptmanns stehen damit in latentem Widerspruch zu den<br />
Intentionen der Landesrätin und umgekehrt. Die aus dieser inhaltlichen Differenz resultie-<br />
rende Optik des Fehlens einer einheitlichen und klaren asylpolitischen Position der Landes-<br />
regierung stürzt indessen gerade die im Unterbringungsbereich umworbenen BürgermeisterIn-<br />
nen in ein Dilemma, das bei einem Auftritt des Landeshauptmanns im Rahmen des Tiroler<br />
Gemeindetags 2004 besonders offensichtlich wurde: Die dort versammelten BürgermeisterIn-<br />
nen bat van Staa zunächst, Quartiere für Asylsuchende zur Verfügung zu stellen, ehe er mit<br />
markigen Worten kundtat: „Kriminelle gehören abgeschoben.“ Wenn die Identität von Asyl-<br />
suchenden „unklar“ sei, so der Landeshauptmann weiter, sollten „diese bis zur Klärung inter-<br />
niert werden, um Missbrauch zu vermeiden“. 5 Wohl unbeabsichtigt konterkarierte van Staa<br />
damit seine eigene Bitte: Bei vielen Gemeindeoberhäuptern konnte als Botschaft zwangs-<br />
läufig nur ankommen, es ginge um die als „humanitären Akt“ zu verstehende Aufnahme und<br />
Unterbringung von Asylsuchenden, die jedoch letztlich zumindest latent gefährlich, weil<br />
„kriminell“ seien. Angesichts dieser Alternativen entschieden sich wenig überraschend viele<br />
BürgermeisterInnen mit Verweis auf einen zu erwartenden Anstieg der Straftaten lieber gegen<br />
2 Vgl. etwa anlässlich der Eröffnung der Unterkunft in Hall in Tirol: „Der Start im Annaheim ist sehr gut gelungen,<br />
das haben alle, die mit dem Projekt befasst sind, gleichermaßen bestätigt. Auch die Zusammenarbeit von<br />
Stadt und Kirche funktioniert hier in Hall sehr gut, besonders eingesetzt hat sich auch das Sozialamt Hall. Ich<br />
möchte mich für das Engagement und den guten Willen aller seitens der Stadtgemeinde Hall Beteiligten sowie<br />
für die gute Aufnahme der Menschen in der Bevölkerung sehr herzlich bedanken!“ (Gangl, zit. nach SPÖ Tirol<br />
19.10.2004)<br />
3 Gangl, zit. nach AdTLR 02.12.2004.<br />
4 Nach mehr als zweijähriger Amtszeit van Staas ließ die offizielle Landeszeitung im Dezember 2004 zum ersten<br />
Mal verlauten, der Landeshauptmann habe eigentlich durchaus „ein Herz für Flüchtlinge“ – der Beitrag stand<br />
freilich unter dem Titel: „Straffällig gewordene Asylwerber unverzüglich abschieben!“ (Gerzabek 2004)<br />
5 van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 24.06.2004c; vgl. Der Standard 25.06.2004.<br />
233
eine Unterkunft in ihrer Gemeinde und leisteten aktiven oder passiven Widerstand. Die Forde-<br />
rungen des Landeshauptmanns untergraben damit in der Praxis die Bemühungen der Landes-<br />
rätin, neue Unterkunftsstandorte zu errichten – ein Zusammenhang, der von regionalen wie<br />
überregionalen <strong>Medien</strong> aufmerksam registriert wurde. 6 Eine unmittelbare Folge ist der Ver-<br />
such einiger Bürgermeister, die Kluft zwischen den unterschiedlichen Positionen von Landes-<br />
hauptmann und Landesrätin zu nutzen, um Regierungsmitglieder, die sie dem einen oder dem<br />
anderen „Lager“ zuordnen, gegeneinander auszuspielen – der Fall des Scharnitzer Bürger-<br />
meisters Heiss, der am Höhepunkt der Konflikte um die in seiner Gemeinde geplante Unter-<br />
kunft stolz verkündete, eine „hochrangige Landespolitikerin“ habe ihm mündlich zugesagt,<br />
dass „das Projekt gestoppt“ sei 7 , kann dafür als besonders deutliches Beispiel gelten.<br />
9.3 Fachpolitik ohne Ziel: Kein Konzept, keine Leitlinien, keine Vorgaben<br />
Wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund der unklaren Positionierung der Tiroler Landesregie-<br />
rung ist das gänzliche Fehlen eines verbindlichen oder zumindest unverbindlichen Handlungs-<br />
rahmens in standortpolitischen Fragen zu sehen. Das Land Tirol verfügt weder über ein<br />
„Flüchtlingsaufnahme-“ oder „-unterbringungsgesetz“, wie es im benachbarten Deutschland<br />
auf Länderebene teils bereits seit vielen Jahren Usus ist, noch über ein klares, ausformuliertes<br />
und schriftlich fixiertes diesbezügliches Konzept. Die politische Ebene verzichtet bislang zur<br />
Gänze auf die Erarbeitung strategischer Leitlinien, konkreter Entwicklungsvorgaben und mit-<br />
tel- bis längerfristiger Zielkategorien, die Führung des zuständigen Ressorts kommt damit<br />
einer originären Aufgabe der Fachpolitik nicht nach. Schlüsselwörter aus den begrifflichen<br />
Kontexten von „Menschenwürde“, „Gemeinsamkeit“ und „Miteinander“, wie sie von der zu-<br />
ständigen Landesrätin zur Charakterisierung ihrer Unterbringungspolitik regelmäßig ange-<br />
führt werden 8 , verweisen damit letztlich auf inhaltliche Leerstellen: Konkrete konzeptionelle<br />
Überlegungen oder gar standortpolitische Grundsätze werden weder durch die Bezeichnung<br />
etwa des im Innsbrucker Stadtteil Rossau ursprünglich geplanten Containerlagers als „men-<br />
schenwürdig und angenehm“ 9 erkennbar – „wenn die mobilen Unterkünfte aber nicht men-<br />
schenwürdig wären“, so die Landesrätin schlicht und ohne jede weitere inhaltliche Begrün-<br />
6 So kritisierte u.a. Michael Sprenger (2004) in einem Leitartikel für die Tiroler Tageszeitung unter dem programmatischen<br />
Titel „Unwürdiges Spiel“, dass sich die österreichischen Bundesländer weniger um die Unterbringung<br />
Asylsuchender kümmerten, als sich den Kopf darüber zerbrächen, „Möglichkeiten zu finden, die angegebene<br />
Quoten-Zahl an Asylwerbern nicht aufnehmen zu müssen“. Statt „Solidarität“, die Unterbringung in kleinen<br />
Einheiten sowie eine „bessere Betreuung und mitunter spätere Integration“ forderten „von Bundeskanzler<br />
Schüssel bis hin zum Tiroler Landeshauptmann van Staa alle ein schärferes Asylrecht. Zugegeben: Das ist allemal<br />
eine einfachere politische Übung.“ Irene Brickner (2004a) charakterisierte in einem Kommentar für den<br />
Standard die Suche nach Unterkunftsstandorten als „Asylprojekt Sisyphos“ und resümierte kritisch und wie<br />
Sprenger unter Bezug auf van Staa: „Dass dies mit dem mangelnden Verantwortungsbewusstsein mancher beteiligter<br />
Politiker zu tun hat, sollte auch einmal festgestellt werden. Etwa wenn der Tiroler Landeshauptmann Herwig<br />
van Staa ungeschaut die Abschiebung kriminell gewordener Asylwerber verlangt: eine Forderung, die – wie<br />
er wohl weiß – in einem Rechtsstaat nicht durchführbar ist.“<br />
7 Heiss, zit. nach Tiroler Tageszeitung 19.08.2004a.<br />
8 Vgl. u.a. in Tiroler Tageszeitung 26.02.2004, 08.05.2004; ORF 06.05.2004; AdTLR 18.06.2004, 02.12.2004;<br />
SPÖ Tirol 06.10.2004; s.a. Interview Gangl 09.02.2004, Z 34ff und 65.<br />
9 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 08.05.2004; vgl. ORF 06.05.2004.<br />
234
dung, „wäre ich die Letzte, die hier zustimmen würde“ 10 –, noch durch die ohnehin im<br />
Konjunktiv formulierte Ansage, dass es „am Wichtigsten wär’, wenn man die Menschen, die<br />
zu uns kommen, wirklich auch so verteilen kann, also gut verteilen kann, dass es auch ein<br />
harmonisches Miteinander gibt in einer Gemeinde“. 11<br />
Letztlich „alleingelassen“ wird so die Verwaltungsebene: Ihr obliegt der rasche Vollzug von<br />
Unterbringung und Betreuung, die jedoch inhaltlich nicht näher definiert sind. Ohne orientie-<br />
rende Vorgaben bleibt den Verwaltungsbediensteten daher vor allem in Krisensituationen, wie<br />
sie sich zuletzt etwa aus dem massiven Anstieg der Zahl unterzubringender Asylsuchender im<br />
Zuge der Umstellung auf das „Grundversorgungssystem“ ergaben, nur der Rückgriff auf das<br />
Arbeitsprinzip des „muddling through“. 12 Entsprechend gibt der Flüchtlingskoordinator des<br />
Landes daher auch an, bei der Wahl und Realisierung neuer Unterkunftsstandorte „von Fall zu<br />
Fall verschieden“ vorzugehen. 13 Das Fehlen eines konkreten Handlungsrahmens bedeutet für<br />
die Verwaltung aber auch, nahezu jeden Schritt ohne formale und politische Absicherung set-<br />
zen zu müssen – im Fall von Konflikten, etwa mit UnterkunftsbesitzerInnen oder Gemeinden,<br />
bleibt der Verwaltung wenig mehr, als die Berufung auf die eigene Vollzugspraxis.<br />
Eine der Folgen dieser Konzeptlosigkeit ist das nahezu gänzliche Fehlen einer von der Lan-<br />
desregierung gezielt forcierten und mit positiven „Images“ besetzten „wohlfahrtspolitischen<br />
Öffentlichkeit“ im Bereich der regionalen Flüchtlingspolitik. Wie in anderen sozialpolitischen<br />
Bereichen gilt auch hier: Das inhaltliche Vakuum „provoziert nachgerade einen öffentlichen<br />
Sozialschmarotzerdiskurs, in dem die Legitimität wohlfahrtsstaatlicher Leistungen kategorial<br />
in Abrede gestellt wird“. 14 Die in der jüngeren Vergangenheit heftig geführte regionale Asyl-<br />
missbrauchsdebatte ist nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund zu sehen.<br />
9.4 »Do it yourself«: Politik als Aufgabe der Verwaltung<br />
Da ein orientierendes asylpolitisches Konzept in Tirol fehlt, ist die Verwaltung letztlich<br />
gezwungen, auf die Maxime des „do it yourself“ zurückzugreifen. Die Standortpolitik wird<br />
daher faktisch von der Administration formuliert und gestaltet, die in Person des fachlich zu-<br />
ständigen Flüchtlingskoordinators entsprechend auch in der Öffentlichkeit eine herausragende<br />
10 Gangl 2004. Die von der Landesrätin (ebd.) angeführten Argumente für die Wahl der Unterkunftsform des<br />
Containerlagers standen in keinem inhaltlichen und logischen Zusammenhang zur Unterkunftsform selbst oder<br />
widersprachen dieser sogar: „Sie sind gut ausgestattet, Familien haben ein Familienleben, Kinder Platz zum<br />
Spielen. Aufenthaltsräume sind ebenso vorgesehen wie eine gute sanitäre Ausstattung.“ Die von ihr angekündigte<br />
„Menschenwürdigkeit“ des Lagers begründete Gangl an anderer Stelle so: „Die Container werden nicht nur<br />
aufeinandergestapelt, es werden Architekten miteinbezogen.“ (Gangl, zit. nach tip 14.05.2004)<br />
11 Interview Gangl 09.02.2004, Z 34ff.<br />
12 Diese schwierige Situation der Administration wird durchaus auch von in der Öffentlichkeit meist als<br />
KritikerInnen auftretenden zivilgesellschaftlichen Organisationen und Social-Profit-Betrieben anerkannt: Zwar<br />
erfolge die Suche und Auswahl von Unterkünften intransparent und funktioniere kaum, so ein Berater, doch der<br />
Flüchtlingskoordinator des Landes „rotiert und ist ständig unterwegs, Quartiere aufzutreiben“ (Interview Beratung/Betreuung<br />
09, 18.08.2004).<br />
13 Interview Logar 10.10.2004, Z 149 und 189f.<br />
14 Dimmel 1999, 30.<br />
235
Stellung einnimmt. Die Herausbildung einer klaren politischen Linie auf Verwaltungsebene<br />
aus dem (nicht normierten) praktischen Vollzug heraus ist unter den gegebenen Rahmen-<br />
bedingungen jedoch von vornherein ausgeschlossen: Die BeamtInnen, die sich einerseits an<br />
die weisungsbefugte Landesrätin, zugleich jedoch auch an den über die Personalhoheit verfü-<br />
genden Landeshauptmann gebunden sehen, sind gezwungen, deren konträre Positionen in<br />
ihrer praktischen Arbeit zu vereinen und pendeln entsprechend zwischen der Bestätigung der<br />
Forderung nach restriktiveren Gesetzen einerseits und der mit Appellen an die „Menschlich-<br />
keit“ einhergehenden Abwehr pauschaler Verurteilungen von Asylsuchenden andererseits –<br />
ein Kurs, der sich in den öffentlichen Stellungnahmen des Flüchtlingskoordinators in aller<br />
Deutlichkeit spiegelt: Der Landesbeamte bestätigte etwa umgehend die Ansicht des Landes-<br />
hauptmanns, es finde ein unzumutbarer „Asyl-Tourismus“ nach Tirol statt 15 , weshalb der zu-<br />
vor bestehende Rechtsanspruch auf Sozialhilfe für Asylsuchende zur Verhinderung von<br />
„Missbräuchen“ auch gegen den Willen der zuständigen Landesrätin abzuschaffen sei. Auch<br />
forderte der Koordinator im Einklang mit dem Landeshauptmann den Bund auf, Gesetze zu<br />
schaffen, um „kriminell gewordene Asylwerber“ ausweisen zu können. 16 An der Seite der<br />
Landesrätin wies er jedoch zugleich immer wieder verzweifelt darauf hin, dass „seine“ Asyl-<br />
suchenden nicht „kriminell“ seien: „Kein einziger Bewohner unserer Asylantenheime ist in<br />
kriminelle Tätigkeiten verwickelt. Kriminelle Ausländer leben im Untergrund, und reichen<br />
erst im Falle ihrer Verhaftung einen Antrag auf Asyl ein. Dadurch entsteht im Nachhinein der<br />
Eindruck, als wären die meisten Asylanten Verbrecher.“ 17<br />
Die Differenz zwischen den Positionen von Landesrätin und Landeshauptmann bei gleichzei-<br />
tig fehlenden konzeptionellen Vorgaben verschafft der Administration jedoch auch einen<br />
Spielraum, der es ihr ermöglicht, über die bloße Formulierung hinaus eine eigenständige Poli-<br />
tik tatsächlich durchzusetzen: So wie die BürgermeisterInnen des Landes können auch die<br />
fachlich zuständigen BeamtInnen wechselnde Allianzen mit einzelnen Regierungsmitgliedern<br />
bilden, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Die in der eingangs skizzierten Struktur des<br />
regionalen politischen Systems grundgelegte Tendenz zu einer Emanzipation der Verwaltung<br />
wird im untersuchten Bereich somit durch das Fehlen jeglicher handlungsleitender Vorgaben<br />
entscheidend verstärkt. Dieses Phänomen ist letztlich freilich weder auf flüchtlings- und asyl-<br />
politische Belange beschränkt noch eine gänzlich neue Entwicklung: Bereits vor Jahren be-<br />
fand etwa Dimmel, die Politik befinde sich im sozial- und wohlfahrtspolitischen Bereich gene-<br />
rell in einer „umfassenden kognitiven Krise“ und übernehme anstelle ihrer strategischen Auf-<br />
gaben „Schritt für Schritt Verwaltungsaufgaben“, eine „pathologisierte“ Verwaltung schwinge<br />
sich in der Folge „zu einem politischen Akteur der Leitliniensetzung“ auf: „Der Verwaltungsbedienstete<br />
teilt dem Politiker mit, was dieser im Landtag zu entscheiden hat.“ 18<br />
15 Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.01.2003; Der Standard 29.01.2003.<br />
16 Tiroler Tageszeitung 24.08.2004a.<br />
17 Logar, zit. nach tip 10.12.2004.<br />
18 Dimmel 1999, 29.<br />
236
Diesen Eindruck vermittelt zuweilen auch die in Tirol für Flüchtlingsfragen zuständige<br />
Landesrätin, wenn sie etwa im Interview offen einräumt, eigene konzeptionelle und strategi-<br />
sche Ideen zu verwerfen, wenn diese nicht den bisherigen Gepflogenheiten der Administra-<br />
tion entsprächen. So merkte Gangl mit Bezug auf die Unterkunftsgröße an: „Mir selber, per-<br />
sönlich, wär’ natürlich lieber, wenn wir so kleine Einheiten hätten, wo auch wirklich auch<br />
Familien sich aufhalten können, nur da, sagt mir eben auch Peter Logar, ist’s einfach ein biss-<br />
chen schwierig [...].“ 19 Trotz ihrer politischen Verantwortlichkeit ist die Landesrätin daher<br />
auch oft nur bedingt über das Vorgehen der Administration informiert – selbst bei die regio-<br />
nale Aufmerksamkeit erregenden Konflikten wie jenen um die Standortrealisierung in Land-<br />
eck Ende 2003: Im Interview ließ sie wissen, man habe für den dort als erweiterte Presse-<br />
konferenz veranstalteten „runden Tisch“ mit ausgewählten lokalen Eliten – die Landesrätin<br />
spricht fälschlich von einer Bürgerversammlung 20 – zusätzlich den Bezirkshauptmann von<br />
Reutte und den damaligen Vilser Bürgermeister Otto Erd eingeladen, letzterer habe dann den<br />
Landecker BürgerInnen sinngemäß erzählt: „Hoppla, Leutln, ihr braucht’s da keine Angst<br />
haben, wir haben jetzt schon seit Jahren [Flüchtlinge], und es gibt eigentlich nichts! Oder es<br />
sind so kleine Vorfälle, die’s ja bei unseren Leuten eigentlich auch gibt. Also die verhalten<br />
sich da ja nicht anders.“ 21 Den Auftritt des Vilser Bürgermeisters wertet die Landesrätin rück-<br />
blickend als Vorgangsweise, „die dann auch bei den Leuten gut ankommt“. 22 Tatsächlich<br />
hatte an der Pressekonferenz nicht der Bezirkshauptmann des Nachbarbezirks Reutte, sondern<br />
jener von Landeck teilgenommen. Der Vilser Bürgermeister, so der Flüchtlingskoordinator<br />
des Landes im Interview, sei zwar ursprünglich eingeladen gewesen, jedoch „an diesem Tag<br />
nicht über den Fernpass gekommen, weil der wegen dem Schnee gesperrt war“. 23<br />
9.5 Die Standortsuche: Appell als Strategie<br />
Wie wirken sich die bislang geschilderten Rahmenbedingungen in der Praxis aus? Wenden<br />
wir uns zunächst der Standortsuche zu. Hier zeigt die Analyse, dass der öffentliche Unter-<br />
kunftsgeber nahezu ausschließlich eine einzige Strategie verfolgt: Vor allem über die regio-<br />
nalen <strong>Medien</strong>, aber auch in persönlichen Briefen oder Telefonaten wird an Privatpersonen,<br />
insbesondere an Gastwirtinnen und -wirte, außerdem an die BürgermeisterInnen des Landes,<br />
an die römisch-katholische Kirche sowie an das Verteidigungsministerium appelliert,<br />
Gebäude zur Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen. In der Folge wer-<br />
den die einlangenden Angebote abgewartet und sondiert. Diese „Appell-Strategie“ wurde<br />
lediglich in vier der 23 untersuchten Fälle 24 – das entspricht etwa einem Sechstel – tatsächlich<br />
19<br />
Interview Gangl 09.02.2004, Z 45ff.<br />
20<br />
Ebd., Z 165.<br />
21<br />
Ebd., Z 155ff.<br />
22<br />
Ebd., Z 172.<br />
23<br />
Interview Logar 15.03.2004.<br />
24<br />
Es handelt sich um die Unterkünfte in Reith im Alpbachtal und Innsbruck-Rossau sowie um die vorübergehend<br />
betriebenen „Notquartiere“ in Innsbruck-Mentlberg und im reaktivierten „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“<br />
in Volders.<br />
237
durchbrochen, gleich drei Mal wurde dabei jedoch auf landeseigene bzw. vom Land gepach-<br />
tete Objekte oder Grundstücke zurückgegriffen.<br />
Der Unterkunftsgeber geht in der Standortsuche damit vorrangig passiv vor: Man tritt nicht<br />
als gestaltender Akteur in Erscheinung, der stets nach geeigneten Objekten Ausschau hält und<br />
diese zu verwirklichen sucht, sondern ruft die Bevölkerung oder ausgewählte Personenkreise<br />
von Zeit zu Zeit auf, leerstehende Gebäude zur Verfügung zu stellen – und wartet auf Ange-<br />
bote. In der Praxis sind damit die Rollen vertauscht: Nicht das Land als Unterkunftsgeber tritt<br />
als „Interessent“ auf, sondern die UnterkunftsbesitzerInnen. In dieser Vorgehensweise ist der<br />
in vielen Gemeinden dominierende Eindruck grundgelegt, die BesitzerInnen hätten Asyl-<br />
suchende in die Gemeinde „geholt“: Es sind tatsächlich sie, die bei der Standortsuche agie-<br />
rend in Erscheinung treten, freilich nur deshalb, weil ihnen diese Rolle vom Unterkunftsgeber<br />
von vornherein zugeschrieben wird.<br />
Die Konsequenzen dieses Vorgehens sind offensichtlich: Indem die öffentliche Hand auf die<br />
Nutzung ihres Gestaltungsspielraums bei der Standortsuche verzichtet, macht sie sich abhän-<br />
gig von der Zielgruppe ihrer Appelle und deren Angeboten. Finden sich GebäudebesitzerIn-<br />
nen, denen die Unterbringung von Flüchtlingen lukrativ erscheint oder die anderweitig daran<br />
interessiert sind, werden die einlangenden Offerte begutachtet, die potentiellen Unterkünfte<br />
besucht und allenfalls als neue Standorte realisiert. Gibt es keine „Bewerbungen“, so wird<br />
nach Ablauf einer faktisch von der Administration definierten Wartefrist verzweifelt versucht,<br />
Notquartiere einzurichten – durch Überbelegung bestehender Unterkünfte, Reaktivierung<br />
ehemaliger (und an sich zum Abriss freigegebener) Gebäudekomplexe oder die freilich auch<br />
nur mittelfristig mögliche (Re-)Konstruktion von Lagern in Container- oder Baracken- bzw.<br />
Fertigteilbauweise. Die durch das Abwarten und Sondieren von Angeboten verloren gegan-<br />
gene Zeit erhöht den Druck auf den Unterkunftsgeber im Fall eines raschen Anstiegs der Zahl<br />
unterzubringender Asylsuchender derart massiv, dass andere Lösungen tatsächlich auf den<br />
ersten Blick nur schwer umsetzbar scheinen – vor allem dann, wenn man über keine Reserve-<br />
kapazitäten verfügt, die bei einer vorausschauenden und also kontinuierlichen und aktiven<br />
Standortsuche aufgebaut werden könnten. Eine den Anforderungen entsprechende, in sich<br />
stimmige, transparente und effiziente, das heißt eben auch: situations- und zeitgerechte Stand-<br />
ortpolitik ist jedenfalls mit der hier konstatierten Vorgehensweise kaum realisierbar.<br />
9.6 Die Standortentscheidung: »Ich kann mir’s nicht aussuchen«<br />
Unmittelbar mit der Standortsuche verbunden ist der an sie anschließende Bereich der<br />
Entscheidung über die Auswahl neuer Unterkunftsstandorte. Obwohl diese Entscheidung for-<br />
mal klar dem öffentlichen Unterkunftsgeber obliegt und den Gemeinden keinerlei Mitsprache-<br />
recht zukommt, tritt dieser auch hier vorrangig passiv in Erscheinung: Die in der Regel prakti-<br />
zierte Appell-Strategie bedingt, dass durch die wenigen GebäudebesitzerInnen, die aktiv ihr<br />
238
Interesse an der Unterbringung von Asylsuchenden bekunden 25 , eine Vorauswahl getroffen<br />
wird. Der Unterkunftsgeber wählt letztlich lediglich aus dem so entstandenen Angebot<br />
passend erscheinende Objekte aus. Das Angebotsspektrum umfasst dabei gerade nicht Ob-<br />
jekte, die aufgrund ihrer besonderen Eignung für die Unterbringung von Flüchtlingen ange-<br />
boten wurden, sondern jene Gebäude, deren BesitzerInnen zur Ansicht gelangt sind, dass sie<br />
in anderen Bereichen nicht mehr gewinnbringend betrieben werden können. Zwangsläufig ist<br />
damit die Breite des Spektrums stark eingeschränkt.<br />
Vor diesem Hintergrund scheint es nicht sonderlich überraschend, wenn der zuständige<br />
Flüchtlingskoordinator des Landes im Interview das Vorhandensein eines Sachzwangs sugge-<br />
riert, der ihm „keine Wahl“ lasse, als jene Unterkünfte zu realisieren, die ihm angeboten wür-<br />
den: „Ich kann mir’s nicht aussuchen.“ 26 Er sei „gezwungen, das, was halbwegs dem Standard<br />
entspricht, zu nehmen“. 27 Mit dieser Argumentation wird der Unterkunftsgeber einerseits von<br />
seiner Verantwortlichkeit entlastet – wer über keine Wahlmöglichkeit verfüge, so die Bot-<br />
schaft, der könne eben auch nicht wählerisch sein. Zugleich ist sie jedoch ein deutlicher Hin-<br />
weis auf das oben konstatierte Fehlen handlungsleitender Richtlinien und Zielkategorien:<br />
Weil eine orientierende (politische) Autorität ebenso fehlt wie eine gesicherte inhaltliche<br />
Basis, konstruiert sich die Verwaltung zur Rechtfertigung ihrer Vollzugspraxis eine eigene<br />
„Autorität“: Nicht die (tatsächlich kaum vorhandenen) politischen Vorgaben und daraus re-<br />
sultierende formale Bestimmungen sind es, die keine andere Vorgehensweise als die gewählte<br />
zulassen, sondern sachliche „Zwänge“. 28 Der Zusammenhang mit der fast ausnahmslos prakti-<br />
zierten und oben skizzierten Strategie der Unterkunftssuche wird dabei freilich übersehen<br />
oder ignoriert: Der Sachzwang ist nur scheinbar ein solcher, tatsächlich sind die einge-<br />
schränkten Wahlmöglichkeiten eine unmittelbare Folge des schmalen Angebotsspektrums,<br />
das sich wiederum aus der vom Unterkunftsgeber praktizierten passiv-reagierenden Art der<br />
Standortsuche ergibt.<br />
Die im Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik keineswegs nur auf Seiten der öffentlichen<br />
Hand zu findende Rechtfertigung mit dem Topos des Sachzwangs 29 kann im Einzelfall, wie<br />
auch hier gezeigt wurde, zwar fast immer widerlegt werden. Wenn Steinmetz resignierend<br />
resümiert, dass mögliche Auswege meist „so viel Umdenken bei allen Beteiligten“ voraus-<br />
25<br />
Aufgrund der mit der Unterbringung verbundenen beträchtlichen Risiken und der erst mit einer ständigen und<br />
länger andauernden Auslastung tatsächlich gegebenen Gewinnmöglichkeiten ist ihre Zahl von vornherein beschränkt<br />
(vgl. Wojak 1993).<br />
26<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 212.<br />
27<br />
Ebd., Z 738.<br />
28<br />
Nicht von ungefähr verortet Steinmetz (1995) in seiner historisch-sprachpragmatischen Untersuchung der<br />
Redefigur des Sachzwangs das Auftreten dieses Topos im Kontext des in der Zwischen- und unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit besonders verbreiteten Gefühls der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, das er u.a. als Folge<br />
fehlender bzw. grundlegend diskreditierter politischer Autoritäten wertet.<br />
29<br />
Vgl. etwa Tedeschi 1996, der in seiner Studie über die in Vorarlberg von der Caritas der Diözese Feldkirch<br />
administrierte „Bund-Länder-Aktion“ für bosnische Kriegsflüchtlinge (an der er als Caritas-Mitarbeiter selbst<br />
beteiligt war) wiederholt und gerade im Bereich der Unterbringung mit nicht näher ausgeführten „Sachzwängen“<br />
argumentiert.<br />
239
setzen würden, dass es „hoffnungslos ist, sie realisieren zu wollen“ 30 , so formuliert er damit<br />
jedoch einen in der Praxis durchaus gewichtigen Einwand – dem freilich zu entgegnen wäre,<br />
dass auch die von ihm befürchtete Unmöglichkeit der Realisierung möglicher Auswege kei-<br />
nesfalls eine Folge eigengesetzlicher technisch-organisatorischer Abläufe und daher auch kei-<br />
nen unveränderlichen Sachzwang darstellt.<br />
9.7 Die Verortung im Raum (I): Absonderung oder Heraushebung<br />
Die vom Land Tirol tatsächlich realisierten Unterkünfte für Asylsuchende sind hinsichtlich<br />
ihrer Lage vorrangig durch die beiden Merkmale der Absonderung oder der Heraushebung<br />
gekennzeichnet: Nicht weniger als 17 der 23 untersuchten Standorte sind<br />
• auf Landesebene in einer Grenz- oder Randlage zu finden oder<br />
• auf kommunaler Ebene in einer Grenz- oder Randlage zu finden oder<br />
• auf kommunaler Ebene durch ihre Gestaltung und Funktion derart aus der (meist äußerst<br />
zentral gelegenen) Umgebung herausgehoben, dass sie dort einen auffälligen Fremdkörper<br />
darstellen und zugleich eine Diffusion der Grenze zwischen öffentlichem und privatem<br />
Raum stattfindet.<br />
Grenz- oder Randlagen auf kommunaler Ebene dominieren das Spektrum dabei deutlich,<br />
mehrere auf Landesebene in Grenzlagen befindliche und einige wenige herausgehobene<br />
Standorte ergänzen das Bild. In einigen Fällen sind bezüglich dieser Merkmale jedoch auch<br />
Mehrfachzuordnungen möglich. Das Prinzip von „Absonderung oder Heraushebung“ kann<br />
vor diesem Hintergrund für den untersuchten Zeitraum tatsächlich als zentrales standortpoliti-<br />
sches Strukturmuster bezeichnet werden. Mit den (teils nur vorübergehend betriebenen) Un-<br />
terkünften in Reith im Alpbachtal, im reaktivierten „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“ in<br />
Volders, in Innsbruck-Mentlberg sowie in der Innsbrucker Rossau sind alle vier vom Unter-<br />
kunftsgeber selbst aktiv, d.h. nicht über Aufrufe und Appelle gesuchten Standorte diesem<br />
Strukturmuster zuzuordnen. Lediglich eine Unterkunft durchbricht das Muster klar sowohl auf<br />
Landes- als auch auf Gemeindeebene: Der Standort in Hall in Tirol befindet sich in einem<br />
regionalen Zentrum, liegt dort selbst zentrumsnah und fügt sich vergleichsweise selbstver-<br />
ständlich ins Stadtbild ein. Es fällt auf, dass dieser Standort zugleich der einzige ist, der von<br />
einem führenden Kommunalpolitiker nach klaren Kriterien ausgewählt und in der Folge auch<br />
durchgesetzt wurde.<br />
Aus dem Muster der „Absonderung oder Heraushebung“ folgen zwangsläufig einige weitere<br />
dominierende Standortmerkmale:<br />
30 Steinmetz 1995, 297. Sachzwänge, so Steinmetz (ebd.) weiter, seien gespenstisch: „Immer wenn man glaubt,<br />
sie gedanklich hinweginterpretiert und durch technische Hilfsmittel praktisch eliminiert zu haben, kehren sie in<br />
anderem Gewand und an anderer Stelle zurück.“<br />
240
• Die auf kommunaler Ebene abgesonderten oder herausgehobenen Unterkünfte befinden<br />
sich in der Regel abseits der üblichen Wohngebiete. Wie in Einzel- und Überblicksdar-<br />
stellungen deutlich wurde, dominieren gewerblich oder durch öffentliche Einrichtungen<br />
geprägte Mischgebiete, Gewerbe- und Industriezonen, Verkehrsknotenpunkte wie vielbe-<br />
fahrene Straßenkreuzungen und Bahnhöfe oder exponierte Plätze im Wald bzw. Hochge-<br />
birge.<br />
• Die Mobilität der in abgesonderter Lage Untergebrachten ist meist erheblich einge-<br />
schränkt, mangels öffentlicher Verkehrsmittel in einzelnen Fällen effektiv unterbunden.<br />
• Die Versorgungslage an den abgesonderten Standorten ist mit Ausnahme des Grundschul-<br />
bereichs meist eingeschränkt, an mehreren Standorten ist eine selbständige Versorgung<br />
praktisch ausgeschlossen.<br />
Vor dem Hintergrund des vom Unterkunftsgeber als für seine Standortentscheidungen bestim-<br />
mend angeführten (scheinbaren) „Sachzwangs“ des beschränkten Angebots an Unterkünften,<br />
das eine gezielte Auswahl unmöglich mache, muss aus dieser Struktur geschlossen werden,<br />
dass das Umfeld der Unterkünfte, ihre Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und<br />
der Zugang zu den eingangs skizzierten 31 zentralen Versorgungsbereichen bei der Standort-<br />
wahl keine entscheidungsrelevante Rolle spielen. Tatsächlich formuliert der zuständige<br />
Flüchtlingskoordinator im Hinblick auf diese Kriterien lakonisch: „Wenn das wer hat ... ist<br />
das alles ... ist das alles positiv.“ 32 Wenn nicht, sei es eben nicht zu ändern: „Ich hab Ihnen gesagt:<br />
Ich kann mir’s nicht aussuchen.“ 33<br />
Das konstatierte Muster der Absonderung oder Heraushebung zieht indessen eine Reihe<br />
konkreter Konsequenzen nach sich, darüber hinaus sind ihm mehrere Entwicklungstendenzen<br />
immanent. Wegen der grundlegenden praktischen Bedeutung für die Tiroler Unterbringungs-<br />
politik sollen diese im Folgenden ausführlicher diskutiert werden.<br />
Absonderung: Aus den Augen, aus dem Sinn<br />
Mit der räumlichen Absonderung von Unterkünften verschwinden die darin lebenden Asyl-<br />
suchenden aus dem Blickfeld der übrigen Bevölkerung. Kontakte zwischen diesen beiden<br />
Gruppen werden erschwert oder überhaupt unmöglich gemacht. Dies allein ist freilich noch<br />
keine spezifische Folge der Absonderung – auch die Heraushebung von Unterkunftsstand-<br />
orten kann, wie weiter unten noch deutlich werden wird, in die Isolation führen. Eine sich<br />
unmittelbar aus der Absonderung (und nur aus dieser) ergebende Konsequenz, die Asyl-<br />
suchende tatsächlich „aus den Augen, aus dem Sinn“ verdrängt, ist jedoch die effektive<br />
Unterbindung der Nutzung wichtiger infrastruktureller Einrichtungen. Für die Betroffenen<br />
kommt vielen dieser Einrichtungen eine herausragende Bedeutung zu, wie Omairi mit einer<br />
31 Abschnitte 1.3.1-1.3.6.<br />
32 Interview Logar 10.10.2003, Z 210.<br />
33 Ebd., Z 212.<br />
241
Untersuchung der Nutzung ausgewählter Institutionen durch Asylsuchende bereits Anfang der<br />
1990er zeigen konnte: Lebensmittelläden, Apotheken, ärztliche Ordinationen, Behörden<br />
sowie Schulen und Kindergärten werden jeweils von nahezu hundert Prozent der Betroffenen<br />
genutzt, ausgewählte Freizeiteinrichtungen in zentralen Lagen, etwa Grün- und Parkanlagen<br />
oder Spielplätze, Sporteinrichtungen sowie Cafés und Kinos von teils weit über fünfzig Pro-<br />
zent. 34 Cafés und Kinos (sowie Besuche bei FreundInnen und Bekannten) werden dabei von<br />
mehr als 66 Prozent der Betroffenen als wichtige Möglichkeiten zur Füllung von „Freizeit-<br />
lücken“ genannt; der von annähernd zwanzig Prozent angeführte sporadische, teils auch re-<br />
gelmäßige Besuch von Spielhallen oder ähnlichem wird mit dem Bedürfnis nach Entspannung<br />
begründet. 35 Die teils sehr hohe Nutzungsquote infrastruktureller Einrichtungen ist mit mehre-<br />
ren Aspekten zu erklären, die prägend für die Lebenslagen Asylsuchender sind:<br />
• Die durch grundlegende Unsicherheiten etwa bezüglich ihres Asylverfahrens, der Dauer ihres Aufenthalts<br />
und einer konkreten Zukunftsperspektive gekennzeichnete spezifische Lebenssituation Asylsuchender, die<br />
verschiedenen individuellen Probleme etwa aufgrund von Traumatisierungen und Retraumatisierungen oder<br />
gesundheitlicher Defizite, aber auch ein fortgesetzter und eklatanter Mangel an konkreter Information führen<br />
zu einer erhöhten Inanspruchnahme öffentlicher und privater Beratungs- und Betreuungseinrichtungen.<br />
• Das Fehlen von ergänzungsökonomischen Lebensmittelläden und Betrieben, aber auch schlicht finanzielle<br />
Engpässe führen zu häufigen kleineren Einkäufen oder Einkaufsversuchen in herkömmlichen Läden und<br />
Betrieben.<br />
• Die erzwungene Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit, die als psychisch belastend empfundene unklare<br />
Gesamtsituation, aber auch das Bedürfnis, sich mit anderen Menschen als den ohnehin ständig präsenten<br />
UnterkunftskollegInnen zu unterhalten und auszutauschen, nicht zuletzt auch der Wunsch, Kontakt zu Exilgemeinschaften<br />
und vor allem zu „Einheimischen“ herzustellen, die Sprache des Aufnahmelandes zu lernen<br />
und praktisch zu üben führen zu häufigen „ungezielten“ Beschäftigungen und Zerstreuungsversuchen etwa<br />
in Grün- und Parkanlagen, Cafés, Kinos oder anderen Freizeit- und Sporteinrichtungen. 36<br />
Der Besuch der genannten Institutionen, insbesondere jedoch jener der klassischen<br />
Versorgungseinrichtungen muss vor diesem Hintergrund als elementares Mittel zur Bewälti-<br />
gung des Alltags verstanden werden das den Betroffenen durch eine räumlich abgesonderte<br />
Unterbringung genommen wird.<br />
Heraushebung: Irritation durch Zweckentfremdung<br />
Anders als bei der Absonderung wird die Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch die<br />
Heraushebung von Unterkünften an durchaus zentralen Orten nicht verhindert. Entsprechend<br />
werden die dort untergebrachten Asylsuchenden auch nicht völlig „aus den Augen, aus dem<br />
Sinn“ verdrängt. Eine spezifische Folge der Heraushebung ist jedoch die dauerhafte und teils<br />
geradezu provokante Irritation der lokalen Bevölkerung durch die Nutzung eines ursprünglich<br />
für gänzlich andere Zwecke vorgesehenen Objekts oder Grundstücks zur Unterbringung:<br />
Herausgehobene Unterkünfte befinden sich so gut wie ausnahmslos entweder<br />
• in Objekten und auf Grundstücken, die aufgrund ihrer Lage, Funktion oder Geschichte für<br />
die Bevölkerung von besonderer symbolischer Bedeutung sind, oder<br />
34 Omairi 1991, 153f.<br />
35 Ebd., 154.<br />
36 Vgl. ebd.<br />
242
• in Objekten und auf Grundstücken, die aufgrund ihrer Lage, Funktion oder Nutzungs-<br />
geschichte eine Verwendung als Unterkunft ausgeschlossen erscheinen lassen.<br />
In seiner Münchener Studie erwähnt Kuhn (ohne näher auf den Aspekt der Heraushebung ein-<br />
zugehen) das Beispiel eines Containerlagers, das inmitten eines Sportplatzes errichtet worden<br />
war 37 – ein Standort, der offenkundig der zweiten angeführten Kategorie entspricht. Auch für<br />
die erste Kategorie referiert Kuhn ein Exempel:<br />
„Als im Advent 1991 eine ganze Schule zum Aufnahmequartier für Asylbewerber umfunktioniert wurde, war –<br />
vielleicht jahreszeitenbedingt – noch so etwas wie Mitgefühl für die ärmliche Situation der dort untergebrachten<br />
Menschen zu spüren. Spätestens aber, als die Stadt bald danach auf dem Oktoberfestplatz Wohncontainer aufstellen<br />
ließ, begann die Münchner Volksseele zu kochen. Der hierfür bei der Landeshauptstadt verantwortliche<br />
»Stab für außergewöhnliche Ereignisse«, auch »Krisenstab« genannt, verteidigte diese Maßnahme zwar mit<br />
technischen Argumenten (Strom- und Wasseranschluß etc.), in der Bevölkerung wurde dies jedoch eher als provokativer<br />
Akt verstanden [...].“ 38<br />
Die Realisierung einer Unterkunft für Asylsuchende auf der Münchener „Wies’n“ stellt zwei-<br />
fellos ein Paradebeispiel für die Zweckentfremdung eines für die lokale Bevölkerung symbo-<br />
lisch bedeutsamen Ortes dar. Doch auch in Tirol finden sich vergleichbar herausgehobene<br />
Standorte: Die Unterkunft im Götzner Gasthof Neuwirt unmittelbar gegenüber der beliebten<br />
Wallfahrtskirche und damit direkt im Zentrum des Ortes ist hier ebenso zu nennen wie jene<br />
im Gasthof Kreuz in Mötz, der sich schräg unterhalb der dortigen Pfarrkirche gegenüber dem<br />
lokalen Musikpavillon, der diesem vorgelagerten einzigen parkähnlichen Anlage der Ge-<br />
meinde und der einzigen (und entsprechend stark genutzten) Bankfiliale befindet. Der ur-<br />
sprünglich als Containerlager geplante, dann jedoch in Form einer Baracke bzw. eines Fertig-<br />
teilhauses ausgeführte Unterkunftskomplex im Innsbrucker Stadtteil Rossau vereint gleich<br />
beide der oben genannten Kategorien: Als einziger „Wohnkomplex“ in einem Industrie- und<br />
Gewerbegebiet auf dem Gelände eines Bauhofs befindlich stellt das Gebäude eine irritierende<br />
Ausnahme in „Tirols stärkstem Wirtschaftsgebiet“ 39 dar. Als „Lager“ in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft jenes Areals, auf dem sich während des Nationalsozialismus das als lokales<br />
„KZ“ berüchtigte Straflager befand, löste die Unterkunft in der Bevölkerung zahlreiche em-<br />
pörte, teils regelrecht entsetzte Reaktionen aus. Unterkünfte an derartigen Standorten stellen<br />
für die lokale Bevölkerung letztlich eine Quelle ständiger Irritation dar. Man redet zwar<br />
irgendwann nicht mehr darüber, der Fremdkörper bleibt jedoch bestehen.<br />
Abseits der Norm: Stigmatisierung<br />
Die solcherart „abseits der Norm“ untergebrachten Asylsuchenden – üblicherweise lebt<br />
„man“ ja nicht an derart abgesonderten oder herausgehobenen Orten – werden von der umge-<br />
benden Bevölkerung mit den damit verbundenen Wohn- und Lebensverhältnissen assoziiert<br />
und als ÜbertreterInnen von Gesetzen und VerletzerInnen von Normen (der Mehrheitsbe-<br />
37 Vgl. Kuhn 1994, 317.<br />
38 Ebd., 316.<br />
39 Tiroler Tageszeitung 25.10.2004.<br />
243
völkerung), als offensichtliche „Außenseiter“ stigmatisiert 40 – ein Mechanismus, der aus an-<br />
deren Bereichen hinlänglich bekannt ist. Es wird, so die dahinterstehende, durchaus auch ex-<br />
plizit formulierte und inhaltlich meist an öffentliche Diskussionen wie die Asylmissbrauchs-<br />
debatte anknüpfende Überlegung, schon seinen Grund haben, warum Asylsuchende unterge-<br />
bracht werden, wo sie untergebracht werden. Das soziale Stigma verwandelt sich über diesen<br />
Begründungsdiskurs nach und nach zum materiellen Stigma: Es erscheint „objektiv“, den<br />
Außenseitern „von der Natur oder den Göttern eingepflanzt“. 41 Der „kriminelle Asylant“ steht<br />
als „Beweis“ immer bereit: Man liest ja, so exemplarisch die an anderer Stelle bereits zitierte<br />
Leiterin einer Unterkunft in einer Tiroler Tourismusgemeinde, „jeden Tag in der Zeitung,<br />
man hört alle Tage: Da sind die Einbrüche – nur, nur, nur Ausländer, und sonst noch so ...<br />
Schlägereien, und Ding und ...“ 42 Die stigmatisierende Gruppe wird damit von jeder Schuld<br />
entlastet: „Nicht wir – das besagt die Phantasie – haben diesen Menschen ein Brandmal auf-<br />
gedrückt, sondern höhere Mächte, die Schöpfer der Welt; sie haben diese Menschen gezeich-<br />
net, um sie als minderwertig oder »schlecht« kenntlich zu machen.“ 43 Den dieser Entwicklung<br />
zugrundeliegenden Mechanismus fasst Thimmel in einer ebenso schlichten wie prägnanten<br />
Gleichung zusammen: ausgegrenzte Räume – ausgegrenzte Menschen. 44<br />
»Leben im Fadenkreuz«: Schwarze Asylsuchende und Absonderung/Heraushebung<br />
Die allgemeine Stigmatisierung Asylsuchender durch Absonderung oder Heraushebung erle-<br />
ben Asylsuchende mit dunkler Hautfarbe, insbesondere Flüchtlinge aus afrikanischen Län-<br />
dern, um ein Vielfaches potenziert: Sie machen die tägliche Erfahrung, für viele Einwohner-<br />
Innen das „absolut Andere“, jedenfalls den Prototypen des „Asylanten“ 45 zu repräsentieren –<br />
das „sichtbarste Symbol von (oft unerwünschter) Zuwanderung“. 46 Dahinter steht letztlich die<br />
keineswegs nur historisch relevante europäische Perspektive auf Afrika als dehumanisiertes<br />
Gegenbild, dem alles abzusprechen ist, was zur Profilierung des eigenen Selbstbilds bei-<br />
trägt. 47 Mit den alltäglichen Effekten dieser symbolischen Konstruktionen sind schwarze<br />
Asylsuchende unmittelbar, Unterkunftsleitungen und BetreuerInnen mittelbar konfrontiert: Es<br />
habe viele negative Rückmeldungen von der Bevölkerung gegeben, als sie die ersten Flücht-<br />
linge in ihrem Gasthof untergebracht habe, so eine Unterkunftsleiterin, „weil es sind ja auch<br />
Neger dabei, und da wollen die Leut’ einfach Abstand“. 48 „Wir wollten nach Geisthal zu-<br />
rück“, berichtet der Pädagoge Abdullahi Osman, Anfang der 1990er als somalischer Asyl-<br />
40<br />
Vgl. Elias/Scotson 1993, 22.<br />
41<br />
Ebd., 32.<br />
42<br />
Interview Unterkunftsleitung 03/1, 03.11.2003, Z 17ff.<br />
43<br />
Elias/Scotson 1993, 32f; Hervorhebung im Original.<br />
44<br />
Thimmel 1994.<br />
45<br />
Vgl. Schenk 1995, 13.<br />
46<br />
Ebermann 2003, 50.<br />
47<br />
„Der europäische Diskurs über Afrika“, so Niedrig et al. (2001, 36) daher, „hat sich somit um die Idee des<br />
Defizits herum aufgebaut – oder besser gesagt: um die Negation dessen, was als spezifisch menschlich angesehen<br />
wird.“<br />
48<br />
Interview Unterkunftsleitung 03/1, 03.11.2003, Z 14f.<br />
244
suchender in einem kleinen steirischen Dorf untergebracht. Nach einem Behördentermin ver-<br />
suchten er und einige andere Asylsuchende, den Rückweg per Autostopp zu bewältigen:<br />
„Aber alle Autos fuhren an uns vorbei. Die Leute sahen uns zwar, aber irgendetwas stimmte nicht. Wir kamen<br />
ins Dorf zurück und erzählten die Geschichte den anderen Flüchtlingen. Einer sagte, es werde behauptet, wir<br />
hätten Aids. Niemand sprach mit uns darüber. [...] Durch das Gerücht wurden wir noch einmal zu Fremden. Wir<br />
informierten die Caritas und das Gemeindeamt, ließen uns untersuchen; wir alle waren alle [sic!] HIV-negativ.<br />
Das Flüchtlingshaus wurde im Dezember 1992 geschlossen. Wir wurden auf verschiedene Städte verteilt. Zum<br />
Glück kam ich nach Zeltweg.“ 49<br />
Was Osman beschreibt, ist ein „Leben im Fadenkreuz“ 50 : Schwarze Menschen, zumal in<br />
kleineren und peripher gelegenen Gemeinden, werden in ihrem Alltag nicht ignoriert, „son-<br />
dern im Gegenteil, sie sind in einer weiß dominierten Gesellschaft immer auffällig“. 51 Die<br />
Wahrnehmung schwarzer Frauen und Männer durch Weiße schwankt „zwischen Unsichtbar-<br />
keit und extremer Sichtbarkeit“. 52 Es ist eine Existenz im Scheinwerferlicht, noch mehr für<br />
Frauen als für Männer: „Kein Café, kein Geschäft, das wir betreten, keine Straße, die wir ent-<br />
langgehen können, ohne daß wir bemerkt werden. Nicht nur bemerkt: begafft, abtaxiert,<br />
mißtrauisch beäugt. Oder genüßlich betrachtet mit einem rassistisch gefärbtem [sic!] Voyeu-<br />
rismus: Guck mal, hat die lange Haare! Ist die nicht schön braun? [...] Diese schmerzhafte<br />
Sichtbarkeit ist eine ständige Erinnerung daran, daß wir die Ausnahme sind.“ 53 Eine Re-<br />
flexion der „Weißheit“ findet dabei, wenig überraschend, nicht statt, es bleibt beim Bestaunen<br />
(und Bestauntwerden) der „Schwarzheit“ – die Weißheit als vorgeblich „neutrales“, „norma-<br />
les“ Maß und damit auch konkrete Machtverhältnisse und Realitäten struktureller Gewalt<br />
bleiben unsichtbar und unbenannt und werden automatisch reproduziert. 54 Sich als schwarzer<br />
Mensch in einer rassistischen Umwelt zu behaupten, merkt Johnston-Arthur an, hieße nichts<br />
weiter, als sich „sein/ihr Leben zu erkämpfen – zu atmen“:<br />
„Durch die unmittelbare Konfrontation mit Rassismus, der die eigene Existenz bedroht, inferiorisiert bzw. ihre<br />
Berechtigung in Frage stellt, kommt es zu einer wie auch immer gearteten aufgezwungenen Auseinandersetzung,<br />
in der jeder einzelne schwarze Mensch gezwungen ist, seine eigenen individuellen Überlebensstrategien bzw.<br />
Antworten zu finden. Diese können von Internalisierung von Rassismen, [sic!] über Assimilation bis zu politischer<br />
Selbstorganisation, Entwicklung von Überlebenskulturen und sozialpolitischen Identitäten reichen. Rassismus<br />
stellt sehr of nicht nur einen direkten, sondern einen subtilen, allgegenwärtigen Stressfaktor dar.“ 55<br />
Für schwarze Asylsuchende ist dies auch dann die bestimmende Erfahrung, wenn sie in der<br />
Gemeinde, in der sie untergebracht sind, augenscheinlich „wohlwollend“, nach einer Weile<br />
vielleicht sogar ausgesprochen freundlich aufgenommen werden. Die ablehnende Haltung<br />
gegenüber den Asylsuchenden, berichtet die bereits mehrfach zitierte Trafikantin aus einer<br />
kleinen Kärntner Tourismusgemeinde, „war noch nie so groß wie in dieser Zeit, als die<br />
Schwarzafrikaner gerade ein paar Tage im Dorf waren“. Es habe sich dann jedoch herausge-<br />
49<br />
Osman 1997, 31.<br />
50<br />
Mysorekar 1990, 21.<br />
51<br />
Ebd.<br />
52<br />
Ebd.<br />
53<br />
Ebd., 22.<br />
54<br />
Frankenberg 1996; Johnston-Arthur 2003.<br />
55<br />
Johnston-Arthur 2002, 12f.<br />
245
stellt, dass „viele der Schwarzen reges Interesse am Dorfleben zeigten, äußerst freundlich wa-<br />
ren und eine sehr offene Art an den Tag legten. Sie besuchten sofort einen Deutschkurs und<br />
nützten jede Gelegenheit, deutsch zu sprechen. Das gefiel den Einheimischen.“ Die Situation<br />
habe sich dann folgendermaßen entwickelt:<br />
„Es gab eine relativ große Gruppe [Einheimischer; Anm. RP], die absolut nicht bereit war, ihre Meinung zu<br />
überdenken. Nach und nach wurde die Gruppe zwar etwas kleiner, aber das ging sehr langsam. Die zweite<br />
Gruppe aber [...] pflegte engeren Kontakt mit den Schwarzafrikanern. Sie waren beliebte Gesprächspartner. In<br />
unserem »In-Lokal« trafen sich täglich Einheimische und Schwarze. Sie wurden immer eingeladen, eigenes Geld<br />
hatten sie für solche Zwecke keines. Rückblickend muss ich sagen, dass dies trotz der vielen rassistischen Vorurteile<br />
eine sehr schöne und interessante Zeit war. [...] Ich möchte nochmals betonen, dass die Gruppe der Einheimischen,<br />
die sich auf diese schöne[n] Abenteuer einließen[,] nur ca. 50 Menschen umfasste, aber unter dieser<br />
Gruppe war der Kontakt sehr gut.“ 56<br />
Die Rollenverteilung ist eindeutig: Die „Einheimischen“ leisten sich – die Wortwahl ist kei-<br />
neswegs polemisch, denn die betreffenden Personen bezahlen ja tatsächlich dafür – einen<br />
schwarzen Asylsuchenden als Gesprächspartner. Der Kontakt stellt für sie, wie die Trafikantin<br />
treffend formuliert, ein schönes „Abenteuer“ dar, das durch den zeitlich beschränkten Aus-<br />
bruch aus allen Selbstverständlichkeiten und Normalitäten ein wenig Abwechslung im dörfli-<br />
chen Alltag verspricht. Man ziert sich gewissermaßen mit dem „Ungewöhnlichen“: „Hie und<br />
da“, so Erian über die Kontakte zwischen „Einheimischen“ und schwarzen Asylsuchenden im<br />
Rahmen sportlicher Betätigung, „hörte man sogar jemanden damit beinahe prahlen, dass sie<br />
»Nigger« in der Mannschaft hätten“. 57 Dieser Stolz der „Einheimischen“ ist dabei keineswegs<br />
auf den berühmten „kleinen Mann“ beschränkt, im Gegenteil: In ihrer qualitativen Studie über<br />
die Aufnahme Asylsuchender im Salzburger Lungau zeigt Fuchshofer deutlich, dass gerade<br />
auch (vor allem jüngere) Angehörige der Mittelschicht ähnlich reagieren. „Grad für diese<br />
Exoten findet sich immer wer, der hilft“, zitiert die Autorin eine Helferin: „Was ich jetzt er-<br />
fahren habe, von diesen Afrikanern, das sind die, wo man sagen muß, daß sie angenehm auf-<br />
fallen. Also die bemühen sich sehr, Deutsch möglichst schnell zu lernen, die sich auch hier<br />
einfügen wollen.“ 58 In einer „gewissen, gehobenen Bildungsschicht bzw. auch bei den<br />
weltoffenen jungen Leuten“, so Fuchshofer etwas holprig resümierend, „scheint es durchaus<br />
so, daß das »Hereinbrechen fremder Kulturen« über den Lungau mit einem gewissen Reiz<br />
verbunden war.“ 59 Für „unangepasste“ junge LungauerInnen sei dies eine Möglichkeit gewe-<br />
sen, eine „Weltreise vor Ort“ – so die Formulierung einer Gesprächspartnerin – unternehmen<br />
zu können oder auch „ein gewisses Maß an Widerstand gegen die öffentliche Meinung, die<br />
etablierten Schichten und deren herrschende Normen und Werte zu dokumentieren. Auch von<br />
besser Situierten wurde z.T. die Möglichkeit, die Nähe der Akademiker und Künstler unter<br />
den Asylwerbern zu suchen [...] wahrgenommen. Kontakte auf dieser Basis blieben allerdings<br />
meist eher lose, zeitlich befristet und ohne weitreichende Konsequenzen auf beiden Seiten.“ 60<br />
56 Erian 2002, 93f.<br />
57 Ebd., 93.<br />
58 Fuchshofer 1994, 56.<br />
59 Ebd., 56f.<br />
60 Ebd., 57.<br />
246
Privat aufgenommene schwarze Asylsuchende nahmen Fuchshofers Berichten zufolge offen-<br />
bar nicht selten eine Rolle im Haushalt ein, die an jene possierlicher Haustiere erinnert – und<br />
wenn es keine Asylsuchenden mit dunkler Hautfarbe mehr gab, eignete sich dafür auch eine<br />
besonders „liebe“ iranische Familie, wie die Schilderung einer Helferin zeigt:<br />
„Am Anfang, als wir die iranische Familie betreuten – in unserem Bekanntenkreis, die waren total interessiert<br />
daran. Zeitweise war das – eben richtig exotisch: »Wir wollen auch so eine Familie[.]« Da war man uns richtig<br />
neidig um unsere Familie, und die X., die sind dann hinaufgefahren und wollten auch so eine Familie. [...] Sie<br />
wollten dann unsere, weil die hat ihnen so getaugt. Da war eine Zeitlang ein richtiges Interesse da. Das ist dann<br />
aber schnell wieder abgeflaut.“ 61<br />
»Von einer Extremsituation in die andere«: Soziale Isolation<br />
Das Interesse an sozialen Kontakten wie den von Fuchshofer geschilderten flaut indessen<br />
nicht nur auf Seiten der „Einheimischen“ rasch wieder ab, sondern auch bei den Asylsuchen-<br />
den selbst – sofern ihnen nicht selbst die demütigende Rolle als ewig dankbarer „Vorzeige-<br />
flüchtling“ oder sportlich-erotische „schwarze Perle“ verweigert worden war oder sie sich der<br />
Übernahme einer derartigen Position von vornherein verweigert hatten. Abgesonderte wie<br />
auch herausgehobene Unterbringung führen daher letztlich meist direkt in die soziale Isola-<br />
tion: Normale Kontakte nach „draußen“ sind effektiv unterbunden. Im Fall räumlich abgeson-<br />
dert gelegener Unterkünfte ist dies zunächst offensichtlicher, handelt es sich bei der Umge-<br />
bung der betroffenen Standorte doch meist um für Wohnzwecke als „unattraktiv“ geltende<br />
schlecht erreichbare Randgebiete, die entweder als besonders „trist“ (etwa im Fall von Indust-<br />
rie- und Gewerbegebieten) oder als besonders „idyllisch“ (etwa im Fall von Ausflugsgast-<br />
häusern oder Almen) eingeschätzt werden. Tristesse wie Idylle wirken auf die betroffenen<br />
Asylsuchenden schnell durchaus bedrohlich: „Andere kommen hier her, um drei Wochen Ur-<br />
laub zu machen, wir warten seit Monaten auf Asyl“, stellte etwa Aslan Gaysultanov, ein auf<br />
der steirischen „Sommeralm“ untergebrachter tschetschenischer Asylsuchender, im Herbst<br />
2004 gegenüber einer Besucherin fest: „Ich habe zehn Jahre Krieg gesehen, in ständiger Ge-<br />
genwart des Todes gelebt. Jetzt bin ich hier zur Untätigkeit verdammt. Mir bleibt nichts ande-<br />
res übrig, als zu warten. Ich bin von einer Extremsituation in die andere geraten. [...] Wir sind<br />
nicht nach Österreich gekommen, um uns zu erholen, sondern um zu leben.“ 62<br />
Die soziale Isolation aus ihrem Umfeld herausgehobener Unterkünfte manifestiert sich weni-<br />
ger offensichtlich in der räumlichen Struktur: Oberflächlich betrachtet scheinen sie ja mitten<br />
im „normalen“ Leben positioniert. Wie die Tiroler Standorte in Götzens und Mötz beispiel-<br />
61 Zit. nach ebd.<br />
62 Gaysultanov, zit. nach Raffer 2004, 6f. Münker-Kramer/Gmeiner (2000, 297f) stellen nicht zu Unrecht fest,<br />
dass die Unterbringung an Standorten wie dem von Gaysultanov beschriebenen – unter den Tiroler Unterkünften<br />
wären jene am „Bürgl“ bei Fieberbrunn und in St. Sigmund im Sellrain vergleichbar (gewesen) – in den ersten<br />
paar Wochen tatsächlich wesentlich zur körperlichen Erholung der fluchtbedingt meist in gesundheitlich deutlich<br />
angeschlagenem Zustand ankommenden Asylsuchenden beitragen kann. Für den Unterkunftsgeber spielt eine<br />
mögliche körperliche Erholung der Untergebrachten jedoch keine entscheidungsrelevante Rolle, wie die an abgesonderten<br />
Standorten fast ausnahmslos schlechte Gesundheitsversorgung zeigt. Bereits nach kurzer Zeit zeigen<br />
sich überdies durch die isolierte Unterbringung die von Gaysultanov angedeuteten (und im Folgenden noch<br />
näher zu erläuternden) massiven negativen Auswirkungen auf die Betroffenen.<br />
247
haft zeigen, sind es hier zunächst die das Unterkunftsgebäude umgebenden Straßen und<br />
öffentlichen Einrichtungen, welche übliche nachbar- und freundschaftliche Beziehungen mit<br />
der Bevölkerung im Umfeld, etwa in Form einer schlichten Unterhaltung über den Gartenzaun<br />
hinweg, schon auf einer praktischen Ebene unmöglich machen. Aus der herausgehobenen<br />
Lage und der spezifischen Gestaltung und Funktion der Unterkunftsgebäude resultiert jedoch<br />
auch ein Verschwimmen der Grenze zwischen privater und öffentlicher Sphäre: Letztere<br />
dehnt sich zwangsläufig auf das Gebäudeinnere aus, wenn wie im Fall der unmittelbar im<br />
Ortszentrum gelegenen oben genannten Standorte jeder Blick aus dem Fenster die aus dem<br />
Fenster Blickenden in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt und jeder Tritt<br />
auf den Balkon zum öffentlichen Auftritt gerät. Wenn die Unterkunft – auch dies kann an der<br />
Götzner und der Mötzer Unterkunft exemplarisch beobachtet werden – zugleich als her-<br />
kömmlicher Gastronomiebetrieb geführt wird, ist die Diffusion der Grenze zwischen privatem<br />
und öffentlichem Raum besonders deutlich: Wo die lokale Bevölkerung an ihrem Vormittags-<br />
kaffee nippt, auf ein nachmittägliches „schnelles Bier“ vorbeischaut oder sich zur abendlichen<br />
Stammtischrunde trifft, leben Asylsuchende ihr alltägliches, privates, an diesem Ort jedoch<br />
„veröffentlichtes“ Leben. Gerade größere und an zentraler Stelle herausgehobene Unterkünfte<br />
sind freilich auch ohne eine gastronomische Erst- oder Zweitfunktion häufig ein beliebtes Ziel<br />
von „Exkursionen“: Schul- und Jugendgruppen, kirchliche und private HelferInnenkreise oder<br />
andere Initiativen kommen vorbei, um einen Eindruck vom Leben im „Lager“ zu gewinnen.<br />
Persönliche Kontakte entstehen in diesem Rahmen naturgemäß kaum: Auch wenn es nicht<br />
intendiert ist, finden sich die „besuchten“ Asylsuchenden gewissermaßen in einem Schau-<br />
fenster wieder, ihr privater Rückzugsraum ist der (unter Umständen lautstark ihre Bestürzung<br />
artikulierenden) Öffentlichkeit preisgegeben. Trotz ihrer zentralen Lage unterscheiden sich<br />
herausgehobene Standorte in der Konsequenz daher kaum von abgesonderten: Die soziale<br />
Isolation aufbrechende „normale“ Kontakte sind durch die räumliche Struktur weitgehend<br />
unmöglich gemacht. Erst vor diesem Hintergrund wird es tatsächlich nachvollziehbar, was ein<br />
Asylsuchender im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Innsbruck Ende 2004 berichtete: Er<br />
sei, so der Mann, ein halbes Jahr lang in der genannten Götzner Unterkunft und also unmittel-<br />
bar im Ortszentrum untergebracht gewesen. Während seines gesamten Aufenthalts habe er<br />
jedoch „keinen einzigen Einheimischen“ kennen gelernt. 63<br />
Die soziale Isolation bleibt dabei keineswegs auf den Kontakt nach „draußen“ beschränkt:<br />
Vor allem in Großquartieren ist das Leben gerade auch „drinnen“ von Kontaktarmut und Kon-<br />
flikten geprägt. Asylsuchende bilden in ihren Unterkünften meist keine Gemeinschaft im<br />
eigentlichen Sinn des Wortes – die Bewohnerschaft einer Unterkunft gleicht in ihrer Zusam-<br />
mensetzung im Grunde den Passagieren eines Zugs oder den NutzerInnen eines Hotels. Unter-<br />
schiedliche, oft tatsächlich konträre nationale, ethnische, kulturelle, politische, religiöse und<br />
soziale Hintergründe, verschiedene Ziele und Perspektiven, Fragmentierungen oder Hierar-<br />
63 Protokoll 2004, Blatt 5.<br />
248
chien aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht oder Generation, aber auch eine beträchtliche<br />
Bandbreite an individuellen Gewohnheiten konstituieren letztlich eine überaus heterogene<br />
Gruppe, deren Angehörige wenig mehr verbindet als der gemeinsame Aufenthaltsort. Für<br />
manche Asylsuchenden ist die Entwicklung eines Gefühls der Zusammengehörigkeit schon<br />
deshalb ausgeschlossen, weil der Kontakt zu anderen Flüchtlingen für sie eine ständige Erin-<br />
nerung an eigene schmerzliche Erfahrungen bedeutet. 64 Die mit der Unterbringung verbun-<br />
dene oben skizzierte Stigmatisierung als von der Norm abweichender „Asylant“ verhindert<br />
die Entstehung eines positiven Gemeinschaftsgefühls jedoch auch für die anderen: Das<br />
„schlechte Image“ führt vorrangig zum verständlichen Wunsch, der Unterkunft und damit<br />
diesem Negativbild zu entkommen. 65 Diese Situation spiegelt sich in der unterkunftsinternen<br />
Kommunikation wider: Auch sie ist meist diffus, häufig vom Wunsch nach sozialer Distanz<br />
geprägt, durch Gereiztheit und Konflikte gekennzeichnet und daher letztlich ohne integrierende<br />
Effekte. 66<br />
Eine Folge der Isolation ist der „Lagerkoller“. Auffälligstes Merkmal ist dabei zunächst die<br />
zunehmende Apathie: Keine sinnvolle Beschäftigung bietet Zerstreuung, der Alltag ist eintö-<br />
nig und gleichförmig und besteht im Wesentlichen aus Warten, Essen und Schlafen. Weil es<br />
im Tagesablauf keine notwendigen Fixpunkte mehr gibt, lösen sich gewohnte Zeitstrukturen<br />
auf. „Es war irrelevant, ob eine Handlung gleich, später oder erst in einigen Tagen durchge-<br />
führt wurde“, resümiert Rosenegger seine Beobachtungen in einem Wiener Flüchtlingslager:<br />
„Selbst Tätigkeiten wie Körperpflege und Essenseinnahme waren an keine bestimmten Tages-<br />
zeiten gebunden.“ 67 Ein Resultat kann das „Liegenlassen“ bestimmter Tätigkeiten sein, die<br />
man anfangs noch ausgeführt hatte – ein „stiller Protest“ gegen die als unerträglich erlebte<br />
Situation. Manchmal wird aus dem stillen indessen auch ein lauter Protest, etwa in Form be-<br />
wusster Verstöße gegen explizite Regelungen. Hennig et al., die Anfang der 1980er eine Feld-<br />
studie in einem herausgehoben liegenden Lager für Asylsuchende in Deutschland durchge-<br />
führt hatten, schildern derartige Entwicklungen am Beispiel der Sauberkeit anschaulich:<br />
„Viele Asylbewerber berichteten uns, daß sie jede Lust verloren hätten, für die notwendige Reinigung der Wohnräume<br />
und sanitären Anlagen zu sorgen. Manche fühlen sich für die von der Allgemeinheit benutzten Räume<br />
nicht verantwortlich, andere wollen durch absichtliche Verschmutzung ihren Protest gegen die Lagersituation<br />
zum Ausdruck bringen. Das hat dann auch zu unhaltbaren hygienischen Zuständen geführt. Wir konnten uns mit<br />
eigenen Augen von dem in vielen Wohnbereichen in gesundheitsgefährdendem Ausmaß herumliegenden Unrat<br />
64 Vgl. Lueger-Schuster 1996b, 30; Pflegerl/Fernández de la Hoz 2001, 55.<br />
65 Vgl. Elias/Scotson 1993, 178ff, die Ähnliches auf Gemeindeebene in ihrer zwischen 1958 und 1960<br />
durchgeführten Untersuchung einer englischen Vorortgemeinde feststellten, in der etwas „abgesondert“ in einer<br />
eigenen Siedlung aus dem zerbombten London evakuierte oder geflohene BritInnen lebten.<br />
66 Vgl. Wischenbart 1995; Karlegger 1996, 77; Rosenegger 1996, 59f; s.a. Elias/Scotson 1993, 178ff. Wie<br />
Carstens (1992) am Beispiel der nach dem Zweiten Weltkrieg im schleswig-holsteinischen Kiel in Flüchtlingslagern<br />
untergebrachten deutschen Vertriebenen zeigt, ist selbst bei relativ homogenen Gruppen, die zudem über<br />
eine klare Zukunftsperspektive im Land verfügen, die Herausbildung eines „Gemeinschaftsgefühls“ in diesem<br />
Umfeld schwierig; immerhin bildeten sich in einigen dieser Lager Selbstverwaltungsstrukturen, wobei jedoch<br />
offen bleibt, ob diese tatsächlich eine Folge der Entstehung einer „Gemeinschaft“ darstellten oder eine Reaktion<br />
auf die vielfache Lagerleitung durch nationalsozialistische „Lagerführer“, die von der öffentlichen Hand häufig<br />
auf ihren Stellen in den zuvor einschlägig genutzten Lagern belassen worden waren (vgl. ebd., 55ff).<br />
67 Rosenegger 1996, 60.<br />
249
überzeugen. In den Monaten November und Dezember 1981 vermehrt aufgetretene Hauterkrankungen dürften<br />
mit auf diese Ursache zurückzuführen sein.“ 68<br />
Das Warten ohne konkrete Perspektive lässt häufig auch Asylsuchende apathisch werden, die<br />
zunächst eifrig an sportlichen Aktivitäten oder Sprachkursen teilgenommen hatten: Sie er-<br />
scheinen ihnen zunehmend schlicht zwecklos. „Die erfolgreiche Teilnahme an Sprachkursen“,<br />
so Wipfler treffend, „steht in keinerlei Zusammenhang mit der Anerkennung als Asylberech-<br />
tigter. Ohne gesicherten Verbleib [...] ist andererseits das Erlernen der deutschen Sprache<br />
(nahezu) sinnlos.“ 69 Oft bleibt es bei der (in vielen Fällen von Alkoholismus begleiteten 70 )<br />
Lethargie, häufig resultiert daraus jedoch eine manifeste psychische Krise, die insbesondere<br />
durch scheinbar psychotische Zustände, ausgeprägte Überlebensschuld und Suizidalität ge-<br />
kennzeichnet ist. Lueger-Schuster, als Psychologin in der ersten Hälfte der 1990er Jahre selbst<br />
in Großquartieren für bosnische Kriegsflüchtlinge tätig, charakterisiert auftretende scheinbar<br />
psychotische Zustände dabei als Reaktionen, „die psychotischen Symptomen entsprechen,<br />
etwa wahnhafte Ideen wie die Vorstellung, das[s] die Nachbarn aus der Nebenkoje Spitzel des<br />
politischen Verfolgers wären oder man auserwählt ist, diesen Krieg siegreich zu beenden oder<br />
die Lagerleitung die Auslieferung an die Feinde plant und man daher Vorsicht walten lassen<br />
muß.“ 71 Diese Zustände seien deshalb nur scheinbar psychotisch, weil sie im Grunde Reaktio-<br />
nen auf ein Übermaß an psychischer Belastung und letztlich vor allem sozial bedingt seien.<br />
Eine ausgeprägte Überlebensschuld zeichnet sich durch auf die Reduzierung dieser Schuld-<br />
gefühle abzielende Handlungen aus: „Zu nennen sind Akte der Selbstkasteiung wie hungern<br />
und fasten, exzessives Geldsammeln, ausgeprägte Betreuungsaktivitäten anderer Flüchtlinge,<br />
z.B. organisieren von Arbeit, ohne davon selbst zu profitieren oder intensive politische Betäti-<br />
gung für den Wiederaufbau der Heimat, die an der Realität gemessen unrealistisch er-<br />
scheint.“ 72 Suizidalität wiederum steht meist in direktem Zusammenhang mit der in Lagern<br />
vorherrschenden apathisch-depressiven Grundstimmung, die oft von psychosomatischen<br />
Erkrankungen begleitet oder verstärkt ist. 73<br />
Eigene Welt: Die Herausbildung eines »Eigenlebens«<br />
Derartige Symptome weisen bereits auf ein zentrales Kennzeichen von sozial isolierten Stand-<br />
orten hin: die Herausbildung eines „Eigenlebens“ innerhalb der Unterkunft. Das Phänomen ist<br />
alles andere als neu: „Zur Typologie der Flüchtlingslager gehörte“, so Carstens über die für<br />
68 Hennig et al. 1982, 27.<br />
69 Wipfler 1986, 111f.<br />
70 Vgl. hierzu etwa Hennig et al. 1982, 45f. Die Autoren stellten bei den im von ihnen untersuchten Lager lebenden<br />
Asylsuchenden fest, dass etwa die Hälfte der Untergebrachten Alkohol „in einem gesundheitsgefährdenden<br />
Ausmaß (mehr als vier Halbe Bier/1 l Wein/1/4 l Spirituosen)“ konsumierten, das Ausmaß des Konsums erhöhte<br />
sich dabei mit zunehmender Dauer der Unterbringung. Die betreffenden Asylsuchenden gaben an, durch ihr<br />
Trinken ihre traurige Verstimmtheit betäuben, wiederkehrende quälende Gedanken vertreiben, ein Gefühl der<br />
Sinnlosigkeit verdrängen oder Schlaflosigkeit bekämpfen zu wollen, einer der Befragten hatte auch versucht,<br />
sich durch eine Alkoholvergiftung das Leben zu nehmen.<br />
71 Lueger-Schuster 1996b, 40.<br />
72 Ebd.<br />
73 Vgl. ebd.<br />
250
die deutschen Weltkriegsflüchtlinge und -vertriebenen im Raum Kiel eingerichteten Lager,<br />
„daß sich aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der jeweiligen Menschengruppe, deren<br />
Fähigkeit und Energie, entsprechend der topographischen Lage, den Wechselbeziehungen zur<br />
Umgebung und anderen Wirkkräften bestimmende Wesenszüge und Sonderheiten heraus-<br />
kristallisierten, die jedem Lager eine individuelle Note verliehen.“ 74 Flüchtlingsunterkünfte,<br />
so auch Anderson, „entwickeln ihre eigene Wohnatmosphäre und auch soziale Kultur. Sie ist<br />
für Außenstehende nicht ohne Weiteres zugänglich.“ 75 Diese eigene „soziale Kultur“ ist eine<br />
direkte Folge der geschilderten relativen Abschottung nach außen bei gleichzeitigem Fehlen<br />
eines Privatraums im Inneren, sei es aufgrund der Ausdehnung des öffentlichen Raums in die<br />
Unterkunft hinein, des erzwungenen Zusammenlebens mit weitgehend oder gänzlich fremden<br />
Personen im selben Zimmer oder der Unterbringung von Familien in zu kleinen Zimmern.<br />
Entsprechend spiegelt sich das Eigenleben sozial isolierter Unterkünfte besonders offensicht-<br />
lich in den Versuchen der dort untergebrachten Menschen, sich private Territorien und Rück-<br />
zugsräume zu schaffen und deren „Besitz“ gegen andere zu verteidigen. Für den einzelnen<br />
Asylsuchenden ist dieser Besitz mangels realer Räume meist verdichtet in einem bestimmten<br />
Gegenstand und einzelnen „Nischen“ im Unterkunftsgebäude – ein Schrank, das von der<br />
Unterkunftsleitung zugeordnete Bett, Bücher und Kleidung, eine eigene Kaffeemaschine oder<br />
Musikanlage, aber auch ein bestimmter Stuhl im Zimmer, ein Platz im Aufenthaltsraum oder<br />
auf einem Balkon. Besonders eindrücklich beschreibt Rosenegger derartige Abgrenzungs-<br />
versuche: In einem Wiener Lager für bosnische Flüchtlinge beobachtete er in den 1990ern,<br />
wie die dort untergebrachten Familien versuchten, feste Sitzordnungen einzuhalten, wobei sie<br />
darauf achteten, sich immer in größtmöglichem Abstand zu den anderen zu befinden. „Diese<br />
»Stammplätze« gab es auch im angeschlossenen Garten, durch dessen Ausdehnung die einge-<br />
nommene Distanz noch augenfälliger war als in der Unterkunft.“ 76 Ähnliches beobachtete<br />
auch Wipfler, der in den 1980ern eine psychologische Feldstudie in einem aus seiner zentral<br />
gelegenen Umgebung auffällig herausgehobenen Flüchtlingslager in Tübingen durchführte. In<br />
einem mit derartigen Praktiken als Territorium gekennzeichneten Bereich, so sein Resümee,<br />
„legt der einzelne fest, welche Personen in welchem Umfang Zugang dazu haben. Diese<br />
Nischen sind die einzigen Orte, die vom Individuum kontrolliert werden können.“ 77 Was<br />
Außenstehenden als seltsame „Schrulle“ erscheinen mag, stellt also letztlich eine Strategie<br />
dar, um in einer Extremsituation Individualität zu bewahren und damit die eigene Identität<br />
aufrechtzuerhalten. Gelingt dies nicht mehr, ist meist Regression die Folge – die Betroffenen<br />
verlieren ihre Selbständigkeit. Hennig et al. berichten etwa von Asylsuchenden, die sich in<br />
kindliche bzw. „kindische“ Verhaltensweisen geflüchtet, das Personal zunehmend mit<br />
„Mama“ und „Papa“ angeredet und sich generell immer „unmündiger“ gezeigt hätten. 78<br />
74 Carstens 1992, 11.<br />
75 Anderson 2000, 26.<br />
76 Rosenegger 1996, 59.<br />
77 Wipfler 1986, 89.<br />
78 Hennig et al. 1982, 47.<br />
251
Derartige Verhaltensweisen sind auch in bestimmten Tiroler Unterkünften feststellbar, etwa<br />
am „Bürgl“ bei Fieberbrunn. 79<br />
Ein anderer Bereich, in dem sich das Eigenleben isolierter Unterkünfte deutlich zeigt, ist jener<br />
der Interaktion und Kommunikation. Die oben konstatierte Diffusität unterkunftsinterner Be-<br />
ziehungen ist wesentlich eine Folge des spezifischen Kommunikationszusammenhangs, der<br />
sich aus der sozialen Abschottung abgesonderter oder herausgehobener Standorte ergibt.<br />
Wischenbart, der Anfang der 1980er seinen Zivildienst im Flüchtlingslager Traiskirchen ab-<br />
leistete und den Lagerkomplex dabei als „teilnehmender Beobachter“ untersuchte, charakteri-<br />
siert diese besondere Gesamtatmosphäre, die Asylsuchende und Unterkunftspersonal glei-<br />
chermaßen umfasst, überaus treffend:<br />
„Keiner ist ausgenommen, keiner weiß die Wahrheit, keiner bleibt unbehelligt, sobald er dieses Universum<br />
betritt, egal durch welche Tür. Auf bizarre Weise bildete sich in solcher Verunsicherung der totalitäre Charakter<br />
der Herkunftsländer der meisten Flüchtlinge an der ersten Etappe jenseits der Schwelle noch einmal ab.“ 80<br />
Ein Flüchtlingslager, so Wischenbart, sei ein „schlechter Ort, um Freundschaften zu<br />
schließen“:<br />
„Es ist ein Ort komplizierter Trennungen und verschachtelter Hierarchien. Die Teilung in Flüchtlinge und Personal<br />
ist dabei nur die gröbste Gliederung, wenngleich die einschneidendste. Sie bewirkt unter anderem, daß jede<br />
Episode aus zwei grundsätzlich unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann, aus jener des subjektiven<br />
Erleidens oder Erduldens (und auch ein diensthabender Gendarm kennt diesen Zustand der Passivität nur<br />
zu gut) und aus einer entgegengesetzten Sicht, wenn der Beobachter auch selbst einzugreifen und nach eigener<br />
Wahl zu handeln vermag.“ 81<br />
Diese Teilung beruht auf wechselseitigen Erwartungen und ebensolchen Enttäuschungen, Ge-<br />
rüchte über „die anderen“ machen die Runde, selten explizit gemachtes Misstrauen prägt die<br />
Beziehungen. Die Erfolglosigkeit ihrer Versuche, der nutzlosen Wartezeit zu entkommen,<br />
führen Asylsuchende häufig auf unzureichenden Einsatz des Betreuungspersonals zurück,<br />
dem nicht selten unterstellt wird, mit den Behörden „zusammenzuarbeiten“ oder gar für sie zu<br />
„spionieren“ – ein Beispiel von jemandem, der es mit einer anderen und also „besseren“<br />
Betreuungsperson „geschafft“ hat, ist rasch bei der Hand. Das Personal wiederum, zumal we-<br />
nig oder falsch qualifiziertes, findet sich zwischen den Stühlen wieder: Aus ihrem Selbstver-<br />
ständnis als „HelferInnen“ heraus wollen die BetreuerInnen durchaus über den institutionellen<br />
Kontakt hinausgehende tätigkeitsbezogene oder gar persönliche Beziehungen aufbauen und<br />
bei der Lösung individueller Probleme in allen möglichen Bereichen helfen, die realen Mög-<br />
lichkeiten dazu sind jedoch meist äußerst beschränkt. Das Ergebnis ist eine schrittweise Ver-<br />
änderung der jeweiligen Perspektive und damit des Umgangs miteinander, wie sie Wischen-<br />
bart beschreibt:<br />
79 Vgl. hierzu Abschnitt 7.1.5.<br />
80 Wischenbart 1995, 205; ähnlich die Wahrnehmungen von Karlegger 1996, 78.<br />
81 Wischenbart 1995, 196.<br />
252
„Als wir Zivildiener am ersten Tag in unsere künftige Tätigkeit eingewiesen wurden, erzählte uns ein Mitglied<br />
der Lagerleitung zur Einstimmung von der allmählichen Veränderung seines eigenen Blickwinkels. Anfangs<br />
habe er angesichts der Fülle der täglichen Probleme im Lager häufig ein Gefühl von Ohnmacht verspürt. Er<br />
wollte sich für jeden einzelnen Flüchtling persönlich einsetzen. Mit der Zeit jedoch [...] sei er abgestumpft, teils<br />
aus Überforderung, mehr aber noch, weil er so häufig, trotz seiner Bemühungen, »hintergangen« worden sei. Die<br />
Klage über die »Undankbarkeit« der Flüchtlinge, erfuhren wir Neulinge bald, war eine durchgängige Melodie in<br />
den Selbstdarstellungen des Personals. Die Episoden, die zur Beweisführung herangezogen wurden, waren<br />
Legion.“ 82<br />
Der Perspektive des Personals auf die „undankbaren“ Flüchtlinge steht jene der Asylsuchen-<br />
den auf den scheinbar intransparent und unendlich langsam und ineffizient agierenden „Appa-<br />
rat“ gegenüber. Die Unterkunft präsentiert sich als schwer durchschaubarer Komplex, in dem<br />
zuverlässige Informationen nur unter Aufbietung aller möglichen „Tricks“ zu bekommen<br />
sind: „Taktische Überlegungen und die Suche nach günstigen Ausgangspositionen für die<br />
Erreichung selten präzise definierbarer Ziele prägten den Tagesablauf und den Lebensrhythmus<br />
der Flüchtlinge ganz entscheidend.“ 83<br />
Tendenz zur »totalen Institution«<br />
In Wischenbarts Schilderungen des „Lagerlebens“ ist die Tendenz zur „totalen Institution“,<br />
die abgesonderten oder herausgehobenen Unterkünften innewohnt, bereits mehr als deutlich<br />
erkennbar. Die Handhabung einer Reihe menschlicher Bedürfnisse durch die bürokratische<br />
Organisation ganzer Menschengruppen – egal, ob diese ein notwendiges oder effektives Mit-<br />
tel der sozialen Organisation unter den jeweiligen Bedingungen darstellt – wertet der Sozio-<br />
loge Erving Goffman als „das zentrale Faktum totaler Institutionen“. In seiner Untersuchung<br />
der sozialen Situation „psychiatrischer Patienten und anderer Insassen“ kommt er zum<br />
Schluss:<br />
„In totalen Institutionen besteht eine fundamentale Trennung zwischen einer großen, gemanagten Gruppe, treffend<br />
»Insassen« genannt, auf der einen Seite, und dem weniger zahlreichen Aufsichtspersonal auf der anderen<br />
Seite. Für den Insassen gilt, daß er in der Institution lebt und beschränkten Kontakt mit der Außenwelt hat. Das<br />
Personal arbeitet häufig auf der Basis des 8-Stundentages und ist sozial in die Außenwelt integriert. Jede der<br />
beiden Gruppen sieht die andere durch die Brille enger, feindseliger Stereotypien. Das Personal hält die Insassen<br />
häufig für verbittert, verschlossen und wenig vertrauenswürdig, während die Insassen den Stab oft als herablassend,<br />
hochmütig und niederträchtig ansehen. Das Personal hält sich für überlegen und glaubt das Recht auf<br />
seiner Seite, während die Insassen sich – zumindest in gewissem Sinn – unterlegen, schwach, tadelnswert und<br />
schuldig fühlen. Die soziale Mobilität zwischen den beiden Schichten ist sehr gering.“ 84<br />
Den totalitären Charakter der Institution hält letztlich die Beschränkung des Kontakts der In-<br />
sassInnen mit der Außenwelt, ihre soziale Isolation vom „Draußen“ aufrecht. Die Mittel zu<br />
dieser Beschränkung können dabei in die „dingliche Anlage“ eingebaut sein, etwa in Form<br />
von Toren, Gittern, Zäunen, Mauern oder Stacheldraht. In Form von großen Entfernungen zu<br />
besiedeltem Gebiet, Wald, Wasser, Sümpfen oder Bergen kann jedoch auch die Struktur des<br />
die Anlage umgebenden Raums zur Beschränkung des sozialen Kontakts genutzt werden. 85<br />
82 Ebd.<br />
83 Ebd., 196f.<br />
84 Goffman 1973, 18f.<br />
85 Vgl. ebd., 15f.<br />
253
Totale Institutionen können mit Goffman anhand von vier Merkmalen charakterisiert wer-<br />
den 86 : Erstens ist eine in modernen Gesellschaften grundlegende soziale Ordnung, die räumli-<br />
che Trennung der drei Bereiche des Schlafens, Arbeitens und Spielens, wobei diese Tätigkei-<br />
ten mit jeweils wechselnden PartnerInnen unter verschiedenen Autoritäten und ohne übergrei-<br />
fenden rationalen Plan durchgeführt werden, in totalen Institutionen aufgehoben: Alle Ange-<br />
legenheiten des Lebens finden an ein und demselben Ort unter ein und derselben Autorität<br />
statt. Zweitens führen die „Mitglieder“ der Institution alle Phasen ihrer täglichen „Arbeit“ in<br />
unmittelbarer Gesellschaft einer größeren Gruppe von „SchicksalsgenossInnen“ aus, grund-<br />
sätzlich wird dabei allen die gleiche Behandlung zuteil, auch haben alle die gleiche Tätigkeit<br />
zu verrichten. Alle Phasen des „Arbeitstages“ sind, drittens, von der Autorität exakt geplant,<br />
Phasenwechsel erfolgen zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt, die Abfolge wird dabei von<br />
oben durch ein System expliziter formaler Regeln und einen Stab von „Funktionären“ vorge-<br />
schrieben. Viertens schließlich werden all diese Tätigkeiten in einem einzigen rationalen Plan<br />
vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen. Doch<br />
auch wenn Außenstehenden solche Institutionen als rationale Organisationen erscheinen, die<br />
bewusst als effektive Apparate zur Hervorbringung einiger offiziell anerkannter und gebillig-<br />
ter Ziele eingerichtet wurden, scheinen sie in der Realität eher als „bloße Aufbewahrungslager<br />
für die Insassen“ zu dienen – „dieser Widerspruch zwischen dem, was die Institution tut, und<br />
dem, was sie offiziell als ihre Tätigkeit angeben muß, bildet den grundlegenden Kontext für<br />
die tägliche Aktivität des Personals“. 87 Aus einer derartigen Organisation des Lebens ergeben<br />
sich, wie Goffman zeigt, eine Reihe an für den Kontext dieser Untersuchung bedeutsamen<br />
Konsequenzen, die im bisher Ausgeführten teils bereits angedeutet wurden:<br />
1. Das oben anhand zweier Teilaspekte skizzierte Eigenleben isolierter Standorte schafft im<br />
Grunde keine eigene „soziale Kultur“, wie sie Anderson konstatiert hatte: „Wenn ein kul-<br />
tureller Wechsel eintritt, handelt es sich vielleicht um ein Verwehren bestimmter Verhal-<br />
tensmöglichkeiten und um die Unmöglichkeit, mit den letzten, in der Außenwelt stattge-<br />
fundenen sozialen Veränderungen Schritt zu halten. Wenn daher der Aufenthalt der Insas-<br />
sen lang andauert, kann das eintreten, was »Diskulturation« genannt wurde – d.h. ein Ver-<br />
lern-Prozeß, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten<br />
der Außenwelt fertig zu werden, wenn und falls er hinausgelangt.“ 88<br />
2. Dieser Verlernprozess steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem massiven Rollen-<br />
verlust der Untergebrachten und ihrer Beschränkung auf eine einzige Rolle 89 – die Arbei-<br />
terin ist nicht mehr Arbeiterin, Tochter und Partnerin, sondern Insassin, der Journalist<br />
nicht mehr Journalist, Reiseführer und Liebhaber, sondern Insasse.<br />
86 Vgl. ebd., 17.<br />
87 Ebd., 78.<br />
88 Ebd., 24.<br />
89 Vgl. ebd., 25.<br />
254
3. Daraus folgt automatisch auch ein Verlust an sozioökonomischem Status: Externe soziale<br />
Merkmale und Unterschiede haben nicht länger Gültigkeit. Der Universitätsprofessor teilt<br />
sich das Zimmer mit dem Automechaniker, der atheistisch eingestellte Alkoholiker mit<br />
dem aus religiöser Überzeugung Abstinenten. „Die Gewißheit des Insassen, daß er nicht<br />
schlechter als jeder seiner Kameraden behandelt wird, kann für ihn sowohl eine Hilfe als<br />
auch einen Verlust darstellen.“ 90<br />
4. Ein funktionierendes Familienleben ist mit dem Leben in einer derartigen Institution<br />
unvereinbar: Wer mit einer Gruppe von „KollegInnen“ zusammen arbeitet (oder wartet),<br />
isst und schläft, ist kaum in der Lage, eine sinnvolle häusliche Existenz aufrecht zu erhal-<br />
ten. Umgekehrt gibt die außerhalb der Institution wohnende Familie den Mitgliedern des<br />
Personals die Möglichkeit, „in die Gemeinschaft der Außenwelt integriert zu bleiben und<br />
dem allumfassenden Anspruch der totalen Institution zu entgehen“. 91<br />
5. Mit der Rolle als Insassin und Insasse verbunden ist damit auch eine dauernde (Selbst-)<br />
Entblößung und (Selbst-)Demütigung, ein Kontroll- und Autonomieverlust: Kollektive<br />
Schlafgelegenheiten wie Mehrbettzimmer oder Schlafsäle reduzieren die Privatsphäre auf<br />
die Bettdecke, der Zwang, Unbekanntes essen und in ständigem zwischenmenschlichem<br />
Kontakt zu ungeliebten KollegInnen stehen zu müssen, erscheint als eine Form der per-<br />
manenten „Verunreinigung“. 92 Die Notwendigkeit, Alltäglichkeiten wie ein Telefonat<br />
oder das vorübergehende Verlassen der Institution erbitten oder sich vom Personal Duzen<br />
lassen zu müssen drängt die Betroffenen in eine Position der „Unterwürfigkeit“.<br />
6. Der fehlende Privatraum zwingt die InsassInnen dazu, sich halbprivate Ersatzräume<br />
gewissermaßen zu ertrotzen. Mit Goffman können hier „Freiräume“ von „Gruppenterrito-<br />
rien“ und „persönlichen Territorien“ unterschieden werden. 93 Während Freiräume als<br />
abgegrenzte, oft nicht einsehbare, aber für jeden frei zugängliche Räume erscheinen, in<br />
denen die InsassInnen in einem gewissen Ausmaß nicht unter der Kontrolle des Personals<br />
stehen und die üblichen Hierarchien daher aufgehoben sind, stellen Gruppenterritorien<br />
Räume dar, die von bestimmten InsassInnengruppen okkupiert und unter ihre Kontrolle<br />
gebracht wurden, zumindest gegenüber anderen InsassInnen wird das so erreichte<br />
Nutzungsprivileg verteidigt. Persönliche Territorien wiederum erscheinen als individueller<br />
territorialer Anspruch, der den Betroffenen bestimmte Annehmlichkeiten und eine<br />
gewisse Selbstbestimmung ermöglicht, etwa durch die Nutzung eines bestimmten Sitz-<br />
platzes oder die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände an einem bestimmten Ort.<br />
7. Sind derartige Mittel zur Selbstbestimmung und Aufrechterhaltung der eigenen Identität<br />
nicht mehr möglich, treten in totalen Institutionen häufig Phänomene auf, die Goffman mit<br />
dem Begriff der „sekundären Anpassung“ zu fassen sucht und als „Unterleben“ der Insti-<br />
90 Ebd., 120.<br />
91 Ebd., 22.<br />
92 Vgl. ebd., 34ff.<br />
93 Vgl. ebd., insbesondere 220-238.<br />
255
tution charakterisiert – ein Verhalten, bei welchem die Insassin oder der Insasse „uner-<br />
laubte Mittel anwendet oder unerlaubte Ziele verfolgt, oder beides tut, um auf diese Weise<br />
die Erwartungen der Organisation hinsichtlich dessen, was er tun sollte und folglich was<br />
er sein sollte, zu umgehen. Sekundäre Anpassung stellt eine Möglichkeit dar, wie das In-<br />
dividuum sich der Rolle und dem Selbst entziehen kann, welche die Institution für es verbindlich<br />
hält.“ 94<br />
8. Zur Aufrechterhaltung der Organisation des Alltags trotz der vielfältigen Einschränkungen<br />
und Demütigungen trägt vor allem ein „Privilegiensystem“ bei, das teils auf einer ver-<br />
gleichsweise nüchternen, das Leben innerhalb der Institution regelnden „Hausordnung“<br />
beruht, teils auf vom Personal bei „Wohlverhalten“ gewährten individuellen Vergüns-<br />
tigungen. Diese Privilegien betreffen jedoch lediglich Teile jener Rechte und Vergünsti-<br />
gungen, welche die InsassInnen in der Außenwelt für gesichert hielten, etwa die Erlaubnis<br />
zur Nutzung alltäglicher Gegenstände oder bestimmter Räume oder auch zum längeren<br />
Verlassen oder überhaupt der Entlassung aus der Institution. Die Vergünstigungen sind im<br />
Grunde nicht mehr als die Abwesenheit von Entbehrungen, die man unter normalen Um-<br />
ständen nicht ertragen zu müssen erwartet. 95 „Die um diese kleinen Privilegien aufgebaute<br />
Welt ist wohl das wichtigste Merkmal der Insassen-Kultur; ein Außenseiter wird diese<br />
Tatsache kaum verstehen, auch wenn er selbst erst vor kurzem eine solche Erfahrung<br />
gemacht hat. Die Sorge um diese Privilegien führt mitunter dazu, daß großzügig geteilt<br />
wird, fast immer führt sie zu der Bereitschaft, um Dinge wie Zigaretten, Bonbons oder<br />
Zeitungen zu bitten. Verständlicherweise dreht sich die Unterhaltung der Insassen oft um<br />
die in der Phantasie ausgemalte »Entlassungs-Sauftour«, nämlich um die Dinge, die man<br />
während des Urlaubs oder nach der Entlassung aus der Anstalt tun will. Mit dieser Phanta-<br />
sie ist das Gefühl verbunden, daß »die draußen« gar nicht wissen, was für ein schönes<br />
Leben sie haben.“ 96<br />
9. Untrennbar mit den Privilegien verbunden sind die Strafen, mit denen Verstöße gegen die<br />
„Hausordnung“ – sei sie nun ex- oder implizit formuliert – sanktioniert werden. Strafen<br />
und Privilegien, beides letztlich typische Organisationsmodi für totale Institutionen, sind<br />
wesentlich mit dem „Arbeitssystem“ des Hauses gekoppelt: „Die Arbeits- und Schlaf-<br />
plätze werden klar als Orte definiert, wo man Privilegien von bestimmter Art und be-<br />
stimmtem Umfang erwerben kann, und die Insassen werden sehr oft und sichtbar von ei-<br />
nem Ort zum anderen verlegt, was jeweils eine administrative Strafe oder Belohnung be-<br />
deutet, je nachdem, was sie aufgrund ihrer Kooperationsbereitschaft verdient haben. Die<br />
Insassen werden bewegt, das System bleibt starr. Daher ist eine gewisse räumliche Spe-<br />
94 Ebd., 185.<br />
95 Ebd., 56f.<br />
96 Ebd., 56.<br />
256
zialisierung zu erwarten, wobei bestimmte Stationen oder Baracken in den Ruf von Strafräumen<br />
für besonders widerspenstige Insassen kommen [...].“ 97<br />
10. Ein solches System schafft zwangsläufig seine eigenen MärtyrerInnen, etwa die „zur<br />
Strafe“ an einen anderen Ort Verlegten, und seine eigenen „strafenden“ InquisitorInnen –<br />
eine „natürliche Kontrollinstanz“, die für eine verständliche Interpretation sorgen würde,<br />
scheint es dabei nicht zu geben. 98<br />
Angepasst an die spezifischen Rahmenbedingungen der Unterbringung von Asylsuchenden<br />
finden sich viele dieser Aspekte auch an Unterkunftsstandorten in Tirol, ohne dass dies vom<br />
Unterkunftsgeber intendiert wäre. Unverkennbar Züge einer solchen totalen Institution trägt<br />
etwa der räumlich abgesonderte lagerartige Unterkunftskomplex am „Bürgl“ bei Fieberbrunn:<br />
• Der Standort auf einem Hochplateau an der Nordostseite des Bürglkopfs bildet einen<br />
durch natürliche Barrieren von besiedeltem Gebiet klar abgetrennten und in sich geschlos-<br />
senen Raum. Er ist ringsum von Wald umgeben, die große Entfernung zum Dorf bedingt,<br />
dass dieses zu Fuß praktisch nicht erreichbar ist. Bereits durch die Lage des Standorts<br />
wird damit eine von der „Außenwelt“ sauber abgetrennte „Innenwelt“ konstruiert. Diese<br />
Tendenz wird durch den Umstand verstärkt, dass die Unterkunft nur von einer Seite her<br />
zugänglich ist: Während an der Bergseite die Felsen des Bürglkopfs aufragen, fällt das<br />
Gelände auf zwei Seiten in den Spielberg- bzw. den Hörndlinger Graben ab, die einzige<br />
Verbindung zum Tal ist eine nicht asphaltierte Forststraße, die über den Rücken des Ofen-<br />
bergs talwärts führt.<br />
• Aufgrund der extrem peripheren Lage ist die Freizügigkeit des Verkehrs mit der „Außen-<br />
welt“ stark eingeschränkt. Um die Unterkunft verlassen und ins Tal fahren zu können,<br />
sind die untergebrachten Flüchtlingen auf den Transport durch einen der beiden unter-<br />
kunftseigenen Kleinbusse angewiesen, die werktags bis zu viermal am Tag ins Dorf<br />
fahren. Dass die Busse auch von „geeigneten“ Flüchtlingen gesteuert werden können, ver-<br />
ringert zwar die Abhängigkeit vom Unterkunftspersonal, schafft andererseits jedoch neue<br />
Hierarchien unter den Untergebrachten selbst – über die von Goffman beschriebene<br />
„Privilegienkultur“ entsteht gewissermaßen eine „informelle Elite“.<br />
• Die Lage des Standorts und die erzwungene Untätigkeit der dort Untergebrachten bzw. die<br />
Arbeit ausgewählter Asylsuchender in der am Standort vorhandenen Lehrküche oder<br />
Werkstatt bedingen, dass die übliche Trennung der Lebensbereiche für Schlaf, Arbeit und<br />
Freizeit aufgehoben ist. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und demselben<br />
Ort mit den gleichen PartnerInnen unter ein und derselben Autorität nach von dieser be-<br />
stimmten umfassenden und mehr oder weniger rationalen Regeln statt, die sich wesentlich<br />
von jenen unterscheiden, die in der „Außenwelt“ das Zusammenleben organisieren.<br />
97 Ebd., 57.<br />
98 Vgl. ebd.<br />
257
• Die abgesonderte Lage macht das „Privileg“ der Verlegung an einen räumlich zentraler<br />
gelegenen Standort für Asylsuchende äußerst erstrebenswert, umgekehrt wird einer Verle-<br />
gung in den Unterkunftskomplex am „Bürgl“ Bestrafungscharakter und dem Standort das<br />
Attribut eines „Strafraumes“ zugeschrieben.<br />
Absonderung als Disziplinierungsmittel<br />
Der zuletzt genannte Punkt zeigt bereits deutlich: Die absonderte Unterbringung kann in der<br />
Praxis als wirkungsvolles Disziplinierungsmittel angewandt werden. Dass dies auch in Tirol<br />
der Fall ist, legen zunächst dahingehende Berichte von Asylsuchenden nahe. So hatte etwa –<br />
ein Fall, der bereits im Rahmen der Einzelfalldarstellungen kurz angesprochen wurde – ein<br />
afghanischer Asylsuchender 2001 seine Verlegung von Volders an den Standort am „Bürgl“<br />
gegenüber Besucherinnen explizit als „Strafversetzung“ bezeichnet, weil er die Arbeit als<br />
Erntehelfer verweigert hatte. 99 Ein Unterkunftsleiter berichtete im Gespräch von ähnlichen<br />
Aussagen „seiner“ Flüchtlinge. 100 Ein asylsuchender georgischer Journalist und Familienvater<br />
wandte sich Anfang 2004 an die Tageszeitung Der Standard, nachdem er innerhalb von zwei<br />
Jahren zum 18. Mal verlegt worden war – zuletzt nach eigenen Aussagen unfreiwillig, wie die<br />
Zeitung berichtete:<br />
„Anlass für die Verlegung ist ein Vorfall in der Flüchtlingsunterkunft im Tiroler Mötz. V. soll am Heiligen<br />
Abend eine Schlägerei angezettelt haben. [Flüchtlingskoordinator] Logar spricht von »mehreren Vorfällen«, die<br />
zur Verlegung »geführt« hätten, verweist aber auf das »Amtsgeheimnis«. V. bestreitet eine Körperverletzung<br />
und legt eine Liste vor, auf der Heimbewohner erklären, kein Problem mit der Familie gehabt zu haben. [...] Er<br />
vermutet, dass das wahre Motiv für die Verlegung seine »Aufmüpfigkeit« sei. Denn er habe sich gewehrt, in das<br />
abgelegene Heim am Bürglkopf bei Fieberbrunn zu ziehen [...]. Vergangenen Juni habe er eine Kundgebung von<br />
obdachlosen Flüchtlingen mit organisiert. Logar bestreitet dies: Das Land habe V. »sogar in Landesbetreuung<br />
genommen«. An die Kundgebung kann er sich »gar nicht mehr erinnern«.“ 101<br />
Die Berichte Asylsuchender geben freilich nur die subjektive Interpretation einer Verlegung<br />
wieder und können daher bestenfalls als Indiz für die Nutzung der Absonderung zur Diszipli-<br />
nierung gelten. Verlegungen als „Strafmaßnahmen“ (wie überhaupt die Existenz von Straf-<br />
maßnahmen) bestritt der Unterkunftsgeber bereits vor Jahren vehement 102 , Verlegungen nach<br />
unterkunftsinternen Konflikten, wie sie der Unterkunftsgeber bereits seit langem offen prakti-<br />
ziert 103 , sind in manchen Fällen zweifellos tatsächlich unumgänglich, um ein einigermaßen<br />
friedliches Leben einer Unterkunft zu gewährleisten. Doch Berichte verschiedener Bürger-<br />
99 Interview Beratung/Betreuung 02, 28.05.2001.<br />
100 Interview Unterkunftsleitung 01/3, 30.10.2003. Auch mehrere BeraterInnen und BetreuerInnen erwähnten im<br />
Gespräch derartige Berichte (vgl. etwa Interviews Beratung/Betreuung 09, 18.08.2004 und 11, 13.11.2004).<br />
101 Der Standard 05.02.2004.<br />
102 So etwa 2001 der damals ressortzuständige Landeshauptmannstellvertreter Prock: „Willkürliche Verlegungen<br />
bestimmter Personen in entlegenere Gebiete bzw. in andere Einrichtungen finden keinesfalls statt.“ (Anfragebeantwortung<br />
Prock 2001a, Punkt 5) „Bei Nichteinhaltung bzw. Übertretung der Hausordnungen werden keine<br />
Strafmaßnahmen verhängt.“ (Anfragebeantwortung Prock 2001b, Punkt 10/11)<br />
103 „Verlegungen von Flüchtlingen bzw. Asylanten sind vornehmlich aus Gründen der Vermeidung von<br />
Überbelegungen erforderlich. Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass derartige Maßnahmen [...] bisweilen<br />
auch deshalb notwendig waren, um sich abzeichnenden, erfahrungsgemäß durchaus auch ethnisch bedingten,<br />
Konfliktsituationen dadurch wirksam begegnen zu können.“ (Anfragebeantwortung Prock 2001a, Punkt 5)<br />
258
meister legen nahe, dass nicht selten ohne genauere Überprüfung verlegt wird. So führt etwa<br />
ein Bürgermeister mit Bezug auf den Flüchtlingskoordinator des Landes aus:<br />
„Also wenn’s Probleme gibt, dann wend ich mich direkt an ihn, und ich mein’, er ist da ein umsichtiger Mann,<br />
mit dem man also eigentlich alle Sachen – also wenn’s Probleme gibt – besprechen kann und der da sicher Hilfe<br />
leistet. Ich mein’, das funktioniert an sich sehr gut – also wenn tatsächlich irgendein Vorfall ist, dann wird reagiert.<br />
Da handelt man also sehr rasch. [...] Das muss ich sagen. Also die werden innerhalb von 24 Stunden werden<br />
die von dort abgezogen und kommen irgendwo anders hin.“ 104<br />
Ein anderer Bürgermeister berichtet von alkoholisierten Asylsuchenden: „Die einen haben<br />
getrunken und haben um zwei in der Früh angefangen auf der Terrasse einen Lärm zu schla-<br />
gen und so, und das ... hat man halt müssen regeln, das. [...] Und das ist gemeinsam mit Logar<br />
– er ist, muss ich ganz ehrlich sagen, er ist ... er bemüht sich und ... er tut die sofort weg, wo’s<br />
nicht hinhaut [...].“ 105 Ein Unterkunftsleiter nennt als Ziele solcher in Reaktion auf „Prob-<br />
leme“ vorgenommener Verlegungen zwei Standorte: jenen am „Bürgl“ bei Fieberbrunn und<br />
jenen in Vils, „ganz im Außerfern draußen“ – zum Zeitpunkt des Gesprächs die beiden „abge-<br />
sondertsten“ Tiroler Unterkünfte. 106 Der den oben genannten Berichten Asylsuchender impli-<br />
zite Vorwurf, der Unterkunftsgeber würde die abgesonderte Lage einzelner Unterkünfte ge-<br />
zielt nutzen, um „Problemfälle“ durch eine Verlegung dorthin zu „disziplinieren“, scheint also<br />
keineswegs aus der Luft gegriffen. Und tatsächlich bestätigt die Unterkunftsleitung einer<br />
landeseigenen Unterkunft unaufgefordert derartige Praktiken:<br />
„Wir machen unsere Arbeit und haben wirklich Ruhe und Disziplin ins Haus gebracht, falls notwendig mit einer<br />
Verlegung in ein anderes Heim.<br />
Mhm, wo anders hin ...<br />
Nach Vils oder ... in erster Linie Randbezirke, wo einfach ... wo ihre Mobilität etwas eingeschränkter ist ...“ 107<br />
Abgesonderte Standorte werden, so kann also resümiert werden, bewusst zur (offensichtlich<br />
disziplinierenden) Einschränkung der Mobilität „schwieriger“ Asylsuchender eingesetzt. 108<br />
Einer durch das Muster von Absonderung oder Heraushebung geprägten Unterbringungs-<br />
struktur ist die Möglichkeit zur Disziplinierung dabei in besonderer Weise immanent: Der<br />
meist an äußerst zentralen Orten herausgehoben liegende Standort erscheint oberflächlich be-<br />
trachtet als das absolute Gegenbild des abgesonderten, seine Existenz lässt die mit der Abson-<br />
derung verbundenen Beschränkungen daher noch deutlicher hervortreten. Erst die Kombina-<br />
tion dieser beiden Merkmale macht die Absonderung zum potentiell wirkungsvollen Diszipli-<br />
nierungsmittel. Dass der Unterkunftsgeber abgesonderte Unterkünfte bereits mit dem Ziel<br />
einer solchen Nutzung errichtet hat, ist indessen wohl auszuschließen: Die oben geschilderte<br />
104<br />
Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 238-245.<br />
105<br />
Interview Bürgermeister 04/1, Z 73-77. Der Bürgermeister bekräftigte dies später nochmals: „Wenn man sich<br />
bemüht – wie der Logar sich auch bemüht, dass wenn ein Fall auftritt: Sofort greift er ein und weg.“ (ebd., Z<br />
158f; vgl. für ähnliche Aussagen die Interviews Bürgermeister 05/1, 2003, Z 609-626 und Mühlberger<br />
03.11.2003, Z 195-200 und 356-372)<br />
106<br />
Vgl. Interviews Unterkunftsleitung 01/1, 30.10.2003, Z 120-132 und 01/3, 30.10.2003.<br />
107<br />
Interview Unterkunftsleitung 06/1, 07.11.2003, Z 144-147; die Zwischenbemerkung des Interviewers wurde<br />
kursiv gesetzt.<br />
108<br />
Dass dies auch andernorts praktiziert wird, zeigt u.a. das von Anderson (2001, 42) referierte Beispiel aus Köln.<br />
259
Praxis der Standortsuche und -entscheidung legt nahe, dass diese Möglichkeit eine letztlich<br />
unbeabsichtigte Folge der weitgehend konzept- und kriterienlosen Standortwahl darstellt.<br />
»Charity-Politik« und die Verhinderung von Selbstorganisation<br />
Das oben zitierte Beispiel des georgischen Journalisten weist – unabhängig vom Wahrheitsge-<br />
halt der gegen den Unterkunftsgeber erhobenen Vorwürfe – auf eine weitere Konsequenz ab-<br />
gesonderter Unterbringung hin: Lagebedingt wird die Selbstorganisation von Asylsuchenden,<br />
aber auch die eingangs angesprochene Mobilisierung von Ressourcen migrantischer Commu-<br />
nities und Exilgemeinschaften verhindert, den Untergebrachten wird letztlich die Möglichkeit<br />
verwehrt, auf „eigenen Füßen zu stehen“. Die Absonderung, aber auch die Heraushebung von<br />
Unterkünften untermauert damit das insbesondere von der ressortzuständigen Landesrätin<br />
Gangl und von einigen Unterkunftsleiterinnen regelmäßig kommunizierte Bild „völlig hilflo-<br />
ser Menschen“ 109 und „notleidende[r] Familien“ 110 , denen mit „Unmengen an Kleider-, Bett-<br />
wäsche- und Spielzeugspenden“ 111 geholfen werden muss und die „durch Taschengeld,<br />
Deutschkurse, Handarbeitskurse“ 112 unterstützt werden können.<br />
Nicht von ungefähr wurde daher die mit der Unterbringung verbundene trennscharfe<br />
Unterscheidung verschiedener Gruppen von Flüchtlingen wie Asylsuchende, Asylberechtigte<br />
und illegalisierte Flüchtlinge von anderen migrantischen Gruppen verschiedentlich als<br />
„divide-et-impera“-Strategie der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der Gesamtgruppe der<br />
MigrantInnen charakterisiert. 113 Das in Tirol weitestgehend fehlende Engagement migran-<br />
tischer Organisationen im Bereich der Flüchtlingsarbeit ist möglicherweise tatsächlich auch<br />
(aber zweifellos nicht nur) vor diesem Hintergrund zu sehen.<br />
Desintegrierende Wirkung<br />
Die Unterbringung an abgesonderten oder herausgehobenen Standorten entspricht letztlich, so<br />
kann resümiert werden, dem vorübergehenden „Abstellen“ von Asylsuchenden an leicht über-<br />
schau- und also auch kontrollierbaren Orten – Münker-Kramer und Gmeiner sprechen<br />
treffend von „Flüchtlingsverwahrung“. 114 Soziale Isolation, das sich in den Unterkünften<br />
rasch herausbildende Eigenleben und die auch an einigen Tiroler Standorten deutlich erkenn-<br />
bare Tendenz zur „totalen Institution“ üben über den damit verbundenen Diskulturations-<br />
prozess eine massiv desintegrierende Wirkung auf die dort untergebrachten Menschen aus,<br />
deren Folge der Verlust von Selbständigkeit und daraus resultierende Abhängigkeitsverhält-<br />
nisse sind, die eine spätere (Re-)Integration deutlich erschweren, weitere gezielte und teils<br />
jahrelange Betreuungsmaßnahmen erforderlich machen und damit zu einem zusätzlichen<br />
109<br />
Gangl, zit. nach AdTLR 15.06.2004.<br />
110<br />
Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 06.10.2004.<br />
111<br />
Osttiroler Bote 15.09.2004.<br />
112<br />
Ebd.<br />
113<br />
So etwa Adick 2001, 29; auch den migrantischen Beitrag dazu reflektierend Bojadžijev et al. 2003.<br />
114 Münker-Kramer/Gmeiner 2000.<br />
260
finanziellen Aufwand führen, der bei adäquaterer Unterbringung zu vermeiden gewesen<br />
wäre. 115 Der Fall des am „Bürgl“ bei Fieberbrunn untergebrachten Flüchtlings, der nach einer<br />
Verlegung in die vergleichsweise zentral gelegene Unterkunft in Volders „back in the bush to<br />
my mama“ gebracht werden wollte, ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel: Das selbständige<br />
Leben in einer „normalen“ Umgebung hatte er schlicht verlernt. 116<br />
Absonderung und Heraushebung als Symbol sozialer Beziehungen<br />
In Anlehnung an Stöger kann die Situation jener Asylsuchenden, die an den untersuchten<br />
Standorten untergebracht sind, durchaus als „eingegrenzt und ausgegrenzt“ bezeichnet 117 , die<br />
abgesonderten Standorte als Exempel für Aus- und die herausgehobenen für Eingrenzung an-<br />
geführt werden. Auch im letztgenannten Fall geht es um Exklusion: Die Heraushebung mitten<br />
im Zentrum stellt eine Exklusion durch Inklusion dar – eine Praxis, die in funktional differen-<br />
zierten Gesellschaften in Form des „Einsperrens“ die Vertreibung und Verbannung ersetzt<br />
hat. 118 Hier zeigt sich jene von Simmel grundlegend dargestellte Qualität des Raumes, die<br />
eingangs skizziert wurde: Raum kann als kulturelle Konfiguration sozialer Beziehungen, dar-<br />
über hinausgehend jedoch auch als integraler Bestandteil der Herstellung sozialer Verhält-<br />
nisse gelesen werden. 119 Durch die räumliche Organisation erfolgt eine symbolische (und<br />
zugleich durchaus reale) Grenzziehung zwischen dem „Wir“ und dem „Sie“, das „Abstands-<br />
gebot brandmarkt die »Unwürdigen« und versichert die »Würdigen«.“ 120 Mit der Verortung<br />
der Unterkünfte wird ein reales Machtgefälle kommuniziert, das von den Ein- und Ausge-<br />
grenzten wie auch den Ein- und Ausgrenzenden mehr und mehr internalisiert wird. Das<br />
„Copyright“ für diese sich selbst verwirklichende Botschaft liegt auf der Ebene konkreter<br />
politischer EntscheidungsträgerInnen: Sie formulieren die Botschaft – im Fall Tirols, so<br />
scheint es, ohne klare Intention, doch mit den festgestellten Konsequenzen.<br />
Angesichts der eindeutigen politischen Verantwortung scheint es durchaus angemessen, den<br />
spezifischen Standort einer Unterkunft auch als politisches Symbol zu werten, mit dem – ent-<br />
sprechend der Funktion politischer Symbolik für die nonverbale Vermittlung von Politik – die<br />
Komplexität des Themas der Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden soweit<br />
reduziert wird, dass es in Form einer bestimmten (politisch-ideologischen) Sichtweise, die<br />
ebensolche Handlungsweisen nahe legt, für die breite Öffentlichkeit nachvollzieh- und hand-<br />
115<br />
Vgl. etwa Hennig et al. 1982; Wipfler 1986; Carstens 1992; Lueger-Schuster 1996b; Merkord 1996; Rosenegger<br />
1996; Schaupp 2004.<br />
116<br />
Wipfler (1986, 121-134) schildert ausführlich ein ähnliches Beispiel – der betreffende Asylsuchende hatte<br />
zunächst in Deutschland einen Arbeitsplatz gefunden und einige Zeit gearbeitet, dann jedoch im Zuge einer<br />
Gesetzesänderung sein Arbeitserlaubnis verloren. In der Folge wurde er für längere Zeit in einem herausgehoben<br />
positionierten Lager untergebracht; nach seiner Entlassung war er ohne kontinuierliche Betreuung und Hilfestellung<br />
nicht mehr in der Lage, alltägliche Dinge wie die Planung und Durchführung des Einkaufs von Lebensmitteln<br />
zu bewältigen.<br />
117<br />
Stöger 1998.<br />
118 Kreissl 1999.<br />
119 Nierhaus 1999, 20.<br />
120 Schenk 2001, 91.<br />
261
habbar wird. Dem folgend, kommt man nicht umhin, das in Tirol bei der Unterbringung von<br />
Asylsuchenden praktizierte Muster als zumindest billigend in Kauf genommenes politisches<br />
Symbol zu begreifen, mit dem den „Untergebrachten“ ebenso wie der Mehrheitsbevölkerung<br />
in signalisiert wird, welche Position Asylsuchenden in Tirol zukommen soll(te).<br />
»... dort, wo sie herkommen«: Die Perspektive des Unterkunftsgebers<br />
Wie erklärt der Unterkunftsgeber selbst das konstatierte Strukturmuster? Jenseits der oben<br />
bereits diskutierten Argumentation mit dem eingeschränkten Angebot an geeigneten Gebäu-<br />
den und der daraus resultierenden fehlenden Wahlmöglichkeiten führt die zuständige Landes-<br />
rätin Gangl für die Dominanz peripher gelegener Unterkunftsstandorte vor allem ins Treffen,<br />
man sei „halt grundsätzlich in Tirol einfach auch ländlich strukturiert“, selbst Bezirkshaupt-<br />
städte hätten „wirklich also einen total ländlichen Charakter“. 121 Für die Landesrätin ent-<br />
spricht das Muster letztlich den regionalen Gegebenheiten, denn „bei uns leben die Leut’ auch<br />
irgendwo am Berg und so, also – wenn man will und wenn man’s zulässt, dann denk ich, ist<br />
es kein großes, kein allzu großes Problem.“ 122 Ohnehin seien die Entfernungen in Tirol „auch<br />
alle nicht dann so wahnsinnig“. 123 Freilich: Die angeblich so „ländliche“ Struktur Tirols er-<br />
klärt in keiner Weise das langjährige Fehlen von Unterkünften in regionalen Zentren und die<br />
Realisierung von mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt nicht oder nur während der<br />
Winter- und der Sommersaison erreichbaren Standorten wie jenen in der 199-EinwohnerIn-<br />
nen-Gemeinde St. Sigmund im Sellrain oder am „Bürgl“ bei Fieberbrunn.<br />
Die abgesonderte Lage vieler Unterkünfte rechtfertigt die Landesrätin daher auch mit dem<br />
Argument, sie entspräche ohnedies den Gewohnheiten vieler Asylsuchender:<br />
„... und es ist halt auch, das darf man nicht vergessen: viele Menschen, die da bei uns halt auch sind – dort wo sie<br />
herkommen, es eigentlich auch so strukturiert ist. Die auch fernab von einer Hauptstadt irgendwie auch gelebt<br />
haben, und es nicht so empfinden, wie’s von uns eigentlich eher vielleicht im ersten Moment als schlimm empfunden<br />
werden könnte.“ 124<br />
Der auf Verwaltungsebene zuständige Flüchtlingskoordinator sieht dies ebenso. Wir müssten<br />
halt aufpassen, so Logar: „Viele Leut’ wohnen ja – Afghanen oder was –, die wohnen ja nicht<br />
irgendwo in einem Zentrum. Und für die ist das ... der ist ... Es kommt darauf an, dass du den<br />
menschlich gut behandelst, dass das Umfeld passt, aber wir dürfen nicht immer unsere Be-<br />
dürfnisse, die wir haben ...“ 125 Logar hält dabei noch einen weiteren Aspekt für wesentlich:<br />
„Und auch, wir haben ja Geld. Wenn wir durch die Stadt gehen und wir sehen was, können<br />
wir uns das kaufen. Und der Asylwerber sieht so viele Dinge, es bringt ihm aber nichts.“ 126<br />
Das Argument, Asylsuchende seien ein Leben in peripher oder extrem peripher gelegenen<br />
121<br />
Interview Gangl 09.02.2004, 65ff.<br />
122<br />
Ebd., Z 88f.<br />
123<br />
Ebd., Z 67.<br />
124<br />
Ebd., Z 72-76.<br />
125<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 754ff.<br />
126<br />
Ebd., Z 757ff.<br />
262
Gebieten ohnehin von „zuhause“ gewohnt, kann indessen kaum ernst genommen werden,<br />
hieße dies doch, die Lebensbedingungen im Verfolger- oder Herkunftsland zum Maßstab für<br />
die hiesige Flüchtlings- und Asylpolitik zu erklären – ein Unterfangen, das dem Unterkunfts-<br />
geber zweifellos nicht unterstellt werden kann. Die Rechtfertigung des festgestellten Struk-<br />
turmusters mit dem Argument, eine zentralräumliche Unterbringung bringe Asylsuchenden<br />
„nichts“, weil sie sich ja mangels Geld nichts kaufen könnten, lässt wiederum zwei Schlüsse<br />
zu: Entweder fürchtet der Unterkunftsgeber, Asylsuchende würden mangels der erforder-<br />
lichen Geldmittel im urbanen Bereich straffällig, oder er sieht sich selbst gewissermaßen als<br />
„pater familias“, der sich um seine asylsuchenden „Kinder“ zu kümmern habe, die in der<br />
„fremden Kultur“ unter seiner Anleitung erst erwachsen werden müssten – eine Perspektive,<br />
die nicht nur auf Seiten der öffentlichen Verwaltung, sondern auch bei zivilgesellschaftlichen<br />
Organisationen und Social-Profit-Betrieben durchaus verbreitet ist. 127<br />
Der Flüchtlingskoordinator führt jedoch einen weiteren Grund für die praktizierte Art der<br />
Unterbringung an: „Wir sagen: Für Asylwerber gibt’s einmal keinen Integrationsauftrag. Der<br />
ist einmal angekommen, und sagt ... gibt seine Gründe an und das wird geprüft, ob seine<br />
Fluchtgründe stimmen.“ 128 Asyl und Integration seien nicht nur ganz unterschiedliche Beg-<br />
riffe, sondern zwei Bereiche, die getrennt gesehen werden müssten – der „Integrationsauftrag“<br />
beginne erst, wenn der Asylantrag positiv beschieden worden sei. 129 Die abgesonderte oder<br />
herausgehobene Lage von Unterkunftsstandorten, so wäre aus dieser Argumentation zu<br />
schließen, beruht auf der bewussten Entscheidung, während des Asylverfahrens „Integration“<br />
möglichst zu verhindern. Tatsächlich entspricht dies jedoch keineswegs den Intentionen des<br />
Unterkunftsgebers, wie der Koordinator selbst einräumt 130 : Die auch an einigen abgesonder-<br />
ten Standorten durchgeführten und auf eine Integration in den hiesigen Arbeitsmarkt abzie-<br />
lenden Qualifizierungsmaßnahmen zumindest für ausgewählte Asylsuchende sind ein deutli-<br />
ches Zeichen dafür, dass „Desintegration“ nicht als bewusst verfolgtes Ziel der Standortpolitik<br />
gewertet werden kann. Dass der Koordinator sich trotzdem auf den fehlenden „Integrations-<br />
auftrag“ beruft, legt freilich den Schluss nahe, dass Desintegration billigend in Kauf genom-<br />
men wird, wenn sie „passiert“.<br />
Keine Absonderung, keine Heraushebung: Die Perspektive der Gemeinden<br />
Wie bewerten die Bürgermeister jener Kommunen, in denen sich Unterkünfte befinden, die<br />
Absonderung oder Heraushebung von Standorten? „Also meine Erfahrung ist“, so das Ober-<br />
haupt einer kleineren Gemeinde, „also ein Standort wär’ aufgrund meiner Erfahrung besser,<br />
dass man sie in so einem Bezirksballungszentrum ... weil da fallen sie nicht so auf.“ 131 Im Fall<br />
seiner Gemeinde befänden sich die Asylsuchenden in einem Ortsteil „mit circa 300 Einwoh-<br />
127<br />
Vgl. Çakır 2002.<br />
128<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 681ff.<br />
129<br />
Logar, zit. nach Schroffenegger 2003.<br />
130<br />
Vgl. ebd.<br />
131<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 132ff.<br />
263
nern, davon schon jetzt circa fünfzig ausländische Bürger, plus jetzt noch fünfzig Asylanten“<br />
– da komme es zu einer gewissen „Konzentration von ausländischen Bürgern und führt da-<br />
durch in der einheimischen Bevölkerung aus verständlichen Gründen – also das ist keine [...]<br />
Fremdenfeindlichkeit, sondern Verunsicherung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensquali-<br />
tät.“ 132 Die Unterbringung in zentraleren Räumen sei jedoch auch für die Asylsuchenden<br />
selbst eindeutig „günstiger“:<br />
„... der kriegt ja einen Abgelegenheitskoller oder wie man da auch immer sagt [...]. Ich mein’, der will ja nicht<br />
Urlaub machen, Ruhe als Manager, dass er abschalten kann, der will ja doch irgendwie noch ... Also ich find das<br />
auch für die Asylanten, für die Flüchtlinge nicht gut, wenn man sie irgendwo so ganz ...“ 133<br />
Der Bürgermeister erkennt hier Parallelen zur Planung von Einrichtungen für alte Menschen:<br />
„Genauso, wenn ich heut’ ein Altersheim – wir haben ja da oben ein Altersheim [...]. Ich bin froh, weil da hab<br />
ich mich zu meiner Zeit als Bürgermeister eingesetzt, dass ich gesagt hab: Die alten Leut’ müssen irgendwo im<br />
Ortszentrum sein, und wenn sie grad zuschauen, wie ein Begräbnis ist oder eine Prozession, oder sie gehen auf<br />
den Friedhof ... Die darf man nie, wie wir’s früher gemacht haben, in einem wunderschönen, grünen, abgelegenen<br />
... zu Tode beruhigen. Weil sie haben’s dann alle einmal lang genug ruhig. Gell. [...] Gott sei Dank, also da<br />
haben wir schon rechtzeitig geschalten, weil wir das auch ausgebaut haben, dieses Heim, [...] und ich bin eigentlich<br />
schon ein bisschen stolz, weil ... und inzwischen sind anderen auch – Gemeinden – draufgekommen, weil<br />
die alten Leut’ darf man ja nicht irgendwo abseits, wo sie’s ruhig und ... und wo’s ungestört und ohne Lärm ... ja,<br />
weil die ... die möchten ein Leben haben. [...] Und wenn die am Balkon sitzen und es ist ein Fest, da kann’s gar<br />
nicht laut genug sein, da kann ruhig ein Krawall sein, dann sind sei halt einfach mit dabei. Und da ... da bin ich<br />
auch bei den Asylanten auch überzeugt: Man tut denen nichts Gutes, wenn man sie irgendwo so abschiebt da.<br />
Also ich würd’ nach wie vor plädieren, der bessere Standort wär’ eben ... also in Bezirkshauptstädten oder sowas.“<br />
134<br />
Für den Bürgermeister spielt dabei offenkundig auch die in zentraleren Räumen eher mög-<br />
liche Anbindung an migrantische Communities oder Exilgemeinschaften eine wichtige Rolle:<br />
„Weil da treffen sie vielleicht schon welche, die schon da sind, und die schon ... die schon<br />
irgendwie ... eine, ja: Arbeit, oder einigermaßen integriert sind ...“ 135<br />
Die Heraushebung mitten im Ortszentrum sieht ein Bürgermeister kritisch: „Fürs Ortsbild und<br />
so wär’s vielleicht besser, wenn’s ... ja ... nicht grad direkt im Zentrum wär’.“ 136 Während des<br />
Tages würden Asylsuchende sonst unmittelbar im Ortskern herumsitzen – „man kriegt einen<br />
Beigeschmack, wenn sie da herumhocken.“ 137 Es müsse ja nicht gleich „weit draußen, neben<br />
draußen sein. Es soll im Dorf sein. Aber grad jetzt im Zentrum ... die ganzen ... Wir sind alles<br />
Katholiken da, wenn da ein Begräbnis oder ein Umgang ist oder irgendetwas, da sind wir<br />
dann ... sind wir unter sich, ja.“ 138 Ein Amtskollege pflichtet ihm hier bei:<br />
„Grad meistens bei einer Beerdigung geht man bei uns immer noch ... da gibt’s also den sogenannten Begräbnisweg,<br />
der von der Kirche hinaufführt und da am ...-platz vorbei und über eine schmale Straße zurück dann wieder<br />
zum Friedhof führt, und es macht natürlich schon ein schlechtes Bild, wenn zum Beispiel bei so einem Begräb-<br />
132 Ebd., Z 164-168.<br />
133 Ebd., Z 202-206.<br />
134 Ebd., Z 206-224.<br />
135 Ebd., Z 461f.<br />
136 Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 169f.<br />
137 Ebd., Z 174f.<br />
138 Ebd., Z 177ff.<br />
264
niszug also dann sämtliche Flüchtlinge am Balkon oben stehen und da zuschauen. Ich mein’, okay: Ich mein’, sie<br />
schreien ja nicht und applaudieren ja nicht, Gott sei Dank, wär’ ja schlimm, aber ich mein’, es macht einfach<br />
kein gutes Bild, wenn die da oben stehen. Im Sommer, muss man sagen, ja – man kann nicht sagen: lungern,<br />
aber da bewegen sie sich halt da zwischen Flüchtlingsheim und im Zentrumsbereich, blockieren halt da die<br />
Bänke, wo halt dann manche ältere Leute Angst haben, dass sie in irgendeiner Form belästigt werden – was aber<br />
Gott sei Dank wenig passiert. Also sie tun grundsätzlich niemandem was.“ 139<br />
„Es hat alles zwei Seiten“, stellt der Bürgermeister einer Gemeinde, in der die Unterkunft ab-<br />
seits des Siedlungsgebiets liegt, dazu fest: „Ist jemand im Ortsteil drinnen, dann haben die<br />
Leut’ einen Horror, wenn sie alle in der Nachbarschaft sind – und für die Leut’ [die Flücht-<br />
linge; Anm. RP] ist das eher besser, weil sie sich dort besser integrieren.“ 140 Im Grunde, so<br />
das Resümee mehrerer Bürgermeister, bestünden eigentlich wenig Unterschiede zwischen der<br />
herausgehobenen und der abgesonderten Lage einer Unterkunft – problematisch sei einerseits<br />
„die ganz zentrale Lage“, andererseits: „Es ist auch eine totale dezentrale Lage [...] auch nicht<br />
sinnvoll. Weil dann ist’s erst wieder das Gleiche. [...] Dann ist’s erst auch wieder ein<br />
Ghetto.“ 141<br />
Lediglich der Bürgermeister einer kleinen Tourismusgemeinde beurteilt die Situation lieber<br />
vor dem Hintergrund möglicher Beschwerden der ZimmervermieterInnen: Liege die Unter-<br />
kunft wie in seiner Gemeinde außerhalb des eigentlichen Siedlungsgebiets, sei wohl alles ein-<br />
facher, „da stört’s, glaub ich, am allerwenigsten. Also dieses spezielle ... Natürlich – wenn das<br />
jetzt in einem Ortskern [...] drin wäre, dann würde niemand da ganz glücklich sein drüber,<br />
nicht? Weil da wär’ das Geschrei von den ganzen Vermietern wieder – das wär’ da, nicht?<br />
Das ist ja ganz klar. [...] Die natürlich sagen: Sie kriegen keine Gäste mehr und dieses und<br />
jenes und ...“ 142<br />
9.8 Die Verortung im Raum (II): Provisorien als Dauereinrichtungen<br />
Die Einzelfallanalysen der im zweiten Halbjahr 2003 bestehenden Unterkünfte in Tirol, aber<br />
auch die Überblicksdarstellung der im Gesamtjahr 2004 neu realisierten Standorte zeigen<br />
deutlich: Aufgrund ihrer baulichen Ausführung und Gestaltung sowie der ursprünglichen<br />
Funktion der Gebäude vermitteln die zur Unterbringung Asylsuchender genutzten Standorte<br />
den Charakter von Provisorien. Praktisch alle Unterkunftsstandorte sind zumindest einer von<br />
vier Kategorien zuordenbar:<br />
• Beherbergungsbetriebe wie Gasthöfe, Pensionen, Hotels oder Ferienhäuser;<br />
• Sonderbauten wie Gewerbe- und Verwaltungsbauten, Kasernen, Klöster oder Anstalten<br />
bzw. Heime;<br />
• Gebäudeprovisorien wie Baracken und Fertigteilhäuser oder Container;<br />
• Abrisshäuser.<br />
139 Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 128-137. Der Name eines Platzes wurde anonymisiert.<br />
140 Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 269ff.<br />
141 Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 198-202.<br />
142 Interview Bürgermeister 01/1, 2003, Z 98-103.<br />
265
Den genannten Kategorien ist gemeinsam, dass es sich um nicht zu Wohnzwecken errichtete<br />
oder, wie im Fall von Abrisshäusern, für Wohnzwecke nicht mehr geeignete Gebäude handelt.<br />
Zwei weitere Aspekte betonen den provisorischen Charakter der Unterkünfte:<br />
• Sammelunterkünfte: Der Unterkunftsgeber nutzt vorrangig Sammelunterkünfte mit einer<br />
möglichen Belegungszahl von zumindest fünfzig, in einzelnen Fällen über hundert Perso-<br />
nen. In mehreren Fällen ist eine Ausweitung der Unterbringungskapazität durch einen<br />
Gebäudeausbau oder die Errichtung weiterer Provisorien auf dem Unterkunftsareal prob-<br />
lemlos möglich.<br />
• Zwischennutzung: Der Unterkunftsgeber setzt zunehmend auf die Zwischennutzung von<br />
Gebäuden, die für einen Verkauf oder den Abriss vorgesehen sind.<br />
Da Asylsuchende mehrheitlich längere Zeit in organisierten Unterkünften untergebracht sind<br />
(eine Unterbringungsdauer von mehreren Jahren ist keine Seltenheit), kann daher resümiert<br />
werden: Der Unterkunftsgeber nutzt zur Unterbringung von Asylsuchenden Provisorien als<br />
Dauereinrichtungen.<br />
Das Lager als »Schutzraum«?<br />
Die Unterbringung Asylsuchender in Gebäudeprovisorien und Sammelunterkünften weist<br />
mehrere positive Aspekte auf. Zunächst sind Provisorien schlicht rascher verfügbar als Ein-<br />
richtungen aus dem Normal(wohnungs)bau, wenngleich die Konstruktionszeit von klassi-<br />
schen Gebäudeprovisorien wie Containern, Baracken und Fertigteilhäusern häufig unter-<br />
schätzt wird und sich durchaus der Bauzeit (und den Kosten) dauerhafter Einrichtungen annä-<br />
hern kann. 143 Bei der Nutzung an sich provisorischer Unterkünfte aus Gastronomie und<br />
Tourismus wiederum kann auf eine grundlegende Gebäudeinfrastruktur zurückgegriffen wer-<br />
den, auch wenn diese in der Regel deutlich veraltet, oft massiv sanierungsbedürftig und häufig<br />
in Form gemeinschaftlicher „Etagenlösungen“ organisiert ist.<br />
Der kollektive Rahmen, den Sammelunterkünfte schaffen, kann auf dort untergebrachte Asyl-<br />
suchende auch durchaus stabilisierend wirken: Die relative Anonymität, welche das „Lager-<br />
kollektiv“ bietet, wird vor allem in der ersten Phase nach der Flucht häufig als Möglichkeit<br />
gesehen, sich in einer Art „Schutzraum“ aufhalten zu können. 144 Der mit einer solchen Unter-<br />
bringung verbundene verzögerte Eingliederungsprozess in das Aufnahmeland ist zudem ge-<br />
eignet, eine schockartige „Umstellung“ zu vermeiden, die Sammelunterkunft kann hier gewis-<br />
sermaßen als „Zwischenwelt“ dienen. In größeren organisierten Quartieren ist schließlich –<br />
zumindest theoretisch – auch eine kontinuierliche Betreuung der dort Untergebrachten mög-<br />
lich, zugleich können Eltern leichter zeitweise von der Betreuung ihrer Kinder entlastet wer-<br />
den, um Zeit für sich selbst bzw. die Orientierung im neuen Land zu gewinnen. All diese<br />
143 Vgl. Thimmel 1994.<br />
144 Karlegger 1996, 79f.<br />
266
Vorteile sind freilich nur gegeben, wenn die Nutzung dem provisorischen Charakter der Un-<br />
terkünfte entsprechend nicht dauerhaft erfolgt. Asylsuchende selbst sehen die Sammelunter-<br />
bringung daher als Zwischenlösung an, eine Unterbringung in Privatwohnungen stellt für sie<br />
das vorrangige Ziel dar. 145<br />
Am »Pranger«: Stigmatisierung<br />
Die auffälligste negative Folge dieser Unterbringungsform gleicht einer Konsequenz<br />
herausgehobener Unterbringung: Das Leben „abseits der Norm“ in nicht für Wohnzwecke<br />
vorgesehenen oder ungewöhnlich großen bzw. dicht belegten Gebäuden führt zu einer Stig-<br />
matisierung der Betroffenen, die kurzfristig soziale Kontakte nach „draußen“, längerfristig<br />
eine Integration in die Mehrheitsgesellschaft deutlich erschwert. 146 Anderson beschreibt erste-<br />
res am Beispiel der Kinder:<br />
„Eins der grundsätzlichen Probleme für die Kinder [...] ist die soziale Stigmatisierung, welche sie als Bewohner<br />
solcher Unterkünfte erleben. Die Kinder haben kaum Spielkameraden aus der näheren Umgebung, sondern sie<br />
bleiben unter sich. Auch wenn Feste stattfinden und Aktivitäten verschiedener Art von der Einrichtung angeboten<br />
werden, bleiben die Kinder aus der Umgebung fern. Es ist schwer, den »Nicht-Kontakt« zu überwinden.<br />
Bestenfalls bleiben »die Kinder in der Unterkunft« exotisch, oft erleben sie eine aktive Ausgrenzung aus der sie<br />
umgebenden Gesellschaft.“ 147<br />
Durch die Unterbringung in einer Sammelunterkunft sehen sich die Kinder – in den Worten<br />
Thimmels – „an einen »Pranger« gestellt“ 148 : Sie sind „die vom Heim“ oder „Lager“, denen<br />
ihre „Herkunft“ überall anhaftet.<br />
Provisorien und Sammelunterkünfte als desintegrierender Faktor<br />
Je stärker der provisorische Charakter und je größer die Sammelunterkünfte, desto häufiger<br />
zeigen sich Auswirkungen, die jenen bei abgesonderter oder herausgehobener Unterbringung<br />
gleichen – von der zunehmenden sozialen Isolation über die Entwicklung eines internen<br />
„Eigenlebens“ bis zur Tendenz zur totalen Institution auf Seiten der dort untergebrachten<br />
Asylsuchenden 149 , von der dauerhaften Irritation über die konsequente Ablehnung bis hin zu<br />
konkreten Widerstandshandlungen auf Seiten der in der Umgebung lebenden Bevölkerung. 150<br />
Die desintegrierende Wirkung von Sammelunterkünften auf die „drinnen“ Lebenden und de-<br />
ren daraus resultierende Schwierigkeiten, sich „draußen“ später wieder zurechtzufinden,<br />
konnte bereits an den Flüchtlingen und Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs studiert werden,<br />
wie die akribische Untersuchung Carstens’ zeigt: Die Unterbringungsform verzögerte, nicht<br />
zuletzt aufgrund des Stigmas, aus dem „Lager“ zu kommen, die Integration der „InsassInnen“<br />
145<br />
Für Österreich vgl. hierzu insbesondere Tedeschi 1996; Engelke/Kerschbaumer 1999.<br />
146<br />
Vgl. etwa Carstens 1992; Brunner et al. 1994 und 2003; Thimmel 1994; Anderson 2000.<br />
147<br />
Anderson 2000, 31; vgl. hierzu Berg 2000, 89f.<br />
148<br />
Thimmel 1994, 146.<br />
149<br />
Vgl. hierzu insbesondere die Arbeiten von Hennig et al. 1982; Wipfler 1986; Carstens 1992; Thimmel 1994;<br />
Lueger-Schuster 1996a; Anderson 2000.<br />
150<br />
Vgl. hierzu insbesondere die Arbeiten von Brunner et al. 1994; FOKUS 1994.<br />
267
in die Aufnahmeorte oder verunmöglichte sie ganz – der Schritt nach „draußen“ wollte den<br />
Betroffenen nicht mehr gelingen:<br />
„Bedingt durch einen langen Lageraufenthalt – häufig in mehreren Lagern – war ihr Eingliederungswille untergraben.<br />
Sie brachten nicht mehr die Kraft auf, das für sie einigermaßen erträgliche Lagerleben mit der Umquartierung<br />
in eine private Wohnung zu tauschen. Durch die jahrelange Behördengängelung war ihnen das Selbstvertrauen<br />
und auch das Gefühl für Selbstverantwortung abhanden gekommen [...]. Es ist sicher kein Zufall, daß sich<br />
viele dieser »sozialen Nachhut« in den Obdachlosenlagern wiederfanden.“ 151<br />
Eine gezielte Nutzung dieser Wirkung von Gebäudeprovisorien und Sammelunterkünften zur<br />
„Abschreckung“ Asylsuchender, wie sie für Deutschland häufig und nicht zu Unrecht konsta-<br />
tiert wurde und wird 152 , ist in Tirol indessen nicht feststellbar. Die vom Unterkunftsgeber im<br />
Jahr 2004 erkennbar intensivierten Bemühungen um eine Verbesserung der unterkunftsinter-<br />
nen Standards (die nicht Gegenstand dieser Untersuchung waren), etwa durch Einstellung von<br />
Betreuungspersonen auch für zur Unterbringung genutzte Gasthöfe oder durch Umbau- und<br />
Adaptierungsarbeiten, können diesbezüglich als deutlicher Hinweis gewertet werden.<br />
Provisorien und Sammelunterkünfte als Symbol sozialer Beziehungen<br />
Wenn wir – den eingangs angestellten Überlegungen folgend, wonach Raum und Architektur<br />
als Mittel zur Kommunikation und Etablierung von Macht und Differenz nutzbar sind und<br />
tatsächlich genutzt werden – den provisorischen Charakter der Unterkünfte Asylsuchender als<br />
der Sprache vergleichbares Medium begreifen und lesen, so muss die bereits in der Analyse<br />
der Einzelfalldarstellungen formulierte These als dieser Unterbringungsform tatsächlich ein-<br />
geschriebene Botschaft bestätigt werden: Flüchtlinge wohnen nicht. Sie halten sich lediglich<br />
für kurze Zeit auf – wie Touristen, die ja auch in Beherbergungsbetrieben vorübergehend ihr<br />
Quartier nehmen. Bildlich gesprochen trägt die Art der Unterbringung aufgrund ihres be-<br />
helfsmäßigen Charakters zur Aufrechterhaltung der Migration bei: Die dort Untergebrachten<br />
sitzen gewissermaßen dauerhaft auf dem gepackten Koffer – aus eigener Sicht wie auch aus<br />
jener der in der Umgebung lebenden Bevölkerung. Ein „Ankommen“ ist so nicht möglich.<br />
151 Carstens 1992, 473. Diese Auswirkungen scheinen zumindest einzelnen Verantwortlichen auf politischer<br />
Ebene in Österreich durchaus bewusst (gewesen) zu sein, wie das Beispiel des früheren Innenministers Löschnak<br />
zeigt: Die Unterbringung in „Großquartieren“, so der Minister gut drei Jahre nach seinem gescheiterten Versuch,<br />
in einer Kaserne in der burgenländischen 260-EinwohnerInnen-Gemeinde Kaisersteinbruch 800 rumänische<br />
Asylsuchende einzuquartieren, bringe „zunehmende Hospitalisierungserscheinungen, interne Konflikte und Konflikte<br />
mit der ortsansässigen Bevölkerung“ mit sich. Die Erfahrungen zeigten zudem, dass zwischen Wohnversorgung<br />
und Arbeitsintegration ein „enger Zusammenhang“ bestehe: „Menschen, die nicht in Großquartieren<br />
wohnen, finden leichter Arbeit und wer Arbeit hat, findet leichter eine Wohnung. Die Auflösung der Großquartiere<br />
ist daher – bis auf eine begrenzte Zahl von Großquartieren als Erstaufnahmestellen – notwendig.“ (Löschnak<br />
1994, 635f)<br />
152 Vgl. etwa Zepf 1986; Omairi 1991; für die jüngere Vergangenheit vgl. u.a. die Ausführungen von Dietmar<br />
Martini-Emden (2000), Leiter des Trierer Amtes für Ausländerangelegenheiten und der Clearingstelle Rheinland-Pfalz<br />
für Flugabschiebung und Passbeschaffung, zu ersten Erfahrungen mit der als Sammelunterkunft konzipierten<br />
„Landesunterkunft für Ausreisepflichtige“ in Ingelheim: „Bei den aufgenommenen Personen zeigt sich,<br />
dass die deutlichen Leistungseinschränkungen, der Ausschluss einer Arbeitsaufnahme sowie das sich in einem<br />
allmählichen Prozess entwickelnde Bewusstsein über die Ausweglosigkeit ihrer Lebensperspektive in Deutschland<br />
die Menschen in eine gewisse Stimmung der Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit versetzt.“ Die in einer<br />
Sammelunterkunft gegebene Möglichkeit einer „intensiven Kontaktaufnahme und Betreuung“ stelle „eine echte<br />
Alternative zur Abschiebungshaft“ dar (ebd.).<br />
268
Da ein „Kurzaufenthalt“ Asylsuchender aufgrund der bekannten Länge der Asylverfahren in<br />
der Praxis jedoch eher eine Fiktion darstellt, hat die mit der Unterbringungsform verbundene<br />
Botschaft faktisch distanzierende und ausschließende Intention: Gebäudeprovisorien, Sam-<br />
melunterkünfte und Lager signalisieren als „Bruchstelle gesellschaftlicher Norm“ 153 , dass die<br />
darin Untergebrachten „anders“ leben, daher wohl auch „anders“ sind und also nicht „dazuge-<br />
hören“. Es ist im Grunde diese (erzwungene) Wohn- und Lebensform, welche den Eindruck<br />
der „Fremdheit“ Asylsuchender vermittelt: Die Andersartigkeit der Unterbringung macht<br />
Flüchtlinge als solche für die Bevölkerung erst wahrnehmbar. Die überaus heterogene Gruppe<br />
der Asylsuchenden wird letztlich durch die Konzentration auf einige wenige Standorte erst als<br />
Gruppe konstruiert – „wirklich gibt es die Minderheiten erst von dem Moment an, wo sie kodifiziert<br />
und kontrolliert werden.“ 154<br />
Die Eignung von Sammelunterkünften zur Kontrolle dieser Minderheit ist offensichtlich: Die<br />
Konzentration ermöglicht zumindest theoretisch die ständige Erreich- und Verfügbarkeit der<br />
untergebrachten Personen. Unterkunftsinterne Regelwerke etwa in Form expliziter „Hausord-<br />
nungen“, aber auch „ungeschriebener Gesetze“ der Unterkunftsleitungen sichern diese Ver-<br />
fügbarkeit ab, zugleich dienen sie der effektiven Durchsetzung allgemeingesetzlicher Be-<br />
stimmungen und gesellschaftlicher (oder politischer) Erwartungen an die Asylsuchenden. Vor<br />
allem im Verein mit der Unterbringung in abgesonderten Gebieten, welche die in ländlichen<br />
Gegenden mit deutlich geringerem Aufwand zu bewältigende polizeiliche Kontrolle erleich-<br />
tert 155 , oder jener an herausgehobenen Standorten – eine Unterbringungsform, bei der die so-<br />
ziale Kontrolle durch PassantInnen und Angestellte der umliegenden Betriebe in den Vorder-<br />
grund tritt – kann so ein effizientes und umfassendes „System administrativer Routine und<br />
Kontrolle“ etabliert werden. 156 Paradoxerweise ist es gerade die Konzentration, die zugleich<br />
das Bild einer bedrohlichen „Masse“ schafft, die aufgrund des provisorischen Charakters der<br />
Unterbringung zudem als „beweglich“ und damit unkontrollierbar erscheint – das massen-<br />
medial eifrig reproduzierte Zerrbild der „Flüchtlingswellen“ und „Asylantenströme“, welche<br />
die Gesellschaft zu „überfluten“ drohen, erhält so einen konkreten Bezugspunkt.<br />
Kosten sparen, Kontrolle erleichtern. Die Perspektive des Unterkunftsgebers<br />
Der Unterkunftsgeber selbst begründet die Unterbringung in Gebäudeprovisorien und<br />
Sammelunterkünften auf mehreren Ebenen. Wie für das konstatierte Muster der Absonderung<br />
oder Heraushebung wird zunächst das beschränkte „Angebot“ an Unterkünften angeführt,<br />
aber auch ein fehlender „Integrationsauftrag“ – Flüchtlingskoordinator Logar erläutert dies<br />
153 Wischenbart 1995, 195.<br />
154 Balibar 1993, 151; Hervorhebungen im Original.<br />
155 Von einigen deutschen Bundesländern wurde dies bereits in den 1970er und 1980er Jahren als Argument für<br />
die Unterbringung im ländlichen Raum angeführt (vgl. etwa Omairi 1991, 27).<br />
156 Vgl. Wischenbart 1995, 195. Die in Tirol bislang meist übliche Praxis, Asylsuchende in ihren Unterkünften<br />
nur werktags zu den üblichen Arbeitszeiten zu betreuen, durchbricht die Kontrolle zumindest zeitweise, an den<br />
abgesonderten Standorten allerdings auch dann nur scheinbar.<br />
269
anhand des „Gegenbeispiels“ der Unterbringung bosnischer Flüchtlinge, für die aus seiner<br />
Sicht ein solcher bestand:<br />
„... es gibt im großen und ganzen ... sehe ich zwei Wohnvarianten: Das eine sind jetzt einmal die Heime, die von<br />
einem Gastwirt wie ein Gewerbebetrieb betrieben werden, nicht? ... dem du einfach das zahlst, nicht? [...] Die<br />
Heime von uns zähl ich jetzt einmal so grob auch unter die Gewerbebetriebe. Und dann ... zu Bosnierzeiten,<br />
wenn du einen Integrationsauftrag hast, haben wir Privathäuser angemietet, in jedem Bezirk etwa eines, und haben<br />
dort die Leut’, zwanzig bis 25 Leut’ untergebracht und dort betreut. Die haben sich selbst versorgt, und ähnliches.“<br />
157<br />
Für den Koordinator – bezeichnenderweise zählt er die landeseigenen Sammelunterkünfte<br />
(„Heime“) zu den „Gewerbebetrieben“ – stellt die gegenwärtig praktizierte Unterbringungs-<br />
form also grundsätzlich keineswegs die einzige Option dar. Neben dem fehlenden „Integra-<br />
tionsauftrag“ wird jedoch auch ins Treffen geführt, für Asylsuchende „in der ersten Phase“ sei<br />
eine Sammelunterbringung „das bessere, weil du die Leut’ auf einem Platz hast, es geht um<br />
Information und ähnliches“. 158 Diese Sichtweise ist offenkundig wohlüberlegt und den Erfor-<br />
dernissen angepasst: Tatsächlich sind viele Asylsuchende in der „ersten Phase“ nach ihrer<br />
Ankunft in vielen Bereichen gerade auch des täglichen Lebens auf Unterstützung angewiesen,<br />
der Informationsbedarf ist am Beginn des Asylverfahrens ebenso enorm wie die persönliche<br />
Verunsicherung. Die gemeinsame Unterbringung mit „SchicksalsgenossInnen“ in Sammel-<br />
quartieren kann hier eine Weile stützend und absichernd wirken und die Orientierung im noch<br />
unbekannten Land wesentlich erleichtern – bis die oben skizzierten Belastungen zu groß wer-<br />
den. Nun nutzt der Unterkunftsgeber jedoch die Sammelunterbringung nicht nur in der ersten<br />
Phase, sondern generell. Für diese Praxis bleiben so letztlich zwei Begründungen übrig:<br />
• Kosten: Kleinere Einheiten seien, so der Koordinator, nicht rentabel – „wenn du den<br />
Rechenstift hernimmst, dann brauchst du etwa, wenn du sie selber betreibst, ich sag jetzt:<br />
fünfzig, sechzig Leut’ in einem Haus, wenn du Essen und das alle haben willst oder kon-<br />
zentrierte Betreuung, dann rechnet sich das alles einfach besser. Das ist einfach ein<br />
Kostenfaktor.“ 159 Die ressortzuständige Landesrätin beziffert diesen Kostenfaktor: „Der<br />
Personal- und Verwaltungsaufwand würde sich in etwa verfünffachen (Beratung und<br />
Betreuung, Vertragsabschlüsse, Instandhaltung der Einheiten, Abrechnung).“ 160<br />
157 Interview Logar 10.10.2003, Z 192-199. Den „Integrationsauftrag“ erläutert der Koordinator so: „[...] bei den<br />
Bosniern, wie man gesehen hat nach zwei oder drei Jahren, politisch wie’s geheißen hat: »Die bleiben da!« – und<br />
von den 95.000 Bosniern sind ja 60.000 jetzt in Österreich geblieben – sind wir eben auf die kleinen Einheiten<br />
übergegangen, um die Integrationsschiene zu fahren.“ (ebd., Z 684-687)<br />
158 Ebd., Z 201f.<br />
159 Ebd., Z 687-690. Im Frühjahr 2004 führte der Koordinator gegenüber regionalen <strong>Medien</strong> eine Mindestanzahl<br />
von dreißig bzw. von vierzig bis fünfzig untergebrachten Personen an, eine Unterkunft rechne sich „betreuungstechnisch“<br />
erst ab dieser Größe, außerdem bestehe das Problem, „dass die Leute [Flüchtlinge; Anm. RP] die<br />
Kultur nicht kennen und dementsprechend betreut werden müssen“ (Tiroler Tageszeitung 03.03.2004; ORF<br />
01.05.2004).<br />
160 Anfragebeantwortung Gangl 2004a, Punkt 2.<br />
270
• Kontrolle: Kleinere Einheiten erschweren nach Ansicht des Koordinators die Kontrolle<br />
der Untergebrachten: „Wenn zudem die Personen zu sehr verstreut sind, ist es schwer, die<br />
Übersicht zu behalten.“ 161<br />
Das finanzielle Argument für die Sammelunterbringung wird freilich durch die vom<br />
Flüchtlingskoordinator selbst angeführte „zu Bosnierzeiten“ durchaus erfolgreich praktizierte<br />
Unterbringung in kleineren Einheiten relativiert. Der damalige Innenminister Löschnak<br />
sprach sogar ausdrücklich von einer Kostenersparnis durch kleinere Einheiten: Der finan-<br />
zielle Aufwand für die Unterbringung in „voll organisierten Großquartieren“ sei „weit höher<br />
[...] als die Aufwendungen bei privater Unterbringung“. 162 Der Koordinator relativierte das<br />
Kostenargument in der jüngeren Vergangenheit zudem selbst durch einen erstaunlichen, frei-<br />
lich gescheiterten Vorstoß:<br />
„Ich hab vor zwei Jahren in der Bauernzeitung, ich hab die Idee gehabt, es haben ja zig Bauern Privatzimmer zu<br />
vermieten, nicht? Und da hab ich gemeint: Na, die sollen so Leut’ nehmen, da haben Bauern dann eigentlich ein<br />
fixes Jahreseinkommen, da sind dem seine Zimmer nicht nur zwei Monate ausgelastet, sondern das ganze Jahr,<br />
und ... und hab das in der Tiroler Bauernzeitung einmal vorgestellt, und ich hab null Rückmeldungen gehabt.“ 163<br />
Ein Bürgermeister, in dessen Gemeinde sich eine Unterkunft befindet, hält die Idee für gera-<br />
dezu „bestechend, weil das wär’ ein bisschen eine Familienanbindung, und am Bauernhof<br />
gibt’s sicher immer wieder so leichte Tätigkeiten, die was ich da einbinden kann“. 164 Der<br />
Koordinator erklärt sich das Scheitern indessen letztlich so: „Das würde sich wahrscheinlich<br />
mit der Mentalität, mit der bäuerlichen, würde das widersprechen.“ 165 Unabhängig von ihrer<br />
tatsächlichen Praktikabilität zeigt die Idee, dass das Kostenargument für die provisorische<br />
Sammelunterbringung und gegen kleinere Einheiten für den Unterkunftsgeber keineswegs<br />
jene entscheidende Rolle einnimmt, die vorgegeben wird. Der „Mindestgröße“ einer Unter-<br />
kunft steht zudem eine quantitativ nicht generell definierte „Maximalgröße“ gegenüber:<br />
„... es muss einen Zusammenhang mit der Größe der Gemeinde oder irgendwas geben, nicht? Du kannst nicht in<br />
einer Mini-Fuzzi-Gemeinde – ich glaube, in Gries am Brenner ist das passiert, in den 90er Jahren, Gries am<br />
Brenner hat 800 Einwohner oder so in der Größenordnung, da hat man 120 Flüchtlinge hineingesteckt, nicht?<br />
Und ich glaub, das erdrückt einfach, das ... [...] da wirst du einen Widerstand haben.“ 166<br />
Die Maximalgröße einer Unterkunft ergibt sich also jeweils nach dem Grad des vom Unter-<br />
kunftsgeber erwarteten Widerstands aus der Gemeinde. Das oben geschilderte Beispiel der<br />
Standortrealisierung in Scharnitz zeigt dies deutlich: Hier wurde, zumindest in den öffentli-<br />
chen Stellungnahmen, aufgrund von anhaltenden Protesten die Zahl der unterzubringenden<br />
Asylsuchenden schrittweise nach unten korrigiert – unter die „Mindestanzahl“.<br />
161 Logar, zit. nach Tiroler Tageszeitung 03.03.2004.<br />
162 Löschnak 1994, 634f.<br />
163 Interview Logar 10.10.2003, Z 692-697.<br />
164 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 543f.<br />
165 Interview Logar 10.10.2003, Z 697.<br />
166 Ebd., Z 392-397. Vgl. hierzu die Ausführungen der zuständigen Landesrätin Gangl (zit. nach SPÖ Tirol<br />
21.09.2004): „Wir haben auch Unterkunftsangebote erhalten, durch welche wir in Gemeinden mit 500 bis 1.000<br />
271
Der steirische Amtskollege des Tiroler Flüchtlingskoordinators, Günther Bauer, hält über-<br />
haupt weniger das Kostenargument für entscheidend, als die mit der jeweiligen Unter-<br />
bringungsform verbundenen Betreuungsmöglichkeiten. Seine Überlegungen zielen auf eine<br />
Kombination größerer Quartiere mit Wohngemeinschaften und Wohnungen bei bedarfsge-<br />
rechter Betreuung ab, wobei er jedoch an der Leistungsfähigkeit zu diesem Zweck einzubin-<br />
dender NGOs zweifelt:<br />
„Einerseits sind kleinere Einheiten für die Betroffenen persönlich besser, andererseits ist die Betreuungsintensität<br />
bei größeren Einheiten eine viel höhere. Mit größeren Einheiten meine ich ca. 50 bis 60 Personen. Kleinere Einheiten<br />
mit 5 bis 6 Personen wären natürlich wünschenswert. Das ist jedoch von der Betreuungsstruktur der NGOs<br />
wahrscheinlich nicht möglich. Bei Privatunterbringung wäre es gut, wenn sich die Leute selbst versorgen können<br />
und wenn begleitend die Betreuung je nach Bedarf durch NGOs erfolgt. Nicht jeder benötigt jeden Tag Betreuung,<br />
es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine tägliche Kontaktaufnahme mit den BetreuerInnen notwendig ist.“ 167<br />
»Ideal wären kleine Einheiten«: Die Perspektive der Gemeinden<br />
Die Bürgermeister jener Gemeinden, die im zweiten Halbjahr 2003 systematisch untersucht<br />
wurden, stimmen hinsichtlich der Unterkunftsgröße und des nicht zuletzt damit verbundenen<br />
provisorischen Charakters der Unterkunft in ihren Einschätzungen (mit einer einzigen Aus-<br />
nahme) überein: Kleinere, gut integrierte Unterbringungseinheiten sind der Sammelunter-<br />
bringung vorzuziehen. „Ich bin ein familiärer Typ“, stellt ein Gemeindeoberhaupt fest, „und<br />
möcht ein ... abgetrenntes Heim haben mit der Familie.“ In einer „Kommune“, wie sie Sam-<br />
melunterkünfte letztlich seien, würde er nicht leben wollen: „Also das ist ja alles ... das ist<br />
alles eine Notlösung, kommt mir vor.“ 168 Ein anderer Bürgermeister wertet große Unterkünfte<br />
als letztlich desintegrierend, eine „dezentrale“ Unterbringung würde er daher<br />
„mehr als sinnvoll finden, weil man einfach die kleinere Einheit, sag ich, eher integrieren kann. [...] Weil wenn<br />
man in ein Haus einfach so wie da zentral fünfzig hineinpfercht – Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber es ist<br />
so! – dann ... wo sollen die integriert werden? Die ... Die können nicht ... Die finden keinen Kontakt! Mit denen<br />
redet niemand! Da ... Wie soll das passieren?“ 169<br />
Sammelunterkünfte, so ein dritter Bürgermeister, würden ein negatives Bild vermitteln und<br />
das Zusammenleben in einer Gemeinde damit erschweren. Er würde daher eine „kleinräumi-<br />
gere“ Verteilung bevorzugen, „ich glaub, dass also das idealer ist, als wie ich hab eine große<br />
Ansammlung, dann hab ich eine größere Negativausstrahlung, hab intern größere Probleme<br />
und ... und schaffe damit das nicht, das so positiv zu ... in der Bevölkerung zu positionie-<br />
ren.“ 170 „Ideal wären kleine Einheiten und in jedem Ortsteil Einheiten“, konkretisiert dies ein<br />
anderes Gemeindeoberhaupt, „und die möglichst integrieren und möglichst nicht auf einen<br />
Haufen zusammentun, sondern ... sondern da eine Person und da eine Person und da. Dann<br />
integrieren sie sich im Dorf, ins Dorfleben besser. Sie werden dann irgendwann heimisch.<br />
Einwohnern rund 100 Flüchtlinge hätten unterbringen können. Dass das denkunmöglich ist, wird jedem klar sein<br />
und wurde auch nie angedacht.“<br />
167 Bauer 2003, 10.<br />
168 Interview Bürgermeister 04/1, 2003, Z 321ff.<br />
169 Interview Bürgermeister 03/1, 2003, Z 186-195.<br />
170 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 512-515.<br />
272
Wenn die beieinander sind, gibt’s nur ... solche Sachen.“ 171 Die wünschenswerte Größe dieser<br />
Einheiten ist nicht nur für diesen Bürgermeister dabei klar: „Wohngemeinschaften. Am besten<br />
wären Wohnungen.“ 172<br />
Für einen Bürgermeister ist die Sache indessen nicht so einfach: Das Kosten- wie auch das<br />
Kontrollargument des Unterkunftsgebers hält er für durchaus berücksichtigenswert. „Ich<br />
glaub so: Wenn ich eine kleine Gemeinschaft hab, und da ist niemand mehr da, wo das<br />
irgendwo kontrolliert, weil das muss sich ja auch rechnen, dann ist’s glaub ich ein Problem,<br />
irgendwo. Wenn’s eine zu große Gemeinschaft ist, dann ist’s wieder ein Problem. Weil dann<br />
hat man die nicht mehr im Griff. Mir kommt halt vor, so ein Haus, so mit vierzig, fünfzig<br />
Leuten, das ist so die Obergrenze.“ 173 Freilich bereite ihm auch diese Größe, die der Unter-<br />
kunft in seiner Gemeinde entspräche, ein gewisses Unbehagen: „Ich mein’, es ist und bleibt<br />
ein Flüchtlingslager, nicht? [...] Ich will jetzt das nicht beschönigen, nicht? Das ist sicher eine<br />
... eine Tragik für die Leute, irgendwo, nicht?“ 174 Völlig konträr äußert sich, wie schon hin-<br />
sichtlich der Lagemerkmale, lediglich ein Bürgermeister, in dessen Gemeinde sich eine<br />
Sammelunterkunft außerhalb des eigentlichen Siedlungsgebiets befindet: „Nein, eine zusammengefasste<br />
Größe – da ist mir das schon lieber, wie’s jetzt drin ist.“ 175<br />
Die Bürgermeister sprechen, so ist anzunehmen, hier letztlich für die Bevölkerung. Die Befra-<br />
gung der (wenigen) NachbarInnen jener Tiroler Unterkünfte, die im zweiten Halbjahr 2003<br />
bestanden, deutet dies bereits an 176 : Nicht weniger als 17 der 22 Befragten und damit 77 Pro-<br />
zent sprachen sich für eine „dezentrale Unterbringung kleiner Gruppen von Asylwerbern in<br />
Wohngemeinschaften und Wohnungen“ aus, fünf traten für die „zentrale Unterbringung einer<br />
größeren Zahl von Asylwerbern in Heimen oder Lagern“ ein. 177 Dieses aufgrund der geringen<br />
Zahl der Befragten noch nicht sonderlich aussagekräftige Ergebnis deckt sich freilich mit den<br />
Ergebnissen größerer deutscher Studien. So stellte etwa Kuhn im Rahmen seiner Unter-<br />
suchung der Erfahrungen und Meinungen der Bevölkerung in der Nachbarschaft großer<br />
Sammelunterkünfte in München fest, dass „die Akzeptanz kleiner Unterkünfte – vor allem bei<br />
Nutzung vorhandener Bausubstanz – besser ist als die von Großunterkünften mit Lager-<br />
171<br />
Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 271-275.<br />
172<br />
Ebd., Z 284. So auch ein weiteres Gemeindeoberhaupt (Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 442-446) und<br />
der Götzner Bürgermeister Hans Payr: „Die sinnvollste Unterbringung für Flüchtlinge ist die Wohngemeinschaft.“<br />
(Interview Payr 12.03.2004, Punkt 16)<br />
173<br />
Interview Erd 31.10.2003, Z 313-316.<br />
174<br />
Ebd., Z 332-335.<br />
175<br />
Interview Bürgermeister 01/1, 2003, Z 111.<br />
176<br />
Die Befragung fand mittels eines stark strukturierten Fragebogens statt, der bei einem Lokalaugenschein<br />
hinterlegt und anonym sowie kostenfrei an den Interview retourniert werden konnte.<br />
177<br />
Bemerkenswert scheint dabei, dass sich unter den BefürworterInnen kleiner Unterbringungseinheiten gleich<br />
vier Personen befanden, die in der vorangegangenen Frage für eine Unterbringung in Lagern „außerhalb Österreichs“<br />
votiert hatten – ist eine Unterbringung außerhalb des Landes nicht zu verhindern, so halten diese Befragten<br />
also nicht etwa eine Lagerunterbringung im Landesinneren für die adäquate Alternative, sondern eine Unterbringung<br />
auf Wohnungsebene.<br />
273
charakter“. 178 Fast drei Viertel der Befragten plädierten für die Unterbringung Asylsuchender<br />
in kleinen, über die ganze Stadt verteilten Unterkünften. Befragte ohne „Berührungsängste“<br />
hielten sogar eine Unterbringung inmitten von Wohngebieten für die beste Lösung. Der<br />
Wunsch, Asylsuchende möglichst stark abzusondern und abseits der Wohnbebauung unterzu-<br />
bringen, so Kuhn resümierend, „gilt also nur für eine kleine Minderheit“. 179 Eine empirische<br />
Studie zur Akzeptanz und Integration „ausländischer Menschen“ im deutschen Bundesland<br />
Brandenburg ergab 2001 Ähnliches: 62 Prozent der BrandenburgerInnen lehnten die Unter-<br />
bringung Asylsuchender in großen „Heimen“ ab, nur dreißig Prozent wollten Sammelunter-<br />
künfte als Unterbringungsform akzeptieren. Umgekehrt sprachen sich 77 Prozent dafür aus,<br />
Asylsuchende nicht zu „konzentrieren“, sondern in verschiedenen Wohnungen im jeweiligen<br />
Ort unterzubringen – eine Variante, die nur 18 Prozent ablehnten. 180<br />
Brunner et al. kamen in ihrer vergleichenden Analyse dreier österreichischer Gemeinden zu<br />
ähnlichen Ergebnissen. Asylsuchende, die nicht in „Massenquartieren“ wie etwa Gasthöfen<br />
untergebracht seien, sondern über eine Gemeinde verstreut lebten, gingen als Gruppe gewis-<br />
sermaßen im Raum „verloren“: Während Personen in Sammelunterkünften „viele Probleme<br />
zugeschrieben werden, sind die im Ortsgebiet verstreut angesiedelten Flüchtlinge weitgehend<br />
der öffentlichen Wahrnehmung entzogen“. Entsprechend würde die Zahl der in einem Gasthof<br />
untergebrachten Personen von der Bevölkerung regelmäßig als viel zu hoch eingeschätzt,<br />
während die Zahl der individuell untergebrachten Asylsuchenden weit unterschätzt bliebe. 181<br />
Ablehnende Reaktionen der Bevölkerung werden daher auch vorrangig durch die Errichtung<br />
von Sammelunterkünften ausgelöst – je deutlicher ihr provisorischer Charakter und damit ihre<br />
Heraushebung aus der umgebenden Bebauung, desto stärker formiert sich der Widerstand der<br />
NachbarInnen. 182<br />
9.9 Die Verortung im Raum (III): Vernachlässigte Gemeinde- und Standortidentitäten<br />
Schon in den 1990ern kamen Brunner et al. zum Schluss, dass die spezifische Identität einer<br />
Gemeinde wohl als zentraler gemeindeinterner Faktor für die Akzeptanz der Flüchtlingsauf-<br />
nahme durch die lokale Bevölkerung zu werten sei. Eine „in sich gefestigte Identität“ ließe<br />
„wahrscheinlich mögliche Aufnahmeprobleme leichter bewältigen“, hinzu kämen die sozialen<br />
und politischen Beziehungen der Gemeinde. 183 Gombos et al. Zeigten, gleichfalls in den<br />
1990ern, am Beispiel der burgenländischen Gemeinde Rechnitz, dass insbesondere die<br />
Gemeindegeschichte Anknüpfungspunkte für die Unterbringung Asylsuchender bieten kann,<br />
welche die Mobilisierung beachtlicher Ressourcen erleichtern können. 184 Die geschilderte<br />
178 Kuhn 1994, 315.<br />
179 Ebd., 334.<br />
180 Müller et al. 2001, Abschnitt 4.6.<br />
181 Vgl. Brunner et al. 1998, 76.<br />
182 Vgl. FOKUS 1994, 56ff und 98ff; Tedeschi 1996, 223.<br />
183 Brunner et al. 1994, 328.<br />
184 Vgl. Gombos et al. 1992.<br />
274
Situation in Tirol bestätigt dies. Wie in den Einzel- und Überblicksdarstellungen deutlich<br />
wurde, werden die Identität(en) der betroffenen Gemeinden und Standorte – der eingangs<br />
skizzierte „Habitus des Ortes“ – bei der Auswahl und Realisierung der Unterkunftsstandorte<br />
in Tirol indessen nicht berücksichtigt. Für ihre Bedeutung ist bislang sowohl auf Seiten des<br />
Unterkunftsgebers wie auch auf Seiten der Gemeinden keinerlei Bewusstsein feststellbar. Vor<br />
allem die ausführlicher geschilderten Beispiele der Standorte in Reith im Alpbachtal, Vils,<br />
Scharnitz und Innsbruck-Rossau zeigen: Vorhandene positive Bezugspunkte werden überse-<br />
hen, negative ignoriert. Teils heftige Proteste sind die Folge, Gemeinden in krisenhaften Um-<br />
bruchssituationen fühlen sich überfordert und fürchten wie in Scharnitz den „totalen Nieder-<br />
gang“. Der Prozess der Standortrealisierung, aber auch das spätere Leben am Standort werden<br />
so unnötig erschwert: Lokale Ressourcen bleiben weitgehend unerkannt und ungenutzt, kon-<br />
kreten Standorten anhaftende negative „Images“ werden übersehen, absehbare „Mauern“ im<br />
alltäglichen Leben gegen die untergebrachten Asylsuchenden werden erst wahrgenommen,<br />
wenn es bereits zu spät ist.<br />
9.10 Die Rolle der Gemeinden bei der Standortrealisierung:<br />
Statisten ohne klares Skript<br />
Bereits Form und Inhalt des Erstkontakts mit den betroffenen Gemeinden, so zeigt die Ana-<br />
lyse, sind für den weiteren Verlauf der Standortrealisierung und die Akzeptanz einer Unter-<br />
kunft entscheidend. Aus dem formal fehlenden Mitspracherecht kann keineswegs auf fehlende<br />
kommunale Handlungsmöglichkeiten geschlossen werden: Insbesondere den Bürgermeister-<br />
Innen kommt eine Schlüsselrolle als MeinungsbildnerInnen und MultiplikatorInnen zu. Unter-<br />
stützende oder ablehnende Aktivitäten der Gemeindeoberhäupter erregen in der Praxis teils<br />
weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit. Dies gilt letztlich, wenngleich in geringerem<br />
Ausmaß, auch für lokale Eliten. Für den Unterkunftsgeber ist es daher von erheblicher Bedeu-<br />
tung, die Standortrealisierung nicht gegen den erklärten Willen der Gemeinden vorzunehmen.<br />
In der Praxis zeigt sich in Tirol hinsichtlich des angesprochenen Erstkontakts mit den<br />
Gemeinden ein klares Muster: Sieht man von jenen Einzelfällen ab, in denen Gemeinden die<br />
Suche einer Unterkunft selbst durchführen und damit letztlich auch die Entscheidung über den<br />
Standort treffen, so werden die Bürgermeister vom Unterkunftsgeber über die Errichtung der<br />
Unterkunft informiert, in den Errichtungsprozess jedoch nicht weiter eingebunden. In einigen<br />
Fällen wurde eine konkrete Information vor Eröffnung des Standorts nach Aussage der betrof-<br />
fenen Bürgermeister überhaupt unterlassen oder erst während dem Bezug der Unterkunft er-<br />
teilt. Während die Gemeindeoberhäupter zumindest in einem gewissen Ausmaß informiert<br />
werden, unterbleibt eine direkte Information der Bevölkerung völlig. Die GemeindebürgerIn-<br />
nen beziehen ihre Informationen daher vorrangig aus dem lokalen Klatsch und aus lokalen<br />
oder regionalen <strong>Medien</strong>.<br />
275
Einen Sonderfall stellte die Gemeinde Kössen dar, in der Bürgermeister Stefan Mühlberger<br />
lokale Eliten und den Flüchtlingskoordinator des Landes im Vorfeld der Standortrealisierung<br />
zu einer Konferenz lud, bei der das Vorhaben und seine Auswirkungen erörtert und geprüft<br />
wurden. In der Folge erging an alle GemeindebürgerInnen eine Ausgabe der „Amtlichen Mit-<br />
teilungen“, in dem diese Elitenkonferenz die Bevölkerung sowohl über die geplante Flücht-<br />
lingsunterbringung als auch über das Ergebnis der Erörterungen informierte und um „positive<br />
Kenntnisnahme“ ersuchte. Dieses erfolgreiche Vorgehen blieb indessen einmalig, die vom<br />
Unterkunftsgeber später in Landeck und Imst veranstalteten Pressekonferenzen mit Bürger-<br />
meister, Bezirkshauptmann und Stadtpfarrer sind mit dem Kössener Modell nur bedingt ver-<br />
gleichbar. Ihren reinen Präsentationscharakter zieht man jedoch offenkundig dem mit Eliten-<br />
konferenzen nach Kössener Muster verbundenen Risiko vor, über den Standort oder zumin-<br />
dest unterkunftsinterne Standards verhandeln zu müssen.<br />
Im Prozess der Standortrealisierung, so kann vor diesem Hintergrund resümiert werden,<br />
kommt den Gemeinden bislang lediglich eine Statistenrolle zu – und auch für diese gibt es<br />
kein klares „Skript“: Ergreift eine Gemeindeführung wie in Kössen selbst die Initiative, so<br />
wird dies vom Unterkunftsgeber durchaus akzeptiert. Das Beispiel der gescheiterten Unter-<br />
kunft in der Kufsteiner Enrich-Kaserne zeigt freilich, wo dabei die Grenze liegt: Kommunale<br />
Veränderungswünsche bezüglich der Lage und Art des Standorts werden nicht gebilligt. 185<br />
»Nicht immer alles an die große Glocke hängen«: Die Perspektive des Unterkunftsgebers<br />
Den Eindruck, dass eine aktivere Rolle der Kommunen oder gar der Bevölkerung im Prozess<br />
der Standortrealisierung letztlich von diesen selbst abhängt und der Unterkunftsgeber grund-<br />
sätzlich keine Mechanismen zu ihrer Einbindung vorsieht, bestätigt der Flüchtlingskoordina-<br />
tor des Landes: Man informiere zwar die Gemeindeführung, mehr jedoch lieber nicht, „weil<br />
wenn wir die Gemeinde informieren, dann wird die Gemeinde wissen, mit wem sie redet.<br />
Weil ... Ich glaube, sonst meint wirklich jeder, er kann mitreden.“ 186 Die in der Praxis häufig<br />
späte und offenkundig auch dann oft nur rudimentäre Information der Gemeinden begründet<br />
der Unterkunftsgeber mit taktischen Überlegungen. „Man muss nicht immer alles an die große<br />
Glocke hängen“, so die zuständige Landesrätin Gangl Anfang Mai 2004 187 , nachdem ihr die<br />
grüne Landtagsabgeordnete Elisabeth Wiesmüller „Heimlichtuerei“ bei der Planung des<br />
Standorts in der Innsbrucker Rossau vorgeworfen hatte. Kurz zuvor hatte Landeshauptmann<br />
van Staa persönlich angemerkt, das Land warte mit der Bekanntgabe der Adressen neuer Un-<br />
terkunftsstandorte ab, um mögliche Widerstände und unbegründete Ängste seitens der Bevölkerung<br />
zu vermeiden. 188<br />
185 In Kufstein trat die Stadtführung für eine Unterbringung in Wohnungen anstelle der geplanten Kasernierung<br />
ein (vgl. Tiroler Tageszeitung 07.10.2004), was der Unterkunftsgeber jedoch umgehend ablehnte. Landeshauptmann<br />
van Staa (zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.10.2004) begründete dies so: „Es wäre nicht klug, das Angebot<br />
des Bundes, die Kaserne zu öffnen, nicht anzunehmen.“<br />
186 Interview Logar 10.10.2003, Z 285f.<br />
187 Gangl, zit. nach Tiroler Tageszeitung 07.05.2004a.<br />
188 Vgl. tip 30.04.2004, 3.<br />
276
Diese Ängste der Bevölkerung stellen für den Unterkunftsgeber auch den Grund dar, warum<br />
auf eine direkte Information der NachbarInnen verzichtet wird. Der Flüchtlingskoordinator<br />
des Landes beruft sich dabei auf seine Erfahrungen im Rahmen zweier BürgerInnenver-<br />
sammlungen am Standort in Reith im Alpbachtal 189 :<br />
„[...] das waren ganz wilde Stimmungen, und ... Ich bin froh, dass ich das erlebt hab, nicht? Weil du siehst halt,<br />
welche Urängste in den Leuten stecken. Und du hast ja gar keine Chance, Informationen zu geben. Der hat sein<br />
Bild, und von dem geht er nicht runter. [...] Ich bin froh, dass ich’s erlebt hab, ich würd’s aber nicht mehr machen,<br />
weil’s ... weil’s nichts bringt.“ 190<br />
Ausführliche Information muss sein: Die Perspektive der Gemeinden<br />
Die Gemeinden selbst bewerten die Information durch den Unterkunftsgeber meist als nicht<br />
ausreichend. Nicht zuletzt eine unklare Informationslage, so die Einschätzung der meisten<br />
Bürgermeister, sei geeignet, Proteste von Teilen der Bevölkerung gegen ein befürchtetes<br />
„zweites Traiskirchen“ zu provozieren. Wie die Beispiele von Landeck, Ehrwald und Schar-<br />
nitz zeigen, entspricht dies durchaus der Realität: In allen drei Kommunen führten auf ungesi-<br />
cherten Informationen beruhende Gerüchte zu teils eskalierenden Protesten. In Ehrwald und<br />
Scharnitz verfügten dabei offensichtlich auch die Bürgermeister selbst nur über beschränkte<br />
oder widersprüchliche Informationen bezüglich der geplanten Unterkunft, eine eigenständige<br />
kommunale Informationspolitik gegenüber der Bevölkerung war hier damit von vornherein<br />
ausgeschlossen. Der Informationsbedarf sowohl der Gemeindeführung als auch der Bevölke-<br />
rung ist jedenfalls enorm und betrifft insbesondere zehn Themenbereiche:<br />
• Unterkunftsgröße und Anzahl der untergebrachten Asylsuchenden (Belegungsdichte);<br />
• Zusammensetzung der untergebrachten Asylsuchenden (Familienstand, Alter, gängige Herkunftsländer und<br />
Fluchtgründe, Begriffsklärung und begriffliche Abgrenzung bei/gegenüber Begriffen wie „Asylanten“,<br />
„Wirtschaftsflüchtlinge“, „Illegale“);<br />
• Aufenthaltsdauer der untergebrachten Asylsuchenden und deren Hintergründe (Asylverfahren);<br />
• Unterbringungsstandards und -kosten, finanzielles „Einkommen“ der Asylsuchenden (Höhe des „Taschengelds“,<br />
konkrete Unterkunftsausstattung;<br />
• Sicherheit (Fragen zu Art und Umfang von Gewalt und Kriminalität unter Asylsuchenden, begriffliche<br />
Abgrenzungen, etwa straffällig gewordene AsylwerberInnen versus AsylwerberIn gewordene „Straffällige“);<br />
• Arbeit (faktisches Arbeitsverbot und damit verbundenes und als „abweichend“ erlebtes Verhalten<br />
Asylsuchender wie Arbeitssuche „von Tür zu Tür“, untätiges „Herumsitzen“; Möglichkeit der gemeinnützigen<br />
Arbeit in der Kommune etc.);<br />
• Betreuung der untergebrachten Asylsuchenden (Ansprechpersonen und deren Qualifikationen, Umfang);<br />
• mögliche Auswirkungen auf das Umfeld (Erfahrungswerte bezüglich einer Zunahme von Lärm oder<br />
Schmutz, Wertminderung durch „schlechten Ruf“ oder Schädigung des Tourismus durch „Ausbleiben“ von<br />
Gästen);<br />
• konkrete unterstützende Handlungsmöglichkeiten der Bevölkerung (materielle und ideelle Unterstützung<br />
durch Spenden, Freizeitgestaltung, regelmäßige Rückmeldungen etwa bei Problemen etc.).<br />
Vor allem die NachbarInnen der Unterkünfte artikulieren diesen Informationsbedarf deutlich,<br />
unklare Informationen und Gerüchte stellen für sie eine reale Belastung dar. Die wenigen<br />
189 Vgl. Abschnitt 7.7.4.<br />
190 Interview Logar 10.10.2003, Z 312-316.<br />
277
NachbarInnen der im zweiten Halbjahr 2003 systematisch untersuchten Unterkünfte fühlten<br />
sich während Standortrealisierung und Startphase fast ausnahmslos nicht ausreichend infor-<br />
miert. 17 der 22 Befragten traten für eine ausführliche Information der AnwohnerInnen vor<br />
der Eröffnung einer Unterkunft ein, lediglich drei hielten eine ausführliche Information im<br />
Zuge der Eröffnung für ausreichend – unter der Voraussetzung, dass Bürgermeister und<br />
Gemeinderat vor dem Bezug der Unterkunft ausführlich informiert wurden. 191 Dieses Ergeb-<br />
nis entspricht den Erkenntnissen einer landesweiten Befragung, die 2001 im deutschen Bun-<br />
desland Brandenburg durchgeführt wurde: Unabhängig davon, ob die dort Befragten generell<br />
für oder gegen eine Unterkunft in ihrer Gemeinde eintraten, sprach sich eine absolute Bevöl-<br />
kerungsmehrheit von 91 Prozent dafür aus, dass die Absicht der Realisierung einer Unterkunft<br />
„rechtzeitig und ausführlich“ mit den AnwohnerInnen besprochen wird. 192 „Wird einem sol-<br />
chen Wunsch zuwidergehandelt“, so das Resümee der StudienautorInnen, „stärkt das die<br />
Aversionen gegen die konkrete Heimansiedlung“. 193 Jahre zuvor war eine umfangreiche<br />
Untersuchung im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit<br />
und Soziales zum selben Ergebnis gekommen: Eine fehlende oder unzureichende Vorberei-<br />
tung der Bevölkerung auf die Unterbringung, insbesondere die Strategie, AnwohnerInnen vor<br />
vollendete Tatsachen zu stellen, stelle eine Überforderung der Betroffenen dar, sie fördere<br />
und verstärke letztlich „die in der Regel vorhandene ablehnende Haltung gegenüber einer<br />
Unterbringung der Flüchtlinge im Wohnumfeld zusätzlich“. Das Resümee der AutorInnen ist<br />
eindeutig:<br />
„Es ist unerläßlich, Anwohner/innen und Bevölkerung in ihren Ängsten ernstzunehmen, statt sie zu übergehen,<br />
zu belächeln, zu verleugnen oder zu kritisieren! Sie brauchen Raum, um ihre Ängste zu artikulieren. Es ist wenig<br />
zweckmäßig, sogar eher kontraproduktiv, wenn eine z.T. irrationale Ablehnung der Flüchtlinge mit Appellen an<br />
Hilfsbereitschaft und Verständnis abzubauen versucht wird.“ 194<br />
9.11 Mit Taktik zum Ziel: Wie man die Zustimmung der Gemeinden erreicht<br />
Die Gemeinden, so wurde resümiert, nehmen im Prozess der Standortrealisierung bislang<br />
meist eine Statistenrolle ohne Einflussmöglichkeiten ein. Doch wie wird dann ihre Zustim-<br />
mung zu einer geplanten Unterkunft oder zumindest ein „Stillhalten“ der Gemeindeführung<br />
trotz grundsätzlich ablehnender Haltung erreicht? Dass es dem Unterkunftsgeber ein Anliegen<br />
ist, neue Standorte möglichst nicht gegen den Willen einer Kommune zu realisieren, hat er<br />
mehrmals deutlich gemacht, ebenso jedoch, dass den Gemeinden formal kein Mitspracherecht<br />
zukomme. Sie denke, so etwa die zuständige Landesrätin im Interview, dass es wichtig sei,<br />
die Bürgermeister und GemeinderätInnen „mit einzubeziehen“:<br />
191 Zwei weitere Befragte konnten sich weder für eine dieser beiden Antwortmöglichkeiten noch für eine dritte<br />
(„egal“) entscheiden.<br />
192<br />
Müller et al. 2001, Abschnitt 4.6.<br />
193<br />
Ebd.<br />
194<br />
FOKUS 1994, 126.<br />
278
„Weil’s keinen Sinn macht, wenn das Land sagt: So! Oder ein Gasthaus sich anbietet und sagt: ich hätte Platz für<br />
so und so viele Personen, und wir schließen mit denen einen Vertrag ab. Könnten wir tun! [...] Weil Gast muss<br />
Gast bleiben. Aber es macht keinen Sinn, wenn der Bürgermeister dann sofort ...“ 195<br />
Ähnlich formuliert es der Flüchtlingskoordinator des Landes:<br />
„Vom Grundsatz hat die Gemeinde ... Vom Recht her hätte sie kein Mitspracherecht. Der Wirt kann vermieten<br />
mit wem er will. [...] Aber ... Es ... Es gehört ja, wenn du die Leute unterbringst, das soziale Umfeld dazu. [...]<br />
Nicht dass alle glücklich sein sollen in der Gemeinde, aber du brauchst ... die Kinder gehen in den Kindergarten,<br />
die Kinder gehen in die Schule. Du brauchst Ansprechpartner dort ... [...] Und ich denk mir, es ist auch im Sinne<br />
derer, die du dort hinbringst, dass sie nicht auf totale Ablehnung stoßen. Und da versuchst du eben das Umfeld<br />
auch mit einzubeziehen. Und wir haben noch nie, wenn wirklich totaler Widerstand war, dann haben wir das ...<br />
wir haben da noch nie mit Gewalt etwas durchgeboxt.“ 196<br />
Letzteres entspricht freilich, wie unter anderem das Beispiel Reith im Alpbachtal zeigt, offen-<br />
kundig nur bedingt der Realität. Und tatsächlich erwog Landesrätin Gangl auch bereits, zu-<br />
mindest bei Unterkünften mit einer geplanten Belegungszahl von unter fünfzig Personen auf<br />
jegliche Form der Einbindung von Gemeinden zu verzichten. 197 Der Vorstoß wurde freilich<br />
von Landeshauptmann van Staa umgehend zurückgewiesen; schon zuvor hatte er mehrmals<br />
deutlich gemacht, keinen „Druck“ auf die BürgermeisterInnen ausüben zu wollen, damit diese<br />
einer Unterbringung Asylsuchender zustimmen würden. 198<br />
Höchstzahl und Familienstand als Mittel zum Zweck<br />
Die kommunale Zustimmung ist also erwünscht, soll jedoch ohne jeden Druck auf die Bürger-<br />
meisterInnen erfolgen – angesichts des vorherrschenden Unwillens, Asylsuchende unterzu-<br />
bringen, manövriert sich der Unterkunftsgeber so in eine scheinbar aussichtslose Situation.<br />
Der Landeshauptmann, kritisierte Mitte 2004 die Journalistin Anita Heubacher in der Tiroler<br />
Tageszeitung, gehe damit vor den „Dorfchefs“ schlicht „in die Knie“. 199 Die Analyse zeigt<br />
jedoch, dass der Unterkunftsgeber einen Ausweg gefunden hat und praktiziert: Sofern<br />
Gemeinden eine Unterkunft nicht von sich aus organisieren oder zumindest akzeptieren oder<br />
auf die gleichermaßen riskante wie schlichte Strategie der „Überrumpelung“ und damit auf<br />
den Bezug eines Standorts ohne vorherige Information der Gemeinde gesetzt wird, greift man<br />
offenbar auf taktische Zusagen, teils auch lediglich diesbezügliche Andeutungen zurück.<br />
Diese betreffen dabei fast ausnahmslos zwei Bereiche:<br />
• Höchstzahl der untergebrachten Asylsuchenden: Der Gemeindeführung wird eine maxi-<br />
male Belegungsdichte zugesagt oder in Aussicht gestellt, die ihrem Wunsch entspricht<br />
oder sich diesem annähert.<br />
195 Interview Gangl 09.02.2004, Z 104-108. Mitte August 2004 sprach Gangl gar von einem „Tiroler Weg“, bei<br />
dem die Gemeinden mit eingebunden würden (vgl. Tiroler Tageszeitung 24.08.2004b).<br />
196 Interview Logar 10.10.2003, Z 271-279.<br />
197 Vgl. AdTLR 20.09.2004; SPÖ Tirol 21.09.2004; Tiroler Tageszeitung 21.09.2004a.<br />
198 Vgl. Tiroler Tageszeitung 18.06.2004b; 22.09.2004.<br />
199 Heubacher 2004a.<br />
279
• Familienstand der untergebrachten Asylsuchenden: Der Gemeindeführung wird die<br />
Unterbringung ausschließlich oder vorrangig von Familien mit Kindern zugesagt oder in<br />
Aussicht gestellt.<br />
Im Konfliktfall ist, so zeigt das Beispiel Scharnitz, auch eine Kombination dieser beiden<br />
Bereiche möglich. Die Zusagen werden in der Regel im Zuge der Eröffnung der Unterkunft<br />
tatsächlich umgesetzt, insbesondere der Bezug durch Familien wird seit Ende 2003 gezielt<br />
über lokale und regionale <strong>Medien</strong> kommuniziert. Die breite mediale Rezeption dieser Taktik<br />
legt freilich den Schluss nahe, dass sie dem Unterkunftsgeber mehr und mehr zu entgleiten<br />
und eine für ihn nicht ungefährliche Eigendynamik zu entwickeln droht. Das Beispiel der<br />
Bezirkshauptstadt Kufstein weist deutlich in diese Richtung: Nachdem die Realisierung einer<br />
Unterkunft in der Kufsteiner Kaserne gescheitert war, wies die dortige Stadtführung auf ein<br />
anderes Objekt zur Unterbringung Asylsuchender hin, Bürgermeister Marschitz stellte jedoch<br />
zugleich klar, man bestehe darauf, „dass es sich dabei um Familien mit Kindern handeln<br />
muss“. 200 Der ursprünglich wohl als Mittel zum Zweck eingesetzte Hinweis auf die Möglich-<br />
keit, vorrangig „notleidende Familien“ mit Kindern unterzubringen, wurde von der Gemeinde<br />
damit zur Voraussetzung erklärt.<br />
Andeutungen oder Zusagen über Höchstzahl und Familienstand der Untergebrachten weisen<br />
indessen den gravierenden Nachteil auf, dass sie nur für einen relativ kurzen Zeitraum um-<br />
setzbar sind:<br />
• Aufgrund des hinlänglich bekannten Mangels an Unterbringungsplätzen ist der<br />
Unterkunftsgeber gezwungen, vorhandene Kapazitäten möglichst zur Gänze zu nutzen,<br />
zugleich drängen Wirtinnen und Wirte ehemaliger oder bestehender Beherbergungs-<br />
betriebe aus ökonomischen Erwägungen auf eine möglichst hohe Belegungsdichte in ihren<br />
Betrieben.<br />
• Die vergleichsweise geringe Zahl an asylsuchenden Familien mit Kindern macht es<br />
zwangsläufig beinahe unmöglich, jede neue Unterkunft ausschließlich oder vorrangig mit<br />
Familien zu belegen.<br />
Strategie der »verbrannten Erde«?<br />
Es überrascht daher kaum, dass eine Reihe an Bürgermeistern bald eine Überschreitung der<br />
zugesagten oder auch nur angedeuteten „Höchstzahl“ untergebrachter Asylsuchender fest-<br />
stellte. Die Gemeindeoberhäupter finden sich damit nun ihrerseits in einer Zwangslage wie-<br />
der: Machen sie auf diese Entwicklung öffentlich aufmerksam oder fordern gar den Unter-<br />
kunftsgeber auf, sich an die tatsächliche oder vermeintliche Vereinbarung zu halten, so droht<br />
ihnen der nicht zuletzt von anderen Gemeinderatsfraktionen erhobene Vorwurf, sie hätten sich<br />
in „naiver Gutgläubigkeit“ schlicht „über den Tisch ziehen lassen“. Kommentieren sie dage-<br />
200 Marschitz, zit. nach Tiroler Tageszeitung 20.01.2005.<br />
280
gen die Entwicklung nicht, bleibt ihnen nur die bange Hoffnung, dass gemeindeinterne „Geg-<br />
nerInnen“ des Unterkunftsstandorts ihr Interesse an der Frage inzwischen verloren haben. Die<br />
Mehrheit der betroffenen Bürgermeister, so zeigt sich, zieht Letzteres vor, ist jedoch deutlich<br />
verbittert und wartet – eindeutige Äußerungen in diese Richtung im Rahmen der Interviews<br />
legen dies nahe – aufmerksam auf eine Möglichkeit, um gegen die Unterkunft wirksam „ein-<br />
schreiten“ zu können. Lediglich der Bürgermeister der Außerferner Gemeinde Ehrwald trat<br />
2004, gemeinsam mit dem Obmann des lokalen Tourismusverbands, gewissermaßen die<br />
Flucht nach vorne an und attackierte über das regionale Leitmedium den Flüchtlingskoordi-<br />
nator des Landes persönlich. Für die Bürgermeister, so ist letztlich zu resümieren, ist das tak-<br />
tische Vorgehen des Unterkunftsgebers schwieriger zu handhaben als die Realisierung eines<br />
Standorts gegen den erklärten Willen der Gemeindeführung: Erst das vielzitierte „Drüber-<br />
fahren“ des Unterkunftsgebers ermöglicht dem Gemeindeoberhaupt nämlich, glaubwürdig zu<br />
versichern, es habe ohnehin „alles“ unternommen, um die kommunalen Interessen zu wahren.<br />
Für den Unterkunftsgeber besteht, wie an anderer Stelle bereits angemerkt wurde, tatsächlich<br />
die Gefahr, mit der nur kurzfristig wirksamen Höchstzahlen-Taktik in den betroffenen<br />
Gemeinden „verbrannte Erde“ in Form eines Umfelds zu schaffen, in dem vorrangig nach<br />
Wegen gesucht wird, die Unterkunft in ihrem Bestand zu gefährden. Das Spektrum möglicher<br />
Maßnahmen reicht dabei von verschiedenen die Existenz der Unterkunft erschwerenden Inter-<br />
ventionen durch enttäuschte oder brüskierte Bürgermeister 201 über die Weitergabe von Ein-<br />
schätzungen und Hinweisen der Gemeindeoberhäupter bezüglich der Strategien des Unter-<br />
kunftsgebers an AmtskollegInnen, in deren Gemeinden ein Standort geplant ist 202 , bis hin zu<br />
öffentlichen bürgermeisterlichen Auftritten insbesondere vor regionalen <strong>Medien</strong>, in denen<br />
lautstark etwa die Einhaltung seitens des Unterkunftsgebers zugesagter Begleitmaßnahmen<br />
gefordert wird. Dass Gemeindeführungen ihre Erfahrungen mit dem Unterkunftsgeber bzw.<br />
mit der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden in der jüngeren Vergangenheit nur<br />
in Einzelfällen untereinander ausgetauscht haben, verhindert zwar bislang breitere negative<br />
Konsequenzen, ist jedoch vor dem Hintergrund eines sich in anderen kommunalpolitischen<br />
Bereichen mehr und mehr durchsetzenden Bewusstseins der Notwendigkeit kommunaler Zu-<br />
sammenarbeit 203 eher als vorübergehende Erscheinung zu werten.<br />
Kinder als »Schachfiguren«<br />
Nicht nur aufgrund ihrer fehlenden Nachhaltigkeit, sondern vor allem wegen der Konsequen-<br />
zen für die unmittelbar betroffenen Asylsuchenden ist die taktische Nutzung des Bildes der<br />
201 So sprachen etwa von den im Herbst 2003 interviewten Bürgermeistern zwei von geplanten oder bereits durch<br />
sie veranlassten „Überprüfungen“ (vgl. Interviews Bürgermeister 02/1, 2003 und 03/1, 2003), einer berichtete<br />
sogar von mehreren Anzeigen bei verschiedenen Behörden (vgl. Interview Bürgermeister 03/1 2003). Ein weiterer<br />
Bürgermeister zitierte im Interview aus einer Reihe von Beschwerdebriefen, die er an den (freilich nicht zuständigen)<br />
Innenminister gerichtet hatte (vgl. Interview Bürgermeister 05/1, 2003).<br />
202 So suchte etwa Ende 2003 der Landecker Bürgermeister Rat beim früheren Bürgermeister von Gries am<br />
Brenner, wo zwischen 1990 und 1992 Asylsuchende untergebracht waren (vgl. Interview Hörtnagl 10.03.2004).<br />
203 Vgl. Bußjäger 2004.<br />
281
„hilfsbedürftigen Familie“ problematisch. Dass sich die Situation für die betroffenen Familien<br />
durch einen erzwungenen Unterkunftswechsel erheblich verschlechtern kann, zeigt das Bei-<br />
spiel der bereits mehrfach erwähnten Familie der irakischen Schülerin Lawa. 204 Das Mädchen<br />
war mit seinen zwei Geschwistern und den Eltern zunächst anlässlich der Eröffnung der<br />
Landecker Unterkunft aus der Leutasch dorthin verlegt worden – mitten im Schuljahr. Etwas<br />
mehr als neun Monate später, im September 2004 und bereits nach Beginn des neuen Schul-<br />
jahrs, wurde die Familie anlässlich der Eröffnung der Unterkunft in Hall erneut verlegt. In<br />
Landeck hatte sie noch zwei Zimmer bewohnen können, in der neuen Unterkunft musste sie<br />
nun mit einem Zimmer auskommen – obwohl inzwischen zu den drei Kindern ein viertes<br />
gekommen war. Wohl kaum überraschend wehrte sich die sechsköpfige Familie und forderte<br />
ein zweites Zimmer. Die zuständige Betreuerin des Landes, Melita Duma, kommentierte dies<br />
so: „Entweder sie bleiben in diesem Zimmer oder sie können zurück nach Landeck.“ 205<br />
Die häufigen Verlegungen von Familien mit Kindern kritisieren einige Bürgermeister scharf:<br />
Der wiederholte Schulwechsel würde es vor allem den Kindern selbst, mittelbar aber auch<br />
ihren LehrerInnen und KlassenkameradInnen äußerst schwer machen. Gerade die LehrerInnen<br />
und DirektorInnen würden sich irgendwann schlicht hilflos fühlen, berichtet ein Gemeinde-<br />
oberhaupt über ein Gespräch mit dem verzweifelten Direktor der lokalen Volksschule:<br />
„Kommt er her und sagt: »Ja, was soll ich bitten tun? Haben wir drei Schritte mit denen gemacht, haben uns bemüht<br />
mit denen, wir wollen ja denen was beibringen! Haben ihnen auch Heftln gegeben, haben ihnen ein bisschen<br />
was gegeben. Jetzt kommen sie nicht mehr! Auf einmal sind sie weg gewesen!«“ 206<br />
Da laufe „viel schief“, so der Bürgermeister empört:<br />
„Was soll das Kind machen? Ich mein’, der Erwachsene ist arm, der hat wirklich ein Problem, wenn er nicht<br />
weiß, wo er daheim ist. Aber was sollen denn die Kinder tun? Die haben ja gar keinen Start mehr! Da muss ich<br />
mir schon überlegen: Sind das jetzt nur Erwachsene? Sind das Erwachsene mit Kindern? Und wenn ich Erwachsene<br />
mit Kindern hab, muss ich eine Kontinuität schaffen. Und die gehören meiner Meinung nach in ein Dorf<br />
hinaus, irgendwo, wo ... wo ... wo’s nicht große Einheiten gibt, wo sie sich auch in der Schule einfinden können,<br />
wo sie [...] Freundschaften knüpfen können.“ 207<br />
Auch der Volderer Bürgermeister Max Harb tritt im Interview vehement für die schulische<br />
Integration und Unterstützung der in der Gemeinde untergebrachten Flüchtlingskinder ein und<br />
kritisiert weitere Verlegungen von Flüchtlingsfamilien nach deren Eintreffen in Tirol – man<br />
könne die Kinder ja nicht „wie Schachfiguren“ herumschieben, sie müssten ja „irgendwo<br />
Wurzeln schlagen“ können. 208<br />
Folgen häufiger Unterkunftswechsel von Familien mit Kindern<br />
Die Folgen häufiger und erzwungener Unterkunftswechsel von Flüchtlingsfamilien mit Kin-<br />
dern sind meist durchaus gravierend. Positive Aspekte, etwa Verbesserungen hinsichtlich der<br />
204<br />
Vgl. insbesondere Abschnitt 5.5.<br />
205<br />
Duma, zit. nach Tiroler Tageszeitung 21.09.2004b.<br />
206<br />
Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 393-396.<br />
207<br />
Ebd., Z 401-406.<br />
208<br />
Interview Harb 30.10.2003.<br />
282
Lage und Ausstattung der Unterkunft oder der Zimmergröße, verlieren mit jedem weiteren<br />
Wechsel gegenüber den zahlreichen negativen Auswirkungen an Bedeutung. Während ein<br />
Unterkunftswechsel bei erwachsenen Asylsuchenden insbesondere für ältere und alte, gesund-<br />
heitlich angeschlagene sowie traumatisierte Personen eine erhebliche Belastung bedeutet, lei-<br />
den Kinder erfahrungsgemäß generell unter den für sei äußerst vielfältigen negativen Konse-<br />
quenzen. 209 Ein Unterkunftswechsel bedeutet für sie in aller Regel – neben dem Verlassen<br />
von Bezugspersonen in der Unterkunft wie etwa SpielkameradInnen und BetreuerInnen –<br />
auch einen Kindergarten- oder Schulwechsel und damit den Abbruch stabilisierender und<br />
orientierender Freundschaften und Beziehungen nicht zuletzt in die Mehrheitsgesellschaft<br />
hinein, wichtige Bezugspersonen wie KindergärtnerInnen und LehrerInnen gehen verloren.<br />
Zugleich werden die Kinder gezwungen, eine Umgebung zu verlassen, in die sie sich mühsam<br />
eingelebt haben. Die Folgen dieses „Herausreißens“ aus einem vertrauten Umfeld zeigen sich<br />
meist in ihrem Verhalten: Die ohnehin bereits entwurzelten Kinder und Jugendlichen gewöh-<br />
nen sich nur vordergründig relativ rasch ein, in sicheres „Fußfassen“ mündet dies erst nach<br />
geraumer Zeit. Frustration, Ängste und vor allem Desorientierung erfordern bis dahin teils<br />
intensive Betreuung und Unterstützung. Besonders viel Kraft kostet die Kinder und Jugend-<br />
lichen dabei ein Wechsel während des Schuljahrs: Der damit verbundene Stress überfordert<br />
sie meist deutlich, häufig sind sich verschlechternde schulische Leistungen, Verhaltensauf-<br />
fälligkeiten oder auch Schulverweigerung und eine Umschulung in Sonderschulen die<br />
Folge. 210 Nicht zuletzt leidet die Beziehungsfähigkeit vieler Kinder unter den häufigen<br />
Beziehungsabbrüchen:<br />
„Die ständigen Trennungen sind für Kinder nur bis zu einem bestimmten Grad erträglich und die Bereitschaft<br />
neue Bindungen einzugehen schwindet mit jedem Mal enttäuschender Erfahrungen. Oft ist die Angst vor erneutem<br />
Verlust größer als das Bedürfnis nach Nähe. Denn das eigene Gefühl massiver Verunsicherung und wiederholter<br />
Frustration stört die Bindungsfähigkeit bis hin zur Persönlichkeitsveränderung. Dem daraus entstehenden<br />
Fehlverhalten ist oftmals nur noch therapeutisch mit Hilfe von Familienhelfern zu begegnen.“ 211<br />
9.12 Eskalierende Konflikte: Keine Prävention, keine Lösung<br />
Auch durch die Anwendung von Strategien wie den oben genannten können Konflikte mit<br />
den betroffenen Gemeinden im Zuge der Standortrealisierung nicht immer verhindert werden,<br />
wie die Praxis zeigt. In Arnbach, Ehrwald, Reith und Scharnitz eskalierten Proteste bereits vor<br />
oder während der Unterkunftserrichtung. Offensichtlich ist, dass in all diesen Fällen keine<br />
Konfliktprävention und, nach der Eskalation, auch keine professionelle Konfliktlösung statt-<br />
gefunden hat. In Arnbach wurde – nach Aussage des Unterkunftsgebers freilich aus anderen<br />
Gründen – von der Realisierung einer Unterkunft überhaupt abgesehen, in Ehrwald, Reith und<br />
Scharnitz wurden Andeutungen oder Zusagen wie die oben geschilderten gegeben, in Reith<br />
zusätzlich auf politischen Druck gesetzt. Die Möglichkeit einer Einbindung qualifizierter,<br />
209 Vgl. Berg 2000; Deutschmann 2003; John-Onyeali 2003; Stein 2003.<br />
210 Stein (2003, 19) bericht hierzu etwa von drei kosovarischen Flüchtlingskindern, die aufgrund von „für den<br />
Klassenverband untragbarem Verhalten“ ausgeschult wurden.<br />
211 Ebd.; vgl. Deutschmann 2003, 10.<br />
283
externer und also vom Konflikt in keiner Weise betroffener MediatorInnen wurde in keinem<br />
Fall genutzt.<br />
Ungenutzt blieb auch das Protesten innewohnende und generell gern übersehene Potential:<br />
BürgerInnenbewegungen und ähnliche Netzwerke weisen auf das Vorhandensein beachtlicher<br />
gemeindeinterner Ressourcen hin. In vielen Fällen sind es gerade selbstorganisierte Proteste,<br />
die innerhalb der Kommune die BefürworterInnen der Unterbringung von Asylsuchenden zu<br />
einer vergleichbaren Netzwerkbildung motivieren 212 , in anderen Fällen zeigte sich eine konse-<br />
quente Einbindung der protestierenden Initiativen als derart erfolgreich, dass sich unter Betei-<br />
ligung der früheren GegnerInnen von qualifiziertem Unterkunftspersonal geleitete Arbeits-<br />
kreise zur Situation im Umfeld der Unterkunft ergaben, die sich regelmäßig trafen. 213 Eine<br />
vergleichbare Nutzung des bei Protesten zum Ausdruck kommenden zivilgesellschaftlichen<br />
Potentials ist für den Unterkunftsgeber bislang jedoch kein Thema. Der Flüchtlingskoordina-<br />
tor des Landes macht deutlich, dass es für ihn bei Konflikten mit den Gemeinden auch keine<br />
„Schmerzgrenze“ gibt – ein Ernstnehmen der Protestierenden und inhaltliches Eingehen auf<br />
ihre Anliegen ist damit von vornherein nicht nötig: „Nein, weil die Schmerzgrenze liegt nicht<br />
bei mir, sondern die Schmerzgrenze wird dann politisch gezogen. Dass sich die Bürgermeister<br />
über den zuständigen Politiker einfach ... dass das dann ... gestoppt wird, nicht?“ 214 Verfügen<br />
die betroffenen Gemeinden oder einzelne BürgerInnen nicht über die dafür erforderlichen<br />
„besten Beziehungen“ in die Landesregierung, bleibt auch der Einsatz der BürgerInnen ohne<br />
Erfolg, wie das Beispiel Scharnitz zeigt. Viele Kommunen setzen deshalb von vornherein auf<br />
eine von zwei Strategien, um aus der Auseinandersetzung mit Hilfe kommunalpolitischer<br />
Mittel doch noch siegreich hervorzugehen:<br />
• Versteckte Verhinderung: Manche Gemeinden versuchen, oft durchaus erfolgreich, die ge-<br />
plante Unterkunft nicht offen, sondern versteckt zu verhindern. Als Rechtfertigung dient<br />
dabei typischerweise das „Wohl“ der unterzubringenden Asylsuchenden. Landeshaupt-<br />
mann van Staa machte Ende September 2004 verärgert auf diese Praxis aufmerksam:<br />
„Kaum sollen Flüchtlinge in ein Objekt einziehen, braucht es aufwendige Adaptierungen,<br />
obwohl die Unterkünfte zuvor auch bewohnt waren.“ 215<br />
• Offene Verhinderung: Politisch starke und finanziell abgesicherte Gemeinden greifen<br />
dagegen durchaus auch auf konkrete Drohungen zurück. So ließ etwa der tagelang über<br />
die geplante Unterkunft nicht offiziell informierte Kufsteiner Bürgermeister Marschitz<br />
Anfang Oktober 2004 den Unterkunftsgeber wissen: „Das Gebäude steht derzeit auf einer<br />
212<br />
Vgl. hierzu etwa die von Fuchshofer (1994, 71) und Tedeschi (1996, 223) referierten Beispiele aus Salzburg<br />
bzw. Vorarlberg.<br />
213<br />
Vgl. hierzu etwa das von Seefeld (2000, 11f) referierte Beispiel der Unterkunft „An der Elisabethwiese“ im<br />
deutschen Rostock.<br />
214<br />
Interview Logar 10.10.2003, Z 403ff.<br />
215<br />
van Staa, zit. nach Tiroler Tageszeitung 22.09.2004.<br />
284
Sonderfläche. Für die Unterbringung der Asylwerber und für den Umbau bedarf es einer<br />
Umwidmung. Und da ist der Gemeinderat am Zug.“ 216<br />
Kommt es zu derartigen Reaktionen der Kommunen, ist eine Standortrealisierung ohne in-<br />
haltliches Eingehen auf die Sicht der Gemeinden und ihrer BürgerInnen meist nur noch durch<br />
massiven politischen Druck möglich – mit dem Ergebnis, dass die brüskierte Gemeindefüh-<br />
rung die alltägliche Existenz der so realisierten Unterkunft zu untergraben sucht. Auch hierfür<br />
gab es unter den untersuchten Fällen ein Beispiel.<br />
9.13 Die Startphase: Zunehmende Professionalisierung<br />
Wie die Beispiele Reith im Alpbachtal und Ehrwald zeigen, kreisen viele Konflikte in der<br />
Realisierungsphase auch um die Frage der Betreuung der unterzubringenden Asylsuchenden,<br />
um das Vorhandensein von Ansprechpersonen sowohl für diese als auch für die Bevölkerung<br />
sowie um die Begleitung der „Startphase“ des neuen Standorts. Forderungen der Gemeinden<br />
nach einer Sicherstellung qualifizierter und möglichst umfassender Betreuung sind nicht un-<br />
begründet: Ist eine Unterkunft in der Umgebung aufgrund diesbezüglicher Mängel erst einmal<br />
„verrufen“, so ist es – falls überhaupt – nur noch unter großen Anstrengungen möglich, den<br />
negativen Eindruck ins Positive zu wenden. Wirkt eine Unterkunft auf die AnwohnerInnen<br />
„sich selbst überlassen“ und verwahrlost, ruft dies fast zwangsläufig Ängste in der Bevölke-<br />
rung hervor, die keineswegs als irrational abgetan werden können.<br />
Der Unterkunftsgeber war sich dessen lange nur bedingt bewusst. „Also die Größe ist viel,<br />
und, natürlich, die Betreuung ist schon auch wichtig“, legte die zuständige Landesrätin noch<br />
Anfang 2004 die Prioritäten klar fest. 217 Nach einem Vergleich der Vorzüge und Nachteile der<br />
beiden vorrangig praktizierten Unterbringungsformen in Beherbergungsbetrieben oder landes-<br />
eigenen „Heimen“ gefragt, räumte sie jedoch durchaus Mängel ein:<br />
„Wenn das Land ein Heim selber betreibt, ist es eben so, dass man vielleicht eben auch von der Betreuung her es<br />
zur Zeit einfach auch besser ist. Ich mein’, da sind fix Angestellte, da sind die Leut’ teilweise rund um die Uhr<br />
da, das ist etwas auch ... ganz etwas Wichtiges. Und da, glaub ich, haben wir noch ein bisschen ein Manko, wenn<br />
das mehr mit Gasthäusern wird. Weil da ist das nicht so gegeben, und das führt eben auch dazu, und ich weiß das<br />
auch mit Gesprächen beim [...] Reither Bürgermeister, dem das ein ganz ein wichtiges Anliegen war, dass er<br />
sagt: »Da muss rund um die Uhr einfach jemand da sein, um sie zu betreuen.« Ich halt das auch für wichtig, dass<br />
eine Ansprechperson immer da ist, ich glaub, das brauchen die Leut’ auch dort, und ... da haben wir sicherlich<br />
noch ein Manko.“ 218<br />
Im Fall der im zweiten Halbjahr 2003 bestehenden Unterkünfte zeigte sich dieses „Manko“ in<br />
einer großteils völlig fehlenden Vorbereitung der Unterkunftsleitungen (meist handelte es sich<br />
dabei um die Wirtinnen oder Wirte von Beherbergungsbetrieben), welche die Startphase<br />
daher teils als regelrechten „Sprung ins kalte Wasser“ charakterisierten. Eine Begleitung<br />
dieser Startphase durch den Unterkunftsgeber fand letztlich nur statt, wenn die betroffene<br />
216 Marschitz, zit. nach Tiroler Tageszeitung 06.10.2004.<br />
217 Interview Gangl 09.02.2004, Z 44f.<br />
218 Ebd., Z 233-241.<br />
285
Gemeinde selbst dafür sorgte. Im Jahr 2004 war hier eine deutliche Veränderung feststellbar:<br />
Der Unterkunftsgeber setzt offenkundig zunehmend auf die Professionalisierung der Leitung<br />
und Betreuung seiner Unterkünfte. Fachlichen Qualifikationen im Bereich der Sozialen Arbeit<br />
zieht er im Zweifelsfall dabei die Verankerung des Leitungs- bzw. Betreuungspersonals in<br />
den betroffenen Gemeinden oder deren Umfeld vor: Das „Schwergewichtigste“ sei einfach, so<br />
der Flüchtlingskoordinator des Landes, „dass du vor Ort mit den Leuten dort bist“. 219 Die<br />
genaue Kenntnis lokaler Gegebenheiten, die im besten Fall mit der Einbindung in lokale<br />
Netzwerke einhergeht, erleichtert dem Personal zweifellos die erfolgreiche Begleitung insbe-<br />
sondere der sensiblen Startphase und stellt ein klares vertrauensbildendes Signal an die Orts-<br />
bevölkerung dar. Entscheidend für die Forcierung dieser Auswahl- und Vorbereitungspraxis<br />
dürften wohl nicht zuletzt gute Erfahrungen im landeseigenen Unterkunftskomplex am<br />
„Bürgl“ bei Fieberbrunn gewesen sein: „Die Heimleiterin, was oben ist“, so der Fieberbrunner<br />
Bürgermeister Herbert Grander zufrieden, „ist aus Fieberbrunn, die macht ihre Sache perfekt,<br />
von daher sind wir relativ gut informiert, was sich oben tut.“ 220<br />
Die zunehmende Professionalierung der Unterkunftsleitungen wird flankiert von teils deutlich<br />
erkennbaren Elementen einer agierenden Öffentlichkeitsarbeit zumindest auf lokaler Ebene<br />
rund um die Eröffnung neuer Standorte. Zugleich setzt der Unterkunftsgeber bei neuen Reali-<br />
sierungen offenbar verstärkt auf räumliche Adaptierungen und Umbaumaßnahmen – ein Hin-<br />
weis darauf, dass dem Bereich der in dieser Untersuchung nicht zu behandelnden unter-<br />
kunftsinternen Standards zunehmend Beachtung geschenkt wird.<br />
9.14 Die Gemeinden und die Unterbringung von Asylsuchenden:<br />
Segregation oder Integration?<br />
Wie gehen die Tiroler Gemeinden mit der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden<br />
um? Die Kommunen treten, so zeigte die Analyse, in den untersuchten Bereichen der Stand-<br />
ortsuche, -entscheidung und -realisierung mit Ausnahme einiger weniger Einzelfälle vor-<br />
rangig passiv in Erscheinung. Werden Pläne zur Eröffnung einer Flüchtlingsunterkunft be-<br />
kannt, so reagieren nahezu alle Gemeindeführungen zunächst mit einem Stoßseufzer: „Jetzt<br />
hat es also auch uns erwischt!“ Vor allem in ländlichen Gemeinden wird in der Folge gerne<br />
das Klischee der tirolischen „Dorfgemeinschaft“ beschworen, in der man auf der Basis demo-<br />
kratischer Gleichheit noch aufeinander achte. Im Unterschied zur Stadt sei diese Gemein-<br />
schaft im jeweiligen Ort noch intakt, nun jedoch aufgrund einer drohenden Unkontrollierbar-<br />
keit gefährdet. „Es ist in der Stadt leider Gottes so“, erläutert etwa ein Bürgermeister, „dass<br />
das denen verantwortlichen Beamten, egal in welcher Gegend, alles entgleitet. Erstens dürfen<br />
sie nichts tun, wenn sie was täten, zweitens tun sie eh schon nichts.“ 221 Man könne das ja<br />
schon an der „Exekutive“ erkennen:<br />
219 Interview Logar 10.10.2003, Z 661.<br />
220 Interview Grander 06.11.2003, Z 27f.<br />
221 Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 319-323.<br />
286
„Ja was dürfen sie auch tun? Die gehen hin und müssen sich blöd anreden lassen, sogar von den kleinen<br />
Kindern! Da hab ich ja noch mehr Macht und Möglichkeiten, denen also was zu sagen, als die! [...] Draußen im<br />
Dorf ist’s noch so, dass ein paar Leut’ sich bemühen, ein paar gibt’s wenigstens noch. Und halt doch schauen,<br />
dass man eine Gemeinschaft hat und einfach besser zusammenleben kann. Und in der Stadt - gibt’s auch schöne<br />
Stadtteile, nicht? Gibt’s überall. Aber ... wenn ich mir heute Innsbruck hernehme, diese Entwicklung ... Dass in<br />
der Nacht Leut’ hergeschlagen werden ... Nicht?“ 222<br />
Schon jetzt sei die Gemeinschaft ja durch Migration bedroht:<br />
„Man hat’s zwar da jetzt auch schon probiert, dass also Türkenbuben, einen ... einen eingesessenen A.’ler, weil<br />
er halt einen Rausch gehabt hat und weil er ihnen kein Geld gegeben hat, hätten sie ihn wollen herschlagen,<br />
nicht? Das passiert da auch schon, und ... natürlich, im Dorf bist du relativ ganz schnell dran, relativ schnell<br />
informiert und relativ schnell bei der Sache. [...] Und dann stellst du das ab. [...] Und das sind keine Flüchtlinge.“<br />
223<br />
Wie, so die offenkundige Sorge, werde es wohl werden, wenn erst einmal Flüchtlinge im Dorf<br />
untergebracht seien oder – eine häufig geäußerte Befürchtung – später etwa aufgrund von<br />
Verlegungen immer wieder „neue“ Asylsuchende kämen? Die kommunalen Reaktionsweisen<br />
auf diese Bedrohung sind durchaus unterschiedlich. Für eine diesbezügliche Analyse scheint<br />
hier die Unterscheidung vier möglicher Reaktionsweisen sinnvoll (vgl. Abb. 4) 224 :<br />
Abbildung 4: Reaktionsweisen der Gemeinden auf die Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung<br />
aktive Segregation passive Segregation passive Integration aktive Integration<br />
Quelle: Eigene Darstellung.<br />
Aktive und passive Segregation sowie passive und aktive Integration treten dabei in der Praxis<br />
naturgemäß kaum in trennscharfen „Idealformen“ auf. Für die Analyse ist eine klare<br />
Trennung indessen sinnvoll – im Bewusstsein, dass es sich dabei um die „zugespitzte“<br />
Wiedergabe der Realität handelt.<br />
Aktive Segregation<br />
Als Komponenten einer aktiv segregierenden Reaktionsweise sind neben der räumlichen Ab-<br />
sonderung oder Heraushebung die soziale Exklusion und insbesondere die bewusste Externa-<br />
lisierung von Verantwortung durch die Gemeindeführung anzuführen. Diese Reaktionsweise<br />
ist im Fall der untersuchten Standorte insbesondere in Reith im Alpbachtal feststellbar – die<br />
dort untergebrachten Flüchtlingskinder mussten anfangs sogar in der Nachbargemeinde Strass<br />
222 Ebd., Z 325-332.<br />
223 Ebd., Z 334-341; der Name der Gemeinde wurde anonymisiert.<br />
224 Ähnliche Überlegungen finden sich ansatzweise auch bei Brunner et al. (2003), die sich jedoch in ihren<br />
Ausführungen lediglich auf die ersten beiden (und jeweils bei einer der drei von ihnen untersuchten Kleingemeinden<br />
konstatierten) Reaktionsweisen beschränken. Die bei der dritten Gemeinde von ihnen festgestellte Reaktionsweise<br />
ist letztlich auch als segregierend zu werten.<br />
287
eingeschult werden. Es liegt auf der Hand, dass aktive Segregation gerade in jenen Gemein-<br />
den als Reaktionsweise gewählt wird, deren Gemeindeidentitäten sich in einer krisenhaften<br />
Umbruchsphase befinden. Schon die klare Grenzziehung zwischen den als Gemeindebürger-<br />
Innen Etablierten und den in der Gemeinde untergebrachten und um Asyl ansuchenden<br />
AußenseiterInnen ist geeignet, zur Festigung der Identität ersterer beizutragen. 225 Das Beispiel<br />
von Hall in Tirol scheint dies, gewissermaßen aus der Gegenrichtung, zu bestätigen: Nachdem<br />
sich die verantwortlichen Gremien prinzipiell dazu entschlossen hatten, dem Land Tirol eine<br />
Unterkunft für Asylsuchende anzubieten, versuchte die regierende ÖVP, angeführt von Vize-<br />
bürgermeister Eva-Maria Posch, einen aktiv segregierenden Umgang mit den Flüchtlingen<br />
durchzusetzen. Anstelle eines vom sozialdemokratischen Vizebürgermeister Schweighofer<br />
wegen seiner Zentrumsnähe favorisierten Gebäudes schlug Posch die Errichtung eines abge-<br />
sonderten Containerlagers vor, eine Lösung, die ihres Erachtens „Rücksicht“ genommen hätte<br />
„auf die Bevölkerung, auf das Steuergeld und auf das Zusammenleben“. 226 Posch konnte in<br />
der urban geprägten, selbstbewusst auftretenden Kleinstadt unweit von Innsbruck ihre Linie<br />
jedoch nicht durchsetzen – im Gegenteil: Schweighofer gelang es, den von ihm ausgewählten<br />
Standort zu realisieren und den untergebrachten Asylsuchenden auch gleich noch bezahlte<br />
Hilfstätigkeiten für die Gemeinde, etwa in der Stadtgärtnerei oder am Bauhof, zu ver-<br />
mitteln. 227 Die Stadt Hall schuf damit eine in mancher Hinsicht vorbildliche Unterkunft, die<br />
auch außerhalb Tirols Anerkennung fand. 228<br />
Passive Segregation<br />
Passive Segregation weist demgegenüber als entscheidende Komponente vor allem das Dele-<br />
gieren jeglicher wie auch immer gearteter Aktivitäten bezüglich der Flüchtlingsaufnahme und<br />
-unterbringung auf. Die Gemeindeführung betrachtet die Unterbringung ausschließlich als<br />
„Privatsache“ der Wirtsleute und allenfalls vorhandener privater HelferInnen, die in ihrer<br />
Arbeit grundsätzlich nicht unterstützt, aber auch nicht ausgesprochen aktiv behindert wer-<br />
den. 229 „Das muss natürlich in erster Linie schon der Wirt wissen, was er da tut“, hält etwa ein<br />
Bürgermeister im Interview fest: „Es verbleibt ja im Freiraum vom Wirt auch, was er tut,<br />
nicht?“ 230 Er sei zwar durchaus von NachbarInnen der Unterkunft auf die Unterbringung<br />
angesprochen worden, aber „da sag ich: »Mensch, ich weiß da weniger wie du! Du bist ja<br />
daneben!«“ 231 Dass mit dieser Delegation an Privatpersonen nicht nur die (offenbar uner-<br />
wünschte) Verantwortung, sondern auch kommunale Entscheidungskompetenzen abgegeben<br />
werden, wird kaum als problematisch bewertet – die Flüchtlingsunterbringung gilt nicht als<br />
225 Vgl. Elias/Scotson 1993; Berghold 2002; Brunner et al. 2003.<br />
226 Posch, zit. nach Tiroler Tageszeitung 15.06.2004.<br />
227 Vgl. Tiroler Tageszeitung 21.09.2004b; 07.01.2005.<br />
228 Vgl. etwa Coudenhove-Kalergi 2004; Spudich 2004; ORF 02.10.2004.<br />
229 Bietet sich jedoch ohne Zutun der Gemeindeführung eine Gelegenheit zur Behinderung dieser Arbeit, etwa im<br />
Rahmen der Bearbeitung eines Ansuchens der Wirtsleute oder der HelferInnen an die Gemeinde, so wird diese<br />
manchmal durchaus genutzt.<br />
230 Interview Bürgermeister 01/1, 2003, Z 20 bzw. 30f.<br />
231 Ebd., Z 147f.<br />
288
öffentliche, sondern als private Angelegenheit, die lediglich in einem gewissen Ausmaß von<br />
der Gemeinde kontrollierend verwaltet und von der Bevölkerung mehr oder weniger toleriert<br />
wird. Aus dieser Perspektive, so kann mit Brunner et al. resümiert werden, „sind Flüchtlinge<br />
dann integriert, wenn sie nicht zur Last fallen und unauffällig sind“. 232 In diese Richtung<br />
äußert sich auch einer der interviewten Bürgermeister: „Wenn was passiert, wenn was ist,<br />
dann werden wir auch was unternehmen. Aber solang es ruhig ist ...“ 233 Das Gemeindeober-<br />
haupt räumt gar ein, die Unterkunft eigentlich noch nie besucht zu haben, er kenne sie daher<br />
auch nicht, „man sollte sich wirklich das da draußen gründlich anschauen [...], möglicher-<br />
weise tut man das bald einmal, und ... und ... Nur, solange du nichts hörst, solange sich das<br />
halbwegs in Grenzen haltet – okay, lasst du sie gewähren, nicht?“ 234 Das Ergreifen aktiver<br />
Maßnahmen gegen die Unterkunft, wenn dort „was passiert“, steht dabei freilich immer als<br />
Drohung im Raum:<br />
„Jetzt schauen wir uns das einmal ein bisschen an, und dann werden wir schon wissen, was wir tun [...] Viele<br />
Möglichkeiten hast du nicht, das wissen wir, aber die Möglichkeiten, die wir haben, schöpfen wir aus. [...] Also<br />
das ist sicher klar. Weil da gibt’s dann ... gibt’s schon einige Möglichkeiten, wo man sagt: So nicht, und wenn’s<br />
die Presse ist, wenn’s die <strong>Medien</strong> sind, da werden wir dann wirklich einmal ein paar Dinge auf den Tisch<br />
legen.“ 235<br />
Dass bei einer passiv segregierenden Reaktionsweise eine selektive Integration keineswegs<br />
ausgeschlossen ist, zeigt das Beispiel Volders. Bürgermeister Max Harb, der Unterkunft<br />
grundsätzlich ablehnend gegenüberstehend, gibt einerseits öffentlich zu verstehen, er halte es<br />
für das beste, wenn über die Flüchtlingsunterbringung möglichst nicht geredet würde: „Je we-<br />
niger darüber geredet wird, desto weniger Aufsehen gibt es.“ 236 Zugleich tritt er jedoch vehe-<br />
ment für die schulische Integration und Unterstützung der in der Gemeinde untergebrachten<br />
Flüchtlingskinder ein und kritisiert, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, Verlegungen von<br />
Flüchtlingsfamilien – man könne die Kinder ja nicht „wie Schachfiguren“ herumschieben. 237<br />
Passive Integration<br />
Vor allem zwischen passiver Segregation und passiver Integration kann hinsichtlich der prak-<br />
tischen Auswirkungen auf das kommunale Leben ein fließender Übergang bestehen. Der ent-<br />
scheidende Unterschied ist jedoch in der grundsätzlichen Haltung der Gemeindeführung zu<br />
sehen: Die passiv integrierende Gemeinde zeigt sich zwar offiziell unbeteiligt und ordnet die<br />
Aufnahme und Unterbringung Asylsuchender in der Öffentlichkeit auch klar dem Verantwor-<br />
tungsbereich von Unterkunftsgeber und -besitzerIn zu – nicht zuletzt, um allfälligen Angriffen<br />
der Gemeinderatsopposition zu entgehen. Zugleich werden jedoch Aktivitäten der Unter-<br />
kunftsleitungen oder privater HelferInnen auf Anfrage stillschweigend und pragmatisch unter-<br />
stützt, insbesondere die schulische Integration und Unterstützung der Flüchtlingskinder wird<br />
232 Brunner et al. 2003.<br />
233 Interview Bürgermeister 02/2, 2003, Z 8f.<br />
234 Interview Bürgermeister 02/1, 2003, Z 192ff.<br />
235 Ebd., Z 183-190.<br />
236 Harb, zit. nach Tiroler Tageszeitung 22.04.2004.<br />
237 Interview Harb 30.10.2003.<br />
289
egelrecht als Selbstverständlichkeit erachtet. Als Beispiele für diese Reaktionsweise können<br />
exemplarisch etwa die Gemeinden Fieberbrunn, Landeck, Lienz, Mötz und Vils, nach Ablauf<br />
der Startphase auch Kössen angeführt werden. In all diesen Fällen zeigt sich, dass sich passiv<br />
integrierende Gemeindeführungen grundsätzlich eine Moderations- und Koordinations-<br />
funktion zuschreiben. Nach dahingehendem Druck von außen erfüllen sie diese partiell auch<br />
durchaus aktiv handelnd, etwa im Rahmen persönlicher Gespräche mit NachbarInnen, bei der<br />
Organisation einer in der Folge autonom agierenden ehrenamtlichen Begleitperson für die<br />
Startphase oder über eine bewusst positive Aspekte betonende Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Aktive Integration<br />
Aktiv integrierend reagierende Gemeindeführungen wiederum setzen zumindest in einem ge-<br />
wissen Rahmen von selbst gezielte Schritte zur sozialen Einbindung der untergebrachten<br />
Asylsuchenden. Nur an drei der 23 untersuchten Standorte war dies zumindest zeitweise tat-<br />
sächlich der Fall: In Hall in Tirol zeigte sich, wie oben geschildert, Vizebürgermeister<br />
Schweighofer in der Startphase persönlich engagiert, in Götzens übernahm bis zum Ende sei-<br />
ner Amtszeit Bürgermeister Singer selbst die Rolle einer Kontakt- und Begleitperson für die<br />
Flüchtlinge, Singer entfaltete darüber hinaus jahrelang eine Vielfalt an Einzelaktivitäten, um<br />
jeweils anstehende individuelle Probleme von Flüchtlingen pragmatisch zu lösen und ihre<br />
Lebensqualität zu verbessern. In Kössen wiederum ergriff Bürgermeister Mühlberger bereits<br />
während der Standortrealisierung die Initiative und nahm von sich aus eine Moderatorenrolle<br />
ein, die er sehr aktiv ausfüllte: Er berief den mehrfach erwähnten „runden Tisch“ lokaler Eli-<br />
ten ein, an dem die geplante Aufnahme Asylsuchender und zu erwartende Auswirkungen auf<br />
das Gemeindeleben mit dem Unterkunftsgeber besprochen wurden, über das Gemeindeblatt<br />
wurde die Bevölkerung in der Folge von Unterbringung und Konferenz informiert und kund-<br />
getan, dass die lokalen Eliten gemeinsam hinter dem Vorhaben stünden. Für die Startphase<br />
der Unterbringung engagierte Mühlberger eine Kontakt- und Begleitperson, die sich in Ab-<br />
stimmung mit der Gemeinde um die untergebrachten Asylsuchenden kümmerte. Zugleich ver-<br />
suchte man, gezielt kleinere sozial integrierende Schritte zu setzen. 238 Eine Reihe an Einzel-<br />
ideen des Kössener Bürgermeisters, die auf eine Verbesserung der sozialen Situation der<br />
Asylsuchenden abzielten, mündeten jedoch nicht in einem umfassenden Gesamtkonzept und<br />
einer Realisierung – wohl nicht zuletzt deshalb, weil nach Einschätzung des Bürgermeisters<br />
die Anstellung einer eigenen Koordinations- und Betreuungsperson für die Gemeinde nicht<br />
finanzierbar und qualifizierte, nur gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung arbeitende<br />
Personen vor Ort nicht vorhanden waren. 239<br />
Das Beispiel Kössen zeigt auch exemplarisch, dass eine aktiv integrierende Politik – anders<br />
als häufig unterstellt – keiner „ideologischen“ Rechtfertigung etwa in Form der christlichen<br />
238 So wurden etwa in der Startphase als Reaktion auf ihre Beschäftigungslosigkeit wie später in Hall einige<br />
Asylsuchende bei kommunalen Arbeiten von der Uferreinigung bis zur Wegerhaltung eingesetzt, für ihre Mithilfe<br />
erhielten sie eine Art „Taschengeld“ (vgl. Interview Mühlberger 03.11.2003).<br />
239 Vgl. ebd.<br />
290
Argumentation mit der „tätigen Nächstenliebe“ oder der aus dem multikulturalistischen Bou-<br />
levard stammenden Floskel von der „kulturellen Bereicherung“ bedarf, sondern auf rein sach-<br />
lich-pragmatischen Überlegungen beruhen kann: Der Bürgermeister entschied für sich, im<br />
Interesse des kommunalen Zusammenlebens in der Rolle eines „umsichtigen Befürworters“<br />
der Unterkunft „offensiv an die Öffentlichkeit“ zu gehen, um nicht „aus der Defensive heraus<br />
dann irgendwelche negativen Erscheinungen“ bekämpfen zu müssen. 240 Der Möglichkeit,<br />
aktiv segregierend zu wirken, war er sich dabei jedoch durchaus bewusst – er nennt, wie<br />
zuvor schon ein anderes Gemeindeoberhaupt, insbesondere die <strong>Medien</strong> als diesbezüglich<br />
nutzbares Instrument:<br />
„Wenn ich jetzt von vornherein sag – medial, öffentliche Meinungsbildung –, dann werd’ ich sicher den [Flüchtlingskoordinator]<br />
Logar so weit bringen, dass er sagt: Nein, Kössen hab ich nur Schwierigkeiten, da ist ... wenn’s<br />
nur irgendwie geht und ich irgendwo anders Plätze krieg, geh ich da nicht mehr hin. Nicht? [...] Weil ich auch<br />
mit allen versuche – ein Gemeinderatsbeschluss, ein Tourismusverbandsbeschluss, laufend geh ich mit Negativmeldungen<br />
in die <strong>Medien</strong>, »jetzt haben’s schon wieder eingebrochen, und die Verdächtigen sind eh bekannt« –<br />
nicht? Ich mein’, ich kann kann’s ja alles spielen!“ 241<br />
Kommunaler Handlungsspielraum<br />
Derartige Überlegungen zeigen: Die Bürgermeister jener Gemeinden, in denen das Land Tirol<br />
Unterkünfte für Asylsuchende unterhält, kennen ihren negativen kommunalen Handlungs-<br />
spielraum und die damit verbundenen gestalterischen Möglichkeiten sehr genau. Allerdings<br />
wird nur in Einzelfällen gezielt auf aktiv segregierende Reaktionsweisen gesetzt. Ein positiver<br />
kommunaler Handlungsspielraum ist den meisten Gemeindeführungen hingegen kaum be-<br />
kannt. Unter Berufung auf die formale Unzuständigkeit der Kommunen setzt man mehrheit-<br />
lich lieber auf passive Reaktionsweisen – teils segregierend, teils integrierend. Aktiv integrie-<br />
rende Maßnahmen bleiben in der Regel zeitlich beschränkt und inhaltlich zersplittert, ein<br />
flüchtlingspolitisches Gesamtkonzept wurde in keiner der neun untersuchten Gemeinden ent-<br />
wickelt. Fügt man die einzelnen Maßnahmen zusammen, entsteht jedoch ein Bild, das das<br />
Vorhandensein eines positiven kommunalen Handlungsspielraums klar belegt und die damit<br />
verbundenen Vorteile für die Gemeinden selbst verdeutlicht:<br />
• Standortsuche und -entscheidung: Zumindest drei Gemeinden suchten selbst aktiv nach<br />
möglichen Unterkunftsstandorten und boten dem Unterkunftsgeber in der Folge auch je-<br />
weils ein Gebäude zur Nutzung an. Für die Kommunen bestand so die Möglichkeit, noch<br />
vor einer diesbezüglichen Entscheidung von „außen“ die schwer oder überhaupt nicht<br />
mehr veränderbaren Rahmenbedingungen in Form der Lage, Größe, Ausführung und<br />
Gestaltung der Unterkunft selbst zu bestimmen. Dies ermöglicht vor allem die Einpassung<br />
in vorhandene lokale Strukturen etwa im Sozialbereich.<br />
• Standortrealisierung: In mehreren Gemeinden nahmen die jeweiligen Bürgermeister eine<br />
teils äußerst aktiv angelegte Koordinations- und Moderationsrolle im Realisierungs-<br />
240 Vgl. ebd., Z 191f.<br />
241 Ebd., Z 417-423.<br />
291
prozess ein, sie konnten so der Bevölkerung vermitteln, die Entwicklungen „unter Kon-<br />
trolle“ zu haben und auf das „Wohl“ der Gemeinde zu achten. Als erfolgreiche Praktiken<br />
erwiesen sich dabei insbesondere das Kössener Modell einer lokalen „Elitenkonferenz“<br />
zur Erörterung der Problematik samt einer öffentlichen Kundmachung des Konferenz-<br />
ergebnisses noch vor Eröffnung der Unterkunft, das vor allem in Kleingemeinden prakti-<br />
kable persönliche Aufsuchen der NachbarInnen durch den Bürgermeister, agierende<br />
<strong>Medien</strong>arbeit auf lokaler Ebene zur gezielten Kommunizierung positiver Aspekte und per-<br />
sönlicher Hintergründe, die Bereitstellung einer eigenen Kontakt- und Ansprechperson<br />
sowie die Übernahme der Koordination lokaler HelferInnen durch die Gemeinde.<br />
Aus vereinzelten Maßnahmen kann freilich noch nicht auf das Vorhandensein einer eigen-<br />
ständigen „kommunalen Flüchtlingspolitik“ geschlossen werden. Dem Land Tirol als öffentli-<br />
chem Unterkunftsgeber erscheint eine solche gar als derart fern der beobachtbaren Realität,<br />
dass dem zuständigen Flüchtlingskoordinator auf die Frage nach Bereichen, in denen er sich<br />
mehr kommunal(politisch)es Engagement wünschen würde, lediglich Beispiele dafür ein-<br />
fallen wollen, wo er selbst gerne aktiver auftreten würde:<br />
„Ja, ich würde mir wünschen, dass es ... wir ... ich sag ... Ich glaub, wir müssten mehr präsent sein bei so freiwilligen<br />
Arbeitsprojekten. Wenn du ... [...] Illusionen macht man sich leicht, aber wenn du zum Beispiel Frauen<br />
hättest, die gut Deutsch können oder auch Männer, wenn die zumindest ein, zwei Mal in der Woche ins Altersheim<br />
gehen, mit irgendjemand spazieren gehen oder ... oder was. [...] Oder dass du sagst: Im Frühling, da tu ich<br />
meine Decke renovieren, und die machen das freiwillig. Gerade die Männer, die ich drin hab ... Ich glaub, man<br />
müsste optisch darstellen, die Leut gibt’s, das sind Menschen wie du und ich, und die tragen ebenfalls irgendetwas<br />
bei, die sind präsent.“ 242<br />
Sind Flüchtlinge und Asylsuchende und ihre (erwartete) Lebenssituation vor Ort – jenseits<br />
diesbezüglicher formaler Zuständigkeiten, von denen nicht unbedingt auf die reale Situation<br />
geschlossen werden kann – Teil der kommunalen Politik?<br />
9.15 Gibt es eine kommunale Flüchtlingspolitik?<br />
Anmerkungen zu einer »verbotenen« Frage<br />
Bei Betrachtung der Geschichte der Migration in Österreich falle auf, so der Politikwissen-<br />
schafter Heinz Schoibl im Jahr 1992, dass die Kommunen sich „wesentlich durch ausländer-<br />
politische Untätigkeit“ ausgezeichnet hätten:<br />
„So wie einerseits auf der Ebene der Bundespolitik die Wandlung von Arbeitsmigration zur Einwanderung nicht<br />
realisiert bzw. durch Ordnungspolitik zu verhindern versucht wurde, blieben andererseits auf der Ebene der<br />
kommunalen Politik, in den Bereichen der sozialen Infrastruktur, in den Bereichen Verwaltung und kommunale<br />
Dienstleistungen die MigrantInnen, ohne viel Aufhebens von ihren Bedürfnissen, ihrer z.T. existenziellen Notlage<br />
zu machen, unberücksichtigt und ausgesperrt.“ 243<br />
Die Kommunen in Österreich hätten wohl noch nicht einmal richtig begriffen, was sie damit<br />
anrichteten:<br />
242 Interview Logar 10.10.2003, Z 815-822.<br />
243 Schoibl 1992, 151.<br />
292
„Zwar zeigen sich die wesentlichen Eckpfeiler der marginalen Lebensverhältnisse der AusländerInnen auf kommunaler<br />
Ebene, aber die VertreterInnen kommunaler Politik und Verwaltung in Österreich setzen sich mit den<br />
Lebenslagen der ausländischen Wohnbevölkerung in der Regel nicht auseinander, die inländischen EntscheidungsträgerInnen<br />
setzen sich mit den AusländerInnen noch nicht einmal zusammen. Zwar stellen sich die zentralen<br />
Anforderungen an die Integrationsfähigkeit der österreichischen Gesellschaft auf dem Niveau städtischer<br />
Siedlungsbereiche – aber die Ausländerpolitik wird von den Kommunen unter Hinweis auf ihre eingeschränkten<br />
Kompetenzen zur Gänze der Bundesregierung überlassen, die, wie sich nunmehr seit Jahren zeigt, eben nicht<br />
über die entsprechende Kompetenz verfügt, soziale Fragen auch wirklich mit sozialen Maßnahmen zu beantworten.<br />
So betrachtet tragen die Kommunen Österreichs eine wesentliche Mitschuld daran, daß sich die österreichische<br />
Ausländerpolitik als Politik des Bundes manifestiert hat, als Politik, die ganz offensichtlich gegen die Interessen<br />
der ausländischen Wohnbevölkerung gerichtet ist.“ 244<br />
Schoibl konstatierte eine „integrationspolitische Abstinenz der Kommunen“, die in Verbin-<br />
dung mit den ordnungspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung – etwa in Form von Ge-<br />
setzesverschärfungen, verstärkten Grenzkontrollen und Zuwanderungsbeschränkungen – in<br />
den vergangenen Jahren ein soziales Klima geschaffen habe, „in dem Arbeitsmigration und<br />
sogar Fluchtbewegungen ein gesellschaftliches Problem darstellen“. 245<br />
Was Schoibl vor mehr als einem Jahrzehnt für den Bereich der Migrations- und Integrations-<br />
politik festgestellt hat, kann für den Bereich der Flüchtlings- und Asylpolitik noch heute gel-<br />
ten. Im erstgenannten Bereich scheint sich, wenngleich erst seit wenigen Jahren, auch in ein-<br />
zelnen Kommunen mittlerer Größe nach und nach ein Bewusstsein für die Bedeutung der<br />
Thematik herauszubilden. Die Vorarlberger Bezirkshauptstadt Dornbirn etwa, eine Gemeinde<br />
mit etwas mehr als 40.000 EinwohnerInnen, konnte im Herbst 2002 nach mehr als einjähriger<br />
Vorbereitung als erste österreichische Gemeinde ein auch theoretisch fundiertes kommunales<br />
Integrationsleitbild mit integriertem Maßnahmenplan präsentieren. 246 Der Stadt wurde in die-<br />
sem Handlungsprogramm die Funktion einer „steuernden, Impulse setzenden, Orientierung<br />
gebenden, Perspektiven entwickelnden, mit anderen Akteuren kooperierenden, koordinieren-<br />
den (auch im Sinne der Vermeidung von Doppelspurigkeiten) und die Effizienz der Aktivitä-<br />
ten und Maßnahmen steigernden Instanz“ 247 zugeordnet, die auf die „bestmögliche Einbeziehung<br />
ALLER MitbürgerInnen“ aus struktureller, sozialer und kultureller Ebene sollte. 248<br />
Nicht einmal erwähnt werden im Dornbirner Leitbild bezeichnenderweise Flüchtlinge und<br />
Asylsuchende – sie befinden sich bislang meist im toten Winkel kommunaler (Integrations-)<br />
Politik. Ein erst 2003 im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten österreichi-<br />
schen Projekts zur interkulturellen Gemeindearbeit erstelltes „Handbuch“ spiegelt diese Situ-<br />
ation beispielhaft wider: Nach theoretischen Arbeiten zur Migrations- und Integrationspolitik<br />
auf europäischer, nationaler und kommunaler Ebene werden dort als konkrete Handlungs-<br />
felder auf kommunaler Ebene unter anderem die Bereiche „Kultur und Identität“, Religion,<br />
Alter, „Miteinander leben“ und Partizipation vorgestellt. Flüchtlinge und Asylsuchende wer-<br />
244<br />
Ebd., 151f.<br />
245<br />
Ebd., 152.<br />
246<br />
Vgl. Güngör/Ehret 2002.<br />
247<br />
Ebd., 3.<br />
248<br />
Andergassen 2003, 68.<br />
293
den wie im Dornbirner Leitbild mit keinem Wort erwähnt. 249 Asylsuchende, so die letztlich<br />
dahinterstehende Annahme, seien ohnehin nur „vorübergehend“ in der Gemeinde: Im Fall<br />
einer Ablehnung ihres Asylantrags müssten sie das Land wieder verlassen, bei einer Zuerken-<br />
nung von Asyl würden sie in der Gruppe der bereits vor Ort lebenden anderen MigrantInnen<br />
gewissermaßen „aufgehen“. Diese verbreitete Sicht ignoriert freilich, dass<br />
• Asylsuchende aufgrund der üblicherweise langen Dauer eines Asylverfahrens nicht selten<br />
mehrere Jahre in einer Gemeinde leben;<br />
• Asylsuchende unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer die kommunale Infrastruktur nutzen<br />
und Bestandteil des kommunalen Alltagslebens sind (am deutlichsten zeigt sich dies in der<br />
Regel im Kindergarten- und Schulbereich und, trotz oder gerade wegen ihrer dortigen<br />
physischen Abwesenheit, an den Stammtischen lokaler Wirtshäuser);<br />
• Asylsuchende in den Gemeinden Kosten verursachen, zugleich jedoch auch zu einer Erhö-<br />
hung der über den Finanzausgleich zu beziehenden Pro-Kopf-Ertragsanteile beitragen – in<br />
beiden Fällen gilt: wie andere BürgerInnen auch;<br />
• Flüchtlinge und Asylsuchende in österreichischen Gemeinden während der gesamten<br />
Zweiten Republik immer wieder, in einigen Fällen sogar kontinuierlich präsent waren –<br />
von einer „vorübergehenden“ Anwesenheit kann also bestenfalls im Hinblick auf einzelne<br />
Individuen, nicht jedoch auf die Gesamtgruppe der Asylsuchenden die Rede sein.<br />
Vier Gründe, die die Existenz einer eigenständigen kommunalen Flüchtlingspolitik nahe legen<br />
würden. Selbst die Bürgermeister jener Gemeinden, in denen bereits seit Längerem Asyl-<br />
suchende untergebracht sind, beharren indessen fast ausnahmslos darauf, dass es eine solche<br />
nicht gäbe. Schon der Kössener Bürgermeister Mühlberger, der die Realisierung wie auch die<br />
Startphase der lokalen Unterkunft aktiv begleitete und über das amtliche Mitteilungsblatt<br />
kundmachte, will dies nicht als Teil der kommunalen Politik verstanden wissen – auf eine<br />
diesbezügliche Frage antwortet er ausweichend: Solange es keine größeren Probleme mit den<br />
Flüchtlingen gebe, „bleib ich dabei, haben die auch da [...] ihre Daseinsberechtigung“. 250 An-<br />
dere Gemeindeoberhäupter werden deutlicher: Flüchtlinge, so der Götzner Bürgermeister<br />
Payr kategorisch, „sind kein Teil der Kommunalpolitik. Sie sollen ausschließlich eine Frage<br />
des Bundes und Landes sein.“ 251 Die Frage nach der Rolle Asylsuchender in der Kommunal-<br />
politik, so scheint es, ist eine „verbotene“ Frage. Hinter den ausweichenden und abwehrenden<br />
Reaktionen steht jedoch ein konkretes bürgermeisterliches „Schreckbild“: der ehemalige Bür-<br />
germeister von Gries am Brenner, Andreas Hörtnagl. Die Gemeinde Gries hatte unter seiner<br />
Führung im Jahr 1990 als eine von lediglich drei Tiroler Gemeinden die Unterbringung von<br />
Asylsuchenden im Ort ermöglicht, bis heute ist Hörtnagl der einzige Bürgermeister Tirols, der<br />
249 Vgl. Zwicklhuber 2003. Erstaunlicherweise wird auch die Dimension Geschlecht nicht als Handlungsfeld auf<br />
kommunaler Ebene erörtert.<br />
250 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 616f.<br />
251 Interview Payr 12.03.2004.<br />
294
Aufnahme und Unterbringung auf der Basis eines konkreten und umfassenden Konzepts or-<br />
ganisierte. Eineinhalb Jahre nach der Flüchtlingsaufnahme wurde Hörtnagl nach zwölfjähriger<br />
Amtszeit abgewählt. Die Tageszeitung Der Standard konstatierte den „Abgang eines Engagierten“<br />
252 , ein Magazin kleidete sein Urteil in eine Frage: „Flüchtlinge als Abwahlhelfer?“ 253<br />
„Radikal, nicht?“, kommentiert dies im Interview der Bürgermeister einer Tourismusge-<br />
meinde, in der sich eine Unterkunft befindet – wie einige seiner Amtskollegen war er selbst<br />
auf Hörtnagl zu sprechen gekommen. „Ich muss echt schauen, dass da unten ... Ich muss in<br />
erster Linie schauen, dass man ... dass das Heim gut geführt ist ...“ 254 Als Gemeindeoberhaupt<br />
könne man es sich schlicht nicht leisten, zu sagen: „Na, da bewirb ich mich jetzt und die<br />
[Flüchtlinge; Anm. RP] tun wir da her ...“ 255 Bei einem solchen Engagement, so die<br />
unverkennbare Botschaft, drohe unweigerlich die Abwahl. Als Teil der Kommunalpolitik will<br />
daher auch er den Umgang mit den in seinem Ort lebenden Asylsuchenden nicht verstanden<br />
wissen. „Ich seh das natürlich total anders“, hält dem Hörtnagl entgegen:<br />
„Ich seh das also nicht nur so rein von der juristischen Zuständigkeit, sondern zuständig sind wir alle. Zuständig<br />
sind wir alle, und natürlich auch jede Kommune. Und wenn schon die obersten Organe der Republik, sprich der<br />
Minister, sprich der Landeshauptmann, die Bitte äußern, dass die Gemeinden – es sind ja die Gemeinden, in<br />
denen die Leut’ untergebracht werden! Jeder Bereich besteht aus Gemeinden, nicht? Jeder Flecken dieses Staates<br />
ist einer Gemeinde zugehörig. Also müssen natürlich die Gemeinden die sein, die das letztendlich durchführen<br />
dann, sonst lasst’s sich nicht machen. Nicht? Also es ist eine relativ einfache Sache, und für mich ist das eigentlich<br />
ganz klar gewesen, dass man das, wenn man als Bürger – man ist ja außerdem auch noch Bürger dieser Republik,<br />
nicht? Und schlussendlich wären wir dann von mir aus auch noch Europäer, wenn einer will, nicht? Ja,<br />
und außerdem gehören halt die Menschen auf dieser Erde alle irgendwie zusammen und müssen schauen, dass<br />
sie sich gegenseitig durchhelfen.“ 256<br />
Hörtnagl weist in aller Deutlichkeit auf das Faktum hin, dass es notwendigerweise die<br />
Gemeinden sind, in denen Asylsuchende die Zeit ihres Asylverfahrens verbringen. In mehr<br />
oder weniger alltäglichen Situationen treffen die Flüchtlinge dabei mit den übrigen Gemein-<br />
debürgerInnen zusammen. Die individuell und kollektiv jeweils realisierbare Form integrati-<br />
ven Zusammenlebens kann daher auch nur auf kommunaler Ebene gesucht und gefunden<br />
werden. Auf der Ebene der Gemeinden sind „Antworten zu finden, die sich nur zum geringe-<br />
ren Teil auf übergeordnete legistische und strukturpolitische Maßnahmen auf Bundesebene<br />
abwälzen lassen“. 257 Es spricht einiges dafür, dass es in der Praxis durchaus eine kommunale<br />
Flüchtlingspolitik gibt – auch im hier untersuchten Bereich. Die vielfältigen pragmatischen<br />
Unterstützungen passiv oder aktiv integrierend agierender Gemeinden oder die Verhinde-<br />
rungsstrategien passiv oder aktiv segregierender Kommunen liefern hierfür anschauliche Bei-<br />
spiele. Die zunächst so eindeutig erscheinende Feststellung vieler Bürgermeister, das Leben<br />
der Asylsuchenden vor Ort stelle kein kommunalpolitisch relevantes Handlungsfeld dar, hat<br />
252<br />
Der Standard 17.03.1992.<br />
253<br />
Hörtner 1992.<br />
254<br />
Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 522f.<br />
255<br />
Ebd., Z 566f.<br />
256<br />
Interview Hörtnagl 10.03.2004, Z 272-282.<br />
257<br />
Schoibl 1992, 154; vgl. Kapuy 2004.<br />
295
zudem offenkundig eher deklamatorischen Charakter: Fragt man die Gemeindeoberhäupter<br />
vorsichtig, ob nach gut sechzig Jahren mehr oder weniger kontinuierlicher Flüchtlingsauf-<br />
nahme in Österreich die Unterbringung Asylsuchender in den Gemeinden „ein Stück Norma-<br />
lität“ geworden sei, räumen die meisten nach kurzer Überlegung ein, dass dem wohl tatsäch-<br />
lich so sei, auch wenn es eigentlich anders sein sollte. „Man sollt’s zur Ausnahme machen“,<br />
bemerkt etwa der Kössener Bürgermeister Mühlberger, doch das sei wohl „ein Wunsch, der<br />
nicht erfüllbar ist“: Solange man die ganze Problematik nicht durch „gesetzliche Regelungen<br />
und durch länderübergreifende, also staatsübergreifende Zusammenarbeit mit den Behörden“<br />
in den Griff bekomme, „müssen wir es so nehmen, wie’s ist. Und das Beste draus machen.“ 258<br />
Der Götzner Bürgermeister, der sich vehement dagegen verwehrte, Asylsuchende als fakti-<br />
schen Teil kommunaler Politik zu betrachten, merkt gar an: „Die Unterbringung einer gewis-<br />
sen Anzahl von Flüchtlingen ist meiner Ansicht nach für die Gemeinde als Normalfall zu<br />
werten.“ 259 Die konkreten Erscheinungsformen dieses „Normalfalls“ als das zu bezeichnen,<br />
was sie letztlich sind – kommunale Flüchtlingspolitik –, scheint gegenwärtig jedoch noch<br />
nicht möglich. Immerhin steht dem Schreckbild des abgewählten Grieser Bürgermeisters<br />
Hörtnagl in Tirol seit Anfang 2004 das Beispiel des nicht nur nicht abgewählten, sondern<br />
sogar mit deutlichem Stimmenzuwachs wiedergewählten Landecker Bürgermeisters Engelbert<br />
Stenico gegenüber.<br />
9.16 Parteipolitik, Kirche und Honoratiorentum: Fragmentierung allerorten<br />
Welche Rolle nehmen Parteipolitik, Kirchen und lokale Eliten im Prozess der Standortreali-<br />
sierung ein? Traditionell wird diesen drei Bereichen ein erheblicher Einfluss zugeschrieben.<br />
Die jeweilige parteipolitische Konstellation, so etwa Brunner et al. in ihrer vergleichenden<br />
Studie dreier Gemeinden, spiele im Kontext der Aufnahme von Asylsuchenden in Kommunen<br />
eine „wichtige Rolle“. 260 Gleiches könne für die (römisch-katholische) Kirche und im kirchli-<br />
chen Kontext angesiedelte Gruppen und Vereine gelten: „Diese vertreten, basierend auf<br />
christlich motivierten Helfereinstellungen, eine betont flüchtlingsfreundliche Haltung.“ 261<br />
Demgegenüber betont Fuchshofer vor dem Hintergrund ihrer Untersuchung der Flüchtlings-<br />
aufnahme im Salzburger Lungau die herausragende Rolle lokaler Eliten: „Integration im vor-<br />
liegenden Ausmaß“ – die Autorin bezieht sich insbesondere auf die von einem privaten<br />
HelferInnenkreis organisierte Unterbringung in Privatunterkünften, etwa bei Familien – „hätte<br />
nicht passieren können, hätten sich nicht Personen dieses Problembereiches angenommen, die<br />
über gesellschaftliche Reputation innerhalb der Dorfgemeinschaft verfügen, die nur bis zu<br />
einem gewissen Maße kritisierbar sind, die integer sind, deren Handlungen eine gewisse Vor-<br />
bildwirkung haben, die, wenn man sich dem Verhalten aus persönlichen Gründen nicht anzu-<br />
258 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 662-666.<br />
259 Interview Payr 12.03.2004, Punkt 20.<br />
260 Brunner et al. 1998, 76.<br />
261 Ebd.<br />
296
schließen imstande ist, zumindest nicht belanglos übergangen werden können.“ 262 Auch<br />
Fuchshofer schreibt dabei insbesondere den kirchlich verankerten „HonoratiorInnen“ eine<br />
entscheidende Rolle zu.<br />
Im Fall einzelner Gemeinden, etwa in den von den genannten AutorInnen untersuchten insge-<br />
samt vier Kommunen, mögen diese Einschätzungen durchaus zutreffen, auch in Tirol sind<br />
ähnliche Beispiele zu finden. Betrachtet man indessen nicht nur ausgewählte Einzelfälle, son-<br />
dern die Gesamtheit an Unterkunftsstandorten eines Bundeslandes, so zeigt sich rasch: Die<br />
Annahme, es gäbe bereits aus ideologischen Gründen „flüchtlingsfreundliche“ (oder umge-<br />
kehrt „flüchtlingsfeindliche“) Gruppierungen auf kommunaler Ebene, beruht eher auf tradier-<br />
ten Vorstellungen und Klischeebildern, als auf der Realität. Mehrere Bürgermeister machten<br />
in den Gesprächen deutlich, dass kommunalpolitische Aktivitäten gegen Asylsuchende grund-<br />
sätzlich von allen oppositionellen Fraktionen zu erwarten sind und Auseinandersetzungen<br />
über Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung nicht primär parteipolitisch motiviert und ge-<br />
prägt sind, sondern gewissermaßen durch die „psychische Struktur“ der handelnden Personen.<br />
Diese Erfahrung musste etwa der christlichsoziale Bürgermeister einer Tiroler Tourismus-<br />
gemeinde machen: Ausgerechnet der „sozialistische“ Mandatar im Gemeinderat, erzählte der<br />
Mann verwundert im Gespräch, habe die ablehnende Haltung der Bevölkerung „ausgenützt“,<br />
dabei seien die „Sozialisten“ doch „sonst eher – was das betrifft – eher, sag ich halt jetzt ein-<br />
mal, ein bisschen aufgeschlossener“. 263 Abseits der Bühne der Kommunalpolitik lösten die<br />
lokalen Proteste im kleinen Osttiroler Grenzort Arnbach gegen die dort geplante (und ge-<br />
scheiterte) Unterkunft ähnlich irritierte Reaktionen aus: Wie an anderer Stelle bereits erwähnt,<br />
hatte sich der Obmann des Pfarrgemeinderates federführend daran beteiligt und unter anderem<br />
in seinem Garten Protestschilder („Wir setzen uns zur Wehr!!!“) aufgestellt. 264<br />
Fragmentierungen, so zeigt sich bei näherer Betrachtung, finden sich innerhalb der Parteien<br />
ebenso wie in kirchlichen und kirchennahen Gruppierungen. Nicht nur in Tirol wird die Be-<br />
deutung klassisch ideologischer Positionen – etwa jene der „christlichen Nächstenliebe“ oder<br />
jene des sozialdemokratischen „Internationalismus’“ – hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz über-<br />
schätzt. Das unterstützende oder verhindernde Engagement christlichsozialer Kommunalpoli-<br />
tikerInnen unterscheidet sich faktisch nicht von jenem sozialdemokratischer PolitikerInnen,<br />
und auch grüne oder freiheitliche MandatarInnen verhalten sich oft genug anders, als es gän-<br />
gige Typisierungen erwarten ließen. Katholisch-kirchliches Engagement in der Flüchtlings-<br />
arbeit wird in Tirol mittlerweile deutlich überschätzt: In mehreren Gemeinden berichteten die<br />
Bürgermeister, dass es private HelferInnenkreise ohne kirchliche Anbindung seien, die sich<br />
nach Bezug einer Unterkunft um die lokale Unterstützung der untergebrachten Asylsuchenden<br />
bemühten, während sich die Pfarren darauf beschränkten, Räumlichkeiten etwa für ein Weih-<br />
262 Fuchshofer 1994, 118.<br />
263 Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 19ff und 56.<br />
264 Vgl. Tiroler Tageszeitung 06.02.2003 sowie die Fotographie in Tiroler Tageszeitung 08./09.02.2003, 26.<br />
297
nachtsfest zur Verfügung zu stellen – auf Bitten der HelferInnen. Umgekehrt wird der alltäg-<br />
liche Einsatz muslimischer Moscheegemeinden insbesondere in der Landeshauptstadt notorisch<br />
unterschätzt. 265<br />
Wie das oben referierte Beispiel der Gemeinde Ehrwald zeigt, wird letztlich auch die Rolle<br />
von HonoratiorInnen aus dem Tourismusbereich unterschätzt, was angesichts der in Tirol be-<br />
trächtlichen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Branche und der vielfachen Einquartierung<br />
von Asylsuchenden in Beherbergungsbetrieben erstaunt. Jene „wichtige Innovations- und<br />
Integrationsfunktion“, die nicht nur Fuchshofer dem dörflichen (und immer männlichen)<br />
Honoratiorenpaar „Pfarrer und Lehrer“ zuschreibt 266 , ist mittlerweile wohl endgültig<br />
Geschichte. Zumindest auf kommunaler Ebene haben dies aufmerksame PolitikerInnen längst<br />
erkannt, wie die sich offenkundig an den realen Verhältnissen orientierende Zusammen-<br />
setzung der Kössener „Elitenkonferenz“ exemplarisch zeigt.<br />
9.17 »Verkehr, Asyl und Müll«. Die Unterbringung von Asylsuchenden<br />
als »Nimby-Projekt«<br />
Bei der Ressortverteilung in der Tiroler Landesregierung, so eine Journalistin der Tiroler<br />
Tageszeitung Mitte 2004, habe man das Gefühl, „dass die SPÖ mit Verkehr, Asyl und Müll<br />
jene Bereiche bekommen hat, bei denen man nur verlieren kann“. 267 Verkehr, Asyl und Müll<br />
– kein Zweifel: Die Unterbringung von Asylsuchenden stellt in der Politik ein „heißes Eisen“<br />
dar. War es 1956 noch möglich gewesen, für die zu tausenden eintreffenden ungarischen<br />
Flüchtlinge das Traiskirchener Lager mit Hilfe der Bauern aus der Umgebung in einer „Blitz-<br />
aktion“ – so der damalige Ministerialbeamte Eduard Stanek – „bewohnbar“ zu machen 268 , so<br />
fürchten heute engagierte Scharnitzer BürgerInnen den „totalen Niedergang“ ihres Ortes, in<br />
dem weniger als fünfzig Asylsuchende untergebracht werden sollen. Auch die Beschwörung<br />
des Asylland-Mythos und Appelle an die „Menschlichkeit“ und „Hilfsbereitschaft“ der Be-<br />
völkerung helfen nicht mehr weiter. Das Ergebnis ist, wie diese Untersuchung zeigt, eine<br />
Standort- und Unterbringungspolitik nach dem Muster von „Versuch und Irrtum“ – auf allen<br />
politischen Ebenen. Warum?<br />
Die »Verräumlichung« der Politik<br />
Die zunehmende Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme, Grenzverwischungen<br />
zwischen Staat und Gesellschaft wie auch zwischen europäischen, nationalen, regionalen und<br />
kommunalen Politiken, damit verbunden wachsende Interdependenzen und Verflechtungen<br />
auf vertikaler wie horizontaler Ebene sowie eine steigende Regulierungsdichte führten in der<br />
jüngeren Vergangenheit in vielen Politikfeldern zu dem, was mit Knoepfel und Kissling-Näf<br />
265 Dass es vorrangig die lokale Polizei ist, der dieses Engagement bekannt ist und die darauf auch sporadisch<br />
zurückgreift (vgl. Interview Beratung/Betreuung 12, 19.11.2004), scheint durchaus bezeichnend.<br />
266 Fuchshofer 1994, 118.<br />
267 Tiroler Tageszeitung 21.08.2004c.<br />
268 Stanek 1985, 63.<br />
298
als „Verräumlichung“ der Politik charakterisiert werden kann 269 : Raumbezogene und<br />
raumkonsumierende Politiken des Staates können immer seltener isoliert von örtlichen Kon-<br />
texten geplant und, eventuell gar gegen örtliche Widerstände, durchgesetzt werden. Die wech-<br />
selseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Ebenen des politischen Systems haben die<br />
zentralstaatlichen Handlungsmöglichkeiten deutlich verändert: Versucht der Zentralstaat seine<br />
Interventionen auf lokaler Ebene hoheitlich durchzusetzen, gefährdet er damit andere bereits<br />
erfolgreich umgesetzte Politiken – ein dafür bestehender Konsens in den jeweiligen örtlichen<br />
Gemeinschaften könnte „weiter abbröckeln und andere Zielsetzungen in Frage stellen“. 270<br />
Bringen die praktischen Auswirkungen seiner Politiken der lokalen Bevölkerung lediglich<br />
Nachteile, werden deren öffentlich-rechtliche Körperschaften eines Tages zum Gegen- oder<br />
Befreiungsschlag ausholen: „Sie werden den von ihnen kontrollierten Raum für bestehende<br />
oder neue zentralstaatliche Nutzungen ganz einfach schließen oder sperren. Damit können<br />
Großsysteme empfindlich getroffen werden, indem deren Funktionsfähigkeit an einer neural-<br />
gischen Stelle beeinträchtigt wird.“ 271 Um dies von vornherein zu verhindern, müssen zentral-<br />
staatliche Politiken daher zunehmend auf jene Räume abgestimmt werden, in denen sie kon-<br />
kret wirksam werden sollen: Sie müssen „verräumlicht“ und also in die jeweiligen lokalen<br />
Politikgewebe eingeflochten werden. Zwangsläufig sind sie damit jedoch den Transforma-<br />
tionsbestrebungen örtlicher AkteurInnen ausgesetzt. Der Zentralstaat muss daher, will er<br />
handlungsfähig bleiben, vom „oktroyierenden“ zum „verhandelnden Staat“ werden und das<br />
Einvernehmen mit den betroffenen AkteurInnen vor Ort suchen. Dieser Konsens ist jedoch<br />
eine „wertvolle, knappe und daher durch Sinnstiftung permanent zu alimentierende Res-<br />
source“ – die Verhandlungsposition des Zentralstaats zwingt seine Behörden daher dazu,<br />
„täglich neu Sinn zu stiften bzw. den Nutzen der Raumbeanspruchung und -verwendung zu<br />
rechtfertigen. Der verhandelnde Staat ist jener Staat, der nicht nur abstrakt, sondern konkret<br />
vor Ort Sinn stiftet, Verständnis für seine Belange sucht und sich durch ausgehandelte Leistungen<br />
und Gegenleistungen legitimiert.“ 272<br />
»Not in my backyard!«<br />
Zur Notwendigkeit dieser Legitimation durch Leistungen und Gegenleistungen trägt auch eine<br />
zweite raumbezogene und -konsumierende Politiken betreffende Entwicklung bei. Die<br />
Lösung sogenannter „leichter Probleme“ vorwiegend technischer Natur, so scheint es gegen-<br />
wärtig, ist in vielen Bereichen weitgehend erfolgt: Häuser, Kindergärten und Schulen sind<br />
gebaut, die Straßen asphaltiert, Abwasserkanäle verbunden, regelmäßige Über-<br />
schwemmungen durch Uferverbauungen verhindert, die Festnetztelefonie funktioniert. In den<br />
Vordergrund tritt nun zunehmend eine Kategorie von Problemen, deren Handhabung deutlich<br />
schwieriger oder gar unmöglich scheint – nicht zuletzt, weil sie die oben beschriebene Ver-<br />
269 Knoepfel/Kissling-Näf 1993.<br />
270 Ebd., 274.<br />
271 Ebd., 278.<br />
272 Ebd., 279.<br />
299
flechtung unterschiedlicher Ebenen spiegeln und sich damit einer eindeutigen Definition ent-<br />
ziehen: Wie umgehen mit den von global gehandelten harten Drogen abhängigen BürgerIn-<br />
nen? Soll die zu errichtende Eisenbahnverbindung, mit der eine Verlagerung des durch die<br />
Region führenden innereuropäischen Transitverkehrs auf die Schiene erreicht werden könnte,<br />
am Nord- oder am Südrand einer Gemeinde vorbeiführen? Wohin mit der für die ganze<br />
Region notwendigen Müllverbrennungsanlage? Und: Wo können die schon lange für die<br />
Mobiltelefonie benötigten Sendemasten errichtet werden? Die hier angeführten Beispiele so-<br />
genannter „schwieriger Probleme“ zeigen bereits: Es geht um eine Antwort auf gesamtgesell-<br />
schaftliche (und gesamtgesellschaftlich verursachte) Entwicklungen auf jener Ebene, auf der<br />
sie zwangsläufig manifest werden: auf Ebene der Gemeinden. Die gesellschaftlich erwünschte<br />
Lösung der Probleme führt auf kommunaler oder Nachbarschaftsebene jedoch zu massiven<br />
Widerständen: Gemeinde A. möchte möglichst verhindern, dass das nötige Therapiezentrum<br />
für die von harten Drogen abhängigen BürgerInnen ausgerechnet auf ihrem Gebiet errichtet<br />
wird, Gemeinde B. hält die Ansiedlung der für die Region bedeutsamen Müllverbrennungs-<br />
anlage auf kommunalem Territorium für unzumutbar. Die am Südrand von Gemeinde C.<br />
wohnenden BürgerInnen befürworten eine Trassenführung der geplanten Bahnverbindung am<br />
Nordrand des Ortes, die dortigen MitbürgerInnen protestieren heftig: „Not in my backyard!“<br />
Als Akronym gebraucht – Nimby – bezeichnet dieser empörte Ausruf zugleich jenen Wider-<br />
stand, mit dem die öffentliche Hand (und im Zuge der Privatisierungen staatlicher Einrichtun-<br />
gen und Infrastrukturen immer öfter auch private Unternehmen) bei der Errichtung gesell-<br />
schaftlich notwendiger und akzeptierter, in der jeweiligen Nachbarschaft jedoch uner-<br />
wünschter Einrichtungen konfrontiert ist. 273 Als klassische Nimby-Projekte gelten dabei Ver-<br />
kehrsprojekte wie das oben genannte Beispiel aus dem Eisenbahnbau, aber auch Straßenver-<br />
legungen und Ortsumfahrungen 274 , außerdem Umweltprojekte insbesondere aus dem erwähn-<br />
ten Bereich der Abfallentsorgung, zunehmend auch die Errichtung von Einrichtungen aus<br />
dem Telekommunikationsbereich – etwa die angesprochenen Sendemasten für die Mobiltele-<br />
fonie – sowie, eine relativ neue Erscheinung, soziale Einrichtungen. Gerade im zuletzt<br />
genannten Bereich ist die Diskrepanz zwischen gesamtgesellschaftlicher Notwendigkeit und<br />
lokalem Nutzen meist besonders groß, die Angst vor einer „negativen Kommunalisierung“<br />
des Sozialbereichs liegt daher nahe:<br />
„Im schlimmsten Fall werden die Kommunen zu Stätten der »Entsorgung« des sozialen »Mülls«, also all jener<br />
sozialen Probleme und Folgen, welche die globalisierte Welt an ihre Gestade spült, zu Stätten der »Endlagerung«<br />
der Menschen auch, welche die globalisierte Welt ausgrenzt, nicht braucht, überfordert. Europa, der Bund, die<br />
Bundesländer und all jene, die auf diesen politischen Ebenen Verantwortung tragen, können noch eher weg-<br />
273 Im deutschen Sprachraum existiert mit dem „St.-Florians-“ oder „Floriani-Prinzip“ („Lieber Sankt Florian,<br />
verschon’ mein Haus und zünd’ das and’re an!“) ein vergleichbarer Begriff, der jedoch nicht die spezifische<br />
Begriffsgeschichte des englischsprachigen Akronyms aufweist: Dem Nimby-Begriff liegen historisch jene Proteste<br />
konservativer mittelständischer anglo-amerikanischer Eigentümervereinigungen zugrunde, die sich seit den<br />
1950er Jahren in vielen Städten der USA gegen drohende „Qualitätsverluste“ im eigenen Quartier durch sozialen<br />
Wohnbau und den Zuzug sozial benachteiligter Haushalte insbesondere schwarzer MieterInnen richteten (Hanhörster<br />
2001, 94).<br />
274 Interview M. <strong>Pehm</strong> 20.09.2003.<br />
300
schauen und die sozialen Folgelasten (Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt, soziale Obdachlosigkeit) »nach unten«<br />
abschieben. Den letzten [sic!] aber beißen die Hunde.“ 275<br />
Das Gefühl, dieser Letzte zu sein, ist bereits ein Hinweis auf die Struktur „schwieriger Prob-<br />
leme“ und der damit verbundenen Nimby-Projekte: In ihnen verbinden sich normative Krite-<br />
rien wie sachpolitische Ziele, fachliche Standards und gesetzliche Regelungen mit den örtli-<br />
chen Situationen und Bedingungen und also mit konkreten Menschen, ihren Sorgen und<br />
Ängsten. Die Schwierigkeit eines Problems und der Nimby-Charakter des damit verbundenen<br />
Projekts ergeben sich letztlich aus der Diskrepanz zwischen diesen beiden Ebenen – ein sol-<br />
ches Problem, so daher Fischer, „ist nicht ein Faktum, das durch die Außenwelt gesetzt wird;<br />
vielmehr ist es ein soziales Konstrukt“, denn fachliche Standards wie auch die Definition der<br />
örtlichen Situation seien „Konstrukte, die auf sozialen Handlungen und Urteilen beruhen“. 276<br />
Konflikte rund um die Realisierung von Nimby-Projekten sind damit weder durch einseitigen<br />
Druck von PolitikerInnen und ExpertInnen, noch durch Blockadedrohungen lokaler Wider-<br />
standsinitiativen beizulegen, im Gegenteil: Die „Verräumlichung“ der Politik macht es erfor-<br />
derlich, dass die im Interesse der Gesamtgesellschaft handelnden zentralstaatlichen AkteurIn-<br />
nen Sinn und Nutzen der geplanten Raumbeanspruchung und -verwendung in „auf Augen-<br />
höhe“ verlaufenden Aushandlungsprozessen mit den örtlichen AkteurInnen legitimieren.<br />
»Sonst bringt man irgendwann gar nichts mehr weiter.« Der Umgang mit Nimby-Projekten<br />
Verkehr, Asyl und Müll: Die oben zitierte Journalistin wies mit dieser Kombination wohl un-<br />
gewollt auf die Parallelen hin, die zwischen den dahinterstehenden Politikfeldern bestehen.<br />
Wie der Bau einer Umfahrungsstraße und die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage stellt<br />
auch die Unterbringung von Asylsuchenden ein „schwieriges Problem“, die Wahl und Reali-<br />
sierung eines dafür nötigen Unterkunftsstandortes ein Nimby-Projekt dar. Die Notwendigkeit<br />
von Flüchtlingsunterkünften ist gesamtgesellschaftlich kaum bestritten, doch wird ein kon-<br />
kreter Standort ins Auge gefasst, heißt es in der Nachbarschaft: „Not in my backyard!“ Dem<br />
mit Taktiken wie der „Überrumpelung“ einer Gemeinde oder kaum erfüllbaren Andeutungen,<br />
eventuell gar Zusagen bezüglich der Höchstzahl und des Familienstands der vor Ort unterzu-<br />
bringenden Asylsuchenden zu kontern, geht offenkundig an der Struktur des Problems vorbei<br />
und produziert in den Kommunen Frustration und Wut – ideale Voraussetzungen für weitere<br />
Nimby-Auseinandersetzungen auch in anderen Bereichen und mit anderen Gemeinden, die<br />
nun vorsorglich auf eine „Politik der geschlossenen Räume“ 277 setzen und dem Unterkunfts-<br />
geber den „Zugriff“ auf von ihnen kontrollierte Gebiete offen oder verdeckt verwehren.<br />
Nimby-erfahrene VerkehrspolitikerInnen und -planerInnen haben daraus schon lange die<br />
Konsequenzen gezogen: Bei Verkehrsprojekten würden, so etwa ein vor allem im Eisenbahn-<br />
bau tätiger Tiroler Verkehrsplaner, sowohl von öffentlichen als auch privaten BetreiberInnen<br />
oder Unternehmen schon seit mehr als zehn Jahren die betroffenen Gemeinden und deren<br />
275 Dettling 1999, 18.<br />
276 Fischer 1993, 457f.<br />
277 Knoepfel/Kissling-Näf 1993, 277.<br />
301
BürgerInnen in die Planungs- und Errichtungsprozesse eingebunden. Einbindung und Infor-<br />
mation würden dabei von vornherein eingeplant – ohne sie würde man „heute gar nichts mehr<br />
bauen können, weil es inzwischen schon bei jeder noch so kleinen Umfahrungsstraße oder<br />
ähnlichen Projekten Widerstände und Proteste gibt“. 278 Mit der von Anfang an bewusst und<br />
qualifiziert durchgeführten Information und Einbindung der Gemeinden und ihrer Bevölke-<br />
rungen ließen sich die Probleme jedoch fast immer sehr gut lösen. Der Punkt sei:<br />
„Man kann das Problem gemeinsam vernünftig ausdiskutieren, eine gemeinsame Lösung finden. Die Leute<br />
sehen, man überrennt sie nicht und zieht sie nicht über den Tisch von hinten bis vorne. Der eine kriegt dann halt<br />
seine Garagenzufahrt, der andere etwas anderes, was er dringend braucht; die eine Gemeinde kriegt einen<br />
Kindergarten, bei der anderen wird halt der Gemeindesaal renoviert. Es ist heute völlig selbstverständlich, dass<br />
die öffentliche Hand oder private Unternehmen, im Eisenbahnbau zum Beispiel, das von vornherein und von sich<br />
aus machen. Da muss man nicht erst drauf hingewiesen werden, das wird schon von vornherein einkalkuliert.“ 279<br />
Ohne Information der BürgerInnen gehe „gar nichts, weil sonst machen da Gerüchte die<br />
Runde und das schaukelt sich auf, und dann bringt man irgendwann gar nichts mehr weiter“.<br />
Es sei daher wichtig, Forderungen der Bevölkerung nicht nur von vornherein zu berücksichti-<br />
gen, sondern ihre Umsetzung auch von Anfang an persönlich mit den Leuten abzustimmen.<br />
Natürlich ließen sich einige dieser Forderungen schlicht nicht realisieren, aber dann finde man<br />
eben andere Lösungen. Ginge man auf die Sorgen und Ängste der BürgerInnen erst ein, wenn<br />
man merke, dass der Widerstand zu groß sei, könne man damit verbundene Forderungen<br />
sogar Punkt für Punkt umsetzen und trotzdem „steigen die Leute nicht mehr darauf ein“:<br />
„Dann sind sie einfach schon zu sauer, da hast du keine Chance mehr.“ 280 Die gezielte Einbin-<br />
dung komme daher mittel- bis langfristig auch entscheidend billiger: „Das Betrogene ist ja, zu<br />
glauben, dass es billiger ist, wenn man auf das verzichtet. Aber bei Protesten und Wider-<br />
ständen verzögert sich das alles dermaßen, dass es am Ende viel teurer wird, als es mit professioneller<br />
Mediation und Einbindung gewesen wäre.“ 281<br />
Fehlendes Bewusstsein für ein Problem und seine Folgen<br />
Für die in dieser Arbeit untersuchten Bereiche der Standortwahl und -realisierung von Flücht-<br />
lingsunterkünften ist letztlich zu konstatieren: Das in der Praxis feststellbare Agieren des Un-<br />
terkunftsgebers legt nahe, dass sich die an verantwortlicher Stelle handelnden Personen des<br />
Nimby-Charakters der Unterbringung Asylsuchender und der sich daraus ergebenden Be-<br />
schränkungen ihres Handelns – zumal unter den Bedingungen „verräumlichter“ Politik – bis-<br />
lang kaum bewusst sind. 282 Sie halte es für wichtig, die Bürgermeister bei der Errichtung von<br />
Flüchtlingsunterkünften einzubeziehen, obwohl man natürlich ihre Zustimmung nicht benö-<br />
tige, hält etwa die zuständige Landesrätin Gangl im Gespräch fest. Aber es gäbe nun einmal<br />
278<br />
Interview M. <strong>Pehm</strong> 12.09.2004.<br />
279<br />
Ebd.; Hervorhebung im Original.<br />
280<br />
Ebd.<br />
281<br />
Ebd.<br />
282<br />
Damit bleiben auch die auf Seiten des Landes zweifellos vorhandenen Erfahrungen, Kompetenzen und<br />
Ressourcen im professionellen Umgang mit Nimby-Projekten – etwa bei im Verkehrs- oder Umweltbereich tätigen<br />
MitarbeiterInnen der Administration – ungenutzt.<br />
302
„so liebe Mitbürger und -bürgerinnen, die aus irgendwelchen Gründen Vorurteile haben,<br />
Ängste haben, die sich irgendwo aufgebaut haben, weil sie da und dort was lesen, und die<br />
dann zum Bürgermeister kommen und der dann vielleicht auch noch eher dafür ist und dann<br />
sagt: »Aber bei mir nicht!« Und dann, dann kommt etwas in Bewegung, was eigentlich den<br />
Leuten nicht gut tut, das uns im Land nicht gut tut, und daher ist das wichtig.“ 283 Für Gangl<br />
folgt aus dieser Analyse jene auf das Bild der „herbergssuchenden Familie“ setzende Strate-<br />
gie, wie sie bei der Realisierung des Landecker Standorts angewandt wurde: Dort habe man<br />
den Bürgermeister von der bevorstehenden Einrichtung der Unterkunft informiert, „nicht dass<br />
der überrascht ist und da plötzlich in einem Gasthaus, das ja vorher geschlossen war, sich jetzt<br />
da ... Leute aufhalten, die er nicht kennt“. Außerdem „war’s einfach auch gut so, dass wir<br />
sagen haben können, wir schauen jetzt einmal, dass Familien kommen“. 284<br />
Ein diesbezüglich fehlendes Bewusstsein ist jedoch auch auf kommunaler Ebene festzustellen.<br />
Lediglich eines der befragten Gemeindeoberhäupter, der Kössener Bürgermeister Stefan<br />
Mühlberger, benannte die Problematik von sich aus. Mühlberger entschloss sich unter ande-<br />
rem auch wegen des Nimby-Charakters der Unterbringung Asylsuchender, diese pragmatisch,<br />
aber durchaus offensiv selbst zu vertreten:<br />
„Wenn ich da von vornherein einigen ... Schreiern, sozusagen, das Gehör schenke und da sag: Sowas brauchen<br />
wir nicht, das ist tourismusschädlich und wir leben vom Tourismus, und ich geh her und sag: Ich will es nicht,<br />
aber ich kann dagegen ja nichts machen, die Bösen sind ja da oben, oder in Wien, nicht? Und dann werd’ ich halt<br />
auch die Stimmung eher ins Negative anheizen und diesen unter Anführungszeichen Schreiern, die’s ja immer<br />
gibt, noch mehr Gewicht verleihen. [...] Und so dämm’ ich aber die ab und sag: Ja, warum sollen wir’s erstens<br />
nicht einmal probieren, zweitens – wenn jeder so tut, das Floriani-Prinzip, das spielt sich halt nicht, und dann<br />
nehmen wir das bes-... und dann haben wir halt noch einen Betrieb, der halt zufällig in Kössen unglücklicherweise<br />
sich entschlossen hat – ja, soll ich den abmurksen? Nicht? Und dann, dann geh ich halt davon aus und sag:<br />
Na, dann machen wir das Beste draus!“ 285<br />
Auf den Vergleich der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften mit jener von Verkehrs-, Um-<br />
welt- und anderen Infrastrukturprojekten – in nahezu allen Gemeinden Bereiche, die Gegens-<br />
tand mehr oder weniger heftiger kommunalpolitischer Auseinandersetzungen waren oder sind<br />
– reagierten im Gespräch einzelne Bürgermeister jedoch so, als hätte ihnen der Hinweis eine<br />
Art „Aha-Erlebnis“ beschert, die Analogien zu vertrauten kommunalpolitischen Handlungs-<br />
feldern schienen teils neue Blickwinkel zu eröffnen. Wenn es bei gesamtgesellschaftlich not-<br />
wendigen, aber lokal keinen unmittelbaren Nutzen bringenden Infrastrukturprojekten mit<br />
Hilfe von Aushandlungsprozessen zwischen staatlichen oder regionalen und lokalen Akteur-<br />
Innen möglich ist, aus einem drohenden kommunalen „Defizitgeschäft“ ein „Geschäft auf<br />
Gegenseitigkeit“ zu machen, dann muss dies ja auch bei der Errichtung von Unterkünften für<br />
Asylsuchende möglich sein.<br />
283 Interview Gangl 09.02.2004, Z 109-113.<br />
284 Ebd., Z 114f bzw. 145f.<br />
285 Interview Mühlberger 03.11.2003, Z 404-414.<br />
303
Oktroyierend bei der Standortentscheidung, verhandelnd bei der Realisierung<br />
Dem Unterkunftsgeber ist dabei partiell durchaus Recht zu geben, wenn er – wie der zustän-<br />
dige Flüchtlingskoordinator – im Hinblick auf lokale Widerstände gegen geplante Unterkünfte<br />
bemerkt: „Ich glaub, man darf auf sowas nicht grundsätzlich Rücksicht nehmen.“ 286<br />
Auch die Gemeinden selbst halten es meist nicht für sinnvoll, dass der „verhandelnde Staat“<br />
bereits beim „Ob“ der Errichtung von Unterkünften in Erscheinung tritt: Seien die<br />
Kommunen und nicht der Unterkunftsgeber für die Grundsatzentscheidung über einen zu rea-<br />
lisierenden Standort zuständig, so würden wohl überhaupt keine Entscheidungen mehr erfol-<br />
gen. „Also gescheiter, glaub ich“, so ein Bürgermeister; „ist’s schon, wenn’s Land halt ein-<br />
fach sagt: »Okay, da müssen wir jetzt ein Haus hintun!«“ 287 Wenn die Sache bei den<br />
Kommunen landen würde, ergänzt ein anderer, „dann würd’s halt der eine auf den anderen<br />
hinschieben ...“ 288 „Grad zu viele Gremien einbinden bringt nichts“, stellt ein drittes<br />
Gemeindeoberhaupt trocken fest: „Da kommt überhaupt nichts heraus. [...] Je mehr dass da<br />
Leut’ sind, je mehr dass am Tisch sind, um so weniger kommt heraus.“ 289 In diese Richtung<br />
äußert sich auch ein weiterer Bürgermeister – nach teils heftigen Verbalattacken in durchaus<br />
versöhnlichem Ton: „Wenn das auf die Gemeinden aufgeteilt wird, oder auf Gemeinde-<br />
verbände, dann wird das nur unnötig zersplittert. Dann ist das wie bei den Tourismusver-<br />
bänden. Es braucht aber Leute, die was von der Sache verstehen, die das zentral steuern<br />
können, und die beim Land machen das gut.“ 290<br />
Anders als bei der Standortentscheidung, wo der „oktroyierende Staat“ durchaus erwünscht<br />
ist, fordern die Kommunen für die Realisierung von Unterkünften jedoch die partnerschaft-<br />
liche Ausverhandlung des „Wie“ mit den lokalen AkteurInnen – schließlich wüssten diese<br />
über die örtlichen Beschränkungen und Potentiale am besten Bescheid. Dahinter steht letztlich<br />
die durchaus berechtigte Annahme, dass eine Politik, die ihren Konzeptionsprozess „mit mehr<br />
bürokratischer als öffentlicher Partizipation durchlaufen hat, während der Implementation so<br />
modifiziert wird, daß sie den Bedingungen der »wirklichen Welt« und den Forderungen von<br />
Zielgruppen besser entspricht“. 291 Für den Unterkunftsgeber bietet sich hier die Chance, das<br />
oben angesprochene „Geschäft auf Gegenseitigkeit“ abzuschließen, die zu realisierende Un-<br />
terkunft mit konkretem Sinn und Nutzen zu verbinden, den Eindruck lokaler AkteurInnen zu<br />
verhindern, jene Letzten zu sein, welche im Sprichwort von den Hunde gebissen werden und<br />
damit den Standort tatsächlich lokal zu „verankern“. In einer seiner seltenen Stellungnahmen<br />
zur Thematik sprach der stellvertretende Landeshauptmann Hannes Gschwentner (SPÖ) Mitte<br />
2004 genau dies an, als er die Frage aufwarf, ob man nicht eventuell jene Gemeinden, die<br />
286 Interview Logar 10.10.2003, Z 399.<br />
287 Interview Bürgermeister 05/1, 2003, Z 533ff.<br />
288 Interview Erd 31.10.2003, Z 424.<br />
289 Interview Grander 06.11.2003, Z 219-222.<br />
290 Interview Bürgermeister 02/2, 2003, Z 14-17.<br />
291 Peters 1993, 301.<br />
304
Asylsuchende aufnähmen, von Landesseite „finanziell unterstützen“ solle 292 – Gschwentners<br />
Aufgabenbereich in der Landesregierung beinhaltet die klassischen „Nimby-Themen“ Ver-<br />
kehr und Umwelt. Erst mit derartigen Anreizen ist auch eine offensive Standortsuche auf<br />
kommunaler Ebene erfolgversprechend. Nötig ist dafür ein „offenes Ohr“ für die Sorgen,<br />
Ängste und Wünsche der Gemeinden und ihrer BürgerInnen. Anfang der 1990er, so der er-<br />
wähnte frühere Grieser Bürgermeister Hörtnagl, war ein solches durchaus vorhanden:<br />
„[...] das Land war ja heilfroh, ich hab nur brauchen zum [Landeshauptmann] Partl hingehen und wenn ich was<br />
wollte, hab ich alles gekriegt! Der hat die Betreuerin gezahlt, der hat ... der hat das alles gezahlt! Alles, alles ist<br />
gezahlt worden klarerweise, was wir ausgegeben haben. Wir haben zwar das meiste vorgeschossen, aber wir<br />
haben alles auf Heller und Pfennig zurückgekriegt, selbstverständlich. Die Gemeinde hat profitiert natürlich.<br />
Wenn ich sonst ein Projekt gehabt hätt’ – hätt’ ich alles durchgesetzt! Was ich wollen hätt’, hätt’ ich alles durchsetzen<br />
können. Wir haben auch einiges durchgesetzt. Das heißt also: Wir haben nur profitiert rundherum [...].“ 293<br />
Nicht nur die Ausgaben rund um die Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung wurden Hört-<br />
nagl also vom Unterkunftsgeber ersetzt, dieser zeigte sich auch offen für die Anliegen der<br />
Kommune im allgemeinen. Was Hörtnagl schildert, ist ein auf „Augenhöhe“ abgeschlossener<br />
„Deal“ mit Vorteilen für beide Seiten: Eine Gemeinde bringt für das Land als Unterkunfts-<br />
geber Asylsuchende unter und schafft dafür die sinnvoll nur auf kommunaler Ebene zu orga-<br />
nisierenden Rahmenbedingungen, das Land geht umgekehrt – soweit es in seinem Wirkungs-<br />
bereich liegt – auf die spezifischen Bedürfnisse der Gemeinde ein.<br />
10 Empfehlungen<br />
1. Nicht zuletzt aufgrund des damit verbundenen Signalcharakters sollte die Unterbringung<br />
Asylsuchender Aufgabe der öffentlichen Hand bleiben. In spezialisierten Teilbereichen,<br />
etwa bei der Unterbringung alleinstehender weiblicher Asylsuchender oder extremtrauma-<br />
tisierter Flüchtlinge, kann eine Vergabe von Unterbringung und Betreuung an einschlägig<br />
qualifizierte Organisationen oder Institutionen jedoch zu einer Entlastung des Unter-<br />
kunftsgebers wie auch zu einer Verbesserung der Situation der betroffenen Gruppen füh-<br />
ren, sie sollte daher in Erwägung gezogen werden.<br />
2. Eine einheitliche flüchtlings- und asylpolitische Linie der Tiroler Landesregierung ist<br />
dringend erforderlich. Gegenwärtig bleibt aufgrund unterschiedlicher, sich im Hinblick<br />
auf ihre Rezeption teils gar widersprechender öffentlicher politischer Positionierungen<br />
einzelner Regierungsmitglieder offen, welche Ziele der Unterkunftsgeber vertritt. Die Er-<br />
stellung eines flüchtlings- und asylpolitischen Leitbilds mit konkreten Positionen und<br />
Zielen könnte hier zur Klärung beitragen und sollte daher rasch in Angriff genommen<br />
werden.<br />
3. Diese Positionen und Zielsetzungen sollten in der Folge mit Hilfe kontinuierlicher<br />
agierender Öffentlichkeitsarbeit nach außen kommuniziert werden – der einzige Weg, um<br />
292 Tiroler Tageszeitung 21.08.2004a.<br />
293 Interview Hörtnagl 10.03.2004, Z 230-236.<br />
305
ein positives „Image“ der regionalen Flüchtlings- und Asylpolitik aufzubauen und zu er-<br />
halten, das für die Standortsuche von zentraler Bedeutung ist. Punktuell agierende Öffent-<br />
lichkeitsarbeit, wie sie 2004 bei Eröffnungen neuer Unterkünfte wiederholt praktiziert<br />
wurde, ist hierfür nicht ausreichend.<br />
4. Die klare, transparente und verbindliche Regelung des untersuchten Bereichs im Rahmen<br />
eines Landesgesetzes oder auf dem Verordnungswege, zumindest jedoch in Form eines<br />
konkreten standortpolitischen Handlungsrahmens, der sowohl strategische Leit- als auch<br />
praxisnahe Richtlinien enthält, ist unerlässlich für ein berechenbares und nachhaltiges<br />
Vorgehen der Verwaltungsebene. Als integrale Bestandteile sind dabei v.a. die Klärung<br />
der Verantwortlichkeiten und Einbindungsmodalitäten zwischen Land und Kommunen<br />
sowie ein detaillierter, transparenter Kriterienkatalog für die Standortwahl zu benennen.<br />
5. Nur durch eine verbindliche Regelung dieses Bereichs und ein deutlich stärkeres, vor al-<br />
lem auch aktiv gestaltendes Engagement der politisch Verantwortlichen ist eine Zurück-<br />
nahme der Verwaltung auf das Verwalten erreichbar – ein Ziel, das aus demokratiepoliti-<br />
schen Erwägungen ebenso wie aus Gründen der Transparenz angestrebt werden sollte.<br />
6. Auf der Ebene der konkreten Standortpolitik ist ein Abgehen von der zwecks Standort-<br />
suche gegenwärtig ausschließlich praktizierten Appell-Strategie zu empfehlen. Eine vor-<br />
ausschauende und also kontinuierliche und aktive Standortsuche ermöglicht sowohl die<br />
Zusammenstellung eines Unterkunftsangebotes nach eigenen Bedingungen (und damit<br />
eine von den UnterkunftsbesitzerInnen tatsächlich unabhängige Standortentscheidung) als<br />
auch den mittel- bis längerfristigen Aufbau von Reservekapazitäten.<br />
7. Das bezüglich der räumlichen Lage der Unterkünfte konstatierte Strukturmuster der<br />
Absonderung oder Heraushebung sollte mittels aktiver Standortsuche gezielt durchkreuzt<br />
werden. Parallel sollte ein schrittweiser Ersatz bestehender und besonders abgesonderter<br />
Standorte erfolgen, gleiches gilt möglichst auch für herausgehobene Standorte. Ziel sollte,<br />
entsprechend den Bedürfnissen der unterzubringenden Asylsuchenden wie auch den<br />
Wünschen der Bevölkerung, die Unterbringung möglichst in zentralen Räumen und nicht<br />
abseits der Wohngebiete sein. Dabei sollte v.a. auf das Vorhandensein einer lückenlosen<br />
Versorgungsstruktur geachtet werden, die eine selbständige Nutzung ermöglicht.<br />
8. Die Nutzung bestehender abgesonderter Standorte zur Disziplinierung („Mobilitätsein-<br />
schränkung“) Asylsuchender ist nicht akzeptabel.<br />
9. Bestehende Unterkünfte mit provisorischem Charakter sollten schrittweise durch dauer-<br />
hafte Lösungen ersetzt werden. Auf Containerlösungen sollte – nicht zuletzt auch auf-<br />
grund ihrer erfahrungsgemäß besonders starken Ablehnung durch AnwohnerInnen – in je-<br />
dem Fall verzichtet werden. Eine verstärkte Unterbringung in baulich in ihre Umgebung<br />
integrierten Wohnhäusern sollte aktiv angestrebt werden.<br />
10. Neben der Unterbringung in Sammelunterkünften sollte entsprechend dem Wunsch der<br />
Gemeindeführungen und der Bevölkerung ein konkretes Konzept zur Unterbringung Asyl-<br />
306
suchender in Wohngemeinschaften und Wohnungen erstellt und eine Umsetzung geprüft<br />
werden. Diesbezügliche praktische Erfahrungen liegen u.a. in Deutschland vor, auch wenn<br />
sie nicht von vornherein auf die Situation in Tirol anwendbar sind.<br />
11. Bei der Standortwahl und -realisierung sollten die Gemeinde- und Standortidentitäten<br />
stärker berücksichtigt werden, um Konflikte wie in Reith im Alpbachtal oder Scharnitz zu<br />
vermeiden, negative Bezugspunkte wie in Innsbruck-Rossau zu vermeiden und positive<br />
Anknüpfungspunkte wie in Mötz oder Vils zu nutzen.<br />
12. Die Realisierung neuer Unterkünfte sollte keinesfalls ohne Einbindung und ausführliche<br />
Information der Kommunen und Nachbarschaften vor sich gehen. Sinnvoll erscheint der<br />
Einsatz bereits erprobter Praktiken in Absprache mit den Gemeindeführungen, etwa des<br />
Kössener Modells der lokalen „Elitenkonferenz“, von BürgerInnenversammlungen unter<br />
Zuziehung professioneller MediatorInnen oder von direkten Nachbarschaftsgesprächen<br />
mit den lokalen Bürgermeistern sinnvoll.<br />
13. Von einer Nutzung lediglich kurzfristiger und häufig Frustration und Wut auf Gemeinde-<br />
seite auslösender Strategien, um die kommunale Zustimmung zu einer geplanten Unter-<br />
kunft zu erreichen, sollte in jedem Fall abgesehen werden.<br />
14. Die Realisierung neuer Unterkünfte sollte stattdessen tatsächlich als „Geschäft auf<br />
Gegenseitigkeit“ verstanden werden. Kommunen werden durch die Unterbringung Asyl-<br />
suchender vor Ort faktisch zusätzliche Arbeit und damit auch Kosten aufgebürdet, Nach-<br />
barInnen die tägliche „Integrationsarbeit“. Um den Eindruck eines „kommunalen Defizit-<br />
geschäfts Flüchtlingsunterbringung“ zu vermeiden und Kommunen zur Aufnahme und<br />
Unterbringung zu motivieren sollte der Unterkunftsgeber offensiv mit Anreizen auftreten,<br />
zumindest jedoch von vornherein und systematisch die Bedürfnisse der Gemeinden oder<br />
konkreten Nachbarschaften berücksichtigen.<br />
15. Bei der Realisierung sollte daher auch gezielt auf Konfliktprävention geachtet werden, zur<br />
Lösung bereits entstandener Konflikte sollten externe MediatorInnen eingesetzt werden.<br />
16. Die zuletzt eingeschlagene Richtung bei der Bestellung von Unterkunftsleitungen und der<br />
Begleitung der Startphase sollte fortgesetzt und weiter professionalisiert werden, insbe-<br />
sondere sollte darauf geachtet werden, dass das Personal bereits bei Eröffnung präsent ist<br />
und NachbarInnen wie Gemeinde von Anfang an für Kontaktnahmen zur Verfügung steht.<br />
307
Anhang
Abkürzungen<br />
Abg. Abgeordnete(r)<br />
Abs. Absatz<br />
Abt. Abteilung<br />
AdTLR Amt der Tiroler Landesregierung<br />
ANAR Austrian Network Against Racism<br />
Anm. Anmerkung<br />
Art. Artikel<br />
AsylG Asylgesetz<br />
Aufl. Auflage<br />
BBetrG Bundesbetreuungsgesetz<br />
BBetrVO Bundesbetreuungsverordnung<br />
Bd. Band<br />
BGBl. Bundesgesetzblatt<br />
Bgm. Bürgermeister<br />
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz<br />
ca. circa<br />
DSA Diplomierte(r) Sozialarbeiter(in)<br />
ebd. ebenda, ebendort<br />
ECRE European Council on Refugees and Exiles<br />
EG Europäische Gemeinschaft<br />
EHC European Homecare GmbH<br />
et al. et alii<br />
etc. et cetera<br />
EU Europäische Union<br />
fpd Freiheitlicher Pressedienst<br />
FOKUS Forschungsgruppe Kommunikation<br />
und Sozialanalysen<br />
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs<br />
Hg. Herausgeber(in)<br />
hg. herausgegeben<br />
HTL Höhere Technische Lehranstalt<br />
IGO International Governmental Organization<br />
ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung<br />
des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
IOM International Organisation for Migration<br />
IRO International Refugee Organisation<br />
iVm in Verbindung mit<br />
LAbg. Landtagsabgeordnete(r)<br />
LGBl. Landesgesetzblatt<br />
LH Landeshauptmann<br />
LR Landesrätin, -rat<br />
309<br />
NGO Non Governmental Organization<br />
Nr. Nummer<br />
ÖAAB Österreichischer Arbeiter- und<br />
Angestelltenbund<br />
ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund<br />
OGH Oberster Gerichtshof<br />
o.J. ohne Jahresangabe<br />
o.O. ohne Ortsangabe<br />
OÖ Oberösterreich<br />
ORF Österreichischer Rundfunk<br />
Orig. Original<br />
öS Österreichische(r) Schilling(e)<br />
ÖVP Österreichische Volkspartei<br />
OZOI ohne Zimmer, ohne Inventar<br />
PORG Privates Oberstufenrealgymnasium<br />
Red. Redaktion<br />
s.a. siehe auch<br />
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs<br />
SS Schutzstaffel der Nationalsozialistischen<br />
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)<br />
Stv. StellvertreterIn<br />
TirSHG Tiroler Sozialhilfegesetz<br />
u.a. unter anderem, und andere<br />
UNHCR United Nations High Commissioner<br />
for Refugees<br />
UNRRA United Nations Refugee Relief<br />
Administration<br />
UNRWA United Nations Relief and Works Agency<br />
for Palestine Refugees in the Near East<br />
URL Uniform Resource Locator<br />
VfGH Verfassungsgerichtshof<br />
verb. verbessert(e)<br />
vgl. vergleiche<br />
VwGH Verwaltungsgerichtshof<br />
Z Zeile, Ziffer<br />
z.B. zum Beispiel<br />
ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen,<br />
rechtlichen und kulturellen Betreuung<br />
von Ausländern und Ausländerinnen<br />
in Österreich<br />
zit. zitiert<br />
Zl. Zahl
Literatur 1<br />
1 Allgemein<br />
Abd El Farrag Nadja, Özdemir Cem, Zaimoğlu Feridun (2000): „Nie mit einem türkischen Mann“ (= Interview),<br />
in: SPIEGEL reporter (2), Februar 2000, 34-38.<br />
Achrainer Martin, Hofinger Niko (1999): Politik nach „Tiroler Art – ein Dreiklang aus Fleiß, Tüchtigkeit und<br />
Zukunftsglaube“. Anmerkungen, Anekdoten und Analysen zum politischen System Tirols 1945-1999, in:<br />
Michael Gehler (Hg.): Tirol. „Land im Gebirge“: Zwischen Tradition und Moderne, Wien–Köln–Weimar:<br />
Böhlau (= Schriftenreihe des Forschungsinstituts für politisch-historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-<br />
Bibliothek Salzburg/Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945 6/3), 27-136.<br />
Adick Christel (2001): Flüchtlinge, Globalisierung und nationalstaatliches Bildungswesen, in: epd-Entwicklungspolitik<br />
(13), 28-32.<br />
Albrich Thomas (1995): Zwischenstation des Exodus. Jüdische Displaced Persons und Flüchtlinge nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg, in: Heiss/Rathkolb 1995, 122-139.<br />
Amt der Tiroler Landesregierung (AdTLR), Abt. Raumordnung – Statistik (2004): Daten für die Tiroler Gemeinden<br />
auf einen Blick, 06.04.2004, Innsbruck: AdTLR, URL: , Dokument<br />
[22.04.2004].<br />
Andergassen Roland (2003): Dornbirns Weg in Sachen Integrationskonzept, in: Zwicklhuber 2003, 68-70.<br />
Anderson Philip (2000): Status Flüchtlingskind – Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Kindern, in:<br />
Deutsches Jugendinstitut (Hg.): Flüchtlingskinder – eine Randgruppe im multikulturellen Milieu, München:<br />
DJI (= Multikulturelles Kinderleben, Projektheft 3/2000), 2-79.<br />
Appelt Erna (2001): Demokratie oder die Kunst der Grenzziehung, in: Erna Appelt (Hg.): Demokratie und das<br />
Fremde. Multikulturelle Gesellschaften als demokratische Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Innsbruck–<br />
Wien–München: StudienVerlag (= Demokratie im 21. Jahrhundert 1), 9-23.<br />
Arnold-Öttl Helga (1988): Krippendorf Götzens, in: Baeck 1988a, 167-180.<br />
Ascher Clemens (2004): Leben am Abgrund, in: 6020 Stadtmagazin Nr. 57, 25.06.2004, 18-21.<br />
Asylanten im Armeebunker, in: Der Spiegel (21), 17.05.2004, 117.<br />
asylkoordination österreich (1995): Flüchtlingsberater auf Bestellung. Nach Wunsch des Sektionschefs, in: asylkoordination<br />
aktuell (1), 24-25.<br />
— (2000): Mehr positive Entscheidungen, in: asylkoordination aktuell (1), 19-20.<br />
— (2003): Bundesbetreuung: Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, in: asylkoordination aktuell (1), 5-7.<br />
Austrian Network Against Racism Tirol (ANAR Tirol) (2001): Vertrieben – verschoben – versteckt, in:<br />
widerst@nd!-MUND 11.06.2001.<br />
Bade Klaus Jürgen (2001): Migration und Integration von Zuwanderern in Deutschland – eine gesellschaftspolitische<br />
Bestandsaufnahme, in: Diakonisches Werk der EKD (Hg.): Integration statt Ausgrenzung. Miteinander<br />
leben im Einwanderungsland Deutschland, Stuttgart: Diakonisches Werk der EKD (= Diakonie Dokumentation<br />
05/2001), 15-20.<br />
Baeck Peter (Red.) (1988a): Götzens, Götzens: Gemeinde.<br />
— (1988b): Kriegsjahre, in: Baeck 1988a, 65-66.<br />
Baeck Peter, Soucek Branomir (1988): Vereine und Organisationen – Germ der Gemeinschaft, in: Baeck 1988a, 185-207.<br />
Balibar Etienne (1993): Die Grenzen der Demokratie, Hamburg: Argument (frz. Orig. 1992).<br />
Balzer Heinz (1990): Die Aufnahme von Flüchtlingen als Aufgabe der Kommune am Beispiel der Stadt Bielefeld,<br />
in: Reinhard G. Varchmin (Hg.): Soziale Arbeit mit Flüchtlingen. Asylbewerber in der Stadt. Erfahrungen,<br />
Informationen und Analysen aus der Praxis, Bielefeld: Böllert (= Kritische Texte), 146-166.<br />
Bauböck Rainer (2001): Föderalismus und Immigration: Fragen an die komparative Forschung, in: Lale Akgün/<br />
Dietrich Thränhardt (Hg.): Integrationspolitik in föderalistischen Systemen. Jahrbuch Migration – Yearbook<br />
Migration 2000/2001, Münster–Hamburg–Berlin–London: LIT (= Studien zu Migration und Minderheiten<br />
10), 249-272.<br />
Bauer Günther (2003): „Vertrauensbasis gestört“. Versorgung von Flüchtlingen in der Steiermark (= Interview),<br />
in: zebratl (5), 10-11.<br />
Bauhardt Christine (2003): Ways to Sustainable Transport: Gender and Mobility, in: Ulla Terlinden (ed.): City<br />
and Gender. International Discourse on Gender, Urbanism and Architecture, Opladen: Leske + Budrich (=<br />
Schriftenreihe der Internationalen Frauenuniversität „Technik und Kultur“ 12), 209-227.<br />
1 Alle Internet-Quellen wurden, sofern nicht anders vermerkt, zuletzt am 15.02.2005 abgerufen.<br />
310
Beck Ulrich (1996): Wie aus Nachbarn Juden werden. Zur politischen Konstruktion des Fremden in der reflexiven<br />
Moderne, in: Max Miller/Hans-Georg Soeffner (Hg.): Modernität und Barbarei. Soziologische Zeitdiagnose<br />
am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 318-343.<br />
Bednarzek Wolfgang (2001): Bundesbetreuung: Hilfsorganisationen fordern Recht auf Grundversorgung, in:<br />
asylkoordination aktuell (2), 10-15.<br />
Beermann Victor, Rosenmayr Stefan (1988): Die Asyl- und Flüchtlingspolitik Österreichs in der Zweiten Republik,<br />
in: Andreas Khol /Günther Ofner/Alfred Stirnemann (Hg.): Österreichisches Jahrbuch für Politik 1987,<br />
Wien–München: Verlag für Geschichte und Politik/Oldenbourg, 481-507.<br />
Berg Ulrike (2000): Flüchtlingskinder in multikulturellen Stadtvierteln – Ergebnisse einer Kinderbefragung, in:<br />
Deutsches Jugendinstitut (Hg.): Flüchtlingskinder – eine Randgruppe im multikulturellen Milieu, München:<br />
Deutsches Jugendinstitut (= Multikulturelles Kinderleben, Projektheft 3/2000), 80-99.<br />
Berghold Josef (2002): Feinbilder und Verständigung. Grundfragen der politischen Psychologie, Opladen: Leske<br />
+ Budrich.<br />
— (2004): Die globale Gesellschaft. Psychologische Herausforderungen und Hindernisse, in: Ludwig Janus/<br />
Winfried Kurth (Hg.): Psychohistorie und Politik, Heidelberg: Mattes (= Jahrbuch für psychohistorische Forschung<br />
4), 47-69.<br />
Berktold Elmar (2002a): Infrastrukturen in ländlichen Regionen – Fakten und Meinungen, in: ro-info Nr. 24,<br />
Dezember 2002, 25-29.<br />
— (2002b): Ist die Versorgung im ländlichen Raum gefährdet?, in: ro-info Nr. 23, Juli 2002, 12-15.<br />
Bidner Christian (2004): Asylfrage ist eine Gratwanderung, in: Tiroler Tageszeitung 06.09.2004, 4.<br />
Bisanz Harald (2004): Achtung: Menschenrechte!, in: ai-info (4), 31.<br />
Blecha Karl (1987): Eröffnung durch den Bundesminister für Inneres Karl Blecha, in: Renner-Institut/Europäisches<br />
Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter/amnesty international (Hg.): Asylrecht ist<br />
Menschenrecht. Internationales Symposium in memoriam Christian Broda, Wien–Basel: C.E.D.R.I., 13-19.<br />
Bodemar Staffan (1994): Asylpolitik in Österreich – Programmatische Erklärungen und Flüchtlingsalltag, in:<br />
Andreas Khol/Günther Ofner/Alfred Stirnemann (Hg.): Österreichisches Jahrbuch für Politik 1993, Wien–<br />
München: Verlag für Geschichte und Politik/Oldenbourg, 653-668.<br />
Bojadžijev Manuela, Karakayali Serhat, Tsianos Vassilis (2003): Papers and Roses. Die Autonomie der Migration<br />
und der Kampf um Rechte, o.O.: Kanak Attack, URL: ,<br />
zuerst in: Theo Bruns/Moe Hierlmeier/Alexander Schudy/Markus Wissen (Hg.): radikal global. Bausteine für<br />
eine internationalistische Linke, Berlin: Assoziation A, 196-208.<br />
Brechelmacher Angelika (2003): Wen meint der Minister?, in: asyl aktuell (3), 7-8.<br />
Brickner Irene (2003): Asylgesetz: Der Bruch geht tief. Innenminister Strasser auf Konfrontationskurs mit Zivilgesellschaft<br />
und Opposition, in: Der Standard 16.10.2003, 38.<br />
— (2004a): Asylprojekt Sisyphus, in: Der Standard 16.09.2004, 40.<br />
— (2004b): Strasser in Blau, in: Der Standard 20./21.11.2004, 40.<br />
Brickner Irene, Möseneder Michael (2003): Kontroversen um Traiskirchen, in: Der Standard 16./17.08.2003, 8.<br />
Brunner Karl-Michael, Egger-Steiner Michaela, Hlavin-Schulze Karin, Lueger Manfred (1998): Flüchtlingsintegration<br />
in Kleingemeinden, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 23 (1), 73-81.<br />
— (2003): Flüchtlingsaufnahme in Kleingemeinden, Wien: Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie<br />
der Wirtschaftsuniversität Wien, 22.08.2003, URL: .<br />
Brunner Karl-Michael, Jost Gerhard, Lueger Manfred (1994): Zur Soziogenese von Akzeptanz und Integration:<br />
eine Gemeindestudie zur Beziehung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, in: Österreichische Zeitschrift<br />
für Politikwissenschaft 23 (3), 315-329.<br />
Bundesministerium für Inneres, Sektion III (Hg.) (1993): Das Bundesasylamt. Eine Behörde stellt sich vor,<br />
Wien: Bundesministerium für Inneres.<br />
Bürstmayr Georg (2003): Die doppelte Republik? Warum ein kleiner Passus im neuen Bundesbetreuungsgesetz<br />
für den Wirtschaftsstandort Österreich fatale Folgen haben könnte, in: Der Standard 22.10.2003, 35.<br />
Bußjäger Peter (2004): Gemeindezusammenarbeit – eine neue Aufgabe für die Gemeinden? Erleichterungen<br />
wären angebracht, in: KOMMUNAL (4), April 2004, 12-15.<br />
Çakır Murat (2002): Die Paternalistischen Stellvertreter. Einige Gedanken über den heißumkämpften Markt der<br />
Betreuungsobjekte, in: Kozmopolit – Deutsch-Türkisches Online-Magazin für Politik, Kunst und Kultur Nr. 15,<br />
Ekim/Oktober 2002, URL: .<br />
Caramelle Franz (1979): Sakrale Kunst in Fieberbrunn, in: Werner Köfler (Red.): Fieberbrunn. Geschichte einer<br />
Tiroler Marktgemeinde, Fieberbrunn: Marktgemeinde, 247-312.<br />
— (1988): Kirchen und Kapellen, in: Baeck 1988a, 149-166.<br />
Caritas Flüchtlingsstelle (2003): Jahresbericht 2002, Innsbruck: Caritas der Diözese Innsbruck.<br />
311
Carstens Uwe (1992): Die Flüchtlingslager der Stadt Kiel. Sammelunterkünfte als desintegrierender Faktor der<br />
Flüchtlingspolitik, Marburg: Elwert (= Schriftenreihe der Kommission für ostdeutsche Volkskunde 62).<br />
Coudenhove-Kalergi Barbara (2004): Symbol Traiskirchen, in: Der Standard 18.10.2004, 23.<br />
Dangschat Jens (1998): Warum ziehen sich Gegensätze nicht an? Zu einer Mehrebenen-Theorie ethnischer und<br />
rassistischer Konflikte um den städtischen Raum, in: Wilhelm Heitmeyer/Rainer Dollase/Otto Backes (Hg.):<br />
Die Krise der Städte. Analysen zu den Folgen desintegrativer Stadtentwicklung für das ethnisch-kulturelle<br />
Zusammenleben, Frankfurt am Main: Suhrkamp (= Kultur und Konflikt), 21-96.<br />
— (2001): Raum als Aspekt und Ursache von Armut, in: Die Armutskonferenz (Hg.): „Und raus bist Du ...!“<br />
Soziale und räumliche Ausgrenzung – inmitten einer reichen Gesellschaft. 4. Österreichische Armutskonferenz<br />
23-24. Oktober 2000 (Dokumentation), Wien: Die Armutskonferenz, 7-15.<br />
David Dieter (2002): Situation von psychisch kranken Flüchtlingen in Stuttgart. Psychische Störungen und Erkrankungen<br />
bei Flüchtlinge, in: Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Soziales, Jugend und Gesundheit<br />
(Hg.): 21. Stuttgarter Flüchtlingsbericht, Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart, 13-16.<br />
Demirović Alex (1995): Die Transformation des Wohlfahrtsstaats und der Diskurs des Nationalismus, in:<br />
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Hg.): Fremdenfeindlichkeit. Konflikte um die<br />
groben Unterschiede. Symposium zur Entwicklung eines Forschungsprogrammes, Wien: bm:wfk, 125-157.<br />
Derviškadić Jovanović Sanja, Mikuš Kos Anica (1999): What Can Mental Health Professionals Do to Help Refugee<br />
Families – Let Us Be Realistic, in: Reiner Buchegger (Hg.): Migranten und Flüchtlinge: eine familienwissenschaftliche<br />
Annäherung, Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung (= Schriftenreihe 8), 185-202.<br />
Dettling Warnfried (1999): Demokratie von unten. Die Wiedergewinnung des Sozialen aus den Wurzeln der<br />
Gesellschaft, in: Kai Leichsenring/Barbara Rosenberg (Hg.): Soziale Lösungen vor Ort. <strong>Neue</strong> Wege in der<br />
kommunalen Sozialpolitik, Wien: Renner-Institut, 17-20.<br />
Deutschmann Annika (2003): Kinder und Jugendliche in staatlichen und kommunalen Flüchtlingsunterkünften:<br />
Am Beispiel der kommunalen Unterkunft für Asylbewerber und jüdische Kontingentflüchtlinge Asperger<br />
Straße im Stadtbezirk Stammheim, in: Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Soziales, Jugend und Gesundheit<br />
(Hg.): 22. Stuttgarter Flüchtlingsbericht, Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart, 9-11.<br />
Die Initiative für die Rechte von Flüchtlingen (2003): Weltflüchtlingstag 2003: Existenzsicherung für Flüchtlinge<br />
– jetzt!, Innsbruck, 16.06.2003 (vervielfältigtes Informationsblatt).<br />
Dimmel Nikolaus (1999): Nutzen und Risiken der Auslagerung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, in: erziehung<br />
heute (1), 27-31.<br />
Diner Dan (1992): Gute alte Zeit, in: Wilhelm von Sternburg (Hg.): Für eine zivile Republik. Ansichten über die<br />
bedrohte Demokratie in Deutschland, Frankfurt am Main: Fischer, 75-78.<br />
Dörhöfer Kerstin, Terlinden Ulla (Hg.) (1985): Verbaute Räume. Auswirkungen von Architektur und Stadtplanung<br />
auf das Leben von Frauen, Köln: Pahl-Rugenstein (= Hochschulschriften Gesellschafts- und Naturwissenschaften<br />
200/Frauenstudien 1).<br />
Dorninger Christian (2003a): Flüchtlingsarbeit von Familie Schobesberger in Tirol, Hagenberg, Winter<br />
2002/2003, (= Freundesbrief 20022.1); URL: .<br />
— (2003b): Flüchtlingsarbeit von Werner (aus OÖ) & Lisa Schobesberger in Tirol, Hagenberg, Herbst 2003 (=<br />
Freundesbrief 20022.2); URL: .<br />
— (2003c): „Flüchtlingsarbeit“ aus Tirol, Hagenberg, Herbst 2003 (= Freundesbrief 20022.3); URL:<br />
.<br />
— (2004): <strong>Neue</strong>s von der „Flüchtlingsarbeit“ aus Tirol, Hagenberg, undatiert (= Freundesbrief 20022.4); URL:<br />
.<br />
Dünnwald Stephan (2002): Die BRD als Lagergesellschaft, in: Infodienst [Bayerischer Flüchtlingsrat] (2), 27-39.<br />
Ebermann Erwin (2003): Afrikaner im Denken der Österreicher, in: Erwin Ebermann (Hg.): Afrikaner in Wien.<br />
Zwischen Mystifizierung und Verteufelung. Erfahrungen und Analysen, 2. Aufl., Münster–Hamburg–<br />
London: LIT (= Afrika und ihre Diaspora 3), 50-69.<br />
Egger Andreas (1991): Flüchtlinge in Tirol, in: Gesellschaft für Politische Aufklärung/Verein zur Betreuung und<br />
Beratung von AusländerInnen in Tirol (Hg.): AusländerInnen: Integration oder Assimilierung?, Innsbruck:<br />
StudienVerlag, 142-146.<br />
— (1995): Der stille Tod in der Kälte der Fremde oder: Die Konstruktion des Asylwerbers als eine gesellschaftliche<br />
Bedrohung, in: Gerhard Hetfleisch/Franko Petri/Sabine Wartha (Hg.): Das österreichische Ausländerrecht.<br />
Ein praktischer Wegweiser mit kritischen Betrachtungen, Wien: WUV, 202-214.<br />
Einflüsse von außen. Es herrschte Angst. Stärker als in den Jahren zuvor wurde die Politik zum Gegenstand des<br />
Alltages, der Beratung und der Fragen der KlientInnen, in: zebratl (1), 2001, 23.<br />
Eisterer Klaus (1992): Französische Besatzungspolitik. Tirol und Vorarlberg 1945/46, Innsbruck: Haymon (=<br />
Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte 9).<br />
Elias Norbert, Scotson John L. (1993): Etablierte und Außenseiter, Frankfurt am Main: Suhrkamp (engl. Orig. 1965).<br />
312
Engelke Edda, Kerschbaumer Gertrud (1999): Flüchtlinge in fortgeschrittenem Lebensalter in der Steiermark, in:<br />
Gerald Schöpfer (Hg.): Seniorenreport Steiermark. Altwerden in der Steiermark: Lust oder Last?, Graz:<br />
Arbeitsgemeinschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 277-295.<br />
Erian Erika (2002): Veränderung von Xenophobie und ethnischen Vorurteilen durch Konfrontation mit dem<br />
Fremden. Feldforschung in einem Dorf mit einem Asylantenheim, Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität<br />
Klagenfurt (unveröffentl. Diplomarbeit am Institut für Psychologie).<br />
Fischer Frank (1993): Bürger, Experten und Politik nach dem „Nimby“-Prinzip: Ein Plädoyer für die partizipatorische<br />
Policy-Analyse, in: Adrienne Héritier (Hg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung, Opladen:<br />
Westdeutscher Verlag (= Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 24), 451-470.<br />
Fleischhacker Michael (2004): Zwischen Konsequenz und Grobheit, in: Die Presse 11.12.2004, 2.<br />
Forschungsgruppe Kommunikation und Sozialanalysen (FOKUS) (1994): Probleme und Problemlösungsstrategien<br />
bei der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in Nachbarschaft zu Einheimischen,<br />
Düsseldorf: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.<br />
Foucault Michel (1990): Andere Räume, in: Karlheinz Barck/Peter Gente/Heidi Paris/Stefan Richter (Hg.):<br />
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais, 3. Aufl., Leipzig: Reclam,<br />
34-46 (frz. Orig. 1987).<br />
Frankenberg Ruth (1996): Weiße Frauen, Feminismus und die Herausforderung des Antirassismus, in: Brigitte<br />
Fuchs/Gabriele Habinger (Hg.): Rassismen & Feminismen. Differenz, Machtverhältnisse und Solidarität<br />
zwischen Frauen, Wien: Promedia, 51-66.<br />
Freithofer Elisabeth (2002): Ausbildung und Arbeit, in: Heinz Fronek/Irene Messinger (Hg.): Handbuch unbegleitete<br />
minderjährige Flüchtlinge. Recht, Politik, Praxis, Alltag, Projekte, Wien: Mandelbaum, 122-137.<br />
Friedrich Max (1999): Plötzlich ist die Geborgenheit weg (= Interview), in: asylkoordination aktuell (2), 24-29.<br />
Fronek Heinz (2003): Willkürlich und gnadenhalber, Wien: asylkoordination österreich, URL: .<br />
— (2004a): Draußen vor der Tür. Erzwungene Untätigkeit während der jahrelangen Verfahren ist eines der<br />
größten Probleme für Flüchtlinge, in: KOMPETENZ (9), 06.09.2004, 26-27.<br />
— (2004b): Hoffen und bangen, in: asyl aktuell (1), 17-19.<br />
Fuchshofer Rosmarie (1994): Asylwerber und ländlicher Raum. Soziale Hilfspotentiale und dörfliche Problemlösungsressourcen<br />
zur Integration von Asylbewerbern im ländlichen Raum am Beispiel des Salzburger<br />
Lungaues, Salzburg: Paris-Lodron-Universität (unveröffentl. Diplomarbeit am Institut für Kultursoziologie).<br />
Gangl Christa (2004): Flucht in den Container, in: Tiroler Tageszeitung 15./16.05.2004, Magazin, 2.<br />
Gärtner Reinhold (1990): Götzens: Zur Behandlung von Ausländern, in: Informationen der Gesellschaft für<br />
politische Aufklärung Nr. 25, Juni 1990, 13-14.<br />
— (1991): Einleitung, in: Gesellschaft für Politische Aufklärung/Verein zur Betreuung und Beratung von AusländerInnen<br />
in Tirol (Hg.): AusländerInnen: Integration oder Assimilierung?, Innsbruck: StudienVerlag, 5-7.<br />
Gazić Dženana (1999): Erzwungene Migrationsprozesse und ihre Folgen. Die psychologische Betreuung von<br />
Flüchtlingsfamilien. Ein Bericht aus der Praxis, in: Rainer Dollase/Thomas Kliche/Helmut Moser (Hg.)<br />
(1999): Politische Psychologie der Fremdenfeindlichkeit. Opfer – Täter – Mittäter, Weinheim–München:<br />
Juventa (= Konflikt- und Gewaltforschung), 109-115.<br />
Gebauer Guido F., Taureck Bernhard H. F. , Ziegler Thomas (1993): Der wahre Mißbrauch des Asylrechts, in:<br />
Guido F. Gebauer/Bernhard H. F. Taureck/Thomas Ziegler: Ausländerfeindschaft ist Zukunftsfeindschaft.<br />
Plädoyer für eine kulturintegrative Gesellschaft, Frankfurt am Main: Fischer, 92-100.<br />
Gehler Michael (2004): Aufbrüche zur Postmoderne. Die Amtszeit von Tirols Landeshauptmann Wendelin<br />
Weingartner 1993-2002, in: Ferdinand Karlhofer/Anton Pelinka (Hg.): Politik in Tirol, Innsbruck–Wien–<br />
München–Bozen: StudienVerlag, 245-275.<br />
Gemeindebund beharrt auf Bürgermeister-Zustimmung: Gespräche auf Landesebene gefordert, in:<br />
KOMMUNAL (4), April 2004, 10.<br />
Genner Michael (1995): Rücktritt!, in: asylkoordination aktuell (1), 29-31.<br />
Gerzabek Rainer (2003): Gerechtere Sozialhilfe & Erhalt der Frühpensions-Möglichkeit!, in: Tiroler Landeszeitung<br />
(1), März 2003, 4.<br />
— (2004): „Straffällig gewordene Asylwerber unverzüglich abschieben!“, in: Tiroler Landeszeitung (6), Dezember<br />
2004, 23.<br />
Ghaderi Cinur (2004): Psychosoziale Versorgungsstruktur von Kurdinnen – schwierige Kommunikation?, in:<br />
FLÜCHTLINGSRAT – Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in Niedersachsen Nr. 99 (Sonderheft), Oktober<br />
2004, 78-84.<br />
Girardi Michael (2004): Bund nimmt auf, Länder kümmern sich um Unterbringung. Gemeinden fordern Mitspracherecht,<br />
in: KOMMUNAL (4), April 2004, 8-10.<br />
Glanzer Edith (1997): Asylgesetz 1997: Die Scheinnovelle, in: asylkoordination aktuell (2), 8-13.<br />
313
— (1998): Vollständig entwurzelt ... Zur rechtlichen und sozialen Situation von Flüchtlingskindern und -jugendlichen<br />
in Österreich, in: asylkoordination aktuell (2), 4-9.<br />
Goffman Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Frankfurt<br />
am Main: Suhrkamp (amerik. Orig. 1961).<br />
Gombos Georg, Gruber Christiane, Teuschler Christine (Hg.) (1992): „... und da sind sie auf einmal dagewesen.“<br />
Zur Situation von Flüchtlingen in Österreich. Beispiel Rechnitz, Oberwart: edition lex liszt 12.<br />
Graessner Sepp (1996): 200 Schläge auf den Kopf – Möglichkeiten und Grenzen der Beurteilung von körperlichen<br />
Folterfolgen, in: Sepp Graessner/Norbert Gurris/Christian Pross (Hg.): Folter. An der Seite der Überlebenden.<br />
Unterstützung und Therapien, München: Beck (= Beck’sche Reihe 1183), 200-218.<br />
Grbic Monika, Glanzer Edith, Gulis Wolfgang (1998): Ende einer Aktion. Was von der humanitären Aktion<br />
übrigblieb, in: asylkoordination aktuell (3), 19-22.<br />
Groß Jessica (2000): Zur gesundheitlichen Versorgung minderjähriger Flüchtlinge, in: FLÜCHTLINGSRAT –<br />
Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in Niedersachsen Nr. 68, Mai 2000, 12-16.<br />
Grünbein Durs (1992): Demokratie als Plebsokratie, in: Wilhelm von Sternburg (Hg.): Für eine zivile Republik.<br />
Ansichten über die bedrohte Demokratie in Deutschland, Frankfurt am Main: Fischer, 114-116.<br />
Guggenbichler Josef (1991): Kössen. Unser Heimatbuch, Kössen: Gemeinde.<br />
Gulis Wolfgang (2002): Richtlinien zum Ausschluss, in: zebratl (4), 4-5.<br />
— (2003a): Editorial, in: zebratl (2), 2.<br />
— (2003b): Orte der Integration?, in: zebratl (5), 12-13.<br />
Güngör Kenan, Ehret Rebekka (2002): Integrationsleitbild der Stadt Dornbirn mit Maßnahmenplan, Basel,<br />
30.10.2003.<br />
Hallson Fridrik (1996): Lebensweltliche Ordnung in der Metropole. Ethnische Konfliktpotentiale, Demarkationslinien<br />
und Typisierung von Ausländern im Frankfurter Gallusviertel, in: Wilhelm Heitmeyer/Rainer<br />
Dollase (Hg.): Die bedrängte Toleranz. Ethnisch-kulturelle Konflikte, religiöse Differenzen und die Gefahren<br />
politisierter Gewalt, Frankfurt am Main: Suhrkamp (= Kultur und Konflikt), 271-312.<br />
Hanhörster Heike (2001): Integration von Migrantinnen und Migranten im Wohnbereich, Dortmund: Institut für<br />
Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (= ILS-Schriften 180).<br />
Hannikainen Lauri (2004): Legal Position of Asylum Seekers in Austria, Graz: ETC (= Occasional Papers Series 15).<br />
Hechenbichler Josef (1991): Vorwort des Bürgermeisters, in: Guggenbichler 1991, 9.<br />
Heckmann Friedrich (1998): Ethnische Kolonien: Schonraum für Integration oder Verstärker der Ausgrenzung?,<br />
in: Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Arbeit und Sozialpolitik (Hg.): Ghettos oder ethnische<br />
Kolonien? Entwicklungschancen von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil, Bonn: Friedrich-Ebert-<br />
Stiftung (= Gesprächskreis Arbeit und Soziales 85), 29-41.<br />
Heiss Gernot, Rathkolb Oliver (Hg.) (1995): Asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen<br />
Kontext seit 1914, Wien: J&V/Edition Wien/Dachs (= Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts<br />
für Geschichte und Gesellschaft 25).<br />
Hennefeld Gertrude (1995): Auf der Flucht und obdachlos. Hinter der restriktiven Aufnahme von Asylwerbern in<br />
die Bundesbetreuung stehen zahlreiche menschliche Schicksale, in: Der Grüne Klub im Parlament (Hg.): Die<br />
negative Bilanz. Drei Jahre Asylgesetz: Praxis, Mängel, Reformvorschläge, Wien: Der Grüne Klub im Parlament,<br />
16-20.<br />
Hennig Claudius, Kremsner Wolfgang, Paul Hari, Weng Günther (1982): Die psychische Situation der Asylbewerber<br />
aus der Dritten Welt im Sammellager Tübingen, in: Claudius Hennig/Siegried Wießner (Hg.):<br />
Lager und menschliche Würde. Die psychische und rechtliche Situation der Asylsuchenden im Sammellager<br />
Tübingen, Tübingen: AS, 19-71.<br />
Heubacher Anita (2004a): Druck auf die Dorfchefs, in: Tiroler Tageszeitung 16.06.2004, 4.<br />
— (2004b): Landtag wird zur Farce, in: Tiroler Tageszeitung 18./19.12.2004, 6.<br />
Himmelbauer Markus (1994): Mitbewohner – Mitbürger. Beispiele kommunaler Ausländerpolitik in Österreich,<br />
Wien: Renner-Institut.<br />
Hink Robert (2004): Kleine Gemeinden – sparsame Verwaltung, in: KOMMUNAL (4), April 2004, 26-27.<br />
Hohlrieder Christian (2003): Die Gemeinde Reith im Alpbachtal im Wandel der Zeit, Innsbruck: Leopold-<br />
Franzens-Universität (unveröffentl. Diplomarbeit am Institut für Geographie).<br />
Hondrich Karl-Otto (1996): Die Nicht-Hintergehbarkeit von Wir-Gefühlen, in: Wilhelm Heitmeyer/Rainer<br />
Dollase (Hg.): Die bedrängte Toleranz. Ethnisch-kulturelle Konflikte, religiöse Differenzen und die Gefahren<br />
politisierter Gewalt, Frankfurt am Main: Suhrkamp (= Kultur und Konflikt), 100-118.<br />
Hörmann Helmut (2001): Die Wallfahrt Maria Hilf am Locherboden in Mötz 1740-2001, Mötz: Römisch-<br />
Katholisches Pfarramt.<br />
Hörtner Werner (1992): Flüchtlinge als Abwahlhelfer?, in: Südwind (5), 6-7.<br />
Horst-Wundsam Eva (2002): Mühsamer Weg zur Demokratie: Tirol hilft Indjija, in: Tiroler Landeszeitung (2), 4-5.<br />
Huber Andrea (2003): § 1: Österreich gewährt kein Asyl, in: ai-info (3), 12-13.<br />
314
Huber Andrea, Öllinger Robert, Steiner Manuela (1998): Handbuch der Flüchtlingsberatung, Wien: amnesty<br />
international Österreich.<br />
Jäger Torsten: (2002): They don’t need no Education? Flüchtlinge und Bildung, in: Zeitschrift für internationale<br />
Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 25 (2), 2-9.<br />
John-Onyeali Brigitte (2003): Auswirkungen von häufigem Wohnort- und Schulwechsel. Am Beispiel der<br />
Familie B., in: Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Hg.): 22. Stuttgarter<br />
Flüchtlingsbericht, Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart, 15-17.<br />
Johnston-Arthur Araba Evelyn (2002): Operation Justice. Widerstandsstrategien gegen Rassismus, in: ZEBRA<br />
(Hg.): „Schwarze Schafe?“ Strategien gegen Diskriminierung – Österreich im EU-Vergleich. Dokumentation<br />
der Tagung am 15.06.2002, Graz: ZEBRA (= zebratl Spezial), 12-15.<br />
— (2003): Schwarze Oppositionen und andere Differenzen, in: planet Nr. 28, 6.<br />
Jormakka Kari, Kuhlmann Dörte (2002): Theorien und Geschichten über Geschlechterkonstruktionen, in: Dörte<br />
Kuhlmann/Kari Jormakka (Hg.): Building Gender. Architektur und Geschlecht, Wien: edition selene (= atheory),<br />
6-27.<br />
Junghanss Thomas (1999): Die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten: Realität und Perspektiven, in:<br />
Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Hg.): Migration und Gesundheit. Perspektiven der Gesundheitsförderung<br />
in einer multikulturellen Gesellschaft, Dokumentation der Fachtagungsreihe „Gesund in eigener<br />
Verantwortung?“, 2. Fachtagung 19./20.11.1999, Dresden: DHMD, URL: .<br />
Kallus Rachel (2003): Gender Reading of the Urban Space, in: Ulla Terlinden (ed.): City and Gender. International<br />
Discourse on Gender, Urbanism and Architecture, Opladen: Leske + Budrich (= Schriftenreihe der Internationalen<br />
Frauenuniversität „Technik und Kultur“ 12), 105-129.<br />
Kampagne zur Verteidigung politischer und sozialer Rechte (2001): Operation Spring. Der Polizeistaat lässt<br />
grüßen, Wien: Kampagne zur Verteidigung politischer und sozialer Rechte.<br />
Kapuy Klaus (2004): The Relevance of the Local Level for Human Security, in: Human Security Perspectives 1<br />
(1), 1-6.<br />
Karlegger Ingrid (1996): Die Lebenssituation von Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen zwischen Unsichtbarkeit<br />
und Pathologisierung, in: Lueger-Schuster 1996a, 66-82.<br />
Kayed Christian, Lechleitner Daniela, Schlichtmeier Verena, Wolf Kozeta (2002): Flüchtlinge in Innsbruck. Ein<br />
Stadtrundgang, in: Lisa Gensluckner/Horst Schreiber/Ingrid Tschugg/Alexandra Weiss (Hg.): Innsbruck –<br />
StattLeben, Innsbruck–Wien–München–Bozen: StudienVerlag (= Gaismair-Jahrbuch 2003), 21-34.<br />
Keller Wilfried (1989): Lage und Naturraum, in: Marktgemeinde Reutte (Hg.): Reutte. 500 Jahre Markt. 1489-<br />
1989, Reutte: Marktgemeinde, 15-26.<br />
Klocker Beate (1996): Wenn die Kinder für die Eltern sprechen – Rollenumkehr, in: Lueger-Schuster 1996a, 92-105.<br />
Knapp Anny (1994): Rekordtief an AsylwerberInnen, in: asylkoordination aktuell (2), 45-46.<br />
— (1995a): Das Asyl- und Bundesbetreuungsgesetz, in: Gerhard Hetfleisch/Franko Petri/Sabine Wartha (Hg.):<br />
Das österreichische Ausländerrecht. Ein praktischer Wegweiser mit kritischen Betrachtungen, Wien: WUV,<br />
166-176.<br />
— (1995b): Kommt die Asylgesetznovelle?, in: asylkoordination aktuell (1), 17-19.<br />
— (1998a): Die neue Gesetzeslage: Weiterhin düster mit einigen Aufhellungen, in: asylkoordination aktuell (1),<br />
4-9.<br />
— (1998b): Zahlen – Fakten. Aus der Jahresstatistik des BMI, in: asylkoordination aktuell (1), 50-51.<br />
— (2001a): Asylwerberstatistik 2000, in: asylkoordination aktuell (1), 46-49.<br />
— (2001b): Provisorisches Leben, in: asylkoordination aktuell (2), 16-19.<br />
— (2002): 2001 Spitzenwert bei Asylanträgen, in: asylkoordination aktuell (1), 34-36.<br />
Knoepfel Peter, Kissling-Näf Ingrid (1993): Transformation öffentlicher Politiken durch Verräumlichung –<br />
Betrachtungen zum gewandelten Verhältnis zwischen Raum und Politik, in: Adrienne Héritier (Hg.): Policy-<br />
Analyse. Kritik und Neuorientierung, Opladen: Westdeutscher Verlag (= Politische Vierteljahresschrift,<br />
Sonderheft 24), 267-288.<br />
Kobenter Samo (2003): Rechts auf die Pauke gehaut. Mit dem Asylgesetz besorgt Minister Strasser einmal mehr<br />
die Geschäfte der FPÖ, in: Der Standard 24.10.2003, 32.<br />
Koch Dietrich F. (2001): Stand des Wissens über Traumatisierungen bei Flüchtlingen, in: REFUGIO (Hg.):<br />
Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Dokumentation eines Tagesseminars in Schleswig-Holstein veranstaltet<br />
am 14.02.2001 in Neumünster, Kiel: REFUGIO, 7-18.<br />
Kofler Günter (1991): Ausländerintegration – das Projekt Hochfilzen, in: Informationen der Gesellschaft für<br />
politische Aufklärung Nr. 31, Dezember 1991, 3-4.<br />
Köfler Werner (1979): Geschichtliche Entwicklung von Fieberbrunn, in: Werner Köfler (Red.): Fieberbrunn.<br />
Geschichte einer Tiroler Marktgemeinde, Fieberbrunn: Marktgemeinde, 7-246.<br />
315
Krapf Matthias (2003): Wer klopfet an? Die Asylpraxis soll reformiert werden, in: 6020 Stadtmagazin Nr. 28,<br />
21.03.2003, 12-13.<br />
Kreissl Reinhard (1999): European Folk Devils – Die Entstehung europäischer Feindbilder, in: Hermann<br />
Schwengel (Hg.): Grenzenlose Gesellschaft? 29. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 16.<br />
Österreichischer Kongress für Soziologie, 11. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie in<br />
Freiburg im Breisgau 1998, Band II/2, Pfaffenweiler: Centaurus, 76-78.<br />
Kremla Marion (2003): „Krankes System“, Wien: asylkoordination österreich, URL: .<br />
Kuhlmann Dörte (2003a): Raum, Macht & Differenz. Genderstudien in der Architektur, Wien: edition selene (=<br />
a-theory).<br />
— (2003b): Vorwort, in: Dörte Kuhlmann/Sonja Hnilica/Kari Jormakka (Hg.): Building Power. Architektur,<br />
Macht, Geschlecht, Wien: edition selene (= a-theory), 7-19.<br />
Kuhn Walter (1994): Asylbewerber in München. Ängste, Erfahrungen und Meinungen der Bevölkerung in der<br />
Nachbarschaft großer Aufnahmelager, in: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München Nr. 79,<br />
315-338.<br />
Kussbach Barbara (2004): Alles, was Recht ist. Zur Asylrechtslage nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs,<br />
in: ai-info (4), 18.<br />
Ladurner Ulrich (1994): Hinter Klostermauern. Innsbrucks Fremdenpolizei ist ratlos und provoziert einen Konflikt<br />
mit der Kirche, in: profil 25 (34), 22.08.1994, 28-30.<br />
Langthaler Herbert (1998): Eingekreist. Anmerkungen und Reaktionen zum Positionspapier der österreichischen<br />
EU-Präsidentschaft, in: asylkoordination aktuell (3), 4-13.<br />
— (2003a): Chaotische Privatisierung, unwillige Länder, trotziger Minister, in: asylkoordination aktuell (2), 29-32.<br />
— (2003b): Heißer Herbst, in: asyl aktuell (3), 2-6.<br />
— (2004a): Chaotischer Start, in: asyl aktuell (2), 8-12.<br />
— (2004b): Engagierte Dienstleister, in: asyl aktuell (3), 18-24.<br />
Lichtenhofer Gunther (2000): Ein-Drittel-Gesellschaft: Bundesbetreute Asylwerber, in: asylkoordination aktuell<br />
(3), 4-9.<br />
Limberger Petra, Rechling Andi (2004): Traiskirchen Neu, in: asyl aktuell (2), 22-25.<br />
Linde Winfried Werner (1992): Der ganz alltägliche Rassismus, in: Kontakt 21 (13), 03.04.1992.<br />
Logar Peter (2001): Nicht zurückschicken in’s Nichts (= Interview), in: Dorfzeitung Inzing (3), URL:<br />
.<br />
Lorenz Nadja (2004): Flüchtlinge sind „großteils quasi kaserniert“ (= Interview), in: Der Standard 22.09.2004, 10.<br />
Löschnak Franz (1993): Menschen aus der Fremde. Flüchtlinge, Vertriebene, Gastarbeiter, Wien: Holzhausen (=<br />
Themen der Zeit 1).<br />
— (1994): Für eine umfassende Integrationspolitik, in: Andreas Khol/Günther Ofner/Alfred Stirnemann (Hg.):<br />
Österreichisches Jahrbuch für Politik 1993, Wien–München: Verlag für Geschichte und Politik/Oldenbourg,<br />
627-640.<br />
Ludwig-Mayerhofer Wolfgang, Müller Marion, Paulgerg-Muschiol Larissa von (2001): „... das extremste Phänomen<br />
der Armut“. Von der Armut, ohne Wohnung zu leben, in: Eva Barlösius/Wolfgang Ludwig-Mayerhofer<br />
(Hg.): Die Armut der Gesellschaft, Opladen: Leske + Budrich (= Sozialstrukturanalyse 15), 263-291.<br />
Lueger-Schuster Brigitte (Hg.) (1996a): Leben im Transit. Über die psychosoziale Situation von Flüchtlingen<br />
und Vertriebenen, Wien: WUV.<br />
— (1996b): Leben im Transit, in: Lueger-Schuster 1996a, 9-43.<br />
— (2000): Psychotraumatologie, in: Psychologie in Österreich 20 (5), 275-281.<br />
Machreich Wolfgang (2003): Sorge um die Fremden. Mit seinem Vorschlag für das neue Asylgesetzt tritt der<br />
Innenminister das österreichische Rechte mit Füßen, in: Die Furche 23.10.2003.<br />
Maihofer Andrea (2004): Geschlecht als hegemonialer Diskurs und gesellschaftliche-kulturelle Existenzweise.<br />
<strong>Neue</strong>re Überlegungen auf dem Weg zu einer kritischen Theorie von Geschlecht, in: Jutta Hartmann (Hg.):<br />
Grenzverwischungen. Vielfältige Lebensweisen im Gender-, Sexualitäts- und Generationendiskurs, Innsbruck:<br />
studia (= Sozial- und Kulturwissenschaftliche Studientexte 9), 33-40.<br />
Mainoni Eduard (2004): Flüchtlingen helfen, Kriminelle bekämpfen. Anmerkungen eines „Ausländerfeindes“,<br />
in: Der Standard 10./11.01.2004, 30.<br />
Mane Gudrun (2004): Wenn die Kommunikation zwischen PatientInnen und medizinischen Fachkräften misslingt,<br />
in: FLÜCHTLINGSRAT – Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in Niedersachsen Nr. 99 (Sonderheft),<br />
Oktober 2004, 52-71.<br />
Martini-Emden Dietmar (2000): Problemstellung und Intention des Modellversuchs einer Landesunterkunft für<br />
Ausreisepflichtige in Rheinland-Pfalz, Rede im Rahmen des 8. Migrationspolitischen Forums („Alternativen<br />
zur Abschiebehaft“) am 03.05.2000 in Berlin, Konstanz: Forschungszentrum für internationales und europäi-<br />
316
sches Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz, URL: .<br />
Marwitz Theo von (1997): Traumatisierte Flüchtlingskinder – psychosoziale Hilfe, in: Rolf Meinhardt (Hg.): Zur<br />
schulischen und außerschulischen Versorgung von Flüchtlingskindern. Dokumentation, Oldenburg: BIS,<br />
129-149.<br />
Massey Doreen (1998): Space, Place and Gender, 2 nd Reprint, Cambridge: Polity Press.<br />
Matouschek Bernd, Wodak Ruth (1995): „Rumänen, Roma ... und andere Fremde.“ Historisch-kritische Diskursanalyse<br />
zur Rede von den „Anderen“, in: Heiss/Rathkolb 1995, 210-238.<br />
Mayer Heinz (2003): Asylgesetz: Wider das Primat der Effizienz. Die geplante Reform ist verfassungswidrig, in:<br />
Der Standard 11.06.2003, 27.<br />
Meier-Braun Karl-Heinz (1981): Das Asylanten-Problem. Ein Grundrecht in der Bewährungsprobe, Frankfurt<br />
am Main–Berlin–Wien: Ullstein.<br />
Meinhart Edith (2003): Wer kommt, der geht, in: profil 34 (47), 17.11.2004, 38-41.<br />
Meinhardt Rolf (1997): Zur Lage der Flüchtlingskinder in Deutschland – eine Problemskizze, in: Rolf Meinhardt<br />
(Hg.): Zur schulischen und außerschulischen Versorgung von Flüchtlingskindern. Dokumentation, Oldenburg:<br />
BIS, 11-19.<br />
Menschenrechtsbeirat beim Bundesministerium für Inneres (2003): Bericht des Menschenrechtsbeirates beim<br />
Bundesministerium für Inneres über seine Tätigkeit im Jahr 2002, Wien, April 2003.<br />
— (2004): Bericht des Menschenrechtsbeirates beim Bundesministerium für Inneres über seine Tätigkeit im Jahr<br />
2003, Wien, April 2004.<br />
Merkord Frank (1996): „Wie ein Tropfen Wasser ...“ Der Alltag von Asylbewerbern und die Sozialarbeit mit<br />
Folterüberlebenden, in: Sepp Graessner/Norbert Gurris/Christian Pross (Hg.): Folter. An der Seite der Überlebenden.<br />
Unterstützung und Therapien, München: Beck (= Beck’sche Reihe 1183), 219-236.<br />
Moser Heinz (1984): Die Schulgeschichte, in: Heinz Moser (Red.): Volders. Eine Wanderung durch drei Jahrtausende,<br />
Volders: Gemeinde, 129-135.<br />
Moser Sieglinde (1984): Burgen, Schlösser, Wohntürme, in: Heinz Moser (Red.): Volders. Eine Wanderung<br />
durch drei Jahrtausende, Volders: Gemeinde, 35-53.<br />
Müller Gert (1988a): Götzens – ein Zentrum des Glaubens, in: Baeck 1988a, 123-147.<br />
— (1988b): Von der Stunde Null zum großen Aufschwung, in: Baeck 1988a, 71-91.<br />
Müller Martin, Hegel Ralf-Dieter, Horstmann Karla (2001): Fremde im Land Brandenburg. Eine empirische<br />
Studie zur Akzeptanz und Integration ausländischer Menschen, o.O.: Holon/kommunalpolitisches forum<br />
Land Brandenburg, URL: .<br />
Münker-Kramer Eva, Gmeiner Veronika (2000): Notfallspsychologie im trojanischen Pferd – Flüchtlingsbetreuung<br />
ohne Auftrag und Struktur. Organisationspsychologische Aspekte, psychologische Behandlung und<br />
Psychotherapie, in: Psychologie in Österreich 20 (5), 293-300.<br />
Murber Ibolya, Weber Wolfgang (2001): Heimat – Fremde – Heimat? Deskriptive Aspekte der Migrationsgeschichte<br />
ungarischer Flüchtlinge 1956/57 in Vorarlberg, in: Kakanien Revisited, 01.10.2001, URL:<br />
.<br />
Mutschlechner Georg (1979): Aus der älteren Geschichte der Berg- und Hüttenwerke in Pillersee (Fieberbrunn),<br />
in: Werner Köfler (Red.): Fieberbrunn. Geschichte einer Tiroler Marktgemeinde, Fieberbrunn: Marktgemeinde,<br />
313-358.<br />
— (1988): Geologie und Erdgeschichte, in: Baeck 1988a, 11-12.<br />
Mysorekar Sheila (1990): Vagabundinnen mit Transitvisum, in: beiträge zur feministischen theorie und praxis<br />
Nr. 27, 21-24.<br />
Niedrig Heike, Schroeder Joachim, Seukwa Louis Henri (2001): Bildung mit beschränktem Zugang. Die Marginalisierung<br />
jugendlicher Flüchtlinge aus Afrika im deutschen Bildungssystem, in: epd-Entwicklungspolitik<br />
(13), 32-36.<br />
Nierhaus Irene (1999): Arch 6 . Raum, Geschlecht, Architektur, Wien: Sonderzahl.<br />
Nindler Peter (2002): Tabus sachlich brechen, in: Tiroler Tageszeitung 20.12.2002, 13.<br />
Novy Andreas (2003a): Macht gestaltet Raum, in: planet Nr. 28, März/April 2003, 12.<br />
— (2003b): Sozialräumliche Polarisierung: Raum, Macht und Staat, Wien: Wirtschaftsuniversität, Abt. für Stadt-<br />
und Regionalentwicklung (= SRE-Discussion 2003/01).<br />
Nowak Manfred, Tretter Hannes (2004): Vorwort der Herausgeber, in: Louise Sperl/Karin Lukas/Helmut Sax:<br />
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von AsylwerberInnen. Die Umsetzung internationaler<br />
Standards in Österreich, Wien: Verlag Österreich (= Studienreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für<br />
Menschenrechte 12), 5-8.<br />
Öggl Hermann (2003a): jobshop – Chance für AsylwerberInnen auf dem Tiroler Arbeitsmarkt, in: jobshop<br />
newsletter (1), Herbst 2003, 3-5.<br />
317
— (2003b): Rahmenbedingungen der Projektarbeit: Projektziele und Organisationsstruktur von jobshop, in:<br />
jobshop newsletter (1), Herbst 2003, 6-7.<br />
Olt Reinhard (1990): Leutasch in Tirol. Eine Ortschronik, Leutasch: Gemeinde.<br />
Omairi Fadlalla (1991): Wohn- und Lebenssituation von Flüchtlingen. Eine empirische Analyse am Beispiel des<br />
Weser-Ems-Raumes, Frankfurt am Main: IKO (= Oldenburger Forschungsbeiträge zur interkulturellen Pädagogik<br />
3).<br />
Osman Abdullahi (1997): Fluchtwege. Auf dem Weg von Mogadischu nach Graz, Graz: ARGE Jugend gegen<br />
Gewalt, Rechtsextremismus und AusländerInnenfeindlichkeit.<br />
Pammer Christoph (2000): Möglichkeiten für MigrantInnen zur gesundheitlichen Versorgung, Graz: Akademie<br />
für Sozialarbeit des Landes Steiermark (Diplomarbeit), URL: .<br />
Paravicini Ursula (2003): Public Spaces as a Contribution to Egalitarian Cities, in: Ulla Terlinden (ed.): City and<br />
Gender. in: Ulla Terlinden (ed.): City and Gender. International Discourse on Gender, Urbanism and Architecture,<br />
Opladen: Leske + Budrich (= Schriftenreihe der Internationalen Frauenuniversität „Technik und<br />
Kultur“ 12), 57-80.<br />
Patzelt Heinz (2004): „Zu viel passiert“ (= Interview), in: profil 35 (8), 16.02.2004, 34.<br />
<strong>Pehm</strong> <strong>Raimund</strong> (2002): Eine andere Asylpolitik? Asylpolitik in Wahlzeiten: Protokoll einer Diskussion, Innsbruck:<br />
Tiroler Institut für Menschenrechte und Entwicklungspolitik (= time-Dokumentation 3).<br />
Pelinka Anton (1994): Innsbrucker und Tiroler Politik nach den Wahlen. Thesen zum Vortrag am 17. Mai 1994,<br />
in: Michael-Gaismair-Gesellschaft (Hg.): Gaismair Kalender 1995, Innsbruck: Michael-Gaismair-Gesellschaft,<br />
47-49.<br />
— (2003): Die Nationalratswahl 2002. Erdrutsch und Bestätigung, in: Lisa Gensluckner/Horst Schreiber/Ingrid<br />
Tschugg/Alexandra Weiss (Hg.): Gegenwind (= Gaismair-Jahrbuch 2004), Innsbruck–Wien–München–<br />
Bozen: StudienVerlag, 12-19.<br />
— (2004a): Das Regierungssystem. Zur Demokratiequalität Tirols, in: Ferdinand Karlhofer/Anton Pelinka (Hg.):<br />
Politik in Tirol, Innsbruck–Wien–München–Bozen: StudienVerlag, 9-25.<br />
— (2004b): Von Landeck lernen. Österreich braucht eine liberale, systematische Flüchtlingspolitik, in: Die<br />
Presse 17.06.2004.<br />
Pelinka Anton, Rosenberger Sieglinde (2000): Österreichische Politik. Grundlagen – Strukturen – Trends, Wien:<br />
WUV.<br />
Peters B. Guy (1993): Alternative Modelle des Policy-Prozesses : Die Sicht „von unten“ und die Sicht „von<br />
oben“, in: Adrienne Héritier (Hg.): Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung, Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag (= Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 24), 289-303.<br />
Pflegerl Johannes, Fernández de la Hoz Paloma (2001): Die Bedeutung des Wohnens für Migrantenfamilien in<br />
Österreich, Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung (= Materialiensammlung 8).<br />
Pilgram Arno (1992): Ausländerkriminalität. Soziologische Weltsicht und Angstwelten, in: Karl S.<br />
Althaler/Andrea Hohenwarter (Hg.): Torschluß. Wanderungsbewegungen und Politik in Europa, Wien:<br />
Verlag für Gesellschaftskritik (= Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik 57), 174-188.<br />
Pirkl Herwig (1979): Die neuere Geschichte der Pillerseer Berg- und Hüttenwerke, in: Werner Köfler (Red.):<br />
Fieberbrunn. Geschichte einer Tiroler Marktgemeinde, Fieberbrunn: Marktgemeinde, 359-433.<br />
Plaikner Peter (2004): Zahlen statt Taten, in: Die NEUE 02.10.2004, 5.<br />
Pletzer Binja Nicole (2002): Der Verein Chambre. Aufbau der interkulturellen psychoanalytischen Ambulanz<br />
Tirol. Erster Versuch, in: Johannes Reichmayr/Binja Nicole Pletzer: Ethnopsychoanalyse und interkulturelle<br />
Therapie, Key Note für den 3. Weltkongreß für Psychotherapie in Wien am 18.07.2002, 4-10.<br />
Pohl Josef (1959): Reith bei Brixlegg. Beiträge zur Geschichte eines Unterinntaler Dorfes, Innsbruck: Universitätsverlag<br />
Wagner (= Schlern-Schriften 186).<br />
Pohl Oliver (2004): Finanzsituation der Gemeinden wenig rosig, in: Wirtschaft im Alpenraum 9 (2-3), 62-64.<br />
Popp Reinhold (2002): Aktivierende Soziale Arbeit. Soziale Kompetenz als Beruf. Das Konzept für Lehre,<br />
Forschung & Entwicklung des Fachhochschulstudiengangs für Sozialarbeit in Salzburg, Salzburg: AK (=<br />
Human & Life Sciences 1).<br />
— (2003): Soziale Arbeit auf dem Weg zur Profession?, in: Sozialarbeit in Österreich 38 (2), 14-16.<br />
Preglau Max (2004): Sozialstruktur und Sozialpolitik, in: Ferdinand Karlhofer/Anton Pelinka (Hg.): Politik in<br />
Tirol, Innsbruck–Wien–München–Bozen: StudienVerlag, 187-207.<br />
Preitler Barbara (1996): Psychotherapeutische Arbeit mit Folter- und Kriegsüberlebenden, in: Lueger-Schuster<br />
1996a, 106-117.<br />
— (2004): Trauma und Flucht, in: asyl aktuell (4), 10-15.<br />
Prieth Sonja, Schlosser Hannes (2003): Illegale Rechtsauffassungen, in: 20er Nr. 42, Februar 2003, 23.<br />
Prock Herbert (1995): Bürglkopf: ein gescheites Projekt, in: Tiroler Landeszeitung (2), 18.<br />
318
profil (2003): Kurzer Prozess. Kontroverse um Tschetschenen: Wurden die Asylanträge ignoriert?, in: profil 34<br />
(47), 17.11.2003, 40.<br />
Protokoll der Abschlussveranstaltung von Job-Shop-Chance für AsylwerberInnen am Tiroler Arbeitsmarkt<br />
(Innsbruck, Landhaus, Großer Sitzungssaal, 10.11.2004), Innsbruck, 15.12.2004.<br />
Raffer Karin (2004): Expedition Österreich. Alm-Asyl, in: Megaphon Nr. 108, September 2004, 6-7.<br />
Ralser Michaela (2003): Herbergssuche. Zur Obdachlosigkeit von Flüchtlingen in Tirol, in: Lisa Gensluckner/<br />
Horst Schreiber/Ingrid Tschugg/Alexandra Weiss (Hg.): Gegenwind, Innsbruck–Wien–München–Bozen:<br />
StudienVerlag (= Gaismair-Jahrbuch 2004), 40-51.<br />
Rásky Béla (1998): „Flüchtlinge haben auch Pflichten“. Österreich und die Ungarnflüchtlinge 1956, Vortrag im<br />
Rahmen einer Konferenz der Außenstelle Budapest des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institutes<br />
am 12.10.1998, in: Kakanien Revisited, 01.10.2001, URL: .<br />
Rapp Irene (2004): Schwierige Herbergssuche, in: Tiroler Tageszeitung 22.04.2004, 11.<br />
Rauchfuss Knut (2001): Krankheit kennt keinen Aufenthaltsstatus. Zur gesundheitlichen Situation von Flüchtlingen,<br />
Bochum: Medizinische Flüchtlingshilfe.<br />
Rauscher Hans (2003): Bundesbetreuung, in: Der Standard 13./14.12.2003, 1.<br />
Reching Andreas (2003): Numerus Clausus Bürokraticus, in: asyl aktuell (4), 24-26.<br />
Reitan Claus (2004): Asylanten-Schubsen. Die Nicht-Einigung ist mehr als beschämend, in: Tiroler Tageszeitung<br />
04.10.2004, 2.<br />
Reiter Martin (1991): St. Gertraudi. Die Geschichte eines Unterinntaler Dorfes, Schwaz: Berenkamp.<br />
Reiterer Albert F. (2001): Nationalstaat – Demokratie – Grenzen. Über die demokratiepolitische Unentbehrlichkeit<br />
nationaler und staatlicher Unabhängigkeit, in: Erna Appelt (Hg.): Demokratie und das Fremde. Multikulturelle<br />
Gesellschaften als demokratische Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Innsbruck–Wien–<br />
München: StudienVerlag (= Demokratie im 21. Jahrhundert 1), 55-75.<br />
Richter Eva A. (2001): Versorgung von Migranten: Mangel an kulturellem Verständnis, in: Deutsches Ärzteblatt<br />
98 (51-52), 24.12.2001, A-3421/B-2883/C-2679.<br />
Riedl Christoph (2001): Kein Platz Nirgendwo. Psychisch erkrankte AsylwerberInnen haben in Österreich keine<br />
Chance auf angemessene Betreuung, in: asylkoordination aktuell (3), 17-19.<br />
Rieser Rudolf (1995): Flüchtlinge und Asylwerber, in: Gerhard Hetfleisch/Franko Petri/Sabine Wartha (Hg.):<br />
Das österreichische Ausländerrecht. Ein praktischer Wegweiser mit kritischen Betrachtungen, Wien: WUV,<br />
59-65.<br />
Rohrauer Bettina (1996): „Du nix Hammel braten in Hof ...“. Fremdenbild und Ausländerpolitik in Grazer<br />
Printmedien. Eine linguistische Analyse, Wien: ÖFSE (= ÖFSE-Forum 2).<br />
Rosenegger Hans (1996): Alltag im Flüchtlingslager: Das Fehlen von Zeitstrukturen, in: Lueger-Schuster 1996a,<br />
54-65.<br />
Rozumek Martin (2003): Asylum seekers of Chechen origin returned by the Austrian authorities/Statistics of<br />
RSD with Chechens in Austria, Note for the File, 10.11.2003, Praha: Organizace pro Pomoc Uprchlíkům<br />
(vervielfältigte Stellungnahme).<br />
Salman Ramazan (2002): Dolmetscher im Sozial- und Gesundheitswesen. Sprachliche, konzeptionelle, qualitative,<br />
politische und rechtliche Aspekte, in: FLÜCHTLINGSRAT – Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in<br />
Niedersachsen Nr. 89/90, November 2002, 58-74.<br />
Scharf Katrin (2003): Betreuung am Limit, in: asyl aktuell (4), 12-14.<br />
Schaupp Cornelia (2004): Das doppelte Minus, in: asyl aktuell (1), 10-14.<br />
Schenk Martin (1995): Österreich in Seenot. Vom politischen Ge- und Mißbrauch der „Asyldebatte“, in: Der<br />
Grüne Klub im Parlament (Hg.): Die negative Bilanz. Drei Jahre Asylgesetz: Praxis, Mängel, Reformvorschläge,<br />
Wien: Der Grüne Klub im Parlament, 13-15.<br />
— (2000): Die Stärke der Schwachen: Zivilgesellschaft „ganz unten“, in: Martin Schaurhofer/Emil Brix/Albert<br />
Brandstätter/Wolfgang Kellner (Hg.): Räume der Civil Society in Österreich, Wien: Österreichische<br />
Forschungsgemeinschaft, 55-67.<br />
— (2001): Das Problem mit der „Treffsicherheit“, in: Die Armutskonferenz (Hg.): „Und raus bist Du ...!“<br />
Soziale und räumliche Ausgrenzung – inmitten einer reichen Gesellschaft. 4. Österreichische Armutskonferenz<br />
23-24. Oktober 2000 (Dokumentation), Wien: Die Armutskonferenz, 85-92.<br />
— (2003): Gravierende Mängel in der Gesundheitsversorgung von AsylwerberInnen, Wien: asylkoordination<br />
österreich, URL: .<br />
Schmidbauer Wolfgang (1977): Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe,<br />
Reinbek: Rowohlt.<br />
Schoibl Heinz (1992): Kommunale Handlungsfelder und die Integration von AusländerInnen, in: Karl S.<br />
Althaler/Andrea Hohenwarter (Hg.): Torschluß. Wanderungsbewegungen und Politik in Europa, Wien:<br />
Verlag für Gesellschaftskritik (= Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik 57), 151-161.<br />
319
Schreiber Horst (1994): Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nazizeit in Tirol, Innsbruck: StudienVerlag (=<br />
Geschichte & Ökonomie 3).<br />
Schrettle Johannes (2003): Divide et impera. Rot-weiß-rote Vergabepolitik, in: zebratl (2), 6-7.<br />
Schröder Günther (2004): Ist da jemand? Die Volkspartei setzt auf FPÖ-Themen – und bringt die Blauen in<br />
Existenznöte, in: Tiroler Tageszeitung 04./05.12.2004, 5.<br />
Schroffenegger Gabriela (2003): Asyl und Integration in Tirol, in: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung<br />
JUFF – Referat Integration (Hg.): fremd? HEIMAT TIROL. Integration von MigrantInnen in Tirol,<br />
Innsbruck: Amt der Tiroler Landesregierung, 13.<br />
Schuler Beat (2004): UNHCR-Besuche in den Erstaufnahmestellen, Zwischenbericht des UNHCR Österreich,<br />
Ref. 063/04, Wien, 26.05.2004.<br />
Seefeld Kathi (2000): Ein Heim, das fast ein Zuhause ist. Das AsylbewerberInnenhaus von Ökohaus e.V. in<br />
Rostock, in: Kathi Seefeld: Das Leben ist bunt. Interkulturelle Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, 5. Aufl.,<br />
Rostock: Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern/Hansestadt Rostock/Diên Hông, 10-12.<br />
Simmel Georg (1908): Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft, in: Georg Simmel: Soziologie.<br />
Untersuchung über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig: Duncker & Humblot, 460-526.<br />
Sohler Karin (2000): Vom „Illegalen“ zum „inneren Feind“. Ausgrenzung, Kriminalisierung und rassistische<br />
Konstruktionen im Sicherheitsdiskurs, in: Kurswechsel (1), 53-64.<br />
Sperl Gerfried (2003): Die umgefärbte Republik. Anmerkungen zu Österreich, Wien: Zsolnay.<br />
Sperl Louise (2004): Das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, in: Louise Sperl/Karin Lukas/Helmut<br />
Sax: Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von AsylwerberInnen. Die Umsetzung internationaler<br />
Standards in Österreich, Wien: Verlag Österreich (= Studienreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für<br />
Menschenrechte 12), 121-214.<br />
Sperl Louise, Lukas Karin (2002): Strassers verhärtete Asylpolitik, in: Der Standard 11.10.2002, 35.<br />
Spiss Roman (1998): Von der Eröffnung der Arlbergbahn bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, in: Peter<br />
Baeck (Red.): Stadtbuch Landeck, Landeck: Stadtgemeinde, 201-237.<br />
Sprenger Michael (2004): Unwürdiges Spiel. Traiskirchen wird immer mehr auch zum Synonym für fehlende<br />
Solidarität, in: Tiroler Tageszeitung 06.10.2004, 2.<br />
Spudich Helmut (2004): Die Flucht vor der Realität. Die Öffnung von Kasernen für Asylwerber ist ein fragwürdiges<br />
Provisorium, in: Der Standard 04.10.2004, 28.<br />
Stanek Eduard (1985): Verfolgt – verjagt – vertrieben. Flüchtlinge in Österreich 1945-1984, Wien–München–<br />
Zürich: Europa-Verlag.<br />
Staud Frank (2004): Ghetto-Weg ist falsch. Container sind zumutbar, der Ort ist fatal, in: Tiroler Tageszeitung<br />
07.05.2004, 2.<br />
Staudinger Hans (1994): Der Zugang des Flüchtlings zum österreichischen Asylverfahren, in: Der Grüne Klub<br />
im Parlament (Hg.): Einsperren – Abschieben. Schubhaft in Österreich, Wien: Der Grüne Klub im Parlament,<br />
33-38.<br />
Stein Angelika (2003): Auswirkungen von häufigem Wohnort- und Schulwechsel. Am Beispiel der Familie U.,<br />
in: Landeshauptstadt Stuttgart, Referat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Hg.): 22. Stuttgarter Flüchtlingsbericht,<br />
Stuttgart: Landeshauptstadt Stuttgart, 18-19.<br />
Steinkeller Anna (1995): Flüchtlingsschicksal: Ohne Arbeit, ohne Hoffnung, in: Salzburger Nachrichten<br />
12.09.1995, 3.<br />
Steinmetz Willibald (1995): Anbetung und Dämonisierung des „Sachzwangs“. Zur Archäologie einer deutschen<br />
Redefigur, in: Michael Jeismann (Hg.): Obsessionen. Beherrschende Gedanken im wissenschaftlichen Zeitalter,<br />
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 293-333.<br />
Stöger Peter (1998): Eingegrenzt und Ausgegrenzt. Tirol und das Fremde. Ein pädagogisch-historisches Lesebuch<br />
zum Thema Fremde, Entfremdung und Fremdbestimmung unter besonderer Berücksichtigung der Auswanderung<br />
nach Lateinamerika und der Geschichte der jüdischen Mitbürger, Frankfurt am Main–Berlin–<br />
Bern–New York–Paris–Wien: Lang (= Europäische Hochschulschriften XI/744).<br />
Stolz Otto (1927): Geschichte der Stadt Vils in Tirol. Herausgegeben zur Feier ihres 600jährigen Bestandes, Vils:<br />
Stadtgemeinde.<br />
Strasser Ernst (2003): Das neue Asylgesetz, in: Tiroler Tageszeitung 28./29.06.2003, Magazin, 2.<br />
— (2004a): „Asylrecht attraktiv für Missbrauch“ (= Interview), in: Der Standard 08.11.2004, 6.<br />
— (2004b): „Ich habe dazugelernt“ (= Interview), in: Der Standard 27./28.11.2004, 12.<br />
— (2004c): Österreich hilft, wo Hilfe gebraucht wird, in: Ernst Strasser/Theodor Thanner/Mathias<br />
Vogl/Alexander Janda (Hg.): Integration Chance Österreich, Wien: Braintrust, 14-21.<br />
Tedeschi Claudio (1996): Planung sozialer Dienste im Spannungsfeld zwischen Social Marketing und Sozialplanung.<br />
Dargestellt am Beispiel der Flüchtlingsbetreuung im Bundesland Vorarlberg, Innsbruck: Leopold-<br />
Franzens-Universität (unveröffentl. phil. Diss. am Institut für Erziehungswissenschaften).<br />
320
Thimmel Stefan (1994): Ausgegrenzte Räume – ausgegrenzte Menschen. Zur Unterbringung von Flüchtlingen<br />
und AsylbewerberInnen am Beispiel Berlin, Frankfurt am Main: IKO.<br />
Ünal Arif (1999): Die Pathologie der Gastfreundschaft. Erfahrungen der MigrantInnen im Sozialstaat Deutschland,<br />
in: Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Hg.): Migration und Gesundheit. Perspektiven der Gesundheitsförderung<br />
in einer multikulturellen Gesellschaft, Dokumentation der Fachtagungsreihe „Gesund in<br />
eigener Verantwortung?“, 2. Fachtagung 19./20.11.1999, Dresden: DHMD, URL: .<br />
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (1996): Flüchtlingsalltag in Österreich. Eine quantitativ-qualitative<br />
Analyse der Vollzugspraxis des Asylgesetzes 1991, 3. durchgesehene Aufl., Wien: UNHCR.<br />
Unterlechner Birgit (2002): Wartezimmer ohne Lektüre, in: Michaela Ralser (Hg.): Kein Land zum Bleiben. Auf<br />
der Flucht durch und nach Österreich. Siebzehn Porträts, Innsbruck–Wien–München–Bozen: StudienVerlag,<br />
13-16.<br />
Vahrner Alois (2004): Starkes Signal aus Landeck, in: Tiroler Tageszeitung 09.03.2004, 5.<br />
Vogl Mathias (2002a): Asyl: Wird die EU-Richtlinie verletzt?, in: Der Standard 15.10.2002, 31.<br />
— (2002b): Integration in Österreich, in: Andreas Khol/Günther Ofner/Günther Burkert-Dottolo/Stefan Karner<br />
(Hg.): Österreichisches Jahrbuch für Politik 2001, Wien–München: Verlag für Geschichte und<br />
Politik/Oldenbourg, 51-82.<br />
Volf Patrik-Paul (1995): Der politische Flüchtling als Symbol der Zweiten Republik. Zur Asyl- und Flüchtlingspolitik<br />
seit 1945, in: Zeitgeschichte Nr. 11-12, 415-435.<br />
Völker Michael (2004): Aufgerieben, in: Der Standard 11.12.2004, 36.<br />
Weber Karl (2004): Politik und Verwaltung, in: Ferdinand Karlhofer/Anton Pelinka (Hg.): Politik in Tirol, Innsbruck–Wien–München–Bozen:<br />
StudienVerlag, 73-96.<br />
Wegscheider Michael (1997): Schutzlose Flüchtlinge? Die österreichische Flüchtlingspolitik vor dem Hintergrund<br />
des internationalen Flüchtlingsrechts, Innsbruck: Leopold-Franzens-Universität (unveröffentl. Diplomarbeit<br />
am Institut für Politikwissenschaft).<br />
Weidenholzer Josef (1999): Non-profit-Organisationen als Partner für Kommunen, in: Kai Leichsenring/Barbara<br />
Rosenberg (Hg.): Soziale Lösungen vor Ort. <strong>Neue</strong> Wege in der kommunalen Sozialpolitik, Wien: Renner-<br />
Institut, 21-24.<br />
Wenk-Ansohn Mechthild (1996): Die Spur des Schmerzes – Psychosomatische Störungen bei Folterüberlebenden,<br />
in: Sepp Graessner/Norbert Gurris/Christian Pross (Hg.): Folter. An der Seite der Überlebenden. Unterstützung<br />
und Therapien, München: Beck (=Beck’sche Reihe 1183), 83-98.<br />
Wenzel Helmut (1998): Von 1945 bis zur Gegenwart, in: Peter Baeck (Red.): Stadtbuch Landeck, Landeck:<br />
Stadtgemeinde, 445-486.<br />
— (2003): Auf Herbergssuche, in: Tiroler Tageszeitung 16.12.2003, 12.<br />
Wicker Hans-Rudolf (1993): Macht schafft Wahrheit: Ein Essay zur systematischen Folter, in: Thomas Fillitz/<br />
Andre Gingrich/Gabriele Rasuly-Paleczek (Hg.): Kultur, Identität und Macht. Ethnologische Beiträge zu<br />
einem Dialog der Kulturen der Welt, Frankfurt am Main: IKO, 257-269.<br />
Wipfler Richard (1986): Asyl konkret. Lageralltag als kritisches Lebensereignis, Berlin: EXpress Edition (= X-<br />
Publikationen).<br />
Wirtgen Waltraud (2000): Gewalt und Legitimität. Auswirkungen von Terror und Gewalt auf die Gesundheit des<br />
einzelnen und der gesamten Bevölkerung, in: FLÜCHTLINGSRAT – Zeitschrift für Flüchtlingspolitik in<br />
Niedersachsen Nr. 68, Mai 2000, 55-58.<br />
Wirtschaft im Alpenraum (2003): Schlechte Erreichbarkeit schadet Image des Bezirks, in: Wirtschaft im Alpenraum<br />
8 (9), September/Oktober 2003 (= Sonderheft Außerfern), 4-5.<br />
Wischenbart Rüdiger (1995): Traiskirchen von innen. Flüchtlingspolitik zu Beginn der 80er Jahre, in:<br />
Heiss/Rathkolb 1995, 195-209.<br />
Wodak Ruth (2004): Notwendige Maßnahmen gegen Fremde?, in: asyl aktuell (4), 8-9.<br />
Wojak Josef (1993): Ökonomische und soziale Aspekte der Asylwerberunterbringung (exemplarisch präsentiert<br />
am Beispiel eines Flüchtlingsbeherbergungsbetriebes), Linz: Johannes-Kepler-Universität (unveröffentl.<br />
Diplomarbeit am Institut für Soziologie).<br />
Zenhäusern Mario (2004a): Gefährliche Statistik, in: Tiroler Tageszeitung 16.09.2004, 11.<br />
— (2004b): Gesamtpaket notwendig, in: Tiroler Tageszeitung 11.11.2004, 23.<br />
— (2004c): Mauern aus Angst. Der Großteil der Asylwerber ist nicht kriminell, in: Tiroler Tageszeitung<br />
20.08.2004, 2.<br />
Zepf Bernhard (1986): Asylrecht ohne „Asylanten“? Flüchtlingshilfe im Spannungsfeld von Weltflüchtlingsproblem<br />
und Abschreckungspolitik, Frankfurt am Main: IKO.<br />
Zierer Brigitta (1995): Willkommene Ungarnflüchtlinge 1956?, in: Heiss/Rathkolb 1995, 157-171.<br />
— (1998): Politische Flüchtlinge in österreichischen Printmedien, Wien: Braumüller (= Abhandlungen zu<br />
Flüchtlingsfragen 23).<br />
321
Zobl Georg (1998a): Die Entwicklung von Angedair und Perfuchs zur Gemeinde Landeck, in: Peter Baeck<br />
(Red.): Stadtbuch Landeck, Landeck: Stadtgemeinde, 133-142.<br />
— (1998b): Die Landecker Stadtapotheke, in: Peter Baeck (Red.): Stadtbuch Landeck, Landeck: Stadtgemeinde,<br />
248-250.<br />
— (1998c): Geschichte der Landecker Gasthäuser, in: Peter Baeck (Red.): Stadtbuch Landeck, Landeck: Stadtgemeinde,<br />
257-288.<br />
Zwicklhuber Maria (Hg.) (2003): Interkulturelles Zusammenleben und Integration als kommunalpolitische<br />
Herausforderung. Handbuch für die interkulturelle Gemeindearbeit, Wien: Interkulturelles Zentrum.<br />
2 Beantwortungen schriftlicher Anfragen im Tiroler Landtag<br />
Gangl Christa (2003): Schriftliche Anfrage der LAbg. Dr. E. Wiesmüller betr. Notunterkunft für Flüchtlinge, Zl.<br />
284/03, Innsbruck, 16.07.2003.<br />
— (2004a): Schriftliche Anfrage der Abg. Dr. Elisabeth Wiesmüller betreffend „Suche nach kleineren Quartieren<br />
für hilfs- und schutzbedürftige Fremde“, Zl. 235/04, Innsbruck, 28.07.2004.<br />
— (2004b): Schriftliche Anfrage der Abg. Dr. Elisabeth Wiesmüller betreffend „Suche nach kleineren Quartieren<br />
für hilfs- und schutzbedürftige Fremde“ – Ergänzung, Zl. 235/04, Innsbruck, 28.07.2004.<br />
Prock Herbert (2001a): Schriftliche Anfrage der Abg. Dr. Elisabeth Wiesmüller betreffend Flüchtlingsunterkünfte,<br />
Zl. 463/00, Innsbruck, 09.01.2001.<br />
— (2001b): Schriftliche Anfrage der Frau Abg. Dr. Elisabeth Wiesmüller betreffend Situation in den Flüchtlingsheimen<br />
in Tirol, Zl. 251/01Innsbruck, 17.07.2001.<br />
3 Homepages<br />
Amt der Tiroler Landesregierung (AdTLR) (2004), URL: .<br />
Ferienland Kufstein Infobüro Erl (2004), URL: .<br />
Gasthof Eiserne Hand (2004), URL: .<br />
Gemeinde Kössen (2004), URL: .<br />
Gemeinde Leutasch (2004), URL: .<br />
Gemeinde Reith im Alpbachtal (2004), URL: .<br />
Gemeinde Scharnitz (2004), URL: .<br />
Marktgemeinde Jenbach (2004), URL: .<br />
Stadt Imst (2004), URL: .<br />
Stadtgemeinde Lienz (2004), URL: .<br />
Stadtgemeinde Schwaz (2004), URL: .<br />
Tourismusverband Ehrwald-Zugspitze (2004), URL: .<br />
4 Tagesaktuelle Berichterstattung, Wochenzeitungen und Pressemitteilungen 2<br />
Amt der Tiroler Landesregierung (AdTLR), Abt. Öffentlichkeitsarbeit (16.04.2004): Unterkünfte für Asylwerber.<br />
Sozaillandesrätin [sic!] LR Gangl: „Die Bemühungen sind voll am laufen!“, Pressemitteilung, Innsbruck,<br />
16.04.2004.<br />
— (14.05.2004): Imst nimmt 60 Flüchtlinge auf. LR Gangl: „Die Zusammenarbeit mit Imst war mustergültig“,<br />
Pressemitteilung, Innsbruck, 14.05.2004.<br />
— (15.06.2004): Zick-Zack-Kurs in Hall geht auf Kosten hilfloser Menschen. Soziallandesrätin Christa Gangl<br />
kritisiert Asylanten-Absage von Vizebürgermeissterin [sic!] Posch, Pressemitteilung, Innsbruck, 15.06.2004.<br />
— (18.06.2004): Statt Containerdorf kommt Fertigteilhaus in die Rossau. LRin Christa Gangl zum Weltflüchtlingstag:<br />
„Tirol steht zu seiner Verantwortung!“, Pressemitteilung, Innsbruck, 18.06.2004 (Eva Horst-<br />
Wundsam).<br />
— (20.09.2004): LH-Konferenz zu Asylfragen. LR Gangl: „Planbarkeit muss gewährleistet werden!“, Pressemitteilung,<br />
Innsbruck, 20.09.2004.<br />
— (02.12.2004): Fertigteilhaus zur Unterbringung von AsylwerberInnen eröffnet. Vorläufiges Zuhause für 14<br />
Familien in Innsbrucker Stadtteil Rossau, Pressemitteilung, Innsbruck, 02.12.2004 (Florian Schallhart).<br />
Bild (25.05.2000): Asylanten-Protest gegen ihre Isolation: „Unsere Nachbarn sind hier nur Fuchs und Reh“, in:<br />
Bild 25.05.2000, 3 (Sven Hadon).<br />
2 AutorInnen soweit angegeben am Ende des Quellenbelegs.<br />
322
Der Standard (17.03.1992): Der Abgang eines Engagierten. Abgewählter Bürgermeister von Gries ist enttäuscht,<br />
aber nicht verbittert, in: Der Standard 17.03.1992, 7 (Helmut Spudich).<br />
— (28.09.2002): Ganze Familien ohne Obdach. Traiskirchen: 360 Asylwerberfreisetzungen befürchtet, in: Der<br />
Standard 28./29.09.2002, 10 (Irene Brickner).<br />
— (15.10.2002): „In die Illegalität abtauchen“. Flüchtlingsexpertin: Asylverfahren in Österreich in Gefahr, in:<br />
Der Standard 15.10.2002, 7 (Irene Brickner).<br />
— (18.10.2002): Flüchtlingsbetreuung ist ein „riesiger Markt“. In anderen Ländern teilweise privatisiert – in<br />
Österreich überwiegend NGOs vorbehalten, in: Der Standard 18.10.2002, 8.<br />
— (27.11.2002): Blankoscheck zum amtlichen Spionieren, in: Der Standard 27.11.2002, 11.<br />
— (29.11.2002): Tiroler Sozialhilfegesetz soll verschärft werden. Staatsbürgerschaft spielte bisher keine Rolle,<br />
in: Der Standard 29.11.2002, 11.<br />
— (20.12.2002): Herbergssuche ein trauriger Erfolg. Differenzen zwischen UNHCR und Land Tirol über<br />
Flüchtlingsbetreuung, in: Der Standard 20.12.2002, 11.<br />
— (29.01.2003): Asylwerber als Schachfiguren. Novelle des Tiroler Sozialhilfegesetzes reißt Lücke für nicht<br />
betreute Flüchtlinge auf, in: Der Standard 29.01.2003, 9.<br />
— (27.03.2003): Ausländer verlieren Sozialhilfe-Anspruch, in: Der Standard 27.03.2003, 13.<br />
— (07.06.2003): Kundgebung obdachloser Asylwerber, in: Der Standard 07./08./09.06.2003, 9.<br />
— (15.05.2003): Beirat übt scharfe Kritik an Strasser, in: Der Standard 15.05.2003, 11.<br />
— (11.08.2003): Vorwürfe an Strasser nach Flüchtlingsschlägerei mit Totem, in: Der Standard 11.08.2003, 7<br />
(Irene Brickner).<br />
— (12.08.2003a): Juniorchef macht Business mit Flüchtlingen, in: Der Standard 12.08.2003, 24 (Andrea Waldbrunner).<br />
— (12.08.2003b): „Wenn viele Menschen auf einem Haufen sind“, in: Der Standard 12.08.2003, 2.<br />
— (25.08.2003): Österreich für Flüchtlinge Schlusslicht, in: Der Standard 25.08.2003, 7.<br />
— (11.10.2003): Das strengste Recht Europas, in: Der Standard 11./12.10.2003, 10 (Jörg Wojahn).<br />
— (21.10.2003): Asylgesetz ohne Wenn und Aber, in: Der Standard 21.10.2003, 8 (Irene Brickner).<br />
— (23.10.2003): Asylgesetz als Zeichen der Berlusconisierung, in: Der Standard 23.10.2004, 11 (Irene Brickner).<br />
— (24.10.2003): Regierung zieht Asylgesetz durch, in: Der Standard 24.10.2004, 7 (Samo Kobenter).<br />
— (07.11.2003): Die Ortschefs sagen Nein zu Asylwerbern. Widerstand auch gegen Unterbringung in<br />
Pensionen, in: Der Standard 07.11.2003, 10 (Irene Brickner/Elisabeth Steiner).<br />
— (10.11.2003): Flüchtlingsquartiere stehen leer, in: Der Standard 10.11.2003, 5.<br />
— (12.11.2003): Strasser in der Mangel der Kritik, in: Der Standard 12.11.2003, 7.<br />
— (13.11.2003): Asyl: Gericht rügt Minister, in: Der Standard 13.11.2003, 10 (Irene Brickner/Michael Simoner).<br />
— (20.12.2003): Strassers Weihnachtsfriede für Flüchtlinge, in: Der Standard 20./21.12.2003, 8 (Irene Brickner).<br />
— (12.01.2004): Integrationsball wurde zur Polit-Bühne, in: Der Standard 12.01.2004, 7.<br />
— (23.01.2004): EU-Finanzstreit belastet Asylpolitik, in: Der Standard 23.01.2004, 4 (Jörg Wojahn).<br />
— (05.02.2004): Ein Leben zwischen Schubhaft, Straße und Flüchtlingsheim. Journalist musste in zwei Jahren<br />
17-mal Quartier wechseln, in: Der Standard 05.02.2004, 10 (Benedikt Sauer).<br />
— (10.03.2004): Einsatz für Asylwerber von Wählern belohnt. Klarer Wahlsieg für SPÖ-Bürgermeister von<br />
Landeck nach Öffnung eines Flüchtlingsheims, in: Der Standard 10.03.2004, 9.<br />
— (06.04.2004): „Ist das hier nicht Europa?“ Caritas schließt Asylwerberquartier, Strasser: „Menschenverachtend“,<br />
in: Der Standard 06.04.2004, 8 (Irene Brickner).<br />
— (08.04.2004): Rufschädigende Obdachlosigkeit. Lorenz Fritz: Asylwerber auf der Straße gefährden Wirtschaftsstandort,<br />
in: Der Standard 08.04.2004, 10.<br />
— (08.05.2004): Container-Siedlung für 100 Flüchtlinge, in: Der Standard 08./09.05.2004, 13.<br />
— (22.06.2004): Keine Containersiedlung in Tirol. Land baut nach Kritik Fertigteilhaus, in: Der Standard<br />
22.06.2004, 10.<br />
— (25.06.2004): „Flüchtlinge internieren“. Ein Wunsch von Herwig van Staa führt zu heftigen Reaktionen, in:<br />
Der Standard 25.06.2003, 8.<br />
— (26.08.2004): Volders fördert Filter für Diesel-Pkw, in: Der Standard 26.08.2004, 8 (Hannes Schlosser).<br />
— (08.09.2004): Sondersitzung zu Asylquoten der Länder. Van Staa: „Kriminelle Asylwerber ausweisen“, in:<br />
Der Standard 08.09.2004, 8.<br />
— (16.09.2004): Flüchtlingslager in der Ukraine gefordert. Innenminister will tschetschenische Flüchtlinge<br />
außerhalb der EU unterbringen, in: Der Standard 16.09.2004, 8.<br />
— (05.10.2004): Asyl-Chaos um die Kasernen/Streit um Asylquartiere eskaliert, in: Der Standard 05.10.2004, 1 und 8.<br />
— (06.10.2004): Asyl in Kasernen: „Wirkung entfaltet“. Strasser schlägt neue Erstaufnahmezentren vor, in: Der<br />
Standard 06.10.2004, 7.<br />
— (14.10.2004): Strasser will 400 Flüchtlinge „freisetzen“, in: Der Standard 14.10.2004, 10.<br />
— (15.10.2004): Asylwerber vor die Tür gesetzt, in: Der Standard 15.10.2004, 11.<br />
— (19.10.2004): Asyl: Schleppende Übersiedlung. Streit um „Hilfsbedürftigkeit“, in: Der Standard 19.10.2004, 8.<br />
323
— (28.10.2004): „Elemente politischer Verfolgung“. Kritik von Amnesty an Polizeiermittlungen gegen Asylanwälte,<br />
in: Der Standard 28.10.2004, 12.<br />
— (30.10.2004): Mysteriöse Ermittlungen eingestellt. Menschenrechtsbeirat prüft Ministerkabinett und Kriminalisten,<br />
in: Der Standard 30./31.10.2004, 13.<br />
— (20.11.2004): Weniger Geld, mehr Zwang: Strasser entfacht Asyldebatte, in: Der Standard 20./21.11.2004, 13<br />
(Markus Rohrhofer/Irene Brickner).<br />
— (26.11.2004): Höchstrichter Korinek warnt vor Strassers Asylplänen. Reform wäre „Systembruch“, in: Der<br />
Standard 26.11.2004, 1.<br />
— (03.12.2004): Eigenes Auto – kein Asylquartier. Erster Konsens über neue Kriterien der „Hilfsbedürftigkeit“,<br />
in: Der Standard 03.12.2004, 8 (Irene Brickner).<br />
Die NEUE (02.10.2004): Asylwerber sollen in Kufsteiner Kaserne, in: Die NEUE 02.10.2004, 4-5.<br />
— (10.11.2004): Flüchtlingsheim in Lienz eröffnet, in: Die NEUE 10.11.2004, 6.<br />
Die Presse (01.10.2002): Strasser: „Drohen Anlaufstelle aller Wirtschaftsflüchtlinge zu werden“, in: Die Presse<br />
01.10.2002, 27 (Norbert Rief).<br />
— (08.10.2002): Debatte um Asylwerber verschärft sich. Hilfsorganisationen stellen Notquartiere, in: Die Presse<br />
08.10.2002, 8.<br />
— (16.10.2003a): Strasser zu Asylgesetz: „Der liebe Gott gehört nicht der Caritas“, in: Die Presse 16.0.2003, 2<br />
(Rainer Nowak).<br />
— (16.10.2003b): Strassers Plan ist der EU zu restriktiv, in: Die Presse 16.10.2003, 3 (Andreas Schnauder).<br />
— (20.10.2003): „Grundsätze der Rechtsordnung verletzt“, in: Die Presse 20.10.2003, 6.<br />
— (08.04.2004): Strasser: „Kampagne der Caritas“, in: Die Presse 08.04.2004, 9 (Christine Lugmayr/Michael<br />
Fleischhacker).<br />
— (11.12.2004): „Hätte durchaus Interesse“, in: Die Presse 11.12.2004, 4 (Claudia Dannhauser).<br />
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Landeck (15.12.2003a): Hochstöger: Nein zum Asylheim „Kaifenau“ in<br />
Landeck! Scharfe FP-Kritik am Vorgehen von Bürgermeister Stenico! Gemeinderat von Bgm. Stenico<br />
belogen!, Pressemitteilung, Landeck, 15.12.2003.<br />
— (15.12.2003b): Hochstöger: Bürgermeister Stenico entgleitet Diskussion um geplantes Asylheim! FP-Kritik<br />
an dilettantischem Vorgehen des Landecker Bürgermeisters! Hochstöger kritisiert vorweihnachtliche<br />
Heuchelei!, Pressemitteilung, Landeck, 15.12.2003.<br />
— (16.12.2003): Asylheim: Scharfe FP-Kritik an Mattle, Bock und Landecker VP! Hochstöger kritisiert verantwortungslose<br />
und feige Politik der VP! Die Kaufmannschaft von Landeck und Zams unterstützt FP-Linie!,<br />
Pressemitteilung, Landeck, 16.12.2003.<br />
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Reutte (10.09.2002): FPÖ: Kriminelle Asylanten sofort abschieben! Für<br />
FPÖ Reutte ist der Standort des Asylantenheims in Vils völlig ungeeignet! FPÖ kritisiert fehlende Information<br />
der Bürger und Verharmlosung der Kriminalität der Asylanten!, Pressemitteilung, Reutte, 10.09.2002.<br />
Jungle World (11.08.2004): Jenseits des Grenzcamps. Die Anti-Lager-Tour protestiert gegen die systematische<br />
Ausgrenzung von Flüchtlingen, in: Jungle World (34), 11.08.2004 (Anke Schwarzer).<br />
Kurier (09.11.2002): 240 Flüchtlinge auf Herbergsuche. Krisengipfel um notwendige Schließung von<br />
Beratungsstelle in Wilten, in: Kurier (Ausgabe Tirol) 09.11.2002, 10 (Alexandra Plank).<br />
Österreichischer Rundfunk (ORF) (01.05.2004): Asylwerber: In Tirol fehlen noch 150 Quartierplätze, in:<br />
tirol.ORF.at 01.05.2004, URL: .<br />
— (06.05.2004): Einquartierung: <strong>Neue</strong> Flüchtlingsheimat Mentlberg, in: tirol.ORF.at 06.05.2004, URL:<br />
.<br />
— (07.05.2004): Flüchtlinge in Tirol angekommen, in: tirol.ORF.at 07.05.2004, URL: .<br />
— (02.10.2004): Flüchtlinge in Hall in Tirol: Es geht auch anders, Ö1 Mittagsjournal 02.10.2004 (Georgia Schultze).<br />
— (10.12.2004): Radioberichterstattung anlässlich des Rücktrittes von Innenminister Dr. Ernst Strasser, Ö1<br />
Mittagsjournal 10.12.2004.<br />
— (11.12.2004): Im Journal zu Gast: Dr. Ernst Strasser, Radiointerview, Ö1 Mittagsjournal 11.12.2004.<br />
Österreichische Volkspartei (ÖVP) Tirol (16.01.2003): Sozialhilfe-Anspruch brachte Flüchtlingsstrom ins<br />
Rollen. LH van Staa: „Änderungen des Sozialhilfe-Gesetzes im Bereich Flüchtlingswesen notwendig!“,<br />
Pressemitteilung, Innsbruck, 16.01.2003.<br />
— (17.01.2003): LH Herwig van Staa hält an Novellierung des Sozialhilfegesetzes fest: „Hilfe für echte Flüchtlinge,<br />
aber keine Sozialhilfe für Illegale!“, Pressemitteilung, Innsbruck, 17.01.2003.<br />
Osttiroler Bote (15.09.2004): Lienz: Asylwerber angekommen, in: Osttirol Online 15.09.2004, URL:<br />
[20.09.2004].<br />
Rundschau (16.12.2003): „Verpflichtung zur Menschlichkeit“. In Landeck könnte ein Asylwerber-Heim<br />
entstehen, in: Rundschau – Oberländer Wochenzeitung 16.12.2003 (Daniel Haueis).<br />
— (23.12.2003a): „Nur miteinander, nicht gegeneinander“. Heute, Dienstag, treffen die ersten Asylwerber in<br />
Landeck ein, in: Rundschau – Oberländer Wochenzeitung 23.12.2003 (Daniel Haueis).<br />
324
— (23.12.2003b): „Too much problems“. Renya Matti erzählt vom Schicksal ihrer Familie, in: Rundschau –<br />
Oberländer Wochenzeitung 23.12.2003 (Daniel Haueis).<br />
— (05.01.2004): „... und sehr viel Hilfsbereitschaft“. Ein Lokalaugenschein im Asylwerberheim Landeck, in:<br />
Rundschau – Oberländer Wochenzeitung 05.01.2004 (Daniel Haueis).<br />
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) Tirol (22.10.2003): Christa Gangl, Innsbruck-Land. Landesrätin<br />
für Soziales, Pressemitteilung, Innsbruck, 22.10.2003.<br />
— (24.08.2004): LR Gangl: „Imst als vorbildhaftes Beispiel zur Flüchtlingsunterbringung“. Eröffnung des<br />
Asylantenheims in der Alten Kaserne in Imst, Pressemitteilung, Innsbruck, 24.08.2004.<br />
— (21.09.2004): Unterbringung von AsylwerberInnen. Soziallandesrätin Christa Gangl will gerechte Verteilung,<br />
Pressemitteilung, Innsbruck, 21.09.2004.<br />
— (06.10.2004): AsylwerberInnen in der Kaserne Kufstein: LR Christa Gangl ist zuversichtlich: „Glaube, dass<br />
wir hier gemeinsam eine gute Lösung finden können!“, Pressemitteilung, Innsbruck, 06.10.2004.<br />
— (19.10.2004): Soziallandesrätin Christa Gangl: Eröffnete heute offiziell die Flüchtlingsunterbringung im<br />
„Annaheim“ Hall, Pressemitteilung, Innsbruck, 19.10.2004.<br />
Stadtblatt Innsbruck (29.12.2003): „Feuerwehrprojekt“: „Uns ist der Mensch wichtig – keiner darf erfrieren“, in:<br />
Stadtblatt Innsbruck (52), 29.12.2004, 54 (Klaus Graber).<br />
— (07.01.2004): Polit-Gezerre um Obdachlose. Caritas-Lob für Bgm. Zach, in: Stadtblatt Innsbruck (2),<br />
07.01.2004, 3 (Charlie Zanon).<br />
— (25.08.2004): Kein Platz für Flüchtlinge/Keine Unterkünfte von der Stadt: Innsbruck bietet nach wie vor<br />
keine Quartiere für Flüchtlinge an, in: Stadtblatt Innsbruck (35), 25.08.2004, 1-3.<br />
tip (30.04.2004): 250 Menschen ohne Unterkunft. Mit 1. Mai tritt das neue Gesetz über Grundversorgung von<br />
Asylwerbern in Kraft – Plätze fehlen, in: tip 27 (18), 30.04.2004, 2-3 (Cornelia Ritzer).<br />
— (14.05.2004): Kritik an Container-Lösung. Grüne gegen Umquartierung der Asylwerber von Mentlberg in die<br />
Rossau, in: tip 27 (20), 14.05.2004, 2-3 (Cornelia Ritzer).<br />
— (25.06.2004): Statt Container-Dorf entsteht Fertigteil-Haus in der Rossau. Mehr Flüchtlinge als erwartet<br />
kommen nach Tirol – Container-Dorf wäre zu teuer, in: tip 27 (26), 25.06.2004, 2.<br />
— (16.07.2004): Schutzraum für Flüchtlinge. Ankyra ist die erste psychotherapeutische Einrichtung für Asylwerber<br />
in Tirol, in: tip 27 (29), 16.07.2004, 9.<br />
— (10.12.2004): Fertigteilhaus für 80 Asylwerber. Asylantenheim in der Rossau wurde eröffnet – Fertigteilhaus<br />
statt umstrittene Container, in: tip 27 (50), 10.12.2004, 6 (Patrick Cassitti).<br />
— (28.01.2005): Flüchtlingsheim eröffnet. 73 Asylwerber sind im alten Schulungsheim der Landwirtschaftskammer<br />
untergebracht, in: tip 28 (4), 28.01.2005, 16.<br />
Tiroler Tageszeitung (02.11.1979): Aus der Hölle von Laos in die neue Heimat Tirol, in: Tiroler Tageszeitung<br />
02.11.1979, 4.<br />
— (02.05.1996): Zeit noch nicht reif für Rückkehr. Kriegsflüchtlinge in Tirol: Experte Logar vorsichtig, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 02.05.1996, 4.<br />
— (20.06.2001): „Ich will in Österreich bleiben“. Stadtcaritas beherbergt Flüchtlingsfamilie aus Nigeria und<br />
fordert Betreuungsmöglichkeiten in Innsbruck, in: Tiroler Tageszeitung 20.06.2001, 6.<br />
— (21.06.2001): 250 Flüchtlinge werden betreut, in: Tiroler Tageszeitung 21.06.2001, 5.<br />
— (19.10.2001): Ruhe statt Aggression im neuen Flüchtlingsheim, in: Tiroler Tageszeitung 19.10.2001, 5.<br />
— (14.03.2002): Tiroler Logos prägen serbische Stadt, in: Tiroler Tageszeitung 14.03.2002, 12 (Margret Klausner).<br />
— (13.05.2002): Tiroler Hilfe bringt Indjija Aufschwung. Letzte offizielle Dienstreise führte LH-Stv. Prock nach<br />
Serbien, in: Tiroler Tageszeitung 13.05.2002, 10 (Margret Klausner).<br />
— (11.09.2002): Abschiebung straffälliger Asylanten nicht möglich, in: Tiroler Tageszeitung 11.09.2002, 11<br />
(Helmut Mittermayr).<br />
— (27.09.2002): Landesrätin auf Herbergssuche. Immer mehr Asylwerber stehen im Regen – Gangl ruft Tiroler<br />
auf, dem Land Unterkünfte zu vermieten, in: Tiroler Tageszeitung 27.02.2002, 10.<br />
— (24.10.2002a): Flüchtlinge: Land fehlt Konzept, in: Tiroler Tageszeitung 24.10.2002, 4.<br />
— (24.10.2002b): Flüchtlinge sorgen für Lernprozess. 31 Flüchtlinge aus aller Welt fanden beim Brennerwirt in<br />
Kössen vorübergehend eine neue Heimat, in: Tiroler Tageszeitung 24.10.2002, 14 (Margret Klausner).<br />
— (29.11.2002): Sozialhilfe für Illegale umstritten. Sprenger: Keine Toleranz für Auswüchse, in: Tiroler Tageszeitung<br />
29.11.2002, 20.<br />
— (30.11.2002): Sozialhilfe: Sprenger im Schussfeld. „Städtische Erbsenzählerei mit Illegalen“, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 30.11./01.12.2002, 26.<br />
— (18.12.2002a): Alkohol und Prügel: Georgier sorgen für Ärger, in: Tiroler Tageszeitung 18.12.2002, 11.<br />
— (18.12.2002b): Streit im Flüchtlingsheim artete in Kleinkrieg aus, in: Tiroler Tageszeitung 18.12.2002, 11.<br />
— (19.12.2002): Georgier: Keine Abschiebung. Fieberbrunn: Schwierige Ermittlungen, in: Tiroler Tageszeitung<br />
19.12.2002, 12.<br />
— (20.12.2002): Georgier bringen viele Asylanten in Misskredit, in: Tiroler Tageszeitung 20.12.2002, 13.<br />
— (24.12.2002): Logar wollte Handtuch werfen, in: Tiroler Tageszeitung 24./25./26.12.2002, 4.<br />
325
— (08.01.2003): Integrationsball soll für alle ein Fest sein, in: Tiroler Tageszeitung 08.01.2003, 10.<br />
— (21.01.2003): Nach SPÖ-Einlenken scheint Regierungskrise beigelegt. Gangl bringt den von van Staa<br />
gewünschten Vorschlag für das Sozialhilfegesetz ein, in: Tiroler Tageszeitung 21.01.2003, 4.<br />
— (25.01.2003a): Mehr Mut zur Menschlichkeit, Leserinnenbrief, in: Tiroler Tageszeitung 25./26.01.2003, 26<br />
(Roswitha Ladurner).<br />
— (25.01.2003b): Nur ein paar Flüchtlinge, Leserbrief, in: Tiroler Tageszeitung 25./26.01.2003, 26 (Hannes König).<br />
— (06.02.2003): „Viele Gäste haben Angst“, in: Tiroler Tageszeitung 06.02.2003, 12 (Egmont Kohlhofer).<br />
— (17.02.2003): Leiter des Asylheims schlagen Alarm, in: Tiroler Tageszeitung 17.02.2003, 11.<br />
— (22.03.2003): Wiesmüllers Empörung, in: Tiroler Tageszeitung 22./23.03.2003, 10.<br />
— (07.06.2003): Demo vor der Annasäule, in: Tiroler Tageszeitung 07./08./09.06.2003, 12.<br />
— (20.06.2003): Politstreit um Asylwerber, in: Tiroler Tageszeitung 20.06.2003, 4.<br />
— (28.06.2003): Gangl: Genug Platz für Asylwerber, in: Tiroler Tageszeitung 28./29.06.2003, 23.<br />
— (25.08.2003): Massiver Tadel für die Asylpolitik. UNHCR-Mahnung an die Adresse Österreichs, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 25.08.2003, 1.<br />
— (13.09.2003): Flüchtlinge sind im Internat unerwünscht. Volders ist gegen den verlängerten Aufenthalt, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 13/14.09.2003, 22.<br />
— (24.09.2003): In Pradl ist der Treffpunkt der Welt. Caritas-Integrationshaus feiert fünften Geburtstag, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 24.09.2003, 23 (Stefanie Kammerlander).<br />
— (23.10.2003): Caritas schafft „Warteraum“ für die Nacht. Ehrenamtliche für Nachtwache gesucht, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 23.0.2003, 24.<br />
— (04.11.2003): <strong>Neue</strong>s Asylgesetz wird als Betreuungsbremse wirken. Statt 420 künftig nur 300 Asylwerber –<br />
Streit um Unterkünfte, in: Tiroler Tageszeitung 04.11.2003, 4.<br />
— (12.11.2003): Asylantenfehde mit Messer ausgetragen, in: Tiroler Tageszeitung 12.11.2003, 11 (Angela Jungfer).<br />
— (13.11.2003): Gangls Heimsuche blieb bislang ohne großen Erfolg, in: Tiroler Tageszeitung 13.11.2003, 14.<br />
— (24.11.2003): Hilft der Asylpakt sparen?, in: Tiroler Tageszeitung 24.11.2003, 4.<br />
— (30.11.2003): Tiroler Kühe grasen auch am Balkan, in: Tirol Online 30.11.2003 (22.05:07), URL:<br />
(Margret Klausner).<br />
— (02.12.2003): Bund und Länder bei Flüchtlingen einig. LH van Staa rechnet mit weniger Flüchtlingen als<br />
bisher, in: Tiroler Tageszeitung 02.12.2003, 4.<br />
— (12.12.2003): Warteraum kann Not nur aufzeigen. Bis zu 24 Personen nächtigen täglich auf Matten im<br />
Integrationshaus, in: Tiroler Tageszeitung 12.12.2003, 23 (Elke Ruß).<br />
— (16.12.2003a): BM Stenico ringt um Landecker Asylheim, in: Tiroler Tageszeitung 16.12.2003, 12.<br />
— (16.12.2003b): Asylheim: Scharfe FP-Kritik an Mattle, Bock und Landecker VP! Hochstöger kritisiert verantwortungslose<br />
und feige Politik der VP! Die Kaufmannschaft von Landeck und Zams unterstützt FP-Linie!,<br />
in: Tirol Online 16.12.2003 (11:25:30), URL: .<br />
— (17.12.2003): In Landeck wird ein Weihnachtsmärchen wahr, in: Tiroler Tageszeitung 17.12.2003, 12.<br />
— (23.12.2003a): Dorfchefs bei Asylfrage im Stich gelassen. Flüchtlingskoordinator Logar rügt Bund, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 23.12.2003, 1.<br />
— (23.12.2003b): Plätze für weitere 300 Asylanten gesucht. Logar: Zu viel Druck für Bürgermeister, Kirche<br />
könnte mehr tun, in: Tiroler Tageszeitung 23.12.2003, 4 (Anita Heubacher).<br />
— (24.12.2003a): 30 Asylwerber per Bus eingetroffen, in: Tiroler Tageszeitung 24./25./26.12.2003, 12.<br />
— (05.01.2004): Kulturenfest im Zeichen der Jugend. Jugendliche Flüchtlinge und Graffiti-Künstler sind<br />
Spezialgäste beim 5. Integrationsball in Innsbruck, in: Tiroler Tageszeitung 05./06.01.2004, 22.<br />
— (10.01.2004): Frage der Flüchtlinge ist für Zach gelöst. Windischer will ständigen Warteraum, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 10./11.01.2004, 20.<br />
— (26.02.2004): Grüne fordern Mindestmaß an Menschlichkeit. Ende des Innsbrucker Warteraums schürt<br />
Flüchtlingsdebatte – Gangl verspricht Lösung, in: Tiroler Tageszeitung 26.02.2004, 19.<br />
— (01.03.2004a): Die Au wird zum Politikum. Zur Verkehrsentlastung haben die BM-Kandidaten unterschiedliche<br />
Ansichten, in: Tiroler Tageszeitung 01.03.2004 (Sonderausgabe Gemeinderatswahl 2004), 14.<br />
— (01.03.2004b): Heißer Kampf um Scharnitz. Vier Listen, vier BM-Kandidaten und davon zwei Frauen, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 01.03.2004 (Sonderausgabe Gemeinderatswahl 2004), 9.<br />
— (02.03.2004): Land Tirol schafft Anlaufstelle für Flüchtlinge. Caritas übergab 17 Flüchtlinge aus dem<br />
„Warteraum“ an das Land, in: Tiroler Tageszeitung 02.03.2004, 9.<br />
— (03.03.2004): Strenge Auswahl für Asylplätze, in: Tiroler Tageszeitung 03.03.2004, 4.<br />
— (09.03.2004): Von der VP-Hochburg zum roten Musterbezirk, in: Tiroler Tageszeitung 09.03.2004, 5.<br />
— (25.03.2004): Teestuben-Warteraum ist wieder nur eine Notlösung. Initiative für die Rechte von Flüchtlingen<br />
drängt auf Tiroler Gipfel, in: Tiroler Tageszeitung 25.03.2004, 22.<br />
— (02.04.2004): Messerattentat im Asylheim: Ein Jahr Haft, in: Tiroler Tageszeitung 02.04.2004, 12.<br />
326
— (13.04.2004): Nächstenliebe auf dem Prüfstand. Am Donnerstag beziehen 20 Asylwerber ein Gasthaus mitten<br />
in Ehrwald. In der Bevölkerung herrscht großes Misstrauen, in: Tirol Online 13.04.2004 (18:53:30), URL:<br />
(Angela<br />
Jungfer).<br />
— (14.04.2004a): Gezeter um Asylquote bei Bund und Land, in: Tiroler Tageszeitung 14.04.2004, 4.<br />
— (14.04.2004b): Land fehlen bis zu 250 Asylplätze. LH appeliert an Kirche und Bundesheer, in: Tiroler Tageszeitung<br />
14.04.2004, 1.<br />
— (14.04.2004c): TVB und Gemeinde in Rage. Touristiker und Gemeindeführung sind mit der Unterbringung<br />
der vorerst 20 Asylwerber in Ehrwald nicht einverstanden, in: Tirol Online 14.04.2004 (19:18:37), URL:<br />
.<br />
— (22.04.2004): 250 Flüchtlinge stehen vor der Tür. Wie Landeck und Volders mit Asylwerbern umgehen –<br />
Schwarze Schafe verschärfen die Situation, in: Tiroler Tageszeitung 22.04.2004, 11.<br />
— (23.04.2004): Debatte um Unterkunft für Asylwerber eskaliert. Eklat in Ehrwald: Während Gemeinde und<br />
TVB mit dem Flüchtlingskoordinator über 17 Asylanten verhandelten, zogen 21 in den Bayrischen Hof ein,<br />
in: Tirol Online 23.04.2004 (07:41:28), URL: .<br />
— (27.04.2004): Gezänk wegen Asyl, in: Tiroler Tageszeitung 27.04.2004, 4.<br />
— (04.05.2004): „Wir fragen nicht, warum jemand da ist“. Das Rote Kreuz betreut in Kleinvolderberg 63 Asylwerber,<br />
in: Tiroler Tageszeitung 04.05.2004, 11.<br />
— (05.05.2004): Eberle will Fernpass und Wasserkraft ausbauen, in: Tiroler Tageszeitung 05.05.2004, 11.<br />
— (07.05.2004a): Land baut für Asylwerber ganzes Container-Dorf. Grüne über Gangls „Heimlichtuerei“<br />
erzürnt – In acht Wochen 50 Container fertig, in: Tiroler Tageszeitung 07.05.2004, 1.<br />
— (07.05.2004b): „Tirol hat Asylquote erfüllt“, in: Tiroler Tageszeitung 07.05.2004, 4.<br />
— (08.05.2004): Spannung in der Koalition. Gangl will Mentlberg für Asylwerber auf Dauer nutzen, ÖVP sagt<br />
nein, in: Tiroler Tageszeitung 08./09.05.2004, 6.<br />
— (10.05.2004): Vom Asyl zum Naturschutz, in: Tiroler Tageszeitung 10.05.2004, 4.<br />
— (13.05.2004a): Heiße Debatte über Asyl und Gletscher, in: Tiroler Tageszeitung 13.05.2004, 4.<br />
— (13.05.2004b): Imst öffnet Herzen und Türen für Flüchtlinge. Auch in Imst klopfte LR Christa Gangl an in<br />
Sachen Flüchtlingen, in: Tirol Online 13.05.2004 (17:33:44), URL: .<br />
— (13.05.2004c): Lienz bietet Platz für Asylanten an. BM Hibler ist verwundert, dass bis jetzt noch niemand auf<br />
das Angebot der Stadt Lienz, zwei bis drei Asylantefamilien aufzunehmen, reagiert hat, in: Tirol Online<br />
13.05.2004 (20:39:21), URL: .<br />
— (14.05.2004): Imst und Schwaz bieten Asylplätze, in: Tiroler Tageszeitung 14.05.2004, 4.<br />
— (15.05.2004a): Das Innsbrucker „Lager“, Leserbrief, in: Tiroler Tageszeitung 15./16.05.2004, 28 (Sylvia Dürr).<br />
— (15.05.2004b): Es ist eine Schande!, Leserbrief, in: Tiroler Tageszeitung 15./16.05.2004, 28 (Siegfried<br />
Mittermüller).<br />
— (17.05.2004): Asyl: Schüler schimpften Minister. Strasser von Tiroler Aufnahmequote enttäuscht – BM Hilde<br />
Zach findet Container samt Standort ideal, in: Tiroler Tageszeitung 17.05.2004, 21 (Helmut Mittermayr).<br />
— (21.05.2004): Ein Zuhause für Heimatlose: Hall nimmt 40 Flüchtlinge auf, in: Tiroler Tageszeitung<br />
21.05.2004, 20.<br />
— (02.06.2004): Platznot im Asylantenheim. Übersiedlung nach Fieberbrunn lindert Überbelegung in St.<br />
Gertraudi, in: Tiroler Tageszeitung 02.06.2004, 13.<br />
— (03.06.2004): „Container-Dorf kommt – egal, um welchen Preis!“, in: Tiroler Tageszeitung 03.06.2004, 11.<br />
— (07.06.2004): „Und jetzt gebt’s euch einen Ruck“. Notschlafstelle wurde geschlossen: Luggi Brantner, früher<br />
selbst obdachlos, lud zum Flüchtlingsgipfel, in: Tiroler Tageszeitung 07.06.2004, 23 (Michaela Spirk-Paulmichl).<br />
— (08.06.2004): Tirol erfüllt Asyl-Quote nicht, in: Tiroler Tageszeitung 09./10.06.2004, 4.<br />
— (09.06.2004): Symbolische Straßensperre in Volders durch SPÖ-Spitze, in: Tiroler Tageszeitung<br />
09./10.06.2004, 27.<br />
— (11.06.2004a): Flüchtlinge lernen Deutsch und spielen mit Tiroler Familien, in: Tiroler Tageszeitung<br />
11.06.2004, 23.<br />
— (11.06.2004b): Platz für Flüchtlinge in Hall fraglich. Sicherheit des Hauses wird diskutiert, in: Tiroler Tageszeitung<br />
11.06.2004, 21 (Miriam Sulaiman).<br />
— (15.06.2004): Posch hat Argumente gegen Asylwerber in Hall. Vizebürgermeisterin Eva Posch sieht Gefahr<br />
für den Pflegeerfolg, wenn im Altersheim Flüchtlinge wohnen, in: Tiroler Tageszeitung 15.06.2004, 19.<br />
— (16.06.2004a): Asylpläne bringen Länder in Rage: Van Staa und Haider drohen Innenminister, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 16.06.2004, 1.<br />
327
— (16.06.2004b): Van Staa lässt Innenminister mit seinen Asylplänen abblitzen. Landeshauptmann sieht<br />
„mustergültiges Verhalten Tirols“ und droht Vereinbarung mit Bund zu lösen, in: Tiroler Tageszeitung<br />
16.06.2004, 4.<br />
— (17.06.2004): Tirol gibt bei Asyl nach: Anreise nächste Woche, in: Tiroler Tageszeitung 17.06.2004, 4.<br />
— (18.06.2004): Annaheim für 40 Flüchtlinge: Land am Zug. Rot-goldenes Bündnis trotzt Haller ÖVP, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 18.06.2004, 22.<br />
— (19.06.2004): Aus für Container, Fertigteilhaus kommt, in: Tiroler Tageszeitung 19./20.06.2004, 6.<br />
— (22.06.2004): Innenminister schickt 50 Asylwerber mit Bus. Notquartiere in Mentlberg und Götzens, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 22.06.2004, 4.<br />
— (23.06.2004): 50 Asylwerber in Tirol angekommen, in: Tiroler Tageszeitung 23.06.2004, 4.<br />
— (24.06.2004a): Asylsuche mit Erfolg in Lienz. Ehrwald ärgert sich, in: Tiroler Tageszeitung 24.06.2004, 24.<br />
— (24.06.2004b): Wer hat an der Uhr gedreht? Polizei-Großeinsatz im Flüchtlingsheim Mentlberg, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 24.06.2004, 24.<br />
— (24.06.2004c): Zwei Drittel sind knapp bei Kasse, in: Tiroler Tageszeitung 24.06.2004, 4.<br />
— (25.06.2004): Flüchtlingen wird Anker zugeworfen, in: Tiroler Tageszeitung 25.06.2004, 11.<br />
— (28.06.2004): Asylpolitik wird Zankapfel, in: Tiroler Tageszeitung 28.06.2004, 4.<br />
— (29.06.2004): Strasser will Busse schicken, in: Tiroler Tageszeitung 29.06.2004, 4.<br />
— (03.07.2004a): Endlich ein offenes Wort, Leserinnenbrief, in: Tiroler Tageszeitung 03./04.07.2004, 26 (Ingrid<br />
Brunner).<br />
— (03.07.2004b): Grüne Verbalentgleiser, Leserbrief, in: Tiroler Tageszeitung 03./04.07.2004, 26 (Paul Hashold).<br />
— (05.07.2004): Van Staa bei Asylfrage hart, in: Tiroler Tageszeitung 05.07.2004, 4.<br />
— (10.07.2004): Obdach für 50 Asylwerber. Land verhandelt mit Landwirtschaftskammer über Schulungsheim,<br />
in: Tiroler Tageszeitung 10./11.07.2004, 6.<br />
— (31.07.2004a): Asylantin droht mit Hungerstreik, in: Tirol Online 31.07.2004 (13:10:04), URL:<br />
.<br />
— (31.07.2004b): Van Staa will leiser werden und sieht Grüne als Fundamentalisten, in: Tiroler Tageszeitung<br />
31.07./01.08.2004, 6 (Frank Staud).<br />
— (03.08.2004): Kloster nicht für Asylanten geeignet, in: Tirol Online 03.08.2004 (18:07:29), URL:<br />
.<br />
— (05.08.2004): Autobahn stößt 2008 an die Grenze. Letzter Teilabschnitt soll in vier Jahren eröffnet werden –<br />
Verkehrslösung für das Außerfern steht aus, in: Tiroler Tageszeitung 05.08.2004, 9 (Simone Falger).<br />
— (14.08.2004a): Polizei für schärferes Asylrecht, in: Tiroler Tageszeitung 14./15.08.2004, 21.<br />
— (14.08.2004b): Vize Blaha gegen Asylantenheim, in: Tiroler Tageszeitung 14./15.08.2004, 22.<br />
— (17.08.2004): Zahl der Asylwerber in Tirol steigt weiter, 600 Quartiere fehlen noch, in: Tiroler Tageszeitung<br />
17.08.2004, 4.<br />
— (19.08.2004a): Eine breite Front gegen Asylanten. Stimmung in Scharnitz aufgeheizt – Betriebe fürchten um<br />
Geschäft – Gangl will Gespräche führen, in: Tiroler Tageszeitung 19.08.2004, 13 (Albert Bloch).<br />
— (19.08.2004b): FP fordert Aufnahmestopp, in: Tiroler Tageszeitung 19.08.2004, 4.<br />
— (20.08.2004a): Blaha: Gangl fehlt der Realitätssinn, in: Tiroler Tageszeitung 20.08.2004, 10.<br />
— (20.08.2004b): Härte gegen kriminelle Asylanten. Polizeichef Angermair im TT-Interview, in: Tiroler Tageszeitung<br />
20.08.2004, 1.<br />
— (21.08.2004a): LH verhängt Aufnahmestopp für Asylwerber. Gangl fordert Bund auf, Kasernen zu öffnen, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 21./22.08.2004, 6.<br />
— (21.08.2004b): Rapoldipark-Szene im Fadenkreuz. Polizei und Stadt intensivieren Überwachung, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 21./22.08.2004, 21.<br />
— (21.08.2004c): SP-Chef Gschwentner sieht sich nicht als Ministrant in der Koalition, in: Tiroler Tageszeitung<br />
21./22.08.2004, 6 (Anita Heubacher).<br />
— (24.08.2004a): Asyl: Ruf nach härterer Gangart. Abschiebung während des Asylverfahrens derzeit unmöglich,<br />
in: Tiroler Tageszeitung 24.08.2004, 4.<br />
— (24.08.2004b): Gangl streut den Imstern Rosen, in: Tiroler Tageszeitung 24.09.2004, 4.<br />
— (24.08.2004c): Strasser lässt van Staa bei Asyl abblitzen. <strong>Neue</strong>r Schlagabtausch um Asyl-Quartiere, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 24.08.2004, 1.<br />
— (01.09.2004a): Eldorado für Wanderer und Tourengeher. Oft liegt bis zum Frühsommer Schnee, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 01.09.2004, 22.<br />
— (01.09.2004b): Haggen und St. Sigmund, in: Tiroler Tageszeitung 01.09.2004, 22.<br />
— (08.09.2004): LH bilanziert vom Asyl bis zur Pflege, in: Tiroler Tageszeitung 08.09.2004, 4.<br />
— (10.09.2004): Verdächtige leugnen hartnäckig, in: Tiroler Tageszeitung 10.09.2004, 11.<br />
— (16.09.2004a): Asylwerber zu Unrecht kriminalisiert. Ein Siebtel aller Straftaten wird von Fremden begangen<br />
– Steigerung gegenüber 2003 um zehn Prozent, in: Tiroler Tageszeitung 16.09.2004, 11 (Mario Zenhäusern).<br />
328
— (16.09.2004b): FPÖ lässt Strasser mit Asylplan vorerst abblitzen. „Keine Aufteilung auf Bundesgebiet“ –<br />
Auffanglager für Tschetschenen?, in: Tiroler Tageszeitung 16.09.2004, 3.<br />
— (16.09.2004c): VP setzt auf Schiene und Härte bei Asyl, in: Tiroler Tageszeitung 16.09.2004, 4.<br />
— (20.09.2004): „Die Sache ist total aufgebauscht“. Hauseigentümerin: Bereichere mich nicht an Scharnitz –<br />
Gangl: Notfalls nur eine Familie unterbringen, in: Tiroler Tageszeitung 20.09.2004, 22 (Albert Bloch).<br />
— (21.09.2004a): Asylrecht soll noch schärfer werden. Van Staa: Flüchtlingszahl begrenzen, in: Tiroler Tageszeitung<br />
21.09.2004, 1.<br />
— (21.09.2004b): Für die Flüchtlinge ist alles wie neu. Der Standort Annaheim stand lange zur Diskussion – die<br />
Renovierungsarbeiten sind nun fertig, in: Tiroler Tageszeitung 21.09.2004, 22 (Miriam Sulaiman).<br />
— (22.09.2004): Vorerst Stopp bei Asylfrage, in: Tiroler Tageszeitung 22.09.2004, 4.<br />
— (24.09.2004): „Haus ist bestens geeignet“, in: Tiroler Tageszeitung 24.09.2004, 20.<br />
— (04.10.2004): Kufstein wartet auf weitere Informationen zu Asylanten, in: Tiroler Tageszeitung 04.10.2004, 9<br />
(Mario Zenhäusern).<br />
— (05.10.2004): Van Staa für rigide Maßnahmen bei straffälligen Flüchtlingen, in: Tiroler Tageszeitung<br />
05.10.2004, 2.<br />
— (06.10.2004): 70 nicht 100 Asylwerber sollen in Kufstein einrücken. LH van Staa kann sich Erstaufnahmezentren<br />
in jedem Bundesland vorstellen, in: Tiroler Tageszeitung 06.10.2004, 4.<br />
— (07.10.2004): Misstrauen in Kufstein gegen Bund, in: Tiroler Tageszeitung 07.10.2004, 1.<br />
— (11.10.2004a): Gangl rüffelt Kirche wegen Asyl-Boykotts. Landesrätin will Quoten neu verhandeln, in:<br />
Tiroler Tageszeitung 11.10.2004, 1.<br />
— (11.10.2004b): Gangl will Asyl-Quote neu festlegen, Attacke auf Rauch, in: Tiroler Tageszeitung 11.10.2004,<br />
4 (Anita Heubacher).<br />
— (12.10.2004): Kirche zürnt Gangl, VP ist verschnupft. Empörung über Vorwürfe in Asylfrage, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 12.10.2004, 4.<br />
— (20.10.2004): Asylfrage bleibt weiter Zankapfel. LH Herwig van Staa will, dass Asylwerber auf ganz Europa<br />
gerecht verteilt werden, in: Tiroler Tageszeitung 20.10.2004, 10.<br />
— (22.10.2004): Polizisten stürmten Drogenlokal. Polizei verstärkt Druck in Innsbruck – 13 Marokkaner sitzen<br />
in U-Haft, in: Tiroler Tageszeitung 22.10.2004, 11 (Mario Zenhäusern).<br />
— (25.10.2004): Ruhe und pulsierende Wirtschaft. Der Unterschied zwischen den benachbarten Stadtteilen<br />
Reichenau und Rossau könnte nicht größer sein, in: Tiroler Tageszeitung 25./26.10.2004, Beilage<br />
„Reichenau – Rossau“, 1 (Peter Weirather).<br />
— (29.10.2004a): Asyl: Tirol muss hilflos zuschauen. Österreich Asyl-Zielland Nr. 1 in Europa, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 29.10.2004, 1.<br />
— (29.10.2004b): Asylantenproblem bewegt die Länder, in: Tiroler Tageszeitung 29.10.2004, 13.<br />
— (05.11.2004): Wohin mit Asylwerbern? Polit-Karussell dreht sich. Bei der Asylfrage kommt die Politik nicht<br />
vom Fleck, in: Tiroler Tageszeitung 05.11.2004, 4.<br />
— (11.11.2004): Wird die Asylanten-Quote verpasst, heißt es zahlen, in: Tiroler Tageszeitung 11.11.2004, 4.<br />
— (19.11.2004): Asyl zwischen Traumtanz und Realität. Van Staa: „Verurteilte abschieben“, in: Tiroler Tageszeitung<br />
19.11.2004, 4.<br />
— (20.11.2004): Dickes FPÖ-Lob für Strassers „Luftblase“. Verfassungsexperten orten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit,<br />
in: Tiroler Tageszeitung 20./21.11.2004, 5.<br />
— (23.11.2004): Illegale reisen verstärkt über den Brenner. Polizeichef Angermair im TT-Interview, in: Tiroler<br />
Tageszeitung 23.11.2004, 18 (Mario Zenhäusern).<br />
— (03.12.2004): Asylwerber freuen sich schon auf die Stadt, in: Tiroler Tageszeitung 03.12.2004, 4.<br />
— (31.12.2004): Flüchtlinge spalten Orte, in: Tiroler Tageszeitung 31.12.2004/01./02.01.2005, Beilage „Rückblick<br />
2004“, 10.<br />
— (07.01.2005): Flüchtlinge in Hall sind integriert, in: Tiroler Tageszeitung 07.01.2005, 18.<br />
— (12.01.2005): Kolpingsfamilie betreut Flüchtlinge, in: Tiroler Tageszeitung 12.01.2005, 19.<br />
— (14.01.2005): Prokop will keine weiteren Wachzimmer schließen. Innenministerin stand TT-Lesern Rede und<br />
Antwort – Klarstellung bei Asyl-Quote, in: Tiroler Tageszeitung 14.01.2005, 11.<br />
— (18.01.2005): Keine Asylwerber in Kaserne Kufstein, in: Tiroler Tageszeitung 18.01.2005, 4.<br />
— (20.01.2005): Privatquartiere für Asylwerber gesucht. Für 40 Asylwerber sucht das Land jetzt in der<br />
Festungsstadt nach passenden Wohnungen, in: Tirol Online 20.01.2005 (21:17:30), URL: .<br />
— (26.01.2005): Quote wird mit 1900 Asylwerbern fixiert, in: Tiroler Tageszeitung 26.01.2005, 4.<br />
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Pressestelle (21.11.2001): „Nicht warten, bis ein<br />
Asylwerber erfriert!“ UNHCR: In ganz Österreich obdachlose Asylwerber, Pressemitteilung, Wien, 21.11.2001.<br />
— (23.09.2002): UNHCR: Österreich fördert „Asylshopping“. Große Zahl von Asylsuchenden der Obdachlosigkeit<br />
ausgesetzt, Pressemitteilung, Wien, 23.09.2002.<br />
329
5 Interviews und ExpertInnengespräche: Allgemein<br />
Erd Otto; Bürgermeister der Stadtgemeinde Vils: Vils, 31.10.2003 (Transkript).<br />
Gangl Christa; Landesrätin für Soziales und Gesundheit: Innsbruck, 09.02.2004 (Transkript).<br />
Grander Herbert, Ing.; Bürgermeister der Marktgemeinde Fieberbrunn: Fieberbrunn, 06.11.2003 (Transkript).<br />
Harb Max; Bürgermeister der Gemeinde Volders: Volders, 30.10.2003 (Postkript).<br />
Hohlrieder Günther; Bürgermeister der Gemeinde Reith im Alpbachtal: Reith im Alpbachtal, 07.11.2003 (Postkript).<br />
Hörtnagl Andreas; Bürgermeister i.R. der Gemeinde Gries am Brenner: Innsbruck, 10.03.2004 (Transkript).<br />
Klotz Josef; Bürgermeister der Gemeinde Leutasch: Leutasch, 05.12.2003 (Postskript).<br />
König Johannes, Dr., SJ; Jesuitenkolleg Innsbruck: Innsbruck, 24.10.2003 (Transkript).<br />
Logar Peter; Flüchtlingskoordinator des Landes Tirol: Innsbruck, 10.10.2003 (Transkript), 15.03.2004<br />
(Gesprächsprotokoll).<br />
Mühlberger Stefan; Bürgermeister der Gemeinde Kössen: Kössen, 03.11.2003 (Transkript).<br />
Onay Efendi; Geschäftsführer (i.V.) des Caritas Integrationshauses Innsbruck: Innsbruck, 10.03.2004<br />
(Gesprächsprotokoll).<br />
Payr Hans; Bürgermeister der Gemeinde Götzens: Götzens, 05.12.2003 (Postskript), 12.03.2004 (schriftliche<br />
Stellungnahme).<br />
<strong>Pehm</strong> Martin, DI; Verkehrsplaner ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH: Innsbruck, 20.09.2003 (Gesprächsprotokoll),<br />
12.09.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Reindl Anton, Ök.-Rat; Bürgermeister der Gemeinde Mötz: Mötz, 04.11.2003 (Postskript).<br />
Singer Werner; Bürgermeister i.R. der Gemeinde Götzens: Götzens, 05.12.2003 (Transkript).<br />
6 Interviews und ExpertInnengespräche: BeraterInnen, BetreuerInnen und Unterkunftsleitungen 3<br />
Beratung/Betreuung 01: Innsbruck, 15.05.2001 (schriftlicher Bericht der GesprächspartnerInnen).<br />
Beratung/Betreuung 02: Innsbruck, 28.05.2001 (schriftlicher Bericht der GesprächspartnerInnen).<br />
Beratung/Betreuung 03: Innsbruck, 28.08.2003 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 04: Innsbruck, 15.09.2003 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 05: Innsbruck, 06.10.2003 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 06: Innsbruck, 22.12.2003 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 07: Innsbruck, 30.01.2004 (schriftlicher Bericht der Gesprächspartnerin).<br />
Beratung/Betreuung 08: Innsbruck, 05.06.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 09: Innsbruck, 18.08.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 10: Innsbruck, 13.11.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 11: Innsbruck, 13.11.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Beratung/Betreuung 12: Innsbruck, 19.11.2004 (Gesprächsprotokoll).<br />
Unterkunftsleitung 01/1; 01/2; 01/3: Volders, 30.10.2003 (Transkript; Gesprächsprotokoll; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 02/1; 02/2: Vils, 31.10.2003 (Transkript; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 03/1; 03/2: Kössen, 03.11.2003 (Transkript; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 04/1; 04/2: Mötz, 04.11.2003 (Transkript; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 05/1; 05/2; 05/3: Fieberbrunn, 06.11.2003 (Transkript; Gesprächsprotokoll; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 06/1; 06/2: Reith im Alpbachtal, 07.11.2003 (Transkript; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 07/1; 07/2: Leutasch, 05.12.2003 (Transkript; Postskript).<br />
Unterkunftsleitung 08/1; 08/2: Götzens, 05.12.2003 (Gesprächsprotokoll; Postskript).<br />
7 Interviews und ExpertInnengespräche: Bürgermeister 4<br />
Bürgermeister 01/1: Herbst 2003 (Transkript); 01/2: 12.02.2004 (Gesprächsnotiz).<br />
Bürgermeister 02/1: Herbst 2003 (Transkript); 02/2: 04.03.2004 (Gesprächsnotiz).<br />
Bürgermeister 03/1: Herbst 2003 (Transkript).<br />
Bürgermeister 04/1: Herbst 2003 (Transkript).<br />
Bürgermeister 05/1: Herbst 2003 (Transkript); 05/2: 11.03.2004 (Gesprächsnotiz).<br />
3 Auf Wunsch teilweise anonymisiert.<br />
4 Auf Wunsch vollständig anonymisiert.<br />
330