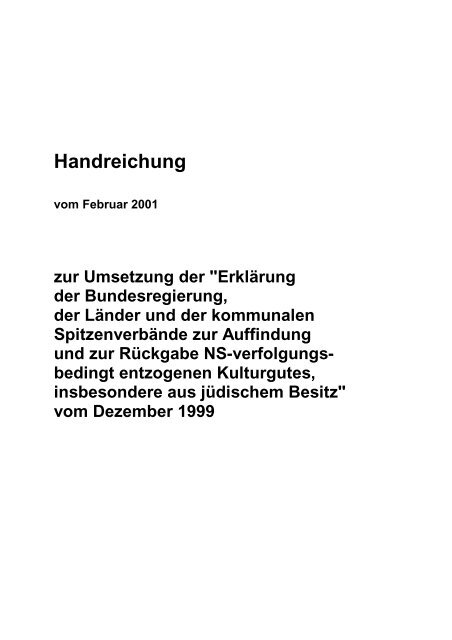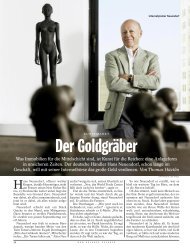Handreichung - Artnet
Handreichung - Artnet
Handreichung - Artnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Handreichung</strong><br />
vom Februar 2001<br />
zur Umsetzung der "Erklärung<br />
der Bundesregierung,<br />
der Länder und der kommunalen<br />
Spitzenverbände zur Auffindung<br />
und zur Rückgabe NS-verfolgungs-<br />
bedingt entzogenen Kulturgutes,<br />
insbesondere aus jüdischem Besitz"<br />
vom Dezember 1999
Herausgeber:<br />
BKM Bonn/Berlin<br />
März 2001
Inhalt:<br />
I.<br />
II.<br />
III.<br />
IV.<br />
V.<br />
Vorbemerkung<br />
Eigene Bestandsprüfung der Sammlungen - Umfang und Grenzen<br />
eigenaktiver Recherchen<br />
Hinweise zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes<br />
a) Allgemeine Hinweise<br />
b) Ansatzpunkte für Verdachtsmomente auf NS-verfolgungsbedingten<br />
Entzug von Kulturgütern (Suchkriterien für die Einzelfallprüfung)<br />
Weiterführende Hinweise zur Archivlage<br />
a) Übersicht über relevante Archivbestände<br />
b) Erläuterungen des Bundesarchivs zum Bestand 323<br />
c) Rückerstattungsakten<br />
Umgang mit Rechercheergebnissen<br />
a) Verfahren der Länder und Kommunen<br />
b) Übermittlung der Rechercheergebnisse an die Koordinierungsstelle<br />
für Kulturgutverluste (KK)<br />
Prüfung des verfolgungsbedingten Entzugs und ggf. Abwicklung des<br />
Rückgabeverfahrens<br />
a) Vorbemerkung<br />
b) Prüfraster<br />
c) Kunstwerke mit Bezug zum Beitrittsgebiet<br />
d) Entschädigungszahlungen des Bundes, sonstige Kompensationen,<br />
Gegenleistungen<br />
e) Modelle (Rückkauf, Dauerleihe, Tausch ...)<br />
1<br />
Seite<br />
3<br />
4<br />
6<br />
12<br />
14<br />
19
Anlagen<br />
Anlage I a<br />
Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von<br />
den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden<br />
Anlage I b<br />
"Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen<br />
Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz" vom<br />
Dezember 1999<br />
Anlagen II a bis II k<br />
Zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes<br />
Anlagen III a und III b<br />
Zur Archivlage<br />
Anlage IV a bis IV f - Tab. 1 bis 8<br />
Zum Umgang mit Rechercheergebnissen<br />
Anlage IV g<br />
Erfassungskriterien<br />
Anlage V a<br />
Erläuterungen zum Prüfraster<br />
Anlage V b<br />
Erläuterungen zu Kunstwerken mit Bezug zum Beitrittsgebiet<br />
Anlage V c<br />
Erläuterungen zu Entschädigungszahlungen usw.<br />
Anlage V d<br />
Beispiel einer Vereinbarung<br />
Seite<br />
2<br />
22<br />
24<br />
27<br />
41<br />
58<br />
70<br />
75<br />
78<br />
80<br />
82
Vorbemerkung<br />
Die nachfolgende <strong>Handreichung</strong> versteht sich als Hilfe zur Umsetzung der<br />
"Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den<br />
Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden“ 1 vom 3. Dezember 1998 und der<br />
"Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände<br />
zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes,<br />
insbesondere aus jüdischem Besitz“ 2 vom Dezember 1999. Sie wurde von einer<br />
redaktionellen Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundes, der Länder und<br />
kommunalen Spitzenverbände sowie mit Unterstützung durch Vertreter aus den<br />
Bereichen Museen, Bibliotheken und Archive erarbeitet.<br />
Die <strong>Handreichung</strong> wurde von der Kultusministerkonferenz am 1. Februar 2001<br />
beschlossen. Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat am 6. Februar 2001<br />
zugestimmt. Der Kulturausschuss des Deutschen Landkreistages hat am 15. Februar<br />
2001 zugestimmt. Der Kulturausschuss/das Präsidium des Deutschen Städte- und<br />
Gemeindebundes hat einen entsprechenden Beschluss am 15. Februar 2001<br />
gefasst.<br />
Die Erläuterungen sind als Orientierungen gedacht, die den Kulturgut bewahrenden<br />
Institutionen Hilfestellung bei ihren Bemühungen um die Feststellung noch nicht<br />
identifizierter NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter und der Vorbereitung<br />
von Entscheidungen über deren mögliche Rückgabe geben soll.<br />
Es ist vorgesehen, dass diese jeweiligen Einrichtungen ihre Rechercheergebnisse an<br />
die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste (KK) weiterleiten, die diese dann i.S.d.<br />
der Nr. III Gemeinsame Erklärung im Internet unter www.lostart.de präsentiert (siehe<br />
hierzu ausführlich Abschnitt IV).<br />
Die eigenverantwortliche Zuständigkeit der jeweiligen Einrichtungen bzw. deren<br />
Träger für alle damit zusammenhängenden Entscheidungen bleibt davon unberührt.<br />
Die folgenden Texte enthalten keine abschließenden Feststellungen und sind offen<br />
für die sich aus den Erfahrungen der Praxis ergebenden Änderungs- bzw.<br />
Ergänzungsvorschläge. Entsprechende Hinweise können adressiert werden an:<br />
Beauftragter der Bundesregierung<br />
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien<br />
Referat K 13<br />
Bundesallee 216 - 218<br />
10719 Berlin.<br />
1 Siehe Anlage I a "Washingtoner Erklärung“.<br />
2 Siehe Anlage I b "Gemeinsame Erklärung“.<br />
3
I. Eigene Bestandsprüfung der Sammlungen – Umfang und<br />
Grenzen eigenaktiver Recherchen<br />
In der "Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen<br />
Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 1999<br />
heißt es :<br />
"... Die Bundesrepublik Deutschland hat – ungeachtet dieser materiellen Wiedergutmachung<br />
– auf der Washingtoner Konferenz über Holocaust-Vermögen am<br />
3. Dezember 1998 erneut ihre Bereitschaft erklärt, auf der Basis der verabschiedeten<br />
Grundsätze und nach Maßgabe ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten<br />
nach weiterem NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut zu suchen ..."<br />
"Die deutschen öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Archive und Bibliotheken<br />
haben schon in der Vergangenheit die Suche nach NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenem Kulturgut unterstützt:<br />
1. durch Erschließung und Offenlegung ihrer Informationen, Forschungsstände und<br />
Unterlagen,<br />
2. durch Nachforschungen bei konkreten Anfragen und eigene Recherchen im Falle<br />
von aktuellen Erwerbungen,<br />
3. durch eigene Suche im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen<br />
Einrichtung, ...<br />
Diese Bemühungen sollen – wo immer hinreichend Anlass besteht – fortgeführt<br />
werden." 1<br />
�� Anlage I a<br />
�� Anlage I b<br />
Zum verantwortungsvollen Umgang mit den Beständen gehört im Rahmen der<br />
originären Aufgabenwahrnehmung der Sammlungen die Prüfung, inwieweit<br />
eigenaktive Untersuchungen der Erwerbungsumstände notwendig und möglich sind.<br />
Dazu sollte auch nachfolgende Orientierung herangezogen werden. Dabei geht es<br />
nicht darum, den Erwerb sämtlicher im Sammlungsbestand vorhandenen Objekte zu<br />
"rechtfertigen" und sie – soweit dies nicht ausreichend gelingt – herauszugeben.<br />
Jedoch ist im Sinne des in der Gemeinsamen Erklärung formulierten Zwischenziels,<br />
Informationen über Bestandsobjekte öffentlich zugänglich zu machen, die<br />
1 In der Folge der Washingtoner Konferenz hatte bereits zuvor der Beauftragte der Bundesregierung<br />
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien in Schreiben an die für Kultur zuständigen Minister der<br />
Länder, die kommunalen Spitzenverbände, den Deutschen Museumsbund, den Deutschen<br />
Bibliotheksverband und den Verein Deutscher Archivare appelliert, alle Bemühungen zur<br />
Identifizierung und Bekanntmachung der noch unerkannten, nicht an ihre jüdischen Eigentümer<br />
restituierten Kunstwerke in den Beständen der öffentlichen Sammlungen zu intensivieren. In einem<br />
weiteren, gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder und dem Deutschen Museumsbund verfassten<br />
Schreiben wurden die Museen der öffentlichen Hand direkt aufgerufen, erneut zu prüfen, ob<br />
Kunstwerke aus jüdischem Eigentum, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden, sich in<br />
ihren Häusern befinden.<br />
4
nachweislich verfolgungsbedingt entzogen wurden oder bei denen<br />
verfolgungsbedingter<br />
5
Entzug vermutet wird bzw. nicht ausgeschlossen werden kann, ein ausschließlich<br />
reaktiver Ansatz unzureichend.<br />
Im Ergebnis der eigenverantwortlichen Entscheidungen der jeweiligen Sammlung,<br />
adäquate Recherchemöglichkeiten entsprechend ihren spezifischen Bedingungen<br />
(Bestandsumfang und -art, Dokumentation der Erwerbungen usw.) zu bestimmen,<br />
kann u.U. auch eine Dokumentation von Basisinformationen durch die<br />
Veröffentlichung von Angaben (zu Gegenstand, Verfasser, Erwerbungsart und -<br />
zeitpunkt) über alle Erwerbungen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai<br />
1945 erfolgen.<br />
Die Aufgabenstellung lässt sich wie folgt zusammenfassen:<br />
Die Sammlungen der öffentlichen Hand sollten sich der Verantwortung<br />
bewusst sein, zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter in<br />
ihren Beständen beizutragen, indem sie anhand der ihnen zugänglichen<br />
Dokumente unter Berücksichtigung des derzeitigen Forschungsstandes<br />
derartige bzw. in einer solchen Vermutung stehende Erwerbungen aufspüren,<br />
Informationen darüber mit Hilfe der Internet-Website www.lostart.de der<br />
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste (KK) der Öffentlichkeit zugänglich<br />
machen sowie gegebenenfalls potentiellen Berechtigten weiterführende<br />
Hinweise geben.<br />
Sofern im Zusammenhang mit der Bestandssichtung noch bis dato unentdeckt gebliebene<br />
kriegsbedingt aus anderen Staaten nach Deutschland verbrachte Kulturgüter festgestellt werden<br />
sollten, wird gebeten, alle verfügbaren Angaben dazu den zuständigen Trägern der Sammlungen zur<br />
Weitergabe an den<br />
sowie der<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Beauftragten der Bundesregierung<br />
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien<br />
Ref. K 13<br />
Bundesallee 216<br />
10719 Berlin<br />
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste<br />
beim Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt<br />
City Carré<br />
Kantstr. 5<br />
39104 Magdeburg<br />
6
II. Hinweise zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogenen<br />
Kulturgutes 1<br />
a) Allgemeine Hinweise<br />
1. Erwerbungsumstände<br />
Folgende Formen der Besitzübertragung an Museen, Sammlungen, Archive und<br />
Bibliotheken usw. können Indikatoren für verfolgungsbedingten Entzug sein:<br />
• Erwerbungen in Folge verfolgungsbedingt zustande gekommener<br />
Rechtsgeschäfte (Betroffene waren verfolgte Privatpersonen und Institutionen), z.<br />
B. auf Auktionen;<br />
• direkte Zuweisungen beschlagnahmter Kulturgüter durch amtliche NS-Stellen an<br />
Museen usw. ("Geschenke").<br />
2. Erwerbungsarten und -zeiträume<br />
Grundsätzlich kommen mit dem Ziel der Feststellung unklarer Provenienzen alle<br />
Erwerbsvorgänge (Kauf, Tausch, Schenkung, Vermächtnis usw.) zwischen 1933 und<br />
1945 und als Gegenstand alle Kulturgüter in Frage, die in dieser Zeit den Besitzer<br />
gewechselt haben. Bei allen Erwerbungen nach 1945 sind die Provenienzen<br />
zwischen 1933 und 1945 in jedem Falle klärungsbedürftig.<br />
3. Quellenlage<br />
Als Quellen zur eigenen Bestandsprüfung der Sammlungen nach diesen Kriterien<br />
sind in erster Linie die Erwerbungs- und Verzeichnungsunterlagen, also z.B. die<br />
Zugangsbücher (Akzessionsjournale) der Bibliotheken, Inventare und Erwerbslisten<br />
der Museen und die Findhilfsmittel der Archive für den genannten Zeitraum und,<br />
soweit vorhanden, im Hause befindliche Korrespondenzakten heranzuziehen. Die<br />
Inventarisierungsangaben sind allerdings oft nicht ausreichend; Inventarisierungs-<br />
und Erwerbungsdaten liegen unter Umständen weit auseinander.<br />
Es sind folgende Sachverhalte zu überprüfen:<br />
- Eigentümerwechsel (u.a. Übergang in Reichsvermögen) im Erwerbungszeitraum<br />
1933 – 1945,<br />
- Erwerbsumstände,<br />
- Beteiligte.<br />
1 Diese Ausführungen wurden dankenswerterweise von Frau Dr. Barbara Strenge, Berlin, recherchiert<br />
und zusammengetragen. Sie sollen verständniserleichternden Zugang zur Komplexität des Themas<br />
ermöglichen. Insofern können sie lediglich Anregungen für das eigene methodische Vorgehen der<br />
Institutionen vermitteln, die sich um weitere Provenienzaufklärung ihrer Sammlungen bemühen bzw.<br />
diese durch zusätzliche Informationen unterstützen.<br />
Die redaktionelle Arbeitsgruppe bekennt sich zur Unvollständigkeit der darin enthaltenen Angaben und<br />
ist für weitere Anregungen zur Fortschreibung der Hinweise dankbar.<br />
Die im Folgenden genannten Namen von natürlichen und juristischen Personen sind bereits durch<br />
einschlägige Veröffentlichungen zum Thema Kulturgutverbringungen und Kunsthandel zwischen 1933<br />
und 1945 bekannt. Namensnennungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie implizieren<br />
keine Wertung im moralischen oder juristischen Sinne.<br />
(Auf die in "THE ART NEWSPAPER", Nr. 88, im Januar 1999 veröffentlichte, 1946 vom US-Office of<br />
Strategic Services angefertigte Liste von Personen, die in den Kunsthandel in der NS-Zeit verwickelt<br />
waren, wird verwiesen.)<br />
8
4. Provenienzforschung<br />
Für die Provenienzforschung, d.h. die Identifizierung der Voreigentümer aus der<br />
Gruppe der Verfolgten, können im Einzelfall einschlägige gedruckte Verzeichnisse,<br />
Fachliteratur und archivalische Quellen herangezogen werden, wie z.B.<br />
• Handbuch der deutschsprachigen Emigration,<br />
• Angaben im Bestand der Treuhandverwaltung für Kulturgut (Bestand 323 im<br />
Bundesarchiv oder auch Unterlagen im Münchener Institut für Zeitgeschichte),<br />
• "Biographical Index of Individuals in Art Looting" des amerikanischen Office of<br />
Strategic Services,<br />
• Auswertung der zugänglichen Auktionsüberlieferungen, u.a. im Archiv des<br />
deutschen Kunsthandels in München, einschließlich der Fachpresse 1933 – 1945,<br />
• ggf., sofern es sich um bedeutende Gemälde handelt, Werkverzeichnisse und<br />
Künstlerlexika (z.B. Thieme-Becker).<br />
Besteht die Vermutung, dass es sich um ein NS-verfolgungsbedingt entzogenes<br />
Objekt handelt und der/die Voreigentümer bekannt sind, kann zudem in den<br />
• aus NS-Überlieferungen stammenden Entziehungsakten, z.B. den Unterlagen der<br />
Vermögensverwertungsstellen bei den Oberfinanzpräsidenten der Länder, sowie<br />
auch in den<br />
• Aktenbeständen der Rückerstattungs- und Entschädigungsverfahren (in den<br />
Oberfinanzdirektionen, dabei insbesondere in der OFD Berlin)<br />
gesucht werden.<br />
Derartige Unterlagen können sich auch in den einschlägigen Beständen der Landes-<br />
und Kommunalarchive befinden.<br />
5. Kurzgefasste Checkliste zur Einzelfallprüfung zweifelhafter<br />
Erwerbsvorgänge<br />
• Was ? (z.B. Kulturgüter eindeutig jüdischer Provenienz)<br />
• Wann? (Erwerbungszeitraum, insbes. 1933-1945)<br />
• Wo? Erwerbungsort, z.B. besetzte Länder, Pfandleihen, "Zentralstelle",<br />
"Judenauktionen", Auslagerungsort)<br />
• Wie? (a) Erwerbungsart, z.B. Kauf, Tausch, Schenkung nach hier ange-<br />
führten Verdachtsmomenten,<br />
b) Art und Weise der Verzeichnung)<br />
• Von wem? (Herkunft: Von in den Handel mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen<br />
Kulturgütern involvierten Händlern, Zuweisungen staatlicher Stellen,<br />
Namen der ursprünglichen Besitzer)<br />
b) Ansatzpunkte für Verdachtsmomente auf NS-verfolgungsbedingten Entzug<br />
von Kulturgütern (Suchkriterien für die Einzelfallprüfung)<br />
Eindeutige Hinweise auf eine zweifelhafte Herkunft von Sammlungsobjekten in<br />
öffentlichen Einrichtungen auf der Grundlage eindeutiger und detaillierter Angaben in<br />
den Erwerbsunterlagen oder an den Objekten selbst sind die Ausnahme. So ergibt<br />
sich die Notwendigkeit, Kriterien auszumachen, die bei der beabsichtigten<br />
Recherche Anhaltspunkte für die Vermutung eines verfolgungsbedingten Entzugs<br />
geben können.<br />
9
Indizien können sein:<br />
• Angaben über NS-staatliche Auftraggeber, insbesondere NS-Kulturgutrauborganisationen<br />
und -eliten, deren Beauftragte und Institutionen und/oder<br />
• Namen von in den Handel mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern<br />
involvierten Kunsthändlern und/oder<br />
• Angaben zu den ursprünglichen (insbesondere jüdischen) Eigentümern bzw.<br />
Besitzern der Kulturgüter.<br />
Hinzu kommen Indikatoren, die sich beziehen<br />
• auf die Art und Weise des Erwerbs (Geschenke in größeren geschlossenen<br />
Einheiten, Ankäufe unter Marktpreis, größere Auktions- oder Antiquariatszugänge,<br />
oft in Losen);<br />
• auf die Art der Verzeichnung der Sammlungsobjekte durch die Sammlungen<br />
selbst (plötzlich fehlende oder kryptische Herkunftsvermerke, vom bisherigen<br />
Verzeichnungsusus abweichende Registrierungen);<br />
• auf den Ort des Erwerbs (z.B. Ankäufe in oder aus besetzen Gebieten).<br />
1. Staatliche Auftraggeber des systematischen und organisierten<br />
Kulturgutraubes 1933 - 1945<br />
1.1. Inbesitznahme (Raub, Beschlagnahmung, Enteignung und Zwangsverkäufe) durch<br />
Dienststellen des Deutschen Reiches 1933 - 1945, und deren überwiegend auf Kulturgutraub<br />
spezialisierte Organisationen (über die Gestapo, die Militärverwaltung in besetzen Gebieten,<br />
die Reichsministerien, Reichskanzlei und die jeweiligen Oberfinanzdirektionen hinaus):<br />
� Anlage II 1.1<br />
1.2. Beteiligte an der Inbesitznahme, Beschlagnahmungen bzw. "Käufen" oder<br />
"Tausch" von Kunstwerken im Auftrag von Hitler, Bormann, Himmler, Göring,<br />
Ribbentrop, Rosenberg u.a.<br />
�� Anlage II 1.2<br />
1.3. Die so genannte "Hohe Schule" als unmittelbarer Nutznießer von<br />
beschlagnahmtem Kulturgut<br />
�� Anlage II 1.3<br />
1.4. Namen von Spezialsachverständigen der NS-Zeit<br />
�� Anlage II 1.4<br />
2. Museen, Bibliotheken, individuelle Sammler als Auftraggeber bzw.<br />
Empfänger (Ankäufe, Zuweisungen, Geschenke, Tausch) 1933 - 1945<br />
2.1. Ankäufe in besetzen Gebieten können ein Indiz für einen Verkauf unter Zwang<br />
sein und sind daher genauer zu prüfen.<br />
Bei "Geschenken" bzw. Zuweisungen staatlicher NS-Stellen aus besetzten Gebieten<br />
kann man in der Regel von Beschlagnahmungen ausgehen.<br />
10
2.2. Geschenke wertvoller Objekte und/oder von Objekten in größerer Zahl (und<br />
größere, geschlossene Lose und Einheiten) von Privatpersonen im<br />
Erwerbungszeitraum 1933 - 1945, insbesondere in den Jahren 1938-1942 sowie<br />
staatliche Ersatzleistungen für Beschlagnahmen, sollten im Einzelfall hinsichtlich<br />
ihrer Herkunft (ehemals jüdischer Besitz) überprüft werden.<br />
Die Erwerbungsart "Geschenk" (ggf. auch Tausch) gehört auch dann in die<br />
"verdächtigen" Erwerbungsvorgänge, wenn NS-staatliche oder Parteiorganisationen<br />
einbezogen sind bzw. Objekte außerhalb regulär bestehender Tauschbeziehungen<br />
getauscht wurden.<br />
2.3. Dies trifft auch auf die Erwerbungsart Kauf zu, wenn in größeren<br />
geschlossenen Losen und Einheiten gekauft wurde, von NS-Dienststellen, von in den<br />
Handel mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Werken involvierten Händlern, auf so<br />
genannten "Judenauktionen" oder von solchen Händlern, zu denen bisher keine<br />
Geschäftsbeziehungen bestanden, und/oder inadäquate Preise gezahlt wurden.<br />
Ankäufe von Wertgegenständen aus Städtischen Pfandleihanstalten können in<br />
diesem Sinne zweifelhafte Erwerbungen sein. Juden waren nach der "Dritten<br />
Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens der<br />
Juden" vom 21. Februar 1939 gezwungen, Schmuck und Edelmetallgegenstände an<br />
die Städtischen Pfandleihanstalten abzuliefern. (Die Berliner Pfandleihanstalt<br />
fungierte als "Zentralstelle", in der alle höherwertigen Objekte der<br />
Zwangsablieferungsaktionen aus ganz Deutschland zusammenflossen.)<br />
2.4. Auffällig ist auch, wenn nicht regelkonform akzessioniert wurde: Bei vielen<br />
Objekten, die von den Museen in der NS-Zeit als Zugänge registriert wurden, fehlen<br />
die sonst üblichen detaillierten Angaben (z.B. lediglich "erworben 1942" als Hinweis<br />
auf "arisierte", also gestohlene, abgepresste oder unter Wert verkaufte Objekte).<br />
2.5. Bei Inventarisierungen und Zugängen nach 1945 ist eine Überprüfung der<br />
genauen Herkunft angezeigt, wenn Angaben nicht zusammenpassen, beispielsweise<br />
ein Objekt angeblich erst nach 1945 erworben oder übernommen wurde, während<br />
die Inventarnummer des Bildes auf eine Übernahme aus der NS-Zeit hindeutet.<br />
2.6. Hinzu kommen thematische Indikatoren (z.B. Objekte mit direktem Bezug auf<br />
jüdische Themen, religiös/weltanschaulich missliebige Literatur) oder der<br />
Verfassername bzw. Name des Künstlers (z.B. "verbotene“ Autoren, bildende<br />
Künstler jüdischer Herkunft) als Verdachtsmomente in Kombination mit den o.g.<br />
Kriterien "verdächtiger“ Erwerbungsvorgänge.<br />
2.7. Provenienzvermerke (Stempel, Widmungen, Eigentumsvermerke) sind dazu<br />
in Bezug zu setzen und gegebenenfalls weiter zu untersuchen.<br />
Inwieweit jüdische bzw. vermeintlich jüdische Namen, die nicht mit den Namen der<br />
unten aufgeführten oder darüber hinaus bekannten jüdischen Sammler,<br />
Kunsthändler usw. identisch sind, als allein stehendes Indiz in die Überprüfung der<br />
Erwerbungen 1933 - 1945 einbezogen werden, muss im Einzelfall entschieden<br />
werden (bekanntlich waren seit dem 1. Januar 1939 "Sara" und "Israel" zwangsweise<br />
als zusätzliche Vornamen von Juden zu führen).<br />
11
3. Lieferanten / Veräußerer / Vermittler von Kulturgut<br />
Unter "in den Handel mit verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern involvierten<br />
Kunsthändlern" werden hier solche verstanden, die unter anderem Geschäfte mit den<br />
o.g. NS-Vertretern betrieben (auch bestimmte Objekte in deren Auftrag ausfindig<br />
machten) bzw. mit beschlagnahmtem Kulturgut handelten (und teilweise beträchtlich<br />
davon profitierten). Darunter befanden sich renommierte französische<br />
Kunsthandlungen und auch jüdische Händler, die später ihrerseits Opfer persönlicher<br />
Verfolgung und der Beschlagnahmung ihrer Sammlungen wurden. Aus diesem<br />
Grunde erscheinen einige der genannten Personen auch unter 4.<br />
Auch Dienststellen und Ämter des NS-Staates können als "Lieferanten" in Frage<br />
kommen, bspw. die Geheime Staatspolizei Berlin oder der Oberbefehlshaber Ost, die<br />
beschlagnahmte Güter zum Teil an staatliche Sammlungen weiterleiteten.<br />
Überschneidungen mit den unter 1.2. aufgeführten Namen sind ebenfalls möglich.<br />
3.1. An- und Verkäufe oder Vermittlung durch in den Handel mit<br />
verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern involvierte Kunsthändler<br />
(teilweise im Auftrag der o.g. Vertreter des NS-Staates)<br />
�� Anlage II e<br />
3.2. Erwerbungen bei Auktionshäusern, die auf (Zwangs-)Versteigerungen von<br />
Kunst aus jüdischem Besitz spezialisiert waren (u.a. so genannte "Judenauktionen")<br />
�� Anlage II f<br />
3.3. Bedeutung von Abkürzungen in Erwerbsverzeichnissen<br />
Nach Beschlagnahme und Inventarisierung von Kulturgut aus der "Möbel-Aktion" des<br />
ERR in Frankreich seit 1941 Verwendung der Signatur "MA" für "Möbel-Aktion"<br />
(Gemälde, Graphiken, Plastiken, Asiatica und antike Waffen).<br />
Nach der "Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden" vom 26. April<br />
1938 mussten alle Juden sowie deren nichtjüdische Ehegatten ihr gesamtes<br />
Vermögen (über 5.000 RM) anmelden und bewerten lassen. Mit der "Dritten<br />
Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens der<br />
Juden" vom 21. Februar 1939 mussten sie dieses binnen zwei Wochen an<br />
öffentlichen Sammelstellen (kommunale Pfandleihanstalten) abliefern. Kulturgüter<br />
jüdischen Eigentums aus sogenannten "Judenauktionen" wurden seitdem u.a. mit<br />
"JA" gekennzeichnet, bei Versteigerungen häufig auch mit " * ".<br />
3.4. Transportfirmen / -organisationen (u.a. mit Transporten von geraubtem<br />
Kulturgut in das Deutsche Reich befasst).<br />
Zwischen 1941 und 1944 fanden allein 29 große Transporte des ERR mit geraubtem<br />
Kulturgut nach Deutschland statt. Insgesamt überquerten 120 Eisenbahnwaggons<br />
und 4 170 Kisten mit Kulturgütern die Grenzen nach Deutschland. Neben Hermann<br />
Görings Sonderzügen sowie Flugzeugen und Lastwagen der Luftwaffe nutzen<br />
Göring, vor allem aber Hofer, Mühlmann und Angerer und andere auch Dienste<br />
privater Speditionsfirmen.<br />
�� Anlage II g<br />
12
4. Betroffene Personen und private Sammlungen<br />
Im Blickfeld ist hier vor allem Frankreich, wo private jüdische Sammlungen,<br />
insbesondere durch den Einsatzstab Rosenberg beschlagnahmt wurden. Durch den<br />
ERR wurden allein in Frankreich über 21 900 Objekte aus 203 Sammlungen<br />
beschlagnahmt. Jedes Objekt erhielt eine Signatur. An dieser Stelle kann nur eine<br />
unvollständige Auswahl der betroffenen größeren Sammlungen aufgeführt werden.<br />
Bekannte, mögliche Signaturen sind in Anlage II 4.1 in [ ] angegeben.<br />
Beschlagnahmte Gemälde für die Linzer Sammlung haben oftmals die Signatur "AR"<br />
und "LR".<br />
Kisten von ERR-Beschlagnahmungen der französischen Rothschild-Sammlungen<br />
erhielten beim Abtransport nach Deutschland folgende Stempel: H (für Hitler, Num.<br />
1 - 19), G (für Göring, Num. 1 - 23). Sie konnten von den Alliierten größtenteils<br />
zurückgegeben werden.<br />
4.1. Namen (in alphabetischer Reihenfolge) bedeutender (im Sinne der NS-<br />
Ideologie) jüdischer Sammler und/oder Kunsthändler (u. a.), deren Eigentum<br />
beschlagnahmt, "arisiert", und/oder zwangsverkauft wurde<br />
�� Anlage II h<br />
4.2. Beschlagnahmte Bibliotheken. Schriftgut "deutschfeindlicher" Personen in<br />
Frankreich<br />
�� Anlage II i<br />
4.3. Beschlagnahmte Musikalien:<br />
�� Anlage II j<br />
5. Auslagerungsorte der geraubten Kulturgüter<br />
[Für die Recherche können entsprechende Angaben – im günstigsten Falle – auf<br />
Klebezetteln o.ä. auf den Transportkisten oder an den Objekten (insbes. Gemälden)<br />
von Interesse sein.]<br />
Die amerikanischen Kulturgutschutz-Offiziere und andere westliche Alliierte<br />
entdeckten 1945 nach und nach mehr als 2 000 Verstecke von Kulturgut in<br />
Deutschland und führten sie in sogenannten Collecting Points (Marburg, München,<br />
Offenbach, Wiesbaden, Celle) zusammen. Auch in den von der Roten Armee<br />
eingenommenen Gebieten befanden sich derartige Depots, in denen die so genannte<br />
NS-Raubkunst oft zusammen mit regulär erworbenen Museums-, Bibliotheks- und<br />
Archivbeständen untergebracht worden war.<br />
�� Anlage II k (Liste der bekanntesten Auslagerungs- bzw. Verbringungsorte)<br />
13
III. Weiterführende Hinweise zur Archivlage<br />
a) Übersicht über relevante Archivbestände<br />
Die Kommunal- und Landesarchive werden den anfragenden Kultureinrichtungen,<br />
Behörden und möglichen privaten Anspruchsberechtigten mit ihrem üblichen<br />
Serviceangebot, insbesondere recherchespezifischer Beratungstätigkeit im Rahmen<br />
ihres laufenden Dienstbetriebes zur Verfügung stehen, "Präventivrecherchen" ohne<br />
konkrete Anfrage aber nicht durchführen können. Die spezifischen Recherchen sind<br />
von der jeweiligen Einrichtung und deren Personal zu realisieren. Archive stellen,<br />
soweit es sich nicht um eigenes Kulturgut handelt, nur die Rechercheinfrastruktur zur<br />
Verfügung. Die in der Anlage III a beigefügten Listen benennen Archivbestände in<br />
den Kommunal-, Landes-, Bundes- und anderen Archiven, in denen Unterlagen zur<br />
Verbringung ehemals jüdischen Eigentums vermutet werden können.<br />
Bei konkreter Veranlassung sind jeweils noch vor Ort detaillierte Nachforschungen<br />
notwendig.<br />
�� Anlage III a (Liste der Kommunal- und Landesarchive sowie anderer Archive)<br />
b) Erläuterungen des Bundesarchivs zum Bestand 323<br />
Das Bundesarchiv hat zu dem in der Anlage III b genannten Archivbestand "B 323<br />
Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München“ gesonderte<br />
Kurzinformationen für Archivbenutzer herausgegeben. Diese enthalten allgemeine<br />
Angaben zur Bestandsgeschichte, zum Inhalt, zur Benutzung und weiterführende<br />
Hinweise. Die Kurzinformationen des Bundesarchivs sind in der Anlage III b im<br />
vollständigen Wortlaut beigefügt.<br />
�� Anlage III b (Erläuterungen des Bundesarchivs zum Bestand 323)<br />
c) Rückerstattungsakten<br />
Eine wichtige Erkenntnisquelle zur Provenienzforschung sind die Akten aufgrund des<br />
Bundesrückerstattungsgesetzes (BRüG), in denen früher vielfach die Entziehung von<br />
Kunstwerken dokumentiert worden ist. Insofern gab es korrespondierende<br />
Aktenbestände bei den kommunalen Wiedergutmachungsämtern sowie bei den<br />
Oberfinanzdirektionen, welche als Vertreter des Bundes in Nachfolge des Deutschen<br />
Reiches zwecks Entschädigung beteiligt wurden. Die örtliche Zuständigkeit der<br />
Ämter richtete sich nach der aktuellen Belegenheit bei rückgabefähigen<br />
Vermögensgegenständen, ansonsten nach der Belegenheit im Zeitpunkt der<br />
Entziehung. Dementsprechend sind die Archivaktenbestände der Rückerstattung<br />
über eine Vielzahl von Standorten verstreut.<br />
Schätzungsweise 80 % aller Rückerstattungsakten befinden sich allerdings in Berlin,<br />
allein die Oberfinanzdirektion Berlin verfügt über ca. eine Million<br />
Rückerstattungsakten. Dies beruht nicht nur auf der früheren Größe der jüdischen<br />
Gemeinde zu Berlin sowie auf dem Umstand, dass sich die zentralen Staatsorgane,<br />
welche die Vermögenseinziehung betrieben haben, in der Reichshauptstadt<br />
befanden, sondern insbesondere auf der Sonderzuständigkeit Berlins gemäß § 5<br />
BRüG. Nach dieser Vorschrift war (West-)Berlin zuständig, wenn<br />
14
Vermögensgegenstände außerhalb der Altbundesländer entzogen worden sind (also<br />
insbesondere alle ausländischen Entziehungen) und mit hinreichender<br />
Wahrscheinlichkeit die Verbringung in die Altbundesländer belegt war, ohne dass der<br />
genaue Ort festgestellt werden konnte; dasselbe galt für Verbringungen nach (Ost-<br />
)Berlin, so dass der ganze Bereich der ehemaligen Reichshauptstadt abgedeckt war<br />
(vor allem war Berlin zentraler Standort für Versteigerungen jüdischer<br />
Kunstsammlungen).<br />
Es wird daher empfohlen, sich mit Anfragen zunächst an die<br />
Oberfinanzdirektion Berlin<br />
Referat V 41 / Archive<br />
Fasanenstraße 87<br />
10623 Berlin<br />
zu wenden. Bei der Beantwortung werden ggf. Hinweise auf andere Standorte von<br />
Rückerstattungsarchiven gegeben. Da das Rückerstattungsarchiv der<br />
Oberfinanzdirektion Berlin mit einer zentralen Geschädigtenkartei erschlossen ist,<br />
sollten Anfragen den Namen und Vornamen des Geschädigten sowie möglichst<br />
Geburtsdatum/Geburtsort oder sonstige Hinweise zur Identifizierung enthalten.<br />
Ferner hat die Oberfinanzdirektion Berlin begonnen, die aus ihrem<br />
Rückerstattungsarchiv ersichtlichen Kunstwerke in einer Kunstobjektdatei zu<br />
erfassen, so dass künftig auch rein objektbezogene Anfragen möglich sein werden.<br />
Die Erfassung eines Grunddatenbestandes wird noch einige Zeit beanspruchen,<br />
wobei auch danach Auskünfte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben werden.<br />
Rein objektbezogene Anfragen sind deshalb erst ab Jahresbeginn 2001 sinnvoll.<br />
15
IV. Umgang mit Rechercheergebnissen<br />
a) Verfahren der Länder und Kommunen<br />
Länder und Kommunen stellen durch geeignete, den jeweiligen Gegebenheiten<br />
angemessene Verfahren sicher, dass Rechercheergebnisse und Informationen nicht<br />
ohne Gegenprüfung (Vier-Augen-Prinzip) an die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste<br />
(KK 1 ) weitergeleitet werden. Die großen Kultureinrichtungen des Landes<br />
oder der Gebietskörperschaften, in denen die doppelte Ergebnisprüfung per se<br />
organisierbar ist, könnten insoweit eine Patronatsfunktion für kleinere oder gar nur<br />
neben- oder ehrenamtlich geleitete Einrichtungen übernehmen, als sie regelmäßig,<br />
spätestens aber vor der Weiterleitung an die KK beratend und überprüfend<br />
eingebunden werden.<br />
Ob außerdem Dachverbänden oder Fachämtern eine Clearing-Funktion zugewiesen<br />
wird, Ministerien, Dezernate oder Mittelbehörden in das Verfahren einzuschalten<br />
sind, ist auf Landesebene unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände zu<br />
entscheiden und mit der Verteilung der <strong>Handreichung</strong> bekannt zu geben.<br />
Ebenfalls obliegt der Entscheidung der Länder nach Abstimmung mit den<br />
kommunalen Spitzenverbänden, ob und wie die betroffenen Mitarbeiter der<br />
Kultureinrichtungen durch zusätzliche Information und/oder Veranstaltungen mit der<br />
<strong>Handreichung</strong> vertraut gemacht werden.<br />
b) Übermittlung der Rechercheergebnisse an die KK<br />
1. Allgemeines<br />
- Die KK arbeitet im Rahmen des in Fußnote 1 dargestellten Internet-Projektes<br />
gemeinsam mit dem Institut für Technische und Betriebliche Informationssysteme<br />
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg an mehreren Varianten für die<br />
Aufnahme von Informationen zu o.g. Kulturgütern in die Internetdatenbank<br />
http://www.lostart.de.<br />
- Zum einen wird ein kontrollierter schreibender Zugriff auf lostart.de vorbereitet,<br />
der es betroffenen Institutionen erlauben soll, o.g. Kulturgüter unmittelbar via<br />
Internet in lostart.de einzugeben (1).<br />
1 Die "Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern" wurde 1994 gegründet<br />
und ist seit 1998 im Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt angesiedelt. Die<br />
Koordinierungsstelle hat primär die Aufgabe, kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter der deutschen<br />
öffentlichen Einrichtungen, also die so genannte "Beutekunst", zu dokumentieren und zu<br />
recherchieren. Eine hierzu angelegte Grundlagendatenbank wird seit 1999 durch ein Internet-Projekt<br />
zu einer Internet-Datenbank (www.lostart.de) umgebaut.<br />
Unter Nr. III der Gemeinsamen Erklärung ist die Prüfung eines Internetangebotes bzgl. der<br />
Dokumentation und Recherche NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes vorgesehen. Bund<br />
und Länder sind übereingekommen, diese Aufgabe mit der Nutzung der finanziellen, personellen und<br />
tatsächlichen Synergieeffekte der Koordinierungsstelle und deren Internet-Projekt zu verbinden.<br />
Hierzu wurde die vorhandene Koordinierungsstelle durch eine vom Land Sachsen-Anhalt<br />
eingerichtete "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste", finanziert durch Bund und Länder, erweitert.<br />
16
Weiterhin wird für jene Einrichtungen, die über keinen Internetzugang verfügen,<br />
an einem Programm gearbeitet, welches auf Diskette zur Verfügung gestellt<br />
werden kann und welches jene Formulare zur Informationsaufnahme beinhaltet,<br />
die in lostart.de zur unmittelbaren Dateneingabe bereit gestellt werden (2).<br />
Schließlich ist für jene Institutionen, welche über eigene Erfahrungen in der<br />
Datenerfassung verfügen und intern bereits andere Programme nutzen, ein<br />
Datenexport aus deren Datenbanken und ein Datenimport in die<br />
Grundlagendatenbank der Koordinierungsstelle vorgesehen (3).<br />
- In der Variante (1) gelangen die Informationen per Internet zur KK, von der sie<br />
nach einer Aufbereitung in lostart.de eingestellt würden. In den Varianten (2) und<br />
(3) wären die zusammengestellten Informationen auf Datenträgern oder<br />
beispielsweise als e-mail an die KK zu senden, damit eine Einstellung ins Internet<br />
erfolgen kann. Es bleibt den Institutionen überlassen, ob sie ihre Informationen<br />
zukünftig unmittelbar per Internet oder auf Datenträgern an die<br />
Koordinierungsstelle übermitteln. In jedem Falle sollten die unten beschriebenen<br />
Hinweise berücksichtigt werden. Je nach Erfassungsweise wären die im<br />
folgenden Schema (Seite 20) dargestellten Tabellen (Variante (3)) bzw.<br />
Formularentwürfe (Variante (1) und (2)) zu berücksichtigen. Dabei liefert die<br />
Beschreibung der Tabellen insbesondere mit den Spalten Inhaltliche Belegung<br />
des Feldes und Feldlänge allgemeingültige Erläuterungen für die Datenerfassung<br />
unabhängig davon, ob diese per Internet, Sonderprogramm oder hausinternem<br />
Programm erfolgt.<br />
- Prinzipiell sollten möglichst alle Felder, zu denen die Institutionen über<br />
Informationen verfügen, ausgefüllt werden. Unabhängig davon sollten die<br />
Institutionen kennzeichnen, ob die von ihnen zusammengestellten Informationen<br />
zukünftig im Internet unter LostArt.de öffentlich angezeigt werden sollen. Wünscht<br />
die Institution eine interne Handhabung ausgewählter Informationen, wären diese<br />
zu unterstreichen. Bei dem Feld Bemerkung handelt es sich um ein internes Feld,<br />
welches Informationen aufnehmen kann, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt<br />
sind. Hier kann es sich beispielsweise um die Namen von Personen handeln, die<br />
in den Entzugsvorgang involviert waren.<br />
- Die Informationen, die die Institutionen bei Variante (3) außerhalb des Internets<br />
auf Datenträgern oder als e-mail zusammentragen, sind prinzipiell als Tabellen zu<br />
strukturieren. Anzustreben sind Exceltabellen. Steht dieses Programm nicht zur<br />
Verfügung, sollte zumindest eine Umwandlung der Tabellen (beispielsweise aus<br />
Works oder Word) in Excel möglich sein. Das Tabellenformat ist für eine<br />
Integration der eingehenden Informationen in die Grundlagendatenbank und<br />
damit in die Internet-Datenbank lostart.de. unabdingbar.<br />
- Neben der Texterfassung dürfte eine bildliche Darstellung der identifizierten<br />
Werke von großer Bedeutung sein. Bilder sind mit einer Auflösung bis maximal<br />
300 dpi zu scannen und als jpg-Dateien abzuspeichern. Die Dateigröße soll dabei<br />
100 KB nicht überschreiten. Der Dateiname für die Bilddateien muss eindeutig<br />
gewählt werden, etwa unter Nennung der Bezeichnung der Einrichtung, der<br />
Nummer der Objektgruppe und der Nummer des einzelnen Objektes (z.B.<br />
Gleimhaus_03_17 für das 17. Objekt aus der 3. Objektgruppe, das im Gleimhaus<br />
identifiziert wurde).<br />
17
- Formal-inhaltliche Fragen im Vorfeld oder während der Datenerfassung können<br />
gerichtet werden an:<br />
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste<br />
beim Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt<br />
City Carré<br />
Kantstr. 5<br />
39104 Magdeburg<br />
Tel. 0391-54 487-12<br />
Fax 0391-535 396-33<br />
e-mail mfranz@mk.sachsen-anhalt.de<br />
dehnel@mk.sachsen-anhalt.de<br />
haeder@mk.sachsen-anhalt.de<br />
Die aktuelle Entwicklung bezüglich des schreibenden Zugriffs ist der Web-Seite der<br />
Koordinierungsstelle zu entnehmen:<br />
http://www.lostart.de/institutionen<br />
18
2. Zur Struktur der zu übermittelnden Informationen<br />
Tabelle 1:<br />
Institution = alle<br />
Informationen, die zur<br />
Kennzeichnung der<br />
meldenden Institution dienen<br />
Tabelle 3:<br />
Sammlung = alle<br />
Informationen, die, sollten<br />
die identifizierten Objekte<br />
erkennbar zu einer<br />
Sammlung gehören, diese<br />
Sammlung kennzeichnen<br />
Tabelle 5:<br />
Zugangsgeschichte = alle<br />
Informationen zur Art und<br />
Weise, wie die Objektgruppe<br />
in die betroffene Einrichtung<br />
gelangte, und Angaben oder<br />
Hinweise zu/auf mögliche<br />
vorherige Besitzer<br />
Tabelle 6:<br />
Einzelobjekt Archiv = alle<br />
Informationen, die ein<br />
Kulturgut aus dem<br />
Archivbereich<br />
kennzeichnen<br />
Tabelle 7:<br />
Einzelobjekt Bibliothek<br />
= alle Informationen, die<br />
ein Kulturgut aus dem<br />
Bibliotheksbereich<br />
kennzeichnen<br />
Tabelle 2:<br />
Ansprechpartner = alle Informationen,<br />
die den (die) Ansprechpartner(in)<br />
kennzeichnen, mit denen die<br />
Kommunikation zu den identifizierten<br />
Objekten erfolgen soll und die für<br />
Rücksprachen der Koordinierungsstelle<br />
und für Fragen von Suchenden zur<br />
V fü t h<br />
Tabelle 4:<br />
Objektgruppe = alle Informationen zur<br />
Kennzeichnung einer Gruppe von<br />
Objekten, die sich in ihrer Objektart (vgl.<br />
Anlage IV h) und den Zugangsumständen<br />
ähneln<br />
Tabelle 8:<br />
Einzelobjekt Museum =<br />
alle Informationen, die ein<br />
Kulturgut aus dem<br />
Museumsbereich<br />
kennzeichnen<br />
Art der Informationserfassung in jenen Fällen, in denen keine Sammlungen zu berücksichtigen<br />
sind<br />
Art der Informationserfassung in jenen Fällen, in denen Sammlungen zu<br />
berücksichtigen sind<br />
20
3. Zur Herangehensweise<br />
Bei der Erfassung der einzelnen Informationen ist es sinnvoll, zunächst die<br />
Informationen zur Kennzeichnung der eigenen Institution und des oder der<br />
Ansprechpartner zusammenzustellen. Dabei empfiehlt sich für jene Institutionen, die<br />
bereits Arbeitskontakte mit der Koordinierungsstelle hatten, die unter lostart.de<br />
aktuell verfügbaren Angaben zu ihrer Institution bzw. zu den Ansprechpartnern<br />
zunächst auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und nur notwendige<br />
Korrekturen und Ergänzungen in den entsprechenden Tabellen vorzunehmen.<br />
�� Anlage IV a - Tabelle 1 (Institution)<br />
�� Anlage IV b - Tabelle 2 (Ansprechpartner)<br />
Ausgehend davon, dass es ggf. unmöglich (oder auch wenig sinnvoll) ist, alle<br />
identifizierten Objekte im Detail zu beschreiben, kann anschließend die Erfassung<br />
der Sammlungen und/oder Objektgruppen erfolgen. Dabei schließt sich die<br />
Erfassung der Objektgruppen der Erfassung der Sammlungen (historisch<br />
gewachsene Sammlungen, Sammlungen zu Spezialgebieten etc.) an. Sammlungen<br />
können aus mehreren Objektgruppen bestehen, die sich wiederum aus mehreren<br />
einzelnen Objekten zusammensetzen können.<br />
�� Anlage IV c - Tabelle 3 (Sammlung)<br />
�� Anlage IV d - Tabelle 4 (Objektgruppen)<br />
Anschließend an die Objektgruppen werden die entsprechenden<br />
Zugangsgeschichten erfasst.<br />
�� Anlage IV e - Tabelle 5 (Zugangsgeschichte)<br />
Die Beschreibung der einzelnen Objekte kann den abschließenden Schritt darstellen.<br />
Dabei wird insofern zwischen den Tabellen 6, 7 und 8 (Anlage IV f) unterschieden,<br />
als die Erfassungskriterien zu den drei Bereichen Archiv, Bibliothek, Museum z.T.<br />
differieren und dem in der Belegung der einzelnen Tabellenfelder Rechnung<br />
getragen werden muss. Wahrscheinlich werden viele Einrichtungen jeweils nur mit<br />
einer der Tabellen 6 - 8 bzw. (Anlage IV f) arbeiten müssen, da sie entweder nur<br />
Gegenstände der Kunst/des Kunsthandwerks oder Archivgut oder Bibliotheksgut zu<br />
überprüfen haben.<br />
�� Anlage IV f - Tabelle 6 - 8 (Einzelobjekte, Tab. 6 - Bereich Archiv<br />
Tab. 7 - Bereich Bibliothek<br />
Tab. 8 - Bereich Museum)<br />
Da der Arbeitsstand in den einzelnen Einrichtungen sehr unterschiedlich sein wird, ist<br />
auch vorstellbar, dass die Institutionen zunächst mit der Erfassung einzelner Objekte<br />
beginnen und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Objektgruppen<br />
zusammengefasst werden.<br />
Prinzipiell stellt die oben beschriebene Erfassungsarbeit einen längeren Prozess dar,<br />
in dem es Ergänzungen bzw. Aktualisierungen geben wird. Es sollte entsprechend<br />
nicht mit einer Übermittlung der Informationen an die KK gewartet werden, bis "alle"<br />
Informationen komplett erfasst sind.<br />
21
V. Prüfung des verfolgungsbedingten Entzugs und ggf. Abwick-<br />
lung des Rückgabeverfahrens<br />
a) Vorbemerkung<br />
Auf dem Rechtsweg durchsetzbare Rechtsansprüche auf Herausgabe von<br />
Kulturgütern, deren Besitz während der NS-Zeit verloren ging, gibt es in der Regel<br />
nicht mehr. Bei dem nachfolgenden Prüfraster handelt es sich daher nicht um ein<br />
verbindliches rechtliches Regelwerk, sondern lediglich um die Anregung, bei der<br />
Prüfung des Herausgabeverlangens den Leitlinien der rückerstattungsrechtlichen<br />
Praxis der Nachkriegszeit zu folgen. Die Entscheidung im Einzelfall liegt unter<br />
Berücksichtigung der so genannten Washingtoner Erklärung und der Erklärung von<br />
Bund, Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden zur Auffindung und zur<br />
Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts im Rahmen der jeweils<br />
geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen im Ermessen der betroffenen<br />
Einrichtung.<br />
Grundsätzlich ist es Aufgabe des Trägers der Kultureinrichtung,<br />
Herausgabeverlangen federführend zu behandeln.<br />
Der deutsche Gesetzgeber hat sowohl im Rückerstattungsrecht für den Bereich der<br />
Altbundesländer (Bundesrückerstattungsgesetz) als auch im Rückerstattungsrecht<br />
für den Bereich der neuen Länder (Vermögensgesetz) darauf verzichtet, den die<br />
Restitution begründenden Entziehungstatbestand selbst zu definieren. Die deutsche<br />
Rückerstattungsgesetzgebung verweist vielmehr auf die Definitionen und<br />
Vermutungsregelungen (Beweislastverteilung) in den Rückerstattungsvorschriften<br />
der westlichen Alliierten, welche in den Erläuterungen zum Prüfraster insbesondere<br />
durch Entscheidungen der Obersten Rückerstattungsgerichte und der<br />
rückerstattungsrechtlichen Praxis ergänzt werden.<br />
b) Prüfraster<br />
aa) Wurde der Antragsteller bzw. sein Rechtsvorgänger in der Zeit vom 30.01.1933<br />
bis zum 08.05.1945 aus rassischen, politischen, religiösen oder<br />
weltanschaulichen Gründen verfolgt?<br />
bb) Erfolgte im maßgeblichen Zeitraum ein Vermögensverlust durch<br />
Zwangsverkauf, Enteignung oder auf sonstige Weise und wie ist die<br />
Beweislastverteilung hinsichtlich der Verfolgungsbedingtheit des Verlustes?<br />
cc) Kann die Vermutungsregelung bei rechtsgeschäftlichen Verlusten durch den<br />
Nachweis widerlegt werden,<br />
� dass der Veräußerer einen angemessenen Kaufpreis erhalten hat<br />
und<br />
� dass er über ihn frei verfügen konnte<br />
22
und (bei Veräußerungen ab dem 15.09.1935)<br />
� dass der Abschluss des Rechtsgeschäftes seinem wesentlichen Inhalt<br />
nach auch ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus stattfand oder die<br />
Wahrung der Vermögensinteressen des Verfolgten in besonderer Weise<br />
und mit wesentlichem Erfolg vorgenommen wurde, z. B. durch Mitwirkung<br />
bei einer Vermögensübertragung ins Ausland?<br />
dd) Gibt es Gründe für einen Restitutionsausschluss (Prioritätsprinzip,<br />
Missbrauch)?<br />
�� Anlage V a (Erläuterungen zum Prüfraster)<br />
c) Kulturgüter mit Bezug zum Beitrittsgebiet<br />
Für das Beitrittsgebiet ist zu beachten, dass es bei der Rückübertragung NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogener Kulturgüter nicht um eine Ermessensentscheidung der<br />
betroffenen Einrichtung auf freiwilliger Basis geht, sondern das Gesetz zur Regelung<br />
offener Vermögensfragen – Vermögensgesetz – (VermG) die maßgebliche<br />
Rechtsgrundlage darstellt.<br />
�� Anlage V b (Erläuterungen zu Kulturgütern mit Bezug zum Beitrittsgebiet)<br />
d) Entschädigungszahlungen des Bundes, sonstige Kompensationen, Gegen-<br />
leistungen<br />
In der Gemeinsamen Erklärung vom 14.12.1999 heißt es in der Ziffer l:<br />
"Diese Prüfung schließt den Abgleich mit bereits erfolgten materiellen<br />
Wiedergutmachungsleistungen ein. Ein derartiges Verfahren ermöglicht es, die<br />
wahren Berechtigten festzustellen und dabei Doppelentschädigungen (z. B. durch<br />
Rückzahlungen von geleisteten Entschädigungen) zu vermeiden."<br />
Die Entziehung von Kulturgütern ist früher vielfach aufgrund der Rechtsvorschriften<br />
des Bundesrückerstattungsgesetzes (BRüG) entschädigt worden. Bei der oben (III c)<br />
als Mittel zur Provenienzforschung empfohlenen Archivanfrage bei der<br />
Oberfinanzdirektion Berlin wird daher stets auch geprüft, ob es für den<br />
betreffenden Kunstgegenstand Entschädigungsleistungen des Bundes gab.<br />
Zu beachten sind außerdem ggf. im Rahmen des Kulturgutentzugs seinerzeit<br />
gezahlte Kaufpreise sowie sonstige Kompensationen aufgrund privater Vergleiche.<br />
�� Anlage V c (Erläuterungen zu Entschädigungszahlungen usw.)<br />
23
e) Modelle (Rückkauf, Dauerleihe, Tausch ...)<br />
Nach der Washingtoner Erklärung vom 3. Dezember 1998 sollen im Fall, dass<br />
Vorkriegseigentümer oder Erben von durch die Nationalsozialisten beschlagnahmten<br />
und in der Folge nicht zurückgegeben Kunstwerken ausfindig gemacht werden<br />
können, rasch "faire und gerechte Lösungen" gefunden werden "wobei diese je nach<br />
Gegebenheiten und Umständen des spezifischen Falls unterschiedlich ausfallen"<br />
können. Die Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen<br />
Spitzenverbände vom Dezember 1999 geht davon aus, Kulturgüter, die als NSverfolgungsbedingt<br />
identifiziert und bestimmten Entschädigten zugeordnet werden<br />
können, nach individueller Prüfung den legitimierten früheren Eigentümern bzw.<br />
deren Erben zurückzugeben. Damit wird auf eine Spannbreite von<br />
Entscheidungsmöglichkeiten für Lösungsmodelle hingewiesen.<br />
Die bisherigen Erfahrungen der betroffenen Institutionen, wie z. B. der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz, mit Modellen für die Abwicklung von Rückgabeverfahren<br />
beschränken sich in der Regel auf die Rückgabe oder den Rückkauf von<br />
Kunstwerken aus ehemals jüdischem Eigentum (In zwei Fällen hat die Stiftung die<br />
Werke direkt von den Berechtigten zurückgekauft, in einem Fall wurde das Werk<br />
einige Wochen nach der Rückgabe auf einer Auktion im Ausland von der Stiftung<br />
ersteigert und befindet sich heute wieder in den Sammlungen der Staatlichen<br />
Museen zu Berlin.) Darüber hinaus wäre aber auch denkbar, Anspruchstellern das<br />
Angebot einer Tauschvereinbarung zu unterbreiten. Eine weitere denkbare<br />
Lösungsvariante könnte der Abschluss eines (Dauer-)Leihvertrages mit den<br />
Berechtigten sein.<br />
Unabhängig vom Modell der konkreten einvernehmlichen Lösungsfindung sollte<br />
geprüft werden, ob und wie die betreffenden Objekte in Ausstellungen künftig mit<br />
Hinweisen auf ihre Provenienz und das Schicksal ihrer ehemaligen Eigentümer<br />
kenntlich gemacht werden können.<br />
Im Anhang befindet sich ein von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz entwickeltes<br />
Beispiel einer Vereinbarung, bei der ein Werk von der Stiftung rückübereignet und<br />
ein anderes - nach Rückübereignung - an die Stiftung verkauft wird.<br />
�� Anlage V d (Beispiel einer Vereinbarung)<br />
24
Anlage I a<br />
Washingtoner Erklärung<br />
Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den<br />
Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden ∗<br />
Veröffentlicht im Zusammenhang mit der Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte<br />
aus der Zeit des Holocaust, Washington DC, 3. Dezember 1998<br />
Im Bestreben, eine Einigung über nicht bindende Grundsätze herbeizuführen, die zur<br />
Lösung offener Fragen und Probleme im Zusammenhang mit den durch die Nationalsozialisten<br />
beschlagnahmten Kunstwerken beitragen sollen, anerkennt die Konferenz<br />
die Tatsache, dass die Teilnehmerstaaten unterschiedliche Rechtssysteme haben<br />
und dass die Länder im Rahmen ihrer eigenen Rechtsvorschriften handeln.<br />
1. Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der Folge<br />
nicht zurückerstattet wurden, sollten identifiziert werden.<br />
2. Einschlägige Unterlagen und Archive sollten der Forschung gemäß den Richtlinien<br />
des International Council of Archives zugänglich gemacht werden.<br />
3. Es sollten Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden, um die Identifizierung<br />
aller Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der<br />
Folge nicht zurückerstattet wurden, zu erleichtern.<br />
4. Bei dem Nachweis, dass ein Kunstwerk durch die Nationalsozialisten beschlagnahmt<br />
und in der Folge nicht zurückerstattet wurde, sollte berücksichtigt werden,<br />
dass aufgrund der verstrichenen Zeit und der besonderen Umstände des Holocaust<br />
Lücken und Unklarheiten in der Frage der Herkunft unvermeidlich sind.<br />
5. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, Kunstwerke, die als durch<br />
die Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der Folge nicht zurückerstattet<br />
identifiziert wurden, zu veröffentlichen, um so die Vorkriegseigentümer oder ihre<br />
Erben ausfindig zu machen.<br />
6. Es sollten Anstrengungen zur Einrichtung eines zentralen Registers aller diesbezüglichen<br />
Informationen unternommen werden.<br />
7. Die Vorkriegseigentümer und ihre Erben sollten ermutigt werden, ihre Ansprüche<br />
auf Kunstwerke, die durch die Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der<br />
Folge nicht zurückgegeben wurden, anzumelden.<br />
8. Wenn die Vorkriegseigentümer von Kunstwerken, die durch die Nationalsozialisten<br />
beschlagnahmt und in der Folge nicht zurückgegeben wurden, oder<br />
ihre Erben ausfindig gemacht werden können, sollten rasch die nötigen Schritte<br />
unternommen werden, um eine gerechte und faire Lösung zu finden, wobei diese<br />
∗ Die Übersetzung aus dem Englischen erfolgte durch das Schweizer Bundesamt für Kultur und wurde<br />
vom Sprachendienst des Bundesministeriums des Innern überarbeitet.<br />
25
Anlage I a<br />
Washingtoner Erklärung<br />
je nach den Gegebenheiten und Umständen des spezifischen Falls unterschiedlich<br />
ausfallen kann.<br />
9. Wenn bei Kunstwerken, die nachweislich von den Nationalsozialisten beschlagnahmt<br />
und in der Folge nicht zurückgegeben wurden, die Vorkriegseigentümer<br />
oder deren Erben nicht ausfindig gemacht werden können, sollten rasch die nötigen<br />
Schritte unternommen werden, um eine gerechte und faire Lösung zu finden.<br />
10. Kommissionen oder andere Gremien, welche die Identifizierung der durch die<br />
Nationalsozialisten beschlagnahmten Kunstwerke vornehmen und zur Klärung<br />
strittiger Eigentumsfragen beitragen, sollten eine ausgeglichene Zusammensetzung<br />
haben.<br />
11. Die Staaten werden dazu aufgerufen, innerstaatliche Verfahren zur Umsetzung<br />
dieser Richtlinien zu entwickeln. Dies betrifft insbesondere die Einrichtung alternativer<br />
Mechanismen zur Klärung strittiger Eigentumsfragen.<br />
26
Anlage I b<br />
Gemeinsame Erklärung<br />
Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen<br />
Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, vom Dezember<br />
1999<br />
Die Bundesrepublik Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg unter den<br />
Voraussetzungen der alliierten Rückerstattungsregelungen, des<br />
Bundesrückerstattungsgesetzes und des Bundesentschädigungsgesetzes<br />
begründete Ansprüche wegen des verfolgungsbedingten Entzugs von Kulturgütern<br />
erfüllt sowie die entsprechenden Verfahren und Institutionen zur Verfügung gestellt,<br />
damit die sonstigen Rückerstattungsverpflichteten von den Berechtigten in Anspruch<br />
genommen werden konnten. Die Ansprüche standen in erster Linie den unmittelbar<br />
Geschädigten und deren Rechtsnachfolgern oder im Fall erbenloser oder nicht in<br />
Anspruch genommenen jüdischen Vermögens den in den Westzonen und in Berlin<br />
eingesetzten Nachfolgeorganisationen zu. Die materielle Wiedergutmachung erfolgte<br />
im Einzelfall oder durch Globalabfindungsvergleiche. Das Rückerstattungsrecht und<br />
das allgemeine Zivilrecht der Bundesrepublik Deutschland regeln damit abschließend<br />
und umfassend die Frage der Restitution und Entschädigung von NSverfolgungsbedingt<br />
entzogenem Kulturgut, das insbesondere aus jüdischem Besitz<br />
stammt.<br />
In der DDR war die Wiedergutmachung von NS-Unrecht nach alliiertem Recht über<br />
gewisse Anfänge nicht hinausgekommen. Im Zuge der deutschen Vereinigung hat<br />
sich die Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung der Grundsätze des Rückerstattungs-<br />
und Entschädigungsrechts verpflichtet. NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenes Kulturgut wurde nach den Bestimmungen des Vermögensgesetzes und<br />
des NS-Verfolgtenentschädigungsgesetzes zurückgegeben oder entschädigt. Dank<br />
der globalen Anmeldung seitens der Conference on Jewish Material Claims against<br />
Germany, Inc. (JCC) als der heutigen Vereinigung der Nachfolgeorganisationen sind<br />
im Beitrittsgebiet gelegene Ansprüche im Hinblick auf Kulturgüter jüdischer<br />
Geschädigter geltend gemacht worden. Wie früher in den alten Bundesländern<br />
wurde auch hier soweit wie möglich eine einzelfallbezogene materielle<br />
Wiedergutmachung und im Übrigen eine Wiedergutmachung durch Globalvergleich<br />
angestrebt.<br />
I.<br />
Die Bundesrepublik Deutschland hat - ungeachtet dieser materiellen<br />
Wiedergutmachung - auf der Washingtoner Konferenz über Holocaust-Vermögen am<br />
3. Dezember 1998 erneut ihre Bereitschaft erklärt, auf der Basis der verabschiedeten<br />
Grundsätze und nach Maßgabe ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten<br />
nach weiterem NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut zu suchen und<br />
gegebenenfalls die notwendigen Schritte zu unternehmen, eine gerechte und faire<br />
Lösung zu finden. In diesem Sinne wird der Stiftungsratsbeschluss der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz vom 4. Juni 1999 begrüßt.<br />
27
Anlage I b<br />
Gemeinsame Erklärung<br />
Die Bundesregierung, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände werden im<br />
Sinne der Washingtoner Erklärung in den verantwortlichen Gremien der Träger<br />
einschlägiger öffentlicher Einrichtungen darauf hinwirken, dass Kulturgüter, die als<br />
NS-verfolgungsbedingt entzogen identifiziert und bestimmten Geschädigten<br />
zugeordnet werden können, nach individueller Prüfung den legitimierten früheren<br />
Eigentümern bzw. deren Erben zurückgegeben werden. Diese Prüfung schließt den<br />
Abgleich mit bereits erfolgten materiellen Wiedergutmachungsleistungen ein. Ein<br />
derartiges Verfahren ermöglicht es, die wahren Berechtigten festzustellen und dabei<br />
Doppelentschädigungen (z.B. durch Rückzahlungen von geleisteten Entschädigungen)<br />
zu vermeiden.<br />
Den jeweiligen Einrichtungen wird empfohlen, mit zweifelsfrei legitimierten früheren<br />
Eigentümern bzw. deren Erben über Umfang sowie Art und Weise einer Rückgabe<br />
oder anderweitige materielle Wiedergutmachung (z.B. gegebenenfalls in Verbindung<br />
mit Dauerleihgaben, finanziellem oder materiellem Wertausgleich) zu verhandeln,<br />
soweit diese nicht bereits anderweitig geregelt sind (z.B. durch<br />
Rückerstattungsvergleich).<br />
II.<br />
Die deutschen öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Archive und Bibliotheken<br />
haben schon in der Vergangenheit die Suche nach NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenem Kulturgut unterstützt:<br />
1. durch Erschließung und Offenlegung ihrer Informationen, Forschungsstände und<br />
Unterlagen,<br />
2. durch Nachforschungen bei konkreten Anfragen und eigene Recherchen im Falle<br />
von aktuellen Erwerbungen,<br />
3. durch eigene Suche im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen<br />
Einrichtung,<br />
4. durch Hinweise auf die Geschichte von Kulturgütern aus NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenem Besitz in den Sammlungen, Ausstellungen und Publikationen.<br />
Diese Bemühungen sollen – wo immer hinreichend Anlass besteht – fortgeführt<br />
werden.<br />
III.<br />
Darüber hinaus prüfen Bundesregierung, Länder und kommunale Spitzenverbände<br />
im Sinne der Washingtoner Grundsätze, ein Internet-Angebot einzurichten, das<br />
folgende Bereiche umfassen sollte:<br />
1. Möglichkeiten der beteiligten Einrichtungen, Kulturgüter ungeklärter Herkunft zu<br />
veröffentlichen, sofern NS-verfolgungsbedingter Entzug vermutet wird.<br />
2. Eine Suchliste, in die jeder Berechtigte die von ihm gesuchten Kulturgüter<br />
eintragen und damit zur Nachforschung für die in Frage kommenden<br />
Einrichtungen und die interessierte Öffentlichkeit ausschreiben kann.<br />
28
Anlage I b<br />
Gemeinsame Erklärung<br />
3. Informationen über kriegsbedingte Verbringung NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogener Kulturgüter in das Ausland.<br />
4. Die Schaffung eines virtuellen Informationsforums, in dem die beteiligten<br />
öffentlichen Einrichtungen und auch Dritte ihre Erkenntnisse bei der Suche nach<br />
NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern eingeben können, um<br />
Parallelarbeiten zu gleichen Themen (z.B.: Bei welcher Auktion wurden jüdische<br />
Kulturgüter welcher Sammlung versteigert?) auszuschließen und im Wege der<br />
Volltextrecherche schnell zugänglich zu machen.<br />
IV.<br />
Diese Erklärung bezieht sich auf die öffentlich unterhaltenen Archive, Museen,<br />
Bibliotheken und deren Inventar. Die öffentlichen Träger dieser Einrichtungen werden<br />
aufgefordert, durch Beschlussfassung in ihren Gremien für die Umsetzung dieser<br />
Grundsätze zu sorgen. Privatrechtlich organisierte Einrichtungen und Privatpersonen<br />
werden aufgefordert, sich den niedergelegten Grundsätzen und Verfahrensweisen<br />
gleichfalls anzuschließen.<br />
29
Dienststellen und auf Kulturgutraub spezialisierte Organisationen der NS-Zeit<br />
Anlage II a<br />
• Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)<br />
• Sonderkommando Künsberg (angegliedert an das Auswärtige Amt)<br />
• Abt. VI G des Reichssicherheitshauptamtes<br />
• Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (Rosenberg)<br />
• SS-Organisation "Das Ahnenerbe" (Himmler)<br />
• Kommission "Sonderauftrag (Führermuseum) Linz"<br />
• Kunstschutz der Wehrmacht (im besetzten Ausland)<br />
• Deutsche Botschaft Frankreich<br />
• Dienststelle Mühlmann (Niederlande und Belgien)<br />
• Devisenschutzkommando (Finanzministerium, Abt. für Belgien/Frankreich und Abt.<br />
Holland)<br />
• Kunstsammlung Göring (gewisser Organisationsgrad, Käufe zu einem Großteil aus<br />
öffentlichen Mitteln finanziert)<br />
• Deutsche Reichsbank (gehörte als Zentral- und Staatsbank NS-Deutschlands zu den<br />
Hauptakteuren auf dem französischen Kunstmarkt).<br />
Für Verkäufe jüdischer Kunst ins Ausland kann die Genehmigung der "Ankaufstelle" der<br />
Reichskammer der bildenden Künste ein Hinweis sein.<br />
Der Vermerk "Buchleitstelle" weist auf die Vermittlung von Objekten über die Abteilung<br />
Erfassung und Sichtung des ERR hin (Weiterführung der Arbeit ab Oktober 1943 in Ratibor).<br />
30
Anlage II b<br />
Beteiligte an Inbesitznahme, Beschlagnahmungen bzw. "Käufen" oder "Tausch" von<br />
Kunstwerken<br />
• Otto Abetz (seit 1935 Frankreich-Referent in der Dienststelle Ribbentrop, 1938<br />
Hauptreferent West, 1940-44 Botschafter in Paris)<br />
• Dr. Gustav Abb (Dir. UB Berlin, Leitung Sonderstab "Bibliotheksschutz" in den<br />
besetzen Ostgebieten, Angliederung an ERR)<br />
• Kurt Freiherr von Behr Leiter des Einsatzstabes Westen ERR, Leiter des<br />
"Sonderstabes Bildende Kunst", Stellvertreter Utikals, Leiter der "M-Aktion")<br />
• Dr. Binder (Berliner Kunsthändler und –Spezialist , Berater Görings, Vorgänger Hofers)<br />
• Dr. von Boeck (Leiter der "Feindvermögensstelle" Holland)<br />
• General Karl Bodenschatz (Leiter des "Kunstfonds Göring")<br />
• Dr. Wolff Braumüller (ERR)<br />
• Dr. Hermann Bunjes (Berater und Vermittler für Görings Kunstkäufe, seit 1942 Leiter<br />
der Kunsthistorischen Forschungsstätte, Verbindungsmann Görings zum ERR)<br />
• Dr. Fritz Dworschak (für "Sonderauftrag Linz", Münzkabinett)<br />
• Georg Ebert (Leiter des Aufbaustabs des ERR in Paris bis Anf. 1941, Vorgänger von<br />
Gerhard Utikal)<br />
• Dr. Hermann Fuchs (ERR, Bibliotheksschutz)<br />
• Dr. Herbert Gerigk (Musikhistoriker, seit 1943 Leiter der Hochschule für Musik in<br />
Leipzig, Leiter des "Sonderstabes Musik" des ERR)<br />
• Dr. Erhard Goepel (agierte in Holland, Chefeinkäufer für Posse im Westen)<br />
• Karl Haberstock (Berliner Kunsthändler, Mitglied der Verwertungskommission zur<br />
Beseitigung "entarteter Kunst", Berater "Sonderauftrag Linz")<br />
• Dr. Gritzbach (Staatsrat, Berlin, Finanzen der Kunstkäufe Görings)<br />
• Dirk Hannema (Mitglied von Seyß-Inquarts holländischer "Kulturkammer", seit 1942<br />
Leiter der holländischen Museen)<br />
• Dr. Jürgen von Hehn (1939 Leiter der Buchsammelstelle der Universität Posen, bis<br />
1941 in der Publikationsstelle Berlin-Dahlem, 1941-43 im "Sonderkommando<br />
Künsberg", danach Mitarbeit in der Abteilung VI G des Reichssicherheitshauptamtes)<br />
• Philipp Prinz von Hessen (u.a. Ankäufer für den Sonderauftrag Linz, bes. Italien)<br />
• Dr. Niels von Holst (Kunsthistoriker, Mitarbeiter im Reichsministerium für Wissenschaft,<br />
Erziehung und Volksbildung und im Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, speziell im<br />
Baltikum und Osteuropa tätig)<br />
• Walter Andreas Hofer (Kurator und Kunsthändler Görings)<br />
• Heinrich Hoffmann (Fotograf, Kunstberater Hitlers für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Dr. Hellmuth von Hummel (Sekretär Martin Bormanns, aktiv bei Auswahl des<br />
konfiszierten Materials für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Dr. Hans Helmut Klihm (Mitarbeiter Hans Posses)<br />
• Erich Koch (Reichskommissar für die Ukraine)<br />
• Wilfried Krallert ( 1941-43 im "Sonderkommando Künsberg", danach Mitarbeit in der<br />
Abteilung VI G des Reichssicherheitshauptamtes, Leiter der "Reichsstiftung für<br />
Länderkunde")<br />
• Dr. Alfred Kraut (Generaltreuhänder für die Sicherstellung der Kulturgüter,<br />
Reichshauptstelle, "Ahnenerbe")<br />
• Eberhard Freiherr von Künsberg (Legationsrat im Auswärtigen Amt, Leiter des<br />
"Sonderkommando Künsberg")<br />
• Dr. Hans Heinrich Lammers (Chef der Reichskanzlei, Finanzen für “Sonderauftrag<br />
Linz“)<br />
31
Anlage II b<br />
• Gisela Limberger (seit 1942 Privatsekretärin Görings, inventarisierte u.a. Görings<br />
Kunstwerke)<br />
• Bruno Lohse (zweiter Verbindungsmann Görings zum ERR, als Kunsthändler für<br />
Göring, "Sonderauftrag Linz", Speer und Bormann tätig)<br />
• Kajetan Mühlmann (seit 1938 Staatssekretär für Kunst in Wien, für den<br />
Reichskommissar für die besetzten niederländischen und polnischen Gebiete tätig,<br />
spielte bedeutende Rolle beim Kunstraub in Polen und den Niederlanden; sein<br />
Halbbruder Joseph Mühlmann verwaltete das Pariser Büro der Dienststelle)<br />
• Ferdinand Niedermeyer (vormals Direktor der Deutschen Bank in Berlin, während der<br />
Besetzung seit 1941 "Verwalter des dem Reich verfallenen Vermögens im Bereich des<br />
Militärbefehlshabers in Frankreich", sog. "Arisierungskommissar")<br />
• Dr. Rudolf Oertel (Mitarbeiter Hans Posses)<br />
• William Ernst de Palèzieux (Kurator des Generalgouverneurs Hans Frank, ersetzte<br />
Mühlmann)<br />
• Louis Darquier de Pellepoix ("Generalkommissar für Judenfragen" der Vichy-<br />
Regierung)<br />
• Edouard Plietzsch (Kunsthistoriker und -händler aus Berlin, Mitarbeiter der Dienststelle<br />
Mühlmann)<br />
• Dr. Georg Poensgen (Referent für den militärischen Kunstschutz für Militärverwaltung<br />
Osten)<br />
• Dr. Hans Posse (Leiter der Dresdner Gemäldegalerie und zugleich Organisator des<br />
"Führermuseums Linz")<br />
• Hans Reger (registrierte Kunstwerke für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Dr. Gottfried Reimer (Mitarbeiter Hans Posses)<br />
• Dr. Hans Reinerth (Prähistoriker, Leiter des "Sonderstabes Vor- und Frühgeschichte"<br />
des ERR, Kulturgutraub vornehmlich in der Sowjetunion)<br />
• Dr. Leopold Ruprecht (für "Sonderauftrag Linz", Waffensammlung)<br />
• Gunther Schiedlausky (Kunsthistoriker, ERR)<br />
• Dr. Gerhard Schilde (Dienststelle ERR Paris, "Kommando Schilde" für Reval)<br />
• Dr. Robert Scholz (Rosenbergs langjähriger Kunstexperte, "Sonderstab Bildende<br />
Kunst")<br />
• Dr. Franz Schubert (Mitarbeiter Hans Posses)<br />
• Wolfram Sievers und Prof. Heinrich Harmjanz (Generaltreuhänder Ost in den<br />
angegliederten polnischen Gebieten, "Ahnenerbe")<br />
• Dr. Ernstotto Graf zu Solms-Laubach (Referent für den militärischen Kunstschutz für<br />
Militärverwaltung Osten)<br />
• Gerhard Utikal (Reichshauptstellenleiter ERR Frankreich, Leiter der "Zentralstelle zur<br />
Erfassung und Bergung von Kulturgütern" in den besetzten Ostgebieten)<br />
• Dr. Hermann Voss (ehem. Leiter der Wiesbadener Gemäldegalerie, Nachfolger von<br />
Posse 1943)<br />
• Dr. Friedrich Wolffhardt (für "Sonderauftrag Linz", Bibliothek)<br />
• Adolph Wüster (Konsul, Kulturattaché der deutschen Botschaft in Paris,<br />
Gelegenheitskunsthändler für Ribbentrop)<br />
• Carltheo Zeitschel (hochrangiger Botschaftssektretär in Paris, verantwortl. für<br />
Beschlagnahmungen jüdischen Besitzes)<br />
• Dr. Zipfel (ab 1940 "Kommissar für Archivschutz" im westlichen Operationsgebiet, dann<br />
Leiter der "Archivschutzkommision" bzw. des "Sonderreferats Archivwesen" im<br />
Ostministerium, Zusammenarbeit mit ERR)<br />
32
Die so genannte "Hohe Schule"<br />
Anlage II c<br />
"Hohe Schule", 1938 auf Betreiben Alfred Rosenbergs als Groß-Projekt gegründet.<br />
Alle Forschungsinstitute der "Hohen Schule" waren mehr oder weniger eingebunden in den<br />
Kulturraub des ERR.<br />
Die Zentralbibliothek der "Hohen Schule" (seit Oktober 1942 in Villach, Außenstelle in<br />
Tanzenberg). Der Leiter der Bibliothek, Dr. Grothe, wählte 1940-1941 in Paris Bücher und<br />
Dokumente aus den Plünderungen in Frankreich für seine Zwecke aus. Nach dem Überfall<br />
auf die Sowjetunion Einrichtung einer "Ostbücherei", die Zuweisungen vom ERR erhielt und<br />
am meisten von den dortigen Plünderungen profitierte.<br />
Das "Institut zur Erforschung der Judenfrage" als erste Außenstelle der "Hohen Schule" in<br />
Frankfurt am Main, gegr. 1939 (Forschungsabteilung, Archiv, Bibliothek). Bibliotheks- und<br />
(seit 1940) Institutsleiter: Dr. Wilhelm Grau, ab 1942 Dr. Johann Pohl. Den Grundstock der<br />
Bibliothek stellten die Altbestände an Judaica und Hebraica der Frankfurter<br />
Universitätsbibliothek und die in den westlichen Ländern beschlagnahmten Bibliotheken dar.<br />
Aus den Beschlagnahmungen des ERR in der Sowjetunion erhielt sie jiddische Literatur,<br />
Talmudica etc.<br />
33
Spezialsachverständige der NS-Zeit<br />
Anlage II d<br />
• Als Sachverständiger des Reichserziehungs- und Innenministeriums Hans Carl Krüger<br />
(Berlin, Brandenburg, Meseritz, Schwerin)<br />
• Als Sachverständiger des Reichserziehungs- und Innenministeriums Wilhelm Ettle<br />
(Kunsthändler) (Hessen, Wiesbaden, Rheinpfalz, Saarland u.a.); nach dessen<br />
Verhaftung durch die Gestapo wegen persönlicher Bereicherung Übernahme der<br />
Tätigkeit seit 1941 durch Julius Hahn (ebenfalls Kunsthändler)<br />
• Spezialsachverständige in Kunstfragen für Frankfurt a.M. Dr. Alfred Wolters (Direktor<br />
der Städtischen Galerie Frankfurt a.M.), Prof. Walter Manowsky (Direktor des<br />
Kunstgewerbemuseums Frankfurt a.M.), Dr. Ernst Holzinger (Direktor des Städelschen<br />
Kunstinstitutes, Dr. Richard Oehler (Direktor der Universitätsbibliothek Frankfurt a.M.)<br />
als Sachverständige der "Anlaufstelle für jüdisches Kulturgut", Dr. Hans Bergmann<br />
(Universitätsbuchhandlung Blazek & Bergmann Frankfurt a.M.)<br />
• Wilhelm Schumann (Kunsthändler) als Fachreferent beim Landeskulturverwalter des<br />
NSDAP-Gaus Hessen-Nassau<br />
34
Anlage II e<br />
In den Handel mit verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern involvierte<br />
Kunsthändler<br />
(Die Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge enthält nur die bekanntesten Händler<br />
und damit verbundene größere Transaktionen und beansprucht keine Vollständigkeit.<br />
Die Schreibweise der Namen kann variieren.)<br />
• Sepp Angerer (Berlin, Vertrauter und Kunsthändler im Auftrage Görings)<br />
• Bruno Walter Bachstitz (Kunsthändler in Den Haag)<br />
• Ètienne Bignou<br />
• Zacharias Birtschansky (Paris)<br />
• Boedecker (Frankfurt a.M.)<br />
• Bernhard A. Boehmer<br />
• Kunsthandlung Pieter de Boer (Amsterdam)<br />
• Achilles Boitl (Paris)<br />
• Walter Bornheim (Galerie der Alten Kunst München, ehem. A.S. Drey, neben Haberstock<br />
größter deutscher Kunsthändler, u.a. Einkäufer Görings)<br />
• Brimo de la Laroussilhe (Paris)<br />
• Kunsthaus Brosseron-Marchand (Paris)<br />
• Karl Buchholz<br />
• Kunstgalerie A. und Eugen Brüchwiller (München)<br />
• Emil G. Bührle (Schweizer Waffenproduzent und Kunstsammler, einer der Hauptlieferanten der<br />
dt. Wehrmacht)<br />
• O.W. Bümming (Buchhändler, u.a. im Auftrag Wolffhardts in der Schweiz)<br />
• Kunsthändler Cailleux (Pseud.: Paul de Cayeux de Sénarpont)<br />
• Louis Caré (Galerie André Weil)<br />
• Galerie Charpentier (Paris, Geschäftsführer: Raymond Nasenta)<br />
• Charles Collet (Kunsthändler, kaufte Objekte aus ERR-Beschlagnahmungen)<br />
• Kunsthandlung Etienne Delaunoy (Amsterdam)<br />
• Roger Dequoy (ehem. Geschäftspartner von Georges Wildenstein, Agent Haberstocks)<br />
• Georges Deestrem (Agent von Haberstock)<br />
• Jan Dik jr. (Amsterdam)<br />
• Auktionshaus Dorotheum (Wien)<br />
• Galerie Dreyfus (Schweiz)<br />
• Auktionshaus Hotel Drouot (Paris)<br />
• Maria Almas Dietrich (München)<br />
• Dupont (Spekulant, kaufte Objekte aus ERR-Beschlagnahmungen)<br />
• Galerie Hugo Engel (Paris, Handel mit Haberstock))<br />
• Kunstgalerie Martin Fabiani (Paris, Kontakt zum ERR))<br />
• Schweizer Kunsthändler S. [Theodor] Fischer, Luzern<br />
• Vicomte de la Forest-Divonne (Paris)<br />
• Myrtel Frank (den Haag)<br />
• Dr. Alexander von Frey<br />
• Max Friedländer (Holland)<br />
• Smit van Gelder (Holland)<br />
• Mme. Renee Gerard (Paris)<br />
• Raphael Gérard (belgischer Kunsthändler)<br />
• Galerie Gerstenberger (Einkäufer für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Paul Gouvert (Paris)<br />
• Dr. Hildebrandt Gurlitt (Kommissionär für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Dr. Wolfgang Gurlitt (Kunsthändler, Berlin, Cousin von H. Gurlitt)<br />
• Karl Haberstock (Berlin, für "Sonderauftrag Linz")<br />
35
Anlage II e<br />
• Dr. Hans Herbst (Wien, offizieller Einkäufer für "Sonderauftrag Linz", bes. in Holland und Paris)<br />
• Theo Hermssen (holländischer Händler in Paris)<br />
• Walter Hoeckner (Leipzig, für Wolffhardt in Prag)<br />
• Walter Andreas Hofer (Leiter der Kunstsammlung Görings)<br />
• Ward Holzapfel (Paris)<br />
• Hoogendijk (Amsterdam)<br />
• Fa. Jansen (exklusives Pariser Dekorationshaus)<br />
• Nathan Katz (Dieren bei Arnheim, Den Haag)<br />
• Kornfeld & Klipstein (Bonn)<br />
• Maurice Lagrand (Brüssel)<br />
• J.O. Leegenhoek (Paris)<br />
• Jean-Francois Lefranc (Frankreich, u.a. "provisorischer Verwalter" der Sammlung Schloss)<br />
• Comte de Lestang (Antiquitätenhändler, regelmäßiger Zuträger der Deutschen in Paris)<br />
• Paul Lindpainter (Pariser Agent von Fritz Pössenbacher, für Bormann)<br />
• Bank Lippmann, Rosenthal & Co., Amsterdam ( war von Dienststelle Mühlmann beauftragt,<br />
beschlagnahmte Kulturgüter zu verkaufen: Inventar, Schätzung, Verkauf; Verwalter: Herr von<br />
Karner, Abt.leiter: Baron Steckow)<br />
• Allen Loebl (Fa. E. Gerig - jüdischer Pariser Kunsthändler, unter persönlichem Schutz Görings,<br />
für Göring und Haberstock)<br />
• Dr. Bruno Lohse (Görings Mann im ERR)<br />
• Victor Mandl (Paris)<br />
• Alice Manteau (Paris)<br />
• Serge Markowsky (Paris)<br />
• Alois Miedl (Bankier und Kunsthändler, Finanzberater Hermann Görings)<br />
• Ferdinand Möller<br />
• Wilhelm Jakob ["Ernst von"] Mohnen (deutscher Gestapo-Agent in Paris)<br />
• Charles Montag (Schweizer in Paris)<br />
• Galerie Neupert (Schweiz)<br />
• Kunsthändler Walter Paech (Holland)<br />
• Yves Perdoux (Pariser Antiquitätenhändler, Denunziant)<br />
• Paul Pétrides (Paris)<br />
• Fritz Pössenbacher (Münchner Händler, für Bormann)<br />
• Dr. G.F. Reber (Repräsentant für Göring und Hofer in Italien, Schweiz)<br />
• Arthur Pfannstiel (von Behrs Vertrauter)<br />
• Gustav Rochlitz (im Auftrag Görings in Frankreich tätig)<br />
• Isidor Rosner (Paris)<br />
• Georg Schilling (Zürich, "Sonderauftrag Linz", Einkäufer, aktiv bes. in Belgien)<br />
• Ernst Schmidt (Berlin, Einkäufer für "Sonderauftrag Linz")<br />
• Galerie Schmidtlin (Zürich)<br />
• André Schoeller (Frankreich)<br />
• Karl Schwarzinger (Österreich)<br />
• Fa. Jacob Stodel / Übernahme durch Kalb (Amsterdam)<br />
• Max Stoecklin<br />
• Jean Souffrice (Galerie Voltaire, Paris)<br />
• Adolf Weinmüller (Auktionshäuser in München und Wien)<br />
• Galerie Friedrich Welz (Kunsthändler für die Salzburger Gauleitung)<br />
• Hans Wendland (dominierende Rolle bei Göring-Sammlung, vor allem in Frankreich tätig)<br />
• Mme. Jane Weyll (Paris)<br />
36
Anlage II f<br />
Auktionshäuser, die auf Zwangsversteigerungen von Kunst aus jüdischem Besitz<br />
spezialisiert waren (u.a. sog. "Judenauktionen")<br />
• Kunsthändler Paul Graupe (Auktionshaus Graupe führte von 1933-1937 in Berlin eine<br />
Reihe aufsehenerregender Auktionen jüdischer Sammlungen durch - mit<br />
Sondergenehmigung als Jude Mitglied der Reichskulturkammer; emigrierte 1937 nach<br />
Frankreich, wo er in Paris unter den Decknamen Jaques Vial und Muir als<br />
Kunsthändler arbeitet, seit 1941 in New York, 1942 wurde sein Eigentum<br />
beschlagnahmt)<br />
• Auktionshaus H.W. Lange (Weiterführung von Paul Graupes "arisiertem" Geschäft ab<br />
1937, Zusammenarbeit mit Finanzbehörden)<br />
• Kunsthändler Max Perl<br />
• Kunst-Auktionshaus Rudolph Lepke (Berlin, u.a. Versteigerung der Sammlung Eduard<br />
Fuchs)<br />
• Kunstantiquariat C.G. Boerner (Leipzig, u.a. Versteigerung der Sammlung Eduard<br />
Fuchs)<br />
• Leo Spik (Berlin)<br />
• Eduard Plietzsch (Kunsthistoriker und -händler, auch Mitarbeiter der Dienststelle<br />
Mühlmann)<br />
• G. Harms (Berlin)<br />
• Versteigerungshäuser Franz Pfaff (Inhaber Max Bechler), August Danz, Emil Neuhof,<br />
Schweppenhäuser in Frankfurt a.M.<br />
37
Anlage II g<br />
Transportfirmen / -organisationen (u.a. mit Transporten von geraubtem Kulturgut in<br />
das Deutsche Reich befasst)<br />
• J.B. Bratenburg, Den Haag, de Kuyper-Straat<br />
• Brauner, Schweiz<br />
• Brenzlau, Berlin, Apostel-Paul-Straße<br />
• Bronner, Basel<br />
• Gondrand, Florenz, Piazza Stazione 1<br />
• de Gruyter, Amsterdam, Frans-van-Mieres-Straat<br />
• Martelli, Florenz, Via Vignea Nuova 12<br />
• Pottler, Paris, Rue Gaillon 14<br />
• Rosoni, Rom, Piazza di Spagna 33<br />
• Fa. Schenker (Büro Paris – große deutsche Firma, spezialisiert auf Kunsttransporte)<br />
• Schumacher, Berlin, Obertrautstraße<br />
• Wacker-Bondy, Paris<br />
38
Jüdische Sammler und/oder Kunsthändler<br />
• Hans Arnhold (Bankier, nach Frankreich emigriert)<br />
• Eduard Arnhold<br />
• Kunsthändler Hugo Ball<br />
• Claire Barach<br />
• Sammlung Levy de Benzion (Frankreich) [Signatur: LB ]<br />
• Kunsthandelsgeschäft Bernheim-Jeune (Frankreich)<br />
• Leonce Bernheim (Frankreich)<br />
• Kunsthandlung Bernheimer (München)<br />
• Sammlung Ferdinand Bloch-Bauer (Wien)<br />
• Sammlung Bondy (Österreich)<br />
• Sammlung Emma Budge<br />
• Sammlung Baron Cassel (Frankreich, NS-"Aktion Berta") ["Berta"]<br />
• Sammlung van Cleef [Signatur: CLF]<br />
• Sammlung David David-Weill (Frankreich) [Signatur: D-W]<br />
• Sammlung Dr. Wilhelm Dosquet (Berlin)<br />
• Kunsthandlung A.S. Drey (München)<br />
• Sammlung Goldschmidt-Rothschild (Frankfurt)<br />
• Kunstbesitz Maurice (Emmy, Louis) Dreyfus<br />
• Sammlung Dr. Erlanger (beschlagnahmt in Paris)<br />
• Sammlung Salomo Flavian (Paris)<br />
• Sammlung Eduard Fuchs (Berlin)<br />
• Sammlung Leo Fürst (Münzen, Wien)<br />
• Hans Fürstenberg (nach Frankreich emigriert)<br />
• Sammlung Frederico Gentili di Guiseppe (Paris)<br />
• Ginzberg (Menzel-Zeichnungen)<br />
• Jacques und Desi Goudstikker (Amsterdam)<br />
• Sammlung Fritz Gugenheim (Berlin)<br />
• Sammlung Baron Gutmann (Wien)<br />
• Sammlung Friedrich Gutmann (deutsch-niederländischer Bankier) [MUIR]<br />
• Kunsthandelgeschäft Emile und Fernand Halphen (Frankreich)<br />
• Sammlung Isaak, Jean und Hermann Hamburger (Paris)<br />
• Sammlung Hartog<br />
• Sammlung Alexander Hauser (Münzen, Wien)<br />
• Galerie Josse Hessel (Paris)<br />
• B. Jacobi (Paris, private Akten des deutsch-französischen Emigranten)<br />
• Maurice-Wolf Jacobson (Paris)<br />
• Sammlung Dr. Alphons Jaffé (Berlin, Leiden)<br />
• Sammlung Alphonse Kann (Frankreich), [ Signatur: KA, ka]<br />
• Claire [Clara] Kierstein<br />
• Sammlung Victor von Klemperer (Dresden)<br />
• Sammlung Franz Koenigs (Holland)<br />
• Sammlung Joseph Kronig (Holländer, Paris)<br />
• Bibliothek Jürgen Kuczynski (Berlin)<br />
• Sammlung Graf Lanckoronsky (Österreich)<br />
• Sammlung Otto Lanz (Holland)<br />
• Kunstbesitz Raymond Lazare<br />
• Sammlung August Lederer (Österreich)<br />
• Kunstbesitz Levalocourt<br />
• Leo Lewin (Breslau)<br />
• Sammlung Lindenbaum (Frankreich)<br />
Anlage II h<br />
39
Anlage II h<br />
• Sammlung Lippmann / Rosenthal (Bank in Amsterdam, Zentraldepot für alle jüdischen<br />
Sammlungen, die von der "Feindvermögensstelle" Holland beschlagnahmt worden waren)<br />
• Jüdische Buchhandlung Lipschütz, Paris<br />
• Sammlung Ismar Littmann<br />
• Sammlung Fürst Lobkowitz (Schloss Raudnitz, Tschechoslowakei )<br />
• Kunstbibliothek Allen Loebl<br />
• Sammlung Fritz Lugt (Den Haag und Schweiz)<br />
• Israel Mandel (Akten und Kunstwerke aus dem Besitz des französischen Ministers)<br />
• Sammlung Fritz Mannheimer (Bankier in Berlin, emigriert nach Amsterdam, Palais bei Paris –<br />
eine der bedeutendsten Privatsammlungen Europas)<br />
• Verschiedene Sammlungen Mendelssohn (Hinweis: nicht in allen Fällen jüdisches Eigentum<br />
und/oder verfolgungsbedingter Entzug)<br />
• Etienne Nicolas (Frankreich)<br />
• Sammlung Alfred Oppenheim (Frankfurt a.M.)<br />
• Kunsthändler Hugo Perls<br />
• Sammlung Polak (Amersfoort)<br />
• Sammlung Redlich (Österreich)<br />
• Bernhard und Mme. Reichenbach (Frankreich)<br />
• Kunsthandelsgeschäft Paul Rosenberg (Frankreich)<br />
• Sammlung Rosenberg-Bernstein (Bordeaux) [Rosenberg Bordeaux]<br />
• Sammlung Sarah Rosenstein (Paris)<br />
• Sammlung der Familien Rothschild (Wien und Paris) [z.T. Invent.-Nr: "R ..." ] und Archiv der<br />
Rothschild-Bank, Paris<br />
• Carl Sachs<br />
• Sammlung der Familie (Adolphe) Schloss<br />
• Kunsthändler Firma Seligmann (Paris)<br />
• Sammlung Max Silberberg (Breslau / Schlesien)<br />
• Hugo Simon (Bankier, Kunstsammler und Mäzen, nach Frankreich emigriert),<br />
• Sammlung Jacques Stern (Bordeaux)<br />
• Sammlungen Dr. M. Wassermann (Paris)<br />
• Sammlung Prosper-Èmile Weil<br />
• Sammlung Weil-Picard (Frankreich)<br />
• Sammlung Weinberg (Frankfurt)<br />
• Sammlung Pierre Wertheimer (Frankreich)<br />
• Kunsthändler Georges Wildenstein (Frankreich)<br />
• Bibliothek der Schriftstellerin Luise Weiss, Paris<br />
• Sammlung Zsolnay (Österreich)<br />
• Helene de Zuylen<br />
• weitere Sammlungen (alle Frankreich): Aronson, Calmann-Lévy, Erlanger, Feldberg, Goldman,<br />
Haas, Hackenbroch, Raymond Hesse, Jacobson, Leven, Mme. Roger Levy, Loewell, Kapferer,<br />
Kronfeld, Oppenheim, Simon- Levy, Reinach, Jules Rouff, Thierry, Trosch, Wolfsohn<br />
40
Beschlagnahmte Bibliotheken<br />
• Bibliothek der Alliance Israélite Paris<br />
• Privatbibliothek des Direktors der Alliance Israelite Paris, Sylvain Levy<br />
• Bibliothek der "Ecole Rabbinique", Paris<br />
• Bibliothek der Féderation des Société des Juifs de France<br />
• Turgenjew-Bibliothek, Paris<br />
• gesamte Korrespondenz von Leon Blum und Delbos, Mme. Talbois<br />
• Akten und Dokumente der Loge "Groß-Orient de France"<br />
• Akten und Dokumente der "Grand Loge de France".<br />
• Claire und Ivan Goll (Korrespondenz, Manuskripte und anderes Schriftgut)<br />
Anlage II i<br />
41
Beschlagnahmte Musikalien<br />
• Musikinstrumenten-Sammlung der jüdischen Musikerin Wanda Landowska<br />
• Musicalia-Sammlung des jüdischen Komponisten Darius Milhaud<br />
• Musicalia-Sammlung des Cellisten Gregor Piatigorski<br />
Anlage II j<br />
42
Anlage II k<br />
Liste der bekanntesten Auslagerungs- und Verbringungsorte geraubter Kulturgüter<br />
• Sammlung Führermuseum Linz: Salzmine Alt-Aussee und Steinberg (Österreich),<br />
Hohenfurth, Stift Kremsmünster, Schloss Thürntal (bei Kremsmünster), Schloss<br />
Steiersberg (bei Wien-Neustadt), Schloß Kogl (St. Georgen, Attergau), Grundlsee (Villa<br />
Castiglione), St. Agatha (bei Alt-Aussee, Schloss Weesenstein (bei Dresden),<br />
Gemäldegalerie Dresden<br />
• Einsatzstab Rosenberg: Schlösser Neuschwanstein (Füssen), Kogl, Herrenchiemsee,<br />
Seisenegg, Nikolsburg und Kloster Buxheim bei Memmingen,<br />
• Sammlung Göring: Carinhall, Berchtesgaden, Veldenstein<br />
• "Ostbücherei": Ratibor (Polen)<br />
• Hungen bei Gießen (jüdische Literatur und Kultgegenstände aus der Sowjetunion)<br />
43
Anlage III a<br />
1. Kommunalarchive<br />
Bestände in Kommunalarchiven mit eventuellen Unterlagen über NS-verfolgungsbedingt<br />
entzogenes Kulturgut<br />
− Stadtratsprotokolle/Entschließungen des Oberbürgermeisters (für Ankäufe)/ Protokolle<br />
von Beigeordnetenbesprechungen bzw. Magistratsunterlagen<br />
− Verwaltungsberichte<br />
− Finanzverwaltung: Rechnungsbände mit Beilagen<br />
− Leihamt/Pfandleihanstalt<br />
− Kulturamt<br />
− Kulturinstitute (Museen, Archive, Bibliotheken)<br />
− Sammlungen und Nachlässe<br />
− Stiftungen<br />
− Polizeiverwaltung<br />
− Rechtsamt<br />
− Gewerbeamt<br />
− Liegenschaftsamt<br />
− Entschädigungs-/Rückerstattungsunterlagen<br />
− SMAD und SMA-Befehle und deren Umsetzung<br />
44
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Baden-Württemberg<br />
Staatsarchiv Ludwigsburg<br />
EL 350 Landesamt für Wiedergutmachung<br />
EL 402 Oberfinanzdirektion Stuttgart<br />
FL 300/33 Amtsgericht Stuttgart,<br />
Schlichter für die Wiedergutmachung<br />
K 19 II Landesfinanzamt Stuttgart: Verwertung jüdischen Besitzes<br />
K 50 Oberfinanzdirektion Stuttgart, Bundesvermögensabteilung:<br />
Rückerstattung<br />
Generallandesarchiv Karlsruhe<br />
417 Finanzämter<br />
465 d NSDAP, Verbände und Polizei<br />
237 Finanzministerium: Rückerstattung jüdischen Vermögens<br />
505 Finanzministerium, Jüdisches Vermögen:<br />
Akten zur "Arisierung"<br />
276 Amtsgericht Mannheim, Schlichter für die Wiedergutmachung:<br />
Rückerstattung jüdischen Vermögens<br />
480 Landesamt für die Wiedergutmachung Karlsruhe:<br />
Einzelfallakten<br />
243 Landesgericht Karlsruhe:<br />
Wiedergutmachungskammer für Nordbaden<br />
Staatsarchiv Freiburg<br />
C 20/1 – C 20/7 Badisches Ministerium der Justiz<br />
C 30/1 – C 34/7 Badisches Ministerium der Finanzen<br />
F 196/1 – F 196/2 Landesamt für die Wiedergutmachung,<br />
Außenstelle Freiburg<br />
G 540/2 Amtsgericht Freiburg<br />
F 200/7 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
F 202/2 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
F 202/4 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
F 202/22 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
F 202/32 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
P 303/4 Oberfinanzdirektion Freiburg<br />
Bundesvermögensabteilung<br />
F 165/1 Landgericht Baden-Baden<br />
F 167/2- F 167/3 Landgericht Konstanz<br />
F 168/2 Landgericht Offenburg<br />
Staatsarchiv Sigmaringen<br />
Wü 1 Landtag: Anfragen betr. Rückerstattung geraubter<br />
Vermögenswerte von Juden<br />
Wü 25 Justizministerium: Aufstellung von jüdischen<br />
Vermögenswerten<br />
Wü 40 Innenministerium: Wiedergutmachung<br />
Wü 80 Kultusministerium:<br />
45
Israelische Kultusvereinigung Württemberg<br />
Wü 120 T 3 Finanzministerium, Vermögenskontrolle:<br />
Restitutionsklagen<br />
Ho 235/1-VIII Preußische Regierung Sigmaringen:<br />
Verzeichnisse jüdischen Besitzes und "Arisierung"<br />
Wü 33 Landesamt für Wiedergutmachung Tübingen<br />
Wü 28 Landgerichte: Restitutionsklagen<br />
Ho 13 Landratsämter: Juden, jüdischer Grundbesitz,<br />
Wiedergutmachung<br />
Ho 199 Landratsämter: Juden, jüdischer Grundbesitz,<br />
Wiedergutmachung<br />
Wü 65 Landratsämter: Juden, jüdischer Grundbesitz,<br />
Wiedergutmachung<br />
Wü 126 Finanzämter: Judenvermögen<br />
Wü 49/10a Staatliche Polizeidirektion Reutlingen:<br />
Ausbürgerung von Juden<br />
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Bayern<br />
Bayerisches Hauptstaatsarchiv<br />
Bayerisches Landesentschädigungsamt (größerer Teil noch nicht übernommen)<br />
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus<br />
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen<br />
Bayerische Staatskanzlei (vereinzelte Akten auch in den meisten anderen<br />
Ministerialüberlieferungen)<br />
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns<br />
Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (Übernahme in Vorbereitung)<br />
OMGUS (Mikrofiches von Akten der US-Militärregierung)<br />
Staatsarchiv Amberg<br />
Regierung der Oberpfalz<br />
alle Bezirksämter<br />
Landgerichte<br />
Staatsanwaltschaften<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Zollamt Amberg<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
NSDAP<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv Augsburg<br />
Regierung von Schwaben<br />
alle Bezirksämter<br />
Staatsanwaltschaften<br />
Finanzmittelstelle Augsburg<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
46
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Staatsarchiv Bamberg<br />
Regierung von Oberfranken<br />
alle Bezirksämter<br />
Staatsanwaltschaften<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
IHK Oberfranken Bayreuth (v.a. Arisierungsakten)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv Coburg<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv Landshut<br />
Regierung von Niederbayern<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv München<br />
alle Bezirksämter<br />
Oberfinanzdirektion München (u.a. Devisenstelle)<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
Wiedergutmachungsbehörde V (Rückerstattungsakten, nur kleiner Teil)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv Nürnberg<br />
alle Bezirksämter<br />
Wiedergutmachungsbehörde Bayern (Rückerstattungsakten, Übernahme im Gange)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
Staatsarchiv Würzburg<br />
Regierung von Unterfranken<br />
alle Bezirksämter<br />
Gestapo Würzburg (v.a. Personenakten)<br />
Polizeidirektion Würzburg<br />
Finanzämter (v.a. Steuerakten rassisch Verfolgter)<br />
Außenstelle des Landesamtes für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung<br />
(Vermögenskontrollakten)<br />
NSDAP<br />
Spruchkammern (erst teilweise übernommen)<br />
47
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Berlin<br />
Landesarchiv<br />
A Rep. 092 Landesfinanzamt/Oberfinanzpräsident Berlin (Ver<br />
mögensstelle, Finanzamt Moabit-West)<br />
A Rep. 243-04 Reichskammer der bildenden Künste – Landesleitung Berlin<br />
(Versteigerungsunterlagen)<br />
B Rep. 039 Landesgericht Berlin (Archiv für Wiedergutmachung)<br />
B Rep. 064 Oberstes Rückerstattungsgericht für Berlins<br />
C Rep. 105 Magistrat von Berlin – Finanzen (Treuhandstelle für polnisches<br />
und jüdisches Vermögen)<br />
Brandenburg<br />
Landeshauptarchiv Potsdam<br />
Rep. 36 A Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg<br />
Rep. 36 C Finanzämter<br />
Rep. 2 A Regierung Potsdam<br />
Rep. 6 B Landratsämter<br />
Rep. 203 Ministerium des Innern,<br />
Amt zum Schutz des Volkseigentums<br />
Rep. 204 A Ministerium der Finanzen<br />
Rep. 205 A Ministerium für Voksbildung<br />
Rep. 250 Landratsämter<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Staatsarchiv<br />
Oberfinanzdirektion/Vermögensverwertungsstelle und Referat Rückerstattung<br />
Landesamt für Wiedergutmachung<br />
Senator für innere Verwaltung<br />
Freie und Hansestadt Hamburg<br />
Staatsarchiv<br />
214-1 Gerichtsvollzieherwesen<br />
311-31 Finanzbehörde<br />
314-15 Oberfinanzdirektion<br />
(Devisenstelle und Vermögensverwertungsstelle)<br />
Jüdische Rechtskonsulenten, nämlich<br />
621-1 Alexander Bachur<br />
621-1 Edgar Haas<br />
621-1 Ernst Kaufmann<br />
621-1 Walter Schüler<br />
621-1 Siegfried Urias<br />
621-1 Walter Wulff<br />
Hessen<br />
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden<br />
Abt. Z 460 Landgericht Frankfurt/M. Wiedergutmachungskammern<br />
Abt. 474/1-11 Jüdische Rechtsanwälte in Frankfurt/M.<br />
Abs. 483 NSDAP, Gauleitung Hessen-Nassau und<br />
Gauleitung Kurhessen<br />
48
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Abt. 518 Regierungspräsidien als Entschädigungsbehörde<br />
Abt. 519 Landesamt für Vermögenskontrolle und<br />
Wiedergutmachung Hessen<br />
Abt. 676 Finanzamt Frankfurt-Stiftstraße, Veranlagungsakten<br />
Abt. 677 Finanzamt Frankfurt-Taunustor, Reichsfluchtsteuerakten<br />
Abt. 685 Finanzamt Wiesbaden I, Veranlagungsakten<br />
Abt. 2052 Hessisches Landesentwicklungs-<br />
und Treuhandgesellschaft, Rückerstattungsakten<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Landesarchiv Greifswald<br />
Rep. 90 Oberpräsident Pommern – Devisenstelle –<br />
Rep. 77 Amtsgericht Gartz / Oder<br />
Rep. 90a Finanzamt Greifswald<br />
Rep. 92 Reichsbankstelle Stralsund<br />
Rep. 65b Regierung Köslin<br />
Niedersachsen<br />
Staatsarchiv Aurich<br />
Rep. 17/2 Nieders. Regierungspräsident Aurich<br />
Rep. 251 Bezirksstelle Aurich des Nieders. Landesamtes für<br />
die Beaufsichtigung gesperrten Vermögens<br />
Rep. 109 Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Aurich<br />
Dep. 60 Stadtarchiv Norden<br />
Staatsarchiv Bückeburg<br />
L 4 Schaumburg-Lippische Landesregierung<br />
L 102a Landratsamt Bückeburg<br />
L 102b Landratsamt Stadthagen<br />
Dep. 9 Stadtarchiv Bückeburg<br />
Dep. 29 Stadtarchiv Obernkirchen<br />
Dep. 42 Samtgemeinde Rodenberg<br />
Dep. 46A Landkreis Schaumburg-Lippe<br />
Dep. 46B Landkreis Grafschaft Schaumburg<br />
Hauptstaatsarchiv Hannover<br />
Hann. 210 Landesfinanzamt/Oberfinanzpräsident Hannover,<br />
Devisenabteilung<br />
Nds. 210 Nieders. Landesamt für die Beaufsichtigung gesperrten<br />
Vermögens<br />
Nds. 211 Bezirksstellen Hannover, Hildesheim und Lüneburg des<br />
Nieders. Landesamtes für die Beaufsichtigung gesperrten<br />
Vermögens<br />
Nds. 110 W Nieders. Landesverwaltungsamt, Abt. Wiedergutmachung<br />
Staatsarchiv Osnabrück<br />
Rep. 430 – 201 Regierung Osnabrück, Polizeidezernat<br />
Rep. 430 – 904 Bezirksstelle Osnabrück des Nieders. Landesamtes für<br />
die Beaufsichtigung gesperrten Vermögens<br />
Rep. 520 Lin Finanzamt Lingen<br />
49
Rep. 945 Staatsanwaltschaft beim Landgericht Osnabrück<br />
Dep. 3c Stadtarchiv Osnabrück<br />
Dep. 59b Stadtarchiv Bramsche<br />
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Staatsarchiv Stade<br />
Rep. 171a Stade Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stade<br />
Rep. 171a Verden Staatsanwaltschaft beim Landgericht Verden<br />
Rep. 180 G II Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Gewerbesachen<br />
Rep. 180 KuJ Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Kultur und Jugendsachen<br />
Rep. 180 J Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Jugendsachen<br />
Rep. 180 L Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Landwirtschaftssachen<br />
Rep. 180 P Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Polizeisachen<br />
Rep. 180 S Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Schulsachen<br />
Rep. 180 U Preuß./Nieders. Regierungspräsident Stade,<br />
Unterstützung-, Sozial- und Arbeitsangelegenheiten<br />
Rep. 209 Bezirksstelle Stade des Nieders. Landesamtes für die<br />
Beaufsichtigung gesperrten Vermögens<br />
Rep. 269 Bezirksverwaltungsgericht<br />
Staatsarchiv Wolfenbüttel<br />
15 R 4 Finanzamt Wolfenbüttel<br />
23 A Nds. Finanzamt Braunschweig-Wilhelmstraße<br />
12 Neu, SF G Verwaltungspräsident Braunschweig,<br />
ältere Wiedergutmachungssachen<br />
12 Neu, 17 V u. VI Verwaltungspräsident Baunschweig, Präsidialabteilung<br />
4 Nds. Fb. 3 Verwaltungspräsident Braunschweig,<br />
jüngere Wiedergutmachungssachen<br />
58 Nds. Fb. 3 Landgericht Braunschweig, Wiedergutmachungskommission<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf<br />
Rückerstattungsakten der Landgerichte Aachen, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Kleve,<br />
Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Wuppertal<br />
Landesamt für gesperrte Vermögen (FB 247.01.2 und 247.02.1-5)<br />
NW 60: Kultusministerium – Kunst und Kulturpflege (FB 330.21)<br />
NW 99: Ministerium für Wirtschaft und Verkehr – Demontage (FB 350.13)<br />
Staatsarchiv Münster<br />
Ämter für gesperrte Vermögen<br />
Landgericht Dortmund, Rückerstattung<br />
Regierung Arnsberg, Wiedergutmachung<br />
Dienstregistratur<br />
50
Staatsarchiv Detmold<br />
D 1 Regierung Detmold, Wiedergutmachung,<br />
Liegenschaften und Vermögen<br />
D 2 A Polizeipräsident Bielefeld<br />
D 20 A Landgericht Bielefeld, Rückerstattungsakten<br />
D 20 B Landgericht Detmold, Rückerstattungsakten,<br />
Akten der Entschädigungskammer<br />
D 20 C Landgericht Paderborn, Rückerstattungsakten<br />
M 1 IP Regierung Minden, Polizei<br />
D 100 Detmold, Lemgo (Kreisverwaltungen)<br />
D 26 Finanzämter<br />
D 27 Amt für gesperrte Vermögen<br />
D 28 Finanzbauamt Bielefeld<br />
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Landeshauptarchiv Koblenz<br />
Bes. 403 C.4.4.: Wissenschaft, Kunst und Kultur<br />
Best. 441 Regierung Koblenz, Nachweisungen ausländischen und<br />
jüdischen Grund-, Gebäude- und Kapitalbesitzes<br />
Best. 442 Regierung Trier: Museen, Synagogen,<br />
Judenangelegenheiten<br />
Best. 457 Landratsamt Bernkastel<br />
Best. 467 Landratsamt Bad Kreuznach<br />
Best. 475 Landratsamt Neuwied<br />
Best. 491 Landratsamt Simmern<br />
Best. 498 Landratsamt Wittlich<br />
Best. 806 Landratsamt Marienberg / Westerburg<br />
Best. 662, 3 Kreisleitung Trier-West und Trier-Land<br />
Best. 662, 5 Alexandria-Akten<br />
Best. 662, 6 SD-Koblenz<br />
Best. 662, 7 NS-Mischbestand<br />
Landesarchiv Speyer<br />
H 13 Oberreg. Präs. Hessen-Pfalz, Bez. Reg. Pfalz, Prov. Reg. Rheinhessen,<br />
Bez. Reg. Rheinh.-Pfalz<br />
Korrespondenz mit der franz. Militärregierung (u.a. über Kultur, Inneres,<br />
Polizei)<br />
Abt. O/I Akten über Polizei, Justiz, Kultur, requirierter Besitz, beschlagnahmte<br />
Vermögen<br />
Abt. O/II Wiedergutmachung, Opfer des Faschismus, kontrollierte Vermögen<br />
Abt. D/PS: Politische Schädigungen, Widergutmachung<br />
Abt. D/Vm Vermögen von NS-Organisationen, kontrollierte Vermögen, ehem. jüdischer<br />
Besitz<br />
H 31 Bezirks- bzw. Landratsamt Bergzabern<br />
47, 128<br />
H 33 Bezirks- bzw. Landratsamt Frankenthal<br />
986 b, 902, 905, 986 c, 1268, 1296, 1319<br />
H 34 Bezirks- bzw. Landratsamt Germersheim<br />
180, 2129<br />
51
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
H 36 Bezirks- bzw. Landratsamt Kaiserslautern<br />
366, 377<br />
H 37 Bezirks- bzw. Landratsamt Kirchheimbolanden<br />
851, 852, 1890, 1990, 1991+1992, 2438, 2459, 2464, 2569<br />
H 38 Bezirks- bzw. Landratsamt Kusel<br />
1351, 1354<br />
H 39 Bezirks- bzw. Landratsamt Landau<br />
Auswanderung jüdischer Bürger in der NS-Zeit, Judenverfolgung, Arisierung,<br />
jüdische Stiftungen und Vereine, Ausweisungen und Abschiebungen<br />
H 40 Bezirks- bzw. Landratsamt Ludwigshafen<br />
Passwesen<br />
Religionsgemeinschaften<br />
Stiftungen<br />
H 41 Bezirks- bzw. Landratsamt Neustadt<br />
2, 24, 62-66, 334<br />
H 42 Bezirks- bzw. Landratsamt Pirmasens<br />
377, 391, 394, 395. Abt. VIII/E-G<br />
H 43 Bezirks- bzw. Landratsamt Rockenhausen<br />
971, 1328, 1259-1325<br />
H 45 Bezirks- bzw. Landratsamt Speyer<br />
409, 410<br />
H 46 Bezirks- bzw. Landratsamt Zweibrücken<br />
945+1664, 1075, 1076, 1172-1640<br />
H 51 Kreis- bzw. Landratsamt Alzey<br />
51, 70, 72, 73, 76+77, 80, 82, 85, 86, 88+89, 112-126, 127-138, 206ff., 282ff.,<br />
308, 366, 615, 1178, 1197-1212, 1272-1274, 1325-1342, 1478-1490,<br />
1516+1517, 1522+1523, 1533<br />
H 53 Kreis- bzw. Landratsamt Mainz / Oppenheim<br />
569-570, 600, 1433-1440, 1589+1590, 1772, 1773+1774, 1776, 2252<br />
H 79 Polizeipräsidium Mainz<br />
H 87 Gendarmeriestationen<br />
7 Maßnahmen gegen Juden<br />
H 91 Geheime Staatspolizei Neustadt<br />
J 1 Oberlandesgericht Zweibrücken, Akten<br />
Akten über Wiedergutmachung, Wissenschaft und Kunst, Internationale<br />
Interessengemeinschaften, Behandlung feindlichen Vermögens, Pflegschaften<br />
über das Vermögen ausgewanderter Juden<br />
J 8 Landgericht Landau<br />
Z 3010, Z 3675<br />
J 15 Amtsgericht Edenkoben<br />
1395, 1435<br />
J 20 Amtsgericht Kaiserslautern<br />
Enthält u.a. Hinweise auf Juden in Handelsregistern, Todeserklärungen von<br />
Juden<br />
J 24 Amtsgericht Landau<br />
875, 986<br />
J 28 Amtsgericht Neustadt<br />
1043 Verband der israelitischen Kultusgemeinden der Pfalz<br />
J 71 Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Zweibrücken<br />
26, 34, 41, 42<br />
J 72 – J 76 Staatsanwaltschaften<br />
52
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
L 13 Finanzamt Dahn<br />
(Z 3326) Besteuerung, Verwaltung und Verwertung jüdischer Vermögenswerte<br />
(55 Akten)<br />
(z.T. auch Restitutions-, Rückerstattungs- oder Wiedergutmachungsnachweise)<br />
L 24 Finanzamt Landau<br />
(Z 3402) Verwaltung, Verwertung und Nutzung entzogener jüdischer Vermögen<br />
L 28 Finanzamt Neustadt<br />
(Z 4196) Verwaltung und Verwertung jüdischer Vermögenswerte<br />
L 30 Finanzamt Pirmasens<br />
(Z 3326) Besteuerung, Verwaltung und Verwertung jüdischer Vermögenswerte<br />
L 32 Finanzamt Speyer<br />
(Z 3629) desgl. (z.T. auch Restitutions-, Rückerstattungs- oder<br />
Wiedergutmachungsnachweise)<br />
L 36 Finanzamt Bingen<br />
(Z 4286) desgl. (z.T. auch Restitutions-, Rückerstattungs- oder<br />
Wiedergutmachungsnachweise)<br />
R 19 Wiedergutmachungsämter<br />
Saarland<br />
Landesarchiv<br />
Landesentschädigungsamt<br />
Landgericht Saarbrücken / Restitutions- und Wiedergutmachungsakten<br />
Sachsen<br />
Hauptstaatsarchiv Dresden<br />
Oberfinanzpräsident Dresden<br />
Finanzämter<br />
Amtsgerichte<br />
Polizeipräsident Dresden<br />
Banken<br />
Notare (bei Amtsgerichten)<br />
Industrie- und Handelskammer Chemnitz<br />
Staatsarchiv Leipzig<br />
Oberfinanzpräsident Leipzig<br />
Amtsgerichte<br />
Polizeipräsident Leipzig<br />
Banken<br />
Versteigerungshaus Hans Klemm<br />
Staatsarchiv Chemnitz<br />
Banken<br />
Amtsgerichte<br />
Staatsfilialarchiv Bautzen<br />
Amtsgerichte<br />
53
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Landesarchiv Magdeburg – Landeshauptarchiv –<br />
Rep. C 96 II Archivberatungsstelle der Provinz Sachsen<br />
Rep. C 28 If Regierung Magdeburg, Polizeiregistratur<br />
Rep. C 128 Landgericht Halberstadt<br />
Rep. G 11 Devisenstelle Provinz Sachsen, Länder Anhalt und Thüringen, Magdeburg<br />
Rep. C 110 Industrie- und Handelskammer Halberstadt<br />
Rep. K 3 Ministerium des Innern<br />
Rep. K 5 Ministerium der Finanzen<br />
Rep. K 6 Ministerium für Wirtschaft und Verkehr<br />
Rep. K 10 Ministerium für Volksbildung, Kunst und Wissenschaft<br />
Landesarchiv Merseburg<br />
Rep. C 48 Regierung Merseburg<br />
Kreisverwaltungen<br />
Rat des Bezirkes Halle<br />
Landesarchiv Oranienbaum<br />
Staatsministerium/Abteilungen Wirtschaft und Finanzen<br />
Regierung, Abteilung des Innern<br />
Kreisdirektion Bernburg II<br />
Kreisdirektion Zerbst<br />
Amtsgericht Bernburg<br />
Amtsgericht Zerbst<br />
Oberstaatsanwalt Dessau<br />
Bezirksverwaltung Dessau<br />
Kreisbehörden Blankenburg<br />
Bankbestände<br />
Schleswig-Holstein<br />
Landesarchiv Schleswig<br />
E 130 b Staatsministerium<br />
EA 4/202 Justizministerium, Wiedergutmachung:<br />
Grundsatzfragen der Wiedergutmachung<br />
EA 4/203 Justizministerium, Wiedergutmachung:<br />
Entschädigung, Rückerstattung<br />
EA 4/204 Justizministerium, Wiedergutmachung: Einzelfallakten<br />
Thüringen<br />
Hauptstaatsarchiv Weimar<br />
Thüringisches Volksbildungsministerium C:<br />
Aktengruppe "Museen und Sammlungen"<br />
Der Oberfinanzpräsident Thüringen in Rudolstadt:<br />
"Behandlung jüdischen Vermögens – Sicherungsanordnungen"<br />
Der Reichsstatthalter in Thüringen:<br />
"Theater, Literatur, Kunst, Institute usw."<br />
Land Thüringen, Ministerpräsident – Büro des Ministerpräsidenten:<br />
"Enteignung und Sequestierungen" und<br />
"Einzelfälle der Wiedergutmachung"<br />
54
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
Land Thüringen – Ministerium für Volksbildung:<br />
"Ermittlung, Sicherstellung und Rückführung von Kulturgut"<br />
Oberlandesgericht Erfurt:<br />
"Wiedergutmachung – Einzelfälle"<br />
Land Thüringen – Ministerium der Finanzen:<br />
"Wiedergutmachung – Einzelfälle"<br />
Staatsarchiv Altenburg<br />
Thüringisches Kreisamt Altenburg<br />
Kreisrat Altenburg<br />
Staatsarchiv Gotha<br />
Thüringisches Kreisamt Eisenach<br />
Landgericht Eisenach<br />
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Gotha<br />
Strafgefängnis Eisenach<br />
Regierung zu Erfurt<br />
Landratsamt Mühlhausen<br />
Landratsamt Schleusingen<br />
Finanzamt Nordhausen<br />
Landgericht Erfurt<br />
Landratsamt Schmalkalden<br />
Amtsgericht Schmalkalden<br />
Kreisräte<br />
Staatsarchiv Meiningen<br />
Kreisamt Hildburghausen<br />
Kreisamt Meiningen<br />
Landgericht Meiningen<br />
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Meiningen<br />
Staatsanwaltschaft Sonneberg<br />
Thür. Amtsgericht Hildburghausen<br />
Thür. Amtsgericht Römhild<br />
Thür. Amtsgericht Sonneberg<br />
Thür. Amtsgericht Thema<br />
Notare<br />
Katasteramt Meiningen<br />
Finanzamt Bad Salzungen<br />
Finanzamt Meiningen<br />
Kreisrat Hildburghausen<br />
Kreisrat Meiningen<br />
Deutsche Bank, Filiale Meiningen<br />
Deutsche Bank, Filiale Sonneberg<br />
Bankhaus Wachenfeld & Gumprich, Schmalkalden<br />
Bankhaus Karl Meinhardt, Meiningen<br />
Hypothekenbank, Filiale Meiningen<br />
Thür. Staatsbank, Filiale Hildburghausen<br />
Reichsbank, Filiale Sonneberg<br />
Nachlass der Familie Strupp, Meiningen<br />
Bezirkstag/Rat des Bezirkes Suhl<br />
55
Staatsarchiv Greiz<br />
Thüringisches Kreisamt Gera<br />
Thüringisches Kreisamt Greiz<br />
Thüringisches Kreisamt Schleiz<br />
Kreisrat Gera<br />
Kreisrat Greiz<br />
Kreisrat Schleiz<br />
Amtsgerichte<br />
Anlage III a<br />
2. Landesarchive<br />
56
Bund<br />
Bundesarchiv (vgl. Anlage III b)<br />
Anlage III a<br />
3. Andere Archive<br />
R 2 Reichsfinanzministerium<br />
R 87 Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens<br />
R 2107 OFD Berlin-Brandenburg, Außenstelle für feindliches Vermögen<br />
R 182 Deutsche Golddiskontbank<br />
R 177 Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete,<br />
Referat Feindvermögen beim Generalkommissar für Finanzen<br />
und Wirtschaft<br />
R 4901 Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung<br />
R 55 Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda<br />
R 56 (BDC) Reichskulturkammer, Personalakten<br />
NS 30 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg<br />
NS 15 Der Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten<br />
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der<br />
NSDAP<br />
NS 8 Kanzlei Rosenberg<br />
B 323 Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der OFD München<br />
(Erläuterungen unter Anlage III b)<br />
Auswärtiges Amt<br />
117 Politisches Archiv<br />
Stiftung Preußischer Kulturbesitz<br />
Geheimes Staatsarchiv<br />
57
Erläuterungen des Bundesarchivs zum Bestand 323<br />
Anlage III b<br />
Bundesarchiv<br />
Bundesarchiv Koblenz Stand: Jan. 1999<br />
B 4<br />
Kurzinformationen für Benutzer<br />
Der Bundesarchiv-Bestand<br />
B 323 Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München<br />
1. Allgemeines<br />
Zur Sicherung und vorläufigen Verwahrung des zwischen 1933 und 1945 von den<br />
Nationalsozialisten im In- und Ausland geraubten, entzogenen, gekauften oder<br />
ausgelagerten Kulturguts wurden ab Mai 1945 von der amerikanischen Militärverwaltung<br />
Central Collecting Points (CCP) eingerichtet. Neben dem in München in der ehemaligen<br />
Parteizentrale der NSDAP eingerichteten CCP München bestanden zeitweise kleinere<br />
CCP's in Wiesbaden und Marburg.<br />
Die Collecting Points sollten die o. g. Kunstobjekte sammeln, inventarisieren,<br />
restauratorisch sichern sowie zur Vorbereitung ihrer Restituierung die Herkunft<br />
(Privatbesitz, staatliche Kunstsammlung usw.) und genauere Informationen zum Erwerb<br />
(Kauf, Beschlagnahmung, Entzug) ermitteln.<br />
Im November 1949 wurden die bis dahin nicht restituierbaren Kunstbestände zunächst in<br />
die Treuhänderschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten gegeben. Das von 1952 bis<br />
1962 zuständige Auswärtige Amt richtete eine "Treuhandverwaltung von Kulturgut<br />
München" zur Klärung der Eigentumsverhältnisse der Objekte ein. 1963 übernahm der<br />
Freistaat Bayern die Verwaltung der Restbestände des ehemaligen NS-Vermögens,<br />
während das Bundesschatzministerium bzw. später das Bundesfinanzministerium<br />
(Oberfinanzdirektion München) die übrigen bislang nicht restituierbaren Kunstbestände<br />
verwalten sollte.<br />
2. Inhaltliche Zusammensetzung des Bestandes<br />
Der Bestand enthält<br />
A) Akten und Karteien (z.T. unvollständig) über folgende zwischen 1933 und 1945<br />
entstandene Kunstsammlungen:<br />
- "Sammlung Sonderauftrag/Führerauftrag Linz":<br />
u.a. Unterlagen des Beauftragten für den Sonderauftrag Linz und der<br />
Reichskanzlei (u. a. Ankäufe, Rechnungen, Schriftwechsel); numerisches<br />
Verzeichnis der für den Sonderauftrag Linz erworbenen Kunstwerke; Fotobände<br />
zum Katalog der Gemäldegalerie Linz (ca. 84 Aufbewahrungseinheiten [AE])<br />
58
- "Sammlung Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)":<br />
Anlage III b<br />
Bundesarchiv<br />
u.a. Inventare der durch den ERR in verschiedenen westeuropäischen Ländern<br />
(u.a. Frankreich und Niederlande) beschlagnahmten Sammlungen einschließlich<br />
einer Fotosammlung ("ERR-Fotothek"); diverse Teilinventare und Verzeichnisse<br />
"sichergestellter Objekte"; Transportlisten; Beschlagnahmelisten des<br />
Devisenschutzkommandos Frankreich; französische Zolllisten;<br />
Restaurierungsberichte (ca. 77 AE)<br />
- "Sammlung Göring":<br />
Sammlungskatalog, z.T. mit Fotos; Erwerbsunterlagen (ca. 30 AE)<br />
- "Sammlung Bormann" und "Sammlung Heinrich Hoffmann":<br />
Bestandslisten und Kataloge (z.T. mit Fotos), Erwerbsunterlagen (ca. 6 AE)<br />
B) Unterlagen des CCP München und der Treuhandverwaltung von Kulturgut zu<br />
Bestandsaufnahmen, Nachforschungen und Auswertungen der unter A genannten<br />
Materialien (ca. 48 AE)<br />
enthält u.a.: "Dresdener Katalog" zum Sonderauftrag Linz; Listen von in Österreich<br />
und Frankreich beschlagnahmten Kunstwerken; alphabetisches CCP-Inventar der für<br />
den Sonderauftrag Linz erworbenen Kunstwerke<br />
C) Unterlagen der Monuments, Fine Arts and Archives Restitution Branch (ca. 14 AE)<br />
enthält: Verwaltungsangelegenheiten, Tätigkeitsberichte, Lagerungsbedingungen<br />
(Tagebücher)<br />
D) Materialien zur Rückgabe sichergestellter Kunstgüter durch die CCP's; Verwaltung<br />
der Kunstobjekte durch die Treuhandverwaltung von Kulturgut (z.T. lückenhaft) (ca.<br />
400 AE)<br />
enthält u.a.: Verzeichnisse der in die CCP's München und Wiesbaden<br />
übernommenen Kunstgüter; Inventare und Karteien der CCP's München, Wiesbaden<br />
und Marburg; In- und Outshipment-Verzeichnisse; Aufstellung der in München und<br />
Wiesbaden eingegangenen Deklarationen (nach Staaten und Deklarationsnummern);<br />
Innere und äußere Restitution von Kunstgut (nach Staaten); Restitutionseinzelfälle;<br />
Französische Verlustlisten ("Repertoire des biens spoliés en France durant la guerre<br />
1939 – 1945", verschiedene Ausfertigungen); Ansprüche von<br />
Restitutionsgeschädigten; Verzeichnis bekannt gewordener Restitutionen (nach<br />
Staaten und Namen).<br />
Weiter enthält der Bestand u.a. Kopien der vom Office of Strategic Services (OSS) – Art<br />
Looting Investigation Unit erstellten "Göring-Reports", "Mühlmann-Reports" und "Linz-<br />
Reports". Die Unterlagen des Bestandes sind nur teilweise organisch erwachsen. Große<br />
Teile des Materials wurden als Kopie oder Rückvergrößerung von Mikrofilmen in teils<br />
schlechter Qualität aus dem Schriftgut anderer Einrichtungen zusammengetragen, u.a.<br />
59
aus Akten von Reichsbehörden, NS-Dienststellen, US-Militär- und OMGUS-Einrichtungen.<br />
60
Anlage III b<br />
Bundesarchiv<br />
Aus der OFD München sind bisher noch nicht alle Unterlagen in das Bundesarchiv<br />
gelangt.<br />
3. Benutzung<br />
Der Bestand ist durch ein vorläufiges Findbuch erschlossen. Die für Recherchen<br />
wichtigsten Inventarkarteien ("Property Cards Art", Restitutionskartei) sind nach den sog.<br />
Münchener Nummern ("Mü.-Nrn." = vom CCP vergebene Inventarnummern)<br />
systematisiert. Einzelrecherchen zum Schicksal der durch CCP's betreuten Kunst- oder<br />
Kulturgüter sind daher nur erfolgversprechend, wenn deren "Mü.-Nr." bereits bekannt ist<br />
oder vorab ermittelt werden kann. Zu einzelnen Objekten liegen auch Fotonegative vor,<br />
die ebenfalls nach "Mü.-Nrn." geordnet sind.<br />
Die Unterlagen zum ERR betreffen hauptsächlich Einsätze in Westeuropa. Nur vereinzelt<br />
sind Informationen zu Münzsammlungen, Archiv- und Bibliotheksgut überliefert.<br />
Eine persönliche Einsichtnahme ist grundsätzlich jederzeit möglich; die vorherige<br />
Mitteilung des Besuchstermins ist erwünscht. Wegen der o.g. mangelhaften Qualität<br />
einiger Kopien ist das Mitbringen einer Leselupe zu empfehlen. Englische und deutsche<br />
Sprachkenntnisse sind erforderlich. Über die Öffnungszeiten des Benutzersaals<br />
informiert ein Merkblatt. Reproduktionsaufträge (Kosten vgl. gesondertes Info-Blatt)<br />
werden an die Firma Selke Archivdienste GmbH weitergeleitet).<br />
4. Weitere Hinweise<br />
Korrespondierende Aktenbestände (Auswahl) im Bundesarchiv, die jedoch zur Klärung<br />
von Einzelfällen in der Regel nicht hilfreich sind:<br />
Reichskanzlei (R 43), Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens<br />
(R 87), Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (NS 30), Kanzlei Rosenberg (NS 8)<br />
(Vor der Benutzung dieser Bestände ist eine direkte Kontaktaufnahme mit dem<br />
Bundesarchiv, Abteilungen Berlin, Postfach 450569, 12175 Berlin, erforderlich.)<br />
Literatur (Auswahl):<br />
Feliciano, Hector: Das verlorene Museum. Vom Kunstraub der Nazis, Berlin 1998<br />
Opper, Dieter: Cultural treasures moved because of the war: A cultural legacy of the second world war;<br />
documentation and research on losses; documentation of the international meeting in Bremen (30.11. -<br />
2.12.1994). Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern, Bremen 1995<br />
Johann Petropoulos: Art as Politics: The Nazi Elite's quest for the political and material control of Art, Chapel Hill<br />
1996<br />
Smyth, Craig Hugh: Repatriation of Art from the Collecting Point of Munich after WW II: Backgrounds and<br />
Beginnings with reference especially to the Netherlands, The Haag 1988<br />
______________________________________<br />
Bundesarchiv, 56064 Koblenz<br />
Telefon: 0261/505 – 242 (Frau Martens), Telefax: 0261/505-226<br />
e-mail: www.bundesarchiv.de<br />
61
Anlage IV a<br />
Tabelle 1- Institution<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldes<br />
Feldlänge<br />
Anschrift Anschrift der Institution 90 Zeichen<br />
Institutionstyp Typ der Institution Diese Bezeichnung ist bei Variante<br />
(3) der Tabelle Institutionstyp (vgl.<br />
Anlage IV g) zu entnehmen bzw.<br />
wird in Variante (1) und (2) als<br />
Auswahlliste zur Verfügung gestellt<br />
Telefon zentrale Telefonnummer der<br />
Institution<br />
z.B. (030) 4423756 30 Zeichen<br />
Fax zentrale Faxnummer der<br />
Institution<br />
z.B. (030) 4423756 30 Zeichen<br />
eMail zentrale e-mail-Adresse der<br />
Institution<br />
100 Zeichen<br />
Homepage Internetadresse der Institution die eigentliche Adresse ab<br />
„www.“<br />
100 Zeichen<br />
Straße Straße und Hausnummer, in der z.B. Mansfelder Str. 52 30 Zeichen<br />
sich die Institution befindet<br />
Postfach Sollte die Postanschrift<br />
gegenüber der Hausanschrift<br />
differieren: Angabe des<br />
Postfaches<br />
30 Zeichen<br />
Postleitzahl 1 Postleitzahl der Hausadresse 7 Zeichen<br />
Postleitzahl 2 Postleitzahl der Postadresse 7 Zeichen<br />
Ort1 Name des Ortes, zu dem die<br />
Hausadresse gehört<br />
30 Zeichen<br />
Ort2 Name des Ortes, zu dem die<br />
30 Zeichen<br />
Postadresse gehört<br />
Staat Name des Staates Diese Bezeichnung ist in Variante<br />
(3) der Tabelle Staaten zu<br />
entnehmen (vgl. Anlage IV g) bzw.<br />
wird in Variante (1) und (2) als<br />
Auswahlliste zur Verfügung<br />
gestellt. Dabei kann die<br />
Staatentabelle nach Rücksprache<br />
um weitere Staaten erweitert<br />
werden, sollte dies inhaltlich<br />
notwendig sein.<br />
Land Name des Bundeslandes Diese Bezeichnung ist in Variante<br />
(3) der Tabelle Staaten zu<br />
entnehmen (vgl. Anlage IV g) bzw.<br />
wird in Variante (1) und (2) als<br />
Auswahlliste zur Verfügung gestellt<br />
Beschreibung Beschreibung der Institution unbegrenzt<br />
Bemerkung Information, die keinen anderen<br />
Feldern zugeordnet werden kann<br />
oder nicht zur Veröffentlichung<br />
bestimmt ist<br />
unbegrenzt<br />
62
Anlage IV b<br />
Tabelle 2 – Ansprechpartner<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldes<br />
Feldlänge<br />
Name Name des Ansprechpartners Akademischer Grad. Nachname,<br />
Vorname; sollte es mehrere<br />
Ansprechpartner geben, wären die<br />
Spalten Name, Telefon, eMail<br />
entsprechend zu duplizieren<br />
(Name 1; Funktion 1; Telefon 1<br />
etc.)<br />
50 Zeichen<br />
Funktion Welche Funktion übt der<br />
Ansprechpartner in der Institution<br />
aus?<br />
100 Zeichen<br />
Telefon Telefonnummer des<br />
Ansprechpartners<br />
z.B. (030) 4423756 50 Zeichen<br />
e-mail e-mail-Adresse des<br />
Ansprechpartners<br />
z.B. (030) 4423756 100 Zeichen<br />
Bemerkung z.B. eine von der Hausadresse<br />
abweichende Adresse, an der<br />
der Ansprechpartner zu finden ist<br />
unbegrenzt<br />
63
Anlage IV c<br />
Tabelle 3 - Sammlung<br />
Ist eindeutig ersichtlich, dass es sich bei den identifizierten Objekten um (Teile)<br />
eine(r) Sammlung (historisch gewachsen, zu einem Spezialgebiet etc.) handelt, so<br />
wird zunächst die Sammlung kurz beschrieben<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldes<br />
Feldlänge<br />
Name Name der Sammlung 255 Zeichen<br />
Stifter Wer war der Stifter<br />
(Begründer) der Sammlung?<br />
100 Zeichen<br />
Zeitraum Aus welchem Zeitraum Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889- 50 Zeichen<br />
stammt die Sammlung ? 06-24 für den 24. Juni 1889<br />
oder 1777/1821 für die<br />
Laufzeit von 1777 bis 1821<br />
etc.)<br />
Geschichte Geschichte der Sammlung unbegrenzt<br />
Beschreibung Kurze inhaltliche<br />
Beschreibung der Sammlung<br />
unbegrenzt<br />
Bemerkung Information, die keinen/<br />
anderen Feldern zugeordnet<br />
werden kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt ist<br />
unbegrenzt<br />
Erfassungsda Datum, an dem die Erfassung Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889tum<br />
durch die Einrichtung für 06-24 für den 24. Juni 1889<br />
LostArt.de erfolgte<br />
oder 1777/1821 für die<br />
Laufzeit von 1777 bis 1821<br />
etc.)<br />
UrheberIn / Name des Autors (der Akademischer Grad.<br />
AutorIn Autorin) bzw. Urhebers (der<br />
Urheberin), der (die) die<br />
Erfassung für LostArt.de<br />
vornahm<br />
Nachname, Vorname<br />
64
Anlage IV d<br />
Tabelle 4 - Objektgruppen<br />
Handelt es sich nicht um eine historisch gewachsene oder anders erkennbare<br />
Sammlung, sondern um inhaltlich nicht verbundene Objekte, werden diese zu<br />
Objektgruppen zusammengefasst und als solche beschrieben.<br />
Objektgruppen werden zusammengefasst nach der Objektart (vgl. Anlage IV g) und<br />
den Umständen, durch welche sie in die Einrichtung gelangt sind. Entscheidend sind<br />
beide Kriterien, eine gemeinsame Objektart und eine gemeinsame<br />
Zugangsgeschichte. Zum Beispiel werden alle Bücher, die an einem bestimmten Tag<br />
durch eine bestimmte Stelle einer Bibliothek übergeben wurden, oder alle Grafiken,<br />
die im Ergebnis ein– und derselben Auktion in das Museum gelangten, zu jeweils<br />
einer Objektgruppe zusammengefasst. Auch Sammlungen bestehen i.d.R. aus<br />
Objektgruppen, ehe sie sich in einzelne Objekte aufgliedern.<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldes<br />
Feldlänge<br />
Nummer Nummer der Objektgruppe Diese Nummer muss bei Variante<br />
(3) vergeben werden, damit die im<br />
weiteren zu erfassenden<br />
Zugangsgeschichten (vgl. Tabelle 5)<br />
und die zu beschreibenden<br />
einzelnen Objekte (vgl.Tabelle 6-8)<br />
beim Datenimport der richtigen<br />
Objektgruppe zugeordnet werden<br />
können. In Variante (1) und (2) wird<br />
dies durch das Programm<br />
Name der<br />
Sammlung<br />
Name der in Tabelle 3<br />
genannten Sammlung<br />
Spezifizierung Hier erfolgen Einträge wie<br />
Kisten, Mappen, Kartons o.<br />
Ä., soweit die Objekte noch<br />
nicht ausgezählt wurden<br />
Objektklasse Hier werden die Objekte den<br />
Bereichen A(rchiv),<br />
B(ibliothek) oder M(useum)<br />
zugeordnet<br />
Objektart Hier werden die Objekte einer<br />
Objektart zugeordnet<br />
automatisch gewährleistet.<br />
Dieser Name muss bei Variante (3)<br />
eingetragen werden, damit die im<br />
weiteren zu erfassenden<br />
Objektgruppen (Tabelle 4) und die<br />
zu beschreibenden einzelnen<br />
Objekte (vgl.Tabelle 6-8) beim<br />
Datenimport der richtigen Sammlung<br />
zugeordnet werden können. In<br />
Variante (1) und (2) wird dies durch<br />
das Programm automatisch<br />
gewährleistet.<br />
Es werden die Buchstaben A, B<br />
oder M vergeben, je nachdem, um<br />
welche Klasse von Kulturgut es sich<br />
handelt.<br />
Die Bezeichnungen für die Objektarten<br />
müssen bei Variante (3)<br />
der Tabelle Objektart (vgl. Anlage IV<br />
g) entnommen werden. In Variante<br />
(1) und (2) wird eine Auswahlliste<br />
zur Verfügung gestellt<br />
50 Zeichen<br />
1 Zeichen<br />
65
Circa -1 (=Ja=wahr) – falls die<br />
genaue Anzahl der Objekte<br />
unklar ist; ansonsten 0<br />
(=nein=falsch)<br />
Anzahl (vermutliche oder genaue)<br />
Anzahl der Objekte<br />
Zeitraum Entstehungszeitraum der<br />
Objekte<br />
Anlage IV d<br />
Tabelle 4 - Objektgruppen<br />
0 oder –1 1 Zeichen<br />
Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24<br />
für den 24. Juni 1889 oder<br />
1777/1821 für die Laufzeit von 1777<br />
bis 1821 etc.)<br />
Bezeichnung Genauere Bezeichnung der<br />
Objektgruppe<br />
Bestand Genauere Bezeichnung des Diese Angabe betrifft nur zu<br />
Bestandes, zu dem die erfassende Objektgruppen im<br />
Objektgruppe früher gehörte archivalischen Bereich.<br />
Bestandsnum Angabe der<br />
Diese Angabe betrifft nur zu<br />
mer<br />
Bestandsnummer, zu dem die erfassende Objektgruppen im<br />
Objektgruppe früher gehörte archivalischen Bereich.<br />
Beschreibung Beschreibung der<br />
Objektgruppe<br />
Bemerkung Information, die keinen<br />
anderen Feldern zugeordnet<br />
werden kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt ist<br />
Erfassungsda- Datum, an dem die Erfassung Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24<br />
tum<br />
durch die Einrichtung für für den 24. Juni 1889 oder<br />
LostArt.de erfolgte<br />
1777/1821 für die Laufzeit von 1777<br />
bis 1821 etc.)<br />
UrheberIn / Name des Autors (der Akademischer Grad. Nachname,<br />
AutorIn Autorin) bzw. Urhebers (der<br />
Urheberin), der (die) die<br />
Erfassung für LostArt.de<br />
vornahm<br />
Vorname<br />
Zahl<br />
50 Zeichen<br />
255 Zeichen<br />
255 Zeichen<br />
50 Zeichen<br />
unbegrenzt<br />
66
Feldname Inhaltliche Belegung des<br />
Feldes<br />
Nummer der<br />
Objektgruppe<br />
In Tabelle 4 vergebene<br />
Nummer der Objektgruppe<br />
Zugangsart Wie erfolgte der Zugang<br />
(Zuweisung, im Ergebnis einer<br />
Zugangszeitraum<br />
Auktion etc.)?<br />
In welchem Zeitraum (an<br />
welchem Tag) ging der<br />
Einrichtung die Objektgruppe<br />
zu?<br />
Zugangsort In welchem Ort wurde die<br />
Objektgruppe angekauft,<br />
Zugangsstaa<br />
t<br />
requiriert o. Ä..?<br />
In welchem Staat wurde die<br />
Objektgruppe angekauft,<br />
requiriert o. Ä..?<br />
Zugangsum- Wie, unter welchen Umständen<br />
stände erfolgte der Zugang?<br />
Bemerkung Information, die keinen anderen<br />
Feldern zugeordnet werden<br />
kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt ist<br />
Ausgleich Soweit bezüglich des<br />
Sammelobjektes mit der<br />
Opferseite ein Ausgleich<br />
erfolgte, Beschreibung der<br />
Umstände, des Zeitpunktes, der<br />
Personen /<br />
Institutionen<br />
Erfassungsdatum<br />
UrheberIn /<br />
AutorIn<br />
Form<br />
Mit wem erfolgte der<br />
Ausgleich?<br />
Datum, an dem die Erfassung<br />
durch die Einrichtung für<br />
LostArt.de erfolgte<br />
Name des Autors (der Autorin)<br />
bzw. Urhebers (der Urheberin),<br />
der (die) die Erfassung für<br />
LostArt.de vornahm<br />
Anlage IV e<br />
Tabelle 5 – Zugangsgeschichte<br />
Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldlänge<br />
Diese Nummer muss bei<br />
Variante (3) vergeben werden,<br />
damit die Zugangsgeschichten<br />
den richtigen Objektgruppen<br />
zugeordnet werden können (vgl.<br />
Tabelle 4). In Variante (1) und (2)<br />
wird dies durch die Programme<br />
automatisch gewährleistet.<br />
ISO-Norm für Datumsangaben<br />
Diese Bezeichnung ist in<br />
Variante (3) der Tabelle Staaten<br />
zu entnehmen (vgl. Anlage IV g)<br />
bzw. wird in Variante (1) und (2)<br />
als Auswahlliste zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Nachname, Vorname (mehrere<br />
Personen werden durch<br />
Semikolon voneinander getrennt)<br />
oder Adresse der Institution<br />
Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-<br />
24 für den 24. Juni 1889 oder<br />
1777/1821 für die Laufzeit von<br />
1777 bis 1821 etc.)<br />
Akademischer Grad. Nachname,<br />
Vorname<br />
67
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 – Einzelobjekte<br />
Einzelne Objekte sind in diesen Tabellen zu beschreiben und dabei den vorher<br />
erfassten Objektgruppen (Tabelle 4) zuzuordnen. Dabei gibt es für die Bereiche<br />
Archiv, Bibliothek, Museum jeweils etwas differierende Beschreibungskriterien.<br />
Tabelle 6: Bereich Archiv<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des<br />
Feldes<br />
Nummer Nummer des Einzelobjektes<br />
Objektgrup- In Tabelle 4 vergebene<br />
pennummer Nummer, zu dem das<br />
Einzelobjekt gehört<br />
Objektart Soll die der Objektgruppe in<br />
Tabelle 4 bereits zugeordnete<br />
Objektart für das Einzelobjekt<br />
spezifiziert werden, kann hier<br />
eine weitere Objektart<br />
(Unterbegriff) vergeben werden<br />
(vgl. Anlage 4)<br />
Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldlänge<br />
Diese Nummer muss bei Variante<br />
(3) vergeben werden, damit die<br />
Einzelobjekte den richtigen<br />
Objektgruppen zugeordnet werden<br />
können (vgl. Tabelle 4). In Variante<br />
(1) und (2) wird dies durch das<br />
Programm automatisch<br />
gewährleistet.<br />
Die Bezeichnungen für die Objektarten<br />
müssen der Tabelle Objektart<br />
entnommen werden (vgl. Anlage IV<br />
g). In Variante (1) und (2) wird eine<br />
Auswahlliste zur Verfügung gestellt.<br />
Titel Titel der Handschrift, Akte etc. 255 Zeichen<br />
Bestand Benennung des ursprünglichen betrifft nur den archivalischen 50 Zeichen<br />
Bestandes, soweit dies für NSverfolgungsbedingt<br />
entzogene<br />
Objekte relevant sein sollte<br />
(setzt wohl eine entsprechende<br />
Notiz auf dem Objekt oder eine<br />
diesbezügliche Überlieferung<br />
voraus)<br />
Bereich<br />
Ausferti- Ort der Ausfertigung des<br />
100 Zeichen<br />
gungsort Objektes<br />
Ausferti- Dokumentdatum oder Laufzeit Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24 100 Zeichen<br />
gungsdatum<br />
für den 24. Juni 1889 oder<br />
1777/1821 für die Laufzeit von 1777<br />
bis 1821 etc.)<br />
Signatur Aktuelle Signatur des<br />
Dokumentes, soweit durch die<br />
Institution eine vergeben wurde<br />
50 Zeichen<br />
Beschrei- Beschreibender Text,<br />
unbegrenzt<br />
bung beispielsweise zum Absender,<br />
Empfänger, Unterzeichner<br />
eines Dokumentes, zu dem<br />
verwendeten Material, der<br />
Sprache, Schrift, dem Zustand<br />
des Dokumentes, alten<br />
Signaturen, Beschriftungen etc.<br />
68
Provenienz Historische Herkunft des<br />
Objektes, soweit diese<br />
überliefert ist<br />
Literatur Literaturangaben, soweit sie<br />
das Objekt betreffen<br />
Bemerkung Information, die keinen anderen<br />
Feldern zugeordnet werden<br />
kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt ist<br />
Ausgleich Sollte bezüglich des konkreten<br />
Objektes ein Ausgleich<br />
vorgenommen worden sein, der<br />
von dem Ausgleich, bezogen<br />
auf die gesamte Objektgruppe<br />
differiert, so wären hier<br />
Ausgleichsform und -umstände,<br />
Personen /<br />
Institutionen<br />
Erfassungsdatum<br />
UrheberIn /<br />
AutorIn<br />
Zeitpunkt u.ä. zu vermerken<br />
Mit wem erfolgte der<br />
Ausgleich?<br />
Datum, an dem die Erfassung<br />
durch die Einrichtung für<br />
LostArt.de erfolgte<br />
Name des Autors (der Autorin)<br />
bzw. Urhebers (der Urheberin),<br />
der (die) die Erfassung für<br />
LostArt.de vornahm<br />
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 – Einzelobjekte<br />
Nachname, Vorname (mehrere<br />
Personen werden durch Semikolon<br />
voneinander getrennt) oder Adresse<br />
der Institution<br />
Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24<br />
für den 24. Juni 1889 oder<br />
1777/1821 für die Laufzeit von 1777<br />
bis 1821 etc.)<br />
Akademischer Grad. Nachname,<br />
Vorname<br />
unbegrenzt<br />
Unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
69
Tabelle 7: Bereich Bibliothek<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des<br />
Feldes<br />
Nummer Nummer des Einzelobjektes<br />
Objektgrup- In Tabelle 4 vergebene<br />
pennummer Nummer, zu dem das<br />
Einzelobjekt gehört<br />
Objektart Soll die der Objektgruppe in<br />
Tabelle 4 bereits<br />
zugeordnete Objektart für<br />
das Einzelobjekt spezifiziert<br />
werden, kann hier eine<br />
weitere Objektart<br />
(Unterbegriff) vergeben<br />
Autor /<br />
Herausgeber<br />
werden (vgl. Anlage 4)<br />
Autor(en) bzw. Herausgeber<br />
der Publikation (oder beide)<br />
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 – Einzelobjekte<br />
Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldlänge<br />
Diese Nummer muss bei Variante (3)<br />
vergeben werden, damit die<br />
Einzelobjekte den richtigen<br />
Objektgruppen zugeordnet werden<br />
können (vgl. Tabelle 4). In Variante<br />
(1) und (2) wird dies durch das<br />
Programm automatisch gewährleistet.<br />
Die Bezeichnungen für die<br />
Objektarten müssen der Tabelle<br />
Objektart entnommen werden (vgl.<br />
Anlage IV g). In Variante (1) und (2)<br />
wird eine Auswahlliste zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Einträge an erster Stelle betreffen<br />
Autoren; Einträge hinter Schrägstrich<br />
und Leerzeichen betreffen<br />
Herausgeber; mehrere Autoren oder<br />
Herausgeber werden durch<br />
Semikolon getrennt; Herausgeber<br />
sind immer durch (Hg.) zu<br />
kennzeichnen; Ansetzung und<br />
Schreibweise sollten nach RAK<br />
(Regeln für die alphabetische<br />
Katalogisierung) erfolgen<br />
255 Zeichen<br />
Titel Titel der Publikation Ansetzung und Schreibweise sollten<br />
nach RAK erfolgen<br />
255 Zeichen<br />
Erscheinungs- Erscheinungsort der<br />
100 Zeichen<br />
ort<br />
Publikation<br />
Erscheinungs- Erscheinungsjahr (-datum) Nach ISO-Norm (siehe oben) 100 Zeichen<br />
datum der Publikation<br />
Signatur aktuelle Signatur der<br />
Publikation<br />
50 Zeichen<br />
Verlag Name des Verlages, in dem<br />
die Publikation erschienen<br />
ist<br />
100 Zeichen<br />
Drucker Name des Druckers, soweit Schreibweise nach den Normen des 100 Zeichen<br />
dieser überliefert ist Allgemeinen Künstlerlexikons, soweit<br />
dieses den Drucker aufführt<br />
Beschreibung Beschreibender Text,<br />
beispielsweise zum<br />
verwendeten Material, der<br />
Sprache, Schrift, dem<br />
Zustand der Publikation, zu<br />
Illustrationen, besonderen<br />
Kennzeichen etc.<br />
unbegrenzt<br />
70
Provenienz Historische Herkunft der<br />
Publikation, soweit diese<br />
überliefert ist<br />
Literatur Literaturangaben, soweit sie<br />
die Publikation betreffen<br />
Bemerkung Information, die keinen<br />
anderen Feldern zugeordnet<br />
werden kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt<br />
ist<br />
Ausgleich Sollte bezüglich des<br />
konkreten Objektes ein<br />
Ausgleich vorgenommen<br />
worden sein, der von dem<br />
Ausgleich, bezogen auf die<br />
gesamte Objektgruppe<br />
differiert, so wären hier<br />
Ausgleichsform und -<br />
umstände, Zeitpunkt u. Ä. zu<br />
Personen /<br />
Institutionen<br />
Erfassungsdatum<br />
UrheberIn /<br />
AutorIn<br />
vermerken<br />
Mit wem erfolgte der<br />
Ausgleich?<br />
Datum, an dem die<br />
Erfassung durch die<br />
Einrichtung für LostArt.de<br />
erfolgte<br />
Name des Autors (der<br />
Autorin) bzw. Urhebers (der<br />
Urheberin), der (die) die<br />
Erfassung für LostArt.de<br />
vornahm<br />
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 – Einzelobjekte<br />
Nachname, Vorname (mehrere<br />
Personen werden durch Semikolon<br />
voneinander getrennt) oder Adresse<br />
der Institution<br />
Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24<br />
für den 24. Juni 1889 oder 1777/1821<br />
für die Laufzeit von 1777 bis 1821<br />
etc.)<br />
Akademischer Grad. Nachname,<br />
Vorname<br />
unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
71
Tabelle 8 : Bereich Museum<br />
Feldname Inhaltliche Belegung des<br />
Feldes<br />
Nummer Nummer des Einzelobjektes<br />
Objektgrup- In Tabelle 4 vergebene<br />
pennummer Nummer, zu dem das<br />
Einzelobjekt gehört<br />
Objektart Soll die der Objektgruppe in<br />
Tabelle 4 bereits zugeordnete<br />
Objektart für das Einzelobjekt<br />
spezifiziert werden, kann hier<br />
eine weitere Objektart<br />
(Unterbegriff) vergeben<br />
werden (vgl. Anlage 4)<br />
Künstler Name des Künstlers<br />
(beispielsweise auch – wenn<br />
dieser nicht konkret bekannt<br />
ist - „Schweiz“, Niederlande“,<br />
„Oberitalienisch“ o.ä.)<br />
Künstler_Det<br />
ail<br />
Detailangaben, z.B. Schule<br />
des, Nachfolger des, Umfeld<br />
des etc. bzw. Angaben zu<br />
Künstlern, die in der<br />
Auswahlliste noch nicht<br />
erfasst sind<br />
Titel Titel oder Bezeichnung des<br />
Kunstwerks (z.B. auch<br />
Material /<br />
Technik<br />
„Spiegeltisch“ etc.)<br />
Angaben zu den verwendeten<br />
Materialien oder Techniken<br />
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 – Einzelobjekte<br />
Zu beachtende Normen (maximale)<br />
Feldlänge<br />
Diese Nummer muss bei Variante (3)<br />
vergeben werden, damit die<br />
Einzelobjekte den richtigen<br />
Objektgruppen zugeordnet werden<br />
können (vgl. Tabelle 4). In Variante (1)<br />
und (2) wird dies durch das Programm<br />
automatisch gewährleistet.<br />
Die Bezeichnungen für die Objektarten<br />
müssen der Tabelle Objektart<br />
entnommen werden (vgl. Anlage IV g).<br />
In Variante (1) und (2) wird eine<br />
Auswahlliste zur Verfügung gestellt<br />
Entsprechend den Normen des AKL;<br />
gibt es mehrere Künstler, ist dieses<br />
Feld zu duplizieren; in Variante (1) und<br />
(2) wird eine Auswahlliste der in der<br />
Grundlagendatenbank bereits erfassten<br />
Künstler zur Verfügung gestellt<br />
Verwendung von Substantiven bzw.<br />
Substantivierungen, z.B. Vergoldung,<br />
Teilvergoldung, Blattstickerei; Trennung<br />
der einzelnen Material- bzw.<br />
Technikangaben durch Leerzeichen,<br />
Bindestrich, Leerzeichen (z.B. Blei –<br />
Aquarell – Papier)<br />
Datierung Entstehungsjahr (-zeitraum) Nach ISO-Norm (siehe oben); ggf.<br />
beispielsweise auch Ende des 17.<br />
Jahrhunderts, Mitte des 18.<br />
Circa Sind die nachstehenden<br />
Maße im Rahmen der<br />
Messgenauigkeit exakt?<br />
Höhe Höhe des kleinsten<br />
umschreibenden Rechtecks<br />
bzw. Quaders in cm<br />
Jahrhunderts o.ä.<br />
Sollte es neben dem eigentlichen Maß<br />
des Kulturgutes Rahmenmaße,<br />
Blattmaße o.ä. geben, sind diese<br />
Angaben in der Beschreibung zu<br />
vermerken; ansonsten -1 = ja = wahr / 0<br />
= nein = falsch<br />
255 Zeichen<br />
255 Zeichen<br />
255 Zeichen<br />
100 Zeichen<br />
1 Zeichen<br />
Zahl<br />
72
Breite Breite des kleinsten<br />
umschreibenden Rechtecks<br />
bzw. Quaders in cm<br />
Tiefe Optional: Tiefe des kleinsten<br />
umschreibenden Rechtecks<br />
bzw. Quaders in cm<br />
Anlage IV f<br />
Tabelle 6/7/8 - Einzelobjekte<br />
Durchmesser Falls es sich um einen runden<br />
Gegenstand handelt (eine<br />
Schale o.ä.) Angabe in cm<br />
Zahl<br />
Inventarnum aktuelle Inventarnummer 50 Zeichen<br />
mer<br />
Beschreibung<br />
Beschreibender Text,<br />
beispielsweise zu<br />
Beschriftungen, Signaturen,<br />
besonderen Kennzeichen,<br />
dem dargestellten Motiv, dem<br />
Zustand, dem Rahmen und<br />
den Rahmenmaßen etc.<br />
Provenienz Historische Herkunft des<br />
Kunstwerks, soweit diese<br />
überliefert ist<br />
Literatur Literaturangaben, soweit sie<br />
das Kunstwerk betreffen<br />
Bemerkung Information, die keinen<br />
anderen Feldern zugeordnet<br />
werden kann oder nicht zur<br />
Veröffentlichung bestimmt ist<br />
Ausgleich Sollte bezüglich des<br />
konkreten Objektes ein<br />
Ausgleich vorgenommen<br />
worden sein, der von dem<br />
Ausgleich, bezogen auf die<br />
gesamte Objektgruppe<br />
differiert, so wären hier<br />
Ausgleichsform und -<br />
umstände, Zeitpunkt u. Ä. zu<br />
vermerken<br />
Personen Mit wem erfolgte der<br />
Ausgleich?<br />
Erfassungsd<br />
atum<br />
UrheberIn /<br />
AutorIn<br />
Datum, an dem die Erfassung<br />
durch die Einrichtung für<br />
LostArt.de erfolgte<br />
Name des Autors (der<br />
Autorin) bzw. Urhebers (der<br />
Urheberin), der (die) die<br />
Erfassung für LostArt.de<br />
vornahm<br />
Nachname, Vorname (mehrere<br />
Personen werden durch Semikolon<br />
voneinander getrennt) oder Adresse<br />
der Institution<br />
Gemäß ISO-Norm (z.B. 1889-06-24 für<br />
den 24. Juni 1889 oder 1777/1821 für<br />
die Laufzeit von 1777 bis 1821 etc.)<br />
Akademischer Grad. Nachname,<br />
Vorname<br />
Zahl<br />
Zahl<br />
unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
unbegrenzt<br />
73
I. ARCHIVE<br />
1. Firmenarchiv<br />
2. Kirchenarchiv<br />
3. Kommunalarchiv<br />
4. Organisationsarchiv<br />
5. Privatarchiv<br />
6. Sonstige Archivaliensammlung<br />
7. Spezialarchiv<br />
8. Staatliches Archiv<br />
II. BIBLIOTHEKEN<br />
9. Hoch- oder Fachhochschulbibliothek<br />
10. Institutsbibliothek<br />
11. Kirchliche Bibliothek<br />
12. Kommunale Bibliothek<br />
13. Privatbibliothek<br />
14. Sonstige Bibliothek<br />
15. Spezialbibliothek<br />
16. Staatsbibliothek / Landesbibliothek<br />
III. MUSEEN<br />
17. Geschichtliches Museum<br />
18. Institutionelles Museum<br />
19. Kirchliche Museale Sammlung<br />
20. Kunstmuseum<br />
21. Museum der Technikgeschichte<br />
22. Naturkundliches Museum<br />
23. Personenbezogenes Museum<br />
24. Schlossmuseum<br />
25. Sonstiges Museum<br />
26. Staatliches Museum<br />
27. Ur- und frühgeschichtliches Museum<br />
28. Völkerkundliches Museum<br />
29. Volkskundliches Museum<br />
IV. NICHTMUSEALE SAMMLUNGEN<br />
30. Privatsammlung<br />
31. Sammlung von Vereinigungen<br />
32. Sammlung von Verwaltungen<br />
33. Sammlung von Wirtschaftsunternehmen<br />
34. Sonstige nichtmuseale Sammlung<br />
V. SONSTIGE<br />
35. Kirche<br />
Anlage IV g<br />
Erfassungskriterien<br />
Liste – Institutionstypen<br />
74
Anlage IV g<br />
Erfassungskriterien<br />
Liste – Staaten<br />
Diese Tabelle ist eine offene. Sie ist erweiterbar je nach Notwendigkeit. Sie verwendet<br />
als Staatenkürzel die Liste der ehemaligen internationalen Kraftfahrzeugkennzeichen.<br />
Staat Staatenkürzel<br />
Albanien AL<br />
Armenien AR<br />
Aserbaidschan AZ<br />
Australien AUS<br />
Belgien B<br />
Bosnien-Herzegowina BIH<br />
Bulgarien BG<br />
Dänemark DK<br />
Deutschland D<br />
Estland EST<br />
Frankreich F<br />
Georgien GE<br />
Griechenland GR<br />
Großbritannien GB<br />
Italien I<br />
Jugoslawien YU<br />
Kanada CDN<br />
Kasachstan KZ<br />
Kirgisistan KS<br />
Kroatien HR<br />
Lettland LV<br />
Litauen LT<br />
Luxemburg L<br />
Makedonien MK<br />
Moldau MD<br />
Niederlande NL<br />
Norwegen N<br />
Österreich A<br />
Polen PL<br />
Russland RUS<br />
Schweiz CH<br />
Slowakische Republik SK<br />
Slowenien SLO<br />
Tadschikistan TJ<br />
Tschechische Republik CZ<br />
Turkmenistan TM<br />
Ukraine UA<br />
Ungarn H<br />
Vereinigte Staaten von Amerika USA<br />
Weißrussland BY<br />
Sowjetunion UdSSR<br />
Volksrepublik Polen VRP<br />
Tschechoslowakische Sozialistische Republik CSSR<br />
75
Anlage IV g<br />
Erfassungskriterien<br />
Liste – Objektart<br />
Nr. Objektart Beschreibung<br />
1 Alltags- /<br />
Geräte, Instrumente, Apparate aus Haushalt, Wissenschaft,<br />
Gebrauchsgegenstand Technik, Produktivbereich, auch Werkzeuge und<br />
volkskundliche Gegenstände (keine Uhren)<br />
2 Architektur / Handwerk Nichtkünstlerische Teile von Gebäuden und Installationen,<br />
sofern keine eigenständigen Alltags- oder<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
3 Archivalie, allgemein Nicht- oder nur begrenzt spezifiziertes Aktenmaterial<br />
4 Archivalie,<br />
Autographen / Tagebücher / Manuskripte mit bekanntem<br />
personenbezogen Autor oder der Zuordbarkeit zu einer konkreten<br />
Persönlichkeit (keine Briefe, keine Nachlässe)<br />
5 Archivalie, sonstige Nicht personenbezogenes, aber in besonderer Weise<br />
spezifizierbares Archiv- und Dokumentationsgut, auch<br />
Ausschnittsammlungen u.a.<br />
6 Archivalienzubehör Siegel, Stempel, deren Abdrücke, Zubehör u.a.<br />
7 Bekleidung Auch Bekleidungsteile, Kostüme und Uniformen (keine<br />
liturgischen Gewänder)<br />
8 Bekleidungszubehör Eigenständige Zier- und Schmucktextilien, Posamenten,<br />
Fächer, Schirme, Stöcke, Handtaschen u.a.<br />
9 Beleuchtungskörper Lampen, Leuchter, Lüster u.a., sofern beispielsweise der<br />
Kunst- oder Gebrauchscharakter nicht die Zuordnung zu<br />
einer anderen Objektart sinnvoller erscheinen läßt<br />
10 Bibliotheksgut, sonstiges (Lose) Druckschriften, Flugblätter u.a.<br />
11 Bildmaterial Dokumentatorisches Bildmaterial, sofern nicht fotografisch<br />
(kein künstlerisches Bildmaterial)<br />
12 Botanika naturkundliche Präparate aus dem Pflanzenreich, auch<br />
florale Fossilien<br />
13 Brief<br />
14 Buch<br />
Auch Postkarten, Fernschreiben, Telegramme usw.<br />
15 Buchbestand, speziell<br />
16 Bucheinband<br />
17 Design-Produkt<br />
Bibliophile oder sammlungsgeschichtliche Sonderbestände,<br />
Rara, auch bibliographisch dokumentierte Einzelwerke,<br />
sofern keine Frühdrucke / Inkunabeln oder Erstdrucke /<br />
Erstausgaben<br />
76
18 Druckgrafik Auch Ex libris (keine Gebrauchsgrafik)<br />
19 Erstdruck / Erstausgabe Druckerzeugnisse, die im Unterschied zu späteren Auflagen<br />
oder Ausgaben gleichen Inhalts eine besondere Bedeutung<br />
erlangt haben<br />
20 Fotografisches Material Diapositive, Filme, Fotographien, Fotoplatten, Negative,<br />
Zeugnisse aller fotografischen Techniken<br />
21 Frühdruck / Inkunabel auch Blockbücher<br />
22 Fundmaterial,<br />
Ur- und früh- bzw. vorgeschichtliches Fundmaterial<br />
archäologisch<br />
23 Fundmaterial, geologisch Edelsteine, Gesteine, Mineralien (keine Fossilien)<br />
24 Gebrauchsgrafik Briefmarken, Plakate u.a.<br />
25 Gebrauchstextilie / Stoff (Historische) Stoffe, Stoffmuster, -proben u.ä.<br />
26 Glaskunst Gebrauchs- und Zierglas, auch mosaizierte Kirchenfenster<br />
(keine Glasmalerei)<br />
27 Globus Alle Arten von Erd- und Himmelsgloben<br />
28 Handschrift Inhaltlich und formal abgegrenzte handschriftliche<br />
Schriftzeugnisse in Buchform oder Teile davon (keine<br />
einzelnen Dokumente wie Briefe oder personenbezogene<br />
Archivalien)<br />
29 Kartenmaterial Geographische Plandarstellungen aller Art, auch Atlanten<br />
(keine Globen)<br />
30 Keramik z.B. Steingut, Fayencen, Majoliken<br />
31 Kirchenbuch Personenbezogene Registerakten kirchlicher bzw.<br />
religiöser Gemeinden wie Tauf-, Sterbe-,<br />
Konfirmationsregister, Kirchen- und Totenbücher usw.<br />
32 Kunsthandwerk / - z.B. Arbeiten aus Edelstein, Email, Schildpatt, sofern<br />
gewerbe, sonstiges nicht anders zuzuordnen; Sammelwerke mehrerer<br />
verschiedener Technologien und Materialien bzw.<br />
Objektarten<br />
33 Künstlerbuch<br />
34 Kunstmedaille / Plakette<br />
35 Liturgischer / kultischer Gegenstände, Geräte und Ausstattungen für Liturgie<br />
Gegenstand<br />
und Kultus (z.B. Meß- und sonstige liturgische<br />
Gewänder, Meßgeschirre, Reliquiare, Antependien,<br />
Weihwasser- und Weihrauchgefäße)<br />
36 Malerei Aquarelle, Gemälde, Gouachen, Miniaturen, Pastelle,<br />
Temperamalerei, auch Buchmalerei, Glas- und<br />
Hinterglasmalerei sowie eigenständige Porzellan- oder<br />
Emailmalereien<br />
77
37 Mappenwerk /<br />
Gruppen lose oder fest zusammengefügter<br />
Skizzenbuch<br />
Einzelwerke gleicher oder verschiedener Techniken<br />
insbesondere der Druckgrafik und der Zeichnung<br />
38 Metallkunst Glocke, Kunstguß, Schmiedekunst, sonstiges<br />
39 Militaria, sonstige Ausrüstungen und Zubehör, auch Rangattribute wie<br />
Inventions-, Regiments-, Marschallstäbe (keine<br />
Waffen, Bekleidungen oder Teile davon)<br />
40 Möbel Auch Möbelteile oder verselbständigte Details wie<br />
Intarsien oder Mosaiken, Paravents, Spiegel u.ä.<br />
(keine Beleuchtungskörper)<br />
41 Modell Für oder von Kunstwerken, Gebäuden, Gegenständen,<br />
Städten, Verkehrsmitteln<br />
42 Münze Zahlungsmittel, einschließlich geldadäquater<br />
Sonderprägungen<br />
43 Museumsgut, sonstiges Einzel- und Sammelobjekte, die anderen Kategorien<br />
nicht zugeordnet werden können; Sammelobjekte<br />
mehrerer unterschiedlicher Kategorien<br />
44 Musikalia, Instrument alle Arten von Blas-, Saiten-, Schlag-, Tasten- und<br />
sonstigen Musikinstrumenten<br />
45 Musikalia, Schriftgut Libretti, Notendrucke, Notenhandschriften, Partituren<br />
46 Nachlaß Geschlossene Hinterlassenschaft einer Person oder<br />
Familie mit Einzelobjekten verschiedener Kategorien<br />
oder Verfasser<br />
47 Numismatika, allgemein Sammelobjekte mehrerer verschiedener oder dem<br />
Inhalt nach unbekannter Objektarten der Numismatik<br />
48 Orden / Ehrenzeichen<br />
49 Papierkunst z.B. Scherenschnitte, Faltarbeiten<br />
50 Periodika Zeitungen und Zeitschriften, unabhängig von äußerer<br />
Form, Erscheinungsweise und Bibliotheksaufstellung<br />
51 Plastik Alle Arten dreidimensional modellierter Kunstwerke<br />
unabhängig von Material und Technik<br />
52 Porzellan Figuren, Gefäße (keine Plaketten)<br />
53 Raumausstattung, Intarsien, bestimmte Mosaiken, Öfen/Kamine,<br />
installiert<br />
Vertäfelungen, nichttextile Wandbespannungen, z.B. Leder<br />
(keine Tapisserien)<br />
54 Raumtextilie Tapisserien, Vorhänge, Gardinen u.a.<br />
55 Schmuck<br />
56 Schnitzkunst Objekte aus Bein, Elfenbein, Horn, Holz u.a. mit<br />
kunsthandwerklichem Charakter (keine Plastik)<br />
78
57 Schriftgut,<br />
systematisierend<br />
Findbücher, Inventare, Karteien, Kataloge u.a.<br />
58 Schriftverkehr, institutionell Behördliche Akten, Firmen-, Vereins- und<br />
Institutionsarchive, auch Akten kirchlicher bzw. religiöser<br />
Einrichtungen (keine Kirchenbücher und entsprechendes<br />
Schriftgut)<br />
59 Spielzeug / Spiel / Automat Auch Spieldosen<br />
60 Steinschneidekunst z.B. Gemmen, Kameen<br />
61 Teppich Boden- und Wandteppiche aller Art, unabhängig vom<br />
Herstellungsverfahren (auch Gobelins)<br />
62 Textilie, sonstige Fahnen u.a.<br />
63 Tondokument Schallplatten u.a.<br />
64 Uhr<br />
65 Urkunde / Faksimile<br />
66 Verkehrsmittel Land-, Luft-, Wasserfahrzeuge, auch Fahrzeugteile und<br />
Zubehör (auch Geschirre, Zaumzeug, Pferdedecken, sofern<br />
keine Alltagsgegenstände oder Gebrauchstextilien)<br />
67 Waffe Fern-, Feuer-, Hieb-, Stich- und Schutzwaffen, Zier-,<br />
Zeremonial- und Prunkwaffen einschließlich Zubehör,<br />
Waffenteilen und Munition, auch Munitionsbehältnisse (z.B.<br />
Köcher, Patronentaschen, Pulverhörner)<br />
68 Zeichnung auch Aquarelle und Pastelle möglich, sofern der<br />
zeichnerische Charakter gewahrt ist<br />
69 Zoologika Naturkundliche Präparate aus dem Tierreich, auch<br />
archäologisches Fundmaterial (z.B. Skelette,<br />
Knochenfunde, Fossilien aus dem Tierreich)<br />
79
Zu V b) aa<br />
Anlage V a<br />
Erläuterungen zum Prüfraster<br />
➝ Die Berechtigung / Rechtsnachfolge vom Geschädigten auf den Anspruchsteller<br />
ist durch die Vorlage von Erbscheinen und Vollmachtsurkunden lückenlos zu<br />
belegen.<br />
➝ Ist eine Erbengemeinschaft Rechtsnachfolger eines jüdischen Geschädigten<br />
und vertritt der Anspruchsteller diese nur teilweise, weil Mitglieder namentlich bzw.<br />
deren Aufenthalt unbekannt sind, sollte die Conference on Jewish Material Claims<br />
against Germany Inc. 1 beteiligt werden. War der NS-Verfolgte nichtjüdisch oder eine<br />
Gesamthandsgemeinschaft mit "arischen" Mitgliedern, ist die treuhänderische<br />
Wahrnehmung der Rechte anderweitig sicherzustellen 2 .<br />
➝ Stand der Kunstgegenstand zum Schädigungszeitpunkt im Eigentum eines<br />
Unternehmens, sollte eine Herausgabe nur an eine Gesamthandsgemeinschaft in<br />
Rechtsnachfolge der ehemaligen Anteilseigner (vgl. oben die Anmerkung zur<br />
Erbengemeinschaft) oder im Falle einer Nachtragsliquidation an das Unternehmen<br />
i.L. erfolgen.<br />
➝ Die individuelle NS-Verfolgung ist darzulegen; für jüdische Geschädigte<br />
spricht bereits seit dem 30.01.1933 die Vermutung der Kollektivverfolgung 3 .<br />
Zu V b) bb<br />
➝ Wesentlich für die Beweislastverteilung ist die Unterscheidung zwischen<br />
rechtsgeschäftlichen Vermögensverlusten und Verlusten aufgrund von<br />
Entziehungsmaßnahmen der Staatsgewalt. Bei Verlusten aufgrund eines<br />
Rechtsgeschäftes kann sich der Antragsteller auf die Vermutungsregelung berufen,<br />
dass Vermögensverluste von NS-Verfolgten im Verfolgungszeitraum<br />
ungerechtfertigte Entziehungen waren 4 . Die Beweislast der Verfolgungsbedingtheit<br />
von staatlichen Eingriffen zulasten des Antragstellers wird nur in wenigen<br />
Fallkonstellationen relevant; bei dem Verlust von Kunstwerken durch staatliche<br />
Eingriffe kann der kausale Zusammenhang mit einer NS-Verfolgung insbesondere<br />
bei Einziehungen sog. "entarteter Kunst" 5 Verfügungsbeschränkungen nach der VO<br />
über die Ausfuhr von Kunstwerken 6 oder ggf. auch bei Zwangsversteigerungen 7<br />
fehlen.<br />
1<br />
Adresse: Claims Conference Nachfolgeorganisation, Sophienstraße 26, 60487 Frankfurt/M.<br />
2<br />
Insbesondere durch den Nachweis einer amtlichen Pflegschaft gem. §§ 1911, 1913 BGB.<br />
3<br />
ORG (Oberstes Rückerstattungsgericht) Berlin in NJW/RzW (Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht)<br />
1956 S. 210.<br />
4<br />
vgl. Art. 3 REAO (Anordnung BK/O ���� ��� ��� ���������� ������������ ��������<br />
5<br />
Die Beschlagnahmeaktion "entartete Kunst" betraf grundsätzlich alle Reichsangehörigen und inländischen<br />
juristischen Personen; vgl. ORG Berlin in RzW 1967 S. 299 und S. 301, OLG München in<br />
RzW 1968 S. 58, KG in RzW 1965 S. 161, OLG Karlsruhe in RzW 1954 S. 225.<br />
6<br />
Genehmigungspflicht für die Ausfuhr von Kunstwerken, die im Verzeichnis der national wertvollen<br />
Kunstwerke enthalten waren; VO stammt aus dem Jahr 1919, also kein diskriminierendes NS-<br />
Gesetz.<br />
7<br />
Zu nicht verfolgungsbedingten Versteigerungen wegen Insolvenz vgl. BGH in RzW 1954 S. 34.<br />
80
Anlage V a<br />
Erläuterungen zum Prüfraster<br />
➝ Jede Partei kann die ihr obliegende Beweisführung mangels konkreter<br />
Unterlagen im Einzelfall auch durch den sog. Anscheinsbeweis erfüllen 8 . Der<br />
Anscheinsbeweis setzt voraus, dass ein unstreitiger/bewiesener Grundsachverhalt<br />
sowie historische Erkenntnisse vorliegen, wonach bei derartigen Fallkonstellationen<br />
typische Geschehensabläufe folgten. Die Gegenseite kann den Anscheinsbeweis<br />
erschüttern, wenn sie Anhaltspunkte belegt (nicht nur behauptet), welche ernsthaft<br />
die Möglichkeit eines atypischen Geschehensablaufes in Betracht kommen lassen.<br />
➝ Auch bei Schenkungen gilt die Vermutungsregelung, es sei denn, es<br />
handelte sich aufgrund der persönlichen Beziehungen der Beteiligten um eine<br />
"Anstandsschenkung" oder der Beschenkte kann die Vermutung durch den Nachweis<br />
einer "echten" Schenkung widerlegen 9 .<br />
Zu V b) cc<br />
➝ Die Zäsur für die Vermutungsregelung bei rechtsgeschäftlichen Verlusten<br />
hinsichtlich der Kausalität zwischen Verfolgung und Vermögensverlust ist der<br />
15.09.1935 (Inkrafttreten der "Nürnberger Gesetze"). Bei Vermögensverlusten bis<br />
zum 15.09.1935 reicht für die Widerlegung der Vermutungsregelung die Darlegung,<br />
dass der NS-Verfolgte einen angemessenen Kaufpreis erhalten hat und über diesen<br />
frei verfügen konnte. Auch bei einer Widerlegung der Vermutungsregelung bleibt es<br />
dem Anspruchsteller allerdings unbenommen, Beweise vorzulegen, aus denen sich<br />
dennoch eine ungerechtfertigte Entziehung ergibt.<br />
➝ Die Vermutung ungerechtfertigter Entziehung besteht zugunsten eines<br />
jüdischen Veräußerers auch dann, wenn der Erwerber gleichfalls ein Jude war 10 .<br />
➝ Für die Angemessenheit des Kaufpreises ist grundsätzlich der objektive<br />
Verkehrswert maßgeblich, den das Objekt im Zeitpunkt des Verkaufs unter<br />
Nichtverfolgten gehabt hätte. Bei direkten Verkäufen von Kunstwerken käme es<br />
darauf an, ob z. B. durch zeitnahe Versteigerungskataloge ein Marktpreis für<br />
ähnliche Werke des Künstlers ermittelbar ist. Für Kunstversteigerungen aufgrund<br />
privater Einlieferung muss es dem Ermessen der betroffenen Einrichtung überlassen<br />
bleiben, den erzielten Versteigerungserlös stets als angemessenen "Marktpreis"<br />
anzusehen oder zugunsten des Anspruchstellers ggf. im Einzelfall zu unterstellen,<br />
dass zum Zeitpunkt des Vermögensverlustes wegen der zunehmenden<br />
Verfolgungsmaßnahmen und der sich daran anschließenden Vielzahl der Verkäufe<br />
das Preisniveau generell "zu niedrig" war.<br />
8<br />
Ständige Rechtsprechung der Obersten Rückerstattungsgerichte, vgl. z. B. ORG Berlin in RzW<br />
1976 S. 3.<br />
9<br />
Art. 4 REAO; vgl. zur Auslegung Täpper in RzW 1953 S. 354.<br />
10<br />
ORG/Britische Zone in RzW 1955 S. 9, Court of Restitution Appeals in RzW 1952 S. 164.<br />
81
Anlage V a<br />
Erläuterungen zum Prüfraster<br />
➝ Der Versuch, die freie Verfügung durch Nachweise zu belegen, ist<br />
regelmäßig bei inländischen Verkäufen ab dem 14.05.1938 11 , jedenfalls aber<br />
ab dem 03.12.1938 12 aussichtslos. Für den Nachweis einer freien Verfügung<br />
bei inländischen Verkäufen vor dem 14.05.1938 kommt evtl. der<br />
Anscheinsbeweis (s. o.) in Betracht.<br />
Zu V b) dd<br />
➝ Es gilt das Prioritätsprinzip. Erfüllen Zwischenerwerbsvorgänge mehrerer<br />
NS-Verfolgter bezüglich desselben Kunstgegenstandes den Entziehungstatbestand,<br />
hat der Geschädigte Priorität, welcher als Erster betroffen war 13 . Die Vorgänger-<br />
Provenienz ist daher unbedingt bis zum 30.01.1933 rückzuverfolgen!<br />
➝ Hat der Anspruchsteller sich unlauterer Mittel bedient oder vorsätzlich oder<br />
grob fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben gemacht, veranlasst oder<br />
zugelassen (Missbrauch), kann die Herausgabe versagt werden 14 .<br />
11<br />
Verfügungsbeschränkungen aufgrund des "vertraulichen Erlasses Nr. 64" vom 14.05.1938.<br />
12<br />
§ 14 der VO über den Einsatz jüdischen Vermögens verbot den inländischen Juden, "Kunstgegenstände,<br />
soweit der Preis für den einzelnen Gegenstand 1000 Reichsmark übersteigt", zu verpfänden<br />
oder freihändig zu veräußern. Mit der 5. DVO vom 25.04.1941 entfiel auch die 1000 RM-<br />
Grenze.<br />
13<br />
vgl. § 3 Abs. 2 Vermögensgesetz.<br />
14<br />
Analogie zu § 6 a Bundesrückerstattungsgesetz.<br />
82
Anlage V b<br />
Erläuterungen zu Kunstwerken<br />
mit Bezug zum Beitrittsgebiet<br />
Soweit Ansprüche von jüdischen Berechtigten oder deren Rechtsnachfolgern nicht<br />
geltend gemacht werden, gelten in Ansehung der Ansprüche nach dem<br />
Vermögensgesetz die Nachfolgeorganisationen des Rückerstattungsrechts und,<br />
soweit diese keine Ansprüche anmelden, die Conference on Jewish Material Claims<br />
against Germany, Inc (JCC), als Rechtsnachfolger.<br />
Für die Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögensgesetz gilt die gesetzliche<br />
Ausschlussfrist des § 30a VermG, die für bewegliche Sachen am 30. Juni 1993<br />
endete. Bei dieser Frist handelt es sich um eine materielle Ausschlussfrist, d. h. die<br />
Anmeldung eines vermögensrechtlichen Anspruches kann nach Ablauf dieser Frist<br />
nicht mehr wirksam vorgenommen werden und der Berechtigte ist mit seinem<br />
vermögensrechtlichen Anspruch materiell-rechtlich ausgeschlossen (vgl.<br />
Bundesverwaltungsgericht vom 28. März 1996 – 7 C 28/95).<br />
Die JCC hat ihre vermögensrechtlichen Ansprüche als Rechtsnachfolger per<br />
Globalanmeldung wirksam mit Schreiben vom 28. Juni 1993 fristgerecht geltend<br />
gemacht. Da für einen vermögensrechtlichen Antrag keine besonderen<br />
Formerfordernisse gelten, ist die JCC, soweit die weiteren Voraussetzungen für eine<br />
Rückübertragung vorliegen, in allen Fällen, in denen natürliche jüdische Berechtigte<br />
oder deren Rechtsnachfolger ihre Ansprüche nicht fristgerecht gelten gemacht<br />
haben, aus eigenem Recht rückübertragungsberechtigt. Dies bedeutet: Auch wenn<br />
keine konkrete Anmeldung ersichtlich ist, kann die JCC noch ggf. Einzelansprüche<br />
nachmelden und einen Rechtsanspruch auf Herausgabe herbeiführen.<br />
Liegt für das betreffende Kunstwerk ein Restitutionsantrag nach dem<br />
Vermögensgesetz bei einem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen vor, ist der<br />
(derzeitige) Verfügungsberechtigte gem. § 3 Abs.3 VermG insbesondere verpflichtet,<br />
den Abschluss dinglicher Rechtsgeschäfte (vor allem die Herausgabe an<br />
"irgendwelche" Anspruchsteller) zu unterlassen. Wird die Verfügungssperre<br />
missachtet und später ein anderer Herausgabeberechtigter festgestellt, kommen ggf.<br />
Schadensersatzansprüche in Betracht.<br />
Der Verfügungsberechtigte hat sich vor einer Verfügung bei dem Amt zur Regelung<br />
offener Vermögensfragen, in dessen Bezirk der Vermögenswert belegen ist, zu<br />
vergewissern, dass keine Anmeldung vorhanden ist (§ 3 Abs.5 VermG); das<br />
zuständige Amt stellt auf Anfrage ggf. ein "Negativattest" aus. Bei einer beweglichen<br />
Sache wie einem Kunstwerk ist allerdings zu berücksichtigen, dass die örtliche<br />
Zuständigkeit oft durchaus zweifelhaft sein wird, weil verschiedene Ansatzpunkte den<br />
Bezug zum Beitrittsgebiet herstellen können (der letzte Wohnsitz des Geschädigten,<br />
der Entziehungsort, die Belegenheit im Zeitraum bis zum Inkrafttreten des<br />
83
Anlage V b<br />
Erläuterungen zu Kulturgütern<br />
mit Bezug zum Beitrittsgebiet<br />
Vermögensgesetzes, evtl. auch eine abweichende aktuelle Belegenheit). Die Anfrage<br />
sollte daher bei einem Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen 1 erfolgen.<br />
Empfehlenswert ist ferner, sich bei Kunstwerken mit festgestellter oder auch nur<br />
vermuteter jüdischer Provenienz und einem Bezug zum Beitrittsgebiet von<br />
vornherein mit der JCC 2 in Verbindung zu setzen. Erfahrungsgemäß meldet die JCC<br />
derartige Kunstwerke im Rahmen ihres Globalanspruches sogleich an, woraufhin das<br />
betreffende Amt ohnehin die Frage der Zuständigkeit, das Vorhandensein<br />
anderweitiger Anträge und letztlich die Berechtigung für den Restitutionsantrag<br />
klären muss.<br />
Die JCC hat zur Förderung eines gerechten Ausgleichs zwischen dem wegen der<br />
Fristversäumung von der Restitution Ausgeschlossenen einerseits und ihrer eigenen<br />
Berechtigung aufgrund der fristgerechten Anmeldung andererseits einen "Good-Will-<br />
Fonds" eingerichtet. An diesen können sich Antragsteller wenden, die die Antragsfrist<br />
versäumt haben. 3 Im Übrigen erlaubt das Vermögensgesetz auch eine Abtretung<br />
fristgerecht angemeldeter vermögensrechtlicher Ansprüche.<br />
1 Berlin: Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, Rungestr. 22- 24, 10179 Berlin,<br />
Brandenburg: Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen des Landes Brandenburg,<br />
Landesbehördenhaus, Magdeburger Str. 51, 14770 Brandenburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern: Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen des Landes<br />
Mecklenburg- Vorpommern, Markt 20/21, 17489 Greifswald,<br />
Sachsen: Sächsisches Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, Olbrichtplatz 1, 01099<br />
Dresden,<br />
Sachsen- Anhalt: Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen des Landes Sachsen-Anhalt, An<br />
der Fleiderkaserne 13, 06110 Halle/Saale<br />
Thüringen: Thüringer Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, Ernst-Toller-Str. 14, 07545<br />
Gera.<br />
2 Claims Conference Nachfolgeorganisation, Sophienstraße 26, 60487 Frankfurt/M.<br />
3<br />
Auszug aus einer Stellungnahme der Conference on Jewish Material Claims against Germany, Inc.,<br />
Office for Germany, Nachfolgeorganisation:<br />
"Das interne Goodwill-Verfahren der Claims Conference Nachfolgeorganisation ist für jene Erben<br />
geschaffen worden, die die gesetzliche Anmeldefrist des Vermögensgesetzes nicht eingehalten<br />
hatten.<br />
Die Regelungen des internen Goodwill-Fund hinsichtlich von Kunstwerken sehen vor, dass<br />
Kunstobjekte von der Claims Conference an die berechtigten Erben weitergegeben werden. Gebühren<br />
oder Kosten werden von der Claims Conference nicht geltend gemacht, d.h. die berechtigten Erben<br />
erhalten die Objekte kostenfrei seitens der Claims Conference."<br />
84
Anlage V c<br />
Erläuterungen zu<br />
Entschädigungszahlungen usw.<br />
1. Die Oberfinanzdirektion Berlin wird die erforderlichen Recherchen veranlassen<br />
und ggf. für den Bund Rückzahlungsansprüche erheben.<br />
Eine Rückgabevereinbarung mit den Restitutionsberechtigten sollte eine<br />
Erklärung über den Erhalt aller für den NS-verfolgungsbedingten Verlust des<br />
Kunstgegenstandes früher gewährten Leistungen und – im Falle einer<br />
Entschädigungsleistung des Bundes – eine Rückzahlungsverpflichtung Zug<br />
um Zug gegen die Rückübertragung enthalten. Die gewünschte<br />
Rückzahlungsklausel resultiert aus den bisherigen Erfahrungen mit derartigen<br />
Restitutionsvorgängen. Handelt es sich um einen Restitutionsvorgang, welcher in<br />
den Geltungsbereich des Vermögensgesetzes fällt (s.o. V a), setzt das<br />
zuständige Amt zur Regelung offener Vermögensfragen mit dem<br />
Restitutionsbescheid auch die Verpflichtung zur Rückzahlung der Entschädigung<br />
fest 2 . Eine diesbezügliche Anfrage bei der Oberfinanzdirektion Berlin erübrigt sich<br />
bei diesen Vorgängen, denn alle Landesämter zur Regelung offener<br />
Vermögensfragen haben zugesichert, die Oberfinanzdirektion Berlin von Amts<br />
wegen an den Verfahren zu beteiligen.<br />
2. Sonstige Kompensationen<br />
Als Restitutionsausschluss kommt ferner die gar nicht so seltene<br />
Fallkonstellation in Betracht, dass der damalige Besitzer mit dem<br />
Restitutionsberechtigten nach 1945 auf der Grundlage der alliierten<br />
Rückerstattungsgesetze einen Privatvergleich (Verbleiben des Kunstwerkes bei<br />
dem restitutionspflichtigen Besitzer gegen Zahlung einer Entschädigung)<br />
abgeschlossen hat.<br />
Derartige Vorgänge (in der Regel aus der Zeit vor Inkrafttreten des Bundesrückerstattungsgesetzes<br />
im Jahre 1957) sind nicht in den Rückerstattungsarchiven<br />
der Oberfinanzdirektionen, sondern allenfalls (bei einem vor der Wiedergutmachungskammer<br />
protokollierten Vergleich oder einer entsprechend begründeten<br />
Antragsrücknahme) in den Akten der Wiedergutmachungsämter zu finden.<br />
3. Gegenleistungen<br />
Wurde im Rahmen des verfolgungsbedingten Entzuges für den Kunstgegenstand<br />
ein Kaufpreis gezahlt, ergibt sich die Frage, wie diese Gegenleistung<br />
zurückzuzahlen ist.<br />
Bei Fällen im Geltungsbereich des Vermögensgesetzes setzt das zuständige Amt<br />
zur Regelung offener Vermögensfragen im Restitutionsbescheid die Rückzahlung<br />
der Gegenleistung fest, wenn diese dem Berechtigten aus Anlass des<br />
Vermögensverlustes tatsächlich zugeflossen ist; Geldbeträge in Reichsmark sind<br />
dabei im Verhältnis 20 zu 1 umzustellen 3 .<br />
2 Vgl. § 7a Abs. 2 Satz 1 und 3 VermG.<br />
3 Vgl. § 7 a Abs. 2 Satz 1 und 3 VermG.<br />
85
Anlage V c<br />
Erläuterungen zu<br />
Entschädigungszahlungen usw.<br />
Fallkonstellationen außerhalb des Vermögensgesetzes können mit Hilfe<br />
rückerstattungsrechtlicher Grundsätze gelöst werden. Voraussetzung ist auch<br />
hier, dass der Kaufpreis in die freie Verfügung des Geschädigten gelangt ist 4 ,<br />
Reichsmarkbeträge werden im Verhältnis 10 zu 1 zuzüglich einer pauschalen<br />
Verzinsung in Höhe von 25 % umgestellt 5 .<br />
4 Art. 37 der REAO, vgl. ferner die Ausführungen oben unter IV b, cc.<br />
5 § 15 Abs. 1 und 2 BRüG; zu dem abweichenden Umstellungsverhältnis im Rahmen des VermG ist<br />
anzumerken, dass es sich dort um eine Sondervorschrift handelt, welche von dem sonst der Wäh-<br />
rungsreform folgenden Umstellungsverhältnis 10 zu 1 abweicht.<br />
86
zwischen<br />
Anlage V d<br />
Beispiel einer Vereinbarung<br />
Vereinbarung zur Regelung von Rückgabeansprüchen<br />
der Erbengemeinschaft nach..............................<br />
bestehend aus:<br />
und<br />
.........................................<br />
.........................................<br />
Bezeichnung der Institution ..........<br />
vertreten durch ........<br />
Adresse ........<br />
Präambel<br />
In der ... Bezeichnung der Institution / Sammlung ....befinden sich folgende identifizierte<br />
Werke aus der ehemaligen Kunstsammlung von<br />
...................................., die den Eigentümern / Erben nach .....................................<br />
verfolgungsbedingt in der Zeit zwischen 1933 und 1945 entzogen worden sind.<br />
Es handelt sich um<br />
das Gemälde "................................." von ..............................<br />
und<br />
die Zeichnung "..............................." von ..............................<br />
Das Gemälde ........................................ war 19....(beispielsweise: auf einer Auktion)<br />
in .................................. erworben worden.<br />
Es galt bislang als Eigentum der Institution .......<br />
Auf der Rückseite des Blattes befindet sich der handschriftliche Eintrag .............. .<br />
Dieser ist identisch mit dem von dem Sammler .......................... handschriftlich geführten<br />
Verzeichnis seiner Erwerbungen.<br />
Zur Provenienz der Zeichnung ist bekannt, dass diese 19.............................................<br />
.......................................................................................................................................<br />
(An dieser Stelle sollten alle bekannten und nachgewiesenen Umstände über Vorerwerb des<br />
Werkes, verfolgungsbedingtem Verlust und Verbleib bis heute aufgeführt werden.)<br />
87
Anlage V d<br />
Beispiel einer Vereinbarung<br />
In Kenntnis dieser Umstände möchte die Institution...... unabhängig davon, ob und in welcher<br />
Weise sie im einzelnen rechtlich dazu verpflichtet ist, die Werke an die Erben des Herrn/der<br />
Frau ......................... zurückgeben.<br />
Die Parteien treffen nunmehr darüber folgende Vereinbarung:<br />
1. Die Institution ........verpflichtet sich,<br />
Vereinbarung<br />
das Gemälde ......................................<br />
und<br />
die Zeichnung .....................................<br />
an die Erbengemeinschaft nach ................................ zurückzuübereignen.<br />
2. Die Zeichnung ".............................. " von ..................... wird nach der Rückübereignung<br />
für den Betrag von DM ....................... (in Worten: ..................... Deutsche Mark) von der<br />
Erbengemeinschaft nach ........................... an die Institution ....... verkauft.<br />
3. Die Übereignung beider Werke und die Übergabe des Gemäldes ................... an die<br />
Erbengemeinschaft nach ............................... erfolgt an einem noch zu bestimmenden<br />
Termin an eine von der Erbengemeinschaft hierzu bevollmächtigte Person in den<br />
Räumen ............................... gegen Quittung und Vorlage einer von allen Miterben<br />
unterzeichneten Vollmacht.<br />
4. Die Institution ...... übernimmt für die Zeit ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung bis zur<br />
Übergabe an die Erbengemeinschaft gegenüber dieser die unbeschränkte Haftung für<br />
Verlust oder Beschädigung des Gemäldes<br />
"............................" von ...................... .<br />
Ansprüche, die der Institution....... im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung<br />
der Werke bis zum Zeitpunkt der Übergabe erwachsen, werden ggf. an die<br />
Erbengemeinschaft abgetreten.<br />
Gefahren, Nutzen und Lasten gehen mit dem Zeitpunkt der Übergabe auf die<br />
Erbengemeinschaft über.<br />
5. Mit der Übergabe des Gemäldes und der Zahlung des Kaufpreises für die Zeichnung sind<br />
alle wechselseitigen Ansprüche, die sich aus dem verfolgungsbedingten Verlust dieser<br />
Werke ergeben, erledigt.<br />
Für die Erbengemeinschaft Für die Institution .......:<br />
_____________________ __________________________________<br />
88