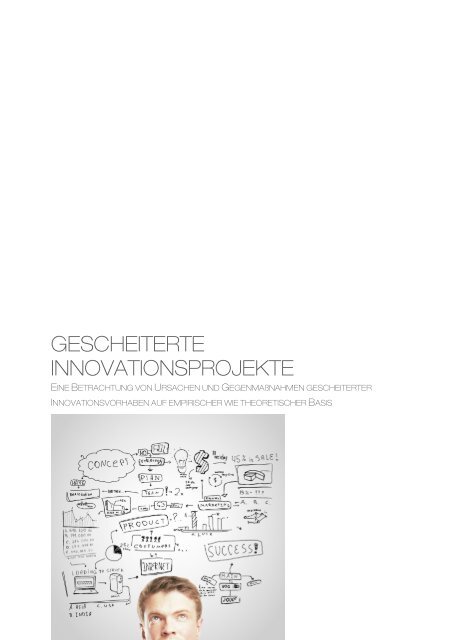GESCHEITERTE INNOVATIONSPROJEKTE
Eine Betrachtung von Ursachen und Gegenmaßnahmen gescheiterter Innovationsvorhaben auf empirischer wie theoretischer Basis
Eine Betrachtung von Ursachen und Gegenmaßnahmen gescheiterter Innovationsvorhaben auf empirischer wie theoretischer Basis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>GESCHEITERTE</strong><br />
<strong>INNOVATIONSPROJEKTE</strong><br />
EINE BETRACHTUNG VON URSACHEN UND GEGENMAßNAHMEN <strong>GESCHEITERTE</strong>R<br />
INNOVATIONSVORHABEN AUF EMPIRISCHER WIE THEORETISCHER BASIS
Seminararbeit<br />
Thema<br />
Gescheiterte Innovationsprojekte<br />
Eine Betrachtung von Ursachen und Gegenmaßnahmen gescheiterter<br />
Innovationsvorhaben auf empirischer wie theoretischer Basis<br />
(Innovationsflops)<br />
Fachbereich<br />
Ingenieurwissenschaften<br />
Studiengang<br />
Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Modul<br />
11 / Industrial Engineering I<br />
Lehrveranstaltung<br />
Forschungs- und Entwicklungsmanagement<br />
Dozent<br />
Dr. rer. pol. Christoph Brodhun<br />
Verfasser<br />
Jan Amelong<br />
iqw39087<br />
jan.amelong@stud.fh-nordhausen.de<br />
Benjamin Rasehorn<br />
iqw21367<br />
benjamin.rasehorn@stud.fh-nordhausen.de<br />
Abgabedatum 18.02.2015
I<br />
Inhalt<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
II<br />
1 Einleitung und thematische Motivation 1<br />
2 Quantitative Ausgangslage 1<br />
3 Begriffliche Abgrenzungen 2<br />
3 1 Die Innovation 2<br />
3 2 Der Innovationsflop 2<br />
4 Gründe und Gegenmaßnahmen für gescheiterte Innovationen 3<br />
4 1 Systematisches Vorgehen 3<br />
4 2 Managementtheoretische Dimensionen des Scheiterns 3<br />
4 3 Fallstudien 5<br />
4 4 Auswertung der Fallstudien 7<br />
5 Zusammenfassung und Theorie des Scheiterns 10<br />
6 Literaturverzeichnis 12<br />
7 Anhang 13
II<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Abbildung 1: Zweiteilung des Innovationsprozesses 13<br />
Abbildung 2: Top 20 R&D Spenders worldwide 13<br />
Abbildung 3 CL-Aktie im Vgl. zum MDax 15<br />
Grafik 1: Logo Cargolifter AG 14<br />
Grafik 2: CL-75 "AirCrane" vor Werfthalle 14<br />
Grafik 3: Lage der Cargolifter Werfthalle in Brand / Brandenburg 14<br />
Grafik 7: Skyship 600 "Charly" 14<br />
Grafik 5: Computergrafik des CL160 14<br />
Grafik 6: CargoLifter Werfthalle 14<br />
Grafik 4: Versuchsluftschiff "Joey" 14<br />
Grafik 8: Transrapid 15
1 Einleitung und thematische Motivation<br />
Gerade in Zeiten zunehmenden internationalen Wandels gewinnt der Innovationsdruck auf Unternehmen<br />
zunehmend an Bedeutung. Insoweit ist es nicht mehr ausreichend, bestehende Aktivitäten qualitativ und<br />
quantitativ bestmöglich durchzuführen, sondern es besteht der Bedarf innovativer Neuschöpfungen. 1 Dieser<br />
Bedarf ist insbesondere in solchen Volkswirtschaften ausgeprägt, welche sich durch hohe Löhne auszeichnen.<br />
2<br />
Die Rechtfertigung solcher Hochlohnvolkswirtschaften, zu denen zweifelsohne auch Deutschland zu zählen<br />
ist, ergibt sich demnach auch aus ihrer besonderen Innovationsstärke.<br />
Regelmäßig bieten Innovationsprojekte vielfältige unternehmerische Chancen, mit welchen jedoch auch<br />
immer Risiken verbunden sind. Das weitreichendste Risiko besteht indes darin, dass ein Innovationsprojekt<br />
scheitert.<br />
Insbesondere zeigt das Finanzvolumen, welches in Innovationsprojekte fließt, die finanziellen Risiken eines<br />
Scheiterns. Besonders deutlich wird diese Problematik etwa bei solchen Unternehmen, die eine geringe Diversifikation<br />
aufweisen, sich daher auf wenige Projekte verlassen und somit auf deren Erfolg besonders angewiesen<br />
sind. Gerade bei derartig aufgestellten Unternehmen kann das Scheitern eines Innovationsprojektes<br />
in eine existenzbedrohenden Situation münden.<br />
Im Lichte des vorangegangenen Problemaufrisses ist es der Anspruch der nachfolgenden Ausarbeitung,<br />
Gründe und Gegenmaßnahmen von gescheiterten Innovationen aufzuzeigen und zu beleuchten. Hierbei wird<br />
insbesondere angestrebt, über bisherige, in der Wissenschaft verfasste empirische Erkenntnisse hinaus, ein<br />
theoretisches Modell des Scheiterns zu konzipieren. Ferner sollen die gefundenen Erkenntnisse an zwei Praxisbeispielen<br />
illustriert werden.<br />
2 Quantitative Ausgangslage<br />
Das Investitionsvolumen in Innovationsvorhaben wird greifbar in aktuellen Zahlen von Strategy&, einer internationalen<br />
Strategieberatung und Teil des PricewaterhouseCoopers-Firmennetzwerkes. Weltweit wurden die<br />
1000 größten Unternehmen des Jahres 2014 erfasst. Die Top 20 mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben<br />
wiesen ein kumuliertes Investitionsvolumen von ca. 165 Milliarden US-Dollar auf, was einem<br />
durchschnittlichen Anteil von acht Prozent am Unternehmensumsatz ausmachte. 3 In der Summe aller untersuchten<br />
Unternehmen ergaben sich 647 Milliarden US-Dollar Investitionssumme im F&E-Sektor. 4<br />
Den genauen Prozentsatz der fehlgeschlagenen Innovationsprojekte zu ermitteln, ist nahezu unmöglich. Es ist<br />
lediglich die Tendenz zu erkennen, dass ein Großteil der Projekte fehlschlägt. So berichtet Bauer 5 2014 in<br />
einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung von 80 bis 90 Prozent Misserfolgen bei Innovationsversu-<br />
1 Wahren Heinz-Kurt, Erfolgsfaktor Innovationen, S. 1 ff.<br />
2 Wahren Heinz-Kurt, Erfolgsfaktor Innovationen, S. 2.<br />
3 siehe Anhang, S. 13, Abbildung 2.<br />
4 Jaruzelski Barry/ Staack Volker/ Goehle Brad, Global Innovation 1000: Proven Paths to Innovation Success, S. 5.<br />
5 Professor am Fachbereich Technik-Geschichte der Universität Stuttgart.<br />
1
chen. 6 Im Jahr 2010 schätzte er ferner in einem Artikel des Handelsblatts die Rate der gescheiterten Innovationen<br />
auf 85 Prozent. 7 Die Forbes Incorporated geht in einem Artikel desselben Jahres gar von einer Rate<br />
von 95 Prozent Flops aus, basierend auf Erhebungen des Marktforschungsinstitutes AcuPOLL. 8<br />
Zusammenfassend bleibt demnach festzuhalten, dass jährlich weltweit ein hoher dreistelliger Milliardenbetrag<br />
an Investitionssummen verloren geht, weil initiierte Innovationen fehlschlagen.<br />
3 Begriffliche Abgrenzungen<br />
3 1 Die Innovation<br />
Um den Begriff Innovationsflop eingrenzen zu können, ist eine genaue Bestimmung des weit gefassten<br />
Schlagwortes Innovation unabdingbar. Der allgemeine Ansatz von Hauschildt und Salomo, Innovationen als<br />
"[...] qualitativ neuartige Produkte oder Verfahren, die sich gegenüber einem Vergleichszustand 'merklich'<br />
[...] unterscheiden" 9 zu betrachten, reicht in diesem Fall nicht aus. In der Literatur existieren zur Konkretisierung<br />
des Begriffs verschiedene Denkansätze, welche ihre Definition aus der Art der jeweiligen Innovation<br />
beziehen. 10<br />
Grundlage dieser Arbeit soll nun Rickards Auslegung darstellen, der Innovationen als eine neuartige Kombination<br />
von Zweck und Mitteln herausstellt: "Innovation is a process ... is the process of matching problems<br />
(needs) [Nachfrage, B.R.] of systems with solutions [Technologie, B.R.] which are new and relevant to those<br />
needs ... ." 11 Gemäß diesem Ansatz entsteht eine Zweck-Mittel-Beziehung, wobei die (neuartigen) Zwecke<br />
durch die Nachfrage und die (neuartigen) Mittel durch die Technologie offeriert werden. 12<br />
3 2 Der Innovationsflop<br />
Ein Innovationsflop ist somit das Scheitern einer so definierten Innovation, einer "Niete". Dieser Flop kann<br />
verschiedene Ausprägungen annehmen und sich vom vollständigen Misserfolg, über den teilweisen bis zum<br />
vermeintlichen (eventuell bis heute falsch eingeschätzten) Misserfolg erstrecken und dabei in den verschiedenen<br />
Phasen der Innovation eintreten. 13<br />
Auch die Phasen der Innovation sind in der Literatur unterschiedlich definiert und herausgestellt. Grundlage<br />
dieser Ausarbeitung soll ein zweiteiliger Innovationsprozess nach Gassmann und Sutter sein. Dieser setzt sich<br />
zusammen aus der sogenannten Wolken- und der anschließenden Bausteinphase. 14<br />
6 Hauck Mirjam, Was Nutzer nicht mögen.<br />
7 Knauß Ferdinand, Wie Innovationen entstehen.<br />
8 Burkitt Laurie, Brand Flops: Ford, GE, Coca-Cola Know Hype Can Hurt New Products.<br />
9 Hauschildt Jürgen/ Salomo Sören, Innovationsmanagement, S. 4.<br />
10 Hauschildt Jürgen/ Salomo Sören, Innovationsmanagement, S. 6 f.<br />
11 Rickards Robert, 1985, S.10 f., S.28 f.; zitiert nach Hauschildt Jürgen/ Salomo Sören, Innovationsmanag., S. 6.<br />
12 Hauschildt Jürgen/ Salomo Sören, Innovationsmanagement, S. 4 f.<br />
13 Schlick Gerhard, Innovationen A-Z, S. 14.<br />
14 Gassmann Oliver/ Sutter Philipp, Praxiswissen Innovationsmanagement, S. 45.<br />
2
Die Wolkenphase (die Kreativphase des Prozesses) wird zu Beginn in die Elemente Suchfeldanalyse, Produktportfolio<br />
und Kernkompetenzen unterteilt, aus welchen die eigentliche Business Idee resultiert. Das Ergebnis<br />
der Wolkenphase stellt der Business Case dar, die finale Grundlage für den Investitionsentscheid.<br />
In der Bausteinphase (der Disziplinphase) steht das Prozessmanagement im Vordergrund und der Innovationsprozess<br />
wird stärker strukturiert. In dieser Phase wird vermehrt die Geschäftsführung eingebunden, sowie<br />
das Controlling. Es wird ein Systemdesign festgelegt, worauf die Realisierung und die Kompetenzentwicklung<br />
folgen. Auch Marketingmaßnahmen und der eigentliche Entwicklungsprozess müssen abgeschlossen sein,<br />
bevor die Serien- und Markteinführung starten kann. Am Ende der Bausteinphase steht die Produktpflege.<br />
Diese Strukturierung der einzelnen Prozesse der Bausteinphase soll die Innovationsrate erhöhen, nicht je-<br />
15 16<br />
doch den Innovationsprozess behindern oder bürokratisieren.<br />
4 Gründe und Gegenmaßnahmen für gescheiterte Innovationen<br />
4 1 Systematisches Vorgehen<br />
Kernstück dieser Bearbeitung ist die Beleuchtung der Gründe, die zu einem Scheitern des Innovationsprojektes<br />
führen können, sowie etwaige Gegenmaßnahmen. Problematisch ist jedoch, dass es sich weder bei Innovationen<br />
noch bei den Gründen für deren Scheitern um ein homogenes Feld handelt, welches eine einheitliche<br />
Bewertung zuließe. 17 Würde eine solche Bewertung unbeschadet dieser Erkenntnis erfolgen, so wäre<br />
dies lediglich auf hohem Abstraktionsgrad mit entsprechend geringem Erkenntniswert möglich. Aus diesem<br />
Grund widmet sich diese Bearbeitung insbesondere industrietechnologischer Leuchtturmprojekte, welche<br />
mit hohem finanziellen Entwicklungsaufwand einhergehen. Ausgenommen werden somit etwa Dienstleitungs-<br />
und Finanzinnovationen wie auch solche, die Alltagsgüter betreffen. Beispielhafte Projekte wären<br />
demgegenüber etwa der Transrapid, der Airbus 380 oder der Cargolifter.<br />
Des Weiteren sollen die Ursachen für das Scheitern anhand des F&E Managementprozesses herausgearbeitet<br />
werden. Mithin werden also verschiedene Risikofaktoren betrachtet, welche zu einem Scheitern der Innovation<br />
führen können. Darauf folgt wiederum eine induktive Betrachtung bisheriger Fehlschläge sowie deren<br />
Bewertung.<br />
4 2 Managementtheoretische Dimensionen des Scheiterns<br />
Jede Aktivität im Bereich von Forschung und Entwicklung birgt das Risiko des Scheiterns. Dabei lassen sich die<br />
verschiedenen Risiken in Einzelrisiken aufteilen, das Gesamtrisiko des Scheiterns einer Innovation ergibt sich<br />
wiederum aus der Kumulation der Einzelrisiken. Das Scheitern einer Innovation lässt sich also als konkrete<br />
Realisierung des bewusst eingegangenen Risikos auffassen.<br />
15 Gassmann Oliver/ Sutter Philipp, Praxiswissen Innovationsmanagement, S. 45 ff.<br />
16 Siehe Anhang, S. 13, Abbildung 1.<br />
17 Matzler Kurt, The Innovators Dilemma, S. 1 ff.<br />
3
Die insoweit relevanten Risiken lassen sich ferner in verschiedene Dimensionen aufteilen. Zunächst kann eine<br />
Aufteilung in interne und externe sowie innovationsspezifische Faktoren vorgenommen werden. 18<br />
Innovationsspezifische Faktoren sind zentral für eine erfolgreiche Markteinführung und Diffusion des Produktes.<br />
Eine zentrale Rolle nimmt in diesem Bereich die relative Vorteilhaftigkeit der Innovation ein. Verlangt<br />
wird somit, dass das neue Produkt gegenüber seinen Vorgängerprodukten wie auch Konkurrenzprodukten<br />
ein verbessertes Leistungsprofil aufweist. Die sich hieraus ergebenden komparativen Wettbewerbsvorteile<br />
stützen die Erfolgswahrscheinlichkeit des Produktes. Weiter ist zu verlangen, dass diese Wettbewerbsvorteile<br />
für den anvisierten Kunden sowohl objektiv nachvollziehbar, wie auch subjektiv beobachtbar sind. 19<br />
Ein weiterer interner Innovationsfaktor betrifft die Kompatibilität der Innovation. Unter einem kompatiblen<br />
Produkt wird ein solches verstanden, welches mit vorhandenen Verwendungsmöglichkeiten der Nutzer<br />
weitmöglichst übereinstimmt bzw. vereinbar ist. Nicht kompatible Produktinnovationen laufen hingegen<br />
Gefahr, wegen fehlender Anpassungsfähigkeit an bereits eingesetzte Systeme vom Markt abgelehnt zu werden.<br />
20<br />
Über die Kompatibilität hinaus vermag auch eine gesteigerte Komplexität den Innovationserfolg zu gefährden.<br />
Hohe Komplexität führt zu gesteigertem Aufwand für den Kunden und reduziert in der Folge dessen<br />
Produktnutzen.<br />
Ein letzter als zentral anzunehmender innovationsspezifischer Faktor besteht in dem Reifegrad der Innovation.<br />
21 Gemeint ist hiermit die Fehlerfreiheit eines neuen Produktes. Gerade bei innovativer Neuentwicklung<br />
besteht eine erhöhte Gefahr, dass der Nutzer mit "Kinderkrankheiten" des Produktes konfrontiert ist, welche<br />
erst im Laufe der Zeit und durch Rückmeldungen der Nutzer abgestellt werden können.<br />
Über die produktimmanenten Gefahren hinaus können auch unternehmensinterne Einflussgrößen bestehen,<br />
welche das Risiko des Scheiterns determinieren. Von zentraler Bedeutung ist hier zum einen die finanzielle<br />
Leistungsstärke des Innovators. So besteht gerade bei solchen Innovationen, die technisches Neuland beschreiten,<br />
das Risiko finanzieller Nachschüsse. Ein weiterer zentraler Faktor sind Kompetenzen und Ressourcen<br />
eines Unternehmens. Insbesondere technologische Kompetenzen müssen in ausreichender Form zur<br />
Verfügung stehen und ex ante zutreffend beurteilt werden. 22<br />
Im Rahmen der internen Einflussfaktoren wird teilweise auch die Unternehmensgröße als maßgeblich angesehen,<br />
23 wenngleich sollte jedoch nicht generell von einer positiven Korrelation zwischen Unternehmensgröße<br />
und Innovation ausgegangen werden. Zwar verfügen Großunternehmen regelmäßig über weitgehende<br />
Ressourcen, größere Marktmacht und vielfältige Erfahrungen im Umgang mit Innovationen, jedoch werden<br />
diese Vorteile schnell durch Kommunikations- , Koordinations- und Steuerungsprobleme konterkariert. 24<br />
18 Vahs Dietmar/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 376.<br />
19 Vahs Dietmar/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 377.<br />
20 Vahs Dieter/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 378 f.<br />
21 Vahs Dietmar/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 379.<br />
22 Hartschen Michael, Innovationsmanagement- Die 6 Phasen von der Idee zur Umsetzung, S. 134.<br />
23 Amstad/Arvanitis/Hollenstein, Innovationsm. - Gestaltung von Innovationsproz. im globalen Wettbewerb, S. 247.<br />
24 Vahs Dietmar/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 384.<br />
4
Anders als die internen Einflussgrößen stellen externe Einflussgrößen ein besonderes Problem bei Innovationsvorhaben<br />
dar. Grund hierfür ist, dass diese besonders schwer zu beurteilen und darüber hinaus einem<br />
steten Wandel unterlegen sind.<br />
Vielfach wird in der Größe des relevanten Marktes ein solcher externer Faktor gesehen. Eine in den sechziger<br />
Jahren erstellte OECD-Studie zur Untersuchung der überlegenen Innovationsstärke der USA gegenüber Europa,<br />
wies auf einen positiven Zusammenhang zwischen Innovationserfolg und Marktgröße hin. Insbesondere<br />
die Homogenität des amerikanischen Binnenmarktes schien insoweit von Vorteil zu sein. 25 Zu beachten ist<br />
jedoch, dass ein größerer Markt, vor allem die Marketingaktivitäten, vor umfangreiche Herausforderungen<br />
stellen kann.<br />
Neben der reinen Größe des relevanten Marktes ist auch dessen Dynamik von Bedeutung. Dynamische Märkte<br />
sind geprägt durch geringe Planungssicherheit, instabile Absatzlagen sowie unklare Produktperspektiven. 26<br />
Häufig finden sich gerade auf dynamischen Märkten jedoch auch besonders hohe Wachstumsraten. Um den<br />
Risiken dynamischer Märkte entgegen zu wirken gilt es zunächst, eine geeignete Auswahl des Zielmarktes zu<br />
treffen. Des Weiteren müssen bestehende Risiken im Sinne einer integrierten Planung minimiert werden.<br />
Auch etwaige Kooperationsmöglichkeiten stellen eine externe Einflussgröße auf den Unternehmenserfolg<br />
dar. Ein interner Mangel an Kompetenzen kann so durch das Hinzuziehen externer Partner überwunden werden.<br />
Überdies können Synergiepotentiale ausgeschöpft und Ressourcenknappheiten überwunden werden.<br />
Bestehen derartige Kooperationsmöglichkeiten nicht oder in unzureichender Form, so ist der Innovator auf<br />
die Tragfähigkeit des eigenen Kompetenzprofils angewiesen. In diesem Fall ist eine besonders genaue Prüfung<br />
des Selbigen verlangt.<br />
Über die vorstehenden Dimensionen des Scheiterns hinaus kommt auch dem Zeitpunkt des Scheiterns eine<br />
große Bedeutung zu. Je später das Scheitern des Projektes aufgedeckt wird, desto höher fallen die realisierten<br />
Verluste aus. Ferner ist zu erwarten, dass ein Scheitern zu einem späten Zeitpunkt von den Verantwortlichen<br />
ungern eingestanden wird, was den wichtigen Zeitpunkt des Projektstops weiter nach hinten verlagert.<br />
4 3 Fallstudien<br />
Zur weiteren Konkretisierung der Gründe für gescheitete Innovationen erscheint ein Blick in die Unternehmensrealität<br />
praktikabel. Insoweit sollen die Fallbeispiele der ehemaligen Cargolifter AG sowie des Transrapid<br />
zur Illustration dienen. Die im Folgenden angesprochenen Untersuchungspunkte korrespondieren dabei<br />
mit den Ergebnissen einer von Reinhold Bauer verfassten historischen Untersuchung.<br />
4 3 1 Cargolifter<br />
Die Geschichte um den steilen Aufstieg und noch steileren Fall der Cargolifter AG war ein Musterbeispiel für<br />
eine gescheiterte Innovation. Im Jahr 1996 gründete Carl Freiherr von Gablenz das Unternehmen mit dem<br />
Ziel Großluftschiffe zu konstruieren, zu bauen und zu vermarkten. Diese Luftschiffe sollten große und schwere<br />
Güter mit einer Masse von bis zu 160 Tonnen transportieren. Nachdem die Grundlagenplanung abge-<br />
25 Mohr Hans-Walter, Bestimmungsgründe für die Verbreitung neuer Technologien, S. 65.<br />
26 Vahs Dietmar/Burmester Ralph, Innovationsmanagement, S. 386.<br />
5
schlossen war, stand fest, dass der Cargolifter (CL)160 Ausmaße von 260 Metern Länge, 82 Metern Höhe und<br />
einen Durchmesser von 65 Metern besitzen sollte. 27<br />
Bürgschaften des Bundes und des Landes Brandenburg wurden gewährt und im Oktober 1999 hob das Experimental-Luftschiff<br />
"Joey" 28 zum ersten Mal ab. Im Mai 2000 erfolgte der Börsengang. Hierbei wurden insgesamt<br />
6,23 Millionen Aktien platziert und 270 Millionen Euro eingenommen. 29<br />
Doch bereits im Januar 2001 begann der steile Abstieg des Unternehmens. Der europäische Flugzeugkonzern<br />
Airbus kooperierte nicht, wie erwartet wurde, mit CL und somit verzögerte sich erstmals die Entwicklung des<br />
CL 160. Obwohl im Oktober 2001 der erste Transportballon CL 75 die Werfthalle in Brand verließ 30 , musste<br />
der Vorstandsvorsitzende Gablenz im Januar 2002 einräumen, dass der CL nur noch mit staatlicher Hilfe fertigzustellen<br />
sei, was den Aktienkurs auf unter 5 Euro fallen ließ.<br />
Im März 2002 wurde nach Unternehmensangaben ein erster Transport-Ballon verkauft, jedoch auch der<br />
Starttermin des CL 160 weiter auf Frühjahr 2005 verschoben. Der US-Konzern Boeing willigte im Mai 2002 in<br />
eine Kooperation ein, ohne jedoch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch der Bund und das Land<br />
Brandenburg versagten eine schnelle Finanzhilfe und sodass sich das Unternehmen gezwungen sah, nur noch<br />
Ballons zu produzieren. Die Summe dieser Negativereignisse ließ den Aktienkurs auf 1,22 Euro absacken.<br />
Am 28. Mai 2002 erklärte sich die CL AG für zahlungsunfähig. Die Aktie wurde mit einem letzten Kurs von<br />
1,05 Euro vom Handel ausgesetzt. Wenige Tage später erklärte das Land Brandenburg, eventuell doch wieder<br />
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und auch der Insolvenzverwalter sah noch Chancen für das Unternehmen.<br />
Durch eine Insolvenz der wichtigsten Tochter der CL AG, der Cargolifter Development GmbH, sollte eine<br />
Insolvenz der gesamten (Unternehmens-) Gruppe verhindert werden. Doch am 7. Juni meldete die CL AG<br />
endgültig Insolvenz an. 31<br />
4 3 2 Transrapid<br />
Ein weiteres Beispiel für eine wohl gescheiterte Innovation stellt das Vorhaben des Transrapid 32 dar. Hierbei<br />
handelt es sich um eine Hochgeschwindigkeitsmagnetschwebebahn, welche zur Personenbeförderung gedacht<br />
war. Im Wesentlichen erfolgte die Entwicklung durch ein Konsortium, bestehend aus der Siemens AG<br />
und ThyssenKrupp. Die Finanzierung des Projektes erfolgte vorrangig durch die öffentliche Hand.<br />
Schon im Jahre 1979 wurde ein erster funktionsfähiger Prototyp des Transrapid vorgestellt. Im Jahre 1990<br />
wurde die Anwendungsreife anerkannt. Dabei konnte die Bahn aus bis zu zehn Sektionen bestehen und 1172<br />
Passagiere befördern.<br />
27 Siehe Anhang, S. 14, Grafik 5.<br />
28 Siehe Anhang, S. 14, Grafik 4.<br />
29 Siehe Anhang, S. 15, Abbildung 3.<br />
30 Siehe Anhang, S. 14, Grafik 2.<br />
31 manager magazin Verlagsgesellschaft mbH, Die Chronik eines Absturzes.<br />
32 Siehe Anhang, S.15, Grafik 8.<br />
6
Die wesentlichen Vorteile des neuartigen Transportmittels wurden von dem Hersteller darin gesehen, dass<br />
dieses sehr hohe Geschwindigkeiten (500 km/h) bei geringem Energieverbrauch (70 % eines ICE 3) erreichen<br />
konnte. Des Weiteren wurde eine geräusch- und verschleißarme Fortbewegung ermöglicht.<br />
Nach Feststellung der Einsatzreife des Transrapids wurden sowohl in Deutschland als auch international zahlreiche<br />
Projektstudien erstellt, von denen lediglich eine Versuchsstrecke im Emsland sowie ein Flughafenzubringer<br />
in Shanghai realisiert wurden. Alle deutschen Projekte, insbesondere der Flughafenzubringer München,<br />
wurden mittlerweile aufgegeben. 33<br />
4 4 Auswertung der Fallstudien<br />
Im Folgenden wird bestrebt, die managementtheoretischen Ausführungen sowie die empirischen Befunde<br />
der Fallstudien auf gemeinsame Gründe des Scheiterns herunter zu brechen. Die Ausführungen beanspruchen<br />
insoweit eine gewisse Allgemeingültigkeit bezogen auf die untersuchten Wirtschaftsbereiche.<br />
4 4 1 Konkurrenzsituation<br />
Auf Ebene der unternehmensexternen Risikofaktoren kommt der bestehenden Konkurrenzsituation eine<br />
eminente Bedeutung zu. Sobald alternative Techniken zu einer quantitativ oder qualitativ überlegenen Problemlösung<br />
in der Lage sind, besteht die Gefahr der Substitution der Innovation. 34 Dies lässt sich sowohl deduktiv<br />
als auch induktiv anhand der gewählten Praxisbeispiele zeigen.<br />
Auch wenn sich das Angebot der Cargolifter AG als gewissermaßen einzigartig darstellt, so zeigt sich auch hier<br />
eine Substitutionsmöglichkeit in Gestalt einer imperfekten Substitution. Es besteht etwa die Möglichkeit,<br />
Schwerlasten durch temporär angelegte Straßen auch in entlegene Gebiete zu befördern.<br />
Noch dramatischer stellt sich die Konkurrenzsituation im Rahmen des Transrapidprojektes dar, welche unmittelbar<br />
durch die bestehende Bahn und Luftverkehrsinfrastruktur hervorgerufen wurde. Beide Substitutionsprodukte<br />
waren zum Entwicklungszeitpunkt des Transrapid voll entwickelt und am Markt etabliert. Des Weiteren<br />
handelt es sich sowohl bei dem Bahn- als auch Luftverkehr um nahezu vollständige Substitutionsalternativen,<br />
da annähernde Gleichwertigkeit in den Bereichen Geschwindigkeit, Komfort sowie Preis bestand.<br />
Um diesem Problemfeld entgegen zu wirken, scheint in der Praxis eine adäquate Konkurrenzanalyse zwingend,<br />
wobei auch zukünftige Entwicklungen zu antizipieren sind. Hierzu bietet die allgemeine Managementlehre<br />
zahlreiche systematische Instrumentarien.<br />
4 4 2 Technische Probleme<br />
Gerade bei den zuvor diskutierten Innovationsprojekten, daher solchen die technisches Neuland beschreiten,<br />
kann die technische Machbarkeit ein zentrales Hindernis darstellen. Unter technischer Machbarkeit wird<br />
insoweit nicht nur die generelle Durchführbarkeit, sondern eine solche zu adäquaten Kosten, verstanden.<br />
Hierbei ist eine eigene technische Kompetenz nicht zwingend vorausgesetzt, wenn stattdessen die Möglichkeit<br />
besteht, diese von externer Quelle hinzuzukaufen.<br />
33 Backovic Lazar, Deutschland im Magnetschwebewahn.<br />
34 Bauer Reinhold, Gescheiterte Innovationen, S. 289 f.<br />
7
Mit technischen Problemen hatte auch die junge Cargolifter AG zu kämpfen. So begannen die technischen<br />
Probleme im Falle Cargolifter schon beim Aufbau der notwendigen Werksinfrastruktur, konkret bei der Errichtung<br />
der riesigen Fertigungshalle, welche Ausmaße von 300 Metern Länge, 210 Metern Breite und 107<br />
Metern Höhe hatte. Neben diesen sekundären technischen Herausforderungen stellte jedoch auch das eigentliche<br />
Produkt des Schwerlastluftschiffes die Entwicklungsingenieure der Cargolifter AG vor vielfältige<br />
Herausforderungen, welche zum Teil bis heute nicht belastbar gelöst werden konnten. Zu nennen sind in<br />
diesem Zusammenhang etwa Probleme mit der Windanfälligkeit der riesigen, aber vergleichsweise leichten<br />
Konstruktionen. Gerade der vermeintliche Vorteil eines präzisen Absetzens der Fracht war hierdurch gefährdet.<br />
Um den vielfältigen technischen Problemen gerecht zu werden, setzte das junge Unternehmen jedoch nicht<br />
nur auf eigene Fähigkeiten, sondern auch auf Kooperationsprojekte wie beispielsweise mit Airbus, welche<br />
letztlich allerdings nicht zustande kamen.<br />
Ebenso mit technischen Problemen hatten auch die Entwickler der Magnetschwebebahn Transrapid zu kämpfen.<br />
Anders hingegen als Cargolifter waren hier von Beginn an vielfältige technologische Kompetenzen vertreten.<br />
So war auch die Siemens AG Mitglied des Entwicklungskonsortiums, welche über langjährige Erfahrungen<br />
auf dem Bereich des Eisenbahnbaus verfügt.<br />
Auch wenn tatsächlich eine Transrapidstrecke in Shanghai errichtet wurde, konnten vereinzelte technische<br />
Probleme dennoch nicht gelöst werden. Dies galt beispielsweise für eine zu harte Laufkultur des Transrapids,<br />
welcher von den Entwicklern gerade für ein ruhiges Fahrverhalten angepriesen wurde. 35 Wenngleich einzelne<br />
technische Probleme verblieben, so ist den Entwicklern des Transrapid jedoch zuzugestehen, dass sie ein<br />
letztlich funktionsfähiges Produkt hervorbrachten. Hierbei darf jedoch nicht vernachlässigt werden, dass in<br />
der Entwicklungsphase aufgetretene technische Probleme zu einem enormen Kostenanstieg führten, welcher<br />
in Form des angestiegenen Verkaufspreises auch die spätere Markterschließung beeinflusste.<br />
Ein generalisierender Lösungsansatz zur Verhinderung technischer Probleme bei Innovationsprojekten kann<br />
nicht angeboten werden. Grund hierfür ist, dass technische Probleme kein homogenes Feld darstellen, sich<br />
insoweit also auch eine homogene Lösung verbietet. Festzuhalten bleibt indes, dass jeder Innovator sein<br />
Kompetenzprofil im Vorfeld genau zu prüfen hat. 36 Werden hierbei Kompetenzlücken festgestellt, so scheinen<br />
auch frühzeitige, bindende Kooperationen ein gangbarer Lösungsansatz. Ferner ist eine umfassende<br />
Unternehmenskommunikation zwingend, um eine zutreffende Bewertung des Kompetenzprofils zu gewährleisten.<br />
4 4 3 Nutzerbedürfnisse<br />
Ein weiterer Grund für das Scheitern einer Innovation kann in dem Verkennen von Nutzerbedürfnissen gesehen<br />
werden. Hierbei ist der Begriff des Nutzers weit, daher über den des Endkonsumenten hinaus, auszule-<br />
35 Bernd Bartsch, Enttäuscht: Shanghai bereut die Transrapid-Bahn.<br />
36 Bauer Reinhold, Gescheiterte Innovationen, S. 290 f.<br />
8
gen. Letztlich kann sich ein Produkt nur dann am Markt durchsetzen, wenn es den Bedürfnissen des Zielkunden<br />
entspricht, diesem also einen relevanten Mehrwert verschafft. 37<br />
Im Falle der Cargolifter AG wurde erwartet, dass insbesondere im Bereich der Bau- und Rohstoffindustrie ein<br />
Nutzerbedürfnis bestand, Schwerlasten in entlegene und schwer zugängliche Regionen zu transportieren.<br />
Zweifelsohne schien dieses Bedürfnis nicht völlig fernliegend. Verzichtet wurde jedoch auf eine Präzisierung<br />
des Nutzerbegriffes. So war nicht angedacht, dass die Cargolifter AG die Luftschiffdienstleistungen selber<br />
anbietet, stattdessen sollte diese Aufgabe sollte vielmehr von Dritten übernommen werden. Solche Anbieter<br />
waren, auch aufgrund der umfangreichen Neuentwicklung, jedoch noch nicht existent. Auch etablierte Logistikunternehmen<br />
verfügten bereits über ausgereifte Transportkonzepte und scheuten die hohen Folgekosten<br />
des Cargolifterkonzeptes.<br />
Mit einem ähnlichen, die Nutzerbedürfnisse betreffenden Problem, sahen sich auch die Entwickler des Transrapid<br />
konfrontiert. Auch hier sollte die Magnetschwebebahn Dritten angeboten werden, die diese dann betreiben<br />
sollten. Bei eingehender Betrachtung kam hierbei insbesondere die Deutsche Bahn in Betracht, da<br />
sich das Eintreten neuer Marktakteure als unrealistisch herausstellte. Die Deutsche Bahn verfügte jedoch<br />
über einen ausgereiften Hochgeschwindigkeitszug sowie ein ausgebautes Streckennetz. Insoweit war das<br />
Bedürfnis für eine umfangreiche Neueinführung und somit der Parallelbetrieb zweier gleichwertiger Systeme<br />
gering.<br />
Es zeigt sich, dass allein die Erkenntnis eines Bedürfnisses nicht ausreichend ist. Vielmehr besteht das Bedürfnis<br />
der konkreten Individualisierung eines potentiellen Nutzers.<br />
4 4 4 Anpassungserfordernisse<br />
Des Weiteren kann ein Grund des Scheiterns in der unzureichenden Beachtung etwaiger Anpassungserfordernisse<br />
gesehen werden. Unter Anpassung werden insoweit notwendige weitere Aktivitäten des Nutzers zur<br />
Adaptierung der Innovation verstanden.<br />
Auch im Falle des Cargolifter kann in nötigen Anpassungserfordernissen ein mitursächlicher Grund des Scheiterns<br />
gesehen werden. So besteht beim Betrieb eines Schwerlastluftschiffes die Notwendigkeit Wartungshallen<br />
und entsprechende spezielle Landemöglichkeiten zu errichten. Des Weiteren ist technisches Personal für<br />
derart neue Technologien auf dem Markt nicht einfach zu finden, sondern muss umfangreich neu geschult<br />
werden.<br />
Ähnlich problematische Anpassungserfordernisse bestanden im Falle des Transrapid. Hier bestand die Notwendigkeit<br />
der Errichtung einer gesamten, auf die Schwebebahn ausgelegten Infrastruktur. Überdies zeigt<br />
sich auch hier das Erfordernis, neues technische Personal auszubilden sowie entsprechende Wartungsanlagen<br />
zu errichten.<br />
37 Bauer Reinhold, Gescheiterte Innovationen, S. 296 f.<br />
9
Um etwaigen problematischen Anpassungserfordernissen entgegenzuwirken, erscheint eine solide Kommunikation<br />
mit den Stakeholdern, insbesondere den potentiellen Kunden, zu einem möglichst frühen Stadium<br />
zwingend.<br />
4 4 5 Entwicklungsraum<br />
Ein besonders komplexer Typ des Scheiterns resultiert aus einem instabilen Entwicklungsraum. Unter Entwicklungsraum<br />
kann dabei das konkrete Umfeld verstanden werden, innerhalb dessen sich das Innovationsprojekt<br />
entwickelt. Insbesondere die differierenden Ziele der verschiedenen Akteure verleihen dem Entwicklungsraum<br />
sein besonderes Gepräge. 38<br />
Sowohl das Projekt des Cargolifters als auch das des Transrapids waren geprägt von erheblichem staatlichen<br />
Einfluss, was insbesondere die Entwicklungsfinanzierung betraf. Im Falle des Transrapid erfolgte eine fast<br />
vollständige Finanzierung durch die öffentliche Hand. Dieser starke öffentliche Einfluss beschränkte den unternehmerischen<br />
Spielraum umfassend. Insbesondere bestand im Falle des Transrapid eine Abhängigkeit von<br />
späterer staatlicher Förderung des Streckennetzes, welche nicht realisiert wurde.<br />
4 4 6 Timing<br />
Letztlich muss eine Innovation nicht nur in der richtigen Art und Weise, sondern auch zu dem richtigen Zeitpunkt<br />
durchgeführt werden. Dieser Punkt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem vorgenannten, da<br />
sowohl Konkurrenzsituation, Anpassungserfordernisse oder Entwicklungsräume zu verschiedenen Zeitpunkten<br />
günstiger oder weniger günstig ausfallen können.<br />
Es besteht die berechtigte Annahme, dass das Scheitern des Cargolifter auch mit einem falschen Zeitpunkt in<br />
Zusammenhang stand. So ist durchaus denkbar, dass zu späterer Zeit ein gesteigertes Umweltbewusstsein<br />
oder Rohstoffknappheiten dem Cargolifter zur Durchsetzung verholfen hätten.<br />
Vielfach wird auch vertreten, der Transrapid habe zur falschen Zeit seine Marktreife erreicht. Reinhold Bauer<br />
postuliert insoweit, die Bahn sei zu schnell und das Flugzeug zu günstig geworden. 39 Dieser These folgend<br />
schwand das Marktsegment für den Transrapid. Des Weiteren ist vorstellbar, dass auch im Falle des Transrapids<br />
ein zunehmendes Umweltbewusstsein und steigende Rohstoffpreise zu einer besseren Durchsetzung<br />
geführt hätten.<br />
5 Zusammenfassung und Theorie des Scheiterns<br />
Fraglich erscheint, ob sich eine abstrakte, generelle Gültigkeit beanspruchende Theorie des Scheiterns formulieren<br />
lässt, welche als präventives Instrument fruchtbar zu machen ist.<br />
Die vorstehenden Ausführungen konnten zeigen, dass sich über Einzelfälle hinaus Umstände abstrahieren<br />
lassen, welche das Risiko des innovatorischen Scheiterns erhöhen. Die ausgesprochene Komplexität innovatorischer<br />
Fehlschläge verbietet jedoch die Formulierung einer allgemeingültigen Theorie des Scheiterns. Dies<br />
38 Bauer Reinhold, Gescheiterte Innovationen, S. 299 f.<br />
39 Balzter Sebastian, Reif für die Tonne - Gescheiterte Ingenieursprojekte.<br />
10
findet seinen Grund insbesondere darin, dass ein Scheitern auch in historischem Kontext zu sehen ist, welcher<br />
nicht verallgemeinert werden kann.<br />
Letztlich ist innovatorisches Scheitern retrospektiv erklärbar, jedoch nicht prospektiv sicher vermeidbar. Dies<br />
erscheint insoweit konsistent, als dass eine Vermeidbarkeit der Risikolosigkeit gleichkäme. Das Nutzen unternehmerischer<br />
Chancen unter Ausschluss von Risiken widerspräche überdies jeder ökonomischen Logik. Dem<br />
Innovator verbleibt insoweit nur sich bestehender Risiken bewusst zu werden und durch entsprechende<br />
strategische und operative Maßnahmen hierauf zu reagieren.<br />
11
6 Literaturverzeichnis<br />
Printquellen<br />
Burmester Ralph, Vahs Dietmar (2005). Innovationsmanagement: Von der Produktidee zur erfolgreichen<br />
Vermarktung. Frankfurt: Schäffer-Poeschel.<br />
Hartschen Michael (2009). Innovationsmanagement: Die 6 Phasen von der Idee zur Umsetzung. Offenbach:<br />
Gabel Verlag.<br />
Hauschildt Jürgen/ Salomo Sören (2011). Innovationsmanagement. München: Franz Vahlen GmbH<br />
Gassmann Oliver/ Sutter Philipp (2011). Praxiswissen Innovationsmanagement - von der Idee zum Markterfolg.<br />
München: Carl Hanser Verlag.<br />
Mohr Hans-Walter (1977). Bestimmungsgründe für die Verbreitung neuer Technologien. Berlin: Duncker<br />
Humbolt Verlag.<br />
Bauer Reinhold (2006). Gescheiterte Innovationen - Fehlschläge und technologischer Wandel. Frankfurt:<br />
Campus Verlag.<br />
Schlick Gerhard (1995). Innovationen von A-Z; Begriffe, Definitionen, Erläuterungen und Beispiele.<br />
Renningen-Malmsheim: Expert-Verlag.<br />
Wahren Kurt-Heinz (2003). Erfolgsfaktor Innovation - Ideen systematisch generieren, bewerten und umsetzen.<br />
Berlin: Springer Verlag.<br />
Internetquellen<br />
Backovic Lazar (26.2..2014). www.spiegel.de. abgerufen am 1.1.2015 unter http://www.spiegel.de<br />
/einestages/milliardenflop-transrapid-magnetschwebebahn-in-deutschland-a-958241.html<br />
Balzter Sebastian (27.10.2010). www.faz.net. Abgerufen am 16.1.2015 von http://www.faz.net/ aktuell/ berufchance/arbeitswelt/gescheiterte-ingenieursprojekte-reif-fuer-die-tonne<br />
11052740.html<br />
Bernd Bartsch (04.02.2013). www.augsburger-allgemeine.de. Abgerufen am 20.1.2015 von http://www. augs<br />
burger-allgemeine.de/wirtschaft/Enttaeuscht-Shanghai-bereut-die-Transrapid-Bahn-id23869956.html<br />
Burkitt Laurie (31.3.2010). www.forbes.com. Abgerufen am 27. 12 2014 von http://www.forbes.com<br />
/2010/03/31/brand-flops-apple-ford-pepsi-coors-cmo-network-brand-fail.html<br />
Google Inc. (1. 1 2014). www.maps.google.de. Abgerufen am 12. 28 2014 von https://www.google.de/maps/<br />
place/Brand,+15757+Halbe/@52.0341397,13.7319152,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47a804559e4b62<br />
61:0x4c2650245ee99aff<br />
Hauck Mirjam (24.9.2014). www.Süddeutsche.de. Abgerufen am 27. 12 2014 von http://www.<br />
sueddeutsche.de/digital/gescheiterte-innovationen-was-nutzer-nicht-moegen-1.2142747<br />
Jaruzelski Barry/ Staack Volker/ Goehle Brad (1. 1 2014). www.strategyand.pwc.com. Abgerufen am 27. 12<br />
2014 von http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/reports-whitepapers/<br />
article-display /2014-global-innovation-1000-study<br />
Knauß Ferdinand (15. 3 2010). www.handelsblatt.com. Abgerufen am 2014. 12 27 von http://www<br />
.handelsblatt.com/technologie/forschung-medizin/forschung-innovation/forschung-wieinnovationenentstehen-seite-3/3390458-3.html<br />
manager magazin new media GmbH (10. 10 2003). www.manager-magazin.de. Abgerufen am 28.12.2014 von<br />
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-198297.html<br />
von Gablenz Carl-Heinrich (1. 1 2014). www.cargolifter.de. Abgerufen am 28. 12 2014 von http://www.<br />
cargolifter.de/geschichte_der_cl_ag.html<br />
12
7 Anhang<br />
Abbildung 1: Zweiteilung des Innovationsprozesses.<br />
(Gassmann Oliver/ Sutter Philipp, Praxiswissen<br />
Innovationsmanagement, S. 45)<br />
Abbildung 2: Top 20 R&D Spenders worldwide. (Jaruzelski Barry/ Staack Volker/<br />
Goehle Brad, Global Innovation 1000: Proven Paths to Innovation Success, S.5)<br />
13
Grafik 1: Logo Cargolifter AG (manager<br />
magazin new media GmbH, Chronik eines<br />
Absturzes)<br />
Grafik 2: CL-75 "AirCrane" vor Werfthalle (von<br />
Gablenz Carl-Heinrich, Geschichter der CL-AG)<br />
Grafik 3: Lage der Cargolifter Werfthalle in Brand /<br />
Brandenburg (Google Inc., Lage Brand in<br />
Brandenburg/ Deutschland)<br />
Grafik 4: Versuchsluftschiff "Joey" (von<br />
Gablenz Carl-Heinrich, Geschichter der CL-AG)<br />
Grafik 6: Computergrafik des CL160 (von Gablenz<br />
Carl-Heinrich, Geschichter der CL-AG)<br />
Grafik 7: CargoLifter Werfthalle (von Gablenz Carl-<br />
Heinrich, Geschichter der CL-AG)<br />
Grafik 5: Skyship 600 "Charly" (von Gablenz Carl-<br />
Heinrich, Geschichter der CL-AG)<br />
14
Grafik 8: Transrapid (Backovic Lazar, Deutschland im Magnetschwebewahn)<br />
Abbildung 3 CL-Aktie im Vgl. zum MDax (rot) (manager magazin Verlagsgesellschaft mbH, Die Chronik eines Absturzes)<br />
15