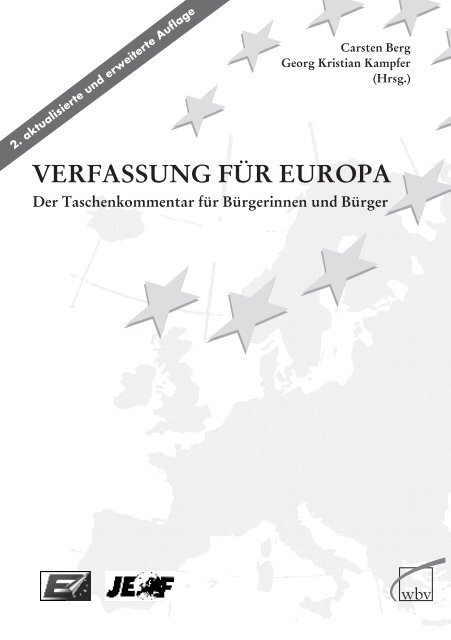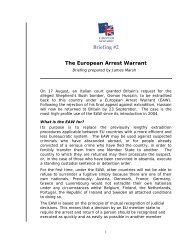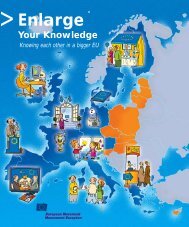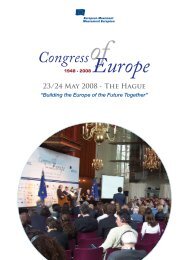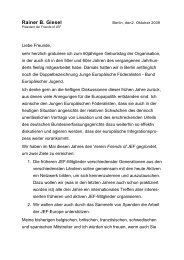VERFASSUNG FÃR EUROPA - Netzwerk Europäische Bewegung ...
VERFASSUNG FÃR EUROPA - Netzwerk Europäische Bewegung ...
VERFASSUNG FÃR EUROPA - Netzwerk Europäische Bewegung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. aktualisierte und erweiterte Auflage<br />
Carsten Berg<br />
Georg Kristian Kampfer<br />
(Hrsg.)<br />
<strong>VERFASSUNG</strong> FÜR <strong>EUROPA</strong><br />
Der Taschenkommentar für Bürgerinnen und Bürger
Impressum<br />
Bibliographische Informationen Der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;<br />
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über<br />
http://dnb.ddb.de abrufbar.<br />
Herausgeber:<br />
Redaktionsleitung:<br />
Verlag:<br />
Gesamtherstellung:<br />
Umschlaggestaltung:<br />
Layoutgestaltung:<br />
Europa-Union Deutschland e.V.<br />
Carsten Berg, Georg Kristian Kampfer,<br />
Ann-Kathrin Fischer und Moritz Alt<br />
W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG<br />
Postfach 10 06 33, D-33506 Bielefeld<br />
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld<br />
Christiane Zay, Bielefeld<br />
Ann-Kathrin Fischer, Berlin<br />
ISBN 3-7639-3371-9<br />
Bestell-Nr. 60.01.515a<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede<br />
Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.<br />
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Die Herausgeber, die Autoren und der Verlag haben sich bemüht, die in dieser<br />
Veröffentlichung enthaltenen Angaben mit größter Sorgfalt zusammenzustellen.<br />
Sie können jedoch nicht ausschließen, dass die eine oder andere Information<br />
auf irrtümlichen Angaben beruht oder bei Drucklegung bereits Änderungen<br />
eingetreten sind. Aus diesem Grund kann keine Gewähr und Haftung für<br />
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernommen werden.<br />
© 2005 W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co.KG<br />
Bielefeld 2005<br />
Printed in Germany<br />
II
Impressum<br />
Die in diesem Kommentar dargelegten Informationen und Ansichten sind die<br />
der Autoren und beinhalten nicht den offiziellen Standpunkt der Europäischen<br />
Gemeinschaften. Die Verantwortung für den Inhalt des Vertrags über eine Verfassung<br />
für Europa obliegt vollständig den Staats- und Regierungschefs der<br />
Europäischen Union.<br />
Die vollständige Version der hier abgedruckten Auszüge aus dem Vertrag<br />
über eine Verfassung für Europa ist im Amtsblatt der Europäischen Union,<br />
„Mitteilungen und Bekanntmachungen“, C 310 vom 16. Dezember 2004,<br />
veröffentlicht worden. Der Text des Vertrages über eine Verfassung für<br />
Europa wurde am 29. Oktober 2004 von den Staats- bzw. Regierungschefs<br />
der 25 Mitgliedstaaten sowie der 3 Kandidatenländer unterzeichnet. Dieser<br />
Vertrag liegt nunmehr den Unterzeichnerstaaten zur Annahme (Ratifizierung)<br />
gemäß der in ihrer jeweiligen Verfassung vorgesehenen Verfahren<br />
vor.<br />
Verbindlich sind ausschließlich die in den gedruckten Ausgaben des Amtsblattes<br />
der Europäischen Union veröffentlichten offiziellen Dokumente.<br />
Diese Publikation wird von der Europäischen Union finanziell unterstützt.<br />
Sie ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Centre International de Formation<br />
Européenne. Die Verantwortung für den Inhalt tragen allein die<br />
Herausgeber. Die vertretenen Meinungen sind nicht notwendigerweise die<br />
der Europäischen Kommission.<br />
Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die<br />
von ihnen vertretenen Ansichten sind nicht zwingend mit denen der Herausgeber<br />
identisch.<br />
Sollten Sie bei der Lektüre dieses Buches auf Unstimmigkeiten gestoßen<br />
sein, so sind wir Ihnen über einen entsprechenden Hinweis dankbar. In diesem<br />
Buch werden sämtliche maskuline Formen geschlechtsneutral verwandt.<br />
Sie implizieren zugleich eine weiblich Besetzung.<br />
E-mail: buchprojekt@verfassung-europa.de · www.verfassung-europa.de<br />
III
Die Redaktion „Verfassung für Europa“<br />
Diese Buch entstand unter redaktioneller Mitarbeit von<br />
Moritz Alt<br />
Friedrich Bokern<br />
Ann-Kathrin Fischer<br />
Feodora von Franz<br />
Jana Hoppe<br />
Annett Jagiela<br />
Jens Jenssen<br />
Andrea Kämpf<br />
Beatrice Kolp<br />
Georg Philipp Kössler<br />
Ivo Mechtel<br />
Nicole Meßmer<br />
Yoriko Rach<br />
Miriam Rupprecht<br />
Jan Schubert<br />
IV
Inhalt<br />
Geleitwort<br />
Elmar Brok<br />
IX<br />
Über dieses Buch<br />
XI<br />
Carsten Berg/Georg Kristian Kampfer<br />
Der Weg von Brüssel nach Rom durch das Tal der Ahnungslosen<br />
Georg Kristian Kampfer 1<br />
Vom Flickenteppich zur Europäischen Verfassung<br />
Annett Jagiela 7<br />
Abkürzungen 17<br />
I. Originaltext<br />
<strong>VERFASSUNG</strong> FÜR <strong>EUROPA</strong> (Teil I, II und IV) 19<br />
II. Kommentar 75<br />
Teil I<br />
1. PRÄAMBEL 76<br />
Einstimmung und Skizze der Befindlichkeit?<br />
Georg Kristian Kampfer<br />
2. DEFINITION UND ZIELE DER UNION (Artikel 1-8) 82<br />
Auf Zuwachs geschneidert<br />
Lutz Hager<br />
3. GRUNDRECHTE UND UNIONSBÜRGERSCHAFT (Artikel 9, 10) 93<br />
Ein Europa für den Menschen – die fundamentalen Rechte der<br />
Europäer<br />
Stephan Korte<br />
4. DIE GRUNDPRINZIPIEN DER KOMPETENZORDNUNG 101<br />
(Artikel 6, 11, 18)<br />
Alles in bester Ordnung?<br />
Christian Wenning/Florian Ziegenbalg<br />
5. DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION (Artikel 12-17) 111<br />
Was darf die Europäische Union?<br />
Christian Wenning/Florian Ziegenbalg<br />
V
Inhalt<br />
6. DER INSTITUTIONELLE RAHMEN (Artikel 19) 119<br />
Die Europäische Union – ein einzigartiges Projekt<br />
Nicole Meßmer<br />
7. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT (Artikel 20) 128<br />
Demokratischer Goliath ohne Keule?<br />
Marc Schreiner<br />
8. DER EUROPÄISCHE RAT (Artikel 21, 22) 136<br />
Der Europäische Rat – Macht oder Ohnmacht der EU?<br />
Jan Kreutz<br />
9. DER MINISTERRAT (Artikel 23-25) 145<br />
Ministerrat – das Machtzentrum der Europäischen Union<br />
Beatrice Kolp<br />
10. DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION (Artikel 26-28) 156<br />
Europäische Regierung oder neutraler Verwaltungsapparat?<br />
Die Kommission auf der Suche nach sich selbst<br />
Julia Strese<br />
11. DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION (Artikel 29) 165<br />
Der Gerichtshof als Motor und Spiegelbild der Integration<br />
Reinhard Ruge<br />
12. DIE SONSTIGEN ORGANE UND DIE BERATENDEN 173<br />
EINRICHTUNGEN DER UNION (Artikel 30-32)<br />
Kommission, Parlament und Ministerrat – ist das alles?<br />
Tobias Schwab<br />
13. AUSÜBUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION – 182<br />
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN (Artikel 33-39)<br />
Es gibt nichts Komplizierteres als eine Vereinfachung<br />
Stefan Evers<br />
14. DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 191<br />
(Artikel 40)<br />
Eine Stimme für Europa – Europas Stimme in der Welt<br />
Anna Lührmann/Tina Löffelsend<br />
15. DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGS- 202<br />
POLITIK (Artikel 41)<br />
Die EU wird wehrhaft<br />
Sebastian Peter Sass<br />
VI
Inhalt<br />
16. DES RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT 212<br />
UND DES RECHTS (Artikel 42)<br />
Europäische Innen- und Justizpolitik: Der Raum der Freiheit,<br />
der Sicherheit und des Rechts – ein magisches Dreieck?<br />
Tamara Ritter<br />
17. SOLIDARITÄTSKLAUSEL (Artikel 43) 223<br />
Neues Regelwerk gegen Terror und Katastrophen<br />
Sebastian Peter Sass<br />
18. VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT (Artikel 44) 225<br />
Wie kommt die Europäische Union rascher voran?<br />
Luise Papcke<br />
19. DAS DEMOKRATISCHE LEBEN DER UNION (Artikel 45-52) 233<br />
Vom Demokratiedefizit zur europäischen Öffentlichkeit und zurück<br />
Jan Seifert<br />
20. DIE FINANZEN DER UNION (Artikel 53-56) 243<br />
Von den Budgetrechten über die Europa-Steuer hin zu einer<br />
engeren Union?<br />
Annegret Katharina Schäfer<br />
21. DIE UNION UND IHRE NACHBARN (Artikel 57) 251<br />
Die Europäische Union – ein stabilisierender Faktor in der Welt<br />
Anna Lührmann<br />
22. ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION (Artikel 58-60) 254<br />
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, jedem Ende ...<br />
Florentina Harbo<br />
Teil II: Die Charta der Grundrechte der Union<br />
1. PRÄAMBEL<br />
Eine Einführung in die Welt der Grundrechte<br />
Georg Kristian Kampfer 266<br />
2. TITEL I-IV (Artikel 61-98) 270<br />
Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität<br />
Ann-Kathrin Fischer<br />
3. TITEL V-VII (Artikel 99-114) 284<br />
Bürgerrechte, justizielle Rechte, allgemeine Bestimmungen<br />
über die Auslegung und Anwendung der Charta<br />
Moritz Alt<br />
VII
Inhalt<br />
Teil IV: Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
1. ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 300<br />
(Artikel 437-448)<br />
Und zum Abschluss ein Referendum?<br />
Carsten Berg<br />
III. Autorinnen und Autoren 312<br />
IV. Danksagung 315<br />
V. Glossar 316<br />
VI. Personen- und Sachverzeichnis 325<br />
VIII
Geleitwort<br />
GELEITWORT<br />
des Europaparlamentariers, ehemaligen Konventsmitglieds<br />
und Präsidenten der Europa-Union Deutschland Elmar Brok<br />
Die Verfassung ist gut für die Bürger Europas. Diesen scheinbar banalen<br />
Satz kann man heute nicht oft und eindringlich genug wiederholen. Er<br />
lässt sich schließlich, wie dieser Taschenkommentar unter Beweis stellt,<br />
auch leicht untermauern. Doch genau dies hat die politische Klasse bislang<br />
nicht oder nur mangelhaft bewerkstelligt. Ich nehme mich dabei<br />
nicht aus, trotz aller Bemühungen der letzten 12 Monate. Insbesondere<br />
muss klar sein: Die Europäische Union wird scheitern, wenn sie weiterhin<br />
in den öffentlichen Debatten auf ein innenpolitisches Kampfinstrument<br />
reduziert wird.<br />
Wichtiger noch als die konkreten Inhalte der Verfassung ist oftmals die<br />
allgemeine Stimmung zu Europa. Hier liegt ein noch schwereres Versäumnis<br />
der politischen Elite und der Wirtschaft vor. Europa ist zu einer<br />
Sache des Schacherns und zu einer mit dem Argument der Realpolitik<br />
gerechtfertigten Windfähnchenpolitik geworden. Niemand hat den Menschen<br />
den wahren Nutzen der europäischen Erweiterung des vergangenen<br />
Jahres erklärt, etwa eine Kosten-Nutzen-Aufstellung veröffentlicht.<br />
Niemand hat den Menschen vermittelt, dass die Europäische Union die<br />
kostengünstigste Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand bei uns<br />
und unseren Nachbarländern ist. Wie soll ein Nationalstaat allein in der<br />
globalen Ordnung politisch und wirtschaftlich die Interessen seiner Bürger<br />
noch wahrnehmen können? Was passiert, wo die Europäische Union<br />
abwesend ist, konnte man auf dem Balkan in den 1990er Jahren sehen.<br />
Aber auch die Grenzen Europas bleiben diffus und damit beängstigend<br />
für die Bürger. Es wäre nötig gewesen, dies bis zu den Stammtischen zu<br />
vermitteln – mehr noch, es bleibt nötig. Denn sonst entfernt sich das<br />
Volk von dem Projekt.<br />
Doch die Politik hält auch selbst die Instrumente der Problemlösung in<br />
der Hand. Anders als zu Zeiten von Konrad Adenauer und Robert Schuman<br />
oder Helmut Kohl und Francois Mitterand ist heute keinerlei charismatische<br />
Führung in der Europäischen Union erkennbar. Europa ist<br />
keine Sache des Herzens mehr. Das lässt sich ändern.<br />
IX
Geleitwort<br />
Die Verbesserungen und Zwecke der Verfassung müssen letztlich kommen<br />
– aber sie müssen den Bürgern auch erklärt werden. Die politische<br />
Klasse hat dies weitgehend versäumt. Wie sonst ist es zu erklären, dass<br />
die Franzosen und die Niederländer die Verfassung ablehnen, um die<br />
EU-Mitgliedschaft der Türkei zu verhindern – wo doch gerade die Verfassung<br />
die Messlatte für die Türkei durch die neue europäische Grundrechtecharta<br />
höher legen soll als heute? Wie sonst ist es zu erklären, dass<br />
die Menschen befürchteten, ihr Land hätte nichts mehr zu sagen, obwohl<br />
doch gerade die Stimmengewichtung sich mehr an der Bevölkerungszahl<br />
orientieren und die nationalen Parlamente gestärkt werden sollen?<br />
Wie sonst ist zu erklären, dass die Bürger eine bürgernähere Politik wünschen,<br />
wo doch die Verfassung gerade Sitzungen des Ministerrats öffentlich<br />
machen, Bürgerbegehren ermöglichen und das direkt vom Volk<br />
gewählte Parlament stärken will? All dies – die Inhalte – wurden nicht<br />
vermittelt.<br />
Der Verfassungskonvent und die Staats- und Regierungschefs verfolgten<br />
ein Ziel. Denn der Vertrag von Nizza reicht nicht für die Union mit<br />
25 Mitgliedern und bleibt zwingend hinter den Erwartungen der Bürger<br />
zurück – der Unmut würde auf Dauer nur größer und verbreiteter. Einen<br />
Teil der Verfassung umzusetzen wäre ebenso wenig möglich, da er nur<br />
als Paket die Zustimmung fand. Jeder Teil, den man weglassen wollte,<br />
würde einen Kritiker hervorbringen, der nur wegen dieses Teiles andere<br />
Teile akzeptiert hatte. Schließlich ein ganz neues Paket zu verhandeln<br />
würde nicht nur die Staaten ignorieren, die bereits ratifiziert haben, sondern<br />
auch erneut viele Jahre brauchen – nur um letztlich abermals von<br />
allen Mitgliedern ratifiziert werden zu müssen. Auch ein Kerneuropa<br />
ohne Staaten wie Frankreich wäre kaum denkbar oder praktikabel. Will<br />
man also die Verfassung als Ganzes umsetzen und wirken lassen, so sollten<br />
die Staats- und Regierungschefs einen Weg finden, auf die Nein-<br />
Sager zuzugehen. Ein einfaches Wiederholen der Abstimmungen, bis<br />
das gewünschte Ergebnis herauskommt, wäre hingegen Beweis genau<br />
jener Arroganz, die die Bürger der Politik unterstellen – und gegen den<br />
bürgernahen Geist des Verfassungsvertrages selbst. Es müssen andere<br />
Vorzeichen her: offensichtlich vorwiegend innenpolitische, aber auch<br />
europapolitische.<br />
Brüssel, im Juli 2005<br />
X<br />
Elmar Brok
Vorwort<br />
Über dieses Buch<br />
„Ja, wir können träumen und diesen Traum von Europa vermitteln.“ 1<br />
Verfassung für Europa heißt es auf der 480 Seiten starken Publikation<br />
der Europäischen Union. 2 Das Buch enthält das gesellschaftliche Fundament<br />
eines zukünftigen Europas mit 458 Millionen Bürgern, das Regelwerk<br />
der größten Wirtschafts- und Exportgemeinschaft der Welt sowie<br />
die Voraussetzungen für einen friedlichen Zusammenschluss von über<br />
25 Völkern 3 . Vielleicht stehen wir sogar vor dem Beginn der Verwirklichung<br />
eines „European Dream“, eines Traums von einem demokratischen<br />
europäischen Volk, das sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,<br />
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen<br />
und Männern auszeichnet 4 und in Frieden in und mit dieser Welt lebt.<br />
Doch zunächst einmal haben viele Bürger 5 in Referenden, zum Beispiel<br />
in Frankreich und den Niederlanden, mit einem „Nein“ zur Europäischen<br />
Verfassung ihren generellen Unmut über die Europäische Union zum<br />
Ausdruck gebracht. Dies muss debattiert und verstanden werden. Die<br />
Chance, das Vertrauen aller Bürger zu gewinnen, liegt in dem „Plan D“,<br />
dem Plan für Demokratie und Diskussion über die Inhalte der Verfassung<br />
für Europa.<br />
Die Verfassung für Europa gliedert sich in vier Teile mit insgesamt<br />
990 Artikeln 6 und geht damit über den Umfang anderer Verfassungen,<br />
wie etwa das deutsche Grundgesetz mit 146 Artikeln 7 , weit hinaus. In<br />
der ersten Auflage dieses Taschenkommentars kommentierten wir ausschließlich<br />
Teil I der Verfassung. Die drei weiteren Teile und die Proto-<br />
1<br />
Valéry Giscard d’Estaing bei der Eröffnung des Verfassungskonvents am 28. Februar 2002.<br />
2<br />
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (2005): Vertrag über eine Verfassung<br />
für Europa, Luxemburg. Die Bezeichnung „Vertrag über ein Verfassung für Europa“ weist<br />
darauf hin, dass die Verfassung aus juristischer Sicht ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den<br />
Unterzeichnerstaaten ist.<br />
3<br />
Bei Redaktionsschluss umfasste die EU 25 Mitgliedstaaten. Das „Zieldatum“ für den Beitritt<br />
Rumäniens und Bulgariens war der 1. Januar 2007 (Unterzeichnungsdatum des Erweiterungsvertrages:<br />
25. April 2005).<br />
4<br />
Vgl. „Die Werte der Union“ in Artikel 2.<br />
5<br />
Die Verwendung der männlichen Form schließt stets die weibliche mit ein.<br />
6<br />
448 Artikel der Teile I bis IV plus 542 Artikel der 36 Protokolle.<br />
7<br />
Mit allen neu eingefügten Artikeln hat das Grundgesetz über 180 Artikel.<br />
XI
Vorwort<br />
kolle sparten wir aus, da wir davon überzeugt waren, dass dies für einen<br />
ersten Überblick ausreicht. Doch viele Leser belehrten uns eines Besseren<br />
... Teil II der Europäischen Verfassung enthält die „Charta der Grundrechte<br />
der Union“. Sie wurde von dem ersten Konvent der Europäischen<br />
Union, dem Grundrechte-Konvent, in den Jahren 1999 und 2000 erarbeitet.<br />
Diesem saß der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog vor. Die<br />
Kommentierung der Grundrechtecharta sowie der Originaltext der<br />
ersten beiden Teile finden sich neuerdings in diesem Buch. Ebenso<br />
wurde der Teil IV („Allgemeine und Schlussbestimmungen“) in dieser<br />
zweiten Auflage kommentiert. Sie enthalten den Artikel 447 – den<br />
„Schicksalsartikel“ der Verfassung –, welcher die Ratifikation und das<br />
Inkrafttreten der Verfassung regelt.<br />
Auch wenn von einem Abdruck und einer ausführlichen Kommentierung<br />
von Teil III der Verfassung („Die Politikbereiche und Arbeitsweise<br />
der Union“) hier abgesehen wurde, so wird doch in verständlicher Weise<br />
auf diesen Bezug genommen. Würden wir auch Teil III mit seinen<br />
322 Artikeln kommentieren, so wäre dieses Buch kein Taschenkommentar<br />
für Bürger, sondern eine „Enzyklopädie für Wirtschaftsjuristen“.<br />
Wie bei der ersten Ausgabe standen eine klare Übersicht und Konzentration<br />
auf das Wesentliche bei der zweiten Ausgabe wieder im Vordergrund<br />
der Bearbeitung. Die Europäische Verfassung wird allgemein verständlich<br />
erklärt und kommentiert. Das Buch erhebt nicht den Anspruch,<br />
juristischen Feinheiten zu genügen. Die europäische Fachsprache wird<br />
nur dann verwendet, wenn dies zur Klarheit und Präzision erforderlich<br />
ist. Sie wird so gebraucht, dass jeder interessierte Bürger, der sich bisher<br />
noch nicht so ausführlich mit Europapolitik und Europarecht beschäftigt<br />
hat, sie verstehen kann.<br />
Wer in dem Europa von morgen seine Rechte nicht kennt, wird diese nicht<br />
wahrnehmen. Wer die Organisation und Funktionsweise der Bürgervertretung<br />
in der Europäischen Union nicht versteht, wird machtlos.<br />
Aus der Projektbeschreibung zu diesem Buch aus dem Jahr 2001<br />
Zu der ersten Buchauflage haben wir uns über die zahlreichen Leserbriefe<br />
gefreut. Wir wünschen uns, dass dies so bleibt. Wir möchten auch zur<br />
zweiten Auflage dazu ermutigen, den Kontakt zu den Autoren und den<br />
Herausgebern zu suchen. Hierzu besteht die Möglichkeit über unsere<br />
Homepage: http://www.verfassung-europa.de.<br />
XII
Vorwort<br />
Dieses Buch ist das Ergebnis eines nun zweijährigen Projektes der Jungen<br />
Europäischen Föderalisten. In dessen Zentrum steht eine junge Berliner<br />
Redaktion, die 26 europaerfahrene Autorinnen und Autoren aus<br />
ganz Deutschland betreut. Zum Austausch und zur Vertiefung der gewonnenen<br />
Erkenntnisse fand im Oktober 2003 in Zusammenarbeit mit<br />
dem Deutschen Bundesjugendring in Berlin eine gemeinsame Klausurtagung<br />
von Autoren und Redaktion statt. An dieser nahmen als Experten<br />
auch die ehemaligen Konventsmitglieder Professor Jürgen Meyer und<br />
Bundestagsabgeordneter Peter Altmaier teil sowie der Brüsseler Korrespondent<br />
der Süddeutschen Zeitung Christian Wernicke, der Politologe<br />
Professor Wolfgang Wessels und Daniel Göler als Vertreter des Instituts<br />
für Europäische Politik.<br />
Ganz besonders freuen wir uns über die Unterstützung dieser zweiten<br />
Auflage durch die Europa-Union Deutschland. Gemeinsam mit den Jungen<br />
Europäischen Föderalisten und dem Deutschen Bundesjugendring<br />
stellt sich die Europa-Union Deutschland auf den letzten Seiten des Buches<br />
dem Leser vor.<br />
Unser besonderer Dank gilt dem W. Bertelsmann Verlag aus Bielefeld,<br />
der in gewohnter Manier wieder für beste Qualität des Buches sorgte.<br />
Brüssel, im Juli 2005<br />
Carsten Berg & Georg Kristian Kampfer<br />
XIII
Die Meilensteine der Europäischen Verfassung<br />
15. Dezember 2001<br />
Europäischer Rat von Laeken<br />
Einberufung des Europäischen Konvents<br />
28. Februar 2002<br />
Europäischer Konvent<br />
Eröffnungssitzung<br />
20. Juni und 18. Juli 2003<br />
Vorlage des Verfassungsentwurfs<br />
4. Oktober 2003<br />
Regierungskonferenz von 2003/2004<br />
Eröffnungssitzung<br />
16. und 17. Juni 2004<br />
Europäischer Rat von Brüssel<br />
Politische Einigung über den Verfassungstext<br />
29. Oktober 2004<br />
Unterzeichnung der Verfassung<br />
2004–2007<br />
Annahmeverfahren in den<br />
Mitgliedstaaten<br />
Hinterlegung der Annahmeurkunden in Rom<br />
Juni 2006<br />
Bilanz über Annahmeverfahren<br />
auf EU-Sondergipfel<br />
1. November 2006<br />
Vorgesehenes Datum des Inkrafttretens<br />
Verschoben auf Mitte 2007<br />
XIV
Georg Kristian Kampfer<br />
Der Weg von Brüssel nach Rom<br />
durch das Tal der Ahnungslosen<br />
Zukunftsverhandlungen in Brüssel<br />
Vor etwa zweihundert Jahren tagten in Nordamerika die 55 Männer 1 des<br />
„Konvents von Philadelphia“ und erarbeiteten die Verfassung der Vereinigten<br />
Staaten von Amerika. 2 Als im Jahr 2002 nun auch in Europa<br />
116 Frauen und Männer zusammentraten 3 , erweckten sie bei manch<br />
einem Erinnerungen an den Konvent von Philadelphia. 4 Die Brüsseler<br />
Versammlung hieß nämlich „Konvent zur Zukunft Europas“ und gab<br />
sich schon bald den einprägsamen Namen „Verfassungskonvent“. Und<br />
tatsächlich, das Ergebnis der Versammlung war nicht nur, wie ursprünglich<br />
gedacht, eine Neuordnung der bestehenden europäischen Verträge,<br />
sondern der Entwurf einer Verfassung für Europa. 5<br />
„Der Text [...] ist das Ergebnis sechzehnmonatiger gemeinsamer Anstrengungen.<br />
[...] Unser Vorschlag ist insofern ehrgeizig, als er über das hinausgeht,<br />
was allgemein für möglich gehalten wurde. Dieser Entwurf<br />
eines Verfassungsvertrages ist ein harmonisches Bauwerk. Ein Bauwerk,<br />
weil es ein Werk aus einem Guss darstellt [...]. Harmonisch, weil wir<br />
sorgfältig darauf geachtet haben, ein optimales Gleichgewicht zwischen<br />
der Rolle der Union und der Rolle der Mitgliedstaaten herzustellen [...].“<br />
Mit diesen Worten überreichte am 20. Juni 2003 der ehemalige Staatspräsident<br />
Frankreichs, Valéry Giscard d’Estaing, als Präsident des Verfassungskonvents<br />
den europäischen Staats- und Regierungschefs den<br />
ausgearbeiteten Entwurf einer Verfassung für Europa. Dies geschah,<br />
weil sie es nach geltendem europäischem Recht sind, die eine Änderung<br />
der Grundstruktur der Europäischen Union auszuhandeln haben. Valéry<br />
Giscard d’Estaing ermahnte die Regierungsoberhäupter zur Disziplin:<br />
„Ich möchte betonen, dass der Entwurf nun in Ihren Händen liegt, dass<br />
Sie als europäische Staats- und Regierungschefs über ihn entscheiden,<br />
1<br />
Vor allem Juristen, Großgrundbesitzer, Kaufleute und politische Führungspersönlichkeiten.<br />
2<br />
Der Konvent von Philadelphia tagte von Mai bis September 1787. Er legte eine Bundesstaatsverfassung<br />
vor, welche der Annahme durch mindestens neun der dreizehn amerikanischen<br />
Kolonien bedurfte. Dieses Ziel wurde im Juli 1787 erreicht. Als nach einigem Zögern auch die<br />
Staaten New York und Virginia zustimmten, konnte die Verfassung mit Geltung für die gesamten<br />
USA im Jahr 1789 in Kraft treten.<br />
3<br />
19 Frauen und 97 Männer tagten vom 28. Februar 2002 bis zum 10. Juli 2003 in Brüssel.<br />
4<br />
Vgl. Richter 2003.<br />
5<br />
Auch der Konvent von Philadelphia ging über den Auftrag einer Revision der „Articles of Confederation“<br />
hinaus. Vgl. hierzu Richter 2003, 20.<br />
Kampfer 1
Einführung<br />
denn es geht nicht mehr nur um technische Details, sondern um das<br />
Schicksal der Verfassung.“<br />
Dennoch scheiterte am 13. Dezember 2003 der erste Versuch einer Einigung.<br />
Zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten sich geweigert,<br />
einer vom Konvent vorgeschlagenen neuen Machtverteilung im<br />
Ministerrat – dem Entscheidungsgremium der Europäischen Union –<br />
zuzustimmen: Polen und Spanien. Erst im Juni 2004 war nach einigem<br />
Tauziehen der Diplomaten und Politiker die Machtfrage im Ministerrat<br />
geklärt und die Mitgliedstaaten einigten sich verbindlich auf den „Vertrag<br />
über eine Verfassung für Europa“, eine etwas überarbeitete Version<br />
des vom Konvent vorgelegten Verfassungsentwurfs. Noch im Oktober<br />
desselben Jahres wurde das Dokument unterzeichnet. 6 Für Deutschland<br />
unterschrieben Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister<br />
Joschka Fischer. Verbindlich? Erst langsam wurde allen Beteiligten<br />
bewusst, dass im Oktober die Verfassung zwar feierlich verkündet, die<br />
eigentliche Hürde aber noch nicht genommen war. Das Schicksal der<br />
Verfassung hängt vielmehr von dem Ausgang des größten Ratifizierungsprozesses<br />
der europäischen Geschichte ab, denn nach Artikel 447<br />
müssen alle 25 Mitgliedstaaten die Verfassung „im Einklang mit ihren<br />
verfassungsrechtlichen Vorschriften“ 7 annehmen. Danach tritt sie – frühestens<br />
„am 1. November 2006“ – in Kraft.<br />
Noch bevor das Europäische Parlament in Straßburg die Verfassung mit<br />
großer Mehrheit billigte 8 , gaben neun Mitgliedstaaten 9 bekannt, dass bei<br />
ihnen nicht nur ihr Parlament, sondern auch das Volk direkt abstimmen<br />
werde. Darunter waren Staaten wie Frankreich, dessen Bevölkerung 1992<br />
nur mit knapper Mehrheit einer wichtigen Reform der Europäischen<br />
Union zugestimmt hatte 10 , Irland, wo im Juni 2001 das Referendum zu<br />
einem neuen Europavertrag gescheitert war 11 , das traditionell europaskeptische<br />
Großbritannien und die Tschechische Republik, deren Staats-<br />
6<br />
Die feierliche Unterzeichnung fand am 29. Oktober 2004 in Rom statt.<br />
7<br />
Vgl. Artikel 447 Absatz 1.<br />
8<br />
Das Europäische Parlament billigte am 12. Januar 2005 mit 500 Ja- und 137 Neinstimmen die<br />
Verfassung und befürwortete rückhaltlos deren Ratifizierung.<br />
9<br />
Spanien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg,<br />
Niederlande und Portugal mit insgesamt etwa 250 Mio. Bürgern, d.h. mehr als die Hälfte aller<br />
EU-Bürger (448 Mio.).<br />
10<br />
Die Bevölkerung Frankreichs nahm am 20. September 1992 mit einer Mehrheit von nur 51 %<br />
den Maastrichter Vertrag an.<br />
11<br />
Der Vertrag von Nizza wurde erst bei einem zweiten Referendum am 19. Oktober 2002 angenommen.<br />
2 Kampfer
Einführung<br />
präsident Václav Klaus im April 2005 seine Bevölkerung dazu aufrief, die<br />
Verfassung abzulehnen. 12 Mit einem negativen Votum in den europafreundlichen<br />
Niederlanden rechnete noch niemand. In Deutschland entschied sich<br />
der Bundestag wie bei der Einführung des Euro und der Erweiterung der<br />
Europäischen Union um zehn neue Staaten gegen eine Volksabstimmung,<br />
obgleich bei den Bürgern in verschiedenen Umfragen eine große Zustimmung<br />
zur Verfassung festgestellt wurde. 13 Der deutsche Verein „Mehr<br />
Demokratie e.V.“ machte schließlich die Ortschaft Strempt in Nordrhein-<br />
Westfalen zum Testgebiet für die Verfassung. Bei einer simulierten Volksabstimmung<br />
stimmten dort 73 % Prozent der Wähler für die Verfassung. 14<br />
Das Tal der Ahnungslosen<br />
Was die deutschen Bürger mit den Bürgern anderer Mitgliedstaaten<br />
damals wie heute verbindet, ist die mangelnde Kenntnis des Inhalts der<br />
Europäischen Verfassung. In Deutschland fühlen sich drei von vier<br />
Befragten nicht ausreichend informiert. 15 EU-weit gaben im November<br />
2004 30 % der Befragten an, noch nie etwas von einer Europäischen<br />
Verfassung gehört zu haben. Im Alter zwischen 15 und 24 taten dies über<br />
40 % der Befragten. 16 Trotz der mangelnden Kenntnisse herrscht europaweit<br />
eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber der Verfassung.<br />
So auch im Februar 2005 in Spanien, als 76,7 % der abstimmenden<br />
Bürger der Verfassung zustimmten, obgleich kurz zuvor in Meinungsumfragen<br />
fast 80 % der Befragten angegeben hatten, sie besäßen<br />
keine genaueren Kenntnisse über deren Inhalt. 17<br />
12<br />
Klaus kritisiert unter anderem, dass „der Verfassungsvertrag“ durch die Ratifizierung eine<br />
„echte Verfassung“ und die EU „ein Staat“ werde. Die Mitgliedstaaten würden „einfache<br />
Regionen“, da sie das Recht der nationalen Gesetzgebung immer mehr verlieren würden. Durch<br />
die neue Stimmenverteilung im Rat würden „kleinere Mitgliedstaaten“ (z.B. Tschechische<br />
Republik) benachteiligt. Auch kritisiert Klaus, dass die Ansichten der bei einer Entscheidung<br />
im Rat unterliegenden Staaten unberücksichtigt bleiben würden. Vgl. Klaus 2005, 1 ff.<br />
13<br />
Das Eurobarometer der Europäischen Kommission stellt eine „generelle Zustimmung“ von 83<br />
% fest. Vgl. Europäische Kommission 2004a, 21. Nach einer Emnid-Umfrage für DIE WELT<br />
am 1. November 2004 sind sogar 89 % der Befragten „grundsätzlich für eine Verfassung“.<br />
14<br />
An der simulierten Volksabstimmung nahmen am 13. Juni 2004 insgesamt 383 Bürger teil. Vgl.<br />
http://www.mehr-demokratie.de/strempt.html (20.06.2005) und Rübel 2004.<br />
15<br />
Vgl. Europäische Kommission 2004b, 4.<br />
16<br />
Vgl. Europäische Kommission 2005a, 3.<br />
17<br />
Vgl. Europäische Kommission 2004b, 4. Bei einem „Kontrolltest“ der Kommission in Spanien<br />
wurde durchschnittlich jede zweite von sechs inhaltlichen Fragen falsch beantwortet. Vgl.<br />
Europäische Kommission 2005b, 28.<br />
Kampfer 3
Einführung<br />
Wenn die Europäische Union in Zukunft nicht nur eine Union der Staaten,<br />
sondern auch eine Union der Bürger sein soll, dann müssen wir, die Bürger,<br />
auch die Inhalte der Verfassung verstehen. Denn: „Es ist das Europa<br />
der Bürgerinnen und Bürger – oder es gibt kein politisches Europa“. 18<br />
Dabei sind doch die zentralen Neuerungen schnell ausgemacht: Die Verfassung<br />
stärkt die Handlungsfähigkeit der erweiterten Europäischen<br />
Union, gibt den Bürgern neue Grundrechte und unternimmt den Versuch,<br />
den Parlamentarismus in Europa auszubauen. Das Europäische Parlament<br />
erhält mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, der Deutsche Bundestag<br />
und der Bundesrat können vor dem Europäischen Gerichtshof klagen,<br />
wenn sie meinen, dass die Europäische Union in ihren Aufgabenbereich<br />
eingreift. Die Verfassung schafft die Voraussetzung für eine lebendige<br />
Demokratie, indem nun 1.000.000 Bürger die Europäische Kommission<br />
dazu auffordern können, ein Gesetz zu erarbeiten. Die Verfassung macht<br />
die Europäische Union verständlicher, weil sie die verschiedenen europäischen<br />
Verträge zusammenführt und an vielen Stellen einfache Begriffe<br />
verwendet werden. Ein Novum ist auch das Amt eines Außenministers<br />
und eines vom Europäischen Parlament gewählten „Präsidenten<br />
der Europäischen Union“. 19<br />
Trotz dieser Neuerungen hieß es – nachdem neun europäische Staaten<br />
die Verfassung angenommen hatten – in Frankreich am 29. Mai 2005<br />
einfach „Non“. In dem dort erforderlichen Referendum hatten rund 55%<br />
der Franzosen gegen die Europäische Verfassung gestimmt. Die Wahlbeteiligung<br />
lag bei 70 %. 20 Attac Deutschland erklärte dazu: „Die Menschen<br />
wollen ein sozialeres Europa und ein Ende der noeliberalen Politik.“<br />
21 Wenige Tage später folgte am 1. Juni 2005 wie das Fallen eines<br />
weiteren Dominosteines das negative Votum der Niederländer mit fast<br />
62 % bei einer Wahlbeteiligung von 62,8 %. 22 Die Bürger dort kritisierten<br />
ähnlich wie zuvor in Frankreich ganz allgemein den Sozialabbau im<br />
eigenen Land, die Senkung des Lohnniveaus und die Reduzierung der<br />
18<br />
Pernice 2003, 100.<br />
19<br />
Genau genommen ist dies der Präsident des für Rechtsakte der Europäischen Union vorschlagsberechtigten<br />
Organs (Europäische Kommission), die bzgl. des Vorschlagsrechts eine Art „EU-<br />
Regierung“ darstellt.<br />
20<br />
Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 lag bei 24 %.<br />
21<br />
Attac Deutschland: „Attac Deutschland begrüßt französisches Nein zur EU-Verfassung“, Pressemitteilung<br />
vom 29. Mai 2005 – Frankfurt/Main.<br />
22<br />
Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 lag bei 39 %.<br />
4 Kampfer
Einführung<br />
Abgaben von Wirtschaftsunternehmen an den Staat. 23 Der Europäischen<br />
Union warfen sie vor, ihrem Heimatland die Unabhängigkeit zu nehmen.<br />
Das Zünglein an der Waage war dann oftmals die ablehnende Haltung zur<br />
Aufnahme der Türkei in die Europäische Union.<br />
Daraufhin erklärten die 25 Staats- und Regierungschefs der Europäischen<br />
Union am 18. Juni 2005 in Brüssel: „Wir haben den Ausgang der<br />
Referenden in Frankreich und den Niederlanden zur Kenntnis genommen.<br />
Wir sind der Auffassung, dass hierdurch das Engagement der Bürger<br />
für das europäische Aufbauwerk nicht in Frage gestellt wird. Die<br />
Bürger haben jedoch Bedenken und Ängste zum Ausdruck gebracht,<br />
denen Rechnung getragen werden muss. Es ist daher notwendig, die<br />
Lage gemeinsam zu überdenken.“ Das Ende des Ratifizierungsverfahrens<br />
verschoben sie auf Mitte 2007.<br />
Rome: A town that wasn’t built in a day<br />
Terroranschläge in Europa wie die Anschläge vom 11. März 2004 auf<br />
Vorortzüge in Madrid und am 7. Juli 2005 auf das U-Bahn- und Busnetz<br />
von London lassen die Europäische Union näher zusammenrücken und<br />
Naturkatastrophen wie die Tsunami-Welle vom 26. Dezember 2004 in<br />
Asien erfordern nicht zuletzt wegen der zahlreichen betroffenen Europäer<br />
eine europäische Antwort. So haben die Staats- und Regierungschefs<br />
der Europäischen Union auf ihrem Treffen im März 2004 in Brüssel<br />
die „Solidaritätsklausel“ aus Artikel 43 der Europäischen Verfassung<br />
bereits der Ratifizierung vorgezogen. Im Juni 2004 einigten sich die<br />
25 europäischen Fachminister auf die von Artikel 41 vorgesehenen Einrichtung<br />
der Europäischen Verteidigungsagentur mit Sitz in Brüssel. Der<br />
im Januar 2005 einberufene Sonderrat der Außen-, Gesundheits- und Entwicklungsminister<br />
zur Situation in Asien behandelte zudem Fragen, die<br />
den Ausbau der konsularischen Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten<br />
betrafen und in der Konsequenz den von der Verfassung vorgesehenen<br />
Aufbau eines Europäischen Auswärtigen Dienstes beschleunigen. Die<br />
Schattenseiten des Politikalltags zeigen also, dass unabhängig von dem<br />
Ausgang des Annahmeverfahrens die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen<br />
auf der Grundlage des Verfassungstextes erfolgen wird. Die<br />
Inhalte der Verfassung sind damit ein europäisches Produkt von bleibender<br />
Aktualität. Weder die Väter der Verfassung noch die nachfolgenden<br />
23<br />
Vgl. Victor/Kreickenbaum 2005.<br />
Kampfer 5
Politiker und Diplomaten werden das Ziel aus den Augen verlieren, die<br />
Ratifikationsurkunden aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
„bei der Regierung der Italienischen Republik“ 24 in Rom zu hinterlegen.<br />
25 Ansonsten wird die Verfassung in Einzelteile zerlegt und in Brüssel<br />
am Volk vorbei Schritt für Schritt umgesetzt. 26<br />
Literatur: Däubler-Gmelin, Herta/Mohr, Irina (Hrsg.): Recht schafft Zukunft. Perspektiven der<br />
Rechtspolitik in einer globalisierten Welt – Bonn. Europäische Kommission (2004a): Flash EB<br />
159/1 „The Future European Constitution“, Januar/Februar 2004 – Brüssel. Europäische Kommission<br />
(2004b): Flash EB159/2 „The Future European Constitution“, Juni/Juli 2004 – Brüssel.<br />
Europäische Kommission (2005a): The Future Constitutional Treaty – First Results, Eurobarometer<br />
Special 214, November 2004 – Brüssel. Europäische Kommission (2005b): Flash EB168<br />
„The European Constitution: post-Referendum Spain“, Report, Februar/März 2005 – Brüssel.<br />
Pernice, Ingolf (2003): Welche Verfassung braucht Europa?, in: Däubler-Gmelin, Herta/Mohr,<br />
Irina (Hrsg.): Recht schafft Zukunft. Perspektiven der Rechtspolitik in einer globalisierten Welt<br />
– Bonn, S. 100–111. Richter, Emanuel (2003): Ein republikanischer Aufbruch für Europa? –<br />
Demokratietheorethische Anmerkungen zum „Europäischen Konvent“, in: Berliner Debatte Initial<br />
14 (2003) 1, S. 16–33. Rübel, Jan (2004): Das gallische Dorf in der Eifel – Strempt stimmt<br />
über EU-Verfassung ab: symbolisch und ganz ernst, in: DIE WELT vom 8. Juni 2004. Victor,<br />
Jörg/Kreickenbaum, Martin (2005): Niederlande. EU-Verfassung scheitert an sozialem Widerstand,<br />
unter: http://www.wsws.org/2005/jun2005/hall-j04.shtml (23.06.2005). Zentrum für Wirtschaft<br />
und Politik (2004): Sagen wir zur europäischen Verfassung Ja oder Nein? – Prag.<br />
24<br />
Artikel 447 Absatz 1<br />
25<br />
In Rom werden seit den so genannten „Römischen Verträgen“ (1957) alle europäischen Verträge<br />
hinterlegt.<br />
26<br />
Neben den oben genannten Beispielen können über Vereinbarungen zwischen den europäischen<br />
Institutionen und durch Änderungen in deren Geschäftsordnungen etwa der ständige Präsident<br />
des Europäischen Rates ernannt oder durch eine Personalunion von Hohem Vertreter der<br />
GASP und dem EU-Außenkommissar das Amt des Europäischen Außenministers faktisch<br />
geschaffen werden.<br />
6
Annett Jagiela<br />
Vom Flickenteppich zur Europäischen Verfassung<br />
Die Schreckgespenster Europas sind seine Verträge. Seit dem 1. Februar<br />
2003 gilt der Vertrag von Nizza, der aus einem Sammelsurium von<br />
Verträgen besteht und das Ergebnis einer 50-jährigen Entwicklung ist.<br />
Die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union 1 (EU) wurden immer<br />
wieder überarbeitet, ergänzt oder erneuert, so dass der Vertrag von Nizza<br />
wie ein Flickenteppich erscheint: bestehend aus Hunderten von Artikeln,<br />
Protokollen und Erklärungen. Kein Wunder, dass kaum verständlich ist,<br />
was die Europäische Union überhaupt ist, wer in Europa entscheidet,<br />
wessen Rechte und Interessen diese allgegenwärtige EU vertritt und wer<br />
wofür zuständig und verantwortlich ist. Der Gesetzesdschungel behindert<br />
nicht nur ein effektives und effizientes Vorgehen zwischen den<br />
europäischen Institutionen sowie zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten.<br />
Die mangelnde Transparenz untergräbt auch sämtliche Bemühungen<br />
der Politiker, den Bürgern Europa näher zu bringen.<br />
Im Laufe der europäischen Einigung gab es viele Anläufe, die Gemeinschaft<br />
der Mitgliedstaaten zu einer handlungsfähigen wirtschaftlichen,<br />
sozialen und politischen Einheit umzugestalten. Bereits im Jahr 1953<br />
legten der französische Politiker Jean Monnet und der belgische Politiker<br />
Paul-Henri Spaak den Entwurf eines Vertrages zu Errichtung einer<br />
Satzung der Europäischen Gemeinschaft vor, welcher jedoch vom französischen<br />
Parlament abgelehnt wurde. Im Jahre 1984 präsentierte dann<br />
das Europäische Parlament den so genannten Spinelli-Entwurf für eine<br />
Verfassung der Europäischen Union. Der Entwurf hatte bereits die Form<br />
einer richtigen Verfassung. Er enthielt Grundrechte, institutionelle<br />
Bestimmungen, Ziele und Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft.<br />
Leider interessierten sich die Mitgliedstaaten zu diesem Zeitpunkt<br />
nicht für den Entwurf und so landete er vorerst wieder in der<br />
Schublade. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) im Jahre<br />
1986 verpflichteten sich die Mitgliedstaaten zur Schaffung des europäischen<br />
Binnenmarktes. Die zunehmende Integration erzeugte einen institutionellen<br />
Reformdruck, wodurch allmählich der Weg zu einem neuen<br />
Vertrag geebnet wurde: dem Vertrag von Maastricht, der für die Grundsteinlegung<br />
des Euro bekannt ist. 1995 machte die Erweiterung um drei<br />
1<br />
Die wichtigsten Grundlagen waren der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und<br />
Stahl (1951), der Vertrag über die Europäischen Gemeinschaften (1957), die Einheitliche Europäische<br />
Akte (1986) sowie die Verträge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997).<br />
Jagiela 7
Einführung<br />
Länder (Österreich, Finnland und Schweden) eine erneute Überarbeitung<br />
der Verträge notwendig. Außerdem stand die wohl bisher größte<br />
Herausforderung der EU vor der Tür: die Erweiterung der EU um zehn<br />
Mitgliedstaaten. Für diesen historischen Schritt mussten die europäischen<br />
Institutionen und Entscheidungsverfahren reformiert werden,<br />
denn schließlich kann eine „EU der 25“ nicht mit denselben Strukturen<br />
operieren wie eine EU mit nur 15 Staaten. Der Vertrag von Amsterdam<br />
sollte Abhilfe schaffen. Doch wurde in Amsterdam viel über den „Stabilitäts-<br />
und Wachstumspakt“ 2 gestritten und nur wenig über die wichtigen<br />
Erweiterungsfragen gesprochen: Wie groß soll die Europäische Kommission<br />
zukünftig sein? Wie sollen die Stimmen der kleinen und der großen<br />
Staaten im Ministerrat gewichtet werden? Und in welchen Politikbereichen<br />
soll statt des Konsenses die Mehrheit entscheiden? Diese Fragen<br />
wurden fortan als „Left-overs von Amsterdam“ bezeichnet und<br />
mussten auf der nächsten Regierungskonferenz behandelt werden, die<br />
im Jahre 2001 mit dem Vertrag von Nizza und vielen frustrierten Staatsund<br />
Regierungschefs endete. Nein, auch in Nizza konnten die Umbauarbeiten<br />
für ein Europahaus mit 25 neuen Mitgliedstaaten nicht vollendet<br />
werden.<br />
Der Konvent zur Zukunft Europas<br />
Angesichts der Unfähigkeit der Staats- und Regierungschefs, Kompromisse<br />
zu finden, wurde ein neues Gremium geschaffen: der Konvent zur<br />
Zukunft Europas. Die Aufgaben des Konvents waren, die bestehenden<br />
Verträge zu vereinfachen, die Aufgabenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten<br />
und der EU neu zu regeln, den Status der Grundrechtecharta<br />
zu klären und über eine stärkere Integration der nationalen Parlamente<br />
nachzudenken, kurzum, für mehr Effizienz, Transparenz und Demokratie<br />
in der EU zu sorgen. 3 Der Konvent setzte sich aus einem Plenum<br />
und einem Präsidium zusammen und bestand aus 102 Mitgliedern:<br />
15 Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten, 30 nationalen Parlamentsabgeordneten,<br />
16 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, 2 Mitgliedern<br />
der Kommission sowie 13 Regierungsvertretern und 26 Parlamentsabgeordneten<br />
der Beitrittsländer ohne Stimmrecht. Auf diese<br />
Weise wurden vier Ebenen der Legitimation eingebunden: So vertraten<br />
2<br />
Vgl. hierzu ausführlicher den entsprechenden Abschnitt im Glossar dieses Buches.<br />
3<br />
Vgl. 6. Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union (Laeken) S. 367-374 und III. Einberufung<br />
eines Konvents zur Zukunft Europas, in: Läufer 2002, S. 375-377.<br />
8 Jagiela
Einführung<br />
die nationalen Parlamentarier die Bürger der Mitgliedstaaten und die<br />
Europaparlamentarier das Volk der Union. Die Vertreter der Regierungen<br />
repräsentierten nationalstaatliche Interessen und die Vertreter der<br />
Kommission das europäische Gemeinschaftsinteresse. Mit 72 Personen<br />
waren die Parlamentarier im Plenum eindeutig in der Mehrheit und trugen<br />
damit zur Bürgernähe des Konvents bei.<br />
Im Präsidium war dies nicht der Fall. Hier waren die Parlamentarier in<br />
der Minderheit. Das Präsidium bestand aus zwölf Personen: dem Präsidenten<br />
des Konvents Valéry Giscard d’Estaing und seinen zwei Stellvertretern<br />
Giuliano Amato und Jean-Luc Dehaene. Diesen drei standen<br />
neun Mitglieder des Plenums zur Seite: drei Regierungsvertreter, zwei<br />
Mitglieder der Europäischen Kommission, zwei Vertreter der nationalen<br />
Parlamente und zwei Vertreter des Europäischen Parlamentes.<br />
Das Plenum<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
16 Europa-Abgeordnete<br />
15 Regierungsvertreter<br />
(je einer pro EU-Staat)<br />
30 Nationale Abgeordnete<br />
(je zwei pro EU-Staat)<br />
2 EU-Kommissare<br />
Mitspracherecht aber kein<br />
Mitentscheidungsrecht<br />
13 Regierungsvertreter<br />
der Kandidaten-Staaten<br />
26 Abgeordnete<br />
der Kandidaten-Staaten<br />
Darstellung nach: http://www.auswaertiges-amt.de/konvent<br />
Arbeitsweise des Verfassungskonvents<br />
Die Arbeitsweise des Konvents wurde nicht nur durch die große Anzahl<br />
der Parlamentarier, sondern auch durch die öffentlichen und transparenten<br />
Plenartagungen sowie die Beteiligung der Zivilgesellschaft<br />
Jagiela 9
Einführung<br />
geprägt. 4 Alle Plenartagungen waren öffentlich und können noch heute<br />
im Internet unter http://www.european-convention.eu.int nachvollzogen<br />
werden.<br />
Im Plenum wurden Konzepte und Textvorschläge für die zukünftige Verfassung<br />
diskutiert. Die Konventsmitglieder konnten dabei Reden oder<br />
Gegenreden halten, Unterschriftensammlungen oder Resolutionen präsentieren.<br />
5 Inhaltliche Arbeit wurde aber vor allem in den Arbeitsgruppen<br />
und Arbeitskreisen des Konvents geleistet. 6 Deren Ergebnisse wurden<br />
dann im Plenum vorgestellt und beraten.<br />
Die Aufgaben des Präsidiums waren, die Regeln für die Arbeitsweise<br />
des Konvents festzulegen, Textvorschläge für Verfassungsartikel zu<br />
erarbeiten, Plenartagungen vorzubereiten und die Debatten des Plenums<br />
auszuwerten. Im Gegensatz zum Plenum tagte das Präsidium nicht<br />
öffentlich.<br />
Um die Arbeit im Konvent strukturiert voranzutreiben, wurde die<br />
16-monatige Arbeitszeit in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase<br />
(28. Februar 2002 bis 12. Juni 2002) übten sich die Delegierten im<br />
Zuhören und „Brainstormen“. In einer großen allgemeinen Debatte wurden<br />
Ziele und Ideen bezüglich der europäischen Institutionen, Aufgaben<br />
und Ent-scheidungsmechanismen ausgetauscht. Hier hatten auch zivilgesellschaftliche<br />
Organisationen die Möglichkeit sich einzubringen. Die<br />
Konventsmitglieder entschieden sich auch schon am Anfang dazu, nicht<br />
nur – wie von den Staats- und Regierungschefs ursprünglich gefordert –<br />
Empfehlungen für die nächste Regierungskonferenz zu erarbeiten. Sie<br />
einigten sich vielmehr darauf, am Ende ihrer Konventsarbeit einen<br />
umfassenden europäischen Verfassungsentwurf zu präsentieren. 7<br />
In der zweiten Phase (12. Juni 2002 bis 6. Februar 2003) entwickelte der<br />
Konvent eine Eigendynamik. Die Konventsmitglieder wollten endlich<br />
mit der konkreten Textarbeit beginnen. Das zeigte sich an den verschiedenen<br />
Positionspapieren und ersten Verfassungsentwürfen, welche das<br />
Präsidium unter Zugzwang setzten. Deshalb präsentierte Giscard<br />
4<br />
Vgl. das Interview mit dem deutschen Konventsmitglied Jürgen Meyer: „Langfristig werden<br />
die europäischen Entscheidungen auf das Parlament und den Rat übergehen.“, unter:<br />
http://www.das-parlament.de/2003/45/Thema/002.html (20.06.2005).<br />
5<br />
Vgl. Brok/Selmayr 2004, 679.<br />
6<br />
Die Konventsmitglieder arbeiteten in elf Arbeitsgruppen und drei kleineren Arbeitskreisen, die<br />
vom Präsidium eingesetzt wurden. Sie tagten insgesamt 86-mal. Das Präsidium konnte auf insgesamt<br />
50 Sitzungen und das Plenum auf 27 Sitzungen zurückschauen.<br />
7<br />
Vgl. Brok/Selmayr 2004, 678.<br />
10 Jagiela
Einführung<br />
d’Estaing schon am 28. Oktober 2002 einen „Vorentwurf des Verfassungsvertrages“,<br />
obwohl er eigentlich die Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />
im Januar 2003 abwarten wollte. 8 Ausgehend von diesen ersten Entwürfen<br />
beschäftigten sich die Konventsmitglieder mit Ordnungs- und<br />
Strukturfragen: Wie sollte die Verfassung aufgebaut sein? Wo sollte die<br />
Grundrechtecharta eingebaut werden? In dieser Phase wurde jedoch<br />
noch nicht über die Reform der Institutionen gesprochen. Auch debattierten<br />
die Delegierten noch nicht über die einzelnen Politikbereiche,<br />
wie zum Beispiel die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
(GASP). Diese Diskussionen wurden vom Konventspräsidium aus strategischen<br />
Gründen in die dritte Phase verschoben. So sollten unruhige<br />
Debatten vorerst verhindert werden, denn institutionelle Reformen sind<br />
immer auch Machtfragen zwischen den Institutionen der Europäischen<br />
Union, aber auch zwischen den Mitgliedstaaten und der EU.<br />
Doch auch diese Machtfragen mussten letztlich angepackt werden: In<br />
der dritten und letzten Phase (27. Februar 2003 bis 14. Juni 2003) wurden<br />
alle relevanten Vorschläge und verbleibenden „heißen Eisen“ analysiert<br />
und auf ihre politische Durchsetzbarkeit hin geprüft. Dies erfolgte<br />
in unerwarteter Disziplin in Anbetracht der noch verbleibenden kurzen<br />
Zeit.<br />
Obgleich die Konventsmitglieder noch uneinig über den Aufbau und die<br />
zukünftige Arbeitsweise der europäischen Institutionen und die Entscheidungsverfahren<br />
waren, nahmen sie am 13. Juni 2003 im Konsensverfahren<br />
ein vorläufiges Schlussdokument an. Diesen Entwurf für eine<br />
Verfassung für Europa überreichte der Konventspräsident Valéry Giscard<br />
d’Estaing am 20. Juni 2003 den Staats- und Regierungschefs in<br />
Thessaloniki (Griechenland). Vollständigkeit erlangte der Entwurf erst<br />
am 10. Juli 2003, nachdem auch Teil III der Verfassung (Die Politikbereiche<br />
und die Arbeitsweise der Union) vom Verfassungskonvent angenommen<br />
wurde.<br />
Nach der Übergabe des Verfassungsentwurfes lag das Schicksal der EU<br />
wieder in den Händen der Staats- und Regierungschefs: beim Gipfeltreffen<br />
in Brüssel im Dezember 2003. Hier sollte der Konventsentwurf einstimmig<br />
angenommen werden. Doch die Verhandlungen waren kompliziert.<br />
Da der Konventsentwurf ein sehr engmaschiges und in sich<br />
8<br />
Vgl. Göler 2003, 17 f. Beispiele sind u.a. der Entwurf der EVP „Eine Verfassung für ein starkes<br />
Europa“, das Dokument der SPE „Priorities for Europe“, das Grundlagenpapier der Europäischen<br />
Kommission sowie das Memorandum der Benelux-Staaten.<br />
Jagiela 11
Einführung<br />
zusammenhängendes Dokument war, erwies es sich als schwierig, einzelne<br />
Elemente herauszunehmen oder gar auszutauschen. Eine komplette<br />
Ablehnung des Entwurfes wäre undenkbar gewesen, da dieser von<br />
einem so stark legitimierten Gremium verhandelt und geschrieben worden<br />
war. Obwohl die Mehrheit der Staatsoberhäupter dem Konventsentwurf<br />
grundsätzlich zustimmte, konnte im Dezember noch keine Einigung<br />
erzielt werden. Spanien und Polen hielten an einer in Nizza vereinbarten<br />
Regelung zur Stimmengewichtung im Ministerrat fest, obgleich<br />
mit den damals vereinbarten hohen Hürden Beschlüsse im Ministerrat<br />
bei 25 Mitgliedstaaten eine Seltenheit geworden wären. Schließlich<br />
machte die irische Regierung einen erneuten Einigungsversuch – mit<br />
Erfolg. Dank der guten Verhandlungsführung des irischen Ministerpräsidenten<br />
Bertie Ahern wurde im Juni 2004 die Verfassung von den Staatsund<br />
Regierungschefs angenommen. 9<br />
Inhalt und Streitpunkte der Verfassung<br />
Die Verfassung besteht aus zwei Präambeln, vier Teilen, 36 Protokollen<br />
und 50 Erklärungen und gehört damit zu den längsten Verfassungen der<br />
Welt 10 , doch besticht sie im Vergleich zum Vertrag von Nizza durch ihre<br />
Übersichtlichkeit. Mit der Verfassung wird das bestehende Vertragschaos<br />
beendet, denn alles Wichtige steht nun in nur einem Dokument.<br />
Gestritten wurde über die Verfassung bereits bei dem Text der Präambel.<br />
Hier ging es um den so genannten Gottesbezug. Während die französischen<br />
Delegierten jede Erwähnung Gottes oder des Wortes „Religion“<br />
strikt ablehnten, hatten sich die polnischen und italienischen Konventsmitglieder<br />
einen solchen Verweis gewünscht. Der katholische Glauben<br />
spielt in Polen und Italien eine wichtige integrative und kulturelle Rolle.<br />
In Frankreich dagegen ist eine Vermischung von Politik und Religion<br />
nicht erwünscht. Letztlich setzten sich die Franzosen durch.<br />
Im ersten Teil der Verfassung geht es um die Werte, Ziele, Finanzen und<br />
die Institutionen der EU, aber auch darum, welche Aufgaben die Union<br />
und welche die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. Hier steht auch, wie<br />
diese Kompetenzen ausgeübt werden und welche Instrumente der Union<br />
und den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, um ihre Ziele zu errei-<br />
9<br />
Irland übernahm nach Italien von Januar bis Juni 2004 die EU-Ratspräsidentschaft und war<br />
somit für die Verhandlungen zuständig. Vgl. auch Prange 2004.<br />
10<br />
Während die Protokolle rechtliche und verbindliche Bestandteile des Verfassungsentwurfes<br />
sind, sind die beiden Erklärungen eher als eine Art Versprechen zu verstehen. Zu den Präambeln<br />
siehe die Texte von Kristian Kampfer in diesem Band.<br />
12 Jagiela
Einführung<br />
chen. 11 Daneben gibt es zudem einen „Rauswurfartikel“ und einen<br />
„Scheidungsparagrafen“. Der „Rauswurfartikel“ besagt, dass sich die<br />
EU von einem Staat trennen kann, wenn dieses Mitglied die Werte und<br />
Ziele der Union verletzt. Der „Scheidungsparagraf“ regelt erstmals den<br />
freiwilligen Austritt eines Mitgliedstaates aus der Europäischen Union. 12<br />
Zu den wichtigsten Neuerungen im ersten Teil der Verfassung gehören<br />
die Schaffung des Postens eines Außenministers, die Zusammensetzung<br />
der Kommission sowie die so genannte „doppelte Mehrheit“. Der neue<br />
europäische Außenminister wird zukünftig nicht nur den Vorsitz im Rat<br />
der Außenminister leiten, sondern auch der Vizepräsident der Kommission<br />
sein. Es ist abzuwarten, inwiefern dieser Posten zu einer stärkeren<br />
politischen Integration im Bereich der GASP beitragen kann. 13 Um die<br />
Zusammensetzung der Kommission wurde lange gestritten. Bisher galt:<br />
ein Land, ein Kommissar. Ab 2014 wird die Kommission jedoch nur<br />
noch aus 18 Personen bestehen. Besonders die kleineren Staaten hatten<br />
sich lange gegen diese neue Regelung gewehrt, aus Angst benachteiligt<br />
zu werden. Am heftigsten wurde jedoch das Prinzip der „doppelten<br />
Mehrheit“ angegriffen. Zukünftig müssen im Ministerrat 55 % (15 von<br />
25 Staaten) der Staaten für eine Initiative stimmen. Zugleich muss diese<br />
Mehrheit mindestens 65 % der europäischen Bevölkerung repräsentieren.<br />
Damit zerfällt das Konzept der nationalen Stimmengewichtung.<br />
Jedes Land hat zukünftig nur eine Stimme im Ministerrat, wobei aber<br />
nunmehr die Bevölkerungsanzahl jedes Landes ebenfalls in die Waagschale<br />
geworfen wird. 14<br />
Ein weiterer Streitpunkt war die Frage, in welchen Politikbereichen mit<br />
dieser neuen Regelung abgestimmt werden sollte. Die Neuerung der<br />
„doppelten Mehrheit“ bereitete vor allem der polnischen Regierung<br />
Bauchschmerzen. 15 Polen konnte jedoch am Ende davon überzeugt<br />
werden, dass diese Regelung für mehr Effektivität in der EU sorgen<br />
kann.<br />
Im zweiten Teil der Verfassung fand die vom Grundrechtekonvent<br />
bereits in den Jahren 1999 und 2000 erarbeitete Grundrechtecharta ihren<br />
Platz. 16 Jagiela 13<br />
11<br />
Vgl. die Texte von Christian Wenning, Florian Ziegenbalg und Stefan Evers in diesem Band.<br />
12<br />
Vgl. den Text von Florentina Bodnari in diesem Band.<br />
13<br />
Vgl. den Text von Anna Lührmann und Tina Löffelsend in diesem Band.<br />
14<br />
Vgl. den Text von Beatrice Kolp in diesem Band.<br />
15<br />
Vgl. Lang/Maurer 2003, 2 f.<br />
16<br />
Vgl. den Text von Stephan Korte in diesem Band.
Einführung<br />
Im dritten Teil der Verfassung geht es „ans Eingemachte“. Dort steht das<br />
„Wer, Wie, Wo und Wann“ der Europapolitik. Hier werden die einzelnen<br />
Politikfelder separat aufgeführt und es wird erklärt, welche Institutionen<br />
– ob europäische oder mitgliedstaatliche – wann und wie für die Erfüllung<br />
von Aufgaben verantwortlich sind. Zum Beispiel koordinieren die<br />
Mitgliedstaaten bei der Beschäftigungs- und Sozialpolitik ihre Arbeit.<br />
Bei der Geldpolitik haben einige hingegen nichts zu sagen. Hier ist ausschließlich<br />
die EU über das Europäische System der Zentralbanken<br />
zuständig.<br />
Im vierten und letzten Teil der Verfassung finden sich die so genannten<br />
„Schlussbestimmungen“. Hier steht, wann die Verfassung in Kraft tritt:<br />
wenn sie von jedem Mitgliedstaat nach dem dort vorgeschriebenen Verfahren<br />
ratifiziert wurde. Damit ist klar, dass die Parlamente aller Mitgliedstaaten<br />
der Verfassung zustimmen müssen (parlamentarisches Verfahren)<br />
und in vielen Staaten dazu noch das Volk gefragt wird (Referenden).<br />
Außerdem gibt es im Anhang der Verfassung Erklärungen und Protokolle.<br />
So heißt es beispielsweise in der Erklärung Nr. 30 zur Ratifikation<br />
der Verfassung, dass im Falle von Schwierigkeiten bei der Ratifikation<br />
sich der Europäische Rat mit der Frage des weiteren Vorgehens befassen<br />
wird.<br />
Die Ratifizierung der Verfassung – der Weg ist das Ziel<br />
Als im Jahr 1957 die Römischen Verträge von sechs Gründerstaaten unterzeichnet<br />
worden waren, dauerte es nur acht Monate, bis die Verträge<br />
im Januar 1958 in Kraft treten konnten. Heute – mit 25 Mitgliedstaaten<br />
und einer weit größeren Verhandlungsmasse – geht dies nicht mehr so<br />
einfach. Oft wird argumentiert, dass Referenda „Risikofaktoren“ für den<br />
Ratifizierungsprozess darstellten und es besser wäre, die Ratifizierung<br />
zuerst in „sicheren“ Staaten durchzuführen, um so ein positives Signal in<br />
die anderen Mitgliedstaaten zu senden. Diese Annahmen signalisieren<br />
jedoch ein starkes Misstrauen gegenüber den europäischen Bürgerinnen und<br />
Bürgern und sie erwiesen sich zum Teil auch als falsch im Ratifizierungsprozess<br />
der Europäischen Verfassung. Obwohl neun Länder 17 die Verfassung<br />
im Mai 2005 bereits angenommen hatten, lehnten die Franzosen und<br />
die Niederländer bei ihren jeweiligen Volksbefragungen die Europäische<br />
17<br />
Litauen, Ungarn, Slowenien, Italien, Griechenland, die Slowakei, Spanien, Österreich und<br />
Deutschland hatten die Verfassung bereits angenommen. Dabei war Spanien das einzige Land,<br />
das ein Referendum durchführte. Bei einer Wahlbeteiligung von 42 % votierten 77 % der Spanier<br />
für die Verfassung.<br />
14 Jagiela
Einführung<br />
Verfassung ab. 54,9 % der Franzosen votierten mit „Non“ und 61,6 % der<br />
Niederländer wählten „Nee“. Insbesondere die Entscheidung Frankreichs –<br />
Gründer und Motor der Europäischen Union – verursachte schiere Ratlosigkeit<br />
und Unsicherheit. Die Ankündigung Großbritanniens, das geplante<br />
Referendum auszusetzen, und die schlechten Umfragewerte in den noch<br />
unentschiedenen Mitgliedstaaten ließen Portugal, Irland, Schweden, Finnland,<br />
Dänemark und die Tschechische Republik dem Beispiel Großbritanniens<br />
folgen. Belgien, Estland, Malta und Zypern hielten hingegen an ihren<br />
Ratifizierungsplänen fest.<br />
Der Brüsseler Gipfel im Juni 2005 sorgte dann für den Rest. Hier ging es<br />
vor allem um die Finanzplanung für 2007–2013 und um die Frage: Wie<br />
weiter mit dem Ratifizierungsprozess? Der Gipfel endete wieder einmal mit<br />
frustrierten Staats- und Regierungschefs und einer „Krise“ der Europäischen<br />
Union. 18<br />
Themen wie der Briten-Rabatt, Strukturhilfen und Agrarsubventionen<br />
waren leider noch nie populäre Schlagzeilen – nicht zuletzt weil es sich hier<br />
um komplizierte Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten handelt, denn<br />
die Frage des Geldes gehört immer noch zu den „heiligen“ nationalstaatlichen<br />
Entscheidungskompetenzen. Vielleicht brauchte es aber die Europäische<br />
Verfassung, um über diese grundlegenden Fragen der europäischen<br />
Verteilungsgerechtigkeit, Solidarität und Demokratie nachzudenken. Dafür<br />
verordneten sich die Staats- und Regierungschefs eine „Denkpause“ bis<br />
Mitte 2007.<br />
Literatur: Bouc, Frantisek (2004): Disunion, unter: http://www.praguepost.com/P03/2004/Art/<br />
1111/news1.php (20.06.2005). Brok, Elmar/Selmayr, Martin (2004): EU-Verfassungskonvent und<br />
Regierungskonferenz: Monnet oder Metternich?, in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Die Europäische<br />
Union. Politisches System und Politikbereich – Bonn, S. 675–680. Göler, Daniel (2003): Die Europäische<br />
Union vor ihrer Konstitutionalisierung: Eine Bilanz der ersten Verfassungsentwürfe, in: Integration,<br />
H. 1, S. 17–19. Lang, Kai-Olaf/Maurer, Andreas (2003): Polens Gewicht und die doppelte<br />
Mehrheit. Vor dem Endspiel der Regierungskonferenz, unter: http://www.swp-berlin.org/common/<br />
get_document.php?id=570 (20.06.2005). Läufer, Thomas (Hrsg.) (2002): Der Vertrag von Nizza.<br />
Die EU der 25 (Bundeszentrale für politische Bildung) – Bonn. Prange, Sven (2004): Viel Glanz<br />
und ein bisschen Schatten, unter: http://www.europa-digital.de/laender/irl/eu_pol/praes04/bilanz.shtml<br />
(20.06.2005). Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2004): Die Europäische Union. Politisches System und<br />
Politikbereich – Bonn.<br />
18<br />
Während einige Mitgliedstaaten endlich den so genannten Briten-Rabatt streichen wollten, gab<br />
es diesbezüglich selbstverständlich Vorbehalte auf britischer Seite. Premierminister Tony Blair<br />
wollte sich nur dann auf Verhandlungen einlassen, wenn gleichzeitig auch über die Agrarsubventionen<br />
und Strukturhilfen verhandelt werden würde. Deutschland und Frankreich lehnten<br />
dies vehement ab.<br />
Jagiela 15
Einführung<br />
Der Annahme-Marathon zur Europäischen Verfassung<br />
16 Jagiela/Kampfer<br />
– Die 25 Länder in zeitlicher Reihenfolge –<br />
Mitgliedstaat Wie? Wann? Erfahrung mit Erfolg?<br />
Referenden?<br />
Litauen Parlament P: 11.11.04 2003 EU-Beitritt Ja Nein<br />
Ungarn Parlament P: 20.12.04 2003 EU-Beitritt Ja Nein<br />
Slowenien Parlament P: 01.02.05 2003 EU-Beitritt Ja Nein<br />
Italien Parlament P: 06.04.05 Keine Ja Nein<br />
Griechenland Parlament P: 19.04.05 Keine Ja Nein<br />
Slowakei Parlament P: 11.05.05 2003 EU-Beitritt Ja Nein<br />
Spanien Parlament & k. P: 18.05.05 2005 Europäische Ja Nein<br />
Referendum R: 20.02.05 Verfassung<br />
Österreich Parlament P: 25.05.05 1994 EU-Beitritt Ja Nein<br />
Deutschland Parlament P: 27.05. 2005 Keine Ja Nein<br />
Frankreich Parlament & P: ausgesetzt 1972 EU-Erweiterung, Ja Nein<br />
Referendum R: 29.05.05 1992 Maastricht<br />
Niederlande Parlament & k. P: ausgesetzt Keine Ja Nein<br />
Referendum R: 01.06.05<br />
Lettland Parlament P: 2. Juni 2005 2003 EU-Beitritt Ja/Nein<br />
(R. unwahrsch.)<br />
Zypern Parlament P: 30. Juni 05 Keine Ja/Nein<br />
Estland Parlament P: noch unklar 2003 EU-Beitritt Ja/Nein<br />
(R. unwahrsch.)<br />
Malta Parlament P: 6. Juli 05 2003 EU-Beitritt Ja/Nein<br />
Luxemburg Parlament & k. P: noch unklar Keine Ja/Nein<br />
Referendum R: 10.07.2005 (R. erfolgreich)<br />
Belgien Parlament P: noch unklar Keine Ja/Nein<br />
(R. unwahrsch.) Mitte/Ende 2005<br />
Tschechische Parlament & P: noch unklar 2003 EU-Beitritt Ja/Nein<br />
Republik Referendum R: voraussichtlich<br />
Ende 2006/<br />
Anfang 2007<br />
Polen Parlament & P: noch unklar 2003 EU-Beitritt Ja/Nein<br />
Referendum R: ausgesetzt
Einführung<br />
Mitgliedstaat Wie? Wann? Erfahrung mit Erfolg?<br />
Referenden?<br />
Dänemark Parlament & P: noch unklar 1972 EU-Beitritt, Ja/Nein<br />
Referendum R: ausgesetzt 1986 Einheitliche<br />
Europäische Akte,<br />
1992 Maastricht,<br />
1998 Amsterdam,<br />
2000 Euroeinführung<br />
Portugal Parlament & P: noch unklar Keine Ja/Nein<br />
Referendum R: ausgesetzt<br />
Schweden Parlament P: ausgesetzt 1994 EU-Beitritt und Ja/Nein<br />
2003 Euro (jeweils<br />
konsultativ)<br />
Finnland Parlament P: ausgesetzt 1994 EU-Beitritt (k.R.) Ja/Nein<br />
Irland Parlament & P: noch unklar 1972 EU-Beitritt, Ja/Nein<br />
Referendum R: ausgesetzt 1987 Einheitliche<br />
Europäische Akte,<br />
1992 Maastricht,<br />
1998 Amsterdam,<br />
2001/2002 Nizza<br />
Groß- Parlament & k. P: noch unklar 1975 weitere Mitgliedbritannien<br />
Referendum R: ausgesetzt schaft in der EG Ja/Nein<br />
Erläuterungen<br />
unwahrsch.: unwahrscheinlich<br />
P: Parlament (parlamentarisches Verfahren)<br />
R: Referendum (Abstimmung des Volkes)<br />
k.:<br />
konsultativ (nicht bindend)<br />
Hervorgehoben: Referenden und Zeitpunkt ihrer Durchführung<br />
17
Abkürzungen<br />
ABl.<br />
Amtsblatt (der EG)<br />
AdR<br />
Ausschuss der Regionen<br />
AStV<br />
Ausschuss der Ständigen Vertreter<br />
BGBl.<br />
Bundesgesetzblatt<br />
BIP<br />
Bruttoinlandsprodukt<br />
BSP<br />
Bruttosozialprodukt<br />
BVerfG Bundesverfassungsgericht<br />
EAG<br />
Europäische Atomgemeinschaft (Euratom)<br />
EEA<br />
Einheitliche Europäische Akte<br />
EGV/EG-Vertrag Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften<br />
EGKS<br />
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl<br />
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte<br />
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention<br />
EP<br />
Europäisches Parlament<br />
ER<br />
Europäischer Rat<br />
ESVP<br />
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
ESZB<br />
Europäisches System der Zentralbanken<br />
EuG<br />
Gericht erster Instanz<br />
EuGH<br />
Europäischer Gerichtshof<br />
Eurojust Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit<br />
Europol Europäisches Polizeiamt<br />
Eurostat Statistisches Amt der EU<br />
EUV/EU-Vertrag Vertrag über die Europäische Union<br />
EVP<br />
Europäisches Volkspartei (EP)<br />
EWG<br />
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
EZB<br />
Europäische Zentralbank<br />
GASP<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
GG<br />
Grundgesetz<br />
GSVP<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
NATO<br />
North Atlantic Treaty Organization<br />
NOA<br />
Nicht-obligatorische Ausgaben<br />
OA<br />
Obligatorische Ausgaben<br />
RFSR<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Rs.<br />
Rechtssache<br />
SPE<br />
Sozialdemokratische Partei Europas (EP)<br />
SIS<br />
Schengener Informationssystem<br />
StGB<br />
Strafgesetzbuch<br />
VZ<br />
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
WEU<br />
Westeuropäische Union<br />
WSA<br />
Wirtschafts- und Sozialausschuss<br />
18
VERTRAG ÜBER EINE<br />
<strong>VERFASSUNG</strong> FÜR <strong>EUROPA</strong><br />
(Teil I, II und IV)
Verfassung für Europa<br />
PRÄAMBEL<br />
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER TSCHE-<br />
CHISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,<br />
DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSI-<br />
DENT DER REPUBLIK ESTLAND, DER PRÄSIDENT DER HELLENISCHEN<br />
REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT<br />
DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DIE PRÄSIDENTIN IRLANDS, DER PRÄ-<br />
SIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK<br />
ZYPERN, DIE PRÄSIDENTIN DER REPUBLIK LETTLAND, DER PRÄSIDENT<br />
DER REPUBLIK LITAUEN, SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHER-<br />
ZOG VON LUXEMBURG, DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK UNGARN, DER<br />
PRÄSIDENT MALTAS, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,<br />
DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, DER PRÄSIDENT<br />
DER REPUBLIK POLEN, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPU-<br />
BLIK, DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK SLOWENIEN, DER PRÄSIDENT DER<br />
SLOWAKISCHEN REPUBLIK, DIE PRÄSIDENTIN DER REPUBLIK FINNLAND,<br />
DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN, IHRE MAJESTÄT DIE<br />
KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND<br />
NORDIRLAND,<br />
SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus<br />
dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit,<br />
Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt<br />
haben,<br />
IN DER ÜBERZEUGUNG, dass ein nach schmerzlichen Erfahrungen nunmehr geeintes<br />
Europa auf dem Weg der Zivilisation, des Fortschritts und des Wohlstands zum<br />
Wohl aller seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der Ärmsten, weiter voranschreiten<br />
will, dass es ein Kontinent bleiben will, der offen ist für Kultur, Wissen und<br />
sozialen Fortschritt, dass es Demokratie und Transparenz als Grundlage seines öffentlichen<br />
Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken<br />
will,<br />
IN DER GEWISSHEIT, dass die Völker Europas, stolz auf ihre nationale Identität und<br />
Geschichte, entschlossen sind, die alten Gegensätze zu überwinden und immer enger<br />
vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten,<br />
IN DER GEWISSHEIT, dass Europa, „in Vielfalt geeint“, ihnen die besten Möglichkeiten<br />
bietet, unter Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer Verantwortung<br />
gegenüber den künftigen Generationen und der Erde dieses große Unterfangen<br />
fortzusetzen, das einen Raum eröffnet, in dem sich die Hoffnung der Menschen<br />
entfalten kann,<br />
20
Präambel<br />
Verfassung für Europa<br />
ENTSCHLOSSEN, das Werk, das im Rahmen der Verträge zur Gründung der Europäischen<br />
Gemeinschaften und des Vertrags über die Europäische Union geschaffen<br />
wurde, unter Wahrung der Kontinuität des gemeinschaftlichen Besitzstands fortzuführen,<br />
IN WÜRDIGUNG der Leistung der Mitglieder des Europäischen Konvents, die den<br />
Entwurf dieser Verfassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten<br />
Europas erarbeitet haben –<br />
HABEN ZU BEVOLLMÄCHTIGTEN ERNANNT:<br />
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,<br />
Guy VERHOFSTADT – Premierminister<br />
Karel DE GUCHT – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK,<br />
Stanislav GROSS – Premierminister<br />
Cyril SVOBODA – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,<br />
Anders Fogh RASMUSSEN – Ministerpräsident<br />
Per Stig MØLLER – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,<br />
Gerhard SCHRÖDER – Bundeskanzler<br />
Joseph FISCHER – Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des<br />
Bundeskanzlers.<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK ESTLAND,<br />
Juhan PARTS – Premierminister<br />
Kristiina OULAND – Ministerin für auswertige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER HELLENISCHEN REPUBLIK,<br />
Kostas KARAMANLIS – Premierminister<br />
Petros G. MOLYVIATIS – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
21
Verfassung für Europa<br />
Präambel<br />
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN,<br />
José Luis RODRÌGUEZ ZAPATERO – Ministerpräsident<br />
Miguel Àngel MORATINOS CUYAUBÈ – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
und Zusammenarbeit<br />
DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,<br />
Jacques CHIRAC – Präsident<br />
Jan-Pierre RAFFARIN – Premierminister<br />
Michel BARNIER – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DIE PRÄSIDENTIN IRLANDS,<br />
Bertie AHERN – Premierminister (Taoiseach)<br />
Dermot AHERN – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,<br />
Silvio BERLUSCONI – Ministerpräsident<br />
Franco FRATTINI – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK ZYPERN,<br />
Tassos PAPADOPOULUS – Präsident<br />
George IACOVOU – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DIE PRÄSIDENTIN DER REPUBLIK LETTLAND,<br />
Vaira VIĶE FREIBERGA – Präsidentin<br />
Indilis EMSIS – Premierminister<br />
Artis PABRIKS – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK LITAUEN<br />
Valdas ADAMKUS – Präsident<br />
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS – Premierminister<br />
Antanas VALIONIS – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,<br />
22<br />
Jean-Claude JUNCKER – Premierminister, „Ministre d’Etat“<br />
Jean ASSELBORN – Vizepremierminister, Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
und Einwanderung
Präambel<br />
Verfassung für Europa<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK UNGARN,<br />
Ferenc GYURCSÁNY – Premierminister<br />
László KOVÁCS – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT MALTAS,<br />
The Hon Lawrence GONZI – Premierminister<br />
The Hon Michael FRENDO – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE<br />
Dr. J. P. BALKENENDE – Premierminister<br />
Dr. B. R. BOT – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,<br />
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL – Bundeskanzler<br />
Dr. Ursula PLASSNIK – Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK POLEN,<br />
Marek BELKA- Premierminister<br />
Wlodzimierz CIMOSZEWICZ – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,<br />
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES – Premierminister<br />
António Victor MARTINS MONTEIRO – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
und die portugiesischen Gemeinschaften im Ausland<br />
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK SLOWENIEN,<br />
Anton ROP – Ministerpräsident<br />
Ivo VAJGL – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DER PRÄSIDENT DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK,<br />
Mikulás DZURINDA – Premierminister<br />
Eduard KUKAN – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
23
Verfassung für Europa<br />
Präambel<br />
DIE PRÄSIDENTIN DER REPUBLIK FINNLAND,<br />
Matti VANHANEN – Premierminister<br />
Erkki TUOMIOJA – Minister für auswärtige Angelegenheiten<br />
DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN,<br />
Göran PERSSON – Ministerpräsident<br />
Laila FREIVALDS – Ministerin für auswärtige Angelegenheiten<br />
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS-<br />
BRITANIEN UND NORDIRLAND,<br />
The Rt. Hon Tony BLAIR – Premierminister<br />
The Rt. Hon Jack STRAW – Minister für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen<br />
DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten<br />
wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:<br />
24
Verfassung für Europa<br />
TEIL I<br />
Titel I<br />
DEFINITION UND ZIELE DER UNION<br />
Artikel I-1 Gründung der Union<br />
(1) Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas,<br />
ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten, begründet diese Verfassung die Europäische<br />
Union, der die Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen<br />
Ziele übertragen. Die Union koordiniert die diesen Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten<br />
und übt die ihr von den Mitgliedstaaten übertragenen Zuständigkeiten in gemeinschaftlicher<br />
Weise aus.<br />
(2) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte achten und sich<br />
verpflichten, sie gemeinsam zu fördern.<br />
Artikel I-2 Die Werte der Union<br />
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,<br />
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte<br />
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind<br />
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,<br />
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen<br />
und Männern auszeichnet.<br />
Artikel I-3 Die Ziele der Union<br />
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker<br />
zu fördern.<br />
(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der<br />
Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit freiem und<br />
unverfälschtem Wettbewerb.<br />
(3) Die Union wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage<br />
eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße<br />
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt<br />
abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität<br />
hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.<br />
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit<br />
und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität<br />
zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.<br />
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität<br />
zwischen den Mitgliedstaaten.<br />
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den<br />
Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.<br />
25
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
(4) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte<br />
und Interessen. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger<br />
Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und<br />
gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere<br />
der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung<br />
des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten<br />
Nationen.<br />
(5) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten,<br />
die ihr in der Verfassung übertragen sind.<br />
Artikel I-4 Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung<br />
(1) Der freie Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die<br />
Niederlassungsfreiheit werden von der Union und innerhalb der Union nach Maßgabe<br />
der Verfassung gewährleistet.<br />
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungsbereich<br />
jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.<br />
Artikel I-5 Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten<br />
(1) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor der Verfassung sowie<br />
die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender politischer und<br />
verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung<br />
zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates,<br />
insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der<br />
öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit.<br />
(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich<br />
die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich<br />
aus der Verfassung ergeben.<br />
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer<br />
Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Verfassung oder den Handlungen<br />
der Organe der Union ergeben.<br />
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen<br />
alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten.<br />
Artikel I-6 Das Unionsrecht<br />
Die Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der der Union übertragenen<br />
Zuständigkeiten gesetzte Recht haben Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten.<br />
Artikel I-7 Rechtspersönlichkeit<br />
Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit.<br />
26
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel I-8 Die Symbole der Union<br />
Die Flagge der Union stellt einen Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund<br />
dar.<br />
Die Hymne der Union entstammt der „Ode an die Freude“ aus der Neunten Symphonie<br />
von Ludwig van Beethoven.<br />
Der Leitspruch der Union lautet: „In Vielfalt geeint“.<br />
Die Währung der Union ist der Euro.<br />
Der Europatag wird in der gesamten Union am 9. Mai gefeiert.<br />
Titel II<br />
GRUNDRECHTE UND UNIONSBÜRGERSCHAFT<br />
Artikel I-9 Grundrechte<br />
(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta<br />
der Grundrechte, die den Teil II bildet, enthalten sind.<br />
(2) Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte<br />
und Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in der Verfassung festgelegten<br />
Zuständigkeiten der Union.<br />
(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte<br />
und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen<br />
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine<br />
Grundsätze Teil des Unionsrechts.<br />
Artikel I-10 Unionsbürgerschaft<br />
(1) Unionsbürgerin oder Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats<br />
besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit<br />
hinzu, ohne diese zu ersetzen.<br />
(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in der Verfassung vorgesehenen<br />
Rechte und Pflichten. Sie haben<br />
a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten;<br />
b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive<br />
Wahlrecht bei<br />
c) den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei<br />
für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden<br />
Mitgliedstaats;<br />
d) im Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit<br />
sie besitzen, nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die diplomatischen<br />
und konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats unter denselben<br />
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates;<br />
27
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
e) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an den<br />
Europäischen Bürgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der<br />
Sprachen der Verfassung an die Organe und die beratenden Einrichtungen der<br />
Union zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten.<br />
Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgeübt, die<br />
in der Verfassung und durch die in Anwendung der Verfassung erlassenen Maßnahmen<br />
festgelegt sind.<br />
Titel III<br />
DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION<br />
Artikel I-11 Grundsätze<br />
(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der<br />
begrenzten Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten<br />
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.<br />
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union innerhalb<br />
der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in der Verfassung<br />
zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union<br />
nicht in der Verfassung übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.<br />
(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in<br />
ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in<br />
Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf<br />
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr<br />
wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen<br />
sind.<br />
Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die<br />
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen<br />
Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in<br />
jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.<br />
(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union<br />
inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verfassung erforderliche<br />
Maß hinaus.<br />
Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll<br />
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit<br />
an.<br />
Artikel I-12 Arten von Zuständigkeiten<br />
(1) Überträgt die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche<br />
Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und ver-<br />
28
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
bindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig<br />
werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der<br />
Union durchzuführen.<br />
(2) Überträgt die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den<br />
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in<br />
diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die<br />
Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre<br />
Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben.<br />
(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im<br />
Rahmen von Regelungen nach Maßgabe von Teil III, für deren Festlegung die Union<br />
zuständig ist.<br />
(4) Die Union ist dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu<br />
erarbeiten und zu verwirklichen.<br />
(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verfassung dafür<br />
zuständig, Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen<br />
der Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union<br />
für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.<br />
Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden<br />
Bestimmungen des Teils III erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften<br />
der Mitgliedstaaten beinhalten.<br />
(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung<br />
ergeben sich aus den Bestimmungen des Teils III zu den einzelnen Bereichen.<br />
Artikel I-13 Bereiche mit ausschließlicher Zuständigkeit<br />
(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen:<br />
a) Zollunion,<br />
b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln,<br />
c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist,<br />
d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen<br />
Fischereipolitik,<br />
e) gemeinsame Handelspolitik.<br />
(2) Die Union hat ferner ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler<br />
Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt<br />
der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne<br />
Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder<br />
deren Tragweite verändern könnte.<br />
29
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Artikel I-14 Bereiche mit geteilter Zuständigkeit<br />
(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verfassung<br />
außerhalb der in den Artikeln I-13 und I-17 genannten Bereiche eine Zuständigkeit<br />
überträgt.<br />
(2) Die geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche:<br />
a) Binnenmarkt,<br />
b) Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte,<br />
c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt,<br />
d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen<br />
Meeresschätze,<br />
e) Umwelt,<br />
f) Verbraucherschutz,<br />
g) Verkehr,<br />
h) transeuropäische Netze,<br />
i) Energie,<br />
j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,<br />
k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich<br />
der in Teil III genannten Aspekte.<br />
(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt<br />
erstreckt sich die Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere<br />
Programme zu erstellen und durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit<br />
die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben.<br />
(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt<br />
sich die Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame<br />
Politik zu verfolgen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten<br />
hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben.<br />
Artikel I-15 Die Koordinierung der Wirtschaftsund<br />
Beschäftigungspolitik<br />
(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Zu<br />
diesem Zweck erlässt der Ministerrat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die<br />
Grundzüge dieser Politik.<br />
Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen.<br />
(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der<br />
Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik.<br />
(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten<br />
ergreifen.<br />
30
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel I-16 Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
(1) Die Zuständigkeit der Union in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik<br />
erstreckt sich auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im<br />
Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festlegung<br />
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung<br />
führen kann.<br />
(2) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität<br />
und achten das Handeln der Union in diesem Bereich. Sie enthalten sich jeder Handlung,<br />
die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit schaden könnte.<br />
Artikel I-17 Unterstützungs-, Koordinierungsund<br />
Ergänzungsmaßnahmen<br />
Die Union ist für die Durchführung von Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen<br />
zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung können in<br />
folgenden Bereichen getroffen werden:<br />
a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit,<br />
b) Industrie,<br />
c) Kultur,<br />
d) Tourismus,<br />
e) allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung,<br />
f) Katastrophenschutz,<br />
g) Verwaltungszusammenarbeit.<br />
Artikel I-18 Flexibilitätsklausel<br />
(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil III festgelegten Politikbereiche<br />
erforderlich, um eines der Ziele der Verfassung zu verwirklichen, und sind in<br />
dieser Verfassung die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der<br />
Ministerrat einstimmig auf Vorschlag der Europäischen Kommission und nach Zustimmung<br />
des Europäischen Parlaments die geeigneten Maßnahmen.<br />
(2) Die Europäische Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen<br />
des Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel I-<br />
11 Absatz 3 auf die Vorschläge aufmerksam, die sich auf den vorliegenden Artikel stützen.<br />
(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung<br />
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen eine solche<br />
Harmonisierung nach der Verfassung ausgeschlossen ist.<br />
31
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Titel IV<br />
Kapitel I<br />
DIE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER<br />
UNION<br />
INSTITUTIONELLER RAHMEN<br />
Artikel I-19 Die Organe der Union<br />
(1) Die Union verfügt über einen institutionellen Rahmen, der zum Zweck hat,<br />
– ihren Werten Geltung zu verschaffen,<br />
– ihre Ziele zu verfolgen,<br />
– ihren Interessen, denen ihrer Bürgerinnen und Bürger und denen der Mitgliedstaaten<br />
zu dienen,<br />
– die Kohärenz, Effizienz und Kontinuität ihrer Politik und ihrer Maßnahmen<br />
sicherzustellen.<br />
Dieser institutionelle Rahmen umfasst<br />
– das Europäische Parlament,<br />
– den Europäischen Rat,<br />
– den Ministerrat (im Folgenden „Rat“),<br />
– die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“),<br />
– den Gerichtshof der Europäischen Union.<br />
(2) Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in der Verfassung zugewiesenen<br />
Befugnisse nach den Verfahren und unter den Bedingungen, die in der Verfassung festgelegt<br />
sind. Die Organe arbeiten loyal zusammen.<br />
Artikel I-20 Das Europäische Parlament<br />
(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig<br />
und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es erfüllt Aufgaben der politischen<br />
Kontrolle und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der Verfassung. Es wählt den<br />
Präsidenten der Kommission.<br />
(2) Das Europäische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbürgerinnen und<br />
Unionsbürger zusammen. Ihre Anzahl darf 750 nicht überschreiten. Die Bürgerinnen und<br />
Bürger sind im Europäischen Parlament degressiv proportional, mindestens jedoch mit<br />
sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze.<br />
Der Europäische Rat erlässt einstimmig auf Initiative des Europäischen Parlaments und<br />
mit dessen Zustimmung einen Europäischen Beschluss über die Zusammensetzung des<br />
Europäischen Parlaments, in dem die in Unterabsatz 1 genannten Grundsätze gewahrt<br />
sind.<br />
(3) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer,<br />
freier und geheimer Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.<br />
32
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
(4) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein<br />
Präsidium.<br />
Artikel I-21 Der Europäische Rat<br />
(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen<br />
Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür<br />
fest. Er wird nicht gesetzgeberisch tätig.<br />
(2) Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs<br />
der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten<br />
der Kommission. Der Außenminister der Union nimmt an seinen Arbeiten teil.<br />
(3) Der Europäische Rat tritt vierteljährlich zusammen; er wird von seinem Präsidenten<br />
einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des Europäischen<br />
Rates beschließen, sich jeweils von einem Minister oder – im Fall des Präsidenten<br />
der Kommission – von einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen.<br />
Wenn es die Lage erfordert, beruft der Präsident eine außerordentliche Tagung des Europäischen<br />
Rates ein.<br />
(4) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische<br />
Rat im Konsens.<br />
Artikel I-22 Der Präsident des Europäischen Rates<br />
(1) Der Europäische Rat wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für<br />
eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren; der Präsident kann einmal wiedergewählt werden.<br />
Im Falle einer Verhinderung oder einer schweren Verfehlung kann der Europäische<br />
Rat ihn im Wege des gleichen Verfahrens von seinem Amt entbinden.<br />
(2) Der Präsident des Europäischen Rates<br />
a) führt den Vorsitz bei den Arbeiten des Europäischen Rates und gibt ihnen Impulse,<br />
b) sorgt in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission auf der Grundlage<br />
der Arbeiten des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ für die Vorbereitung<br />
und Kontinuität der Arbeiten des Europäischen Rates,<br />
c) wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt und Konsens im Europäischen Rat gefördert<br />
werden,<br />
d) legt dem Europäischen Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europäischen<br />
Rates einen Bericht vor.<br />
e) Der Präsident des Europäischen Rates nimmt in seiner Eigenschaft auf seiner<br />
Ebene, unbeschadet der Befugnisse des Außenministers der Union, die Außenvertretung<br />
der Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik<br />
wahr.<br />
(3) Der Präsident des Europäischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt ausüben.<br />
33
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Artikel I-23 Der Ministerrat<br />
(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig<br />
und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben gehört die<br />
Festlegung der Politik und die Koordinierung nach Maßgabe der Verfassung.<br />
(2) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene,<br />
der befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu<br />
handeln und das Stimmrecht auszuüben.<br />
(3) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, beschließt der Rat mit<br />
qualifizierter Mehrheit.<br />
Artikel I-24 Die Zusammensetzung des Ministerrates<br />
(1) Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen.<br />
(2) Als Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ sorgt er für die Kohärenz der Arbeiten<br />
des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen.<br />
In Verbindung mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und mit der Kommission<br />
bereitet er die Tagungen des Europäischen Rates vor und sorgt für das weitere Vorgehen.<br />
(3) Als Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ gestaltet er das auswärtige Handeln der<br />
Union entsprechend den strategischen Vorgaben des Europäischen Rates und sorgt für<br />
die Kohärenz des Handelns der Union.<br />
(4) Der Europäische Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Europäischen<br />
Beschluss, mit dem die anderen Zusammensetzungen des Rates festgelegt werden.<br />
(5) Ein Ausschuss von Ständigen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten ist<br />
für die Vorbereitung der Arbeiten des Rates verantwortlich.<br />
(6) Der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät<br />
oder abstimmt. Zu diesem Zweck wird jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt, von<br />
denen der eine den Beratungen über die Gesetzgebungsakte der Union und der andere<br />
den nicht die Gesetzgebung betreffenden Tätigkeiten gewidmet ist.<br />
(7) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des Rates<br />
„Auswärtige Angelegenheiten“ wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat nach<br />
Maßgabe eines Europäischen Beschlusses des Europäischen Rates nach einem System<br />
der gleichberechtigten Rotation wahrgenommen. Der Europäische Rat beschließt mit<br />
qualifizierter Mehrheit.<br />
Artikel I-25 Definition der qualifizierten Mehrheit im Europäischen Rat<br />
und im Rat<br />
(1) Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % der Mitglieder<br />
des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern, sofern die von diesen vertretenen<br />
Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausmachen.<br />
34
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Für eine Sperrminorität sind mindestens vier Mitglieder des Rates erforderlich, andernfalls<br />
gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht.<br />
(2) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Außenministers<br />
der Union, so gilt abweichend von Absatz 1 als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von<br />
mindestens 72 % der Mitglieder des Rates, sofern die von diesen vertretenen Mitgliedstaaten<br />
zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausmachen.<br />
(3) Beschließt der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit, so gelten die Absätze<br />
1 und 2 für ihn.<br />
(4) Der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der Kommission nehmen<br />
an den Abstimmungen im Europäischen Rat nicht teil.<br />
Artikel I-26 Die Europäische Kommission<br />
(1) Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift<br />
geeignete Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verfassung<br />
sowie der von den Organen kraft der Verfassung erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht<br />
die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen<br />
Union. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie übt nach Maßgabe<br />
der Verfassung Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. Außer<br />
in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in der Verfassung<br />
vorgesehenen Fällen nimmt sie die Vertretung der Union nach außen wahr. Sie leitet die<br />
jährliche und die mehrjährige Programmplanung der Union mit dem Ziel ein, interinstitutionelle<br />
Vereinbarungen zu erreichen.<br />
(2) Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt<br />
der Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte<br />
werden auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags erlassen, wenn dies in der Verfassung<br />
vorgesehen ist.<br />
(3) Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre.<br />
(4) Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung<br />
und ihres Einsatzes für Europa unter Persönlichkeiten ausgewählt, die volle Gewähr für<br />
ihre Unabhängigkeit bieten.<br />
(5) Die erste Kommission, die in Anwendung der Verfassung ernannt wird, einschließlich<br />
ihres Präsidenten und des Außenministers der Union, der einer der Vizepräsidenten<br />
der Kommission ist, besteht aus je einem Staatsangehörigen jedes Mitgliedstaats.<br />
(6) Ab dem Ende der Amtszeit der Kommission nach Absatz 5 besteht die Kommission,<br />
einschließlich ihres Präsidenten und des Außenministers der Union, aus einer<br />
Anzahl von Mitgliedern, die zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, sofern<br />
der Europäische Rat nicht einstimmig eine Änderung dieser Anzahl beschließt.<br />
Die Kommissionsmitglieder werden unter den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in<br />
einem System der gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten ausge-<br />
35
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
wählt. Dieses System wird durch einen vom Europäischen Rat einstimmig erlassenen<br />
Europäischen Beschluss geschaffen, der auf folgenden Grundsätzen beruht:<br />
a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer<br />
der Amtszeiten<br />
b) ihrer Staatsangehörigen in der Kommission vollkommen gleich behandelt; demzufolge<br />
kann die Gesamtzahl der Mandate, welche Staatsangehörige zweier<br />
beliebiger Mitgliedstaaten innehaben, niemals um mehr als eines voneinander<br />
abweichen.<br />
c) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jede der aufeinander folgenden Kommissionen<br />
so zusammengesetzt, dass das demographische und geographische Spektrum<br />
der Gesamtheit der Mitgliedstaaten auf zufrieden stellende Weise zum Ausdruck<br />
kommt.<br />
(7) Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder<br />
der Kommission dürfen unbeschadet des Artikels I–28 Absatz 2 Weisungen von einer<br />
Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder jeder anderen Stelle weder einholen<br />
noch entgegennehmen.<br />
Sie enthalten sich jeder Handlung, die mit ihrem Amt oder der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
unvereinbar ist.<br />
(8) Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich.<br />
Das Europäische Parlament kann nach Artikel III-340 einen Misstrauensantrag gegen die<br />
Kommission annehmen. Wird ein solcher Antrag angenommen, so müssen die Mitglieder<br />
der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen, und der Außenminister der Union<br />
muss sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt niederlegen.<br />
Artikel I-27 Der Präsident der Europäischen Kommission<br />
(1) Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden<br />
Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten<br />
der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen<br />
Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit<br />
seiner Mitglieder. Erhält dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so schlägt der Europäische<br />
Rat dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats mit qualifizierter Mehrheit<br />
einen neuen Kandidaten vor, für dessen Wahl das Europäische Parlament dasselbe Verfahren<br />
anwendet.<br />
(2) Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten, die Liste der<br />
anderen Persönlichkeiten an, die er als Mitglieder der Kommission vorschlägt. Diese<br />
werden auf der Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien<br />
nach Artikel I-26 Absatz 4 und Absatz 6 Unterabsatz 2 ausgewählt.<br />
Der Präsident, der Außenminister der Union und die übrigen Mitglieder der Kommission<br />
stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Auf<br />
der Grundlage dieser Zustimmung wird die Kommission vom Europäischen Rat mit qualifizierter<br />
Mehrheit ernannt.<br />
36
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
(3) Der Präsident der Kommission<br />
a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt,<br />
b) beschließt über die interne Organisation der Kommission, um die Kohärenz, die<br />
Effizienz und das Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen,<br />
c) ernennt, mit Ausnahme des Außenministers der Union, die Vizepräsidenten aus<br />
dem Kreis der Mitglieder der Kommission.<br />
d) Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten<br />
dazu aufgefordert wird. Der Außenminister der Union legt sein Amt nach dem<br />
Verfahren des Artikels I-28 Absatz 1 nieder, wenn er vom Präsidenten dazu aufgefordert<br />
wird.<br />
Artikel I-28 Der Außenminister der Union<br />
(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des<br />
Präsidenten der Kommission den Außenminister der Union. Der Europäische Rat kann<br />
die Amtszeit des Außenministers nach dem gleichen Verfahren beenden.<br />
(2) Der Außenminister der Union leitet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
der Union. Er trägt durch seine Vorschläge zur Festlegung dieser Politik bei und<br />
führt sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt ebenso im Bereich der Gemeinsamen<br />
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.<br />
(3) Der Außenminister der Union führt den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“.<br />
(4) Der Außenminister der Union ist einer der Vizepräsidenten der Kommission. Er<br />
sorgt für die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union. Er ist innerhalb der Kommission<br />
mit deren Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen und mit der Koordinierung<br />
der übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut. Bei der<br />
Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten in der Kommission und ausschließlich im Hinblick<br />
auf diese Zuständigkeiten unterliegt der Außenminister der Union den Verfahren,<br />
die für die Arbeitsweise der Kommission gelten, soweit dies mit den Absätzen 2 und 3<br />
vereinbar ist.<br />
Artikel I-29 Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht<br />
und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung<br />
der Verfassung.<br />
Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer<br />
Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.<br />
(2) Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Er wird von Generalanwälten<br />
unterstützt.<br />
Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat.<br />
37
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Als Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs und als Richter des Gerichts sind Persönlichkeiten<br />
auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die Voraussetzungen<br />
der Artikel III-355 und III-356 erfüllen. Sie werden von den Regierungen der<br />
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren<br />
ernannt. Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig.<br />
(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe von Teil III<br />
a) über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder natürlicher oder juristischer Personen;<br />
b) im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte über<br />
die Auslegung des Unionsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen der<br />
Organe;<br />
c) in allen anderen in der Verfassung vorgesehenen Fällen.<br />
Kapitel II<br />
DIE SONSTIGEN ORGANE UND DIE BERATENDEN<br />
EINRICHTUNGEN DER UNION<br />
Artikel I-30 Die Europäische Zentralbank<br />
(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das Europäische<br />
System der Zentralbanken. Die Europäische Zentralbank und die nationalen<br />
Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, bilden das Eurosystem<br />
und betreiben die Währungspolitik der Union.<br />
(2) Das Europäische System der Zentralbanken wird von den Beschlussorganen der<br />
Europäischen Zentralbank geleitet. Sein vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu<br />
gewährleisten. Unbeschadet dieses Zieles unterstützt es die allgemeine Wirtschaftspolitik<br />
in der Union, um zur Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen. Es führt alle weiteren<br />
Aufgaben einer Zentralbank nach Maßgabe des Teils III und der Satzung des Europäischen<br />
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank aus.<br />
(3) Die Europäische Zentralbank ist ein Organ. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie<br />
allein ist befugt, die Ausgabe des Euro zu genehmigen. Sie ist in der Ausübung ihrer<br />
Befugnisse und der Verwaltung ihrer Mittel unabhängig. Die Organe, Einrichtungen und<br />
sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten achten diese<br />
Unabhängigkeit.<br />
(4) Die Europäische Zentralbank erlässt die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen<br />
Maßnahmen nach den Artikeln III-185 bis III-191und Artikel III-196 und nach<br />
Maßgabe der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen<br />
Zentralbank. Nach diesen Artikeln behalten die Mitgliedstaaten, deren Währung<br />
nicht der Euro ist, sowie deren Zentralbanken ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich.<br />
(5) Die Europäische Zentralbank wird in den Bereichen, auf die sich ihre Befugnisse<br />
erstrecken, zu allen Entwürfen für Rechtsakte der Union sowie zu allen Entwürfen für<br />
38
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört und kann Stellungnahmen abgeben.<br />
(6) Die Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank, ihre Zusammensetzung und<br />
ihre Arbeitsweise sind in den Artikeln III-382 und III-383 sowie in der Satzung des Europäischen<br />
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank festgelegt.<br />
Artikel I-31 Der Rechnungshof<br />
(1) Der Rechnungshof ist ein Organ. Er nimmt die Rechnungsprüfung der Union<br />
wahr.<br />
(2) Er prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union und überzeugt<br />
sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.<br />
(3) Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine<br />
Mitglieder üben ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der<br />
Union aus.<br />
Artikel I-32 Die beratenden Einrichtungen der Union<br />
(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem<br />
Ausschuss der Regionen sowie einem Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt, die<br />
beratende Aufgaben wahrnehmen.<br />
(2) Der Ausschuss der Regionen setzt sich aus Vertretern der regionalen und lokalen<br />
Gebietskörperschaften zusammen, die entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in<br />
einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer<br />
gewählten Versammlung politisch verantwortlich sind.<br />
(3) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der<br />
Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern der<br />
Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem sozialen und wirtschaftlichen, dem staatsbürgerlichen,<br />
dem beruflichen und dem kulturellen Bereich.<br />
(4) Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses<br />
sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit<br />
zum allgemeinen Wohl der Union aus.<br />
(5) Die Zusammensetzung dieser Ausschüsse, die Ernennung ihrer Mitglieder, ihre<br />
Befugnisse und ihre Arbeitsweise sind in den Artikeln III-386 bis III-392 geregelt.<br />
Die Vorschriften der Absätze 2 und 3 über die Art ihrer Zusammensetzung werden in<br />
regelmäßigen Abständen vom Rat überprüft, um der wirtschaftlichen, sozialen und<br />
demographischen Entwicklung in der Union Rechnung zu tragen. Der Rat erlässt auf<br />
Vorschlag der Kommission Europäische Beschlüsse zu diesem Zweck.<br />
39
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Titel V<br />
Kapitel I<br />
AUSÜBUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN DER<br />
UNION<br />
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN<br />
Artikel I-33 Die Rechtsakte der Union<br />
(1) Bei der Ausübung der Zuständigkeiten der Union bedienen sich die Organe nach<br />
Maßgabe von Teil III folgender Rechtsakte: Europäisches Gesetz, Europäisches Rahmengesetz,<br />
Europäische Verordnung, Europäischer Beschluss, Empfehlung und Stellungnahme.<br />
Das Europäische Gesetz ist ein Gesetzgebungsakt mit allgemeiner Geltung. Es ist in<br />
allen seinen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.<br />
Das Europäische Rahmengesetz ist ein Gesetzgebungsakt, der für jeden Mitgliedstaat, an<br />
den es gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist, jedoch den<br />
innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlässt.<br />
Die Europäische Verordnung ist ein Rechtsakt ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner<br />
Geltung; sie dient der Durchführung der Gesetzgebungsakte und einzelner Bestimmungen<br />
der Verfassung. Sie kann entweder in allen ihren Teilen verbindlich sein und<br />
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten oder für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet<br />
ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich sein, jedoch den innerstaatlichen<br />
Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlassen.<br />
Der Europäische Beschluss ist ein Rechtsakt ohne Gesetzescharakter, der in allen seinen<br />
Teilen verbindlich ist. Ist er an bestimmte Adressaten gerichtet, so ist er nur für diese verbindlich.<br />
Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.<br />
(2) Werden das Europäische Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetzgebungsakts<br />
befasst, so nehmen sie keine Akte an, die nach dem für den betreffenden<br />
Bereich geltenden Gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen sind.<br />
Artikel I-34 Gesetzgebungsakte<br />
(1) Europäisches Gesetz und Rahmengesetz werden im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<br />
nach Artikel III-396 auf Vorschlag der Kommission vom Europäischen<br />
Parlament und vom Rat gemeinsam erlassen. Gelangen die beiden Organe nicht zu einer<br />
Einigung, so kommt der betreffende Gesetzgebungsakt nicht zustande.<br />
(2) In bestimmten, in der Verfassung vorgesehenen Fällen werden Europäisches<br />
Gesetz und Rahmengesetz nach besonderen Gesetzgebungsverfahren vom Europäischen<br />
Parlament mit Beteiligung des Rates oder vom Rat mit Beteiligung des Europäischen<br />
Parlaments erlassen.<br />
(3) In bestimmten, in der Verfassung vorgesehenen Fällen können Europäisches<br />
Gesetz und Rahmengesetz auf Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des<br />
Europäischen Parlaments, auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf Antrag<br />
des Gerichtshofs oder der Europäischen Investitionsbank erlassen werden.<br />
40
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel I-35 Rechtsakte ohne Gesetzescharakter<br />
(1) Der Europäische Rat erlässt Europäische Beschlüsse in den in der Verfassung<br />
vorgesehenen Fällen.<br />
(2) Der Rat und die Kommission erlassen insbesondere in den Fällen nach den Artikeln<br />
I-36 und I-37 Europäische Verordnungen oder Beschlüsse; die Europäische Zentralbank<br />
erlässt Europäische Verordnungen oder Beschlüsse in bestimmten, in der Verfassung<br />
vorgesehenen Fällen.<br />
(3) Der Rat gibt Empfehlungen ab. Er beschließt auf Vorschlag der Kommission in<br />
allen Fällen, in denen er nach Maßgabe der Verfassung Rechtsakte auf Vorschlag der<br />
Kommission erlässt. In den Bereichen, in denen für den Erlass eines Rechtsakts der<br />
Union Einstimmigkeit vorgesehen ist, beschließt er einstimmig. Die Kommission und, in<br />
bestimmten in der Verfassung vorgesehenen Fällen, die Europäische Zentralbank geben<br />
Empfehlungen ab.<br />
Artikel I-36 Delegierte Europäische Verordnungen<br />
(1) In Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen kann der Kommission die<br />
Befugnis übertragen werden, delegierte Europäische Verordnungen zur Ergänzung oder<br />
Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzes oder<br />
Rahmengesetzes zu erlassen.<br />
In den betreffenden Europäischen Gesetzen oder Rahmengesetzen werden Ziele, Inhalt,<br />
Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die<br />
wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind dem Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz<br />
vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb ausgeschlossen.<br />
(2) Die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, werden in Europäischen<br />
Gesetzen oder Rahmengesetzen ausdrücklich festgelegt, wobei folgende Möglichkeiten<br />
bestehen:<br />
a) Das Europäische Parlament oder der Rat kann beschließen, die Übertragung zu<br />
widerrufen.<br />
b) Die delegierte Europäische Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische<br />
Parlament oder der Rat innerhalb der im Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz<br />
festgelegten Frist keine Einwände erhebt.<br />
Für die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das Europäische Parlament mit der<br />
Mehrheit seiner Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit.<br />
Artikel I-37 Durchführungsrechtsakte<br />
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte<br />
der Union erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht.<br />
(2) Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen<br />
Rechtsakte der Union, so werden mit diesen Rechtsakten der Kommission oder, in ent-<br />
41
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
sprechend begründeten Sonderfällen und in den Fällen nach Artikel I-40, dem Rat<br />
Durchführungsbefugnisse übertragen.<br />
(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 werden durch Europäisches Gesetz im Voraus allgemeine<br />
Regeln und Grundsätze festgelegt, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung<br />
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren.<br />
(4) Die Durchführungsrechtsakte der Union ergehen in der Form von Europäischen<br />
Durchführungsverordnungen oder Europäischen Durchführungsbeschlüssen.<br />
Artikel I-38 Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union<br />
(1) Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von der Verfassung nicht vorgegeben,<br />
so entscheiden die Organe darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden<br />
Verfahren und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach Artikel I-11.<br />
(2) Die Rechtsakte sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in<br />
der Verfassung vorgesehenen Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder Stellungnahmen<br />
Bezug.<br />
Artikel I-39 Veröffentlichung und Inkrafttreten<br />
(1) Europäische Gesetze und Rahmengesetze, die nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<br />
erlassen wurden, werden vom Präsidenten des Europäischen Parlaments<br />
und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet.<br />
In den übrigen Fällen werden sie vom Präsidenten des Organs, das sie erlassen hat, unterzeichnet.<br />
Die Europäischen Gesetze und Rahmengesetze werden im Amtsblatt der Europäischen<br />
Union veröffentlicht und treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls<br />
am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.<br />
(2) Europäische Beschlüsse, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind,<br />
sowie Europäische Verordnungen werden vom Präsidenten des Organs, das sie erlassen<br />
hat, unterzeichnet.<br />
Europäische Beschlüsse, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind, sowie<br />
Europäische Verordnungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht<br />
und treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten<br />
Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.<br />
(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Europäischen Beschlüsse werden denjenigen,<br />
für die sie bestimmt sind, bekannt gegeben und durch diese Bekanntgabe wirksam.<br />
42
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
Kapitel II<br />
BESONDERE BESTIMMUNGEN<br />
Artikel I-40 Besondere Bestimmungen über die<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
(1) Die Europäische Union verfolgt eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,<br />
die auf einer Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarität der Mitgliedstaaten,<br />
der Ermittlung der Fragen von allgemeiner Bedeutung und der Erreichung einer<br />
immer stärkeren Konvergenz des Handelns der Mitgliedstaaten beruht.<br />
(2) Der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt<br />
die Ziele ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest. Der Rat gestaltet diese<br />
Politik im Rahmen der vom Europäischen Rat festgelegten strategischen Leitlinien in<br />
Übereinstimmung mit Teil III.<br />
(3) Der Europäische Rat und der Rat erlassen die erforderlichen Europäischen<br />
Beschlüsse.<br />
(4) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Außenminister der<br />
Union und von den Mitgliedstaaten mit einzelstaatlichen Mitteln und den Mitteln der<br />
Union durchgeführt.<br />
(5) Die Mitgliedstaaten stimmen sich im Europäischen Rat und im Rat zu jeder<br />
außen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemeinsames<br />
Vorgehen festzulegen. Bevor ein Mitgliedstaat in einer Weise, die die Interessen<br />
der Union berühren könnte, auf internationaler Ebene tätig wird oder eine Verpflichtung<br />
eingeht, konsultiert er die anderen Mitgliedstaaten im Europäischen Rat oder im Rat. Die<br />
Mitgliedstaaten gewährleisten durch konvergentes Handeln, dass die Union ihre Interessen<br />
und ihre Werte auf internationaler Ebene geltend machen kann. Die Mitgliedstaaten<br />
sind untereinander solidarisch.<br />
(6) Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erlassen der Europäische<br />
Rat und der Rat außer in den in Teil III genannten Fällen Europäische Beschlüsse<br />
einstimmig. Sie beschließen auf Initiative eines Mitgliedstaates, auf Vorschlag des<br />
Außenministers der Union oder auf Vorschlag des Außenministers mit Unterstützung der<br />
Kommission. Europäische Gesetze und Rahmengesetze sind ausgeschlossen.<br />
(7) Der Europäische Rat kann einstimmig einen Europäischen Beschluss erlassen,<br />
wonach der Rat in anderen als den in Teil III genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit<br />
beschließt.<br />
(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden<br />
Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik regelmäßig<br />
gehört. Es wird über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten.<br />
Artikel I-41 Besondere Bestimmungen über die<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil<br />
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile<br />
43
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
und militärische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei<br />
Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung<br />
der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der<br />
Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten,<br />
die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.<br />
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise<br />
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer<br />
gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen<br />
hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne<br />
im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen.<br />
Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der<br />
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen<br />
bestimmter Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der<br />
Nordatlantikvertrags-Organisation verwirklicht sehen, aufgrund des Nordatlantikvertrags<br />
und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheitsund<br />
Verteidigungspolitik.<br />
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen<br />
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur<br />
Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die<br />
zusammen multinationale Streitkräfte aufstellen, können diese auch für die Gemeinsame<br />
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen.<br />
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.<br />
Es wird eine Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten,<br />
Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) eingerichtet,<br />
deren Aufgabe es ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur<br />
Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen<br />
und technologischen Basis des Verteidigungssektors beizutragen und diese Maßnahmen<br />
gegebenenfalls durchzuführen, sich an der Festlegung einer europäischen Politik im<br />
Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung zu beteiligen sowie den Rat bei der Beurteilung<br />
der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen.<br />
(4) Europäische Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,<br />
einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel,<br />
werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Außenministers der Union oder auf Initiative<br />
eines Mitgliedstaats erlassen. Der Außenminister der Union kann gegebenenfalls<br />
gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf<br />
Instrumente der Union vorschlagen.<br />
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen<br />
eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen<br />
der Union beauftragen. Die Durchführung einer solchen Mission fällt unter Artikel III-<br />
310.<br />
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen<br />
Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderun-<br />
44
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
gen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine<br />
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit<br />
erfolgt nach Maßgabe von Artikel III-312. Sie berührt nicht die Bestimmungen des Artikels<br />
III-309.<br />
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats<br />
müssen die anderen Mitgliedstaaten nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen<br />
alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Dies lässt den besonderen<br />
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.<br />
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang<br />
mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen,<br />
die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung<br />
und das Instrument für deren Verwirklichung ist.<br />
(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden<br />
Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
regelmäßig gehört. Es wird über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten.<br />
Artikel I-42 Besondere Bestimmungen über den Raum der Freiheit,<br />
der Sicherheit und des Rechts<br />
(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
a) durch den Erlass von Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen, mit denen,<br />
soweit erforderlich, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den in Teil III<br />
genannten Bereichen einander angeglichen werden sollen;<br />
b) durch Förderung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den zuständigen Behörden<br />
der Mitgliedstaaten, insbesondere auf der Grundlage der gegenseitigen<br />
Anerkennung der gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen;<br />
c) durch operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten<br />
einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die Verhütung und die Aufdeckung<br />
von Straftaten spezialisierter Behörden.<br />
(2) Die nationalen Parlamente können sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der<br />
Sicherheit und des Rechts an den Bewertungsmechanismen nach Artikel III-260 beteiligen.<br />
Sie werden in die politische Kontrolle von Europol und die Bewertung der Tätigkeit<br />
von Eurojust nach den Artikeln III-276 und III-273 einbezogen.<br />
(3) Die Mitgliedstaaten verfügen nach Artikel III-264 über ein Initiativrecht im<br />
Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.<br />
Artikel I-43 Solidaritätsklausel<br />
(1) Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität,<br />
wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder<br />
einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Union mobilisiert alle<br />
45
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten<br />
bereitgestellten militärischen Mittel, um<br />
a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden;<br />
– die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen<br />
zu schützen;<br />
– im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen<br />
Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen;<br />
b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe<br />
einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb<br />
seines Hoheitsgebiets zu unterstützen.<br />
(2) Die Einzelheiten der Durchführung dieses Artikels sind in Artikel III-329 vorgesehen.<br />
Kapitel III<br />
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT<br />
Artikel I-44 Verstärkte Zusammenarbeit<br />
(1) Die Mitgliedstaaten, die untereinander eine Verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen<br />
der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union begründen wollen, können, in<br />
den Grenzen und nach Maßgabe dieses Artikels und der Artikel III-416 bis III-423, die<br />
Organe der Union in Anspruch nehmen und diese Zuständigkeiten unter Anwendung der<br />
einschlägigen Verfassungsbestimmungen ausüben.<br />
Eine Verstärkte Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die Verwirklichung der Ziele<br />
der Union zu fördern, ihre Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken.<br />
Sie steht allen Mitgliedstaaten nach Artikel III-418 jederzeit offen.<br />
(2) Der Europäische Beschluss über die Ermächtigung zu einer Verstärkten<br />
Zusammenarbeit wird vom Rat als letztes Mittel erlassen, wenn dieser feststellt, dass die<br />
mit dieser Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht<br />
innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können, und sofern an der<br />
Zusammenarbeit mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten beteiligt ist. Der Rat<br />
beschließt nach dem in Artikel III-419 vorgesehenen Verfahren.<br />
(3) Alle Mitglieder des Rates können an dessen Beratungen teilnehmen, aber nur die<br />
Mitglieder des Rates, welche die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten<br />
vertreten, nehmen an der Abstimmung teil.<br />
Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die Stimmen der Vertreter der an der Verstärkten<br />
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten.<br />
Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen Mitglieder<br />
des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden Mit-<br />
46
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
gliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten<br />
ausmachen.<br />
Für eine Sperrminorität ist mindestens die Mindestzahl der Mitglieder des Rates, die<br />
zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten vertreten,<br />
zuzüglich eines Mitglieds erforderlich; andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als<br />
erreicht.<br />
Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Außenministers der<br />
Union, so gilt abweichend von den Unterabsätzen 3 und 4 als die erforderliche qualifizierte<br />
Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, die<br />
die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden Mitgliedstaaten mindestens<br />
65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen.<br />
(4) An die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit erlassenen Rechtsakte<br />
sind nur die an dieser Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten gebunden. Sie gelten<br />
nicht als Besitzstand, der von beitrittswilligen Staaten angenommen werden muss.<br />
Titel VI<br />
DAS DEMOKRATISCHE LEBEN<br />
DER UNION<br />
Artikel I-45 Grundsatz der demokratischen Gleichheit<br />
Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen<br />
und Bürger, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen<br />
und sonstigen Stellen der Union zuteil wird.<br />
Artikel I-46 Grundsatz der repräsentativen Demokratie<br />
(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie.<br />
(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen<br />
Parlament vertreten.<br />
Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder<br />
Regierungschef und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in<br />
demokratischer Weise gegenüber ihrem nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen<br />
und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen.<br />
(3) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der<br />
Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich<br />
getroffen.<br />
(4) Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen<br />
politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und<br />
Bürger der Union bei.<br />
47
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
Artikel I-47 Grundsatz der partizipativen Demokratie<br />
(1) Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden<br />
in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns<br />
der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen.<br />
(2) Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit<br />
den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft.<br />
(3) Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten,<br />
führt die Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch.<br />
(4) Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million<br />
betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten<br />
handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Kommission auffordern,<br />
im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu<br />
denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf,<br />
um die Verfassung umzusetzen. Die Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen,<br />
die für eine solche Bürgerinitiative gelten, einschließlich der Mindestzahl von Mitgliedstaaten,<br />
aus denen diese Bürgerinnen und Bürger kommen müssen, werden durch<br />
Europäisches Gesetz festgelegt.<br />
Artikel I-48 Die Sozialpartner und der autonome soziale Dialog<br />
Die Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter<br />
Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen<br />
Dialog und achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner.<br />
Der Dreigliedrige Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung trägt zum sozialen Dialog<br />
bei.<br />
Artikel I-49 Der Europäische Bürgerbeauftragte<br />
Das Europäische Parlament wählt einen Europäischen Bürgerbeauftragten, der<br />
Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen<br />
Stellen der Union nach Maßgabe der Verfassung entgegennimmt. Er untersucht<br />
diese Beschwerden und erstattet darüber Bericht. Der Europäische Bürgerbeauftragte übt<br />
sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus.<br />
Artikel I-50 Transparenz der Arbeit der Organe, Einrichtungen<br />
und sonstigen Stellen der Union<br />
(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der<br />
Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen<br />
der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit.<br />
(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er<br />
über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt.<br />
48
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
(3) Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische<br />
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat hat nach<br />
Maßgabe des Teils III das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen<br />
und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten<br />
Träger.<br />
Durch Europäisches Gesetz werden die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund<br />
öffentlicher oder privater Interessen geltenden Einschränkungen für die Ausübung des<br />
Rechts auf Zugang zu solchen Dokumenten festgelegt.<br />
(4) Im Einklang mit dem in Absatz 3 genannten Europäischen Gesetz legen die<br />
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen in ihren jeweiligen Geschäftsordnungen<br />
besondere Bestimmungen für den Zugang zu ihren Dokumenten fest.<br />
Artikel I-51 Schutz personenbezogener Daten<br />
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen<br />
Daten.<br />
(2) Durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz werden Vorschriften über den<br />
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die<br />
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten<br />
im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts<br />
fallen, und über den freien Datenverkehr festgelegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften<br />
wird von unabhängigen Behörden überwacht.<br />
Artikel I-52 Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften<br />
(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder<br />
Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und<br />
beeinträchtigt ihn nicht.<br />
(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften<br />
nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen.<br />
(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer<br />
Identität und ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen<br />
Dialog.<br />
Titel VII<br />
DIE FINANZEN DER UNION<br />
Artikel I-53 Die Haushalts- und Finanzgrundsätze<br />
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden im Einklang mit Teil III für<br />
jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan der Union eingesetzt.<br />
(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.<br />
(3) Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr<br />
entsprechend dem Europäischen Gesetz nach Artikel III-412 bewilligt.<br />
49
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
(4) Die Ausführung der in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben setzt den Erlass<br />
eines verbindlichen Rechtsakts der Union voraus, mit dem die Maßnahme der Union und<br />
die Ausführung der entsprechenden Ausgabe entsprechend dem Europäischen Gesetz<br />
nach Artikel III-412 eine Rechtsgrundlage erhalten, soweit nicht dieses Gesetz Ausnahmen<br />
vorsieht.<br />
(5) Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, erlässt die Union keine Rechtsakte,<br />
die erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben könnten, ohne die<br />
Gewähr zu bieten, dass die mit diesen Rechtsakten verbundenen Ausgaben im Rahmen<br />
der Eigenmittel der Union und unter Einhaltung des mehrjährigen Finanzrahmens nach<br />
Artikel I-55 finanziert werden können.<br />
(6) Der Haushaltsplan wird entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der<br />
Haushaltsführung ausgeführt. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Union zusammen,<br />
um sicherzustellen, dass die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel nach diesem<br />
Grundsatz verwendet werden.<br />
(7) Die Union und die Mitgliedstaaten bekämpfen nach Artikel III-415 Betrügereien<br />
und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen.<br />
Artikel I-54 Die Eigenmittel der Union<br />
(1) Die Union stattet sich mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen<br />
und ihre Politik durchführen zu können.<br />
(2) Der Haushalt der Union wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig<br />
aus Eigenmitteln finanziert.<br />
(3) Die Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Union werden durch<br />
Europäisches Gesetz des Rates festgelegt. Darin können neue Kategorien von Eigenmitteln<br />
eingeführt und bestehende Kategorien abgeschafft werden. Der Rat beschließt einstimmig<br />
nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Dieses Gesetz tritt erst nach<br />
Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen<br />
Vorschriften in Kraft.<br />
(4) Durchführungsmaßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union werden<br />
durch Europäisches Gesetz des Rates festgelegt, sofern dies in dem nach Absatz 3 erlassenen<br />
Europäischen Gesetz vorgesehen ist. Der Rat beschließt nach Zustimmung des<br />
Europäischen Parlaments.<br />
Artikel I-55 Der mehrjährige Finanzrahmen<br />
(1) Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen soll sichergestellt werden, dass die Ausgaben<br />
der Union innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel eine geordnete Entwicklung nehmen.<br />
Im mehrjährigen Finanzrahmen werden die jährlichen Obergrenzen für die Mittel<br />
für Verpflichtungen je Ausgabenkategorie nach Artikel III-402 festgesetzt.<br />
(2) Der mehrjährige Finanzrahmen wird durch Europäisches Gesetz des Rates festgelegt.<br />
Dieser beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,<br />
die mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt wird.<br />
50
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
(3) Bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans der Union ist der mehrjährige<br />
Finanzrahmen einzuhalten.<br />
(4) Der Europäische Rat kann einstimmig einen Europäischen Beschluss erlassen,<br />
wonach der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann, wenn er das in Absatz 2<br />
genannte Europäische Gesetz des Rates erlässt.<br />
Artikel I-56 Der Haushaltsplan der Union<br />
Der jährliche Haushaltsplan der Union wird durch Europäisches Gesetz nach Maßgabe<br />
des Artikels III-404 aufgestellt.<br />
Titel VIII<br />
DIE UNION UND IHRE NACHBARN<br />
Artikel I-57 Die Union und ihre Nachbarn<br />
(1) Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft,<br />
um einen Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf<br />
den Werten der Union aufbaut und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der<br />
Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.<br />
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Union spezielle Übereinkünfte mit den<br />
betreffenden Ländern schließen. Diese Übereinkünfte können gegenseitige Rechte und<br />
Pflichten umfassen und die Möglichkeit zu gemeinsamem Vorgehen eröffnen. Zur<br />
Durchführung der Übereinkünfte finden regelmäßige Konsultationen statt.<br />
TITEL IX<br />
ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION<br />
Artikel I-58 Kriterien und Verfahren für den Beitritt zur Union<br />
(1) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die die in Artikel I-2 genannten<br />
Werte achten und sich verpflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen.<br />
(2) Europäische Staaten, die Mitglied der Union werden möchten, richten ihren<br />
Antrag an den Rat. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden<br />
von diesem Antrag unterrichtet. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission<br />
und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der Mehrheit seiner<br />
Mitglieder beschließt. Die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme werden<br />
durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat<br />
geregelt. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten im Einklang<br />
mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.<br />
Artikel I-59 Aussetzung bestimmter mit der Zugehörigkeit zur Union<br />
verbundener Rechte<br />
(1) Auf begründete Initiative eines Drittels der Mitgliedstaaten, auf begründete Initiative<br />
des Europäischen Parlaments oder auf Vorschlag der Kommission kann der Rat<br />
51
Verfassung für Europa<br />
Teil I<br />
einen Europäischen Beschluss erlassen, mit dem festgestellt wird, dass die eindeutige<br />
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel I-2 genannten Werte durch<br />
einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat beschließt mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner<br />
Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.<br />
Der Rat hört, bevor er eine solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und<br />
kann Empfehlungen an ihn richten, über die er nach demselben Verfahren beschließt.<br />
Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser Feststellung geführt haben,<br />
noch zutreffen.<br />
(2) Auf Initiative eines Drittels der Mitgliedstaaten oder auf Vorschlag der Kommission<br />
kann der Europäische Rat einen Europäischen Beschluss erlassen, mit dem festgestellt<br />
wird, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der in Artikel I-2<br />
genannten Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er diesen Staat zu einer<br />
Stellungnahme aufgefordert hat. Der Europäische Rat beschließt einstimmig nach<br />
Zustimmung des Europäischen Parlaments.<br />
(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter<br />
Mehrheit einen Europäischen Beschluss erlassen, mit dem bestimmte Rechte, die sich<br />
aus der Anwendung der Verfassung auf den betreffenden Mitgliedstaat herleiten, einschließlich<br />
der Stimmrechte des Mitglieds des Rates, das diesen Staat vertritt, ausgesetzt<br />
werden. Dabei berücksichtigt der Rat die möglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung<br />
auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.<br />
Der betreffende Staat bleibt auf jeden Fall durch seine Verpflichtungen aus der Verfassung<br />
gebunden.<br />
(4) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit einen Europäischen Beschluss erlassen,<br />
mit dem die nach Absatz 3 erlassenen Maßnahmen abgeändert oder aufgehoben werden,<br />
wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten<br />
sind.<br />
(5) Für die Zwecke dieses Artikels nimmt das Mitglied des Europäischen Rates oder<br />
des Rates, das den betroffenen Mitgliedstaat vertritt, nicht an der Abstimmung teil und<br />
der betreffende Mitgliedstaat wird bei der Berechnung des Drittels oder der vier Fünftel<br />
der Mitgliedstaaten nach den Absätzen 1 und 2 nicht berücksichtigt. Die Stimmenthaltung<br />
von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Erlass von Europäischen<br />
Beschlüssen nach Absatz 2 nicht entgegen.<br />
Für den Erlass Europäischer Beschlüsse nach den Absätzen 3 und 4 gilt als qualifizierte<br />
Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, die die<br />
beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden Mitgliedstaaten zusammen<br />
mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen.<br />
Beschließt der Rat nach dem Erlass eines Beschlusses über die Aussetzung der Stimmrechte<br />
nach Absatz 3 auf der Grundlage einer Bestimmung der Verfassung mit qualifizierter<br />
Mehrheit, so gilt als qualifizierte Mehrheit hierfür die in Unterabsatz 2 festgelegte<br />
qualifizierte Mehrheit oder, wenn der Rat auf Vorschlag der Kommission oder des<br />
Außenministers der Union handelt, eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen Mit-<br />
52
Teil I<br />
Verfassung für Europa<br />
glieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden<br />
Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten<br />
ausmachen. In letzterem Fall ist für eine Sperrminorität mindestens die Mindestzahl<br />
der Mitglieder des Rates, die zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten<br />
Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich eines Mitglieds erforderlich; andernfalls gilt<br />
die qualifizierte Mehrheit als erreicht.<br />
(6) Für die Zwecke dieses Artikels beschließt das Europäische Parlament mit der<br />
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.<br />
Artikel I-60 Freiwilliger Austritt aus der Union<br />
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften<br />
beschließen, aus der Union auszutreten.<br />
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine<br />
Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union<br />
mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt es<br />
ab, wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt<br />
wird. Das Abkommen wird nach Artikel III-325 Absatz 3 ausgehandelt. Es wird<br />
vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit<br />
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.<br />
(3) Die Verfassung findet auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens<br />
des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten<br />
Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen<br />
mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern.<br />
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates<br />
und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat<br />
betreffenden Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen<br />
Rates oder des Rates teil.<br />
Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder<br />
des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden Mitgliedstaaten<br />
zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten<br />
ausmachen.<br />
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte,<br />
muss dies nach dem Verfahren des Artikels I-58 beantragen.<br />
53
Verfassung für Europa<br />
TEIL II<br />
DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER UNION<br />
PRÄAMBEL<br />
Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche<br />
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.<br />
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union<br />
auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der<br />
Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der<br />
Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem<br />
sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
begründet.<br />
Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter<br />
Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen<br />
Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf<br />
nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und<br />
nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den freien Personen-, Dienstleistungs-,<br />
Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher.<br />
Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft,<br />
des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen<br />
den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht<br />
werden.<br />
Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und<br />
des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen<br />
und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten,<br />
aus der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,<br />
aus den von der Union und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie<br />
aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen<br />
Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem Zusammenhang erfolgt die Auslegung<br />
der Charta durch die Gerichte der Union und der Mitgliedstaaten unter gebührender<br />
Berücksichtigung der Erläuterungen, die unter der Leitung des Präsidiums des Konvents<br />
zur Ausarbeitung der Charta formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums<br />
des Europäischen Konvents aktualisiert wurden.<br />
Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortung und mit Pflichten sowohl gegenüber<br />
den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen<br />
Generationen verbunden.<br />
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze<br />
an.<br />
54
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
Titel I<br />
WÜRDE DES MENSCHEN<br />
Artikel II-61 Würde des Menschen<br />
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.<br />
Artikel II-62 Recht auf Leben<br />
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.<br />
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.<br />
Artikel II-63 Recht auf Unversehrtheit<br />
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.<br />
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet<br />
werden:<br />
a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend<br />
den gesetzlich festgelegten Einzelheiten,<br />
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion<br />
von Menschen zum Ziel haben,<br />
c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung<br />
von Gewinnen zu nutzen,<br />
d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.<br />
Artikel II-64 Verbot der Folter und unmenschlicher<br />
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung<br />
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung<br />
unterworfen werden.<br />
Artikel II-65 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit<br />
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.<br />
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.<br />
(3) Menschenhandel ist verboten.<br />
55
Verfassung für Europa<br />
Teil II<br />
Titel II<br />
FREIHEITEN<br />
Artikel II-66 Recht auf Freiheit und Sicherheit<br />
Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.<br />
Artikel II-67 Achtung des Privat- und Familienlebens<br />
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung<br />
sowie ihrer Kommunikation.<br />
Artikel II-68 Schutz personenbezogener Daten<br />
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen<br />
Daten.<br />
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit<br />
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen<br />
Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie<br />
betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.<br />
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.<br />
Artikel II-69 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen<br />
Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach<br />
den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte<br />
regeln.<br />
Artikel II-70 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit<br />
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.<br />
Dieses Recht umfasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und<br />
die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen<br />
öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen.<br />
(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den<br />
einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln.<br />
Artikel II-71 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit<br />
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt<br />
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche<br />
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.<br />
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.<br />
56
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel II-72 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit<br />
(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen<br />
und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu<br />
versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person<br />
umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften<br />
beizutreten.<br />
(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen<br />
Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.<br />
Artikel II-73 Freiheit der Kunst und der Wissenschaft<br />
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.<br />
Artikel II-74 Recht auf Bildung<br />
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung<br />
und Weiterbildung.<br />
(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht<br />
teilzunehmen.<br />
(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen<br />
Grundsätze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder<br />
entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen<br />
sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche<br />
ihre Ausübung regeln.<br />
Artikel II-75 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten<br />
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen<br />
Beruf auszuüben.<br />
(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat<br />
Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu<br />
erbringen.<br />
(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten<br />
arbeiten dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen<br />
und Unionsbürger entsprechen.<br />
Artikel II-76 Unternehmerische Freiheit<br />
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.<br />
Artikel II-77 Eigentumsrecht<br />
(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu<br />
nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen<br />
57
Verfassung für Europa<br />
Teil II<br />
werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den<br />
Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene<br />
Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann<br />
gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.<br />
(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.<br />
Artikel II-78 Asylrecht<br />
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und<br />
des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie nach<br />
Maßgabe der Verfassung gewährleistet.<br />
Artikel II-79 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung<br />
(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig.<br />
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat<br />
ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der<br />
Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung<br />
besteht.<br />
Titel III<br />
GLEICHHEIT<br />
Artikel II-80 Gleichheit vor dem Gesetz<br />
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.<br />
Artikel II-81 Nichtdiskriminierung<br />
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe,<br />
der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der<br />
Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der<br />
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung,<br />
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten.<br />
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungsbereich<br />
jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.<br />
Artikel II-82 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen<br />
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.<br />
Artikel II-83 Gleichheit von Frauen und Männern<br />
Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der<br />
Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.<br />
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer<br />
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen.<br />
58
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel II-84 Rechte des Kindes<br />
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen<br />
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den<br />
Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden<br />
Weise berücksichtigt.<br />
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen<br />
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.<br />
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte<br />
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.<br />
Artikel II-85 Rechte älterer Menschen<br />
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges<br />
Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.<br />
Artikel II-86 Integration von Menschen mit Behinderung<br />
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen<br />
zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung<br />
und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.<br />
Titel IV<br />
SOLIDARITÄT<br />
Artikel II-87 Recht auf Unterrichtung und Anhörung<br />
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen<br />
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten<br />
Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den<br />
Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.<br />
Artikel II-88 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen<br />
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber<br />
oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten<br />
Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive<br />
Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.<br />
Artikel II-89 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst<br />
Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.<br />
59
Verfassung für Europa<br />
Teil II<br />
Artikel II-90 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung<br />
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter<br />
Entlassung.<br />
Artikel II-91 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen<br />
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere<br />
und würdige Arbeitsbedingungen.<br />
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung<br />
der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten<br />
Jahresurlaub.<br />
Artikel II-92 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen<br />
am Arbeitsplatz<br />
Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und<br />
abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt in das<br />
Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.<br />
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen<br />
erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt werden, die<br />
ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder soziale Entwicklung<br />
beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden könnte.<br />
Artikel II-93 Familien- und Berufsleben<br />
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.<br />
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat<br />
jeder Mensch das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft<br />
zusammenhängenden Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub<br />
und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes.<br />
Artikel II-94 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung<br />
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der<br />
sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit,<br />
Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes<br />
Schutz gewährleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.<br />
(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen<br />
Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit<br />
und die sozialen Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.<br />
60
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet<br />
die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die<br />
Wohnung, die allen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges<br />
Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen<br />
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.<br />
Artikel II-95 Gesundheitsschutz<br />
Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung<br />
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.<br />
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen der Union in allen<br />
Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.<br />
Artikel II-96 Zugang zu Dienstleistungen<br />
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse<br />
Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen<br />
Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten<br />
im Einklang mit der Verfassung geregelt ist, um den sozialen und territorialen<br />
Zusammenhalt der Union zu fördern.<br />
Artikel II-97 Umweltschutz<br />
Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die<br />
Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung<br />
sichergestellt werden.<br />
Artikel II-98 Verbraucherschutz<br />
Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher.<br />
Titel V<br />
BÜRGERRECHTE<br />
Artikel II-99 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen<br />
zum Europäischen Parlament<br />
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem<br />
sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen<br />
Parlament unter denselben Bedingungen wie die Angehörigen des betreffenden<br />
Mitgliedstaats.<br />
(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer,<br />
freier und geheimer Wahl gewählt.<br />
61
Verfassung für Europa<br />
Teil II<br />
Artikel II-100 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen<br />
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie<br />
ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen unter<br />
denselben Bedingungen wie die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats.<br />
Artikel II-101 Recht auf eine gute Verwaltung<br />
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen,<br />
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer<br />
angemessenen Frist behandelt werden.<br />
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere<br />
a) das Recht jeder Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie nachteilige<br />
individuelle Maßnahme getroffen wird,<br />
b) das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung<br />
des berechtigten Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses,<br />
c) die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen.<br />
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre Organe oder<br />
Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen<br />
Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam<br />
sind.<br />
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verfassung an die Organe der<br />
Union wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.<br />
Artikel II-102 Recht auf Zugang zu Dokumenten<br />
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person<br />
mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf<br />
Zugang zu den Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union,<br />
unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger.<br />
Artikel II-103 Der Europäische Bürgerbeauftragte<br />
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person<br />
mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, den<br />
Europäischen Bürgerbeauftragten im Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe,<br />
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der<br />
Europäischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.<br />
Artikel II-104 Petitionsrecht<br />
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person<br />
mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, eine<br />
Petition an das Europäische Parlament zu richten.<br />
62
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel II-105 Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit<br />
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet<br />
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.<br />
(2) Staatsangehörigen von Drittländern, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines<br />
Mitgliedstaats aufhalten, kann nach Maßgabe der Verfassung Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit<br />
gewährt werden.<br />
Artikel II-106 Diplomatischer und konsularischer Schutz<br />
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlands,<br />
in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den<br />
Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats<br />
unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates.<br />
Titel VI<br />
JUSTIZIELLE RECHTE<br />
Artikel II-107 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf<br />
und ein unparteiisches Gericht<br />
Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt<br />
worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen<br />
bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.<br />
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen<br />
und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich<br />
und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen<br />
und vertreten lassen.<br />
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt,<br />
soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu<br />
gewährleisten.<br />
Artikel II-108 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte<br />
(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld<br />
als unschuldig.<br />
(2) Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet.<br />
Artikel II-109 Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit<br />
im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen<br />
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die<br />
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar<br />
war. Es darf auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte<br />
63
Verfassung für Europa<br />
Teil II<br />
Strafe verhängt werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere<br />
Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen.<br />
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder<br />
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen,<br />
von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war.<br />
(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhältnismäßig sein.<br />
Artikel II-110 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal<br />
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden<br />
Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz<br />
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut<br />
verfolgt oder bestraft werden.<br />
Titel VII<br />
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE<br />
AUSLEGUNG UND ANWENDUNG DER CHARTA<br />
Artikel II-111 Anwendungsbereich<br />
(1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union<br />
unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei<br />
der Durchführung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten<br />
sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen<br />
Zuständigkeiten und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der<br />
Union in anderen Teilen der Verfassung übertragen werden.<br />
(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten<br />
der Union hinaus aus und begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue<br />
Aufgaben für die Union, noch ändert sie die in den anderen Teilen der Verfassung festgelegten<br />
Zuständigkeiten und Aufgaben.<br />
Artikel II-112 Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze<br />
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und<br />
Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und<br />
Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen<br />
nur vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind und den von der<br />
Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen<br />
des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.<br />
(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in anderen Teilen<br />
der Verfassung geregelt sind, erfolgt im Rahmen der dort festgelegten Bedingungen und<br />
Grenzen.<br />
64
Teil II<br />
Verfassung für Europa<br />
(3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention<br />
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen,<br />
haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention<br />
verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der<br />
Union einen weiter gehenden Schutz gewährt.<br />
(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den<br />
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im<br />
Einklang mit diesen Überlieferungen ausgelegt.<br />
(5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können<br />
durch Akte der Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen<br />
Stellen der Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des<br />
Rechts der Union in Ausübung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie<br />
können vor Gericht nur bei der Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über<br />
deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden.<br />
(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in dieser<br />
Charta bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen.<br />
(7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung der Charta der Grundrechte<br />
verfasst wurden, sind von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten<br />
gebührend zu berücksichtigen.<br />
Artikel II-113 Schutzniveau<br />
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte<br />
und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich<br />
durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkünfte,<br />
bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter<br />
insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,<br />
sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden.<br />
Artikel II-114 Verbot des Missbrauchs der Rechte<br />
Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine<br />
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der<br />
Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken,<br />
als dies in der Charta vorgesehen ist.<br />
65
Verfassung für Europa<br />
TEIL IV<br />
ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN<br />
Artikel IV-437 Aufhebung der früheren Verträge<br />
(1) Mit diesem Vertrag über eine Verfassung für Europa werden der Vertrag zur<br />
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und der Vertrag über die Europäische Union<br />
sowie, nach Maßgabe des Protokolls über die Rechtsakte und Verträge zur Ergänzung<br />
oder Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags<br />
über die Europäische Union, die Rechtsakte und Verträge zu ihrer Ergänzung oder<br />
Änderung vorbehaltlich des Absatzes 2 aufgehoben.<br />
(2) Die Verträge über den Beitritt<br />
a) des Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien<br />
und Nordirland,<br />
b) der Hellenischen Republik,<br />
c) des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik,<br />
d) der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden<br />
sowie<br />
e) der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der<br />
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik<br />
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik<br />
werden aufgehoben.<br />
Jedoch<br />
– bleiben diejenigen Bestimmungen der unter den Buchstaben a bis d genannten Verträge,<br />
die in das Protokoll betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des<br />
Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien<br />
und Nordirland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen<br />
Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs<br />
Schweden übernommen wurden oder darin angeführt sind, in Kraft und behalten<br />
ihre Rechtswirkung nach Maßgabe dieses Protokolls.<br />
– bleiben diejenigen Bestimmungen des unter Buchstabe e genannten Vertrags, die in<br />
das Protokoll betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen<br />
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland,<br />
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen,<br />
der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik übernommenen wurden<br />
oder darin aufgeführt sind, in Kraft und behalten ihre Rechtswirkung nach Maßgabe<br />
dieses Protokolls.<br />
66
Teil IV<br />
Verfassung für Europa<br />
Artikel IV-438 Rechtsnachfolge und rechtliche Kontinuität<br />
(1) Die durch diesen Vertrag geschaffene Europäische Union tritt die Rechtsnachfolge<br />
der durch den Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union<br />
und der Europäischen Gemeinschaft an.<br />
(2) Vorbehaltlich des Artikels IV-439 nehmen die bei Inkrafttreten dieses Vertrags<br />
bestehenden Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen ihre Befugnisse nach diesem<br />
Vertrag in ihrer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens gegebenen Zusammensetzung so lange<br />
wahr, bis in Anwendung dieses Vertrags neue Bestimmungen erlassen werden oder ihr<br />
Mandat endet.<br />
(3) Die Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen, die auf der<br />
Grundlage der durch Artikel IV-437 aufgehobenen Verträge und Rechtsakte angenommen<br />
wurden, gelten weiter. Sie behalten so lange Rechtswirkung, bis sie in Anwendung<br />
dieses Vertrags aufgehoben, für nichtig erklärt oder geändert werden. Dies gilt auch für<br />
Übereinkommen, die auf der Grundlage der durch Artikel IV-437 aufgehobenen Verträge<br />
und Rechtsakte zwischen Mitgliedstaaten geschlossen wurden.<br />
Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags geltenden weiteren Teile des<br />
Besitzstands der Gemeinschaft und der Union, insbesondere die interinstitutionellen Vereinbarungen,<br />
die Beschlüsse und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der<br />
Regierungen der Mitgliedstaaten, die Vereinbarungen der Mitgliedstaaten über die Funktionsweise<br />
der Union oder der Gemeinschaft oder im Zusammenhang mit deren Handeln,<br />
die Erklärungen, einschließlich jener im Rahmen von Regierungskonferenzen, und<br />
die Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen des Europäischen Rates oder des<br />
Rates sowie die die Union oder die Gemeinschaft betreffenden Entschließungen oder<br />
sonstigen Stellungnahmen, die von den Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen<br />
angenommen wurden, haben ebenfalls so lange weiter Bestand, bis sie aufgehoben oder<br />
geändert werden.<br />
(4) Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des<br />
Gerichts erster Instanz zur Auslegung und Anwendung der durch Artikel IV-437 aufgehobenen<br />
Verträge und Rechtsakte und der für ihre Anwendung erlassenen Rechtsakte<br />
und geschlossenen Übereinkommen bleibt sinngemäß auch weiterhin maßgeblich für die<br />
verbindliche Auslegung des Unionsrechts und insbesondere vergleichbarer Bestimmungen<br />
der Verfassung.<br />
(5) Die Kontinuität der vor dem Inkrafttreten dieses Vertrags eingeleiteten Gerichtsund<br />
Verwaltungsverfahren wird unter Wahrung der Verfassung gewährleistet. Die für<br />
diese Verfahren verantwortlichen Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen ergreifen<br />
alle hierfür erforderlichen Maßnahmen.<br />
Artikel IV-439 Übergangsbestimmungen für bestimmte Organe<br />
Die Übergangsbestimmungen zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, zur<br />
Definition der qualifizierten Mehrheit im Europäischen Rat und im Rat, einschließlich in<br />
den Fällen, in denen nicht alle Mitglieder des Europäischen Rates oder des Rates an der<br />
67
Verfassung für Europa<br />
Teil IV<br />
Abstimmung teilnehmen, und zur Zusammensetzung der Kommission, einschließlich<br />
des Außenministers der Union, sind im Protokoll über die Übergangsbestimmungen für<br />
die Organe und Einrichtungen der Union enthalten.<br />
Artikel IV-440 Räumlicher Geltungsbereich<br />
(1) Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien, die Tschechische Republik, das<br />
Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, die Hellenische<br />
Republik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, Irland, die Italienische<br />
Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen,<br />
das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das Königreich<br />
der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische<br />
Republik, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland,<br />
das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland.<br />
(2) Dieser Vertrag gilt nach Artikel III-424 für Guadeloupe, Französisch-Guayana,<br />
Martinique, Réunion, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln.<br />
(3) Auf die in Anhang II genannten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete findet<br />
die in Teil III Titel IV festgelegte besondere Assoziierungsregelung Anwendung.<br />
Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete,<br />
die besondere Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland<br />
unterhalten und in dieser Liste nicht genannt sind.<br />
(4) Dieser Vertrag findet auf die europäischen Hoheitsgebiete Anwendung, deren<br />
auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt.<br />
(5) Dieser Vertrag findet auf die Ålandinseln mit den Ausnahmeregelungen Anwendung,<br />
die ursprünglich in dem in Artikel IV-437 Absatz 2 Buchstabe d genannten Vertrag<br />
vorgesehen waren und die in das Protokoll betreffend die Verträge und die Akten über<br />
den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs<br />
Großbritannien und Nordirland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien<br />
und der Portugiesischen Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und<br />
des Königreichs Schweden übernommen worden sind.<br />
(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 findet<br />
a) dieser Vertrag auf die Färöer keine Anwendung;<br />
b) dieser Vertrag auf die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien<br />
und Nordirland auf Zypern, Akrotiri und Dhekelia nur insoweit Anwendung, als<br />
dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzustellen, die<br />
ursprünglich in dem Protokoll über die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs<br />
Großbritannien und Nordirland auf Zypern, das der Beitrittsakte, die<br />
Bestandteil des in Artikel IV-437 Absatz 2 Buchstabe e genannten Vertrags ist,<br />
beigefügt ist und das im Zweiten Teil Titel III des Protokolls betreffend den Vertrag<br />
und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik<br />
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der<br />
68
Teil IV<br />
Verfassung für Europa<br />
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien<br />
und der Slowakischen Republik übernommen worden ist, vorgesehen war;<br />
c) dieser Vertrag auf die Kanalinseln und die Insel Man nur insoweit Anwendung,<br />
als dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzustellen, die<br />
ursprünglich in dem in Artikel IV-437 Absatz 2 Buchstabe a genannten Vertrag<br />
für diese Inseln vorgesehen war und die in Titel II Abschnitt 3 des Protokolls<br />
betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des Königreichs Dänemark,<br />
Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland,<br />
der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen<br />
Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs<br />
Schweden übernommen worden ist.<br />
(7) Der Europäische Rat kann auf Initiative des betroffenen Mitgliedstaats einen<br />
Europäischen Beschluss zur Änderung des Status eines in den Absätzen 2 und 3 genannten<br />
dänischen, französischen oder niederländischen Landes oder Hoheitsgebiets gegenüber<br />
der Union erlassen. Der Europäische Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der<br />
Kommission.<br />
Artikel IV-441 Regionale Zusammenschlüsse<br />
Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchführung der regionalen Zusammenschlüsse<br />
zwischen Belgien und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxemburg und<br />
den Niederlanden nicht entgegen, sofern die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch die<br />
Anwendung dieses Vertrags nicht erreicht werden.<br />
Artikel IV-442 Protokolle und Anhänge<br />
Die Protokolle und Anhänge dieses Vertrags sind Bestandteil dieses Vertrags.<br />
Artikel IV-443 Ordentliches Änderungsverfahren<br />
(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission<br />
kann dem Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrags vorlegen. Diese Entwürfe<br />
werden vom Rat dem Europäischen Rat übermittelt und den nationalen Parlamenten zur<br />
Kenntnis gebracht.<br />
(2) Beschließt der Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments<br />
und der Kommission mit einfacher Mehrheit die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen,<br />
so beruft der Präsident des Europäischen Rates einen Konvent von Vertretern<br />
der nationalen Parlamente, der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, des<br />
Europäischen Parlaments und der Kommission ein. Bei institutionellen Änderungen im<br />
Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört. Der Konvent prüft die<br />
Änderungsentwürfe und nimmt im Konsensverfahren eine Empfehlung an, die an eine<br />
Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten nach Absatz 3 gerichtet<br />
ist.<br />
69
Verfassung für Europa<br />
Teil IV<br />
Der Europäische Rat kann mit einfacher Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen<br />
Parlaments beschließen, keinen Konvent einzuberufen, wenn seine Einberufung aufgrund<br />
des Umfangs der geplanten Änderungen nicht gerechtfertigt ist. In diesem Fall<br />
legt der Europäische Rat das Mandat für eine Konferenz der Vertreter der Regierungen<br />
der Mitgliedstaaten fest.<br />
(3) Eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten wird vom Präsidenten<br />
des Rates einberufen, um die an diesem Vertrag vorzunehmenden Änderungen<br />
zu vereinbaren.<br />
Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten nach Maßgabe<br />
ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind.<br />
(4) Haben nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung des Vertrags zur<br />
Änderung dieses Vertrags vier Fünftel der Mitgliedstaaten den genannten Vertrag ratifiziert<br />
und sind in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei<br />
der Ratifikation aufgetreten, so befasst sich der Europäische Rat mit der Frage.<br />
Artikel IV-444 Vereinfachtes Änderungsverfahren<br />
(1) In Fällen, in denen der Rat nach Maßgabe von Teil III in einem Bereich oder in<br />
einem bestimmten Fall einstimmig beschließt, kann der Europäische Rat einen Europäischen<br />
Beschluss erlassen, wonach der Rat in diesem Bereich oder in diesem Fall mit<br />
qualifizierter Mehrheit beschließen kann.<br />
Dieser Absatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen<br />
Bezügen.<br />
(2) In Fällen, in denen nach Maßgabe von Teil III Europäische Gesetze oder Rahmengesetze<br />
vom Rat nach einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden<br />
müssen, kann der Europäische Rat einen Europäischen Beschluss erlassen, wonach diese<br />
Europäischen Gesetze oder Rahmengesetze nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<br />
erlassen werden können.<br />
(3) Jede vom Europäischen Rat auf der Grundlage von Absatz 1 oder Absatz 2<br />
ergriffene Initiative wird den nationalen Parlamenten übermittelt. Wird diese Initiative<br />
innerhalb von sechs Monaten nach der Übermittlung von einem nationalen Parlament<br />
abgelehnt, so wird der Europäische Beschluss nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht erlassen.<br />
Wird die Initiative nicht abgelehnt, so kann der Europäische Rat den Europäischen<br />
Beschluss erlassen.<br />
Der Europäische Rat erlässt die Europäischen Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2<br />
einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der Mehrheit seiner<br />
Mitglieder beschließt.<br />
Artikel IV-445 Vereinfachtes Änderungsverfahren betreffend<br />
die internen Politikbereiche der Union<br />
(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission<br />
kann dem Europäischen Rat Entwürfe zur Änderung aller oder eines Teils der Bestimmungen<br />
des Teils III Titel III über die internen Politikbereiche der Union vorlegen.<br />
70
Teil IV<br />
Verfassung für Europa<br />
(2) Der Europäische Rat kann einen Europäischen Beschluss zur Änderung aller<br />
oder eines Teils der Bestimmungen des Teils III Titel III erlassen. Der Europäische Rat<br />
beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission<br />
sowie, bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich, der Europäischen Zentralbank.<br />
Dieser Europäische Beschluss tritt erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang<br />
mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.<br />
(3) Der Europäische Beschluss nach Absatz 2 darf nicht zu einer Ausdehnung der<br />
der Union im Rahmen dieses Vertrags übertragenen Zuständigkeiten führen.<br />
Artikel IV-446 Geltungsdauer<br />
Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.<br />
Artikel IV-447 Ratifikation und Inkrafttreten<br />
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien im Einklang<br />
mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden<br />
bei der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.<br />
(2) Dieser Vertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden<br />
hinterlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag des zweiten auf die<br />
Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats.<br />
Artikel IV-448 Verbindliche Fassungen und Übersetzungen<br />
(1) Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, estnischer,<br />
finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, lettischer, litauischer,<br />
maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, schwedischer, slowakischer,<br />
slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder<br />
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Regierung der Italienischen<br />
Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats<br />
eine beglaubigte Abschrift.<br />
(2) Dieser Vertrag kann ferner in jede andere von den Mitgliedstaaten bestimmte<br />
Sprache übersetzt werden, sofern diese Sprache nach der Verfassungsordnung des jeweiligen<br />
Mitgliedstaats in dessen gesamtem Hoheitsgebiet oder in Teilen davon Amtssprache<br />
ist. Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen eine beglaubigte Abschrift dieser Übersetzungen<br />
zur Verfügung, die in den Archiven des Rates hinterlegt wird.<br />
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften<br />
unter diesen Vertrag gesetzt.<br />
Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.<br />
71
KOMMENTAR<br />
Teil 1
Georg Kristian Kampfer<br />
PRÄAMBEL<br />
Die Präambel der Europäischen Verfassung besteht aus nur einem, schier endlosen<br />
Satz mit über 250 Wörtern. Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist dieser in<br />
sechs Abschnitte unterteilt. Der Autor des Aufmachers: Valéry Giscard d’Estaing,<br />
der Präsident des Verfassungskonvents höchstpersönlich.<br />
Im ersten Abschnitt wird die Urquelle Europas beschrieben, aus der die Mütter<br />
und Väter der Verfassung schöpften. Diese Quelle speist sich aus kulturellen,<br />
religiösen und humanistischen Strömungen. Aus derselben Quelle entwickelten<br />
sich sowohl die allgemeinen Menschenrechte als auch die speziell europäischen<br />
Werte. Diese sind: Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit.<br />
1<br />
Der Abschnitt zwei ist ein Sammelbecken der zentralen Ziele der Europäischen<br />
Union. Während Demokratie und Transparenz die Grundlage des öffentlichen<br />
Lebens in Europa bilden, plant die Europäische Union, in der Welt Frieden,<br />
Gerechtigkeit und Solidarität durchzusetzen. Im Haus Europa sollen vor allem<br />
Fortschritt und Wohlstand allen Menschen nutzen, selbst den Schwächsten und<br />
den Ärmsten. Kultur, Wissenschaft und sozialer Fortschritt sollen das Leben<br />
der Menschen in Europa prägen.<br />
Dass die „Völker Europas“ durch das Projekt der europäischen Integration<br />
„immer enger vereint“ ihr Schicksal gemeinsam gestalten sollen, erfährt der<br />
Leser in Abschnitt drei.<br />
Im vierten Abschnitt ist das Grundelement des deutschen Föderalismus 2 und<br />
zugleich auch der Leitspruch 3 der Union genannt: Europa ist „in Vielfalt<br />
geeint“. Die Europäische Union soll danach die jeweils unterschiedliche Kultur,<br />
Tradition und nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten schützen. Weiterhin<br />
wird in diesem Abschnitt auf die Verantwortung der Europäer gegenüber<br />
zukünftigen Generationen und der Erde hingewiesen.<br />
Der fünfte Abschnitt ist ein durch die Staats- und Regierungschefs neu aufgenommener<br />
Appell an sich selbst, die europäische Integration fortzuführen.<br />
1<br />
Während die allgemeinen Menschenrechte auf die Zeit der Französischen Revolution zurückzuführen<br />
sind, reicht die Entstehung der europäischen Werte bis in die griechisch-römische<br />
Antike zurück.<br />
2<br />
Vgl. zum Begriff des Föderalismus Kampfer 2003, 21–23.<br />
3<br />
Vgl. Artikel 8.<br />
76 Kampfer
Präambel<br />
Schließlich betonen die Staats- und Regierungschefs, dass sie die Leistung des<br />
Europäischen Verfassungskonvents würdigen. Diese bestand in der Erarbeitung<br />
des Entwurfs zu dieser Verfassung „im Namen der Bürgerinnen und Bürger und<br />
der Staaten Europas“.<br />
Einstimmung und Skizze der Befindlichkeit?<br />
Charakteristisch für die Präambel einer Verfassung sind zwei Eigenschaften:<br />
Sie dient erstens der „Einstimmung in das Regelwerk“ der<br />
Verfassung und sie ist zweitens eine „Skizze der Befindlichkeit des<br />
Verfassungsgebers“ 4 . Aufgrund der besonderen Ausgangskonstellation<br />
trifft dies jedoch bei der europäischen Verfassungspräambel nicht ganz<br />
zu, und zwar aus den folgenden Gründen. Die Verfassung der Vereinigten<br />
Staaten von Amerika besitzt zum Beispiel eine Präambel aus nur<br />
einem kurzen Satz, der mit den Worten beginnt: „Wir, das Volk der Vereinigten<br />
Staaten“ und endet mit „erlassen diese Verfassung für die Vereinigten<br />
Staaten von Amerika“. 5 Auch die Präambel des deutschen<br />
Grundgesetzes ist kurz gefasst und endet mit den Worten: „hat sich das<br />
Deutsche Volk 6 [...] dieses Grundgesetz gegeben“ 6 . Im Gegensatz zur<br />
europäischen Präambel haben sowohl die deutschen wie auch die USamerikanischen<br />
Verfassungsgeber damit das Volk als die verfassungsgebende<br />
Gewalt bezeichnet. 7 Der Leser dieser Präambeln fühlt sich daher<br />
„mitgenommen“, als Staatsbürger empfindet er ein wenig Stolz.<br />
Die vom Konvent im Namen der Bürgerinnen und Bürger erarbeitete 8<br />
Europäische Verfassung dagegen beginnt nicht etwa mit den Worten:<br />
„Wir, die Völker Europas“. Doch eben ein solcher Auftakt hätte beim<br />
Leser zu einer guten „Einstimmung in das Regelwerk“ geführt. Auch<br />
hätte eine solche Formulierung den Staats- und Regierungschefs einen<br />
Anlass geboten, über eine europaweite Volksabstimmung nachzudenken.<br />
Da dem Verfassungskonvent aber offenbar der Mut und die Zuversicht<br />
zu dieser Vorlage fehlten, stimmt Europa nun lediglich mit einer<br />
begrenzten Zahl seiner Unionsbürger über die Verfassung ab, während die<br />
restlichen Unionsbürger als „Beifahrer der europäischen Integration“ dem<br />
4<br />
Kunig in Münch/Kunig 1992, Präambel, Rn.1.<br />
5<br />
Präambel der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, abgedruckt in: Adams 1994.<br />
6<br />
Präambel des deutschen Grundgesetzes, abgedruckt in: Schade 2003.<br />
7<br />
Vgl. Hömig in Seifert/Hömig 2003, Präambel, Rn.4.<br />
8<br />
Abschnitt 6 der Präambel der Verfassung für Europa.<br />
Kampfer 77
Präambel<br />
Ausgang der Referenda ohne direkte Mitwirkungsmöglichkeit entgegenblickt.<br />
Damit ist Europa einen Schritt zurückgefallen auf dem<br />
Weg zu einer europäischen Demokratie. Wenig Trost ist darin zu erkennen,<br />
dass schon das deutsche Grundgesetz nicht durch das Volk direkt<br />
beschlossen wurde. Doch neben diesem demokratietheoretischen Mangel<br />
ist die europäische Verfassungspräambel als „Einstimmung“ zudem<br />
zu lang, und ihre Abstraktheit erinnert eher an die einleitenden Worte<br />
eines völkerrechtlichen Vertrages.<br />
Die Präambel und ihre Vorgängerin<br />
Vergleicht man die Verfassungspräambel mit ihrer Vorgängerin, der Präambel<br />
des Vertrags von Maastricht aus dem Jahr 1992, so fällt auf, dass<br />
die dort noch konkret benannten Ziele nunmehr fehlen. Es handelt sich<br />
um das Ziel der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, der<br />
Einführung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und<br />
einer Unionsbürgerschaft sowie der Schaffung eines Raumes der Freiheit,<br />
der Sicherheit und des Rechts. Zwar wurden seitdem schon einige<br />
dieser Ziele erreicht; ihre zukünftige Vertiefung ist aber eine neu angestrebte,<br />
beachtliche Aufgabe. Und gerade die Erreichung von Zielen,<br />
wie die Einführung einer Unionsbürgerschaft, hätte zugunsten der „Einstimmung“<br />
in der Präambel erwähnt werden können. Denn bereits heute<br />
genießt jeder Staatsbürger eines Mitgliedstaates der Union (Unionsbürger)<br />
das Recht der Freizügigkeit in der gesamten Europäischen<br />
Union, das Wahlrecht zum Europaparlament, das kommunale EU-Wahlrecht,<br />
das Beschwerderecht beim Europaparlament sowie einen umfassenden<br />
diplomatischen EU-Schutz im Ausland. 9 Indem die Präambel<br />
anstelle von Unionsbürgern von „Bewohnern“ 10 der Union spricht,<br />
macht sie einen geradezu rückständigen Eindruck.<br />
Weggefallen sind auch die Bekenntnisse zu einer „neuen Stufe“ 11 der<br />
europäischen Integration und der Schaffung einer „immer engeren<br />
Union“ 12 . Die Abwesenheit dieser Begriffe lässt die Europäische Verfassung<br />
als abschließendes Werk erscheinen.<br />
Eine Verfassung mit zwei unterschiedlichen Präambeln<br />
Die mangelnde Einstimmung der Verfassungspräambel wird durch eine<br />
zweite Präambel geheilt, denn die Europäische Verfassung enthält in<br />
9<br />
Vgl. Artikel 17 ff. des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag).<br />
10<br />
Abschnitt 1 und Abschnitt 2 der Präambel; in der französischen Übersetzung: „citoyen“.<br />
11<br />
Vertrag über die Europäische Union (EU-Vertrag), Präambel.<br />
12<br />
EU-Vertrag, Präambel.<br />
78 Kampfer
Präambel<br />
ihrem Teil II eine weitere Präambel, die es zu lesen lohnt – die der<br />
Grundrechtecharta. 13 Damit besitzen die Europäer die weltweit einzige<br />
Verfassung mit zwei Präambeln: einer abstrakten und einer konkreten.<br />
Eine „Skizze der Befindlichkeit des Verfassungsgebers“ ist dagegen die<br />
Präambel der Europäischen Verfassung sehr wohl, denn die Konventsmitglieder<br />
hatten am 13. Juni 2003 nach 23 offiziellen Sitzungen in über<br />
16 Monaten nur noch einen gemeinsamen Wunsch: Sie wollten Väter<br />
und Mütter der Europäischen Verfassung werden. Angesichts eines<br />
möglichen Scheiterns des zeitlich begrenzten Verfassungskonvents<br />
wollte am Ende niemand mehr das Konsensverfahren stören. Deshalb<br />
stimmten sie dem Präambeltext vorbehaltlos zu. 14 Und so setzte sich<br />
Valéry Giscard d’Estaing durch – mit dieser Präambel.<br />
Weder ein Gottesbezug noch ein Verweis auf das christliche Erbe<br />
Einen direkten Gottesbezug, wie er etwa in den Worten „im Bewusstsein<br />
der Verantwortung vor Gott“ 15 zum Ausdruck kommt, enthält die<br />
Europäische Verfassung nicht. Giscard d’Estaing als ehemaliger Staatspräsident<br />
Frankreichs war anderes gewohnt, denn Frankreich trennt<br />
infolge von Aufklärung und Revolution strikt zwischen Staat und Kirche.<br />
16 So fehlt auch ein Verweis auf das christliche Erbe, obgleich beides<br />
von Konventsmitgliedern gefordert worden war. 17<br />
Doch eine religiöse Aussage musste so formuliert werden, dass sie sich<br />
nicht auf ein christliches Verständnis beschränkte, denn es leben in der<br />
EU gegenwärtig fünfzehn Millionen Muslime, was der Bevölkerung<br />
eines mittleren Staates entspricht. Vor dem Hintergrund der Beitrittsverhandlungen<br />
der EU mit der Türkei wäre eine Beschränkung auf das so<br />
genannte „christliche Abendland“ zumindest bedenklich gewesen.<br />
Daneben hätten sich auch andere Religionsgemeinschaften oder die<br />
atheistischen Mitbürger Europas schnell ausgegrenzt gefühlt. Vor diesem<br />
Hintergrund enthält Europas Präambel jetzt nur einen Hinweis auf<br />
das „religiöse Erbe“ der Europäer.<br />
13<br />
Siehe Teil II der Verfassung für Europa, Präambel.<br />
14<br />
Siehe unter http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/konvent/plenar/pt23.shtml (20.06.2005).<br />
15<br />
Vgl. Präambel des deutschen Grundgesetzes.<br />
16<br />
Giscard d’Estaing wurde daher auch von einer polnischen Journalistin mit dem russischen<br />
Astronauten Gagarin verglichen, der aus dem Weltraum mit dem berühmten Satz zurückkam,<br />
er habe dort oben Gott nicht gefunden.<br />
17<br />
Vgl. Wernicke 2003 und Meier 2003.<br />
Kampfer 79
Präambel<br />
Ein starkes Argument für einen Gottesbezug war, dass dadurch alle<br />
absoluten Machtansprüche staatlicher Willkür zurückgewiesen und sich<br />
die politischen Entscheidungsträger ihrer besonderen Verantwortung –<br />
vor Gott – jederzeit bewusst würden. Denn auch die europäische<br />
Geschichte ist, wie Naziherrschaft und Stalindiktatur belegen, nicht von<br />
unbedingter staatlicher Gewalt verschont geblieben.<br />
Auch eine Kompromisslösung, wie sie in der offenen Formulierung der<br />
polnischen Verfassungspräambel zum Ausdruck kommt, wurde nicht<br />
gefunden. Danach respektiert die polnische Nation sowohl diejenigen,<br />
die an Gott als Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte und Herrlichkeit<br />
glauben, als auch jene, die diesen Glauben nicht teilen, aber diese<br />
fundamentalen Werte abgeleitet aus anderen Quellen respektieren. 18<br />
Stattdessen wurde das Thema auf dem Brüsseler Gipfeltreffen am 12.<br />
und 13. Dezember 2003 folgenlos debattiert. 19 Zuvor hatte ein entsprechender<br />
Änderungsantrag im Europaparlament keine Mehrheit gefunden<br />
20 und auch im Deutschen Bundestag war der Versuch der CDU/<br />
CSU-Fraktion, die Bundesregierung zur Intervention zu bewegen,<br />
gescheitert. 21<br />
Am Anfang war Thukydides<br />
Als die Regierungskonferenz zur Europäischen Verfassung im Juni<br />
2004 mit einer Einigung der Staats- und Regierungschefs zu Ende ging,<br />
war der Konventsentwurf nicht mehr der alte. Obgleich der Entwurf zur<br />
Präambel direkt aus der Feder des Konventspräsidenten Giscard d’Estaing<br />
stammte, hatten die Vertreter der Regierungen sich nicht davor<br />
gescheut, auch den Text dieser Vorlage zu verändern. Während die<br />
meisten Änderungen redaktioneller Natur waren, strichen sie das ehemals<br />
vorangestellte Motto des antiken Staatsdenkers Thukydides aus<br />
der Verfassung. 22 Entnommen war es seinem Lebenswerk, dem vierbändigen<br />
Faktenbericht „Der Peloponnesische Krieg“, den er in den Jahren<br />
431 bis 424 vor Christus schrieb. Doch einige Regierungsvertreter müssen<br />
bemerkt haben, dass im Mittelpunkt dieses Werkes der Untergang<br />
18<br />
Vgl. http://www.ecln.net unter der Rubrik „European Constitutions“.<br />
19<br />
Vgl. REGIERUNGonline 2003.<br />
20<br />
Vgl. Barbier 2003 und Entschließung B5-0513/2003 des Europaparlaments vom 04.12.2003.<br />
21<br />
Der Antrag (Drucksache Nr.15/1695 vom 14.10.2003 des Deutschen Bundestages) fand keine<br />
Mehrheit.<br />
22<br />
„Die Verfassung, die wir haben ... heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger,<br />
sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.“ (Thukydides, II, 37)<br />
80 Kampfer
Präambel<br />
Athens und damit eine Darstellung der Ursachen des Verfalls der Vaterstadt<br />
von Thukydides stand 23 , eine Zukunftsvision, welche wohl von<br />
niemandem mit dem Haus Europa in Verbindung gebracht werden soll.<br />
Doch das Zitat hatte nun auch bereits erfolgreich als strategisches Mittel<br />
des Konventspräsidenten gedient. Denn dieser überreichte am 20. Juni<br />
2003 in Thessaloniki der griechischen Ratspräsidentschaft den Verfassungsentwurf<br />
mit den Worten „Kyrie Proethre!“. Das in griechischer<br />
Sprache gehaltene Motto Thukdides’ fachte die Begeisterung der Ratspräsidentschaft<br />
weiter an. Der Funken sprang auf die Staats- und Regierungschefs<br />
über, welche sich am 16. Juni 2004 auf den endgültigen Verfassungstext<br />
einigten und die Verfassung am 29. Oktober 2004 in Rom<br />
feierlich unterzeichneten.<br />
Allein eine textliche Ergänzung der Vertreter der Regierungen darf in<br />
keiner Kommentierung fehlen. Denn wenn die Präambel nunmehr unter<br />
dem Hinweis auf die vergangenen „schmerzlichen Erfahrungen“ von<br />
der Bedeutung des geeinten Europas spricht, so betont sie mit großer<br />
Berechtigung die Erfahrungen der Europäer mit zwei Weltkriegen: Es<br />
waren zwei Weltkriege, die Europa verwüsteten, zwei Weltkriege, die in<br />
Europa begannen.<br />
Literatur: Adams, Willi Paul (1994): Hamilton/Madison/Jay: Die Federalist-Artikel – Paderborn.<br />
Barbier, Cécile (2003): Die Regierungskonferenz ist unterbrochen, in: Zukunft Europa,<br />
H. 20, S. 1–4. Büchler, Otto (1950): Thukydides und der Peloponnesische Krieg. Ein Kommentar<br />
in fünf Tabellen – Heidelberg. Kampfer, Georg Kristian (2003): Die Europäische Union auf<br />
dem Weg zu einer Föderation? – Berlin. Malitz, Jürgen (1982): Thukydides’ Weg zur<br />
Geschichtsschreibung, in: Historia, H. 31, S. 257–289. Meier, Albrecht (2003): Christlich oder<br />
nur religiös? Die geplante Präambel der Verfassung erntet Kritik, in: Der Tagesspiegel vom<br />
05.06.2003. Münch, Ingo von/Kunig, Philip (1992): Grundgesetz-Kommentar, Band 1 (Präambel<br />
bis Art. 20), 4. Aufl. – München. REGIERUNGonline (2003): Europäische Union: EU-Gipfel<br />
gescheitert – Verfassungsprozess geht weiter (13.12.2003). Schade, Peter (2003): Grundgesetz<br />
mit Kommentierung, 6. Aufl. – Regensburg. Seifert, Karl-Heinz/Hömig, Dieter (2003):<br />
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Taschenkommentar, 7. Aufl. – Baden-Baden.<br />
Wernicke, Christian (2003): Giscard sucht nach Kompromissen, in: Süddeutsche Zeitung vom<br />
04.06.2003.<br />
23<br />
Vgl. Malitz 1982.<br />
Kampfer 81
Lutz Hager<br />
Artikel 1-8<br />
DEFINITION UND ZIELE DER UNION<br />
Artikel 1: Gründung der Union<br />
Artikel 1 legt grundlegend die Gestalt der Union fest. Die Europäische Union<br />
ist gleichermaßen ihren Bürgern und Mitgliedstaaten verpflichtet; sie ist jedoch<br />
in besonderem Maße von den Mitgliedstaaten abhängig. Denn diese übertragen<br />
der Union die Zuständigkeiten, die sie zur Verwirklichung der vorgegebenen<br />
Ziele benötigt. Erst dadurch wird sie als Gemeinschaft handlungsfähig.<br />
Dazu werden der Union zwei Aufgaben zugewiesen: Einerseits soll sie die Politik<br />
der Mitgliedstaaten „koordinieren“. 1 Hier hat sie lediglich eine beratende<br />
Rolle; Entscheidungen werden letztlich von den Regierungen der Mitgliedstaaten<br />
getroffen. Andererseits soll sie selbständig Zuständigkeiten ausüben. Diese<br />
so genannte Gemeinschaftsmethode kommt allerdings nur bei den explizit der<br />
Union übertragenen Zuständigkeiten zum Zuge, ist also auf einen engen<br />
Bereich beschränkt. 2 Absatz 2 erklärt, dass die Union prinzipiell offen für neue<br />
Mitglieder ist, sofern diese die – im folgenden Artikel 2 genannten – Werte teilen.<br />
3 Diese Einladung ist bereits in Artikel 49 des Maastrichter Vertrages (EU-<br />
Vertrag) enthalten und gilt hier wie dort für „alle europäischen Staaten“. Bei<br />
der Frage, welche Staaten dazu zählen, ist der Leser auf die zweimalige Erwähnung<br />
des „Kontinents Europa“ in der Präambel verwiesen. 4<br />
Artikel 2: Die Werte der Union<br />
Artikel 2 benennt Werte, die das Handeln der Union anleiten sollen. Gegenüber<br />
dem EU-Vertrag ist diese explizite Nennung an früher Stelle eine Neuerung.<br />
Vor allen anderen wird die Achtung der Menschenwürde genannt, die damit als<br />
Bezugspunkt der nachfolgend aufgeführten Werte dient. 5 Die anschließend<br />
1<br />
In einer früheren Formulierung war die Rede davon, dass die Politiken der Mitgliedstaaten „im<br />
Rahmen“ der Union „aufeinander abgestimmt“ werden sollen (CONV 724/03).<br />
2<br />
Die Formulierung „in gemeinschaftlicher Weise“ ersetzt den zuerst benutzten Ausdruck „in<br />
föderaler Weise“. Diese Änderung trägt der teilweisen gegensätzlichen Verwendung des Föderalismus-Begriffs<br />
in europäischen Ländern Rechnung (vgl. CONV 724/03).<br />
3<br />
Hier werden die Beschlüsse von Kopenhagen in einem Satz zusammengefasst. Auf dem Gipfel<br />
in Kopenhagen 1993 haben die EU-Staats- und Regierungschefs Kriterien für den Beitritt<br />
zur EU aufgestellt. Diese umfassen vor allem Stabilität der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit<br />
und Schutz der Menschenrechte, eine funktionierende Marktwirtschaft, Fähigkeit zur Übernahme<br />
der bisherigen EU-Regelungen und Einverständnis mit den politischen Zielen der<br />
Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion (nach Lippert 1997, 122–129).<br />
4<br />
„Europa“ wird in Artikel 1 mehrdeutig verwendet; die Verwendung im ersten Satz soll sich<br />
offensichtlich auf die EU-Staaten und -Bürger beziehen, die Formulierung in Absatz 2 weist<br />
über das EU-Europa hinaus.<br />
5<br />
Zuvor stand die Menschenwürde als ein gleichrangiger Wert unter vielen. Vgl. Müller-Graff<br />
2003, 116.<br />
82 Hager
Definition und Ziele der Union<br />
Artikel 1-8<br />
genannten Werte stellen keine willkürliche Aneinanderreihung dar. Sie sind<br />
vielmehr eingebunden in eine geteilte und geschichtlich begründete Vorstellung<br />
menschlichen Zusammenlebens, nämlich – zusammengefasst – in eine pluralistische<br />
und solidarische Gesellschaft nach westlichem Muster. 6 Die EU wird<br />
hier als eine transkontinentale, „europäische Wertegemeinschaft“ verstanden.<br />
Artikel 3: Die Ziele der Union<br />
Artikel 3 entspricht den klassischen „Staatszielbestimmungen“, wie sie beispielsweise<br />
auch im deutschen Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 1, zu finden<br />
sind. Sie können als Auftrag der Union verstanden werden, sind jedoch nicht<br />
einklagbar. Frieden, die oben genannten Werte der Union und das Wohlergehen<br />
ihrer Völker in Absatz 1 lassen sich als „übergreifende Hauptziele“ charakterisieren.<br />
7<br />
Die folgenden drei Absätze stellen eine detailliertere Beschreibung dieser<br />
Hauptziele dar und schaffen eine Verbindung zu den – dann rechtlich verbindlichen<br />
– Kompetenzen der Union im dritten Teil der Verfassung. 8 Absatz 2<br />
nimmt die beiden bisher dominierenden Projekte der EU auf: den Binnenmarkt<br />
und den später hinzugekommenen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des<br />
Rechts. Die in Absatz 3 dann weiter genannten Ziele ergeben sich vor allem als<br />
Folgeverpflichtungen aus diesen. Gegenüber dem Konventsentwurf und auf<br />
Kritik aus der Europäischen Zentralbank hin ist das Ziel der Preisstabilität hinzugefügt<br />
worden.<br />
Absatz 5 betont noch einmal die bereits in Artikel 1 festgelegte Abhängigkeit<br />
der Unionstätigkeit von der Übertragung mitgliedstaatlicher Souveränität.<br />
Artikel 4: Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung<br />
Artikel 4 betont und verstärkt zwei auch anderweitig in der Verfassung enthaltene<br />
Rechtsgarantien den Bürgern gegenüber: die Grundfreiheit und die<br />
Nichtdiskriminierung. 9 Die vier „Grundfreiheiten“ garantieren die Freizügigkeit<br />
von Kapital, Gütern, Dienstleistungen und Menschen über die Binnengrenzen<br />
der EU hinweg. Sie haben maßgeblich zum Fortschritt der wirtschaftlichen<br />
Integration beigetragen und stellen auch in den Augen der Bürger eine der<br />
wesentlichen Errungenschaften der europäischen Einigung dar. Um diesem<br />
6<br />
Bezeichnend für die Schwierigkeit, Werte und sie anleitendes Gesellschaftsbild zu trennen, ist,<br />
dass der Begriff der Gleichheit schließlich anders als in einem früheren Entwurf den Werten<br />
und nicht dem Gesellschaftsbild zugeordnet wurde.<br />
7<br />
Müller-Graff 2003, 117.<br />
8<br />
Dies jedenfalls nach Absicht des Konvents-Präsidiums (vgl. CONV 724/03).<br />
9<br />
Die Union ist bereits durch das Binnenmarktziel (s.o.) auf die vier „Grundfreiheiten“ verpflichtet.<br />
Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit findet in der Charta<br />
der Grundrechte (nun Teil II der Verfassung) seinen Niederschlag.<br />
Hager 83
Artikel 1-8<br />
Definition und Ziele der Union<br />
Kernstück europäischer Integration einen sichtbaren Platz zu geben, haben die<br />
Grundfreiheiten zusammen mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung von<br />
Unionsbürgern einen besonderen Platz erhalten.<br />
Beide Absätze sollten nach Ansicht des Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes<br />
als „direkt anwendbare Garantien“ aufgefasst werden und damit – anders<br />
als die Ziele in Artikel 3 – von jedem Bürger direkt beim Europäischen<br />
Gerichtshof einklagbar sein. 10<br />
Artikel 5: Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten<br />
Dieser Artikel weist wiederum auf den zentralen Platz hin, den das Verhältnis<br />
zwischen Union und Mitgliedstaaten in den ersten Artikeln einnimmt.<br />
Absatz 1 erweitert und präzisiert Artikel 6 Absatz 3 des EU-Vertrages; die Mitgliedstaaten<br />
erhalten eine Bestandsgarantie. Das Handeln der Union darf nicht<br />
dazu führen, dass Machtstrukturen innerhalb der Mitgliedstaaten schleichend<br />
ausgehöhlt werden, so dass die Mitgliedstaaten nicht mehr als eigene staatliche<br />
Einheiten erkennbar wären. Die deutschen Bundesländer sind hier besonders<br />
angesprochen, da auch die regionale und kommunale Selbstverwaltung in den<br />
Mitgliedstaaten vom Handeln der Union nicht unterlaufen werden darf. 11<br />
Ebenso unverzichtbar für einen bundesstaatlichen Aufbau ist die gegenseitige<br />
Verpflichtung von Union und Mitgliedstaaten zur loyalen Zusammenarbeit,<br />
wie sie in Absatz 2 genannt wird. 12 Die Teilung der Souveränität entledigt<br />
schließlich nicht von der gemeinsamen Verantwortung für die ja ebenfalls<br />
gemeinsamen Ziele.<br />
Artikel 6: Unionsrecht<br />
Artikel 6, gegenüber dem Konventsentwurf neu eingefügt, schließt an den vorangehenden<br />
Artikel an. Analog zum Grundgesetz 13 gilt, dass Unionsrecht<br />
Bundesrecht bricht, das bedeutet, dass EU-Recht Vorrang vor dem Recht der<br />
Mitgliedstaaten hat. Dieses in der Rechtsprechung bereits vom Europäischen<br />
Gerichtshof etablierte Prinzip hat nun auch Verfassungsrang.<br />
Artikel 7: Rechtspersönlichkeit<br />
Dieser Artikel wird als eine der wichtigsten Neuerungen der Verfassung angesehen.<br />
In knapper Form hebt er die seit dem Maastrichter Vertrag bestehende<br />
10<br />
Vgl. CONV 724/03.<br />
11<br />
Vgl. weiterführend den Bericht der Konvents-Arbeitsgruppe V „Ergänzende Zuständigkeiten“<br />
(CONV 375/1/02).<br />
12<br />
Beide Bestimmungen finden sich in vergleichbarer Form auch in den bundesstaatlichen Verfassungen<br />
der USA, der Schweiz und Deutschlands.<br />
13<br />
Artikel 31.<br />
84 Hager
Definition und Ziele der Union<br />
Artikel 1-8<br />
„Säulenstruktur“ 14 der Union auf. Durch das Nebeneinander von EU- und EG-<br />
Vertrag existierten unter dem Dach der EU verschiedene rechtliche Gebilde.<br />
Bislang hatten die Europäischen Gemeinschaften in ihrem im Wesentlichen auf<br />
den Binnenmarkt beschränkten Bereich Rechtspersönlichkeit, die Europäische<br />
Union laut dem EU-Vertrag jedoch nicht. Die Verfassung führt diese beiden<br />
Bereiche nun zusammen – wie auch bereits in Artikel 1 ausgedrückt. Damit ist<br />
die Union im gesamten Bereich dieser Verfassung befugt, Verträge mit Dritten<br />
zu schließen. Sie könnte dann zum Beispiel selbständig vor Gericht auftreten<br />
und als „Völkerrechtssubjekt“ internationalen Organisationen beitreten. 15 Erst<br />
die Zuerkennung dieses rechtlichen Status ermöglicht es, die verschiedenen<br />
Verträge zu einem einzigen Text zusammenzufassen – als Verfassung der Europäischen<br />
Union.<br />
Artikel 8: Die Symbole der Union<br />
Dieser Artikel ist gegenüber dem Konventsentwurf vom Schlussteil der Verfassung<br />
in den ersten Teil aufgerückt. Er legt Flagge, Hymne und Motto der Union<br />
sowie den Euro als Währung und den 9. Mai als Europatag fest. Der Europatag<br />
erhält damit jedoch nicht den Rang eines Feiertages.<br />
Auf Zuwachs geschneidert<br />
Verfassung für ein föderales Europa?<br />
Der Abschnitt zu Definition und Zielen der Union markiert in dreifacher<br />
Hinsicht das Fundament der Verfassung. Erstens legt diese rechtlich die<br />
Gestalt der Union fest; zweitens hat sie durch ihren symbolischen<br />
Gehalt eine integrative Funktion; und drittens markiert sie eine politische<br />
Weichenstellung für die Machtverteilung und -entfaltung in der<br />
Union. Für eine Bewertung aus föderalistischer Sicht sind vor allem die<br />
beiden letztgenannten Punkte relevant.<br />
Im Kern bedeutet Föderalismus, dass es in einem Gemeinwesen mehrere<br />
Ebenen gibt, die jeweils selbständig politische Entscheidungen<br />
treffen. 16 Damit ist eine EU gemeint, in der die Macht zwar gemeinsam<br />
ausgeübt, gleichzeitig aber den Mitgliedstaaten weitgehende Autonomie<br />
zugestanden wird. Föderale Strukturen können Machtmissbrauch<br />
14<br />
Vgl. den Text von Christian Wenning und Florian Ziegenbalg („Zuständigkeiten der Union“)<br />
in diesem Band.<br />
15<br />
Vgl. Schlussbericht der Konvents-Arbeitsgruppe III „Rechtspersönlichkeit“ (CONV 305/02).<br />
16<br />
Vgl. Riker 1964, 5.<br />
Hager 85
Artikel 1-8<br />
Definition und Ziele der Union<br />
begrenzen, Minderheiten integrieren und sind in der Lage, Probleme aus<br />
der Nähe und mit größtmöglicher Beteiligung der Betroffenen zu<br />
lösen. 17 Wie sich dieses Versprechen einlösen lässt, ist jedoch schwierig<br />
zu bestimmen, da Föderalismus nicht an eine klar benennbare institutionelle<br />
Struktur gebunden ist. 18 Man kann sich jedoch an zwei Fragen<br />
orientieren, um festzustellen, ob die Europäische Union einem föderalen<br />
Aufbau nahe kommt. Dazu gehört erstens die konsequente Trennung<br />
von mitgliedstaatlichen und europäischen Entscheidungsverfahren. In<br />
Bundesstaaten wie den USA oder besonders der Bundesrepublik lässt<br />
sich ein Trend zur Zentralisierung beobachten. Durch ihre größeren<br />
finanziellen Mittel bestimmt die Bundesebene auch die Politik in den<br />
Mitgliedstaaten. In der Europäischen Union bahnt sich eine ähnliche<br />
Entwicklung an, jedoch mit dem Unterschied, dass die Mitgliedstaaten<br />
selbst der Motor einer Ausweitung der Unionskompetenzen sind. 19<br />
Gerade die Unabhängigkeit der europäischen Ebene von den Mitgliedstaaten<br />
ist nicht genügend ausgebildet. Dies führt zum zweiten Föderalismus-Kriterium:<br />
demokratischen Strukturen, insbesondere auf der<br />
Bundesebene. Auch die Entscheidungen der Bundesebene sollten sich<br />
möglichst direkt aus dem Willen der Bevölkerung ableiten. Anstelle von<br />
Verhandlungen zwischen den Gliedstaaten sollten Institutionen entscheiden,<br />
die den Bürgern direkt verantwortlich sind (z.B. das Europäische<br />
Parlament). Der Gemeinplatz vom „Demokratiedefizit“ der EU<br />
deutet darauf hin, dass hier noch Verbesserungsbedarf besteht. 20<br />
Es geht jedoch nicht nur um das Zusammenspiel von Institutionen, sondern<br />
auch um die Lösung von Problemen. Deshalb ist nicht nur zu fragen,<br />
ob Kompetenzen eindeutig verteilt sind, sondern auch, ob dadurch<br />
politische Handlungsfähigkeit geschaffen wird, zum Beispiel in wichtigen<br />
Fragen wie der Außen- oder der Wirtschaftspolitik.<br />
Verfassung und europäisches Bewusstsein<br />
Eine Verfassung gibt nicht nur einen rechtlichen Rahmen für die Politik<br />
an, sondern wirkt auch durch ihren symbolischen Gehalt. Ein politisches<br />
Gemeinwesen gründet sich auf Werte, die über die Interessenkonflikte im<br />
politischen Alltag hinausreichen. Da Werte aber abstrakt sind, bedarf es<br />
Symbolen, um sie auszudrücken und erlebbar zu machen. Die Verfassung<br />
17<br />
Vgl. Wachendörfer-Schmitt 2000.<br />
18<br />
Vgl. Bieber 1999, 353.<br />
19<br />
Vgl. Wessels 1992.<br />
20<br />
Vgl. für eine ausführliche und aktuelle Diskussion des Demokratiedefizits Abromeit 2002.<br />
86 Hager
Definition und Ziele der Union<br />
Artikel 1-8<br />
eignet sich hierzu besonders gut, da eine Verfassung generell als historisches<br />
Dokument Symbolwert hat – wie die US-amerikanische Verfassung<br />
von 1787 eindrucksvoll beweist. Gerade diese symbolische Ausdruckskraft<br />
ist auch für die Europäische Union bedeutsam. Denn daran mangelt<br />
es ihr. Neben der Integration von Funktionsbereichen (z.B. Wirtschaft,<br />
Umweltpolitik, Verkehr, Währung) braucht die Europäische Union auch<br />
symbolische Integration. Sie muss sich auf eine „Wir-Identität“ der Bürger<br />
berufen können, die bei Konflikten für Ausgleich sorgen kann. 21 Solch<br />
eine Wir-Identität ist die Grundlage für eine funktionierende Demokratie<br />
auf europäischer Ebene.<br />
Eine Verfassung eignet sich gut als symbolischer Integrationsanker, da sie<br />
sich von vordemokratischen, nationalistischen und auf Abgrenzung angelegten<br />
Gründungsmythen abgrenzt. Aus diesem Grund wurde für die<br />
Bundesrepublik ein auf dem Grundgesetz und den darin enthaltenen Wertvorstellungen<br />
(z.B. der Unantastbarkeit der Menschenwürde) aufbauender<br />
„Verfassungspatriotismus“ als Identifikationsmuster vorgeschlagen. Jürgen<br />
Habermas hat diese Vorstellung auf die Europäische Union übertragen.<br />
22 Nach den eher technischen Formulierungen des EG- und EU-Vertrages<br />
ist die vom Konvent zur Zukunft Europas erarbeitete Europäische Verfassung<br />
tatsächlich auch im Hinblick auf symbolische Wirkung geschrieben.<br />
Die hierfür ausschlaggebenden Passagen finden sich besonders in den<br />
ersten Artikeln zu Definition und Zielen der Union. Anders als viele neuere<br />
Verfassungen stellt die Europäische Verfassung Definition und Ziele<br />
der Union an den Anfang. Damit wird die ohnehin hohe deklaratorische<br />
und symbolische Aussagekraft dieser Passage noch verstärkt. Als Leser<br />
wundert man sich über den verschlungenen Aufbau des ersten Satzes von<br />
Artikel 1. Gerade hier wird man aber als Bürger der Union direkt angesprochen.<br />
Des Weiteren erhält man in den ersten Artikeln klar verständlich<br />
Auskunft über die Werte, welche die Union vertritt und die Ziele, die sie<br />
verfolgt. Diese Bereiche dürften auf breite Zustimmung stoßen.<br />
Die Symbole der Union, die diese Werte verkörpern sollen, sind bereits<br />
fest im öffentlichen Leben verankert. Die Verfassungsgebung bietet einen<br />
zusätzlichen starken Bezugspunkt zwischen Bürgern und Union. Die Ver-<br />
21<br />
Was Menschen gemeinsam haben, kann man mit Norbert Elias auch als „Wir-Identität“<br />
beschreiben, die zu der „Ich-Identität“ jedes Individuums hinzukommt (Vgl. Elias 1987, 210).<br />
22<br />
Vgl. Habermas 1998, 804–817. Mit dem Begriff „Verfassungspatriotismus“ soll aber keine<br />
Abgrenzung zu Rudolf Smend vorgenommen werden, der die Unverzichtbarkeit emotionaler<br />
„Gemeinschaftserlebnisse“ betont, um die gemeinsame Wertegrundlage eines Gemeinwesens<br />
erfahrbar zu machen.<br />
Hager 87
Artikel 1-8<br />
Definition und Ziele der Union<br />
fassung versäumt es jedoch, den Europatag zum offiziellen Feiertag zu<br />
erklären.<br />
Vielleicht ist es aber auch von Vorteil, dass den Artikeln zu den Werten und<br />
Zielen das Pathos abgeht. 23 Die Union ist in ihren Ursprüngen funktional<br />
angelegt und wird von den Bürgern auch so verstanden. Die Sprache<br />
kommt damit einem kritischen Zeitgeist entgegen, der „Leistung“ statt<br />
Phrasen verlangt. Zu diesem Eindruck trägt auch Artikel 4 bei, der wichtige<br />
Vorteile für die Bürger hervorhebt. Ein europäischer „Verfassungspatriotismus“<br />
sollte ohnehin noch einmal distanzierter ausfallen als seine<br />
bundesdeutsche Ausgabe, da er sich nicht auf ein schon existierendes<br />
Nationalbewusstsein stützen kann. Die Europäische Verfassung formuliert<br />
gerade deshalb behutsam, weil eine „europäische Identität“ erst im Entstehen<br />
ist; sie maßt es sich nicht an, diese schon vorauszusetzen. Sie kann<br />
aber ein gemeinsames und den Europäern eigenes Wertefundament formulieren,<br />
das mit der Zeit und im Kristallisationspunkt der Verfassung „Wir-<br />
Identität“ stiftet. Und durch die klare Benennung von Werten und Zielen<br />
vergrößert sie die Chancen für eine Identifikation der Bürger mit dem Handeln<br />
der EU.<br />
Dieses Ziel hat umso bessere Chancen, wenn die Verfassung auch inhaltlich<br />
eine Weiterentwicklung der EU bedeutet. Die Verfassung sollte sichtbar<br />
machen, dass die Union auch den Willen und die Mittel hat, die umfangreichen<br />
Ziele zu verfolgen, die sich aus ihren Werten ergeben.<br />
Bürger, Mitgliedstaaten und die Demokratie in der Union<br />
Die Artikel zu Definition und Zielen der Union begründen die Union nicht<br />
nur juristisch und repräsentieren sie ihren Bürgern gegenüber. Sie haben<br />
auch und vor allem eine beträchtliche Wirkung auf die Verteilung von<br />
Macht und Einfluss in der Union. Die ersten Artikel geben zwar keine<br />
detaillierte Auskunft über das Funktionieren der Institutionen, aber sie<br />
drücken grundlegender noch eine Erwartung über die Auslegung der später<br />
folgenden Artikel aus. Damit „verfassen“ und „definieren“ sie die EU.<br />
Wichtiger als die – wohl nur in Ausnahmefällen mögliche – Einklagbarkeit<br />
dieses Grundverständnisses ist dessen politische Auslegung. Es gilt in der<br />
politischen Debatte darüber zu entscheiden, welche Erwartung über das<br />
Funktionieren der EU hier angelegt wird. Eine Bewertung dieser Artikel<br />
ist daher auch ausdrücklich ein politischer Kommentar, der für ein<br />
bestimmtes Verständnis der Europäischen Union argumentiert.<br />
23<br />
Zum Beispiel im Unterschied zur US-Verfassung, die mit den Worten anhebt „We, the people<br />
[…]“.<br />
88 Hager
Definition und Ziele der Union<br />
Artikel 1-8<br />
Der Schlüssel zum Verständnis der EU ist Artikel 1. Er gibt Aufschluss<br />
über die Rolle der Bürger und der Mitgliedstaaten sowie deren Gewichtung<br />
im Gefüge der Institutionen. So nennt Artikel 1 Absatz 1 anfangs die<br />
Bürger und Staaten gleichermaßen und deutet damit eine Gleichrangigkeit<br />
zwischen ihnen an. Die Bürger können sogar für sich in Anspruch nehmen,<br />
zuerst genannt zu werden. Dem widerspricht jedoch, dass es nicht die Bürger,<br />
sondern allein die Staaten sind, die der Union Zuständigkeiten übertragen.<br />
Die Staaten in ihrer Funktion als Mitglied der Union sind quasi<br />
zwischen Bürger und EU geschaltet; und nur sie und nicht die Bürger können<br />
Zuständigkeiten im Bedarfsfall auch wieder zurückholen. Daraus<br />
ergibt sich, dass die EU weiterhin an die Souveränität der Mitgliedstaaten<br />
gebunden ist. 24<br />
Neu und beachtenswert ist allerdings, dass die Union nicht allein durch<br />
ihre Mitgliedstaaten gegründet wird. Die Verfassung verweist auf sich<br />
selbst als Gründungsinstanz der EU („[...] begründet diese Verfassung die<br />
Europäische Union“). Dies lässt ein merkwürdiges Vakuum entstehen.<br />
Die Formulierung drückt sich um eine eindeutige Festlegung. Sie wurde<br />
gewählt, so kann man vermuten, um zu vermeiden, dass zwischen Bürgern<br />
und Staaten als Quelle der Legitimation hierarchisch unterschieden<br />
wird. 25 Daraus folgt, dass die Bürger hier nicht in ihrer Eigenschaft als<br />
Bürger der Mitgliedstaaten, sondern als EU-Bürger angesprochen sind.<br />
Folglich sollen sie in der EU nicht durch die Regierungen ihrer Mitgliedstaaten,<br />
sondern durch direkt von ihnen gewählte Abgeordnete vertreten<br />
werden.<br />
Der Satz „Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger [...]“<br />
strahlt wie ein Leuchtturm auf die gesamte Verfassung; aus ihm lässt sich<br />
zwar kein „Staatsvolk“, zumindest aber eine Bürgerschaft der Union herauslesen.<br />
Dementsprechend spricht Artikel 2 nicht von „mitgliedstaatlichen<br />
Gesellschaften“, sondern von einer europäischen „Gesellschaft“. Hält man<br />
an dieser Auslegung fest, gewinnt der Begriff der Verfassung an Bedeutung.<br />
Diese Architektur vorwegnehmend hatte Valéry Giscard d’Estaing in<br />
seiner Eröffnungsrede des Konvents betont, dass Verfassungen zwischen<br />
24<br />
Weiter kann man argumentieren, dass hier auch die Kontinuität der derzeitigen Finanzverfassung<br />
der EU angelegt ist; die EU ist sowohl in ihren Zuständigkeiten als auch der diesbezüglichen<br />
finanziellen Ausstattung von den Mitgliedstaaten abhängig.<br />
25<br />
Ein Indiz für diese Auslegung ist, dass die Präambel darauf verzichtet, die Mitgliedstaaten<br />
durch einzelne Nennung gesondert aufzuführen. Müller-Graff 2003, 114 weist darauf hin, dass<br />
damit jedoch nicht Artikel 48 EU-Vertrag berührt werde, der die Ratifizierung von Vertragsänderungen<br />
durch jeden Mitgliedstaat vorsieht.<br />
Hager 89
Artikel 1-8<br />
Definition und Ziele der Union<br />
Bürgern geschlossen würden. 26 Die Union bleibt also wie gehabt auf eine<br />
Souveränitätsübertragung durch die Mitgliedstaaten angewiesen. Doch<br />
nach der Verfassung geht sie nicht allein aus diesen hervor. Auch die EU-<br />
Bürger übernehmen zusätzlich zu den Mitgliedstaaten Verantwortung für<br />
die Union – und sollten dementsprechend mehr Beteiligung einfordern.<br />
Eine leistungsfähige Union?<br />
Die wegweisende Hervorhebung der Bürger in der Architektur der EU<br />
steht in einem Spannungsverhältnis zur tatsächlichen Dominanz der Mitgliedstaaten.<br />
Dem könnte mit einer klaren Trennung von Zuständigkeiten<br />
entgegengewirkt werden. Dies wäre aus föderalistischer Sicht zu begrüßen,<br />
da so nicht nur die Demokratie in der Union gestärkt, sondern auch<br />
die Leistungsfähigkeit der Union verbessert würde.<br />
Die Institutionen der Union sind jedoch nur im engen Bereich der ihr von<br />
den Mitgliedstaaten übertragenen Kompetenzen zuständig, wie die ersten<br />
Artikel überaus deutlich machen. 27 Damit ist nur ein Teil der sehr weitreichenden<br />
Ziele 28 aus Artikel 3 abgedeckt. Dazu soll die Union die mitgliedstaatlichen<br />
Politiken im Hinblick auf die Ziele „koordinieren“. Ist die<br />
Union damit ausreichend gerüstet, um den hohen Erwartungen gerecht zu<br />
werden?<br />
Im Bereich der Koordinierung sind die Defizite schon heute deutlich sichtbar.<br />
29 Die Mitgliedstaaten haben sich zwar mehrfach auf gemeinsame und<br />
in der Regel sehr ambitionierte Ziele verpflichtet. Diese Deklarationen<br />
können jedoch nicht von den europäischen Institutionen eingefordert und<br />
in konkrete Politik umgesetzt werden. Deshalb hat es hier bislang kaum<br />
vorzeigbare Ergebnisse gegeben. Im Gegenteil wird die EU je nach politischer<br />
Wetterlage für ehrgeizige Ziele in Anspruch genommen, ohne von<br />
den Mitgliedstaaten mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet zu<br />
werden. Um trotz Untätigkeit einen fleißigen Eindruck zu machen, laden<br />
die Staats- und Regierungschefs ihren Wählern versprochene Mammut-<br />
26<br />
Vgl. SN 1565/02.<br />
27<br />
Vgl. Artikel 1, 3, 5. Zu den Kompetenzen vgl. den Beitrag von Christian Wenning und Florian<br />
Ziegenbalg in diesem Band.<br />
28<br />
Unter anderem soll die Union zu Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, Umweltschutz,<br />
wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, Gleichstellung, Generationensolidarität und<br />
regionaler Entwicklung beitragen.<br />
29<br />
Bislang ist dieses Verfahren als „Offene Methode der Koordinierung“ bezeichnet worden.<br />
„Offen“, weil Entscheidungen gerade nicht von den EU-Institutionen forciert werden können,<br />
sondern allein von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten abhängen.<br />
90 Hager
Definition und Ziele der Union<br />
Artikel 1-8<br />
projekte unverbindlich bei der EU ab, was ihre Glaubwürdigkeit langfristig<br />
nicht gerade steigern dürfte. Obwohl lobenswert, scheint zum Beispiel<br />
das Versprechen, die Europäische Union bis 2010 zum dynamischsten<br />
Wirtschaftsraum der Welt zu machen, kaum einlösbar. 30 Intergouvernementale<br />
Zusammenarbeit mit all ihren Schwächen ist auch weiterhin vorgesehen;<br />
die „Säulenstruktur“ 31 der Union lebt in neuem Gewand fort.<br />
Zwischen Zielen und Kompetenzen der Union besteht ein deutliches Missverhältnis<br />
– zumal die EU auch finanziell abhängig von den Beiträgen der<br />
Mitgliedstaaten bleibt. Soll die Europäische Verfassung glaubwürdig sein,<br />
müssen dem umfangreichen Zielkatalog auch Taten folgen. Dazu ist weitere<br />
Integrationsdynamik notwendig. Nach allen Erfahrungen ist diese<br />
aber nicht von den Mitgliedstaaten, sondern von den europäischen Institutionen<br />
zu erwarten. Die europäischen Institutionen sollten daher weiter<br />
gestärkt werden.<br />
Fazit: Verfassung für ein föderales Europa?<br />
Allen Auslegungen der ersten Artikel 1 bis 8 zum Trotz: Das Kräfteverhältnis<br />
zwischen europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten wird politisch<br />
entschieden werden. Nach der erfolgreichen Machtprobe zwischen<br />
Europäischem Parlament und neuer Kommission eilt die Verfassungswirklichkeit<br />
dem geschriebenen Text in einem wesentlichen Punkt voraus. Der<br />
Verfassungstext unterstützt diese Dynamik; auf ihn können sich EU-Bürger<br />
und Europaabgeordnete zukünftig berufen.<br />
In Artikel 3 beruft sich die Union nicht nur ausdrücklich auf die Demokratie<br />
als Wert, sie gibt sich auch eine Sammlung von Zielen, die jeder<br />
nationalstaatlichen Verfassung Konkurrenz machen könnte – was konsequenterweise<br />
auch ein vergleichbares Modell demokratischer Legitimation<br />
verlangt. Deutlicher als zuvor gibt die Verfassung zu verstehen, dass die<br />
Union bereit ist, sich in Zukunft mit anspruchsvolleren Maßstäben messen<br />
zu lassen. Dabei sollte man nicht idealisierte Modelle nationalstaatlicher<br />
Demokratie anlegen, die der Wirklichkeit bei weitem nicht entsprechen. 32<br />
30<br />
So beschlossen von den Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel 2000 in Lissabon (Europäischer<br />
Rat von Lissabon: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, abrufbar unter: http://ue.eu.int/<br />
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm, 20.06.2005).<br />
31<br />
Das Nebeneinander unterschiedlicher Entscheidungsverfahren, die sich aus dem EG- und dem<br />
EU-Vertrag ergaben, namentlich der Gemeinschaftsmethode und der „Offenen Methode der<br />
Koordinierung“ sowie weiterer Regelungen, wurde bislang als Säulenstruktur der Union<br />
bezeichnet.<br />
32<br />
Vgl. Peters 2001.<br />
Hager 91
Artikel 1-8<br />
Definition und Ziele der Union<br />
Wenngleich man insgesamt die alte Machtverteilung bestätigt sehen kann,<br />
so öffnet die Europäische Verfassung in ihrem ersten Artikel die Tür für<br />
eine weitergehende Demokratisierung der Union. Dieser weist über die<br />
Verfassung hinaus in Richtung auf weitere Integration. Diese Auslegung<br />
wird auch durch den Anspruch der Verfassung bestärkt, als Wertefundament<br />
selbst zur Integration beizutragen.<br />
Die weitere Integration wird nicht zuletzt auch von der fortlaufenden<br />
Erweiterung der Union angetrieben, die in Artikel 2 der Verfassung bekräftigt<br />
wird. Vertraut man dem Grundsatz, dass Erweiterung der Union und<br />
Vertiefung der Integration sich gegenseitig bedingen, so ergibt sich auch<br />
für die kommenden Jahre eine Dynamik im Verfassungsprozess. 33<br />
Die Karawane wird also weiterziehen. Die Verfassung bestätigt damit für<br />
die Zukunft eine altbewährte Grundvoraussetzung der europäischen Integration:<br />
den Prozesscharakter eines Projektes auf der Suche nach seiner<br />
Zukunft.<br />
Literatur: Abromeit, Heidrun (2002): Wozu braucht man Demokratie? Die transnationale Herausforderung<br />
der Demokratietheorie – Opladen. Bieber, Roland (1999): Föderalismus in Europa,<br />
in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Europa-Handbuch – Berlin, S. 353–366. Elias, Norbert<br />
(1987): Die Gesellschaft der Individuen, hrsg. von Michael Schröter – Frankfurt/M. Habermas,<br />
Jürgen (1998): Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie, in: Blätter für<br />
deutsche und internationale Politik, H. 8, S. 804–817. Klingemann, Hans-Dieter/Neidhardt,<br />
Friedhelm (Hrsg.) (2000): Die Zukunft der Demokratie, WZB Jahrbuch 2000 – Berlin. Kreile,<br />
Michael (Hrsg.) (1992): Die Integration Europas (PVS-Sonderheft Nr. 23) – Opladen. Lippert,<br />
Barbara (1997): Erweiterung, in: Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.): Europa von<br />
A–Z. Taschenbuch der europäischen Integration, 6. Auflage – Bonn, S. 122–129. Müller-Graff,<br />
Peter-Christian (2003): Die Kopfartikel für Europa – ein europarechtlicher Vergleichsblick, in:<br />
Integration, H. 2, S. 111–129. Peters, Anne (2001): Elemente einer Theorie der Verfassung<br />
Europas – Berlin. Riker, William H. (1964): Federalism: Origin, Operation, Significance – Boston.<br />
Wachendörfer-Schmitt, Ute (2000): Leistungsprofil und Zukunftschancen des Föderalismus,<br />
in: Klingemann, Hans-Dieter/Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.): Die Zukunft der Demokratie,<br />
WZB Jahrbuch 2000 – Berlin, S. 439–469. Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (1999): Europa-<br />
Handbuch – Berlin. Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (1997): Europa von A–Z.<br />
Taschenbuch der europäischen Integration, 6. Auflage – Bonn. Wessels, Wolfgang (1992): Staat<br />
und (westeuropäische) Integration. Die Fusionsthese, in: Kreile, Michael (Hrsg.): Die Integration<br />
Europas (PVS-Sonderheft Nr. 23) – Opladen, S. 36–61.<br />
33<br />
Die Verschiebung des bekannten Passus einer „immer engeren Union der Völker Europas“ aus<br />
Artikel 1 EU-Vertrag in die Präambel wird dem keinen Abbruch tun (vgl. CONV 724/03).<br />
92 Hager
Stephan Korte<br />
Artikel 9, 10<br />
GRUNDRECHTE UND UNIONSBÜRGERSCHAFT<br />
Artikel 9: Grundrechte<br />
In diesem Artikel wird eine umfassende Grundrechtsbindung der Europäischen<br />
Union festgeschrieben. Kein Organ darf die Grundrechte der europäischen Bürger<br />
verletzen, kein Rechtsakt sich zu den Grundrechten im Widerspruch befinden.<br />
Aber nicht nur die EU selbst wird durch die Grundrechte verpflichtet; die<br />
Bindung erstreckt sich auch auf die Mitgliedstaaten, wenn sie Unionsrecht<br />
umsetzen. Der Artikel verbürgt einen mehrfachen Schutz, indem verschiedene<br />
Quellen von Grundrechten genannt werden. Die aus diesen Quellen fließenden<br />
Rechte sind alle gleichermaßen verbindlich.<br />
Zunächst wird die Verbindung zum zweiten Teil der Verfassung hergestellt.<br />
Dieser enthält die „Charta der Grundrechte der Union“ 1 , die mit dem Inkrafttreten<br />
der Verfassung als deren Teil II rechtsverbindlich wird. Nach Absatz 1 ist<br />
die Union also an die dort genannten Rechte, Freiheiten und Grundsätze gebunden.<br />
Gemäß Absatz 2 soll die Union zusätzlich der Europäischen Konvention<br />
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) beitreten.<br />
Diese Vorschrift stellt einen Auftrag an die zuständigen Organe der Union dar,<br />
einen solchen Beitritt zu vollziehen. Dazu müsste allerdings erst die EMRK<br />
selbst geändert werden.<br />
Absatz 3 bestimmt, dass die in der EMRK enthaltenen Grundrechte auch schon<br />
vor einem Beitritt als Teil des Unionsrechts verbindlich sein sollen. Aber damit<br />
nicht genug: Als dritte Grundrechtsquelle kommen auch noch die „gemeinsamen<br />
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“ hinzu. Demnach ist die<br />
Union auch an diejenigen Grundrechte gebunden, die allen mitgliedstaatlichen<br />
Verfassungen gemeinsam sind. Herauszufinden, welche Rechte mit welchen<br />
Inhalten das sind, ist Aufgabe des Gerichtshofs. 2<br />
Artikel 10: Die Unionsbürgerschaft<br />
In Artikel 10 wird festgelegt, wer Unionsbürger ist und welche grundlegenden<br />
Rechte mit der Unionsbürgerschaft verknüpft sind. Absatz 1 bestimmt ganz<br />
schlicht, dass jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU gleichzeitig<br />
Unionsbürger ist. Die Unionsbürgerschaft ist also von der nationalen Staatsangehörigkeit<br />
eines Mitgliedstaats abhängig; jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats<br />
ist damit automatisch Unionsbürger. Dabei ist es den einzelnen Mit-<br />
1<br />
Vgl. auch die entsprechenden Texte zur Grundrechtecharta in diesem Band.<br />
2<br />
Vgl. Artikel 29 Absatz 1.<br />
Korte 93
Artikel 9, 10<br />
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
gliedstaaten überlassen festzulegen, wer jeweils ihre Staatsangehörigen sind,<br />
wie also ihre Staatsangehörigkeit erworben und verloren wird.<br />
Gemäß Absatz 2 haben die Unionsbürger die in der Verfassung vorgesehenen<br />
Rechte und Pflichten. Damit wird deutlich gemacht, dass die Stellung der Unionsbürger<br />
nicht nur in diesem Artikel niedergeschrieben, sondern durch alle in<br />
der Verfassung festgelegten Rechtsbeziehungen zwischen Unionsbürgern und<br />
Union gekennzeichnet ist. Im Folgenden sind dann nur diejenigen Rechte aufgeführt,<br />
welche die Unionsbürgerschaft inhaltlich besonders prägen. Pflichten<br />
kommen, obwohl sie genannt sind, in diesem Artikel gar nicht und auch in der<br />
übrigen Verfassung nur sehr rudimentär vor.<br />
Zunächst wird die <strong>Bewegung</strong>s- und Aufenthaltsfreiheit genannt. Der Unionsbürger<br />
darf sich in der gesamten EU frei bewegen, kein Mitgliedstaat darf ihm<br />
die Ein- oder Ausreise verwehren. Sodann erhält die Unionsbürgerschaft eine<br />
politische Dimension: Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen<br />
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, haben bei Kommunal- und Europawahlen<br />
ebenso wie die Einheimischen das Recht zur Stimmabgabe (aktives<br />
Wahlrecht, Wahlberechtigung) sowie das Recht, sich als Kandidat aufstellen<br />
und wählen zu lassen (passives Wahlrecht, Wählbarkeit). Drittens wird die<br />
gemeinsame Verantwortung der Mitgliedstaaten für die sich in Drittstaaten aufhaltenden<br />
Unionsbürger hervorgehoben. Jeder Unionsbürger genießt in Drittstaaten,<br />
in denen der Heimatstaat nicht vertreten ist, Schutz durch die Botschaften<br />
und Konsulate der anderen Mitgliedstaaten.<br />
Der Transparenz und Bürgernähe der Union dienen die zuletzt genannten<br />
Bestimmungen. Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich mit Gesuchen und Beschwerden<br />
(Petitionen) an das Europäische Parlament, den Europäischen Bürgerbeauftragten<br />
und die sonstigen Organe und beratenden Einrichtungen der<br />
Union zu wenden. 3 Der Petent kann sich dabei jeder Sprache der Verfassung<br />
bedienen 4 ; das Organ oder die Einrichtung muss in derselben Sprache antworten.<br />
Im dritten Absatz wird klargestellt, dass die umschriebenen Rechte nicht<br />
absolut gelten, sondern von den übrigen Verfassungsbestimmungen und anderen<br />
Rechtsakten eingeschränkt werden können. Dieser Vorbehalt ist vor allem<br />
für die allgemeine Freizügigkeit von Bedeutung.<br />
3<br />
Diese sonstigen Organe und beratenden Einrichtungen sind nach Artikel 128 in Verbindung<br />
mit Artikel 19 Absatz 1 und den Artikeln 30 bis 32 der Europäische Rat, der Ministerrat, die<br />
Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof, die Europäische Zentralbank, der<br />
Rechnungshof, der Ausschuss der Regionen und der Wirtschafts- und Sozialausschuss.<br />
4<br />
Diese Sprachen sind in Artikel 448 Absatz 1 aufgeführt: Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch,<br />
Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch,<br />
Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch<br />
und Ungarisch.<br />
94 Korte
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
Artikel 9, 10<br />
Ein Europa für den Menschen –<br />
die fundamentalen Rechte der Europäer<br />
Grundrechte<br />
Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte<br />
und Grundfreiheiten (EMRK)<br />
Im Jahre 1949 wurde der Europarat gegründet. Dieser ist eine eigenständige,<br />
von der EU unabhängige Organisation, die den Frieden in Europa<br />
fördern soll. In diesem Rahmen wurde 1950 die EMRK verabschiedet, die,<br />
zusammen mit später hinzugekommenen Zusatzprotokollen, eine Reihe<br />
wichtiger Grundrechte verbürgt und somit einen gesamteuropäischen<br />
Grundrechtsstandard verkörpert. 5 Über die Einhaltung dieser Rechte durch<br />
die Mitgliedstaaten des Europarats, dem auch alle EU-Staaten angehören,<br />
wacht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, den<br />
jeder Bürger eines Mitgliedstaats anrufen kann.<br />
Die Grundrechtsentwicklung im Europäischen Gemeinschaftsrecht<br />
In den Römischen Verträgen war von Grundrechten nicht die Rede; dies<br />
entsprach dem Konzept einer reinen internationalen Organisation, bei dem<br />
die Menschen keine unmittelbare Rolle spielen. Der Europäische Gerichtshof<br />
(EuGH) lehnte deshalb zunächst die Anerkennung von Gemeinschaftsgrundrechten<br />
in mehreren Entscheidungen ab. 6<br />
Mit fortschreitender Integration entwickelte sich die Gemeinschaft aber<br />
immer mehr von einer zwischenstaatlichen zu einer überstaatlichen Organisation,<br />
die in bestimmten Bereichen unmittelbar gültiges Recht setzen konnte.<br />
Der EuGH entwickelte daher seit 1969 eine immer umfassendere Rechtsprechung<br />
zum Grundrechtsschutz. Er hatte erkannt, dass eine fehlende<br />
Grundrechtssicherung im Gemeinschaftsrecht die Legitimität und Akzeptanz<br />
der Integration überhaupt in Frage stellte. Da die Verträge selbst bis in<br />
die 90er Jahre hinein den einzelnen Bürgern nur vereinzelte wirtschaftliche<br />
Rechte zugestanden, war der EuGH dazu gezwungen, im Übrigen Grundrechte<br />
zu „erfinden“. Dabei griff er einerseits auf die Verfassungen der Mitgliedstaaten,<br />
andererseits auf die EMRK als „Rechtserkenntnisquellen“<br />
zurück und behauptete, die so gewonnenen Grundrechte seien allgemeine<br />
Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts. Diese Formel wurde 1992 fast<br />
5<br />
Vgl. zum Europarat und zur EMRK Streinz 2003, 25 ff.<br />
6<br />
Vgl. dazu Kühling 2003, 329.<br />
Korte 95
Artikel 9, 10<br />
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
wörtlich in den Vertrag von Maastricht übernommen und damit von den Mitgliedstaaten<br />
gebilligt. Die einzelnen Grundrechte selbst blieben jedoch<br />
weiterhin „unsichtbar“ – sie waren nicht in den Verträgen niedergelegt.<br />
Die Grundrechtecharta<br />
Als die EU immer mehr Kompetenzen bekam, wurde deutlich, dass ein<br />
Grundrechtsschutz, der allein auf der Rechtsprechung anhand von einzelnen<br />
Fällen aufbaut, den wachsenden Anforderungen nicht gerecht werden<br />
konnte. Deswegen stimmte der Europäische Rat in Köln 1999 der deutschen<br />
Initiative zur Erarbeitung einer Grundrechtecharta zu. Es sollten<br />
endlich alle Grundrechte, die die Gemeinschaftsgewalt binden, ausdrücklich<br />
verankert werden. Diese Charta sollte die in der EMRK und den<br />
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen niedergelegten Grundsätze<br />
sowie weitere wirtschaftliche und auch soziale Grundrechte enthalten. 7<br />
Der daraufhin geschaffene Konvent war der erste Konvent in der Geschichte<br />
der Europäischen Union. Er setzte sich aus Vertretern der Union 8<br />
und der Mitgliedstaaten zusammen und erarbeitete unter dem Vorsitz von<br />
Roman Herzog die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Auf<br />
dem Gipfel von Nizza im Dezember 2000 wurde die Charta vom Europäischen<br />
Rat angenommen und feierlich verkündet. Da sich die Regierungsvertreter<br />
aber noch nicht über eine Rechtsverbindlichkeit einigen konnten,<br />
blieb sie formal unverbindlich. Sie entfaltete dennoch Wirkungen, indem<br />
der EuGH sie als Rechtserkenntnisquelle heranzog und die Kommission<br />
ihr Handeln vorbeugend am Maßstab der Charta prüfte.<br />
In der Charta werden fundamentale Menschenrechte, klassische Freiheitsrechte,<br />
Gleichbehandlungsgebote und Diskriminierungsverbote, soziale<br />
Rechte, Unionsbürgerrechte sowie Rechte, die dem Einzelnen im Verhältnis<br />
zur Justiz zustehen, aufgeführt. 9<br />
Der Europäische Konvent 10<br />
Der Verfassungskonvent nahm die Charta in seinen Entwurf mit auf. Ob es<br />
zu dieser Errungenschaft kommen sollte, war im Konvent jedoch umstritten.<br />
11 Vor allem die Vertreter aus Großbritannien wollten vor dem Hinter-<br />
7<br />
Vgl. Europäischer Rat 1999.<br />
8<br />
Vgl. zur Entstehungsgeschichte Weber 2000, 537.<br />
9<br />
Vgl. zum Inhalt der Charta Meyer 2003 sowie die Beiträge von Georg Kristian Kampfer, Ann-<br />
Kathrin Fischer und Moritz Alt in diesem Band.<br />
10<br />
Vgl. auch den Schlussbericht der Arbeitsgruppe II (CONV 354/02).<br />
11<br />
Vgl. Meyer/Hölscheidt 2003, 619.<br />
96 Korte
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
Artikel 9, 10<br />
grund ihrer eigenen Verfassungstradition „so wenig Charta wie möglich“.<br />
Zwischen der Extremposition, die Charta an den Anfang der Verfassung zu<br />
stellen, und der anderen Extremposition, sie unverbindlich zu belassen,<br />
zeichneten sich noch die Möglichkeiten ab, sie an anderer Stelle in der Verfassung<br />
unterzubringen, einfach auf sie Bezug zu nehmen oder sie als Protokoll<br />
der Verfassung anzuhängen. Letztlich gab es den Kompromiss, die<br />
Charta als Teil II der Verfassung (mit kleinen Änderungen) einzugliedern<br />
und ihr damit Verfassungsrang zu verschaffen. Auf eine spezielle Grundrechtsklage,<br />
die zeitweise in der allgemeinen Diskussion war, wurde verzichtet,<br />
vor allen Dingen weil eine Arbeitsüberlastung des Gerichtshofs<br />
befürchtet wurde. Debatten gab es auch über die Frage des Verhältnisses<br />
der Union zur EMRK. Die Delegierten einigten sich schließlich darauf,<br />
dass die Union den Beitritt anstreben soll, nachdem zunächst nur eine<br />
Ermächtigung ohne entsprechendes politisches Signal angedacht war. Insgesamt<br />
spielte das Thema „Grundrechte“ in den Konventsberatungen eine<br />
vergleichsweise geringe Rolle.<br />
Die Europäische Verfassung<br />
Durch die Europäische Verfassung wird die Grundrechtecharta nun also in<br />
Kraft gesetzt. Zum ersten Mal wird die Union damit über einen verbindlichen<br />
Grundrechtskatalog verfügen. Durch die Regierungskonferenz<br />
wurde der in Artikel 9 Absatz 2 enthaltene Auftrag, der EMRK beizutreten,<br />
klarer formuliert. Im Übrigen beschloss man lediglich redaktionelle Änderungen<br />
an diesem Artikel.<br />
Fazit<br />
Die Bedeutung von Grundrechten für die europäische Integration kann gar<br />
nicht hoch genug geschätzt werden. Die vorgesehene Verbindlichkeit der<br />
Grundrechtecharta macht deutlich, dass die Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft,<br />
sondern auch eine Wertegemeinschaft ist. Diese<br />
Werte, die aus über 2000 Jahren europäischer Geschichte und Philosophie<br />
hervorgegangen sind, bilden das Fundament der gemeinsamen Zukunft<br />
aller Europäer. Das Bekenntnis des Artikel 9 zu den Grundrechten stellt<br />
klar, dass letztlich der Mensch und seine Würde, seine Freiheit und sein<br />
Wohlergehen grundlegender Zweck der Union ist. Einen spezifisch europäischen<br />
Charakter gewinnt die Charta durch die Einbeziehung des Grundwerts<br />
der Solidarität (Titel IV), der im nordamerikanischen Grundrechtsverständnis<br />
nicht zu finden ist. 12 Die mit der Verfassung geschaffene Mög-<br />
12<br />
So auch Schmitz 2004, 713.<br />
Korte 97
Artikel 9, 10<br />
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
lichkeit, dass jeder Bürger nachlesen kann, welche Rechte er gegenüber der<br />
Union hat, ist eine Grundvoraussetzung für mehr Transparenz und Akzeptanz<br />
der EU.<br />
Dennoch bleibt die Verfassung auf halbem Wege stehen. Zunächst ist zu<br />
bemängeln, dass die Platzierung der Charta ihrer Bedeutung nicht gerecht<br />
wird. Angemessen wäre es gewesen, die Charta ganz an den Anfang der<br />
Verfassung zu stellen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass die in der<br />
Charta verkörperten Werte die Grundlage der Union sind. Auch hätte sich<br />
die Präambel der Charta (modifiziert) gut als Präambel für die gesamte Verfassung<br />
geeignet. 13 Der Kompromiss, die Charta als „Teil II“ der Verfassung<br />
zu platzieren, wird den Anforderungen an eine klar gegliederte und verständliche<br />
moderne Verfassung nicht gerecht. Zudem wurde versäumt, die<br />
Möglichkeit einer Grundrechtsklage zu schaffen, so dass der Bürger die<br />
Verletzung seiner in der Charta garantierten Grundrechte in einem eigens<br />
dafür geschaffenen Verfahren vor dem Gerichtshof geltend machen kann.<br />
Diese Möglichkeit, die auch in vielen mitgliedstaatlichen Verfassungen<br />
besteht, würde viel dazu beitragen, die Union und ihre Verfassung dem Bürger<br />
näher zu bringen und sie unmittelbar positiv erfahrbar zu machen. Die<br />
aufgrund einer Grundrechtsklage entstehende Mehrbelastung des Gerichtshofs<br />
hätte man durch die Einrichtung einer Beschwerdekammer abfangen<br />
können. In Deutschland hat die Einführung des entsprechenden Verfahrens,<br />
der Verfassungsbeschwerde, das allgemein sehr hohe Ansehen des Bundesverfassungsgerichts<br />
geprägt und für eine nie da gewesene Identifizierung<br />
der Deutschen mit ihrer Verfassung, dem Grundgesetz, gesorgt. Warum also<br />
dieser Weg zu einem europäischen Verfassungspatriotismus 14 verschlossen<br />
bleiben muss, ist unverständlich. 15 Da sich die Charta inhaltlich aus der<br />
EMRK und den „gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“<br />
speist und ja gerade den Zweck hatte, die durch den Gerichtshof<br />
entwickelten Gemeinschaftsgrundrechte abzulösen, bleibt auch fraglich,<br />
warum neben den in der Charta ausdrücklich und umfassend aufgeführten<br />
Grundrechten weiter diese ungeschriebenen „allgemeinen Rechtsgrundsätze<br />
des Unionsrechts“ in Geltung bleiben sollen. 16 Zuletzt wäre es angebracht<br />
gewesen, einige inhaltliche Schwachpunkte der Charta zu beseitigen.<br />
13<br />
Vgl. den Text zur Präambel der Grundrechtecharta von Georg Kristian Kampfer in diesem<br />
Band.<br />
14<br />
Für eine Erklärung diese Begriffs siehe auch den Text von Lutz Hager in diesem Band.<br />
15<br />
Vgl. auch Ruffert 2004, 175 f.<br />
16<br />
Vgl. auch Grabenwarter 2004, 568 und Kingreen 2004, 571.<br />
98 Korte
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
Artikel 9, 10<br />
Insgesamt bleibt dennoch festzuhalten, dass die Einbindung der Grundrechtecharta<br />
in die Europäische Verfassung sehr zu begrüßen ist und<br />
einen gewaltigen Sprung gegenüber der vorherigen Rechtslage darstellt.<br />
Die Grundrechte bieten als elementare Prinzipien auch eine<br />
Vision für die weitere europäische Integration.<br />
Die Unionsbürgerschaft<br />
Entstehung und Entwicklung der Unionsbürgerschaft 17<br />
Bereits im EWG-Vertrag waren bestimmte Rechte für den Bürger festgelegt,<br />
die aber nur an dessen wirtschaftliche Aktivitäten anknüpften<br />
(Konzept des Marktbürgers). Im Laufe der 70er und 80er Jahre entwickelte<br />
sich dann die Rechtsstellung der EG-Bürger immer weiter über<br />
das Ökonomische hinaus. So fand die Freizügigkeit von Personen Eingang<br />
in den durch die Einheitliche Europäische Akte 1986 reformierten<br />
EWG-Vertrag. Aber erst mit dem Maastrichter Vertrag über die Europäische<br />
Union (1992) wurde, zurückgehend auf eine Initiative Spaniens,<br />
die Unionsbürgerschaft zusammen mit ihren vier Hauptkomponenten<br />
eingeführt. Grundlage war die Idee, dass die ursprüngliche Wirtschaftsgemeinschaft<br />
sich zur staatsähnlichen Europäischen Union weiterentwickelte.<br />
Man wollte auch die persönliche, soziale und politische<br />
Dimension der Integration berücksichtigen. Durch den Vertrag von<br />
Amsterdam wurde dieses Kapitel 1997 ergänzt und präzisiert.<br />
Der Europäische Konvent<br />
Der vom Verfassungskonvent vorgelegte Entwurf einer europäischen<br />
Verfassung fasste in dem Artikel zur Unionsbürgerschaft lediglich das<br />
zusammen, was bereits seit 1993 geltendes Recht war. Das Thema „Unionsbürgerschaft“<br />
war im Konvent von untergeordneter Bedeutung.<br />
Die Europäische Verfassung<br />
Der Artikel 10 wurde von der Regierungskonferenz inhaltlich nicht<br />
geändert.<br />
Fazit<br />
Die Unionsbürgerschaft schafft eine Verbundenheit der Bürger mit der<br />
Union. Gerade das Wahlrecht zeigt, dass die Unionsbürgerschaft die<br />
17<br />
Siehe hierzu auch Fischer 1992, 566.<br />
Korte 99
Artikel 9, 10<br />
Gundrechte und Unionsbürgerschaft<br />
Keimzelle für eine künftige europäische Staatsbürgerschaft sein kann,<br />
obwohl sie davon derzeit noch weit entfernt ist. Die Regelung in Artikel<br />
10 ist allerdings unglücklich, denn fast alle Rechte, die dem Unionsbürger<br />
laut diesem Artikel zukommen, sind schon im Teil II der Verfassung<br />
unter dem Titel V „Bürgerrechte“ garantiert. 18 Auch sind weitere<br />
Unionsbürgerrechte in Titel IV des ersten Teils „Die Organe und Einrichtungen<br />
der Union“ aufgeführt. Die verstreute Aufzählung und teilweise<br />
wortgleiche Erwähnung (Duplizierung) von Unionsbürgerrechten<br />
in der Verfassung stiftet daher nur Verwirrung, verlängert die ohnehin<br />
schon zu umfangreiche Verfassung unnötig und sollte daher bei einer<br />
Verfassungsrevision bereinigt werden: Alle Unionsbürgerrechte gehören<br />
zusammengefasst in die Grundrechtecharta!<br />
Literatur: Bettermann, Karl August/Neumann, Franz L./Nipperdey, Hans Carl (Hrsg.) (1966):<br />
Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Band 1, Halbband 1 – Berlin.<br />
Bogdandy, Armin von (Hrsg.) (2003): Europäisches Verfassungsrecht. Theoretische und<br />
dogmatische Grundzüge – Berlin; Heidelberg. Europäischer Rat (1999): Schlussfolgerungen<br />
des Vorsitzes, Köln, 3./4. Juni 1999, unter: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/<br />
en/ec/57886.pdf (20.06.2005). Fischer, Hans Georg (1992): Die Unionsbürgerschaft, in: Europäische<br />
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, H. 18, S. 560–569. Grabenwater, Christoph (2004):<br />
Auf dem Weg in die Grundrechtsgemeinschaft?, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, H. 19,<br />
S. 563–570. Kingreen, Thorsten (2004): Theorie und Dogmatik der Grundrechte im Europäischen<br />
Verfassungsrecht, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, H. 19, S. 570–576. Kühling,<br />
Jürgen (2003): Grundrechte, in: Bogdandy, Armin von (Hrsg.): Europäisches Verfassungsrecht.<br />
Theoretische und dogmatische Grundzüge – Berlin; Heidelberg, S. 583–630. Meyer, Jürgen<br />
(Hrsg.) (2003): Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Baden-Baden.<br />
Meyer, Jürgen/Hölscheid, Sven (2003): Die Europäische Verfassung des Europäischen Konvents,<br />
in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, H. 20, S. 613–621. Oestreich, Gerhard<br />
(1966): Die Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Eine historische Einführung,<br />
in: Bettermann, Karl August/Neumann, Franz L./Nipperdey, Hans Carl (Hrsg.): Die Grundrechte.<br />
Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Band 1, Halbband 1 – Berlin, S. 1–123.<br />
Ruffert, Matthias (2004): Schlüsselfragen der Europäischen Verfassung der Zukunft. Grundrechte<br />
– Institutionen – Kompetenzen – Ratifizierung, in: Europarecht, H. 2, S. 165–201.<br />
Schmitz, Thomas (2004): Die Grundrechtecharta als Teil der Verfassung der Europäischen<br />
Union, in: Europarecht, H. 5, S. 691–713. Streinz, Rudolf (2003): Europarecht, 6. Aufl. – Heidelberg.<br />
Weber, Albrecht (2000): Die Europäische Grundrechtecharta – auf dem Weg zu einer<br />
europäischen Verfassung, in: Neue Juristische Wochenschrift, H. 8, S. 537–544.<br />
18<br />
Vgl. Artikel 99 f., Artikel 103 bis 106.<br />
100 Korte
Christian Wenning/Florian Ziegenbalg<br />
Artikel 6, 11, 18<br />
DIE GRUNDPRINZIPIEN DER KOMPETENZORDNUNG<br />
Artikel 6: Das Unionsrecht<br />
Dieser Artikel schreibt fest, dass das Europarecht Vorrang vor dem nationalen<br />
Recht hat, es also gegenüber dem nationalen Recht einen höheren Rang einnimmt.<br />
Dabei ist das Recht der Union dann maßgeblich, wenn sich zwischen<br />
dem nationalen und dem europäischen Recht Unterschiede ergeben. In einem<br />
solchen Fall darf das nationale Recht nicht mehr angewendet werden. Dies<br />
eröffnet der Union große Einflussmöglichkeiten in den Mitgliedstaaten.<br />
Artikel 11: Die Grundprinzipien<br />
Dieser Artikel benennt die Grundprinzipien für die Abgrenzung und die Ausübung<br />
der Zuständigkeiten der Union. Hierzu zählen der „Grundsatz der begrenzten<br />
Einzelermächtigung“, das „Subsidiaritätsprinzip“ und das „Verhältnismäßigkeitsprinzip“.<br />
Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung besagt, dass die Union nur<br />
dort zuständig ist, wo die Mitgliedstaaten ihr konkret Aufgaben zugewiesen haben.<br />
Hierbei darf es sich nicht nur um reine Ziele (z.B. Herstellung eines Raumes<br />
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts) handeln, sondern es müssen<br />
konkrete Aufgaben in den politischen Ausführungsbestimmungen und Detailregelungen<br />
des dritten Teils der Verfassung festgelegt sein (wie Maßnahmen im<br />
Bereich der Kontrolle der EU-Außengrenzen). Die EU ist also auf die in der<br />
Verfassung (in Teil III) enthaltenen Zuständigkeiten beschränkt. Ansonsten gilt,<br />
dass die Mitgliedstaaten beziehungsweise die Regionen oder Kommunen<br />
zuständig sind.<br />
Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Grundprinzip für die Ausübung der Zuständigkeiten<br />
der Union. In Bereichen, in denen die Union nicht ausschließlich zuständig<br />
ist, muss sie dieses Prinzip beachten. Ausgehend vom Grundverständnis,<br />
dass die Zuständigkeitsverteilung von unten nach oben aufgebaut ist, sollen<br />
Aufgaben möglichst auf den untersten Ebenen (Kommunen, Regionen) wahrgenommen<br />
werden. Für ein Handeln der Union muss ein besonderer Grund<br />
vorliegen. Zur Begründung werden zwei Kriterien herangezogen: Einmal müssen<br />
die Ziele der Maßnahmen von den Mitgliedstaaten oder den Regionen und<br />
Kommunen nicht ausreichend erreicht werden können. Zum anderen müssen<br />
die Ziele wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Unionsebene<br />
erreicht werden. Beide Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit die<br />
Union tätig werden kann.<br />
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besagt, dass die Maßnahmen der Union<br />
für die Mitgliedstaaten und ihre Untergliederungen möglichst schonend sein<br />
Wenning/Ziegenbalg 101
Artikel 6, 11, 18<br />
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
sollen. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Rahmengesetzen gegenüber<br />
Gesetzen der Vorzug zu geben ist, die Mitgliedstaaten also innerhalb der Rahmengesetze<br />
eigenständig agieren können.<br />
Das im Anhang der Verfassung beigefügte „Protokoll über die Anwendung des<br />
Subsidiaritätsprinzips und der Verhältnismäßigkeit“ legt das Verfahren für die<br />
Kontrolle der Einhaltung der Prinzipien fest. Alle Organe der Union sind an<br />
den „Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung“, das „Subsidiaritätsprinzip“<br />
und das „Verhältnismäßigkeitsprinzip“ gebunden.<br />
Artikel 18: Flexibilitätsklausel<br />
Die Flexibilitätsklausel soll der Union die Möglichkeit eröffnen, in den Bereichen<br />
tätig zu werden, in denen für sie keine explizite Zuständigkeit vorgesehen<br />
ist. Dies kann aber nur unter der Voraussetzung geschehen, dass mit diesem<br />
Tätigwerden die Ziele der Verfassung besser erreicht werden können. Um der<br />
Gefahr einer schleichenden Kompetenzerweiterung vorzubeugen, wird in der<br />
Klausel erwähnt, dass dieser Artikel nur im Rahmen der in Teil III festgelegten<br />
Politikbereiche Anwendung finden kann. Um den Befürchtungen einer potentiellen<br />
Kompetenzerweiterung zu Gunsten der Union weiter vorzubeugen, wird<br />
im zweiten Absatz auf das Verfahren zur Kontrolle der Subsidiarität 1 hingewiesen.<br />
Zudem wird die Flexibilitätsklausel durch den dritten Absatz weiter eingeschränkt.<br />
Demnach dürfen Vorschriften, die auf Grundlage dieses Artikels<br />
erlassen werden, keine Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften<br />
für die Bereiche beinhalten, in denen dies durch die Verfassung ausgeschlossen<br />
ist.<br />
Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der<br />
Verhältnismäßigkeit<br />
Dieses Protokoll regelt das Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der in Artikel<br />
11 festgelegten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.<br />
Das so genannte „Frühwarnsystem“ wird ergänzt durch eine nachträgliche<br />
gerichtliche Kontrolle, die durch Klage gegen die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips<br />
(„Subsidiaritätsklage“) möglich ist.<br />
Das Frühwarnverfahren („ex-ante“) läuft in verschiedenen Schritten ab: Bevor<br />
die Kommission einen Gesetzgebungsakt vorschlägt, führt sie Anhörungen<br />
durch. Danach werden die Gesetzgebungsvorschläge von der Kommission an<br />
die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten, den Ministerrat und das Europäische<br />
Parlament übermittelt. Die Kommission muss ihre Vorschläge begründen<br />
und nachweisen, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit<br />
eingehalten wurden. Hierbei sind die möglichen finanziellen Aus-<br />
1<br />
Siehe den nächsten Abschnitt.<br />
102 Wenning/Ziegenbalg
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Artikel 6, 11, 18<br />
wirkungen und die Auswirkungen auf die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten<br />
und Regionen wichtig. Sechs Wochen haben daraufhin die nationalen Parlamente<br />
beziehungsweise ihre Kammern (in Deutschland der Bundestag und<br />
der Bundesrat) Zeit zur Stellungnahme. Die regionalen Parlamente können<br />
dabei von den nationalen Parlamenten beziehungsweise ihren Kammern einbezogen<br />
werden. Die Kommission, der Ministerrat und das Europäische Parlament<br />
müssen die nationalen Stellungnahmen berücksichtigen. Überschreitet<br />
die Zahl der nationalen Einsprüche wegen einer vermuteten Verletzung des<br />
Subsidiaritätsprinzips ein Drittel der Gesamtzahl der Stimmen 2 , so muss die<br />
Kommission ihr Handeln begründen. Sie hat die freie Wahl und kann den Vorschlag<br />
zurückziehen, ändern oder an ihm festhalten. Generell hat jedes Land in<br />
diesem Prozedere zwei Stimmen: Bei Parlamenten mit zwei Kammern verfügt<br />
jede Kammer über eine Stimme, bei Einkammersystemen hat das nationale<br />
Parlament zwei Stimmen.<br />
Nach Abschluss („ex-post“) des Gesetzgebungsverfahrens können die Mitgliedstaaten<br />
von sich aus oder im Namen eines nationalen Parlaments oder<br />
einer Kammer dieses Parlaments Klage gegen die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips<br />
erheben.<br />
Alles in bester Ordnung?<br />
Die Ausgangslage: Unklare Kompetenzverteilung<br />
Die Zuständigkeitsverteilung der Europäischen Union ist das Ergebnis von<br />
verschiedenen Vertragsänderungen, die zumeist von drängenden politischen<br />
Problemen und Handlungsdefiziten ausgelöst wurden, diese zu beheben<br />
trachteten und nicht selten Ergebnisse schwieriger Verhandlungsprozesse<br />
zwischen den Mitgliedstaaten waren. 3 Bislang mangelte es deshalb an einer<br />
klaren Struktur, d.h. einem Muster für die Verteilung der Zuständigkeiten<br />
und an klaren Kriterien für deren Übertragung auf die europäische Ebene. In<br />
den EU-Verträgen selbst sind die einzelnen Zuständigkeiten oftmals sehr<br />
verstreut und für die Bürger schwer zu finden. 4<br />
Nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung konnte die Europäische<br />
Gemeinschaft gemäß den Vertragstexten nur dann tätig werden,<br />
wenn ihr eine Zuständigkeit ausdrücklich zugewiesen worden war. Da<br />
aber viele Vertragsartikel ungenau formuliert worden waren, bean-<br />
2<br />
Bei Vorschlägen im Bereich Justiz und Inneres genügt ein Viertel der Stimmen.<br />
3<br />
Vgl. Dorau 2001, 127.<br />
4<br />
Vgl. Jarass 1996, 174 f.<br />
Wenning/Ziegenbalg 103
Artikel 6, 11, 18<br />
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
spruchte die EG Kompetenzen, die weit über das eigentliche Kompetenzfeld<br />
hinausgingen.<br />
Ein Beispiel ist die so genannte Tabakwerbe-Richtlinie, mit der die EG<br />
alle Formen der Tabakwerbung in den Mitgliedstaaten verbieten wollte.<br />
Die Kommission begründete dies mit der Zuständigkeit der EG für die<br />
Herstellung des Binnenmarktes. 5 Der Europäische Gerichtshof stellte<br />
aber fest, dass dies nicht zur Herstellung des Binnenmarktes diene, sondern<br />
dem Gesundheitsschutz zuzurechnen sei, der aber Sache der Mitgliedstaaten<br />
bleibe. 6<br />
Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es ist, nicht nur präzise Zuständigkeitsbeschreibungen<br />
festzulegen, sondern auch klare Regeln, wie die<br />
Kompetenzen auszuüben sind.<br />
Eine neue Klarheit: Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung<br />
und der Vorrang des Unionsrechts<br />
Um in Zukunft Missverständnisse hinsichtlich der Frage zu vermeiden,<br />
ob die Europäische Union relativ großzügig Kompetenzen aufgrund der<br />
in Artikel 1 genannten „Ziele der Union“ beanspruchen kann oder nicht,<br />
war dem Konvent daran gelegen, Klarheit zu schaffen. Der Zusatz in<br />
Artikel 11, dass „alle der Union nicht in der Verfassung zugewiesenen<br />
Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben“, dient der schärferen<br />
Abgrenzung zwischen europäischer und mitgliedstaatlicher Kompetenz<br />
7 und stärkt die Mitgliedstaaten.<br />
Dies bedeutet in der Konsequenz, dass für die konkrete Zuordnung von<br />
Kompetenzen der Teil III der Verfassung maßgeblich ist. Hier werden<br />
im Einzelnen die Zuständigkeiten der Union aufgeführt. Es ist jedoch zu<br />
bedauern, dass dieser Teil nicht die gleiche Übersichtlichkeit wie der<br />
erste Teil der Verfassung hat.<br />
Was passiert aber, wenn die EU eine Zuständigkeit in der Verfassung<br />
zugewiesen bekommt und nationales Recht dem europäischen Recht widerspricht?<br />
Schon im Jahre 1964 stellte der Europäische Gerichtshof<br />
fest, dass das Europarecht Vorrang vor dem nationalen Recht hat. Das<br />
nationale Recht wird zwar nicht ungültig, darf aber nicht mehr angewendet<br />
werden. 8 Diese jahrelange Rechtspraxis wird nun durch Artikel<br />
6 in der Verfassung festgeschrieben.<br />
5<br />
Vgl. Artikel 95 EG-Vertrag.<br />
6<br />
Vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 05.10.2000, C-376/98.<br />
7<br />
Vgl. Fischer 2003, 38.<br />
8<br />
Vgl. EuGH Rspr 1964, 1251/1269.<br />
104 Wenning/Ziegenbalg
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Artikel 6, 11, 18<br />
Das Subsidiaritätsprinzip:<br />
Die goldene Formel der Kompetenzordnung?<br />
Das aus der katholischen Soziallehre stammende Subsidiaritätsprinzip<br />
wird oftmals als sinnvoller Lösungsansatz für eine neue Kompetenzordnung<br />
angesehen. Das Prinzip besagt, dass sich staatliches oder<br />
gesellschaftliches Handeln darauf beschränken soll, Individuen oder<br />
gesellschaftliche Gruppen zu unterstützen, wenn diese mit der Wahrnehmung<br />
einer Aufgabe überfordert sind. 9<br />
Im EU-Rahmen dient das Subsidiaritätsprinzip als Regel bei der Frage,<br />
wann die Gemeinschaft die ihr übertragenen Kompetenzen ausübt.<br />
Dafür gibt es zwei Voraussetzungen, die beide gleichzeitig erfüllt sein<br />
müssen: Zum einen müssen die Ziele der Maßnahmen auf der Ebene der<br />
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden. Zum anderen müssen<br />
sie wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene<br />
erreicht werden. 10 Die Schwierigkeit besteht jedoch darin<br />
zu entscheiden, wann ein Ziel „nicht ausreichend“ auf der Ebene der<br />
Mitgliedstaaten und wann es „besser“ auf der Ebene der Gemeinschaft<br />
erreicht wird. Daher wurde das Subsidiaritätsprinzip bislang eher als<br />
politische Leitlinie denn als präzise Rechtsnorm aufgefasst. 11<br />
Im Vertrag von Maastricht fehlten klare Maßstäbe für seine Anwendung.<br />
Entsprechend wenig Beachtung fand das Subsidiaritätsprinzip dann auch in<br />
der europapolitischen Praxis. 12 Der Konvent war angetreten, dem Subsidiaritätsprinzip<br />
eine bessere Wirkung zu verschaffen. Eines der Hauptprobleme<br />
der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips waren die weit gefassten<br />
Formulierungen der Ziele der Gemeinschaft, die immer wieder zur Begründung<br />
ihrer Aufgaben herangezogen wurden. Eine klare Abgrenzung der<br />
Kompetenzen dient daher auch der besseren Anwendbarkeit des Subsidiaritätsprinzips.<br />
Dies haben der Verfassungskonvent und die Regierungskonferenz<br />
durch die neue Einteilung in die drei Kategorien von Zuständigkeiten<br />
erreicht. 13 Das Subsidiaritätsprinzip findet nur in zwei der drei Bereiche<br />
Anwendung: der geteilten und der ergänzenden Zuständigkeit. Dies macht<br />
Sinn, da es im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten kein Konkurrenzverhältnis<br />
zwischen den Mitgliedstaaten (oder Regionen) und der<br />
Union gibt.<br />
9<br />
Vgl. Melchionni 1995.<br />
10<br />
Vgl. Artikel 5 EG-Vertrag.<br />
11<br />
Vgl. Pieper 2002, 458 f.<br />
12<br />
Vgl. Hrbek 2000, 519 f.<br />
13<br />
Siehe weiterführend hierzu den Text „Die Zuständigkeiten der Union“ in diesem Band.<br />
Wenning/Ziegenbalg 105
Artikel 6, 11, 18<br />
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
An der bisherigen Formulierung des Subsidiaritätsprinzips wurde<br />
bemängelt, dass es zu wenige Kriterien für eine Überprüfung biete. 14<br />
Als Abhilfe hätte die Einführung zusätzlicher Kriterien dienen können.<br />
15 Doch wurde im Verfassungskonvent leider nur vereinzelt eine<br />
Präzisierung des Subsidiaritätsprinzips gefordert. 16 Dennoch sieht die<br />
Verfassung einen neuen Wortlaut vor. Neu gegenüber den bisherigen<br />
Bestimmungen ist die Einbeziehung der regionalen und lokalen Ebene<br />
als Bezugspunkt der Prüfung. Aus Sicht der Regionen und Kommunen<br />
ist dies ein Fortschritt, da nun auch ihr Handeln in das Blickfeld gerät.<br />
Die Entscheidung allerdings, ob das Ziel einer Maßnahme nicht mehr<br />
ausreichend auf einer dieser unteren Ebenen erreicht wird, bleibt weiterhin<br />
dem Ermessen von Ministerrat und Europäischem Parlament, die als<br />
europäischer Gesetzgeber wirken, überlassen.<br />
Präzisiert wurde das Subsidiaritätsprinzip auch an einer anderen Stelle:<br />
Statt wie bisher „und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen<br />
besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“ 17 , heißt es nun<br />
„sondern vielmehr wegen ihres Umgangs oder ihrer Wirkungen besser<br />
auf Unionsebene erreicht werden können“. Damit wird klargestellt, dass<br />
beide Kriterien gleichzeitig erfüllt sein müssen. Auch folgt aus der<br />
Erfüllung des ersten Kriteriums (nicht mehr ausreichend auf der Ebene<br />
der Mitgliedstaaten/Regionen/Kommunen) nicht automatisch die Erfüllung<br />
der zweiten Bedingung (besser auf Unionsebene), wovon die bisherige<br />
Formulierung ausging.<br />
Eine Verschlechterung hingegen zeigt sich im Subsidiaritätsprotokoll:<br />
Enthielt das bisherige Protokoll noch Leitlinien für die Prüfung, die<br />
jedenfalls Ansätze für konkrete Tatbestände lieferten, verzichtet das<br />
vom Konventspräsidium erarbeitete und von der Regierungskonferenz<br />
unverändert übernommene neue Protokoll auf diese Leitlinien. Gerade<br />
für die Bewertung im Rahmen des Frühwarnsystems sowie in möglichen<br />
Gerichtsverfahren wäre die Beibehaltung solcher Leitlinien<br />
erstrebenswert gewesen.<br />
14<br />
Vgl. Fischer/Schley 1999, 68 f.<br />
15<br />
Vgl. ebd., 91–99.<br />
16<br />
Bspw. Beitrag von Hannes Farnleiter/Reinhard Bösch, WG I–WD 11; Erwin Teufel, WG I–<br />
WD 6.<br />
17<br />
Artikel 5 EG-Vertrag.<br />
106 Wenning/Ziegenbalg
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Artikel 6, 11, 18<br />
Das Frühwarnsystem und die Subsidiaritätsklage:<br />
Eine Innovation oder nur eine Seifenblase?<br />
In der Vergangenheit waren regionale Parlamente und Regierungen<br />
ebenso wie nationale Parlamente von Kompetenzübertragungen auf die<br />
europäische Ebene oftmals betroffen, ohne dass sie im europäischen<br />
Gesetzgebungsprozess die Möglichkeit hatten, ihre Bedenken anzumelden.<br />
Insbesondere Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip konnten<br />
nicht gerügt werden.<br />
Während der Beratungen im Verfassungskonvent kam deshalb bald die<br />
Idee auf, die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch mehrere Verfahren<br />
sicherzustellen. 18 Dabei waren vor allem ein politisches Verfahren<br />
vor und während des Gesetzgebungsprozesses sowie eine nachträgliche<br />
gerichtliche Kontrolle in der Diskussion. 19 Die Arbeitsgruppen<br />
„Subsidiarität“ und „Einzelstaatliche Parlamente“ einigten sich auf eine<br />
Kombination aus einem politischen Frühwarnverfahren und der nachträglichen<br />
Klagemöglichkeit. 20 Das Präsidium folgte diesem Vorschlag<br />
bei der Vorlage einer neuen Fassung des Subsidiaritätsprotokolls 21 ,sah<br />
aber keine Klagemöglichkeit der nationalen Parlamente beziehungsweise<br />
ihrer Kammern vor. Auf Druck der Vertreter der nationalen Parlamente<br />
und der Regionen konnte jedoch erreicht werden, dass beide<br />
Kammern der nationalen Parlamente (soweit vorhanden) ein gemeinsames<br />
Klagerecht erhalten. 22<br />
Damit wurde das Frühwarnsystem erheblich effektiver gestaltet. Durch<br />
die frühzeitige Information können die nationalen Parlamente beziehungsweise<br />
ihre Kammern ihre Bedenken gegenüber Gesetzesvorschlägen<br />
geltend machen. Auf diese Weise sind sie zumindest indirekt am<br />
europäischen Gesetzgebungsprozess beteiligt und das Monopol der<br />
Regierungen in Sachen Europapolitik wird damit aufgeweicht. Europäische<br />
Themen können so in den nationalen Parlamenten besser ihren<br />
18<br />
So der Beitrag von Erwin Teufel, „Eine wirksame Kompetenzkontrolle bei der Rechtsetzung<br />
der Europäischen Union“, Working Document 6, Arbeitsgruppe I „Subsidiarität“, 09.07.2003.<br />
19<br />
Vgl. Koenig/Lorz 2003.<br />
20<br />
Vgl. die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe I „Subsidiarität“ (CONV 286/02) vom<br />
23.09.2002.<br />
21<br />
Vgl. Präsidium des Konvents, „Entwurf von Protokollen über die Anwendung der Grundsätze<br />
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit und über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente<br />
in der Europäischen Union“ (CONV 579/03) vom 27.02.2003.<br />
22<br />
Vgl. z.B. Erwin Teufel, „Änderungsvorschlag zum Entwurf des Subsidiaritätsprotokolls“<br />
(CONV 576/03) vom 10.03.2003, unter: http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/<br />
20000/SubTeufel%20(DE,EN).pdf (20.06.2005).<br />
Wenning/Ziegenbalg 107
Artikel 6, 11, 18<br />
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Platz finden und auch die nationale Öffentlichkeit wird mehr mit<br />
Europapolitik konfrontiert. Den Bedürfnissen der Regionen wird durch<br />
das Klagerecht des Ausschusses der Regionen sowie den zweiten Parlamentskammern<br />
– die wie der deutsche Bundesrat oft Vertretungsorgane<br />
regionaler Interessen sind – Rechnung getragen. 23<br />
So begrüßenswert aus dieser Sicht die Information und die Möglichkeit<br />
der Stellungnahme auch sein mögen, sie allein bieten den nationalen<br />
Parlamenten sicher keine ausreichende Handhabe. Eine „Veto-Position“<br />
der nationalen Parlamente innerhalb des europäischen Gesetzgebungsverfahrens<br />
wäre sehr viel wirkungsvoller gewesen, ist aber dennoch<br />
abzulehnen. Aus Gründen der Handlungsfähigkeit kann die Entscheidung<br />
über die Gesetze nur in den Händen des Europäischen Parlaments<br />
und des Ministerrats liegen. Dem gestärkten Europäischen Parlament<br />
würde ein Bärendienst erwiesen, wenn nun die nationalen Parlamente<br />
als „Mitgesetzgeber“ auftreten würden. Daher war der Ansatz des Konvents<br />
richtig, nur im Nachhinein den nationalen Parlamenten beziehungsweise<br />
ihren Kammern ein rechtliches Mittel in die Hand zu geben.<br />
Eine nachträgliche gerichtliche Kontrolle mindert die Gefahr einer Blockade<br />
der Union. Die Kommission, der Ministerrat und das Europäische<br />
Parlament sollten sich allerdings immer darüber im Klaren sein, dass<br />
von Seiten der nationalen Parlamente Klagen drohen könnten.<br />
Eine andere Frage aber ist die Erfolgsaussicht einer solchen Klage der<br />
nationalen Parlamente. Die anfangs beschriebenen Probleme der Handhabbarkeit<br />
des Subsidiaritätsprinzips haben der Konvent und die Regierungskonferenz<br />
nicht vertieft behandelt. Gerade die fehlenden Kriterien<br />
werden es den europäischen Richtern schwer machen zu beurteilen, ob<br />
das Subsidiaritätsprinzip verletzt ist oder nicht. So wird erst die Praxis<br />
zeigen, ob eine gerichtliche Kontrolle nun besser möglich ist als in der<br />
Vergangenheit.<br />
Eine weitere Frage ist die Annahme der neuen Verfahren in den nationalen<br />
Parlamenten. Hier sind die Volksvertretungen in der Pflicht, geeignete<br />
und effiziente Verfahren zu schaffen. 24<br />
23<br />
So auch Mager 2003, 481.<br />
24<br />
Vgl. Maurer/Kietz 2003.<br />
108 Wenning/Ziegenbalg
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Artikel 6, 11, 18<br />
Ist Flexibilität alles?<br />
Um der Dynamik der europäischen Integration Rechnung zu tragen und<br />
sich auf aktuell ergebende Notwendigkeiten reagieren zu können, enthält<br />
der bis zum In-Kraft-Treten der Europäischen Verfassung geltende<br />
EG-Vertrag die so genannte Flexibilitätsklausel, den Artikel 308. Um<br />
die Ziele der Gemeinschaft verwirklichen zu können, erlaubt er den<br />
Mitgliedstaaten, einstimmig die Übertragung neuer Zuständigkeiten auf<br />
die Gemeinschaft zu beschließen, die nicht im Vertrag enthalten sind.<br />
Damit sollte ein aufwändiges Vertragsänderungsverfahren vermieden<br />
werden und im Bedarfsfall eine gewisse Flexibilität gesichert sein. 25<br />
Problematisch an diesem Verfahren ist jedoch, dass eine Übertragung<br />
von Zuständigkeiten ohne formalen Eingriff in den EG-Vertrag zum<br />
einen weitgehend ohne Herstellung von Öffentlichkeit und zum anderen<br />
unter mangelhafter Beteiligung des Europäischen Parlaments und ohne<br />
die Beteiligung nationaler Parlamente erfolgen würde.<br />
Daher wurde verschiedentlich die Abschaffung der Flexibilitätsklausel<br />
gewünscht. 26 Wenn eine klare und zukunftsfähige Kompetenzordnung<br />
erreicht werde, sei eine solche Klausel entbehrlich, so die Argumentation.<br />
Im Konvent und in der Regierungskonferenz herrschte allerdings<br />
die Meinung vor, die Dynamik müsse erhalten bleiben und die EU auf<br />
neue Entwicklungen schnell reagieren können. Mit einer zeitlichen<br />
Befristung der über die Flexibilitätsklausel angenommenen Zuständigkeiten<br />
hätte diese Dynamik gesichert werden können, aber die Eingriffe<br />
in die Zuständigkeiten der Regionen und Mitgliedstaaten wären<br />
gemildert worden.<br />
Fazit<br />
Mit den neuen Regelungen bringt die Verfassung mehr Transparenz und<br />
Klarheit im Bereich der Grundprinzipien der Kompetenzordnung. Das<br />
Frühwarnsystem und die Klagemöglichkeiten sind eine besondere<br />
Neuerung, da sie eine bessere Einbindung der nationalen Parlamente<br />
(und über ihre zweiten Kammern auch der Regionen) bieten und dazu<br />
beitragen können, dass die Ausübung der Zuständigkeiten stärker im<br />
Geiste der Subsidiarität erfolgt.<br />
25<br />
Vgl. Bungenberg 2000.<br />
26<br />
Bspw. Bundesrat Drucksache 1081/01 (Beschluss), „Entschließung des Bundesrates zur Kompetenzabgrenzung<br />
im Rahmen der Reformdiskussion zur Zukunft der Europäischen Union“<br />
vom 20.12.2001.<br />
Wenning/Ziegenbalg 109
Artikel 6, 11, 18<br />
Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung<br />
Literatur: Blickle, Peter/Hüglin, Thomas/Wyduckel, Dieter (Hrsg.) (2002): Subsidiarität als<br />
rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft – Berlin. Bungenberg,<br />
Marc (2000): Dynamische Integration, Art. 308 und die Forderung nach dem Kompetenzkatalog,<br />
in: Europa-Recht, H. 35, S. 878–900. Dorau, Christoph (2001): Die Verfassung<br />
der Europäischen Union. Möglichkeiten und Grenzen der europäischen Verfassungsentwicklung<br />
nach Nizza – Baden-Baden. Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Hrsg.)<br />
(2000): Jahrbuch des Föderalismus 2000 – Baden-Baden. Fischer, Thomas/Schley, Nicole<br />
(1999): Europa föderal organisieren. Ein neues Kompetenz- und Vertragsgefüge für die Europäische<br />
Union (Münchner Beiträge zur Europäischen Einigung, Band 3) – Bonn. Fischer, Thomas<br />
(2003): Kompetenzordnung und Handlungsinstrumente – Verhaltene Reformansätze im<br />
Konventsentwurf, in: Giering, Claus (Hrsg.): Der EU-Reformkonvent. Analyse und Dokumentation,<br />
CD-ROM – München. Giering, Claus (Hrsg.) (2003): Der EU-Reformkonvent. Analyse<br />
und Dokumentation, CD-ROM – München. Koenig, Christian/Lorz, Ralph (2003): Stärkung<br />
des Subsidiaritätsprinzips, in: Juristenzeitung, H. 4, S. 169–172. Hrbek, Rudolf (Hrsg.) (1995):<br />
Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union – Erfahrungen und Perspektiven<br />
– Baden-Baden, S. 105–119. Hrbek, Rudolf (2000): Das Subsidiaritätsprinzip in der<br />
EU – Bedeutung und Wirkung nach dem Vertrag von Amsterdam, in: Europäisches Zentrum für<br />
Föderalismus-Forschung (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000 – Baden-Baden, S. 510–531.<br />
Jarass, Hans D. (1996): Die Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Gemeinschaft<br />
und den Mitgliedstaaten, in: Archiv des öffentlichen Rechts, Band 121, S. 173–199. Mager, Ute<br />
(2003): Die Prozeduralisierung des Subsidiaritätsprinzips im Verfassungsentwurf des Europäischen<br />
Konvents – Verbesserter Schutz vor Kompetenzverlagerung auf die Gemeinschaftsebene,<br />
in: Zeitschrift für europarechtliche Studien H. 4, S. 471-484. Maurer, Andreas/Kietz, Daniela<br />
(2003): Nach dem Konvent. Die neuen Kompetenzen der nationalen Parlamente, Stiftung Wissenschaft<br />
und Politik – Berlin. Melchionni, Maria Grazi (1995): Subsidiarity from the historical<br />
perspective, in: Hrbek, Rudolf (Hrsg.): Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in der<br />
Europäischen Union – Erfahrungen und Perspektiven – Baden-Baden, S. 105–119. Pieper, Stefan<br />
Ulrich (2002): Das Subsidiaritätsprinzip im europäischen Gemeinschaftsrecht sowie in der<br />
politisch-rechtlichen Praxis der Union, in: Blickle, Peter/Hüglin, Thomas/Wyduckel, Dieter<br />
(Hrsg): Subsidiarität als rechtliches und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft<br />
– Berlin, S. 458–459.<br />
110 Wenning/Ziegenbalg
Christian Wenning/Florian Ziegenbalg<br />
Artikel 12-17<br />
DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION<br />
Artikel 12: Arten von Zuständigkeiten<br />
In diesem Artikel werden die Arten der Zuständigkeiten benannt, die im Einzelnen<br />
in den Artikeln 13 bis 17 beschrieben werden. Grundsätzlich unterscheidet<br />
der Artikel zwischen der ausschließlichen und der geteilten Zuständigkeit.<br />
Weist die Verfassung einen Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit zu 1 ,so<br />
kann hier nur die Union gesetzgeberisch tätig werden. Wollen die Mitgliedstaaten<br />
in einem Bereich tätig werden, der in der ausschließlichen Zuständigkeit der<br />
Union liegt, so benötigen sie hierzu von der Union eine spezielle Ermächtigung.<br />
Weist die Verfassung der Union hingegen für einen bestimmten Bereich eine mit<br />
den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit zu 2 , so müssen Union und Mitgliedstaaten<br />
gemeinsam gesetzgeberisch tätig werden. Die Mitgliedstaaten können<br />
dann dort agieren, wo die Union noch nicht tätig wurde oder nicht mehr tätig wird.<br />
Neben der ausschließlichen und der geteilten Zuständigkeit gibt es spezielle<br />
Zuständigkeiten der Union zur Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik<br />
und zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Für diese<br />
Bereiche sind spezielle Regelungen und Prozeduren vorgesehen und daher die<br />
Zuständigkeiten nicht in ausschließliche beziehungsweise geteilte Zuständigkeit<br />
einteilbar. Das Konventspräsidium hat in seiner Vorstellung des Artikels<br />
von einem „speziellen Charakter der Zuständigkeiten“ 3 gesprochen.<br />
Im Weiteren wird die Union in diesem Artikel befugt, „Maßnahmen zur<br />
Koordinierung, Ergänzung oder Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten<br />
durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für<br />
diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt“ 4 . Die<br />
ergänzenden Maßnahmen der Union, die sich aus Teil III 5 ergeben, dürfen<br />
aber nicht zu Harmonisierungen (Angleichungen) der Rechts- und Verwaltungsvorschriften<br />
der Mitgliedstaaten führen.<br />
Grundsätzlich ergeben sich der Umfang der Zuständigkeiten und die Einzelheiten<br />
ihrer Ausübung aus den jeweiligen Bestimmungen in Teil III der Verfassung.<br />
Die nähere Ausgestaltung der Zuständigkeitsarten zeigt sich in den Artikeln<br />
13, 14 und 17.<br />
1<br />
Die Bereiche werden in Artikel 13 aufgeführt.<br />
2<br />
Die Bereiche werden in Artikel 14 aufgeführt.<br />
3<br />
Entwurf der Artikel 1 bis 16 der Europäischen Verfassung vom 6. Februar 2003 (CONV<br />
528/03).<br />
4<br />
Artikel 12.<br />
5<br />
Titel IV, Kapitel V.<br />
Wenning/Ziegenbalg 111
Artikel 12-17<br />
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 13: Ausschließliche Zuständigkeiten<br />
Unter die ausschließlichen Zuständigkeiten werden mehrere Bereiche gefasst.<br />
Entsprechend dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung sind jedoch die<br />
im Teil III enthaltenen konkreten Bestimmungen maßgeblich. Die Liste des<br />
Artikels 13 ist jedoch abschließend.<br />
Die Union besitzt für das Funktionieren des Binnenmarktes, für den Bereich<br />
der Währungspolitik für die Euro-Länder, im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik,<br />
für die Zollunion sowie die Erhaltung der biologischen Meeresschätze<br />
im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik die ausschließliche<br />
Zuständigkeit. Die Union hat immer dann die ausschließliche Zuständigkeit<br />
zum Abschluss von Abkommen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen,<br />
wenn dies in einem Rechtsakt so vorgesehen ist, wenn es notwendig ist,<br />
damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann oder wenn es einen internen<br />
Rechtsakt der Union beeinträchtigt.<br />
Artikel 14: Bereiche mit geteilter Zuständigkeit<br />
Die meisten Zuständigkeitsbereiche fallen unter diese Kategorie. Außerhalb der<br />
in Artikel 13 genannten Bereiche ausschließlicher Zuständigkeit und der in<br />
Artikel 17 aufgeführten Bereiche der Unterstützungs-, Koordinierungs- oder<br />
Ergänzungsmaßnahmen teilt sich die Union ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten.<br />
Die in Absatz 2 genannten Hauptbereiche haben nur illustrierenden Charakter.<br />
Maßgeblich sind die der Union in Teil III der Verfassung übertragenen einzelnen<br />
Zuständigkeiten. Folgende Hauptbereiche werden den geteilten Zuständigkeiten<br />
zugeordnet: der Binnenmarkt, Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III<br />
genannten Aspekte, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt,<br />
Landwirtschaft und Fischerei 6 , Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, transeuropäische<br />
Netze, Energie, der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
sowie gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich des Gesundheitswesens. In<br />
den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt<br />
beschränkt sich die Zuständigkeit der Union auf die Durchführung gemeinsamer<br />
Programme, die aber die nationalen Maßnahmen nicht beeinträchtigen dürfen.<br />
Im Bereich der auswärtigen Beziehungen werden die Entwicklungszusammenarbeit<br />
und die humanitäre Hilfe den geteilten Zuständigkeiten zugeordnet.<br />
Auch hier dürfen die Maßnahmen der Union die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten<br />
nicht behindern.<br />
6<br />
Ausgenommen ist allerdings die Erhaltung der biologischen Meeresschätze. Sie wird in Artikel<br />
13 geregelt.<br />
112 Wenning/Ziegenbalg
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 12-17<br />
Artikel 15: Die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik<br />
Mit der Erwähnung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in einem eigenen<br />
Artikel unterstreicht die Verfassung die Bedeutung dieses Politikfeldes für<br />
die gesamte Union. Dabei beschränken sich die Aufgaben der Union darauf,<br />
Maßnahmen zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik zu treffen, insbesondere<br />
durch die Ausarbeitung von Leitlinien für die Beschäftigungspolitik. Zudem<br />
kann die Union Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten<br />
ergreifen. Die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik bleibt aber grundsätzlich<br />
in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Eine Ausnahme innerhalb dieses<br />
Bereiches ist die Währungspolitik jener Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt<br />
haben. Hier ist die ausschließliche Zuständigkeit der Union vorgesehen.<br />
Artikel 16: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 7<br />
Der Artikel erklärt die Zuständigkeit der Europäischen Union in allen außenund<br />
sicherheitspolitischen Belangen der Staatengemeinschaft. Er eröffnet ausdrücklich<br />
die Möglichkeit, eine gemeinsame Verteidigung zu entwickeln. Die<br />
Staaten der EU sind den Zielen und Interessen der gemeinsamen Politik in<br />
„Loyalität“ und „Solidarität“ verpflichtet. Sie vermeiden jegliche Handlungen,<br />
die der gemeinsamen europäischen Politik schaden könnten.<br />
Artikel 17: Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen<br />
In den Bereichen der Gesundheits- und der Industriepolitik, Kultur, Tourismus,<br />
allgemeine berufliche Bildung, Jugend und Sport, Katastrophenschutz sowie<br />
Verwaltungszusammenarbeit kann die Union lediglich Unterstützungs-, Koordinierungs-<br />
oder Ergänzungsmaßnahmen ergreifen, während die Mitgliedstaaten<br />
in den Bereichen grundsätzlich zuständig bleiben.<br />
Was darf die Europäische Union?<br />
Im Folgenden soll noch einmal ein kurzer Überblick über die Ordnung der<br />
Kompetenzen in den verschiedenen Verträgen der letzten Jahre gegeben<br />
werden, bevor in einer Übersicht die neue Kompetenzordnung der Verfassung<br />
veranschaulicht wird.<br />
Auswege aus dem Zuständigkeitsdschungel<br />
Wer sich im Vertrag von Nizza informieren will, wofür die Europäische<br />
Union zuständig ist, muss in mindestens zwei verschiedene Vertrags-<br />
7<br />
Diese Erklärung zu Artikel 16 stammt von Anna Lührmann und Tina Löffelsend; zur Kommentierung<br />
siehe ihren Text zu Artikel 40 in diesem Band.<br />
Wenning/Ziegenbalg 113
Artikel 12-17<br />
Die Zuständigkeiten der Union<br />
werke schauen und jede Einzelbestimmung lesen. Aufgaben und Eigenschaften<br />
werden miteinander vermengt, einmal Ziele (wie der Binnenmarkt),<br />
einmal Handlungen genannt, die als solche niemals im Vertrag<br />
definiert werden. 8<br />
Als Problem erwies sich oftmals, dass die Verträge anstelle konkreter<br />
Aufgaben lediglich Ziele enthalten und diese Ziele vielfach weit und<br />
unbestimmt formuliert sind. Daraus konnten relativ leicht Aufgaben<br />
abgeleitet werden, ohne dass eine konkrete Befugnis dazu vorlag. Ein<br />
Beispiel hierfür ist die so genannte Binnenmarkt-Klausel 9 . Sie ermöglichte<br />
Rechtsangleichungen, die dem Funktionieren des Binnenmarktes<br />
dienten. Da sich in sehr vielen Bereichen Bezüge zum Binnenmarkt herstellen<br />
lassen, wurde die Klausel sehr oft genutzt, um Bereiche zu<br />
regeln, die eigentlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten lagen. 10<br />
Für eine klare Aufgabenverteilung – Der Auftrag von Laeken<br />
In seiner Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union<br />
vom 15. Dezember 2001 greift der Europäische Rat die Hauptprobleme<br />
der Europäischen Union nach der letzten Vertragsrevision von Nizza<br />
auf. Der Verfassungskonvent hatte demnach die Aufgabe, die Kompetenzen<br />
der Europäischen Union den Bürgern in einer Verfassung verständlich<br />
und nachvollziehbar zu beschreiben. Künftig sollte somit<br />
einerseits unerfüllbaren Erwartungen an die Union vorgebeugt und<br />
andererseits nicht mehr der Eindruck erweckt werden, dass die Union<br />
auch dort tätig wird, wo es eigentlich nicht nötig (und eventuell sogar<br />
wenig sinnvoll) ist. Die neu zu bestimmende Aufgabenverteilung zwischen<br />
den Mitgliedstaaten und der Union sollte so gestaltet werden,<br />
dass sie nicht mehr zu einer schleichenden Übertragung von Kompetenzen<br />
zu Gunsten der Union führt. Zuletzt war man sich einig, dass insgesamt<br />
mehr Klarheit zu schaffen war, in welchem Bereich wer tätig werden<br />
darf.<br />
Mit dem bislang in der Union geltenden Säulenmodell gelang dies nicht.<br />
Das Säulenmodell – mitunter auch „Tempelkonstruktion“ genannt –<br />
veranschaulicht den „einheitlichen institutionellen Rahmen“ nach Artikel<br />
3 des EU-Vertrages, der sich bei näherem Hinsehen in drei Säulen<br />
gliedert:<br />
8<br />
Vgl. Bieber 2002, 4.<br />
9<br />
Artikel 95 EG-Vertrag in der Fassung von Nizza.<br />
10<br />
Vgl. Müller-Graff 1999, 787.<br />
114 Wenning/Ziegenbalg
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 12-17<br />
1. Europäische Gemeinschaften,<br />
2. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,<br />
3. Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen.<br />
Nur bei der ersten Säule gibt es eine originäre Zuständigkeit der europäischen<br />
Institutionen und somit wirklich supranationale (überstaatliche)<br />
Politik, wohingegen es sich bei der zweiten und der dritten Säule<br />
letztlich um verstetigte und vertiefte intergouvernementale (zwischenstaatliche)<br />
Zusammenarbeit handelt.<br />
Ein wichtiges Ziel im Verfassungskonvent war es, die Aufgabenverteilung<br />
in der Verfassung klar zu systematisieren und das so genannte Säulenmodell<br />
aufzulösen. Dieses Ziel wurde im Verfassungskonvent<br />
erreicht und von der Regierungskonferenz bestätigt.<br />
Die Diskussion um einen Kompetenzkatalog<br />
Die deutlichste Systematisierung der Unionskompetenzen wäre nach<br />
der Auffassung mancher Konventsteilnehmer durch einen Kompetenzkatalog<br />
gegeben gewesen. 11 Insbesondere die deutschen Länder, die um<br />
ihr Mitspracherecht im demokratischen Entscheidungsprozess fürchteten,<br />
drängten auf eine Diskussion über einen Kompetenzkatalog. 12 In<br />
diesem Katalog sollten alle Bereiche aufgezählt werden, die durch die<br />
Union gemeinschaftlich geregelt werden, sowie die Bereiche, die in den<br />
Mitgliedstaaten verbleiben sollen.<br />
So groß im Konvent die Unterstützung für eine klare Kompetenzabgrenzung<br />
aber auch war, so umstritten war es, die Kompetenzen in einem<br />
Katalog einzeln aufzuzählen. Freilich sind die Zuständigkeiten für die<br />
jeweiligen Politikbereiche abgrenzbar, eine umfassende und erschöpfende<br />
Beschreibung der Kompetenzen, auf deren alleiniger Grundlage<br />
die Union gesetzgeberisch tätig werden darf, schien jedoch nicht realisierbar.<br />
Die deutschen Länder, die selber erfahren in der Schwierigkeit der<br />
Kompetenzabgrenzung im deutschen Föderalismus sind, einigten sich<br />
im Bundesrat aber schon früh darauf, zumindest eine eingehende Prüfung<br />
des Kompetenzkataloges zu fordern. 13 Insbesondere sollte in<br />
11<br />
Vgl. etwa Brok 2003.<br />
12<br />
Vgl. etwa Teufel 2002.<br />
13<br />
Vgl. die Entschließung des Bundesrates zur Kompetenzabgrenzung im Rahmen der Reformdiskussion<br />
zur Zukunft der Europäischen Union, BR-Drucksache 1081/01 vom 20. Dezember<br />
2001.<br />
Wenning/Ziegenbalg 115
Artikel 12-17<br />
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Erfahrung gebracht werden, ob mit einem Kompetenzkatalog größere<br />
Transparenz im Zuständigkeitsgeflecht der EU geschaffen werden<br />
könnte. Allerdings konnten die Befürchtungen, dass der Kompetenzkatalog<br />
der Handlungsfähigkeit der Union schaden könnte, nicht ausgeräumt<br />
werden. Eine explizite Festlegung aller Kompetenzen in einem<br />
Katalog als Grundlage für das gesetzgeberische Handeln der Union<br />
wäre durch seinen statischen Charakter an der seit jeher dynamischen<br />
Föderation gescheitert. Hätte der Kompetenzkatalog weiter entwickelt<br />
werden sollen oder wäre er fehlerhaft gewesen, so hätte die Union durch<br />
alle Bereiche ihrer Politik schwerfällige und langwierige Vertragsverhandlungen<br />
ansetzen müssen. Die Befürworter eines Kompetenzkataloges<br />
hielten ihre Position zwar aufrecht, zeigten sich aber offen für alternative<br />
Lösungen. Auch wenn sie sich nicht durchsetzten, konnten sie<br />
doch mit den neuen Errungenschaften für die nationalen Parlamente –<br />
zu denen eben auch der Bundesrat als zweite Kammer gehört – in Mitsprache<br />
und Kontrolle, aber auch im Schutz der Subsidiarität insgesamt<br />
zufrieden sein.<br />
Grundprinzipien der Kompetenzabgrenzung in der Verfassung<br />
Eine schöne Vorstellung ist der Kompetenzkatalog schon: Mit einem<br />
Blick in die Verfassung wäre klar gewesen, was die EU darf und was<br />
nicht. Aus praxisorientierter Sicht wäre dies aber eventuell ein zu starres<br />
System für die europäische Gesetzgebung geworden. Zur besseren<br />
Verständlichkeit der Verträge, wie es der Auftrag von Laeken vorsah,<br />
wurde dennoch einiges erreicht. So waren die Zuständigkeiten der<br />
Union in den Artikeln des EG-Vertrags bislang undurchsichtig versteckt.<br />
In der Verfassung werden sie zum einen neu und verständlicher<br />
sortiert, zum anderen wird in den Artikeln 11 bis 18 klar und nur an dieser<br />
Stelle benannt, wofür die Union zuständig ist.<br />
Zuständigkeiten der Europäischen Union<br />
Die Europäische Verfassung unterscheidet zwischen ausschließlicher<br />
und geteilter Zuständigkeit sowie Unterstützungs-, Koordinierungs- und<br />
Ergänzungsmaßnahmen:<br />
116 Wenning/Ziegenbalg
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 12-17<br />
Ausschließliche<br />
Zuständigkeit<br />
Geteilte Zuständigkeit<br />
mit den Mitgliedstaaten<br />
Maßnahmen zur Koordinierung,<br />
Ergänzung<br />
oder Unterstützung<br />
• Zollunion<br />
• Binnenmarkt<br />
• Regelung des Wettbewerbs • Sozialpolitik<br />
für das Funktionieren des • Wirtschaftlicher, sozialer &<br />
Binnenmarktes<br />
territorialer Zusammenhalt<br />
• Währungspolitik für Euroländer<br />
• Landwirtschaft & Fischerei<br />
• Umwelt<br />
• Erhaltung der biologischen<br />
Meeresschätze<br />
• Verbraucherschutz<br />
• EU-Handelspolitik<br />
• Verkehr<br />
sowie<br />
• Transeuropäische Netze<br />
• Abschluss internationaler<br />
• Energie<br />
Übereinkünfte, wenn dies: • Raum der Freiheit, der Sicherheit<br />
& des Rechts<br />
– in einem Gesetzgebungsakt<br />
vorgesehen ist, • Gemeinsame Sicherheitsanliegen<br />
im Gesundheitswesen<br />
– notwendig ist, damit die<br />
EU ihre interne Zuständigkeit<br />
ausüben kann Entwicklung & Raumfahrt*<br />
• Forschung, technologische<br />
oder<br />
• Entwicklungszusammenarbeit<br />
– gemeinsame Regeln oder<br />
& humanitäre Hilfe*<br />
deren Tragweite verändern * soweit die EU hierdurch nicht<br />
könnte.<br />
das Handeln der Mitgliedstaaten<br />
behindert.<br />
• Gesundheitsschutz<br />
• Industrie<br />
• Kultur<br />
• Tourismus<br />
• Bildung, Jugend, Sport &<br />
berufliche Bildung<br />
• Katastrophenschutz<br />
• Verwaltungszusammenarbeit<br />
Die „Koordinierung der<br />
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik“<br />
wird in Artikel 15 wegen<br />
ihrer großen Bedeutung<br />
gesondert erwähnt,<br />
obwohl sie zum Bereich<br />
der Koordinierung zählt.<br />
Leider wird in Teil III der Verfassung die klare Unterscheidung in ausschließliche,<br />
geteilte und ergänzende Zuständigkeiten nicht beibehalten.<br />
Änderungen an der bestehenden Verteilung der Zuständigkeiten<br />
Es war der Auftrag des Konvents, das Europarecht zu vereinfachen,<br />
ohne es inhaltlich zu ändern. Daher wurden bei der Zuständigkeitsverteilung<br />
zumeist die bestehenden Bestimmungen des EG-Vertrages<br />
unverändert in den Teil III übernommen. Geändert wurde aber die Systematik.<br />
Wie man dem dritten Teil der Verfassung entnehmen kann,<br />
wurden der Union neue geteilte Zuständigkeiten in den Bereichen<br />
Raumfahrt und Energie 14 sowie ergänzende Zuständigkeiten in den<br />
14<br />
Artikel 254 und 256.<br />
Wenning/Ziegenbalg 117
Artikel 12-17<br />
Die Zuständigkeiten der Union<br />
Bereichen Tourismus 15 , Sport 16 , Katastrophenschutz und Verwaltungszusammenarbeit<br />
17 übertragen. Von großer Bedeutung ist die neu übertragene<br />
Koordinierungszuständigkeit für die Sozial- und Beschäftigungspolitik.<br />
18 Im gesamten Bereich Justiz und Inneres wurden umfangreiche<br />
Änderungen vorgenommen, die sich aus der Auflösung der Säulenstruktur<br />
ergaben. Angesichts neuer außenpolitischer Herausforderungen wurden<br />
der EU im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik vereinzelt<br />
neue Kompetenzen übertragen.<br />
Fazit<br />
Dem Konvent ist es gelungen, eine für den Bürger verständlichere Kompetenzordnung<br />
zu schaffen. Die Einteilung in ausschließliche, geteilte<br />
und ergänzende Zuständigkeiten ist ein Fortschritt. Zu bedauern ist<br />
jedoch, dass diese klare Linie in Teil III der Verfassung nicht beibehalten<br />
wurde.<br />
Literatur: Bieber, Roland (2001): Zur Kompetenzabgrenzung der Europäischen Union, in: Integration,<br />
H. 3, S. 308–313. Brok, Elmar (2003): Die Zuständigkeiten der Europäischen Union,<br />
Beitrag bei der Tagung des Konvents zur Zukunft Europas, 6. Februar 2003, CONV 541/03.<br />
Müller-Graff, Peter-Christian (1999): Die Kompetenzen in der Europäischen Union, in:<br />
Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Europa-Handbuch – Bonn, S. 779–801. Ludwigs, Markus (2004):<br />
Die Kompetenzordnung der Europäischen Union im Vertragsentwurf über eine Verfassung für<br />
Europa, in: Zeitschrift für europarechtliche Studien. H. 2. S. 211–249. Nettesheim, Martin<br />
(2004): Die Kompetenzordnung im Vertrag über eine Verfassung für Europa, in: Europarecht.<br />
39.Jg. H. 4. S. 511-546 Teufel, Erwin (2002): Erwartungen an die Europäische Union, Beitrag<br />
bei der Tagung des Konvents zur Zukunft Europas, 21./22. März 2002. Weidenfeld, Werner<br />
(Hrsg.) (1999): Europa-Handbuch – Bonn.<br />
Weiterführende Literatur: Boeck, Ilka (2000): Die Abgrenzung der Rechtsetzungskompetenzen<br />
von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Zur Notwendigkeit und<br />
zu den Vorteilen bzw. Nachteilen der Aufstellung eines Kompetenzkataloges in den Gemeinschaftsverträgen<br />
– Baden-Baden. Mayer, Franz C. (2001): Die drei Dimensionen der Europäischen<br />
Kompetenzdebatte, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,<br />
H. 2–3, S. 577–640. Pernice, Ingolf (2000): Kompetenzabgrenzung im Europäischen Verfassungsverbund,<br />
in: Juristenzeitung, H. 18, S. 866–876. Swinden, Wilfried (2004): Is the European<br />
Union in Need of a Competence Catalogue? Insights from Comparative Federalism, in:<br />
Journal of Common Market Studies, H. 2, S. 371–392.<br />
15<br />
Artikel 281 wurde von der Regierungskonferenz neu in die Verfassung aufgenommen.<br />
16<br />
Artikel 282.<br />
17<br />
Artikel 284 und 285.<br />
18<br />
Vgl. Nettesheim 2004, 518.<br />
118 Wenning/Ziegenbalg
Der institutionelle Rahmen<br />
Nicole Meßmer<br />
Artikel 19<br />
DER INSTITUTIONELLE RAHMEN<br />
Artikel 19: Die Institutionen im Überblick<br />
Den institutionellen Rahmen der Europäischen Union bilden die Organe Europäisches<br />
Parlament, Europäischer Rat, Ministerrat, Kommission und Gerichtshof.<br />
Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Ministerrat als Gesetzgeber<br />
tätig und übt mit diesem die Haushaltsbefugnisse aus (Artikel 20). Im<br />
Parlament tagen maximal 750 Vertreter der Unionsbürger. Die Sitze im Parlament<br />
sind „degressiv proportional“ auf die Mitgliedstaaten verteilt. Das bedeutet,<br />
dass die Anzahl der Sitze die Bevölkerungsstärke eines Staates in etwa<br />
widerspiegelt, wobei jeder Staat mindestens sechs und maximal 96 Sitze erhält.<br />
Das Parlament ist das einzige direkt demokratisch legitimierte Organ der EU.<br />
Augenfällig ist, dass es einige traditionelle Befugnisse nationalstaatlicher Parlamente<br />
nicht besitzt. So ist zum Beispiel das Mitentscheidungsrecht im<br />
Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) eingeschränkt.<br />
Der Europäische Rat setzt sich nach Artikel 21 Absatz 2 aus seinem Präsidenten,<br />
den Staats- und Regierungschefs sowie dem Präsidenten der Kommission<br />
zusammen. Darüber hinaus nimmt der EU-Außenminister an den Arbeiten teil.<br />
Nachzulesen in seinen Schlussfolgerungen gibt der Europäische Rat der Union<br />
zukunftsweisende Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen<br />
und Prioritäten fest. Damit übernimmt er einen Teil der Aufgaben, die in<br />
Deutschland der Bundesregierung zukommen. Ein Organ wie der Europäische<br />
Rat lässt sich jedoch in nationalstaatlichen Systemen nicht finden. Die Aufgabe<br />
der Gesetzgebung fällt ihm nicht zu (Artikel 21 Absatz 1).<br />
Der Ministerrat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber<br />
tätig, hat gemeinsam mit diesem Haushaltsbefugnisse und erfüllt Aufgaben<br />
der Politikfestlegung und -koordinierung (Artikel 23 Absatz 1). Er übt<br />
somit sowohl gesetzgeberische (legislative) als auch ausführende (exekutive)<br />
Befugnisse aus. In ihm sind die jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten<br />
versammelt.Von seiner legislativen Funktion her ist er mit dem deutschen Bundesrat<br />
oder dem amerikanischen Senat vergleichbar. Aufgrund seiner weitergehenden<br />
Exekutivbefugnisse findet sich jedoch auch hier in staatlichen Modellen<br />
kein entsprechendes Organ.<br />
Die Europäische Kommission besitzt nach Artikel 26 Absatz 1 das Initiativrecht.<br />
Sie ist verantwortlich für die Ausführung europäischen Rechts und überwacht<br />
dessen Umsetzung. Sie übt Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen<br />
aus und vertritt die Union – mit Ausnahme der GASP – nach<br />
außen. Die Kommission ist damit einer Regierung vergleichbar.<br />
Meßmer 119
Artikel 19<br />
Der institutionelle Rahmen<br />
Zum Gerichtshof gehören der Europäische Gerichtshof, das Gericht und Fachgerichte.<br />
Er gewährleistet die Achtung des Rechts bei der Auslegung und<br />
Anwendung der Verfassung (Artikel 29 Absatz 1). Der Gerichtshof ist somit ein<br />
klassisches oberstes Verfassungsgericht.<br />
Die Europäische Union – ein einzigartiges Projekt<br />
Gewaltenteilung als Grundprinzip parlamentarischer Demokratien<br />
Ein Herzstück der Verfassung sind die Institutionen. Ein Ziel des Verfassungskonvents<br />
war es, dass die Arbeit der Institutionen effizienter,<br />
demokratischer und transparenter wird. Dazu sollte die Machtbalance<br />
und die Gewaltenteilung zwischen den Organen verbessert werden.<br />
Doch die Regierungskonferenz zur Europäischen Verfassung veränderte<br />
das Machtgefüge der EU entgegen der Vorschläge des Konvents nur<br />
geringfügig. Dies ist zu bedauern, denn das Ziel der Gewaltenteilung ist<br />
es, eine Begrenzung staatlicher Macht durch gegenseitige Hemmung<br />
und Kontrolle zu gewährleisten. Nachzulesen ist dies in dem Buch „De<br />
l’Esprit des Lois“ des französischen Philosophen Montesquieu aus dem<br />
Jahr 1748, in dem dieser als Kernprinzip parlamentarischer Verfassungen<br />
die Lehre von der Gewaltenteilung entwickelte (Machtausübung<br />
durch Legislative, Exekutive und Judikative). Danach soll auf horizontaler<br />
Ebene eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den einzelnen<br />
Institutionen zum einen die Machtkonzentration auf eine Institution<br />
verhindern, zum anderen den politischen Prozess transparenter<br />
gestalten: Weiß der Bürger, wer für was verantwortlich ist, fällt es ihm<br />
leichter, sich ein Urteil über die Politik zu bilden. Auch die Idee des<br />
Föderalismus gründet auf dem Prinzip der Gewalten- und Kompetenzteilung<br />
zwischen verschiedenen Ebenen: Auf vertikaler Ebene führt die<br />
Aufgabenteilung in ausschließliche und getrennte Kompetenzen zu<br />
einer gegenseitigen Verantwortlichkeit und Kontrolle zwischen Region,<br />
Nation und suprastaatlicher Ebene.<br />
Der Vater des Föderalismus, James Madison, bezeichnete schon 1788<br />
die Aufteilung der Gewalten auf verschiedene Institutionen, die sich<br />
gegenseitig kontrollieren, als Grundsatz demokratischer Staatsformen:<br />
„[...] it would require that all the appointments for the supreme executive,<br />
legislative, and judiciary magistracies, should be drawn from the<br />
same fountain of authority, the people, through channels, having no<br />
communication whatever with one another. [...] You must first enable<br />
120 Meßmer
Der institutionelle Rahmen<br />
Artikel 19<br />
the government to control the governed; and in the next place, oblige it<br />
to control itself.“ 1<br />
Es ist offensichtlich, dass eine strikte Gewaltenteilung, wie Madison sie<br />
im Sinn hatte, heutzutage nicht praktikabel ist. Fraglich ist auch, ob sie<br />
erwünscht wäre. Die EU jedoch zeichnet sich durch eine extrem starke<br />
Gewaltenverschränkung aus. „In der Legislative wirken [Minister-]Rat,<br />
Parlament und Kommission zusammen, die Kommission trägt zugleich<br />
exekutivische Funktionen; es fehlt also eine klare Trennung von Exekutive<br />
und Legislative.“ 2 Eine stärkere Trennung der Gewalten innerhalb<br />
der EU wurde immer wieder gefordert. Auch Madisons Gedanke der<br />
Legitimation von Seiten der Bürger wurde im Rahmen des Konvents zur<br />
Zukunft der Europäischen Union wiederholt aufgegriffen: „Die EU-Verfassung<br />
muss die doppelte Legitimität der EU als Union von Bürgern<br />
und als Union von Staaten reflektieren, während die Gewaltenteilung<br />
zwischen dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission<br />
und dem [Minister-]Rat erreicht werden muss.“ 3<br />
Legislative und Exekutive auf verschiedene Schultern verteilt<br />
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit das Prinzip der Gewaltenteilung<br />
in der Europäischen Verfassung umgesetzt wurde.<br />
Legislativorgan eines parlamentarischen Systems ist grundsätzlich das<br />
Parlament. In föderalen Staaten besteht dieses aus zwei Kammern. In<br />
der EU ist dies nicht so: Es gibt das Europäische Parlament als das<br />
Repräsentativorgan der Bürger und den Ministerrat als Repräsentationsorgan<br />
der Mitgliedstaaten. Prinzipiell ist das Europäische Parlament<br />
durch die Umwandlung des Mitentscheidungsverfahrens in das reguläre<br />
Gesetzgebungsverfahren gemeinsam mit dem Ministerrat Gesetzgeber<br />
der Europäischen Union. Durch zahlreiche Ausnahmen gibt es jedoch<br />
einige Bereiche, in denen das Parlament nur beratend tätig oder gar<br />
nicht beteiligt ist. Dazu gehören generell alle Rechtsakte ohne Gesetzescharakter,<br />
das heißt alle Bereiche, in denen Abläufe nicht durch Gesetze<br />
geregelt werden. Dies gilt insbesondere für weite Bereiche von Teil III<br />
der Europäischen Verfassung, in dem die einzelnen Politikfelder der<br />
Union geregelt werden. 4 Besonders gravierend wirkt sich dies im<br />
1<br />
Madison 1788.<br />
2<br />
Nicolaysen 1999, 866.<br />
3<br />
Duhamel et al. 2003.<br />
4<br />
Vgl. Scholl 2003, 211 f.<br />
Meßmer 121
Artikel 19<br />
Der institutionelle Rahmen<br />
Bereich der GASP aus, denn das Parlament besitzt im Rahmen der<br />
GASP lediglich ein indirektes Druckmittel. Im Unterschied zum deutschen<br />
politischen System verfügt das Europäische Parlament zudem<br />
nicht über ein direktes Initiativrecht. Das heißt, es kann keine eigenen<br />
Vorschläge für Gesetzesentwürfe einbringen und ist somit weder eine<br />
vollwertige Legislative noch hinreichend mit Handlungsoptionen ausgestattet,<br />
um in einem System von „checks and balances“ – einem Gefüge<br />
politischer Institutionen, die sich gegenseitig begrenzen und kontrollieren<br />
– ein wirksames Gegengewicht zu den anderen Organen bilden<br />
zu können.<br />
Der Ministerrat übernimmt ebenfalls legislative Aufgaben. Auch er verfügt<br />
grundsätzlich nicht über das Initiativrecht. Eine Ausnahme bilden<br />
die GASP und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
(GSVP). Sie sind die wichtigsten Politikbereiche, in denen der Ministerrat<br />
die alleinige legislative Funktion innehält und das Parlament aufgrund<br />
der oben genannten Ausnahmen keinerlei Mitentscheidungsbefugnis<br />
hat. Der Ministerrat tritt darüber hinaus auch in exekutiver<br />
Funktion zusammen, wobei diese doppelte Aufgabenstellung in der Verfassung<br />
durch die klare Ordnung der Rechtsinstrumente in legislative<br />
und nicht-legislative Akte von nun an deutlicher und insofern auch<br />
transparenter zu sehen ist. 5<br />
Die Europäische Kommission, also diejenige Institution, die als Einzige<br />
über ein Initiativrecht in der Gesetzgebung verfügt, spielt im Gesetzgebungsverfahren<br />
höchstens als Vermittlerin zwischen Europäischem<br />
Parlament und Ministerrat eine Rolle – jedoch auch nur minimal im<br />
Rahmen der Mitentscheidung.<br />
Ebenso wie im Bereich der Ausübung der legislativen Gewalt kommt es<br />
im Bereich der exekutiven Gewalt nicht zu einer eindeutigen Zuordnung<br />
einer Kompetenz zu einem Organ. Vergleicht man das institutionelle<br />
System der EU mit nationalstaatlichen Modellen, sollte die Kommission<br />
die eigentliche Exekutive bilden. Doch sowohl der Europäische Rat als<br />
auch der Ministerrat verfügen, wie bereits dargelegt, über exekutive<br />
Funktion. Darüber hinaus sollte nicht vergessen werden, dass die Ausübung<br />
in diesem Bereich durch das grundsätzlich begrüßenswerte Prinzip<br />
der Subsidiarität zusätzlich erschwert wird.<br />
5<br />
Vgl. ebd., 213.<br />
122 Meßmer
Der institutionelle Rahmen<br />
Artikel 19<br />
In der Exekutive ist also eine klare Kompetenzverteilung zwischen den<br />
Organen auch weiterhin nicht gewährleistet. Dies mahnte bereits Joschka<br />
Fischer in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22. Februar<br />
2002 an, in der er die Trennung der Gewalten als zentrales Unterscheidungsmerkmal<br />
zwischen Staatenbund und Föderation benannte. Er forderte,<br />
dass die Doppelrolle des Ministerrats aufgelöst werden müsse:<br />
„Überschreiten wir den Staatenverbund, werden wir den Schritt in die<br />
Föderation gehen und der [Minister-]Rat wird sich zwischen Legislative<br />
und Exekutive entscheiden müssen. Das ist für mich die zentrale<br />
Frage.“ 6<br />
Überschneidungen bei Kompetenzen und Funktionen<br />
Ein vergleichbares Zuordnungsproblem von Aufgabenfeldern ergibt<br />
sich hinsichtlich der Präsidenten der Europäischen Kommission und des<br />
Europäischen Rates. Braucht Europa wirklich zwei Präsidenten?<br />
Fragwürdig unter dem Aspekt der Gewaltenteilung erscheint vor allem<br />
die Auswahl des Kommissionspräsidenten. Der Kommissionspräsident,<br />
der als „Legitimationsbrücke zwischen Bürger und Kommission“ 7 fungieren<br />
sollte, wird weder direkt noch indirekt durch den Bürger gewählt.<br />
Stattdessen schlägt der Europäische Rat unter Berücksichtigung der<br />
Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament einen Kandidaten<br />
vor, den das Europäische Parlament bestätigen kann (Artikel 27 Absatz<br />
1). Dass dieses dem Kandidaten jedoch nicht ungeprüft seinen Segen<br />
gibt, durfte die EU im Oktober 2004 erfahren, als das Europäische<br />
Parlament sich auf eine Machtprobe mit dem designierten Kommissionspräsidenten<br />
José Manuel Barroso einließ und den Austausch<br />
zweier Kommissare erzwang. Der Kommissionspräsident, der nach<br />
nationalstaatlichem Verständnis von Gewaltenteilung der Regierungschef<br />
sein sollte, bleibt dennoch von der Interessenlage im Europäischen<br />
Rat abhängig, wodurch die Mitgliedstaaten Einfluss auf die an sich<br />
unabhängige Kommission ausüben können.<br />
Die Kompetenzen des Präsidenten des Europäischen Rates überschneiden<br />
sich teilweise mit denen des Kommissionspräsidenten. Indem er<br />
über den Europäischen Rat die Richtlinien der Europäischen Politik<br />
mitbestimmen kann, nimmt der Ratspräsident klassische Aufgaben der<br />
ausführenden Gewalt wahr, sodass hier keine klare Kompetenzzuwei-<br />
6<br />
Fischer 2002.<br />
7<br />
Vgl. Scholl 2003, 207.<br />
Meßmer 123
Artikel 19<br />
Der institutionelle Rahmen<br />
sung an ein Exekutivorgan stattfindet. Selbiges Problem findet man im<br />
Bereich der Außenvertretung, die nicht nur durch den Außenminister,<br />
der Teil der Europäischen Kommission ist, sondern auch durch den Präsidenten<br />
des Europäischen Rates wahrgenommen wird. Damit bleibt für<br />
den Bürger weiterhin unklar, welches Organ welche exekutiven Kompetenzen<br />
wahrnimmt. Die von Henry Kissinger geforderte Telefonnummer<br />
für Europa gibt es also immer noch nicht – es sind mindestens zwei<br />
Repräsentanten Europas, die Kissingers Erben im Falle eines Falles<br />
konsultieren müssen.<br />
Weiterhin problematisch ist der so genannte „Doppelhut“, also die Möglichkeit<br />
der Personalunion von Kommissions- und Ratspräsident.<br />
Dadurch besteht die Gefahr, dass die Funktion des Ratspräsidenten zu<br />
stark wird. Ein solcher „Doppelpräsident“ ist dann nicht mehr nur der<br />
Kommission verantwortlich, sondern auch dem Europäischen Rat.<br />
Sollte der Präsident Interessen vertreten, die denen der Mitgliedstaaten<br />
zuwiderlaufen, kann er vom Europäischen Rat als Ratspräsident abberufen<br />
werden. Dadurch können die Mitgliedstaaten einen großen Druck<br />
auf ihn ausüben. Unklar ist in einem solchen Fall, ob der Präsident dann<br />
weiterhin Kommissionspräsident bleiben kann oder auch dieses Amt<br />
abgeben muss. Letztlich wird es wohl vor allem von der Person als solcher<br />
abhängen, ob der potentielle „Doppelpräsident“ stark genug sein<br />
wird, eine integrierende Wirkung auf Ministerrat, Kommission und Parlament<br />
auszuüben oder stattdessen nur einem Teil seiner Aufgaben<br />
gerecht werden wird.<br />
Teil dieser Verflechtung ist – wie bereits erwähnt – auch der Außenminister,<br />
der dem Kommissionspräsidenten zur Seite gestellt ist. Er wird<br />
ebenfalls vom Europäischen Rat – mit Zustimmung des Kommissionspräsidenten<br />
– für fünf Jahre gewählt (Artikel 28). Vom Europäischen<br />
Rat kann er auch wieder abgewählt werden, was seltsam anmutet, da er<br />
auch stellvertretender Kommissionspräsident ist. Als solcher unterliegt<br />
er den Bestimmungen eines Kommissars, wobei er vom Kommissionspräsidenten<br />
zum Rücktritt aufgefordert werden kann. Die Verfassungspraxis<br />
wird zeigen, ob er sich mehr dem Europäischen Rat oder mehr<br />
der Kommission verpflichtet fühlt.<br />
Der Europäische Gerichtshof – ein wachsames Auge über der EU?<br />
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist gemäß Artikel 29 Absatz 3<br />
zuständig für alle in der Verfassung vorgesehenen Gegenstände. Klageberechtigt<br />
sind die Mitgliedstaaten, die Organe der EU sowie juristische<br />
124 Meßmer
Der institutionelle Rahmen<br />
Artikel 19<br />
oder natürliche Personen gemäß den Bestimmungen des Teil III der Verfassung.<br />
Der EuGH war und ist allein zuständig für die Auslegung der<br />
Verfassung. Die Richter werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten<br />
im gegenseitigen Einvernehmen gewählt. Dadurch besteht zwar eine<br />
gewisse Abhängigkeit des EuGHs (Judikative) vom Europäischem Rat<br />
(Exekutive), dies ist jedoch beispielsweise in Deutschland nicht anders.<br />
Gewaltenteilung als überholtes Modell?<br />
Die Analyse zeigt eindeutig, dass in Europa keine klare Trennung der<br />
Gewalten auf horizontaler Ebene besteht. Die legislative Gewalt liegt in<br />
den Händen von Europäischem Parlament und Ministerrat, die exekutive<br />
Gewalt in den Händen von Kommission und Europäischem Rat.<br />
Problematisch ist vor allem die Tatsache, dass der Ministerrat sowohl<br />
Legislative als auch Exekutive in sich vereinigt. Es stellt sich aber die<br />
Frage, ob der Grundsatz der strikten Gewaltenteilung nicht vielleicht<br />
ein überholtes Modell und besonders in der EU nicht praktikabel ist.<br />
Doch wo bleibt dann die Begrenzung von Macht durch gegenseitige<br />
Hemmung und Kontrolle?<br />
Auch auf Staatenebene lässt sich eine zunehmende Verflechtung von<br />
Exekutive und Legislative beobachten. Doch gilt die Gewaltenteilung<br />
im Allgemeinen als gewahrt, wenn jede der Gewalten über einen Kernbereich<br />
verfügt, der nicht angetastet werden darf. 8 Damit stellt sich nach<br />
bisheriger Analyse die Frage, ob solch ein klar definierter Kernbereich<br />
an horizontalen Kompetenzen in der EU existieren kann.<br />
Bislang greifen die unterschiedlichen Institutionen in ihrer Arbeit zu<br />
sehr ineinander, wobei vor allem die Mitgliedstaaten über die Räte<br />
einen großen Einfluss sowohl auf die Legislative als auch auf die Exekutive<br />
haben. Damit werden vor allem die Kernbereiche der Kommission<br />
und des Parlaments angetastet. Die Exekutivfunktion der Kommission<br />
wird durch die starke Richtlinienkompetenz des Europäischen Rats<br />
eingeschränkt. Auch verfügt sie nicht in allen Bereichen über das Initiativrecht.<br />
Das Europäische Parlament besitzt nicht in allen Politikfeldern<br />
Mitspracherecht, was dazu führt, dass es als die eigentliche „Bürgerkammer“<br />
nicht über volle legislative Kompetenzen verfügt und damit<br />
nicht in allen Belangen Entscheidungsbefugnis besitzt. Problematisch<br />
ist außerdem, dass der Ministerrat als „Staatenkammer“ wiederum über<br />
8<br />
Vgl. Avenarius 2001, 46.<br />
Meßmer 125
Artikel 19<br />
Der institutionelle Rahmen<br />
die selbst verfassten Gesetze auch gleichzeitig bestimmen kann, indem<br />
er neben legislativen auch exekutive Kompetenzen besitzt.<br />
Wie die Analyse zeigt, sind die Veränderungen im Rahmen des Verfassungsprozesses<br />
lediglich ein erster Schritt in Richtung Föderalismus<br />
und klarer Gewaltenteilung im Sinne von Montesquieu, Madison und<br />
deren Nachfolgern. Die Vision eines föderalen Europa wird jedoch erst<br />
dann Realität, wenn die Kommission zur Europäischen Regierung<br />
geworden ist, das Europäische Parlament in Form einer ,ersten Parlamentskammer’<br />
volle parlamentarische Rechte wahrnimmt, der Ministerrat<br />
in einer ,zweiten Parlamentskammer’ aufgeht, um dort die Interessen<br />
der Mitgliedstaaten zu wahren, und der Europäische Rat nur noch repräsentative<br />
Funktionen wahrnimmt. Erst wenn Gewaltenteilung und<br />
Transparenz es ermöglichen, dass unbequeme Entscheidungen nicht<br />
mehr nach Brüssel weggeschoben werden, können die in Europa Entscheidungen<br />
treffenden Politiker klar ausgemacht und vom Bürger zur<br />
Verantwortung gezogen werden.<br />
Literatur: Avenarius, Hermann (2001): Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland –<br />
Eine Einführung – Bonn. Duhamel, Olivier et al. (2003): CONV 813/03, unter: http://register.<br />
consilium.eu.int/pdf/de/03/cv00/cv00813de03.pdf (20.06.2005). Fischer, Joschka (2002): Rede<br />
vor dem Deutschen Bundestag vom 22. Februar 2002. Madison, James (1788): Separation of<br />
Powers, in: Federalist, Nr. 51, S. 347–353. Meyer, Jürgen (2003): Der Brüssler Konvent und<br />
die zukünftige Verfassung der Europäischen Union – Zur Rolle der Regionen in Europa und weiteren<br />
Schwerpunkten der Konventsarbeit, unter: http://www.uni-magdeburg.de/eurostud/dokumente/rvl/meyer.pdf<br />
(20.06.2005). Nicolaysen, Gert (1999): Europa als Rechtsgemeinschaft,<br />
in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Europa-Handbuch – Bonn, S. 348–360. Scholl, Bruno (2003):<br />
Wie tragfähig ist die neue institutionelle Architektur der EU – Der Verfassungsentwurf des Konvents<br />
im Spiegel nationalstaatlicher Präferenzen, in: Integration, H. 3, S. 204–217. Weidenfeld,<br />
Werner (Hrsg.) (1999): Europa-Handbuch – Bonn. Rudzio, Wolfgang (1999): Das politische<br />
System der Bundesrepublik Deutschland – Bonn.<br />
126 Meßmer
Der institutionelle Rahmen<br />
Artikel 19<br />
Der institutionelle Rahmen der EU<br />
- vereinfachtes Modell -<br />
ORGANE DER EU<br />
Gerichtshof der EU <br />
Kontrolle der Anwendung und Auslegung von EU-Recht<br />
Europäische<br />
Kommission<br />
Kommissionspräsident<br />
ist Mitglied<br />
Präsident des Europäischen Rates<br />
leitet<br />
Außenminister<br />
<br />
ernennt<br />
nimmt teil<br />
Europäischer Rat<br />
wählt<br />
auf<br />
2 1/2<br />
Jahre<br />
schlägt Programme und Richtlinien<br />
vor, überwacht Umsetzung<br />
der Verfassung<br />
nimmt<br />
teil<br />
Gesetzesvorschläge<br />
bestimmt Leitlinien der EU-Politik<br />
Ministerrat<br />
wählt alle<br />
5 Jahre und<br />
kontrolliert<br />
Gesetzesvorschläge<br />
Europäisches<br />
Parlament<br />
setzt Recht für Staaten und<br />
Bürger<br />
<br />
EU-Gesetze<br />
EU-Haushalt<br />
setzt Recht für Staaten und Bürger<br />
entsenden<br />
Minister<br />
entsenden<br />
Staats- und<br />
Regierungschefs<br />
wählen<br />
alle 5<br />
Jahre<br />
Bürgerinitiative<br />
mind. 1 Mio.<br />
Unterstützer<br />
Grafik von<br />
Ann-Kathrin Fischer<br />
kontrollieren<br />
wählen<br />
Regierungen der Mitgliedstaaten<br />
Parlamente der Mitgliedstaaten<br />
Bürgerinnen und Bürger<br />
aus den EU-Mitgliedstaaten<br />
127
Artikel Marc Schreiner 20<br />
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 20<br />
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT<br />
Artikel 20: Das Europäische Parlament<br />
In Absatz 1 wird festgelegt, dass das Europäische Parlament (EP) gemeinsam<br />
mit dem Ministerrat der Gesetzgeber der Europäischen Union ist und in Zusammenarbeit<br />
mit diesem die Haushaltsbefugnisse ausübt. Daneben nimmt es Aufgaben<br />
der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen war. Letztere gelten<br />
nach Maßgabe der Verfassung, was bedeutet, dass diese Vorschrift im Zusammenhang<br />
mit den so genannten Ermächtigungsnormen, die über alle Teile der<br />
Verfassung verstreut sind, gelesen werden muss.<br />
Des Weiteren hat das Europäische Parlament die Aufgabe, den Präsidenten der<br />
Europäischen Kommission zu wählen. Das genaue Verfahren, welches hierfür<br />
einzuhalten ist, wird in Artikel 27 der Verfassung erläutert. 1<br />
Nach Absatz 2 besteht das Parlament aus höchstens 750 Mitgliedern. Dabei wird<br />
festgelegt, dass jeder Mitgliedstaat mit mindestens sechs, maximal mit 96 Mitgliedern<br />
vertreten ist, wobei die Zahl der Abgeordneten pro Mitgliedstaat bei steigender<br />
Einwohnerzahl immer geringfügiger erhöht wird. Im zweiten Abschnitt<br />
des zweiten Absatzes wird dem Parlament der Auftrag erteilt, seine Zusammensetzung<br />
nach den oben beschriebenen Grundsätzen per Beschluss neu zu regeln.<br />
Das Europäische Parlament unterbreitet dem Europäischen Rat dazu einen entsprechenden<br />
Vorschlag, über den der Europäische Rat einstimmig entscheidet.<br />
In Absatz 3 werden die Wahlrechtsgrundsätze festgelegt, wonach die Mitglieder<br />
des Europäischen Parlaments von den Unionsbürgern in allgemeinen,<br />
freien und geheimen Wahlen alle fünf Jahre unmittelbar gewählt werden.<br />
In Absatz 4 erhält das Europäische Parlament eine gewisse Autonomie hinsichtlich<br />
seiner Selbstorganisation. Danach darf es seinen Präsidenten nebst Präsidium<br />
aus den eigenen Reihen wählen. Das einzuhaltende Verfahren ergibt sich<br />
aus der Geschäftsordnung, welche sich das Europäische Parlament selbst gibt.<br />
Demokratischer Goliath ohne Keule<br />
Eine besondere Stellung für das Europäische Parlament<br />
im Institutionengefüge?<br />
Die zentrale Vorschrift über das Europäische Parlament, Artikel 20,<br />
steht an erster Stelle des Titels der Europäischen Verfassung, der den<br />
1<br />
Vgl. hierzu den Text von Julia Strese in diesem Band.<br />
128 Schreiner
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 20<br />
institutionellen Rahmen der EU regelt. 2 Damit wird die besondere<br />
Bedeutung des Parlamentes im europäischen Institutionengefüge betont.<br />
Sie ist Anerkennung einer einzigartigen Entwicklung des EP von der in<br />
den Gründungsverträgen vorgesehenen Versammlung von Repräsentanten<br />
der Parlamente der Mitgliedstaaten hin zu einem vollwertigen<br />
Parlament, welches im Laufe dieser Entwicklung einen kontinuierlichen<br />
Zuwachs an Mitwirkungs- und Kontrollbefugnissen verzeichnen konnte.<br />
Stellung und Funktion des Europäischen Parlaments unterliegen allerdings<br />
den Besonderheiten einer supranationalen Gemeinschaft wie der<br />
EU und können daher nicht uneingeschränkt mit denen nationaler Parlamente<br />
verglichen werden. Vor diesem Hintergrund kann man das<br />
Europäische Parlament trotz seiner vermeintlichen Defizite gegenüber<br />
der Kompetenz mancher nationalen Parlamente als dasjenige EU-Organ<br />
bezeichnen, dessen Stellung durch die Verfassung gegenüber den anderen<br />
Hauptorganen Ministerrat und Kommission am stärksten ausgebaut<br />
wurde.<br />
Das Europäische Parlament als Gesetzgeber<br />
Als parlamentarische Kammer ist das Europäische Parlament an der<br />
europäischen Gesetzgebung beteiligt. Der Umfang seiner Beteiligung<br />
bestimmt sich nach den einzelnen Verfahrensvorschriften. Das Verfahren,<br />
welches bei der stärksten Form der Beteiligung, dem so genannten<br />
Mitentscheidungsverfahren, einzuhalten ist, findet sich in Artikel 302<br />
der Verfassung. Danach kann das Europäischen Parlament gleichberechtigt<br />
mit dem Ministerrat einen Rechtsakt erlassen. 3 Schwächere Beteiligungsformen<br />
sind die der Zustimmung und die der Anhörung. 4<br />
Wann das Europäische Parlament in welcher Form beteiligt werden<br />
muss, ergibt sich aus den einzelnen Kompetenzvorschriften, die die<br />
Gemeinschaftsorgane zum Handeln ermächtigen. In der Verfassung ist<br />
die Zahl der Anwendungsfälle des Mitentscheidungsverfahrens im Vergleich<br />
zum Vertrag von Nizza weiter ausgedehnt worden. Die Rechtsgrundlagen,<br />
welche die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens<br />
2<br />
Weitere Vorschriften, die die Stellung und Aufgaben sowie die Befugnisse des EP regeln, sind<br />
im gesamten Text der Europäischen Verfassung – insbesondere in den Artikeln 330 ff. – zu finden<br />
und ergeben sich darüber hinaus auch aus interinstitutionellen Vereinbarungen.<br />
3<br />
Vgl. auch Artikel 251 EG-Vertrag sowie den Text von Stefan Evers in diesem Band.<br />
4<br />
Vgl. z.B. Artikel 171 Absatz 2 und Artikel 167 Absatz 3.<br />
Schreiner 129
Artikel 20<br />
Das Europäische Parlament<br />
anordnen, sind sogar zahlenmäßig verdoppelt worden. Das Verfahren<br />
findet danach auf rund 95 % der europäischen Gesetzgebung Anwendung.<br />
Dabei werden auch finanzwirksame Bereiche wie Regional- und<br />
Agrarpolitik erfasst. Neu ist beispielsweise auch der Katastrophenschutz<br />
gemäß Artikel 284.<br />
Diese Kompetenzausweitung korrespondiert mit dem Entschluss, Politikbereiche,<br />
die im Ministerrat bisher einstimmig entschieden wurden, nun<br />
mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden. So besteht nun zunehmend die<br />
Möglichkeit, dass einzelne Mitgliedstaaten bei Mehrheitsentscheidungen<br />
im Ministerrat überstimmt werden, was die Handlungsfähigkeit der<br />
Union erhöht. Dem dabei entstehenden Legitimationsdefizit beugt man<br />
durch eine extensive Beteiligung des Parlamentes vor. So wird das EP in<br />
fast allen Politikbereichen beteiligt, zumeist durch das Instrument des<br />
Mitentscheidungsverfahrens. Andernfalls kann das EP zumindest eine<br />
Stellungnahme abgeben. Durch die Beteiligung des EP an den Rechtsetzungsakten<br />
wird diesen, je nach Intensität der Beteiligung, ein gewisses<br />
Maß an direkter demokratischer Legitimation auf europäischer Ebene<br />
vermittelt. Diese ergänzt die von den Regierungen der Mitgliedstaaten im<br />
Ministerrat mittelbar vermittelte demokratische Legitimation.<br />
Ein eigenes Initiativrecht für die Rechtsetzung hat das Europäische Parlament<br />
nicht. Gemäß Artikel 332 kann es aber die Kommission auffordern,<br />
geeignete Vorschläge für Rechtsetzungsakte zu unterbreiten<br />
(„mittelbares Initiativrecht“). Lehnt die Kommission dies mit einer<br />
begründeten Stellungnahme ab, sind die Möglichkeiten des EP erschöpft,<br />
denn auch eine klageweise Durchsetzung der Aufforderung vor dem<br />
Europäischen Gerichtshof (EuGH) steht dem Parlament nicht zu.<br />
Weitere Möglichkeiten, Recht zu setzen, hat das Europäische Parlament<br />
in Angelegenheiten der Selbstorganisation, wie zum Beispiel bei seiner<br />
Geschäftsordnung. Außerdem ist es am Abschluss von Verträgen der EU<br />
mit Drittstaaten und internationalen Organisationen beteiligt. 5<br />
Kontrolle und Beratung durch das Europäische Parlament<br />
Das Europäische Parlament verfügt über eine Vielzahl von Kontrollmöglichkeiten,<br />
die in ihrer Ausgestaltung wie auch in ihrer Wirkung<br />
unterschiedlich ausfallen. Kontrolle kann nur derjenige ausüben, der<br />
Zugang zu allen wichtigen Informationen hat. Deshalb besitzt das Euro-<br />
5<br />
Siehe hierzu z.B. Artikel 325.<br />
130 Schreiner
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 20<br />
päische Parlament ein umfassendes Informationsrecht. Zu diesem<br />
Zweck kann es Untersuchungsausschüsse einsetzen 6 sowie Fragestunden<br />
und aktuelle Aussprachen im Plenum durchführen. Daneben wird es<br />
auch im Rahmen von Petitionen, die Bürger der Mitgliedstaaten gemäß<br />
Artikel 334 an das EP richten können, mit wichtigen Informationen versorgt.<br />
7 Mit der in der Europäischen Verfassung geregelten Öffentlichkeit<br />
der Sitzungen des Ministerrates wird es dem Parlament zudem leichter<br />
gemacht, sich auch im Ministerrat, wo bisher eher nach den Prinzipien<br />
der Geheimdiplomatie verhandelt wurde, Klarheit über Positionen und<br />
Verhandlungsgrundlagen zu verschaffen. Das Informationsrecht des<br />
Europäischen Parlaments wird darüber hinaus durch Berichtspflichten<br />
der anderen Organe ergänzt. 8<br />
Eine andere Gattung von Kontrollmöglichkeit, da sie rechtliche Wirkungen<br />
nach sich ziehen kann, ist das Misstrauensvotum gegen die Kommission,<br />
welches zugleich die schärfste Form der Kontrolle ist. 9 Dabei hat<br />
das EP ja auch bei der Wahl des Präsidenten der Kommission bereits Kontrolle<br />
über die Besetzung dieses zentralen Amtes. Das Verfahren dieser<br />
Wahl bestimmt sich nach Artikel 27 Absatz 1. Neu ist durch die Verfassung,<br />
dass die Kandidatenauswahl für dieses Amt den politischen Mehrheiten<br />
im Parlament entsprechen soll. 10 Das Besetzungsrecht des EP –<br />
allein oder zusammen mit anderen Organen der EU – erstreckt sich darüber<br />
hinaus noch auf eine ganze Reihe weiterer Schlüsselpositionen. 11<br />
Wichtig sind auch die Kontrollmöglichkeiten, die dem Europäischen Parlament<br />
im Zusammenhang mit dem Haushalt der EU zustehen. So wirkt<br />
es gleichberechtigt mit dem Ministerrat an der Aufstellung des Haushaltes<br />
mit, während ihm die alleinige Entscheidung über die Haushaltsentlastung<br />
zusteht. Weitere Mittel der Kontrolle nach Maßgabe der Verfassung<br />
sind die dem Europäischen Parlament zuerkannten Klagerechte vor dem<br />
EuGH. Hier ist das Europäische Parlament in einer Vielzahl von Fällen<br />
originär klagebefugt. Das bedeutet, es kann auch dann klagen, wenn keine<br />
eigenen Rechte betroffen sind, und kann so die Missachtung, Verletzung<br />
6<br />
Gemäß Artikel 333.<br />
7<br />
Vgl. Guckelsberger 2004.<br />
8<br />
Z.B. gemäß Artikel 335 für den Europäischen Bürgerbeauftragten und Artikel 352 für die<br />
Europäische Kommission.<br />
9<br />
Zu dem Verfahren siehe insbesondere Artikel 340.<br />
10<br />
Siehe hierzu den Text von Julia Strese in diesem Band.<br />
11<br />
Z.B. der Europäische Bürgerbeauftragte gemäß Artikel 335 und die Mitglieder des Europäischen<br />
Rechnungshofes.<br />
Schreiner 131
Artikel 20<br />
Das Europäische Parlament<br />
oder Überschreitung europäischen Rechts durch Gemeinschaftsorgane<br />
oder Mitgliedstaaten rügen.<br />
Seine Beratungsbefugnisse, das heißt, mit der Mehrheit seiner Mitglieder<br />
einen einheitlichen Willen zu fassen und diesen zu äußern 12 , kann<br />
das Europäische Parlament dort ausüben, wo Interessen der Union<br />
betroffen sind. Regelmäßig wird es dann Stellungnahmen, Entschließungen<br />
oder Initiativberichte verfassen. Diese sind zwar nicht rechtsverbindlich,<br />
ihre politische Wirkung ist jedoch nicht zu unterschätzen.<br />
Artikel 20 Absatz 1 bietet dem Europäischen Parlament somit eine Fülle<br />
von Möglichkeiten, am legislativen Leben der Union teilzunehmen oder<br />
es gar zu bestimmen. Durch die Ausweitung der Mitentscheidungsverfahren<br />
auf noch mehr Politikbereiche ist man im Konvent der Forderung<br />
von Laeken dahingehend zum Teil nachgekommen, ein „Mehr“ an<br />
demokratischer Legitimation zu ermöglichen. 13 Dazu war man aber im<br />
Hinblick auf die Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Mehrheitsentscheidung<br />
im Ministerrat auch gezwungen. Trotzdem wird deutlich,<br />
dass man dem Europäischen Parlament allein diese legitimierende Leistung<br />
nicht zutraut und hat die nationalen Parlamente zu Hilfe gerufen.<br />
Diese werden mit eingeschränkten Informations- und Beratungsrechten<br />
am Gesetzgebungsverfahren als zusätzliche Akteure beteiligt werden. 14<br />
Sollten sie diese Chance umfassend wahrnehmen, steht nun zu befürchten,<br />
dass sich die Rolle des EP als Volksvertretung der Unionsbürger<br />
relativiert und es seinen Rang von nationalen Parlamenten abgelaufen<br />
bekommt. Da scheinen Konflikte zwischen den Parlamenten vorprogrammiert!<br />
Der Katalog der Kontroll- und Beratungsformen wenigstens ist umfangreich.<br />
Was hier besonders hervorzuheben ist, ist die Möglichkeit eines<br />
Misstrauensvotums gegen die Kommission. Zu beklagen ist in diesem<br />
Zusammenhang, dass nur die Kommission in ihrer Gesamtheit aus dem<br />
Amt gehoben werden kann. Dass man mit Hilfe eines Vertrauensantrages<br />
einzelne Kommissare entsprechend ihrer persönlichen Verfehlung<br />
des Amtes entheben könnte, wäre wünschenswert gewesen. Die Enthe-<br />
12<br />
Definition nach EuGH, Rs. C-230/ 81, Slg. 1983, 255 (287), Rn 39.<br />
13<br />
Siehe hierzu die so genannte Erklärung von Laeken (Europäischer Rat 2001), unter II.: Mehr<br />
Demokratie, Transparenz und Effizienz in der Europäischen Union.<br />
14<br />
Siehe hierzu das Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen<br />
Union. Danach lassen sich Unterrichtungsrechte (I.1 und 2) und das Recht, eine eigene Stellungnahme<br />
abzugeben (I.3) unterscheiden.<br />
132 Schreiner
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 20<br />
bung eines ganzen Kommissionskollegiums ist politisch gesehen eine<br />
ultima ratio, die das Europäische Parlament in seiner Laufbahn nur erst<br />
einmal erfolgreich durchgesetzt hat. 15<br />
Die Zahl der Abgeordneten und die „degressive Proportionalität“<br />
Die mit Verfassungsrang vorgesehene Begrenzung der Zahl der Abgeordneten<br />
auf 750 bedingt die Anwendung des Grundsatzes der degressiven<br />
Proportionalität. Dies führt zum Beispiel dazu, dass Deutschland<br />
trotz seiner rund 80 Millionen Einwohner lediglich auf 96 Abgeordnete<br />
kommt, während Luxemburg mit ca. 400 000 Einwohnern immerhin<br />
sechs Abgeordnete zählen kann. Würde man für die deutschen Abgeordneten<br />
die gleiche Zahl an notwendigen Stimmen pro Abgeordnetem wie<br />
in Luxemburg fordern, so müsste Deutschland rund 1.200 Mitglieder im<br />
Europäischen Parlament stellen dürfen. Dank der degressiven Proportionalität<br />
wird aber noch kein Zehntel erreicht. Das klingt ungerecht, ist<br />
aber politisch plausibel, wenn man bedenkt, dass die Idee der in Europa<br />
vereinigten Völker sich eben nur durch diese auf den ersten Blick ungerecht<br />
erscheinende Regelung herstellen lässt. Welche Motivation sollten<br />
denn kleine Mitgliedstaaten sonst haben, an einer Union mitzuwirken,<br />
die ihnen überhaupt kein politisches Gewicht in dieser Vereinigung<br />
belässt? 16<br />
Mit der Zahl 750 dürfte nunmehr auch eine Grenze erreicht sein, deren<br />
Überschreiten die Effektivität des EP besonders gefährden dürfte.<br />
Bereits im Vorfeld der Regierungskonferenzen von Amsterdam (1996)<br />
und Nizza (2000) hatten die Europaparlamentarier die Forderung erhoben,<br />
die Zahl der Abgeordneten zu begrenzen. 17 Denn bereits damals<br />
wurde mit Sorge auf die Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments<br />
hingewiesen. Auch die ersten Konventsentwürfe sahen eine<br />
Beschränkung auf 736 vor. Erst auf dem Europäischen Gipfel im Oktober<br />
2004 in Brüssel einigte man sich auf die abschließende Zahl von<br />
sagenhaften 750 Mitgliedern des Europäischen Parlaments. In der<br />
Erkenntnis, dass vor dem Hintergrund der somit schier ins Gigantische<br />
15<br />
Von den bisher neun Versuchen war man lediglich im Fall der Kommission unter Präsident Jacques<br />
Santer im März 1999 erfolgreich.<br />
16<br />
Nach dem Bundesverfassungsgericht entspricht dieser Verteilungsschlüssel dem Charakter der<br />
EU als einem Verband souveräner Staaten. Er verstößt nicht gegen den Grundsatz der Gleichheit<br />
der Wahl. Vgl. BVerfG, NJW 1995, S. 2210.<br />
17<br />
Während man sich im Vertrag von Amsterdam auf 700 Abgeordnete einigen konnte, waren es<br />
in Nizza bereits 732 Mandatsträger!<br />
Schreiner 133
Artikel 20<br />
Das Europäische Parlament<br />
steigenden Zahl der Abgeordneten im EP schon bald wieder eine neue<br />
Lösung herbeigeführt werden muss, hat man in Artikel 20 Absatz 2<br />
gleich den Auftrag eingefügt, dieses Problem zu lösen. Schade nur, dass<br />
man nicht bereits jetzt den Mut zu einer endgültigen Lösung hatte und<br />
diese in die Hände der nächsten Politikergeneration legt. Dass man darüber<br />
hinaus den Europäischen Rat an dem Verfahren beteiligt, der sogar<br />
einstimmig darüber zu entscheiden hat, zeigt nur zu deutlich, dass sich<br />
die Mitgliedstaaten auch im Konvent und auf dem abschließenden Europäischen<br />
Gipfel mit ihren Ängsten, zu viele Mandate im Europäischen<br />
Parlament zu verlieren, durchsetzen konnten.<br />
Wahlrechtsgrundsätze<br />
Artikel 20 Absatz 3 enthält die Wahlrechtsgrundsätze der Allgemeinheit,<br />
der Freiheit und der Unmittelbarkeit. Außerdem wird die Wahl in<br />
geheimer Abstimmung durchgeführt. Daneben hat man zur Regelung<br />
des Wahlverfahrens bereits 1976 einen Direktwahlakt eingeführt. 18<br />
Unter anderem ermächtigt dieser die Mitgliedstaaten, bis zum Erlass<br />
einer Regelung über ein einheitliches Wahlverfahren dieses durch innerstaatliche<br />
Vorschriften zu regeln. Die auf dieser Grundlage erlassenen<br />
Regelungen weichen zum Teil aber erheblich voneinander ab (unterschiedliche<br />
Wahlsysteme, Bestehen einer Wahlpflicht, Sperrklauseln,<br />
die Bedingungen zur Wahlzulassung). 19 Von einer Gleichheit der Wahl<br />
kann also keine Rede sein und bei der Lektüre des Absatzes 3 fällt<br />
zudem auf, dass sie auch nach wie vor nicht angestrebt wird. Dem steht<br />
(bei institutionellen Fragen in der EU wohl dauerhaft) entgegen, dass<br />
ein Kompromiss zwischen den Prinzipien der Gleichheit der Mitgliedstaaten<br />
und ihrem Gewicht nach der Bevölkerungszahl erreicht werden<br />
muss.<br />
Die interne Organisation des Europäischen Parlaments<br />
Die in Absatz 4 vorgesehene Regelung, dass das Europäische Parlament<br />
seinen Präsidenten aus der Mitte seiner Mitglieder wählt, führt in der<br />
Praxis dazu, dass sich die beiden größten Fraktionen (die Konservativen<br />
und die Sozialisten) über das Amt einigen. Jeweils für die Hälfte einer<br />
Legislaturperiode ist danach jeweils ein Mitglied dieser Fraktionen Präsident.<br />
18<br />
ABL. EG 1976 Nr. L 287/ 1 = BGBl. II 1977, S. 733.<br />
19<br />
Eine ausführliche Übersicht findet sich in Haag/Bieber 1997, Artikel 138, Rn 41 ff.<br />
134 Schreiner
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 20<br />
Das Präsidium besteht gemäß Artikel 21 der Geschäftsordnung des<br />
Europäischen Parlaments aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten<br />
sowie den Quästoren, die Aufgaben der Verwaltung wahrnehmen. Zur<br />
Zusammensetzung des Parlamentes im Einzelnen sagt die Europäische<br />
Verfassung sonst nichts aus. Die Rolle der Fraktionen sowie das Profil<br />
der einzelnen Abgeordneten regelt die Geschäftsordnung des Europäischen<br />
Parlaments. Danach können sich die Parlamentarier in Fraktionen<br />
zusammenschließen. Gegenwärtig gibt es im Europäischen Parlament<br />
sieben Fraktionen (sowie einige fraktionslose Abgeordnete), die die<br />
gesamte politische Bandbreite von konservativ bis sozialistisch abdecken.<br />
Die Fraktionen sind Länder übergreifend, weshalb es zum Beispiel<br />
keine deutsche Fraktion gibt. Oft bilden sich aber innerhalb der Fraktionen<br />
nationale Gruppen. Der einzelne Abgeordnete ist regelmäßig<br />
ordentliches Mitglied in einem Parlamentsausschuss und stellvertretendes<br />
Mitglied in einem weiteren. Wegen der großen Zahl von Abgeordneten<br />
wird es hier in Zukunft wohl zu Verteilungskämpfen um die Mitgliedschaft<br />
in einzelnen besonders beliebten Ausschüssen kommen. Im<br />
Rahmen der Ausschussarbeit kann der Abgeordnete für ein bestimmtes<br />
Gesetzesvorhaben als Berichterstatter ernannt werden. In dieser Eigenschaft<br />
holt er Expertenrat ein, erarbeitet Änderungsanträge, organisiert<br />
Mehrheiten und kommuniziert mit den anderen beteiligten europäischen<br />
Organen. Darüber hinaus hat der Abgeordnete zahlreiche repräsentative<br />
Aufgaben in Brüssel, Straßburg und in seinem jeweiligen Wahlkreis zu<br />
erfüllen. Dies führt zu einer intensiven Reisetätigkeit.<br />
Literatur: Europäischer Rat (2001): Erklärung von Laeken vom 15.12.2001, unter:<br />
http://europa.eu.int/futurum/documents/offtext/doc151201_de.htm (20.06.2005). Groeben,<br />
Hans von der/Thiesing, Jochen/Ehlermann, Claus-Dieter (Hrsg.): Kommentar zum EU-/EG-Vertrag,<br />
Band 4, Art. 137 - 209a EGV, 5. Aufl. – Baden-Baden. Guckelsberger, Annette (2004):<br />
Der Europäische Bürgerbeauftragte und die Petitionen zum Europäischen Parlament – Berlin.<br />
Haag, Roland/Bieber, Marcel (1997): Artikel 138, in: Groeben, Hans von der/Thiesing, Jochen/<br />
Ehlermann, Claus-Dieter (Hrsg.): Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Band 4, Art. 137–209a<br />
EGV, 5. Aufl. – Baden-Baden.<br />
Weiterführende Literatur: Callies, Christian/Ruffert, Matthias (Hrsg.) (2002): Kommentar<br />
zum EUV und EGV, 2. Auflage – Neuwied. Lenz, Carl-Otto (Hrsg.) (1999): Kommentar zum<br />
EG-Vertrag, 2. Auflage – Köln. Suski, Birgit (1996): Das Europäische Parlament – Volksvertretung<br />
ohne Volk und Macht? – Berlin. Wuermeling, Joachim (2004): Mehr Kraft zum Konflikt<br />
– Sieben Anmerkungen zur Zukunft des Europäischen Parlamentes nach dem Verfassungsvertrag,<br />
in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, Jg. 31, S. 559 ff.<br />
Weitere Informationen zum Europäischen Parlament unter http://europarl.eu.int.<br />
Schreiner 135
Jan Kreutz<br />
Das Europäische Parlament<br />
Artikel 21, 22<br />
DER EUROPÄISCHE RAT<br />
Artikel 21: Der Europäische Rat<br />
Der Europäische Rat (ER) ist eines von fünf Organen der EU, die den institutionellen<br />
Rahmen der Union bilden. Er legt die politischen Prioritäten und Ziele<br />
der EU fest, wird dabei aber nicht gesetzgeberisch tätig. Bestehend aus den<br />
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dem Präsidenten des Europäischen<br />
Rates und dem Präsidenten der Kommission, tagt der Europäische Rat<br />
mindestens viermal im Jahr. Seine Entscheidungen werden, abgesehen von sehr<br />
wenigen Ausnahmen, im Konsens gefällt.<br />
Artikel 22: Der Präsident des Europäischen Rates<br />
Der Präsident des Europäischen Rates wird durch die qualifizierte Mehrheit<br />
seiner Mitglieder gewählt. Die qualifizierte Mehrheit erfordert die Zustimmung<br />
von mindestens 15 Mitgliedern des ER, die zusammen 65 % der Bevölkerung<br />
repräsentieren müssen. 1 Auf dieselbe Weise kann der Präsident bei schwerwiegenden<br />
Verfehlungen von seinem Amt entbunden werden. Die Amtszeit beträgt<br />
zweieinhalb Jahre und kann einmal erneuert werden. Zum Präsidenten des<br />
Europäischen Rates dürfen nur Kandidaten gewählt werden, die nicht gleichzeitig<br />
ein Mandat in einem Mitgliedsland innehaben. Die Aufgabe des Präsidenten<br />
ist es, den Vorsitz des Europäischen Rates zu führen, Impulse zu setzen<br />
und den Zusammenhalt des ER sicherzustellen. Ferner ist er verpflichtet, dem<br />
Europäischen Parlament einen Bericht über die Sitzungen des ER vorzulegen.<br />
Darüber hinaus vertritt er die EU in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außenund<br />
Sicherheitspolitik, ohne dabei in die Tätigkeit des Außenministers der EU<br />
einzugreifen.<br />
Der Europäische Rat – Macht oder Ohnmacht der EU?<br />
Die Diskussion im Konvent<br />
Die Rolle des Europäischen Rates im zukünftigen Institutionengefüge<br />
der EU und die Frage, ob das Amt eines ständigen Präsidenten des ER<br />
eingerichtet werden soll, war ein wichtiger Streitpunkt im Konvent. Konträre<br />
Vorstellungen darüber, ob die Mitgliedstaaten, insbesondere die im<br />
Europäischen Rat vertretenen Staats- und Regierungschefs, oder Institu-<br />
1<br />
Vgl. Artikel 25.<br />
136 Kreutz
Der Europäische Rat<br />
Artikel 21, 22<br />
tionen wie das Europäische Parlament und die Europäische Kommission<br />
über politische Fragen der Union entscheiden sollen, zogen sich durch die<br />
Konventsdebatten und wurden insbesondere in der Diskussion über das<br />
Präsidentenamt des Europäischen Rates offenbar. Auf der einen Seite<br />
standen die so genannten „Föderalisten“ und „Integrationisten“, unter<br />
ihnen viele Vertreter kleiner EU-Mitgliedstaaten und Deutschlands. Sie<br />
forderten ein starkes Europäischen Parlament und eine starke Kommission,<br />
während sie dem Europäischen Rat nur eine schwache Rolle zugestanden.<br />
Mit der Schaffung eines hauptamtlichen Präsidenten des ER<br />
wurde von dieser Gruppe vor allem die Sorge verbunden, dass sich der<br />
Europäische Rat zu einem allmächtigen Gremium entwickeln könnte, das<br />
die supranationalen Organe schwächt. 2 Auf der anderen Seite gab es viele<br />
Regierungsvertreter und Konventsmitglieder aus eher europaskeptischen<br />
Ländern, die eine EU anstrebten, die vor allem auf Verhandlungen zwischen<br />
den mitgliedstaatlichen Regierungen aufbaut, der so genannten<br />
„intergouvernementalen Methode“. Sie sprachen sich für eine wesentliche<br />
Stärkung des Europäischen Rates und die Einführung eines starken<br />
Präsidenten aus. 3<br />
Der Aufstieg des Europäischen Rates<br />
Geschaffen wurde der Europäische Rat im Jahre 1974, unter anderem<br />
auf die Initiative von Valéry Giscard d’Estaing hin, der damals Staatspräsident<br />
Frankreichs war und in den Jahren 2002/2003 dem Verfassungskonvent<br />
vorsaß. 4 Der Europäische Rat sollte als Plattform für den<br />
Dialog dienen, durch den die Staats- und Regierungschefs ihre Differenzen<br />
gemeinsam ausräumen. Zum einen erwies sich der ER als das Gremium,<br />
das richtungsweisende Entscheidungen über Erweiterungsrunden<br />
sowie die zunehmende Integration der Union traf und die Leitlinien<br />
europäischer Politik festlegte. 5 Zum anderen agierte er auch als<br />
Streitschlichter: Wenn es in verschiedenen Ministerräten in bestimmten<br />
Fragen zu keiner Einigung kam, wurde das Problem an den ER weiterdelegiert.<br />
6<br />
2<br />
Für eine gute Darstellung der Position dieser Gruppe siehe Leinen 2002.<br />
3<br />
Zu den Debatten um den Europäischen Rat im Konvent siehe die Verbatim-Records zu den Sitzungen<br />
15.–16. sowie 30.–31. Mai und 11.–13. Juni 2003.<br />
4<br />
Vgl. Oppermann 1999, 125.<br />
5<br />
Vgl. Werts 1992, 56–75.<br />
6<br />
Vgl. Bulmer/Wessels 1987, 103–109.<br />
Kreutz 137
Artikel 21, 22<br />
Der Europäische Rat<br />
Allerdings war der Europäische Rat aufgrund seiner Arbeitsweise auch<br />
immer ein Zeichen für die Handlungsunfähigkeit der Union. Sämtliche<br />
Verhandlungen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und alle<br />
Entscheidungen mussten einstimmig getroffen werden. Dies führte zu<br />
mehr oder weniger ungenierten Erpressungsversuchen durch die verschiedenen<br />
Regierungen und es kam zu so genannten „package-deals“<br />
(Paketlösungen), in denen jeder Regierung einzelne Pfründe zugesichert<br />
wurden. 7 Auf das Wohl der Union als solche wurde bei diesen „deals“<br />
selten geachtet. Darüber hinaus wurden etliche europäische Initiativen<br />
im ER durch einzelne Mitgliedstaaten blockiert. Aufgrund dieser Arbeitsweise<br />
und dem meist sehr nationalen Denken hatte der Europäische<br />
Rat bereits in den 80er Jahren eine Routine des Scheiterns entwickelt,<br />
von der er sich auch in den 90er Jahren nicht verabschieden konnte. 8<br />
War der Europäische Rat zuerst als informelles Gremium gegründet<br />
worden, ist es mit dem Vertrag von Maastricht zu seiner Aufnahme in<br />
die Europäischen Verträge gekommen. Im Gegensatz zu anderen wichtigen<br />
Institutionen der EU besaß er allerdings nicht den Status eines EU-<br />
Organs, sondern tauchte nur im Abschnitt „Gemeinsame Bestimmungen“<br />
des EU-Vertrages auf. 9 Damit wurde er allerdings auch außerhalb<br />
der demokratischen „checks and balances“ des Europäischen Parlaments<br />
und des Europäischen Gerichtshofs angesiedelt. 10 Problematisch<br />
ist auch, dass der Europäische Rat in seinem Handeln und in seinen Entscheidungen<br />
keinen anderen europäischen Gremien gegenüber verantwortlich<br />
ist und Entscheidungen der Regierungsvertreter im Europäischen<br />
Rat auch von den Mitgliedstaaten kaum legitimiert sind. Die<br />
meisten Regierungsvertreter lassen sich im Vorfeld der ER-Sitzungen<br />
von ihren Parlamenten nicht auf eine bestimmte Position festlegen, da<br />
sie dann nicht flexibel in die Verhandlungen gehen könnten. Zwar sind<br />
die Regierungen in den meisten Mitgliedstaaten für Entscheidungen, die<br />
sie im Europäischen Rat getroffen haben, ihrem Parlament gegenüber<br />
rechenschaftspflichtig. Doch bisher ist es noch nicht dazu gekommen,<br />
dass Regierungschefs für falsche Entscheidungen im Europäischen Rat<br />
von ihren Parlamenten sanktioniert wurden, beispielsweise durch ihre<br />
Abwahl. Die Regierungschefs verfügen daher über eine sehr geringe<br />
7<br />
Vgl. Wessels 2002, 332.<br />
8<br />
Vgl. Weidenfeld 2002, 26 ff.<br />
9<br />
Vgl. Artikel 4 EU-Vertrag in der Fassung von Nizza.<br />
10<br />
Vgl. Wessels 2002, 331.<br />
138 Kreutz
Der Europäische Rat<br />
Artikel 21, 22<br />
demokratische Legitimation für ihre Entscheidungen im Europäischen<br />
Rat.<br />
Mit der Verfassung findet der Aufstieg des Europäischen Rates einen<br />
Höhepunkt: Vom informellen Gremium hat er sich zu einem vollwertigen<br />
EU-Organ entwickelt – in der Verfassung wird er hinter dem Europäischen<br />
Parlament als zweites Organ benannt – ohne dass dabei allerdings<br />
sein Legitimationsdefizit beseitigt worden wäre.<br />
Die Aufgaben des Europäischen Rates<br />
Laut der Verfassung hat der Europäische Rat nach wie vor sehr weitreichende<br />
Kompetenzen. Zwar wird in Artikel 21 erstmals ausdrücklich<br />
festgelegt, dass er „nicht gesetzgeberisch tätig“ wird; da er dieses Recht<br />
aber auch laut der bisherigen Verträge nicht hatte, stellt dies keine wirkliche<br />
Änderung dar. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die für die<br />
Weiterentwicklung der Union notwendigen Impulse zu geben und die<br />
dafür notwendigen Zielvorstellungen und Prioritäten festzulegen. 11<br />
Diese Macht, die Politikagenda der Union zu diktieren, ermöglicht es<br />
ihm allerdings, den Handlungsrahmen der legislativen Organe, also von<br />
Europäischem Parlament und Ministerrat, erheblich zu beschränken.<br />
Durch die Festschreibung von sehr eng formulierten Zielen und Prioritäten<br />
kann er viele legislative Entscheidungen im Vorhinein verhindern.<br />
Auch das Recht, spezielle Richtlinien für die Wirtschaftspolitik<br />
der Mitgliedstaaten zu beschließen und die strategischen Grundlinien<br />
für die legislative und operationelle Planung innerhalb des Raums der<br />
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu definieren 12 , gibt ihm weitere<br />
Möglichkeiten, die Arbeit des Parlaments und des Ministerrats zu<br />
beschränken.<br />
Darüber hinaus gibt die Verfassung dem Europäischen Rat die Kompetenz,<br />
Änderungen der inneren Struktur anderer Organe zu beschließen.<br />
Sie überlässt dem Europäischen Rat laut Artikel 24 die Entscheidung<br />
über die Modalitäten des Rotationsverfahrens des Vorsitzes der verschiedenen<br />
Ministerräte und das Einrichten neuer Ratsformationen.<br />
Auch die Details des Rotationsverfahrens, durch welche die gleichberechtigte<br />
Vertretung der Mitgliedstaaten gewährleistet wird, werden<br />
durch einen einstimmigen Beschluss des ER bestimmt. Darüber hinaus<br />
entscheidet der ER auch darüber mit, wie die Verteilung der Abgeordne-<br />
11<br />
Artikel 21.<br />
12<br />
Vgl. Artikel 179 und Artikel 258.<br />
Kreutz 139
Artikel 21, 22<br />
Der Europäische Rat<br />
ten des Europäischen Parlaments auf die einzelnen Mitgliedsländer<br />
nach dem Jahr 2009 aussehen wird. 13 Diese Möglichkeiten des ER, über<br />
die interne Zusammensetzung verschiedener Organe zu entscheiden,<br />
stellen ihn institutionell über die anderen Organe und statten ihn mit<br />
einer großen Machtfülle aus.<br />
Auch auf die Auswahl des zukünftigen Kommissionspräsidenten wird<br />
der ER einen großen Einfluss haben. Zwar wird dieser laut Artikel 27<br />
nicht mehr vom Europäischen Rat ernannt, sondern vom Europäischen<br />
Parlament gewählt. Nach wie vor hat der ER aber das Vorschlagsrecht<br />
für dieses Amt. Selbst wenn er gezwungen ist, seine Auswahl unter<br />
Berücksichtigung des Ergebnisses der Wahlen zum Europäischen Parlament<br />
zu treffen, muss er keineswegs den Wunschkandidaten des Europäischen<br />
Parlaments vorschlagen. Es bleibt abzuwarten, ob die europäischen<br />
Parteien ein eigenes Profil entwickeln können, so dass sie einen<br />
für das Europäische Parlament inakzeptablen Vorschlag des ER, der<br />
erwartungsgemäß von allen nationalen Regierungsparteien gestützt<br />
werden wird, tatsächlich ablehnen.<br />
Darüber hinaus kann der Europäische Rat mit einem Europäischen Beschluss<br />
– also ohne formelle Verfassungsänderungen – erzwingen, dass<br />
der Ministerrat in anderen als in der Verfassung vorgesehenen Politikbereichen<br />
mit qualifizierter Mehrheit anstatt einstimmig beschließt oder<br />
das Gesetzgebungsverfahren in diesen Bereichen angewandt wird. 14<br />
Gerade die heftigen Debatten im Konvent über die Ausweitung der qualifizierten<br />
Mehrheitsentscheidungen zeigen, welche Macht dem ER damit<br />
übertragen wurde. 15 Der ER kann gemeinsam mit dem Parlament auch die<br />
Verletzung der Werte der Union durch einen Mitgliedstaat feststellen, in<br />
diesem Fall bestimmte Rechte dieses Mitgliedstaates, einschließlich des<br />
Stimmrechts, aussetzen und mit „europamüden“ Mitgliedstaaten über die<br />
Modalitäten ihres Austrittes aus der Union verhandeln. 16 Ferner ist es<br />
auch der Europäische Rat, der darüber entscheidet, ob Verfassungsänderungen<br />
mit oder ohne die Einbeziehung eines Konvents vorbereitet werden.<br />
17 Entscheidend dabei ist, dass die Regierungskonferenz fast diesel-<br />
13<br />
Vgl. Artikel 20.<br />
14<br />
Artikel 40 und Artikel 444.<br />
15<br />
Zu den Debatten um die Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Konvent<br />
siehe die Verbatim-Records zu den Sitzungen 30.-31. Mai 2003, 11.-13. Juni 2003, 4. sowie<br />
9.–10. Juli 2003.<br />
16<br />
Vgl. Artikel 59 und 60.<br />
17<br />
Vgl. Artikel 443.<br />
140 Kreutz
Der Europäische Rat<br />
Artikel 21, 22<br />
be Zusammensetzung wie der ER hat, während die Regierungsvertreter<br />
im Konvent eine Minderheit darstellen. Es ist daher nicht anmaßend zu<br />
vermuten, dass der ER in vielen Fällen versuchen wird, das Einsetzen<br />
eines Konvents zu verhindern, um die Position seiner eigenen Mitglieder<br />
bei den anstehenden Verfassungsänderungen zu stärken.<br />
Weil sich weder die Konventsmitglieder noch die Regierungschefs bei der<br />
endgültigen Verabschiedung der Verfassung dazu durchringen konnten 18 ,<br />
die Außenpolitik der Europäischen Union stärker zu „vergemeinschaften“,<br />
wird der Europäische Rat auch in der Zukunft über eine weit reichende<br />
außenpolitische Kompetenz verfügen. Zwar wurde ein Europäischer<br />
Außenminister geschaffen, der als Vizepräsident der Kommission in dieser<br />
verankert ist. Da dieser aber nach Artikel 28 durch die Staats- und<br />
Regierungschefs gewählt und abgewählt wird, ist er erwartungsgemäß<br />
nur bedingt unabhängig von deren Entscheidungen. Darüber hinaus versäumt<br />
es die Verfassung, eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen<br />
dem Präsidenten des ER und dem Außenminister vorzunehmen.<br />
Während der Präsident des ER die Außenvertretung der Union wahrnimmt,<br />
leitet der Außenminister die Außenpolitik und führt sie durch. 19<br />
Überschneidungen der Zuständigkeiten sind daher vorprogrammiert.<br />
Die Natur des Europäischen Rates<br />
Da sich weder bei der Zusammensetzung noch bei der Arbeitsweise des<br />
Europäischen Rates Entscheidendes verändert hat, wird auch die Kritik<br />
dieselbe bleiben: Nach wie vor werden die Staats- und Regierungschefs<br />
hinter verschlossenen Türen tagen, und die meisten Entscheidungen werden<br />
im Konsens aller gefällt. 20 Dadurch wird es immer wieder zu Paketlösungen<br />
und zu Blockaden einzelner Regierungen kommen. Auch in der<br />
Zukunft wird der Europäische Rat dabei keinerlei demokratischer Kontrolle<br />
unterliegen. Zwar kann der Präsident des ER abgewählt werden,<br />
allerdings nur vom Europäischen Rat selbst, nicht vom Europäischen Parlament<br />
oder den Ministerräten. Die anderen Mitglieder des ER können<br />
auch bei schweren Verfehlungen nur innerhalb ihrer Mitgliedstaaten<br />
abgewählt werden. 21<br />
18<br />
Zu den Debatten um den Europäischen Rat im Konvent siehe die Verbatim-Records zu den Sitzungen<br />
15.-16. sowie 30.-31. Mai 2003, 11.-13. Juni 2003.<br />
19<br />
Vgl. Artikel 22 und Artikel 28.<br />
20<br />
Vgl. Artikel 21, 22 und 341.<br />
21<br />
Vgl. Artikel 22.<br />
Kreutz 141
Artikel 21, 22<br />
Der Europäische Rat<br />
Der Präsident des Europäischen Rates<br />
Nach heftigen Debatten über die Notwendigkeit eines hauptamtlichen<br />
Präsidenten des ER wurde dieses Amt trotz des Vorbehalts der Mehrheit<br />
der Konventsmitglieder geschaffen. Welche wirkliche Rolle dieser Präsident<br />
in der zukünftigen Union spielen wird, ist schwer vorauszusagen.<br />
Offiziell besteht seine Aufgabe lediglich darin, die vier jährlichen Sitzungen<br />
des Gremiums vorzubereiten und Impulse für sie zu geben, sie<br />
zu leiten und für die Kontinuität der Beratungen zu sorgen sowie den<br />
Zusammenhalt und die Konsensfähigkeit des Europäischen Rates zu<br />
ermöglichen. 22 Welche tatsächliche Macht er im Vergleich zu anderen<br />
Führungspersönlichkeiten entwickeln wird, bleibt pure Spekulation. Es<br />
steht allerdings zu befürchten, dass es auf der einen Seite zu einer Konkurrenz<br />
zwischen dem Präsidenten des ER und dem Kommissionspräsidenten<br />
um die ideologische und politische Führung der EU kommt, da<br />
beide Exekutivfunktionen wahrnehmen. Während der Europäische Rat die<br />
politischen Leitlinien und Ziele der Union festlegt, fördert die Kommission<br />
die allgemeinen Interessen der EU und ergreift die dafür notwendigen Initiativen.<br />
Als Kopf der EU-Exekutive können aus verschiedenen Perspektiven<br />
also beide Präsidenten betrachtet werden. Auf der anderen Seite wird es zu<br />
einer Konkurrenz zwischen dem Präsidenten des ER und dem EU-Außenminister<br />
kommen, da, wie oben gezeigt, die Verfassung deren außenpolitische<br />
Aufgaben nicht klar voneinander abgrenzt.<br />
Ein mächtiger Akteur der EU wird der Präsident des ER nur dann sein<br />
können, wenn er Autorität über die Staats- und Regierungschefs, sprich<br />
die anderen Mitglieder des ER, entwickeln und sich beispielsweise eine<br />
Art Richtlinienkompetenz nach Modell des deutschen Bundeskanzlers<br />
erkämpfen kann. Sollte er allerdings einem zerstrittenen Europäischen<br />
Rat vorsitzen, der sich aufgrund von Konsensentscheidungen größtenteils<br />
selbst blockiert, wird der Präsident des ER zur Ohnmächtigkeit<br />
verurteilt sein.<br />
Fazit<br />
Um ein abschließendes Urteil über die Macht oder Ohnmacht des Europäischen<br />
Rates in der zukünftigen Union fällen zu können, muss das Inkrafttreten<br />
der Verfassung abgewartet werden. Die Verfassung eröffnet<br />
die Möglichkeit, dass der Europäische Rat in Zukunft ein sehr mächti-<br />
22<br />
Vgl. ebd.<br />
142 Kreutz
Der Europäische Rat<br />
Artikel 21, 22<br />
ges, eventuell sogar ein übermächtiges Organ in der Union sein kann.<br />
Zwar hat er laut Verfassung keinerlei gesetzgeberische Funktion und<br />
wird auch nicht ausdrücklich als Exekutive der Union bezeichnet. Doch<br />
hat er die Aufgabe, die für die Entwicklung der Union notwendigen<br />
Impulse zu setzen und die dafür notwendigen Prioritäten und Ziele der<br />
Union zu formulieren. Ferner gibt ihm die Verfassung das Recht, Richtlinien<br />
für die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu erlassen; die<br />
Möglichkeit, Grundlinien für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und<br />
des Rechts festzulegen; weitreichende Kompetenzen im Bereich der<br />
Außenvertretung sowie weitere Sonderrechte in den verschiedensten<br />
Politikbereichen. Dadurch kann er zum einen die ordentlichen Legislativorgane<br />
der EU – Europäisches Parlament und Ministerrat – beschränken<br />
und macht zum anderen der Kommission die Aufgabe als europäische<br />
Exekutive streitig. Auch im Bereich der Außenpolitik wurde er<br />
durch die Einrichtung eines Außenministers nicht wirklich geschwächt,<br />
sondern hat durch die Aufgabe, die Union nach außen zu vertreten,<br />
weitreichende Kompetenzen. Der Europäische Rat hat darüber hinaus<br />
die Legitimation bekommen, sich auch in Zukunft in die innere Organisation<br />
anderer Organe einzumischen. Dies beispielsweise durch die<br />
Festlegung des Rotationsverfahrens im Ministerrat und die Aufteilung<br />
der Sitze des Parlaments auf die Mitgliedstaaten nach 2009.<br />
Das Demokratiedefizit des Europäischen Rates konnte dabei nicht aufgelöst<br />
werden. Weder ist der ER anderen Gremien gegenüber verantwortlich<br />
noch finden seine Sitzungen in der Öffentlichkeit oder unter<br />
Gewährleistung eines Mindestmaßes an Transparenz statt. Zumindest<br />
im Bezug auf die Stellung des Europäischen Rates ist es dem Konvent<br />
und der folgenden Regierungskonferenz daher nicht gelungen, europäische<br />
Demokratie voranzutreiben.<br />
Ohnmächtig ist der Europäische Rat allerdings nach wie vor gegenüber<br />
den Mitgliedstaaten. Da im ER in der Regel im Konsens entschieden<br />
wird, ist er bei jeder Entscheidung vom guten Willen jedes einzelnen Mitgliedstaates<br />
abhängig. Sollte einer der 25 Mitgliedstaaten eine Blockadepolitik<br />
im Europäischen Rat einschlagen, ist dieser handlungsunfähig.<br />
Auch der Präsident des ER ist nur dann mächtig und eine Konkurrenz<br />
für den Kommissionspräsidenten, wenn die Mitgliedstaaten ihm erlauben,<br />
die Arbeit des Gremiums effizient zu führen und seine Richtlinienkompetenz<br />
akzeptieren.<br />
Eine Aussicht in eine idealtypische demokratische und föderale Zukunft<br />
Europas lässt allerdings das gesamte Konzept des Europäischen Rates<br />
Kreutz 143
Artikel 21, 22<br />
Der Europäische Rat<br />
zweifelhaft erscheinen. Ursprünglich war es seine Aufgabe, die Interessen<br />
der Regierungen zu vertreten und es den Regierungen zu ermöglichen,<br />
gemeinsame Positionen auszuarbeiten. Diese Funktion nehmen<br />
heute die verschiedenen Ministerräte wahr. Die Formulierung der Ziele<br />
und Prioritäten der EU sollte in der Zukunft stattdessen das Europäische<br />
Parlament übernehmen, wie das bei fast allen anderen parlamentarischen<br />
Systemen der Fall ist. In der zukünftigen Union sollten politische<br />
Entscheidungen von den Parlamenten, sprich den Bürgervertretungen<br />
der verschiedenen Ebenen getroffen werden, nicht von 15 bis 30 mitgliedstaatlichen<br />
Staats- und Regierungschefs. Die Angst der Staats- und<br />
Regierungschefs um den Verlust der persönlichen Macht, mit ihren<br />
Vetos europäische Entwicklungen blockieren zu können, darf für die<br />
Bürger nicht von Bedeutung sein. In der demokratischen Union von<br />
morgen sollte daher ein Europäischer Rat, der sowohl seine Aufgaben<br />
als auch seine Existenzberechtigung verloren hat, nur noch in Geschichtsbüchern<br />
eine Rolle spielen.<br />
Literatur: Bulmer, Simon/Wessels, Wolfgang (1987): The European Council – Decisionmaking<br />
in European Politics – London. Europäischer Konvent (2003): Verbatim-Records zu den<br />
Sitzungen 15.–16. sowie 30.–31. Mai 2003, 11.–13. Juni 2003, 4. sowie 9.–10. Juli 2003, unter:<br />
http://www.europakonvent.info/europakonvent/konvent (20.06.2005). Leinen, Jo (2002): Die<br />
Präsidentschaft der Europäischen Union – Für eine verbesserte Legitimität, Transparenz und<br />
Effizienz der EU, unter: http://www.joleinen.de/www/html/content/pressespiegel/artikel/<br />
pdfs/AT02-Praesidentschaft.pdf (20.06.2005). Oppermann, Thomas (1999): Europarecht –<br />
München. Weidenfeld, Werner (2002): Europäische Einigung im historischen Überblick, in:<br />
Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.): Europa von A–Z. Taschenbuch der Europäischen<br />
Integration, 8. Aufl. – Bonn, S. 10–50. Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2002): Europahandbuch<br />
– Bonn. Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (2002): Europa von A–Z.<br />
Taschenbuch der Europäischen Integration, 8. Aufl. – Bonn. Werts, Jan (1992): The<br />
European Council – Amsterdam. Wessels, Wolfgang (2002): Das politische System der EU, in:<br />
Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Europahandbuch – Bonn, S. 329–347.<br />
144 Kreutz
Der Ministerrat<br />
Beatrice Kolp<br />
Artikel 23-25<br />
DER MINISTERRAT<br />
Artikel 23: Der Ministerrat<br />
Wird in Deutschland europäisches Recht wie die „Verordnung zur Festsetzung<br />
von Qualitätsnormen von Rispentomaten“ 1 angewandt oder müssen die<br />
Bundesländer die Bestimmungen zum Umweltschutz der „Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie“<br />
2 in ihr Landesrecht umsetzen, so steht eines fest: Der Ministerrat<br />
in Brüssel 3 hat sich hiermit vorher befasst. Der Ministerrat ist eines der beiden<br />
Gesetzgebungsorgane 4 der Europäischen Union. Im Ministerrat tagen die<br />
Fachminister aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Für Deutschland<br />
sind es im Regelfall die Bundesminister aus dem Kabinett des Bundeskanzlers,<br />
welche als Vertreter der Bundesregierung im Ministerrat verbindlich abstimmen<br />
können. 5 Sie vertreten also die Interessen Deutschlands und bringen diese<br />
in den europäischen Gesetzgebungsprozess ein. Daneben gibt es die direkt<br />
gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlament, welche oft an der<br />
Gesetzgebung in Brüssel und Strassburg beteiligt sind – „oft“, aber nicht<br />
immer. Denn bei einigen Punkten, wie die Festlegung der Höhe des EU-Budgets<br />
oder die Entscheidung über eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen<br />
mit potentiellen Mitgliedstaaten, entscheidet der Ministerrat allein.<br />
Artikel 24: Die Zusammensetzung des Ministerrates<br />
Von der Verfassung werden zwei Arbeitsgremien auf Ministerebene verbindlich<br />
vorgegeben, wobei nicht auszuschließen ist, dass diese überwiegend in gleicher<br />
Besetzung und unmittelbar nacheinander tagen werden. 6 Die beiden Gremien<br />
tragen die Namen Rat für Allgemeine Angelegenheiten sowie Rat für Auswärtige<br />
Angelegenheiten. Da die Verfassung, wenn sie von Ministerrat spricht, diesen<br />
oft nur als „der Rat“ benennt, darf man sich nun von den Namen der ministeriellen<br />
Arbeitsgremien nicht verwirren lassen. Der Rat für Auswärtige Angelegenheiten<br />
ist rein faktisch ein Arbeitsgremium im Hause des Ministerrats, in<br />
1<br />
Verordnung (EWG) Nr. 778/83 zur Festsetzung von Qualitätsnormen in Bezug auf Tomaten/<br />
Paradeiser am Stiel (Rispentomaten), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2250/96 veröffentlicht<br />
im Amtsblatt L 302/16 vom 12.3.1997.<br />
2<br />
Richtlinie 92/43/EWG.<br />
3<br />
In den Monaten April, Juni und Oktober tagt der Ministerrat in Luxemburg.<br />
4<br />
Daneben gibt es das Europäische Parlament in Straßburg/Brüssel.<br />
5<br />
Mit dem Maastrichter Vertrag (Artikel 203 Absatz 1 EGV) wurde die Möglichkeit geschaffen,<br />
dass auch Vertreter der 16 Bundesländer in den Ministerrat entsandt werden können.<br />
6<br />
Es ist zu erwarten, dass in der Regel die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen<br />
der beiden Ratsformationen tagen. Denn dies ist für die Zeit vor der Verfassung in dem Rat<br />
Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen der Fall gewesen.<br />
Kolp 145
Artikel 23-25<br />
Der Ministerrat<br />
dem die Außenminister der 25 Mitgliedstaaten zusammenkommen und über<br />
Themen wie zum Beispiel die Entsendung von zivilen, polizeilichen oder militärischen<br />
EU-Missionen entscheiden. 7 Hier wird also nichts Geringeres als die<br />
Außenpolitik der Union formuliert. Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten<br />
nimmt nun insofern eine besondere Stellung ein, als dass er die Aufgabe der<br />
Politikfestlegung des gesamten Ministerrats und der Koordinierung aller Fachministertreffen<br />
wahrnimmt. Er bereitet daneben noch die Tagungen des Europäischen<br />
Rates – die Treffen der Staats- und Regierungschefs – inhaltlich vor<br />
und achtet auf die Umsetzung der dort beschlossenen Leitlinien der europäischen<br />
Politik.<br />
Doch damit nicht genug. Die beiden beschriebenen ministeriellen Arbeitsgremien,<br />
auch Ratsformationen genannt, sind nicht die einzigen im Hause „Ministerrat“.<br />
Schon immer hat es im Ministerrat eine Vielzahl von weiteren Ratsformationen<br />
gegeben, wie zum Beispiel den Agrarministerrat oder den Wirtschaftsund<br />
Finanzministerrat. Diese Fachministertreffen soll es nach der Verfassung<br />
auch weiterhin geben. Wenn also zum Beispiel wieder einmal über die „Legehennen-Verordnung“<br />
oder über den „Anbau von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen“<br />
gestritten wird, kann die deutsche Verbraucherministerin weiterhin<br />
ihre Interessen im Ministerrat vertreten. Über Art und Anzahl der Ratsformationen<br />
entscheiden je nach Bedarf die Staats- und Regierungschefs. 8<br />
Die Vorbereitung der Arbeiten der Ministertreffen übernehmen die von den Mitgliedstaaten<br />
in den so genannten Ausschuss der Ständigen Vertreter, kurz AStV,<br />
entsandten EU-Botschafter. 9 Oftmals sind dies alterfahrene Kenner der europäischen<br />
Materie. 10 Wenn auch die Treffen dieser „Ständigen Vertreter“ geheim<br />
sind, sieht die Verfassung erstmals vor, dass die Fachminister immer dann<br />
öffentlich tagen, wenn sie in die Schlussphase der Gesetzgebung kommen.<br />
Artikel 25: Die qualifizierte Mehrheit<br />
Entscheidet der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit, so müssen mindestens<br />
55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen, die zugleich mindestens 65 Prozent<br />
7<br />
Z.B. ist die erste militärische EU-Mission „Concordia“, die von März bis Dezember 2003 für<br />
politische Stabilität in Mazedonien sorgte, auf eine Entscheidung des Rats für Allgemeine<br />
Angelegenheiten und Außenbeziehungen zurückzuführen.<br />
8<br />
Anzahl und Art der Ratsformationen sollen nach Artikel 24 Absatz 4 mit qualifizierter Mehrheit<br />
beschlossen werden.<br />
9<br />
Die Arbeiten dieses Ausschusses werden wiederum von rund 250 Fachausschüssen und<br />
Arbeitsgruppen vorbereitet. Zu diesen gehört z.B. der Militärausschuss und das Politische und<br />
Sicherheitspolitische Komitee, aber auch die AG „Erweiterung“, die AG „Westliche Balkanstaaten“,<br />
die Gruppe „Olivenöl“ und die Gruppe „Wein und Alkohol“.<br />
10<br />
Deutschland wird von Botschafter Dr. Wilhelm Schönfelder vertreten, welcher zuvor Leiter<br />
der Europaabteilung im Auswärtigen Amt war.<br />
146 Kolp
Der Ministerrat<br />
Artikel 23-25<br />
der EU-Bevölkerung repräsentieren. Grundsätzlich werden alle Beschlüsse mit<br />
qualifizierter Mehrheit gefasst. Nur in bestimmten Bereichen ist Einstimmigkeit<br />
für einen Beschluss erforderlich. Wenn der Ministerrat nicht auf der<br />
Grundlage eines Vorschlags der Kommission oder auf Initiative der Außenminister<br />
beschließt, dann sollte die erforderliche qualifizierte Mehrheit 72 Prozent<br />
der Mitgliedstaaten entsprechen, die gleichzeitig ebenfalls 65 Prozent der EU-<br />
Bevölkerung repräsentieren. Die Sperrminorität wird künftig erst mit vier Mitgliedstaaten<br />
möglich sein, andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als<br />
erreicht.<br />
Ministerrat und Bundesrat im Vergleich<br />
Der Ministerrat: Die 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden<br />
durch den Ministerrat an der Gesetzgebung der Europäischen Union beteiligt.<br />
In die Sitzungen entsenden die Regierungen ihre Vertreter nach Brüssel<br />
oder Straßburg. Die Einwohnerzahl eines Mitgliedstaates wird durch das<br />
Prinzip der doppelten Mehrheit bei der Abstimmung im Ministerrat berücksichtigt<br />
(vorteilhaft für Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern), wobei<br />
aber auch die Anzahl der zustimmenden Staaten in der Regel mindestens 55<br />
Prozent ausmachen muss (vorteilhaft für Luxemburg, Zypern und Malta mit<br />
zusammen drei Stimmen bei insgesamt nur 1,5 Millionen Einwohnern).<br />
Der Deutsche Bundesrat: Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik<br />
Deutschland werden durch den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes<br />
beteiligt. In die Sitzungen entsenden die Landesregierungen ihre Vertreter.<br />
Zu wichtigen Sitzungen kommt der Ministerpräsident höchstpersönlich<br />
nach Berlin. Jedes Land hat je nach Einwohnerzahl unterschiedlich viele<br />
Stimmen. Die Einwohnerzahl wird aber nicht genau proportional gewichtet:<br />
Während das große Flächenland Bayern sechs Stimmen hat, wirft der kleine<br />
Stadtstaat Bremen immerhin drei Stimmen in die Waagschale.<br />
Kolp/Kampfer<br />
Ministerrat – das Machtzentrum der Europäischen Union<br />
Der Ministerrat ist eines der EU-Organe, die das Image Brüssels als bürokratischer<br />
und ineffizienter „Moloch“ immer wieder verschärfen.<br />
Dabei ist der Ministerrat eines der wichtigsten Organe in der EU. Er<br />
bestimmt, was Recht und Gesetz wird und ist dabei das Organ, das die<br />
nationalen Interessen auf europäischer Ebene artikuliert und umsetzt.<br />
Damit verfügt er über die größte Macht in der EU – denn ohne ihn geht<br />
Kolp 147
Artikel 23-25<br />
Der Ministerrat<br />
gar nichts. Zur Undurchsichtigkeit trugen insbesondere die Abstimmungsmodalitäten<br />
und die teilweise bis zu 20 verschiedenen Ratsformationen<br />
bei. Aus diesem Grund konzentrierte sich der Konvent vor<br />
allem auf Reformen bei der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen,<br />
die Abstimmungsmodalitäten, den Ratsvorsitz, aber auch auf die Neugestaltung<br />
der verschiedenen Ratsformationen – die nun Eingang in die<br />
neue Verfassung gefunden haben.<br />
Auf dem Weg zu einer Staatenkammer?<br />
Die Verfassung der Europäischen Union sieht vor, den Ministerrat in seinen<br />
gesetzgeberischen Kompetenzen zu stärken. Diese greifen jedoch zu<br />
kurz und bedeuten sogar ein Rückschritt hinter die Vorschläge des Konvents.<br />
So könnte man die von der Verfassung vorgeschlagene Formation<br />
des „Gesetzgebungsrates“ stärken, indem er zu einer „echten“ zweiten<br />
Kammer (Staatenkammer) – neben dem Parlament (Völkerkammer/<br />
Bürgerkammer) – ausgebaut werden würde. Ähnlich dem Verhältnis<br />
zwischen Bundesrat und Bundestag würde sich der Ministerrat mit dem<br />
Europäischen Parlament die legislative Gewalt teilen. Erheblich ausgeweitet<br />
wurde der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens,<br />
das künftig Legislativverfahren heißt. 11 Doch auch wenn etwa 95 Prozent<br />
der europäischen Gesetze vom Europäischen Parlament und vom<br />
Ministerrat gemeinsam verabschiedet werden 12 , ist das Parlament dennoch<br />
kein vollständig gleichberechtigter Partner neben dem Ministerrat.<br />
Grundsätzlich gilt, dass das Parlament dann Mitentscheidungsrecht<br />
besitzt, wenn im Ministerrat mit Mehrheit abgestimmt wird. Damit<br />
schließt sich eines der gravierendsten Löcher in der europäischen Legitimationskette,<br />
da legislative Entscheidungen auf Ministerebene in den<br />
meisten Fällen von einer Mehrheit der direkt gewählten Parlamentarier<br />
unterstützt werden müssen. 13 Hinsichtlich der Forderung nach einer klaren<br />
Gewaltentrennung zwischen Ministerrat, Parlament und Kommission<br />
wäre die Schaffung einer eigenständigen Staatenkammer, die an die<br />
Stelle des Ministerrats tritt, ein guter Vorschlag für mehr Demokratie<br />
11<br />
Vgl. http://www.eiz-niedersachsen.de/frames-eiz.html (20.06.2005).<br />
12<br />
Das Parlament erhält ein zusätzliches Mitbestimmungsrecht u.a. in sensiblen Bereichen wie<br />
der Justiz- und Innenpolitik – wenn auch nur teilweise. Der siebenjährige Finanzrahmen der<br />
EU kann weiterhin nur einstimmig beschlossen werden. Ein Vetorecht behält der Ministerrat<br />
auch in der Steuerpolitik und überwiegend in der GASP. Vgl. Artikel 396 Absatz 1–9.<br />
13<br />
Vgl. dazu Artikel 338.<br />
148 Kolp
Der Ministerrat<br />
Artikel 23-25<br />
und Transparenz. Die Legislative bestünde dann aus dem Parlament und<br />
einem aus dem Gesetzgebungsrat hervorgehobenen Senat als Staatenkammer.<br />
14 Dies würde, in Verbindung mit der Angleichung von Mehrheitsentscheidungen<br />
und des Mehrheitsprinzips, nicht nur zu einer besseren<br />
Legitimation und Handlungsfähigkeit des Ministerrates führen,<br />
sondern auch zur Stärkung des Europäischen Parlaments als Legislativorgan,<br />
was zudem viel eher der föderativen Struktur der EU entspräche<br />
(europäisch-zentrale Gesetzgebungskompetenz über das Europäische<br />
Parlament und europäisch-dezentrale Gesetzgebungskompetenz über<br />
den Ministerrat als Organ der Mitgliedstaaten). 15 Zudem würde diese<br />
Kammer zur Wahrung der Souveränität der Nationalstaaten beitragen.<br />
Für die Zukunft wäre das Ziel einer direkt gewählten Staatenkammer<br />
erstrebenswert.<br />
Reform der Vorsitzrotation<br />
Die Bandbreite der Ratsformationen wird sich weiter an den Entscheidungen<br />
des Gipfels von Sevilla orientieren, infolgedessen eine Reduktion<br />
von 16 auf neun Formationen vorgenommen wurde. Auch zukünftig wird<br />
es einen Rat für Landwirtschaft und Fischerei, Justiz und Inneres sowie<br />
für Wirtschaft und Finanzen geben. 16 Der Vorsitz wechselt durch Rotationsverfahren.<br />
Nach der Verfassung soll der Zeitraum des Rotationsverfahrens<br />
durch einen Beschluss des Europäischen Rates festgelegt werden.<br />
Ein Entwurf dafür wurde in Form einer Erklärung beigefügt. 17 Danach<br />
sollen drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten zusammen<br />
den Ratsvorsitz innehaben. Die drei Mitglieder innerhalb dieser<br />
„Teampräsidentschaft“ sollen dabei verschiedene, sich ergänzende Aufgaben<br />
wahrnehmen. Die Mitgliedstaaten sind dazu gezwungen, ihre Prioritäten<br />
aufeinander abzustimmen. Gleichwohl ist in der Praxis keine größere<br />
Kohärenz innerhalb der Arbeiten des Ministerrates zu erwarten. Vielmehr<br />
wird das Modell der Teampräsidentschaft wahrscheinlich dazu führen,<br />
dass die Vorsitzenden aufgrund des Willens zur nationalen Profilierung<br />
in ein Konkurrenzverhältnis zueinander treten. 18<br />
14<br />
Vgl. Maurer 2003a, 20.<br />
15<br />
Vgl. Scholz 2003.<br />
16<br />
Genaue Angaben zu weiteren künftigen Ratsformationen sind der Verfassung nicht zu entnehmen.<br />
Vgl. dazu weiter Emmanouilidis 2004, 15.<br />
17<br />
Vgl. CIG 87/04 ADD 2.<br />
18<br />
Vgl. Emmanouilidis 2004, 17.<br />
Kolp 149
Artikel 23-25<br />
Der Ministerrat<br />
Einführung der doppelten Mehrheit<br />
Die Abstimmungsmodalitäten im Ministerrat waren auf der Regierungskonferenz<br />
zur Europäischen Verfassung höchst umstritten. Hier ging es<br />
um die Frage, wie viele Stimmen die einzelnen Mitgliedstaaten erhalten<br />
sollten. Doch ist dieses Problem nicht neu. Seit jeher wird auf Regierungskonferenzen<br />
über die Stimmenverteilung gestritten. Mit dem Vertrag<br />
von Nizza wurde eine neue, dreifache Regelung bei Beschlüssen mit<br />
qualifizierter Mehrheit angenommen. Ein Beschluss kommt demnach<br />
dann zustande, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Ministerrates:<br />
• ein bestimmtes Quorum der gewichteten Stimmen erreicht (in der<br />
EU-15: 71,3 Prozent; in der EU-25: 72,4 Prozent) und, auf<br />
gesonderten Antrag eines Mitgliedstaates,<br />
• zusätzlich 62 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentiert sind. 19<br />
Durch die Stimmengewichtung soll erreicht werden, dass die großen<br />
Staaten die kleineren mit geringerer Stimmengewichtung nicht überstimmen<br />
und umgekehrt, dass viele kleine Staaten nicht die großen überstimmen.<br />
Ein Korrekturmechanismus bewirkt dabei, dass Staaten mit kleinerer<br />
Bevölkerungszahl relativ überrepräsentiert sind. 20 Auch wenn laut<br />
Nizza ein erforderliches Quorum von 72,3 % der Stimmen erforderlich<br />
ist, bleibt noch jedem Mitgliedstaat die Möglichkeit einen Beschluss zu<br />
blockieren, wenn nicht 62 % der Gesamtbevölkerung der EU repräsentiert<br />
werden.<br />
Die Anwendung dieses Systems, das kleine Länder überrepräsentiert,<br />
ginge in einer EU der 25 bzw. 27 Mitglieder noch stärker zu Lasten der<br />
großen, das heißt bevölkerungsreichen Länder, und würde damit die<br />
demokratische Legitimität der Entscheidungen in Frage stellen. Die Verfassung<br />
sieht deshalb vor, Entscheidungen ab dem 1. November 2009<br />
• mit qualifizierter Mehrheit zu beschließen – wofür eine Mehrheit<br />
der Länder notwendig ist (55 Prozent),<br />
• die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung stellen<br />
(doppelte Mehrheit). 21<br />
Wenn der Beschluss nicht auf der Grundlage einer Initiative der Kommission<br />
oder des EU-Außenministers erfolgt, erhöht sich die notwendi-<br />
19<br />
Vgl. CAP 04/2003.<br />
20<br />
Vgl. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/cig/g4000s.htm (20.06.2005).<br />
21<br />
Vgl. Artikel 25 Absatz 1.<br />
150 Kolp
Der Ministerrat<br />
Artikel 23-25<br />
<br />
<br />
Regelfall<br />
laut<br />
Verfassung<br />
Mind. 55 % der<br />
Mitgliedstaaten und<br />
mind. 15 Staaten<br />
Mind. 65 % der EU-<br />
Bevölkerung<br />
Mind. 72 % der<br />
Mitgliedstaaten<br />
<br />
Mind. 65 % der<br />
EU-Bevölkerung<br />
<br />
Sonderfall laut<br />
Verfassung<br />
ge Mehrheit auf mindestens 72 Prozent der Mitgliedstaaten, die ebenfalls<br />
65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren müssen. 22<br />
Die Einführung der doppelten Mehrheit stellt hinsichtlich einer verbesserten<br />
Handlungs- bzw. Entscheidungsfähigkeit und Effektivität im<br />
Ministerrat eine bedeutende Verbesserung dar. Die doppelte Mehrheit<br />
verändert vor allem das Gewicht der einzelnen Mitgliedstaaten im<br />
Ministerrat. Bisher wurde Ländern wie Polen und Spanien überproportionales<br />
Gewicht verliehen. Seit dem 1. November 2004 erhalten sie<br />
jeweils 27 Stimmen im Ministerrat und damit nur zwei Stimmen weniger<br />
als große Länder wie Deutschland oder Frankreich. So wird sich<br />
zwar in einer EU der 25 oder gar 27 das absolute Gewicht zum Beispiel<br />
Spaniens kaum ändern, da es mit 39,4 Millionen Einwohnern rund 8,7<br />
Prozent der EU-Bevölkerung stellen würde. Spaniens 27 Stimmen würden<br />
nach der Gewichtung von Nizza hingegen nur 7,8 Prozent der dann<br />
321 Gesamtstimmen ausmachen. In einer EU der 27 würde Spanien<br />
sogar „besser dastehen“ als heute. Erst im Vergleich zu anderen bevölkerungsreichen<br />
Ländern wie Frankreich und Deutschland werden Spaniens<br />
Bedenken deutlich. Das künftige Prinzip bedeutet zum Beispiel<br />
22<br />
Vgl. Artikel 25 Absatz 2.<br />
Kolp 151
Artikel 23-25<br />
Der Ministerrat<br />
für Spanien gegenüber Deutschland eine Reduzierung des Gewichts<br />
sowohl bei der Verabschiedung als auch bei der Blockade von Entscheidungen.<br />
Demnach stellt Deutschland in einer EU der 27 nach dem neuen<br />
Prinzip etwa 17,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Derzeit erreicht<br />
Deutschland mit seinen 29 Stimmen gerade einmal 8,4 Prozent der<br />
Gesamtstimmen. 23 Aus diesen Überlegungen heraus ist auch Polens und<br />
Spaniens Blockadehaltung auf dem Gipfeltreffen im Dezember 2003 zu<br />
verstehen. So beharrte vor allem Polens damaliger Ministerpräsident<br />
Leszek Miller im Streit um die Stimmengewichtung auf dem Prinzip<br />
von Nizza. Für alle Beteiligten geht es jedoch um weit mehr als um das<br />
Prinzip, denn die Stimmengewichte sind besonders wichtig, wenn über<br />
Geld entschieden wird. So will Deutschland als größter Beitragszahler<br />
zum EU-Haushalt seine Kontrolle stärken. Spanien will als Empfängerland<br />
die Brüsseler Töpfe gefüllt wissen. Die deutsche Bundesregierung<br />
beruft sich zudem auf demokratische Prinzipien: So sei es doch ungerecht,<br />
wenn ein deutscher Bürger bei Ratsabstimmungen weniger zähle<br />
als ein Pole oder Spanier. 24<br />
Im Vergleich zum Konventsvorschlag bedeutet die Verfassung einen<br />
Rückschritt, da die Anhebung des Bevölkerungsquorums die Bildung<br />
von Gestaltungsmehrheiten erschwert. Zudem ist das Erreichen von<br />
Sperrminoritäten weiter möglich – obgleich erst mit mindestens vier<br />
statt bisher drei Mitgliedstaaten.<br />
Öfter Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat<br />
Zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit wurden die einstimmig zu<br />
beschließenden Gebiete reduziert. Das Problem des Einstimmigkeitsprinzips<br />
liegt darin, dass es den Ministerrat in seiner Handlungsfähigkeit<br />
lähmt. Der EU wird durch das Einstimmigkeitserfordernis jede<br />
Möglichkeit genommen, schnell zu reagieren. Denn ein Konsens unter<br />
25 bzw. 27 Mitgliedern ist nur schwer zu erzielen. Dennoch ist die Ausweitung<br />
von Mehrheitsentscheidungen nicht das Maß aller Dinge. Denn<br />
Mehrheitsentscheidungen gehen auf Kosten der unterliegenden Mitgliedstaaten.<br />
Deren Ansichten bleiben unberücksichtigt. So befürchten<br />
kleinere Länder nach dem Prinzip der doppelten Mehrheit leichter überstimmt<br />
zu werden. Das Einstimmigkeitsprinzip hingegen führt zu Entscheidungen,<br />
welche von allen Mitgliedstaaten getragen werden.<br />
23<br />
Vgl. Giering 2003.<br />
24<br />
Vgl. Büchner 2003, 2.<br />
152 Kolp
Der Ministerrat<br />
Artikel 23-25<br />
Gleichwohl kann die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen<br />
undurchschaubare Tauschgeschäfte der Minister verhindern. So wurden<br />
im Ministerrat bereits Milchquoten gegen Strukturbeihilfen gehandelt.<br />
Im Ergebnis ist es aber sehr wahrscheinlich, dass das Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip<br />
in etwa 70 Politikbereichen den Ministerrat dauerhaft<br />
blockieren würde. Aus diesem Grund wurde für die Fälle, in denen<br />
keine Einigung für den Übergang zur qualifizierten Mehrheit erzielt<br />
wurde, eine allgemeine „Passerelle-Klausel“ vorgesehen. Danach kann<br />
der Europäische Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments<br />
einstimmig beschließen, dass der Rat künftig mit qualifizierter Mehrheit<br />
beschließt 25 , ohne dass eine Vertragsrevision oder eine Ratifizierung<br />
durch jeden einzelnen Mitgliedstaat erforderlich wird. Jedoch reicht<br />
bereits der formelle Widerstand eines nationalen Parlaments aus, um<br />
diese Anwendung zu blockieren. 26 Andererseits werden damit die Kontrollrechte<br />
der nationalen Parlamente bei der Übertragung von Hoheitsrechten<br />
gewahrt. Theoretisch kann die Passerelle-Klausel innerhalb der<br />
Mehrheitsfragen im Ministerrat beitragen, sich dynamisch zu entwickeln.<br />
Praktisch ist dies jedoch fraglich, da diese Möglichkeit einen einstimmigen<br />
Beschluss der Staats- und Regierungschefs voraussetzt.<br />
Die Doppelrolle des neuen Europäischen Außenministers<br />
Beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten soll künftig ein hauptamtlicher<br />
Europäischer Minister den Vorsitz führen, der gleichzeitig als<br />
Vizepräsident der Kommission für die auswärtigen Angelegenheiten zuständig<br />
ist (Artikel 28). 27 In dieser Konstruktion nimmt der neue Europäische<br />
Außenminister eine „Doppelrolle“ ein, indem er die Aufgaben<br />
des Kommissars für Auswärtige Angelegenheiten und des beim Ministerrat<br />
verankerten Hohen Vertreters für die Außen- und Sicherheitspolitik<br />
in Personalunion übernehmen soll. Damit ist er sowohl an den<br />
Ministerrat als auch an die Kommission gebunden. Wenn auf der einen<br />
Seite die Schaffung des neuen Amtes zu begrüßen ist – diese Neuerung<br />
kann als erster Schritt zur „Vergemeinschaftung“ der europäischen<br />
Außenpolitik gesehen werden –, sind auf der anderen Seite auch offensichtliche<br />
Probleme mit diesem Posten verbunden. Solange nationale<br />
Souveränitätsvorbehalte den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik<br />
25<br />
Vgl. Artikel 444, Absatz 1.<br />
26<br />
Vgl. Europäisches Parlament 2004, 4.<br />
27<br />
Artikel 28.<br />
Kolp 153
Artikel 23-25<br />
Der Ministerrat<br />
dominieren, wird es nicht gelingen, die angestrebte eigenständige und<br />
vor allem gemeinschaftliche europäische Außen- und Sicherheitspolitik<br />
über die EU zu erreichen – auch nicht durch einen „Europäischen<br />
Außenminister“. Auch aus institutioneller Sicht ist dieser Posten nicht<br />
gerade unproblematisch, da er gewissermaßen zwischen der Kommission<br />
und dem Rat angesiedelt ist. So wird der Außenminister vom Europäischen<br />
Rat eingesetzt, ist Vizepräsident der Kommission und handelt<br />
zugleich im Auftrag des Ministerrats. Zu der immer wieder geforderten<br />
Transparenz der EU trägt dies nicht gerade bei. Hinzu kommt, dass<br />
damit ein Kommissionsmitglied geschaffen wird, das weder der Wahl<br />
noch der Kontrolle des Europäischen Parlamentes unterliegt. Auch sind<br />
Überlagerungen der Aufgabenbereiche des Europäischen Außenministers<br />
mit denen des Präsidenten des Europäischen Rates und denen des<br />
Kommissionspräsidenten wahrscheinlich. Dies kann zu Auseinandersetzungen<br />
unter den drei verschiedenen Ämtern führen.<br />
Das Ende ist noch nicht erreicht<br />
Trotz der durch die Verfassung erzielten umfassenden Reformen sind<br />
weitere Schritte hin zu mehr Legitimation, Handlungsfähigkeit und<br />
Transparenz im Ministerrat nötig. Zwar wird es durch die Einführung<br />
von Mehrheitsbeschlüssen in wesentlichen Bereichen für die Mitgliedstaaten<br />
zunehmend schwieriger, Entscheidungen zu blockieren. Dennoch<br />
können nach wie vor Handlungsermächtigungen durch Einstimmigkeit<br />
in der EU der 25 zu Handlungsblockaden führen. Und um es mit den<br />
Worten des französischen Außenministers Michel Barnier auszudrücken:<br />
„Einstimmige Kompetenzen sind tote Kompetenzen.“ Ein wichtiger<br />
Fortschritt ist jedoch die Neudefinition von Entscheidungen mit doppelter<br />
Mehrheit. Das heißt, künftig wird eine Mehrheit der Staaten vonnöten<br />
sein, die der Mehrheit der EU-Bevölkerung entsprechen muss. Damit<br />
werden die Interessen aller Länder berücksichtigt. Große Länder können<br />
einen Beschluss nicht aufgrund einer Bevölkerungsmehrheit über kleine<br />
Länder „hinweg“ beschließen. Andererseits können kleine Länder auch<br />
nicht ihr überproportionales Gewicht ausnutzen, da sie ebenfalls mindestens<br />
65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Zudem fördert<br />
das Verfahren der doppelten Mehrheit die Bildung konstruktiver<br />
Mehrheiten und verringert zugleich die Zahl potentieller Sperrminoritäten.<br />
Die Schaffung einer Ratsformation für Gesetzgebung ist als kleiner<br />
Fortschritt auf dem Weg zu mehr Transparenz und einer verbesserten<br />
Handlungsfähigkeit in der EU zu sehen; ebenso, dass künftig eine Tren-<br />
154 Kolp
Der Ministerrat<br />
Artikel 23-25<br />
nung der Tagungen des „Gesetzgebungsrates“ sowie Formationen des<br />
Ministerrates mit rein exekutiven und koordinierenden Befugnissen<br />
stattfinden, um den Anforderungen an eine klarere Gewaltentrennung<br />
wenigstens zum Teil gerecht zu werden. Dennoch ist die Ablehnung<br />
eines vom Konvent vorgeschlagenen selbständigen Gesetzgebungsrates<br />
bei der Regierungskonferenz zur Europäischen Verfassung ein klarer<br />
Demokratierückschritt. 28 Durch die Haushaltskompetenz, Beteiligung<br />
am Gesetzgebungsverfahren sowie die weiterhin bestehende Kontrollfunktion<br />
des Europäischen Parlaments sind zumindest die Grundlagen<br />
für die Weiterentwicklung eines ausgewogenen und vor allem auch verständlichen<br />
„Zwei-Kammer-Systems“ geschaffen. Dieses System zu<br />
vollenden, hat die Verfassung jedoch versäumt. Auch das neu entwickelte<br />
Rotationssystem im Rat greift in mancher Hinsicht zu kurz. De facto<br />
bedeutet dieses Verfahren, dass im Endeffekt wieder alle sechs Monate<br />
der Vorsitz wechseln wird. Jedoch wurde damit zumindest die Idee eines<br />
dauerhaften Vorsitzes im Ministerrat verworfen.<br />
Der vorgesehene Posten des „Europäischen Außenministers“ bringt zwar<br />
die Möglichkeit mit sich, die EU in der Außenpolitik künftig mit einer<br />
Stimme sprechen zu lassen. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn die<br />
Nationalstaaten mehr Macht an die europäische Ebene abgeben. Solange<br />
dies nicht geschieht, bleibt der Sinn und Zweck eines Europäischen Außenministers<br />
fragwürdig. Auch wenn die Verfassung bezüglich ihrer Reformen<br />
im Ministerrat einen Schritt nach vorn bedeutet, ist das Ende notwendiger<br />
Reformen noch nicht erreicht und damit die eigentliche „Machtstellung“,<br />
die diesem Organ zukommen soll, nicht vollends sichergestellt.<br />
Literatur: Büchner, Gerold (2003): 350 Seiten und 100 Probleme, in: Berliner Zeitung vom<br />
12.12.2003, S. 2. Emmanouilidis, Jannis A. (2004): Die institutionellen Reformen in der Verfassung<br />
– die neue Machtarchitektur in der Europäischen Union – Gütersloh. Emmanouilidis,<br />
Jannis A./Fischer, Thomas (2003): Die Machtfrage europäisch beantworten, unter: http://www.<br />
cap-lmu.de/download/spotlight/Reformspotlight_04-03_d.pdf(20.06.2005). Europäisches<br />
Parlament (2004): Die Europäische Verfassung. Zusammenfassung wesentlicher Inhalte, in:<br />
Medienservice (Sonderausgabe August 2004), unter: http://ue.eu.int/igcpdf/de/04/cg00/<br />
cg00086.de04.pdf (20.06.2005). Giering, Claus (2003): Mutige Entscheidungen und verzagte<br />
Kompromisse – das verzagte Reformpaket des EU-Konvents, unter: http://www.cap.<br />
uni-muenchen.de/aktuell/positionen/2003_08_eukonvent_giering2.htm (20.06.2005). Maurer,<br />
Andreas (2003a): Auf dem Weg zur Staatenkammer, SWP-Studie – Berlin. Andreas Maurer<br />
(2003b): Der Endspurt des Konvents, unter: http://www.swp-berlin.org/common/ get_<br />
document.php?id=129 (20.06.2005). Scholz, Rupert (2003): Eine Verfassung für Europa, unter:<br />
http://www.kas.de/proj/home/pub/30/1/year-2003/dokument_id-2051 (20.06.2005).<br />
28<br />
Vgl. dazu Artikel 49.<br />
Kolp 155
Artikel Julia Strese 26-28<br />
Die Europäische Kommission<br />
Artikel 26-28<br />
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION<br />
Artikel 26: Die Europäische Kommission<br />
Absatz 1: Die Kommission als Hüterin der Verträge<br />
Der Kommission wird in Artikel 26 Absatz 1 die Überwachung der Anwendung<br />
des Gemeinschaftsrechts übertragen. Als Hüterin der Verträge verfolgt sie Gemeinschaftsrechtsverstöße<br />
der Mitgliedstaaten oder von Einzelpersonen. 1 Die<br />
Kommission steht unter der Kontrolle des Gerichtshofes, kontrolliert aber auch<br />
sich selbst. Zu diesem Zweck hat sie den Juristischen Dienst eingerichtet, der<br />
zu allen maßgeblichen Schritten Stellung nimmt.<br />
Die Kommission stellt zudem die Verwaltung der Union bereit und erlässt die<br />
Durchführungsvorschriften für die Europäischen Gesetze. Sie verfolgt und ahndet<br />
beispielsweise Unternehmenskartelle im Wettbewerbsrecht, wobei oftmals<br />
Geldbußen in spektakulärer Höhe festgesetzt werden. Zudem führt sie den<br />
Haushaltsplan aus. Auch die Vertretung der Union nach außen gehört zu ihren<br />
Verwaltungsaufgaben. 2 Diese wichtige Aufgabe der Sprecherin der Union ist<br />
jedoch dadurch eingeschränkt, dass Bereiche wie die Gemeinsame Außen- und<br />
Sicherheitspolitik (GASP) hiervon ausgenommen bleiben. 3 Als Impulsgeberin<br />
und Koordinatorin handelt die Kommission bei der Erfüllung der Aufgabe der<br />
jährlichen und mehrjährigen Programmplanung, mit welcher interinstitutionelle<br />
Vereinbarungen über politische Zielsetzungen vorbereitet werden sollen. 4<br />
Absatz 2: Die Kommission als Motor der Integration<br />
Artikel 26 Absatz 2 stellt eine wichtige Neuerung dar, da er der Kommission<br />
als allgemeine Regel das Recht überträgt, die Vorschläge für Gesetzesakte zu<br />
machen, die das Gesetzgebungsverfahren einleiten. Während das so genannte<br />
Initiativrecht in Artikel 211 EG-Vertrag „nur zwischen den Zeilen durchschimmert“<br />
5 , wird der Kommission nunmehr die Rolle der Exekutive zugeschrieben.<br />
Die Macht des Initiativrechts wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass der Ministerrat<br />
gegen den Willen der Kommission deren Vorschlag nur einstimmig<br />
ändern darf. 6 Der Kommission soll also ein scharfes Schwert in die Hand gelegt<br />
werden.<br />
1<br />
Schmitt von Sydow in Groeben/Schwarze 2004, 208.<br />
2<br />
Beutler/Bieber/Epiney/Haag 2001, 168.<br />
3<br />
Vgl. die Artikel 295 und 297.<br />
4<br />
Wie zum Beispiel das Programm „Europa 2010“ für Wohlstand, Solidarität und Sicherheit,<br />
KOM (2005) 12 endgültig.<br />
5<br />
Schmitt von Sydow in Groeben/Schwarze 2004, 205.<br />
6<br />
Vgl. Artikel 395 Absatz 1 und siehe auch die dort genannten Ausnahmen.<br />
156 Strese
Die Europäische Kommission<br />
Artikel 26-28<br />
Absätze 3 bis 6: Die personelle Zusammensetzung der Kommission<br />
Schon jetzt birgt die Größe des Kollegiums, das 25 gleichberechtigte „Chefs“<br />
beinhaltet, auch die Gefahr der Selbstblockade in sich. Bei der traditionell sensiblen<br />
und viel diskutierten Frage der Zusammensetzung der Kommission<br />
haben sich in der Verfassung einschneidende Neuerungen ergeben. 7 Zwar wird<br />
gemäß Absatz 5 die erste Kommission, die in Anwendung der Verfassung<br />
ernannt werden wird, dem momentan geltenden System entsprechen, nach welchem<br />
jeder Mitgliedstaat je einen Kommissar stellt. Die darauf folgenden Kollegien<br />
werden jedoch nur noch die Anzahl von Kommissaren beinhalten, die<br />
zwei Dritteln der Anzahl der Mitgliedstaaten entspricht. 8 Bei voraussichtlich 27<br />
Mitgliedstaaten würde das Kollegium also aus 18 Kommissionsmitgliedern<br />
bestehen, wobei auch der Präsident und der Außenminister mit eingerechnet<br />
sind. Damit hat sich die Union – unter dem Protest der kleineren Mitgliedstaaten<br />
– von dem zuvor eisernen Prinzip 9 der spiegelbildlichen Vertretung der Mitgliedstaaten<br />
in der Kommission gelöst. 10 Kein Mitgliedstaat möchte jedoch nur<br />
zusehen, wie die weit reichenden und auch für ihn gültigen Kommissionsentscheidungen<br />
ohne sein Zutun fallen. Das daher bedeutende und komplizierte 11<br />
Rotationssystem hat die vollkommene Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten<br />
zu gewährleisten. Während der Konventsentwurf noch vorsah, dass die in der<br />
aktuellen Amtszeit nicht vertretenen Mitgliedstaaten eine gewisse Kompensation<br />
durch die Ernennung eines Kommissars ohne Stimmrecht aus ihren Reihen<br />
erhalten sollten, hat sich die Regierungskonferenz von diesem – wenig konsistenten<br />
12 – Konzept der so genannten „Junior Commissioners“ abgewandt. Aus<br />
vielen Mitgliedstaaten wurden kritische Stimmen hörbar, nachdem man durchschaut<br />
hatte, dass der „Kommissar zweiter Klasse“ zwar weder Handlungsbefugnisse<br />
noch Stimmrecht haben sollte, aber gleichwohl zahlreiche Ausgaben<br />
für Amtssitz, Mitarbeiter etc. verursachen würde. 13 Um die jeweils nicht vertretenen<br />
Mitgliedstaaten gleichwohl einzubinden, legt die von der Regierungskonferenz<br />
angenommene Erklärung Nr. 6 zu Artikel 26 das Gebot der nahtlosen<br />
Transparenz fest, was jedoch angesichts der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit<br />
als ein eher schwacher Trost anmutet. 14 Hinsichtlich der fünfjährigen Amtszeit<br />
der Kommission haben sich keine Änderungen ergeben. Die Amtszeit des<br />
momentan amtierenden Kollegiums endet 2009.<br />
7<br />
Vgl. zum Gang der Verhandlung in Konvent und Regierungskonferenz Fischer 2005, 173.<br />
8<br />
Vgl. Absatz 6. Der Konventsentwurf sah noch die statische Zahl von insgesamt 15 Kommissionsmitgliedern<br />
vor.<br />
9<br />
Das Spiegelbildprinzip war allerdings noch nicht in den Römischen Verträgen verankert.<br />
10<br />
Kritisch hierzu Temple Lang 2004, 551.<br />
11<br />
Vgl. ebd., 556.<br />
12<br />
Vgl. ebd., 558 f.<br />
13<br />
Vgl. die Einschätzung bei Fischer 2005, 173.<br />
14<br />
Vgl. ebd., 174.<br />
Strese 157
Artikel 26-28<br />
Die Europäische Kommission<br />
Absatz 7: Die Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder<br />
Absatz 7 legt die Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder 15 fest. Sie dürfen<br />
insbesondere keine Weisungen von den Regierungen der Mitgliedstaaten entgegennehmen.<br />
Sie übernehmen die Pflicht, bei der Annahme „gewisser Tätigkeiten<br />
oder Vorteile [...] ehrenhaft und zurückhaltend“ zu sein. 16<br />
Absatz 8: Misstrauensantrag und Amtsenthebungsverfahren<br />
Absatz 8 konkretisiert die Verantwortlichkeit des Kollegiums gegenüber dem<br />
Parlament, das gemäß Artikel 340 einen Misstrauensantrag gegen die Kommission<br />
stellen kann. Der Ministerrat ist zudem zur Amtsenthebung einzelner<br />
Kommissionsmitglieder befugt, denen schwere Verfehlungen nachgewiesen<br />
werden. Die Schwelle liegt nicht erst bei strafbarem Verhalten. 17 Dabei muss<br />
die Kommission oder der Rat gemäß Artikel 349 mit einfacher Mehrheit einen<br />
Antrag stellen. Der Gerichtshof spricht sodann die Amtsenthebung aus.<br />
Artikel 27: Der Präsident der Europäischen Kommission<br />
Absatz 1: Die Wahl des Präsidenten<br />
Das Parlament wählt „im Lichte der Europawahlen“ mit einfacher Mehrheit<br />
den Präsidenten der Kommission, wobei es jedoch nur über den vom Europäischen<br />
Rat mit qualifizierter Mehrheit beschlossenen Vorschlag abstimmen<br />
kann, sodass es sich nicht um eine Wahl im Wortsinne handelt. Der Europäische<br />
Rat hat die Zusammensetzung des Europäischen Parlamentes zu beachten,<br />
wodurch die Besetzung der Kommission eine deutliche politische Prägung<br />
bekommt: Der Präsident wird parteipolitisch stets derjenigen Gruppierung<br />
angehören, die die Mehrheit im Parlament innehat.<br />
Absatz 2: Die Wahl der übrigen Kommissionsmitglieder<br />
Der Europäische Rat entwirft im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten<br />
und auf der Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten eine Liste der<br />
übrigen Mitglieder des Kollegiums. Oftmals werden Führungspersonen und<br />
Spitzenpolitiker der Mitgliedstaaten für dieses Amt benannt. Danach erteilt das<br />
Parlament sein Zustimmungsvotum gemeinsam für den Präsidenten, den<br />
Außenminister und die übrigen Kommissionsmitglieder, woraufhin die Kommission<br />
vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt wird. 18<br />
15<br />
Die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Kommissare werden in Art. 347 konkretisiert.<br />
16<br />
Vgl. Artikel 347 Absatz 2.<br />
17<br />
Vgl. ebd.<br />
18<br />
Der Wortlaut des Artikels 27 Absatz 2 klärt nicht, mit welcher Mehrheit das Parlament das<br />
Zustimmungsvotum beschließt. Es erscheint jedoch angesichts der klaren Regelung in Absatz<br />
1, nach der der Präsident mit der einfachen Mehrheit des Parlamentes gewählt wird, möglich,<br />
diese entsprechend auch auf Absatz 2 anzuwenden. Vgl. Fischer 2005, 177.<br />
158 Strese
Die Europäische Kommission<br />
Artikel 26-28<br />
Absatz 3: Die Kompetenzen des Präsidenten<br />
Der Präsident hat die Richtlinienkompetenz hinsichtlich der politischen Aufgaben<br />
inne. Damit bestimmt er sowohl die generellen Zielrichtungen der<br />
Kommissionsarbeit als auch über einzelne Richtungsfragen in der Arbeit der<br />
Kommissare. Weiterhin bestimmt der Präsident die innere Organisation der<br />
Kommission, also die Hierarchien und Entscheidungswege und verteilt die<br />
Ressorts auf die so genannten Generaldirektionen, die nach Sachgebieten wie<br />
zum Beispiel „Binnenmarkt“, „Wettbewerb“ oder „Landwirtschaft“ aufgeteilt<br />
sind. Der Präsident ernennt die Vizepräsidenten und ist befugt, Kommissionsmitglieder<br />
zu entlassen.<br />
Artikel 28: Der europäische Außenminister<br />
Artikel 28 schafft mit dem Außenminister eine völlig neue Position, die den<br />
Kontakt der EU „nach außen“ durch einen konkreten Ansprechpartner als<br />
Mittelsmann der Institution zu anderen Staaten erleichtern soll. Der Konvent<br />
versah das Amt des Außenministers mit dem so genannten „Doppelhut“:<br />
Danach ist der Außenminister gleichzeitig Vizepräsident der Kommission und<br />
Vorsitzender des Rates für auswärtige Angelegenheiten. Da er zudem Teilnehmer<br />
am Europäischen Rat ist, tanzt er gar „auf drei Hochzeiten“ 19 .<br />
Europäische Regierung oder neutraler Verwaltungsapparat?<br />
Die Kommission auf der Suche nach sich selbst<br />
Die schon äußerlich bombastisch anmutende Behörde, die in einem dreiarmigen<br />
Glaspalast in der Rue de la Loi 200 über dem restlichen Brüsseler<br />
Europaviertel thront, ist für viele die größte und bei weitem mächtigste<br />
supranationale Behörde dieses Planeten. 20 Die breit gefächerte<br />
Aufgabenpalette der Kommission bringt so unterschiedliche Anforderungen<br />
an ihre institutionelle Ausgestaltung mit sich, dass ihnen eine einzige<br />
Institution im Grunde nicht gerecht werden kann: Als ausführendes<br />
Verwaltungsorgan muss die Kommission vor allem effizient und flexibel<br />
sein sowie fachliche Kompetenz aufweisen. Eine Blockade durch langwierige,<br />
von mitgliedstaatlichen Partikularinteressen dominierte Entscheidungsprozesse<br />
muss im Hinblick darauf unbedingt vermieden werden.<br />
Die Rolle der Kommission als Programmplanerin und Impulsgeberin<br />
verlangt andererseits nach einer politischen Legitimation, die jeden<br />
19<br />
Papier 2004, 756.<br />
20<br />
Vgl. Oldag/Tillack 2003, 75.<br />
Strese 159
Artikel 26-28<br />
Die Europäische Kommission<br />
Mitgliedstaat berücksichtigt. Als Hüterin der Verträge muss sie wiederum<br />
eine möglichst neutrale Stellung beziehen und allein gesamteuropäische<br />
Interessen in den Vordergrund stellen. In der Verfassung wurde<br />
zwar zaghaft eine gewisse Politisierung der traditionell neutralen Behörde<br />
angestrebt. Wie zu zeigen sein wird, überwiegen jedoch weiterhin<br />
jene Elemente, die eine neutrale Regulierungsbehörde kennzeichnen.<br />
Auf dem Weg zu einer Politisierung der Kommission?<br />
Auch wenn sie bereits teilweise als die europäische Regierung angesehen<br />
wird 21 , fehlt der Kommission bislang vor allem im Hinblick auf die<br />
Art der Ernennung der Kommissare und des Präsidenten die Prägung als<br />
politisches Organ. Die in der Verfassung neu geregelte Wahl des Präsidenten<br />
der Kommission stellt immerhin einen deutlichen Schritt hin zur<br />
„Parlamentarisierung“ der Kommission dar: Artikel 27 Absatz 1 regelt,<br />
dass der Europäische Rat bei seinem Vorschlag das „Ergebnis der Wahlen<br />
zum Europäischen Parlament“ zu berücksichtigen hat. Damit erfährt<br />
die Bedeutung der Parlamentswahlen eine Aufwertung und die bislang<br />
neutrale Besetzung der Kommission erhält eine deutlich politische<br />
Note, die sie dem Wesen einer Regierung schon näher kommen lässt.<br />
Dass gleichzeitig die Macht des Präsidenten erweitert wurde, verstärkt<br />
diesen Effekt der Politisierung noch.<br />
Freilich bleibt zweifelhaft, inwieweit eine Parlamentarisierung der<br />
Kommission tatsächlich einer Politisierung gleichkommt: Ein Blick auf<br />
die zum Teil erschreckend geringe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen<br />
macht klar, dass die demokratische Legitimierung in dieser Hinsicht<br />
noch zu wünschen übrig lässt. Die faktische Situation hält damit nicht,<br />
was die verfassungstheoretische Vorgabe verspricht. Von der Kommission<br />
als einem nunmehr politischen Gremium zu sprechen, wäre daher<br />
wohl übereilt. Hinzu kommt, dass der mutige Schritt, den man bei der<br />
Wahl des Präsidenten durch das Europäische Parlament wagte, nicht<br />
auch gleichzeitig bei der Wahl der übrigen Kommissionsmitglieder vollzogen<br />
wurde. Ihre Sachentscheidungen müssen die Kommissare nicht<br />
unter dem Druck der Mehrheiten im Parlament treffen. Unabhängig von<br />
parlamentarischer Kontrolle agieren auch die Generaldirektoren, die<br />
den einzelnen Generaldirektionen der Kommissare vorstehen und für<br />
viele die eigentlichen Lenker in Brüssel sind. Die hohen Beamten, die<br />
21<br />
Vgl. Cromme 2005, 44.<br />
160 Strese
Die Europäische Kommission<br />
Artikel 26-28<br />
häufig aufgrund ihrer langjährigen Praxis über mehr spezifische Fachkompetenz<br />
verfügen als die Kommissare, sind in der Tat wichtige<br />
„Strippenzieher“ der Eurokratie. Sie sind nicht nur fachlich brillant,<br />
sondern beherrschen auch die Tricks der ganz speziellen Brüsseler<br />
Diplomatie, in der man mit den herkömmlichen Methoden des in den<br />
Mitgliedstaaten bekannten Politikgeschäfts häufig nicht weit kommt.<br />
Hinzu kommt, dass sie teilweise auch die Kollegienwechsel überstehen<br />
und aufgrund dieser in der Kommission ansonsten ungekannten Kontinuität<br />
ihre Machtstellung ausweiten können. Da die Generaldirektoren<br />
zumeist entscheiden, welche Punkte auf die Tagesordnung der wöchentlichen<br />
Sitzungen der Generaldirektion mit ihrem Kommissar kommen<br />
und auch die Art und Weise bestimmen, in der die Sachverhalte dort dargestellt<br />
werden, ist ihr Einfluss auf die ohnehin chronisch überlasteten<br />
Kommissare immens. Im Hinblick auf die teilweise an der mangelnden<br />
demokratischen Legitimierung dieser „Barone der Eurokratie“ geübte<br />
Kritik 22 sei jedoch unterstrichen, dass die in den Generaldirektionen<br />
dringend benötigte Sachkompetenz eben nicht beliebig ersetzbar ist und<br />
gerade die Kontinuität erst die Herausbildung fachlicher Exzellenz<br />
ermöglicht. Hingewiesen sei auch auf den Juristischen Dienst, dessen<br />
Urteil als Kontrollinstanz in den Reihen der Kommission gefürchtet ist<br />
und dessen Bedeutung die einer bloßen Rechtsabteilung erheblich übersteigt.<br />
Vom mitgliedstaatlichen Repräsentativorgan zur gesamteuropäischen<br />
Interessenvertreterin?<br />
Die in der Verfassung vorhergesehene Schrumpfung der Anzahl der<br />
Kommissionsmitglieder könnte eine Abwendung von mitgliedstaatlichen<br />
Einzelinteressen hin zu einer stärkeren Fokussierung auf das gesamteuropäische<br />
Wohl bedeuten. Selbstverständlich ist der Kommission<br />
schon immer die Vertretung gesamteuropäischer Interessen zugedacht: 23<br />
Während der Ministerrat durch die intergouvernementale Methode<br />
geprägt ist, also dem Ausgleich nationaler Interessen dienen soll, sollen<br />
die Kommissionsmitglieder gerade nicht ihren Heimatstaat vertreten,<br />
sondern die genuinen Unionsinteressen verfechten. Das europäische<br />
Interesse beinhaltet nicht lediglich die Summe der mitgliedstaatlichen<br />
22<br />
Vgl. Oldag/Tillack 2003, 79.<br />
23<br />
Vgl. Artikel 213 Absatz 1 des EG-Vertrags.<br />
Strese 161
Artikel 26-28<br />
Die Europäische Kommission<br />
Interessen, sondern hat die Verbesserung der Lebensbedingungen der<br />
gesamten Bevölkerung sowie die Durchsetzung der Zielsetzungen der<br />
Verfassung, wie sie in der Präambel und in Artikel 3 niedergelegt sind,<br />
vor Augen. 24 Es ist jedoch kein Geheimnis, dass jeder Kommissar sich<br />
in der Praxis sehr wohl dem Druck seines Heimatstaates ausgesetzt<br />
sieht. 25 Auf diese Weise wurde die Kommission in gewissem Maße doch<br />
zum „Repräsentativorgan“ 26 und könnte – überspitzt dargestellt – im<br />
schlechtesten Fall gleichsam zu einem Abbild des Ausschusses der ständigen<br />
Vertreter werden, den es ja bereits gibt. 27<br />
Die Verfassung weicht nun vom Spiegelbildprinzip ab. Wenn damit<br />
nicht alle Mitgliedstaaten ihren „eigenen“ Vertreter entsenden können,<br />
tritt der gesamteuropäische Auftrag und neutrale Charakter noch deutlicher<br />
in den Vordergrund. Würden auch die nicht personell vertretenen<br />
Mitgliedstaaten die Beschlüsse des Kollegiums akzeptieren, wäre ein<br />
weiterer großer Schritt zur Schaffung einer europäischen Identität<br />
erfolgt: Die Ansicht der europäischen Kommission wäre danach nicht<br />
nur die Summe der mitgliedstaatlichen Partikularinteressen, sondern<br />
bekäme einen eigenen, supranationalen, eben europäischen Charakter.<br />
So weit die Theorie. Ob die Mitgliedstaaten jedoch die Beschlüsse einer<br />
Kommission, in der sie keinen Einfluss geltend machen können, tatsächlich<br />
akzeptieren werden, ist eine ganz andere Frage. Die psychologische,<br />
vertrauensfördernde Wirkung der eigenen Beteiligung an Beschlüssen<br />
darf keinesfalls unterschätzt werden! Gerade im Falle der<br />
Überstimmung der großen Mitgliedstaaten durch eine – bevölkerungsmäßig<br />
deutlich unterlegene – Koalition kleinerer Mitgliedstaaten ist die<br />
uneingeschränkte Akzeptanz solcher Kommissions-Mehrheitsentscheidungen<br />
eher schwer vorstellbar 28 , wenn auch nicht undenkbar. Nicht<br />
einmal die Rückkehr zum Spiegelbildprinzip durch eine einstimmig<br />
beschlossene Änderung dieser Regel durch den Europäischen Rat ist<br />
angesichts der Interessenlage der Regierungschefs, die sehr wahrschein-<br />
24<br />
Diese beinhalten die Schaffung und Förderung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und<br />
des Rechts sowie des Binnenmarktes mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb.<br />
25<br />
Schmitt von Sydow in Groeben/Schwarze 2004, 242.<br />
26<br />
Collignon 2003, 157.<br />
27<br />
Der so genannte COREPER (Comité des Représentants Permanents des Etats Membres) hat<br />
die Aufgabe, die Ratstagungen inhaltlich vorzubereiten. Er besteht aus dem Kollegium der<br />
Botschafter der Mitgliedstaaten und deren Stellvertretern.<br />
28<br />
Vgl. Temple Lang 2004, 564.<br />
162 Strese
Die Europäische Kommission<br />
Artikel 26-28<br />
lich nur ungern von ihrer Hausmacht ablassen wollen, ausgeschlossen. 29<br />
Erst die Praxis eines verkleinerten Kollegiums wird also zeigen, wie<br />
weit die „Europäisierung“ der Kommission tatsächlich vorangeschritten<br />
ist.<br />
Vom Team der Kommissare zum gelenkten Präsidialorgan?<br />
Die Stärkung der Stellung des Präsidenten deutet auch noch eine andere<br />
Entwicklung an: Mit der Machterweiterung des Präsidenten wird die<br />
Kommission einen Schritt vom kollegialen Organ hin zu einer präsidialen<br />
Regulierungsbehörde vollziehen. Mit der Betonung der hierarchischen<br />
Struktur soll eine weitere Effizienzsteigerung erreicht werden.<br />
Die starken Kompetenzen des Präsidenten führen zu einer Aufweichung<br />
des Kollegialitätsprinzips, das freilich ausdrücklich im Text des Artikels<br />
27 Absatz 3 als Arbeitsauftrag an den Präsidenten genannt wird. Zwar<br />
hat der Präsident nicht etwa besondere Stimmrechte: Die Beschlüsse<br />
werden nach der Geschäftsordnung der Kommission stets mit einfacher<br />
Mehrheit gefasst. Insbesondere seine Macht über die Zuständigkeitsverteilung<br />
innerhalb der Kommission 30 sowie seine Haftung für einzelne<br />
Mitglieder unterstreichen jedoch seine Führungsrolle deutlich.<br />
Mit der Stärkung des Präsidenten und der Einschränkung des Kollegialitätsprinzips<br />
wird der Charakter der Kommission als Regulierungsbehörde<br />
hervorgehoben. Die vertikale, beinahe autoritäre Ausrichtung entspricht<br />
eher der Struktur einer Behörde denn der eines politischen Plenums.<br />
Merkmalen wie Effizienz, Leistungsfähigkeit und Organisationsstraffheit<br />
wurde hier gegenüber der politischen Legitimität des Entscheidungsvorgangs<br />
eindeutig der Vorrang gegeben. Umso weniger<br />
kann die von der Verfassung vorgesehene Kommission als politisches<br />
Gremium eingeschätzt werden.<br />
In der starken Hand des Präsidenten liegt jedoch auf der anderen Seite<br />
tatsächlich die Chance, die Effektivität und Kohärenz der Kommissionsarbeit<br />
zu verstärken. Unstimmigkeiten in der Arbeit der einzelnen<br />
Kommissare werden vermieden, wenn dem Präsidenten das letzte Wort<br />
zukommt. Kritiker werfen den Kommissaren häufig vor, sich durch<br />
nationale Teilinteressen blenden zu lassen oder sich hinter den Mehrheitsbeschlüssen<br />
des Kollegiums zu verstecken, ohne sich wirklich ver-<br />
29<br />
Vgl. Wessels 2004, 171.<br />
30<br />
Vgl. Artikel 350.<br />
Strese 163
Artikel 26-28<br />
Die Europäische Kommission<br />
antwortlich zu fühlen. 31 Ein weiterer Vorteil der neuen Regel ist, dass<br />
mit der Erweiterung seiner Macht auch gleichzeitig die Verantwortlichkeit<br />
des Präsidenten verstärkt wird: Er muss dafür geradestehen, dass<br />
seine Ziele erreicht werden, was ebenfalls eine Qualitäts- und Effektivitätssteigerung<br />
seiner Arbeit mit sich bringen sollte. Letztlich sind es<br />
ungeachtet aller staatsorganisationsrechtlichen Erwägungen solche<br />
Merkmale, die einer Kommission erst den tatsächlichen Respekt unter<br />
den Mitgliedstaaten und unter den Unionsbürgern verschaffen können.<br />
Unikum Kommission<br />
Die Entwicklung, deren Ergebnis sich in der Verfassung niedergeschlagen<br />
hat, hat gezeigt, dass zwar eine gewisse Politisierung der Kommission<br />
gewollt war, letztlich aber das Verlangen nach der Effizienz und<br />
Neutralität der Institution doch größer war. Vor einer Verurteilung dieses<br />
Konzepts vor dem Hintergrund mitgliedstaatlicher Systeme der<br />
Gewaltenteilung, in denen eine Vermischung der Gewalten undenkbar<br />
ist, sei gewarnt: Im europäischen System der checks and balances erfüllt<br />
die Kommission im Interessenausgleich zwischen der Union und den<br />
Mitgliedstaaten mit Erfolg ihre ganz eigene Aufgabe – sie ist eben ein<br />
Unikum.<br />
Literatur: Berg, Carsten/Kampfer, Georg Kristian (Hrsg.) (2004): Verfassung für Europa.<br />
Taschenkommentar für junge Bürgerinnen und Bürger, 1. Aufl. – Bielefeld. Beutler, Bengt/<br />
Bieber, Roland/Epiney, Astrid/Haag, Marcel (Hrsg.) (2001): Die Europäische Union. Rechtsordnung<br />
und Politik, 5. Aufl. – Baden-Baden. Collignon, Stefan (2003): The European Republic – London.<br />
Cromme, Franz (2005): Spezifische Bauelemente der europäischen Verfassung, in: Europa-<br />
Recht, H. 1, Jg. 40, S. 36–53. Fischer, Klemens H. (2005): Der Europäische Verfassungsvertrag.<br />
Texte und Kommentar – Baden-Baden/Wien/Bern. Groeben, Hans von der/Schwarze, Jürgen<br />
(Hrsg.) (2004): Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der<br />
Europäischen Gemeinschaft, 6. Aufl. – Baden-Baden. Oldag, Andreas/Tillack, Hans-Martin<br />
(2003): Raumschiff Brüssel: Wie die Demokratie in Europa scheitert – Berlin. Papier, Hans-<br />
Jürgen (2004): Die Neuordnung der Europäischen Union. Zum Vertrag über eine Verfassung für<br />
Europa, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, H. 1, Jg. 40, S. 753-785. Temple Lang, John<br />
(2004): The main issues after the Convention on the Constitutional Treaty for Europe, in: Fordham<br />
International Law Journal, H. 27, Jg. 25, S. 544–589. Wessels, Wolfgang (2004): Die institutionelle<br />
Architektur der EU nach der europäischen Verfassung: Höhere Entscheidungsdynamik –<br />
neue Koalitionen?, in: Integration, H. 3, Jg. 27, S. 161–175.<br />
31<br />
Vgl. Oldag/Tillack 2003, 76.<br />
164 Strese
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Reinhard Ruge<br />
Artikel 29<br />
DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION<br />
Artikel 29: Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Der Gerichtshof ist nach dem Wortlaut der Verfassung eines der fünf „Organe der<br />
Union“. Wie bei den übrigen Organen legt auch Artikel 29 lediglich den allgemeinen<br />
Rahmen für den Gerichtshof fest, während die Ausgestaltung im Einzelnen<br />
den Artikeln 353 bis 383 in Teil III der Verfassung überlassen wird. Der<br />
Begriff des Gerichtshofs der Union wird als Oberbegriff für die verschiedenen<br />
voneinander unabhängigen Gerichte, die so genannten Spruchkörper, verwendet.<br />
Diese sind der Europäische Gerichtshof, das Gericht und die Fachgerichte.<br />
Das Gericht ist in Streitverfahren regelmäßig die erste Instanz. Seine Urteile<br />
können durch den Europäischen Gerichtshof in zweiter Instanz überprüft werden.<br />
Soweit Fachgerichten eingerichtet werden, sind sie die Eingangsinstanz für<br />
Fragen in bestimmten Sachgebieten. Zweite Instanz ist hierbei das Gericht.<br />
In verschiedenen Klageverfahren bleibt der Gerichtshof erste und letzte<br />
Instanz. Dies sind in erster Linie die Verfahren, welche sich mit der Einhaltung<br />
der Rechte und Pflichten der EU-Organe oder der Mitgliedstaaten befassen. 1<br />
Klagerecht haben nicht nur die EU-Organe und die Mitgliedstaaten, sondern<br />
auch Bürger und Unternehmen, wenn sie durch den Rechtsakt der Union, gegen<br />
den sie klagen, unmittelbar und individuell betroffen sind. 2 Auch das Vorabentscheidungsverfahren,<br />
das heißt die Vorlage einer europarechtlichen Frage<br />
durch ein Gericht eines Mitgliedstaates, bleibt dem Gerichtshof vorbehalten.<br />
Der Europäische Gerichtshof und das Gericht bestehen aus einem Richter je<br />
Mitgliedstaat. Der Europäische Gerichtshof wird zusätzlich von Generalanwälten<br />
unterstützt. Die Mitglieder des Gerichtshofs werden von den Regierungen<br />
der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für sechs Jahre ernannt.<br />
Der Gerichtshof als Motor und Spiegelbild der Integration<br />
Vor Gericht ist es wie auf hoher See: Man ist allein in Gottes Hand.<br />
Durch Redensarten wie diese tröstet mancher Rechtsanwalt seinen Mandanten<br />
– und sich selbst –, wenn ein Gerichtsprozess vor deutschen<br />
Gerichten verloren geht. Dieser Spruch lässt sich aber auch auf die<br />
europäische Gerichtsbarkeit übertragen, denn vielen Bürgern erscheint<br />
die europäische Gerichtsbarkeit undurchsichtig und fremd.<br />
1<br />
Vgl. im Einzelnen Artikel 263.<br />
2<br />
Vgl. im Einzelnen Artikel 270, insbesondere Absatz 4.<br />
Ruge 165
Artikel 29<br />
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
- vereinfachtes Modell -<br />
EU-Bürger/in<br />
Unternehmen<br />
Klage<br />
fühlt sich durch<br />
EU-Recht verletzt<br />
Regelfall<br />
Spezialfall<br />
Gericht<br />
25 Richter<br />
Fachgericht<br />
z.B. für Personalfragen<br />
Stellungnahmen<br />
erstellt<br />
erstellt<br />
8 Generalanwälte<br />
Urteil<br />
Urteil<br />
in wichtigen Fällen<br />
Klage<br />
Europäischer<br />
Gerichtshof<br />
25 Richter<br />
erstellt<br />
Stellungnahmen<br />
Urteil<br />
8 Generalanwälte<br />
EU-Mitgliedstaat<br />
EU-Organ<br />
fühlt sich in seinem<br />
Recht verletzt<br />
Mitgliedstaatliches<br />
Gericht<br />
Urteil wird ggf. in 2. Instanz geprüft durch<br />
Vorlage europarechtlicher Fragen<br />
Grafik: Ann-Kathrin Fischer<br />
Oberstes Ziel der „dritten Gewalt“ auf europäischer Ebene ist es, für<br />
eine einheitliche Anwendung und Auslegung des europäischen Rechts<br />
zu sorgen. Würde man nämlich die Auslegung des europäischen Rechts<br />
den nationalen Gerichten überlassen, so bestünde die Gefahr, dass die<br />
Gerichte jedes einzelnen Mitgliedstaates das europäische Recht jeweils<br />
nach ihren eigenen Vorstellungen auslegen würden. Dies wäre dann aber<br />
der Anfang vom Ende der EU, denn jeder Mitgliedstaat könnte über<br />
seine Gerichte die Regelungen der EU torpedieren und aushebeln. Der<br />
Gewinn der EU besteht aber gerade darin, dass für eine Vielzahl von<br />
Fällen einheitliche Regelungen getroffen werden. Dadurch kann auf der<br />
166 Ruge
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Artikel 29<br />
einen Seite in ganz Europa ein gewisses Mindestmaß an sozialer und<br />
technischer Sicherheit, Umweltschutz und Versorgung mit bestimmten<br />
Produkten und Dienstleistungen („Daseinsvorsorge“) sichergestellt und<br />
damit das große Ziel der Angleichung der Lebensverhältnisse in der<br />
ganzen EU verwirklicht werden. Auf der anderen Seite werden durch<br />
die einheitliche Rechtsanwendung gleiche Wettbewerbsbedingungen<br />
zwischen den Unternehmen aus den Mitgliedstaaten hergestellt. Es soll<br />
verhindert werden, dass ein Mitgliedstaat unter dem Deckmantel angeblich<br />
fehlender Umwelt- oder Sicherheitsstandards fremde Produkte<br />
nicht für den Import zulässt, obwohl der eigentliche Grund ein anderer<br />
ist: nämlich die Abschottung des eigenen Wirtschaftsmarktes vor ausländischen<br />
Produkten. Gleiches gilt für nationale Fördermaßnahmen für<br />
Wirtschaftsunternehmen. Auch hier muss ein europäischer Rechtsrahmen<br />
dafür sorgen, dass nicht Unternehmen aus einem Mitgliedstaat aufgrund<br />
staatlicher Förderung Vorteile gegenüber Unternehmen aus anderen<br />
Mitgliedstaaten erhalten.<br />
Der Gerichtshof als Motor der Integration: Anwendung, Auslegung<br />
und Fortbildung des EU-Rechts<br />
Die europäische Gerichtsbarkeit hat drei Aufgaben: Kontrolle der<br />
Anwendung des Gemeinschaftsrechts, Auslegung des Gemeinschafsrechts<br />
und Fortbildung des Gemeinschaftsrechts. 3<br />
• Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts: Das Europarecht wird<br />
sowohl durch die Organe der EU, zum Beispiel die Kommission<br />
oder den Ministerrat, als auch durch die Behörden der Mitgliedstaaten<br />
angewendet. Daher bezieht sich die Kontrolle der Anwendung<br />
des Europarechts sowohl auf das Verhalten der europäischen Organe<br />
als auch auf das Verhalten der Mitgliedstaaten und ihrer Organe.<br />
So kann etwa der Gerichtshof auf europäischer Ebene von der Kommission<br />
wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht der Union<br />
verhängte Bußgelder aufheben. Auf nationaler Ebene kann er ein<br />
deutsches Importverbot für Bier, das nicht nach dem deutschen<br />
Reinheitsgebot gebraut wurde, für rechtswidrig erklären und eine<br />
Schadensersatzverpflichtung gegen Deutschland wegen Verletzung<br />
europäischen Rechts aussprechen.<br />
3<br />
Vgl. Borchardt 2002, 117 ff.<br />
Ruge 167
Artikel 29<br />
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
• Auslegung des EU-Rechts: Treten bei der Anwendung von Europarecht<br />
durch die EU-Organe oder die Mitgliedstaaten Unklarheiten<br />
auf, legt der Gerichtshof den Inhalt der umstrittenen Rechtsbestimmungen<br />
aus. So befasste sich der Gerichtshof mit der im Einzelnen<br />
umstrittenen Reichweite des Gebots gleicher Bezahlung von Männern<br />
und Frauen für gleiche Arbeit nach Artikel 141 EG-Vertrag. Es<br />
ging dabei um die Frage, ob das Gleichbehandlungsgebot einen<br />
Ausschluss von lediglich teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern von<br />
Leistungen einer Betriebsrente zulässt, und zwar vor dem Hintergrund,<br />
dass 95 % aller Teilzeitbeschäftigten Frauen sind. Eine eindeutige<br />
Aussage enthält die einschlägige Vorschrift des Artikel 141<br />
EG-Vertrag nicht. Der Gerichtshof urteilte, dass auch solche<br />
Ungleichbehandlungen vom Diskriminierungsverbot des Artikel<br />
114 EG-Vertrag erfasst werden, die zwar nicht direkt zwischen<br />
Männern und Frauen unterscheiden, aber im Ergebnis gerade eine<br />
Gruppe besonders treffen würden, hier also die Frauen als überwiegend<br />
in Teilzeit beschäftigte Personen. Den Klägerinnen wurde<br />
im Ergebnis aufgrund des EU-Rechts ein rückwirkendes unbefristetes<br />
Leistungsrecht aus der Betriebsrentenversicherung zugestanden,<br />
obwohl sie nach nationalem Recht davon ausgeschlossen<br />
waren. 4<br />
• Fortbildung des EU-Rechts: Schließlich sind immer wieder Situationen<br />
denkbar, in denen auch die Auslegung des Rechts nicht zu<br />
eindeutigen Ergebnissen führt. Für diesen Fall trifft die europäische<br />
Gerichtsbarkeit, ähnlich wie die nationalen Gerichte, die Aufgabe<br />
der Rechtsfortbildung. Der Gerichtshof schließt in diesem Fall<br />
durch seine Rechtsprechung bestehende Lücken des geschriebenen<br />
Rechts. In zahlreichen Fällen hat sich erwiesen, dass der Gerichtshof<br />
mit seiner Rechtsprechung die Integration der Union vorantreibt.<br />
Er wird daher als Motor der Integration bezeichnet. So zielen<br />
seine Entscheidungen regelmäßig darauf ab, die Arbeitsmöglichkeiten<br />
der EU-Organe zu stärken, Handelshemmnisse oder Diskriminierungen<br />
zwischen den nationalen Staaten abzubauen. Zum Beispiel<br />
hat der EuGH zu Beginn der Geschichte der EU in zwei Urtei-<br />
4<br />
Vgl. EuGH, Urteil vom 9.2.1999, Slg. I-1999, 623, Rs. C-167/97 – Seymour Smith u.a.; Urteile<br />
v. 10.2.2000, Slg. I-2000, 743, Rs. C-234-235/96-Vick&Conze/Deutsche Telekom; Rs. C-<br />
270-271/97 – Deutsche Post/Sievers & Schrage.<br />
168 Ruge
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Artikel 29<br />
len entschieden, dass das Europarecht eine eigenständige Rechtsordnung<br />
darstellt und im Falle des Widerspruchs zwischen europäischem<br />
und nationalem Recht das Europarecht Vorrang vor dem<br />
nationalen Recht besitzt. Steht also eine Vorschrift des Europarechts<br />
im Widerspruch zu einer Vorschrift des nationalen Rechts, so<br />
wird auf den betreffenden Fall ausschließlich das EU-Recht angewendet.<br />
Dieser Grundsatz, der damals in den 1960er Jahren spektakulär<br />
war, ist heute allgemein anerkannt und einer der zentralen<br />
Bausteine der Rechtsordnung der Union. 5 Neben diesen, die EU-<br />
Rechtsordnung stärkenden Urteilen gibt es auch rechtsfortbildende<br />
Entscheidungen des Gerichtshofs zum Abbau von Handelshemmnissen.<br />
So hat der Gerichtshof entschieden, dass Mitgliedstaaten<br />
schadensersatzpflichtig sind, wenn sie EU-Recht nicht in nationales<br />
Recht umsetzen und dadurch Dritten ein Schaden entsteht. Deutschland<br />
wurde zu Schadensersatzleistung verpflichtet, da es – dem<br />
Europarecht zuwider – unter Berufung auf das deutsche Reinheitsgebot<br />
Bier aus Frankreich nicht nach Deutschland importieren ließ<br />
und damit einem französischen Bierproduzenten erheblichen Schaden<br />
zufügte. 6 Diese Schadensersatzpflicht war in den EG-Verträgen<br />
nie vorgesehen.<br />
Schließlich hat der Gerichtshof der EU zu neuen Politikfelder verholfen.<br />
So konnte die Kommission mit Rückendeckung des Gerichtshofs<br />
eine europäische Energiepolitik entwickeln, obwohl das Europarecht<br />
eine Tätigkeit der Union hier nicht vorsah. Die Verfassung hat diesen<br />
neuen Politikbereich nun in Artikel 256 festgeschrieben. 7<br />
Der Gerichtshof als Spiegelbild der Integration<br />
Der Gerichtshof ist aber nicht nur Motor der Integration. Man kann ihn<br />
auch als deren Spiegelbild bezeichnen. Seit den Verträgen von Rom und<br />
Paris in den 1950er Jahren vollzieht sich eine stete Vertiefung der Integration.<br />
Das bedeutet, dass mit jedem neuen Vertrag unter Abänderung<br />
5<br />
Vgl. EuGH, Rs. 26/62, Slg. 1963, 1 – Van Gend & Loos, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251 –<br />
Costa/ENEL; Rs. 106/77, Slg. 1978, 629 – Simmenthal; dazu ausführlich Ruge 2004, 284 f.<br />
6<br />
Vgl. EuGH, Rs. C-46/93, Slg. I-1029 – Brasserie de Pêcheur. Vgl. auch Rs. C-6&9/90, Slg. I-<br />
5357 – Francovich.<br />
7<br />
Vgl. ausführlich zur zentralen Rolle des EuGH bei der Begründung einer EU-Energiepolitik<br />
ohne jegliche Kompetenz im EG-Vertrag Ruge 2004, 106 ff.<br />
Ruge 169
Artikel 29<br />
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
der Grundverträge von Rom und Paris die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten<br />
intensiviert und die Institutionen der EU gestärkt wurden.<br />
Die Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten wurden abgebaut.<br />
8 Entlang des Prozesses der fortwährenden Vertiefung der Union<br />
entwickelte sich der Gerichtshof. Zudem führte die Aufnahme immer<br />
neuer Mitgliedstaaten in die EU zu einer stärkeren Belastung, die in die<br />
Schaffung eines zweiten Spruchkörpers, des Gerichts erster Instanz, im<br />
Jahre 1989 mündete.<br />
Auch nachdem durch den Vertrag von Maastricht 1992 die drei Gemeinschaften<br />
9 und die beiden neuen Bereiche Zusammenarbeit in der Justizund<br />
Innenpolitik sowie Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
unter das Dach der Europäischen Union gestellt worden waren, wurde<br />
die Reichweite der europäischen Urteilssprüche durch den Vertrag von<br />
Amsterdam aus dem Jahr 1996 noch weiter vergrößert 10 und auch der<br />
Vertrag von Nizza brachte 2001 Änderungen organisatorischer Art. So<br />
gestaltete man das Gericht erster Instanz zu einem vom EuGH unabhängigen<br />
Rechtsprechungsorgan der Gemeinschaft um, das in gewissen<br />
Grenzen nunmehr auch in Vorabentscheidungsverfahren entscheidet.<br />
Zudem wurden beim Gericht erster Instanz so genannte Gerichtliche<br />
Kammern für bestimmte Sachbereiche eingerichtet, zum Beispiel für<br />
Personalstreitigkeiten. 11<br />
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Verfassung diese dynamische<br />
Entwicklung fortführt. Eine erhebliche Neuerung bringt die Eingliederung<br />
der Grundrechtecharta. Diese hat bisher keine verbindliche<br />
Rechtswirkung und der Gerichtshof konnte bei seiner bisherigen<br />
Rechtsprechung die Grundrechte der Charta nicht direkt berücksichtigen.<br />
12 Artikel 7 der Verfassung sieht nun vor, dass sich die Gerichtsbarkeit<br />
auch auf die Einhaltung der Grundrechtecharta erstreckt. Begrenzt<br />
wird diese Ausdehnung allein dadurch, dass nach Artikel 111 die dort<br />
genannten Grundrechte nur für die EU-Organe und für die Mitgliedstaaten<br />
bei der Ausführung des EU-Rechts gelten, also nicht für die Anwen-<br />
8<br />
Vgl. zu den rechtlichen Grenzen der Integration Huber 1993 und 2001.<br />
9<br />
Europäische Gemeinschaft, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und EURATOM<br />
10<br />
Vgl. Classen 1999, 73 ff.<br />
11<br />
Vgl. Borchardt 2002, 125 ff. und Sack 2001, 77 ff.<br />
12<br />
Vgl. Borchardt 2002, Rn. 144; Pernice 2000, 847 ff.; Schmitz 2001, 833 ff. Vgl. hierzu auch<br />
den Text von Stephan Korte in diesem Band.<br />
170 Ruge
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Artikel 29<br />
dung nationalen Rechts durch die Mitgliedstaaten. Hier gilt weiterhin<br />
nationales Verfassungsrecht.<br />
Eine grundlegende Änderung bringt die Auflösung des bisherigen „Säulenmodells“<br />
des Maastrichter Vertrags mit sich. Danach variierte die<br />
Rechtsprechung des Gerichtshofs in ihrer Reichweite stark danach, um<br />
welche der drei „Säulen“ der Union es in einem Rechtsstreit ging. Während<br />
in der ersten Säule, den Grundverträgen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,<br />
der Gerichtshof volle Rechtsprechungsgewalt<br />
besaß, war diese für die zweite und dritte Säule, die Bereiche Zusammenarbeit<br />
im Bereich Justiz und Inneres sowie Gemeinsame Außenund<br />
Sicherheitspolitik stark eingeschränkt. Für den Bereich der Justizund<br />
Innenpolitik sind die Beschränkungen nunmehr aufgehoben.<br />
Begrüßenswert ist auch die durch Artikel 358 der Verfassung neu eingeführte<br />
Abgrenzung der Zuständigkeiten von Europäischem Gerichtshof,<br />
Gericht und Fachgerichten. Das Bemühen um klare Kompetenzabgrenzungen<br />
ist ja ein zentrales Anliegen der Verfassungsreform. Dem entspricht<br />
die nunmehr eingeführte Zuständigkeitsvermutung. Danach ist<br />
das Gericht grundsätzlich für alle Klagen zuständig, wenn nicht die Satzung<br />
des Gerichtshofes bestimmte Verfahren oder Sachgebiete dem<br />
Europäischen Gerichtshof vorbehält. Neu sind auch die so genannten<br />
Fachgerichte, die für bestimmte Sachgebiete eingerichtet werden können.<br />
Zudem wird der Instanzenzug klar geregelt. Danach bildet das<br />
Gericht grundsätzlich die erste Instanz. Gegen seine Entscheidungen<br />
gibt es ein Rechtsmittel zum Gerichtshof. Wenn ein Fachgericht erste<br />
Instanz war, dann ist ein Rechtsmittel beim Gericht zulässig.<br />
All diese in der Verfassung vorgeschlagenen Veränderungen stellen eine<br />
Erweiterung der Reichweite der Rechtsprechung des Europäischen<br />
Gerichtshofes dar, stehen aber in einer Kontinuität der kleinen Schritte.<br />
Sie bringen insgesamt mehr Klarheit und Übersichtlichkeit in die den<br />
Gerichtshof betreffenden Regelungen des Europarechts. Trotz dieser<br />
begrüßenswerten Entwicklung wird wohl auch weiterhin gelten: Auch<br />
vor dem veränderten Gerichtshof wird der Rechtsuchende wie auf See<br />
in Gottes Hand sein. Lediglich die See wird überschaubarer sein.<br />
Ruge 171
Artikel 29<br />
Der Gerichtshof der Europäischen Union<br />
Literatur: Borchardt, Wolfgang (2002): Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union,<br />
2. Aufl. – Berlin. Classen, Claus Dieter (1999): Die Jurisdiktion des Gerichtshofs der EG nach<br />
Amsterdam, in: Rechtsschutz und Rechtskontrolle nach Amsterdam (Europa-Recht, Beiheft<br />
1/1999) – Baden-Baden, S. 73–90. Huber, Peter Michael (1993): Maastricht – ein Staatsstreich?,<br />
in: Jenaer Schriften zum Recht, Band 1 – Stuttgart. Huber, Peter Michael (2001):<br />
Recht der Europäischen Integration, 2. Aufl. – München. Pernice, Ingolf (2000): Eine Grundrechtecharta<br />
für die Europäische Union, in: Deutsches Verwaltungsblatt, H. 12, S. 847–859.<br />
Ruge, Reinhard (2004): Die Gewährleistungsverantwortung des Staates und der Regulatory<br />
State – Berlin. Sack, Jörn (2001): Zur künftigen europäischen Gerichtsbarkeit nach Nizza, in:<br />
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, H. 3, S. 77–80. Schmitz, Thomas (2001): Die EU-<br />
Grundrechtecharta aus grundrechtsdogmatischer und grundrechtstheoretischer Sicht, in: Juristenzeitung,<br />
H. 17, S. 833–843.<br />
172 Ruge
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Tobias Schwab<br />
Artikel 30-32<br />
DIE SONSTIGEN ORGANE UND DIE BERATENDEN<br />
EINRICHTUNGEN DER UNION<br />
Artikel 30: Die Europäische Zentralbank<br />
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Zusammen<br />
mit den Zentralbanken der 25 EU-Mitgliedstaaten bildet sie das Europäische<br />
System der Zentralbanken (ESZB). Die Aufgaben des ESZB bestehen<br />
darin, die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen, die Währungsreserven<br />
der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten sowie das reibungslose<br />
Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern und zu überwachen.<br />
Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität in der Europäischen Union sicherzustellen<br />
und – soweit dies ohne eine Beeinträchtigung dieses Hauptziels möglich ist<br />
– die EU bei ihrer Wirtschaftspolitik zu unterstützen. 1<br />
Die Europäische Zentralbank ist ein Organ der Europäischen Union, dessen<br />
Un-abhängigkeit verfassungsrechtlich geschützt ist. 2 Die EZB leitet das Europäische<br />
System der Zentralbanken. Die Amtsgeschäfte der EZB werden durch<br />
das Direktorium erledigt. Dieses besteht aus dem Präsidenten (der Franzose<br />
Jean-Claude Trichet) 3 , dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern. Die<br />
Hauptaufgabe des Direktoriums besteht darin, die vom EZB-Rat getroffenen<br />
Entscheidungen und Leitlinien umzusetzen. Der EZB-Rat setzt sich aus den<br />
sechs Mitgliedern des Direktoriums und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken<br />
der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Es dürfen jedoch nur die Präsidenten<br />
der nationalen Zentralbanken an den Sitzungen des EZB-Rates teilnehmen,<br />
in deren Ländern der Euro als Zahlungsmittel eingeführt wurde. In diesem<br />
Gremium werden die Strategiepapiere entworfen, die der Währungspolitik<br />
in der Europäischen Union die entscheidenden Impulse geben.<br />
Das dritte Beschlussorgan der EZB ist der Erweiterte Rat. Er setzt sich aus dem<br />
Direktorium der EZB sowie den Präsidenten aller nationalen Zentralbanken zusammen,<br />
einschließlich der Präsidenten der Länder der Eurogruppe. Die Gremiumsmitglieder<br />
sind hauptsächlich damit beschäftigt, eine mögliche Erweite-<br />
1<br />
Vgl. Artikel 185 Absatz 2.<br />
2<br />
Vgl. Artikel 30 Absatz 3.<br />
3<br />
Die Entscheidung, Trichet zum EZB-Präsidenten zu wählen, war umstritten. Im Zusammenhang<br />
mit einem Bilanzfälschungsskandal bei der ehemaligen französischen Staatsbank Crédit<br />
Lyonnais war Trichet in die Kritik geraten. Erst als im Juni 2003 seine Unschuld gerichtlich<br />
festgestellt wurde, war der Weg für ihn frei. Mittlerweile genießt Trichet ein hohes Ansehen.<br />
Bislang hat er die Ziele der EZB konsequent verfolgt.<br />
Schwab 173
Artikel 30-32<br />
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
rung des EU-Währungsgebiets zu überprüfen und deren finanzpolitische Auswirkungen<br />
abzuwägen. 4<br />
Artikel 31: Der Europäische Rechnungshof<br />
Der Europäische Rechnungshof mit Sitz in Luxemburg ist der „Wirtschaftsprüfer“<br />
der Europäischen Union. Der derzeitige Präsident Juan Manuel Fabra Vallés<br />
und die weiteren Mitglieder 5 dieses EU-Organs überwachen die Einnahmen<br />
und Ausgaben der Europäischen Union sowie die Wirtschaftlichkeit der EU-<br />
Hausführung. Der Prüfungsauftrag des Rechnungshofes umfasst neben den<br />
Ausgaben und Einnahmen der Europäischen Union auch die Europäischen Entwicklungsfonds<br />
sowie die einzelnen Jahresabschlüsse der Einrichtungen und<br />
Agenturen der EU. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Rechnungshof<br />
Berichte seiner Arbeit, damit die Bürger die europäische Finanzpolitik besser<br />
nachvollziehen können. Bei der Berichterstellung werden die Geldflüsse<br />
vor allem anhand der Kriterien Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit<br />
geprüft. Als externe Kontrollinstitution ist der Rechnungshof politisch<br />
unabhängig.<br />
Artikel 32: Die beratenden Einrichtungen der Union<br />
Ausschuss der Regionen<br />
Der Ausschuss der Regionen (AdR) setzt sich aus 330 Mitgliedern (höchstens<br />
350) zusammen, die sich zu fünf Plenartagungen pro Jahr am Sitz des AdR in<br />
Brüssel treffen. Der AdR ist formal unabhängig und an keinerlei Weisungen<br />
gebunden. Die Mitglieder werden vom Ministerrat auf Vorschlag der jeweiligen<br />
Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit auf fünf Jahre ernannt. Sie<br />
erfüllen eine Doppelfunktion: Zum einen vertreten sie die Interessen der Bürger<br />
aus ihrer Region und zum anderen vermitteln sie Einblicke in nahezu alle<br />
Bereiche der Europäischen Union. Seit dem Vertrag von Nizza müssen die Mitglieder<br />
des AdR ein gewähltes Mandat in ihrem Heimatland besitzen „(...) oder<br />
gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich sein.“ 6<br />
Das Organisationsstatut des AdR sieht die Wahl eines Präsidenten sowie eines<br />
Präsidiums vor. 7 Die Arbeit des AdR beruht im Kern auf der Formulierung von<br />
Stellungnahmen, insbesondere zu Gesetzesinitiativen der Europäischen Kommission.<br />
Seit dem Vertrag von Amsterdam ist auch das Europäische Parlament<br />
verpflichtet, den Ausschuss in Fragen, die regionale Interessen berühren, anzu-<br />
4<br />
Vgl. Scheller 2000, 143.<br />
5<br />
Der Rechnungshof besteht laut Artikel 31 Absatz 3 aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedsland.<br />
6<br />
Vgl. Artikel 32 Absatz 2.<br />
7<br />
Vgl. auch Artikel 387.<br />
174 Schwab
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Artikel 30-32<br />
hören. Die Zuständigkeiten erstrecken sich auf vielfältige Belange der lokalen<br />
und regionalen Gebietskörperschaften, wie beispielsweise Verkehr, Sozialpolitik,<br />
Kultur, Gesundheitswesen oder transeuropäische Netze. 8<br />
In allen weiteren Politikfeldern kann der Ausschuss angehört werden. Zudem<br />
hat er die Möglichkeit, Initiativstellungnahmen und Entschließungen zu verabschieden.<br />
9 Das Instrument der Stellungnahme verfolgt dabei zwei grundlegende<br />
Ziele: Zum einen soll über die Einhaltung des Subsidiaritätsziels<br />
gewacht und zum anderen sollen regionalspezifische politische Erfahrungen in<br />
den Entscheidungsfindungsprozess eingebracht werden. Letztendlich soll der<br />
AdR ein bürgernahes Europa fördern (sog. „Bottom-up-Ansatz“). 10<br />
Wirtschafts- und Sozialausschuss<br />
Die zweite beratende Einrichtung der Europäischen Union ist der Wirtschaftsund<br />
Sozialausschuss (WSA). Als beratende Einrichtung und Repräsentant von<br />
Vertretern sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher und kultureller Lobbyisten verfolgt<br />
der WSA zwei grundlegende Aufgaben: Einerseits nimmt er durch Stellungnahmen<br />
beratend am Gesetzgebungsverfahren der EU teil. Andererseits<br />
sollen seine Mitglieder durch ihre Fachkompetenz die Entscheidungsfindung<br />
verbessern.<br />
Dem WSA gehören derzeit 330 Mitglieder (maximal 350 Mitglieder) an, die<br />
auf fünf Jahre ernannt sind. Die Mitglieder des WSA organisieren sich in drei<br />
Gruppen: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und verschiedene Interessen. Der WSA<br />
wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und ein Präsidium und gibt sich eine<br />
eigene Geschäftsordnung. Ebenso wie der AdR besteht die Hauptaufgabe des<br />
WSA vor allem in der Abgabe von Stellungnahmen. Diese betreffen die wirtschaftlichen<br />
und sozialen Interessen der Europäischen Union. 11<br />
Kommission, Parlament und Ministerrat – ist das alles?<br />
„Bei der künftigen europäischen Verfassung geht es um drei zentrale Aspekte.<br />
[...] um ein Mehr an Transparenz, an Bürgernähe und an Demokratie<br />
in Europa“, sagte Joschka Fischer am 26. Juni 2003 vor dem Deutschen<br />
Bundestag. Tatsächlich sind Transparenz, Bürgernähe und eine<br />
8<br />
Vgl. Artikel 388.<br />
9<br />
Vgl. Weidenfeld/Wessels 2002, 144.<br />
10<br />
Der „Bottom-up-Ansatz“ soll zum Ausdruck bringen, dass politische Entscheidungen aus einer<br />
„teilnehmenden, mit individuellen politischen Interessen verbundenen Akteursperspektive“<br />
betrachtet werden. Vgl. Nohlen/Schultze 2002, 86.<br />
11<br />
Vgl. Artikel 389 bis 392.<br />
Schwab 175
Artikel 30-32<br />
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Demokratisierung Europas die drei Prämissen, auf die es in Zukunft<br />
ankommt. Damit diese Visionen aber nicht wie leere Seifenblasen zerplatzen,<br />
darf man das Scheinwerferlicht nicht ausschließlich auf die<br />
Europäische Kommission, das Europäische Parlament oder den Ministerrat<br />
richten. Vielmehr stecken gerade hinter den Artikeln 30 bis 32<br />
spannende (sonstige) Organe und beratende Einrichtungen der Europäischen<br />
Union, die leicht übersehen werden. Aus politikwissenschaftlicher<br />
Sicht stellen sich gerade hier interessante Fragen: Verändert sich<br />
die Europäische Zentralbank durch die Verfassung? Warum sichert die<br />
Unabhängigkeit des Rechnungshofs die Funktionsfähigkeit und Demokratie<br />
in der Europäischen Union? Erreicht der Ausschuss der Regionen<br />
mehr „Bürgernähe der EU“? Können die beratenden Einrichtungen politisch<br />
gesteuert werden?<br />
Europäisierung und Regionalisierung – Organe und Einrichtungen<br />
im Mehrebenensystem<br />
Legt man dem institutionellen Aufbau der Europäischen Union das Modell<br />
eines Systems mit mehreren Ebenen 12 zu Grunde, so vollzieht sich<br />
europäische Politik in einem Spannungsverhältnis zwischen Europäisierung<br />
und Regionalisierung. Europäisierung bezeichnet die seit über 50<br />
Jahren andauernde Verlagerung von immer neuen Politikfeldern auf die<br />
europäische Entscheidungsebene. Dieser Prozess vollzieht sich deshalb,<br />
weil politische Entscheidungen immer mehr Komplexität und internationale<br />
Reichweite aufweisen und nationale Lösungen oftmals zu kurz<br />
greifen. Es ist also ein Regieren jenseits des Nationalstaates erforderlich.<br />
13 Dies lässt sich sehr gut an der Geldpolitik der Europäischen<br />
Union ablesen: Waren geldpolitische Entscheidungen in den 1950er<br />
Jahren noch Sache der einzelnen Nationalstaaten, garantiert heute die<br />
Europäische Zentralbank die Preisstabilität in Europa und unterstützt<br />
die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union.<br />
Europäische Zentralbank – formaler Status ist unklar<br />
Mit dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs der Europäischen<br />
Union zum Start der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion<br />
entstand am 1. Januar 1998 die Europäische Zentralbank. Sie hat die<br />
Geldpolitik auf europäischer Ebene in den vergangenen Jahren stetig<br />
12<br />
Vgl. Nohlen/Schultze 2002, 517 f.<br />
13<br />
Vgl. Zürn 1998.<br />
176 Schwab
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Artikel 30-32<br />
begleitet und trägt einen nicht unwesentlichen Anteil an deren Erfolg.<br />
Die Einführung des Euro ist hierfür ein wichtiger Indikator.<br />
Alles in allem bringt die Europäische Verfassung bei den Vorschriften<br />
zur Europäischen Zentralbank aber keine wesentlichen Änderungen des<br />
bisherigen Standes. Allein der formale Status der Europäischen Zentralbank<br />
ist unklar. So wird sie in der Verfassung als „Organ“ bezeichnet und<br />
findet sich konsequenterweise in dem Abschnitt „Die sonstigen Organe<br />
und die beratenden Einrichtungen der Union“. Dies steht im Widerspruch<br />
zum ursprünglichen Vertrag zur Gründung der Europäischen<br />
Gemeinschaft (EG-Vertrag). Dort fehlt die Bezeichnung „Organ“. 14 Der<br />
Hinweis auf diesen Unterschied mag zunächst als kleinlich erscheinen.<br />
Dennoch berührt gerade dieser Unterschied ein zentrales Merkmal der<br />
Europäischen Zentralbank, nämlich deren Unabhängigkeit. Gemäß Artikel<br />
18 Absatz 3 der Verfassung sind Organe der Europäischen Union verpflichtet,<br />
loyal zusammenzuarbeiten. „Der Begriff ‚loyale Zusammenarbeit’<br />
suggeriert aber eine gewisse Unterordnung unter gemeinsame<br />
Ziele, die von den Regierungen festgelegt werden. Hieraus könnte in<br />
künftigen politischen Debatten eine stärkere, die Gewährleistung der<br />
Preisstabilität schwächende Verpflichtung des ESZB abgeleitet werden,<br />
die Wirtschaftspolitik der Union zu unterstützen“, heißt es in einer Stellungnahme<br />
des Bundesverbandes Deutscher Banken zur europäischen<br />
Verfassung. 15 Es bleibt zu hoffen, dass die Unabhängigkeit der Europäischen<br />
Zentralbank auch zukünftig gewahrt bleiben wird.<br />
Demokratie braucht Kontrolle – ohne Rechnungshof ist effektive<br />
europäische Politik undenkbar<br />
Die Entstehungsgeschichte des Rechnungshofes ist eng verknüpft mit<br />
der vertraglichen Entwicklung der Europäischen Union. Mit dem Vertrag<br />
von Brüssel vom 22. Juli 1975 wurde der Rechnungshof gegründet.<br />
Den Status eines vollwertigen EU-Organs erhielt er jedoch erst im<br />
Februar 1992 durch den Vertrag von Maastricht. Der nächste Meilenstein<br />
war die Ausweitung der Kontrollbefugnis auf die Bereiche der<br />
Außen- und Sicherheitspolitik sowie auf die Politikfelder Justiz und<br />
Inneres 16 , welche durch den Vertrag von Amsterdam am 2. Oktober<br />
1997 vollzogen wurde.<br />
14<br />
Vgl. Artikel 107 Absatz 2 EG-Vertrag.<br />
15<br />
Bundesverband Deutscher Banken 2004.<br />
16<br />
Diese Politikfelder werden auch als die 3. Säule der EU bezeichnet. Vgl. Wessels 2002, 329 f.<br />
Schwab 177
Artikel 30-32<br />
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Kontrolle ist ein elementarer Bestandteil einer funktionsfähigen Demokratie.<br />
Das gilt auch für die Europäische Union. Im Gefüge ihrer Einrichtungen<br />
nimmt der Rechnungshof vor allem die Überprüfung der<br />
Einnahmen und Ausgaben vor. Langfristiges Ziel der Finanzkontrolleure<br />
ist es dabei, das Finanzmanagement der Europäischen Union zu verbessern.<br />
Auch werden durch Berichte des Rechnungshofes die Unionsbürger<br />
über die Verwendung ihrer Steuergelder informiert. Schließlich<br />
geht es darum, die Steuergelder der Bürger nicht nur optimal, sondern<br />
auch transparent einzusetzen. Die Unabhängigkeit des Rechnungshofs<br />
hat einen hohen Stellenwert und ist Teil und Ausdruck einer modernen<br />
Demokratie. 17 Der Etat des Rechnungshofes ist verglichen mit anderen<br />
Ausgabenposten der Europäischen Union vergleichsweise gering. Für<br />
ihre umfassenden Aufgaben standen den Prüfern im Jahr 2004 etwa 0,1<br />
Prozent (rund 95 Millionen Euro) der Gesamtausgaben der EU zur Verfügung.<br />
18<br />
Ausschuss der Regionen und Wirtschafts- und Sozialausschuss<br />
– „Optimale Betriebsgröße“ fehlt!<br />
Neben der Europäischen Zentralbank und dem Europäischen Rechnungshof<br />
gibt es zwei beratende Einrichtungen der Europäischen<br />
Union, die oftmals leichtfertig übersehen werden: der Ausschuss der<br />
Regionen und der Wirtschafts- und Sozialausschuss. Eingangs wurde<br />
verdeutlicht, dass europäische Politik im Spannungsfeld zwischen<br />
Supranationalisierung und Regionalisierung stattfindet. Die Bedeutung<br />
von Supranationalisierung wurde bereits ausführlich beschrieben.<br />
Regionalisierung umschreibt die Tatsache, dass Politik auf supranationaler<br />
Ebene immer auch Auswirkungen auf die regionale Politik der<br />
einzelnen Mitgliedstaaten hat, beziehungsweise regional umgesetzt<br />
werden muss. Demnach findet Politik in Europa zumeist supranational<br />
und regional statt, was wiederum die Existenz eines Ausschusses der<br />
Regionen im Mehrebenensystem der Europäischen Union rechtfertigt.<br />
Seit dem Bestehen der Europäischen Union hat es immer wieder Dis-<br />
17<br />
Die Unabhängigkeit schlägt sich vor allem im Status der Mitglieder des Rechnungshofs nieder.<br />
So dürfen sie nach Artikel 385 Absatz 6 nur dann entlassen werden, wenn der Gerichtshof<br />
auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, dass ein Mitglied, „(...) nicht mehr die erforderlichen<br />
Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr<br />
nachkommt.“<br />
18<br />
Für einen Gesamtüberblick über den Rechnungshof vgl. Europäische Union 2004.<br />
178 Schwab
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Artikel 30-32<br />
kussionen darüber gegeben, welche Rolle die Nationalstaaten und deren<br />
Regionen spielen. In der Politikwissenschaft wird in diesem Zusammenhang<br />
oftmals über die Effektivität europäischen Regierungshandelns<br />
19 gesprochen. Bereits heute werden drei Viertel aller Rechtsvorschriften<br />
der Europäischen Union auf regionaler Ebene umgesetzt.<br />
Demzufolge war es aus dem Blickwinkel der lokalen und regionalen<br />
Gebietskörperschaften eine logische Konsequenz, mehr Mitsprache einzufordern.<br />
Es war die Geburtsstunde des Ausschusses der Regionen. Er<br />
wurde durch den Vertrag über die Europäische Union ins Leben gerufen<br />
und hielt im März 1994 seine erste Versammlung ab. 2004 feierte der<br />
AdR sein zehnjähriges Bestehen.<br />
Für die Zeit bis 2006 hat der AdR im Jahr 2002 ein Papier mit seinen<br />
Schwerpunkten veröffentlicht. Dazu zählt auch die Erweiterung der<br />
Europäischen Union. „Als Vertretungsinstanz der Kommunen und<br />
Regionen betrachtet der Ausschuss der Regionen die Erweiterung und<br />
die europäischen Entscheidungsstrukturen als zwei seiner Prioritäten.<br />
Beide wirken sich auf andere Themen aus, z.B. den sozialen, wirtschaftlichen<br />
und territorialen Zusammenhalt, weshalb dieses Thema auch zu<br />
den Prioritäten des AdR gehört“ 20 , so der amtierende Präsident Albert<br />
Bore.<br />
Der Ausschuss der Regionen soll sich in Zukunft aus bis zu 350 Mitgliedern<br />
zusammensetzen. Ferner wird die Amtszeit der Repräsentanten im<br />
Ausschuss der Regionen der Verweildauer der Europaparlamentarier<br />
angepasst und beträgt fortan fünf Jahre. Das sind im Wesentlichen die<br />
in der Verfassung vorgesehenen Veränderungen. Und genau an dieser<br />
Stelle lässt sich einiges an Kritik äußern. Wie kann ein beratendes Gremium<br />
von 350 Mitgliedern effektiv arbeiten, geschweige denn Entscheidungen<br />
treffen? Die stockende Arbeit der Kommission zur Reform<br />
der bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland (sog. Föderalismuskommission)<br />
verdeutlichte, wie schwer es schon bei 16 Ländervertretern ist,<br />
Reformen auf den Weg zu bringen. Es ist schwer vorstellbar, dass 350<br />
Vertreter regionaler Gebietskörperschaften sich in wichtigen Fragen<br />
einig werden, beziehungsweise auch einmal über ihren eigenen Schatten<br />
springen, um getroffene Entscheidungen zu akzeptieren. Hinzu<br />
kommt, dass es nicht zusammenpasst, wenn auf nationalstaatlicher<br />
19<br />
Vgl. Scharpf 1999.<br />
20<br />
Europäische Union/Ausschuss der Regionen: Die politischen Prioritäten des Ausschusses der<br />
Regionen für den Zeitraum 2002 bis 2006, 1 f.<br />
Schwab 179
Artikel 30-32<br />
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Ebene darüber nachgedacht wird Verflechtungen abzubauen, wir uns<br />
aber auf europäischer Ebene ein Gremium leisten, das die Interessen<br />
von 350 regionalen Gebietskörperschaften äußert und in den Entscheidungsfindungsprozess<br />
einfließen lässt.<br />
Es soll hier nicht die These vertreten werden, der Ausschuss der Regionen<br />
sei überflüssig. Es ist jedoch angebracht, die beratende Einrichtung<br />
nicht weiter zu vergrößern, sondern vielmehr über eine „optimale<br />
Betriebsgröße“ nachzudenken, das heißt auch eine Verkleinerung des<br />
Ausschusses der Regionen in Erwägung zu ziehen.<br />
Ähnliches gilt für den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Auch hier sind<br />
in Zukunft 350 Mitglieder vorgesehen. Der WSA wurde 1957 im Zuge<br />
der Römischen Verträge gegründet. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte<br />
hat sich seine Arbeit wesentlich verändert. War er anfangs eine<br />
Art Lobbyvertretung unterschiedlicher Interessen, findet Interessenvertretung<br />
heute oftmals direkt in den zahlreichen Ausschüssen der Europäischen<br />
Union statt. In Zukunft wollen sich die Mitglieder des WSA<br />
verstärkt als Sprachrohr der engagierten Bürgergesellschaft etablieren. 21<br />
Die Ausschussmitglieder haben sich hohe Ziele gesteckt: „Der Ausschuss<br />
verhilft der Zivilgesellschaft zu mehr Wissen über Europa, bringt<br />
ihr das europäische Einigungswerk näher und veranlasst sie, sich stärker<br />
darin zu engagieren (...)“ 22 , heißt es in einer Selbstdarstellung des<br />
WSA.<br />
Die Europäische Union ist unsere Zukunft<br />
Um die Diskussion über die Rolle der sonstigen Organe und beratenden<br />
Einrichtungen auf den Punkt zu bringen, bleibt festzuhalten, dass die<br />
Mitglieder des Verfassungskonvents versucht haben, die genannten<br />
Organe und Einrichtungen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei<br />
haben sie jedoch übersehen, dass es an der einen oder anderen Stelle<br />
angebracht gewesen wäre, mehr Reformbereitschaft an den Tag zu<br />
legen.<br />
So bleibt auf den ersten Blick bei den sonstigen Organen und beratenden<br />
Einrichtungen alles beim Alten. Das mag bei der Europäischen Zentralbank<br />
und beim Rechnungshof durchaus berechtigt sein. Beim Ausschuss<br />
der Regionen und beim Wirtschafts- und Sozialausschuss entsteht<br />
in der Verfassung der Eindruck, dass die Konventsmitglieder als<br />
21<br />
Vgl. Weidenfeld/Wessels 2002, 361 f. und zum Stichwort „Interessenvertretung“ ebd., 267 f.<br />
22<br />
Vgl. http://www.esc.eu.int/pages/memo_ces_de.pdf (20.06.2005).<br />
180 Schwab
Sonstige Organe und beratende Einrichtungen<br />
Artikel 30-32<br />
Tiger gestartet und am Ende nur als Bettvorleger gelandet sind. Hoffen<br />
wir alle, dass die Mitglieder im Ausschuss der Regionen und im Wirtschafts-<br />
und Sozialausschuss ihrer Verantwortung gerecht werden und<br />
individuelle Bedenken zurückstecken können. Vielleicht müssen die<br />
Vertreter in den beratenden Einrichtungen von Zeit zu Zeit auch an ihre<br />
Visionen und Ziele erinnert werden, die sie im Internet veröffentlichen.<br />
Letztendlich wird eine Verfassung, bestehend aus trockenen und nüchtern<br />
klingenden Sätzen in Artikeln nie die Ziele von Transparenz, Bürgernähe<br />
und Demokratie leisten und vor allem ausfüllen können. Hier<br />
sind die Bürger Europas gefordert. Sie selbst müssen sich mit den Institutionen<br />
der Europäischen Union auseinander setzen, und dazu zählen<br />
eben nicht nur die Kommission, das Parlament und der Ministerrat, sondern<br />
auch die sonstigen Organe und beratenden Einrichtungen. Eine<br />
spannende Reise in die Politik, die sich durchaus lohnt.<br />
Literatur: Bundesverband Deutscher Banken (2004): Die europäische Verfassung – ein akzeptabler<br />
Kompromiss, unter: http://www.bdb.de/finanzmaerkte/index.asp?channel=121210&art=<br />
1193&ttyp=1&tid=1553 (20.06.2005). Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (2003):<br />
Informationen zur politischen Bildung. Europäische Union – Bonn. Europäische Union (2004):<br />
Der Europäische Rechnungshof. Optimierung des Finanzmanagements in der Europäischen<br />
Union – Luxemburg. Nohlen, Dieter/Schultze, Rainer-Olaf (Hrsg.) (2002): Lexikon der Politikwissenschaft,<br />
Band 1 und Band 2 – München. Scharpf, Fritz W. (1999): Regieren in Europa –<br />
Frankfurt/M. et al. Scheller, Hanspeter K. (2000): Die Europäische Zentralbank – Frankfurt/M.<br />
Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2002): Europa-Handbuch – Bonn. Weidenfeld, Werner/<br />
Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (2002): Europa von A bis Z – Bonn. Wessels, Wolfgang (2002): Das<br />
politische System der EU, Weidenfeld 2002, in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2002): Europa-<br />
Handbuch – Bonn, S. 329–347. Zürn, Michael (1998): Regieren jenseits des Nationalstaates –<br />
Frankfurt/M.<br />
Internetquellen:<br />
Ausschuss der Regionen: http://europa.eu.int/institutions/cor/index_de.htm<br />
Bundesverband Deutscher Banken: http://www.bdb.de<br />
Europäischer Rechnungshof: http://www.eca.eu.int<br />
Europäische Zentralbank: http//www.ecb.int<br />
Wirtschafts- und Sozialausschuss: http://www.esc.eu.int/pages/intro_de.htm<br />
Schwab 181
Artikel Stefan Evers 33-39<br />
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 33-39<br />
AUSÜBUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION<br />
– GEMEINSAME BESTIMMUNGEN<br />
Artikel 33: Die Rechtsakte der Union<br />
Auch die besten Handwerker können ohne das richtige Werkzeug nicht gut arbeiten.<br />
Die Artikel 33 bis 39 erlauben einen Blick in den Werkzeugkasten der EU-<br />
Organe. Hier steht, wie aus politischem Willen europäisches Recht werden kann:<br />
Bezeichnung Beschreibung Beispiel<br />
Europäisches<br />
Gesetz<br />
Europäisches<br />
Rahmengesetz<br />
Europäischer<br />
Beschluss<br />
Europäische<br />
Verordnung<br />
Empfehlungen<br />
und Stellungnahmen<br />
Rechtlich allgemein verbindlicher Gesetzgebungsakt<br />
mit allgemeiner Geltung und<br />
direkter Wirkung für jedermann (früher:<br />
Verordnung)<br />
Rechtlich hinsichtlich seines Ziels verbindlicher<br />
Gesetzgebungsakt; die Mitgliedstaaten<br />
wählen Form und Mittel seiner<br />
Umsetzung (früher: Richtlinie)<br />
Rechtlich verbindlicher Rechtsakt ohne<br />
Gesetzescharakter von allgemeiner oder<br />
beschränkter Geltung; dient insb. der<br />
Kommission als Verwaltungsinstrument 3<br />
Allgemein geltender Rechtsakt ohne<br />
Gesetzescharakter; dient v.a. der Durchführung<br />
von Gesetzgebungsakten. Allgemeine<br />
Verbindlichkeit (wie beim Gesetz)<br />
und direkte Wirkung ist möglich, aber<br />
auch Verbindlichkeit des zu erreichenden<br />
Ziels (wie beim Rahmengesetz); darf dem<br />
zugrunde liegenden Gesetzgebungsakt<br />
nicht widersprechen (vgl. Art. 35 ff.)<br />
Nur politisch, nicht rechtlich verbindliche<br />
Rechtsakte der Institutionen (vgl. Art. 35)<br />
EU-Verordnung zur beschleunigten<br />
Einführung von Doppelhüllen-Tankern<br />
1<br />
➨ Verbot von Tankern wie der<br />
„Prestige“ bis 2015<br />
EU-Richtlinie zum<br />
Urheberrecht 2<br />
➨ führte zur Novelle des<br />
Urheberrechtsgesetzes<br />
Europäischer Beschluss der<br />
Kommission über die Zulässigkeit<br />
von Staatsbeihilfen<br />
(Subventionen) 4<br />
Europäische Verordnung über<br />
Beihilfen für benachteiligte<br />
landwirtschaftliche Betriebe 5<br />
Stellungnahme des EU-Parlamentes<br />
zur Unterstützung für<br />
Gentechnik in der Landwirtschaft<br />
1<br />
Vgl. http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/pdf/2002/de_2002R0417_do_001.pdf.<br />
2<br />
Vgl. http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/pdf/2001/de_2001L0029_do_001.pdf.<br />
3<br />
Vgl. Artikel 35.<br />
4<br />
Vgl. Artikel 168.<br />
5<br />
Vgl. Artikel 230.<br />
182<br />
Evers
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 33-39<br />
In der täglichen Praxis kommen viele hier nicht vorgesehene Rechtsakte vor (so<br />
genannte atypische Rechtsakte wie z.B. Entschließungen und Schlussfolgerungen).<br />
Dies ist grundsätzlich erlaubt, um die Flexibilität der europäischen Institutionen<br />
nicht zu gefährden. Die Gesetzgebung darf jedoch nicht davon betroffen<br />
sein. Die Transparenz des Verfahrens geht hier der Flexibilität der beteiligten<br />
Organe vor.<br />
Artikel 34: Gesetzgebungsakte<br />
Der Artikel beschreibt das Verfahren der Gesetzgebung (gilt nur für Europäische<br />
Gesetze und Rahmengesetze): Das so genannte Mitentscheidungsverfahren<br />
6 ist das Regelverfahren der europäischen Gesetzgebung. Auf Initiative der<br />
Kommission erlassen Ministerrat und Parlament gleichberechtigt Europäische<br />
Gesetze und Rahmengesetze. Das Mitentscheidungsverfahren umfasst insgesamt<br />
eine, zwei oder (nach einem Vermittlungsverfahren) drei Lesungen (siehe<br />
das folgende Schaubild).<br />
Es gibt auch Ausnahmen vom „Vorschlagsmonopol“ der Kommission: Zum<br />
Beispiel können Rechtsakte auch auf Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten<br />
erlassen werden. 7 Die Regel der Mitentscheidung kennt ebenfalls viele Ausnahmen.<br />
Deshalb erklärt Absatz 2 besondere Gesetzgebungsverfahren für<br />
zulässig.<br />
Artikel 35: Rechtsakte ohne Gesetzescharakter<br />
Europäische Verordnungen und Beschlüsse werden nach dem Prinzip der Gewaltenteilung,<br />
vor allem von Organen mit exekutiven Befugnissen, erlassen:<br />
Kommission und Ministerrat. Weitere Vorschriften enthalten die Einzelheiten<br />
darüber, in welchen Fällen sie zu erlassen sind. 8 Artikel 34 enthält außerdem<br />
Bestimmungen über die Zulässigkeit von Empfehlungen. Die Stellungnahme ist<br />
nicht erwähnt, steht aber allen Institutionen als Instrument zur Verfügung.<br />
6<br />
Vgl. Artikel 396.<br />
7<br />
Artikel 264.<br />
8<br />
Vgl. Artikel 36.<br />
Evers 183
Artikel 33-39<br />
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Europäisches Parlament<br />
Ministerrat<br />
Aufforderung zur Abgabe von<br />
Vorschlägen<br />
Kommission<br />
Vorschläge<br />
Europäisches Parlament (Erste Lesung)<br />
Standpunkt<br />
Ministerrat (Erste Lesung)<br />
Annahme<br />
Keine Einigung<br />
Rechtsakt<br />
Standpunkt<br />
Europäisches Parlament (Zweite Lesung)<br />
Annahme Abänderung Ablehnung<br />
Rechtsakt<br />
Ministerrat (Zweite Lesung)<br />
Annahme<br />
Ablehnung<br />
Rechtsakt<br />
Vermittlungsausschuss<br />
Gemeinsamer Entwurf<br />
Kein gemeinsamer Entwurf<br />
Annahme<br />
(EP und Ministerrat)<br />
Rechtsakt<br />
Ablehnung<br />
(EP oder Ministerrat)<br />
= Rechtsakt<br />
erlassen<br />
= Rechtsakt<br />
gescheitert<br />
184<br />
Evers
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 33-39<br />
Artikel 36: Delegierte Verordnungen<br />
Hier wird eine neue Art von Rechtsakt eingeführt: die „Delegierte Verordnung“.<br />
Der Kommission kann die Befugnis übertragen werden, eine solche<br />
Delegierte Verordnung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht<br />
wesentlicher Vorschriften eines Gesetzgebungsaktes zu erlassen. Das heißt,<br />
vom Gesetzgeber wird erwartet, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Die<br />
Regelung technischer Detailfragen kann (und soll) er der Kommission überlassen.<br />
Natürlich muss dabei die Balance zwischen den gesetzgebenden Organen<br />
und der Kommission gewahrt bleiben. Darum gilt, dass die Grenzen der<br />
Übertragung immer aus den zugrunde liegenden Gesetzen und Rahmengesetzen<br />
hervorgehen müssen. Der so genannte Wesentlichkeitsvorbehalt besagt:<br />
die grundlegenden Bestimmungen eines Gesetzgebungsakts darf nur der<br />
Gesetzgeber selbst festlegen. Die Kommission darf nicht an die Stelle des<br />
Gesetzgebers treten (Gewaltenteilung!), sie soll ihn lediglich ergänzen. Um<br />
die Ausübung der übertragenen Befugnisse kontrollieren zu können, gibt<br />
Absatz 2 dem Gesetzgeber zwei Instrumente an die Hand: Widerrufsrecht und<br />
Schweigefrist. Das Widerrufs- oder Evokationsrecht besagt, dass der Gesetzgeber<br />
sich in dem zugrunde liegenden Rechtsakt vorbehalten kann, die Übertragung<br />
von Befugnissen zu widerrufen. Dies könnte etwa dann der Fall sein,<br />
wenn diese Befugnisse überschritten werden oder es um Fragen geht, die sich<br />
als politisch sehr heikel erweisen. Die Schweigefrist macht das Inkrafttreten<br />
einer Delegierten Verordnung von der stillschweigenden Zustimmung von<br />
Ministerrat und Parlament abhängig. Nur wenn keines der beiden Organe<br />
innerhalb einer vorher festgelegten Frist widerspricht, tritt die Delegierte Verordnung<br />
in Kraft.<br />
Artikel 37: Durchführungsrechtsakte<br />
Gesetze und Rahmengesetze bedürfen zu ihrer Umsetzung in die „Praxis“<br />
meistens weiterer Rechtsakte, so genannter Durchführungsrechtsakte. Artikel<br />
36 legt hierfür die allgemeine Regel fest, wonach diese Rechtsakte von den<br />
Mitgliedstaaten erlassen werden (nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsordnung).<br />
Absatz 2 benennt die häufige Ausnahme von dieser Regel. Erweist sich<br />
eine Durchführung durch die Union als sinnvoll, können durch die zugrunde<br />
liegenden Rechtsakte der Kommission (in Ausnahmefällen, etwa der GASP,<br />
auch dem Ministerrat) Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese<br />
Befugnisse werden in der Form von (Durchführungs-)Verordnungen und<br />
(Durchführungs-)Beschlüssen ausgeübt. Natürlich muss die Kommission dabei<br />
kontrolliert werden. Das zu diesem Zweck anzuwendende Verfahren legt die<br />
Verfassung noch nicht fest: Ein Europäisches Gesetz wird später eine Regelung<br />
treffen.<br />
Evers 185
Artikel 33-39<br />
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 38: Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union<br />
Dieser Artikel ermahnt die Organe, den so genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
zu berücksichtigen. Der besagt, dass Zweck und Mittel der Rechtsetzung<br />
in angemessener Relation zueinander stehen müssen. Ferner enthält<br />
Artikel 37 den Grundsatz, dass Rechtsakte nicht ohne eine Begründung erfolgen<br />
sollen. Jeder Bürger muss verstehen können, warum ein bestimmter<br />
Rechtsakt ergeht.<br />
Artikel 39: Veröffentlichung und Inkrafttreten<br />
Artikel 39 enthält detaillierte Formvorschriften, welche für die Gewährleistung<br />
der Rechtssicherheit von Bedeutung sind (zum Beispiel wann genau ein<br />
Rechtsakt in Kraft tritt).<br />
Es gibt nichts Komplizierteres als eine Vereinfachung<br />
„Die Union muss demokratischer, transparenter und effizienter werden.“<br />
Im Geiste der Erklärung von Laeken 9 erarbeitete die Arbeitsgruppe IX<br />
„Vereinfachung der Verfahren“ des Konvents Vorschläge zur Reform der<br />
verschiedenen Handlungsformen der Union. Man war sich einig: Das<br />
System der Union war für den Bürger kaum verständlich. 10 Seine Undurchschaubarkeit<br />
stellte einen hässlichen Makel für das Demokratieniveau<br />
der Gemeinschaft dar. Wie sollte der Bürger eine Union kritisieren<br />
und kontrollieren können, wenn ihre zahlreichen Rechtsakte und<br />
Rechtsetzungsverfahren für ihn nicht nachvollziehbar waren? 11 An diesem<br />
Punkt setzte die Gruppe an und gelangte schnell zu der Feststellung:<br />
„Es gibt nichts Komplizierteres als eine Vereinfachung.“<br />
Die künftigen Verfahren sollen dem dreifachen Anspruch der Erklärung<br />
von Laeken gerecht werden. Das erreichte Maß an Demokratie, Transparenz<br />
und Effizienz ist somit der Indikator für den Erfolg der Verfassung.<br />
Dieser Erfolg ist an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft:<br />
Die rechtlich-politische Wirkung jedes Rechtsaktes muss seiner demokratischen<br />
Legitimität entsprechen (eine Selbstverständlichkeit). Da die<br />
nationalen Regierungen diese Legitimität nur begrenzt vermitteln können,<br />
sind demnach vor allem das Europäische Parlament und die nationalen<br />
Volksvertretungen bei der Rechtsetzung stärker zu berücksichti-<br />
9<br />
Vgl. Europäischer Rat 2001.<br />
10<br />
Vgl. den Schlussbericht der Gruppe IX „Vereinfachung“ (CONV 424/02), 1.<br />
11<br />
Vgl. Sobotta 2001, 79 f.<br />
186<br />
Evers
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 33-39<br />
gen. Die verschiedenen Rechtsakte müssen darüber hinaus im Sinne des<br />
Grundsatzes der Gewaltenteilung einer klaren Hierarchie unterworfen<br />
sein. Die zum Erlass von Rechtsakten vorgesehenen Verfahren müssen<br />
durchschaubar und effizient sein und eine deutliche Trennung von legislativen<br />
und exekutiven Akten erkennen lassen. Verantwortlichkeit muss<br />
klar zugeordnet werden können, wenn die Union für den Bürger ein<br />
Gesicht bekommen soll. 12<br />
Alter Wein in neuen Schläuchen<br />
Welche Neuerungen bringt vor diesem Hintergrund die Verfassung? Die<br />
Anzahl der Rechtsetzungsinstrumente der Union wurde von ehemals<br />
fünfzehn auf sechs reduziert. Das allein ist bereits ein Erfolg. Bessere<br />
Überschaubarkeit ist ein erster Schritt zu größerer Durchschaubarkeit.<br />
Einen schalen Beigeschmack hinterlässt nach Durchsicht des dritten<br />
Verfassungsteils allerdings die große Zahl von unterschiedlichen<br />
(Rechtsetzungs-)Verfahren, die im ersten Teil nicht definiert sind. Vor<br />
allem in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik hat man diesbezüglich<br />
auf Übersichtlichkeit weitgehend verzichtet.<br />
Die terminologischen Änderungen (Umbenennung von Verordnung und<br />
Richtlinie in Gesetz und Rahmengesetz) sind zwar vor allem kosmetischer<br />
Natur. Allerdings sind sie der sprachliche Schlüssel zu einem besseren<br />
Verständnis von Art und Wirkung des jeweiligen Rechtsaktes. Wer wusste<br />
bisher schon um die weitreichende Wirkung einer EU-Verordnung? 13 Von<br />
der Wirkung eines „Gesetzes“ hat der Bürger eine klare Vorstellung.<br />
Die bessere Unterscheidbarkeit von Rechtsakten mit und solchen ohne<br />
Gesetzescharakter erleichtert die Orientierung in der europäischen Normenhierarchie<br />
ganz erheblich. Im nationalen Recht der Mitgliedstaaten<br />
lässt sich in der Regel deutlich abgrenzen, was unter die Legislative und<br />
was unter die Exekutive fällt. Dies war für den Bereich des europäischen<br />
Rechts in Anbetracht der Besonderheiten des institutionellen Systems<br />
der Union bislang eher schwierig. Diese Besonderheiten bleiben<br />
zwar im Wesentlichen erhalten. Künftig wird man jedoch leichter erkennen<br />
können, ob ein Organ beim Erlass eines Rechtsaktes legislative oder<br />
exekutive Befugnisse wahrnimmt. Es wird damit besser als vorher möglich<br />
sein, die demokratische Legitimität eines bestimmten Rechtsaktes<br />
abzuschätzen.<br />
12<br />
Vgl. Feus 2001, 55 f.<br />
13<br />
Vgl. bereits Hoffstetter 1974, 306.<br />
Evers 187
Artikel 33-39<br />
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Diese Kategorisierung der Rechtsakte bringt aber nicht nur Fortschritte:<br />
So wäre eine Unterscheidung von „Delegierter Verordnung“ und<br />
„Europäischer Verordnung“ wünschenswert gewesen. Der in Artikel 34<br />
enthaltene Verweis auf Artikel 35 definiert die Delegierte Verordnung<br />
als Unterfall der Europäischen Verordnung. Diese Sichtweise darf angesichts<br />
des gesetzesähnlichen Charakters der Delegierten Verordnung<br />
jedoch bezweifelt werden. Schon die Bezeichnung „Delegierte Verordnung“<br />
ist unglücklich gewählt und dem Laien kaum zu vermitteln.<br />
Eine Frage des Stils<br />
Grundsätzlich gilt, dass ein Verfassungstext sich auf die Wesenszüge einer<br />
Rechtsordnung konzentrieren sollte. 14 Das beschränkte Verbot atypischer<br />
Rechtsakte in Artikel 33 ist dort überflüssig und stiftet unnötig<br />
Verwirrung. 15 Natürlich muss der Gesetzgeber davon abgehalten werden,<br />
durch irreführende Rechtsakte die Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens<br />
zu gefährden. Das Verbot wäre aber in den Geschäftsordnungen<br />
von Parlament und Ministerrat besser aufgehoben gewesen. 16<br />
An anderer Stelle hätte man sich die Verfassung ausführlicher gewünscht.<br />
So verweist Artikel 37 nur auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.<br />
Eine Klarstellung hätte aber auch hinsichtlich des ebenfalls<br />
in Artikel 11 festgeschriebenen Subsidiaritätsprinzips erfolgen sollen.<br />
Als Richtschnur des Handelns der Union strahlt auch dieses Prinzip<br />
selbstverständlich auf den Bereich der Rechtsetzung innerhalb der Verfassung<br />
aus. Die Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit<br />
sind bei der Auswahl eines Rechtsaktes gleichermaßen zu wahren.<br />
Das Mitentscheidungsverfahren – Ausnahmen bestätigen die Regel?<br />
Artikel 34 definiert das Mitentscheidungsverfahren endlich als „ordentliches<br />
Gesetzgebungsverfahren“. Das führt zu einer nachhaltigen<br />
Demokratisierung der europäischen Rechtsetzung 17 und ist ein substanzieller<br />
Erfolg für das Europäische Parlament. Die absolute Anzahl der<br />
Bereiche, in denen das Mitentscheidungsverfahren anzuwenden ist,<br />
erhöht sich mit der Verfassung von 45 auf über 80. Es hat sich gezeigt,<br />
14<br />
Vgl. Peters 2001, 44 ff.<br />
15<br />
Vgl. Fischer, K. 2003 – Der Verfasser leitet aus Artikel 33 Absatz 2 den irrigen Schluss ab,<br />
atypische Rechtsakte seien insgesamt unzulässig.<br />
16<br />
Vgl. Artikel 7 der Geschäftsordnung des Rates.<br />
17<br />
Vgl. Fischer, R. 2001, 72 ff.<br />
188<br />
Evers
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
Artikel 33-39<br />
dass die verstärkte Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens seit<br />
den Verträgen von Amsterdam und Nizza nicht zu einer Verlangsamung<br />
oder Blockade, sondern im Gegenteil zu einer Beschleunigung der<br />
Gesetzgebung geführt hat. 18 Mehr Demokratie führt also nicht zu einem<br />
Verlust von Handlungsfähigkeit. Das Europäische Parlament hat sich als<br />
effizienter Gesetzgeber bewährt. Darüber hinaus war der Schritt zu<br />
einem „einheitlichen“ europäischen Gesetzgebungsverfahren unverzichtbar,<br />
um der Europäischen Union im Sinne des Mandats von Laeken<br />
ein Gesicht zu geben.<br />
Enttäuschend ist die noch immer verhältnismäßig hohe Zahl von Ausnahmen<br />
von der Regel der Mitentscheidung. Der dritte Verfassungsteil<br />
kennt über 30 solcher Abweichungen.<br />
Delegierte Rechtsakte – eine Gefahr für die Gewaltenteilung?<br />
Die Verfassung führt mit der „Delegierten Verordnung“ einen neuen<br />
Rechtsakt ein. Hintergrund ist die oft geäußerte Kritik an der überbordenden<br />
Detailliertheit, der mangelnden Flexibilität und der Langsamkeit<br />
der europäischen Gesetzgebung. 19 Woher kam die Detailversessenheit?<br />
Der EU-Gesetzgeber (Parlament und Ministerrat) hatte bisher nur<br />
die Möglichkeit, einen von ihm erlassenen Rechtsakt in allen Einzelheiten<br />
selbst zu regeln oder diese Regelung der Kommission zu übertragen,<br />
als ob es sich dabei um Durchführungsmaßnahmen handeln würde. 20<br />
Das soll sich nun ändern: Wenn der EU-Gesetzgeber die Kommission<br />
zum Erlass einer Delegierten Verordnung ermächtigt, stehen ihm die<br />
Kontrollmöglichkeiten des Artikels 36 zur Verfügung (Widerrufsrecht<br />
und Schweigefrist). Vor allem die Schweigefrist soll zu einer engen Abstimmung<br />
der Kommission mit den gesetzgebenden Organen beim<br />
Erlass Delegierter Verordnungen führen und auf diese Weise die demokratische<br />
Legitimität ihrer Rechtsetzung stärken.<br />
Die Delegierte Verordnung ist allerdings mit einem schwerwiegenden<br />
Problem behaftet: Durch sie wird die Kommission zu einer Art „Ersatzgesetzgeber“.<br />
Daran ändert auch die Bezeichnung „Verordnung“ nichts.<br />
Es werden schließlich Kompetenzen des Gesetzgebers übertragen – die<br />
Kommission soll über den Inhalt eines Gesetzgebungsaktes bestimmen<br />
(Legislative). Das ist etwas anderes als die Durchführung und Konkre-<br />
18<br />
Vgl. Maurer 2003, 29.<br />
19<br />
Vgl. Fischer, T. 2003.<br />
20<br />
Artikel 202 EG-Vertrag.<br />
Evers 189
Artikel 33-39<br />
Ausübung der Zuständigkeiten der Union<br />
tisierung eines Gesetzgebungsaktes im Wege der „normalen“ Durchführungsverordnung<br />
(Exekutive). Gibt man aber die klare Trennung von<br />
exekutiven und legislativen Rechtsakten auf, drängt sich eine Frage auf:<br />
Worin soll der materielle Unterschied zwischen bindenden Rechtsakten<br />
ohne Gesetzescharakter und europäischen Gesetzgebungsakten liegen?<br />
Fraglich ist darüber hinaus, welchen Gehalt der in Artikel 36 festgeschriebene<br />
Wesentlichkeitsvorbehalt haben soll. Der Begriff der<br />
Wesentlichkeit lässt viel Raum für Interpretationen. Vermutlich wird er<br />
erst durch die künftige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes<br />
feste Konturen gewinnen. Der Vorbehalt soll wohl sicherstellen, dass<br />
zumindest grundlegende Wertentscheidungen für einen bestimmten<br />
Bereich Sache des gemeinschaftlichen Gesetzgebers bleiben und nicht<br />
der Administration überlassen werden können. 21<br />
Es gibt Komplizierteres als eine Vereinfachung<br />
Man wird über diese Probleme nicht hinwegsehen können. Gleichzeitig<br />
bleibt aber festzuhalten, dass in puncto Vereinfachung im Vergleich zum<br />
früheren Zustand große Fortschritte erzielt worden sind. Die eigentlichen<br />
Schwächen der Verfassung ergeben sich aus der wackeligen Balance des<br />
europäischen Machtgefüges. Man gewinnt daher den Eindruck, dass es<br />
ganz offensichtlich Komplizierteres gibt als eine Vereinfachung.<br />
Literatur: Europäischer Rat (2001): Erklärung von Laeken, unter: http://european-convention.<br />
eu.int/pdf/LKNDE.pdf (20.06.2005). Feus, Kim (Hrsg.) (2001): A Simplified Treaty for the<br />
European Union – London. Fischer, Klemens (2003): Konvent zur Zukunft Europas – Texte<br />
und Kommentar – Baden-Baden. Fischer, Robert (2001): Das Demokratiedefizit bei der<br />
Rechtsetzung durch die Europäische Gemeinschaft – Münster. Fischer, Thomas (2003): Kompetenzordnung<br />
und Handlungsinstrumente – Verhaltene Reformansätze im Konventsentwurf, in:<br />
Giering, Claus (Hrsg.): Der EU-Reformkonvent – Analyse und Dokumentation, CD-ROM –<br />
München. Giering, Claus (Hrsg.) (2003): Der EU-Reformkonvent – Analyse und Dokumentation,<br />
CD-ROM – München. Hoffstetter, Helmuth (1974): Die Verordnung als Rechtsvorschrift<br />
der Europäischen Gemeinschaften, in: Staats- und Kommunalverwaltung, H. 10, S. 306 ff.<br />
Maurer, Andreas (2003): Schließt sich der Kreis? – Der Konvent, nationale Vorbehalte und die<br />
Regierungskonferenz, Stiftung Wissenschaft und Politik – Berlin. Peters, Anne (2001): Elemente<br />
einer Theorie der Verfassung Europas – Berlin. Sobotta, Christoph (2001): Transparenz<br />
in den Rechtsetzungsverfahren der Europäischen Union – Baden-Baden.<br />
21<br />
Entspricht der „Wesentlichkeitstheorie“ im deutschen Recht. Vgl. u.a. BVerfGE 40, 237<br />
(248 ff.); 47, 46 (78 f.); 49, 89 (126 f.); 57, 295 (320 f.); 58, 257 (268 f.).<br />
190<br />
Evers
Anna Lührmann/Tina Löffelsend<br />
Artikel 40<br />
DIE GEMEINSAME AUßEN- UND SICHERHEITSPOLITIK<br />
Artikel 40: Besondere Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und<br />
Sicherheitspolitik<br />
In Artikel 40 werden die Bestimmungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,<br />
kurz GASP, präzisiert. Die Europäische Union gibt sich mit diesem<br />
Artikel die Möglichkeit, außenpolitisch gemeinsam zu handeln. Gegenseitige<br />
Solidarität unter den Mitgliedstaaten, eine immer engere Kooperation und die<br />
Entwicklung gemeinsamer Fragestellungen werden als Grundlage der gemeinsamen<br />
Außenpolitik benannt. Die Leitlinien der GASP bestimmt der Europäische<br />
Rat, also die Staats- und Regierungschefs der EU. Sie definieren die strategischen<br />
Ziele und Interessen der EU-Staaten für die GASP. Europäische<br />
Beschlüsse, welche die Leitlinien des Europäischen Rates weiter ausgestalten,<br />
fasst der Ministerrat. Deren weitere Ausgestaltung liegt ebenfalls in der Verantwortung<br />
des Ministerrates.<br />
Der zusammengesetzte Charakter der GASP wird an dieser Stelle auch ausformuliert:<br />
Die Außenvertretung der EU erfolgt durch den europäischen Außenminister<br />
und die Mitgliedstaaten. Dazu stehen ihnen die Mittel der einzelstaatlichen<br />
Politik sowie die der EU zur Verfügung.<br />
Die Staaten verpflichten sich zu gegenseitigen Konsultationen und einmal<br />
mehr zu Solidarität sowie dazu, die Annäherung einzelstaatlichen Handelns mit<br />
dem der Union sicherzustellen und die gemeinsamen Werte und Interessen in<br />
der Welt zu vertreten. Das Europäische Parlament wird zu Fragen der GASP<br />
gehört und in regelmäßigen Abständen unterrichtet. Als grundlegender Abstimmungsmodus<br />
in der GASP wird die Einstimmigkeit festgelegt, im Europäischen<br />
Rat wie im Ministerrat. Initiativrecht haben, wie erwähnt, die Mitgliedstaaten,<br />
der Außenminister bzw. der Außenminister gemeinsam mit der Kommission,<br />
wenn die Initiative nicht in den originären GASP-, sondern in einen<br />
verwandten Bereich fällt. Auch in der GASP gilt: Der Ministerrat kann einstimmig<br />
beschließen, dass bestimmte Fälle aus der Einstimmigkeit in die qualifizierte<br />
Mehrheit überführt werden („Passarelle-Klausel“). 1<br />
Für die GASP sind weiterhin die Artikel 3, 16 und 28 der Verfassung relevant:<br />
In Artikel 3 wird ein wertebasierter Zielkatalog formuliert, in dem unter anderem<br />
friedliche und nachhaltige Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte,<br />
die unbedingte Einhaltung und die Weiterentwicklung des Völkerrechts,<br />
1<br />
Vgl. Artikel 300 Absatz 3 auf Grundlage von 40 Absatz 7.<br />
Lührmann/Löffelsend 191
Artikel 40<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Armutsbekämpfung sowie „freier und gerechter Handel“ als Basis und Ziel<br />
europäischer Außenpolitik formuliert werden.<br />
Artikel 16 erklärt die Zuständigkeit der Europäischen Union in allen außen- und<br />
sicherheitspolitischen Belangen der Staatengemeinschaft. Er eröffnet ausdrücklich<br />
die Möglichkeit, eine gemeinsame Verteidigung zu entwickeln. Die Staaten<br />
der EU sind den Zielen und Interessen der gemeinsamen Politik in „Loyalität“<br />
und „Solidarität“ verpflichtet. Sie vermeiden jegliche Handlungen, die<br />
der gemeinsamen europäischen Politik schaden könnten.<br />
In Artikel 28 besteht die größte außenpolitische Neuerung der Verfassung. Dort<br />
wird das Amt des europäischen Außenministers geschaffen. Der Minister – hier<br />
geschlechtsneutral verwendet, denn „er“ kann natürlich auch weiblich besetzt<br />
werden – besitzt die Zuständigkeit für das gesamte Spektrum der Außenpolitik<br />
der EU, einschließlich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Der Minister<br />
wird mit der Zustimmung des Kommissionspräsidenten vom Europäischen Rat<br />
mit qualifizierter Mehrheit für fünf Jahre gewählt. Der Außenminister trägt den<br />
so genannten „Doppelhut“: Er ist gleichzeitig Vizepräsident der Kommission<br />
und Vorsitzender des Rates für Auswärtige Angelegenheiten. Hier werden<br />
somit die beiden bisherigen Posten des Außenkommissars und des Hohen Vertreters<br />
für die GASP fusioniert, inklusive ihrer Aufgaben-Portfolios.<br />
Als Teil der Kommission unterliegt der Außenminister dem Votum des Europäischen<br />
Parlaments. In den Teilen seines Handelns, die in den Aufgabenbereich<br />
der Kommission fallen, unterliegt er den geltenden „Verfahren“ der Arbeitsweise<br />
der Kommission. Er ist in diesen Bereichen dem Parlament verantwortlich<br />
und kann von diesem zur Rechenschaft gezogen werden. Wird also das<br />
Kommissionskollegium vom Parlament zum Rücktritt gezwungen, muss auch<br />
der Außenminister seinen Hut nehmen. Doch als Ratsmitglied bleibt er weiterhin<br />
im Amt in der Annahme, dass er der neuen Kommission wieder angehören<br />
wird. In den Kompetenzbereichen, in denen er Aufgaben des bisherigen Hohen<br />
Vertreters wahrnimmt, muss er sich dem Europäischen Rat gegenüber verantworten<br />
und kann bei schwerwiegendem Fehlverhalten von diesem abgesetzt<br />
werden. Analog zu den Mitgliedstaaten im Ministerrat besitzt er Initiativrecht<br />
in der GASP, das heißt, er kann den Ministerrat mit Befassung beauftragen.<br />
Die einschlägigen Bestimmungen zum „Auswärtigen Handeln der Union“ finden<br />
sich in Teil III der Verfassung. 2<br />
2<br />
Titel V, Artikel 292 bis 328.<br />
192 Lührmann/Löffelsend
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Artikel 40<br />
Eine Stimme für Europa – Europas Stimme in der Welt<br />
Die Weltpolitik ist ein rutschiges Parkett. Man kann darauf ins Schleudern<br />
geraten. Die Europäische Union, so der weit verbreitete Eindruck,<br />
ist ein noch recht ungeübter Läufer auf dem Weltparkett. Das Joggen<br />
funktioniert zwar schon ganz gut, doch beim Spurt, dem Staffel- oder<br />
Hürdenlauf stolpert die EU gern über die eigenen Füße. Doch abseits<br />
solcher Beobachtungen kann man getrost festhalten: Die europäische<br />
Außenpolitik ist besser als ihr Ruf. Die EU tritt in der internationalen<br />
Arena in vielen Bereichen als kompetenter Akteur auf. Sie verfügt über<br />
einen ausgefeilten Instrumentarien-Baukasten, mit dem sie differenziert<br />
auf außenpolitische Anforderungen reagieren kann – und dies auch in<br />
der Vergangenheit durchaus erfolgreich praktiziert hat.<br />
Abseits des Alltagsgeschäftes enger außenpolitischer Kooperation fällt<br />
jedoch im Rampenlicht brisanter außenpolitischer Fragen die Einheitlichkeit<br />
der GASP oft nationalen Interessen und unterschiedlichen Loyalitäten<br />
zum Opfer. Zudem bestehen neben der intergouvernemental<br />
geprägten GASP noch die Bereiche der europäischen Entwicklungspolitik<br />
und des Außenhandels. 3 Ebenfalls nicht zu unterschlagen sind die<br />
Außenpolitiken der Mitgliedstaaten, die zusätzlich von nationaler<br />
Ebene aus das gesamte außenpolitische Spektrum bedienen. Aus dieser<br />
Konstellation resultiert eine äußerst komplexe Zuständigkeits- und Aufgabenverflechtung<br />
zwischen nationalstaatlichen und supranationalen<br />
Akteuren. Überlappende und unklare Zuständigkeiten produzieren fast<br />
unausweichlich eine europäische „Vielstimmigkeit“ und transportieren<br />
ein uneinheitliches Bild nach außen. Die Hauptursache für diese Uneinheitlichkeit<br />
liegt also in der Organisation des europäischen Politikmodells.<br />
Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass sich die EU vor<br />
allem mit dem Vorwurf der mangelnden Kohärenz und Kontinuität ihres<br />
außenpolitischen Handelns konfrontiert sieht. Es drängt sich also die<br />
Frage auf, was die neue Verfassung vorsieht, um diese grundsätzlichen<br />
Mängel anzugehen.<br />
3<br />
Nach dem Vertrag von Maastricht (1992) fallen diese vergemeinschafteten Politikbereiche in<br />
die „1. Säule“, die GASP wird als zweite Säule bezeichnet, in die dritte Säule fällt die Innenund<br />
Justizpolitik.<br />
Lührmann/Löffelsend 193
Artikel 40<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Was bringt die neue Verfassung?<br />
Die gemeinsame europäische Außenpolitik wird durch die Verfassung<br />
nicht neu erfunden. Einige qualitative Verbesserungen sind aber zu verzeichnen.<br />
Deren positives Potenzial muss sich allerdings noch im „Praxistest“<br />
beweisen. Die wohl bedeutendsten Neuerungen sind die Abkehr<br />
von der rotierenden EU-Präsidentschaft und die Schaffung des Amtes<br />
eines europäischen Außenministers. Der neue Außenminister wird die<br />
Möglichkeit haben, der europäischen Außenpolitik eine Stimme zu<br />
geben und Initiativen der EU effizienter vorzubereiten. Die Verfassung<br />
macht damit einen Schritt hin zu einer größeren Handlungsfähigkeit der<br />
EU in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig<br />
wurde im Konvent deutlich, dass die Mitgliedstaaten noch nicht bereit<br />
sind, ihre nationale Souveränität im Bereich der Außenpolitik vollständig<br />
aufzugeben. Daher wird der Zwang zur Einstimmigkeit auch in<br />
Zukunft noch bei kontroversen außenpolitischen Fragen potenziell zu<br />
Handlungsunfähigkeit führen. Auf der Regierungskonferenz wurde<br />
auch das Außenministeramt in der „Doppelhut-Konstruktion“ (Vorsitzender<br />
im Außenrat und Vizepräsident der Kommission) noch einmal<br />
stark attackiert, blieb aber letztendlich bestehen. Die im Oktober 2004<br />
verabschiedete Verfassung legt den Grundstein für eine positive Entwicklung.<br />
In allen Mitgliedstaaten setzt sich allmählich die Erkenntnis<br />
durch, dass ein geeinigtes Europa mehr Einfluss ausüben kann, als es<br />
jeder Mitgliedstaat alleine vermag.<br />
Ein gemeinsames Handeln der EU-Mitgliedstaaten in der Welt ist daher<br />
auch die eigentliche Vision des Verfassungsartikels 16 und den anschließenden<br />
Ausführungen in Artikel 40. Beide Artikel beschwören als Basis<br />
der europäischen Außenpolitik die Loyalität der Mitgliedstaaten gegenüber<br />
der gemeinsamen Politik und die gegenseitige politische Solidarität.<br />
Die häufige Wiederholung der Solidaritätsverpflichtung könnte missgünstige<br />
Geister auch zu der Vermutung veranlassen, dass diese ständige Mahnung<br />
an die Mitglieder wohl sehr notwendig sein müsse. Auch wenn man<br />
nicht zu den Unken zählen möchte, offenbart sich an diesem Punkt die<br />
auffällige Diskrepanz von Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit:<br />
Es mangelt in Europa nicht an guten Ideen, aber vielfach am gemeinsamen<br />
Willen. Diese Hürde wird nur langfristig zu überwinden sein.<br />
Gesicht und Stimme der GASP<br />
Mit der Einführung eines europäischen Außenministers wird die inzwischen<br />
legendäre Forderung Henry Kissingers nach der „Telefonnummer<br />
194 Lührmann/Löffelsend
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Artikel 40<br />
für Europa“ fast Wirklichkeit. Die Teilung der Außenpolitik zwischen<br />
dem Hohen Repräsentanten, dem Kommissar für Außenbeziehungen<br />
und der jeweiligen Präsidentschaft wird aufgehoben. Die EU wird dann<br />
allein durch den Präsidenten des Europäischen Rates und den neuen<br />
Außenminister nach außen vertreten. Der Außenminister wird deshalb<br />
vielseitig gefordert sein, denn der Aufgabenkatalog des neuen Postens<br />
umfasst eine beeindruckende Fülle von Pflichten für den Amtsinhaber:<br />
Er übernimmt die Vertretung der EU nach außen, in internationalen<br />
Organisationen ebenso wie gegenüber Drittstaaten und Staatengruppen.<br />
Das bedeutet zum Beispiel, die Verhandlungsführung bei internationalen<br />
Vertragsverhandlungen gehört in sein Aufgaben-Portfolio. Er trägt –<br />
so vorhanden – den gemeinsamen Standpunkt der EU in internationalen<br />
Organisationen vor, so etwa in der UN-Vollversammlung. 4 Letzteres<br />
allerdings wird jedoch vermutlich für längere Zeit noch Zukunftsmusik<br />
bleiben. Vereinfacht kann man sagen, der Außenminister übernimmt im<br />
Wesentlichen Funktionen, die bisher durch die außenpolitische Troika 5<br />
wahrgenommen wurden. Er sitzt dem Ministerrat „Auswärtige Angelegenheiten“<br />
vor 6 und ist für dessen Beschlussfähigkeit zuständig. Der<br />
Außenminister soll für die Koordination aller mit der GASP verwandten<br />
Bereiche Sorge tragen. Die Durchsetzung der gefassten Entscheidungen<br />
im Europäischen Rat und im Ministerrat obliegt seiner Verantwortung.<br />
7 Diese Aufgabenfülle wird von Experten als problematisch<br />
eingestuft. Die Verfassung lässt offen, wie die Arbeit des Außenministers<br />
organisiert werden soll, woher er seine finanziellen Mittel beziehen<br />
wird, wo sein „Unterbau“, sein Stab sowie der neu zu schaffende Europäische<br />
Diplomatische Dienst angesiedelt sein sollen. 8 Ein effizienter<br />
operativer Apparat aber wird essenziell sein, soll der neue Minister<br />
nicht an der Fülle seiner Aufgaben scheitern.<br />
Bei aller Skepsis ist die Schaffung des neuen Amtes und damit die Aufhebung<br />
der halbjährlichen Rotation des Ratsvorsitzes ein großer Schritt<br />
in Richtung einer einheitlicheren und verlässlicheren europäischen<br />
Außenpolitik. Die bisherige Praxis verschaffte dem jeweils vorsitzenden<br />
Mitgliedstaat die geschätzte Möglichkeit zur Profilierung auf dem<br />
4<br />
Vgl. Artikel 305.<br />
5<br />
Das heißt durch den Hohen Repräsentanten, den Kommissar und den jeweiligen Ratsvorsitz.<br />
6<br />
Der Außenrat ist damit die einzige Ratsformation, die nicht durch eine rotierende (Team-) Präsidentschaft<br />
geführt werden wird, sondern permanent durch den Außenminister.<br />
7<br />
Vgl. Artikel 296.<br />
8<br />
Vgl. Regelsberger 2003, 235.<br />
Lührmann/Löffelsend 195
Artikel 40<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
außenpolitischen Parkett. Für die Kontinuität und Kohärenz der GASP<br />
war diese Regelung jedoch wenig brauchbar. Jede neue Ratspräsidentschaft<br />
setzte neue Prioritäten und eine eigene, nicht selten vom nationalen<br />
Interesse dominierte Agenda. Die Übergabe an die nachfolgende<br />
Präsidentschaft war daher immer mit Reibungsverlusten verbunden.<br />
Eine längerfristige europäische Zielsetzung wird jetzt möglich. Gepaart<br />
mit der koordinierenden und leitenden Funktion des Außenministers<br />
bietet sich die Chance, die vorhandenen Ressourcen in der Außenpolitik<br />
besser zu bündeln und nutzbar zu machen.<br />
So ist das Potenzial des neu geschaffenen Ministeramtes sicherlich<br />
groß. Doch darf dabei nicht übersehen werden, dass die Staats- und<br />
Regierungschefs nach wie vor den Ton angeben. Sie bestimmen die<br />
Leitlinien in allen Fragen europäischer Außenpolitik und sie definieren<br />
die Ziele und Interessen der Staatengemeinschaft. 9 Die Ernennung des<br />
Außenministers erfolgt auf ihren Wunsch und sie können ihn auch wieder<br />
absetzen. Beschlüsse zu gemeinsamen Aktionen, operativen Maßnahmen<br />
und Entscheidungen über die finanziellen Mittel fallen im<br />
Ministerrat. 10 Zudem sind die Kompetenzen des neu ausgestalteten<br />
Amtes des Ratspräsidenten in der Außenvertretung der Union nicht eindeutig<br />
definiert. Diese Person wird vom Europäischen Rat für zweieinhalb<br />
Jahre gewählt und nimmt „auf seiner Ebene unbeschadet der<br />
Zuständigkeiten des Außenministers“ 11 ebenfalls die Außenvertretung<br />
der Union wahr. Hier zeichnen sich mögliche Konfliktlinien und Kompetenzgerangel<br />
bereits in der Verfassung ab. 12<br />
Umso mehr wird es daher auf die Persönlichkeit ankommen, die das<br />
neue Außenministeramt der EU bekleidet und sich in dem Spagat zwischen<br />
Kommission und Europäischem Rat behaupten muss. Diese Person<br />
wird sich aller Voraussicht nach aus dem Kreise angesehener und<br />
außenpolitisch versierter Politikerpersönlichkeiten rekrutieren. Es verwundert<br />
daher nicht, wenn der erste europäischer Außenminister wohl<br />
Javier Solana sein wird, der bisherige Hohe Vertreter und ehemalige<br />
Nato-Generalsekretär. Eine anerkannte und durchsetzungsfähige Person<br />
9<br />
Vgl. Artikel 40 und 295.<br />
10<br />
Vgl. Artikel 297.<br />
11<br />
Artikel 22.<br />
12<br />
Die nach der Verfassung offene Möglichkeit der Personalunion von Rats- und Kommissionspräsidenten<br />
würde die Machtbalance stärker zu Ungunsten des Außenministers verschieben.<br />
Doch tatsächlich ist eine solche „große Doppelhut“-Konstruktion auf absehbare Zeit wohl<br />
noch Zukunftsmusik.<br />
196 Lührmann/Löffelsend
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Artikel 40<br />
ist unerlässlich, um in strittigen Fragen die unterschiedlichen Standpunkte<br />
zu moderieren und zu „versöhnen“. Darüber hinaus soll dem<br />
Minister ein Europäischer Diplomatischer Dienst zur Seite gestellt werden.<br />
13 Dieser soll binnen eines Jahres geschaffen werden.<br />
Die Angehörigen des Europäischen Diplomatischen Dienstes werden<br />
aus den nationalen diplomatischen Diensten, dem Stab des Hohen Vertreters<br />
und der entsprechenden Generaldirektion in der Kommission<br />
zusammengestellt. Eine gemeinsame europäische Diplomatie ist im<br />
Zuge einer immer stärkeren Vergemeinschaftung der GASP unerlässlich.<br />
Erste Ansätze bestehen bereits mit den Vertretungen der EU in<br />
Drittstaaten; manche Länder unterhalten gemeinsame Botschaften oder<br />
übernehmen die Vertretung anderer EU-Länder mit. Die Schaffung<br />
eines Europäischen Auswärtigen Dienstes ist daher die logische Fortentwicklung<br />
der bisherigen Zusammenarbeit.<br />
Stolperstein Einstimmigkeit<br />
Mit der Europäischen Verfassung wurde die alte Säulenstruktur formal<br />
aufgelöst. Die bislang zweite Säule der GASP wird in einen einheitlichen<br />
Rahmen überführt. Dieser begrüßenswerte Schritt hat jedoch<br />
einen Haken: Die Methode der Zusammenarbeit hat sich nicht grundsätzlich<br />
verändert. Nach wie vor ist die Regierungszusammenarbeit das<br />
dominierende Mittel der europäischen außenpolitischen Kooperation.<br />
Eine weitere Vergemeinschaftung war im Konvent vor allem gegen die<br />
Stimme Großbritanniens nicht durchzusetzen, obwohl sich die Mehrheit<br />
der Konventsmitglieder vehement dafür eingesetzt hat. So sah ein Kompromiss-Vorschlag<br />
der Konvents-Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“<br />
beispielsweise vor, die qualifizierte Mehrheit zu ermöglichen, wenn es<br />
sich um einen gemeinsamen Vorschlag von Außenminister und Kommission<br />
handelt. 14 Die Furcht vor dem Verlust nationalstaatlicher Souveränität<br />
war jedoch zu groß. So ist das Prinzip der Einstimmigkeit bei<br />
Abstimmungen im Ministerrat grundsätzlich beibehalten worden. Ausgenommen<br />
von diesem Prinzip sind nur die Beschlüsse zu Gemeinsamen<br />
Aktionen und Gemeinsamen Standpunkten der Union bzw. Beschlüsse<br />
zu deren Durchführung sowie die Ernennung von Sonderbeauftragten.<br />
Diese werden, wie schon bisher, mit qualifizierter Mehrheit gefasst.<br />
13<br />
Vgl. Artikel 296 sowie das Protokoll zur Verfassung „Erklärung über die Einrichtung eines<br />
Europäischen Auswärtigen Dienstes“.<br />
14<br />
Vgl. CONV 459/02, Pkt. 8.<br />
Lührmann/Löffelsend 197
Artikel 40<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Die erzwungene Einstimmigkeit in den meisten GASP-Bereichen<br />
erweist sich als Haupthindernis für die außenpolitische Handlungsfähigkeit<br />
der EU. 15 Durch einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates<br />
können jedoch einzelne Politikbereiche aus der Einstimmigkeit in die<br />
qualifizierte Mehrheit überführt werden. 16 Hier liegt ein Schlüssel für<br />
die Weiterentwicklung der GASP. Ein weiteres Mittel, der GASP auf die<br />
Sprünge zu helfen, ist die nach Artikel 44 mögliche „Verstärkte<br />
Zusammenarbeit“ 17 . Durch diese Bestimmung kann eine dazu bereite<br />
Gruppe von EU-Staaten (mindestens aber ein Drittel) sich auf eine<br />
engere Kooperation in einem bestimmten Feld verständigen, wenn eine<br />
gesamteuropäische Lösung nicht zustande kommt. 18 Die Staaten, die<br />
voranschreiten wollen, erhalten diese Möglichkeit also im Rahmen der<br />
Verträge und innerhalb der gemeinsamen Strukturen. 19<br />
Die grundsätzliche Offenheit und Transparenz der Verstärkten<br />
Zusammenarbeit für alle EU-Staaten wurde auf der Regierungskonferenz<br />
noch einmal präzisiert und untermauert, was der viel diskutierten<br />
Sorge um die Herausbildung eines „Kerneuropas“ Rechnung trug. Dieses<br />
Voranschreiten, eingebettet in den europäischen Rahmen, könnte ein<br />
Motor für weitere Integrationsschritte auch in der GASP sein. Einschränkend<br />
muss aber angemerkt werden, dass es diese Regelung auch<br />
bisher schon gab, von ihr aber kein Gebrauch gemacht wurde. Die allgemeine<br />
Einschätzung geht dahin, dass diese Möglichkeit in näherer<br />
Zukunft vor allem in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)<br />
zur Anwendung kommen wird. Dort gelten allerdings eigene Bestimmungen.<br />
20 Trotz aller avantgardistischen Wertschätzung und trotz der<br />
einhegenden Bestimmungen dieser Regelung sollte aber auch ihr Spaltpotenzial<br />
nicht unterschätzt werden: Hiermit ist die Tür zu einem<br />
Europa der zwei – oder mehr – Geschwindigkeiten geöffnet. Ob die<br />
erwartete Sogwirkung dieser Kooperationsprojekte auf die (noch) nicht<br />
beteiligten Mitgliedstaaten tatsächlich eintritt und langfristig alle EU-<br />
Staaten integrieren würde, bleibt fraglich. In diesem Zusammenhang<br />
15<br />
Näheres zur Handlungsfähigkeit durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in GASP und<br />
GSVP bei Diedrichs/Jopp 2003.<br />
16<br />
Siehe oben.<br />
17<br />
Bestimmungen zur „Verstärkten Zusammenarbeit“ in der GASP finden sich in den Artikeln<br />
416 bis 423, insbesondere Artikel 419 Absatz 2 und 420 Absatz 2.<br />
18<br />
Vgl. zur Verstärkten Zusammenarbeit auch den Text von Luise Papcke in diesem Band.<br />
19<br />
Positiv ist darüber hinaus die Möglichkeit, auch in diesem Rahmen zu Mehrheitsentscheidungen<br />
überzugehen (Artikel 422 Absatz 1).<br />
20<br />
Vgl. zur GSVP den Text von Sebastian Peter Sass in diesem Band.<br />
198 Lührmann/Löffelsend
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Artikel 40<br />
tun sich sehr grundsätzliche Fragen nach der zukünftigen Gestalt Europas<br />
und des europäischen Gemeinschaftsprojektes auf, die hier nur als<br />
Denkanstoß erwähnt seien: Wie viel Gemeinsamkeit ist nötig? Wie viel<br />
Unterschiedlichkeit kann Europa vertragen auf dem Weg zu einer immer<br />
engeren Union der Staaten und der Bürgerinnen und Bürger?<br />
Wer kontrolliert die Außenpolitik?<br />
Die Förderung von Demokratie ist ein Hauptziel der europäischen<br />
Außenpolitik. Doch im Widerspruch zu diesem begrüßenswerten Ziel<br />
weisen die Entscheidungsstrukturen der GASP selbst ein bemerkenswertes<br />
Demokratiedefizit auf. Die demokratische Kontrolle und die<br />
Legitimation der GASP können nur durch die Mitbestimmung und aktive<br />
Einbeziehung des Europäischen Parlaments gelingen. Zwar muss<br />
sich der zukünftige Außenminister als Mitglied der Kommission dem<br />
Zustimmungsvotum des Parlaments stellen, in Fragen der GASP jedoch<br />
kann dieses nicht mitentscheiden. Die Verfassung verharrt hier auf dem<br />
Niveau des Nizza-Vertrages.<br />
Das Europäische Parlament macht zwar durchaus seine eigene Außenpolitik,<br />
beispielsweise durch seine vehemente Menschenrechtspolitik, doch<br />
besitzt es keine vertraglichen Kompetenzen in diesem Feld. Es gab Vorschläge<br />
aus dem Konvent und auch von wissenschaftlicher Seite, die beispielsweise<br />
die Ernennung des europäischen außenpolitischen Personals<br />
von der Zustimmung des Parlaments abhängig machen oder die Haushaltsbefugnis<br />
des Parlaments auf die operativen GASP-Mittel ausdehnen<br />
wollten. Doch bereits die GASP-Arbeitsgruppe des Konvents entwickelte<br />
keine weitergehenden Vorschläge in diesem Sinne. Gemäß der neuen<br />
Verfassung wird es nun zweimal im Jahr (bisher einmal) eine Aussprache<br />
zur GASP geben, bei der der Außenminister die Parlamentarier<br />
unterrichtet. 21 Die Aussprache soll die Berücksichtigung der Auffassungen<br />
des Europäischen Parlaments und dessen regelmäßige Unterrichtung<br />
wie Anhörung sicherstellen. Das Parlament kann analog zu Artikel 21<br />
des Nizza-Vertrages Anfragen und Empfehlungen an den Ministerrat<br />
oder den Außenminister richten. Es bedarf jedoch in der Regel keiner<br />
Zustimmung des Parlaments bei internationalen Verträgen. 22 Bei einer<br />
21<br />
Vgl. Artikel 304 Absatz 2.<br />
22<br />
Die Zustimmung des Parlaments ist allerdings notwendig bei gewissen Arten internationaler<br />
Übereinkünfte. So zum Beispiel bei Assoziationsabkommen oder bei Übereinkommen, welche<br />
den Haushalt der EU besonders belasten (Artikel 325 Absatz 6).<br />
Lührmann/Löffelsend 199
Artikel 40<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
zukünftig zu erwartenden weiteren Integration in der europäischen<br />
Außenpolitik wird die Rolle des Europäischen Parlaments immer entscheidender.<br />
Denn nationale Parlamente werden im Zuge dieser Kompetenzverschiebung<br />
sukzessiv weniger Einflussmöglichkeiten haben. Dieses<br />
legitimatorische Vakuum muss durch das Europäische Parlament<br />
gefüllt werden.<br />
Europäische Außenpolitik: Klingt gut – ist gut?<br />
Außenpolitik ist integraler Bestandteil und Ausdruck der nationalen<br />
Souveränität moderner Nationalstaaten. Die Abtretung dieser ureigensten<br />
und zudem prestigeträchtigen, nationalstaatlichen Kompetenz in<br />
Diplomatie und Verteidigung an eine übergeordnete Ebene, die EU,<br />
bereitet den Mitgliedstaaten nach wie vor Unbehagen. 23 Vor diesem<br />
Hintergrund spiegelt die Verfassung das derzeitige Maximum an Bereitschaft<br />
zu einer gemeinsamen Außenpolitik wider. Festzuhalten bleibt,<br />
dass die Chance zu weitergehender Integration in der GASP verpasst<br />
wurde. Die Veränderungen sind nicht bahnbrechend. Es handelt sich<br />
aber immerhin um Neuerungen mit Potenzial, die mit der Kraft politischen<br />
Willens urbar gemacht werden können.<br />
So werden Befürworter einer stärkeren europäischen Außenpolitik ihre<br />
Hoffnungen auf die Strahlkraft des neuen Außenministers setzen und<br />
auf die Möglichkeit zur verstärkten Zusammenarbeit. Das Dilemma<br />
europäischer Außenpolitik und nationaler Alleingänge kann auch mit<br />
dieser Verfassung nicht vollständig behoben werden. Stärker als auf den<br />
Verfassungstext wird es auch in Zukunft auf die Praxis, den politischen<br />
Willen der Regierungen zur Zusammenarbeit ankommen. In der<br />
erweiterten Union wird das Abstimmungsprozedere nicht einfacher.<br />
Denn die unterschiedlichen Traditionen und historischen Erfahrungen<br />
der europäischen Länder sind in der Außenpolitik besonders sichtbar. In<br />
Kristallisationspunkten, wie dem Zerfall Jugoslawiens und jüngst dem<br />
Irak-Krieg, manifestieren sich diese Unterschiede. Der Unterstützungsbrief<br />
der acht Staats- und Regierungschefs an die Adresse der Bush-<br />
Regierung – und die brüske Abstrafung derselben durch Frankreichs<br />
Präsidenten Chirac – war jüngst das drastischste Beispiel innereuropäischer<br />
Zwietracht in Zeiten einer ernsten internationalen Krise. Gleichzeitig<br />
aber wächst aus anderen außenpolitischen Erfahrungen die Ein-<br />
23<br />
Vgl. Forster/Wallace 2000, 462.<br />
200 Lührmann/Löffelsend
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Artikel 40<br />
sicht, dass die EU sich nur Gehör verschaffen kann, wenn sie in der<br />
internationalen Arena mit einer einheitlichen Haltung auftritt, wie die<br />
Beispiele Kyoto-Protokoll, Mazedonien oder der Internationale Strafgerichtshof<br />
zeigen.<br />
Nach dem Ende des Kalten Krieges und nach den Anschlägen des<br />
11. September 2001 hat Europa seine gemeinsame und strategische<br />
Rolle in der Welt noch immer nicht gefunden. Doch wird die Welt und<br />
werden die Herausforderungen nicht warten bis die EU die Phase ihrer<br />
Selbstfindung abgeschlossen hat. Europa hat nun die Chance, seine<br />
neue Verfassung als sinnstiftendes Fundament oder auch nur als solide<br />
Basis anzunehmen. Auf diesem Grund lässt sich eine Außenpolitik entwickeln,<br />
die den gemeinsam gesteckten Zielen gerecht werden kann.<br />
Literatur: Diedrichs, Udo/Jopp, Mathias (2003): Flexible Modes of Governance: Making CFSP<br />
and ESDP Work, in: The International Spectator, H. 3, S. 15–30. Europäischer Konvent<br />
(2002): Final report of Working Group VII on External Action (CONV 459/02). Forster,<br />
Anthony/Wallace, William (2000): Common Foreign and Security Policy. From Shadow to Substance?,<br />
in: Wallace Helen/Wallace, William (Hrsg.): Policy-Making in the European Union –<br />
Oxford; New York, S. 461–491. Regelsberger, Elfriede (2003): Gemeinsame Außen- und<br />
Sicherheitspolitik, in: Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.): Jahrbuch der Europäischen<br />
Integration 2002/2003 – Berlin, S. 251–260. Wallace Helen/Wallace, William (Hrsg.)<br />
(2000): Policy-Making in the European Union – Oxford; New York. Weidenfeld, Werner/Wessels,<br />
Wolfgang (Hrsg.) (2003): Jahrbuch der Europäischen Integration 2002/2003 – Berlin.<br />
Lührmann/Löffelsend 201
Sebastian Peter Sass<br />
Artikel 41<br />
DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK 1<br />
Artikel 41: Besondere Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheitsund<br />
Verteidigungspolitik<br />
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist kein selbständiger<br />
Politikbereich, sondern Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und<br />
Sicherheitspolitik (GASP) der Union. Sie verleiht der EU operative Handlungsfähigkeit,<br />
um bei Bedarf die GASP mit militärischen und/oder zivilen Mitteln<br />
praktisch durchsetzen zu können.<br />
Ein zentrales Kennzeichen der GSVP ist, dass sie der EU keine eigenen operativen<br />
Kapazitäten, also zum Beispiel keine eigene Armee zur Verfügung stellt.<br />
Sie ist vielmehr der Ordnungsrahmen, der die Kooperationsformen und die<br />
konkreten Abläufe der Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
vorgibt. Es bleibt also dabei, dass fast jeder Mitgliedstaat weiterhin<br />
eigene Streitkräfte unterhält.<br />
Zur Durchführung von gemeinsamen Operationen wird auf die militärischen<br />
und/oder zivilen Kapazitäten der Mitgliedstaaten zurückgegriffen. Die GSVP<br />
hat drei Schwerpunkte: die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit gemäß Artikel<br />
41 Absatz 6, die gegenseitige Verteidigung gemäß Artikel 41 Absatz 7<br />
sowie die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten,<br />
Forschung, Beschaffung und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur). Die<br />
Solidaritätsklausel in Artikel 43 ist formell kein Teil der GSVP, trägt aber ebenfalls<br />
zur Sicherheitspolitik bei und hat gegebenenfalls verteidigungspolitische<br />
Auswirkungen. 2<br />
Absatz 6: Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit<br />
Für die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit enthält die Verfassung die<br />
grundlegenden Bestimmungen. Diese werden durch nähere Vorschriften im<br />
dritten Teil der Verfassung sowie durch das Protokoll über die Ständige Strukturierte<br />
Zusammenarbeit (GSVP-Protokoll) ergänzt. 3<br />
Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit dient in erster Linie dazu, durch<br />
eine enge Kooperation der Mitgliedstaaten die militärischen Fähigkeiten der<br />
Union zu verbessern, um auf diese Weise Missionen mit höchsten Anforderungen<br />
durchführen zu können. Hier geht es also nicht um klassische Territorial-<br />
1<br />
Der vorliegende Text gibt nur die persönliche Auffassung des Autors wieder.<br />
2<br />
Siehe hierzu die Kommentierung von Sebastian Sass zu Artikel 42.<br />
3<br />
Siehe Artikel 312 sowie das Protokoll über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit gemäß<br />
Artikel 41 Absatz 6 und Artikel 312 der Verfassung.<br />
202 Sass
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Artikel 41<br />
verteidigung, sondern um die Fähigkeit zur militärischen Krisenbewältigung<br />
außerhalb der EU-Grenzen.<br />
Um an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit beteiligt zu werden, müssen<br />
die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen und Anforderungen des GSVP-<br />
Protokolls erfüllen. Dabei handelt es sich einerseits um konkrete militärische<br />
Kapazitätsvorgaben, andererseits um verstärkte Angleichung und Vereinbarkeit<br />
der nationalen militärischen Ressourcen.<br />
Die Kriterien wurden von allen Mitgliedstaaten gemeinsam beschlossen. Die<br />
Teilnahme ist den Mitgliedstaaten freigestellt. Nach dem Inkrafttreten der<br />
Europäischen Verfassung entscheidet der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit<br />
über den Beginn der Zusammenarbeit. Sollte sich ein Mitgliedstaat erst<br />
später der bereits bestehenden Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit<br />
anschließen wollen, so muss er dieselben Kriterien des GSVP-Protokolls erfüllen<br />
wie die bereits teilnehmenden Mitgliedstaaten. Über die Beteiligung des<br />
Neulings entscheiden die bereits zusammenarbeitenden Mitgliedstaaten mit<br />
qualifizierter Mehrheit. Dabei soll das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit<br />
verhindern, dass ein einzelner Mitgliedstaat mit seinem Veto die Beteiligung<br />
eines anderen Mitgliedstaates boykottieren kann.<br />
Um aus der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit freiwillig auszutreten,<br />
genügt eine Mitteilung des austrittswilligen Staates an den Ministerrat. Ist ein an<br />
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit teilnehmender Mitgliedstaat nicht<br />
mehr in der Lage, die Kriterien des GSVP-Protokolls zu erfüllen, können ihn die<br />
anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit ausschließen.<br />
Ob die Mitgliedstaaten die Kriterien der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit<br />
einhalten, beobachtet die neu gegründete Europäische Verteidigungsagentur.<br />
Ihre Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Beurteilung der Mitgliedstaaten.<br />
Mit Ausnahme der in Artikel 213 Absatz 2 bis 5 des dritten Verfassungsteils<br />
ausdrücklich genannten Fälle treffen die an der Ständigen Strukturierten<br />
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten alle Entscheidungen bezüglich<br />
ihrer Zusammenarbeit einstimmig.<br />
Absatz 7: Die gegenseitige Verteidigung<br />
Bei der gegenseitigen Verteidigung verpflichten sich die Mitgliedstaaten im<br />
Falle eines bewaffneten Angriffs einander mit militärischen und anderen Mitteln<br />
kollektiven Beistand zu leisten. Im Gegensatz zur Ständigen Strukturierten<br />
Zusammenarbeit geht es hier um klassische Territorialverteidigung.<br />
Artikel 41 Absatz 7 ermöglicht es den Mitgliedstaaten, im Falle eines bewaffneten<br />
Angriffs auf ihr Territorium die anderen Mitgliedstaaten um Beistand zu<br />
ersuchen. Daraufhin müssen die anderen Mitgliedstaaten „alle in ihrer Macht<br />
stehende Hilfe und Unterstützung leisten“. Der Beistand kann sowohl militärischer<br />
als auch ziviler Art sein.<br />
Sass 203
Artikel 41<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Mit dem Inkrafttreten der Verfassung werden die Vorschriften über die gegenseitige<br />
Verteidigung automatisch für alle Mitgliedstaaten wirksam. Die Teilnahme<br />
ist also nicht mit besonderen Kriterien oder Aufnahmeprozessen verbunden,<br />
wie es bei der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit der Fall ist.<br />
Die Ausübung der kollektiven Verteidigung wird ausdrücklich an Artikel 51 der<br />
Charta der Vereinten Nationen gebunden. Dieser Artikel erlaubt militärische<br />
Gewaltanwendung zur Selbstverteidigung sowie militärischen Beistand für<br />
Staaten, die Opfer eines militärischen Angriffs geworden sind. Die Verpflichtungen<br />
im Bereich der gegenseitigen Verteidigung stehen laut Verfassung nicht<br />
im Widerspruch zu Verpflichtungen aus dem NATO-Vertrag. Damit bleibt die<br />
NATO weiterhin primär für die Verteidigung ihrer Mitglieder zuständig. Andererseits<br />
stellt die Verfassung fest, dass die Pflicht zur gegenseitigen Verteidigung<br />
den „besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
bestimmter Mitgliedstaaten“ unberührt lässt. Diese Bestimmung soll es den<br />
nicht zur NATO gehörenden EU-Mitgliedstaaten 4 ermöglichen, ihre militärische<br />
Neutralitätspolitik bzw. Bündnisfreiheit fortzuführen.<br />
Absatz 3: Die Europäische Verteidigungsagentur<br />
Die Verteidigungsagentur 5 hat zur Aufgabe, im Rahmen der GSVP den „operativen<br />
Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur<br />
Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen<br />
Basis des Verteidigungssektors beizutragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls<br />
durchzuführen, sich an der Festlegung einer europäischen Politik im<br />
Bereich der Fähigkeiten und Rüstung zu beteiligen sowie den Rat bei der Beurteilung<br />
der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen.“ Die<br />
Agentur soll also die Entwicklung der GSVP umfassend fördern. Insbesondere<br />
im Rüstungsbereich und bei der Weiterentwicklung nationaler Kapazitäten ist<br />
zu hoffen, dass die Agentur zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen und<br />
zum Abbau von Überschneidungen führt.<br />
Die EU wird wehrhaft<br />
Die Entwicklung der GSVP<br />
Die GSVP wurde bislang zumeist als „Europäische Sicherheits- und<br />
Verteidigungspolitik“ (ESVP) bezeichnet. In der Verfassung hat sich<br />
jedoch die Bezeichnung „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik“<br />
(GSVP) durchgesetzt. Die GSVP nahm ihren Anfang mit der<br />
4<br />
Finnland, Irland, Malta, Österreich, Schweden und Zypern.<br />
5<br />
Vgl. Rat der Europäischen Union 2003b, 19.<br />
204 Sass
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Artikel 41<br />
Regierungskonferenz von Maastricht, die in den Vertrag von Maastricht<br />
(1992) mündete. Damals wurde erstmalig eine verteidigungspolitische<br />
Perspektive im Gründungsvertrag festgeschrieben. Der Vertrag von<br />
Maastricht sah jedoch noch nicht vor, für die EU eigene verteidigungspolitische<br />
Instrumente und Institutionen zu schaffen. Stattdessen einigte<br />
man sich darauf, die Westeuropäische Union (WEU) 6 zu einem „integralen<br />
Bestandteil“ der Entwicklung der EU zu erklären. 7<br />
Die WEU sollte mit der Ausarbeitung und Durchführung von militärischen<br />
Aktionen beauftragt werden, die zuvor von der EU beschlossen<br />
worden waren. Dazu wurden der WEU vier Aufgabenbereiche vorgegeben,<br />
die noch heute nach dem damaligen Verhandlungsort „Petersberg-<br />
Aufgaben“ genannt werden:<br />
• humanitäre Einsätze – Rettungsmaßnahmen in Katastrophenfällen,<br />
• friedenserhaltende Einsätze,<br />
• Kampfeinsätze zur Bewältigung von Krisen und<br />
• friedensschaffende Maßnahmen.<br />
Eine weitergehende Einigung, insbesondere eine militärische bzw. verteidigungspolitische<br />
Autonomie der EU durch die Schaffung eigener<br />
Instrumente und Institutionen, war aufgrund von Interessengegensätzen<br />
nicht durchsetzbar. Damit blieb die Zuständigkeit der WEU für die operative<br />
Durchführung der GSVP erhalten. Die vollständige Integration<br />
der WEU in die EU, wie sie einige Mitgliedstaaten im Rahmen der Verhandlungen<br />
zum Vertrag von Amsterdam (1997) vorgeschlagen hatten,<br />
war gegen die ablehnende Haltung Großbritanniens und Dänemarks<br />
nicht machbar gewesen.<br />
Der Kosovo-Konflikt im Jahre 1999 führte den Europäern schließlich<br />
ihre militärische und sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA<br />
überdeutlich vor Augen. Zugleich war die britische Außenpolitik von<br />
ihrer ablehnenden Haltung gegenüber verteidigungspolitischen Ambitionen<br />
der EU abgerückt und hatte im Dezember 1998 zusammen mit<br />
Frankreich eine neue verteidigungspolitische Initiative ergriffen. Das<br />
führte schließlich zur britisch-französischen Erklärung von St. Malo 8 ,<br />
die eine allmähliche Schaffung autonomer Fähigkeiten der EU zur<br />
6<br />
Das 1954 gegründete westeuropäische Verteidigungsbündnis WEU war bis dahin nie wirklich<br />
aktiv geworden, sondern hatte im Schatten der NATO in einer Art Dornröschenschlaf verharrt.<br />
7<br />
Vgl. http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/EU_treaty.html (20.06.2005).<br />
8<br />
Vgl. http://www.france.diplomatie.fr/actual/evenements/stmalo2.html (20.06.2005).<br />
Sass 205
Artikel 41<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Durchführung militärischer Operationen erlaubte – allerdings nur für<br />
Fälle, in denen die NATO als Ganzes nicht involviert ist.<br />
Nachdem das britisch-französische Einverständnis den Weg frei<br />
gemacht hatte, einigten sich die EU-Mitgliedstaaten schon auf dem<br />
Europäischen Rat in Köln am 3./4. Juni 1999 auf eine Erklärung zur<br />
Stärkung der GSVP. 9 Nur wenige Monate später beschloss der Europäische<br />
Rat in Helsinki am 10./11. Dezember 1999 ein konkretes Planziel<br />
für den Aufbau militärischer Fähigkeiten bis zum Jahr 2003 (Helsinki<br />
Headline Goal 10 ). Der Ministerrat bestätigte im Mai 2003, „dass die EU<br />
nunmehr im gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben einsatzfähig<br />
ist, wobei es Einschränkungen und Zwänge durch anerkannte Defizite<br />
gibt.“ 11 Im Mai 2004 setzten sich die Mitgliedstaaten daraufhin ein<br />
neues Planziel (Headline Goal 2010), das den veränderten strategischen<br />
und technologischen Bedingungen angepasst war. 12 Einer der Schwerpunkte<br />
des neuen Planziels ist die Umsetzung des Gefechtsverbandkonzepts<br />
(Battlegroup Concept), einer ursprünglich britisch-französischen<br />
Initiative. Hierbei handelt es sich um besonders schnell verlegbare und<br />
einsetzbare Gefechtsverbände, die die Mitgliedstaaten einzeln und<br />
gemeinsam aufstellen sollen. 13 Im November 2004 machten die Mitgliedstaaten<br />
ihre ersten konkreten Beitragszusagen 14 und übertrafen<br />
dabei deutlich die zunächst an sie gestellten Erwartungen.<br />
Auf dem Europäischen Rat von Feira am 19./20. Juni 2000 wiederum<br />
wurden konkrete Zielvorgaben für den Aufbau von zivilen Kapazitäten<br />
zur Krisenbewältigung vereinbart 15 , die Ende 2002 sogar übertroffen<br />
werden konnten. Im Dezember 2004 billigte der Europäische Rat ein<br />
neues Planziel für zivile Krisenbewältigung (Headline Goal 2008). 16<br />
Durch den zum 1. Februar 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza<br />
wurde die GSVP schließlich vollständig in die EU integriert. Die WEU,<br />
dadurch praktisch stillgelegt, existiert seither nur noch als rechtliche<br />
9<br />
Vgl. Europäischer Rat 1999a.<br />
10<br />
Vgl. Europäischer Rat 1999b.<br />
11<br />
Vgl. Rat der Europäischen Union 2003a.<br />
12<br />
Vgl. Rat der Europäischen Union 2004a.<br />
13<br />
Hinsichtlich der Verlegung der Einsatzkräfte gilt als Ziel, dass die Einsatzkräfte nicht später<br />
als zehn Tage nach der Beschlussfassung über die Einleitung der Operation mit der Ausführung<br />
ihres Auftrags im Einsatzgebiet beginnen.<br />
14<br />
Vgl. Rat der Europäischen Union 2004b.<br />
15<br />
Vgl. Europäischer Rat 2004a.<br />
16<br />
Vgl. Europäischer Rat 2004b.<br />
206 Sass
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Artikel 41<br />
Grundlage der militärischen Beistandszusage. Ihrer ursprünglichen Aufgabe<br />
der Sicherung und Verteidigung Westeuropas ist die WEU somit<br />
nie wirklich nachgekommen.<br />
Im Verhältnis zwischen der GSVP der EU zur WEU ist bemerkenswert,<br />
dass die WEU die einzige Kooperationsform von EU-Mitgliedstaaten<br />
bleibt, die eine direkte parlamentarische Kontrolle der gemeinsamen<br />
Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorsieht. Während die WEU über<br />
eine parlamentarische Versammlung bestehend aus nationalen Abgeordneten<br />
verfügt, sieht die GSVP der EU keine wirksame Kontrolle durch<br />
das Europäische Parlament vor. Sollten sich die Mitgliedstaaten zur<br />
endgültigen Stilllegung der WEU entschließen, so wäre es wünschenswert,<br />
dass diese parlamentarische Errungenschaft nicht völlig verloren<br />
geht.<br />
Haushälterin wird Wachhund<br />
Bis mit der Schaffung militärischer Strukturen das erste uniformierte<br />
Personal in die Räume der EU einzog, ist die Union stets eine rein zivile<br />
Institution gewesen. Hatte die EU im gemeinsamen europäischen<br />
Haus bislang nur als Haushälterin gedient, so sollte sie sich nun auch als<br />
Wachhund nützlich machen. Darauf hatten sich die Hausinhaber zwar<br />
grundsätzlich verständigt, doch herrschte noch Uneinigkeit in zahlreichen<br />
Fragen der praktischen Umsetzung: Auf wessen Befehl sollte der<br />
neue Wachhund hören? Wie lang sollte seine Leine sein und wer würde<br />
die Leine führen? Und wie sollte das Revier aufgeteilt werden zwischen<br />
dem neuen und dem viel älteren Wachhund namens NATO, den sich die<br />
Hausinhaber schon lange mit dem Nachbarn von der anderen Straßenseite<br />
teilten?<br />
Wäre die GSVP lediglich ein Projekt der EU-Gründerstaaten Belgien,<br />
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande, so wäre<br />
eine Einigung vergleichsweise einfach zu erzielen. Eine glaubwürdige<br />
und tragfähige GSVP aber ist ohne die Beteiligung Großbritanniens<br />
undenkbar, nicht zuletzt aus Gründen der militärischen Leistungsfähigkeit.<br />
Im Verhältnis zu Großbritannien kommt jedoch ein fundamentaler<br />
Gegensatz zum Vorschein, der den Ärmelkanal zuweilen breiter als den<br />
Atlantik erscheinen lässt: Frankreich und Großbritannien unterscheiden<br />
sich bereits in ihrer grundlegenden sicherheitspolitischen Standortbestimmung<br />
und Interessenanalyse. Sie kommen zu unterschiedlichen<br />
Schlussfolgerungen und definieren daher auch ihr jeweiliges nationales<br />
Interesse sehr unterschiedlich. Seit der Erklärung von St. Malo besteht<br />
Sass 207
Artikel 41<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
jedoch zumindest prinzipielle Übereinstimmung darüber, dass eine<br />
wirksame GSVP im gemeinsamen Interesse liegt. Was mit der GSVP<br />
jedoch konkret angestrebt werden soll, sehen beide Länder weiterhin<br />
unterschiedlich.<br />
Pragmatismus versus Vision<br />
Schon als beide Länder auf ihrem Gipfeltreffen in St. Malo 1998 den Weg<br />
frei machten für die GSVP, verbanden sie damit unterschiedliche Zielsetzungen:<br />
Frankreich wollte mit der GSVP operative Handlungsfähigkeit<br />
erreichen, um die EU als autonomen weltpolitischen Akteur zu stärken<br />
und durch die EU den eigenen Einfluss zu steigern. Großbritannien hingegen<br />
erhoffte sich durch eine verbesserte militärische Kapazität Europas,<br />
die USA dauerhaft an die transatlantische Allianz binden zu können<br />
und durch die besonderen Beziehungen zu Washington den britischen<br />
Einfluss zu steigern. 17 Frankreich sieht seine nationalen Interessen am<br />
besten in einer EU verwirklicht, die unabhängig von den USA agieren<br />
kann und gegebenenfalls einen Gegenpol darstellt. Eine solche EU bleibt<br />
jedoch vorerst eine reine Vision und so hat sich Großbritannien ganz<br />
pragmatisch auf die gegebenen Umstände eingerichtet. London möchte<br />
eine stärkere Abgrenzung von den USA gar nicht erst versuchen. Da die<br />
GSVP aus britischer Sicht ausschließlich zur Stärkung des transatlantischen<br />
Bündnisses eingesetzt werden soll, möchte London von vornherein<br />
klarstellen, dass die GSVP nicht in Konkurrenz zur NATO tritt.<br />
Auf einer sicherheitspolitischen Skala, auf der London und Paris die<br />
jeweiligen konträren Extreme zu dieser Frage darstellen würden, ließe<br />
sich Deutschland irgendwo in der Mitte positionieren. Berlin versucht<br />
sich an der Quadratur des Kreises, indem sowohl an der Schaffung einer<br />
autonomen militärischen Kapazität der EU festgehalten wird, zugleich<br />
aber andererseits keinesfalls die NATO in Frage gestellt werden soll.<br />
Die USA haben sich stets skeptisch gezeigt gegenüber jeglichen Versuchen,<br />
mit der Schaffung der GSVP eine größere militärische Autonomie<br />
der EU zu erreichen. Zwar fordert Washington von den Europäern<br />
immer wieder einen deutlichen Ausbau ihrer militärischen Kapazitäten.<br />
Sobald jedoch Strukturen geschaffen werden, die eine größere Unabhängigkeit<br />
von den USA erlauben, reagiert Washington sehr sensibel,<br />
oft mit Unterstützung Londons. Das zeigt sich beispielsweise an der<br />
17<br />
Vgl. Howorth 2003, 173.<br />
208 Sass
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Artikel 41<br />
Frage, ob ein europäischer Generalstab in die NATO integriert wird 18<br />
oder beim Projekt des europäischen Satellitennavigationssystems GALI-<br />
LEO. 19 In der Praxis ist bislang keine ernsthafte Konkurrenz zwischen<br />
europäischen Verteidigungsstrukturen und der NATO zu beobachten<br />
gewesen. So ist beispielsweise das Eurokorps bisher einzig in NATOgeführten<br />
Operationen zur Krisenbewältigung eingesetzt worden.<br />
Allen Beteiligten ist jedenfalls bewusst, dass die GSVP in kritischen<br />
Bereichen bis auf weiteres auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit<br />
der NATO – d.h. mit den USA – angewiesen bleibt. Das betrifft insbesondere<br />
strategische Planungs- und Führungskapazitäten sowie militärische<br />
Aufklärung. Um die Defizite der GSVP auszugleichen, haben die EU und<br />
die NATO im Dezember 2002 das so genannte „Berlin-plus-Abkommen“<br />
geschlossen. 20 Danach kann die EU in den vorgenannten Bereichen auf<br />
Kapazitäten der NATO zurückgreifen. Aufgrund der enormen militärischen<br />
Überlegenheit der USA heißt ein Zugriff auf NATO-Kapazitäten<br />
praktisch aber immer auch Zugriff auf US-amerikanische Ressourcen.<br />
Die EU besteht jedoch nicht nur aus NATO-Mitgliedstaaten. Die militärisch<br />
bündnisfreien EU-Mitglieder hielten sich während der Verhandlungen<br />
zur Europäischen Verfassung ebenfalls vorsichtig distanziert gegenüber<br />
der neuen GSVP-Struktur. Sie befürchteten eine Entwicklungsdynamik,<br />
in deren Zuge sie an Einfluss auf die GSVP verlieren und infolgedessen<br />
ihre verteidigungspolitischen Grundsatzentscheidungen in Frage<br />
gestellt sehen würden. Nach langwierigen Verhandlungen einigte man<br />
sich schließlich auf einen Wortlaut, der auch im Fall eines konventionellen<br />
militärischen Angriffs auf einen Mitgliedstaat den bündnisfreien Mitgliedstaaten<br />
die Fortführung ihrer Bündnisfreiheit ermöglichen soll. 21<br />
Teufel nicht nur im Detail<br />
Vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Interessenlagen erscheint es<br />
erstaunlich, dass die Regierungskonferenz überhaupt einen Konsens<br />
über die GSVP erzielen konnte. Obwohl nun Einigkeit über die großen<br />
Strukturen besteht, treten die unterschiedlichen Ambitionen der Mit-<br />
18<br />
Vgl. http://euobserver.com/?aid=13558 (20.06.2005).<br />
19<br />
Vgl. http://www.bundestag.de/bic/analysen/2003/2003_04_08.pdf (20.06.2005) und Atlantic<br />
News No. 3546 vom 04.02.2004, 2.<br />
20<br />
Vgl. http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm (20.06.2005).<br />
21<br />
Wenngleich es zum endgültigen Wortlaut und seiner Auslegung zum gegenwärtigen Zeitpunkt<br />
noch abweichende Auffassungen gibt. Vgl. Bulletin Quotidien Europe, Nr. 8637 vom<br />
04.02.2004, 3 f.<br />
Sass 209
Artikel 41<br />
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
gliedstaaten wieder hervor, sobald es um Auslegung und praktische<br />
Anwendung des GSVP-Regelwerks geht. So hatte es sich gleich zu<br />
Anfang als problematisch erwiesen, eine Einigung darüber herbeizuführen,<br />
ob ein Franzose oder ein Brite die Leitung der neu geschaffenen<br />
Europäischen Verteidigungsagentur übernehmen sollte. 22 Über Personalfragen<br />
kann man sich aber jedenfalls leichter verständigen als über<br />
abweichende strategische Analysen und Schlussfolgerungen. Um<br />
wenigstens einen gemeinsamen strategischen Ausgangspunkt für die<br />
GSVP zu schaffen, hatte der Europäische Rat den Hohen Vertreter der<br />
GASP der EU, Javier Solana, mit der Ausarbeitung einer gemeinsamen<br />
Sicherheitsstrategie beauftragt. 23 Im Dezember 2003 auf dem Europäischen<br />
Rat in Brüssel wurde Solanas Strategie von den EU-Mitgliedstaaten<br />
angenommen. 24<br />
Fortschritt der GSVP?<br />
Die Entwicklung der GSVP ist entgegen aller Vorurteile gegenüber<br />
europäischen Projekten geradezu rasant fortgeschritten. Wurde die<br />
Rechtsgrundlage der GSVP erst im Jahre 1992 geschaffen, so hat die<br />
EU schon im Januar 2003 von den Vereinten Nationen die Polizeimission<br />
in Bosnien und Herzegowina „EUPM“ übernommen sowie mit<br />
ihrer militärischen Operation „Concordia“ in Mazedonien ab April 2003<br />
die NATO abgelöst. Im Gegensatz zu „Concordia“ führte die EU ihre<br />
militärische Krisenbewältigungsoperation „Artemis“ im Kongo von<br />
Juni bis September 2003 ganz ohne Rückgriff auf NATO-Mittel und<br />
-Fähigkeiten aus. Darüber hinaus hat die EU im Dezember 2004 die<br />
militärische Führung der Friedensmission in Bosnien-Herzegowina von<br />
der NATO übernommen. 25<br />
Die GSVP-Vorschriften der Verfassung stellen durch ihr bloßes Vorhandensein<br />
einen großen formellen Fortschritt gegenüber den Regelungen<br />
im Vertrag von Nizza dar. Die Zusammenfassung der einschlägigen Vorschriften<br />
in Artikel 41 sowie in einem eigenen Abschnitt im dritten Teil<br />
trägt zur Verständlichkeit und damit zur Transparenz bei. Darüber hin-<br />
22<br />
Vgl. Atlantic News, No. 3545 vom 30.1.2004, 3.<br />
23<br />
Vgl. Europäische Sicherheitsstrategie „Ein sicheres Europa in einer besseren Welt“, unter:<br />
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf (20.06.2005).<br />
24<br />
Vgl. Europäischer Rat 2003.<br />
25<br />
Vgl. http://www.bundesregierung.de/Politikthemen/Europaeische-Union/Nachrichten-,9221.<br />
538271/artikel/EU-uebernimmt-2004-Friedens-Mi.htm (20.06.2005).<br />
210 Sass
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik<br />
Artikel 41<br />
aus dürften die neuen Regelungen die Effektivität und Leistungsfähigkeit<br />
der GSVP erheblich steigern. Dies gilt nicht nur für die operative<br />
Seite, sondern insbesondere auch für die effiziente Nutzung von<br />
Ressourcen, z.B. durch koordinierte Beschaffungen. Für die weitere<br />
Entwicklung der GSVP erscheint es von zentraler Bedeutung, dass die<br />
Einrichtung der strukturierten Zusammenarbeit nicht zu einem<br />
geschlossenen militärischen Kern führt. Für die Integrationsziele der<br />
EU ist es besonders wichtig, dass die Zusammenarbeit allen Staaten<br />
offen steht, die sich daran beteiligen wollen und können. Andernfalls<br />
erscheint es fraglich, ob sich eine echte gemeinsame europäische<br />
Sicherheitsidentität entwickeln kann. Dies gilt umso mehr angesichts<br />
der EU-Erweiterung, die eine schnelle und möglichst umfassende Integration<br />
der neuen Mitgliedstaaten erforderlich werden lässt.<br />
Hinsichtlich der demokratischen Kontrolle der GSVP wurde versäumt,<br />
parlamentarische Kompetenzen auszubauen. Das Europäische Parlament<br />
wird lediglich angehört und informiert, Mitentscheidungsbefugnisse<br />
hat es nicht. Unter diesen Umständen wird das Europäische Parlament<br />
weiter versuchen müssen, seinen Einfluss auf die GSVP über das<br />
Haushaltsrecht geltend zu machen.<br />
Literatur: Europäischer Rat (1999a): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Köln, 03./04.06.1999,<br />
unter: http://europa.eu.int/council/off/conclu/june99/annexe_de.htm#a3 (20.06.2005). Europäischer<br />
Rat (1999b): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Helsinki, 10./11.12.1999, unter: http://ue.eu.int/<br />
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00300-r1.d9.htm (20.06.2005). Europäischer Rat (2003):<br />
Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, 12.12.2003, Rn. 84, unter: http://ue.eu.int/ueDocs/<br />
cms_Data/docs/pressData/de/ec/79654.pdf (20.06.2005). Europäischer Rat (2004a): Schlussfolgerungen<br />
des Vorsitzes, Santa Maria da Feira, 19./20.06.2000, unter: http://ue.eu.int/<br />
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00200-r1.d0.htm (20.06.2005). Europäischer Rat<br />
(2004b): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, 17.12.2004, unter: http://ue.eu.int/<br />
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/83221.pdf (20.06.2005). Howorth, Jolyon (2003):<br />
France, Britain and the Euro-Atlantic Crisis, in: Survival, H. 45, S. 173–192. Lindstrom, Gustav<br />
(2004): The Headline Goal, unter: http://www.iss-eu.org/esdp/05-gl.pdf (20.06.2005). Rat<br />
der Europäischen Union (2003a): 2509. Tagung des Rates (Außenbeziehungen) am 19./20.05.2003<br />
in Brüssel, Ratsdokument 93797/03 unter: http://ue.euint/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/<br />
gena/76070.pdf (20.06.2005). Rat der Europäischen Union (2003b): Beschluss des Rates<br />
2003/834/EG vom 17.11.2003 zur Einsetzung eines Stabes zur Vorbereitung der Einrichtung<br />
einer Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung<br />
und Rüstung, in: ABl. L 318 vom 03.12.2003). Rat der Europäischen Union (2004a):<br />
Ratsdokument 6309/6/04 REV 6 vom 04.05.2004, unter: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/04/<br />
st06/st06309-re06.de04.pdf (20.06.2005). Rat der Europäischen Union (2004b): Ministererklärung<br />
zu den europäischen militärischen Fähigkeiten, Ratsdokument 15547/04 vom 13.12.2004,<br />
unter: http://register.consilium.eu.int/pdf/de/04/st15/st15547.de04.pdf (20.06.2005).<br />
Sass 211
Tamara Ritter<br />
Artikel 42<br />
DER RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS<br />
Artikel 42: Besondere Bestimmungen über den Raum der Freiheit, der<br />
Sicherheit und des Rechts<br />
Nach Artikel 42 wird der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
(RFSR) durch drei Ebenen gebildet. Auf der ersten Ebene werden durch Europäische<br />
Gesetze und Rahmengesetze die nationalen Rechtssysteme einander<br />
angeglichen. Auf der zweiten Ebene werden außergerichtliche und gerichtliche<br />
Entscheidungen als „vertrauensbildende Maßnahmen” gegenseitig anerkannt.<br />
Zu den vertrauensbildenden Maßnahmen zählt auch die wechselseitige Bewertung<br />
der Mitgliedstaaten untereinander. 1 Ziel ist es zu überwachen, ob die EU-<br />
Politik tatsächlich in den Verwaltungen und Justizbehörden der Mitgliedstaaten<br />
umgesetzt wird. Die dritte Ebene ist die verstärkte Zusammenarbeit der verschiedenen<br />
Polizei- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten.<br />
Der RFSR umfasst die Asyl-, Einwanderungs- und Grenzpolitik, die justizielle<br />
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie die polizeiliche Zusammenarbeit<br />
auf europäischer Ebene. Diese Bereiche waren bisher auf zwei verschiedene<br />
Säulen verteilt. Durch die Verfassung wird nun ein gemeinsamer Rechtsrahmen<br />
geschaffen und damit das Drei-Säulen-Modell (EG, GASP, PJZS) aufgelöst.<br />
Zwei Besonderheiten unterscheiden den RFSR von anderen Politikbereichen:<br />
• Die Verfassung weist den nationalen Parlamenten in Artikel 42 Absatz 2 eine<br />
gesonderte Rolle im RFSR zu. 2 Sie können sich an der gegenseitigen Bewertung<br />
der Mitgliedstaaten beteiligen und durch Europäische Gesetze in die<br />
Kontrolle des Europäischen Polizeiamtes (Europol) und der Europäischen<br />
Stelle für Justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) mit einbezogen werden.<br />
• Nach Artikel 42 Absatz 3 haben die Mitgliedstaaten ein Initiativrecht, das sie<br />
neben der Kommission im Bereich der strafrechtlichen und polizeilichen<br />
Zusammenarbeit ausüben. Dabei reicht ein Viertel der Mitgliedstaaten aus,<br />
um einen Gesetzesvorschlag zur Abstimmung zu bringen. 3<br />
Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (ehemals dritte<br />
Säule) ist nun vergemeinschaftet. Das bedeutet, dass in diesem Bereich nun Europäische<br />
Gesetze und Rahmengesetze erlassen und durch einheitliche Verfahren<br />
umgesetzt werden. Neu sind damit grundsätzlich Mehrheitsentscheidungen im<br />
1<br />
Siehe Artikel 260.<br />
2<br />
Diese spiegelt sich auch in einem Artikel in Teil III der Verfassung wider. Siehe Artikel 259.<br />
3<br />
Siehe Artikel 264.<br />
212 Ritter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Artikel 42<br />
Ministerrat (mit dem Europäischen Parlament als gleichberechtigtem Gesetzgeber)<br />
sowie das uneingeschränkte Initiativrecht der Europäischen Kommission. In<br />
manchen Bereichen sind allerdings einstimmige Entscheidungen im Ministerrat<br />
erhalten geblieben, so zum Beispiel bei der Frage um die Schaffung einer europäischen<br />
Staatsanwaltschaft. Ebenfalls neu ist in diesem Bereich die allgemeine<br />
Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes. 4 Der RFSR ist gemäß Artikel 14<br />
ein Bereich der geteilten Kompetenz. 5 Es gibt für diesen gesamten Bereich allerdings<br />
nur einen einzigen Verfassungsartikel im ersten Teil der Verfassung. Die<br />
entscheidenden Regelungen, wie die Zielbestimmungen und deren Umsetzung,<br />
sind im Teil III der Verfassung zu finden. 6<br />
Europäische Innen- und Justizpolitik:<br />
Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts –<br />
ein magisches Dreieck?<br />
Das europäische Vorgehen in Fragen von Justiz und Innerem war jahrelang<br />
außerhalb der EU-Strukturen angesiedelt. Erst mit dem Vertrag von<br />
Amsterdam 1997 wurden mehrere Schlüsselbereiche in die europäischen<br />
Verträge überführt. Seitdem wird der „Raum der Freiheit, Sicherheit<br />
und des Rechts” als Synonym für die Innen- und Justizpolitik in der<br />
Europäischen Union verwendet. Das Spannungsverhältnis zwischen<br />
Freiheit und Sicherheit ist nicht dauerhaft lösbar, sondern es stellt sich<br />
immer wieder die politische Aufgabe, mittels des Rechts die richtige<br />
Balance zu finden:<br />
Recht<br />
Freiheit<br />
Sicherheit<br />
Grafik: Kraus-Vonjahr 2002, 41<br />
4<br />
Vgl. zur Rolle des Gerichtshofes den Text von Reinhard Ruge in diesem Band.<br />
5<br />
D.h., die Gesetzgebungskompetenz liegt vorrangig bei der EU. Nur wenn diese davon keinen<br />
Gebrauch macht, sind die Mitgliedstaaten zuständig. Vgl. hierzu den Text zu den Zuständigkeiten<br />
der EU von Christian Wenning und Florian Ziegenbalg in diesem Band.<br />
6<br />
Insbesondere in den Artikeln 257 bis 277.<br />
Ritter 213
Artikel 42<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Grundlegende Entscheidungen in diesem sensiblen Bereich finden jedoch<br />
in einer Zeit statt, in der die Sensibilität für Bürgerrechte gering und die<br />
Angst vor terroristischen Anschlägen zugleich groß ist. Eine europäische<br />
Öffentlichkeit, die diese Entwicklung kritisch hinterfragt, existiert kaum.<br />
Zu begrüßen ist, dass das gemeinsame Entscheidungsverfahren, bei dem<br />
das Europäische Parlament neben dem Ministerrat gleichberechtigter<br />
Partner im Gesetzgebungsverfahren ist, nun die Regel ist. Dies ermöglicht<br />
eine demokratische Kontrolle. Leider wurde aber dieses Mitentscheidungsverfahren<br />
aus manchen Bereichen ausgeklammert. So zum<br />
Beispiel im Bereich der operativen Zusammenarbeit der Polizei- und<br />
Strafverfolgungsbehörden und im Familienrecht. 7<br />
Festung Europa: Knocking on heaven’s door –<br />
Grenzkontrollen, Asyl- und Einwanderungspolitik<br />
Die Verfassung sieht grundsätzlich den Abbau der Binnengrenzen vor<br />
und schreibt damit die mit dem Schengener Abkommen und dem<br />
Amsterdamer Vertrag begonnene Entwicklung fort. In Folge der terroristischen<br />
Anschläge in den USA vom 11. September 2001 wurden<br />
jedoch Kriterien für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den<br />
Binnengrenzen festgelegt, zum Beispiel für Fälle von „außerordentlichen<br />
terroristischen Bedrohungssituationen“. Problematisch ist in diesem<br />
Zusammenhang die Definition dieser „außerordentlichen terroristischen<br />
Bedrohungssituationen“. 8 Fallen beispielsweise globalisierungskritische<br />
Demonstrationen darunter? Unklarheiten wie diese bringen die<br />
Gefahr mit sich, dass unter dem Vorwand terroristischer Bedrohungen<br />
das Demonstrationsrecht und die <strong>Bewegung</strong>sfreiheit eingeschränkt werden<br />
können. 9<br />
Gleichzeitig mit dem Abbau der Binnengrenzen werden die Außengrenzen<br />
stärker gesichert. Während die Binnengrenzen zu den neuen EU-Mitgliedsländer<br />
infolge ihres Beitritts im Mai 2004 schrittweise abgebaut<br />
werden, wird zugleich im Sinne von ‚Ausgleichsmaßnahmen‘ eine schärfere<br />
Bewachung der Außengrenzen vorgesehen. Neben der weiteren Ausgestaltung<br />
der bereits beschlossenen gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik<br />
wird durch die Verfassung eine rechtliche Grundlage für ein<br />
„Integriertes Grenzschutzsystem“ geschaffen 10 : Hierbei soll unter ande-<br />
7<br />
Siehe die Artikel 261, Artikel 275 Absatz 3 und Artikel 269 Absatz 3.<br />
8<br />
Vgl. Monar 2002, 175.<br />
9<br />
Dass dies nicht allzu unwahrscheinlich ist, zeigt Studzinsky 2003.<br />
10<br />
Siehe Artikel 265 Absatz 1c und Absatz 2d.<br />
214 Ritter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Artikel 42<br />
rem ein Netz von Rückführungsabkommen mit so genannten „sicheren<br />
Drittstaaten“ geschlossen werden. Als sicherer Drittstaat wird ein Land<br />
definiert, in dem sich Flüchtlinge auf ihrem Fluchtweg aufgehalten haben<br />
und wo ihnen keine Gefahr droht. 11 Diese Länder verpflichten sich im<br />
Rahmen dieser Rückführungsübereinkommen, Flüchtlinge, die von<br />
ihrem Territorium eingereist sind „zurückzunehmen“. Wenn also ein EU-<br />
Staat seine Nachbarstaaten oder gar die Herkunftsländer der Verfolgten<br />
in die Gruppe der sicheren Drittstaaten einbezieht, werden Flüchtlinge<br />
ohne die Möglichkeit der Asylbeantragung zurückgeschickt. 12 Immer<br />
mehr Flüchtlinge scheitern daher an den Außengrenzen der EU. 13 Hinzu<br />
kommt, dass der Nachbarstaat vielleicht selbst eine „sichere Drittstaatenregelung“<br />
hat – aber ganz andere Vorstellungen davon, was ein sicherer<br />
Drittstaat ist. So kommt es vor, dass Flüchtlinge im Wege einer Kettenabschiebung<br />
oft bis zurück in ihre Heimatländer abgeschoben werden, in<br />
denen ihnen Folter und politische Verfolgung drohen. Dies widerspricht<br />
jedoch nicht nur der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern auch der<br />
EU-Grundrechtecharta, die Abschiebungen, Ausweisungen und Auslieferungen<br />
bei drohender Folter verbietet. 14<br />
Die „Last“ der neuen EU-Außengrenze wird damit nicht nur den Beitrittsländern,<br />
sondern auch den neuen Nachbarstaaten der EU auferlegt.<br />
Diese Länder sind mit ihrer Aufgabe, den Flüchtlingen Schutz zu bieten,<br />
in der Regel aber überfordert. Die Flucht endet dort oft im Gefängnis<br />
oder in Flüchtlingslagern mit katastrophalen Zuständen. 15 Die Ukraine<br />
beispielsweise bekam in den letzten Jahren fast 26 Millionen Euro für<br />
die Aufrüstung der Grenzkontrollen, aber kein Geld für den Flüchtlingsschutz.<br />
Insgesamt will die EU zwischen den Jahren 2004 und 2006 für<br />
Grenzsicherungsmaßnahmen 140 Millionen Euro ausgeben. 16<br />
11<br />
Welche Länder genau zu den sicheren Drittstaaten gehören, wird unter den Innen- und Justizministern<br />
verhandelt. Zukünftig könnten darunter auch Länder fallen, in denen sich ein Flüchtling<br />
nie aufgehalten hat. Vgl. „Experten warnen EU vor Einführung sicherer Drittstaaten“, in:<br />
Frankfurter Rundschau vom 19.02.2004, 6.<br />
12<br />
So will Italien die Flüchtlingszahl auf Null senken: Frankfurter Rundschau v. 30.09.2004, 5.<br />
13<br />
Siehe „Flüchtlingstod im Meer: Armutszeugnis für Europa“, in: Frankfurter Rundschau vom<br />
19.04.2004, 3.<br />
14<br />
In diesem Zusammenhang warnen Flüchtlingsorganisationen dringend vor der Verschärfung<br />
des Asylrechts. Vgl. „Amnesty warnt EU-Minister vor Verschärfung des Asylrechts“, in:<br />
Frankfurter Rundschau vom 22.01.2004, 5 und „Vor Angriff auf globales Asylrecht gewarnt“,<br />
in: Frankfurter Rundschau vom 30.03.2004, 6.<br />
15<br />
Siehe „Menschenrechtler prangern Zustände in Flüchtlingscamps an“, in: Frankfurter Rundschau<br />
vom 26.07.2004, 1.<br />
16<br />
Siehe „L’Union européenne tente de contenir l’immigration“, in: Le Monde vom 21.06.03, 1.<br />
Ritter 215
Artikel 42<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Es ist zu bezweifeln, dass die Verlagerung des Flüchtlingsproblems<br />
nach außen eine gute Lösung ist. Vielmehr könnten die Mittel für Hilfen<br />
in den Transit- und Herkunftsstaaten eingesetzt werden, um die<br />
Fluchtursachen zu bekämpfen und den Menschen einen Anreiz zu<br />
geben, in ihrer Heimat zu bleiben. Nur wenige Flüchtlinge sind überhaupt<br />
in der Lage, die EU zu erreichen. 17<br />
Alle genannten Maßnahmen in der Asyl-, Einwanderungs- und Grenzpolitik<br />
werden nach der Verfassung durch Europäische Gesetze und Rahmengesetze<br />
festgelegt. Das bedeutet, dass in den genannten Bereichen<br />
künftig Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat möglich sind und das<br />
Europäische Parlament gleichberechtigter Gesetzgeber ist. Dies ist ein<br />
erheblicher Integrationsfortschritt. Bisher wurden Maßnahmen in diesem<br />
Bereich nur einstimmig vom Ministerrat beschlossen; das Europäische<br />
Parlament wurde nur angehört. Unklar ist, wie sich die Mehrheitsentscheidungen<br />
auswirken werden, wobei insbesondere im Asylbereich zu<br />
befürchten ist, dass es zu einer Verschärfung der bereits strikten Regelungen<br />
kommt. 18 Vom Verfassungskonvent noch verworfen, ist nun eine Europäische<br />
Grenzschutzagentur entstanden.<br />
Festschreibung des Status quo?!<br />
Die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen<br />
Mit der Einführung und Vertiefung des Binnenmarktes wurde auch die<br />
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich des Zivilrechtes verstärkt.<br />
Bereits vor der Verfassung gab es eine relativ breite Rechtsgrundlage<br />
für die Angleichung der nationalen Zivilrechtsvorschriften.<br />
Die Verfassung bringt daher kaum Änderungen. 19 Zur justiziellen<br />
Zusammenarbeit gehören insbesondere Regelungen zur gegenseitigen<br />
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen. Mit dem<br />
Vertrag von Nizza wurden hier Mehrheitsentscheidungen des Ministerrates<br />
unter Zustimmung des Europäischen Parlamentes eingeführt.<br />
Allein das Familienrecht wird in der Verfassung nur einstimmig und<br />
ohne Mitspracherecht des Europäischen Parlamentes entschieden. 20<br />
17<br />
Siehe Nuscheler 2004.<br />
18<br />
Auf nationaler Ebene wird derzeit in mehreren europäischen Staaten die Asylgesetzgebung<br />
verschärft (z.B. Frankreich, Österreich, Niederlande), obwohl die Asylbewerberzahlen rückläufig<br />
sind. Vgl. „UN-Flüchtlingshilfswerk: Zahl der Asylanträge in Industriestaaten gesunken“,<br />
in: Frankfurter Rundschau vom 01.09.2004, 5.<br />
19<br />
Es gab nur Ergänzungen hinsichtlich des Zugangs zum Recht, der alternativen Streitbeilegung<br />
und der Weiterbildung von Richtern und Justizbediensteten (Artikel 269e, g und h).<br />
20<br />
Vgl. Artikel 269 Absatz 3.<br />
216 Ritter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Artikel 42<br />
Festnahmen in Europa – Gleiches Recht für alle?<br />
Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen<br />
Die Mitgliedstaaten der EU haben bisher vor allem im Rahmen des<br />
Europarates, des Schengener Abkommens oder auf informeller Ebene<br />
auf dem Gebiet des Strafrechts zusammengearbeitet. Neu ist nun die<br />
Einbeziehung der strafrechtlichen Zusammenarbeit in den allgemeinen<br />
institutionellen Rahmen der EU. Die Verfassung stellt im Wesentlichen<br />
zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um die Zusammenarbeit zwischen<br />
den Mitgliedstaaten in Zukunft zu erleichtern: Die EU-Mitgliedstaaten<br />
sollen Gerichtsurteile und -entscheidungen gegenseitig anerkennen und<br />
die entsprechenden Behörden zusammenarbeiten. 21 Hierbei wird das<br />
Urteil des anderen Mitgliedstaates ohne weitere Prüfung anerkannt.<br />
Unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsordnungen können die<br />
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aber auch angeglichen werden.<br />
Hierzu kann zunächst auf EU-Ebene einheitlich festgelegt werden, welche<br />
Straftaten EU-weit strafbar sind, mit welchen Strafen sie belegt<br />
werden und welche gemeinsamen Vorschriften im Strafverfahrensrecht<br />
gelten. Als Straftaten gelten bestimmte Bereiche besonders schwerer<br />
Kriminalität, die in der Verfassung explizit aufgeführt sind. 22 Im Strafverfahrensrecht<br />
können EU-weite Rechte von Angeklagten oder Opfern<br />
festgelegt werden. 23<br />
Die Angleichung von Rechtsvorschriften geschieht in Form von Mindestvorschriften<br />
und Rahmengesetzen, die von den EU-Mitgliedstaaten<br />
unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze umgesetzt<br />
werden. Der Erlass eines Rahmengesetzes bedeutet neben der Beteiligung<br />
des Europäischen Parlaments jedoch auch Mehrheitsentscheidungen.<br />
24 Dies kann im Einzelfall problematisch sein, da auf diese Weise<br />
ein Land überstimmt werden kann und dann bestimmte Handlungen<br />
unter Strafe stellen muss. Aus diesem Grund enthält die Verfassung nun<br />
eine Vorbehaltsklausel. 25 Sollte ein Staat aufgrund seiner nationalen<br />
Rechtsordnung Probleme mit einem Rahmengesetz in diesem Bereich<br />
haben, so kann der Europäische Rat damit befasst werden. Kommt hier<br />
21<br />
Siehe Artikel 270.<br />
22<br />
Hierzu zählen u. a. Terrorismus, Menschenhandel und Computerkriminalität mit einer grenzüberschreitenden<br />
Dimension. Vgl. Artikel 271 Absatz 1. Diese Liste kann vom Ministerrat einstimmig<br />
unter Zustimmung des Europäischen Parlamentes geändert werden.<br />
23<br />
Siehe Artikel 270 Absatz 2.<br />
24<br />
Derzeit gilt im Strafrecht das Prinzip der Einstimmigkeit.<br />
25<br />
Siehe die Artikel 270 Absatz 3 und Artikel 271 Absatz 3.<br />
Ritter 217
Artikel 42<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
keine Einigung zustande, können mindestens ein Drittel der Staaten<br />
eine verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich beschließen. 26 Das<br />
jeweilige Strafrecht oder Strafverfahrensrecht gilt dann nicht EU-weit,<br />
sondern nur in bestimmten Staaten.<br />
Das Spannungsverhältnis zwischen gegenseitiger Anerkennung auf der<br />
einen und Angleichung des materiellen Strafrechts auf der anderen Seite<br />
wird auch bei der Einführung des Europäischen Haftbefehls deutlich.<br />
Dieser wurde in Folge des 11. Septembers 2001 beschlossen. 27 Er gilt für<br />
eine sehr vage formulierte Liste von 32 Straftaten mit einer Mindeststrafe<br />
von zwölf Monaten. Ein Haftbefehl, der durch ein Gericht in einem Mitgliedstaat<br />
ausgestellt wurde, könnte dann in allen anderen EU-Staaten<br />
ohne weiteres Verfahren vollstreckt werden. EU-Staaten müssen ihre<br />
Bürger in diesem Fall auch dann ausliefern, wenn die dem Haftbefehl<br />
zugrunde liegende Tat in ihrem eigenen Staat nicht strafbar ist. 28 Dies<br />
kann im Einzelfall problematisch sein. Hierzu zwei Beispiele:<br />
Eine in Spanien lebende Deutsche, die einen Zeitungsartikel veröffentlicht,<br />
in dem sie freundlich über die ETA schreibt, kann dort aufgrund<br />
eines solchen Artikels wegen Terrorismus verurteilt werden. Dem Strafverfahren<br />
entzieht sie sich durch eine Reise nach Deutschland. Wenn nun<br />
die spanische Richterin einen Europäischen Haftbefehl ausstellt, müsste<br />
die Bundesrepublik die Frau nach Spanien ausliefern, wo diese möglicherweise<br />
verurteilt wird. Da allerdings in Europa die Vollstreckung<br />
normalerweise im Heimatland erfolgt, würde die Frau ihre Gefängnisstrafe<br />
wegen Terrorismus in einem deutschen Gefängnis abbüßen –<br />
wegen einer Tat, die in Deutschland nicht strafbar ist. Dies ist nur schwer<br />
vorstellbar.<br />
In Großbritannien hingegen genießt die Meinungsfreiheit einen sehr<br />
hohen Stellenwert. Dies bedeutet aber auch, dass Großbritannien den<br />
Straftatbestand der Billigung, Leugnung oder Verharmlosung nationalistischer<br />
Straftaten – im Gegensatz zu Deutschland – nicht kennt. Die britische<br />
Regierung hat daher beschlossen, ihre Staatsbürger bei einem Haftbefehl<br />
wegen Delikten aus dem Rassismusbereich nicht auszuliefern. 29<br />
26<br />
Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit erklärt Luise Papcke in diesem Band.<br />
27<br />
Er trat in Deutschland am 23.08.2004 in Kraft.<br />
28<br />
Bei den Auslieferungsverfahren musste bislang Strafrelevanz in Deutschland gegeben sein.<br />
29<br />
Siehe „Haftbefehl. Briten sind vor europäischen Rassismus-Anklagen sicher”, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung vom 04.07.2003, 35.<br />
218 Ritter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Artikel 42<br />
Gemeinsame Mindeststandards bei der Definition von Straftaten, wie in<br />
der Verfassung vorgesehen, sind daher zwingend notwendig. Aber auch<br />
eine Angleichung des Strafverfahrens ist für eine gegenseitige Anerkennung<br />
wichtig. Nur durch Angleichung rechtsstaatlicher Grundsätze, wie<br />
das Recht auf ein faires Strafverfahren, kann Vertrauen in die Justiz des<br />
anderen Mitgliedstaates entstehen. Das Fehlen von europaweit gemeinsamen<br />
Rechtsgrundlagen ist beim Europäischen Haftbefehl daher problematisch.<br />
30 In Deutschland prüft nun das Bundesverfassungsgericht die<br />
Rechtmäßigkeit des Europäischen Haftbefehls.<br />
Ein weiteres Element der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen ist<br />
Eurojust. Eurojust ist eine europäische Koordinierungsstelle, die die<br />
Zusammenarbeit der Strafverfolgung zwischen EU-Staaten verbessern<br />
soll. Das Tätigkeitsfeld umfasst schwere Straftaten, die die EU oder<br />
mindestens zwei Mitgliedstaaten betreffen. Die Arbeit von Eurojust<br />
basiert auf den Informationen und den Tätigkeiten der nationalen Strafverfolgungs-<br />
und Ermittlungsbehörden und Europol. Die genauen Aufgaben<br />
werden durch Europäische Gesetze festgelegt.<br />
Eine europäische Staatsanwaltschaft kann ausgehend von Eurojust<br />
geschaffen werden. Hierzu bedarf es eines Europäischen Gesetzes, das<br />
der Ministerrat nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes einstimmig<br />
beschließt. Die Anklage erfolgt dann vor den nationalen<br />
Gerichten. Die Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft ist<br />
jedoch bislang am Veto Großbritanniens gescheitert. Zudem fehlt auf<br />
europäischer Ebene noch immer eine europäische Strafverteidigung. 31<br />
Europol – mehr als eine „Festplatte Europa“<br />
Die europäische Polizeibehörde Europol wurde 1995 durch einen völkerrechtlichen<br />
Vertrag geschaffen, um die polizeiliche Zusammenarbeit<br />
zwischen den EU-Staaten zu verbessern. Die Verfassung bezieht nun die<br />
ehemals weitestgehend zwischenstaatliche polizeiliche Zusammenarbeit<br />
in den allgemeinen institutionellen Rahmen der EU ein. War Europol bislang<br />
vor allem durch umfangreiche Informationssammlung und -analyse<br />
bekannt, gibt es nun in der Verfassung eine Rechtsgrundlage, die dem<br />
Gesetzgeber einen breiten Spielraum für deren Einsatz einräumt.<br />
30<br />
Aus diesem Grund gibt es außerdem als weitere Ausnahme die Möglichkeit eines<br />
Vollstreckungsvorbehaltes durch das jeweilige nationale Gericht.<br />
31<br />
Entsprechende Vorschläge „Eurojust“ einen „Eurodefensor“ entgegenzusetzen, gibt es bereits.<br />
Ritter 219
Artikel 42<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Zu begrüßen ist, dass der Ministerrat nun nicht mehr allein die Aufgabenbereiche<br />
festlegt, sondern dies im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens<br />
nur zusammen mit dem Europäischen Parlament tun kann. Dadurch<br />
erfolgt nun auf europäischer Ebene eine demokratische Kontrolle von<br />
Europol. 32 Kritisch zu bewerten ist allerdings die fehlende Kompetenz<br />
des Europäischen Parlamentes im nicht näher definierten operativen<br />
Bereich. Europol soll nationale Polizei- und Strafverfolgungsbehörden<br />
unter anderem bei grenzüberschreitender schwerer Kriminalität und<br />
„Terrorismus“ unterstützen. Es gibt nun die explizite Möglichkeit, hierzu<br />
eine Rechtsgrundlagen für Ermittlungen und operative Maßnahmen<br />
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu schaffen. 33 Zwar sollen konkrete<br />
Eingriffe in die Grundrechte der Bürger auf nationaler Ebene verbleiben,<br />
dabei wird jedoch vergessen, dass bereits die Informationsverarbeitung<br />
ganz konkrete Auswirkungen auf die Unionsbürger hat. So werden auch<br />
Personen, die keiner Straftat beschuldigt werden, sondern gegen die eine<br />
„Gefährlichkeitsvermutung“ vorliegt, in den zahlreichen Datenbanken<br />
auf verschiedenen europäischen Ebenen gespeichert. Diese sollen weiter<br />
verknüpft werden. 34 Hierzu gehören seit neuestem auch Teilnehmer an<br />
internationalen Veranstaltungen. 35 Diese Gefährlichkeitsvermutungen<br />
sind gerichtlich kaum zu widerlegen. Ein Eintrag in einer polizeilichen<br />
Datenbank reicht jedoch aus, um die <strong>Bewegung</strong>s- und Demonstrationsfreiheit<br />
derart einzuschränken, dass eine Ausreise verboten werden kann.<br />
Es gibt zwar für Europol eine gemeinsame Kontrollinstanz, die den<br />
Umgang mit diesen riesigen Datenmengen überwachen soll, ihre Einbindung<br />
in die Verwaltungsstruktur Europols gewährleistet aber keine hinreichende<br />
Unabhängigkeit. Ein Antrag, in dem Verfassungsartikel zu Europol<br />
höchst mögliche Datenschutzrechte zu gewährleisten, wurde im Konvent<br />
abgelehnt. 36 Wie sich die Einbeziehung der Grundrechtecharta und der dort<br />
festgelegte Schutz personenbezogener Daten auswirkt, bleibt abzuwarten.<br />
32<br />
Europol wurde bislang nur vom Ministerrat „Justiz- und Innenminister“ als oberstem Aufsichtsorgan<br />
kontrolliert, ihre konkreten Aktivitäten von einem Verwaltungsrat.<br />
33<br />
Siehe Artikel 276 Absatz 2b.<br />
34<br />
Siehe „EU will Daten verknüpfen. Rat der Innenminister tagt“, in: Frankfurter Rundschau vom<br />
01.10.2004, 6.<br />
35<br />
So gelten neben Fußballfans beispielsweise auch Globalisierungskritiker als „potenziell<br />
gefährliche Personen, die an der Beteiligung an internationalen Kundgebungen zu hindern<br />
sind“ (siehe Europäischer Rat 2001). Die Daten festgenommener Globalisierungskritiker werden<br />
regelmäßig im SIS, einer polizeilichen Datenbank der Schengen-Staaten, gespeichert.<br />
36<br />
Siehe die Änderungsanträge von Voggenhuber, Lichtenberger, MacCormick und Nagy, unter:<br />
http://www.elisabeth-schroedter.de/downloads/JHA_GreenAmendments.doc (20.06.2005).<br />
220 Ritter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Artikel 42<br />
Mittel- oder langfristig wird Europol eigene Ermittlungen durchführen,<br />
die Rede ist bereits von einem „europäischen FBI“ 37 . Aus diesem Grund<br />
ist bereits jetzt eine umfassende Kontrolle besonders wichtig. Laut Verfassung<br />
soll die Kontrolle durch das Europäische Parlament und die<br />
nationalen Parlamente erst durch Europäische Gesetze festgelegt werden.<br />
Die ursprünglich von der Konvents-Arbeitsgruppe X „Freiheit,<br />
Sicherheit und Recht“ vorgesehene Überwachung von Europol durch<br />
Eurojust ist in der Verfassung nicht vorgesehen.<br />
Ausblick auf die weitere Tätigkeit im Bereich RFSR gibt das Ende 2004<br />
von den Staats- und Regierungschefs beschlossene Haager Programm. 38<br />
Ziele sind bis 2010 u.a. Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit, der<br />
Aufbau eines EU-weiten Asylsystems, eine einheitliche Grenzsicherung<br />
und eine bessere Koordination der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung.<br />
39 Es bleibt also spannend!<br />
37<br />
Siehe u. a. Ellermann 2002, 561 ff.<br />
38<br />
Vgl. http://www.heise.de/newsticker/data/anw-28.11.03-001/ (20.06.2005).<br />
39<br />
Siehe die allgemeine Kommentareinleitung in diesem Text.<br />
Ritter 221
Artikel 42<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts<br />
Literatur: Ellermann, Jan (2002): Vom Sammler zum Jäger – Europol auf dem Weg zu einem<br />
europäischen FBI?, in: Zeitschrift für europarechtliche Studien (ZeuS), H. 4, S. 561–586. <br />
Europäischer Konvent (2002): Schlussbericht der Gruppe X „Freiheit, Sicherheit und Recht“<br />
vom 02. Dezember 2002 (CONV 426/02). Europäischer Rat (2001): New functions of the SIS<br />
II, Dokument 6164/5/01 Rev 5, Limite, Brüssel, 6.11.2001. Kraus-Vonjahr, Martin (2002): Der<br />
Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in Europa – Frankfurt/M. <br />
Monar, Jörg (2002): Die EU als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und die Herausforderung<br />
des internationalen Terrorismus, in: Integration, H. 3, S. 171–186. Nuscheler,<br />
Franz (2004): Internationale Migration. Flucht und Asyl, 2. Aufl. – Wiesbaden. Studzinsky,<br />
Silke (2003): Die Macht der Straße, in: European Democratic Lawyers/Republikanischer<br />
Anwaltsverein/Holfort-Stiftung (Hrsg.): Reader zur Konferenz: Europa – Raum von Freiheit,<br />
Sicherheit und Recht?, unter: http://www.rav.de/kongress/materialien.htm (20.06.2005).<br />
Weiterführende Literatur: Däubler-Gmelin, Herta/Mohr, Irina (Hrsg.) (2003): Recht schafft<br />
Zukunft. Perspektiven der Rechtspolitik in einer globalisierten Welt – Bonn. Meyer, Jürgen<br />
(2002): Gruppe X „Freiheit, Sicherheit und Recht“, Beitrag von Prof. Jürgen Meyer, Mitglied des<br />
Konvents, vom 29. November 2002, Working Document 34. Monar, Jörg (2003a): Auf dem<br />
Weg zu einem neuen Verfassungsvertrag: Der Reformbedarf der Innen- und Justizpolitik der<br />
Union, in: Integration, H. 1, S. 31–47. Monar, Jörg (2003b): Der Raum der Freiheit, der Sicherheit<br />
und des Rechts im Verfassungsentwurf des Konventes, in: Integration, H. 4, S. 536–550. <br />
Schroedter, Elisabeth (2003): An den neuen Grenzen von Europa, Fraktion Die Grünen/EFA im<br />
Europäischen Parlament, Berlin (Bestellung unter info@elisabeth-schroedter.de). Zypries, Brigitte<br />
(2003): Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Verfassung der Europäischen<br />
Union (Vortrag an der Humboldt-Universität Berlin am 27. Mai 2003), in: Walter-Hallstein-Institut<br />
für Europäisches Verfassungsrecht (Hrsg.): Forum Constitutionis Europae FCE<br />
4/03.<br />
222 Ritter
Sebastian Peter Sass<br />
Artikel 43<br />
SOLIDARITÄTSKLAUSEL<br />
Artikel 43: Solidaritätsklausel<br />
Sollte ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag oder einer Naturkatastrophe<br />
natürlichen oder menschlichen Ursprungs betroffen sein, so sind die anderen<br />
Mitgliedstaaten zur Solidarität verpflichtet. Die Solidaritätsklausel verpflichtet<br />
die Union, dem betroffenen Mitgliedstaat mit allen ihr zur Verfügung gestellten<br />
Mitteln zu Hilfe zu kommen.<br />
Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf militärische Mittel. Bei dieser Vorschrift<br />
geht es dem Wortlaut nach also weder um militärische Krisenbewältigung<br />
außerhalb der EU-Grenzen noch um klassische Territorialverteidigung.<br />
Es handelt sich vielmehr um eine gegenseitige Hilfsverpflichtung innerhalb der<br />
EU-Grenzen, die in Kraft tritt, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag,<br />
einer Naturkatastrophe oder einem Unfall betroffen ist.<br />
Neues Regelwerk gegen Terror und Katastrophen<br />
Die Solidaritätsklausel ist eine völlig neuartige Bestimmung innerhalb<br />
des gesamten EU-Regelwerks. Es handelt sich hierbei um eine Beistandsverpflichtung,<br />
die mit Inkrafttreten der Verfassung für alle Mitgliedstaaten<br />
wirksam wird.<br />
Die Bestimmung richtet sich gegen zwei Arten von Bedrohungen: Terror<br />
und Katastrophen. Die Vorkehrungen zur Terrorabwehr dürften auf<br />
den Bewusstseinswandel nach den Terroranschlägen vom 11. September<br />
2001 in den USA zurückzuführen sein.<br />
Der Wortlaut in Absatz 1 setzt voraus, dass ein Terroranschlag bereits<br />
eingetreten ist, bevor die Beistandspflicht aus der Solidaritätsklausel<br />
ausgelöst wird. Dagegen ist in Absatz 1a von „Abwendung terroristischer<br />
Bedrohungen“ die Rede, was auf ein Tätigwerden schon im Vorfeld<br />
eines Terroranschlags hinweist. Dieser unpräzise Wortlaut sowie<br />
das Fehlen einer Definition „terroristischer Bedrohungen“ machen eine<br />
besonders sorgfältige Auslegung erforderlich, zumal die Solidaritätsklausel<br />
sogar den Einsatz militärischer Mittel vorsieht. Die Notwendigkeit<br />
besonderer Sorgfalt wird vor allem dann deutlich, wenn man sich<br />
vor Augen hält, dass Terroranschläge sogar einen konventionellen Krieg<br />
zur Folge haben können, wie der Afghanistan-Krieg infolge der<br />
Anschläge vom 11. September 2001 zeigte.<br />
Sass 223
Artikel 43<br />
Solidaritätsklausel<br />
In solchen Fällen muss unbedingt Klarheit darüber bestehen, wann und<br />
wie die Beistandsverpflichtung Anwendung findet. Bezüglich einer<br />
ersten Definition von Terrorismus kann zwar auf den Rahmenbeschluss<br />
des Ministerrates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung verwiesen<br />
werden 1 , doch für die Fortführbarkeit der Politik militärischer<br />
Bündnisfreiheit einzelner EU-Mitgliedstaaten wirft die Beistandsverpflichtung<br />
grundlegende Fragen auf.<br />
Die Vorkehrungen für den Katastrophenfall tragen dem verblüffenden<br />
Umstand Rechnung, dass die EU mit der GSVP zwar über eine Rechtsgrundlage<br />
für zivile und militärische Interventionen außerhalb der EU-<br />
Grenzen verfügt, bisher aber nicht über ein Regelwerk für Katastropheneinsätze<br />
auf eigenem Gebiet. Die GSVP-Regeln zur Katastrophenhilfe<br />
bestätigen lediglich eine gegenseitige Solidarität, die im heutigen<br />
Europa eigentlich selbstverständlich sein sollte.<br />
Von der Wirklichkeit eingeholt<br />
Mit den Terroranschlägen in Madrid vom 11. März 2004, denen etwa<br />
200 Menschenleben zum Opfer fielen, wurde die sicherheitspolitische<br />
Diskussion urplötzlich von der Wirklichkeit eingeholt. So beschlossen<br />
die Mitgliedstaaten der Union auf dem Gipfeltreffen in Brüssel vom<br />
25./26. März 2004, dass die Solidaritätsklausel bezüglich terroristischer<br />
Bedrohungen unabhängig vom Inkrafttreten der Verfassung sofortige<br />
Anwendung finden soll. 2 Allerdings handelt es sich hierbei zunächst nur<br />
um eine politische Absichtserklärung; denn für die Rechtsverbindlichkeit<br />
bedarf es der Zustimmung der Parlamente aller Mitgliedstaaten,<br />
welche diese wahrscheinlich erst im Zusammenhang mit der Verabschiedung<br />
der Verfassung erteilen werden.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass die Klausel niemals in Anspruch genommen<br />
werden muss.<br />
1<br />
Vgl. Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung, Abl. Nr. L<br />
164, vom 22.06.2002, 3.<br />
2<br />
Vgl. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/79702.pdf (20.06.2005).<br />
224 Sass
Luise Papcke<br />
Artikel 44<br />
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT<br />
Artikel 44: Verstärkte Zusammenarbeit<br />
Der Artikel legt fest, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union enger als<br />
grundsätzlich vorgesehen zusammenarbeiten können. An einer solchen Kooperation<br />
nach Artikel 44 Absatz 1 1 , der Verstärkten Zusammenarbeit (VZ), müssen<br />
nicht alle Länder teilnehmen. Die Zusammenarbeit ist vielmehr ein besonderes<br />
Instrument zur europäischen Aufgabenerfüllung. Sie gilt nur für Politikfelder,<br />
die nicht „den ausschließlichen Zuständigkeiten der Union“ 2 unterliegen.<br />
Voraussetzung ist, dass die Ziele und der Integrationsprozess der Europäischen<br />
Union gefördert und die Verfassung und die Rechte der Union geachtet<br />
werden. Zudem muss Rücksicht auf die Zuständigkeiten wie auch auf die Rechte<br />
und Pflichten der nicht an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten<br />
genommen werden. Gleichzeitig dürfen die unbeteiligten Staaten nicht die<br />
Zusammenarbeit der anderen Mitgliedstaaten behindern. Jede Form der verstärkten<br />
Zusammenarbeit muss den anderen Staaten offen stehen, sofern diese<br />
die Beteiligungsvoraussetzungen erfüllen und (bei späterem Beitritt) die im<br />
Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit bereits erlassenen Rechtsakte umsetzen.<br />
Die Kommission und die beteiligten Staaten fördern die Teilnahme neuer<br />
Mitgliedstaaten 3 , um einen „geschlossenen Verein“ 4 innerhalb der Gemeinschaft<br />
zu verhindern. Die Kosten einer Verstärkten Zusammenarbeit, mit Ausnahme<br />
der Verwaltungskosten der Organe, tragen die beteiligten Staaten.<br />
Artikel 44 Absatz 2 stellt klar, dass die Ermächtigung für eine Verstärkte<br />
Zusammenarbeit vom Ministerrat nur als „letztes Mittel“ gewährt werden darf.<br />
Dieser muss zuvor feststellen, dass die angestrebten Ziele integrationspolitisch<br />
sinnvoll sind und von der Union insgesamt selbst nicht innerhalb eines „vertretbaren<br />
Zeitraumes“ verwirklicht werden können. Weitere Voraussetzung ist,<br />
dass sich mindestens ein Drittel aller Mitgliedstaaten an der Verstärkten<br />
Zusammenarbeit beteiligt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass nicht zu<br />
viele und womöglich gegenläufige VZ-Kreise gebildet werden.<br />
Artikel 44 Absatz 3 regelt das Abstimmungsverfahren innerhalb der Verstärkten<br />
Zusammenarbeit. Dabei dürfen nur Minister aus beteiligten Staaten abstimmen.<br />
Die Sitzungen stehen jedoch allen Mitgliedstaaten offen. Eine Abstimmungsmehrheit<br />
innerhalb einer Verstärkten Zusammenarbeit ist qualifiziert,<br />
1<br />
Sowie Artikel 416 bis 423.<br />
2<br />
Vgl. Artikel 12 Absatz 1.<br />
3<br />
Vgl. Artikel 418 Absatz 1.<br />
4<br />
Juncker 1999, 3.<br />
Papcke<br />
225
Artikel 44<br />
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
wenn sie 55 % der Stimmen und zugleich mindestens 65 % der Bevölkerung<br />
der beteiligten Staaten vertritt. In Fällen, in denen die Verfassung Einstimmigkeit<br />
vorschreibt, wenn also die Verstärkte Zusammenarbeit in Politikbereichen<br />
stattfindet, in denen normalerweise einstimmig abgestimmt werden muss, kann<br />
der VZ-Rat gemäß Artikel 422 Absatz 1 einstimmig beschließen, dass für<br />
Abstimmungen innerhalb der Verstärkten Zusammenarbeit die qualifizierte<br />
Mehrheit genügt.<br />
Artikel 44 Absatz 4 bestimmt, dass die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit<br />
erlassenen Rechtsakte nur für die beteiligten Staaten gelten.<br />
Wie kommt die Europäische Union rascher voran?<br />
Die Debatte um die abgestufte Integration beziehungsweise ein Europa<br />
mehrerer Geschwindigkeiten läuft bereits seit einiger Zeit, schon der<br />
Tindemans-Bericht fasste sie im Jahr 1975 ins Auge. Aber erst 1997<br />
wurde „als eine der wirklich herausragenden Ideen“ 5 eine Regelung für<br />
die engere innergemeinschaftliche Zusammenarbeit (Flexibilisierung) in<br />
Amsterdam vertraglich verankert 6 – jedenfalls für die Europäischen<br />
Gemeinschaften (Erste Säule) und die Innen- und Justizpolitik (Dritte<br />
Säule). Dabei ging es darum, eine intensivere Verflechtung der Gemeinschaft<br />
zu ermöglichen und zugleich an Regeln zu binden. Gedacht war<br />
an „Öffnungsklauseln“, die es der Gemeinschaft erlauben sollten, Neuerungen<br />
anzustreben, „denen sich derzeit oder auf Dauer nicht alle<br />
anschließen wollen beziehungsweise können“ 7 . Vor allem nach der<br />
Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitliedstaaten im<br />
Mai 2004 besteht das Bedürfnis, einer größer und damit unbeweglicher<br />
werdenden EU durch Artikel 44 der Verfassung Innovationschancen zu<br />
eröffnen, um den Integrationsmut einiger Staaten in die gemeinsame<br />
Politik einzubinden. Der Wille einiger Staaten zur politischen Integration<br />
ist vorhanden: Das Scheitern des ersten Verfassungsgipfels in Brüssel<br />
vom 12./13. Dezember 2003 wurde nicht zuletzt von Berlin und Paris 8<br />
mit Verweisen auf die Möglichkeiten beantwortet, eine Entwicklungsblockade<br />
notfalls mit einer Zusammenarbeit in einem „Kerneuropa“ zu<br />
5<br />
Bergmann/Lanz 1998, 331.<br />
6<br />
Vgl. Artikel 5a Absatz 2 EG-Vertrag in der Fassung von Amsterdam.<br />
7<br />
Dauderstädt/Lippert 1998, 40.<br />
8<br />
Vgl. „Die EU vor einer ungewissen Zukunft“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom<br />
15.12.2003, 1 f.<br />
226<br />
Papcke
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
Artikel 44<br />
überwinden. „Die Konstruktion einer Union in der Union“, so wurde<br />
öffentlich gefordert, „sollte nun ohne Zögern begonnen werden“ 9 , und<br />
sei es gleich von einer „Pioniergruppe“ (Chirac) europapolitisch stärker<br />
engagierter Staaten. Der luxemburgische Premierminister Jean-Claude<br />
Juncker dachte sogar laut darüber nach, dass, wenn „der Karren irgendwann<br />
so feststeckt, ein paar von uns allein weitermachen müssen“. 10<br />
Die Flexibilität der Integration hat sich in zwei Formen entwickelt: Einerseits<br />
bestehen so genannte „opting-out“-Klauseln (Verlangsamung), die<br />
es einzelnen Ländern ermöglichen, auf unbestimmte Zeit gewisse Bereiche<br />
der europäischen Integration auszublenden. So sind zum Beispiel<br />
weder England noch Dänemark der Währungsunion beigetreten, obwohl<br />
sie den Vertrag von Maastricht (1993) ratifiziert haben. Andererseits gab<br />
es als umstrittenere Variante der Flexibilisierung der Integrationsgeschwindigkeit<br />
die Verstärkte Zusammenarbeit. Sie stellt sozusagen das<br />
„opting-in“ (Beschleunigung) einer Avantgarde von Staaten dar, die die<br />
europäische Integration auf einigen Feldern schneller betreibt als andere.<br />
Durch die unterschiedlichen Interessen der wachsenden Zahl von Mitgliedern<br />
durchlief die Europäische Union immer wieder Phasen einer<br />
„Eurosklerose“, wie etwa während der Ära de Gaulle oder zu Beginn<br />
der 1980er Jahre. Der Gedanke lag daher nahe, integrationswillige Staaten<br />
vorangehen zu lassen, um das Projekt Europa wieder anzustoßen.<br />
Andererseits gab es aber auch Vorbehalte gegen eine zu weit gehende<br />
Flexibilisierung, die ihrerseits Staatenbündnisse in der Union und damit<br />
eine neue Politik der balance of power fördern könnte.<br />
Das Für und Wider der Verstärkten Zusammenarbeit<br />
Nach Ansicht der Kritiker führt die VZ zu einem Europa à la carte, in<br />
dem jeder Mitgliedstaat nach Belieben entscheidet wo er mitmacht und<br />
wo nicht. Die Folge sei eine „variable Geometrie“ 11 , bei der die „EU-<br />
Speisekarte“ je nach Politikfeld sehr unterschiedlich ausfällt und am<br />
Ende viele kleine Arbeitsgruppen ohne logischen Zusammenhang<br />
nebeneinander stehen. 12 Provozierender noch wirkt die Vorstellung eines<br />
Gravitationszentrums 13 , das die nicht teilnehmenden Staaten womöglich<br />
9<br />
Harpprecht 2004, 34.<br />
10<br />
Juncker 2003, 9.<br />
11<br />
Kreis 2004, 33 f.<br />
12<br />
Vgl. Donelly/Dawes 2004, 4.<br />
13<br />
Vgl. Fischer 2000.<br />
Papcke<br />
227
Artikel 44<br />
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
immer mehr an den Rand drängt. 14 Ein derart abgestuftes Europa eines<br />
„geschlossenen Clubs“ schnell voranschreitender Staaten und einiger<br />
Reststaaten „zweiter Klasse“, würde tatsächlich die europäische Union<br />
gleichrangiger Staaten in Frage stellen. Zudem verlieren EU-Standards<br />
etwa in Steuer- oder Sozialfragen ihren Sinn, wenn nicht alle Mitgliedstaaten<br />
diese erreichen. 15<br />
Ist die Weiterentwicklung der Europäischen Union ohne die Option<br />
einer voranschreitenden Staatengruppe trotz alledem gefährdet? Nach<br />
der erfolgten Osterweiterung ist es zumindest fraglich, ob sich ein Konsens<br />
noch herstellen lässt, um notwendige Integrationsschritte zu erreichen.<br />
Bei einer Verlangsamung oder gar Stagnation der europäischen<br />
Integration ohne eine Verstärkte Zusammenarbeit müssten die integrationsfreudigen<br />
Staaten sich außerhalb der Verträge verständigen – wie<br />
es beispielsweise auf dem „Pralinengipfel“ im April 2003 16 geschehen<br />
ist. Gerade dabei könnte ein „Kerneuropa“ neben der EU entstehen. Ein<br />
solches Zusammenwirken jenseits der Verträge als Folge der Flexibilitätsbehinderung<br />
innerhalb des Vertragsrahmens gefährdet aber die<br />
Kohäsion der Union ebenso wie eine übertriebene Differenzierung auf<br />
Vertragsbasis. Eine Gemeinschaft, die auf der Stelle tritt, verlöre wahrscheinlich<br />
rasch den Zusammenhalt, weswegen Jacques Delors der EG<br />
nach 1985 zur Belebung der Vergemeinschaftung neue Projekte verordnete.<br />
Im Ergebnis sind daher engere Beziehungen in europapolitisch<br />
relevanten Feldern zwischen einigen Mitgliedstaaten durch eine Verstärkte<br />
Zusammenarbeit vorzuziehen. Denn um in Richtung einer politischen<br />
Union fortzuschreiten, war und ist die EU auf die Integrationswilligkeit<br />
– wenn auch vorerst einiger Staaten – angewiesen. Dieses<br />
Vorgehen birgt wie beschrieben auch Risiken, doch die Europäische<br />
Union selbst ist, wie Jean-Claude Juncker 17 einst betonte, das Ergebnis<br />
eines ebenso gewagten Schrittes in die Zusammenarbeit ehemals unkooperativer<br />
Nachbarn. Eine Gruppe voranschreitender Staaten wird in<br />
der Regel eine Vorbildfunktion für andere Staaten haben, sich ihrerseits<br />
stärker zu engagieren.<br />
14<br />
Vgl. Donelly/Dawes 2004, 3. Diese Befürchtung wurde vor allem durch gleich lautende Forderungen<br />
während der Diskussion über die Auswahl des nächsten Kandidaten für das Kommissionspräsidentenamt<br />
2004 verstärkt.<br />
15<br />
Vgl. Giering/Janning 2001, 152.<br />
16<br />
Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg trafen sich im April 2003, um über eine<br />
europäische Verteidigungsinitiative zu verhandeln.<br />
17<br />
Vgl. Anmerkung 10.<br />
228<br />
Papcke
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
Artikel 44<br />
Die Verstärkte Zusammenarbeit laut Verfassung – ist sie möglich?<br />
Neben der Übersichtlichkeit der Bestimmungen über die Verstärkte<br />
Zusammenarbeit in der Verfassung 18 lassen sich noch weitere positive<br />
Entwicklungen im Bereich der VZ feststellen:<br />
• Die VZ kann anders als bisher nur noch in festgelegten Politikfeldern<br />
nicht angewendet werden. 19 Dies bietet die Chance, durch die<br />
Ausdehnung auf weitere Felder der EU-Politik neue Integrationsanstöße<br />
zu geben. Vor allem die Öffnung des GASP-Bereiches für<br />
die VZ ist viel versprechend, da hier bereits Kooperationsinitiativen<br />
bestanden. 20 Allerdings sind neue Politikfelder nur insoweit für die<br />
VZ zu erschließen, sofern sie zu Bereichen der Vertragsgrundlage<br />
zählen 21 , was damit „die Initiierung gänzlich neuer Integrationsschritte<br />
… [ausschließt]“ 22 .<br />
• Das Ermächtigungsverfahren wird erleichtert: Die VZ bedarf der<br />
qualifizierten Mehrheit. Die bisherige Regelung wird aufgehoben,<br />
nach der ein Ministerratsmitglied verlangen konnte, dass der Europäische<br />
Rat sich mit der Frage befasst und erst danach der Ministerrat<br />
entscheidet.<br />
• In allen Fällen außer im Bereich der GASP muss das Europäische<br />
Parlament zukünftig die Ermächtigung einer VZ billigen. Bislang<br />
wurde das Europäische Parlament nur einbezogen, falls es im jeweiligen<br />
Politikbereich auch ein Mitentscheidungsrecht hatte.<br />
• Einschlägige Verfassungsbestimmungen können der Arbeit in der<br />
VZ angepasst werden, zu denken wäre hier zum Beispiel an den<br />
Übergang von der Einstimmigkeit auf die Qualifizierte Mehrheit.<br />
Diese Neuerung in der Verfassung lässt der VZ größeren Spielraum<br />
und damit mehr Aussicht auf Erfolg.<br />
• Das Prinzip der „bedingungslosen Offenheit“ 23 wird eingeschränkt.<br />
Es kann Voraussetzungen geben, die zu erfüllen sind, um der VZ<br />
beizutreten, wodurch eine Blockade durch nur aus taktischen Gründen<br />
beigetretene Staaten erschwert wird. Angestrebte Integrations-<br />
18<br />
Artikel 44 und Artikel 416 bis 423.<br />
19<br />
Vgl. Artikel 43 Absatz 1.<br />
20<br />
Wie z. B. das Eurokorps von Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Spanien. Vgl.<br />
Heinrich 2004, 13.<br />
21<br />
Vgl. Artikel 419.<br />
22<br />
Tömmel 2004, 210.<br />
23<br />
Philippart 2003, 21.<br />
Papcke<br />
229
Artikel 44<br />
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
schritte müssen sich nicht mehr nach dem langsamsten Teilnehmer<br />
richten. Ein geschlossener Club kann sich dennoch nicht bilden, da<br />
die VZ-Mitglieder wie auch die Kommission nach Artikel 44 Absatz<br />
1 24 explizit dazu angehalten werden, allen (integrationswilligen,<br />
aber noch nicht oder nur bedingt integrationsfähigen) Staaten<br />
den Einstieg in die Verstärkte Zusammenarbeit zu erleichtern.<br />
Dennoch bleiben viele Hindernisse für eine Verstärkte Zusammenarbeit<br />
auch in der Europäischen Verfassung bestehen:<br />
• Eine VZ wird nur als „letztes Mittel“ gewährt, wenn die Ziele anders<br />
nicht „innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes“ verwirklicht werden<br />
können. 25 Was ein vertretbarer Zeitraum ist, bleibt unbestimmt. Der<br />
schon in den Verträgen von Amsterdam und Nizza verwendete Ausdruck<br />
„letztes Mittel“ verdeutlicht zudem, dass die VZ keineswegs<br />
als Chance zur Vertiefung der Integration, sondern als notwendiges<br />
Übel gilt, das möglichst selten zugelassen werden sollte.<br />
• Eine weitere Schranke ist die benötigte Mindestzahl der Teilnehmer.<br />
Die verlangte hohe Beteiligung (ein Drittel aller Mitgliedsstaaten)<br />
wirkt beliebig. Zur Vermeidung gegenläufiger Kooperationen reicht<br />
es aus, dass jede VZ die Ziele und Interessen der Union fördern<br />
muss. Weder das Schengener Abkommen (1985) noch die Wirtschafts-<br />
und Währungsunion (1992) wären bei dieser Regelung<br />
möglich gewesen.<br />
• Auch die Finanzierung bleibt problematisch. Da eine VZ nur zugelassen<br />
wird, wenn die beteiligten Staaten im allgemeinen Interesse<br />
handeln, ist es unverständlich, warum die anfallenden Kosten überwiegend<br />
von den Beteiligten selber getragen werden müssen. Die<br />
VZ sollte vielmehr aus dem Unionsbudget finanziert werden. 26<br />
• Obwohl die Ermächtigung zur VZ durch qualifizierte Mehrheit<br />
erteilt wird, wird innerhalb der VZ in denjenigen Politikbereichen,<br />
in denen nach der Verfassung Einstimmigkeit vorgeschrieben ist, für<br />
die Durchführungsbestimmungen weiterhin Einstimmigkeit gefordert.<br />
Davon kann wiederum nur einstimmig abgerückt werden.<br />
Daher ist zu erwarten, dass Mitgliedstaaten einer VZ beitreten, um<br />
deren Entwicklungen zu kontrollieren. Das Vetorecht besteht somit<br />
faktisch weiter.<br />
24<br />
Bzw. in Artikel 418 Absatz 1.<br />
25<br />
Vgl. Artikel 44 Absatz 2.<br />
26<br />
Vgl. Emmanouilidis 2003, 5.<br />
230<br />
Papcke
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
Artikel 44<br />
Fazit<br />
Nach einem Ausspruch Hans-Dietrich Genschers sollte kein Mitgliedstaat<br />
gezwungen werden weiter zu gehen, als er es kann oder wünscht.<br />
Doch derjenige, der nicht weitergehen möchte, sollte die anderen auch<br />
nicht aufhalten können.<br />
Die Regelungen zur Verstärkten Zusammenarbeit in der Verfassung stellen<br />
wie bisher einen Kompromiss dar, der die geteilte Meinung über die<br />
differenzierte Integration widerspiegelt. Es zeigen sich Verfahrensfortschritte,<br />
aber die auferlegten Schwierigkeiten, eine Verstärkte Zusammenarbeit<br />
zu begründen, stempeln diese weiterhin zur Ausnahme ab.<br />
Viele Mitglieder besitzen Verhinderungsmacht, doch es lassen sich<br />
kaum Gestaltungsmehrheiten bilden. 27 Wird die Verstärkte Zusammenarbeit<br />
als in der Verfassung festgelegtes Verfahren daher vielleicht<br />
„weniger der Kernbildung als vielmehr der effizienteren Politikgestaltung<br />
dienen“ 28 ? Als Instrument der Feinabstimmung könnte sie in denjenigen<br />
Bereichen ein Druckmittel bilden, in denen weiterhin Einstimmigkeit<br />
vorgeschrieben ist. Wie häufig die Verstärkte Zusammenarbeit<br />
auf diese Weise – oder eben anders – zur Anwendung kommen wird,<br />
hängt davon ab, wie der politische Integrationsprozess der Union insgesamt<br />
weiter verläuft.<br />
Es gibt zu denken, dass trotz der erstmaligen Verankerung des VZ-Prinzips<br />
im Vertrag von Amsterdam 1997 bisher noch keine Verstärkte<br />
Zusammenarbeit auf Vertragsbasis gegründet wurde, sondern alle Initiativen<br />
außerhalb der Verträge stattfanden. 29 Da auch der Artikel 44 „eher<br />
[ein] Dokument des Zögerns und der Einhegung der Chancen einer Differenzierung“<br />
30 ist und nur einen „Satz nochmals verfeinerter Möglichkeiten“<br />
darstellt, auf den man „keine große Hoffnung [setzen sollte]“ 31 ,<br />
wollen Stimmen nicht verstummen, die – wie schon Joschka Fischer 32 –<br />
darauf hinweisen, dass sich außerhalb der Verträge Zentren herausbilden<br />
werden. Nicht wenige Akteure fordern sogar die Bildung eines Integrationskerns,<br />
da es offensichtlich „keine Alternative“ 33 gibt, so dass ein<br />
27<br />
Vgl. Janning 1999, 120. Vgl. dazu auch Wessels 2004, 170 (Tabelle 1: „Koalitionen für qualifizierte<br />
Mehrheiten und Sperrminoritäten im Rat in der EU-27 (nach dem VVE)“).<br />
28<br />
Giering/Janning 2001, 153.<br />
29<br />
Vgl. „Die Runde der Fünf. Die großen EU-Mitglieder koordinieren ihre innere Sicherheit“, in:<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.10.2003, 4.<br />
30<br />
Janning 1999, 127, in Bezug auf den VZ-Artikel im Vertrag von Amsterdam.<br />
31<br />
Wessels 2004, 173.<br />
32<br />
Vgl. Fischer 2000.<br />
33<br />
„Lamers und Rüttgers für Kerneuropa“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.03.2004, 4.<br />
Papcke<br />
231
Artikel 44<br />
Verstärkte Zusammenarbeit<br />
„Kerneuropa“ als „Antriebskraft für flexible Vorgriffe … für den Fortschritt<br />
im Prozeß der europäischen Einigung unabdingbar“ 34 zu sein<br />
scheint. Es bleibt also dabei: Diejenigen Mitglieder, die eine politische<br />
Union anstreben, werden da, wo sie innerhalb des Vertrages blockiert<br />
sind, außerhalb kooperieren – soweit der europäische Integrationswille<br />
ausreicht.<br />
Literatur: Bergmann, Jan/Lanz, Christopher (Hrsg.) (1998): Der Amsterdamer Vertrag – Köln.<br />
Dauderstädt, Michael/Lippert, Barbara (1998): Doppelstrategie zur Vertiefung und Erweiterung<br />
der EU – Bonn. Donnelly, Brendan/Dawes, Anthony (2004): The Beginning of the End<br />
or the End of the Beginning? Enhanced Co-operation in the Constitutional Treaty, in: European<br />
Policy Brief, Federal Trust, issue 7, unter: http://www.fedtrust.co.uk/admin/uploads/Policy-<br />
Brief7.pdf (20.06.2005) Emmanouilidis, Janis A. (2003): Differenzierung im Verfassungsentwurf<br />
– Auf dem Weg zu einer neuen Integrationslogik, in: Giering, Claus (Hrsg.): Der EU-<br />
Reformkonvent – Analyse und Dokumentation, CD-ROM – München. Fischer, Joschka<br />
(2000): Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europäischen Integration,<br />
Rede gehalten am 12. Mai 2000 in der Humboldt-Universität zu Berlin, abgedruckt in:<br />
Integration, H. 3, S. 149–156. Giering, Claus/Janning, Josef (2001): Flexibilität als Katalysator<br />
für Finalität? Die Gestaltungskraft der „Verstärkten Zusammenarbeit“ nach Nizza, in: Integration,<br />
H. 2, S. 146–155. Harpprecht, Klaus (2004): Nach dem Fiasko in Brüssel, in: Die<br />
neue Gesellschaft, H. 1–2, S. 30–43. Heinrich, E.C. (2004): Schritt zu einer weltweiten<br />
Sicherheitspolitik, in: Das Parlament, Nr. 49, S. 13. Janning, Josef: Das „große Europa“ als<br />
Chance – Auswirkungen der EU-Erweiterung auf Solidarität, Regierbarkeit und Sicherheit in<br />
Europa (1999), in: Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik, S. 109-128, unter: http://www.<br />
bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/person.php?id=242 (20.06.2005). Juncker, Jean-<br />
Claude (1999): Flexibilitätsklauseln neu formulieren, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom<br />
13.12.1999, S. 3. Juncker, Jean-Claude (2003): Kerneuropa? Das schließe ich nicht aus,<br />
in: Die Zeit vom 11.12.2003, S. 9. Kreis, Georg (2004): Europa und seine Grenzen – Bern u. a.<br />
Meyer, Thomas (2004): Die Identität Europas – Frankfurt am Main. Philippart, Eric (2003):<br />
A New Mechanism of Enhanced Cooperation for the Enlarged European Union, in: Research on<br />
European Issues, Notre Europe, S. 1–37. Tömmel, Ingeborg (2004): Eine Verfassung für die<br />
EU: Institutionelle Anpassung oder Systemreform?, in: Integration, H. 3, S. 202–210. Wessels,<br />
Wolfgang (2004): Die institutionelle Architektur der EU nach der Europäischen Verfassung, in:<br />
Integration, H. 3, S.161–175.<br />
34<br />
Meyer 2004, 206.<br />
232<br />
Papcke
Jan Seifert<br />
Artikel 45-52<br />
DAS DEMOKRATISCHE LEBEN DER UNION<br />
Artikel 45: Grundsatz der demokratischen Gleichheit<br />
Dieser Artikel macht den klassischen demokratischen Grundsatz der Gleichheit<br />
der Bürger zum Ausgangspunkt des Handelns der Union. Aus dem deutschen<br />
Grundgesetz 1 kennen wir diesen Grundsatz als Gleichheit vor dem Gesetz. Die<br />
EU allerdings vermittelt den Anspruch, dass allen Bürgern „ein gleiches Maß<br />
an Aufmerksamkeit seitens der Organe“ gewidmet werden soll. Der direkte<br />
EU-Bürger-Bezug ist hier besonders zu betonen, weil damit der unmittelbare<br />
Einfluss von Aktivitäten der EU auf das Leben der Bürger hervorgehoben wird.<br />
Daneben schließt dieser Artikel auch mögliche „Ungleichbehandlungen“ vor<br />
dem Hintergrund ungleicher Machtverteilungen zwischen Bürgern zum Beispiel<br />
in großen bzw. kleinen Mitgliedstaaten aus.<br />
Artikel 46: Grundsatz der repräsentativen Demokratie<br />
Artikel 46 benennt die repräsentative, d.h. parlamentarische Demokratie als<br />
Modell der Union. Er verdeutlicht, dass die Bürger auf EU-Ebene ihre Vertretung<br />
direkt im Europäischen Parlament finden. Aber auch die Regierungsvertreter<br />
im Europäischen Rat bzw. dem Ministerrat unterliegen über die nationalen<br />
Parlamente einer Rechenschaftspflicht. 2<br />
Der bereits seit dem Maastrichter Vertrag 3 bestehende Artikel über die Rolle<br />
europäischer Parteien findet sich unter Artikel 46 Absatz 4 wieder. 4 Für einen<br />
breiten politischen Diskurs bedarf es auch auf europäischer Ebene politischer<br />
Parteien, die die verschiedensten politischen Interessen artikulieren. Daneben<br />
wird ihre Aufgabe zur Herausbildung eines europäischen Bewusstseins hervorgehoben.<br />
Artikel 47: Grundsatz der partizipativen Demokratie<br />
Die partizipative (beteiligungsorientierte) Demokratie setzt auf aktive Beteiligung<br />
und Mitarbeit der Bürger. Die Absätze 1 bis 3 definieren, dass Austausch,<br />
Transparenz und Information gegenüber und mit den Bürgern und Interessengruppen<br />
wichtige Ziele der Unionspolitik sind. Absatz 4 erweitert die „partizi-<br />
1<br />
Artikel 3 GG.<br />
2<br />
Dieser Aspekt wird auch jetzt schon vom Grundgesetz (Artikel 23) aufgegriffen, allerdings<br />
eher mit dem Hinweis auf Stellungnahmen von Seiten des Bundestags bzw. des Bundesrats.<br />
Aus anderen Ländern wie Dänemark sind auch unmittelbare Verhandlungsaufträge an die<br />
Regierung aus dem EU-Ausschuss des Parlaments bekannt.<br />
3<br />
Artikel 191 EG-Vertrag bzw. Artikel 138a im Maastrichter Vertrag.<br />
4<br />
Vgl. auch Grundrechtecharta Artikel 72 Absatz 2.<br />
Seifert<br />
233
Artikel 45-52<br />
Das demokratische Leben der Union<br />
pative Demokratie“ der EU um das Instrument des europäischen Bürgerbegehrens.<br />
Genauso wie schon jetzt das Europäische Parlament die Kommission zur<br />
Gesetzgebung auffordern kann, gilt nun Gleiches, wenn eine Million Unionsbürger<br />
„aus einer erheblichen Zahl von Mitgliedstaaten“ eine bestimmte Initiative<br />
unterstützen.<br />
Artikel 48: Die Sozialpartner und der autonome soziale Dialog<br />
Artikel 48 schreibt explizit die zentrale Rolle der Sozialpartner auf europäischer<br />
Ebene fest. Quasi seit Beginn der europäischen Integration wird den<br />
Arbeitgebern und Gewerkschaften – vergleichbar bspw. der deutschen Tradition<br />
der Tarifautonomie – eine ergänzende, eigenständige Rolle in der Wirtschafts-<br />
und Sozialpolitik beigemessen. Die Union achtet dabei zwar die Vielfalt<br />
der Systeme und Ansätze in den Mitgliedstaaten, bemisst der Autonomie<br />
der Sozialpartner aber eine hervorgehobene Rolle. Diese wird zusätzlich durch<br />
die Dominanz innerhalb ihres „eigenen“ Gremiums, des Wirtschafts- und Sozialausschusses<br />
(WSA) 5 fortgesetzt. Darüber hinaus sieht die Verfassung weitere<br />
Foren für die Mitarbeit der Sozialpartner vor: den (beratenden) Beschäftigungsausschuss<br />
des Ministerrates oder den Ausschuss für Sozialschutz. 6<br />
Artikel 49: Der Europäische Bürgerbeauftragte<br />
Der Europäische Bürgerbeauftragte oder auch „Ombudsmann“ ist relativ neu in<br />
den EU-Verträgen. 7 Er prüft die Handlungen der Institutionen auf Nachfrage<br />
seitens eines Unionsbürgers und geht Missständen nach. 8 Seine Stellung auf<br />
Verfassungsrangebene verdeutlicht den Offenheitsanspruch der EU.<br />
Artikel 50: Transparenz der Arbeit der Organe der Union<br />
Artikel 50 greift einige der Hauptkritikpunkte an der EU auf, indem der Grundsatz<br />
der Offenheit aller Einrichtungen festgeschrieben wird. Die wichtigste Neuerung<br />
ist dabei, dass neben dem Europäischen Parlament nun auch der Ministerrat<br />
in seiner gesetzgebenden Funktion öffentlich tagt. 9 Darüber hinaus wird der prinzipiell<br />
freie Zugang der Unionsbürger zu allen Dokumenten festgeschrieben. 10<br />
Artikel 51: Schutz personenbezogener Daten<br />
Der Artikel betont wie auch die Grundrechtecharta 11 das Recht auf Schutz persönlicher<br />
Daten.<br />
5<br />
Vgl. Artikel 389 bis 392 sowie den Beitrag von Tobias Schwab in diesem Band.<br />
6<br />
Vgl. Artikel 208 und Artikel 217.<br />
7<br />
Seine Rolle ist auch in der Grundrechtecharta (Artikel 103) niedergeschrieben.<br />
8<br />
Wahl und Aufgaben des Ombudsmannes werden in Artikel 335 festgelegt.<br />
9<br />
In seiner exekutiven Funktion tagt der Ministerrat weiterhin hinter verschlossenen Türen.<br />
10<br />
Vgl. auch Grundrechtecharta (Artikel 102).<br />
11<br />
Vgl. auch Grundrechtecharta (Artikel 68).<br />
234<br />
Seifert
Das demokratische Leben der Union<br />
Artikel 45-52<br />
Artikel 52: Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften<br />
Artikel 52 benennt die zentrale Rolle, die den Religionsgemeinschaften seit der<br />
Erklärung von Amsterdam 12 im „demokratischen Leben“ zugestanden wird.<br />
Vom Demokratiedefizit zur europäischen Öffentlichkeit<br />
und zurück<br />
Das „Demokratiedefizit“ der Europäischen Union<br />
Der Titel „Das demokratische Leben“ ist als neuer, eigenständiger Teil<br />
in das europäische Verfassungswerk aufgenommen worden. Sein Inhalt<br />
lässt sich als Antwort auf die fortdauernde Demokratie- bzw. Bürokratiekritik<br />
interpretieren. Es wird regelmäßig darauf verwiesen, dass die<br />
EU, würde sie einen Antrag auf Mitgliedschaft bei sich selbst stellen,<br />
nicht Mitglied werden könnte. Dafür werden verschiedene demokratietheoretische<br />
Erwägungen angebracht: Die drei Gewalten sind nicht voneinander<br />
getrennt. So ist zum Beispiel der Ministerrat gleichzeitig<br />
Gesetzgeber (Legislative) und Gesetzesvollstrecker (Exekutive). Daneben<br />
hat die „echte Legislative“ (das Europäische Parlament) pro forma<br />
nicht einmal das Initiativrecht für die Gesetzgebung (dies liegt auch<br />
weiterhin bei der Kommission). „Demokratische“ Entscheidungen werden<br />
hinter verschlossenen Türen getroffen (der Ministerrat tagte bisher<br />
immer nicht-öffentlich). Nicht zuletzt steht der EU eine Kommission<br />
vor, deren Mitglieder nicht von europäischen Bürgern gewählt werden<br />
und deren interne Organisation auf Grund fehlender Kontrollmechanismen<br />
und Verantwortlichkeit weder effektiv noch legitimiert 13 ist. Bisher<br />
müssen wir auch auf das ursprünglichste demokratische Recht, die Abwahl<br />
einer erfolglosen Kommission, verzichten, weil es keine klare<br />
Legitimationskette vom Bürger über das Parlament zur Exekutive<br />
(Kommission) gibt.<br />
Daneben steht die oft gehegte Wahrnehmung des für den Bürger entfernten<br />
und unerreichbaren „Brüssels“. Geografisch gesehen ist Brüssel<br />
für viele Bundesbürger sogar näher als Berlin, aber natürlich ergibt sich<br />
zur Innenpolitik durch die klar wahrnehmbare deutsche Öffentlichkeit<br />
oft eine direkte(re) Verbindung als zur EU-Politik. Hier spielt die Frage<br />
12<br />
Vgl. Erklärung 11 der Amsterdamer Regierungskonferenz zum Status der Kirchen und weltanschaulichen<br />
Gemeinschaften.<br />
13<br />
Vgl. Offe 2000,13.<br />
Seifert<br />
235
Artikel 45-52<br />
Das demokratische Leben der Union<br />
der (entstehenden) europäischen Öffentlichkeit und ihrer Antriebskräfte<br />
bzw. Transporteure in Verbänden und Parteien eine entscheidende Rolle.<br />
Wird es diesen mit Hilfe der Instrumente und Rechte dieser Verfassung<br />
gelingen, über eigene Kanäle und die Medien die Brücke vom Bürger<br />
nach „Brüssel“ zu bauen?<br />
Prinzipien des „demokratischen Lebens“ in der Verfassung<br />
Durch Offenheit, Partizipation und die prominente Rolle europäischer<br />
Verbände und Parteien sollen die Bürger stärker am „demokratischen“<br />
Leben der Union beteiligt werden. Dass dies auf den verschiedensten<br />
Wegen geschehen muss, wird im Kapitel „Demokratisches Leben der<br />
Union“ deutlich. Methoden (Konsultationsverfahren, Datenschutz, Bürgerbegehren),<br />
Institutionen (Bürgerbeauftragter) und Verbände/Organisationen<br />
(Kirchen, Sozialpartner, Parteien, Jugendorganisationen) werden<br />
dafür benannt. Insofern bildet dieser Teil auch einen Gegenpunkt zu<br />
den zahlreichen technischen bzw. formalen Verfassungskapiteln.<br />
Keine europäische Demokratie ohne europäische Öffentlichkeit<br />
Wer sich heute die Frage stellt, ob es überhaupt ein politisches –<br />
geschweige denn demokratisches – Leben in der Union gibt, wird zu<br />
keiner leichten Antwort kommen. Da Europa von den meisten Menschen<br />
(noch?) nicht primär als politischer Raum („Agora“) wahrgenommen<br />
wird, steht auch heute die Frage nach der Entwicklung der europäischen<br />
Öffentlichkeit im Vordergrund. Folgt man zum Beispiel dem<br />
deutschen Sozialphilosophen Jürgen Habermas 14 , so kann das „Demokratiedefizit<br />
[...] freilich nur behoben werden, wenn zugleich eine europäische<br />
Öffentlichkeit entsteht, in die der demokratische Prozess eingebettet<br />
ist“.<br />
Schon heute lassen sich Elemente einer europäischen Agora erkennen.<br />
Die Diskussionen über BSE-Krise, Stabilitätspakt, Türkeibeitritt, Irakkrieg<br />
und letztlich auch die Verfassung werden europaweit und europäisch<br />
geführt. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir uns bewusst<br />
machen, dass es eine exklusive agora europaeis genauso wenig gibt<br />
bzw. geben wird wie bisher eine nationale. Öffentlichkeit ergibt sich<br />
dort, wo ein politischer Raum ist. Dieser findet sich auf lokaler Ebene<br />
genauso wie auf mitgliedstaatlicher oder europäischer. Entscheidend ist,<br />
14<br />
Vgl. Habermas 2001.<br />
236<br />
Seifert
Das demokratische Leben der Union<br />
Artikel 45-52<br />
ob wir ihn auch als legitimierten und in erster Linie zugänglichen oder<br />
beteiligungsorientierten Raum wahrnehmen. Und genau in dieser Wahrnehmung<br />
liegt das Problem des heutigen politischen Lebens der EU.<br />
Durch die Medien (dem Transmitter einer Öffentlichkeit) wird oft nicht<br />
zu Unrecht das Bild einer Fortsetzung nationaler Politik auf europäischer<br />
Ebene vermittelt. Diesem Bild kann nur entgegengewirkt werden,<br />
indem sich die europäischen Politiker wie auch die zivilgesellschaftlichen<br />
Akteure endlich auf ihre europäische Rolle besinnen. Dafür werden<br />
im diskutierten Teil der Verfassung Wege eröffnet.<br />
Auf dem Weg zur europäischen Öffentlichkeit:<br />
Fünf Akteure und die Bürger<br />
Fünf verschiedenen Akteurstypen wird eine besondere Rolle als zusätzlicher,<br />
primär europäischer Vermittler zugewiesen:<br />
• den „repräsentativen Verbänden“,<br />
• den Jugendverbänden (neu!),<br />
• den Sozialpartnern (d.h. den Gewerkschaften und Arbeitgebern),<br />
• den Kirchen und Glaubensgemeinschaften (jetzt auch als besonderer<br />
Partner der Institutionen) sowie<br />
• den europäischen Parteien.<br />
Über sie soll der Grundsatz der partizipativen Demokratie verwirklicht<br />
werden. Formell kennt beispielsweise das Grundgesetz solch eine starke<br />
Einbindung der „zivilgesellschaftlichen“ Akteure nicht. Im politischen<br />
Alltag erleben wir aber auch in Deutschland die zahlreichen<br />
extern besetzten Kommissionen (Hartz, Rürup, etc.) und letztlich nicht<br />
nur darüber die faktische Veto-Macht großer Verbände (z.B. Gewerkschaften<br />
oder Handwerk) auf (Regierungs-) Politik.<br />
Europäische Verbände – Politikberatung, Interessensverteidigung<br />
und Schnittpunkt zwischen europäischer und nationaler Ebene<br />
Im Unterschied zu starken, zentralisierten nationalen Verbänden wie<br />
den deutschen oder französischen Bauernverbänden sind die meisten<br />
Interessengruppen auf europäischer Ebene lediglich Zusammenschlüsse<br />
nationaler Verbände. Sie nehmen zwar teilweise eine vermittelnde Rolle<br />
wahr, in der Mehrheit werden sie jedoch durch die Hauptmitgliedsverbände<br />
der großen Mitgliedstaaten dominiert – wenn nicht gar ausgehebelt.<br />
Kaum ein Verband ist bisher bereit gewesen, seinem europäischen<br />
Dachverband für die (immerhin „nur“) europäischen Fragen ein autono-<br />
Seifert<br />
237
Artikel 45-52<br />
Das demokratische Leben der Union<br />
mes Mandat zu verleihen. Auf der anderen Seite können die europäischen<br />
(Dach-)Verbände im klassischen Sinne politikberatend tätig werden,<br />
um Initiativen der Kommission in den jeweiligen Politikfeldern<br />
qualitativ zu verbessern. Hier sind die Verbände als Schnittpunkt zum<br />
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ebenen gefragt. In<br />
dieser Rolle fanden sich viele Verbände gerade im Konventprozess bei<br />
der Entstehung dieser Verfassung zum ersten Mal wieder. Dabei wurden<br />
wertvolle europäische Erfahrungen gesammelt, die bei der späteren Verwirklichung<br />
der ausgeweiteten EU-Verfahren eine wichtige Rolle spielen<br />
werden.<br />
Dieser positiven (aktiven wie passiven) Mittlerrolle steht die Gefahr<br />
gegenüber, dass durch die aufwändigen Beratungsverfahren neue Initiativen<br />
nicht nur verlangsamt werden, sondern auch durch die vorrangige<br />
Einbeziehung „der Betroffenen“ 15 der Blick auf das Allgemeinwohl verloren<br />
geht. Diese Gefahr ist für die Union besonders akut, da die europäische<br />
Ebene dem Bürger am entferntesten liegt, zudem als besonders<br />
intransparent erscheint und daher zu „Expertenlösungen“ verführt.<br />
Jugendbeteiligung – ein Schritt nach vorn für das Europa von morgen<br />
Obwohl beim Blick in den ersten Teil der Verfassung nicht offensichtlich,<br />
bewegt sich die EU in puncto Jugendbeteiligung gerade mit großen<br />
Schritten nach vorne. Als wesentliche Innovation der Verfassung ist hervorzuheben,<br />
dass nun in Artikel 282 Absatz 1e explizit auf die Beteiligung<br />
Jugendlicher verwiesen wird. Nicht nur ein äußerst erfolgreiches<br />
Programm „JUGEND“ zur Unterstützung von Jugendbegegnung und<br />
Europäischem Freiwilligendienst spricht dafür, sondern auch die professionelle<br />
Art, in der sich Jugendverbände im European Youth Forum<br />
(EYF) europäisch organisieren. Daraus ergibt sich zum einen die Hoffnung,<br />
dass auch und gerade die europäischen Jugendverbände als Teil<br />
der „repräsentativen Verbände“ angesehen und als solche gehört werden.<br />
Dazu kommt aber auch die neue Vorgabe aus Artikel 282 Absatz 1,<br />
Jugendliche verstärkt am demokratischen Leben der EU teilhaben zu<br />
lassen.<br />
Die formale Anerkennung und Wertschätzung der Jugendbeteiligung auf<br />
europäischer Ebene ist insofern wichtig, als dass durch sie eine langfristige<br />
europäische Perspektive eröffnet wird. Nur durch frühzeitige<br />
Zusammenarbeit (Erfahrung des „europäischen Geistes“) wird das spä-<br />
15<br />
Artikel 47 Absatz 3.<br />
238<br />
Seifert
Das demokratische Leben der Union<br />
Artikel 45-52<br />
tere Vertreten gemeinsamer Interessen auf europäischer Ebene erst<br />
ermöglicht. Dies setzt aber finanzielle und rechtliche Grundlagen voraus,<br />
die (noch) nicht gegeben sind. Neben einem transparenten Finanzierungsverfahren<br />
müsste zudem definiert werden, was überhaupt ein<br />
europäischer Jugendverband ist. 16<br />
Europäische Sozialpartner – zu national um Europa zu gestalten<br />
Die dominierende Rolle der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände,<br />
die wir aus vielen nationalen Diskursen kennen, hat sich auf europäischer<br />
Ebene in dieser Form noch nicht herausgebildet. Organisationen<br />
wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) treten ungern Macht nach<br />
„oben“ ab und betreiben lieber eigenständige Europapolitik. Nichtsdestotrotz<br />
spricht die Verfassung den Sozialpartnern nicht nur eine hervorgehobene<br />
Rolle, sondern sogar eigene Autonomie zu: Die EU ist das<br />
einzige Gebilde von staatlicher Qualität, das den Sozialpartnern über<br />
den Wirtschafts- und Sozialausschuss sogar ein eigenes Organ bietet.<br />
Inwiefern die Dominanz der Sozialpartner auch angesichts ihrer überwältigenden<br />
Ressourcen in den Mitgliedstaaten noch weiter „gefördert“<br />
(d.h. in der Regel finanziell unterstützt) werden muss, erscheint<br />
mehr als fraglich. Genauso stellt sich die Frage, ob gerade dieser Kern<br />
korporatistischer 17 Auswüchse institutionalisiert werden muss. Nicht<br />
dass den Verbänden schon in Artikel 47 eine möglicherweise zu weitgehende<br />
Einbindung verfassungsrechtlich zugesichert wird. Durch die<br />
explizite Herausstellung der Sozialpartner 18 (und später auch der Kirchen)<br />
werden neue Räume außerparlamentarischer Verfahren eröffnet 19 ,<br />
die dem Grundsatz der Gleichheit 20 entgegenstehen. Nur die Organisierten<br />
und deren Spitzenvertreter werden von der Hoffnung vermeintlich<br />
einstimmiger Politikgestaltung profitieren. Schon heute sehen wir in<br />
den meisten Mitgliedstaaten, dass die Gewerkschaften und Arbeitgeber<br />
nicht in der Lage sind, nachhaltige Beschäftigungsbündnisse herzustel-<br />
16<br />
Vgl. vorbereitender Kommissionsvorschlag „Über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft<br />
zur Unterstützung europaweit tätiger Jugendorganisationen“: KOM (2003) 272 endgültig.<br />
2003/0113 (COD).<br />
17<br />
Der Korporatismus bezeichnet eine enge Koordinierung der Politik in Verbindung zu Verbänden/Interessenvertretungen<br />
und dabei insbesondere den Gewerkschaften und den Arbeitgebern.<br />
18<br />
Vgl. Artikel 48.<br />
19<br />
Vgl. Artikel 212 Absatz 1, nach dem es bis zu verbindlichen Vereinbarungen kommen kann.<br />
20<br />
Vgl. Artikel 45.<br />
Seifert<br />
239
Artikel 45-52<br />
Das demokratische Leben der Union<br />
len, die das Problem der Arbeitslosigkeit strukturell beseitigen könnten.<br />
Warum wird dieser Ansatz auf europäischer Ebene dann fortgeführt?<br />
Europäische Parteien – Kern europäischer Demokratie<br />
Die zentrale Rolle zum Beleben der europäischen Demokratie müssen<br />
die europäischen Parteien spielen. Ihre Rolle wurde mit Inkrafttreten<br />
des europäischen Parteienstatuts zu den Europawahlen 2004 auch formell<br />
relevant. Erst über funktionierende europäische Parteien wird der<br />
politische Wettbewerb um die Macht, nämlich die Besetzung der Kommission<br />
auf Grundlage der Europawahlergebnisse 21 , zu einer politischen,<br />
europäischen Öffentlichkeit führen. Man stelle sich folgendes<br />
Szenario vor: Konkurrierende Kandidaten derselben europäischen Partei<br />
bereisen – analog den US-amerikanischen Vorwahlen – die EU, um<br />
die Unterstützung der Parteigänger für sich als Kandidaten für das Amt<br />
des Kommissionspräsidenten zu gewinnen. Von diesem Moment an<br />
wird über die regionale Tageszeitung und damit den Bürger vor Ort das<br />
volle demokratische Recht auf Wahl und Abwahl in der Union greifbar.<br />
Wenn gleichzeitig die Mitglieder der Kommission aus den Europawahlen<br />
hervorgingen, wäre die notwendige Polarisierung erreicht und für<br />
eine breite Öffentlichkeit des Diskurses viel getan. Durch die Zuordnung<br />
der Kommission auf eine klare parlamentarische Koalition ist<br />
auch sichergestellt, dass Verfehlungen wie im Eurostat- oder BSE-Skandal<br />
von der Opposition aufgegriffen und entsprechend in die Öffentlichkeit<br />
getragen werden. Diese Veränderungen sollten spätestens mit der<br />
Europawahl 2009 von den europäischen Parteien genutzt werden und<br />
zur Herausbildung eines wahrhaft demokratischen Lebens führen.<br />
Demokratie braucht öffentliche Entscheidungen<br />
Durch die im Verfassungskonvent erreichte Öffnung des Ministerrates –<br />
zumindest in gesetzgebenden Entscheidungen („Legislativrat“) – ist es<br />
in Zukunft möglich, die (eigene) Regierung für ihr Abstimmungsverhalten<br />
verantwortlich zu machen. Möglicherweise werden dann die so<br />
genannten Paketlösungen von der Öffentlichkeit immer weniger akzeptiert,<br />
so dass sich auch im Ministerrat Lösungen entlang parteiideologischer<br />
und nicht national-historischer Linien ergeben.<br />
21<br />
Vgl. Artikel 26 Absatz 1.<br />
240<br />
Seifert
Das demokratische Leben der Union<br />
Artikel 45-52<br />
Bürger – direkt: das europäische Bürgerbegehren<br />
Neben den europäischen Parteien spielt das neue Instrument des europäischen<br />
Bürgerbegehrens eine entscheidende Rolle für die Entwicklung<br />
hin zu einer erweiterten Bürgerbeteiligung. So revolutionär dieser<br />
Vorschlag auch aus deutscher Sicht klingen mag, fast alle Mitgliedstaaten<br />
der erweiterten EU kennen direktdemokratische Verfahren auf nationaler<br />
Ebene und haben diese auch schon eingesetzt. Im Gegensatz zur<br />
bloßen Aufforderung des Einbringens eines Gesetzesvorschlags führen<br />
die meisten Mitgliedstaaten sogar bindende Referenden durch. Zwar ist<br />
die Verfassung mit dem vorliegenden Artikel noch nicht so weit gegangen,<br />
auch europäische Referenden (z.B. zur Ratifikation von zukünftigen<br />
Verfassungsänderungen) zu ermöglichen, allerdings kann selbst die<br />
vorliegende Neuerung zu weitreichenden politischen Veränderungen<br />
führen. Dadurch dass die Kommission bei Vorlage von einer Million<br />
Unterschriften für eine Initiative zum Handeln gezwungen wird, ergibt<br />
sich eine Aufweichung des gesetzgeberischen Initiativmonopols der<br />
Kommission. 22 Wichtige Themen, die die Menschen europaweit bewegen<br />
und aus ihrer Sicht nur ungenügend von der Kommission bzw.<br />
den Regierungen verfolgt werden, können in Zukunft direkt auf die<br />
Tagesordnung gesetzt werden. Schon jetzt haben zahlreiche Gruppen<br />
die verschiedensten Initiativen gestartet, um direkt nach Inkrafttreten<br />
der Verfassung aktiv zu werden. Beispiele dafür sind unter anderem die<br />
Forderung nach Auflösung des Euratom-Vertrags (europäische Umweltverbände),<br />
die Einberufung eines neuen Verfassungskonvents (föderalistische<br />
<strong>Bewegung</strong>) oder die explizite Erwähnung des christlichen<br />
Erbes. Durch das Einbeziehen von Verbänden und Parteien werden sich<br />
verstärkt transnationale Allianzen bilden und damit die Entstehung der<br />
europäischen Öffentlichkeit befördert.<br />
Interessant ist aber insbesondere, dass quasi durch die Hintertür auch<br />
Verfassungsänderungen eingeleitet werden können. Die Kommission<br />
(genauso wie das Europäische Parlament), die mit der Verfassung nun<br />
auch das Vorschlagsrecht für Änderungen der Verfassung erhalten hat 23 ,<br />
könnte nun über ein Bürgerbegehren „gezwungen“ werden, dem Europäischen<br />
Rat Änderungsvorschläge vorzulegen. Dies wäre ein mächtiges<br />
Instrument für zivilgesellschaftliche Forderungen nach Veränderung,<br />
die andernfalls auf ihrem Weg durch den diplomatischen Dschungel<br />
verschwänden. Der europäische Gesetzgeber ist nun gefordert, mög-<br />
22<br />
Vgl. auch Fischer 2004.<br />
23<br />
Vgl. Artikel 443 Absatz 1.<br />
Seifert<br />
241
Artikel 45-52<br />
Das demokratische Leben der Union<br />
lichst schnell ein entsprechendes Gesetz zu verfassen, um den Rahmen<br />
des Bürgerbegehrens (Wie viele Unterschriften in wie vielen Staaten? In<br />
welchem Zeitraum? Finanzierung?) zu definieren und eine schnelle<br />
Nutzung des Instruments zu ermöglichen.<br />
Fazit: Demokratie entsteht durch Politisierung<br />
Inwiefern man nach der Verabschiedung der europäischen Verfassung<br />
davon sprechen kann, dass das demokratische Defizit überwunden<br />
wurde, hängt davon ab, wie die Verfassung von den politischen Akteuren<br />
und Bürgern „gelebt“ und genutzt wird. Aufschluss darüber sollte in<br />
einer „normalen“ Verfassung eigentlich ein Blick auf den institutionellen<br />
Rahmen geben. In der jetzt verfassten EU wird entscheidend sein,<br />
inwiefern die Akteure Verfassungswirklichkeit schaffen. Den Institutionen<br />
wird es nur gelingen, langfristig eine wahre demokratische Öffnung<br />
zu erreichen, wenn sie sich der klassischen demokratischen Elemente<br />
bedienen können. Drei Punkte stehen dabei im Vordergrund: offene<br />
politische Entscheidungen im Ministerrat, die direkte Einbeziehung und<br />
Verantwortung gegenüber den Bürgern via Bürgerbegehren und – letztlich<br />
zentral – die vollständige Politisierung durch wahrlich europäische<br />
Wahlen zum Europäischen Parlament – stimuliert durch europäische<br />
Parteien und ihre im Wettbewerb stehenden Spitzenkandidaten. An diesen<br />
drei Punkten wird sich spätestens bei der nächsten Europawahl 2009<br />
messen lassen, inwiefern die EU sich einem demokratischen Leben<br />
geöffnet hat.<br />
Literatur: Fischer, Klemens H. (2004): Der europäische Verfassungsvertrag – Baden-Baden. <br />
Habermas, Jürgen (2001): Warum braucht Europa eine Verfassung?, Vortrag gehalten im Rahmen<br />
der 8. „Hamburg Lecture“ am 26. Juni 2001, unter: http://www.zeit.de/archiv/ 2001/27/200127_<br />
verfassung.xml (20.06.2005). Koj, Aleksander/Sztompka, Piotr (Hrsg.) (2001): Images of the<br />
World. Science. Humanties. Art – Krakau. Offe, Claus (2001): Is there, or can there be a ‘European<br />
Society’? in: Koj, Aleksander/Sztompka, Piotr (Hrsg.): Images of the World. Science.<br />
Humanties. Art – Krakau, S. 143–159.<br />
242<br />
Seifert
Annegret Katharina Schäfer<br />
Artikel 53-56<br />
DIE FINANZEN DER UNION<br />
Artikel 53: Die Haushalts- und Finanzgrundsätze<br />
Die Handhabung von Einnahmen und Ausgaben der Union beruht auf acht<br />
Haushaltsgrundsätzen, deren Ursprung im Wesentlichen auf die Haushaltsprinzipien<br />
der Mitgliedstaaten zurückzuführen ist. In der Verfassung werden insbesondere<br />
die Prinzipien der Jährlichkeit, der Einheit, des Haushaltsausgleichs<br />
und der Wirtschaftlichkeit hervorgehoben.<br />
Der Grundsatz der Jährlichkeit besagt, dass das europäische Budget in der<br />
Regel für einen Zeitraum von einem Jahr festgelegt wird. Die Finanzplanung<br />
unterliegt daher einer Regelmäßigkeit, die Transparenz schafft und die Kontrolle<br />
der Tätigkeit der Gemeinschaftsexekutiven erleichtert.<br />
Das Prinzip der Einheit enthält die Forderung, dass alle Einnahmen und Ausgaben<br />
der EU in einem Haushaltsplan enthalten sein müssen; es dürfen keine Neben-<br />
oder Schattenhaushalte existieren.<br />
Das Ziel des Prinzips des Haushaltsausgleichs ist ein stets ausgeglichener<br />
Haushalt. Auch wenn es augenscheinlich nicht einfach klingt, diesem Grundsatz<br />
zu entsprechen ist grundsätzlich leicht. Denn per Saldo ist, wie ein Blick<br />
in die Mitgliedstaaten der EU zeigt, jeder Haushalt grundsätzlich ausgeglichen:<br />
Übersteigen in Deutschland beispielsweise die Ausgaben die Einnahmen, wird<br />
die entstehende Finanzierungslücke über Kreditaufnahme umgehend geschlossen.<br />
Auf europäischer Ebene gestaltet sich dies jedoch wesentlich schwieriger,<br />
da die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen dürfen. Eine Kreditfinanzierung<br />
der EU-Aufgaben ist nicht zulässig, Verschuldung im Gegensatz zu den<br />
nationalen öffentlichen Haushalten untersagt.<br />
Bevor Ausgaben zum Beispiel für einen Autobahnbau in Spanien getätigt werden<br />
können, müssen sie durch einen Rechtsakt legitimiert werden. Damit die<br />
Ausgaben nicht die Einnahmen übersteigen, nehmen Europäisches Parlament,<br />
Kommission und der Ministerrat Abstand davon, Ausgaben einzuplanen, die<br />
eine unerwartete Mehrbelastung mit sich bringen könnten. Bei der Entscheidung,<br />
welche Aufgaben aus EU-Mitteln finanziert werden sollen, muss also darauf<br />
geachtet werden, dass man sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden<br />
Mittel befindet. Als Richtwert gilt dabei die festgelegte Ausgabenobergrenze<br />
von derzeit 1,27 % des Bruttoinlandsprodukts 1 der Europäischen Gemeinschaft.<br />
Die Verfassung räumt einem weiteren wichtigen Haushaltsgrundsatz eine<br />
besondere Rolle ein: dem der Wirtschaftlichkeit. Dieser besagt, dass die einge-<br />
1<br />
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt die Summe alle Güter- und Dienstleistungen zu ihren<br />
Marktpreisen an, die im Inland innerhalb eines bestimmten Zeitraumes hergestellt wurden und<br />
dem Endverbraucher dienen.<br />
Schäfer<br />
243
Artikel 53-56<br />
Die Finanzen der Union<br />
nommenen Mittel (so genannte Eigenmittel) effizient und effektiv eingesetzt<br />
werden sollen. Eine Mittelverschwendung soll es in der EU nicht geben. In dieser<br />
Hinsicht ist das Handeln der Mitgliedstaaten wesentlich, da sie nach Erhalt<br />
von EU-(Förder-)mitteln dazu angehalten sind, einen rechtmäßigen und wirtschaftlichen<br />
Einsatz der Gelder anzustreben und zu prüfen. In der Regel sind<br />
dafür die nationalen Behörden vor Ort sowie die nationalen Rechnungshöfe<br />
zuständig. Die EU-Institutionen ebenso wie die Mitgliedstaaten verfolgen<br />
zudem gemeinsam den nicht ordnungsgemäßen Einsatz von EU-Finanzmitteln.<br />
Werden Mittel zweckentfremdet oder falsche Abrechnungen angefertigt, also<br />
betrügerische Methoden angewandt, so kann dies strafrechtliche Folgen haben.<br />
Artikel 54: Die Eigenmittel der Union<br />
Die EU muss dafür Sorge tragen, dass den geplanten Ausgaben im ausreichenden<br />
Maße Einnahmen gegenüberstehen. Der Haushalt besteht einzig und allein<br />
aus Eigenmitteln. Hauptsächlich sind drei Arten von Eigenmitteln zu unterscheiden:<br />
Die traditionellen Eigenmittel der EU sind die Zolleinnahmen und<br />
Agrarabschöpfungen 2 , die vollständig der Union zufließen (originäre Eigenmittel).<br />
Die Mitgliedstaaten des Weiteren treten einen Teil ihres Mehrwertsteueraufkommens<br />
sowie einen Anteil von ihrem Bruttosozialprodukt 3 an die EU ab.<br />
Das Volumen der Einnahmen wird ausschließlich durch den Ministerrat festgelegt,<br />
der auch neue Einnahmequellen einführen oder bestehende abschaffen<br />
darf. Grundsätzlich besteht damit die Möglichkeit der Einführung einer Europa-Steuer.<br />
Die Hürde hierfür ist allerdings hoch. Einem Gesetz zur Einführung<br />
einer Europa-Steuer müssten alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union<br />
zustimmen. Darüber hinaus muss der Ministerrat über neue Einnahmequellen<br />
einstimmig entscheiden – das gilt zumindest bis Ende 2006. 4 Wie die Einnahmen<br />
dann erhoben werden, legt der Ministerrat in einem Gesetz fest, nach<br />
Zustimmung des Europäischen Parlaments.<br />
Artikel 55: Der mehrjährige Finanzrahmen<br />
Um einen langfristigen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der EU zu<br />
wahren, wird ein mehrjähriger Finanzrahmen erstellt. Dabei werden verschiedene<br />
Ausgabenkategorien festgelegt. Diese Praxis führte in den 1980er Jahren<br />
der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors ein, um finanzielle Planungssicherheit<br />
für die Aufgabenausführung der EU zu gewährleisten.<br />
2<br />
Die Europäische Union erhebt bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern Zölle. Bei landwirtschaftlichen<br />
Produkten werden diese Zölle als Abschöpfungen bezeichnet. Ihre Höhe unterliegt<br />
abhängig von der Preissituation auf dem Weltmarkt Schwankungen.<br />
3<br />
Das Bruttosozialprodukt (BSP) ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein in Geld<br />
angegebenes Maß für die erwirtschaftete Leistung der Inländer einer Volkswirtschaft.<br />
4<br />
Vgl. Artikel 318 Absatz 3.<br />
244<br />
Schäfer
Die Finanzen der Union<br />
Artikel 53-56<br />
Ebenso wie alle Ausgaben genehmigt werden müssen, bedarf auch der Finanzrahmen<br />
der rechtlichen Legitimation. Dabei wird er von der Kommission in ein<br />
Europäisches Gesetz gegossen, welches anschließend vom Europäischen Parlament<br />
verabschiedet wird.<br />
Bei der Ausgestaltung des Haushaltsplans, das heißt bei der Veranschlagung<br />
und Planung der Ausgaben, muss die in der mehrjährigen finanziellen Vorausschau<br />
angesetzte Obergrenze für jede einzelne Ausgabenkategorie unbedingt<br />
eingehalten werden. Die Ausgabenkategorien spiegeln dabei die Haupttätigkeitsbereiche<br />
der Union wider. Als Oberkategorien seien hier beispielsweise<br />
die Landwirtschaft, strukturpolitische Maßnahmen sowie die Verwaltung, aber<br />
auch Instrumente zur Vorbereitung der Aufnahme neuer EU-Mitgliedstaaten<br />
genannt.<br />
Nach dem Inkrafttreten der Verfassung ist für die Festlegung des ersten mehrjährigen<br />
Finanzrahmens die einstimmige Beschlussfassung des Ministerrates<br />
erforderlich, es sei denn, der Europäische Rat entscheidet, dass der Ministerrat<br />
in dieser Angelegenheit mit qualifizierter Mehrheit beschließen darf.<br />
Artikel 56: Der Haushaltsplan der Union<br />
Der jährliche Haushaltsplan wird auf Vorschlag der Kommission von Europäischem<br />
Parlament und Ministerrat gemeinsam erlassen. Das Verfahren läuft<br />
dabei wie folgt ab: Die Kommission erarbeitet zunächst einen Vorentwurf des<br />
Haushaltsplans, auf dessen Grundlage der Ministerrat dann mit qualifizierter<br />
Mehrheit einen Entwurf des Haushalts beschließt und diesen dem Europäischen<br />
Parlament weiterleitet. Befindet das Europäischen Parlament den Entwurf<br />
für gut und nimmt diesen an, ist der Haushalt festgestellt. Der Haushalt<br />
gilt auch dann als angenommen, wenn keine explizite Zustimmung des Europäischen<br />
Parlaments erfolgt, der Entwurf aber binnen 42 Tagen nicht von diesem<br />
abgeändert wird. Im Falle einer ganzheitlichen Ablehnung durch das Europäische<br />
Parlament hat der Ministerrat die Aufgabe, einen neuen Entwurf zu<br />
erarbeiten.<br />
Hat das Europäische Parlament jedoch bezüglich des Entwurfes durch den<br />
Ministerrat Änderungsvorschläge, werden diese dem Ministerrat zugeleitet. Im<br />
Falle der Ablehnung der Änderungsvorschläge durch den Ministerrat wird der<br />
Vermittlungsausschuss einberufen. Dieses Gremium besteht zu gleichen Teilen<br />
aus Vertretern des Ministerrates und Europaabgeordneten. Die Kommission<br />
nimmt die Funktion eines beratenden und schlichtenden Organs wahr. Kann der<br />
Vermittlungsausschuss einen gemeinsamen Entwurf vorlegen und stimmen<br />
dem der Ministerrat mit qualifizierter und das Europäische Parlament mit absoluter<br />
Mehrheit zu, so steht der Haushaltsplan fest. Findet der Vermittlungsausschuss<br />
jedoch keine gemeinsame Lösung, so gibt es keinen Haushaltsplan für<br />
das kommende Jahr. Ist bis zu Beginn des neuen Haushaltsjahres kein neuer<br />
Schäfer<br />
245
Artikel 53-56<br />
Die Finanzen der Union<br />
Haushaltsplan verabschiedet worden, greift die Regelung des Artikel 311<br />
Absatz 1 der Verfassung 5 , der die Finanzierung der einzelnen Ausgabenkategorien<br />
dadurch sichert, dass für jedes Kapitel oder jede sonstige Untergliederung<br />
monatlich maximal ein Zwölftel der Mittel des vorherigen Haushaltsjahres<br />
bereitgestellt werden.<br />
Von den Budgetrechten über die Europa-Steuer<br />
hin zu einer engeren Union?<br />
Viel Altbekanntes<br />
Getreu dem Motto „Europa wächst über das Geld zusammen oder gar<br />
nicht“ 6 sind die finanziellen Mittel für die politische und wirtschaftliche<br />
Arbeit der Europäischen Union unverzichtbar. Vergleicht man nun die<br />
Bestimmungen zu den Finanzen der Union im Vertrag von Nizza mit<br />
denen der Verfassung, scheint auf den ersten Blick Altbekanntes neu<br />
entdeckt worden zu sein: Die Haushaltsgrundsätze der bereits bestehenden<br />
Haushaltsordnung werden in der Verfassung noch unterstrichen.<br />
Daneben ist der Versuch der „Verfassungsväter und -mütter“ erkennbar,<br />
eventuelle Schattenhaushalte der Union zu minimieren und dem Grundsatz<br />
der Einheit gerecht zu werden. Alle getätigten Ausgaben sollen in<br />
einem Haushaltsplan erfasst werden. Wer nun meint, dass künftig mehr<br />
Übersichtlichkeit bei den EU-Finanzen herrschen werde, hat sich geirrt.<br />
Weiterhin außen vor bleiben nämlich die Haushalte der Darlehens- und<br />
Anleihetätigkeiten der EU sowie des Europäischen Entwicklungsfonds<br />
und der insgesamt über 15 Europäischen Agenturen.<br />
Was das Prinzip der Wirtschaftlichkeit der Verwendung der Finanzmittel<br />
angeht, beschränkt sich dieses nicht mehr allein auf das Handeln der<br />
Kommission, sondern dehnt sich auf den Begriff der Union aus. Mit<br />
anderen Worten: Alle am Budget beteiligten Organe tragen fortan Mitverantwortung<br />
für einen effizienten und effektiven Mitteleinsatz.<br />
Das Europäische Parlament und seine Budgetrechte<br />
Einen erheblichen Fortschritt stellt die geplante Kompetenzerweiterung<br />
des Europäischen Parlaments bezüglich seiner Budgetrechte dar. Wäh-<br />
5<br />
Vgl. auch Artikel 273 EG-Vertrag.<br />
6<br />
Freie Übersetzung von „L’Europe se fera par la monnaie ou elle ne se fera pas.“ Jacques Rueff<br />
(Richter am Europäischen Gerichtshof) 1958.<br />
246<br />
Schäfer
Die Finanzen der Union<br />
Artikel 53-56<br />
rend es zurzeit im Wesentlichen nur Budgetrechte im Bereich der so<br />
genannten nicht-obligatorischen Ausgaben hat, sollen diese Rechte<br />
künftig auch für die obligatorischen, das heißt verpflichtenden Ausgaben<br />
gelten, die etwa 65 Prozent des Gesamtbudgets darstellen. Die obligatorischen<br />
Ausgaben ergeben sich direkt aus dem Europäischen Vertragswerk<br />
wie zum Beispiel die Ausgaben in Zusammenhang mit der<br />
Garantieseite der Gemeinsamen Agrarpolitik. Die nicht-obligatorischen<br />
Ausgaben machen hingegen nur etwa 35 Prozent des Gesamtbudgets<br />
aus und beziehen sich auf solche Ausgaben oder Aufgaben, die sich<br />
nicht zwingend aus dem Vertrag ergeben. Dazu gehören im Wesentlichen<br />
Ausgaben im Bereich der Strukturfonds und der internen Politikbereiche,<br />
wie beispielsweise der Forschungs- und Umweltpolitik. Insbesondere<br />
bei den nicht-obligatorischen Ausgaben hat das Europäische<br />
Parlament ein größeres Mitspracherecht, denn auf diese Ausgabenkategorie<br />
kann mit der Mehrheit der Europaabgeordneten Einfluss genommen<br />
werden. Im Hinblick auf die obligatorischen Ausgaben hingegen<br />
gibt es – jedenfalls bis zum Inkrafttreten der Verfassung – nur die Möglichkeit<br />
von Änderungsvorschlägen durch das Parlament. Ob diese dann<br />
überhaupt berücksichtigt werden, hängt alleine davon ab, ob der Ministerrat<br />
sie annimmt oder ablehnt.<br />
Von Bedeutung ist deshalb, dass mit der Verfassung das Mitentscheidungsverfahren<br />
auf den Bereich der obligatorischen Ausgaben ausgedehnt<br />
wird. Damit hat das Europäische Parlament ein Mitspracherecht in<br />
allen Ausgabenbereichen. Das bislang ungleiche Machtverhältnis zwischen<br />
Parlament und Ministerrat wird durch die Verfassung ausbalanciert.<br />
Die geplante Kompetenzerweiterung steigert einmal mehr den Einfluss<br />
des Europäischen Parlaments, ist aber bei weitem nicht ausreichend.<br />
Denn vom Status eines Vollparlaments mit autonomen Steuererhebungsrechten<br />
ist das Parlament noch weit entfernt. Die Bestimmung von Einnahmequellen<br />
obliegt weiterhin allein dem Ministerrat, auch wenn festzustellen<br />
ist, dass dieser in naher Zukunft diesbezüglich nicht mehr an<br />
Einstimmigkeit gebunden ist. Letzteres dient insbesondere der Aufrechterhaltung<br />
der Handlungsfähigkeit der erweiterten Union, denn in einem<br />
Europa der 25 ist die Wahrscheinlichkeit der völligen Meinungsübereinstimmung<br />
im Ministerrat geringer als in einer Gemeinschaft von<br />
15 Mitgliedstaaten. Dies alles ändert jedoch nichts daran, dass der jetzige<br />
und durch die Verfassung angestrebte Zustand im starken Widerspruch<br />
zur Entwicklung der parlamentarischen Demokratie steht. Denn<br />
lange ist es her, als sich die Parlamente ihre Souveränität erkämpfen<br />
Schäfer<br />
247
Artikel 53-56<br />
Die Finanzen der Union<br />
mussten. Auch im Kontext der Weiterentwicklung der Union hat die<br />
Frage der Budgetrechte nicht an Attraktivität verloren. Dies rührt insbesondere<br />
aus den Budgetfunktionen, die ein jeder Etat beinhaltet: Das ist<br />
vor allem die Kontrolle über und die Einflussnahme auf die Exekutive,<br />
indem der verabschiedete Haushalt deren Handeln zumindest finanziell<br />
beschränkt und die im Haushalt innewohnende politische Programmfunktion<br />
beeinflusst. 7<br />
Das Für und Wider einer Europa-Steuer<br />
Der Verfassungskonvent verfolgte das Ziel, festzuschreiben, wer für<br />
was zuständig ist, für welche Aufgaben also ausschließlich die Union<br />
zuständig ist, welche Aufgaben die Mitgliedstaaten zu übernehmen<br />
haben und in welchen Bereichen Union und Mitgliedstaaten sich Aufgaben<br />
teilen. Bei Aufgaben, für die ausschließlich die Union zuständig ist,<br />
benötigt sie ausreichend Finanzmittel. 8 Aufgrund der stark rückläufigen<br />
Entwicklung des Anteils der originären Eigenmittel und des durch die<br />
Erweiterung der EU um neue Mitgliedstaaten steigenden Finanzierungsbedarfs<br />
wäre eine Europa-Steuer sinnvoll. Zudem würde eine Europa-<br />
Steuer der Transparenz dienen, denn an ihr könnte der Bürger ablesen,<br />
was ihn die Union kostet. Ein weiterer Vorteil der Europa-Steuer würde<br />
sich aus dem Umstand der direkten Verantwortlichkeit der Union gegenüber<br />
dem Steuerzahler ergeben. Die Finanzkontrolle wäre akribisch,<br />
wenn die am Budget beteiligten Organe ihre Ausgaben dem Bürger<br />
gegenüber rechtfertigen müssten.<br />
Darüber hinaus müssen auch die Vorteile einer fiskalischen Autonomie<br />
der Union im Hinblick auf eine wesentlich unabhängigere europäische<br />
Politik gesehen werden. Letztere wäre dann weniger gebunden an die<br />
Maßnahmen und Politiken der Mitgliedstaaten. Dennoch sollte auch<br />
nicht vergessen werden, dass das Recht auf autonome Einnahmenerhebung<br />
des Parlaments nicht nur eine bloße Berechtigung zur Steuererhebung<br />
ist, sondern einhergeht mit dem Recht der Verschuldung. Die<br />
Fähigkeit einer öffentlichen Gebietskörperschaft bei Finanzierungsproblemen<br />
ihre Einnahmen autonom bestimmen zu können, ist eine für<br />
deren Kreditwürdigkeit notwendige Voraussetzung. Gerade im Hinblick<br />
auf die laxe Handhabung der durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt<br />
festgesetzten Verschuldungsgrenzen in einigen großen Mitgliedsländern<br />
7<br />
Vgl. Dickertmann/Gelbhaar 2000, 83.<br />
8<br />
Vgl. Stroll 1990, 143 f.<br />
248<br />
Schäfer
Die Finanzen der Union<br />
Artikel 53-56<br />
ist ein eigenes Verschuldungsrecht für die Union mit Vorsicht zu genießen.<br />
Allerdings muss eingeräumt werden, dass eine Verknüpfung von<br />
Ertragshoheit und Gesetzgebungskompetenz nicht zwingend notwendig<br />
ist. 9 Ähnlich wie in Deutschland, wo zum Beispiel den Bundesländern<br />
Anteile der Einkommensteuer zustehen, während der Bund die Gesetzgebungshoheit<br />
hat und damit die materielle Ausgestaltung dieser Steuern<br />
innehält, könnte auf europäischer Ebene eine EU-Steuer geschaffen werden.<br />
Damit könnte allmählich vom bisherigen Eigenmittelsystem<br />
Abstand genommen werden. Denn das Eigenmittelsystem der EU entwickelt<br />
sich zunehmend zu einem System der Pauschalzuweisungen. Das<br />
ist darauf zurückzuführen, dass die traditionellen Einnahmequellen, also<br />
die Einnahmen aus Agrarabschöpfungen bzw. -abgaben und Zolleinnahmen<br />
ständig sinken. Ursache dessen ist die Angleichung der EU-Agrarmarktpreise<br />
an die Weltmarktpreise sowie der Abbau von Zolltarifen im<br />
Rahmen der Liberalisierung des Welthandels gegenüber Drittstaaten.<br />
Dadurch erlangen die Mehrwertsteuer- und BSP-Einnahmen zunehmend<br />
an Bedeutung. Bei diesen Mitteln handelt es sich jedoch weniger um<br />
wirkliche Eigenmittel der EU als um Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten,<br />
die bis dato bei Nichtnutzung im betreffenden Haushaltsjahr den Geberländern<br />
zurückgezahlt werden. Ein solches Finanzierungssystem ist<br />
typisch für internationale Organisationen, aber nicht angemessen für die<br />
Europäische Union. 10 Auch wenn Mehrwertsteuer- und BSP-Anteil den<br />
Charakter von Finanzbeiträgen behalten, so führt zumindest die durch<br />
die Verfassung geschaffene Möglichkeit der Mittelübertragungen von<br />
einem Jahr in das nächste 11 zu einer Entschärfung dieser Problematik und<br />
ferner zu einer besseren Ausschöpfung der Eigenmittelobergrenze. 12<br />
Von einer wahren Union noch weit entfernt<br />
Zugegeben, die Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments in<br />
Bezug auf die finanziellen Mittel der Gemeinschaft haben sich seit 1971<br />
nach und nach verbessert. 13 Die Errichtung des Europäischen Rechnungshofes<br />
als eigenständige Institution ist zudem für die Ausübung der<br />
Kontrollfunktion des Parlaments äußerst dienlich. Dennoch muss die<br />
9<br />
Vgl. Klein 1987, 28 f.<br />
10<br />
Vgl. Meyer 2000, 165.<br />
11<br />
Vgl. Artikel 312.<br />
12<br />
Vgl. Bardong 1998, 232.<br />
13<br />
Vgl. Langes 1997, 105 f.<br />
Schäfer<br />
249
Artikel 53-56<br />
Die Finanzen der Union<br />
Frage gestellt werden, ob es nicht ein unerträglicher Zustand ist, dass zu<br />
Beginn des 21. Jahrhunderts in einem Europa, dessen Nationalstaaten<br />
alle über parlamentarische Demokratien verfügen, ein übergeordnetes<br />
Parlament lediglich mit rudimentären Mitentscheidungsrechten ausgestattet<br />
ist und sein Dasein als Ko-Legislative fristet.<br />
Befürwortern einer weiteren Demokratisierung der EU bietet die langsame<br />
Weiterentwicklung der Rechte des Europäischen Parlaments eine<br />
breite Angriffsfläche. Solange bei den Mitgliedstaaten der politische<br />
Wille für eine Weiterentwicklung im Bereich der Finanzen fehlt, wird die<br />
EU nicht über den Status eines Staatenverbundes hinwegkommen. Ganz<br />
im Sinne der politischen Theorie des Intergouvernementalismus versuchen<br />
die Mitgliedstaaten immer wieder ihren Eigennutzen zu maximieren,<br />
indem sie Politikbereiche, in denen ihr eigener Erfolg durch Drittfaktoren<br />
wie Interdependenzen und externe Effekte stark eingeschränkt<br />
ist, ausgliedern und auf die supranationale Ebene verlagern, um letztendlich<br />
selbst mehr innenpolitischen Gestaltungsspielraum zurückzuerlangen.<br />
Mit wahren Souveränitätsübertragungen tut man sich allerdings<br />
sehr schwer und so ist es auch nicht verwunderlich, dass bei der Weiterentwicklung<br />
des Finanzbedarfs letztendlich nur Entscheidungen des<br />
kleinsten gemeinsamen Nenners getroffen werden. Hier darf der Union<br />
nicht vorgeworfen werden, sie sei undemokratisch, denn sie wurde als<br />
Organisation durch die Mitgliedstaaten so geschaffen. Es sind allein also<br />
die Mitgliedstaaten, die für diesen Status quo verantwortlich sind.<br />
Literatur: Bardong, Otto (1998): Die Eigenmittel der EU, in: Rinsche, Günther/Friedrich, Ingo<br />
(Hrsg.): Weichenstellung für das 21. Jahrhundert – Erfordernisse und Perspektiven der europäischen<br />
Integration – Köln, S. 229–234. Biehl, Dieter/Winter, Horst (Hrsg.) (1990): Europa<br />
finanzieren – ein föderalistisches Modell – Gütersloh. Dickertmann, Dietrich/Gelbhaar, Siegfried<br />
(2000): Finanzwissenschaft – Berlin. Klein, Franz (1987): Zur Frage einer zukünftigen<br />
Finanzierung der Europäischen Gemeinschaften durch eigene Steuereinnahmen, in: Europäische<br />
Hefte, Jg. 54, S. 28–35. Langes, Horst (1997): Vernünftige und sparsame Haushaltspolitik des<br />
Europäischen Parlaments, in: Rinsche, Günther/Friedrich, Ingo (Hrsg.): Europa als Auftrag<br />
–Köln, S. 105–112. Meyer, Steffen (2000): Zwischenstaatliche Finanzzuweisungen im zusammenwachsenden<br />
Europa: zur Gestaltung eines Finanzausgleichs für die Europäische Union –<br />
Frankfurt/M. Rinsche, Günther/Friedrich, Ingo (Hrsg.) (1997): Europa als Auftrag – Köln. <br />
Rinsche, Günther/Friedrich, Ingo (Hrsg.) (1998): Weichenstellung für das 21. Jahrhundert –<br />
Erfordernisse und Perspektiven der europäischen Integration – Köln. Siuts, Carl-Gustav<br />
(2001): Die öffentlichen Finanzen der Europäischen Union – Frankfurt/M. Stroll, Karin<br />
(1990): Alternativen der EG-Finanzierung, in: Biehl, Dieter/Winter, Horst (Hrsg.): Europa finanzieren<br />
– ein föderalistisches Modell – Gütersloh, S. 143–151. Tillich, Stanislav (1998): Haushalt<br />
und Finanzen der EU, in: Rinsche, Günther/Friedrich, Ingo (Hrsg.): Weichenstellung für das<br />
21. Jahrhundert – Erfordernisse und Perspektiven der europäischen Integration – Köln, S. 235–238.<br />
Zimmermann, Horst/Henke, Klaus-Dirk (1985): Finanzwissenschaft – München.<br />
250<br />
Schäfer
Anna Lührmann<br />
Artikel 57<br />
DIE UNION UND IHRE NACHBARN<br />
Artikel 57: Die Union und ihre Nachbarn<br />
Der achte Titel „Die Union und ihre Nachbarn“ besteht lediglich aus einem<br />
Artikel, dem Artikel 57. Absatz 1 legt fest, dass die Europäische Union besondere<br />
Beziehungen zu den Staaten ihrer Nachbarschaft entwickeln soll. Diese<br />
Beziehungen haben zum Ziel, die Europäische Union als einen „Raum des<br />
Wohlstands und der guten Nachbarschaft“ zu schaffen. Diese Beziehungen sollen<br />
„friedlich“ sein und „eng“ und eine Zusammenarbeit ermöglichen, die auf<br />
den Werten der Europäischen Union basiert. Um dieses Ziel zu erreichen, kann<br />
die Europäische Union, so Absatz 2, spezielle Abkommen mit diesen Staaten<br />
oder Staatengruppen abschließen und mit diesen gemeinsam handeln.<br />
Die Europäische Union –<br />
ein stabilisierender Faktor in der Welt<br />
Die Zielsetzung des Artikel 57 ist die Verbesserung der Situation in den<br />
Nachbarstaaten der Union. Denn eine Verbesserung führt zu einer indirekten<br />
Rückwirkung auf die EU selbst: Ihre eigene Sicherheitslage wird<br />
verbessert. Ziele sind deshalb friedliche Beziehungen zu allen Nachbarstaaten,<br />
eine intensivere Zusammenarbeit und die Förderung der Entwicklung<br />
dieser Staaten, um das Wohlstandsgefälle zwischen diesen<br />
und der EU zu reduzieren.<br />
Die Bestimmungen des Artikels 57 sind an sich nicht neu. Die Europäische<br />
Union hat schon seit Jahrzehnten Assoziationsabkommen mit Staaten<br />
ihres regionalen Umfelds geschlossen und in den letzten Jahren vermehrt<br />
spezielle Strategien entwickelt. So gibt es zum Beispiel eine EU-<br />
Russland-Strategie, um zum größten Nachbarn der Europäischen Union<br />
ein strukturiertes Verhältnis aufzubauen. Zudem gibt es das größer<br />
angelegte strategische Programm „Nördliche Dimension“ (Northern<br />
Dimension), das auf die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen<br />
im nördlichen Europa abgestellt ist. Die „Nördliche Dimension“<br />
umfasst alte wie neue EU-Mitglieder ebenso wie Russland und Weißrussland.<br />
Ein anderes schon existierendes Projekt ist die EU-Mittelmeerpolitik,<br />
die unter dem Label „Barcelona-Prozess“ läuft. Der „Barcelona-Pro-<br />
Lührmann<br />
251
Artikel 57<br />
Die Union und ihre Nachbarn<br />
zess“ unterstützt die Vernetzung in der Region und will die wirtschaftliche<br />
und demokratische Entwicklung der südlichen Mittelmeeranrainer<br />
fördern.<br />
Artikel 57 beschreibt also eher den Ist-Zustand, als dass er die Europäische<br />
Union zu neuem Handeln auffordert. Es ist aber kritisch zu hinterfragen,<br />
ob diese Bestimmung wirklich so zentral ist, dass sie in den<br />
ersten Teil der Europäischen Verfassung aufgenommen werden musste.<br />
Ihr Inhalt ist zweifelsohne sehr wichtig, aber wenn man das Ziel verfolgt,<br />
eine möglichst kurze Verfassung zu entwerfen, dann hätte diese<br />
Bestimmung eher im dritten Teil ihren Platz.<br />
Ein möglicher Grund, warum diese Bestimmung dennoch Eingang in<br />
den ersten Teil der Verfassung gefunden hat, ist die sich verschärfende<br />
Diskussion über die Grenzen Europas. Dabei geht es nicht nur um die<br />
Türkei-Debatte, sondern auch um immer wieder erhobene Forderungen,<br />
Russland, die Ukraine, Belarus, Moldawien, Georgien, Israel oder die<br />
südlichen Mittelmeeranrainer eines Tages in die EU aufzunehmen. 1 Mit<br />
der expliziten Einfügung dieser Verfassungsbestimmung soll vermutlich<br />
deutlich werden, dass neben der „Vollmitgliedschaft“ in der EU auch<br />
andere Formen der (privilegierten) Zusammenarbeit möglich sein können<br />
und auch schon sind. Dieser Idee entspricht auch das neue Nachbarschaftskonzept<br />
„Größeres Europa“ (Wider Europe), das die Europäische<br />
Kommission im März 2003 verabschiedet hat. Dort wird der Rahmen<br />
der Beziehungen der Europäischen Union zu ihren östlichen und südlichen<br />
Nachbarn für die nächsten zehn Jahre abgesteckt. Hierbei handelt<br />
es sich um Länder, die explizit vorerst keine Beitrittsperspektive haben.<br />
Denkbar sind solche besonderen Beziehungen aber auch als Zwischenstufe<br />
bis zum Beitritt. Wenn ein solcher erst in zehn oder zwanzig Jahren<br />
realistisch ist, könnte in der Zwischenzeit eine privilegierte Beziehung<br />
quasi als „Heranführungsstrategie“ dienen, wie dies bei bisherigen<br />
Beitritten bereits praktiziert wurde. Gerade im Hinblick auf die Staaten<br />
Südosteuropas wäre eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit<br />
über den Stabilitätspakt hinaus sehr wünschenswert.<br />
Es ist jedoch notwendig, dass die Abkommen im Rahmen des Artikels<br />
57 explizit das strategische Ziel der Partnerschaft klarstellen. Es muss<br />
allen Beteiligten klar sein, ob es sich um eine Heranführung an die Mitgliedschaft<br />
handelt oder ob diese nicht das erklärte Ziel sein soll. Wenn<br />
1<br />
Vgl. hierzu auch den Text von Florentina Bodnari in diesem Band.<br />
252<br />
Lührmann
Die Union und ihre Nachbarn<br />
Artikel 57<br />
einem Nachbarn erst einmal das Versprechen einer späteren Mitgliedschaft<br />
gemacht wird, kann dieses bei Erfüllung der Kopenhagener Kriterien<br />
kaum wieder zurückgenommen werden. Eine spätere Änderung<br />
der Zielsetzung zur Heranführung an eine Mitgliedschaft im beiderseitigen<br />
Einvernehmen sollte natürlich trotzdem noch möglich sein.<br />
Die EU steht hier vor einer gewaltigen Aufgabe. Denn nach der Osterweiterung<br />
sind ihre neuen Nachbarstaaten fast ausschließlich Länder,<br />
die enorme wirtschaftliche Probleme und oft schwere demokratische<br />
Defizite aufweisen. Die Entwicklungen in diesen Ländern positiv zu<br />
beeinflussen, ist originäres Interesse der Europäischen Union. Gleichzeitig<br />
ist dies tatsächlich der geographische Raum, in dem die EU ihren<br />
positiven Einfluss wirksam geltend machen kann. Die Heranführungsstrategie<br />
der zwölf Beitrittskandidaten war erfolgreich und hat zweifelsohne<br />
zur politischen Stabilisierung und zur wirtschaftlichen Entwicklung<br />
beigetragen. Diese Erfahrung zeigt, dass die Europäische Union als<br />
stabilisierender Faktor in der Region von großer Bedeutung ist und auch<br />
weiterhin sein kann.<br />
Lührmann<br />
253
Florentina Harbo<br />
Artikel 58-60<br />
ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION<br />
Artikel 58: Kriterien und Verfahren für den Beitritt zur Union<br />
So wie Artikel 49 des Amsterdamer Vertrages gibt auch der Artikel 58 der Verfassung<br />
jedem europäischen Staat die Möglichkeit, Mitglied der EU zu werden.<br />
Die beitrittswilligen Staaten müssen hierzu eine Reihe von Kriterien erfüllen,<br />
wie zum Beispiel die Werte der Union respektieren. Seinen Antrag auf Mitgliedschaft<br />
richtet ein Staat an den Ministerrat, welcher anschließend das Europäische<br />
Parlament und die nationalen Parlamente davon unterrichtet. Vor dem<br />
Beitritt wird die Kommission angehört. Im Vorfeld dieser Anhörung steht sie in<br />
enger Verbindung mit den Beitrittskandidaten und unterstützt diese bei der<br />
Erfüllung der Beitrittskriterien. Dieser Prozess kann mehrere Jahre dauern. Das<br />
Europäische Parlament spielt bei der Aufnahmeprozedur eine besondere Rolle,<br />
da seine Zustimmung für den Beitritt eines Staates notwendig ist. Am Ende<br />
muss der Ministerrat einstimmig darüber beschließen, ob der Beitrittskandidat<br />
aufgenommen wird. Die Einstimmigkeit ist dabei von erheblicher Bedeutung,<br />
denn wenn nur ein EU-Mitgliedstaat gegen eine solche Mitgliedschaft stimmt,<br />
ist die ganze Prozedur beendet und der Beitrittskandidat wird nicht aufgenommen.<br />
Stimmen aber alle zu, so kommt ein Abkommen über die genaueren<br />
Bedingungen der Aufnahme zustande. Ein solches Abkommen muss alsbald<br />
sowohl von jedem Mitgliedstaat als auch von dem jeweiligen Beitrittstaat ratifiziert<br />
werden. Das genaue Ratifizierungsverfahren ist in der Verfassungsordnung<br />
jedes Staates festgeschrieben. In Deutschland müssen beispielsweise<br />
sowohl Bundestag als auch Bundesrat dem Beitrittsabkommen zustimmen.<br />
Artikel 59: Aussetzung bestimmter mit der Zugehörigkeit zur Union<br />
verbundenen Rechte<br />
Artikel 59 definiert, wann und wie ein Staat die Rechte, die er mit der Mitgliedschaft<br />
in der Union erhält, wieder verliert. Wenn ein Mitgliedstaat die in Artikel<br />
2 definierten Werte verletzt, so können sowohl ein Drittel der Mitgliedstaaten<br />
als auch die Kommission nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments<br />
einen Vorschlag zur Aussetzung der Rechte dieses Staates unterbreiten.<br />
Der Ministerrat kann dann mit einer 4/5-Mehrheit seiner Mitglieder und mit der<br />
Zustimmung des Parlaments einen Beschluss zur Feststellung der Werteverletzung<br />
fassen. Bevor dieser in Kraft tritt, wird der Ministerrat den betroffenen<br />
Staat aber anhören. Mit einem Aussetzungsbeschluss verliert der betroffene<br />
Staat seine Rechte, in erster Linie seine Stimmrechte im Ministerrat. Zugleich<br />
aber ist er weiterhin aufgefordert, seinen Verpflichtungen gemäß der Verfassung<br />
nachzukommen. Ändert sich das Verhalten des Staates, kann der Minis-<br />
254<br />
Harbo
Zugehörigkeit zur Union<br />
Artikel 58-60<br />
terrat mit qualifizierter Mehrheit seinen Beschluss später entsprechend modifizieren<br />
oder gar aufheben.<br />
Artikel 60: Freiwilliger Austritt aus der Union<br />
Die mit Artikel 60 festgeschriebene Möglichkeit des freiwilligen Austrittes ist<br />
neu. Die bisherigen Verträge wurden für eine unbegrenzte Zeit ohne ein ausdrückliches<br />
Austrittsrecht unterschrieben. Mit diesem Artikel kann nun jedes<br />
Mitglied nach eigenem Willen aus der EU austreten. Es muss jedoch zuerst den<br />
Ministerrat über sein Anliegen informieren und anschließend mit ihm ein<br />
Abkommen über das „Wann“ und „Wie“ des Austritts aushandeln. 1 Diesem<br />
muss der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit 2 zustimmen und auch im Europäischen<br />
Parlament muss ein positives Votum darüber erzielt werden. Der austrittswillige<br />
Staat selbst nimmt an diesem Prozess nicht teil. Nach Abschluss<br />
des Austrittsverfahrens gilt die Verfassung für den entsprechenden Staat nicht<br />
mehr und er verliert alle mit der EU-Mitgliedschaft verbundenen Rechte. Allerdings<br />
kann er der Union abermals beitreten, muss aber zuvor das in Artikel 58<br />
vorgeschriebene Verfahren durchlaufen.<br />
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, jedem Ende ...<br />
Wer kann Mitglied der EU werden? – Der „Beitrittsartikel“<br />
Prinzipiell können alle europäischen Staaten, die die Werte der EU, das<br />
heißt beispielsweise die Achtung der Menschenwürde, Freiheit und<br />
Demokratie respektieren, Mitglied der Union werden. Es ist schwierig,<br />
die Erfüllung dieser Werte zu messen, aber die EU hat trotzdem im<br />
Laufe der Zeit klare Kriterien hierfür entwickelt. 3 Könnten aber die Türkei,<br />
Russland oder die Balkanstaaten ebenfalls Mitglieder der EU werden,<br />
solange sie nur die Kriterien erfüllen? Dies führt zur Frage nach<br />
den geographischen Grenzen der EU. Wie weit also kann die EU sich<br />
erweitern, ohne ihren Charakter zu verlieren?<br />
Nun sagen die geographischen Grenzen Europas recht wenig über die<br />
Grenzen der Erweiterungsfähigkeit der EU aus. Zudem unterscheiden<br />
1<br />
Vgl. Artikel 325 Absatz 3.<br />
2<br />
Als qualifizierte Mehrheit gilt in diesem Falle eine Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen<br />
Mitglieder des Ministerrates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden<br />
Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten<br />
ausmachen.<br />
3<br />
Der Kopenhagener Gipfel von 1993 hat die folgenden Kriterien für den Beitritt zur EU festgelegt:<br />
Demokratie, Schutz der Menschen- und Minderheitenrechte, Marktwirtschaft und<br />
Übernahme des acquis communautaire.<br />
Harbo<br />
255
Artikel 58-60<br />
Zugehörigkeit zur Union<br />
sich die Grenzen Europas von denen der EU. Während des Kalten Krieges<br />
war dieses Verhältnis noch klarer: Europa war dort, wo die politische<br />
kommunistische Macht aufhörte. Die historischen Räume Europas<br />
haben sich immer wieder verändert und verschoben. Diese Veränderungen<br />
beeinflussten schließlich Europas heutige Grenzen. Geographisch<br />
ist ein Kontinent ein Land, das von Seen und Ozeanen umgeben ist. In<br />
Europa ist dies nicht der Fall. Asien hat keine natürlichen Grenzen im<br />
Westen und Europa deshalb nur recht willkürliche Grenzen im Osten<br />
des Ural. Als Kontinent reicht Europa vom Nordkap bis zum Mittelmeer<br />
und von der Atlantikküste bis zum Ural und dem Kaspischen Meer.<br />
Auch historisch war Europa nie geeint. Im Gegenteil: Die europäischen<br />
Staaten haben immer wieder Kriege gegeneinander geführt. In der Vergangenheit,<br />
insbesondere zwischen 1800 und 1950, erlebten sie etwa<br />
alle 13 Jahre einen vierjährigen Krieg 4 , was glücklicherweise mit dem<br />
europäischen Integrationsprozess beendet wurde. Heutzutage hat das<br />
Territorium einen großen Teil seiner Bedeutung als Grundlage der politischen<br />
Geographie, aber auch des traditionellen politischen Denkens<br />
verloren. 5 Das politische Europa kann deshalb heute als geographischer,<br />
kultureller oder historisch-politischer Raum begriffen werden, der aber<br />
trotzdem immer noch keine eindeutigen Grenzen aufweist.<br />
Das politische Projekt Europas bewegt sich im Rahmen der EU und<br />
steht so in einem Widerspruch zwischen grundsätzlicher geographischer<br />
Offenheit und politisch notwendiger Begrenzung. Die EU hat ihre Grenzen<br />
noch nicht endgültig definiert, obwohl sich diese Herausforderung<br />
mit jedem neuen Vertrag gestellt hat. Artikel 58 Absatz 2 der Verfassung<br />
sagt deutlich, dass alle europäische Staaten, „die Mitglied der Union<br />
werden möchten, ... ihren Antrag an den Rat [richten]“. Was jedoch<br />
unter dem Begriff „europäische Staaten“ zu verstehen ist, ist nach dem<br />
Wortlaut des Artikels nicht ganz klar. Ob sich ein Staat zu Europa zugehörig<br />
fühlt, ist letztlich nicht die Frage seiner eigenen Orientierung und<br />
Selbstdefinition und schon gar nicht seiner Mitgliedschaft in der EU. In<br />
jedem Fall entscheiden zugleich auch immer die Mitglieder der EU im<br />
Konsens über jede neue Mitgliedschaft, nach gemeinsam definierten<br />
Kriterien, aber auch gemäß ihren Interessen. So wurde 1987 der Antrag<br />
Marokkos auf Mitgliedschaft mit der Begründung abgelehnt, dass es<br />
kein europäischer Staat sei.<br />
4<br />
Vgl. Barthalay 1999.<br />
5<br />
Vgl. Grosser 1996.<br />
256<br />
Harbo
Zugehörigkeit zur Union<br />
Artikel 58-60<br />
Die Türkei hingegen hat auf dem Gipfel des Europäischen Rates 1999<br />
in Helsinki offiziell den Status eines Beitrittskandidaten erhalten und<br />
auf dem Gipfeltreffen am 17. Dezember 2004 in Brüssel beschlossen die<br />
Staats- und Regierungschef, die Beitrittsverhandlungen im Oktober<br />
2005 aufzunehmen. Ein Beitritt wird aber wohl kaum vor 2014 stattfinden.<br />
Bis dahin muss die Türkei noch wichtige Reformgesetze verabschieden<br />
und in die Praxis umsetzen. So gibt es immer noch gravierende<br />
Probleme beim Schutz der Menschen- und Minderheitenrechte. Außerdem<br />
sind die geographische und demographische Größe des Landes ein<br />
streitbares Argument. Mit 67,6 Millionen Bürgern wäre die Türkei heute<br />
das zweitgrößte Land in der EU. Und aufgrund des starken Bevölkerungswachstums<br />
könnte sie im Jahre 2015 rund 79 Millionen Einwohner<br />
haben. 6 Damit wäre sie fast so groß wie Deutschland. Das schürt<br />
Ängste. So sah zum Beispiel Valéry Giscard d’Estaing, der Präsident<br />
des Verfassungskonvents, die Aufnahme der Türkei als „das Ende der<br />
EU“ 7 an. Nach Ansicht der Gegner eines Türkei-Beitritts ist das Land<br />
von den Grundlagen der europäischen Integration, also der christlichjüdischen<br />
Tradition, dem römischen Recht und der griechischen Philosophie,<br />
ausgeschlossen. 8 Auch wenn die Türkei alle Beitrittskriterien<br />
erfüllen würde, wäre ein Beitritt deshalb aus Sicht der Gegner nicht<br />
wünschenswert. Andererseits könnte die Türkei aber gerade der Testfall<br />
für die Demokratisierung und Modernisierung eines moslemischen Landes<br />
sein. Zudem könnte die Aufnahme eines islamischen Landes in<br />
Zukunft eine bedeutende geopolitische Rolle spielen: Die EU würde<br />
dadurch mehr Akzeptanz in der arabischen Welt erfahren. Dies wäre<br />
angesichts der weltpolitischen Lage durchaus von Vorteil. Doch trotz<br />
allem gilt: Solange die EU ihre geographischen Grenzen nicht eindeutig<br />
bestimmt hat, ist die Erfüllung der Beitrittskriterien das wichtigste<br />
Argument für eine Aufnahme der Türkei in die Union.<br />
Die Zahl der Mitgliedstaaten der EU bestimmt auch deren institutionelle<br />
Struktur und Entscheidungsfähigkeit. Politische Einheiten mit weniger<br />
Mitgliedern sind durchaus funktionsfähiger – nach dem Motto:<br />
„small is beautiful“. Je größer eine politische Einheit ist, desto kleiner<br />
6<br />
Vgl. Vereinte Nationen: Human Development Indicators – Statistik des Entwicklungsprogramms<br />
der Vereinten Nationen (UNDP), unter: http://hdr.undp.org/statistics/data/cty/cty_f_ TUR.html<br />
(20.06.2005).<br />
7<br />
Vgl. Marschall 2002.<br />
8<br />
Vgl. Davies 1997.<br />
Harbo<br />
257
Artikel 58-60<br />
Zugehörigkeit zur Union<br />
ist die Stimmenmacht jedes Mitglieds und desto schwieriger ist es auch,<br />
einen Konsens zu erarbeiten. 9 Hinzukommt, dass die EU-Mitgliedstaaten<br />
sehr heterogen sind.<br />
Es gibt aber eine Antwort auf solche Probleme: den Föderalismus. Er<br />
kann die Einheit in der Vielfalt garantieren und mit seinen Prinzipien<br />
zur Lösung einer Reihe von Problemen beitragen. Das föderale Prinzip<br />
findet sich auch in der Europäischen Verfassung wieder. So heißt es in<br />
der Präambel: „Europa in Vielfalt geeint.“ Föderale Prinzipien – wie<br />
zum Beispiel Autonomie, Partizipation, Kooperation, Subsidiarität –<br />
können der EU als wesentliche Instrumente der Konfliktlösung zugute<br />
kommen. Obwohl die EU aller Wahrscheinlichkeit nach in naher Zukunft<br />
kein Bundesstaat im traditionellen Sinne 10 werden wird, kann sie<br />
durchaus föderale Prinzipien nutzen und sich mit ihrer Hilfe weiter zu<br />
einer föderalen Union eigener Art, das heißt zu einer föderalen Union<br />
von Staaten und Völkern entwickeln.<br />
Das bedeutet nicht, dass sie nichts von den „richtigen“ Bundesstaaten<br />
lernen könnte. In diesen werden auch Entscheidungen zu „high politics“<br />
(z.B. Außen- und Währungspolitik) mit Mehrheitsentscheiden<br />
getroffen. In der EU ist hingegen Einstimmigkeit erforderlich. Das<br />
bedeutet, dass in der EU gegenwärtig 3,84 Millionen (irische) Bürger<br />
über die Zukunft von 455 Millionen EU-Bürgern entscheiden können,<br />
wie zum Beispiel das irische „Nein“ im Jahre 2001 zum Nizza-Vertrag<br />
gezeigt hat. Andere Fragen kann jedes Mitglied selbst entscheiden. So<br />
hat Großbritannien beschlossen, den Euro nicht zu akzeptieren. Das<br />
war eine Entscheidung, die nur Großbritannien betraf und nicht die<br />
anderen 14 Mitglieder. Aber als Irland „Nein“ zum Nizza-Vertrag<br />
sagte, hatte das Konsequenzen für alle Mitglieder und Beitrittskandidaten.<br />
Anders in den USA: Hier haben anfangs nur neun von dreizehn<br />
Staaten entschieden, die föderale Verfassung anzunehmen, und die<br />
USA sind erst dadurch zu einem Bundesstaat geworden. Für die EU<br />
würde dies bedeuten, dass die Mitgliedstaaten zwar auf einen Teil ihrer<br />
Souveränität in entscheidenden Fragen verzichten müssten. Jedoch<br />
kann man auf der Weltbühne gemeinsam sehr viel mehr erreichen, als<br />
wenn sich jeder im Bereich der Außenpolitik allein abmüht. Bis<br />
Europa aber mit einer Stimme spricht, wird es wohl noch ein weiter<br />
Weg sein.<br />
9<br />
Vgl. Moravcsik 1995.<br />
10<br />
Wie z.B. die USA, Deutschland oder die Schweiz.<br />
258<br />
Harbo
Zugehörigkeit zur Union<br />
Artikel 58-60<br />
Und wer die Spielregeln nicht beachtet? – Der „Aussetzungsartikel“<br />
Was passiert, wenn ein neues Mitglied der Union beigetreten ist? Es<br />
kommt nicht nur auf den ersten Schritt an. Das neue Mitglied muss auch<br />
weiterhin alle Regeln und Werte der EU beachten und respektieren.<br />
Wenn ein Mitglied eine schwere Verletzung der EU-Rechte begangen<br />
hat, so muss es dafür die Verantwortung übernehmen und entweder<br />
seine eigene Haltung korrigieren oder aber den „EU-Club“ schlicht und<br />
einfach wieder verlassen, um den verfassungstreuen Mitgliedern ihr<br />
eigenes Festhalten an der Verfassung weiterhin zu ermöglichen.<br />
Bis jetzt war alles in der EU viel einfacher: Die Mitgliedstaaten konnten<br />
die Werte verletzen, ohne die Folgen beachten zu müssen. Natürlich<br />
gab es Kritik, aber kein Mitglied musste die EU verlassen. So haben<br />
z.B. nach dem Wahlerfolg Jörg Haiders und seiner Partei in Österreich<br />
die EU-Mitgliedstaaten sehr kritische Stellungnahmen abgegeben. Auch<br />
als Jean-Marie Le Pen kurz vor einem Wahlsieg stand, unterstützten<br />
viele Europäer den Protest der französischen Bürger gegen ihn. Heute,<br />
da es so offensichtlich geworden ist, dass Silvio Berlusconi sich nicht<br />
unbedingt immer an demokratische Grundsätze hält, bleibt er trotzdem<br />
noch an der Macht und Italien Mitglied der EU. Alle diese Beispiele zeigen<br />
letztlich die Unfähigkeit der EU, ihre Mitglieder zu kontrollieren.<br />
Mit dem neuen Artikel wird es anders: Die Mitglieder werden sich verpflichtet<br />
fühlen, Regeln und Werte zu beachten, ihre Fehler zu korrigieren<br />
oder die EU freiwillig zu verlassen. Wenn ein Mitgliedstaat sich mit<br />
dem Ausschluss bedroht sieht, kann er dem zuvorkommen und freiwillig<br />
austreten.<br />
Ein erster Schritt weg von einem Bundesstaat – Der „Austrittsartikel“<br />
Artikel 60, der diesen freiwilligen Austritt aus der Union ermöglicht, ist<br />
für die Befürworter der Integration ein Schritt weg vom Projekt einer<br />
föderalen Union. Obwohl dieser Artikel während des Konvents sehr kontrovers<br />
diskutiert wurde (besonders die Deutschen, Niederländer und<br />
Polen waren sehr skeptisch), wurde er doch angenommen. 11 Das Recht<br />
zum Austritt ist das signifikante Kriterium, das einen Staatenbund von<br />
einem Bundesstaat unterscheidet. Anders als Staatenbünde erlauben Bundesstaaten<br />
per definitionem keinen Austritt. „… das Sezessionsrecht [ist]<br />
den Gliedern des ... Bundesstaates absolut verboten”. 12 Allerdings gab es<br />
11<br />
Vgl. Reuters, 25. April 2003.<br />
12<br />
Vgl. Jellinek 1882/1969, 298.<br />
Harbo<br />
259
Artikel 58-60<br />
Zugehörigkeit zur Union<br />
Ausnahmen: Die Bundesstaaten UdSSR, Jugoslawien, St. Kitts-Nevis und<br />
Malaysia sahen das Recht des einseitigen Austritts vor. Heute ist Äthiopien<br />
der einzige Bundesstaat, dessen Verfassung ein Austrittsrecht enthält.<br />
Es gab aber auch Staatenbünde, die das Austrittsrecht ausdrücklich ausschlossen:<br />
zum Beispiel den Deutschen Bund (1815–1866), die Amerikanische<br />
Articles of Confederation (1777–1787) und die konföderierten<br />
Staaten von Amerika („Südstaaten“) (1861–1865). Somit wäre nichts<br />
gegen den „Austrittsartikel“ in der Europäischen Verfassung zu sagen –<br />
die Union wäre einfach nur eine weitere Ausnahme. Allerdings sprechen<br />
mindestens drei Gründe gegen die Schaffung eines Austrittsrechts 13 :<br />
• Erstens könnte ein solches Recht das ganze System erheblich<br />
schwächen, da die Regierungen der Mitgliedstaaten diese Option<br />
eventuell nutzen könnten, um politischen, die Union destabilisierenden<br />
Druck auszuüben.<br />
• Zweitens würde eine solche Austrittsmöglichkeit zusätzliche Unsicherheiten<br />
für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und<br />
schließlich auch für die Einheit der Union schaffen.<br />
• Drittens könnte es negative Konsequenzen für die fundamentalen<br />
Prinzipien der Kooperation und der Bundestreue in einem Bundesstaat<br />
mit sich bringen. Denn wenn ein Staat austreten möchte,<br />
nimmt er seine föderalen Verpflichtungen nicht mehr wahr. Dies<br />
könnte dazu führen, dass auch die anderen Ebenen ihr Vertrauen in<br />
den Bundesstaat verlieren und sich somit die „föderale Loyalität“<br />
zwischen den Ebenen auflöst.<br />
Wenn die Regierung eines Mitgliedstaates das Recht hat, den Bundesstaat<br />
zu verlassen oder umgekehrt die Regierung der supranationalen<br />
Ebene das Recht hat, einen Mitgliedstaat aus der Union einseitig auszuschließen,<br />
dann sind alle voneinander verfassungsmäßig abhängig. Trotz<br />
einer solchen Abhängigkeit kann es dennoch zu einem Austritt kommen,<br />
ob er nun rechtlich vorgesehen ist oder nicht. Im letzteren Fall hat ein<br />
Austritt dann einen so genannten extra-verfassungsrechtlichen Charakter.<br />
Er kommt nämlich durch politischen Druck zustande. Somit wird klar,<br />
dass die EU so lange nicht zu einem „echten“ Bundesstaat werden kann,<br />
solange das neu geschaffene Austrittsrecht nicht wieder abgeschafft wird.<br />
Der Verzicht auf den Austritt kommt vor dem Föderalismus. 14 Solange<br />
13<br />
Vgl. Watts 1999 und Buchanan 1991.<br />
14<br />
Vgl. Preuss 1997, 24.<br />
260<br />
Harbo
Zugehörigkeit zur Union<br />
Artikel 58-60<br />
die Austrittsmöglichkeit besteht, bleiben die Mitgliedstaaten souverän<br />
und die EU hat keine „Kompetenz-Kompetenz“.<br />
Obwohl es in den bisherigen Verträgen keinen „Austrittsartikel“ gibt,<br />
hat die EU schon einen Austritt erlebt: Grönland hat als Teil Dänemarks<br />
zwölf Jahre lang der Gemeinschaft angehört. Mit Erlangung der Autonomie<br />
entschied es sich jedoch gegen einen Verbleib und trat aus der<br />
Union 1985 aus. Dies ist ein Beispiel dafür, dass die EU weder die<br />
Autorität besitzt noch über die Macht verfügt, einen Austritt zu verhindern.<br />
15 Auf der anderen Seite könnte das Recht zum Austritt aber auch<br />
als ein demokratisches Recht betrachtet werden: Ein Staat hat die Möglichkeit,<br />
freiwillig der EU beizutreten. Er sollte deshalb auch über die<br />
Möglichkeit verfügen, die EU zu verlassen, wenn die Bürger es so wollen.<br />
Valéry Giscard d’Estaing hat die Aufnahme des Austrittsrechts in<br />
die Verfassung deshalb auch als einen notwendigen Schritt interpretiert.<br />
Seiner Ansicht nach ist es die Antwort auf die Vorwürfe, das Erscheinungsbild<br />
der EU sei ein „antidemokratischer, ja fast diabolischer<br />
Zwang“ 16 , dem die Bürger nicht entfliehen könnten. Doch diese Prämisse,<br />
dass eine notwendige Verbindung zwischen freier Eintritts- und<br />
Austrittsoption herzustellen sei, trifft nicht zu, da ohne Zustimmung<br />
aller Vertragspartner kein Beitritt erfolgen kann. Die Zuerkennung<br />
eines einseitigen Austrittsrechts verhält sich damit asymmetrisch zum<br />
Beitrittsverfahren. 17 Die Drohung mit dem Austritt stellt deshalb vor<br />
allem ein Instrument dar um sicherzustellen, dass die Zentralgewalt<br />
ihre Politik auf jene Maßnahmen beschränkt, die dem Interesse der Bürger<br />
dienen. Für die EU bedeutet dies, dass sie sich mit ihrer Politik<br />
möglichst nicht zu weit von den Interessen der Bürger und der Staaten<br />
entfernen sollte. Denn sind diese unzufrieden, könnten sie ohne weiteres<br />
aus der Gemeinschaft austreten. Und das kann nicht im Interesse der<br />
Union liegen. Damit ist der „Austrittsartikel“ letztlich auch ein Instrument<br />
der Mitgliedstaaten, den Gestaltungswillen der Union einzudämmen.<br />
Verhindern könnte die Union einen Austritt aber letztlich nicht.<br />
Ein Staat kann diesen Artikel als „legitime“ Drohung benutzen, anders<br />
als die „illegitime“ Politik des „leeren Stuhls“ Frankreichs im Jahre<br />
1960. Das in der Verfassung festgelegte Verfahren zwingt einen aus-<br />
15<br />
Obwohl Frey schreibt: „Eine Sezession würde aber der EU großen Schaden zufügen und riesige<br />
Kosten verursachen, weil dafür keine Verfahrensregeln vorgesehen sind.“ Vgl. Frey 1997.<br />
16<br />
Giscard d’Estaing 2003, 74.<br />
17<br />
Vgl. Bruha/Nowak 2004, 23.<br />
Harbo<br />
261
Artikel 58-60<br />
Zugehörigkeit zur Union<br />
trittswilligen Staat allerdings dazu, den Austritt noch einmal genauer zu<br />
überdenken und zu klären, ob er wirklich die richtige Entscheidung<br />
trifft. Trotzdem stellt dieser Artikel die ganze politische Zukunft der EU<br />
in Frage.<br />
Fazit<br />
Die EU hat immer eine gewisse Attraktivität auf andere Länder ausgeübt,<br />
auch in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten.<br />
Ihre Entwicklung ist deshalb durch ständige Erweiterung geprägt. Im<br />
Laufe der Jahrzehnte wuchs sie von sechs auf 25 Mitglieder an, drei<br />
weitere warten vor der Tür und es wird bereits diskutiert, wer danach<br />
kommt. Auch wenn die Beitrittskriterien schwer zu erfüllen sind, wird<br />
die EU trotzdem attraktiv bleiben. Doch irgendwann wird Schluss sein<br />
müssen; die Aufnahmefähigkeit der Union wird erschöpft sein. Denn<br />
bei zu vielen Mitgliedern könnte die Integration in Desintegration<br />
umschlagen. Wann es aber so weit ist, bleibt vorerst offen. Auch die<br />
Verfassung legt keine geographischen oder politischen Grenzen fest.<br />
Die Frage, wann die EU zu groß ist, wird demnach eine politische Entscheidung<br />
der Mitgliedstaaten sein.<br />
Bei einer Umsetzung der Verfassung werden die Mitglieder mehr darauf<br />
achten müssen, die Regeln und Werte der EU wirklich zu respektieren.<br />
Denn eine Aussetzung ihrer Rechte ist jetzt prinzipiell möglich. Gleichzeitig<br />
existiert nun aber auch die Möglichkeit eines freiwilligen Austritts<br />
aus der Union. Sie kann ein Ausweg für diejenigen sein, die Zweifel<br />
an der Richtigkeit ihrer EU-Mitgliedschaft bekommen. Und sie ist<br />
ein Druckmittel gegen die Union: Sollte diese beispielsweise ihre Grenzen<br />
überschreiten oder sollte ihr Demokratiedefizit weiter wachsen,<br />
können Mitgliedstaaten mit dem Austritt drohen und die Union auf<br />
diese Weise wieder auf den „richtigen“ Weg zwingen.<br />
Die Europäische Union wird auch weiterhin nach der Logik eines offenen<br />
Prozesses funktionieren. Auch mit einer Verfassung ist also die viel<br />
beschworene Finalität der EU noch immer nicht erreicht. Der Integrationsprozess<br />
war immer eine Reise mit einem bestimmten Abreisepunkt,<br />
aber ohne Ankunftsziel. Er bleibt es auch weiterhin. Erst die Zukunft<br />
wird zeigen, welchen Weg die EU wählen wird: Erfolg oder Misserfolg,<br />
Integration oder Desintegration. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne;<br />
wie das „Ende“ aussieht, wird sich erst noch zeigen müssen.<br />
262<br />
Harbo
Zugehörigkeit zur Union<br />
Artikel 58-60<br />
Literatur: Barthalay, Bernard (1999): Nous citoyens des Etats d’Europe – Paris. Bruha, Thomas/Nowak,<br />
Carsten (2004): Recht auf Austritt aus der Europäischen Union? Anmerkungen zu<br />
Artikel I-59 des Entwurfs eines Vertrages über eine Verfassung für Europa, in: Archiv des<br />
Völkerrechts, H. 1, S. 1–25. Buchanan, Allen (1991): Secession. The Morality of Political<br />
Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec – Oxford. Davies, Norman (1997): Europe.<br />
A History – Pimlico (USA). Frey, Bruno S. (1997): Ein neuer Föderalismus für Europa: die<br />
Idee der FOCJ – Tübingen. Giscard d’Estaing, Valéry (2003): La Constitution pour l’Europe<br />
(Fondation Robert Schuman) – Paris. Grosser, Alfred (1996): Les identités difficiles – Paris.<br />
Jellinek, Georg (1882/1969): Die Lehre von den Staatenverbindungen, 2. Auflage – Aalen. <br />
Marschall, Christoph von (2002): Die Türkei als Wette auf die Zukunft, in: Der Tagesspiegel<br />
vom 24.11.2002. Moravcsik, Andrew (1995): Explaining International Human Rights Regimes:<br />
Liberal Theory and Western Europe, in: European Journal of International Relations, H. 1,<br />
S. 157–189. Preuss, Ulrich K. (1997): Federalism in Pluralistic Societies: Between Secession<br />
and Centralisation, in: The Good Society, Committee on the Political Economy of the Good<br />
Society, H. 1, S. 22–25. Watts, Ronald L. (1999): Comparing federal systems – Ontario.<br />
Harbo<br />
263
KOMMENTAR<br />
Teil II<br />
Die Charta der Grundrechte der Union
Georg Kristian Kampfer<br />
266 Kampfer<br />
PRÄAMBEL<br />
Die Präambel der Grundrechtecharta hat sieben Absätze mit unterschiedlicher<br />
Länge. Der erste Absatz ist die Einleitung der Präambel. Sie bekräftigt, dass die<br />
„Völker Europas“ den Frieden in Europa sichern werden, indem sie immer<br />
enger in der Europäischen Union zusammenrücken. Was die Völker vereine,<br />
seien vor allem ihre gemeinsamen europäischen Werte.<br />
Der zweite Absatz benennt die vier europäischen Grundwerte:<br />
1. Würde des Menschen<br />
2. Freiheit<br />
3. Gleichheit<br />
4. Solidarität<br />
Als Grundlage der Europäischen Union bezeichnet der zweite Absatz zudem<br />
die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Die Union sei ein demokratischer<br />
„Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, in dessen Mittelpunkt der<br />
Unionsbürger stehe.<br />
Im dritten Absatz gibt die Europäische Union zu erkennen, dass sie die Vielfalt<br />
Europas – die unterschiedlichen Traditionen und Kulturen – achte. Sie greife<br />
zudem nicht in die Organisation der Staatsgewalt ein, weder auf nationaler<br />
noch auf regionaler oder lokaler Ebene. Vielmehr sei sie Garant für vier europäische<br />
Grundfreiheiten: die Personen-, die Dienstleistungs-, die Waren- und<br />
Kapitalverkehrs- sowie die Niederlassungsfreiheit.<br />
Der Sinn und Zweck der Grundrechtecharta wird in Absatz vier genannt: die<br />
Grundrechte des Bürgers zu stärken.<br />
Absatz fünf wendet sich an all jene Richter, welche die Charta bei der Prüfung<br />
eines Grundrechtsverstoßes deuten müssen. Der Absatz verweist darauf, dass<br />
zu ihrer Arbeitserleichterung am Ende der Verfassung Erläuterungen 1 angefügt<br />
sind.<br />
Der sechste Abschnitt weist ganz allgemein auf die Verantwortung und die<br />
Pflichten des Unionsbürgers gegenüber seinen Mitmenschen, den Rechtskreis<br />
der Gemeinschaft und das Leben künftiger Generationen hin.<br />
Der siebte Abschnitt enthält das klare Bekenntnis der Europäischen Union zu<br />
den Rechten, Freiheiten und Grundsätzen der Charta.<br />
1<br />
Von einem Abdruck der „12. Erklärung betreffend der Erläuterungen zur Charta der Grundrechte“<br />
wurde hier abgesehen.
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Präambel<br />
Eine Einführung in die Welt der Grundrechte<br />
Mit der Präambel der „Charta der Grundrechte der Union“, auch<br />
Grundrechtecharta genannt, ziert eine zweite Präambel die Europäische<br />
Verfassung, denn bereits der „Aufmacher“ der Europäischen Verfassung<br />
kam als Präambel daher. Während der „Aufmacher“ aber ein Produkt<br />
des Verfassungskonvents aus den Jahren 2002 bis 2003 war, wurde die<br />
Präambel der Grundrechtecharta von einem anderen Konvent, dem<br />
Grundrechte-Konvent, bereits in den Jahren 1999 bis 2000 erarbeitet.<br />
Während der Verfassungskonvent von dem ehemaligen französischen<br />
Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing geleitet wurde, hatte in dem<br />
Grundrechte-Konvent der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman<br />
Herzog den Vorsitz. Auch bei der Grundrechtecharta wird deutlich, wie<br />
stark ein Vorsitzender inhaltlich Einfluss nehmen kann. So heißt es beispielsweise<br />
bereits zu Beginn der Grundrechtecharta wortgleich mit<br />
Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist<br />
unantastbar.“ Schon der Anstoß zur Ausarbeitung einer Grundrechte-<br />
Charta war aus Deutschland gekommen, denn Bundeskanzler Gerhard<br />
Schröder hatte in seiner Eigenschaft als Präsident des Europäischen<br />
Rates den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs einen entsprechenden<br />
Vorschlag gemacht. So wurde bei dem Gipfeltreffen in<br />
Köln im Juni 1999 der Grundrechte-Konvent eingesetzt, dessen<br />
Ergebnis „die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre<br />
Tragweite für die Unionsbürger“ 2 sichtbar machen sollte.<br />
Während im Verfassungskonvent über 100 Mitglieder versammelt<br />
waren, bestand der Grundrechte-Konvent als erster Konvent in der<br />
Geschichte der Europäischen Union nur aus 62 Delegierten. Bereits im<br />
Grundrechte-Konvent besaßen die Parlamentarier die klare Mehrheit.<br />
16 Abgeordnete aus dem Europaparlament und 30 aus nationalen<br />
Parlamenten tagten gemeinsam mit 15 nationalen Regierungsvertretern<br />
sowie dem damaligen EU-Kommissar für Justiz und Inneres, Antonio<br />
Vitorino. Der Thüringer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten,<br />
Jürgen Gnauck, vertrat bei den Konventstagungen den Bundesrat<br />
und Professor Jürgen Meyer – wie später auch im Verfassungskonvent –<br />
den Bundestag. Verglichen mit der Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungskonvents<br />
nutzte der Grundrechte-Konvent das Internet und die<br />
Möglichkeiten der Diskussion mit „der Zivilgesellschaft“ noch recht<br />
2<br />
Vgl. die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Köln vom Juni 1999.<br />
Kampfer 267
Präambel<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
zaghaft. Er entwickelte jedoch bereits viele Ideen zur Einbeziehung der<br />
Öffentlichkeit, auf die einige Jahre später bei der Arbeit an der gesamten<br />
Europäischen Verfassung zurückgegriffen werden konnte.<br />
Am 7. Dezember 2000 wurde die Grundrechtecharta schließlich von den<br />
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Ministerrats und dem<br />
Ministerrat und der Kommission feierlich verkündet. 3 Da sie hierdurch<br />
allein aber noch nicht rechtswirksam wurde, war es „ein wichtiges deutsches<br />
Anliegen“ 4 , die Charta in die Europäische Verfassung aufzunehmen.<br />
„Jede Bürgerin, jeder Bürger Europas spürt es: In ungeahntem Tempo<br />
entwickelt sich ein neues Europa. [...] Keinesfalls darf sich aber Europa<br />
nur auf einen gemeinsamen Markt beschränken lassen. Denn die EU ist<br />
doch vor allem ein politisches Friedensprojekt.“ 5<br />
Die Bedeutung der Grundrechte in der Europäischen Verfassung wird<br />
deutlich, wenn man die fortschreitende Übertragung von Aufgaben von<br />
der nationalen auf die europäische Ebene bedenkt. 6 Schon heute benötigen<br />
die Bürger in Deutschland nicht nur verfassungsmäßigen Rechtsschutz<br />
gegenüber dem Handeln des deutschen Staates 7 , sondern auch<br />
wenn Organe, Einrichtungen und sonstige Dienststellen der Union tätig<br />
werden. Hiervor und auch vor unrechtmäßigem Handeln des deutschen<br />
Staates bei der Ausführung europäischen Rechts schützen die neuen<br />
Grundrechte. 8<br />
Die tatsächliche Reichweite des Grundrechtsschutzes wird die richterliche<br />
Praxis zeigen. Die zahlreichen Neuerungen lassen aber schon<br />
heute weitreichende Konsequenzen erwarten. So sind neben den klassischen<br />
Menschen- und Bürgerrechten auch soziale Grundrechte aufgeführt<br />
wie die Berufsfreiheit und das Recht zu arbeiten. Neue Bestimmungen<br />
wie das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst<br />
oder das Verbot reproduktiven Klonens kommen konkret<br />
und modern daher. 9<br />
3<br />
Zur Geschichte des Grundrechte-Konvents vgl. Bossi 2001 und Knelangen/Varwick 2000.<br />
4<br />
Bundesrat, Drucksache 983/04, 231.<br />
5<br />
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas 2001, 5.<br />
6<br />
Vgl. Kaufmann 2001, 7.<br />
7<br />
Grundrechte sind „Abwehrrechte gegenüber dem Staat“.<br />
8<br />
Vgl. Artikel 111.<br />
9<br />
Vgl. auch Hohmann 2000, 7.<br />
268 Kampfer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Präambel<br />
Vorausblickend und vorbeugend sind die Grundrechte formuliert, denn<br />
sie schützen mit ihren Bestimmungen den Unionsbürger sogar in<br />
Bereichen, in denen die Europäische Union (noch) kein Recht zum<br />
Handeln besitzt. So findet man zum Beispiel strafrechtliche Grundsätze<br />
wie die Gesetz- und Verhältnismäßigkeit bei Straftaten oder das Verbot<br />
der Doppelbestrafung. Diese Vorschriften leben auf, sobald der<br />
Aufgabenbereich der Europäischen Union auch die Strafverfolgung<br />
umfasst. 10 Die sieben Titel der Grundrechtecharta sind ihre genaue Betrachtung<br />
daher wert. Sie lauten: I. Würde des Menschen, II. Freiheiten,<br />
III. Gleichheit, IV. Solidarität, V. Bürgerrechte, VI. Justizielle Rechte<br />
und VII. Allgemeine Bestimmungen über die Auslegung und<br />
Anwendung der Charta. In Kraft treten sie frühestens im Januar 2007,<br />
vorausgesetzt bis dahin haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen<br />
Union die Europäische Verfassung angenommen.<br />
Literatur: Bossi, Tania (2001): Die Grundrechtecharta – Wertekanon für die Europäische Union,<br />
in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Nizza in der Analyse – Gütersloh, S. 203–242. Fraktion der<br />
Sozialdemokratischen Partei Europas (2001): Charta der Grundrechte der Europäischen Union.<br />
Eine Charta – wozu? – Brüssel. Hohmann, Harald (2000): Die Charta der Grundrechte der EU,<br />
in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Jg. 50, B 52–53,<br />
S. 5–12. Kaufmann, Sylvia-Yvonne (2001): Vorwort, in: dieselb. (Hrsg.): Grundrechtecharta der<br />
Europäischen Union – Bonn, S. 7–15. Knelangen, Wilhelm/Varwick, Johannes (2000): Die<br />
Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Grundrechtslyrik oder Signalwirkung?, in:<br />
Gegenwartskunde, Jg. 49, H. 4, S. 467–471. Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2001): Nizza in der<br />
Analyse – Gütersloh.<br />
10<br />
Vgl. ebd.<br />
Kampfer 269
Ann-Kathrin Fischer<br />
Titel I<br />
WÜRDE DES MENSCHEN<br />
Artikel 61-65<br />
Am Anfang und damit gleichsam an der Spitze der Grundrechtshierarchie steht<br />
die unveräußerliche und unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen. Die<br />
Union muss die Menschenwürde zum einen achten, darf sie also nicht einschränken.<br />
Zum anderen muss sie sie schützen, also eingreifen, wenn sie von<br />
Seiten Dritter, das heißt beispielsweise von anderen Menschen oder Staaten,<br />
verletzt wird (Artikel 61).<br />
Besonders eng mit der Menschenwürde verknüpft sind das Recht jedes<br />
Menschen auf Leben, das Verbot der Todesstrafe (Artikel 62) und das Recht auf<br />
Unversehrtheit (Artikel 63). Letzteres beinhaltet, dass jeder Mensch vor allen<br />
Einwirkungen geschützt werden muss, die seine körperliche oder geistige<br />
Gesundheit beeinträchtigen könnten. Angesichts der rasanten wissenschaftlichen<br />
Fortschritte hat der Grundrechte-Konvent zusätzlich genauere Details<br />
für den Bereich der Medizin und Biologie festgelegt. So muss jeder Mensch<br />
medizinischen Eingriffen ausdrücklich zustimmen, mit denen sein Recht auf<br />
Unversehrtheit verletzt werden könnte. Darüber hinaus werden staatliche eugenische<br />
Praktiken, insbesondere die zur Selektion von Menschen 1 sowie der<br />
Handel mit dem menschlichen Körper oder Körperteilen (Organhandel) und<br />
das Klonen zu Zwecken der Fortpflanzung (reproduktives Klonen) 2 verboten.<br />
Nach Artikel 64 gilt in der Union ein Folterverbot und für Verletzungen der<br />
Menschenwürde unterhalb der Schwelle der Folter das Verbot der unmenschlichen<br />
oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe. Dieses soll zum Beispiel<br />
die Prügelstrafe in der Schule oder unmenschliche Haftbedingungen wie Lichtoder<br />
Essensentzug verhindern. Die Grundrechtecharta verbiete zudem in<br />
Artikel 65 Sklaverei und Leibeigenschaft sowie Zwangs- und Pflichtarbeit.<br />
Abgerundet werden diese beiden Verbote in Absatz 3 durch das Verbot des<br />
Menschenhandels, das angesichts der Entwicklungen im Bereich der organisierten<br />
Kriminalität als neues „modernes“ Grundrecht in die Charta aufgenommen<br />
wurde.<br />
1<br />
Damit sind bspw. staatlich verordnete oder geduldete Sterilisierungskampagnen, erzwungene<br />
Schwangerschaften oder die Pflicht, einen Ehepartner aus der gleichen Volksgruppe zu wählen,<br />
gemeint. Nicht gemeint ist die „private“, also nicht von oben verordnete Selektion.<br />
Umstrittene Fragen im Zusammenhang mit Abtreibung und Präimplantationsdiagnostik sind<br />
damit von dem Verbot ausdrücklich ausgenommen. Vgl. Meyer 2004, 6.<br />
2<br />
Da sich dieses Verbot nur auf das reproduktive Klonen bezieht, bleibt es den Mitgliedstaaten<br />
selbst überlassen, ob sie das so genannte therapeutische Klonen, das im engen Zusammenhang<br />
mit der Forschung an embryonalen Stammzellen steht, verbieten oder unter bestimmten<br />
Voraussetzungen erlauben. Vgl. Borowsky in Meyer 2003, 105.<br />
270 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
Die Mutter aller Grundrechte<br />
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Wohl jedem Deutschen wird<br />
dieser Satz irgendwie bekannt vorkommen. Und wirklich: Der erste Satz in<br />
Artikel 61 der Grundrechtecharta entspricht haargenau dem ersten Satz<br />
in Artikel 1 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes 3 und ebenso wie dieser<br />
steht er am prominenten ersten Platz des Grundrechtskatalogs. Dies signalisiert,<br />
dass die Menschenwürde unbestritten der oberste Wert in der<br />
Europäischen Union ist 4 und damit das Fundament bildet, auf dem alle folgenden<br />
Grundrechte aufbauen. Diese sind alle Ableitungen oder<br />
Konkretisierungen des „Muttergrundrechts“ und dürfen weder so ausgelegt<br />
noch so angewandt werden, dass sie die Menschenwürde verletzen.<br />
In der heutigen pluralistischen Zeit, in der kein einheitliches Welt- und<br />
Menschenbild mehr existiert und die infolgedessen von einer schier<br />
ungeheuren Zahl an religiösen, weltanschaulichen und sittlichen Wertvorstellungen<br />
geprägt ist, stellt die Menschenwürde einen wichtigen<br />
Orientierungspunkt dar: Sie ist der gemeinsame Nenner, auf den sich<br />
der für das gesellschaftliche Zusammenleben notwendige Grundkonsens<br />
gründet. 5 Würde kommt jedem Menschen gleichermaßen zu.<br />
Man muss dafür keine Leistungen erbringen oder bestimmte Kriterien<br />
erfüllen. Man kann sie weder teilen noch abgeben oder verlieren. Das<br />
bedeutet, dass die Menschenwürde unter keinen Umständen durch die<br />
Organe der EU eingeschränkt werden darf, wie es zum Teil bei anderen<br />
Grundrechten der Charta möglich ist. 6<br />
Allerdings endet die Würde des einen Menschen dort, wo die Würde des<br />
anderen beginnt. Spricht man beispielsweise dem Embryo ein Recht auf<br />
Achtung seiner Würde zu, darf nicht vergessen werden, dass auch der<br />
schwangeren Frau dasselbe Recht zusteht. Wenn also das Leben der Frau<br />
durch die Schwangerschaft gefährdet ist, darf dann eine Abtreibung vor-<br />
3<br />
Allerdings unterscheidet sich der zweite Satz ein wenig vom deutschen Vorbild, da das<br />
Grundrecht aus dem expliziten staatlichen Kontext gelöst wurde. In der Europäischen<br />
Verfassung heißt es: „Sie ist zu achten und zu schützen.“, im Grundgesetz hingegen: „Sie zu<br />
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“<br />
4<br />
Dies spiegelt sich auch an anderen Stellen der Verfassung wider. So steht die Menschenwürde<br />
in der Liste der Werte in Artikel 2 und in der Präambel zur Grundrechtecharta auch an erster<br />
Stelle.<br />
5<br />
Vgl. Reiter 2004, 6.<br />
6<br />
Für das Grundrecht der Menschwürde gelten damit nicht die Schranken des Artikel 112<br />
Absatz 1.<br />
Fischer 271
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
genommen und das Leben des Embryos beendet werden? Wie solch eine<br />
„Grundrechtskollision“ letztlich zu lösen ist, lässt die Grundrechtecharta<br />
offen. Zwar gab es im Grundrechte-Konvent intensive Debatten über den<br />
Beginn des menschlichen Lebens, Sterbehilfe und Klonverbot. Doch entschied<br />
man sich angesichts der vielfältigen Kulturen und Traditionen in<br />
den Mitgliedstaaten gegen abschließende Antworten. Die Charta verbietet<br />
reproduktives Klonen, alle anderen Formen des Klonens werden von<br />
ihr weder gestattet noch verboten. Die Charta-Rechte stellen damit lediglich<br />
einen Mindestschutz dar, der ohne weiteres durch das nationale Recht<br />
ausgeweitet werden kann. Deshalb kann es in Irland weiterhin bei einem<br />
nahezu ausnahmslosen Abtreibungsverbot und in den Niederlanden bei<br />
einer großzügigen Sterbehilfegesetzgebung bleiben, in Deutschland das<br />
Klonen von Embryonen zu therapeutischen Zwecken verboten, in Großbritannien<br />
hingegen erlaubt sein. 7 Jedoch werden die sich daraus ergebenden<br />
Spannungen im Zusammenhang mit Fragen der Forschungsförderung<br />
in der Europäischen Union mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf den<br />
Tisch kommen, zum Beispiel bei der Frage, ob die EU Forschungsvorhaben<br />
fördern darf, bei denen embryonale Stammzellen verwendet werden.<br />
Man mag kritisieren, dass sich der Grundrechte-Konvent gerade bei diesen<br />
besonders schwierigen Fragen um endgültige Antworten „gedrückt“<br />
hat. Doch auch wenn in Europa viele Werte geteilt werden, stößt die europäische<br />
Wertegemeinschaft in diesem sensiblen Bereich an ihre Grenzen.<br />
Der Grundrechte-Konvent hat deshalb richtig daran getan, die Wertediskussion<br />
in die Mitgliedstaaten zurückzuverlagern und auf diese Weise<br />
der in der Präambel zur Grundrechtecharta enthaltenen Verpflichtung zur<br />
Achtung der nationalen Identität Rechnung getragen. Ein nicht unerheblicher,<br />
sehr innovativer Mindestschutz ist auf europäischer Ebene trotzdem<br />
gegeben und dieser zudem „zukunftsoffen“ formuliert, da die in Artikel<br />
2 Absatz 2 aufgelisteten Gebote und Verbote im Bereich der Biomedizin<br />
lediglich als Beispiele anzusehen sind. 8 Auch wenn es nicht ausdrücklich<br />
erwähnt wird, stellt die Kreuzung von Menschen und Tieren<br />
eine gravierende Verletzung der Menschenwürde dar und ist deshalb verboten.<br />
Gleiches gilt für weitere Auswüchse, die der Fortschritt in der<br />
Biotechnologie noch möglich machen könnte.<br />
7<br />
Vgl. Meyer 2004, 6 f.<br />
8<br />
Vgl. Borowsky in Meyer 2003, 103 f.<br />
272 Fischer
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Gravierende Menschenrechtsverletzungen in Konzentrationslagern und<br />
während der Kolonialkriege vor Augen, herrschte bei den Mitgliedern des<br />
Grundrechte-Konvents über die besondere Bedeutung der Menschenwürde<br />
von vornherein Einigkeit. Uneinig war man sich hingegen darüber,<br />
ob die Menschenwürde überhaupt „Grundrechtsqualität“ besitzt und als<br />
ein eigenständiges Grundrecht angesehen werden kann oder ob sie nur als<br />
Grundsatz in die Präambel gehört. Die neunmonatige Diskussion drehte<br />
sich deshalb vor allem um die Formulierung, den Rang und die Funktion<br />
der Menschenwürde.<br />
Was für die deutschen Konventsmitglieder ganz selbstverständlich war,<br />
erschien vielen anderen als etwas völlig Neues. Denn Deutschland ist<br />
bislang das einzige EU-Mitgliedsland, in dem die Menschenwürde echten<br />
Grundrechtscharakter hat, also für sich alleine steht und für jeden direkt<br />
einklagbar ist. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass die anderen<br />
EU-Länder die Menschenwürde nicht anerkennen würden. Nur taucht sie<br />
in den dortigen Verfassungen nicht als gesondertes Grundrecht auf, sondern<br />
findet sich in den geschriebenen und ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen<br />
sowie indirekt in konkreteren Grundrechten wieder. So<br />
äußert sie sich beispielsweise im Verbot der Todesstrafe, dem Folterverbot<br />
oder auch dem Gebot würdiger Arbeits- und Lebensbedingungen.<br />
Auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), an der<br />
sich der Grundrechte-Konvent bei seiner Arbeit stark orientierte 9 , oder<br />
dem bisherigen EU-Vertragswerk wird die Menschenwürde nicht gesondert<br />
aufgeführt. Es ist deshalb vor allem den deutschen Vertretern im<br />
Grundrechte-Konvent zu verdanken, dass Neuland betreten wurde und die<br />
Würde des Menschen nun als „echtes Grundrecht“ in der Verfassung<br />
steht. 10<br />
9<br />
Neben der EMRK und deren Zusatzprotokollen dienten auch andere Menschenrechtsabkommen,<br />
die Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten sowie die Rechtsprechung des EuGH und<br />
bereits vorhandene Regelungen im Gemeinschaftsrecht dem Grundrechte-Konvent als Rechtsquellen.<br />
Vgl. Schmitz 2001, 834.<br />
10<br />
Vgl. hierzu ausführlich Borowsky in Meyer 2003, 47 ff.<br />
Fischer 273
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Titel II<br />
FREIHEITEN<br />
Artikel 66-79<br />
Mit dem Recht auf Freiheit und Sicherheit findet sich eine der ältesten Menschenrechtsgarantien<br />
am Anfang der Liste der Freiheitsrechte. Sie gewährleistet<br />
die körperliche <strong>Bewegung</strong>sfreiheit und schützt vor willkürlicher Verhaftung<br />
(Artikel 66). Des Weiteren wird die Union zur Achtung des Privat- und Familienlebens<br />
verpflichtet. Danach sind Eingriffe in die Privatsphäre, das bedeutet<br />
auch in die Wohnung und die private Kommunikation, zu unterlassen (Artikel<br />
67). Eng mit diesem Recht verbunden ist das Datenschutzrecht, das persönliche<br />
Daten schützt und eine Reihe von Bedingungen an deren Verarbeitung knüpft<br />
(Artikel 68). Das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, stellt<br />
sicher, dass jeder volljährige Mensch selbst entscheiden kann, ob, wann und<br />
wen 11 er heiraten und ob er Kinder haben möchte. Letzteres meint nicht nur die<br />
Freiheit zur Zeugung von Kindern, sondern umfasst auch das Recht, Kinder zu<br />
adoptieren oder als Stief- oder Pflegekinder anzunehmen (Artikel 69).<br />
Nach Artikel 70 sind Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in der<br />
Union garantiert. Dabei umfasst die Gewissensfreiheit explizit auch das Recht<br />
auf Wehrdienstverweigerung. Diese Freiheiten stehen in engem Zusammenhang<br />
mit der Freiheit auf Meinungsäußerung und Information, das heißt auch<br />
auf Pressefreiheit, sowie der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Artikel<br />
71 und 72). Artikel 73 sichert die Freiheit von Kunst und Wissenschaft zu. Das<br />
Recht auf Bildung garantiert unter anderem das vorrangige Erziehungsrecht der<br />
Eltern sowie den Zugang zu kostenlosem Schulunterricht, beruflicher Ausbildung<br />
und Weiterbildung (Artikel 74).<br />
Die Artikel 75 bis 77 enthalten wirtschaftliche Grundrechte. Danach hat jeder<br />
Mensch das Recht zu arbeiten, also seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen.<br />
Die gleichzeitig garantierte Berufsfreiheit ermöglicht es jedem, auch die Art<br />
sowie das „Wann“ und „Wo“ seiner Arbeit frei zu wählen. Was den Arbeitsort<br />
anbetrifft, so stehen den Unionsbürgern alle Arbeitsmärkte, auch die in anderen<br />
EU-Mitgliedstaaten, offen (Artikel 75). Eng mit diesem Artikel verbunden sind<br />
die unternehmerische Freiheit, also die Freiheit, ein Unternehmen zu gründen,<br />
zu führen und Verträge abzuschließen, sowie das Recht auf materielles und<br />
geistiges Eigentum (Artikel 76 und 77).<br />
Abgeschlossen wird das Kapitel durch zwei miteinander verzahnte Grundrechte:<br />
Zum einen wird ein Recht auf Asyl nach den Vorgaben des Genfer Flüchtlings-<br />
11<br />
Es gilt jedoch das Verbot der Eheschließung zwischen Verwandten in gerader Linie (z.B. zwischen<br />
Geschwistern) und das Verbot der „Mehrehe“. Vgl. Präsidium des Europäischen<br />
Konvents 2003, 13.<br />
274 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
abkommens gewährleistet (Artikel 78). Zum anderen gilt in der Union ein<br />
Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung. Damit sind Kollektivausweisungen<br />
verboten und darf beispielsweise niemand abgeschoben werden,<br />
dem in seinem Heimatland Todesstrafe oder Folter drohen (Artikel 79).<br />
Lückenhafte Freiheitsräume?<br />
Alle Menschen sind frei. Diese Annahme steht im Zentrum des westlichen<br />
politischen Denkens. Doch wo immer mehrere Menschen mit ihren unterschiedlichen<br />
Freiheitsbedürfnissen aufeinander treffen, werden Regeln notwendig,<br />
die bestimmen, wo die Freiheit des einen endet und die des anderen<br />
beginnt. Für das Festlegen dieser Regeln ist der Staat und auf europäischer<br />
Ebene die EU zuständig, die durch Gesetze die Freiheit des Einzelnen<br />
zum Wohle der Allgemeinheit einschränken. Allerdings gilt die Freiheit als<br />
derart hohes Rechtsgut, dass die Beschränkung einiger Freiheiten nur in<br />
ganz bestimmten Fällen zulässig ist. Diese Freiheitsrechte sind im<br />
Grundrechtsbestand aller EU-Mitgliedstaaten, in internationalen Menschenrechtsabkommen<br />
und nun auch in der europäischen Grundrechtecharta<br />
enthalten. Neben dem Recht auf Freiheit und Sicherheit sind dazu<br />
insbesondere das Recht auf Privatsphäre, die Gedanken-, Gewissens- und<br />
Religionsfreiheit, die Freiheit auf Meinungsäußerung sowie die<br />
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu zählen.<br />
Doch hat der Grundrechte-Konvent die Freiheitsrechte zum Teil modernisiert<br />
und sie neuen Entwicklungen und Wertvorstellungen angepasst. So<br />
spricht beispielsweise Artikel 67 („Achtung des Privat- und Familienlebens“)<br />
nicht von „Briefverkehr“ oder „Fernmeldegeheimnis“ 12 , sondern<br />
allgemeiner von „Kommunikation“. Dies trägt dem raschen Wandel der<br />
Mediengesellschaft Rechnung, der Kommunikation über Briefeschreiben<br />
und Telefonieren hinaus ermöglicht. Eng damit verknüpft ist das Recht auf<br />
Schutz personenbezogener Daten, das überhaupt zum ersten Mal in<br />
einem Grundrechtskatalog auftaucht und auf den bereits bestehenden Datenschutz<br />
der Union zurückgeht. 13 Grund für die Aufnahme in die Charta ist<br />
der technische Fortschritt, der zusehends die Erfassung und Verarbeitung<br />
von Daten erleichtert und es den Bürgern erschwert, sich vor deren<br />
12<br />
So bspw. die Begriffswahl in Artikel 8 EMRK und Artikel 10 GG.<br />
13<br />
Vgl. Richtlinie 95/46/EG vom 24.10.1995 („Datenschutz-Richtlinie“) und Richtlinie 97/66/EG<br />
vom 15.12.1997 („Telekommunikations-Richtlinie“).<br />
Fischer 275
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Missbrauch zu schützen. Neu ist auch 14 , dass der Zusammenhang zwischen<br />
Ehe und Familie aufgelöst wurde und somit „auch andere (nichteheliche)<br />
Lebens- und Erziehungsgemeinschaften als Grundlage einer Familie“<br />
15 anerkannt werden. Zudem wird die Ehe nicht als Recht von Frauen<br />
und Männern definiert. Artikel 69 lässt demnach die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher<br />
Partnerschaften zu, ohne freilich ein explizites Recht darauf<br />
zu garantieren, denn die Charta verweist hier auf die jeweiligen<br />
Bestimmungen der Mitgliedstaaten. Angesichts der Unterschiede zwischen<br />
den Mitgliedstaaten stellt diese Formulierung den kleinsten gemeinsamen<br />
Nenner dar, den der Grundrechte-Konvent finden konnte. Ähnlich verhält<br />
es sich mit dem Recht auf Wehrdienstverweigerung. Auch hier wird auf die<br />
nationalen Vorschriften verwiesen, denn die Union besitzt in diesem<br />
Bereich keine Kompetenzen. Doch könnte dieses Recht bei fortschreitender<br />
Herausbildung einer außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen<br />
Unionsidentität zunehmend an Bedeutung gewinnen. 16<br />
Liegt uns also ein „perfekter“ Katalog von Freiheitsrechten vor, an dem<br />
nichts auszusetzen ist? Dies trifft leider nicht zu, da es an einem so genannten<br />
Auffang-Grundrecht fehlt, das wie Artikel 2 Absatz 2 des deutschen<br />
Grundgesetzes jedem Menschen eine allgemeine Handlungsfreiheit<br />
zugesteht. Damit sind Aktivitäten, die nicht unter die in der Charta aufgelisteten<br />
Freiheitsrechte fallen, ungeschützt. Dies könnte für das<br />
Rauchen von Marihuana, das Reiten im Wald und das Taubenfüttern im<br />
Park zutreffen – um einige Beispiele aus der deutschen Rechtsprechung<br />
zu nennen. Auch das Grundrecht der Menschenwürde kann nicht als<br />
Ersatz für die allgemeine Handlungsfreiheit herhalten. 17 Die lückenhafte<br />
Freiheitsgewährleistung wird wohl nach Inkrafttreten der Verfassung<br />
dazu führen, dass die vorhandenen Freiheitsrechte von den Gerichten weit<br />
ausgelegt werden müssen. So ließe sich aus dem Recht auf Achtung des<br />
Privatlebens vielleicht ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit<br />
herleiten. Besser wäre jedoch eine Nachbesserung an dieser Stelle. Dies<br />
ist natürlich Zukunftsmusik. Doch da das Einfügen eines solchen Artikels<br />
nicht wirklich aufwändig wäre, könnte dies ja Gegenstand der ersten<br />
Reform der Europäischen Verfassung werden.<br />
14<br />
Insbesondere im Vergleich zu Artikel 12 EMRK.<br />
15<br />
Bernsdorff in Meyer 2003, 172.<br />
16<br />
Vgl. Philippi 2002, 22.<br />
17<br />
Vgl. Borowsky in Meyer 2003, 63 f.<br />
276 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
Titel III<br />
GLEICHHEIT<br />
Artikel 80-86<br />
Das dritte Kapitel der Grundrechtecharta beginnt mit dem allgemeinen Gleichheitssatz,<br />
der festlegt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Artikel<br />
80).<br />
Ergänzt wird er durch zwei Diskriminierungsverbote: Artikel 81 enthält ein<br />
umfassendes Diskriminierungsverbot, das es generell verbietet, Menschen aufgrund<br />
bestimmter Merkmale zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Absatz 1<br />
listet 17 beispielhafte Diskriminierungsmerkmale auf. So ist es unter anderem<br />
verboten, Menschen aufgrund ihres Vermögen, ihrer sexuellen Ausrichtung,<br />
ihrer sozialen Herkunft, genetischer Merkmale oder ihres Alters zu diskriminieren.<br />
Absatz 2 verbietet darüber hinaus eine Ungleichbehandlung aus<br />
Gründen der Staatsangehörigkeit. Artikel 83 formuliert explizit das Gebot der<br />
Gleichheit von Männern und Frauen in allen Bereichen des Lebens, lässt aber<br />
ausdrücklich Vergünstigungen, zum Beispiel Frauenquoten im öffentlichen<br />
Dienst, für das benachteiligte Geschlecht zu. 18<br />
Mit Artikel 82 wird die Union verpflichtet, die Vielfalt der Kulturen, Religionen<br />
und Sprachen zu achten – nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. 19<br />
Die letzten drei Artikel des Kapitels sind als soziale Grundrechte einzuordnen.<br />
Die Rechte des Kindes umfassen einen Anspruch auf Schutz und Fürsorge<br />
sowie ein Meinungsäußerungsrecht für Kinder. Öffentliche und private Einrichtungen<br />
müssen bei allen Angelegenheiten, die Kinder betreffen, deren Wohl<br />
vorrangig berücksichtigen. Zudem erhält jedes Kind Anspruch auf regelmäßigen<br />
persönlichen Kontakt zu beiden Elternteilen – vorausgesetzt sein Wohl ist<br />
dadurch nicht gefährdet (Artikel 84). Die Artikel 85 und 86 enthalten Rechte<br />
für ältere und für behinderte Menschen. Deren Recht auf ein würdiges und<br />
unabhängiges Leben sowie auf Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben muss<br />
von der Union anerkannt und geachtet werden. Darüber hinaus wird die Union<br />
verpflichtet, auch den Anspruch behinderter Menschen auf berufliche<br />
Integration zu berücksichtigen.<br />
18<br />
Vgl. Artikel 83 Absatz 2.<br />
19<br />
Vgl. Hölscheidt in Meyer 2003, 295.<br />
Fischer 277
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Ein Gleichheitskapitel mit Kompositionsfehlern<br />
In fast allen mitgliedstaatlichen Verfassungen findet sich der allgemeine<br />
Gleichheitssatz 20 ; wo nicht, wird die Gleichheit durch speziellere Garantien<br />
gewährleistet. Entsprechend unumstritten war die Aufnahme des Prinzips<br />
der Gleichheit vor dem Gesetz und der ergänzenden Diskriminierungsverbote<br />
im Grundrechte-Konvent. Die Diskussion drehte sich vielmehr um<br />
die Diskriminierungsmerkmale.<br />
Für Deutsche dürften insbesondere die Diskriminierungsverbote aufgrund<br />
des Vermögens, des Alters und wegen genetischer Merkmale neu sein.<br />
Letzteres taucht überhaupt zum ersten Mal in einem Grundrechtstext auf<br />
und soll eine Zukunft verhindern, in der Menschen, die genetische<br />
Krankheiten oder ein Risiko dafür aufweisen, zum Beispiel teurere Lebensoder<br />
Krankenversicherungen abschließen müssen. Dabei ist die Liste der<br />
Diskriminierungsmerkmale nicht als endgültig anzusehen. Es handelt sich<br />
um Beispiele, die Hoheitsträger und Bürger für Diskriminierungen sensibilisieren<br />
sollen. In der Union gilt ein umfassendes Diskriminierungsverbot;<br />
Bevorzugung oder Benachteiligung aus welchen Gründen auch immer sind<br />
verboten. Dies zeigt sich auch in Artikel 83, gemäß dem die Gleichheit von<br />
Mann und Frau „in allen Bereichen“ sicherzustellen ist. Dabei geht es nicht<br />
um Gleichmacherei, sondern um Gleichheit vor dem Gesetz. Menschen in<br />
vergleichbaren Situationen müssen gleich behandelt werden. Diese Gleichheit<br />
wird zudem nicht nur passiv anerkannt oder geachtet, sondern muss<br />
von der Union zum Beispiel bei der Gesetzgebung aktiv verwirklicht werden.<br />
Gleichzeitig werden aber auch „spezifische Vergünstigungen für das<br />
unterrepräsentierte Geschlecht“ ermöglicht.<br />
Nicht sehr gelungen scheint die Komposition des Kapitels „Gleichheit“ zu<br />
sein. Weshalb steht die „Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen“<br />
zwischen den beiden Diskriminierungsverboten? Und weshalb finden sich<br />
drei soziale Rechte in dem Kapitel? Der „Vielfalt-Artikel“ wurde erst<br />
recht spät in die Charta aufgenommen. Vorausgegangen waren Forderungen<br />
nach einem Recht für nationale Minderheiten. Doch da sich der<br />
Grundrechte-Konvent angesichts der bestehenden Probleme mit Minderheiten<br />
in Nordirland, im Baskenland und auf Korsika nicht einigen<br />
konnte 21 , rückte als Kompromiss das Bekenntnis zur Vielfalt an die Stelle.<br />
20<br />
Im deutschen Grundgesetz wortgleich in Artikel 3 Absatz 3.<br />
21<br />
Vgl. Philippi 2002, 24.<br />
278 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
Die Platzierung ist demnach auf den Verhandlungsprozess im Grundrechte-Konvent<br />
zurückzuführen. 22<br />
Ähnlich verhält es sich mit den drei sozialen Rechten, die auf den ersten<br />
Blick nicht so recht zur Gleichheit passen wollen. Doch auch hier hat sich<br />
der Grundrechte-Konvent bewusst für deren Platzierung entschieden. 23 Die<br />
Einteilung der Grundrechte in mehrere Kapitel war eine Entscheidung<br />
zugunsten der Übersichtlichkeit. Doch verzichten Grundrechtskataloge<br />
nicht ohne Grund normalerweise auf eine solche Einteilung, denn<br />
Grundrechte können gleichzeitig zum Beispiel einen freiheitlichen und<br />
einen sozialen Aspekt aufweisen. 24 Ungereimtheiten in der europäischen<br />
Grundrechtecharta sind da vorprogrammiert. 25 Mit der Platzierung der<br />
Rechte des Kindes, älterer Menschen und Behinderter hat sich der<br />
Grundrechte-Konvent für die Betonung des in ihnen enthaltenen<br />
Gleichstellungsgedankens entschieden und den sozialen Aspekt damit<br />
bewusst vernachlässigt – auch wenn das nun textliche Ungereimtheiten zur<br />
Folge hat. 26<br />
Titel IV<br />
SOLIDARITÄT<br />
Artikel 87-98<br />
Die ersten sechs Artikel des Kapitels „Solidarität“ befassen sich jeweils mit<br />
einem Aspekt des Themenfeldes „Arbeit“: Während Artikel 87 ein Recht auf<br />
Unterrichtung und Anhörung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im<br />
Unternehmen gewährleistet, steht ihnen mit Artikel 88 ein Recht auf Kollektivverhandlungen<br />
und Kollektivmaßnahmen zu. Dies meint vor allem das Recht, in<br />
Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern Tarifverträge auszuhandeln und abzuschließen<br />
sowie bei Konflikten gemeinsame Aktionen zur Verteidigung ihrer<br />
Interessen (z.B. Streiks) durchzuführen. Des Weiteren hat jeder ein Recht auf Zugang<br />
zu einem kostenlosen Arbeitsvermittlungsdienst (Artikel 89) und genießt<br />
jeder Arbeitnehmer Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung (Artikel 90).<br />
22<br />
Allerdings können Angehörige nationaler Minderheiten aus Artikel 82 keine Rechte für sich<br />
ableiten, da der Artikel niemandem einen Anspruch auf seine Kultur, Religion und Sprache<br />
gewährt.<br />
23<br />
Vgl. Hölscheidt in Meyer 2003, 263.<br />
24<br />
So enthält das Recht zu arbeiten (Artikel 75) einen freiheitlichen und einen sozialen Aspekt.<br />
25<br />
So sind bspw. die Rechte zum Bereich Ehe und Familie auf drei Kapitel verteilt: Artikel 69<br />
(Titel II), Artikel 84 (Titel III), Artikel 93 (Titel IV).<br />
26<br />
Vgl. Hölscheidt in Meyer 2003, 321 f.<br />
Fischer 279
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Letzteres bezieht sich auf Entlassungsgründe wie die Mitgliedschaft in einer<br />
Gewerkschaft oder die zeitweilige Abwesenheit wegen Krankheit. Weiterhin<br />
hat jeder Arbeitsnehmer ein Recht auf gerechte und angemessene<br />
Arbeitsbedingungen, die unter anderem eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit,<br />
Ruhezeiten sowie bezahlten Jahresurlaub beinhalten (Artikel 91). Zudem gilt in<br />
der Union das Verbot von Kinderarbeit und ein besonderer Schutz für<br />
Jugendliche am Arbeitsplatz (Artikel 92).<br />
Artikel 93 garantiert unter der Überschrift Familien- und Berufsleben den<br />
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Familie. Familie und<br />
Beruf müssen miteinander in Einklang zu bringen sein. Zudem genießt jeder<br />
Mensch ein Recht auf Schutz vor Entlassung während der Mutterschaft und hat<br />
Anspruch auf bezahlten Mutterschafts- und auf Elternurlaub nach der Geburt<br />
oder Adoption eines Kindes.<br />
Artikel 94 befasst sich mit der sozialen Sicherheit und sozialen Unterstützung.<br />
Er verpflichtet die Union, den Zugang zu den von den Mitgliedstaaten garantierten<br />
Leistungen und Diensten zu achten, die im Fall von zum Beispiel<br />
Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Alter soziale Ausgrenzung und Armut verhindern<br />
sollen. Gemeint sind damit beispielsweise gesetzliche Krankenkassen,<br />
Unfall- und Rentenversicherungen, Arbeitslosen- und Wohngeld sowie<br />
Sozialhilfe. Anspruch auf diese Leistungen hat jeder Mensch, der seinen rechtmäßigen<br />
Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet hat und ihn rechtmäßig wechselt.<br />
Des Weiteren hat jeder Mensch ein Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge<br />
und auf ärztliche Versorgung sowie auf Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem<br />
wirtschaftlichen Interesse (Artikel 95 und 96). Letzteres meint beispielsweise<br />
den Zugang zum Öffentlichen Personennahverkehr und zur kommunalen<br />
Wasserver- und Abwasserentsorgung. 27 Neben einem hohen Gesundheitsschutzniveau<br />
muss die Union bei all ihren Aktivitäten darüber hinaus auch ein<br />
hohes Maß an Umwelt- und Verbraucherschutz sicherstellen (Artikel 97 und 98).<br />
Brüderlichkeit ohne Substanz?<br />
Wohl in Anlehnung an die Parole „liberté, égalité, fraternité“ der<br />
Französischen Revolution folgt auf die Kapitel „Freiheit“ und „Gleichheit“<br />
das Kapitel „Solidarität“. Es war der umstrittenste Abschnitt der ganzen<br />
Charta und führte im Grundrechte-Konvent zu derart heftigen Debatten,<br />
dass die Verhandlungen zeitweise gar zu scheitern drohten. 28<br />
27<br />
Diskutiert wird dieser Themenbereich unter dem Stichwort „Daseinsvorsorge“. Vgl. weiterführend<br />
unter anderem Friedrich 2004.<br />
28<br />
Vgl. Riedel in Meyer 2003, 325 f.<br />
280 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
Der Auftrag des Europäischen Rates von Köln lautete, neben den Freiheits-,<br />
Gleichheits- und Verfahrensrechten ausdrücklich auch die wirtschaftlichen<br />
und sozialen Rechte in der Charta zu berücksichtigen. 29 Doch<br />
gingen die Meinungen im Grundrechte-Konvent weit auseinander: Sie<br />
reichten von entschiedenen Gegnern einer Verankerung sozialer Rechte, die<br />
eine weitere Kompetenzverlagerung auf die europäische Ebene befürchteten,<br />
bis hin zu starken Befürwortern, die die sozialen Grundrechte so gestalten<br />
wollten, dass sich daraus echte Leistungen ableiten ließen.<br />
Am Ende steht wie so häufig ein Kompromiss. Eine Charta ohne soziale<br />
Rechte hätte einen Rückschritt gegenüber dem bereits bestehenden EU-<br />
Recht und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten<br />
bedeutet. Die Aufnahme von Leistungsrechten wäre eine unzulässige<br />
Kompetenzausweitung gewesen.<br />
In den zwölf Artikeln des Kapitels „Solidarität“ 30 finden sich deshalb nur<br />
wirtschaftliche und soziale Rechte, die auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen<br />
der Mitgliedstaaten zurückgehen und als unstrittig<br />
gelten. Darüber hinaus verzichtete man auf Detailregelungen und formulierte<br />
äußerst zurückhaltend. So werden vielfach Formulierungen wie<br />
„anerkennt und achtet die Union“ 31 verwendet und immer wieder auf „das<br />
Unionsrecht und die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“<br />
32 verwiesen. Damit bilden diese in der Charta aufgeführten Rechte<br />
letztlich nur eine Hülle mit geringem normativen Gehalt, denn sie definieren<br />
den Umfang der Rechte nicht selbst, sondern ziehen ihren Inhalt aus<br />
anderen Quellen. 33 Dies bedeutet, dass der gegenwärtige Status quo bestehen<br />
bleibt, den Mitgliedstaaten aus diesen Charta-Rechten also keine<br />
zusätzlichen Verpflichtungen erwachsen. Sie dürfen den anerkannten sozialen<br />
Schutz lediglich nicht wieder völlig abschaffen.<br />
Darüber hinaus finden sich in einigen Artikeln bloße Prinzipien, die keine<br />
Rechte garantieren, sondern lediglich als Zielbestimmungen anzusehen<br />
29<br />
Vgl. Europäischer Rat 1999.<br />
30<br />
Diese zwölf Artikel stellen den Kern sozialer Grundrechte in der Charta dar. Zudem finden sich<br />
weitere Grundrechte mit Bezug in anderen Kapiteln der Charta (z.B. Artikel 75 Absatz 1<br />
„Recht zu arbeiten“, Artikel 85 „Rechte älterer Menschen“).<br />
31<br />
Im Gegensatz zu „gewährleistet die Union“. Vgl. z.B. Artikel 94 und 96.<br />
32<br />
Vgl. z.B. Artikel 87, 90 und 94 bis 96.<br />
33<br />
Vgl. Schmitz 2004, 705.<br />
Fischer 281
Artikel 61-98<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
sind, und bei denen man sich fragt, was sie eigentlich bei den Grundrechten<br />
zu suchen haben. 34<br />
Das mag nach wenig aussehen; den sozialen Grundrechten scheint es an<br />
Substanz zu fehlen. Doch muss berücksichtigt werden, dass der<br />
Grundrechte-Konvent den Auftrag hatte, bereits Bestehendes zusammenzufassen<br />
und für den Bürger übersichtlicher zu gestalten. Er hatte gar nicht die<br />
Berechtigung, neues Recht zu setzen und vielleicht so etwas wie ein europäisches<br />
Sozialhilferecht zu kreieren. Es ist den Konventsmitgliedern deshalb<br />
hoch anzurechnen, dass ihnen der schwierige Balanceakt zwischen<br />
dem Festzurren des bislang Erreichten und neuen sozialen Grundrechten<br />
einigermaßen gelungen ist. Und was die Zukunft anbetrifft, so ist die<br />
Grundrechtecharta offen gestaltet: Sollten die Mitgliedstaaten es wünschen,<br />
ist ein Mehr an sozialen Rechten auf EU-Ebene immer möglich. Außerdem<br />
darf nicht vergessen werden, dass die Organe, Einrichtungen und sonstigen<br />
Stellen der Union sowie die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des<br />
Gemeinschaftsrechts nach dem Inkrafttreten der Verfassung an die Charta<br />
gebunden sein werden und damit jede ihre Handlungen im Einklang mit<br />
den in der Charta verbürgten Grundrechten stehen muss.<br />
Zu guter Letzt ist auch die Außenwirkung der Charta nicht zu verkennen.<br />
Indem sie dem Prinzip der Solidarität den gleichen Rang wie der Freiheit<br />
und der Gleichheit zugesteht und als direkte Ableitung aus der<br />
Menschenwürde gestaltet wird, hebt sie sich deutlich vom nordamerikanischen<br />
Menschenrechtsverständnis ab. Damit markiert die Charta den<br />
Wechsel der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer sozioökonomischen<br />
Union, in der soziale Standards Schutz genießen und die wirtschaftlichen<br />
Ziele mit ihnen in Einklang gebracht werden müssen. 35 Das<br />
Kapitel „Solidarität“ steht demnach im Einklang mit Artikel 3 Absatz 3, der<br />
die „soziale Marktwirtschaft“ als eines der Ziele der Union definiert.<br />
Literatur: Europäischer Rat (1999): Beschlüsse von Köln (3./4. Juni 1999), unter: http://europa.eu.int/council/off/conclu/june99/june99_de.htm<br />
(20.06.2005). Engels, Markus (2001): Die<br />
europäische Grundrechtecharta. Auf dem Weg zu einer europäischen Verfassung?, in:<br />
Eurokolleg, 45/2001, S. 1–17. Friedrich, Hajo (2004): Daseinsvorsorge zwischen Wettbewerb<br />
und Gemeinwohl, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.09.2004, Nr. 226, S. 22. <br />
Grabenwarter, Christoph (2001): Die Charta der Grundrechte für die Europäische Union, in:<br />
Deutsches Verwaltungsblatt, H. 1, S. 1–13. Menéndez, Augustín José (2003): The Rights’<br />
34<br />
Gemeint sind die Artikel 35, 37 und 38 („hohes Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzniveau“).<br />
Vgl. Grabenwarter 2001, 10.<br />
35<br />
Vgl. Schmitz 2004, 712 f. und Menéndez 2003, 14 ff.<br />
282 Fischer
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 61-98<br />
Foundations of Solidarity: Social and Economic Rights in the Charter of Fundamental Rights of<br />
the European Union (ARENA Working Paper 03/1), unter: http://www.arena.uio.no/publications/<br />
wp03_1.pdf (20.06.2005). Meyer, Jürgen (Hrsg.) (2003): Kommentar zur Charta der<br />
Grundrechte der Europäischen Union – Baden-Baden. Meyer, Jürgen (2004): Die<br />
Menschenwürde in der künftigen Verfassung der Europäischen Union, unter: http:// grundrechtsforum.spoe.at/bilder/d25/Meyer.pdf<br />
(20.06.2005). Nohlen, Dieter (Hrsg.) (1996): Wörterbuch<br />
Staat und Politik, 4. Auflage – München; Zürich. Philippi, Nina (2002): Die Charta der<br />
Grundrechte der Europäischen Union. Entstehung, Inhalt und Konsequenzen für den<br />
Grundrechtsschutz in Europa – Baden-Baden. Präsidium des Europäischen Konvents (2003):<br />
Aktualisierte Erläuterung zum Text der Charta der Grundrechte, unter: http://register.consilium.<br />
eu.int/pdf/de/03/cv00/cv00828-re01de03.pdf (20.06.2005). Reiter, Johannes (2004): Menschenwürde<br />
als Maßstab, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das<br />
Parlament, Band 23–24, S. 6–13. Schmitz, Thomas (2001): Die EU-Grundrechtecharta aus<br />
grundrechtsdogmatischer und grundrechtstheoretischer Sicht, in: Juristenzeitung, Jg. 56,<br />
S. 833–843. Schmitz, Thomas (2004): Die Grundrechtecharta als Teil der Verfassung der<br />
Europäischen Union, in: Europa-Recht, H. 5, S. 691–713.<br />
Moderne Grundrechte in der Grundrechtecharta<br />
Die Grundrechtecharta ist der modernste Grundrechtskatalog, der auf internationaler<br />
Ebene derzeit zu finden ist. Folgende Grundrechte sind dabei als besonders innovativ hervorzuheben:<br />
• Artikel 63 Absatz 2: ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, das explizit auch den<br />
Bereich der Biomedizin berücksichtigt (z.B. Verbot des reproduktiven Klonens);<br />
• Artikel 68: ein Recht auf Datenschutz;<br />
• Artikel 81: ein Nichtdiskriminierungsartikel, der über die „gängigen“ Merkmale hinaus<br />
eine Bevorzugung/Benachteiligung aufgrund von genetischen Merkmalen, der<br />
sexuellen Ausrichtung, der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, einer Behinderung<br />
oder des Alters verbietet;<br />
• Artikel 84: Rechte des Kindes;<br />
• Artikel 85: Rechte älterer Menschen;<br />
• Artikel 86: ein Anspruch auf Integrationsleistungen für Menschen mit Behinderung;<br />
• Artikel 93 Absatz 2: Festlegung, dass Familien- und Berufsleben in Einklang zu<br />
bringen sein müssen;<br />
• Artikel 96: ein Anspruch auf Achtung des Zugangs zu Dienstleistungen von allgemeinem<br />
wirtschaftlichen Interesse (z.B. kommunale Abwasserentsorgung, Öffentlicher<br />
Personennahverkehr);<br />
• Artikel 97 und 98: Zielbestimmungen zum Umwelt- und Verbraucherschutz;<br />
• Artikel 101: ein Recht auf gute Verwaltung;<br />
• Artikel 102: ein Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des<br />
Ministerrates und der Europäischen Kommission.<br />
Quelle: Engels 2001, 11.<br />
Fischer 283
Moritz Alt<br />
Titel V<br />
BÜRGERRECHTE<br />
Artikel 99–106<br />
Die Bürgerrechte wiederholen im Wesentlichen die Dinge, die bereits im EG-<br />
Vertrag niedergeschrieben sind. Aus diesem Grund entwickelten sich auch<br />
kaum nennenswerte Auseinandersetzungen im Grundrechte-Konvent. 1<br />
Artikel 99 legt das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen<br />
Parlament sowie in Absatz 2 die Grundsätze der aktiven, unmittelbaren,<br />
freien und geheimen Wahl fest. Laut Artikel 100 besitzen darüber hinaus alle<br />
Unionsbürger in dem Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, ein aktives und<br />
passives Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Ein französischer Staatsbürger mit<br />
dem ersten Wohnsitz in Bonn kann also die Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann<br />
wählen oder sich als Gegenkandidat zur Wahl stellen.<br />
Das Recht auf eine gute Verwaltung in Artikel 101 nennt Standards, die für die<br />
Verwaltung auf europäischer Ebene gelten, nicht jedoch für das Verwaltungsverfahren<br />
der Mitgliedstaaten. Absatz 1 beschreibt „generalklauselartig“ 2 das<br />
Recht auf eine gute Verwaltung, wobei insbesondere der Begriff „gerecht“ viel<br />
Interpretationsspielraum zulässt. 3 Absatz 2 beinhaltet mit dem Recht auf<br />
Anhörung, Akteneinsicht und der Verpflichtung zur Entscheidungsbegründung<br />
eine Konkretisierung des Absatz 1, wobei das Wort „insbesondere“ erkennen<br />
lässt, dass die Aufzählung nicht abschließend, sondern nur beispielhaft ist.<br />
Absatz 3 regelt das bereits durch Artikel 288 EG-Vertrag garantierte Recht auf<br />
Schadensersatz. Das Recht auf Schadensersatz ist die logische Konsequenz des<br />
Artikel 101. Denn eine Verwaltung, die nicht gerecht, sondern fehlerhaft handelt,<br />
sollte für dieses Verhalten von sich aus einstehen oder sie macht sich schadensersatzpflichtig.<br />
Voraussetzung für einen Anspruch auf Schadensersatz bei<br />
Fehlverhalten eines Unionsbediensteten oder Unionsorgans ist ein rechtswidriges<br />
Handeln, welches ursächlich für einen Schaden gewesen ist. Es ist nicht<br />
erforderlich, dass das gerügte Verhalten auch schuldhaft war. 4<br />
Das Recht auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 102) ist Ausfluss des<br />
Demokratieprinzips 5 und soll sicherstellen, dass die Union für den Bürger in all<br />
ihren Entscheidungen transparent ist. Jede Entscheidung muss also für den<br />
Bürger nachvollziehbar und überprüfbar sein. Einschränkbar ist dieses Recht<br />
1<br />
Vgl. Barriga 2002, 134 und Magiera in Meyer 2003, 434.<br />
2<br />
Eine Generalklausel ist eine vom Gesetzgeber verwendete Vorschrift, die möglichst viele<br />
Tatbestände umfassen soll.<br />
3<br />
Vgl. Bauer 2002, 138.<br />
4<br />
Vgl. Wieland in Dreier 1998, 734.<br />
5<br />
Das Demokratieprinzip versteht das Volk als Träger der Staatsgewalt. Es verlangt die Legitimation<br />
jeder staatlichen Handlung durch das Volk.<br />
284 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
lediglich, wenn öffentliche oder private Interessen zu schützen sind. 6 Öffentliche<br />
Interessen sind zum Beispiel berührt, wenn es um militärische Belange<br />
geht. Eine Abwägung zwischen dem Recht auf Zugang zu Dokumenten auf der<br />
einen und dem öffentlichen und privaten Geheimhaltungsinteresse auf der anderen<br />
Seite erfolgt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. 7<br />
Der Europäische Bürgerbeauftragte (Artikel 103) wird durch das Europäische<br />
Parlament für die Dauer einer Wahlperiode benannt. Er hat seinen Sitz als selbständige<br />
Institution in Straßburg. Im Gegensatz zum Petitionsrecht 8 können alle<br />
Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten unabhängig von ihrer unmittelbaren<br />
Betroffenheit direkt beim Bürgerbeauftragten Beschwerde einlegen. Jeder EU-<br />
Bürger kann sich also an den Europäischen Bürgerbeauftragen in jeder Sache<br />
wenden. Der Bürgerbeauftragte befasst sich sodann mit dem Untersuchungsgegenstand<br />
und bemüht sich bei Missständen 9 um eine einvernehmliche Lösung.<br />
Gelingt dies nicht, so kann er der zuständigen Einrichtung Empfehlungen vorschlagen,<br />
zu denen diese Stellung nehmen muss. Auch legt er dem Europäischen<br />
Parlament einen Jahresbericht vor, der wiederum Einfluss auf die<br />
Entwicklung von Gesetzen haben kann. 10<br />
Das Petitionsrecht in Artikel 104 umfasst das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden<br />
an das Europäische Parlament zu wenden, so eine persönliche<br />
Betroffenheit vorliegt. Das heißt, der Petent muss einen persönlichen Bezug zu<br />
der vorgebrachten Angelegenheit haben. Der Petitionsausschuss befasst sich<br />
sodann mit dem Gegenstand und teilt dem Petenten das Ergebnis mit. Das<br />
Europäische Parlament wird hierüber in einem ausführlichen Jahresbericht<br />
unterrichtet.<br />
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit (Artikel 105) haben ihre Grundlage in<br />
Artikel 18 EG-Vertrag. Hinter diesem Artikel steht die Weiterentwicklung der<br />
europäischen Integration von einem einheitlichen Wirtschaftsraum zu einem<br />
Europa der Bürger. 11<br />
Der nach Artikel 106 gewährleistete diplomatische und konsularische Schutz<br />
folgt aus Artikel 20 EG-Vertrag und zählt wohl zu den unumstrittensten Artikeln<br />
der Charta. Zu beachten ist, dass der Anspruch auf diplomatischen und konsularischen<br />
Schutz nur dann greift, wenn keine Vertretung des eigenen Mitgliedstaates<br />
vorhanden ist, sei die eigene auch lediglich funktionsuntüchtig. In einem<br />
6<br />
Vgl. Magiera in Meyer 2003, 465.<br />
7<br />
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip bindet die gesamte Staatsgewalt, so sie in Grundrechte des<br />
Bürgers eingreift. Jeder staatliche Eingriff muss danach geeignet, erforderlich und angemessen<br />
sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.<br />
8<br />
Zum Petitionsrecht vgl. Artikel 104.<br />
9<br />
Missstände liegen beispielsweise bei Diskriminierung oder Parteilichkeit vor.<br />
10<br />
So liegen z.B. der Entwicklung des Artikel 101 (Recht auf eine gute Verwaltung) auch Berichte<br />
des Bürgerbeauftragten zugrunde.<br />
11<br />
Vgl. Magiera in Meyer 2003, 480.<br />
Alt 285
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Land, in dem ein EU-Bürger keine Vertretung seines eigenen Landes vorfindet,<br />
kann er sich also an jede andere Vertretung eines EU-Mitgliedstaates wenden<br />
und hat einen Anspruch, so behandelt zu werden wie dessen Bürger.<br />
Wie haben sich die Bürgerrechte entwickelt?<br />
Was bringen sie dem Bürger?<br />
Im Wesentlichen entsprechen die Bürgerrechte den bereits im Vertrag von<br />
Maastricht genannten Rechten, die auf eine Stärkung eines Europas der<br />
Bürger abzielten. Dies ist von großer Bedeutung, denn ursprünglich ging es<br />
in Europa ja nur um ausgewählte Wirtschaftssektoren, die zusammengeführt<br />
wurden, um die Versorgung mit Stahl und Energie zu gewährleisten<br />
und weitere Kriege zu verhindern. Daraus entwickelte sich zunächst der<br />
Prozess einer umfassenden wirtschaftlichen Integration, der spätestens mit<br />
dem Vertrag von Maastricht 1992 seine rein ökonomische Zielrichtung hinter<br />
sich ließ. Hier wurde nämlich die Unionsbürgerschaft 12 erstmals<br />
auf primärrechtlicher Ebene eingeführt. Fortan ging es nicht mehr<br />
ausschließlich um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), sondern<br />
um die Europäische Gemeinschaft (EG). Die Bürgerrechte stellen<br />
einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem Europa der Bürger dar,<br />
denn durch die hier niedergeschriebenen Rechte und ihre Wahrnehmung<br />
durch den Bürger wird ein weiterer Beitrag zur Bildung einer europäischen<br />
Identität geleistet. 13 Als Beispiel sei hier auf die Möglichkeit verwiesen,<br />
in einem fremden Land diplomatischen Schutz jedweder Botschaft<br />
eines Mitgliedstaates in Anspruch nehmen zu können, so eine eigene<br />
nicht vorhanden ist.<br />
Von einer bereits bestehenden gemeinsamen Identität und einem gemeinsamen<br />
Werteverständnis zeugt auch die Entwicklung der Bürgerrechte.<br />
Diese findet ihre Grundlage zum einen in den Mitgliedstaaten, die in ihren<br />
jeweiligen landeseigenen Verfassungen ähnliche Rechte für ihre Bürger<br />
vorsehen. Zum anderen sind in der Grundrechtecharta aber auch besonders<br />
moderne, als innovativ geltende Grundrechte enthalten. So findet sich<br />
zum Beispiel das in Artikel 104 geregelte Petitionsrecht auch im deut-<br />
12<br />
Wer Unionsbürger ist, definiert Artikel 10. Siehe hierzu ausführlicher den Text von Stephan<br />
Korte in diesem Band.<br />
13<br />
Zur „Wir-Identität“ siehe auch den Beitrag von Lutz Hager in diesem Band.<br />
286 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
schen Grundgesetz in Artikel 17 wieder und geht letztlich auf die Paulskirchenverfassung<br />
von 1849 zurück, die erstmals für jeden Deutschen das<br />
Recht vorsah, sich mit Bitten und Beschwerden an die Volksvertretung zu<br />
wenden. Andere Vorläufer des europäischen Petitionsrechts finden sich in<br />
der englischen Bill of Rights von 1689 und der französischen Verfassung<br />
von 1791.<br />
Das Recht auf gute Verwaltung stellt hingegen ein Novum dar und zählt<br />
damit zu den modernen Grundrechten. Es steht beispielhaft für die<br />
Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene und zeigt, wie die von verschiedenen<br />
Seiten, zum Beispiel vom Europäischen Bürgerbeauftragten<br />
beanspruchten und aufgestellten Grundsätze letztlich in geschriebenes<br />
Recht umgesetzt werden. Seinen Ursprung hat das Grundrecht auf eine<br />
gute Verwaltung in der Rechtsprechung des EuGH. Zunächst machten der<br />
EuGH und auch das Gericht erster Instanz (EuG) in ihrer Entscheidungsterminologie<br />
von Begrifflichkeiten wie dem „Grundsatz der ordnungsgemäßen<br />
Verwaltung“, der „korrekten Verwaltung“ oder auch negativ von<br />
„mangelhafter Verwaltungsführung“ Gebrauch. Das heißt, dass bestimmte<br />
Verwaltungsvorgänge im Urteil des Gerichts als korrekt oder mangelhaft<br />
bezeichnet wurden. Diese von der Rechtsprechung entwickelte<br />
Terminologie wurde bereits im Vorfeld maßgeblich von den Schlussanträgen<br />
der Generalanwälte beeinflusst. Die Literatur nahm Einfluss,<br />
indem sie sich mit den Urteilen des EuGH und des EuG kritisch auseinander<br />
setzte und dadurch wiederum die zukünftige Rechtsprechung beeinflusste.<br />
14 Die so entstandenen vielfältigen Grundsätze der Rechtsprechung<br />
lassen sich in Fallgruppen unterteilen, die zum Beispiel „Maßstäbe für die<br />
Verwaltungstätigkeit“ setzen oder „Anforderungen an die Verwaltungsorganisation“<br />
stellen. 15<br />
Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Rechts auf eine<br />
gute Verwaltung leistete der Europäische Bürgerbeauftragte, denn er<br />
stellt eine Instanz dar, die für jedwede Beschwerde eines Unionsbürgers<br />
zuständig ist und sich mit dieser auseinander setzen muss. Die aus seiner<br />
Arbeit hervorgehenden Jahresberichte weisen auf Missstände in der<br />
Verwaltung hin und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wiederum<br />
waren auch Arbeitsgrundlage für die Entwicklung des Rechts auf eine<br />
gute Verwaltung.<br />
14<br />
Vgl. Bauer 2002, 123.<br />
15<br />
Vgl. ebd., 21 ff.<br />
Alt 287
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Fraglich ist, was die Bürgerrechte – seien sie modern oder auch altbewährt<br />
– dem Bürger wirklich bringen. Steht hinter dem Motto „Europa<br />
der Bürger“ nur eine hohle Phrase oder wird durch die Europäische<br />
Verfassung – insbesondere durch die Grundrechtecharta – die Politik endlich<br />
dem Willen und der Mündigkeit der Bürger gerecht? Hierauf lassen<br />
sich viele Antworten finden. Einigen wird die Verfassung nicht weit<br />
genug gehen, es wird das Demokratiedefizit beklagt, die mangelnde<br />
Transparenz. Anderen hingegen geht die Verfassung zu weit, und es geht<br />
die Angst um vor einer übermächtigen europäischen Staatsmacht, die sich<br />
in nationalstaatliche Angelegenheiten einmischt.<br />
Für die Bürgerrechte der Unionsbürger muss festgestellt werden, dass sie<br />
einerseits einen weiteren wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die<br />
Verständlichkeit des europäischen Vertragswerkes darstellen, andererseits<br />
einen wichtigen Beitrag zur Identitätsstiftung des Einzelnen mit Europa<br />
leisten. So kann zukünftig jeder Unionsbürger einen groben Überblick<br />
über seine Rechte erhalten, indem er einen Blick in die Grundrechtecharta<br />
wirft.<br />
Sehr deutlich wird an diesem Punkt der Unterschied zwischen Menschenund<br />
Bürgerrechten. Denn hinter dem Oberbegriff „Grundrechte“ verbergen<br />
sich auf der einen Seite Rechte, die ausschließlich die Rechte der<br />
Unionsbürger benennen, auf der anderen Seite stehen die so genannten<br />
„Jedermanns-Grundrechte“. 16 In den Genuss der Bürgerrechte kommen<br />
nur diejenigen, die die Unionsbürgerschaft innehaben. Jedermanns-<br />
Grundrechte hingegen sind Rechte, die, wie das Wort bereits impliziert,<br />
für jedermann gelten, der mit europäischem Verwaltungshandeln in<br />
Berührung kommt. Unerheblich ist dabei, ob die Betroffenen Unionsbürger<br />
sind oder einem Nicht-EU-Staat angehören.<br />
Zu den Unionsbürgerrechten gehört auch das in Artikel 99 verordnete aktive<br />
und passive Wahlrecht zum Europäischen Parlament sowie das aktive<br />
und passive Kommunalwahlrecht in Artikel 100. Artikel 99 Absatz 2<br />
zählt die Wahlgrundsätze auf, wobei aber der Grundsatz der Gleichheit<br />
der Wahl, wonach die Stimme jedes Wählers das gleiche Gewicht besitzt,<br />
fehlt. Dies liegt daran, dass in bevölkerungsschwachen Mitgliedstaaten<br />
wie Luxemburg, Malta oder Zypern eine wesentlich geringere Zahl von<br />
Einwohnern durch einen Europaabgeordneten repräsentiert wird als bei-<br />
16<br />
So ist z.B. Artikel 99 ein Unionsbürgerrecht, Artikel 101 hingegen ein „Jedermanns-Grundrecht“.<br />
288 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
spielsweise in bevölkerungsstarken Staaten wie Frankreich, Großbritannien<br />
oder Deutschland. 17 Das erscheint aus der Sicht der Deutschen nicht<br />
gerecht, ist jedoch bei genauerem Hinsehen in einem Europa, in dem die<br />
„kleinen“ Mitgliedstaaten sich nicht von den „großen“ Mitgliedstaaten<br />
an den Rand gedrängt fühlen sollen, nicht anders zu regeln.<br />
Zwei weitere wichtige Grundrechte für den Bürger sind in Artikel 102<br />
(Recht auf Zugang zu Dokumenten) und in Artikel 103 (Der Europäische<br />
Bürgerbeauftragte) geregelt. Der Europäische Bürgerbeauftragte stellt ein<br />
wichtiges Bindeglied zwischen den europäischen Institutionen und den<br />
Bürgern der EU dar. 18 An ihn kann man sich wenden, wenn man Beschwerden<br />
hat, die die europäischen Institutionen betreffen. Dies ist relativ<br />
leicht mittels eines Online-Beschwerdeformulars möglich. 19 Das Recht auf<br />
Zugang zu Dokumenten basiert auf Artikel 255 des EG-Vertrags. Es ist<br />
ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung auf mehr Transparenz für den<br />
Bürger. Umgesetzt wird dieser Artikel zum Beispiel durch ein Internetportal,<br />
welches beim Suchen von Dokumenten behilflich ist. 20<br />
Titel VI<br />
JUSTIZIELLE RECHTE<br />
Artikel 107-110<br />
Das in Artikel 107 verordnete Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein<br />
unparteiisches Gericht eröffnet die Möglichkeit, den EuGH anzurufen, soweit<br />
europäisches Recht durch die Organe der EU verletzt wird. Dies war bislang<br />
selbstverständlich auch möglich. Grundlage für Absatz 1 ist die bisherige Rechtsprechung<br />
des EuGH zum effektiven Rechtsschutz sowie Artikel 13 EMRK.<br />
Absatz 2 des Artikel 107 garantiert das Recht auf ein faires, zügiges und offenes<br />
Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. Der Anspruch<br />
auf Prozesskostenhilfe in Artikel 107 Absatz 3 wurde aus der Rechtsprechung<br />
des EGMR gewonnen 21 und untermauert die Rechtsweggarantie, indem er im<br />
Fall der Bedürftigkeit ausreichend Mittel zur Verfügung stellt.<br />
17<br />
Vgl. Philippi 2002, 28.<br />
18<br />
Der derzeitige Europäische Bürgerbeauftragte ist P. Nikiforos Diamandouros.<br />
19<br />
Zu finden unter: http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/de/form2.htm (20.06.2005). Hier<br />
finden sich auch weitere Hinweise zur Antragsstellung.<br />
20<br />
Unter http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_de.htm (20.06.2005).<br />
21<br />
Vgl. Barriga 2002, 145.<br />
Alt 289
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Hinter Artikel 108 steht die auch aus dem deutschen Strafrecht bekannte<br />
Unschuldsvermutung sowie die Achtung der Verteidigungsrechte. Dem in Artikel<br />
109 Absatz 1 (Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im<br />
Zusammenhang mit Straftaten und Strafen) verkörperten Gesetzmäßigkeitsgrundsatz<br />
lassen sich vier Einzelprinzipien entnehmen, die die Grundlage<br />
für die Garantiefunktion des Strafrechts darstellen 22 : die Erforderlichkeit einer<br />
Rechtsgrundlage für eine Strafe, das Bestimmtheitsgebot, das Analogieverbot<br />
sowie das Rückwirkungsverbot. Die in Artikel 109 Absatz 3 umschriebene<br />
Verhältnismäßigkeit zwischen Straftat und Strafmaß wird aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip,<br />
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht sowie der Menschenwürde<br />
hergeleitet. 23<br />
Das Verbot der Doppelbestrafung in Artikel 110 (Recht, wegen derselben<br />
Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden) 24 findet<br />
im deutschen Recht seine Ausprägung in Artikel 103 Absatz 3 GG. Durch die<br />
Festlegung in Artikel 110 sollen nicht nur zwischenstaatliche Mehrfachverfahren<br />
ausgeschlossen werden, sondern auch das Doppelbestrafungsverbot<br />
innerhalb eines Mitgliedstaates zum Tragen kommen. 25<br />
Entwicklung, Hintergründe und Probleme<br />
der justiziellen Rechte<br />
Bei den justiziellen Rechten geht es um die Rechte des Einzelnen gegenüber<br />
der Justiz. Es gibt zum Beispiel ein Recht auf Tätigwerden der Justiz<br />
26 , wenn garantierte Rechte und Freiheiten verletzt wurden, oder es gibt<br />
Rechte gegenüber der Justiz wie die Unschuldsvermutung in Artikel 108<br />
Absatz 1.<br />
Die Rechte lassen sich nicht einzelnen Gerichtszweigen zuordnen wie<br />
etwa dem Straf- oder dem Zivilgericht. Der Natur der Sache nach kommt<br />
aber zum Beispiel das Verbot der Doppelbestrafung nur für die Strafjustiz<br />
in Betracht, wohingegen der Anspruch auf Prozesskostenhilfe für alle<br />
Gerichtsbarkeiten in Frage kommt. Die justiziellen Rechte bieten die<br />
Möglichkeit, Grundsätze der strafrechtlichen Entwicklung aufzuzeigen,<br />
und sind insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit<br />
22<br />
Eser in Meyer 2003, 536.<br />
23<br />
Vgl. ebd., 546.<br />
24<br />
Auf Lateinisch: „ne bis in idem“.<br />
25<br />
Vgl. Barriga 2002, 149.<br />
26<br />
Z.B. Artikel 107.<br />
290 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
von Interesse. Wie bereits erwähnt, lassen sich dem Artikel 109 Absatz 1<br />
vier Einzelprinzipien entnehmen:<br />
• das Analogieverbot<br />
• das Bestimmtheitsgebot<br />
• das Rückwirkungsverbot<br />
• das Erfordernis einer Rechtsgrundlage für das Verbot<br />
Für eine kurze Erklärung dieser Prinzipien, die selbstverständlich auch<br />
dem deutschen Strafgesetzbuch (StGB) 27 zugrunde liegen, muss der Wortsinn<br />
verdeutlicht werden: Das Analogieverbot besagt, dass eine Lücke im<br />
Gesetz nicht geschlossen werden darf, indem eine ähnliche Norm oder ein<br />
aus mehreren Vorschriften abzuleitender Rechtsgedanke herangezogen<br />
wird. Das Bestimmtheitsgebot beinhaltet, dass sowohl die Tat als auch<br />
deren Folgen mit hinreichender Bestimmtheit umschrieben werden müssen.<br />
Das Rückwirkungsverbot umschreibt das Verbot, auf eine bereits<br />
begangene Tat Recht anzuwenden, welches nach deren Begehung entstanden<br />
ist, soweit es die Rechtslage des Täters verschlechtert. 28<br />
Beispielhaft für einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot ist die<br />
Verurteilung des vermeintlichen Reichstagsbrandstifters Marinus van der<br />
Lubbe durch die Nationalsozialisten, welche zu einer Bestrafung aufgrund<br />
eines nach-träglich erlassenen Gesetzes kamen.<br />
Unter anderem liegt dem Artikel 109 Absatz 1 Satz 1 der Satz „kein<br />
Verbrechen ohne Gesetz“ 29 zugrunde. Auch dieser wohl auf Feuerbach 30<br />
zurückgehende rechtsstaatliche Fundamentalsatz wurde 1935 31 von den<br />
Nationalsozialisten aufgeweicht, indem eine Bestrafung bereits „nach dem<br />
Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden“<br />
32 für zulässig erklärt wurde. Dass dieser Begriff sich in jede beliebige<br />
Richtung auslegen und ausdehnen ließ, liegt auf der Hand. Wenn es<br />
Artikel 109 Absatz 2 schon im Jahr 1945 gegeben hätte, so hätte er bei den<br />
Nürnberger Prozessen gegen die 24 Hauptkriegsverbrecher der natio-<br />
27<br />
Vgl. Artikel 103 Absatz 2 GG und § 2 StGB.<br />
28<br />
Vgl. Tröndle/Fischer 2003, § 1 Rn 14.<br />
29<br />
Auf Lateinisch: „nullum crimen sine lege“.<br />
30<br />
Paul Johann Anselm von Feuerbach gilt als der Begründer der modernen deutschen Strafrechtswissenschaft.<br />
31<br />
Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28. Juni 1935.<br />
32<br />
Vgl. Roxin 1994, § 5 Rn. 15, § 4 Rn. 14.<br />
Alt 291
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
nalsozialistischen Führung in Deutschland 33 den Richtern des Internationalen<br />
Militärgerichtshofs die Arbeit erleichtert. Diese sahen sich damals<br />
mit der Frage konfrontiert, nach welchen Rechtssätzen die Täter zu verurteilen<br />
sind. Es ging um die Problematik der Rangordnung der anzuwendenden<br />
Rechtssätze, konkret um den Vorrang des Völker- vor dem Landesrecht.<br />
Man folgte der Auffassung, dass die Gesetze der Nationalsozialisten<br />
vor einem Gerichtshof, der ermächtigt ist, Völkerrecht anzuwenden, keinen<br />
Bestand haben können, soweit sie gegen dieses verstoßen. 34 Die<br />
Nürnberger Prinzipien von 1950 legten fest, dass ein Handeln auf Anordnung<br />
einer Regierung nicht von der Verantwortung gegenüber dem internationalen<br />
Recht befreit. 35<br />
Artikel 107 Absatz 1 verdeutlicht eine weitere Schwierigkeit im Umgang<br />
mit nationalstaatlichen Gerichten auf der einen und dem Europäischen<br />
Gerichtshof auf der anderen Seite. Diese Schwierigkeit besteht dann,<br />
wenn es zur Anwendung von Gemeinschaftsrecht durch einen Mitgliedstaat<br />
kommt und dabei das Gemeinschaftsrecht verletzt wird. Der Betroffene<br />
hat in einem solchen Fall die Möglichkeit, sich an ein nationales Gericht<br />
zu wenden. Er kann sich jedoch weder an den Europäischen Gerichtshof<br />
noch an den Gerichtshof erster Instanz wenden. Diese kommen<br />
nur dann zum Zuge, wenn das Gericht des Mitgliedstaates ein Vorlageverfahren<br />
(Vorabentscheidungsverfahren) anstrengt. Das bedeutet, dass das<br />
nationalstaatliche Gericht den EuGH fragt, ob Gemeinschaftsrecht verletzt<br />
wurde. Problematisch ist jedoch die Frage, ob und wann das nationalstaatliche<br />
Gericht die Pflicht hat, die Frage dem EuGH vorzulegen. Das Bundesverfassungsgericht<br />
hat hier eine Pflicht dem Grunde nach bejaht und<br />
sie an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Alles andere würde nach<br />
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auf einen Entzug des gesetzlichen<br />
Richters hinauslaufen. 36 Diese Pflicht zur Vorlage ist jedoch an recht vage<br />
Bedingungen geknüpft und ein lückenloser Rechtsschutz kaum gewährleistet.<br />
Eine europäische Grundrechtsbeschwerde würde auch hier zweifellos<br />
zu mehr Transparenz führen, ist allerdings aufgrund der gegenwärtigen<br />
Rechtslage – insbesondere Artikel 111 Absatz 2 – und dem nicht vorhandenen<br />
Willen der Mitgliedstaaten nicht zu erwarten. 37<br />
33<br />
Die Nürnberger Prozesse dauerten vom 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946.<br />
34<br />
Vgl. Heinze 1952, 41.<br />
35<br />
Prinzip IV der Nürnberger Prinzipien von 1950.<br />
36<br />
Vgl. den Kammerbeschluss des BVerfG vom 09.01.2001, in: NJW 2001, 1268.<br />
37<br />
Vgl. Eser in Meyer 2003, 508.<br />
292 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
Titel VII<br />
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE AUSLEGUNG<br />
UND ANWENDUNG DER CHARTA<br />
Artikel 111-114<br />
Artikel 111 (Anwendungsbereich) ist die entscheidende Norm, wenn es um die<br />
Frage der Anwendung der Charta geht. Artikel 111 Absatz 1 stellt fest, dass jedes<br />
Organ in der Union das Subsidiaritätsprinzip zu wahren hat. 38 Darüber hinaus legt<br />
Absatz 1 fest, dass die Charta zum einen für die Organe der EU und zum anderen<br />
nur bei der Durchführung des Rechts der Union gilt, also nicht etwa für rein<br />
nationalstaatliches Recht. Absatz 2 stellt eine Kompetenzschutzklausel dar, die<br />
lediglich deklaratorischen 39 Charakter hat und sich gemeinhin als „Beschwichtigungsklausel“<br />
bezeichnen lässt. 40<br />
Absatz 1 des Artikel 112 (Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze)<br />
stellt eine allgemeine Schrankenklausel dar. Das bedeutet, die Charta darf zwar<br />
eingeschränkt werden, jedoch nur in einem sehr engen Rahmen, der „gesetzlich<br />
vorgesehen sein“ muss und den „Wesensgehalt“ der Rechte und Freiheiten achtet.<br />
Hierbei handelt es sich um einen sehr wichtigen Artikel, denn durch diese<br />
lex specialis 41 gegenüber dem Artikel 112 Absatz 1 werden die Artikel der<br />
EMRK „übernommen“ und so verhindert, dass die in der EMRK festgelegten<br />
Rechte durch die Hintertür wieder Beschränkungen unterworfen werden. 42<br />
Artikel 113 (Schutzniveau) liegt der Gedanke zugrunde, die Charta auf eine<br />
schonende Art und Weise in das bereits bestehende nationale, europäische und<br />
internationale Recht einzufügen. Er soll davor schützen, dass die Charta herangezogen<br />
wird, um bereits bestehende Schutzrechte auf ein niedrigeres Niveau<br />
abzusenken. 43 Artikel 114 (Verbot des Missbrauchs der Rechte) geht in eine<br />
ähnliche Richtung. Er soll einen Grundrechtsmissbrauch verhindern. Die praktische<br />
Bedeutung dieses Artikels ist allerdings gering.<br />
38<br />
Siehe ausführlicher zum Subsidiaritätsprinzip den Text von Christian Wenning und Florian<br />
Ziegenbalg „Die Grundprinzipien der Kompetenzordnung“ in diesem Band.<br />
39<br />
Deklaratorisch ist der Gegensatz zu konstitutiv. Konstitutiv ist ein Rechtsakt, der eine<br />
Rechtsfolge erst begründet. Ein deklaratorischer Rechtsakt stellt hingegen eine bereits eingetretene<br />
Rechtsfolge nur noch fest.<br />
40<br />
Vgl. Barriga 2002, 155.<br />
41<br />
Eine lex specialis ist eine gesetzliche Regelung, die dem allgemeinen Gesetz vorgeht. Hier<br />
geht also Absatz 3 dem Absatz 1 vor. Greift also das Vertragswerk der EMRK, ist der Rückgriff<br />
auf Absatz 1 versperrt.<br />
42<br />
Vgl. Borowsky in Meyer 2002, 581 ff.<br />
43<br />
Vgl. ebd. 596 f.<br />
Alt 293
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Europäische Grundrechtecharta und deutsches<br />
Grundgesetz – ein vorprogrammierter Konflikt?<br />
Um der oft gestellten Frage nach dem Wirkungsbereich der Grundrechtecharta<br />
vorzugreifen, ist hier zur Klarheit zunächst noch einmal festzustellen,<br />
dass die Grundrechte nicht jedwedes staatliche Handeln kontrollieren,<br />
sondern nur das Handeln europäischer Organe sowie das Handeln nationaler<br />
Organe bei der Durchführung europäischen Rechts. Die Grundrechte<br />
haben also unter anderem den Zweck, diese wirksam zu kontrollieren. Eine<br />
solche grundrechtliche Kontrolle gab es bislang nicht, denn es ist ja nicht<br />
möglich, das deutsche Grundgesetz gegenüber europäischen Institutionen<br />
zur Anwendung kommen zu lassen. Dies wäre auch sinnwidrig, da<br />
Europa mit seinen vielen landesspezifischen Verfassungen sonst nicht<br />
handlungsfähig bliebe.<br />
Mit der Wandlung der Grundrechtecharta vom Richterrecht zum niedergeschriebenen<br />
Rechtstext ist nunmehr gewährleistet, dass jeder Unionsbürger<br />
ein Mindestmaß an Grundrechtsschutz gegenüber den europäischen<br />
Institutionen erfährt. 44 Weiterhin soll durch das von den Verfassungsvätern<br />
und -müttern in der Verfassung verankerte Subsidiaritätsprinzip gewährleistet<br />
werden, dass die Union keine Aufgaben übernimmt, die nicht in<br />
ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Mitgliedstaatliche Traditionen und<br />
Eigenarten sollen somit bewahrt werden. Die Union darf nur dort tätig werden,<br />
wo andere Ebenen, insbesondere nationale, regionale und lokale, nicht<br />
effektiv selbst tätig werden können.<br />
Doch nicht nur das Subsidiaritätsprinzip macht deutlich, dass einer<br />
Ausweitung der Unionsrechte ein Riegel vorgeschoben werden soll. Auch<br />
Artikel 111 Absatz 2 (Anwendungsbereich der Charta) ist Ausdruck einer<br />
gewissen Europaskepsis und beinhaltet eine politische Klarstellung, die<br />
allerdings kaum Bedeutung hat. Um die allgemeinen Bestimmungen, insbesondere<br />
um die Frage der Anwendbarkeit der Charta, wurde während des<br />
Konvents am heftigsten gerungen. 45 Denn sie sind maßgeblich für<br />
Auslegungs- und Anwendungsfragen der Charta und somit Grundlage für<br />
die zukünftige Entwicklung einer Grundrechtsdogmatik durch Wissenschaft<br />
und Gerichte. Insbesondere in Artikel 111 Absatz 1 wird von vielen<br />
Seiten ein hohes Konfliktpotential zwischen Landesverfassungen, der<br />
44<br />
So Ingolf Pernice in einem Vortrag am 03.11.2004 in der Urania Berlin.<br />
45<br />
Vgl. Philippi 2002, 37.<br />
294 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
europäischen Grundrechtecharta und der Rechtsprechung des EuGH<br />
gesehen. 46 Dies trifft zumindest insoweit zu, als der EuGH und die Grundrechtecharta<br />
unterschiedliche Formulierungen im Hinblick auf eine<br />
Bindung der Mitgliedstaaten gebrauchen. Der EuGH bejaht eine Bindung<br />
der Mitgliedstaaten bereits „im Bereich der Anwendung des Gemeinschaftsrechts“,<br />
wohingegen Artikel 111 Absatz 1 der Grundrechtecharta<br />
von der „Durchführung von Gemeinschaftsrecht“ spricht.<br />
Auf den ersten Blick erschließt sich nicht sofort ein Unterschied. Jedoch<br />
meinen einige, dass es einen gibt. So wird die Vermutung geäußert, dass es<br />
auch dann zu einer Bindung der Mitgliedstaaten an die Unionsgrundrechte<br />
kommen kann, „wenn diese zwar kein Unionsrecht durchführen, ihr<br />
Verhalten jedoch im Anwendungsbereich des Vertrages liegt“ 47 . Dies<br />
könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn „die Unionsgrundrechte auf<br />
die Auslegung der Rechtfertigungsgründe der Grundfreiheiten ausstrahlen“<br />
48 . Ob diese These zu weit geht oder nicht, wird sich zeigen, zumindest<br />
gab es bereits ähnlich kuriose Urteile des EuGH, die solchen Überlegungen<br />
Raum geben. 49<br />
Aus Sicht der Kritiker dieser Norm ist zumindest Folgendes nicht von<br />
der Hand zu weisen: Die Norm beschränkt zwar die Anwendung der<br />
Grundrechtecharta, indem sie festlegt, dass diese nur gilt, soweit es um<br />
die Durchführung des Rechts der Union geht. Jedoch steht dies im<br />
Widerspruch zu der Rechtsprechung des EuGH, der die Mitgliedstaaten<br />
bereits binden will, wenn ihr Handeln in den Anwendungsbereich der<br />
Grundfreiheiten fällt. 50<br />
Dem wird entgegengehalten, dass es nur durch die Charta zu einer wirksamen<br />
Bändigung der europäischen Hoheitsgewalt kommen kann und es<br />
auch gerade Ziel des Konvents war, die ausufernde Rechtsprechung des<br />
EuGH und den damit einhergehenden Bedeutungsverlust der nationalen<br />
Verfassungsgerichte zu stoppen. 51 Das heißt, dass sich durch die neue<br />
Verfassung auch die zukünftige Rechtsprechung des EuGH wieder auf<br />
eine Bindung der Mitgliedstaaten bei der „Durchführung von Gemein-<br />
46<br />
Vgl. Cremer 2003, 1452.<br />
47<br />
Ebd.<br />
48<br />
Ebd.<br />
49<br />
Vgl. Rechtssache C-60/00 Mary Carpenter gegen Secretary of State for the Home Departement.<br />
50<br />
Vgl. Cremer 2003, 1452.<br />
51<br />
Vgl. Borowsky in Meyer 2003, 566 ff.<br />
Alt 295
Artikel 99-114<br />
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
schaftsrecht“ beschränken muss. Wie sich somit die Grundrechtecharta<br />
nach wirksamer Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten auf die Rechtsprechung<br />
des EuGH auswirkt, bleibt mit einiger Spannung abzuwarten.<br />
Einwendungen, dass dem Zentralisierungssog nur entgegengewirkt werden<br />
kann, indem die Bindungswirkung einer Grundrechtscharta strikt auf die<br />
Unionsorgane beschränkt wird 52 , sollte zumindest ansatzweise Rechnung<br />
getragen werden. Befürchtungen, dass die Flexibilität des Richterrechts<br />
durch die schriftliche Fixierung in einer noch zu ratifizierenden Charta eingeschränkt<br />
wird 53 , sind wohl unbegründet. Auch wenn die derzeitige<br />
Rechtslage durchaus tragbar ist, ist es doch von immanenter Wichtigkeit,<br />
die durch Richterrecht gewonnenen Erkenntnisse in ein Gesetz zu gießen<br />
und es auf diesem Weg der breiten Bevölkerungsmehrheit zugänglich und<br />
verständlicher zu machen. Die Frage, ob – je nach Sichtweise – die Gefahr<br />
beziehungsweise die Chance besteht, dass die Grundrechtecharta direkt<br />
oder indirekt in nationales Verfassungsrecht eingreift, bleibt jedoch. Fest<br />
steht zumindest, dass dies dem geäußerten Willen der Kommission widerspricht.<br />
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die<br />
Festlegung justizieller Grundrechte im Strafverfahren oder auch das Verbot<br />
der Todesstrafe im Widerspruch zur begrenzten Anwendbarkeit der<br />
Charta stehen. Denn wie kann die Anwendung der Charta auf der einen<br />
Seite auf die „Durchführung von Gemeinschaftsrecht“ beschränkt werden,<br />
auf der anderen jedoch Grundrechte im Strafverfahren regeln, die einzig<br />
das Hoheitsrecht der Nationalstaaten berühren? Auch hier wird sich noch<br />
zeigen, welche Folgen die Grundrechtecharta auf die Rechtsprechung des<br />
EuGH hat.<br />
Spannend bleibt also, wie sich das Verhältnis zwischen EuGH und EGMR<br />
in Zukunft ausgestaltet, insbesondere, da sich zu diesem Duett auch noch<br />
das vom Bundesverfassungsgericht postulierte „Kooperationsverhältnis“ 54<br />
gesellt und die Lage zumindest für den Bürger ungleich unübersichtlicher<br />
macht. Dieses Problem gab es allerdings bereits beim Richterrecht des<br />
EuGH.<br />
52<br />
Vgl. Di Fabio 2000, 741.<br />
53<br />
Vgl. Zuleeg 2000, 511 ff.<br />
54<br />
Maastricht-Entscheidung des BVerfG. Siehe auch Classen 1999, 482. Das Kooperationsverhältnis<br />
besagt, dass grundsätzlich der EuGH dafür zuständig ist, den Grundrechtsschutz zu<br />
gewährleisten. Werden allerdings deutsche Grundrechte in ihrem Wesensgehalt verletzt, muss<br />
das BVerfG seinen Auftrag zum Schutz der Grundrechte wieder aktivieren.<br />
296 Alt
Die Charta der Grundrechte der Union<br />
Artikel 99-114<br />
Zuletzt soll hier das Verbot des Missbrauchs der Rechte in Artikel 114<br />
nicht unerwähnt bleiben, da es insbesondere vor dem Hintergrund der in<br />
Deutschland gemachten Erfahrungen von Interesse ist. Aufgabe des<br />
Artikels 114 ist der Schutz vor totalitären Bestrebungen jedweder Art.<br />
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die in Deutschland gemachten<br />
Erfahrungen mit der Weimarer Reichsverfassung und den Ermächtigungsgesetzen<br />
von 1933 von Interesse. Und so kommt es denn<br />
auch, dass eine vergleichbare Regelung in der deutschen Verfassung<br />
existiert: Artikel 79 Absatz 3 GG. Auch wenn die praktische Bedeutung<br />
des Artikels gering ist, so bleibt er doch Ausdruck einer „streitbaren<br />
Demokratie“.<br />
Literatur: Barriga, Stefan (2002): Die Entstehung der Charta der Grundrechte der Europäischen<br />
Union – Baden-Baden. Bauer, Ralf (2002): Das Recht auf eine gute Verwaltung im europäischen<br />
Gemeinschaftsrecht – Frankfurt/Main. Classen, Claus Dieter (1999): Artikel 23 I GG,<br />
in: Mangoldt, Hermann von/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.): Bonner Grundgesetz-<br />
Kommentar, 4. Aufl. – München. Cremer, Wolfram (2003): Der programmierte Verfassungskonflikt:<br />
Zur Bindung der Mitgliedstaaten an die Charta der Grundrechte der<br />
Europäischen Union nach dem Konventsentwurf für eine europäische Verfassung, in: Neue<br />
Zeitschrift für Verwaltungsrecht, S. 1452 ff. Di Fabio, Udo (2000): Eine europäische Charta,<br />
in: Juristenzeitung 2000, S. 737 ff. Dreier, Horst (1998): Grundgesetz-Kommentar –<br />
Tübingen. Heinze, Kurt (1952): Die Rechtsprechung der Nürnberger Militärtribunale – Bonn.<br />
Mangoldt, Hermann von/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.) (1999): Bonner<br />
Grundgesetz-Kommentar, 4. Aufl. – München. Meyer, Jürgen (Hrsg.) (2003): Kommentar zur<br />
Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Baden-Baden. Philippi, Nina (2002): Die<br />
Charta der Grundrechte der EU. Entstehung, Inhalt und Konsequenzen für den Grundrechtsschutz<br />
in Europa – Baden-Baden. Roxin, Claus (1994): Strafrecht. Allgemeiner Teil,<br />
Band 1 – München. Tröndle, Herbert/Fischer, Thomas (2003): Kommentar zum Strafrecht –<br />
München. Zuleeg, Manfred (2000): Zum Verhältnis nationaler und europäischer Grundrechte,<br />
in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, Jg. 27, H. 17–19, S. 511–517.<br />
Alt 297
KOMMENTAR<br />
Teil IV<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen
Carsten Berg<br />
Artikel 437-448<br />
ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN<br />
Artikel 437: Aufhebung der früheren Verträge<br />
Artikel 437 legt fest, dass mit dem Inkrafttreten der Europäischen Verfassung<br />
die bestehenden Grundverträge der Europäischen Union aufgehoben, das heißt<br />
wirkungslos werden. Hiervon betroffen sind sogar die Beitrittsverträge, welche<br />
mit jedem neuen Mitgliedstaat zu dessen Aufnahme in die Europäische Union<br />
geschlossen wurden. 1<br />
Artikel 438: Rechtsnachfolge und rechtliche Kontinuität<br />
Artikel 438 regelt die so genannte „Rechtsnachfolge“ der alten Europäischen<br />
Union. Die durch die Verfassung neu geschaffene EU wird rechtlicher Nachfolger<br />
der alten EU/EG. Die mit dem Inkrafttreten der Verfassung bereits existierenden<br />
EU-Organe 2 bestehen also ebenso weiter wie das von ihnen geschaffene<br />
Recht. Besonders wird darauf hingewiesen, dass die bisherige Rechtsprechung<br />
des Europäischen Gerichtshofs weiterhin der Auslegungsmaßstab<br />
für europäisches Recht ist. Auch die rechtliche Kontinuität ist sichergestellt:<br />
Alle Gerichts- und Verwaltungsverfahren, die vor dem Inkrafttreten der Verfassung<br />
eingeleitet wurden, werden fortgesetzt.<br />
Artikel 439: Übergangsbestimmungen für bestimmte Organe<br />
Artikel 439 sieht spezielle Übergangsregelungen für bestimmte EU-Organe<br />
vor. Die genauen Regelungen werden im Protokoll Nr. 35 über die Übergangsbestimmungen<br />
für die Organe und Einrichtungen der Union festgelegt. Diese<br />
regeln beispielsweise die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und<br />
der Kommission sowie die Definition der qualifizierten Mehrheit im Europäischen<br />
Rat und im Ministerrat während des Übergangszeitraums.<br />
Artikel 440: Räumlicher Geltungsbereich<br />
Artikel 440 regelt, auf welchem Territorium die Verfassung gilt. Dieser so genannte<br />
räumliche Geltungsbereich umfasst nicht nur die 25 EU-Mitgliedstaaten<br />
auf dem europäischen Kontinent, sondern auch die Überseeregionen einiger EU-<br />
Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Guadeloupe, Martinique oder Französisch-<br />
Guayana. Darüber hinaus gibt es bestimmte Sonderregelungen in den Erklärun-<br />
1<br />
Davon ausgenommen sind jedoch nach Absatz 2 einige besondere Bestimmungen der Beitrittsverträge,<br />
auf die in zwei Protokollen im Anhang der Verfassung eingegangen wird. Sie<br />
enthalten weiterhin geltende Übergangs- und Sonderregelungen.<br />
2<br />
Zu den Organen der EU gehören: Europäisches Parlament, Europäische Kommission, Europäischer<br />
Rat, Ministerrat, Europäischer Gerichtshof, Europäische Zentralbank.<br />
300 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
gen Nr. 28, 43 und 45, die sich auf die französische Insel Mayotte, die Niederländischen<br />
Antillen, Aruba und Gibraltar beziehen.<br />
Artikel 441: Regionale Zusammenschlüsse<br />
Artikel 441 besagt, dass die Verfassung mit den bestehenden regionalen Zusammenschlüssen<br />
zwischen Belgien und Luxemburg bzw. Belgien, Luxemburg<br />
und den Niederlanden vereinbar ist.<br />
Artikel 442: Protokolle und Anhänge<br />
Laut Artikel 442 sind auch die Protokolle und Anhänge Bestandteil der Verfassung.<br />
Sie sind sehr umfassend, das heißt insgesamt länger als die vier eigentlichen<br />
Teile der Verfassung, und gehören auch zum Primärrecht. Damit haben<br />
sie den gleichen Rang wie alle anderen Bestandteile der Verfassung.<br />
Insgesamt gibt es 36 Protokolle. Über die zurzeit geltenden Protokolle zum<br />
EG-, EU- und EAG-Vertrag hinaus haben Konvent und Regierungskonferenz<br />
auch noch neue Protokolle erarbeitet. 3 Dazu kommen zwei Anhänge. Anhang I<br />
bezieht sich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse 4 und Anhang II betrifft die<br />
überseeischen Länder und Hoheitsgebiete. 5<br />
Artikel 443: Ordentliches Änderungsverfahren<br />
Nach Artikel 443 können das Europäische Parlament, die Regierungen der Mitgliedstaaten<br />
oder die Europäische Kommission Entwürfe zu Vertragsänderungen<br />
vorlegen. Diese werden vom Europäischen Rat geprüft, der über das<br />
weitere Verfahren mit einfacher Mehrheit beschließt.<br />
Entscheidet sich der Europäische Rat für die weitere Prüfung eingereichter Vorschläge,<br />
ist er nach Absatz 2 grundsätzlich verpflichtet einen Konvent nach Vorbild<br />
des Verfassungskonvents einzuberufen. Dieser Konvent einigt sich im Konsensverfahren<br />
auf eine Empfehlung für eine sich anschließende Regierungskonferenz.<br />
Betrachtet der Europäische Rat jedoch die Einberufung eines Konvents<br />
aufgrund des Umfangs der geplanten Änderungen für nicht gerechtfertigt, kann<br />
er ebenfalls mit einfacher Mehrheit und nach Zustimmung des Europäischen<br />
Parlaments auf die Einberufung des Konvents verzichten. Die Vertragsänderungen<br />
werden dann ausschließlich von einer Regierungskonferenz erarbeitet.<br />
Absatz 3 legt fest, dass die in einer Regierungskonferenz vereinbarten Änderungen<br />
erst dann in Kraft treten, wenn sie von allen Mitgliedstaaten ratifiziert<br />
worden sind. In Absatz 4 wird erstmals geregelt, was passiert, wenn nicht alle<br />
3<br />
So erstellte der Konvent bspw. das Protokoll Nr. 2 zur Subsidiarität und die Regierungskonferenz<br />
das Protokoll zur Aufhebung und Weitergeltung des primären EU-Rechts (vgl. CIG<br />
50/03 ADD 2).<br />
4<br />
Artikel 226.<br />
5<br />
Teil III Titel IV.<br />
Berg 301
Artikel 437-448<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren den Vertragsänderungen zustimmen:<br />
Sofern mindestens vier Fünftel der Staaten ratifiziert haben und in einem<br />
oder mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten aufgetreten sind, muss sich der<br />
Europäische Rat mit der Frage befassen.<br />
Artikel 444: Vereinfachtes Änderungsverfahren<br />
Artikel 444 ist ein gänzlich neuer Bestandteil des neuen europäischen Regelwerks.<br />
Er sieht vor, dass die Beschlussfassung, das heißt Fragen des Abstimmungsmodus<br />
und der Rechtsetzung bestimmter Bereiche in Teil III der Verfassung<br />
vereinfacht geändert werden können. Das Besondere daran ist, dass der<br />
Abstimmungsmodus der Verfassung ohne eine Regierungskonferenz abgeändert<br />
werden darf. Auf diese Weise kann der Europäische Rat beispielsweise den<br />
Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit im Ministerrat<br />
und von einem besonderen zu einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<br />
beschließen. Ausgenommen von diesem Verfahren sind Beschlüsse mit militärischen<br />
und verteidigungspolitischen Bezügen. Der Europäische Rat darf den entsprechenden<br />
Beschluss aber nur erlassen, wenn er zuvor die Zustimmung der<br />
nationalen Parlamente eingeholt hat. Lehnt auch nur ein einziges nationales<br />
Parlament ab, ist das Verfahren zu beenden. Schließlich muss der Europäische<br />
Rat die Abänderung einstimmig treffen und auch das Europäische Parlament<br />
muss seine Zustimmung erteilen.<br />
Artikel 445: Vereinfachtes Änderungsverfahren betreffend die internen<br />
Politikbereiche der Union<br />
Artikel 445 sieht vor, dass auch die internen Politikbereiche der Union in Teil<br />
III Titel III einem vereinfachten Änderungsverfahren unterliegen. Dies ist eine<br />
neue Regelung im EU-Recht und ermöglicht genauso wie Artikel 444 Änderungen<br />
der Verfassung ohne Einberufung einer Regierungskonferenz. Das vereinfachte<br />
Änderungsverfahren gilt für den Binnenmarkt, die Wirtschafts- und<br />
Währungspolitik, die so genannte Politik in anderen Bereichen 6 , den Raum der<br />
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie für die Bereiche, in denen die<br />
Europäische Union Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen<br />
beschließen kann. 7 Im Fall dieser Art des vereinfachten Änderungsverfahrens<br />
benötigt der Europäische Rat nicht die Zustimmung der nationalen<br />
Parlamente. Auch das Europäische Parlament muss nur gehört werden.<br />
Allerdings tritt auch hier der Beschluss des Europäischen Rates erst nach der<br />
Zustimmung der Mitgliedstaaten in Kraft.<br />
6<br />
Zum Beispiel Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt und Verbraucherschutz.<br />
7<br />
Das sind z.B. die Bereiche Gesundheitswesen, Industrie, Kultur, Tourismus, Jugend, Sport und<br />
berufliche Bildung. Vgl. hierzu auch den Text von Christian Wenning und Florian Ziegenbalg<br />
„Zuständigkeiten der Union“.<br />
302 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
Um den Bedenken bezüglich einer „schleichenden“ Kompetenzverschiebung<br />
zugunsten der EU entgegenzuwirken, wird im letzten Absatz des Artikels<br />
explizit verboten, dass eine derartige Änderung der Verfassung zu einer<br />
Ausdehnung der der Union übertragenen Zuständigkeiten führt.<br />
Artikel 446: Geltungsdauer<br />
Nach Artikel 446 gilt die Verfassung auf unbegrenzte Zeit. Damit bringen die<br />
Nationalstaaten zum Ausdruck, dass sie bereit sind, dauerhaft auf einen Teil<br />
nationaler Souveränität zugunsten der Europäischen Union zu verzichten.<br />
Artikel 447: Ratifikation und Inkrafttreten<br />
Artikel 447 unterscheidet sich nicht von der bisherigen Form der Ratifizierung<br />
von europäischen Verträgen. 8 Er legt fest, dass die Verfassung erst in Kraft tritt,<br />
wenn sie in allen EU-Mitgliedstaaten gemäß den dort geltenden verfassungsrechtlichen<br />
Vorschriften ratifiziert wurde. Frühestens tritt die Verfassung am<br />
1. November 2006 in Kraft.<br />
Die verschiedenen nationalen verfassungsrechtlichen Vorschriften sehen unterschiedliche<br />
Verfahren vor. In allen Ländern ist eine Abstimmung im Parlament<br />
vorgesehen, welche in einigen Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer<br />
Volksabstimmung gekoppelt ist.<br />
In einer Erklärung zu den Schlussakten der Verfassung stellt die Regierungskonferenz<br />
fest, dass der Europäische Rat sich mit dem Thema befassen muss,<br />
wenn nach Ablauf von zwei Jahren nach Unterzeichnung der Verfassung vier<br />
Fünftel der Mitgliedstaaten den Vertrag unterzeichnet haben und in einem oder<br />
mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten<br />
sind.<br />
Artikel 448: Verbindliche Fassungen und Übersetzungen<br />
Artikel 448 legt fest, dass die Verfassung in die 21 EU-Amtsprachen authentisch<br />
zu übersetzen ist. Neu hinzugefügt wurde die Regelung, wonach die<br />
Verfassung zusätzlich zu den EU-Amtssprachen in jede weitere nationale<br />
Amtssprache der Mitgliedstaaten übersetzt werden kann, zum Beispiel in<br />
Spanien auch ins Baskische und Katalanische.<br />
8<br />
Vgl. Artikel 52 EU-Vertrag und Artikel 313 EG-Vertrag.<br />
Berg 303
Artikel 437-448<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Und zum Abschluss ein Referendum?<br />
Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Allgemeinen und<br />
Schlussbestimmungen einer Verfassung nicht mehr als formaltechnische<br />
Zusatzdetails sind. So versteht es sich fast von selbst, dass mit dem Inkrafttreten<br />
der Verfassung die bisherigen EU-Verträge aufgehoben, die<br />
rechtliche Kontinuität und die Rechtsnachfolge gesichert sowie Übergangsregelungen<br />
für bestimmte Organe festgelegt werden. 9 Ebenso wenig<br />
überrascht der Hinweis auf den räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich<br />
und die Verbindlichkeit der Verfassung. 10 Diese genannten Regelungen<br />
gleichen in ihrer politischen Bedeutung eher dem „Kleingedruckten“<br />
eines Vertrages.<br />
Im deutlichen Kontrast dazu stehen die ebenfalls hier geregelten Fragen<br />
nach der Ratifikation sowie der zukünftigen Änderung der Verfassung. 11<br />
Beide Fragen sind von großer politischer Tragweite und wurden bereits<br />
während der Beratungen im Verfassungskonvent kontrovers diskutiert.<br />
Insbesondere die Frage nach dem richtigen Verfahren der Ratifikation<br />
verdient unsere größte Aufmerksamkeit, da sie letztendlich den Charakter<br />
der Europäischen Union widerspiegelt. Sie gibt uns Aufschluss über die<br />
Machtfrage in Europa, denn sie zeigt uns, wer über die grundlegendste<br />
Entscheidung, das heißt über die Annahme der Europäischen Verfassung<br />
befinden darf. Sind es die Bürgerinnen und Bürger Europas, die direkt<br />
über die Annahme der Verfassung in einem Referendum entscheiden oder<br />
sind es deren Repräsentativorgane, die Parlamente?<br />
Warum kein Europäisches Referendum?<br />
Nach der Unterzeichnung der Europäischen Verfassung am 29. Oktober<br />
2004 durch die europäischen Staats- und Regierungschefs ist der europäische<br />
Verfassungsgebungsprozess noch längst nicht abgeschlossen. Die<br />
womöglich schwierigste Etappe steht erst noch bevor. Artikel 447 sieht<br />
vor, dass die Verfassung frühestens zum 1. November 2006 in Kraft treten<br />
kann, sofern sie von jedem EU-Mitgliedstaat nach dem in seiner Verfas-<br />
9<br />
Vgl. Artikel 437 bis 439.<br />
10<br />
Vgl. Artikel 440, 446 und 448.<br />
11<br />
Vgl. Artikel 443 bis 445 sowie 447.<br />
304 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
sung vorgeschriebenen Verfahren ratifiziert 12 , das heißt angenommen<br />
wurde. 13 Da auch die Europäische Verfassung formal betrachtet ein völkerrechtlicher<br />
Vertrag zwischen Staaten ist, „ein Vertrag über eine<br />
Verfassung für Europa“, bedarf es der Vertragsratifizierung im Sinne<br />
des Völkerrechts. Ratifizierung meint danach „die an die Partner eines<br />
völkerrechtlichen Vertrags gerichtete Mitteilung eines Staates, dass der<br />
Vertrag innerstaatlich in Kraft gesetzt worden ist.“ 14<br />
Doch welche genauen Handlungsanweisungen lassen sich aus diesem<br />
doch recht allgemein gehaltenen Artikel 447 ableiten? Konkret bedeutet<br />
dies: Es bedarf in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Zustimmung durch<br />
das nationale Parlament. Über die rein parlamentarische Ratifizierung<br />
hinaus sehen einige Verfassungen Volksabstimmungen vor. In der Mehrzahl<br />
der EU-Mitgliedstaaten ist es aber keine juristische, sondern vor allem<br />
eine politische Entscheidung, ob man die jeweilige nationale Verfassung<br />
dahingehend verändert, den Weg für eine Volksabstimmung zu<br />
eröffnen oder nicht. Diese in vielen Mitgliedstaaten juristisch unbestimmte<br />
„Grauzone“ entfachte schon vor der Unterzeichung der Verfassung<br />
im Oktober 2004 in ganz Europa intensive Debatten 15 über die<br />
vermeintlich einfache Frage, warum eigentlich kein europäisches Referendum<br />
über die Verfassung durchgeführt werde.<br />
Dabei ist die Forderung nach mehr Demokratie in Europa, das heißt nach<br />
einer größeren und effektiveren Beteiligung der europäischen Bürger am<br />
EU-Integrationsprozess keineswegs neu. Bereits 1960 erklärte der damalige<br />
französische Staatspräsident Charles de Gaulle: „Europe will be born<br />
on the day on which the different peoples fundamentally decide to join. It<br />
will not suffice for members of parliaments to vote for ratification. It will<br />
require popular referendums, preferably held on the same day in all the<br />
countries concerned.” 16 Ebenso sprach sich 1984 der italienische Vordenker<br />
und Föderalist Altiero Spinelli dafür aus, eine Europäische Verfassung<br />
unmittelbar durch die Bürger ratifizieren zu lassen. Und in diesem Sinne<br />
betonte auch der Präsident des Verfassungskonvents Valéry Giscard<br />
12<br />
Der Begriff „Ratifizieren“ entstammt dem lateinischen Wort „ratificatio“, das so viel bedeutet<br />
wie „Bestätigung“.<br />
13<br />
Artikel 447 unterscheidet sich damit im Kern nicht von der bisherigen Form der Ratifizierung<br />
von europäischen Verträgen. Vgl. Artikel 52 EU-Vertrag und Artikel 313 EG-Vertrag.<br />
14<br />
Brockhaus 1992, 80.<br />
15<br />
Vgl. Maurer 2005.<br />
16<br />
Zitiert nach CONV 658/03, Annex, 3.<br />
Berg 305
Artikel 437-448<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
d’Estaing gleich zu Beginn des Konvents in seiner Eröffnungsrede am 28.<br />
Februar 2002, dass Verträge von Staaten beschlossen, eine Verfassung<br />
jedoch von den Bürgern geschlossen werde. 17 Dabei konnte er sich auch auf<br />
die Erklärung von Laeken berufen, in der die Notwendigkeit nach einer<br />
politischen, bürgernäheren und demokratischeren Union ausdrücklich und<br />
mehrfach gefordert wird.<br />
Nach heutigem Kenntnisstand wird die Ratifikation der Verfassung aber<br />
nur in zehn der 25 EU-Mitgliedstaaten durch ein Referendum erfolgen,<br />
in den restlichen Ländern ratifizieren ausschließlich die Parlamente 18 –<br />
so zum Beispiel auch in Deutschland, obwohl sich eine große Mehrheit<br />
der Bevölkerung 19 und viele Verfassungsexperten 20 für ein Referendum<br />
aussprechen.<br />
Für eine Volksabstimmung spricht, dass ein EU-Verfassungsreferendum<br />
eine einmalige historische Chance wäre, die Bürger „mitzunehmen“, das<br />
heißt aktiv am europäischen Projekt zu beteiligen und damit aus der noch<br />
vornehmlich elitengesteuerten Union eine „Union der Bürger“ zu machen.<br />
Ein Referendum würde zudem eine breite öffentliche Debatte 21 und eine<br />
groß angelegte Informationskampagne über die EU und die Verfassung mit<br />
sich bringen. Für eine Volksabstimmung spricht darüber hinaus, dass die<br />
Europäische Verfassung viele Änderungen bewirkt, die die Souveränität<br />
der Mitgliedstaaten weiter beschneiden werden (z.B. durch weitere<br />
Kompetenzabgaben an die Europäische Union). Erst eine direkte Zustimmung<br />
der Bürger würde dafür eine angemessene Akzeptanzgrundlage und<br />
Legitimität schaffen können.<br />
Ferner überrascht die Forderung nach einem Referendum über die Europäische<br />
Verfassung nicht, da es das allgemein übliche Verfahren ist, eine<br />
Verfassung in Kraft zu setzen. Es entspricht der europäischen Rechtstradition<br />
und dem Prinzip der Volkssouveränität, dass im Verfassungsgebungsprozess<br />
die Bürger als so genannter „pouvoir constituant“ (verfassunggebende<br />
Gewalt) auftreten. In der Praxis wird deshalb entweder die<br />
verfassunggebende Versammlung direkt vom Volk gewählt oder die<br />
17<br />
SN 1565/02.<br />
18<br />
Vgl. hierzu die Tabelle zur Ratifikation im Text von Annett Jagiela in diesem Band.<br />
19<br />
Einige Umfrageergebnisse für Deutschland finden sich unter http://www.mehr-demokratie.<br />
de/300.html (20.06.2005).<br />
20<br />
Vgl. den Aufruf von Staatsrechtslehrern für ein Referendum über die EU-Verfassung in<br />
Deutschland, in: Juristische Wochenschrift 2004, Nr. 11, IV.<br />
21<br />
Vgl. Habermas 2001.<br />
306 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
Verfassung in einem Volksentscheid direkt vom Volk beschlossen. Da die<br />
EU-Bürger keinerlei Gelegenheit hatten, die Mitglieder des Konvents<br />
direkt zu bestimmen, scheint es geboten, die Verfassung der Europäischen<br />
Union ihnen als dem eigentlichen Souverän zur Abstimmung vorzulegen.<br />
Vor allem aber ist eine Verfassung aufgrund ihres Inhaltes den Bürgern<br />
vorzulegen: Eine Europäische Verfassung ist sowohl von ihrer rechtlichen<br />
und politischen Bedeutung als auch von ihrer Ausrichtung auf die Bürgerinnen<br />
und Bürger 22 nicht mit den bisherigen Verträgen der EU/EG<br />
gleichzusetzen. In einer Verfassung verständigen sich die Bürgerinnen<br />
und Bürger über Inhalt, Grenzen, Organisation, Ausgestaltung und<br />
Verteilung politischer Macht. Wenn die EU in Zukunft nicht mehr nur<br />
eine Union der Staaten sein will, dann bedarf es der Legitimation des<br />
Verfassungstextes durch die Bürgerinnen und Bürger selbst in einem<br />
Referendum. Erst dann ist eine wirkliche Akzeptanz der Verfassung und<br />
des europäischen Integrationsprozesses längerfristig zu erwarten.<br />
Aus der Sicht derjenigen, die einem Referendum skeptisch gegenüberstehen,<br />
besteht bereits eine hinreichende Legitimation durch Konvent und<br />
Regierungskonferenz. 23 Außerdem sei eine Volksabstimmung nicht notwendig,<br />
da die EU-Verfassung keine „echte“ Verfassung sei, sondern nur<br />
ein internationaler Grundlagenvertrag, der nicht die Zustimmung des<br />
Volkes benötige. Gleichzeitig sei es zu arbeits- und kostenintensiv, eine<br />
erfolgreiche Bildungs- und Informationskampagne zu starten. Nicht zuletzt<br />
wird an der Entscheidungskompetenz der Bürger gezweifelt und die Gefahr<br />
gesehen, dass die Bürger letztlich nicht über die EU-Verfassung abstimmen,<br />
sondern über den Türkeibeitritt, oder sie ihrer jeweiligen Regierung<br />
einen Denkzettel für ihre Politik verpassen wollen. Des Weiteren bringen<br />
die Gegner häufig ein strategisches Argument ein: Sie schätzen das Risiko<br />
eines Scheiterns der Ratifizierungsphase durch ein negatives Abstimmungsergebnis<br />
in einem Mitgliedstaat als sehr hoch ein. Ihrer Ansicht<br />
nach verhindert ein Referendum eine zügige Ratifizierung und damit ein<br />
fristgerechtes Inkrafttreten der Verfassung.<br />
22<br />
Artikel 1 der Verfassung nennt neben den EU-Mitgliedstaaten erstmals auch die EU-Bürger als<br />
Quelle europäischer Souveränität.<br />
23<br />
Vgl. Altmaier 2003.<br />
Berg 307
Artikel 437-448<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Was passiert nach einem negativen Referendum?<br />
Prinzipiell wäre das Ratifikationsverfahren gescheitert, wenn ein Mitgliedstaat<br />
die Europäische Verfassung nicht annimmt. Denn, wie oben<br />
gezeigt, sehen die Schlussbestimmungen zur Ratifikation weiterhin die<br />
Einstimmigkeit, das bedeutet die Zustimmung aller Mitgliedstaaten vor.<br />
Die Durchführung eines Referendums unterscheidet sich im Ergebnis<br />
nicht vom parlamentarischen Ratifikationsverfahren. So könnte die Verfassung<br />
ebenso wenig in Kraft treten, wenn auch nur ein Parlament, zum<br />
Beispiel der polnische Sejm, gegen die Verfassung stimmte. 24 Dennoch<br />
würde niemand auf die Idee kommen, das parlamentarische Ratifikationserfordernis<br />
in Frage zu stellen.<br />
In der der Verfassung angefügten Erklärung Nr. 30 liest man hierzu: Sollten<br />
zwei Jahre nach Unterzeichnung bereits vier Fünftel der Staaten die<br />
Verfassung ratifiziert haben, „aber in einem der Mitgliedstaaten oder mehreren<br />
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten<br />
sein“ sein, „so befasst sich der Europäische Rat mit der Frage“. Hierbei<br />
handelt es sich um eine verbriefte Einladung an alle Mitgliedstaaten, sich<br />
mit denjenigen Ländern 25 zu beraten, in denen die Annahme der Verfassung<br />
abgelehnt wurde. Bei einem solchen Treffen würde man um eine<br />
politische Lösung ringen, denn dieser Absichtserklärung liegt keine handlungsanweisende<br />
Rechtskraft zugrunde, mit der das Prinzip der Einstimmigkeit<br />
eingeschränkt werden könnte. Wie eine solche politische Lösung<br />
aussehen könnte, weiß niemand, und von offizieller Regierungsseite wird<br />
immer wieder betont, dass es keinen „Plan B“ gäbe. 26<br />
Ein Stocken des Ratifikationsprozesses aufgrund eines negativen Referendums<br />
würde Europa wohl in eine Krise führen. Es wäre nicht gelungen,<br />
die Bürger von der Verfassung zu überzeugen und die EU müsste<br />
weiterhin auf der Basis des Vertrages von Nizza arbeiten. Allerdings<br />
könnte eine solche Krise auch die Chance dazu bieten, aus den vergangenen<br />
Fehlern zu lernen, einen neuen demokratischeren und transparenter<br />
organisierten Konvent einzusetzen und den Verfassungstext zu überarbeiten.<br />
Die durch die Ablehnung sichtbar gewordenen Schwachstellen des<br />
europäischen Projekts könnten dann gezielter angegangen werden. In die-<br />
24<br />
Verschiedene Studien sehen die Zustimmung des polnischen und tschechischen Parlaments als<br />
gefährdet an. Vgl. Kurpas/Incerti/Schönlau 2005.<br />
25<br />
Es dürften höchstens vier Staaten sein, die die Verfassung noch nicht ratifiziert haben.<br />
26<br />
Vgl. Thalmaier 2005.<br />
308 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
sem Zusammenhang wird zum Beispiel vorgeschlagen, die Verfassung zu<br />
„verschlanken“, indem man den unübersichtlichen und schwer zu vermittelnden<br />
Teil III aus der Verfassung herausnimmt. 27 Bei einer grundlegenden<br />
Veränderung der Verfassung müsste man allerdings den gesamten<br />
Ratifikationsprozess neu aufrollen.<br />
Die Erfahrungen der europäischen Integrationsgeschichte zeigen aber<br />
auch, dass ein einzelnes negatives Referendum noch nicht das Ende des<br />
Ratifikationsprozesses bedeuten muss, da in den Mitgliedstaaten – so<br />
geschehen 1993 in Dänemark und 2002 in Irland – zweimal über EU-<br />
Vertragsrevisionen abgestimmt werden kann. Dabei wurden für die<br />
zweite Abstimmung bestimmte Änderungen am Text vorgenommen, die<br />
den entsprechenden Staaten Ausnahmen (so genanntes Opting-out) einräumen.<br />
28<br />
Zweitens wäre es theoretisch auch möglich, dass ein Staat, der der Verfassung<br />
nicht zustimmt, aus der EU austritt, um die anderen Länder nicht an<br />
einer tieferen Integration zu hindern. Umgekehrt, so schlägt der französische<br />
Außenminister Michel Barnier vor, könnten aber auch bei einer Ablehnung<br />
in einem oder zwei Staaten die restlichen 23 oder 24 Staaten austreten<br />
und „außerhalb der Unionsverträge in einer neuen Konstruktion“ 29<br />
kooperieren. Keine dieser Optionen wurde bislang praktiziert, denn sie<br />
verstoßen gegen die nach wie vor gültigen Regel der Einstimmigkeit. Ein<br />
Austrittsrecht ist erst in der neuen Verfassung vorgesehen, also erst<br />
anwendbar, wenn die Verfassung ratifiziert ist. 30 Wenn ein Mitgliedstaat<br />
jedoch freiwillig aus der EU austreten möchte, wird man ihn allerdings<br />
kaum davon abhalten können. Barniers Plan gibt bereits einen Vorgeschmack<br />
darauf, wie ein „Plan B“ aus Sicht der Regierungsvertreter aussehen<br />
könnte.<br />
Verfassungsänderungen ohne parlamentarische Ratifikation?<br />
In Zukunft bedürfen Verfassungsänderungen im Normalfall auch weiterhin<br />
der einstimmigen Ratifikation aller Mitgliedstaaten. Es gibt jedoch<br />
auch Ausnahmen: Die Verfassung enthält im Unterschied zu den bisherigen<br />
Verträgen zwei als Passarelle bezeichnete Möglichkeiten, Teile der<br />
27<br />
Vgl. Spinant 2005.<br />
28<br />
Diese Ausnahmeregelungen wurden über spezielle Erklärungen geregelt, so dass der<br />
Vertragstext unangetastet bleibt.<br />
29<br />
Michel Barnier zitiert nach Vannahme 2004.<br />
30<br />
Vgl. zum Austrittsrecht den Text von Florentina Bodnari in diesem Band.<br />
Berg 309
Artikel 437-448<br />
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Verfassung ohne das bisherige Erfordernis der Einstimmigkeit und der<br />
Ratifikation abzuändern. Da wäre zunächst das „vereinfachte Änderungsverfahren“,<br />
mit dem ermöglicht wird, einerseits vom Einstimmigkeitsprinzip<br />
zur qualifizierten Mehrheit und andererseits vom besonderen zum<br />
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren überzugehen. 31 Voraussetzung ist ein<br />
einstimmiger Beschluss des Europäischen Rates und die Zustimmung des<br />
Europäischen Parlamentes. Jedes nationale Parlament hat ein Vetorecht.<br />
Ein nationales Referendum – wie es bei Vertragsreformen in einigen<br />
Mitgliedstaaten sogar vorgeschrieben ist – wäre aber nicht nötig. So könnte<br />
beispielsweise der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen im Bereich<br />
der GASP vereinfacht vollzogen werden.<br />
Die zweite Möglichkeit ist das so genannte „vereinfachte Änderungsverfahren<br />
betreffend die internen Politikbereiche der Union“ 32 . Danach ist es<br />
möglich, 154 der 321 Bestimmungen des Teils III der Verfassung (ausgenommen<br />
sind vor allem die GASP und die institutionellen Bestimmungen)<br />
ohne eine Regierungskonferenz und ohne Zustimmung des Europäischen<br />
Parlaments zu ändern, sofern es dabei nicht zu einer Ausdehnung der<br />
Zuständigkeiten der Union kommt. Alle Mitgliedstaaten müssen einem solchen<br />
einstimmigen Ratsbeschluss zustimmen. Im Unterschied zum ordentlichen<br />
Verfassungsänderungsverfahren 33 wird nicht von „Ratifikation“,<br />
sondern lediglich von „Zustimmung“ gesprochen. Es bleibt daher unklar,<br />
ob für eine Verfassungsänderung die Zustimmung der nationalen<br />
Parlamente bzw. durch ein Referendum erforderlich ist.<br />
Ausblick<br />
Es wird deutlich, dass die Verfassung ihre schwierigste Feuerprobe erst<br />
noch zu bestehen hat, da die Ratifizierungsphase gemäß Artikel 447 noch<br />
lange nicht abgeschlossen ist. Dies ist keine einfache Situation, denn es<br />
ähnelt einer „Herkulesaufgabe“, die Mehrheit der Europäer von der Verfassung<br />
zu überzeugen. Dazu gibt es jedoch keine Alternative, denn eine<br />
Verfassung ist erst dann eine Verfassung, wenn sie vom Souverän, den<br />
Bürgerinnen und Bürgern getragen wird. Zweitens kann die europäische<br />
Verfassung ohne die Einbeziehung der Bürger nicht erreichen, was sie laut<br />
der Erklärung von Laeken erreichen sollte: Europa demokratischer und<br />
31<br />
Artikel 444.<br />
32<br />
Artikel 445.<br />
33<br />
Artikel 443.<br />
310 Berg
Allgemeine und Schlussbestimmungen<br />
Artikel 437-448<br />
bürgernäher zu machen. Solange Europa die Bürger nur in der Zuschauerrolle<br />
duldet, werden Ablehnung und Europamüdigkeit in der Bevölkerung<br />
weiter zunehmen. Umgekehrt gilt: Ein europäisches Referendum über die<br />
Verfassung ist eine auf absehbare Zeit nicht wiederkehrende Chance, die<br />
Bürger am Bau des vereinten Europas zu beteiligen und damit in Europa ein<br />
Fundament im Sinne einer transnationalen Demokratie zu schaffen. Dieses<br />
fundamentale Anliegen hat der Europäische Rat am 18. Juni 2004 nur halbherzig<br />
behandelt und den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen. 34 Man hat<br />
es verpasst, die Ratifikation europaweit zu koordinieren. Anstatt eine<br />
Abstimmung aller Unionsbürger am gleichen Tage zu organisieren, stimmt<br />
nur etwas mehr als die Hälfte der Unionsbürger in nationalen Referenden<br />
ab. Den anderen Unionsbürgern bleibt dieses grundlegende Mitbestimmungsrecht,<br />
direkt abzustimmen, gänzlich verwehrt.<br />
Sollte es dazu kommen, dass der Verhandlungstext neu verhandelt werden<br />
muss, dann darf man sich nicht erneut die Chance entgehen lassen, alle<br />
Unionsbürger über die Verfassung entscheiden zu lassen. In diesem Falle<br />
sollte von vornherein klar sein, dass der neu auszuhandelnde Text sich<br />
einem europaweiten Referendum stellen muss. Damit würden die politisch<br />
Verantwortlichen von Anfang an stärker gezwungen sein, auf die Verständlichkeit<br />
und Vermittelbarkeit des Verfassungstextes zu achten – eine<br />
elementare Voraussetzung, um die Bürgerinnen und Bürger für die Verfassung<br />
langfristig zu gewinnen und Europa auf eine stabile Grundlage zu<br />
stellen.<br />
Literatur: Abromeit, Heidrun (2002): Wozu braucht man Demokratie? Die postnationale<br />
Herausforderung der Demokratietheorie – Opladen. Altmaier, Peter (2003): Ein würdiges<br />
Verfahren für einen großen Vertrag, in: Dokumente 2003/05, S. 1–4. Habermas, Jürgen<br />
(2001): Warum braucht Europa eine Verfassung?, in: DIE ZEIT vom 08.06.2001. Kurpas,<br />
Sebastian/Incerti, Marc/Schönlau, Justus (2005): What Prospects for the European<br />
Constitutional Treaty? Monitoring the Ratification Debates – Results of an EPIN Survey of<br />
National Experts, unter: www.epin.org/pdf/WP12_KurpasIncertiSchoenlau.pdf (20.06.2005).<br />
Maurer, Andreas et al. (2005): Ratifikationsverfahren zum EU-Verfassungsvertrag, Stiftung<br />
Wissenschaft und Politik – Berlin. Spinant, Dana (2005): What to do if the French vote „Non“,<br />
in: European Voice vom 14.04.2005, S. 7. Thalmaier, Bettina (2005): Optionen für einen<br />
Fall B für den Fall des Scheiterns der Ratifikation des Verfassungsvertrages, CAP-Working-Paper.<br />
Vannahme, Joachim Fritz (2004): Aus eins macht zwei, oder: Europa vor der Sezession, in:<br />
DIE ZEIT, Nr. 36 vom 26.08.2004.<br />
34<br />
Vgl. Erklärung der Staats- und Regierungschefs Nr. 30.<br />
Berg 311
Autorinnen und Autoren<br />
Moritz Alt, geboren 1976 in Berlin,<br />
studierte Rechtswissenschaften in Potsdam<br />
und Berlin und kam über seine<br />
Arbeit im Europaausschuss des Deutschen<br />
Bundestages zu dem Buchprojekt.<br />
Carsten Berg, geboren 1975 in Freiburg<br />
im Breisgau, ist Diplom-<br />
Politikwissenschaftler und war für<br />
Mehr Demokratie e.V. im Verfassungskonvent<br />
tätig. Derzeit arbeitet er für<br />
democracy international in Brüssel und<br />
ist Lehrbeauftragter an der Universität<br />
Potsdam.<br />
Stefan Evers, geboren 1979 in<br />
Herdecke/Ruhr, studiert Rechtswissenschaften<br />
mit Schwerpunkt Europa- und<br />
Völkerrecht an der Universität Potsdam<br />
und ist seit 2002 Mitarbeiter von<br />
MdB Werner Kuhn. Seit 2003 übt er<br />
daneben selbständig verschiedene Beratungstätigkeiten<br />
aus und arbeitete zudem<br />
für den ehemaligen Regierungssprecher<br />
Friedhelm Ost sowie für den<br />
Landrat des Kreises Paderborn und den<br />
Europaparlamentarier Elmar Brok.<br />
Ann-Kathrin Fischer, geboren 1977<br />
in Bückeburg, studierte Politikwissenschaften<br />
an der Universität Potsdam<br />
und in Frankreich, arbeitete im Europäischen<br />
Parlament und ist derzeit für<br />
den Deutschen Bundesjugendring tätig.<br />
Ihr Buch „Legitimation der Europäischen<br />
Union durch eine Verfassung?“<br />
erschien 2004 beim LIT Verlag.<br />
Dr. Lutz Hager, geboren 1973 in<br />
Hamburg, studierte Politik- und Sozialwissenschaften<br />
in Göttingen, am<br />
Amherst College, an der Freien Universität<br />
Berlin sowie am Institut<br />
d'Etudes Politiques in Paris (Sciences<br />
Po). Er hat über direkte Demokratie<br />
promoviert, war von 2003–2004 Bundesvorsitzender<br />
der Jungen Europäischen<br />
Föderalisten e.V. und arbeitet<br />
derzeit als Unternehmensberater.<br />
Dr. Florentina Harbo, geboren 1977<br />
in Kiew, ist Politologin, machte ihren<br />
Master in European and International<br />
Studies in Nizza und Berlin, promovierte<br />
an der Freien Universität Berlin<br />
über vergleichenden Föderalismus und<br />
die EU, ist dort am Otto-Suhr-Institut<br />
Dozentin und forscht derzeit über „Das<br />
Austrittsrecht – ein aföderales Prinzip?“.<br />
Ihr Buch „Towards a European<br />
Federation? EU in the Light of Comparative<br />
Federalism“ erscheint 2005 (Nomos<br />
Verlagsgesellschaft).<br />
Annett Jagiela, geboren 1977 in Görlitz,<br />
studierte Journalismus und Politikwissenschaften<br />
(Schwerpunkte: EU<br />
und USA) in West Palm Beach (USA),<br />
Berlin und Prag. Sie absolvierte Praktika<br />
im Deutschen Bundestag, der<br />
Landesvertretung Sachsen in Berlin,<br />
beim Council on Foreign Relations in<br />
Washington DC. und arbeitete als freie<br />
Journalistin für die Sächsische Zeitung.<br />
Georg Kristian Kampfer, geboren<br />
1975 in Ankara, Doktorand, studierte<br />
Rechts- sowie Politikwissenschaft mit<br />
Europabezug an den Universitäten<br />
Göttingen, Bonn, Potsdam und Speyer.<br />
Er war zunächst bei europa-digital.de<br />
und dann als Rechtsreferendar in der<br />
Ständigen Vertretung Deutschlands bei<br />
312
Autorinnen und Autoren<br />
der Europäischen Union in Brüssel<br />
zuständig für Fragen zur Europäischen<br />
Verfassung.<br />
Beatrice Kolp, geboren 1978 in Berlin,<br />
studierte Politik, Literatur und Linguistik<br />
in Rostock sowie Potsdam, arbeitete<br />
als Mitarbeiterin von MdB Jörg<br />
Vogelsänger, als Nachrichtenredakteurin<br />
bei n-tv sowie bei CNN in Berlin<br />
und Washington und ist derzeit Journalistin<br />
und Juniorberaterin in einer<br />
PR-Agentur in Berlin.<br />
Stephan Korte, geboren 1977 in<br />
Bielefeld, ist Diplom-Jurist und derzeit<br />
Rechtsreferendar, studierte Rechtswissenschaften<br />
mit den Schwerpunkten<br />
Rechtsphilosophie, Staats- und<br />
Verfassungsrecht, Europa- und Völkerrecht<br />
in Frankfurt am Main. Er ist stellvertretender<br />
Kreisvorsitzender der JEF<br />
Frankfurt am Main.<br />
Jan Kreutz, geboren 1980 in Berlin,<br />
studiert Politikwissenschaft an der<br />
Freien Universität Berlin, war bis 2003<br />
Vizepräsident der JEF Europe und ist<br />
heute Mitglied des Vorstands des Europäischen<br />
Jugendforums. Er nahm als<br />
Zuschauer regelmäßig an den Konventssitzungen<br />
teil und warb für die<br />
JEF für eine föderalistische Verfassung.<br />
Tina Löffelsend, geboren 1978 in<br />
Düsseldorf, studierte Politikwissenschaft<br />
in Berlin und Washington DC.<br />
Sie arbeitete als Wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag<br />
und ist derzeit im Europäischen<br />
Parlament tätig.<br />
Anna Lührmann, geboren 1983 in<br />
Lich, Studentin an der FernUni Hagen,<br />
war Mitglied des Jugendkonventes in<br />
Brüssel und ist als Abgeordnete des<br />
Deutschen Bundestages Mitglied im<br />
Haushaltsausschuss. Bis zum Sommer<br />
2002 hat sie für Bündnis 90/Die<br />
Grünen im Ausschuss für die Angelegenheiten<br />
der Europäischen Union<br />
den Verfassungsprozess begleitet.<br />
Nicole Meßmer, geboren 1978 in<br />
Scherzingen (Schweiz), ist Mitarbeiterin<br />
der Europaabgeordneten Rebecca<br />
Harms. Die ehemalige stellvertretende<br />
Bundesvorsitzende und Pressesprecherin<br />
der Jungen Europäischen Föderalisten<br />
e.V. machte im letzten Jahr ihr<br />
Diplom in Politikwissenschaften an<br />
der Freien Universität in Berlin. Ihre<br />
Schwerpunkte sind Europa- und Entwicklungspolitik.<br />
Luise Papcke, geboren 1984 in<br />
Münster, studiert Politikwissenschaft<br />
an der Freien Universität Berlin und<br />
ist stellvertretende Bundesvorsitzende<br />
der Jungen Europäischen Föderalisten<br />
e.V.<br />
Tamara Ritter, geboren 1974 in Hamburg,<br />
studierte Politikwissenschaft an<br />
der Universität Potsdam und am<br />
Institut d’Etudes Politiques in Paris<br />
(Sciences Po). Sie arbeitete im<br />
Deutschen Bundestag und in der französischen<br />
Assemblée Nationale und ist<br />
seit mehreren Jahren bei der Heinrich-<br />
Böll-Stiftung tätig.<br />
Dr. Reinhard Ruge, LL.M., geboren<br />
1974 in Berlin, ist Syndikusanwalt in<br />
der Kartellrechtsabteilung der Deutsche<br />
Bahn AG. Er studierte Rechtswissenschaften<br />
an den Universitäten Passau,<br />
Jena und London, war Lehrbeauftragter<br />
für Europarecht an der Uni-<br />
313
Autorinnen und Autoren<br />
versität Jena und veröffentlichte zahlreiche<br />
Beiträge zum Europarecht.<br />
Sebastian Peter Sass, geboren 1974<br />
in Hamburg, Jurist, arbeitete als Projektleiter<br />
„Europäische Wirtschaftsund<br />
Währungsunion“ in der Verbraucherzentrale<br />
Hamburg und als Mitarbeiter<br />
beim Wissenschaftlichen<br />
Dienst des Deutschen Bundestages.<br />
Derzeit ist er Sekretär für internationale<br />
Angelegenheiten im Parlament<br />
der Finnischen Republik.<br />
Annegret Katharina Schäfer, geboren<br />
1977 in Koblenz, studierte Volkswirtschaftslehre<br />
an der Dublin City<br />
University (DCU) und an der Universität<br />
Trier.<br />
Marc Schreiner, Ass. iur., LL.M.<br />
(Europäische Integration), geboren<br />
1974 in Mainz, studierte Rechtswissenschaften<br />
an den Universitäten<br />
Mainz und Dresden und arbeitete zunächst<br />
im Europäischen Parlament<br />
sowie im Landtag von Rheinland-<br />
Pfalz. Jetzt ist er bei einer Unternehmensberatung<br />
in Brüssel tätig.<br />
Tobias Schwab, geboren 1981 in Göppingen,<br />
studiert an der Freien Universität<br />
Berlin Politikwissenschaft, war<br />
1996–2001 freier Autor der Neuen<br />
Württembergischen Zeitung Göppingen,<br />
nach zwei Praktika bei der Parlamentarischen<br />
Staatssekretärin beim<br />
Bundesminister des Inneren Ute Vogt,<br />
MdB, arbeitet er heute neben seinem<br />
Studium im Bundestagsbüro der Parlamentarischen<br />
Staatssekretärin bei der<br />
Bundesministerin für Gesundheit und<br />
Soziale Sicherung Marion Caspers-<br />
Merk, MdB.<br />
Jan Seifert, geboren 1979 in Pinneberg,<br />
studierte Sozialwissenschaften<br />
an der Berliner Humboldt-Universität<br />
und Staatswissenschaften in Uppsala.<br />
Von 2002–2003 war er Bundesvorsitzender<br />
der Jungen Europäischen<br />
Föderalisten e.V. und arbeitet heute<br />
als Consultant und politischer Assistent.<br />
Julia Strese, licenciée en droit, geboren<br />
1976 in Karlsruhe, studierte<br />
Rechtswissenschaften in Heidelberg<br />
und Montpellier. Als Mitarbeiterin am<br />
Heidelberger Institut für deutsches<br />
und europäisches Gesellschafts- und<br />
Wirtschaftsrecht sowie in ihrer Dissertation<br />
beschäftigte sie sich mit europarechtlichen<br />
Fragestellungen und verbrachte<br />
als Referendarin am Berliner<br />
Kammergericht eine Stage bei der<br />
Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen<br />
Kommission.<br />
Christian Wenning, geboren 1974 in<br />
Münster/Westfalen, Politologe (M.A.),<br />
ist Bundesvorsitzender der Jungen<br />
Europäischen Föderalisten e.V. und<br />
arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
im Deutschen Bundestag.<br />
Florian Ziegenbalg, geboren 1977 in<br />
Wiesbaden, ist Stipendiat am College<br />
of Europe in Brügge. Er studierte Politik-<br />
und Rechtswissenschaften sowie<br />
Geschichte mit dem Regionalschwerpunkt<br />
„Europa“ an der Universität<br />
Tübingen und war Mitarbeiter im<br />
Arbeitsstab „Konvent“ des Staatsministeriums<br />
Baden-Württemberg. Als<br />
stellvertretender Bundesvorsitzender<br />
der Jungen Europäischen Föderalisten<br />
e.V. kümmert er sich um programmatische<br />
Fragen.<br />
314
Danksagung<br />
Wir danken<br />
Bernd Hüttemann und der Europa-Union Deutschland, Christian Wenning<br />
und dem Bundesvorstand der Jungen Europäischen Föderalisten sowie<br />
Jochen Rummenhöller und dem Deutschen Bundesjugendring für das<br />
Fundament, auf dem dieses Buch entstanden ist; dem beim W. Bertelsmann<br />
Verlag für Erwachsenenbildung und den Bereich „Politik“ zuständigen<br />
Ansgar Scholl für die zahlreichen E-Mails, Telefonate, Gespräche in Berlin<br />
und seine Geduld; der Lektorin Barbara Neises und der Produktmanagerin<br />
Sonja Rosenberg für die professionelle Umsetzung unserer Gestaltungswünsche<br />
und die Sorgfalt; Stefan Göbel für den Aufbau und die Betreuung<br />
der Homepage www.verfassung-europa.de zu diesem Buch; Professor<br />
Jürgen Meyer für die Durchsicht der Texte zur Grundrechtecharta; Silvia<br />
Pernice für die Durchsicht des Glossars; für Informationen über die Praxis<br />
der Europäischen Verteidigungspolitik Herrn Fregattenkapitän Karl<br />
Michael Setzer; für Informationen zum Alltag im Ministerrat dem Leiter<br />
der Abteilung Finanzen in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik<br />
Deutschland bei der Europäischen Union Herrn Wilhelm Rißmann;<br />
Dr. Richard Himmer, Jutta Mues, Lars Bosselmann, Georg W. Kampfer,<br />
Nina Florack, Silke Bigalke und Hella Berg für die Überprüfung der Texte<br />
auf Verständlichkeit sowie für eine erste Bewertung des Gesamtkommentars<br />
Dr. Michael Kambeck, Percy Ehlert und Wolfram von Heynitz.<br />
Für die Arbeit in der Redaktionsleitung zu diesem Buch danken wir Moritz<br />
Alt für sein großes Engagement und ganz besonders Ann-Kathrin Fischer<br />
für ihren unschätzbaren Einsatz bei der verlässlichen und einwandfreien<br />
Umsetzung dieses Buchprojektes.<br />
315
Glossar<br />
Glossar<br />
Das Amt des Außenministers der Union wird durch die ➞ Europäische Verfassung<br />
geschaffen. Er soll von den Staats- und Regierungschefs ernannt werden<br />
und die ➞ Europäische Union in außenpolitischen Belangen vertreten. Der<br />
Außenminister ist zugleich Vizepräsident der Kommission und sitzt im Ministerrat<br />
allen Außenministern der Mitgliedstaaten vor. Bei seiner Arbeit kann er<br />
sich auf einen ➞ Europäischen Auswärtigen Dienst stützen.<br />
Die Einheitliche Europäische Akte, kurz EEA, wurde von den damals zwölf<br />
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft im Februar 1986 beschlossen<br />
und trat am 1. Juli 1987 in Kraft. Ihr Ziel war es, einen europaweit einheitlichen<br />
Binnenmarkt bis Ende 1993 zu schaffen. Dieses Ziel wurde durch den Abbau<br />
von Handelsbarrieren zwischen den Mitgliedstaaten erreicht. Die Schaffung<br />
von europaweit einheitlichen Regeln wurde durch die Verträge von ➞ Maastricht<br />
(1993), ➞ Amsterdam (1999) und ➞ Nizza (2003) weiter vorangetrieben.<br />
Darauf folgt nun die ➞ Europäische Verfassung.<br />
Eurojust ist eine europäische Koordinierungsstelle, die die Zusammenarbeit<br />
der Strafverfolgung zwischen Mitgliedstaaten der ➞ Europäischen Union verbessert.<br />
Das Tätigkeitsfeld umfasst schwere Straftaten, die die EU oder mindestens<br />
zwei Mitgliedsstaaten betreffen. Die Arbeit von Eurojust basiert auf<br />
den Informationen und den Tätigkeiten der nationalen Strafverfolgungs- und<br />
Ermittlungsbehörden sowie ➞ Europol.<br />
Der erst mit Inkrafttreten der ➞ Europäischen Verfassung arbeitsfähige Europäische<br />
Auswärtige Dienst, kurz EAD, wird die Arbeit des neuen ➞ Europäischen<br />
Außenministers unterstützen. In dem europäischen Außenministerium<br />
werden Beamte der ➞ Europäischen Kommission, des ➞ Ministerrates und der<br />
nationalen diplomatischen Dienste in regionalen und fachlichen Abteilungen<br />
gemeinsam arbeiten. Die Auslandsvertretungen der Europäischen Kommission<br />
werden voraussichtlich zu EU-Botschaften.<br />
Der Europäische Gerichtshof, kurz EuGH, ist ein unabhängiges Organ der<br />
Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg, dem ein Richter je Mitgliedstaat<br />
angehört, zur Zeit sind es also 25 Richter. Der EuGH wendet das europäische<br />
Recht auf die ihm vorgetragenen Fälle an und legt dieses aus, um problematische<br />
Rechtslagen zu klären. Da er durch seine oft pro-europäische Vertragsauslegung<br />
eine europafreundliche Rechtsfortbildung betreibt, wird er als „Motor der<br />
Integration“ bezeichnet. Der EuGH wird seit 1989 vom Gericht erster Instanz<br />
unterstützt. Die ➞ Europäische Verfassung erleichtert Bürgern und Unternehmen<br />
die Klage auch in Fällen, in denen sie nicht selbst betroffen sind.<br />
316
Glossar<br />
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, ist ein<br />
Organ des ➞ Europarates mit Sitz in Straßburg. Der EGMR ist zuständig für<br />
Klagen bei Verstößen gegen die ➞ Europäische Konvention zum Schutze der<br />
Menschenrechte und Grundfreiheiten.<br />
Ein europäisches Organ, das die Interessen der gesamten EU wie eine<br />
Europäische Regierung vertritt und wahrt, ist die Europäische Kommission<br />
mit Sitz in Brüssel. Sie ist der Motor der ➞ Europäischen Union, denn sie<br />
schlägt Rechtsvorschriften, politische Maßnahmen und Aktionsprogramme vor<br />
und ist für die Umsetzung der<br />
Beschlüsse des ➞ Europäischen<br />
Parlaments und des ➞<br />
Ministerrates verantwortlich.<br />
An ihrer Spitze steht der Kommissionspräsident.<br />
Unter ihm<br />
befinden sich zahlreiche<br />
Generaldirektionen, denen jeweils<br />
wieder ein Kommissar<br />
oder eine Kommissarin aus<br />
einem Mitgliedsland vorsteht.<br />
Die ➞ Europäische Verfassung<br />
sieht die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das ➞ Europäische<br />
Parlament und die Schaffung eines Europäischen Außenministers als<br />
Vizepräsidenten der Kommission vor.<br />
Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und<br />
Grundfreiheiten, kurz EMRK, ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der von den<br />
Mitgliedern der internationalen Organisation ➞ Europarat am 4. November<br />
1950 in Rom unterzeichnet wurde und am 3. September 1953 in Kraft trat.<br />
Die Konvention enthält Grundrechte, welche vor dem ➞ Europäischen<br />
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg direkt eingeklagt werden können.<br />
Die EMRK wurde von allen Mitgliedstaaten der ➞ Europäischen Union angenommen.<br />
Das Europäische Parlament, kurz EP, tagt in Straßburg und Brüssel. Die Mitglieder<br />
des EPs wurden das erste Mal bei der Europawahl 1979 auf fünf Jahre<br />
direkt von den Bürgern gewählt. Sie sollen die Interessen der Bürger in der<br />
Europäischen Union vertreten. Dazu sind sie gemeinsam mit dem Ministerrat<br />
an der europäischen Rechtsetzung beteiligt. Sie verabschieden, genehmigen<br />
und überwachen – den jährlichen Haushaltsplan der EU, kontrollieren die<br />
Arbeit der ➞ Europäischen Kommission, wobei sie die Kommission zum<br />
Rücktritt auffordern können.<br />
317
Glossar<br />
Mit Inkrafttreten der ➞<br />
Europäischen Verfassung<br />
wählen sie den Kommissionspräsidenten.<br />
Derzeit<br />
kommen im EP 732<br />
Abgeordnete (davon 99<br />
aus Deutschland) in unterschiedlichen<br />
Länder übergreifenden<br />
Fraktionen zusammen.<br />
Die Entstehung<br />
von europäischen Parteien<br />
ist in ihren Anfängen.<br />
Bei dem Europäischen Rat handelt es sich um die Treffen aller Staats- und<br />
Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Sie legen unter Mitwirkung des<br />
Präsidenten der Europäischen Kommission die Ziele und Prioritäten der europäischen<br />
Politik fest und beschließen Änderungen des ➞ Primärrechts. Die<br />
Treffen finden mindestens zweimal pro Jahr, nach der ➞ Europäischen<br />
Verfassung sogar vierteljährlich, in der Regel in Brüssel statt. Der Europäische<br />
Rat ist nicht dasselbe EU-Organ wie der ähnlich klingende Rat der<br />
Europäischen Union (➞ „Ministerrat“).<br />
Eine Europäische Staatsanwaltschaft kann ausgehend von ➞ Eurojust eingerichtet<br />
werden. Hierzu bedarf es eines Europäischen Gesetzes, das der<br />
Ministerrat einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes<br />
beschließen kann. Die Anklage würde vor den nationalen Gerichten erfolgen.<br />
Die Einrichtung einer EU-Staatsanwaltschaft ist bislang an dem Veto Großbritanniens<br />
gescheitert.<br />
Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main und die Zentralbanken<br />
der 25 EU-Mitgliedstaaten bilden zusammen das Europäische System<br />
der Zentralbanken, kurz ESZB. Die Aufgaben des ESZB bestehen darin, die<br />
Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen, die Währungsreserven<br />
der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten sowie das reibungslose<br />
Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern und zu überwachen. Ziel<br />
des ESZB ist es, die Preisstabilität in der ➞ Europäischen Union sicherzustellen<br />
und ohne Beeinträchtigung dieses Ziels ➞ die EU bei ihrer Wirtschaftspolitik<br />
zu unterstützen.<br />
Die Europäische Union, kurz Union oder EU, ist ein Zusammenschluss europäischer<br />
Staaten, die das Ziel verfolgen, den Frieden, europäische Werte und<br />
das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Die EU wurde durch den ➞ Vertrag<br />
318
Glossar<br />
von Maastricht (1993) gegründet. Der erste Baustein des Hauses „Europäische<br />
Union“ wurde jedoch bereits im Jahr 1950 gelegt, als der französische<br />
Außenminister Robert Schumann unter dem Eindruck der Folgen des Zweiten<br />
Weltkrieges die Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und<br />
Stahl“ vorschlug. Mit ihr wurde die Eisen- und Stahlindustrie, einst Motor der<br />
Rüstungsproduktion, von sechs europäischen Staaten (Belgien, Frankreich,<br />
Deutschland, Italien, Luxemburg und den Niederlanden) unter die Kontrolle<br />
einer unabhängigen ➞ Europäischen Kommission gestellt. Die EU-Mitgliedstaaten<br />
haben inzwischen zahlreiche weitere Organe eingerichtet, durch<br />
die sie Angelegenheiten auf europäischer Ebene regeln. Die EU hat eine eigene<br />
Flagge, eine Hymne, einen Leitspruch, eine Währung und einen eigenen<br />
Feiertag. Mit dem Inkrafttreten der → Europäischen Verfassung bekommen die<br />
Unionsbürger auch europäische Grundrechte. Die EU ist kein neuer Staat, welcher<br />
an die Stelle der bestehenden Staaten tritt. Sie ist aber mehr als eine internationale<br />
Organisation wie die NATO oder die Vereinten Nationen. Die Unterscheidung<br />
zwischen einem europäischen Staatenverbund und einem europäischen<br />
Bundesstaat wird jedoch zukünftig immer schwerer.<br />
Die Europäische Verfassung hebt alle bestehenden europäischen Verträge auf.<br />
Erarbeitet wurde sie von dem ➞ Verfassungskonvent und einer anschließenden<br />
➞ Regierungskonferenz. Am 29. Oktober 2004 unterschrieben die Staats- und<br />
Regierungschefs der ➞ Europäischen Union die Verfassung. Sie stärkt die<br />
Handlungsfähigkeit der Union, gibt den Bürgern neue Grundrechte und baut<br />
den Parlamentarismus in Europa aus: Das ➞ Europäische Parlament erhält<br />
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, der Deutsche Bundestag und der Bundesrat<br />
können vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, wenn die EU unrechtmäßig<br />
nationale Aufgaben übernimmt. Die Verfassung stärkt die direkte Demokratie:<br />
1.000.000 Bürger können die ➞ Europäische Kommission auffordern, für sie<br />
ein Gesetz zu erarbeiten. Die Verfassung macht die Europäische Union verständlicher:<br />
Sie führt vier europäische Verträge zusammen und verwendet an<br />
vielen Stellen einfache Begriffe. Ein Novum sind auch die Ämter eines<br />
Präsidenten und eines ➞ Außenministers der EU. Die Europäische Verfassung<br />
tritt frühestens Mitte 2007 in Kraft, wenn sie bis dahin von allen Mitgliedstaaten<br />
angenommen wurde.<br />
Die europäische Polizeibehörde Europol wurde 1995 durch einen völkerrechtlichen<br />
Vertrag geschaffen, um die polizeiliche Zusammenarbeit in Europa zu<br />
verbessern. War Europol bislang nur durch ihre Informationssammlungs- und<br />
-analyseaufgaben bekannt, gibt es in der Verfassung eine Rechtsgrundlage,<br />
durch die der Gesetzgeber Europol operative Befugnisse einräumen kann.<br />
Nach dem Prinzip des Föderalismus gibt es in einem Gemeinwesen mehrere<br />
Ebenen, die jeweils selbstständig politische Entscheidungen treffen. Auf die<br />
➞ Europäische Union angewandt bedeutet dies, dass politische Macht zwar<br />
319
Glossar<br />
gemeinsam auf europäischer Ebene ausgeübt, gleichzeitig aber den Mitgliedstaaten<br />
Autonomie zugestanden wird. Föderalismus begrenzt Machtmissbrauch,<br />
integriert Minderheiten und löst Probleme mit größtmöglicher<br />
Beteiligung der Menschen.<br />
Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, kurz GASP, ist<br />
der ➞ Ministerrat zuständig. Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten arbeiten<br />
dort zusammen, um eine außenpolitisch handlungsfähige ➞ Europäische<br />
Union zu schaffen, die internationale Verantwortung übernimmt. Damit die EU<br />
nach außen mit einer Stimme spricht, wurde das Amt des Hohen Vertreters der<br />
GASP (derzeit Javier Solana) geschaffen. Dieser wird mit der ➞ Europäischen<br />
Verfassung zum ➞ Außenminister der Union. Obgleich der Ministerrat im<br />
Bereich der GASP auch nach der Verfassung grundsätzlich einstimmig<br />
beschließt, können die Außenminister mittels der ➞ Passarelle-Klausel die<br />
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit einführen. Hiervon ausgenommen<br />
ist die Militär- und Verteidigungspolitik. Die europäische Außenpolitik<br />
wird weiter an Bedeutung gewinnen.<br />
Als Gipfeltreffen wird eine Konferenz der führenden Politiker bezeichnet. In der<br />
Welt der Europapolitik meint man damit die Tagung des ➞ Europäischen Rates.<br />
Die vom ➞ Grundrechte-Konvent erarbeitete Grundrechtecharta der Europäischen<br />
Union wurde auf dem ➞ Gipfel von Nizza am 7. Dezember 2000 feierlich<br />
verkündet. Sie bildet den Teil II der ➞ Europäischen Verfassung und enthält<br />
europäische Grundrechte, auf die sich mit Inkrafttreten der Verfassung alle<br />
Unionsbürger berufen können. Die Charta enthält neben Menschen-, Freiheits-,<br />
Gleichheits- und Bürgerrechten auch soziale und justizielle Grundrechte.<br />
Auf ihrem ➞ Gipfeltreffen im Juni 1999 in Köln beschlossen die Staats- und<br />
Regierungschefs der ➞ Europäischen Union die Einsetzung des Grundrechte-<br />
Konvents. 62 Konventsmitglieder nahmen im ersten Konvent der EU am<br />
17. Dezember 1999 unter dem Vorsitz des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten<br />
Roman Herzog ihre Arbeit auf und legten nach einem Jahr im<br />
Oktober 2000 den Entwurf einer Grundrechtecharta vor. Aufgrund seiner erfolgreichen<br />
Arbeitsweise diente der Grundrechte-Konvent als Vorbild für den<br />
➞ Verfassungskonvent.<br />
Auf dem Gipfeltreffen in Kopenhagen wurden im Juni 1993 die Kopenhagener<br />
Kriterien von den Staats- und Regierungschefs der ➞ Europäischen Union aufgestellt.<br />
Es handelt sich hierbei um Kriterien, welche ein Land erfüllten muss,<br />
um Mitglied der EU zu werden. Die Kriterien sind: 1. politische Kriterien<br />
(institutionelle Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsschutz),<br />
2. wirtschaftliche Kriterien (Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit)<br />
und 3. das „Acquis-Kriterium“ (Übernahme des Europarechts).<br />
320
Glossar<br />
Korporatismus ist ein Ausdruck für die enge Verknüpfung von Akteuren der<br />
Interessenvermittlung (z.B. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände) mit<br />
dem Staat. Die Akteure treten dabei nicht in Konkurrenz zum Staat, sondern sitzen<br />
mit diesem am Verhandlungstisch.<br />
Neben dem Europäischen Parlament gibt es den Ministerrat, auch „Rat der Europäischen<br />
Union“ genannt, als Gesetzgebungsorgan der Europäischen Union.<br />
Im Gegensatz zum Europäischen<br />
Parlament kann er<br />
Entscheidungen in Bereichen<br />
treffen, die allein in der Hand<br />
der Mitgliedstaaten liegen,<br />
denn in seinen Räumlichkeiten<br />
tagen die Fachminister<br />
aller Mitgliedstaaten. Für<br />
Deutschland sind es die<br />
Bundesminister aus dem Kabinett<br />
von Bundeskanzler<br />
Gerhard Schröder, welche als<br />
Vertreter der Bundesregierung<br />
im Ministerrat verbindlich abstimmen. Die Verfassung schreibt vor, dass Ministerratstagungen<br />
in der Phase der abschließenden Gesetzgebung öffentlich<br />
sein müssen. Ansonsten tagen die Fachminister, genau wie die vorbereitenden<br />
etwa 250 Fachauschüsse und Arbeitsgruppen, hinter verschlossenen Türen. Der<br />
Ministerrat tagt oft am selben Ort wie der ➞ Europäische Rat, im Justus-<br />
Lipsius-Gebäude in Brüssel.<br />
Aufgrund der Passarelle-Klausel können durch einstimmigen Beschluss des<br />
Ministerrats Politikbereiche von der Einstimmigkeit in die qualifizierte<br />
Mehrheit überführt werden. Die Klausel ermöglicht weitere Integrationsschritte<br />
der ➞ Europäischen Union. Angewandt werden kann sie nach der<br />
➞ Europäischen Verfassung z.B. im Bereich der Gemeinsamen Außen- und<br />
Sicherheitspolitik.<br />
Das Primärrecht ist der Ursprung des europäischen Rechts. Zu ihm zählen die<br />
Gründungsverträge und ihre Ergänzungen, wie zum Beispiel der Vertrag zur<br />
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) und der ➞ Vertrag von<br />
Maastricht (EUV). Auch die ➞ Europäische Verfassung wird nach ihrem<br />
Inkrafttreten zum geltenden Primärrecht. Demgegenüber ist das Sekundärrecht<br />
europäisches Recht, welches durch die Rechtsetzung des ➞ Ministerrates und<br />
des ➞ Europäischen Parlaments auf Grundlage des Primärrechts geschaffen<br />
wird.<br />
321
Glossar<br />
Durch die Umgestaltung der Europäischen Union in einen Raum der Freiheit,<br />
der Sicherheit und des Rechts, kurz RFSR, wird die Freizügigkeit der<br />
Unionsbürger geschützt und schwere Kriminalität bekämpft. Dies geschieht<br />
durch die Anpassungen des Asyl- und Einwanderungsrechts der Mitgliedstaaten<br />
und die Stärkung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und<br />
Strafsachen sowie der polizeilichen Zusammenarbeit. Die ➞ Europäische Verfassung<br />
schafft einen gemeinsamen Rechtsrahmen für diese Politikfelder und<br />
stärkt die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Das<br />
Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark haben sich in der Verfassung<br />
Ausnahmeregelungen vorbehalten.<br />
Der europäische Gesetzgeber, ➞ Ministerrat und ➞ Europäisches Parlament,<br />
setzt europäisches Recht durch europäische Rechtsakte. Diese sind je nach bezweckter<br />
Wirkung von unterschiedlicher Art. Die ➞ Europäische Verfassung<br />
benennt 1. das Europäische Gesetz (früher: Verordnung) mit direkter Wirkung<br />
für die Bürger, 2. das Europäische Rahmengesetz (früher: Richtlinie) richtet<br />
sich an die Mitgliedstaaten und verpflichtet diese zur Erreichung eines Ziels,<br />
wobei sie selbst die konkrete Form und das Mittel bestimmen, 3. die Europäische<br />
Verordnung hat allgemeine Geltung und dient der Durchführung von<br />
Rechtsakten, 4. der Europäische Beschluss kann von der ➞ Europäischen<br />
Kommission zu Verwaltungszwecken genutzt werden, 5. und 6. die Empfehlung<br />
und die Stellungnahme, welche rechtlich unverbindlich und daher nur von<br />
politischer Bedeutung sind.<br />
Die Regierungskonferenz dient der inhaltlichen Vorbereitung eines ➞ Gipfeltreffens,<br />
bei dem die europäischen Staats- und Regierungsoberhäupter Entscheidungen<br />
treffen, welche der intensiven Vorbereitung bedürfen. Die Regierungskonferenz<br />
dient auch der Konsensfindung bei unterschiedlichen<br />
Interessen. Sie kann bei Änderung der europäischen Verträge Wochen oder gar<br />
Monate dauern.<br />
Um die Kontrollen an den Binnengrenzen schrittweise abzubauen, schlossen die<br />
Staaten Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande am<br />
14. Juni 1985 im luxemburgischen Schengen einen „Mobilitätspakt“ mit dem<br />
Namen Schengener Abkommen. Infolge des Abkommens fielen die Personenkontrollen<br />
an den Staatsgrenzen weg. Im Jahr 1990 wurden die sich durch den<br />
freien Personenverkehr zwischen den Unterzeichnerstaaten ergebenden Sicherheitsfragen<br />
in einem Durchführungsabkommen geklärt. Die Regeln des Abkommens<br />
wurden von der Europäischen Union übernommen und gelten jetzt für alle<br />
EU-Staaten bis auf Großbritannien, Irland und die neuen zehn Mitgliedstaaten.<br />
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt aus dem Jahr 1996 ist eine Art „Versicherungssystem“<br />
für die europäischen Bürger. Der Pakt verpflichtet die<br />
Mitglieder der Europäischen Währungsunion keine übermäßigen Schulden zu<br />
322
Glossar<br />
machen und die Inflationsrate nicht über 2 % ansteigen zu lassen. Der Pakt soll<br />
die Währungskursstabilität und damit die Kaufkraft des Euros sicherstellen.<br />
Nach dem Subsidiaritätsprinzip darf die Europäische Union nur dann tätig<br />
werden, wenn das Ziel einer Maßnahme durch die Mitgliedstaaten nicht mehr<br />
ausreichend erfüllt und besser auf der europäischen Ebene erreicht werden kann.<br />
Die Unionsbürgerschaft wurde durch den ➞ Vertrag von Maastricht eingeführt.<br />
Es handelt sich hierbei um ein Rechtsverhältnis zwischen den Staatsangehörigen<br />
eines EU-Mitgliedslandes und der Europäischen Union, in dessen Rahmen politische<br />
Rechte gewährleistet werden. Zu den politischen Rechten gehören das<br />
Recht der Freizügigkeit in allen Mitgliedstaaten, das Wahlrecht zum Europaparlament,<br />
das kommunale EU-Wahlrecht, das Beschwerderecht beim<br />
Europaparlament sowie der diplomatische EU-Schutz im Ausland.<br />
Der Verfassungskonvent war nach dem ➞ Grundrechte-Konvent der zweite<br />
Konvent in der Geschichte der Europäischen Union. Er nahm seine Arbeit am 28.<br />
Februar 2002 auf und präsentierte am 20 Juni 2003 die Teile I, II und IV und am<br />
18. Juli 2003 den Teil III eines Entwurfs der ➞ Europäischen Verfassung. Der<br />
Konvent setzte sich aus 105 Delegierten zusammen. Im Präsidium saßen der<br />
Präsident, Valéry Giscard d’Estaing, und zwei Stellvertreter. Das Plenum bestand<br />
aus 15 Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten (z.B. Außenminister Joschka<br />
Fischer), 30 nationalen Parlamentsabgeordneten (z.B. Professor Jürgen Meyer),<br />
16 Abgeordneten des Europäischen Parlaments (z.B. Elmar Brok) sowie zwei<br />
Mitgliedern der Kommission, 13 Regierungsvertretern der Beitrittsländer und<br />
26 Parlamentsabgeordneten der Beitrittsländer.<br />
Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip darf die Europäische Union immer<br />
nur die Maßnahmen durchführen, welche die Mitgliedstaaten am wenigsten<br />
belasten. So muss bei der europäischen Rechtsetzung zum Beispiel vor dem<br />
Erlass eines in allen Teilen verbindlichen unmittelbar geltenden Gesetzes (nach<br />
dem Nizza-Vertrag: „Verordnung“) geprüft werden, ob das gewünschte Regelungsziel<br />
nicht auch durch ein weniger einschneidendes Rahmengesetz (nach<br />
dem Nizza-Vertrag: „Richtlinie“) erreicht werden kann.<br />
Der Vertrag von Amsterdam wurde am 2. Oktober 1997 von den Staats- und<br />
Regierungschefs in Amsterdam beschlossen und trat am 1. Mai 1999 in Kraft. Er<br />
umfasst 150 Seiten, welche den bestehenden EU-Vertrag ergänzen. Die<br />
Europäische Union kümmert sich seither mehr um die Asyl-, Flüchtlings- und<br />
Justizpolitik. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wurde gestärkt und<br />
das Europäische Parlament entscheidet in einigen neuen Politikbereichen auf<br />
323
Glossar<br />
Augenhöhe mit dem ➞ Ministerrat. Als neues Ziel wurde die Umgestaltung der<br />
Europäischen Union in einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“<br />
aufgenommen. Die Rechte der europäischen Polizeibehörde ➞ Europol wurden<br />
gestärkt und das Amt eines Repräsentanten der Gemeinsamen Außen- und<br />
Sicherheitspolitik geschaffen (derzeit Javier Solana, sog. „Mr. GASP“). Die Anzahl<br />
der Mitglieder des Europäischen Parlaments wurde auf maximal 700 festgelegt.<br />
Der Vertrag von Maastricht oder auch „Vertrag über die Europäische Union“,<br />
kurz EU-Vertrag (EUV), wurde am 7. Februar 1992 von den Staats- und Regierungschefs<br />
in Maastricht beschlossen und trat am 1. November 1993 in<br />
Kraft. Die mit diesem Vertrag gegründete ➞ Europäische Union stützt sich auf<br />
drei Säulen: 1. Europäische Gemeinschaften, 2. Gemeinsame Außen- und<br />
Sicherheitspolitik und 3. Zusammenarbeit in der Innen- und Justizpolitik. Die<br />
Europäische Union ist in diesem Bilde eines „Drei-Säulen-Tempels“ das<br />
gemeinsame Dach. Aufgrund des Maastrichter Vertrages arbeiten die Mitgliedstaaten<br />
der EU verstärkt in der Innen- und Außenpolitik zusammen, die<br />
Kompetenzen des Europäischen Parlaments wurden erweitert und die Bürger<br />
zu ➞ Unionsbürgern. Auch enthält der Vertrag die „Maastrichter Kriterien“,<br />
welche erfüllt sein müssen, damit ein Mitgliedstaat den Euro einführen darf.<br />
Die ➞ Europäische Verfassung hebt im Hinblick auf eine weitere Europäisierung<br />
der Politik die Säulenstruktur auf.<br />
Nach einer „Nacht der langen Messer“ einigten sich die Staats- und Regierungschefs<br />
von damals noch 15 Mitgliedstaaten im Dezember 2000 auf den<br />
Vertrag von Nizza. Er wurde am 26. Februar 2001 unterzeichnet, trat jedoch<br />
erst zwei Jahre später, am 1. Februar 2003, in Kraft. Für Probleme hatte das<br />
Annahmeverfahren in den 15 Mitgliedstaaten gesorgt. So lehnten die Iren den<br />
Vertrag in einem Referendum zunächst ab und stimmten ihm erst zu, nachdem<br />
für ihr Land Sonderregelungen vorgesehen wurden. Der Nizza-Vertrag sorgte<br />
dafür, dass seit Januar 2005 jedes Mitgliedsland der EU nur noch einen Kommissar<br />
in die ➞ Europäische Kommission entsendet. Zudem kann nun der<br />
Kommissionspräsident jeden seiner Kommissare zum Rücktritt auffordern. Das<br />
Stimmengewicht im ➞ Ministerrat wurde zugunsten der bevölkerungsstarken<br />
Mitgliedstaaten neu gewichtet und auch die dortige europäische Rechtsetzung<br />
wurde in vielen Bereichen erleichtert, wie zum Beispiel im Bereich der justiziellen<br />
Zusammenarbeit in Zivilsachen oder in der Industriepolitik. Zudem<br />
wurde auch die Anzahl der Abgeordnetenmandate des ➞ Europäischen<br />
Parlaments pro Mitgliedstaat neu verteilt. Obgleich 13 Mitgliedstaaten Sitze<br />
verloren, behielt Deutschland seine 99 Europaabgeordneten. Die begonnene<br />
Etappe auf dem Weg des Reformprozesses der Union soll durch die<br />
➞ Europäische Verfassung abgeschlossen werden.<br />
324
Personen- und Sachverzeichnis<br />
Ahern, Bertie 12, 22<br />
Amato, Giuliano 9<br />
Amsterdamer-Vertrag 8, 99, 133,<br />
170, 174, 177, 189, 205, 213 f.,<br />
226, 230 f., 235, 254, 316, 323<br />
Außenminister der EU 37, 119, 127,<br />
133, 142, 150, 159, 191, 199, 316<br />
Ausschuss der Regionen 18, 39, 174 ff.<br />
Avantgarde 227<br />
Barcelona-Prozess 251<br />
Barnier, Michel 22, 154, 309<br />
Barroso, José Manuel 123<br />
Beitrittskriterien 254, 257, 262<br />
Beratende Einrichtungen<br />
der Union<br />
173 ff.<br />
Berlusconi, Silvio 22, 259<br />
Blair, Tony 24<br />
Bundesstaat 86, 258 ff., 319<br />
Bürgernähe 9, 94, 175 f., 181, 306,<br />
311<br />
Bürgerrechte 61, 96, 100, 214,<br />
268 f., 284 ff., 320<br />
Charta der Grundrechte der EU,<br />
siehe auch Grundrechtecharta<br />
der EU 27, 54, 65, 93, 96, 266 ff.<br />
Chirac, Jacques 22, 200, 227<br />
De Gaulle, Charles 227, 305<br />
Dehaene, Jean-Luc 9<br />
Demokratiedefizit 86, 143, 199,<br />
235 f., 262, 288<br />
Delors, Jacques 228, 244<br />
Doppelhut 124, 159, 192, 194<br />
Doppelte Mehrheit 13, 150 ff.<br />
EG-Vertrag (EGV) 109, 116 f., 129,<br />
156, 168, 177, 284 f., 289<br />
Eigenmittel der EU 244, 249<br />
Einheitliche Europäische Akte<br />
(EEA) 17, 99, 316<br />
Einstimmigkeit 41, 46, 147, 152 ff.,<br />
191, 194, 197 f., 211 ff., 226, 229 ff.,<br />
247, 254, 258, 302, 308 ff., 321<br />
Erklärung von Laeken, siehe auch<br />
Laeken 114, 186, 306, 310<br />
Erweiterung der EU, siehe auch<br />
Osterweiterung 3, 8, 179, 226, 248<br />
EU-Präsidentschaft 194<br />
Euratom 241<br />
Eurogruppe 173<br />
Eurojust 45, 212, 219, 221, 316, 318<br />
Europa der Bürger 4, 285 f., 288<br />
Europäische Atomgemeinschaft<br />
(EAG), siehe auch Euratom 301<br />
Europäische Gemeinschaft für Kohle<br />
und Stahl (EGKS) 18<br />
Europäische Gemeinschaft(en)<br />
(EG) 103, 115, 286, 324<br />
Europäische Integration 76, 97, 99,<br />
227, 232, 314<br />
Europäische Kommission 4, 8, 31,<br />
32, 35, 119, 122, 127, 137, 156 ff.,<br />
176, 252, 301, 317, 319, 324<br />
Europäische Menschenrechtskonvention<br />
(EMRK) 18, 93, 95 ff.,<br />
273, 289, 293, 317<br />
Europäische Sicherheits- und<br />
Verteidigungspolitik (ESVP) 204<br />
Europäische Stelle für justizielle<br />
Zusammenarbeit, siehe Eurojust<br />
325
Personen- und Sachverzeichnis<br />
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
(EWG) 99, 286<br />
Europäische Zentralbank<br />
(EZB) 38 ff., 69, 173, 176, 318<br />
Europäischer Diplomatischer<br />
Dienst 197<br />
Europäischer Gerichtshof (EuGH)<br />
32, 35, 37 f., 40, 54, 62, 67, 84, 93,<br />
95 f., 97 ff., 119 f., 124 f., 127,<br />
130 f., 138, 156, 158, 165 ff., 168,<br />
179, 204, 215, 287, 289, 292,<br />
295 ff., 300, 315 f., 319<br />
Europäischer Rat 119, 127, 144, 257<br />
– Brüssel (Dezember 2003) 11, 80<br />
– Brüssel (März 2004) 5<br />
– Feira (Juni 2000) 206<br />
– Helsinki (Dezember 1999) 206, 257<br />
– Köln (Juni 1999) 96, 206, 267,<br />
281, 320<br />
– Kopenhagen (Juni 1993) 320<br />
– Laeken (Dezember 2001) 114<br />
– Sevilla (Juni 2002) 149<br />
Europäischer Rechnungshof 39,<br />
174 ff., 249<br />
Europäisches Parlament 119, 143,<br />
184, 243, 322<br />
Europäisches System der Zentralbanken<br />
(ESZB) 173, 177, 318<br />
Europarat 54, 95, 217, 317<br />
Europol 45, 212, 219 ff., 316, 319, 324<br />
Fachminister 5, 119, 145 f., 321<br />
Finalität 262<br />
Finanzen der EU 12, 49, 149,<br />
243 ff., 315<br />
Fischer, Joschka 2, 123, 175, 231, 323<br />
Flexibilisierung, siehe auch<br />
Verstärkte Zusammenarbeit 226 f.<br />
Flexibilitätsklausel 31, 102, 109<br />
326<br />
Föderalismus 76, 85 f., 115, 120,<br />
126, 179, 258, 260, 312, 319 f.<br />
Föderation 116, 123<br />
Frühwarnsystem 102, 106 ff.<br />
Gaulle, Charles de 227, 305<br />
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik<br />
(GASP) 11, 13, 18, 29,<br />
31 ff., 115, 119, 122, 156, 170, 185,<br />
191 ff., 229, 310, 320, 323 f.<br />
Gemeinsame Sicherheits- und<br />
Verteidigungspolitik<br />
(GSVP) 122, 198, 202 ff., 224<br />
Genscher, Hans-Dietrich 231<br />
Gerichtshof der EU 4, 32, 35, 37 f.,<br />
54 ff., 84 ff., 127, 156, 163 ff., 300,<br />
316 ff.<br />
Gesetzgebungsverfahren 40 ff., 70,<br />
103, 108, 121 f., 132, 140, 155 f.,<br />
175, 183, 188 f., 214, 220, 302, 310<br />
Gewaltenteilung 120 ff., 164, 183 ff.<br />
Gipfel(treffen), siehe auch<br />
Europäischer Rat 11, 15, 80, 96,<br />
133 f., 149, 152, 208, 224, 257,<br />
267, 320 ff.<br />
Giscard d’Estaing, Valéry 1, 9, 11,<br />
76, 79, 89, 137, 257, 267, 305, 323<br />
Grundrechtecharta der EU 8, 11, 13,<br />
79, 96 f., 170, 215, 221, 234, 266 ff.<br />
Grundrechte-Konvent 267 ff., 320, 323<br />
Handlungsfähigkeit der EU 4, 86,<br />
108, 116, 130, 149, 152, 154, 189,<br />
194, 198, 202, 208, 247, 319<br />
Haushalt der EU 32 ff., 39, 49 ff.,<br />
119, 127 ff., 152, 155 ff., 211,<br />
243 ff., 313, 317<br />
Herzog, Roman 96, 267, 320<br />
Hoher Vertreter für die<br />
GASP 192, 210, 320
Personen- und Sachverzeichnis<br />
Initiativrecht 45, 119, 122, 125, 130,<br />
156, 191 f., 212 f., 235<br />
Inkrafttreten der Europäischen<br />
Verfassung 93, 142, 203 f., 223 f.,<br />
241, 245f., 247, 276, 282,<br />
300, 304, 307, 319 ff.<br />
Institutionelle Reformen 11<br />
Institutioneller Rahmen der EU 32<br />
Juncker, Jean-Claude 22, 227 f.<br />
Justizielle Rechte 63, 269, 289<br />
Justizielle Zusammenarbeit 115, 212,<br />
216 ff., 322<br />
Kerneuropa 198, 226, 228, 232<br />
Kissinger, Henry 124, 194<br />
Klaus, Václav 3<br />
Kommissionspräsident 123 ff., 140 ff.,<br />
154, 192, 240, 244, 317 f., 324<br />
Kommunalwahlrecht 288<br />
Kompetenzordnung<br />
Konvent, siehe Grundrechte-Konvent<br />
sowie Verfassungskonvent<br />
Konvent zur Zukunft Europas, siehe<br />
auch Verfassungskonvent 1, 8, 87<br />
Kopenhagener Kriterien 253,320<br />
Laeken 114, 116, 132, 186,<br />
189, 306, 310<br />
Left-overs von Amsterdam 8<br />
Maastrichter Vertrag 82, 84, 99, 171,<br />
233, 324<br />
Mehrheitsentscheidungen 130, 140,<br />
148 f., 152 f., 162, 212, 216 ff., 310<br />
Menschenwürde 25, 82, 87, 255,<br />
270 ff., 290<br />
Misstrauensvotum 131 f.<br />
Mitentscheidungsrecht 9, 119, 148,<br />
229, 250<br />
Mitentscheidungsverfahren 121,<br />
129 ff., 148, 183, 188 f., 214, 247<br />
Monnet, Jean 7<br />
Nationale Parlamente 107, 200<br />
NATO 204 ff., 319<br />
Nizza-Vertrag 199, 258, 323 f.<br />
Offene Methode der Koordinierung 90<br />
Osterweiterung 228, 253<br />
Parteien, europäische 240 ff.<br />
Passarelle-Klausel 191, 320 f.<br />
„Plan B“ 308 f.<br />
Prinzip der begrenzten<br />
Einzelermächtigung 28, 103 f., 112<br />
Qualifizierte Mehrheit 34 f., 46 f., 52,<br />
136, 146 f., 191, 197 ff., 226, 229 f.,<br />
321<br />
101 ff.<br />
Ratifizierung(sprozess) 2, 5, 14 ff.,<br />
153, 254, 296, 303 ff.<br />
Ratspräsident 123 ff., 196<br />
Ratspräsidentschaft, siehe auch EU-<br />
Präsidentschaft 81, 196<br />
Raum der Freiheit, der Sicherheit und<br />
des Rechts (RFSR) 25, 30, 45,<br />
54, 83, 112, 143, 212 ff.,<br />
266, 302, 322, 324<br />
Referendum 2 ff., 6, 15 ff., 304 ff.<br />
Regierungskonferenz 8 ff., 67, 80,<br />
97 ff., 105 ff., 115, 120, 133, 140 f.,<br />
150, 155 ff., 194, 198, 205, 209,<br />
301 ff., 310, 319, 322<br />
Römische Verträge 14, 95, 180, 257<br />
Rotation(sverfahren) 34 ff., 139, 143,<br />
149, 155 ff., 195<br />
Santer, Jacques 133<br />
Säulenmodell 114 f., 171<br />
327
Personen- und Sachverzeichnis<br />
Schengener Abkommen 214, 217,<br />
230, 322<br />
Schröder, Gerhard 2, 267, 321<br />
Solana, Javier 196, 210, 320, 324<br />
Solidaritätsklausel 5, 45, 202, 223 ff.<br />
Spaak, Paul-Henri 7<br />
Sperrminorität 35, 47, 53, 147, 152ff.<br />
Spinelli, Altiero 7, 305<br />
Staatenverbund 123, 250, 319<br />
Stabilitäts- und Wachstumspakt 8,<br />
248, 322<br />
Stimmengewichtung 12 f., 150, 152<br />
Strukturfonds 247<br />
Subsidiarität 28, 31, 54, 64, 101 ff.,<br />
130, 136, 175, 188, 258, 293 ff., 323<br />
Subsidiaritätsklage 102, 107<br />
Subsidiaritätsprinzip 28, 31, 54, 64,<br />
101 ff., 188, 293 ff., 323<br />
Transparenz 7 f., 20, 48, 76, 94, 98,<br />
109, 116, 126, 143, 149, 154 ff., 175,<br />
181 ff., 186 ff., 198, 210, 233 f., 243,<br />
248, 288 ff.<br />
Trichet, Jean Claude 173<br />
Türkei(beitritt) 5, 79, 236,<br />
252, 255 ff., 307<br />
Unionsbürgerschaft 27, 54, 78, 93 ff.,<br />
286, 288, 323<br />
Unterstützungs-, Koordinierungsund<br />
Ergänzungsmaßnahmen,<br />
siehe auch Zuständigkeiten der<br />
Union 31, 112 f., 116, 302<br />
Verfassungsgerichte, nationale 98,<br />
120, 292, 295 ff.<br />
Verfassungskonvent 1, 9, 11, 76 ff.,<br />
79, 96, 99, 105 ff., 114 ff., 120, 137,<br />
180, 216, 240 ff., 248, 257, 267, 301,<br />
304 ff., 312, 319 ff., 323<br />
328<br />
Verhältnismäßigkeitsprinzip 101 ff.,<br />
285, 290, 323<br />
Verstärkte Zusammenarbeit 46, 198,<br />
212, 218, 225 ff.<br />
Veto(recht) 108, 144, 203, 219, 230,<br />
237, 310, 318<br />
Volksabstimmung, siehe auch<br />
Referendum 3, 77, 303 ff.<br />
Wahlrecht 27, 61, 78, 94, 99, 128,<br />
134, 284, 288, 323<br />
Westeuropäische Union (WEU) 205<br />
Wirtschafts- und Sozialausschuss<br />
(WSA) 39, 175, 178 ff., 181, 234,<br />
239<br />
Wirtschafts- und Währungsunion<br />
(WWU) 78, 176, 230<br />
Zusammenarbeit<br />
– in Strafsachen 45, 115, 212, 217,<br />
219, 322<br />
– in Zivilsachen 216, 324<br />
Zuständigkeiten der Union 27 ff., 40,<br />
46, 64, 101 ff., 111 ff., 141, 171, 175,<br />
182 ff., 225, 310
Selbstdarstellung: Europa-Union Deutschland<br />
Mitwirken am Europa der Bürger<br />
Die Europa-Union (EUD) ist eine überparteiliche und unabhängige politische<br />
Nichtregierungsorganisation, die seit 1946 für eine weitreichende europäische<br />
Integration eintritt. Die Europa-Union gliedert sich in Landes-,<br />
Bezirks- und Kreisverbände mit rund 15.000 Mitgliedern. Sie vereint<br />
Bürgerinnen und Bürger aus allen demokratischen Parteien und parteilose<br />
Mitglieder.<br />
Das Ziel der europäischen Einigung soll von einem möglichst breiten<br />
gesellschaftlichen Konsens getragen werden. Überparteilichkeit und Bürgernähe<br />
stehen daher bei der Europa-Union Deutschland hoch im Kurs. Die<br />
Europa-Union Deutschland unterstützt insbesondere die parlamentarische<br />
Dimension der europäischen Integration. In der aktuellen Legislaturperiode<br />
sind 62 der 99 deutschen Europaparlamentarier Mitglied der Europa-Union<br />
(aus Bündnis90/Grüne, CDU, CSU, FDP, PDS und SPD).<br />
Die Europa-Union entwickelt europapolitische Stellungnahmen, beteiligt<br />
sich an internationalen Kampagnen (www.yes-campaign.net) und lädt zu<br />
Informationsveranstaltungen mit europäischem Themenbezug ein. Sie fördert<br />
ferner aktiv interkulturelle Projekte und Initiativen. Sie ist lokal und<br />
regional Mitveranstalter des „Europäischen Wettbewerbs“, an dem jedes<br />
Jahr über 200.000 Schüler teilnehmen.<br />
329
Jugendverband der Europa-Union sind die Jungen Europäischen Föderalisten.<br />
Ihr internationaler Verband ist mit dem Brüsseler Büro die Union<br />
Europäischer Föderalisten. Die Europa-Union ist Mitglied im <strong>Netzwerk</strong><br />
Europäische <strong>Bewegung</strong> Deutschland.<br />
Anschrift Berlin:<br />
Europa-Union Deutschland<br />
Jean-Monnet Haus<br />
Bundesallee 22<br />
10717 Berlin<br />
Tel.: +49-30-88676620<br />
Fax: +49-30-88412247<br />
www.europa-union.de<br />
330
Selbstdarstellung: Junge Europäische Föderalisten<br />
Deutschland e.V.<br />
Ob man will oder nicht, politische Entscheidungen, deren Auswirkungen<br />
wir in Bund, Land und Kommune spüren, werden zu einem erheblichen<br />
Teil durch die Europäische Union getroffen. Für viele Unternehmer ist eine<br />
gut funktionierende EU längst Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Für<br />
die Bürgerinnen und Bürger Europas gelten aber andere Maßstäbe, wie<br />
kürzlich in den Volksabstimmungen zur Europäischen Verfassung zu sehen<br />
war. Heute, in einer Krise der Europäischen Union, scheint klar, dass die<br />
europäischen Themen und das Wirken aus Brüssel besser vermittelt werden<br />
müssen. Doch braucht Europa auch aktive Bürger, die sich für ihre Politik<br />
stärker interessieren. Den europäischen Gedanken zu vermitteln und junge<br />
Menschen für ihre Zukunft in Europa zum Mitmachen zu bewegen sind seit<br />
über 50 Jahren wichtige Ziele der Jungen Europäischen Föderalisten – wir<br />
nehmen unsere Zukunft in Europa selbst in die Hand. Unser Einsatz für ein<br />
demokratisches, bürgernahes und föderales Europa wurde 2004 mit der<br />
Theodor-Heuss-Medaille geehrt.<br />
Über 25.000 Mitglieder im Alter zwischen 15 und 35 Jahren, die in 32 nationalen<br />
Sektionen der Jungen Europäischen Föderalisten/Young European<br />
Federalists/Jeunes Europeens Fédéralistes europaweit organisiert sind, versuchen<br />
gemeinsam eine Lobby für unsere Anliegen zu schaffen. Wir sind<br />
überparteilich, aber trotzdem politisch – und oft nicht einer Meinung, da<br />
sich bei uns junge Menschen mit verschiedenen politischen Überzeugungen<br />
finden. Was uns verbindet, ist das Ziel der friedlichen europäischen Einigung,<br />
damit die heutige Jugend eine starke Zukunft hat.<br />
Junge Europäische Föderalisten e.V. (JEF)<br />
Haus der Demokratie und Menschenrechte<br />
Greifswalder Str. 4<br />
10405 Berlin<br />
Tel.: 0 30/42 80 90 35 oder http://www.jef.de<br />
331
Selbstdarstellung: Deutscher Bundesjugendring<br />
Die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland stehen im<br />
Mittelpunkt der Arbeit des Deutschen Bundesjugendrings. Der Deutsche<br />
Bundesjugendring ist ein starkes <strong>Netzwerk</strong> der bundesweit tätigen<br />
Jugendverbände und der Landesjugendringe. Mit seinen 24 Mitgliedsorganisationen,<br />
5 Anschlussverbänden und den 16 Landesjugendringen repräsentiert<br />
der Deutsche Bundesjugendring die Vielfalt jugendlicher<br />
Belange und Forderungen – gegenüber Parlament und Regierung und auch<br />
als Lobby für junge Menschen in der Öffentlichkeit.<br />
Die Organisationen im Deutschen Bundesjugendring stehen für ein breites<br />
Spektrum jugendlichen Engagements – von konfessionellen über pfadfinderische,<br />
ökologische, kulturelle und humanitär geprägte Verbände bis hin<br />
zu den Arbeiterjugendverbänden. Bei allen Unterschieden: Der Alltag junger<br />
Menschen, ihre Probleme und Bedürfnisse stehen für alle gleichermaßen<br />
an erster Stelle.<br />
Getragen durch ehrenamtliches Engagement sind die Jugendverbände in<br />
Deutschland ein wichtiger Faktor im Bildungssystem. Statt Leistungs- und<br />
Notendruck setzen sie auf freiwilliges Lernen und eigene Initiative – gerade<br />
auch im Bereich der politischen Bildung. In den Verbänden des Deutschen<br />
Bundesjugendrings lernen Jugendliche demokratische Grundregeln und<br />
verantwortungsvolles Handeln.<br />
Die internationale Arbeit gehört zu einem Schwerpunkt der Tätigkeiten des<br />
Deutschen Bundesjugendrings. Der Deutsche Bundesjugendring unterhält<br />
zahlreiche bilaterale Beziehungen zu anderen Jugendringen weltweit und<br />
nimmt zu Fragen europäischer Jugendpolitik Stellung. Über das Deutsche<br />
Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit ist der Deutsche Bundes-<br />
332
jugendring zudem Mitglied in zahlreichen internationalen Jugendstrukturen<br />
bzw. arbeitet eng mit internationalen Institutionen wie der Europäischen<br />
Union, dem Europarat und den Vereinten Nationen mit ihren Unterorganisationen<br />
zusammen.<br />
Der Deutsche Bundesjugendring hält den Kontakt und Informationsfluss<br />
zwischen seinen Mitgliedern aufrecht. Mit gemeinsamen Positionen nimmt<br />
er Stellung zu jugendpolitischen Themen.<br />
Kontakt:<br />
Deutscher Bundesjugendring<br />
Mühlendamm 3<br />
10178 Berlin<br />
Telefon: 030/400 404-00<br />
Telefax: 030/400 404-22<br />
E-Mail: info@dbjr.de<br />
www.dbjr.de<br />
www.verfassung-<br />
europa.de<br />
Die Website zum Buch<br />
333
Deutschland Archiv –<br />
Zeitschrift für das vereinigte<br />
Deutschland<br />
Deutschland Archiv<br />
Zeitschrift für das vereinigte<br />
Deutschland<br />
ISSN 0012-1428<br />
6 Ausgaben pro Jahr<br />
mit jeweils 192 Seiten<br />
Jahresabonnement<br />
(6 Hefte) 39,– €<br />
Vorzugsabo für Studenten, Wehrund<br />
Ersatzdienstleistende 23,– €<br />
Einzelheft 8,– €<br />
Preise gelten inkl. MwSt., zzgl.<br />
Versandkosten.<br />
Deutschland Archiv ...<br />
... reflektiert die Geschichte der deutschen Teilung , der Deutschlandpolitik,<br />
der „Wende“ und der Vereinigung.<br />
... stellt die Situation in den neuen Bundesländern dar.<br />
... diskutiert differenziert, exemplarisch und vielschichtig die Befindlichkeiten,<br />
Identitäten und das zeitgeschichtliche Erbe der Deutschen.<br />
... wendet sich an ein Publikum, das an politischen, kulturellen und zeitgeschichtlichen<br />
Fragen interessiert ist.<br />
Fordern Sie Ihr kostenloses Probeexemplar an – zum Kennenlernen und<br />
Weiterempfehlen: Tel.: (05 21) 9 11 01-12 oder per E-Mail: service@wbv.de<br />
Ihre Bestellmöglichkeiten: W. Bertelsmann Verlag, Postfach 10 06 33, 33506 Bielefeld<br />
Tel.: (05 21) 9 11 01-12, Fax: (05 21) 9 11 01-19, E-Mail: service@wbv.de, Internet: www.wbv.de<br />
W. Bertelsmann Verlag Fachverlag für Bildung und Beruf