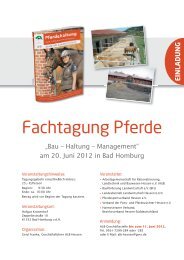Untersuchungen zum kraftfuttergesteuerten Abtränken bei - BFL
Untersuchungen zum kraftfuttergesteuerten Abtränken bei - BFL
Untersuchungen zum kraftfuttergesteuerten Abtränken bei - BFL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Agrartechnische Forschung 5 (1999) H. 2, S. 1-9 1<br />
<strong>Untersuchungen</strong> <strong>zum</strong> <strong>kraftfuttergesteuerten</strong> <strong>Abtränken</strong> <strong>bei</strong> Saugkälbern<br />
Investigations on the feeding regimen of liquid feed reduction<br />
according to the concentrate intake of rearing calves<br />
Andreas Deininger 1 und Markus Käck 2<br />
1 Fachgebiet Agrartechnik der Universität Gesamthochschule Kassel, 37213 Witzenhausen<br />
2 Förster-Technik GmbH, 78234 Engen<br />
Kurzfassung: Als Ergänzung zu den in der Praxis bewährten prozeßrechnergesteuerten Tränkeautomaten sind mittlerweile<br />
auch Automaten für die tierindividuelle Kraftfutterfütterung <strong>bei</strong> Kälbern erhältlich. Die von diesen Automaten zurückgemeldeten<br />
Verzehrsmengen der Einzeltiere an Kraftfutter können für ein tierindividuelles <strong>Abtränken</strong> genutzt werden, wodurch offensichtlich<br />
ein Potential zur Einsparung von Tränkekosten besteht. In einem Aufzuchtversuch wurde die Wirksamkeit dieser<br />
Fütterungsstrategie überprüft. Insgesamt konnten die mittlere Dauer der Tränkeperiode für die Kälber <strong>bei</strong> kraftfutterabhängigem<br />
<strong>Abtränken</strong> erheblich verkürzt und <strong>bei</strong> den sich rasch entwickelnden Tieren erhebliche Mengen an Milchaustauscher eingespart<br />
werden. Das restriktive Tränkeregime <strong>bei</strong> den früh entwickelten Tieren hatte jedoch keinen negativen Einfluß auf deren<br />
Gewichtszunahme. Das untersuchte Verfahren konkurriert mit der Frühentwöhnung der Kälber, <strong>bei</strong> dem jedoch mangels<br />
tierindividueller Tränkesteuerung das Risiko von Minderleistungen und Entwicklungsrückschlägen besteht.<br />
Deskriptoren: Kälberaufzucht, prozeßrechnergesteuerte Tränkeautomaten, tierindividuelle Kälberfütterung, <strong>Abtränken</strong><br />
Abstract: In addition to the well proven computer controlled calf feeding stations, computer controlled concentrate feeding<br />
stations for calves were developed and introduced into the market recently. These machines offer the opportunity to feed<br />
calves individually, thereby obtaining the daily amount of concentrates dispensed to each calf. At the time when this individual<br />
concentrate intake exceeds a certain level, the amount of liquid feed dispensed to that calf can be reduced. This feeding<br />
regimen offers the potential to save a significant amount of liquid feed for calves with a rapid ruminal development. In a<br />
feeding trial, the effectiveness of this regimen was investigated. The mean length of the milk period could be significantly reduced<br />
by determining the amount of liquid feed according to the actual concentrate intake of the calf, and calves with rapid<br />
rumen development consumed considerably less liquid feed than calves with a slow development. The restrictive feeding<br />
regimen for animals with rapid development had no negative impact on their body weight gain. The investigated feeding<br />
regimen competes with the early weaning of the calves. Due to the lack of an individual treatment of the animals, weaning the<br />
calves early involves the risk of lower weight gain and set backs in the development of the calves.<br />
Keywords: calf rearing, computer controlled liquid feed dispensing machines, individual calf feeding, liquid feed reduction<br />
1 Einführung<br />
Die Gruppenhaltung von Aufzuchtkälbern setzt sich in der<br />
Kälberaufzucht gerade auf größeren Betrieben immer mehr<br />
durch. Als Gründe hierfür sind neben aktuellen gesetzlichen<br />
Maßgaben [1] (Verbot der Anbindehaltung <strong>zum</strong> 1.1.99) ar<strong>bei</strong>tswirtschaftliche<br />
Überlegungen [2] sowie Aspekte der<br />
Hygiene (Rein-Raus-Verfahren) [3] maßgebend. In solchen<br />
meist eingestreuten Gruppenhaltungssystemen kommen in<br />
hohem Maße prozeßrechnergesteuerte Tränkeautomaten<br />
<strong>zum</strong> Einsatz. Als Gründe hierfür lassen sich u. a. die tierphysiologischen<br />
Vorteile der Verabreichung von Tränke in<br />
kleinen, stets frisch zubereiteten und mit konstanter Temperatur<br />
angerührten Portionen über den gesamten Tag verteilt<br />
sowie die Möglichkeit zur tierindividuellen Verabreichung<br />
von flüssigen oder pulverförmigen Medikamenten anführen<br />
[4]. Des weiteren bestehen <strong>bei</strong>m Einsatz dieser Fütterungstechnik<br />
wesentlich verbesserte und erweiterte Möglichkeiten<br />
der tierindividuellen Steuerung und der Überwachung<br />
des gesamten Fütterungsprozesses [5]. Eine dieser<br />
Möglichkeiten, nämlich die tierindividuelle Steuerung der<br />
Tränkemenge anhand des aktuellen Kraftfutterverzehrs des<br />
Einzeltieres, soll im Folgenden näher erörtert werden. Neben<br />
technischen Aspekten interessiert hier<strong>bei</strong> vor allem die<br />
Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer solchen Technik.
2 A. Deininger und M. Käck<br />
2 Kraftfuttergesteuertes <strong>Abtränken</strong> <strong>bei</strong> Kälbern<br />
2.1 Kraftfutterautomaten in der Kälberaufzucht<br />
Seit mittlerweile mehreren Jahren werden von verschiedenen<br />
Herstellern Kraftfutterautomaten für Kälber auf dem<br />
Markt angeboten. Bild 1 zeigt einen solchen Automaten,<br />
der die tierindividuelle Versorgung der Kälber anhand eines<br />
Kraftfutterplans ermöglicht und da<strong>bei</strong> zugleich die tägliche<br />
Verzehrsmenge des Einzeltiers zuückliefert. Vom Prinzip<br />
her handelt es sich <strong>bei</strong> diesen Automaten um verkleinerte<br />
Kraftfutterstationen für Milchkühe mit dem Unterschied,<br />
daß für den Einsatz <strong>bei</strong> Kälbern eine Verzehrskontrolle obligatorisch<br />
ist und Kleinstportionen von ca. 10 g ausdosiert<br />
werden. Nur so kann verhindert werden, daß ältere Kälber<br />
jungen, unerfahrenen Tieren, die noch nicht mit dem Futtermittel<br />
Kraftfutter vertraut sind, ihre Kraftfutterportionen<br />
wegfressen. Zugleich werden so auch Verdrängungen vom<br />
Freßplatz wirkungslos und unterbleiben daher meist. Bei<br />
dem in Bild 1 dargestellten Automaten ist die Futterabtastung<br />
mechanisch über eine Pendelklappe realisiert, welche<br />
durch das von der Schnecke ausgeschobene Kraftfutter<br />
ausgelenkt wird und da<strong>bei</strong> einen Schaltkontakt betätigt.<br />
Weiterhin sind auch rein elektronische Lösungen zu finden,<br />
etwa ein Lichtsensor am Grund der Futterschale, dessen<br />
Bedeckung mit Futter zu einem Schaltvorgang führt [6].<br />
Trogschale<br />
Vorratsbehälter für<br />
Kraftfutter<br />
Förderantrieb<br />
mit Dosierschnecke<br />
(verdeckt)<br />
Futterabtastung<br />
Abdeck<br />
blech<br />
Bild 1: Kraftfutterautomat zur tierindividuellen Versorgung<br />
von Kälbern<br />
Fig 1: Concentrate feeder for the individual feeding of<br />
calves<br />
Den nicht unerheblichen Investitionskosten für einen solchen<br />
Automaten (inkl. Tiererkennung und Stationsbegrenzung<br />
ca. 4.000 bis 5.000 DM) muß ein entsprechender Nutzen<br />
gegenüberstehen, um den Einsatz in der Kälberaufzucht<br />
zu rechtfertigen. Nennenswerte ar<strong>bei</strong>tswirtschaftliche<br />
Vorteile sind <strong>bei</strong> den geringen Verzehrsmengen der Kälber<br />
(ca. 30 bis 50 kg pro Kalb während der Tränkeperiode)<br />
nicht zu erwarten. Als echte Vorteile können dagegen angeführt<br />
werden Aspekte der Futterhygiene - das Kraftfutter<br />
wird stets frisch vorgelegt, so daß im Gegensatz zur Trogfütterung<br />
keine Gefahr des Futterverderbs besteht - sowie<br />
der Krankheitsfrüherkennung, denn der Kraftfutterverzehr<br />
ist ein sehr viel sensiblerer Parameter für den Gesundheitszustand<br />
des Einzeltieres als der Tränekabruf. Der mit Sicherheit<br />
wichtigste potentielle Nutzen eines Kraftfutterautomaten<br />
und der größte Anreiz zu dessen Einsatz ist jedoch<br />
in der möglichen Einsparung von teuerem Milchaustauscher<br />
oder Vollmilchtränke und dessen bzw. deren Substitution<br />
durch billigeres Kraftfutter <strong>bei</strong> einer an den aktuellen<br />
Kraftfutterverzehr des Tieres angepaßten Tränkereduzierung<br />
zu sehen [7].<br />
2.2 Konzept des <strong>Abtränken</strong>s nach Kraftfutterverzehr<br />
Zunächst ist generell an<strong>zum</strong>erken, daß ein rein altersabhängiges<br />
Tränken, welches derzeit mangels Verfügbarkeit<br />
weiterer Parameter außer dem Tränkealter <strong>zum</strong>eist Anwendung<br />
findet, den tatsächlichen Verhältnissen und Ansprüchen<br />
der Einzeltiere nicht gerecht wird. Dies belegen die<br />
Probleme, die <strong>bei</strong> einer solchen Strategie auftreten: Wird<br />
sehr früh entwöhnt, besteht die Gefahr, daß es <strong>bei</strong> wenig<br />
entwickelten Tieren zu Rückschlägen kommt, <strong>bei</strong> später<br />
Entwöhnung wird das Einsparpotential früh entwickelter<br />
Kälber nicht ausgeschöpft [8].<br />
Bereits durch die Verwendung eines altersabhängigen<br />
Tränkeplans mit einer graduellen Reduzierung der Tränkemenge<br />
zu Ende der Tränkeperiode kann <strong>bei</strong> prozeßrechnergesteuerten<br />
Tränkeautomaten den Anforderungen des Einzeltieres<br />
besser entsprochen werden als <strong>bei</strong> der Eimertränke,<br />
wo meist <strong>bei</strong> Erreichen eines bestimmten Lebensalters die<br />
Tiere abrupt von der Tränke abgesetzt werden [9]. Da<strong>bei</strong><br />
kann es infolge der verringerten TS-Aufnahme leicht zu<br />
einer negativen Energiebilanz für das Kalb kommen, <strong>zum</strong>al<br />
durch die fehlende Tränkegabe zusätzlicher Streß für das<br />
Kalb verursacht wird.<br />
Eine weitere Verbesserung ist dadurch zu erzielen, daß der<br />
aktuelle Kraftfutterverzehr des Kalbes, der <strong>bei</strong> der Verwendung<br />
von Kraftfutterautomaten zurückgemeldet wird, in die<br />
Tränkesteuerung mit einbezogen wird, also <strong>bei</strong> Erreichen<br />
eines gewissen Kraftfutterschwellenwertes ein tierindividuelles,<br />
graduelles <strong>Abtränken</strong> vorgenommen wird [10]. Bild 2<br />
zeigt das Konzept eines solchen Tränkeregimes.
Bei kraftfutterabhängigem <strong>Abtränken</strong> werden zwei<br />
Schwellenwerte für den Kraftfutterverzehr definiert: ein<br />
unterer Schwellenwert, <strong>bei</strong> dessen Erreichen mit der graduellen<br />
Tränkereduzierung begonnen wird und ein oberer<br />
Schwellenwert, der festlegt, wann das Tier komplett von der<br />
Tränke abgesetzt wird. Nur mit diesem Konzept kann eine<br />
optimale Versorgung des Tieres sichergestellt werden. So<br />
führt durch diese Art der Rückkopplung eine Stagnation des<br />
Kraftfutterverzehrs während der Abtränkphase zu einem<br />
vorübergehenden Aussetzen der Tränkereduzierung, bis der<br />
Kraftfutterverzehr wieder weiter ansteigt. Eine energetische<br />
Unterversorgung des Tieres wird dadurch abgewendet.<br />
Tränkemenge pro Tag<br />
Liter<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Tränketage<br />
Agrartechnische Forschung 5 (1999) H. 2, S. 1-9 3<br />
Tränkekurve <strong>bei</strong> altersabhängigem <strong>Abtränken</strong><br />
Abtränkkurve <strong>bei</strong> Tränkereduzierung nach KF-Verzehr Gramm<br />
K raftfutterverzehrsmenge (5-T age-Mi ttel)<br />
2500<br />
Einsparpotential <strong>bei</strong> Tränkereduzierung nach KF-Verzehr<br />
2250<br />
2000 g<br />
Schwellenwert für Absetzen<br />
2000<br />
1750<br />
700 g<br />
Schwellenwert für<br />
Beginn des <strong>Abtränken</strong>s<br />
1500<br />
1250<br />
1000<br />
Bild 2: Konzept der Tränkereduzierung nach Kraftfutterverzehr<br />
<strong>bei</strong> Saugkälbern<br />
Fig 2: Principle of liquid feed reduction according to the<br />
concentrate intake of rearing calves<br />
Abschließend sei angemerkt, daß als Alternative zur kraftfutterabhängigen<br />
Tränkesteuerung auch eine gewichtsabhängige<br />
Steuerung - in Verbindung mit einer automatisierten<br />
Tiergewichtserfassung - in den Tränkeautomaten mancher<br />
Hersteller realisiert ist. Ohne eine Aussage über die<br />
Vorzüglichkeit einer dieser Strategien zu treffen, sei in diesem<br />
Zusammenhang darauf hingewiesen, daß eine optimale<br />
Tränkesteuerung sich weder am Kraftfutterverzehr noch am<br />
Tiergewicht, sondern an der Gesamtenergieaufnahme der<br />
Einzeltiere orientieren müßte. Ferner sei angemerkt, daß die<br />
Kraftfutteraufnahme tatsächlich ein Parameter für den Grad<br />
der physiologischen Entwicklung hin <strong>zum</strong> Wiederkäuer ist,<br />
während das Tiergewicht mehr ein Parameter für die allgemeine<br />
Entwicklung des Tieres ist, der auch stark von genetischen<br />
Faktoren bestimmt wird, wie dem Wachstumsvermögen<br />
und der Futterverwertung.<br />
2.3 Ernährungsphysiologische Aspekte <strong>zum</strong> Kraftfuttereinsatz<br />
<strong>bei</strong> Saugkälbern<br />
Bei neugeborenen Kälbern ist <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Geburt<br />
von den vier vorhandenen Magensystemen einzig und allein<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
Kraftfutterverzehrsmenge (5-Tage-Mittel)<br />
der Labmagen entwickelt und funktionsfähig. Erst im Laufe<br />
der Ontogenese kommt es dann unter dem Einfluß<br />
stimulierender mechanischer und chemischer Faktoren zur<br />
Ausbildung der restlichen Magensysteme und damit <strong>zum</strong><br />
Übergang vom Monogastrier hin <strong>zum</strong> Wiederkäuer. Zeitpunkt<br />
und Schnelligkeit dieser Entwicklung werden da<strong>bei</strong><br />
stark vom Ernährungsregime und hier<strong>bei</strong> insbesondere von<br />
der Art und Qualität der aufgenommenen Futtermittel bestimmt.<br />
Wie zahlreiche <strong>Untersuchungen</strong> zeigen, wird in diesem Zusammenhang<br />
der sog. "scratch factor", also die mechanische<br />
Stimulation, hervorgerufen durch die Aufnahme rohfaserreicher<br />
Komponenten - im Falle der Kälberaufzucht<br />
sicherlich meist des Heus -, überschätzt [11]. So führt die<br />
Aufnahme dieser Komponenten zwar durchaus zu einem<br />
verstärkten Wachstum des Pansen-Muskelgewebes und<br />
damit zu einer Volumenvergrößerung des Pansens selbst,<br />
das Wachstum der Pansenzotten und die Ausbildung der<br />
Pansenmukosa erfolgt jedoch vornehmlich durch den Einfluß<br />
der im Laufe der mikrobiellen Fermentation gebildeten<br />
flüchtigen Fettsäuren. Da hier<strong>bei</strong> die <strong>bei</strong> der Fermentation<br />
von Kraftfutter vornehmlich gebildete Propionsäure eine<br />
erheblich höhere stimulierende Wirkung besitzt als die <strong>bei</strong><br />
der Heuverdauung überwiegend entstehende Essigsäure,<br />
scheint es angebracht, gerade dem Kraftfutterverzehr <strong>bei</strong><br />
der Kälberaufzucht erhöhte Beachtung zu schenken.<br />
Weitgehende Einigkeit besteht auch darüber, daß eine frühzeitige<br />
Entwöhnung der Kälber sowohl unter Kostenaspekten<br />
- Milchaustauscher oder gar Vollmilch sind <strong>bei</strong> weitem<br />
teurere Futtermittel als Kraftfutter - als auch unter Aspekten<br />
der Tiergesundheit anzustreben ist, denn sind die Tiere erst<br />
einmal von der Milch abgesetzt, so bleiben auch die gefürchteten<br />
Durchfallerkrankungen weitgehend aus. Als<br />
Faustregel gilt da<strong>bei</strong>, daß ein Kalb problemlos dann entwöhnt<br />
werden kann, wenn es ein Kilogramm hochwertiges<br />
Kraftfutter pro Tag aufnimmt [12].<br />
2.4 Bisher vorliegende Versuchsergebnisse<br />
Die Einbeziehung tierindividueller Parameter in die Prozeßsteuerung<br />
ist grundsätzlich nur dann sinnvoll, wenn zwischen<br />
den Einzeltieren eine große Schwankungsbreite des<br />
Parameters zu verzeichnen ist und wenn sinnvolle Strategien<br />
aus der Höhe oder Merkmalsausprägung des Parameters<br />
abgeleitet werden können. Beides ist <strong>bei</strong> der <strong>kraftfuttergesteuerten</strong><br />
Tränkereduzierung der Fall: Alle bekannten<br />
<strong>Untersuchungen</strong> stimmen darin überein, daß <strong>bei</strong> der<br />
Kraftfutteraufnahme von Kälbern gleichen Lebensalters, die<br />
zugleich ein Indikator für die Vormagenentwicklung der<br />
einzelnen Kälber ist, eine enorme Bandbreite zu verzeichnen<br />
ist [13,14]. Dies ist auch als Grund dafür anzusehen,<br />
daß die undifferenzierte Frühentwöhnung von Kälbern in<br />
der Praxis oftmals zu Problemen führt.
4 A. Deininger und M. Käck<br />
Eine Reihe von <strong>Untersuchungen</strong> hat sich mit dem kraftfutterabhängigen<br />
<strong>Abtränken</strong> beschäftigt. So wurde der Einsatz<br />
der Automaten in der Fresserproduktion mit gutem Erfolg<br />
überprüft, wo<strong>bei</strong> jedoch keine Anpassung der Tränkemenge<br />
stattfand [15,16]. Hohenheimer <strong>Untersuchungen</strong> zeigten<br />
mögliche Einspareffekte auf, warnen jedoch vor möglichen<br />
Leistungseinbußen <strong>bei</strong> zu strikter Tränkereduzierung<br />
[14,10]. Sie sehen die Automaten für die Kälberaufzucht als<br />
wirtschaftlich sinnvoll an, halten sie dagegen in der Fresserproduktion<br />
nur für wenig attraktiv. Auch Kunz rechnet<br />
mit einem Minderverbrauch von durchschnittlich 5 kg<br />
Milchaustauscher <strong>bei</strong> einem bereits knapp gehaltenen Gesamtanspruch<br />
von 30 kg Milchaustauscher je Kalb während<br />
der Aufzuchtperiode [17]. <strong>Untersuchungen</strong> an der LVA<br />
Iden erbrachten eine mittlere Reduzierung der Tränkeperiode<br />
der kraftfutterabhängig abgetränkten Kälber um<br />
18 Tage. In der zweiten Hälfte der Tränkeperiode konnten<br />
für diese Kälber signifikant höhere Tageszunahmen registriert<br />
werden, bis <strong>zum</strong> 305. Lebenstag hatten sich diese<br />
Unterschiede jedoch wieder ausgeglichen. Bei Einsparungen<br />
von 10 DM pro Kalb werden Kraftfutterautomaten ab<br />
60 aufgezogenen Kälbern pro Jahr als wirtschaftlich angesehen<br />
[18]. Nicht alle <strong>Untersuchungen</strong> bewerten das Einsparpotential<br />
an Milchaustauscher bzw. Vollmilchtränke jedoch<br />
so positiv. <strong>Untersuchungen</strong> von Laukemper erbrachten<br />
eine Reduzierung der Tränkeperiode um lediglich einen Tag<br />
und demzufolge auch nur Einsparungen <strong>bei</strong> den Futterkosten<br />
in Höhe von 3,50 DM. Sie hält den Einsatz des<br />
Automaten daher für unwirtschaftlich [19]. Zu ähnlichen<br />
Ergebnissen gelangten eigene <strong>Untersuchungen</strong>, <strong>bei</strong> denen<br />
die Tränkeperiode ebenfalls lediglich um knapp über 5 Tage<br />
reduziert und der Milchaustauscherverbrauch sowie die<br />
Futterkosten kaum nennenswert gesenkt werden konnten<br />
[20,21].<br />
Zur nahe verwandten Thematik des gewichtsabhängigen<br />
Tränkens existieren ebenfalls <strong>Untersuchungen</strong>, welche die<br />
Wirksamkeit auch dieser Methode belegen und ihr ein erhebliches<br />
Einsparpotential zusprechen [17,22]. Eigene <strong>Untersuchungen</strong><br />
zeigen hier<strong>bei</strong> jedoch deutlich auf, daß das<br />
Tiergewicht und die Kraftfutteraufnahme zwei gänzlich<br />
unterschiedliche Parameter sind, die nur gering miteinander<br />
korreliert sind, so daß sich <strong>bei</strong> ein und demselben Tier <strong>bei</strong><br />
gewichtsabhängigem <strong>Abtränken</strong> ein gänzlich anderer Abtränkezeitpunkt<br />
ergeben kann als <strong>bei</strong> kraftfutterabhängiger<br />
Tränkereduzierung [23].<br />
3 Eigene <strong>Untersuchungen</strong><br />
3.1 Tiere, Material und Methoden<br />
3.1.1 Versuchsstandort und -zeitraum, Versuchstiere<br />
Der vorgestellte Versuch wurde im Kälberstall der Fa. Förster-Technik,<br />
Engen durchgeführt. Bei diesem Stall handelt<br />
es sich um einen eingestreuten Einraum-Tieflaufstall, der<br />
über zwei Buchten mit je einer Saugstelle verfügt, wo<strong>bei</strong><br />
jede dieser Buchten eine Gesamtfläche von 20 m 2 umfaßt.<br />
In die Versuchsauswertung flossen die Daten von insgesamt<br />
24 Tieren ein, die im Zeitraum von Januar bis September<br />
1996 aufgezogen wurden. Bei den Kälbern handelte es sich<br />
um Fleckviehtiere, wo<strong>bei</strong> <strong>bei</strong> manchen Tieren eine Einkreuzung<br />
mit der Rasse Montbeliard vorhanden war. Es<br />
wurden sowohl männliche als auch weibliche Tiere eingestallt,<br />
wo<strong>bei</strong> die Einstallung der Tiere mit einem Lebensalter<br />
von 1 bis 2 Wochen vorgenommen wurde. Bei der<br />
Einstallung der Tiere betrug deren Gewicht im Mittel<br />
42,2 kg, wo<strong>bei</strong> die Werte zwischen 28 und 56 kg<br />
schwankten.<br />
3.1.2 Fütterung<br />
Die Tiere wurden mit einem hochwertigen Milchaustauscher<br />
mit hohem Magermilchpulveranteil ernährt, wo<strong>bei</strong> die<br />
Konzentration der angerührten Tränke durchgängig<br />
100 Gramm pro Liter betrug. Die Fütterung erfolgte anhand<br />
des in Bild 3 dargestellten Tränkeplans, welcher <strong>bei</strong> einer<br />
Tränkedauer von 83 Tagen die Verabreichung von insgesamt<br />
51 kg Milchaustauscher pro Tier und Aufzuchtperiode<br />
vorsah. Durch die Reduzierung der Tränkemenge von 8 auf<br />
7 Liter nach 5 Wochen sollte die Kraftfutteraufnahme zusätzlich<br />
angeregt und gesteigert werden.<br />
An Kraftfutter kam eine hofeigene Schrotmischung <strong>zum</strong><br />
Einsatz, die aus 50 % Triticale, 20 % Gerste, 20 % Sojaextraktionsschrot<br />
und 10 % Raps bestand. Bei allen Tieren<br />
wurden eine Tränkeverabreichung anhand des Kraftfutterverzehrs<br />
vorgenommen. Zu Beginn der Aufzuchtperiode<br />
orientierte sich die täglich verfügbare Tränkemenge für<br />
jedes Kalb noch strikt am altersabhängigen Tränkeplan, sobald<br />
das Tier jedoch 700 g Kraftfutter pro Tag aufnahm,<br />
wurde mittels Korrekturtagen eine Verschiebung auf den<br />
47. Tränketag vorgenommen und somit das <strong>Abtränken</strong> des<br />
Tieres eingeleitet. Mit weiter zunehmender Kraftfutteraufnahme<br />
reduzierte sich die Tränkemenge schneller als anhand<br />
des Tränkeplans vorgesehen, wo<strong>bei</strong> die Steilheit der<br />
Abtränkkurve und somit der Grad bzw. die Geschwindigkeit<br />
der Tränkereduzierung so gewählt wurde, daß das Ende<br />
der Tränkeverabreichung (2,5 l) genau zu dem Zeitpunkt<br />
erreicht wurde, wenn das Tier eine Kraftfuttermenge von<br />
2,5 kg aufnahm. Dies war zugleich die Maximalmenge an<br />
Kraftfutter, welche anschließend auch weiterhin täglich<br />
verabreicht wurde.<br />
Kälber, die auch am 47. Tränketag, also zu Beginn der Abtränkphase,<br />
den Schwellenwert von 700 g Kraftfutterverzehr<br />
noch nicht erreicht hatten, wurden gemäß dem altersabhängigen<br />
Tränkeplan entwöhnt.
10<br />
Liter<br />
9<br />
Tränkemenge pro Tag<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Tränkeplan (ges. 51 kg MAT)<br />
Kraftfutterplan<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Tränketage<br />
Agrartechnische Forschung 5 (1999) H. 2, S. 1-9 5<br />
Gramm<br />
2500<br />
2250<br />
2000<br />
1750<br />
1500<br />
1250<br />
1000<br />
Bild 3: Während der Aufzucht angewandte Tränke- und<br />
Kraftfutterpläne<br />
Fig 3: Milk and concentrate feeding plans used during the<br />
rearing period<br />
Neben der Milchaustauschertränke und dem Kraftfutter<br />
wurde den Tieren auch Heu als Rauhfutter zur ad libitum<br />
Aufnahme zur Verfügung gestellt, wo<strong>bei</strong> in diesem Zusammenhang<br />
an<strong>zum</strong>erken ist, daß weder das Kraft- noch<br />
das Rauhfutter, welche <strong>bei</strong>de vom Kälberlieferanten bereitgestellt<br />
wurden, immer vom bester Qualität waren.<br />
3.2 Ergebnisse<br />
Bei der Auswertung wurde zunächst für die verschiedenen<br />
Erfolgsgrößen der Mittelwert aller 24 Kälber errechnet. Zu<br />
Vergleichszwecken wurden dann zwei Untergruppen gebildet,<br />
welche jeweils diejenigen 20% der Kälber umfaßten,<br />
welche die kürzeste bzw. die längste Aufzuchtperiode<br />
aufwiesen, die also quasi das obere bzw. untere Fünftel der<br />
Gruppe hinsichtlich der Schnelligkeit der Entwicklung hin<br />
<strong>zum</strong> Wiederkäuer darstellten. Eine Gegenüberstellung der<br />
Erfolgsgrößen als Gruppenmittelwert und als Mittelwert des<br />
oberen sowie unteren Fünftels findet sich in Tabelle 1.<br />
Generell zeigt diese Gegenüberstellung die hohe Schwankungsbreite<br />
in der tierindividuellen Vormagenentwicklung<br />
auf, sofern der Kraftfutterverzehr als Parameter hierfür herangezogen<br />
wird. Diese individuellen Entwicklungsunterschiede<br />
werden auch aus den <strong>bei</strong>den Abbildungen 4 und 5<br />
ersichtlich, welche exemplarisch jeweils den Tränkeabruf<br />
und den Kraftfutterverzehr eines Tieres mit rascher bzw.<br />
verzögerter Entwicklung hin <strong>zum</strong> Wiederkäuer darstellen.<br />
So beginnt das sich rasch entwickelnde Tier (Bild 4) bereits<br />
nach zwei Tagen mit der Aufnahme von Kraftfutter, steigert<br />
dessen Verzehr kontinuierlich und kann deshalb, nachdem<br />
bereits am 23. Tränketag mit der Tränkereduzierung begonnen<br />
wurde, am 35. Tag von der Milch abgesetzt werden.<br />
Das Tier mit verzögerter Entwicklung dagegen (Bild 5)<br />
weist bis <strong>zum</strong> 16. Tränketag keinerlei Kraftfutteraufnahme<br />
auf. Auch hinterher bleibt der Kraftfutterverzehr solange<br />
auf einem niedrigen Niveau (unterhalb der Schwelle für die<br />
Tränkereduzierung), bis das Tier gemäß dem altersabhängi-<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
Kraftfuttermenge pro Tag<br />
gen Tränkeplan am 83. Tag von der Milch abgesetzt wurde.<br />
Erst anschließend kommt es zu einem rasch einsetzenden<br />
Verzehrsanstieg bis <strong>zum</strong> Maximalwert von 2,5 Kilogramm<br />
Kraftfutter pro Tag.<br />
Tabelle 1: Ausgewählte Versuchsergebnisse und Erfolgsgrößen<br />
der Versuchsgruppe<br />
Table 1: Selected results of the investigations on suckler<br />
rearing for the experimental group<br />
alle<br />
Kälber<br />
(n=24)<br />
obere<br />
20%<br />
(n=5)<br />
untere<br />
20%<br />
(n=5)<br />
Tränkeparameter<br />
Beginn des <strong>Abtränken</strong>s [Tage] 40 29 50<br />
Ende des <strong>Abtränken</strong>s [Tage]<br />
Futterverbrauch<br />
53 37 69<br />
Milchaustauscherverbrauch [kg] 34,6 23,6 43,4<br />
Kraftfutterverbrauch [kg]<br />
Futterkosten<br />
29,6 25,9 28,9<br />
Kosten Milchaustauscher [DM]<br />
(3,00 DM/kg)<br />
103,80 70,80 130,20<br />
Kosten Kraftfutter [DM]<br />
(0,50 DM/kg)<br />
14,80 13,00 14,50<br />
Futterkosten gesamt [DM] 118,60 83,80 144,70<br />
Tierische Leistungen<br />
ø tägliche Zunahmen [g/Tag]<br />
• bis <strong>zum</strong> 40. Tag<br />
• bis <strong>zum</strong> 80. Tag<br />
700<br />
836<br />
823 556<br />
720<br />
3.2.1 Tränkeparameter<br />
Von den 24 beobachteten Kälbern wurde der Beginn der<br />
Entwöhnungsphase (unterer Schwellenwert, Kraftfutterverzehr<br />
von einem Kilogramm) durchschnittlich mit dem<br />
40. Tränketag erreicht, im Mittel war ein Kalb dann nach<br />
53 Tagen abgetränkt (oberer Schwellenwert, Kraftfutterverzehr<br />
von 2,5 Kilogramm). Das obere Fünftel der Kälber erreichte<br />
den Abtränkezeitpunkt im Mittel jedoch bereits nach<br />
29 Tagen und war nach 37 Tagen entwöhnt. Beim unteren<br />
Fünftel hingegen verstrichen durchschnittlich 50 Tage, bevor<br />
mit der Entwöhnung begonnen wurde, und es vergingen<br />
weitere 19 Tage bis <strong>zum</strong> Ende der Tränkephase. Durch die<br />
tierindividuell unterschiedliche Gestaltung des Tränkeplans<br />
in Abhängigkeit vom Kraftfutterverzehr läßt sich demnach<br />
die Aufzuchtzeit der Kälber am Tränkeautomaten teilweise<br />
erheblich reduzieren.
6 A. Deininger und M. Käck<br />
Bild 4: Kalb mit zügiger Entwicklung <strong>zum</strong> Wiederkäuer<br />
(abgetränkt mit 45 Tagen)<br />
Fig 4: Calf with rapid ruminal development (off milk with<br />
45 days)<br />
Bild 5: Kalb mit verzögerter Entwicklung <strong>zum</strong> Wiederkäuer<br />
(70 Tage Tränkeperiode gemäß Plan)<br />
Fig 5: Calf with slow development towards a ruminant<br />
(70 days fed with liquid feed)<br />
3.2.2 Futterverbrauch<br />
Durch die tierindividuelle Fütterung kann der Verbrauch an<br />
Milchaustauscher erheblich verringert werden. Während das<br />
untere Fünftel der Kälber infolge der zögerlichen Entwicklung<br />
hin <strong>zum</strong> Wiederkäuer durchschnittlich 43,4 kg<br />
Milchaustauscher verkonsumierten, reichte für das obere<br />
Fünftel bereits eine Milchaustauschermenge von 23,6 kg für<br />
die gesamte Aufzuchtperiode aus. Dies entspricht einer<br />
Einsparung an Milchpulver gegenüber dem unteren Fünftel<br />
der Kälber von 19,8 kg bzw. 46 %.<br />
3.2.3 Futterkosten<br />
Durch den unterschiedlichen Futterverbrauch ergaben sich<br />
erhebliche Auswirkungen auf die während der Aufzuchtperiode<br />
anfallenden Futterkosten. Entstanden durchschnittlich<br />
Futterkosten für Milchaustauscher und Kraftfutter von insgesamt<br />
nahezu 120 DM pro Kalb, so waren <strong>bei</strong>m unteren<br />
Fünftel der Kälber infolge des höheren Milchaustauscherverbrauchs<br />
Aufzuchtkosten von rund 145 DM pro Kalb zu<br />
konstatieren. Dadurch das <strong>bei</strong>m oberen Fünftel der Kälber<br />
die tierindividuelle Tränkereduzierung <strong>zum</strong> Greifen kam,<br />
konnten diese mit knapp 85 DM Futterkosten pro Kalb und<br />
Aufzuchtperiode großgezogen werden, Dies entspricht einer<br />
Reduzierung der Futtermittelkosten von 60 DM bzw. einer<br />
prozentualen Einsparung von 42 %.<br />
3.2.4 Tierische Leistungen<br />
Bei der Betrachtung der täglichen Zunahmen nach 40 bzw.<br />
80 Tagen wird ebenfalls der tierindividuell unterschiedliche<br />
Entwicklungsverlauf deutlich (vgl. Tabelle 1). Während bis<br />
<strong>zum</strong> 40. Tränketag die Käber im Durchschnitt tägliche Zunahmen<br />
von 700 g aufwiesen, ragt das hinsichtlich des<br />
Kraftutterverzehrs obere Fünftel der Kälber auch <strong>bei</strong> den<br />
Zunahmen mit Lesitungen von 823 Gramm pro Tier und<br />
Tag deutlich hervor. Das geringere Wachstumspotential des<br />
unteren Fünftels wird auch an deren geringeren Zunahmen<br />
von lediglich 556 Gramm pro Tier und Tag deutlich. Nach<br />
80 Tagen hatten sich die Aufzuchtleistungen aller Kälber<br />
auf 836 Gramm pro Tier und Tag verbessert. Vor allem das<br />
untere Fünftel der Kälber konnte in der zweiten Hälfte des<br />
Aufzuchtabschnitts das Zunahmeniveau deutlich erhöhen,<br />
so daß sie letztendlich über die gesamte Aufzuchtperiode<br />
gesehen Zunahmen von 720 Gramm pro Tier und Tag aufwiesen<br />
(vgl. Bild 6). Beim oberen Fünftel der Gruppe<br />
konnte die weitere Gewichtsentwicklung nicht festgestellt<br />
werden, da nur ein einziges Kalb über 80 Tage beobachtet<br />
werden konnte, alle anderen Tiere dieser Gruppe hingegen<br />
wurden unmittelbar nach der Tränkeperiode ausgestallt.<br />
mittlere täglichen Zunahmen (g/d)<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
580<br />
648<br />
553<br />
alle Kälber<br />
oberes Fünftel<br />
unteres Fünftel<br />
657<br />
745<br />
576<br />
700<br />
823<br />
556<br />
0<br />
1.-20. 1.-30. 1.-40. 1.-50. 1.-60. 1.-70. 1.-80.<br />
Tag Tag Tag Tag<br />
Zeitraum<br />
Tag Tag Tag<br />
Bild 6: Mittlere tägliche Zunahmen <strong>bei</strong> verschiedenen<br />
Beobachtungszeiträumen<br />
Fig 6: Mean daily weight gain with different periods under<br />
consideration<br />
686<br />
552<br />
763<br />
693<br />
Abschließend sei noch erwähnt, daß die erhoffte Steigerung<br />
der Kraftfutteraufnahme aufgrund der Reduzierung der<br />
Tränkemenge am 35. Tränketag nicht zu verzeichnen war.<br />
Offensichtlich kann eine erhöhte Kraftfutteraufnahme<br />
815<br />
710<br />
836<br />
720
- wenn überhaupt - dann nur durch eine stärkere Reduzierung<br />
der Tränkemenge induziert werden.<br />
4 Diskussion<br />
4.1.1 Beurteilung der Versuchsergebnisse<br />
Mit dem vorgestellten Versuch wird klar das Einsparpotential<br />
einer kraftfutterverzehrsabhängigen Tränkereduzierung<br />
aufgezeigt. Sehr erfreulich ist auch die Tatsache, daß diese<br />
Einsparungen nicht zu Lasten der täglichen Zunahmen gehen,<br />
sondern im Gegenteil diejenigen Tiere mit geringem<br />
Milchaustauscherverbrauch auch die höchsten Tageszunahmen<br />
aufweisen. Die kraftfutterabhängige Tränkereduzierung<br />
kann daher als ein Muster<strong>bei</strong>spiel dafür gelten, wie<br />
im Rahmen einer tierindividuellen Prozeßsteuerung der<br />
Fütterungsprozeß durch die Nutzung zusätzlicher Informationen<br />
- hier des tierindividuellen Kraftfutterverzehrs - optimiert<br />
werden kann.<br />
4.1.2 Vergleich mit anderen Versuchsergebnissen<br />
Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, kamen jedoch nicht alle<br />
Versuchsanstellungen zu dieser Thematik zu den gleichen<br />
Ergebnissen und Schlußfolgerungen. Teils konnten zwar<br />
die Ergebnisse bestätigt werden, teils konnte jedoch weder<br />
die Länge der Tränkeperiode entscheidend verkürzt noch<br />
die insgesamt pro Kalb aufgenommene Tränkemenge durch<br />
kraftfuttergesteuertes <strong>Abtränken</strong> derart reduziert werden,<br />
daß eine Wirtschaftlichkeit der Automaten unterstellt werden<br />
könnte. Begibt man sich auf Ursachenforschung für<br />
diese unterschiedlichen Resultate, so stößt man sehr schnell<br />
auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Aufzucht<br />
in den einzelnen Versuchsanstellungen. Offensichtlich<br />
kann das Einsparpotential nur dann ausgeschöpft werden,<br />
wenn dies die Rahmenbedingungen der Produktion<br />
auch erlauben.<br />
• In der vorgestellten Untersuchung orientierte sich der<br />
Tränkeplan an für die Aufzucht von Fleckviehkälbern<br />
üblicherweise <strong>zum</strong> Einsatz kommenden MAT-Mengen<br />
und war mit 51 Kilogramm Tränke-TS sehr großzügig<br />
angesetzt (vgl. Bild 3). Diese Menge steht im Widerspruch<br />
zu Beratungsempfehlungen [24,25,9], welche<br />
für die gesamte Aufzuchtperiode lediglich eine<br />
Milchaustauschermenge von maximal 30 kg oder für<br />
notwendig erachten, sich aber im allgemeinen auf Aufzuchtkälber<br />
der Rassen Schwarzbunt/HF beziehen.<br />
Vergegenwärtigt man sich, daß der mittlere Verbrauch<br />
an Milchaustauscher <strong>bei</strong> den vorliegenden <strong>Untersuchungen</strong><br />
<strong>bei</strong> 34,6 kg lag, so wird offensichtlich, daß<br />
das Einsparpotential erheblich reduziert worden wäre,<br />
falls den obigen Empfehlungen gefolgt worden wäre.<br />
• In ähnlicher Weise war auch die Länge desr Tränkeperiode<br />
mit 83 Tagen großzügig angesetzt. Konzepte der<br />
Frühentwöhnung sehen Tränkedauern von lediglich 6<br />
Agrartechnische Forschung 5 (1999) H. 2, S. 1-9 7<br />
•<br />
bis 8 Wochen vor [26], <strong>bei</strong> optimalem Management<br />
wird sogar eine Entwöhnung mit vier Wochen als<br />
möglich erachtet [27]. Daß auch <strong>bei</strong>m Einsatz dieser<br />
Konzepte das Einsparpotential reduziert wird, ist evident,<br />
schließlich war selbst das obere Fünftel der Kälber<br />
erst mit über 37 Tagen abgetränkt.<br />
Im Zusammenhang mit der Länge des Tränkeplans ist<br />
auch das Einstallalter ein wichtiger Parameter. Je älter<br />
die Tiere <strong>bei</strong> der Einstallung sind, umso eher wird der<br />
Kraftfutterverzehr und damit die Tränkereduzierung<br />
einsetzen. Während das Anlernen von Kälbern an den<br />
Automaten bereits mit zwei Tagen mit gutem Erfolg<br />
betrieben werden kann [28], wurden die Tiere im vorliegenden<br />
Versuch erst mit einem Alter von<br />
•<br />
1-2 Wochen eingestallt und hatten daher bereits einen<br />
gewissen Entwicklungsvorsprung.<br />
Es sei auch darauf hingewiesen, daß in der Tiergruppe<br />
Kälber aller Altersstufen vertreten waren. Evtl. konnte<br />
da<strong>bei</strong> der Anlernprozeß junger unerfahrener Tiere<br />
durch die Nachahmung älterer Tiere beschleunigt werden.<br />
Diese Möglichkeit ist in einem geschlossenen,<br />
nahezu gleichaltrigen Herdenverband weit weniger gegeben.<br />
• Im Zusammenhang mit dem Zunahmeniveau sei darauf<br />
hingewiesen, daß sowohl sehr hochwertige Futterkomponenten<br />
(Milchaustauscher mit einem hohen Magermilchpulveranteil)<br />
als auch mit der Rasse Fleckvieh<br />
eine wüchsige Fleischrasse eingesetzt wurde, die zusätzlich<br />
mit Montbeliard-Tieren eingekreuzt war.<br />
4.1.3 Beurteilung von Einsparstrategien<br />
Da das Einsparpotential <strong>bei</strong> kraftfutterabhängigem <strong>Abtränken</strong><br />
auf der Reduzierung der eingesetzten Tränkemenge je<br />
Einzeltier während der Tränkeperiode basiert, kann derselbe<br />
Einspareffekt prinzipiell auch durch die Anwendung eines<br />
generell niedrigeren und kürzeren Tränkeplans, also durch<br />
die Methode der Frühentwöhnung, erreicht werden. Jedoch<br />
bestehen zwischen kraftfutterabhängigem <strong>Abtränken</strong> und<br />
der Methode der Frühentwöhnung teils erhebliche Unterschiede,<br />
wie die Gegenüberstellung in Tabelle 2 aufzeigt,<br />
so daß die <strong>bei</strong>den gegenübergestellten Methoden keinesfalls<br />
als gleichwertig anzusehen sind. Da das Aufzuchtregime<br />
der Frühentwöhnung keinerlei zusätzliche Investitionskosten<br />
mit sich bringt, ist es immer dann von Vorteil, wenn<br />
mit diesem Verfahren tatsächlich hohe Zunahmen erreicht<br />
werden können. Überall dort, wo dieses nicht der Fall ist,<br />
oder wo selbst mit herkömmlichen Tränkeplänen mit hohen<br />
Tränkegaben das Leistungsniveau niedrig liegt, ist das<br />
Verfahren des kraftfutterabhängigen <strong>Abtränken</strong>s von Interesse.<br />
Da<strong>bei</strong> muß dessen Nutzen nicht zwangsläufig in einer<br />
Reduzierung der Tränkekosten über einen verringerten<br />
Tränkeverbrauch liegen. Ebenso scheint es eine sinnvolle
8 A. Deininger und M. Käck<br />
Strategie zu sein, die sich durch den Minderverbrauch gut<br />
entwickelter Tiere ergebenden Einsparungen in höherwertige<br />
Futterkomponenten, seien es Milchaustauscher mit hohem<br />
Magermilchanteil oder hochverdauliche Kraftfuttermittel<br />
wie etwa Kälbermüslis [29]. Auf diese Weise können<br />
zwar die Aufzuchtkosten nicht unmittelbar gesenkt werden,<br />
jedoch über hohe Tageszunahmen die Voraussetzungen für<br />
eine erfolgreiche und billige Aufzucht des Jungrinds bis hin<br />
zur Färse, die bereits frühzeitig abkalbt, geschaffen werden.<br />
Tabelle 2: Vergleich von kraftfutterabhängigem <strong>Abtränken</strong><br />
und Frühentwöhnung<br />
Table 2: Comparison of liquid feed reduction according to<br />
the concentrate intake and early weaning<br />
<strong>Abtränken</strong><br />
nach KF-<br />
Aufnahme<br />
Frühentwöhnung<br />
tierindividuelle Behandlung ja nein<br />
Einsparpotential<br />
resultiert aus<br />
Varianz des Tränke-TS-Verbrauchs<br />
je Kalb<br />
maximale Tränkemenge für<br />
das Einzeltier lt. Tränkeplan<br />
Einsatz hochwertigen<br />
Kraftfutters<br />
Minderverbrauch<br />
gut<br />
entwickelter<br />
Tiere<br />
einheitlich<br />
geringerem<br />
Verbrauch<br />
aller Tiere<br />
hoch gering<br />
hoch<br />
(8 l)<br />
empfehlenswert<br />
niedrig<br />
(max. 6l)<br />
obligat<br />
Gerätekosten hoch keine<br />
Voraussetzung<br />
Gefahr von Entwicklungsrückschlägen<br />
Auswirkungen auf die<br />
Zunahmen<br />
Tränke- und<br />
KF-Automat<br />
restriktive<br />
Fütterung<br />
gering hoch<br />
tendenziell<br />
positiv<br />
tendenziell<br />
negativ<br />
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß die vorgestellte<br />
Untersuchung sich ebenso wie die meisten anderen<br />
<strong>Untersuchungen</strong> auf diesem Gebiet lediglich auf den Bereich<br />
der Tränkeperiode der Kälber beschränkt. Die Entwicklung<br />
im Anschluß an das Absetzen wurde nicht mehr<br />
verfolgt, teils schieden die Kälber bereits unmittelbar nach<br />
dem <strong>Abtränken</strong> aus. Da die Entwicklung <strong>zum</strong> Rind nach<br />
dem Absetzen <strong>bei</strong> weitem noch nicht abgeschlossen ist,<br />
sollte <strong>bei</strong> derartigen <strong>Untersuchungen</strong> idealerweise die Entwicklung<br />
der Tiere bis <strong>zum</strong> Abkalben weiterverfolgt werden.<br />
Die gewonnenen Ergebnisse gewinnen damit erheblich<br />
an Aussagekraft.<br />
5 Schlußfolgerung<br />
Es bleibt festzuhalten, daß Kraftfutterautomaten in der Kälberaufzucht<br />
technisch ausgereift sind, ihr Einsatz ist unter<br />
technischen Aspekten problemlos. Die Wirtschaftlichkeit<br />
solcher Automaten wird offensichtlich entscheidend von<br />
den Rahmenbedingungen der Aufzucht und da<strong>bei</strong> insbesondere<br />
vom angewandten Tränkeplan beeinflußt. Während<br />
unterdurchschnittliche Betriebe meist keinen großen Nutzen<br />
aus dem Einsatz der Automaten ziehen dürften, bietet sich<br />
für Betriebe mit gutem Management und hohem Zunahmeniveau<br />
die Möglichkeit, mittels kraftfutterverzehrsabhängigem<br />
Tränken hohe Einsparungen realisieren, ohne daß das<br />
Leistungsniveau darunter zu leiden hat.<br />
Literatur<br />
[1] N. N.: Verordnung <strong>zum</strong> Schutz von Kälbern <strong>bei</strong> Stallhaltung<br />
(Kälberhaltungsverordnung) vom 1. Dezember 1992, modifiziert mit<br />
der Ersten Verordnung zur Änderung der Kälberhaltungsverordnung<br />
vom 22. Dezember 1997 (Bundesgesetzblatt Teil I, S. 3326), in Kraft<br />
getreten am 1. Januar 1998.<br />
[2] Pirkelmann, H.: In der Gruppe säuft es sich am besten. Kälbermastversuch:<br />
Gleiche Leistungen <strong>bei</strong> weniger Ar<strong>bei</strong>t im Laufstall.<br />
Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, 187. Jahrgang, Heft 7,<br />
15. Februar 1997, S. 22-25.<br />
[3] Heiting, N.: Kälberaufzucht: Rein-Raus auch im Kälberstall. top<br />
agrar Heft 2 1997, S. R18-21.<br />
[4] Pirkelmann, H. (Hrsg.): Tiergerechte Kälberhaltung mit rechnergesteuerten<br />
Tränkeverfahren. KTBL-Schrift 352, Darmstadt 1992.<br />
[5] Büscher, W. und M. Käck: Prozeßrechnergesteuerte Tränkeautomaten<br />
zur Kälberfütterung - Ar<strong>bei</strong>ts- und Managementhilfe. In: Zeitschrift<br />
für Agrarinformatik, Jg. 3. (1995), Heft 5, S. 113-116.<br />
[6] Kunz, H.-J.: Stand der Entwicklung: Kraftfutterautomaten für<br />
Kälber. Bauernblatt Schleswig-Holstein und Hamburg, Jahrgang<br />
50/146 (1996), Heft 19, S. 40-42.<br />
[7] Kunz, H.-J.: Kälber steuern ihren Milchaustauscherverbrauch<br />
selbst. Bauernblatt Schleswig-Holstein und Hamburg, Jg. 50/146<br />
(1996), Heft 9, S. 48-50.<br />
[8] Roy, J. H. B.: The calf, 4 th Edition, Butterworths, London, Boston<br />
1980.<br />
[9] Webster, A. J., F.: New techniques in calf production. In: Phillips,<br />
C. J. C. (Ed.): New techniques in cattle production. London 1989.<br />
[10] Büscher, W.und U. Biesinger: Abrufstationen für Kraftfutter in<br />
der Kälberaufzucht. In: Bau und Technik in der landwirtschaftlichen<br />
Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. Internationalen Tagung am 11. und<br />
12. März 1997 in Kiel, Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik<br />
der Christian-Albrechts-Universität Kiel (Hrsg.), Kiel,<br />
S. 24-27.<br />
[11] Haenlein. F. W.: No Hay for Calf's First Six Weeks. Dairy Management<br />
Column, Delaware Cooperative Extension,<br />
http://bluehen.ags.udel.edu/deces/dairycol/dc11-98.htm .<br />
[12] Kirchgeßner, M.: Tierernährung. Leitfaden für Studium, Beratung<br />
und Praxis. Frankfurt am Main 1997.<br />
[13] Kunz, H.-J.: Kälberhaltung: Kraftfutter - der Appetit darauf ist<br />
unterschiedlich. Bauernblatt Schleswig-Holstein und Hamburg,<br />
Jg. 50/146 (1996), Heft 47, S. 38.<br />
[14] Biesinger, U.: Verfahrenstechnische <strong>Untersuchungen</strong> zur computergesteuerten<br />
Kraftfutterfütterung <strong>bei</strong> Aufzuchtkälbern. Diplomar<strong>bei</strong>t,<br />
Institut für Agrartechnik, Universität Hohenheim 1996.<br />
[15] Pirkelmann, H. und F. Freiberger: Einsatz von Kraftfutterabrufautomaten<br />
in der Kälberhaltung. Gruber INFO 3/1997, S. 49-63.<br />
[16] Pirkelmann, H.: Aktuelle Entwicklungen in der Kälberhaltung.<br />
In: Roland Weber (Hrsg.): Tiergerechte Haltungssysteme für landwirtschaftliche<br />
Nutztiere. Wissenschaftliche Tagung in Zusammenar<strong>bei</strong>t<br />
mit der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN) vom<br />
23.-25. Oktober 1997 in Tänikon, Schriftenreihe der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik Nr. 45, Tänikon<br />
1997, S. 146-155.<br />
[17] Kunz, H.-J. (1998): Kälberaufzucht: Mit neuer Technik Tränke<br />
sparen. top agrar 11/1998, S. R22-R24.<br />
[18] Fischer, B. und T. Bäthge: Kraftfutterautomaten: Wann lohnen<br />
sie sich? top agrar 12/1998, S. R16-R18.<br />
[19] Laukemper, I. M.: <strong>Untersuchungen</strong> zu einem tierindividuellen<br />
Kälbertränkeverfahren. Abschlußar<strong>bei</strong>t, Universität-Gesamthochschule<br />
Paderborn, Abteilung Soest, Fachbereich Agrarwirtschaft, 1997.<br />
[20] Deininger, A.und M. Käck: Vergleichende <strong>Untersuchungen</strong> zur<br />
Verabreichung von Kraftfutter an Kälber mittels Kraftfutterautomat<br />
oder am Trog. In: Tagung: Bau, Technik und Umwelt 1999 in der<br />
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. 4. Internationale Tagung am 11.<br />
und 12. März 1999 an der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan,<br />
Landtechnik Weihenstephan (Hrsg.), Freising<br />
1999, S. 237-242.<br />
[21] Burth, F.: Experimentelle <strong>Untersuchungen</strong> zur Aufzucht von<br />
Saugkälbern mit unterschiedlicher Kraftfuttervorlagetechnik. Diplomar<strong>bei</strong>t,<br />
Fachgebiet Agrartechnik, Universität Gesamthochschule Kassel<br />
1998.<br />
[22] Vick, S.: Das Futteraufnahmeverhalten von Aufzuchtkälbern.<br />
Diplomar<strong>bei</strong>t, Institut für Tierzucht und Tierhaltung, Christian-<br />
Albrechts-Universität Kiel, 1995.<br />
Agrartechnische Forschung 5 (1999) H. 2, S. 1-9 9<br />
[23] Fischbach, T.: <strong>Untersuchungen</strong> zu unterschiedlichen Abtränkeverfahren<br />
in der Aufzucht von Saugkälbern. Diplomar<strong>bei</strong>t, Fachgebiet<br />
Agrartechnik, Universität Gesamthochschule Kassel 1999, in Vorbereitung.<br />
[24] Kunz, H.-J.: Erfolgreich füttern: 30 kg Milchaustauscher reichen<br />
aus. Bauernblatt Schleswig-Holstein und Hamburg, 49./145. Jahrgang,<br />
Heft 34, 26. August 1995, S. 45+46.<br />
[25] Moran, J.: Calf rearing. A guide to rearing calves in Australia.<br />
Department of Agriculture, Victoria 1993.<br />
[26] von Bothmer, G. und H. Budde: Kälberaufzucht für Milch und<br />
Mast. Frankfurt am Main, 3. Auflage 1992.<br />
[27] Quigley, J. D., III: Raising replacement heifers from birth to<br />
weaning. In: Advances in Dairy Technology Volume 9. Proceedings of<br />
the 1997 Western Canadian Dairy Seminar, University of Alberta,<br />
Edmonton 1997.<br />
[28] Büscher, W., Jungbluth, T. und M. Kern: <strong>Untersuchungen</strong> <strong>zum</strong><br />
Anlernverhalten von Jungkälbern an prozeßrechnergesteuerten Tränkeautomaten.<br />
In: Bau und Technik in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung.<br />
Beiträge zur 1. Internationalen Tagung vom 16. und<br />
17. März 1993 in Gießen, Institut für Landtechnik der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen (Hrsg.), Gießen 1993, S. 45-53.<br />
[29] Unterschiedliche Kraftfutterkonzepte in der Kälberaufzucht. Versuchsbericht<br />
3/1998, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung<br />
und Grünlandwirtschaft Aulendorf.