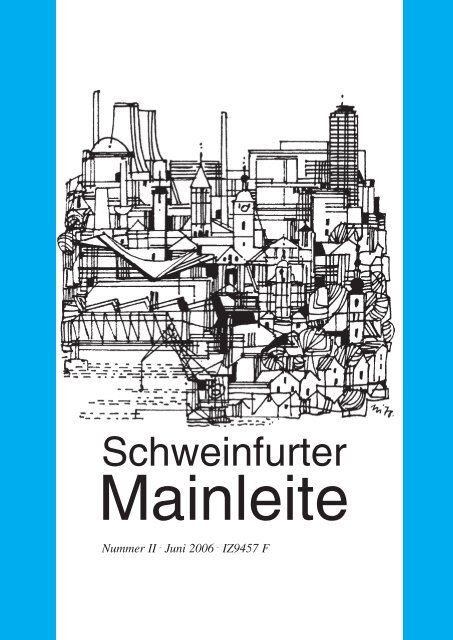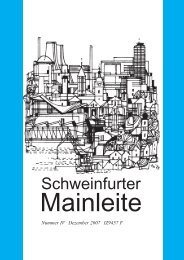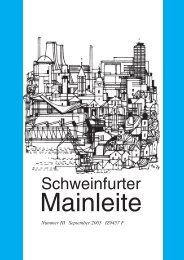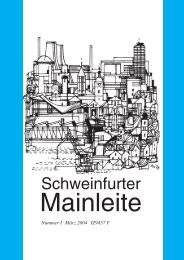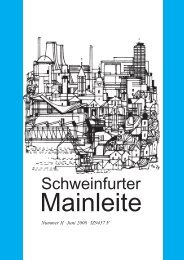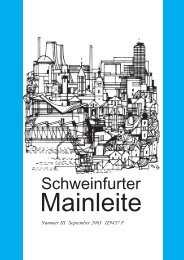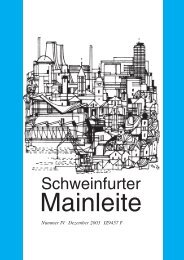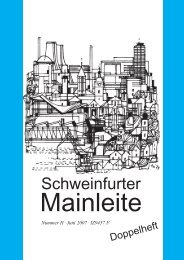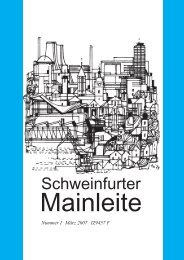Mainleite - Historischer Verein Schweinfurt
Mainleite - Historischer Verein Schweinfurt
Mainleite - Historischer Verein Schweinfurt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schweinfurt</strong>er<br />
<strong>Mainleite</strong><br />
Nummer II . Juni 2006 . IZ9457 F
_________________________________________________________<br />
Anschrift<br />
der Redaktion<br />
Ernst Petersen, Tel. (0 97 21) 2 85 43,<br />
email: petersen-schweinfurt@t-online.de<br />
<strong>Historischer</strong> <strong>Verein</strong> <strong>Schweinfurt</strong> e.V.<br />
Petersgasse 3 („Schrotturm“), 97421 <strong>Schweinfurt</strong><br />
Geschäftszeiten: Mo.+ Do. 15-17 Uhr, Tel. (09721) 18 66 28<br />
_________________________________________________________<br />
Inhalt<br />
Geleitwort ................................................................................. 1<br />
Suchbild ..................................................................................... 2<br />
Aufsätze<br />
Ernst Petersen<br />
Graf Montgelas – ein Segen für Franken<br />
Kurzvortrag anläßlich der Mitgliederversammlung ........................ 4<br />
Hans Graetz<br />
Georg Carl Gottlieb Sattler ........................................................... 19<br />
Hans-Dieter Schorn<br />
Kgl. Post Bayern.<br />
Es war einmal … ......................................................................... 24<br />
Studienfahrten ....................................................................... 28<br />
Personalia ............................................................................... 29<br />
________________________________________________________<br />
Impressum <strong>Schweinfurt</strong>er <strong>Mainleite</strong><br />
Herausgeber: <strong>Historischer</strong> <strong>Verein</strong> <strong>Schweinfurt</strong> e.V.<br />
Redaktion: Ernst Petersen, Dr. Uwe Müller, Dr. Erich Schneider<br />
Umschlaggestaltung: Isi Huber<br />
Druck: Weppert Print & Media GmbH, <strong>Schweinfurt</strong><br />
Der Verkaufspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.<br />
Gefördert von der Stadt <strong>Schweinfurt</strong> und dem Bezirk Unterfranken<br />
_________________________________________________________
_________________________________________________________<br />
Geleitwort<br />
Franken –<br />
ein substantiell<br />
konstitutiver Bestandteil<br />
Bayerns<br />
der Historische<br />
<strong>Verein</strong> führt<br />
zusammen<br />
Die diesjährige Landesausstellung in Nürnberg trägt den Titel<br />
„200 Jahre Franken in Bayern“. Dabei wird vor allem der Beitrag<br />
Frankens zur politischen, gesellschaftlich-kulturellen und<br />
wirtschaftlichen Einheit Bayerns gewürdigt.<br />
Das vorliegende Heft stellt drei Beiträge aus der Epoche der<br />
bayerischen Königszeit vor.<br />
Der erste, umfangreichere Aufsatz, der das Konzept meines<br />
Kurzvortrages bei der Mitgliederversammlung des Historischen<br />
<strong>Verein</strong>s <strong>Schweinfurt</strong> bildete, und hier unverändert gedruckt wird,<br />
zeichnet den Werdegang des Grafen Montgelas nach, der für die<br />
Staatsgründung Bayerns von entscheidender Bedeutung war.<br />
Meine These verläuft entgegen der weitverbreiteten Meinung,<br />
dass Montgelas und der Kurfürst Max Joseph IV. (der spätere<br />
König Max I. Joseph) Franken ins bayerische Kurfürstentum<br />
einverleibt hätten und Franken ein Opfer der bayerisch-französischen<br />
Machtpolitik geworden wäre, in eine andere Richtung: Ich<br />
denke, dass es sachlich richtiger ist, davon zu sprechen, dass<br />
Bayern damals völlig neu entsteht und insgesamt eine völlig neue<br />
Ordnung durch den König und seinem engsten Mitarbeiter<br />
Montgelas erhält. Im Gegensatz zur Wiedervereinigung 1989<br />
wird nicht eine bestehende Ordnung den neu dazukommenden<br />
Gebieten wie Franken übergestülpt. Damit hatte Franken auch<br />
die Chance, sein eigenes Gepräge in das Land Bayern einzubringen.<br />
Der Redakteur muss sich an dieser Stelle entschuldigen, dass im<br />
letzten „<strong>Mainleite</strong>“ 2006-I der Name der Verfasserin des Leserbriefs<br />
zu dem Aufsatz von Kurt Petzold über die Ermordung der<br />
polnischen Fremdarbeiterin Sophie Malcik, versehentlich<br />
unterschlagen wurde. Dies wird hier nachgeholt: Frau Elisabeth<br />
Böhrer ist vielen als ausgewiesene Kennerin von Einzelheiten der<br />
damaligen Verhältnisse bekannt. Mein Versehen hatte allerdings<br />
auch einen positiven, nicht vermuteten Nebeneffekt: Eine weitere<br />
Anfrage und Vermutung zum Grab Sofie Malciks – von Herrn<br />
Scholz an den <strong>Verein</strong> gesandt – konnte auf diesem Wege Frau<br />
Böhrer gleich ein Stück weit erhellen und aufklären.<br />
Ernst Petersen<br />
_________________________________________________________<br />
1
_________________________________________________________<br />
Suchbild<br />
Suchbild<br />
Ein Wappen ziert dieses stattliche Haus. Der versierte Geschichtskenner<br />
wird sofort erkennen, um welches Wappen es<br />
sich handelt. Welches<br />
Gebäude ziert es?<br />
Nur soviel sei hier<br />
verraten: Es wurde<br />
über dem Portal einer<br />
Institution angebracht,<br />
deren Bürogebäude<br />
heute gerne als<br />
„moderne Paläste“<br />
bezeichnet werden.<br />
Viele dieser Gebäude<br />
überragen an Höhe<br />
Kirchen und an Geldaufwand<br />
Schlösser.<br />
Auflösung des Suchbildes der Nummer 2006 - I<br />
Zum Suchbild der letzten Nummer erreichten uns wieder einige<br />
richtige Lösungen. (rechts oben z.B. Herr Lauerbach, Herr<br />
Reusch Herr W. Küntzel), unten Frau Natascha Nowack-<br />
Göttinger).<br />
Herr Küntzel weist darauf hin, dass die Figur aus grünem<br />
Sandstein aus dem Bruch bei Obersteinach/Ebrach gefertigt<br />
wurde. Herr Lauerbach weiß noch: „... eine spontane Spendenaktion<br />
der Bürgerschaft ermöglichte es, daß von 10 unterfränkischen<br />
Bildhauern die neuen Giebelfiguren geschaffen wurden.“<br />
_________________________________________________________<br />
2
_________________________________________________________<br />
Leserbrief zur Auflösung des Suchbildes der Nummer 2005 - IV<br />
Herr Reinhold Jordan sandte uns einen Leserbrief zur Auflösung<br />
des letzten Suchbildes. Er schreibt:<br />
„Diese Darstellung ist so nicht richtig. Das „Kuratorium Unteilbares<br />
Deutschland“ stellte 1964 ein ganz anderes Denkmal auf. Es<br />
handelte sich um einen rechteckigen Stein, auf dem eine<br />
Deutschlandkarte in den Grenzen von 1937 abgebildet war.<br />
Dieser Stein war Mitte der 80er Jahre angeblich reparaturbedürftig.<br />
Er wurde aber nicht repariert (wohl,<br />
weil die Deutschlandkarte politisch nicht<br />
mehr opportun erschien), sondern durch<br />
die jetzt dort stehende Skulptur ersetzt.<br />
Wer kennt den Künstler des alten Denkmals?<br />
Was ist aus diesem Denkmal<br />
geworden? Wer kennt den Künstler des<br />
neuen Denkmals? Wer hat das neue<br />
Denkmal aufstellen lassen?“<br />
_________________________________________________________<br />
3
_________________________________________________________<br />
Aufsätze<br />
Ernst Petersen<br />
Graf Montgelas – ein Segen für Franken<br />
Kurzvortrag anläßlich der Mitgliederversammlung des Historischen <strong>Verein</strong>s <strong>Schweinfurt</strong> 1<br />
Franken – ein Opfer<br />
Napoleons?<br />
Zwei eher zufällige Gründe haben mich bewogen, dieses Thema<br />
für den heutigen Abend zu wählen, als ich um den Kurzvortrag<br />
anlässlich der Mitgliederversammlung gebeten wurde.<br />
Zum einen jährt sich in diesem Jahr 2006 zum 200hundersten<br />
Mal die Erhebung Bayerns zum Königreich. Dazu zähle ich auch<br />
die Schaffung des modernen Bayerns, die sich bekanntlich von<br />
1802, noch vor dem endgültigen Hauptschluss der Reichsdeputation,<br />
bis 1816/17 hinzieht, als auch 1814 wieder das Großherzogtum<br />
Würzburg und schließlich noch kleinere Gebiete wie Alzenau<br />
oder Bad Brückenau in das Königreich integriert wurden.<br />
Zum anderen erschien im vergangenen Jahr der zweite Band der<br />
umfangreichen Biographie Graf Montgelas’. 2 35 Jahre nach der<br />
Veröffentlichung des ersten Teils seiner Habilitationsschrift<br />
konnte nun Eberhard Weis, mittlerweile emeritiert, den 2. Band<br />
folgen lassen. Dort werden akribisch und minutiös die Handlungen<br />
und Überlegungen des „allmächtigen Staatsministers“ auf<br />
Grundlage einer schier unübersehbaren Quellenmasse für den<br />
Zeitraum von 1799 bis 1817 beschrieben.<br />
Es ist ganz gewiß ein Vorurteil von mir als gebürtigen Münchner<br />
gewesen, diesen Montgelas auch gleich als Segen für die fränkischen<br />
Lande zu mutmaßen, wie ich es in meiner Naivität formuliert<br />
hatte. Nichts ahnend, dass allein die Ankündigung dieses<br />
Vortrages mir einen Brief ins Haus flattern ließ, der zum Inhalt<br />
hatte, dass dieser Montgelas keinesfalls ein Segen für Franken<br />
gewesen sei. Denn merkwürdigerweise wird von Franken gerne<br />
der Beginn des 19. Jahrhunderts als Ende des Römischen<br />
Reichs Deutscher Nation betrauert, 3 es wird der Verlust der<br />
Reichsunmittelbarkeit beklagt, es wird vor allem in der älteren<br />
römisch-katholischen Kirchengeschichtsschreibung die Säkularisierung<br />
als Katastrophe oder zumindest großes Unglück bzw.<br />
Unrecht angeprangert und nicht zuletzt die Inbesitznahme<br />
Frankens durch den bayerischen Herzog als Konfiszierung oder<br />
Annexion der fränkischen Lande verstanden. Die Franken, so<br />
meine ich gele-gentlich zu hören, sind zum Opfer einer nicht<br />
durch das Recht getragenen Machtpolitik Frankreichs und<br />
_________________________________________________________<br />
4
_________________________________________________________<br />
Veränderung des<br />
Blickwinkels<br />
Bayerns geworden und es bis heute geblieben. Manche Annektoden<br />
wie die Groteske um die Rückforderung des Fränkischen<br />
Schwertes ins Mainfränkische Museum nach Würzburg oder die<br />
angebliche Benachteiligung fränkischer Gebiete durch Politik<br />
oder Wirtschaft scheinen solchen Vorstellungen Nahrung zu<br />
geben. Auch wenn die Option nach einem eigenen Bundesland<br />
Franken selbst in unseren Ge-bieten kaum ernsthafte Befürworter<br />
findet, es scheint doch ein merkwürdiges latentes „Minderwertigkeitsgefühl“<br />
gegenüber den Altbayern vorhanden zu sein,<br />
als ob eine Niederlage nicht ver-schmerzt sei.<br />
Aber wer sollte der Sieger sein? Gibt es den überhaupt? Etwa<br />
der Kurfürst in München oder das Herzogtum Altbayern?<br />
Ein Blick auf die Entstehung des modernen Bayerns in den ersten<br />
20 Jahren des 19. Jahrhunderts lehrt uns etwas Besseres.<br />
Vor allem führt er uns dazu, den oft unreflektiert althergebrachten<br />
Blickwinkel zu ändern. Ein interessantes Thema, das ich aber<br />
heute übergehen möchte, wäre durchaus die Frage, wer denn ein<br />
Interesse daran gehabt haben könnte, dieses alte Bild des Anschlusses<br />
Frankens an Bayerns zu vertreten.<br />
In der Berufsschule nehme ich zur Zeit den Streit um die Thesen<br />
Galileo Galileis durch. Galileo ist bekanntermaßen der Auffassung<br />
Kopernikus’ gefolgt, dass sich entgegen dem Augenschein<br />
die Sonne nicht um die Erde drehe, sondern es sich andersherum<br />
verhält. Mit anderen Worten: Kann man die Integration<br />
Frankens in das Kurfürstentum Bayern nicht als Gewinn oder als<br />
eine gewisse Befreiung verstehen? Als evangelischer Münchner<br />
würde ich übrigens sofort hinzufügen, müssen nicht in gleicher<br />
Weise die Altbayern oder die Pfälzer das Entstehen des neuen<br />
Bayerns ihrerseits als große Befreiung begreifen, die vielleicht<br />
ohne die fränkischen und pfälzischen Gebietserweiterungen so<br />
nicht möglich gewesen wären?<br />
Noch einmal anders ausgedrückt: „Der Herzog ohne Land“ aus<br />
dem kleinen, nicht einmal 100.000 Bewohner zählenden Herzogtum<br />
Zweibrücken, als zweitgeborener Sohn ohne Regentschaftsanspruch,<br />
dieser Maximilian IV. Joseph konstruiert, nachdem<br />
er urpötzlich zum Kurfürsten hinaufgespült wurde, zusammen<br />
mit seinem Vertrauten und seinem Staatsminister Montgelas,<br />
auch dieser zunächst ein kleiner Adeliger ohne Land und<br />
Macht, aus dem Nichts heraus einen Staat, der schon bald weit<br />
und breit als einer der modernsten gerühmt wird.<br />
_________________________________________________________<br />
5
_________________________________________________________<br />
Die Áufklärung als<br />
geistiger Motor<br />
Erziehung Montgelas’<br />
Taufeintrag Montgelas`<br />
(Münchener<br />
Liebfrauenkirche)<br />
Der Übernahmekandidat, ich denke es ist nicht zu überspitzt<br />
formuliert, der Übernahmekandidat Alt-Bayern – Österreich sah<br />
sich schon mehrmals auf dem Siegertreppchen – wird tatsächlich<br />
übernommen: nicht von Österreich, nicht von Frankreich,<br />
auch nicht von Preussen, das eher ein Auge auf die nördlich der<br />
Donau liegenden fränkischen Lande geworfen hatte, aber auch<br />
nicht vom Kurfürsten Maximilian IV. Joseph und späteren König<br />
Max I. oder dem allmächtigen Staatsminister Montgelas, sondern,<br />
halten Sie sich fest, verehrte Hörer, sondern vom Staat<br />
Bayern als neu entstehender Größe. Es ist eine Revolution von<br />
oben, die gewiß nicht ohne den König möglich gewesen wäre.<br />
Eine Revolution, mit der sich letztlich der König selbst entmachtet.<br />
Er wird den Staat nicht als seinen Besitz begreifen, sondern<br />
als Aufgabe, ihn zu lenken und zu führen. Aus einem absoluten<br />
Fürstentum von Gottes Gnaden wird eine konstitutionelle<br />
Monarchie, die an einer wirklichen Blüte des Landes ihr Interesse<br />
hat. (Die heftigsten Widerstände gegen die Neuordnung Bayerns<br />
kamen übrigens nicht von ungefähr aus Altbayern. Dort wurde<br />
um Privilegien gefürchtet.)<br />
Wie kommt es zu dieser Entwicklung?<br />
Zu allererst ist natürlich die geistige Grundströmung des ausgehenden<br />
18. Jahrhunderts zu nennen, in die hinein Montgelas<br />
hineingeboren wurde: die Aufklärung. So sind verwandte Entwicklungen<br />
der Staatsgestaltung auch in Frankreich, Österreich,<br />
Preussen, besonders aber auch in den süddeutschen Staaten<br />
Baden und Württemberg verlaufen. Eine markante Note erhält<br />
die bayerische Ausgestaltung durch jene beiden Persönlichkeiten,<br />
Max I. und Montgelas.<br />
Letzterer wurde 1759 als Sohn des aus Savoyen stammenden<br />
und in bayerische Dienste übergetretenen Offiziers und Diplomaten<br />
Janus Montgelas und einer Münchner Gräfin geboren. Kur-<br />
_________________________________________________________<br />
6
_________________________________________________________<br />
Staatsdienst<br />
fürst Max III. war übrigens Taufpate, ließ sich aber durch einen<br />
Kammerherrn bei der Taufe vertreten. Die Mutter starb bereits<br />
ein halbes Jahr nach Montgelas Geburt, sein Vater 7 Jahre später.<br />
Die 2 Jahre ältere Schwester wurde in Klöstern erzogen, um<br />
Maximilan Joseph kümmerte sich neben dem Freisinger Kardinal<br />
auch sein Taufpate. Schon mit 5 Jahren wurde der Junge an<br />
einem Kolleg der Universität Nancy erzogen. Er erlebte dort die<br />
Aufhebung des Jesuitenkollegs, an dem er lernte, die Jesuiten<br />
sah er durch neue Lehrkräfte ersetzt, neuere Geschichte und<br />
Naturwissenschaften traten im Lehrplan in den Vordergrund.<br />
Von 1770 (11jährig) bis 76 studiert er dann in Straßburg Jura.<br />
Straßburg – protestantisch geprägt – war in dieser Zeit nicht nur<br />
eine der bedeutendsten Universitäten Frankreichs, sondern auch<br />
Deutschlands. Diese Überschneidung der beiden Kulturkreise, ist<br />
ganz besonders für Montgelas prägend. Er wird sich flüssiger<br />
und gewandter auf französisch ausdrücken können als in seiner<br />
Heimatsprache Deutsch. In Straßburg hört er nicht nur Jurisprudenz<br />
sondern erhielt auch eine auf höchstem Niveau stehende<br />
Ausbildung in den Geschichtswissenschaften. Führende Kräfte<br />
seiner Zeit studierten in Straßburg. <strong>Verein</strong>igt wurden dort deutsche<br />
und franz. Kultur, Gotik und Rokoko, protestantisches und<br />
Katholisches, absolute Monarchie und ehemals freie Reichsstadt<br />
mit Selbstverwaltung, Aristrokratie und selbstbewusste Bürgertum,<br />
Kunst und Wissenschaft. 4<br />
Das letzte Studienjahr verbrachte er dann an der bayerischen<br />
Universität in Ingolstadt. 1777 erwarb er mit außerordentlichem<br />
Lob das Diplom, im gleichen Jahr bestand er in München vor der<br />
Hofratskommission die Proberelation.<br />
Im Alter von 18 Jahren tritt er in den Staatsdienst ein. Drei Monate<br />
vor dem Tod seines Taufpaten wird er zum wirklichen Hofrat<br />
ernannt, allerdings vorläufig ohne Gehalt. Kurfürst Karl Theodor,<br />
der Nachfolger Max III. Josef, strich sogar eine Waisenpension,<br />
so dass Montgelas 10 Jahre nach Dienstantritt ein erneutes Gesuch<br />
nach einer Bezahlung für seine vielfältigen Dienste einreichte.<br />
(Ob sich der heutige Staat auch nach solchen Beamten<br />
sehnt?)<br />
Zuständig war er für Straf- und Zivilsachen. Er wurde mit Finanzangelegenheiten<br />
und Staatskirchenrecht betraut.<br />
Schon in dieser frühen Beamtenzeit wird Montgelas von auswär-<br />
tigen Gesandten sehr positiv beurteilt. Man zählt ihn zu den zwei<br />
_________________________________________________________<br />
7
_________________________________________________________<br />
einzigen wirklich fähigen Hofbeamten. Der franz. Gesandte<br />
Montezan schreibt: „Der Freiherr von Montgelas, ein junger<br />
Mann, der von Natur aus sehr viel Scharfsinn, Gedächtnis und<br />
Kaltblütigkeit besitzt. Er hat sich ausgedehnte Kenntnisse<br />
erworben und sie gut verarbeitet. Er steckt voller Eifer und<br />
Arbeitslust, aber er ist bisher beschränkt auf den einfachen<br />
Posten eines Hofrates unter Herrn Geyer. Er ist hier niemals<br />
gern gesehen gewesen, weil er von Anfang an das Missfallen der<br />
Teutonique erregt hat. Indessen war man bereit im letzten Jahr<br />
etwas für ihn zu tun, als die elende Affäre der Illuminaten<br />
dazwischenkam…“ 5<br />
Ab 1780 war er auch Mitglied des Bücherzensurkollegiums. Freilich<br />
war dies eine sehr merkwürdige Behörde. Sie begünstigte<br />
nämlich das Erscheinen derjenigen Bücher, die sie eigentlich<br />
bekämpfen sollte. Nicht aufgeklärtes Schrifttum, sondernPolemiken<br />
gegen die Aufklärung behinderte dieses Amt. Das hatte<br />
seinen Grund darin, dass fast sämtliche Mitarbeiter dieses<br />
Gremiums Mitglieder des geheimen Illuminatenordens waren.<br />
Diesem Orden, streng hierarchisch aufgebaut, trat auch Montgelas<br />
1779 bei. Als Nummer 35, mit dem Ordensnamen, Museus,<br />
wurde er bis zur Aufdeckung dieser<br />
geheimen Gesellschaft geführt. Wenn<br />
auch freimaurerisch in den Äußerlichkeiten<br />
organisiert, war es ein Zusammenschluß<br />
von Adeligen (35 %) und gut<br />
Bürgerlichen, die sich wohl in lockerer<br />
Runde trafen, diskutierten und zusammen<br />
aufklärerische Ideale vertraten.<br />
Obwohl Montgelas nach der Aufdeckung<br />
seiner Illuminatenzugehörigkeit nicht<br />
politisch verfolgt wurde, sogar seine<br />
Ämter behielt, das Vertrauen des eh<br />
sehr misstrauisch veranlagten Karl<br />
Theodor hatte er verloren. Montgelas<br />
sah keine Zukunft mehr in München.<br />
Der Gesandte schreibt weiter: „… Es ist<br />
wahrhaft schade, dass er mit 27 Jahren<br />
ausgeschaltet ist mit ebensoviel<br />
Verdiensten wie Fähigkeiten.“ 6<br />
Mitgliederverzeichnis<br />
des Illuminatenordens.<br />
Montgelas wurde<br />
unter Nr. 35 mit dem<br />
Namen „Museus“<br />
geführt.<br />
_________________________________________________________<br />
8
_________________________________________________________<br />
Wechsel nach<br />
Zweibrücken<br />
Ansbacher<br />
Memoire<br />
Doch Montegelas bleibt den Wittelsbachern treu.<br />
In Zweibrücken, am Hofe des voraussichtlichen Erben Pfalzbayerns,<br />
Herzog Karl II., wird er 1787 außenpolitischer Berater.<br />
Nach der Eroberung Zweibrückens 1793 durch die Franzosen<br />
und der Flucht des Herzogs nach Mannheim, bleibt Montgelas<br />
allein in Zweibrücken zurück, wohl um wichtige Dokumente zu<br />
sichern und eventuell Verhandlungen mit den Besatzungsoffizieren<br />
zu führen. Schließlich muss er sich jedoch nach Mannheim<br />
zu seinem Herzog durchschlagen. Er wird verdächtig mit den<br />
Jakobinern zusammengearbeitet zu haben, und verliert daraufhin<br />
jeglichen Einfluss. Auch sein Gehalt wird ihm entzogen. Bis zum<br />
überraschenden Tode des Herzogs am 1.4.1795 wird er keine<br />
öffentliche Wirkung erzielen können.<br />
Nun ist Max IV. Joseph Regent der Zweibrücker Linie und, da<br />
Karl Theodor kinderlos blieb, auch der künftige Erbe der gesamten<br />
Wittelsbachischen Linien.<br />
Dieser ernennt Montgelas 1795 erneut zum wirklichen Regierungsrat<br />
mit Sitz und Stimme im Herzoglichen Regierungskollegio.<br />
Das Vertrauen des neuen Herzogs erwarb sich Montgelas<br />
aber wohl erst in Ansbach, in das der Herzog vor den weiter an<br />
Mannheim heranrückenden französischen Heer zurückwich. Dort<br />
lernte Max IV. seine zweite Frau Caroline von Baden kennen,<br />
eine Protestantin, die sich im Ehevertrag die weitere Ausübung<br />
ihrer Religion sicherte.<br />
Montgelas nutze die Zeit im Ansbachischen Exil, um für die<br />
kommende Regierungszeit Max IV. ein Programm auszuarbeiten.<br />
Das sogenannte Ansbachische Memoire beschreibt bereits all die<br />
Ziele, die Montgelas zusammen mit Max Josef später in Angriff<br />
nehmen sollte.<br />
Ähnlich wie Hardenberg und Stein für Preussen oder Reitzenstein<br />
für Baden, entwarf Montgelas ein Konzept zur Anpassung<br />
der Bayerischen Verfassungs- und Verwaltungsverhältnisse an<br />
die Gegebenheiten einer neuen Zeit. Anders als die übrigen Reformer<br />
verfasste Montgelas jedoch seine Vorstellungen für einen<br />
Herzog ohne Land. Das Memoire ist keine theoretische Schrift,<br />
vielmehr ein Leitfaden für künftiges Verwaltungshandeln. Auf sieben<br />
eigenhändig beschriebenen Doppelblättern erörtert der spätere<br />
Minister die herrschenden Verhältnisse in Bayern und<br />
schlägt Maßnahmen vor, die seiner Meinung nach für eine<br />
_________________________________________________________<br />
9
_________________________________________________________<br />
Das von Montgelas<br />
verfasste und eigenhändig<br />
geschriebene<br />
sog. „Ansbacher<br />
Memoire“ von 1796<br />
effektive und nach den Gesichtspunkten der Aufklärung geführte<br />
Staatsverwaltung notwendig seien.<br />
1799 wurde Herzog Maximilan IV. Joseph Kurfürst von Bayern.<br />
Einen Tag nach der Ankunft Max in München wurde Montgelas<br />
sein Minister. Er sollte mit ihm zusammen den neuen Staat<br />
bauen.<br />
_________________________________________________________<br />
10
_________________________________________________________<br />
Das politische<br />
Programm Montgelas’<br />
Das Memoire, französisch abgefasst, stellt zuerst die gröbsten<br />
Missstände der Regierung Karl Theodors dar, die Montgelas<br />
noch aus eigener Anschauung kannte. Ein französischer Gesandter,<br />
nimmt im selben Jahr in einem internen Schreiben kein<br />
Blatt vor den Mund: „der sicherste Beweis dafür, dass Bayern<br />
das irdische Paradies Deutschlands ist, liegt in der Tatsache,<br />
dass diese Provinz … bisher imstande gewesen ist, eine<br />
Regierung zu ertragen, die allgemein als die schlechteste aller<br />
schlechten Regierungen Europas anerkannt ist.“<br />
Gravierendste Mängel sind laut Montgelas eine fehlende klare<br />
Geschäftsverteilung auf höchster Behördenebene, mangelnde<br />
Absprachen sowie vor allem eine schlecht ausgebildete und<br />
obendrein korrupte Beamtenschaft.<br />
So zielen die ersten Vorschläge auf die Erneuerung der Beamtenschaft,<br />
dann werden die einzelnen fünf Geschäftsbereiche, die<br />
ich später nennen werde, im einzelnen vorgestellt:<br />
Ich zitiere: „Man könnte diesem vorrangigen Problem leicht<br />
abhelfen, wenn man sich dazu entschließen würde, die Departements<br />
nach rationalen Gesichtspunkten aufzuteilen, …, indem<br />
man die Platzhirsche, die bisher an der Spitze der Büros standen<br />
durch kompetente Leute ersetzt; sie sollten fähig sein, Untergebene<br />
zu beaufsichtigen, gegebenenfalls deren Vorstellungen zu<br />
berichtigen, und in jeder Hinsicht dem Vertrauen entsprechen,<br />
mit dem der Fürst sie ehrt. Ein Haken, den man auf jeden Fall<br />
vermeiden sollte, wäre die zu große Bescheidenheit bei den<br />
Bezügen. Jedes Individuum das seine Zeit dem Staat verschreibt,<br />
hat einen berechtigten Anspruch auf angemessene<br />
Entlohnung, entsprechend dem gesellschaftlichen Rang, den es<br />
einnimmt, und nach seinem Tod auf angemessene Entschädigung<br />
für seine Frau und seine Kinder.“ 7 Falsche Sparsamkeit in<br />
der Vergangenheit hätte notwendigerweise zu der ausufernden<br />
Bestechungspraxis geführt.<br />
In der Regierungszeit wurden dann einheitliche Ausbildungswege<br />
und Prüfungsordnungen verabschiedet, so dass in der Auswahl<br />
der Beamten ganz nach dem Leistungsprinzip vorgegangen<br />
werden konnte. Nicht mehr die Herkunft entschied, sondern die<br />
Platzziffer bei der Prüfung. Die Beamten wurden finanziell<br />
abgesichert, sie waren praktisch nicht mehr entlassbar. Der Staat<br />
vergab jetzt alle Ämter, es gab keine Privilegien mehr. Die<br />
Besoldung wurde zweigeteilt, zum Grundgehalt, das mit Fort-<br />
_________________________________________________________<br />
11
_________________________________________________________<br />
Der König und sein<br />
Minister.<br />
Max I. Joseph (links)<br />
und Montgelas<br />
(rechts).<br />
Der König am<br />
Schreibtisch. Damit<br />
kommt bildhaft zum<br />
Ausdruck, dass Max I.<br />
unermüdlich arbeitete.<br />
(J. Stieler, 1814)<br />
1804 malte J. Hauber<br />
Montgelas in der<br />
Tracht des<br />
Hubertusordens.<br />
schreiten der Dienstjahre 90% betrug, kam das Dienstgehalt<br />
dazu, das nur aktive Beamte erhielten (+ 10%).<br />
Noch heute folgt das Beamtenrecht im wesentlichen den Montgelas’schen<br />
Reformen. Wichtig war der Geist, der dahinterstand:<br />
Der Beamte ist nicht mehr der Diener des Fürsten, sondern er ist<br />
zum Staatsdiener geworden, der dem Fürsten in gewisser Weise<br />
gegenübersteht. Bis heute wird darauf peinlichst geachtet, dass<br />
der Beamte nicht durch eine Regierungspartei „missbraucht“<br />
wird.<br />
Montglas teilt das Gesamtministerium in 5 Departements: „die<br />
auswärtigen Angelegenheiten, die Finanzen, die Justiz, die<br />
geistlichen Angelegenheiten, der Krieg“. 8 Personelle Ausstattung<br />
und die Höhe der Gehälter werden vorgeschlagen.<br />
Im Bereich der Finanzen wird die Aufhebung finanzieller Vorrechte<br />
der privilegierten Stände gefordert, die Erstellung eines Katasters,<br />
das eine gerechtere Erhebung der Steuern ermöglicht, die<br />
Abschaffung von Abgaben, die das Volk zu sehr belasteten, die<br />
Aufhebung des „katastrophalen bayerischen Zollsystems“. 9 Kein<br />
Wunder, dass die Adeligen und auch die Patrizier der Reichsstädte<br />
gegen diesen Verlust von Vergünstigungen sturmliefen.<br />
Hatten doch nicht sie, sondern die Bevölkerung die enormen<br />
Kriegslasten dieser Jahre zu tragen.<br />
Im Bereich des Justiz- und Verwaltungswesens ging es im<br />
wesentlich um eine vernünftige und klare Neuorganisation der<br />
Gerichte und Verwaltungsstrukturen. Als Resultate können wir<br />
heute noch die Kreiseinteilung Bayerns erkennen. 1808 waren es<br />
15 Kreise, 1810 neun. Die Kreise wurden nach Flüssen benannt.<br />
Später korrigiert wurde die Manie Montgelas, bis in die Gemein-<br />
_________________________________________________________<br />
12
_________________________________________________________<br />
den hinein alles zentral zu entscheiden. Eine gewisse Selbständigkeit<br />
wurde auch <strong>Schweinfurt</strong> später wieder zugestanden.<br />
Eine wichtige Maßnahme, die noch nicht im Memoire vermerkt<br />
ist, wird die schrittweise Trennung von Verwaltung und Justiz<br />
sein. Wohl aus Kostengründen wurde sie auf ländlicher Ebene<br />
zunächst nicht durchgeführt. Außerdem setzte er nicht die in<br />
seinem Denkansatz liegende Entmachtung der Patrimonialgerichte<br />
durch. Der Adel konnte hier nach wie vor seine starke<br />
Stellung halten. Es muss allerdings auch betont werden, dass<br />
Montgelas an der Erhaltung des Adelsstandes interessiert war,<br />
wohl nicht nur weil er selbst in den Grafenstand erhoben wurde,<br />
sondern vor allem, weil er darin einen wesentlichen Rückhalt für<br />
das Königreich sah.<br />
Am bekanntesten wurde Montelas aber durch die besonders<br />
konsequente Erneuerung des Staates auf geistlichem Gebiet, vor<br />
allem durch die Säkularisation.<br />
Der Staatskirchenrechtler schärft er ein: „Alle Welt weiß heute,<br />
dass die Zuständigkeit der Kirche sich auf die Glaubenslehre<br />
beschränkt, und dass alles, was man ihr darüber hinaus zugesteht,<br />
auf Bewilligung basiert, die, um rechtmäßig zu sein, eines<br />
formellen Rechttitels bedürfen.“ 10 Die Kirche, so meint er, hat<br />
allein Einfluss auf die Glaubenslehre, alle andern Lebensäußerungen<br />
einer Kirche fallen in die Zuständigkeit des Landesherrn.<br />
Vermögensverwaltung, zivil-, straf- und disziplinarrechtliche<br />
Vorgänge waren nun Staatsache, die Abhaltung von Feiertagen<br />
oder Prozessionen wurden zum weltlichen Bereich gerechnet,<br />
Priester und Pfarrer wurden Staatsbeamte und als „Volkserzieher“<br />
bezeichnet. Es wurde eine staatliche Prüfungsordnung für<br />
Priester erarbeitet, die Einteilung von Pfarrsprengeln oder die<br />
Besetzung von Pfarreien beanspruchte der Staat. Die evangelische<br />
Kirche konnte dies leicht annehmen, da seit der Reformation<br />
die Standesherrn, Fürsten oder der Stadtrat der freien<br />
Reichsstadt <strong>Schweinfurt</strong> gleichsam das Bischofsamt als „Notbischöfe“<br />
ausfüllten. Die Katholische Kirche tat und tut sich mit<br />
solchen Vorstellungen bis heute sehr viel schwerer.<br />
Ein Ergebnis und ein Erfordernis der Neuordnung Bayerns war<br />
die Gewährung der Toleranz, die sich zunächst im wesentlichen<br />
auf die drei christlichen Konfessionen römisch-katholisch,<br />
evangelisch-lutherisch und reformiert (Pfalz) erstreckte. Alle nicht<br />
aufgeklärten Bürger taten sich auf diesem Gebiet in gleicher<br />
Weise schwer, die Katholiken in Altbayern ebenso wie die Luthe-<br />
_________________________________________________________<br />
13
_________________________________________________________<br />
Säkularisation<br />
Visitenkarte<br />
Montgelas’<br />
raner in <strong>Schweinfurt</strong>. Uwe Müller hat gezeigt, dass evangelischen<br />
Bürger <strong>Schweinfurt</strong>s, die in einer Ermahnung der Regierung als<br />
„intolerant“ bezeichnet werden, keineswegs die Heilig-Geist-Kirche<br />
gerne den Katholiken überließen bzw. alles dagegen mögliche<br />
unternahmen. 11<br />
Die jüdischen Mitbürger erhielten die volle Toleranz bzw. Gleichberechtigung<br />
zunächst nicht, auch wenn ihre Lage sichtbar gebessert<br />
wurde.<br />
Doch nun zur Säkularisation.<br />
Die Aufhebung der bayerischen Klöster 1802/03 war eingebettet<br />
in große Entwicklungen in Europa und im Reich. Nach der Reformation,<br />
im 18. Jhd. in Frankreich und anderen kath. Ländern<br />
im Zeichen der Aufklärung und nach der dritten Welle unter dem<br />
österreichischen Kaiser Joseph II. war die süddeutsche Säkularisation<br />
der 4. Akt. Im Memoire wurde sie wie folgt begründet: „Die<br />
Abteien und Klöster brauchen eine Reform, die sie für die Gesellschaft<br />
nützlicher macht, als sie in der Vergangenheit gewesen<br />
sind. Die Bettelorden sollen vollständig aufgehoben werden. Sie<br />
fallen der Gesellschaft zur Last, in dem sie auf ihre Kosten leben<br />
und in ihr Unwissenheit und Aberglauben erhalten. Die anderen<br />
Ordensgemeinschaften könnten auf die Anzahl ihrer Gründungsmitglieder<br />
reduziert werden. Die verbleibenden Mitglieder würden<br />
die Verwaltung ihrer Güter in der bestehenden Form behalten,<br />
aber es wäre ihn nur gestattet, den für ihren Unterhalt notwendigen<br />
Teil der Einkünfte zu verwenden,… den Rest müssten<br />
sie an die Kirchenkasse abführen, um ihn zugunsten des Staates<br />
zu verwenden.“ 12<br />
Diese Linie liegt exakt im staatskirchenrechtlichen Grundverständnis<br />
Montgelas. Das Vermögen der Klöster und ihre Erträgnisse<br />
haben dem Saat, dem Allgemeinwohl zu dienen. Im Kern<br />
waren sie immer Besitz und Eigentum des Staates. Die Prälaten<br />
hätten für sich und ihre Klöster ein Eigentumsrecht widerrechtlich<br />
behauptet.<br />
Man mag dazu stehen wie man will. Aber volkswirtschaftlich,<br />
über die zwei Jahrhunderte bis heute<br />
gedacht, wird man den Sinn der Säkularisation kaum<br />
bestreiten können. Auch wenn angesichts des fast<br />
bankrotten bayerischen Staates die Regierung<br />
Montgelas nicht den erhofften finanziellen Gewinn<br />
daraus zog, so wurde doch der langfristige Prozess<br />
_________________________________________________________<br />
14
_________________________________________________________<br />
Das Königreich<br />
Bayern entsteht<br />
Proklamation des<br />
Königs (und der<br />
Königin) 1806 im<br />
<strong>Schweinfurt</strong>er<br />
Wochenblatt<br />
eingeleitet, dass die Bauern ehemaliger Klosterbesitzungen<br />
selbst Grund und Boden erwerben konnten.<br />
Selbst das ausschließlich römisch-katholisch orientierte Bayerische<br />
Handbuch der Kirchengeschichte, äußert sich eher<br />
zustimmend, wenn es auch einzelne Unsinnigkeiten der Durch-<br />
führung anprangert.<br />
13, 14<br />
Es ist aber sicher dem Urteil Winfried Müllers im eben erwähnten<br />
Handbuch der KG zuzustimmen, der betont, dass ohne die<br />
Säkularisierung im 19. Jahrhundert die Katholische Kirche sich<br />
wohl nicht zu einer geistlichen Neuorientierung aufgemacht hätte.<br />
Eine erst durch den Reichsdeputationhauptschluss und dann<br />
durch die Abdankung des deutschen Kaisers Franz II. rechtliche<br />
Möglichkeit war die Mediatisierung der deutschen Lande. Das<br />
heißt, viele kleine ehemals selbständige Fürsten und Städte<br />
verloren ihre Unmittelbarkeit und Selbständigkeit. Die große<br />
„Flurbereingung“ Deutschlands, wie man sich öfters vergleichend<br />
ausdrückt, konnte beginnen: Zuerst verloren die geistlichen<br />
Fürstentümer und Freien Reichsstädte ihre Souveränität , dann<br />
folgte auch die Reichsritterschaft, die ja in unseren Gebieten ein<br />
wichtiger Faktor war. Ich muss hier nicht die verschiedenen<br />
Runden, die um die Entschädigungen der deutschen Staaten<br />
geführt wurden, nachzeichnen. Ein hier den meisten bekannter<br />
_________________________________________________________<br />
15
_________________________________________________________<br />
Punkt ist, dass auch <strong>Schweinfurt</strong> für vier Jahre zum Großherzogtum<br />
Würzburg gehörte, das der Toskanafürst und Bruder des<br />
Österreichischen Kaisers innehatte. Es genügt das Ergebnis,<br />
dass Bayern unter Montgelas, er war seine ganze Amtszeit bis zu<br />
seinem Sturz 1817 Außenminister, durch geschickte Bündnispolitik<br />
ein ansehnlicher Flächenstaat wurde, der auch verwaltungsmäßig<br />
in den Griff zu bekommen war.<br />
Auschlaggebend für das Gelingen des Projekts war sicher nicht<br />
das Geld. Bayern war bettelarm. Auschlaggebend war auch nicht<br />
eine besondere Integrationspolitik, wie sie in unseren Tagen mit<br />
Ostdeutschland erprobt wird. Auschlaggebend war m.E., dass in<br />
einem Zuge ganz Bayern aus einem Guss von den Alpen bis ins<br />
entfernte Hof oder Aschaffenburg neu entworfen wurde. Auschlaggebend<br />
war, dass sich kaum Partikularinteressen Einzelner<br />
durchsetzen konnten. Zentralistisch wurde alles geordnet.<br />
Montgelas, sein König Max I. und seine vielen aufgeklärten Mitstreiter<br />
waren innenpolitisch unbestechlich. Nur Finanznöte<br />
konnten sie an der Umsetzung der ein oder andere Reform hindern.<br />
Sie handelten wirklich auf Rechnung des Staates und nicht<br />
auf eigene oder Freunde-Rechnung.<br />
Montgelas fühlte sich durch und durch für das Gelingen seines<br />
Reformwerkes verantwortlich. Immer mehr Aufgaben und Entscheidungen<br />
sollten durch seine Hand gehen. Er hatte zeitweise<br />
drei Ministerien auf einmal inne. Stoiber würde vor Neid erblassen,<br />
wenn er wüsste wieviele Akten durch die Hand Montgelas<br />
täglich gingen. Ruhte er, ruhten die Regierungsgeschäfte. Er war<br />
Kronprinz Ludwig wirklich der 1. Beamte.<br />
von Bayern<br />
(J. Stieler, vor 1817).<br />
Demonstrativ ließ sich<br />
Ludwig in der in<br />
Bayern verbotenen<br />
altdeutschen Tracht<br />
malen. Der schwarze<br />
Rock mit offenem<br />
Kragen war ein<br />
deutliches politsches<br />
Bekenntnis seiner<br />
deutsch-nationalen<br />
und antifranzösischen<br />
Gesinnung.<br />
_________________________________________________________<br />
16
_________________________________________________________<br />
Sturz Montgelas’<br />
Nicht das schlechteste<br />
Los für Franken<br />
Ein einziger Gegner erwuchs Montgelas wirklich. Es war der<br />
Kronprinz Ludwig, der nicht mehr der Aufklärergeneration<br />
angehörte. Wollten die Aufklärer alles zentralistisch, bürokratisch,<br />
von oben herab absolutistisch lösen, waren die Aufklärer<br />
mißtrauisch gegenüber dem einfachen Volk und dessen Sitte und<br />
Religion, so fand sich in Ludwig ein Gegenpart, der liberale<br />
Ansichten in die Waagschale warf, der eine Volksvertretung und<br />
Verfassung wünschte, der durchaus romantische Kunstideale im<br />
Herzen trug.<br />
Dieser seit langem schwelende Generationenkonflikt führte<br />
schließlich in eine überraschende Nacht- und Nebelaktion.<br />
Montgelas wurde ohne Anhörung auf massives Drängen des<br />
Kronprinzen Ludwig hin von König Max I. entlassen und in den<br />
Ruhestand geschickt. Ausdrücklich würdigte Max die Verdienste<br />
des großen Staatsministers und sicherte ihm eine großzügige<br />
Rente zu.<br />
Als Anerkennung für seine Leistungen war sie Montgelas<br />
eigentlich zu gering, das Beamtenrecht hätte ihm auch eine<br />
höhere Pension zubilligen können. Verarmt musste er jedoch<br />
nicht die 21 Jahre bis zu seinem Tod leben. Er hatte sich doch<br />
reichlich Grundbesitz in Teilen des heutigen Niederbayerns<br />
erworben. In seinem Palais am Münchner Karolinenplatz starb<br />
er, in Aham, Landkreis Landshut, wurde er beerdigt.<br />
Montgelas – ein Segen für Franken, so fragte ich.<br />
Als jedenfalls die Geschicke Mitteleuropas im Sturmwind<br />
Napoleons, des 1. Konsuls Frankreichs, gehörig durcheinandergewirbelt<br />
wurden, und die Zukunft der fränkischen Gebiete völlig<br />
offen zeigte, da übermittelt der <strong>Schweinfurt</strong>er Gesandte Boesner<br />
ein Trostwort in unsere Heimatstadt: „Dass unter vielen Loosen<br />
es doch noch eines der wünschenswerthesten ist, ein Bestandtheil<br />
des von einer der aufgeklärtesten Regierungen geleiteten<br />
Kurpfälzischen Staats zu werden.“ 15<br />
Denn dort regierte ein Montgelas.<br />
Und unter dem Eindruck der Abdankung Ludwigs I. konnte man<br />
1849 im Bayerischen Landboten lesen:<br />
„Wenn früher der Herold bei der Deutschen Kaiserkrönung zu<br />
Frankfurt ausrief: „Ist kein Dahlberg da?, so möchte es jetzt für<br />
Bayerns König an der Zeit sein auszurufen: „Ist kein Montgelas<br />
da?“ – Doch vergeblich dürfte der Ruf sein, denn er, der einzige<br />
_________________________________________________________<br />
17
_________________________________________________________<br />
Montgelas, 1836, mit<br />
der markanten Nase<br />
Halbrelief, Kupfer,<br />
getrieben, ø 21 cm<br />
(Franz Woltreck)<br />
Anmerkungen<br />
wirkliche große Staatsmann, den Bayern je besaß, der es auf die<br />
jetzige Stufe der Größe hob, ist todt, und kein ihm ebenbürtiger<br />
Geist, keine ebenso kühne wie starke Hand ist zu finden, die<br />
dem Staatsschiffe jenen Cours zu geben verstände, welchen die<br />
herannahenden Sturmwolken erfordern. Doch klar liegt seine<br />
Politik und Handlungsweise vor den Augen unserer Regierung.<br />
Möge sie seinen Geist erfassen, in seine Fußstapfen treten, und<br />
sie wird und kann nicht irren.“ 16<br />
1 Der Aufsatz wurde als Vortrag konzipiert und der Charakter der Rede nicht<br />
verändert.<br />
2 Weis, Eberhard: Montgelas; 1. Band: Zwischen Revolution und Reform 1759-<br />
1799, München 19882 ; 2. Band: Der Architekt des modernen bayerischen<br />
Staates 1799-1838, München 2005<br />
3 „... und manche hatten geweint.“ <strong>Schweinfurt</strong> wird bayerisch, hg. von Uwe<br />
Müller; Veröffentlichungen des Satdtarchivs <strong>Schweinfurt</strong>, Nr. 3, <strong>Schweinfurt</strong><br />
1989<br />
4 Weis I, S. 13f.<br />
5 Weis I, S. 51. Übrigens wird Montgelas auch durch österreichische Gesandte<br />
sehr positiv beurteilt, so dass die französische Stellungnahme nicht als<br />
einseitige Parteinahme für ihn zu werten ist.<br />
6 ebenda<br />
7 Zitiert nach der Übersetzung in: Das „Ansbacher Memoire“, in : Bayern<br />
entsteht. Montgelas und sein Ansbacher Memoire von 1796, Ausstellungskatalog.<br />
(Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 32/96),<br />
Augsburg 1996, S. 23<br />
8 a.a.O. S. 24<br />
9 a.a.O. S. 26<br />
10 a.a.O. S. 29<br />
11 „... und manche hatten geweint“: a.a.O. S. 47<br />
12 Ansbacher Memoire, a.a.O. S. 30<br />
13 Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, Band III<br />
14 Wittstadt, Klaus und Wolfgang Weiß,: Von der Schönbornzeit zur Säkularistion;<br />
Bd. 4 der Reihe: Das Bistum Würzburg. Leben und Auftrag einer<br />
Ortskirche im Wandel der Zeit, Straßburg 2000, S. 44ff. Im Unterton wird in<br />
dieser Darstellung jedoch die Säkularisation und das Ende des Fürstbistums<br />
beklagt.<br />
15 „... und manche hatten geweint“, a.a.O. S. 21<br />
16 zitiert nach Weis, II, S. XXIV<br />
_________________________________________________________<br />
18
_________________________________________________________<br />
Hans Graetz<br />
Georg Carl Gottlieb Sattler<br />
Vor einiger Zeit – 2003 – wurde die Gedenktafel am Eingang zu<br />
den Wehranlagen (neben der Treppe) aufgefrischt, da die Schrift<br />
kaum mehr zu lesen war. Die Renovierung erfolgte durch unser<br />
ehemaliges, leider inzwischen verstorbenes, Mitglied Fa. Christian<br />
Kämpf.<br />
Die Kosten für die Erneuerung betrugen 580.- Euro, die durch<br />
Sponsoren dankenswerterweise übernommen wurden.<br />
Unser Ehrenmitglied Dr. Hans Graetz stellt uns Carl Sattler und<br />
dessen Familie im folgenden Aufsatz näher vor.<br />
_________________________________________________________<br />
19
_________________________________________________________<br />
Hans Graetz<br />
Georg Carl Gottlieb Sattler<br />
genannt Carl, wurde am 17. Mai 1818 in <strong>Schweinfurt</strong> geboren.<br />
Als Taufpaten wurden ein Schwager seines Vaters, Carl Carvachi<br />
in Kassel, und der technische Leiter der Farbenfabrik in Schonungen,<br />
Georg Gerlach in <strong>Schweinfurt</strong> eingesetzt. Nach dem<br />
Ende seiner kaufmännischen Lehrzeit im väterlichen Geschäft<br />
kam er schon in jungen Jahren zu seiner weiteren Kaufmanns-<br />
Ausbildung zu Verwandten nach Bremen (Bindernagel) und St.<br />
Petersburg (Eck). Auf der Heimfahrt bereiste er Finnland.<br />
Später finden wir ihn in Staffordshire/England, wo sich die<br />
bekannte Wedgwood-Fabrik „Etruria“ befand, um dort für die<br />
väterliche Steingutfabrik in Aschach die Fabrikation von Steingutund<br />
Tonwaren zu erlernen.<br />
Nach seiner Rückkehr leitete Carl sieben Jahre lang diese<br />
Steingutfabrik in Aschach (Fa. Wilhelm Sattler & Söhne), die<br />
vorher von seinem Bruder Jens betreut wurde. (Siehe Katalog<br />
der Steingut-Fabrik Aschach-Ausstellung von 1993)<br />
Nebenher beschäftigte sich Carl mit chemischen, botanischen<br />
und mineralogischen Studien. Er war 1862 Mitbegründer des<br />
Naturwissenschaftlichen <strong>Verein</strong>s in <strong>Schweinfurt</strong>. Eine besondere<br />
Liebhaberei war für ihn die Kultur von Weinreben, die er aus<br />
allen Weingegenden Europas kommen ließ und prüfte, ob sie<br />
sich für den fränkischen Weinbau eigneten. Die Weinberge an<br />
der Peterstirn, in der Lethleite (= Lettenleite ?, die nach Westen<br />
geneigten Hängen des Höllental-Eingangs) und die Mainberger<br />
Schloß-Weinberge konnten damals als Musteranlagen betrachtet<br />
werden. 1862 zog sich Carl bereits in das Privatleben zurück, da<br />
er keine volle Befriedigung im kaufmännischen Beruf fand. Er<br />
hatte sich zwei Jahre vorher (1860) in der Nähe des Stadtbahnhofs<br />
im sog. Tannengarten ein schönes Wohnhaus von Baumeister<br />
J. W. Dauber erbauen lassen. Vorher war das alte Schmidt’<br />
sche Haus in der Kirchgasse (Nr. 27) sein Domizil.<br />
Am 7. Januar 1855 wurde Carl Sattler Mitglied der „Leopoldina“,<br />
der ältesten naturwissenschaftlichen Akademie der Welt, nachdem<br />
er dem damaligen Präsidenten der Akademie, Dr. Nees von<br />
Esenbeck, seine Arbeit über das „<strong>Schweinfurt</strong>er Grün“ mit der<br />
Erörterung der Frage: „Ist der angemessene und gewöhnliche<br />
Gebrauch des genannten Grüns der Gesundheit nachtheilig?“<br />
vorgelegt hatte. Er nahm den Cognomen „Göttling I“ an. Er be-<br />
_________________________________________________________<br />
20
_________________________________________________________<br />
trachtete diese Ernennung als Mitglied als eine besonders hoch<br />
einzuschätzende Ehrung.<br />
Von 1870 - 1883 war er Mitglied des Magistrats von <strong>Schweinfurt</strong>.<br />
Er tat in dieser Zeit sehr viel für die Einrichtung und Verschönerung<br />
der Wehranlagen, in denen er viele ausländische Bäume<br />
anpflanzen ließ. Eine Gedenktafel am Eingang dieser Anlage ehrt<br />
ihn auch noch heute. In den Jahren 1872/73 erwarb er, zusammen<br />
mit dem Magistratsrat Herding, das Gebiet der Peterstirn<br />
und legte dort wieder Weinberge an. Zur Erinnerung an diesen<br />
geschichtsträchtigen Ort, an dem einst die Burg der <strong>Schweinfurt</strong>er<br />
Markgrafen und ein Frauen-, später Deutschordenskloster<br />
standen, erbaute er bis zum Jahre 1874 die noch heute dort<br />
befindlichen burgähnlichen Gebäude, die seinerzeit auch als<br />
„Carlsburg“ bezeichnet wurden. Er gab auch den Anstoß dazu,<br />
daß in dem zinnenbekrönten Turm im oberen Geschoß, für den<br />
Gebrauch als Trinkstube, Malereien ausgeführt wurden. Dieser<br />
Auftrag wurde von seinem Neffen Johann Ernst Sattler mit<br />
dessen Freund Hans Thoma ausgeführt. Neben einem Puttenreigen<br />
an der Decke mit Windgöttern an den vier Ecken zeigten die<br />
Bilder die Obst- und die Weinernte, sowie das Fischen als die<br />
Ernte aus dem Fluß.<br />
Während des Krieges 1870/71 hatte Carl Sattler im „Löhlein“<br />
(Söldnerstr. 8) ein Lazarett eingerichtet. Für die Realschule errichtete<br />
er am 17.5.1868 ein Stipendium in Höhe von 1500.- Gulden,<br />
dem er später noch 300.- Mark hinzufügte. Die Zinsen wurden<br />
an jene Schüler verteilt, die im Abschluß die beste Chemie-<br />
Arbeit geliefert hatten. Carl war aber auch noch in anderen Bereichen<br />
sehr wohltätig.<br />
Am 17. Mai 1843 vermählte er sich in Kassel mit der am 9.10.<br />
1824 in Kassel geborenen Franziska Adolphine Wilhelmine<br />
Friedrike Schwarzenberg, der Tochter des Oberbergrates Ludwig<br />
Schwarzenberg. Sie war zeichnerisch begabt. Bekannt sind aus<br />
ihrer Hand eine Ansicht des früheren Rathauses und späteren<br />
Pfandhauses von <strong>Schweinfurt</strong>, im Zürch gelegen, und die Ansicht<br />
des Schmidt’schen Hauses in der Kirchgasse. Diese Ehe blieb<br />
leider kinderlos. Nach dem Tod seines Bruders Anton Sattler<br />
(† 21.6.1871) adoptierte er dessen einzig überlebendes Kind,<br />
Tochter Franziska Sattler (* 1.9.1859; † 22.4.1928). Diese<br />
heiratete am 18.10.1879 den Rechtsanwalt Friedrich Fischer<br />
(Sohn des <strong>Schweinfurt</strong>er Arztes Dr. Fischer), der vom<br />
19.10.1851 bis 30.4.1923 (Baden-Baden) lebte.<br />
_________________________________________________________<br />
21
_________________________________________________________<br />
Carl und Franziska<br />
Sattler<br />
Diese Franziska Fischer war dann die Haupterbin des Ehepaares<br />
Carl und Franziska Sattler. Alle Kinder seiner Geschwister erbten<br />
je 16.000 Mark, ferner erhielt die Familie seines Bruders Jens<br />
Sattler den Carl’schen Anteil an dem wertvollen, väterlichen<br />
Grundstück und Haus in der Kurhausstraße in Bad Kissingen,<br />
das später für 100.000 Mark verkauft wurde. Das Anwesen im<br />
Löhlein (Söldnerstr. 8) erhielten je zur Hälfte Wilhelm III. und Johann<br />
Ernst Sattler, die Söhne seines Bruders Wilhelm Sattler II.<br />
Carls Haus in der Alten Bahnhofstraße wurde an den Seifenfabrikanten<br />
Carl Kraus verkauft, die von Carl Sattler in den Jahren<br />
1871/73 errichteten burgähnlichen Bauten an der Peterstirn mit<br />
den dazugehörenden Weinbergen gingen an die <strong>Schweinfurt</strong>er<br />
Weinhandlung Lebküchner.<br />
Zum 25-jährigen Hochzeitstag (17.5.1868) erhielt das Ehepaar<br />
Carl Sattler von allen Geschwistern einen Gedenkstein, der mit<br />
Putten in Medaillons und mit einer entsprechenden Widmung<br />
geschmückt ist. Er befindet sich heute im Besitz vom Ehepaar<br />
Dr. med. Manfred und Traudl Spall, Judithstr.. 24. Anläßlich der<br />
Feierlichkeiten zu der silbernen Hochzeit wurde von den Nichten<br />
Bertha Sattler (spätere verheiratete Metzger) und Franziska<br />
Sattler (spätere verheiratete Gademann) nachstehendes Gedicht,<br />
aus der Feder des befreundeten Magistratsrats Düsenberg,<br />
vorgetragen:<br />
Jahre saht Ihr rasch entschwinden,<br />
Unaufhaltsam flieht die Zeit;<br />
Doch verwandte Seelen binden<br />
Gern sich für die Ewigkeit.<br />
Sinnig mit vereintem Streben<br />
_________________________________________________________<br />
22
_________________________________________________________<br />
Schuft Ihr Euch ein Paradies,<br />
Und es reichte Euch das Leben,<br />
Was sein schönster Traum verhieß.<br />
Frühlingslüfte säuseln milde,<br />
Brüder, Freunde, nah’n Euch heut’,<br />
Widmen scherzend Euch im Bilde<br />
Zeichen Eurer Thätigkeit.<br />
Wünschen: Was Ihr froh gegründet<br />
Mög kein rauher Sturm verweh’n,<br />
Und das Band, das Euch umwindet,<br />
Stark durch Liebe fortbesteh’n.<br />
Und daß Ihr in spätern Jahren<br />
Freudig auf vergang’ne blickt,<br />
Sollt Ihr nie ein Leid erfahren,<br />
das den Frieden niederdrückt.<br />
Möcht’ einst in der Freunde Mitte<br />
Sich das Jubelfest erneu’n,<br />
Und nach schöner alter Sitte<br />
Golden nochmals Euch erfreu’n.<br />
Carl Sattler starb nach längerem Leiden am 19.9.1883 in<br />
<strong>Schweinfurt</strong> an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde am<br />
22.9. im Hauptfriedhof in <strong>Schweinfurt</strong> beerdigt. Sein Grab befand<br />
sich in der Reihe, in der auch sein Bruder Jens seine letzte Ruhe<br />
fand, und in der heute, in der Grabstätte von Wilhelm Sattler II.<br />
und dessen 2. Ehefrau Bertha Sattler-Scholl, auch das Grab<br />
meiner Familie (Dr. med. Gerhard Graetz) zu finden ist. Im<br />
Mainberger Sattler-Friedhof erfolgte nur eine Nennung seines<br />
Namens. Carls Ehefrau Franziska verstarb am 25.1.1895 in<br />
Baden-Baden, wo sie bei ihrer Adoptivtochter Franziska Fischer<br />
lebte. 1928 wurden ihre sterblichen Überreste nach <strong>Schweinfurt</strong><br />
überführt und neben denen ihres Mannes beigesetzt.<br />
Großneffen und -nichten durften im Kindesalter mit ihren Eltern<br />
zusammen ab und zu Onkel Carl und Tante Franziska besuchen.<br />
Besonders beliebt war dabei der Garten an der Mainbergerstr./<br />
Alte Bahnhofstr., in dem sich ein zahmer Rehbock befand. Ernst<br />
Sattler (genannt Onkel „Edel“) vermerkte: „Sonst erschienen uns<br />
Onkel und Tante immer sehr zurückhaltend, etwas fremd,<br />
gleichsam als Verkörperung einer längst vergangenen Zeit.“<br />
_________________________________________________________<br />
23
_________________________________________________________<br />
Hans-Dieter Schorn<br />
Kgl. Post Bayern<br />
Es war einmal …<br />
Groß gefeiert hat man nicht. Aber erinnert hat sich das offizielle<br />
Bayern im Januar dieses Jahres schon: Vor genau 200 Jahren,<br />
am 1. Januar 1806, wurde aus dem Kurfürstentum das Königreich<br />
Bayern. Aus dem Kurfürsten Maximilian IV. Joseph wurde der<br />
erste bayer. König Max I. Joseph.<br />
Nur 112 Jahre dauerte die Monarchie in Bayern.<br />
Nach dem Tod des tragisch-legendären Königs Ludwig II. hatte<br />
1886 Prinz Luitpold die königliche Macht übernommen. Als kluger,<br />
volkstümlicher „Prinzregent“ herrschte er bis 1912. Im folgenden<br />
Jahr bestieg ein Sohn Ludwigs II. als König Ludwig III. den<br />
bayerischen Thron. Er war zu der Zeit bereits 67 Jahre alt! Seine<br />
Regentschaft stand unter dem unglücklichen Stern des 1.<br />
Weltkriegs. Nach dessen Ende kam es auch in Bayern am 7.<br />
November 1918 – zwei Tage früher als in Berlin! – zur „roten“<br />
Revolution, die den Monarchen verjagte. Ihr gegenüber stand ein<br />
in sich gespaltenes Lager: Militaristisch, klerikal, liberal, anarchistisch,<br />
bürgerlich. Wohlklingende Parolen konnten nicht darüber<br />
hinweg täuschen, dass bei vielen in erster Linie nicht das Wohl<br />
des Landes, sondern der Eigennutz im Vordergrund stand. Das<br />
Versagen der preußischen Reichsführung, der gesamten politischen<br />
Klasse wie des deutschen Hochadels ( den man mit der<br />
militärischen Führung gleichsetzen konnte) hatte jedenfalls dazu<br />
geführt, dass eine Rückkehr zu den politischen Vorkriegsverhältnissen<br />
undenkbar geworden war. So war auch unter den letztlich<br />
siegreichen Gegnern der roten Revolution niemand, der ernsthaft<br />
für eine Wiederherstellung der Monarchie in Deutschland oder in<br />
Bayern kämpfte.<br />
Ein kleines Spiegelbild der revolutionären Wirren in Bayern vom<br />
November 1918 bis zum Sommer 1919 bietet auch die Bayer.<br />
Postverwaltung. So wie alle Ämter (auch die Pfarrämter beider<br />
Konfessionen!) waren natürlich staatliche Einrichtungen wie<br />
Justiz, Polizei, Eisenbahn und Post bis 1918 „Königlich Bayerisch“.<br />
Stolz hatte Bayern – wie auch Württemberg – im Jahr der<br />
Reichsgründung 1871 an einem eigenen Postwesen festgehalten.<br />
Im November 1918 war es damit zu Ende. Aber der König auf<br />
_________________________________________________________<br />
24
_________________________________________________________<br />
den Briefmarken war einstweilen noch nicht verschwunden!<br />
Aus der Notzeit nach dem Kriegsende erklärt es sich, dass ganz<br />
sparsam bis auf weiteres in bayerischen Behörden noch Stempel,<br />
Vordrucke und auch die vorhandenen Briefmarken weiter<br />
verwendet werden konnten. 1 So findet sich auch die 1914 ausgegebene<br />
Markenserie mit dem Kopfbild des neuen Königs<br />
Ludwig III. als gültige Frankatur noch im Sommer 1920!<br />
Allerdings spiegelt sich auch hier das Bild der Revolution: Eben<br />
diese Serie erscheint anfangs 1919 nun mit dem Überdruck<br />
„Freistaat Bayern“ bzw. wenig später „Volksstaat Bayern“. Als<br />
„Aushilfsausgabe“ gibt es sogar „Germania-Marken“ des Deutschen<br />
Reiches mit dem Überdruck „Freistaat Bayern“.<br />
Inzwischen war im Februar 1920 in Bayern eine „monarchiefreie“<br />
Markenausgabe erschienen. Sie zeigt ganz unverdächtige<br />
Motive: Pflüger und Säemann, die Madonna ebenso wie eine<br />
„jugendstilisierte“ Göttin (auf den hohen Markenwerten).<br />
Aber auch dieser Abschiedsserie der eigenständigen bayerischen<br />
Post war noch ein philatelistisches Extra beschieden: die<br />
nunmehr in ganz Deutschland tätige Reichspost überdruckte im<br />
April 1920 diese Serie mit „Deutsches Reich“.<br />
Ein postalisches Schmankerl zeigt exemplarisch diese Zeit von<br />
Übergang und Ende der eigenständigen Bayer. Post:<br />
Der im Postamt Rothenburg ob der Tauber für Zeitungsbestellungen<br />
zuständige Postverwalter Wilhelm Kaiser klebte vorschriftsmäßig<br />
die Bestellgebühr in Form von Briefmarken auf einen<br />
Bestell-Vordruck. Die erforderlichen 75 Pfennige stellte er – noch<br />
am 18.3.1920, also 16 Monate nach dem Umsturz – zusammen<br />
in Gestalt einer wunderschönen „Mischfrankatur“:<br />
20 Pfg. Abschiedsserie Bayern; 30 Pfg. Ludwig III. mit „Freistaat<br />
Bayern“; 25 Pfg. Ludwig III. mit „Volksstaat Bayern“.<br />
Ebenso wie der eigentliche Zeitungsbesteller, das Bezirksamt<br />
Rothenburg, verwendet auch das Postamt bereits „bereinigte“<br />
_________________________________________________________<br />
25
_________________________________________________________<br />
Anmerkungen<br />
Stempel und Vordrucke. Dagegen hat das bearbeitende Zeitungspostamt<br />
in München noch seinen gelben Gebührenzettel<br />
aufgeklebt, auf dem es heißt: „K.“ Postamt München 4. 2<br />
Auch der Inhalt dieser Zeitschriftenbestellung läßt noch ein wenig<br />
die turbulente Zeit erahnen:<br />
Sowohl Amtsblätter des Staatsministeriums für Unterricht und<br />
Kultus als auch Gesetz- und Verordnungsblätter der Regierung<br />
wurden im Revolutionsjahr 1919 offensichtlich nur lückenhaft<br />
zugestellt. Nun erfolgt die Bestellung der fehlenden Exemplare!<br />
Gegen eine Gebühr von 2 M 15 Pfg. wurden die noch lieferbaren<br />
Exemplare am 29. April 1920 dem Bezirksamt Rothenburg<br />
zugestellt. Der Einzahlungsabschnitt für diese 2 M 15 Pfg ist<br />
ebenfalls erhalten geblieben!<br />
Alles hatte in Rothenburg wieder seine Ordnung. Nur war es<br />
nicht mehr die königlich-bayerische.<br />
1 So verwendete der revolutionäre Ministerpräsident Kurt Eisner Briefpapier,<br />
auf dem der Vorbesitzer, „Der Staatsminister des Königl. Hauses u. des<br />
Äußeren“ durchgestrichen wurde. Darunter liest man nun den Aufdruck:<br />
„Volksstaat Bayern. Ministerium des Äußeren. Ministerpräsident.“<br />
_________________________________________________________<br />
26
_________________________________________________________<br />
siehe Anmerkung 2:<br />
Der Beleg mit Vorderund<br />
Rückseite<br />
Auch das Postamt<br />
führt in seinem<br />
Stempel noch das<br />
königliche Wappen mit<br />
dem entsprechenden<br />
Text.<br />
Photographische Wiedergabe aus: Benno Merkle, Oberbürgermeister von<br />
<strong>Schweinfurt</strong> 1920 - 1933, S. 89. Bearb. von Kathi Petersen; Stadtarchiv<br />
<strong>Schweinfurt</strong>, 2003.<br />
2 Im Januar 1921 hat ein anderer Postbeamter in München auf solchen<br />
Klebzetteln sorgfältig mit roter Tinte das „K“ durchgestrichen. Man darf<br />
annehmen, dass auf diese Weise mancher Staatsdiener ohne Risiko seine<br />
persönliche Einstellung zum neuen „System“ dokumentieren konnte.<br />
_________________________________________________________<br />
27
_________________________________________________________<br />
Studienfahrten<br />
Halbtagesfahrt<br />
KMD Gustav Gunsenheimer<br />
Fahrt zu historischen Orgeln<br />
Donnerstag,<br />
20. Juli 2006<br />
Abfahrt: 13.30<br />
Peter und Paul,<br />
13.40 Theater<br />
Die Orgelfahrten mit KMD Gustav Gunsenheimer sind eine<br />
liebgewordene Tradition geworden. In diesem Sommer geht die<br />
Fahrt ins Coburger Land. Der weit über die Grenzen Franken<br />
hinaus bekannte Künstler wird Konzerte auf der historischen<br />
Orgel in Fechheim und auf der größeren Hofmann-Orgel in<br />
Neustadt bei Coburg gestalten und die musikgeschichtlichen<br />
Zusammenhänge erläutern.<br />
Anmeldung:<br />
ab Montag, 10. Juli, im Schrotturm, 14.30 -17.00<br />
Halbtagesfahrt<br />
Otto Rau<br />
Rund um den Schwanberg - Schwarzenberg<br />
Samstag,<br />
Unsere Herbstfahrt geht wieder einmal in den Süden Schwein-<br />
7. Oktober 2006 furts. Ziel ist das Stammschloß des Fürstengeschlechts der<br />
Abfahrt:<br />
Schwarzenbergs in der Nähe von Scheinfeld. Dort wird das<br />
13.45 Uhr Peter und Schloß und die neue Ausstellung besucht.<br />
Paul<br />
14.00 Theater<br />
Nach einer Einkehr wird gegen 19 Uhr die Rückfahrt sein.<br />
Anmeldung:<br />
ab Montag 18. September, im Schrotturm, 14.30-17.00 Uhr<br />
__________________________________________________________________________<br />
Neue Horizonte - ein kurzgefasster Eindruck von einer Studienfahrt<br />
Der Schiefer-Steinbruch<br />
in Lehesten<br />
Eine außerordentlich kurzweile Studienfahrt in den Frankenwald<br />
bei herrlichem Sommerwetter genosssen über 50 Mitglieder und<br />
Freunde des Historischen <strong>Verein</strong>s. Schloss Lauenstein, das vom<br />
bayerischen Staat gepflegt wird, und das im Thüringischen<br />
gelegene Lehesten waren Schwerpunkte dieses Tages. Der<br />
Fahrtenleiter StD Schöffl wußte fast über jeden Stein seiner<br />
Heimat eine amüsante Geschichte zu erzählen. Beieindruckend<br />
schließlich die Führung durch den ehemalligen Schieferabbau in<br />
Lehesten: Der ehemalige Leiter des Museums veranschaulichte<br />
eindrücklich den harten Alltag der Bergleute. Er demonstrierte<br />
auch sein handwerkliches Können: Schiefersteine spaltete und<br />
bearbeitete er bis ins Kleinste hinein. -pet<br />
_________________________________________________________<br />
28
_________________________________________________________<br />
Personalia<br />
Der <strong>Verein</strong> begrüßt<br />
als neue Mitglieder:<br />
Der <strong>Verein</strong><br />
gratuliert<br />
zum Geburtstag:<br />
(April bis Juni)<br />
Der <strong>Verein</strong><br />
trauert um:<br />
Ingeborg Pfister (übernimmt die Mitgliedschaft<br />
ihres verst. Mannes)<br />
Dr. Herbert Wiener<br />
Hans Seidl<br />
Line Steinmann<br />
Dr. Udo Künzel<br />
90 Jahre Herrn Gottfried Klobe<br />
80 Jahre Frau Gertrud Keßler<br />
Herrn Wolfgang Vogel<br />
Dr. Hans Graetz<br />
Herrn Hilmar Gerschütz<br />
Frau Renate Friemer<br />
Frau Margot Schäfer<br />
75 Jahre Herrn Willi Sauer<br />
Frau Ruth Maria Masuch<br />
Herrn Karl Beck<br />
Frau Rosemarie Willmy<br />
Herrn Werner Kahnt<br />
70 Jahre Herrn Rolf Kuffer<br />
Frau Roswitha May<br />
Herrn Roland Keinholz<br />
Frau Herta Eberlein<br />
Herrn Elmar Weissenseel<br />
Frau Edeltraud Barthel<br />
Frau Sofie Schmidt<br />
Herrn Heribert Reusch<br />
Herrn Peter Schub<br />
65 Jahre Herrn Edgar Kolb<br />
Herrn Karl-Jörg Rumpel<br />
Herrn Andreas Pfister<br />
Herrn Karl Friedlein<br />
Herrn Horst Dietz<br />
_________________________________________________________<br />
29