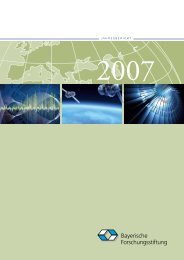Jahresbericht - Bayerische Forschungsstiftung
Jahresbericht - Bayerische Forschungsstiftung
Jahresbericht - Bayerische Forschungsstiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong>2012
Herausgeber<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>Prinzregentenstraße 52D-80538 MünchenRedaktionDorothea Leonhardt, Ministerialrätin,Geschäftsführerin <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>GestaltungH A A K & N A K A T [ www.haak-nakat.de ]Die Inhalte des <strong>Jahresbericht</strong>s sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeitwird z.T. nur die männliche Sprachform (z.B. Wissenschaftler, Doktorand) verwendet.
<strong>Jahresbericht</strong>2012
<strong>Jahresbericht</strong> 2012<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>InhaltVorwortDie Zukunft Bayerns im BlickHorst Seehofer, Vorsitzender des Stiftungsrats 6Gemeinsam zur erfolgreichen InnovationKarolina Gernbauer, Vorsitzende des Vorstands 8Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit,gefördert durch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>Dr. Christoph Grote, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 10kompetenzen<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> – quo vadis?Prof. i. R. Dr.-Ing. Heinz Gerhäuser, Präsident 14<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> –Qualität durch effiziente ProzesseDorothea Leonhardt, Geschäftsführerin 16Haus der Forschung – ein erfolgreiches Geschäftsmodell 18Themen und Inhalte 20Forschungsverbünde 24Abgeschlossene Projekte 32Neue Projekte 76Kleinprojekte 1124
AnhangDie Organe der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 116Zielsetzung und Arbeitsweise der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 122Rechnungsprüfung 128Förderprogramm „Hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 130Gesetz über die Errichtung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 134Satzung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 136Idee, Antrag, Entscheidung, Projekt 140Kontakt, Ansprechpartner 142Bildnachweis 1445
Die Zukunft Bayerns im BlickInnovationen sind eine tragende Säule der zukunftsweisendenPolitik der <strong>Bayerische</strong>n Staatsregierung und Garantdafür, dass Bayern auch weiterhin zu den Top-Regionen derWelt gehört. Ein fester Bestandteil der bayerischen Innovationspolitikist seit mehr als 20 Jahren die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>.Als Vorsitzender des Stiftungsrats der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> ist es mir eine besondereFreude, Ihnen den <strong>Jahresbericht</strong> 2012 vorstellen zu dürfen.Der neue <strong>Jahresbericht</strong> vermittelt Ihnen ein anschaulichesBild, wie die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> arbeitet, wie siemit ihren Förderungen Freiraum schafft für die Umsetzunginnovativer Ideen und wie sie damit einen wertvollen Beitragleistet, den Technologiestandort Bayern nachhaltig mitzugestalten.Der tiefgreifende Wandel, der uns durch die Energiewendebevorsteht, manifestiert sich zunehmend im Bewusstseinder Menschen. Die bayerischen Unternehmen, für die einesichere und bezahlbare Versorgung mit Energie existenziellist, nehmen die großen Herausforderungen, vor die sie gestelltwerden, aktiv an. Die Wissenschaftler an den bayerischenHochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützensie dabei, neue Ideen zu entwickeln und alternativeKonzepte zu denken. Grundlegende Forschungsarbeitensind erforderlich, um diese neuen Konzepte so weit voranzutreiben,dass sowohl das technologische als auch daswirtschaftliche Risiko bei der Umsetzung in die Praxis kalkulierbarwird. Mit dem Forschungsverbund „FOREnergy“unterstützt die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> ein großesKonsortium mit Partnern aus ganz Bayern bei der Entwicklungvon Lösungen, die geeignet sind, Fabriken und Produktionssystemeflexibel auf ein volatiles Stromangebot auszurichten.Der Forschungsverbund „FORELMO“ beschäftigtsich intensiv mit der Lösung technologischer Fragen aufdem Gebiet der Elektromobilität. Denn bevor ein flächendeckenderEinsatz umweltfreundlicher Elektroautos realisiertwerden kann, sind noch viele technische Fragen zu lösen.Wie flexibel die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> auf dieseneuen technologischen Herausforderungen reagieren kann,zeigt sich in der Verteilung ihrer Mittel. Während in den letztenJahren der Schwerpunkt des Mitteleinsatzes im Bereichder Lebenswissenschaften war, liegt der Schwerpunkt nunim Bereich Energie und Umwelt. Flexibel, unbürokratischund schnell neue Themen zu besetzen, das ist die Stärke der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>. Als Partner im „Haus derForschung“ leistet sie einen wertvollen Beitrag für denTransfer von Forschungsergebnissen in die bayerischenNetzwerke und Cluster sowie für die Einwerbung vonBundes- und EU- Fördermitteln.Die Erfolge der <strong>Forschungsstiftung</strong> über die Jahre hinwegbestätigen die Nachhaltigkeit der Idee der Stiftung und gewährleistendie Erfüllung des Stifterwillens. Der FreistaatBayern kann mit Recht stolz darauf sein, sich mit der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> ein einmaliges Instrument zurFörderung von zukunftsorientierter Forschung geschaffenzu haben.Horst Seehofer7
Dr. Christoph GroteVorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats10
<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> –quo vadis?Die Erfolgsgeschichte der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>wird durch mehrere Kriterien begründet:Dazu zählen eine für Innovationen höchst aufgeschlossene<strong>Bayerische</strong> Staatsregierung, Universitäten, Hochschulenund außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die ihrWissen und ihr Können gerne für die Wirtschaft zur Verfügungstellen und von den Drittmitteleinnahmen profitieren,schließlich Unternehmen, die den Wert dieser Unterstützungerkannt haben, und nicht zuletzt erfahrene und kompetenteMitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle,die sehr dienstleistungsorientiert arbeiten.Wenn eine Einrichtung so gut funktioniert, dann gibt es eigentlichkeinen Grund für Veränderungen.Gerade aber in guten Zeiten ist es wichtig, strategischeÜberlegungen zur Zukunft der Stiftung anzustellen.Es ist erstaunlich, wie schnell neue Unternehmungen in denaufstrebenden Nationen beginnen, den bisherigen Vorsprungbayerischer Firmen aufzuholen. Wie sicher sind diedurch Patente geschützten technischen Innovationen derdeutschen Industrie? Findet man diese Innovationen schonbald mehr oder weniger gut getarnt in Konkurrenzproduktenwieder?Die Lösung muss lauten: „Schneller und besser sein und dasNachahmen erheblich erschweren!“Um schneller zu sein, reicht es nicht, dass eine technisch/naturwissenschaftliche Lösung früher als Prototyp zur Verfügungsteht. Ganzheitliches Denken, frühzeitig entwickelteGeschäftsmodelle, genaue Kenntnisse der Zielmärkte undein hoher Kundennutzen, der auch schnell für den Kundenerkennbar ist, entscheiden, ob sich ein Produkt auf demMarkt gegen die Konkurrenz durchsetzt.Der Begriff „besser“ ist sehr stark mit den Kundenerwartungenverbunden. Dabei spielen der Preis, der Kundennutzenund der Prestigefaktor, der mit dem Produkt verbundenist, eine wichtige Rolle. iPod, iPhone, iPad und iTunes sindhier sehr gute Beispiele. Die Audiocodiertechnologie Mp3und die folgenden Generationen waren eine notwendige Voraussetzung.Der entscheidende Durchbruch kam aber mitiTunes, einer Dienstleistung, die es legal erlaubt, auf einfacheWeise und mit moderaten Gebühren Musikstücke ausdem Internet zu erwerben und auf dem Abspielgerät zunutzen.Diese eng mit einer spezifischen Technologie verzahntenDienstleistungen sind es, die einen zunehmenden Anteil derWertschöpfung erzielen. Möglicherweise ist diese Verzahnungauch ein Schlüssel für den Schutz vor dem einfachenund schnellen Nachmachen. Dies gilt nicht nur für Produktefür den Massenmarkt, sondern auch für individuell hergestellteInvestitionsgüter.In der Vergangenheit fand die Entwicklung von der Idee biszum Markt arbeitsteilig und häufig in sequenziellen Abschnittenstatt. Ingenieure und Naturwissenschaftler entwickelteneine Technologie (Hardware und Software). Die Entwicklungder dazu notwendigen Dienstleistungen undGeschäftsmodelle folgte später. Eine Parallelisierung dieserSequenzen erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit,für die es noch keine Tradition gibt. Dies bietet auchUniversitäten und Hochschulen interessante Herausforderungenfür die Ausbildung zukünftiger Experten.Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> hat bisher vorwiegendtechnisch/naturwissenschaftliche Forschungsprojekte zwischenUnternehmen der Wirtschaft und Forschungspartnerngefördert. Wenn zukünftig die Verzahnung von Technologien,Dienstleistungen und Geschäftsmodellen eine höhereBedeutung gewinnt, dann müsste sich das auch in der Förderpolitikder <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> niederschlagen.Dass dabei die Randbedingungen, die der „Gemeinschaftsrahmenfür staatliche Beihilfen für Forschung,Entwicklung und Innovation“ der EU-Kommission vorgibt,auch weiterhin erfüllt werden müssen, ist selbstverständlich.Prof. i. R. Dr.-Ing. Heinz Gerhäuser15
Dorothea LeonhardtGeschäftsführerin16
<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> –Qualität durch effiziente ProzesseWir freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen, mehr über die<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>, ihre Förderprojekte undihre Fördermöglichkeiten zu erfahren. Denn auch in Zeitender modernen Medien halten wir den gedruckten <strong>Jahresbericht</strong>für ein ansprechendes Format, allen Interessenten dieArbeitsweise der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> anschaulichnäherzubringen. Zugleich bietet der <strong>Jahresbericht</strong> 2012allen Antragstellern und ihren Projektpartnern die Gelegenheit,ihr Projekt sowie daraus resultierende Ergebnisse einerbreiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Schön wäre es,wenn der vorliegende <strong>Jahresbericht</strong> Ihnen Perspektiven aufzeigenwürde, wie Sie eine zukunftsweisende Idee mit Unterstützungder <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> realisierenkönnen.Damit Bayern langfristig zukunftsfähig bleibt, darf der Innovationsmotornicht ins Stocken geraten. VorwettbewerblicheForschungs- und Entwicklungsarbeiten sind die notwendigeVoraussetzung, damit später ein erfolgreichesProdukt bzw. eine neue Produktionstechnologie entstehenkann. Und genau hier setzt die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>mit den ihr zur Verfügung stehenden Fördermitteln an.Für bayerische Unternehmen und Wissenschaftler ergibtsich durch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> ein ganz besondererund bundesweit einmaliger Mehrwert. DieserMehrwert basiert aber nicht nur auf der Förderung durchdie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>. Durch das qualifizierteAuswahlverfahren tragen wir dafür Sorge, dass nur die herausragendenProjekte gefördert werden. Das Auswahlverfahren,das auf die Expertise externer, außerbayerischerGutachter zurückgreift, bietet den Antragstellern die Sicherheit,dass das von ihnen geplante Vorhaben vor den Augender besten Fachgutachter bestehen konnte. In vielen Fällenunterstützen die Fachgutachter mit ihren dezidierten Hinweisendie Projektplanung. Mit der Regel, dass nur 50 %der Projektkosten finanziert werden, stellt die <strong>Bayerische</strong><strong>Forschungsstiftung</strong> sicher, dass die Projektpartner nurVorhaben durchführen, die im Erfolgsfall Chancen für einespätere wirtschaftliche Umsetzung aufweisen. Gefördertdurch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> – ein echtes Qualitätssiegelfür die Projektbeteiligten und ein nicht mehr wegzudenkenderStandortvorteil für die bayerische Wirtschaftund Wissenschaft.Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil der erfolgreichenNetzwerkbildung, die der Struktur der Projekte immanentist. Die Voraussetzung für jedes Projekt ist die Zusammenarbeitvon mindestens einem Partner aus der Wissenschaftund einem Partner aus der Wirtschaft, und beide Seiten profitierenvon dem hier entstehenden Netzwerk. Kleine undmittelständische Unternehmen können ihre Idee mit wissenschaftlicherHilfe grundlegend verifizieren, Hochschulenkönnen sich mit ihrer praxisnahen Forschung an betrieblichenAnforderungen orientieren. Und für die <strong>Bayerische</strong><strong>Forschungsstiftung</strong> besonders erfreulich: Die geschaffenenNetzwerke haben in der Mehrzahl der Fälle Bestand über dieProjektlaufzeit hinaus.Dieser erfolgreiche Weg der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>wird seit Jahren begleitet von einem überaus engagiertenund motivierten Team in München und in Nürnberg.Herzlichen Dank allen Kolleginnen und Kollegen für ihrenintensiven Einsatz und das gute Miteinander! Im Namenaller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanke ich michaber ebenso herzlich bei unserem Stiftungsrat, dem Stiftungsvorstandund dem Wissenschaftlichen Beirat für ihreUnterstützung, ihren Rückhalt und ihr Vertrauen.Dorothea Leonhardt17
Haus der Forschung –ein erfolgreiches GeschäftsmodellDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> als Partner im Haus derForschung – was bedeutet das für Sie, was hat sich für die<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> geändert, welcher Mehrwertentsteht daraus? Das Haus der Forschung wurde von der <strong>Bayerische</strong>nStaatsregierung im Jahr 2009 ins Leben gerufen.An seinen Standorten in Nürnberg und in München sind nununter einem Dach die bayerischen Organisationen vertreten,die die Ansprechpartner sind für alle Fragen rund um dieThemen Förderung von Forschung und Technologie, Technologietransferund Netzwerkbildung. Der Fokus richtet sichdabei nicht nur auf Bayern und seine exzellenten Möglichkeiten.Über Bayern hinaus eröffnen sich durch das Haus derForschung die Wege zu Bundes- und EU-Fördermitteln sowiezu den dazugehörigen Netzwerken.Im Haus der Forschung arbeiten langjährig etablierte Organisationenwie die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> und BayernInnovativ eng zusammen mit dem Innnovations- und TechnologiezentrumBayern und der <strong>Bayerische</strong>n Forschungsallianz.Die seit Langem bestehende Zusammenarbeit der be-teiligten und nach wie vor selbstständigen Organisationen istdurch das Haus der Forschung erheblich verstärkt worden.Zielführend wurden zusätzliche Strukturen geschaffen, dieden Austausch zwischen den Partnerorganisationen intensivieren.Die Geschäftsführer der im Haus der Forschung angesiedeltenPartner treffen sich regelmäßig und besprechengemeinsame Aktionen, Veranstaltungen und strategischeEntwicklungen. Sie geben den erforderlichen Input für dieArbeit der Kooperationsbeauftragten. Deren Aufgabe ist es,die Zusammenarbeit auf der operativen Ebene zu optimieren,damit jeder, der sich an das Haus der Forschung wendet, mitdem richtigen Ansprechpartner Kontakt aufnehmen kann,optimale Beratung erhält und die passgenaue Unterstützungfür sein Anliegen bekommt.Das Haus der Forschung ist der Dienstleister in Bayern, derfür jeden Interessenten, der eine Unterstützung für seineinnovative Idee braucht, das jeweils passende Förderprogrammidentifiziert. Die Expertise der beteiligten Organisationenstellt sicher, dass dabei gleichermaßen die Möglich-Unsere beiden Standortein Nürnberg (links) am Gewerbemuseumsplatzundin München (rechts) in derPrinzregentenstraße18
keiten berücksichtigt werden, die Landes-, Bundes- sowieauch EU-Förderprogramme bieten. Selbstverständlich giltdies auch, wenn es darum geht, bereits laufende Projektein einem weiteren Schritt oder in einem größeren, eventuellsogar in einem internationalen Rahmen fortzusetzen. Dieseschrittweise Vorgehensweise hat den Vorteil, dass bereitsein etabliertes und funktionierendes bayerisches Konsortiumexistiert, das bundes- bzw. europaweit ergänzt werden kann.Bestes Beispiel hierfür sind die von der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>geförderten Forschungsverbünde. Von der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> finanziell unterstützt, beschäftigensich in den Forschungsverbünden zahlreiche Partneraus der Wissenschaft und der Wirtschaft mit einem wissenschaftlich-technologischenGeneralthema und erforschendieses unter den unterschiedlichsten Aspekten. Aufgrundihrer Struktur sind die Forschungsverbünde prädestiniert füreine weiterreichende und über den bisherigen Verbund hinausgehendeNetzwerkbildung.Es würde den vorhandenen Möglichkeiten im Haus der Forschungaber nicht gerecht werden, wenn dieser Service nurfür die großen Forschungsverbünde gelten würde. Unser Bestrebenist es natürlich auch, kleinere Verbundprojekte – angestoßenbeispielsweise durch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>– in einen größeren Kontext zu stellen. Ein Aspekt,der hier zusätzlich bei all diesen Aktivitäten bedacht werdenmuss, ist der Mehrwert, den überregionale Kooperationenbieten hinsichtlich der Erschließung neuer Märkte, des Blicksüber den Tellerrand hinaus und der Chance, über die Einbeziehungvon neuen Netzwerkpartnern andere Sichtweisen aufdie eigene technologische Problemstellung zu bekommen.Das Aufgabengebiet des Hauses der Forschung geht abernoch wesentlich weiter. Zur erfolgreichen Umsetzung einerinnovativen Idee sind auch zahlreiche flankierende Rahmenbedingungenentscheidend. Auch diese Rahmenbedingungenstehen im Fokus der Dienstleistung, die das Haus derForschung bietet. Oftmals fehlt der Forschungspartner fürdie entsprechende wissenschaftliche Begleitung. Oftmals bestehtaber auch die Notwendigkeit, sich in ein Netzwerk ausUnternehmen einzubinden, um die gewünschte Umsetzungeiner Idee zu realisieren und die gesamte Wertschöpfungsketteabbilden zu können. Hier wie dort können Türen geöffnetund passende Partner gemeinsam ausfindig gemachtwerden. Technologietransfer und Clusterbildung sind ebensoim Fokus des Hauses der Forschung wie Maßnahmen, dieunter das Stichwort „Open Innovation“ zu subsumieren sind.An zwei herausragenden Beispielen lässt sich festmachen,wie das Haus der Forschung arbeitet und welche Synergiendaraus entstehen:Mit Fördermitteln der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>konnte das Elektroautomobil-Projekt MUTE der TechnischenUniversität München auf den Weg gebracht werden. Das Projektkonnte erfolgreich abgeschlossen werden. Entscheidendfür den weiteren Fortgang war dann aber, dass die Projektbeteiligtenüber den Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativdie einmalige Chance hatte, ihr MUTE-Elektrofahrzeug aufder IAA in Frankfurt einer breiten Öffentlichkeit, aber auchdem Fachpublikum vorzustellen. MUTE wurde begeistertaufgenommen. Daraus entstanden ist das weiterführendeProjekt Visio.M, gefördert mit fast 11 Mio. € aus Mitteln desBundes und mit einem nun bedeutend breiter aufgestelltenKonsortium.Der Forschungsverbund FORGLAS, federführend durchgeführtvon der Universität Bayreuth und ebenfalls von der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> über einen Zeitraum von dreiJahren gefördert, konnte bereits während der noch laufendenVerbundphase erfolgreich einen Antrag bei der EU platzieren.Mit Unterstützung der <strong>Bayerische</strong>n Forschungsallianzkonnten auf diese Weise 3,4 Mio. € für das FolgeprojektHarWIN von der EU eingeworben werden. Aus dem FOR-GLAS-Konsortium sind vier Partner auch an dem EU-Projektbeteiligt, die <strong>Bayerische</strong> Forschungsallianz unterstützt mitder Durchführung der Projektkoordination.Wir möchten auch Sie ermutigen, alle Möglichkeiten und Facetten,die das Haus der Forschung Ihnen als Dienstleistungbieten kann, in Anspruch zu nehmen. Wir waren von Anfangan fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Haus der Forschungum ein vielversprechendes Geschäftsmodell handelt.Über die bereits bestehenden hervorragenden Strukturenhinaus kann Bayern mit dem Haus der Forschung seinenWissenschaftseinrichtungen und Unternehmen einen erheblichenMehrwert bieten. Nehmen Sie das Angebot wahr!Ihr direkter Kontakt: 0800 026872419
Themen undInhalteDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> wurde ins Leben gerufen,um universitäre und außeruniversitäre Forschungsvorhabenzu fördern, die für die wissenschaftlich-technologische unddie wirtschaftliche Entwicklung Bayerns von Bedeutung sind.Wie wichtig diese Zielsetzung ist, bestätigt sich immer wiedervon Neuem. Der globale Wettbewerb erfordert eine ständigeInnovationsbereitschaft, aber auch die Bereitschaft, in Forschungund Wissenschaft zu investieren. Dieser Zielsetzunghat sich die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> verschrieben, undder Erfolg der geförderten Projekte bestätigt sie hierin.Um ihrer innovationspolitischen Aufgabe gerecht zu werden,greift die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> mit ihrer inhaltlichenSchwerpunktsetzung Themen auf, die zu den großenSchlüsseltechnologien der Zukunft zählen. Das bewusst breitgewählte Spektrum der definierten Schlüsselbereiche lässteine Fülle interdisziplinärer Ansätze zu und deckt Schnittstellenab, die es Antragstellern aus Wissenschaft und Wirtschaftermöglichen, themenübergreifende Projekte zu konzipierenund durchzuführen. Interdisziplinarität und die Möglichkeit,Schnittstellen zu überwinden, sind mehr denn je ausschlaggebendfür ein modernes, zukunftsweisendes Innovationsmanagement.Die Vielfalt der gewählten Zielsetzungen der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> bietet in idealer Weise alle Voraussetzungenfür innovative, wissenschaftlich hochwertige undwirtschaftlich zukunftsträchtige Projekte. Dies ermöglicht es,forschungspolitisch wichtige Trends früh zu erkennen, gezieltanzuregen und langfristige Perspektiven zu schaffen.Bis Ende der 1990er-Jahre boomten die Mikrosystemtechniksowie die Informations- und Kommunikationstechnologienund machten damit auch den Schwerpunkt des Mitteleinsatzesder Stiftung aus. In den letzten Jahren war einanderer Trend erkennbar. Nach dem Aufschwung der klassischenTechnologien werden die kommenden Jahre geprägtsein von dem Ziel, die Gesundheit und die Lebensqualität zuverbessern und der demografischen Entwicklung gerecht zuwerden. Als weitere Trends zeichnen sich verstärkte Aktivitätenbei neuen Prozess- und Produktionstechniken und besondersstark im Bereich Energie und Umwelt ab.20
life sciencesDer gesellschaftliche und volkswirtschaftliche SchwerpunktLife Sciences spiegelt sich in der Zahl der Anträge wider,die bei der Stiftung eingereicht werden. Bedingt durchdie demografische Entwicklung, wird sich dieser Trend inden nächsten Jahren fortsetzen. Die alternde Gesellschaftbedarf innovativer Produkte und Dienstleistungen, umlänger am Arbeitsplatz und mobil bleiben und ein selbstbestimmtesLeben führen zu können. Medizintechnik, bildgebendeVerfahren, neue diagnostische und therapeutischeMöglichkeiten durch innovative Entwicklungen auf demGebiet der Bio- und Gentechnologie machen einen nichtunerheblichen Teil der eingereichten Anträge aus. Mit demEinsatz neuer Materialien in der Medizin werden Möglichkeitengeschaffen, therapeutisch wirksame Substanzen gezieltlokal zu applizieren.INformations- UND kommunikationstechnologienDie Informations- und Kommunikationstechnik, auch im BereichMultimedia-Technik, prägt einen tief greifenden Wandelder bisherigen Kommunikationsstrukturen. Sie war nichtnur in den letzten Jahrzehnten einer der wichtigsten Technologieträger,sie wird es auch in den nächsten Jahren bleiben.Gefragt sind hohe Leistungsstandards in der Hardware,multimediale Anwendungen, Simulationstechniken, die Verschmelzungvon Informationsverarbeitung, Telekommunikationund Unterhaltungselektronik sowie neue Technologienfür ein intelligentes Stromnetz als wesentliche Basis derEnergiewende. Zur Kommunikation gesellen sich die Navigation,die im Zuge der Elektromobilität eine zusätzlicheBedeutung gewinnen wird, und Indoor-Anwendungen, umProduktionsabläufe zu optimieren. Neue Aufbau- und Verbindungstechnikenfür die Verarbeitung von elektronischenBauelementen, die auf Materialien basieren, die gänzlichneuen Anforderungen genügen, eröffnen ein großes technologischesPotenzial für neue Einsatzfelder in der Baugruppentechnologie.mikrosystemtechnikDie Mikrosystemtechnik als Schlüsseltechnologie verwendetVerfahren der Mikroelektronik zur Strukturierung undzum Aufbau von Systemen. Sie beeinflusst viele Bereicheder Industrie, von der Automobilindustrie bis hin zur chemischenIndustrie, sowie den Dienstleistungssektor undträgt maßgeblich zur Entstehung neuer Wirtschaftszweigebei. Die Anforderungen an die Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeitvon Werkzeugen werden immer größer. DieMikrosystemtechnik bietet eine Fülle von Einsatzmöglichkeitenin vielen Produktionsprozessen und in den verschiedenstenProdukten. Forschungs- und Entwicklungsvorhabenauf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik sollen dazu beitragen,zukünftige Produkte klein, mobil und intelligent zu gestalten.Die Mikrosystemtechnik hat damit auch die Funktioneiner Querschnittstechnologie, ohne die viele innovativeVorhaben nicht mehr denkbar wären.21
Themen undInhalteMaterialwissenschaftNeue, verbesserte Materialien stehen häufig am Anfang technischerInnovationen, da ihre Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeitin weiten Bereichen den Innovationsgrad neuerTechnologien bestimmen. Als klassische Querschnittstechnologieermöglicht es die Materialwissenschaft, mit der Erforschungund der Kenntnis von Materialeigenschaften zahlloseProdukte neu zu konzipieren und bestehende Produktezu verbessern. Neue Materialien haben einen wesentlichenEinfluss auf die Minderung von Umweltbelastungen unddie Verbesserung der Qualität der Umwelt. Dadurch kommtihnen eine zentrale Rolle im Hinblick auf den technischenFortschritt zu. Mit der Förderung von Projekten aus dem BereichMaterialwissenschaft wird die Definition und Konzipierungvon neuen Materialien, ihren Eigenschaften und ihrerAnwendung in der gesamten Bandbreite von oxidischenFunktionsmaterialien, (Hochleistungs-) Glasmaterialien undPolymeren, kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen für dieLuftfahrt bis hin zu biokompatiblen Materialien angestoßen.Energie und UmweltDie Basis unserer Zukunft ist die sichere, wirtschaftliche undumweltverträgliche Versorgung mit Energie. Dieses Ziel istzu verbinden mit den steigenden Anforderungen im UmweltundKlimaschutz, um die Lebensqualität der Bevölkerungzu erhalten. Die effiziente Nutzung der knappen Güter undRessourcen sowie die Erhaltung und der Schutz der natürlichenLebensgrundlagen bedürfen einer dauerhaften, nachhaltigenund umweltgerechten Entwicklung im Sinn einesvorsorgenden, nachsorgenden und kompensatorischen Umwelt-und Klimaschutzes sowie innovativer Methoden derUmweltbeobachtung. Der Themenschwerpunkt Energie hatmit dem geplanten Atomausstieg eine neue Dimension bekommen.Elektromobilität, Versorgungssicherheit und Energieeffizienzsind wichtige Forschungsschwerpunkte.MechatronikAls eine mittlerweile weitgehend etablierte Querschnittsdisziplinhat die Mechatronik den klassischen, an der Mechanikorientierten Maschinenbau in vielen Bereichen abgelöstund gänzlich neue technische Möglichkeiten eröffnet. MechatronischeSysteme, ihre Auslegung, Herstellung und ihrEinsatz werden zukünftig ein wesentliches Standbein desmodernen Maschinenbaus, der Fahrzeugtechnik, der Medizintechnikund der Kommunikationsindustrie darstellen. Instrumentenbestücktemedizinische Roboterarme werden inder Lage sein, navigationsgestützte Operationen im Rahmenspezifischer Anwendungen durchzuführen. Unter Nutzungpatientenspezifischer Bilddaten können Zielpositionen mithoher Genauigkeit angefahren und Fehler, die beim manuellenPositionieren von Instrumenten auftreten können,vermieden werden. Mit Hilfe innovativer mechatronischerProduktkonzepte sowie den zugehörigen Fertigungs- undMontageketten liefert die Mechatronik aber auch innovativeTechnologien für andere wichtige Produktionszweige inBayern, z. B. den Automobilbau.22
NanotechnologieDie Nanotechnologie rückt Materie mit Abmessungen imNanometerbereich in den Blickpunkt sich stürmisch entwickelnderForschungsrichtungen. Sie erlaubt die gezielteCharakterisierung sowie die Manipulation von Materie aufder Nanometerskala. Durch die supramolekulare Chemieist der gezielte und selbstorganisierende Aufbau komplexerSysteme aus kleinen molekularen Einheiten möglich. Mit derGenerierung von Systemen zur Handhabung von Stoffen imMikro- und Nanoliterbereich sowie zur quantitativen Analysemikrochemischer Reaktionen ist es möglich, Laboranalyseverfahrenderart zu miniaturisieren, dass sie auf derdaumennagelgroßen Fläche eines Chips ablaufen können.Im Bereich der Mikroelektronik sind durch die immer weiterfortschreitende Miniaturisierung von elektronischen BauelementenSysteme mit Elementardimensionen von 100 nmherstellbar.Prozess- und ProduktionstechnikInnovative Prozess- und Produktionstechniken, Automatisierungstechniken,neue Verfahrens- und Umwelttechniken,Simulationstechniken zur Unterstützung komplexerEntscheidungsprozesse sowie wissensbasierte Systemeund Modelle schaffen die technologischen Voraussetzungen,Wertschöpfungs- und Geschäftsprozesse sowieProduktionsketten und Fertigungstechniken zu optimieren.Die zunehmende Miniaturisierung mikrotechnischer Werkstückeerfordert innovative Fertigungstechnologien, neueVerfahren der Aufbau- und Verbindungstechniken sowieHandhabungs-, Montage- und Justagetechniken von hoherPräzision im Mikrometerbereich. Intelligente Sensorsysteme,basierend auf entsprechenden Algorithmen, schaffenund erweitern Diagnosemöglichkeiten und die Funktionsüberwachungablaufender Produktionsprozesse. Ziel diesesFörderschwerpunktes ist es, innovative Entwicklungenauch für kleine und mittlere Unternehmen anzustoßen undeffizient nutzbar zu machen.23
forschungsverbündedes jahres 2012Forschungsverbündeabgeschlossene VerbündeFORZEBRA:Zellbasierte Regeneration des muskuloskelettalen Systems im Alter 26FORPROTECT: Diagnoseverfahren und Therapien zum Infektionsschutz 27FORGLAS:Multifunktionale Werkstoffe aus Glas für energieeffiziente Gebäude 28Neue Verbünde<strong>Bayerische</strong>r Forschungsverbund FOREnergy – Energieflexible Fabrik 29<strong>Bayerische</strong>r Forschungsverbund für Elektromobilität (FORELMO) 30Forschungsverbund Muskelschwund (Sarkopenie) und Osteoporose –Folgen eingeschränkter Regeneration im Alter (FORMOsA) 3125
Life SciencesFORZEBRA: Zellbasierte Regenerationdes muskuloskelettalen Systems im AlterAbgeschlossene VerbündeSprecherKlinikum der Universität MünchenKlinik für Allgemeine, Unfall-, HandundPlastische ChirurgieProf. Dr. W. MutschlerErforschung neuer Therapien für degenerative Erkrankungen der Knochen, Knorpel und SehnenOrthopädisches Zentrumfür Muskuloskelettale ForschungLehrstuhl für Orthopädie und OrthopädischeKlinik im König-Ludwig-HausProf. Dr. F. JakobGeschäftsführungKlinikum der Universität MünchenChirurgische Klinik und Poliklinik–InnenstadtDr. Michael StengeleWIssenschaftspartnerUniversität WürzburgUniversität UlmTechnische Universität MünchenParacelsus Universität SalzburgLudwig-Maximilians-Universität MünchenForschungszentrumMagnet-Resonanz-Bayern e.V. (MRB)BG Unfallchirurgie MurnauIndustriepartnerTutogen Medical GmbH, SiemensMedical Solutions AG, PreSens PrecisionSensing GmbH, MWM Biomodels GmbH,PolyMaterials AG, Novartis DeutschlandGmbH, LivImplant, Coriolis PharmaGmbH, BioStemTec, BIONORICA AG,Arthrex Medizinische Instrumente GmbH,RAPID Biomedical GmbHDer Forschungsverbund FORZEBRA hat die molekularen Ursachen degenerativerErkrankungen im Alter erforscht und neue Modelle für die Validierung von Therapieoptionenin der Regenerativen Medizin geschaffen.Im Verbund hat sich eine interdisziplinäre geeignete biomechanische BedingungenPlattform für „Zellbiologie und Genomik“ simuliert werden können, wie sie beimmit der Genexpression in mesenchymalen Menschen vorliegen. In der VerbundlaufzeitStammzellen und im Laufe ihrer Differenzierungbefasst, mit besonderer Aufmerksamkeitauf Unterschiede bei jungen und altenMenschen. Ergebnis dieses Projekts sindwichtige Fortschritte im Verständnis dersind die Grundlagen für die Klonierung vonSchweinen entwickelt worden, welche einenspeziellen Immundefekt haben. Damit ist einneues Modell entstanden, das geeignet ist,menschliche zellbasierte Konstrukte ohne AbstoßungsreaktionStammzellbiologie; insbesondere konntenzu erproben. Somit ist einhier erste therapeutische Zielmoleküle identifiziertund charakterisiert werden, die zurAdressierung von Gegenmaßnahmen für Alterungund Degeneration geeignet erscheinen.hochattraktives Großtier-Modell für die Validierunginnovativer Therapieoptionen imBereich der Regenerativen Medizin verfügbargeworden. Die durch FORZEBRA entwickeltenPlattformen haben auch über den FörderzeitraumDie Erkenntnisse aus dieser ersten Plattformflossen in eine zweite Plattform „Zellapplikationhinaus ein interaktives Netzwerkgeschaffen, das seine Kompetenz nun auf dieund Zelltracking“ ein. Hier europäische Ebene ausdehnen wird.wurden neue molekulare und auch funktionelleBildgebungsverfahren entwickelt,die es erlauben, die im präklinischen Tierversucherprobten therapeutischen Strategienbezüglich der beteiligten Zellen, derVitalität und letztlich auch der Funktion desneu entstandenen Gewebes zu verfolgen.Die dritte Plattform „Großtiermodelle“ ist beider Erforschung von muskuloskelettalen Erkrankungenbesonders wichtig, da nur hier26
FORPROTECT: Diagnoseverfahrenund Therapien zum InfektionsschutzLife SciencesAbgeschlossene VerbündeSprecherLinks: gezielte genetische Modifikation der Erreger: Verbesserung von Therapie und Impfstoff;rechts: Herausforderung für die Medizin: neue Resistenzen von Bakterien und VirenMax-von-Pettenkofer-Institut für Hygieneund Medizinische MikrobiologieLudwig-Maximilians-Universität MünchenProf. Dr. Ulrich KoszinowskiNeue genombasierte Diagnostik- und Therapie-Lösungen sollen helfen, bakterielle undvirale Infektionskrankheiten besser zu bekämpfen.Sirion Biotech GmbH, M[nchenDr. Christian ThirionIn der Vergangenheit wurden diagnostischeVerfahren etabliert und verbessert, indem Erregerin vitro isoliert und vermehrt wurden.Die Infektionsgenetik zeigt, dass Faktorenwie die Gewebeeigenschaften des erkranktenWirts und das Zusammenspiel mit anderenErregern die Ausbreitung eines Keimes beeinflussen.Bakterien und Viren verhalten sichim Patienten anders als im Reagenzglas, Entstehungund Verlauf einer Krankheit hängenstark mit der Interaktion von Wirt und Erreger(Pathogen) zusammen. Unterschiedliche Programmedes Pathogens werden abgerufen.Die Folge ist die Ausprägung unterschiedlicherAntigen-Profile. Diese Antigen-Profilesollen im Projekt identifiziert werden. Dazugehört, die vom Erreger produzierten Proteinezu isolieren, zu modifizieren und anzureichernund für moderne Immunisierungsstrategiennutzbar zu machen.Im Forschungsverbund wurden acht Projektebearbeitet. Konzeptionell verfolgte derVerbund parallel zwei Strategien. Zum einenwurden in der Diagnostik neue Verfahren derProteinanalyse anhand von MALDI-TOF-Analysatoren(Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation) entwickelt, die die Ermittlung vonProtein-Expressionsprofilen von Bakterien ermöglichen.Unter Berücksichtigung des Invivo-Milieuskönnen so die Antigen-Profileidentifiziert werden, die eine Erkrankung definieren.Zum anderen sollten neue, verfeinerteVerfahren der T-Zell-Analyse entwickelt undEpitop-Muster viraler Infektionen definiertwerden. Daraus entstehen moderne diagnostischeVerfahren und Impfstoffentwicklungen.Daneben ging es um verbesserte Therapieverfahren.Die Arbeiten zielten darauf ab, durchdie gezielte genetische Veränderung der Erregergewünschte biologische Eigenschaften zuerreichen. Die modifizierten Bakterien oderViren können direkt als Impfstoff oder alsVektor zu therapeutischen oder präventivenZwecken verwendet werden.GeschäftsführungMax-von-Pettenkofer-Institut für Hygieneund Medizinische MikrobiologieLudwig-Maximilians-Universität Münchenbis Juli 2012: Dr. Julia NiefneckerWissenschaftspartnerLudwig-Maximilians-Universität München:Max von Pettenkofer-Institut,Klinikum Großhadern;Universität Regensburg, Institut fürMedizinische Mikrobiologie und Hygiene;Universität Würzburg:Institut für Medizinische Strahlenkundeund Zellforschung,Rudolf-Virchow-Zentrum,Institut für Biochemie;Max-Planck-Institut für Biochemie,MartinsriedIndustriepartnerÆterna Zentaris GmbH, Frankfurt;Geneart AG, Regensburg;Mikrogen GmbH, Neuried;MicroCoat Biotechnologie GmbH,Bernried;Intervet Deutschland GmbH,UnterschleißheimBruker Daltonik GmbH, Bremen;Sirion Biotech GmbH, München27
MaterialwissenschaftFORGLAS: Multifunktionale Werkstoffeaus Glas für energieeffiziente GebäudeAbgeschlossene VerbündeSprecherLinks: Pressglas: Entnahme; rechts: Mikro-Hohlglaskugeln: Wärmemanagement für Putze und AnstricheUniversität BayreuthLehrstuhl für WerkstoffverarbeitungProf. Dr. Monika Willert-PoradaSigmund Lindner GmbH, WarmensteinachDipl.-Ing. Stefan TrasslNeue multifunktionale Werkstoffe und Baustoffe auf Glasbasis können dazu beitragen,dass die Gebäude der Zukunft mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen.GeschäftsführungUniversität BayreuthLehrstuhl für WerkstoffverarbeitungDr. Thorsten GerdesWIssenschaftspartnerFraunhofer-Institut für Silikatforschung;Universität Bayreuth:Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe,Lehrstuhl für Technische Thermodynamikund Transportprozesse,Lehrstuhl für Werkstoffverarbeitung;Universität Erlangen:Lehrstuhl für Glas und Keramik (WW3)Department WerkstoffwissenschaftenIndustriepartnerCentrosolar Glas GmbH & Co. KG, Fürth;Eckart GmbH, Velden; Franken MaxitGmbH & Co., Kasendorf; FüllerGlastechnologie Vertriebs GmbH,Spiegelau; Gebrüder Dorfner GmbH &Co., Hirschau; INTERPANE GlasgesellschaftmbH (IPP), Plattling;KEIMFARBEN GmbH & Co. KG, Diedorf;LIPEX Anlagentechnik und HandelGmbH, Puchheim; Nachtmann GmbH,Weiden i. d. Oberpfalz; PLANSEE SE,Reutte (Österreich); Schott AG, Mainz;Sigmund Lindner GmbH, WarmensteinachW.C. Heraeus GmbH, HanauDer Forschungsverbund FORGLAS hat sichzum Ziel gesetzt, mit Hilfe neuer multifunktionalerglasbasierter Werkstoffe eine wesentlicheVerringerung des Energiebedarfs vonGebäuden zu erzielen. Im Rahmen des Projektswurden Funktions-Beschichtungen fürFlachglas-Elemente und für glasbasierte Additivein Putzen und Anstrichen entwickelt,die bei Neubauten wie im Altbestand mit geringemAufwand eine Verringerung des Energiebedarfsermöglichen. Die Beschichtungenund Additive bewirken ein verbessertesLicht- und Wärmemanagement wie auch eineSteuerung der Luftfeuchte. Beides sind passiveMaßnahmen, die zur Verbesserung desWohnklimas ohne zusätzlichen Heiz- oderKühlaufwand beitragen.Im Forschungsverbund ist bei Beschichtungenvon Fenster- und Fassaden-Verglasung eineerhebliche Verbesserung der Produktqualitätund Prozesssicherheit erzielt worden. Es sindneue dispergierbare glasbasierte Additive fürPutze und Anstriche entwickelt worden, diewärmeisolierende und feuchteregulierendeEigenschaften aufweisen, aber auch eine saisonalspezifische Kontrolle der Reflexion oderAbsorption der Sonnenstrahlung im Außenbereichermöglichen.Die zehn Teilprojekte umfassten die gesamteProzesskette der Glasherstellung: von derEntwicklung und Untersuchung neuer Glassortenmit besonderem Absorptions- undReflexionsverhalten über die kontinuierlicheVerarbeitung von geschmolzenem Glaszu dispergierbaren Additiven bis hin zu Beschichtungsverfahren,um zusätzliche Funktionenzu ermöglichen.Durch anwendungsnahe Untersuchungen derglasbasierten Werkstoffe konnten qualitativeund quantitative Aussagen zum Energieeinsparpotenzialgewonnen werden. Mittels Simulationwurde das Verhalten der neuenglasbasierten Materialien im Außenbereichim Verlauf jahreszeitlich veränderter Sonneneinstrahlungund im Innenbereich hinsichtlichdort vorhandener Energie-Quellenund -Senken untersucht. Der Erfolg des Forschungsverbundesist bereits jetzt messbaranhand der zahlreichen Nachfolgeprojekte,einschließlich eines EU-Projektes (HarWin,FP 7, EeB-Programm).28
<strong>Bayerische</strong>r ForschungsverbundFOREnergy – Energieflexible FabrikEnergie und UmweltNEUE VerbündeSprecherProjektgruppe RMV des Fraunhofer IWURessourceneffizente FabrikenProf. Dr.-Ing. Gunther ReinhartSynchronisation von Energieangebot und -nachfrageFriedrich-Alexander UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Fertigungsautomatisierungund Produktionssystematik (FAPS)Prof. Dr.-Ing. Jörg FrankeZollner Elektronik AG, ZandtDr. Josef WeberBis 2050 sollen erneuerbare Quellen 80 % des deutschen Strombedarfs decken.Wind- und Solarenergie sind jedoch wetter- und standortabhängig, was zu sinkenderVersorgungsicherheit führt. Um das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauchzu gewährleisten, ist neben dem Ausbau von Stromnetzen und Stromspeichern auch dieNachfrage an elektrischer Energie zu flexibilisieren.Ziel des Forschungsverbunds FOREnergy ist (erneuerbare) Energieangebot zu ermöglichen.Darüber hinaus sollen Methoden zures, die energieflexible Fabrik zu erforschen.Dabei sind innovative technische Lösungen Bewertung der energieflexiblen Produktionund Methoden zu erarbeiten, mit denen die entwickelt werden.bewusste flexible Steuerung des Energiebedarfsin der Fabrik und somit eine Synchronisationvon Energieangebot und -nachfrageermöglicht wird (siehe schematische Darstellungoben).Um dieses Ziel zu erreichen, muss zunächstTransparenz über den Energieverbrauch derFabrik auf allen Ebenen geschaffen werden.Da Energie bisher in der Produktion nicht alslimitierte Ressource betrachtet wird, soll indiesem Forschungsverbund auf Basis gegenwärtigerEnergieverbrauchsprofile die Fragewissenschaftlich durchdrungen werden, inwieweitund unter welchen BedingungenEnergieflexibilität bei begrenzter Ressourcenverfügbarkeitin der Produktion möglich ist.Hierfür werden Anlagen und Speichermedienfür den energieflexiblen Einsatz erforschtund Konzepte zur Integration von Energieals zu planende Ressource erarbeitet, um soeine Anpassung der Energienachfrage an dasGeschäftsführungFraunhofer IWU PG RMV, AugsburgDipl.-Ing. Markus GraßlWISSENSCHAFTSPARTNERFraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinenund Umformtechnik (IWU), Projektgruppefür Ressourceneffiziente mechatronischeVerarbeitungsmaschinen (RMV)TU München: Institut für Werkzeugmaschinenund Betriebswissenschaften(iwb), LS für Werkzeugmaschinen undFertigungstechnik; Institut für Werkzeugmaschinenund Betriebswissenschaften(iwb), LS für Betriebswissenschaften undMontagetechnik; LS für Energiewirtschaftund Anwendungstechnik (lfE)Universität Erlangen-Nürnberg, LS fürFertigungsautomatisierung undProduktionssystematik (FAPS)Technische Hochschule Nürnberg,Institut für Energie und Gebäude (ieg)INDUSTRIEPARTNERABB Automation Products GmbH, BMWGroup, Balluff GmbH, Bosch RexrothElectric Drives and Controls GmbH,COMBITHERM GmbH, Diehl MetallStiftung & Co. KG, Franken GussKitzingen GmbH & Co. KG, GregorHofbauer GmbH, GROB-WERKE GmbH &Co. KG, Güntner AG & Co. KG, HAWEHydraulik SE, IBB IngenieurbüroBlomeier GmbH, Industrie- undHandelskammer Schwaben, KAESERKompressoren AG, Krones AG, Lech-Stahlwerke GmbH, Lechwerke AG, MBSGmbH, Molkerei Gropper GmbH & Co.KG, Pressmetall Gunzenhausen GmbH,ritter & bader GmbH, SALT SolutionsGmbH, SGL CARBON GmbH, SPINNERGmbH, Vereinigte Wertach-ElektrizitätswerkeGmbH, WAREMA Renkhoff SE,WISAG Energiemanagement GmbH & Co.KG, Zollner Elektronik AG29
Energie und Umwelt<strong>Bayerische</strong>r Forschungsverbundfür Elektromobilität (FORELMO)NEUE VerbündeSprecherFraunhofer-Institut für IntegrierteSysteme und BauelementetechnologieIISB, ErlangenProf. Dr. rer. nat. Lothar FreyTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Fahrzeugtechnik FTMProf. Dr.-Ing. Markus LienkampInfineon Technologies AG, NeubibergJoachim WeitzelFORELMO vernetzt die Forschungskompetenzen zur Elektromobilität in Bayern(Bildquelle: Fraunhofer IISB/TU München)Die Optimierung des elektrischen Antriebsstrangs ist eine der zentralen technischenAufgaben für die erfolgreiche Umsetzung der Elektromobilität. FORELMO erarbeitethierzu neue Lösungen in den Schwerpunkten Elektromotor, Energiespeicher undleistungselektronische Schlüsselkomponenten.GeschäftsführungFraunhofer-Institut für IntegrierteSysteme und BauelementetechnologieIISB, ErlangenDr. Bernd FischerWIssenschaftspartnerFraunhofer-Institut für IntegrierteSysteme und BauelementetechnologieIISB, Erlangen/Nürnberg;TU München: LS für Fahrzeugtechnik(FTM), LS für Elektrische Energiespeichertechnik(EES);Technische Hochschule Nürnberg GeorgSimon Ohm: Fakultät ElektrotechnikFeinwerktechnik Informationstechnik;Hochschule für angewandte WissenschaftenLandshut, TechnologiezentrumEnergieIndustriepartnerEPCOS AG, München; FMS SystemtechnikGmbH, Kraiburg am Inn; IAV GmbH,München; Infineon Technologies AG,Neubiberg; LION Smart GmbH, Frieding;Modelon GmbH, Gilching; Süd-ChemieAG, Moosburg; TÜV SÜD Battery TestingGmbH, Garching b. München;WissenschaftlichtechnischeBegleitung<strong>Bayerische</strong>r Cluster LeistungselektronikElektromobilität spielt weltweit eine zentraleRolle für die Sicherstellung der individuellenMobilität, die Verbesserung des Klimaschutzesund die künftige Ausgestaltung derEnergieversorgung. Für Bayern ergeben sichhier umfangreiche Chancen und Herausforderungen.Wichtige technische Fragen stellensich im Hinblick auf einen effizienten elektrischenAntrieb, das Batteriesystem, Leistungswandlungund Energiemanagement sowie einzuverlässiges, kosten- und energieeffizientesZusammenspiel aller Komponenten in einemoptimierten Antriebsstrang. Die Arbeitenin FORELMO werden sich daher unter demMotto „Der elektrische Antriebsstrang vonmorgen – effizient, sicher, wirtschaftlich“ undin Orientierung an der in Bayern vorhandenenForschungskompetenz und Industrielandschaftauf diese Kernfragen konzentrieren.Ein Hauptaspekt hierbei ist die Technik fürden Elektromotor. FORELMO wird sich mitdem Maschinentyp der fremderregten Synchronmaschinebefassen, die bisher kaumfür Antriebskonzepte im Bereich der Elektromobilitäteingesetzt wird, aber neben sicherheitstechnischenVorteilen das Potenzialbietet, kostensensitive Magnetwerkstoffe zuvermeiden.Das zweite Hauptarbeitsgebiet des Verbundsbeinhaltet die Optimierung des Batteriepacksund des Batteriemanagementsystems durchneue Methoden der Zellanordnung und -verschaltung,der Zustandsbestimmung und Modulüberwachung.Zudem werden verbesserteund auf die Elektromobilität abgestimmteZelltechnologien auf Basis von Materialoptimierungenund innovativen Herstellungsprozessenentwickelt. Im dritten Themenbereichvon FORELMO werden neuartige passiveBauelemente als Schlüsselkomponenten füreine effiziente Leistungselektronik im Vordergrundstehen.30
Forschungsverbund Muskelschwund (Sarkopenie)und Osteoporose – Folgen eingeschränkterRegeneration im Alter (FORMOsA)Life SciencesNEUE VerbündeSprecherLinks: GMP-Raum zur Herstellung therapeutisch wirksamer Substanzen; rechts: Patient auf Galileo(Novotec) zur Applikation von definierter VibrationIm Forschungsverbund FORMOsA sollen messtechnische Standards zur Erfassung derSarkopenie und zur Auswertung des Erfolgs therapeutischer Interventionen erarbeitetsowie neue Therapien entwickelt werden.Die Sarkopenie beschreibt den fortschreitendeneinen pathogenetische Erkenntnisse ausVerlust der Skelettmuskulatur an Masseund Kraft. Daraus resultiert eine geringerekörperliche Leistungsfähigkeit, was zu gravierendenden Tiermodellen gewonnen, die dann dieGrundlagen für die medikamentöse Therapiemit Myostatin-Antagonisten wie Follinellengesundheitlichen und funktiostatinbilden. Hier werden parallele AnsätzeBeeinträchtigungen führt. Die molekularePathogenese ist nur teilweise geklärt, nurverfolgt: eine verzögerte Wirkstoff-Freisetzungsstrategie;eine versatile Toolbox für einwenige früh identifizierbare Risikofaktoren Bio-Device (Bio-Device + Transgenes 3D-Gewebesind bekannt. Die apparative Diagnostik istnoch nicht standardisiert bzw. nicht flächendeckendmit steuerbarer Wirkstoffsekretion) unddie Verbesserung der Heilung nach Trauma.einsetzbar. Multimodale Therapie-ansätze sind nicht standardisiert, eine medikamentöseTherapie ist noch experimentell.Eine verlässliche Diagnostik für die Sarkopenieist aber ebenso wichtig. Die Schwerpunktein der Entwicklung sind hier eine OptimierungZiel des Projekts ist zunächst die Festlegungeiner standardisierten Diagnostik in Bezug aufBildgebung und Funktionstestung. So könnenauch Risikofaktoren mit erfasst werden.Gleichzeitig werden innovative Strategienfür die medikamentöse Therapie entwickelt,von MRT-Sequenzen für die Muskulatur,die Korrelationen von Funktion und Massemit gängigen Messverfahren sowie die Überprüfungund gegebenenfalls Änderung derMessparameter entlang bekannter und optimierterInterventionsverfahren.ebenso wie neue technische Möglichkeitenfür multimodale Prävention und Therapie.Die gewonnenen Erkenntnisse werden dannim Anschluss an FORMOsA in klinische Studienumgesetzt und zur Erstellung von Leitlinienund Standardvorgehensweisen führen.Der Verbund besteht aus mehreren Plattformenund Teilprojekten. Es werden zumJulius-Maximilians-Universität WürzburgOrthopädisches Zentrum fürMuskuloskelettale ForschungProf. Dr. Franz JakobKlinikum der Universität MünchenOsteologisches Schwerpunktzentrumund Experimentelle Chirurgie undRegenerative MedizinProf. Dr. Matthias SchiekerGeschäftsführungJulius-Maximilians-Universität WürzburgOrthopädisches Zentrum fürMuskuloskelettale ForschungDr. Sigrid Müller-DeubertWIssenschaftspartnerFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergJulius-Maximilians-Universität WürzburgLudwig-Maximilians-Universität MünchenKlinikum der LMU MünchenStiftung Bürgerspital z. Hl. GeistWürzburgUniversitätsklinik ErlangenUniversitätsklinikum WürzburgIndustriepartnerGILYOS GmbH, Harvest TechnologiesGmbH, Integion GmbH, ImmundiagnostikAG, Livimplant GmbH, medi GmbH & Co.KG, miha bodytec GmbH, NovartisPharma AG, Novotec Medical GmbH,PAN-Biotech GmbH, Nutricia GmbH,Physiomed Elektromedizin AG, PolymaterialsAG, Institut Predia, Rölke PharmaGmbH, Servier sDeutschland GmbH,Siemens AG, SMT medical GmbH & Co. KG31
Energie und UmweltÖlverbrauch an Automotoren dynamisch messen 34Kontrolliert gestufte OxyCoal-Verbrennung 35Schadstoff- und CO 2-Emissionssenkung im PKW-Dieselmotor 36CO 2-Reduktion durch Auto-CO 2-PASS 37Fahrzeugaerodynamik für innovative Antriebskonzepte (DrivAer) 38Elektroautomobil-Projekt MUTE 39Auswertung eines neuartigen Abwärmeverstromungskonzepts 40Elektrische Antriebe im Pumptankwagen 41Gezieltes Steuern des Energieverbrauchs 42life sciencesSmart Gels – neuartige Hydrogele als Zellträger 43Patientenadaptierte Automatisierung der Herz-Lungen-Maschine 44Echtzeit-Funktionsbilder des Herzens 45Optimierung akkommodativer Kunstlinsenimplantate 46Muskeldystrophieforschung am Großtiermodell – DMDpig 47Optimierung der Prothesenschaftkonstruktion 48MR-kompatible Hochenergie-Elektroden 49Osteoporoseprophylaxe mit pflanzlichen Wirkstoffen 50KAPNOS: Entwicklung eines CO 2-Sensors für die Notfallmedizin 51Elektromagnetische Stimulation humaner Stammzellen im Bioreaktor 52Patch-clamp-Verfahren für intrazelluläre Ionenkanäle 53Aerosoltherapie der oberen Atemwege und Nasennebenhöhlen 54Lichttechnologien für alters- und demenzgerechte Akutkrankenhäuser 55MaterialwissenschaftDiamant auf Stahl für technische Anwendungen 56Sichere Sportgeräte aus CFK 5732
Kontrolliert gestufte OxyCoal-VerbrennungEnergie und UmweltAbgeschlossene PROJEKTEZusammenführung von rezirkuliertem Rauchgas und Sauerstoff in der VersuchsanlageProjektleitungEin optimierter Verbrennungsprozess soll die Effizienz zukünftiger Oxyfuel-Kraftwerkesteigern und somit die Umwelt entlasten.Technische Universität MünchenLehrstuhl für EnergiesystemeBoltzmannstr. 1585748 GarchingAuf Grund des steigenden Energiebedarfsund der heute bekannten Reserven wird dieStromerzeugung aus Kohle auch in Zukunfteine entscheidende Rolle in der Stromversorgungspielen. Eine höhere Energiewandlungseffizienzvon Kohlekraftwerken ist einwesentlicher erster Schritt für niedrigereKohlendioxidemissionen. Für weitergehendeReduktionsziele werden derzeit verschiedeneTechnologien zur Abscheidung des Kohlendioxidsaus dem Kraftwerksprozess und seinerklimaneutralen Speicherung in geeignetengeologischen Lagern entwickelt.Der Oxyfuel-Prozess bietet sich neben Postcombustion-und Pre-combustion-Verfahrenals eine der drei meistversprechenden Carbon-Capture-Technologienan. Anders als inkonventionellen Kohlekraftwerken wird derBrennstoff im Oxyfuel-Prozess nicht mit Luftumgesetzt, sondern mit einem Gemisch ausreinem Sauerstoff und rezirkuliertem Rauchgas.Nach dem Auskondensieren des Wasserdampfesbleibt ein Rauchgas, das im Wesentlichenaus Kohlendioxid besteht und sich zurSequestrierung eignet.In einer 300-kW-Versuchsbrennkammerwurde experimentell und mittels CFD (ComputationalFluid Dynamics)-Simulation einneues Konzept eines oxyfuel-gefeuertenDampferzeugers untersucht. Hier kam einekohlebefeuerte Mehrbrenneranordnung zumEinsatz. Die einzelnen Brenner werden nunmit unterschiedlichen Stöchiometrien betrieben;somit wird die Wärmefreisetzung in derBrennkammer bei minimalen Rauchgas- bzw.CO 2-Rezirkulationsraten gesteuert. Dadurchkönnen die geänderten Wärmeübertragungseigenschaftenauf Grund der geänderten Gaszusammensetzungim Oxyfuel-Prozess für dieAuslegung einer effizienteren Oxyfuel-Dampferzeugergenerationoptimal genutzt werden.ProjektpartnerALSTOM Boiler Deutschland GmbHResearch & Technologywww.alstom.comE.ON Energie AGNew TechnologiesEnBW Energie Baden-Württemberg AGOptimierung F&E (TQO)www.enbw.com35
Energie und UmweltSchadstoff- und CO 2-Emissionssenkungim PKW-DieselmotorAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungNiedrigste Partikel- und NOx-Emissionen durch Aufladung und Abgasrückführung (li.), Injektormit Direktantrieb für optimale Gemischaufbereitung (Mi.), elektronische Motorsteuerung (re.)Continental Automotive GmbHAdvanced Development P ES E AD CBSiemensstraße 1293055 RegensburgIm Fokus des Forschungsprojekts standen zwei Maßnahmen für umweltfreundlichereMotoren: Ein neues Einspritzventil ermöglicht einen laufruhigen und schadstoffarmenMotor, ein neu geführter Luftpfad verringert die Emissionen.ProjektpartnerContinental Mechanical ComponentsGermany GmbH (CMC GmbH)www.continental-corporation.comHochschule RegensburgFakultät Maschinenbauhttp://maschinenbau.fh-regensburg.deMittelfristig wird der Verbrennungsmotoreine der wichtigsten Antriebsquellen bleiben.Insbesondere der Dieselmotor hat durchseinen guten Wirkungsgrad immense Bedeutungfür einen sinkenden CO 2-Ausstoß. Dasgilt nicht nur für den Motor allein, sondernvor allem für die Gesamtbetrachtung einschließlichder Treibstoffaufbereitung (Wellto-Wheel-efficiency).Bisher wurden die Subsystemeeines Motors meist separat und nurbei stationären Betriebspunkten optimiert.Um Schadstoffausstoß und Verbrauch weiterzu senken, ist ein ganzheitlicher Ansatz nötig.Dazu wurden in diesem Projekt wichtige Bausteinedes Gesamtsystems miteinander undauch unter zeitlich veränderlichen Bedingungenuntersucht, also zum Beispiel bei Beschleunigungsvorgängen.Für die Kraftstoffaufbereitung wurde einneues Einspritzventil erprobt, mit dem gleichzeitigein schadstoffarmer und ruhiger Motorlauferreicht wurde. Dazu wurde vor allemdie wiederholbar exakte Kraftstoffzumessungkleinster Voreinspritzungen bei Einspritzdrückenvon über 2000 bar und kleinstenEinspritzpausen untersucht. Das zweiteSubsystem, das zur optimalen Verbrennungbeiträgt, ist der sogenannte Luftpfad. Beimodernen Dieselmotoren sorgt er nicht nurfür die Aufladung mit großen Mengen anFrischluft, sondern auch für die Rückführungerheblicher Anteile des Abgases, um dieStickoxidbildung zu unterdrücken.Insbesondere in der elektronischen Regelungdes Motors sind neue Ansätze nötig, um auchbeim Beschleunigen des Fahrzeugs die richtigeMischung zu gewährleisten. Außerdemmuss auch die Durchmischung beider Gaskomponenten,die Gleichverteilung auf alleZylinder sowie die minimale Sauerstoffkonzentrationsichergestellt werden. Dafür wurdeein modellbasiertes Regelkonzept ausgearbeitetund erprobt. Dies wird wesentlich zurErfüllung kommender Stufen der Emissionsgesetzgebungbeitragen.36
CO 2-Reduktion durch Auto-CO 2-PASSEnergie und UmweltAbgeschlossene PROJEKTELinks: Muster eines Partikelsensors mit Auswerteelektronik; rechts: Partikelsensor-Elektroden mit RußfädenProjektleitungDie Abgase von Fahrzeugen sind für einen erheblichen Teil des CO 2-Ausstoßes und füreine erhöhte Feinstaubbelastung verantwortlich. Im Projekt Auto-CO 2-PASS wurden Wegeerforscht, den CO 2-Ausstoß über eine intelligente Sensorik und Regelung zu verringernund eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte frühzeitig zu erkennen.Continental Automotive GmbHSensors & ActuatorsSiemensstraße 1293055 RegensburgDieses Ziel wurde durch die Entwicklung einesPartikelsensors erreicht, der – anders als beibereits bekannten Konzepten – für die Anwendungvor dem Partikelfilter geeignet ist. Paralleldazu wurden Ansätze zur Verringerung desCO 2-Ausstoßes über eine (Partikel-) sensorgestützteMotorsteuerung erarbeitet. Mit Hilfetheoretischer Betrachtungen und experimentellerUntersuchungen wurden verschiedeneKonzepte getestet und bewertet; die erfolgversprechendstenwurden in einen Motorsteuerungsalgorithmusüberführt und amMotorprüfstand oder im Fahrzeug validiert.gerade in schnellen Übergängen von niedrigerMotorlast zu hoher Last die Verbrennungzu optimieren. In diesen transienten Betriebszuständenist die Partikelkonzentrationim Abgas eine wertvolle Information, um dieSteuerparameter der Kraftstoff-Einspritzung(Menge und Timing), der Abgasrückführungund des Ladedrucks im Betrieb zu optimieren.ProjektpartnerAVL Software and Functions GmbHwww.avl.comFraunhofer-Institut für KeramischeTechnologien und SystemeMikro- und Energiesystemewww.ikts.fraunhofer.deFerner wurden Muster eines integrierendenPartikelsensors aufgebaut, mit dem kleinstePartikelkonzentrationen im Abgas zuverlässignachgewiesen werden können. Mittels einerneuen Steuer- und Auswertefunktion in derSensorelektronik ist der Sensor in der Lage,die Partikelemission insbesondere in transientenMotorbetriebszuständen zu messen.Parallel dazu wurden unterschiedliche Konzepteund Strategien zur CO 2-Reduktion entwickelt,die auf der vom Sensor gemessenenmomentanen Partikelemission basieren.Hiermit könnte es erstmals möglich werden,Hochschule RegensburgFakultät Maschinenbauwww.fh-regensburg.dewww.forwiss.uni-passau.deInstitut für Softwaresysteme intechnischen Anwendungender Informatik (FORWISS)Universität Passau37
Energie und UmweltFahrzeugaerodynamik für innovativeAntriebskonzepte (DrivAer)Abgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: turbulente Ablösungen am DrivAer-Körper, visualisiert durch das Q-Kriterium und Druckverteilungum das Fahrzeug in verschiedenen Ebenen; rechts: 1:2.5 DrivAer-Modell im RUAG-WindkanalTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Aerodynamik undStrömungsmechanikBoltzmannstr. 1585748 Garching bei MünchenDas Projekt DrivAer beschäftigte sich mit der Entwicklung eines generischen Fahrzeugmodells,das Untersuchungen zur Um- und Durchströmungsproblematik von Fahrzeugen– insbesondere auch in der Elektromobilität – ermöglicht.ProjektpartnerAudi AGI/EK-443www.audi.comBMW AGEG-64www.bmwgroup.comTraditionell werden aerodynamische Untersuchungenim automobilen Bereich an starkvereinfachten Prinzipkörpern oder an sehrdetaillierten Serienfahrzeugen durchgeführt.Erkenntnisse, die von Prinzipkörperuntersuchungenabgeleitet werden, können durchden starken Abstraktionsgrad der herkömmlichenPrinzipkörper nur bedingt in der Serienentwicklunggenutzt werden, währendUntersuchungen an Serienfahrzeugen oft ausgeheimhaltungsrechtlichen Aspekten schwerrealisierbar und durch ihren hohen Detaillierungsgradmit großem Aufwand verbundensind. Um die Lücke zwischen diesen beidenHerangehensweisen zu schließen, wurde indiesem Projekt ein neues generisches Fahrzeugmodellfür fahrzeugaerodynamische Untersuchungenentwickelt.zu ermöglichen, wurde der DrivAer-Körperals ein modulares Konzept mit drei verschiedenenHeckformen und zwei Unterbodengeometrienentwickelt.Das DrivAer-Projekt wurde 2012 erfolgreichabgeschlossen, die Geometriedaten und eineerste Validierungsdatenbasis sind öffentlichverfügbar. Der DrivAer-Körper steht mittlerweilesowohl Universitäten als auch Fahrzeugherstellernund Softwareentwicklernweltweit zur Verfügung.Die Zielsetzung des DrivAer-Projekts war dieBereitstellung und Validierung eines zwar seriennahen,jedoch hinreichend vereinfachtenPrinzipkörpers für aerodynamische Untersuchungenim Bereich der Automobilaerodynamik.Die Geometrie des DrivAer-Körperswurde durch eine Mittelung bereits vorhandenerCAD-Oberfächendaten hergeleitet. Umeine große Bandbreite an Untersuchungen38
Elektroautomobil-Projekt MUTEEnergie und UmweltAbgeschlossene PROJEKTELinks: MUTE-Frontansicht; rechts: MUTE bei der IAA 2011, am Stand von Bayern InnovativProjektleitungAn der Technischen Universität München (TUM) wurde die Idee geboren, ein optimalauf die Kundenanforderungen und den Mobilitätsbedarf der Zukunft zugeschnittenesElektrofahrzeug neu zu entwerfen, aufzubauen und zu erforschen. Das in Zusammenarbeitmit drei weiteren Projektpartnern entstandene Ergebnis heißt MUTE.Technische Universität MünchenLehrstuhl für FahrzeugtechnikBoltzmannstr. 1585748 Garching bei MünchenMUTE vereint Innovationen aus Wissenschaftund Forschung von 21 Lehrstühlen der TUMin einem Fahrzeug und dessen Anbindung andie Mobilitäts-Infrastruktur. In Zusammenarbeitmit den Projektpartnern wurde ein neuesund innovatives Mobilitätskonzept mit einemElektrokleinfahrzeug für den urbanen Einsatzbereichumgesetzt. Wesentlicher Aspektder Entwicklung war es, eine kostengünstigeBreitenmobilität sicherzustellen. Der fahrfähigeDemonstrator wurde auf der IAA 2011vorgestellt. Das Fahrzeug ist hocheffizient,um einen geringen Energieverbrauch im Betriebzu ermöglichen – angefangen bei niedrigemGewicht über optimierte Aerodynamikhin zu energieeffizienten Komponenten.Durch das geringe Gewicht ist eine kleineBatterie ausreichend. Zusammen mit ausgereiftenund preiswerten Komponenten könnteso ein günstiges Fahrzeug für die Kunden erstelltwerden. Zudem ist das Fahrzeug sicherund entspricht in seinem Fahrverhalten denAnforderungen eines Automobils.Aufbau der CFK-Komponenten am Fahrzeugoder der Rahmen für das Elektrofahrzeugdurch spezielle Entwicklungen im BereichAluminiumverarbeitung und im Bereichder Beleuchtungstechnologie. WesentlichesZiel des Forschungsprojekts war, zu zeigen,dass Elektromobilität innerhalb mittelfristigerZeiträume bezahlbar gestaltet werden kann.ProjektpartnerC-CON GmbHTechnikwww.c-con.deGerg Rapid Prototyping GmbHIAV GmbH Niederlassung Münchenwww.iav.comAufgrund der vollständigen Neuentwicklungvon Karosserie und Anbauteilen desFahrzeugs entstanden Bestandteile wie der39
Energie und UmweltAuswertung eines neuartigenAbwärmeverstromungskonzeptsAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Vorversuchsanlage Niedertemperatur-Verstromung; rechts: MesswerteMaschinenwerk Misselhorn (MWM)GmbHAgnes-Pockels-Bogen 180992 MünchenDas Forschungsprojekt realisiert ein neuartiges Abwärme-Verstromungs-Konzept, dasseinen Einsatzbereich bei Temperaturen unter 100 Grad Celsius hat.ProjektpartnerForschungsstelle für Energiewirtschaft(FfE)www.ffe.deIm Rahmen des Projekts wurde eine Vorversuchsanlageaufgebaut, welche für eine mechanischeLeistung von ca. 5 kW ausgelegtist. Die Stadtwerke München stellten hierzusowohl die Räumlichkeiten als auch die zumBetrieb benötigte Wärme und das Kühlwasserkostenlos zur Verfügung. Die Vorversuchsanlagewurde mit einer Vielzahl an Messstellenausgestattet, um die Prozessparameter (z. B.Drücke, Temperaturen, Leistungen) möglichstgenau erfassen zu können. Auswertung undAufzeichnung der Messdaten übernimmt dieSPS-Steuerung, welche einen Teil der Messwertefür den Anlagenbetrieb benötigt. ZumTest verschiedener Fahrweisen und zur Optimierungeinzelner Komponenten der Anlage– sowie der Gesamt-Anlage selbst – wurdeeine Fülle an Daten detailliert ausgewertetund analysiert. Die Arbeiten wurden von denProjektpartnern in enger Abstimmung durchgeführt– angefangen von der Überprüfungauf Plausibilität der Messwerte bis hin zuOptimierungsvorschlägen für die Anlage aufGrund der aufgezeichneten Messreihen.niveau von 80 °C eine mechanische Leistungvon ca. 4,7 kW erbringt, was einem Wirkungsgradvon ca. 4 % entspricht. Damit konntedie prinzipielle Eignung des Prozesses zurNutzung von Wärme auf einem niedrigenTemperaturniveau bewiesen werden. In dennächsten Schritten steht eine wesentlicheVerbesserung des Wirkungsgrades durch Anpassungder Komponenten und Optimierungder Regelung im Fokus, um einen wirtschaftlichenEinsatz der Technik zu ermöglichen.Im Rahmen einer Projektdemonstration imletzten Projektmonat konnte gezeigt werden,dass die Vorversuchsanlage aus 115 kW thermischerLeistung mit einem Temperatur-40
Elektrische Antriebe im PumptankwagenEnergie und UmweltPower PackDGPSTriebachsenantriebPumpenantriebAntrieb Zerkleinerungs- undVerteileinrichtung ExaCutAbgeschlossene PROJEKTEAntrieb Zerkleinerungs- und Abscheideeinrichtung RotaCutAntrieb Luftkompressor fürReifendruckregelanlageAlternatives Antriebsstrangkonzept PumptankwagenProjektleitungIm Forschungsvorhaben wurde eine Potenzialanalyse elektrischer Antriebe in Pumptankwagenzur Effizienzsteigerung und Umweltentlastung durch einen verringerten Kraftstoffverbrauchund eine bedarfsgerechte Ausbringtechnik (Precision Farming) durchgeführt.Technische Universität MünchenLehrstuhl für AgrarsystemtechnikAm Staudengarten 285414 FreisingDie Wirtschaftsdüngerausbringung in derLandwirtschaft erfolgt häufig unter einemhohen Primärenergieinput pro ausgebrachterWirtschaftsdüngereinheit, bei gleichzeitigeingeschränkter Regelbarkeit. Pumptankwagenmit elektrischen Antrieben, die zurDüngerausbringung eingesetzt werden, wirdein hohes Potenzial für eine energiesparendeund umweltschonende Landbewirtschaftungzugeschrieben. Darüber hinaus werden finanzielleVorteile für die Landwirtschaft erwartet.Die Zielsetzung des Projekts bestand darin,eine energetische und monetäre Kosten-Nutzen-Analysezum Betrieb von elektrischen Antriebenin Pumptankwagen durchzuführen.Im Rahmen des Projekts ist an den Elektromotoreneines Pumptankwagens mit Hilfevon Lastspielen eine Analyse des Verbrauchsan Antriebsenergie durchgeführt worden.Die monetäre Bewertung erfolgte über einenKosten-Nutzen-Vergleich. Die technischeAnalyse ergab eine Einsparung an notwendigerAntriebsenergie im Bereich von 5 bis16 %, abhängig davon, mit welchem Wirkungsgradder Prozess verlief. Der elektrischeWirkungsgrad belief sich dabei immer aufüber 81 %. Die Analyse der Ist-Situation ergabAusbringungskosten für Wirtschaftsdüngervon 3,30 Euro bis 6,52 Euro je Kubikmeter beiAusbringung ab Hof in Abhängigkeit von derFeldentfernung. Die berechneten Ausbringkostenmit neuer Technik betrugen 4,98 Eurobis 7,50 Euro je Kubikmeter.ProjektpartnerSemikron Elektronik GmbH & Co. KGwww.semikron.comTechnische Universität DresdenLehrstuhl Agrarsystemtechnikwww.agrarsystemtechnik.deZunhammer GmbHGülletechnik Fahrzeugbau41
Energie und Umwelt/Prozess- undProduktionstechnikGezieltes Steuern des EnergieverbrauchsAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungFraunhoferProjektgruppeInstitut für Werkzeug-Ressourceneffiziente mechatronischeVerarbeitungsmaschinenmaschinen und UmformtechnikProjektgruppe Ressourceneffizientemechatronische VerarbeitungsmaschinenRMVBeim Glaspalast 586153 AugsburgLinks: ungedämmtes Reinigungsbecken einer industriellen Waschanlage;rechts: gedämmtes Reinigungsbecken einer industriellen WaschanlageIm Rahmen des Projekts wurden Maßnahmen erarbeitet, durch die der Energiebedarfeiner Fabrik bewusst gesteuert werden kann, um so Spitzenlasten zu vermeiden und dieGrundlast zu senken.ProjektpartnerKrones AGWerkleitungwww.krones.comIm Zuge der Energiewende soll verstärkt aufStromerzeugung aus regenerativen Energiengesetzt werden. Allerdings ist die zeitlicheVerfügbarkeit von Strom aus erneuerbarenEnergien nicht steuerbar. Einen Ansatzzur Gewährleistung der Netzstabilität bietetdabei die Anpassung der Energienachfrageder Verbraucher an das Stromangebot. Aufdiese Weise kann von Seiten der Nachfragedas Netz ausgeglichen werden. Für Wirtschaftsunternehmenbedeutet dies aber, dassEnergie zu einer planbaren Ressource werdenmuss. Dabei gilt es, diese gezielt und effizienteinzusetzen, aber auch flexibel und bewusstzu steuern.Das Projekt „Gezieltes Steuern des Energieverbrauchs“beruht auf der Hypothese, dassder Energiebedarf einer Produktion gezieltgesteuert werden kann. Es wurde das Zielverfolgt, diese Hypothese in einem realenProduktionsumfeld zu belegen und das energetischePotenzial abzuschätzen. Darüberhinaus sollten Maßnahmen aufgezeigtwerden, mit denen Spitzenlasten ausgeglichenund die Grundlast eines Produktionsstandortesgesenkt werden können. Bei derAnalyse der Energiedaten stellten die Forscherfest, dass im Laufe eines Tages sowie im Jahresverlaufgroße Schwankungen im Energiebedarfauftreten. Um die Ursachen dafür zuermitteln, wurden in mehreren Stufen Energiemessungendurchgeführt und wenigeGroßverbraucher identifiziert, die durch ihrendiskontinuierlichen Leistungsbedarf maßgeblichfür das Lastgangprofil des Produktionsbereichsverantwortlich sind. Durch zielgerichteteMaßnahmen, wie z. B. das Anpassender Heizzyklen einer Waschanlage oder durchintelligentes Steuern der Druckluftkompressoren,konnte die maximal benötigte Leistunggesenkt werden. Abschließend wurden aneiner Waschanlage einzelne Maßnahmen beispielhaftumgesetzt und validiert.42
Smart Gels – neuartige Hydrogele als ZellträgerLife Sciences6-WellplatteAbgeschlossene PROJEKTESensorSauerstoff-Imaging-System VisiSensProjektleitungLudwig-Maximilians-Universität MünchenChirurgische Klinik und PoliklinikDie Implantation von Stammzellen ist eine vielversprechende Therapie für spontannicht heilende Knochendefekte. Trägermaterial können Hydrogele sein, die sich durchKörpertemperatur verfestigen. Im Projekt wurde untersucht, wie sich die Integration vonSauerstoffträgern im Gel auf inkorporierte Zellen auswirkt.Eine bedeutende Behandlungsmethode fürKnorpelschäden ist die autologe Chondrozytentransplantation(ACT). Hier wird demPatienten Knorpelgewebe arthroskopisch entnommenund im Labor aufbereitet. Im Anschlusswerden die gewonnenen patienteneigenenZellen in den Knorpeldefekt injiziert,wo sie durch Verschluss mit einem StückKnochenhaut vor Ort gehalten werden. DieseTechnik wurde in den letzten Jahren weitermodifiziert zu der Matrix-gestützten autologenChondrozytentransplantation (MACT),bei der bereits im Labor ein Kollagenträgermit Chondrozyten besiedelt wird. Für denVerschluss vor Ort gerieten Hydrogele in denFokus, die sich nach bzw. durch Implantationin den Körper verfestigen. Mit diesen wurdenbereits erste Erfolge erzielt, jedoch werdendie Zellen nicht ausreichend mit Sauerstoffversorgt und laufen Gefahr, abzusterben.Verbesserung der Sauerstoffversorgung imKonstrukt nachgewiesen werden, was jedochnicht ausreichend ist, um globale Prozesseim Konstrukt ausreichend zu beschreiben.Dies soll mit Hilfe des neuen Sauerstoff-Imaging-SystemsVisiSens überwunden werden,mit dem nicht nur die tatsächlichen Sauerstoffverhältnisseüber den Querschnitt einerProbe, sondern auch die Kontinuität der Sauerstofffreisetzungüberwacht und quantifiziertwerden kann. Mit der neuen differenziertenAnalysemöglichkeit von Materialeigenschaftensoll das geeignetste Material identifiziertund somit langfristig ein Fortschritt für dieBehandlungsmöglichkeiten von Knorpelschädengeneriert werden.ProjektpartnerLivImplant GmbHpolyMaterials AGLife Scienceswww.polymaterials.dePreSens Precision Sensing GmbHR&D Imaging Researchwww.presens.deDer Beschränkung der Sauerstoffversorgungsoll mit der Inkorporation sauerstofftragenderBestandteile in das Trägermaterial und somitmit der Erzeugung von Sauerstoff direkt imKonstrukt begegnet werden. Bisher konntebereits mit punktuellen Messungen eine43
Life Sciences/Prozess- undProduktionstechnikPatientenadaptierte Automatisierungder Herz-Lungen-MaschineAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungDeutsches Herzzentrum München desFreistaates BayernKlinik für Herz- und Gefäßchirurgie derTechnischen Universität MünchenLazarettstr. 3680636 MünchenLinks: schematisches Blockschaltbild der entwickelten Simulation, dargestellt sind das kardio-vaskuläreSystem, venöse und arterielle Kanüle, Herz-Lungen-Maschine; Mitte: Struktur und Aufbau des Controllersim Kontext HLM/Patient; rechts: Versuchsaufbau zur Regleroptimierung. Abgebildet sind das hydraulischeKreislaufmodell mit den regelbaren Gefäßwiderständen sowie die regelbare Zentrifugalpumpe;Fluss-und Druckmessung, Entwicklungsumgebung zur Erprobung verschiedener ControllerMobile Herz-Lungen-Maschinen (HLM) werden bislang ausschließlich durch geschultesPersonal bedient. Mit Hilfe einer automatisierten Steuerung der HLM soll eine sichereund patientenadaptierte Perfusion während einer hektischen Notfallsituation ermöglichtund das Notfallpersonal unterstützt werden.ProjektpartnerLifebridge Medizintechnik AGSorin Group Deutschland GmbHTechnische Universität MünchenInformatik 6, Roboticsand Embedded SystemsDie Versorgung und Aufrechterhaltung desBlutkreislaufs während eines akuten Herz-Kreislauf-Versagens kann durch neuartigemobile Herz-Lungen-Maschinen (HLM) gewährleistetwerden. Die derzeit verfügbarenGeräte werden ausschließlich durch geschultesPersonal/Kardiotechniker bedient. Sieüberwachen die Kreislaufsituation des Patientenund steuern entsprechend die HLM.Mit Hilfe einer automatisierten Steuerungder HLM soll eine sichere und patientenadaptiertePerfusion während einer hektischenNotfallsituation (Krankenwagen etc.) ermöglichtwerden. Im Rahmen des Forschungsprojektssollten die Grundlagen für eine patientenadaptierteAutomatisierung gelegt werden.Hierbei sollten sowohl geeignete Sensoren alsauch optimale Controller-Algorithmen entwickeltund erprobt werden.basierter Ansatz zur automatisierten Regelungentwickelt und in einer Simulation (computerbasiert,hydromechanisch) sowie im Großtierexperimentevaluiert. Ergebnis: Die Automatisierungder HLM ist mit dem entwickeltenRegel-Algorithmus realisierbar. Die eingesetzteSensorik zur Herz-Kreislauf-Überwachungarbeitete zuverlässig. Die entwickeltenStrategien zur Artefaktdetektion und -eliminationerwiesen sich als äußerst zuverlässigin der Simulation und im hydromechanischenModell. Im Tierexperiment konnte die erfolgreicheRegelung der HLM basierend auf Blutdruckund -fluss gezeigt werden.Das Projekt gliederte sich in zwei Schwerpunkte.Diese waren zum einen die Entwicklungeines geeigneten Controllermechanismusund zum anderen die Auswahlgeeigneter Sensoren sowie Filteralgorithmenzur Verarbeitung von Artefakten während desBetriebes. Es wurde ein Fuzzy-Controller-44
Echtzeit-Funktionsbilder des HerzensLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: funktionelle Herzbildgebung einer Arrhythmie mit Echtzeit-Bildgebung (rechts) und „Cine-MRT“(links); Aufgrund der Arrhythmie ist die klare Abgrenzbarkeit des Myokards gegenüber dem Blut in derCine-MRT nicht mehr gegeben; rechts: die neu entwickelte 32-Kanal-Spule mit flexiblem, sehr leichtemOber- und starrem Unterteil. Der Oberkörper des Patienten liegt dazwischenDie Echtzeit-Magnetresonanztomographie erlaubt eine schnelle und direkte Darstellungder Herzbewegung, die auch gegenüber Arrhythmien stabil bleibt.Klinikum der Universität MünchenInstitut für Klinische RadiologieMarchioninistraße 1581377 MünchenDie Magnetresonanztomografie (MRT) erlaubtnicht nur die bildliche Darstellung vonOrganen, sondern ermöglicht auch eine Funktionsanalyse,z. B. die Bestimmung des Pumpvolumensdes Herzens. Diese ist integrativerBestandteil der kardialen MR-Diagnostik undhat sich aufgrund ihrer Genauigkeit als Referenzstandardder Funktionsanalyse etabliert.Bisher verfügbare Techniken der sogenannten„Cine-MRT“ (Aufnahme von Teilbildernimmer zu gleichen Herzphasen, anschließendezusammengesetzte Rekonstruktion) erlaubenjedoch nicht die Echtzeitanalyse desHerzens bei gleichzeitig hoher räumlicherund zeitlicher Auflösung und erfordern deshalbAtemanhaltephasen. Dies ist bei Kindernund schwerkranken Patienten aber nur seltenmöglich. Bei Herzrhythmusstörungen führendiese Techniken zu einer ungenügendenBildqualität. Die Genauigkeit des Verfahrenshängt stark von der zeitlichen und räumlichenAuflösung und Bildqualität ab, welche indiesem Projekt im Hinblick auf die Echtzeit-Cine-MRT durch Hochfeld-MRT (3 Tesla) unddas Ausreizen von Beschleunigungstechnikenoptimiert wurden. Um den Signalverlustdurch die Beschleunigung weiter zu vermindern,war eine geometrisch und elektronischoptimierte Multielement-Empfangsspule (32Elemente) notwendig, die im Rahmen desProjekts aufgebaut wurde. Zudem wurde dieMesstechnik an Vielkanaltechnik und Echtzeitbildgebungangepasst.Das Projekt bestand aus folgenden Teilschritten:Identifizierung der optimalen Spulengeometriein Simulationen und Phantomaufbauten,Testaufbau einer 32-Element-Spule zuPhantom- und Probandenmessungen, Optimierungund Anpassung der Sequenztechnikenan den Spulenaufbau, Evaluierung derEchtzeittechniken mit patiententauglichemSpulenaufbau bei gesunden Probanden.Nach Abschluss des Projekts werden dieseTechniken auch an verschiedenen Patientenkollektivenuntersucht. Mit Hilfe dieser Verbesserungenkann durch die Echtzeit-Cine-MRT das Einsatzspektrum der Herz-MRTerweitert bzw. der Einsatz belastender Eingriffe,wie etwa die Narkose bei Kindern, unnötigwerden.ProjektpartnerRAPID Biomedizinische Geräte RAPIDBiomedical GmbHForschung und Entwicklungwww.rapidbiomed.de45
Life SciencesOptimierung akkommodativerKunstlinsenimplantateAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergInstitut für Medizinische PhysikAG Medizinische OptikHenkestr. 9191052 ErlangenLinks: Expansionseinheit zur Vermessung des Akkommodationsverhaltens der IOL-Prototypen imimplantierten Zustand in Schweineaugen; rechts: Designstudie zum Konzept „Akkommodation durchaxiale Verlagerung der IOL“ mit ringförmigem Haptikbereich und fünf Übergangsbereichen von derOptik in die HaptikNach der Implantation einer Intraokularlinse (IOL) im Rahmen einer Kataraktoperationsoll die Lesefähigkeit des Auges ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich sein. GrundlegendeUntersuchungen sollten Konzepte einer akkommodationsfähigen IOL liefern.Universität des SaarlandesExperimentelle OphthalmologieKirrberger Straße 10066424 HomburgProjektpartnerHumanOptics AGGeschäftsführungwww.humanoptics.comDie Fähigkeit des Auges zur Einstellung aufnahe Objekte (Akkommodation) reduziertsich im Alter und geht bei der Implantationvon Kunstlinsen im Rahmen einer Kataraktoperation(Grauer Star) vollständig verloren.Mit neuartigen Kunstlinsengeometrien ist esbereits gelungen die Akkommodationsfähigkeitteilweise, aber nicht vollkommen wiederherzustellen.Die Projektziele waren daher, eine wissenschaftlicheBasis zu schaffen für die Weiterentwicklungdes bestehenden Optik-Shift-Prinzips (axiale Verlagerung der IOL) und füreinen neuen Ansatz (Änderung der Optikgeometrie),beide bei Ziliarkörperkontraktion.Der Ziliarkörper ist Teil der mittleren Augenhaut,an dem die Linse aufgehängt ist. DasAuge soll sich wieder so anpassen können,dass die Lesefähigkeit ohne Lesehilfe möglichist, was neben einer Kosteneinsparungeinen großen Gewinn an Lebensqualität fürden Patienten bedeuten würde. Als Datenbasisfür die Entwicklung diente ein morphologisch,also in Struktur und Form funktionellesAugenmodell auf der Grundlage vonSchweineaugen. Die Akkommodation sowohldes phaken Auges, also eines Auges mitnatürlicher Linse, als auch des Auges nachImplantation verschiedener Kunstlinsenwurde mit diesem Modell nachgebildet undausgewertet. Darauf aufbauend wurde dasKonzept für akkommodative Kunstlinsenimplantateverbessert, charakteristische Kenngrößenfür das neue Konzept wurden abgeleitet,im Modell simuliert und präklinischexperimentell evaluiert.Der Workflow zur Entwicklung von IOL-Designsund die Umsetzung in akkommodationsfähigeFunktionsmuster konnte erfolgreichumgesetzt werden, sodass nun Grundlagenvorhanden sind, mit denen die Entwicklungoptimierter akkommodativer Intraokularlinsenbegonnen werden kann. Weiterhin wirdein Konzept favorisiert, das durch Neuentwicklungenim Bereich der Linsenmaterialienaußerhalb der Förderung durch die <strong>Bayerische</strong><strong>Forschungsstiftung</strong> zur Produktreifeweiterverfolgt werden soll.46
Muskeldystrophieforschungam Großtiermodell – DMDpigLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTEWild typedystrophinspectrinWTDMD mutantPIGDMDProjektleitungLinks: Vergleich eines gesunden, neun Wochen alten Ferkels (WT) mit einem muskelkranken DMDpig.Das DMDpig kann die Stufe aufgrund einer ausgeprägten Muskelschwäche nicht erklimmen;rechts: Immunfluoreszenzanalyse (Dystrophin-/Spektrinfärbung) von Muskelgewebe eines gesundenFerkels (WT: a+c) und eines DMDpig (b+d). Im Vergleich zum gesunden Kontrolltier ist beimDMDpig ebenso wie bei einem an Muskeldystrophie Duchenne erkrankten Patienten die Dystrophinfärbungnegativ. Besonders zu erwähnen sind analog zum Duchenne-Patienten die auffälligenFaserkalibervariationen beim DMDpigLudwig-Maximilians-UniversitätFriedrich-Baur-InstitutZiemssenstraße 1a80336 MünchenFür die kausale Therapie von Muskeldystrophien wurden in den letzten Jahren entscheidendeFortschritte erzielt. Der Transfer präklinisch validierter Behandlungen in die klinischeEntwicklung ist jedoch aufwendig und teuer und nur für wenige Therapieansätze möglich.ProjektpartnerDie weltweit häufigste erblich bedingteMuskelerkrankung beim Menschen ist dieDuchenne - Muskeldystrophie (DMD). DMDbeginnt im Vorschulalter und führt zu langsamer,aber unweigerlich fortschreitenderDegeneration von Skelett, Herz- und Atemmuskulatur.Die Betroffenen erleiden einenzunehmendem Kraftverlust, Lähmungen undschwere Behinderung. Ihre Lebenserwartungverringert sich deutlich – mit enormen vorherigenEinbußen ihrer Lebensqualität und derihrer Familien.eines Großtierschweinemodells. Das Muskeldystrophieschwein– DMDpig – stellt einweltweit einmaliges, innovatives Modelltierdar. Mit seiner Hilfe ist die Erprobung neuerTherapieansätze und Wirksubstanzen für diebisher unheilbaren Muskeldystrophieerkrankungenvorangetrieben worden.Ludwig-Maximilians-Universität MünchenLehrstuhl für Molekulare Tierzuchtund Biotechnologiewww.lmb.uni-muenchen.deMinitüb GmbHwww.minitube.deDMD ist eine Modellerkrankung für die großeZahl weiterer, genetisch und klinisch heterogenerdegenerativer Erkrankungen derMuskulatur. Machbarkeit und Wirksamkeitder entwickelten Therapieansätze müssenzunächst im Tiermodell überprüft werden.Offene Fragen, die nicht oder nur ansatzweiseim Mausmodell gelöst werden können, betreffenvor allem die systemische Anwendung derTherapeutika, Wechselwirkungen mit demImmunsystem und Verträglichkeit. Gegenstanddieses Projekts war die GenerierungSIRION BIOTECH GmbHwww.sirion-biotech.deMWM Biomodels GmbH47
Life SciencesOptimierung der ProthesenschaftkonstruktionAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungTechnische Universität MünchenKlinikum rechts der IsarKlinik und Poliklinik für PlastischeChirurgie und HandchirurgieIsmaninger Str. 2281675 MünchenLinks: Segmentierungen der internen Anatomie des Oberschenkelstumpfes eines Beinamputierten,Beckenknochen und residualer Knochen, Muskulatur und das darüber liegende Weichgewebe;rechts: Visualisierung von SimulationenDie Herstellung von Prothesenschäften für Beinamputierte ist heutzutage ein manuellgeprägter Prozess, der stark vom individuellen Können der Orthopädietechniker abhängt.Das Projekt versuchte, diese manuelle Herstellung von Prothesen durch einecomputergestützte Prothesenversorgung zu verbessern.ProjektpartnerCADFEM GmbHCADFEM Medicalwww.cadfem.deF. Gottinger Orthopädie-Technik GmbHForschung und Entwicklungwww.gottinger.deMaterialise GmbHwww.materialise.comIm Rahmen des Projekts sollte unter Berücksichtigungder patientenspezifischen Materialeigenschaftendes Gewebes am Amputationsstumpfund unter Zuhilfenahme modernerbildgebender Verfahren und computerunterstützterTechnologien die Formanpassungder Prothesen optimiert werden. Dazu wurdeeine Anpassung von bisher nur industriell genutzterSoftware aus dem Ingenieurbereichauf die speziellen Anforderungen bei der Planungvon Prothesenschäften für beinamputiertePatienten vorgenommen.Die Erstellung von Simulationsmodellen ausMRT-Aufnahmen und die Simulation der mechanischenBelastungen wurden zu einemstringenten Arbeitsablauf zusammengefasst,um eine Integration in die alltägliche Patientenversorgungzu ermöglichen. Hierbei bietetdie Simulation Vorteile gegenüber konventionellenFertigungsverfahren. Die Planung desProthesenschaftes kann nach objektiven undreproduzierbaren Kriterien erfolgen und dieQualität der Patientenversorgung hängt nichtmehr allein von den Erfahrungen des Orthopädietechnikersab.Im Projektverlauf wurden mittels der beschriebenencomputergestützten VerfahrenProthesen entwickelt, die eine für die jeweiligenbesonderen anatomischen Gegebenheitender Patienten optimale Druckverteilungaufwiesen.Hierzu wurde der komplette Arbeitsablauf ineinen automatisierten Prozess integriert, deres ermöglicht, eine Vielzahl von unterschiedlichenProthesenformen am Rechner virtuellzu beurteilen, ohne sie tatsächlich zur Probeanfertigen zu müssen. Bei dem abschließendenSchritt der Validierung der Simulationsergebnissezeigte sich eine gute Übereinstimmungdieser Ergebnisse sowohl mit denDruckmessungen im Schaft als auch mit densubjektiven Empfindungen der Patienten.48
MR-kompatible Hochenergie-ElektrodenLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTEKatheter für die flüssigkeitsgekühlte Hochfrequenzablation von ArrhythmienProjektleitungSpezielle Elektroden und Katheter sind mit der Magnetresonanztomographie (MRT) kompa-tibel und verbessern die Therapie von Herzrhythmusstörungen und Herzmuskelschwäche.Medizinische Klinik und Poliklinik Ider Universität WürzburgSchwerpunktsleiter Kardiale MRTund Klinische ElektrophysiologieOberdürrbacher Straße 697080 WürzburgDie Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglichtes, eine Vielzahl von Informationenmit nur einer Bildgebungstechnik zu gewinnen.Allerdings können zahlreiche technischeGeräte im MRT nicht verwendet werden.Hierzu gehören auch Elektroden für implantierbareDefibrillatoren (ICDs) oder Herzkatheter,die zur Behandlung von schnellenHerzrhythmusstörungen eingesetzt werden.Ziel der Projektarbeit war es, Hochenergieelektrodenzu entwickeln, die im MRTverwendet werden können. Damit soll Patientenmit schnellen Herzrhythmusstörungendie gefahrlose Diagnostik undTherapie im MRT ermöglicht werden.Die Projektarbeit umfasste eine intensiveGrundlagenforschung zur genauen Charakterisierungder Wechselwirkungen zwischenHochenergieelektroden und dem MRT undverschiedene Modifikationen an den medizintechnischenGeräten und der Bildgebungstechnik.Sofern sich die Neuentwicklungenbewährten, wurde die einwandfreie Funktionim nächsten Schritt im Großtierversuch validiert,bevor schließlich die ersten klinischenAnwendungen ermöglicht werden konnten.Im Rahmen der dreijährigen Projektarbeitkonnten zahlreiche Neuentwicklungendazu beitragen, einen Großteil der eingangsgeschilderten Probleme zu beheben. Aufgrundder entscheidenden Fortschritte aufdiesem Gebiet konnte das weltweit erste MRkompatibleICD-System entwickelt werden.Als weiteres Hauptergebnis konnte zudem einSetup entwickelt werden, das unter Beteiligungvon MR-kompatiblen Herzkathetern dieDurchführung von invasiven elektrophysiologischenHerzkatheteruntersuchungen undAblationen unter MRT-Kontrolle ermöglicht.Auch diese entscheidende Weiterentwicklungkonnte mittlerweile klinisch eingesetztwerden, wobei im Rahmen der Projektarbeiterstmalig schnelle Herzrhythmusstörungenvon Patienten unter MRT-Echtzeit-Bildgebungdauerhaft verödet werden konnten.ProjektpartnerBIOTRONIK SE & Co. KGCenter for Clinical Research andScientific Studieswww.biotronik.comMRB Forschungszentrum für Magnet-Resonanz-Bayern e.V.www.mr-bavaria.de49
Life SciencesOsteoporoseprophylaxe mitpflanzlichen WirkstoffenAbgeschlossene PROJEKTETermini = Freie Enden der StrutsNodi = Verbindung zwischen 3 oder mehr StrutsVerbindung zwischen weniger als 3 StrutsStrut = linearer TrabekelstrangAuszählung ca. 300 µm unterhalb der EpiphyseProjektleitungBestimmung des trabekulären Vernetzungsgrades aus Gewebeschnitten der Methaphyse der Tibia ausRatten durch die computergestützte STRUT-AnalyseBIONORICA AGThe phytoneering companyKerschensteinerstraße 11–1592318 NeumarktZielsetzung des Projekts war, die knochenprotektive Wirkung der Cimicifuga racemosa(Traubensilberkerze, BNO 1055) durch präparative Verfahren anzureichern und bestimmtenSubstanzgruppen zuzuordnen sowie Hinweise auf Wirkmechanismen zu generieren.ProjektpartnerUniversität WürzburgOrthopädisches Zentrum fürMuskuloskelettale Forschungwww.orthopaedie.uni-wuerzburg.de,www.mcw.medizin.uni-wuerzburg.deCimicifuga racemosa (Traubensilberkerze,BNO 1055) wird bereits in einem zugelassenenArzneimittel zur Therapie klimakterischer Beschwerdeneingesetzt. Auf Basis vorhandenerVorarbeiten war es naheliegend zu prüfen,ob Cimicifuga racemosa auch den Knochenverlustverhindern kann. Immerhin leiden inDeutschland etwa 8 Mio. und weltweit etwa200 Mio. Menschen unter Osteoporose.Zielsetzung des Projekts war, die knochenprotektiveWirkung von BNO 1055 durch präparativeVerfahren anzureichern, bestimmtenSubstanzgruppen zuzuordnen und Hinweiseauf Wirkmechanismen zu generieren. Durchein neu entwickeltes chromatographischesTrennverfahren und eine speziell adaptierteAnalytik konnten den universitären Partnernzur zellbiologischen und pharmakologischenPrüfung reproduzierbare, charakterisierteExtraktfraktionen zur Verfügung gestelltwerden. Die In-vivo-Testung wurde an ovarektomiertenRatten durchgeführt, die aufgrunddes Östrogenmangels eine Osteoporose imSchienbeinknochen entwickeln. Der Einflussvon BNO 1055 und seinen Extraktfraktionenauf die Knochendichte und -strukturwurde durch qCT und histomorphometrisch(STRUT-Analyse) bestimmt. In vitro wurdendie Hemmung der Adipogenese und Stimulationder Osteogenese nachgewiesen.Es konnte gezeigt werden, dass der Spezialextrakttatsächlich osteoprotektiv wirkt unddass diese Wirkung vor allem in SaponinhaltigenTochter- und Enkelfraktionen angereichertist. Aus der Kombination der In-vivoundIn-vitro-Untersuchungsergebnisse kanngeschlossen werden, dass diese Fraktionendas Potenzial haben, durch einen DifferenzierungsshiftStammzellen für die Osteogenesezu rekrutieren und Adipogenese, möglicherweiseauch degenerative Verfettung, zu vermindern.50
KAPNOS: Entwicklung einesCO 2-Sensors für die NotfallmedizinLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTE108c(CO 2 ) / %64Ausatmung2a) b)0Einatmung0 10 20 30 40 50 60t / sProjektleitungLinks: Sensor im Versuchstubus eingebaut, a) Kompletter Tubus mit eingebautem Sensor, b) Durchsichtdurch den Tubus mit eingebautem Sensor parallel zur Strömungsrichtung; rechts: mit dem Sensorgemessene CO 2-Konzentration während mehrerer Ein- und Ausatemzyklen einer TestpersonEin kostengünstiger, schneller CO 2-Sensor für die Kapnometrie soll die Risiken in derNotfallmedizin beim Beatmen verringern.Universität BayreuthLehrstuhl für FunktionsmaterialienUniversitätsstraße 3095447 BayreuthZur Erstversorgung eines Notfallpatientengehört die künstliche Beatmung. Wenn derNotarzt eine Intubation durchführt, wirdein Kunststofftubus in die Luftröhre eingeführt,über den der Patient mit Sauerstoffversorgt wird. Es besteht jedoch dieGefahr, dass der Tubus fälschlicherweise indie Speiseröhre eingebracht wird oder dasser sich während der Beatmung verschiebt.Um die korrekte Lage des Tubus zu erkennen,ist seit Kurzem vorgeschrieben, einKapnometer, das die CO 2-Konzentration derAusatemluft des Patienten erfasst, zu verwenden.Kennt man diese, lässt sich eineFehlintubation in die Speiseröhre erkennen.stark schwankenden Strömungsgeschwindigkeiten,wie sie beim Wechsel zwischen EinundAusatmen auftreten, auf seiner Arbeitstemperaturzu halten. Dazu und um einenniedrigen Leistungsverbrauch und eine homogeneTemperaturverteilung zu erreichen,wurden FEM-Simulationen eingesetzt.Der Sensor kann so kostengünstig gefertigtwerden, dass er als Einwegsensor eingesetztwerden kann. Die Sensoren wurden abschließendauch von Probanden getestet. Diezeitliche Abhängigkeit der zu erwartendenCO 2-Konzentrationen wurde korrekt wiedergegeben.ProjektpartnerCorscience GmbH & Co. KGwww.corscience.deSiegert electronic GmbHEntwicklungwww.siegert.deGegenstand des Projekts war es, einen äußerstkleinen und schnellen CO 2-Sensor darzustellen,der im Gegensatz zu existierendeninfrarotbasierten Nebenstromverfahren direktim Vollstrom in den Tubus eingebaut werdenkann. Der potentiometrische Sensor basiertauf dem ionenleitenden Werkstoff Nasiconund wird komplett in planarer Dickschichttechnikgefertigt. Der Sensor ist auf CO 2selektivund reagiert auch nicht auf Änderungenim O 2-Gehalt. Neben der reproduzierbarenHerstellung des Sensors lag ein Hauptaugenmerkdes Projekts darin, den Sensor auch bei51
Life SciencesElektromagnetische Stimulation humanerStammzellen im BioreaktorAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungHelmholtz-Spule mit Antrieb für Mikrogravitations-BioreaktorNeue Magnetodyn GmbHAugustenstr. 4180333 MünchenIm Projekt wurde der Einfluss definierter niederfrequenter elektromagnetischer Wechselfelderauf die chondrogene Differenzierung humaner mesenchymaler Stammzellen unterkombinierter Anwendung von Wachstumsfaktoren und Mikrogravitation untersucht.ProjektpartnerLudwig-Maximilians-Universität MünchenOrthopädische Klinik und Poliklinikhttp://ortho.klinikum.uni-muenchen.deDazu wurde ein experimentelles Setup zurKultivierung von Zellen unter simulierterMikrogravitation und gleichzeitiger Stimulationdurch niederfrequente elektromagnetischeWechselfelder (NF-EMF) entwickelt;anschließend wurden mit dem Setup In-vitro-Untersuchungen vorgenommen. WichtigsteGrundlage für die Differenzierung bleibt derWachstumsfaktor, wie aus dem fehlendenNachweis knorpelspezifischer Marker bei denwachstumsfaktorfreien Kulturen hervorgeht.Der Einsatz der simulierten Mikrogravitationin einem Bioreaktor bringt für die chondrogeneDifferenzierung keinen Vorteil,sondern führt zu einer reduzierten Kollagen-II-Synthese.Das EMF bewirkt eine Reversiondes Mikrogravitationseffektes undkann die Abnahme der Kollagen-II-Synthesemindern, führt aber bei einer unbeeinflusstenKollagensynthese zu keiner signifikantenZunahme. Allerdings zeigt sich einpositiver Effekt des Magnetfeldes auf denKollagen-II-/Kollagen-X-Quotienten, sodassdie chondrogene Differenzierung von derEMF-Stimulation profitiert. Zusammenfassendlässt sich sagen, dass eine Stimulationdurch elektromagnetische Felder in chondrogendifferenzierten Stammzellen unteroptimalen Bedingungen keine zusätzlichenpositiven Effekte aufweist. Kommt es jedoch zueiner Verschlechterung der chondrogenen Situation,wie hier durch den Bioreaktor und diesimulierte Mikrogravitation, führt der Einsatzelektromagnetischer Felder erneut zu einerSteigerung des chondrogenen Potenzials.Da im klinischen Einsatz häufig suboptimaleBedingungen vorliegen, könnten elektromagnetischeFelder somit durchaus zu einerVerbesserung der Chondrogenität von Zellenbeitragen. Von einem klinischen Einsatzder Mikrogravitation im Bereich der chondrogenenDifferenzierung wird nach vorliegenderDatenlage abgeraten.52
Patch-clamp-Verfahren fürintrazelluläre IonenkanäleLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTEext.chipint.VerstärkerLinks: das planare Patch-Clamp-Setup; rechts: Schema des planaren Glaschips mit LysosomProjektleitungZiel des Forschungsvorhabens war es, ein neues Standardverfahren zu entwickeln,das den Zugang zu dem breiten Feld der intrazellulären Ionenkanäle eröffnet.Ludwig-Maximilians-Universität MünchenMolekulare Pharmakologie,Department Pharmazie-Zentrumfür Pharmaforschungwww.pharmacology.cup.uni-muenchen.de/prof_wahl/index.htmlIonenkanäle in intrazellulären Organellensind essenziell für zahlreiche physiologischeProzesse. Sie steuern beispielsweise die Muskelkontraktionsowie die Sekretion von Hormonenund Neurotransmittern. Daneben sinddiese Kanäle für die Entstehung genetischerErkrankungen wie Epilepsien und Herzrhythmusstörungenund als Drug-Targets vongroßer klinischer Relevanz. Bisher stehen fürdie Analyse von intrazellulären Ionenkanälenkeine Routine-Methoden zur Verfügung, dieeine effiziente Analyse im Rahmen von Arzneistoffentwicklungund Forschung ermöglicht.Ziel des Projekts war es daher, ein neues Standardverfahrenzu entwickeln, das den Zugangzu dem breiten Feld der intrazellulären Ionenkanäleeröffnet.empfindlichen Organellen verhindert. Imzweiten Jahr der Förderung wurde das Verfahrenweiterentwickelt und so weit optimiert,dass Ionenströme in weiteren intrazellulärenOrganellen wie Mitochondrien charakterisiertwerden können. Schließlich ist es gelungen,Ionenströme in Bakterien zu untersuchen. Ergebnis:Mit dieser Technologie gelang es, Ionenflüssein intakten Lysosomen, Mitochondrienund Bakterien direkt zu messen.ProjektpartnerNanion Technologies GmbHGabrielenstr. 980636 Münchenwww.nanion.deIm ersten Jahr der Förderung lag der Fokusauf speziellen intrazellulären Organellen, denLysosomen. Das Grundprinzip der Methodebesteht darin, biochemisch isolierte Lysosomenauf einer Festphasenmatrix, einemspeziell entwickelten und optimierten planarenGlaschip, zu immobilisieren. Der Glaschipenthält eine Öffnung, die durch ihre spezielleAusformung die Lysosomen bei elektrophysiologischenExperimenten mechanischstabilisiert und damit das Zerreißen dieser53
Life SciencesAerosoltherapie der oberen Atemwegeund NasennebenhöhlenAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungHelmholtz Zentrum München -Deutsches Forschungszentrum fürGesundheit und UmweltInstitut für Lungenbiologie (iLBD)www.helmholtz-muenchen.deLinks: CT-Bild eines CRS-Patienten vor der Operation. Die Schleimhäute in den Kieferhöhlen undden Siebbeinzellen sind entzündet; rechts: CT-Bild überlagert mit Gammakamerabild nach Applikationvon radioaktiv markiertem Pulsationsaerosol. Die Deposition von Aktivität in denKieferhöhlen ist deutlich erkennbarChronische Rhinosinusitis (CRS) ist eine häufige chronische Erkrankung, die bei etwa5 bis 15 % der Bevölkerung auftritt. Da die entzündeten Nasennebenhöhlen (NNH) nurschwer mit Medikamenten erreicht werden können, scheitern häufig konservativeTherapien und es kommt zu chirurgischen Eingriffen.ProjektpartnerPARI Pharma GmbHBU Pharmawww.paripharma.comDie NNH sind nicht aktiv belüftete Hohlräumeim oberen Atemwegstrakt und daher fürtopische Medikamente wie Nasenspraysund -tropfen kaum zu erreichen. Um einenAerosoltransport in die NNH zu ermöglichen,müssen diese durch zusätzliche Flussbzw.Druckschwankungen belüftet werden.Dies wird durch die sog. Pulsationsaerosoleermöglicht, wie in einer früheren Studiedes Helmholtz Zentrum München an gesundenProbanden gezeigt wurde. Allerdings warnicht klar, in welchem Umfang CRS-Patientenvon diesem Verfahren profitieren können, dasie z. T. starke Entzündungen und Obstruktionenim Nasenraum aufweisen.Deshalb wurden im Rahmen dieses Projekts20 CRS-Patienten, die unmittelbarvor einer Operation standen, eingeschlossen.Je Patient wurden mindestens zweiAerosolanwendungen durchgeführt: vorder OP und zwei bis drei Monate danach.Hierzu wurden nuklearmedizinische Aerosol-Depositionsstudienmit 99mTc-DTPAdurchgeführt. Die Gammakamera-Bilder wurdenmit CT- oder MRT-Aufnahmen überlagertund die deponierte Aktivität in den Nasennebenhöhlenund verschiedenen Arealen derNase bestimmt. Bei den CRS-Patienten betrugdie nasale Deposition 58.3+/-13.5 % vor OPsowie 45.4+/-16.7 % 140 Tage nach OP.Die anteilige Deposition in den NNH betrug4.4+/-3.3 % vor und 5.0+/-2.7 % nach OP.Damit konnte erstmalig gezeigt werden, dasses bei operierten CRS-Patienten mit vergleichbarerEffizienz wie bei gesunden Probandenmöglich ist, Aerosol in den NNH zudeponieren. Interessanterweise konnte einesignifikante Aerosoldeposition auch vor demoperativen Eingriff gezeigt werden, wennauch in geringerem Umfang als nach derOP. Damit könnte diese neue Technologie alsletzte therapeutische Option vor einem operativenEingriff sowie zur medikamentösenNachbehandlung in Frage kommen.54
Lichttechnologien für alters- unddemenzgerechte AkutkrankenhäuserLife SciencesAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Ortstermin, Patientenzimmer Klinikum rechts der Isar;rechts: Einbau der Leuchte im Klinikum BambergTechnische Universität MünchenFakultät Architektur LS Baukonstruktionund Baustoffkunde (EBB)Das Projekt ist Modul 1 des Forschungsvorhabens „Nebendiagnose Demenz im Akutkrankenhaus– Einsatzpotenziale innovativer Licht-, Kommunikations- und Planungstechnologienfür eine alters- und demenzsensible Architektur“.www.dietz-hcf.deBis zu 60 % aller Patienten in bayerischenAkutkrankenhäusern sind heute über 65 Jahrealt, mit steigender Tendenz. Ein beständigwachsender Anteil dieser Akutpatienten zeigtdemenzielle Veränderungen. Bisher sind dieAkutkrankenhäuser kaum auf die Bedürfnissedemenzkranker Patienten eingestellt. Nebenihrer Organisationsstruktur und Personalentwicklungist das Milieu und damit die Architekturzu überprüfen.Sturzereignisse und Rückgang der Verweildauer,allerdings bei etwas veränderten Rahmenbedingungenim Verlauf der Untersuchung.Von der Pflegedienstleitung wurdeeine besonders hohe Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheitfestgestellt.Weitere Untersuchungen zu möglichen Hilfestellungenfür kognitiv eingeschränkte Patientenfolgen.Phase I/II: Entwickeln und Überprüfen geeignetercircadianer Lichtbausteine für den Einsatzim Akutkrankenhaus.Ergebnis: Helleres Licht kann – bei gleicherAufenthaltsdauer im Raum – zu einer reduziertenTagschlafzeit und damit zur Stabilisierungdes Tag-Nacht-Rhythmus beitragen.Trotz teilweise kritischer Haltung gegenüberder Belichtung gaben die Patienten im Durchschnittein besseres subjektives Befinden an.Phase III/IV: Einbau der entwickelten Leuchtemit weiteren Komponenten im Klinikum amBruderwald, Bamberg.Ergebnis: Die quantitativen und qualitativenParameter zeigten im 10-Wochen-Vergleicheine positive Tendenz: Rückgang der55
MaterialwissenschaftDiamant auf Stahl für technische AnwendungenAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergZentralinstitut für Neue Materialienund Prozesstechnik (ZMP)Dr. Mack Straße 8190762 FürthProjektpartnerCemeCon AGwww.cemecon.deDiehl Metall Stiftung & Co. KGwww.diehlmetall.deElma Hans Schmidbauer GmbH & Co. KGwww.elma-ultrasonic.comScherdel Innotec Forschungs- undEntwicklungs-GmbHSchaeffler Technologies AG & Co. KGwww.schaeffler.comOtto Haas KGwww.haas.deKSB Aktiengesellschaftwww.ksb.comKennametal Technologies GmbHwww.kennametal.comHerold & Co. GmbHwww.herold-gefrees.deLehrstuhl für Chemische ReaktionstechnikFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnbergwww.crt.cbi.uni-erlangen.deLinks: Focus-Ion-Beam-Querschnitt des Stahl-Zwischenschicht-Diamant-Verbundes mit einer ca. 1,5 µmdicken Diamantschicht. Mit dieser Zwischenschicht konnten haftfeste Diamantschichten bis zu 10 µmDicke realisiert werden; rechts: diamantbeschichtetes Stahlinsert eines Aluminiumdruckgusswerkzeuges(oben) und Vergleich des mit Diamant (unten links) und Standardwerkzeug (unten rechts) hergestelltenAluminiumdruckgussbauteilsDie Abscheidung kristalliner Diamantschichten auf Stählen ist bereits seit vielenJahren ein weltweiter Forschungsschwerpunkt bei der Entwicklung von neuartigenHochleistungsbeschichtungen. Jetzt gelang der Universität Erlangen-Nürnberg erstmalsder Übertrag der erfolgreichen Laborergebnisse auf industrielle Bauteile.Die direkte Abscheidung kristalliner CVD-Diamantschichtenauf Stahl ist aufgrund des me-zum Stahlwerkzeug und verhindert damitallem die Adhäsion der Aluminiumschmelzetastabilen Charakters des Eisenkarbids unter die Stahlauflösung und Rissbildung. Sowohlden für die Abscheidung vorherrschenden Stahlkerne als auch Stahlinserts für den Aluminiumdruckgusswurden mit Zwischen- undProzessparametern nicht durchführbar. Umdiese Problematik zu lösen, wurde eine neuartigeCVD-Hochtemperaturzwischenschicht Neben der deutlichen Standzeiterhöhung derDiamantschicht beschichtet und getestet.auf Titannitridbasis mit Bordotierung entwickelt.Die in-situ oberflächenstrukturierte auch die Oberflächenqualität der hergestell-Werkzeuge verbessert die DiamantschichtZwischenschicht dient als Haftvermittlerschichtzwischen dem Stahlsubstrat und der tungsschritte einspart.ten Aluminiumbauteile, was Nachbearbei-Diamantschicht. Dies ermöglicht eine haftfesteAbscheidung von bis zu 10 µm dickenDiamantschichten auf unterschiedlichen austenitisch-ferritischumwandelnden Stählenbei Substrattemperaturen zwischen 780 °Cund 920 °C (je nach Stahlsorte). Abhängig vonden Legierungselementen im Stahl lässt sichzusätzlich eine In-situ-Härtung des Stahleswährend des Abkühlprozesses einstellen.Die im Labormaßstab gewonnenen Ergebnissekonnten anschließend erfolgreich auf große3-dimensionale Bauteile wie z. B. Stahlinsertsfür den Aluminiumdruckguss mit einemGewicht von ca. 1 kg übertragen werden.Die Diamantschicht unterbindet hierbei vor56
Sichere Sportgeräte aus CFKMaterialwissenschaftAbgeschlossene PROJEKTELinks: Impacttest, Ermüdungstest; rechts: Schäden durch Impact- und ErmüdungstestsProjektleitungBei Sportgeräten kommen aufgrund der guten gewichtsspezifischen Eigenschaftenvermehrt Faserverbundwerkstoffe zum Einsatz. Aufgrund des spröden und komplexenVersagensverhaltens ist allerdings eine ausreichende Betriebssicherheit zu beachten.Geeignete Maßnahmen hierzu waren Schwerpunkt des Projekts.Technische Universität MünchenFachgebiet Sportgeräte und -materialienBoltzmannstraße 1585747 MünchenDas Ziel des Projekts war es, eine Möglichkeitzu finden, die Betriebssicherheit vonSportgeräten zu erhöhen. Da die Firmenstrukturdieser Industriesparte durch kleineund mittelständische Unternehmen geprägtist, sollten die definierten Maßnahmen einfachund effizient umzusetzen sein. Zur Erreichungdieser Ziele wurden drei wesentlichePunkte betrachtet: In der Konstruktion undEntwicklung sollten geeignete Maßnahmenentwickelt werden, um das Dauerfestigkeitsverhaltenberücksichtigen zu können. Dazuwurden speziell vereinfachte Modelle für dieAuslegung betrachtet. Parallel dazu wurde derEinfluss von Schädigungen, und hier speziellvon Impactschädigungen, auf die Strukturuntersucht. Dabei wurde besonderes Augenmerkauf stark gekrümmte Strukturen gelegt,die für diesen Industriezweig charakteristischsind, bisher aber kaum Beachtung fanden.Der dritte Aspekt betraf das zerstörungsfreieund möglichst einfache Auffinden von Fehlstellen.Da aktuell auf dem Markt befindlicheSysteme sehr kostenintensiv, die Prüfvorgängeaufwendig und die Ergebnisse schwierigzu interpretieren sind, wurde ein geeignetesSystem entwickelt und untersucht, das eineeinfache erste Schadensbewertung ermöglicht.Die Ergebnisse des Projekts zeigten,dass großes Potenzial für die betriebssichereAuslegung von Sportgeräten vorhanden ist. Eskonnten wesentliche Erkenntnisse im Bereichder Bauteilauslegung, der Schädigungen bzw.Schädigungsmechanismen, aber auch im Bereichder zerstörungsfreien Prüfung und derSchadensbewertung erlangt werden.ProjektpartnerCUBE BikesPending System GmbH & Co. KGwww.cube.euModell- und Formenbau Blasius GERGGmbHwww.gerggroup.comTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Leichtbauwww.llb.mw.tum.deVISPIRON AGwww.vispiron.de57
MaterialwissenschaftLängere Lebensdauer hochbelasteter RaketenbauteileAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Schnitt durch eine Vulcain-Brennkammer (Ariane 5);rechts: Kühlkanal mit typischem Schadensbild in Heißgaswand (Schliffbild und Simulation)Astrium GmbHLudwig-Bölkow-Allee81663 MünchenDie Lebensdauer einer Raketenschubkammer ist aufgrund ihrer enormen Belastungdurch Hitze und Druck schwer vorherzusagen. Ein neues Simulationsmodell verbessertdie Beschreibung der Lebensdauer und senkt damit Entwicklungskosten.ProjektpartnerWW1 - Allgemeine WerkstoffeigenschaftenFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergKayser-Threde GmbHwww.kayser-threde.deDer Bedarf an weltweiter Kommunikationwächst – und somit auch an leistungsfähigen,zuverlässigen Raketenantrieben zum Satelliten-Transport.Die wichtigsten Herausforderungensind dabei die Reduktion der Entwicklungskostenund eine erhöhte Zuverlässigkeitdes Systems. Bei der Raketenschubkammerentwicklunggehört die Lebensdauer derBrennkammer zu den wichtigsten Anforderungen.Diese ist durch die Lebensdauer derHeißgaswand begrenzt, deren Vorhersageaufgrund der extremen Anforderungen eineder größten Herausforderungen darstellt. ImRahmen dieses Projekts wurde eine verbesserteMethode zur Lebensdauervorhersageentwickelt und im Zusammenspiel mit anderenRechenmodellen beispielhaft angewandtund validiert.Das Vorhaben hatte folgende Ziele:1. Verbesserung der Methoden zur Lebensdauervorhersagevon thermomechanischhoch belasteten Bauteilen am Beispiel Raketenbrennkammer.Durch die Entwicklungeiner allgemeinen Methode wurde angewandteGrundlagenforschung betrieben, undes wurden Rechenverfahren bereitgestellt.2. Funktionelle Demonstration eines fortschrittlichenMessverfahrens.Das entwickelte Lebensdauermodell basiertauf einer möglichst präzisen Beschreibungdes Werkstoffverhaltens. Es bedient sich derSchädigungsmechanik und steht in Formeines Finite-Elemente-Codes zur Anwendungfür beliebige Geometrien und Lastkombinationenzur Verfügung. Es wurde über faseroptischeMesstechnik und TMF-Tests (ThermoMechanical Fatigue) validiert. Diese TMF-Tests repräsentieren brennkammerähnlicheVerhältnisse und liefern Validierungsdatenbis zur Rissbildung, während mit faseroptischerMesstechnik Spannungen und Temperaturenim TMF-Panel gemessen werden.Mit dem allgemein entwickelten Modellansatzfür die Vorhersage der Lebensdauer steht imVerbund mit dem vertieften Verständnis desMaterialschadenverhaltens sowie mit verbessertenAnsätzen der Temperaturberechnungein grundlegend neues Werkzeug zur Verfügung.Insbesondere bildet es erstmals dentypischen Schadensfall (siehe Abbildungoben) in Raketenbrennkammern realistisch ab.58
Leiter und Kontaktierung zukünftigerElektrofahrzeug-BordnetzeMaterialwissenschaft/Prozess- undProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Explosionsdarstellung der LEIKO-Steckverbindung;rechts: Aufbau des Langzeitversuchs mit 20 PrüflingsverbindungenIm Kooperationsprojekt LEIKO wurden die Grundlagen für einen durchgängigen Einsatz vonAluminium statt Kupfer in Hochvolt-Bordnetzen zukünftiger Elektrofahrzeuge untersucht.Technische Universität MünchenLehrstuhl für ProduktentwicklungBoltzmannstr. 1585748 MünchenIn konventionellen Kraft- und aktuellen Hybridfahrzeugenwerden Bordnetze auf Kupferbasisverbaut. Aluminium stellt ein potenziellesSubstitutionsmaterial dar, um Kosten und Gewichtzu reduzieren. Vor einem Praxiseinsatzsind allerdings noch Fragen der Verbindungstechnikzu klären und das Langzeitverhaltender Verbindungen abzusichern. Im KooperationsprojektLEIKO wurden Untersuchungenfür innovative Aluminiumhochvoltbordnetzefür elektrifizierte Fahrzeuge durchgeführt.Das Langzeitverhalten der LEIKO-Klemmverbindungwurde sowohl in einem allgemeinenLangzeitversuch mit Dauerbelastung als auchin Versuchen zur gezielten Abklärung einzelnerAlterungsmechanismen, z. B. der Elektromigrationund der Reibkorrosion, durchgeführt.In keinem Versuch wurde dabei einemessbare Beeinträchtigung für den Einsatz inElektrofahrzeugen festgestellt.Es wurden Verfahren untersucht, die ineine Prozesskette zur wirtschaftlichen Herstellungder Kontakte überführt werdenkönnen. Die Herstellung von Kontaktelementenaus Aluminium-Strangpressprofilenstellt hierbei einen neuartigen Ansatzdar. Bezüglich der Verbindungstechnik zwischenKabel und Kontaktelement wurdenzwei Schweißverfahren untersucht, die sichfür weiterführende Untersuchungen eignen.Aus konstruktiver Sicht galt es, automobilspezifischeAnforderungen umzusetzen.Adressiert wurden die Bereiche Verriegelung,Berührschutz sowie elektromagnetischeSchirmung. Ziel war die Definition eines modularenDesigns, das die Entwicklung einesBaukastens für die geforderten Steckervariantenunterstützt.ProjektpartnerBMW AGEG-51Nexans autoelectric GmbHVorentwicklungwww.autoelectric.deOtto Dunkel GmbHF&ELehrstuhl für Umformtechnikund GießereiwesenTechnische Universität MünchenLehrstuhl für HochspannungsundAnlagentechnikTechnische Universität Münchenwww.hsa.ei.tum.de59
MechatronikFAIR: Fahrwerks-/Antriebs-Integration ins RadAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Fahrzeugunteransicht mit konventioneller Achse;rechts: erster Fahrzeugprototyp mit FAIR-Achse und E-SpeicherBMW Forschung und Technik GmbHHanauerstraße 4680788 MünchenElektroautos erfordern ganz neue Fahrzeugkonzeptionen, die sich aus bisherigenStrukturen nur bedingt ableiten lassen. Kernfrage: Lassen sich Antriebe und Fahrwerkskomponentensinnvoll ins Rad integrieren?ProjektpartnerDeutsches Zentrum für LuftundRaumfahrt e. V. DLRInstitut für Robotik und MechatronikSchaeffler GruppeAGVHZA-VDwww.schaeffler.comBedingt durch den großen Platzbedarf vonBatterien und Elektrokomponenten bildenElektrofahrzeuge auf Basis herkömmlicherFahrzeugarchitekturen derzeit noch keineattraktive Alternative zu verbrennungsmotorischangetriebenen Fahrzeugen. Technischwie wirtschaftlich gilt es vielmehr, die Besonderheitendes Elektroantriebes optimalzu nutzen. Vorteilhaft hierfür ist es, den Antriebdezentral am Rad bereitzustellen. Zieldieses Projekts war eine systematische Untersuchungsogenannter In-Wheel-Variantenmit wissenschaftlichen Methoden. Das vielversprechendsteKonzept wurde durch denAufbau einer mechatronischen Hinterachsemit zwei In-Wheel-Radmodulen analysiert.sowohl die Fahrsicherheit durch Fahrdynamik-geregeltenEinzelradantrieb als auch derFahrkomfort auf hohem Niveau sichergestellt.Die große Neuerung besteht in der bauraumoptimiertenPlatzgestaltung des integriertenKonzepts, ohne ungünstige Kompromisseeingehen zu müssen. Das Konzeptwurde in einem ersten Fahrzeugprototypenumgesetzt. Die theoretisch erwarteten Antriebs-und Fahrwerkseigenschaften konntenvollständig bestätigt werden. Die ungefedertenMassen konnten gegenüber demursprünglichen Fahrzeug mit Standardantriebtrotz hoher installierter elektrischer Leistungengleich gehalten werden.Das im Projekt entstandene integrierte Fahrwerks-und Antriebskonzept beinhaltet drehbargelagerte Getriebehälften, die – jeweilsim Bauraum einer Radfelge integriert – auchdie Fahrwerksfunktionen übernehmen. Durchgeschicktes Design ist es gelungen, fahrdynamischgeforderte Eigenschaften wie SpurundSturzverlauf, Wankpol und Abstützwinkeldarzustellen bei gleichzeitig hoher Getriebeübersetzungfür kompakte, hochdrehende undkarosseriefeste Elektromotoren. So wurden60
CISS.S (Crash Impact Sound Sensing for SideImpact): Seitencrasherkennung mit KörperschallMechatronikAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungDer neue Crash Impact Sound Sensor bietet die Möglichkeit, in Kombination mit strukturellen Verbesserungsmaßnahmendie Verformung des Fahrzeugs im besonders kritischen Seitencrash zu erfassenIm Vorgängerprojekt CISS wurde ein Verfahren für die Frontalcrasherkennung entwickelt,das auf der Erfassung hochfrequenter Schwingungssignale basiert. Das ForschungsprojektCISS.S widmete sich nun dem Seitencrash, der wegen der geringen Knautschzonebesonders gefährlich ist.Hochschule für angewandteWissenschaften IngolstadtInstitut für Angewandte Forschung (IAF)Esplanade 1085049 IngolstadtProjektpartnerAufgrund gestiegener Anforderungen an dieFahrzeugsicherheit war das wesentliche Zielvon CISS.S die frühzeitige Erkennung desSeitencrashs zur verbesserten Airbag-Auslösung.Projektinhalte waren zudem die Weiterentwicklungeines Simulationsverfahrensfür Körperschall (KS) und der Transfer inQuerschnittsbereiche wie Produktions- undMedizintechnik. Durch Grundlagenuntersuchungenkonnten die Effekte der KS-Entstehungin den kritischen seitlichen Lastfällenidentifiziert und bewertet werden. Dabeizeigten sich konstruktive Abhängigkeiten, diemittels struktureller Anpassungen optimiertwerden können, um die KS-Anregung undAusbreitung zu verbessern. Die Maßnahmenwurden an Fahrzeugen erprobt.Mit der neuen Sensorgeneration steht erstmalseine digitale Generation des CISS-Sensorszur Verfügung, dessen Einsatz auchin Satelliten-Sensoren in der Fahrzeugperipheriemöglich ist. Zusammen mit konventionellenSensoren lassen sich durchKombination aus Strukturanpassungenund KS-Messung optimierte Lösungenfür intelligente Insassenschutzsysteme imSeitencrash realisieren. Durch eine schnellerePlausibilisierung der Standardsensorikoder eine verbesserte Diskriminierungsleistungdurch Einsatz dezentraler KS-Sensorenist so eine höhere Leistungsfähigkeit möglich.Zudem bietet das neue Simulationsverfahrendas Potenzial, die KS-Ausbreitung in komplexenStrukturen erstmals für den virtuellenFahrzeugentwicklungsprozess effizient abzuschätzen.Die Anwendung der KS-Technologiein der Medizintechnik zeigte, dass sichVerschleiß- und Fehlerindikatoren von Hüft-Endoprothesen (z. B. Mikroseparation) durchKS-Messung erfassen lassen. Die Projekterfolgetrugen maßgeblich zur Gewinnung desForschungsbaus CARISSMA, des ersten aneiner Fachhochschule, bei.ACHAT SOLUTIONS GmbHSoftwareentwicklungwww.achat-solutions.deContinentalDivision Chassis & Safety,Business Unit Passive Safety & Sensoricswww.continental-automotive.comISKO engineers AGwww.isko-engineers.dePSW automotive engineering GmbHwww.psw-konstruktion.deMicroFuzzy GmbHwww.microfuzzy.comLTT Labortechnik Tasler GmbHwww.tasler.de61
MikrosystemtechnikMILKO: Mikro-Dosierpumpe undMikro-Förderpumpe für BrennstoffzellenAbgeschlossene PROJEKTEDeckelGegendruck [kPa]0 20 40 60 80 100150125PiezoaktorEin- und AuslassventilPumpenkammerbodenFörderrate [ml/min]100755025Förderrate:Pumpe B2Double Layer Pumpe 626 und PSEGegendruckfähigkeit:Pumpe B2Double Layer Pumpe 626Grundkörper00 40 80 120 160 200Frequenz [Hz]ProjektleitungFraunhofer Einrichtung für ModulareFestkörper-Technologien EMFTAbteilung Mikromechanik,Aktorik und Fluidik (MAF)Hansastraße 27 D80686 MünchenLinks: Aufbau der bei Paritec GmbH hergestellten Hochleistungspumpe MicroRun; rechts: Mit einerDouble-Layer-Piezokeramik erreicht die Hochleistungspumpe die für die Umwälzpumpe geforderteSpezifikation von 100 ml/min bei 10 kPa Gegendruck, was für eine piezoangetriebene Mikropumpe einenweltweiten Spitzenwert darstelltDirekt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) stellen eine saubere, leise und umweltfreundlicheEnergiequelle im Vergleich zu Dieselgeneratoren, Batterien oder Akkus dar. Umderen Bauvolumen und Gewicht weiter zu reduzieren, ist die Miniaturisierung derfluidischen Peripherie eine der zentralen Aufgabenstellungen.ProjektpartnerPARItec GmbHwww.paritec.deRKT – Rodinger Kunststoff TechnikGmbHForschung und Entwicklungwww.rkt.deSFC Energy AGwww.sfc.deBei DMFC-Brennstoffzellen werden eine Methanol-Dosierpumpe,eine Methanol-Wasser-Umwälzpumpe und ein Luftkompressor benötigt.Im Forschungsprojekt wurden auf Basiseines piezoelektrischen Antriebes diese dreiKomponenten miniaturisiert und für den Einsatzin der Mikro-Brennstoffzelle getestet. Eswurden spezielle Entwürfe umgesetzt, umden Mikro-Luftkompressor, die Mikro-Dosierpumpeund die Umwälzpumpe zu entwickeln.Dabei wurde ein Ring-Piezoaktor mitSilizium-Mikroventilen aufgebaut, um einenhohen Kompressorfluss zu erreichen. Bei denMikropumpen wurden diese Siliziumventilekombiniert mit einer kostengünstigen Edelstahlmembran,die mit einer Double-Layer-Piezokeramik angetrieben wurde.puncto Dosiergenauigkeit, Ansaugfähigkeit,Geräuschemission und Vibration.Mit den Flussraten für den Kompressor(4 l/min Luftfluss) und der Umwälzpumpe(100 ml/min Methanolfluss bei 10 kPa Gegendruck)wurden jeweils Leistungsdatenerreicht, die für einen Mikrokompressor undeine Mikropumpe bislang unerreicht sind. DieMikropumpe wurde ausführlich als Dosierpumpefür die Brennstoffzelle validiert, sie erfülltealle Qualitäts- und Lebensdauertests in62
Nanomaterialien für das GalvanoformenNanotechnologieAbgeschlossene PROJEKTE1 2 3amorphkristallinStromElektrode0ZeitZeitZeitProjektleitungLinks: Galvanoformwerkzeug für die Abformung von Instrumententafeln für die Automobilindustrie;rechts: schematische Darstellung der gepulsten galvanischen Abscheidung zur Erzeugungnanokristalliner, hochfester MaterialienNeue Nanomaterialien für Galvanoformen führen zu besseren mechanischen Eigenschaftenund damit verbunden zu einer effizienten Ressourcennutzung und Energieeinsparung.Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergDepartment Werkstoffwissenschaften,Lehrstuhl I für Allgemeine Werkstoffeigenschaften(WW1)Martensstraße 591058 ErlangenDie galvanische Abscheidung, das sogenannteGalvanoformen, erlaubt in einem wirtschaftlichenProzess komplexe dreidimensionaleFormen aus hochwertigen Materialienin Verbindung mit einer extrem genauenOberflächenabbildung. Die mit Galvanoformenhergestellten Teile werden häufig alsFormwerkzeuge für die Massenproduktiongroßer, komplizierter Kunststoffbauteileeingesetzt. Im bisherigen galvanischenProzess wurden Galvanoformen häufig ausReinnickel abgeschieden, das aufgrundseiner Mikrostruktur nur moderat fest ist.Ziel des Projekts war daher die Erforschungneuer Materialien für Galvanowerkzeugemit erhöhter Lebensdauer oder mit angepasstemWärmeausdehnungskoeffizienten.Im Teilprojekt Nanonickel dienten die Kennwerteaus der Schadensanalyse ausgefallenerFormen und der Evaluierung von Materialkennwertenaus Standardabscheidungen alsGrundlage für die Entwicklung verbesserterElektrolyte. Über die gesamte Laufzeit desProjekts hinweg wurden Abscheidungen füreinen späteren Einsatz im industriellen Betriebentwickelt und die unterschiedlichen Abscheidungenhinsichtlich der Mikrostruktur,Festigkeit und thermischen Stabilität charakterisiert.Die Bandbreite der Untersuchungsmethodenreichte daher u. a. von REM- undTEM-Untersuchungen über Nanoindentierungenbis hin zu mechanischen Festigkeitsmessungen.Es konnten Platten mit anorganischenAdditiven abgeschieden werden, dienach Temperaturbehandlung eine knappeVerdreifachung der Festigkeit im Vergleich zubisherigen Standardabscheidungen zeigten.Als Alternative zur Invargalvanoformungwurde die Abscheidung von dünnen Nickelschichtenauf CFK erprobt.Nach entsprechender Vorbehandlung durchSchleifen, Anodisieren und Besputtern mitGold konnten haftfeste Schichten von Nickelauf CFK realisiert werden, sodass das Ziel desTeilprojekts 2 (neue Materialien für galvanogeformteWerkzeugschalen mit angepasstemWärmeausdehungskoeffizienten) durch dieAlternativroute erreicht werden konnte. ImFokus des Teilprojektes 2 wurden herkömmliche,aber sehr dünne Nickel-Galvanoformenwirtschaftlicher mittels thermisch Spritzensvon Invar verstärkt und hinsichtlich ihrerniedrigen Wärmedehnung für die CFK-Herstellungoptimiert.ProjektpartnerCADFEM GmbHwww.cadfem.deEADS Deutschland GmbHwww.eads.comEurocopter Deutschland GmbHwww.eurocopter.comInstitut für Physikalische ChemieUniversität des Saarlandeswww.uni-saarland.deProzesstechnikIntier Automotive Eybl Interiors GmbHwww.magna.comZentralinstitut für Neue Materialienund Prozesstechnik (ZMP)Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnbergwww.zmp.uni-erlangen.deFichtner & Schicht GmbHwww.fi-sch.de63
NanotechnologieRastersondenmikroskop mit NanopositionierungAbgeschlossene PROJEKTE10 nmProjektleitungLudwig-Maximilians-UniversitätDepartment für Geo- und Umweltwissenschaftenund Center for NanoScience(CeNS)Theresienstraße 4180333 MünchenLinks: Foto des Raster-Sonden-Mikroskops für Experimente unter Umgebungsbedingungen;Mitte: Schnittdarstellung desselben Mikroskops mit freiem Blick auf Scanpiezo und Nanopositionierer;rechts: Raster-Tunnel-mikroskopische AufnahmeEin neues Rastersondenmikroskop mit piezobasiertem Nanopositioniersystem sollbesonders stabil und nutzerfreundlich werden.Projektpartnerattocube systems AGwww.attocube.comAufgrund der sehr hohen erreichbaren Auflösungbis hin zu atomaren Dimensionensind Raster-Sonden-Mikroskope zu einemder wichtigsten Werkzeuge in den Nanowissenschaftenavanciert. Jedoch gehen kommerzielleInstrumente oftmals Kompromissezwischen Nutzerfreundlichkeit und Abbildungseigenschaftenein. Das übergeordneteProjektziel war es daher, durch Integrationeines sehr stabilen und zuverlässigen„attocube“-Nanopositionierers in eine angepassteMikroskop-Architektur ein einfach zubedienendes, aber dennoch stabiles Raster-Sonden-Mikroskop mit hervorragenden Abbildungseigenschaftenund variablen Einsatzmöglichkeitenzu konzipieren.Gestaltung der Sondenaufnahme können dieInstrumente sowohl als Raster-Tunnel-Mikroskopals auch als Raster-Kraft-Mikroskopbasierend auf Quarz-Stimmgabeln betriebenwerden. Für Vakuumexperimente wurdeeigens eine auf das Mikroskop abgestimmteVakuumanlage mit integrierten Einrichtungenfür die Probenpräparation und -handhabungaufgebaut. Die Leistungsfähigkeit beider Mikroskopewurde in einer Vielzahl von hochauflösendenExperimenten zur supramolekularenSelbstassemblierung demonstriert.Die optimierte Nutzerfreundlichkeit kommtunter anderem in einer sehr effizienten Annährungsroutineund in einer deutlich vereinfachtenHandhabung zum Ausdruck.Konstruktionsgrundlage war die in Vorversuchenoptimierte Einbaulage des Nanopositionierers.Darauf aufbauend wurden zweiunterschiedliche Typen von Raster-Sonden-Mikroskopen für den Einsatz unter Umgebungsbedingungenund im Ultrahoch-Vakuumrealisiert. Deren Abbildungseigenschaftenprofitieren maßgeblich von der inhärentenStabilität des Nanopositionierers, zusätzlichtragen ein symmetrischer Aufbau und dieVerwendung von Spezialmaterialien zu optimierterDriftstabilität bei. Durch variable64
Einsatz von RFID bei der Herstellungvon FaserverbundwerkstoffenProzess- undProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTERFID-Transponder (auf Matte aus Kohlefaserverbundwerkstoff)ProjektleitungTechnische Universität MünchenInstitut für Werkzeugmaschinen undBetriebswissenschaften iwbStatt mit drahtgebundenen Sensoren soll der Herstellungsprozess von Faserverbundwerkstoffenkünftig auf Basis der Radio-Frequenz-Identifikation (RFID) überwacht werden.Die als Leichtbaumaterialien verwendeten Faserverbundwerkstoffe(FVW) erfahren in ihrerHerstellung komplexe Verläufe physikalischerGrößen wie Temperatur und Druck. DieseProzessgrößen entscheiden über die Qualitätund die industrielle Einsetzbarkeit derBauteile und werden derzeit durch drahtgebundeneSensoren überwacht. Besonders inder Luftfahrtindustrie sind hohe Qualitätsanforderungenvorgeschrieben, und ihr Erreichenmuss im Prozessfortschritt und -verlaufdurchgehend dokumentiert werden.Ziel des Projekts war es, Einsatzpotenzialeder RFID-Technologie entlang des FVW-Produktionsprozesses zu ermitteln und dietechnischen Herausforderungen bei derAnwendung von RFID-Transpondern aufFVW-Bauteilen bzw. bei der Integration inFVW-Bauteile zu lösen. Durch sensorielle Erweiterungder RFID-Transponder sollten dieProzessparameter genauer erfasst und damitdie Prozessqualität erhöht werden. Weiterhinsollte die RFID-Technologie genutzt werden,um durch produktindividuelle Datenspeicherungdie Produktionssteuerung und -dokumentationflexibler zu gestalten.Zunächst wurde der sinnvolle Einsatz vonRFID-Transpondern im Produktionsprozessuntersucht und an einem exemplarischenTeilprozess validiert. Auf Basis dieser Ergebnissewurden Verfahren zur informationstechnischenEinbindung der RFID-Transponder indie Produktionssteuerung entwickelt. Parallelwurden Möglichkeiten der technischen Integrationvon Transpondern in Form- und Bauteileaus FVW sowie deren sensortechnischeErweiterung erarbeitet. Dabei waren vorallem die Funktionsfähigkeit der Transponderund die Strukturfestigkeit der Bauteile zu gewährleisten.ProjektpartnerACC Technologies GmbH & Co. KGwww.acc-technologies.deEADS Deutschland GmbH InnovationWorksIW-MSwww.eads.netFraunhofer-Institut fürIntegrierte SchaltungenHochfrequenz- und Mikrowellentechnikwww.iis.fraunhofer.deSondermaschinenTajima GmbH / Mountek GmbHwww.tajima.deSchreiner Group GmbH & Co. KGwww.schreiner-group.com65
Prozess- undProduktionstechnikProzesskette zur simulationsgestütztenAuslegung von Werkzeugen mit konturangepasstenTemperiersystemen – ProTEMPAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungOben: Spritzgießwerkzeug und Artikel (Quelle: Hofmann Innovation Group GmbH);unten: Segmentdarstellung der Temperaturverteilung beim Nominalversuch und optimiertSiegfried Hofmann Werkzeugbau GmbHStefan HofmannAn der Zeil 296215 Lichtenfelswww.hofmann-innovation.comOptimierung von Temperierkanälen: Die schier grenzenlose Designfreiheit der additivenVerfahren stellt den Werkzeugkonstrukteur vor große Herausforderungen. Gestalt, Lageund Durchmesser der Kühlkanäle wollen gut überlegt sein – digitale Modelle können beider Konstruktion helfen.ProjektpartnerISKO Engineers AGKoller Werkzeug- und Formenbau GmbHwww.koller-formenbau.deMT Misslbeck Technologies GmbHWerkzeug- und Formenbauwww.misslbeck.dewww.iwb.tum.deiwb Anwenderzentrum AugsburgTechnische Universität MünchenBeim Spritzgießen werden zur Kühlung vonWerkzeugformeinsätzen Temperiersystemeeingesetzt. Dazu finden derzeit neben konventionellgebohrten auch durch das Strahlschmelzenhergestellte, konturnahe TemperierkanäleVerwendung. Letztere können anden Verlauf der Werkzeugkavität angepasstwerden und ermöglichen daher eine verbesserteWärmeregulierung (vgl. obere Abbildung).Die geometrischen Freiheiten bei derAuslegung konturnaher Temperierkanäle hinsichtlichihrer Gestalt und Lage stellen denKonstrukteur vor hohe Herausforderungen.Zielsetzung des Forschungsvorhabens war dieEntwicklung einer Prozesskette für die simulationsgestützteAnalyse und Auslegung vonTemperiersystemen. Die dazugehörige Zielgrößebestand in der Reduzierung von Temperaturgradientenentlang der Kavitätsoberseiteund die damit verbundene Verringerung vonVerformungen des gespritzten Artikels nachdem Entformen. Das im Projekt entwickelteVorgehen sieht vor, das Temperiersystem beider Konstruktion des Werkzeugformeinsatzesin Abschnitte zu unterteilen. Dadurch wardie abschnittsweise Vorgabe der zu optimierendenKanaldurchmesser möglich. In einerdarauf folgenden Spritzgießsimulation konntedas Temperaturfeld des Artikels berechnetund als Randbedingung anschließend ineiner gekoppelten thermischen Fluidsimulationverwendet werden. In der Berechnungwurde vorwiegend der Abkühlvorgang unterBerücksichtigung der Strömungsverhältnisseim Temperiersystem betrachtet.Durch zahlreiche Optimierungszyklen ist einverbesserter Parametersatz für die Kanaldurchmesserzum Erhalt einer homogenerenTemperaturverteilung an der Werkzeugoberseiteermittelt worden. Ausgehend von demursprünglichen Parametersatz konnte für dasbetrachtete Testbauteil durch die Optimierungder Kanaldurchmesser der Temperaturgradientan der Werkzeugoberseite um 13,7 %reduziert werden (vgl. untere Abbildung).66
EsIMiP: Effiziente und sichere Interaktion vonMenschen und intelligenten ProduktionsanlagenProzess- undProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLinks: Arbeitszelle mit Demonstratoraufbau; rechts: Volumenrekonstruktion in der Arbeitszellemit Reis RV20-16Durch die sichere und effiziente Einbindung des Menschen in den Produktionsprozessunter Berücksichtigung seines Verhaltens zur Erhöhung der Zuverlässigkeit werden neueSzenarien in der sicheren Mensch-Roboter Koexistenz ermöglicht.Technische Universität MünchenLehrstuhl für Automatisierung undInformationssysteme (AIS)Boltzmannstraße 1585748 Garching bei MünchenDer Einbezug des Menschen in industrielleArbeitsabläufe durch Mensch-Roboter-Koexistenz führt zu hohen Anforderungenhinsichtlich der vorzusehenden Sicherheitsmaßnahmen.Ziel des Projekts war es, Kollaborationsformenzu ermöglichen, in denenbeide Interaktionspartner in räumlich wiezeitlich naher Distanz effizient zusammen arbeiten.Da das Verhalten des Menschen nichtexakt vorausgesagt werden kann, war eineSteuerungslösung erforderlich, die sich denGegebenheiten dynamisch anpasst und außerdemin der Lage ist, sich unter Gewährleistungder Sicherheitsanforderungen aufändernde Umgebungsparameter einzustellen.Im Projekt wurde ein neuartiger Ansatz vorangetrieben,bei dem a) die SystemkomponenteOSC (Optimizing Strategic Control) die Zuverlässigkeitund Verfügbarkeit des Systemsdurch Erlernen von Kontrollstrategien unterEinbezug des Verhaltens der FSC (Fail-SafeControl) erhöht und b) die unabhängige SystemkomponenteFSC die Sicherheit des Gesamtsystemsgewährleistet. Die Umgebungdes Roboters wird durch ein entwickeltes Sensorsystemkontinuierlich überwacht, um eineVorhersage über das Verhalten des Benutzersin der Produktionsumgebung und damit eineffizientes Produktionsverhalten des Roboterszu ermöglichen, das zugleich die Sicherheitdes Gesamtsystems nicht beeinträchtigt. Einesichere Detektion von dynamischen Objektenim Arbeitsraum wie auch die sichere Verarbeitungund Ansteuerung des Roboters wurdefür die erforderlichen Sicherheitsfunktionenentworfen und umgesetzt.Systemergonomische Anforderungen wurdenmit Hilfe von Untersuchungen gewonnen undspezifiziert, womit die Wahrscheinlichkeit vonFehlhandlungen des Menschen durch die Implementierungder Erkenntnisse in die Steuerungsarchitekturund in die Gestaltung desArbeitsplatzes reduziert werden konnte. Dieentworfene Systemarchitektur ermöglichteine sicherheitsgerichtete Adaption in technischenSystemen und mit den implementiertenSystemkomponenten eine zuverlässige,sichere Mensch-Roboter-Kooperation.ProjektpartnerBaumüller Anlagen-Systemtechnik GmbH& Co. KGDGUV/IFA Institut für Arbeitsschutzwww.dguv.de/ifaReis GmbH & Co.KG MaschinenfabrikObernburgEntwicklung Steuerungs-Softwarewww.reisrobotics.deRegelungs- und SystemtheorieUniversität Kasselwww.control.eecs.uni-kassel.deLehrstuhl für ErgonomieTechnische Universität Münchenhttp://www.lfe.mw.tum.de67
Prozess- undProduktionstechnikLow-Loss-KunststoffverzahnungAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungKunststoff/Stahl-Zahnradpaarung mit konventioneller (links) und verlustoptimierterVerzahnungsgeometrie (rechts)FZG-AugsburgBoltzmannstr. 1585748 GarchingVerlustoptimierte Verzahnungen steigern die Leistungsübertragung trocken laufenderKunststoffzahnräder. Systematische Untersuchungen des Betriebsverhaltens unterstützendie Erschließung neuer Anwendungsbereiche.ProjektpartnerA. Handtmann EltekaKunststofftechnik GmbHwww.handtmann.deSPN Schwaben PräzisionFritz Hopf GmbHwww.spn-hopf.deKunststoffzahnräder haben gegenüber Stahlzahnräderneinige Vorteile, die in speziellenGetriebeanwendungen zunehmend zumTragen kommen. Durch ihre Trockenlauffähigkeitsind sie prädestiniert für Anwendungen,beispielsweise im Bereich der Medizintechnik,Lebensmittelverarbeitung oderDruckindustrie, bei denen eine Schmierungnicht möglich ist. Hohe Reibungsverluste begrenzendabei jedoch die aus thermischerSicht übertragbare Leistung. VerlustoptimierteVerzahnungen weisen durch Konzentrationdes Zahneingriffs um den Wälzpunktdeutlich niedrigere Reibungsverluste auf undhaben damit das Potenzial, die Anwendungsbereichevon Kunststoffzahnrädern deutlichzu erweitern. Die Gültigkeit bestehender Berechnungsverfahrenzur Auslegung der Zahnräderist aufgrund der deutlichen Abweichungenzu konventionellen Verzahnungennicht gesichert.umfangreiche Prüfstandsversuche durchgeführt.Neben Verzahnungsverlusten, Temperaturenund Tragfähigkeit wurde das dynamischeBetriebsverhalten untersucht. ImVergleich zu einer konventionellen Verzahnungsauslegungkonnte eine deutliche Verringerungder Verzahnungsverluste und eineSteigerung der aus thermischer Sicht übertragbarenLeistung von bis zu 75 % experimentellnachgewiesen werden. Aus denVersuchsergebnissen wurde eine umfassendeAuslegungsstrategie erarbeitet, dieneben Erweiterungen zu bestehenden Berechnungsverfahrenneue Ansätze zu bishernicht berücksichtigten Aspekten enthält.Ziel des Forschungsvorhabens war die Ermittlungdes Betriebsverhaltens verlustoptimierterKunststoffzahnräder, um eine sichereAuslegung und Anwendung in derPraxis zu ermöglichen. In Zusammenarbeitmit den Projektpartnern wurden dazu68
Thermoplastisches SubstratmaterialProzess- undProduktionstechnikKupferleiterbahnenAbgeschlossene PROJEKTEGeschäumter KernProjektleitungLinks: thermoplastisches Substratmaterial: strukturierte Leiterplatte (oben: schematische Darstellung,unten: Netzteil als Serienbaugruppe); rechts: Anlage zur kontinuierlichen Kaschierung mit Kupferfolien(braune Rollen) und thermoplastischen Kleberfolien (weiße Rollen)Innovationen im Bereich von Leiterplatten sind von entscheidender Bedeutung, um demstetigen Technologiefortschritt Folge zu leisten. Ein geeigneter Ansatz ist thermoplastischgeschäumtes Substratmaterial.Universität BayreuthLehrstuhl für Polymere WerkstoffeUniversitätsstraße 3095447 BayreuthZiel des Projekts war es, ein rein thermoplastischesund kontinuierlich (im Inline-Verfahren)mit Kupfer kaschiertes Substratmaterialauf Basis eines geschäumten Hochtemperatur-Thermoplastenzu entwickeln, das in bleifreienLötprozessen prozessfähig verarbeitbarist. Auf Basis eines geschäumten Polyetherimids(PEI) wurde ein neuartiges Leiterplatten-Substratmaterialentwickelt, das Vorteilewie 3D-Verformbarkeit, Recycelbarkeit, keineFlammschutzmittel (inhärent flammwidrig,halogenfrei), kontinuierliche Herstellbarkeit(Extrusion), geringe Dichte, gute Hochfrequenzeigenschaftenund kostengünstigeStarr-Flex-Strukturen gegenüber Standard-Leiterplatten wie z. B. FR4 bietet.Es wurde ein kostengünstiges Inline-Kaschierverfahrenentwickelt. Dadurch wirdermöglicht, dass direkt nach der Schaumsubstratherstellungmittels Extrusion demSubstrat kontinuierlich Kleber- und Kupferfolievor dem Kaschierprozess in einem Herstellschrittzugeführt werden. Resultat istein beidseitig mit Kupferfolie beschichtetesLeiterplattenbasismaterial. Die thermischeUmformung geschäumter PEI-Platinen ermöglichtkostengünstige und platzsparendeAufbaukonzepte (optimierte Bauraumnutzung)für elektronische Baugruppen. Weiterhinwurden erstmals Multilayer mitdünnen Schaumsubstratkernen hergestellt.Anhand verschiedener Demonstratoren wurdendie Funktionen der elektronischen Baugruppenim Hinblick auf die Unterhaltungselektronikerfolgreich untersucht. Im Rahmendieses Projekts ist es gelungen, ein rein thermoplastischesSubstratmaterial zu entwikkeln,das keine Flammschutzmittel, Epoxidharzeoder Glasfasergewebe enthält undsomit vollständig werkstofflich recyclebar ist.ProjektpartnerUniversität BayreuthLehrstuhl für Polymere WerkstoffeUniversitätsstraße 3095447 BayreuthKEW Konzeptentwicklung GmbHwww.kew-konzeptentwicklung.deLoewe Opta GmbHwww.loewe.deMaschinenfabrik Herbert Meyer GmbHwww.meyer-machines.com69
Prozess- undProduktionstechnikLEAN:log – Lösungen für Effizienzsteigerungenin automobilen Netzwerken durch LogistikAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungLogistik der Zukunft: Prozesse ganzheitlich planen, auslegen und steuernTechnische Universität MünchenLehrstuhl für FördertechnikMaterialfluss Logistik (fml)Boltzmannstraße 1585748 Garching bei Münchenwww.fml.mw.tum.deSchlanke Logistikprozessketten sollen die Automobilindustrie kundenorientierter,flexibler und damit auch wirtschaftlicher machen.ProjektpartnerBayern Innovativ GmbHNetzwerk Logistikwww.bayern-innovativ.deBLSGwww.b-l-s-g.comBMW AGProduktion Fahrwerks- undAntriebskomponentenwww.bmw.detrilogIQawww.trilogiqa.deSchenker Deutschland AGwww.dbschenker.com/deLISA Dräxlmaier GmbHwww.draexlmaier.deF. X. Meiller GmbH & Co KGwww.meiller.comIndividuelle Kundenwünsche und sich schnellverändernde Märkte stellen die Fahrzeugindustrievor große Herausforderungen. Ummit diesen Entwicklungen umzugehen, ist esfür die Unternehmen unumgänglich, ihre Prozessein den Wertschöpfungsketten kundenorientiert,effizient und robust zu gestalten. DieLogistik als Schnittstellenfunktion spielt darineine besondere Rolle: Durch eine schlanke,d. h. effektive und effiziente Logistik wirdWertschöpfung in einer oftmals bereitsschlank organisierten Produktion und damitdie vollständige Befriedigung der Kundenwünscheerst möglich.Im Forschungsprojekt LEAN:log wurde dasZiel verfolgt, Konzepte und Methoden zurganzheitlichen Planung, Auslegung und Steuerungschlanker Logistikprozessketten zuentwickeln und zu testen. Entstanden sindLeitlinien und Zielgrößen für eine schlankeLogistik, die das gemeinsame Verständnisaller Projektbeteiligten wiedergeben und alsGestaltungsrichtlinien und Bewertungsgrößendienen. Phasen von der Entscheidungfür die Einführung von Lean Logistics biszur Umsetzung wurden in einem Referenzmodelldokumentiert. Zur Unterstützung derwesentlichen Phase „Analyse und Planung“wurden aufeinander aufbauende Methodenzur Prozessanalyse, zum Wertstromdesignfür die Logistik, zur Dimensionierung schlankerLogistikprozesse sowie zur Optimierungder Schnittstellen zwischen Prozessen geschaffen.Um den Menschen als planendenund ausführenden Akteur bei der Einführungschlanker Logistikprozesse zu sensibilisierenund zu befähigen und seine Kreativität gezieltzu nutzen, können Grundlagen, Planungsvorgehenund die Auswirkungen schlanker, kooperativerPlanung in einem ebenfalls entwickeltenPlanspiel erlebt und erlernt werden.70
Funktionale Charakterisierungvon WerkzeugoberflächenProzess- undProduktionstechnikDIN 50113n Proben22Prüfdurchmesser 5 mmPrüfdrehzahl 6.000 U/minAbgeschlossene PROJEKTES1 + PE1 + PS1 + PE1 + PS2 + PE2 + PS2 + PE2 + PS3 + PE3 + PS3 + PE3 + P2000N/mm 21500G55Bruchw. 50%2000N/mm 21500G45CBruchw. 50%Erodierstrategie E(Entladedauer [µs] / Entladestrom [A])E1 (2,1/5,0) E2 (2,1/2,5) E3 (4,9/12,5)s Bmax12501000750s Bmax12501000750Schleifstrategie S(Vorschub [mm/min] / Drehzahl [U/min])S1 (4,0/100) S2 (2,0/150) S3 (4,0/150)5002505002500010 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8SchwingspieleSchwingspielePolieren PKörnung D 15µm, n P= 400 U/minIm Umlaufbiegemodellversuch ermittelte Wöhlerkurven für die untersuchten ProzesskettenProjektleitungIn der industriellen Massenfertigung ist die Kaltmassivumformung ein gängigesVerfahren zur Herstellung von metallischen Bauteilen. Für die Wirtschaftlichkeit desUmformprozesses ist die Standzeit der eingesetzten Werkzeuge maßgeblich, wobeidiese bereits durch den Werkzeugherstellungsprozess entscheidend beeinflusst wird.Weiss Umformwerkzeuge GmbHPruppacher Weg 691126 Rednitzhembachwww.weiss-form.deIn der Kaltmassivumformung kommen vielfachHartmetalle als Werkzeugwerkstoff zurAnwendung. Aufgrund der hohen Härte wirddie Werkzeuggeometrie mittels eines Hartbearbeitungsverfahrens,im WesentlichenErodieren oder Schleifen, erzeugt. Zur Verbesserungdes Verschleiß- und Ermüdungsverhaltenswird die Werkzeugoberfläche abschließenddurch Polieren feinbearbeitet.Das Ziel des Projekts war, den Einfluss desHerstellungsprozesses auf das Einsatzverhaltenvon G55- und G45C-Hartmetallwerkzeugenzu untersuchen und Empfehlungen füreine standzeitoptimierte Fertigung von Umformwerkzeugenabzuleiten. Im Rahmen desVorhabens wurden die Eigenschaften vonerodierten bzw. geschliffenen und anschließendpolierten Oberflächen messtechnischerfasst sowie deren Einfluss auf das Werkzeugeinsatzverhaltenmit Hilfe von Modellversuchensowie in der industriellen Serienfertigungermittelt. In Standzeitversuchenwurden durch topografische Analysen adhäsiverund abrasiver Verschleiß an der untersuchtenFließpressschulter der Hartmetallwerkzeugenachgewiesen. Ein Einfluss aufdas Verschleißverhalten zwischen Schleifenund Erodieren konnte bei entsprechender Polierbearbeitungnicht festgestellt werden.Die Ermüdungsversuche ergaben, dass dieProzesskette „Schleifen – Polieren“ deutlichhöhere Wechselfestigkeiten gegenüber derProzesskette „Erodieren – Polieren“ erreicht.Die Versuche zeigten zudem, dass die härtereHartmetallsorte G45C bei gleicher Bearbeitungeine höhere Biegewechselfestigkeit gegenüberG55 erreicht. Die ermittelten Zusammenhängezwischen Werkzeugherstellung,Oberflächeneigenschaften und Werkzeugeinsatzverhaltenermöglichen dem Werkzeugherstellerund -anwender, von der messtechnischerfassten Oberflächenbeschaffenheitdes Werkzeugs Aussagen über das Einsatzverhaltenim Umformprozess zu treffen undso über die Standzeiterhöhung die Herstellkostenzu senken.ProjektpartnerFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Fertigungstechnologiewww.lft.uni-erlangen.deSSF-Verbindungsteile GmbHwww.ssf-nuernberg.deGF AgieCharmilles Agie SAwww.gfac.comKennametal Shared Services GmbHwww.kennametal.com71
Prozess- undProduktionstechnikHochintegrierte Messwerterfassungin der ProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTEV in*ComparatorV REFDigital-AnalogConverterOutputRegisterShiftRegisterClockOutputConditionalGatesProjektleitungLinks: Architektur des Wägeverfahren-ADUs; rechts: Chipfoto des entwickelten ADUsFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Technische ElektronikCauerstraße 991058 ErlangenAnalog-Digital-Umsetzer sind die Schnittstelle zwischen analogen Signalen und digitalerSignalverarbeitung. Neue Konzepte sollen ihre Leistungsaufnahme reduzieren und dieIntegrationsdichte erhöhen.ProjektpartnerFriedrich-Alexander UniversitätErlangen-NürnbergLS für Zuverlässige Schaltungenund Systemewww.lzs.eei.uni-erlangen.deTexas Instruments Deutschland GmbHHPA-PA-Nyquist ADCwww.ti.com<strong>Bayerische</strong> Firmen sind stark in der Produktionvon Fertigungs- und Antriebstechnikenwie zum Beispiel automatischen Prozess- undMotorsteuerungen, Robotiksystemen, Hybridantriebenoder Solarsystemen. Bei all diesenApplikationen muss eine grundlegend neue,hochintegrierte Messwerterfassung vieleSensoren simultan und hochgenau auswerten,um die Energieeffizienz drastisch zu steigern.Dies reduziert gleichzeitig die Abgasbelastungender Umwelt beispielsweise durchden verringerten Kohlenstoffdioxid-Ausstoß.In diesem Projekt wurde ein hochauflösenderAnalog-Digital-Umsetzer (ADU) für die Messwerterfassungin der Produktionstechnikentwickelt. ADUs bilden die Schnittstellezwischen der analogen Signalwelt und der digitalenSignalverarbeitung. Das neu entwickelteund mit einem neuen Halbleiterfertigungsprozessumgesetzte ADU-Konzept reduziertdie Leistungsaufnahme von ADUs und erhöhtgleichzeitig die Integrationsdichte. Die Fertigungstechnologiegestaltet den Einsatz neuerSchaltungskonzepte zur Verbesserung wichtigerKennwerte des ADU. Eine höhere Integrationsdichteerlaubt zusätzlich die Realisierungvon digitalen Schaltungen zur Korrekturvon Fehlern, die durch Fertigungstoleranzenentstehen, weshalb jeder einzelne ADU getestetwerden muss. Hierzu wurde ein vollautomatischerTest entwickelt, der eine hoheDurchsatzrate aufweist.Mögliche Einsatzgebiete solcher ADUs sindzum Beispiel Motorsteuerungen, die Stromnetzüberwachung,die Medizintechnik undauf Grund der verringerten Leistungsaufnahmeauch mobile Geräte. Um diese ADUs zurMarktreife zu entwickeln, ist noch weitereEntwicklungsarbeit notwendig. Es konntegezeigt werden, dass die digitale Fehlerkorrekturfunktionsfähig ist, und es wurde einTestverfahren implementiert, welches die erforderlicheTestzeit erheblich reduziert.72
MultiGO: Multifunktionale Messzellezur Geometrie- und Oberflächenprüfungunlackierter BauteileProzess- undProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTEGeometrieOberflächeGesamtkarosserie: automatisierte MessungProjektleitungDas Projekt hatte zum Ziel, eine multifunktionale Messzelle für die kombinierteGeometriemessung und Oberflächenprüfung unlackierter Bauteile mit einem photogrammetrischenSensor zu entwickeln.BMW AGGeometrieabsicherungKarosseriekomponentenPetuelring 13080788 MünchenFür die Zufriedenheit von Automobilkundensind die fehlerfreie Oberfläche der Karosserieaußenhautund die Maßhaltigkeit derGeometrie entscheidend. Das Projekt hattedaher zum Ziel, eine multifunktionale Messzellefür die kombinierte Geometriemessungund Oberflächenprüfung unlackierterBauteile mit einem photogrammetrischenSensor zu entwickeln. Dabei musste die individuelleReferenzkulisse durch ein praktikableresKonzept ersetzt werden. Letztendlichsollte eine Gesamtkarosse außen undinnen geometrisch zu erfassen sein, wobeiein Besprühen der Bauteile nicht zulässig ist.Verzicht auf den individuellen Kulissenaufbauwurde durch ein zusätzliches Mehrkamerasystem,das sich über ein invariantes Referenzmarkensystemeinmisst, ermöglicht. DiePosition und Orientierung des Sensors imRaum wird so höchstpräzise festgestellt. FürAbschattungen der Referenzmarken bei Messungeninnerhalb der Karosserie wurde einVerfahren entwickelt, das „temporäre Referenzmarken“nutzt. Die Ergebnisse der Versuchsreihenzeigen das Potenzial der Technik.Für den Praxiseinsatz müssen die entwickeltenVerfahren noch optimiert werden.ProjektpartnerSteinbichler Optotechnik GmbHBusiness Developmentwww.steinbichler.deTechnische Universität MünchenFachgebiet Photogrammetrieund Fernerkundungwww.pf.bv.tum.deIm Rahmen des Projekts wurde eine Roboter-Messzelle mit stehender und liegender Messplatteaufgebaut. Das System steht dabei aufeinem Betonsockel, der vom Gebäude durcheine aktive Schwingungsdämpfung entkoppeltist. Zunächst wurde ein Hybridsensor entwickelt,der die Geometrie hochpräzise geometrischerfasst und kleinste Oberflächenunruhenermittelt. Der Hybridsensor besteht auseinem aktiven Projektor und zwei Kameras,die asymmetrisch zum Projektor angeordnetsind. Damit wird für die „Oberflächenkamera“eine bessere Tiefenauflösung erreicht. DerTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Geodäsiewww.geo.bv.tum.de73
Prozess- undProduktionstechnikEndkonturnahe Kohlenstoff-FormteileAbgeschlossene PROJEKTEProjektleitungSpritzgießfähiges Granulat auf Agar-Basis und spritzgegossene ProbekörperFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergZentralinstitut für Neue Materialien undProzesstechnik (ZMP)Dr.-Mack-Straße 8190762 FürthDie Herstellung selbstschmierender Lager mit Graphitkäfigen ist aufwendig.Ein neues spanloses Verfahren verspricht schneller und günstiger zu sein.ProjektpartnerSchaeffler Technologies GmbH & Co. KGWerkstoffentwicklung Herzogenaurachwww.schaeffler.deIm Projekt sollten geometrisch komplexeFormkörper aus Kohlenstoffwerkstoffen,die nicht schmelz- oder umformbar sind, ineinem spanlosen Verfahren endkonturnahhergestellt werden. Dazu wird in einem Pulverspritzgussverfahreneine Formmasse ausMesophasen-Kohlenstoffpulver und einemneuartigen wasserbasierten Bindersystem indie gewünschte Form gebracht. Anschließendwird durch Trocknungs- und Thermoprozesseder Binder entfernt und das Mesophasenmaterialin Graphit umgesetzt. Die dabei auftretendenUmwandlungs- und Zersetzungsreaktionenin der Kohlenstoffmesophase führenzur Freisetzung von Gasen, die aus dem Bauteilentweichen müssen, ohne Blasen undRisse zu verursachen.klassischen Graphitmaterials (Herstellungdurch Pressen), und die Wechselfestigkeit istsogar etwas höher.Ziel des Projekts war das Verständnis derEinflussparameter, um das Material möglichstdicht zu sintern und gleichzeitig Defekteund Verzug im Rahmen bestimmterToleranzen zu verhindern. Mit Hilfe der gewonnenenErkenntnisse ist es jetzt möglich,Prototypen eines Nadellagerkäfigs im Pulverspritzgussverfahrenherzustellen. Die Materialkennwertesind vergleichbar mit denen des74
Funktionalisierung von Kunststoffendurch Inkjet- und AerosoldruckProzess- undProduktionstechnikAbgeschlossene PROJEKTEProjektLEITUNGLinks: FKIA-Funktionsdemonstrator: bedruckter Kunststoffbehälter aus PA 66 mit kapazitiven Sensoren zurFüllstandsmessung, aufgebauter Auswerteelektronik mit LED-Anzeige zur Visualisierung und einemLeistungsteil zur Ansteuerung eines Pumpenmotors; rechts: Bildung des Tintentropfens an der DruckdüseElektronische und mechatronische Baugruppen stoßen in immer neue Anwendungsgebietevor und sind dabei der Anforderung ausgesetzt, begrenzten Bauraum optimalauszuschöpfen. Einen Lösungsansatz bietet die Technologie der Molded InterconnectDevices (MID), die das Aufbringen der elektronischen Schaltung direkt auf einspritzgegossenes 3D-Kunststoffformteil ermöglicht.Im Rahmen des Projekts FKIA wurde untersucht,wie mit den digitalen Verfahren Inkjet- sich, dass im Hinblick auf die Konturschärfebis zu 180 °C gesintert werden. Dabei zeigteund Aerosoljet-Druck eine zuverlässige selektiveMetallisierung von Kunststoffen durch im Spritzguss erzielten Oberflächengüte derund die erzielten Leiterbahnwiderstände derTinten mit nanoskaligen Silberpartikeln ermöglichtund damit die MID-Prozesskette er-zukommt.Schaltungsträger eine entscheidende Rollegänzt werden kann. Dazu wurde eine Auswahlan thermoplastischen Werkstoffen getroffen, Diese hat auch Einfluss auf die Langzeitzuverlässigkeit,wobei in den Tests zur beschleu-die für die Anwendung im Automobil und füreine thermische Nachbehandlung der Nanotintenim Ofen geeignet sind.geringer Abfall des Leiterbahnwiderstandsnigten Alterung zusammenfassend nur einund der Haftfestigkeit gemessen werdenAus den Kunststoffen wurden im Spritzgussverfahrenverschiedene Probekörper hergestellt. sehr gut für die Übertragung elektrischer Si-konnte. Die gedruckten Strukturen sind somitHiermit konnten die beiden Druckverfahren gnale und die Herstellung von Sensorelementengeeignet. Für Anwendungen, die eineangepasst und Teststrukturen mit Linienbreitenbis zu 200 µm hergestellt werden. Mit höhere Stromtragfähigkeit erfordern, bestehtden Probekörpern war es möglich, die Langzeitzuverlässigkeitin Anlehnung an Tests misch und galvanisch abgeschiedenes Kupferdie Möglichkeit, die Leiterbahnen durch che-für Automobilanwendungen zu überprüfen. zu verstärken. Die vielversprechenden Ergebnisseaus dem Projekt sind anhand ei-In zusätzlichen Untersuchungen wurde dieSchichtdicke der gedruckten Strukturen durch nes Funktionsdemonstrators veranschaulicht.Verfahren aus der Leiterplattentechnik erhöht.Die auf Polyamid-Werkstoffen gedrucktenSilbertinten konnten mit einem angepasstenTemperaturprofil im Ofen bei TemperaturenFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Fertigungsautomatisierungund Produktionssystematik FAPSwww.faps.uni-erlangen.deProjektpartnerFraunhofer Institut für Zuverlässigkeitund Mikrointegration (IZM)Mikro-Mechatronik Zentrumwww.mmz.izm.fraunhofer.deGeorg-Simon-Ohm Hochschule NürnbergFakultät efiwww.ohm-hochschule.deLEONI Bordnetz-Systeme GmbHR&D Electromechanical Engineeringwww.leoni.comForschung & EntwicklungRF Plast GmbHwww.rf-plast.deNeotech Services MTPwww.neotechservices.comLüberg Elektronik GmbH & Co.Rothfischer KGwww.lueberg.de75
Energie und UmweltRobuste und effiziente NO X-Minderung mit Ammoniak 78TWIN-JET 79Intelligenz im Solarglas 80Herstellung wärmeleitfähiger Zeolith/Kunststoff-Verbundwerkstoffefür Anwendungen in Wärmetransformationsprozessen 81Technologische Grundlagen zur Herstellung vonSiC-Spannungswandlern für intelligente Stromnetze (SiC-WinS) 82Konstruktiv materialtechnologische Verbesserung vonBetonfertigteilwandkonstruktionen 83Zink-Luft-Batterien als stationäre Energiespeicher 84INformations- UNDkommunikationstechnologienEffizienter Breitband-Leistungsverstärker 85MuSe Bayreuth 86Faseroptische Gigabit-Übertragungsstrecke mitseitlicher Einkoppelung (GigaFluo) 87life sciencesThermophorese für die Proteinformulierung 88Tumortherapie durch Triomab/anti-CTLA-Kombination 89Computerassistierte histologische Befundung am Beispielvon Knochenmark- und Lymphknotenuntersuchungen – PathoMaps 90Automatisierung der elektromechanischen Reanimationshilfe 91Ein extravaskuläres Herzunterstützungssystem 92Entwicklung der Herstellung von Ga-68-Generatoren 93i3 Screen – in vitro Impedanz Screening System 94In-vitro-Diagnostik mit einem gepulsten elektrochemischenVerfahren – SMART-Scan 9576
neue Projekte des jahres 2012Neue ProjekteGenerierung und Charakterisierung von innovativen monoklonalen anti-ErbB-Rezeptor-Antikörpern mit erhöhtem therapeutischem Potenzial 96„Springs“ und „Parachutes“ – neue Formulierungen fürschlecht wasserlösliche Wirkstoffe 97Entwicklung hochwertiger umweltfreundlicher Infrastrukturproduktefür den Einsatz im Tiefbau 98MaterialwissenschaftTrockenlauf-Kunststoff–Scharnierbandkette 99Freie Fahrt durch Tunnel dank geringerem Erhaltungsaufwandmit optimierten Baustoffen 100Übertragung der Flächenpressung von Luftreifen über einLuftlager bei Flachbahnprüfständen 101MechatronikRobustes 24-GHz-Funkortungs-Tachymeter – RFTACH 102Nanoraue Beschichtungen für Touchscreens – TOUCH 103NanotechnologieDirekt-Kasch 104BrewPAT – Fermentative Optimierung mittelsprozessanalytischer Technologie (PAT) 105Prozess- undProduktionstechnikInitiale Nassfestigkeit von Papier 106Feinbearbeitung von Werkzeugoberflächen 107Intelligente Deformationskompensation im 3D-Druck – IDe3D 108Optimierung von Flüssigkeitsringvakuumpumpen 109Zellenmodell zur Auslegung von Packungskolonnenund Flüssigkeitsverteilern 110IDA: Intelligente Datenakquisition in Gießereifertigungen 11177
Energie und UmweltRobuste und effiziente NO X-Minderungmit AmmoniakNeue PROJEKTEBrennstoffPrimärluftDosiersystemDrallbrennerReaktionsrohrPrimärzoneλ < 1HeizungAmmoniakPortIsolierungAusbrandluftAusbrandzoneλ > 1ProjektleitungTechnische Universität MünchenLehrstuhl für EnergiesystemeBoltzmannstraße 1585748 Garching bei MünchenAbgaskanalSchematischer Versuchsaufbau des Flugstromreaktors. Die Ammoniakeindüsung erfolgt in die unterstöchiometrischePrimärzone, bevor der Brennstoff in der Ausbrandzone vollständig umgesetzt wirdZielsetzung des Projekts ist die Weiterentwicklung der Feuerungs- und SNCR (SelektiveNicht-Katalytische Reduktion)-Technologie, um Emissionen von Müllverbrennungsanlagenzu reduzieren. Die Eindüsung des Ammoniaks in unterstöchiometrische Zonenlässt deutliche Vorteile bei der NO x-Minderung erwarten.ProjektpartnerMartin GmbHLeopoldstraße 24880807 MünchenWährend der Verbrennung entstehen ausdem Brennstoff und der Verbrennungsluftumweltneutrale niederenergetische Produkte,aber auch umweltbelastende Schadstoffe wieStickstoffoxid (NO x). In Deutschland ist diezulässige Menge an Emissionen im Bundesimmissionsschutzgesetzgeregelt. Seit 2013ist der Jahresgrenzwert der NO x-Emissionenfür bestehende Müllverbrennungsanlagen(MVAs) mit einer Leistung größer 50 MW auf100 mg/Nm³ festgelegt.Um diesen Grenzwert einhalten zu können,werden neben feuerungstechnischen Maßnahmenauch sog. Sekundärmaßnahmenzur NO x-Minderung angewendet. In MVAskommen hier die Selektive Katalytische Reduktion(SCR) sowie die Selektive Nicht-KatalytischeReduktion (SNCR) zum Einsatz.Ein Großteil der Anlagen mit SCR-Systemhält bereits den neuen Grenzwert ein. Hingegenerreichen nur wenige Anlagen mitSNCR-Technologie Emissionen unter 100mg NO 2/Nm³. Es liegt also im Interesse derAnlagenbetreiber, die kostengünstigereSNCR-Technologie weiter zu verbessern.Das Projekt zielt auf die Bestimmung desPotenzials des SNCR–Verfahrens ab. Gegenstandder Forschung ist die Ammoniakeindüsungin unterstöchiometrische Zonen, dadieses Verfahren vielversprechend ist, jedochbisher nicht in industriellen Anlagen zur Anwendungkommt.Am Lehrstuhl für Energiesysteme der TUMünchen werden hierzu Versuche amFlugstromreaktor durchgeführt. Alle experimentellenUntersuchungen werden mitCFD-Simulationen begleitet. Außerdem sindMesskampagnen an großtechnischen MVAsgeplant, um die Umsetzbarkeit des Verfahrensin der Praxis zu bewerten.78
TWIN-JETEnergie und UmweltCharacterisation of the global spray structureVariation of design / operation parameterIntroduction:The atomization processNeue PROJEKTEOriginal ImagesVariation of the design parameter:Nozzle INozzle IINozzle IIINozzle IVNozzle VNozzle VIBore-hole diameterD [µm]10010010080120200Impinging angle2Θ [°]203040404040Variation of the injection pressure: 5MPa / 10MPa / 20MPaInjection pressurep Fuel [MPa]202020202020Development of theliquid sheet (sketch)Liquid sheetatomization (sketch)+10µsProjektleitungLinks: Skizze der beiden kollidierenden Jets und Entstehung des Sprayfächers; rechts: entsprechendeAufnahmen mit der High-Speed-KameraDas Projekt erforscht den Einsatz von neuartigen Doppelstrahl-Sprayinjektoren für diehomogene interne Gemischbildung und Verbrennung in Ottomotoren.Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Prozessmaschinen undAnlagentechnik (iPAT)Cauerstraße 491058 Erlangenwww.ipat.uni-erlangen.deMit dem Ziel, eine Verbrauchsminimierungund dadurch eine Reduktion der Emissionenzu erreichen, erfolgt die Kraftstoffeinspritzungin modernen Ottomotoren zunehmenddurch eine Direkteinspritzung. Vor allem dasKonzept der Mehrfacheinspritzung bietetüber das Motorkennfeld hinweg die Möglichkeit,die notwendigen Variationen in derKraftstoffmenge bereitzustellen, wodurch dieKraftstoffverdampfung in kürzester Zeit erreichtwird.Gegenwärtige Mehrlochdüsen stoßen allerdingsvermehrt an ihre physikalischen Grenzenhinsichtlich der optimalen Zerstäubungsqualitätdes Kraftstoffsprays. Bedingtdurch die Funktionsweise der Injektoren unddie Fördercharakteristik der Kraftstoffpumpenkommt es zudem zu Druckpulsationenim gesamten Einspritzsystem, wodurch dieKraftstoffmenge sowie die Eindringtiefe desSprays in den Brennraum negativ beeinflusstwerden. In der Folge können unkontrollierteVerbrennungsprozesse und eine verstärkteKolben- und Zylinderbenetzung auftreten mitdaraus resultierender Erhöhung der HC- undRuß-Emission.Eine neuartige und effektivere Methode derKraftstoffzerstäubung zeigt sich durch denEinsatz von Doppelstrahl-Sprayinjektoren(Twin-Jets), die bereits in Vorstudien ihre Vorteileaufzeigen konnten. Die Zerstäubung desKraftstoffes ist bereits bei moderaten Drückensehr fein, zudem kann mit ihrem Einsatz dieSpraygeometrie sehr frei gestaltet und eineverbesserte Durchdringung des Brennraumserreicht werden. Eine Reduzierung der auftretendenDruckpulsationen im Einspritz -system ist durch Pulsationsdämpfer-Elementemöglich.Das vorliegende Projekt soll die Einsetzbarkeitder neuartigen Doppelstrahl-Sprayinjektorenund der Dämpferelemente für Ottomotorennachweisen, die wesentlichen Einflussparameteruntersuchen und eine Grundlage füreine zügige Industrialisierung der Technologiengeben.ProjektpartnerFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Technische Thermodynamikwww.ltt.uni-erlangen.deFMP TECHNOLOGY GMBHwww.fmp-technology.comGeiger Fertigungstechnologie GmbHwww.geiger-pretzfeld.deBMW GroupVorentwicklung Ottomotorenwww.bmwgroup.comRobert Bosch GmbHCR/AED2-SPGemischbildung Otto&Dieselwww.bosch.com79
Energie und UmweltIntelligenz im SolarglasNeue PROJEKTEProjektleitungEin Beispiel der Lichtkonversion für Si-Solarzellen: Konversion des blauen Lichtes zum grün-gelben Lichtmittels einer Scheibe mit einer 20 µm YAG:Ce-Leuchtstoff-SchichtFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl Werkstoffe der Elektronikund EnergietechnikMartensstr. 791058 ErlangenSolarzellen können nur einen Teil des Sonnenlichtspektrums nutzen. Ziel des Projekts ist es,durch eine Modifizierung dieses Spektrums eine Erhöhung des Wirkungsgrades vonSolarzellen zu erreichen. Das Projekt umfasst die Entwicklung von Leuchtstoffen undSchutzgläsern, die das Sonnenlicht an die spektrale Empfindlichkeit der Solarzelle anpassen.Projektpartner<strong>Bayerische</strong>s Zentrum für AngewandteEnergieforschung e. V.Abt. 3 Thermosensorik und Photovoltaikwww.zae-bayern.de/das-zae-bayern/standorte/erlangen.htmlCENTROSOLAR GLAS GmbH & Co. KGwww.centrosolarglas.comSeit Jahren ist ein Lösungsansatz bekannt,wie der Spektralbereich von Solarzellen erweitertwerden kann: Durch den Einsatz vonLeuchtstoffen sollen die Teile des Sonnenlichts,bei denen die Effizienz der Solarzelleniedrig ist, in jene Frequenzbereiche umgewandeltwerden, bei denen die Effizienz derSolarzelle hoch ist. In diesem Vorhaben istgeplant, sich mit der Umwandlung von hochenergetischen(Ultraviolett und Blau) in dieniedrig energetischen Quanten (z. B. Grünoder Rot), d. h. mit sog. Lumineszenz DownShifting (LDS), zu beschäftigen. ErheblicheReduzierungen der Effizienz bei vielen Typenvon Solarzellen unter 500 nm offenbaren dieVorteile der Modifizierung des Sonnenlichtspektrumsfür die Erhöhung des Wirkungsgradesvon Solarzellen.in Teilen der Beschichtung zu modifizieren.Im Rahmen dieses Projekts sollen effizienteLDS-Konverter entwickelt werden, deren Performancean den Stand der Technik anknüpftbzw. sie übertrifft, jedoch ohne die Nachteileder bisher berichteten Schichten. Die Projektpartnersind in der Lage, anorganischeLeuchtstoffe mit sehr hoher Effizienz wieauch Stabilität zu entwickeln. Darüber hinauslassen sich die Absorptions- bzw. Emissionsspektrender Leuchtstoffe an die spektrale Effizienzder Solarzellen anpassen. Außerdemkönnen die Leuchtstoffe und Beschichtungenso entwickelt werden, dass kaum Selbstabsorptionstattfindet.Gegenstand des Projekts ist also eine wissenschaftlich-technischeLösung der gewünschtenModifizierung des Sonnenlichtspektrumsin einem Teil der Solarzelle im Schutzglas.Dabei ist es bei der geplanten Anpassung desSpektrums nicht erforderlich, die etabliertenTechnologien der Herstellung des Solarglasesgrundsätzlich zu ändern, sondern nur80
Herstellung wärmeleitfähiger Zeolith/Kunststoff-Verbundwerkstoffefür Anwendungen inWärmetransformationsprozessenEnergie und UmweltZeolithischeAdsorbentienVerbundsystemeWärmeleitendeKunststoffeVerbundwerkstoffeNeue PROJEKTEZeolithschichtZeolithpartikelKunststoffKunststoffwärmeleitender Füllstoffwärmeleitender FüllstoffAdsorbersysteme mit erhöhter LeistungsdichteProjektLeitungSystematische Material- und Systemoptimierung zur Generierung von flexiblen Adsorbersystemen miterhöhter LeistungsdichteIm Forschungsprojekt werden Adsorbersysteme auf Basis von Verbundwerkstoffen auszeolithischen Sorptionsmaterialien und wärmeleitenden Kunststoffen hergestellt und fürihre Eignung in Wärmetransformationsprozessen getestet.Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Chemische Reaktionstechnikwww.fau.deProjektpartnerWärmetransformationsprozesse auf Basis vonAdsorptionsvorgängen werden bereits seiteinigen Jahren hinsichtlich ihres Potenzialsfür die Heizung und Klimatisierung von Gebäudenund Fahrzeugen wissenschaftlich erforschtund kontinuierlich in kommerzielleSysteme überführt. In den meisten Fällenjedoch werden bislang nur geringe Leistungsdichtenerzielt, weshalb sich Adsorptionswärmepumpenund -kälteanlagen noch nichtdurchgängig etablieren konnten. Hierbeikommt dem Stoffpaar Adsorbens-Adsorptivsowie deren Integration in die Adsorbereinheiteine erhebliche Bedeutung zu. GrundlegendeVoraussetzungen für eine hohe Effizienzsind neben einem großen Sorptionshubzwischen Ad- und Desorption im angestrebtenArbeitsbereich ein guter Wärmeübergangzwischen dem Adsorbens und der wärmeleitendenTrägerstruktur sowie ein schnellerDampftransport bzw. ein geringer Druckverlustinnerhalb des Systems bei gleichzeitiggeringer thermischer Masse.visionären Ausprägung könnten bauraumundleistungsoptimierte Adsorbersysteme mitgeringem Gewicht und unterschiedlichstenGeometrien entwickelt und für die Transformationvon Niedertemperaturwärme genutztwerden. Darüber hinaus würden sich günstigeMaterialkosten mit rationellen Formgebungsverfahrender Kunststofftechnik kombinierenlassen. Der wärmeleitende Kunststoff fungiertdabei als Trägermaterial mit hoher gestalterischerFreiheit, welche das anwendungs- undsystemangepasste zeolithische Adsorbensprozesssicher aufnimmt und gleichzeitig einenzielgerichteten Wärmetransport zum adsorberseitigenWärmeträgermedium ermöglicht.Clariant Produkte (Deutschland) GmbHKatalyselabor Heufeldwww.clariant.comDr. Collin GmbHGeschäftsführer Vertrieb,Service & Verfahrenstechnikwww.drcollin.deFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Kunststofftechnikwww.lkt.techfak.uni-erlangen.deSorTech AGMaterialentwicklungsortech.deRF Plast GmbHForschung und EntwicklungDie Entwicklung von Verbundwerkstoffen bzw.-systemen, bestehend aus Zeolith und wärmeleitendenKunststoffen, eröffnet neue Möglichkeitenim Adsorberdesign. In einer idealen,PTS Plastic Technology ServiceMarketing und Vertriebs GmbH81
Energie und UmweltTechnologische Grundlagen zur Herstellungvon SiC-Spannungswandlern für intelligenteStromnetze (SiC-WinS)Neue PROJEKTEProjektleitungLinks: Operator während des Beladens der Epitaxieanlage mit einem SiC-Wafer; rechts: Blick in denEpitaxiereaktor während des Beladens mit einem SiC-Wafer. (Bilder: Fraunhofer IISB / Kurt Fuchs)Fraunhofer-Institut für IntegrierteSysteme und BauelementetechnologieIISBSchottkystraße 1091058 ErlangenFür das Stromnetz der Zukunft werden energieeffiziente SiC-Hochvolt-Bauelemente benötigt.Deren Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit müssen weiter erhöht und Herstellungskostenreduziert werden. Im SiC-WinS-Projekt sollen dazu die technologischenGrundlagen geschaffen werden, indem die Epitaxietechnologie und die prozessbegleitendeQualitätssicherung weiterentwickelt werden.ProjektpartnerFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Angewandte Physikwww.lap.physik.uni-erlangen.deInfineon Technologies AGIPC TD SICwww.infineon.comIntego GmbHProjektierungwww.intego.deBei Solaranlagen und Servern sind energiesparendeWechselrichter bzw. Netzteile mitHalbleiterbauelementen aus Siliziumkarbid(SiC) Stand der Technik. Auch in Windkraftanlagenund dem intelligenten Stromnetz derZukunft soll Siliziumkarbid die heutigen Silizium-Bauelementeersetzen. Hierfür müssendie Herstellungskosten der SiC-Bauelementedeutlich gesenkt, ihre Leistungsfähigkeit aufbis zu 13 kV Sperrspannung erhöht und dieZuverlässigkeit im Sinne einer „Null-Fehler-Toleranz“ verbessert werden. Diese Zielewerden im Projekt „SiC-WinS – TechnologischeGrundlagen zur Herstellung von SiC-Spannungswandlern für intelligente Stromnetze“von Partnern aus Wissenschaft undIndustrie adressiert.Bei der Herstellung solcher SiC-Hochvoltbauelementeist die sogenannte Epitaxie einbedeutender Prozessschritt, der einen Großteilder Herstellungskosten verursacht undsowohl die Leistungsfähigkeit als auch dieZuverlässigkeit der Bauelemente maßgeblichbeeinflusst. Der bisher übliche Epitaxieprozesswird durch Zusatz von Chlorwasserstoffweiterentwickelt, wobei die Prozessdauer unddamit die Prozesskosten verringert werdensollen. Zugleich wird eine verbesserte Qualitätder Epitaxie angestrebt, was sich positivauf die Zuverlässigkeit der Bauelemente auswirkensoll. Ein neuartiger „Defektlumineszenz-Scanner“soll eine Lücke in der prozessbegleitendenQualitätssicherung schließen,sodass zukünftig defektbehaftete Bauelementefrühzeitig im Herstellungsprozess identifiziertund gezielt verworfen werden können.Hierdurch werden sowohl die Herstellungskostengesenkt als auch die Zuverlässigkeitder SiC-Bauelemente weiter verbessert.82
Konstruktiv materialtechnologische Verbesserungvon BetonfertigteilwandkonstruktionenEnergie und UmweltNeue PROJEKTEProjektleitungLinks: Prinzipmodell der Tragwirkung von Innen- und Außenschale; rechts: Oberflächenqualität undHaptik von Betonoberflächen (Fotos: Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde 2011)Auf dem Weg zum Null-Energie-Standard bei öffentlichen und privaten Gebäuden zeigendoppelschalige Betonfertig- und -halbfertigteilwandkonstruktionen großes Potenzial.Im Forschungsvorhaben sollen zwei konstruktive Ansätze untersucht werden.Technische Universität MünchenFakultät für ArchitekturLehrstuhl für Baukonstruktionund BaustoffkundeArcisstr. 2180333 MünchenDie Bautechnologie ist durch die Klimazieleder Bundesregierung und die europäischeRichtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäudengefordert, besonders gut gedämmte,einfache und robuste Außenwandsysteme zuentwickeln. Ab 2018/2019 sollen alle öffentlichenGebäude im Null-Energie-Standard erstelltwerden. Gebäude privater Bauherrensollen bis 2020 folgen.Doppelschalige Betonfertig- und -halbfertigteilwandkonstruktionenhaben großes Potenzialzur Optimierung. Hier sollen zweikonstruktive Ansätze untersucht werden: tragendeWände mit davor gehängter Schaleund zweischalige Verbundkonstruktionen.Für jede Variante werden unterschiedlicheAufbauten und Materialien für Schalen, Bewehrung,Verbund und Dämmung verglichen.Das Ziel ist ein minimaler Wärmedurchgangbei gegebener Wandstärke oder eine minimaleWandstärke bei gegebenen Dämmeigenschaften.Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen,wie Sockel, Dach, Öffnungen sollenskizziert und die Haptik der Oberfläche thematisiertwerden. Zusätzlich sollen Lösungenzur Verbesserung der Oberflächenqualitätvon Sichtbeton durch die Verbesserung derBetonmatrix und die Wahl von Zuschlägengefunden werden.ProjektpartnerRBW Rohrdorfer BetonwerkeGmbH & Co. KGwww.r-bw.deTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Massivbauwww.mb.bv.tum.deTechnische Universität MünchenFachgebiet Gesteinshüttenkundewww.cbm.bv.tum.de83
Energie und UmweltZink-Luft-Batterien als stationäre EnergiespeicherNeue PROJEKTEZn 2+ + 3OH - [Zn(OH) 3 ] -Zn Zn 2+ + 2e -70Zn 2+ + 4OH - [Zn(OH) 4 ] 2-Passivierung: 50[Zn(OH) 4 ] 2- ZnO + H 2 O + 2OH -// mA-0.530-100.51. Zyklus2. Zyklus3. Zyklus4. ZyklusWeiter Oxidation von noch nicht passiviertem ZinkZn Zn 2+ + 2e -Zn 2+ + 4OH - [Zn(OH) 4 ] 2-Zn 2+ + 2e - ZnU / V vs. Ag / AgClProjektLeitungECKART GmbHORDwww.eckart.deLinks: Elektrochemische Charakterisierung der entwickelten Materialien in kommerziell erhältlichenEL-Cells für Metall-Luft-Systeme; rechts: Elektrochemische Prozesse bei Ent- und Beladung einerZink-Batterie im alkalischen ElektrolytenWieder aufladbare Batterien, die Sauerstoff aus der Luft als Reaktionspartner nutzenkönnen, sind das Zukunftsziel moderner Batterieentwicklung. Zink als Anodenmaterialist dabei besonders interessant.ProjektpartnerFraunhofer-Institut für SilicatforschungISCZentrum für Angewandte Elektrochemiewww.isc.fraunhofer.deUniversität BayreuthLehrstuhl Werkstoffverarbeitungwww.lswv.uni-bayreuth.deVARTA Microbattery GmbHR&Dwww.varta-microbattery.comMit Zink als Anodenmaterial könnte einehöhere theoretische Energiedichte erreichtwerden als bei Lithium-Ionen-Batterien fürden mobilen Einsatz. Und auch für große stationäreBatterien ist Zink als stoffliche Grundlageinteressant, denn es ist industriell weitverbreitet und preiswert im Vergleich zu anderenBatteriematerialien. Trotz zahlreicherInitiativen ist es jedoch bisher nicht gelungen,stabile wiederaufladbare Zink-Luft Batterienzu entwickeln. Die Herausforderungensind vielfältig: bei Batterie-Komponenten undneuen Batteriestrukturen, mit denen die Luftzufuhrkontrolliert wird, aber auch bei derEntwicklung von Materialien für bisher nichtrealisierbare elektrochemische Prozesse, dieeine hohe Reversibilität der Oxidations- undReduktions-Reaktion und eine strukturelleStabilität der Batterie ermöglichen sollen.Hier setzt das ZiBa-Vorhaben an. Die beteiligtenInstitute und Industriepartner bündelnihre Kompetenzen im Bereich nanoskaligerBeschichtungen, metallischer Composit-Materialienund katalytisch aktiver Gas-Diffusions-Elektrodenmit der Verfahrens- undProzess-Kompetenz der Zink-Luft-Mikrobatteriemit dem Ziel, für die Zink-Anode unddie katalytisch aktive Kathode eine hoheReaktions-Reversibilität bei maximaler Materialnutzungzu erzielen. Strukturveränderungund eine Verringerung der Anzahl elektrischund katalytisch aktiver Transportpfade sollendurch Einsatz neuer Materialien unterbundenwerden.Die Eignung der neuen Materialien wird zunächstim Labormaßstab untersucht, mit entsprechenden„Luft-Messzellen“, wie im Bildo. l. dargestellt. Die Irreversibilität der bekannten,im Bild o. r. gezeigten elektrochemischenProzesse, die auf der Anodenseiteablaufen, wird durch Materialentwicklungbehoben. Das Projekt soll innerhalb von zweiJahren erste Hinweise liefern, welches Potenzialdie neuen Materialien und Strukturen fürdie Realisierung einer auch industriell umsetzbarenZink-Luft-Sekundärbatterie-Technologiebieten.84
Effizienter Breitband-LeistungsverstärkerInformations- undKommunikationstechnologienNeue PROJEKTEConstant Supply VoltageEnvelopeShapingDigitalAnalogEnvelopeModulatedPowerSupplyInputSignalEnvelopeDetectionDPD /LinearizationSystemIdentificationAnalogDigitalDigitalAnalogDownConversionUpConversionFeedbackOutputSignalBasebandProjektLeitungPrinzip des Envelope Trackings für BreitbandverstärkerModerne Funksysteme stellen immer höhere Anforderungen an Sendeverstärker, die zuhöherem Stromverbrauch führen. Im Rahmen des Projekts sollen hocheffiziente undbreitbandige Leistungsverstärker mit neuen Technologien entwickelt und aufgebaut werden.Fraunhofer-Institut für IntegrierteSchaltungen IISAbteilung HochfrequenzundMikrowellentechnikwww.iis.fraunhofer.deSteigende Nutzeranforderungen und zunehmenderDatenverkehr stellen immer höhereAnforderungen an künftige Mobilfunksysteme.Hinzu kommt, dass die benötigte Energiefür die notwendige Infrastruktur (z. B.die Basisstationen) in Zukunft signifikant reduziertwerden soll. Um trotzdem den steigendenAnforderungen gerecht zu werden,bedarf es einer kontinuierlichen Weiterentwicklungder Schlüsselkomponenten.Im Rahmen dieses Projekts soll ein effizienterHF-Leistungsverstärker entwickeltwerden, der den steigenden Anforderungenan die Bandbreite und die spektrale Effizienzzukünftiger Funkstandards genügt.So sollen zwei Leistungsverstärker im UHF-Bereich bzw. einer im S-Band mit Ausgangsleistungenvon 40 Watt oder größer entwickeltwerden, die einen deutlich höherenWirkungsgrad als existierende Systeme aufweisen.Die Effizienz der Verstärker soll umFaktor 1,5 bis 2, abhängig vom Frequenzbereich,verbessert werden. Da die Verstärkermit komplexen OFDM-Signalen betriebenwerden sollen, dürfen die zu verstärkendenSignale nahezu nicht verzerrt werden, waseine weitere große Herausforderung darstellt.Gerade bei modernen OFDM-Modulationsverfahrensind hierbei deutlich Einsparungenzu erwarten.Dies soll durch die Implementierung der Verfahren„Envelope Tracking“ und „Vorverzerrung“in Verbindung mit den neuesten HF-Verstärkertechnologien realisiert werden. Umdie Effizienz des Verstärkers deutlich zu steigern,wird beim Verfahren des „Envelope Trackings“zur Verringerung der Stromaufnahmedie Versorgungsspannung des Verstärkersdurch ein spezielles Schaltnetzteil mit derHüllkurve des Sendesignals moduliert. Durcheine „digitale Vorverzerrung“ wird das zusendende Signal unter Berücksichtigung dernichtlinearen Eigenschaften der Endstufe soverändert, dass die signalstörenden Einflüssedes Verstärkers kompensiert werden könnenund insgesamt eine hochlineare Endstufe realisiertwerden kann.ProjektpartnerHochschule RosenheimStudiengang Elektro- undInformationstechnikKathrein-Werke KGwww.kathrein.deRohde & Schwarz GmbH & Co. KGGeschäftsbereich Funkkommunikationssystemewww.rohde-schwarz.com85
Informations- undKommunikationstechnologienMuSe BayreuthNeue PROJEKTEProjektleitungDeutsches Zentrum für Luft- undRaumfahrt e. V. (DLR)Robotik und Mechatronik Zentrum, RMCwww.dlr.de/rmLinks: Die Fürstenloge im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth; rechts: 3D Modell auf der Basis vonLaserscanner-Daten. In einem zweiten Arbeitsschritt wird die 3D-Auflösung der Oberflächen vonca. 3 mm mittels einer speziellen Kamera auf 0,5 mm erhöhtDas seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Markgräfliche Opernhaus inBayreuth soll im Projekt hochgenau fotorealistisch in 3D modelliert werden. Ziel desVorhabens ist die Entwicklung und Erprobung durchgängiger Hard- und Software-Werkzeuge für eine authentische, multiskalige, multisensorielle 3D-Modellierung aufden Gebieten der Industrie, der Kultur, des Umweltschutzes und des Tourismus.Projektpartner<strong>Bayerische</strong> Verwaltung der staatlichenSchlösser, Gärten und SeenBauabteilungwww.schloesser.bayern.dePCO AGEntwicklungsabteilungScanTec 3D GmbHwww.scantec3d.deSunpatrolwww.zf-laser.comZ+F Zoller+Fröhlich ElektrotechnikGmbHZur dreidimensionalen Erfassung und Dokumentationgrößerer Strukturen oder ganzerRaumabfolgen in Architektur und Denkmalpflegewerden heute Laserscanner (auch Laserradar)eingesetzt. Diese Systeme arbeitenmit mittleren Punktfehlern im Bereich von ca.+/- 2 mm. Mit zunehmender Komplexität derRaumstruktur und wenn das bauliche Gefügeund die künstlerische Ausstattung einesRaumes kaum noch zu trennen sind, steigtdie Anforderung an Genauigkeit und Auflösungeiner 3D-Dokumentation auf Bereichedeutlich unter 0,5 mm, wobei auch die exaktefarbliche Erfassung erforderlich ist. Bei Objektenvon einigen 1.000 m³ Ausdehnung, dieeine Arbeit von Gerüsten oder Höhenplattformenaus erforderlich macht, ergibt sich dadurchein erheblicher Aufwand, um eine ungewollteEigenbewegung des Sensors bei derAufnahme zu unterdrücken und ein genauesTracking der Sensorposition sicherzustellen.Hier setzt das Forschungsvorhaben mit einemzweistufigen Verfahren an, bei dem zunächstmit einem Laserscanner ein 3D-Modell desganzen Objektes im Bereich von 2 mm Auflösungerstellt wird. Dieses Modell wird miteinem selbstreferenzierenden, photogrammetrischenSystem verfeinert, das ohne externeLagemessung und ohne aktive Beleuchtungmit Mustern u. Ä. auskommt. Die Sensorpositionund die 3D-Punktewolke werden dabeidirekt aus den Kamerabildern bestimmt. Fürdie Berechnung der dichten 3D-Punktewolkenwird das SGM-Verfahren des DLR alsMulti-Bild-Matching-Methode eingesetzt. ImGegensatz zu Laserscannern oder anderenSensoren mit aktiver Beleuchtung wird beider 3D-Rekonstruktion aus Kamerabildern dievorhandene Texturinformation benutzt.Die Vorteile von passiven 3D-Sensorsystemensind die Flexibilität des Arbeitsbereichsund die Robustheit bezüglich Beleuchtungseinflussund Eigenbewegung des Sensors.Dies wird durch die hohe Bilddynamik von20.000:1 der sCMOS-Bildwandler-Technologiein dem 3D-Handsensor noch unterstützt.86
Faseroptische Gigabit-Übertragungsstreckemit seitlicher Einkoppelung (GigaFluo)Informations- undKommunikationstechnologienNeue PROJEKTEGrüner Laser bringt die farbstoffdotierte Faser zum LeuchtenProjektleitungIm Fokus des Forschungsprojekts GigaFluo steht die Gigabit-Datenübertragung mitfluoreszierenden Fasern.Georg-Simon-Ohm-Hochschule fürangewandte Wissenschaften NürnbergInstitut POF-ACKesslerplatz 1290489 NürnbergIn vielen Anwendungen ist es notwendig,Daten zwischen einem rotierenden Systemteilund einem feststehenden Systemteil zuübertragen. Beispiele dafür sind Computertomographen,Gepäckscanner an Flughäfen,Fertigungsanlagen, Industrieroboter, Windkraftwerkeund Radarantennen. Diese Aufgabewird von sogenannten Drehübertragern erledigt.Zunehmend werden für Anwendungenmit sehr hohen Datenübertragungsraten, imBereich von mehreren Gigabit/s, „faseroptischeDrehübertrager“ eingesetzt. Diese ermöglichenes, die herausragenden Vorteileder faseroptischen Übertragungstechnik,nämlich hohe Datenraten und extreme Störsicherheit,auch über die rotierende Schnittstellehinweg zu gewährleisten. Die Mengeder Daten steigt jedoch enorm, und derzeitigeLösungen sind in absehbarer Zeit den Anforderungennicht mehr gewachsen oder nichtzu akzeptablen Kosten herstellbar.schnellerer und stabilerer Farbstoffe, diemaßgeschneidert in Absorptions- und Emissionsverhaltenan verfügbare Sender und Empfängerangepasst werden, durch Anwendunghöherer Codierungs- und Fehlerkorrekturverfahrenin Anlehnung an VDSL-Techniken unddurch verbesserte laterale Einkopplung desSignallichts in die Faser. Der Industriepartnerist verantwortlich für die komplette mechanischeStruktur und wird die Drehübertrager,die in der finalen Version mindestens 1 mfreien Innendurchmesser haben sollen, in anwendungsnahenTestaufbauten unter realenBedingungen prüfen.ProjektpartnerHochschule für angewandte WissenschaftenCoburg IPMLudwig-Maximilians-Universität MünchenFakultät für Chemie und Pharmaziewww.cup.uni-muenchen.de/dept/ch/oc/langhals.phpVenturetec Mechatronics GmbHFasern, die mit fluoreszierenden Farbstoffendotiert sind, erlauben die seitliche Einkopplungder zu übertragenden Information. Diebisher geltende Limitierung auf etwa 600Mbit/s pro Kanal soll innerhalb des Projektsum den Faktor 10 angehoben werden. Diessoll erreicht werden durch die Entwicklung87
Life Sciences/MikrosystemtechnikThermophorese für die ProteinformulierungNeue PROJEKTEProjektleitungLudwig-Maximilians-Universität MünchenDepartment Pharmazie, PharmazeutischeTechnologie und BiopharmazieButenandtstr. 5, Haus B81377 MünchenDie mikroskalige Thermophorese nutzt IR-Laser-induziertes Heizen, um mit höchster Präzisionund Reproduzierbarkeit einen mikroskaligen Temperaturgradienten in flüssigkeitsgefülltenKapillaren zu erzeugenZiel dieses Vorhabens ist, die mikroskalige Thermophorese (MST) als eine zuverlässigeanalytische Methode für die industrielle Proteinformulierungsentwicklung zu etablieren.MST ist in der Lage, in kürzester Zeit sehr kleine Probenmengen zu messen und dadurchVeränderungen in der Proteinbindung, Aggregation und Proteinhydration zu detektieren.ProjektpartnerNanoTemper Technologies GmbHIn den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutungvon Biopharmazeutika und insbesondere rekombinanterProteine enorm zugenommen,sodass der Anteil an biopharmazeutischenProdukten inzwischen schon mehr als 15 %des Gesamtumsatzes an Arzneimitteln ausmacht.Ein wichtiger Aspekt während derEntwicklung eines Proteinarzneimittels istdie Auswahl der richtigen Formulierung.Ziel dabei ist es, die Proteinstabilität unterdem Einfluss von Hitze und Licht sowie chemischenund mechanischen Belastungenwährend der Transport- und Lagerungszeitensicherzustellen. Proteine sind sehr empfindlicheund komplex aufgebaute Makromolekülemit definierten Strukturen, die durchchemischen und/oder physischen Zerfall ihreWirksamkeit verlieren können.hauptsächlich von der Molekülgröße, derLadung und der Hydrationshülle eines Proteinsbeeinflusst wird. Somit wirkt sich jedeVeränderung der primären, sekundären, tertiärenund/oder quartären Struktur von Biomolekülenauf ihre thermophoretische Beweglichkeitaus und ermöglicht es, Änderungenin ihrer Hydrationshülle, Bindungsaffinitätsowie der Partikelgröße unter natürlichen Bedingungenzu bestimmen. MST bietet daherneue Chancen und Möglichkeiten zur Auswertungund Vorhersage von Proteinstabilitäten,um den Bedarf nach leistungsfähigerenanalytischen Methoden zu decken.Trotz des wesentlichen Fortschritts beim Verständnisund der Kontrolle von Proteinstabilitätengibt es immer noch viele analytischeHerausforderungen. Die Charakterisierungvon Proteinen mittels MST ist sehr erfolgversprechend,da die Methode die Bewegungvon Proteinmolekülen in laserinduziertenmikroskaligen Temperaturgefällen misst, die88
Tumortherapie durch Triomab/anti-CTLA-KombinationLife SciencesZytolyseApoptoseNeue PROJEKTETumorzelleCTLA-4CTLA-4T-ZelleEpCAM oder GD2CD3AktivierungADCCPhagozytoseApoptoseFcg-RCD40L / CD28 / CD2CD40 / B7.1-2 / LFA-3IL-1, IL-2IL-12, IL-6TNF-a, IFN-gDC-CK1GM-CSFFcg-RI + , RIIa + oder RIII + Antigenpräsentierende ZellenMakrophagen, Dendritische Zellen, Natürliche KillerzellenPhysiologischeCo-StimmulierungQuelle: Ruf und Lindhofer, Blood 98: 2526 (2001)ImmunisierungtrAKanti-EpCAM x anti-CD3anti-GD2 x anti-CD3mAKanti-CTLA-4ProjektleitungKombinierte bzw. sequenzielle Tumortherapie mit jeweils trifunktionalen bispezifischen(anti-EpCAM x anti-CD3 bzw. anti-GD2 x anti-CD3) Antikörpern (trAk) und einem monoklonalenmonospezifischen anti-CTLA-4-Antiköper (mAk)Durch Kombination von zwei Antikörpern mit unterschiedlicher Wirkung aufT-Zellen sollen lang anhaltende tumorspezifische Immunantworten in experimentellenTiermodellen hervorgerufen werden.TRION Research GmbHScientific AffairsAm Klopferspitz 1982152 MartinsriedEine CTLA4-Blockade könnte den Immunisierungseffektvon trifunktionalen bispezifischenTriomab ® -Antikörpern gegenüber Tumorenweiter verstärken. In Maus-Tumormodellensoll mittels trifunktionaler bispezifischer Antikörper,die gegen ein tumorassoziiertesAntigen (GD2 oder EpCAM) bzw. gegen dasT-Zell-Antigen CD3 gerichtet sind, in Kombinationmit einer Blockade des inhibitorischenT-Zell-Oberflächenmoleküls CTLA-4 eine zelluläreMikroumgebung im Tumorgewebe generiertwerden, die die Induktion protektivertumorspezifischer T-Zellantworten stimuliert.Diese In-situ-Immunisierung – ähnlich einerautologen Tumorimpfung – soll den Grundsteinfür ein vollkommen neues personalisiertesBehandlungskonzept in der Onkologielegen und dabei die Therapie mit einer Vakzinierungverbinden.CTLA4-Hochregulierung auf den T-Zellen selektivam Ort des Tumors abläuft. Daher solltedie konzertierte Immunmodulation auf T-Zell-Ebene durch ein engmaschiges Monitoring-Programm im Tiermodell begleitet werden,um mögliche pathologische Veränderungenzeitnah erkennen zu können. Mit Projektstartim August 2012 wurde begonnen, sämtlichetherapeutischen Antikörper, die für die experimentelleTumortherapie benötigt werden, inausreichender Menge herzustellen, zu charakterisierenund funktionell zu analysieren,um die geplanten In-vivo-Experimente zügigdurchführen zu können.ProjektpartnerHelmholtz Zentrum MünchenInstitut für Molekulare Immunologiewww.helmholtz-muenchen.de/imiGenerelles Ziel dieses tierexperimentellenProjekts ist die immunologische Analyseder protektiven Tumorantwort sowie diebegleitende Risiko-Nutzen-Abwägung deranti-CTLA4/anti-CD3-Kostimulation von T-Zellen. Das Nebenwirkungsrisiko von anti-CTLA4-Antikörpern könnte reduziert werden,weil die T-Zell-Aktivierung und damit eine89
Life SciencesComputerassistierte histologische Befundung amBeispiel von Knochenmark- und Lymphknotenuntersuchungen– PathoMapsNeue PROJEKTEZentrale LandmarkeLandmarkeGewebe ID=7Biopsie ID=3Biopsie ID=1LandmarkenID=-3LandmarkeLandmarkeRotation = 100.18 GradProjektleitungDarstellung einer vollautomatischen Ausrichtung und Zuordnung unterschiedlich gefärbter Schnittpräparate(vorausgegangene Evaluierung, Nadelbiopsien eines Mammakarzinoms)Definiens AGResearchwww.definiens.comDas Forschungsprojekt PathoMaps hat die Entwicklung eines Softwareprototyps fürein neuartiges Gewebeerkundungssystem für den potenziellen Einsatz in der klinischenPathologie zum Ziel.ProjektpartnerLudwig-Maximilians-Universität MünchenPathologisches InstitutDie Krebsdiagnostik versucht heute, die Komplexitätund Heterogenität jeder Tumorerkrankungso präzise wie möglich zu erfassen.Dies geschieht durch eine zunehmende Subtypisierungvon Tumorgruppen aufgrund biologischerErkenntnisse. Hierdurch gelingtes, die Prognose und den besten Behandlungswegzu definieren und eine individualisierteKrebstherapie festzulegen. Die histomorphologischeAnalyse eines Tumorfallserfordert für die Subtypisierung inzwischendie Auswertung zahlreicher Serienschnitteund immunhistochemischer Färbungen. NeueMethoden, die eine hohe Parallelität der Auswertung,die Erfassung von Koexpressionendiagnostisch relevanter Biomarker sowie eineQuantifizierung von Expressionsstärke undder Zahl positiver Zellen ermöglichen, sinddaher dringend erforderlich.gefärbten Gewebeschnitten ermöglicht (Abbildungoben). Auf dieser Grundlage soll mitHilfe einer rechnergestützten Navigation innerhalbdieser Schnitte ein System für die Unterstützungder Diagnose entwickelt werden,das qualitative und quantitative Parameterverschiedener histologischer und immunhistologischerFärbungen auswertet und demPathologen in Form einer selektiven Gesamtdarstellungzugänglich macht. Diese Informationenstellen die Basis für eine verbesserte,differenzierte Krebsdiagnose dar.Hier setzt das Forschungsprojekt an. Ziel istdie Entwicklung eines Softwareprototyps fürein neuartiges Gewebeerkundungssystemfür den potenziellen Einsatz in der klinischenPathologie. Die technische Realisierung desForschungsprojekts basiert auf der Entwicklungeines Softwareprototyps, der ein vollautomatischesAusrichten von unterschiedlich90
Automatisierung der elektromechanischenReanimationshilfeLife SciencesController 2Steuerung des therapeutischen GesamtkonzeptsNeue PROJEKTEController 1MotorregelungSensorikElektromech.ReanimationElektrotherapieMedikamenteProjektleitungLinks: Hierarchisches Regelungskonzept der elektromechanischen Reanimationshilfe. Ein untergeordneterController (1) regelt die Motorfunktion, Eindrucktiefe und Druckfrequenz der elektromechanischenReanimationshilfe; rechts: Funktionsmuster der elektromechanischen Reanimationshilfe. Das Gerätzeichnet sich durch eine variable, an den Patienten adaptierbare Kompressionseinheit ausIm Zentrum des Forschungsvorhabens steht die Optimierung einer elektromechanischenReanimationshilfe, um in Notfallsituationen die optimale Versorgung des Patienten nachdessen individueller Kreislaufsituation zu gewährleisten und das Notfallpersonal zu entlasten.Deutsches Herzzentrum MünchenKlinik für Herz- und GefäßchirurgieLazarettstr. 3680636 MünchenIn Deutschland sterben jährlich bis zu 200.000Menschen am plötzlichen Herztod. Mit derderzeitig üblichen manuellen Herzdruckmassagewird der Kreislauf bis zum Einsetzen dereigenen Herztätigkeit aufrechterhalten. Dieserfordert einen hohen körperlichen Einsatzund führt selbst bei geschultem Personal zuErmüdungserscheinungen und folglich zurAbnahme der Reanimationsqualität. Derzeitverfügbare mechanische Reanimationshilfenunterstützen das Notfallpersonal, müssenaber ständig überwacht werden. Das Forschungsprojektsoll die Grundlagen für eineAutomatisierung der elektromechanischenReanimationshilfe schaffen. In der hektischenNotfallsituation soll so die optimale Versorgungdes Patienten nach dessen individuellerKreislaufsituation gewährleistet und das Personalentlastet werden.elektrischen/mechanischen Herzaktion zukonzipieren. Es werden Regler entworfen, diesich laufend an die individuellen Bedürfnisseanpassen und optimieren. Hierdurch soll einefür den Patienten individuell optimale Therapieermöglicht werden. Die Entwicklung undValidierung erfolgt anhand eines zu erstellendenvirtuellen und physikalischen Modellsder Reanimationshilfe und des Herzkreislaufs.ProjektpartnerGS Elektromedizinische GeräteG. Stemple GmbHTechnische Universität MünchenInformatik 6, Roboticsand Embedded SystemsIm Zentrum des Forschungsvorhabens stehtdie Optimierung einer elektromechanischenReanimationshilfe. Geplant ist, ein geeignetesSensorkonzept zur Echtzeit-Überwachung derVitalparameter und darauf aufbauend eineAutomatisierung der Drucktiefe und Druckentlastungsowie der Kompressionsfrequenzin Abhängigkeit der Gehirnperfusion und der91
Life SciencesEin extravaskuläres HerzunterstützungssystemNeue PROJEKTETraeger-SchaleAugmentationskissenProjektleitungAdjucor GmbHLichtenbergstraße 885748 GarchingLinks: Darstellung eines Sagittalschnittes eines menschlichen Herzens aus einer Computertomographie.Die rote Linie kennzeichnet die Herz-Längsachse; rechts: Schnitt durch eine idealisierte Herzgeometriemit linker und rechter Herzkammer. Darstellung einer Augmentierungseinheit am rechten VentrikelDie terminale Herzinsuffizienz ist aus medizinischer und ökonomischer Sicht von großer undwachsender Bedeutung. In der nächsten Dekade könnten weltweit 23 Mio. Menschen an derHerzinsuffizienz leiden, mit einer jährlichen Neuerkrankungsrate von 2 Mio. Menschen.ProjektpartnerFachgebiet Mechanik aufHöchstleistungsrechnernTechnische Universität Münchenwww.tum.deDie gegenwärtigen Unterstützungssystemesind komplex und können nur mit einer aufwendigenchirurgischen Operation implantiertwerden. Sämtlich werden sie in den Blutkreislaufder Patienten integriert. VerbesserteZentrifugalpumpen und magnetisch gelagerteImpeller-Systeme befördern das Blut kontinuierlich.Der Kontakt des Blutes mit der körperfremdenOberfläche der Systeme stellt einegroße technische und medizinische Herausforderungdar. Gängige Komplikationen sindSchlaganfälle, Blutungen und Infektionen. Sieführen nicht selten zur Langzeithospitalisierungund zu häufigen Wiederaufnahmen bereitsentlassener Patienten. Auch die damitverbundene ökonomische Problematik ist sehrgroß, die Kosten für ein solches System betragenca. 150.000 bis 200.000 Euro pro Patient.Verhaltensweisen und Funktionen unterschiedlicherMaterialien, Formen und Größensolcher Augmentationseinheiten. Die in denSimulationen erhobenen Ergebnisse erfahreneine anschließende Verifizierung am isoliertenHerzmodell und in vivo. Die an denrealen Herzen erhobenen Daten dienen wiederumder Verbesserung der nachfolgendenSimulationsschritte. Dieser vollständig unerforschteAspekt der extravaskulären Herzunterstützungstellt einen notwendigen und signifikantenMeilenstein im Verständnis derInteraktionen zwischen Herz und körperfremdemMaterial dar.Das vorliegende Projekt erforscht einen bisdato unbekannten, aber zwingend notwendigenSachverhalt zur Realisierung eines extravaskulärenHerzunterstützungssystems.Das Verhalten des Herzens und des Herzgewebesbei einer von außen wirkenden Kraftist unbekannt. Der zentrale Schwerpunkt desbeantragten Projekts ist die komplexe undumfassende simulationsbasierte Analyse von92
Entwicklung der Herstellungvon Ga-68-GeneratorenLife SciencesNeue PROJEKTEHOHOHOOO10CH 3ProjektleitungLinks: [68Ga]DOTA-DPhe1-Tyr3-Octreotide-Image von neuroendokrinen Tumoren mittels PET/CT (rechts),verglichen mit 111In-octreoscan ® SPECT (Mitte) und 18F-FDG PET (links) (PD Dr. Dr. H. Bihl, Stuttgart);rechts: Struktur des neuen Ge-spezifischen HarzesIsotope Technologies Garching GmbHLichtenbergstr. 185748 GarchingMit der Entwicklung der Produktionstechnologie eines neuen 68Ge/68Ga-Generators wirdder Onkologie ein deutlich effektiveres Werkzeug zur Diagnose von Tumorerkrankungenzur Verfügung gestellt.68Ga, das mit der Halbwertszeit von 68 minzu 89 % unter Aussendung eines Positronszum stabilen 68Zn zerfällt, besitzt einen essenziellenVorteil gegenüber herkömmlichenPET-Radiopharmaka: die unmittelbare Verfügbarkeitdes im radiopharmazeutischenLabor durch ein 68Ge/68Ga-Generatorsystem(Halbwertszeit von 68Ge = 271 d) gewonnenenNuklids. Insbesondere eignetsich 68Ga zur Diagnose von neuroendokrinenTumoren. Da diese Tumore den Somatostatinrezeptorverstärkt exprimieren,erlauben 68Ga-markierte Somatostatinanalogawie z. B. 68Ga-DOTA-Octreotid-Derivateeine exzellente Tumorvisualisierung miteiner verbesserten Qualität gegenüber konventionellenMethoden. Trotz einer weltweitsteigenden Nachfrage existiert jedoch zurzeitkein zugelassener 68Ge/68Ga-Generator.eines Montagekonzepts zur Herstellung vonsterilen Generatoren. Ein kritischer Schritt istdabei die Dampfsterilisation der Generatoren,da das Mutternuklid 68Ge leicht flüchtig istund das Produkt sowie die Anlage kontaminierenkann. Eine zwingende Randbedingungist, dass sowohl bei der Entwicklung der Herstellungstechnologieals auch beim Betriebder Generatoren die rechtlichen und regulatorischenRahmenbedingungen beachtetwerden, um in der späteren Umsetzung derProzesse die GMP-Richtlinien zu erfüllen undeine nachfolgende pharmazeutische Zulassungzu ermöglichen.ProjektpartnerTechnische Universität MünchenInstitut für Werkzeugmaschinen undBetriebswissenschaften (iwb)www.iwb.tum.deIm Projekt wird die Produktionstechnologieeines neuartigen GMP-gerechten 68Ge/68Ga-Generators entwickelt. Innerhalb der Projektlaufzeitsoll eine Methode zur Produktion vonneuartigen, sterilen 68Ge/68Ga-Generatorenerarbeitet werden. Dies umfasst im Wesentlichendie Weiterentwicklung des aktuellenGeneratordesigns sowie die Entwicklung93
Life Sciencesi3 Screen – in vitro Impedanz Screening SystemNeue PROJEKTEMUXZell-Substrat ImpendanzDACOhmmVMUXADCExtrazelluläres PotentialADC2100 100 200 300 400 500 600 … Zeit [ms]ProjektleitungNanion Technologies GmbHGabrielenstr. 980636 Münchenwww.nanion.deSynchron schlagende Herzmuskelzellen in Kultur modulieren die Eigenimpedanz und das elektrischePotenzial der überwachsenen Mikroelektrode, die extern über eine analoge Messtechnik abgetastetwerden sollDas Forschungsprojekt hat zum Ziel, ein neues bioelektrisches Testsystem für spontankontrahierende Herzmuskelzellen (Kardiomyozyten) in der In-vitro-Diagnostik zu entwickeln.ProjektpartnerTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Medizinische ElektronikDie Entstehung neuartiger Pharmaka vollziehtsich in einer geregelten Abfolge von Entwicklungs-und Screening-Stufen. Sie beginnt mitder Phase der „Forschung“ (geprägt durchprimäres Screening mit Wirkstoffsuche undIdentifikation von Targets), gefolgt von „vorklinischerErprobung“, „klinischen Studien“und schließt mit der Phase der „Patentierungund Vermarktung“ ab. Bis ein Präparat somitverkauft oder lizensiert werden kann, verstreichenoft mehrere Jahre, und es können Gesamtkostenin der Größenordnung von bis zu1 Mrd. Euro entstehen. Kardiale Nebenwirkungender Pharmaka (wie sie sich beispielsweisein Form einer Verlängerung des QT-Intervallsim Elektrokardiogramm zeigen) sindhäufige und spät erkannte Hinderungsgründeeiner Neuzulassung, da sie ein hohes Risikopotenzialfür lebensbedrohliche Auswirkungenwie Herzflimmern oder Infarkte mitsich bringen.durch die zyklische und synchronisierte Zellkontraktionmodulierte Bioimpedanz und dieAktionspotenziale der Zellen sollen mit höchsterzeitlicher Auflösung gemessen werden,um die durch kardioaktive pharmakologischeSubstanzen ausgelösten Arrhythmien sensitivzu erkennen. Solche Assays an Zellkulturmodellenin der Frühphase der Entwicklungneuer Wirkstoffe sind äußerst wichtig, umFehlinvestitionen zu vermeiden.Leistungsfähige In-vitro-Testmodelle für einefrühzeitige Erkennung solcher möglicher Nebenwirkungensind daher äußerst wichtig.Das wissenschaftliche Ziel des Projekts ist einneues bioelektrisches Testsystem für spontankontrahierende Herzmuskelzellen (Kardiomyozyten)in der In-vitro-Diagnostik. Die94
In-vitro-Diagnostik mit einem gepulstenelektrochemischen Verfahren – SMART-ScanLife SciencesNeue PROJEKTEIn-vitro-Diagnostik mit dem SMART-ScanProjektleitungMit dem SMART-Scan soll ein neues elektrochemisches Verfahren zur In-vitro-Diagnostikentwickelt werden. Das Verfahren basiert auf einer Multiparameteranalyse, bei dermehrere Analyten gleichzeitig detektiert werden.Das Vorhaben zielt auf die Entwicklung einesneuen konzeptionellen Ansatzes zur Multiparameter-Erfassungaus Vollblut und anderenKörperflüssigkeiten. In diesem Projekt wirdein neuartiges Messverfahren entwickelt, dassich durch folgende Eigenschaften von denauf dem Markt vorhandenen Systemen unterscheidet.Der neuartige Schichtaufbau des Biosensorserlaubt das zeitgleiche Verarbeitenvon mehreren Messparametern. Dazu werdenin der bioaktiven Membran des Testsystemsenzymatisch aktive Pasten mittels eines Siebdruckverfahrensaufgebracht. Es wird ein gepulstesamperometrisches Messverfahrenangewandt, um Störfaktoren in den Flüssigkeitenzu eliminieren.Helmholtz Zentrum MünchenInstitut für StrahlenschutzIngolstädter Landstraße 185764 NeuherbergProjektpartnerDiabetes online AGwww.d-on.bizAls aussichtsreiche Anwendungsfelder werdenevaluiert: Blutzucker- und Cholesterinbestimmungzur Anpassung einer diabetischenDiät, Laktatmessung für sportmedizinischeFragestellungen sowie Trächtigkeitsmessungbei Kühen durch Bestimmungdes Progesteronwerts.95
Life SciencesGenerierung und Charakterisierung von innovativenmonoklonalen anti-ErbB-Rezeptor-Antikörpernmit erhöhtem therapeutischem PotenzialNeue PROJEKTE1. Kaninchen Immunisierung 2. Zellsortierung & Kokultivierung3. Hochdurchsatz ScreeningMehrfache B-Zell Gewinnung Isolierung von B-Zell Klonen Screening von B-Zell Überständenauf IgG / Antigen Bindung5. Expressionsanalytik4. Sequenzierung & KlonierungHunderte rekombinantexprimierte, monoklonaleAntikörper fürWirksamkeitstestungExpression in HEK293 ZellenReinigung, AnalyseSequenzierung "variabler" RegionenKlonierung in humane "konstante" RegionenProjektleitungWorkflow des Generierungsprozesses monoklonaler AntikörperUniversität RegensburgKlinik für Frauenheilkundeund Geburtshilfe(Schwerpunkt Frauenheilkunde)Caritas Krankenhaus St. JosefLandshuterstraße 6593053 Regensburgwww.caritasstjosef.de/forschung/node_3376.htmBei Therapien mit anti-ErbB-Rezeptor-Antikörpern gegen maligne Erkrankungen sindhäufig Resistenzen zu verzeichnen. Die Entwicklung von innovativen, hochaffinenanti-ErbB-Antikörpern mit multivalenter ErbB-Rezeptor-Bindungsspezifität und pleiotroperAktivität verspricht, ein insuffizientes Therapieansprechen überwinden zu können.ProjektpartnerAgrobiogen GmbHwww.agrobiogen.deMAB Discovery GmbHwww.mabdiscovery.comErbB-Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (RTK) repräsentierenzellmembranständige therapeutischeZielstrukturen bei verschiedenenKrebserkrankungen, darunter Hals- und Kopftumoren,Entartungen des Magen-Darm-Trakts und das Mammakarzinom. Die ErbB-RTK können mit monoklonalen Antikörpern,die hochspezifisch an diese Rezeptorenbinden, aufgespürt werden, womit das Tumorwachstumstark inhibiert und im optimalenFall ganz unterbunden werden kann.Ein solches Antigen-spezifisches Targeting istTumorzell-selektiv und kann auf Basis einermolekularen Diagnostik individuell eingesetztwerden. Damit ist dieser therapeutischeAnsatz einem konventionellen, systemischenTherapieansatz hinsichtlich Spezifität undEffektivität potenziell überlegen. Dennochsind auch bei den bislang eingesetzten Antigen-spezifischenTherapien von TumorpatientInnenhäufig Behandlungsresistenzen zukonstatieren, sodass dringender Bedarf anTarget-spezifischen Therapeutika mit höhererWirksamkeit besteht.In dieser Projektarbeit werden neue anti-ErbB-Antikörper mit höherer Affinität undggf. mulivalenter Spezifität hergestellt unddann getestet. Dazu werden speziell generierteund ausgewählte Antikörper in die präklinischeTestung gehen. Darüber hinaus wirdin einem translationalen Untersuchungsansatzdie Aktivität der Antikörper in einem humanisiertenTumormausmodell (Wege AK, etal., Int. J Cancer, 2011) evaluiert, um nicht nurzelluläre, sondern auch therapeutisch induzierbareimmunologische Effekte zu erfassen.Ziel ist es, Antikörper mit neuartigen Charakteristikafür personalisierte, höchst effektiveBehandlungen von TumorpatientInnenzu entwickeln, mit denen auch Resistenzengegenüber etablierten (konventionellen undAntigen-spezifischen) Therapien überwundenwerden können. Antikörper mit der höchstenWirksamkeit sollen mittelfristig in die Kliniküberführt werden.96
„Springs“ und „Parachutes“ – neue Formulierungenfür schlecht wasserlösliche WirkstoffeLife SciencesNeue PROJEKTEProjektleitungWie ein Fallschirmspringer in der Schwebe sollen die Wirkstoffe kontrolliert zunächst in einerübersättigten Lösung mit hohen Konzentrationen gehalten werden, damit sie besser vom Körperaufgenommen werden könnenJulius-Maximilians-Universität WürzburgInstitut für Pharmazie und LMCwww.pharmaceutics.uni-wuerzburg.deIm Fokus des Projekts stehen neuartige hypothesengetriebene Entwicklungsansätze vonFormulierungen, die zu Übersättigungen führen – mit dem Ziel, zukünftig eine zügige undzuverlässige Entwicklung für diese galenisch anspruchsvollen Arzneistoffe zu ermöglichen.Die Herausforderung der erfolgreichen Formulierungvon schlecht in Wasser löslichenArzneistoffen durchdringt die gesamtePharmabranche und ist ein erhebliches Entwicklungsrisikofür Medikamente. Oft bleibtdem Apotheker dann kein anderer Ausweg,als instabile Übersättigungsphänomene auszunutzen,um überhaupt die Voraussetzungenfür eine angemessene Aufnahme des Wirkstoffeszu ermöglichen. Zwar können dieseübersättigten Lösungen für eine gewisse Zeitdeutlich höhere Konzentrationen an gelöstemArzneistoff haben, allerdings werden sie irgendwannausfallen, ein Phänomen, welchesschon von anderen durch die plakativen Begriffe„spring“ oder „Feder“ (für den Grad derÜbersättigung) und „parachute“ oder „Fallschirm“(für die Dauer der Übersättigung) beschriebenworden ist.Erste Ergebnisse zeigen, dass schwach übersättigteLösungen nicht selten eine niedrigePräzipitierungs- und Auflösungsrate zeigen,während die untersuchten stark übersättigtenLösungen eine hohe Präzipitierungs- und eineniedrige Auflösungsrate zeigen. Dabei spielenHilfsstoffe, die man den Lösungen nebendem Wirkstoff beimischt, eine übergeordneteRolle. Diese Phänomene werden kinetisch,kristallographisch und spektroskopischmit dem Ziel untersucht, belastbare Modellefür zunächst eine Substanzklasse zu entwickeln.Nachdem diese Untersuchungen in gutcharakterisierten Systemen (wie z. B. einemPuffer) abgeschlossen sind, werden die Experimenteauf biologisch relevante Flüssigkeiten(z. B. simulierte intestinale Flüssigkeiten)ausgedehnt, um mit möglichst hoherIn-vivo-Relevanz Aussagen treffen zu können.ProjektpartnerACC GmbHwww.accgmbh.comJulius-Maximilians-Universität WürzburgLehrstuhl für Pharmazeutische undMedizinische Chemiewww.pharmazie.uni-wuerzburg.de/PharmChem/AKHg/cvkurz.htmlVasopharm GmbHwww.vasopharm.com97
MaterialwissenschaftEntwicklung hochwertiger umweltfreundlicherInfrastrukturprodukte für den Einsatz im TiefbauNeue PROJEKTEProjektleitungLinks: Beispielschacht für die WPC-Umsetzung; rechts: Kunststoff, Holzmehl und WPC-CompoundLangmatz GmbHTechnische Entwicklung Mechanik (TEM)Am Gschwend 1082467 Garmisch-PartenkirchenDas Ziel des Vorhabens liegt in der Entwicklung neuer Materialien, die für dieHerstellung von komplexen geschäumten Kabelschachtsystemen im Spritzgießverfahrengeeignet sind und zu einem bedeutenden Teil aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.ProjektpartnerSKZ – Das Kunststoff-Zentrumwww.skz.deÜber die Jahre hat sich die Verwendung vonKunststoffen im Tiefbau im Gegensatz zuanderen Materialien wie z. B. Beton durchderen Langlebigkeit sowie deutlich einfacherenTransport und Montage bewährt. Es istallerdings allgemein bekannt, dass die Verfügbarkeitvon Produkten, die aus fossilenRohstoffen hergestellt werden, nicht lang fristiggegeben ist. Auch wenn Experten je nachStudienlage unterschiedliche Prognosen überden sogenannten „Peak Oil“ abgeben, ist esunbestritten, dass die Vorkommen endlichsind bzw. deren Gewinnung immer aufwendigerwerden wird. Vor diesem Hintergrundist es unerlässlich, Alternativen für fossileRohstoffe zu erarbeiten bzw. deren Einsatzdeutlich zu reduzieren.mit größeren Dimensionen übertragbar sind.Neben der Materialentwicklung liegt ein weitererSchwerpunkt des Projekts auf der Optimierungdes Verarbeitungsprozesses undder Anpassung der Werkzeugtechnologie. DieForschungsergebnisse sollen das Potenzialvon Wood Polymer Composites (WPC) für denEinsatz in hochwertigeren Produkten aufzeigenund eine spätere Umsetzung fördern.Im Rahmen dieses Projekts sollen neue Materialienentwickelt werden, die für die Herstellungvon komplexen und geschäumtenGroßbauteilen im Spritzgießverfahren geeignetsind und zu einem bedeutenden Teil ausnachwachsenden Rohstoffen bestehen. Alsübergeordnetes Ziel soll ein Schachtsystem-Modell aus einem naturfaserverstärkten Thermoplastgefertigt werden, sodass die Ergebnisseauf die Produktion von Schachtsystemen98
Trockenlauf-Kunststoff–ScharnierbandketteMaterialwissenschaftTribo-Mittelwerte von PE-UHMW gegen POM Produktep = 0,22 N/mm 2 , v = 0,25 m/s,oszillierende Bewegung, Versuchsdauer 24 Stunden(Oberprobe PE-UHMW; Unterprobe POM-Produkte)Neue PROJEKTE0,44Reibwert0,30,20,10,0-0,1-0,20,38-1,6-0,50,16-1,0-0,30,110,0-0,53210-1-2Verschleißkennwert-0,3-3-0,4Standart-POM modifiziertes-POM I modifiziertes-POM II-4Reibwert (gemittelt zwischen 22-24 h) Abrieb Unterprobe/t[h] Abrieb Oberprobe/t[h]ProjektleitungLinks: Messprinzip; rechts: Versuchsergebnisseiwis antriebssysteme GmbH & Co. KGAlbert-Roßhaupter-Straße 5381369 MünchenIm Rahmen des Vorhabens soll ein modifiziertes Polymer entwickelt werden, das imSpritzgießverfahren verarbeitet werden kann und die Herstellung von Scharnierbandkettengliedernfür den verschleiß- und reibwertoptimierten Einsatz z. B. in Getränkeabfüllanlagenermöglicht. Dadurch soll der Einsatz von Schmierstoffen entfallen oderbei trocken betriebenen Anlagen Antriebsenergie eingespart werden.Im Bereich der Intralogistik haben sich fürden Transport von Gütern, z. B. zwischen Fertigungsanlagen,oft Kunststoffscharnierbandkettenals Transportmittel durchgesetzt. In derPraxis werden diese Fördersysteme aufgrundder herrschenden Gleitreibung in vielen Einsatzfällengeschmiert, wodurch der Reibungskoeffizientim System reduziert werden kann.Seitens der Anlagenhersteller und -betreiberbesteht die Anforderung, die Ketten ohneSchmierung, also im Trockenlauf zu betreiben.Durch das unvermeidliche Auftreten vonReibung und Verschleiß kommt es hierbei zuenergetischen sowie materiellen und folglichwirtschaftlichen Verlusten. Verfügbare modifizierteKunststoffe von Polymerherstellernerzielen nicht die gewünschten Erfolge.Ziel des Forschungsvorhabens ist deshalb dieEntwicklung eines verschleiß- und reibwertoptimiertenPolymers, welches die Herstellungvon Scharnierbandkettengliedern für denEinsatz in Getränkeabfüll- und Flaschenreinigungsanlagenohne zusätzliche Schmierungermöglicht. Zu diesem Zweck werden das tribologischeSystem analysiert und die Kontaktpaarungennäher betrachtet. Es werden geeignetePolymere und Additive zusammengestelltund daraus eigene Compounds hergestellt.Zur Untersuchung dieser Mischungenwerden Prüfkörper gefertigt und deren tribologischeund mechanische Eigenschaftenuntersucht. Das Prüfverfahren ist in der Abbildungoben dargestellt. Wie das Diagrammzeigt, ist durch gezielte Kombination von Additiveneine deutliche Verringerung des Reibwertesim Vergleich zum Standardmaterialmöglich. Im Projektfortgang werden weitereTestreihen durchgeführt und die Ergebnisseauf neue Kettenprototypen übertragen.ProjektpartnerFachhochschule Würzburg-SchweinfurtFakultät Maschinenbauwww.fhws.deMüller + Wilisch GmbHGeschäftsleitungwww.spritzguss.deTechnische Universität ChemnitzInstitut für Fördertechnik und Kunststoffewww.tu-chemnitz.de/mb/FoerdTech99
MaterialwissenschaftFreie Fahrt durch Tunnel dank geringeremErhaltungsaufwand mit optimierten BaustoffenNeue PROJEKTEProjektpleitungLinks: Mit modernen Nassspritzgeräten werden bis zu 20 m 3 pro Stunde an Spritzbetonaufgetragen (Bild ABT); rechts: Kalkaussinterungen in einer Drainageleitung (Bild Testor, ÖBB)Hochschule für angewandte WissenschaftenRegensburgBauingenieurwesenwww.hs-regensburg.deVersinterungen im Drainagesystem von Tunneln können zu schwerwiegenden Schädenmit hohen Folgekosten führen. Zementgebundene Baustoffe können einen nichtunwesentlichen Einfluss darauf haben. Im Projekt sollen deshalb neue zementgebundeneBaustoffe mit geringerem Versinterungspotenzial entwickelt werden.ProjektpartnerSüdbayerisches Portland-ZementwerkGebr. Wiesböck & Co. GmbHwww.rohrdorfer.euDie Versinterungsneigung in Entwässerungssystemenist grundsätzlich von Faktoren wieder Zusammensetzung des Bergwassers undder Geologie abhängig, kann aber auch durchden Querschnitt und die Linienführung derRohrleitungen, ihr Material und ihre Oberflächenbeschaffenheitbeeinflusst werden. Entscheidendist auch der Kontakt des Wassersmit den Baustoffen und deren chemische Zusammensetzung.Beim Tunnelausbau könnenhäufig die verwendeten zementgebundenenBaustoffe an der Entstehung von Versinterungenbeteiligt sein. Durch Kontakt mit Bergwasserwird Kalkhydrat aus diesen Baustoffenausgelöst und der pH-Wert des Wassers dadurchangehoben; durch Neutralisation derHydroxide erfolgt eine Kalksteinbildung.Ziel des Forschungsprojekts ist es, zementgebundeneBaustoffe mit möglichst geringemVersinterungspotenzial zu entwickeln, ohnedie exzellenten sonstigen Eigenschaften desBaustoffs Beton nachteilig zu beeinflussen.Dazu sind umfangreiche Untersuchungennotwendig. Die geplanten Arbeiten bauen aufeigenen sowie auf Voruntersuchungen andererForschergruppen auf. In dem Forschungsprogrammgeht es um die Absteckung dermöglichen Bandbreiten bei der Entwicklungoptimierter Produkte, das Erkennen bishernicht berücksichtigter Einflussfaktoren, dieEinbeziehung der Einflüsse des Spritzvorgangesund des dabei verwendeten Erstarrungsbeschleunigerssowie die Entwicklungneuer, erfolgversprechender hydraulischerBindemittel mit verringertem Versinterungspotenzial.Dazu sollen aussagekräftige Prüfverfahrenzur Abschätzung des Versinterungspotenzialsherangezogen und die Ergebnissemit Rechenmodellen verglichen werden.100
Übertragung der Flächenpressung von Luftreifenüber ein Luftlager bei FlachbahnprüfständenMechatronikNeue PROJEKTEFahrdynamik-Prüfstand mit gepulster FlachbahnProjektleitungGegenstand des Projekts ist die Abstützung der bei Flachbahnprüfständen vom Reifenlatschausgehenden Flächenpressung, insbesondere die Wechselwirkung zwischen Bandund Luftlager. Mit experimentellen Methoden und Simulationsverfahren wird der Einflussder physikalischen und technischen Parameter analysiert.MAHA-AIP GmbH & Co. KGAutomotive Industry ProductsHoyen 3087490 HaldenwangFlachbahnprüfstände werden in der Kraftfahrzeugentwicklungbei Untersuchungender Fahrzeugdynamik und in Kraftfahrzeugwindkanäleneingesetzt. Dabei rollt derReifen auf der ebenen Aufstandsfläche einesbeschichteten, endlosen Stahlbandes, dasüber zwei Rollen geführt wird. Die in derReifenaufstandsfläche wirkende Flächenpressungwird durch ein ebenes Luftlager,welches das Band abstützt, aufgenommen.Bei zukünftigen Anwendungen soll die Reifenaufstandskraftdurch Band und Luftlagerhindurch bestimmt werden. Bei der Übertragungder vertikalen Kräfte vom Reifen überBand und Luftlager gibt es eine Reihe offenerFragestellungen, so bei der Wechselwirkungzwischen dem Band und den Luftparameternim Lagerspalt mit dem darausresultierenden Tragverhalten des Luftlagers.in Abhängigkeit der Einflussparameter wieauch der Luftzufuhr durch die poröse Tragplatteder Luftlager-Unterseite ermitteltwerden. Für die experimentellen Untersuchungenwird dazu ein Flachbahnprüfstandmodifiziert, bei dem Sensoren die Verteilungvon Spalthöhe und Druck im Luftlager erfassensowie die vertikalen und horizontalenLagerkräfte bestimmen sollen. Die Wechselwirkungzwischen der Verformung des Stahlbandesund der Druckverteilung im Luftspaltinfolge aerostatischer und aerodynamischerEffekte soll theoretisch mit numerischenLösungsverfahren simuliert und analysiertwerden. Die Luftverteilung durch die Lagertragplattewird experimentell und theoretischuntersucht und optimiert.ProjektpartnerHochschule KemptenFakultät Maschinenbauwww.hs-kempten.deZiel des Projekts ist die Klärung, ob die Ermittlungder im Reifenlatsch wirkenden Aufstandskraftdurch das bewegte Flachbandhindurch mit der Messung der Stützkraft amLuftlager bei Kompensation von auftretendenStöreinflüssen möglich ist. Es sollen dazu dieDruck- und Spalthöhenverteilung im Luftlager101
MechatronikRobustes 24-GHz-Funkortungs-Tachymeter –RFTACHNeue PROJEKTEKranspitzeRadar-SystemProjektleitungFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLinks: Kran im Einsatz; Mitte: Kran mit halb ausgefahrenem Ausleger – die Position der Spitze desAuslegers wird gemessen; rechts: typisches Radarspektrum. Aus der Frequenz des Maximums einesSignals kann die Entfernung ermittelt werdenPräzise 3D-Ortung mit Sekundärradarsystemen eröffnet neue Möglichkeiten zurflexiblen, zuverlässigen und sicheren Positionsbestimmung unter widrigen Umgebungsbedingungen,bei denen optische oder mechanische Sensoren versagen.ProjektpartnerLiebherr-Elektronik GmbHVorentwicklungwww.liebherr.comSymeo GmbHFür zahlreiche Anwendungen im Bereich derindustriellen Automation, Sicherungs- undVerkehrstechnik wird die hochgenaue dreidimensionaleOrtung von bewegten Objektenzunehmend zur entscheidenden Grundlagentechnologie.Beispielsweise ist die exaktePosition für die Personensicherheit bei drohendenKollisionen, für die Navigation autonomagierender Fahrzeuge oder zur Ortungvon Transport- und Lastaufnahmemittelnzwingend erforderlich. Bisher wird die 3D-Ortungzumeist mit optischen Systemen, sogenanntenTachymetern, realisiert, die zwar einehohe Genauigkeit erreichen, jedoch dem Dauereinsatzunter widrigen Umgebungsbedingungenwie z. B. Sonneneinstrahlung, Regen,Nebel oder Staub nicht gewachsen sind.eine Lastmoment-Überwachung an der Auslegerspitzeermöglicht. Im Rahmen des ProjektsRFTACH wird daher ein neuartiges, hochinnovatives24-GHz-Funkortungs-Tachymetermit aktiver Antworteinheit erforscht. Mitzwei Stationen soll durch Entfernungs- undWinkelmessung eine robuste, aber hochpräzisedreidimensionale Positionsbestimmungdurchgeführt werden. Hierfür werden optimierteAntennenanordnungen und Ortungsalgorithmenerforscht sowie Mikrowellen- undSignalverarbeitungsschaltungen entworfen.Das Sensorsystem wird anschließend testweiseund unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanterAspekte in einen Mobilkran integriertund unter Praxisbedingungen erprobt.Im Zuge der dynamischen Entwicklung derMobilkrane werden durch immer leistungsfähigere,längere und komplexere Auslegerkonstruktionenhohe Anforderungen an dieSicherheitstechnik gestellt. Bisherige mechanischeoder optische Positionsmessmethodenkommen dabei an systematische Grenzen.Um den Anforderungen gerecht zu werden,benötigt man eine innovative, besonders robusteund zuverlässige Ortungstechnik, die102
Nanoraue Beschichtungen für Touchscreens –TOUCHNanotechnologieNeue PROJEKTEPSDOrtsfrequenzProjektleitungLinks: Touchscreen in Automotive-Bereich; rechts: Topografie eines Fingerabdrucks(InfiniteFocus-Messung) und Rauheitsanalyse (Power Spectral Density-Funktion)Im Fokus des Forschungsvorhabens TOUCH stehen nanoraue Beschichtungen fürTouchscreens mit definierten haptisch/optisch/tribologischen Eigenschaftskombinationen.ETC Products GmbHnanocoatings and additivesUlrichsberger Str. 1794469 DeggendorfGlasoberflächen werden in beträchtlichemUmfang mit immer mehr Funktionalitätenausgestattet. Prominente Beispiele dafürsind Antireflex-, Easy-to-Clean- und Kratzschutzfunktionen.Derartige Eigenschaftenwerden insbesondere durch Beschichtungenerzeugt, die jedoch die Materialeigenschaftender Oberfläche verändern, wodurch sichdie Oberfläche bei Berührung im Vergleichzur reinen Glasoberfläche „ungewohnt anfühlt“:Die Haptik hat sich verändert. Verantwortlichdafür ist in erster Linie die Rauheitder Beschichtung im Zusammenspielmit deren chemischen Komponenten. DieserEffekt tritt bereits bei Rauheiten von wenigenNanometern deutlich hervor. Haptik alsOberflächeneigenschaft nimmt mithin anBedeutung signifikant zu, ist aber gleichzeitigeine noch weitgehend durch rein individuelleWahrnehmung geprägte, quantitativkaum beschriebene Eigenschaft.Automobilbereich entstehen, die sich durchneuartige Eigenschaftskombinationen Haptik/Optik/Tribologie auszeichnen. Dies soll durchSol-Gel- und PVD-Prozesse realisiert werden.Die Zusammenhänge zwischen den strukturellenund funktionalen Eigenschaften sollenunter Einsatz kombinativer Analysemethodenaufgeklärt und Beschichtungen mit definiertenEinzelmerkmalen sowie multifunktionalenEigenschaften dargestellt werden.ProjektpartnerFLABEG Deutschland GmbHwww.flabeg.comFraunhofer-Institut für Angewandte Optikund Feinmechanik IOFwww.iof.fraunhofer.deIn dem Projekt sollen deshalb die haptischenEffekte von Beschichtungen auf Glasoberflächenim Zusammenhang mit ihrer Rauheitsstruktursowie ihren physikalischen und chemischenEigenschaften untersucht werden.Damit soll eine Basis zur Herstellung vonSystemen für Touchscreen-Anwendungen im103
Prozess- undProduktionstechnikDirekt-KaschNeue PROJEKTEKunststoffExtrusionswerkzeugMetallfolieProjektleitungLinks: Wirkprinzip des Extrusionswerkzeugs zur direkten Laminierung der Kunststoffschmelze mitMetallfolien; rechts: Umgeformtes thermoplastisches Leiterplattensubstrat mit KupferbahnenUniversität BayreuthLehrstuhl für Polymere WerkstoffeUniversitätsstraße 3095447 BayreuthDie Kombination von Metallfolien und extrudierten Kunststofffolien oder -plattenkommt in vielen Bereichen zur Anwendung. Die Entwicklung eines Extrusionswerkzeugs,mit dem es möglich ist, den Kunststoff direkt mit Metallfolie zu verbinden, würde einengroßen Vorteil bringen.ProjektpartnerConti Temic microelectronic GmbHCCMPwww.continental-corporation.comDr. Collin GmbHGeschäftsführer Vertrieb, Service &Verfahrenstechnik.www.drcollin.deLüberg Elektronik GmbH & Co. RothfischerKGwww.lueberg.deExtrudierte Kunststofffolien oder -plattenwerden häufig in einem gesonderten Produktionsschrittmit Metallschichten versehen. Zumeinen aus ästhetischen Gründen, meist aber,um eine bestimmte Oberflächenfunktionalitätzu erzielen, wie z. B. Wärmeleitfähigkeit, elektrischeLeitfähigkeit, UV-Schutz. Eines derwichtigsten Beschichtungsverfahren stellt dasKaschieren dar. Bei diesem Vorhaben werdendie beiden Materialen durch Druck und Temperaturverbunden, z. B. durch eine sogenannteDoppelbandpresse. Allerdings sinddamit erhebliche Investitions- und Energiekostenverbunden. Darüber hinaus wird derKunststoff in dem Kaschierprozess einer zusätzlichenthermischen Belastung ausgesetzt.Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklungeiner neuen Kaschiertechnologie zur Auflaminierungvon Metallfolien auf Kunststoffsubstrate.Die Laminierung soll direkt im Extrusionswerkzeugstattfinden und somit zurEinsparung von Kosten im Vergleich zu konventionellenVerfahren führen. Eine Reduktionder Investitions- und Energiekosten würdesich direkt auf die Herstellkosten niederschlagen.Ein neuartiges und zukunftsträchtigesthermoplastisches Leiterplattensubstrat bildetzusammen mit der zu entwickelnden Kaschiertechnologieden Grundpfeiler des Projekts.Das thermoplastische Leiterplattenmaterialsoll durch die entwickelte Kaschierdüsedirekt mit Kupfer laminiert werden. Das hierdurcherhaltene kaschierte Leiterplattensubstratwird nachfolgend durch Teststrukturenauf sein Alterungsverhalten unter Temperatur-und Medieneinfluss untersucht. Im Gegensatzzu den aktuellen duroplastischenLeiterplattenmaterialien bietet das thermoplastischeLeiterplattensubstrat den Vorteilder nachträglichen Verformbarkeit. Zusätzlichsollen daher im Rahmen des Projektsaus dem kaschierten Material nachträglichthermisch verformbare Schaltungsträgerentwickelt werden.104
BrewPAT – Fermentative Optimierung mittelsprozessanalytischer Technologie (PAT)Prozess- undProduktionstechnikNeue PROJEKTEExpertenwissenGanzheitliche Optimierung fermentativer Prozesse mittels prozessanalytischer TechnologieProjektleitungIm Projekt soll eine Optimierung des Gär- und Reifungsprozesses von Bier erfolgen.Im Mittelpunkt stehen die Optimierung von Reinigungszyklen, eine praxistauglicheProzessbeobachtung, eine automatisierte Prozesszustandsregelung der Gärung undReifung mit Produktfreigabe und die Optimierung der Anlagenbelegungszeiten unterBerücksichtigung globaler Produktionspläne.Technische Universität MünchenLehrstuhl für Brau- und GetränketechnologieWeihenstephaner Steig 2085354 Freising-WeihenstephanMit ihrer 2004 begründeten PAT-Initiative hatdie FDA (Food & Drug Administration) einenzentralen Leitfaden für die ganzheitliche Gestaltung,Analyse und Kontrolle der Fertigunggeschaffen. Über die zeitlich definierte Messungkritischer Qualitätsmerkmale präsentiertsie ein innovatives Werkzeug zur Gestaltungeiner optimalen Prozessführung mit demZiel einer gesicherten Produktqualität. ImRahmen dieses Projekts soll eine prozessorientierteValidierung und Freigabe von Prozessabschnittenin Echtzeit über die Einbindungeines ausgewählten PAT-Instrumentariumsermöglicht und die in der Praxis bislang etablierteFreigabe mittels aufwendiger Laboranalytikabgelöst werden.Im Vordergrund für die Umsetzung des Vorhabenssteht hierbei die Bereitstellung der notwendigenProzessintelligenz und -informationenüber die Entwicklung eines neuartigenSensorarrays in Kombination mit chemometrischenAuswerteverfahren zur Festlegungstatistisch gesicherter Prozesskorridore sowiederen Einbindung in ein Steuerungs- und Prognosetoolauf der Basis eines virtuellen Anlagenfahrers.In den Mittelpunkt tritt dabei derTeilprozess der Gärung und Reifung von Bierund seine gleichzeitige Verflechtung mit derFermenterbelegung in einem Tankpark unterBerücksichtigung des gesamten Produktionsablaufs.Der Grundsatz „Wenn die Prozessein vorgegebenen zuvor validierten Korridorenverlaufen, müssen auch die Produkte die nötigenStandards einhalten“ eröffnet somit einevöllig neue Perspektive in der Prozessbetrachtungund würde einen Paradigmenwechsel inder Gestaltung, Führung und Zertifizierungvon Life Science Prozessen einläuten.Projektpartner<strong>Bayerische</strong> StaatsbrauereiWeihenstephanwww.weihenstephaner.deKrones AGwww.krones.com105
Prozess- undProduktionstechnikInitiale Nassfestigkeit von PapierNeue PROJEKTEProjektleitungHerstellungsprozessHochschule für angewandteWissenschaften MünchenFakultät 05Lothstr. 3480335 MünchenProjektpartnerDas Ziel dieses Projekts ist es, die Mechanismen der initialen Nassfestigkeit zu identifizierenund dieses Wissen zu nutzen, um die initiale Nassfestigkeit in der Produktion von Papierengezielt zu steigern und damit eine wirtschaftlichere Papierherstellung zu ermöglichen.BTG Instruments GmbHwww.btg.comInstitut für Verfahrenstechnik Papier e.V.LEIPA Georg Leinfelder GmbHPapier & Kartonwww.leipa.deUPM GmbHForschung und Entwicklungwww.upm.comSCA Packaging Containerboard GmbHSappi Stockstadt GmbHProduktionsleiterwww.sappi.comNeenah Gessner GmbHTechnologie und ProzessentwicklungEs gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen,die empirisch zeigen, dass die initiale Nassfestigkeitvon Papierbahnen durch Additive,mechanische oder chemische Fasermodifizierungenbeeinflusst werden kann.Demgegenüber gibt es jedoch kaum Hinweisein der Literatur, welchen chemischenoder physikalischen Mechanismen die initialeNassfestigkeit folgt und wie diese gezieltbeeinflusst werden kann. Die initiale Nassfestigkeitstellt im Papiererzeugungsprozess diewichtigste Größe zum Einstellen des erstenfreien Zuges in der Papiermaschine dar undist damit der wichtigste Parameter zur Verringerungvon Abrissen innerhalb der Papiermaschine.Insbesondere für Papiere, die einniedriges Flächengewicht haben und/oderdie auf Maschinen mit offener Bahnführungnach der Sieb- oder Pressenpartie gefertigtwerden, ist dieser Parameter sehr wichtig.Immer höhere Maschinengeschwindigkeitenin der Folge von Produktivitätssteigerungenführen zu größeren Zugbeanspruchungen derPapierbahn, die häufig zu Abrissen führen.Der Wirkungsgrad einer Papiermaschine istdabei immer nur so gut, wie der schwächsteAbschnitt der Anlage. Der erste freie Zug mitnoch initial nasser Papierbahn kann daher denGesamtwirkungsgrad empfindlich reduzieren.Die bayerische Papierindustrie produziert mitgroßen, schnelllaufenden Maschinen an verschiedenenStandorten Druck- und Verpackungspapiersowie auf langsamer laufendenMaschinen Spezialpapiere. Beide Gruppenhaben ein großes Interesse an den Ergebnissendieses Projekts. An den Maschinenmit großer Tonnage und Geschwindigkeitensind es besonders die Adhäsions- und Fliehkräfte,die eine hohe initiale Nassfestigkeit inder Presse erfordern. Bei den Spezialpapierherstellernsind es vor allem freie Züge unddamit verbundene Zugspannungen zwischenden einzelnen Prozessschritten, die demnoch nassen Papier hohes Kraftaufnahmevermögenabverlangen.106
Feinbearbeitung von WerkzeugoberflächenProzess- undProduktionstechnikNeue PROJEKTERohlingHartbearbeitungNachbearbeitungFeinbearbeitungWerkzeug• Senkerodieren• Wärmebehandlung• Druckstrahlen• PolierenUntersuchte Prozessketten im Rahmen des WerkzeugherstellungsprozessesProjektleitungIn dem Forschungsvorhaben wird der Einfluss der Oberflächennachbearbeitung und-endbearbeitung auf das Ermüdungsverhalten erodierter Werkzeugoberflächen ausHartmetall und Schnellarbeitsstahl analysiert und bewertet.Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für FertigungstechnologieEgerlandstr. 1391058 Erlangenwww.lft.fau.deDie Kaltmassivumformung ermöglicht diewerkstoff- und energiesparende Herstellungmechanisch belastbarer und präziser Bauteilehoher Oberflächengüte. Aufgrund der ausgeprägtenWerkzeugbeanspruchung kommenin der Kaltmassivumformung häufig Schnellarbeitsstähleund Hartmetalle als Werkzeugwerkstoffzum Einsatz. Komplexe Werkzeuggeometrienwerden ausgehend von einemRohling üblicherweise mittels Senkerodierenhartbearbeitet. Die aus dem Erodierprozessresultierende weiße Schicht wird in derindustriellen Praxis in der Regel durch einenkostenintensiven Poliervorgang entfernt. ZurReduzierung des Polieraufwands sind Nachbearbeitungsverfahreneinsetzbar, die Eigenschaftsverbesserungender erodierten Oberflächebewirken.der Oberflächenbeschaffenheit in Abhängigkeitder angewendeten Prozesskette werdenModellversuche zur Untersuchung des Ermüdungsverhaltensdurchgeführt und Korrelationenzwischen den Oberflächeneigenschaftenund der Wechselfestigkeit hergestellt.Die ermittelten Zusammenhänge werden anschließendin industriellen Standzeitversuchenbei den Industriepartnern validiert. Parallelwird eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtungzur Quantifizierung des ökonomischen Mehrwertsder Oberflächennachbehandlung zwischenErodier- und Polierbearbeitung durchgeführt.Hieraus soll ein wirtschaftlichesOptimum bezüglich Fertigungsaufwand undWerkzeugstandzeit abgeleitet werden.ProjektpartnerFRANK Formenbau GmbHwww.frank-praezision.deRichard Bergner Holding GmbH & Co. KGwww.ribe.deThyssenKrupp Presta AGwww.thyssenkrupp-presta.comDa das Ermüdungsverhalten von Werkzeugenaus Hartmetall und Schnellarbeitsstahl in Abhängigkeitder Oberflächeneigenschaften bislangnur unzureichend untersucht worden ist,wird in dem Forschungsvorhaben der Einflussder Prozesskette „Erodieren – Nachbearbeitung– Polieren“ auf das Ermüdungsverhaltenvon Umformwerkzeugen analysiert undquantifiziert. Ausgehend von der Ermittlung107
Prozess- undProduktionstechnikIntelligente Deformationskompensationim 3D-Druck – IDe3DNeue PROJEKTEProjektleitungvoxeljet technology GmbHTypische Deformationserscheinungen der Bauteile, hergestellt mit dem 3D-Druckverfahren;Links: Deformation durch eingeschlossenes nichtschwindendes Pulver;rechts: Verzug und Kantenunschärfe durch zeitlich versetztes Schwinden der einzelnen Schichten(Quelle: voxeljet technology GmbH)ProjektpartnerZur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des 3D-Druckens werden Korrekturstrategienerarbeitet, um fertigungsbedingte Geometrieabweichungen gezielt zu kompensieren.Alphaform AGBMW AGTechnische Integration TI-67www.bmwgroup.comMicro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KGSchübel GmbHDie aus dem Werkzeug- und Prototypenbaubekannten additiven Fertigungstechnologienwerden in Zukunft vermehrt für die Herstellungfunktioneller Serienbauteile genutzt.Neben der Wirtschaftlichkeit eines Verfahrenssind die Maßhaltigkeit und die Reproduzierbarkeitadditiv gefertigter Bauteile ein wesentlichesKriterium für die Qualifizierung derTechnologie. Das pulverbasierte 3D-Druckverfahrenbietet aufgrund niedriger MaterialundProzesskosten ein hohes wirtschaftlichesPotenzial. Die selektive Verfestigung einerBauteilschicht mittels Einbringen eines Bindersführt zu Schwund und kann Deformationenhervorrufen. Durch gezielte Kompensationdieser Fehler und die damit erreichbareVerbesserung der Maßhaltigkeit kann derwirtschaftliche Vorteil des 3D-Druckens verstärktwerden.werden im Rahmen des Projekts zunächstreproduzierbare Geometrieabweichungenim 3D-Druck durch die Anfertigung von Referenzbauteilenund unter Berücksichtigungeiner systematischen Parametervariation aufgenommenund charakterisiert. Basierendauf diesen Erkenntnissen werden Simulationsmodelleerzeugt, welche die Deformationund das Bauteilverhalten abbilden. Anhandder gewonnenen Erfahrungswerte und derErgebnisse der Simulationsläufe werden Korrekturstrategienerarbeitet und an Refererenzbauteilengetestet. Die ausgewählte Strategiesoll in die Anlagensoftware implementiertund deren Anwendbarkeit auf relevante Bauprozessegezeigt werden.Universität PassauFakultät für Mathematik und InformatikTechnische Universität Müncheniwb Anwenderzentrum Augsburgwww.iwb.tum.deZiel dieses Projekts ist es, ein Kompensationswerkzeugfür den 3D-Druckprozess zuentwickeln und dieses direkt in die Anlagensteuerungzu integrieren. Mögliche Geometrieabweichungensollen zunächst erfasstund mittels softwaretechnischer Vorskalierungreduziert werden. Damit kann die Bauteilqualitätund insbesondere die Maßhaltigkeitsignifikant verbessert werden. Dafür108
Optimierung von FlüssigkeitsringvakuumpumpenProzess- undProduktionstechnikNeue PROJEKTEFlüssigkeitsringvakuumpumpe Typ 2BV5 (links) bzw. 2BV2070 (rechts)ProjektleitungFlüssigkeitsringvakuumpumpen haben im Vergleich zu anderen Vakuumpumpeneindeutige Vorteile, doch der erreichbare Vakuumdruck ist durch den Dampfdruck derRingflüssigkeit limitiert. Ziel des Projekts ist es, den Saugdruck der Pumpen durch denEinsatz ionischer Flüssigkeiten deutlich unter 1 mbar zu senken.Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Prozessmaschinenund AnlagentechnikCauerstr. 491058 ErlangenBei Flüssigkeitsringvakuumpumpen (FRVP)sorgt der rotierende Flüssigkeitsring, der zusammenmit dem sternförmigen und exzentrischgelagerten Rotor auch die Ansaug- undVerdrängerfunktion erfüllt, für eine nahezuisotherme Kompression und gewährleistet dadurcheine schonende Förderung. Alllerdingsist der erreichbare Vakuumdruck durch denDampfdruck der Ringflüssigkeit limitiert. DaFRVP meist mit Wasser als Betriebsflüssigkeitbetrieben werden, können nur Ansaugdrückebis etwa 30 mbar realisiert werden. Dienoch recht junge Stoffgruppe der IonischenFlüssigkeiten (IL) eröffnet hier aufgrund ihresvernachlässigbaren Dampfdrucks von unter10 -8 mbar neue Möglichkeiten.Ziel des Projekts ist es daher, durch denEinsatz von IL den erreichbaren Saugdruckvon Flüssigkeitsringvakuumpumpen deutlichunter 1 mbar zu bringen. Neben möglichsthohen Wirkungsgraden und großer Betriebssicherheitsoll auch die Maschinenlautstärkereduziert werden. Die gewonnenen Erkenntnissesollen aufgrund des ähnlichen Wirkprinzipsauch auf Drehschieberpumpen übertragenwerden.Um das Potenzial von Flüssigkeitsringvakuumpumpenhinsichtlich der erreichbarenVakuumtiefe voll ausschöpfen zu könnensowie die Geräuschentwicklung in der Pumpebesser verstehen und nachfolgend optimierenzu können, ist eine tiefgehende Analyse derStrömungsverhältnisse anhand einer CFD-Simulationder Strömung in einer ausgewähltenBaugröße vonnöten.Die in der Simulation festgestellten Effektesollen in einer Versuchsanlage messtechnischverifiziert werden. Gelingt es, die angestrebtenZiele zu verwirklichen, ist für diesenPumpentyp mit deutlich niedrigeren Vakuumdrücken,geringeren Geräuschemissionenund einer Reduktion der Energieaufnahme zurechnen.ProjektpartnerFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Chemische ReaktionstechnikGardner Denver Deutschland GmbH109
Prozess- undProduktionstechnikZellenmodell zur Auslegung vonPackungskolonnen und FlüssigkeitsverteilernNeue PROJEKTEProjektleitungLinks: Verschiedene Füllkörper für den Einsatz in Packungskolonnen; rechts: Virtuelle Berieselung eines3D-Füllkörpermodells mit FlüssigkeitsfädenTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnikwww.apt.mw.tum.deEin Zellenmodell soll die Vorhersage der Flüssigkeitsverteilung in Packungskolonnenverbessern. Zur Validierung wird die Flüssigkeitsverteilung in verschiedenen Packungenexperimentell gemessen, mit Berechnungen des Zellenmodells verglichen und das Modellfalls notwendig erweitert oder angepasst.ProjektpartnerLINDE AG / Division LINDE EngineeringEquipment Process Designwww.linde.comRVT Process Equipment GmbHProcess Engineeringwww.rvtpe.deWelChem GmbHwww.welchem.comDie Vorhersage der Flüssigkeitsverteilung inPackungskolonnen ist bisher unzureichend,woraus hohe Sicherheitsaufschläge bei derAuslegung resultieren. In industriellen Prozessenwerden deshalb bei vielen AnwendungenBodenkolonnen eingesetzt, wo gleichgroße Packungskolonnen mit höheren Durchsätzenund weniger Energiebedarf effizienterbetrieben werden könnten. Ein Zellenmodellberechnet die Flüssigkeitsverteilung in Packungskolonnenmit regellosen Füllkörpernauf Basis einer wabenförmigen Grundgeometrievoraus. Die zur Berechnung notwendi genrichtungsabhängigen Dispersionskoeffizientenwerden spezifisch für einzelne Füllkörperüber eine virtuelle 3D-Berieselungssimulationermittelt.Im Rahmen dieses Projekts soll die experimentelleValidierung des Zellenmodells fürFüllkörper sowie die Weiterentwicklung undValidierung des Zellenmodells für strukturiertePackungen erfolgen. Dazu werden vondrei Projektpartnern Flüssigkeitsverteilungsversuchedurchgeführt und eine Datenbasiszur Flüssigkeitsverteilung in Packungskolonnenerstellt. Die Kolonnen mit Durchmessernvon 400, 1200 und 2000 mm haben variablePackungshöhen von bis zu 6 m und werdenmit dem Stoffsystem Wasser/Luft betrieben,wobei an der 400-mm-Kolonne auch Messungenmit iso-Hexan/Stickstoff realisiertwerden. Außerdem sollen verschiedene Flüssigkeitsverteilerzum Einsatz kommen.Durch Aufnahmevorrichtungen unterhalb derPackung werden der Strömungsquerschnitt indefinierte Bereiche unterteilt und die Durchflussratenin den einzelnen Segmenten bestimmt.Zunächst werden Füllkörper und anschließendstrukturierte Packungen in denKolonnen vermessen. Die ermittelten Verteilspektrenwerden zur Anpassung und Validierungdes Zellenmodells verwendet. Am Endedes Projekts werden alle Rohdaten publiziert.110
IDA: Intelligente Datenakquisitionin GießereifertigungenProzess- undProduktionstechnikNeue PROJEKTEProjektleitungLinks: „Smart Factories“ nutzen alle Technologien, die aus der Informations- und Kommunikationstechnologiekommen. Damit könnten dann hochkomplexe Abläufe dezentral betrieben und optimiert werden(Bild: Kemptener Eisengießerei); rechts: Die Herstellung von anspruchsvollen Gussteilen erfordert dievollständige Beherrschung sämtlicher Einzelprozesse der komplexen Prozesskette (Bild: Fronberg Guss)<strong>Bayerische</strong> Gießereien liefern Gussteile für den Automobil- und Maschinenbau. Mitsicheren, ressourceneffizienten Fertigungsprozessen tragen sie dazu bei, die Abhängigkeitvon Rohstoffimporten dauerhaft zu verringern, die internationale Wettbewerbsfähigkeitdurch Senkung der Energie- und Materialkosten zu verbessern und die Umwelt zu entlasten.Hochschule KemptenForschungszentrum AllgäuBahnhofstraße 6187435 Kempten (Allgäu)Die Anforderungen an moderne Gießereiprozessesind geprägt von einer wachsendenKomplexität bezüglich der gefordertenGussteileigenschaftsprofile und der Forderungnach ressourcen- und energieeffizienterProduktion. Dies ist nur realisierbar,wenn höchste Standards für die Verfügbarkeitund Stabilität der angewendeten Prozessegewährleistet sind. Basisvoraussetzungdafür ist eine extensive Kenntnis der prozessbestimmendenEinflüsse und Abhängigkeiten.Gießereifertigungsprozesse gehörenzu den komplexesten ihrer Art. Sie sind gekennzeichnetvon einer großen Zahl zwangsläufigerforderlicher Einzelprozesse, die inihrer Gesamtheit die Fertigungsprozesskettedefinieren. Vielschichtige Abhängigkeitender Prozessparameter und -variablen undeine Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren bestimmendie Stabilität jedes Einzelprozessesund damit der Prozess- und Produktqualität.Das Projekt IDA hat das Ziel, mit der Entwicklungvon innovativen Datenerfassungsmethodenfür intelligente Datenbewertungsverfahrenund deren konsequentem Einsatz neueWege zu öffnen, um die Qualitätsmerkmaleexakt auf Prozesskenngrößen zurückführenkönnen. IDA entwickelt so die Grundlagen füroptimierte und leistungsfähige Gießereiprozessemit hohem Wirkungsgrad im Hinblickauf eine ressourceneffiziente und damit wirtschaftlicheFertigung.Das Projekt integriert Hersteller von Sensorsystemen,industrielle Kompetenz inDatenmanagement und klassische Gießereifertigung,ausschließlich mit bayerischenStandorten, mit wissenschaftlichtechnischerKompetenz der HochschuleKempten in einem leistungsfähigen und zielorientiertarbeitenden Verbundvorhaben.Die im Projekt gewonnenen Erkenntnissewerden in Form eines Leitfadens mit Umsetzungs-und Verwertungsstrategien publiziert.In diese Verwertungsaktivitäten ist der LandesverbandBayern des Bundesverbandes derdeutschen Gießereiindustrie eingebunden.ProjektpartnerFranken Guss Kitzingen GmbH & Co.Fronberg Guss GmbHKemptener Eisengießerei Adam-Hönig AGLeiter technische Arbeitsvorbereitungwww.ke-ag.deVenturetec Mechatronics GmbHNET New Electronic Technology GmbHwww.net-gmbh.com111
KleinProjekteKleinprojekteMachbarkeitsstudie zur Optimierungder Tankstellen-ZapfsäuleneichungProjektleitungSensorik-Bayern GmbHDr. Hubert SteigerwaldGeschäftsführerBiopark IIIJosef-Engert-Straße 1393053 RegensburgTel.: 0941 630916-0Fax: 0941 630916-10E-Mail: h.steigerwald@sensorik-bayern.deVerfahrensentwicklung für reproduzierbareund vergleichbare unidirektionalePrepregs – UniPregProjektleitungProfessor Dr. Ingo EhrlichHochschule für angewandteWissenschaften RegensburgFakultät MaschinenbauGalgenbergstr. 3093053 RegensburgTel.: 0941 943-5152E-Mail: ingo.ehrlich@hs-regensburg.deProjektpartnerLeistritz Pumpen GmbH, EGPshornivius@leistritz.comProjektpartnerMühlmeier GmbH & Co. KGmuehl@muehlmeier.deEvopro Systems Engineering GmbHstefan.fink@evopro-gmbh.deSK Carbon Roding GmbHinfo@sk-carbon.deHochschule RegensburgFK Elektro- und Informationstechnikgeorg.scharfenberg@hs-regensburg.de112
KleinProjekteElektrostatischer WechselstromgeneratorProjektleitungEPCOS AGDr. Stefan SeitzSt.-Martin-Straße 5381669 MünchenTel.: 089 636-26028Fax: 089 636-21730E-Mail: stefan.seitz@epcos.comProjektpartnerTechnische Universität MünchenFakultät EILehrstuhl für Technische Elektrophysikschwesinger@tum.deInlinerauigkeitsmessung am Brillenglas –InBriEffiziente Speicherung von Überschussstromin Erdgasnetzen mittels partiellerNiedertemperatur-Reformierung(Power-to-Hydrogen)ProjektleitungProf. Dr.-Ing. Jürgen KarlLehrstuhl für EnergieverfahrenstechnikFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergFürther Straße 244 f90429 NürnbergTel.: 0911 5302 9021Fax: 0911 5302 9030E-Mail: juergen.karl@cbi.uni-erlangen.deProjektpartnereta energieberatung GbRvolkmar.schaefer@eta-energieberatung.deProjektleitungProf. Dr.-Ing. Rolf RascherHochschule DeggendorfTechnologiecampus TeisnachEdlmairstraße 6 und 894469 DeggendorfTel.: 0991 3615-323 Fax: 0991 3615-399E-Mail: rolf.rascher@hdu-deggendorf.deProjektpartnerMicro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KGmartin.sellen@micro-epsilon.deRodenstock GmbHkarl.huber@rodenstock.com113
114
<strong>Jahresbericht</strong> 2012<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>AnhangDie Organe der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 116Zielsetzung und Arbeitsweise der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 122Rechnungsprüfung 128Förderprogramm „Hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 130Gesetz über die Errichtung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 134Satzung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> 136Idee, Antrag, Entscheidung, Projekt 140Kontakt, Ansprechpartner 142Bildnachweis 144115
Die Organe der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>StiftungsratVorsitzenderHorst Seehofer,<strong>Bayerische</strong>r Ministerpräsident1. Stellvertreter des Vorsitzenden(ab Juli 2013)Dr. Wolfgang Heubisch,Staatsminister für Wissenschaft,Forschung und Kunst2. Stellvertreter des Vorsitzenden(ab Juli 2013)Martin Zeil,Staatsminister für Wirtschaft,Infrastruktur, Verkehr und TechnologieDr. Markus Söder,Staatsminister der FinanzenErika Görlitz,Mitglied des <strong>Bayerische</strong>n LandtagsNatascha Kohnen,Mitglied des <strong>Bayerische</strong>n Landtags116
StiftungsvorstandVorsitzendeKarolina Gernbauer, Ministerialdirektorin,Amtschefin der <strong>Bayerische</strong>n StaatskanzleiDr. Michael Mihatsch, Ministerialdirigent,<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Wissenschaft,Forschung und KunstStellvertreter (ab Juni 2013)Dr. Ronald Mertz, Ministerialdirigent,<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium fürWirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und TechnologieDr. Ulrich Klein, Ministerialdirigent,<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium der FinanzenDr. Hubert Jäger,<strong>Bayerische</strong>r Industrie- und HandelskammertagDr. Lothar Semper,Hauptgeschäftsführer des <strong>Bayerische</strong>n Handwerkstagesund der Handwerkskammer fürMünchen und OberbayernProf. Dr. Hans-Werner Schmidt,Vizepräsident Forschung und wissenschaftlicherNachwuchs der Universität BayreuthProf. Dr. Michael Pötzl,Präsident der Hochschule für angewandteWissenschaften Coburg117
Die Organe der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>Wissenschaftlicher Beirat BIS 31.12.2012VorsitzenderProf. Dr.-Ing. Heinz Gerhäuser,ehem. Leiter des Fraunhofer-Institutsfür Integrierte Schaltungen, ErlangenStellvertretende VorsitzendeProf. Dr. Marianne Jochum,ehem. Leiterin Abt. Klin. Chemie undKlin. Biochemie,Ludwig-Maximilians-Universität MünchenProf. Dr. Erich Bauer,Präsident der Hochschule für angewandteWissenschaften Amberg-WeidenProf. Dr. Klaus Donner,ehem. Leiter des Instituts FORWISS,Universität PassauDr. Christoph Grote,Geschäftsführer BMWForschung und Technik GmbH, MünchenDr. rer. nat. Wolfgang Heuring,Executive Vice President derSiemens AG, MünchenProf. Dr. Daniela Männel,Lehrstuhl für Immunologie, UniversitätRegensburgPD Dr. Gerhard Maier,Vorstand (CTO) der Polymaterials AG,Kaufbeuren118
Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart,Leiter des Instituts für Werkzeugmaschinenund Betriebswissenschaften, TU MünchenProf. Dr. Klaus Schilling,Lehrstuhl für Robotik und Telematik,Universität WürzburgDr.-Ing. Thomas Stockmeier,Geschäftsführer der SEMIKRON Elektronik AG,NürnbergProf. Dr. Ralf Wagner,ehem. Geschäftsführer (CEO, CSO)der GENEART AG, RegensburgProf. Dr. Josef Weber,Vorstand Technik und Entwicklung der ZollnerElektronik AG, Zandt bei ChamDr. Sabine Zeyß,ehem. Leiterin Fördermanagement,Wacker Chemie AG, München119
Die Organe der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>Wissenschaftlicher Beirat AB 01.01.2013VorsitzenderDr. Christoph Grote,Geschäftsführer BMWForschung und Technik GmbH, MünchenStellvertretende VorsitzendeProf. Dr. Claudia Eckert,Leiterin des Lehrstuhls für IT-Sicherheit,Institut für Informatik, TU MünchenProf. Dr. Erich Bauer,Präsident der Hochschule für angewandteWissenschaften Amberg-WeidenProf. Dr. rer. nat. Lothar Frey,Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente,Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergProf. Dr.-Ing. Christiane Fritze,Vizepräsidentin für Forschung undEntwicklung, Hochschule MünchenDr. rer. nat. Wolfgang HeuringExecutive Vice President derSiemens AG, MünchenDr. Brigitte Kaluza,Senior Scientific Director Biologics AllianceManagement, Pharma Research and Early Development(pRED), Roche Diagnostics GmbH,PenzbergProf. Dr. Caroline Kisker,Lehrstuhl für Strukturbiologie,Rudolf-Virchow-Zentrum,Universität Würzburg120
Dr. Eberhard Kroth,Geschäftsführer der Reis GroupHolding GmbH & Co. KG, ObernburgPD Dr. Gerhard Maier,Vorstand (CTO) der Polymaterials AG,KaufbeurenProf. Dr.-Ing. Gunther Reinhart,Leiter des Instituts für Werkzeugmaschinenund Betriebswissenschaften, TU MünchenProf. Dr. Klaus Schilling,Lehrstuhl für Robotik und Telematik,Universität WürzburgDr. Birgit Schwab,Director Grant Management,Wacker Chemie AG, BurghausenProf. Dr.-Ing. Martin Sellen,Geschäftsführer der Micro-EpsilonMesstechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg121
Zielsetzung undArbeitsweiseder <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>ErrichtungDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> ist mit Inkrafttreten desErrichtungsgesetzes (s. Seite 134, Art. 1) am 1. August 1990entstanden.Ausgehend von dem Gedanken, Gewinne aus Wirtschaftsbeteiligungendes Freistaates über die Forschung der Wirtschaftunmittelbar wieder zuzuführen, hat die Staatsregierungdamit ein Instrument ins Leben gerufen, das BayernsSchlagkraft im weltweiten Forschungs- und Technologiewettbewerbstärken und fördern soll.StiftungszweckNach Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> hat die Stiftung den Zweck,1. ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch zusätzlicheMittel oder auf sonstige Weise universitäre undaußeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die wissenschaftlich-technologischeEntwicklung Bayerns oder für diebayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichenLebensgrundlagen nach Art. 131 und 141 der Verfassungvon Bedeutung sind, und2. die schnelle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnissedurch die Wirtschaftzu fördern.OrganeOrgane der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungsvorstandund der Wissenschaftliche Beirat.Der Stiftungsrat legt die Grundsätze der Stiftungspolitik unddie Arbeitsprogramme fest. Er beschließt über den Haushaltund erlässt Richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln.Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der laufenden Verwaltungund vollzieht die Beschlüsse des Stiftungsrats. Er beschließtüber die Mittelvergabe für einzelne Fördervorhaben.122
Der Stiftungsvorstand bedient sich einer Geschäftsstelle. DieGeschäftsführerin ist für das operative Geschäft der Stiftungverantwortlich. Der ehrenamtliche Präsident berät die Stiftungin allen Fragen der Förderpolitik.Der Wissenschaftliche Beirat berät die Stiftung in Forschungs-und Technologiefragen und gibt zu einzelnen Vorhabenbzw. Forschungsverbünden Empfehlungen auf derGrundlage von Gutachten externer Experten.Stiftungsvermögen und FördermittelInsgesamt 396,5 Mio. Euro betrug das Stiftungsvermögenzum 31. Dezember 2012. Zielsetzung ist eine Ausreichungvon Fördergeldern in Höhe von jährlich ca. 20 Mio. Euro.Jedes Projekt, jeder Forschungsverbund muss von Wissenschaftund Wirtschaft gemeinsam getragen werden.Das besondere Augenmerk gilt mittelständischen Unternehmen.Jedes Vorhaben muss innovativ sein.Der Schwerpunkt des Mitteleinsatzes liegt im Bereich deranwendungsorientierten Forschung und Entwicklung;späteres wirtschaftliches Potenzial soll erkennbar sein.Die Dauer der Projekte wird befristet; der Förderzeitraumsoll im Regelfall drei Jahre nicht überschreiten.Institutionelle Förderung (z. B. Gründung neuer Institute)scheidet aus.Das Projekt darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nochnicht begonnen worden sein.MittelvergabeDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> kann ihre Mittel raschund flexibel einsetzen, um interessante Projekte in Realisationsnähezu bringen.Die Stiftung kann ergänzend zum bewährten staatlichen Förderinstrumentariumtätig werden. Sie bietet die Möglichkeit,sich der jeweils gegebenen Situation anzupassen und wichtigeProjekte zu fördern, für die anderweitige Mittel nichtoder nicht schnell genug zur Verfügung stehen.Sie kann für Forschungsprojekte zum Beispiel Personalmittelvergeben und Reisekosten erstatten oder die Beschaffungvon Geräten und Arbeitsmaterial ermöglichen.Grundsätze der StiftungspolitikDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> sieht es als hochrangigesZiel an, durch den Einsatz ihrer Mittel strategisch wichtige anwendungsorientierteForschung zu fördern. Dabei konzentriertsie sich auf zukunftsträchtige Projekte, bei deren VerwirklichungWissenschaft und Wirtschaft ge meinsam gefordert sindund eine enge Zusammenarbeit besonderen Er folg verspricht.Definition von FördervorhabenDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> fördert zwei Typen vonVorhaben:EinzelprojekteForschungsverbündeFür beide Kategorien ist eine Beteiligung von Wirtschaft(einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen) und Wissenschafterforderlich. Die maximale Förderdauer beträgtgrundsätzlich drei Jahre.Forschungsverbünde unterscheiden sich von Einzelprojektendadurch, dass sieein bedeutendes, im Vordergrund wissenschaftlich-technischerEntwicklung stehendes „Generalthema” behandeln,eine große Anzahl von Mitgliedern aufweisen,ein hohes Finanzvolumen haben,eine eigene Organisationsstruktur aufweisen.123
Zielsetzung undArbeitsweiseAntragstellungDie Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> zu richten. Antragsformularekönnen dort angefordert bzw. über das Internet(www.forschungsstiftung.de) heruntergeladen werden.Die Anträge müssen folgende Angaben enthalten:1. Allgemeine Angaben:Gegenstand des ProjektsAntragsteller; weitere an der Maßnahme beteiligtePersonen, Firmen oder InstitutionenKurzbeschreibung des ProjektsBeginn und Dauerdie Höhe der angestrebten Förderung durch die<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>evtl. weitere bei der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>eingereichte bzw. bewilligte Anträgeevtl. thematisch verwandte Förderanträge bei anderenStellen2. Kostenkalkulation:Arbeits- und Zeitplan mit PersonaleinsatzKostenplanErläuterung der KostenkalkulationFinanzierungsplan124
3. Eingehende technische Erläuterung der Vorhaben:Stand der Wissenschaft und Technik – Konkurrenzprodukteoder -verfahren (Literaturrecherche)eigene Vorarbeitenwissenschaftliche und technische ProjektbeschreibungZiele des Vorhabens (Innovationscharakter)Festlegung von jährlichen Zwischenzielen („Meilensteinen“)wirtschaftliches Potenzial und Risiko (Breite der Anwendbarkeit,Verwendung der Ergebnisse, Geschäftsmodelle)SchutzrechtslageDie Projekte, für die eine Förderung beantragt wird, sollenzum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnenworden sein.AntragsbearbeitungDie Anträge werden von der Geschäftsstelle vorgeprüft.Die fachlich berührten Staatsministerien geben hierzu eineStellungnahme ab.Die Prüfung der Relevanz der Thematik, der Innovationshöheder beabsichtigten Forschungsarbeiten, des damit verbundenenRisikos und der Angemessenheit des Forschungsaufwandserfolgt durch externe Fachgutachter und durchden Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung.Die daraus resultierende Empfehlung bildet die Grundlagefür die abschließende Förderentscheidung, die derStiftungsvorstand nach Behandlung der Anträge durch denStiftungsrat trifft.BewilligungsgrundsätzeMaßgebend für die Abwicklung des Projekts ist der von derStiftung erteilte Bewilligungsbescheid und die darin ausgewieseneFörderquote. Basis des Bewilligungsbescheids sinddie im Antrag gemachten Angaben zur Durchführung sowiezu den Kosten und der Finanzierung des Projekts. Die durchdie Zuwendung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> nichtabgedeckte Finanzierung muss gesichert sein.Im Falle einer Bewilligung werden dem Zuwendungsempfängerdie Mittel zur eigenverantwortlichen Verwendungüberlassen. Es besteht die Möglichkeit, durch Umschichtungeninnerhalb der Ausgabengruppen auf notwendige Anpassungenwährend der Projektlaufzeit zu reagieren. Die bewilligtenMittel sind nicht an Haushaltsjahre gebunden undverfallen nicht am Schluss des Kalenderjahres.Die Stiftung behält sich vor, die Förderung des Vorhabensaus wichtigem Grund einzustellen. Ein wichtiger Grund liegtinsbesondere vor, wenn wesentliche Voraussetzungen fürdie Durchführung des Vorhabens weggefallen sind oder dieZiele des Vorhabens nicht mehr erreichbar erscheinen.Der Zuwendungsempfänger hat jährlich in einem Zwischenberichtden Projektfortschritt anhand von „Meilensteinen“in geeigneter Weise nachzuweisen. Dieser Nachweis bildetjeweils die Grundlage für die weitere Förderung des Vorhabensdurch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>.Nach Abschluss der Fördermaßnahme ist ein zahlenmäßigerNachweis über die Verwendung der Mittel und ein Sachberichtüber die erzielten Ergebnisse vorzulegen.Der Bewilligungsempfänger ist verpflichtet, die Ergebnissedes von der Stiftung geförderten Vorhabens zeitnah derÖffentlichkeit zugänglich zu machen, vorzugsweise durchPublikationen in gängigen Fachorganen. Die Förderungdurch die Stiftung ist dabei an prominenter Stelle (Logo etc.)hervorzuheben.125
Zielsetzung undArbeitsweiseFörderung der internationalen Zusammenarbeit in derangewandten ForschungInternationale Beziehungen in Wissenschaft und Forschungsind ein wichtiges Anliegen der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>.Sie stärken Bayern im globalen Wettbewerb undsind eine unerlässliche Voraussetzung für die BehauptungBayerns auf den internationalen Märkten. Gerade im Hochschulbereichkönnen zahlreiche Ideen jedoch nicht verwirklichtwerden, weil z. T. nur verhältnismäßig geringe Geldbeträgefehlen oder erst mit hohem Verwaltungsaufwandbereitgestellt werden können.Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> möchte hier mit ihrenunbürokratischen Strukturen zielgerichtet tätig sein. Fördermittelfür internationale Wissenschafts- und Forschungskontaktekönnen nur in Verbindung mit Projekten der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> gewährt wer den.Zuwendungsfähig sindKosten für kurzzeitige, wechselseitige Aufenthalte inden Partnerlabors,Kosten, die mit der Anschaffung von gemeinsam genutztenoder dem Austausch von Geräten entstehen.Der Antrag muss den Gegenstand, die Partnerschaft, denZeitablauf, die Kosten und den Bezug zu einem Projekt der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> enthalten. Die Höchstfördersummepro Antrag ist auf 15.000 Euro begrenzt.126
Stipendien für DoktorandenIn Bayern promovierte ausländische Wissenschaftler sind imRegelfall hervorragende „Botschafter“ des WissenschaftsstandortsBayern und als künftige Entscheidungsträger inihren Ländern auch für die Marktchancen unserer Wirtschaftvon großer Bedeutung. Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>möchte mit dieser Initiative dazu beitragen, dass Studentenmit guter Weiterbildung und Promotion als Freunde unserLand verlassen. Eine entsprechende Werbewirkung für denWissenschafts- und Wirtschaftsstandort Bayern sieht die<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> darüber hinaus in jungenbayerischen Wissenschaftlern, die an ausländischen Hochschulenpromovieren.Stipendien für Post-DoktorandenDas Post-Doc-Programm läuft nach ähnlichen Modalitätenwie das Doktorandenprogramm. Es bietet die Möglichkeit,promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftleraus dem Ausland während ihres Aufenthalts inBayern und bayerische Post-Doktoranden während ihresAufenthalts im Ausland bis zu 12 Monate zu fördern. Stipendienwerden nur für Forschungsvorhaben gewährt, diein einem thematischen Zusammenhang mit Projekten undden Forschungszielen der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>stehen. Das Stipendium beträgt bis zu 2.500 Euro pro Monat.Hinzu kommen Reise- und Sachmittel in Höhe von insgesamt2.500 Euro.Aufgrund der Stiftungssatzung und der Richtlinien für dieVergabe von Fördermitteln der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>werden Stipendien nur für Forschungsvorhabengewährt, die in einem thematischen Zusammenhang mitProjekten und den Forschungszielen der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>stehen.Voraussetzung: Je ein Wissenschaftler einer ausländischenund einer bayerischen Hochschule, die wissenschaftlichzusammenarbeiten, treffen die Auswahl des Doktoranden.Gemeinsam bestimmen sie das Thema, das in einem thematischenZusammenhang mit einem Projekt und den Forschungszielender <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> steht,und übernehmen die Betreuung.Das Stipendium beträgt bis zu 1.500 Euro pro Monat. Hinzukommen Reise- und Sachmittel in Höhe von 2.500 Euro proJahr.127
RechnungsprüfungAllgemeinesFür das Rechnungswesen der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>gelten gemäß § 9 Abs. 5 der Stiftungssatzung dieRechtsvorschriften des Freistaates Bayern über das Haushalts-,Kassen- und Rechnungswesen entsprechend. DasStiftungsvermögen nach Art. 3 Abs. 1 des Errichtungsgesetzeswird hinsichtlich der Buchführung getrennt von denlaufenden Einnahmen und Ausgaben erfasst. Vor Beginneines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung einen Voranschlag(Haushaltsplan) aufzustellen, der die Grundlagefür die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben bildet(§ 9 Abs. 2 der Stiftungssatzung).StiftungsrechnungDie Stiftungsrechnung 2012 schließt mit Einnahmen von21,2 Mio. Euro, denen Ausgaben von 20,2 Mio. Euro gegenüberstehen.VermögensübersichtDas Gesamtvermögen beläuft sich zum Jahresende 2012ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten auf insgesamt396,5 Mio. Euro.Davon entfallen auf das Stiftungsvermögen gemäß Art. 3Abs. 1 des Errichtungsgesetzes 343,9 Mio. Euro. DieStiftungsmittel belaufen sich auf 52,6 Mio. Euro.Nach Abzug von Verbindlichkeiten beträgt das Gesamtvermögender Stiftung zum Jahresultimo 350,9 Mio. Euro.JahresabschlussDer Jahresabschluss wurde durch die Rödl & Partner GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaftder vorgeschriebenen Prüfung unterzogen. Das Ergebnisder Prüfung ist im Bericht vom 1. Februar 2013 festgehalten.Da sich keine Beanstandungen ergeben haben, wurde fürdie Jahresrechnung 2012 und die Vermögensübersicht zum31. Dezember 2012 von der Rödl & Partner GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsge sell schaftfolgende Be schei nigung erteilt:128
BescheinigungAn die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>, München:Wir haben die Jahresrechnung – bestehend aus einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung– und die Vermögensübersichtunter Einbeziehung der Buchführung der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong>, München, für das Geschäftsjahr vom1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Entsprechend Artikel16 Abs. 3 BayStG wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.Die Prüfung erstreckte sich daher auch auf dieErhaltung des Grundstockvermögens und die bestimmungsgemäßeVerwendung seiner Erträge und zum Verbrauchbestimmter Zuwendungen. Die Buchführung und die Aufstellungder Jahresrechnung und Vermögensübersicht nachden Verwaltungsvorschriften des Freistaates Bayern zur<strong>Bayerische</strong>n Haushaltsordnung, den Vorschriften des <strong>Bayerische</strong>nStiftungsgesetzes und den ergänzenden Bestimmungender Satzung der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter derStiftung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der vonuns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Jahresrechnungund die Vermögensübersicht unter Einbeziehungder Buchführung sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstandabzugeben.Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom Institutder Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzeordnungsmäßiger Abschlussprüfung und des IDW-Prüfungsstandards zur Prüfung von Stiftungen (IDW PS 740)sowie des Artikels 16 Abs. 3 BayStG vorgenommen. Danachist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeitenund Verstöße, die sich auf die Darstellung derJahresrechnung und Vermögensübersicht wesentlich auswirken,mit hinreichender Sicherheit erkannt werden unddass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, obdie Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandsnach Artikel 16 Abs. 3 BayStG ergeben,erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungenwerden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und überdas wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stiftung sowiedie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. ImRahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogeneninternen Kontrollsystems sowieNachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresrechnungund Vermögensübersicht überwiegend auf der Basisvon Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilungder angewandten Bewertungsgrundsätze und der wesentlichenEinschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowiedie Würdigung der Gesamtdarstellung von Jahresrechnungund Vermögensübersicht. Wir sind der Auffassung, dassunsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage fürunsere Beurteilung bildet.Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenenErkenntnisse entsprechen die Jahresrechnungund die Vermögensübersicht den Verwaltungsvorschriftendes Freistaates Bayern zur <strong>Bayerische</strong>n Haushaltsordnung,den Vorschriften des <strong>Bayerische</strong>n Stiftungsgesetzes und denergänzenden Bestimmungen der Satzung der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong>.Die Prüfung der Erhaltung des Grundstockvermögens undder bestimmungsgemäßen Verwendung seiner Erträge undzum Verbrauch bestimmter Zuwendungen nach Artikel 16Abs. 3 BayStG hat zu keinen Einwendungen geführt.München, den 1. Februar 2013Rödl & Partner GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaftgez. Hagergez. PantzeWirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer129
Förderprogramm„Hochtechnologien fürdas 21. Jahrhundert“RichtlinienVorbemerkungDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> fördert Forschung undEntwicklung auf den Gebieten Life Sciences, InformationsundKommunikationstechnologien, Mikrosystemtechnik,Materialwissenschaft, Energie und Umwelt, Mechatronik,Nanotechnologie sowie Prozess- und Produktionstechniknach Maßgabeihrer im Gesetz über die Errichtung der <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong> festgelegten Bestimmungen,ihrer Satzung,dieser Richtlinien,der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondereder Art. 23 und 44 BayHO und der dazu erlassenenVerwaltungsvorschriften,der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmterGruppen von Beihilfen mit dem GemeinsamenMarkt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag(Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), Abl. L 214,9. 8. 2008, S. 3 (im Folgenden: AGFVO) 1 .Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen derverfügbaren Mittel.1. Zweck der FörderungDie Förderung soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungensowie Unternehmen der gewerblichenWirtschaft ermöglichen, grundlegende Forschungs- und Entwicklungsarbeitenauf den Gebieten zukunftsträchtigerSchlüsseltechnologien durchzuführen. Schwerpunktmäßig sinddies die Gebiete Life Sciences, Informations- und Kommunikationstechnologien,Mikrosystemtechnik, Materialwissenschaft,Energie und Umwelt, Mechatronik, Nanotechnologiesowie Prozess- und Produktionstechnik. Sie soll die Umsetzungvon Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus diesenSchlüsseltechnologien in neue Produkte, neue Verfahrenund neue Technologien ermöglichen oder beschleunigen.2. Gegenstand der FörderungFörderfähig sind Vorhaben zur Lösung firmenübergreifenderF&E-Aufgaben, die in enger Zusammenarbeit von einem(oder mehreren) Unternehmen mit einem (oder mehreren)Partner(n) aus der Wissenschaft (Hochschulen bzw. Forschungsinstitute)gelöst werden sollen (Verbundvorhaben).Gefördert werden können innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhabenvon Technologien, Verfahren, Produktenund Dienstleistungen gemäß Artikel 31 AGFVO sowie in begründetenAusnahmefällen die Durchführung von Studienüber die technische Durchführbarkeit für Vorhaben der industriellenForschung oder der experimentellen Entwicklunggemäß Artikel 32 AGFVO insbesondere in folgendenThemenbereichen und Fragestellungen:2.1. Life SciencesForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhabenim Bereich der Bio- und Gentechnologie, insbesondereMethoden und Ansätze der funktionellen Genomforschung,innovative Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe,innovative Verfahren zur Pflanzen- und Tierzucht,im Bereich Ernährung und der Nahrungsmitteltechnologiesowie Methoden und Verfahren zur effizientenNutzung und nachhaltigen Bewirtschaftung biologischerRessourcen.Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhabenim Bereich Medizin und Medizintechnik, insbesondereinnovative Vorhaben der medizinischen und biomedizinischenTechnik, der medizinischen Bild- und Datenverarbeitung,der biokompatiblen Werkstoffe / Implantate, derTelemedizin und des Disease-Managements.Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhabenim Bereich der Gerontotechnologie, insbesondere innova-(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:DE:PDF130
tive Technologien für die Robotik im Pflegebereich, diealters- und behindertengerechte Domotik und sonstigeVerfahren und Methoden zum Erhalt und zur Steigerungder Lebensqualität und der Selbstständigkeit. KlinischeStudien sowie Vorhaben, die Bestandteil von Zulassungsverfahrensind, sind grundsätzlich nicht förderbar.2.2. Informations- und KommunikationstechnologienForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben insbesonderein den BereichenInformationsverarbeitung und Informationssysteme,Software-Entwicklung und Software-Engineering,Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Kommunikationssysteme,einschließlich Mikroelektronik,innovative Anwendungen (z. B. Multimedia, intelligenteHaustechnik, Kraftfahrzeuge, Verkehr, Navigation).2.3. MikrosystemtechnikForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben insbesondereim Bereich der Konzeption, des Entwurfs und der Fertigungsverfahrenvon mikrosystemtechnischen Bauteilenund den hierzu erforderlichen Techniken,Systementwicklungsmethoden zur In te gration verschiedenerMikrotechniken,zur Erarbeitung grundlegender Erkenntnisse bei der Anwendungvon Mikrosystemen.2.4. MaterialwissenschaftForschungs- und experimentelle Entwick lungsvorhaben insbesonderein den BereichenDefinition, Konzipierung und Festlegung von neuen Materialienund Eigenschaften von Materialien sowie ihrerAnwendung,(Hochleistungs-) Keramiken, (Hochleistungs-) Polymere,Verbundwerkstoffe und Legierungen,Definition, Konzipierung sowie Festlegung von Eigenschaftenbiokompatibler Materialien und abbaubarerKunststoffe,Oberflächen-, Schicht- und Trocknungstechniken.2.5. Energie und UmweltForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben insbesonderein den Bereicheninnovative Verfahren und Techniken zur Nutzung fossilerund regenerativer Energieträger sowie neuer Energieträger,rationelle Energieanwendungen und Verfahren zur Effizienzsteigerung,neue Technologien der Energieumwandlung, -speicherungund -übertragung,produktionsintegrierter Umweltschutz, grundlagenorientierteInnovationen im Vorfeld der Entwicklung neuer,umweltverträglicher Produkte,Bereitstellung neuer Stoffkreisläufe und energetische Verwertungvon Abfall- und Reststoffen,innovative Verkehrstechnologien.2.6. MechatronikForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben insbesondereim Bereichder Konzeption mechatronischer Komponenten und Systeme,der Erarbeitung von innovativen Produktions- und Montagekonzeptenfür mechatronische Komponenten und Systeme,der Entwicklung rechnergestützter Methoden und Toolszum virtuellen Entwerfen und zur Auslegungsoptimierung,der Entwicklung von leistungsfähigen Verfahren des RapidPrototyping und der Echtzeit-Emulation von Steuerungen,der Höchstintegration von Elektronik, Aktorik und Sensorikund der Entwicklung geeigneter Aufbau- und Verbindungstechnik.131
„Hochtechnologien fürdas 21. Jahrhundert“2.7. NanotechnologieForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben insbesondereim Bereichder auf der Beherrschung von Nanostrukturen beruhendenneuen technologischen Verfahren,der Nutzung in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichenwie der Elektronik und Sensorik, der Energie- undWerkstofftechnik sowie in (bio-) chemischen Prozessenund der Medizin bzw. der Medizintechnik.2.8. Prozess- und ProduktionstechnikForschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben zurOptimierung von Wertschöpfungs- und Geschäftsprozesseninsbesondere im Bereichinnovativer Automatisierungs- und Verfahrenstechniken,Produktionsketten und Fertigungstechniken,neuer Planungs- und Simulationstechniken,wissensbasierter Modelle und Systeme.3. ZuwendungsempfängerAntragsberechtigt sind rechtlich selbstständige Unternehmender gewerblichen Wirtschaft, Angehörige der freien Berufe,außeruniversitäre Forschungsinstitute, Universitätenund Fachhochschulen sowie Mitglieder oder Einrichtungenbayerischer Hochschulen, die zur Durchführung von F&E-Vorhabenberechtigt sind, mit Sitz bzw. Niederlassung in Bayern.Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß Anhang Ider AGFVO werden bevorzugt berücksichtigt. Danach werdenKMU definiert als Unternehmen, dieweniger als 250 Personen beschäftigen undentweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Eurooder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. Eurohaben undeigenständig sind, d. h. keine Partnerunternehmen bzw.verbundene Unternehmen sind.Die näheren Einzelheiten, insbesondere zur Berechnung derAnzahl der Personen, zum Jahresumsatz oder zur Feststellungeines „verbundenen Unternehmens“ sind in Anhang Ider AGFVO geregelt.4. ZuwendungsvoraussetzungenDie Durchführung des Vorhabens muss mit einem erheblichentechni schen und wirtschaftlichen Risiko verbundensein. Der für das Vorhaben erforderliche Aufwand mussso erheblich sein, dass die Durchführung des Vorhabensohne Förderung durch die Stiftung nicht oder nur erheblichverzögert zu erwarten wäre.Das Vorhaben muss sich durch einen hohen Innovationsgehaltauszeichnen, d. h. die zu entwickelnden Verfahren,Produkte, Technologien und Dienstleis tungen müssen inihrer Eigenschaft über den Stand von Wissenschaft undTechnik hinausgehen. Die Beurteilung der Innovationshöheerfolgt durch externe Fachgutachter.Nicht gefördert werden Vorhaben, die bei Antragstellungbereits begonnen sind.Unternehmen, die keine KMU sind, erhalten nur danneine Förderung, wenn sie den Anreizeffekt der beantragtenFörderung nachweisen.Das Vorhaben muss in seinen wesentlichen Teilen inBayern durchgeführt werden. Die Einbeziehung außerbayerischerPartner ist möglich.Der Antragsteller sowie die Projektbeteiligten sollen zumZeitpunkt der Antragstellung bereits über spezifische Forschungs-und Entwicklungskapazitäten und einschlägigefachliche Erfahrungen verfügen.Gefördert werden in der Regel nur Verbundprojekte zwischenWirtschaft und Wissenschaft. An einem Vorhabensollen mindestens ein Partner aus dem Unternehmensbereichund mindestens ein Partner aus dem Wissenschaftsbereich(außeruniversitäre Forschungseinrichtung oderHochschule) beteiligt sein (Verbundvorhaben).132
Die Antragsteller bzw. die Projektbeteiligten aus der gewerblichenWirtschaft müssen für die Finanzierung desVorhabens in angemessenem Umfang Eigen- oder Fremdmitteleinsetzen, die nicht durch andere öffentliche Finanzierungshilfenersetzt oder zinsverbilligt werden.Eine Kumulierung mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaftbzw. mit anderen staatlichen Beihilfen ist gemäßArtikel 7 AGFVO möglich.Einem Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Artikel1 Absatz 7 AGFVO bzw. einem Unternehmen, das einerRückforderung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidungzur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeiteiner Beihilfe mit dem Gemeinsamen Marktnicht Folge geleistet hat, darf eine Beihilfe nach diesenRichtlinien nicht gewährt werden.Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> verfolgt ausschließlichund unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aus diesemGrund sind die Projektbeteiligten verpflichtet, die Ergebnisseder geförderten Vorhaben zeitnah der Öffentlichkeitzugänglich zu machen.Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> behält sich ein Mitspracherechtbei Lizenzvergaben vor. Grundsätzlich bestehtauf Grund der gemeinnützigen Zweckbestimmungder <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> die Verpflichtung,Lizenzen zu marktüblichen Bedingungen zu vergeben.5. Art und Umfang der FörderungDie Förderung erfolgt durch Zuschüsse im Rahmen einerProjektförderung.Für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft beträgtdie Höhe der Förderung für die im Rahmen des Vorhabensgemachten Aufwendungenbis zu maximal 100 % der zuwendungsfähigen Kosten imFalle von strate gisch wichtiger und außergewöhnli cherGrundlagenforschung, die nicht an industrielle und kommerzielleZiele ei nes bestimmten Unternehmens geknüpftist,bis zu maximal 50 % der zuwendungsfähigen Kosten imFalle der industriellen Forschung,bis zu maximal 25 % der zuwendungsfähigen Kosten imFalle der experimentellen Entwicklung.Grundsätzlich wird auch im Falle der Grundlagenforschungeine angemesse ne Eigenbeteiligung vorausgesetzt, sodassdie Förderquote in der Regel 50 % der Gesamtkosten desVorhabens nicht übersteigt.Falls unterschiedliche Projekttätigkeiten sowohl der industriellenForschung als auch der experimentellen Entwicklungzuordenbar sind, wird der Fördersatz anteilig festgelegt.Im Übrigen gelten die Bestimmungen der AGFVO. Diesgilt insbesondere auch hinsichtlich etwaiger Zuschläge imRahmen der industriellen Forschung und der experimentellenEntwicklung nach Artikel 31 Abs. 4 AGFVO.Kleine und mittlere Unternehmen i. S. d. AGFVO werdenbevorzugt gefördert.Zuwendungsfähig sind Personalkosten, Reisekosten, Materialkosten,Kosten für Fremdleistungen (in begrenztemUmfang), Kosten für Instrumente und Ausrüstung (zeitundvorhabensanteilig), soweit sie für die Durchführungdes Vorhabens erforderlich sind, sowie Druckkostenzuschüssebei wissenschaftlichen Veröffentlichungen.Bei Antragstellern aus dem Unternehmensbereich werdendie Personal- und Reisekosten pauschaliert. Es können jenachgewiesenem Mannmonat (entspricht 160 Stunden beistundenweiser Aufzeichnung) für eigenes fest angestelltesPersonal folgende Pauschalen in Ansatz gebracht werden:Akademiker, Dipl.-Ing. u. ä. 9.000,– Euro,Techniker, Meister u. ä. 7.000,– Euro,Facharbeiter, Laboranten u. ä. 5.000,– Euro.Mit den Pauschalen sind die Personal einzelkosten, diePersonalnebenkosten sowie die Reisekosten abgegolten.Auf die zuwendungsfähigen Aufwendungen wird ein Verwaltungsgemeinkostenzuschlagi. H. v. max. 7 % anerkannt.Bei den Kosten für Material kann ein Materialkostenzuschlagi. H. v. max. 10 % in Ansatz gebracht werden.Bei Mitgliedern und Einrichtungen von Hochschulen (Institutenetc.) werden die zuwendungsfähigen Kosten aufAusgabenbasis errechnet. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungenkönnen auf Kostenbasis gefördert werden.6. VerfahrenAnträge auf die Gewährung von Zuwendungen sind an die<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>Prinzregentenstraße 52, 80538 MünchenTelefon + 49 89/21 02 86-3Telefax + 49 89/21 02 86-55zu richten.Die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> überprüft die Anträgeunter Einschaltung von externen Fachgutachtern.Die Bewilligung der Anträge, die Auszahlung der Förderungund die abschließende Prüfung der Verwendungsnachweiseerfolgt durch die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>.133
Gesetzüber die Errichtung der<strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>Vom 24. Juli 1990 (GVBI S. 241), zuletzt geändert durch § 22 des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 (GVBl S. 521)Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetzbeschlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:Art. 1 Errichtung1 Unter dem Namen „<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>“ wirdeine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet.2 Sie entsteht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes.Art. 2 Zweck, Stiftungsgenuss1 Die Stiftung hat den Zweck,1. ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durchzusätzliche Mittel oder auf sonstige Weise universitäre undaußeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die wissenschaftlich-technologische Entwicklung Bayerns oder für diebayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichenLebensgrundlagen nach Art. 131 und 141 der Verfassungvon Bedeutung sind,2. die schnelle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnissedurch die Wirtschaftzu fördern.2 1 Die Stiftung soll ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigeZwecke im Sinne des Abschnittes SteuerbegünstigteZwecke der Abgabenordnung erfüllen.2 Das Nähere regelt die Satzung.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung des jederzeit widerruflichenStiftungsgenusses besteht nicht.Art. 3 Stiftungsvermögen1 Das Vermögen der Stiftung besteht1. aus dem Anspruch gegen den Freistaat Bayern auf Zuweisungder Erträge aus seiner Beteiligung an der VIAG AGoder einer dagegen eingetauschten anderen Beteiligung;diese Zuweisung ist auf fünf Jahre befristet,2. aus einem Kapitalstock, den die Stiftung sich aus den inNummern 1 und 3 genannten Erträgen aufbaut,3. aus Zustiftungen vor allem aus der Wirtschaft, sonstigenZuwendungen so wie sonstigen Einnahmen, soweit sie nichtzur unmittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmtsind.2 Im Falle der Veräußerung oder des Wegfalls der Beteiligungenhat die Stiftung Anspruch auf eine gleichwertigeandere Ausstattung.Art. 4 StiftungsmittelDie Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus1. der in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Zuweisung, soweitdiese nicht in den Kapitalstock eingestellt wird,2. Erträgen des gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 gebildeten Kapitalstocks,3. Zuwendungen und sonstigen Einnahmen, soweit sie zurunmittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.Art. 5 OrganeOrgane der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungsvorstandsowie der Wissenschaftliche Beirat.Art. 6 Stiftungsrat1 Der Stiftungsrat besteht aus1. dem Ministerpräsidenten als Vorsitzenden,2. dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst,134
3. dem Staatsminister der Finanzen,4. dem Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Technologie,5. zwei Vertretern des <strong>Bayerische</strong>n Landtags,6. zwei Vertretern der Wirtschaft,7. zwei Vertretern der Wissenschaft, davon einem Vertreterder Universitäten und einem Vertreter der Fachhochschulen.2 1 Der Stiftungsrat hat insbesondere die Aufgabe, dieGrundsätze der Stiftungspolitik und die Arbeitsprogrammefestzulegen sowie über den Haushaltsplan, die Jahresrechnungund die Vermögensübersicht zu beschließen.2 Er kann Richtlinien für die Vergabe von Stiftungsmittelnerlassen.Art. 7 Stiftungsvorstand1 1 Der Stiftungsvorstand besteht aus je einem Vertreterder Staatskanzlei, des Staatsministeriums für Wissenschaft,Forschung und Kunst, des Staats minis teriums der Finanzensowie des Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr undTechnologie.2 Der Stiftungsvorstand bestimmt aus seiner Mitte einenVorsitzenden und einen Stellvertreter.2 1 Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinienund Beschlüs sen des Stiftungsrats die Geschäfte derlaufenden Verwaltung.2 Soweit der Bereich einzelner Staatsministerien berührtist, entscheidet der Stiftungsvorstand einstimmig.3 Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands vertritt dieArt. 8 Wissenschaftlicher Beirat1 Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus Sachverständigender Wirtschaft und der Wissenschaft.2 Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, die Stiftungin Forschungs- und Technologiefragen zu beraten undeinzelne Vorhaben zu begutachten.Art. 9 Satzung1 Die nähere Ausgestaltung der Stiftung wird durch eineSatzung geregelt.2 Die Satzung wird durch die Staatsregierung erlassen.Art. 10 StiftungsaufsichtDie Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staatsministeriumsder Finanzen.Art. 11 Beendigung, Heimfall1 Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben werden.2 Im Falle der Aufhebung der Stiftung fällt ihr Vermögenan den Freistaat Bayern.Art. 12 StiftungsgesetzIm Übrigen gelten die Bestimmungen des Stiftungsgesetzes(BayRS 282-1-1-K) in seiner jeweils gültigen Fassung.Art. 13 InkrafttretenDieses Gesetz tritt am 1. August 1990 in Kraft.Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.3 1 Der Vorstand bedient sich einer Geschäftsstelle.2 Sie wird von einem Geschäftsführer geleitet, der nachMaßgabe der Satzung auch Vertretungsaufgaben wahrnehmenkann.3 Der Vorstand beruft einen ehrenamtlichen Präsidenten.München, den 24. Juli 1990Der <strong>Bayerische</strong> Ministerpräsident Dr. h. c. Max Streibl135
Satzungder <strong>Bayerische</strong>n<strong>Forschungsstiftung</strong>Vom 5. Februar 1991 (GVBl S. 49), zuletzt geändert durchSatzung vom 14. Dezember 2010 (GVBl S. 863)Auf Grund des Art. 9 Satz 2 des Gesetzes über die Errichtungder <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong> vom 24. Juli 1990 (GVBlS. 241, BayRS 282-2-11-W), zuletzt geändert durch § 22 desGesetzes vom 16. Dezember 1999 (GVBI S. 521), erlässt die<strong>Bayerische</strong> Staatsregierung folgende Satzung:§ 1 Name, Rechtsform, SitzDie <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> ist eine rechtsfähige Stiftungdes öffentlichen Rechts mit dem Sitz in München.§ 2 Stiftungszweck1 Die Stiftung hat den Zweck,1. ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durchzusätzliche Mittel oder auf sonstige Weise universitäre undaußeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die wissenschaftlich-technologischeEntwicklung Bayerns oder für diebayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichenLebensgrundlagen nach Art. 131 und 141 der Verfassungvon Bedeutung sind,2. die schnelle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnissedurch die Wirtschaftzu fördern.2 Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbargemeinnützige Zwecke zur Förderung von Wissenschaftund Forschung im Sinn des zweiten Teils dritter Abschnitt(Steuerbegünstigte Zwecke) der Abgabenordnung. Die Stiftungist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linieeigenwirtschaftliche Zwecke. Sie verwirklicht ihren Zweckinsbesondere durch die Gewährung von Zuschüssen undDarlehen und durch die Übernahme von Bürgschaften undGarantien.§ 3 Stiftungsvermögen1 Das Vermögen der Stiftung besteht1. aus dem Anspruch gegen den Freistaat Bayern auf Zuweisungder Erträge aus seiner Beteiligung an der VIAG AGoder einer dagegen eingetauschten anderen Beteiligung;diese Zuweisung ist auf fünf Jahre befristet,2. aus einem Kapitalstock, den die Stiftung sich aus den inNummern 1 und 3 genannten Erträgen aufbaut,3. aus Zustiftungen vor allem aus der Wirtschaft, sonstigen Zuwendungensowie sonstigen Einnahmen, soweit sie nicht zurunmittelbaren Erfüllung des Stiftungszweck bestimmt sind.2 Für den Aufbau des Kapitalstocks nach Absatz 1 Nr. 2werden die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Mittel sowienach Maßgabe der Haushaltsgesetzgebung Teile der inAbsatz 1 Nr. 1 bezeichneten Erträge verwendet.3 Der Ertrag des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen,die nicht dem Kapitalstock zuzuführen sind, dürfennur entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden.Etwaige Zuwendungen dürfen nur für spenden begünstigteZwecke im Sinn des Abschnitts Steuer begünstigte Zweckeder Abgabenordnung verwendet werden.4 Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälertzu erhalten. Um den Stiftungszweck nachhaltigfördern zu können und um das Stiftungsvermögen zu erhalten,dürfen auch Rücklagen gebildet werden.§ 4 Stiftungsmittel1 Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus1. den in § 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Zuweisungen, soweitdiese nicht in den Kapitalstock eingestellt werden,2. Erträgen des gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 gebildeten Kapitalstocks,3. Zuwendungen und sonstige Einnahmen, soweit sie zur unmittelbarenErfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.136
2 Sämtliche Mittel dürfen nur im Sinn des Stiftungszwecksnach § 2 verwendet werden. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.Die Mitglieder des Stiftungsrats, des Stiftungsvorstandsund des Wissenschaftlichen Beirats erhalten keine Zu wendungenaus Mitteln der Stiftung.5. zwei Vertretern des <strong>Bayerische</strong>n Land tags,6. zwei Vertretern der Wirtschaft,7. zwei Vertretern der Wissenschaft, davon einem Vertreterder Universitäten und einem Vertreter der Hochschulen fürangewandte Wissenschaften – Fachhochschulen.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung des jederzeitwiderruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.4 Bei der Vergabe von Fördermitteln ist zu bestimmen, wiedie zweckentsprechende Verwendung der Stiftungsmitteldurch den Empfänger nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrechtder Stiftung oder ihrer Beauftragten festzustellen.5 Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck derStiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hoheVergütungen begünstigt werden.§ 5 Organe1 Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungsvorstandund der Wissenschaftliche Beirat.2 Die Mitglieder der Stiftungsorgane werden jeweils grundsätzlichehrenamtlich tätig; anfallende Auslagen können ersetztwerden. Der Stiftungsvorstand kann im Einvernehmenmit dem Stiftungsrat eine jährliche pauschale Tätigkeitsvergütungfür Mitglieder der Stiftungsorgane und sonstigeehrenamtlich tätige Personen beschließen.§ 6 Stiftungsrat1 Der Stiftungsrat besteht aus1. dem Ministerpräsidenten als Vorsitzenden,2. dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst,3. dem Staatsminister der Finanzen,4. dem Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehrund Technologie,2 Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 5 werden durch denLandtag für fünf Jahre bestellt. Ihre Amtszeit endet vorzeitig,wenn sie aus dem Landtag ausscheiden.3 Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 6 werden jeweils vom<strong>Bayerische</strong>n Industrie- und Handelskammertag sowie dem<strong>Bayerische</strong>n Handwerkstag gewählt. Die Mitglieder gemäßAbsatz 1 Nr. 7 werden von der Universität Bayern e.V. bzw.von der Hochschule Bayern e.V. gewählt. Ihre Amtszeit beträgtvier Jahre.4 Der Stiftungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen erstenund zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden.5 Für jedes Mitglied des Stiftungsrats kann ein Stellvertreterbestimmt werden. Der Ministerpräsident und die Staatsministerbestimmen ihre Stellvertreter in ihrer Eigenschaftals Stiftungsratsmitglieder. Für die Bestimmung der übrigenStellvertreter gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.6 Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er fasstseine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn dieMehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Alsanwesend gilt auch ein Mitglied, das sein Stimmrecht aufein anwesendes Mitglied oder dessen Stellvertreter übertragenhat. Eine Weiterübertragung des Stimmrechts istausgeschlossen.137
Satzung7 Der Stiftungsrat legt die Grundsätze der Stiftungspolitikund die Arbeitsprogramme fest. Er beschließt über:1. den Haushaltsplan, die Jahresrechnung und die Vermögensübersicht,2. den <strong>Jahresbericht</strong>,3. die Entlastung des Stiftungsvorstands,4. die Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresrechnung,5. den Erlass von Richtlinien zur zweck entsprechenden Verwaltungdes Stiftungsvermögens, u. a. im Hinblick auf diesteuerliche Begünstigung etwaiger Zustiftungen und Spenden,6. den Erlass von Richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln,7. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Stiftungsvorstands,8. die Bestellung der Mitglieder des WissenschaftlichenBeirats.Darüber hinaus kann der Stiftungsrat über Fragen vonallgemeiner Bedeutung oder über wichtige Einzelfragenbeschließen.3 Der Stiftungsvorstand gibt sich mit Zustimmung des Stiftungsratseine Geschäftsordnung. Er fasst seine Beschlüssemit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheitentscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Soweitder Bereich einzelner Ministerien berührt ist, entscheidetder Stiftungsvorstand einstimmig.4 Der Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich vomVorsitzenden des Stiftungsvorstands vertreten. Der Geschäftsführerführt im Auftrag des Stiftungsvorstands dielaufenden Geschäfte der Stiftung und vertritt insoweit dieStiftung nach außen. Der ehrenamtliche Präsident berät dieStiftung in allen Fragen der Förderpolitik. Das Nähere regeltdie Geschäftsordnung.§ 8 Wissenschaftlicher Beirat1 Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus je sieben Sachverständigender Wirtschaft und der Wissenschaft.§ 7 Stiftungsvorstand1 Der Stiftungsvorstand besteht aus je einem Vertreter1. der Staatskanzlei,2. des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung undKunst,3. des Staatsministeriums der Finanzen sowie4. des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehrund Technologie.Der Stiftungsvorstand bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzendenund einen Stellvertreter. Für jedes Mitglied desStiftungsvorstands kann ein Stellvertreter bestellt werden.2 Die Mitglieder werden vom Stiftungsrat bestellt; dasStaatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr undTechnologie unterbreitet Vorschläge für die Benennung derSachverständigen der Wirtschaft, das Staatsministerium fürWissenschaft, Forschung und Kunst für die Benennung derSachverständigen der Wissenschaft. Ihre Amtszeit beträgtdrei Jahre. Eine einmalige Wiederbestellung ist möglich.3 Der Wissenschaftliche Beirat bestimmt aus seiner Mitteeinen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er gibt sicheine Geschäftsordnung.2 Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den vomStiftungsrat festgelegten Richtlinien die Geschäfte derlaufenden Verwaltung und vollzieht die Beschlüsse desStiftungsrats. Er beschließt über die Mittelvergabe füreinzelne Fördervorhaben.4 Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, den Stiftungsratund den Stiftungsvorstand in Forschungs- undTechnologiefragen zu beraten und die einzelnen Vorhabenzu begutachten. Der Wissenschaftliche Beirat kann insbesonderegegenüber dem Stiftungsrat Empfehlungen zu138
den Grundsätzen der Stiftungspolitik sowie Stellungnahmenzu Beschlüssen des Stiftungsrats abgeben. Bei der Begutachtungder Anträge auf Fördermaßnahmen nach § 2 Abs. 2achtet er auf die Wahrung des Stiftungszwecks nach § 2 Abs.1 und auf die Einhaltung der Qualitätserfordernisse.5 Der Wissenschaftliche Beirat kann zur Erledigung seinerAufgaben Kommissionen bilden. Zu diesen Kommissionenkönnen auch Dritte hinzugezogen werden.§ 9 Haushalts- und Wirtschaftsführung1 Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.2 Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftungeinen Voranschlag (Haushaltsplan) aufzustellen, der dieGrund lage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgabenbildet. Der Voranschlag muss in Einnahmen und Ausgabenausgeglichen sein. Der Haushaltsplan ist der Aufsichtsbehördespätestens einen Monat vor Beginn des neuenGeschäftsjahres vorzulegen.3 Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftunginnerhalb von sechs Monaten Rechnung zu legen und diedurch den Abschlussprüfer geprüfte Jahresrechnung zusammenmit einer Vermögensübersicht und dem Prüfungsvermerkder Aufsichtsbehörde vorzulegen.§ 10 StiftungsaufsichtDie Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staatsministeriumsder Finanzen.§ 11 Beendigung, Heimfall1 Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben werden.2 Der Freistaat Bayern erhält bei Auflösung oder Aufhebungder Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigterZwecke nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile undden gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen zurück.Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfallsteuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung,soweit es die eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinenWert der geleisteten Sachanlagen des Stifters übersteigt, anden Freistaat Bayern, der es unmittelbar und ausschließlichfür gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.§ 12 SatzungsänderungenSatzungsänderungen werden von der Staatsregierung nachAnhörung des Stif tungsrats beschlossen.§ 13 InkrafttretenDiese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1991 in Kraft.4 Die Aufsichtsbehörde kann anstelle des in Absatz 2 geregeltenHaushaltsplans und der in Absatz 3 geregeltenJahresrechnung und Vermögensübersicht die Aufstellungeines Wirtschaftsplans vorschreiben, wenn ein Wirtschaftennach Einnahmen und Ausgaben nicht zweckmäßig ist.5 Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften des FreistaatesBayern über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.München, den 5. Februar 1991Der <strong>Bayerische</strong> Ministerpräsident Dr. h. c. Max Streibl139
Idee, Antrag,Entscheidung, ProjektVon Ihrer Idee zum ProjektWir helfen Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Projektidee.Zug um Zug hat die <strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong> in denletzten Jahren ihr Beratungsangebot ausgebaut. ModerneKommunikationsstrukturen und eine effiziente interneStruktur ermöglichen es uns, Ihnen die Unterstützung zubieten, die Sie brauchen, um Ihre Ideen in einen Erfolg versprechendenAntrag umzusetzen und ein bewilligtes Projektzu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Gerne stehenwir Ihnen für ein klärendes Vorgespräch zur Verfügung.Sollte die <strong>Forschungsstiftung</strong> nicht der passende Adressatfür Ihr Projekt sein, vermitteln wir Ihnen – als Partner imHaus der Forschung – den richtigen Ansprechpartner fürandere Landes- bzw. für Bundes- und EU-Förderprogramme.Vor der AntragseinreichungDie Mehrzahl der Antragsteller kommt mittlerweile zunächstmit einer Projektskizze zu uns. Dieser erste Schritt ermöglichtes, Ihnen bereits vor einer aufwendigen Antragstellung,die personelle Kapazitäten bindet und damit Zeit und Geldkostet, zielgerichtete Tipps zur Antragstellung zu geben.Sollten Sie einen Partner suchen, der Ihnen bei der UmsetzungIhrer Projektidee zur Seite steht, können wir Ihnen auchaufgrund unserer langjährigen Erfahrung geeignete Partneraus Bayern benennen und Ihnen dank unserer Kontakte als„Türöffner“ behilflich sein. Gerne kristallisieren wir mit Ihnengemeinsam aus Ihrer Idee die Forschungsschwerpunkteheraus, die eine erfolgreiche Antragstellung erwarten lassen.Der AntragJedes Projekt braucht einen Antragsteller und mindestenseinen projektbeteiligten Partner. Grundsätzlich sollen sichunabhängige Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenfinden.Nur in diesem Tandem ist eine Antragstellungmöglich. Die Zahl der Projektbeteiligten kann je nachder Art der Themenstellung variieren und die Zusammenset-140
zung interdisziplinäre Schnittstellen berücksichtigen.Die Förderung beträgt maximal 50 %. Die anderen 50 % erwartenwir als Eigenleistung der beteiligten Partner. Diesekann auch in geldwerten Leistungen, also in Personal- undSachkosten, erfolgen.Obwohl wir immer bemüht sind, bürokratische Hürden möglichstgering zu halten: Auch unser Verfahren erfordert gewisseGrundsätze. Um unseren Stiftungszweck langfristigerfüllen zu können, müssen wir mit unseren Stiftungsmittelnsorgsam umgehen und die Regeln einer ordnungsgemäßenAbwicklung einhalten. Wir helfen Ihnen aber, mit diesenErfordernissen zurechtzukommen. Wir beraten Sie bei derAufstellung der Kosten- und Finanzierungspläne ebenso wiebei der Darstellung der wissenschaftlichen Inhalte.Als technologieorientierte Stiftung ist es für uns selbstverständlich,Ihnen ein elektronisches Antragsformular anzubieten.Es ist so aufgebaut, dass es alle wichtigen Informationenenthält und Sie wie ein Leitfaden durch die Antragsformalitätenbegleitet. Sie können es von unserer Homepage abrufen,Ihre Angaben eintragen, auf Plausibilität überprüfenund uns datensicher auf elektronischem Weg zuschicken.Von der Antragseinreichung zur EntscheidungDie Antragseinreichung ist an keine Fristen gebunden. JederAntrag wird von mehreren externen Fachgutachtern geprüftund bewertet. Entscheidende Kriterien sind z. B. die Innovationshöhe,die Originalität der Idee, die Kompetenz derBeteiligten, aber auch mögliche Arbeitsplatzeffekte sowiedie spätere Umsetzbarkeit und Verwertbarkeit der gewonnenenErkenntnisse. Ist die externe Bewertung abgeschlossen,durchläuft jeder Antrag die Entscheidungsgremien derStiftung. Eine erste Prioritätensetzung erfolgt durch unserenWissenschaftlichen Beirat. Dieses Gremium ist besetzt mitführenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft.Hier wird jeder Antrag mit den hierzu erstellten externenGutachten ausführlich diskutiert und ein Vorschlagfür das Votum unseres Stiftungsvorstands erarbeitet. DieFörderentscheidung selbst trifft unser Stiftungsvorstand imEinvernehmen mit dem Stiftungsrat. In der Regel vergehtvon der Antragseinreichung bis zur Entscheidung ein Zeitraumvon 3 bis 6 Monaten.Die Förderung des ProjektsIst ein Projekt bewilligt, können jeweils vierteljährlich imVoraus die benötigten finanziellen Mittel zur Durchführungder Projektarbeiten abgerufen werden. Die entsprechendenFormulare stellen wir zur Verfügung. Der Antragsteller istfür die Durchführung des Projekts verantwortlich, fachlichund finanziell.Jedes Projekt erhält einen „Paten“ aus dem WissenschaftlichenBeirat, der das Projekt wissenschaftlich begleitet unddie Erreichung der „Meilensteine“ und der Zielvorgabenüberprüft. Die wissenschaftliche Berichterstattung erfolgt ineinem Soll-Ist-Vergleich jährlich, ebenso der Nachweis derMittel. Im Abschlussbericht, nach Beendigung des Projekts,werden alle erreichten Ergebnisse dargestellt, ebenso die imRahmen des Vorhabens entstandenen wissenschaftlichenVeröffentlichungen, Diplom arbeiten und Promotionen.Ein datenbankgestütztes Controlling ermöglicht es uns, dieVielzahl der laufenden Projekte finanziell und fachlich zuüberwachen und den Projektfortschritt zu dokumentieren.EvaluationUnsere Aufgabe ist damit aber noch nicht zu Ende. Da allevon der Stiftung geförderten Projekte sich im Bereich deranwendungsorientierten Forschung bewegen, interessiertuns natürlich, was längerfristig aus den von uns gefördertenProjekten entsteht. Deshalb fragen wir ca. 2 Jahre nach Projektendenoch einmal bei Ihnen nach, was aus den gewonnenenErkenntnissen geworden ist. Wir freuen uns über jedeErfolgsstory und machen die Arbeit der <strong>Bayerische</strong>n <strong>Forschungsstiftung</strong>mit Ihrer Hilfe dadurch transparent.141
KontaktElisenstr.HauptbahnhofLindwurmstr.Gabelsbergerstr.Brienner Str.Sonnenstr.StachusBarer Str.Sendlinger TorLudwigstr.IsartorPrinzregentenstr.LehelUMaximilianstr.Oettingenstr.MaximilianeumIsmaninger Str.Europapl.Ismaninger Str.Einsteinstr.<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>Prinzregentenstraße 5280538 MünchenTelefon + 49 89 / 21 02 86 - 3Telefax + 49 89 / 21 02 86 - 55forschungsstiftung@bfs.bayern.dewww.forschungsstiftung.deAnreise mit der DeutschenBahn / U-BahnVom Hauptbahnhof mit der U4 oderder U5 bis Halte stelle Lehel. Von dortca. 10 Minuten zu Fuß über die Tattenbach-und Oettingenstraße bis zurPrinzregentenstraße.Fraunhoferstr.Rosenheimer Str.Büro NürnbergGewerbemuseumsplatz 290403 NürnbergTelefon + 49 911 / 50 715 - 800Johannisstr.SpittlertorgrabenFrauentorgrabenVestnertorgrabenGewerbemuseumsplatzMarientorgrabenUMarienstr.Sulzbacherstr.Bahnhofstr.Telefax + 49 911 / 50 715 - 888Anreise mit der Deutschen BahnVom Hauptbahnhof (Ausgang City)ca. 10 Minuten zu Fuß über den Marientorgrabenbis zum Gewerbemuseumsplatz.Partner im „Haus der Forschung“www.hausderforschung.bayern.deSHauptbahnhof142
Ihre AnsprechpartnerProf. i. R. Dr.-Ing.Heinz Gerhäuser,PräsidentDorothea Leonhardt,GeschäftsführerinDipl.-Ing.Johannes Kastner,Leiter Wirtschaft /TransferDr.-Ing.Karl Glas,Leiter Wissenschaft /ForschungReiner Donaubauer,Leiter VerwaltungRobert Zitzlsperger,Leiter Rechnungswesen/ControllingDagmar Williams,Büro Nürnberg/AntragsberatungMelanie Binder,Büro Nürnberg/AntragsberatungSusanne Ahr,Leitung Sekretariat /SachbearbeitungChristine Reeb,Vorzimmer /SachbearbeitungMaria Raucheisen,Sekretariat /Sachbearbeitung143
BildnachweisTitel, Seiten 5, 14 / 15, 21, 23, 24 / 25, 32 / 33,76 / 77, 114 / 115, 123, 125, 127, 128 – 131,134 – 137, 139, 141HAAK & NAKAT [www.haak-nakat.de]Seiten 6, 8, 10, 12 / 13, 16, 18, 116 – 121,142 / 143<strong>Bayerische</strong> <strong>Forschungsstiftung</strong>Seite 26 / 27Klinikum der Universität MünchenKlinik für Allgemeine, Unfall-, HandundPlastische ChirurgieProjektgruppe RMV des Fraunhofer IWURessourceneffizente FabrikenSeite 28 / 29Max von Pettenkofer-Institut für Hygieneund Medizinische MikrobiologieLudwig-Maximilians-Universität MünchenFraunhofer-Institut für Integrierte Systemeund Bauelementetechnologie IISBSeite 30 / 31Universität BayreuthLehrstuhl für WerkstoffverarbeitungJulius-Maximilians-Universität WürzburgOrthopädisches Zentrum fürMuskuloskelettale ForschungSeite 34 / 35Technische Universität MünchenDepartment Chemie / Physikalische ChemieTechnische Universität MünchenLehrstuhl für EnergiesystemeSeite 36 / 37Continental Automotive GmbHAdvanced Development P ES E AD CBContinental Automotive GmbHSensors & ActuatorsSeite 38 / 39Technische Universität MünchenLehrstuhl für Aerodynamikund StrömungsmechanikTechnische Universität MünchenLehrstuhl für FahrzeugtechnikSeite 40 / 41Maschinenwerk Misselhorn (MWM) GmbHTechnische Universität MünchenLehrstuhl für AgrarsystemtechnikSeite 42 / 43Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinenund UmformtechnikProjektgruppe Ressourceneffizientemechatronische Verarbeitungsmaschinen RMVLudwig-Maximilians-Universität MünchenChirurgische Klinik und PoliklinikSeite 44 / 45Deutsches Herzzentrum Münchendes Freistaates BayernKlinik für Herz- und Gefäßchirurgieder Technischen Universität MünchenKlinikum der Universität MünchenInstitut für Klinische RadiologieSeite 46 / 47Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergInstitut für Medizinische PhysikAG Medizinische OptikUniversität des SaarlandesExperimentelle OphthalmologieLudwig-Maximilians-UniversitätFriedrich-Baur-Institut144
Seite 48 / 49Technische Universität MünchenKlinikum rechts der IsarKlinik und Poliklinik für PlastischeChirurgie und HandchirurgieMedizinische Klinik und Poliklinik Ider Universität WürzburgSchwerpunktsleiter Kardiale MRTund Klinische ElektrophysiologieSeite 50 / 51BIONORICA AGThe phytoneering companyUniversität BayreuthLehrstuhl für FunktionsmaterialienSeite 52 / 53Neue Magnetodyn GmbHLudwig-Maximilians-Universität MünchenMolekulare Pharmakologie,Department Pharmazie-Zentrumfür PharmaforschungSeite 54 / 55Helmholtz Zentrum München -Deutsches Forschungszentrumfür Gesundheit und UmweltInstitut für Lungenbiologie (iLBD)Technische Universität MünchenFakultät Architektur LS Baukonstruktionund Baustoffkunde (EBB)Seite 56 / 57Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergZentralinstitut für Neue Materialienund Prozesstechnik (ZMP)Technische Universität MünchenFachgebiet Sportgeräte und -materialienSeite 58 / 59Astrium GmbHTechnische Universität MünchenLehrstuhl für ProduktentwicklungSeite 60 / 61BMW Forschung und Technik GmbHHochschule für angewandte WissenschaftenIngolstadtInstitut für Angewandte Forschung (IAF)Seite 62 / 63Fraunhofer-Einrichtung für ModulareFestkörper-Technologien EMFTAbteilung Mikromechanik,Aktorik und Fluidik (MAF)Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergDepartment Werkstoffwissenschaften,Lehrstuhl I für AllgemeineWerkstoffeigenschaften (WW1)Seite 64 / 65Ludwig-Maximilians-UniversitätDepartment für Geo- und Umweltwissenschaftenund Center for NanoScience (CeNS)Technische Universität MünchenInstitut für Werkzeugmaschinenund Betriebswissenschaften iwbSeite 66 / 67Hofmann Innovation Group GmbHSiegfried Hofmann Werkzeugbau GmbHStefan HofmannTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Automatisierungund Informationssysteme (AIS)145
BildnachweisSeite 68 / 69FZG-AugsburgUniversität BayreuthLehrstuhl für Polymere WerkstoffeSeite 70 / 71Technische Universität MünchenLehrstuhl für FördertechnikMaterialfluss Logistik (fml)Weiss Umformwerkzeuge GmbHSeite 72 / 73Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Technische ElektronikBMW AGGeometrieabsicherungKarosseriekomponentenSeite 74 / 75Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergZentralinstitut für Neue Materialienund Prozesstechnik (ZMP)Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Fertigungsautomatisierungund Produktionssystematik FAPSSeite 78 / 79Technische Universität MünchenLehrstuhl für EnergiesystemeMartin GmbHFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Prozessmaschinenund Anlagentechnik (iPAT)Seite 80 / 81Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl Werkstoffe der Elektronikund EnergietechnikFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Chemische ReaktionstechnikSeite 82 / 83Fraunhofer-Institut für Integrierte Systemeund Bauelementetechnologie IISBTechnische Universität MünchenFakultät für ArchitekturLehrstuhl für Baukonstruktionund BaustoffkundeSeite 84 / 85ECKART GmbH ORDFraunhofer-Institut fürIntegrierte Schaltungen IISAbteilung HochfrequenzundMikrowellentechnikSeite 86 / 87Deutsches Zentrum fürLuft- und Raumfahrt e. V. (DLR)Robotik und Mechatronik Zentrum, RMCGeorg-Simon-Ohm-Hochschule fürangewandte Wissenschaften NürnbergInstitut POF-ACSeite 88 / 89Ludwig-Maximilians-Universität MünchenDepartment Pharmazie, PharmazeutischeTechnologie und BiopharmazieTRION Research GmbHScientific AffairsSeite 90 / 91Definiens AG ResearchLudwig-Maximilians-Universität MünchenPathologisches InstitutDeutsches Herzzentrum MünchenKlinik für Herz- und Gefäßchirurgie146
Seite 92 / 93Adjucor GmbHIsotope Technologies Garching GmbHSeite 94 / 95Nanion Technologies GmbHHelmholtz Zentrum MünchenInstitut für StrahlenschutzSeite 96 / 97Universität RegensburgKlinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe(Schwerpunkt Frauenheilkunde)Caritas Krankenhaus St. JosefJulius-Maximilians-Universität WürzburgInstitut für Pharmazie und LMCSeite 98 / 99Langmatz GmbHTechnische Entwicklung Mechanik (TEM)iwis antriebssysteme GmbH & Co. KGSeite 100 / 101ABTTestor, ÖBBHochschule für angewandte WissenschaftenRegensburgBauingenieurwesenMAHA-AIP GmbH & Co. KGAutomotive Industry ProductsSeite 102 / 103Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergETC Products GmbHnanocoatings and additivesSeite 104 / 105Universität BayreuthLehrstuhl für Polymere WerkstoffeTechnische Universität MünchenLehrstuhl für Brau- und GetränketechnologieSeite 106 / 107Hochschule für angewandteWissenschaften MünchenFakultät 05Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für FertigungstechnologieSeite 108 / 109voxeljet technology GmbHFriedrich-Alexander-UniversitätErlangen-NürnbergLehrstuhl für Prozessmaschinenund AnlagentechnikSeite 110 / 111Technische Universität MünchenLehrstuhl für Anlagen- und ProzesstechnikFronberg GussHochschule KemptenForschungszentrum Allgäu147
148
Prinzregentenstraße 5280538 MünchenTelefon + 49 89 / 21 02 86 - 3Telefax + 49 89 / 21 02 86 - 55forschungsstiftung@bfs.bayern.dewww.forschungsstiftung.deBüro NürnbergGewerbemuseumsplatz 290403 NürnbergTelefon + 49 911 / 507 15 - 800Telefax + 49 911 / 507 15 - 888forschungsstiftung@bfs.bayern.dewww.hausderforschung.bayern.de