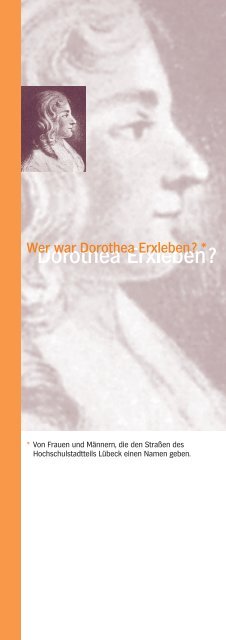Wer war Dorothea Erxleben ? * - Hochschulstadtteil ...
Wer war Dorothea Erxleben ? * - Hochschulstadtteil ...
Wer war Dorothea Erxleben ? * - Hochschulstadtteil ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wer</strong> <strong>war</strong> <strong>Dorothea</strong> <strong>Erxleben</strong> ? *<br />
* Von Frauen und Männern, die den Straßen des<br />
<strong>Hochschulstadtteil</strong>s Lübeck einen Namen geben.
InhaltsverzeIchnIs<br />
Inhalt<br />
1 Maria Gaetana aGnesI<br />
2 amelie hedwig Beese<br />
3 ernst aBBe<br />
4 andré Marie aMpère<br />
5 Gerty theresa corI<br />
6 <strong>Dorothea</strong> christiana erxleBen<br />
7 Johannes richard Baltzer<br />
8 Joseph carleBach<br />
9 Marie-sophie GerMaIn<br />
10 Maria Goeppert-Mayer<br />
11 christian andreas Doppler<br />
12 paul ehrlIch<br />
13 Karoline lucretia herschel<br />
14 henriette hIrschfelD-tIBurtIus<br />
In der Broschürenmitte:<br />
straßennamen im hochschulstadtteil –<br />
ein ÜBersIchtsplan<br />
15 alexander fleMInG<br />
16 carl friedrich Gauss<br />
17 Grace Murray hopper<br />
18 lise MeItner<br />
19 Joachim JunGIus<br />
20 albert lezIus<br />
21 Maria sibylla MerIan<br />
22 Maria MItchell<br />
23 Maximilian wilhelm hermann lInDe<br />
24 carl MÜhlenpforDt<br />
25 amalie emmy noether<br />
26 cornelia Bernhardine J. schorer<br />
27 Isaac newton<br />
28 Johannes scherBecK<br />
29 Johann adam soherr<br />
30 Johann Julius walBauM<br />
Impressum/ Kontakt<br />
Grusswort<br />
Die Lübecker Bürgerschaft hat in Ihrer Sitzung<br />
am 10. Oktober 2002 folgenden Antrag beschlossen:<br />
„Der Bürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft<br />
in ihrer nächsten sitzung einen geschlechtsspezifisch<br />
ausgewogenen namens-<br />
vorschlag für die Benennung der straßen im<br />
hochschulstadtteil vorzulegen.“<br />
Ein entsprechender Vorschlag zur Benennung<br />
der 29 Straßen und Wege wurde den politischen<br />
Gremien zur Novembersitzung 2002 vorgelegt.<br />
Die straßenrechtlichen Anforderungen für eine<br />
gute Orientierung der zukünftigen BewohnerInnen<br />
im neuen Stadtteil wurden somit erfüllt.<br />
Gleichzeitig sollte eine angemessene Ehrung<br />
verdienter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
mit Bezug zum neuen Hochschulstandort<br />
vorgenommen werden. Hierzu hat es in<br />
vielen Gremien Diskussionen und Empfehlungen<br />
gegeben, wobei sich herausstellte, dass das<br />
Wissen um die Verdienste von Männern viel bekannter<br />
ist, als das um die Leistungen von<br />
Frauen. Das bestätigte sich sogar bei den Nachforschungen<br />
zu dieser Broschüre! Wir freuen<br />
uns deshalb, dass es mit maßgeblicher Unterstützung<br />
des Lübecker Frauenbüros gelungen<br />
ist, den Alltagsblick für die wissenschaftlichen<br />
Errungenschaften von Frauen zu schärfen.<br />
In den Gremiendiskussionen wurde ebenfalls<br />
die Idee zu dieser Broschüre geboren, die wir –<br />
die <strong>Hochschulstadtteil</strong> Entwicklungsgesellschaft<br />
– gerne aufgegriffen haben. Zusammen mit dem<br />
Straßenplan hoffen wir, Ihnen eine interessante<br />
und wissenswerte Orientierungshilfe an die<br />
Hand zu geben. Stöbern Sie darin und erkunden<br />
Sie Ihr neues Viertel einmal ganz anders!<br />
Ihr HEG - Projektteam<br />
Grusswort
16. aprIl 1718 – 9. Januar 1799<br />
MarIa Gaetana aGnesI<br />
MarIa Gaetana aGnesI<br />
la prima signora della matematica:<br />
eine frau schafft sich einen platz in<br />
der Männerdomäne der Mathematik<br />
Mit neun Jahren hielt die junge Mailänderin im Salon<br />
ihres Elternhauses Vorlesungen auf Latein und beherrschte<br />
bereits sieben Sprachen. Mit 14 fand sie<br />
neue originelle Lösungen für Probleme der Ballistik und<br />
der analytischen Geometrie. Mit 20 Jahren <strong>war</strong> sie<br />
schon eine anerkannte Mathematikerin und veröffentlichte<br />
die „Propositiones philosophicae“, eine thesenhafte<br />
Sammlung naturwissenschaftlicher und philoso-<br />
phischer Streitgespräche, die sie im elterlichen Salon<br />
abhielt, in der sie sich vor allem auch für eine umfassende<br />
Bildung von Frauen ausspricht.<br />
Mit 30 Jahren veröffentlichte Agnesi dann ihre „Analytischen<br />
Gesetze“, eine der wichtigsten Grundlagen für<br />
die Integralrechnung, und wurde in die Akademie der<br />
Wissenschaften zu Bologna gewählt. Damit nicht genug,<br />
sorgte sie bald mit der „Agnesischen Hexe“, wie ihre<br />
Formel für die kubische Kurve genannt wird, für großes<br />
Aufsehen. Sie erntete Anerkennung und Begeisterung<br />
von Mathematikern, wissenschaftlichen Gesellschaften,<br />
Fürsten und Regenten aus weiten Teilen Europas. Auch<br />
Papst Benedikt XIV. – selbst begeisterter Mathematiker<br />
– <strong>war</strong> hoch beeindruckt und bot ihr in der Folge einen<br />
Lehrstuhl für höhere Mathematik und Naturphilosophie<br />
an der Universität zu Bologna an. Mit der Berufung von<br />
Frauen auf universitäre Lehrstühle stellte Italien zur<br />
damaligen Zeit die absolute Ausnahme im sonst eher<br />
patriarchalisch gesinnten Europa dar.<br />
Nach dem Tod ihres Vaters trat die nun 34-jährige von<br />
all ihren Ämtern zurück und widmete sich fortan der<br />
Religion und wohltätigen Zwecken. Bis heute gilt Maria<br />
Gaetana Agnesi als erste Mathematikerin der Geschichte.<br />
„nichts hat mich mehr ermutigt als die tatsache<br />
ihres Geschlechts, das durch eine glückliche fügung<br />
auch meines ist. es ist meine feste Überzeugung,<br />
dass in diesem zeitalter, das durch ihre herrschaft<br />
ausgezeichnet sein wird bis in die fernsten<br />
Generationen, sich jede frau bis an die Grenzen<br />
ihrer Kraft anstrengen muss, um den ruhm ihres<br />
Geschlechts zu fördern.“<br />
M. G. Agnesi im Vorwort ihrer „Analytischen<br />
Gesetze“, die sie der österreichischen<br />
Erzherzogin Maria Theresia gewidmet hat<br />
>MellI< Beese<br />
eine frau erobert die lüfte: die erste fliegerin<br />
und flugzeugkonstrukteurin Deutschlands<br />
Melli Beese sollte als erste deutsche Pilotin in die<br />
Geschichte eingehen, doch zunächst studierte sie<br />
Bildhauerei an der Kunsthochschule Stockholm, beschäftigte<br />
sich mit Schiffsbau und hörte Vorlesungen<br />
über Mathematik. Schließlich gelangte sie so an der<br />
Technischen Hochschule Dresden zur Flugtechnik und<br />
-mechanik. Mehr und mehr reifte in ihr der Wunsch, ihre<br />
theoretischen Kenntnisse in die Tat umzusetzen – doch<br />
an den meisten der wenigen Flugschulen, die zur damaligen<br />
Zeit existierten, wurde sie mit der Begründung,<br />
Frauen seien Technik-unverständig und ungeeignet, ein<br />
Flugzeug zu führen, abgelehnt. Nur ihrer Hartnäckigkeit<br />
ist es zu verdanken, dass sie im September 1911 als<br />
erste Frau Deutschlands und 115. Person überhaupt<br />
ihren Pilotenschein erhielt – allen Manipulationsversuchen<br />
männlicher Kollegen zum Trotz.<br />
Schon ein Jahr später gründete sie gemeinsam mit<br />
ihrem zukünftigen Mann Charles Boutard ihre eigene<br />
Flugschule und <strong>war</strong> nebenbei Flugzeugkonstrukteurin.<br />
Von 1912 bis 1914 wurden mehrere Patente von ihr angemeldet,<br />
u.a. ein „zerlegbares Flugzeug“, dessen Tragflächengerüst<br />
zusammenlegbar <strong>war</strong>; ein Wasserflug-<br />
zeug und ein einsitziges Leichtflugzeug.<br />
1913 heiratete Melli Beese Charles Boutard, einen Franzosen.<br />
Ihre Lehr- und Geschäftserlaubnis wurde ihr<br />
daraufhin im ersten Weltkrieg entzogen, ihr Mann<br />
wurde interniert. In den kommenden Jahren hielt sie<br />
der seelischen Belastung und den Kriegsrepressalien<br />
nicht mehr stand. Ihre Ehe ging in die Brüche, die Kraft<br />
zu einem Neuanfang <strong>war</strong> ihr abhanden<br />
gekommen. Am 22. Dezember 1925<br />
beging Melli Beese Selbstmord.<br />
Kurz zuvor, im Mai 1925, wurde auf der<br />
Tagung der internationalen Kommission<br />
für die Luftfahrt beschlossen, dass nur<br />
Männern ein Führerschein für Luftverkehrsflugzeuge<br />
ausgestellt werden dürfe.<br />
Noch heute sind – bis auf einige wenige<br />
Ausnahmen – Frauen im Cockpit eher<br />
eine Seltenheit.<br />
„an jenem 22. Dezember 1925 erschießt sich<br />
Melli Beese verzweifelt und entwürdigt, weil ihr<br />
die Gesellschaftsordnung, in der sie lebte, nicht<br />
den platz einräumte, der ihr gebührte.“<br />
Hans Ahner: Sturz in die Tiefe. Berlin 1983.<br />
aMelIe heDwIG Beese<br />
13. septeMBer 1886 – 22. DezeMBer 1925<br />
2
23. Januar 1840 – 14. Januar 1905<br />
ernst aBBe<br />
ernst aBBe<br />
Begründer des modernen Mikroskopbaus,<br />
fortschrittlicher sozialreformer und<br />
wichtiger partner von carl zeiss<br />
Bereits als Schüler <strong>war</strong> Ernst Abbes Taten- und Wissensdrang<br />
nicht zu bremsen: Neben der Schule studierte<br />
er die <strong>Wer</strong>ke des berühmten Mathematikers Carl<br />
Friedrich Gauß und begann bereits mit 17 Jahren sein<br />
Studium der Mathematik und Physik in Jena. Schon als<br />
23-jähriger <strong>war</strong> er hier nach seiner Habilitation Privatdozent,<br />
später dann, von 1870 bis 1896, Professor für<br />
Physik.<br />
1866 sollte er dem fast doppelt so alten „Mechanikus“<br />
Carl Zeiss begegnen. Gemeinsam mit ihm begründet<br />
Abbe in den Jahren 1871/ 72 den wissenschaftlichen<br />
Mikroskopbau: Zunächst erforscht Abbe im Auftrage<br />
Zeiss die wissenschaftlichen Grundlagen des Mikroskopbaus,<br />
danach entwickelt er die Beugungstheorie der<br />
mikroskopischen Abbildung. Er schafft so die Grundlagen<br />
für die wissenschaftlich fundierte Mikroskopherstellung<br />
– und die Firma Carl Zeiss entwickelt sich<br />
zu einem Unternehmen von Weltruhm.<br />
Nach dem Tode Carl Zeiss übernimmt Abbe 1889 die<br />
alleinige Leitung des Zeiss-<strong>Wer</strong>ks und führt maßgebliche<br />
Sozialreformen – u. a. die Einführung des Achtstundentags,<br />
der Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung und des bezahlten<br />
Urlaubs – durch. In diesem Zusammenhang<br />
gründet er 1891 auch die Carl-Zeiss-Stiftung, der er die<br />
Firma Zeiss und auch Teile seines eigenen Vermögens<br />
überschreibt und so für die wirtschaftliche Absicherung<br />
des Unternehmens sorgt.<br />
Ohne Abbes Untersuchungen und Entwicklungen wären<br />
zahlreiche medizinische Forschungserfolge in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts, v. a. auf dem Gebiet der<br />
Bakteriologie, undenkbar gewesen.<br />
anDré MarIe aMpère<br />
Der herausragende universalgelehrte –<br />
ein franzose unter strom<br />
Ein Sohn der Aufklärung von Beginn an: Ampère genoss<br />
keine Schulbildung, sondern <strong>war</strong> auf allen Wissensgebieten<br />
Autodidakt. Am meisten interessierte er sich<br />
jedoch für die Naturwissenschaften Mathematik und<br />
Physik und wurde so Lehrer und später sogar Professor<br />
auf diesen Gebieten.<br />
Anfangs beschäftigt sich Ampère noch mit Theorien zur<br />
Wahrscheinlichkeit und zu Differentialgleichungen, bis<br />
er von der Entdeckung des Elektromagnetismus hört<br />
und sofort zu experimentieren beginnt: Ampères unbestrittener<br />
Hauptverdienst zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
ist die Zusammenführung der bis dahin relativ<br />
unabhängigen Gebiete Elektrizität und Magnetismus.<br />
Der Franzose schuf so die Basis für die weitere Entwicklung<br />
der Elektrodynamik und gilt daher als ihr<br />
wichtigster Begründer. 1820 stellt er dann die mechanische<br />
Anziehung bzw. Abstoßung stromdurchflossener<br />
Leiter aufeinander fest, was heute als Ampère‘sches<br />
Gesetz bzw. -Kräftegesetz bekannt ist.<br />
Weiterhin gilt er als Erfinder des Prinzips der elektrischen<br />
Telegraphie, welches Carl Friedrich Gauß und<br />
Wilhelm Weber erstmals angewandt haben, und<br />
formuliert mit seinem Ampère‘schen Verkettungsgesetz<br />
die Grundlage für die Maxwell´schen Gleichungen.<br />
Zudem hat Ampère der Maßeinheit<br />
für die Stromstärke seinen Namen<br />
gegeben und besaß ganze vier Professuren:<br />
in Mathematik, Physik,<br />
Astronomie und Philosophie. Ein<br />
wissenschaftliches Multitalent.<br />
ampère:<br />
Kurzzeichen a, nach a. M. ampère<br />
benannte einheit der elektrischen<br />
stromstärke. a ist die stärke eines<br />
konstanten elektrischen stromes,<br />
der durch zwei parallele, geradlinige, unendlich lange<br />
und im vakuum im abstand von 1 m voneinander angeordnete<br />
leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen<br />
Querschnitt fließend, zwischen diesen leitern<br />
pro 1 m die Kraft 2 • 10 -7 n hervorrufen würde.<br />
Definition: wissen.de-Lexikon<br />
anDré MarIe aMpère<br />
22. Januar 1775 – 10. Juni 1836<br />
4
15. auGust 1896 – 26. oKtoBer 1957<br />
Gerty theresa corI<br />
Gerty theresa corI<br />
engagierte Medizinerin, die ihr leben der<br />
Biochemie verschreibt<br />
1914 studierte Gerty Theresa in Prag an der deutschen<br />
Universität Medizin – und lernte dort nicht nur ihre Liebe<br />
zur Biochemie, sondern auch zu Carl Cori, ihrem<br />
späteren Ehemann und beruflichen Partner, kennen.<br />
Gemeinsam sollten sie als Biochemiker-Ehepaar bekannt<br />
werden.<br />
Obwohl beide Medizin studierten, stand für sie schon<br />
früh fest, dass sie in die Forschung gehen und keine<br />
konventionellen praktischen Ärzte werden wollten. So<br />
kam es, dass die Coris 1922 in die USA gingen, um dort<br />
wissenschaftlich zu arbeiten, und 1928 auch ihre amerikanische<br />
Staatsbürgerschaft erhielten.<br />
Zunächst musste auch Gerty Cori Unterschätzungen<br />
und Abwertungen hinnehmen: Während ihr gleicher-<br />
maßen qualifizierter Ehemann als Biochemiker oder<br />
Forschungsleiter angestellt <strong>war</strong>, musste sie als Assistentin<br />
arbeiten. So ist auch zu erklären, weshalb vor<br />
allem Carl Cori bekannt wurde, obwohl beide immer<br />
gemeinsam forschten.<br />
Erst 1947 erhielt Gerty ihre Professur – in eben diesem<br />
Jahr wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann als erstes<br />
Ehepaar, als dritte Frau und als erste US-Amerikanerin<br />
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet (für die Glykogen-<br />
Synthese). Vor allem für die Erforschung der Verwandlung<br />
der Glukose in Glykogen, eine wesentliche Er-<br />
kenntnis zur Diabetes-Behandlung, sind die Coris<br />
verantwortlich. Zudem legten sie durch ihre Arbeit mit<br />
Enzymen und Hormonen die Grundlage für die Erforschung<br />
genetischer Defekte beim Menschen.<br />
1957 starb Gerty Cori. Doch noch anerkannt und hoch<br />
geehrt. Ihrer Lebensphilosophie ist sie bis dahin immer<br />
treu geblieben:<br />
„Ich glaube, dass die wunder des menschlichen<br />
Geistes in Kunst und wissenschaft zum ausdruck<br />
kommen, und sehe zwischen beiden keinen<br />
Gegensatz. ehrlichkeit, vor allem intellektuelle<br />
Integrität, Mut und freundlichkeit sind noch immer<br />
die tugenden, die ich bewundere. Die liebe zu meiner<br />
arbeit und die hingabe an sie sind für mich die<br />
Grundlage des Glücks.“<br />
<strong>Dorothea</strong> chrIstIana<br />
erxleBen<br />
Die erste Doktorin Deutschlands<br />
Seit jeher <strong>war</strong> es für Frauen mehr als beschwerlich, in<br />
der Medizin Fuß zu fassen. Erst recht im 18. Jahrhundert,<br />
als Frauen so gut wie keine Bildungsmöglichkeiten hatten.<br />
<strong>Dorothea</strong> <strong>Erxleben</strong> erging es nicht anders, dennoch<br />
hatte sie das Glück, von ihrem Vater, in dessen Praxis<br />
sie assistierte und den sie auf Krankenbesuchen begleitete,<br />
in die Medizin eingewiesen zu werden. Ein ordentliches<br />
universitäres Medizinstudium blieb ihr dennoch<br />
verwehrt.<br />
1740 bat sie deshalb den jungen Preußenkönig Friedrich<br />
den Großen (1712-1786), ihr die Promotion zu ermöglichen,<br />
woraufhin dieser die medizinische Fakultät in<br />
Halle/ Saale anwies, ihr bei einer Promovierung nicht im<br />
Wege zu stehen. Nun hatte Friedrich der Große aber<br />
erst in diesem Jahr den Thron bestiegen, sodass diese<br />
Anweisung wenig hilfreich <strong>war</strong>. Tief enttäuscht schrieb<br />
<strong>Dorothea</strong> zwei Jahre später ihre Gedanken zu einem<br />
Frauenstudium in ihrem Manuskript „Untersuchung der<br />
Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studiren<br />
abhalten“ nieder und verursachte damit – wohl kaum<br />
verwunderlich, zieht man den damaligen<br />
Zeitgeist in Betracht – erhebliche<br />
Unruhen im akademischen<br />
Berlin, die ihr noch weniger dienlich<br />
sein sollten.<br />
Dennoch machte sie weiterhin ärztliche<br />
Hilfreichungen und musste<br />
sich bald mit einer Anzeige Quedlinburger<br />
Ärzte wegen Kurpfuscherei<br />
auseinandersetzen. Doch wie das<br />
Schicksal es wollte, konnte sie die<br />
Praxis ihres Vaters dennoch übernehmen.<br />
Sie studierte Medizin, promovierte<br />
1754 in Halle, praktizierte bis zu ihrem Tode<br />
als erste Ärztin Deutschlands – und half so vielen anderen<br />
Frauen, die es ihr in Zukunft gleichtun wollten.<br />
„[…]<br />
auch Deutschland sieht in seiner töchter schaar<br />
Das, was sonst nur die Männer zieret.<br />
Ihm stellet sich die erxlebin jetzt dar<br />
Im schmuck, der Ihr mit recht gebühret,<br />
Im Doctorschmuck der edlen heilungskunst.<br />
Ihr gab ihn nicht die schmeicheley und Gunst.<br />
nein, Ihr verdienst ist dieser würde werth,<br />
sie <strong>war</strong>d von Ihr durch fleiß errungen.<br />
Die ehre, die Ihr jetzo wiederfährt,<br />
Bestärken selbst der neider zungen:<br />
sie machen am beschäumten dürren Mund<br />
Ihr hohes lob unwiedersprechlich kund.<br />
[…]“<br />
Johann Joachim Lange (1698-1765), Professor<br />
der Philosophie und Mathematik an der<br />
Friedrichs-Universität Halle, Auszug aus seinem<br />
Lobgedicht auf <strong>Dorothea</strong> <strong>Erxleben</strong> zu ihrer Promotion<br />
<strong>Dorothea</strong> chrIstIana erxleBen<br />
13. noveMBer 1715 – 13. JunI 1762<br />
6
4. Dezember 1862 – 25. Juni 1940<br />
Johannes rIcharD Baltzer<br />
Johannes rIcharD<br />
Baltzer<br />
architekt, Denkmalpfleger, oberbaudirektor<br />
Johannes Richard Baltzer entstammt einer westfälischen<br />
Baumeister-Familie, in deren berufliche Fußstapfen<br />
er nach seiner schulischen Laufbahn dann<br />
auch treten soll. Er studiert an der TH Berlin-Charlottenburg<br />
in der Abteilung für Architektur bei Karl<br />
Schäfer und schließt dieses Studium 1886 als Bauführer<br />
(mit Auszeichnung) ab. Vier Jahre später besteht<br />
er auch sein 2. Staatsexamen – abermals mit Auszeichnung.<br />
In den nächsten Jahren ist er Regierungsbaumeister<br />
im Ministerium der Öffentlichen Arbeiten in Berlin, und<br />
Kreisbauinspektor in Bartenstein (Ostpreußen). Das Regierungsgebäude<br />
in Osnabrück entsteht in dieser Zeit<br />
unter seiner Leitung.<br />
Am 1. Juli 1898 trat Baltzer als Bauinspektor in den<br />
lübeckischen Staatsdienst, womit sein mehr als 30<br />
Jahre andauerndes Wirken in der Hansestadt begann.<br />
1903 wurde er dann zum Baudirektor, 1923 zum Oberbaudirektor<br />
ernannt.<br />
An folgenden Bauten <strong>war</strong> Baltzer v.a. als Leiter maßgeblich<br />
beteiligt:<br />
Marlikaserne, Navigationsschule (spätere Seefahrtsschule),<br />
Ernestinenschule, Johanneum, zahlreiche<br />
städtische Verwaltungsgebäude und Krankenhäuser<br />
(u.a. Heilanstalt Strecknitz) u.v.m.<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg richtete sich sein Hauptaugenmerk<br />
auf die Schaffung von Wohnungen, um der<br />
dramatischen Wohnungsnot zu begegnen. Die Bearbeitung<br />
des Generalsiedlungsplans für Lübeck <strong>war</strong> sein<br />
wichtigstes Betätigungsfeld nachdem er zum Oberbaudirektor<br />
ernannt worden <strong>war</strong>.<br />
Baltzers Schaffen und Formensprache, die sich aus<br />
neugotischen, barocken, Jugendstil- und Renaissance-<br />
Elementen zusammensetzt, hat das Lübecker Stadtbild<br />
mehr als nachhaltig geprägt.<br />
Bilder mit freundlicher Genehmigung des Dölling und Galitz Verlags sowie des Joseph-Carlebach-Instituts, Israel<br />
Joseph<br />
carleBach<br />
einer der bedeutendsten<br />
deutschen rabbiner des<br />
20. Jahrhunderts<br />
Joseph Carlebach <strong>war</strong> das achte von insgesamt zwölf<br />
Kindern des seit 1870 in Lübeck amtierenden Rabbiners<br />
Salomon Carlebach. So wie die meisten seiner Brüder<br />
schlug auch er die Rabbinerlaufbahn ein. In dieser<br />
Funktion <strong>war</strong> er als Lehrer und Rabbiner in Jerusalem,<br />
Berlin, Litauen und Lübeck tätig. Joseph Carlebach <strong>war</strong><br />
Direktor der Talmud Tora-Realschule in Hamburg,<br />
Oberrabbiner der Hochdeutschen Israeliten-Gemeinde<br />
Altona mit Zuständigkeit für die gesamte Provinz<br />
Schleswig-Holstein, Oberrabbiner des Deutsch-Israelitischen<br />
Synagogen-Verbands Hamburg und Chacham<br />
(Rabbiner) der Portugiesisch-Jüdischen Gemeinde.<br />
Auch neben diesen Aufgaben <strong>war</strong> Carlebach mehr als<br />
vielseitig: 1901 schloss er seine Schulbildung am noch<br />
heute existierenden Katharineum mit dem Abitur ab<br />
und ging für vier Jahre nach Berlin, um dort an der<br />
Universität die Fächer Naturwissenschaften, Mathematik,<br />
Philosophie und Kunstgeschichte für das Lehramt<br />
zu studieren – u.a. bei Max Planck und Philosoph<br />
Wilhelm Dilthey. Seine akademischen Studien schloss<br />
er 1909 mit der Promotion zum Dr. phil. nat. an der Uni<br />
Heidelberg ab.<br />
Joseph Carlebach <strong>war</strong> Rabbiner und Pädagoge, Mathematiker<br />
und Philosoph, Übersetzer, Kunstkritiker und<br />
Bibelausleger, begnadeter Redner und vor allem geistiger<br />
Führer der jüdischen Gemeinde Hamburgs – und<br />
das in ihrer schwersten Zeit. Einer seiner wichtigsten<br />
Verdienste ist es, im Nazi-Deutschland für die jüdische<br />
Selbstbehauptung gekämpft zu haben. Auch dann noch,<br />
als er gemeinsam mit seiner Frau und den vier jüngsten<br />
Kindern sowie zahlreichen Angehörigen der jüdischen<br />
Gemeinde Hamburgs in das Konzentrationslager Jungfernhof<br />
bei Riga deportiert wurde. Hier wurden Joseph<br />
und Lotte Carlebach sowie die drei Töchter Ruth, Noemi<br />
und Sara (nur Sohn Shlomo Carlebach überlebte) am<br />
26. März 1942 ermordet.<br />
„sein wirken als rabbiner, die treue zu seiner Gemeinde<br />
und sein tragisches ende haben ihn zu einem<br />
symbol jüdischen wirkens und leidens in Deutschland<br />
in diesem Jahrhundert werden lassen. – seinen<br />
namen tragen eine straße in hamburg und eine in<br />
Jerusalem, sowie die Joseph-carlebach-loge [die<br />
leider nicht mehr existiert] in hamburg [und jetzt der<br />
stadtteilpark im hochschulstadtteil lübeck].“<br />
Peter Freimark in: Biografisches Lexikon für<br />
Schleswig-Holstein und Lübeck, Bd. 7, S. 42, 1985.<br />
Joseph carleBach<br />
30. Januar 1883 – 26. märz 1942<br />
8
1. aprIl 1776 – 27. JunI 1831<br />
MarIe-sophIe GerMaIn<br />
MarIe-sophIe GerMaIn<br />
ausnahmemathematikerin ohne Beruf –<br />
aber mit „unweiblicher“ Berufung<br />
Wie viele junge Mädchen stöberte auch Sophie Germain<br />
gern in der Bibliothek ihres Vaters Ambroise Francoise<br />
Germain – jedoch las sie Bücher, die für Mädchen ihres<br />
Alters nicht alltäglich <strong>war</strong>en: Mathematikbücher und die<br />
„Histoire des Mathématiques“ von Montucla. Allen<br />
Versuchen ihrer Familie zum Trotz, lies sie sich nicht von<br />
der Mathematik und Geometrie abbringen. So kam es,<br />
dass sie Vorlesungsmitschriften verschiedener Professoren<br />
der Pariser „Ecole Polytechnique“ wenigstens<br />
sammeln dufte – Frauen <strong>war</strong>en dort nicht zugelassen<br />
–, vor allem Chemie- und Analysisvorlesungen von J.L.<br />
Lagrange.<br />
Studenten <strong>war</strong> es nach der Französischen Revolution<br />
erlaubt, den Professoren ihre Meinung und Ideen zu den<br />
Vorlesungen mitzuteilen – und das tat Sophie auch: unter<br />
dem Pseudonym Auguste Antoine LeBlanc. Lagrange<br />
<strong>war</strong> beeindruckt – und kam ihrem Pseudonym auf die<br />
Schliche. Er pries sie als großes Talent, verhalf ihr so zu<br />
der moralischen Unterstützung, die ihr von ihrer Familie<br />
versagt blieb und wurde zu einem lebenslangen Freund<br />
und Mentor.<br />
Sophie Germain nutzte ihr Pseudonym ein zweites Mal:<br />
Als sie Gauß, dem bedeutendsten Mathematiker ihrer<br />
Zeit, ihre Gedanken zu dessen Theorien mitteilte. Gauß<br />
<strong>war</strong> beeindruckt und zwischen beiden erwuchs eine<br />
lange und umfangreiche Korrespondenz, obwohl sie<br />
sich nie persönlich getroffen haben.<br />
Die französische Akademie der Wissenschaften schrieb<br />
mehrere Preise für Essays zum Thema „Vibration elastischer<br />
Flächen“ aus. Einen davon erhielt Sophie<br />
Germain – und gelangte damit in die Kreise der berühmtesten<br />
Mathematiker Frankreichs. Sie wurde öffentlich<br />
gefeiert und durfte an den Sitzungen des<br />
„Institut de France“ teilnehmen – die höchste Ehre, die<br />
das Institut jemals einer Frau zuteil werden ließ.<br />
Neben ihren Arbeiten zur Theorie der Elastizität sind<br />
ihre zahlentheoretischen Abhandlungen am bekanntesten<br />
geworden. Daneben beschäftigte sie sich mit<br />
Philosophie, Chemie, Physik, Geographie und Geschichte.<br />
Auf Bitten Gauß sollte Sophie Germain die Ehrendoktorwürde<br />
der Universität Göttingen erhalten – doch sie<br />
starb, bevor sie diese hohe Auszeichnung entgegen-<br />
b c b b ∫ x dx ∑a x ∏a x (x+y)(x-<br />
a<br />
y) = x2-xy+xy-y2 = x2-y2 n 2∑i=1 a ∫ b f(x)g (x) dx {[ ∫x2 dx +<br />
MarIa Goeppert-Mayer<br />
von den rätseln, die die natur geschaffen hat<br />
– und der frau, die sie zu lösen suchte<br />
Im Alter von drei Jahren kam Maria Goeppert mit ihren<br />
Eltern nach Göttingen. Da es zur damaligen Zeit in<br />
Deutschland keine staatlichen weiterführenden Schulen<br />
für Mädchen gab, besuchte sie nach der Volksschule<br />
für zwei Jahre eine von Frauenrechtlerinnen geführte<br />
„Sufragetten-Schule“ und machte danach als sogenannte<br />
„Externe“ ihr Abitur. Sie studierte im Anschluss<br />
Mathematik und Physik in Göttingen – bei keinem<br />
geringeren als Max Born, der 1954 für seine quantenmechanischen<br />
Forschungen den Nobelpreis erhielt, 24<br />
Jahre nachdem die jetzige Maria Goeppert-Mayer ihren<br />
Doktortitel erhielt.<br />
Gemeinsam mit ihrem Mann, der an die Baltimore University<br />
als Professor für Chemie berufen wurde, ging sie<br />
in die USA. Hier wurde es ihr allerdings nicht viel leichter<br />
gemacht, einen Arbeitsplatz finden. Die Weltwirtschaftskrise,<br />
die Tatsachen, dass sie Frau eines Universitätsprofessors<br />
und die Quantenmechanik in den USA noch<br />
unbekannt <strong>war</strong>, kamen erschwerend hinzu. Schließlich<br />
fand sie eine Anstellung als Deutschkorrespondentin<br />
bei einem Physikprofessor. Hier durfte sie ihren Arbeitsplatz<br />
für Forschungen nutzen, sodass sie eigene<br />
Artikel veröffentlichte und Studentinnen ausbildete.<br />
Gemeinsam mit ihrem Mann veröffentlichte sie das<br />
Lehrbuch „Statische Mechanik“. Zudem unterstützte sie<br />
jüdische Kolleginnen, die ebenfalls in die USA<br />
emigrierten.<br />
1941 arbeitete sie am Atombombenbau<br />
mit, setzte sich<br />
aber gleichzeitig für eine friedliche<br />
Nutzung der Kernenergie<br />
ein. 1946, nachdem sie nach<br />
Chicago, das Zentrum der Atombombenforschung,<br />
gezogen <strong>war</strong>,<br />
wurde sie Institutsmitglied mit<br />
Professorentitel – aber ohne<br />
Bezahlung.<br />
Aufgrund ihrer Forschungen in<br />
der theoretischen Physik erhielt<br />
sie 1963 den Nobelpreis für ihre<br />
Arbeit „Kernkonfiguration nach<br />
dem Spin-Bahn-Kopplungsmodell“<br />
– nach Marie Curie <strong>war</strong> sie<br />
die zweite und bislang letzte<br />
Frau, die diese Auszeichnung im<br />
Bereich Physik erhalten hat.<br />
Bis zu ihrem Tode 1972 forschte und publizierte sie in<br />
San Diego – und ermunterte junge Frauen, Naturwissenschaftlerinnen<br />
zu werden.<br />
nehmen konnte.<br />
„Du wirst einen Beruf erlernen, du wirst studieren und<br />
etwas Interessantes tun.“<br />
Vater von Maria Goeppert<br />
10<br />
MarIa Goeppert-Mayer<br />
28. Juli 1906 – 20. Februar 1972
29. november 1803 – 17. märz 1853<br />
chrIstIan anDreas Doppler<br />
chrIstIan anDreas<br />
Doppler<br />
Doppelter enthusiasmus – doppelter effekt<br />
Schon früh förderten seine Eltern seine mathematischanalytisch<br />
orientierte Begabung. Doppler studierte so<br />
am Polytechnischen Institut Wien Mathematik und Physik,<br />
und an der Universität Salzburg Philosophie. Nachdem<br />
er eine erste Assistenzstelle in Wien inne hatte,<br />
wurde er schon mit 32 Jahren als Professor nach Prag<br />
berufen, wo er 13 Jahre lang forschte und mehr als 50<br />
wissenschaftliche Arbeiten publizierte.<br />
1842 veröffentlichte Doppler vor der Königlichen Böhmischen<br />
Gesellschaft sein berühmtes Buch „Über das<br />
farbige Licht der Doppelsterne und einige andere<br />
Gestirne des Himmels“. Er wurde damit weltberühmt.<br />
1848 kehrte er als Mitglied der Kaiserlichen Akademie<br />
der Wissenschaft nach Wien zurück und wurde hier<br />
1850 erster Direktor des Physikalischen Instituts an der<br />
Universität.<br />
Im Mittelpunkt seiner Forschungen stand die „Frequenzverschiebung“.<br />
Er untersuchte die Folgen, wenn<br />
sich Sender und Empfänger einer Welle gegeneinander<br />
bewegen. 1842 sagte er voraus, dass bei Annäherung<br />
eine höhere und bei Entfernung eine tiefere Frequenz<br />
zum Empfänger gelangt. Der „Doppler Effekt“.<br />
„was haben flugzeuge, schnelle<br />
autos, rote Blutkörperchen, klopfende<br />
herzen, Gase in dichten röhren<br />
und die sterne am himmel<br />
gemeinsam? Ihre Geschwindigkeit<br />
wird mit hilfe eines physikalischen<br />
prinzips gemessen, das der weltbekannte<br />
salzburger naturwissenschaftler<br />
christian andreas Doppler<br />
entdeckt hat.“<br />
paul ehrlIch<br />
ein leben für die Immunitätsforschung<br />
Paul Ehrlich studierte Medizin und promovierte anschließend<br />
zum Thema „Beiträge zur Theorie und Praxis<br />
der histologischen Färbung“. (Die Dissertation enthält<br />
u.a. Ehrlichs Entdeckung der Mastzellen.) Kurz darauf<br />
wird er an die Berliner Charité als Assistenzarzt, später<br />
als Oberarzt, berufen, wo er bis 1887 tätig ist.<br />
Ab 1882 arbeitet er nebenbei mit Robert Koch zusammen.<br />
Gemeinsam forschen sie auf dem Gebiet der<br />
Farbstoffe, versuchen, bakterielle Erreger durch Färbung<br />
kenntlich zu machen und entwickeln den ersten<br />
Direktnachweis von Mykobakterien. Ehrlich leistet zudem<br />
wesentliche Beiträge zur Diagnostik von Blutkrankheiten<br />
und setzt Methylenblau zur Vitalfärbung ein.<br />
Mit Ende seiner Tätigkeit an der Charité beginnt für Paul<br />
Ehrlich ein neuer Abschnitt: er habilitiert, wird Privatdozent<br />
für Innere Medizin an der Universität Berlin und<br />
arbeitet mit Emil Behring (Begründer der Serumtherapie)<br />
zusammen. Ehrlich beginnt mit der Immunitätsforschung<br />
und der Entwicklung wirkungsvoller Im-<br />
munisierungsprotokolle zur Gewinnung hochtitriger<br />
Heilsera – und entdeckt und definiert verschiedene<br />
Antikörperqualitäten bzw. Immunglobulinklassen. Aus<br />
seinen Beobachtungen zur Wirkung von Sera und<br />
Toxinen geht die Seitenkettentheorie als erstes konsistentes<br />
Konzept der Immunologie hervor.<br />
1891 wird Ehrlich von Robert Koch an das neu gegründete<br />
Institut für Infektionskrankheiten in Berlin<br />
berufen, das heutige Robert Koch-Institut. Hier arbeitet<br />
er an der Gewinnung sowie der Konzentrations- und<br />
<strong>Wer</strong>tbestimmung von Diphterieserum und schafft eine<br />
international anerkannte Maßeinheit. 1901 beginnt er<br />
explizit mit der Krebsforschung und errichtet 1902 eine<br />
Abteilung dafür, in der er u. a. an der experimentellen<br />
Chemotherapie forscht.<br />
1903 wird er mit der „Preußischen Großen Goldenen<br />
Medaille für Wissenschaft“ ausgezeichnet, eine Ehrung<br />
die zuvor nur Rudolf Virchow zuteil geworden ist. Nur<br />
fünf Jahre später erhält er gemeinsam mit Elia<br />
Metschnikow, dem Entdecker der Phagozytose, den<br />
Nobelpreis für „unvergängliche Verdienste um die<br />
medizinische und biologische Forschung, namentlich<br />
um die <strong>Wer</strong>tbestimmung der Serumpräparate“.<br />
Darauf ruht sich der leidenschaftliche Mediziner jedoch<br />
nicht aus und entdeckt ein Jahr später gemeinsam mit<br />
seinem Mitarbeiter Sachahiro Hata das Salvarsan 1 , das<br />
erste Chemotherapeutikum zur Syphilisbehandlung.<br />
1 12<br />
www.christian-doppler.com: Christian Doppler<br />
Forschungs- und Gedenkstätte, Salzburg<br />
Bildquelle: Freie Universität Berlin, www.linf.fu-berlin.de/ ~gutsche/intern<br />
Paul Ehrlich in seinem Arbeitszimmer. Mit freundlicher Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts (Bundesamt für Sera und Impfstoffe)<br />
1<br />
Am 10. Juli 1910 wird die erste größere Charge von<br />
Salvarsan bei Hoechst produziert. Salvarsan ist ein<br />
Kunstwort und bedeutet soviel wie: Das Mittel, das<br />
mit Arsen heilt.<br />
paul ehrlIch<br />
14. märz 1854 – 20. august 1915
1750 – 1848<br />
KarolIne lucretIa herschel<br />
KarolIne<br />
lucretIa<br />
herschel<br />
ein erster weiblicher stern<br />
am himmel der astronomie<br />
Karolines musikalisches Talent<br />
wurde von ihrem Vater, selbst<br />
Musiker, bewusst gefördert. Eine<br />
umfassende allgemeine Ausbildung<br />
blieb ihr dennoch verwehrt.<br />
Nach des Vaters Tod wollte sie Erzieherin und selbständig<br />
werden. Diese Pläne durchkreuzte allerdings<br />
ihre eigene, sehr konservative Mutter – ihr elf Jahre älterer<br />
Bruder Wilhelm hingegen half ihr unbewusst. Er<br />
<strong>war</strong> nach England gegangen, brauchte eine Haushälterin.<br />
Karoline durfte ihm aber erst folgen, als er ihrer Mutter<br />
Geld zusicherte, damit sich diese eine bezahlte Haushälterin<br />
nehmen konnte.<br />
Mit 22 Jahren kam sie nach England: Sie lernt die Sprache,<br />
beschäftigt sich mit Rechnungswesen und setzt<br />
ihre musikalische Ausbildung fort. Für einige wenige<br />
Gäste gibt sie kleine Konzerte, mit ihrem Bruder diskutiert<br />
sie astronomische Probleme. Zugunsten dessen<br />
astronomischer Studien muss sie ihre musikalische<br />
Karriere aber zurückstellen. Wilhelm entdeckt 1781 den<br />
Uranus, wird darauf in die Royal Society eingeführt und<br />
zum Hofastronom ernannt. Damit enden auch die musikalischen<br />
Aufführungen der Herschels. Doch – Karoline<br />
wird Assistentin ihres Bruders und erhält jährlich<br />
50 Pfund. Damit ist sie die erste Frau, die eine entsprechende<br />
Stelle in der Astronomie erhalten hat – aber<br />
auch diejenige, die am geringsten für diese Assistenzposition<br />
entlohnt wird. Ein Mann in ihrer Stellung<br />
hätte deutlich mehr verdient.<br />
Schließlich nimmt Karoline Wilhelm die meiste Arbeit<br />
ab und findet noch die Zeit, des Nächtens den Himmel<br />
systematisch abzusuchen. Sie entdeckt vierzehn Nebel<br />
und acht Kometen. Sie erstellt Kataloge und Berechnungen<br />
über 2500 Nebel und teilt Flamsteeds „British<br />
Catalogue“, der ca. 3000 Sterne auflistete, so ein, dass<br />
man mit ihm den Himmel systematisch absuchen<br />
konnte.<br />
1822 stirbt Wilhelm. Karoline geht zurück nach Hannover.<br />
Finanziell unabhängig stellt sie der Königlichen Akademie<br />
Flamsteeds Arbeiten vor, publiziert Wilhelms<br />
Bücher und vervollständigt die Katalogisierung der<br />
1500 Nebel und zahllosen Sternenhaufen, die sie gemeinsam<br />
entdeckt hatten. Letzteres bringt ihr schließlich<br />
anerkennend die Goldmedaille der Royal Astronomical<br />
Society ein, deren Ehrenmitglied sie im Alter<br />
von 85 Jahren wird. Zu ihrem 90. Geburtstag verleiht ihr<br />
der König von Preußen die<br />
goldene Medaille für Wissenschaften.<br />
Karoline Lucretia<br />
Herschel – eine der wenigen<br />
Frauen, deren Errungenschaften<br />
– wenn auch fast viel zu<br />
spät – letztlich doch noch gewürdigt<br />
wurden.<br />
henrIette<br />
hIrschfelDtIBurtIus<br />
Deutschlands erste zahnärztin mit<br />
außerordentlichem engagement für<br />
frauen und Bedürftige<br />
3 14<br />
Der Uranus<br />
Sie zählt zu den PionierInnen der Zahnmedizin – und<br />
gehört in die Reihe der Frauen, die mutig genug sind,<br />
mit den tradierten weiblichen Rollenbildern zu brechen,<br />
indem Sie einen Beruf wählen, der ihrem Geschlecht –<br />
nach damals weit verbreiteter Ansicht – nicht gut zu<br />
Gesicht steht. Sie gehört zu den Frauen, die anderen<br />
Frauen, die ihr folgen sollen, den Weg bereitet haben.<br />
Von 1867 bis 1869 studiert Henriette Zahnmedizin am<br />
Dental College in Philadelphia (USA). Trotz großer Vorbehalte<br />
vieler Professoren. Im Jahr ihres Abschlusses<br />
kam sie nach Deutschland zurück und eröffnete hier im<br />
November 1869 in Berlin als „Doctor of Dental Surgery“<br />
die erste Zahnarztpraxis in Deutschland, die einer Frau<br />
gehörte: ein „Zahnatelier“. Dies <strong>war</strong> allerdings nur möglich,<br />
weil sie vom Preußischen Kultusministerium die<br />
Genehmigung dazu erhielt – die natürlich mit einer wesentlichen<br />
Bedingung verbunden <strong>war</strong>: Henriette<br />
Hirschfeld-Tiburtius durfte, um die Grenzen der Sitte zu<br />
wahren, nur weibliche Patienten behandeln.<br />
Ihr beruflicher Schwerpunkt lag vor allem auf präventivmedizinischem<br />
Gebiet, also der Vorbeugung von Karies<br />
und Mund- und Kiefererkrankungen. Trotz der Heirat<br />
mit dem Arzt Carl<br />
Tiburtius und der<br />
Geburt zweier Kinder<br />
setzt sie ihre<br />
Arbeit fort, meinte<br />
sie doch, Kinder<br />
bräuchten selbständig<br />
denkende Mütter.<br />
Aber auch ihrem<br />
großen sozialen Engagement<br />
sollte deutlich<br />
mehr Würdigung<br />
geschenkt werden.<br />
Sie <strong>war</strong> z. B. in<br />
den Vorständen des<br />
„Heimathauses für<br />
Stellung suchende Mädchen“ und der „Heimstätte in<br />
Berlin“, die erwerbslosen Mädchen und deren Kindern<br />
Zuflucht bot, aktiv tätig. Vereins- und Wohlfahrtstätigkeiten<br />
nutzte sie, um Mädchen und jungen Frauen<br />
Wege in die finanzielle Selbständigkeit und zu einem<br />
Beruf zu zeigen. Der Schwester ihres Mannes, Franziska<br />
Tiburtius, <strong>war</strong> sie mehr als Vorbild. Diese studierte in<br />
der Schweiz Medizin und gründete danach mit Hilfe<br />
Henriettes eine „Poliklinik für Frauen“. Auch dort hielt<br />
Henriettes Geist Einzug – wurden doch dort vor allem<br />
Frauen aufgenommen, die keiner Krankenkasse angehörten<br />
und demzufolge am bedürftigsten <strong>war</strong>en.<br />
henrIette hIrschfelD-tIBurtIus<br />
14. feBruar 1834 – 25. auGust 1911
strassennaMen IM hochschulstaDtteIl<br />
straßennamen im hochschulstadtteil<br />
eIn ÜBersIchtsplan
6. august 1881 – 11. märz 1955<br />
alexanDer fleMInG<br />
alexanDer<br />
fleMInG<br />
zufälle gibt es nicht – oder wie das erste<br />
antibiotikum entdeckt wurde<br />
Als der schottische Professor Alexander Fleming im<br />
September 1928 sein Labor aufräumt, findet er eine<br />
verschimmelte Glasschale. Kaum, dass er sie wegwerfen<br />
will, besinnt er sich eines Besseren und schaut noch<br />
einmal genauer hin: Er erkennt, dass der Schimmelpilz<br />
seinen gezüchteten Bakterien nicht gut zu tun scheint<br />
– alle sind tot. Bei genaueren Beobachtungen erkennt<br />
er schließlich, dass eine Substanz des Pilzes die Bakterien<br />
vernichtet. Den Schimmelpilz nennt er fortan<br />
Penicillium 1 .<br />
Versuche, die eigentliche Substanz, das Penicillin G, in<br />
eine Substanz umzuwandeln, die stabil genug ist, um<br />
medikamentös eingesetzt zu werden, schlugen jedoch<br />
fehl. Fleming <strong>war</strong> kein Chemiker und gab im Jahre<br />
1931 seine Forschungen daran auf. Andere Wissenschaftler,<br />
v. a. Chemiker wie Ho<strong>war</strong>d Florey und Ernst<br />
Chain, setzten seine Versuche ab 1935 fort und entwickelten<br />
eine Substanz, die 1940 erfolgreich am Menschen<br />
getestet werden konnte.<br />
Seinen Siegeszug tritt das Medikament im Zweiten<br />
Weltkrieg an. Lungenentzündungen, Scharlach oder die<br />
Pest verlieren durch Flemings Penicillium ihre tödliche<br />
Bedrohung. Heute hingegen wird es zu häufig eingesetzt<br />
– Bakterien werden zunehmend resistent gegen die<br />
Substanz, die sie eigentlich vernichten soll.<br />
1944 wird Fleming in den Adelsstand erhoben und<br />
erhält 1945, nach dem breiten Einsatz des Penicillins im<br />
Zweiten Weltkrieg, gemeinsam mit Florey und Chain<br />
den Nobelpreis.<br />
„we unconsciously learned<br />
a great deal from nature.“<br />
Alexander Fleming über seine<br />
Jugend<br />
1<br />
Penicillium ist ein Stoffwechselprodukt verschiedener Arten des<br />
Pinselschimmels, das als Antibiotikum gegen viele Krankheitserreger<br />
(z. B. Kokken, Syphilisspirochäten) wirkt. Penicillin kann eingespritzt,<br />
eingenommen und örtlich angewandt werden. Penicillin wurde als<br />
erstes Antibiotikum in die Heilkunde eingeführt.<br />
Kugelmodell des Penicillins<br />
carl frIeDrIch Gauss<br />
eine mathematische Koryphäe – und die<br />
erfindung der weltweit ersten telegraphenverbindung<br />
Schenken wir Gauß´ Anekdoten Glauben, so hat er seinen<br />
Vater bereits mit drei Jahren bei der Lohnabrechnung<br />
korrigiert; in der Grundschule die Summe der<br />
Zahlen von 1 bis 100 nach s=n(n+1)/2 berechnet und<br />
mit 18 Jahren das reguläre Siebzehneck mit Zirkel und<br />
Lineal konstruiert.<br />
Gauß studierte zunächst in Göttingen, promovierte danach<br />
in Helmstedt und reüssierte mit der Bahnberechnung<br />
des Kleinplaneten Ceres, in die er seine Methode<br />
der kleinsten Quadrate und Überlegungen zur Zufallsberechnung<br />
(Glockenkurve) bereits einbezog. Diese<br />
<strong>war</strong> damals jedoch noch nicht veröffentlicht, brachte<br />
ihm aber den Ruf als Direktor an die noch nicht fertig<br />
gestellte Göttinger Stern<strong>war</strong>te ein. Die Bahnberechnungsmethoden<br />
publizierte er erst 1809 unter dem<br />
Titel „Theoria Motus Corporum Coelestium“. Bis heute<br />
sind sie – bis auf kleine Modifikationen aufgrund des<br />
modernen Rechnereinsatzes – im Kern nicht mehr verbessert<br />
worden.<br />
In der Folge veröffentlichte Gauß grundlegende <strong>Wer</strong>ke<br />
zur höheren Arithmetik, zur Differentialgeometrie und<br />
zur Bewegung der Himmelskörper. Er vermaß in seinen<br />
geodätischen Projekten u.a. das Königreich Hannover.<br />
Hier nahm er über fünf Jahre persönlich an den Vermessungen<br />
teil, für die er eigens neue Geräte (z. B. das<br />
Heliotrop) entwickelte.<br />
1802 wird er Mitglied der Königlichen Gesellschaft der<br />
Wissenschaften, der heutigen Akademie der Wissenschaften,<br />
und nach Petersburg berufen – doch er lehnt<br />
ab, so, wie er die Rufe vieler anderer Universitäten<br />
ebenfalls ablehnt. Statt dessen wird er 1807 zum ordentlichen<br />
Professor der Astronomie und Direktor der<br />
Universitäts-Stern<strong>war</strong>te in Göttingen ernannt. Hier<br />
bleibt er bis zu seinem Tode und macht zahlreiche<br />
wichtige Entdeckungen. 1833 verbanden er und Wilhelm<br />
Weber z. B. seine Stern<strong>war</strong>te mit dem physikalischen<br />
Kabinett mittels einer Drahtleitung und tauschten über<br />
elektromagnetisch beeinflusste Kompassnadeln Nachrichten<br />
aus: die erste elektrische Telegraphen-Verbindung<br />
der Welt! Völlig zu Recht lies König Georg V. von<br />
Hannover Gauß-Münzen mit der Inschrift „dem ersten<br />
Mathematiker“ prägen.<br />
„Die Mathematik ist die Königin<br />
der Wissenschaften und die<br />
Zahlentheorie ist die Königin<br />
der Mathematik.“<br />
5 16<br />
Carl Friedrich Gauß<br />
carl frIeDrIch Gauss<br />
30. april 1777 – 23. Februar 1855
9. Dezember 1906 – 1. Januar 1992<br />
Grace Murray hopper<br />
7<br />
Grace Murray hopper<br />
MarK I und „debugging“ – oder – von einer frau,<br />
die die technik-Geschichte des letzten Jahrhunderts<br />
maßgeblich mitgeschrieben hat<br />
Betrachten wir die Lebensdaten von Grace Hopper, fragen<br />
wir uns, in welchem Bereich ihre Leistungen anzusiedeln<br />
sind: In einem der mo-<br />
dernsten überhaupt – Grace<br />
Hopper ist die einzige Pionierin<br />
der Computerentwicklung.<br />
Schon früh interessierte sie sich<br />
für die Mathematik, doch Anfang<br />
des 20. Jahrhunderts <strong>war</strong> dies<br />
für Frauen noch immer verpönt.<br />
Nichtsdestotrotz erhielt sie gerade<br />
von einem Mann, ihrem<br />
Vater, die nötige Bestätigung darin,<br />
diesem Interesse nachzugehen<br />
– entgegen der typischen<br />
Frauenrollen. Genau das tat sie<br />
auch: Sie machte ihren Abschluss<br />
in Mathematik und Physik,<br />
erhielt ein Stipendium und vertiefte ihre Studien in<br />
Yale, wo sie im Alter von 23 Jahren ihr Masters Degree<br />
erhielt. Ein Jahr später trat sie an ihrem früheren College<br />
den Dienst als Mathematiklehrerin an. Nebenbei<br />
er<strong>war</strong>b sie ihren Doktor- und Professortitel in Yale.<br />
Seit 1944 <strong>war</strong> sie an der Entwicklung des ersten programmierbaren<br />
Digitalrechners der USA, dem MARK I,<br />
beteiligt. Sie <strong>war</strong> aber auch die dritte Person überhaupt,<br />
die diesen Rechner programmierte. Entgegen der allgemeinen<br />
Meinung, <strong>war</strong> Grace Hopper schon früh von den<br />
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten von Computern<br />
überzeugt, doch fehlten ihr geeignete programmier-<br />
und nutzerfreundliche <strong>Wer</strong>kzeuge. Sie gab ihre berufliche<br />
Karriere als College-Professorin deshalb auf und<br />
wechselte zum kommerziellen Computerprojekt<br />
UNIVAC I. Von ihr stammte in den folgenden Jahren die<br />
Idee des Compilers, der die Basis für Generationen von<br />
Programmiersprachen bilden sollte. An der Entwicklung<br />
der Programmiersprache COBOL <strong>war</strong> sie maßgeblich<br />
beteiligt, ebenso wie der Begriff des „debugging“ 1 von<br />
ihr geprägt wurde. Zudem entwickelte sie MARK II und<br />
III sowie die Programmiersprache „FLOW MATIV“ mit.<br />
Grace Hoppers fachliche Errungenschaften sind eindeutig,<br />
ihre Person ist jedoch umstritten: Zur Computerentwicklung<br />
kam sie über die US Navy, in der sie bis ins<br />
hohe Alter hinein eine der wichtigsten EDV-Beraterinnen<br />
<strong>war</strong>. Erst im Alter von 80 Jahren schied sie als Konteradmiralin<br />
aus dem Militärdienst aus.<br />
Die erste große Tagung von Frauen im Computerbereich,<br />
1994, trug ihren Namen: die „Grace Hopper Celebration<br />
of Women in Computing“. Neben zahlreichen weiteren<br />
Auszeichnungen verleiht ihr Präsident Bush 1990 die<br />
„National Medal of Technology“, die höchste nationale<br />
Auszeichnung für Verdienste um den technischen Fortschritt.<br />
1 debugging: Beim debugging/ debuggen [engl. to debug = entwanzen,<br />
einen Fehler beseitigen] wird ein Computerfehler (Bug)<br />
im Soft<strong>war</strong>e-Programm gesucht und entschärft.<br />
Quelle: wissen.de<br />
lIse MeItner<br />
Der nobel-fehler: eine<br />
frau und ihr lebenslanger<br />
Kampf um berufliche und<br />
menschliche anerkennung<br />
1902 macht Lise Meitner ihr<br />
Abitur und studiert im Anschluss<br />
daran Mathematik,<br />
Physik und Philosophie in<br />
Wien. Als zweite Frau schließt<br />
sie 1906 erfolgreich mit der<br />
Promotion ab. Um ein „wirkliches<br />
Verständnis von Physik zu gewinnen“, wechselt sie<br />
nach Berlin, hört Max Bohrs Vorlesungen, experimentiert<br />
mit Otto Hahn. Letzteres jedoch nur unter der Voraussetzung,<br />
das Institut niemals zu betreten. Sie<br />
arbeitet fortan in einer Holzwerkstatt im Keller des<br />
Hauses.<br />
Lise Meitner lässt sich nicht entmutigen und wird belohnt:<br />
Sie wird Universitätsassistentin bei Max Planck.<br />
1918 ist sie Leiterin der physikalischen Abteilung des<br />
Kaiser-Wilhelm-Instituts.<br />
Abermals als erste Frau, habilitiert sie 1922 in Physik<br />
und wird 1926 außerordentliche Professorin für experimentelle<br />
Kernphysik. Von einer entspannten Lage<br />
kann, wenn überhaupt, so nur kurzzeitig die Rede sein.<br />
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird ihr<br />
als Jüdin die Lehrerlaubnis entzogen. Wie so viele emigriert<br />
sie – zunächst nach Schweden, wo sie am Stockholmer<br />
Nobel-Institut für Physik beruflichen „Unter-<br />
schlupf“ findet. 1938 gelingt Bohr und Hahn zufällig die<br />
Kernspaltung. Da sie nicht weiter kommen, bitten sie<br />
Lise um Rat. Sie drängt beide zu weiteren Kontrollexperimenten,<br />
woraufhin ihnen die Entdeckung der Kernspaltung<br />
gelingt. Mit ihrem Neffen, Otto Robert Fritsch,<br />
liefert sie 1939 die erste theoretische Deutung dazu.<br />
Doch allein Otto Hahn erhält 1944 den Nobelpreis für<br />
diese bedeutende Entdeckung – er erwähnt Meitners<br />
Anteil daran mit keiner Silbe. Wieder wird sie beruflich<br />
wie menschlich hart gekränkt. Noch immer gilt sie als<br />
Mitarbeiterin Hahns, obwohl sie Leiterin einer eigenen<br />
physikalischen Abteilung ist und bedeutende Forschungserfolge<br />
aufzuweisen hat. Auch die Forschungsprofessur<br />
in Stockholm, der Otto-Hahn-Preis,<br />
den sie 1955 verliehen bekommt, und das Bundesverdienstkreuz,<br />
das sie 1959 erhält, können diese herben<br />
Schläge wohl nicht gemindert haben. 1960 wird sie<br />
emeritiert und siedelt nach Cambridge um.<br />
1966 erhalten sie, Hahn und Fritz Straßmann den<br />
Enrico-Fermi-Preis der Atomenergiekommission der<br />
USA. Bis zu ihrem Tod 1968 setzt sie sich für eine<br />
friedliche Nutzung der Atomenergie ein – wohl deshalb<br />
auch hat sie abgelehnt, in die USA zu gehen, um am<br />
geheimen Atombombenbau mitzuarbeiten.<br />
Lise Meitner und Otto Hahn:<br />
Zeichnung von Carola Schramm<br />
(Copyright Hahn-Meitner-Institut Berlin)<br />
lIse MeItner<br />
7. noveMBer 1878 – 27. oKtoBer 1968<br />
18
21./22. oKtoBer 1587 – 23. septeMBer 1657<br />
JoachIM JunGIus<br />
JoachIM JunGIus<br />
„Jungius <strong>war</strong> einer der ersten<br />
und mutigsten Kämpfer gegen<br />
die kritiklose annahme der<br />
aristotelischen naturlehre und<br />
für die freie forschung auf<br />
dem Gebiete der naturwissenschaften.“<br />
J.F. Bubendey über Joachim Jungius<br />
vielseitig, begabt und rastlos:<br />
einer der ersten deutschen universalgelehrten<br />
Joachim Jungius führte ein mehr als bewegtes Leben.<br />
Bis 1605 besuchte er das Lübecker Katharineum, in den<br />
Jahren darauf studierte er Philosophie und Mathematik<br />
in Rostock und Gießen, 1608 erhielt er seinen Magisterabschluss.<br />
1609 wurde er an die Universität Gießen<br />
als Mathematik-Professor berufen und legte hier bereits<br />
die propädeutische Bedeutung der Mathematik für<br />
die Philosophie dar. Die Professur legte er 1614 nieder,<br />
widmete sich als Privatgelehrter in Augsburg und Lübeck<br />
naturwissenschaftlichen und philosophischen<br />
Studien. Ab 1616 studierte er weitere zwei Jahre in Rostock<br />
– diesmal Medizin. In Padua wurde er zum Doktor<br />
der Medizin ernannt und daraufhin in die Philosophische<br />
Fakultät in Rostock aufgenommen. Als dort jedoch die<br />
Pest ausbrach, ging er nach Lübeck zurück, um kurze<br />
Zeit darauf dem Ruf als ordentlicher Professor nach<br />
Helmstedt zu folgen. Doch die Universität wurde aus<br />
Kriegsgründen aufgehoben – Jungius praktizierte kurzzeitig<br />
als Arzt in Braunschweig. 1626 kehrte er nochmals<br />
als rätlicher Professor der Mathematik nach Rostock<br />
zurück, doch schon zwei Jahre später folgte der Rastlose<br />
dem Ruf des Hamburger Johanneums als Rektor.<br />
Hier wurde er endlich sesshaft, hier blieb er bis zu seinem<br />
Tode und verhalf dem Akademischen Gymnasium<br />
zu neuem Glanz.<br />
Jungius bedeutendste Leistungen liegen auf den Gebieten<br />
der Logik, Physik, Chemie, Botanik und Mathematik.<br />
Später befasste er sich noch mit didaktischen, sprachwissenschaftlichen<br />
und geografischen Fragestellungen.<br />
1622 rief er in Rostock zur Gründung der ersten naturwissenschaftlichen<br />
Gesellschaft Nordeuropas auf, und<br />
verankerte in den Statuten der „Societa Ereunetica sive<br />
Zetetica“ sein Konzept von der Erneuerung der Naturerkenntnis<br />
durch die mathematisch-naturwissenschaftliche<br />
Fundierung der philosophischen Forschung. Er<br />
wurde so zum Pionier einer neuen Denkweise in der<br />
Naturwissenschaft und der wissenschaftlichen Methodologie<br />
Deutschlands.<br />
Leibnitz, einer der bedeutendsten<br />
Logiker Deutschlands,<br />
stellte Jungius mit<br />
Aristoteles und Descartes<br />
gleich, und auch Goethe<br />
befasste sich in seinen<br />
letzten Lebensjahren mit<br />
dem Universalgelehrten.<br />
Bild Albert Lezius: Mit freundlicher Genehmigung der DMW.<br />
alBert lezIus<br />
ein chirurg mit herz und seele<br />
Albert Lezius medizinische Laufbahn begann in Tübingen<br />
und München. Hier studierte er Medizin und bestand<br />
sein Staatsexamen. Es folgte<br />
eine Assistenz- und spätere Oberarztstelle<br />
am Mainzer Krankenhaus. 1938<br />
habilitierte er, schon ein Jahr später<br />
übernahm er die Leitung der Chirurgie<br />
am Bürgerspital in Frankfurt. Fünf<br />
Monate darauf folgte ein dreijähriger<br />
Militärdienst, in dem er Leiter der chirurgischen<br />
Abteilung des großen Luftwaffenlazaretts<br />
in Clichy bei Paris <strong>war</strong>.<br />
1944 kam Lezius in Gefangenschaft –<br />
zeitgleich verlieh ihm die Frankfurter<br />
Fakultät den Professorentitel. 1946<br />
kehrte er ans Bürgerspital zurück,<br />
1947 übernahm er dann als Chefarzt<br />
die Chirurgie am Lübecker „Krankenhaus<br />
Ost“, dem heutigen Universitätsklinikum. Hier<br />
konnte sich Lezius endlich entfalten: In kürzester Zeit<br />
entstand unter seiner Leitung ein für den norddeutschen<br />
Raum seit langem fehlendes Zentrum für Thoraxchirurgie.<br />
Bald hielt die Hamburger Universitätsklinik Ausschau<br />
nach einem Chirurgen und entschied sich nach längerem<br />
Zögern für Albert Lezius – eine, wie sich herausstellen<br />
sollte, mehr als glückliche Wahl.<br />
Lezius Name wurde international bekannt, als er Ende<br />
der 30er Jahre eine Methode der Revaskulierung des<br />
insuffizienten Koronarkreislaufes veröffentlichte. Er gehört<br />
zu den ersten Medizinern, die sich in Deutschland<br />
mit der operativen Behandlung von Herzklappenfehlern<br />
beschäftigten: Für die Neubearbeitung der Bier-, Braun-<br />
und Kümmelschen Operationslehre hatte er gerade das<br />
Kapitel der Herz- und Gefäßchirurgie fertig gestellt und<br />
widmete seine letzten Lebenstage der Vorbereitung einer<br />
Monographie über die Technik von Operationen am<br />
Herzen.<br />
Lezius gehört in die Reihe der bedeutenden Chirurgen,<br />
die sich durch eine unvergleichliche Geschicklichkeit<br />
und das Beherrschen verschiedenster Operationsmethoden<br />
auszeichnen. Wichtiger noch ist jedoch sein<br />
außerordentliches Engagement für die Pflege der Menschen,<br />
die von ihm behandelt wurden. Lezius <strong>war</strong> so zu<br />
einem Workaholic geworden – ohne seine Arbeit konnte<br />
er nicht, doch auf die Dauer konnte er auch nicht<br />
mit ihr. Er erlitt am 10. November 1953 einen Herzinfarkt,<br />
an dem er neun Tage später, im Alter von nur 50 Jahren,<br />
verstarb.<br />
„[...] ein ideenreicher und zuverlässiger chirurg,<br />
der überall, wo er auftrat, die herzen gewann<br />
durch die einfachheit und lauterkeit seines<br />
wesens, durch die ernsthaftigkeit seiner Bestrebungen<br />
und durch die empfänglichkeit für<br />
den guten willen und die leistungen anderer.“<br />
9 20<br />
R. Nissen zum Gedenken an Albert Lezius. In: Deutsche<br />
medizinische Wochenschrift (DMW). 79. Jg. 1954, S. 88<br />
alBert lezIus<br />
15. Januar 1903 – 19. november 1953
2. aprIl 1647 – 13. Januar 1717<br />
MarIa sIBylla MerIan<br />
MarIa sIBylla MerIan<br />
vielfältig wie ein schmetterling.<br />
Die erste große entomologin 1<br />
Das 17. Jahrhundert hieß intellektuelle Frauen nicht gerade<br />
willkommen, aber Maria Sibylla Merian fand dennoch<br />
einen winzigen Schlupfwinkel zum geistigen, zum<br />
gebildeten Leben. Mit 13 Jahren schrieb sie bereits: „Ich<br />
sammelte alle Schmetterlinge, die ich finden konnte,<br />
um ihre Metamorphose zu studieren.“ Heimlich häufte<br />
sie Tierchen, Insekten und Pflanzen an und schuf erste<br />
Zeichnungen.<br />
Allmählich wandelte sich ihr Interesse, aus der Künstlerin<br />
wurde eine Naturforscherin mit einer Wohnung<br />
voll „Teufelsgetier“, wie die Insekten, Raupen und Käfer,<br />
die Maria Sibylla untersuchte, damals abfällig genannt<br />
wurden. Sie ließ sich nicht beirren und entdeckte die<br />
Metamorphose von der Raupe über die Puppe hin zum<br />
Schmetterling. Minutiös hielt sie diese Stadien fest,<br />
entdeckte, dass jede Schmetterlingsart ihre eigene Futterpflanze<br />
hat, ohne die die Falter nicht leben können.<br />
1675 publizierte sie ihr „ Neues Blumenbuch“, worin sie<br />
Blumen und -gebinde kunstvoll illustrierte. Ihr zweites<br />
epochales <strong>Wer</strong>k erschien 1679: „Der Raupen wunderbare<br />
Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“.<br />
Epochal, weil Merian damit die Insektenkunde als<br />
Wissenschaft begründete. Die von ihr getroffene<br />
Einteilung in Tag- und Nachtfalter gilt noch heute.<br />
1685 zog sie nach Holland. Hier hörte sie von der tropischen<br />
Flora und Fauna. Ihre Begeisterung <strong>war</strong> so groß,<br />
dass sie nach achtjähriger Vorbereitung 1699 in See<br />
sticht: nach Surinam. Sie machte zahlreiche Exkursionen,<br />
hält die Metamorphose der tropischen Insekten<br />
minutiös fest. 1701 erkrankt sie an Malaria und<br />
muss nach Holland zurück – trotz<br />
allem mit einer mehr als reichen<br />
Ausbeute. Mit Hilfe Amsterdamer<br />
Kupferstecher fertigt sie sogleich ein<br />
großes Prachtwerk kolorierter Stiche<br />
über die Flora und Fauna Surinams an<br />
und veröffentlichte nach drei Jahren<br />
unermüdlicher Arbeit ihr Hauptwerk<br />
„Metamorphosis insectorum Surinamensium“.<br />
Zwölf Jahre später stirbt sie<br />
– als erste Naturwissenschaftlerin, die<br />
erkannte, dass Insekten Entwicklungs-<br />
stufen durchlaufen.<br />
1 Entomologie = Insektenkunde<br />
„Im Juni 1699 schifft sich<br />
die 52-Jährige [...] nach<br />
südamerika ein [...] in einer<br />
zeit, in der eine frau<br />
ohne männliche Begleitung<br />
noch nicht einmal<br />
mit der postkutsche in die<br />
nächste stadt fahren darf!<br />
In die Kolonien reist eine ehrbare frau nur mit Männern<br />
aus ihrer familie. allein überqueren in der regel<br />
nur >zuchthaushuren, betrunkene straßenferkel und<br />
Diebinnen< den atlantik...”<br />
MarIa MItchell<br />
ein leben für die sterne oder:<br />
amerikas erste astronomin<br />
Maria Mitchell <strong>war</strong> die bedeutendste amerikanische<br />
Wissenschaftlerin des 19. Jahrhunderts und erste Astronomie-Professorin<br />
der USA. Ihr Wissen erhielt sie<br />
zunächst von ihrem Vater, der meinte, Mädchen sollten<br />
den gleichen Bildungsstand wie Jungen besitzen. Dann<br />
bildete sie sich autodidaktisch weiter, wobei ihr ihre<br />
Arbeit als Bibliothekarin behilflich <strong>war</strong>. Einerseits, weil<br />
sie dort an der Quelle zu all ihrem Wissen saß, andererseits,<br />
weil dies ein gut bezahlter Arbeitsplatz <strong>war</strong>, der<br />
ihr den nötigen Feiraum zum Studieren und Lesen gab.<br />
Nicht alle gebildeten Frauen konnten solche Vorzüge<br />
genießen.<br />
Im Observatorium ihres Vater, das mit einem nagelneuen<br />
Teleskop ausgestattet <strong>war</strong>, entdeckte sie 1847 einen<br />
Stern, wo zuvor keiner gewesen <strong>war</strong>. Weil sie einen Kometen<br />
vermutete, notierte sie sich dessen Koordinaten.<br />
Der Stern bewegte sich weiter und bestätigte damit<br />
ihre Vermutung. Marias<br />
Entdeckung wurde<br />
„Question everything.“<br />
an den dänischen Kö-<br />
Maria Mitchell<br />
nig weitergeleitet –<br />
dieser hatte versprochen,<br />
demjenigen, der einen Kometen allein durch ein<br />
Teleskop zu entdecken vermag, eine Goldmedaille zu<br />
schenken. Doch auch ein römischer Priester sah den<br />
Kometen – allerdings zwei Tage später –, und da seine<br />
Entdeckung vor der Marias beim König eintraf, erhielt<br />
zunächst er den Preis. Nach langwierigen Verhandlungen<br />
wurde er schließlich doch Maria zugesprochen, und der<br />
Komet nach ihr benannt. Maria wurde berühmt, Wissenschaftler<br />
gratulierten ihr, Menschen kamen, um die Frau<br />
zu sehen, die einen Kometen entdeckt hatte. Nur ein<br />
Jahr nach ihrer Entdeckung, wurde sie in die American<br />
Academy of Arts and Sciences als erstes weibliches<br />
Mitglied aufgenommen, zwei Jahre später in die Association<br />
for the Advancement of Science. Maria besuchte<br />
nun wissenschaftliche Versammlungen und machte<br />
astronomische Berechnungen.<br />
Unterdessen sammelten zahlreiche Amerikanerinnen<br />
Geld für die erste Astronomin des Landes und schenkten<br />
ihr davon ein neues Teleskop, welches sie zum<br />
Studium von Sonnenflecken nutzte. 1865 wurde sie<br />
Astronomieprofessorin und Direktorin des Observatoriums<br />
im neu eröffneten Vassar College. Hier veranstaltete<br />
sie Nachtobservationen von Meteorschauern,<br />
fotografierte Sterne und untersuchte die Oberflächen<br />
von Saturn und Jupiter. 1869 wurde sie als erste Frau in<br />
die American Philosophical Society gewählt und beteiligte<br />
sich vier Jahre später an der Gründung der<br />
American Association for the Advancement of Women,<br />
deren Präsidentin sie <strong>war</strong>.<br />
1 22<br />
Dieter Wunderlich: EigenSinnige Frauen. Zehn Porträts. Verlag<br />
Friedrich Pustet, Regensburg.<br />
Merians Zeichnung des<br />
großen Atlasschmetterlings<br />
MarIa MItchell<br />
1. auGust 1818 – 28. JunI 1889
14. Juni 1862 – 23. april 1940<br />
MaxIMIlIan wIlhelM herMann lInDe<br />
Max lInDe<br />
lübecker augenarzt und Kunstliebhaber<br />
Wie so viele Lübecker Persönlichkeiten machte auch<br />
Max Linde sein Abitur am humanistischen Gymnasium,<br />
dem Katharineum, bevor er nach Kiel, Berlin, Marburg,<br />
Straßburg und München ging, um Medizin zu studieren<br />
und 1886 zu promovieren. Im Anschluss daran assistierte<br />
er seinem Großonkel, einem Sanitätsrat; er fuhr<br />
ein halbes Jahr lang als Schiffsarzt zur See und praktizierte<br />
ab 1887 als Arzt und Geburtshelfer in Hamburg-<br />
Eimsbüttel. Nach einer dreijährigen Fortbildung zum<br />
Augenarzt kehrte er 1897 nach Lübeck zurück. Er<br />
eröffnete ein Jahr darauf eine Augenarzt-Praxis, die er<br />
bis 1926 betrieb.<br />
Doch Max Linde zählt weniger aufgrund seiner beruflichen<br />
Leistungen zu den bedeutendsten Lübecker Persönlichkeiten<br />
– vielmehr <strong>war</strong> er einer der fortschrittlichsten<br />
Kunstsammler seiner Zeit. 1898 kaufte er das<br />
heutige Lübecker Standesamt und vereinigte dort eine<br />
große Anzahl moderner Kunstwerke: Gemälde und Pastelle<br />
Cézannes, Degas´, Manets, Monets und Renoirs.<br />
Dessen monumentale Bronze „Le Penseur“ stand seit<br />
1905 im Garten des Hauses. Zudem besaß Linde Gemälde<br />
von Böcklin, Leibl und Trübner, Plakate von Toulouse-Lautrec<br />
und Farbholzschnitte von Utamaro,<br />
einem japanischen Künstler.<br />
Zu Max Liebermann, dem bedeutendsten Portraitisten<br />
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, knüpfte Linde schon<br />
Mitte der 90er Jahre Kontakt. 1897 kam er nach Lübeck,<br />
um den Arzt und Kunstliebhaber zu malen – so wie<br />
auch viele andere nationale und internationale Künstler,<br />
Architekten und Kunstinteressierte nach Lübeck kamen,<br />
um Linde und dessen Sammlung zu besuchen.<br />
Aber Linde <strong>war</strong> nicht nur Sammler, er <strong>war</strong> vor allem<br />
Mäzen und ist als erster dieser Art in die Kunstgeschichtsschreibung<br />
eingegangen. Er förderte und protegierte<br />
den norwegischen Maler Edvard Munch, erklärt<br />
ihn 1902 in seiner Schrift „Edvard Munch und die Kunst<br />
der Zukunft“ zum Künstler der Moderne. Im selben Jahr<br />
entstand in Lübeck Munchs „Linde Mappe“, Radierungen<br />
und Lithographien, die die Familie Linde zeigen. Linde<br />
verhalf Munch vor allem zu wesentlichen Kontakten, die<br />
die Grundsteine für dessen internationale Anerkennung<br />
legen sollten.<br />
Linde setzte sich aber vor allem auch für die kulturelle<br />
Entwicklung in Lübeck ein. Er <strong>war</strong> z. B. Vorsteher des<br />
Naturhistorischen Museums, des Gewerbemuseums<br />
und der Sammlung von Gemälden, Kupferstichen und<br />
Gipsabgüssen. Er machte die Lübecker in zahlreichen<br />
Ausstellungen mit den neuesten Kunstströmungen bekannt,<br />
hielt Vorträge und gründete als reformfreudiger<br />
Arzt den Verein für Schulgesundheitspflege.<br />
Aus Munchs „Linde Mappe“ – Die vier Söhne des Dr. Linde<br />
Bildquellen: Universitätsarchiv der Technischen Universität Braunschweig (UniA BS), J I M : 26) Das katholische Gesellenhaus am Dom<br />
carl MÜhlenpforDt<br />
ein Baumeister für lübeck<br />
Carl Mühlenpfordt´s Karriere begann am humanistischen<br />
Gymnasium in Blankenburg und setzte sich an<br />
der Technischen Hochschule Braunschweig fort, wo er<br />
Architektur studierte.<br />
Mühlenpfordt´s architektonische Leistung in Lübeck, wo<br />
er von 1903 bis 1905 Regierungsbauführer und von<br />
1907 bis 1914 Bauinspektor <strong>war</strong>, ist vor allem dadurch<br />
gekennzeichnet, dass sie stets das individuelle Gesicht<br />
der Hansestadt berücksichtigte und formte und sich<br />
nicht in modernen Neubauten verlor. Seine Bauwerke<br />
fügen sich so ein in die einzigartige Architektur der<br />
Stadt, immer zweckmäßig und klar gestaltet, und<br />
schaffen ein ausgewogenes, ruhiges und vor allem traditionsreiches<br />
Miteinander. Bei der Instandsetzung des<br />
Rathauses <strong>war</strong> er z. B. bemüht, traditionelle Arbeitsweisen<br />
zu nutzen und die alten Materialien zu reproduzieren.<br />
Weitere lübsche Bauwerke, an denen Mühlenpfordt´s<br />
architektonischer Stil deutlich wird, sind u. a. der Giebel<br />
der Apotheke in der Sandstraße (1912), das Hauptzollamt<br />
(1910), die Schule am damaligen Falkendamm (1913),<br />
das katholische Gesellenhaus am Dom (1907), der<br />
<strong>Wer</strong>kbau des Drägerwerks (um 1937), die Kirche in<br />
Kücknitz (erbaut 1909) und seine Siedlungsbauten<br />
„Heimstätten“ (1910 und 1935).<br />
Die Hansestadt Lübeck würdigte Mühlenpfordt´s Leistungen<br />
mit dem Titel eines Baurats und dem Lübecker<br />
Hanseatenkreuz – und im Jahre 2003 mit einem<br />
Straßennamen im <strong>Hochschulstadtteil</strong>.<br />
„Die große linie seiner architektur zieht über Jahrzehnte<br />
hinweg. Der raum verbietet, seine ganze<br />
arbeit, besonders auch seine lehrtätigkeit, zu<br />
schildern. als professor in Braunschweig schuf er<br />
neben großen stadtbauten die Kirchen in der<br />
Moorsiedlung thausen und in oldenburg. Diese zeigen<br />
rund zwanzig Jahre nach den ersten lübecker<br />
Bauten den gleichen reifen, klaren stil und die enge<br />
verbundenheit mit niedersachsen .“<br />
3 24<br />
Die Schule am Falkendamm<br />
Dr. Ing. Hespeler: Ein Lübeckischer Baumeister.<br />
In: Lübeckische Blätter. 1938<br />
carl MÜhlenpforDt<br />
12. feBruar 1878 – 19. Januar 1944
23. märz 1882 – 14. april 1935<br />
aMalIe eMMy noether<br />
Aufgabe 4: Sei R ein noetherscher<br />
Ring. Zeigen Sie, dass der<br />
Potenzreihenring R[[X]] in einer<br />
Variablen wieder noethersch ist.<br />
aMalIe<br />
eMMy<br />
noether<br />
ein leben für die<br />
Mathematik<br />
Emmy Noether gilt laut ihrer Biographin Tollmien als die<br />
„Begründerin der axiomatischen Algebra“ und „bedeutendste<br />
Mathematikerin, die je gelebt hat“. Soweit<br />
so gut. Eine überragende akademische Bedeutung an<br />
deutschen Universitäten kam ihr dennoch nicht zu.<br />
Mehr als einen kleinen Lehrauftrag hatte man(n) der<br />
„genialen Mathematikerin“ (Luise F. Pusch) nie zugestanden.<br />
Soweit die Tatsachen.<br />
Emmy macht im Jahr der Jahrtausendwende (1900) ihr<br />
Lehrerinnenexamen für Englisch und Französisch und<br />
legt 1903 ihr Abitur ab. Zum Wintersemester 1903/04<br />
geht sie nach Göttingen, damals eine der Hochburgen<br />
der Mathematik. Sie wird jedoch krank, kehrt schon<br />
nach einem Semester nach Erlangen zurück. Ab 1904/<br />
05 studiert sie dort bei ihrem Vater weiter: als einzige<br />
Frau unter 47 Mathematikkommilitonen. Sie promoviert<br />
summa cum laude und wird in die „Deutsche Mathematikervereinigung“<br />
aufgenommen, wo sie sich abermals<br />
in einer von Männern beherrschten Domäne be-<br />
weisen muss.<br />
Zwei Göttinger Mathematiker bitten sie 1915 um Hilfe<br />
bei der Relativitätstheorie. Sie geht erneut nach Göttingen,<br />
stellt einen Antrag auf Habilitation, der allerdings<br />
zu dieser Zeit abgelehnt wird. Laut Luise F. Pusch wollte<br />
man keinen Präzedenzfall schaffen. Nach dem Krieg hat<br />
sich die Situation jedoch umgekehrt: Emmy darf nun<br />
habilitieren – als erste Frau an der Universität Göttingen<br />
– und unter ihrem Namen lehren.<br />
1921 veröffentlicht sie eine Arbeit, die ihr internationale<br />
Beachtung einbringt und woraufhin sie zur „nichtbeamteten<br />
außerordentlichen Professorin“ ernannt wird.<br />
Ihren ersten bezahlten Lehrauftrag – der nur für die<br />
lebensnotwendigsten Dinge ausreichte – erhält sie dennoch<br />
erst, als sie durch die Inflation all ihre Ersparnisse<br />
verliert.<br />
1933 entziehen ihr die Nationalsozialisten die Lehrbefugnis.<br />
Sie geht ins Exil in die USA, wo sie eine Gastprofessur<br />
an einem Frauen-College erhält.<br />
Einzige Entschädigung für die Demütigungen und Entbehrungen,<br />
die sie als Frau unter männlichen Akademikern<br />
zu erdulden hatte, <strong>war</strong> der wachsende inter-<br />
nationale Schüler- und Kollegenkreis, der ihren Namen<br />
in die Welt trug.<br />
cornelIa B. J. schorer<br />
ärztin in amerika<br />
Als eine der ersten deutschen Frauen – und erste Lübeckerin<br />
überhaupt – studierte Cornelia Schorer Medizin:<br />
In Zürich, da sich Frauen im Deutschen Reich zu<br />
dieser Zeit (1891-1898) nicht immatrikulieren durften.<br />
1898 arbeitete sie für einige Monate als „Volontärarzt“<br />
in der Klinik für Hautkrankheiten und Syphilis der k.k.<br />
deutschen Universität in Prag – wahrscheinlich in Hinblick<br />
auf ihren Wunsch, Psychiaterin und Neurologin zu<br />
werden.<br />
1898 geht sie in die USA, um dort als Psychiaterin zu<br />
arbeiten. In der Passagierliste führt man sie in der<br />
Rubrik „Bezeichnung des bisherigen Berufs“ als<br />
„Fräulein“ – nicht als „Ärztin“. Die Gründe für die Auswanderung<br />
sind bis heute ungewiss. Sicher ist nur, dass<br />
es für Frauen in den USA erheblich einfacher <strong>war</strong>, als<br />
Ärztin zu praktizieren bzw. eine Anstellung in einem<br />
Krankenhaus zu finden. So konnte Cornelia bereits ein<br />
Jahr später auf eine Lizenz als Ärztin in Massachusetts<br />
verweisen. 1900 trat sie dann in die Massachusetts<br />
Medical Society ein. Unklar in ihrer Biographieschreibung<br />
ist allerdings bis heute, ob sie in ihren ersten Jahren in<br />
den USA auch als Ärztin praktizierte – und wenn ja, auf<br />
welchem Fachgebiet.<br />
1901 nahm sie eine Stelle als „Assistant Physician“, als<br />
Assistenzärztin, am Worcester Insane Hospital, einem<br />
psychiatrischen Krankenhaus, an und <strong>war</strong> dort bis zu<br />
ihrer Kündigung im Jahre 1914 tätig – eine kurze krankheitsbedingte<br />
Pause im Jahre 1908 ausgenommen. Von<br />
1914 bis 1916 arbeitete sie am Psychopathic Department<br />
des Boston State Hospital, wo sie als „Junior<br />
Assistant Physician“ angestellt und für „all persons<br />
suffering from delirium, mania, mental confusion, delusions<br />
or hallucinations“ 1 zuständig <strong>war</strong>. Noch im selben<br />
Jahr nahm sie eine Stelle als Psychiaterin in einer<br />
von der Ärztin Dr. Edith Rogers Spaulding<br />
geleiteten Studie über „Psychopathic<br />
delinquent women“ am zu<br />
diesem Zwecks erbauten „Bedford<br />
Hills Psychopathic Hospital“ nahe<br />
New York an. Im April 1920 wurde sie<br />
dann zum Ende ihrer Berufstätigkeit<br />
„Senior Assistant Physician“ am „Foxborough<br />
State Hospital“, wo sie auch<br />
die „School Clinic“ leitete.<br />
1933 ließ sich Cornelia Schorer pensionieren<br />
und kehrte nach Deutschland<br />
zurück. Da sie jedoch nie<br />
lange an einem Ort verweilen konnte<br />
– wie auch ihre gesamte Biographie<br />
zeigt –, reiste sie viel durch<br />
Deutschland und in andere europäische Länder. 1935<br />
besuchte sie die USA ein letztes Mal zu einer langen<br />
Rundreise.<br />
1 Briggs, Lloyd Vernon and collaborators: History of the Psychopathic<br />
Hospital Boston. Massachusetts, Boston 1922.<br />
5 26<br />
„an dem >fall noether< lässt sich die<br />
grausame Borniertheit der deutschen<br />
Männer-universität exemplarisch<br />
nachweisen.“<br />
luise f. pusch<br />
Portrait Privateigentum Helga Wiskemann, Lübeck<br />
„[...] Dr. cornelia B. J. schorer was appointed to fill the<br />
vacancy of female physician.“<br />
Superintendent Hosea M. Quinby in: Sixty-ninth Annual Report of the<br />
Trustees of the Worcester Insane Hospital and twenty-fourth Annual<br />
Report of the Trustees of the Worcester Insane Asylum at Worcester,<br />
for the year ending September 30. 1901. Boston 1902<br />
cornelIa BernharDIne Johanna schorer<br />
12. JulI 1863 – 9. Januar 1939
4. Januar 1643 – 31. märz 1727<br />
Isaac newton<br />
Isaac newton<br />
„I feign no hypotheses“<br />
(newton in seiner principia Mathematica)<br />
Seinem Onkel ist es zu verdanken, dass Sir Isaac<br />
Newton heute in nahezu allen Lexika und Nachschlagewerken<br />
vertreten ist. Er bewirkte, dass sein<br />
Neffe nicht den väterlichen Hof übernehmen musste,<br />
und sich so seinen mathematischen Studien, experimentellen<br />
Untersuchungen und handwerklichen<br />
Konstruktionen widmen konnte. Mit 18 kam Isaac so an<br />
die University of Cambridge. Hier entwickelte er<br />
bahnbrechende theoretische Ansätze über die Natur<br />
des Lichts, die Gravitation und die Planetenbewegung<br />
sowie über die mathematischen Probleme, die mit<br />
Tangenten-, Flächen- und Schwerpunktsberechnungen<br />
zusammenhängen. 1699 wurde er Nachfolger seines<br />
Lehrers und Mentors Isaac Barrow und somit Professor<br />
der Mathematik. Drei Jahre später wurde Newton Mitglied<br />
der Royal Society.<br />
1689 begann ein neues Kapitel: Die University of Cambridge<br />
entsandte Newton ans englische Parlament.<br />
1699 wurde er zudem Vorsteher der königlichen Münze<br />
– sein Bild prangte nun auf jeder englischen 1-Pfund-<br />
Note – und 1703 Präsident der Royal Society. 1705<br />
schlug Königin Anne ihn wegen seiner wissenschaftlichen<br />
Verdienste zum Ritter.<br />
Newtons Ansehen als Begründer der klassisch theoretischen<br />
Physik und damit der exakten Naturwissenschaften<br />
(neben Galilei) geht v. a. auf sein Hauptwerk<br />
„Philosophiae naturalis principa mathematica“ (Mathematische<br />
Prinzipien der Naturlehre) zurück. Hier vereinte<br />
er Galilei´s Forschungen zur Beschleunigung und<br />
Kepler´s zu den Planetenbewegungen zu einer einheitlichen<br />
Theorie der Gravitation. Damit legte er die<br />
Grundsteine der klassischen Mechanik, indem er die<br />
drei Grundgesetze der Bewegung formulierte. Nach<br />
dem Tod seines Erzfeindes Hooke veröffentlichte er<br />
sein Buch „Optik oder eine Abhandlung über die Reflexion,<br />
Brechung, Krümmung und die Farben des<br />
Lichtes“. Neben Leibnitz gilt er zudem auch als einer der<br />
Begründer der Infinitesimalrechnung.<br />
Nach Sir Isaac Newton sind das Newton`sche Näherungsverfahren<br />
und die internationale Einheit der Kraft,<br />
das Newton, benannt.<br />
Johannes scherBecK<br />
Medicus et chymicus<br />
Wie für einen Humanisten üblich, er<strong>war</strong>b Scherbeck<br />
zunächst Allgemeinkenntnisse in Grammatik, Rhetorik<br />
und Logik und studierte danach an der Artistenfakultät<br />
der Universität Kopenhagen, um dieses philologische<br />
Grundwissen zu erweitern. Laut Scherbecks biografischer<br />
Chronik, sollte er anfangs – wie sein Vater – die<br />
Pastorenlaufbahn einschlagen. Der zur damaligen Zeit<br />
herrschende Glaubensstreit zwischen orthodoxen<br />
Lutheranern und den als Philippisten bezeichneten<br />
Schülern Melanchton´s, zu denen sich auch Johannes<br />
zählte, machte selbst vor Familienbanden nicht halt,<br />
sodass es zum Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn<br />
kam.<br />
An der traditionsreichen Universität Wittenberg er<strong>war</strong>b<br />
Scherbeck 1580 seine Magisterwürde und erkannte<br />
bald, dass für einen Philippisten seiner Art eine theologische<br />
Laufbahn in seiner orthodox lutherischen Heimat<br />
unvorstellbar <strong>war</strong>. Scherbeck entschließt sich also,<br />
Medizin zu studieren und unternimmt mehrjährige<br />
Studien- und Bildungsreisen, die ihn u. a. in die Schweiz,<br />
durch Frankreich, nach London und in die Niederlande<br />
führen. 1591 beendet er sein Medizinstudium an der<br />
Universität Basel mit der Doktorwürde. In Scherbecks<br />
Biographie ist überliefert, dass er versuchte, Nierensteine<br />
mit eigens präpariertem Salpetergeist zu behandeln<br />
und nicht zuletzt deswegen als „Medicus et<br />
chymicus“ bzw. „Philosophus et chemiatros“ bezeichnet<br />
wurde.<br />
1591 ließ sich Scherbeck als Arzt in Lübeck nieder und<br />
erarbeitete sich hier in 40-jähriger ärztlicher Praxis Ansehen<br />
und Wohlstand. In seinem Haus trafen sich zahlreiche<br />
Reisende und Gelehrte. Bis ins frühe 20. Jahrhundert<br />
wurde die Erinnerung an Scherbeck in Lübeck<br />
durch ein Epitaph in der Jakobikirche erhalten:<br />
„[...] mit knapp über achtzig Jahren, lebenssatt und<br />
am ende seines irdischen schauspiels angelangt [...],<br />
nicht ungern von der Bühne des lebens abgetreten.“<br />
Peter Voswinckel beurteilt Scherbecks Bedeutung für<br />
unsere Hansestadt in seinem Aufsatz im Biographischen<br />
Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck folgendermaßen:<br />
„ohne zweifel gebührt ihm in der wissenschaftsgeschichte<br />
schleswig-holsteins und lübecks ein platz<br />
als markanter vertreter der späthumanistischen,<br />
grenz-überschreitenden >res publica litteraria
12. oKtober 1706 – 22./23. september 1778<br />
Johann aDaM soherr<br />
Johann aDaM soherr<br />
lübecker Baumeister des rokoko<br />
Soherr übernimmt 1730 die Nachfolge seines Vaters als<br />
Stadtbaumeister in seiner Heimatstadt. Zuvor <strong>war</strong> er<br />
vermutlich am Bau der Hofburg in Wien sowie am<br />
Schloss zu Kirmint (Ungarn) des Grafen Batthyanyi beteiligt.<br />
Nach zweijähriger Tätigkeit in Mannheim geht er<br />
dann nach Kopenhagen, um den Posten eines Bauinspektors<br />
am königlichen Residenzschloss Christiansborg<br />
zu bekleiden. 1742 wird er Hofbauinspektor und<br />
Mitarbeiter Laurids de Thurahs und Nicolai Eigtveds. In<br />
diese Zeit fällt auch seine Mitarbeit an den Schlössern<br />
Frederiksborg, Fredensborg und Jægersborg sowie am<br />
Prinzenpalais.<br />
1748/49 be<strong>war</strong>b sich Soherr dann um die vakante<br />
Stelle des Stadtbaumeisters in Lübeck, die er dann<br />
ganze dreißig Jahre besetzte. Zu seinen Aufgaben<br />
zählten u.a.: die allgemeine Bauaufsicht; die Aufsicht<br />
über städtische Gebäude; der Neubau, die Restauration<br />
und die Verbesserung technischer Anlagen (Mühlen und<br />
Waagen) sowie von Straßen und Wasserwegen. In<br />
Soherrs Amtszeit wurden zahlreiche solcher Bau- und<br />
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt – u.a. 1750<br />
der Bau des Pfarrhauses in Behlendorf und des Gasthauses<br />
Lachswehrallee 39, 1751 der Bau der Brauerei<br />
und Brennerei und 1753 des Pächterhauses in Ritzau,<br />
1754 der Umbau der Ratsstube und 1775 der Bau eines<br />
neuen Gutshauses für Lübeck-Steinrade.<br />
Da jedoch nur sehr wenig aus Soherr´s Baumeisterzeit<br />
erhalten geblieben ist, lässt sich seine Arbeit künstlerisch<br />
kaum einschätzen. Sein Verdienst liegt vor allem<br />
darin, dass er Gestaltungsweisen des dänischen Rokoko<br />
nach Lübeck übertragen hat.<br />
Wiener Hofburg<br />
Johann JulIus<br />
walBauM<br />
von der Brauerei ins Behandlungszimmer<br />
Johann Walbaum führte nach dem Tod seines Vaters<br />
gemeinsam mit seiner Mutter die geerbte Brauerei<br />
weiter – beschäftigte sich aber in seiner Freizeit mit<br />
ganz anderen Dingen: Johann las viel und interessierte<br />
sich für Botanik und Kräuterkunde. Diesem speziellen<br />
Interesse ist es wohl auch zu verdanken, dass er<br />
schließlich doch Medizin studiert und 1748 zum Doktor<br />
der Medizin promoviert. Am nächsten lag Walbaum die<br />
Chirurgie, doch aus finanziellen Gründen <strong>war</strong> es ihm<br />
nicht möglich, sich auf langen Reisen fortzubilden.<br />
1749 ließ sich Johann Walbaum deshalb und aufgrund<br />
eines akuten Medizinermangels in Lübeck in der Hansestadt<br />
nieder – und wurde mehr als freundlich aufgenommen,<br />
sodass er auch blieb, als ihn einer seiner<br />
wichtigsten Lehrer nach Göttingen rief.<br />
Walbaum wurde nach und nach zu Lübecks bedeutendstem<br />
Arzt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts:<br />
Er verbesserte das Hebammen- und Apothe-<br />
kenwesen, setzte sich für die Ausbildung von Wund-<br />
ärzten ein und benutzte 1758 erstmals Handschuhe bei<br />
einer Geburtshilfe-OP – 100 Jahre vor Einführung steriler<br />
OP-Handschuhe.<br />
Walbaum <strong>war</strong> aber vor allem Aufklärer und in diesem<br />
Sinne entsprechend engagiert: Die Erziehung und Bildung<br />
seiner Kinder, Dienstboten<br />
und Mitbürger lag ihm gleichermaßen<br />
am Herzen. Den Mittelpunkt<br />
seiner gemeinnützigen Tätigkeit<br />
bildete die Gesellschaft zur Beförderung<br />
gemeinnütziger Tätigkeit,<br />
die er vorangetrieben und im Sinne<br />
der Aufklärung mit reformiert hat.<br />
Kein Wunder also, dass Johann<br />
Walbaum als einer der einflussreichsten<br />
Aufklärer Lübecks im<br />
ausgehenden 18. Jahrhundert gilt.<br />
Ein dritter Aspekt darf in Bezug auf<br />
Johann Walbaum nicht vergessen<br />
werden: Neben allem beruflichen<br />
und gemeinnützigem Engagement<br />
galt sein wissenschaftliches Interesse weiterhin der<br />
Natur und Botanik. Seine <strong>Wer</strong>ke über Schildkröten,<br />
Fische und Vögel fanden in der Fachwelt große<br />
Anerkennung.<br />
9 30<br />
„verdienter arzt – emsiger naturforscher –<br />
Gemeinnütziger Bürger.“<br />
Inschrift in Walbaums Grabstein auf dem Dom-Innenhof<br />
Johann JulIus walBauM<br />
30. Juni 1724 – 21. august 1799
Herausgeberin:<br />
<strong>Hochschulstadtteil</strong> Entwicklungsgesellschaft<br />
HEG Projektbüro<br />
Kanalstraße 64 • 23552 Lübeck<br />
www.hochschulstadtteil.de<br />
info@hochschulstadtteil.de<br />
in Zusammenarbeit mit:<br />
Frauenbüro der Hansestadt Lübeck<br />
Kanzleigebäude • 23539 Lübeck<br />
frauenbuero@luebeck.de<br />
Grundlage:<br />
Beschluss der Lübecker Bürgerschaft vom<br />
28. November 2002, Vorlage des Fachbereichs<br />
Stadtplanung, Bereich Verkehr,<br />
Sachbearbeiterin Frau Dorothee Gutzeit.<br />
Die Vorlage basierte auf Vorschlägen verschiedener<br />
Institutionen und Gruppen:<br />
u.a. des Frauenbüros der Hansestadt<br />
Lübeck, der Medizinischen Universität<br />
connection<br />
Lübeck und der Fachhochschule Lübeck<br />
sowie der WTP-Gesellschaft. penguin