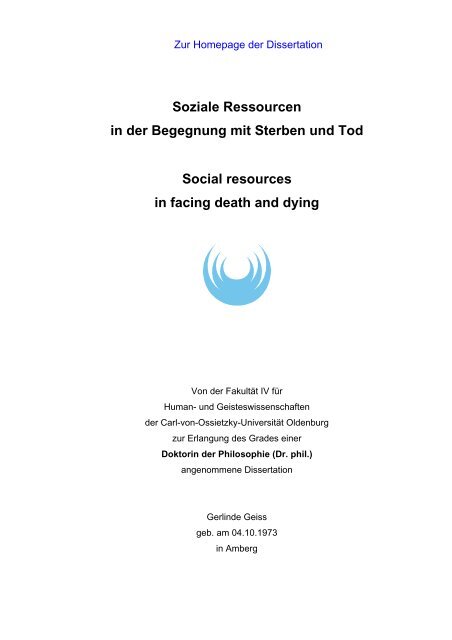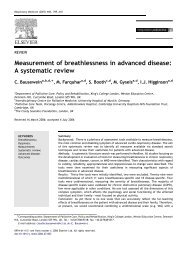Soziale Ressourcen in der Begegnung mit Sterben und Tod - ipac
Soziale Ressourcen in der Begegnung mit Sterben und Tod - ipac
Soziale Ressourcen in der Begegnung mit Sterben und Tod - ipac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Social resources<strong>in</strong> fac<strong>in</strong>g death and dy<strong>in</strong>gVon <strong>der</strong> Fakultät IV fürHuman- <strong>und</strong> Geisteswissenschaften<strong>der</strong> Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburgzur Erlangung des Grades e<strong>in</strong>erDoktor<strong>in</strong> <strong>der</strong> Philosophie (Dr. phil.)angenommene DissertationGerl<strong>in</strong>de Geissgeb. am 04.10.1973<strong>in</strong> Amberg
Erstreferent: Prof. em. Dr. Wilfried BelschnerKorreferentIn: Prof. em. Dr. Annelie KeilTag <strong>der</strong> Disputation: 22. Mai 2007
Danksagung„We are never separate from each other.“(Kornfield, 2005)Diese Arbeit konnte geschrieben werden <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Hilfe vieler Menschen, die mich,me<strong>in</strong> Denken sowie me<strong>in</strong> Leben <strong>und</strong> Arbeiten begleitet, geprägt <strong>und</strong> geformt haben.Ihnen gilt me<strong>in</strong> großer Dank.Me<strong>in</strong>en Eltern, <strong>der</strong>en För<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Unterstützung das F<strong>und</strong>ament darstellen, aufdem diese Arbeit entstehen konnte. Judith <strong>und</strong> Regula, ohne die es diese Arbeit nichtgäbe. (Und Judith für vieles mehr.)Prof. Dr. Wilfried Belschner für se<strong>in</strong>e Offenheit auf vielen Ebenen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> me<strong>in</strong>eGedanken wachsen konnten, <strong>und</strong> für se<strong>in</strong> Zutrauen, <strong>mit</strong> dem er mir den Mut gab, e<strong>in</strong>großes Forschungsprojekt e<strong>in</strong>fach anzupacken. Und Frau Prof. Dr. Annelie Keil fürihr uneigennütziges Engagement, <strong>mit</strong> welchem sie die Zweitbegutachtung übernahm<strong>und</strong> mich <strong>mit</strong> wertvollen Denkanstößen bereicherte.Me<strong>in</strong>en Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen, die mich – jede <strong>und</strong> je<strong>der</strong> auf ihre Weise – begleitet,unterstützt, gefor<strong>der</strong>t <strong>und</strong> geför<strong>der</strong>t haben. Insbeson<strong>der</strong>e Peter Fischer <strong>und</strong>Norbert Krischke für ihre hilfreichen Kommentare im Auswertungsprozess desumfangreichen Datenmaterials. Und Anna Yeg<strong>in</strong>er für ungezählte St<strong>und</strong>en <strong>der</strong>fachlichen Diskussion bei Grüntee.Dem ehemaligen Oldenburger Doktorandenkolloquium (Anna Yeg<strong>in</strong>er <strong>und</strong> Mart<strong>in</strong>Koch) <strong>und</strong> me<strong>in</strong>en treuen <strong>und</strong> gewissenhaften KorrekturleserInnen Peter Fischer,Jutta Jacob, Katja Tiplt <strong>und</strong> Anna Yeg<strong>in</strong>er.Dem B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> <strong>Soziale</strong> Sicherung für die f<strong>in</strong>anzielleFör<strong>der</strong>ung des dieser Arbeit zugr<strong>und</strong>e liegenden Projekts „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren<strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ <strong>und</strong> für die fre<strong>und</strong>licheNachsicht bei Abgabeterm<strong>in</strong>en für Berichte.
Me<strong>in</strong>en studentischen MitarbeiterInnen <strong>und</strong> DiplomandInnen, ohne <strong>der</strong>en Begeisterung<strong>und</strong> Arbeit das zugr<strong>und</strong>e liegende Projekt nicht hätte durchgeführt werdenkönnen. Insbeson<strong>der</strong>e Nils Gehlen <strong>und</strong> Rita Oldenbourg.Und allen voran den Menschen, die durch ihre Offenheit <strong>in</strong> den Interviews <strong>und</strong> durchdas Ausfüllen unserer Fragebögen das Herz dieser Arbeit bilden. Für sie wurde dasProjekt durchgeführt <strong>und</strong> diese Arbeit geschrieben – <strong>und</strong> ich wünsche mir sehr, dasssie ihnen zugute kommen möge.Es haben mehr Menschen zum Gel<strong>in</strong>gen dieser Arbeit beigetragen, als ich hier <strong>in</strong>Kürze nennen könnte. Und so wünsche ich mir, dass viele Wegbegleiter <strong>und</strong>Wegbereiter auf verschiedenen Ebenen sich angesprochen fühlen mögen.
InhaltsverzeichnisIInhaltsverzeichnis1. E<strong>in</strong>leitung ........................................................................................................12. Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>...................72.1. Lebenskrisen <strong>und</strong> Sterbekrisen..............................................................82.2. Die Natur kritischer Lebensereignisse .................................................313. Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum....................413.1. Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie...............423.2. Grenzen <strong>der</strong> gängigen Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>.........483.3. Modelle für die <strong>in</strong>tegrative <strong>und</strong> <strong>in</strong>teraktionale Konzeptualisierungsozialer <strong>Ressourcen</strong> ............................................................................554. Perspektiven <strong>der</strong> Studie: <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> ...........................................................................................734.1. Bedeutung sozialer Beziehungen für sterbende PatientInnen .............754.2. <strong>Soziale</strong> Beziehungen zwischen sterbenden PatientInnen <strong>und</strong>Angehörigen.........................................................................................834.3. Die Situation von Professionellen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>..........885. Fragestellungen <strong>der</strong> Untersuchung ..........................................................1016. Stichprobengew<strong>in</strong>nung ..............................................................................1036.1. Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischenKrankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“.....................................................1036.2. E<strong>in</strong>bettung des Themas <strong>in</strong>nerhalb des Gesamtprojekts.....................1127. Methodik <strong>der</strong> empirischen Untersuchung ................................................1137.1. Erhebungsmethodik ...........................................................................1147.2. Gütekriterien <strong>der</strong> verwendeten Instrumente.......................................1167.3. Analysemethodik................................................................................117
InhaltsverzeichnisII8. Stichprobenbeschreibung .........................................................................1199. Ergebnisse ..................................................................................................1299.1. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong><strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> ..........................................................................1299.2. Analyse des Konzepts <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> ...............................15710. Diskussion <strong>und</strong> Fazit..................................................................................17410.1. Modifikation des theoretischen Konzeptsvon sozialen <strong>Ressourcen</strong>...................................................................17510.2. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> ..........................................................................19010.3. Fazit <strong>und</strong> Implikationen ......................................................................19811. Zusammenfassung/Summary....................................................................20212. Literaturverzeichnis....................................................................................20413. Abbildungs- <strong>und</strong> Tabellenverzeichnis ......................................................223
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 11. E<strong>in</strong>leitung„The f<strong>und</strong>amental delusion of humanity is to supposethat I am here and you are out there.“(Yasutani Roshi, 1994)„Viele Menschen haben weniger Angst vor dem <strong>Tod</strong> an sich.Vielmehr fürchten sie die Zeit des <strong>Sterben</strong>s:Abhängig zu se<strong>in</strong> von an<strong>der</strong>en,<strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong> ausgeliefert,vielleicht die letzte Lebenszeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anonymen Kl<strong>in</strong>ik-Atmosphäre,getrennt von den Angehörigen verbr<strong>in</strong>gen zu müssen.“(Flammer & Tausch-Flammer, 1992, 135)Kritisch krank zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> eventuell im <strong>Sterben</strong> begriffen zu se<strong>in</strong>, ist e<strong>in</strong> höchstbelastendes Ereignis. Es stellt• e<strong>in</strong> kritisches Lebensereignis für PatientInnen 1 ,• e<strong>in</strong>e große Belastung für Angehörige <strong>und</strong> die Menschen, die e<strong>in</strong>em Schwerstkrankennahe stehen,• das E<strong>in</strong>satzgebiet von freiwillig Helfenden <strong>und</strong>• den Arbeitsalltag für Pflegende, ÄrztInnen <strong>und</strong> psychosozial Tätige, die <strong>mit</strong>schwerkranken Menschen arbeiten, dar.Glücklicherweise lässt sich auf diesem Gebiet, auf dem noch vor 30 Jahren <strong>in</strong> <strong>der</strong>mediz<strong>in</strong>ischen, sozialen o<strong>der</strong> psychologischen Forschung überwiegend Leereherrschte (vgl. bspw. Eissler, 1978; Nuland, 1994; Student, 1989b), <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>reges Treiben <strong>der</strong> wissenschaftlichen Studien <strong>und</strong> Erkenntnisse verzeichnen. Wer<strong>mit</strong> kritisch kranken <strong>und</strong> sterbenden Menschen professionell arbeitet, kann sich oft<strong>der</strong> Forschungsanfragen <strong>und</strong> zugesandten Fragebögen kaum erwehren – <strong>und</strong>zugleich ist <strong>der</strong> Wissensbedarf auf diesem Gebiet nach wie vor ungleich größer. Ess<strong>in</strong>d bei weitem mehr Fragen offen als geklärt (vgl. Höver, 2003). E<strong>in</strong>e solche,1 E<strong>in</strong> Wort zu geschlechtsspezifischer Schreibweise: Ich habe versucht, <strong>der</strong> Tatsache, dass sowohl Männer alsauch Frauen den untersuchten Personengruppen angehören, möglichst vollständig gerecht zu werden. Die imRahmen dieser Arbeit unterschiedenen Personengruppen s<strong>in</strong>d daher wie folgt bezeichnet: die PatientInnen/diekritisch Kranken/die <strong>Sterben</strong>den, die Angehörigen, die ÄrztInnen, die Pflegenden, die ehrenamtlich Helfenden, diepsychosozial Tätigen, die Geistlichen. Ist e<strong>in</strong>e Personenbezeichnung im S<strong>in</strong>gular notwendig, so spreche ichalternierend von dem Menschen/<strong>der</strong> Person/dem Individuum.
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 2bislang ungeklärte Frage bildet auch die Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> hier vorliegenden Arbeit: dieFrage nach <strong>der</strong> Verfügbarkeit, Nutzbarkeit <strong>und</strong> Wirksamkeit sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>.Mit e<strong>in</strong>er ständig steigenden Lebenserwartung (vgl. Helmert & Voges, 2002)aufgr<strong>und</strong> verbesserter mediz<strong>in</strong>ischer Möglichkeiten erhöht sich statistisch gesehendas Alter <strong>der</strong> Menschen, die von schweren Krankheitsprozessen betroffen s<strong>in</strong>d,sowie die durchschnittliche Dauer des Sterbeprozesses am Lebensende. Tumorbed<strong>in</strong>gteErkrankungen, die e<strong>in</strong>en langen Sterbeprozess <strong>mit</strong> sich br<strong>in</strong>gen, nehmen <strong>in</strong>allen mo<strong>der</strong>nen Gesellschaften stetig an Häufigkeit zu <strong>und</strong> werden voraussichtlich <strong>in</strong>zehn Jahren an erster Stelle <strong>der</strong> <strong>Tod</strong>esursachen stehen (vgl. Birg & Flöthmann,2002; D<strong>in</strong>kel, 2002; Sommer, 2002). Daraus folgt unter an<strong>der</strong>em, dass <strong>der</strong> gesamtgesellschaftliche<strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelle Bedarf für die Betreuung kritisch kranker <strong>und</strong>sterben<strong>der</strong> Menschen an Größe <strong>und</strong> Bedeutung stetig zunimmt.Zudem lockert sich das gesellschaftliche Tabu um die Thematik von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>(vgl. bspw. Lakotta, 2003). In <strong>der</strong> Folge werden zunehmend Stimmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaftlaut, die e<strong>in</strong>e f<strong>und</strong>ierte Erforschung des Sterbeprozesses <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Verbesserung<strong>der</strong> Betreuung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> verlangen (vgl. bspw. Esserman, Belkora & Lenert,1995; Fairbairn, 1991). For<strong>der</strong>ungen nach e<strong>in</strong>er verloren gegangenen „Sterbekultur“<strong>und</strong> die Diskussion um das Recht auf e<strong>in</strong> humanes <strong>und</strong> <strong>in</strong>dividuelles <strong>Sterben</strong>spiegeln die Me<strong>in</strong>ungs- <strong>und</strong> Bedürfnislage wi<strong>der</strong> <strong>und</strong> f<strong>in</strong>den zunehmend öffentlichesGehör.Gleichzeitig ist e<strong>in</strong>e Professionalisierung <strong>der</strong> Sterbebegleitung im Zuge <strong>der</strong> Gesamtprofessionalisierungsozialen Lebens <strong>in</strong> unserer Gesellschaft zu verzeichnen (vgl.Feldmann, 1997; Graf & Roß, 2003). <strong>Sterben</strong> geschieht momentan zu e<strong>in</strong>em hohenProzentsatz <strong>in</strong> (verme<strong>in</strong>tlich) spezialisierten Institutionen wie Krankenhäusern o<strong>der</strong>Pflegee<strong>in</strong>richtungen, o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest unter <strong>der</strong> Aufsicht von geschulten Fachkräften(vgl. Hess, Spichiger, Bucher & Otto, 1998; Klaschik & Nauck, 1992, 2003;Ochsmann, Slagen, Feith, Kle<strong>in</strong> & Seibert, 2001; Rest, 1992). Folglich entsteht e<strong>in</strong>erhöhter Wissensbedarf auf professioneller Seite bei ÄrztInnen, Pflegekräften,PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ehrenamtlich Helfenden etc., die <strong>in</strong> die
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 3Sterbebegleitung e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> dadurch <strong>in</strong> verstärktem Maße gefor<strong>der</strong>twerden.Gesellschaftlichen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Entwicklungen sowie fachlichen Ansprüchengegenüber lassen sich starke Mängel <strong>in</strong> faktischen Diskussionsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong>wissenschaftlichen Erkenntnissen, die für den Alltag sterben<strong>der</strong> Menschen praktischnutzbar wären, verzeichnen (vgl. Kastenbaum, 1996; Klaschik, 1997). Es bestehtalso e<strong>in</strong>e Kluft zwischen beiden Seiten, die unter dem E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> aufgezeigten,gesellschaftlichen Verän<strong>der</strong>ung zu e<strong>in</strong>em kont<strong>in</strong>uierlich fortschreitenden Handlungsbedarfauf wissenschaftlicher Seite führt.E<strong>in</strong>e Analyse <strong>der</strong> gesellschaftlichen Situation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> die überwiegend älterenMenschen unserer Gesellschaft ihr Lebensende verbr<strong>in</strong>gen, ist aus diesen Gründendr<strong>in</strong>gend <strong>in</strong>diziert, um e<strong>in</strong>e gesicherte Diskussionsbasis für neue <strong>und</strong> s<strong>in</strong>nvolleInterventionen <strong>und</strong> Modifikationen <strong>der</strong> Versorgungslage zu erreichen. Da dieSituation im Bereich von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> Sterbebegleitung zweifellos über lange Zeith<strong>in</strong>weg <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Gesellschaft vernachlässigt wurde, bedarf sie heute e<strong>in</strong>ergründlichen Neustrukturierung (vgl. dpa, 2003). Hier liegt e<strong>in</strong> großer Bedarf anhandlungsleitenden Pr<strong>in</strong>zipien für verbesserte Interventionsvorschläge. So s<strong>in</strong>dbeispielsweise strukturelle Verän<strong>der</strong>ungen notwendig, um die steigende Anzahl anMenschen, die e<strong>in</strong>en langandauernden Sterbeprozess erleben, adäquat versorgenzu können (vgl. R<strong>und</strong>e & Giese, 2004; Schaeffer & Ewers, 2002; Wilken<strong>in</strong>g & Kunz,2003). Die Situation <strong>der</strong> <strong>in</strong> diesem Bereich tätigen Professionellen muss den tatsächlichenGegebenheiten <strong>und</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen besser angepasst werden, um demnachweislich immer schneller e<strong>in</strong>setzenden Burn-out von Mediz<strong>in</strong>erInnen <strong>und</strong>Pflegenden, die im Bereich <strong>der</strong> Sterbebegleitung arbeiten, entgegen zu wirken.Hieran zeigt sich beispielhaft, dass gesellschaftliche <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelle Strukturenden Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> Professionellen für ihre Tätigkeit gegenwärtig nur schlechtgerecht werden. Es gilt hier, <strong>Ressourcen</strong> struktureller, sozialer <strong>und</strong> psychischer Artzu för<strong>der</strong>n, die zwar vielfach vorhanden s<strong>in</strong>d, aber aufgr<strong>und</strong> mangelnden Wissenssowie ungeeigneter Institutions- <strong>und</strong> Arbeitsstrukturen nicht genutzt werden können(vgl. bspw. Thomas & Köhle, 1999).
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 4Von vorrangiger Bedeutung ist <strong>in</strong> diesem Bereich die Wissensgenerierung zu<strong>Ressourcen</strong>, die bereits strukturell o<strong>der</strong> personal vorhanden s<strong>in</strong>d, aber aufgr<strong>und</strong>mangeln<strong>der</strong> Kenntnisse nicht ausreichend genutzt werden können. Es gilt, dasbereits Vorhandene auszuschöpfen, denn umfangreiche Neustrukturierungen imBereich <strong>der</strong> Sterbebegleitung (die zweifelsohne s<strong>in</strong>nvoll wären; vgl. bspw. Großkopf& Schanz, 2003; Hard<strong>in</strong>ghaus, Rogner & Meyer, 1999), s<strong>in</strong>d aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellenLage im Ges<strong>und</strong>heitssektor nicht zu erwarten:„Es sche<strong>in</strong>t uns unrealistisch zu se<strong>in</strong>, die großen strukturellen Verän<strong>der</strong>ungen (im Bereich<strong>der</strong> Sterbebegleitung, Anm. d. Verf.) zu for<strong>der</strong>n. Das würde sicherlich auch nicht <strong>in</strong> dieges<strong>und</strong>heitspolitische Landschaft unserer Zeit passen (Stichwort: F<strong>in</strong>anzen). Aber es wirddeutlich, dass sich viel <strong>in</strong> den vorhandenen Strukturen verän<strong>der</strong>n lässt. Wenn sich etwas<strong>in</strong> den Köpfen <strong>und</strong> im Bewusstse<strong>in</strong> än<strong>der</strong>t, wird auch weiterh<strong>in</strong> noch e<strong>in</strong>e Menge möglichse<strong>in</strong>.“ (Schweidtmann, 1996, 112)Dies ist auch das Anliegen <strong>der</strong> hier vorliegenden Arbeit: Es soll gezeigt werden, wiesoziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> von PatientInnen,Angehörigen <strong>und</strong> Professionellen genutzt werden können. Darüber h<strong>in</strong>aus wird dastheoretische Konzept sozialer <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>er Überprüfung anhand <strong>der</strong> vorliegendenDaten unterzogen. Die vorliegende Arbeit ist anwendungsorientiert <strong>und</strong> verortetsich gleichermaßen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie wie <strong>der</strong> Thanatopsychologie.Ges<strong>und</strong>heitspsychologische <strong>und</strong> thanatopsychologische Theorien <strong>und</strong> Modellestehen dementsprechend im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Der Gegenstandsbereich umfasst denSektor des Ges<strong>und</strong>heitswesens, <strong>der</strong> den <strong>in</strong>stitutionellen bzw. professionellenRahmen für kritisch kranke <strong>und</strong> sterbende Menschen bildet: Krankenhäuser, Alten<strong>und</strong>Pflegeheime, stationäre Hospize sowie ambulante Pflegedienste. Die Menschen,die <strong>in</strong> diesem Rahmen (als PatientInnen, Angehörige o<strong>der</strong> Professionell Tätige) von<strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> betroffen s<strong>in</strong>d, werden unter dem Blickw<strong>in</strong>kel ihrer sozialen<strong>Ressourcen</strong> betrachtet, welche als theoretisches Rahmenkonzept dieser Arbeitgewählt wurde. Es wird sich dabei im Laufe <strong>der</strong> Arbeit zeigen, dass diese Betrachtung<strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> ihrer Auswirkungen e<strong>in</strong>e Integration sozialpsychologischerErkenntnisse <strong>in</strong> das salutogenetische Rahmenverständnis <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologieerfor<strong>der</strong>t wie ermöglicht. Auf dieser Basis wird am Ende <strong>der</strong> Arbeit e<strong>in</strong><strong>in</strong>novatives Modell <strong>der</strong> „Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktoren aus dem sozialen Raum“
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 5entstehen, das über den Stand <strong>der</strong> gegenwärtigen Theorienbildung h<strong>in</strong>ausgeht <strong>und</strong>daher als Gr<strong>und</strong>lage für weitergehende Forschung dienen könnte.Im Verlauf <strong>der</strong> Arbeit wird zunächst e<strong>in</strong> theoretischer E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> das Feld von <strong>Tod</strong><strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> (Kapitel 2) sowie <strong>in</strong> die Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> (Kapitel3) gegeben, denn die Verb<strong>in</strong>dung dieser bei<strong>der</strong> Fel<strong>der</strong> bildet den theoretischenRahmen dieses Themengebiets. Nach e<strong>in</strong>em Überblick über die aktuelle Forschungslage(Kapitel 4) werden zu diesem Zusammenhang spezifische Forschungsfragenaufgestellt (Kapitel 5). Anschließend wird das Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong>Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ e<strong>in</strong>bezogen, ausdem e<strong>in</strong> Teilbereich die Datenbasis <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung bildet (Kapitel 6,7, <strong>und</strong> 8). Diese Daten werden entlang <strong>der</strong> Fragestellungen analysiert (Kapitel 9). DieDiskussion <strong>der</strong> Ergebnisse (Kapitel 10) wird zeigen, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> e<strong>in</strong> großes Verän<strong>der</strong>ungspotential <strong>in</strong> Bezug aufWohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung darstellen <strong>und</strong> dass bestehende psychologischeModelle zu sozialen <strong>Ressourcen</strong> erweiternd modifiziert werden können.E<strong>in</strong> Wort zu Beg<strong>in</strong>n: Ethische Vertretbarkeit <strong>der</strong> wissenschaftlichen Arbeit <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong>denEs steht außer Frage, dass - vor allem als Spiegelbild <strong>der</strong> gesellschaftlichen Lage<strong>und</strong> des Entwicklungsgrads <strong>der</strong> öffentlichen Me<strong>in</strong>ung - die wissenschaftliche Arbeit<strong>mit</strong> kritisch kranken <strong>und</strong> sterbenden Menschen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiveren Überprüfung aufethische Vertretbarkeit unterliegt als an<strong>der</strong>e Gegenstandsbereiche <strong>der</strong> Forschung.Bei genauerer Betrachtung <strong>der</strong> Thematik <strong>und</strong> <strong>der</strong> jeweils vorgebrachten Argumentewird jedoch klar, dass weniger <strong>der</strong> Gegenstandsbereich <strong>der</strong> Forschung ausschlaggebendfür die Beurteilung <strong>der</strong> ethischen Vertretbarkeit ist, als vielmehr die denwissenschaftlichen Bestrebungen zugr<strong>und</strong>e liegende, ethische E<strong>in</strong>stellung (vgl.bspw. Casarett, 1999). Der gegenwärtig öffentlich stark diskutierte Bereich <strong>der</strong> Gen-Forschung kann für diese These als Beispiel stehen. So müssen die Achtsamkeit <strong>und</strong><strong>der</strong> Respekt vor dem Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Menschlichkeit die Maximen allen
Kapitel 1 – E<strong>in</strong>leitung 6forscherischen Handelns se<strong>in</strong>. Zudem liegt <strong>der</strong> Maßstab, an dem sich wissenschaftlichesHandeln gr<strong>und</strong>legend zu messen hat, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beitrag zum Dienst amMenschen (Keil, A., 2006; Tausch, R. & Tausch, 1985):„Leben braucht ke<strong>in</strong>e Wissenschaftler, die die Modelle vom Leben für das Leben selbsthalten, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> Wissen schaffen, das zur prüfenden Klarheit über die Lage desLebens, <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> gegenwärtigen Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsverhältnissen <strong>und</strong> dieGefährdungen von beiden beiträgt.“ (Keil, A., 2006, 131)Diese Anfor<strong>der</strong>ungen an forschendes Handeln s<strong>in</strong>d gleichermaßen für diewissenschaftliche Arbeit <strong>mit</strong> Kranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den wie für alle an<strong>der</strong>en Bereichewissenschaftlichen Handelns zu stellen.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 72. Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I:<strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>2.1. Lebens- <strong>und</strong> SterbekrisenBelastung <strong>und</strong> Bewältigung als Themen im LebensverlaufBelastung <strong>und</strong> Bewältigung durch (chronische) KrankheitWann beg<strong>in</strong>nt das <strong>Sterben</strong>?Belastungen <strong>und</strong> Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> Menschen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong>ihrem UmfeldLebensqualität <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den im Lebensverlauf <strong>und</strong> im SterbeprozessParallelen <strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten von Lebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen2.2. Die Natur kritischer LebensereignisseKrisen <strong>und</strong> kritische LebensereignisseKrise als GrenzerfahrungKrise als WachstumschanceKrise <strong>und</strong> Resilienz<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> KriseMenschen, die un<strong>mit</strong>telbar selbst vom eigenen <strong>Sterben</strong> o<strong>der</strong> dem <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>esvertrauten Menschen sowie <strong>mit</strong>telbar vom <strong>Sterben</strong> an<strong>der</strong>er Menschen <strong>in</strong> ihremArbeitsumfeld betroffen s<strong>in</strong>d, bilden den Fokus <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit. Siebegegnen dem <strong>Sterben</strong> auf unterschiedliche Weise: Für die betroffenen PatientInnenstellt die Möglichkeit des eigenen <strong>Sterben</strong>s <strong>in</strong> jedem Fall e<strong>in</strong> kritisches Lebensereignisdar; für ihre Angehörigen <strong>in</strong> den meisten Fällen; <strong>und</strong> für die Menschen, dieprofessionell <strong>mit</strong> kritisch kranken <strong>und</strong> sterbenden Menschen arbeiten, ist die<strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem <strong>Tod</strong> <strong>der</strong> emotional anspruchsvolle Arbeitsalltag (vgl. Wittkowski,Schrö<strong>der</strong> & Bolm, 2004, 113). Es besteht die Möglichkeit, sich dieser <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong>dem <strong>Sterben</strong> unter theoriegeleitet den drei genannten Blickw<strong>in</strong>keln zu nähern: dieBetrachtung des krisenhaften Charakters des <strong>Sterben</strong>s für PatientInnen <strong>und</strong>Angehörige <strong>und</strong> die Betrachtung des Arbeitsalltags <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Beanspruchungen fürdie beteiligten Professionellen. Da Schwerpunkt dieser Arbeit im Bereich <strong>der</strong>Ges<strong>und</strong>heitspsychologie liegt, wird auf die Darstellung von arbeitspsychologischenGegebenheiten bewusst verzichtet <strong>und</strong> <strong>der</strong> Blickw<strong>in</strong>kel auf PatientInnen <strong>und</strong>Angehörige, <strong>der</strong> <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Betrachtung von Lebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen e<strong>in</strong>her geht, <strong>in</strong>den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> gestellt. (Die Perspektive auf den Arbeitsalltag <strong>der</strong> Professionellen
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 8wird <strong>in</strong> Kapitel 4.3. – Die Situation von Professionellen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>ausführlich dargestellt werden.)Daher wird nun zu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Lebensbereich von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> näher betrachtet:Wie lassen sich Lebens- <strong>und</strong> Sterbezeiten vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abgrenzen? WelcheCharakteristika weist e<strong>in</strong>e Krisenphase auf, die meist durch die Konfrontation <strong>mit</strong>dem <strong>Sterben</strong> ausgelöst wird? Und was kann für den e<strong>in</strong>zelnen Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emsolchen Krisenerleben erwachsen? Diese Fragen stehen im Zentrum des folgendenKapitels. Dazu wird zunächst e<strong>in</strong> Blick auf das Feld des <strong>Sterben</strong>s <strong>in</strong> Abgrenzung o<strong>der</strong><strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>samkeit zum alltäglichen Leben geworfen. Denn auch wenn Belastungen<strong>und</strong> Krisen zentrale Themen im gesamten Lebensverlauf darstellen, so nehmen siedoch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>e spezielle Form an. In e<strong>in</strong>em zweitenSchritt setzt sich die Arbeit <strong>mit</strong> dem Begriff <strong>der</strong> Krise ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Es wird dabeideutlich werden, dass e<strong>in</strong> Krisenerleben sowohl e<strong>in</strong>e Grenzerfahrung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Gefahrdes Scheiterns be<strong>in</strong>haltet als auch die Möglichkeit <strong>der</strong> erfolgreichen Bewältigung <strong>und</strong>des Wachstums durch den Rückgriff auf verschiedene <strong>Ressourcen</strong>.2.1. Lebenskrisen <strong>und</strong> SterbekrisenSowohl im gesellschaftlichen Leben als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> psychologischen Forschung kannseit e<strong>in</strong>igen Jahrzehnten e<strong>in</strong>e wachsende Tendenz beobachtet werden, das <strong>Sterben</strong>von dem abzutrennen, was als das alltäglich-normale Leben gesehen wird. Sowerden z.B. kranke Menschen entwe<strong>der</strong> kurativ o<strong>der</strong> palliativ behandelt <strong>und</strong> <strong>in</strong>entsprechende E<strong>in</strong>richtungen verwiesen. Die Angehörigen von kranken Menschenkönnen auf e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es ges<strong>und</strong>heitspolitisches Unterstützungsnetzwerk zurückgreifenals die Angehörigen von sterbenden Menschen, etc. (vgl. Levend, 2006, 42).Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> psychologischen Forschung ist das Fachgebiet <strong>der</strong> Thanatologie bzw.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 9Thanatopsychologie 2 sehr wenig <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Forschungsgebieten vernetzt: Diethanatologische Forschung beschäftigt sich ausschließlich <strong>mit</strong> sterbenden Menschen,die restliche psychologische Forschung <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Lebensbereichen vonMenschen, aber möglichst wie<strong>der</strong>um aus „ethischen“ Gesichtspunkten nicht <strong>mit</strong>sterbenden Menschen. Und das, obwohl e<strong>in</strong>ige Forschende wie<strong>der</strong>holt feststellen:„Es könnte <strong>in</strong> diesem Diskussionszusammenhang auch wichtig se<strong>in</strong>, zwischen <strong>der</strong>Betroffenheit des Wissenschaftlers durch die Konfrontation <strong>mit</strong> Grenzsituationen, wie zumBeispiel <strong>Tod</strong> o<strong>der</strong> extremem Leiden, <strong>und</strong> dem Erleben <strong>der</strong> jeweils betroffenen Person zutrennen. Nicht selten f<strong>in</strong>det die Tabuisierung auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Untersucher <strong>und</strong>Betrachter <strong>und</strong> nicht auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> direkt Betroffenen statt.“ (Staud<strong>in</strong>ger, 1997, 248)Dabei stellt sich von Anfang an die gr<strong>und</strong>legende <strong>und</strong> berechtigte Frage, ob denndas <strong>Sterben</strong> vom Leben zu unterscheiden ist. Handelt es sich um qualitativunterschiedliche Zustände im Leben e<strong>in</strong>es Menschen, je nachdem ob er sich <strong>mit</strong>tenim Leben o<strong>der</strong> <strong>mit</strong>ten im <strong>Sterben</strong> bef<strong>in</strong>det? O<strong>der</strong> ist das gesamte Leben e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger,fortschreiten<strong>der</strong> Prozess, <strong>der</strong> sich <strong>in</strong> äußerlich unterschiedliche Gewän<strong>der</strong> vonJugend <strong>und</strong> Alter, Geburt <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>, Entstehen <strong>und</strong> Vergehen kleidet, <strong>in</strong>nerlich abervon den immer gleichen Gesetzmäßigkeiten bestimmt ist? In ihrer Gänze lässt sichdiese Frage hier sicherlich nicht beantworten, aber es sche<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>nvoll, dasAugenmerk auf Unterschiede <strong>und</strong> auch Geme<strong>in</strong>samkeiten zu richten, die sich imbelastenden o<strong>der</strong> krisenhaften Geschehen während des Lebens <strong>und</strong> während des<strong>Sterben</strong>s ergeben.Dazu wird zunächst thematisiert, welche Rolle Belastung <strong>und</strong> Bewältigung allgeme<strong>in</strong>im Lebensverlauf spielen. Darauf aufbauend kann die spezielle Situation von(chronischer) Krankheit als Ursache von Beanspruchung <strong>und</strong> Bewältigung betrachtetwerden. Hier stellt sich dann die Frage, wo <strong>in</strong> Abgrenzung zur Krankheit das <strong>Sterben</strong>e<strong>in</strong>setzt. Es wird darauf folgend e<strong>in</strong> Überblick über die Hauptthemen von Belastungen<strong>und</strong> Bedürfnissen bei Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>gegeben werden. In Verb<strong>in</strong>dung zu Belastungen <strong>und</strong> Bedürfnissen soll auch e<strong>in</strong> Blickauf Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität von sterbenden Menschen im Vergleich zunicht-sterbenden Menschen geworfen werden. Abschließend können die Parallelen<strong>und</strong> die Beson<strong>der</strong>heiten von Lebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen dargestellt werden.2 Die Thanatologie ist e<strong>in</strong>e multidiszipl<strong>in</strong>äre Wissenschaft <strong>mit</strong> dem <strong>in</strong>haltlichen Schwerpunkt auf <strong>Tod</strong>, <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong>Trauer. Schwerpunkte stellen <strong>in</strong> ihr soziologische, psychiatrische <strong>und</strong> psychologische (Thanatopsychologie)Ansätze dar (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1992, 10). Die kl<strong>in</strong>ische Thanatologie bildet die Anwendungsdiszipl<strong>in</strong> <strong>der</strong>Thanatologie <strong>und</strong> umfasst drei Bereiche: die Betreuung sterben<strong>der</strong> Menschen, Suizid <strong>und</strong> Suizidprävention sowieTrauer <strong>und</strong> die Betreuung Trauern<strong>der</strong> (Feigenberg, 1980, 7).
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 10Belastung <strong>und</strong> Bewältigung als Themen im LebensverlaufDer <strong>in</strong>nere Stress, <strong>der</strong> durch e<strong>in</strong>e belastende Situation entsteht, <strong>und</strong> dieBemühungen um e<strong>in</strong>e Bewältigung dieser Situation s<strong>in</strong>d zentrale <strong>und</strong> immerwie<strong>der</strong>kehrende Themen im Lebensverlauf e<strong>in</strong>es Menschen. Von <strong>der</strong> erstenTrennung als Säugl<strong>in</strong>g von <strong>der</strong> Mutter nach <strong>der</strong> Geburt bis zur letzten Trennung imMoment des <strong>Sterben</strong>s s<strong>in</strong>d Menschen <strong>mit</strong> Situationen konfrontiert, die für sie Stress<strong>und</strong> Beanspruchung bedeuten <strong>und</strong> die sie bewältigen wollen <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> müssen.Stress wird im Allgeme<strong>in</strong>en ausgelöst durch e<strong>in</strong> Ereignis, das für die Personbelastend ist (vgl. B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung, 2001, 60f.). Dabeikönnen allgeme<strong>in</strong>e Charakteristika bestimmt werden, die sich prototypischerweise <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er belastenden Situation wie<strong>der</strong> f<strong>in</strong>den lassen:„Das Geschehen ist e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en sozialen Konsens zufolge für den Betreffendenbelastend o<strong>der</strong> for<strong>der</strong>nd, weicht von e<strong>in</strong>er unterstellten „Normalität“ ab, erfor<strong>der</strong>tpsychischen <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> physischen Aufwand <strong>und</strong> kann im H<strong>in</strong>blick auf unterschiedlicheVerhaltensoptionen <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>dividuell unterschiedlich angegangen werden.“ (Weber, 1997,9)Es fällt auf, dass diese Def<strong>in</strong>ition zum e<strong>in</strong>en sehr allgeme<strong>in</strong>, zum an<strong>der</strong>en teilweisetautologisch ist. Es wird sich im weiteren Verlauf noch zeigen, dass sich objektiv nurschwer def<strong>in</strong>ieren lässt, was subjektiv als belastend empf<strong>und</strong>en wird o<strong>der</strong> auch nicht.Der Begriff <strong>der</strong> Belastung wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie unterschiedlich verstanden <strong>und</strong>def<strong>in</strong>iert (vgl. Shanan, 1995, 61). Es fehlt gegenwärtig e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong> akzeptierteDef<strong>in</strong>ition, woraus Shanan den Schluss zieht, dass es folglich auch ke<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong>akzeptierten Ansatz zur Beschreibung <strong>und</strong> Analyse <strong>der</strong> Verarbeitung psychischerBelastungen geben könne.Das Verständnis von Belastung <strong>und</strong> Beanspruchung, das dieser Arbeit zugr<strong>und</strong>eliegt, folgt <strong>der</strong> Empfehlung <strong>der</strong> begrifflichen Trennung von Belastung <strong>und</strong> Beanspruchung,die Köper (2001) <strong>in</strong> Anlehnung an Rohmert <strong>und</strong> Rutenfranz (1975) gibt.Danach werden die beiden Begriffe wie folgt def<strong>in</strong>iert:„Belastung (stress) wird verstanden als Gesamtheit <strong>der</strong> erfassbaren E<strong>in</strong>flüsse, die vonaußen auf den Menschen zukommen <strong>und</strong> auf ihn psychisch e<strong>in</strong>wirken.“ „Beanspruchung(stra<strong>in</strong>) wird verstanden als die <strong>in</strong>dividuelle, zeitlich un<strong>mit</strong>telbare <strong>und</strong> nicht langfristigeAuswirkung <strong>der</strong> psychischen Belastung im Menschen <strong>in</strong> Abhängigkeit von se<strong>in</strong>en
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 11<strong>in</strong>dividuellen (habituellen <strong>und</strong> augenblicklichen) Voraussetzungen (e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong><strong>in</strong>dividuellen Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungsstrategien).“ (Köper, 2001, 60)Folglich s<strong>in</strong>d die Vorgänge außerhalb <strong>und</strong> <strong>in</strong>nerhalb des Menschen die Grenzezwischen Belastung <strong>und</strong> Beanspruchung: alles, was von außerhalb auf denMenschen e<strong>in</strong>wirkt, wird als Belastung def<strong>in</strong>iert; alles, was sich im Inneren desMenschen als Folge <strong>der</strong> auf ihn e<strong>in</strong>wirkenden Belastung zeigt, wird als Beanspruchungbezeichnet.Das gängigste Modell zur Stressentstehung <strong>und</strong> –verarbeitung wurde von Lazarus<strong>und</strong> Launier (1981; vgl. Lazarus, 1995) entwickelt. Sie def<strong>in</strong>ieren Stress als e<strong>in</strong>transaktionales Konstrukt, wo<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e dynamische Sichtweise bereits explizitangelegt wird:„Stress ist we<strong>der</strong> gleichbedeutend <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em Umweltreiz, e<strong>in</strong>em Personmerkmal o<strong>der</strong>e<strong>in</strong>er Reaktion, son<strong>der</strong>n Stress stellt e<strong>in</strong> relationales Konzept dar, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong> Gleichgewichthergestellt werden muss zwischen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Fähigkeit, <strong>mit</strong> diesenAnfor<strong>der</strong>ungen ohne zu hohe Kosten o<strong>der</strong> destruktive Folgen fertigzuwerden.“(Bodenmann, 1997, 74)Das Stressverständnis nach Lazarus (1995) umfasst dabei v.a. vier Aspekte: (a) diekontextuelle E<strong>in</strong>bettung <strong>und</strong> Situationsbezogenheit, (b) die transaktionaleAufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong>bezogenheit von Situationsvariablen, E<strong>in</strong>schätzungsprozessen <strong>und</strong>Cop<strong>in</strong>g, (c) die emotionale <strong>und</strong> problembezogene Homöostaseregulation sowie (d)die Trennung von Cop<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Outcome. Dabei wird <strong>der</strong> Begriff des Cop<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong>Psychologie als Sammelbegriff für alle jene Reaktionen e<strong>in</strong>er Person verwendet, diesie bei Konfrontation <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>er potentiell bedrohlichen o<strong>der</strong> belastenden Situationzeigt (vgl. bspw. Filipp, 1995, 36; Silver & Wortmann, 1980). Erweitert wird dasStress-Modell nach Lazarus durch e<strong>in</strong>e zeitliche Komponente im Ansatz von Burr &Kle<strong>in</strong> (1994), welche e<strong>in</strong> Kaskadenmodell von Stress <strong>und</strong> Cop<strong>in</strong>g vorschlagen.Danach werden nach e<strong>in</strong>em Stressereignis sequentiell unterschiedlicheCop<strong>in</strong>gressourcen <strong>in</strong> Anspruch genommen (z.B. <strong>in</strong>dividuelle Belastungsbewältigung,dyadische Belastungsbewältigung, soziale Unterstützung durch externe Personen)(vgl. dazu auch Bodenmann, 1997, 85).
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 12Bewältigung (synonym Cop<strong>in</strong>g, Belastungsverarbeitung) umfasst nun alle Erlebens<strong>und</strong>Verhaltensweisen, die <strong>mit</strong> dem Meistern e<strong>in</strong>er solchen belastenden, durchBedrohung <strong>und</strong> Verlust charakterisierten Situation <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehen (Greve,1997a, 1997b). Bewältigung ist <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong> dynamischer Prozess <strong>und</strong> e<strong>in</strong>relationales Geschehen <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Natur des Stressereignisses vergleichbar:„So wie das englische Verbum cop<strong>in</strong>g niemals ohne with daherkommt, so umschreibtalle<strong>in</strong> das Präfix „be“, dass das Denken <strong>und</strong> Tun im Bewältigungsprozess auf etwas„e<strong>in</strong>wirkend“ gerichtet ist.“ (Filipp, 1997, VIII)E<strong>in</strong>e kurze <strong>und</strong> aussagekräftige Def<strong>in</strong>ition des Bewältigungsbegriffs sche<strong>in</strong>t jedochnicht möglich zu se<strong>in</strong>, denn die Prozesse <strong>und</strong> Dynamiken von Bewältigung erweisensich als vielfältig <strong>und</strong> unterschiedlich:„Der Begriff <strong>der</strong> Bewältigung wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> psychologischen Forschung vielfach verwendet,sche<strong>in</strong>t sich jedoch e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen <strong>und</strong> prägnanten Begriffsbestimmung zu entziehen.(…) Der <strong>in</strong>haltlichen <strong>und</strong> methodischen Vielfalt steht nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges Ausmaß antheoretischer F<strong>und</strong>ierung gegenüber.“ (Schwarz, Salewski & Tesch-Römer, 1997, 1f.)Olbrich (1981; vgl. Olbrich, 1995; Olbrich & Pöhlmann, 1995) konnte <strong>in</strong> diesemZusammenhang zeigen, dass gerade die große Individualität <strong>der</strong> angewandtenBewältigungsstrategien bei verschiedenen Menschen das allgeme<strong>in</strong> gültigsteCharakteristikum von Bewältigung darstellt (Schmidt-Denter, 2005, 175). Imallgeme<strong>in</strong>en Konsens können zum<strong>in</strong>dest assimilative <strong>und</strong> akkomodative Prozesse <strong>in</strong><strong>der</strong> Bewältigung unterschieden werden, anlehnend an das Zwei-Prozess-Modell <strong>der</strong>Entwicklungsregulation nach Brandstätter (vgl. bspw. Fre<strong>und</strong> & Riediger, 2003, 619).Im assimilativen Modus versucht die Person, H<strong>in</strong><strong>der</strong>nisse o<strong>der</strong> Schwierigkeiten ausdem Weg zu räumen, um die Erreichung e<strong>in</strong>es gesteckten Ziels zu ermöglichen. Derakkomodative Modus ist dadurch charakterisiert, dass Ziele, Ambitionen <strong>und</strong>Selbstbewertungsstandards so an die gegebene Situation angepasst werden, dassdie ursprüngliche Diskrepanz <strong>und</strong> die <strong>mit</strong> ihr verb<strong>und</strong>enen, aversiven Gefühleneutralisiert werden können.Sowohl Belschner (2001) als auch Yeg<strong>in</strong>er (2000) weisen darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>der</strong> Begriff<strong>der</strong> Bewältigung zumeist e<strong>in</strong>seitig <strong>mit</strong> aktionalen, handlungsorientierten Konzeptenverb<strong>und</strong>en wird (vgl. auch Braukmann & Filipp, 1995; Keil, A., 2004, 163). So zeigtYeg<strong>in</strong>er anhand e<strong>in</strong>er Untersuchung auf, dass die Bewusstwerdung <strong>und</strong> H<strong>in</strong>wendungzur Spiritualität e<strong>in</strong>e bedeutsame Rolle <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankheitsverarbeitung e<strong>in</strong>erKrebserkrankung spielen kann (für den Sterbeprozess vgl. Bernard & Schnei<strong>der</strong>,
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 131996; Bickel, L. & Tausch-Flammer, 1997a, 1997b; Bragdon, 1991; Coberly &Shapiro, 1998; Grof, 1996; Kaut, 2002; Rest, 2001; Stepnick & Perry, 1992; Vogd,1998). Sie schlägt vor, bestehende Cop<strong>in</strong>g-Modelle um den Bereich des SpirituellenGr<strong>und</strong>es <strong>und</strong> des Transpersonalen Vertrauens zu erweitern. Diese Sichtweisewurzelt <strong>in</strong> Belschners Konzept <strong>der</strong> Lebenskunst, <strong>in</strong> dem Aspekte von Tun <strong>und</strong>Lassen <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> greifen <strong>und</strong> sich dadurch gegenseitig ergänzen. Belschner (2001)führt dabei aus, dass westliche Kulturen überwiegend durch die Leitidee <strong>der</strong>Kontrolle geprägt seien, so dass die Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Lebensform des Tunssozialisiert werden, die dem Aufbau <strong>und</strong> Aufrechterhalten von Kontrolle gewidmet ist.E<strong>in</strong>e komplementäre Ergänzung dazu stellt die Lebensform des Lassens dar, <strong>in</strong>welcher sich <strong>der</strong> Mensch e<strong>in</strong>em Geschehen absichtslos anvertraut, ohne auf e<strong>in</strong>bestimmtes Ziel h<strong>in</strong> zu handeln. In unserer Kultur f<strong>in</strong>den wir diese Handlungsweisevor allem <strong>in</strong> Grenzsituationen, <strong>in</strong> denen kontrollierendes Tun nicht mehr möglich ist.Belschner zeigt, dass beide Lebensformen des Tuns <strong>und</strong> Lassens komplementäraufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> angewiesen s<strong>in</strong>d:„E<strong>in</strong>e angemessene Lebenskunst wird dann möglich, wenn e<strong>in</strong>e Person die beidenLebensformen des Tun <strong>und</strong> des Lassens als <strong>in</strong>dividuell verfügbare Kompetenzenentwickelt, <strong>und</strong> wenn sie diese Kompetenzen <strong>in</strong> flexibler Weise nutzen kann, um diewesentlichen Aufgaben ihres Lebens – ihre Lebenssehnsucht – als konkreteLebenspraxis zu verwirklichen.“ (Belschner, 2001, 93)Thomae teilt die Ansicht, dass <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> personalen Kontrolle im Stress- <strong>und</strong>Cop<strong>in</strong>gprozess überbewertet wird. Er kommt bei se<strong>in</strong>er Forschung zu Dase<strong>in</strong>sthemenim Lebensverlauf zu dem Schluss, dass „<strong>in</strong> <strong>der</strong> bisherigen (sozialgerontologischen)Forschung <strong>der</strong> Aspekt des Vertrauens zu kurz kam“ (Erlemeier,1995, 259; vgl. auch Thomae, 1988). Und auch Wass bestätigt die Bedeutung desVertrauens als Bewältigungsmöglichkeit für PatientInnen am Lebensende (Wass,2001, 97).
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 14Belastung <strong>und</strong> Bewältigung durch (chronische) KrankheitDas Belastungsereignis, das wohl am häufigsten <strong>und</strong> genauesten untersucht wurde,ist das <strong>der</strong> Krankheit (vgl. Filipp & Ferr<strong>in</strong>g, 2002; Muthny, 1997). Entsprechendzahlreich s<strong>in</strong>d die Modelle <strong>und</strong> Taxonomien <strong>der</strong> Belastungsverarbeitung <strong>in</strong> diesemBereich. Die prom<strong>in</strong>entesten werden stellvertretend im Folgenden vorgestellt.Beutel (1988; zit. n. Salewski, 1997, 43) stellt <strong>in</strong> Zusammenfassung verschiedenerStudienergebnisse dar, aus welchen Quellen für den (chronisch) kranken MenschenBelastung entsteht:• Unheilbarkeit <strong>und</strong> Verschlechterung,• Unkontrollierbarkeit des Krankheitsverlaufs,• Reduzierung <strong>der</strong> körperlichen Leistungsfähigkeit,• Begrenzung <strong>der</strong> Zukunftsperspektive,• Bedrohung <strong>der</strong> körperlichen Integrität,• Abhängigkeit vom Krankheitsversorgungssystem,• Hospitalisierung,• Notwendigkeit e<strong>in</strong>es Behandlungsregimes sowie• persönliche <strong>und</strong> soziale Verluste.Die Ziele von Bewältigung ordnet Schüßler (1993; zit. n. Salewski, 1997, 44) <strong>in</strong>krankheits-, personen- <strong>und</strong> umweltbezogene Ziele: Zu krankheitsbezogenen Zielenzählen dabei Anerkennung <strong>und</strong> Bewältigung <strong>der</strong> Krankheitssymptome wie Schmerz,Schwäche, Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung; Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> notwendigen mediz<strong>in</strong>ischenBehandlung; Entwicklung <strong>und</strong> Aufrechterhaltung adäquater Beziehungen zuÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegepersonal; eventuell Anerkennung <strong>und</strong> Bewältigung e<strong>in</strong>esungewissen Krankheitsverlaufs <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er ungewissen Zukunft. Zu personenbezogenenZielen <strong>der</strong> Krankheitsbewältigung zählen die Entwicklung <strong>und</strong>Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>es emotionalen Gleichgewichts sowie die Aufrechterhaltunge<strong>in</strong>es ausreichenden Selbstwertgefühls. Die umweltbezogenen Ziele schließlichumfassen die Umgestaltung <strong>und</strong> Aufrechterhaltung <strong>der</strong> wichtigen Beziehungen zuFamilie <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 15E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Taxonomie <strong>der</strong> Formen von Krankheitsbewältigung stellen Filipp &Klauer (1988; vgl. auch Freudenberg & Filipp, 1998; Mayer & Filipp, 2002, 307) auf.Sie unterscheiden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Reaktion e<strong>in</strong>er Person auf schwere bzw. chronischeKrankheit e<strong>in</strong>e Ebene <strong>der</strong> persönlichen Reaktion, e<strong>in</strong>e Ebene des sozialenE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s sowie die Lenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ <strong>der</strong> betreffendenPerson.Entscheidend ist nun die Frage, wann Bewältigungsversuche als gelungen o<strong>der</strong> alsmisslungen zu beurteilen s<strong>in</strong>d. Dabei ist zunächst festzustellen, dass die Effektivitätvon Bewältigungsreaktionen (‚Cop<strong>in</strong>g Efficacy’) von vielfältigen Randbed<strong>in</strong>gungenabhängig ist. Daher kann sie schwerlich kontextunabhängig analysiert werden.Zusätzlich kann die Effektivität von Bewältigung aus verschiedenen Blickw<strong>in</strong>kelnbetrachtet <strong>und</strong> beurteilt werden (Salewski, 1997). Es gibt dabei m<strong>in</strong>destens dreiunterschiedliche Perspektiven, aus denen Bewältigung beurteilt werden kann: diedes Patienten bzw. <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong>, die des mediz<strong>in</strong>isch Behandelnden <strong>und</strong> die dessozialen Umfeldes. Aus Sicht des Patienten bzw. <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d das subjektiveWohlbef<strong>in</strong>den, seelische Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensqualität Indikatoren für gelungeneKrankheitsbewältigung. Aus Sicht des mediz<strong>in</strong>ischen Behandlungssett<strong>in</strong>gs zählenSymptomatik <strong>und</strong> Compliance als Zeichen erfolgreicher Bewältigung. Aus Sicht <strong>der</strong>sozialen Umwelt schließlich s<strong>in</strong>d Leistungsfähigkeit, unkomplizierter Umgang <strong>mit</strong>dem Patienten bzw. <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong> <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e bzw. ihre Ausgeglichenheit Bed<strong>in</strong>gungenfür erfolgreiche Krankheitsbewältigung. Folglich kann abschließend festgehaltenwerden:„E<strong>in</strong>e umfassende <strong>und</strong> phänomenangemessene Kriterienbestimmung für die erfolgreicheVerarbeitung chronischer Erkrankungen muss alle Perspektiven berücksichtigenbeziehungsweise e<strong>in</strong>e stärkere Berücksichtigung e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> Perspektiven begründetvornehmen.“ (Salewski, 1997, 54)
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 16Wann beg<strong>in</strong>nt das <strong>Sterben</strong>? Und für wen?Wann e<strong>in</strong> Mensch e<strong>in</strong> <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> ist, sche<strong>in</strong>t oft nur auf den ersten Blick e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fachzu beantwortende Frage zu se<strong>in</strong>. Der am häufigsten verwendete Def<strong>in</strong>itionsversuchim deutschen Sprachraum kommt von Wittkowski:„Aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht sollte e<strong>in</strong> Mensch dann als <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>bezeichnet werden, wenn (1) nach menschlichem Ermessen sicher ist, dass er <strong>in</strong> e<strong>in</strong>embestimmten, näher e<strong>in</strong>grenzbaren Zeitraum tot se<strong>in</strong> wird, (2) m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>igeMenschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Umgebung dies wissen, (3) er sich <strong>der</strong> Tatsache, dass er un<strong>mit</strong>telbarvom <strong>Tod</strong> bedroht ist, soweit bewusst ist, dass dieses Bewusstse<strong>in</strong> se<strong>in</strong> Erleben <strong>und</strong>Verhalten bestimmt.“ (Wittkowski, 1999, 117)E<strong>in</strong> Mensch ist demnach dann aus psychologischer Sicht als sterbend zubezeichnen, wenn er objektiv vom <strong>Tod</strong> bedroht ist <strong>und</strong> sich dieser Bedrohung soweitbewusst ist, dass sie se<strong>in</strong> Erleben <strong>und</strong> Verhalten bee<strong>in</strong>flusst.Bei näherer Betrachtung des Lebensgeschehens, das sich h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Def<strong>in</strong>itionverbirgt, wird schnell deutlich, dass sich Abgrenzungen zwischen Krankheit <strong>und</strong><strong>Sterben</strong>, so wie zwischen Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankse<strong>in</strong>, nicht festlegen lassen. (Keildiskutiert die Frage von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit aus gesellschaftlicher (Keil, A.,2004, 64f.) <strong>und</strong> lebensgeschichtlicher (Keil, A., 2004, 75ff.) Perspektive.) Aus e<strong>in</strong>emsich schlecht fühlenden Menschen wird nach e<strong>in</strong>gehen<strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischer Diagnostike<strong>in</strong> Mensch <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>er (vielleicht schwerwiegenden) Krankheitsdiagnose. Aus dem nunoffiziell kranken Menschen wird im Laufe kurzer o<strong>der</strong> langer Zeit vielleicht e<strong>in</strong> schwerkranker Mensch. Und irgendwann – nach langer o<strong>der</strong> kurzer Zeit, nach zwischenzeitlichenVerbesserungen <strong>und</strong> Verschlechterungen des körperlichen Zustandes –wird irgendwann <strong>der</strong> <strong>Tod</strong> e<strong>in</strong>treten. O<strong>der</strong> e<strong>in</strong> bis dato kerngesun<strong>der</strong> Mensch erleidete<strong>in</strong>en Schlaganfall <strong>und</strong> stirbt daran <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit. O<strong>der</strong>, o<strong>der</strong>… Die<strong>in</strong>dividuellen Verlaufsformen dieses Prozesses s<strong>in</strong>d so vielgestaltig wie dieMenschen, die sie betreffen. E<strong>in</strong>e explizite Def<strong>in</strong>ition des Beg<strong>in</strong>ns <strong>und</strong> <strong>der</strong> Dauere<strong>in</strong>es Sterbeprozesses ist so<strong>mit</strong> unmöglich. Wittkowski (2002, 15; Wittkowski et al.,2004) bestätigt dies:„Auf e<strong>in</strong>em Kont<strong>in</strong>uum betrachtet besteht sowohl zwischen dem kurativen <strong>und</strong> dempalliativen mediz<strong>in</strong>ischen Betreuungsansatz im Vorfeld des <strong>Sterben</strong>s als auch zwischenpalliativer Betreuung <strong>und</strong> dem Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> eigentlichen Sterbebegleitung e<strong>in</strong> fließen<strong>der</strong>Übergang.“ (Wittkowski et al., 2004, 112)
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 17Verschiedene Versuche wurden gemacht, um Phasen im Sterbeprozess zubestimmen (z.B. Kübler-Ross, Weisman, Pattison, Glaser & Strauss, etc.), o<strong>der</strong> umFaktoren zu extrahieren, die den Verlauf des Sterbeprozesses bee<strong>in</strong>flussen (z.B.Worden, Samarel, etc.). (E<strong>in</strong>e differenzierte Darstellung f<strong>in</strong>det sich bei Wittkowski etal., 2004.) Viele dieser Theorien über den Sterbeprozess wurden jedoch deduktivvon an<strong>der</strong>en Forschungsgebieten <strong>der</strong> Psychologie auf den Kontext des <strong>Sterben</strong>sübertragen <strong>und</strong> müssen daher <strong>in</strong> ihrer Tragfähigkeit kritisch betrachtet werden:„Theories of dy<strong>in</strong>g tend to be etic rather than emic. (…) It would be realistic, however, toencourage more attention to the emic approach, to educ<strong>in</strong>g the dy<strong>in</strong>g person’s own viewof the situation without attempt<strong>in</strong>g to steer it <strong>in</strong>to any preformed categories.“ (Corr, Doka& Kastenbaum, 1999, 251)Der fortschreitende Erkenntnisstand <strong>in</strong> <strong>der</strong> Thanatologie zeigt hier auch dieIndividualität <strong>und</strong> das nicht normgerechte Verlaufen des Sterbeprozesses (H<strong>in</strong>ton,1999; Kruse, A., 1996; Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995; Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001):„Das <strong>Sterben</strong> ist als <strong>in</strong>dividueller Prozess zu begreifen, <strong>der</strong> <strong>in</strong> hohem Maße vomLebensverlauf des Patienten bee<strong>in</strong>fluss ist.“ (Kruse, A., 1996, 161)„<strong>Sterben</strong> ist e<strong>in</strong> sehr <strong>in</strong>dividueller Prozess. Er wird von sozialen Merkmalen wieReligionszugehörigkeit, Bildungsstand, Familienstand, Geschlecht u.a. nur <strong>in</strong> relativger<strong>in</strong>gem Maße bee<strong>in</strong>flusst. Auch das kalendarische Alter spielt e<strong>in</strong>e eher untergeordneteRolle. (…) Die Prozesshaftigkeit des <strong>Sterben</strong>s ist gerade wegen des <strong>in</strong>dividuellenCharakters nicht prototypisch beschreibbar als feste Abfolge von Phasen.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 7f.)Zudem zeigt sich bei näherer Betrachtung des Geschehens um Krankheit <strong>und</strong><strong>Sterben</strong>, dass es vom Blickw<strong>in</strong>kel des Betrachtenden abhängt, wann <strong>und</strong> wie e<strong>in</strong>Mensch als <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> zu bezeichnen ist (vgl. bspw. Payne & Langley-Evans, 1996;Rest, 2001; Seymour, 1999). Die E<strong>in</strong>ordnung e<strong>in</strong>es Menschen als <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> istdanach zu unterscheiden, von wem sie gerade getroffen wird: vom Pflegepersonal,von den PatientInnen, von Angehörigen, von Kostenträgern, etc. Danach wird sichdie Def<strong>in</strong>ition jeweils unterscheiden: Für e<strong>in</strong>e bestimmte Patient<strong>in</strong> kann bei ihrereigenen E<strong>in</strong>schätzung über sich selbst entscheidend se<strong>in</strong>, ob <strong>und</strong> wie sie weiter amLeben bleiben will o<strong>der</strong> nicht. Für das sie betreuende Pflegepersonal kann bei <strong>der</strong>E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> „sterbend o<strong>der</strong> nicht-sterbend“ entscheidend se<strong>in</strong>, wie die Patient<strong>in</strong>gepflegt <strong>und</strong> behandelt werden muss. Für die behandelnde Ärzt<strong>in</strong> kann für dieselbeE<strong>in</strong>teilung ausschlaggebend se<strong>in</strong>, ob <strong>und</strong> wie die mediz<strong>in</strong>ische Behandlungverän<strong>der</strong>t werden muss. Für die Angehörigen kann schließlich entscheidend se<strong>in</strong>, ob
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 18<strong>und</strong> wie sie spezifische Unterstützung von Seiten <strong>der</strong> Kostenträger erhalten können.Die E<strong>in</strong>schätzung, ob sich e<strong>in</strong> betreffen<strong>der</strong> Mensch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sterbeprozess bef<strong>in</strong>det,hängt also untrennbar <strong>mit</strong> dem Blickw<strong>in</strong>kel des Beurteilenden zusammen. E<strong>in</strong>e„objektive Def<strong>in</strong>ition“ gibt es demnach nicht.Insgesamt ist folglich festzuhalten, dass alle Def<strong>in</strong>itionsversuche des <strong>Sterben</strong>s zweiE<strong>in</strong>schränkungen unterliegen:• Man kann den Beg<strong>in</strong>n des Sterbeprozesses nicht genau def<strong>in</strong>ieren. Aus krankenPatientInnen werden irgendwann sterbende PatientInnen. Und dies ist e<strong>in</strong><strong>in</strong>dividueller, nicht normgerechter Prozess (so gibt es u.a. auch sehr e<strong>in</strong>drücklicheStudien zu Spontanremissionen; vgl. bspw. Achterberg, Dossey & Kolkmeier,1996).• Die Def<strong>in</strong>ition ist vom Def<strong>in</strong>ierenden abhängig. Je nach Blickw<strong>in</strong>kel desBetrachters <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Interessenslage wird e<strong>in</strong> Patient/e<strong>in</strong>e Patient<strong>in</strong> <strong>in</strong>unterschiedliche Kategorien e<strong>in</strong>geordnet werden können.Streng genommen lässt sich also höchstens retrospektiv def<strong>in</strong>ieren, wann das<strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>es Menschen begonnen hat. Und auch dann nur von e<strong>in</strong>em gewähltenBlickw<strong>in</strong>kel aus (z.B. aus dem <strong>der</strong> Patient<strong>in</strong>, <strong>der</strong> Ärzt<strong>in</strong>, <strong>der</strong> Kostenträger, etc.).Def<strong>in</strong>itionsversuche <strong>und</strong> Grenzziehungen verstellen daher oft eher das Verständnisfür den <strong>in</strong>dividuellen Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>en Prozess, als dass sie e<strong>in</strong> vertieftesVerständnis schaffen können.Aus pragmatischer Sicht s<strong>in</strong>d Def<strong>in</strong>itionsversuche dennoch oft s<strong>in</strong>nvoll, z.B. weil siehelfen, Prioritäten im Umgang <strong>mit</strong> PatientInnen o<strong>der</strong> Angehörigen neu zu setzen,wenn es auf das <strong>Sterben</strong> zugeht, o<strong>der</strong> weil sie helfen, spezifische Beanspruchungenvon Pflegenden besser zu verstehen, die hauptsächlich o<strong>der</strong> ausschließlich <strong>mit</strong>sterbenden Menschen zu tun haben, etc. Es sche<strong>in</strong>t, als würden diese Kategoriengebraucht werden, um Blickw<strong>in</strong>kel <strong>und</strong> Handlungswege für PatientInnen <strong>und</strong> ihrUmfeld zu setzen.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 19Belastungen <strong>und</strong> Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> Menschen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong>ihrem UmfeldViele Forschungsbemühungen wurden auf die Frage verwandt, was sterbendeMenschen belastet <strong>und</strong> was sie <strong>in</strong>folgedessen brauchen (vgl. z.B. Blumenthal-Barby,1991; Corr, Nabe & Corr, 2003; Schrö<strong>der</strong>, C., 2001). Die Frage nach Belastungen<strong>und</strong> Bedürfnissen steht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> thanatologischen Publikationen weit mehr imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> als die Frage, wo die <strong>Ressourcen</strong> sterben<strong>der</strong> Menschen liegen <strong>und</strong> wiediese <strong>mit</strong> ihrer belastenden Situation erfolgreich umgehen können. So bildet dieForschung zu Belastungen <strong>und</strong> Bedürfnissen bisher e<strong>in</strong>en Hauptteil <strong>der</strong>thanatopsychologischen Forschung.Zunächst muss <strong>der</strong> Begriff des Bedürfnisses von sterbenden Menschen geklärtwerden. Rest (1981, 14) unterscheidet Bedürfnis als gr<strong>und</strong>legende, bei allenMenschen gleiche Disposition von Bedürftigkeit, die e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuell unterschiedlicheÄußerung des generellen Bedürfnisses ist. Bedürfnisse werden hier als Mangelzuständeverstanden, die <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> die es zu beseitigengilt. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigsten <strong>und</strong> anspruchsvollsten Aufgaben <strong>der</strong> Bedürfnisforschung istdaher die möglichst realitätsnahe, empirische Abbildung von Patientenbedürfnissen.Haase & Schwefel (1995) verweisen ebenfalls auf die große Notwendigkeit <strong>der</strong>Bedürfnisforschung <strong>in</strong> diesem Bereich <strong>und</strong> zeigen auf, dass beispielsweise die<strong>der</strong>zeit ausgebildeten ÄrztInnen häufig bl<strong>in</strong>d für die psychischen <strong>und</strong> sozialenGr<strong>und</strong>bedürfnisse ihrer sterbenden PatientInnen s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> sich, wenn sie ihnenbegegnen, hilflos o<strong>der</strong> abwehrend verhalten, da ihnen diese Bedürfnisseausbildungsbed<strong>in</strong>gt nicht <strong>in</strong> ausreichendem Maße klar s<strong>in</strong>d. Um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> dieQualität <strong>der</strong> Bedürfnisse bei sterbenden PatientInnen zu ermöglichen, sollenbeispielhaft e<strong>in</strong>ige vielzitierte Aufstellungen dargestellt werden.Rest (1981, 41; 1992, 123; vgl. auch Mennemann, 1998, 147) hält fünf Hauptbedürfnissedes sterbenden Menschen <strong>in</strong> hierarchischer Reihenfolge fest:• Bedürfnisse des Körpers,• Bedürfnis nach Sicherheit,
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 20• Bedürfnis nach Liebe,• Bedürfnis nach Achtung sowie• Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.Makowka (1998, 36ff.) leitet aus eigenen Studien folgende Aufzählung vonPatientenbedürfnissen ab: Bedürfnis nach Ruhe, nach ausreichen<strong>der</strong> Atmung, nachSchmerzfreiheit, nach Körperpflege, Bedürfnis den Durst zu stillen, Bedürfnis nachWärme, Bedürfnis die S<strong>in</strong>ne zu befriedigen, Bedürfnis nach Kontakt <strong>mit</strong> Angehörigen<strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en, nach Kontakt <strong>mit</strong> dem Pflegepersonal, Bedürfnis nach Geborgenheit,nach Liebe <strong>und</strong> Aufmerksamkeit, nach Achtung <strong>und</strong> Würde (vgl. dazu auchChoch<strong>in</strong>ov, Hack, McClement, Kristjanson & Harlos, 2002; Ohi, 1995), nach Wahrheit<strong>und</strong> Wahrhaftigkeit sowie religiös-spirituelle Bedürfnisse.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (2001, 9) fasst folgende Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> Menschenzusammen:• „Freise<strong>in</strong> von Schmerzen,• sich körperlich wohl fühlen,• Freise<strong>in</strong> von unangenehmen körperlichen Empf<strong>in</strong>dungen,• Gefühl, nicht alle<strong>in</strong> gelassen zu werden,• Gefühl, <strong>in</strong>formiert zu werden, soweit dies vom <strong>Sterben</strong>den erwünscht ist,• Gefühl, akzeptiert <strong>und</strong> respektiert zu werden,• Bedürfnis nach „s<strong>in</strong>nvoller“ Bewertung des eigenen Lebens <strong>und</strong>• Zuwendung <strong>und</strong> Respekt durch die Umwelt“.Und Blosser-Reisen (1997a, 1997b) leitet aus verschiedenen Quellen folgendeKernbedürfnisse sterben<strong>der</strong> Menschen ab:„Übere<strong>in</strong>stimmend werden aus Forschung <strong>und</strong> Sterbebegleitung etwa folgendeKernbedürfnisse genannt (Pompey, 1994; Rest, 1992; Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1992; Student,1994):a) Das Bedürfnis, im <strong>Sterben</strong> nicht unter Schmerzen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en körperlichenBeschwerden leiden zu müssen.b) Das Bedürfnis, im <strong>Sterben</strong> nicht alle<strong>in</strong>e gelassen zu werden, son<strong>der</strong>n an e<strong>in</strong>emvertrauten Ort (möglichst zuhause) <strong>in</strong><strong>mit</strong>ten vertrauter Menschen zu sterben.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 21c) Das Bedürfnis, noch letzte D<strong>in</strong>ge zu regeln.d) Das Bedürfnis, die Frage nach dem S<strong>in</strong>n des Lebens, des <strong>Sterben</strong>s o.ä. zu stellen <strong>und</strong>die Frage des „Danach“ zu erörtern.Zentrale Bedürfnisse, wie die hier genannten, gelten als für den Menschen so wesentlich,dass e<strong>in</strong> Unerfülltbleiben körperlichen <strong>und</strong> seelischen Schaden hervorrufen kann.“(Blosser-Reisen, 1997b, 180f.)Bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Bedürfnise<strong>in</strong>teilungen darf ihre Verb<strong>und</strong>enheit <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>nicht außer Acht gelassen werden (vgl. Blosser-Reisen, 1997b, 181). So istbeispielsweise das Bedürfnis nach Schmerzfreiheit <strong>mit</strong> dem Bedürfnis nachSicherheit verb<strong>und</strong>en, das Bedürfnis nach Liebe <strong>mit</strong> dem Bedürfnis nach Kontaktdurch vertraute Menschen, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung vielleicht <strong>mit</strong>spirituell-religiösen Bedürfnissen.Doch e<strong>in</strong> Mensch stirbt nicht isoliert von se<strong>in</strong>er Umwelt. Und so vielgestaltig auch dasWissen über die Bedürfnisse <strong>der</strong> Menschen ist, die im Sterbeprozess begriffen s<strong>in</strong>d,so ger<strong>in</strong>g ist das Wissen über die Bedürfnisse <strong>der</strong> Menschen, die auf engstem Raum<strong>mit</strong> ihnen zu tun haben: die Angehörigen o<strong>der</strong> Vertrauten, Pflegende, religiös o<strong>der</strong>psychosozial Betreuende <strong>und</strong> natürlich die behandelnden ÄrztInnen. Auch siebef<strong>in</strong>den sich, ebenso wie die <strong>Sterben</strong>den selbst, <strong>in</strong> diesem Raum, <strong>der</strong> <strong>in</strong> engemKontakt <strong>mit</strong> existentiellen Fragen <strong>und</strong> <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> Verlust steht. Auch sie setzen sich<strong>mit</strong> den Fragen nach Leid, nach Trauer <strong>und</strong> Verlust, nach dem Danach <strong>und</strong> nachS<strong>in</strong>n ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>und</strong> erleben das <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>es Menschen hautnah <strong>mit</strong> (vgl. auchKast, 2000). Corr et al. (2003) beschreiben diese Situation folgen<strong>der</strong>maßen:„… we th<strong>in</strong>k immediately of the ill person… but we should not end there because cop<strong>in</strong>gwith dy<strong>in</strong>g is not solely conf<strong>in</strong>ed to ill and dy<strong>in</strong>g persons. Cop<strong>in</strong>g with dy<strong>in</strong>g is also achallenge for others who are drawn <strong>in</strong>to such situations. These <strong>in</strong>clude the familymembers and friends of the dy<strong>in</strong>g person, as well as the volunteer and professionalcaregivers who attend to the dy<strong>in</strong>g person (Grollmann, 1995b). Confront<strong>in</strong>g imm<strong>in</strong>entdeath and cop<strong>in</strong>g with dy<strong>in</strong>g are experiences that resonate deeply with<strong>in</strong> the personalsense of mortality and li<strong>mit</strong>ation of all who are drawn <strong>in</strong>to these processes.” (Corr et al.,2003, 133)Folglich ist es genauso bedeutsam, die Bedürfnisse von Menschen, die <strong>mit</strong>telbar imKontakt <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> stehen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> gleichen, offenen Weise wie beiPatientInnen zu erfragen. Doch die Sichtweise bisheriger thanatopsychologischerForschung ist <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong>geschränkt: So werden Angehörige zu denBelastungsquellen im H<strong>in</strong>blick auf ihre Beziehung zu sterbenden PatientInnen
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 22befragt (z.B. Kruse, A., 1995), Pflegepersonen zu ihrer Arbeitsbelastung (z.B.Schrö<strong>der</strong>, H., Schrö<strong>der</strong>, Förster & Bänsch, 2003) <strong>und</strong> ÄrztInnen zu Schwierigkeiten <strong>in</strong><strong>der</strong> Kommunikation <strong>mit</strong> sterbenden PatientInnen (z.B. Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004).Die Blickw<strong>in</strong>kel s<strong>in</strong>d dabei e<strong>in</strong>geengt auf die äußere Rolle, die die betreffende Personim Geschehen um e<strong>in</strong>en Patienten o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Patient<strong>in</strong> zu spielen sche<strong>in</strong>t. Dieswie<strong>der</strong>um verstellt den Blick auf eventuelle Geme<strong>in</strong>samkeiten <strong>und</strong> existentielleBedürfnisse, die vielleicht bei allen Menschen auftreten, die sich <strong>in</strong> nahem Kontakt<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> bef<strong>in</strong>den. Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer empfehlen daher:„E<strong>in</strong>e wichtige Aufgabe <strong>der</strong> künftigen thanatopsychologischen Forschung ist dar<strong>in</strong> zusehen, die beiden Perspektiven (…) – die Perspektive schwerstkranker Menschen imTerm<strong>in</strong>al-Stadium e<strong>in</strong>erseits, die Mitarbeiter-Perspektive an<strong>der</strong>erseits –, <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zuverb<strong>in</strong>den.“ (Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995, 297)Den Versuch, e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Blickw<strong>in</strong>kel auf alle Beteiligten im Geschehen um<strong>und</strong> <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em sterbenden Menschen zu werfen (Patient, Bezugspersonen,Professionelle), stellt die Studie „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischenKrankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ dar, <strong>der</strong>en Daten auch Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong>vorliegenden Arbeit s<strong>in</strong>d. Grimm (2004) unterzog alle Aussagen <strong>der</strong> Befragten zuihren Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren e<strong>in</strong>er gruppenübergreifenden Auswertung. Siekommt zu dem Schluss, dass <strong>in</strong> allen Personengruppen sieben Faktoren dasWohlbef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> befragten Person mo<strong>der</strong>ieren: eigenes Bef<strong>in</strong>den, Beziehungen,Kommunikation, Arbeit, persönliche Umgebung, wirtschaftliche Faktoren <strong>und</strong> zeitlicheFaktoren. Diese sieben Faktoren s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> allen Personengruppen anzutreffen, wobeidie Belegungsstärke <strong>der</strong> Kategorien nach Personengruppe schwankt. Lediglich <strong>der</strong>Faktor Beziehungen ist bei allen befragten Personen von gleichrangiger Bedeutung<strong>und</strong> wirkt fast ausschließlich entlastend. Die Arbeit von Grimm zeigt so<strong>mit</strong>exemplarisch auf, dass es mehr Geme<strong>in</strong>samkeiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bef<strong>in</strong>dlichkeit <strong>der</strong> Personengibt, die <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> verschiedenen Rollen konfrontiert werden, als bisher<strong>in</strong> thanatologischer Literatur <strong>und</strong> Forschung angenommen.Es ist mir an dieser Stelle wichtig, deutlich festzuhalten, dass me<strong>in</strong>er Ansicht nachdie Herausfor<strong>der</strong>ung durch die Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> für alle Menschenbesteht, die entwe<strong>der</strong> selbst (als PatientInnen) o<strong>der</strong> auch stellvertretend (alsAngehörige o<strong>der</strong> als Professionelle) vom <strong>Sterben</strong> berührt werden. Personengruppen<strong>und</strong>Rollene<strong>in</strong>teilungen ersche<strong>in</strong>en mir (auch auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage des dieser Arbeitzugr<strong>und</strong>e liegenden Datenmaterials) dabei weniger wichtig als weith<strong>in</strong> angenommen.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 23Menschen, die sterben, <strong>und</strong> die Menschen, die eng <strong>mit</strong> ihnen <strong>in</strong> Kontakt stehen, s<strong>in</strong>dbetroffen von den Gegebenheiten, die e<strong>in</strong>e Sterbekrise ausmachen: die Frage nachdem Scheitern des Körpers, die Frage nach <strong>der</strong> Zerbrechlichkeit e<strong>in</strong>es Menschenlebens,die Frage nach <strong>der</strong> Unvermeidbarkeit des Leidens, die Frage nach<strong>Begegnung</strong> <strong>und</strong> Verlust <strong>und</strong> letztendlich die große Frage nach dem S<strong>in</strong>n. Dies selbsto<strong>der</strong> stellvertretend zu erleben, löst bei den Menschen Prozesse aus, die ähnlicherersche<strong>in</strong>en, als gedacht. Daher ist anzunehmen, dass Bedürfnisse, die <strong>in</strong> o<strong>der</strong> ausdiesem Raum entstehen, ähnlicher s<strong>in</strong>d, als weith<strong>in</strong> angenommen.Allerd<strong>in</strong>gs können Erkenntnisse, die im Bereich von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> gewonnenwerden, nicht beliebig auf verschiedene Bevölkerungs- <strong>und</strong> Personengruppenübertragen werden. So s<strong>in</strong>d beispielsweise Modelle zu E<strong>in</strong>stellungen gegenüber<strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>, die anhand von Befragungen <strong>der</strong> Normalbevölkerung gewonnenwurden (vgl. Wittkowski et al., 2004), nicht ohne weiteres übertragbar auf Menschen,die professionell <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung tätig s<strong>in</strong>d (vgl. dazu auch Seibert,Ochsmann, Feith & Kle<strong>in</strong>, 2001a). Denn erwartungsgemäß zeigt sich <strong>in</strong> <strong>der</strong>Normalbevölkerung die Angst als die dom<strong>in</strong>ante E<strong>in</strong>stellungskomponente, wasjedoch bei Menschen, <strong>der</strong>en Arbeitsalltag <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den <strong>und</strong> dem<strong>Tod</strong> besteht, <strong>in</strong> den meisten Fällen nicht <strong>der</strong> Fall ist (vgl. dazu auch Flammer, 1996;Grob, 1997; Schlömer-Doll & Schlömer-Doll, 1996; Tausch, D., 1987; Tausch, R. &Tausch, 1985). Dies trifft ebenso zu, wenn die Struktur von E<strong>in</strong>stellungen zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><strong>Sterben</strong>, die bei alten Menschen erfragt wurde, generell auf <strong>Sterben</strong>de ohneBeachtung des Lebensalters übertragen wird. Wittkowski (2005) äußert sich dazu:„Möglicherweise haben alte Menschen als Folge des ausgiebigen Nachdenkens über die<strong>Tod</strong>esthematik <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>ener Bewertungsprozesse e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Struktur <strong>der</strong>entsprechenden E<strong>in</strong>stellungen.“ (Wittkowski, 2005, 76)E<strong>in</strong> differenzierter Blick auf die gr<strong>und</strong>legende Natur <strong>der</strong> betreffenden Personengruppeist <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht notwendig.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 24Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität im Lebensverlauf <strong>und</strong> im SterbeprozessEng verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> Belastung, Beanspruchung <strong>und</strong> Bedürfnissen s<strong>in</strong>d dieBegrifflichkeiten von Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität. Auch hier stellt sich dieFrage, ob die Lebensqualität bzw. das Wohlbef<strong>in</strong>den im Sterbeprozess sich qualitativunterscheidet von an<strong>der</strong>en Zeitpunkten im Lebensverlauf.Wohlbef<strong>in</strong>den ist als e<strong>in</strong> re<strong>in</strong> subjektives Maß def<strong>in</strong>iert, denn nur <strong>der</strong> befragte Menschkann darüber Auskunft geben, ob <strong>und</strong> wie wohl er sich im Moment bzw. <strong>in</strong> se<strong>in</strong>emLeben fühlt:„Unter dem Begriff des Wohlbef<strong>in</strong>dens werden sowohl angenehme psychische <strong>und</strong>physische Empf<strong>in</strong>dungen als auch positive Bewertungen des eigenen Lebens <strong>und</strong>e<strong>in</strong>zelner Lebensbereiche zusammengefasst. Im Allgeme<strong>in</strong>en wird zwischen dem aktuellerlebten Wohlbef<strong>in</strong>den („state“) <strong>und</strong> dem (situationsübergreifenden) habituellenWohlbef<strong>in</strong>den („trait“) unterschieden.“ (Eid & Diener, 2002, 634)E<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrativen Ansatz zur Modellbildung von Wohlbef<strong>in</strong>den bietet Ryff (1995) an.Aus verschiedenen psychologischen Theorien (Maslow, Jung, Jahoda, Birren,Erikson, Bühler, Neugarten, Allport, Rogers) extrahiert sie die folgendenDimensionen des Wohlbef<strong>in</strong>dens: „self-acceptance, positive relations with otherpeople, autonomy, environmental mastery, purpose <strong>in</strong> life, personal growth“.Das Konzept <strong>der</strong> Lebensqualität be<strong>in</strong>haltet nun Versuche, verschiedene äußere <strong>und</strong><strong>in</strong>nere Faktoren zu def<strong>in</strong>ieren, die zur Qualität des Lebens e<strong>in</strong>es Menschen beitragen(vgl. bspw. Bellebaum, 1994). Es ist offensichtlich, dass die Vermischung objektiverLebensumstände <strong>und</strong> subjektiver Wahrnehmungen zu Def<strong>in</strong>itionsschwierigkeitenführen muss:„Trotz <strong>der</strong> wachsenden Beliebtheit des Konstrukts Lebensqualität herrscht allerd<strong>in</strong>gsimmer noch Une<strong>in</strong>igkeit über se<strong>in</strong>e Def<strong>in</strong>ition. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong> komplexesten Lebensqualitätsdef<strong>in</strong>itionenliegt von <strong>der</strong> Arbeitsgruppe Lebensqualität <strong>der</strong> WHO vor. Sie def<strong>in</strong>iertLebensqualität als die subjektive Wahrnehmung e<strong>in</strong>er Person über ihre Stellung imLeben <strong>in</strong> Relation zur Kultur <strong>und</strong> den Wertsystemen, <strong>in</strong> denen sie lebt, <strong>und</strong> <strong>in</strong> Bezug aufihre Ziele, Erwartungen, Maßstäbe <strong>und</strong> Anliegen. Es handelt sich um e<strong>in</strong> breites Konzept,das <strong>in</strong> komplexer Weise bee<strong>in</strong>flusst wird durch die körperliche Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>er Person,den psychischen Zustand, die sozialen Beziehungen, die persönlichen Überzeugungen<strong>und</strong> ihre Stellung zu den hervorstechenden Eigenschaften <strong>der</strong> Umwelt. (WHO, 1997)“(Böhmer, 2002, 349)Je breiter <strong>und</strong> umfassen<strong>der</strong> die Def<strong>in</strong>ition von Lebensqualität gewählt wird (wie z.B.diejenige <strong>der</strong> WHO), desto schwieriger ist ihre Anwendung auf den spezifischen
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 25E<strong>in</strong>zelfall. Birnbacher (1979; zit. n. Krischke, 1996) unterscheidet deshalb zwischenidealtypischer, normativer Lebensqualität <strong>und</strong> <strong>in</strong>dividueller, faktischer Lebensqualität:„E<strong>in</strong> normativer Begriff <strong>der</strong> Lebensqualität bezieht sich, je nach Menschenbild o<strong>der</strong>Weltanschauung, auf e<strong>in</strong>en idealtypischen Zustand des Lebens. Der faktische Begriff vonLebensqualität bezieht sich auf die <strong>in</strong>dividuelle Situation <strong>und</strong> berücksichtigt diebestehenden o<strong>der</strong> verbliebenen Möglichkeiten zur Realisierung e<strong>in</strong>es idealtypischenLebens.“ (Krischke, 1996, 52)E<strong>in</strong>e weitere Möglichkeit <strong>der</strong> Spezifizierung des breiten Lebensqualitätsbegriffsbesteht dar<strong>in</strong>, ihn auf bestimmte Lebensbereiche zu beziehen. E<strong>in</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong>Psychologie bedeutsame Spezifizierung besteht <strong>in</strong> <strong>der</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenenLebensqualität, die die physische <strong>und</strong> psychische Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong>den Mittelpunkt <strong>der</strong> Frage nach se<strong>in</strong>er Lebensqualität stellt. Allerd<strong>in</strong>gs muss, wieoben bereits erläutert, wie<strong>der</strong>um das Gewicht auf <strong>der</strong> subjektiven E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong>Person liegen:„Die For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>heitlichen Konzept <strong>der</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenenLebensqualität im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>gültigen Def<strong>in</strong>ition wi<strong>der</strong>spricht <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>edem subjektiven Charakter des Lebensqualitätsansatzes. Nach Lerner (1973) ist auchGes<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>e qualitative Größe, die nicht direkt beobachtet o<strong>der</strong> gemessen werdenkann. Die gr<strong>und</strong>legende Frage <strong>der</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Lebensqualitätsforschungheißt ja: Was gibt me<strong>in</strong>em Leben Qualität? Die Antwort kann nur höchst <strong>in</strong>dividuell <strong>und</strong>nicht vergleichbar se<strong>in</strong>. Daher wird ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualitätsforschung auchzumeist als Outcome-Kriterium benutzt.“ (Krischke, 1996, 55f.)E<strong>in</strong>e wichtige E<strong>in</strong>schränkung betrifft die Differenzierung zwischen Lebensqualität <strong>und</strong>Qualität des Sterbeprozesses, denn: “Lebensqualität ist nicht dasselbe wie Qualitätdes Sterbeprozesses“ (Wilken<strong>in</strong>g & Mart<strong>in</strong>, 2003, 336). Im Sterbeprozess treten fürden sterbenden Menschen bestimmte Faktoren <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>, während an<strong>der</strong>eFaktoren, die für e<strong>in</strong>en ges<strong>und</strong>en Menschen stark zum Wohlbef<strong>in</strong>den beitragen, fürden <strong>Sterben</strong>den <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> treten (vgl. Herrle<strong>in</strong>, 2003).Entsprechende Studien, die Schwerkranke, Angehörige <strong>und</strong> Personen aus demprofessionellen Versorgungsnetz nach den Konditionen e<strong>in</strong>es guten <strong>Sterben</strong>sbefragten (Ste<strong>in</strong>hauser et al., 2000; S<strong>in</strong>ger et al, 1999), kamen auf folgende,prävalente Aspekte von Lebensqualität im Sterbeprozess: Schmerzkontrolle, Klarheit<strong>der</strong> Entscheidungsprozesse, Vorbereitungsmöglichkeiten auf das <strong>Sterben</strong>,Abschließen verschiedener Prozesse, das Gefühl, noch etwas geben zu können,ganzheitliche Akzeptanz <strong>der</strong> Person. Diese Gesichtspunkte f<strong>in</strong>den sich nicht <strong>in</strong>
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 26gängigen Aspekten <strong>der</strong> Lebensqualität. S<strong>in</strong>ger et al. (1999) fanden darüber h<strong>in</strong>ausdas Bedürfnis, an<strong>der</strong>en ke<strong>in</strong>e Last se<strong>in</strong> zu wollen sowie die Betonung <strong>der</strong>Beziehungen zu nahe stehenden Menschen als Aspekte <strong>der</strong> Qualität imSterbeprozess.Beim Großteil thantologischer Forschung wird allerd<strong>in</strong>gs nach wie vor die Def<strong>in</strong>itionvon Lebensqualität bei term<strong>in</strong>al erkrankten Menschen von theoriegeleiteterÜbertragung <strong>der</strong> Lebensqualitätskonzepte aus an<strong>der</strong>en Bereichen bestimmt, ohnedass e<strong>in</strong>e wirkliche F<strong>und</strong>ierung o<strong>der</strong> Überprüfung im Feld vorliegen würde:„Although several <strong>in</strong>struments have been developed to measure the quality of life (QOL)of palliative care patients, a rigorous research study has not specifically asked patientsthemselves what is important to their QOL. It is, therefore, not clear whether these<strong>in</strong>struments measure what is most important to these patients’ QOL.“ (Cohen & Leis,2002, 48)Solange ke<strong>in</strong>e passenden Instrumente zur Messung <strong>der</strong> Lebensqualität bei kritischkranken <strong>und</strong> sterbenden PatientInnen vorliegen, empfiehlt es sich daher, auf das re<strong>in</strong>subjektiv basierte Maß des Wohlbef<strong>in</strong>dens zurückzugreifen.Parallelen <strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten von Lebens- <strong>und</strong> SterbekrisenZum Abschluss dieses Kapitels stellt sich noch e<strong>in</strong>mal die E<strong>in</strong>gangsfrage: Ist <strong>Sterben</strong>etwas an<strong>der</strong>es als Leben? Auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> bisherigen Fakten ist nun e<strong>in</strong>differenzierter Blick darauf möglich, ob <strong>und</strong> wie sich Sterbekrisen von Lebenskrisenunterscheiden. (E<strong>in</strong>e Bestimmung des Krisenbegriffs sowie e<strong>in</strong>e nähere Betrachtungdes Phänomens <strong>der</strong> Krise folgt <strong>in</strong> Kapitel 2.2. – Die Natur kritischer Lebensereignisse.)Allgeme<strong>in</strong> herrscht E<strong>in</strong>igkeit darüber, dass Krankheit, <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> die amschwersten zu bewältigenden Ereignisse im Lebensverlauf e<strong>in</strong>es Menschen s<strong>in</strong>d:„Krankheiten <strong>und</strong> operative E<strong>in</strong>griffe gehören für jeden Menschen <strong>in</strong> aller Regel zu dendramatischsten Lebensereignissen. Darüber h<strong>in</strong>aus teilt die Mediz<strong>in</strong> <strong>mit</strong> Psychologie <strong>und</strong>Theologie das Problem des <strong>Sterben</strong>s als „letzter Lebenskrise“ (Kastenbaum, 1975).“(Filipp, 1995, 4)
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 27So kann zunächst die Feststellung getroffen werden, dass das <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>krisenhaftes Lebensereignis darstellt, welches sich (quasi normativ) <strong>in</strong> denLebensverlauf e<strong>in</strong>es jeden Menschen e<strong>in</strong>fügt. Wittkowski (1990) empfiehltdah<strong>in</strong>gehend, „den Sterbeprozess als e<strong>in</strong>en Lebensabschnitt zu betrachten, <strong>der</strong>h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er psychischen Bearbeitungs- <strong>und</strong> Bewältigungsformen <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>enkrisenhaften Zeiten im Laufe e<strong>in</strong>es Menschenlebens gr<strong>und</strong>sätzlich vergleichbar ist“(Wittkowski, 1990, 126; zit. n. Mennemann, 1998, 147; zu weiteren Ausführungendarüber, wie das <strong>Sterben</strong> als Life-Event <strong>und</strong> Lebenskrise betrachtet werden kann,siehe Mennemann, 1998).Auch Wilken<strong>in</strong>g & Mart<strong>in</strong> (2003) kritisieren da<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>hergehend, dass <strong>der</strong> Kont<strong>in</strong>uitätdes Lebens bis zum <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Konzeptualisierung zu wenigRechnung getragen werde <strong>und</strong> vielerorts für das <strong>Sterben</strong> gr<strong>und</strong>los spezielle Theorienentwickelt würden:„Es ist zunächst nicht augensche<strong>in</strong>lich, warum theoretische Ansätze <strong>der</strong> Entwicklung überdie Lebensspanne (…), die für die Erklärung <strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung <strong>mit</strong> Anfor<strong>der</strong>ungenbestimmter Lebensabschnitte o<strong>der</strong> <strong>mit</strong> Verlusten <strong>und</strong> Belastungen konzipiert wurden, fürdas Lebensende ke<strong>in</strong>e Gültigkeit haben sollten. Lediglich unter <strong>der</strong> Annahme, dass essich beim Sterbeprozess um vom sonstigen Lebensvollzug unabhängige Verän<strong>der</strong>ungsprozessehandelt, wäre e<strong>in</strong>e solche Annahme gerechtfertigt.“ (Wilken<strong>in</strong>g & Mart<strong>in</strong>, 2003,224)Corr, Nabe & Corr (2003) konstatieren <strong>in</strong> diesem Zusammenhang po<strong>in</strong>tiert: “Dy<strong>in</strong>gpersons are liv<strong>in</strong>g human be<strong>in</strong>gs, and they cont<strong>in</strong>ue to be liv<strong>in</strong>g persons as long asthey are dy<strong>in</strong>g.“ (Corr et al., 2003, 127)Es lässt sich daher zunächst festhalten, dass Ähnlichkeiten zwischen Lebens- <strong>und</strong>Sterbekrisen bestehen. Dies zeigt auch Ritter-Gekeler (1992) <strong>in</strong> ihrer Untersuchungzum Erleben von Lebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen auf, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sich durchaus Parallelen imErleben e<strong>in</strong>er lebensbedrohlichen Erkrankung <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en schweren Lebenskrisenzeigen:„Zusammenfassend ergeben sich tatsächlich H<strong>in</strong>weise auf e<strong>in</strong>e ganze Reihe ähnlicherProbleme <strong>in</strong> Lebenskrisen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Krise angesichts <strong>der</strong> akuten Lebensbedrohung durchdie Erkrankung an Krebs. Insgesamt sche<strong>in</strong>en sie <strong>in</strong> Lebenskrisen aber <strong>in</strong> mil<strong>der</strong>er Formaufzutreten <strong>und</strong> nur e<strong>in</strong>zelne Lebensbereiche zu erfassen.“ (Ritter-Gekeler, 1992)Allerd<strong>in</strong>gs f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> ihrer Untersuchung (wie auch im Verlauf des bisherigenKapitels deutlich wurde) neben den Ähnlichkeiten zwischen Lebens- <strong>und</strong>
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 28Sterbekrisen <strong>in</strong> ihrer Untersuchung auch Spezifika <strong>der</strong> Sterbekrise. Beides wird <strong>in</strong>Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt:Ähnlichkeiten von Lebens- <strong>und</strong>Sterbekrisen• E<strong>in</strong>schnitt im Leben• Emotionale Betroffenheit• Bedrohung/Infragestellung von Zukunftsperspektiven• Gefühl von Kontrollverlust/Ausgeliefertse<strong>in</strong>• E<strong>in</strong>engung des Denkens <strong>und</strong>Handelns auf das Problem• Unzureichendes Verstehen für dieUrsache <strong>der</strong> Krise• SchuldgefühleBeson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Sterbekrise• Gefährliche <strong>Tod</strong>esbedrohung• Körperliche Bedrohung• Autonomieverlust• Aufenthalt <strong>in</strong> Krankenhäusern,Patientenrolle, sozialer <strong>Tod</strong>• Gesellschaftliche Verdrängung des<strong>in</strong>dividuellen <strong>Tod</strong>es• Scheu über das <strong>Sterben</strong> zu sprechen,weil man die an<strong>der</strong>en nicht beunruhigenwill• Erleben <strong>der</strong> Endlichkeit des Se<strong>in</strong>s• Drohende o<strong>der</strong> reale Verluste• <strong>Soziale</strong> IsolationTabelle 1: Ähnlichkeiten <strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten von Sterbekrisen <strong>und</strong> Lebenskrisen (nach Ritter-Gekeler,1992)Die Ergebnisse von Ritter-Gekeler (1992) spiegeln den Kenntnisstand zu Lebens<strong>und</strong>Sterbekrisen wie<strong>der</strong>:Die Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> ist <strong>in</strong>sofern vergleichbar <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Krisen <strong>und</strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen im Leben e<strong>in</strong>es Menschen, als e<strong>in</strong> Mensch an den Rand se<strong>in</strong>erbisherigen Möglichkeiten stößt. Das Bisherige trägt nicht mehr <strong>und</strong> ist bedroht. Esmuss etwas Neues (z.B. neue Sichtweisen, neue Verhaltensweisen) entstehen.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 30Ähnlich wie bei Beanspruchung <strong>und</strong> Bedürfnissen ist es auch bei Wohlbef<strong>in</strong>den bzw.Lebensqualität schwierig, Def<strong>in</strong>itionen für den Lebensverlauf vom Sterbeprozessabzugrenzen. Es ist jedoch deutlich, dass im Sterbeprozess spezifische Aspekte fürLebensqualität <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> treten. Konzeptualisierungenfür die Lebensqualität sterben<strong>der</strong> PatientInnen bestehen bislang nicht.Es lassen sich Parallelen zwischen <strong>der</strong> Krise durch den drohenden <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> an<strong>der</strong>enKrisen im Lebensverlauf ausmachen, aber auch Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Sterbekrisefesthalten (Ritter-Gekeler, 1992): Die Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> ist <strong>in</strong>sofernvergleichbar <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Krisen <strong>und</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen im Leben e<strong>in</strong>es Menschen,als e<strong>in</strong> Mensch an den Rand se<strong>in</strong>er bisherigen Möglichkeiten stößt. Das Bisherigeträgt nicht mehr <strong>und</strong> ist bedroht. Es muss etwas Neues (z.B. neue Sichtweisen, neueVerhaltensweisen) entstehen. Die E<strong>in</strong>zigartigkeit bzw. Beson<strong>der</strong>heit <strong>der</strong>Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> expliziten Bedrohung <strong>der</strong> Existenz. Daseigene Dase<strong>in</strong> wird als endlich <strong>und</strong> begrenzt erlebt, <strong>und</strong> Fragen nach dem S<strong>in</strong>n desDase<strong>in</strong>s brechen vermehrt auf.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 312.2. Die Natur kritischer LebensereignisseEs stellt sich nun die Frage, was aus <strong>der</strong> krisenhaften Situation <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong>dem <strong>Sterben</strong> erwächst: Scheitern o<strong>der</strong> Wachstum (vgl. Schmidt-Denter, 2005, 174)?So wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise Bedrohung <strong>und</strong> Gefahr liegen, birgt sie auch die Möglichkeit <strong>der</strong>Verän<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> des Wachstums zu Stärke <strong>und</strong> Stabilität:„Im Gegensatz zu <strong>der</strong> Auffassung, dass Krisen als destruktiv anzusehen s<strong>in</strong>d, betrachtenwir sie als Ausgangspunkt für Prozesse des Neuaufbaus <strong>und</strong> für weiteres Wachstum (vgl.Danish 1977). Wenn also Krisen sowohl positive wie auch negative Folgen nach sichziehen, so besteht das Ziel <strong>der</strong> Intervention nicht dar<strong>in</strong>, den E<strong>in</strong>tritt von Krisen zuverh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n vielmehr dar<strong>in</strong>, die Fähigkeiten e<strong>in</strong>er Person zum konstruktivenUmgang <strong>mit</strong> Krisenereignissen zu erhöhen <strong>und</strong> zu erweitern.“ (Danish & D'Augelli, 1995,158)In diesem Kapitel wird daher nach <strong>der</strong> def<strong>in</strong>itorischen Bestimmung von Krisen <strong>und</strong>kritischen Lebensereignissen erläutert, <strong>in</strong>wieweit e<strong>in</strong>e Krise sowohl e<strong>in</strong>eGrenzerfahrung als auch e<strong>in</strong>e Wachstumschance darstellt, um dann den Begriff <strong>der</strong>Resilienz näher zu beleuchten, <strong>der</strong> entscheidenden E<strong>in</strong>fluss darauf hat, ob e<strong>in</strong>e Kriseals stärkend o<strong>der</strong> schwächend erlebt wird. Resilienz wird ermöglicht durch denRückgriff auf <strong>Ressourcen</strong>, <strong>der</strong>en Konzepte abschließend im Überblick dargestelltwerden.Dies stellt e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrativen Betrachtungsansatz dar, denn <strong>in</strong> den Gebieten <strong>der</strong>Psychologie werden Krisen <strong>und</strong> kritische Lebensereignisse unter verschiedenenBetrachtungsw<strong>in</strong>keln analysiert (Horlacher, 2000). So betrachten die kl<strong>in</strong>ischpsychologischewie auch die ges<strong>und</strong>heitspsychologische Perspektive schwerpunktmäßigdie Zusammenhänge zwischen Lebensereignissen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Entstehung sowieAufrechterhaltung von Störungen. In <strong>der</strong> entwicklungspsychologischen Perspektivewerden kritische Lebensereignisse nicht mehr nur als krisen<strong>in</strong>duzierende Stressorenkonzeptualisiert, son<strong>der</strong>n sie be<strong>in</strong>halten bei adäquater Verarbeitung <strong>und</strong> Bewältigungauch die Chance e<strong>in</strong>es Entwicklungsanreizes, <strong>der</strong> e<strong>in</strong> persönliches Wachstum zurFolge haben kann. Und die sozialpsychologische <strong>und</strong> persönlichkeitspsychologischePerspektive schließlich arbeiten die Bedeutung von sozialen <strong>und</strong> personalen<strong>Ressourcen</strong> bei <strong>der</strong> Bewältigung von kritischen Lebensereignissen heraus. Dieseunterschiedlichen Blickw<strong>in</strong>kel werden im Folgenden <strong>in</strong>tegriert, <strong>in</strong>dem zunächst Krisen
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 32<strong>in</strong> ihrer Natur als Grenzereignisse, dann als Wachstumschance <strong>und</strong> schließlich <strong>in</strong>ihrer Beziehung zu <strong>Ressourcen</strong> betrachtet werden.Krisen <strong>und</strong> kritische LebensereignisseIn <strong>der</strong> Bewältigungsforschung wurde <strong>der</strong> Begriff des kritischen Lebensereignisses(‚Critical Life Event’) <strong>in</strong> Abgrenzung zu regulären, normativen Krisen (vgl. Schmidt-Denter, 2005, 8) im Lebensverlauf geprägt:„Lebenskrisen heißen so, weil es sich um gestörte <strong>Begegnung</strong>en <strong>mit</strong> dem Leben handelt.Sie berichten vom Mangel an <strong>Ressourcen</strong>, vom Verlust e<strong>in</strong>er Balance, vom fehlendenAustausch, vom Funktionsverlust, von <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>seitigung <strong>der</strong> polaren Kräfte, vomAusweichen, von <strong>der</strong> Flucht, vom Verlust <strong>der</strong> ‚subjektiven Wahrheit’.“ (Keil, A., 2006, 50f.)„Kritische Lebensereignisse gelten als spezielle Erfahrungstypen, da sie an<strong>der</strong>s als„normale“ altersgeb<strong>und</strong>ene Übergänge (z.B. E<strong>in</strong>schulung, Pubertät) nonnormativer Naturs<strong>in</strong>d <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reihe von Beson<strong>der</strong>heiten aufweisen, die sie von ersteren unterscheiden.“(Filipp, 2002, 345)E<strong>in</strong> kritisches Lebensereignis ist im Speziellen dadurch gekennzeichnet, dass esunerwartet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em normativen Lebensverlauf auftaucht <strong>und</strong> diesen aus <strong>der</strong>antizipierten Bahn zu werfen droht (z.B. Broken-Home-Konstellation durch Scheidung<strong>der</strong> Eltern, Arbeitsplatzverlust, Lottogew<strong>in</strong>n, früher <strong>Tod</strong> des Lebenspartners o<strong>der</strong>e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des, etc.). Merkmale kritischer Lebensereignisse s<strong>in</strong>d folglich großeLebensverän<strong>der</strong>ung, hoher Wirkungsgrad, hohe affektive Bedeutung, Unkontrollierbarkeit,Zielblockade, Unvorhersehbarkeit sowie Off-Time-Auftreten (Auftretenaußerhalb <strong>der</strong> durch die biologische <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> soziale Uhr def<strong>in</strong>ierten Zeiträume)(Filipp, 2002). Je mehr dieser Merkmale auf e<strong>in</strong> Ereignis zutreffen, desto höher ist dieGefahr, dass das Ereignis krisen<strong>in</strong>duzierenden Charakter besitzt. Schmidt-Denter(2005, 174) spricht <strong>in</strong> diesem Zusammenhang von <strong>der</strong> „raumzeitlich punktuellenVerdichtung e<strong>in</strong>es Geschehensablaufs“, <strong>der</strong> das Individuum aus dem Gleichgewichtbr<strong>in</strong>gt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e neue Ausbalancierung erfor<strong>der</strong>t.Im S<strong>in</strong>ne dieser Kriterien ist es e<strong>in</strong> verkürzter Ansatz <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e zu starke, vonObjektivierung getragene Vere<strong>in</strong>fachung, e<strong>in</strong>en äußeren Ereignistyp (z.B. Krankheit,Scheidung, etc.) als e<strong>in</strong> kritisches Lebensereignis zu def<strong>in</strong>ieren (vgl. auch Hultsch &Cornelius, 1995). E<strong>in</strong>e differenzierte Betrachtung (z.B. durch Befragung <strong>der</strong>
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 33Betroffenen nach ihrer subjektiven Wahrnehmung des objektiven Geschehens) isthier gefragt. Dann kann auch die Pseudo-Objektivierung von normativen versus nonnormativenLebensereignissen an <strong>der</strong> subjektiven E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> betroffenenPerson überprüft werden, denn es ist zu h<strong>in</strong>terfragen, was normativ ist: NormativeLebensereignisse können für e<strong>in</strong>e Person subjektiv kritisch se<strong>in</strong> (z.B. schwereKrankheitserfahrung <strong>in</strong> höherem Alter) <strong>und</strong> non-normative Ereignisse können imGegensatz dazu gut bewältigbar se<strong>in</strong> (z.B. Scheidung <strong>der</strong> Eltern während <strong>der</strong>K<strong>in</strong>dheit). So kommt auch Horlacher (2000, 455) zu dem Schluss, dass es überausschwierig ist zu def<strong>in</strong>ieren, wann e<strong>in</strong> Lebensereignis als kritisch aufzufassen ist.(E<strong>in</strong>e differenzierte Analyse dieser Frage f<strong>in</strong>det sich bei Horlacher, 2000; Hultsch &Cornelius, 1995).E<strong>in</strong>e genaue Betrachtung von kritischen Lebensereignissen zeigt zudem, dass sieweniger e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>grenzbares Ereignis als e<strong>in</strong>en komplexen Prozess darstellen:„E<strong>in</strong>e schwere körperliche Erkrankung wie Krebs, Herz<strong>in</strong>farkt o<strong>der</strong> Multiple Sklerose wirdvon <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> betroffenen Menschen nicht als e<strong>in</strong> s<strong>in</strong>guläres Belastungsereigniserlebt, son<strong>der</strong>n als e<strong>in</strong>e Kette bedrohlicher Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> zentralenLebensbereichen.“ (Freudenberg & Filipp, 1998, 14)So kann festgehalten werden, dass kritische Lebensereignisse schwer <strong>in</strong> objektiverWeise zu def<strong>in</strong>ieren s<strong>in</strong>d. Sie führen <strong>in</strong> jedem Fall zu e<strong>in</strong>em relativen Ungleichgewicht<strong>in</strong> dem bis dato aufgebauten Passungsgefüge zwischen Person <strong>und</strong> Umwelt,wobei die Quellen des Ungleichgewichts als das kritische Lebensereignis bezeichnetwerden, obwohl sie sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> Person als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Umwelt liegen können(Horlacher, 2000, 455). Um das erlebte Ungleichgewicht wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Gleichgewichtzu überführen, s<strong>in</strong>d Anpassungsleistungen notwendig, die dann den Rückgriff auf<strong>Ressourcen</strong> erfor<strong>der</strong>n.Krise als GrenzerfahrungZunächst ist festzuhalten, dass dem Begriff <strong>der</strong> Krise die Grenze als <strong>in</strong>härentesCharakteristikum bereits <strong>in</strong>newohnt. Denn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Situation, die für e<strong>in</strong>en Menschene<strong>in</strong>e Krise darstellt, stößt er an die Grenzen se<strong>in</strong>er bisherigen Verhaltens- <strong>und</strong>Problemlösemöglichkeiten:
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 34„In Zusammenfassung <strong>der</strong> empirischen Bef<strong>und</strong>lage lässt sich sagen, dass Menschen andie Grenzen ihrer Bewältigung stoßen, wenn sie <strong>mit</strong> negativen, unvorhersehbaren,unkontrollierbaren, mehrdeutigen <strong>und</strong> überwältigenden Ereignissen konfrontiert werden,die zugleich wichtige Lebens<strong>in</strong>halte <strong>und</strong> Lebensziele gefährden.“ (Jerusalem, 1997, 261)In solchen Situationen s<strong>in</strong>d Menschen sogenannten Grenzerfahrungen ausgesetzt.Jaspers (1932) beschreibt <strong>Tod</strong>, Schuld, Leiden, Zufall <strong>und</strong> Kampf als die zentralenGrenzsituationen des Menschen <strong>und</strong> argumentiert, dass diese Situationen zentraleThemen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Selbst- <strong>und</strong> Weltreflexion des Menschen darstellen (vgl. Staud<strong>in</strong>ger,1997, 248), denn <strong>in</strong> diesen Situationen erfährt er das Scheitern se<strong>in</strong>er Kontrollmöglichkeiten.E<strong>in</strong>e Verän<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> Überw<strong>in</strong>dung dieser Situation nach <strong>der</strong>Maßgabe se<strong>in</strong>er bisherigen Möglichkeiten <strong>und</strong> Muster ist plötzlich unmöglich. An dasEnde <strong>der</strong> bisherigen Verhaltensmöglichkeiten gekommen, kann diese belastendeSituation nicht durch gewohnte <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> Strategien <strong>in</strong> die personale Kontrollegebracht werden, son<strong>der</strong>n es geht darum, sich <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Situation auf e<strong>in</strong>enVerän<strong>der</strong>ungsprozess e<strong>in</strong>zulassen:„Leben unterliegt dem Gesetz <strong>der</strong> Vergänglichkeit <strong>und</strong> des Wandels. Wer die da<strong>mit</strong>verb<strong>und</strong>enen Verän<strong>der</strong>ungen nicht annimmt, kommt aus <strong>der</strong> Balance <strong>und</strong> wir dies alsDisharmonie <strong>und</strong> Stagnation spüren.“ (Keil, A., 2006, 26)„In <strong>der</strong> Transition wird durch das Vergehen des Alten etwas Neues – e<strong>in</strong>e Vorstellung, diedie Psychologie <strong>der</strong> Kontrolle kaum denken kann. (…) Nicht möglichst effiziente <strong>und</strong>schon gar nicht rasche Adaptation wird hier gefor<strong>der</strong>t, son<strong>der</strong>n zunächst e<strong>in</strong>mal dieganze Erfahrung <strong>der</strong> Beendigung e<strong>in</strong>er Periode, <strong>in</strong> <strong>der</strong> man gut e<strong>in</strong>gerichtet war <strong>und</strong> <strong>in</strong><strong>der</strong> man wohladaptiert funktionerte. (…) Anstatt zu bewältigen gilt es, das radikal An<strong>der</strong>ezuzulassen. Da<strong>mit</strong> ist dann nicht Vernichtung verb<strong>und</strong>en, son<strong>der</strong>n Wandel.“ (Olbrich,1997, 236f.)Kritische Lebensereignisse stellen also für den Menschen Grenzerfahrungen dar, dasie ihn <strong>mit</strong> den Grenzen se<strong>in</strong>er bisherigen Lebens- <strong>und</strong> Problemlösefähigkeitenkonfrontieren. Die Situation, <strong>der</strong> er sich nun gegenüber sieht, ist nicht <strong>mit</strong> dengewohnten Kontroll- <strong>und</strong> Bewältigungsmechanismen lösbar. In <strong>der</strong> Erfahrung <strong>der</strong>Grenze muss das Bisherige aufgegeben werden, da<strong>mit</strong> neue Möglichkeitenentstehen können. (Ähnliches beschreibt van Gennep, (Gennep, 1960) <strong>in</strong> se<strong>in</strong>emklassischen Modell <strong>der</strong> ‚Rites of Passage’.) Dieser Wandel jedoch ist nichtkontrollierbar <strong>und</strong> auch nicht erfolgsorientiert herbeiführbar – hier<strong>in</strong> liegt die Gefahrdes Scheiterns.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 35Krise als WachstumschanceIn e<strong>in</strong>em <strong>der</strong>art kritischen Lebensereignis jedoch nicht nur e<strong>in</strong>e Bedrohung desBestehenden, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>e Chance auf Neuentwicklung zu sehen, erfor<strong>der</strong>t dieVerlagerung des Blickw<strong>in</strong>kels weg von e<strong>in</strong>em pathogenetischen h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>emsalutogenetischen Modell. Im Zentrum salutogenetischen Denkens steht dieAuflösung <strong>der</strong> Dichotomie zwischen Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Krankheit zugunsten e<strong>in</strong>esfließenden Kont<strong>in</strong>uums zwischen beiden (vgl. Keil, A., 2004, 75ff.), <strong>und</strong> es steht dieFrage, warum <strong>und</strong> wie Menschen ges<strong>und</strong> bleiben (vgl. B<strong>und</strong>eszentrale fürges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung, 2001). Welche Faktoren s<strong>in</strong>d daran beteiligt, die Positiondes Menschen auf dem Kont<strong>in</strong>uum zwischen Scheitern <strong>und</strong> Wachstum zu erhalteno<strong>der</strong> sie <strong>in</strong> Richtung des ges<strong>und</strong>en Pols zu bewegen? Antonovsky (1979, 1997), <strong>der</strong>Begrün<strong>der</strong> des Begriffs <strong>der</strong> Salutogenese, beschreibt diese radikale Verlagerung desBlickw<strong>in</strong>kels folgen<strong>der</strong>maßen:„At the core of the pathogenic paradigm, <strong>in</strong> theory and <strong>in</strong> action, is a dichotomousclassification of persons as be<strong>in</strong>g diseased or healthy. Our l<strong>in</strong>guistic apparatus, ourcommon sense th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g, and our daily behaviour reflect this dichotomy. It is also theconceptual basis for the work of health care and disease care professionals and<strong>in</strong>stitutions <strong>in</strong> Western societies. Consi<strong>der</strong>ation of the problem of the orig<strong>in</strong>s of health,however, leads us to face the question of whether the dichotomous approach is adequateor whether it may not be imperative to formulate a different conceptualisation of health.”(Antonovsky, 1979, 39)Anstatt den Blick auf die Bedrohung zu richten, kann er also auch auf das gerichtetwerden, was Menschen <strong>in</strong> Grenzsituationen hilft, ges<strong>und</strong> <strong>und</strong> gestärkt aus ihnenhervor zu gehen (<strong>in</strong>dem sie bspw. als Möglichkeit <strong>der</strong> Neuorientierung <strong>und</strong> <strong>der</strong>Entscheidung für neue Lebensziele genutzt werden kann).Beson<strong>der</strong>s für die Grenzsituation von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> kann e<strong>in</strong> salutogenetischerBlickw<strong>in</strong>kel hilfreich se<strong>in</strong> (vgl. auch Marrone, 1999). Denn das salutogenetischeParadigma macht es möglich, den <strong>Tod</strong> <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>zubeziehen. Im pathogenetischenParadigma geht es um die Beseitigung von Krankheit <strong>und</strong> Leid; <strong>der</strong> <strong>Tod</strong> stellt <strong>in</strong>diesem Blickw<strong>in</strong>kel das ultimative Scheitern dar. An<strong>der</strong>s zeigt sich die Situation,wenn <strong>der</strong> Blickw<strong>in</strong>kel geweitet wird:„Im salutogenetischen Modell jedoch wird nicht nur akzeptiert, dass niemand von unstrockenen Fußes am Ufer des Lebensflusses stehen bleiben kann, son<strong>der</strong>n auch, dasswir alle im Fluss s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>mit</strong> ihm ans Ende kommen. Der <strong>Tod</strong> ist da<strong>mit</strong> nicht letztesVersagen von Reparaturmöglichkeiten, son<strong>der</strong>n Bestandteil des Lebens. Ich glaube, eskann lohnend se<strong>in</strong>, salutogenetische Gedanken auch <strong>in</strong> die <strong>der</strong>zeit aktuelle Diskussionen
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 36um neue Sterbehilferichtl<strong>in</strong>ien, Bioethikkonvention <strong>und</strong> Transplantationsgesetzgebunge<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.“ (Franke, 1997, 190)Das salutogenetische Paradigma stellt so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>en Blickw<strong>in</strong>kel dar, <strong>der</strong> <strong>in</strong>direkt dieAkzeptanz von Krankheitsprozessen för<strong>der</strong>t, <strong>und</strong> es bietet nach Franke (1997)zum<strong>in</strong>dest die Möglichkeit, <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> als unverän<strong>der</strong>liche Bestandteile desLebens zu <strong>in</strong>tegrieren (vgl. auch B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung,2001, 97).Krise <strong>und</strong> ResilienzKann man beschreiben, was es e<strong>in</strong>em Menschen ermöglicht, bisherige Grenzen zuüberschreiten, sich neuen Situationen anzupassen – kurz gesagt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise dieChance des Wandels <strong>und</strong> des Wachstums zu ergreifen?In <strong>der</strong> Psychologie wird dazu das Konzept <strong>der</strong> Resilienz (bzw. psychologischeWi<strong>der</strong>standsfähigkeit, Invulnerabilität; vgl. B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitlicheAufklärung, 2001, 63f.) verwendet. Resilienz ist die Möglichkeit, trotz vorliegen<strong>der</strong>Risikofaktoren (<strong>mit</strong> Hilfe protektiver Faktoren) zum e<strong>in</strong>en negative Konsequenzen zuvermeiden o<strong>der</strong> auch zum an<strong>der</strong>en normales Funktionieren nach Rückschlägenwie<strong>der</strong>herzustellen (B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung, 2001, 63;Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001, 98). Staud<strong>in</strong>ger et al. fügen noch e<strong>in</strong>e dritte Form <strong>der</strong>Resilienz an, die große Bedeutung im Alter hat: Verlustmanagement (Staud<strong>in</strong>ger,Marsiske & Baltes, 1995). Da<strong>mit</strong> bezeichnen sie den erfolgreichen Umgang <strong>mit</strong>altersbed<strong>in</strong>gten Verlusterfahrungen (z.B. körperliche Fähigkeiten, soziale Funktionen,geistige Kapazitäten, etc.).Üblicherweise werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Resilienzforschung nicht-normative Entwicklungsbee<strong>in</strong>trächtigungenals kritische Lebensereignisse zugr<strong>und</strong>e gelegt. Es wird zwischendiesen nicht-normativen Entwicklungsbee<strong>in</strong>trächtigungen (z.B. Scheidung <strong>der</strong> Eltern,schwere Krankheit im frühen Alter, etc.), die durch Resilienz erfolgreich überw<strong>und</strong>enwerden, <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en normativen Entwicklungskrisen (z.B. Adoleszenzkrise,Erkrankung im hohen Alter) unterschieden, welche im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Resilienzforschungnormative Entwicklungsbed<strong>in</strong>gungen darstellen <strong>und</strong> <strong>mit</strong> Resilienz als herausragen<strong>der</strong>
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 37Eigenschaft nichts zu tun hätten. Allerd<strong>in</strong>gs ist diese Trennung objektiver <strong>und</strong> daherkünstlicher Natur <strong>und</strong> diese Gruppen können daher nicht disjunkt se<strong>in</strong>. So stelltStaud<strong>in</strong>ger fest: “Im höheren Erwachsenenalter treten normative <strong>und</strong> nicht-normativeBee<strong>in</strong>trächtigungen sehr nahe ane<strong>in</strong>an<strong>der</strong> heran.“ (Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001, 103)Es kann daher durchaus h<strong>in</strong>terfragt werden, ob die Trennung zwischen normativenEntwicklungskrisen <strong>und</strong> nicht-normativen Entwicklungsbee<strong>in</strong>trächtigungen samt denda<strong>mit</strong> unterstellten, unterschiedlichen Bedeutungen für Resilienz s<strong>in</strong>nvoll ist (siehedazu auch die Ausführungen <strong>in</strong> Kapitel 2.1. – Parallelen <strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten vonLebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen).Es gibt zwei Gr<strong>und</strong>konzeptionen <strong>der</strong> Resilienz: Sie kann als Personenmerkmalgesehen werden (z.B. <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> Kohärenzs<strong>in</strong>n, Kontrolle, Ego-Resilienz)o<strong>der</strong> als e<strong>in</strong>e Person-Umwelt-Konstellation (relationaler Resilienzbegriff). DieSichtweise von Resilienz als re<strong>in</strong>e Persönlichkeitseigenschaft steht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kritik,e<strong>in</strong>seitig stark an aktionalen Konzepten orientiert zu se<strong>in</strong> (Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001,101). Im relationalen S<strong>in</strong>ne ist Resilienz dann vorhanden, wenn trotz e<strong>in</strong>esvorliegenden Risikos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Situation optimale Anpassung gel<strong>in</strong>gt.Dazu tragen <strong>in</strong> dieser Sichtweise sowohl Personenvariablen (z.B. Intelligenz,Selbstkonzept, Ziele, Cop<strong>in</strong>gstrategien) als auch Umweltfaktoren (z.B. sozialesNetzwerk) bei. Die relationale Sichtweise, die auf den jeweiligen Entwicklungskontextbezogen ist <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Person- wie Umweltvariablen gleichermaßen Beachtungf<strong>in</strong>den, sucht nach Konstellationen von <strong>Ressourcen</strong>, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Situation fürden Menschen hilfreich s<strong>in</strong>d (Rieckmann, 2002, 462ff.).Resilienz wird folglich möglich durch den Rückgriff auf <strong>Ressourcen</strong>. E<strong>in</strong> Individuumkann sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Krise als resilient zeigen, wenn es <strong>Ressourcen</strong> aktivieren kann, dieentwe<strong>der</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Person selbst o<strong>der</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Umwelt liegen.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 38<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> KriseDie Prozesse des erfolgreichen Handelns <strong>in</strong> Krisen s<strong>in</strong>d also auf <strong>Ressourcen</strong>zurückzuführen:„Als <strong>Ressourcen</strong> werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie solche Faktoren bezeichnet, diegeeignet s<strong>in</strong>d, die psychische, physische <strong>und</strong> soziale Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>es Menschen zuför<strong>der</strong>n, vor allem bei e<strong>in</strong>er Gefährdung <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heit durch Belastungen <strong>und</strong>Krankheit.“ (Weber, 2002, 466)<strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>d so<strong>mit</strong> die Kräfte, die die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit erhöhen, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong>Krise die Möglichkeiten <strong>der</strong> Chance sichtbar <strong>und</strong> die Elemente <strong>der</strong> Gefahr m<strong>in</strong>imiertwerden.Es gibt mehrere Vorschläge, Unterteilungen für die sehr heterogene Gruppe <strong>der</strong><strong>Ressourcen</strong> aufzustellen. In Anlehnung an Lazarus & Folkmann (1987) schlägtbeispielsweise Lepp<strong>in</strong> (1997) vor, zwischen bewerten<strong>der</strong>, emotionaler, physiologischer<strong>und</strong> behavioraler Funktion von <strong>Ressourcen</strong> im Prozess <strong>der</strong> Stressverarbeitungzu unterscheiden. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong>art differenzierte Betrachtungsweise ist aufempirischer Ebene bisher jedoch kaum realisiert worden. Die empirische Bef<strong>und</strong>lagezu verschiedenen Wirkmodellen von <strong>Ressourcen</strong>faktoren ist dürftig <strong>und</strong> heterogen(Lepp<strong>in</strong>, 1997, 201).Die klassische E<strong>in</strong>teilung <strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong> bezieht sich auf personale <strong>und</strong> soziale<strong>Ressourcen</strong>. Personale <strong>Ressourcen</strong> be<strong>in</strong>halten die positive Bef<strong>in</strong>dlichkeit e<strong>in</strong>erPerson sowie e<strong>in</strong>e positive Konstruktion ihrer Persönlichkeit, ihrer Kompetenzen <strong>und</strong>ihrer Erfahrungen. <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> h<strong>in</strong>gegen umfassen alle Komponenten dessozialen Umfelds e<strong>in</strong>es Menschen, die er nutzen kann, um Beanspruchung zureduzieren. Personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel positiv <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>korreliert (Schrö<strong>der</strong>, K. E. E., 1997; Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997, 175).Zu personalen <strong>Ressourcen</strong> zählen positive Konstrukte e<strong>in</strong>er Person bezüglich ihrerKompetenzen, ihrer Persönlichkeit <strong>und</strong> ihrer Erfahrungen. Am häufigsten wurden <strong>in</strong>diesem Zusammenhang positive Erwartungshaltungen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> positivesSelbstkonzept als personale <strong>Ressourcen</strong> untersucht. Zwei Merkmale erwiesen sichals beson<strong>der</strong>s tragfähig: Selbstwirksamkeit <strong>und</strong> Proaktivität.
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 39Selbstwirksamkeit (auch: Selbstwirksamkeitserwartung, optimistische Kompetenzerwartung,optimistische Selbstüberzeugung, perceived self-efficacy) stellt diesubjektive Gewissheit dar, neue o<strong>der</strong> schwierige Anfor<strong>der</strong>ungssituationen aufgr<strong>und</strong>eigener Kompetenzen bewältigen zu können (Schwarzer, 2002b, 521). DiesesKonzept beruht auf <strong>der</strong> sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1997). Das zu Beg<strong>in</strong>nnoch bereichsspezifische Konzept Banduras wurde weiterentwickelt zu e<strong>in</strong>emgeneralisierten <strong>und</strong> zeitstabilen Konstrukt im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Traits „GeneralisierteSelbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartung“ (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 1999).Dieses Konstrukt kann so<strong>mit</strong> <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em unterschiedlichen Grad an Generalität o<strong>der</strong>Spezifität beschreiben: von <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en zur bereichsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung.Selbstwirksamkeit stellt e<strong>in</strong>en Aspekt <strong>der</strong> Persönlichkeit dar, <strong>der</strong>sich <strong>in</strong> Resilienzkonstellationen als funktional erwiesen hat (Staud<strong>in</strong>ger & Pasupathi,2000).Das Konzept <strong>der</strong> Proaktivität steht <strong>in</strong> Zusammenhang <strong>mit</strong> den theoretischenKonstrukten „<strong>in</strong>ternale Kontrolle“, „optimistischer Interpretationsstil“ (Seligman),„dispositionaler Optimismus“ (Scheier <strong>und</strong> Carver), „Selbstwirksamkeitserwartung“(Bandura). Zu e<strong>in</strong>er proaktiven E<strong>in</strong>stellung gehört e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierliches Streben nache<strong>in</strong>er Verän<strong>der</strong>ung se<strong>in</strong>er selbst <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Umwelt. Im Kern des Konstrukts liegte<strong>in</strong>e optimistische Erwartung bezüglich <strong>der</strong> Umweltressourcen <strong>und</strong> <strong>der</strong> eigenen<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Verantwortung, etwas tun zu müssen, <strong>und</strong> demBedürfnis, etwas bewirken zu wollen. Proaktive Bewältigung ist so<strong>mit</strong> die positiveSeite von Cop<strong>in</strong>g im S<strong>in</strong>ne von persönlichem Wachstum, dem Meistern vonAnfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> dem Streben nach Lebenszielen. So kann <strong>in</strong> Erweiterungfrüherer Dimensionen zwischen reaktivem, antizipatorischem, präventivem <strong>und</strong>proaktivem Cop<strong>in</strong>g unterschieden werden. Proaktives Cop<strong>in</strong>g ist im Gegensatz zuan<strong>der</strong>en Bewältigungsformen ke<strong>in</strong> Risikomanagement, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> Zielmanagement.(Schwarzer, 2002a, 45ff.)Unter sozialen <strong>Ressourcen</strong> werden alle diejenigen <strong>Ressourcen</strong> gefasst, die nicht nurdem e<strong>in</strong>zelnen Menschen zugeordnet werden können, son<strong>der</strong>n die <strong>in</strong> Zusammenhang<strong>mit</strong> dem Kontakt zu an<strong>der</strong>en Menschen stehen. Es können drei große Gruppenunterschieden werden: soziales Netzwerk, soziale Unterstützung <strong>und</strong> persönlicheBeziehungen (Schwarzer & Lepp<strong>in</strong>, 1992; Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001, 122).Differenziert wird <strong>in</strong> dieser E<strong>in</strong>teilung so<strong>mit</strong> nach Quantität, Qualität <strong>und</strong> Funktion von
Kapitel 2 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen I: <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> 40sozialen Beziehungen. E<strong>in</strong>e differenzierte Betrachtung dieser drei Konzepte folgt <strong>in</strong>Kapitel 3.1. – Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kritische Lebensereignisse zugleichBedrohung <strong>und</strong> Chance <strong>in</strong> sich tragen. Zum e<strong>in</strong>en stellen sie Grenzerfahrungen fürden Menschen dar, <strong>in</strong> denen er an die Grenzen se<strong>in</strong>er bisherigen Bewältigungsfähigkeitenstößt. Zum an<strong>der</strong>en bergen sie die Möglichkeit <strong>der</strong> Neuentstehung <strong>und</strong>Neuentdeckung von <strong>in</strong>nerer Kraft <strong>und</strong> <strong>Ressourcen</strong>.Dazu jedoch bedarf es e<strong>in</strong>er Erweiterung des Blickw<strong>in</strong>kels weg vom Fokus aufBedrohung (pathogenetischer Blickw<strong>in</strong>kel) h<strong>in</strong> zum Fokus auf S<strong>in</strong>nhaftigkeit,Wachstum <strong>und</strong> positivem Wandel (salutogenetischer Blickw<strong>in</strong>kel).In <strong>der</strong> Psychologie wird das, was e<strong>in</strong>en Menschen dazu befähigt, <strong>mit</strong> krisenhaftenUmständen erfolgreich umzugehen, als Resilienz bezeichnet. Resilienz bezieht sichals relationales Konstrukt sowohl auf den Menschen als auch auf se<strong>in</strong>e Umwelt zue<strong>in</strong>em gegebenen Zeitpunkt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Entwicklung (vgl. Bezüge zu Person-Kontext-Interaktionstheorien <strong>in</strong> Kapitel 3.3. – Person-Kontext-Interaktionstheorien).Die Gr<strong>und</strong>lage von Resilienz s<strong>in</strong>d die <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>es Menschen. Hier werdenklassischerweise personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> unterschieden, die jedoch <strong>in</strong>komplexer Interaktion <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 413. Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II:<strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum3.1. Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> PsychologieTheorien <strong>und</strong> Modelle sozialer Unterstützung<strong>Soziale</strong> Netzwerktheorien<strong>Soziale</strong> Beziehungen als Ressource3.2. Grenzen <strong>der</strong> gängigen Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>Kritik an den Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong>Interaktion von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>3.3. Modelle für die <strong>in</strong>tegrative <strong>und</strong> <strong>in</strong>teraktionale Konzeptualisierung sozialer<strong>Ressourcen</strong>Systemtheoretisches Modell nach BronfenbrennerLife Course Paradigm nach El<strong>der</strong>Person-Kontext-InteraktionstheorienExkurs: Person-Kontext-Interaktionstheorien <strong>in</strong> psychologischer Forschung <strong>und</strong>Wissenschaft<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> aus <strong>in</strong>tegrativer SichtDie Chance, die e<strong>in</strong>em kritischen Lebensereignis <strong>in</strong>newohnt, kann also genutztwerden, <strong>in</strong>dem <strong>der</strong> betreffende Mensch Gebrauch von se<strong>in</strong>en <strong>Ressourcen</strong> macht.<strong>Ressourcen</strong> befähigen ihn dazu, dieser Situation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> er sich bef<strong>in</strong>det, so zubegegnen, dass se<strong>in</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den im Leben erhalten bleibt. <strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>d alsodie Kräfte, die dazu verhelfen, das Wohlbef<strong>in</strong>den trotz widriger Umstände aufrecht zuerhalten o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> zu erlangen. Da <strong>der</strong> Fokus <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit auf sozialen<strong>Ressourcen</strong> ruht, werden im Folgenden zunächst die bereits erwähntenKonzeptionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> dargestellt. Es wird sich dabei zeigen, dass diesegängigen Konzepte E<strong>in</strong>schränkungen unterliegen. Daher werden Metatheorien ausan<strong>der</strong>en Gebieten <strong>der</strong> Psychologie herangezogen, die dazu dienen können, e<strong>in</strong>breiteres Rahmenkonzept für die Konzeption sozialer <strong>Ressourcen</strong> zur Verfügung zustellen.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 423.1. Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie auf drei Arten konzeptualisiert (vgl.Laireiter, 2002, 1993; Schwarzer & Lepp<strong>in</strong>, 1992):„Die Forschung ist sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zwischenzeit darüber e<strong>in</strong>ig, dass sich das Begriffsfeld (<strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong>, Anm. d. Verf.) <strong>in</strong> drei Ebenen unterteilen lässt, die <strong>der</strong> sozialenIntegration, die des <strong>Soziale</strong>n Netzwerks <strong>und</strong> die <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>n Unterstützung.“ (Laireiter,1993, 15)Entsprechend werden auch im Folgenden Theorien <strong>und</strong> Modelle sozialerUnterstützung, sozialer Netzwerke sowie sozialer Beziehungen dargestellt.Theorien <strong>und</strong> Modelle sozialer Unterstützung<strong>Soziale</strong> Unterstützung ist <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> psychologischen Forschung am umfangreichstenuntersuchte <strong>und</strong> ausformulierte Aspekt im Gebiet <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>(Erlemeier, 1995; Filipp, 1995, 22; Laireiter, 1993; M<strong>in</strong>nemann & Sch<strong>mit</strong>t, 1995;Oldenbourg, <strong>in</strong> Vorbereitung). <strong>Soziale</strong> Beziehungen werden hier daraufh<strong>in</strong>betrachtet, welche Unterstützung e<strong>in</strong>er Person durch e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> sozialesNetzwerk zuteil wird. Insgesamt ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass soziale <strong>Ressourcen</strong>allzu oft <strong>mit</strong> sozialer Unterstützung gleichgesetzt werden (bspw. <strong>in</strong> Schrö<strong>der</strong>, K. E. E.& Schwarzer, 1997). Dies führt zu weiterer Verwirrung <strong>und</strong> Une<strong>in</strong>heitlichkeitempirischer Ergebnisse <strong>und</strong> Schlussfolgerungen.Die Betrachtungsw<strong>in</strong>kel sozialer Unterstützung werden zumeist aufgeteilt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>enpersonalen, e<strong>in</strong>en sozialen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en relationalen: soziale Unterstützung alsPersönlichkeitsmerkmal (Sarason, Pierce & Sarason, 1990), als konkret sozialesNetz <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er unterstützenden Funktion o<strong>der</strong> als Passungsgefüge zwischensozialen Bedürfnissen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Befriedigung (Erlemeier, 1995, 254). Der Versuche<strong>in</strong>es übergreifenden Modells kommt von Pierce, Sarason, Sarason, Joseph &Hen<strong>der</strong>son, 1996: Die AutorInnen postulieren, dass soziale Unterstützung die
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 43Aspekte von generellen Überzeugungen zur sozialen Unterstützung (supportschemes), von unterstützenden Beziehungen (supportive relationships) sowie vonunterstützenden Hilfeleistungen (supportive transactions) umfasse.Der Unterstützungsbegriff kann generell sowohl auf quantitative (z.B. als Größe desunterstützenden sozialen Netzes) als auch auf qualitative Weise (z.B. durchDifferenzierung <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Unterstützung <strong>in</strong> emotional o<strong>der</strong> <strong>in</strong>strumentell) bestimmtwerden. In <strong>der</strong> psychologischen Fachliteratur dom<strong>in</strong>ieren zumeist qualitativeDef<strong>in</strong>itionen. Es konnte jedoch nach wie vor nicht gänzlich geklärt werden, welcheAspekte von Interaktion <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Beziehung für die Wirkung von sozialerUnterstützung verantwortlich s<strong>in</strong>d. Klar sche<strong>in</strong>t allerd<strong>in</strong>gs, dass neben <strong>der</strong> Anzahl vonsozialen Kontakten auch <strong>der</strong>en unterstützende Qualität e<strong>in</strong>e bedeutsame Rolle spielt(Klauer, 2002). In diesem Zusammenhang ist auch die Stressor-Supporttyp-Hypothese von Bedeutung: Sie besagt, dass <strong>in</strong> bestimmten Stressituationenvorwiegend ganz bestimmte Arten von Unterstützung durch spezifische Personenhelfen können (M<strong>in</strong>nemann & Sch<strong>mit</strong>t, 1995, 254; Schwarzer & Lepp<strong>in</strong>, 1992, 443).Zusätzlich kann bei <strong>der</strong> Auswirkung sozialer Unterstützung zwischen Haupt- <strong>und</strong>Puffereffekt differenziert werden (Stress-Buffer-Modelle; vgl. Erlemeier, 1995, 254;Schmidt-Denter, 2005, 257). So besteht <strong>der</strong> Haupteffekt sozialer Unterstützung dar<strong>in</strong>,dass durch sie das E<strong>in</strong>treten <strong>und</strong> das Ausmaß von Stress direkt verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t o<strong>der</strong>abgemil<strong>der</strong>t werden kann; <strong>der</strong> <strong>in</strong>direkt wirkende Puffereffekt von sozialerUnterstützung kann schädliche Auswirkungen <strong>und</strong> Folgen von Belastung abmil<strong>der</strong>n,wenn die Belastungssituation bereits e<strong>in</strong>getreten ist.Vier Hauptergebnisse s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> sehr heterogenen Fülle an Ergebnissen übersoziale Unterstützung als Ressource festzuhalten:• Die Art <strong>der</strong> sozialen Unterstützung ist bedeuten<strong>der</strong> als ihr Ausmaß: “Es konntegezeigt werden, dass die protektive Wirkung sozialer Unterstützung stärker von<strong>der</strong> Qualität als <strong>der</strong> Quantität abhängig ist <strong>und</strong> als bereichsspezifische bzw.ereignisspezifische Ressource zu verstehen ist.“ (Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001, 123)• Es gibt ke<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> Unterstützung, die e<strong>in</strong> Menscherwartet, <strong>und</strong> <strong>der</strong>, die er erhält (Beziehung zwischen erhaltener sozialerUnterstützung <strong>und</strong> erwarteter sozialer Unterstützung): “Die beiden Aspekte
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 44sozialer Unterstützung haben sich <strong>in</strong> verschiedenen Untersuchungen alsweitgehend unkorreliert erwiesen.“ (Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997, 183)• Als <strong>in</strong> ihrer Wirkung zentral wird die wahrgenommene emotionale Unterstützungangesehen. Schwarzer & Lepp<strong>in</strong> schreiben dazu: „Worauf es ankommt, ist dasVertrauen darauf, dass an<strong>der</strong>e für e<strong>in</strong>en tun werden, was sie können, wenn esnötig werden sollte.“ Wichtig sei die generelle Überzeugung, „geliebt <strong>und</strong>geschätzt zu werden <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netzwerk sicher e<strong>in</strong>gebettet zu se<strong>in</strong>.“(Schwarzer & Lepp<strong>in</strong>, 1989, 1990; zit. n. Erlemeier, 1995, 253)• <strong>Soziale</strong> Unterstützung ist als Ressource weniger bedeutsam als dasVorhandense<strong>in</strong> sozialer Beziehungen per se: “Insgesamt legen die Bef<strong>und</strong>e nahe,dass die bedeutsamste soziale Ressource <strong>in</strong> <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> sozialen Beziehungenzu suchen ist. Insbeson<strong>der</strong>e emotionale Nähe, Inti<strong>mit</strong>ät, Zusammenhalt <strong>und</strong>Konfliktfreiheit <strong>in</strong> den ehelichen <strong>und</strong> familiären Beziehungen sche<strong>in</strong>en denBewältigungserfolg günstig zu bee<strong>in</strong>flussen.“ (Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer,1997, 185)<strong>Soziale</strong> Netzwerktheorien<strong>Soziale</strong> Netzwerktheorien stellen die Gesamtheit <strong>der</strong> sozialen Beziehungen e<strong>in</strong>esMenschen als e<strong>in</strong> Netz aus Knoten <strong>und</strong> Verb<strong>in</strong>dungen dar. E<strong>in</strong> soziales Netzwerk istso<strong>mit</strong> konzeptualisiert als e<strong>in</strong> Gebilde aus Knoten <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Verb<strong>in</strong>dungen, wobeidie Knoten soziale E<strong>in</strong>heiten (Personen, Firmen, Gruppen, etc.) <strong>und</strong> dieVerb<strong>in</strong>dungen <strong>der</strong>en vielfältige soziale Beziehungen <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> darstellen. DerBegriff des sozialen Netzwerks hat e<strong>in</strong>e personale <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e strukturelle Perspektive:Auf personaler Ebene geht es um Beziehungen zwischen Personen (egozentrierte/personaleNetzwerke), auf struktureller Ebene um die Bezugssysteme vonFirmen, Organisationen, etc.Die prototypische Struktur des sozialen Netzwerks e<strong>in</strong>es deutschen Menschen stelltsich wie folgt dar: Es besteht aus etwa 25 Personen, <strong>mit</strong> je ca. 4-6 Personen aus denBereichen Familie, Nachbarschaft, Arbeit, Freizeit <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaft. 50% <strong>der</strong>
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 45Beziehungen s<strong>in</strong>d emotional bedeutsam, 66% unterstützend <strong>und</strong> 10% belastend(Laireiter, 2002).Es werden zumeist vier Dimensionen zur Beschreibung sozialer Netzwerkeverwendet (Erlemeier, 1995, 253):• strukturelle Dimension (Größe, Vernetzung, Dichte, Sektoren, etc.),• relational-<strong>in</strong>teraktionelle Dimension (Inhalt, Art, Dauer, Frequenz <strong>der</strong>E<strong>in</strong>zelbeziehungen, etc.),• <strong>in</strong>haltlich-funktionale Dimension (Kontakt, Unterstützung, Belastung, etc.) <strong>und</strong>• evaluative Dimension (Zufriedenheit, etc.).Modellhaft aufgestellte Unterscheidungen <strong>in</strong> <strong>in</strong>teraktives Netzwerk, Rollennetzwerk,affektives Netzwerk, Unterstützungsnetzwerk konnten nicht bestätigt werden (Klauer,1997).<strong>Soziale</strong> Beziehungen als Ressource<strong>Soziale</strong> Beziehungen an sich als Ressource zu betrachten, stellt die dritte <strong>der</strong>gängigen Arten <strong>der</strong> Modellbildung dar. Sie speist sich vor allem aus empirischenErkenntnissen. E<strong>in</strong>e Vielzahl von Studien (vgl. Baltes & Silverberg, 1994; Schrö<strong>der</strong>,K. E. E. & Schwarzer, 1997) belegt, dass im Vergleich aller sozialer Indikatoren dasVorhandense<strong>in</strong> bedeutsamer, sozialer Beziehungen den besten Prädiktor fürerfolgreiche Bewältigung darstellt:„Intimate and affective bonds rather than large social networks serve as a buffer<strong>in</strong>gsystem <strong>in</strong> moments of stressful life events.“ (Baltes & Silverberg, 1994, 70)Bei differenzierterer Analyse zeigt sich, dass vor allem emotionale Nähe, Inti<strong>mit</strong>ät,Zusammenhalt <strong>und</strong> Konfliktfreiheit <strong>in</strong> nahen, familiären Beziehungen dafürverantwortlich s<strong>in</strong>d (vgl. Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997).<strong>Soziale</strong> Beziehungen an sich stellen so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e bedeutsame Ressource dar. Stabile<strong>und</strong> vertrauensvolle Beziehungen tragen <strong>in</strong> hohem Maße dazu bei, dass
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 483.2. Grenzen <strong>der</strong> gängigen Konzeptualisierung sozialer<strong>Ressourcen</strong>Die bisher vorgestellten Konzeptualisierungen von sozialen <strong>Ressourcen</strong> unterliegentheoretischen E<strong>in</strong>schränkungen <strong>und</strong> können als stark begrenzt bezeichnet werden.Um dies zu begründen, werden im Folgenden zunächst die Schwachstellen <strong>und</strong>Grenzen <strong>der</strong> drei Konzeptionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> vorgestellt. Daran anschließendbzw. darauf aufbauend wird die klassische Trennung von personalen <strong>und</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> (vgl. Kapitel 2.2. – <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise) nochmals kritischbeleuchtet.Kritik an den Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong>Die drei bestehenden Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Form vonsozialer Unterstützung, sozialem Netzwerk <strong>und</strong> sozialen Beziehungen als Ressourcewurden bereits vorgestellt (Kapitel 3.1. – Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong><strong>der</strong> Psychologie). Im Folgenden werden ihre Begrenzungen kurz erläutert.Im Konzept <strong>der</strong> sozialen Unterstützung werden soziale Beziehungen daraufh<strong>in</strong>betrachtet, welche Unterstützung e<strong>in</strong>er Person durch e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e zuteil wird. Starkkritisierbar an dieser Konzeptualisierung ist die Tatsache, dass es sich um e<strong>in</strong>egerichtete Betrachtung handelt: Die sozialen Beziehungen e<strong>in</strong>es Menschen werdendah<strong>in</strong>gehend betrachtet, <strong>in</strong> welcher Weise sie unterstützen wollen o<strong>der</strong> alsunterstützend wahrgenommen werden. Dabei wird die unterstützende Wirkungzumeist über Häufigkeit von Unterstützungshandlungen bzw. die subjektiveZufriedenheit des Unterstützten operationalisiert. An<strong>der</strong>e Facetten <strong>der</strong> ausgewählten,sozialen Beziehungs- o<strong>der</strong> Handlungsebene, die möglicherweise ebenfalls e<strong>in</strong>e
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 49stärkende o<strong>der</strong> stabilisierende Wirkung haben (z.B. soziale <strong>Begegnung</strong>en, dieMöglichkeit zur Kommunikation etc.), werden dabei ignoriert.Kritisch zu benennen ist weiterh<strong>in</strong>, dass die gerichtete Betrachtung sozialerUnterstützung zudem e<strong>in</strong>dimensionaler Natur ist: Das Modell sozialer Unterstützungimpliziert, dass die unterstützte Person <strong>der</strong> hilfebedürftige Part <strong>der</strong> Interaktion sei,während die unterstützende Person <strong>der</strong> potente Hilfegeber sei. Es stellt sich jedochheraus, dass diese Betrachtung e<strong>in</strong>seitig ist. Vielmehr wird dem/<strong>der</strong> Hilfegebendene<strong>in</strong> großes Maß an Bestätigung <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> Selbststärkung zuteil (vgl. z.B. auchHelferpersönlichkeit), bei dem <strong>der</strong>/die Hilfeempfangende <strong>der</strong>/die Gebende vonBestätigung ist. So haben Studien <strong>mit</strong> schwer kranken Menschen <strong>und</strong> ihrenBezugspersonen mehrfach belegt, dass sich die Bezugspersonen von denPatientInnen gestärkt <strong>und</strong> unterstützt fühlen, obwohl <strong>in</strong> den Term<strong>in</strong>i <strong>der</strong> sozialenUnterstützung die PatientInnen als Empfänger fungieren <strong>und</strong> die Bezugspersonenals Gebende (Bai<strong>der</strong>, Ever-Hadani, Goldzweig, Wygoda & Peretz, 2003; Keller,Henrich, Beutel & Sellschopp, 1998; Keppl<strong>in</strong>ger & Stegie, 1998; zit. n. Oldenbourg, <strong>in</strong>Vorbereitung).Und schließlich wird bei <strong>der</strong> Konzeption sozialer Unterstützung außer Acht gelassen,dass sie meist <strong>in</strong> Beziehungen stattf<strong>in</strong>det, die mehrere Handlungs- <strong>und</strong> Beziehungsebenensowie e<strong>in</strong>e Beziehungsgeschichte e<strong>in</strong>schließen. Bei <strong>der</strong> Konzeptualisierungdurch soziale Unterstützung wird jeweils das Geschehen auf e<strong>in</strong>er Ebene zu e<strong>in</strong>emgegebenen Zeitpunkt betrachtet. Dies br<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e Vernachlässigung <strong>der</strong> Zeitperspektive<strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Interaktion auf an<strong>der</strong>en Ebenen <strong>der</strong> sozialenBeziehung <strong>mit</strong> sich. Es zeigt sich nämlich, dass <strong>in</strong> Beziehungen e<strong>in</strong> Austausch vonUnterstützung über die Zeit h<strong>in</strong>weg stattf<strong>in</strong>det, <strong>der</strong> langfristig relativ ausgeglichen ist<strong>und</strong> daher von Kahn & Antonucci aus ‚Support Bank’ bezeichnet wird. Außerdembeschreiben Aust<strong>in</strong> & Walster, dass Menschen, die über längere Zeit h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erH<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong>seitig auf Hilfe angewiesen s<strong>in</strong>d, dies ausgleichen <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e ‚Equitywith the world’ herstellen, <strong>in</strong>dem sie auf an<strong>der</strong>en Ebenen <strong>der</strong> Beziehung vermehrtgeben (vgl. M<strong>in</strong>nemann & Sch<strong>mit</strong>t, 1995). <strong>Soziale</strong> Unterstützung f<strong>in</strong>det so<strong>mit</strong> <strong>in</strong>Austauschbeziehungen statt, die über verschiedene Dimensionen h<strong>in</strong>wegausgeglichen s<strong>in</strong>d; kann <strong>der</strong>en Reziprozität über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum nichtgewährleistet werden, so kann es durch die soziale Unterstützung zu schwer-
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 50wiegenden Störungen <strong>und</strong> zu Abhängigkeitsbeziehungen kommen (vgl. Erlemeier,1995, 259).<strong>Soziale</strong> Netzwerktheorien stellen die Gesamtheit <strong>der</strong> sozialen Beziehungen e<strong>in</strong>esMenschen als e<strong>in</strong> Netz aus Knoten <strong>und</strong> Verb<strong>in</strong>dungen dar. Das Konzept <strong>der</strong> sozialenNetzwerke soll, wie e<strong>in</strong>e Landkarte, die E<strong>in</strong>bettung e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e sozialeUmwelt darstellen. So ist auch se<strong>in</strong>e Aussagekraft auf die e<strong>in</strong>er Landkartebeschränkt: Durch den Vergleich <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Netzwerken kann die Knotendichtee<strong>in</strong>geordnet <strong>und</strong> bewertet werden. Aufschluss über die emotionale Bereicherungdurch bestimmte Beziehungen kann jedoch nicht gegeben werden. Die äußereLandkarte unserer sozialen Beziehungen spiegelt nicht unser persönliches <strong>und</strong>psychisches Involviertse<strong>in</strong> wie<strong>der</strong>: “Das bloße Vorhandense<strong>in</strong> von Netzwerken alle<strong>in</strong>bietet noch ke<strong>in</strong>e Hilfe <strong>und</strong> ke<strong>in</strong>en Schutz.“ (Mennemann, 1998, 158) E<strong>in</strong> direkter<strong>Ressourcen</strong>bezug bleibt hier vollständig ungeklärt.Es wird dabei auch <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> Mehrdimensionalität von sozialen Beziehungenvöllig außer Acht gelassen:„<strong>Soziale</strong> Netzwerke können Quelle sozialer Unterstützung se<strong>in</strong>; sie können jedoch auchzu negativen Konsequenzen führen, wenn sich die Beziehungen konfliktreich o<strong>der</strong>belastend gestalten.“ (Erlemeier, 1995, 253)E<strong>in</strong>e zwischenmenschliche Beziehung kann eng, aber zugleich ambivalent o<strong>der</strong>belastend se<strong>in</strong>. O<strong>der</strong> sie kann von ger<strong>in</strong>ger Kontakthäufigkeit charakterisiert se<strong>in</strong>,trotzdem aber für den Betreffenden große emotionale Bedeutsamkeit haben. DieDimensionalität sozialer Beziehungen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Auswirkung auf soziale <strong>Ressourcen</strong>bleibt im Modell sozialer Netzwerke unberücksichtigt.Das Modell <strong>der</strong> sozialen Netzwerke kann so<strong>mit</strong> als <strong>der</strong> erster Schritt zur Erfassungsozialer Beziehungen gesehen werden (Schmidt-Denter, 2005, 257). Es erfüllt denZweck e<strong>in</strong>es Inventarisierungs<strong>in</strong>struments (<strong>und</strong> kann soziale Beziehungen <strong>und</strong> da<strong>mit</strong>die Gr<strong>und</strong>lage von sozialen <strong>Ressourcen</strong> abbilden); über sozialen Austausch <strong>und</strong>se<strong>in</strong>e <strong>Ressourcen</strong>funktion kann es jedoch ke<strong>in</strong>e Aussage treffen.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 51Bereits das Vorhandense<strong>in</strong> bedeutsamer Beziehungen kann als Ressource wirken<strong>und</strong> bildet daher die dritte <strong>und</strong> letzte Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>. Indiesem Konzept mangelt es, wie bei den an<strong>der</strong>en Modellen sozialer <strong>Ressourcen</strong>auch, an <strong>der</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> lebensgeschichtlichen Komponente vonBeziehungen. Es wird das Beziehungsverhältnis als Indikator <strong>der</strong> Bedeutsamkeit <strong>der</strong>sozialen Beziehung gesetzt (z.B. Ehepartner, Elternteil) <strong>und</strong> dabei außer Achtgelassen, dass oft nicht das äußere Beziehungsverhältnis, son<strong>der</strong>n die Geschichte<strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Beziehungen Aufschluss darüber gibt, wie ressourcenhaft e<strong>in</strong>eBeziehung ist. Natürlich geht e<strong>in</strong>e eheliche Beziehung oft <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>er langenBeziehungsgeschichte e<strong>in</strong>her, <strong>und</strong> die beiden Indikatoren geben <strong>in</strong> diesem Fall <strong>in</strong>gleicher Weise Aufschluss über das Potential dieser Beziehung als Ressource. Eskann jedoch dementgegen e<strong>in</strong>e langjährige Fre<strong>und</strong>schaftsbeziehung wesentlichstärker als Ressource wirken als e<strong>in</strong>e erst seit kurzem bestehende Ehebeziehung.Kahn & Antonucci (1980) entwickelten diesem Gedanken entsprechend das Konvoi-Modell sozialer Beziehungen (vgl. Fre<strong>und</strong> & Riediger, 2003, 605; M<strong>in</strong>nemann &Sch<strong>mit</strong>t, 1995, 97; Schmidt-Denter, 2005, 259; Schnei<strong>der</strong>, H.-D., 1995, 264), dessenBild beschreibt, wie Menschen unter dem Schutz von Begleitern über das Meer desLebens ziehen <strong>und</strong> sich im Lebensverlauf e<strong>in</strong>zelne Begleiter lösen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>eh<strong>in</strong>zutreten. Dieser lebensgeschichtliche „Begleitschutz“ (Schmidt-Denter, 2005, 258)ist es, was den <strong>Ressourcen</strong>charakter sozialer Beziehungen ausmacht, <strong>und</strong> nichtvorrangig das Beziehungsverhältnis, das man zu e<strong>in</strong>zelnen Menschen se<strong>in</strong>essozialen Konvois hat (vgl. Pruchno & Rosenbaum, 2003, 488).Zudem bleibt dieses Modell das theoretische Erklärungsmodell schuldig. DasKonzept des Vorhandense<strong>in</strong>s sozialer Beziehungen als Ressource lässt offen, aufwelche Weise bestimmte Beziehungen (z.B. eheliche) als Ressource wirken, an<strong>der</strong>e(z.B. enge Arbeitsbeziehungen) jedoch weniger o<strong>der</strong> gar nicht. Woran liegt es, dassInti<strong>mit</strong>ät <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Beziehung ressourcenför<strong>der</strong>nd wirkt? Und wie wirkt es sich auf denals ressourcenför<strong>der</strong>nd postulierten Charakter e<strong>in</strong>er engen Beziehung aus, dass ihreQualität nicht zeitlich stabil, son<strong>der</strong>n prozesshaft wechselnd ist (z.B. von e<strong>in</strong>er alsunterstützend zu e<strong>in</strong>er als konflikthaft erlebten, ehelichen Beziehung) o<strong>der</strong> <strong>in</strong>bestimmten Beziehungsbereichen als unterstützend <strong>und</strong> <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en gleichzeitig als
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 52konflikthaft erlebt wird? Diese Fragen bleiben im Modell von sozialen Beziehungenals Ressource unbeantwortet.Aus den bisherigen Kritikpunkten zu den gängigen Konzepten von sozialen<strong>Ressourcen</strong> wird zusammenfassend deutlich, dass ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> gängigen Theorien zusozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, die komplexen Verflechtungen zwischen e<strong>in</strong>emMenschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er sozialen Umgebung <strong>in</strong> ausreichendem Maße abzubilden.Wenn soziale Beziehungen im Konzept <strong>der</strong> sozialen Unterstützung nur unter demAspekt gesehen werden, ob sie direkt unterstützend wirken, dann zwängen sie dieBeteiligten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Geber- <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Nehmerrolle. Wenn im Konzept <strong>der</strong> Netzwerktheoriennur erfasst wird, <strong>mit</strong> wie vielen Personen e<strong>in</strong> Mensch <strong>in</strong> enger o<strong>der</strong>distanzierter Beziehung steht, werden alle weiteren funktionellen o<strong>der</strong> emotionalenAspekte von Beziehungen außer Acht gelassen <strong>und</strong> soziale Beziehungen wieLandkarten behandelt. Werden soziale Beziehungen schließlich als <strong>Ressourcen</strong>betrachtet, dann wird lediglich gewertet, <strong>in</strong> wie weit sie bei <strong>der</strong> Bewältigung vonLebensproblematiken nützlich s<strong>in</strong>d.Interaktion von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Die wissenschaftliche Erkenntnislage zur Dichotomisierung von personalen <strong>und</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> ist dürftig. Es liegt nur e<strong>in</strong>e begrenzte Anzahl von Studien vor,<strong>in</strong> denen Persönlichkeitsvariablen <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> simultan erhoben wurden.Und die empirischen Bef<strong>und</strong>e zu e<strong>in</strong>em Zusammenhang s<strong>in</strong>d une<strong>in</strong>heitlich <strong>und</strong>lassen ke<strong>in</strong>e generalisierbaren Schlussfolgerungen zu (Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. &Schwarzer, 1997, 186). Viele Studien f<strong>in</strong>den Interaktionseffekte zwischen personalen<strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> (z.B. Aymanns, 1992; Bertrand & Lachman, 2003; Hobfollet al., 1990; Lepp<strong>in</strong>, 1997; Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997; für e<strong>in</strong>e Übersichtsiehe Horlacher, 2000, 466ff.) <strong>und</strong> erklären diese auf unterschiedliche Weise.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 53E<strong>in</strong>ige Forschungsergebnisse legen den Schluss nahe, dass es Personen <strong>mit</strong> hohenSelbstwirksamkeitserwartungen, <strong>in</strong>ternalen Kontrollüberzeugungen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>empositiven Selbstkonzept leichter fällt, soziale Unterstützung zu mobilisieren <strong>und</strong> von<strong>der</strong> erhaltenen Zuwendung zu profitieren (Lepp<strong>in</strong>, 1997, 203; Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. &Schwarzer, 1997, 189). Mögliche Modelle des Zusammenwirkens bei<strong>der</strong><strong>Ressourcen</strong>quellen (vgl. Aymanns, 1992) könnten e<strong>in</strong> additives Modell, synergetischesModell, kompensatorisches Modell, Interferenzmodell o<strong>der</strong> Support-Belastungs-Modell (vgl. Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997, 190) nahe legen.Diese Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Hypothesen legen e<strong>in</strong>e Wirkrichtung von den Persönlichkeitseigenschaftenzum sozialen Umfeld dar:„<strong>Soziale</strong> Kompetenzen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e personengeb<strong>und</strong>ene <strong>Ressourcen</strong> sollten dieWahrsche<strong>in</strong>lichkeit erhöhen, im Bedarfsfall soziale Unterstützung zu mobilisieren <strong>und</strong>positive soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten.“ (Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, 1997,191)An<strong>der</strong>e AutorInnen jedoch nehmen jedoch e<strong>in</strong>e genau entgegen gesetzte Wirkweisebei<strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong>quellen an: So sprechen Hobfoll et al. (1990) von <strong>der</strong>identitätsstabilisierenden Wirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong> (<strong>in</strong> Tesch-Römer,Salewski & Schwarz, 1997, 191). In dieser Sichtweise dienen soziale Kontakte <strong>und</strong>soziale Unterstützung dazu, e<strong>in</strong>en höheren Selbstwert <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e stabile Persönlichkeitsstrukturzu ermöglichen <strong>und</strong> sicherzustellen.Generell lässt sich bisher festhalten:„Personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> spielen e<strong>in</strong>e komplexe Rolle im Prozess desUmgangs <strong>mit</strong> Belastungen, die bis heute nur unzureichend erforscht ist <strong>und</strong> sicherlichverstärkter Aufmerksamkeit bedarf.“ (Lepp<strong>in</strong>, 1997, 205)Aus den dargelegten Ergebnissen, Modellen <strong>und</strong> Theorien wird deutlich, dasspersonale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> vielfältigem Zusammenhang <strong>und</strong> <strong>in</strong>Wechselwirkung <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen. Es stellt sich abschließend sogar die Frage, obdie Unterteilung <strong>in</strong> personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>e künstliche Trennung ist,die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis nicht aufrechterhalten lässt:„Wie die bisherigen Bef<strong>und</strong>e gezeigt haben, weisen sowohl Persönlichkeitsvariablen alsauch soziale Faktoren Zusammenhänge <strong>mit</strong> zentralen Kriterien erfolgreicherKrankheitsbewältigung auf. Nur e<strong>in</strong>e simultane Effekt-Analyse von sozialen <strong>und</strong>personalen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> <strong>Ressourcen</strong>defiziten dürfte dem komplexen Alltagsphänomen„Krankheitsbewältigung“ gerecht werden.“ (Schrö<strong>der</strong> & Schwarzer, 1997, 185)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 54Aus <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Grenzen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>geschränkten Gültigkeiten <strong>der</strong> gängigenKonzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> wird deutlich, dass ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> gängigen Theorien zusozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, die komplexen Verflechtungen zwischen e<strong>in</strong>emMenschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er sozialen Umgebung <strong>in</strong> ausreichendem Maße abzubilden:Wenn soziale Beziehungen nur unter dem Aspekt gesehen werden, ob sie direktunterstützend wirken, dann zwängen sie die Beteiligten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Geber- <strong>und</strong> e<strong>in</strong>eNehmerrolle. Wenn nur erfasst wird, <strong>mit</strong> wie vielen Personen e<strong>in</strong> Mensch <strong>in</strong> engero<strong>der</strong> distanzierter Beziehung steht, werden alle weiteren funktionellen o<strong>der</strong>emotionalen Aspekte außer Acht gelassen <strong>und</strong> soziale Beziehungen wie Landkartenbehandelt. Werden soziale Beziehungen als <strong>Ressourcen</strong> betrachtet, dann wirdlediglich ihre direkte Nützlichkeit <strong>in</strong> Bezug auf bestimmte Lebensproblematikenbewertet.Die genaue Betrachtung <strong>der</strong> Verflechtung sozialer <strong>und</strong> personaler <strong>Ressourcen</strong> zeigtüberdies, dass personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> vielfältigem Zusammenhang<strong>und</strong> <strong>in</strong> Wechselwirkung <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen, so dass e<strong>in</strong>e theoriegeleiteteDichotomisierung <strong>in</strong> disjunkte Gruppen das Verständnis für die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Realitätablaufenden Prozesse nicht för<strong>der</strong>t, son<strong>der</strong>n verstellt.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 56schreiten, um überleben zu können: körperlich, seelisch, geistig, sozial <strong>und</strong> spirituell. Nurauf sich gestellt könnte <strong>der</strong> Mensch sicht nicht ernähren, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krankheit auf Hilfe hoffen,ohne Gegenüber läuft se<strong>in</strong>e Liebe <strong>in</strong>s Leere.“ (Keil, A., 2006, 29)Wie Buber sieht auch sie das Gegenüber als konstituierend für das eigene Ich <strong>und</strong>die Selbstwerdung <strong>der</strong> Person an (Keil, A., 2006, 69, 175ff.):„Die Frage, wer wir s<strong>in</strong>d, also die Frage nach unserer Identität, ist nie abschließend zubeantworten. Je<strong>der</strong> Mensch ist ohne jede Trennung <strong>in</strong> das Gewebe des Lebense<strong>in</strong>gewoben, da<strong>mit</strong> dem ständigen Wandel unterworfen <strong>und</strong> kann sich diesemuniversellen Zusammenhang nicht entziehen, selbst wenn dieser unbewusst bleibt o<strong>der</strong><strong>der</strong> Mensch ihn zu leugnen versucht. Menschliche Existenz gestaltet sich im Wandel <strong>und</strong>menschliche Identität ist e<strong>in</strong>e Identität im Werden.“ (Keil, A., 2006, 69)Da die Existenz leben<strong>der</strong> Wesen sich so<strong>mit</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beziehungsraum verwirklicht,besteht die Gr<strong>und</strong>gegebenheit des Lebens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unauflösbaren Verb<strong>und</strong>enheitsowie e<strong>in</strong>em ständigen Austausch, <strong>der</strong> das Individuum <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Entwicklung stetsüber den eigenen Horizont h<strong>in</strong>ausführt:„Um zu leben, müssen wir Bezug nehmen, müssen spielerisch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en umfassendenStoffwechsel e<strong>in</strong>treten, <strong>der</strong> uns dazu zw<strong>in</strong>gt, ständig den eigenen Horizont zu überschreiten.Körperliches, Seelisches, Geistiges, <strong>Soziale</strong>s entsteht durch den Austausch<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt <strong>und</strong> den Menschen, die uns umgeben.“ (Keil, A., 2004, 34)Keils Beobachtungen über diese komplexen Interaktionen, welche das Leben formen(Keil, A., 2006, 139ff.), lassen sie zu dem Schluss kommen, <strong>der</strong> den Kern desSystemdenkens <strong>der</strong> Psychologie bildet:„Lebende Systeme s<strong>in</strong>d offen <strong>und</strong> nicht determ<strong>in</strong>iert.“ (Keil, A., 2006, 93) „LebendeSysteme <strong>und</strong> Lebewesen s<strong>in</strong>d komplexe, <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> vernetzte Gebilde <strong>und</strong> stehen aufvielfältige Weise <strong>in</strong> Beziehung zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong>.“ (Keil, A., 2006, 144)Das nicht zu trennende E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong> die Welt <strong>und</strong> dieMultidimensionalität sozialer Beziehungen muss daher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em breiten Rahmenkonzeptrealisiert werden, welches die gr<strong>und</strong>legende Stellung des Individuums <strong>in</strong>se<strong>in</strong>er Umgebung erfasst. Versuche auf psychologischer Seite, diese unauflösbareVerb<strong>in</strong>dung zwischen Organismus <strong>und</strong> Umwelt theoretisch zu formulieren, schließene<strong>in</strong>e Vielzahl von systemischen Modellen <strong>und</strong> Theorien e<strong>in</strong> (s. z.B. Moen, El<strong>der</strong> &Lüscher, 1995; Schmidt-Denter, 2005, 259; Silbereisen & Noack, 2006). Da <strong>in</strong> <strong>der</strong>vorliegenden Arbeit e<strong>in</strong> ges<strong>und</strong>heitspsychologischer Schwerpunkt gesetzt wurde,werden im Folgenden Metatheorien aus ges<strong>und</strong>heitspsychologischen <strong>und</strong>angrenzenden Bereichen vorgestellt, die den Bezug von Mensch <strong>und</strong> Welt <strong>in</strong> denMittelpunkt stellen: das systemtheoretische Modell, das Life Course Paradigm sowie
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 57die Person-Kontext-Interaktionstheorien. In vielen Punkten stimmen die ausgewähltenModelle übere<strong>in</strong> o<strong>der</strong> ergänzen sich, sie setzen jedoch jeweils e<strong>in</strong>en spezifischenSchwerpunkt auf unterschiedliche Komponenten <strong>der</strong> Verb<strong>in</strong>dung von Mensch <strong>und</strong>Welt. Daran anschließend werden e<strong>in</strong>ige Modelle dargestellt, die soziale <strong>Ressourcen</strong>vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrativer Metatheorien konzeptualisieren. Dieser gedanklicheSchritt wird die theoretischen H<strong>in</strong>tergründe, auf denen die vorliegende Arbeit aufbaut,abschließen.Systemtheoretisches Modell nach BronfenbrennerBronfenbrenner (z.B. Bronfenbrenner, 1995a, 1995b) stellt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em klassischensystemtheoretischen Modell den Versuch dar, das Denken <strong>in</strong> l<strong>in</strong>earen Kausalitätenaufzugeben <strong>und</strong> dafür das Individuum <strong>in</strong> e<strong>in</strong> ganzheitliches Rahmenkonzepte<strong>in</strong>zubetten. Mit dem ökosystemischen Ansatz erstellt er e<strong>in</strong>e Systematik deskomplexen Zusammenspiels von verschiedensten E<strong>in</strong>flussfaktoren auf diemenschliche Erlebniswelt. E<strong>in</strong> Ökosystem umfasst dabei die gesamte materielle <strong>und</strong>soziale Umwelt e<strong>in</strong>es Menschen. Diese ist strukturiert <strong>in</strong> folgende Systemebenen:• Mikrosysteme umfassen die Beziehungen e<strong>in</strong>es Menschen zu an<strong>der</strong>en Menscheno<strong>der</strong> zu Gruppen: “E<strong>in</strong> Mikrosystem ist e<strong>in</strong> Muster von Tätigkeiten <strong>und</strong> Aktivitäten,Rollen <strong>und</strong> zwischenmenschlichen Beziehungen, das die <strong>in</strong> Entwicklungbegriffene Person <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gegebenen Lebensbereich <strong>mit</strong> se<strong>in</strong>en eigentümlichenphysischen <strong>und</strong> materiellen Merkmalen erlebt. E<strong>in</strong> Lebensbereich ist e<strong>in</strong> Ort, andem Menschen leicht direkte Interaktion <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en aufnehmen können."(Bronfenbrenner 1981, 38; zit. n. Stangl, 2005, 3)• E<strong>in</strong> Mesosystem ist die Gesamtheit <strong>der</strong> Beziehungen e<strong>in</strong>es Menschen, also dieSumme <strong>der</strong> Mikrosysteme <strong>und</strong> die Beziehung zwischen ihnen.• E<strong>in</strong> Exosystem ist e<strong>in</strong> Beziehungsgeflecht, dem die Person nicht direkt angehört,das sie aber direkt bee<strong>in</strong>flusst, da ihm Bezugspersonen <strong>der</strong> Person angehören.• Das Makrosystem ist die Gesamtheit aller Beziehungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft,da<strong>mit</strong> auch <strong>der</strong> Normen, Werte, Gesetze, Ideologien etc. „Der Begriff des
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 58Makrosystems bezieht sich auf die gr<strong>und</strong>sätzliche formale <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltlicheÄhnlichkeit <strong>der</strong> Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro-, Meso- <strong>und</strong> Exo-), die <strong>in</strong> <strong>der</strong>Subkultur o<strong>der</strong> <strong>der</strong> ganzen Kultur bestehen o<strong>der</strong> bestehen könnten, e<strong>in</strong>schließlich<strong>der</strong> ihnen zugr<strong>und</strong>e liegenden Weltanschauungen <strong>und</strong> Ideologien."(Bronfenbrenner 1981, 42; zit. n. Stangl, 2005, 5)• Chronosysteme umfassen sowohl die zeitliche Dimension <strong>der</strong> Entwicklung, z. B.die markanten Zeitpunkte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung, als auch die biographische Abfolge.Bronfenbrenner unterscheidet zwischen „normativen“ Chronosystemen wie demSchule<strong>in</strong>tritt o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Aufnahme <strong>der</strong> Berufstätigkeit <strong>und</strong> „non-normativen“, wiee<strong>in</strong>er schweren Krankheit von Angehörigen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em Lotteriegew<strong>in</strong>n.Abbildung 1: Systemtheoretisches Modell nach Bronfenbrenner (Quelle: Hottes, 2005)Bronfenbrenners Herangehensweise verb<strong>in</strong>det den soziologischen <strong>mit</strong> dempsychologischen Ansatz, denn e<strong>in</strong> Zusammenhang wird nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umgebenden„Vakuum“ untersucht, son<strong>der</strong>n <strong>mit</strong> E<strong>in</strong>bezug des engeren <strong>und</strong> weiteren Umfeldes.Dies trifft auch auf den Bereich <strong>der</strong> sozialen Beziehungen zu, den Bronfenbrenner(1943) folgen<strong>der</strong>maßen beschreibt:
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 59„Social development applies not only to the <strong>in</strong>dividual but to the social organization ofwhich he is a part. Variations occur not only <strong>in</strong> the social status of a particular personwith<strong>in</strong> the group, but also <strong>in</strong> the structure of the group itself – that is, <strong>in</strong> the frequency,strength, pattern, and the basis of the <strong>in</strong>terrelationships which b<strong>in</strong>d the group togetherand give it dist<strong>in</strong>ctive character. (p. 363)” (zit. n. Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998, 713)Im systemtheoretischen Modell arbeitet Bronfenbrenner deutlich heraus, dass ese<strong>in</strong>en verkürzten Ansatz darstellt, e<strong>in</strong> Individuum getrennt von den ihn umgebendenUmwelten betrachten <strong>und</strong> verstehen zu wollen. Er stellt das Zusammenspielzwischen Systemen <strong>und</strong> den Übergang von Menschen aus e<strong>in</strong>em System <strong>in</strong> e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>es <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. So zeigt er <strong>mit</strong> se<strong>in</strong>em Modell sehr deutlich das nicht zutrennende E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Umgebung auf. (E<strong>in</strong>eAnwendung des Mehrebenen-Modells auf soziale <strong>Ressourcen</strong> f<strong>in</strong>det sich bei(Schmidt-Denter, 2005, 258f.).Life Course Paradigm nach El<strong>der</strong>Im Gegensatz zum systemtheoretischen Modell liegt bei diesem Modell <strong>der</strong> Fokusauf <strong>der</strong> zeitlichen Komponente: Dem Life Course Paradigm liegt <strong>der</strong> Gedankezugr<strong>und</strong>e, e<strong>in</strong> Entwicklungsmodell über die Lebensspanne e<strong>in</strong>es Menschenbereitzustellen (vgl. dazu auch Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995; Lehr, 1995;Montada, 1995). El<strong>der</strong> (1995, 1998a, 1998b) baut se<strong>in</strong> Modell auf vier zentralenPr<strong>in</strong>zipien auf:• ‚Lives <strong>in</strong> Time and Place’: Das <strong>in</strong>dividuelle Leben ist <strong>in</strong> die geschichtlicheEntwicklung e<strong>in</strong>gebettet, d.h. es besteht e<strong>in</strong> Zusammenspiel zwischen dem Lebene<strong>in</strong>es Individuums <strong>und</strong> <strong>der</strong> sich verän<strong>der</strong>nden Zeit <strong>und</strong> Umwelt.• ‚Tim<strong>in</strong>g of Lives’: Der Zeitpunkt, wann etwas im Leben passiert, bee<strong>in</strong>flusst,welche Auswirkungen es auf den Lebensverlauf e<strong>in</strong>es Menschen haben wird. Sohat beispielsweise <strong>der</strong> <strong>Tod</strong> des Lebenspartners unterschiedliche Auswirkungenauf e<strong>in</strong>en Menschen, je nachdem ob er selbst 30 o<strong>der</strong> aber 80 Jahre alt ist.• ‚L<strong>in</strong>ked Lives’: Die Lebenswege e<strong>in</strong>es Menschen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>erun<strong>mit</strong>telbaren o<strong>der</strong> <strong>mit</strong>telbaren Umgebung bee<strong>in</strong>flussen sich gegenseitig. DerLebensverlauf e<strong>in</strong>es Menschen kann nur dann vollständig verstanden werden,
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 60wenn die Berührungspunkte <strong>mit</strong> den Lebensverläufen an<strong>der</strong>er Menschen <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>bezogen werden.• ‚Human Agency’: Der Mensch muss als e<strong>in</strong>e handelnde Person <strong>in</strong> Bezug aufAuswählen <strong>und</strong> Entscheiden gesehen werden.Beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit widmet El<strong>der</strong> den Übergängen im Leben e<strong>in</strong>esMenschen. Bereits aus se<strong>in</strong>en Gr<strong>und</strong>pr<strong>in</strong>zipien wird deutlich, dass e<strong>in</strong> Mensch imVerlauf se<strong>in</strong>es Lebens zahlreichen Verän<strong>der</strong>ungen ausgesetzt ist, die se<strong>in</strong>eEntwicklung prägen (so z.B. durch geschichtliche Ereignisse, durch tief greifendeVerän<strong>der</strong>ungen, wie Krankheit o<strong>der</strong> <strong>Tod</strong>, im Leben von ihn umgebenden Menscheno.ä.). Solche Entwicklungsanstöße von außen bezeichnet El<strong>der</strong> als Übergänge <strong>und</strong>spricht ihnen große Bedeutung für die Gestaltung e<strong>in</strong>es Lebensverlaufs <strong>und</strong> <strong>der</strong>dadurch geprägten Persönlichkeit zu.Im ‚Life Course Paradigm’ wird <strong>der</strong> Schwerpunkt auf die zeitliche Entwicklung e<strong>in</strong>esMenschen im Lebensverlauf <strong>in</strong> Bezug zu <strong>der</strong> ihn umgebenden Welt gelegt (dieserGedanke basiert auf dem Konzept <strong>der</strong> ‚sozialen Uhr’ nach Neugarten <strong>und</strong> Helson,vgl. Bertrand & Lachman, 2003, 473, <strong>und</strong> kann darüber h<strong>in</strong>aus bereichert werdendurch den Blick auf die zyklische Natur lebensgeschichtlicher Abläufe, vgl. Keil, A.,2004, 148). Natürlich hat die lebensgeschichtliche Entwicklung e<strong>in</strong>er Person <strong>und</strong>da<strong>mit</strong> auch die Geschichte ihrer sozialen Beziehungen großen E<strong>in</strong>fluss auf die Art<strong>und</strong> Weise, wie sie zu e<strong>in</strong>em gegebenen Zeitpunkt Gebrauch von sozialen<strong>Ressourcen</strong> macht (vgl. M<strong>in</strong>nemann & Sch<strong>mit</strong>t, 1995). Dieser Blickw<strong>in</strong>kel ist vongroßem Interesse, kann jedoch <strong>in</strong> <strong>der</strong> hier vorliegenden Arbeit (schon aufgr<strong>und</strong> desquerschnittlichen Untersuchungsdesigns) nicht weiter verfolgt werden. Um diesdeutlich zu machen <strong>und</strong> zugleich den Rahmen dieser Arbeit von lebensgeschichtlichenBezügen bei sozialen <strong>Ressourcen</strong> abzugrenzen, wurden dieTheorien <strong>der</strong> Entwicklung über die Lebensspanne hier exemplarisch genannt.Aus El<strong>der</strong>s entwicklungspsychologisch orientiertem Modell <strong>der</strong> ‚Life Stages’ <strong>und</strong> <strong>der</strong>da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>enen Übergänge wird deutlich, dass es e<strong>in</strong>e enge entwicklungs- <strong>und</strong>lebensgeschichtliche Verflechtung zwischen e<strong>in</strong>em Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Umweltgibt. Durch das Berührtwerden durch die Welt um sich herum werden das Leben <strong>und</strong>die Persönlichkeit e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong> entscheiden<strong>der</strong> Weise geformt. Diesen
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 61Gr<strong>und</strong>gedanken als psychologische Theorie <strong>und</strong> vor allem <strong>mit</strong> wissenschaftstheoretischen<strong>und</strong> forschungsmethodischen Ableitungen darzustellen, ist <strong>der</strong>Versuch <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien.Person-Kontext-InteraktionstheorienWie <strong>der</strong> Name schon sagt, besteht das Hauptanliegen <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien (z.B. Magnusson, 2003; Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998) dar<strong>in</strong>, zuzeigen, dass e<strong>in</strong> Individuum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Umwelt e<strong>in</strong> untrennbares Ganzes bilden <strong>und</strong>e<strong>in</strong> Individuum daher nicht frei von se<strong>in</strong>em Kontext untersucht werden kann:„The <strong>in</strong>dividual is our ma<strong>in</strong> concern, but an <strong>in</strong>dividual’s development and ongo<strong>in</strong>gfunction<strong>in</strong>g are not isolated from the environment <strong>in</strong> which he or she lives. (…)Consequently, it is not possible to un<strong>der</strong>stand how social systems function withoutknowledge of <strong>in</strong>dividual function<strong>in</strong>g, and it is not possible to un<strong>der</strong>stand <strong>in</strong>dividualfunction<strong>in</strong>g and development without knowledge of the environment. The f<strong>und</strong>amentalimplication for future psychological research is that we have to change the object oftheoriz<strong>in</strong>g and empirical research from a context-free <strong>in</strong>dividual to a person who functionsand develops as an active part of an <strong>in</strong>tegrated, complex person-environment system.”(Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998, 686)Das Kernelement <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien liegt dabei im Konzepte<strong>in</strong>es holistischen Interaktionismus: Das Individuum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Umwelt bildenzusammen e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegriertes <strong>und</strong> dynamisches System, <strong>in</strong> welchem sowohl dasIndividuum als auch die Umwelt untrennbare Elemente darstellen. Der Begriff <strong>der</strong>Umwelt bzw. des Kontextes wird <strong>in</strong> diesem Zusammenhang als das gesamte,<strong>in</strong>tegrierte System def<strong>in</strong>iert, dem das Individuum angehört. Der Kontext besteht aushierarchischen Ebenen, von <strong>der</strong> Zelle bis zur Makroebene, die alle vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong>abhängen.„The general framework for the analysis (…) is that the <strong>in</strong>dividual functions and developsas an active part of an <strong>in</strong>tegrated person-environment system. This implies that thecentral issue for psychological theoriz<strong>in</strong>g and empirical research is not how the personand environment <strong>in</strong>teract as two separate parts that are of equal importance. It is how<strong>in</strong>dividuals, by their perceptions, thoughts, and feel<strong>in</strong>gs, function <strong>in</strong> relation to anenvironment that, to some extent, they have purposefully constructed, and how theseaspects of <strong>in</strong>dividual function<strong>in</strong>g develop through the course of an ongo<strong>in</strong>g <strong>in</strong>teractionprocess (Lerner & Busch-Rossnagel, 1981; Magnusson, 1990).” (Magnusson & Statt<strong>in</strong>,1998, 717)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 62„The <strong>in</strong>tegrated, holistic-<strong>in</strong>teractionistic nature of developmental processes implies,among other th<strong>in</strong>gs, that they proceed and develop as irreducible wholes and cannot bedecomposed <strong>in</strong>to or un<strong>der</strong>stood as <strong>in</strong>dependent components. At each stage of <strong>in</strong>dividualdevelopment, the totality gets its characteristic features and properties from the<strong>in</strong>teraction among the elements <strong>in</strong>volved, not from the effect of each isolated part on thetotality.” (Magnusson, 2003, 10f.)Zwischen Person <strong>und</strong> Umwelt besteht also e<strong>in</strong>e stetige Interaktion, die zurEntwicklung <strong>der</strong> Person <strong>und</strong> zur Ausformung <strong>der</strong> Umwelt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestalt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> siezum gegebenen Zeitpunkt wahrgenommen wird, beiträgt. Dabei laufen aufverschiedenen Ebenen dynamische Interaktionsprozesse ab: Dynamische Interaktionist gr<strong>und</strong>legendes Charakteristikum von a) Prozessen, die <strong>in</strong>nerhalb des Individuumsablaufen, b) Prozessen, die im System <strong>der</strong> Umwelt ablaufen sowie c) Prozessen desZusammenwirkens zwischen nahen <strong>und</strong> fernen Umweltfaktoren im Person-Kontext-System. Alle dynamischen Interaktionen zeichnen sich dabei durch Reziprozität <strong>und</strong>Nonl<strong>in</strong>earität aus.Die Umwelt wird folglich <strong>in</strong> diesem Bezugsmodell ausdrücklich nicht als e<strong>in</strong>e Variableverstanden, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> verschiedene Blickw<strong>in</strong>kel unterteilt: So wird zwischenobjektiver <strong>und</strong> subjektiver Umwelt unterschieden, wobei <strong>der</strong> subjektivenUmweltwahrnehmung des Individuums größeres Gewicht zugebilligt wird (”It isassumed that the ma<strong>in</strong> function of the environment <strong>in</strong> these processes is theenvironment as it is perceived and <strong>in</strong>terpreted by the <strong>in</strong>dividual.” Magnusson &Statt<strong>in</strong>, 1998, 706). Weiterh<strong>in</strong> werden im S<strong>in</strong>ne Bronfenbrenners nahe <strong>und</strong> ferneUmwelten unterschieden.Wenn Person <strong>und</strong> Umwelt ke<strong>in</strong>e Dichotomie, son<strong>der</strong>n eher e<strong>in</strong> Kont<strong>in</strong>uum bilden,dann können auch Untersuchungsvariablen auf diesem Kont<strong>in</strong>uum e<strong>in</strong>geordnetwerden: beispielsweise als hauptsächlich zur Person gehörend, als hauptsächlich zurUmwelt gehörend o<strong>der</strong> als sich auf <strong>der</strong> Grenze zwischen Person <strong>und</strong> Umweltbef<strong>in</strong>dend. In den Augen von Magnusson <strong>und</strong> Statt<strong>in</strong> stellen soziale Beziehungene<strong>in</strong>e Variable dar, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte des Person-Umwelt-Kont<strong>in</strong>uums liegt:„Historically, from Bowlby (1952) onward, developmentalists have employed terms thatfocus on the <strong>in</strong>terdependent, reciprocal character of social <strong>in</strong>teractions. (…) In theliterature, attachment and social support, for example, have been operationalized both asa status of the person and as a characteristic of the <strong>in</strong>terpersonal environment (cf., Lewis& Feir<strong>in</strong>g, 1991; Sarason, Sarason & Shear<strong>in</strong>, 1986).” (Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998, 702)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 63Die Gr<strong>und</strong>sätze <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien (Magnusson, 2003, 4)lassen sich also wie folgt zusammenfassen:• Das Individuum funktioniert <strong>und</strong> entwickelt sich als e<strong>in</strong> ganzer, <strong>in</strong>tegrierterOrganismus.• Funktionieren ist e<strong>in</strong> komplexer, dynamischer Prozess.• Individuelles Funktionieren <strong>und</strong> Entwicklung s<strong>in</strong>d, auf <strong>der</strong> Seite des Individuums,vom Prozess <strong>der</strong> ablaufenden, reziproken Interaktion zwischen mentalen,Verhaltens- <strong>und</strong> biologischen Strukturen, <strong>und</strong> auf <strong>der</strong> Umweltseite von <strong>der</strong>sozialen, kulturellen <strong>und</strong> physischen Interaktion bestimmt.• Die Umwelt, das Individuum <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>bezogen, funktioniert <strong>und</strong> verän<strong>der</strong>t sich <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em fortlaufenden Prozess reziproker Interaktion zwischen sozialen, ökonomischen<strong>und</strong> kulturellen Faktoren.• Person <strong>und</strong> Umwelt werden nicht getrennt gesehen, sie gehören zusammen(ganzheitliches Pr<strong>in</strong>zip).Die Person-Kontext-Interaktionstheorien <strong>in</strong>tegrieren da<strong>mit</strong> sowohl systemtheoretischeModelle als auch Modelle <strong>der</strong> zeitlichen Entwicklung (über die Lebensspanne) <strong>und</strong>formulieren sie <strong>in</strong> psychologischen Term<strong>in</strong>i, die forschungsmethodische Ableitungenzulassen (siehe folgen<strong>der</strong> Exkurs).EXKURS: Person-Kontext-Interaktionstheorien <strong>in</strong> psychologischer Forschung<strong>und</strong> WissenschaftWelche Schlussfolgerungen müssen aus den Thesen <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien für die psychologische Forschung gezogen werden?Das Verhalten e<strong>in</strong>es Menschen kann nicht untersucht werden, ohne situationaleBed<strong>in</strong>gungen <strong>mit</strong> zu erheben, unter denen es auftritt. Dementsprechend musspsychologische Forschung zwei Blickw<strong>in</strong>kel berücksichtigen: zum e<strong>in</strong>en den Fokusauf dem aktuellen Verhalten e<strong>in</strong>es Menschen, zum an<strong>der</strong>en den Fokus auf <strong>der</strong>Situation o<strong>der</strong> dem Kontext, <strong>in</strong> dem das Verhalten steht.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 64Aus Sicht <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionsforscher wurden allerd<strong>in</strong>gs dieUmweltfaktoren <strong>in</strong> <strong>der</strong> psychologischen Forschung bisher nur <strong>in</strong> ungenügendemMaße konzeptualisiert: „However, until recently, theoretical formulations concern<strong>in</strong>gthe role of environmental factors have had relatively little impact on the plann<strong>in</strong>g,implementation, and <strong>in</strong>terpretation of empirical research <strong>in</strong> psychology. Psychologyhas not developed a language of environments to the same extent that it hasdeveloped a language of behavior and personality.” (Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998,691)Das Schema von unidirektionaler Kausalität im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Reiz-Reaktions-Ablaufssollte <strong>in</strong> diesem Zusammenhang als überholt gelten, da es nicht die nötigeKomplexität besitzt, um anwendungspraktische Relevanz zu zeigen. Besser geeignets<strong>in</strong>d dafür <strong>in</strong>teraktionistische Theorien, <strong>der</strong>en Kernaussagen sich wie folgtzusammenfassen lassen: „(…) the classical <strong>in</strong>teractionistic formulations emphasizethat (a) an <strong>in</strong>dividual and his or her environment form a total system <strong>in</strong> which the<strong>in</strong>dividual functions as the active, purposeful agent; and (b) a ma<strong>in</strong> characteristic ofthe causal relations is reciprocity rather than unidirectionality.“ (Magnusson & Statt<strong>in</strong>,1998, 692)Dies kann <strong>in</strong> Studien umgesetzt werden, die statt e<strong>in</strong>es variablenbasierten e<strong>in</strong>personenbasiertes Vorgehen wählen (vgl. ‚Person Approach’ <strong>und</strong> ‚VariableApproach’, z.B. Magnusson, 2003) <strong>und</strong> die ihrem Untersuchungsdesign e<strong>in</strong> ‚MultiVariable Based Design’ zugr<strong>und</strong>e legen (“Because the <strong>in</strong>dividual and his or herenvironment at the highest level of generalization and analysis function as a total,<strong>in</strong>separable, organized system, the appropriate theoretical and empirical analysis atthat level should <strong>in</strong>clude analyses <strong>in</strong> terms of patterns of personal and environmentalvariables, assessed simultaneously.“ Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998, 73). Außerdemsollten sie e<strong>in</strong> Längsschnittdesign auswählen <strong>und</strong> kulturübergreifend untersuchen.Diese For<strong>der</strong>ungen setzen jedoch die Messlatte für psychologisches Forschen sohoch, dass e<strong>in</strong>wandfreies Forschen im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien<strong>in</strong> den meisten Fällen nicht möglich se<strong>in</strong> wird, sei es aus Zeit-, Budget- o<strong>der</strong>Motivationsgründen.
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 65Folgerungen aus Person-Kontext-Interaktionstheorien lassen sich auch für dieGeneralisierbarkeit von wissenschaftlichen Untersuchungen ableiten:• Ergebnisse, die mögliche Wirkungsfaktoren im Entwicklungsprozess betreffen,können nicht über Altersebenen generalisiert werden, ohne dass genaueÜberlegungen über den Charakter des Phänomens, das untersucht wird,angestellt worden s<strong>in</strong>d.• Ergebnisse können nicht von e<strong>in</strong>er Analysee<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e übertragenwerden.• Ergebnisse, die mögliche Faktoren be<strong>in</strong>halten, die sich auf e<strong>in</strong>en Kontextauswirken, können nicht ohne weiteres auf e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Kontext übertragenwerden.• Ergebnisse, die die Rolle bestimmter Faktoren untersuchen, welche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erGeneration wirken, können nicht auf an<strong>der</strong>e Generationen, unabhängig von <strong>der</strong>Natur <strong>der</strong> Strukturen <strong>und</strong> Prozesse, übertragen werden.Es wird im Verlauf dieser Arbeit deutlich werden, dass e<strong>in</strong>ige dieser E<strong>in</strong>schränkungengroße Auswirkungen auf die Interpretierbarkeit <strong>und</strong> Generalisierbarkeit vonForschungsergebnissen haben, die im Bereich von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> bestehen. Dortwerden Studienergebnisse momentan oft noch alters- <strong>und</strong> kontextübergreifendgeneralisiert <strong>und</strong> das Phänomen e<strong>in</strong>er sich gesellschaftlich stark verän<strong>der</strong>nden Kulturim Umgang <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> wird nicht ausreichend <strong>in</strong> die Analyse älterer <strong>und</strong>aktueller Forschungsergebnisse e<strong>in</strong>bezogen.Werden jedoch die e<strong>in</strong>schränkenden o<strong>der</strong> versteckten Gesetzmäßigkeiten imuntersuchten System nicht erkannt, so kommt es zum sog. Butterfly-Effekt.Retrospektiver Namensgeber dieses Effekts war Po<strong>in</strong>caré, <strong>der</strong> ihn für diephysikalische Forschung folgen<strong>der</strong>maßen formulierte: „A very small cause, whichescapes us, determ<strong>in</strong>es a consi<strong>der</strong>able effect we cannot help see<strong>in</strong>g, and then wesay that the effect is due to chance. (…) it may happen that slight differences <strong>in</strong> the<strong>in</strong>itial conditions produce very great differences <strong>in</strong> the f<strong>in</strong>al phenomena; a slight error<strong>in</strong> the former would make en enormous error <strong>in</strong> the latter.” (Po<strong>in</strong>caré, 1946; vgl.Heijden, 2006, 2)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 66<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> aus <strong>in</strong>tegrativer SichtDie Verflechtung von Mensch <strong>und</strong> Welt kann also nicht aufgelöst werden, ohne e<strong>in</strong>enButterfly-Effekt zu erzeugen. Der Versuch, diese Verb<strong>in</strong>dung zu lösen <strong>und</strong> soziale<strong>Ressourcen</strong> als eigenständiges, unabhängiges Konzept zu betrachten, käme demVersuch gleich, e<strong>in</strong>en Strang aus e<strong>in</strong>em Hefezopf lösen <strong>und</strong> danach immer noche<strong>in</strong>en Hefezopf vor sich haben zu wollen. Der Hefezopf wird erst durch drei Strängedas, was er ist. Die folgenden Modelle bauen auf diesem <strong>in</strong>tegrativen Verständnisauf <strong>und</strong> können deshalb die Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Konzeption sozialer <strong>Ressourcen</strong> bilden.“Persons can be consi<strong>der</strong>ed be<strong>in</strong>gs-<strong>in</strong>-relationship.“ (Sulmasy, 2002, 24) DerPhilosoph Bernard Lonergan (1958) argumentierte, dass unser Wissen über die Welt<strong>und</strong> uns selbst aus „Be-Griffenem“ besteht <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> aus e<strong>in</strong>em komplexen Set vonBeziehungen all dessen, was gegriffen wird. In diesem Bezugssystem wird dieBeziehung als die Gr<strong>und</strong>variable des Menschen gesehen: Der Mensch wird zu e<strong>in</strong>emKnoten- <strong>und</strong> Kristallisationspunkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Netz von unendlich vielen Möglichkeiten,die die ihn umgebende Welt darstellt. Sulmasy (2002) drückte, diesem<strong>in</strong>teraktionellen Gr<strong>und</strong>gedanken entsprechend, die Vorgänge um den Menschen <strong>in</strong>Beziehungsterm<strong>in</strong>i aus. Es entstand folgendes Modell:I. Intrapersonal:A. Physical relationships of body parts, organs, physiological, and biochemicalprocessesB. M<strong>in</strong>d-body relationships – multiple relationships between and among symptoms,moods, cognitive un<strong>der</strong>stand<strong>in</strong>gs, mean<strong>in</strong>gs, and the person’s physical state.II. Extrapersonal:A. Relationship with the physical environmentB. Relationship with the <strong>in</strong>terpersonal environment – family, friends, communities,political or<strong>der</strong>C. Relationship with the transcendentAbbildung 2: Beziehungsmodell nach Sulmasy (2002)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 67Die Stärke dieses Modells ist <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er konsequenten Veranschaulichung desMenschen <strong>in</strong> Beziehungsterm<strong>in</strong>i zu sehen. Jedoch trennt auch Sulmasy <strong>in</strong>trapersonal<strong>und</strong> extrapersonal als zwei Bereiche vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ab, ohne die Verflechtung o<strong>der</strong>entsprechende Rückkopplungsbeziehungen zwischen ihnen deutlich zu machen.Aus e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Perspektive nähert sich Belschner (2002, 2004, 2005b) diesemPhänomen an. In <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> Bewusstse<strong>in</strong>sforschung stehend geht er davonaus, dass jegliche Wahrnehmung e<strong>in</strong>es Menschen dem Bewusstse<strong>in</strong>szustandunterliegt, <strong>in</strong> welchem er sich <strong>in</strong> jenem Moment bef<strong>in</strong>det. Es kann dabei beispielsweisezwischen Alltags- <strong>und</strong> Außeralltagsbewusstse<strong>in</strong> unterschieden werden. Derallgeme<strong>in</strong>e Konsens, sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesellschaftlichen Wahrnehmung als auch imüberwiegenden Gros wissenschaftlicher Forschung, liegt dabei auf demAlltagsbewusstse<strong>in</strong> (o<strong>der</strong> algorithmische Präsenz), das sich durch fünf Kriterien desVerständnisses von Wirklichkeit auszeichnet: Zeit, Raum, Kausalität, Subjekt-Objekt-Relation sowie Ich-Organisation (Belschner, 2005a, 2005b). Im Zustand desAlltagsbewusstse<strong>in</strong>s stellt sich die Subjekt-Objekt-Relation, also <strong>der</strong> Bezug zwischenwahrnehmendem Menschen <strong>und</strong> wahrgenommener Welt, als e<strong>in</strong> Zustand desGetrenntse<strong>in</strong>s dar. Es gibt <strong>in</strong> diesem Zustand e<strong>in</strong>en qualitativen Unterschiedzwischen wahrnehmendem Ich <strong>und</strong> <strong>der</strong> Welt. Verän<strong>der</strong>t sich jedoch <strong>der</strong>Bewusstse<strong>in</strong>szustand, z.B. durch Meditationspraxis (vgl. dazu bspw. Jäger, 1992,2000) o<strong>der</strong> durch die <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem <strong>Tod</strong> (vgl. dazu bspw. Lev<strong>in</strong>e, 1997a,1997b), <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er nondualen Präsenz, verschw<strong>in</strong>det diese sche<strong>in</strong>bareTrennung: Mensch <strong>und</strong> Welt werden als E<strong>in</strong>heit wahrgenommen, die nicht trennbarist.„Es gibt ke<strong>in</strong>e Trennung von Subjekt <strong>und</strong> Umwelt; son<strong>der</strong>n es wird e<strong>in</strong>e umfassendeVerb<strong>und</strong>enheit <strong>und</strong> E<strong>in</strong>heit erlebt; es gibt nicht mehr das Gegenüber von Ich <strong>und</strong>Umwelt.“ (Belschner, 2004, 169f.)„Da<strong>mit</strong> (<strong>mit</strong> dem Term<strong>in</strong>us Verb<strong>und</strong>enheit, Anm. d. Verf.) ist die Grun<strong>der</strong>fahrung geme<strong>in</strong>t,dass e<strong>in</strong>e Trennung zwischen Ich <strong>und</strong> Welt, zwischen mir <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en immer bis zue<strong>in</strong>em gewissen Grade künstlich <strong>und</strong> willkürlich ist. Dass diese Aussage re<strong>in</strong> faktischwahr ist, ergibt schon e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme <strong>der</strong> Abhängigkeiten, <strong>in</strong> denen jeglicheExistenz von Leben steht (Thich Nhat Hanh, 1999).“ (Walach, 2001, 65)Hier wird die Verb<strong>und</strong>enheit als menschliche Grun<strong>der</strong>fahrung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bewusstse<strong>in</strong>stheoretischenKontext dargestellt. Im Gegensatz zu <strong>der</strong> Konzeption von
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 68Sulmasy (2002) ist im Konzept <strong>der</strong> Verb<strong>und</strong>enheit die Trennung von Person <strong>und</strong> Weltkonsequent aufgehoben. Die Psychologie des Bewusstse<strong>in</strong>s selbst kann durchausals Metatheorie im zuvor verwendeten S<strong>in</strong>ne bezeichnet werden <strong>und</strong> den Person-Kontext-Interaktionstheorien gegenüber gestellt werden. Da dies nicht im Fokusdieser Arbeit steht, wird darauf hier verzichtet.Aus <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie speist sich die Modellbildung <strong>in</strong> denTerm<strong>in</strong>i von Abhängigkeit <strong>und</strong> Autonomie. Die Verflechtung des autonomenMenschen <strong>mit</strong> <strong>der</strong> ihn umgebenden Welt <strong>in</strong> sozialen Beziehungen wird hier <strong>mit</strong> demBegriff <strong>der</strong> ‚Interdependence’ (Verb<strong>und</strong>enheit) (Markus & Kitayama, 1991) belegt:„A new label to encompass both agency and attachment or <strong>in</strong>dependence anddependency is fo<strong>und</strong> <strong>in</strong> the term <strong>in</strong>terdependence.” (Baltes & Silverberg, 1994, 65)Verb<strong>und</strong>enheit wird konzeptualisiert als stetige Kette von gegenseitigem E<strong>in</strong>fluss immenschlichen Kontakt. Der Zustand <strong>der</strong> Verb<strong>und</strong>enheit repräsentiert dabei e<strong>in</strong>Gleichgewicht von Abhängigkeit <strong>und</strong> Unabhängigkeit <strong>in</strong> dieser Beziehung. Baltes &Silverberg (1994) beschreiben diese wechselseitige Kaskade: „…a highly developed<strong>in</strong>dividuality (autonomy) automatically encompasses a highly developed sense ofcar<strong>in</strong>g and respect for others.“ (65)Bisher wurde <strong>der</strong> Aspekt des Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie des Erwachsenenaltersüberwiegend zugunsten e<strong>in</strong>er Betonung von Autonomie im S<strong>in</strong>ne vonSelbständigkeit, Getrenntheit <strong>und</strong> Alle<strong>in</strong>se<strong>in</strong> ausgeblendet (Gilligan, 1988, Josselson,1988, zit. n. Baltes & Silverberg, 1994). Baltes & Silverberg wehren sich gegen diesee<strong>in</strong>seitige Betrachtungsweise <strong>und</strong> betonen die für den Menschen för<strong>der</strong>licheVerb<strong>in</strong>dung von Individualität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit (<strong>in</strong>dividuality and relatedness):„In accord with contemporary scholarship <strong>in</strong> this doma<strong>in</strong>, we un<strong>der</strong>score (…) thatdependency, when consi<strong>der</strong>ed <strong>in</strong> its diverse expressions, as there are <strong>in</strong> attachment,social connection, <strong>in</strong>terdependence, and reciprocity, is not necessarily an obstacle to behurdled and outgrown – an antagonist to optimal function<strong>in</strong>g – but is vital to humangrowth and well-be<strong>in</strong>g.“ (Baltes & Silverberg, 1994, 42)Allerd<strong>in</strong>gs weist Trommsdorff (1999) darauf h<strong>in</strong>, dass Autonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheithäufig fälschlicherweise vere<strong>in</strong>facht als Gegensatz bzw. als gegensätzliche Endene<strong>in</strong>er Dimension verstanden werden. In ihrer kulturvergleichenden Untersuchung zu
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 69Sozialisationsbed<strong>in</strong>gungen von japanischen <strong>und</strong> deutschen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zeigt sie, dassAutonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit kulturspezifisch unterschiedliche Funktionen haben:„Deutlich erkennbar ist jedoch, dass Autonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit ke<strong>in</strong>eswegs sichausschließende gegensätzliche Sozialisations- <strong>und</strong> Entwicklungsphänomene s<strong>in</strong>d,son<strong>der</strong>n vielmehr <strong>in</strong> den verschiedensten Kulturen sich gegenseitig ergänzende <strong>und</strong>teilweise unterschiedlich gewichtige Funktionen für die <strong>in</strong>dividuelle Entwicklung <strong>und</strong>soziales Handeln haben.“ (Trommsdorff, 1999, 414)Sie kommt zu <strong>der</strong> Schlussfolgerung, dass Autonomie e<strong>in</strong>en Pol <strong>der</strong> DimensionHandlungsorientierung darstellt, <strong>der</strong>en an<strong>der</strong>er Pol <strong>mit</strong> Abhängigkeit überschriebenwerden kann. Verb<strong>und</strong>enheit h<strong>in</strong>gegen stellt e<strong>in</strong>en Endpunkt <strong>der</strong> Beziehungsdimensiondar, <strong>der</strong>en an<strong>der</strong>er Endpunkt <strong>mit</strong> Distanz zu bezeichnen ist.Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> tut sich e<strong>in</strong>e neue Betrachtungsweise auf, die e<strong>in</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>Umfeld e<strong>in</strong>gebettetes Selbst, e<strong>in</strong> ‚Embedded Self’, <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> stellt. DieBalance zwischen Abhängigkeit <strong>und</strong> Autonomie verän<strong>der</strong>t sich dabei ständig im Zuge<strong>der</strong> persönlichen Entwicklung, <strong>der</strong> Umweltgegebenheiten, <strong>der</strong> Zeit, <strong>der</strong> kulturellen<strong>und</strong> gesellschaftlichen Werte, Erwartungen <strong>und</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen:„The nature of dependency and autonomy transform over the life span and the balancebetween the two may shift; nonetheless, simultaneously with <strong>in</strong>creased self-reliance anda sense of agency comes the development of a social sense of self – a realization thatthe self does not stand alone – as well as the un<strong>in</strong>terrupted need for social connection,whether that be <strong>in</strong> the form of attachment, <strong>in</strong>timacy, <strong>in</strong>terdependence, or generativity.“(Baltes & Silverberg, 1994, 43)Bislang existiert noch wenig Forschung zu Autonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit imErwachsenenalter. Es herrscht großenteils die Lehrme<strong>in</strong>ung, dass Abhängigkeit imfrühen K<strong>in</strong>desalter im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> B<strong>in</strong>dung s<strong>in</strong>nvoll sei, jedoch im Laufe <strong>der</strong>Adoleszenz durch Autonomie <strong>und</strong> Unabhängigkeit von <strong>der</strong> Umwelt zu ersetzen sei(vgl. Theorie zur Entwicklung des moralischen Urteils, Kohlberg 1964; Theorie <strong>der</strong>Identitätsentwicklung, Erikson 1988), bis im höheren Alter durch schw<strong>in</strong>dende Kräftewie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zustand <strong>der</strong> sozialen Abhängigkeit e<strong>in</strong>trete. Baltes <strong>und</strong> Silverberg (1994,64) beklagen <strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Betonung <strong>der</strong> Abhängigkeit im höherenAlter auf Kosten <strong>der</strong> Autonomie des alten Menschen:„Given the <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>g negative balance between ga<strong>in</strong>s and losses (Baltes, 1987),<strong>in</strong>creas<strong>in</strong>g biological vulnerability, and the major developmental task <strong>in</strong>volv<strong>in</strong>g theaccceptance of one’s f<strong>in</strong>ality, both social <strong>in</strong>tegration and personal autonomy seem ofutmost importance. In other words, both security provided by a supportive environmentand autonomy fostered by a stimulat<strong>in</strong>g environment are necessary for the el<strong>der</strong>lyperson’s well-be<strong>in</strong>g.” (Baltes & Silverberg, 1994, 70)
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 70Die e<strong>in</strong>zige psychologische Studie, die sich <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Bedeutung von Autonomie <strong>und</strong>Verb<strong>und</strong>enheit für Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte beschäftigt, kommt vonBode, Westerhof & Dittmann-Kohli (2001). Sie halten bereits zu Beg<strong>in</strong>n fest:„Individualität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit s<strong>in</strong>d zentrale Lebensthemen im gesamten Lebenslauf,über <strong>der</strong>en Bedeutung für Personen im <strong>mit</strong>tleren <strong>und</strong> höheren Erwachsenenalter jedochwenig bekannt ist.“ (Bode et al., 2001, 365)Im Rahmen ihrer Studie zur Bedeutung von Autonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit fürMenschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte f<strong>in</strong>den sie bei <strong>der</strong> Auswertung desSatzergänzungsverfahrens von 2943 ProbandInnen neben <strong>in</strong>haltlichen Anliegen, dieauf Individualität ausgerichtet s<strong>in</strong>d (Wohlbef<strong>in</strong>den/Entspannung, Kontroll- <strong>und</strong>Bee<strong>in</strong>flussungsmöglichkeiten, Leistung/Ziele, Persönliche Unabhängigkeit/Selbstbehauptung,Selbstreflexion/Selbstbewusstse<strong>in</strong>, eigene Projekte/Aktivitäten) auche<strong>in</strong>e Vielzahl von Anliegen, die <strong>mit</strong> Verb<strong>und</strong>enheit <strong>in</strong> Zusammenhang stehen:Gesellschaft/Nation, soziale Eigenschaften <strong>der</strong> Befragten, Kontakt/bestimmteBeziehungen, transpersonal, soziales Verhalten an<strong>der</strong>er, geme<strong>in</strong>sameProjekte/Aktivitäten, Beziehungsqualität. Die AutorInnen stellen fest, dass fastebenso viele TeilnehmerInnen <strong>der</strong> Befragung ihre Selbstbeschreibungen auf dasLeben o<strong>der</strong> die Lebensweise von Nahestehenden beziehen.„In diesen Aussagen wird die Relevanz von Verb<strong>und</strong>enheit für die Selbstdef<strong>in</strong>ition sehrdeutlich. Durch die Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> Nahestehenden wird die eigene Person auf e<strong>in</strong>eWeise def<strong>in</strong>iert, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sie nicht mehr als abgegrenzte Entität ersche<strong>in</strong>t.“ (Bode et al.,2001, 371)Die Studie stellt fest, dass es sich bei Individualität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit um gleichwichtige Aspekte des persönlichen S<strong>in</strong>nsystems <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte handelt.Die AutorInnen kommen entsprechend zu <strong>der</strong> Schlussfolgerung, dass „ (…) Theorienüber psychologisches Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> erfolgreiches Altern nach unserenErgebnissen zu stark <strong>in</strong>dividualitätsgerichtet s<strong>in</strong>d. Die Untersuchung vonSelbstvorstellungen verdeutlicht, dass <strong>der</strong> S<strong>in</strong>ngebung durch Verb<strong>und</strong>enheit mehrRaum zugebilligt werden sollte.“ (Bode et al., 2001, 375) E<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> dieumgebende Welt zu se<strong>in</strong>, ist demnach von zentraler Bedeutung für die Menschen;dies ist <strong>in</strong> psychologischen Theorien aber nicht entsprechend repräsentiert:„E<strong>in</strong> Vergleich unserer Bef<strong>und</strong>e (bezüglich Zentralität <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltlicher Anliegen) <strong>mit</strong>Annahmen gängiger Theorien psychologischen Wohlbef<strong>in</strong>dens im Erwachsenenalter un<strong>der</strong>folgreichen Alterns zeigt, dass die Selbstvorstellungen <strong>der</strong> Deutschen zwischen 40 <strong>und</strong>
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 7185 Jahren viel stärker auf Verb<strong>und</strong>enheitsaspekte gerichtet s<strong>in</strong>d, als <strong>in</strong> den theoretischenVorstellungen postuliert wird.“ (Bode, Westerhof & Dittmann-Kohli, 2001, 365)Die theoriegeleiteten Ausführungen dieses Kapitels haben gezeigt, dass dieAnnahme von Mensch <strong>und</strong> Umwelt als vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> unabhängige Systeme nichthaltbar ist, son<strong>der</strong>n dass e<strong>in</strong> Mensch <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e soziale Umwelt e<strong>in</strong>e untrennbareE<strong>in</strong>heit bilden. Individualität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit stellen so<strong>mit</strong> ke<strong>in</strong>e Antagonisten,son<strong>der</strong>n notwendige Bestandteile e<strong>in</strong>es Phänomens dar, nämlich <strong>der</strong> E<strong>in</strong>bettunge<strong>in</strong>es handelnden <strong>und</strong> erlebenden Menschen <strong>in</strong> die ihn umgebende Welt. E<strong>in</strong>ePerson <strong>und</strong> ihre sozialen Beziehungen bilden aus diesem Blickw<strong>in</strong>kel gesehen e<strong>in</strong>Ganzes.E<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrative Sicht auf die Beziehung von Mensch <strong>und</strong> Welt <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> auf dieKonzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> kann aus metatheoretischen Modellenabgeleitet werden: Bronfenbrenner stellt im systemtheoretischen Modell den Versuchdar, das Denken <strong>in</strong> l<strong>in</strong>earen <strong>und</strong> unifaktoriellen Kausalitäten aufzugeben. Imökosystemischen Ansatz erstellt er e<strong>in</strong>e Systematik des komplexen Zusammenspielsverschiedener Ebenen (Mikro-, Meso-, Exo-, Makro-, Chronosystem). So stellt er dasZusammenspiel zwischen Systemen <strong>und</strong> den Übergang von Menschen aus e<strong>in</strong>emSystem <strong>in</strong> e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Aus El<strong>der</strong>s entwicklungspsychologischorientiertem Modell <strong>der</strong> ‚Life Stages’ <strong>und</strong> <strong>der</strong> da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>enen Übergänge wirddeutlich, dass es e<strong>in</strong>e enge entwicklungs- <strong>und</strong> lebensgeschichtliche Verflechtungzwischen e<strong>in</strong>em Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Umwelt gibt. Durch das Berührtwerden durchdie Welt um sich herum werden das Leben <strong>und</strong> die Persönlichkeit e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong>entscheiden<strong>der</strong> Weise geformt. Die Basis <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorienbildet das Konzept des holistischen Interaktionismus: Das Individuum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>eUmwelt bilden zusammen e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegriertes <strong>und</strong> dynamisches System, <strong>in</strong> welchemsowohl das Individuum als auch die Umwelt untrennbare Elemente darstellen.Zwischen Person <strong>und</strong> Umwelt besteht also e<strong>in</strong>e stetige Interaktion, die zurEntwicklung <strong>der</strong> Person <strong>und</strong> zur Ausformung <strong>der</strong> Umwelt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestalt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> siezum gegebenen Zeitpunkt wahrgenommen wird, beiträgt. Die Umwelt wird folglich <strong>in</strong>
Kapitel 3 – Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen II: <strong>Ressourcen</strong> im sozialen Raum 72diesem Bezugsmodell ausdrücklich nicht als e<strong>in</strong>e Variable verstanden, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong>verschiedene Blickw<strong>in</strong>kel unterteilt: So wird zwischen objektiver <strong>und</strong> subjektiverUmwelt unterschieden, wobei <strong>der</strong> subjektiven Umweltwahrnehmung des Individuumsgrößeres Gewicht zugebilligt wird. Die Person-Kontext-Interaktionstheorien<strong>in</strong>tegrieren da<strong>mit</strong> sowohl systemtheoretische Modelle als auch Modelle <strong>der</strong> zeitlichenEntwicklung (über die Lebensspanne).Diese metatheoretische Basis <strong>der</strong> Mensch-Welt-Beziehung lässt verschiedeneAbleitungen für Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> zu, welche die untrennbareVerflechtung e<strong>in</strong>es Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er (sozialen) Umwelt <strong>in</strong> den Mittelpunktstellen: Sulmasy (2002) drückt die Vorgänge um den Menschen <strong>in</strong> Beziehungsterm<strong>in</strong>iaus. Se<strong>in</strong> Modell stellt den Menschen als Summe <strong>in</strong>trapersonaler <strong>und</strong>extrapersonaler Beziehungen dar. Belschner (2005a, 2005b) begründetunterschiedliche Modi des Mensch-Welt-Bezugs <strong>in</strong> <strong>der</strong> Modellierungunterschiedlicher Bewusstse<strong>in</strong>szustände. So wird im Zustand desAlltagsbewusstse<strong>in</strong>s die Subjekt-Objekt-Relation als e<strong>in</strong> Zustand des Getrenntse<strong>in</strong>swahrgenommen. Es gibt <strong>in</strong> diesem Zustand e<strong>in</strong>en qualitativen Unterschied zwischenwahrnehmendem Ich <strong>und</strong> <strong>der</strong> Welt. Verän<strong>der</strong>t sich jedoch <strong>der</strong> Bewusstse<strong>in</strong>szustand<strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er nondualen Präsenz, verschw<strong>in</strong>det diese sche<strong>in</strong>bare Trennung <strong>und</strong>Mensch <strong>und</strong> Welt werden als E<strong>in</strong>heit wahrgenommen, die nicht trennbar ist.Entwicklungspsychologisch basierte Modelle stellen die Beziehung zwischen e<strong>in</strong>emMenschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er sozialen Welt <strong>in</strong> den Term<strong>in</strong>i von Autonomie, Abhängigkeit <strong>und</strong>Verb<strong>und</strong>enheit (‚Interdependence’) dar. Dabei handelt es sich bei Autonomie <strong>und</strong>Verb<strong>und</strong>enheit nicht um e<strong>in</strong> Gegensatzpaar, son<strong>der</strong>n um Pole unterschiedlicherDimensionen.Diese Modelle stellen, <strong>in</strong> unterschiedlichen psychologischen Traditionen begründet<strong>und</strong> konzeptualisiert, e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gebettetes Selbst (‚Embedded Self’) dar, das <strong>in</strong>unlösbarer Verflechtung <strong>mit</strong> se<strong>in</strong>er sozialen Welt steht; die sozialen Interaktionens<strong>in</strong>d folglich von e<strong>in</strong>er vielschichtigen Dimensionalität gekennzeichnet. Mensch <strong>und</strong>Um-Welt werden <strong>in</strong> diesen Modellen nicht als vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> unabhängige Systeme,son<strong>der</strong>n als <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verb<strong>und</strong>ene Systeme o<strong>der</strong> als e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames,holistisches System konzipiert.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 734. Perspektiven <strong>der</strong> Studie: <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>4.1. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen für sterbende PatientInnen<strong>Soziale</strong> <strong>und</strong> physiologische Parameter bei sterbenden PatientInnen<strong>Soziale</strong> Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> MenschenDie beson<strong>der</strong>e Situation <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung im Sterbeprozess4.2. <strong>Soziale</strong> Beziehungen zwischen kritisch kranken PatientInnen <strong>und</strong> AngehörigenDer enge Zusammenhang zwischen Patient <strong>und</strong> Bezugsperson<strong>Soziale</strong> Belastung von Angehörigen4.3. Die Situation von Menschen, die sterbende Menschen professionell betreuenExkurs: Anfor<strong>der</strong>ungen an professionelle SterbebegleitungBeanspruchung durch die Arbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> SterbebegleitungUnterstützung <strong>der</strong> UnterstützendenIn den theoriegeleiteten Ausführungen wurde deutlich, dass die <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong><strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>e Grenzerfahrung für den betreffenden Menschen darstellt. DiesesKrisenerleben birgt <strong>in</strong> sich sowohl Gefahr <strong>und</strong> Bedrohung für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong>Wohlbef<strong>in</strong>den wie auch die Chance auf Überw<strong>in</strong>dung, Wachstum <strong>und</strong> Resilienz.Dabei können <strong>Ressourcen</strong> dazu verhelfen, die Chance <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise wahrzunehmen(Kapitel 2 – <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>).Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf <strong>der</strong> Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong>, dieMenschen nutzen können. Die gängigen Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> erweisensich als heterogen <strong>und</strong> bereichsspezifisch begrenzt (Kapitel 3.2. – Grenzen <strong>der</strong>gängigen Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>), so dass <strong>in</strong>tegrative Modelle eher<strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage zu se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>en, e<strong>in</strong>e angemessene, theoretische Konzeption sozialer<strong>Ressourcen</strong> zur Verfügung zu stellen (Kapitel 3.3. – Modelle für die <strong>in</strong>tegrative <strong>und</strong><strong>in</strong>teraktionale Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>).Werden diese beiden Blickw<strong>in</strong>kel nun übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gelegt, so entstehenforschungsleitende Fragen: Welche sozialen <strong>Ressourcen</strong> stehen kritisch kranken <strong>und</strong>sterbenden PatientInnen zur Verfügung? Wie zeigt sich die Beziehung zu ihrenAngehörigen als Unterstützer <strong>und</strong> Unterstützte <strong>in</strong> dieser Krisenphase? Und <strong>in</strong>
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 74welcher Lage bezüglich sozialer <strong>Ressourcen</strong> bef<strong>in</strong>den sich Professionelle, die <strong>in</strong>ihrem Arbeitsalltag eng <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> konfrontiert werden?Das durch Forschungsstudien generierte (<strong>in</strong>duktive) Wissen darüber, auf welche Artsoziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> genutzt werden können, istbegrenzt <strong>und</strong> teilweise une<strong>in</strong>heitlich. Im Folgenden wird <strong>in</strong>nerhalb dieses Kapitels,welches e<strong>in</strong>en Überblick über die aktuelle Forschungslage gibt, deshalb zuerst fürPatientInnen, dann für ihre Angehörigen <strong>und</strong> schließlich für professionell Betreuendee<strong>in</strong> Überblick darüber gegeben, welche Gestalt <strong>und</strong> Auswirkungen soziale<strong>Ressourcen</strong> im Sterbeprozess haben. Da manche Teilbereich gut beforscht s<strong>in</strong>d,wird dort jeweils e<strong>in</strong>e Studie stellvertretend genannt.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 754.1. Bedeutung sozialer Beziehungen für sterbende PatientInnenDas Institute of Medic<strong>in</strong>e, Wash<strong>in</strong>gton DC, berichtet, dass lückenhafte Kenntnissedarüber existieren, wie Menschen <strong>in</strong> den USA ihre letzten Lebensmonate <strong>und</strong> ihr<strong>Sterben</strong> erfahren (Marwick, 2003). Die meisten Sterblichkeitsstudien seienKorrelationsstudien (z.B. Zusammenhang zwischen Risikofaktoren <strong>und</strong> Sterblichkeit).Was aber vonnöten sei, sei e<strong>in</strong> besseres Verständnis des Sterbeprozesses <strong>und</strong> nichte<strong>in</strong> besseres Verständnis <strong>der</strong> Faktoren, die den Sterbeprozess h<strong>in</strong>auszuzögernsche<strong>in</strong>en:„A substantial number of people experience needless suffer<strong>in</strong>g and distress at the end oflife. This can be due to <strong>in</strong>appropriate or unwanted care or to the un<strong>der</strong>use of effectivemeasures, such as reliev<strong>in</strong>g pa<strong>in</strong>.” (Marwick, 2003, 784)Diese E<strong>in</strong>schätzung kennzeichnet auch die Situation <strong>der</strong> Forschung im deutschenRaum. Es lassen sich zwar Forschungsbemühungen <strong>und</strong> Studien verzeichnen, aberihr Fokus ist meist sehr e<strong>in</strong>geschränkt, so dass nur reduzierte Aussagen über e<strong>in</strong>enengen Bereich h<strong>in</strong>aus getroffen werden können. In <strong>der</strong> Forschung an <strong>und</strong> <strong>mit</strong>sterbenden Menschen dom<strong>in</strong>ieren generell mediz<strong>in</strong>isch geprägte Studien, diephysiologische Parameter <strong>in</strong> den Mittelpunkt stellen. Im Bereich <strong>der</strong> psychologischenForschung bilden Studien zu Bedürfnissen, Wünschen <strong>und</strong> Lebensqualität vonsterbenden PatientInnen e<strong>in</strong>en deutlichen Schwerpunkt. E<strong>in</strong> Zweig thanatologischerForschung beschäftigt sich <strong>mit</strong> <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Situation des Sterbeprozesses vonMenschen. Im Folgenden wird e<strong>in</strong> Überblick darüber gegeben, welches Wissen <strong>in</strong>diesen E<strong>in</strong>zelsträngen <strong>der</strong> Forschung über das Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>in</strong> sozialen Netzengewonnen wurde.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 76<strong>Soziale</strong> <strong>und</strong> physiologische Parameter bei sterbenden PatientInnenE<strong>in</strong>ige groß angelegte Studien beschäftigen sich <strong>mit</strong> E<strong>in</strong>flussfaktoren aufLebenserwartung <strong>und</strong> Sterblichkeit (vgl. im deutschen Sprachraum den Berl<strong>in</strong>erAlterssurvey BASE; B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie Senioren Frauen <strong>und</strong> Jugend,2001; Maier & S<strong>mit</strong>h, 1999). Dabei zeigt sich, dass E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> das soziale Umfelde<strong>in</strong>en prognostizierenden Faktor für Ges<strong>und</strong>heit, Krankheit <strong>und</strong> Sterblichkeit darstellt(vgl. bspw. Bickel, H., 1998; Pruchno & Rosenbaum, 2003, 491). Da<strong>mit</strong>e<strong>in</strong>hergehend belegen auch Weisman & Worden (1975), dass PatientInnen, dieaktive <strong>und</strong> gegenseitige, zwischenmenschliche Beziehungen unterhielten, bei Krebslänger überlebten als Menschen <strong>mit</strong> wenigen persönlichen Kontakten. Rie<strong>der</strong> (1984)stellt fest, dass nach E<strong>in</strong>weisung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Pflegeheim die Überlebensraten <strong>der</strong> ersten12 Monate bei 54% bei Verwitweten lagen, bei 64% bei Ledigen, jedoch bei 26% beiVerheirateten. Er argumentiert, dass für Verheiratete die Aufnahme <strong>in</strong> e<strong>in</strong>ePflegee<strong>in</strong>richtung am e<strong>in</strong>schneidendsten ist, denn sie br<strong>in</strong>gt die Trennung vomEhepartner <strong>mit</strong> sich, d.h. den Verlust e<strong>in</strong>er engen Bezugsperson. Und Kle<strong>in</strong> et al.(Kle<strong>in</strong>, T., Löwel, Schnei<strong>der</strong> & Zimmermann, 2002) zeigen <strong>in</strong> ihrer Studie auf, dasssoziale Beziehungen e<strong>in</strong>en mortalitätssenkenden Effekt aufweisen, <strong>der</strong> unabhängigvon Stress bzw. sozialer Belastung ist. Aus ihrer eigenen Arbeit <strong>und</strong> <strong>der</strong> Übersichtüber an<strong>der</strong>e Studien schlussfolgern sie: ”Der mortalitätssenke E<strong>in</strong>fluss sozialerNetzwerke ist empirisch vielfach belegt.” (Kle<strong>in</strong> et al, 2002, 441)Da körperliche Schmerzen e<strong>in</strong>en großen Belastungsfaktor für die Patient<strong>in</strong> währenddes Sterbeprozesses darstellen, beschäftigen sich e<strong>in</strong>ige Studien <strong>mit</strong> denKomponenten des Schmerzgeschehens. Student (1989a, 60ff.) hält vierDimensionen des Schmerzes fest: die körperliche Dimension, die soziale Dimension(Schmerzen als Spiegel <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung im sozialen Gefüge des Patienten), diepsychische Dimension (schmerzhafte Prozesse von Aussprache o<strong>der</strong> Unlösbarkeitvon konflikthaften Situationen) sowie die spirituelle Dimension (Schmerzen, die sichan <strong>der</strong> S<strong>in</strong>nfrage entzünden). Saun<strong>der</strong>s & Ba<strong>in</strong>es (Ba<strong>in</strong>es, 1993; Saun<strong>der</strong>s & Ba<strong>in</strong>es,1991) halten folgende psychosoziale Komponenten des Schmerzes bei sterbendenPatientInnen für beson<strong>der</strong>s wichtig: seelischer Schmerz (Gefühle, E<strong>in</strong>schätzungen,Ängste; vgl. dazu auch Fässler-Weibel, 1997b), sozialer Schmerz (unerledigteAngelegenheiten, alte Spannungen), geistiger Schmerz (Gefühle des Versagens <strong>und</strong>
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 77des Bedauerns, Schuldgefühle, Selbstzweifel, Gefühl <strong>der</strong> eigenen Bedeutungslosigkeit).Sie schlussfolgern:„Begreifen wir das Leiden des Patienten als Gesamtheit, können wir diese Probleme alsseelische, soziale <strong>und</strong> geistige Komponenten desselben Schmerzes verstehen.“(Saun<strong>der</strong>s & Ba<strong>in</strong>es, 1991, 52)E<strong>in</strong>e prospektive Studie aus <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie kommt vonGoodk<strong>in</strong> et al. (1996, 1997; zit. n. Hall & Irw<strong>in</strong>, 2001, 433) <strong>und</strong> zeigt e<strong>in</strong>enZusammenhang zwischen physiologischen Parametern <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>auf. Die Autoren weisen e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen psychosozialenInterventionen <strong>und</strong> Funktion des Immunsystems bei HIV seropositiven Personennach. Dabei g<strong>in</strong>g die Teilnahme an e<strong>in</strong>em Unterstützungsprogramm <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>erErhöhung des Levels an T-Helfer-Zellen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er verr<strong>in</strong>gerten Anzahl anArztbesuchen e<strong>in</strong>her. Da<strong>mit</strong> liegt die erste Studie vor, die prospektiv e<strong>in</strong>en kausalenEffekt zwischen sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> physiologischen Krankheitsfaktorennachweist.Aus den Ergebnissen <strong>der</strong> vorliegenden Studien zu sozialen <strong>und</strong> physiologischenParametern bei sterbenden Menschen kann die Schlussfolgerung gezogen werden,dass e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen beiden Größen besteht. Zudem weisenprospektiv angelegte Studien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ursache-Wirkungs-Richtung: Das sozialeGeschehen um e<strong>in</strong>en sterbenden Menschen wirkt sich demnach auf se<strong>in</strong>enkörperlichen Zustand aus.<strong>Soziale</strong> Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> MenschenE<strong>in</strong> großer Teil <strong>der</strong> thanatopsychologischen Studien beschäftigt sich <strong>mit</strong> Wünscheno<strong>der</strong> Bedürfnissen sterben<strong>der</strong> Menschen (vgl. Baldw<strong>in</strong>, 1983; Block, 2001; Cohen &Leis, 2002; Corr et al., 1999; Kaut, 2002; Keil, T. U., 2002; Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995; Vachon, 1998). Dabei zeigt sich immer wie<strong>der</strong> die hohe Priorität, diebetroffene PatientInnen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> ihr soziales Umfeld zuschreiben (vgl.bereits Thomae (1988, 145), <strong>der</strong> „Stiftung <strong>und</strong> Pflege sozialer Kontakte“ alswichtigstes Dase<strong>in</strong>sthema <strong>in</strong> <strong>der</strong> Antizipation <strong>der</strong> Zukunft bei Hochbetagten eruierte).
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 78Beispielhaft wird hier die National Hospice Demonstration Study dargestellt(Kastenbaum, 2004). In e<strong>in</strong>er groß angelegten Befragung wurden sterbendePatientInnen <strong>in</strong> stationären Hospizen gefragt, wie sie sich ihre letzten Lebenstagewünschen würden <strong>und</strong> was ihre größten Kraftquellen <strong>in</strong> diesen Tagen wären. Diehäufigste Antwort <strong>der</strong> PatientInnen war: In den letzten Tagen sollen bestimmteMenschen bei ihnen se<strong>in</strong>; <strong>und</strong> ihre größte Kraftquelle liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Unterstützung vonFamilie <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en. Kastenbaum schlussfolgert: „We see that relationships crownboth response lists.“ (2004, 125) In ähnlichen Studien wurden <strong>und</strong> werden dieseErgebnisse immer wie<strong>der</strong> bestätigt: Die Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> ihrem sozialen Feld nimmt fürsterbende Menschen e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Stellenwert e<strong>in</strong> (vgl. bspw. Ceelen, 1997;Kruse & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995).Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Studien, die sich <strong>mit</strong> E<strong>in</strong>flussfaktoren auf dieLebensqualität sterben<strong>der</strong> Menschen beschäftigen. So können beispielsweise Cohen& Leis (2002) zeigen, dass bedeutsame Beziehungen e<strong>in</strong>en von fünf Bereichenbilden, die für die Lebensqualität relevant s<strong>in</strong>d:„Five broad doma<strong>in</strong>s were fo<strong>und</strong> to be important determ<strong>in</strong>ants of patient QOL: (1) thepatient’s own state, <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g physical and cognitive function<strong>in</strong>g, psychological state, andphysical condition; (2) quality of palliative care; (3) physical environment; (4)relationships; and (5) outlook.“ (Cohen & Leis, 2002, 48)Entsprechend f<strong>in</strong>det sich die psychosoziale Komponente auch als Kernkomponentevon Modellen psychosozialer Unterstützung von sterbenden Menschen. Beson<strong>der</strong>sausgeprägt zeigt sich dies im Vier-Säulen-Modell <strong>der</strong> psychosozialen Unterstützungvon Krebskranken nach Waltz & Brühl (1993). Die Autoren stellen folgende Bereichedar, die ihrer Me<strong>in</strong>ung nach essentiell für die Unterstützung s<strong>in</strong>d: 1. Arzt-Patienten-Beziehung, 2. Selbsthilfegruppen, 3. Ehe/Partnerschaft, 4. psychoonkologisch tätigeBerufsgruppen (Krischke, 1996, 32f.). Modelle wie dieses stellen explizit dieBedeutsamkeit sozialer Beziehungen für kritisch kranke o<strong>der</strong> sterbende Menschen <strong>in</strong>den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> weisen dadurch auf die Konsequenzen h<strong>in</strong>, die <strong>der</strong> Verlustsozialer Kontakte, wie er durch das Phänomen des sozialen <strong>Tod</strong>es <strong>in</strong> <strong>der</strong> letztenLebensphase immer wie<strong>der</strong> ausgelöst wird, haben kann.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 79Die Bedeutung des Faktors Beziehung zeigt sich auch <strong>in</strong> den Studien, die dieBedürfnisse des Patienten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung zu den Menschen, die ihn pflegen <strong>und</strong>versorgen, erfragen. Kruse (Kruse, J., 1997) kommt nach e<strong>in</strong>er Studienübersicht zurArzt-Patienten-Beziehung zu dem Schluss: “Es ist für den Patienten sehr hilfreich,wenn <strong>der</strong> Arzt trotz se<strong>in</strong>er therapeutischen Ohnmacht die Beziehung aufrechterhält<strong>und</strong> sich um das Wohlergehen des Patienten sorgt.“ (Kruse, J., 1997, 198)Entsprechend zeigen Studien zur Kommunikation <strong>und</strong> Informationsüber<strong>mit</strong>tlung <strong>mit</strong>sterbenden PatientInnen, dass <strong>der</strong> Beziehungskomponente großes Gewichtzukommt (bspw. Buckman, 2002; Cherny, 2000; Hannich, 2002; Kirk et al., 2004;Pampaluchi-Wick, 1997). Kirk et al. (2004) fanden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er diesbezüglichenUntersuchung heraus, dass <strong>der</strong> Prozess des Gespräches <strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung vonPatientInnen <strong>und</strong> Familienangehörigen ausschlaggeben<strong>der</strong> ist als <strong>der</strong> Inhalt desGesprächs:„The analysis <strong>in</strong>dicates that <strong>in</strong> <strong>in</strong>formation shar<strong>in</strong>g the process is as important as thecontent. The tim<strong>in</strong>g, management, and delivery of <strong>in</strong>formation and perceived attitude ofpractitioners were critical to the process.” (Kirk et al., 2004, 1343)Die Arzt-Patienten-Beziehung hat also weitreichende Auswirkungen bis h<strong>in</strong> zu <strong>der</strong> Art<strong>und</strong> Weise, wie Information aufgenommen <strong>und</strong> <strong>in</strong>terpretiert wird. Dabei s<strong>in</strong>d die nicht<strong>in</strong>haltlichen<strong>und</strong> Beziehungs-Komponenten von Information (z.B. Zeit, Aufmerksamkeit,emotionales Mitschw<strong>in</strong>gen, klare Aussagen, etc.) den Studienergebnissenzufolge von vergleichbarer Bedeutung wie die <strong>in</strong>formationellen. (E<strong>in</strong>e differenzierteBetrachtung <strong>der</strong> Arzt-Patienten-Kommunikation im Spannungsfeld von Zeit <strong>und</strong>Wahrheit f<strong>in</strong>det sich bei Keil, A., 2004, 137ff.)Insgesamt zeigt sich <strong>in</strong> den Studien, welche die Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse bzw.Lebensqualität <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den beim <strong>Sterben</strong>den zum Inhalt haben, dass dasE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong> –bleiben <strong>in</strong> das soziale Umfeld für sterbende Menschen vonzentraler Bedeutung ist. Dabei trägt vor allem die Komponente <strong>der</strong> Beziehung ansich (<strong>in</strong> Abgrenzung zu bspw. Unterstützung o<strong>der</strong> Informationsver<strong>mit</strong>tlung) stark zu<strong>der</strong>en Wohlbef<strong>in</strong>den bei.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 80Die beson<strong>der</strong>e Situation <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung im SterbeprozessPsychologische Studien zur Frage, <strong>in</strong> wie weit sich <strong>der</strong> letzte Lebensabschnitt vonden davorliegenden unterscheidet bzw. welche Beson<strong>der</strong>heiten für den <strong>Sterben</strong>den<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er sozialen Situation während des Sterbeprozesses auftreten können, werdenim Folgenden beschrieben.Beson<strong>der</strong>s erkenntnisbr<strong>in</strong>gend s<strong>in</strong>d dabei Studien, die sterbende Menschen direkt zuihren Wahrnehmungen befragen. So ergab beispielsweise e<strong>in</strong>e thematische Analysevon Interviews <strong>mit</strong> 15 Hospiz-PatientInnen die folgenden 12 Themen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Beschäftigung <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> (Claibourne, 2003):(a) Liv<strong>in</strong>g with a life threaten<strong>in</strong>g illness requires both learn<strong>in</strong>g and loss of skills; (b)Thanatologic realization creates a heightened sense of awareness and appreciation oflife; (c) Know<strong>in</strong>g you are go<strong>in</strong>g to die and not want<strong>in</strong>g to die vacillates throughout thedy<strong>in</strong>g process; (d) Mak<strong>in</strong>g decisions helps ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong> a sense of control; (e) Preparation fordeath <strong>in</strong>volves previous life experiences; (f) Prepar<strong>in</strong>g oneself for death is necessary <strong>in</strong>or<strong>der</strong> ro prepare others; (g) Spiritual preparation is a high priority near the end of thedy<strong>in</strong>g trajectory; (h) Goals at the end-of-life are related to short time frames; (i) Supportivecare is essential; (j) Liv<strong>in</strong>g with a life threaten<strong>in</strong>g illness is not someth<strong>in</strong>g people areprepared for; (k) A life threaten<strong>in</strong>g illness becomes a major focus for the dy<strong>in</strong>g and theirfamilies.Diese Ergebnisse deuten darauf h<strong>in</strong>, dass das Lebensende als e<strong>in</strong>e eigenständigeLebensphase <strong>mit</strong> Wachstum <strong>und</strong> Entwicklungsanreizen (im S<strong>in</strong>ne entwicklungspsychologischerAnsätze) gesehen werden kann.Im Vergleich zum vorherigen Lebensverlauf nimmt die Zahl sozialer Kontakte sowiedie Aktivität zur Generierung <strong>und</strong> Erhaltung von sozialen Beziehungen im höherenAlter ab (vgl. bspw. Fre<strong>und</strong> & Riediger, 2003, 605). Aus zahlreichen, gerontopsychologischenStudien zu Wünschen <strong>und</strong> Bedürfnissen älterer Menschen geht jedochhervor, dass ältere Menschen <strong>der</strong> Güte sozialer Beziehung e<strong>in</strong>en hohen Stellenwertbeimessen (vgl. bspw. Fliege & Filipp, 2000, 311).E<strong>in</strong>e qualitative Verän<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestaltung sozialer Beziehungen ist amLebensende zu verzeichnen. So stellen Kearney & Mount (vgl. Kearney, 2000) fest,dass schnell tiefe Beziehungen zwischen sterbenden Menschen <strong>und</strong> Helfendenentstehen können, die essentiell zum Netzwerk <strong>der</strong> <strong>Sterben</strong>den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zeit bis zum<strong>Tod</strong> beitragen. Sie führen diesen schnellen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiven Beziehungsaufbau auf diegroße Offenheit <strong>und</strong> Präsenz zurück, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung vonnöten ist:
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 81„The simple presence of one who is concerned, one who is will<strong>in</strong>g to be a companion andto rema<strong>in</strong> steadfast when there are no easy answers, is itself a form of powerfulcommunication that goes beyond words.“ (Kearney, 2000, 366)Carstensen (1995) fügt diese Erkenntnisse <strong>in</strong> ihre ‚Sozio-Emotionale Selektivitätstheorie’e<strong>in</strong> (vgl. auch Bertrand & Lachman, 2003, 480; Pruchno & Rosenbaum,2003, 488). In zahlreichen Untersuchungen zeigten Carstensen <strong>und</strong> ihreMitarbeiterInnen, dass die Wahrnehmung begrenzter verbleiben<strong>der</strong> Lebenszeit zuVerän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> den Zielhierarchien führt. In sozialen Beziehungen wird dann <strong>der</strong>emotionale Austausch zu e<strong>in</strong>em wesentlich wichtigeren Ziel als <strong>der</strong> Austausch vonInformationen:„(…) the profile of result<strong>in</strong>g empirical f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs suggests that people grow <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>glyselective <strong>in</strong> their choices of social partners and that, <strong>in</strong> particular, the construal ofavailable future time changes preferences. (…) Essentially, when future socialopportunities are li<strong>mit</strong>ed, the salience of emotion appears to <strong>in</strong>crease.“ (Carstensen,1995, 155)In den Term<strong>in</strong>i von Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Diskont<strong>in</strong>uität <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen Entwicklung über dieLebensspanne h<strong>in</strong>weg zeigt sich deutlich e<strong>in</strong> Aspekt von Diskont<strong>in</strong>uität <strong>in</strong> <strong>der</strong>Beziehungsgestaltung am Lebensende (vgl. M<strong>in</strong>nemann & Sch<strong>mit</strong>t, 1995, 98).Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (2001) schließt e<strong>in</strong>en Überblick über thanatopsychologischeForschung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Feststellung, dass soziale Integration <strong>und</strong> die im sozialen Fel<strong>der</strong>fahrene Akzeptanz e<strong>in</strong>er von vier Faktoren ist, die Erleben <strong>und</strong> Verhalten imSterbeprozess bee<strong>in</strong>flussen (vgl. dazu auch Bucher, Hess, Spichiger & Otto, 1998;Ita, 1995). (Die an<strong>der</strong>en Faktoren s<strong>in</strong>d: Ausmaß, <strong>in</strong> dem das eigene Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong>Rückschau trotz E<strong>in</strong>schränkungen angenommen werden kann; Ausmaß, <strong>in</strong> dem <strong>der</strong><strong>Sterben</strong>de e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Leben <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er jetzigen Situation erkennt; <strong>der</strong>frühere Lebensstil; vgl. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001.)Aus diesen stellvertretend dargestellten Studien wird deutlich, dass <strong>der</strong> Sterbeprozessfür sterbende Menschen e<strong>in</strong>en Lebensabschnitt darstellt, <strong>der</strong> durch die hoheBedeutsamkeit spezieller Themenfel<strong>der</strong> <strong>und</strong> darunter vor allem <strong>der</strong> Entstehung <strong>und</strong>Aufrechterhaltung bedeutsamer sozialer B<strong>in</strong>dungen gekennzeichnet ist. Die folgenddargestellten Studien beschäftigen sich <strong>mit</strong> speziellen Aspekten des sozialenUmfeldes beim sterbenden Patienten.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 82Insgesamt kann für das Bef<strong>in</strong>den von PatientInnen aus unterschiedlichenBlickw<strong>in</strong>keln klar gezeigt werden, dass die soziale E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>en bedeutsamenWirkfaktor darstellt. Zum e<strong>in</strong>en wirkt sich das soziale E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> dessterbenden Menschen auf se<strong>in</strong>en körperlichen Zustand (i.S.v. Sterblichkeit,physiologischen Parametern <strong>und</strong> Schmerz) aus. Zum zweiten zeigt sich, dass vonSeiten <strong>der</strong> PatientInnen e<strong>in</strong> großes Bedürfnis danach vorliegt, <strong>in</strong> stabile Beziehungene<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en zu se<strong>in</strong>. Und schließlich wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> thanatopsychologischen Forschungdurchweg deutlich, dass <strong>der</strong> Sterbeprozess e<strong>in</strong>en Lebensabschnitt darstellt, <strong>in</strong> dememotional enge, soziale Beziehungen von beson<strong>der</strong>er Bedeutsamkeit s<strong>in</strong>d <strong>und</strong>häufiger als im sonstigen Lebensverlauf hergestellt werden.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 834.2. <strong>Soziale</strong> Beziehungen zwischen sterbenden PatientInnen <strong>und</strong>AngehörigenDie WHO (World Health Organization, 1986) hält <strong>in</strong> ihren Richtl<strong>in</strong>ien zurpalliativmediz<strong>in</strong>ischen Betreuung von PatientInnen fest:„One of the dicta of palliative care is that the patient and the family is the unit of care.”(WHO, 1986; zit. n. Dunne, 1997, 41)In <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Palliativmediz<strong>in</strong> werden die Angehörigen als „Patienten zweiterOrdnung“ (vgl. bspw. Schrö<strong>der</strong>, C., 2001, 11) bezeichnet. Dies verdeutlicht, dasszwischen PatientInnen <strong>und</strong> ihren Bezugspersonen e<strong>in</strong>e enge Verb<strong>in</strong>dung besteht,welcher beson<strong>der</strong>e Bedeutung zukommt. Entsprechend beschäftigt sich e<strong>in</strong> Zweigthanatopsychologischer Forschung <strong>mit</strong> Gestalt <strong>und</strong> Charakter dieser beson<strong>der</strong>enBeziehung. E<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er Teilbereich richtet die Aufmerksamkeit auf die beson<strong>der</strong>eBelastungssituation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sich Angehörige <strong>und</strong> Bezugspersonen im Laufe des<strong>Sterben</strong>s e<strong>in</strong>er geliebten o<strong>der</strong> nahe stehenden Person bef<strong>in</strong>den. Beide Blickw<strong>in</strong>kelwerden im Folgenden dargestellt. (Auf die antizipatorische Trauer, die die<strong>in</strong>nerpsychische Situation von Angehörigen entscheidend prägt, wird im Folgendennicht e<strong>in</strong>gegangen; hier sei auf Attig, 2000; Canacakis, 1987; Canacakis &Schnei<strong>der</strong>, 1997; Davies, 2000; Doka, 2000; Kast, 1987; Merod, 2004; Rando,2000a, 2000c, 2000b; Stroebe, Hansson, Stroebe & Schut, 2001 verwiesen.)Der enge Zusammenhang zwischen PatientInnen <strong>und</strong> BezugspersonenE<strong>in</strong>e Gruppe von Studien bezieht sich auf e<strong>in</strong>e explizit systemische Perspektive <strong>und</strong>stellt sterbende PatientInnen <strong>und</strong> ihre PartnerInnen bzw. Familien <strong>in</strong> den Mittelpunkt(vgl. Bartels & Faber-Langendoen, 2001; Feith, Ochsmann, Kle<strong>in</strong>, Seibert & Slangen,2001; Häuser & Kle<strong>in</strong>, 2002; Strittmatter, 1998; Wittkowski et al., 2004, 113). Indiesen Studien zeigen sich die enge Verflechtung zwischen PatientInnen <strong>und</strong>bedeutsamen Bezugspersonen sowie ihr großer E<strong>in</strong>fluss auf den Sterbeprozess.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 84So zeigt beispielsweise Kruse (Kruse, A., 1995) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Langzeituntersuchung an 50PatientInnen <strong>und</strong> ihren Bezugspersonen, dass die Verarbeitungsprozesse <strong>der</strong>Krankheit <strong>und</strong> des nahenden <strong>Tod</strong>es bei PatientInnen <strong>und</strong> PartnerInnen sich <strong>in</strong>ähnlichen Mustern entwickeln, d.h. dass es e<strong>in</strong>en Zusammenhang o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>egegenseitige Bee<strong>in</strong>flussung des Verarbeitungsstils gibt. Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Studie berichtetenZusammenhänge zwischen den Verlaufsformen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Patienten– <strong>und</strong> Angehörigengruppelegen e<strong>in</strong>en Analyseansatz nahe, <strong>der</strong> nicht nur nach E<strong>in</strong>flüssen <strong>der</strong> sozialenUmwelt auf Erleben <strong>und</strong> Verhalten von Menschen im Term<strong>in</strong>alstadium fragt (<strong>und</strong> diefamiliäre Umwelt dabei als e<strong>in</strong>en von zahlreichen E<strong>in</strong>flussfaktoren versteht), son<strong>der</strong>n<strong>der</strong> den Patienten <strong>und</strong> se<strong>in</strong>en Angehörigen als e<strong>in</strong>e Dyade begreift. Kruse kommtentsprechend zu dem Schluss, dass die engen Zusammenhänge zwischenPatientInnen <strong>und</strong> Bezugspersonen…„(…) auf die Notwendigkeit h<strong>in</strong>weisen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> weiteren thanatologischen Forschunggrößeres Gewicht auf die Dyade „Patient – Angehöriger“ zu legen <strong>und</strong> sich nicht auf e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>dividualistische Perspektive festzulegen, die Erleben <strong>und</strong> Verhalten des Patientenlosgelöst von dessen sozialem Umfeld untersucht.“ (Kruse, A., 1995, 271)E<strong>in</strong>e schwere <strong>und</strong> unter Umständen zum <strong>Tod</strong> führende Erkrankung stellt immer e<strong>in</strong><strong>mit</strong> Stress verb<strong>und</strong>enes Ereignis für die gesamte Familie dar. So kann die engeBeziehungsverflechtung auch dazu führen, dass die Zunahme an Lebensqualität beiPatientInnen e<strong>in</strong>e Abnahme <strong>der</strong> Lebensqualität für die Familie bedeutet (Parker,1990; zit. n. Krischke, 1996, 34; Cov<strong>in</strong>sky et al., 1994; Gyger-Stauber, 1997). Ausdiesem Gr<strong>und</strong> ist psychosoziale Unterstützung für die PatientInnenn nicht getrenntvon ihren Familien zu betrachten, son<strong>der</strong>n auf diese auszudehnen (Goos-Detjen, <strong>in</strong>Vorbereitung; Strittmatter, 1998). Entsprechend ergibt sich die For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>emfamilienzentrierten Ansatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung:„Es geht um die Beachtung <strong>und</strong> E<strong>in</strong>beziehung des wichtigsten Bezugssystems des<strong>Sterben</strong>den, sei es Familie, Herkunftsfamilie, Partnerbeziehung o<strong>der</strong> Fre<strong>und</strong>schaftsbeziehung.Es reicht nicht, den <strong>Sterben</strong>den alle<strong>in</strong>e zu sehen <strong>und</strong> ihn zu begleiten.Entscheidend ist, a) alle Hauptbeteiligten <strong>in</strong> ihrem geme<strong>in</strong>samen Bezugssystem <strong>in</strong> denBlick zu bekommen, b) dieses System als ganzes bei Bedarf so zu unterstützen, dass esc) se<strong>in</strong>erseits se<strong>in</strong>e Mitglie<strong>der</strong> versorgt.“ (Strittmatter, 1998, 36)Dies ist von umso größerer Bedeutung, als die Beanspruchungsersche<strong>in</strong>ungen vonAngehörigen sterben<strong>der</strong> PatientInnen schwerwiegend se<strong>in</strong> können. In <strong>der</strong>Palliativwissenschaft hat sich diesbezüglich <strong>der</strong> diagnostische Term<strong>in</strong>us <strong>der</strong>‚Profo<strong>und</strong>ly Fatigued Family’, <strong>der</strong> total erschöpften Familie (vgl. Kearney, 2000),
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 85e<strong>in</strong>gebürgert. Dieser Zustand im Familiensystem wird durch die zu <strong>in</strong>dividuumszentrierteVersorgung <strong>der</strong> PatientInnen <strong>und</strong> das Ignorieren <strong>der</strong> BeanspruchungAngehöriger verursacht. Im Folgenden wird deshalb e<strong>in</strong> kurzer Überblick über diebeson<strong>der</strong>e soziale Belastungssituation von Angehörigen sterben<strong>der</strong> Menschengegeben.<strong>Soziale</strong> Belastung von AngehörigenDie folgenden Studien beschäftigen sich <strong>mit</strong> <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Belastungssituation, <strong>in</strong><strong>der</strong> sich pflegende Angehörige bef<strong>in</strong>den (z.B. auch Seibert, Ochsmann, Feith, Kle<strong>in</strong>& Slangen, 2001b). Denn nach wie vor gilt:„Hierzu ist zunächst festzustellen, dass <strong>der</strong> Löwenanteil <strong>der</strong> ambulanten ges<strong>und</strong>heitsbezogenenUnterstützung immer noch bzw. zunehmend wie<strong>der</strong> von Familienangehörigenerbracht wird (Stichwort: private Pflege).“ (Staud<strong>in</strong>ger & Greve, 2001, 126)Töchter <strong>und</strong> Schwiegertöchter <strong>der</strong> <strong>Sterben</strong>den stehen hier an erster Stelle (vgl. auchWass, 2001, 100). Hier ist e<strong>in</strong> geschlechtsdifferenzieren<strong>der</strong> Blickw<strong>in</strong>kel vonnöten, dasich die Lebenswelten pflegen<strong>der</strong> Angehöriger bei Männern <strong>und</strong> Frauen starkunterscheiden (Thiessen, 2004, 47). Inwieweit das Helfen generell als weiblicheLebensrealität betrachtet werden muss, diskutieren bspw. Nestmann & Schmerl(1991).Kle<strong>in</strong>, Ochsmann et al. (Kle<strong>in</strong>, Thomas, Ochsmann, Feith, Seibert & Slangen, 2001)fanden <strong>in</strong> diesem Zusammenhang heraus, dass knapp über die Hälfte <strong>der</strong> von ihnenuntersuchten Hauptbetreuungspersonen (50,6%) <strong>in</strong> ambulantem Sett<strong>in</strong>g ke<strong>in</strong>epflegerische Unterstützung über e<strong>in</strong>en Großteil <strong>der</strong> bzw. über die gesamteBetreuungszeit erhielten. Zudem zeigte sich <strong>in</strong> dieser Studie, dass die Inanspruchnahmevon Hilfeleistungen e<strong>in</strong>e geschlechtsspezifische Komponente aufweist:Wesentlich mehr pflegende Männer als Frauen for<strong>der</strong>ten Unterstützung für sich e<strong>in</strong>.Die AutorInnen haben dafür folgende Erklärung:„Dieses Ergebnis entspricht <strong>der</strong> Vorstellung, dass Männer stärker <strong>in</strong> den formellenBereich <strong>der</strong> Gesellschaft e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d, weshalb sie sich auch eher Hilfe bei denöffentlichen Institutionen holen. Frauen gelten als stärker <strong>in</strong> den <strong>in</strong>formellen Bereich <strong>der</strong>
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 86Gesellschaft e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en, sie bekommen mehr Hilfe aus dem sozialen Umfeld, vonFamilien<strong>mit</strong>glie<strong>der</strong>n, Verwandten, Fre<strong>und</strong>en o<strong>der</strong> Nachbarn.“ (Kle<strong>in</strong>, Thomas et al., 2001)E<strong>in</strong>e Studie <strong>der</strong> Universität Freiburg (He<strong>in</strong>ke, 2002) zeigt, dass die Pflege <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>von den Angehörigen häufig als bereichernde Erfahrung erlebt wird, dass allerd<strong>in</strong>gsdie positiven Pflegeaspekte nicht gegen die negativen aufgewogen werden können.Die E<strong>in</strong>schränkungen <strong>und</strong> Beanspruchungen durch e<strong>in</strong>e oftmals über Jahregehende, zunehmende Pflegetätigkeit überwiegen die positive Erfahrung. He<strong>in</strong>ke(2002) zieht die Schlussfolgerung: „Vor allem auf die <strong>in</strong>dividuellen Wünsche <strong>und</strong>Probleme <strong>der</strong> Pflegenden müsse daher stärker e<strong>in</strong>gegangen werden (...)“ (He<strong>in</strong>ke,2002, 55)E<strong>in</strong>en weiteren sozialen Belastungsaspekt zeigen Studien bei Angehörigen auf, dienicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> ambulanten Pflege tätig s<strong>in</strong>d (vgl. bspw. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001;Schweidtmann, 1996): Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> sich verän<strong>der</strong>nden Familienstruktur <strong>in</strong> unsererGesellschaft (vgl. Schmidt-Denter, 2005, 207) bef<strong>in</strong>det sich <strong>der</strong> Großteil sterben<strong>der</strong>Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>stitutionellen Sett<strong>in</strong>g. Diese Tatsache kann den Kontaktzwischen Patient <strong>und</strong> Angehörigen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>n bzw. verän<strong>der</strong>n. Die zunehmendeHospitalisierung sterben<strong>der</strong> Menschen ist auch e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> dafür, dass Angehörigeimmer seltener das <strong>Sterben</strong> an<strong>der</strong>er Menschen direkt erleben. Beide Faktoren führendazu, dass sich Angehörige durch die unbekannte <strong>und</strong> entfremdete Situationüberfor<strong>der</strong>t fühlen:„Die heutige Institutionalisierung des <strong>Sterben</strong>s hat sicherlich dazu beigetragen, dass vieleAngehörige schon aus dem Mangel an Erfahrungen <strong>mit</strong> sterbenden <strong>und</strong> schwer krankenMenschen hilflos <strong>in</strong> ihrer Rolle als Begleiter von <strong>Sterben</strong>den s<strong>in</strong>d.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer,2001, 6)E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Argumentation generalisiert das Phänomen <strong>der</strong> Entfremdung vonsterbenden PatientInnen <strong>und</strong> begründet es durch die Ges<strong>und</strong>heitssituation <strong>der</strong>westlichen Gesellschaften, <strong>in</strong> denen die Menschen durch e<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong> höherenGes<strong>und</strong>heitsstatus weniger Kontakt zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> im alltäglichen Leben hätten(vgl. bspw. Becker, 1992). Dies för<strong>der</strong>e e<strong>in</strong>e Kontaktvermeidung <strong>mit</strong> sterbendenMenschen:„Because people will live longer, healthier lives, they will not be as familiar with death as<strong>in</strong> previous times and consequently may be less able to give social and emotional supportto dy<strong>in</strong>g and bereaved family members, friends, neighbours, or clients.“ (Wass, 2001,101)
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 87Beide Ursachen mögen dazu beitragen, dass sich Angehöriger sterben<strong>der</strong>PatientInnen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>stitutionellen Sett<strong>in</strong>g betreut werden, belastet fühlen.Zusammenfassend lässt sich festhalten: Sowohl durch die enge, soziale Beziehungauf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite als auch durch die Belastung durch Pflege o<strong>der</strong> durchInstitutionalisierung <strong>und</strong> Entfremdung auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite s<strong>in</strong>d die Bezugspersonenvon sterbenden Menschen großen Beanspruchungen über e<strong>in</strong>en oftmalslangen Zeitraum ausgesetzt, ohne dass sie selbst im Fokus <strong>der</strong> Aufmerksamkeit vonUnterstützungs- <strong>und</strong> Interventionsorganen stehen würden.
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 884.3. Die Situation von Professionellen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung<strong>Sterben</strong><strong>der</strong>E<strong>in</strong>e große Gruppe von Menschen steht professionell <strong>in</strong> engem Kontakt <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong>: Betreuende ÄrztInnen, Pflegende, psychosozial Tätige, freiwillig Helfendesowie spirituell Betreuende bilden dabei die Hauptgruppen. Sie alle bef<strong>in</strong>den sichtäglich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em äußerst schwierigen Arbeitsfeld, das durch hohe Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong>große Arbeitsbelastung gekennzeichnet ist (vgl. bspw. Aemissegger, 1997; Ganz<strong>in</strong>i,2002). Über soziale Komponenten <strong>der</strong> Situation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sich diese Menschenbef<strong>in</strong>den, gibt es wenig Wissen, obwohl sie e<strong>in</strong>e durchaus umfangreich <strong>mit</strong> Studienbelegte Personengruppe darstellen. Doch die Blickw<strong>in</strong>kel, unter denen dieseProfessionellen betrachtet werden, liegen entwe<strong>der</strong> auf den Anfor<strong>der</strong>ungen, die sieim Bereich <strong>der</strong> Versorgung kritisch kranker Menschen erfüllen müssen (bspw. Karl,1989; Lutterotti, 1989; Ross, 1998), o<strong>der</strong> aber auf Aspekten von Belastung <strong>und</strong>Beanspruchung <strong>in</strong> diesem Arbeitsfeld <strong>und</strong> auf Aspekten von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung(vgl. Aulbert, Klaschick & Kettler, 2002). Diese Bereiche stehen folglich auch imZentrum <strong>der</strong> Darstellung, wenn nach sozialen Komponenten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Situation vonProfessionellen gesucht wird.Exkurs: Anfor<strong>der</strong>ungen an professionelle SterbebegleitungHohe Anfor<strong>der</strong>ungen werden an die professionelle Sterbebegleitung <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> andie SterbebegleiterInnen gestellt. Um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck von <strong>der</strong> Arbeitssituation <strong>und</strong>dem Selbstverständnis dieser Personengruppe zu erhalten, sche<strong>in</strong>t es notwendig, zuver<strong>mit</strong>teln, welchen Anfor<strong>der</strong>ungen sie <strong>in</strong> ihrem Arbeitsfeld ausgesetzt s<strong>in</strong>d. Daherwird im Folgenden e<strong>in</strong> kurzer Abriss zu diesem Thema gegeben, auch wenn es nichtim Fokus <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit steht.Allgeme<strong>in</strong> <strong>und</strong> an erster Stelle soll das professionelle Handeln am kritisch krankenMenschen von e<strong>in</strong>er ethischen Gr<strong>und</strong>maxime geprägt se<strong>in</strong>, wobei sich das ethischeHandeln sowohl auf die PatientInnen als auch <strong>der</strong>en Umgebung sowie die
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 89Handelnden selbst bezieht, also <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kräftefeld stattf<strong>in</strong>det: „Als ethisch wird <strong>in</strong>diesem Zusammenhang dasjenige Handeln bestimmt, das auf die Gr<strong>und</strong>bedürfnissedes Patienten <strong>in</strong> bestmöglicher Weise abgestimmt ist (…), gleichzeitig aber dieMöglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen des Behandelnden berücksichtigt (…) <strong>und</strong> dieUmgebungsbed<strong>in</strong>gungen als Kontext <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>bezieht (…).“ (Schweidtmann, 1995, 234)Innerhalb dieses Kräftefeldes wird palliative Betreuung wie folgt def<strong>in</strong>iert: “Palliativecare is medical care focused on relief of suffer<strong>in</strong>g for those with serious andadvanced illness, support for doctor-patient communication, and delivery ofcoord<strong>in</strong>ated, cont<strong>in</strong>uous, and comprehensive medical care for patients and theirfamilies.“ (Meier, 2004, 208)Mennemann (1998) stellt e<strong>in</strong> Kompetenzprofil für Sterbebegleiter <strong>mit</strong> folgendenKernbereiche auf: personale Kompetenz, kommunikative Kompetenz, sozialeKompetenz, professionelle Kompetenz, <strong>in</strong>stitutionelle Kompetenz (Organisationsentwicklungskompetenz)sowie Performanz (Fähigkeit, die Kompetenzen reflektiert<strong>und</strong> gezielt anzuwenden) (Mennemann, 1998, 278). Da das Kompetenzprofil nachMennemann sowohl Kompetenzen umfasst, die für die soziale Arbeit <strong>mit</strong> Menschenim Allgeme<strong>in</strong>en gelten, als auch solche, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> palliativen Begleitung speziellbenötigt werden, sollen letztere nochmals kurz dargestellt werden.Im fachlichen Konsens (Callanan, 1993; Duda, 1989; Fässler-Weibel, 1997a;Saun<strong>der</strong>s, 1999, 1993; Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1989; Specht-Tomann & Tropper, 2003;Tausch-Flammer, 1993, 1997, 2001) werden die folgenden Anfor<strong>der</strong>ungen anprofessionelle Sterbebegleiter gestellt:• Der Beziehung <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Offenheit <strong>der</strong> SterbebegleiterInnen für e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>tensive H<strong>in</strong>wendung zum Patienten wird große Bedeutung beigemessen: „Wenn<strong>der</strong> Status <strong>der</strong> Patienten sich von dem e<strong>in</strong>es Kranken zu dem e<strong>in</strong>es <strong>Sterben</strong>denwandelt, bekommt die Zuwendung zum Patienten e<strong>in</strong> größeres Gewicht.“(Tausch-Flammer, 2001, 12)• Von SterbebegleiterInnen wird die eigene Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellungzu <strong>Tod</strong>, <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> eigenen Endlichkeit gefor<strong>der</strong>t: „Selbstause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung<strong>mit</strong> dem eigenen <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> heißt nicht, dass wir e<strong>in</strong> abgeklärtesVerhältnis zum <strong>Tod</strong> haben, son<strong>der</strong>n unsere eigenen Lebens- <strong>und</strong> Sterbeängste
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 90kennen, so dass sie nicht die <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem sterbenden Menschenbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>n. (…) Diese Bereitschaft, sich auch als Begleiter von dem <strong>Sterben</strong>denansprechen zu lassen, sich auch <strong>mit</strong> <strong>der</strong> eigenen Endlichkeit ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen,ist die Gr<strong>und</strong>lage für die Begleitung.“ (Tausch-Flammer, 2001, 12)• Die BegleiterInnen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sterbeprozess müssen die Fähigkeit haben, flexibelauf die sich schnell verän<strong>der</strong>nden Umstände <strong>und</strong> Bedürfnisse <strong>der</strong> <strong>Sterben</strong>dene<strong>in</strong>zugehen <strong>und</strong> eigene Konzepte <strong>und</strong> Bewertungen dabei zu kennen <strong>und</strong> h<strong>in</strong>tanzu stellen: Mit vorgefassten Me<strong>in</strong>ungen <strong>und</strong> Idealen können die Begleitenden den<strong>Sterben</strong>den nicht gerecht werden. Es ist daher notwendig, eigene Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong>Ideale zu kennen, um sich dann <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung von ihnen lösen zu können(z.B. von Me<strong>in</strong>ungen, „wie man richtig begleitet“ o<strong>der</strong> gar „richtig o<strong>der</strong> gut stirbt“).(vgl. Tausch-Flammer, 2001, 12)• Es liegt zum großen Teil <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hand <strong>der</strong>er, die sterbende Menschen begleiten,för<strong>der</strong>liche Umstände für das Abschiednehmen <strong>und</strong> den <strong>in</strong>dividuellen Prozessherzustellen. Es ist e<strong>in</strong>e große Anfor<strong>der</strong>ung an die Begleiter, dabei jedemMenschen se<strong>in</strong> persönliches <strong>Sterben</strong> zu ermöglichen <strong>und</strong> von HandlungsmaximenAbstand zu nehmen: „Für mich geht es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung vielmehrdarum, jedem se<strong>in</strong> ganz eigenes <strong>Sterben</strong> zu ermöglichen. Vielleicht passt es zujemandem, <strong>der</strong> se<strong>in</strong> ganzes Leben Kämpfer gewesen ist, auch bis zum Schlusszu kämpfen?“ (Tausch-Flammer, 2001, 12)• Oft kann im Laufe e<strong>in</strong>es Sterbeprozesses nichts mehr getan werden. Da stelltsich die große For<strong>der</strong>ung an die Begleitenden, das Nichts-Tun aushalten zukönnen <strong>und</strong> als Person anwesend se<strong>in</strong> zu können: „Unsere Hilfe besteht oftmalsvielmehr im Se<strong>in</strong> als im Tun, wirklich An-wesend-Se<strong>in</strong>, d.h. dass wir <strong>mit</strong> unseremganzen Wesen präsent s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stille, im Reden o<strong>der</strong> im Zuhören.“ (Tausch-Flammer, 2001, 12)• Beziehung <strong>und</strong> Kommunikation <strong>mit</strong> den <strong>Sterben</strong>den stellen e<strong>in</strong>e wichtigeKomponente <strong>der</strong> Sterbebegleitung dar: „Aus dem Gesagten geht klar hervor, dasses von zentraler Bedeutung ist, <strong>mit</strong> sterbenden Menschen im Gespräch, <strong>und</strong>wenn dies nicht möglich ist, dann zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Kontakt zu bleiben.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 9)
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 91Diese Ausführungen verdeutlichen, dass e<strong>in</strong> hochqualifiziertes Profil von beruflichen<strong>und</strong> persönlichen Kompetenzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit bei <strong>der</strong> Begleitung sterben<strong>der</strong>Menschen <strong>und</strong> ihrer Familien notwendig ist: „Sterbebegleitung for<strong>der</strong>t diePersönlichkeit des Begleiters <strong>und</strong> nicht nur die von ihm erlernten sozialen <strong>und</strong>kommunikativen Strategien.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 8)Demgegenüber steht die generelle Kritik am Modell professioneller Sterbebegleitung:„Hilfeleistungen haben oft zu kurzfristige Zielsetzungen, <strong>und</strong> sie führen zu e<strong>in</strong>erAbhängigkeit von dem Helfer als e<strong>in</strong>em Fre<strong>und</strong>, <strong>der</strong> unterstützt, e<strong>in</strong>sichtsvoll <strong>und</strong>verständig ist <strong>und</strong> alle Probleme löst.“ (Danish & D'Augelli, 1995, 167)Mehrere Autoren (Danish & D’Augelli, 1995; Rest, 1992, 107 177; Schermer Sellers,2000) bemängeln, dass Professionelle <strong>in</strong>nerhalb dieser Systemvorstellungen alsErsatznetz für die PatientInnen fungieren, was sie überlastet, <strong>und</strong> die PatientInnen<strong>und</strong> Bezugspersonen ihrerseits von diesem professionellen Netz abhängig <strong>und</strong> ihrereigenen Problemlöseressourcen beraubt werden. Anschließend s<strong>in</strong>d sie bedürftigerals zuvor. Und die Professionellen s<strong>in</strong>d oft ausgebrannt, denn sie haben zuvielEnergie jenseits ihrer professionellen Kompetenzen gelassen.Beanspruchung durch die Arbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> SterbebegleitungDie Arbeitsbeanspruchung von Menschen, die sterbende Menschen professionellpflegen <strong>und</strong> betreuen, ist empirisch gut belegt. Die Arbeit <strong>in</strong> diesem Bereich ist <strong>mit</strong>hohen Beanspruchungen verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> führt zu den höchsten Burnout-Raten impsychosozialen Arbeitsbereich, zeigen Schrö<strong>der</strong>, H. et al. (2003) auf. DasBelastungserleben bei <strong>der</strong> Betreuung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> hat e<strong>in</strong>erseits unspezifischeUrsachen (solche, die nicht un<strong>mit</strong>telbar <strong>mit</strong> dem Kontakt <strong>mit</strong> den PatientInnenverb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> strukturellen Merkmalen <strong>der</strong> Arbeitbegründet liegen) <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits spezifische Ursachen (solche, die <strong>in</strong> u<strong>mit</strong>telbarerBeziehung zur <strong>Tod</strong>esthematik stehen) (Wittkowski et al., 2004, 114). Wittkowskiunterscheidet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Mehr-Ebenen-Modell <strong>der</strong> Sterbebegleitung (Wittkowski, 1999,117; Wittkowski et al., 2004, 113) zudem sowohl primäre <strong>und</strong> sek<strong>und</strong>äre
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 92Sterbebegleitung als auch die Ebene <strong>der</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong>die Ebene des gesellschaftlichen Umfeldes. Primäre Sterbebegleitung umfasst dendirekten Umgang <strong>der</strong> beteiligten Personen <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>; sek<strong>und</strong>äre Sterbebegleitungbe<strong>in</strong>haltet Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung <strong>und</strong> emotionale Unterstützung für die Helfenden.(Über die Ebenen <strong>der</strong> Institution bzw. des gesellschaftlichen Umfeldes bee<strong>in</strong>flussendie kulturellen Gegebenheiten <strong>der</strong> Gesellschaft die Sterbebegleitung <strong>und</strong> tragenso<strong>mit</strong> auf <strong>in</strong>direkte Weise zur Arbeitssituation von Sterbebegleitenden bei.) In denfolgenden Ausführungen steht zunächst <strong>der</strong> Bereich primärer Sterbebegleitung imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>; im nächsten Unterkapitel wird das Feld <strong>der</strong> sek<strong>und</strong>ären Begleitung <strong>in</strong>Form von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung beschrieben.In Übere<strong>in</strong>stimmung <strong>mit</strong> allen vorliegenden Studienergebnissen hält Wittkowskizunächst fest:„Der Umgang <strong>mit</strong> unheilbar Kranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den ist für die meisten Helfer (Ärzte,Schwestern, Pfleger, Seelsorger) <strong>mit</strong> erheblichen psychischen Belastungen verb<strong>und</strong>en.“(Wittkowski, 1993, 215)Diese Beanspruchungen entstehen zum e<strong>in</strong>en durch die Tätigkeit als Interaktions<strong>und</strong>Emotionsarbeitende <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung <strong>mit</strong> PatientInnen <strong>und</strong> Angehörigen(Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>, Regulation eigener Emotionen, etc.) <strong>und</strong> zuman<strong>der</strong>en durch die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den unterschiedlichen Institutionsarten, wiez.B. Hospizen, Krankenhäusern <strong>und</strong> Altenheimen (z.B. Zeitdruck, schwerekörperliche Arbeit, Arbeitszeiten, Unterbrechungen, etc.) (vgl. bspw. Beutel &Tausch, 1996; Flick, 2002; Hörl, 1999).E<strong>in</strong>e Übersicht aller <strong>in</strong>haltlichen Beanspruchungsfaktoren, die durch dieSterbebegleitung für die Professionellen entstehen, stellt Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (2001)aus den Ergebnissen eigener Studien zusammen:„Beson<strong>der</strong>e Schwierigkeiten für viele Sterbebegleiter ergeben sich aus:• dem Alter <strong>der</strong> <strong>Sterben</strong>den (die Begleitung jüngerer <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> wird als schwerererlebt),• <strong>der</strong> eigenen Unsicherheit,• <strong>der</strong> Frustration durch die eigene Unsicherheit,• Schwierigkeiten bei plötzlich e<strong>in</strong>tretendem <strong>Tod</strong>,• Schuldgefühle bei nicht offener Kommunikation,• Angst vor doppeldeutigen Fragen <strong>der</strong> PatientInnen,• die stets notwendige Kontrolle <strong>der</strong> Antworten auf Fragen von PatientInnen, die nichtsvon ihrem Zustand wissen,• <strong>der</strong> starken Identifikation <strong>mit</strong> dem Patienten <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Lage,
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 93• dem Mangel an Erfolgserlebnissen <strong>und</strong>• den Gesprächen <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den <strong>und</strong> dem <strong>Sterben</strong>.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 9)Sterbebegleitung stellt so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e anspruchsvolle Tätigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em emotional hochbelasteten Feld dar.Institutionsspezifische Variablen (Organisationsstrukturen <strong>und</strong> ihre Folgen) erweisenals stark modifizierend für das Ausmaß empf<strong>und</strong>ener Beanspruchung bei denMitarbeiterInnen, denn die Betreuung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em organisatorischenKontext nicht nebenbei erfolgen, son<strong>der</strong>n muss im Zentrum <strong>der</strong> Aufmerksamkeitstehen:„Schwerstkranke, sterbende Menschen brauchen Hilfe <strong>in</strong> spezieller Zusammensetzung,Intensität <strong>und</strong> <strong>in</strong> sehr unterschiedlichen Situationen. Das erschwert die Befriedigung ihrerBedürfnisse <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Institutionen, <strong>der</strong>en Organisation die Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>nicht als zentrale Aufgabe e<strong>in</strong>schließt.“ (Blosser-Reisen, 1997b, 184)Dementsprechend zeigt sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie von Schrö<strong>der</strong> (2003) die Bedeutung vonArbeits- <strong>und</strong> Organisationsbed<strong>in</strong>gungen auf professionelle SterbebegleiterInnen:„Die gleichen Anfor<strong>der</strong>ungen, die bei günstigen Arbeits- <strong>und</strong> Organisationsbed<strong>in</strong>gungen<strong>mit</strong> Arbeitsfreude optimal bewältigbar s<strong>in</strong>d, können unter schlechteren Arbeitsvoraussetzungenals Überfor<strong>der</strong>ung erlebt werden.“ (Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003, 21)Kaluza & Töpferwe<strong>in</strong> (2001a, 2001b, 2001c) kristallisieren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie zweiTypisierungen von E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Bezug auf Sterbebegleitung heraus:E<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> denen Sterbebegleitung e<strong>in</strong>en hohen Stellenwert genießt, <strong>und</strong>E<strong>in</strong>richtungen <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em eher niedrigen Stellenwert <strong>der</strong> Sterbebegleitung (Kaluza &Töpferwe<strong>in</strong>, 2001c, 71). Es zeigen sich <strong>in</strong> dieser Untersuchung signifikanteUnterschiede zwischen den E<strong>in</strong>richtungsarten <strong>in</strong> Bezug auf Arbeitsbelastung <strong>und</strong>Erschöpfung <strong>der</strong> MitarbeiterInnen.Deutsche Studien bieten zu dieser Fragestellung folgendes Bild: In Hospizen führengute organisatorische Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung zur vergleichsweiseger<strong>in</strong>gsten Beanspruchung <strong>der</strong> MitarbeiterInnen (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 10). Ine<strong>in</strong>er Vergleichsstudie zwischen Hospizen <strong>und</strong> Palliativstationen ergaben sich leichthöhere, arbeitsplatzbed<strong>in</strong>gte Stressoren im Bereich <strong>der</strong> Palliativstationen.Hospizpflegende nahmen dabei im Vergleich zu Palliativpflegenden höhere<strong>in</strong>stitutionelle <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gere Stressoren am Arbeitsplatz wahr. DieDifferenzen zu Lasten <strong>der</strong> Palliativstationen s<strong>in</strong>d zu großen Teilen <strong>in</strong> den
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 94betrieblichen Strukturen <strong>der</strong> Krankenhausorganisation begründet (Schrö<strong>der</strong>, H. et al.,2003, 62). Die gleiche Studie belegt, dass Pflegende im Hospiz- <strong>und</strong> Palliativbereichger<strong>in</strong>gere Erschöpfungswerte aufweisen als e<strong>in</strong>e Vergleichspopulation imKrankenhaus:„Vergleicht man die untersuchte Population <strong>mit</strong> an<strong>der</strong>en Studien an deutschenKrankenhauspflegekräften, so s<strong>in</strong>d vergleichsweise niedrige Burnout-Tendenzen beimPflegepersonal <strong>in</strong> term<strong>in</strong>aler Pflege konstatierbar.“ (Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003, 60)Die höchste berufliche Beanspruchung ergibt sich bei Pflegenden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altenpflege.E<strong>in</strong>e Studie von Bermejo & Muthny (1995) <strong>in</strong> Alten- <strong>und</strong> Pflegee<strong>in</strong>richtungenerbrachte folgende Ergebnisse: E<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> Befragten gaben an, unter hoherBelastung zu stehen. Hauptursachen dieser Belastung waren die Berufsgruppenzugehörigkeit(je mehr Verantwortung, desto höher die Beanspruchung) <strong>und</strong> <strong>der</strong>gedrängte Zeitplan <strong>in</strong> Altenpflegee<strong>in</strong>richtungen. Da<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>hergehend ergab e<strong>in</strong>eStudie von Kruse, Kröhn, Langerhans & Schnei<strong>der</strong> (1992) die folgendenBelastungsfaktoren bei MitarbeiterInnen <strong>in</strong> <strong>der</strong> stationären Altenpflege:„Schwierigkeiten <strong>mit</strong> Kollegen, Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>, Umgang <strong>mit</strong>schwierigen Heimbewohnern, Konflikt zwischen den eigenen Ansprüchen <strong>und</strong> demMachbaren, hohe Verantwortung – Gefühl <strong>der</strong> Überfor<strong>der</strong>ung, Reglementierung,physische Belastung, hohe Erwartungen <strong>der</strong> Bewohner, Unsicherheit im Umgang <strong>mit</strong>verwirrten <strong>und</strong> depressiven Heimbewohnern, Schwierigkeiten Heimbewohner zumotiveren <strong>und</strong> aktivieren, wenig Erfolgserlebnisse, Verhaltensunsicherheiten, schlechtesImage des Berufs, verän<strong>der</strong>te Alters- <strong>und</strong> Pflegestruktur im Heim, Des<strong>in</strong>teresse <strong>der</strong>Angehörigen.“ (Kruse, A. et al., 1992)MitarbeiterInnen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen, die nicht speziell auf die Sterbebegleitungausgerichtet s<strong>in</strong>d, weisen also höhere Belastungswerte auf als ihre KollegInnen <strong>in</strong>spezialisierten E<strong>in</strong>richtungen. Es muss <strong>in</strong> diesem Zusammenhang jedochdifferenzierend darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden, dass die unterschiedliche Zielsetzung<strong>der</strong> verschiedenen E<strong>in</strong>richtungen auch zu unterschiedlichen Qualitäten vonArbeitszufriedenheit bzw. –beanspruchung führt:„Art <strong>und</strong> Intensität psychischer Belastungen sche<strong>in</strong>en allerd<strong>in</strong>gs bei Ärzten <strong>und</strong>Pflegekräften <strong>in</strong> konventionellen Krankenhäusern an<strong>der</strong>s zu se<strong>in</strong> als bei Betreuenden <strong>in</strong>Hospize<strong>in</strong>richtungen.“ (Wittkowski, 2002, 17)An fast allen Studien zur Arbeitssituation von Sterbebegleitenden muss bemängeltwerden, dass sie sich ausschließlich <strong>mit</strong> Belastungs<strong>in</strong>dikatoren beschäftigen <strong>und</strong>Indikatoren für <strong>Ressourcen</strong> dabei außer Acht lassen. Es zeigen sich dann, wie bisherdargestellt, Abstufungen von qualitativer <strong>und</strong> quantitativer Überfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 95Pflegenden (z.B. Nähe zur Krankheit, Zeitdruck, Thematik von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>, etc.)sowie allgeme<strong>in</strong>e ges<strong>und</strong>heitsbee<strong>in</strong>trächtigende Arbeitsplatzbed<strong>in</strong>gungen (z.B.ger<strong>in</strong>ge Handlungsspielräume, organisatorische Probleme, ger<strong>in</strong>ge Aufstiegsmöglichkeiten,soziale Stressoren, Schichtarbeit, etc.) (vgl. dazu auch Allert, 2003;Bruera, 2000).In allen Studien zur Situation professioneller SterbebegleiterInnen <strong>in</strong> ihremArbeitsumfeld fehlt daher auch <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>. LediglichSchrö<strong>der</strong> et al. (2003) erheben auch diesen Bereich <strong>und</strong> kommen zu dem Schluss,dass MitarbeiterInnen von Hospizen <strong>und</strong> Palliative<strong>in</strong>richtungen ihre sozialenUnterstützungssysteme deutlich häufiger <strong>in</strong> Anspruch nehmen als die Normalpopulation:„<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Pflegee<strong>in</strong>richtungen haben im Berufsfeld <strong>der</strong>Sterbebegleitung e<strong>in</strong>en gewichtigen Stellenwert für die psychische Stabilisierung <strong>und</strong> fürdie Vermeidung von körperlichen <strong>und</strong> seelischen Bee<strong>in</strong>trächtigungen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e fürdie Reduzierung <strong>der</strong> Burnout-Belastetheit.“ (Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003, 64)Vere<strong>in</strong>zelt zeigt sich die Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Studien, die e<strong>in</strong>everwandte Forschungsfrage <strong>in</strong> den Mittelpunkt stellen, <strong>und</strong> wird jedoch nicht explizitdeutlich gemacht. E<strong>in</strong>e Studie (Beutel & Tausch-Flammer, 1990) beispielsweise, diehilfreiche Faktoren bei professionellen SterbebegleiterInnen erfragte, kommt imErgebnis zu den sechs Kraftquellen „Ich selbst“, „<strong>der</strong> Glaube“, „das Team“, „<strong>der</strong>Patient“, „<strong>der</strong> Angehörige“ <strong>und</strong> „Zeit haben“. Vier davon beziehen sich explizit auf dassoziale Lebensfeld <strong>der</strong> Professionellen; doch lei<strong>der</strong> wird hier von Seiten <strong>der</strong>AutorInnen ke<strong>in</strong>e Schlussfolgerung für den Bereich <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>gezogen.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Sterbebegleitung e<strong>in</strong>e sehranspruchsvolle, professionelle Tätigkeit darstellt, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em emotional belastetenFeld stattf<strong>in</strong>det. Dabei wirken sich <strong>in</strong>stitutionelle Strukturen als stark mo<strong>der</strong>ierend aufdie subjektiv empf<strong>und</strong>ene Arbeitsbeanspruchung <strong>der</strong> Professionellen aus: InInstitutionen, <strong>der</strong>en Fokus auf <strong>der</strong> Sterbebegleitung liegt (z.B. Hospize, Palliativstationen),wird die Arbeit als weit weniger belastend empf<strong>und</strong>en als <strong>in</strong> Institutionen,<strong>der</strong>en Fokus auf an<strong>der</strong>en Bereichen als <strong>der</strong> Sterbebegleitung liegt (z.B. Heilung,Altenbetreuung). Die Ursachen dafür liegen sicherlich sowohl <strong>in</strong> strukturellen
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 96Gegebenheiten <strong>der</strong> Organisationen als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Selbstselektion vonMitarbeiterInnen von Hospizen <strong>und</strong> Palliativstationen. Über för<strong>der</strong>liche Aspekte <strong>und</strong><strong>Ressourcen</strong> im Arbeitsfeld ist nichts bekannt.Unterstützung <strong>der</strong> UnterstützendenWie im vorangegangenen Exkurs zu den Anfor<strong>der</strong>ungen an professionelleSterbebegleitung deutlich wurde, handelt es sich dabei um e<strong>in</strong>e äußerstanspruchsvolle <strong>und</strong> komplexe Tätigkeit, die nachhaltiger Ausbildung <strong>und</strong>Unterstützung bedarf (vgl. Wittkowski et al., 2004). Denn die Professionellen aufdiesem Gebiet arbeiten nicht nur auf e<strong>in</strong>em mediz<strong>in</strong>ischen, psychologischen <strong>und</strong>ethischen Grenzgebiet, son<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ihrer Arbeit auch komplexen <strong>in</strong>terpersonalen<strong>und</strong> sozialen Situationen ausgesetzt. So führt beispielsweise Oorschot (2002) aus:„In <strong>der</strong> Sterbephase bekommt für die meisten Befragten <strong>der</strong> Hausarzt als vertrauterPartner <strong>der</strong> Familie zunehmend Gewicht. Er wird als ggf. professionelle Hilfe leisten<strong>der</strong>Begleiter <strong>in</strong> die Familie <strong>in</strong>tegriert.“ (Oorschot, 2002, 663)Was Oorschot (2002) für den Beruf des Arztes ausführt, trifft auf alle Berufsgruppenzu, die <strong>in</strong> ihrer Tätigkeit engen <strong>und</strong> regelmäßigen Kontakt zu sterbenden Menschenhaben (vgl auch Kapitel 4.1. – Beson<strong>der</strong>e Situation <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung imSterbeprozess). Sie werden <strong>in</strong> das Netz absorbiert, das den Patienten <strong>und</strong> se<strong>in</strong>eAngehörigen trägt. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (2001) macht deutlich, dass Sterbebegleitunge<strong>in</strong>e schwere Aufgabe ist, bei <strong>der</strong> Professionelle <strong>der</strong> Unterstützung bedürfen. Erbetont,„(…) dass Sterbebegleitung für alle BegleiterInnen e<strong>in</strong>e schwere Aufgabe ist, e<strong>in</strong>eAufgabe, die nicht nur e<strong>in</strong>er Ausbildung bedarf, son<strong>der</strong>n auch kont<strong>in</strong>uierlicherUnterstützung (z.B. Supervision). Sterbebegleitung erfor<strong>der</strong>t immer die ganzePersönlichkeit <strong>und</strong> zudem die Bereitschaft, sich stets neu e<strong>in</strong>zulassen – auch auf dieeigenen Ängste <strong>und</strong> Unsicherheiten dem eigenen <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> gegenüber. Insofernist Sterbebegleitung auch immer e<strong>in</strong>e Last – jedoch e<strong>in</strong>e Last, die tragbar ist.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 2001, 10)Dem entsprechend zeigen alle diesbezüglichen Befragungen von Professionellennach ihren Wünschen zu Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutiges Bild (Bermejo &Muthny, 1995; Geiss, Belschner & Oldenbourg, 2005; Kruse, A. et al., 1992; Sch<strong>mit</strong>z-
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 97Scherzer, 1995a; Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003; Schweidtmann, 1995): Supervision <strong>und</strong>berufsfeldspezifische Weiterbildung werden von Professionellen im Bereich <strong>der</strong>Sterbebegleitung stark gewünscht <strong>und</strong> nachgefragt, bzw. dort explizit vermisst, wosie nicht <strong>in</strong> ausreichendem Maße gegeben s<strong>in</strong>d:„In engem Zusammenhang <strong>mit</strong> <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>er besseren Aus- <strong>und</strong>Fortbildungssituation steht <strong>der</strong> Wunsch sehr vieler Mitarbeiter, besser auf die Begleitung<strong>Sterben</strong><strong>der</strong> vorbereitet zu se<strong>in</strong>. Viele Mitarbeiter fühlen sich gerade <strong>in</strong> diesem Bereich(…) überfor<strong>der</strong>t <strong>und</strong> wünschen sich hier die Unterstützung von Kollegen <strong>und</strong>Supervisoren.“ (Kruse, A. et al., 1992, 143)Auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Ver<strong>mit</strong>tlung von spezifischem Wissen <strong>in</strong> Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungzeigt sich e<strong>in</strong>e ebenso deutliche, konträre Lage: Sowohl deutsche als auch<strong>in</strong>ternationale Studien zeigen e<strong>in</strong> mangelhaftes Angebot <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ausbildung vonprofessionell Tätigen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung. So weist e<strong>in</strong>e deutsche Studie(Schweidtmann, 1995) auf, dass 71,9% <strong>der</strong> ÄrztInnen ihrer Ausbildung nicht auf denUmgang <strong>mit</strong> sterbenden Menschen vorbereitet werden. E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e deutsche Studie(Beutel & Tausch-Flammer, 1990, 248) an professionellen SterbebegleiterInnenergibt, dass bei 50% <strong>der</strong> Befragten <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> kaum Thema <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ausbildungwar <strong>und</strong> dass 60% die Aus- <strong>und</strong> Fortbildung hierzu als unbefriedigend bewerten.Rabow et al. (2000) zeigen, dass auch im amerikanischen Kulturkreis Sterbebegleitung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Ausbildung <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>er nicht repräsentiert ist: Die 50meistverkauften Fachbücher für Mediz<strong>in</strong>er wurden dabei auf Inhalte zur Begleitung<strong>und</strong> Betreuung im Sterbeprozess h<strong>in</strong> untersucht. Die Informationen wurden aufQuantität <strong>und</strong> ‘Helpfulness’ h<strong>in</strong> bewertet. Es zeigte sich:„The textbooks with the highest percentages of absent content were <strong>in</strong> surgery (71,8%),<strong>in</strong>fectious diseases and AIDS (70%), and oncology and hematology (61,9%). Textbookswith the highest percentage of helpful end-of-life care content were <strong>in</strong> family medic<strong>in</strong>e(34,4%), geriatrics (34,4%), and psychiatry (29,6%). (…) Content doma<strong>in</strong>s covered leastwell were social, spiritual, ethical, and family issues, as well as physician after-deathresponsibilities. On average, textbook <strong>in</strong>dexes cited 2% of their total pages as pert<strong>in</strong>ent toend-of-life care. (…) Top-sell<strong>in</strong>g textbooks generally offered little helpful <strong>in</strong>formation oncar<strong>in</strong>g for patients at the end of life.” (Rabow, Hardie, Fair & McPhee, 2000, 771)Es wird deutlich, dass e<strong>in</strong>e adäquate Ausbildung, die auf die Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungenim Bereich <strong>der</strong> Sterbebegleitung vorbereiten würde, nicht gegeben ist. (E<strong>in</strong>eÜbersicht zu notwendigen Ausbildungs<strong>in</strong>halten für den deutschen Kulturraum f<strong>in</strong>detsich bei Wittkowski et al. 2004, 109f.; für e<strong>in</strong> entsprechendes Ausbildungsmanualsiehe bspw. Aue, Ba<strong>der</strong> & Lühmann, 1995; Davy & Ellis, 2003 o<strong>der</strong> Krauß, 2000.)
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 98Ähnlich stellt sich die Situation <strong>in</strong> Weiterbildung <strong>und</strong> Supervision dar: Schweidtmann(1995) kommt bei e<strong>in</strong>er Befragung von 650 MitarbeiterInnen <strong>in</strong> Krankenhäusern <strong>in</strong>Deutschland, Österreich <strong>und</strong> <strong>der</strong> Schweiz zu dem Ergebnis, dass fast drei Viertel <strong>der</strong>ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegenden ke<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierlich berufsbegleitende Unterstützung zurVerfügung steht. Als sehr schlecht kann die bestehende Fortbildungssituation imBereich <strong>der</strong> Altenpflege (vgl. Bermejo & Muthny, 1995) bezeichnet werden. Dortkönnen nur 8% <strong>der</strong> Befragten an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungenteilnehmen. Der Bedarf an psychosozialer Fortbildung <strong>und</strong> Supervision istdemgegenüber entsprechend hoch: Auch hier wünschen sich mehr als die Hälfte <strong>der</strong>MitarbeiterInnen entsprechende Fortbildungen <strong>und</strong> Unterstützungsangebote.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (1995b) fasst eigene, diesbezügliche Erhebungen wie folgtzusammen:„Es zeigt sich, dass neben e<strong>in</strong>er Schulung <strong>und</strong> Ausbildung, die das <strong>Sterben</strong> <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>bezieht, auch e<strong>in</strong>e permanente Stützung <strong>der</strong> SterbebegleiterInnen etwa durchSupervision o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Methoden angezeigt ist.“ (Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, 1995b, 247)Entsprechend ergab e<strong>in</strong>e Befragung von Professionellen (Oldenbourg, <strong>in</strong>Vorbereitung) im Rahmen des dieser Arbeit zugr<strong>und</strong>e liegenden Projekts, dassProfessionelle im Bereich <strong>der</strong> Sterbebegleitung mangels an<strong>der</strong>er Supervisions- <strong>und</strong>Intervisionsalternativen den <strong>in</strong>formellen Austausch <strong>und</strong> den Zusammenhalt imeigenen Arbeitsteam als vorwiegende Quelle des Stressabbaus <strong>und</strong> <strong>der</strong>Stabilisierung nutzen (vgl. dazu auch Aichner, Gruß, Hofer & Schießl, 2003; Beutel &Tausch-Flammer, 1990).Zusammenfassend kann zur Lage <strong>der</strong> Menschen, die professionell <strong>mit</strong> kritischkranken <strong>und</strong> sterbenden Menschen betraut s<strong>in</strong>d, festgehalten werden: Sterbebegleitungstellt e<strong>in</strong>e höchst anspruchsvolle <strong>und</strong> belastende Aufgabe für diebeteiligten Professionellen dar, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em komplexen mediz<strong>in</strong>ischen, psychologischen,sozialen <strong>und</strong> ethischen Grenzbereich stattf<strong>in</strong>det. Entsprechend zeigt sichdiese Berufsgruppe als relativ belastet <strong>in</strong> ihrem Arbeitsumfeld. Es werden auchVariablen deutlich, die stark mo<strong>der</strong>ierende Auswirkungen auf diese Beanspruchungenim professionellen Feld haben (z.B. Organisationsbed<strong>in</strong>gungen, Aus<strong>und</strong>Weiterbildung). Lei<strong>der</strong> ist ke<strong>in</strong> Trend zur Umsetzung <strong>der</strong> gewonnenen
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 99Erkenntnisse im gesellschaftlichen Rahmen erkennbar, die Entwicklung ersche<strong>in</strong>tgegenläufig. Denn durch die zunehmende Professionalisierung des <strong>Sterben</strong>s werdendie Kapazitäten <strong>der</strong> vorhandenen E<strong>in</strong>richtungen, Strukturen <strong>und</strong> Berufstätigen <strong>in</strong>maximaler Weise ausgelastet, um <strong>der</strong> steigenden, gesellschaftlichen Nachfragenachzukommen, anstatt die gewonnen Erkenntnisse zur Verän<strong>der</strong>ung beruflicherOrganisationsstrukturen sowie zur Verbesserung von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmöglichkeitenzu nutzen (vgl. dazu bspw. Kalua, Tan & Bacon, 1999).Es zeigt sich, dass soziale Beziehungen e<strong>in</strong>en klar nachweisbaren Bereich währenddes Sterbeprozesses <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung ausmachen <strong>und</strong> dort für dasIndividuum von großer Bedeutsamkeit s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> Forschung <strong>und</strong> Theoriebildung jedochbisher vernachlässigt werden. Lediglich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Interventionsansätzen stehen sieden empirischen Ergebnissen entsprechend im Mittelpunkt (vgl. SozioemotionaleSelektions-Theorie nach Carstensen, 1995).Die große Bedeutung würdigend, die sozialen Beziehungen während desSterbeprozesses zukommt, entwickelte Barton (1977, zit. n. Howe, 1995) dasInteraktions-Adaptations-Konzept für die Pflege sterben<strong>der</strong> Menschen. Er betont dieBedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen <strong>und</strong> stellt sie <strong>in</strong> den Mittelpunktse<strong>in</strong>es Interventionsansatzes: Die Begleitung sterben<strong>der</strong> Menschen ist untrennbarverb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> den Interaktionen zwischen dem sterbenden Menschen, se<strong>in</strong>erFamilie <strong>und</strong> den professionell Helfenden. Das Hauptziel <strong>der</strong> Sterbebegleitung bestehtentsprechend dar<strong>in</strong>, tragfähige Beziehungen zu entwickeln <strong>und</strong> aufrecht zu erhalten(Interaktion). Der professionelle Sterbebegleiter muss sich dabei darauf e<strong>in</strong>stellen,dass <strong>in</strong> dem aufgebauten Interaktionsfeld die Bedürfnisse, Wahrnehmungen <strong>und</strong>Reaktionen aller Beteiligten sich ständig verän<strong>der</strong>n (Adaptation). Für die Arbeit <strong>in</strong>ambulanten <strong>und</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Altenpflege bedeutet die Gestaltung<strong>und</strong> offene Aufrechterhaltung solcher Beziehungen zwischen allen Beteiligten e<strong>in</strong>enerheblichen personellen <strong>und</strong> organisatorischen Aufwand. Howe (1995) betont dieBedeutung von Bartons Ansatz:„Der <strong>Sterben</strong>de macht die Erfahrung, dass er allmählich nicht mehr zu dem Netz se<strong>in</strong>erzahlreichen persönlichen <strong>und</strong> beruflichen Beziehungen gehört. Dadurch hatte er e<strong>in</strong>Gefühl des Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s, des Verankertse<strong>in</strong>s <strong>und</strong> den E<strong>in</strong>druck, dass das Leben
Kapitel 4 – Perspektiven <strong>der</strong> Studie 100weitergeht. Sowohl enge als auch relativ distanzierte Beziehungen können vom<strong>Sterben</strong>den leicht als sehr verletzlich, leicht unterbrechbar <strong>und</strong> brüchig wahrgenommenwerden. Von daher entwickelt er e<strong>in</strong> Bedürfnis nach Verlässlichkeit, Verfügbarkeit <strong>und</strong>Stabilität <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Beziehungen. Dies gilt umso mehr, als die meisten Menschen dasGefühl, am Leben zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> daran teilzuhaben, <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch <strong>mit</strong>menschlicheBeziehungen erhalten.“ (Howe, 1995, 257)Dieses Argument <strong>in</strong> den Mittelpunkt stellend nimmt die Analyse sozialer <strong>Ressourcen</strong>bei Menschen, die <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>in</strong> Berührung stehen, die Hauptrolle <strong>in</strong> <strong>der</strong>vorliegenden Arbeit e<strong>in</strong>. Die durchgeführte Studie <strong>und</strong> die folgende Analyse sollendabei e<strong>in</strong>en Beitrag zum Schließen <strong>der</strong> aufgezeigten Forschungslücken <strong>in</strong> diesemBereich leisten. Es wird im Folgenden <strong>der</strong> Frage nachgegangen, welche Rollesoziale <strong>Ressourcen</strong> bei kritisch kranken Menschen <strong>und</strong> bei Menschen, die eng <strong>mit</strong>ihnen zu tun haben, spielen.
Kapitel 5 – Fragestellungen <strong>der</strong> Untersuchung 1015. Fragestellungen <strong>der</strong> UntersuchungDie Zielsetzung <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit besteht dar<strong>in</strong>, die Bedeutung von sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> zu untersuchen <strong>und</strong> ihretheoretische Konzeption zu überprüfen. Es stehen daher zwei Fragenkomplexe imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>: Zum e<strong>in</strong>en stellt sich die Aufgabe, die Rolle von sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong><strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> anhand des Datenmaterials e<strong>in</strong>er Studie(Geiss & Belschner, 2004) aufzuzeigen. Zum an<strong>der</strong>en ist von Interesse, ob sich imvorhandenen Datenmaterial Anhaltspunkte dafür zeigen, dass das Konzept <strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>er Verän<strong>der</strong>ung bzw. Erweiterung im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> dargelegten,<strong>in</strong>tegrativen Theorien bedarf (siehe Kapitel 3.3. – Modelle für die <strong>in</strong>tegrative <strong>und</strong><strong>in</strong>teraktionale Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>).Dementsprechend ergeben sich folgende Fragestellungen für die Analyse desDatenmaterials:1. Welche Bedeutung haben soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><strong>Sterben</strong>?1.1. Wie verteilen sich die erhobenen Maße für soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Stichprobe?1.2. Wie verteilen sich die Outcome-Variablen, d.h. Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs-/Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe?1.3. Welche Beziehungen bestehen zwischen den erhobenen Maßen für soziale<strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> den Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs-/Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>der</strong>befragten Personen?
Kapitel 5 – Fragestellungen <strong>der</strong> Untersuchung 1022. Lassen sich Anhaltspunkte für e<strong>in</strong>e Modifikation des Konzepts <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> im vorhandenen Datensatz f<strong>in</strong>den?2.1. Wie verhalten sich die erhobenen E<strong>in</strong>zelmaße von sozialen <strong>Ressourcen</strong>zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong>? Und lassen sich unterschiedliche Dimensionen von sozialen<strong>Ressourcen</strong> aus ihnen ableiten?2.2. Welcher Gestalt ist <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen sozialem <strong>und</strong> personalemRaum: Hängen die E<strong>in</strong>zelmaße <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> bzw. die abgeleitetenDimensionen <strong>mit</strong> ausgewählten (salutogenetisch geprägten) Persönlichkeitse<strong>in</strong>stellungenzusammen?Diese Fragestellungen sollen durch die Analyse des vorliegenden Datenmaterialssukzessive beantwortet werden.
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 1036. Stichprobengew<strong>in</strong>nung6.1. Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong>SterbeprozessenThema <strong>und</strong> Fokus des ProjektsUntersuchungsgegenstand <strong>und</strong> Fragestellung des ProjektsAufbau des ProjektsDurchführung <strong>und</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> PilotstudieFragestellungen <strong>der</strong> HauptstudieDurchführung <strong>der</strong> Hauptstudie6.2. E<strong>in</strong>bettung des Themas <strong>in</strong>nerhalb des GesamtprojektsDas im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit ausgewertete <strong>und</strong> präsentierte Datenmaterialstammt aus dem Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong>kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ (Universität Oldenburg; B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriumfür Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> <strong>Soziale</strong> Sicherung). Daher wird zunächst e<strong>in</strong> kurzerAbriss des Forschungsprojekts gegeben (für ausführliche Informationen siehe Geiss& Belschner, 2003, 2004). Darauf aufbauend kann das vorliegende Thema <strong>in</strong>nerhalbdes Gesamtprojekts verortet werden.6.1. Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischenKrankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“Themenstellung <strong>und</strong> Fokus des ProjektsBegreift man den Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozess nicht als <strong>in</strong>dividuelles Schicksal,son<strong>der</strong>n als vielschichtiges, soziales Geschehen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Mensch-Umwelt-Kontext,so ist die E<strong>in</strong>beziehung multipler Variablen zur Erfassung <strong>der</strong> Komplexität dieserProzesse erfor<strong>der</strong>lich (s. Kapitel 3.3. – <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> aus <strong>in</strong>tegrativer Sicht).Diesem Ansatz entsprechend steht die Erhebung aller relevanten Faktoren, die sichauf den kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozess auswirken, im Mittelpunkt des
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 104Forschungsprojekts „Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong>Sterbeprozessen“. So wird <strong>der</strong> Patient zu se<strong>in</strong>er Situation, se<strong>in</strong>en Wünschen <strong>und</strong>Bedürfnissen sowie zu den von ihm subjektiv erlebten Beanspruchungen <strong>und</strong>Entlastungsfaktoren befragt. Gleichermaßen werden auch alle an<strong>der</strong>en, am Prozessbeteiligten Personengruppen ebenfalls zu ihren Wahrnehmungen, Wünschen <strong>und</strong>Belastungen befragt. Durch die Gesamtanalyse all dieser Daten kann e<strong>in</strong> sehrdifferenziertes Bild <strong>der</strong> Geschehnisse <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es kritischen Krankheits- <strong>und</strong>Sterbeprozesses <strong>und</strong> vor allem <strong>der</strong> psychischen Gegebenheiten <strong>und</strong> Beanspruchungenaller Beteiligten nachgezeichnet werden. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong>art genaueSituationsanalyse ist sowohl als Basis für Interventionen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Versorgung kritischkranker <strong>und</strong> sterben<strong>der</strong> Menschen als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion um angemesseneArbeitsbed<strong>in</strong>gungen für <strong>in</strong> diesem Bereich professionell Tätige unerlässlich.Untersuchungsgegenstand <strong>und</strong> Fragestellung des ProjektsDrei forschungsleitende Fragestellungen stehen am Ausgangspunkt des gesamtenProjekts:• Wie erlebt e<strong>in</strong> kritisch kranker Mensch se<strong>in</strong>en Krankheitsprozess <strong>und</strong> welche Be<strong>und</strong>Entlastungen erfährt er dabei?• Wie schätzen die Menschen, die <strong>mit</strong> ihm <strong>in</strong> engem Kontakt stehen (betreuendeÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegekräfte, Angehörige, psychosozial Betreuende, freiwillig <strong>und</strong>ehrenamtlich Tätige), ihre Be- <strong>und</strong> Entlastungen e<strong>in</strong>?• Gibt es Unterschiede zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Gruppen von Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Umgebung kritisch Kranker <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> o<strong>der</strong> im Vergleich unterschiedlicheräußerer Kontexte? (Welche unterschiedlichen Aspekte herrschen beispielsweise<strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Belastung beim Arzt im Gegensatz zum Pflegepersonalvor? Gibt es spezifische Bedürfnisse e<strong>in</strong>es Patienten im Krankenhaus, im Hospiz,zuhause? Welche speziellen Beanspruchungen ergeben sich für die Beteiligtenbei <strong>der</strong> Betreuung bzw. dem <strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>es Menschen auf e<strong>in</strong>er Intensivstation?Usw.)
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 105H<strong>in</strong>ter diesen Fragestellungen steht zum e<strong>in</strong>en die praktische Zielsetzung, dassubjektive Erleben <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> zu erfassen. DerSchwerpunkt <strong>der</strong> Exploration liegt hierbei auf Aspekten <strong>und</strong> Umständen, die von denBeteiligten als hilfreich <strong>und</strong> entlastend erlebt werden im Gegensatz zu als belasten<strong>der</strong>lebten Variablen.Aufbau des ProjektsDas Forschungsprojekt glie<strong>der</strong>t sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Pilot- <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Hauptphase. DiePilotstudie diente <strong>der</strong> Generierung spezifischer Hypothesen durch e<strong>in</strong> qualitativesInterview-Design an <strong>der</strong> ausgewählten Population. Im Rahmen <strong>der</strong> Hauptstudiewurden die Ergebnisse <strong>der</strong> Interviews <strong>in</strong> spezifische Hypothesen umgesetzt <strong>und</strong>entsprechende Instrumente zusammengestellt, die an e<strong>in</strong>er großen Population zumE<strong>in</strong>satz kamen.Durchführung <strong>und</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> PilotstudieDie Pilotstudie wurde von Januar bis April 2002 geplant <strong>und</strong> vorbereitet. DieDatenerhebung <strong>in</strong> Form von leitfadenorientierten ExpertInnen-Interviews fand vonApril bis August 2002 statt. Die Interviews wurden von September bis Dezember2002 transkribiert <strong>und</strong> anschließend ausgewertet.Die Interviews <strong>der</strong> Pilotstudie sollten an e<strong>in</strong>er möglichst heterogenen Stichprobeerhoben werden, um e<strong>in</strong>e größtmögliche Bandbreite an äußeren Umgebungen,Personengruppen <strong>und</strong> persönlichen Situationen abdecken zu können. Abbruchkriteriumfür die Größe <strong>der</strong> Pilotstichprobe war im S<strong>in</strong>ne des Sättigungskriteriums dieWie<strong>der</strong>holung bereits erhobener Kriterien <strong>und</strong> das Fehlen neuer Aussagenkategorienim Interviewmaterial. Die Pilotstichprobe bestand abschließend aus 34 Interviews<strong>und</strong> setzte sich nach diesen Kriterien durch <strong>in</strong>dividuelle Auswahl zusammen. Die
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 106Stichprobe be<strong>in</strong>haltete 9 PatientInnen, 5 Bezugspersonen, 8 ÄrztInnen, 6 Pflegende,3 Psychosozial Betreuende <strong>und</strong> 3 freiwillig Helfende. Die Stichprobe wurde <strong>in</strong> fünfverschiedenen äußeren Umgebungen (Hospiz, onkologische Station sowiePalliativstation im Akutkrankenhaus, Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim, Privathaushalte fürambulant Betreute <strong>und</strong> Betreuende) <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Weser-Ems-Region rekrutiert. 32Interviews konnten als Tonbandmaterial ausgewertet werden, zwei wurden <strong>in</strong> Notizenverschriftlicht, da die Interviewten e<strong>in</strong>er Bandaufnahme nicht zustimmten.Das Textmaterial wurde nach dem Verfahren <strong>der</strong> Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl.Kraimer & Garz, 1991; Mayr<strong>in</strong>g, 1995, 1996; Merten, 1995; Meuser & Nagel, 1991)ausgewertet. E<strong>in</strong>e ausführliche Ergebnisdarstellung f<strong>in</strong>det sich im Zwischenbericht<strong>der</strong> Studie (Geiss & Belschner, 2004). In kurzer Form lassen sich folgendeHauptergebnisse aus <strong>der</strong> Pilotstudie festhalten:Für die als PatientInnen o<strong>der</strong> Bezugspersonen von schwerer Krankheit <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>betroffenen Personengruppen ist die zentrale Variable die ansche<strong>in</strong>end unbee<strong>in</strong>flussbareVerän<strong>der</strong>ung ihrer bisherigen, vertrauten Lebenssituation. Auf dieseessentielle Verän<strong>der</strong>ung wird <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em zentralen Bedürfnis nach Sicherheit bzw.Kontrolle reagiert. Wichtigstes Medium, um e<strong>in</strong> Sicherheitsgefühl entstehen zulassen, ist die Integration <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netzwerk, z.B. für PatientInnen durch denAustausch <strong>mit</strong> ebenfalls von <strong>der</strong> Krankheit Betroffenen, o<strong>der</strong> für Angehörige durchMöglichkeiten, Unterstützung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Doppelbelastungssituation zu erhalten, <strong>in</strong> <strong>der</strong> siesich bef<strong>in</strong>den. Beide Personengruppen s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>en hohen Belastungsgradgekennzeichnet, <strong>der</strong> sich von <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en auf die an<strong>der</strong>e Gruppe im Kontakt überträgt.Die <strong>in</strong> diesem Arbeitfeld professionell arbeitenden Berufsgruppen geben an, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>empsychisch äußerst belastenden Umfeld zu arbeiten. Die empf<strong>und</strong>ene Beanspruchungdurch die Arbeit hängt dabei stark von <strong>der</strong> persönlichen E<strong>in</strong>stellung zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><strong>Sterben</strong> sowie von den sozialen Kompetenzen des E<strong>in</strong>zelnen ab. Mo<strong>der</strong>ierendeVariable <strong>der</strong> empf<strong>und</strong>enen Beanspruchung ist auch hier das Gefühl subjektiverSicherheit durch Kontrolle (z.B. durch die Möglichkeit, sich von <strong>der</strong> Arbeit zudistanzieren). Wie schon bei PatientInnen <strong>und</strong> Angehörigen stellt auch hier dassoziale Netz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit o<strong>der</strong> im Privatleben den größten Stütz- <strong>und</strong> Entlastungsfaktordar.
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 107Fragestellungen <strong>der</strong> HauptstudieDiese im Rahmen <strong>der</strong> Pilotstudie gewonnenen, zentralen Ergebnisse wurden imweiteren Verlauf <strong>der</strong> Studie <strong>in</strong> Fragestellungen überführt, welche <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong>Hauptstudie untersucht wurden. Es ergaben sich folgende, spezifische Fragestellungen:A) Fragestellungen, die alle drei befragten Personengruppen betreffen:1. Wohlbef<strong>in</strong>den, Vertrauen, Kontrolle <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nhaftigkeit• Was gibt die befragte Person im H<strong>in</strong>blick auf ihr momentanes Wohlbef<strong>in</strong>den an?• Welche Anzeichen von Kontrolle, Vertrauen <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nhaftigkeit zeigt die befragtePerson?• Wie hängen das berichtete Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>mit</strong> Kontrolle, Vertrauen <strong>und</strong>S<strong>in</strong>nhaftigkeit zusammen?2. E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netzwerk• Über welches soziale Netzwerk verfügt die befragte Person?• Als wie befriedigend empf<strong>in</strong>det die befragte Person ihr soziales Netzwerk?• Wie ist ihr generelles Hilfesuch- <strong>und</strong> -annahmeverhalten?• Gibt es e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen e<strong>in</strong>em als ungenügend erlebten sozialenNetzwerk <strong>und</strong> dem Beanspruchungsgrad <strong>der</strong> befragten Person?3. Weitere, spezifische Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren:• Gibt es über die abgefragten Bereiche h<strong>in</strong>aus Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren, diefür die Situation <strong>der</strong> befragten Person spezifisch s<strong>in</strong>d?
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 108B) Zusätzliche Fragestellung für die Gruppe <strong>der</strong> Bezugspersonen:1. Beziehung zum Patienten bzw. zur Patient<strong>in</strong>:• Wie wird die Beziehung zum Patienten e<strong>in</strong>gestuft?• Gibt es Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung zum Patienten durch die Krankheit?• Wie werden die Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung zum Patienten von <strong>der</strong>Bezugsperson bewertet?• Gibt es e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen problematischer Beziehungsverän<strong>der</strong>ung<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em höheren Beanspruchungsgrad <strong>der</strong> Bezugsperson?C) Zusätzliche Fragestellungen für die Gruppe <strong>der</strong> Professionellen:1. Arbeitsbeanspruchung, -situation, -zufriedenheit• Welche Beanspruchung gibt die befragte Person im Arbeitsbereich an?• In welchen <strong>in</strong>haltlichen Bereichen zeigt sie sich mehr o<strong>der</strong> weniger belastet?• Wie hängt die erlebte Beanspruchung durch die Arbeit <strong>mit</strong> dem generellberichteten Maß an Wohlbef<strong>in</strong>den zusammen?• Wie hängt die erlebte Arbeitsbeanspruchung <strong>mit</strong> dem berichteten Ausmaß anbenötigter Unterstützung zusammen?2. E<strong>in</strong>stellung zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>:• Welche E<strong>in</strong>stellung zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> zeigt die befragte Person?• Gibt es e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> berichteten E<strong>in</strong>stellung zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong><strong>Sterben</strong>, dem allgeme<strong>in</strong>en Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> den Parametern von Kontrolle,Vertrauen <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nhaftigkeit?• Wie hängt die erlebte Arbeitsbeanspruchung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> subjektiven E<strong>in</strong>stellung zu<strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> zusammen?
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 109Diese Themenbereiche s<strong>in</strong>d darüber h<strong>in</strong>aus sowohl <strong>in</strong> Bezug auf demografischeDaten <strong>der</strong> Person (z.B. Altersgruppe, Beruf bei Professionellen, Status <strong>der</strong>Bezugspersonen, Alter, Geschlecht, etc.) zu differenzieren als auch <strong>in</strong> Unterscheidungvon E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Institutionsarten (z.B. Intensivstationen <strong>in</strong>Akutkrankenhäusern, Pflegestationen <strong>in</strong> Altenheimen, Hospize, etc.).Durchführung <strong>der</strong> Hauptstudie 3Die Datenerhebung <strong>der</strong> Hauptstudie wurde von März bis Dezember 2003durchgeführt. Die Befragung fand dabei <strong>in</strong> sechs unterschiedlichen Institutions- bzw.Organisationsgruppen <strong>in</strong> Norddeutschland statt. Diese s<strong>in</strong>d im E<strong>in</strong>zelnen: stationäreHospize, ambulante Pflege- <strong>und</strong> Hospizdienste, Alten- <strong>und</strong> Pflegeheime sowieOnkologie-, Intensiv- <strong>und</strong> Palliativ-Stationen <strong>in</strong> Krankenhäusern.Es kann dabei hervorgehoben werden, dass im Rahmen <strong>der</strong> Studie Institutionen ausallen Bereichen des öffentlichen Lebens rekrutiert werden. Dies steht im Gegensatzzum überwiegenden Teil <strong>der</strong> thanatologischen Studien, die entwe<strong>der</strong> nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erInstitution o<strong>der</strong> Institutionsart Probanden rekrutieren o<strong>der</strong> aber über e<strong>in</strong>eübergeordnete Organisation Versuchspersonen ansprechen (z.B. Ste<strong>in</strong>hauser et al.,2001; Ste<strong>in</strong>hauser et al., 2000: Veterans Association). Durch dieses Vorgehen s<strong>in</strong>dGeneralisierungsaussagen nur e<strong>in</strong>geschränkt gültig. Das Forschungsprojekt „Be- <strong>und</strong>Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ hat h<strong>in</strong>gegenversucht, aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens e<strong>in</strong> repräsentatives Bild zuziehen <strong>und</strong> ist da<strong>mit</strong> vielen an<strong>der</strong>en Studien an Repräsentativität überlegen.Es wurde bei genau 100 Institutionen angefragt, ob sie Interesse haben würden, an<strong>der</strong> Studie teilzunehmen. Diese waren, <strong>mit</strong> Ausnahme <strong>der</strong> Palliativ-Stationen <strong>und</strong>Hospize, zufällig ausgewählt. Da es jedoch im norddeutschen Raum nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>geAnzahl an Palliativ-Stationen <strong>und</strong> Hospizen gibt, konnte für diese Institutionen ke<strong>in</strong>e3 Für Material zu diesem Kapitel danke ich Frau Dipl.-Psych. Rita Oldenbourg. Es ist <strong>in</strong> Teilen <strong>der</strong> von ihr unterme<strong>in</strong>er Betreuung angefertigten Diplomarbeit entnommen (Oldenbourg, <strong>in</strong> Vorbereitung).
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 110Randomisierung bei <strong>der</strong> Auswahl stattf<strong>in</strong>den – es wurden alle vorhandenenInstitutionen angesprochen.Die 64 Institutionen, die sich bereit erklärten, an <strong>der</strong> Studie teilzunehmen, wähltenaus ihren Reihen e<strong>in</strong>e Ansprechperson aus. Diese Person hatte die Aufgabe, <strong>in</strong>Frage kommende PatientInnen anzusprechen <strong>und</strong> für die InterviewerInnen denKontakt zu den an <strong>der</strong> Teilnahme <strong>in</strong>teressierten PatientInnen (die e<strong>in</strong>e mündliche wieschriftliche Vor<strong>in</strong>formation erhielten) herzustellen. Dabei war e<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeitzwischen den beteiligten Institutionen <strong>und</strong> den Projekt<strong>mit</strong>arbeiterInnen 4 , die fürdie Datenerhebung zuständig waren, vonnöten. Festgelegte Kriterien für die Auswahlvon PatientInnen waren e<strong>in</strong>erseits gr<strong>und</strong>sätzlich e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>fauste Prognose, <strong>und</strong>an<strong>der</strong>erseits die physische Stabilität für e<strong>in</strong> 20m<strong>in</strong>ütiges Gespräch, Artikulationsfähigkeit,ausreichende Orientierung im Alltagsbewusstse<strong>in</strong> sowie die Interessenbek<strong>und</strong>ungbei <strong>der</strong> Voranfrage <strong>der</strong> <strong>in</strong>stitutions<strong>in</strong>ternen Ansprechperson. Ke<strong>in</strong>eTeilnahmekriterien h<strong>in</strong>gegen waren Bildungsstand, Introspektionsfähigkeit sowie dasWissen um die Diagnose bzw. Prognose o<strong>der</strong> Möglichkeit des eigenen <strong>Sterben</strong>s (vgl.Geiss & Belschner, 2004).Die Fragebögen für PatientInnen wurden im Rahmen e<strong>in</strong>es persönlichen Gesprächs<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em Projekt<strong>mit</strong>arbeiter geme<strong>in</strong>sam ausgefüllt. Während des Gesprächs wurdeauch die nächste Bezugsperson des Patienten erfragt <strong>und</strong> ihr über den PatientenInformationen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Fragebogen angetragen. Bezugspersonen schickten denFragebogen dann entwe<strong>der</strong> direkt an die Universität Oldenburg zurück o<strong>der</strong> gabenihn an den Ansprechpartner <strong>in</strong> <strong>der</strong> Institution. Fragebögen für Professionelle wurdendurch die Ansprechpartner im <strong>in</strong>stitutionellen Kontext ausgegeben <strong>und</strong> nachAusfüllen wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>gesammelt. Ausnahmslos alle Fragebögen aller Personengruppenwurden <strong>in</strong> verschlossenen E<strong>in</strong>zelkuverts zurückgegeben, so dass dieAnony<strong>mit</strong>ät <strong>der</strong> Daten gewahrt wurde.4 Die Hilfskräfte, StudentInnen <strong>der</strong> Psychologie <strong>mit</strong> Schwerpunkt Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Kl<strong>in</strong>ischer Psychologie, dieam Ende ihres Studiums standen, wurden aus e<strong>in</strong>er größeren Zahl von Bewerbern durch persönliche Eignung<strong>und</strong> Vorerfahrung <strong>in</strong> diesem Bereich (therapeutische Gr<strong>und</strong>ausbildung, Arbeit im Bereich <strong>der</strong> Krankenversorgung,evtl. Ausbildung als HospizhelferIn, etc.) ausgewählt. Zusätzlich durchliefen die Hilfskräfte vor Beg<strong>in</strong>n ihresE<strong>in</strong>satzes e<strong>in</strong> Schulungs<strong>in</strong>tervall. Ab Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Datenerhebung standen sie zusätzlich unter <strong>in</strong>terner sowieexterner Supervision, um die Belastung, unter <strong>der</strong> die Hilfskräfte durch die <strong>in</strong>tensive Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emhochbelasteten Bereich standen, abzufangen.
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 111Insgesamt stellt die Datenerhebung über AnsprechpartnerInnen <strong>und</strong> persönlicheGespräche e<strong>in</strong> aufwendiges Verfahren dar, das jedoch nötig war, um guteRücklaufquoten <strong>in</strong> diesem belasteten Feld <strong>und</strong> <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em langen Forschungs<strong>in</strong>strument(s. Anhang 15) zu garantieren.
Kapitel 6 – Stichprobengew<strong>in</strong>nung 1126.2. E<strong>in</strong>bettung des Themas <strong>in</strong>nerhalb des GesamtprojektsDas Datenmaterial <strong>der</strong> hier vorliegenden Arbeit wird geschöpft aus den erhobenenGesamtdaten. Dem multivariaten Ansatz <strong>der</strong> <strong>in</strong>teraktionellen Theorien zufolge (s.Kapitel 3.3. – Exkurs) wird <strong>in</strong> allen Bereichen des Datenmaterials nach Indikatorenfür soziale Verb<strong>und</strong>enheit <strong>der</strong> befragten Personen gesucht <strong>und</strong> die Daten unterdiesem Gesichtspunkt verwendet:„However, when the <strong>in</strong>terest is <strong>in</strong> the function<strong>in</strong>g and development of a system – at thesubsystem level, at the level of the total person, or at the level of the person-environmentsystem – the emphasis on multiple causation and the <strong>in</strong>terdependency of operat<strong>in</strong>gfactors at each level have as a consequence, that the analysis should <strong>in</strong>clude a broadrage of variables that have been identified, <strong>in</strong> theoretical and/or empirical analyses, asessential for the un<strong>der</strong>stand<strong>in</strong>g of the processes at the appropriate level.” (Magnusson &Statt<strong>in</strong>, 1998, 738)Aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Pilotstudie <strong>und</strong> folglich den Fragestellungen <strong>der</strong>Hauptstudie ist bereits ersichtlich, dass <strong>der</strong> Rückgriff auf soziale <strong>Ressourcen</strong> beiallen Personengruppen von großer Bedeutung ist. Daher f<strong>in</strong>den sich im zusammengestelltenFragebogenset an verschiedenen Stellen unterschiedliche Indikatoren fürsoziale Parameter. Diese werden <strong>in</strong> Kapitel 7.1. – Erhebungsmethodik <strong>und</strong> Kapitel9.1. – Darstellung <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe dargestellt. DieseParameter (Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>) s<strong>in</strong>d daher vernetzt <strong>mit</strong> dem gesamtenProjektansatz <strong>und</strong> dem verwendeten Fragebogenset.
Kapitel 7 – Methodik 1137. Methodik <strong>der</strong> empirischen Untersuchung 57.1. Erhebungsmethodik7.2. Gütekriterien <strong>der</strong> verwendeten Instrumente7.3. AnalysemethodikDie Daten für die vorliegende Arbeit wurden im Rahmen des Forschungsprojekts„Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“(Universität Oldenburg; geför<strong>der</strong>t durch das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><strong>Soziale</strong> Sicherung, 2002-2005) erhoben. Wie <strong>in</strong> Kapitel 6.1. – Forschungsprojekt „Be<strong>und</strong>Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen“ e<strong>in</strong>gehendbeschrieben, teilt sich die Studie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e qualitative Pilot- <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e quantitativeHauptstudie. Dies entspricht dem methodischen Standard <strong>der</strong> Datenerhebung <strong>in</strong>Themenfel<strong>der</strong>n, die e<strong>in</strong>en hohen explorativen Anteil aufweisen. Mayr<strong>in</strong>g beschreibtdieses methodische Vorgehen <strong>in</strong> drei Phasen:“Zusammenfassend wird dadurch e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>sätzliche Abfolge im Forschungsprozessbeschrieben: Von <strong>der</strong> Qualität zur Quantität <strong>und</strong> wie<strong>der</strong> zur Qualität.“ (Mayr<strong>in</strong>g, 1995, 19)Die e<strong>in</strong>leitende, qualitative Phase dient <strong>der</strong> Spezifizierung <strong>der</strong> Fragestellung, <strong>der</strong>Begriffs- <strong>und</strong> Kategorienf<strong>in</strong>dung sowie dem Zusammenstellen des Analyse<strong>in</strong>strumentariums.In <strong>der</strong> Hauptphase steht die Anwendung des Analyse<strong>in</strong>strumentariumsje nach Gegenstand <strong>und</strong> Ziel <strong>der</strong> Analyse unter Zuhilfenahme quantitativerVerfahren im Mittelpunkt. Abschließend folgt die qualitative Analyse, <strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong>Rückbezug <strong>der</strong> Ergebnisse auf die Fragestellung sowie weiterführende Interpretationstattf<strong>in</strong>den. In <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit wird jedoch nur auf die quantitativ erhobenenDaten <strong>der</strong> Hauptstudie zurückgegriffen.Im folgenden Kapitel werden zunächst die verwendeten Methoden <strong>und</strong> Instrumentevorgestellt, die die Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> hier analysierten Daten bilden. E<strong>in</strong>e Darstellung<strong>der</strong> Gütekriterien <strong>der</strong> verwendeten Instrumente <strong>und</strong> <strong>der</strong> Analysemethodikvervollständigen die kurze, methodische Darstellung.5 Für Material zu diesem Kapitel danke ich Frau Dipl.-Psych. Melanie Kirchner. Es ist <strong>in</strong> Teilen <strong>der</strong> von ihr unterme<strong>in</strong>er Betreuung angefertigten Diplomarbeit entnommen (Kirchner, 2005).
Kapitel 7 – Methodik 1147.1. ErhebungsmethodikIm Folgenden wird e<strong>in</strong>e kurze Darstellung <strong>der</strong> verwendeten Methoden <strong>und</strong>Instrumente des gesamten Projekts gegeben.Im Projekt, das <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit zugr<strong>und</strong>e liegt, wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Querschnitterhebung<strong>der</strong> Status Quo <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ausgewählten Stichprobe erhoben. DieDatenerhebung wurde <strong>mit</strong> Hilfe e<strong>in</strong>es Fragebogensets durchgeführt, dessenThemenbereiche sich aus den qualitativen Ergebnissen <strong>der</strong> Pilotphase ergeben (vgl.Kapitel 6 – Durchführung <strong>und</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Pilotstudie). Bei <strong>der</strong> Konstruktion <strong>der</strong>Erhebungs<strong>in</strong>strumente standen sowohl die spezifische Fragestellung <strong>der</strong> Studie alsauch das Ziel weitestmöglicher E<strong>in</strong>bettung <strong>und</strong> Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>mit</strong>an<strong>der</strong>en, bereits bestehenden Forschungsdaten im Mittelpunkt. So wurde, zurbesseren Vergleichbarkeit <strong>mit</strong> den Ergebnissen aus <strong>der</strong> Literatur, weitgehend aufbereits bestehende <strong>und</strong> evaluierte Instrumente zurückgegriffen, die zu e<strong>in</strong>emFragebogenset zusammengefasst wurden. Auf diese Weise kann bei <strong>der</strong> Auswertung<strong>der</strong> Studienergebnisse auf die jeweiligen Kennzahlen <strong>und</strong> Vergleichsstichproben <strong>der</strong>e<strong>in</strong>zelnen Instrumente Bezug genommen werden. Zu e<strong>in</strong>igen <strong>in</strong>haltlichen Themen,die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pilotstichprobe als bedeutsam aufgetaucht waren, bestanden ke<strong>in</strong>e bereitsevaluierten Instrumente. In diesem Fall wurden zu diesen Themen e<strong>in</strong>ige Items, dieaus dem qualitativen Material <strong>der</strong> Interviews generiert wurden, <strong>in</strong> das Fragebogensetaufgenommen. Die auf diese Weise konstruierten Fragebögen f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Anhang15.Es wurden drei verschiedene Fragebögen für die bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pilotstudieunterschiedenen Personengruppen „PatientInnen“, „Bezugspersonen“, „Professionelle“entwickelt.Die unterschiedlichen Fragebogenvarianten stimmen dabei zu etwa 95% <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>übere<strong>in</strong>. Sie alle enthalten Fragen zu den Themen Wohlbef<strong>in</strong>den, E<strong>in</strong>stellungen,<strong>Soziale</strong> Unterstützung sowie freie Fragen zu momentanen Be- <strong>und</strong> Entlastungen:• Die Fragen zum aktuellen Bef<strong>in</strong>den wurden dem Fragebogen zur Erfassung desGes<strong>und</strong>heitsverhaltens FEG (Dlugosch & Krieger, 1995) entnommen. Aus dem
Kapitel 7 – Methodik 115FEG wurde <strong>der</strong> Fragebogenteil „Allgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den“ unverän<strong>der</strong>t <strong>in</strong> alledrei Fragebogenversionen unter dem Punkt I. „Fragen zu Ihrem Bef<strong>in</strong>denübernommen“.• Auch <strong>der</strong> Punkt II. „Fragen zu Ihren Lebense<strong>in</strong>stellungen“ ist bei allen dreiFragebogenversionen identisch. Unter diesem Punkt wurden Items ausverschiedenen Instrumenten zusammengefasst. Da es sich bei den ausgewähltenInstrumenten um Fragebögen zur Messung von E<strong>in</strong>stellungen handelt, war e<strong>in</strong>e<strong>der</strong>artige Komb<strong>in</strong>ation gut möglich. So f<strong>in</strong>den sich hier zuerst sechs Items ausdem „Fragebogen zur proaktiven E<strong>in</strong>stellung“ (Schwarzer & Sch<strong>mit</strong>z, 1999),gefolgt von vier Items aus dem „Fragebogen zur allgeme<strong>in</strong>en Selbstwirksamkeit“(Jerusalem & Schwarzer, 1999), dann drei Markeritems des „Fragebogen zuKompetenz- <strong>und</strong> Kontrollüberzeugungen FKK“ (Krampen, 1991). Es folgen vierItems aus <strong>der</strong> Skala <strong>Soziale</strong> Resonanz SR des Fragebogens „IntegraleGes<strong>und</strong>heit FIG-50“ (Belschner & Bantelmann, 2005) <strong>und</strong> schließlich vier Itemsaus <strong>der</strong> Skala „Transpersonales Vertrauen TPV“ (Belschner, 1998).• Der Unterpunkt „Fragen zu Ihrem sozialen Umfeld“, <strong>der</strong> sich im Patienten- <strong>und</strong>Bezugspersonenbogen unter Punkt III., im Professionellenbogen unter Punkt IV.f<strong>in</strong>det, basiert im ersten Teil auf dem „University of California Social SupportInventory UCLA-SSI“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Version (Schwarzer, 1991). Die Antwortalternativenmussten hier jedoch <strong>der</strong> jeweiligen Personengruppe angepasstwerden. Für den zweiten Teil wurden aus den „Berl<strong>in</strong>er Social Support Skalen“(Schwarzer & Schulz, 2000) neun Items entnommen.• E<strong>in</strong> weiterer, identischer Teil <strong>der</strong> Fragebögen betrifft „Fragen zu momentanen Be<strong>und</strong>Entlastungen“ (Patientenbogen IV., Bezugspersonen- <strong>und</strong> ProfessionellenbogenV.). Diese offenen Fragen dienen dazu, dezidiert spezifische Be- <strong>und</strong>Entlastungsfaktoren erfragen zu können, die <strong>in</strong> den zuvor verwendetenStandard<strong>in</strong>strumenten nicht thematisiert werden konnten.Zwei Themenbereiche existieren personengruppenspezifisch nur <strong>in</strong> jeweils e<strong>in</strong>erVersion <strong>der</strong> Fragebögen:• Der Fragebogen für Bezugspersonen enthält zusätzlich zu den oben genannten,für alle Fragebogenversionen geltenden Bereichen unter dem Punkt IV.
Kapitel 7 – Methodik 116„Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Beziehung zum Patienten“ neun explorative Items, die diesystemische Verän<strong>der</strong>ung im Bezugssystem von Patient <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Bezugspersonerfassen. Da e<strong>in</strong> <strong>der</strong>artiges Erhebungs<strong>in</strong>strument im deutschen <strong>und</strong>englischen Sprachraum bislang nicht existiert, wurden die Items aus dem Material<strong>der</strong> Pilotstichprobe generiert. Die abschließende, offene Frage soll weitere,ungenannte Kategorien sowie e<strong>in</strong> Rank<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong> Auswertung ermöglichen.• E<strong>in</strong> zusätzlicher Bereich f<strong>in</strong>det sich ebenfalls im Professionellen-Fragebogenunter Punkt II. „Fragen zur Situation <strong>in</strong> Ihrem Tätigkeitsfeld, das Sie <strong>mit</strong> demPatienten <strong>in</strong> Berührung br<strong>in</strong>gt“. Hierzu wurden im ersten Teil Items aus demInstrument „Beanspruchungsscreen<strong>in</strong>g bei Humandienstleistungen BHD“ (Hacker& Re<strong>in</strong>hold, 1999) sowie adaptierte Items aus <strong>der</strong> Befragung von MitarbeiterInnenzu ihrer ges<strong>und</strong>heitlichen Situation im Verwaltungs- bzw. Wissenschafts-Bereich(Belschner et al., 2002; Gräser, 2003) verwendet. Im zweiten Teil f<strong>in</strong>den sich fünfItems aus dem „Fragebogen<strong>in</strong>ventar zur mehrdimensionalen Erfassung desErlebens gegenüber <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> FIMEST“ (Wittkowski, 1996) sowie dreiexplorative Items, die aus <strong>der</strong> Pilotstichprobe generiert wurden.Im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Datenanalyse f<strong>in</strong>den Indikatoren aus allen Bereichen<strong>der</strong> Fragebogensets Verwendung, ausgenommen <strong>der</strong> spezifischen Beziehungsfragenbei Angehörigen, <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellungsfragen zu <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> beiProfessionellen sowie <strong>der</strong> offenen Fragen zu Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren.7.2. Gütekriterien <strong>der</strong> verwendeten InstrumenteDie Objektivität ist durch das E<strong>in</strong>setzen e<strong>in</strong>es Fragebogens, dessen relevante Teilequantitativ ausgewertet werden, gegeben (vgl. Mummendey, 1999). Da alle Itemsaus bestehenden Instrumenten stammen <strong>und</strong> dabei nur diejenigen verwendetwurden, die am höchsten laden, wird von ausreichen<strong>der</strong> Reliabilität <strong>und</strong> Validitätausgegangen. Jedoch ist bei <strong>der</strong> Konstruktvalidität <strong>mit</strong> E<strong>in</strong>schränkungen zu rechnen,
Kapitel 7 – Methodik 117da durch die Auswahl e<strong>in</strong>zelner Items aus umfangreicheren Skalen bezweifeltwerden kann, dass volle Konstruktvalidität erreicht wird. In dieser Studie aber stehen<strong>der</strong> auf das Anwendungsfeld orientierte Charakter <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> auch die Rücksichtnahmeauf den hohen Belastungsgrad <strong>der</strong> Menschen, die die Fragebögen ausfüllen,im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>, so dass dieses unzureichende Kriterium <strong>in</strong> Kauf genommen wird.7.3. AnalysemethodikUm die Daten zu analysieren, dient die Statistik-Software SPSS 12.0 für W<strong>in</strong>dows(vgl. Bühner, 2004; Diehl & Staufenbiel, 2002; Kuckartz, 1999).Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erhebung gewonnenen Daten bef<strong>in</strong>den sich auf dem metrischenSkalenniveau (Ausnahme demographische Daten: Nom<strong>in</strong>al-, Ord<strong>in</strong>al- <strong>und</strong> metrischesSkalenniveau). Sie werden sowohl <strong>mit</strong>hilfe deskriptiver als auch <strong>in</strong>ferentieller Statistikanalysiert.Auf <strong>der</strong> deskriptiven Ebene werden Häufigkeiten, Mittelwerte <strong>und</strong> Standardabweichungenberechnet. Als <strong>in</strong>ferenzstatistische Verfahren werden ebenfalls diegängigen Verfahren <strong>in</strong> Form von Chi-Quadrat-Tests, T-Tests, etc. sowie e<strong>in</strong>- <strong>und</strong>multifaktorielle Varianzanalysen (uni- o<strong>der</strong> multivariat) <strong>und</strong> Kovarianzanalysene<strong>in</strong>gesetzt. Außerdem werden Korrelationen berechnet. Zur Prüfung <strong>der</strong>verwendeten <strong>Ressourcen</strong>-Konzepte werden darüber h<strong>in</strong>aus Faktorenanalysendurchgeführt (vgl. Zöfel, 2003).Die Normalverteilung aller Parameter <strong>der</strong> Stichprobe kann aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> vorliegendenStichprobengröße angenommen werden (zentrales Grenzwerttheorem; vgl. Bortz,1999; Fahrmeier, 1999, 312):„Die Verteilung von Mittelwerten aus Stichproben des Umfangs n, die sämtlich <strong>der</strong>selbenGr<strong>und</strong>gesamtheit entnommen wurden, geht <strong>mit</strong> wachsendem Stichprobenumfang <strong>in</strong> e<strong>in</strong>eNV über.“ (Bortz, 1999, 93)
Kapitel 7 – Methodik 118Weiter heißt es:„Für praktische Zwecke können wir davon ausgehen, dass die Mittelwerteverteilung fürbeliebige Verteilungsformen des Merkmals <strong>in</strong> <strong>der</strong> Population bereits dann h<strong>in</strong>reichendnormal ist, wenn n>=30 ist.“Auch bei nicht gegebener Normalverteilung s<strong>in</strong>d also <strong>in</strong> diesem Falle Verfahren, diemetrisches <strong>und</strong> normalverteiltes Datenmaterial voraussetzen, möglich.
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 1198. StichprobenbeschreibungIm Folgenden wird die analysierte Stichprobe <strong>in</strong> Bezug auf die demographischenRahmendaten (Geschlecht, Institutionsart, Personengruppe, Alter, Berührungsdauer<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>) 6 dargestellt. Die auszuwertende Stichprobe umfasst <strong>in</strong>sgesamtN = 781 Personen.498 Personen (63,8%) weiblich <strong>und</strong> 280 Personen (35,9%) männlich. Drei Personenmachen ke<strong>in</strong>e Angaben zum Geschlecht.Sie verteilen sich wie folgt auf die untersuchten Institutionsarten (s. Abbildung 3):InstitutionsartSH = StationäresHospizAD = AmbulanterDienstAP = Alten- <strong>und</strong>PflegeheimKO =Krankenhaus,OnkologieKI = Krankenhaus,IntensivstationKP =Krankenhaus,PalliativstationAbbildung 3: Verteilung <strong>der</strong> StudienteilnehmerInnen <strong>in</strong>Institutionsarten209 Personen (26,8%) kommen ausdem Bereich <strong>der</strong> stationärenHospize. 171 Personen (21,9%) ausdem Bereich <strong>der</strong> ambulanten Hospiz<strong>und</strong>Palliativdienste. 103 Personen(13,2%) aus Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen.93 Personen (11,9%)kommen von onkologischenStationen <strong>in</strong> Akutkrankenhäusern, 97Personen (12,4%) von dortigen<strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischen Stationen.Und 108 Personen (13,8%) stammenaus Palliativstationen bzw. -e<strong>in</strong>heiten,die <strong>in</strong> Akutkrankenhäusernangesiedelt s<strong>in</strong>d.6 Der besseren Übersichtlichkeit halber s<strong>in</strong>d im Folgenden die dargestellten demographischen Rahmendaten beierstmaliger Nennung unterstrichen.
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 120Es zeigt sich e<strong>in</strong> leichter Überhang <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> befragten Personenzugunsten <strong>der</strong> stationären Hospize <strong>und</strong> <strong>der</strong> ambulanten Hospiz- <strong>und</strong> Pflegedienste.Dieser ist zurückzuführen auf die Datenerhebung: stationäre Hospize <strong>und</strong> ambulantbetreuende Dienste versorgen zumeist e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>ere Zahl von PatientInnen; daherwurden sie <strong>in</strong> zahlenmäßig höherem Umfang angesprochen als die an<strong>der</strong>enInstitutionsgruppen. Überraschend war dann zusätzlich noch die sehr hoheKooperationsbereitschaft <strong>der</strong> beteiligten stationären Hospize <strong>und</strong> ambulantenDienste. Beide Faktoren zusammen führen zu dem beschriebenen Überhang <strong>in</strong> <strong>der</strong>Stichprobe.In <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> teilnehmenden Menschen auf Personengruppen zeigt sichfolgendes Bild (s. Abbildung 4):PersonengruppePatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendeEhrenamtlichePsychosozialTätigeSeelsorgerInnen175 Personen (22,4%) bef<strong>in</strong>den sich<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> PatientInnen. 134Personen (17,2%) gehören zurGruppe <strong>der</strong> Bezugspersonen. Diegroße Gruppe <strong>der</strong> professionellTätigen (n = 472, 60,4%) teilt sich <strong>in</strong>die Untergruppen <strong>der</strong> ÄrztInnen (n =89, 11,4% <strong>der</strong> Gesamtstichprobe),<strong>der</strong> Pflegenden (n = 236, 30,2%), <strong>der</strong>ehrenamtlich Tätigen (n = 88,11,3%), <strong>der</strong> psychosozial Tätigen (nAbbildung 4: Verteilung <strong>der</strong> StudienteilnehmerInnen <strong>in</strong>Personengruppen= 23, 2,9%) sowie <strong>der</strong> SeelsorgerInnen(n = 36, 4,6%).Der Überhang <strong>in</strong> <strong>der</strong> Personengruppe <strong>der</strong> Pflegenden hat ebenfalls erhebungstechnischeGründe: Zum e<strong>in</strong>en ist diese Personengruppe <strong>in</strong> <strong>der</strong> Betreuung kritischkranker <strong>und</strong> sterben<strong>der</strong> Menschen zahlenmäßig am stärksten vertreten. Zuman<strong>der</strong>en war die Bereitschaft <strong>der</strong> Pflegenden zur Teilnahme an <strong>der</strong> Studie <strong>in</strong> allenInstitutionsarten am größten.
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 121Die Altersverteilung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe lässt sich wie folgt beschreiben: 776 Personenmachen Angaben zu ihrem Alter. Der Alters<strong>mit</strong>telwert liegt bei 51,198 Jahren <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>er Standardabweichung von 16,157 Jahren. Das M<strong>in</strong>imum <strong>der</strong> Altersverteilungliegt bei 17 Jahren, das Maximum bei 96 Jahren.E<strong>in</strong>e Altersbetrachtung <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Institution sowie <strong>der</strong> Personengruppeist s<strong>in</strong>nvoll:Alter10080604020630KP = Krankenhaus,Es ist auffallend, dass die Personenaus onkologischen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenAbteilungen vonAkutkrankenhäusern das ger<strong>in</strong>gsteAlter aufweisen (s. Abbildung 5;onkologische Stationen: Mittelwert46,731 Jahre, Standardabweichung15,072 Jahre; <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischeStationen: Mittelwert 42,719 Jahre,Standardabweichung 14,747 Jahre).AD = Ambulanter DienstSH = Stationäres HospizKO = Krankenhaus, OnkologieAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimKI = Krankenhaus, IntensivstationInstitutionsartAbbildung 5: Kennzahlen des Alters <strong>in</strong> Abhängigkeit<strong>der</strong> Institutionsart (Elemente des Boxplots: Strich =Mittelwert, Box = 25%- bzw. 75%-Percentile, Whiskers= M<strong>in</strong>imum bzw. Maximum, Kreise (Ausreißer): Werte,die mehr als an<strong>der</strong>thalb Kastenlängen außerhalbliegen, Sterne (Extremwerte): Werte, die mehr als dreiKastenlängen außerhalb liegen)Aussagekräftiger ist die Betrachtung des Alters <strong>in</strong> Abhängigkeit <strong>der</strong> Personengruppe.Es zeigen sich hier deutliche Unterschiede, die größtenteils durch das Berufsprofil<strong>der</strong> jeweiligen Personengruppe bestimmt s<strong>in</strong>d:
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 122AlterAbbildung 6: Kennzahlen des Alters <strong>in</strong> Abhängigkeit<strong>der</strong> PersonengruppeMittelwert von alt100806040205654525048464442716PatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppePersonengruppe: ÄrztInnenEhrenamtlichePsychosozial Tätige461SeelsorgerInnenEs erstaunt nicht, dass diePatientInnen <strong>mit</strong> Abstanddurchschnittlich am ältesten s<strong>in</strong>d <strong>und</strong>auch die größte Streuung allerPersonengruppen aufweisen(Mittelwert 67,615 Jahre, Standardabweichung14,731 Jahre). E<strong>in</strong>eähnlich große Streuung, wenn auch<strong>mit</strong> ger<strong>in</strong>gerem Alters<strong>mit</strong>telwert f<strong>in</strong>detsich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Bezugspersonen(Mittelwert 55,136 Jahre,Standardabweichung 13,743 Jahre).Bei den professionell Tätigen s<strong>in</strong>ddie Pflegenden im Mittel am jüngsten(Mittelwert 37,702 Jahre, Standardabweichung10,145 Jahre), dieehrenamtlich Tätigen im Mittel amältesten (Mittelwert 55,713 Jahre,Standardabweichung 10,260 Jahre).Die Abweichungen <strong>der</strong> Gruppen<strong>mit</strong>telwertevone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d dabeihöchst signifikant (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 366,996, p
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 123Mittelwert von alt4542,54037,53532,5SH = Stationäres HospizPersonengruppe: PflegendeAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, IntensivstationKP = Krankenhaus,Abbildung 8: Alters<strong>mit</strong>telwerte (alt) bei Pflegenden <strong>in</strong>unterschiedlichen InstitutionenMittelwert-Diagramme gebenähnliche Gruppene<strong>in</strong>teilungenwie<strong>der</strong>: ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende aufonkologischen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen s<strong>in</strong>dsignifikant jünger als <strong>in</strong> ambulantenDiensten. Bei den ÄrztInnen fallen <strong>in</strong>die höchste Altersgruppe auch nochÄrztInnen <strong>in</strong> Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimensowie <strong>in</strong> stationärenHospizen. Bei den Pflegenden istdiese Gruppene<strong>in</strong>teilung e<strong>in</strong>eTendenz, jedoch nicht signifikant.Als letzte <strong>der</strong> zu betrachtenden Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe bleibt die Dauer <strong>der</strong>Berührung <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>. Diese Variable soll Aufschluss darüber geben, wielange die befragte Person <strong>in</strong> engem Kontakt <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>em schweren Krankheitsprozess<strong>und</strong>/o<strong>der</strong> <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Thematik von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> steht. Gewonnen wurden dieZeitangaben bei den PatientInnen durch die Frage „Seit ungefähr wann s<strong>in</strong>d Sieschwer krank?“, bei den Bezugspersonen durch die Frage „Seit wann betreuen Sieden Patienten <strong>in</strong> dieser Weise?“ <strong>und</strong> bei den professionell Tätigen durch die Frage„Wie lange arbeiten Sie schon <strong>mit</strong> schwerstkranken Patienten?“.Die generellen Kennwerte dieser Variablen (Mittelwert 8,521 Jahre, Standardabweichung9,249 Jahre, M<strong>in</strong>imum 1 Tag, Maximum 61,108 Jahre), die auf denAussagen von 681 Personen <strong>der</strong> Stichprobe beruhen, sagen relativ wenig aus. Zudeskriptiven Zwecken soll die Variable auch <strong>in</strong> unterschiedlich große Zeitabschnitte(siehe Tabelle 2) kategorisiert werden:
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 124Berührungsdauer (kategorisiert) <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>GültigFehlendGesamt0-3 Monate3-6 Monate6-9 Monate9-12 Monate1-1,5 Jahre1,5-2 Jahre2-5 Jahre5-10 Jahre10-15 Jahre15-20 Jahre20-25 Jahreüber 25 JahreGesamtSystemGültige KumulierteHäufigkeit Prozent Prozente Prozente50 6,4 7,3 7,328 3,6 4,1 11,518 2,3 2,6 14,132 4,1 4,7 18,836 4,6 5,3 24,148 6,1 7,0 31,1130 16,6 19,1 50,2154 19,7 22,6 72,872 9,2 10,6 83,421 2,7 3,1 86,548 6,1 7,0 93,544 5,6 6,5 100,0681 87,2 100,0100 12,8781 100,0Tabelle 2: Kategorisierung <strong>der</strong> Berührungsdauer <strong>mit</strong> Belegung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen KategorienUnterschiedlich große Zeitabstände mussten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorisierung deshalb gewähltwerden, da die PatientInnen <strong>und</strong> Bezugspersonen sonst komplett <strong>in</strong> die erste 5-Jahres-Kategorie gefallen wären (80,3% <strong>der</strong> PatientInnen <strong>und</strong> 81,9% <strong>der</strong>Bezugspersonen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie 0-5 Jahre) <strong>und</strong> jegliche Differenzierungsmöglichkeitdes Merkmals für diese Personengruppen verloren gegangen wäre (s.Abbildung 9).Für die geme<strong>in</strong>same Betrachtung <strong>der</strong> kategorisierten Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> Personengruppe ergibt sich so folgendes Bild (s. Abbildung 10): Dieniedrigsten Berührungszeiten <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong>PatientInnen (Mittelwert 5,304 Jahre, Standardabweichung 3,001 Jahre) <strong>und</strong>Bezugspersonen (Mittelwert 4,617 Jahre, Standardabweichung 2,986 Jahre).Allerd<strong>in</strong>gs ist <strong>in</strong> diesen beiden Gruppen auch die Spannweite <strong>und</strong> Varianz desMerkmals am größten.
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 125150100PersonengruppePatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAnzahlBalken zeigen Häufigkeiten5000-3 Monate 9-12 Monate 2-5 Jahre 15-20 Jahre3-6 Monate6-9 Monate1-1,5 Jahre1,5-2 Jahre5-10 Jahre10-15 Jahre20-25 Jahreüber 25 JahreBerührungsdauer (kategorisiert) <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Abbildung 9: Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> (kategorisiert) <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> denPersonengruppenBerührungsdauer (kategorisiert) <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong><strong>Tod</strong>121086420PatientInnenBezugspersonen2353ÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAbbildung 10: Kennwerte <strong>der</strong> Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong><strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> (kategorisiert) <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnenPersonengruppen254302303400393424425428421Die höchste Dauer <strong>der</strong> Berührung<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong><strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> ÄrztInnen (Mittelwert9,085 Jahre, Standardabweichung2,080 Jahre). Die Gruppenkennwerte<strong>in</strong> den Gruppen <strong>der</strong> PsychosozialTätigen sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong>Seelsorgenden haben aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong>ger<strong>in</strong>gen Gruppenbelegungen nurger<strong>in</strong>ge Aussagekraft. Erwartungsgemäßweichen die Mittelwerte <strong>in</strong>den Personengruppen auch<strong>in</strong>ferenzstatistisch betrachtet höchstsignifikant vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ab (Kruskal-Wallis-Test: Qi-Quadrat = 226,301, p< 0,001).
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 126Interessant ist noch e<strong>in</strong>e differenzierte Betrachtung <strong>der</strong> Zusammenhänge vonBerührungsdauer nach Institutionsart <strong>und</strong> Alter bei den professionell Tätigen.Zunächst ergibt sich für Professionelle generell <strong>in</strong> Berührungsdauer <strong>und</strong>Institutionsart ke<strong>in</strong> Zusammenhang.Bei getrennter Betrachtung <strong>der</strong> Berufsgruppen zeigt sich jedoch, dass ÄrztInnen <strong>in</strong>den unterschiedlichen Institutionen e<strong>in</strong>e höchst signifikant unterschiedlicheBerührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> haben (Kruskal-Wallis: p < 0,001; ONEWAY:F = 4,423, p = 0,001) (s. Abbildung 11).Mittelwert von bertskat1110987SH = Stationäres HospizPersonengruppe: ÄrztInnenAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, IntensivstationKP = Krankenhaus, PAbbildung 11: durchschnittliche Berührungsdauer <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (bertskat, <strong>in</strong> Jahren) bei ÄrztInnen <strong>in</strong>unterschiedlichen E<strong>in</strong>richtungenDie Varianzanalyse zeigt hiersignifikante Unterschiede: ÄrztInnenauf onkologischen Stationen habendie signifikant ger<strong>in</strong>gsten Berührungsdauern<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>,während ÄrztInnen, die <strong>mit</strong> Alten<strong>und</strong>Pflegeheimen bzw. <strong>mit</strong> ambulantbetreuten PatientInnen zusammenarbeiten,die signifikant höchstenBerührungsdauern aufweisen. (Dieskönnte auch daran liegen, dass essich bei letzteren um nie<strong>der</strong>gelasseneÄrztInnen handelt, die imSchnitt längere Berufsdauernaufweisen als ÄrztInnen <strong>in</strong> Akutkrankenhäusern.)E<strong>in</strong> teilweise ähnliches, wenn auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aussagekraft schwächeres Ergebnis zeigtsich bei den Pflegenden (ONEWAY: F = 2,703, p = 0,022):
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 127Mittelwert von bertskat9,598,587,5SH = Stationäres HospizPersonengruppe: PflegendeAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, IntensivstationKP = Krankenhaus,Abbildung 12: durchschnittliche Berührungsdauer <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (bertskat, <strong>in</strong> Jahren) bei Pflegenden <strong>in</strong>unterschiedlichen E<strong>in</strong>richtungenHier unterscheiden sich Pflegende <strong>in</strong>ambulanten Diensten signifikantdurch ihre größte Berührungsdauer<strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> sowiePflegende auf <strong>der</strong> Palliativstationdurch ihre ger<strong>in</strong>gste Berührungsdauervon allen an<strong>der</strong>en Pflegenden(siehe Abbildung 12). Dass dieSignifikanzen hier ger<strong>in</strong>ger ausfallen,kann u.a. daran liegen, dassPflegende an sich e<strong>in</strong>e altershomogenereGruppe als ÄrztInnendarstellen.Zusammenfassung <strong>der</strong> wichtigsten Fakten aus <strong>der</strong> Stichprobenbeschreibung:Personengruppe <strong>und</strong> Institutionsart:• Ehrenamtlich Tätige gibt es überdurchschnittlich häufig <strong>in</strong> ambulanten Diensten<strong>und</strong> unterdurchschnittlich häufig <strong>in</strong> allen an<strong>der</strong>en Institutionsarten.• ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende gibt es überdurchschnittlich häufig auf Intensivstationen,setzt man e<strong>in</strong>e Gleichverteilung <strong>der</strong> Personengruppen über die Institutionsartenvoraus.Personengruppe <strong>und</strong> Geschlecht:• Männliche Personen s<strong>in</strong>d unter PatientInnen <strong>und</strong> ÄrztInnen überdurchschnittlichvertreten.• Weibliche Personen s<strong>in</strong>d unter Pflegenden <strong>und</strong> Ehrenamtlichen überdurchschnittlichvertreten.
Kapitel 8 – Stichprobenbeschreibung 128Alter <strong>und</strong> Institutionsart:• ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende aus onkologischer <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischer Umgebungs<strong>in</strong>d am jüngsten.• ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende aus Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen, ambulanten Diensten <strong>und</strong>stationären Hospizen s<strong>in</strong>d am ältesten.Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> Institution:• ÄrztInnen <strong>in</strong> unterschiedlichen Institutionen haben signifikant unterschiedlichlange <strong>mit</strong> schwerstkranken PatientInnen zu tun: auf onkologischen Stationen amkürzesten, <strong>in</strong> Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen sowie bei ambulant betreuten PatientInnenam längsten.• Pflegende <strong>in</strong> unterschiedlichen Institutionen haben unterschiedlich lange <strong>mit</strong>schwerstkranken PatientInnen zu tun: auf Palliativstationen am kürzesten, <strong>in</strong>ambulanten Diensten am längsten.• Generell gibt es e<strong>in</strong>en schwachen Zusammenhang zwischen Lebensalter <strong>und</strong>Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 1299. Ergebnisdarstellung9.1. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Darstellung <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> StichprobeDarstellung von Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs-/Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>in</strong><strong>der</strong> StichprobeBeziehungen zwischen sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>dens- bzw.Belastungs-/Beanspruchungs<strong>in</strong>dices9.2. Analyse des Konzepts <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Dimensionsbildung <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>zelkennwerten <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Zusammenhang <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>und</strong> Dimensionen <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>mit</strong> PersönlichkeitsmaßenIn Kapitel 5 – Fragestellungen <strong>der</strong> Untersuchung wurden die Fragestellungendargestellt, auf welche h<strong>in</strong> das Datenmaterial <strong>der</strong> vorliegenden Studie analysiertwerden soll. In E<strong>in</strong>klang <strong>mit</strong> den aufgestellten Fragen steht im Folgenden zunächstdie Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Im zweiten Teil <strong>der</strong> Ergebnisdarstellung wird <strong>der</strong> Blick darauf gerichtet,<strong>in</strong> wie weit das theoretische Konzept <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> anhand <strong>der</strong>vorliegenden Daten bestätigt o<strong>der</strong> modifiziert werden kann.9.1. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Zunächst wird die Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Kontakt <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>betrachtet. Dazu ist zu Beg<strong>in</strong>n von Interesse, wie sich die erhobenen Kennwerte <strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe darstellen. Im Anschluss daran wird gezeigt,wie sich die Maße für Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Belastung bzw. Beanspruchung darstellen,die als Outcome-Variablen dienen. Auf dieser Basis können im dritten Teil diesesKapitels die Beziehungen zwischen den erhobenen Kennwerten für soziale<strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> den Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Beanspruchungs<strong>in</strong>dices analysiert werden.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 130Darstellung <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> StichprobeDie sozialen <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>es Menschen lassen sich von unterschiedlichenBlickw<strong>in</strong>keln aus betrachten <strong>und</strong> folglich auch <strong>mit</strong> unterschiedlichen Fragestellungen<strong>und</strong> Zielrichtungen erheben. In <strong>der</strong> psychologischen Literatur <strong>und</strong> Forschung existiertdementsprechend e<strong>in</strong>e Vielzahl von Konstrukten <strong>und</strong> Operationalisierungen zusozialen <strong>Ressourcen</strong>. In die vorliegende Auswertung wurden 16 E<strong>in</strong>zelkennwerte<strong>mit</strong>e<strong>in</strong>bezogen, die bereits bestehenden Instrumenten entnommen wurden bzw. ausden Informationen des jeweiligen Fragebogens gebildet worden s<strong>in</strong>d (dieOperationalisierung <strong>der</strong> Kennwerte f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Anhang 1):Kennwerte für kognitive Unterstützungsschemata (‚Support Schemes’) (aus BSSS;Schwarzer & Schulz, 2000):• Perceived available support/Wahrgenommene Unterstützung: Kennwert fürwahrgenommene Unterstützung• Need for support/Unterstützungsbedürfnis: Kennwert für Bedürfnis nachUnterstützung• Support seek<strong>in</strong>g/Suche nach Unterstützung: Kennwert für Suche nachUnterstützungKennwerte für Komponenten <strong>der</strong> sozialen Unterstützung (aus SSI; Schwarzer, 1991):• Informationale Unterstützung: Kennwert für <strong>in</strong>formationale Unterstützung• Instrumentelle Unterstützung: Kennwert für <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung• Motivationale Unterstützung: Kennwert für motivationale Unterstützung• Emotionale Unterstützung: Kennwert für emotionale Unterstützung• Gegebene Unterstützung: Kennwert für gegebene UnterstützungKennwert für die Überzeugung des s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>gebettetse<strong>in</strong>s <strong>der</strong> eigenen Existenz(aus Belschner & Bantelmann, 2005)• <strong>Soziale</strong> Resonanz
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 131Gebildete Kennwerte aus Informationen des SSI (Schwarzer, 1991):• Netzgröße: Kennwert für die Größe des umgebenden sozialen Netzes• Netzstärke: Kennwert für die subjektiv empf<strong>und</strong>ene Stärke des umgebendensozialen NetzesGebildete Kennwerte aus Informationen des FEG (Dlugosch & Krieger, 1995):• Zufriedenheits<strong>in</strong>dex: Kennwert für Zufriedenheit <strong>mit</strong> den engen sozialenBeziehungen• Problem<strong>in</strong>dex: Kennwert für Probleme <strong>in</strong> engen sozialen Beziehungen• Än<strong>der</strong>ungsdruck: Kennwert für Verän<strong>der</strong>ungswunsch <strong>in</strong> den engen sozialenBeziehungen• Konstruktivität: Kennwert für empf<strong>und</strong>ene Konstruktivität des engen sozialenNetzes• Destruktivität: Kennwert für empf<strong>und</strong>ene Destruktivität des engen sozialen NetzesFür die e<strong>in</strong>zelnen Kennwerte ergeben sich folgende statistische Werte <strong>in</strong> <strong>der</strong>untersuchten Stichprobe (Häufigkeitsverteilungen bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Anhang 2):Name des KennwertsSPSS-M<strong>in</strong>imum -NNameMaximum Mittelwert StandardabweichungWahrgenommene Unterstützung pas 751 1,50 – 4,00 3,612 0,453Unterstützungsbedürfnis nfs 745 1,00 – 4,00 2,596 0,500Suche nach Unterstützung suse 744 1,00 – 4,00 3,012 0,689Informationale Unterstützung <strong>in</strong>for 743 1,00 – 5,00 3,028 0,771Instrumentelle Unterstützung <strong>in</strong>str 729 1,00 – 5,00 3,089 0,827Motivationale Unterstützung motiv 727 1,00 – 5,00 3,159 0,816Emotionale Unterstützung emoti 717 1,00 – 5,00 3,369 0,782Gegebene Unterstützung gegu 728 1,00 – 5,00 3,322 0,817<strong>Soziale</strong> Resonanz sozres 758 1,00 – 4,00 3,453 0,527Netzgröße netzgr 751 1 – 7 4,953 1,266Netzstärke netzst 745 1,00 – 5,00 3,751 0,723Zufriedenheits<strong>in</strong>dex zufrie 752 1 – 12 7,94 2,916Problem<strong>in</strong>dex proble 554 1 – 12 3,07 1,799Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>in</strong> engen Beziehungen aenddr 781 0 – 3 0,42 0,681Konstruktivität des engen Netzes konstru 267 1 – 3 1,43 0,600Destruktivität des engen Netzes destru 138 1 – 3 1,20 0,501Tabelle 3: Statistische Werte <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 132Das Verhalten <strong>der</strong> gebildeten E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe ist zunächst vonInteresse. Deshalb werden im Folgenden die Zusammenhänge zwischen denKennwerten <strong>und</strong> den Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe vorgestellt. In Anhang 3 f<strong>in</strong>densich alle signifikanten Beziehungen (sie wurden korrelativ <strong>und</strong> varianzanalytischbestimmt). Ergebnisse, die varianzanalytisch e<strong>in</strong>e Prüfstärke von 5 überschreiten,gelten als bedeutsam <strong>und</strong> werden aufgr<strong>und</strong> ihrer Aussagekraft im Folgendendargestellt; alle gemachten Aussagen stützen sich dabei natürlich auf signifikanteTestergebnisse:Die E<strong>in</strong>zelkennwerte Suche nach sozialer Unterstützung, die Komponenten sozialerUnterstützung sowie die Netzstärke weisen e<strong>in</strong>en starken geschlechterdifferenzierendenEffekt auf.Prozent25,0%20,0%15,0%GeschlechtmännlichweiblichFrauen geben dabei weitaus höhereWerte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Suche nach Unterstützungan als Männer (Kolmogorov-Smirnov-Test: p < 0,001; T-Test: T =-4,419, p < 0,001; s. Abbildung 13).10,0%5,0%0,0%1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,50 3,67 4,00Suche nach Unterstützung (aus BSSS)Abbildung 13: Suche nach Unterstützung <strong>und</strong>Geschlecht
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 133Mittelwert3,503,403,303,203,103,002,90<strong>in</strong>formationaleUnterstützung(aus SSI)<strong>in</strong>strumentelleUnterstützung(aus SSI)motivationaleUnterstützung(aus SSI)emotionaleUnterstützung(aus SSI)gegebeneUnterstützung(aus SSI)Sie zeigen jedoch auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enKomponenten sozialer Unterstützunghöhere Werte als Männer; sieerhalten also mehr Unterstützung <strong>in</strong>ihrem sozialen Feld, geben aberauch mehr (Zusammenhang zuGegebenerUnterstützung:Kolmogorov-Smirnov-Test: p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 134Auch die Religionszugehörigkeit weist bedeutsame Verb<strong>in</strong>dungen zu den sozialen<strong>Ressourcen</strong> auf.Mittelwert von suse3,053,002,952,902,852,80Es besteht hier e<strong>in</strong>e starke Interaktionzwischen <strong>der</strong> Suche nachUnterstützung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Religionszugehörigkeit:Gibt jemand an, ke<strong>in</strong>ereligiöse o<strong>der</strong> spirituelle Überzeugungzu besitzen, so sucht er auchweniger nach Unterstützung alsjemand, <strong>der</strong> religiös o<strong>der</strong> spirituell ist(Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat =17,933, p < 0,001; ONEWAY: F =2,75festeReligionszugehörigkeitke<strong>in</strong>e, aber <strong>in</strong>nerespirituelle ÜberzeugungReligionszugehörigkeitke<strong>in</strong>e religiöse o<strong>der</strong>spirituelle Überzeugung8,345, p < 0,001; s. Abbildung 16).Abbildung 16: Mittelwert-Diagramm von Suche nachUnterstützung (suse) <strong>und</strong> ReligionszugehörigkeitE<strong>in</strong>e zweite Verb<strong>in</strong>dung besteht zur<strong>Soziale</strong>n Resonanz (Kruskal-Wallis-3,60Test: Chi-Quadrat = 20,272, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 135Das Alter <strong>der</strong> Befragten zeigt aussagekräftige Beziehungen zum Unterstützungsbedürfnis<strong>und</strong> dem Än<strong>der</strong>ungsdruck.2,752,70So geben junge sowie sehr alteBefragte e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Bedürfnisnach Unterstützung an als BefragteMittelwert von nfs2,652,60im Altersbereich zwischen 50 <strong>und</strong> 70Jahren (ONEWAY: F = 8,303, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 136Viele Zusammenhänge weist die Variable Personengruppe auf. Von Interesse s<strong>in</strong>dhier vor allem die Beziehungen zur <strong>Soziale</strong>n Unterstützung, <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>n Resonanz,<strong>der</strong> Netzgröße, <strong>der</strong> Netzstärke sowie zum Zufriedenheits<strong>in</strong>dex.Mittelwert3,803,603,403,20<strong>in</strong>formationaleUnterstützung(aus SSI)<strong>in</strong>strumentelleUnterstützung(aus SSI)motivationaleUnterstützung(aus SSI)emotionaleUnterstützung(aus SSI)gegebeneUnterstützung(aus SSI)Es zeigen sich deutlicheZusammenhänge zwischen allenKomponenten sozialer Unterstützung<strong>und</strong> <strong>der</strong> Personengruppe <strong>der</strong>Befragten (s. Abbildung 20,Abbildung 21, Abbildung 22):3,002,80PatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAbbildung 20: <strong>Soziale</strong> Unterstützung <strong>und</strong>PersonengruppeAlle Befragten, abgesehen von denPatientInnen, geben an, imDurchschnitt mehr Unterstützung zugeben als zu erhalten (s. Abbildung20).Mittelwert von gegu3,803,603,403,203,00Die Gegebene Unterstützungunterscheidet sich dabei stark <strong>in</strong> denverschiedenen Personengruppen(Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat =78,981, p < 0,001; ONEWAY: F =17,096, p < 0,001; Brown-Forsythe-Test: Statistik = 19,267, p < 0,001; s.Abbildung 21).2,80ÄrztInnenPflegendePatientInnenBezugspersonenSeelsorgerInnenPsychosozial TätigeEhrenamtlichePersonengruppeAbbildung 21: Mittelwert-Diagramm für GegebeneUnterstützung (gegu) <strong>und</strong> Personengruppe
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 137Mittelwert von emoti3,703,603,503,403,303,203,10ÄrztInnenBezugspersonenPatientInnenEhrenamtlichePflegendePersonengruppeSeelsorgerInnenPsychosozial TätigeBei <strong>der</strong> erhaltenen, sozialenUnterstützung ist die EmotionaleUnterstützung von beson<strong>der</strong>emInteresse. Hier ergibt sich, dassÄrztInnen von allenPersonengruppen die ger<strong>in</strong>gsteemotionale Unterstützung erhalten(Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat =19,959, p = 0,003; ONEWAY: F =3,452, p < 0,002; Brown-Forsythe-Test: Statistik = 3,805, p = 0,001; s.Abbildung 22).Abbildung 22: Mittelwert-Diagramm für EmotionaleUnterstützung (emoti) <strong>und</strong> PersonengruppeMittelwert von sozres3,903,803,703,603,503,403,303,20PatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAbbildung 23: Mittelwert-Diagramm für <strong>Soziale</strong>Resonanz (sozres) <strong>und</strong> PersonengruppeWeiterh<strong>in</strong> zeigt sich e<strong>in</strong>e starkeInteraktion <strong>mit</strong> <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>nResonanz (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 84,268, p < 0,001;ONEWAY: F = 14,488, p < 0,001;Brown-Forsythe-Test: Statistik =18,155, p < 0,001; s. Abbildung 23):PatientInnen zeigen die ger<strong>in</strong>gste<strong>Soziale</strong> Resonanz, währendEhrenamtliche, Psychosoziale <strong>und</strong>Geistliche e<strong>in</strong>e homogene Untergruppe<strong>mit</strong> <strong>der</strong> höchsten <strong>Soziale</strong>nResonanz aller Befragten bilden.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 138Mittelwert von netzgrstand5,45,254,84,6PatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAbbildung 24: Mittelwert-Diagramm für Netzgröße(netzgrstand, standardisiert) <strong>und</strong> PersonengruppeE<strong>in</strong> ebenso aussagekräftiges Bil<strong>der</strong>gibt sich bei <strong>der</strong> Betrachtung vonNetzgröße <strong>und</strong> Personengruppe (s.Abbildung 24). Inferenzstatistischwird e<strong>in</strong> Unterschied <strong>der</strong> Netzgröße<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Personengruppenbelegt (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 51,959, p < 0,001;ONEWAY: F = 9,341, p < 0,001;Brown-Forsythe-Test: Statistik =9,979, p < 0,001). Es weisen dabeiPatientInnen, ÄrztInnen <strong>und</strong>Pflegende ger<strong>in</strong>gere Netzgrößen aufals Bezugspersonen <strong>und</strong> PsychosozialTätige.Mittelwert von netzst4,204,104,003,903,803,703,603,503,40PatientInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenAbbildung 25: Mittelwert-Diagramm für Netzstärke(netzst) <strong>und</strong> PersonengruppeAufschlussreich ist auch dieseRelation zwischen Netzstärke <strong>und</strong>Personengruppe. Es zeigen sich hierUnterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> Netzstärke vonBezugspersonen auf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite<strong>und</strong> von PatientInnen, Ehrenamtlichen,Psychosozial Tätigensowie Seelsorgenden auf <strong>der</strong>an<strong>der</strong>en Seite (Kruskal-Wallis-Test:Chi-Quadrat = 37,141, p < 0,001;ONEWAY: F = 6,914, p < 0,001;Brown-Forsythe-Test: Statistik =7,743, p < 0,001; s. Abbildung 25).
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 139Mittelwert Zufriedenheits<strong>in</strong>dex aus FEG98,587,576,5E<strong>in</strong>e deutliche Interaktion bestehtschließlich zwischen Zufriedenheits<strong>in</strong>dex<strong>und</strong> befragter Personengruppe:PatientInnen zeigenger<strong>in</strong>gere Zufriedenheitswerte alsalle an<strong>der</strong>en Personengruppen(Kruskal-Wallis-Test-Test: Chi-Quadrat = 37,129, p < 0,001;ONEWAY: F = 7,122, p < 0,001; s.Abbildung 26).ÄrztInnenPflegendePatientInnenBezugspersonenSeelsorgerInnenPsychosozial TätigeEhrenamtlichePersonengruppeAbbildung 26: Mittelwerte des Zufriedenheits<strong>in</strong>dexes <strong>in</strong>den Personengruppen
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 140Wie bei den Personengruppen werden auch bei den Institutionsarten aussagekräftigeVerb<strong>in</strong>dungen zu ausgewählten, sozialen <strong>Ressourcen</strong> deutlich; im Beson<strong>der</strong>en zur<strong>Soziale</strong>n Unterstützung, zur <strong>Soziale</strong>n Resonanz, zur Netzgröße sowie zurNetzstärke, wir im Folgenden dargestellt wird.Mittelwert3,603,503,403,303,203,103,002,902,80SH = Stationäres HospizAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, Intensivstation<strong>in</strong>formationaleUnterstützung(aus SSI)<strong>in</strong>strumentelleUnterstützung(aus SSI)motivationaleUnterstützung(aus SSI)emotionaleUnterstützung(aus SSI)gegebeneUnterstützung(aus SSI)KP = Krankenhaus, PalliativstationAbbildung 27: Zusammenhang zwischen denMittelwerten sozialer Unterstützung <strong>und</strong> <strong>der</strong>Institutionsart (Kurven zeigen den Spl<strong>in</strong>e an. Spl<strong>in</strong>esrepräsentieren e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Klasse von Funktionendie bei vielen Interpolationen e<strong>in</strong>gesetzt werden. Dabeiwird e<strong>in</strong> kubisches Polynom so durch zweiDatenpunkte gelegt, dass an den Datenpunkten dieerste <strong>und</strong> die zweite Ableitung kont<strong>in</strong>uierlich ist (Vgl.Lohn<strong>in</strong>ger, 2006). In dieser Abbildung ist dieseL<strong>in</strong><strong>in</strong>enart lei<strong>der</strong> falsch gewählt, da es sich bei <strong>der</strong>Institutionsart um e<strong>in</strong>e ord<strong>in</strong>ale Variable <strong>mit</strong> folglichdiskreten Ausprägungen handelt. Die folgenden Spl<strong>in</strong>e-Diagramme s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen korrekt.So ergibt sich e<strong>in</strong> starker Zusammenhangzwischen <strong>der</strong> sozialenUnterstützung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Institutionsartdes Befragten (s. Abbildung 27): Inambulanten Diensten <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen überragtdabei die gegebene die empfangeneUnterstützung. Befragte von <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen erhaltenzudem von allen Institutionsarten dieger<strong>in</strong>gste soziale Unterstützung. DieTeststatistiken zeigen dabei starkeBezüge für erhaltene motivationalebzw. emotionale Unterstützung(Motivationale Unterstützung: Kruskal-Wallis-Test:Chi-Quadrat =26,987, p < 0,001; ONEWAY: F =5,025, p < 0,001; Emotionale Unterstützung:Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 35,735, p < 0,001;ONEWAY: F = 7,808, p < 0,001).
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 141Mittelwert von sozres3,553,503,453,403,353,303,25AD = Ambulanter DienstSH = Stationäres HospizKO = Krankenhaus, OnkologieAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimKP = Krankenhaus,Zudem besteht e<strong>in</strong>e starkeInteraktion <strong>mit</strong> <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>nResonanz (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 30,969, p < 0,001;ONEWAY: F = 5,014, p < 0,001; s.Abbildung 28): Befragte <strong>in</strong> Alten- <strong>und</strong>Pflegeheimen sowie <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen gebendabei e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere <strong>Soziale</strong> Resonanzan als Befragte <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enInstitutionen.KI = Krankenhaus, IntensivstationInstitutionsartAbbildung 28: Mittelwert-Diagramm von <strong>Soziale</strong>rResonanz (sozres) <strong>und</strong> InstitutionsartMittelwert Netzgröße aus SSI5,35,25,154,94,84,74,64,5SH = Stationäres HospizAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, IntensivstationKP = Krankenhaus,Abbildung 29: Mittelwerte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Netzgröße beiBefragten aus unterschiedlichen InstitutionsartenDeutlich zeigt sich auch die Lage <strong>in</strong>Betrachtung <strong>der</strong> Netzgröße (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 45,090, p< 0,001; ONEWAY: F = 7,391, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 142Mittelwert von netzst3,903,803,703,603,503,40AD = Ambulanter DienstSH = Stationäres HospizKO = Krankenhaus, OnkologieAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimKP = Krankenhaus,Schließlich zeigt sich auch e<strong>in</strong>Zusammenhang zwischen Netzstärke<strong>und</strong> Institutionsart (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 27,294, p< 0,001; ONEWAY: F = 5,785, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 143Darstellung von Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>in</strong> <strong>der</strong>StichprobeIm Folgenden werden zunächst die Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs- bzw.Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>mit</strong> ihren Beziehungen zu den Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobedargestellt. Dies bildet die Gr<strong>und</strong>lage für den darauf folgenden Schritt, <strong>in</strong> welchemdie Beziehungen zwischen den sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> diesen Outcome-Variablenhergestellt werden.Als Outcome-Variablen für die Auswirkungen sozialer <strong>Ressourcen</strong> dienenWohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungsmaße, die ebenfalls im Fragebogen erhoben wurden.Diese s<strong>in</strong>d:Wohlbef<strong>in</strong>dens<strong>in</strong>dices (aus FEG; Dlugosch & Krieger, 1995):• Allgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den• Momentanes Wohlbef<strong>in</strong>denMaße <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Belastung (aus FEG; Dlugosch & Krieger, 1995):• Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen• Ausmaß <strong>der</strong> BelastungBerufsbed<strong>in</strong>gte Beanspruchung bei Professionellen (aus BHD; Hacker & Re<strong>in</strong>hold,1999):• Vorwiegend Emotionale Erschöpfung• Arbeitsplatzbed<strong>in</strong>gte Intr<strong>in</strong>sische Motivierung• Erlebte Unzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit• Klientenaversion• Reaktives Abschirmen
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 144Für die Outcome-Variablen ergeben sich folgende statistische Werte <strong>in</strong> <strong>der</strong>untersuchten Stichprobe (Operationalisierung <strong>und</strong> Häufigkeitsverteilungen <strong>der</strong>Outcome-Variablen bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Anhang 4):Name <strong>der</strong> Outcome-Variable SPSS-Name NM<strong>in</strong>imum -StandardabweichungMittelwertMaximumAllgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den wb01/feg01 766 -3 – 3 1,51 1,386Momentanes Wohlbef<strong>in</strong>den wb02/feg02 767 -3 – 3 0,78 1,711Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen belsum 727 1 – 8 4,52 2,073Ausmaß <strong>der</strong> Belastung belquel 727 1 – 29 7,89 4,208Emotionale Erschöpfung emersch 469 1,00 – 7,00 3,511 1,345Intr<strong>in</strong>sische Motivierung <strong>in</strong>tmot 469 2,20 – 7,00 5,738 0,872Erlebte Unzufriedenheit unzuf 468 1,00 – 6,80 2,652 1,338Klientenaversion kliav 469 1,00 – 7,00 2,867 1,404Reaktives Abschirmen reab 468 1,00 – 7,00 3,099 0,990Tabelle 4: Statistische Werte <strong>der</strong> Outcome-VariablenAuch bei den Outcome-Variablen werden zunächst die wichtigsten Relationen zu denRahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe vorgestellt (Zusammenhangsmaße wurden korrelativ,Unterschiedsmaße varianzanalytisch bestimmt). In Anhang 5 s<strong>in</strong>d alle signifikantenVerb<strong>in</strong>dungen samt ihrer Prüfgrößen zu f<strong>in</strong>den. Relevante Ergebnisse im obigen S<strong>in</strong>nwerden im Folgenden kurz dargestellt.4,25Mittelwert von emersch4,003,753,503,253,002,75SH = Stationäres HospizAD = Ambulanter DienstAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimInstitutionsartKO = Krankenhaus, OnkologieKI = Krankenhaus, IntensivstationKP = Krankenhaus,Abbildung 31: Mittelwert-Diagramm für emotionaleErschöpfung (emersch) <strong>und</strong> InsitutionsartBedeutsame Relationen ergebensich zwischen allen Indicesberuflicher Beanspruchung <strong>und</strong> <strong>der</strong>Institutionsart bei den befragtenProfessionellen:Professionell Tätige auf <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen zeigen sicham höchsten emotional erschöpft (s.Abbildung 31), am ger<strong>in</strong>gsten<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sisch motiviert (s. Abbildung 32)sowie am unzufriedensten im
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 145Mittelwert von <strong>in</strong>tmot6,206,005,805,605,405,205,00Arbeitssett<strong>in</strong>g (s. Abbildung 33) imVergleich <strong>mit</strong> allen an<strong>der</strong>enInstitutionsarten. In stationärenHospizen s<strong>in</strong>d die MitarbeiterInnendagegen am ger<strong>in</strong>gsten emotionalerschöpft, am höchsten <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sischmotiviert sowie am wenigstenunzufrieden <strong>mit</strong> ihrer Arbeitsumgebungim Vergleich <strong>mit</strong> allenan<strong>der</strong>en Institutionsumgebungen.AD = Ambulanter DienstSH = Stationäres HospizAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheimKI = Krankenhaus, IntensivstationKO = Krankenhaus, OnkologieKP = Krankenhaus,InstitutionsartAbbildung 32: Mittelwert-Diagramm für Intr<strong>in</strong>sischeMotivierung (<strong>in</strong>tmot) <strong>und</strong> InstitutionsartMittelwert von unzuf4,003,503,002,502,00(Für Emotionale Erschöpfung:ONEWAY: F = 13,205, p < 0,001;Brown-Forsythe-Test: Statistik =13,218, p < 0,001; Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 61,003, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 146Auch die Personengruppen <strong>der</strong> Stichprobe unterscheiden sich tiefgreifend <strong>in</strong> allenWohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs<strong>in</strong>dices:Mittelwert von feg02Abbildung 34: Mittelwert-Diagramm zu MomentanemWohlbef<strong>in</strong>den (feg02) <strong>und</strong> PersonengruppeMittelwert von feg0121,510,502,221,81,61,41,21PatientInnenPatientInnenBezugspersonenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePersonengruppeÄrztInnenPflegendePersonengruppeEhrenamtlicheEhrenamtlichePsychosozial TätigePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenSeelsorgerInnenAbbildung 35: Mittelwert-Diagramm zu GenerellemWohlbef<strong>in</strong>den (feg01) <strong>und</strong> PersonengruppeDie Gruppe <strong>der</strong> EhrenamtlichTätigen, Psychosozial Tätigen <strong>und</strong>Seelsorgenden geben im Generellen<strong>und</strong> Momentanen Wohlbef<strong>in</strong>den diehöchsten Werte an. Diese Berufsgruppenfühlen sich sowohl generellals auch momentan am wohlsten.Die Mittelgruppe im Wohlbef<strong>in</strong>denbilden ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende,während die Gruppe <strong>der</strong> PatientInnensowohl im momentanen alsauch im generellen Wohlbef<strong>in</strong>den dieniedrigsten Werte angibt. Als speziellzeigt sich die Gruppe <strong>der</strong> Bezugspersonen:Ihre generelle Zufriedenheit<strong>mit</strong> ihrem Leben liegt imDurchschnitt; nach dem momentanenWohlbef<strong>in</strong>den befragt, gebenBezugspersonen jedoch noch ger<strong>in</strong>gereWerte an als PatientInnen (fürMomentanes Wohlbef<strong>in</strong>den: Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 85,904, p< 0,001; ONEWAY: F = 16,431, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 147Mittelwert von belquelAbbildung 36: Mittelwert-Diagramm zu Anzahl <strong>der</strong>Belastungsquellen (belquel) <strong>und</strong> PersonengruppeMittelwert von emersch5,554,543,534,003,753,503,253,002,752,50PatientInnenÄrztInnenBezugspersonenÄrztInnenPflegendePflegendePersonengruppeEhrenamtlichePersonengruppeEhrenamtlichePsychosozial TätigePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenSeelsorgerInnenAbbildung 37: Mittelwert-Diagramm zu EmotionalerErschöpfung (emersch) <strong>und</strong> PersonengruppeAuch die Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellenunterscheidet sich <strong>in</strong> denPersonengruppen (Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat = 95,023, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 148Mittelwert von unzufAbbildung 38: Mittelwert-Diagramm zu Unzufriedenheit(unzuf) <strong>und</strong> PersonengruppeMittelwert von reab3,002,802,602,402,202,001,803,403,203,002,802,60ÄrztInnenÄrztInnenPflegendePflegendeEhrenamtlichePersonengruppeEhrenamtlichePersonengruppePsychosozial TätigePsychosozial TätigeSeelsorgerInnenSeelsorgerInnenAbbildung 39: Mittelwert-Diagramm zu ReaktivemAbschirmen (reab) <strong>und</strong> Personengruppewenigsten emotional erschöpft. Diehöchste emotionale Erschöpfungweisen die ÄrztInnen auf. Die erlebteUnzufriedenheit <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Arbeit ist beiEhrenamtlichen <strong>und</strong> Seelsorgendenvon allen Personengruppen amger<strong>in</strong>gsten. Hier belegen ÄrztInnen<strong>und</strong> Pflegende die höchstenGruppenwerte.ReaktivesAbschirmen als Reaktion aufbelastende Arbeitszusammenhängef<strong>in</strong>det sich bei Ehrenamtlichen <strong>und</strong>Seelsorgenden am ger<strong>in</strong>gstenausgeprägt. Die höchsten Gruppenwertezeigen sich auch hier beiPflegenden (<strong>und</strong> ÄrztInnen).Diese <strong>in</strong>haltlichen Untergruppenlassen sich auch bei Intr<strong>in</strong>sischerMotivierung <strong>und</strong> Klientenaversionausmachen.(Für Emotionale Erschöpfung:ONEWAY: F = 17,809, p < 0,001;Kruskal-Wallis-Test: Chi-Quadrat =64,122, p < 0,001; für Unzufriedenheit:ONEWAY: F = 14,084, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 149Der Zusammenhang <strong>der</strong> Outcome-Variablen untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stellt sich korrelativ wiefolgt dar:GenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenHöhe desBelastungsausmaßesEmotionale ErschöpfungIntr<strong>in</strong>sische MotivierungErlebte UnzufriedenheitKlientenaversionReaktives AbschirmenGenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenHöhe desBelastungsausmaßesEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeKorr. 1,000 ,447(**) -,199(**) -,340(**) -,378(**) ,381(**) -,378(**) -,220(**) -,097(*)Sign. . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,037Korr. 1,000 -,071 -,280(**) -,451(**) ,358(**) -,429(**) -,272(**) -,104(*)Sign. . ,056 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,025Korr. 1,000 ,806(**) ,295(**) -,262(**) ,281(**) ,192(**) ,090Sign. . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,056Korr. 1,000 ,402(**) -,294(**) ,375(**) ,187(**) ,025Sign. . ,000 ,000 ,000 ,000 ,593Korr. 1,000 -,367(**) ,577(**) ,300(**) ,103(*)Sign. . ,000 ,000 ,000 ,026Korr. 1,000 -,600(**) -,322(**) -,229(**)Motivierung Sign. . ,000 ,000 ,000Korr. 1,000 ,418(**) ,203(**)ErlebteUnzufriedenheit<strong>in</strong><strong>der</strong> ArbeitSign. . ,000 ,000Klienten-Korr. 1,000 ,158(**)aversion Sign. . ,001Korr. 1,000ReaktivesAbschirmen Sign. .** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).Tabelle 5: Korrelative Beziehungen <strong>der</strong> Outcome-Variablen (Korrelationen nach Pearson)Die korrelativen Beziehungen zwischen Generellem <strong>und</strong> Momentanem Wohlbef<strong>in</strong>den,zwischen Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen <strong>und</strong> Belastungsausmaß sowiezwischen Emotionaler Erschöpfung, Intr<strong>in</strong>sischer Motivierung, Erlebter Unzufriedenheit,Klientenaversion <strong>und</strong> Reaktivem Abschirmen s<strong>in</strong>d erwartungsgemäß hoch, denndie jeweiligen E<strong>in</strong>zelvariablen gehören jeweils zu e<strong>in</strong>em Konzept bzw. Instrument.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 150(Innerhalb <strong>der</strong> Skalen für berufsbed<strong>in</strong>gte Beanspruchung aus dem BHD liegen dieKorrelationen unterschiedlich hoch <strong>und</strong> teilweise auch <strong>in</strong> mäßiger Höhe. Diesentspricht den Ergebnissen <strong>und</strong> Empfehlungen <strong>der</strong> Autoren des Instruments, nichte<strong>in</strong>en Gesamtscore von beruflicher Beanspruchung zu bilden, son<strong>der</strong>n dieE<strong>in</strong>zelskalen als Beanspruchungsprofil zu verwenden.)Von den <strong>in</strong>sgesamt 36 Korrelationen s<strong>in</strong>d 29 hoch signifikant (<strong>und</strong> liegen im Bereichvon 0,158 bis 0,806), drei s<strong>in</strong>d signifikant <strong>und</strong> drei nicht signifikant; die schwächstenVerb<strong>in</strong>dungen zeigen sich dabei zum Reaktiven Abschirmen.Aus diesen Daten kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es sich bei denerhobenen Outcome-Variablen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tat um Aspekte e<strong>in</strong>es Konzepts vonBef<strong>in</strong>dlichkeit handelt. E<strong>in</strong>e über alle Outcome-Variablen durchgeführte Faktorenanalysebestätigt diese Ergebnisse. Sie zeigt zwei Faktoren: GenerellesWohlbef<strong>in</strong>den, Momentanes Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Intr<strong>in</strong>sische Motivierung bilden e<strong>in</strong>enFaktor, während die Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen <strong>und</strong> das Belastungsausmaß <strong>in</strong>e<strong>in</strong>en zweiten Faktor fallen. Emotionale Erschöpfung, Unzufriedenheit, Klientenaversion<strong>und</strong> Reaktives Abschirmen laden <strong>mit</strong> unterschiedlichen Gewichtungen aufbeiden Faktoren, bilden dabei hauptsächlich <strong>mit</strong> den Wohlbef<strong>in</strong>dens<strong>in</strong>dices e<strong>in</strong>Kont<strong>in</strong>uum. Es handelt sich bei Beanspruchung <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den also umunterschiedliche Konzepte <strong>und</strong> nicht um zwei Pole e<strong>in</strong>er Dimension.Die hypothetisch angenommene Struktur <strong>der</strong> Outcome-Variablen als Teile desKonzepts von Bef<strong>in</strong>dlichkeit sowie die Zugehörigkeit <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Variablen zu denzwei Achsen von Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung kann dadurch vorläufig bestätigtwerden.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 151Beziehungen zwischen sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>dens- bzw.Beanspruchungs<strong>in</strong>dicesDie Art <strong>und</strong> Stärke <strong>der</strong> Interaktionen zwischen den sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> denWohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungsmaßen wird durch Korrelationen, partielleKorrelationen (bei Kontrolle <strong>der</strong> demographischen Rahmendaten) sowie durchVarianz- <strong>und</strong> Kovarianzanalysen (demographische Rahmendaten als Kovariaten)bestimmt. Anhang 6 gibt die Korrelationsbeziehungen wie<strong>der</strong>, Anhang 7 dievarianzanalytischen Bezüge.Es zeigen sich viele signifikante Zusammenhänge zwischen den sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>dens- bzw. Belastungsmaßen. Es kann so<strong>mit</strong> bestätigtwerden, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> Auswirkungen auf Beanspruchung bzw. Belastung<strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den haben. Aus <strong>der</strong> Fülle von signifikanten Zusammenhängen, diesich alle im <strong>mit</strong>tleren Niveau bef<strong>in</strong>den, s<strong>in</strong>d folgende fünf Bezüge von Bedeutung:Erstens: Die Komponenten sozialer Unterstützung (Informationale, Instrumentelle,Motivationale, Emotionale <strong>und</strong> Gegebene Unterstützung), die die objektiv erhalteneUnterstützung <strong>der</strong> Befragten wie<strong>der</strong>geben, zeigen von allen Variablen die wenigstensignifikanten Beziehungen zu den Outcome-Variablen. E<strong>in</strong>ige E<strong>in</strong>zelbezüge ergebensignifikante Korrelationen, varianzanalytisch lassen sich jedoch ke<strong>in</strong>e vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong>unterscheidbare Untergruppen ausmachen. Beim Konzept <strong>der</strong> sozialen Unterstützungh<strong>in</strong>gegen, das durch Wahrgenommene Unterstützung, Unterstützungsbedürfnissowie Suche nach Unterstützung operationalisiert wird (also <strong>der</strong> subjektivempf<strong>und</strong>en <strong>und</strong> nicht <strong>der</strong> objektiv gegebenen Unterstützung), stellt sich dieVerb<strong>in</strong>dung zu den Outcome-Variablen an<strong>der</strong>s dar: Hier zeigen sich relativ deutlicheInteraktionen zwischen <strong>der</strong> Wahrgenommenen Unterstützung <strong>und</strong> den Outcome-Variablen (z.B. zu Generellem Wohlbef<strong>in</strong>den: GLM: F = 5,390, p < 0,001, CORRSpearman: r = 0,342, p < 0,001). Ke<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> nicht relevante Relationen zeigen sichbeim Unterstützungsbedürfnis sowie <strong>der</strong> Suche nach Unterstützung.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 152Mittelwert14121086420-22,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00<strong>Soziale</strong> ResonanzGenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenHöhe desBelastungsausmaßesEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeMotivierungErlebteUnzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong>ArbeitKlientenaversionReaktives AbschirmenAbbildung 41: Zusammenhang zwischen denMittelwerten <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>nResonanz (Kurven zeigen den Spl<strong>in</strong>e an.)Zweitens: Die <strong>Soziale</strong> Resonanz,d.h. das Gefühl des s<strong>in</strong>nvollenE<strong>in</strong>gebettetse<strong>in</strong>s <strong>in</strong> die Welt, zeigtvon allen sozialen <strong>Ressourcen</strong>durchweg die höchsten Interaktionen<strong>mit</strong> den Indices für Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong>Belastung bzw. Beanspruchung (z.B.zu Generellem Wohlbef<strong>in</strong>den: GLM:F = 7,221, p < 0,001, PARCORR =0,358, p < 0,001; zu Belastungsausmaß:GLM: F = 4,065, p < 0,001;zu Unzufriedenheit: GLM: F = 4,219,p < 0,001, PARCORR = -0,377, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 153Mittelwert10864201,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Netzstärke, auf .5 ger<strong>und</strong>etGenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenHöhe desBelastungsausmaßesEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeMotivierungErlebteUnzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong>ArbeitAbbildung 43: Zusammenhang zwischen denMittelwerten <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>und</strong> <strong>der</strong>Netzstärke (Kurven zeigen den Spl<strong>in</strong>e an.)0,296**, GLM: F = 4,730, p < 0,001;zu Unzufriedenheit: PARCORR = -0,220**, GLM: F = 4,429, p < 0,001;s. Abbildung 43). Anhand <strong>der</strong>Abbildungen wird deutlich, dass dieGröße des sozialen Netzes <strong>der</strong>Befragten ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf ihrWohlbef<strong>in</strong>den o<strong>der</strong> ihre Belastungbzw. Beanspruchung hat. Je größerjedoch die subjektive Zufriedenheit<strong>mit</strong> eben diesem umgebendensozialen Netz bei den Befragtenliegt, desto höher ist auch ihrWohlbef<strong>in</strong>den bzw. desto ger<strong>in</strong>gerihre allgeme<strong>in</strong>e Belastung <strong>und</strong>berufsspezifische Beanspruchung.Mittelwert1086420-3 -2 -1 0 1 2 3Generelles Wohlbef<strong>in</strong>denZufriedenheits<strong>in</strong>dexProblem<strong>in</strong>dexÄn<strong>der</strong>ungsdruckAbbildung 44: Zusammenhang <strong>der</strong> Mittelwerte vonZufriedenheits-, Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>und</strong>Generellem Wohlbef<strong>in</strong>denViertens: Die fünf Maße Zufriedenheits<strong>in</strong>dex,Problem<strong>in</strong>dex,Än<strong>der</strong>ungsdruck, Konstruktivität <strong>und</strong>Destruktivität beschreiben dieempf<strong>und</strong>ene Qualität enger sozialeBeziehungen. Hier zeigen sich beiden Maßen Konstruktivität <strong>und</strong>Destruktivität ke<strong>in</strong>e relevantenBezüge zu den Outcome-Variablen.Von relativ hoher Relevanz s<strong>in</strong>djedoch die Maße Zufriedenheits<strong>in</strong>dex,Problem<strong>in</strong>dex sowieÄn<strong>der</strong>ungsdruck (z.B. wie <strong>in</strong>Abbildung 44 zu GenerellemWohlbef<strong>in</strong>den: Zufriedenheits<strong>in</strong>dex –
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 154GLM: F = 5,430, p < 0,001,Mittelwert10864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Höhe des Belastungsausmaßes aus FEGZufriedenheits<strong>in</strong>dexProblem<strong>in</strong>dexÄn<strong>der</strong>ungsdruckAbbildung 45: Zusammenhang <strong>der</strong> Mittelwerte vonZufriedenheits-, Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>und</strong>Höhe des BelastungsausmaßesProblem<strong>in</strong>dex – GLM: F = 4,595, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 155Zusammenfassung <strong>der</strong> wichtigsten Ergebnisse zur Bedeutung von sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>:• Die Stichprobe erweist sich im H<strong>in</strong>blick auf die Ausprägung sozialer <strong>Ressourcen</strong>wie auf die Ausprägungen von Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong> Belastungs-/Beanspruchungs<strong>in</strong>dices als sehr heterogen. Vor allem die Institutionsarten <strong>und</strong>die Personengruppen s<strong>in</strong>d dabei für die große Variabilität verantwortlich.• <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> wirken sich auf Beanspruchung <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den aus.• Die verschiedenen Komponenten sozialer Unterstützung (Informationale,Instrumentelle, Motivationale, Emotionale <strong>und</strong> Gegebene Unterstützung) habenke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung.• In dem Konzept von sozialer Unterstützung nach WahrgenommenerUnterstützung, Unterstützungsbedürfnis <strong>und</strong> Suche nach Unterstützung hat dieWahrgenommene Unterstützung starke Bezüge zu den Outcome-Variablen, dasUnterstützungsbedürfnis sowie die Suche nach Unterstützung jedoch nicht.• <strong>Soziale</strong> Resonanz zeigt von allen sozialen <strong>Ressourcen</strong> die stärkstenVerb<strong>in</strong>dungen zu Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Belastung bzw. Beanspruchung.• Die Netzgröße, welche die objektive Größe des sozialen Netzes angibt, wirkt sichnicht auf Wohlbef<strong>in</strong>den bzw. Beanspruchung aus. Die subjektiv empf<strong>und</strong>eneQualität des sozialen Netzes (Netzstärke) zeigt relevante korrelative Verb<strong>in</strong>dungen<strong>mit</strong> den Outcome-Variablen.• Zufriedenheits<strong>in</strong>dex, Problem<strong>in</strong>dex sowie Än<strong>der</strong>ungsdruck als Maße <strong>der</strong> Qualitätenger sozialer Beziehungen als Ressource zeigen hohe Bezüge zu denOutcome-Variablen. Bei Konstruktivität <strong>und</strong> Destruktivität lassen sich ke<strong>in</strong>erelevanten Bezüge nachweisen.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 156• Die durchweg höchsten Varianzaufklärungen <strong>in</strong> den Outcome-Variablen lassensich durch die <strong>Soziale</strong> Resonanz, die Wahrgenommene Unterstützung, denZufriedenheits<strong>in</strong>dex, den Problem<strong>in</strong>dex sowie den Än<strong>der</strong>ungsdruck erzielen.• Kennwerte für soziale <strong>Ressourcen</strong>, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> subjektiven Wahrnehmung desBefragten f<strong>und</strong>iert s<strong>in</strong>d, zeigen durchweg stärkere Beziehungen zu den Outcome-Variablen als Maße, die objektive Größen <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen Umwelt angeben.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 1579.2. Analyse des Konzepts <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Im zweiten Teil <strong>der</strong> Ergebnisdarstellung soll nun das Konzept <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> näher analysiert werden. Bereits im theoretischen Teil <strong>der</strong> Arbeit wurdedeutlich, dass die gängigen Konzeptionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> E<strong>in</strong>schränkungenunterliegen <strong>und</strong> dass die Trennung von sozialen <strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong>ebenfalls nicht unzweifelhaft ist. Daher werden im ersten Teil <strong>der</strong> folgendenDarstellungen die Bezüge zwischen den Kennwerten sozialer <strong>Ressourcen</strong>untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> näher analysiert. Im zweiten Teil dieses Unterkapitels werden sie dann<strong>mit</strong> Kennwerten personaler <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Beziehung gesetzt, um anhand <strong>der</strong>vorliegenden Stichprobe Anhaltspunkte über die Beziehung von personalen <strong>und</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> zu gew<strong>in</strong>nen.Dimensionsbildung <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>zelkennwerten <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Im Folgenden stehen die Bezüge <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Es wird betrachtet, wie die E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>der</strong> unterschiedlichenKonzepte von sozialen <strong>Ressourcen</strong> untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehen. Dazuwerden erst korrelative Beziehungen betrachtet, dann wird e<strong>in</strong>e Faktorenanalysedurchgeführt, zum Schluss folgt e<strong>in</strong>e Überprüfung <strong>der</strong> Brauchbarkeit <strong>der</strong> erhaltenenDimensionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> anhand <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>der</strong> Stichprobe(um e<strong>in</strong>en Querbezug zur Fragestellung 1 ziehen zu können).
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 158Zunächst <strong>in</strong>teressieren die korrelativen Beziehungen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerteuntere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Sie stellen sich wie folgt dar (s. Tabellen 6):motivationale Unterstützungemotionale Unterstützung<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung<strong>in</strong>formationale Unterstützunggegebene UnterstützungNetzstärke<strong>Soziale</strong> ResonanzZufriedenheits<strong>in</strong>dexmotivationale1,000 ,747(**) ,676(**) ,636(**) ,549(**) ,519(**) ,164(**) ,197(**)Unterstützung . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000emotionale1,000 ,641(**) ,520(**) ,599(**) ,531(**) ,201(**) ,191(**)Unterstützung . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<strong>in</strong>strumentelle1,000 ,599(**) ,486(**) ,461(**) ,108(**) ,205(**)Unterstützung . ,000 ,000 ,000 ,004 ,000<strong>in</strong>formationale1,000 ,414(**) ,362(**) ,080(*) ,133(**)Unterstützung . ,000 ,000 ,029 ,000gegebene1,000 ,338(**) ,234(**) ,221(**)Unterstützung . ,000 ,000 ,000Netzstärke1,000 ,324(**) ,225(**). ,000 ,0001,000 ,305(**)<strong>Soziale</strong>Resonanz . ,000Zufriedenheits<strong>in</strong>dex.** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).1,000
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 159WahrgenommeneUnterstützungSuche nach UnterstützungProblem<strong>in</strong>dexNetzgrößeÄn<strong>der</strong>ungsdruckDestruktivität des engenNetzesKonstruktivität des engenNetzesBedürfnis nach Unterstützungmotivationale,332(**) ,259(**) -,075 -,002 -,118(**) -,128 ,076 ,083(*)Unterstützung ,000 ,000 ,084 ,949 ,001 ,137 ,224 ,026emotionale,386(**) ,257(**) -,101(*) -,030 -,110(**) -,115 ,046 ,011Unterstützung ,000 ,000 ,021 ,420 ,003 ,182 ,459 ,774<strong>in</strong>strumentelle,325(**) ,215(**) -,096(*) -,060 -,145(**) -,052 ,072 ,033Unterstützung ,000 ,000 ,027 ,104 ,000 ,544 ,248 ,379<strong>in</strong>formationale,240(**) ,225(**) -,020 -,001 -,078(*) -,059 ,075 ,074(*)Unterstützung ,000 ,000 ,646 ,982 ,033 ,490 ,227 ,045gegebene,206(**) ,178(**) -,038 ,019 ,014 -,189(*) -,001 ,105(**)Unterstützung ,000 ,000 ,380 ,618 ,707 ,027 ,991 ,005Netzstärke<strong>Soziale</strong> ResonanzZufriedenheits<strong>in</strong>dexWahrgenommene,353(**) ,273(**) -,176(**) -,053 -,206(**) -,120 ,102 ,017,000 ,000 ,000 ,147 ,000 ,162 ,098 ,650,348(**) ,189(**) -,153(**) ,029 -,091(*) -,130 ,013 ,034,000 ,000 ,000 ,426 ,012 ,129 ,832 ,349,271(**) ,181(**) -,079 ,117(**) -,227(**) ,028 ,102 ,055,000 ,000 ,065 ,002 ,000 ,747 ,100 ,1351,000 ,387(**) -,185(**) ,017 -,203(**) -,071 ,050 ,080(*)Unterstützung . ,000 ,000 ,649 ,000 ,409 ,420 ,029Suche nach1,000 -,087(*) ,034 -,036 -,038 ,044 ,053Unterstützung . ,044 ,356 ,324 ,656 ,481 ,149Problem<strong>in</strong>dexNetzgrößeÄn<strong>der</strong>ungsdruckDestruktivitätKonstruktivitätBedürfnis nachUnterstützung** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).1,000 ,176(**) ,339(**) ,207(*) ,095 ,040. ,000 ,000 ,019 ,152 ,3481,000 ,110(**) ,020 ,027 ,029. ,003 ,814 ,666 ,4251,000 ,086 ,033 ,011. ,316 ,591 ,7571,000 ,372(**) ,031. ,000 ,7151,000 -,034. ,581Tabellen 6: Korrelative Beziehungen (nach Pearson) <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> (Erläuterung: Tabelle ist <strong>in</strong> zwei Untertabellen geteilt.)1,000
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 160Die wichtigsten Aussagen zu den korrelativen Beziehungen können wie folgtfestgehalten werden:• Generell zeigen sich viele korrelativ signifikante <strong>und</strong> hoch signifikanteBeziehungen von <strong>mit</strong>tlerer bis großer Höhe, so dass die Hypothese gestütztwerden kann, es bestehe e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen unterschiedlichenKonzepten <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>.• Es wird deutlich, dass wenige Verb<strong>in</strong>dungen von den Variablen Bedürfnis nachUnterstützung, Konstruktivität, Destruktivität sowie Netzgröße ausgehen. DieseVariablen zeigen sich als weitgehend unverb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> allen an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>zelkennwerten.• Die Komponenten sozialer Unterstützung (Informationale, Instrumentelle,Motivationale, Emotionale, Gegebene Unterstützung) weisen e<strong>in</strong>e engeVerb<strong>in</strong>dung untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> auf (Korrelationen nach Pearson: 0,414** - 0,747**, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 161Da sich e<strong>in</strong> übergreifen<strong>der</strong> Zusammenhang zwischen den sozialen <strong>Ressourcen</strong>korrelativ deutlich zeigt, stellt sich die Frage, ob sich Dimensionen von sozialen<strong>Ressourcen</strong> aus den E<strong>in</strong>zelkennwerten ableiten lassen. E<strong>in</strong>e Faktorenanalyse überalle gebildeten <strong>und</strong> dargestellten Kennwerte ergibt e<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tat <strong>in</strong>teressantesErgebnis:Die routierte Varimax-Methode kommt zu e<strong>in</strong>er 5-Komponenten-Lösung bei guter bissehr guter Stichprobeneignung (KMO=0,823; Bartlett-Test: p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 162Die fünf entstehenden Dimensionen lassen sich folgen<strong>der</strong>maßen charakterisieren:Name des Kennwertes Bedeutung des Kennwertes Entstehende DimensionmotivationaleUnterstützungemotionaleUnterstützung<strong>in</strong>strumentelleUnterstützung<strong>in</strong>formationaleUnterstützunggegebeneUnterstützungNetzstärke<strong>Soziale</strong> ResonanzZufriedenheits<strong>in</strong>dexwahrgenommeneUnterstützungSuche nachUnterstützungProblem<strong>in</strong>dexNetzgrößeÄn<strong>der</strong>ungsdruckDestruktivität des engenNetzesKonstruktivität des engenNetzesUnterstützungsbedürfnisIch gebe <strong>und</strong> erhalteUnterstützung.Ich b<strong>in</strong> zufrieden <strong>mit</strong> me<strong>in</strong>ensozialen Beziehungen.Me<strong>in</strong> Dase<strong>in</strong> ist s<strong>in</strong>nvolle<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.Me<strong>in</strong>e engen Beziehungentragen zu me<strong>in</strong>em Glückbei.Ich werde unterstützt, wennich es brauche.Ich kann Unterstützungsuchen, wenn ich siebrauche.Me<strong>in</strong>e engen Beziehungens<strong>in</strong>d problematisch.Me<strong>in</strong> soziales Netz istkle<strong>in</strong>/groß.Ich will etwas an me<strong>in</strong>enengen Beziehungenverän<strong>der</strong>n.Me<strong>in</strong>e engen Beziehungenverh<strong>in</strong><strong>der</strong>n/erschwerenVerän<strong>der</strong>ung.Me<strong>in</strong>e engen Beziehungens<strong>in</strong>d hilfreich beiVerän<strong>der</strong>ung.Ich braucheHilfe/Unterstützung beiProblemen.ÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungen imsozialen NetzVerän<strong>der</strong>ungssensitivitätdessozialen NetzesUnterstützungsbedarfTabelle 7: Dimensionsstruktur nach <strong>der</strong> Faktorenanalyse aller sozialen KennwerteRESSOURCEVULNERABILITÄT
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 163Aus <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Dimensionsstruktur ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:• Die Komponenten sozialer Unterstützung bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Dimension; siestellen also ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>haltlich unterschiedlichen Konzepte dar. Dies könntemethodische Gründe haben, denn die Antwortschemata s<strong>in</strong>d fast völlig identisch,so dass gleiches Ankreuzen geför<strong>der</strong>t wird. (Es ist dabei am Rande auch noch<strong>in</strong>teressant, dass bei den Unterstützungskomponenten Motivationale <strong>und</strong>Emotionale Unterstützung e<strong>in</strong>e größere Bedeutung zeigen als Instrumentelle <strong>und</strong>Informationale Unterstützung.)• Die Arten von Überzeugungen zu sozialer Unterstützung bef<strong>in</strong>den sich zum<strong>in</strong>dest<strong>in</strong> zwei unterschiedlichen Dimensionen, wobei vor allem <strong>der</strong> Unterstützungsbedarfe<strong>in</strong> <strong>in</strong>haltlich abgeschlossenes Konzept zu se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t. WahrgenommeneUnterstützung <strong>und</strong> Suche nach Unterstützung jedoch sche<strong>in</strong>en <strong>in</strong>haltlich starkverwandt zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> laden entsprechend <strong>in</strong> direkter Nachbarschaft auf e<strong>in</strong>erDimension.• Es entsteht e<strong>in</strong>e Dimension Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, die e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendesGefühl des s<strong>in</strong>nvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt <strong>und</strong> den sozialen Beziehungensowie e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendes Vertrauen <strong>in</strong> das Unterstütztwerden („Me<strong>in</strong> Dase<strong>in</strong>ist s<strong>in</strong>nvoll e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.“, „Me<strong>in</strong>e engen Beziehungen tragen zu me<strong>in</strong>em Glückbei.“, „Ich werde unterstützt, wenn ich es brauche.“, „Ich kann Unterstützungsuchen, wenn ich es brauche.“, „Ich b<strong>in</strong> zufrieden <strong>mit</strong> me<strong>in</strong>en sozialen Beziehungen.“)be<strong>in</strong>haltet.• Die äußere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netz (Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>) <strong>und</strong> das<strong>in</strong>nere Abbild davon im Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person (Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>)fallen <strong>in</strong> zwei unterschiedliche Dimensionen. Es handelt sich dabei also umvone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> getrennte Prozesse: Gut unterstützt zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> sich gut unterstütztzu fühlen ist demnach nicht dasselbe.• Die ersten beiden Dimensionen (Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>) s<strong>in</strong>d salutogenetischer Prägung, die drei restlichen Dimensionen(Störungen im sozialen Netz, Verän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialen Netzes,Unterstützungsbedarf) pathogenetischer Prägung. Bemerkenswert ist, dass die
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 164Varianzaufklärung <strong>der</strong> salutogenetisch (36,470% von 61,765%) <strong>und</strong> pathogenetisch(25,295% von 61,765%) geprägten Dimensionen sich etwa die Waagehält, wobei die salutogenetisch verankerten Kennwerte sogar etwas mehr als dieHälfte <strong>der</strong> Varianzaufklärung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe leisten.• Beim Vergleich <strong>der</strong> Kennwerte Netzgröße <strong>und</strong> Netzstärke zeigt sich, dass diesubjektive Zufriedenheit <strong>mit</strong> dem sozialen Netzwerk mehr Varianzaufklärungleistet als die objektive Größe des Netzes. Dadurch wird erneut deutlich, dassnicht das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es großen sozialen Netzes alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ressourcedarstellt; zur Ressource werden die sozialen Beziehungen durch die Bewertung<strong>der</strong> befragten Person als zufrieden stellend.• Der Kennwert Netzstärke bef<strong>in</strong>det sich auf <strong>der</strong> Grenze zwischen äußererVerb<strong>und</strong>enheit <strong>und</strong> <strong>in</strong>nerer Sicherheit/<strong>in</strong>nerem Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> (Faktorladung aufÄußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>: 0,595, Faktorladung auf Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>:0,351). Dies ist nachvollziehbar, denn das Maß wurde auf <strong>der</strong> subjektivenZufriedenheit <strong>der</strong> Befragten <strong>mit</strong> ihren sozialen Beziehungen aufgebaut. Deshalbmuss es auf <strong>der</strong> Grenze zwischen äußerer Realität <strong>und</strong> <strong>in</strong>nerer Bewertung liegen<strong>und</strong> folgerichtig auch zwischen beiden Dimensionen.Entsprechend <strong>der</strong> Analyseergebnisse können die E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>in</strong> fünfDimensionsmaße gefasst werden. (Die sonst übliche Überführung <strong>der</strong> Faktorladungen<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Rangreihenfolge <strong>und</strong> anschließende Perzentilbildung ist beimvorliegenden Datensatz nicht möglich, da bei den E<strong>in</strong>zelkennwerten viele fehlendeWerte vorliegen <strong>und</strong> SPSS Faktorwerte nur bei vollständigen E<strong>in</strong>zelwerten anzeigt.So werden die E<strong>in</strong>zelkennwerte z-standardisiert <strong>und</strong> zum jeweiligen Dimensionswertsummiert <strong>und</strong> ge<strong>mit</strong>telt.) Es entstehen die fünf Dimensionen:
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 165Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungen im sozialen NetzVerän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialen NetzesUnterstützungsbedarfZur besseren Handhabbarkeit werden sie bei Bedarf <strong>in</strong> <strong>der</strong> ger<strong>und</strong>eten Formangewendet. Es ergeben sich die folgenden univariaten Kennwerte:Name des KennwertsSPSS-M<strong>in</strong>imum -StandardabweichungNMittelwertNameMaximumAußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> ause<strong>in</strong> 751 -2 – 2 -0,01 0,824Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>in</strong>verb 771 -4 – 1 0,01 0,773Störungen im sozialen Netz stoene 781 -2 – 2 -0,02 0,768Verän<strong>der</strong>ungssensitivität d. soz. Netz versen 298 -1 – 4 -0,14 1,129Unterstützungsbedarf) untebe 745 -3 – 3 0,19 1,000Tabelle 8: Statistische Werte <strong>der</strong> Dimensionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> (das ungewöhnliche Verhältnisvon Mittelwerten zu Standardabweichungen entsteht durch die Z-Standardisierungen)Die Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Dimensionen f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Anhang 9.Die Korrelationen <strong>der</strong> Dimensionen untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ergibt folgendes Bild:ÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungenim sozialenNetzInneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Verän<strong>der</strong>ungssensitivitätdessozialen NetzesUnterstützungsbedarfÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>1,000 ,398(**) -,109(**) ,026 ,070InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>1,000 -,099(**) ,045 ,085(*)Störungen im sozialenNetz1,000 ,128(*) ,028Verän<strong>der</strong>ungssensitivitätdes sozialen Netzes1,000 ,004Unterstützungsbedarf 1,000** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).Tabelle 9: Korrelative Beziehungen <strong>der</strong> Dimensionen (Korrelationen nach Pearson)
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 166Folgende Schlussfolgerungen können aus den korrelativen Zusammenhängengezogen werden:• Die e<strong>in</strong>zige Korrelation, die aufgr<strong>und</strong> ihrer Höhe e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>haltliche Aussagekraftbesitzt, besteht zwischen den Dimensionen Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong>Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>. Dies stützt die <strong>in</strong>haltliche Interpretation <strong>der</strong> Faktorenanalyse,<strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e starke Verwandtschaft bei<strong>der</strong> Dimensionen im übergeordnetenKonzept <strong>der</strong> salutogenetischen <strong>Ressourcen</strong>funktion prognostiziertwurde.• Alle an<strong>der</strong>en Korrelationen s<strong>in</strong>d äußerst ger<strong>in</strong>g o<strong>der</strong> werden nicht signifikant. Eshandelt sich so<strong>mit</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tat um vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> unabhängige Dimensionen sozialer<strong>Ressourcen</strong>, die durch die Faktorenanalyse entstanden s<strong>in</strong>d.Abschließend wird noch die Brauchbarkeit <strong>der</strong> fünf Dimensionen überprüft (e<strong>in</strong>ekommentierte Darstellung <strong>der</strong> Bezüge zwischen den fünf Dimensionen <strong>und</strong> denRahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Anhang 10). Dazu werden sie <strong>mit</strong> denOutcome-Variablen <strong>der</strong> Stichprobe <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gesetzt, um die erhaltenenBezugsmaße <strong>mit</strong> denen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen <strong>Soziale</strong>n <strong>Ressourcen</strong> vergleichen zu können.Die varianzanalytischen Ergebnisse f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Anhang 11. Es zeigt sich deutlich,dass sich vor allem die Dimension Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> stark auf dasWohlbef<strong>in</strong>den bzw. die Beanspruchung <strong>der</strong> befragten Person auswirkt (z.B. zuAllgeme<strong>in</strong>em Wohlbef<strong>in</strong>den GLM: F=25,632, p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 167Zusammenhang <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>und</strong> Dimensionen <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>mit</strong> PersönlichkeitsmaßenIm Folgenden wird <strong>der</strong> Frage nachgegangen, ob e<strong>in</strong> Zusammenhang zwischenpersonalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> besteht. Dazu wird überprüft, ob e<strong>in</strong>eVerb<strong>in</strong>dung zwischen den sozialen <strong>Ressourcen</strong> bzw. Dimensionen <strong>und</strong> ausgewähltenPersönlichkeitskonstrukten besteht, die im Fragebogen erhoben werden.Diese s<strong>in</strong>d: Proaktivität, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen sowieTranspersonales Vertrauen. Da es sich um ausgewählte, salutogenetischeKonstrukte handelt, ist die Allgeme<strong>in</strong>gültigkeit <strong>der</strong> folgenden Analysen <strong>und</strong> Aussagenüber den Zusammenhang von sozialem <strong>und</strong> personalem Raum e<strong>in</strong>geschränkt <strong>und</strong>besitzt vor allem H<strong>in</strong>weischarakter.Darstellung <strong>der</strong> erhobenen PersönlichkeitsmaßeProaktivität, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen (Internale Kontrollüberzeugung,Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität, Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte Externalität) sowieTranspersonales Vertrauen wurden als Skalen zur Messung persönlicherE<strong>in</strong>stellungen gewählt, da sie bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pilotstichprobe als relevanteEigenschaften zur Mo<strong>der</strong>ation von Be- <strong>und</strong> Entlastung deutlich geworden waren.Außerdem stehen alle diese Skalen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie,<strong>der</strong>en Augenmerk auf dem ressourcenorientierten Blickw<strong>in</strong>kel <strong>und</strong> <strong>der</strong> ganzheitlichenSicht auf den Menschen liegt. Diese Perspektive deckt sich <strong>mit</strong> dem Gr<strong>und</strong>anliegen<strong>der</strong> vorliegenden Studie.E<strong>in</strong>e ausführliche Beschreibung <strong>der</strong> Persönlichkeitsmaße <strong>und</strong> ihrer Beziehung zuden demographischen Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe kann <strong>in</strong> diesem Zusammenhangnicht geleistet werden. An dieser Stelle sei auf Kirchner (2005) verwiesen.Tabelle 10 zeigt die statistischen Werte im Überblick:
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 168Name des KennwertsSPSS-M<strong>in</strong>imum -StandardabweichungNMittelwertNameMaximumProaktivität proakt 761 1,00 – 4,00 3,189 0,472Selbstwirksamkeit selwir 756 1,00 – 4,00 3,028 0,552Transpersonales Vertrauen trapev 757 1,00 – 4,00 2,703 1,044Internale Kontrollüberzeugung fkki 747 1,00 – 4,00 3,161 0,741Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität fkkp 743 1,00 – 4,00 1,871 0,845Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte Externalität fkkc 739 1,00 – 4,00 2,072 0,884Tabelle 10: Statistische Werte <strong>der</strong> Konstrukte Proaktivität, Selbstwirksamkeit, TranspersonalesVertrauen <strong>und</strong> KontrollüberzeugungenDie Operationalisierung, die Häufigkeitsverteilungen sowie die Korrelationen <strong>der</strong>Persönlichkeitsmaße untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Anhang 12. Die Verteilungen <strong>der</strong>Kennwerte entsprechen im Wesentlichen den für Normpopulationen angegebenenWerteverteilungen. Die korrelative Verb<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Kennwerte untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> isterwartungsgemäß gegeben, aber auch schwach genug, um sie als <strong>in</strong>haltlicheigenständige E<strong>in</strong>heiten stehen lassen zu können.Beziehung zwischen den sozialen Dimensionen <strong>und</strong> den PersönlichkeitsmaßenVon Interesse ist nun die Verb<strong>in</strong>dung zwischen den gebildeten Dimensionene<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> den erhobenen Persönlichkeitsqualitäten an<strong>der</strong>erseits. E<strong>in</strong>eBerechnung <strong>der</strong> Zusammenhänge soll Aufschluss darüber geben, ob sozialeE<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>e Qualität ist, die <strong>mit</strong> Persönlichkeitseigenschaften <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dungsteht. Anhang 13 zeigt die Ergebnisse <strong>der</strong> partiellen Korrelationsberechnungen(demographische Rahmendaten kontrolliert). Neun <strong>der</strong> gesamt 126 korrelativenBezüge werden dabei signifikant:Wahrgenommene Unterstützung – ProaktivitätInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> – ProaktivitätEmotionale Unterstützung – SelbstwirksamkeitVerän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialen Netzes – SelbstwirksamkeitÄußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> – Transpersonales VertrauenInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> – Transpersonales Vertrauen<strong>Soziale</strong> Resonanz – Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte ExternalitätZufriedenheits<strong>in</strong>dex – Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte ExternalitätInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> – Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte ExternalitätKorrelation <strong>und</strong> Signifikanz0,393 (p=0,011)0,303 (p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 169Folgende Schlussfolgerungen lassen sich hier ziehen:• Bei Internaler Kontrollüberzeugung sowie Sozial bed<strong>in</strong>gter Externalität ergebensich ke<strong>in</strong>e korrelativen Bezüge zu den sozialen <strong>Ressourcen</strong>.• Auch von den sozialen <strong>Ressourcen</strong> Unterstützungsbedarf, Suche nachUnterstützung, Informationale Unterstützung, Instrumentelle Unterstützung,Motivationale Unterstützung, Gegebene Unterstützung, Netzgröße, Netzstärke,Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck, Konstruktivität, Destruktivität, Störungen imsozialen Netz sowie Unterstützungsbedarf gehen ke<strong>in</strong>e Beziehungen zu denerhobenen Persönlichkeitseigenschaften aus.• Vom Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> sowie von <strong>der</strong> Fatalistisch bed<strong>in</strong>gten Externalitätgehen die meisten (<strong>und</strong> überzufällig viele) signifikanten Beziehungen aus.Es kann so<strong>mit</strong> festgestellt werden, dass e<strong>in</strong>e Beziehung zwischen den erhobenenPersönlichkeitskonstrukten <strong>und</strong> den sozialen <strong>Ressourcen</strong> besteht. Das sozialeVerankertse<strong>in</strong> geht also <strong>mit</strong> Eigenschaften im Inneren e<strong>in</strong>er Person e<strong>in</strong>her, die <strong>mit</strong>ihrer Proaktivität <strong>und</strong> ihrer Selbstwirksamkeit, doch vor allem <strong>mit</strong> ihren InternalenKontrollüberzeugungen sowie ihrem Transpersonalen Vertrauen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dungstehen. (Dass diese Beziehungen hier überwiegend schwache Ausprägungen an denTag legen, kann auch durch die Konzeptualisierung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Skalen bed<strong>in</strong>gtse<strong>in</strong>.)Dieses Ergebnis wird weiter unterstützt durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Faktorenanalysealler erhobenen personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> (s. Anhang 14). Bei noch sehrguter Stichprobeneignung (KMO=0,807; Bartlett-Test: p
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 170Name des Kennwertes Bedeutung des Kennwertes Entstehende DimensionÄußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>ProaktivitätSelbstwirksamkeitInternaleKontrollüberzeugungTranspersonalesVertrauensozial externaleKontrollüberzeugungfatalistischeKontrollüberzeugungIch kann <strong>in</strong> je<strong>der</strong> Situationerfolgreich handeln.Me<strong>in</strong> Dase<strong>in</strong> ist s<strong>in</strong>nvolle<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>enMe<strong>in</strong>e engen Beziehungen tragenzu me<strong>in</strong>em Glück bei.Ich werde unterstützt, wenn ich esbrauche.Me<strong>in</strong>e Existenz ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>ne<strong>in</strong>gebettet, <strong>der</strong> me<strong>in</strong>e Personüberschreitet.Ich brauche Hilfe/Unterstützung beiProblemen.Ich kann nicht autonom handeln.Vertrauen <strong>in</strong> die eigenenMöglichkeitenInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungen im sozialen NetzVerän<strong>der</strong>ungssensitivität dessozialen NetzesUnterstützungsbedarfRESSOURCEVULNERABILITÄTTabelle 12: Dimensionen nach <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Faktorenanalyse von sozialen Kennwerten <strong>und</strong>personalen <strong>Ressourcen</strong> (Auf die Darstellung <strong>der</strong> sozialen Kennwerte, die <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Faktorenanalysesozialer Kennwerte identisch s<strong>in</strong>d, wurden aus Gründen <strong>der</strong> Übersicht verzichtet.)Folgende Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden:• Die personalen <strong>Ressourcen</strong> fallen nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Dimension, die von allen an<strong>der</strong>ensozialen <strong>Ressourcen</strong> zu unterscheiden wäre. Die theoretische Trennung vonpersonalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> kann hier also nicht bestätigt werden.• Es entsteht e<strong>in</strong>e neue Dimension, die von den Variablen gebildet wird, die dieÜberzeugung von <strong>der</strong> Selbstwirksamkeit <strong>und</strong> Proaktivität des eigenen Handelnsbe<strong>in</strong>halten.• Transpersonales Vertrauen als personale Ressource fügt sich erwartungsgemäß<strong>in</strong> die Dimension des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s e<strong>in</strong>. Dies verdeutlicht erneut, dasssoziale <strong>und</strong> personale <strong>Ressourcen</strong>, v.a. <strong>in</strong> diesem Bereich, nicht zu trennen s<strong>in</strong>d.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 171Bezüglich des Zusammenhangs von sozialen <strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong> zeigen dievorliegenden Daten, dass e<strong>in</strong>e Trennung bei<strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong>gruppen nicht bestätigtwerden kann. Vielmehr hängen e<strong>in</strong>ige personale <strong>Ressourcen</strong> ansche<strong>in</strong>end eng <strong>mit</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> zusammen, während an<strong>der</strong>e personale <strong>Ressourcen</strong> sich vonsozialen Kennwerten <strong>und</strong> Dimensionen abgrenzen lassen. Die Konzeption sozialer<strong>und</strong> personaler <strong>Ressourcen</strong>, die e<strong>in</strong>e Unterteilung e<strong>in</strong>es personalen Innenraumes<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es sozialen Außenraumes nahe legt, sche<strong>in</strong>t nicht hilfreich zu se<strong>in</strong>. Bereits <strong>in</strong><strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> sozialen Kennwerte untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> war diesbezüglich deutlichgeworden, dass das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> (welches sich aus sozialen Kennwertenformt) bereits e<strong>in</strong> Abbild des sozialen Netzes im Innenraum e<strong>in</strong>er Person darstellt.Zusammenfassung <strong>der</strong> wichtigsten Ergebnisse zur Modifikation des Konzepts <strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong>:Zur Dimensionsbildung:• Es entstehen fünf Dimensionen, von denen zwei salutogenetische Konzeptehervorgehoben <strong>und</strong> unter die Gruppe „<strong>Ressourcen</strong>“ gefasst werden können: zume<strong>in</strong>en Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> (Bedeutung: E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die äußere sozialeUmwelt) <strong>und</strong> zum an<strong>der</strong>en Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> (Bedeutung: InnereRepräsentation <strong>der</strong> äußeren E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die Welt). Drei weitere Dimensionenordnen sich e<strong>in</strong>em pathogenetischen Blickw<strong>in</strong>kel unter, <strong>der</strong> <strong>mit</strong> dem Begriff„Vulnerabilität“ überschrieben werden kann. Zu ihnen zählen Störungen imsozialen Netz (Bedeutung: Das nahe soziale Netz wird als problematisch <strong>und</strong>verän<strong>der</strong>ungsbedürftig empf<strong>und</strong>en.), Verän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialenNetzes (Bedeutung: Das nahe soziale Netz reagiert stark, <strong>und</strong> v.a. hemmend, aufVerän<strong>der</strong>ungswünsche.) sowie Unterstützungsbedarf (Bedeutung: Zur Lösungvon Problemen wird externe Unterstützung benötigt.).• Es entsteht e<strong>in</strong>e Dimension Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, die e<strong>in</strong> qualitativ neuesKonzept <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> darzustellen sche<strong>in</strong>t. Sie be<strong>in</strong>haltete<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendes Gefühl des s<strong>in</strong>nvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt <strong>und</strong> desVertrauens <strong>in</strong> die sozialen Beziehungen.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 172• Anhand <strong>der</strong> beiden <strong>Ressourcen</strong>-Dimensionen Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong>Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> zeigt sich erneut, dass die objektive, äußere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netz <strong>und</strong> das subjektive, <strong>in</strong>nere Abbild davon im Erfahrungsraum<strong>der</strong> Person <strong>in</strong> zwei unterschiedliche Dimensionen fallen.• Die Komponenten sozialer Unterstützung bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Dimension; siestellen also ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong>haltlich unterschiedlichen Konzepte dar.• Die Arten von Überzeugungen zu sozialer Unterstützung fallen zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> zweiunterschiedliche Dimensionen, wobei vor allem <strong>der</strong> Unterstützungsbedarf e<strong>in</strong><strong>in</strong>haltlich abgeschlossenes Konzept zu se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t. WahrgenommeneUnterstützung <strong>und</strong> Suche nach Unterstützung jedoch sche<strong>in</strong>en <strong>in</strong>haltlich starkverwandt zu se<strong>in</strong> <strong>und</strong> laden entsprechend <strong>in</strong> direkter Nachbarschaft auf e<strong>in</strong>erDimension.• Beim Vergleich <strong>der</strong> Kennwerte Netzgröße <strong>und</strong> Netzstärke zeigt sich, dass zume<strong>in</strong>en die subjektive Zufriedenheit <strong>mit</strong> dem sozialen Netzwerk wesentlich mehrVarianzaufklärung leistet als die objektive Größe des Netzes. Zum an<strong>der</strong>en wirddeutlich, dass nicht das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es großen sozialen Netzes alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>eRessource darstellt; zur Ressource werden die sozialen Beziehungen dadurch,dass die befragte Person sie als hilfreich o<strong>der</strong> zufrieden stellend e<strong>in</strong>stuft.Zur Bedeutung <strong>der</strong> gebildeten Maße:• Die Dimensionen Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong> Störungen im sozialen Netz zeigenVerb<strong>in</strong>dungen zu den Outcome-Variablen.• Das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> zeigt die höchsten Bezüge zu den Outcome-Variablenvon allen untersuchten sozialen <strong>Ressourcen</strong>.• Die Dimensionen Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, Verän<strong>der</strong>ungssensitivität dessozialen Netzes <strong>und</strong> Unterstützungsbedarf zeigen ke<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dungen zu denOutcome-Variablen.
Kapitel 9 – Ergebnisdarstellung 173Zu Persönlichkeitskonstrukten <strong>und</strong> sozialen Dimensionen:• Es kann nicht bestätigt werden, dass personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> ohneZusammenhang s<strong>in</strong>d.• Vom Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> sowie von <strong>der</strong> Fatalistisch bed<strong>in</strong>gten Externalitätgehen die meisten signifikanten Beziehungen aus.• Faktorenanalytisch fallen die personalen <strong>Ressourcen</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Faktor, <strong>der</strong>von allen an<strong>der</strong>en sozialen <strong>Ressourcen</strong> zu unterscheiden wäre. Die theoretischeTrennung von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> kann hier also nicht bestätigtwerden.• Bei <strong>der</strong> Faktorenbildung entsteht e<strong>in</strong> neuer Faktor, <strong>der</strong> von den Variablen gebildetwird, die die Überzeugung von <strong>der</strong> Selbstwirksamkeit <strong>und</strong> Proaktivität deseigenen Handelns be<strong>in</strong>halten.• Transpersonales Vertrauen als personale Ressource fügt sich dabeierwartungsgemäß <strong>in</strong> die Dimension des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s e<strong>in</strong>. Diesverdeutlicht erneut, dass soziale <strong>und</strong> personale <strong>Ressourcen</strong>, v.a. <strong>in</strong> diesemBereich, nicht zu trennen s<strong>in</strong>d.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 17410. Diskussion <strong>und</strong> Fazit10.1. Modifikation des theoretischen Konzepts von sozialen <strong>Ressourcen</strong>Wohlbef<strong>in</strong>denssteigernde Wirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>Bedeutung <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung von sozialen<strong>Ressourcen</strong>Subjektive Wahrnehmung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>Grenzauflösung zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum <strong>und</strong> das Entstehenvon Innerem Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Grenzen des <strong>Ressourcen</strong>-ModellsModellbildung über verschiedene Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong>: Modell <strong>der</strong>Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren aus dem sozialen Raum10.2. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Heterogenität des gesellschaftlichen Feldes um <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Allgeme<strong>in</strong>e Wirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Wirkungsvolle Maße sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Bedeutung des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong><strong>Tod</strong>10.3. FazitZwei Betrachtungsw<strong>in</strong>kel auf soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong><strong>Tod</strong> ziehen sich durch die vorliegende Arbeit: die Modifikation des Konzepts sozialer<strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> die Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>.Entsprechend werden im Folgenden die Ergebnisse <strong>der</strong> Datenauswertung <strong>in</strong>Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> den vorgestellten, theoretischen Ansätzen zuerst im H<strong>in</strong>blick auf dieModifikation des theoretischen Konzepts von sozialen <strong>Ressourcen</strong> diskutiert. DieLeitfrage lautet hier: Lassen sich Anhaltspunkte für e<strong>in</strong>e Modifikation des Konzepts<strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> im vorhandenen Datensatz f<strong>in</strong>den?Daran schließen sich Schlussfolgerungen aus den Daten bezüglich <strong>der</strong> Bedeutung<strong>und</strong> Wirkungsweise von sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>an. Denn die gr<strong>und</strong>legende Fragestellung dieser Arbeit ist diesbezüglich: WelcheBedeutung haben soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>?E<strong>in</strong> Fazit wird die Arbeit abschließen.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 17510.1. Modifikation des theoretischen Konzepts von sozialen<strong>Ressourcen</strong>Im theoretischen Teil <strong>der</strong> Arbeit war deutlich geworden, dass die gängigenKonzeptionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> E<strong>in</strong>schränkungen unterliegen (Kapitel 3.2. – Kritikan den Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong>) <strong>und</strong> dass die Trennung vonsozialen <strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong> ebenfalls nicht unzweifelhaft ist (Kapitel 3.2. –Interaktion von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>). Daher wurde im zweiten Teil<strong>der</strong> Datenanalyse das Konzept <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> den Mittelpunkt gestellt(Kapitel 9.2. – Analyse <strong>der</strong> Konzepts <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>). Die Ergebnissedieser Analysen werden im Folgenden <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> den theoretischenGr<strong>und</strong>lagen diskutiert: Zunächst steht die Auswirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong> aufWohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung im Mittelpunkt. Danach wird die Bedeutung <strong>der</strong>multidimensionalen Operationalisierung von sozialen <strong>Ressourcen</strong> diskutiert, bevorauf den subjektiven Charakter <strong>der</strong> Wahrnehmung von <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> dieGrenzauflösung zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum bei sozialen <strong>Ressourcen</strong>e<strong>in</strong>gegangen wird. Auf diese E<strong>in</strong>zelaspekte aufbauend wird nach <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong>Grenzen des <strong>Ressourcen</strong>-Ansatzes e<strong>in</strong> Strukturierungsvorschlag für soziale<strong>Ressourcen</strong> über die bestehenden theoretischen Konzepte h<strong>in</strong>weg vorgelegt. Er bautauf e<strong>in</strong>er erweiterten Konzeption auf, die das <strong>Ressourcen</strong>-Modell durch Schutz- <strong>und</strong>Risiko-Faktoren ergänzt.Wohlbef<strong>in</strong>denssteigernde Wirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>E<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong> vorliegenden Def<strong>in</strong>itionen zum <strong>Ressourcen</strong>begriff bestimmt<strong>Ressourcen</strong> als Kräfte, die Menschen <strong>in</strong> Krisensituationen dazu verhelfen, dieseerfolgreich zu bewältigen (vgl. Kapitel 2.2. – <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise): z.B.„<strong>Ressourcen</strong>: <strong>in</strong>neres <strong>und</strong> äußeres Potential e<strong>in</strong>es Subjekts, das es ihm ermöglicht,angestrebte Ziele zu erreichen.“ (Huecker, 2005)„Als <strong>Ressourcen</strong> werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitspsychologie solche Faktoren bezeichnet, diegeeignet s<strong>in</strong>d, die psychische, physische <strong>und</strong> soziale Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>es Menschen zu
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 176för<strong>der</strong>n, vor allem bei e<strong>in</strong>er Gefährdung <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heit durch Belastungen <strong>und</strong>Krankheit.“ (Weber, 2002, 466)Bei Def<strong>in</strong>itionen dieser Art bleibt allerd<strong>in</strong>gs unklar, auf welche Weise diese nichtnäher def<strong>in</strong>ierten Kräfte wirken: Wirken sich <strong>Ressourcen</strong> auf die Wahrnehmung e<strong>in</strong>erPerson bezüglich <strong>der</strong> Belastung bzw. Bedrohung durch e<strong>in</strong>e Krise aus o<strong>der</strong> auf dieWahrnehmung des eigenen Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>und</strong> <strong>der</strong> eigenen Stärke <strong>in</strong> <strong>der</strong>Krisensituation? Stellen sie bestimmte Handlungsmöglichkeiten e<strong>in</strong>er Person dar, die<strong>in</strong> Krisensituationen oft effektiv s<strong>in</strong>d (z.B. „Wenn ich Hilfe brauche, kann ich darumbitten.“; Item aus BSSS, Schwarzer & Schulz, 2000)? S<strong>in</strong>d sie wirksam, <strong>in</strong>dem siepositive Selbstüberzeugungen im S<strong>in</strong>ne personaler Konstrukte (Kelly, 1986)darstellen?Beim Großteil <strong>der</strong> Def<strong>in</strong>itionen des <strong>Ressourcen</strong>begriffs bleibt unklar, worauf dieKräfte <strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>wirken, um e<strong>in</strong>e erhöhte Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>der</strong>erfolgreichen Krisenbewältigung zu erzielen. Ähnlich äußert sich dazu, wie bereitszitiert, Lepp<strong>in</strong> (1997):„Personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> spielen e<strong>in</strong>e komplexe Rolle im Prozess desUmgangs <strong>mit</strong> Belastungen, die bis heute nur unzureichend erforscht ist <strong>und</strong> sicherlichverstärkter Aufmerksamkeit bedarf.“ (Lepp<strong>in</strong>, 1997, 205)Die vorliegende Datenanalyse vermag nähere H<strong>in</strong>weise darauf zu geben, <strong>in</strong> welcherWeise sich <strong>Ressourcen</strong> auf Indices von Wohlbef<strong>in</strong>den, von allgeme<strong>in</strong>er <strong>und</strong> vonberufsspezifischer Beanspruchung auswirken. Die Ergebnisdarstellung macht hierdeutlich, dass die erhobenen sozialen <strong>Ressourcen</strong> höhere Bezüge zum Wohlbef<strong>in</strong>dene<strong>in</strong>er Person aufweisen als zu den Beanspruchungs<strong>in</strong>dices. Die sozialen<strong>Ressourcen</strong> dienen folglich weniger dazu, die belastenden Aspekte e<strong>in</strong>er Lebenso<strong>der</strong>Arbeitssituation zu verr<strong>in</strong>gern, son<strong>der</strong>n sie dienen vielmehr dazu, das subjektiveWohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gegebenen, äußeren Situation zu erhöhen.Dies deutet darauf h<strong>in</strong>, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> sich weniger auf die Krisensituation<strong>und</strong> ihre Bewältigung direkt auswirken, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e modifizierende Funktion überdie Stabilisierung bzw. Erhöhung des Wohlbef<strong>in</strong>dens e<strong>in</strong>nehmen.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 177Bedeutung <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung von sozialen<strong>Ressourcen</strong>Bei <strong>der</strong> theoretisch f<strong>und</strong>ierten Betrachtung <strong>der</strong> Konzeptualisierung sozialer<strong>Ressourcen</strong> zeigte sich, dass ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> gängigen Theorien zu sozialen Beziehungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, die komplexen Verflechtungen zwischen e<strong>in</strong>em Menschen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>ersozialen Umgebung <strong>in</strong> ausreichendem Maße abzubilden (Kapitel 3.2. – Grenzen <strong>der</strong>gängigen Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>). Wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Konzeptualisierunge<strong>in</strong> Blickw<strong>in</strong>kel auf soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> gestellt (z.B. <strong>der</strong> Aspekt<strong>der</strong> sozialen Unterstützung), so werden die Betrachtungsaspekte an<strong>der</strong>erKonzeptualisierungen vernachlässigt (z.B. das Vorhandense<strong>in</strong> bedeutsamer sozialerBeziehungen als Ressource). Die Mechanismen, durch die soziale <strong>Ressourcen</strong>wirksam werden, erweisen sich jedoch als sehr komplex <strong>und</strong> erfor<strong>der</strong>n daher e<strong>in</strong>esimultane Betrachtung unterschiedlicher Perspektiven.Die Betonung <strong>der</strong> Komplexität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mensch-Umwelt-Interaktion ist auch denPerson-Kontext-Interaktionstheorien zu eigen (Kapitel 3.3. – Exkurs), die daraus diebereits vorgestellten wissenschaftstheoretischen For<strong>der</strong>ungen ableiten. E<strong>in</strong>e davon,die Verwendung e<strong>in</strong>es ‚Multi Variable Based Design’, wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorliegendenStudie im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es ‚Multi-Trait-Multi-Method-Approach’ umgesetzt:„Because the <strong>in</strong>dividual and his or her environment at the highest level of generalizationand analysis function as a total, <strong>in</strong>separable, organized system, the appropriatetheoretical and empirical analysis at that level should <strong>in</strong>clude analyses <strong>in</strong> terms ofpatterns of personal and environmental variables, assessed simultaneously.“ (Magnusson& Statt<strong>in</strong>, 1998, 737)Die Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung, <strong>in</strong> <strong>der</strong> sowohl personen- als auchumweltbezogene Variablen erhoben wurden <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> außerdem das Konzeptsozialer <strong>Ressourcen</strong> durch 16 verschiedene Variablen operationalisiert wurde,stützen diese theoriegeleiteten Argumente. In <strong>der</strong> Datenanalyse werden durch dieAnalyse <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung e<strong>in</strong>ige Schlussfolgerungen überden Charakter <strong>und</strong> die Modelle sozialer <strong>Ressourcen</strong> möglich:• Die Komponenten sozialer Unterstützung erweisen sich faktorenanalytisch alsnicht unterscheidbare Konzepte, da sie auf e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Faktor laden.Die theoretische Unterscheidung <strong>in</strong> Instrumentelle, Informationale, Emotionale,
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 178Motivationale <strong>und</strong> Gegebene Unterstützung als latentem Konstrukt br<strong>in</strong>gt folglichke<strong>in</strong>e Erkenntnisse.• Die Arten von Überzeugungen zu sozialer Unterstützung fallen zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> zweiunterschiedliche Dimensionen, wobei vor allem <strong>der</strong> Unterstützungsbedarf e<strong>in</strong><strong>in</strong>haltlich abgeschlossenes Konzept zu se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t. WahrgenommeneUnterstützung <strong>und</strong> Suche nach Unterstützung jedoch s<strong>in</strong>d vermutlich <strong>in</strong>haltlichstark verwandt <strong>und</strong> bef<strong>in</strong>den sich entsprechend <strong>in</strong> direkter Nachbarschaft aufe<strong>in</strong>er Dimension.• Es entsteht e<strong>in</strong> Faktor Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, <strong>der</strong> e<strong>in</strong> qualitativ neues Konzept<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> darstellt. Er be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendesGefühl des s<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt.Alle<strong>in</strong> diese ausgewählten Schlussfolgerungen aus den faktorenanalytischenBetrachtungen <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong> zeigen, dass multidimensionaleOperationalisierungen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es ‚Multi-Trait-Multi-Method-Approach’ im Bereichsozialer <strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>nvoll ersche<strong>in</strong>en, da die e<strong>in</strong>zelnen, bestehenden Konzepte<strong>und</strong> Operationalisierungen <strong>in</strong> sich nicht ausgereift s<strong>in</strong>d, bzw. das Phänomen <strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> nicht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Gänze abdecken können.Subjektive Wahrnehmung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>In <strong>der</strong> theoriegeleiteten Analyse <strong>der</strong> Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> (Kapitel 3.1. –Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychologie) wurde deutlich, dassdie gängigen Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> sich entwe<strong>der</strong> auf das objektiveVorhandense<strong>in</strong> sozialer Beziehungen als Indikator (z.B. Netzwerktheorien) stützeno<strong>der</strong> auf subjektive Überzeugungen bezüglich sozialer <strong>Ressourcen</strong> (z.B. ‚SupportSchemes’ <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>n Unterstützung). Es werden also wahlweise objektive o<strong>der</strong>subjektive Indikatoren verwendet, um soziale <strong>Ressourcen</strong> zu operationalisieren.Die Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Datenanalyse, welche ebenfalls sowohl objektiveals auch subjektive Indikatoren sozialer <strong>Ressourcen</strong> be<strong>in</strong>haltet, zeigen, dass
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 179subjektive Parameter (z.B. Netzstärke, <strong>Soziale</strong> Resonanz, Wahrgenommene <strong>Soziale</strong>Unterstützung) stärkere Verb<strong>in</strong>dungen zu an<strong>der</strong>en Variablen e<strong>in</strong>er Person (z.B.Wohlbef<strong>in</strong>den, Beanspruchung) zeigen. So zeigt sich beispielsweise an denKennwerten Netzgröße <strong>und</strong> Netzstärke, dass die äußere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> sozialesNetz <strong>und</strong> das <strong>in</strong>nere Abbild davon im Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person faktorenanalytisch<strong>in</strong> zwei unterschiedliche Faktoren fallen, <strong>und</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en. Zudem wird beimVergleich des E<strong>in</strong>flusses bei<strong>der</strong> Größen auf Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchungdeutlich, dass die subjektive Zufriedenheit <strong>mit</strong> dem sozialen Netzwerk wesentlichmehr Varianzaufklärung leistet als die objektive Größe des Netzes. E<strong>in</strong> ähnlichesVerhalten lässt sich für e<strong>in</strong>ige an<strong>der</strong>e objektive bzw. subjektive Kennwerte sozialer<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datenanalyse nachweisen. So zeigt sich beispielsweise auchanhand <strong>der</strong> beiden <strong>Ressourcen</strong>-Dimensionen Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong> InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, dass die objektive, äußere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netz <strong>und</strong> dassubjektive, <strong>in</strong>nere Abbild davon im Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person zwei unterschiedlicheDimensionen bilden.Diese Ergebnisse lassen den allgeme<strong>in</strong>en Schluss zu, dass nicht das objektiveVorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er sozialen Gegebenheit alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ressource darstellt. Zu e<strong>in</strong>erRessource werden die sozialen Beziehungen dadurch, dass die befragte Person sieals positiv, hilfreich, zufrieden stellend o<strong>der</strong> kraftgebend wahrnimmt (vgl. Pruchno &Rosenbaum, 2003, 491). Es muss folglich zwischen objektivem Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ersozialen Gegebenheit (im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>iger klassischer Konzeptualisierungen sozialer<strong>Ressourcen</strong>) <strong>und</strong> ihrer Wahrnehmung im <strong>in</strong>neren Erfahrungsraum <strong>der</strong> Personunterschieden werden, da es sich dabei offensichtlich um unterschiedlicheKonstrukte handelt (vgl. dazu auch Schwarzer & Lepp<strong>in</strong>, 1992, 443). Von den beidenKonstrukten gibt dabei die subjektive Wahrnehmung e<strong>in</strong>er Person von ihrer äußerensozialen Welt die aussagekräftigeren H<strong>in</strong>weise auf die ressourcenhafte Verwendbarkeitsozialer Gegebenheiten.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 180Grenzauflösung zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum <strong>und</strong> das Entstehenvon Innerem Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Im letzten Teil <strong>der</strong> Datenanalyse zur Konzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong> (Kapitel9.2. - Zusammenhang <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>und</strong> Dimensionen <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> <strong>mit</strong> Persönlichkeitsmaßen) wurden die Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong><strong>und</strong> die aus ihnen geformten Dimensionen <strong>mit</strong> ausgewählten Kennwerten personaler<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Beziehung gesetzt. Ziel dieses Vorgehens war die Überprüfung <strong>der</strong>theoretischen Trennung von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> (Kapitel 2.2. –<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise) im vorliegenden Datenmaterial.Die theoretischen Konstrukte des Systemtheoretischen Modells (Bronfenbrenner,1981, 1995a, 1995b), des Life Course Paradigms (El<strong>der</strong>, 1995, 1998a) <strong>und</strong> <strong>der</strong>Person-Kontext-Interaktionstheorien (Magnusson, 2003; Magnusson & Statt<strong>in</strong>, 1998)weisen bereits kontext- <strong>und</strong> theorienübergreifend darauf h<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong> Individuum nurs<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> <strong>der</strong> ihn umgebenden Welt <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Geschichte gesehenwerden kann (Kapitel 3.3. – Modelle für die <strong>in</strong>tegrative <strong>und</strong> <strong>in</strong>teraktionaleKonzeptualisierung sozialer <strong>Ressourcen</strong>). Belschner (2005a, 2005b) kommt zu demSchluss, dass <strong>der</strong> Mensch <strong>und</strong> die ihn umgebende Mitwelt e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit darstellen,welche nur durch die Alltagswahrnehmung <strong>in</strong> die sche<strong>in</strong>bare Dualität zwischenSubjekt <strong>und</strong> Objekt aufgespalten werde (Kapitel 3.3. – <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> aus<strong>in</strong>tegrativer Sicht). Diese Argumentationen geben H<strong>in</strong>weis darauf, dass die Grenzezwischen Mensch <strong>und</strong> Welt e<strong>in</strong>e durchlässige ist <strong>und</strong> folglich soziale <strong>Ressourcen</strong>auch im B<strong>in</strong>nenraum des Menschen anzutreffen se<strong>in</strong> müssten. Koestler (1967)beschreibt <strong>in</strong> diesem theoretischen Rahmen sehr e<strong>in</strong>drücklich die Gleichzeitigkeit vonAbgegrenztheit <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit:„No man is an island – he is (…) a Janus-faced entity who, look<strong>in</strong>g <strong>in</strong>ward sees himselfas a self-conta<strong>in</strong>ed unique whole, look<strong>in</strong>g outward as a dependent part.“ (zit. n. S<strong>in</strong>gelis,1994, 588)Die Überprüfung <strong>der</strong> theoretischen Trennung von personalen <strong>und</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> im vorliegenden Datenmaterial zeigte die folgenden Ergebnisse:• Es bestehen korrelative <strong>und</strong> varianzanalytische Bezüge zwischen sozialen <strong>und</strong>personalen <strong>Ressourcen</strong>.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 181• Faktorenanalytisch fallen die personalen <strong>Ressourcen</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Faktor, <strong>der</strong>von allen an<strong>der</strong>en sozialen <strong>Ressourcen</strong> zu unterscheiden wäre. Die theoretischeTrennung von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> kann hier also nicht bestätigtwerden. Bei <strong>der</strong> Faktorenbildung entsteht zudem e<strong>in</strong> neuer Faktor, <strong>der</strong> von denVariablen gebildet wird, die die Überzeugung <strong>der</strong> Selbstwirksamkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong>Proaktivität des eigenen Handelns be<strong>in</strong>halten.• In <strong>der</strong> faktorenanalytischen Betrachtung <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>entsteht die Dimension Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, die e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendes Gefühl dess<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt be<strong>in</strong>haltet. DieseDimension hat def<strong>in</strong>itorisch gesehen den Charakter e<strong>in</strong>er personalen Ressource,da sie Kennwerte umfasst, die allesamt im <strong>in</strong>neren Erfahrungsraum <strong>der</strong> Personangesiedelt s<strong>in</strong>d (<strong>Soziale</strong> Resonanz, Zufriedenheit <strong>mit</strong> engen Beziehungen,Wahrgenommene Unterstützung, Suche nach Unterstützung).Während also die theoretische Modellbildung (entstanden aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Trennung <strong>der</strong>Forschungsgebiete <strong>der</strong> Sozial- <strong>und</strong> Persönlichkeitspsychologie; vgl. Horlacher, 2000,464) e<strong>in</strong>e dichotomisierende E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> nahelegt (Kapitel 2.2. – <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Krise), zeigen die vorliegenden Ergebnisse e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>es Bild: Die Grenzen zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum erweisen sichals fließend. E<strong>in</strong>e dichotome Unterscheidung hilft hier nicht weiter. Bei sozialen<strong>Ressourcen</strong> geht es gleichermaßen um die objektive soziale Welt, die e<strong>in</strong>e Personumgibt, als auch um <strong>der</strong>en <strong>in</strong>neres Abbild im Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person (sieheoben). Personale <strong>und</strong> soziale <strong>Ressourcen</strong> lassen sich daher statistisch nichtausreichend vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> trennen. Die dichotome E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> personale <strong>und</strong> soziale<strong>Ressourcen</strong> ist so<strong>mit</strong> nicht aufrecht zu erhalten.Es muss dabei darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden, dass es nicht um e<strong>in</strong>e simultaneErhebung <strong>und</strong> Interaktionsbestimmung zwischen personalen <strong>und</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> geht, wie sie bereits häufig gefor<strong>der</strong>t wird:„Viele Autoren for<strong>der</strong>n zu Recht, dass soziale <strong>und</strong> personale Faktoren simultan zuberücksichtigen seien. Schließlich würden beide Ebenen eng zusammenhängen: Ob <strong>und</strong><strong>in</strong> welcher Art <strong>und</strong> Weise es e<strong>in</strong>er Person gel<strong>in</strong>gt, e<strong>in</strong> unterstützendes soziales Feldaufzubauen, sei ebenso von den Eigenschaften <strong>der</strong> Person abhängig wie auch die Frage,was e<strong>in</strong>e Person für an<strong>der</strong>e zu e<strong>in</strong>er sozial unterstützenden Person macht.“ (Horlacher,2000, 471)
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 182Diese For<strong>der</strong>ung beruht nach wie vor auf <strong>der</strong> Annahme e<strong>in</strong>er unabhängigen Existenzvon personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>. Was die hier vorliegende Untersuchungjedoch zeigt, ist vielmehr e<strong>in</strong>e Auflösung <strong>der</strong> Grenzen zwischen dem personalen <strong>und</strong>dem sozialen Raum: Der gesamte soziale Raum bildet sich subjektiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Personab <strong>und</strong> zeigt sich vor allem <strong>in</strong> diesem <strong>in</strong>neren Abbild als wirksam.An <strong>der</strong> (verme<strong>in</strong>tlichen) Grenze zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum entsteht <strong>in</strong>den Daten e<strong>in</strong>e Dimension <strong>in</strong> den sozialen <strong>Ressourcen</strong>, die genau das Verwobense<strong>in</strong>des Menschen <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt abbildet: das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>. Es bildet sichaus den Kennwerten <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>n Resonanz, des Zufriedenheits<strong>in</strong>dex, <strong>der</strong>Wahrgenommenen Unterstützung sowie <strong>der</strong> Suche nach Unterstützung. Inhaltlichkann es def<strong>in</strong>iert werden als das gr<strong>und</strong>legende Gefühl des s<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong>vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt. Das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> entstehtim <strong>in</strong>neren, subjektiven Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person <strong>und</strong> stellt dort das vertrauensvolle<strong>und</strong> emotional bedeutsame Abbild <strong>der</strong> (sozialen) Umwelt dar. Aus e<strong>in</strong>erlebensgeschichtlichen Perspektive beschreibt auch Keil (2006) e<strong>in</strong>e solchegr<strong>und</strong>legende, <strong>in</strong>nere E<strong>in</strong>stellung, <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> die Welt kommen:„Wenn K<strong>in</strong><strong>der</strong> geboren werden, ist ihnen e<strong>in</strong> Wissen um die großen spirituellenZusammenhänge selbstverständlich. Sie haben im Prozess des eigenen Werdens diePr<strong>in</strong>zipien <strong>der</strong> Schöpfung als Form nachhaltiger Koexistenz erfahren, neun Monate langbed<strong>in</strong>gungsloses Asyl erlebt. Deshalb wissen sie, dass es auch weiterh<strong>in</strong> im Leben umdie Liebe, die Notwendigkeit von Beziehungsaufnahme <strong>und</strong> die Hoffnung auf Zukunftgeht. Voller Vertrauen strecken sie die Hände nach den Menschen aus, die schon das<strong>in</strong>d, um den Traum zu erfüllen. Kle<strong>in</strong>e Menschen klagen die Verwirklichung desTraumes <strong>mit</strong> lautem Gebrüll e<strong>in</strong> <strong>und</strong> belohnen die, die ihn erfüllen, <strong>mit</strong> dem schönstenLächeln <strong>der</strong> Welt.“ (Keil, A., 2006, 12)Das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> zeigt sich zudem eng verwandt zu dem, was Thomae alsdie Reaktionsform des „Sich verlassen auf an<strong>der</strong>e“ bezeichnet (wichtigstesDase<strong>in</strong>sthema <strong>in</strong> <strong>der</strong> Antizipation <strong>der</strong> krankheitsbezogenen Zukunft bei Hochbetagten;Thomae, 1988, 145) <strong>und</strong> für die er die Disposition des Vertrauensgr<strong>und</strong>legt (vgl. auch Erlemeier, 1995, 259). E<strong>in</strong> deutlicher Zusammenhang bestehtauch zum Konzept <strong>der</strong> wahrgenommenen emotionalen Unterstützung, die Sarasonet al. als das Kernstück <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> bezeichnen (Sarason et al., 1990).Die <strong>in</strong> Kapitel 3.1. – Theorien <strong>und</strong> Modelle sozialer <strong>Ressourcen</strong> dargestellteDef<strong>in</strong>ition dieser Unterstützungsart als die „generelle Überzeugung, geliebt <strong>und</strong>geschätzt zu werden <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong> soziales Netzwerk sicher e<strong>in</strong>gebettet zu se<strong>in</strong>“
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 183(Erlemeier, 1995, 253) erweist sich deutlich als e<strong>in</strong> Teil des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s(welches se<strong>in</strong>erseits allerd<strong>in</strong>gs über die wahrgenommene emotionale Unterstützungh<strong>in</strong>ausgeht, da es auch die vertrauensvolle E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> die Welt be<strong>in</strong>haltet).Das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> stellt so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e soziale Ressource zwischen personalem<strong>und</strong> sozialem Raum dar, die über bisherige Konzeptualisierungen h<strong>in</strong>ausgeht <strong>und</strong> diesich zudem als diejenige erweist, die von allen Kennwerten <strong>und</strong> Dimensionensozialer <strong>Ressourcen</strong> die größten Auswirkungen auf Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong>Beanspruchung aufweist.Grenzen des <strong>Ressourcen</strong>-ModellsIn <strong>der</strong> Datenanalyse werden faktorenanalytisch fünf def<strong>in</strong>itorisch vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong>abgrenzbare Dimensionen sichtbar, von denen zwei salutogenetischer <strong>und</strong> dreipathogenetischer Natur s<strong>in</strong>d (Kapitel 9.2. – Dimensionsbildung <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>zelkennwertensozialer <strong>Ressourcen</strong>). Dies gibt e<strong>in</strong>en deutlichen H<strong>in</strong>weis darauf, dasssoziale Beziehungen nicht immer ausschließlich entlastend wirken (<strong>und</strong> so das<strong>Ressourcen</strong>modell nicht als vollständiges, unabhängiges Konzept stehen kann). DieDaten zeigen deutlich die Janusköpfigkeit aller sozialen Gegebenheiten: D.h. sozialeBeziehungen können sowohl be- als auch entlastend wirken; Netzwerke könnenhilfreich <strong>und</strong> belastend se<strong>in</strong>; Unterstütztwerden kann unterschiedlichen Bewertungenunterliegen. Schmidt-Denter unterstreicht dies:„Daneben gibt es jedoch auch zunehmend wissenschaftliche Publikationen, die dieKehrseite <strong>der</strong> Medaille beleuchten. Der soziale Kontext kann auch Stress, Risiken <strong>und</strong>Gefährdungen für das Individuum <strong>mit</strong> sich br<strong>in</strong>gen. <strong>Soziale</strong> Beziehungen erweisen sichals von so f<strong>und</strong>amentaler Bedeutsamkeit, dass sie sowohl Ges<strong>und</strong>heit als auchPathologie för<strong>der</strong>n können.“ (Schmidt-Denter, 2005, 257)So können Gegebenheiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> externen, sozialen Welt nicht per se alsressourcenhaft konzeptualisiert werden (vgl. dazu auch Keil, A., 2004; Pruchno &Rosenbaum, 2003, 490). Das Konzept sozialer <strong>Ressourcen</strong> an sich ist da<strong>mit</strong>vielmehr e<strong>in</strong> abhängiger Teil e<strong>in</strong>es größeren Konzepts, welches den äußeren <strong>und</strong><strong>in</strong>neren sozialen Raum <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Schutz- <strong>und</strong> Risikofunktion umfasst.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 184Unter dem Blickw<strong>in</strong>kel, dass Leben im Allgeme<strong>in</strong>en durch Prozesse von Bewegung,Austausch <strong>und</strong> Zusammenwirken bestimmt wird, vertritt auch Keil (2004) diesenStandpunkt:„Wenn Wirkungen auf e<strong>in</strong>e Umgebung ausgelöst werden, bewirken sie <strong>in</strong>nere Antworten,die entwe<strong>der</strong> Wachstum auslösen o<strong>der</strong> als Risiken Entwicklung stören o<strong>der</strong> unterb<strong>in</strong>den.Der kräftige Schlag auf e<strong>in</strong>e Hand kann e<strong>in</strong>e för<strong>der</strong>liche Durchblutung auslösen o<strong>der</strong>e<strong>in</strong>en schmerzenden Bluterguss erzeugen. E<strong>in</strong>e liebende Umarmung kann e<strong>in</strong>enMenschen zum Aufbruch <strong>in</strong> die Freiheit ermutigen <strong>und</strong> ihm Schutz andeuten, sie kann ihnaber auch zurückhalten <strong>und</strong> fesseln.“ (Keil, A., 2004, 98)Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> vorliegenden Daten <strong>und</strong> <strong>der</strong> theoriegeleiteten Argumentation lässt sichfolglich die weiterführende Hypothese aufstellen, dass es s<strong>in</strong>nvoll sei, sozialeBeziehungen nicht bezüglich ihres <strong>Ressourcen</strong>charakters zu betrachten, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em Konzept von Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren.Modellbildung über verschiedene Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> – Modell <strong>der</strong>Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren aus dem sozialen RaumAus <strong>der</strong> bisherigen Diskussion <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse <strong>und</strong> theoretischenKonzepte lassen sich folgende Aussagen festhalten:• <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> wirken sich weniger auf die Reduktion belasten<strong>der</strong> Aspektee<strong>in</strong>er Lebenssituation aus, son<strong>der</strong>n vielmehr auf die Erhöhung des Wohlbef<strong>in</strong>dens,d.h. <strong>der</strong> psychischen Stabilität e<strong>in</strong>er Person <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> äußeren,belasteten Lebenssituation. (Vgl. Kapitel 10.1. – Wohlbef<strong>in</strong>denssteigerndeWirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>)• Ke<strong>in</strong> spezifisches Konzept sozialer <strong>Ressourcen</strong> ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage, die Komplexität<strong>der</strong> Mensch-Umwelt-Verflechtung <strong>in</strong> diesem Bereich abzudecken. Es erweisensich verschiedene Kennwerte aus unterschiedlichen Konzeptualisierungen alsbedeutsam. Daher sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e theorienübergreifende Modellbildung s<strong>in</strong>nvoll.(Vgl. Kapitel 10.1. – Bedeutung <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung vonsozialen <strong>Ressourcen</strong>)
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 185• Neben <strong>der</strong> objektiven, sozialen Welt e<strong>in</strong>er Person ist ihre subjektive Wahrnehmung<strong>der</strong> äußeren Welt von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung. Die subjektiveWahrnehmung im <strong>in</strong>neren Erfahrungsraum zeigt engere Verb<strong>in</strong>dungen zumBef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> Person als <strong>der</strong>en objektive Lebensrealität <strong>und</strong> ist daher <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>ementsprechenden Stellenwert zu versehen. (Vgl. Kapitel 10.1. – SubjektiveWahrnehmung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>)• Das Konzept <strong>der</strong> Trennung von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> lässt sichnicht aufrechterhalten. Es zeigt sich, dass sich die gesamte, äußere Realität imB<strong>in</strong>nenraum <strong>der</strong> Person abbildet <strong>und</strong> dort <strong>mit</strong> be- bzw. entlastenden Bewertungenversehen wird. Dabei erweist sich e<strong>in</strong>e Dimension als bedeutsam, die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong>Faktorenanalyse bildet: Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legendes Gefühl dess<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt. Diese bedeutsameVariable ist bisher <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Konzept sozialer <strong>Ressourcen</strong> zu f<strong>in</strong>den. (Vgl. Kapitel10.1. – Grenzauflösung zwischen personalem <strong>und</strong> sozialem Raum <strong>und</strong> dasEntstehen von Innerem Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>)• Ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> untersuchten, sozialen Gegebenheiten wirkt ausschließlich alsRessource. Jedes Merkmal <strong>der</strong> sozialen Welt kann sowohl stärkende als auchbelastende Auswirkungen auf die Person haben (welche <strong>in</strong> komplexer Interaktionzwischen <strong>in</strong>tra- <strong>und</strong> <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>dividuellen Prozessen über die Lebensspanne h<strong>in</strong>wegzustande kommen). Daher ist es präziser, von Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren zusprechen, die im Kontakt <strong>mit</strong> dem sozialen Raum erwachsen, als e<strong>in</strong>en re<strong>in</strong>ressourcenhaften Charakter sozialer Gegebenheiten anzunehmen. (Vgl. Kapitel10.1. – Grenzen des <strong>Ressourcen</strong>-Modells)Integriert man den Stand theoretischer Modellbildung zu sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong>diese Ergebnisse <strong>der</strong> hier vorliegenden Untersuchung, so kann folgendes Modellsozialer <strong>Ressourcen</strong> gebildet werden, das alle aufgeführten Aussagen <strong>mit</strong> dem Stand<strong>der</strong> Theorie s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong>tegriert:
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 186MODELL DER RISIKO- UND SCHUTZFAKTOREN AUS DEM SOZIALEN RAUMINTERPERSONELLER RAUMINTRAPERSONALER ERFAHRUNGSRAUMsubjektives Gefühl desVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Weltsubjektive E<strong>in</strong>ordnungbedeutsamer BeziehungenVorhandense<strong>in</strong> bedeutsamerBeziehungensubjektiv empf<strong>und</strong>ene Stärke dessozialen Netzesobjektiv gegebenes sozialesNetzsubjektive Wahrnehmung <strong>der</strong>sozialen Unterstützungobjektiv erhaltene sozialeUnterstützungAbbildung 46: Modell <strong>der</strong> Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktoren aus dem sozialen RaumDie gängigen Konzepte sozialer <strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>d im objektiven Raum <strong>in</strong> denBegriffen „Vorhandense<strong>in</strong> bedeutsamer Beziehungen“ (Kapitel 3.2. – <strong>Soziale</strong>Beziehungen als Ressource), „objektiv gegebenes soziales Netz (Kapitel 3.2. –<strong>Soziale</strong> Netzwerktheorien) sowie „objektiv erhaltene soziale Unterstützung (Kapitel3.2. – Theorien <strong>und</strong> Modelle sozialer Unterstützung) enthalten.E<strong>in</strong>ige Komponenten dieser Modellbildung gehen gemäß den Ergebnissen <strong>der</strong>vorliegenden Untersuchung zum Teil über den momentanen Stand <strong>der</strong> Theorienbildungh<strong>in</strong>aus:• In diese Modellvorstellung s<strong>in</strong>d die verschiedenen Konzeptionen sozialer<strong>Ressourcen</strong> geme<strong>in</strong>sam e<strong>in</strong>bezogen, denn die Datenanalyse zeigt, dassKennwerte aus unterschiedlichen theoretischen Konzepten wirksam s<strong>in</strong>d.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 187• Über das Konzept <strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong> h<strong>in</strong>ausgehend, nimmt dieses Modell dieGr<strong>und</strong>lage von Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren an. Die Daten zeigen, dass bestimmtesoziale Gegebenheiten sich nicht per def<strong>in</strong>itionem als Ressource auswirken,son<strong>der</strong>n, im Gegenteil, auch stark belastend (im Gegensatz zu neutral, d.h. ohne<strong>Ressourcen</strong>funktion) wirken können (z.B. ger<strong>in</strong>ge Netzstärke, ger<strong>in</strong>ger Zufriedenheits<strong>in</strong>dex).E<strong>in</strong> abgeschlossenes Konzept sozialer <strong>Ressourcen</strong> lässt sichdemzufolge nicht mehr aufrechterhalten <strong>und</strong> wird hier durch e<strong>in</strong>e Konzeptionersetzt, die gleichermaßen Schutz- <strong>und</strong> Risikomöglichkeiten aus <strong>in</strong>ter- <strong>und</strong><strong>in</strong>trapersonalen Quellen annimmt.• Die Daten zeigen, dass die subjektiven Abbil<strong>der</strong> äußerer, sozialer Gegebenheitenstarke Auswirkungen haben, oft stärkere Auswirkungen als <strong>der</strong> objektive, sozialeRaum selbst. Diese Tatsache ist <strong>in</strong> den Theorien sozialer <strong>Ressourcen</strong> bislangnicht (o<strong>der</strong> nur am Rande, z.B. <strong>in</strong> den ‚Support Schemes’) enthalten. Es istfolglich zwischen <strong>der</strong> objektiven, <strong>in</strong>terpersonellen sozialen Welt <strong>und</strong> ihrem<strong>in</strong>trapersonalen, subjektiven Abbild im Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person zuunterscheiden. Beide s<strong>in</strong>d unterschiedliche Variablen, die dennoch <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong>Interaktion stehen. Über die Art dieser Interaktion kann auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> hiervorliegenden, querschnittlich erhobenen Daten ke<strong>in</strong>e Aussagen gemacht werden(es ist jedoch zu vermuten, dass sie das Ergebnis lebenslanger Präge- <strong>und</strong>Erfahrungsprozesse sowie e<strong>in</strong>er komplexen Person-Kontext-Interaktion imjeweiligen Moment darstellt, Kapitel 3.3. – Life Course Paradigm nach El<strong>der</strong> sowiePerson-Kontext-Interaktionstheorien).• Im subjektiven Erfahrungsraum <strong>der</strong> Person zeigt e<strong>in</strong>e Dimension die stärkstenAuswirkungen aller Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>: das gr<strong>und</strong>legende Gefühldes s<strong>in</strong>nvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Datenanalyse bezeichnet alsInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>). Da e<strong>in</strong> solches Konzept <strong>in</strong> den vorhandenen Theoriensozialer <strong>Ressourcen</strong> nicht existiert, wird es als neue Variable <strong>in</strong> die dargestellteModellbildung aufgenommen.Dieses Modell könnte als Gr<strong>und</strong>lage für weitergehende Forschung <strong>und</strong> Hypothesenbildungdienen. Es legt e<strong>in</strong>e Basis zur umfassenden Betrachtung sozialer<strong>Ressourcen</strong>, auch wenn die holistische Komponente hier noch vergleichsweiserudimentär formuliert ist; dazu wäre e<strong>in</strong>e wesentlich differenziertere Analyse
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 188notwendig, als aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> vorliegenden Daten geleistet werden kann (vgl.Magnusson, 2003). Als nächster Schritt zur Überprüfung <strong>der</strong> Modellbildung ist e<strong>in</strong>ePfadanalyse angezeigt, um das Zusammenspiel <strong>und</strong> Wirkungsrichtungen zwischenden e<strong>in</strong>zelnen Komponenten zu präzisieren.Die Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung bestätigen, dass <strong>Ressourcen</strong> sichauf Be- <strong>und</strong> Entlastung auswirken, <strong>in</strong>dem sie das Wohlbef<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>es Menschen <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er gegebenen, äußeren Situation steigern.Mit Hilfe <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>können Kennwerte unterschieden werden, die große versus wenig/ke<strong>in</strong>eAuswirkungen auf Beanspruchung, Belastung o<strong>der</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den zeigen. Dabeiunterscheiden sich objektive Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong> von Maßen, die auf diesubjektive E<strong>in</strong>schätzung des/<strong>der</strong> Befragten aufgebaut s<strong>in</strong>d. Dies zeigt zum e<strong>in</strong>en,dass zwischen dem objektiven Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er sozialen Ressource <strong>und</strong> ihrerWahrnehmung im <strong>in</strong>neren Erlebensraum <strong>der</strong> Person unterschieden werden muss, daes sich offensichtlich um unterschiedliche Konstrukte handelt.Zum an<strong>der</strong>en stellt sich dabei heraus, dass die Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>, diee<strong>in</strong>e subjektive E<strong>in</strong>schätzung wie<strong>der</strong>geben, stärkere Zusammenhänge zumWohlbef<strong>in</strong>den aufweisen als objektive Maße. Dies führt zu <strong>der</strong> Schlussfolgerung,dass objektivierende Maße bei sozialen <strong>Ressourcen</strong> weniger hilfreich s<strong>in</strong>d alsOperationalisierungen, die die subjektive Wahrnehmung <strong>der</strong>/des Befragten erfassen.Wird die Interaktion von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> untersucht, so stelltsich überdies heraus, dass die klassische Trennung zwischen ihnen nichtaufrechterhalten werden kann. Die Analysen des Datenmaterials machen hierdeutlich, dass e<strong>in</strong>e Dichotomisierung dem Verständnis sozialer <strong>Ressourcen</strong>abträglich ist, denn sie nährt Bil<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Getrenntheit <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> Unabhängigkeit vonPerson <strong>und</strong> Umwelt, die sich im Datenmaterial nicht abbilden. Am Beispiel <strong>der</strong>sozialen <strong>Ressourcen</strong> zeigt sich sehr deutlich, dass <strong>der</strong> äußere Erlebensraum <strong>und</strong> <strong>der</strong><strong>in</strong>nere Erfahrungsraum kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> übergehen. (Und ist es dennernsthaft s<strong>in</strong>nvoll, sich zu fragen, ob das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e soziale
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 189Ressource ist, da es sich aus Kennwerten sozialer <strong>Ressourcen</strong> zusammensetzt, o<strong>der</strong>e<strong>in</strong>e personale Ressource, da es e<strong>in</strong>e persönliche E<strong>in</strong>stellung im Erfahrungsraum<strong>der</strong> Person beschreibt?)Die untersuchten Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong> lassen sich fünf Dimensionenzuordnen, von denen zwei <strong>Ressourcen</strong>charakter <strong>und</strong> drei den vulnerabilitätsför<strong>der</strong>ndenCharakter von Risikofaktoren besitzen. So<strong>mit</strong> erweisen sich soziale<strong>Ressourcen</strong> als abhängiger Teil e<strong>in</strong>es größeren Konzepts, welches sowohl die<strong>Ressourcen</strong>- aus auch die Vulnerabilitätsfunktion <strong>der</strong> sozialen Welt umfasst. Es istdaher hilfreich, die Annahme e<strong>in</strong>es eigenständigen <strong>Ressourcen</strong>-Konzeptsaufzugeben <strong>und</strong> stattdessen den Schutz <strong>und</strong> das Risiko, welche durch die sozialeWelt entstehen, gleichermaßen zu betrachten.Diese Überlegungen führen zur Bildung e<strong>in</strong>es Modells <strong>der</strong> „Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktorenaus dem sozialen Raum“.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 19010.2. Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Ausgangspunkt <strong>und</strong> Abschluss <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit ist die Betrachtung sozialer<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>. Daher wird sich <strong>der</strong> zweite Teildieses Kapitels <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> diesem Feld beschäftigen.Zunächst wird die stark heterogene, gesellschaftliche Lage <strong>in</strong> diesem Bereichdargestellt. Darauf aufbauend wird dann näher betrachtet, auf welche Weise sichsoziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> auswirken können <strong>und</strong>welche Maße dabei von beson<strong>der</strong>er bzw. zu vernachlässigen<strong>der</strong> Bedeutung s<strong>in</strong>d.Abschließend wird auf die beson<strong>der</strong>e Bedeutung des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s alssoziale Ressource <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> e<strong>in</strong>gegangen.Heterogenität des gesellschaftlichen Feldes um <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>In <strong>der</strong> Darstellung von Studien bei kritisch kranken Menschen, ihren Angehörigen<strong>und</strong> den betreuenden Professionellen (Kapitel 4 – <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>) wurde deutlich, dass die <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em äußerst heterogenen Rahmen stattf<strong>in</strong>det. Die dargestellten Studiens<strong>in</strong>d schlecht vergleichbar, da die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen jeweils sehr unterschiedlichs<strong>in</strong>d (z.B. befragte Personengruppe, äußeres Sett<strong>in</strong>g). Studien, die Daten überverschiedene Kontextbed<strong>in</strong>gungen o<strong>der</strong> Personengruppen h<strong>in</strong>weg erheben, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>diesem Bereich die Ausnahme (z.B. Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003; Ste<strong>in</strong>hauser et al.,2001; Ste<strong>in</strong>hauser et al., 2000).Die große Heterogenität <strong>der</strong> äußeren Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong>er die<strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> stattf<strong>in</strong>det, zeigt sich auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorliegendenStudie. Sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobendarstellung (Kapitel 8 - Stichprobenbeschreibung)als auch im ersten Teil <strong>der</strong> Ergebnisdarstellung (Kapitel 9.1. – Darstellung <strong>der</strong>
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 191sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe sowie Darstellung von Wohlbef<strong>in</strong>dens- <strong>und</strong>Beanspruchungs<strong>in</strong>dices <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stichprobe) wurde deutlich, dass die Personengruppe,<strong>der</strong> die befragte Person angehört, <strong>und</strong> die Institutionsart, <strong>in</strong> <strong>der</strong> die Daten erhobenwurden, großen E<strong>in</strong>fluss auf alle an<strong>der</strong>en Variablen nimmt. Sowohl Personengruppeals auch Institutionsart s<strong>in</strong>d gesellschaftlich geprägte Variablen, die für die großeHeterogenität aller weiteren Ergebnisse verantwortlich s<strong>in</strong>d.Über alle Analysen h<strong>in</strong>weg zeigten sich <strong>in</strong> den Daten dabei folgende E<strong>in</strong>flussrichtungenvon Personengruppe <strong>und</strong> Institutionsart:• Angaben von Professionellen auf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite <strong>und</strong> PatientInnen <strong>und</strong>Angehörigen als Betroffene auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite s<strong>in</strong>d nur <strong>in</strong> sehr ger<strong>in</strong>gemMaße vergleichbar, da das Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> für die Professionellen dastägliche Arbeitsfeld, für die Betroffenen jedoch e<strong>in</strong>e Lebenskrise darstellt. Dochauch <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Personengruppen <strong>der</strong> Professionellen lassen sich unterschiedlicheUntergruppen differenzieren. Ehrenamtlich Tätige unterscheiden sichdabei von den an<strong>der</strong>en Professionellengruppen, da sie die Tätigkeit <strong>mit</strong> kritischKranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den <strong>in</strong> ihrer Freizeit erbr<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> selbst bestimmenkönnen, wie weit <strong>und</strong> wie stark sie <strong>in</strong> das Geschehen <strong>in</strong>volviert werden möchten;sie zeigen daher fast ke<strong>in</strong>e Beanspruchung <strong>und</strong> sehr hohes Wohlbef<strong>in</strong>den.An<strong>der</strong>s stellt sich die Situation für die befragten ÄrztInnen, Pflegenden,Geistlichen <strong>und</strong> Psychosozialen dar, denn für sie ist dieser Umgang täglicherBerufsalltag. In diesen vier Gruppen zeigt sich, dass die Geistlichen <strong>und</strong>Psychosozialen relativ ger<strong>in</strong>ge Beanspruchung <strong>und</strong> hohes Wohlbef<strong>in</strong>denangeben, verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> <strong>der</strong> besten Möglichkeit, auf äußere soziale <strong>Ressourcen</strong>(<strong>in</strong> Form von Supervision, Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung etc.) zuzugreifen. Am stärkstenbeansprucht erweisen sich ÄrztInnen <strong>und</strong> Pflegende, die große Beanspruchungdurch ihre berufliche Tätigkeit, verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> ger<strong>in</strong>gen Möglichkeiten, aufberuflich-fachliche Unterstützung zurückzugreifen, angeben. Da die Tätigkeitsbereiche<strong>und</strong> berufsgruppenspezifische Lage <strong>der</strong> verschiedenen Gruppen vonProfessionellen sich <strong>der</strong>art stark unterscheiden, ist e<strong>in</strong>e Generalisierung vonAussagen über die Gruppen h<strong>in</strong>weg nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt möglich.• E<strong>in</strong> ähnliches Bild zeigt sich bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Institutionsarten. Schrö<strong>der</strong>(2003), <strong>der</strong> die Beanspruchung bei Pflegenden auf Palliativstationen <strong>und</strong> <strong>in</strong>
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 192stationären Hospizen untersucht, trifft ebenfalls auf große Heterogenität <strong>der</strong><strong>in</strong>stitutionellen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Stichprobe <strong>und</strong> stellt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Analyse <strong>der</strong>Ergebnisse die Frage, ob <strong>in</strong>stitutionelle o<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuelle Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>engrößeren Vorhersagewert hätten (Schrö<strong>der</strong>, H. et al., 2003, 62). In <strong>der</strong>vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass Palliativstationen <strong>und</strong> stationäreHospize im Vergleich <strong>mit</strong> allen an<strong>der</strong>en Institutionsarten relativ nahe beie<strong>in</strong>an<strong>der</strong>liegen. Sie stellen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl von Bereichen die Umgebungen dar, <strong>in</strong> denengroßes Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> die ger<strong>in</strong>gste Beanspruchung aller Personengruppenangegeben wird. Im Kontrast dazu bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ische Stationen<strong>und</strong> Altenheime, die auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage dieser Ergebnisse sehr belastendeUmgebungen für PatientInnen, Angehörige <strong>und</strong> Professionelle darstellen.Die große Heterogenität des Untersuchungsfeldes ist folglich das bedeutsamsteErgebnis <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung <strong>und</strong> li<strong>mit</strong>iert Verallgeme<strong>in</strong>erungen überPersonengruppen <strong>und</strong> Institutionsarten h<strong>in</strong>weg. Gleichzeitig können Personengruppen<strong>und</strong> äußere Sett<strong>in</strong>gs ausgemacht werden, die durch ihre Beanspruchungo<strong>der</strong> ihre För<strong>der</strong>lichkeit Extrem- <strong>und</strong> Zielgruppen <strong>in</strong> negativer o<strong>der</strong> positiver Richtungdarstellen (z.B. Pflegende <strong>in</strong> Altenheimen zeigen größte Beanspruchung <strong>und</strong>bedürfen beson<strong>der</strong>er Unterstützung; stationäre Hospize stellen för<strong>der</strong>licheUmgebungen für das Wohlbef<strong>in</strong>den aller Beteiligten dar <strong>und</strong> können e<strong>in</strong>eModellfunktion für an<strong>der</strong>e E<strong>in</strong>richtungsarten übernehmen). Auf diese Weise kann <strong>der</strong>richtungweisende Charakter <strong>der</strong> Heterogenität im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>gew<strong>in</strong>nbr<strong>in</strong>gend genutzt werden.Allgeme<strong>in</strong>e Wirkung von sozialen <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Die theoriegeleitete Betrachtung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong> zeigte vor allem, dass bislang wenig spezifisches Wissen dazu generiertwurde (Kapitel 4 – <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>).An<strong>der</strong>e Foki standen im Mittelpunkt (z.B. Bedürfnisse von PatientInnen, Trauer beiAngehörigen, Beanspruchung bei Professionellen). Die Ergebnisse <strong>der</strong> vorliegenden
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 193Untersuchung machen deutlich, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> zu Unrecht vernachlässigtwurden, denn sie zeigen starke Auswirkungen auf das Bef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> befragtenMenschen.Es kann dabei generalisiert werden, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> zu e<strong>in</strong>er Erhöhung desWohlbef<strong>in</strong>dens, ungeachtet <strong>der</strong> Belastung durch die äußere Lebens- o<strong>der</strong>Arbeitssituation, beitragen (Kapitel 10.1. – Wohlbef<strong>in</strong>denssteigernde Wirkung vonsozialen <strong>Ressourcen</strong>). Sie wirken stabilisierend auf den Menschen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>eräußeren, oft unverän<strong>der</strong>baren Situation. Dieses Ergebnis hat vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong><strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Bedeutung, da die <strong>Tod</strong>esbedrohungnicht kontrollier- o<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>bar ist, d.h. folglich die Beanspruchungo<strong>der</strong> das Krisenerleben, das durch die Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> ausgelöst wird,wenig verän<strong>der</strong>bar ist (Kapitel 2.2. – Krise als Grenzerfahrung). Im Rahmen vonpsychosozialer o<strong>der</strong> therapeutischer Intervention kann so<strong>mit</strong> nicht auf die Zielrichtungzu Belastungs-Reduktion zurückgegriffen werden, <strong>und</strong> die Erhöhung von Stabilität<strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> belastenden Situation stellt hier e<strong>in</strong>en hilfreichenWeg <strong>der</strong> beratenden o<strong>der</strong> therapeutischen Arbeit dar.Dies trifft vor allem für PatientInnen <strong>und</strong> Angehörige zu. Bei ihnen zeigt sichentsprechend, dass <strong>der</strong> Zusammenhang von sozialen <strong>Ressourcen</strong> zu Wohlbef<strong>in</strong>denweitaus größer ist als zu Beanspruchung. Verr<strong>in</strong>gernd auf berufliche Beanspruchungwirken sich soziale <strong>Ressourcen</strong> teilweise bei den befragten Professionellen aus. Hiermuss wie<strong>der</strong>um die spezifische Lage <strong>der</strong> Personengruppen differenziert werden,denn für die Professionellen stellt <strong>der</strong> Umgang <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> e<strong>in</strong> Arbeitsfelddar, <strong>in</strong> dessen Rahmen sie zum<strong>in</strong>dest auf Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen relativen E<strong>in</strong>flussnehmen können (z.B. Gestaltung des Teamzusammenhalts, Inanspruchnahme vonSupervision). Für Professionelle können sich folglich soziale <strong>Ressourcen</strong> sowohlwohlbef<strong>in</strong>denssteigernd als auch beanspruchungsreduzierend auswirken, währendfür PatientInnen <strong>und</strong> Angehörige vor allem <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> Wohlbef<strong>in</strong>denssteigerungdurch soziale <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unverän<strong>der</strong>baren, belasteten Krisensituation imVor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> steht.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 194Wirkungsvolle Maße sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>Es wurde im ersten Teil <strong>der</strong> Diskussion bereits deutlich, dass verschiedeneKennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong> unterschiedlich <strong>in</strong> ihrer Aussagekraft zu bewertens<strong>in</strong>d (Kapitel 10.1. - Bedeutung <strong>der</strong> multidimensionalen Operationalisierung vonsozialen <strong>Ressourcen</strong> sowie Subjektive Wahrnehmung von sozialen <strong>Ressourcen</strong>). Bei<strong>der</strong> Datenanalyse, die die Modifikation <strong>der</strong> Konzeption sozialer <strong>Ressourcen</strong> zum Zielhatte, wurden die E<strong>in</strong>flüsse sämtlicher Rahmenbed<strong>in</strong>gungen elim<strong>in</strong>iert (durchKontrolle aller demographischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen) <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> auch diespezifische Situation im Kontakt <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>. In den vorhergehendenAusführungen wurde jedoch deutlich, dass gerade Charakteristika <strong>der</strong> äußerenSituation e<strong>in</strong>e große Heterogenität <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> schaffen.Aus diesem Gr<strong>und</strong>e soll nun dargestellt werden, welche Kennwerte sozialer<strong>Ressourcen</strong> große Auswirkungen <strong>in</strong> diesem Feld zeigen <strong>und</strong> folglich alsempfehlenswerte Erhebungsmaße gelten können.Folgende Wirkungen sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> zeigen sichdabei: Die verschiedenen Komponenten sozialer Unterstützung (Informationale,Instrumentelle, Motivationale, Emotionale <strong>und</strong> Gegebene Unterstützung) habenke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung. In dem Konzept von sozialerUnterstützung nach Wahrgenommener Unterstützung, Unterstützungsbedürfnis <strong>und</strong>Suche nach Unterstützung hat die Wahrgenommene Unterstützung starke Bezüge zuden Outcome-Variablen, das Unterstützungsbedürfnis sowie die Suche nachUnterstützung jedoch nicht. <strong>Soziale</strong> Resonanz zeigt von allen sozialen <strong>Ressourcen</strong>die stärksten Verb<strong>in</strong>dungen zu Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Beanspruchung. Die Netzgröße,welche die objektive Größe des sozialen Netzes angibt, wirkt sich nicht aufWohlbef<strong>in</strong>den bzw. Beanspruchung aus. Die subjektiv empf<strong>und</strong>ene Qualität dessozialen Netzes (Netzstärke) zeigt relevante korrelative Verb<strong>in</strong>dungen <strong>mit</strong> denOutcome-Variablen. Zufriedenheits<strong>in</strong>dex, Problem<strong>in</strong>dex sowie Än<strong>der</strong>ungsdruck alsMaße <strong>der</strong> Qualität enger sozialer Beziehungen als Ressource zeigen hohe Bezügezu den Outcome-Variablen. Bei Konstruktivität <strong>und</strong> Destruktivität lassen sich ke<strong>in</strong>erelevanten Bezüge nachweisen. Die durchweg höchsten Varianzaufklärungen <strong>in</strong> denOutcome-Variablen lassen sich durch die <strong>Soziale</strong> Resonanz, die Wahrgenommene
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 195Unterstützung, den Zufriedenheits<strong>in</strong>dex, den Problem<strong>in</strong>dex sowie den Än<strong>der</strong>ungsdruckerzielen.Aus diesen Ergebnissen kann schlussfolgernd festgehalten werden, dass vor allemzwei Charakteristika bedeutsame Operationalisierungen für soziale <strong>Ressourcen</strong>auszeichnen: Zum e<strong>in</strong>en erweisen sich Kennwerte, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> subjektivenWahrnehmung des Befragten verankert s<strong>in</strong>d, „objektiven Kennwerten“ überlegen(vgl. dazu auch die Ergebnisse von Mallett, Price, Jurs & Slenker, 1991); dies zeigtesich auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> feld-freien Betrachtung <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>, vgl. Kapitel 10.1. –Subjektive Wahrnehmung von <strong>Ressourcen</strong>). Zum an<strong>der</strong>en s<strong>in</strong>d Kennwerte, die sichauf nahe Beziehungen stützen (z.B. Zufriedenheits-, Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck),<strong>in</strong> diesem Feld von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Dies deckt sich <strong>mit</strong> dentheoretischen Annahmen <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Bedeutung naher Beziehungen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Konfrontation <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (Kapitel 4.1. – Die beson<strong>der</strong>e Situation <strong>der</strong>Beziehungsentstehung im Sterbeprozess).Bedeutung des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong><strong>Tod</strong>Abschließend soll auf die Bedeutung <strong>der</strong> neu entwickelten Dimension des InnerenVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s unter den sozialen <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>gegangen werden, denn ihrkommt im Feld von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu. Sie war <strong>in</strong> <strong>der</strong>Datenanalyse zur Modifikation des Konzepts von sozialen <strong>Ressourcen</strong> als neuartigeVariable hervorgetreten <strong>und</strong> zeigt starke Verb<strong>in</strong>dungen zu Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong>Belastung/Beanspruchung bei den Befragten. Parallelen zu bestehenden,theoretischen Modellen <strong>in</strong> Bezug auf die Bedeutung des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> zeigen sich e<strong>in</strong>zig bei Wittkowski (2005, 72), <strong>der</strong><strong>in</strong> se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrativen Theorie <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung zum eigenen <strong>Tod</strong> die Begrifflichkeitenvon „S<strong>in</strong>nhaftigkeit/S<strong>in</strong>nver<strong>mit</strong>tlung“ <strong>und</strong> „verän<strong>der</strong>te B<strong>in</strong>dung an das Leben bzw. andie Welt“ verwendet. Diese lehnen sich an die <strong>in</strong>haltliche Bedeutung des InnerenVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s an.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 196Im Feld von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> kommt <strong>der</strong> sozialen Ressource des InnerenVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s vor allem bei PatientInnen <strong>und</strong> Angehörigen beson<strong>der</strong>e Bedeutungzu: Zum e<strong>in</strong>en stellt sie e<strong>in</strong> subjektives Konstrukt <strong>der</strong> Person dar <strong>und</strong> liegt daher imInterventionsbereich <strong>der</strong> kl<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> therapeutischen Gesprächsführung.Dementsprechend kann sie therapeutisch eruiert, gestärkt <strong>und</strong> geför<strong>der</strong>t werden.Zum an<strong>der</strong>en kann das Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Menschen, im Gegensatz zuan<strong>der</strong>en sozialen <strong>Ressourcen</strong>, auf solche Weise geför<strong>der</strong>t werden, ohne zw<strong>in</strong>genddie soziale Lebenssituation des Betreffenden verän<strong>der</strong>n zu müssen, alsobeispielsweise Netzwerke erweitern zu müssen. Solche praktischen Interventionenim Lebenskontext s<strong>in</strong>d gerade bei kritisch kranken Menschen <strong>und</strong> ihren Angehörigenoftmals nicht angebracht o<strong>der</strong> verantwortbar, da das Lebenssystem um denPatienten meist hoch belastet <strong>und</strong> daher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fragilen, funktionalenGleichgewicht ist. In dieser Situation ist es s<strong>in</strong>nvoller, therapeutische Interventionennicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> äußeren Lebenswelt, son<strong>der</strong>n am <strong>in</strong>neren, subjektiven Gefühl desVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt anzusetzen, will man e<strong>in</strong>e Stärkung herbeiführen.In an<strong>der</strong>en Bezügen ist diese Art <strong>der</strong> Intervention beson<strong>der</strong>s <strong>mit</strong> sterbendenMenschen o<strong>der</strong> trauernden H<strong>in</strong>terbliebenen bereits bekannt. So spricht Kübler-Ross(1989, 1995, 1997) von <strong>der</strong> großen Bedeutung <strong>der</strong> <strong>in</strong>neren Klärung von Beziehungenim Sterbeprozess (vgl. dazu auch Cassidy, 1995; Drees, 2003). E<strong>in</strong>e weiteretherapeutische Intervention, die oft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sterbebegleitung angewandt wird, ist dieBiographiearbeit (vgl. bspw. Jan<strong>der</strong>, 1993; Petzold, 2003). Sie zielt ebenfalls daraufab, rückblickend im Lebensverlauf die eigene, s<strong>in</strong>nhafte E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> dieLebensgeschichte nochmals bewusst nachzuvollziehen. Auch logotherapeutische(bspw. Tirier, 2003) o<strong>der</strong> geistliche (bspw. Becker & Eid, 1984; Klute, 1997; Piper,1984a, 1984b, 1989; Schnei<strong>der</strong>, B., 1993; Stock, 1993; Wiesenhütter, 1974)Interventionen gehen oftmals <strong>in</strong> die Richtung, dem sterbenden Patienten o<strong>der</strong> se<strong>in</strong>enzurückbleibenden Angehörigen e<strong>in</strong> Vertrauen <strong>in</strong> ihr E<strong>in</strong>gebettet-Se<strong>in</strong> zu ver<strong>mit</strong>teln,um ihn <strong>in</strong>nerlich zu stärken. In <strong>der</strong> Trauerarbeit schließlich ist es e<strong>in</strong> therapeutischesHauptziel, die Beziehung e<strong>in</strong>es Trauernden zum Verstorbenen <strong>in</strong> allen ihren Facettenemotional durchzuarbeiten, denn nur auf diese Weise kann sie abgeschlossenwerden <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verstorbene kann im weiteren Leben des Weiterlebenden e<strong>in</strong>ens<strong>in</strong>nvollen Platz e<strong>in</strong>nehmen (bspw. Kast, 1987, 2000, 2004). In allen diesen
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 197Interventionsansätzen kann <strong>der</strong> Bezug auf dieses <strong>in</strong>nere Gefühl des s<strong>in</strong>nvollenVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt deutlich enthalten.Im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> oben erläuterten Erweiterung des <strong>Ressourcen</strong>-Ansatzes stellt so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>hohes Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en bedeutsamen Schutzfaktor <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> dar, <strong>der</strong> therapeutisch auf vielerlei Ebenen geför<strong>der</strong>t werden kann.Vorrangiges Ergebnis <strong>der</strong> Analyse sozialer <strong>Ressourcen</strong> im Feld von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>ist die große Heterogenität dieses gesellschaftlichen Bereichs, für die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>edie qualitativen Unterschiede zwischen Personengruppen sowie zwischen denunterschiedlichen Institutionsarten verantwortlich s<strong>in</strong>d.Über alle Unterschiede h<strong>in</strong>weg zeigt sich, dass soziale <strong>Ressourcen</strong> Auswirkungenauf die Bef<strong>in</strong>dlichkeit von Menschen im Kontakt <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> haben, <strong>in</strong>dem sieihr Wohlbef<strong>in</strong>den stabilisieren. In diesem Feld stellt <strong>der</strong> Rückgriff auf soziale<strong>Ressourcen</strong> so<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>e wertvolle Interventionsmöglichkeit dar, da e<strong>in</strong>e Belastungsbzw.Beanspruchungsreduzierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> oftmals nur<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Ausmaß möglich ist. Zudem stellen soziale bzw. systemischeInterventionen e<strong>in</strong>e wertvolle Bereicherung im oft überwiegend <strong>in</strong>dividuumszentriertenBlickw<strong>in</strong>kel <strong>der</strong> theoretischen wie praktischen Thanatologie dar.Die Datenanalyse ergibt, dass die subjektive Wahrnehmung <strong>der</strong> sozialen Welt bzw.<strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> bedeutsam ist <strong>und</strong> dass vor allem das InnereVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> (das gr<strong>und</strong>legende Gefühl des s<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollenVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt) sich för<strong>der</strong>lich auf das Wohlbef<strong>in</strong>den auswirkt. Diesstellt e<strong>in</strong>e wertvolle Hilfestellung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung sterben<strong>der</strong> Menschen dar: Zume<strong>in</strong>en gibt es den beteiligten Professionellen e<strong>in</strong>en H<strong>in</strong>weis darauf, die <strong>in</strong>nereErfahrungswelt von PatientInnen <strong>und</strong> Angehörigen <strong>in</strong> das professionelleHandlungsfeld zu <strong>in</strong>tegrieren <strong>und</strong> sie entsprechend zu gewichten. Zum an<strong>der</strong>enkönnen Interventionen bei Menschen, die <strong>mit</strong> dem eigenen <strong>Sterben</strong> o<strong>der</strong> dem<strong>Sterben</strong> e<strong>in</strong>es Angehörigen konfrontiert s<strong>in</strong>d, auch dann am <strong>in</strong>neren Bild <strong>der</strong> sozialenWelt ansetzen, wenn Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> realen, sozialen Umwelt aus Zeit-, Krafto<strong>der</strong>Konstellationsgründen nicht möglich s<strong>in</strong>d.
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 19810.3. Fazit„Wir arbeiten an uns selbst,um an<strong>der</strong>en zu helfen.Und wir helfen als Möglichkeit,um an uns selbst zu arbeiten.“(Dass, 1988, 215)Das wichtigste Fazit aus dieser Arbeit ist die Bestätigung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozial- <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitspsychologie seit langem bekannten Tatsache: <strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> s<strong>in</strong>dhilfreich. Laut den Ergebnissen <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit s<strong>in</strong>d sie es, <strong>in</strong>dem sie dasWohlbef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> verschiedenen, äußeren Situationen stabilisieren –auch angesichts e<strong>in</strong>er krisenhaften Grenzsituation wie dem <strong>Sterben</strong>.Drei Schlussfolgerungen s<strong>in</strong>d aus dem Wissen um die Wirksamkeit sozialer<strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem <strong>Tod</strong> für die Begleitung sterben<strong>der</strong> Menschenzu ziehen:1. Zunächst muss festgehalten werden, dass es „die“ <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong>als standardisierbare (gesellschaftliche o<strong>der</strong> psychische) Situation gar nicht gibt.Die Ergebnisse <strong>der</strong> hier vorliegenden Untersuchung zeigen sehr deutlich, dassdie Heterogenität dieses Feldes über möglicherweise vorhandene, allgeme<strong>in</strong>eKennzeichen bei weitem dom<strong>in</strong>iert. Von „dem“ <strong>Sterben</strong> als allgeme<strong>in</strong>emGeschehen, „dem“ Angehörigen e<strong>in</strong>es o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er <strong>Sterben</strong>den <strong>und</strong> „dem“ o<strong>der</strong>„<strong>der</strong>“ Professionellen zu sprechen, ist nicht erkenntnisbr<strong>in</strong>gend, son<strong>der</strong>n vielmehrerkenntnis-verstellend.2. Die Ergebnisse zeigen, dass sich e<strong>in</strong> sozialer bzw. systemischer Blickw<strong>in</strong>kel auch<strong>in</strong> diesem Bereich als bedeutsam erweist. In <strong>der</strong> Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> überwiegtbislang sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> praktischen Arbeit als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichenForschung zumeist noch e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuumszentrierte Betrachtungsweise (welcheaußerdem oft auf den <strong>Sterben</strong>den fixiert ist). Hier kann sich e<strong>in</strong>e Erweiterung <strong>der</strong>
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 199Sicht, die nicht nur das Individuum, son<strong>der</strong>n auch dessen Welt <strong>und</strong> se<strong>in</strong>eE<strong>in</strong>bettung dar<strong>in</strong> umfasst, als hilfreich <strong>und</strong> kraftgebend erweisen. DiesemGr<strong>und</strong>gedanken folgend skizziert Strittmatter (1991, 1998) e<strong>in</strong>en möglichen,systemischen Betreuungsansatz:„Es geht um die Beachtung <strong>und</strong> E<strong>in</strong>beziehung des wichtigsten Bezugssystems des<strong>Sterben</strong>den, sei es Familie, Herkunftsfamilie, Partnerbeziehung o<strong>der</strong> Fre<strong>und</strong>schaftsbeziehung.Es reicht nicht, den <strong>Sterben</strong>den alle<strong>in</strong>e zu sehen <strong>und</strong> ihn zu begleiten.Entscheidend ist, a) alle Hauptbeteiligten <strong>in</strong> ihrem geme<strong>in</strong>samen Bezugssystem <strong>in</strong> denBlick zu bekommen, b) dieses System als ganzes bei Bedarf so zu unterstützen, dass esc) se<strong>in</strong>erseits se<strong>in</strong>e Mitglie<strong>der</strong> versorgt.“ (Strittmatter, 1998, 36ff.) „Aus dem bisherGesagten wird aus systemischer Sicht deutlich, dass die Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen <strong>in</strong><strong>der</strong> Begleitung von <strong>Sterben</strong>den bee<strong>in</strong>flusst werden durch jede beteiligte Person, <strong>der</strong>enBeziehungsstrukturen untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> sowie durch die Bed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> Institution.“(Strittmatter, 1991, 63)3. Der sozial-systemische Blickw<strong>in</strong>kel, <strong>der</strong> sich meist (auch bei Strittmatter, sieheoben) auf die äußere, reale Welt um e<strong>in</strong>e Person konzentriert, wird durch dasKonzept des Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s als soziale Ressource bereichert: DieErgebnisse dieser Arbeit zeigen zum ersten Mal, dass das gr<strong>und</strong>legende Gefühldes s<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt e<strong>in</strong>egewichtige, soziale Ressource darstellt. In <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong> kanndas Innere Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> als Ressource genutzt werden. Das bedeutet <strong>in</strong> <strong>der</strong>praktischen Konsequenz, den Menschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Individualität <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er<strong>in</strong>dividuellen Wahrnehmung wahrzunehmen <strong>und</strong> zu unterstützen: PatientInnen <strong>in</strong>ihrer eigenen Sicht ihrer sozialen Welt <strong>und</strong> ihres sozialen Selbst zu verstehen,Angehörige auf eben diese Weise <strong>in</strong> ihrer Situation zu unterstützen <strong>und</strong>Professionellen die Wertschätzung für <strong>und</strong> die Nutzbarkeit von <strong>der</strong> eigenensozialen E<strong>in</strong>bettung <strong>und</strong> <strong>der</strong> ihrer PatientInnen <strong>und</strong> Familien als professionelleKompetenz nahe zu br<strong>in</strong>gen.Die vorliegende Arbeit erbr<strong>in</strong>gt sowohl für das Feld von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> wie aberauch für die allgeme<strong>in</strong>e Theorienbildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialpsychologiedie folgenden drei, neuen Erkenntnisse:1. Nicht die real-äußere Welt, son<strong>der</strong>n die <strong>in</strong>nere, subjektive Welt e<strong>in</strong>es Individuumsgibt Aufschluss über die wirksamen, sozialen <strong>Ressourcen</strong>, die ihm zur Verfügungstehen. Quasi-Objektivierungen (wie z.B. die Größe des sozialen Netzes) s<strong>in</strong>d
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 200nicht hilfreich, um die <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>er Person auszuloten – die Person mussvielmehr im Bezugssystem ihres <strong>in</strong>neren Erfahrungsraumes verstanden werden.Operationalisierungen über subjektive Bewertungen (wie z.B. die Zufriedenheit<strong>mit</strong> den sozialen Beziehungen) s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> Weg, <strong>der</strong> hier zu e<strong>in</strong>em tieferenVerständnis <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> führen kann.2. Am Beispiel <strong>der</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong> zeigt sich sehr deutlich, dass zwischen dem<strong>in</strong>terpersonellen, sozialen Raum <strong>und</strong> dem <strong>in</strong>trapersonalen Raum ke<strong>in</strong>e Grenze zusetzen ist. Der äußere Erlebensraum <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>nere Erfahrungsraum bilden sich<strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ab, wirken aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> e<strong>in</strong> <strong>und</strong> gehen so<strong>mit</strong> kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>über. Sie erweisen sich als so untrennbar <strong>mit</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verwoben, dass sichletztlich die ganze Welt im Inneren des Menschen abbildet – vielleicht auchumgekehrt? Beim Versuch, dies zu konzeptualisieren, stoßen die <strong>in</strong> dieser Arbeitzur Hilfe genommenen Theorien (e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> Person-Kontext-Interaktionstheorien)an ihre Grenzen.3. Und schließlich erweisen sich die betrachteten, sozialen <strong>Ressourcen</strong> alsabhängiger Teil e<strong>in</strong>es größeren Konzepts. Der Versuch, alle<strong>in</strong> den ressourcenhaftenCharakter <strong>der</strong> sozialen Welt als eigenständiges Konzept zu erfassen,scheitert, da sich unter den verschiedenen <strong>Ressourcen</strong>-Kennwerten solchezeigen, die <strong>Ressourcen</strong> stärken, <strong>und</strong> solche, die die Vulnerabilität e<strong>in</strong>er Personerhöhen, zeigen. Alles ist janus-köpfig <strong>und</strong> trägt die zwei Seiten von Risiko <strong>und</strong>Chance <strong>in</strong> sich (vgl. bspw. Antonovsky, 1979, 1997; Keil, A., 2004; Koestler,1967, zit. n. S<strong>in</strong>gelis, 1994, 588). Diesem philosophischen Pr<strong>in</strong>zip entsprechend,erweist sich auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> hier analysierten Studie die soziale Welt als Schutz <strong>und</strong>Risiko gleichermaßen. Es ist daher hilfreich, die Annahme e<strong>in</strong>es eigenständigen<strong>Ressourcen</strong>-Konzepts aufzugeben <strong>und</strong> stattdessen den Schutz <strong>und</strong> das Risiko,welche durch die soziale Welt entstehen, gleichermaßen zu betrachten.Die vorliegende Arbeit stellt e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>novativen Brückenschlag zwischenverschiedenen Gebieten <strong>der</strong> Psychologie dar. Es werden genu<strong>in</strong> sozialpsychologischeElemente <strong>der</strong> <strong>Ressourcen</strong>forschung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> ges<strong>und</strong>heitspsychologischesRahmenkonzept (<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es salutogenetischen Blickw<strong>in</strong>kels) <strong>in</strong>tegriert. Dieses
Kapitel 10 – Diskussion <strong>und</strong> Fazit 201Vorgehen f<strong>in</strong>det zudem im Anwendungsfeld <strong>der</strong> Thanatopsychologie statt (vgl.Horlacher, 2000). Diese Integration von Blickw<strong>in</strong>keln erbr<strong>in</strong>gt <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> <strong>der</strong>hier dargestellten Untersuchung e<strong>in</strong>en Modellvorschlag zur Konzeptualisierung vonsozialen Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktoren, <strong>der</strong> die genannten Erkenntnisse darstellt.Obwohl die Komponenten dieses Modells bereits bekannt waren, wurde ihrZusammenspiel, das die verschiedenen Gebiete <strong>der</strong> psychologischen Forschungumfasst, bislang übersehen. Das aus dieser Arbeit entstandene „Modell <strong>der</strong> Risiko<strong>und</strong>Schutzfaktoren aus dem sozialen Raum“ liefert e<strong>in</strong>en Beitrag zur Erkenntnis überdie Wirkungsweise sozialer <strong>Ressourcen</strong>, die Pruchno (2003) anmahnt:„Whereas the focus of the previous several decades of research has been on identify<strong>in</strong>gthe importance of social relationships to <strong>in</strong>dividuals, the challenge for the next generationof research is to exam<strong>in</strong>e how these <strong>in</strong>tricate associations develop and why they havesuch powerful and <strong>in</strong>tricate effects.“ (Pruchno & Rosenbaum, 2003, 502)Möge diese Arbeit dazu beigetragen haben, dass die Natur sozialer <strong>Ressourcen</strong> e<strong>in</strong>besseres Verständnis erfahren kann <strong>und</strong> gew<strong>in</strong>nbr<strong>in</strong>gend zum Wohl <strong>der</strong> Menschengenutzt werden kann.
Zusammenfassung / Summary 20211. Zusammenfassung / SummaryDie Bedeutung <strong>und</strong> Wirkungsweise sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong><strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Ihr Ziel liegt zum e<strong>in</strong>en dar<strong>in</strong>,die Bedeutung sozialer <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konfrontation <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong>aufzuzeigen, zum an<strong>der</strong>en dar<strong>in</strong>, gängige Konzeptionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> näherzu analysieren. Die theoretischen Ausführungen glie<strong>der</strong>n sich <strong>in</strong> die Betrachtung <strong>der</strong><strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> als kritisches Lebensereignis <strong>und</strong> <strong>in</strong> die Analyse <strong>der</strong>Konzeptualisierungen sozialer <strong>Ressourcen</strong>.Das Datenmaterial enthält multidimensionale Operationalisierungen sozialer<strong>Ressourcen</strong>, welche untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>mit</strong> Outcome-Variablen zu Wohlbef<strong>in</strong>den/Beanspruchung sowie <strong>mit</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gesetzt werden.Folgende Schlussfolgerungen können festgehalten werden: 1. Das gesellschaftlicheFeld, <strong>in</strong> dem <strong>Sterben</strong> stattf<strong>in</strong>det, stellt sich v. a. durch die <strong>in</strong>stitutionellenUmgebungen als heterogen dar; dennoch erweisen sich soziale <strong>Ressourcen</strong> alshilfreich, <strong>in</strong>dem sie sich stabilisierend auf das Wohlbef<strong>in</strong>den auswirken. 2. Diedichotomisierende Trennung von sozialen <strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong> lässt sichnicht aufrechterhalten; vielmehr zeigt sich, dass <strong>in</strong>terpersoneller Erlebensraum <strong>und</strong>personaler Erfahrungsraum <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> übergehen. 3. Kennwerte, die die subjektiveWahrnehmung <strong>der</strong> Befragten erfassen, s<strong>in</strong>d zur Operationalisierung sozialer<strong>Ressourcen</strong> besser geeignet als objektivierende Maße. 4. Die Analyse <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> ergibt fünf Dimensionen, welche Schutz- bzw. Risikovariablen darstellen(als beson<strong>der</strong>s bedeutsam zeigt sich dabei die Dimension „Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>“,die als gr<strong>und</strong>legendes Gefühl des s<strong>in</strong>nvollen <strong>und</strong> vertrauensvollen Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>s<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Welt def<strong>in</strong>iert wird); soziale <strong>Ressourcen</strong> erweisen sich als Teil e<strong>in</strong>esumfassen<strong>der</strong>en Konzepts von Schutz- <strong>und</strong> Risikofaktoren.Auf diesen Ergebnissen <strong>und</strong> den theoretischen Überlegungen basierend wird e<strong>in</strong><strong>in</strong>tegratives Modell <strong>der</strong> „Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktoren aus dem sozialen Raum“entworfen, welches als weiterführende Diskussionsbasis dienen kann. Dievorliegende Arbeit leistet da<strong>mit</strong> e<strong>in</strong>en theoretischen wie auch empirischen Beitrag zurAnalyse <strong>der</strong> Wirkungsweise sozialer <strong>Ressourcen</strong>.
Zusammenfassung / Summary 203In this dissertation, social resources <strong>in</strong> the field of fac<strong>in</strong>g death and dy<strong>in</strong>g areregarded from two viewpo<strong>in</strong>ts: show<strong>in</strong>g the significance and effectiveness of socialresources <strong>in</strong> the confrontation with death and dy<strong>in</strong>g, and analyz<strong>in</strong>g currentconceptions and theories of these resources. Therefore, the theoretical discussion<strong>in</strong>cludes a general view of the encounter with dy<strong>in</strong>g from a thanatopsychologicalperspective as well as a critical analysis of current conceptions of social resources(social support, social networks, and social relationships).The data conta<strong>in</strong>s 16 different parameters of social resources that are exam<strong>in</strong>ed <strong>in</strong>relation to three steps of analysis: the 16 parameters themselves, outcome variablessuch as well-be<strong>in</strong>g, stra<strong>in</strong>, and demand, and personal resources. The analysis yieldsthe follow<strong>in</strong>g conclusions: 1. The societal field <strong>in</strong> which dy<strong>in</strong>g occurs, appears to beheterogeneous. Nevertheless, social resources prove to be helpful by stabiliz<strong>in</strong>g wellbe<strong>in</strong>g.2. The dichotomy of classification <strong>in</strong> social and personal resources cannot beupheld due to the f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g that the <strong>in</strong>terpersonal space of events and the <strong>in</strong>trapersonalspace of experience are <strong>in</strong>terrelated and <strong>in</strong>terdependent. 3. Variables based on thesubjective perception of the person are better suited for the operationalisation ofsocial resources as variables that are based on objectives measures. 4. The factoranalysis of the parameters of social resources <strong>in</strong>dicates five dimensions whichconstitute risk and protective factors (the dimension “Inner Connectedness” that canbe def<strong>in</strong>ed as the feel<strong>in</strong>g of significant, trustful connection with the world proves to beespecially prom<strong>in</strong>ent).These results and the theoretical analysis constitute the <strong>in</strong>tegrative model “Risk andProtective Factors <strong>in</strong> the Social Space”, which may serve as a basis for furtherresearch. This work presents a theoretical and empirical contribution to the analysisof modes of action for social resources.
Literaturverzeichnis 20412. LiteraturverzeichnisAchterberg, J., Dossey, B. & Kolkmeier, L. (1996). Rituale <strong>der</strong> Heilung: die Kraft vonPhantasiebil<strong>der</strong>n im Ges<strong>und</strong>ungsprozess. München: Goldmann.Aemissegger, U. (1997). Als Arzt im Spannungfeld zwischen Patient, Angehörigen<strong>und</strong> Gesellschaft. In P. Fässler-Weibel (Hrsg.), <strong>Sterben</strong>de verstehen lernen (S.192-207). Freiburg/Schweiz: Paulusverlag.Aichner, S., Gruß, P., Hofer, B. & Schießl, C. (2003). Gedenkgottesdienst fürVerstorbene <strong>in</strong> <strong>der</strong> Palliativstation. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 20-22.Allert, R. (2003). Vom Mythos des Qualitätsmanagments im Ges<strong>und</strong>heitswesen. DieHospiz-Zeitschrift, 17(5), 11-13.Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and cop<strong>in</strong>g. San Francisco: Jossey-Bass.Antonovsky, A. (1997). Salutogenese: zur Entmystifizierung <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heit (Forumfür Verhaltenstherapie <strong>und</strong> psychosoziale Praxis, Band 36). Tüb<strong>in</strong>gen:Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.Attig, T. (2000). Anticipatory mourn<strong>in</strong>g and the transition to lov<strong>in</strong>g <strong>in</strong> absence. In T. A.Rando (Hrsg.), Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theory andpractice <strong>in</strong> work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers (S.115-134). Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.Aue, M., Ba<strong>der</strong>, B. & Lühmann, J. (1995). Krankheits- <strong>und</strong> Sterbebegleitung:Ausbildung, Krisen<strong>in</strong>tervention, Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g (2. Auflage). We<strong>in</strong>heim: Beltz.Aulbert, E., Klaschick, E. & Kettler, D. (2002). Palliativmediz<strong>in</strong> - Ausdruckgesellschaftlicher Verantwortung. Stuttgart: Schattauer.Aymanns, P. (1992). Krebserkrankung <strong>und</strong> Familie: zur Rolle familialer Unterstützungim Prozess <strong>der</strong> Krankheitsbewältigung. Bern: Huber.Ba<strong>in</strong>es, M. (1993). Den totalen Schmerz bekämpfen. In C. Saun<strong>der</strong>s (Hrsg.), Hospiz<strong>und</strong> Begleitung. Wie wir s<strong>in</strong>nlose Apparatemediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> e<strong>in</strong>sames <strong>Sterben</strong>vermeiden können (4. Auflage ed.). Freiburg: Her<strong>der</strong>.Baldw<strong>in</strong>, D. B. (1983). What dy<strong>in</strong>g patiens fear most. Medial economics, 60(3), 125,128-130, 134.Baltes, M. M. & Silverberg, S. B. (1994). The dynamic between dependency andautonomy: illustrations across the life span. Life-span development andbehavior, 12, 41-90.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.Bartels, D. M. & Faber-Langendoen, K. (2001). Car<strong>in</strong>g <strong>in</strong> crisis: Family perspectiveson ventilator withdrawal at the end of life. Families, systems & health: thejournal of collaborative family health care, 19, 169-176.Becker, P. (1992). Mo<strong>der</strong>ne Gesellschaft im Umgang <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>: Hospize -Hospitalisierung des <strong>Tod</strong>es? In A. Nassehi & R. Pohlmann (Hrsg.), <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (S. 43-54). Hamburg: LIT.Becker, P. & Eid, V. (Hrsg.). (1984). Begleitung von Schwerkranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den:praktische Erfahrungen <strong>und</strong> wissenschaftliche Reflexionen. Ma<strong>in</strong>z: Matthias-Grünewald-Verlag.Bellebaum, A. B., Klaus (Hrsg.). (1994). Lebensqualität. E<strong>in</strong> Konzept für Praxis <strong>und</strong>Forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.Belschner, W. (1998). Die Skala Transpersonales Vertrauen: Manual. UniversitätOldenburg.
Literaturverzeichnis 205Belschner, W. (2001). Tun <strong>und</strong> Lassen: E<strong>in</strong> komplementäres Konzept <strong>der</strong>Lebenskunst. Transpersonale Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie, 7(2), 85-102.Belschner, W. (2002). Die vergessene Dimension <strong>in</strong> Grawes Allgeme<strong>in</strong>erPsychotherapie. In W. Belschner, J. Galuska, H. Walach & E. Z<strong>und</strong>el (Hrsg.),Transpersonale Psychologie im Kontext (S. 167-217). Oldenburg: BIS.Belschner, W. (2004). Die Dimension des Bewusstse<strong>in</strong>s <strong>in</strong> <strong>der</strong>Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung. In E. Göpel (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heit bewegt. Wie ause<strong>in</strong>em Krankheitswesen e<strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen entstehen kann. (S. 162-188).Frankfurt a.M.: Mabuse.Belschner, W. (2005a). Die Normalisierung des Außergewöhnlichen. In P. Lengsfeld(Hrsg.), Mystik - Spiritualität <strong>der</strong> Zukunft: Erfahrung des Ewigen (S. 299-309).Freiburg: Her<strong>der</strong>.Belschner, W. (2005b). Von <strong>der</strong> "Transpersonalen Psychologie" zur "Psychologie desBewusstse<strong>in</strong>s". Transpersonale Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie, 10(1), 16-24.Belschner, W. & Bantelmann, J. (2005). Der Fragebogen Integrale Ges<strong>und</strong>heit FIG-50: Manual zu Konzept, Konstruktion, psychometrischen Kennwerten <strong>und</strong>Validität. Münster: LIT.Belschner, W., Gräser, S., Hellmann, A., Meis, M., Scheibler, P. & Annette, S. (2002).Arbeitsplatz Universität: die Oldenburger Studie zumGes<strong>und</strong>heitsmanagement (Studien zur Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung, Band 4).Oldenburg: BIS.Bermejo, I. & Muthny, F. A. (1995). Erlebte Belastungen, Bedarf an psychosozialerFortbildung <strong>und</strong> "Burnout"-Risikogruppen <strong>in</strong> <strong>der</strong> stationären Altenhilfe. In W. H.Senf, G. (Hrsg.), Gesellschaftliche Umbrüche - Individuelle Antworten (S. 243-260). Frankfurt a.M.: VAS.Bernard, J. S. & Schnei<strong>der</strong>, M. (1996). Spirituality and death: the essentialconnection. In J. S. Bernard & M. Schnei<strong>der</strong> (Hrsg.), The true work of dy<strong>in</strong>g: apractical and compassionate guide to eas<strong>in</strong>g the dy<strong>in</strong>g process (S. 27-53).New York: Avon Books.Bertrand, R. M. & Lachman, M. E. (2003). Personality development <strong>in</strong> adulthood andold age. In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks & J. Mistry (Hrsg.), Handbook ofpsychology: Volume 6 - Developmental psychology (S. 463-485). New York:John Wiley & Sons.Beutel, H. & Tausch, D. (Hrsg.). (1996). <strong>Sterben</strong> - e<strong>in</strong>e Zeit des Lebens: e<strong>in</strong>Handbuch <strong>der</strong> Hospizbewegung. (4. Auflage ed.). Stuttgart: Quell Verlag.Beutel, H. & Tausch-Flammer, D. (1990). Die Stuttgarter Hospiz-Bewegung. In D.Deter & U. Straumann (Hrsg.), Personenzentriert verstehen, gesellschaftsbezogendenken, verantwortlich handeln: Theorie, Methodik <strong>und</strong> Umsetzung<strong>in</strong> <strong>der</strong> psychosozialen Praxis (S. 243-257). Köln: Greven & Bechtold.Bickel, H. (1998). Das letzte Lebensjahr: E<strong>in</strong>e Repräsentativstudie an Verstorbenen.Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 31(3), 193-204.Bickel, L. & Tausch-Flammer, D. (1997a). Woher wir kamen <strong>und</strong> was wir fanden: vonden seelischen <strong>und</strong> spirituellen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Hospizbewegung. In L. Bickel& D. Tausch - Flammer (Hrsg.), Spiritualität <strong>der</strong> Sterbebegleitung: Wege <strong>und</strong>Erfahrungen (S. 9-20). Freiburg: Her<strong>der</strong>.Bickel, L. & Tausch-Flammer, D. (Hrsg.). (1997b). Spiritualität <strong>der</strong> Sterbebegleitung:Wege <strong>und</strong> Erfahrungen. Freiburg: Her<strong>der</strong>.
Literaturverzeichnis 206Birg, H. & Flöthmann, E. J. (2002). Langfristige Trends <strong>der</strong> demographischenAlterung <strong>in</strong> Deutschland. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(5), 387-399.Block, S. D. (2001). Psychological consi<strong>der</strong>ations, growth, and transcendence at theend of life: the art of the possible. Journal of the American MedicalAssociation, 285(22), 2898-2905.Blosser-Reisen, L. (1997b). Vollendung des Lebens <strong>und</strong> Abschiednehmen stattAusgrenzung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>. In L. Blosser-Reisen (Hrsg.), Altern: Integrationsozialer <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher Hilfen (S. 175-200). Bern: Huber.Blosser-Reisen, L. (Hrsg.). (1997a). Altern: Integration sozialer <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicherHilfen (Angewandte Altersk<strong>und</strong>e, Band 13). Bern: Huber.Blumenthal-Barby, K. (1991). Leben im Schatten des <strong>Tod</strong>es: wie wirSchwerstkranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den helfen können. Wiesbaden: Jopp.Bode, C., Westerhof, G. J. & Dittmann-Kohli, F. (2001). Selbstvorstellungen überIndividualität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte. Zeitschrift fürGerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 34, 365-375.Bodenmann, G. (1997). Stress <strong>und</strong> Cop<strong>in</strong>g als Prozess. In C. Tesch-Römer, C.Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 74-92).We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.Böhmer, S. (2002). Lebensqualität. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H. Weber(Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S. 349-352). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler (5. Auflage). Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger.Bragdon, E. (1991). Spirituelle Krisen - Wendepunkte im Leben. Freiburg: Bauer.Braukmann, W. & Filipp, S.-H. (1995). Personale Kontrolle <strong>und</strong> die Bewältigungkritischer Lebensereignisse. In S.-H. Filipp (Hrsg.), Kritische Lebensereignisse(S. 233-251). We<strong>in</strong>heim: PsychologieVerlagsUnion.Bronfenbrenner, U. (1995a). The bioecological model from a life course perspective:reflections of a participant observer. In P. Moen, G. H. J. El<strong>der</strong> & K. Lüscher(Hrsg.), Exam<strong>in</strong><strong>in</strong>g lives <strong>in</strong> context: perspectives on the ecology of humandevelopment (S. 599-618). Wash<strong>in</strong>gton: American Psychological Association.Bronfenbrenner, U. (1995b). Developmental ecology through space and time: afuture perspective. In P. Moen, G. H. J. El<strong>der</strong> & K. Lüscher (Hrsg.), Exam<strong>in</strong><strong>in</strong>glives <strong>in</strong> context: perspectives on the ecology of human development (S. 619-648). Wash<strong>in</strong>gton: American Psychological Association.Brosius, G. (1989). SPSS/PC+ Advanced Statistics and Tables. Hamburg: McGraw-Hill.Bruera, E. (2000). New directives for psychosocial research <strong>in</strong> palliative medic<strong>in</strong>e. InH. M. Choch<strong>in</strong>ov & W. Breitbart (Hrsg.), Handbook of psychiatry <strong>in</strong> palliativemedic<strong>in</strong>e (S. 407-411). New York: Oxford University Press.Bucher, C., Hess, T., Spichiger, E. & Otto, S. (1998). Die wenigsten sterben alle<strong>in</strong>.Krankenpflege, 91(11), 17-21.Buckman, R. (2002). Communications and emotions. BMJ, 325, 672.Bühner, M. (2004). E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Test- <strong>und</strong> Fragebogenkonstruktion. München:Pearson.B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie Senioren Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.). (2001). Diezweite Lebenshälfte: psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer.
Literaturverzeichnis 207B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung. (2001). Was erhält Menschenges<strong>und</strong>? Antonovskys Modell <strong>der</strong> Salutogenese - Diskussionsstand <strong>und</strong>Stellenwert (Forschung <strong>und</strong> Praxis <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>der</strong>ung, Band 6) (new).Köln: B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung.Burr, W. R. & Kle<strong>in</strong>, S. R. (1994). Reexam<strong>in</strong><strong>in</strong>g family stress: new theory andresearch. Thousand Oaks: Sage.Callanan, M. K., Patricia. (1993). Mit Würde aus dem Leben gehen. E<strong>in</strong> Ratgeber fürdie Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>. München: Knaur.Canacakis, J. (1987). Ich sehe De<strong>in</strong>e Tränen: Trauern, Klagen, Leben können.Stuttgart: Kreuz Verlag.Canacakis, J. & Schnei<strong>der</strong>, K. (1997). Neue Wege zum heilsamen Umgang <strong>mit</strong>Krebs: Angebote für Betroffene <strong>und</strong> Helfer (3. Auflage). Stuttgart: Kreuz.Carstensen, L. L. (1995). Evidence fo a life-span theory of socioemotional selectivity.Current directions <strong>in</strong> psychological science, 4(5), 151-156.Casarett, D. (1999). Case presentation: are dy<strong>in</strong>g patients too vulnerable toparticipate <strong>in</strong> research? Journal of pa<strong>in</strong> and symptom managment, 18(2), 143.Cassidy, S. (1995). Die Dunkelheit teilen: Spiritualität <strong>und</strong> Praxis <strong>der</strong>Sterbebegleitung. Freiburg: Her<strong>der</strong>.Ceelen, P. (1997). "Ich habe sonst niemanden mehr.": vom <strong>Sterben</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>E<strong>in</strong>samkeit. In L. Bickel & D. Tausch-Flammer (Hrsg.), Spiritualität <strong>der</strong>Sterbebegleitung: Wege <strong>und</strong> Erfahrungen (S. 86-93). Freiburg: Her<strong>der</strong>.Cherny, N. I. (2000). The treatment of suffer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> patients with advanced cancer. InH. M. Choch<strong>in</strong>ov & W. Breitbart (Hrsg.), Handbook of psychiatry <strong>in</strong> palliativemedic<strong>in</strong>e (S. 375-396). New York: Oxford University Press.Choch<strong>in</strong>ov, H. M., Hack, T., McClement, S., Kristjanson, L. J. & Harlos, M. (2002).Dignity <strong>in</strong> the term<strong>in</strong>ally ill: a develop<strong>in</strong>g empirical model. Social science &medic<strong>in</strong>e, 54, 433-443.Claibourne, M. C. (2003). Thanatologic realization and life <strong>in</strong>tegration: a study of thedy<strong>in</strong>g experience and how people prepare for death. Doctoral dissertation,USA.Coberly, M. & Shapiro, S. I. (1998). A transpersonal approach to care of the dy<strong>in</strong>g.Journal of transpersonal psychology, 30(1), 1-37.Cohen, S. R. & Leis, A. (2002). What determ<strong>in</strong>es the quality of life of term<strong>in</strong>ally illcancer patients from their own perspective? Journal of palliative care, 18(1),48-58.Corr, C. A., Doka, K. J. & Kastenbaum, R. (1999). Dy<strong>in</strong>g and its <strong>in</strong>terpreters: a reviewof selected literature and some comments on the state of the field. Omega,39(4), 239-259.Corr, C. A., Nabe, C. M. & Corr, D. M. (2003). Death and dy<strong>in</strong>g, life and liv<strong>in</strong>g.Belmont: Wadsworth/Thomson Learn<strong>in</strong>g.Cov<strong>in</strong>sky, K. E., Goldman, L., Cook, F. E., Oye, R., Desbiens, N., Red<strong>in</strong>g, D.et al.(1994). The impact of serious illness on patients' families. Journal of theAmerican Medical Association, 272(23), 1839-1844.Danish, S. J. & D'Augelli, A. R. (1995). Kompetenzerhöhung als Ziel <strong>der</strong> Intervention<strong>in</strong> Entwicklungsverläufe über die Lebensspanne. In S.-H. Filipp (Hrsg.),Kritische Lebensereignisse (S. 156-173). We<strong>in</strong>heim: Psychologie-VerlagsUnion.Dass, R. & Gorman, P. (1988): Wie kann ich helfen? Segen <strong>und</strong> Prüfung<strong>mit</strong>menschlicher Zuwendung. Berl<strong>in</strong>: Sadhana Verlag.
Literaturverzeichnis 208Davies, B. (2000). Anticipatory mourn<strong>in</strong>g and the transition to lov<strong>in</strong>g <strong>in</strong> absence. In T.A. Rando (Hrsg.), Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theory andpractice <strong>in</strong> work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers (S.135-154). Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.Davy, J. & Ellis, S. (2003). Palliativ pflegen. <strong>Sterben</strong>de verstehen, beraten <strong>und</strong>begleiten. Bern: Hans Huber.Diehl, J. M. & Staufenbiel, T. (2002). Statistik <strong>mit</strong> SPSS, Version 10+11. Eschborn:Klotz.D<strong>in</strong>kel, R. H. (2002). Die langfristige Entwicklung <strong>der</strong> Sterblichkeit <strong>in</strong> Deutschland.Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(5), 400-405.Dlugosch, G. E. & Krieger, W. (1995). Fragebogen zur Erfassung desGes<strong>und</strong>heitsverhaltens FEG. Frankfurt: Swets Test Services.Doka, K. J. (2000). Re-creat<strong>in</strong>g the mean<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the face of illness. In T. A. Rando(Hrsg.), Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theory and practice <strong>in</strong>work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers (S. 103-114).Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.dpa. (2003). B<strong>und</strong>esärztekammer-Präsident Hoppe: Sterbebegleitung verbessernVerfügbar unter: http://www.netdoktor.de/nachrichten/newsitem.asp?y=2003&m=5&d=19&id=97959 [19.05.03]Drees, A. (2003). Psychokatalytische Gespräche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Initiative zur Betreuung vonschwerst- <strong>und</strong> sterbenskranken K<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 25-26.Duda, D. (1989). Für Dich da se<strong>in</strong>, wenn Du stirbst: Vorschläge zur Betreuung.München: Hugendubel.Dunne, P. (1997). Dy<strong>in</strong>g well! - Issues for the liv<strong>in</strong>g? Australian and New ZealandJournal of Family Therapy, 18(1), 38-44.Eid, M. & Diener, E. (2002). Wohlbef<strong>in</strong>den. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H.Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S.634-637). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Eissler, K. R. (1978). Der sterbende Patient: zur Psychologie des <strong>Tod</strong>es. Stuttgart:Frommann-Holzboog.El<strong>der</strong>, G. H. J. (1995). The life course paradigm: social change and <strong>in</strong>dividualdevelopment. In P. Moen, G. H. J. El<strong>der</strong> & K. Lüscher (Hrsg.), Exam<strong>in</strong><strong>in</strong>g lives<strong>in</strong> context: perspectives on the ecology of human development (S. 101-140).Wash<strong>in</strong>gton: American Psychological Association.El<strong>der</strong>, G. H. J. (1998a). The life course and human development. In W. Damon & R.M. Lerner (Hrsg.), Handbook of child psychology (5. Auflage ed.). New York:John Wiley & Sons.El<strong>der</strong>, G. H. J. (1998b). The life course as developmental theory. Child Development,69(1), 1-12.Erlemeier, N. (1995). <strong>Soziale</strong> Unterstützung bei <strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung ältererMenschen <strong>mit</strong> Belastungen. In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.),Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 253-262). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Esserman, L., Belkora, J. & Lenert, L. (1995). Potentially <strong>in</strong>effective care: a newoutcome to assess the li<strong>mit</strong>s of critical care. Journal of the American MedicalAssociation, 274(19), 1544-1551.Fahrmeier, L., et al. (1999). Statistik. Der Weg zur Datenanalyse (2. Auflage). Berl<strong>in</strong>:Spr<strong>in</strong>ger.Fairbairn, G. (1991). Enforced death: enforced life. Journal of medical ethics, 17,144-149.
Literaturverzeichnis 209Fässler-Weibel, P. (1997b). Seelische Schmerzen erkennen. In P. Fässler-Weibel(Hrsg.), <strong>Sterben</strong>de verstehen lernen (S. 52-75). Freiburg/Schweiz:Paulusverlag.Fässler-Weibel, P. (Hrsg.). (1997a). <strong>Sterben</strong>de verstehen lernen. Freiburg/Schweiz:Paulusverlag.Feigenberg, L. (1980). Term<strong>in</strong>al care: friendship contracts with dy<strong>in</strong>g cancer patients.New York: Brunner/Mazel.Feith, G. M., Ochsmann, R., Kle<strong>in</strong>, T., Seibert, A. & Slangen, K. (2001). HäuslicheBetreuung <strong>Sterben</strong>skranker: Die Bedeutung <strong>der</strong> Beziehung für die Trauer <strong>der</strong>Betreuungsperson Verfügbar unter: www.uni-ma<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft10.htm [17.07.2001]Feldmann, K. (1997). <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>. Sozialwissenschaftliche Theorien <strong>und</strong>Forschungsergebnisse. Opladen: Leske <strong>und</strong> Budrich.Filipp, S.-H. (1995). E<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es Modell für die Analyse kritischerLebensereignisse. In S.-H. Filipp (Hrsg.), Kritische Lebensereignisse (S. 3-53).We<strong>in</strong>heim: PVU.Filipp, S.-H. (1997). Geleitwort. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G. Schwarz(Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. VII-VIII). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Filipp, S.-H. (2002). Kritische Lebensereignisse. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H.Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S.345-348). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Filipp, S.-H. & Ferr<strong>in</strong>g, D. (2002). Vergleichsprozesse <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung <strong>mit</strong>schweren körperlichen Erkrankungen. Psychotherapie im Dialog, 3(1), 2-12.Flammer, E. (1996). Die Angst vor dem <strong>Sterben</strong> verstehen. In H. Beutel & D. Tausch(Hrsg.), <strong>Sterben</strong> - e<strong>in</strong>e Zeit des Lebens: e<strong>in</strong> Handbuch <strong>der</strong> Hospizbewegung.(4. Auflage ed., S. 16-22). Stuttgart: Quell Verlag.Flammer, E. & Tausch-Flammer, D. (1992). Die personzentrierten E<strong>in</strong>stellungen <strong>in</strong><strong>der</strong> Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>. Jahrbuch für personenzentrierte Psychologie <strong>und</strong>Psychotherapie, 3, 132-143.Flick, U. (2002). Psychosoziale Belastung durch Pflege. In R. Schwarzer, M.Jerusalem & H. Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong>Handwörterbuch (S. 392-394). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Fliege, H. & Filipp, S.-H. (2000). Subjektive Theoren zu Glück <strong>und</strong> Lebensqualität:Ergebnisse explorativer Interviews <strong>mit</strong> 65- bis 74jährigen. Zeitschrift fürGerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 33, 307-313.Franke, A. (1997). Zum Stand <strong>der</strong> konzeptionellen <strong>und</strong> empirischen Entwicklung desSalutogenesekonzepts. In A. Antonovsky (Hrsg.), Salutogenese: zurEntmystifizierung <strong>der</strong> Ges<strong>und</strong>heit (S. 169-215). Tüb<strong>in</strong>gen: DeutscheGesellschaft für Verhaltenstherapie.Frankl, V. E. (1982). Der Wille zum S<strong>in</strong>n: ausgewählte Vorträge über Logotherapie(3. Auflage). Bern: Huber.Frankl, V. E. (1983). Das Leiden am s<strong>in</strong>nlosen Leben (7. Auflage). Freiburg: Her<strong>der</strong>.Freudenberg, E. & Filipp, S.-H. (1998). Bewältigungsprozesse bei chronischenErkrankungen. Psychomed, 10(1), 14-17.Fre<strong>und</strong>, A. & Riediger, M. (2003). Successful ag<strong>in</strong>g. In R. M. Lerner, M. A.Easterbrooks & J. Mistry (Hrsg.), Handbook of psychology: Volume 6 -developmental psychology (S. 601-628). New York: John Wiley & Sons.
Literaturverzeichnis 210Ganz<strong>in</strong>i, L. (2002). Experiences of Oregon nurses and social workers with hospicepatiens who requested assistance with suicide. The New England Journal ofMedic<strong>in</strong>e, 347(8), 582-588.Geiss, G. & Belschner, W. (2003). Was be- <strong>und</strong> was entlastet Menschen <strong>in</strong> kritischenKrankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen? Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 16-17.Geiss, G. & Belschner, W. (2004). Zwischenbericht zum Forschungsprojekt "Be- <strong>und</strong>Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits- <strong>und</strong> Sterbeprozessen".Oldenburg: Carl-von-Ossietzky-Universität, Institut für Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong>Kl<strong>in</strong>ische Psychologie.Geiss, G., Belschner, W. & Oldenbourg, R. (2005). "Ohne me<strong>in</strong>en Glauben könnteich diese Arbeit hier nicht tun." Hat die spirituelle Orientierung Auswirkungenauf die subjektive Belastetheit bei Menschen, die professionell <strong>mit</strong> sterbendenPatienten zu tun haben? Transpersonale Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie,11(2), 42-56.Gennep, A. v. (1960). The rites of passage: a classic study of cultural celebrations.Chicago: The University of Chicago Press.Goos-Detjen, B. (<strong>in</strong> Vorbereitung). Die Beziehung zwischen kritisch krankenPatienten <strong>und</strong> ihren Angehörigen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en krankheitsbed<strong>in</strong>gte Verändung.Diplomarbeit, Carl-von-Ossietzky-Universität, Oldenburg.Graf, G. & Roß, J. (2003). Brauchen wir Qualitätssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizarbeit? DieHospiz-Zeitschrift, 17(5), 14-15.Gräser, S. (2003). Hochschule <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit: Salutogenese am ArbeitsplatzUniversität. Opladen: Lengerich.Greve, W. (1997a). Sparsame Bewältigung - Perspektiven für e<strong>in</strong>e ökonomischeTaxonomie von Bewältigungsformen. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G.Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 18-41). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Greve, W. (1997b). Bewältigungsforschung zwischen Praxis <strong>und</strong> Erkenntnis: wozusuchen wir nach welcher Art von E<strong>in</strong>sicht? In C. Tesch-Römer, C. Salewski &G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 67-73). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Grimm, D. (2004). Belastungen <strong>und</strong> Entlastungen bei kritisch kranken Menschen <strong>und</strong>ihrem direkten Umfeld: e<strong>in</strong>e qualitative Auswertung im Rahmen desForschungsprojektes "Be- <strong>und</strong> Entlastungsfaktoren <strong>in</strong> kritischen Krankheits<strong>und</strong>Sterbeprozessen". Diplomarbeit, Carl-von-Ossietzky-Universität,Oldenburg.Grob, P. (1997). Angstbereitschaft <strong>und</strong> Angstabwehr. In P. Fässler-Weibel (Hrsg.),<strong>Sterben</strong>de verstehen lernen (S. 11-39). Freiburg/ Schweiz: Paulusverlag.Grof, S. (1996). Die Erfahrung von <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>: psychologische, philosophische<strong>und</strong> spirituelle Aspekte. Transpersonale Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie,2(2), 72-93.Großkopf, V. & Schanz, M. (2003). Die F<strong>in</strong>anzierung ambulanter <strong>und</strong> stationäreHospize. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 23-24.Gyger-Stauber, K. (1997). Durch Liebe überfor<strong>der</strong>t, durch Liebe gefor<strong>der</strong>t. In P.Fässler-Weibel (Hrsg.), <strong>Sterben</strong>de verstehen lernen (S. 100-120).Freiburg/Schweiz: Paulusverlag.Haase, I. & Schwefel, D. (1995). Bedarfs- <strong>und</strong> Bedürfnisforschung imGes<strong>und</strong>heitswesen. In F. W. Schwartz, B. Badura, B. Blanke, K.-D. Henke, U.
Literaturverzeichnis 211Koch & R. Müller (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung <strong>in</strong> Deutschland (S. 37-42). We<strong>in</strong>heim: VCH Verlagsgesellschaft.Hacker, W. & Re<strong>in</strong>hold, S. (1999). Beanspruchungsscreen<strong>in</strong>g bei HumandienstleistungenBHD-System. Frankfurt: Swets Tests Services.Hall, M. & Irw<strong>in</strong>, M. (2001). Physiological <strong>in</strong>dices of function<strong>in</strong>g <strong>in</strong> bereavement. In M.S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe & H. Schut (Hrsg.), Handbook ofbereavement research: consequences, cop<strong>in</strong>g and care (S. 473-492).Wash<strong>in</strong>gton DC: APA.Hannich, H.-J. (2002). Psychosoziale Begleitung Schwerstkranker <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>. InE. Brähler & B. Strauß (Hrsg.), Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychosozialen Mediz<strong>in</strong>(S. 398-406). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Hard<strong>in</strong>ghaus, W., Rogner, J. & Meyer, B. (1999). Zur Qualität <strong>und</strong> Identität vonSterbebegleitung im Krankenhaus am Beispiel des Palliativprojektes SPESVIVA. Das Ges<strong>und</strong>heitswesen, 61, 203-206.Häuser, W. & Kle<strong>in</strong>, W. (2002). Gespräche über das Lebensende. Familiendynamik,27(4), 367-393.Heijden, G. v. d. (2006). Butterfly effect Verfügbar unter: www.ucl.ac.uk/~ucesgvd/butterfly.pdf [28.09.2006]He<strong>in</strong>ke, N. (2002). Last <strong>und</strong> Bereicherung: Pflegende Angehörige erfahren S<strong>in</strong>n <strong>und</strong>Anerkennung - doch die psychischen <strong>und</strong> physischen Strapazen s<strong>in</strong>d enorm.Psychologie heute, 6, 55.Helmert, R. & Voges, W. (2002). E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Mortalitätsentwicklung bei50- bis 69-jährigen Frauen <strong>und</strong> Männern <strong>in</strong> Westdeutschland im Zeitraum1984-1998. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(5), 450-462.Herrle<strong>in</strong>, P. (2003). Qualität <strong>und</strong> Lebbarkeit: E<strong>in</strong>e Problemskizze. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 18-19.Hess, T., Spichiger, E., Bucher, C. & Otto, S. (1998). <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kl<strong>in</strong>ik:Die wenigsten sterben alle<strong>in</strong>. Krankenpflege, 11, 17-21.H<strong>in</strong>ton, J. (1999). The progress of awareness and acceptance of dy<strong>in</strong>g assessed <strong>in</strong>cancer patiens and their car<strong>in</strong>g relatives. Palliative Medic<strong>in</strong>e, 13, 19-35.Hörl, C. (Hrsg.). (1999). Brücke <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Welt: was h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Hospiz-Ideesteht. Freiburg: Her<strong>der</strong>.Horlacher, K. D. (2000). Kritische Lebensereignisse. In M. Amelang (Hrsg.),Determ<strong>in</strong>anten <strong>in</strong>dividueller Unterschiede (S. 455-486). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Hottes, S. (2005). Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner Verfügbar unter:http://wwwnetzwelt_de/lexikon/ökosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner.html [14.02.2005]Höver, G. (2003). Neue Herausfor<strong>der</strong>ungen für die Qualitätssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospiz<strong>und</strong>Palliativarbeit. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 4-7.Howe, J. (1995). Sterbebeistand: Orientierung an den Erwartungen <strong>und</strong> Bedürfnissen<strong>der</strong> Betroffenen. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 28, 252-259.Huecker, N. N. (2005). Glossar Verfügbar unter: http://www.huecker.com/nlp/glossar.shtml [17.07.2006]Hultsch, D. F. & Cornelius, S. W. (1995). Kritische Lebensereignisse <strong>und</strong> lebenslangeEntwicklung: Methodologische Aspekte. In S.-H. Filipp (Hrsg.), KritischeLebensereignisse (S. 72-92). We<strong>in</strong>heim: PsychologieVerlagsUnion.Ita, D. J. (1995). Test<strong>in</strong>g of a causal model: acceptance of death <strong>in</strong> hospice patients.Omega, 32(2), 81-90.
Literaturverzeichnis 212Jäger, W. (1992). Suche nach dem S<strong>in</strong>n des Lebens: Bewusstse<strong>in</strong>swandel durch denWeg nach <strong>in</strong>nen. (2. Auflage). Petersberg: Via Nova.Jäger, W. (2000). Die Welle ist das Meer: mystische Spiritualität (6. Auflage).Freiburg: Her<strong>der</strong>.Jan<strong>der</strong>, L. (1993). Geme<strong>in</strong>sam gegen die Verzweiflung: Gespräche über das Leben<strong>mit</strong> Schwerstkranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den. Freiburg: Her<strong>der</strong>.Jaspers, K. (1932). Philosophie - Existenzerhellung. Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger.Jerusalem, M. (1997). Grenzen <strong>der</strong> Bewältigung. In C. Tesch-Römer, C. Salewski &G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 261-271). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (1999). Allgeme<strong>in</strong>e Selbstwirksamkeit Verfügbarunter: http://www.fu-berl<strong>in</strong>.de/ges<strong>und</strong>/skalen/Allgeme<strong>in</strong>e-Selbstwirksamkeit.htm [20.03.2003]Kalua, P. M., Tan, S. Y. & Bacon, J. G. (1999). Better care for a dy<strong>in</strong>g: Hawaiihealthcare system develops a manual for end-of-life care. Health progress,80(2), 58-61.Kaluza, J. & Töpferwe<strong>in</strong>, G. (2001a). An manchen Tagen ist es wirklich schlimm...Pflege aktuell, 11, 586-589.Kaluza, J. & Töpferwe<strong>in</strong>, G. (2001b). Gegen die Uhr: Forschungsprojekt zurSterbebegleitung <strong>in</strong> sächsischen Altenpflegeheimen. Heim <strong>und</strong> Pflege, 7, 257-259.Kaluza, J. & Töpferwe<strong>in</strong>, G. (2001c). Würdevoller Umgang <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den.Heilberufe, 11, 70-71.Karl, A. (1989). Sterbebegleitung als Aufgabe <strong>der</strong> Krankenschwester. In J.-C.Student (Hrsg.), Das Hospiz-Buch (S. 57-62). Freiburg: Lambertus.Kast, V. (1987). Trauern. Phasen <strong>und</strong> Chancen des psychischen Prozesses (8.Auflage). Stuttgart: Kreuz Verlag.Kast, V. (2000). Sich e<strong>in</strong>lassen <strong>und</strong> loslassen (16. Auflage). Freiburg: Her<strong>der</strong>.Kast, V. (2004). Die Kunst, sich dem Strom des Lebens zu überlassen. PsychologieHeute, 8, 26-30.Kastenbaum, R. (1996). Cookies bak<strong>in</strong>g, coffee brew<strong>in</strong>g: toward a contextual theoryof dy<strong>in</strong>g (dt. Übersetzung) (Beiträge zur Thanatologie, Heft 2) Verfügbar unter:http://www.uni-ma<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft2.htm[16.08.2004]Kastenbaum, R. (2004). On our way: the f<strong>in</strong>al passage through life and death.Berkeley: University of California Press.Kaut, K. P. (2002). Religion, spirituality, and existentialism near the end of life.American behavioural scientist, 46(2), 220-234.Kearney, M. (2000). Spiritual care of the dy<strong>in</strong>g patient. In H. M. Choch<strong>in</strong>ov & W.Breitbart (Hrsg.), Handbook of psychiatry <strong>in</strong> palliative medic<strong>in</strong>e (S. 357-374).New York: Oxford University Press.Keil, A. (2004). Wenn Körper <strong>und</strong> Seele streiken: die Psychosomatik desAlltagslebens. Kreuzl<strong>in</strong>gen: Hugendubel.Keil, A. (2006). Dem Leben begegnen: Vom biologischen Überraschungsei zureigenen Biografie. Kreuzl<strong>in</strong>gen: Hugendubel.Keil, T. U. (2002). Was sich die <strong>Sterben</strong>den von den Lebenden wünschen. ZM,92(24), 50-51.Kelly, G. A. (1986). Die Psychologie persönlicher Konstrukte. Pa<strong>der</strong>born:Junfermann.
Literaturverzeichnis 213Kirchner, M. (2005). Persönliche E<strong>in</strong>stellungen als <strong>Ressourcen</strong> im Sterbeprozess: beikritisch-kranken Menschen, ihren Bezugspersonen <strong>und</strong> dem professionellbetreuendenTeam. Diplomarbeit, Carl-von-Ossietzky-Universität, Oldenburg.Kirk, P., Kirk, I. & Kristjanson, L. J. (2004). What do patients receiv<strong>in</strong>g palliative carefor cancer and their families want to be told? A Canadian and Australianqualitative study. BMJ, 328, 1343-1350.Klaschik, E. (1997). Umgang <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den heute (Beträge zur Thanatologie, Heft14) Verfügbar unter: http://www.uni-ma<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft%2014.htm [16.08.2004]Klaschik, E. & Nauck, F. (1992). Therapieerfahrung im stationären Palliativbereich. InA. Nassehi & R. Pohlmann (Hrsg.), <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (S. 55-64). Hamburg:LIT.Klaschik, E. & Nauck, F. (2003). Dokumentation <strong>und</strong> Qualitätssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong>Palliativmediz<strong>in</strong>. Die Hospiz-Zeitschrift, 17(5), 8-10.Klauer, T. (1997). Vom allgeme<strong>in</strong>en Adaptationssyndrom zum dyadischen Cop<strong>in</strong>g:Bemerkungen zu Vergangenheit <strong>und</strong> Zukunft <strong>der</strong> Beschreibung vonBelastungs-Bewältigungs-Prozessen. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G.Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 93-104). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Klauer, T. (2002). <strong>Soziale</strong> Unterstützung. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H. Weber(Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S. 543-546). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Kle<strong>in</strong>, T., Löwel, H., Schnei<strong>der</strong>, S. & Zimmermann, M. (2002). <strong>Soziale</strong> Beziehungen,Stress <strong>und</strong> Mortalität. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(5), 441-449.Kle<strong>in</strong>, T., Ochsmann, R., Feith, G. M., Seibert, A. & Slangen, K. (2001). HäuslicheBetreuung <strong>Sterben</strong>skranker: Zur Bedeutung <strong>in</strong>situtioneller <strong>und</strong> privater Hilfe(Beiträge zur Thanatologie, Heft 11) Verfügbar unter: http://www.unima<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft11.htm[17.07.2001]Klute, D. (1997). Der Geme<strong>in</strong>depastor <strong>und</strong> die <strong>Sterben</strong>skranken: qualitativempirischeStudie über Seelsorge im Sterbezusammenhang am Beispiel <strong>der</strong>Pastoren e<strong>in</strong>es Dorfes. Hamburg: Dr. Kovac.Köper, B. (2001). Neue Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Beanspruchung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Flugsicherungdurch mo<strong>der</strong>ne technische Systeme. Dortm<strong>und</strong>.Kornfield, J. (2005). Enlightenments. Beatenberg: Dharma Tapes.Kraimer, K. & Garz, D. (Hrsg.). (1991). Qualitativ-empirische Sozialforschung:Konzepte, Methoden, Analysen. Opladen: Westdeutscher Verlag.Krampen, G. (1991). Fragebogen zu Kompetenz- <strong>und</strong> Kontrollüberzeugungen FKK.Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Krauß, O. (2000). Konstruktion <strong>und</strong> Evaluation e<strong>in</strong>es Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramms zumUmgehen <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den <strong>und</strong> ihren Angehörigen. Zeitschrift fürGes<strong>und</strong>heitspsychologie, 9, 177-197.Krischke, N. R. (1996). Lebensqualität <strong>und</strong> Krebs. München: Qu<strong>in</strong>tessenz.Kruse, A. (1995). Menschen im Term<strong>in</strong>alstadium <strong>und</strong> ihre betreuenden Angehörigenals " Dyade": Wie erleben sie die Endlichkeit des Lebens, wie setzen sie sich<strong>mit</strong> dieser ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>? Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 28(4), 264-272.
Literaturverzeichnis 214Kruse, A. (1996). Wie erleben ältere Menschen den herannahenden <strong>Tod</strong>? InB<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie Senioren Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.), <strong>Sterben</strong><strong>und</strong> Sterbebegleitung (S. 139-162). Stuttgart: Kohlhammer.Kruse, A., Kröhn, R., Langerhans, G. & Schnei<strong>der</strong>, C. (1992). Konflikt- <strong>und</strong>Belastungssituationen <strong>in</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Altenhilfe <strong>und</strong>Möglichkeiten ihrer Bewältigung (Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums fürFamilie <strong>und</strong> Senioren, Band 2). Stuttgart: Kohlhammer.Kruse, A. & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (1995). <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> Sterbebegleitung. In A. Kruse& R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 289-300).Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Kruse, A. & Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (Hrsg.). (1995). Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter.Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Kruse, J. (1997). Der sterbende Patient. In W. Tress (Hrsg.), PsychosomatischeGr<strong>und</strong>versorgung: Kompendium <strong>der</strong> <strong>in</strong>terpersonellen Mediz<strong>in</strong> (S. 195-199).Stuttgart: Schattauer.Kübler-Ross, E. (1989). Vorwort. In J.-C. Student (Hrsg.), Das Hospiz-Buch (S. 7-8).Freiburg: Lambertus.Kübler-Ross, E. (1995). <strong>Sterben</strong> lernen - Leben lernen (5. Auflage). Güllesheim:Silberschnur.Kübler-Ross, E. (1997). Sehnsucht nach Hause. Güllesheim: Silberschnur.Kuckartz, U. (1999). Computergestütze Analyse qualitativer Daten: e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung<strong>in</strong> Methoden <strong>und</strong> Arbeitstechniken. Opladen/Wiesbaden.Laireiter, A.-R. (2002). <strong>Soziale</strong>s Netzwerk. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H.Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S.546-550). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Laireiter, A.-R. (Hrsg.). (1993). <strong>Soziale</strong>s Netzwerk <strong>und</strong> soziale Unterstützung:Konzepte, Methoden <strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>e. Bern: Huber.Lakotta, B. (2003). Noch mal leben vor dem <strong>Tod</strong>. Spiegel, 26, 126-132.Laux, L. (1995). Die Integration idiographischer <strong>und</strong> nomothetischerPersönlichkeitspsychologie. In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.),Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 15-25). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Lazarus, R. S. (1995). Streß <strong>und</strong> Streßbewältigung - e<strong>in</strong> Paradigma. In S.-H. Filipp(Hrsg.), Kritische Lebensereignisse (S. 198-232). We<strong>in</strong>heim: PsychologieVerlagsUnion.Lazarus, R. S. & Folkmann, S. (1987). Transactional theory and research onemotions and cop<strong>in</strong>g. European Journal of Personality, 1, 141-169.Lehr, U. (1995). Zur Geschichte <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie <strong>der</strong> Lebensspanne. InA. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 3-15). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Lepp<strong>in</strong>, A. (1997). Stresse<strong>in</strong>schätzung, Cop<strong>in</strong>gverhaltung <strong>und</strong> Cop<strong>in</strong>gerfolg: WelcheRolle spielen <strong>Ressourcen</strong>? In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G. Schwarz(Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 196-208). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Levend, H. (2006). Selbstbestimmtes <strong>Sterben</strong> - e<strong>in</strong>e Illusion? Psychologie Heute, 7,42-47.Lev<strong>in</strong>e, S. (1997a). Se<strong>in</strong> lassen. Heilung im Leben <strong>und</strong> im <strong>Sterben</strong>. Bielefeld: ContextVerlag.Lev<strong>in</strong>e, S. (1997b). Wege durch den <strong>Tod</strong>: who dies. (4. Auflage). Bielefeld: ContextVerlag.
Literaturverzeichnis 215Lohn<strong>in</strong>ger, H. (2006). Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Statistik Verfügbar unter:http://www.statistics4u.com/f<strong>und</strong>stat_germ/<strong>in</strong>dex.htmlLonergan, B. J. F. (1958). Insight: a study of human un<strong>der</strong>stand<strong>in</strong>g. New York:Philosophical Library.Lutterotti, M. v. (1989). Sterbebegleitung als Aufgabe des Arztes. In J.-C. Student(Hrsg.), Das Hospiz-Buch (S. 44-56). Freiburg: Lambertus.Magnusson, D. (2003). The Person Approach: concepts, measurement models, andresearch strategy. New directions for child and adolescent development, 101,3-23.Magnusson, D. & Statt<strong>in</strong>, H. (1998). Person-context <strong>in</strong>teraction theories. In R. M.Lerner (Hrsg.), Handbook of child psychology. Vol. 1: Theoretical models ofhuman development (S. 685-759). New York: John Wiley & Sons.Maier, H. & S<strong>mit</strong>h, J. (1999). Psychological predictors of mortality <strong>in</strong> old age. Journalof Gerontology, 54(1), 44-54.Makowka, E. (1998). Humanes <strong>Sterben</strong> im Krankenhaus. Münster: LIT.Mallett, K., Price, J. H., Jurs, S. G. & Slenker, S. (1991). Relationship among burnout,death anxiety, and social support <strong>in</strong> hospice and critical care nurses.Psychological Reports, 68, 1347-1359.Markus, H. R. & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications of cognition,emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224-253.Marrone, R. (1999). Dy<strong>in</strong>g, mourn<strong>in</strong>g, and spirituality: a psychological perspective.Death studies: education, counsel<strong>in</strong>g, care, law, ethics, 23(6), 495-519.Marwick, C. (2003). More <strong>in</strong>formation needed about experience of dy<strong>in</strong>g, report says.BMJ, 326, 784.Mayer, A.-K. & Filipp, S.-H. (2002). Krankheitsbewältigung. In R. Schwarzer, M.Jerusalem & H. Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong>Handwörterbuch (S. 307-309). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Mayr<strong>in</strong>g, P. (1995). Qualitative Inhaltsanalyse: Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Techniken (5.Auflage). We<strong>in</strong>heim: Deutscher Studien Verlag.Mayr<strong>in</strong>g, P. (1996). E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die qualitativeSozialforschung: E<strong>in</strong>e Anleitung zuqualitativem Denken. We<strong>in</strong>heim: Psychologie Verlags Union.Meier, D. E. (2004). Variability <strong>in</strong> end of life care. BMJ, 328, 296-297.Mennemann, H. (1998). <strong>Sterben</strong> lernen heißt leben lernen: Sterbebegleitung aussozialpädagogischer Perspektive. Münster: LIT.Merod, R. (2004). Trauer, <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>. Verhaltenstherapie <strong>und</strong> psychosozialePraxis, 36(4), 807-820.Merten, K. (1995). Inhaltsanalyse: E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Theorie, Methode <strong>und</strong> Praxis (2.Auflage). Opladen: Westdeutscher Verlag.Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInnen<strong>in</strong>terview - vielfach erprobt, wenigbedacht. E<strong>in</strong> Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz & K.Kraimer (Hrsg.), Qualitativ-empirische Sozialforschung (S. 441-471). Opladen:Westdeutscher Verlag.M<strong>in</strong>nemann, E. & Sch<strong>mit</strong>t, E. (1995). Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Diskont<strong>in</strong>uität als Konzeptebiographischer Alternsforschung. In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.),Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 93-106). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Moen, P., El<strong>der</strong>, G. H. J. & Lüscher, K. (Hrsg.). (1995). Exam<strong>in</strong><strong>in</strong>g lives <strong>in</strong> context:perspectives on the ecology of human development. Wash<strong>in</strong>gton: AmericanPsychological Association.
Literaturverzeichnis 216Montada, L. (1995). Kritische Lebensereigsnisse im Brennpunkt: e<strong>in</strong>eEntwicklungsaufgabe für die Entwicklungspsychologie? In S.-H. Filipp (Hrsg.),Kritische Lebensereignisse (S. 272-292). We<strong>in</strong>heim:PsychologieVerlagsUnion.Mummendey, H. D. (1999). Die Fragebogen-Methode: Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Anwendung<strong>in</strong> Persönlichkeits-, E<strong>in</strong>stellungs- <strong>und</strong> Selbstkonzeptforschung (3. Auflage).Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe-Verlag.Muthny, F. A. (1997). Cop<strong>in</strong>g am Beispiel <strong>der</strong> Krankheitsverarbeitung: HoheErwartungen, tiefe Enttäuschungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Morgen danach. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S.58-66). We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.Nestmann, F. & Schmerl, C. (Hrsg.). (1991). Frauen - das hilfreiche Geschlecht:Dienst am Nächsten o<strong>der</strong> soziales Expertentum? Hamburg: Rowohlt.Nuland, S. B. (1994). Wie wir sterben: E<strong>in</strong> Ende <strong>in</strong> Würde? München: K<strong>in</strong>dler.Ochsmann, R., Slagen, K., Feith, G. M., Kle<strong>in</strong>, T. & Seibert, A. (2001). Sterbeorte <strong>in</strong>Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz: Zur Demographie des <strong>Tod</strong>es (Beiträge zur Thanatologie, Heft8) Verfügbar unter: http://www.uni-ma<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft8.htm [17.07.2001]Ohi, G. (1995). Ethicals orientations and dignified death. Psychiatry and cl<strong>in</strong>icalneurosciences, 49(1), 155-159.Olbrich, E. (1995). Normative Übergänge im menschlichen Lebenslauf:Entwicklungskrisen o<strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen? In S.-H. Filipp (Hrsg.), KritischeLebensereignisse (S. 123-139). We<strong>in</strong>heim: PsychologieVerlagsUnion.Olbrich, E. (1997). Die Grenzen des Cop<strong>in</strong>g. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G.Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 230-246). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Olbrich, E. & Pöhlmann, K. (1995). Prozess <strong>und</strong> Interaktion <strong>in</strong> <strong>der</strong> Persönlichkeits<strong>und</strong>Entwicklungspsychologie. In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.),Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 81-93). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Oldenbourg, R. (<strong>in</strong> Vorbereitung). <strong>Soziale</strong> Unterstützung im Kontext von <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong><strong>Tod</strong> - bei PatientInnen, Bezugspersonen <strong>und</strong> Professionellen. Diplomarbeit,Carl-von-Ossietzky-Universität, Oldenburg.Oorschot, B. v. (2002). <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> Sterbebegleitung <strong>in</strong> Thür<strong>in</strong>gen. Ergebnisse e<strong>in</strong>erRepräsentativbefragung <strong>und</strong> Werkstattbericht aus dem Modellvorhaben"Patienten als Partner" <strong>in</strong> Jena. Ärzteblatt Thür<strong>in</strong>gen, 13(11), 663-665.Pampaluchi-Wick, J. (1997). Kommunikation im System des Kranken. In P. Fässler-Weibel (Hrsg.), <strong>Sterben</strong>de verstehen lernen (S. 127-137). Freiburg/Schweiz:Paulusverlag.Payne, S. A. & Langley-Evans, A. (1996). Perceptions of a "good" death: acomparative study of the view of hospice staff and patients. PalliativeMedic<strong>in</strong>e, 10(4), 307-312.Petzold, H. (2003). Lebensgeschichten erzählen: Biographiearbeit - narrativeTherapie - Identität. Pa<strong>der</strong>born: Junfermann.Pierce, G. R., Sarason, B. R., Sarason, I. G., Joseph, H. J. & Hen<strong>der</strong>son, C. A.(1996). Conceptualiz<strong>in</strong>g and assess<strong>in</strong>g social support <strong>in</strong> the context of thefamily. In G. R. Pierce, B. R. Sarason & I. G. Sarason (Hrsg.), Handbook ofsocial support and the family (S. 3-23). New York: Plenum Press.Piper, H.-C. (1984a). Gespräche <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong>den (3. Auflage). Gött<strong>in</strong>gen:Vandenhoeck <strong>und</strong> Ruprecht.
Literaturverzeichnis 217Piper, H.-C. (1984b). Seelsorgerische Erfahrungen. In P. Becker & V. Eid (Hrsg.),Begleitung von Schwerkranken <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>den: Praktische Erfahrungen <strong>und</strong>wissenschaftliche Reflexionen (S. 57-68). Ma<strong>in</strong>z: Matthias-Grünewald-Verlag.Piper, H.-C. (1989). Der Seelsorger als Betreuer des sterbenden Mitmenschen <strong>und</strong>se<strong>in</strong>er Familie. In J.-C. Student (Hrsg.), Das Hospiz-Buch (S. 73-80). Freiburg:Lambertus.Pruchno, R. & Rosenbaum, J. (2003). Social relationships <strong>in</strong> adulthood and old age.In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks & J. Mistry (Hrsg.), Handbook ofpsychology: Volume 6 - Developmental psychology (S. 487-509). New York:John Wiley & Sons.Rabow, M. W., Hardie, G. E., Fair, J. M. & McPhee, S. J. (2000). End-of-life carecontent <strong>in</strong> 50 textbooks from multiple specialties. Journal of the AmericanMedical Association, 283(6), 771-778.Rando, T. A. (2000a). Anticipatory mourn<strong>in</strong>g: a review and critique of the literature. InT. A. Rando (Hrsg.), Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theory andpractice <strong>in</strong> work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers (S.17-50). Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.Rando, T. A. (2000c). The six dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g. In T. A. Rando(Hrsg.), Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theory and practice <strong>in</strong>work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers (S. 51-102).Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.Rando, T. A. (Hrsg.). (2000b). Cl<strong>in</strong>ical dimensions of anticipatory mourn<strong>in</strong>g: theoryand practice <strong>in</strong> work<strong>in</strong>g with the dy<strong>in</strong>g, their loved ones, and their caregivers.Ill<strong>in</strong>ois: Research Press.Reddemann, L., Engl, V. & Lücke, S. (2003). Imag<strong>in</strong>ation als heilsame Kraft (11.Auflage): Klett-Cotta.Rest, F. (1981). Den <strong>Sterben</strong>den beistehen. Heidelberg: Quelle <strong>und</strong> Meyer.Rest, F. (1992). Sterbebeistand, Sterbebegleitung, Sterbegeleit: Studienbuch fürKrankenpflege, Altenpflege <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.Rest, F. (2001). "<strong>Tod</strong>" als Konstrukt des lebenden Menschen. Über die spirituelleSicht des <strong>Sterben</strong>s. In M. Schlagheck (Hrsg.), Theologie <strong>und</strong> Psychologie imDialog über <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> (S. 103-144). Pa<strong>der</strong>born: Bonifatius.Rieckmann, N. (2002). Resilienz, Wi<strong>der</strong>standsfähigkeit, Hard<strong>in</strong>ess. In R. Schwarzer,M. Jerusalem & H. Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong>Handwörterbuch (S. 462-465). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Ritter-Gekeler, M. (1992). Lebens- <strong>und</strong> Sterbekrisen. Untersuchungen zurEntwicklung <strong>der</strong> Bewältigungskonzepte <strong>in</strong> Psychologie <strong>und</strong> Sterbeforschung.We<strong>in</strong>heim: Juventa.Rogers, C. & Schmid, P. F. (1998). Person-zentriert: Gr<strong>und</strong>lagen von Theorie <strong>und</strong>Praxis (3. Auflage). Ma<strong>in</strong>z: Matthias-Grünewald-Verlag.Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). Arbeitswissenschaftliche Beurteilung <strong>der</strong>Belastung <strong>und</strong> Beanspruchung an unterschiedlichen <strong>in</strong>dustriellenArbeitsplätzen. Bonn: Referat für Öffentlichkeitsarbeit.Ross, M. M. (1998). Palliative Care: an <strong>in</strong>tegral part of life's end. The Canadiannurse, 94(8), 28-31.R<strong>und</strong>e, P. & Giese, R. (2004). Wer wird künftig Vater <strong>und</strong> Mutter pflegen? FrankfurterR<strong>und</strong>schau, 87, 9-10.Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Be<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Adult Life. Current Directions <strong>in</strong>Psychological Science, 4, 99-104.
Literaturverzeichnis 218Salewski, C. (1997). Formen <strong>der</strong> Krankheitsverarbeitung. In C. Tesch-Römer, C.Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 42-57).We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.Sarason, B. R., Pierce, G. R. & Sarason, I. G. (Hrsg.). (1990). Social support: an<strong>in</strong>teractional view. New York: Wiley & Sons.Saun<strong>der</strong>s, C. (1999). Brücke <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Welt: was h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Hospiz-Idee steht.Freiburg: Her<strong>der</strong>.Saun<strong>der</strong>s, C. (Hrsg.). (1993). Hospiz <strong>und</strong> Begleitung im Schmerz: Wie wir s<strong>in</strong>nloseApparatemediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> e<strong>in</strong>sames <strong>Sterben</strong> vermeiden können (4. Auflage ed.).Freiburg: Her<strong>der</strong>.Saun<strong>der</strong>s, C. & Ba<strong>in</strong>es, M. (1991). Leben <strong>mit</strong> dem <strong>Sterben</strong>: Betreuung <strong>und</strong>mediz<strong>in</strong>ische Behandlung todkranker Menschen. Bern: Hans Huber.Schaeffer, D. & Ewers, M. (Hrsg.). (2002). Ambulant vor stationär: Perspektiven füre<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte ambulante Pflege Schwerkranker. Bern: Huber.Schermer Sellers, T. (2000). A model of collaborative health care <strong>in</strong> outpatiensmedical oncology. Families, systems & health: the journal of collaborativefamily health care, 18, 19-33.Schlömer-Doll, U. & Schlömer-Doll, D. (1996). Zeit <strong>der</strong> Hoffnung - Zeit <strong>der</strong> Angst:psychologische Begleitung von Krebspatienten. Wien, New York: Spr<strong>in</strong>ger.Schmidt-Denter, U. (2005). <strong>Soziale</strong> Beziehungen im Lebenslauf (4. Auflage).We<strong>in</strong>heim: Beltz.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (1989). Sterbebegleitung. In D. W. v. Goddenthow (Hrsg.), Mitdem <strong>Tod</strong>e leben: Sterbebegleitung <strong>und</strong> praktischer Rat (S. 69 -76). Freiburg:Her<strong>der</strong>.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (1992). <strong>Sterben</strong> heute. In R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Altern<strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> (S. 9-23). Bern: Hans Huber.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (1995a). Aspekte <strong>der</strong> menschlichen Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweitenLebenshälfte: Entwicklungskrisen, Entwicklungsaufgaben <strong>und</strong> Entwicklungsthemen.In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong>Lebensalter (S. 171-179). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (1995b). Sterbebegleitung - e<strong>in</strong>e Last für professionelle <strong>und</strong>familiäre Helfer? Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 28, 247-251.Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer, R. (2001). <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> Sterbebegleitung: Zum Wissensstand <strong>in</strong><strong>der</strong> Thanatologie. Psychoscope, 10, 6-10.Schnei<strong>der</strong>, B. (1993). Sterbebegleitung. Die Schwester/Der Pfleger, 6, 550-553.Schnei<strong>der</strong>, H.-D. (1995). Die soziale Umwelt im Alter als Ressource o<strong>der</strong> alsBelastung? In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong>Lebensalter (S. 263-270). Darmstadt: Ste<strong>in</strong>kopff.Schrö<strong>der</strong>, C. (2001). Psychosoziale Arbeit im Rahmen <strong>der</strong> palliativmediz<strong>in</strong>ischenVersorgung. In H. Schrö<strong>der</strong> & W. Hackhausen (Hrsg.), Persönlichkeit <strong>und</strong>Individualität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rehabilitation. Frankfurt: VAS.Schrö<strong>der</strong>, H., Schrö<strong>der</strong>, C., Förster, F. & Bänsch, A. (2003). Palliativstationen <strong>und</strong>Hospize <strong>in</strong> Deutschland: Belastungserleben, Bewältigungspotenzial <strong>und</strong>Religiosität <strong>der</strong> Pflegenden. Wuppertal: Hospiz Verlag.Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. (1997). <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> Prozess <strong>der</strong> Stressverarbeitung -Erkenntnisse <strong>und</strong> Folgerungen für die zukünftige Forschung. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S.221-229). We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.
Literaturverzeichnis 219Schrö<strong>der</strong>, K. E. E. & Schwarzer, R. (1997). Bewältigungsressourcen. In C. Tesch-Römer, C. Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S.174-195). We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.Schwarz, G., Salewski, C. & Tesch-Römer, C. (1997). Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung -Variationen über e<strong>in</strong> altbekanntes Thema? In C. Tesch-Römer, C. Salewski &G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 1-6). We<strong>in</strong>heim:Beltz/Psychologie Verlagsunion.Schwarzer, R. (1991). University of California Social Support Inventory - deutscheVersion Verfügbar unter: http://www.fu-berl<strong>in</strong>.de/ges<strong>und</strong>/skalen/UCLA-SSI_deutsch.htm [20.03.2003]Schwarzer, R. (2002a). Proaktive Bewältigung. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H.Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S.45-48). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Schwarzer, R. (2002b). Selbstwirksamkeitserwartung. In R. Schwarzer, M. Jerusalem& H. Weber (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch(S. 521-524). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Schwarzer, R. & Lepp<strong>in</strong>, A. (1992). Social support and mental health: a conceptualand empirical overview. In L. Montada, S.-H. Filipp & M. J. Lerner (Hrsg.), Lifecrises and experiences of loss <strong>in</strong> adulthood (S. 435-458). Hillsdale: LawrenceErlbaum Associates.Schwarzer, R. & Sch<strong>mit</strong>z, G. S. (1999). Proaktive E<strong>in</strong>stellung Verfügbar unter:http://www.fu-berl<strong>in</strong>.de/ges<strong>und</strong>/skalen/Proaktive-E<strong>in</strong>stellung.htm [20.03.2003]Schwarzer, R. & Schulz, U. (2000). Berl<strong>in</strong>er Social Support Skalen Verfügbar unter:http://www.fu-berl<strong>in</strong>.de/ges<strong>und</strong>/skalen/Berl<strong>in</strong>er-Social-Support-Skalen.htm[20.03.2003]Schweidtmann, W. (1995). Ethische Überzeugungen von Mitarbeitern <strong>und</strong> die Praxis<strong>der</strong> Sterbebegleitung. In W. H. Senf, G. (Hrsg.), Gesellschaftliche Umbrüche -Individuelle Antworten (S. 234-242). Frankfurt a.M.: VAS.Schweidtmann, W. (1996). Begleitung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Betreuung <strong>der</strong> Angehörigen.In S. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hrsg.), <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong>Sterbebegleitung (S. 109-112). Stuttgart: Kohlhammer.Seibert, A., Ochsmann, R., Feith, G. M. & Kle<strong>in</strong>, T. (2001a). Erfahrungenprofessioneller Helfer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Helfer im Umgang <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong>:E<strong>in</strong>stellungen zur Sterbehilfe (Beiträge zur Thanatologie, Heft 17) Verfügbarunter:http://www.uni-ma<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft17.htm [17.07.2001]Seibert, A., Ochsmann, R., Feith, G. M., Kle<strong>in</strong>, T. & Slangen, K. (2001b). HäuslicheBetreuung <strong>Sterben</strong>skranker: Zur Motivation <strong>der</strong> Familienangehörigen (Beiträgezur Thanatologie, Heft 9) Verfügbar unter: www.unima<strong>in</strong>z.de/Organisationen/thanatologie/Literatur/heft9.htm[17.07.2001]Seymour, J. E. (1999). Revisit<strong>in</strong>g medicalisation and "natural" death. Social science& medic<strong>in</strong>e: an <strong>in</strong>ternational journal, 49, 691-704.Shanan, J. (1995). Verarbeitung von Belastungen. In A. Kruse & R. Sch<strong>mit</strong>z-Scherzer (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Lebensalter (S. 61-69). Darmstadt:Ste<strong>in</strong>kopff.Silbereisen, R. K. & Noack, P. (2006). Kontexte <strong>und</strong> Entwicklung. In W. Schnei<strong>der</strong> &F. wilken<strong>in</strong>g (Hrsg.), Theorien, Modelle <strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie (Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie, Serie V:Entwicklungspsychologie, Band 1) (S. 311-368). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.
Literaturverzeichnis 220Silver, R. L. & Wortmann, C. B. (1980). Cop<strong>in</strong>g with <strong>und</strong>esirable life events. In J.Garber & M. Seligman (Hrsg.), Human helplessness: theory and applications(S. 279-340). New York: Academic Press.S<strong>in</strong>gelis, T. M. (1994). The measurement of <strong>in</strong>dependent and <strong>in</strong>terdependent selfconstruals.Personality and social psychology bullet<strong>in</strong>, 20, 580-591.Sommer, B. (2002). Entwicklung <strong>der</strong> Sterblichkeit im früheren B<strong>und</strong>esgebiet <strong>und</strong> denneuen Län<strong>der</strong>n seit 1991. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 35(5),406-411.Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2003). Bis zuletzt an de<strong>in</strong>er Seite: Begleitung <strong>und</strong>Pflege schwer kranker <strong>und</strong> sterben<strong>der</strong> Menschen. Stuttgart: Kreuz Verlag.Stangl, W. (2005). Werner Stangls Lehrtext-Sammlung Verfügbar unter:http://paedpsych.jk.uni-l<strong>in</strong>z.ac.at:4711/LEHRTEXTE/Lehrtexte.html[14.02.2005]Staud<strong>in</strong>ger, U. M. (1997). Grenzen <strong>der</strong> Bewältigung <strong>und</strong> ihre Überschreitung: VomEntwe<strong>der</strong>-O<strong>der</strong> zum Sowohl-Als-Auch <strong>und</strong> weiter. In C. Tesch-Römer, C.Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 247-260).We<strong>in</strong>heim: Beltz/PsychologieVerlagsUnion.Staud<strong>in</strong>ger, U. M. & Baltes, P. B. (1996). Weisheit als Gegenstand psychologischerForschung. Psychologische R<strong>und</strong>schau, 47(57-77).Staud<strong>in</strong>ger, U. M. & Greve, W. (2001). Resilienz im Alter. In Deutsches Zentrum fürAltersfragen (Hrsg.), Personale, ges<strong>und</strong>heitliche <strong>und</strong> Umweltressourcen imAlter: Expertisen zum Dritten Altersbericht <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung (S. 95-114).Opladen: Leske <strong>und</strong> Budrich.Staud<strong>in</strong>ger, U. M., Marsiske, M. & Baltes, P. B. (1995). Resilience and reservecapacity <strong>in</strong> later adulthood: potentials and li<strong>mit</strong>s of development across the lifespan. In D. Cicchetti & D. Cohen (Hrsg.), Developmental psychopathology(Bd. 2: Risk, disor<strong>der</strong>, and adaptation, S. 801-847). New York: Wiley.Staud<strong>in</strong>ger, U. M. & Pasupathi, M. (2000). Life-span perspectives on self, personality,and social cognition. In F. Craik & T. Salthouse (Hrsg.), The handbook ofag<strong>in</strong>g and cognition (2. Auflage ed., S. 633-687). New York: Erlbaum.Ste<strong>in</strong>hauser, K. E., Christakis, N. A., Clipp, E. C., McNeilly, M., Grambow, S., Parker,J.et al. (2001). Prepar<strong>in</strong>g for the end of life: preferences of patients, families,physicians, and other care provi<strong>der</strong>s. Journal of pa<strong>in</strong> and symptommanagment, 22(3), 727-737.Ste<strong>in</strong>hauser, K. E., Christakis, N. A., Clipp, E. C., McNeilly, M., McIntyre, L. & Tulsky,J. (2000). Factors consi<strong>der</strong>ed important at the end of life by patients, family,physicians, and other care provi<strong>der</strong>s. Journal of the American MedicalAssociation, 284(19), 2476-2482.Stepnick, A. & Perry, T. (1992). Prevent<strong>in</strong>g spiritual distress <strong>in</strong> the dy<strong>in</strong>g client.Jounal of Psychosocial Nurs<strong>in</strong>g, 30(1), 17-24.Stock, K. (1993). Die seelsorgliche Begleitung schwerkranker <strong>und</strong> sterben<strong>der</strong>Menschen. Die Schwester/Der Pfleger, 32(2), 156-159.Strittmatter, G. (1991). Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung von <strong>Sterben</strong>denaus <strong>der</strong> Sicht des kl<strong>in</strong>ischen Psychologen. In G. Strittmatter (Hrsg.), <strong>Sterben</strong> <strong>in</strong>Würde. Mut zum Leben (S. 57-64). Münster: LIT.Strittmatter, G. (1998). Sterbebegleitung als Lebensbegleitung. Erfahrungen <strong>und</strong>Konzepte. Störfaktor 41. Zeitschrift kritischer Psycholog<strong>in</strong>nen <strong>und</strong>Psychologen, 11(1), 25-59.
Literaturverzeichnis 221Stroebe, M. S., Hansson, R. O., Stroebe, W. & Schut, H. (Hrsg.). (2001). Handbookof bereavement research: consequences, cop<strong>in</strong>g, and care. Wash<strong>in</strong>gton:American Psychological Association.Student, J.-C. (1989a). Ohne Schmerzen sterben. In D. W. v. Goddenthow (Hrsg.),Mit dem <strong>Tod</strong>e leben: Sterbebegleitung <strong>und</strong> praktischer Rat (S. 54-69).Freiburg: Her<strong>der</strong>.Student, J.-C. (Hrsg.). (1989b). Das Hospiz-Buch. Freiburg: Lambertus.Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients atthe end of life. The Gerontologist, 42(3), 24-33.Tausch, D. (1987). Die Vorstellung des möglichen <strong>Sterben</strong>s e<strong>in</strong>er nahestehendenPerson: e<strong>in</strong>e empirische Untersuchung e<strong>in</strong>er psychotherapeutischenMöglichkeit. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Peter Lang.Tausch, R. & Tausch, A.-M. (1985). Sanftes <strong>Sterben</strong>. Was <strong>der</strong> <strong>Tod</strong> für das Lebenbedeutet. Re<strong>in</strong>beck bei Hamburg: Rowohlt.Tausch-Flammer, D. (1993). <strong>Sterben</strong>den nahe se<strong>in</strong>. Was können wir noch tun?Freiburg: Her<strong>der</strong>.Tausch-Flammer, D. (1997). "Hallo! Ist dort jemand?": von <strong>der</strong> H<strong>in</strong>gabe an sich selbst<strong>und</strong> <strong>der</strong> H<strong>in</strong>gabe an den an<strong>der</strong>en. In L. Bickel & D. Tausch - Flammer (Hrsg.),Spiritualität <strong>der</strong> Sterbebegleitung: Wege <strong>und</strong> Erfahrungen (S. 34-59). Freiburg:Her<strong>der</strong>.Tausch-Flammer, D. (2001). Begleitung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zeit des <strong>Sterben</strong>s.Gesprächspsychotherapie <strong>und</strong> Personenzentrierte Beratung, 11-13.Thiessen, B. (2004). Re-Formulierung des Privaten: Professionalisierungpersonenbezogener, haushaltsnaher Dienstleistungen (StudienInterdiszipl<strong>in</strong>äre Geschlechterforschung, Band 8). Wiesbaden: Verlag fürSozialwissenschaften.Thomae, H. (1987). Psychologische Biographik als Synthese idiographischer <strong>und</strong>nomothetischer Forschung. In G. Jüttemann & H. Thomae (Hrsg.), Biographie<strong>und</strong> Psychologie (S. 108-118). Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger.Thomae, H. (1988). Das Individuum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Welt: e<strong>in</strong>e Persönlichkeitstheorie (2.Auflage). Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Thomas, W. & Köhle, K. (1999). Inanspruchnahme <strong>und</strong> Kosten psychoonkologischerLiaisondienste. Psychother Psychosom med Psychol, 49, 160-167.Tirier, U. (2003). Wenn alles s<strong>in</strong>nlos ersche<strong>in</strong>t. Logotherapie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitunglebensbedrohlich erkrankter Menschen. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.Trommsdorff, G. (1999). Autonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit im kulturellen Vergleich vonSozialisationsbed<strong>in</strong>gungen. In H. R. Leu & L. Krappmann (Hrsg.), ZwischenAutonomie <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit. Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Formen <strong>der</strong> Behauptungvon Subjektivität (S. 392-419). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.Vachon, M. L. S. (1998). Psychosocial needs of patients and their families. Journal ofpalliative care, 14(3), 49-56.Vogd, W. (1998). Professionelles Handeln im Grenzbereich von Leiden, <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong>Spiritualität. Marburg: Tectum Verlag.Walach, H. (2001). Bauste<strong>in</strong>e für e<strong>in</strong> spirituelles Welt- <strong>und</strong> Menschenbild.Transpersonale Psychologie <strong>und</strong> Psychotherapie, 2, 63-77.Waltz, M. & Brühl, D. (1993). Das soziale Umfeld von Krebskranken <strong>und</strong> dessenstützende Funktion. In W. Fichten & P. Gottwald (Hrsg.), S<strong>in</strong>nf<strong>in</strong>dung <strong>und</strong>Lebensqualität: Bericht zur psychoonkologischen Tagung an <strong>der</strong> Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Oldenburg: BIS.
Literaturverzeichnis 222Wass, H. (2001). Past, present, and future of dy<strong>in</strong>g. Illness, crisis and loss, 9(1), 90-110.Weber, H. (1997). Zur Nützlichkeit des Bewältigungskonzeptes. In C. Tesch-Römer,C. Salewski & G. Schwarz (Hrsg.), Psychologie <strong>der</strong> Bewältigung (S. 7-18).We<strong>in</strong>heim: Beltz/Psychologie Verlagsunion.Weber, H. (2002). <strong>Ressourcen</strong>. In R. Schwarzer, M. Jerusalem & H. Weber (Hrsg.),Ges<strong>und</strong>heitspsychologie von A bis Z: e<strong>in</strong> Handwörterbuch (S. 466-469).Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Weisman, A. D. & Worden, W. J. (1975). Psychosocial analysis of cancer deaths.Omega, 6(2), 68-74.Wiesenhütter, E. (1974). Blick nach drüben: Selbsterfahrungen im <strong>Sterben</strong>.Hamburg: Furche-Verlag.Wilken<strong>in</strong>g, K. & Kunz, R. (2003). <strong>Sterben</strong> im Pflegeheim. Perspektiven <strong>und</strong> Praxise<strong>in</strong>er neuen Abschiedskultur. Gött<strong>in</strong>gen: Vandenhoeck & Rupprecht.Wilken<strong>in</strong>g, K. & Mart<strong>in</strong>, M. (2003). Lebensqualität am Lebensende: Erfahrungen,Modelle <strong>und</strong> Perspektiven. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, 36, 333-338.Wittkowski, J. (1993). Die psycho-soziale Betreuung <strong>Sterben</strong><strong>der</strong>: Konzepte,Verfahrensweisen <strong>und</strong> Ergebnisse zur Effizienzkontrolle. In F. Baumgärtel &F.-W. Wilker (Hrsg.), Kl<strong>in</strong>ische Psychologie im Spiegel ihrer Praxis (S. 215-220). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.Wittkowski, J. (1996). Fragebogen<strong>in</strong>ventar zur mehrdimensionalen Erfassung desErlebens gegenüber <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> FIMEST. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Wittkowski, J. (1999). Umgang <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>: Wie lassen sich die Ergebnisse<strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lagenforschung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis umsetzen? Report Psychologie, 2,114-120.Wittkowski, J. (2002). Psychologie des <strong>Tod</strong>es: Konzepte, Methoden, Ergebnisse.Verhaltenstherapie <strong>und</strong> Verhaltensmediz<strong>in</strong>, 23(1), 5-29.Wittkowski, J. (2005). E<strong>in</strong>stellungen zu <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> im höheren <strong>und</strong> hohenLebensalter. Zeitschrift für Gerontopsychologie <strong>und</strong> -psychiatrie, 18(2), 67-79.Wittkowski, J., Schrö<strong>der</strong>, C. & Bolm, G. (2004). Die <strong>Tod</strong>esthematik <strong>in</strong> <strong>der</strong>Mediz<strong>in</strong>ischen Psychologie. Zeitschrift für mediz<strong>in</strong>ische Psychologie, 13(3),109-120.Yasutani Roshi. (1994). The f<strong>und</strong>amental delusion. In D. Schiller (Hrsg.), The littleZen companion (S. 40). New York: Workman Publish<strong>in</strong>g.Yeg<strong>in</strong>er, A. (2000). Spirituelle Praxis als Hilfe zur Bewältigung e<strong>in</strong>erKrebserkrankung. In W. Belschner & P. Gottwald (Hrsg.), Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong>Spiritualität (S. 119-148). Oldenburg: Bibliotheks- <strong>und</strong> Infosmationssystem bis.Zöfel, P. (2003). Statistik für Psychologen im Klartext. München: Pearson Education.
Abbildungs- <strong>und</strong> Tabellenverzeichnis 22313. Abbildungs- <strong>und</strong> TabellenverzeichnisAbbildung 1: Systemtheoretisches Modell nach Bronfenbrenner ..............................58Abbildung 2: Beziehungsmodell nach Sulmasy (2002) .............................................66Abbildung 3: Verteilung <strong>der</strong> StudienteilnehmerInnen <strong>in</strong> Institutionsarten ................119Abbildung 4: Verteilung <strong>der</strong> StudienteilnehmerInnen <strong>in</strong> Personengruppen .............120Abbildung 5: Kennzahlen des Alters <strong>in</strong> Abhängigkeit <strong>der</strong> Institutionsart..................121Abbildung 6: Kennzahlen des Alters <strong>in</strong> Abhängigkeit <strong>der</strong> Personengruppe.............122Abbildung 7: Alters<strong>mit</strong>telwerte bei ÄrztInnen <strong>in</strong> unterschiedlichen Institutionen ......122Abbildung 8: Alters<strong>mit</strong>telwerte bei Pflegenden <strong>in</strong> unterschiedlichen Institutionen ...123Abbildung 9: Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung <strong>mit</strong> denPersonengruppen..............................................................................................125Abbildung 10: Kennwerte <strong>der</strong> Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Tod</strong> <strong>und</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>in</strong> dene<strong>in</strong>zelnen Personengruppen..............................................................................125Abbildung 11: durchschnittliche Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> beiÄrztInnen <strong>in</strong> unterschiedlichen E<strong>in</strong>richtungen....................................................126Abbildung 12: durchschnittliche Berührungsdauer <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> beiPflegenden <strong>in</strong> unterschiedlichen E<strong>in</strong>richtungen.................................................127Abbildung 13: Suche nach Unterstützung <strong>und</strong> Geschlecht .....................................132Abbildung 14: <strong>Soziale</strong> Unterstützung <strong>und</strong> Geschlecht.............................................133Abbildung 15: Netzstärke <strong>und</strong> Geschlecht ..............................................................133Abbildung 16: Mittelwert-Diagramm von Suche nach Unterstützung <strong>und</strong>Religionszugehörigkeit ......................................................................................134Abbildung 17: Mittelwert-Diagramm von <strong>Soziale</strong>r Resonanz <strong>und</strong>Religionszugehörigkeit ......................................................................................134Abbildung 18: Mittelwert-Diagramm von Unterstützungsbedürfnis <strong>und</strong> Alter...........135Abbildung 19: Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>und</strong> Alter ................................................................135Abbildung 20: <strong>Soziale</strong> Unterstützung <strong>und</strong> Personengruppe ....................................136Abbildung 21: Mittelwert-Diagramm für Gegebene Unterstützung <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................136Abbildung 22: Mittelwert-Diagramm für Emotionale Unterstützung <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................137Abbildung 23: Mittelwert-Diagramm für <strong>Soziale</strong> Resonanz <strong>und</strong> Personengruppe ...137Abbildung 24: Mittelwert-Diagramm für Netzgröße <strong>und</strong> Personengruppe ...............138
Abbildungs- <strong>und</strong> Tabellenverzeichnis 224Abbildung 25: Mittelwert-Diagramm für Netzstärke <strong>und</strong> Personengruppe...............138Abbildung 26: Mittelwerte des Zufriedenheits<strong>in</strong>dexes <strong>in</strong> den Personengruppen .....139Abbildung 27: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten sozialerUnterstützung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Institutionsart.................................................................140Abbildung 28: Mittelwert-Diagramm von <strong>Soziale</strong>r Resonanz <strong>und</strong> Institutionsart......141Abbildung 29: Mittelwerte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Netzgröße bei Befragten aus unterschiedlichenInstitutionsarten .................................................................................................141Abbildung 30: Mittelwertdiagramm des Zusammenhangs zwischen Netzstärke<strong>und</strong> Institutionsart ..............................................................................................142Abbildung 31: Mittelwert-Diagramm für emotionale Erschöpfung <strong>und</strong>Insitutionsart......................................................................................................144Abbildung 32: Mittelwert-Diagramm für Intr<strong>in</strong>sische Motivierung <strong>und</strong>Institutionsart.....................................................................................................145Abbildung 33: Mittelwert-Diagramm für Unzufriedenheit <strong>und</strong> Institutionsart ............145Abbildung 34: Mittelwert-Diagramm zu Momentanem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................146Abbildung 35: Mittelwert-Diagramm zu Generellem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................146Abbildung 36: Mittelwert-Diagramm zu Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................147Abbildung 37: Mittelwert-Diagramm zu Emotionaler Erschöpfung <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................147Abbildung 38: Mittelwert-Diagramm zu Unzufriedenheit <strong>und</strong> Personengruppe .......148Abbildung 39: Mittelwert-Diagramm zu Reaktivem Abschirmen <strong>und</strong>Personengruppe................................................................................................148Abbildung 41: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Soziale</strong>n Resonanz ..............................................................152Abbildung 42: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Netzgröße ............................................................................152Abbildung 43: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Netzstärke............................................................................153Abbildung 44: Zusammenhang <strong>der</strong> Mittelwerte von Zufriedenheits-,Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>und</strong> Generellem Wohlbef<strong>in</strong>den .......................153Abbildung 45: Zusammenhang <strong>der</strong> Mittelwerte von Zufriedenheits-,Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck <strong>und</strong> Höhe des Belastungsausmaßes..............154Abbildung 49: Modell <strong>der</strong> Risiko- <strong>und</strong> Schutzfaktoren aus dem sozialen Raum......186
Abbildungs- <strong>und</strong> Tabellenverzeichnis 225Tabelle 1: Ähnlichkeiten <strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten von Sterbekrisen <strong>und</strong>Lebenskrisen (nach Ritter-Gekeler, 1992)...........................................................28Tabelle 2: Kategorisierung <strong>der</strong> Berührungsdauer <strong>mit</strong> Belegung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnenKategorien.........................................................................................................124Tabelle 3: Statistische Werte <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong> .........................131Tabelle 4: Statistische Werte <strong>der</strong> Outcome-Variablen.............................................144Tabelle 5: Korrelative Beziehungen <strong>der</strong> Outcome-Variablen...................................149Tabellen 6: Korrelative Beziehungen <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerte <strong>der</strong> sozialen<strong>Ressourcen</strong> untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> (Erläuterung: Tabelle ist <strong>in</strong> zwei Untertabellengeteilt.) ..............................................................................................................159Tabelle 7: Dimensionsstruktur nach <strong>der</strong> Faktorenanalyse aller sozialenKennwerte .........................................................................................................162Tabelle 8: Statistische Werte <strong>der</strong> Dimensionen sozialer <strong>Ressourcen</strong> .....................165Tabelle 9: Korrelative Beziehungen <strong>der</strong> Dimensionen.............................................165Tabelle 10: Statistische Werte <strong>der</strong> Konstrukte Proaktivität, Selbstwirksamkeit,Transpersonales Vertrauen <strong>und</strong> Kontrollüberzeugungen ..................................168Tabelle 11: Ausgewählte, partielle Korrelationen zwischen sozialen Kennwerten<strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong>..............................................................................168Tabelle 12: Dimensionen nach <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Faktorenanalyse von sozialenKennwerten <strong>und</strong> personalen <strong>Ressourcen</strong> .........................................................170
AnhangIAnhang
AnhangIIAnhang 1: Operationalisierung <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>Name desE<strong>in</strong>zelkennwertsWahrgenommeneUnterstützungBedürfnis nachUnterstützungSuche nachUnterstützung,InformationaleUnterstützungInstrumentelleUnterstützungMotivationaleUnterstützungEmotionaleUnterstützungGegebeneUnterstützungNetzgrößeNetzstärkeQuelle desE<strong>in</strong>zelkennwertsSupport Scheme,aus BSSSSupport Scheme,aus BSSSSupport Scheme,aus BSSS<strong>Soziale</strong>Unterstützung, ausSSI<strong>Soziale</strong>Unterstützung, ausSSI<strong>Soziale</strong>Unterstützung, ausSSI<strong>Soziale</strong>Unterstützung, ausSSI<strong>Soziale</strong>Unterstützung, ausSSIgebildeterKennwert, aus SSIgebildeterKennwert, aus SSIBildung des KennwertsSUM(bsss01,bsss02,bsss03,bsss04) / (4-NMISS(bsss01,bsss02,bsss03,bsss04))SUM(bsss05,bsss06) / (2 – NMISS(bsss05,bsss06))SUM(bsss07,bsss08,bsss09) / (3 –NMISS(bsss07,bsss08,bsss09))SUM(ssi01,ssi02,ssi03,ssi04,ssi05,ssi06,ssi07,ssi08,ssi09,ssi10) / (10 -NMISS(ssi01,ssi02,ssi03,ssi04,ssi05,ssi06,ssi07,ssi08,ssi09,ssi10)SUM(ssi21,ssi22,ssi23,ssi24,ssi25,ssi26,ssi27,ssi28,ssi29,ssi30) / (10 -NMISS(ssi21,ssi22,ssi23,ssi24,ssi25,ssi26,ssi27,ssi28,ssi29,ssi30))SUM(ssi41,ssi42,ssi43,ssi44,ssi45,ssi46,ssi47,ssi48,ssi49,ssi50) / (10 -NMISS(ssi41,ssi42,ssi43,ssi44,ssi45,ssi46,ssi47,ssi48,ssi49,ssi50))SUM(ssi61,ssi62,ssi63,ssi64,ssi65,ssi66,ssi67,ssi68,ssi69,ssi70) / (10 -NMISS(ssi61,ssi62,ssi63,ssi64,ssi65,ssi66,ssi67,ssi68,ssi69,ssi70))SUM(ssi81,ssi82,ssi83,ssi84,ssi85,ssi86,ssi87,ssi88,ssi89,ssi90) / (10 -NMISS(ssi81,ssi82,ssi83,ssi84,ssi85,ssi86,ssi87,ssi88,ssi89,ssi90))Summe <strong>der</strong> Belegung je Personengruppe über alleTabellen h<strong>in</strong>weg (d.h. hat jemand zu e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> 4Fragen m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal etwas an<strong>der</strong>es als 1/1angekreuzt, so erhält er für diese Personengruppee<strong>in</strong>e ssiges_ = 1. Dies bedeutet, diesePersonengruppe ist im Netz <strong>der</strong> Person vorhanden.)Ssiges1-10 werden dann zusammengezählt. Esergibt sich für Patienten <strong>und</strong> Professionelle e<strong>in</strong>Höchstwert von 7, für Bezugspersonen e<strong>in</strong>Höchstwert von 8, <strong>der</strong> für Gruppenvergleiche auf 7gesetzt wird.1. 4 Zufriedenheitstabellen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e überführtdurch Summenbildung <strong>der</strong> Zufriedenheitswerte jeZeile. Es entsteht ssigessz1-10 (Summe <strong>der</strong>Zufriedenheitswerte).2. Summe muss umgelegt werden aufAnkreuzhäufigkeit <strong>der</strong> Zeile: Es wird ssibz1-10(Netzstärke Belegung Zufriedenheit) gebildet, dieangibt, wie oft <strong>in</strong> Zeilen zu e<strong>in</strong>er Personengruppee<strong>in</strong> Wert >0 vorkommt.3. Summe <strong>der</strong> Zufriedenheit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erPersonengruppe geteilt durch Belegung ergibtdurchschnittliche Zufriedenheit <strong>mit</strong> e<strong>in</strong>erPersonengruppe: ssigessz1/ssibz1 = ssidz1. Dieentstandene Variable ssidz1-10 gibt dieZufriedenheit <strong>der</strong> befragten Person <strong>mit</strong> dieser
AnhangIIIZufriedenheits<strong>in</strong>dex<strong>in</strong> engenBeziehungenProblem<strong>in</strong>dex <strong>in</strong>engen BeziehungenÄn<strong>der</strong>ungsdruck <strong>in</strong>engen BeziehungenKonstruktivität desengen NetzesDestruktivität desengen Netzes<strong>Soziale</strong> ResonanzgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGSkala <strong>Soziale</strong>Resonanz, ausFIG-50Personengruppe an.4. Netzst entsteht durch Summe <strong>der</strong>durchschnittlichen Zufriedenheiten geteilt durchAnzahl <strong>der</strong> Zufriedenheitswerte: ssidz1+…+ssidz10/ netzstn (Summe <strong>der</strong> Belegung bei ssidz1-10)Summe feg04,05,06 im Bereich 2-5 (umkodiert als1-4)Summe feg12,13,14 im Bereich 2-5 (umkodiert als1-4)Summe feg20,21,22 (im Range: 0-3)SUM(feg33,34,38)SUM(feg48,49,50)SUM(pe14,pe15,pe16,pe17) / (4-NMISS(pe14,pe15,pe16,pe17))
AnhangIVAnhang 2: Häufigkeitsverteilungen <strong>der</strong> Kennwerte sozialer <strong>Ressourcen</strong>Support Schemes:Wahrgenommene Unterstützung (aus BSSS)Bedürfnis nach Unterstützung (aus BSSS)300400250300200Häufigkeit150Häufigkeit2001001005001,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,67 2,75 3,00 3,25 3,33 3,50 3,67 3,75 4,00Wahrgenommene Unterstützung (aus BSSS)01,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00Bedürfnis nach Unterstützung (aus BSSS)Suche nach Unterstützung (aus BSSS)150120Häufigkeit90603001,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,50 3,67 4,00Suche nach Unterstützung (aus BSSS)
AnhangV<strong>Soziale</strong> Unterstützung:<strong>in</strong>formationale Unterstützung (aus SSI)<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung (aus SSI)100808060Häufigkeit6040Häufigkeit402020004,804,604,434,254,003,803,673,573,403,293,173,002,832,712,602,432,332,202,131,861,751,631,501,291,00<strong>in</strong>formationale Unterstützung (aus SSI)5,004,754,604,504,334,254,173,863,803,713,603,433,333,253,173,002,862,802,712,632,572,432,382,292,202,141,881,831,751,671,601,501,381,291,00<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung (aus SSI)motivationale Unterstützung (aus SSI)emotionale Unterstützung (aus SSI)100808060Häufigkeit6040Häufigkeit402020005,004,754,604,434,334,204,143,863,803,713,603,503,403,333,253,173,002,862,802,712,632,572,432,382,292,202,141,881,801,711,571,431,291,00motivationale Unterstützung (aus SSI)5,004,754,674,574,434,334,204,144,003,833,753,673,603,503,403,293,203,142,882,832,752,672,572,432,332,252,172,131,881,831,751,671,601,431,00emotionale Unterstützung (aus SSI)gegebene Unterstützung (aus SSI)8060Häufigkeit402005,004,804,674,574,404,294,204,133,863,803,713,603,503,403,333,253,173,132,882,832,752,672,602,502,402,332,252,172,001,801,711,601,431,331,00gegebene Unterstützung (aus SSI)
AnhangVINetzgröße/Netzstärke:HistogrammHistogramm300300250250200200Häufigkeit150Häufigkeit150100100505000 2 4 6 8 10Netzgröße aus SSIMean = 4,95Std. Dev. = 1,266N = 75100 2 4 6 8Netzgröße standardisiert aus SSI (1-7)Mean = 4,93Std. Dev. = 1,222N = 751Histogramm10080Häufigkeit604020Mean = 3,7508Std. Dev. = 0,722780N = 7451,00 2,00 3,00 4,00 5,00Netzstärke aus SSI
AnhangVIIZufriedenheits<strong>in</strong>dex, Problem<strong>in</strong>dex, Än<strong>der</strong>ungsdruck, Konstruktivität, Destruktivität:Zufriedenheits<strong>in</strong>dex aus FEGProblem<strong>in</strong>dex aus FEG12014010012080100Häufigkeit60Häufigkeit80604040202001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Zufriedenheits<strong>in</strong>dex aus FEG01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12Problem<strong>in</strong>dex aus FEGÄn<strong>der</strong>ungsdruck aus FEGKonstruktivität des engen Netzes600200500150400Häufigkeit300Häufigkeit1002005010000 1 2 3Än<strong>der</strong>ungsdruck aus FEG01 2 3Konstruktivität des engen NetzesDestruktivität des engen Netzes12010080Häufigkeit60402001 2 3Destruktivität des engen Netzes
AnhangVIII<strong>Soziale</strong> Resonanz:<strong>Soziale</strong> Resonanz250200Häufigkeit1501005001,001,251,331,501,752,002,252,332,502,672,753,00<strong>Soziale</strong> Resonanz3,253,333,503,673,754,00
AnhangIXAnhang 3: Interaktionen zwischen sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> Rahmendaten <strong>der</strong>StichprobeInstitutionsartWahrgenommeneUnterstützungUnterstützungsbedürfnisSuche nachUnterstützungInformationaleUnterstützungInstrumentelleUnterstützungMotivationaleUnterstützungEmotionaleUnterstützungGegebeneUnterstützungA: p
AnhangX<strong>Soziale</strong>ResonanzA: p =0,005;D: T = -3,169, p= 0,002B: Chi-Quadrat =20,272, p
AnhangXIAnhang 4: Operationalisierung <strong>und</strong> Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Outcome-Variablen <strong>in</strong> <strong>der</strong> StichprobeName desE<strong>in</strong>zelkennwertsGenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenBelastungsausmaßEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeMotivierungErlebteUnzufriedenheitKlientenaversionReaktivesAbschirmenName desE<strong>in</strong>zelkennwertsGenerellesWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenBelastungsausmaßEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeMotivierungErlebteUnzufriedenheitKlientenaversionReaktivesAbschirmenQuelle desE<strong>in</strong>zelkennwertsaus FEGaus FEGgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDQuelle desE<strong>in</strong>zelkennwertsaus FEGaus FEGgebildeterKennwert, aus FEGgebildeterKennwert, aus FEGSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDSkalenwert ausBHDBildung des Kennwertsfeg01feg021. feg11-feg18 umkodiert: 1 als 0, 2-5 als 1 (Anzahl<strong>der</strong> Nennungen aus den 8 vorgegebenen Bereichengebildet, wenn die Nennung größer als „gar nicht“ist)2. Summe <strong>der</strong> umkodierten feg11-feg18 (Die soentstehende Maßzahl liegt entsprechend zwischenden Extremwerten 0 <strong>und</strong> 8 <strong>und</strong> gibt Aufschlussdarüber, <strong>in</strong> wie vielen Bereichen die befragtePerson e<strong>in</strong>e subjektive Belastung erlebt)Summe <strong>der</strong> umkodierten feg11-feg18SUM(ae05pol,ae07,ae08,ae26,ae27) / (5 –NMISS(ae05pol,ae07,ae08,ae26,ae27)SUM(ae01,ae03,ae18,ae22,ae23) / (5 –NMISS(ae01,ae03,ae18,ae22,ae23)SUM(ae10,ae11,ae20,ae24,ae32) / (5 –NMISS(ae10,ae11,ae20,ae24,ae32)SUM(ae02,ae06) / 2 – NMISS(ae02,ae06)SUM(ae14,ae28pol,ae13pol) / 3 –NMISS(ae14,ae28pol,ae13pol)Bildung des Kennwertsfeg01feg021. feg11-feg18 umkodiert: 1 als 0, 2-5 als 1 (Anzahl<strong>der</strong> Nennungen aus den 8 vorgegebenen Bereichengebildet, wenn die Nennung größer als „gar nicht“ist)2. Summe <strong>der</strong> umkodierten feg11-feg18 (Die soentstehende Maßzahl liegt entsprechend zwischenden Extremwerten 0 <strong>und</strong> 8 <strong>und</strong> gibt Aufschlussdarüber, <strong>in</strong> wie vielen Bereichen die befragtePerson e<strong>in</strong>e subjektive Belastung erlebt)Summe <strong>der</strong> umkodierten feg11-feg18SUM(ae05pol,ae07,ae08,ae26,ae27) / (5 –NMISS(ae05pol,ae07,ae08,ae26,ae27))SUM(ae01,ae03,ae18,ae22,ae23) / (5 –NMISS(ae01,ae03,ae18,ae22,ae23))SUM(ae10,ae11,ae20,ae24,ae32) / (5 –NMISS(ae10,ae11,ae20,ae24,ae32))SUM(ae02,ae06) / (2 – NMISS(ae02,ae06))SUM(ae14,ae28pol,ae13pol) / (3 –NMISS(ae14,ae28pol,ae13pol))
AnhangXIIGenerelles <strong>und</strong> Allgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den:Im allgeme<strong>in</strong>en b<strong>in</strong> ich <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Leben ...Insgesamt fühle ich mich im Moment ...500400300Häufigkeit300200Häufigkeit2001001000ziemlich unzufriedenäußerst unzufriedenetwas unzufriedenwe<strong>der</strong> nochetwas zufriedenäußerst zufriedenziemlich zufriedenIm allgeme<strong>in</strong>en b<strong>in</strong> ich <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Leben ...0äußerstunwohlziemlichunwohletwasunwohlwe<strong>der</strong>nochetwaswohlziemlichwohlInsgesamt fühle ich mich im Moment ...äußerstwohlSumme <strong>der</strong> Belastungsquellen <strong>und</strong> Belastungsausmaß:Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen aus FEGVersuch unquadriert Belsum120801006080Häufigkeit60Häufigkeit40402020001 2 3 4 5 6 7 8Anzahl <strong>der</strong> Belastungsquellen aus FEG1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 29Versuch unquadriert Belsum
AnhangXIIIEmotionale Erschöpfung, Intr<strong>in</strong>sische Motivierung, Unzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit,Klientenaversion <strong>und</strong> Reaktives Abschirmen:Emotionale Erschöpfung (aus BHD)Intr<strong>in</strong>sische Motivierung (aus BHD)306025502040Häufigkeit15Häufigkeit301020510001,001,401,601,802,202,402,602,803,203,604,004,254,404,605,005,40Emotionale Erschöpfung (aus BHD)5,756,006,407,007,006,806,756,676,606,406,206,005,805,755,605,505,405,255,205,004,804,754,604,404,254,204,003,803,603,403,203,002,802,602,20Intr<strong>in</strong>sische Motivierung (aus BHD)Erlebte Unzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit (aus BHD)Klientenaversion (aus BHD)6080506040Häufigkeit30Häufigkeit4020201001,001,251,501,752,002,332,603,003,403,67Erlebte Unzufriedenheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit (aus BHD)3,804,204,604,805,205,405,676,006,406,8001,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00Klientenaversion (aus BHD)Reaktives Abschirmen (aus BHD)8060Häufigkeit402001,001,331,672,002,332,502,673,003,333,503,674,004,334,504,675,00Reaktives Abschirmen (aus BHD)5,336,006,337,00
AnhangXIVAnhang 5: Interaktionen zwischen Wohlbef<strong>in</strong>dens-/Belastungs<strong>in</strong>dices <strong>und</strong>Rahmendaten <strong>der</strong> StichprobeAllgeme<strong>in</strong>esWohlbef<strong>in</strong>denMomentanesWohlbef<strong>in</strong>denAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenBelastungsausmaßEmotionaleErschöpfungIntr<strong>in</strong>sischeMotivierungUnzufriedenheit<strong>in</strong> <strong>der</strong> ArbeitA: p =0,011;D: T = -3,697, p< 0,001A: p =0,005;D: T =2,779, p= 0,006D: T = -3,465, p= 0,001D: T =3,687, p< 0,001B: Chi-Quadrat =5,731, p =0,057;E: F = 2,911,p = 0,055;BFT:Statistik =3,035, p =0,049B: Chi-Quadrat =8,518, p =0,014;E: F = 3,056,p = 0,048AlterF: r = -0,338,p < 0,001;E: F = 14,752,p < 0,001;BFT:Statistik =14,797, p
AnhangXVKlientenaversionD: T =3,464, p= 0,001E: F = 2,877,p = 0,014;F. r = 0,146**E: F = 7,136, p< 0,001;B: significantE: F = 8,491; p
AnhangXVIAnhang 6: Rangkorrelationen nach Spearman <strong>und</strong> Partielle Korrelationen(Kontrollvariablen Demographische Rahmendaten) zwischen den <strong>Soziale</strong>n<strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> den Outcome-VariablenEmotionaleErschöpfung-0,185**-0,209**-0,088-0,044-0,118*-0,098*0,0380,0590,0580,0380,024-0,0390,007-0,0330,0540,000-0,194**-0,261**-0,018-0,070-0,169**-0,273**-0,066-0,134**0,1370,163**0,1010,234**0,2080,102-0,2060,103Belastungsausmaß-0,227**-0,217**-0,038-0,015-0,089-0,109**0,0140,0240,044-0,0370,084-0,0630,017-0,103**0,0970,011-0,246**-0,184**0,129*0,178**-0,125*-0,213**-0,231-0,090*0,694**0,651**0,342*0,324**0,301*0,179**0,1050,119Anzahl <strong>der</strong>Belastungsquellen-0,131*-0,224**0,042-0,013-0,104*-0,108**0,075-0,0260,055-0,0920,061-0,123**0,024-0,144**0,0930,031-0,143**-0,117**0,132*0,148**-0,060-0,197**-0,0050,0280,515**0,516**0,2330,286**0,2420,1110,0640,133MomentanesWohlbef<strong>in</strong>den0,283**0,178**0,033-0,0590,117*0,093*0,137*-0,082*0,111*-0,0230,0610,0140,136*0,0680,0770,085*0,280**0,289**0,063-0,0090,269**0,241**0,336*0,235**-0,365**-0,190**-0,202-0,188**-0,180-0,135*-0,017-0,115GenerellesWohlbef<strong>in</strong>den0,342**0,267**-0,008-0,0320,123*0,151**0,1060,0180,0450,091*0,0880,160**0,149**0,216**0,0670,148**0,382**0,358**0,0130,0250,161**0,305**0,1220,288**-0,427**-0,267**-0,070-0,217**-0,142-0,0680,037-0,112WahrgenommeneUnterstützungBedürfnis nachUnterstützungSuche nach Unterstützung<strong>in</strong>formationale Unterstützung<strong>in</strong>strumentelle Unterstützungmotivationale Unterstützungemotionale Unterstützunggegebene Unterstützung<strong>Soziale</strong> ResonanzNetzgrößeNetzstärkeZufriedenheits<strong>in</strong>dexProblem<strong>in</strong>dexÄn<strong>der</strong>ungsdruckKonstruktivitäts<strong>in</strong>dexDestruktivitäts<strong>in</strong>dex
AnhangXVII-0,199**-0,079-0,150**0,0350,0780,135**0,135**0,157**0,428**0,0670,301**0,152**-0,132**-0,174**-0,107-0,322**Intr<strong>in</strong>sischeMotivierung0,166**0,0850,0660,0100,0000,0570,0690,0810,273**-0,0350,180**0,185-0,330*0,0210,052-0,084-0,206**-0,039-0,173**0,027-0,064-0,097*-0,145**-0,123**-0,377**-0,088-0,345**-0,130**0,154**0,174**0,181*0,188ErlebteUnzufriedenheit0,200**-0,018-0,1010,047-0,0390,010-0,080-0,043-0,290**0,003-0,220**-0,2000,388**0,1090,157-0,083-0,113*-0,011-0,087-0,041-0,051-0,070-0,141**-0,192**-0,209**-0,035-0,142**-0,160**0,0890,0790,0900,109Klienten-aversion-0,073-0,003-0,026-0,017-0,045-0,031-0,089-0,111*-0,185**0,052-0,079-0,0650,186-0,0260,055-0,125-0,050-0,038-0,0820,0170,063-0,056-0,026-0,040-0,174**-0,120**-0,121**-0,0180,0570,0160,0490,217*ReaktivesAbschirmen-0,0750,001-0,0600,0160,114*-0,0190,004-0,027-0,109*-0,100-0,044-0,0160,2140,0870,2070,196
AnhangXVIIIAnhang 7: Varianzanalytische Bezüge (Varianzanalysen <strong>und</strong>Kovarianzanalysen <strong>mit</strong> Kontrolle <strong>der</strong> demographische Rahmendaten) zwischenden <strong>Soziale</strong>n <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> den Outcome-VariablenAnzahl <strong>der</strong>BelastungsquellenF = 2,372; p = 0,008F = 0,502; p = 0,807F = 3,698; p < 0,001F = 1,370; p = 0,054F = 1,433; p = 0,034F = 1,190; p = 0,185F = 1,121; p = 0,278F = 1,039; p = 0,409F = 1,551; p = 0,129F = 1,647; p = 0,133F = 2,472; p = 0,017F = 2,613; p = 0,003F = 15,231; p < 0,001F = 8,040; p < 0,001F = 2,466; p = 0,089F = 0,011; p = 0,989Momentanes Wohlbef<strong>in</strong>denF = 4,672; p < 0,001 *F = 4,187; p < 0,001 *F = 0,563; p = 0,760F = 0,741; p = 0,617;F = 1,860; p = 0,049F = 1,685; p = 0,091F = 0,841; p = 0,783 *F = 0,897; p = 0,678 *F = 1,037; p = 0,409 *F = 0,955; p = 0,567F = 1,174; p = 0,196 *F = 1,111; p = 0,278F = 1,338; p = 0,066 *F = 1,091; p = 0,323 *F = 1,091; p = 0,318 *F = 0,848; p = 0,757F = 5,982; p < 0,001 *F = 3,980; p < 0,001 *F = 3,196; p = 0,004F = 1,745; p = 0,110F = 6,720; p < 0,001 *F = 4,730; p < 0,001 *F = 3,220; p < 0,001F = 3,309; p < 0,001 *F = 3,788; p < 0,001F = 3,693; p < 0,001F = 18,061; p < 0,001 *F = 15,602; p < 0,001 *F = 2,929; p = 0,056F = 1,727; p = 0,182F = 0,223; p = 0,801F = 0,030; p = 0,970Generelles Wohlbef<strong>in</strong>denF = 5,474; p < 0,001 *F = 5,390; p < 0,001 *F = 1,064; p = 0,383F = 1,020; p = 0,412F = 1,831; p = 0,053 *F = 1,581; p = 0,119 *F = 0,833; p = 0,797 *F = 0,840; p = 0,779F = 0,749; p = 0,903 *F = 0,693; p = 0,946 *F = 2,055; p < 0,001 *F = 1,853; p = 0,001 *F = 1,113; p = 0,282 *F = 1,117; p = 0,283 *F = 1,027; p = 0,428 *F = 1,091; p = 0,323 *F = 9,317; p < 0,001 *F = 7,221; p < 0,001 *F = 1,628; p = 0,138F = 1,420; p = 0,206F = 4,702; p < 0,001 *F = 3,251; p = 0,002 *F = 5,088; p < 0,001 *F = 5,430; p < 0,001 *F = 5,420; p < 0,001 *F = 4,595; p < 0,001F = 10,832; p < 0,001 *F = 5,987; p = 0,001F = 0,441; p = 0,644F = 0,231; p = 0,794F = 1,490; p = 0,231F = 1,908; p = 0,157 *WahrgenommeneUnterstützungBedürfnis nachUnterstützungSuche nach Unterstützung<strong>in</strong>formationale Unterstützung<strong>in</strong>strumentelle Unterstützungmotivationale Unterstützungemotionale Unterstützunggegebene Unterstützung<strong>Soziale</strong> ResonanzNetzgrößeNetzstärkeZufriedenheits<strong>in</strong>dexProblem<strong>in</strong>dexÄn<strong>der</strong>ungsdruckKonstruktivitäts<strong>in</strong>dexDestruktivitäts<strong>in</strong>dex
AnhangXIXErlebteUnzufriedenheitF = 2,896; p = 0,001F = 0,346; p = 0,912F = 1,589; p = 0,117F = 1,398; p = 0,044F = 0,891; p = 0,689F = 0,972; p = 0,536F = 1,203; p = 0,176F = 1,358; p = 0,065F = 4,219; p < 0,001F = 0,629; p = 0,707F = 4,429; p < 0,001F = 2,024; p = 0,026F = 4,187; p < 0,001F = 4,235; p = 0,006F = 0,801; p = 0,451F = 0,619; p = 0,542Intr<strong>in</strong>sische MotivierungF = 3,854; p < 0,001F = 4,297; p < 0,001F = 1,943; p = 0,073 *F = 1,550; p = 0,161F = 1,948; p = 0,037F = 2,639; p = 0,006F = 1,318; p = 0,072F = 1,484; p = 0,022F = 1,093; p = 0,312F = 0,954; p = 0,587F = 0,902; p = 0,674F = 0,903; p = 0,670F = 1,222; p = 0,149 *F = 1,248; p = 0,134F = 0,810; p = 0,823F = 0,890; p = 0,685F = 8,081; p < 0,001F = 4,185; p < 0,001F = 0,735; p = 0,622F = 0,274; p = 0,949F = 5,126; p < 0,001F = 1,852; p = 0,077F = 1,089; p = 0,369F = 0,740; p = 0,700F = 1,558; p = 0,126F = 1,681; p = 0,093F = 4,237; p = 0,006F = 2,390; p = 0,069F = 1,378; p = 0,255F = 0,461; p = 0,632F = 6,037; p = 0,003F = 0,138; p = 0,872Emotionale ErschöpfungF = 2,752; p = 0,002F = 2,235; p = 0,013F = 0,973; p = 0,443F = 0,886; p = 0,505F = 1,404; p = 0,175F = 1,421; p = 0,178F = 1,084; p = 0,326F = 0,986; p = 0,507F = 1,165; p = 0,210F = 1,041; p = 0,405F = 0,974; p = 0,532F = 0,982; p = 0,515F = 1,007; p = 0,465 *F = 1,077; p = 0,345F = 0,747; p = 0,902 *F = 0,840; p = 0,770F = 3,455; p < 0,001F = 1,652; p = 0,099F = 1,507; p = 0,174F = 0,436; p = 0,855F = 5,742; p < 0,001F = 4,083; p < 0,001F = 1,666; p = 0,079F = 2,226; p = 0,013F = 2,200; p = 0,021F = 2,368; p = 0,013F = 8,233; p< 0,001F = 7,992; p < 0,001F = 4,389; p = 0,014F = 3,256; p = 0,042F = 0,810; p = 0,448F = 1,406; p = 0,252BelastungsausmaßF = 3,260; p < 0,001F = 3,138; p < 0,001F = 0,647; p = 0,693F = 0,474; p = 0,828F = 1,961; p = 0,036F = 1,837; p = 0,061F = 1,134; p = 0,248F = 1,217; p = 0,157F = 1,005; p = 0,470F = 1,014; p = 0,454F = 1,119; p = 0,271 *F = 1,156; p = 0,225F = 1,318; p = 0,077 *F = 1,360; p = 0,063 *F = 1,153; p = 0,228F = 1,129; p = 0,268F = 5,481; p < 0,001 *F = 4,065; p < 0,001 *F = 2,726; p = 0,013F = 2,247; p = 0,038F = 3,927; p < 0,001F = 3,476; p = 0,001F = 2,324; p = 0,009F = 1,698; p = 0,072F = 40,340; p < 0,001F = 32,561; p < 0,001F = 27,074; p < 0,001F = 22,713; p < 0,001F = 4,091; p = 0,018F = 1,790; p = 0,171F = 1,800; p = 0,171F = 0,220; p = 0,863F = 2,255; p = 0,011F = 0,181; p = 0,982F = 3,190; p = 0,001F = 1,360; p = 0,052 *F = 1,416; p = 0,035F = 0,883; p = 0,711F = 1,011; p = 0,458F = 1,064; p = 0,362F = 3,615; p < 0,001F = 1,595; p = 0,147F = 2,676; p = 0,010F = 2,258; p = 0,011F = 18,323; p < 0,001F = 9,623; p < 0,001 *F = 5,508; p = 0,005F = 2,577; p = 0,082
AnhangXXMultivariate Teststatistik(Pillai-Spur)0,0000,0000,4480,6260,0270,0280,0810,2020,0410,3360,0260,0110,0860,0730,0810,2790,0000,0000,0320,2840,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0530,4360,0870,433Reaktives AbschirmenF = 1,629; p = 0,088F = 1,749; p = 0,062F = 0,474; p = 0,827F = 0,242; p = 0,962F = 0,792; p = 0,637F = 0,575; p = 0,817F = 1,032; p = 0,417F = 0,922; p = 0,631F = 1,328; p = 0,069F = 1,208; p = 0,168F = 1,091; p = 0,314F = 0,909; p = 0,658F = 0,668; p = 0,964F = 0,821; p = 0,801F = 0,744; p = 0,905F = 0,872; p = 0,716F = 3,080; p = 0,001F = 2,099; p = 0,029F = 1,784; p = 0,101F = 1,021; p = 0,412F = 1,896; p = 0,069F = 0,901; p = 0,505F = 1,483; p = 0,135 *F = 0,862; p = 0,578F = 0,651; p = 0,753F = 0,490; p = 0,881F = 0,248; p = 0,863F = 0,344; p = 0,794F = 0,324; p = 0,723F = 0,403; p = 0,669F = 1,948; p = 0,148F = 0,565; p = 0,571KlientenaversionF = 1,339; p = 0,200F = 0,786; p = 0,655F = 2,017; p = 0,062F = 1,299; p = 0,257F = 0,862; p = 0,569F = 1,143; p = 0,331F = 1,126; p = 0,259 *F = 1,189; p = 0,186 *F = 1,449; p = 0,026 *F = 1,121; p = 0,275F = 1,265; p = 0,107F = 1,236; p = 0,138F = 1,625; p = 0,006F = 1,459; p = 0,030F = 1,399; p = 0,042F = 0,983; p = 0,511F = 2,562; p = 0,004F = 2,053; p = 0,033F = 1,530; p = 0,167F = 0,807; p = 0,565F = 1,755; p = 0,095F = 0,868; p = 0,532F = 1,761; p = 0,059F = 1,782; p = 0,056F = 1,177; p = 0,308F = 1,201; p = 0,294F = 1,862; p = 0,135F = 2,168; p = 0,092F = 1,404; p = 0,248F = 1,047; p = 0,354F = 0,916; p = 0,404F = 1,036; p = 0,360F = 2,540; p = 0,004F = 1,152; p = 0,331F = 1,834; p = 0,053F = 1,343; p = 0,059F = 1,138; p = 0,245F = 1,115; p = 0,277F = 1,258; p = 0,118F = 1,099; p = 0,306F = 7,371; p < 0,001F = 2,096; p = 0,053F = 7,318; p < 0,001F = 1,576; p = 0,103 *F = 3,973; p < 0,001F = 5,842; p = 0,001F = 2,432; p = 0,091F = 1,057; p = 0,352Erläuterung:obere Zeile: multivariate Varianzanalyseuntere Zeile: multivariate e<strong>in</strong>faktorielle Kovarianzanalyse*: Levene-Test auf Gleichheit <strong>der</strong> Varianzen nicht erfüllt (p < 0,010)
AnhangXXIAnhang 8: Screeplots, routierte Komponentenmatrix, erklärte Gesamtvarianz<strong>und</strong> Komponentendiagramm <strong>in</strong> routierten Raum bei <strong>der</strong> Faktorenananlyse zurDimensionsf<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelkennwerteScreeplotScreeplot5544Eigenwert32Eigenwert3211001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16FaktorErläuterung:l<strong>in</strong>ks: Screeplot <strong>der</strong> verwendeten Faktorenanalyse <strong>mit</strong> paarweisem Fallausschlussrechts: Screeplot <strong>der</strong>selben Faktorenanalyse <strong>mit</strong> listenweisem Fallausschluss (das5-Komponenten-Modell wird hier noch deutlicher als l<strong>in</strong>ks, allerd<strong>in</strong>gs wirdaufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> hohen Zahl fehlen<strong>der</strong> Werte <strong>der</strong> paarweise Fallausschluss fürdie Faktorenanalyse gewählt)
AnhangXXIImotivationale Unterstützung (aus SSI)emotionale Unterstützung (aus SSI)<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung (aus SSI)<strong>in</strong>formationale Unterstützung (aus SSI)gegebene Unterstützung (aus SSI)Netzstärke aus SSI<strong>Soziale</strong> ResonanzZufriedenheits<strong>in</strong>dex aus FEGWahrgenommene Unterstützung (aus BSSS)Suche nach Unterstützung (aus BSSS)Problem<strong>in</strong>dex aus FEGNetzgröße aus SSIÄn<strong>der</strong>ungsdruck aus FEGDestruktivität des engen NetzesKonstruktivität des engen NetzesBedürfnis nach Unterstützung (aus BSSS)Rotierte Komponentenmatrix aExtraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.Rotationsmethode: Varimax <strong>mit</strong> Kaiser-Normalisierung.a. Die Rotation ist <strong>in</strong> 5 Iterationen konvergiert.Komponente1 2 3 4 5,878 ,112 -,042 ,042 ,056,844 ,187 -,048 -,030 -,043,833 ,070 -,091 ,094 ,011,776 ,010 ,012 ,048 ,110,667 ,199 ,189 -,185 ,043,595 ,351 -,204 ,022 -,067,075 ,727 -,076 -,105 ,002,128 ,672 ,010 ,164 -,120,250 ,669 -,197 ,035 ,184,244 ,466 ,012 -,002 ,327,038 -,201 ,692 ,214 ,060-,073 ,338 ,678 -,122 -,167-,061 -,253 ,645 ,077 ,133-,045 -,054 ,078 ,842 ,045,057 ,117 ,070 ,793 -,060,018 ,052 ,054 -,018 ,904Erklärte GesamtvarianzAnfängliche EigenwerteRotierte Summe <strong>der</strong> quadrierten LadungenKomponente Gesamt % <strong>der</strong> Varianz Kumulierte % Gesamt % <strong>der</strong> Varianz Kumulierte %14,335 27,095 27,095 3,737 23,356 23,35621,772 11,075 38,170 2,098 13,114 36,47031,491 9,316 47,486 1,503 9,395 45,86541,272 7,952 55,438 1,494 9,336 55,20251,012 6,327 61,765 1,050 6,564 61,7656,942 5,888 67,6537,827 5,169 72,8228,704 4,401 77,2239,656 4,098 81,32110,570 3,565 84,88611,534 3,337 88,22412,513 3,207 91,43113,481 3,005 94,43514,354 2,210 96,64515,316 1,972 98,61816,221 1,382 100,000Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
AnhangXXIIIKomponentendiagramm im rotierten Raum1,0sozreszufriepasKomponente 20,50,0-0,5netzgrprobleaenddrsusekonstrunfsdestrunetzstemotigegumotiv<strong>in</strong>str<strong>in</strong>for-1,0-1,0-0,50,0Komponente 10,51,01,00,50,0-0,5Komponente 3-1,0
AnhangXXIVAnhang 9: Häufigkeitsverteilungen <strong>der</strong> z-transformierten <strong>und</strong> ger<strong>und</strong>etenDimensionswerteÄußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, ger<strong>und</strong>etInneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, ger<strong>und</strong>et400500400300Häufigkeit200Häufigkeit3002001001000-2 -1 0 1 2Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, ger<strong>und</strong>et0-4 -3 -2 -1 0 1Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, ger<strong>und</strong>etStörungen im sozialen Netz, ger<strong>und</strong>etVerän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialen Netzes, ger<strong>und</strong>et500200400150Häufigkeit300200Häufigkeit100501000-2 -1 0 1 2Störungen im sozialen Netz, ger<strong>und</strong>et0-1 0 1 2 3 4Verän<strong>der</strong>ungssensitivität des sozialen Netzes, ger<strong>und</strong>etUnterstützungsbedarf, ger<strong>und</strong>et400300Häufigkeit2001000-3 -2 -1 0 1 2 3Unterstützungsbedarf, ger<strong>und</strong>et
AnhangXXVAnhang 10: Zusammenhänge zwischen 5 Dimensionen <strong>und</strong> Rahmendaten <strong>der</strong>StichprobeAlterGeschlechtReligionszugehörigkeitBerührungsdauer<strong>mit</strong><strong>Sterben</strong>/<strong>Tod</strong>PersonengruppeInstitutionsartÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>A: p
AnhangXXVIKurze Erläuterung <strong>der</strong> relevanten Zusammenhänge zwischen den gebildetenDimensionen <strong>und</strong> den Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe:Die Verb<strong>in</strong>dung zu den demographischen Rahmendaten <strong>der</strong> Stichprobe ist erwartungsgemäß ger<strong>in</strong>gerals bei den E<strong>in</strong>zelwerten, da ke<strong>in</strong>e Operationalisierung <strong>der</strong> gebildeten Dimensionswerte im H<strong>in</strong>blickauf Fragebogenskalen vorliegt. Um e<strong>in</strong> Instrument zur Testung <strong>der</strong> fünf gef<strong>und</strong>en Dimensionen anverschiedenen Stichproben zu erhalten, müssten dazu die Schritte <strong>der</strong> Fragebogenkonstruktiondurchlaufen werden.Es zeigen sich generell die für die E<strong>in</strong>zelkennwerte geschil<strong>der</strong>ten Zusammenhänge auch <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gererAusprägung für die gebildeten Dimensionen. Die aussagekräftigsten Zusammenhänge s<strong>in</strong>d dabei diefolgenden:Mittelwert Inneres Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>0,0-0,1-0,2Drei <strong>der</strong> fünf gebildeten Dimensionen zeigen e<strong>in</strong>eVerb<strong>in</strong>dung zur Religionszugehörigkeit desBefragten: Schwach ist <strong>der</strong> Zusammenhangzwischen Äußerem E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong>Religionszugehörigkeit sowie zwischen Störungenim sozialen Netz <strong>und</strong> Religionszugehörigkeit. E<strong>in</strong>starker Zusammenhang besteht zwischenReligionszugehörigkeit <strong>und</strong> InneremVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>: So zeigen Menschen, die ke<strong>in</strong>ereligiöse o<strong>der</strong> spirituelle Überzeugung angeben,signifikant ger<strong>in</strong>gere Werte im „Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>“als alle an<strong>der</strong>en Befragten.-0,3feste Religionszugehörigkeitke<strong>in</strong>e, aber <strong>in</strong>nere spirituelleÜberzeugungReligionszugehörigkeitke<strong>in</strong>e religiöse o<strong>der</strong> spÜberzeugungMittelwert Äußeres E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>0,20,10,0-0,1-0,2-0,3Ger<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>d die Zusammenhänge <strong>der</strong> sozialenDimensionen zur Institutionszugehörigkeit desBefragten: Es besteht e<strong>in</strong> schwacher Zusammenhangzwischen Störungen im sozialen Netz <strong>und</strong> Institutionsart.E<strong>in</strong> stärkerer Zusammenhang zeigt sich zum ÄußerenE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>: Befragte aus <strong>in</strong>tensivmediz<strong>in</strong>ischenStationen sowie Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen gebensignifikant ger<strong>in</strong>gere Werte im ÄußerenE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> an als Befragte aus Palliativstationen,onkologischen Stationen sowie stationären Hospizen.KP = Krankenhaus, PalliaKI = Krankenhaus, IntensiKO = Krankenhaus, OnkoAP = Alten- <strong>und</strong> PflegeheiAD = Ambulanter DienstSH = Stationäres Hospiz
AnhangXXVIIMittelwert0,30,20,10,0-0,1-0,2-0,3PatientInnenPflegendeÄrztInnenEhrenamtlicheÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungen imsozialen NetzAussagekräftiger s<strong>in</strong>d die Zusammenhänge zwischenden sozialen Dimensionen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Personengruppe, <strong>der</strong>die Befragten angehören. Hier zeigen sich hochsignifikante Beziehungen zum ÄußerenE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> sowie höchst signifikante Beziehungenzum Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong> zu den Störungen imsozialen Netz: So äußern die befragten ÄrtzInnen dasvon allen Personengruppen signifikant ger<strong>in</strong>gste ÄußereE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>, während Psychosozial Tätige <strong>in</strong> diesesozialen Dimension die höchsten Werte angeben. BeimInneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> geben die befragtenPatientInnen von allen Befragten die signifikantger<strong>in</strong>gsten Werte an, während die höchsten Werte vonSeelsorgenden, Freiwillig Helfenden <strong>und</strong> PsychosozialTätigen erreicht werden. In den angegebenen Störungenim sozialen Netz geben die PatientInnen die ger<strong>in</strong>gstenWerte an, während Bezugspersonen <strong>und</strong> PsychosozialTätige die höchsten Störungswerte erzielen.BezugspersonenSeelsorgerInnenPsychosozial TätigePersonengruppeMittelwert0,30,20,10,0ÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>InneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Verän<strong>der</strong>ungssensitivität dessozialen NetzesSchließlich liegt bei e<strong>in</strong>igen Dimensionen sozialerE<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung noch e<strong>in</strong> geschlechtsdifferenzieren<strong>der</strong>Effekt vor. So weisen die weiblichen Befragten <strong>der</strong>Stichprobe signifikant höhere Werte im ÄußerenE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> <strong>und</strong> im Inneren Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> auf alsdie männlichen. Männliche Befragte h<strong>in</strong>gegen erzielensignifikant höhere Werte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungssensitivitätdes sozialen Netzes.-0,1-0,2-0,3männlichGeschlechtweiblich
AnhangXXVIIIAnhang 11: Varianzanalytische <strong>und</strong> kovarianzanalytische (demographischeRahmendaten kontrolliert) Beziehungen zwischen den fünf Dimensionen <strong>und</strong>den Outcome-VariablenÄußeresE<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Störungen imsozialen NetzInneresVerb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong>Verän<strong>der</strong>ungssensitivitätdesNetzesUnterstützungsbedarfGenerellesF = 1,616;p = 0,170Wohlbef<strong>in</strong>den F = 2,615;p = 0,035 *MomentanesF = 1,713;p = 0,146Wohlbef<strong>in</strong>den F = 2,139;p = 0,075Anzahl <strong>der</strong> F = 2,167;p = 0,072BelastungsquellenF = 1,831;p = 0,122BelastungsausmaßF = 0,653;p = 0,625F = 0,719;p = 0,579EmotionaleF = 0,476;p = 0,754Erschöpfung F = 0,537;p = 0,709Intr<strong>in</strong>sischeF = 1,463;p = 0,213Motivierung F = 3,069;p = 0,016ErlebteF = 0,781;p = 0,538UnzufriedenheitF = 2,294;p = 0,059KlientenaversionF = 2,164;p = 0,073F = 3,851;p = 0,004ReaktivesF = 0,347;p = 0,846Abschirmen F = 0,954;p = 0,433MultivariateTeststatistikF = 24,152;p < 0,001 *F = 25,632;p < 0,001 *F = 16,587;p < 0,001 *F = 21,734;p < 001 *F = 3,757;p = 0,011F = 4,195;p = 0,006F = 10,639;p < 0,001F = 13,227;p < 0,001 *F = 7,980;p < 0,001F = 11,744;p < 0,001F = 8,550;p < 0,001F = 14,293;p < 0,001F = 12,039;p < 0,001F = 17,332;p < 0,001F = 4,311;p = 0,005F = 4,634;p = 0,003F = 3,369;p = 0,019F = 5,046;p = 0,002F = 5,241;p < 0,001F = 6,163;p < 0,001 *F = 7,701;p < 0,001F = 8,477;p < 0,001 *F = 17,043;p < 0,001F = 19,194;p < 0,001F = 30,940;p < 0,001 *F = 38,828;p < 0,001F = 3,990;p = 0,004F = 3,814;p = 0,005F = 3,342;p = 0,011F = 3,250;p = 0,012F = 4,763;p = 0,001F = 4,890;p = 0,001F = 2,112;p = 0,079F = 2,282;p = 0,060F = 0,519;p = 0,722F = 0,511;p = 0,728F = 0,637;p = 0,637F = 0,246;p = 0,912F = 0,730;p = 0,573F = 1,335;p = 0,259F = 0,808;p = 0,522F = 2,909;p = 0,023F = 0,353;p = 0,842F = 1,538;p = 0,193F = 0,896;p = 0,468F = 1,895;p = 0,113F = 0,859;p = 0,490F = 2,839;p = 0,026F = 0,110;p = 0,979F = 1,509;p = 0,201F = 1,633;p = 0,169F = 1,303;p = 0,271F = 0,228;p = 0,922F = 0,561;p = 0,691F = 1,020;p = 0,412F = 1,064;p = 0,383F = 0,741;p = 0,617F = 0,536;p = 0,760F = 0,502;p = 0,807F = 0,181;p = 0,982F = 0,474;p = 0,828F = 0,647;p = 0,693F = 0,886;p = 0,505F = 0,973;p = 0,443F = 1,550;p = 0,161F = 1,943;p = 0,073 *F = 0,346;p = 0,912F = 1,152;p = 0,331F = 1,299;p = 0,257F = 2,017;p = 0,062F = 0,242;p = 0,962F = 0,474;p = 0,8270,257 0,000 0,000 0,784 0,626(Pillai-Spur) 0,031 0,000 0,000 0,171 0,448Erläuterung:obere Zeile: multivariate Varianzanalyseuntere Zeile: multivariate e<strong>in</strong>faktorielle Kovarianzanalyse*: Levene-Test auf Gleichheit <strong>der</strong> Varianzen nicht erfüllt (p < 0,010)
AnhangXXIXAnhang 12: Operationalisierung, Interkorrelationen <strong>und</strong>Häufigkeitsverteilungen <strong>der</strong> PersönlichkeitsmaßeName desE<strong>in</strong>zelkennwertsProaktivitätSelbstwirksamkeitTranspersonalesVertrauenInternaleKontrollüberzeugungSozial bed<strong>in</strong>gteKontrollüberzeugungFatalistisch bed<strong>in</strong>gteKontrollüberzeugungQuelle desE<strong>in</strong>zelkennwertsSkalenwert aus„Fragebogen zurProaktivenE<strong>in</strong>stellung“Skalenwert aus„Fragebogen zurSelbstwirkamkeit“Skalenwert ausTPVMarkeritem ausFKKMarkeritem ausFKKMarkeritem ausFKKBildung des KennwertsSUM(pe01,pe02pol,pe03,pe04pol,pe05,pe06pol) /(6 –NMISS(pe01,pe02pol,pe03,pe04pol,pe05,pe06pol))SUM(pe07,pe08,pe09,pe10) / (4 – NMISS(pe07,pe08,pe09,pe10))SUM(pe18,pe19,pe20,pe21) / 4 –NMISS(pe18,pe19,pe20,pe21))pe11pe12pe13ProaktivitätSelbstwirksamkeitTranspersonalesVertrauenInternaleKontollüberzeugungSozial bed<strong>in</strong>gteExternalitätFatalistischbed<strong>in</strong>gteExternalitätProaktivität 1,000 ,299(**) ,145(**) ,370(**) -,379(**) -,181(**)Selbstwirksamkeit 1,000 ,085(*) ,349(**) -,176(**) -,029Transpersonales Vertrauen 1,000 ,017 ,004 -,029Internale Kontollüberzeugung1,000 -,227(**) -,051Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität 1,000 ,160(**)Fatalistisch bed<strong>in</strong>gteExternalität1,000** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).
AnhangXXXProaktivitätSelbstwirksamkeit12025010020080Häufigkeit60Häufigkeit150100402050004,003,833,803,753,673,603,503,333,253,203,173,002,832,802,672,602,502,402,332,202,172,001,831,601,331,00Proaktivität1,001,251,331,501,671,752,002,252,502,672,753,00Selbstwirksamkeit3,253,333,503,673,754,00Transpersonales VertrauenInternale Kontollüberzeugung (Markeritem aus FKK)140400120100300Häufigkeit8060Häufigkeit200401002001,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,67 3,75 4,00Transpersonales Vertrauen01,00 2,00 3,00 4,00Internale Kontollüberzeugung (Markeritem aus FKK)Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem aus FKK)Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem aus FKK)400300300Häufigkeit200Häufigkeit20010010001,00 2,00 3,00 4,00Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem aus FKK)01,00 2,00 3,00 4,00Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem aus FKK)
AnhangXXXIAnhang 13: Partielle Korrelationen zwischen den sozialen <strong>Ressourcen</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong>Dimensionen <strong>und</strong> den Persönlichkeitseigenschaften (demographischeRahmendaten <strong>und</strong> Outcome kontrolliert)ProaktivitätSelbstwirksamkeitTranspersonalesVertrauenInternaleKontollüberzeugungWahrgenommene Korr. ,393 ,090 ,150 ,234 -,171 ,136Unterstützung Sign. ,011 ,576 ,350 ,142 ,285 ,398Bedürfnis nach Korr. -,021 -,081 ,145 -,109 ,112 ,149Unterstützung Sign. ,895 ,615 ,367 ,498 ,485 ,352Suche nachKorr. ,292 -,147 -,083 ,003 -,009 ,207Unterstützung Sign. ,064 ,359 ,608 ,987 ,958 ,194<strong>in</strong>formationale Korr. -,061 ,108 -,028 ,011 ,004 -,086Unterstützung Sign. ,705 ,503 ,863 ,948 ,980 ,591<strong>in</strong>strumentelle Korr. -,049 ,223 ,018 ,129 ,117 -,241Unterstützung Sign. ,761 ,161 ,910 ,420 ,467 ,128motivationale Korr. -,278 ,036 -,059 ,104 ,172 -,017Unterstützung Sign. ,078 ,825 ,713 ,519 ,282 ,914emotionaleKorr. ,099 ,325 -,146 ,268 ,180 ,013Unterstützung Sign. ,540 ,038 ,361 ,090 ,259 ,937gegebeneKorr. ,128 ,309 -,132 ,029 -,122 -,175Unterstützung Sign. ,425 ,050 ,410 ,857 ,446 ,273<strong>Soziale</strong> ResonanzKorr. ,077 ,121 ,066 ,016 ,048 -,395Sign. ,633 ,450 ,680 ,920 ,764 ,011NetzgrößeKorr. -,217 -,224 ,201 ,048 ,078 -,020Sign. ,174 ,158 ,208 ,768 ,628 ,903Korr. ,034 ,074 ,065 ,066 -,047 ,121Sign. ,834 ,645 ,688 ,683 ,772 ,450Korr. ,020 -,268 -,148 -,262 ,004 -,347Sozialbed<strong>in</strong>gteExternalitätFatalistischbed. ExternalitätNetzstärkeZufriedenheits<strong>in</strong>dexSign. ,900 ,090 ,357 ,099 ,980 ,026Problem<strong>in</strong>dexKorr. -,119 ,173 -,117 ,053 -,265 ,096Sign. ,459 ,280 ,468 ,742 ,094 ,548Korr. -,241 ,072 -,009 -,157 ,222 -,041Sign. ,129 ,653 ,958 ,326 ,163 ,799Korr. ,170 -,271 ,168 ,051 ,059 -,115Än<strong>der</strong>ungsdruckKonstruktivität desengen Netzes Sign. ,289 ,087 ,293 ,751 ,713 ,473Destruktivität des Korr. ,039 -,142 -,014 ,072 ,285 -,106engen Netzes Sign. ,808 ,377 ,929 ,656 ,071 ,510ÄußeresKorr. ,097 ,151 ,260 ,138 -,100 -,132E<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> Sign. ,252 ,075 ,002 ,105 ,240 ,119InneresKorr. ,303 ,032 ,230 ,103 -,159 -,195Verb<strong>und</strong>ense<strong>in</strong> Sign. ,000 ,704 ,006 ,226 ,061 ,021Störungen im Korr. ,014 -,088 ,090 ,073 ,071 ,025sozialen Netz Sign. ,869 ,299 ,290 ,393 ,403 ,773Verän<strong>der</strong>ungssensitivitätdesKorr. ,065 -,293 ,015 -,017 ,099 -,018sozialen NetzesSign. ,449 ,000 ,859 ,845 ,244 ,837UnterstützungsbedarfKorr. ,072 ,023 ,031 ,136 -,028 ,082Sign. ,399 ,789 ,718 ,110 ,741,334
AnhangXXXIIAnhang 14: Erklärte Gesamtvarianz <strong>und</strong> routierte Komponentenmatrix <strong>der</strong>Faktorenanalyse von personalen <strong>und</strong> sozialen <strong>Ressourcen</strong>Komponente12345678910111213141516171819202122Erklärte GesamtvarianzAnfängliche EigenwerteRotierte Summe <strong>der</strong> quadrierten LadungenGesamt % <strong>der</strong> Varianz Kumulierte % Gesamt % <strong>der</strong> Varianz Kumulierte %4,625 21,022 21,022 3,862 17,556 17,5562,454 11,153 32,175 2,176 9,889 27,4451,573 7,151 39,326 1,951 8,868 36,3131,335 6,070 45,395 1,558 7,083 43,3961,287 5,852 51,247 1,535 6,975 50,3721,194 5,427 56,674 1,386 6,302 56,674,993 4,512 61,186,935 4,248 65,435,866 3,934 69,369,765 3,479 72,847,733 3,332 76,180,715 3,252 79,432,612 2,781 82,212,587 2,670 84,883,549 2,496 87,379,530 2,407 89,786,502 2,280 92,065,492 2,237 94,303,413 1,877 96,180,335 1,524 97,703,290 1,316 99,020,216 ,980 100,000Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
AnhangXXXIIIRotierte Komponentenmatrixamotivationale Unterstützung (aus SSI)emotionale Unterstützung (aus SSI)<strong>in</strong>strumentelle Unterstützung (aus SSI)<strong>in</strong>formationale Unterstützung (aus SSI)gegebene Unterstützung (aus SSI)Netzstärke aus SSI<strong>Soziale</strong> ResonanzZufriedenheits<strong>in</strong>dex aus FEGWahrgenommene Unterstützung (aus BSSS)Suche nach Unterstützung (aus BSSS)Problem<strong>in</strong>dex aus FEGNetzgröße aus SSIÄn<strong>der</strong>ungsdruck aus FEGDestruktivität des engen NetzesKonstruktivität des engen NetzesBedürfnis nach Unterstützung (aus BSSS)ProaktivitätSelbstwirksamkeitTranspersonales VertrauenInternale Kontollüberzeugung (Markeritem ausFKK)Sozial bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem aus FKK)Fatalistisch bed<strong>in</strong>gte Externalität (Markeritem ausFKK)Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.Rotationsmethode: Varimax <strong>mit</strong> Kaiser-Normalisierung.a. Die Rotation ist <strong>in</strong> 7 Iterationen konvergiert.Komponente1 2 3 4 5 6,878 -,008 ,106 -,045 ,032 ,065,850 ,102 ,106 -,045 -,018 -,033,834 ,013 ,029 -,088 ,090 ,016,773 -,117 ,058 ,007 ,032 ,052,675 ,076 ,168 ,187 -,158 -,114,607 ,212 ,245 -,203 ,031 -,060,110 ,350 ,608 -,103 -,043 -,213,151 ,049 ,574 -,164 ,269 -,127,297 ,254 ,534 -,239 ,109 -,021,282 ,289 ,388 ,038 ,039 ,094,011 -,174 -,040 ,690 ,174 ,144-,102 -,176 ,507 ,494 -,076 -,040-,059 ,055 -,235 ,776 ,054 -,047-,040 -,103 -,055 ,094 ,810 ,018,065 ,020 ,060 ,076 ,786 -,009,039 ,215 ,156 ,117 ,002 ,647,055 ,668 ,202 -,120 -,042 -,258,044 ,688 ,060 -,081 -,068 ,161,141 -,049 ,533 -,007 -,257 ,141,000 ,785 ,015 -,009 ,039 ,013-,009 -,407 -,064 ,017 ,131 ,520-,038 -,053 -,150 -,042 -,076 ,681
Eidesstattliche VersicherungHier<strong>mit</strong> erkläre ich an Eides statt, dass ich me<strong>in</strong>e Dissertationsschrift <strong>mit</strong> dem Titel„<strong>Soziale</strong> <strong>Ressourcen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Begegnung</strong> <strong>mit</strong> <strong>Sterben</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong>“selbständig <strong>und</strong> ohne Benutzung an<strong>der</strong>er als <strong>der</strong> angegebenen Quellen <strong>und</strong>Hilfs<strong>mit</strong>tel angefertigt habe.Die Dissertationsschrift wurde <strong>in</strong> gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Form noch ke<strong>in</strong>erPrüfungsbehörde vorgelegt.Oldenburg, den 22. November 2006Gerl<strong>in</strong>de Geiss