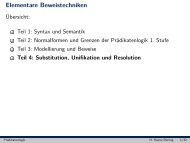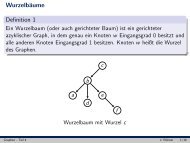Multidisziplinäre Vernetzung von Konzepten der Mensch
Multidisziplinäre Vernetzung von Konzepten der Mensch
Multidisziplinäre Vernetzung von Konzepten der Mensch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Usability-Engineering –<br />
<strong>Multidisziplinäre</strong> <strong>Vernetzung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Konzepten</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion<br />
Diplomarbeit<br />
Von Jana Neuhaus<br />
Matrikel-Nummer: 3599277<br />
Vorgelegt bei Prof. Dr. Gerd Szwillus<br />
17. Mai 2003<br />
Universität Pa<strong>der</strong>born<br />
Fakultät für Kulturwissenschaften<br />
Medienwissenschaft
Erklärung<br />
Ich versichere, dass ich die beiliegende Diplomarbeit ohne Hilfe Dritter<br />
und ohne Benutzung an<strong>der</strong>er als den angegebenen Quellen und<br />
Hilfsmitteln angefertigt habe.<br />
Verwendete Quellen sowie wörtlich o<strong>der</strong> inhaltlich entnommene<br />
Stellen sind als solche kenntlich gemacht.<br />
Diese Arbeit hat in gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde<br />
vorgelegen.<br />
17. Mai 2003<br />
Jana Neuhaus<br />
Württemberger Weg 44<br />
33102 Pa<strong>der</strong>born<br />
III
Danksagung<br />
Ich bedanke mich für die Betreuung meiner Arbeit bei Prof. Dr. Gerd<br />
Szwillus sowie bei Dr. Michael U. Krause.<br />
IV
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung 1<br />
2 Vorüberlegungen zum Medium<br />
2.1 Definition <strong>von</strong> Medien<br />
2.2 Wechselwirkungen zwischen dem Mediensystem<br />
und <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
2.2.1 Allgemeine gesellschaftliche Funktionen<br />
<strong>von</strong> Medien<br />
2.2.2 Wissensverteilung durch Medien<br />
2.2.3 Meinungsbildung<br />
2.3 Die Funktionen <strong>der</strong> Neuen Medien<br />
2.3.1 Individuelle primäre Medienfunktionen<br />
2.3.2 Kooperative primäre Medienfunktionen<br />
2.4 Das Internet als Träger <strong>von</strong> Webseiten<br />
2.4.1 Definition Internet<br />
2.4.2 Zur Entstehung des neuen Massenmediums<br />
2.4.3 Inhalte<br />
2.4.4 Bedeutung<br />
2.5 <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion<br />
2.5.1 Definition<br />
2.5.2 Funktionalitäten<br />
3 Einführung in Usability<br />
3.1 Entstehung <strong>von</strong> Usability<br />
3.2 Definition <strong>von</strong> Usability<br />
3.3 Die Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
3.4 Methoden zur Bewertung <strong>von</strong> Usability<br />
3.4.1 Operationalisierte Methoden<br />
3.4.2 Anwen<strong>der</strong>tests<br />
3.4.3 Gutachterinspektionen<br />
3.4.4 Methodenauswahl<br />
4 Wirtschaftliche Komponenten<br />
4.1 Das traditionelle Marketing<br />
5<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
10<br />
12<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
19<br />
21<br />
22<br />
24<br />
24<br />
24<br />
28<br />
29<br />
31<br />
33<br />
36<br />
37<br />
40<br />
41<br />
45<br />
48<br />
48<br />
VI
4.1.1 Unternehmensziele<br />
4.1.2 Unternehmensstrukturen<br />
4.2 Die Kommunikation eines Unternehmens mit <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit<br />
4.2.1 Öffentlichkeitsarbeit<br />
4.2.2 Werbung<br />
4.2.3 Verkaufsför<strong>der</strong>ung<br />
4.3 Die Präsentation <strong>von</strong> Botschaften<br />
4.3.1 Planung<br />
4.3.2 Gestaltung<br />
4.4 Virtueller Markt<br />
4.4.1 Voraussetzungen zum eCommerce<br />
4.4.2 Stufen des elektronischen Marketings<br />
4.4.3 Virtuelle Transaktionsplattformen<br />
4.4.4 Online-Kommunikation zur Unterstützung<br />
des elektronischen Marketings<br />
4.4.5 Bedeutung <strong>der</strong> Kommerzialisierung des<br />
Internets<br />
4.5 Kundenmotivation durch Webseiten<br />
4.5.1 Intentionsrealisierung<br />
4.5.2 Kundenvertrauen<br />
4.5.3 Kundenbindung<br />
5 Psychologische Grundlagen<br />
5.1 Biologische Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung<br />
5.1.1 Visuelle Wahrnehmung<br />
5.1.2 Bewusstsein und Aufmerksamkeit<br />
5.1.3 Behalten und Erinnern<br />
5.1.4 Lernen und Verstehen<br />
5.1.5 Emotion und Motivation<br />
5.1.6 Gewöhnen und Erwarten<br />
5.1.7 Entscheiden<br />
5.1.8 Handeln und Fehler<br />
5.2 Informationsaufnahme und -verarbeitung bei Webseiten<br />
5.2.1 Wahrnehmungspsychologische Zusammenhänge<br />
5.2.2 Kognitive Zusammenhänge<br />
5.2.3 Rezeption <strong>von</strong> Texten auf Webseiten<br />
48<br />
51<br />
52<br />
52<br />
53<br />
54<br />
54<br />
55<br />
56<br />
58<br />
59<br />
59<br />
61<br />
63<br />
64<br />
65<br />
66<br />
67<br />
70<br />
72<br />
72<br />
73<br />
81<br />
82<br />
83<br />
84<br />
85<br />
85<br />
87<br />
89<br />
90<br />
93<br />
94<br />
VII
6 Gesetze und Normen als formale Basis <strong>der</strong><br />
Usability<br />
6.1 Entstehung und Bedeutung<br />
6.1.1 Übersicht über die gesamte DIN EN ISO<br />
9241<br />
6.1.2 Die einzelnen Teile <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241<br />
6.2 Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
6.2.1 Aufgabenangemessenheit<br />
6.2.2 Selbstbeschreibungsfähigkeit<br />
6.2.3 Steuerbarkeit<br />
6.2.4 Erwartungskonformität<br />
6.2.5 Fehlertoleranz<br />
6.2.6 Individualisierbarkeit<br />
6.2.7 Lernför<strong>der</strong>lichkeit<br />
6.3 Bewertung <strong>der</strong> Normen und ihre Anwendbarkeit<br />
7 Usability in <strong>der</strong> Nutzer-Website-<br />
Wechselwirkung<br />
7.1 Nutzerprofil<br />
7.1.1 Individuelle Voraussetzungen<br />
7.1.2 Möglichkeiten zur generellen Umsetzung<br />
<strong>von</strong> unterschiedlichen individuellen Faktoren<br />
7.1.3 Benutzerziele und Benutzerverhalten auf<br />
Webseiten<br />
7.2 Die Struktur <strong>von</strong> Webseiten<br />
7.2.1 Die Zielsetzung als Gerüst<br />
7.2.2 Aufbau<br />
7.3 Arten <strong>von</strong> Websites<br />
7.3.1 Identitäts-Sites<br />
7.3.2 Informations-Sites<br />
7.3.3 Shopping-Sites<br />
7.3.4 Community-Sites<br />
7.3.5 Unterhaltungs-Sites<br />
7.3.6 Lern-Sites<br />
7.3.7 Intranet und Extranet<br />
8 Gestaltung und Design<br />
8.1 Die Navigation in einer Website<br />
8.1.1 Navigationsleisten<br />
97<br />
98<br />
99<br />
100<br />
102<br />
102<br />
103<br />
105<br />
106<br />
107<br />
108<br />
109<br />
110<br />
112<br />
112<br />
112<br />
114<br />
116<br />
117<br />
118<br />
119<br />
121<br />
122<br />
123<br />
124<br />
125<br />
126<br />
128<br />
129<br />
131<br />
131<br />
132<br />
VIII
8.1.2 Hyperlinks<br />
8.1.3 Inhaltsverzeichnisse<br />
8.1.4 Informationen suchen und finden<br />
8.2 Das Layout einer Webseite<br />
8.2.1 Atmosphäre<br />
8.2.2 Farben<br />
8.2.3 Anordnung <strong>der</strong> Elemente<br />
8.2.4 Grafiken<br />
8.2.5 Multimediale Elemente<br />
8.2.6 Leere Bereiche<br />
8.2.7 Gestaltung <strong>von</strong> Texten und Schriften<br />
8.2.8 Formulierung <strong>von</strong> Texten<br />
134<br />
134<br />
136<br />
138<br />
138<br />
139<br />
143<br />
144<br />
146<br />
146<br />
148<br />
148<br />
9 Zusammenfassung und Ausblick 150<br />
Literaturverzeichnis 154<br />
IX
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1.1: Erste Tonwaren<br />
Abbildung 1.2: Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
Abbildung 2.1: Ebenen <strong>der</strong> Medienfunktionen<br />
Abbildung 3.1: Gebrauchstauglichkeit<br />
Abbildung 4.1: System <strong>der</strong> Zielebenen<br />
Abbildung 4.2: Unternehmerische Aufgaben<br />
Abbildung 5.1: Klassifikationsprozesse<br />
Abbildung 6.1: „Deutsche Post“<br />
Abbildung 6.2: „Space Art“<br />
Abbildung 6.3: „Telekom“<br />
Abbildung 6.4: „Amazon“<br />
Abbildung 7.1: Konzeptuelle Modelle<br />
Abbildung 7.2: Hierarchische Struktur<br />
Abbildung 7.3: Sequenzielle Struktur<br />
Abbildung 7.4: Netzstruktur<br />
Abbildung 7.5: „Helicopter Tours“<br />
Abbildung 7.6: „Universität Pa<strong>der</strong>born“<br />
Abbildung 7.7: „Brigitte Hachenburg exclusiv“<br />
Abbildung 7.8: „Ägyptologie-Community“<br />
Abbildung 7.9: „Online-Spiele“<br />
Abbildung 7.10: „Mathe Prisma“<br />
Abbildung 8.1: „Haribo“<br />
Abbildung 8.2: „AG Blömer“<br />
Abbildung 8.3: „WDR“<br />
Abbildung 8.4: „Die Welt“<br />
Abbildung 8.5: „Ferrari Deutschland“<br />
Abbildung 8.6: „comdirect“<br />
Abbildung 8.7: „BND“<br />
Abbildung 8.9: „berlin-tourismus-online“<br />
Tabellenverzeichnis<br />
1<br />
3<br />
15<br />
33<br />
49<br />
51<br />
80<br />
104<br />
105<br />
107<br />
109<br />
114<br />
119<br />
120<br />
121<br />
122<br />
124<br />
125<br />
126<br />
127<br />
128<br />
132<br />
135<br />
136<br />
137<br />
139<br />
140<br />
144<br />
147<br />
Tabelle 3.1: Methoden <strong>der</strong> Usability-Evaluation 46<br />
X
1 Einleitung<br />
Der Begriff „Usability“ ist gegenwärtig in aller Munde, auch wenn nicht<br />
immer klar ist, was sich genau dahinter verbirgt. Er hat etwas mit<br />
Gebrauchstauglichkeit zu tun und wird heute meist mit Software und Webseiten<br />
in Verbindung gebracht.<br />
Aber diese Thematik ist nichts grundsätzlich Neues. Bereits seit Beginn <strong>der</strong><br />
menschlichen Zivilisation werden Gebrauchsgegenstände mit bestimmten<br />
Funktionen, welche zur möglichst optimalen Erledigung <strong>von</strong> Aufgaben<br />
dienen sollen, entworfen. Gegenstände wurden darüber hinaus zusätzlich<br />
verziert, um ein vorhandenes Schönheitsempfinden zu befriedigen und beim<br />
Benutzer Zufriedenheit beim Anblick und während <strong>der</strong> Handhabung zu<br />
erzielen.<br />
Abbildung 1.1: Erste Tonwaren aus <strong>der</strong> Jungsteinzeit, hergestellt etwa um 10000 vor Christus.<br />
Sie wurden bereits mit Verzierungen versehen und bemalt. 1<br />
Wie anhand <strong>der</strong> Abbildung 1.1 zu sehen ist, gibt es also schon seit tausenden<br />
<strong>von</strong> Jahren ein Verständnis für die Gestaltung sowie die Nutzung <strong>von</strong> Hilfsmittel<br />
und Werkzeugen. Das Bewusstsein hierfür zieht sich durch bis zur<br />
Gegenwart. Beson<strong>der</strong>s bei dem Gebrauch <strong>von</strong> technischen Geräten wurde<br />
Herstellern wie Anwen<strong>der</strong>n gleichermaßen deutlich, wie wichtig eine gute<br />
und einfache Handhabung dieser ist.<br />
1 Foto: Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart<br />
1
Mit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>von</strong> Computern und Software sowie <strong>der</strong>en komplexen<br />
Funktionen und Möglichkeiten wurden die Anfor<strong>der</strong>ungen an ihre Bedienbarkeit<br />
immer anspruchsvoller. Nach dieser Erkenntnis erfuhr diese Problematik<br />
erstmalig konkrete Untersuchungen und Beschreibungen, die in den<br />
Begriff Usability mündeten.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit soll ausschließlich die Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
bzw. Websites 2 behandelt werden. Entwurf, Gestaltung sowie Bewertung<br />
<strong>von</strong> Webseiten geben gegenwärtig Anlass zu vielen Diskussionen. Da sich<br />
Webseiten mittlerweile zu einem stark frequentierten Medium entwickelt<br />
haben, bietet diese Thematik gleichzeitig hinsichtlich medienwissenschaftlicher<br />
Betrachtungen einen aktuellen und interessanten Untersuchungsgegenstand.<br />
Bei <strong>der</strong> Web-Usability geht es nicht nur, wie häufig angenommen, um die<br />
Gestaltung <strong>von</strong> Oberflächen. Es wirken zusätzlich die Aspekte vieler Fachgebiete<br />
ein. Faktoren wie ökonomische Interessen, psychologische Grundlagen,<br />
Normen und Richtlinien, technische und gesellschaftliche Funktionen<br />
<strong>von</strong> Medien, sowie die Wünsche und Vorstellungen <strong>der</strong> Benutzer spielen<br />
eine wesentliche Rolle. Dabei haben diese einzelnen Sachverhalte einen<br />
unterschiedlich engen Bezug zur Usability <strong>von</strong> Webseiten: Während zum<br />
Beispiel die Thematik „Medien“ eher als weiteres technisches Umfeld fungiert,<br />
stellen hingegen die Benutzer die wichtigste Quelle sowie Adresse für<br />
Usability dar. In Abbildung 1.2 werden diese Zusammenhänge sowie <strong>der</strong><br />
Einfluss <strong>der</strong> einzelnen Faktoren noch einmal dargestellt.<br />
Charakteristisches Ziel dieser Arbeit ist, die entsprechenden beteiligten<br />
Fachgebiete genau zu bestimmen und ihre jeweiligen usability-relevanten<br />
Bezüge und Sachverhalte zu beschreiben. Die einzelnen Themengebiete<br />
sollen interdisziplinär bearbeitet und jeweils im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Vernetzung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Konzepten</strong> <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion ineinan<strong>der</strong> integriert werden.<br />
Ähnliche multidisziplinäre Untersuchungen unter dem Gesichtspunkt <strong>der</strong><br />
Usability <strong>von</strong> Webseiten liegen in dieser Ausführlichkeit bislang nicht vor,<br />
2 Die Bezeichnungen „Usability <strong>von</strong> Webseiten“ und „Web-Usability“ werden in dieser<br />
Arbeit synonym verwendet. Der Begriff „Webseite“ beschreibt eine einzelne Seite,<br />
während mit „Website“ ein technisch zusammenhängendes System <strong>von</strong> mehreren<br />
Webseiten eines Anbieters gemeint ist.<br />
2
eson<strong>der</strong>s medienwissenschaftliche Überlegungen wurden in diesem Zusammenhang<br />
noch nicht unternommen.<br />
In dieser Arbeit wird <strong>der</strong> Anspruch erhoben, zum einen für alle beteiligten<br />
Disziplinen ein Verständnis <strong>der</strong> Thematik in ihrer Gesamtheit zu erzielen.<br />
Zum an<strong>der</strong>en soll dem Leser ein umfangreiches Bewusstsein für die Problematiken<br />
<strong>der</strong> Website-Usability vermittelt werden. Beson<strong>der</strong>s die Gewährleistung<br />
<strong>der</strong> Zufriedenheit <strong>der</strong> Benutzer <strong>von</strong> Webseiten stellt eine grundsätzliche<br />
Schwierigkeit dar: Zufriedenheit ist stets subjektiv und dementsprechend<br />
schwer zu gewährleisten.<br />
Medienfunktionen<br />
Benutzer<br />
Abbildung 1.2: Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
Normen<br />
Usability<br />
<strong>von</strong><br />
Webseiten<br />
Informationsverarbeitung<br />
Ökonomische<br />
Interessen<br />
Design<br />
Psychologische<br />
Grundlagen<br />
In dieser Arbeit wird generell auf verschiedene Arten <strong>von</strong> Websites eingegangen.<br />
Die mehrfache Bezugnahme auf kommerzielle Websites ist beabsichtigt,<br />
da diesen aufgrund ihrer ständig steigenden Anzahl eine große<br />
wirtschaftliche Bedeutung zukommt.<br />
Auf beson<strong>der</strong>e Probleme, die im Intranet und Extranet, auf behin<strong>der</strong>tengerechten<br />
Websites o<strong>der</strong> bei Lernsoftware auftreten, wird hier nicht näher<br />
eingegangen, da je<strong>der</strong> dieser Themenbereiche aufgrund seines Umfangs<br />
eigenständige Untersuchungen erfor<strong>der</strong>t.<br />
Die aufgezeigten Usability-Faktoren spiegeln sich mehr o<strong>der</strong> weniger in den<br />
einzelnen Webseiten wi<strong>der</strong>. Um das komplexe Zusammenspiel aller Einflussfaktoren<br />
zu erklären, wurde folgendes Vorgehen gewählt: In den verschiedenen<br />
Themenbereichen wird jeweils als Einstieg relevantes Basiswis-<br />
3
sen vermittelt, welches als Grundlage bei <strong>der</strong> Untersuchung des Themas<br />
dient und angewendet wird. Danach erfolgt ein fließen<strong>der</strong> Übergang zu den<br />
Beson<strong>der</strong>heiten <strong>von</strong> Websites, welche schließlich ausführlich erläutert werden.<br />
Da die verschiedenen usability-relevanten Themen auf Websites keine<br />
autonome Rolle spielen, son<strong>der</strong>n ständig aufeinan<strong>der</strong> einwirken und in ihrer<br />
Komplexität beachtet werden müssen, werden immer wie<strong>der</strong> Bezüge zwischen<br />
den einzelnen Kapiteln hergestellt.<br />
Zu Beginn <strong>der</strong> Arbeit werden einführend einige Vorüberlegungen zum Medium<br />
Webseite getroffen. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Einführung<br />
in das Thema Usability. Nach <strong>der</strong> Erläuterung wirtschaftlicher Komponenten<br />
und psychologischer Grundlagen folgt eine Ausführung formaler Grundlagen<br />
<strong>von</strong> Website-Usability. Abschließend wird auf die Usability-Umgebung<br />
Bezug genommen und um Gestaltungs- und Designprinzipien erweitert.<br />
Der Fokus dieser Arbeit liegt insgesamt weniger auf konkreten Gestaltungsempfehlungen<br />
o<strong>der</strong> -bewertungen, son<strong>der</strong>n vielmehr auf interdisziplinären<br />
Betrachtungen, wobei eine beson<strong>der</strong>e Gewichtung auf den Bereich <strong>der</strong> Psychologie<br />
erfolgt.<br />
4
2 Vorüberlegungen zum Medium<br />
Bevor die einzelnen Konzepte des Usability-Engineering miteinan<strong>der</strong> vernetzt<br />
und erläutert werden, erfolgen einige Vorüberlegungen zum Medium<br />
Webseite: Benutzerumfeld, Technik sowie Verbindungen zwischen <strong>Mensch</strong><br />
und Werkzeug bilden den gestalterischen Rahmen, in den die Web-Usability<br />
eingebettet wird. Er setzt sich aus den Ebenen Medien, Internet und <strong>Mensch</strong>-<br />
Computer-Interaktion zusammen.<br />
Das Arbeitsfeld einer Überprüfung <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten ist die Bildschirmoberfläche<br />
eines Computers. Mit Hilfe <strong>der</strong> dort angezeigten Objekte<br />
kann ein Benutzer mit dem Rechnersystem sowie seiner Umwelt interagieren.<br />
Bevor diese Plattform und <strong>der</strong>en Funktionalitäten dargestellt werden, wird<br />
auf zwei Bereiche Bezug genommen, die Träger <strong>der</strong> Web-Usability sind: Die<br />
Medien allgemein und das Internet. Durch dieses Vorgehen soll eine schrittweise<br />
Annäherung an die eigentliche Thematik erfolgen sowie bereits auf<br />
die Usability <strong>von</strong> Webseiten Einfluss nehmenden Faktoren eingegangen<br />
werden.<br />
2.1 Definition <strong>von</strong> Medien<br />
Eine klare und eindeutig abgrenzbare Definition <strong>von</strong> Medien gibt es bislang<br />
nicht. Durch die lange Geschichte <strong>von</strong> Medien (unter <strong>der</strong> Annahme, dass<br />
auch prähistorische Höhlenmalereien Medien sind) sowie ihrer vielfältigen<br />
Ausprägungen kann eine Definition nur hinsichtlich bestimmter individueller<br />
Techniken bzw. <strong>der</strong>en Anwendungsmöglichkeiten sinnvoll sein.<br />
Vorerst ist zur Bearbeitung des Themas eine Unterteilung des Medienbegriffs<br />
in einen engeren sowie in einen weiteren Rahmen hilfreich [vgl. TU-<br />
LODZIECKI (1997): 33 – 42].<br />
< Medien im weiteren Sinne werden als Möglichkeiten verstanden,<br />
mit denen Erfahrungen 3 gemacht werden können. Diese Formen<br />
3 Mit Erfahrungen meint Tulodziecki Sachverhalte bzw. Inhalte, mit denen <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> im<br />
Laufe seines Lebens in unterschiedlicher Form in Berührung kommt [vgl. TULOD-<br />
ZIECKI (1997): 34]. Hiermit können z.B. prähistorische Höhlenmalereien o<strong>der</strong> die<br />
Funktionsweise eines Schiffshebewerks gemeint sein.<br />
5
medialer Erfahrung können real, modellhaft, abbildhaft o<strong>der</strong><br />
symbolisch sein.<br />
< Medien im engeren Sinne gelten „als Mittler, durch die in kommunikativen<br />
Zusammenhängen bestimmte Zeichen mit technischer<br />
Unterstützung übertragen, gespeichert, wie<strong>der</strong>gegeben o<strong>der</strong><br />
verarbeitet und in abbildhafter o<strong>der</strong> symbolischer Form präsentiert<br />
werden. Die Zeichen fungieren dabei als Träger <strong>von</strong> Bedeutungen<br />
für die an <strong>der</strong> Kommunikation beteiligten Personen.“ 4<br />
Seit dem Ende <strong>der</strong> achtziger Jahre ist <strong>der</strong> spezielle Begriff <strong>der</strong> „Neuen Medien“,<br />
welche insbeson<strong>der</strong>e den Computer mit einschließen, hinzugekommen:<br />
< Neue Medien sind in diesem Zusammenhang Systeme, die zur<br />
Informationsbearbeitung, Informationsspeicherung sowie Informationsübermittlung<br />
dienen. Sie sind mit neuartigen Technologien<br />
(z.B. Glasfaserkabel) ausgestattet und zur Nutzung durch<br />
eine breite Öffentlichkeit bestimmt.<br />
Der Hauptzweck <strong>von</strong> Medien wird mit einem allgemeinen, vereinfachten<br />
Kommunikationsmodell erklärt: Ein Kommunikat (Übermittlungsobjekt)<br />
wird <strong>von</strong> einem Sen<strong>der</strong> unter Verwendung seiner jeweils spezifischen medialen<br />
Gestaltungsmöglichkeiten zu einem Empfänger gesendet, welches<br />
dieser verarbeitet und interpretiert. Bei diesem Ablauf gibt es verschiedene<br />
Einflussfaktoren, wie zum Beispiel gewisse Absichten des Sen<strong>der</strong>s sowie<br />
bereits vorhandene Einstellungen beim Empfänger. Institutionelle und soziale<br />
Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine Rolle.<br />
2.2 Wechselwirkungen zwischen dem Mediensystem<br />
und <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
Die jeweils praktizierten Kommunikationsformen sind ein wesentliches<br />
strukturelles Merkmal <strong>von</strong> Gesellschaften. Kommunikation för<strong>der</strong>t den<br />
Zusammenhalt einer Gesellschaft sowie die Einheit ihrer Sozialgebilde.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e mo<strong>der</strong>ne Gesellschaften benötigen zur schnellen Verbreitung<br />
4 TULODZIECKI (1997): 37<br />
6
und unbeschränkten Wie<strong>der</strong>gabe <strong>von</strong> Kommunikationsinhalten ein umfassendes<br />
Kommunikationsnetz. Nur so können den Beteiligten je<strong>der</strong>zeit vielfältige<br />
politische, wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen und Abhängigkeiten<br />
deutlich gemacht und <strong>von</strong> ihnen erfasst werden. Die Neuen Medien<br />
– und als Teil dieser auch das Internet – sind im Zeitalter <strong>der</strong> Globalisierung<br />
zu einer unverzichtbaren Einrichtung geworden [vgl. HUNZICKER<br />
(1996): 98] und haben sich zudem zu Massenmedien entwickelt.<br />
So spiegeln sich mehr o<strong>der</strong> weniger direkt auch auf Webseiten allgemeine<br />
gesellschaftliche Funktionen wi<strong>der</strong>, welche ein gewisses Potential zur Wissensverteilung<br />
und Meinungsbildung beinhalten. Da diese Faktoren (bedingt<br />
durch die Veröffentlichung <strong>von</strong> Webseiten mit entsprechenden Inhalten)<br />
innerhalb des Mediums Internet in ihrer Wirkung eine immer größer werdende<br />
Bedeutung erlangen, werden sie im Folgenden genauer erläutert.<br />
2.2.1 Allgemeine gesellschaftliche Funktionen <strong>von</strong> Medien<br />
Zur Erläuterung <strong>der</strong> Funktionsweise <strong>der</strong> Massenmedien bezüglich <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
werden in <strong>der</strong> Wissenschaft zwei verschiedene Ansätze herangezogen<br />
[vgl. HUNZICKER (1996): 98 ff]:<br />
Sozialwissenschaftliche Systemtheorie<br />
Materialistische Medientheorie<br />
In <strong>der</strong> sozialwissenschaftlichen Systemtheorie gilt die Annahme, dass zwischen<br />
dem jeweiligen Informationsmedium und <strong>der</strong> Gesellschaft Austauschbeziehungen<br />
in Form eines Wechselspiels bestehen: Das Mediensystem<br />
erhält <strong>von</strong> <strong>der</strong> Umwelt einen Input. Daraufhin erfolgt als Output die<br />
Berichterstattung durch die Medien. Die soziale Umwelt wie<strong>der</strong>um liefert<br />
dann zur erfolgten Berichterstattung ein Feedback.<br />
In <strong>der</strong> materialistischen Medientheorie herrscht die marxistische Tradition<br />
vor. In dieser wird da<strong>von</strong> ausgegangen, dass <strong>der</strong> Prozess <strong>der</strong> Massenkommunikation<br />
ein Teilaspekt <strong>der</strong> kapitalistischen Warenzirkulation ist: Hierbei<br />
sind die Medien die Ware, da sie einen Gebrauchswert und einen<br />
Tauschwert besitzen. Der Gebrauchswert (mit seinem Nutzen) wird jedoch<br />
zugunsten des Tauschwertes (dem Gewinn) vernachlässigt, da für die Rezipienten<br />
Informationsgehalt, künstlerische Qualität etc. <strong>von</strong> geringerer Be-<br />
7
deutung sind. Aus diesem Grund sind die Medienproduzenten bestrebt,<br />
möglichst gewinnbringende anstelle <strong>von</strong> möglichst nützlichen Inhalten zu<br />
verbreiten. 5<br />
Die beschriebene Warenzirkulation wird durch stimulierende Werbung<br />
unterstützt, welche beim Rezipienten die Illusion eines Zusatznutzens weckt<br />
und dadurch gerade den Tauschwert noch erhöht.<br />
Massenmedien haben in einer Gesellschaft ein großes Potential an Einflussmöglichkeiten<br />
[vgl. HUNZICKER (1996): 103 – 107]:<br />
Machtpotential<br />
Integrationspotential<br />
Ihr Machtpotential erzielen und erhalten (erfolgreiche) Medien bzw. <strong>der</strong>en<br />
Veröffentlichungen, indem sie die bestehende Gesellschaftsordnung tendenziell<br />
unterstützen: Da die Verbreitung <strong>von</strong> Inhalten an ein großes Publikum<br />
den Anschein einer breiten Zustimmung erweckt, wirkt diese Streuung,<br />
einschließlich ihrer Inhalte, legitimierend [vgl. HUNZICKER (1996): 104].<br />
Zusätzlich werden die Rezipienten durch die Art <strong>der</strong> Darstellung und<br />
Verbreitung sowie durch Selektion und beson<strong>der</strong>e Gewichtungen <strong>von</strong> Botschaften<br />
beeinflusst.<br />
Integration und <strong>der</strong>en Potential entsteht durch das Bewusstmachen einer<br />
Zugehörigkeit <strong>der</strong> verschiedenen Personen(gruppen) zu übergeordneten<br />
Sozialgebilden sowie zur gesamten Gesellschaft. Diese Zugehörigkeit bildet<br />
sich durch ein Hineinwachsen <strong>der</strong> Individuen in die Gesellschaft, indem sie<br />
Verhaltensmuster, Normvorstellungen und Werthaltungen übernehmen. Die<br />
Identifikation <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> einer Gesellschaft mit den vorhandenen elementaren<br />
Grundwerten des jeweiligen sozialen Umfeldes för<strong>der</strong>t gegenseitiges<br />
Verständnis. Basis hierfür ist eine umfassende Information.<br />
2.2.2 Wissensverteilung durch Medien<br />
In einer Gesellschaft werden verschiedene Arten <strong>von</strong> Wissen verbreitet. Die<br />
Verteilung richtet sich vor allem nach <strong>der</strong> (durch die Verteiler subjektiv<br />
5 Hier handelt es sich um zwei sich gegenseitig bedingende Faktoren. Welcher <strong>von</strong> ihnen als<br />
Einstieg in diesen Kreislauf zu bewerten ist, soll nicht Thema dieser Arbeit sein.<br />
8
estimmten) Relevanz, welche einer Information jeweils beigemessen wird.<br />
Die Empfänger nehmen die Aussage unterschiedlich auf. Das hier entstehende<br />
Wissensmuster ist abhängig <strong>von</strong> verschiedenen individuellen Einflussfaktoren:<br />
Rezeptionsbereitschaft, Bildung, Medienauswahl, technische Fähigkeiten<br />
zur Mediennutzung, Medienausstattung sowie inhaltliche Interessen<br />
und subjektive Kommunikationsbedürfnisse. Auf Grund dieser Faktoren<br />
entsteht in <strong>der</strong> Gesellschaft eine ungleichmäßige Verteilung <strong>von</strong> Wissen.<br />
Das über die Medien mitgeteilte Wissen dient vielfältigen Interessen <strong>der</strong><br />
Rezipienten. Aus diesem Grund besitzen die verbreiteten Informationen<br />
verschiedene inhaltliche Komponenten [vgl. HUNZICKER (1996): 120 ff]:<br />
(Politische) Information<br />
Spezialisiertes Sachwissen<br />
Unterhaltung<br />
(Politische) Informationen sind Wissensbestände, die <strong>von</strong> allgemeinem<br />
öffentlichem Interesse sind, wobei ein beson<strong>der</strong>s ausgeprägtes Interesse an<br />
politischen Informationen besteht. Im Allgemeinen verfügen Personen mit<br />
besserer Bildung über mehr Detail- und Hintergrundwissen, da <strong>von</strong> diesen<br />
Nutzerkreisen insbeson<strong>der</strong>e die Printmedien 6 mit ihren umfangreichen speziellen<br />
Informationen beson<strong>der</strong>s intensiv genutzt werden.<br />
Ein spezialisiertes Sachwissen wird durch breite und vielfältige Informationsaufnahme<br />
über verschiedenste Gebiete des Berufslebens sowie <strong>der</strong> Freizeitgestaltung<br />
erworben. Voraussetzungen sind informationstechnologische<br />
Spezialkenntnisse 7 , eine (evtl. eingeschränkte) freie Zugänglichkeit zu den<br />
betreffenden Informationen und entsprechende finanzielle Mittel. Dies aber<br />
begünstigt beson<strong>der</strong>s wirtschaftliche bzw. professionell organisierte Nutzer.<br />
Aktuelle Tendenz ist ein zunehmendes System <strong>von</strong> privatwirtschaftlichen<br />
und auf Gewinn orientierten Informationen, wobei eine enorme Ausweitung<br />
<strong>der</strong> Wissensproduktion vor allem in den wissenschaftlichen und technischen<br />
Sektoren festzustellen ist.<br />
6<br />
Diese Aussage bezieht sich insbeson<strong>der</strong>e auf jene Printmedien, die allgemein als seriös<br />
gelten.<br />
7<br />
Die gefor<strong>der</strong>ten Kenntnisse reichen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Lesefähigkeit bis zur Benutzung neuester,<br />
technisch komplexer Systeme.<br />
9
Das Erlangen <strong>von</strong> Sachkenntnissen kann eine verstärkte Individualisierung<br />
<strong>der</strong> Lebenslagen zur Folge haben, welche den Rückzug ins Private för<strong>der</strong>t.<br />
Die ausschließliche Beschäftigung mit (Neuen) Medien kann eine Herauslösung<br />
aus traditionellen gesellschaftlichen Gruppensolidaritäten und Ordnungsstrukturen<br />
bedeuten und letztendlich zu Vereinsamung führen.<br />
Das (populäre) Unterhaltungsprogramm richtet sich vor allem an ein Massenpublikum.<br />
Es erzielt seine breite Akzeptanz durch Darstellungsformen,<br />
die sich als publikumswirksam erwiesen haben. Die Inhalte vermitteln einerseits<br />
allgemein anerkannte Werte, signalisieren aber an<strong>der</strong>erseits gleichzeitig<br />
eine gewisse Loslösung aus den Zwängen des Alltags. Dem Rezipienten<br />
werden relativ anspruchslose Handlungsabläufe geboten sowie eine Identifikation<br />
mit vertrauten Persönlichkeitstypen ermöglicht. Da hier mit gleichen<br />
Inhalten die Mehrheit <strong>der</strong> Bevölkerung angesprochen wird, erfolgt auf diese<br />
Weise eine gewisse Gleichschaltung <strong>der</strong> Nutzer, welche beson<strong>der</strong>s bei Themen<br />
wie Sport und Darstellungen populärer Konsum-Lebensstile zum Tragen<br />
kommt [vgl. HUNZICKER (1996): 123, 125].<br />
Bedingt durch die technische sowie ökonomische Entwicklung <strong>der</strong> Medien<br />
ist es mittlerweile zu einem Überangebot an allgemein zugänglichen medial<br />
vermittelten Informationen gekommen 8 . Aufgrund o<strong>der</strong> trotz dieser Tatsache<br />
ist festzustellen, dass sich mit <strong>der</strong> Entwicklung des Mediensystems und <strong>der</strong><br />
Ausweitung seiner Kommunikationsangebote die Wissensunterschiede<br />
zwischen den verschiedenen Individuen und Bevölkerungsschichten vergrößern.<br />
Beson<strong>der</strong>s Personen mit höherer Bildung und höherem sozioökonomischen<br />
Status können sich (neues) Wissen schneller aneignen. Die Differenzen<br />
im Wissenspotential werden voraussichtlich noch weiter zunehmen.<br />
2.2.3 Meinungsbildung<br />
Der unspezifizierte Begriff <strong>der</strong> öffentlichen Meinung kann in zwei sich<br />
gegenseitig beeinflussenden Sichtweisen gesehen werden [vgl. HUNZI-<br />
CKER (1996): 112]:<br />
Sozialpsychologische Sicht<br />
Gesellschaftstheoretische Sicht<br />
8 In diesem Zusammenhang entstand <strong>der</strong> populäre Begriff <strong>der</strong> „Informationsüberflutung“,<br />
siehe auch Kapitel 4.2.2: „Werbung“.<br />
10
Aus sozialpsychologischer Sicht baut die öffentliche Meinung auf gemeinsamen<br />
Normen und Wertvorstellungen auf. Sie umfasst Meinungen und<br />
Verhaltensweisen, die das Individuum öffentlich äußern und einnehmen<br />
muss, wenn es sich nicht isolieren will.<br />
Die gesellschaftstheoretische Sicht begreift die öffentliche Meinung als<br />
einen funktionalen Bestandteil des politischen Systems: Der Ausdruck des<br />
Volkswillens wird <strong>von</strong> den Herrschenden als mehr o<strong>der</strong> weniger wichtiges<br />
Entscheidungselement in Betracht gezogen 9 .<br />
Für die Bildung <strong>der</strong> öffentlichen Meinung sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
<strong>von</strong> entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung [vgl. HUNZICKER (1996):<br />
111 ff]. Diese sind abhängig vom jeweiligen Gesellschaftssystem, seiner<br />
Struktur und dem gesellschaftlichen Schichtgefüge. Gleiches gilt für die<br />
Auswahl <strong>der</strong> Themen, die öffentlich diskutiert werden 10 . Dies trifft vor allem<br />
auf solche Themen zu, die <strong>von</strong> allgemeinem Interesse sind (z.B. soziale<br />
Rahmenbedingungen).<br />
Beim eben genannten Aspekt <strong>der</strong> öffentlichen Thematisierung spielen die<br />
Massenmedien eine beson<strong>der</strong>e Rolle: Es gibt die These, nach <strong>der</strong> die Rezipienten<br />
genau die Elemente und Inhalte <strong>der</strong> politischen Meinungsbildung als<br />
wichtig einstufen, die <strong>von</strong> den Medien hervorgehoben werden. Umgekehrt<br />
kann aber auch die Selektion und Gewichtung <strong>der</strong> Themen durch die Herausgeber<br />
abhängig sein vom Problembewusstsein des Publikums (z.B. durch<br />
seine beson<strong>der</strong>e Anteilnahme).<br />
Entscheidend ist letztendlich die Aufnahme eines Problems durch die Instanzen,<br />
<strong>von</strong> denen die Bevölkerung Lösungen erwarten (z.B. Politik, Wirtschaft,<br />
Kultur, bestimmte Bevölkerungsteile), und <strong>der</strong>en Reaktionen darauf.<br />
Ein allgemeines (sozialpsychologisches) Wirkungskonzept zur Bildung <strong>der</strong><br />
öffentlichen Meinung hat E. Noelle-Neumann entworfen [vgl. HUNZICKER<br />
(1996): 119]: Ausgangspunkt sind sozialpsychologische Erkenntnisse zur<br />
Entstehung <strong>von</strong> konformen Verhalten. Demnach passen sich die meisten<br />
<strong>Mensch</strong>en aus Furcht vor sozialer Isolation in ihrem Prozess <strong>der</strong> Meinungsbildung<br />
<strong>der</strong> gegenwärtigen bzw. zukünftig angenommenen Mehrheitsmei-<br />
9<br />
Diese Auffassung entspricht staatstheoretischen Modelvorstellungen zur politischen Partizipation<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung.<br />
10<br />
Im Gegensatz dazu gibt es Themen, die im Allgemeinen <strong>der</strong> Privatsphäre vorbehalten<br />
bleiben.<br />
11
nung an. Dazu beobachten sie (mit Hilfe <strong>der</strong> Medien) ihre soziale Umwelt<br />
und nehmen das vorherrschende Meinungsbild auf, welches sie dann letztendlich<br />
selbst vertreten.<br />
Abschließend ist zu sagen, dass jedes Medium versucht, mit seinen Inhalten<br />
ein gewünschtes Zielpublikum zu erreichen. Entsprechende Erfolge können<br />
durch die Wirkungsforschung überprüft und nachgewiesen werden. Die<br />
Folgen für die Gesellschaft als Ganzes sind jedoch meist langfristig und<br />
somit zu großen Teilen noch offen.<br />
Wissensverteilung und Meinungsbildung durch Medien sind Faktoren, die<br />
eine übergeordnete gesamt-gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. Damit diese<br />
Meta-Funktionen ihre Wirkung entfalten können, müssen sie zuvor auf einer<br />
tieferen Ebene umgesetzt werden. Hierfür dienen mehrere technische Möglichkeiten,<br />
die <strong>von</strong> den Herstellern sowie Nutzern <strong>der</strong> (Neuen) Medien angewendet<br />
werden. Im folgenden Kapitel werden diese Voraussetzungen zur<br />
Mediengestaltung ausführlich erläutert.<br />
2.3 Die Funktionen <strong>der</strong> Neuen Medien<br />
Medien sind nicht neutral. Sie werden bestimmt durch ein Wechselspiel <strong>von</strong><br />
drei sie bestimmenden Faktoren: Ihre technische Beschaffenheit, ihre praktische<br />
Verwendung sowie einen das Medium umgebenden Mythos 11 [vgl.<br />
MÜNKER, ROESLER (2002): 15].<br />
Seit ihrem Vorhandensein unterstützen Medien insbeson<strong>der</strong>e geistige Prozesse<br />
12 . Sie gestatten es, Phänomene 13 aufzubewahren, zu verän<strong>der</strong>n und<br />
gegebenenfalls wahrnehmbar zu machen 14 . Aus diesem Grund sind die Mittel<br />
zur Mediennutzung so zu gestalten, dass <strong>der</strong> manuelle sowie kognitive<br />
11 Beispiel: „In Büchern abgedrucktes Wissen gilt stets als bewiesen und richtig.“ O<strong>der</strong>: „Im<br />
Internet sind alle gewünschten Informationen zu finden.“ Weitere Erläuterungen dazu<br />
in Kapitel 2.4.4: „Bedeutung des Internets“.<br />
12 Medien können geistige Prozesse bei ungünstiger Gestaltung jedoch auch behin<strong>der</strong>n.<br />
13 Phänomene in diesem Zusammenhang sind Denken (individueller Prozess <strong>der</strong> Informationsverarbeitung)<br />
und Lernen (kultureller Prozess <strong>der</strong> kooperativen Erschließung und<br />
Gestaltung <strong>der</strong> menschlichen Umwelt). [vgl. KEIL-SLAWIK, SELKE (1998)]<br />
14 In diesem Zusammenhang wird häufig die Metapher „Artefakte als externes Gedächtnis“<br />
verwendet (siehe weitere Ausführungen).<br />
12
Aufwand während <strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> (primären) Medienfunktionen verringert<br />
wird.<br />
Medien können aufgrund ihrer maschinellen Abläufe technische Prozesse<br />
för<strong>der</strong>n, indem sie menschliche Handlungen o<strong>der</strong> Handlungssequenzen<br />
unterstützen o<strong>der</strong> ersetzen. Insbeson<strong>der</strong>e trifft dieser Sachverhalt auf die<br />
Neuen Medien zu und soll im Folgenden genauer erläutert werden. Zur<br />
Erklärung wird das <strong>von</strong> Keil-Slawik und Selke [vgl. KEIL-SLAWIK, SEL-<br />
KE (1998): 171 – 175] aufgestellte und <strong>von</strong> Hampel [vgl. HAMPEL (2002):<br />
37 ff] weiter entwickelte spezifische Konzept <strong>der</strong> Medienfunktionen<br />
hinzugezogen. Dieses wird in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit erstmalig als Ansatz<br />
zur Usability <strong>von</strong> Webseiten – bezüglich <strong>der</strong> technischen Möglichkeiten<br />
während <strong>der</strong> Benutzung – verwendet.<br />
In diesem Entwurf werden (für den Bereich <strong>der</strong> Neuen Medien) technische<br />
gegenüber den nicht-technischen Aspekten <strong>von</strong> Medienfunktionen spezifiziert<br />
und gegeneinan<strong>der</strong> abgegrenzt. Er wurde insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich des<br />
virtuellen Lernens entwickelt. Da auch bei <strong>der</strong> Benutzung <strong>von</strong> Webseiten<br />
beim Nutzer ein ständiger Lernprozess (z.B. Erfassen <strong>von</strong> Site-Strukturen)<br />
erfolgt, wird <strong>der</strong> vorliegende Entwurf hier angewendet. Gleichzeitig entfaltet<br />
es auch Allgemeingültigkeit bezüglich <strong>der</strong> Medienfunktionen.<br />
Ausgangspunkt dieses Konzeptes sind zwei Grundüberlegungen:<br />
< Da <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> nicht in <strong>der</strong> Lage ist, allein durch sein Vorstellungsvermögen<br />
neue Erkenntnisse über einen Gegenstand zu<br />
gewinnen, ist sein Denken an Wahrnehmung und physisches<br />
Handeln gebunden. Die zum Lernen notwendige Informationsgewinnung<br />
ist nur unter Verwendung <strong>von</strong> Medien möglich.<br />
< Die Evolution des menschlichen Geistes ist im Wesentlichen eine<br />
Evolution <strong>der</strong> verwendeten Ausdrucksmittel: Verän<strong>der</strong>t hat<br />
sich nicht die generelle Ausstattung des <strong>Mensch</strong>en, son<strong>der</strong>n seine<br />
kulturelle Entwicklung sowie die seiner Werkzeuge.<br />
Physische bzw. technische Elemente <strong>von</strong> Medien und <strong>der</strong>en Verwendung<br />
erzeugen eine neue Qualität im Umgang mit ihnen. Die spezielle Ausübbarkeit<br />
(Aufwand und Nutzungspotential <strong>von</strong> Medien) für die Nutzer gilt hier<br />
als Identifikation einer Medienfunktion. Gemessen an diesem Aufwand<br />
sowie dem Nutzen entstehen drei Klassen <strong>von</strong> Medienfunktionen.<br />
13
Primäre Medienfunktionen<br />
Sekundäre Medienfunktionen<br />
Tertiäre Medienfunktionen<br />
Primäre Medienfunktionen veranschaulichen die technischen Möglichkeiten<br />
<strong>von</strong> Medien – ihre verschiedenen Medienprodukte sowie ihre jeweiligen<br />
technischen Funktionen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass primäre Medienfunktionen<br />
elementare Funktionen beinhalten, um Artefakte, zum Beispiel<br />
durch Zeichen o<strong>der</strong> Zeichensysteme, in den Wahrnehmungsraum des <strong>Mensch</strong>en<br />
zu bringen und diese physisch zu bearbeiten. Möglich sind außerdem<br />
die Erfahrung neuer Wahrnehmungsdimensionen und Erschließungsqualitäten,<br />
wodurch Vorstellungen und Realität durch Handlungen in Beziehung<br />
gesetzt werden können.<br />
Sekundäre Medienfunktionen beschreiben nicht-technische Möglichkeiten<br />
<strong>von</strong> Medien. Diese beziehen sich insbeson<strong>der</strong>e auf das Wissen über den<br />
Gebrauch <strong>der</strong> Medien. Hier geht es um (insbes. didaktische) Kenntnisse über<br />
Art <strong>der</strong> Auswahl sowie Zusammenstellung <strong>der</strong> Medien, Lehr-Lern-Verhalten<br />
und Funktionsweise sozialer Gruppenprozesse.<br />
Tertiäre Medienfunktionen charakterisieren das Medium als selbst anpassungs-<br />
und lernfähig 15 .<br />
Die drei Medienfunktionen sind in hierarchischen Ebenen aufgebaut, wobei<br />
die primären Medienfunktionen genau abgrenzbar sind und sich in <strong>der</strong> ersten<br />
Ebene an oberster Position befinden. Die sekundären Medienfunktionen<br />
liegen in einem umfangreicheren Radius auf einer tieferen (zweiten) Ebene.<br />
Ihre inhaltlichen Abgrenzungen sind jedoch nicht genau spezifizierbar.<br />
Die tertiären Medienfunktionen werden hier so dargestellt, dass sie (unter<br />
<strong>der</strong> Annahme vollständiger Funktionalität) mindestens auf die sekundären<br />
Medienfunktionen Einfluss nehmen, später evtl. auch auf die primären Funktionen.<br />
Die Position <strong>der</strong> Ebene kann, bedingt durch das mangelnde Wissen<br />
im Bereich <strong>der</strong> künstlichen Intelligenz, nicht genau festgelegt werden. Mög-<br />
15 Hier wird <strong>von</strong> <strong>der</strong> Annahme <strong>der</strong> „künstlichen Intelligenz“ ausgegangen. Die Entwicklung<br />
solcher Systeme unterliegt <strong>der</strong> wissenschaftlichen Forschung.<br />
14
licherweise verhält sie sich horizontal zu den beiden übrigen Ebenen 16 . Zur<br />
Veranschaulichung dient die Abbildung 2.1:<br />
1. Ebene<br />
2. Ebene<br />
Abbildung 2.1: Ebenen <strong>der</strong> Medienfunktionen<br />
3. Ebene<br />
Die sekundären sowie tertiären Medienfunktionen besitzen aufgrund ihrer<br />
theoretischen Dimension vorerst nur wenig Relevanz für die Entwicklung<br />
praktischer Medientechniken – das Verständnis <strong>der</strong> Funktionen und Wirkungen<br />
<strong>der</strong> primären Medienfunktionen steht zunächst im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Nach Keil-Slawik, Selke und Hampel [vgl. HAMPEL (2002)] sind beson<strong>der</strong>s<br />
die primären Medienfunktionen ein wesentlicher Bestandteil eines jeden<br />
Lernprozesses, da sie ein großes Potential in <strong>der</strong> Intensivierung und Rationalisierung<br />
<strong>von</strong> (Lern)Prozessen aufweisen und je<strong>der</strong> Lernende somit selbst<br />
durch seine Intelligenz (und kooperative Zusammenarbeit) einen Wissenszuwachs<br />
erzielt. Der Nutzer hat die Möglichkeit, Materialien in sein Wahrnehmungsfeld<br />
und in seinen Handlungsraum zu bringen und mit diesen<br />
(möglichst fließend, ohne störende Medienbrüche) zu lernen. Dadurch<br />
wächst sein geistiges Leistungsvermögen, und <strong>der</strong> Nutzer kann bedeutungsvolle<br />
Sinnzusammenhänge schaffen.<br />
Im Folgenden werden die primären Medienfunktionen weiter unterteilt in<br />
individuelle sowie kooperative Medienfunktionen 17 .<br />
16 Dies könnte im Bereich <strong>der</strong> „künstlichen Intelligenz“ weiter untersucht werden.<br />
17 In diesem Zusammenhang besteht die Idee des Zusammenfassens <strong>von</strong> individuellen und<br />
kooperativen Medienfunktionen aufgrund <strong>von</strong> möglichen Abgrenzungsschwierigkeiten.<br />
Da die entsprechende Forschungsleistung noch erbracht werden muss, wird in<br />
dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen.<br />
15
2.3.1 Individuelle primäre Medienfunktionen<br />
Die primären Medienfunktionen erklären die Nutzung <strong>von</strong> Medien durch<br />
einen einzelnen Anwen<strong>der</strong>. Aufgrund ihrer bereits oben beschriebenen Bedeutung<br />
werden sie in eine weitere praxisbezogene Funktionsebene eingeglie<strong>der</strong>t<br />
und erläutert [vgl. HAMPEL (2002): 41 – 43]:<br />
Erzeugen<br />
Arrangieren<br />
Verknüpfen<br />
Löschen<br />
Beim Erzeugen werden Zeichen mit Hilfe technischer Mittel kreiert, wie<br />
zum Beispiel das Anfertigen <strong>von</strong> Skizzen o<strong>der</strong> das Erschaffen <strong>von</strong> Modellen.<br />
Voraussetzungen zum Erzeugen sind Ausdauer und vor allem eine ständige<br />
Verfügbarkeit <strong>der</strong> dazu notwendigen Materialien.<br />
Beim Arrangieren werden Erkenntnisse, unterschiedliche Darstellungen und<br />
Beschreibungsformen sowie verschiedene Aussagen miteinan<strong>der</strong> kombiniert<br />
und in Beziehung gesetzt (wobei räumliche Anordnungen <strong>von</strong> Zusammenhängen<br />
eine schnellere Erkennung und Bearbeitung ermöglichen). Daraus<br />
folgende logische Zusammenhänge können mit ihren jeweiligen Übereinstimmungen<br />
o<strong>der</strong> Differenzen neue Einsichten liefern. Voraussetzung dafür<br />
ist, dass mehrere Materialien gleichzeitig und möglichst frei angeordnet in<br />
das Wahrnehmungsfeld des Nutzers gelangen.<br />
Durch Verknüpfen werden (dauerhafte) Beziehungen und Referenzen zwischen<br />
beliebigen einzelnen Materialien hergestellt. Dieses Erstellen <strong>von</strong><br />
logischen Zusammenhängen ist unabhängig <strong>von</strong> den jeweiligen Positionen<br />
sowie <strong>der</strong> Gestalt <strong>der</strong> verbundenen Materialien. Verknüpfungen spiegeln<br />
mentale Strukturen wie<strong>der</strong> und dienen zur Reduktion sowie Konzentration<br />
<strong>von</strong> Wissen. Dies stellt eine elementare Vorbedingung zur Schaffung eines<br />
Wahrnehmungs- und Handlungsraumes dar.<br />
Das Löschen <strong>von</strong> Medieninhalten bedeutet das gezielte Entfernen <strong>von</strong> Materialien<br />
aus dem Wahrnehmungsraum des <strong>Mensch</strong>en, wobei die Zugreifbar-<br />
16
keit des referenzierten Materials beeinflusst wird. Es kann zudem Auswirkungen<br />
auf an<strong>der</strong>e Materialien haben. Löschen ist eine grundlegende Funktion<br />
eines jeden Lern- und Arbeitsprozesses.<br />
2.3.2 Kooperative primäre Medienfunktionen<br />
Die primären kooperativen Medienfunktionen zeigen den Umgang mit Medien<br />
durch mehrere Nutzer. Hierbei gibt es bezüglich des Zeitpunktes <strong>der</strong><br />
Mediennutzung durch die Teilnehmer synchrone und asynchrone Formen.<br />
Gegenüber den individuellen Medienfunktionen erfolgen bei den kooperativen<br />
Funktionen Verbesserungen auf technischer und auf mentaler Seite: Es<br />
können einerseits mögliche Medienbrüche bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Funktionen<br />
reduziert, und an<strong>der</strong>erseits die Arbeitsumgebung durch die Nutzer<br />
zumindest teilweise selbstorganisiert und -administriert werden.<br />
Zusätzlich zu den oben beschriebenen individuellen Merkmalen kommen bei<br />
den primären kooperativen Medienfunktionen weitere Funktionen hinzu [vgl.<br />
HAMPEL (2002): 43 – 48]:<br />
Zugreifen<br />
Übertragen<br />
Synchronisieren<br />
Beim Zugreifen werden gemeinsame Berechtigungen durch kooperative<br />
Nutzung <strong>von</strong> Materialien erworben. Das heißt, dass ein Zugriff auf Materialien<br />
einer an<strong>der</strong>en Person möglich wird. Dieser Zugriff kann auch <strong>von</strong> verschiedenen<br />
Orten (meist asynchron, aber auch zeitgleich möglich) sowie<br />
ohne Einwirkung des Herstellers erfolgen. Schreib- und Leserechte werden<br />
durch Nutzerrechte gesteuert.<br />
Übertragen bedeutet den Transport, also das aktive Übertragen, <strong>von</strong> Medien<br />
bzw. <strong>der</strong>en Inhalten. Diese werden zwischen Personen o<strong>der</strong> zwischen Personen<br />
und einem Medium (Vermittlung <strong>der</strong> Übertragung) ausgetauscht. Die<br />
Anzahl sowie die Richtung <strong>der</strong> Beteiligten kann in einer eins-zu-eins- o<strong>der</strong><br />
in einer eins-zu-n-Beziehung erfolgen. Voraussetzung zur erfolgreichen<br />
Übertragung ist eine explizite Adressierung und Identifikation des Adressaten.<br />
17
Durch Synchronisieren werden Sichten auf gemeinsame Objekte sowie<br />
Rückmeldungen über Handlungen an diesen übermittelt. Es entsteht eine<br />
zeitnahe gegenseitige Wahrnehmung zwischen den Kooperationspartnern<br />
sowie zwischen ihnen und den gemeinsamen Dokumenten und Arrangements.<br />
Darstellungen können abgeglichen und gegebenenfalls aktualisiert<br />
werden.<br />
Die primären Medienfunktionen sind durch ein Medium bereitgestellte<br />
Funktionalitäten, die überwiegend auch während <strong>der</strong> Erstellung und Nutzung<br />
<strong>von</strong> Webseiten zum Einsatz kommen. So können zum Beispiel durch den<br />
Hersteller Texte erzeugt und gelöscht, Hyperinks 18 eingefügt und auf bestehende<br />
Webseiten zugegriffen und diese verän<strong>der</strong>t werden. Nutzer haben auf<br />
Webseiten die Möglichkeit, Texte in „Newsgroups“ 19 zu schreiben (erzeugen)<br />
und diese (sofern implementiert) wie<strong>der</strong> zu löschen, Dateien herunter zu<br />
laden (zugreifen), sowie E-Mails zu versenden (übertragen) 20 . Hier wird<br />
deutlich, welche Möglichkeiten insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Benutzer besitzt, wenn er<br />
mit Hilfe <strong>von</strong> Webseiten seine Aufgabenziele optimal bearbeitet und dieses<br />
Medium effizient und effektiv für sich nutzen möchte.<br />
2.4 Das Internet als Träger <strong>von</strong> Webseiten<br />
Nach <strong>der</strong> Erläuterung des Themas Medien als eine erste Ebene <strong>der</strong> gestalterischen<br />
Basis <strong>von</strong> Webseiten folgt nun die zweite, darauf aufsetzende Ebene –<br />
das Internet. Gemäß den in Kapitel 2.1: „Definition <strong>von</strong> Medien“ aufgeführten<br />
Definitionen ist das Internet ein Medium, da es die einzelnen Kriterien<br />
erfüllt.<br />
Im Folgenden werden die Inhalte und die Bedeutung des Internets erläutert.<br />
Zuvor wird kurz seine Entstehung dargestellt, sowie seine Entwicklung zu<br />
einem Massenmedium – ein Aspekt, <strong>der</strong> die ökonomische Notwendigkeit<br />
einer Usability <strong>von</strong> Webseiten begründet.<br />
18 Gerichtete Verbindungen zwischen zwei Webseiten<br />
19 Nachrichtenforum, in dem Benutzer ihre Meinungen u. ä. öffentlich mitteilen können.<br />
20 Arrangieren und Synchronisieren (ausgenommen in Webseiten eingebettete Chat-Systeme)<br />
sind im Zusammenhang mit Webseiten we<strong>der</strong> während <strong>der</strong> Erstellung noch während<br />
<strong>der</strong> Nutzung möglich.<br />
18
2.4.1 Definition Internet<br />
Das Internet ist die Gesamtheit aller weltweit zusammengeschlossenen<br />
Computernetzwerke, die nach einem standardisierten Verfahren (z. Z.<br />
TCP/IP) miteinan<strong>der</strong> kommunizieren. Dazu gehören die über Standleitungen<br />
verbundenen Knotenrechner und Server, sowie die Computer <strong>der</strong> Internetnutzer,<br />
die nur zeitweise, meist über Telefonleitungen, mit dem Internet<br />
verbunden sind [vgl. INTERNET & RECHT (2003)].<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Internetnutzer lag im Jahr 2001 bei schätzungsweise vierhun<strong>der</strong>t<br />
Millionen. Allein in Deutschland hatte im selben Jahr knapp die Hälfte<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung Zugang zum Internet [vgl. MÜNKER, ROESLER (2002):<br />
13].<br />
2.4.2 Zur Entstehung des neuen Massenmediums<br />
Die Entstehung und Entwicklung des Internets kann in drei Stufen eingeteilt<br />
werden:<br />
Strategisches Experiment des amerikanischen Militärs<br />
Internationale Kommunikationsplattform <strong>der</strong> universitären Forschung<br />
Zunehmend kommerzialisiertes Medium<br />
Die Idee zur Kommunikation mittels Datenpakete kam unabhängig <strong>von</strong>einan<strong>der</strong><br />
fast zeitgleich in den USA sowie in Großbritannien auf. Der entscheidende<br />
Anlass zur späteren Entwicklung des Internets waren jedoch die Befürchtungen<br />
<strong>der</strong> USA, die Vorherrschaft im All an die Sowjetunion (Start<br />
des Sputniks 1957) zu verlieren. So wurde am Ende <strong>der</strong> fünfziger Jahre<br />
durch das amerikanische Pentagon eine neue Forschungsgruppe gegründet –<br />
die „Advanced Research Project Agency“ (kurz: Arpa) – eine Abteilung des<br />
US-Verteidigungsministeriums. Deren Mitglie<strong>der</strong> entwickelten 1969 ein<br />
dezentrales Netzwerk: Das „ARPANET“ (Advanced Research Projects<br />
Agency Network). Dessen Innovation war <strong>der</strong> Aufbau eines Netzwerkes mit<br />
<strong>von</strong>einan<strong>der</strong> unabhängigen Rechnern, welches selbst bei einem Ausfall <strong>von</strong><br />
einem o<strong>der</strong> mehreren Netzrechnern arbeitsfähig blieb.<br />
Diese Tatsache unterstützte in beson<strong>der</strong>em Maße das immer noch vorhandene<br />
strategische Ziel: Computer verschiedener militärischer Stützpunkte<br />
19
sollten so miteinan<strong>der</strong> verbunden werden können, dass selbst bei einem<br />
Nuklearschlag die Kommunikation innerhalb des Netzwerkes nicht abreißen<br />
konnte. Der beson<strong>der</strong>e Vorteil lag darin, dass nach Meinung <strong>der</strong> Militärs die<br />
beson<strong>der</strong>e Robustheit des Systems sowie <strong>der</strong> Kommunikation dadurch gesichert<br />
wurde, dass es we<strong>der</strong> Zentralrechner noch einzelne Kontrollinstanzen<br />
gab.<br />
Aber auch die Wissenschaft mit ihren Universitäten und Forschungsinstituten<br />
erkannten den Nutzen <strong>der</strong> neuen Technologie – diesmal jedoch hinsichtlich<br />
des (friedlichen) Austausches <strong>von</strong> Daten und Informationen. Zur damaligen<br />
Zeit waren Rechnerkapazitäten extrem teuer. Durch eine gemeinsame<br />
Nutzung (räumlich getrennter Forscher) konnten erhebliche Kosten gespart<br />
und Rechenleistungen ermöglicht werden. Im Herbst 1969 ging das<br />
„ARPANET“ durch einen Zusammenschluss mit den Universitäten in<br />
Kalifornien (Berkeley) und Utah sowie dem Stanford Research Institute<br />
online. Die Nutzung als Medium des rein wissenschaftlichen<br />
Informationsaustausches setzte sich zunehmend durch und die Zahl <strong>der</strong><br />
beteiligten Universitäten stieg schnell an.<br />
Die technischen Möglichkeiten wurden ständig weiterentwickelt: 1971 wurden<br />
das „File-Transfer-Protocol“ (FTP, Möglichkeit des direkten Austauschs<br />
<strong>von</strong> Dateien zwischen einzelnen Rechnern), das „Telnet“ (Möglichkeit des<br />
direkten Zugriffs auf einen an<strong>der</strong>en angeschlossenen Computer) sowie die<br />
user@host-Konvention (Programmierung des Internet-E-Mail-Dienstes)<br />
entworfen. Anfang Oktober 1971 wurde dann zum ersten Mal tatsächlich<br />
eine elektronische Nachricht <strong>von</strong> einem Rechner an einen an<strong>der</strong>en übertragen<br />
– die sog. E-Mail. Nun bestand die Möglichkeit, auf einfache Art und<br />
Weise unter den beteiligten Wissenschaftlern Informationen auszutauschen.<br />
Dies hatte erhebliche anspornende Auswirkungen auf den weiteren Ausbau<br />
des Netzes, welches dann erstmals 1972 öffentlich vorgestellt wurde. 1982<br />
entstand die Idee des Internets – <strong>der</strong> Verbindung unterschiedlicher Rechner.<br />
Basis war die Definition einheitlicher Kommunikationsschnittstellen durch<br />
(TCP/IP-) Protokolle: „Transmission Control Protocol“ (TCP, Überwachung<br />
des Versands sowie Zusammenführung verlorener o<strong>der</strong> beschädigter Datenpakete)<br />
und „Internet Protocol“ (IP, Adressierung <strong>der</strong> Datenpakete).<br />
Zwar wurde das Arpanet-Experiment bereits 1987 offiziell beendigt, aber<br />
erst 1990 endgültig abgeschaltet.<br />
20
Ende <strong>der</strong> achtziger Jahre war das Internet bereits ein weltweites Computernetz,<br />
<strong>der</strong> breiten Bevölkerungsmasse zu dieser Zeit aber noch unbekannt.<br />
1991 entwickelte Tim Berners-Lee am Schweizer Kernforschungszentrum<br />
CERN in Genf das „World Wide Web“, den grafischen Teil des Internets.<br />
Erst mit <strong>der</strong> Erfindung des WWW wurde das Internet insgesamt populär. 21<br />
Ein wesentlicher Beitrag zur Nutzung <strong>der</strong> technischen Möglichkeiten des<br />
Internets ist die Entwicklung <strong>der</strong> einheitlichen Seitenbeschreibungssprache<br />
„HTML“ (Hyper Text Markup Language) sowie die zunehmende Multimediatauglichkeit.<br />
Mitte <strong>der</strong> neunziger Jahre trat das Internet seinen globalen<br />
Siegeszug an und erzielte seinen Durchbruch zum Massenmedium durch die<br />
verstärkte Entwicklung <strong>von</strong> grafischen Benutzeroberflächen zusammen mit<br />
verschiedenen Browsertechnologien. Durch die Umwandlung des Computers<br />
<strong>von</strong> einer reinen Rechenmaschine in ein Kommunikationsmedium erhielt das<br />
Internet eine äußerst flexible Struktur.<br />
2.4.3 Inhalte<br />
Die thematischen Inhalte des Internets sind praktisch unbegrenzt. Das Internet<br />
lässt sich für alles nutzen, was digitalisierbar ist o<strong>der</strong> mit dem Austausch<br />
digitaler Daten zu tun hat. Im Allgemeinen unterliegen die Inhalte jedoch<br />
zwei bestimmenden Dimensionen:<br />
Grundsätzliche Prinzipien<br />
Inhaltliche Struktur<br />
Zu den Prinzipien des Internets gehören drei Faktoren: Interaktivität, Dezentralität<br />
und Unabgeschlossenheit:<br />
< Interaktiv ist Kommunikation bereits per Definition – und im Internet<br />
herrschen verschiedenste Formen <strong>der</strong> Kommunikation. Je<strong>der</strong><br />
Nutzer kann außerdem Sen<strong>der</strong> sowie Empfänger in einer Person<br />
sein.<br />
< Die Dezentralität ist ein Ergebnis <strong>der</strong> ehemals strategischen Aufgabenstellung.<br />
Sie wird weiterhin verfolgt.<br />
< Das Internet ist außerdem ein globaler Verbund unterschiedlicher<br />
einzelner Rechnerarchitekturen und Netzwerktechniken und auf<br />
21 Vermutlich aus diesem Grund ist <strong>der</strong> Begriff des WWW inzwischen fälschlicherweise zum<br />
Synonym für das Internet geworden.<br />
21
unbegrenztes Wachstum ausgerichtet. In ihm gibt es keine räumlichen<br />
Beschränkungen und es ist offen für die verschiedensten<br />
Formen <strong>der</strong> Nutzung. Dies macht seine Unabgeschlossenheit aus<br />
[vgl. MÜNKER, ROESLER (2002): 17 ff].<br />
Die inhaltliche Struktur des Internets (bzw. die Informationsdarstellung auf<br />
Webseiten) wird im Wesentlichen bestimmt durch „seine Ziele“: Informationsvermittlung<br />
sowie Dienstleistungs- und Produktangebote.<br />
Sinn <strong>der</strong> Informationsvermittlung ist es, zweckbezogenes Wissen über Zustände<br />
und Ereignisse (per Kommunikation) zu speichern, zu verarbeiten<br />
und zu übermitteln. Der Informationsfluss ist dabei die Gesamtheit aller<br />
Informationen, die zwischen Sen<strong>der</strong>n und Empfängern ausgetauscht werden<br />
[vgl. GABLER (1993)].<br />
Produktangebote sind Ergebnisse <strong>der</strong> Produktion und werden eingeteilt in<br />
materielle Güter (Sach-, Gebrauchs-, Verbrauchsgüter) sowie immaterielle<br />
Güter (Dienstleistungen). Ihre Charakterisierungen erfolgen durch die Art<br />
<strong>der</strong> Kombination materieller und immaterieller Produktanteile sowie <strong>der</strong><br />
realisierten Produktfunktionen. Produkte sind meist das Sachziel einer Unternehmung<br />
und dienen dem Käufer zur Bedürfnisbefriedigung [vgl.<br />
GABLER (1993)].<br />
Als Dienstleistungen werden immaterielle Güter angesehen, bei denen die<br />
Produktion und <strong>der</strong>en Verbrauch zeitlich zusammen fallen. Sie sind we<strong>der</strong><br />
lagerfähig, noch transportierbar, noch übertragbar (z.B. Bank- und Versicherungsleistungen,<br />
Angebote kultureller Einrichtungen) [vgl. GABLER<br />
(1993)].<br />
Jegliche Inhalte des Internets und dessen Handhabung liegen allein in <strong>der</strong><br />
Ausführung sowie Verantwortung seiner Nutzer.<br />
2.4.4 Bedeutung<br />
Das neuartige und beson<strong>der</strong>e am Medium Internet sind die rasanten technischen<br />
Innovationen und grundlegende gesellschaftliche Verän<strong>der</strong>ungen, die<br />
es mit sich brachte. Es sind völlig neue Kulturtechniken entstanden (die<br />
gleichzeitig auf alte, noch bestehende Techniken zurückwirken). Außerdem<br />
ist erstaunlich, dass die bereits erwähnten Einflussfaktoren auf Medien, wie<br />
Entwicklung, Gebrauch und Mythos, beim Internet (vermutlich bedingt<br />
durch die vergleichsweise kurze zeitliche Entwicklung) weitgehend parallel<br />
22
verlaufen sind [vgl. MÜNKER, ROESLER (2002): 11 ff; BACHOFER<br />
(1998): 14; TUTT (2002): 14 ff].<br />
Die Nutzer informieren sich schneller, arbeiten und kommunizieren an<strong>der</strong>s<br />
und agieren globaler in einer kleiner gewordenen, medial verän<strong>der</strong>ten Welt<br />
[vgl. MÜNKER, ROESLER (2002): 23]. Marshall Mc Luhan, <strong>der</strong> inzwischen<br />
als Grün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Medienwissenschaft gilt, hat in diesem Zusammenhang<br />
den Begriff des „Globalen Dorfes“ geprägt: In unserem elektrischen<br />
Zeitalter ist die gesamte <strong>Mensch</strong>heit durch ein weltumspannendes Netz<br />
miteinan<strong>der</strong> verflochten – sie wird elektrisch zusammengezogen – „Raum<br />
und Zeit“ werden aufgehoben [vgl. MC LUHAN (1995): 15 ff]. Als mittlerweile<br />
selbstverständlicher Ausdruck gesamtgesellschaftlicher Praxis findet<br />
Leben und Handeln im elektronischen Raum statt – das Internet ist nicht<br />
mehr wegzudenken.<br />
Zu Beginn illusionierte <strong>der</strong> „Raum“ Internet sogar die Eroberung eines neuen<br />
fernen Kontinents, des „Cyberspace“ 22 . In ihm sollten ungeahnte Möglichkeiten<br />
umsetzbar sein. Zwar hat dieser Mythos mittlerweile keinen Bestand<br />
mehr, aber er war Energieträger für einen enormen technologischen<br />
sowie ökonomischen Einsatz. Diese Anstrengungen waren Voraussetzung<br />
für die Durchsetzung des Internets als global funktionierendes und massenhaft<br />
genutztes Medium. Eine weitere Utopie, die sich nicht bewahrheiten<br />
konnte, war die Vision eines völlig neuen ökonomischen Marktes. Man<br />
musste jedoch begreifen, dass es trotz aller neuen Möglichkeiten stets nur<br />
einen Markt gibt [vgl. MÜNKER, ROESLER (2002): 23].<br />
Das Internet bietet große Vorteile: räumlich und zeitlich unabhängiger und<br />
zudem kostenloser Zugang zu Informationen 23 sowie die Hypothese des<br />
Demokratiegedankens, <strong>der</strong> Gleichberechtigung aller Teilnehmer. Gleichzeitig<br />
gibt es jedoch, bedingt durch die Unüberschaubarkeit des Informationsangebotes<br />
sowie <strong>der</strong> unterschiedlichen Qualität <strong>von</strong> Suchergebnissen, Orientierungsprobleme<br />
im Netz. Weiter gibt es eine Reihe praktischer<br />
Schwierigkeiten: technische Probleme beim Netzzugang, inkompatible<br />
Ausstattungen, Risiken beim Datenschutz und <strong>der</strong> Datensicherheit,<br />
ungeklärte Urheberrechts- und Steuerfragen, sowie Hin<strong>der</strong>nisse bei Regeln<br />
zu Haftung und Gerichtsstand [vgl. TUTT (2002): 16 ff]. Hinzu kommt eine<br />
häufig fehlende Benutzerfreundlichkeit <strong>von</strong> Angeboten. Dieser Umstand<br />
22 Virtuelle Scheinwelt<br />
23 Zur Zeit ist <strong>der</strong> Zugang (bei Nichteinbeziehung <strong>von</strong> Telefonkosten) noch kostenlos.<br />
23
Benutzerfreundlichkeit <strong>von</strong> Angeboten. Dieser Umstand macht das Motiv<br />
dieser Arbeit aus – hier soll zur Lösung beigetragen werden.<br />
2.5 <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion<br />
Das Internet erlangt seine (zunehmende) Bedeutung erst durch seine Benutzung:<br />
Der <strong>Mensch</strong> als Benutzer interagiert mit den im Web visuell angebotenen<br />
Informationen. Dies macht den beschreibbaren Rahmen <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-<br />
Computer-Interaktion aus.<br />
2.5.1 Definition<br />
Die <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion ist ein Zusammenspiel <strong>von</strong> drei beteiligten<br />
Faktoren: dem Benutzer, <strong>der</strong> zu erledigenden Aufgabe und dem hierfür<br />
benötigten Werkzeug – dem Computersystem 24 [vgl. WANDMACHER<br />
(1993)].<br />
2.5.2 Funktionalitäten<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion kann zwischen zwei Dimensionen<br />
unterschieden werden, die insbeson<strong>der</strong>e im Rahmen <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
<strong>von</strong> Bedeutung sind:<br />
Benutzungsschnittstellen und -oberflächen<br />
<strong>Mensch</strong>-Computer-Dialog<br />
Benutzungsschnittstellen sind diejenigen Komponenten eines <strong>Mensch</strong>-<br />
Computer-Systems, mit denen die Benutzer motorisch o<strong>der</strong> begrifflich in<br />
Verbindung kommen. Sie beeinflussen einerseits das Lernen <strong>von</strong> Fertigkeiten,<br />
welche bei <strong>der</strong> Aufgabenbearbeitung notwendig werden und das Problemlöseverhalten<br />
<strong>der</strong> Benutzer, sowie an<strong>der</strong>erseits die Art und Qualität <strong>der</strong><br />
Aufgaben. Benutzungsoberflächen sind als Teilmenge <strong>der</strong> Benutzungsschnittstellen<br />
<strong>der</strong>en sichtbarer Teil: Sie umfassen alle Einheiten, Formen<br />
24 Häufig wird das Zusammenspiel dieser drei Faktoren als ABC-Modell (Aufgabe-Benutzer-<br />
Computer) bezeichnet.<br />
24
sowie Techniken, mit <strong>der</strong>en Hilfe die Benutzer mit dem Computersystem<br />
kommunizieren.<br />
Je nach Literaturquelle wird zwischen beiden Begrifflichkeiten unterschieden<br />
o<strong>der</strong> sie werden gleichbedeutend verwendet. Eine genaue funktionelle<br />
Abgrenzung <strong>der</strong> beiden Begrifflichkeiten ist schwierig. Weiterhin haben sich<br />
im Sprachgebrauch beide Begriffe gleichbedeutend durchgesetzt. Da im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> sichtbare Teil einer<br />
Benutzungsoberfläche fokussiert wird, wird in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit <strong>der</strong><br />
Begriff <strong>der</strong> Benutzungsoberfläche verwendet.<br />
Ein wesentlicher Aspekt <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion ist <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-<br />
Computer-Dialog. Er bestimmt die kommunikative Ebene. Im Rahmen<br />
dieses Dialogs erfolgt auf <strong>der</strong> Grundlage informationsverarbeiten<strong>der</strong> Prozesse<br />
bei<strong>der</strong> Dialogpartner ein wechselseitiger Austausch <strong>von</strong> Informationen<br />
zwischen dem Benutzer und dem System. Ziel ist die Bearbeitung <strong>von</strong> Aufgaben,<br />
wobei mehrere Dialogschritte zum Einsatz kommen: Auswahl und<br />
Auslösung einer Systemfunktion durch den Benutzer, Ausführung <strong>der</strong><br />
Systemfunktion und Ausgabe des Ergebnisses durch das System.<br />
Der Umgang mit dem System durch den <strong>Mensch</strong>en glie<strong>der</strong>t sich in drei<br />
Hauptkomponenten, die teilweise in weitere Abstraktionsebenen unterglie<strong>der</strong>t<br />
werden [vgl. WANDMACHER (1993): 1 – 5]:<br />
Begriffliche Komponente mit Aufgabenebene und semantischer<br />
Ebene<br />
Kommunikationskomponente mit syntaktischer Ebene und Interaktionsebene<br />
Physikalische Komponente<br />
Die Aufgabenebene besteht aus den hierarchisch geordneten werkzeugunabhängigen<br />
Zielen des Benutzers und den entsprechenden zu lösenden Aufgaben.<br />
Wichtige Einflussfaktoren hierbei sind seine (werkzeugunabhängige)<br />
Aufgabenkompetenz einschließlich <strong>der</strong> angewendeten Methoden zur Aufgabenbearbeitung,<br />
sowie Problemlösestrategien und kognitive Fertigkeiten des<br />
Benutzers.<br />
25
Die semantische Ebene beinhaltet sämtliche verfügbaren Systemfunktionen<br />
zur Bearbeitung <strong>von</strong> Aufgaben 25 . Sie bestehen aus gegenüber dem Benutzer<br />
repräsentierten Objekten des Systems (in Abhängigkeit des Ortes seiner<br />
Funktionalität) einschließlich <strong>der</strong> Funktionen zur Manipulation dieser Objekte.<br />
Der Benutzer ist außerdem in <strong>der</strong> Lage, den wahrnehmbaren sowie den<br />
vorstellbaren Objekten Bedeutungen zuzuordnen.<br />
Die syntaktische Ebene erfasst das notwendige Benutzerwissen zur Handhabung<br />
<strong>der</strong> Systemfunktionen 26 . Er (<strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong>) muss Kenntnis über die<br />
mögliche Auswahl und Kombination <strong>von</strong> Objekten und Optionen haben.<br />
Weiterhin muss er über Wissen möglicher Folgen verfügen, welche durch<br />
seine Aktionen ausgelöst werden können. Zusätzlich muss er Systemausgaben<br />
und an<strong>der</strong>e wahrnehmbare Systemzustände interpretieren und letztendlich<br />
damit umgehen können.<br />
Die Interaktionsebene bezieht sich insbeson<strong>der</strong>e auf motorische Fähigkeiten<br />
– die Benutzung entsprechen<strong>der</strong> Werkzeuge zum Auslösen gewünschter<br />
Funktionen 27 . Danach spezifiziert sie die erfolgten physikalischen Ein- und<br />
Ausgabeoperationen für das System.<br />
Die physikalische Komponente beinhaltet die Gestaltung bzw. räumliche<br />
Anordnung des Systems sowie <strong>der</strong>en technische Eigenschaften (z.B. optische<br />
Signale).<br />
Zwischen den jeweiligen Ebenen herrscht eine hierarchische Ordnung: Die<br />
übergeordnete Ebene wird auf die jeweils folgende Ebene im Sinne einer<br />
Spezifizierung abgebildet. Effizienz sowie Leichtigkeit dessen sind abhängig<br />
<strong>von</strong> den Merkmalen <strong>der</strong> Benutzungsoberfläche.<br />
Im Wesentlichen geht es bei diesen Ebenen um Objekte und <strong>der</strong>en Funktionen:<br />
Der Anwen<strong>der</strong> muss über Handlungsmöglichkeiten und über an <strong>der</strong><br />
Handlung beteiligte Objekte Bescheid wissen.<br />
25 Die semantische Ebene bezieht sich auf das Wissen des Anwen<strong>der</strong>s über die Bedeutung<br />
möglicher Systemfunktionen.<br />
26 Die syntaktische Ebene bezieht sich insbeson<strong>der</strong>e auf das Wissen des Anwen<strong>der</strong>s über die<br />
Möglichkeiten seiner Aktionen im und am System.<br />
27 Die Interaktionsebene bezieht sich auf die motorische Umsetzung des Benutzerwissens.<br />
26
In den eingangs erwähnten Rahmen <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion ist<br />
schließlich auch die Usability <strong>von</strong> Webseiten eingebettet. Deren einzelne<br />
Komponenten werden nun in den folgenden Kapiteln eingehend untersucht<br />
und im Sinne <strong>der</strong> Zielsetzung dieser Arbeit miteinan<strong>der</strong> vernetzt und in eine<br />
Gesamtthematik integriert.<br />
27
3 Einführung in Usability<br />
Usability ist ein Begriff aus dem angloamerikanischen Bereich, <strong>der</strong> sich<br />
inzwischen auch im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat. Er ist vorwiegend<br />
im Umfeld <strong>der</strong> Computersoftware und ihres Einsatzes anzusiedeln.<br />
Usability setzt sich zum Ziel, dem Benutzer ein nicht nur in funktioneller<br />
Hinsicht gut funktionierendes Produkt anzubieten. Laut Jakob Nielsen,<br />
einem bekannten Experten auf diesem Gebiet, ist Benutzerfreundlichkeit im<br />
Internet <strong>der</strong> entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Vermarktung <strong>von</strong><br />
Software, Webseiten und den in ihnen angebotenen Waren [vgl. NIELSEN<br />
(2000): 9]. Er begründet dies damit, indem er sagt, dass es mittlerweile eine<br />
überwältigende Auswahl <strong>von</strong> Informationsangeboten aller Art gibt, zwischen<br />
denen sich die Benutzer innerhalb des „World Wide Web“ mit Leichtigkeit<br />
bewegen können. Daraus resultieren erhebliche Anfor<strong>der</strong>ungen an die Erfüllung<br />
gewünschter Aufgaben, und gleichzeitig entsteht die Erwartung, dass<br />
diese Wünsche sofort befriedigt werden. Und warum sollten die Benutzer<br />
unter diesen Umständen ihre Zeit für etwas verschwenden, das langsam o<strong>der</strong><br />
verwirrend ist o<strong>der</strong> ihre Bedürfnisse nicht befriedigt?<br />
Usability – offiziell 28 übersetzt mit „Gebrauchstauglichkeit“ – ist ein Qualitätsmerkmal<br />
<strong>von</strong> Software, welches sich insbeson<strong>der</strong>e auf ihre Schnittstellen<br />
zum Benutzer bezieht. Die Usability <strong>von</strong> Webseiten ist ein Teilbereich da<strong>von</strong>.<br />
Sie umfasst den sichtbaren Inhalt einer Webseite, wobei diese in einen<br />
Browser eingebettet ist und <strong>von</strong> seinen Bedienelementen umrahmt wird.<br />
Während <strong>der</strong> Browser Software ist und somit an dieser Stelle eine umfassende<br />
Software-Usability zum Einsatz kommt, ist eine Webseite keine Software:<br />
In dieser Hinsicht kann man <strong>von</strong> einer Website-Usability sprechen,<br />
welche gegenüber <strong>der</strong> Software-Usability eine an<strong>der</strong>e Qualität besitzt: Erstens<br />
werden Webseiten möglichst nach einem bestimmten Standard konzipiert,<br />
so dass sie in verschiedenen Geräten und Browsern gut lesbar dargestellt<br />
werden können. Gleichzeitig hat <strong>der</strong> Browser jedoch aufgrund bestimmter<br />
Benutzereinstellungen Einfluss auf die Darstellung einer Webseite.<br />
Hier handelt es sich um ein Dilemma, welches aufgrund verschiedener Interessen<br />
<strong>von</strong> Browserherstellern bislang nicht aufgehoben wurde. Zweitens ist<br />
28 Gemäß DIN EN ISO 9241-11 (1998)<br />
28
das Bedienkonzept <strong>von</strong> Browser und Webseite prinzipiell an<strong>der</strong>s. Auf Webseiten<br />
können grundsätzlich wesentlich größere Informationsmengen dargestellt<br />
werden. Außerdem wechseln die jeweiligen Webseiten beim Bewegen<br />
durch das Internet ständig. Der (benutzte) Browser bleibt stets <strong>der</strong>selbe. Die<br />
gleichen Sachverhalte treffen auf die Navigation zu. Beson<strong>der</strong>s deutlich wird<br />
dies an dem Beispiel des „Zurück-Button“. Dieser ist innerhalb des Browsers<br />
stets an <strong>der</strong>selben Stelle zu finden und je<strong>der</strong>zeit verfügbar 29 , während er auf<br />
einer Webseite immer wie<strong>der</strong> <strong>von</strong> neuem gesucht werden muss, sofern er<br />
überhaupt vorhanden ist 30 . Während die Bedienelemente eines Browsers nur<br />
in genau diesem sichtbar sind (interner Dialog), können die Bedienelemente<br />
einer Webseite auch auf an<strong>der</strong>en Browsern dargestellt werden (externer<br />
Dialog).<br />
Auch wenn die Bedienelemente des Browsers sowie <strong>der</strong> Webseite aus Benutzersicht<br />
prinzipiell gleich sind o<strong>der</strong> sich ergänzen, so können sie sich<br />
doch auch in ihrer Anwendung mischen o<strong>der</strong> sogar gegenseitig stören.<br />
Bevor <strong>der</strong> Begriff Usability genauer charakterisiert und seine weiteren Inhalte<br />
erläutert werden, folgt eine kurze Beschreibung <strong>der</strong> Entstehung <strong>von</strong> Usability<br />
sowie die Abgrenzung zum Fachgebiet <strong>der</strong> Software-Ergonomie.<br />
3.1 Entstehung <strong>von</strong> Usability<br />
Die Thematik des Usability kommt traditionell aus dem Computerumfeld.<br />
Anfangs <strong>der</strong> siebziger Jahre interessierten sich jedoch beson<strong>der</strong>s Psychologen<br />
für die Gestaltung <strong>von</strong> Dialogsystemen. Sie wollten herausfinden, wie<br />
<strong>Mensch</strong>en Informationen verarbeiten und bei auftretenden Problemen vorgehen.<br />
Später waren es die Anhänger <strong>der</strong> Bewegung <strong>der</strong> künstlichen Intelligenz,<br />
die Systeme vor allem schneller und effizienter machen wollten. Nur<br />
ein kleiner Teil dieser Gruppierung interessierte sich für eine einfachere<br />
Bedienung <strong>von</strong> Computersystemen: Die Kommunikation sollte vereinfacht<br />
und <strong>der</strong> Computer „menschlicher“ gemacht werden.<br />
Der Begriff „Usability“ wurde zu Beginn <strong>der</strong> achtziger Jahre im Rahmen <strong>der</strong><br />
<strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion in den USA geprägt. Vermutlich entstand er<br />
29<br />
In einigen Ausnahmefällen können Webseiten nach ihrem Aufruf z.B. die Navigationsleiste<br />
des Browsers abschalten.<br />
30<br />
In <strong>der</strong> Bedienung <strong>der</strong> beiden Elemente gibt es außerdem hinsichtlich <strong>der</strong> Technik Unter-<br />
schiede.<br />
29
aus zwei aufeinan<strong>der</strong> bezogenen Arrangements: dem „Usability-<br />
Engineering“ als Philosophie, sowie dem Testen <strong>von</strong> „Usability“ als entsprechende<br />
Methodologie [vgl. DUMAS, REDISH (1993)].<br />
Lange Zeit konnte sich <strong>der</strong> Usability-Gedanke nicht durchsetzen. Einer <strong>der</strong><br />
Gründe war die damals irrtümliche Gleichsetzung mit dem Bereich <strong>der</strong><br />
Software-Ergonomie.<br />
Mit <strong>der</strong> zunehmenden Verbreitung <strong>von</strong> Computern entstand jedoch gleichzeitig<br />
auch ein Bewusstsein für die Eigenständigkeit <strong>der</strong> Usability-Thematik.<br />
Ihren Durchbruch und wirtschaftliche Relevanz erhielt sie durch die Verbreitung<br />
des Internets und dem daraus resultierenden Interesse an gut gestalteten<br />
Benutzeroberflächen 31 . Nicht mehr die Ziele <strong>der</strong> Hersteller, son<strong>der</strong>n die <strong>der</strong><br />
Benutzer rücken nun in das Zentrum <strong>der</strong> Aufmerksamkeit – ihre Erwartungen<br />
und Wünsche an eine Software sollen erfüllt werden.<br />
Da Usability für Software traditionell in Informatikbereichen angesiedelt<br />
war, spielen benutzergerechte Informationsarchitekturen und an Aufgaben<br />
orientierte Interaktionsdesigns eine beson<strong>der</strong>e Rolle. Spezielle Empfehlungen<br />
für die Entwicklung <strong>von</strong> Benutzerschnittstellen wurden schnell populär<br />
und setzten sich auch in <strong>der</strong> Praxis durch.<br />
Erst seit ein paar Jahren etablieren sich Usability-Experten (auch im<br />
deutschsprachigen Raum) aufgrund <strong>der</strong> sich ständig erweiternden Materie zu<br />
eigenständigen Kompetenzen. Sie sind inzwischen in <strong>der</strong> Lage, professionelle<br />
Expertisen <strong>von</strong> Software zu erstellen. Durch ihr notwendiges interdisziplinäres<br />
Fachwissen bilden sie eine Brücke zwischen <strong>der</strong> Informatik und an<strong>der</strong>en<br />
beteiligten Fachgebieten. Solche Experten befassen sich mit <strong>der</strong> menschlichen<br />
Informationsverarbeitung, stellen geltende Standards immer wie<strong>der</strong> in<br />
Frage und probieren kreative Ideen aus. Dies sorgt für eine andauernde<br />
Weiterentwicklung und Erforschung des Themas Usability [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 33 ff].<br />
Der Bereich <strong>der</strong> Software-Ergonomie entwickelte sich zu Beginn <strong>der</strong> achtziger<br />
Jahre zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin, als man die<br />
Notwendigkeit <strong>von</strong> Untersuchungen über ergonomische Gestaltung in kognitiver<br />
Hinsicht erkannte. Ausgangspunkt waren zunächst hardwareergonomische<br />
Themen wie die Festlegung <strong>von</strong> Normen und Belastungsgrenzen.<br />
Später wurde dann die Gestaltung <strong>von</strong> Dialogsystemen zum Gegenstand<br />
31 Einhergehend mit <strong>der</strong> Entwicklung, dass eine Benutzung auch für Nicht-Experten möglich<br />
wurde (frühe Anwendungen konnten nur <strong>von</strong> Experten benutzt werden).<br />
30
<strong>der</strong> Forschung. Durch die Verbreitung <strong>von</strong> PCs und Arbeitsplatzrechnern,<br />
dem Aufkommen graphischer Benutzeroberflächen sowie durch neue technische<br />
Konzepte entwickelte sich in Deutschland das Fachgebiet Softwareergonomie:<br />
Der entstandene weitreichende Gestaltungsspielraum und seine<br />
vielfältigen Aspekte mussten berücksichtigt und miteinan<strong>der</strong> abgewogen<br />
werden.<br />
Wie bereits erwähnt, wurde die Thematik <strong>der</strong> Usability mit <strong>der</strong> Software-<br />
Ergonomie gleichgesetzt. Auch heute ist dieser Irrtum noch anzutreffen. Um<br />
diesem entgegen zu treten, soll an dieser Stelle eine Abgrenzung zwischen<br />
Software-Ergonomie und Usability erfolgen: Inhalt <strong>der</strong> Software-Ergonomie<br />
ist die Entwicklung und Gestaltung gut benutzbarer Computersysteme. Hierbei<br />
ist es ihr Ziel, die Arbeitsbedingungen während <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Computer-<br />
Interaktion an sensomotorische sowie kognitive Fähigkeiten des <strong>Mensch</strong>en<br />
anzupassen [vgl. WANDMACHER (1993)]. Software-ergonomische Kriterien<br />
zielen also beson<strong>der</strong>s auf die Qualität <strong>der</strong> Benutzungsschnittstelle hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> Interaktion ab, weniger auf die technische Funktionalität des<br />
Systems.<br />
Während Software-Ergonomie gestaltungsorientiert 32 arbeitet und sich mit<br />
<strong>der</strong> Neuentwicklung <strong>von</strong> Webseiten und an<strong>der</strong>er Software beschäftigt, sind<br />
die Inhalte <strong>der</strong> Usability Analysen und Evaluationen <strong>der</strong> Gestaltung sowie<br />
<strong>der</strong> Funktionalität <strong>von</strong> Benutzeroberflächen. Hierbei werden bereits bestehende<br />
Produkte o<strong>der</strong> Produktentwürfe hinsichtlich verschiedener Kriterien,<br />
welche zu großen Teilen auf den Erkenntnissen aus <strong>der</strong> Software-Ergonomie<br />
beruhen, überprüft und schlecht gestaltete Benutzeroberflächen und Systemfunktionen<br />
benannt und gegebenenfalls verbessert.<br />
3.2 Definition <strong>von</strong> Usability<br />
Was ist Usability? Eine genaue allgemein gültige Definition für diesen Begriff<br />
gibt es bislang nicht 33 . Um sich trotzdem <strong>der</strong> Thematik <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong><br />
32 Beispiel Prägnanz <strong>von</strong> Webseitenelementen: Elemente sind so zu gestalten, dass sie schnell<br />
zu erkennen sind, und dass Einzelelemente unter Vielen identifiziert und ausgewählt<br />
werden können.<br />
33 Es wird nur „Gebrauchstauglichkeit“ definiert (siehe Beginn des Kapitels 3: „Einführung in<br />
Usability“).<br />
31
Webseiten anzunähern, können zwei verschiedene Argumente verwendet<br />
werden:<br />
Intuitivität<br />
Gebrauchstauglichkeit<br />
Donald A. Norman hat in seinem Buch „Dinge des Alltags. Gutes Design<br />
und Psychologie für Gebrauchsgegenstände“ das Konzept <strong>der</strong> „Affordance“<br />
beschrieben. Es sagt aus, dass ein Produkt durch seine Gestaltung intuitiv<br />
benutzbar sein soll und dadurch eine einfachere Bedienung ermöglicht wird<br />
[vgl. NORMAN (1989)]. Diese Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Intuitivität ist ein äußerst<br />
wichtiger Aspekt <strong>von</strong> Usability und kann bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong> Webseiten<br />
durch seine Kompatibilität direkt angewendet werden 34 .<br />
Der Begriff „Usability“ beinhaltet Bedienbarkeit, Verwendbarkeit o<strong>der</strong><br />
Benutzerfreundlichkeit. Diese Komponenten können in dem Prinzip <strong>der</strong><br />
Gebrauchstauglichkeit zusammengefasst werden. Dieses ist ein wichtiges<br />
Qualitätsmerkmal <strong>von</strong> Produkten, da die Benutzer aufgrund einer guten<br />
Gebrauchstauglichkeit effektiv, effizient und zufrieden stellend arbeiten<br />
können. In <strong>der</strong> europäischen Norm über die „Anfor<strong>der</strong>ungen an die<br />
Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze“ (in: „Ergonomische Anfor<strong>der</strong>ungen für<br />
Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“) wird <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
folgen<strong>der</strong>maßen definiert:<br />
< „Das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in<br />
einem bestimmten Nutzungskonzept genutzt werden kann, um<br />
bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufrieden stellend zu erreichen.“<br />
35<br />
Die in dieser Definition aufgeführten Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
werden im folgenden Kapitel im Einzelnen erläutert.<br />
34 Nähere Erklärungen hierzu erfolgen im Weiteren dieser Arbeit.<br />
35 DIN EN ISO 9241-11 (1998): 4<br />
32
3.3 Die Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt, spielen bei<br />
Webseiten hinsichtlich einer guten Usability folgende Faktoren eine beson<strong>der</strong>s<br />
wichtige Rolle:<br />
Effektivität<br />
Effizienz<br />
Subjektive Zufriedenheit des Benutzers<br />
Effektivität bedeutet die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit <strong>der</strong> die Benutzer<br />
ihre Ziele auf einer Website und darüber hinaus mit einer Software erreichen<br />
können.<br />
Effizienz ist <strong>der</strong> im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzte<br />
Aufwand zum Erreichen des Ziels. Dieser sollte geringer sein als <strong>der</strong><br />
durch die Website tatsächlich erreichte Ertrag (o<strong>der</strong> ihm zumindest entsprechen).<br />
Subjektive Zufriedenheit ist dann erreicht, wenn das Erreichen des Zieles<br />
frei <strong>von</strong> Beeinträchtigungen ist und die Erwartungen des Nutzers erfüllt o<strong>der</strong><br />
besser noch übertroffen worden sind.<br />
Benutzer<br />
Arbeitsaufgabe<br />
Arbeitsmittel<br />
Umgebung<br />
Nutzungskontext<br />
Website<br />
Angestrebtes<br />
Ergebnis<br />
Ergebnis <strong>der</strong><br />
Nutzung<br />
Gebrauchstauglichkeit<br />
Abbildung 3.1: Gebrauchstauglichkeit [EN ISO 9241-11 (1998): 6]<br />
Ziele<br />
Effektivität<br />
Effizienz<br />
Zufriedenstellung<br />
Maße <strong>der</strong><br />
Gebrauchstauglichkeit<br />
33
Um Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, die Voraussetzungen<br />
<strong>der</strong> Zielgruppe zu betrachten, die Ziele einer Arbeitsaufgabe zu<br />
identifizieren, sowie die Komponenten des jeweiligen Nutzungskontextes<br />
weiter zu zerlegen. Der Zusammenhang dieser Einflussfaktoren wird in <strong>der</strong><br />
Abbildung 3.1 dargestellt.<br />
In Anlehnung an Beier und v. Gizycki [vgl. BEIER, V. GIZYCKI (2002): 2<br />
ff] sowie Nielsen [vgl. NIELSEN (1993): 26] bestehen Websites aus vier<br />
verschiedenen Dimensionen: Struktur (gesamte Anordnung <strong>der</strong> einzelnen<br />
Seiten), Funktionalität, Inhalt (und die Art seiner Darstellung), sowie dem<br />
Web-Design. Diese vier Dimensionen haben im Zusammenhang mit den drei<br />
oben genannten Faktoren jeweils verschiedene Bedeutungen sowie konkrete<br />
Funktionen, die im Folgenden beispielhaft dargestellt und erläutert werden 36 :<br />
Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit bezüglich <strong>der</strong> Struktur:<br />
Effektivität: Der Nutzer kann sich einen ungefähren Überblick über<br />
das gesamte Angebot einer Website sowie über ihren<br />
Aufbau machen. Die einzelnen Seiten müssen mit Hyperlinks<br />
37 (kurz: Links) verbunden sein, die <strong>der</strong> Benutzer als<br />
solche erkennen kann.<br />
Effizienz: In <strong>der</strong> Navigation gibt es erkennbare Hierarchien o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>e einfach nachvollziehbare Strukturen: Durch Angabe<br />
des Navigationspfades weiß <strong>der</strong> Nutzer je<strong>der</strong>zeit, wo er<br />
sich befindet. Rück- und Querschritte sind je<strong>der</strong>zeit möglich<br />
(inkl. <strong>der</strong> Rückkehr zur Einstiegsseite).<br />
Zufriedenheit: Die einzelnen Seiten sind mit Hilfe <strong>der</strong> Links sinnvoll<br />
zusammengefügt. Der Nutzer hat außerdem stets verschiedene<br />
Navigationswege sowie Orientierungsmöglichkeiten.<br />
Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit bezüglich <strong>der</strong> Funktionalität:<br />
Effektivität: Der Nutzer findet die Funktionalitäten des Systems, und<br />
sie ermöglichen eine optimale Anwendung.<br />
Das System besitzt eine niedrige Fehlerrate: Während <strong>der</strong><br />
36<br />
Konkrete Möglichkeiten <strong>der</strong> Umsetzung werden in Kapitel 7: „Gestaltung und Design“<br />
erläutert.<br />
37<br />
Gerichtete Verbindung zwischen (i. d. R.) zwei Webseiten, vgl. Abschnitt 8.1.2: „Hyper-<br />
links“<br />
34
Benutzung können nur wenige Fehler gemacht werden.<br />
Folgenschwere Fehler dürfen nicht auftreten.<br />
Effizienz: Selbst <strong>der</strong> gelegentliche Benutzer kann sich leicht an die<br />
verschiedenen Funktionalitäten erinnern, auch nach längerer<br />
Zeit <strong>der</strong> Nicht-Nutzung.<br />
Wenn Fehler im System auftreten, sollten diese leicht zu<br />
entdecken und zu beheben sein.<br />
Zufriedenheit: Präsentation einer für den Benutzer einprägsamen und<br />
angenehmen Gestaltung, sowie verständliche Fehlermeldungen.<br />
Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit bezüglich des Inhalts:<br />
Effektivität: Der Nutzer findet die Informationen, die er sucht. Sie sind<br />
zudem mediengerecht aufbereitet.<br />
Effizienz: Den Aufwand, den <strong>der</strong> Nutzer beim Finden dieser Informationen<br />
aufbringen muss, empfindet er als angemessen.<br />
Dies kann durch eine übersichtliche Anordnung <strong>der</strong> Informationen<br />
sowie kürzere Ladezeiten erreicht werden.<br />
Zufriedenheit: Durch eine Individualisierung <strong>von</strong> Inhalten bekommt <strong>der</strong><br />
Nutzer prägnante Informationen (im Rahmen <strong>der</strong> Aufgabenangemessenheit<br />
38 ) geliefert. Eine angemessene Personalisierung<br />
verhin<strong>der</strong>t, dass <strong>der</strong> Benutzer gleiche Eingaben<br />
bei jedem Zugang wie<strong>der</strong>holen muss.<br />
Komponenten <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit bezüglich des Designs:<br />
Effektivität: Wahrnehmungspsychologische Aspekte werden beachtet.<br />
Zum Beispiel erhalten gleich gestaltete Elemente jeweils<br />
gleiche Funktionen.<br />
Effizienz: Durch optische Kategorisierungen lassen sich bestimmte<br />
Inhalte schnell und intuitiv zu einzelnen Seiten und Elementen<br />
zuordnen.<br />
Zufriedenheit: Berücksichtigung des Geschmacks <strong>der</strong> Zielgruppe (soweit<br />
bekannt) sowie ergonomischer Kriterien.<br />
38 Laut DIN EN ISO 9241-10 ist Aufgabenangemessenheit einer <strong>der</strong> sieben Grundsätze <strong>der</strong><br />
Dialoggestaltung (siehe Kapitel 6: „Gesetze und Normen – Die Formale Basis“).<br />
35
Die genannten Kriterien sind nicht für jede Zielgruppe gleichermaßen anwendbar.<br />
Es muss jeweils auf <strong>der</strong>en spezielle Bedürfnisse und Ziele eingegangen<br />
werden. Um diese herauszufinden und anhand dieser die Usability<br />
einer gesamten Website zu bewerten, können verschiedene Benutzertests<br />
und ähnliches durchgeführt werden. Mögliche Methoden werden im folgenden<br />
Kapitel vorgestellt.<br />
3.4 Methoden zur Bewertung <strong>von</strong> Usability<br />
Um festzustellen, ob Webseiten die verschiedenen Usability-Faktoren erfüllen,<br />
sind eine Anzahl unterschiedlicher Methoden entwickelt worden. Es gibt<br />
operationalisierte Methoden, Anwen<strong>der</strong>tests und Gutachterinspektionen.<br />
Diese Methoden werden jeweils auf spezifische Art und Weise durchgeführt,<br />
und ihre Ergebnisse unterscheiden sich durch Darstellung verschiedener<br />
Dimensionen <strong>von</strong> Benutzungsqualitäten einer Website.<br />
Oberstes Ziel ist das Überprüfen <strong>der</strong> Seiten hinsichtlich <strong>der</strong> Benutzerorientierung<br />
und das schnelle und genaue Herausfinden möglicher Schwachstellen.<br />
Weitere Zielsetzungen sind zum Beispiel die Einhaltung <strong>von</strong> Standards,<br />
eine leichte Erlernbarkeit <strong>der</strong> Anwendung sowie die Wie<strong>der</strong>erkennbarkeit<br />
einzelner Elemente o<strong>der</strong> <strong>der</strong> gesamten Seite. Die Einhaltung dieser Kriterien<br />
soll zur Zufriedenheit <strong>der</strong> Benutzer beitragen.<br />
Usability-Methoden kommen bereits während <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Webseite<br />
zum Einsatz und werden im Idealfall beson<strong>der</strong>s nach größeren Än<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong>selben wie<strong>der</strong>holt. Sie können also in jedem Entwicklungsstadium durchgeführt<br />
werden. Ideal sind Überprüfungen im mittleren Projektzyklus in<br />
Kombination mit einer Aufgabenanalyse, sowie einem Szenarienentwurf am<br />
Anfang und Benutzertests am Schluss einer Projektentwicklung [BEIER, V.<br />
GIZYCKI (2002): 89 ff].<br />
Ein entscheidendes Problem ist, wie die bereits genannten Usability-<br />
Faktoren gemessen werden können. Es gibt eine große Zahl <strong>von</strong> möglichen<br />
Methoden, die meist in zwei größere Bereiche geglie<strong>der</strong>t werden: Usability-<br />
Inspektionen durch Experten, sowie Usability-Tests mit Endanwen<strong>der</strong>n [vgl.<br />
TEKOM (1/2002): 16 – 18]. Dieser Einteilung wird noch die Gruppe <strong>der</strong><br />
operationalisierten Methoden hinzugefügt:<br />
36
3.4.1 Operationalisierte Methoden<br />
Operationalisierte Methoden zeichnen sich insbeson<strong>der</strong>e durch ihre Messbarkeit<br />
aus.<br />
Es folgt eine Auswahl verschiedener Methoden, bei denen es insbeson<strong>der</strong>e<br />
um die Berechnung aufgewendeter Bearbeitungszeiten während <strong>der</strong> Handhabung<br />
mit dem System geht [vgl. BEIER, V. GIZYCKI (2002): 90 – 94].<br />
Fitt-Gesetz<br />
Hick-Gesetz<br />
GOMS<br />
Key-Stroke-Modell<br />
Das Fitt-Gesetz dient zur Ermittlung <strong>der</strong> Zeit, die benötigt wird, um einen<br />
Positionszeiger zum Ziel zu bewegen.<br />
Mit Hilfe des Hick-Gesetzes wird die Zeit ermittelt, die benötigt wird, um<br />
ein Element aus einer bestimmten Anzahl <strong>von</strong> alternativ angebotenen Elementen<br />
auszuwählen.<br />
Das GOMS-Gesetz (Goals, Operators, Methods, Selection rules 39 ) ist ein<br />
heuristisch quantitatives Maß zur Berechnung <strong>von</strong> Interaktionszeiten.<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse hinsichtlich <strong>der</strong> Messung zur Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
ist das GOMS „Key-Stroke“-Modell 40 . Es baut auf dem Fitt- sowie<br />
dem Hick-Gesetz auf und stellt eine Erweiterung des GOMS-Modells dar.<br />
Seine Beson<strong>der</strong>heit liegt in speziellen Darstellungsmöglichkeiten hinsichtlich<br />
motorischer sowie kognitiver Aktionen während <strong>der</strong> Arbeit mit einer<br />
Benutzeroberfläche. Vor allem die Darstellung des kognitiven Aspektes ist<br />
im Rahmen dieser Arbeit <strong>von</strong> Interesse. Dieser Aspekt macht deutlich, dass<br />
selbst während geringer motorischer Aktionen Denkleistungen des Benutzers<br />
notwendig werden und die Benutzeroberfläche dementsprechend gestaltet<br />
werden muss. Da eine Verwendung des „Key-Stroke“-Modells aus diesen<br />
39 Deutsch: Ziele, Operatoren, Methoden, Auswahlregeln<br />
40 Deutsch: Tastenanschlag<br />
37
Gründen sehr nützlich sein kann, wird diese Methode im Folgenden genauer<br />
erläutert:<br />
Das „Key-Stroke“-Modell misst die Dauer <strong>von</strong> Handlungen am Bildschirm<br />
(wie z.B. das Bewegen <strong>der</strong> Maus) und erfasst durch Beobachtung die entsprechenden<br />
motorischen und kognitiven Aktionen. Hierbei wird das Benutzerverhalten<br />
durch Verwendung grundlegen<strong>der</strong> Operatoren beschrieben [vgl.<br />
WANDMACHER (1993): 124 – 134]. Durch diese Methode können die<br />
Bearbeitungszeiten für Routineaufgaben vorhergesagt und ineffiziente Methoden<br />
identifiziert werden. Es kann die Effizienz (als Aspekt <strong>der</strong> Aufgabenangemessenheit)<br />
einer Benutzungsoberfläche beurteilt werden. Wichtigster<br />
Zweck <strong>der</strong> Anwendung ist die Abschätzung des Zeitaufwandes, den ein<br />
geübter Benutzer für verschiedene Arten <strong>der</strong> Aufgabenbearbeitung unter<br />
Verwendung einer gegebenen Benutzungsoberfläche leisten muss. Beson<strong>der</strong>s<br />
interessant ist, wie bereits oben erwähnt, die gleichzeitige Darstellung<br />
kognitiver Aktionen. Voraussetzungen zur Anwendung dieser Methode sind<br />
effektive Methoden und Auswahlregeln 41 sowie eine geeignete Struktur <strong>von</strong><br />
Zielen 42 des Benutzers. Der Benutzer muss die ausgewählte Methode fehlerfrei<br />
anwenden.<br />
Das Key-Stroke-Modell baut auf zwei Annahmen auf. Erstens: Serielle<br />
Ausführung <strong>der</strong> jeweils berücksichtigten Operatoren (siehe unten); Zweitens:<br />
Die erwartete Dauer eines Operators ist unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Art vorangegangener<br />
Operatoren. Entscheidende Einflussfaktoren während <strong>der</strong> Anwendung<br />
sind einerseits die verwendete Methode, welche die Sequenz <strong>der</strong> auszuführenden<br />
elementaren Operatoren bestimmt, an<strong>der</strong>erseits die motorischen<br />
und kognitiven Operatorzeiten des Benutzers sowie die Antwortzeiten des<br />
Systems.<br />
Die Erstellung <strong>der</strong> Folge <strong>der</strong> Operatoren leitet sich aus an<strong>der</strong>en Modellen<br />
(z.B. GOMS-Modell, siehe oben) und aus Beobachtungen ab. Hinzu kommen<br />
die nicht beobachtbaren, jedoch angenommenen mentalen Operatoren.<br />
Grundlage des Modells sind die Operatoren mit ihren Operatorzeiten [vgl.<br />
WANDMACHER (1993): 125 f]:<br />
P: Positionieren des Positionszeigers mit <strong>der</strong><br />
Maus über verschiedene Distanzen und<br />
41 Diese genannten Faktoren sind i. d. R. bei Experten o<strong>der</strong> geübten Benutzern erfüllt.<br />
42 Der Benutzer muss über einen ungefähren mentalen Ablaufplan zur Lösung seiner Aufgabe<br />
verfügen.<br />
38
Zielgrößen 1,5 s<br />
H: Handbewegung <strong>von</strong> <strong>der</strong> Tastatur zur Maus<br />
(bzw. umgekehrt) 0,36 s<br />
T: Anschlag einer Taste/Maus 0,23 s<br />
E: Erinnern aus dem Langzeitgedächtnis 1,2 s<br />
C: Auswahl einer Methode aus mehreren Alternativen<br />
1,25 s<br />
Erweiterungen für spezielle Anwendungsbereiche:<br />
W: Erkennen eines Wortes (6 Buchstaben) 0,34 s<br />
D: Zeichnen mit <strong>der</strong> Maus <strong>von</strong> verbundenen<br />
Liniensegmenten (n) mit <strong>der</strong> Gesamtlänge<br />
(k) (0,9n+0,16k) s<br />
S: Doppelte Bildschirmsuche (Erfassung <strong>von</strong><br />
Koordinaten in Tabellen) 2,29 s<br />
Beson<strong>der</strong>heit: Der mentale Operator:<br />
M: Planung einer motorischen Aktion (ersetzt<br />
E und C) 1,35 s<br />
Die Beson<strong>der</strong>heit dieses Modells stellen die jeweiligen M-Operatoren (mentale<br />
Operatoren) dar. Sie sind abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Benutzungsoberfläche, <strong>der</strong><br />
jeweiligen Aufgabe sowie dem Übungsgrad des Benutzers 43 . Zum Aufbau<br />
<strong>der</strong> gesamten Sequenz und insbeson<strong>der</strong>e zur Verwendung des M-Operators<br />
gibt es einen Algorithmus mit mehreren festgelegten Regeln:<br />
< Einsetzen eines M-Operators vor jedem Operator T, H, P sowie<br />
D.<br />
< Ein M-Operator wird eliminiert, wenn ein motorischer Operator<br />
durch das Ergebnis eines vorangegangenen M-Operators impliziert<br />
wird (BSP: M P M T M P T).<br />
< Alle zu einer Folge gehörenden M-Operatoren werden (mit Ausnahme<br />
des M vor dem ersten T) eliminiert, wenn mehrere aufeinan<strong>der</strong><br />
folgende Tasteneingaben eine kognitive Einheit bilden<br />
(BSP: M T M T M T M T T T).<br />
< Der M-Operator vor einem T-Operator wird eliminiert, wenn die<br />
43 Mit zunehmendem Übungsgrad nehmen die Anzahl sowie die jeweilige Dauer <strong>der</strong> mentalen<br />
Operatoren ab.<br />
39
Tasteneingabe ein redundanter Eingabeschluss ist (BSP: M Treturn<br />
M T-return M T-return T-return).<br />
< Der M-Operator wird eliminiert, wenn er den Abschluss einer<br />
Folge <strong>von</strong> Tasteneingaben für ein Kommando darstellt (BSP: M<br />
T T M T-return M T T T-return).<br />
Eine Sequenz zum Abspeichern einer Datei in einem Word-Dokument (Dateiname<br />
mit 4 Buchstaben) könnte zum Beispiel folgen<strong>der</strong>maßen aussehen:<br />
C / M P / T / M H / E / M T T T T / T (Auswahl <strong>der</strong> Speichern-Methode /<br />
Positionieren des Positionszeigers mit <strong>der</strong> Maus zum Speichern-Symbol /<br />
Drücken des Speichern-Symbols / Handbewegung <strong>von</strong> <strong>der</strong> Maus zur Tastatur<br />
/ Überlegen des Dateinamens / Eintragen des Dateinamens / Drücken des<br />
Speichern-Symbols).<br />
Die Vorteile dieser Methode liegen im geringen Aufwand 44 und dem Aufzeigen<br />
beson<strong>der</strong>s umständlicher Handlungsabfolgen. Schwierig jedoch ist<br />
die Entscheidung über die jeweiligen mentalen Operatoren, da <strong>der</strong>en Einsatz<br />
abhängig ist vom Übungsgrad des Benutzers und dem zugrunde liegenden<br />
kognitiven Prozessen [vgl. WANDMACHER (1993): 127]. Bei komplexen<br />
Systemen ist zudem <strong>der</strong> Aufwand im Verhältnis zu den tatsächlichen Ergebnissen<br />
bedenklich. Mit dem „Key-Stroke-Modell“ sind we<strong>der</strong> Vorhersagen<br />
über das Verhalten <strong>von</strong> Anfängern o<strong>der</strong> Benutzern mit geringer Übung möglich,<br />
noch über <strong>der</strong>en Lernaufwand bzw. das Lernen an sich. Aufgrund <strong>der</strong><br />
zunehmenden Komplexität <strong>von</strong> Sequenzen ist es außerdem ungeeignet zur<br />
Beschreibung <strong>von</strong> Ablaufprozessen.<br />
Im Folgenden werden Usability-Tests mit Endanwen<strong>der</strong>n sowie Usability-<br />
Inspektionen durch Experten erläutert.<br />
3.4.2 Anwen<strong>der</strong>tests<br />
Ein Usability-Test ist eine Methode zur Überprüfung <strong>von</strong> Benutzungsoberflächen<br />
hinsichtlich des Erreichens zuvor festgelegter Usability-Ziele. Hierbei<br />
erhalten repräsentative Endbenutzer produkttypische Aufgaben, welche<br />
sie dann ggf. mit Hilfe einer technischen Dokumentation bearbeiten. Die<br />
Interaktion zwischen dem Produkt und dem Anwen<strong>der</strong> wird beobachtet,<br />
analysiert und ausgewertet. Beson<strong>der</strong>s effektiv und wichtig während <strong>der</strong><br />
44 Hierfür kann entsprechende Software verwendet werden.<br />
40
Durchführung ist hierbei die Methode des „lauten Denkens“, bei <strong>der</strong> die<br />
Testpersonen jeden ihrer Gedanken während <strong>der</strong> Aufgabenbearbeitung laut<br />
mitteilen müssen. Die Beobachter können dadurch konkrete Problempunkte<br />
während <strong>der</strong> Benutzung des jeweiligen Produktes erkennen.<br />
Usability-Tests sollten schon während <strong>der</strong> Produktentwicklung durchgeführt<br />
werden, um gravierende Fehler rechtzeitig mit möglichst geringem Aufwand<br />
zu entfernen.<br />
Mit einem Usability-Test können vor allem markante Schwachstellen im<br />
Umgang mit <strong>der</strong> jeweiligen Benutzungsoberfläche erkannt und korrigiert<br />
werden. Konkrete Problemstellen können herausgefunden und Effektivität,<br />
Effizienz sowie Zufriedenheit <strong>der</strong> Benutzer erfasst werden.<br />
Die Anwen<strong>der</strong> finden meist jedoch nur Probleme, welche mit <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Aufgabenstellung verbunden sind. Außerdem beansprucht diese Methode<br />
einen relativ hohen Aufwand zur Rekrutierung <strong>von</strong> Testpartnern. Zusätzlich<br />
werden zur professionellen Beobachtung <strong>der</strong> Testpersonen spezielle Usability-Labore<br />
benötigt [vgl. TEKOM (1/2002): 16 – 18].<br />
Es ist sinnvoll, vor solch einem Test eine Heuristische Evaluation o<strong>der</strong> eine<br />
an<strong>der</strong>e Bewertung durch Experten vorzunehmen. Solche Vorgehen sind<br />
Methoden im Rahmen <strong>von</strong> Gutachterinspektionen. Sie werden nachfolgend<br />
erläutert.<br />
3.4.3 Gutachterinspektionen<br />
Gutachterinspektionen basieren, im Unterschied zu Usability-Tests, auf <strong>der</strong><br />
Urteilsbildung <strong>von</strong> Experten. Sie evaluieren anstelle <strong>von</strong> Endanwen<strong>der</strong>n die<br />
betreffenden Webseiten, wobei beson<strong>der</strong>s differenzierte und tief liegende<br />
Schwachstellen aufgespürt werden können. Ihre Ergebnisse dienen dann als<br />
evaluative Rückmeldungen hinsichtlich spezifischer Elemente einer Benutzerschnittstelle.<br />
Experten können mögliche Probleme vorhersagen, erkennen<br />
unklare Formulierungen und geben Hinweise über mögliche Gestaltungsmängel.<br />
Charakteristisch für solche Gutachterinspektionen ist das Vertrauen<br />
in diese Beurteilungen [vgl. NIELSEN, MACK (1994): 1].<br />
Experten können Usability-Spezialisten, Software-Entwicklungsberater mit<br />
speziellen Fachkenntnissen (z.B. Kenntnis eines beson<strong>der</strong>en Interface-<br />
Designs/-Stils) o<strong>der</strong> Endnutzer mit Kenntnissen über Inhalte o<strong>der</strong> Aufgaben<br />
<strong>der</strong> Benutzeroberflächen sein. Der Vorteil <strong>von</strong> Expertengutachten liegt eindeutig<br />
im geringen zeitlichen sowie finanziellen Aufwand. Dafür jedoch<br />
41
gehen solche Experten stets <strong>von</strong> Annahmen über eine Benutzung aus, welche<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger zutreffend sein können (vgl. TEKOM (1/2002), S. 16 –<br />
18).<br />
Zur Durchführung solcher Expertenevaluierungen gibt es eine Reihe <strong>von</strong><br />
verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen, die unter dem Begriff Usability-Inspektionen<br />
zusammengefasst werden [vgl. NIELSEN, MACK<br />
(1994): 5 ff]:<br />
Heuristische Evaluation:<br />
Die Heuristische Evaluation ist die am wenigsten formale Inspektionsmethode.<br />
Mehrere <strong>von</strong>einan<strong>der</strong> unabhängige Usability-<br />
Spezialisten o<strong>der</strong> -Sachverständige überprüfen, ob jedes Dialogelement<br />
bewährten Usability-Prinzipien entspricht:<br />
< Einfache und natürliche Dialogführung<br />
< Verwendung <strong>der</strong> Sprache des Benutzers<br />
< Minimierung <strong>der</strong> Gedächtnisbelastung des Benutzers<br />
< Konsistenz<br />
< Rückmeldung<br />
< Deutlich gekennzeichnete Zurück- und Abbruchfunktionen<br />
< Verwendung <strong>von</strong> Tastenkombinationen, Piktogrammen und<br />
Ähnlichem<br />
< Präzise und konstruktive Fehlermeldungen<br />
< Fehlervermeidung<br />
< Hilfe und Dokumentation<br />
Diese Inhalte <strong>der</strong> Heuristischen Evaluation beruhen auf festgelegten,<br />
allgemeinen sowie greifbaren Prinzipien. Entsprechende Prüfmethoden<br />
sind leicht erlernbar, schnell durchzuführen und verursachen nur<br />
geringe Kosten. Da sie grundlegende Richtlinien darstellen, können<br />
diese zehn Heuristiken, unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Anwendung einer bestimmten<br />
Expertenmethode, grundsätzlich <strong>von</strong> jedem Projektbeteiligten<br />
schon während <strong>der</strong> Entwicklung <strong>von</strong> Webseiten beachtet und eingehalten<br />
werden. In verschiedenen weiteren Methoden werden einzelne<br />
o<strong>der</strong> mehrere Aspekte dieser Heuristiken genauer untersucht.<br />
42
Standardüberprüfungen:<br />
In Standardüberprüfungen werden Benutzeroberflächen <strong>von</strong> Experten<br />
auf Einhaltung marketingrelevanter Aspekte überprüft. Solche Inspektionen<br />
können gezielt den Wert innerhalb an<strong>der</strong>er Systeme des Marktes,<br />
welche die gleichen Standards befolgen, steigern.<br />
Leitfadenüberprüfungen:<br />
Leitfadenüberprüfungen sind Inspektionen, welche die Benutzeroberfläche<br />
auf Übereinstimmung mit einer Liste <strong>von</strong> übergreifenden Usability-Richtlinien<br />
(zum Beispiel ISO-Normen) überprüft. Derartige<br />
Dokumente beinhalten allerdings eine Auflistung <strong>von</strong> tausend Richtlinien.<br />
Leitfadenüberprüfungen benötigen ein hohes Ausmaß an Expertisen<br />
und sind in <strong>der</strong> Praxis selten. Diese Methode kann als eine Mischung<br />
aus Heuristischer Evaluation und Standard-Inspektion betrachtet<br />
werden.<br />
Konsistenzüberprüfungen:<br />
Bei den Konsistenzüberprüfungen begutachten Designer die jeweiligen<br />
Benutzeroberflächen hinsichtlich <strong>der</strong> konsequenten Einhaltung<br />
des gewünschten Designs. Solche Inspektionen sind gezielte Evaluationen<br />
<strong>von</strong> Benutzeroberflächen innerhalb eines Inspektionsteams.<br />
Formale Benutzungsüberprüfungen:<br />
Formale Benutzungsüberprüfungen sind so gestaltet, dass sie <strong>der</strong> (den<br />
meisten Software-Programmierern bereits bekannten) Code-Abnahme<br />
ähneln: Der Programm-Code wird durch Dritte auf Fehler überprüft.<br />
Diese Methode zielt jedoch nicht direkt auf die Benutzeroberfläche ab.<br />
Spezielle Merkmalsüberprüfungen:<br />
In einer speziellen Merkmalsüberprüfung wird kontrolliert, ob die in<br />
einem Softwaresystem geplanten Funktionen eingehalten wurden und<br />
für den Benutzer erkennbar sind. Insbeson<strong>der</strong>e kann dies zum Beispiel<br />
die Frage bedeuten, ob die Funktion des Designs eine allgemeine Anerkennung<br />
<strong>der</strong> Bedürfnisse des Endbenutzers erfährt. Solche fokussierten<br />
Merkmalsüberprüfungen können nicht nur die Evaluation einer<br />
Funktion, son<strong>der</strong>n auch das Design <strong>der</strong> Funktion beinhalten.<br />
43
„Pluralistic walkthroughs“:<br />
„Walkthrough“ bedeutet so viel wie das „Durchdenken eines Problems“.<br />
Mehrfach-„Walkthroughs“ sind Begegnungen <strong>von</strong> Entwicklern<br />
sowie Benutzern, die gemeinsam ein simuliertes Benutzer-Szenario<br />
durchlaufen und diskutieren. Die einzelnen Szenarioschritte beinhalten<br />
Usability zugehörige Sachverhalte, die den jeweiligen Dialogelementen<br />
entsprechen. Mit Hilfe <strong>von</strong> „Walkthroughs“ können sich Experten<br />
in Benutzerverhalten hineindenken. Jedoch ist die Annahme<br />
bestimmter Benutzerszenarios fraglich. Außerdem besitzen Experten<br />
mehr Wissen über die jeweilige Webseite als die späteren Benutzer.<br />
Mögliche Probleme werden dadurch möglicherweise nicht erahnt.<br />
„Cognitive walkthroughs“:<br />
Im kognitiven „Walkthrough“ wird getestet, ob das simulierte bzw.<br />
gedachte Benutzerziel bzw. die verschiedenen Aktionen erreicht sowie<br />
<strong>von</strong> den Benutzern angenommen werden können und ob sie zur nächsten<br />
korrekten Aktion führen. Diese Methode nutzt viele Details im<br />
Prozess <strong>der</strong> Simulation eines Problemlösungsprozesses durch den Benutzer<br />
im <strong>Mensch</strong>-Computer-Dialog.<br />
Hochwertige Usability-Inspektionen können beson<strong>der</strong>s durch ausgebildete<br />
Ergonomen durchgeführt werden. Projektbeteiligte (Entwickler <strong>der</strong> Webseiten)<br />
sind allerdings sehr wenig geeignet, da sie bereits über spezielles Wissen<br />
zum jeweiligen Produkt verfügen und nicht mehr intuitiv vorgehen. Die<br />
hochwertigsten Ergebnisse werden durch Hilfe <strong>von</strong> sog. Doppelexperten<br />
erzielt, die in Usability und zusätzlich im zu untersuchenden Metier ausgebildet<br />
sind. Sie sind in <strong>der</strong> Lage, wissenschaftlich fundierte Grundlagen mit<br />
dem notwendigen Verständnis produktspezifischer Eigenheiten zu verbinden<br />
[vgl. BEIER, V. GIZYCKI (2002): 89 f].<br />
In sich mehrmals wie<strong>der</strong>holenden Prozessen werden usability-relevante<br />
Erkenntnisse aus Überprüfungen gewonnen, welche in die weitere Entwicklung<br />
eines Produktes einfließen. Danach wird <strong>von</strong> neuem getestet. Dieser<br />
gesamte Prozess, in dem die Usability eines Produktes definiert, gemessen<br />
und verbessert wird, ist <strong>der</strong> Vorgang des Usability-Engineering.<br />
44
3.4.4 Methodenauswahl<br />
Die Frage ist nun, welche ist die richtige Methode zum Feststellen <strong>der</strong> Usability?<br />
In <strong>der</strong> folgenden Tabelle werden alle noch einmal kurz vergleichend<br />
gegenüber gestellt:<br />
Erläuterungen:<br />
In einigen Fällen, in denen es um Aktivitäten des Benutzers geht, können<br />
Aussagen nur indirekt bestätigt werden. Das liegt daran, dass konkrete Aussagen<br />
<strong>der</strong> Benutzer nicht erfolgen, jedoch durch Überprüfung bestimmter<br />
Usability-Prinzipien auf solche geschlossen werden kann.<br />
Beim Vergleich <strong>der</strong> Kosten werden Personalkosten ausgeschlossen, da diese<br />
in allen Fällen <strong>der</strong> Anwendung <strong>von</strong> Usability-Methoden vorliegen. In dieser<br />
Übersicht werden primär Material- und Beschaffungskosten sowie Kosten<br />
aufgrund des Einsatzes <strong>von</strong> Endanwen<strong>der</strong>n betrachtet.<br />
Die Kriterien betreffs <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> Leitfadenüberprüfung sind stark<br />
abhängig vom Umfang und <strong>der</strong> Genauigkeit <strong>der</strong> jeweiligen Richtlinien.<br />
45
Tabelle 3.1: Methoden <strong>der</strong> Usability-Evaluation<br />
Bewertung:<br />
Methoden:<br />
Key-Stroke-<br />
Modell<br />
Usability-<br />
Test<br />
Heuristische<br />
Evaluation<br />
Standardüberprüfung<br />
Leitfadenüberprüfung<br />
Konsistenzüberprüfung<br />
Formale<br />
Benutzungsüberprüfung<br />
Spezielle<br />
Merkmalsüberprüfung<br />
Rate des Auffindens <strong>von</strong><br />
Fehlern/Problemen mittel hoch hoch gering mittel gering gering mittel hoch<br />
Aussagen über<br />
Effektivität keine ja ja keine keine - gering keine keine ja ja<br />
Aussagen über<br />
Effizienz ja ja ja keine keine - gering keine keine ja ja<br />
Aussagen über Zufriedenheit<br />
des Nutzers keine ja nur indirekt keine keine - gering keine keine ja ja<br />
Überprüfung des<br />
Designs nein ja ja ja ja ja nein ja ja<br />
Überprüfung <strong>der</strong> Funktionalität<br />
ja ja ja nein ja nein ja ja ja<br />
Überprüfung auf Einhaltung<br />
bestimmter Prinzipien und<br />
Richtlinien nein nein ja ja ja nein nein nein nein<br />
Überprüfung kognitiver<br />
Aktionen des Benutzers ja ja nur indirekt nein nein nein nein ja ja<br />
Überprüfung motorischer<br />
Aktionen des Benutzers ja ja nein nein nein nein nein nein ja<br />
Aufwand gering - mittel hoch gering gering hoch gering gering gering gering<br />
Kosten gering hoch gering gering gering gering gering gering gering<br />
Bewertung durch Anwen<strong>der</strong>,<br />
Experten, (Masch.) System E / S A E E E E E / S E A / E<br />
Walkthrough
Eine endgültige Aussage zur richtigen Auswahl einer einzigen bestimmten<br />
Methode ist nicht möglich. Abhängig vom Hersteller, den Inhalten <strong>der</strong> Webseiten<br />
sowie den verschiedenen Zielgruppen können jeweils unterschiedliche<br />
einzelne Methoden o<strong>der</strong> Kombinationen da<strong>von</strong> in Frage kommen. Grundsätzlich<br />
kann aber folgendes gesagt werden: Alle Methoden <strong>der</strong> Gutachterinspektionen<br />
können innerhalb einer Firma o<strong>der</strong> einer Entwicklungsumgebung<br />
durchgeführt werden – mit den Software-Entwicklern, Designern, Marketingexperten<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Personen. Also Experten, die in Firmen bereits<br />
vorhanden sind und nicht extra rekrutiert werden müssen. Dies kann in erheblichem<br />
Maße Zeit und Kosten einsparen.<br />
Häufig werden Befragungen und Inspektionen miteinan<strong>der</strong> kombiniert. Die<br />
Ergebnisse zeigen die Richtung <strong>von</strong> Schwierigkeiten im Umgang mit <strong>der</strong><br />
Webseite auf. Später sollten vermeintliche Probleme in zusätzlichen Usability-Tests<br />
genau überprüft werden.<br />
47
4 Wirtschaftliche Komponenten<br />
Webseiten sind nicht nur zum Schönsein da. Häufig sollen sie ganz bestimmte<br />
Dinge bezwecken und vermitteln. Die Anlässe für viele Internetauftritte<br />
werden durch erhebliche wirtschaftliche Gründe bestimmt.<br />
Was genau wollen Unternehmen, Gewerbetreibende o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Hersteller<br />
<strong>von</strong> Webseiten in wirtschaftlicher Hinsicht mit ihren Internetauftritten bezwecken?<br />
Einen ersten Aufschluss darüber können Aspekte des traditionellen<br />
Marketings geben, denn die grundsätzlichen Unternehmensziele motivieren<br />
die Veröffentlichung <strong>von</strong> Webseiten sowie <strong>der</strong>en Inhalten. Im weiteren<br />
Verlauf dieses Kapitels folgen Aussagen zum elektronischen Marketing<br />
sowie dem Einsatz <strong>von</strong> Webseiten in Unternehmen.<br />
4.1 Das traditionelle Marketing<br />
Das Marketing eines Unternehmens bestimmt die Ausrichtung <strong>der</strong> unternehmerischen<br />
Tätigkeit in <strong>der</strong> jeweiligen Marktsituation. Beides beeinflusst<br />
gleichzeitig die Ziele eines Unternehmens sowie seine Strukturen, welche<br />
wie<strong>der</strong>um auf das unternehmerische Handeln zurückwirken.<br />
4.1.1 Unternehmensziele<br />
Die verschiedenen Teilziele einer Unternehmung sind ein komplexes Gefüge<br />
aus Absichten und Zielvorstellungen, welches hierarchisch angeordnet ist.<br />
Die oberste Ebene besteht aus den übergeordneten Wertvorstellungen des<br />
Unternehmens, welche als Grundlage für die Definition des eigentlichen<br />
Unternehmenszwecks dient. Aus diesem lassen sich dann die konkreten<br />
Unternehmensziele ableiten, die wie<strong>der</strong>um Orientierungsgrößen für die<br />
nachgelagerten Bereichs-, Aktionsfeld- und Instrumentalziele sind. Angefangen<br />
<strong>von</strong> den allgemeinen Wertvorstellungen bis hin zu den Instrumentalzielen<br />
werden die Ziele vielfacher und zunehmend konkreter [vgl. GABLER<br />
(1993) und BECKER (1998): 28 – 60]. Der Aufbau ist anschaulich in <strong>der</strong><br />
Abbildung 4.1 dargestellt und wird nachfolgend im Einzelnen erläutert:<br />
48
Unternehmensverfassung<br />
Unternehmensphilosophie<br />
Unternehmensziele<br />
Bereichsziele<br />
Aktionsfeldziele<br />
Instrumentalziele<br />
Abbildung 4.1: System <strong>der</strong> Zielebenen [BECKER (1998): 28]<br />
Die Unternehmensverfassung beinhaltet allgemeine Wertvorstellungen eines<br />
Unternehmens. In ihr werden alle langfristig angelegten konstitutiven Regelungen<br />
<strong>der</strong> institutionellen Ausgestaltung festgehalten. Sie umfassen die<br />
interne (formale) Machtverteilung zwischen den einzelnen Interessengruppen,<br />
sowie die sie ergänzenden externen Regelungen zum Schutz <strong>der</strong> verfassungsrelevanten<br />
Interessen. Die Grundfrage <strong>der</strong> Unternehmensverfassung ist:<br />
Welche Interessen sollen die Zielsetzung und die Politik des Unternehmens<br />
bestimmen? Hier gibt es primär zwei verschiedene Ansätze: Die ökonomische<br />
Realität <strong>der</strong> westlichen Industrienationen wird durch eine traditionelle<br />
kapitalistische Unternehmensverfassung geprägt. Im Gegensatz dazu haben<br />
bei <strong>der</strong> mitbestimmenden Unternehmung auch die Interessen <strong>der</strong> Konsumenten<br />
und <strong>der</strong> allgemeinen Öffentlichkeit Verfassungsrang 45 .<br />
Die Unternehmensphilosophie ist ein Instrument <strong>der</strong> unternehmenspolitischen<br />
Rahmenplanung und formuliert explizite Grundsätze zur<br />
Unternehmenspolitik sowie <strong>der</strong>en Taktiken. Die Unternehmensphilosophie<br />
kann nach innen 46 o<strong>der</strong> außen 47 gerichtet, rational o<strong>der</strong> emotional sein. Sie<br />
enthält konkrete Ausprägungen grundlegen<strong>der</strong> Meta-Ziele einer<br />
Unternehmung: Die Unternehmensidentität betrifft vor allem die<br />
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Orientierung, Motivation und Legitimation<br />
45 Zum Beispiel Betriebe nach dem Genossenschaftsprinzip.<br />
46 betrifft die eigenen Mitarbeiter<br />
47 betrifft Kunden, Geschäftspartner etc.<br />
49
Orientierung, Motivation und Legitimation <strong>der</strong> Mitarbeiter (Innenwirkung).<br />
Durch eine Unternehmensethik werden die Zusammenhänge zwischen internen<br />
sozialen Beziehungen, Auffassungen zum Umweltschutz sowie den<br />
eigentlichen Unternehmenszielen festgemacht. In <strong>der</strong> Unternehmenskultur<br />
kommen Mission (bestimmte Unternehmenstätigkeit) und Vision (neue,<br />
ehrgeizige Zielsetzungen und -richtungen) des jeweiligen Unternehmens<br />
zum Ausdruck.<br />
Die eigentlichen Unternehmensziele motivieren die konkreten unternehmerischen<br />
Betätigungen: Der Gewinn gilt hierbei als das bedeutendste Ziel.<br />
Hinzu kommt das Streben bezüglich des Umsatzes, <strong>der</strong> Liquidität, <strong>der</strong> Substanzerhaltung<br />
etc. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das angestrebte<br />
Ausmaß <strong>der</strong> Zielerreichung in Verbindung mit einer bestimmten<br />
zeitlichen Komponente.<br />
Zusätzlich bilden die Unternehmensziele die Grundlage <strong>der</strong> Analyse sowie<br />
Erklärung unternehmerischer Verhaltensweisen. Unternehmensziele sind<br />
Ergebnisse <strong>von</strong> Entscheidungsprozessen verschiedener Gruppen, welche zur<br />
Willensbildung befähigt und berechtigt sind. Die einzelnen Zielformulierungen<br />
sind an dieser Stelle noch vieldeutig. Dies schafft einen Interpretationsspielraum<br />
zugunsten individueller Zielvorstellungen.<br />
Bereichsziele werden meist kurzfristig geplant (bis zu einem Jahr) und<br />
betreffen Beschaffung, Produktion, Absatz sowie Forschung und Entwicklung<br />
des Unternehmens.<br />
Aktionsfeldziele beinhalten konkrete Angaben zu gegenwärtigen o<strong>der</strong> zukünftigen<br />
Aktivitäten des gesamten Leistungsprozesses einschließlich <strong>der</strong><br />
Teilmärkte (sichern Leistungsbezug und -abgabe).<br />
Instrumentalziele steuern die Anwendung marketingpolitischer Instrumente.<br />
Sie ergeben sich aus den Reaktionen <strong>der</strong> betrieblichen Umwelt wie zum<br />
Beispiel Abnehmer, Konkurrenten o<strong>der</strong> staatliche Stellen.<br />
Diese grundlegenden wirtschaftlichen Ziele spiegeln sich auf vielen Webseiten<br />
durch die Art <strong>der</strong> Unternehmenspräsentation, dem Verkauf <strong>von</strong> Produkten<br />
und Leistungen, Werbung etc. mehr o<strong>der</strong> weniger direkt wi<strong>der</strong>. Hierbei<br />
spielt weniger die Größe eines Unternehmens eine Rolle, son<strong>der</strong>n vielmehr<br />
50
das Bewusstsein, seine eigenen Ziele und Vorhaben erfolgsorientiert nach<br />
außen vermitteln zu wollen 48 .<br />
4.1.2 Unternehmensstrukturen<br />
Damit ein Unternehmen überhaupt bestehen und sein Zielvorhaben umsetzen<br />
kann, gibt es eine Fülle <strong>von</strong> grundsätzlichen Aufgaben. Um die einzelnen<br />
Funktionsbereiche eines Unternehmens in einen Gesamtablauf einordnen zu<br />
können, ist nachfolgend kurz eine allgemeine Unternehmensstruktur dargestellt,<br />
die nach den Ausführungen <strong>von</strong> Wolfgang Weber [vgl. WEBER<br />
(1993)] in <strong>der</strong> Abbildung 4.2 visualisiert wurde: Unternehmerische Aufgaben<br />
werden entsprechend ihrer Ausprägungen in verschiedene Unternehmensbereiche<br />
wie leistungswirtschaftliche Funktionen, Finanzwirtschaft und<br />
Management eingeglie<strong>der</strong>t. Hier<strong>von</strong> leiten sich in mehreren Ebenen weitere<br />
Aufgabenbereiche ab, <strong>von</strong> denen jeweils die für diese Arbeit relevanten<br />
Bereiche herausgegriffen und weiter aufgeschlüsselt werden.<br />
Unternehmerische Aufgaben<br />
Abbildung 4.2: Unternehmerische Aufgaben<br />
Leistungswirtschaftliche Funktionen<br />
Beschaffung<br />
Produktion<br />
Absatz<br />
Kommunikations-Mix<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Werbung<br />
Verkaufsför<strong>der</strong>ung<br />
Produktions-Mix<br />
Kontrahierungs-Mix<br />
Distributions-Mix<br />
Finanzwirtschaft<br />
Management<br />
Zu den leistungswirtschaftlichen Funktionen gehören die Beschaffung (Bereitstellung<br />
<strong>der</strong> Güter und Dienstleistungen), die Produktion (betriebliche<br />
48 Unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Größe verfügen Unternehmen über Interessen wie Gewinn, Umsatz,<br />
Identitätsdarstellung etc.<br />
51
Umwandlung und Transformation <strong>von</strong> Einsatzgütern in an<strong>der</strong>e Güter und<br />
Dienstleistungen) sowie <strong>der</strong> Absatz (Maßnahmen, die <strong>der</strong> Verwendung <strong>der</strong><br />
erstellten Leistungen auf dem Markt dienen).<br />
Der betriebswirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens hängt im Wesentlichen<br />
da<strong>von</strong> ab, ob die erstellten Güter o<strong>der</strong> Dienstleistungen (mit Gewinn)<br />
verkauft werden. Hierzu dienen insbeson<strong>der</strong>e Maßnahmen zur Unterstützung<br />
und För<strong>der</strong>ung des Absatzes. Diese werden dann durch weitere Komponenten<br />
genau aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt: Der Produkt-Mix beschreibt Produktqualität,<br />
Sortiment, Marke und Kundendienst, <strong>der</strong> Kontrahierungs-Mix beinhaltet<br />
Preis, Kredite, Rabatt und Skonto, und <strong>der</strong> Distributions-Mix steuert<br />
Absatzkanäle und Logistik 49 [vgl. WEBER (1993): 89 ff].<br />
Hinsichtlich <strong>von</strong> Webseiten ist für die weitere Bearbeitung <strong>der</strong> Kommunikations-Mix<br />
<strong>von</strong> entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung. Wie sich zeigen wird, sind einige<br />
seiner Basisinstrumente diejenigen, die mit Hilfe <strong>von</strong> Webseiten abgebildet<br />
und umgesetzt werden können. Insgesamt beinhaltet <strong>der</strong> Kommunikations-<br />
Mix Schulungen, persönlichen Verkauf, Verkaufsför<strong>der</strong>ung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Werbung.<br />
4.2 Die Kommunikation eines Unternehmens mit <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Kommunikationspolitik eines Unternehmens ist es, die Einstellungen,<br />
Kenntnisse sowie Verhaltensweisen <strong>von</strong> möglichen Zielgruppen zu<br />
beeinflussen und im Sinne eigener Marketing- bzw. Unternehmensziele zu<br />
lenken. Im Folgenden werden diejenigen Basisinstrumente <strong>der</strong> unternehmerischen<br />
Kommunikationsmöglichkeiten herausgegriffen und erläutert, die für<br />
eine spätere Betrachtung im Fokus <strong>der</strong> elektronischen Medien in Frage<br />
kommen: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Verkaufsför<strong>der</strong>ung.<br />
4.2.1 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) möchte ein Unternehmen<br />
durch die Beeinflussung seiner weiteren Umwelt generelles Vertrauen sowie<br />
49 Diese drei Komponenten zuzüglich des Kommunikations-Mix sind Bestandteil des sog.<br />
Marketing-Mix.<br />
52
eine positive Einstellung in <strong>der</strong> Öffentlichkeit erwirken [vgl. WEBER (1993):<br />
97]. Das Unternehmen profiliert sich als Absen<strong>der</strong> und Garant seiner Produkte<br />
und Leistungen. Außerdem soll die Öffentlichkeit über Preis-<br />
Leistungsverhältnisse, Umweltengagement, Forschungsinvestitionen und<br />
innere soziale Strukturen (je nach Wunsch des Unternehmens) informiert<br />
werden. Im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Öffentlichkeitsarbeit steht im Allgemeinen eine<br />
ehrliche Informationspolitik; bedingt durch die Erkenntnis, dass Kaufentscheidungen<br />
unter an<strong>der</strong>em auch <strong>von</strong> dem Ruf und <strong>der</strong> Kompetenz des Unternehmens<br />
als Ganzes abhängig sind [vgl. BECKER (1998): 600].<br />
4.2.2 Werbung<br />
Zur Werbung gehören alle gezielt eingesetzten Maßnahmen zur Beeinflussung<br />
des Kaufverhaltens <strong>der</strong> Nachfrager in eine bestimmte Richtung.<br />
Hierbei sollen Produkte wie auch Unternehmen bekannt gemacht und Kaufentscheidungen<br />
geför<strong>der</strong>t werden, indem Informationen über Produkte an<br />
mögliche Käufergruppen übermittelt werden. Grundsätzliches Ziel <strong>der</strong> Werbung<br />
ist, die Bedürfnisse <strong>der</strong> Verbraucher anzusprechen, um die Nachfrage<br />
nach bestimmten Produkten zu wecken und zu steigern. Gleichzeitig sollen<br />
potentielle Kunden motiviert werden, nicht bei <strong>der</strong> Konkurrenz, son<strong>der</strong>n<br />
beim eigenen Unternehmen zu kaufen [vgl. WEBER (1993): 95].<br />
Die angebotenen Produkte und Leistungen müssen kundenorientiert profiliert<br />
werden. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit des potentiellen Kunden<br />
geweckt wird, seine Wünsche und Motive angesprochen werden und dass<br />
sich <strong>der</strong> Werbeinhalt in sein Gedächtnis einprägt. Außerdem sollte die Werbung<br />
im Idealfall den Tatsachen entsprechen 50 .<br />
Es gibt individuelle Werbung, durch die bestimmte Unternehmen o<strong>der</strong> Personen<br />
angesprochen werden, sowie Massenwerbung, die sich an die Allgemeinheit<br />
richtet. Hierbei sind neben den klassischen Werbeträgern wie Plakate<br />
o<strong>der</strong> Werbebriefe die Neuen Medien die wichtigsten Medien zur Streuung<br />
<strong>von</strong> Werbung.<br />
Ein häufig auftretendes Problem <strong>der</strong> Werbung ist <strong>der</strong> Anteil <strong>von</strong> nicht beachteten<br />
Botschaften und Informationen. Zum einen besteht aufgrund <strong>der</strong> Fülle<br />
<strong>von</strong> Werbebotschaften eine Informationsüberlastung. Zum an<strong>der</strong>en sind die<br />
Reizschwellen für eine wirksame Werbung deutlich höher geworden. Auch<br />
50 Dies gilt beson<strong>der</strong>s im Rahmen entsprechen<strong>der</strong> Gesetze und Normen (z.B. „Gesetz gegen<br />
den unlauteren Wettbewerb“).<br />
53
gleichen sich Produkte und Leistungen häufig so stark, dass sie kaum noch<br />
<strong>von</strong>einan<strong>der</strong> unterschieden werden können. Die Einstellungen <strong>der</strong> Rezipienten<br />
gegenüber <strong>der</strong> Werbung werden außerdem zunehmend kritischer, was<br />
zusätzliche Än<strong>der</strong>ungen im Abnehmerverhalten zur Folge hat [vgl.<br />
BECKER (1998): 567].<br />
Bei <strong>der</strong> Eignung bzw. <strong>der</strong> Verkaufsmöglichkeit <strong>von</strong> Produkten o<strong>der</strong> Dienstleistungen<br />
durch die (Neuen) Medien gibt es im Allgemeinen keine Einschränkungen.<br />
Wichtig ist jedoch, dass die jeweilige Werbung mit den verschiedenen<br />
Werbeträgern hinsichtlich Qualität, Quantität und Aktualität<br />
entsprechend aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt wird.<br />
4.2.3 Verkaufsför<strong>der</strong>ung<br />
Die Verkaufsför<strong>der</strong>ung schließt alle Maßnahmen zur Unterstützung <strong>der</strong><br />
unternehmenseigenen Absatzorgane ein, wie zum Bespiel Warenpräsentationen<br />
und -informationen o<strong>der</strong> Werbung am Ort des Verkaufs. Sie ist somit<br />
auch ein Kommunikationsmittel im Bereich <strong>der</strong> elektronischen Medien.<br />
Kernaufgabe <strong>der</strong> Verkaufsför<strong>der</strong>ung ist die Unterstützung des Verkaufs <strong>der</strong><br />
Produkte und Leistungen durch (notwendige) zusätzliche Verkaufs- bzw.<br />
Kaufanreize [vgl. WEBER (1993): 97 und BECKER (1998): 587].<br />
Nach <strong>der</strong> für die elektronischen Medien in Frage kommenden Bestimmung<br />
traditioneller Kommunikationsmöglichkeiten wird im folgenden Abschnitt<br />
beschrieben, wie diese in <strong>der</strong> Öffentlichkeit präsentiert werden.<br />
4.3 Die Präsentation <strong>von</strong> Botschaften<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Darstellung <strong>von</strong> Botschaften ist es, die Ansichten eines Unternehmens<br />
(z.B. seine Firmenphilosophie) in <strong>der</strong> Öffentlichkeit bekannt zu<br />
machen. Insbeson<strong>der</strong>e die Werbung soll ihr Zielpublikum wirksam und<br />
dauerhaft erreichen. Dies kann nur über eine geeignete Präsentation geschehen.<br />
Nachfolgend werden die entsprechenden Methoden des traditionellen Marketings<br />
beschrieben. Wie anhand <strong>der</strong> Erläuterungen zu sehen sein wird,<br />
können diese aufgrund ihrer Kompatibilität auch auf die Gestaltung <strong>von</strong><br />
Webseiten angewendet werden.<br />
54
4.3.1 Planung<br />
Bevor Werbebotschaften in <strong>der</strong> Öffentlichkeit präsentiert werden, ist eine<br />
genaue Planung dieser notwendig. Hierbei gibt es verschiedene grundsätzliche<br />
Überlegungen [vgl. BECKER (1998): 567 ff]:<br />
Bestimmung <strong>der</strong> Werbeziele<br />
Festlegen <strong>der</strong> Werbeaussagen<br />
Ermitteln <strong>der</strong> Werbeträger<br />
Vor <strong>der</strong> Festlegung eines Werbeziels muss das eigentliche Werbeobjekt, also<br />
ein Produkt o<strong>der</strong> eine Leistung, bestimmt werden. Für eine planmäßige<br />
Positionierung am Markt ist es hilfreich, wenn es sich <strong>von</strong> den Konkurrenzprodukten<br />
abhebt und ein unverwechselbares Nutzenangebot darstellt. Danach<br />
werden die Werbesubjekte, die zukünftigen Ziel- und Käufergruppen<br />
eines bestimmten Produktes, spezifiziert. Diese lassen sich aus <strong>der</strong> Definition<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Anspruchsmerkmale und -niveaus sowie aus <strong>der</strong> vorgenommenen<br />
Positionierung ableiten und bestimmen. Jetzt werden die Werbeziele<br />
festgelegt. Sie beinhalten Aussagen über den geplanten Absatz und den<br />
Umsatz sowie den gewünschten Bekanntheitsgrad und das jeweilige Image<br />
des umworbenen Produktes.<br />
Die inhaltliche Gestaltung <strong>der</strong> Werbeaussagen erfolgt über die Schaffung<br />
eines glaubhaften Produktversprechens, welches dann durch möglichst objektive<br />
Kerneigenschaften des Produktes nachvollziehbar begründet wird.<br />
Werbeideen werden in <strong>der</strong> Art und Weise <strong>der</strong> Präsentation deutlich. Dazu<br />
gehört nicht nur eine bestimmte Werbebotschaft, son<strong>der</strong>n auch die jeweilige<br />
Atmosphäre, in <strong>der</strong> ein bestimmtes Produkt dargestellt wird. Mit dieser soll<br />
beim Publikum die Nachvollziehbarkeit <strong>der</strong> Versprechen und <strong>der</strong>en Akzeptanz<br />
erreicht werden. Ein beson<strong>der</strong>er Faktor einer wirksamen Werbegestaltung<br />
ist das Erstellen origineller Werbelösungen. Dies kann durch hohe<br />
Kreativität und Intuition sowie durch die Nutzung verhaltenswissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse, die durch Beobachtung während <strong>der</strong> Aufnahme <strong>von</strong> Werbung<br />
getroffen werden, erfolgen [vgl. BECKER (570)]. Hierbei ist entscheidend,<br />
dass einerseits die Unternehmensziele beachtet werden und an<strong>der</strong>erseits<br />
stets auch die Einstellungen, Wünsche, Meinungen und Kenntnisse <strong>der</strong><br />
Kunden.<br />
55
Bereits während <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Werbeaussage werden die verschiedenen<br />
Werbeträger (teilweise) festgelegt. Deren Auswahl orientiert sich an <strong>der</strong> Art<br />
und dem Inhalt <strong>der</strong> Werbebotschaft, sowie an Überlegungen, wie die jeweilige<br />
Botschaft am besten <strong>der</strong> geplanten Zielgruppe vermittelt werden kann 51 .<br />
Als Werbeträger können einerseits unterschiedliche Medien verwendet<br />
werden, aber an<strong>der</strong>erseits auch verschiedene Formen <strong>der</strong> Darstellung innerhalb<br />
eines bestimmten Mediums. Wichtig ist ein angemessenes aufeinan<strong>der</strong><br />
Abstimmen <strong>der</strong> jeweiligen Komponenten.<br />
4.3.2 Gestaltung<br />
Werbebotschaften sind (im Sinne des Unternehmens) möglichst so zu gestalten,<br />
dass sie bei <strong>der</strong> entsprechenden Zielgruppe einen kaufpsychologischen<br />
Prozess auslösen. Um dies zu erreichen, müssen verschiedene Aspekte <strong>der</strong><br />
Gestaltung <strong>von</strong> Werbung beachtet werden [vgl. BECKER (1998): 572]:<br />
Gestaltungsart<br />
Gestaltungsform<br />
Gestaltungsmittel<br />
Je nach angestrebter Verwendung eines Produktes sowie seiner Zielgruppe<br />
gibt es verschiedene Arten <strong>der</strong> Gestaltung: Rationale o<strong>der</strong> sachargumentierende<br />
Werbung ist eher statisch und produktbetont – emotionale bzw. erlebnisorientierte<br />
Werbung ist meist dynamisch und verwendungsbezogen. Eine<br />
Kombination bei<strong>der</strong> Arten, also eine rational-emotionale Ansprache gelingt<br />
nur, wenn eine <strong>der</strong> beiden Komponenten dominiert.<br />
Produkte mit niedrigem Involvement (geringe emotionale Beteiligung), wie<br />
zum Beispiel Produkte des täglichen Bedarfs, benötigen gerade zum Auffallen<br />
häufig emotionale Werbeansprachen. Im Gegensatz dazu erfor<strong>der</strong>n Produkte<br />
mit hohem Involvement eher sachargumentierende Werbegestaltungen.<br />
In diesem Fall kann aber auch eine sachlich-emotionale Kombination hilfreich<br />
sein, und zwar dann, wenn die jeweilige Zielgruppe sowohl rational als<br />
auch emotional steuerbar ist. Es ist festzustellen, dass emotionale Werbeges-<br />
51 Unter Beachtung anfallen<strong>der</strong> Kosten.<br />
56
taltungen zunehmen. Dies liegt vor allem an <strong>der</strong> zunehmenden Erlebnisorientierung<br />
52 [vgl. BECKER (1998): 577].<br />
Grundsätzlich hängt die jeweilige Werbehandschrift vom zu bewerbenden<br />
Produkt und <strong>der</strong> Produktkategorie ab. Viele Gestaltungsarten beziehen sich<br />
auch auf ein bereits bestehendes Firmenimage (bzw. Firmendesign) 53 .<br />
Mit unterschiedlichen Gestaltungsformen sind verschiedene Ausdrucksmittel<br />
gemeint, sowie inhaltliche Übersetzungs- o<strong>der</strong> Inszenierungsformen. Hier<br />
korrelieren bestimmte Formen mit bestimmten generellen Gestaltungsarten:<br />
< Problemlösungsorientierte Muster knüpfen an einen konkreten<br />
Produktnutzen an und suggerieren eine spezifische Problemlösungseignung.<br />
Zur Darstellung werden häufig typische Testsituationen<br />
genutzt.<br />
< Bei symbolorientierten Mustern werden wichtige Aussagen mit<br />
Hilfe geeigneter Symbole wie zum Beispiel Tiere, Zeichentrickfiguren<br />
o<strong>der</strong> auch Prominente kodiert und verkürzt.<br />
< In erzählungsorientierten Mustern können durch Verwendung<br />
spezifischer Ausdrucks- und Dramatisierungsformen Werbebotschaften<br />
inszeniert werden. In bestimmten Szenarien werden<br />
dann Geschichten erzählt und attraktive Alltagssituationen geschil<strong>der</strong>t.<br />
< Eine Steigerungsform stellt schließlich das lebensweltenorientierte<br />
Muster dar: In ihm werden Wunsch- o<strong>der</strong> Traumwelten<br />
inszeniert, in die Produkte sowie bestimmte Marken als<br />
selbstverständliche Bestandteile zugeordnet werden.<br />
Von ausschlaggeben<strong>der</strong> Bedeutung sind Gestaltungsmittel in Form <strong>von</strong><br />
Zeichen, Farben, Formen, Größen sowie Proportionen. Durch sie werden<br />
variable sowie konstante Werbeelemente im Sinne eines einheitlichen firmen-<br />
bzw. markenspezifischen Kommunikations- o<strong>der</strong> Grafik-Designs zu<br />
einer erlebbaren, eigenständigen Ganzheit verwoben.<br />
Variable Werbeelemente werden nur einmal o<strong>der</strong> nur für einen bestimmten<br />
Zeitraum genutzt. Konstante Werbeelemente (z.B. Logos, Schlagworte,<br />
Schlüsselbil<strong>der</strong>) sind hingegen Ausdrucksmittel, die in allen verwendeten<br />
52 In diesen Fällen erhalten die entsprechenden Produkte einen stark angeglichenen objektiven<br />
Produktnutzen.<br />
53 „Corporate Identity“<br />
57
Werbemitteln wie<strong>der</strong>kehren, möglichst lange unverän<strong>der</strong>t eingesetzt werden<br />
und sich den <strong>Mensch</strong>en so besser und dauerhafter einprägen 54 .<br />
Um den Erfolg einer Werbung zu beurteilen, gibt es verschiedene Bewertungskriterien,<br />
die abhängig sind <strong>von</strong> einer klaren Zielsetzung, <strong>der</strong> Auswahl<br />
geeigneter Werbemittel sowie <strong>der</strong>en zweckmäßigen Streuung: Entspricht die<br />
Werbung den Tatsachen, steht sie im Rahmen gesetzlicher und sonstiger<br />
Normen? Wird das gesetzte Werbeziel erreicht? Stehen Aufwand und Erfolg<br />
in einem angemessenen Verhältnis zueinan<strong>der</strong>? Wird die Aufmerksamkeit<br />
des Kunden geweckt? Werden Wünsche und Motive potentieller Käufer<br />
angesprochen? Prägt sich <strong>der</strong> Werbeinhalt im Gedächtnis <strong>der</strong> Zielgruppe ein?<br />
[vgl. WEBER (1993): 96]<br />
Wichtig bei <strong>der</strong> Verbreitung einer Werbebotschaft sind die Geschlossenheit<br />
einer Werbekonzeption sowie die Ausbildung eines eigenständigen Werbesowie<br />
Firmenstils. Das, was eine gute Werbung ausmacht, ist ihre Unverwechselbarkeit,<br />
ihre Nachhaltigkeit und ihre Dauerhaftigkeit. Hier kommt es<br />
auf die richtige Mischung an.<br />
4.4 Virtueller Markt<br />
Durch vielfältige technische Möglichkeiten werden die Schnittstellen zwischen<br />
den Unternehmen und den Endverbrauchern immer mehr in private<br />
Haushalte verlagert. Dieser Trend ist mittlerweile so massiv, dass es zur<br />
Entstehung eines elektronischen Marktes kommt, welcher globale Ausmaße<br />
annimmt. Der Begriff des „virtuellen Marktes“ umschreibt den Bereich des<br />
sog. electronic-Commerce (kurz: eCommerce) 55 . Auch wenn hier ein neuer<br />
Begriff verwendet wird und scheinbar ein eigenständiger Wirtschaftsbereich<br />
entsteht, handelt es sich doch weiterhin um einen Teil des bereits bestehenden<br />
realen globalen Marktes 56 . Allerdings haben sich im „virtuellen<br />
Markt“ die technischen Hilfsmittel und Verfahrensweisen geän<strong>der</strong>t. Hier<br />
werden Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens über elektronische<br />
Medien vermarktet und vertrieben.<br />
54<br />
Gestaltungsaspekte hierzu werden in Kapitel 8: „Gestaltung und Design“ näher erläutert.<br />
55<br />
Deutsch: Elektronischer Handel<br />
56<br />
Vgl. Kapitel 2.4.4: „Bedeutung des Internets“<br />
58
4.4.1 Voraussetzungen zum eCommerce<br />
Damit ein elektronischer Handel entstehen und dauerhaft bestehen kann,<br />
bedarf es verschiedener Voraussetzungen [vgl. TUTT (2002): 21 f]:<br />
Elektronische Marktanwendungen<br />
Standardisierte Kommunikationskanäle<br />
Einheitliche Marktsprache<br />
Elektronische Marktanwendungen und -dienste ermöglichen die Zusammenführung<br />
<strong>von</strong> Anbietern und Nachfragern sowie die Abwicklung <strong>der</strong> gewünschten<br />
Transaktionen.<br />
Diese Anwendungen basieren auf standardisierten Kommunikationstechniken<br />
wie zum Beispiel <strong>der</strong> Textauszeichnungssprache HTML, mit <strong>der</strong>en Hilfe<br />
die Oberflächen <strong>von</strong> Webseiten gestaltet werden 57 . Mit solchen Kommunikationstechniken<br />
wird die ökonomisch orientierte Interaktion technisch möglich<br />
und unter Nutzung des Internets umgesetzt.<br />
Eine einheitliche Marktsprache entsteht durch die Anwendung <strong>der</strong> realweltlichen<br />
Sprache, sowie durch die Bildung eines branchenspezifischen Sprachcodes.<br />
4.4.2 Stufen des elektronischen Marketings<br />
Um die Transaktionen des eCommerce koordinieren und steuern zu können,<br />
wird ein entsprechendes Marketing 58 benötigt, welches sich elektronischer<br />
Möglichkeiten 59 bedient. Das Internet bietet für diese Zwecke interaktive<br />
Unterstützung. Der hierbei notwendige Computereinsatz dient vor allem<br />
einem taktischen Vorgehen. Im Bereich des Marketings gibt es drei Stufen<br />
<strong>der</strong> Anwendung [vgl. BECKER (1998): 639 ff]:<br />
Computerisiertes Marketing<br />
57 Für das Verschieben <strong>von</strong> Daten sind an<strong>der</strong>e Transferprotokolle notwendig, auf die in dieser<br />
Arbeit nicht näher eingegangen wird.<br />
58 betrifft die organisatorische Unterstützung<br />
59 betrifft die technische Unterstützung<br />
59
Computergestütztes Marketing<br />
Computerintegriertes Marketing<br />
Das computerisierte Marketing wird kurzfristig eingesetzt und dient zur<br />
kostenreduzierten Ausführung einer bestimmten Aufgabe (z.B. mit<br />
entsprechenden Programmen Berechnungen durchführen).<br />
Computergestütztes Marketing ist hilfreich bei mittelfristigen und sehr komplexen<br />
Marketingentscheidungen (z.B. Marktanalysen). Im Vor<strong>der</strong>grund<br />
steht hier die unternehmerische Leistungssteigerung.<br />
Mit Hilfe des computerintegrierten Marketings werden Verbindungen nach<br />
außen hergestellt. Kunden sollen langfristig auf strategische Art und Weise<br />
bei ihren Einkaufsprozessen beeinflusst, und zu möglichen Geschäftspartnern<br />
sollen Kontakte hergestellt werden.<br />
Solch ein elektronisch unterstütztes Marketing ist eine Möglichkeit <strong>der</strong><br />
interaktiven kommerziellen Kommunikation, die mittels vernetzter<br />
Informationssysteme mit Individuen o<strong>der</strong> Massen Verbindungen schafft und<br />
eine globale Verbreitung gefunden hat. Es eröffnet bei <strong>der</strong> Kommunikation<br />
mit verschiedenen Zielgruppen und Kunden neue Möglichkeiten und<br />
Chancen. Hierbei werden offline-Medien (z.B. CD-ROMs) o<strong>der</strong> online-<br />
Medien, wie zum Beispiel Computernetze o<strong>der</strong> online-Dienste, verwendet.<br />
Beson<strong>der</strong>s letztere sind hinsichtlich ihres Umfanges, <strong>der</strong> Aktualisierbarkeit<br />
<strong>der</strong> Inhalte und des Zugriffs auf die Informationen sowie <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Kommunikation mit mehreren Beteiligten <strong>von</strong> Vorteil. Hier bieten sich zwei<br />
grundlegende Einsatzfel<strong>der</strong> an: Mit Hilfe <strong>von</strong> Informationsverbesserung und<br />
Entscheidungsunterstützung sowie Beziehungsmarketing kann <strong>der</strong> Aufbau<br />
<strong>von</strong> Kundenbeziehungen unterstützt werden. Beson<strong>der</strong>s die online-<br />
Kommunikation ist eine Möglichkeit <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Verständigung <strong>von</strong><br />
Unternehmen mit ihren Kunden und Geschäftspartnern. Bevor sie genauer<br />
erläutert wird, erfolgt eine Beschreibung <strong>der</strong> verschiedenen virtuellen Transaktionsplattformen.<br />
60
4.4.3 Virtuelle Transaktionsplattformen<br />
Damit „virtuelle Märkte“ funktionieren können, benötigen sie verschiedene<br />
reale elektronische Transaktionsplattformen. Hierbei gibt es zwei verschiedene<br />
Klassifizierungen: Erstens nach <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Anbieter (individueller<br />
Auftritt eines Anbieters o<strong>der</strong> gemeinsamer Auftritt einer Anbietergruppe),<br />
zweitens nach <strong>der</strong> Möglichkeit des Zugangs zur Plattform durch die Nachfrager<br />
(Zugang offen o<strong>der</strong> beschränkt) [vgl. TUTT (2002): 22].<br />
Transaktionsplattformen mit offenen Zugängen werden primär in drei verschiedene<br />
Arten unterteilt [vgl. BACHOFER (1998): 16]:<br />
Virtuelle Einkaufszentren<br />
Unternehmenseigene Web-Präsenz<br />
Fremde Werbeträger<br />
In virtuellen Einkaufszentren (BSP: www.market2000.de und<br />
www.ebay.de 60 ) werden Angebote mehrerer Anbieter gebündelt. Diese<br />
können Unternehmen o<strong>der</strong> Privatpersonen sein. Ein Betreiber stellt die Plattform<br />
zur Präsentation <strong>der</strong> Angebote und übernimmt <strong>der</strong>en Organisation und<br />
Koordination. Gleichzeitig schafft er so den Rahmen des virtuellen Angebotes<br />
und vermittelt (je nach Konzeption unterschiedlich stark) zwischen Anbietern<br />
und Nachfragern. Das Vorhandensein solch eines Betreibers sowie<br />
dessen Mittlerfunktion stellen den Unterschied zu eigenständigen Web-<br />
Präsenzen dar.<br />
Unternehmenseigene Web-Präsenzen sind Internetseiten <strong>von</strong> Unternehmen<br />
und Händlern, die ihre Waren durch Präsentation auf solchen eigenen Webseiten<br />
anbieten und verkaufen. Für die Inhalte auf den Seiten ist das Unternehmen<br />
verantwortlich. Das Ziel solcher Internetauftritte ist, einen interaktiven<br />
Dialog zwischen dem Anbieter und den Konsumenten zu schaffen. In<br />
diesem Zusammenhang gibt es vier verschiedene Arten <strong>von</strong> Seiten 61 , die<br />
60 Hier handelte es sich ursprünglich um ein reines Internet-Auktionshaus. Mittlerweile haben<br />
sich in diesem Forum Händler wie Privatpersonen versammelt, die ihre Produkte teilweise<br />
auch zu Festpreisen anbieten und verkaufen.<br />
61 Da eine Bearbeitung des Themas „Usability“ in dieser Arbeit nicht entlang einer Charakterisierung<br />
<strong>von</strong> Webseiten erfolgt, wird beginnend im Kapitel 7.3: „Arten <strong>von</strong> Websites“<br />
auf generelle Nutzungszwecke näher eingegangen.<br />
61
primär jeweils an<strong>der</strong>e Funktionen erfüllen sollen [vgl. TUTT (2002): 21 –<br />
26]:<br />
< Auf einer Motivationsseite („Incentive Site“) werden eine o<strong>der</strong><br />
mehrere „Attraktionen“ geboten, welche zum Besuch dieser und<br />
weiterer Seiten des Anbieters bewegen sollen (BSP:<br />
www.mcdonalds.de). So sollen die Besucher auf vielfältige Angebote<br />
aufmerksam gemacht und schließlich zu Transaktionen<br />
(im realen Geschäft) angeregt werden.<br />
< Weitere Arten <strong>von</strong> Homepages 62 sind Internetauftritte mit reinem<br />
Informationscharakter („Internet Presence“). Zwar sollen diese<br />
die Besucher ebenfalls zum Kauf motivieren, ihre Hauptaufgabe<br />
liegt jedoch darin, insbeson<strong>der</strong>e schon vor einem möglichen Geschäftsabschluss<br />
eine Beziehung zum Kunden aufzubauen (BSP:<br />
www.porsche.de).<br />
< Websites mit einem online-Prospekt bzw. -Katalog bieten Angebotspräsentationen<br />
mit <strong>der</strong> Möglichkeit direkter Geschäftsabschlüsse<br />
(BSP: www.quelle.de). Die Warenlieferung und evtl.<br />
auch die Bezahlung erfolgen auf konventionellen Wegen („Online<br />
storefont“).<br />
< Im Unterschied dazu können auf sog. Inhalts-Seiten Produkte<br />
nach <strong>der</strong> Bezahlung (auf elektronischem Wege, durch entsprechende<br />
Applikationen) direkt erworben werden („Content Site“).<br />
Dies ist beson<strong>der</strong>s bei Software möglich, die nach dem Kauf sofort<br />
herunter geladen werden kann (BSP:<br />
www.metacolor.de/farbwaehler.htm).<br />
Fremde Werbeträger können bestimmte Bereiche frem<strong>der</strong> Webseiten sein, in<br />
denen (z.B. durch Werbe-Banner) die eigene Unternehmenswerbung präsentiert<br />
wird (BSP: www.heise.de).<br />
Das electronic-Business (kurz: eBusiness) 63 wird generell in drei verschiedene<br />
Arten <strong>von</strong> Geschäftsbeziehungen eingeteilt:<br />
Business-to-Business („B2B“)<br />
62 Deutsch: Heimseite. Selbstdarstellung einer Person o<strong>der</strong> eines Unternehmens im Internet<br />
durch eine Website o<strong>der</strong> eine einzelne Webseite.<br />
63 Deutsch: Elektronisches Geschäft<br />
62
Business-to-Consumer 64 („B2C“)<br />
Consumer-to-Consumer („C2C“)<br />
Das „B2B“-Geschäft deckt sämtliche Transaktionen zwischen zwei o<strong>der</strong><br />
mehreren Geschäftspartnern ab und basiert häufig auf einem Extranet 65 .<br />
Das „B2C“-Geschäft beschreibt die Beziehungen zwischen Händler und<br />
Privatkunden und wird meist über das offene Internet abgewickelt.<br />
Das „C2C“-Geschäft umfasst alle Transaktionen zwischen privaten Konsumenten.<br />
Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Transaktionsplattformen und<br />
den verschiedenen eBusiness-Beziehungen können folgen<strong>der</strong>maßen beschrieben<br />
werden: Bei allen drei Transaktionsplattformen gibt es „B2B“und<br />
„B2C“-Geschäftsabläufe, wobei beson<strong>der</strong>s in virtuellen Einkaufszentren<br />
die Business-to-Consumer-Beziehungen Vorrang haben. „B2B“-<br />
Beziehungen sind hier zwar theoretisch möglich, werden in <strong>der</strong> Praxis aber<br />
kaum genutzt, da es für diese Fälle spezielle Handelswege gibt.<br />
Da unternehmenseigene Web-Präsenzen und fremde Werbeträger gemäß <strong>der</strong><br />
oben aufgeführten Definition stets mit Unternehmen in Verbindung gebracht<br />
werden, gibt es innerhalb dieser Transaktionsplattformen keine Consumerto-Consumer-Beziehungen.<br />
4.4.4 Online-Kommunikation zur Unterstützung des elektronischen<br />
Marketings<br />
Die online-Kommunikation ist Teil des eBusiness und unterstützt dieses im<br />
unternehmerischen Ablauf. Die Aufgaben <strong>der</strong> allgemeinen Unternehmenskommunikation<br />
sind Aktivitäten <strong>der</strong> Werbung, des Verkaufs sowie des<br />
Services. Mit Hilfe <strong>der</strong> elektronischen Medien kann beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> Kundenservice<br />
umfangreich ausgebaut werden. Dazu zählen Methoden wie Informationen<br />
über die Anwendung des Produktes, Kundenberatung sowie Kundenschulung<br />
und -weiterbildung. Zur ständigen Verbesserung <strong>der</strong> Kundenzufriedenheit<br />
sind Befragungen über die Zufriedenheit <strong>der</strong> Kunden möglich<br />
64 Deutsch: Verbraucher<br />
65 Siehe Kapitel 7.3.7: „Intranet und Extranet“<br />
63
(z.B. durch Einsatz <strong>von</strong> „E-Mail-Meckerkästen“), sowie <strong>der</strong> Einsatz <strong>von</strong><br />
online-durchführbaren Fehler-, Verschleißerkennungs- und Diagnosesystemen<br />
66 . Mittels dieser Systeme können dem Anwen<strong>der</strong> hilfreiche Informationen<br />
bei Problemen geliefert werden.<br />
Eine ständige online-Präsenz eröffnet noch weitere Kommunikationsmöglichkeiten<br />
für das Marketing, welche beson<strong>der</strong>s für den Nutzer Vorteile<br />
bieten: Einerseits wird bei solch einer Präsenz das jeweilige Unternehmen<br />
rund um die Uhr vertreten, an<strong>der</strong>erseits tritt es mit seinen Informationen<br />
nicht ungefragt an die verschiedenen Zielgruppen heran. Der potentielle<br />
Kunde allein entscheidet, ob und wann er bestimmte Informationen online<br />
holen möchte o<strong>der</strong> nicht.<br />
Als sinnvolle Ergänzung kann die Kommunikation mit den Kunden über<br />
weitere Formen erfolgen: Spezifische Anfragen werden weiterhin individuell<br />
beantwortet. Jedoch können nun zusätzlich bei sich häufig wie<strong>der</strong>holenden<br />
Anfragen mit vorgefertigten Antworten bzw. Lösungen effektiv reagiert und<br />
entsprechende digitale Kundenzeitschriften erstellt werden [vgl. BECKER<br />
(1998): 639 ff].<br />
4.4.5 Bedeutung <strong>der</strong> Kommerzialisierung des Internets<br />
Das Internet ist für Unternehmen als Marktplatz äußerst attraktiv. Als<br />
Hauptgrund ist vor allem das immense Wachstumspotential zu nennen: Der<br />
Einstieg in die Nutzung ist relativ einfach und die Handhabung wird immer<br />
selbstverständlicher und leichter. Die Zahl <strong>der</strong> Nutzer wächst ständig und es<br />
entwickeln sich Nutzergruppen, die aus Marketingsicht beson<strong>der</strong>s interessant<br />
sind. Dazu zählen diejenigen Nutzerstrukturen, die zu den sog. Innovatoren<br />
gehören – Personen mit hohem Bildungsstand und vergleichsweise hohem<br />
Einkommen. Es wird angenommen, dass diese Nutzer beson<strong>der</strong>s häufig<br />
Einkäufe im Internet tätigen [vgl. TUTT (2002): 18]. Gleichzeitig erfolgt in<br />
den gesamten Medien eine große, positive Resonanz gegenüber dem elektronischen<br />
Handel.<br />
Mit Hilfe des Internets werden ständig verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten<br />
angeboten, <strong>der</strong>en anfallende Kosten stark reduziert werden können:<br />
Vollautomatische Transaktionen ohne Benötigung menschlicher Arbeitskraft<br />
66 Insofern die Produkt(-systeme) <strong>der</strong> Kunden über Elektronik zur Fernwartung bzw. -<br />
reparatur verfügen, können Fehler in Form eines <strong>Mensch</strong>-Maschine-Dialogs auch online<br />
beseitigt werden [vgl. BECKER (1998): 647 f].<br />
64
sowie Verringerung bzw. Einsparung <strong>der</strong> Kosten <strong>der</strong> gesamten Distribution<br />
sowie <strong>der</strong> Transaktionen in erheblichem Maße. Zudem werden Marktinformationen<br />
weiter gestreut und können somit eine größere Zahl <strong>von</strong> potentiellen<br />
Kunden erreichen. Webseiten bieten mittlerweile alle technischen Voraussetzungen<br />
zur Abwicklung <strong>von</strong> Geschäften. Das Spektrum reicht <strong>von</strong><br />
online-Kauf und -Verkauf und online-Werbung bis zum online-Service.<br />
Für den Kunden können zudem eventuelle Unsicherheiten bei Kaufentscheidungen<br />
reduziert werden: Er hat die Möglichkeit, auf einfache sowie schnelle<br />
Art und Weise eine Vielzahl <strong>von</strong> Produkten miteinan<strong>der</strong> zu vergleichen<br />
und ggf. bereits vor Vertragsschluss zu testen (z.B. Software). Außerdem<br />
kann er sich Produkte nun beliebig lange anschauen, ohne dass er einem,<br />
durch anwesende Verkäufer suggerierten, Kaufzwang unterliegt. Allerdings<br />
ist es dem Käufer nicht möglich, Ware in die Hand zu nehmen, zu fühlen<br />
o<strong>der</strong> anzuprobieren – Tätigkeiten, die die meisten Kunden im realen Markt<br />
ständig ausführen. Aus diesem Grunde handelt es sich bei den am häufigsten<br />
im Internet verkauften Produkten um solche, <strong>der</strong>en Produkteigenschaften<br />
und -funktionen sehr genau auf Webseiten beschrieben werden können, wie<br />
zum Beispiel Produkte aus dem Elektronik- und Software-Bereich, CDs und<br />
Bücher.<br />
Was im elektronischen Handel letztendlich zählt, ist die „Konversationsrate“:<br />
Der Prozentsatz an Benutzern, die <strong>von</strong> Besuchern in Kunden umgewandelt<br />
werden können [vgl. MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 42]. Um die<br />
hierfür notwendige Motivation <strong>der</strong> Besucher geht es im folgenden Abschnitt.<br />
Es werden Faktoren beschrieben, die dieses Ziel unterstützen und för<strong>der</strong>n.<br />
4.5 Kundenmotivation durch Webseiten<br />
Ein entscheiden<strong>der</strong> Faktor bei <strong>der</strong> Kundengewinnung und <strong>der</strong>en Kaufrealisierungen<br />
ist die Gestaltung <strong>der</strong> Schnittstelle zwischen dem Unternehmen<br />
und dem Kunden. Online-Dienste müssen attraktiv gestaltet werden. Wichtig<br />
hierbei sind Suchhilfen innerhalb <strong>der</strong> entsprechenden Seiten, sowie ein möglichst<br />
schneller Zugriff <strong>von</strong> außerhalb durch Suchmaschinen. (Technische)<br />
Möglichkeiten genügen jedoch nicht, um zwischen <strong>der</strong> Vielzahl <strong>von</strong> Anbietern<br />
beson<strong>der</strong>s positiv aufzufallen. Zusätzlich müssen Maßnahmen ergriffen<br />
werden, die auf den Kunden motivierend wirken, zum Kauf anregen und sie<br />
65
zum Wie<strong>der</strong>kommen veranlassen. Hier gibt es einige Möglichkeiten, die<br />
nachfolgend genauer erläutert werden.<br />
4.5.1 Intentionsrealisierung<br />
Der Besucher einer Webseite beurteilt ihre formalen und inhaltlichen Merkmale<br />
hinsichtlich des Nutzwertes 67 seiner Intentionsrealisierung [vgl. I-COM<br />
(2/2002): 24 f]. Eine subjektive Nutzenanalyse <strong>der</strong> Websiteelemente sowie<br />
die Einschätzung ihrer relativen Wichtigkeit sind für das weitere Verhalten<br />
des Nutzers im Web-Laden <strong>von</strong> entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung. Diese beiden<br />
Faktoren machen den Erfolg des elektronischen Handels aus.<br />
Webangebote sind sehr komplexe Wahrnehmungsobjekte, die aus formalen<br />
und inhaltlichen Websitemerkmalen bestehen. Formale Merkmale sind verschiedene<br />
Aspekte <strong>der</strong> Benutzerführung sowie bestimmte Kriterien des<br />
Erscheinungsbildes (insbes. gestalterische Elemente). Inhaltliche Merkmale<br />
sind natürlich <strong>der</strong> Inhalt selbst und alle angebotenen weiteren Dienste. Die<br />
Frage ist, welche dieser Merkmalsausprägungen die höchsten Teilnutzenwerte<br />
erzielen und welche Sensitivitäten (relative Wichtigkeiten) des Gesamtnutzens<br />
sich für die einzelnen Merkmale ergeben.<br />
Grundsätzlich können an dieser Stelle bereits einige allgemeine Erkenntnisse<br />
festgehalten werden: Bei <strong>der</strong> (formalen) Benutzerführung und Gestaltung<br />
sind eindeutige, auf allen Seiten sichtbare gestalterische Elemente sowie<br />
grafische o<strong>der</strong> textbasierte Orientierungshilfen <strong>von</strong> beson<strong>der</strong>er Bedeutung.<br />
Im Einzelnen können dies eine Navigationsleiste, die Wahl des Domainnamens,<br />
eine „Sitemap“ 68 , Suchfunktionen und Hilfefunktion sowie Indices<br />
und bestimmte Farben sein. Bil<strong>der</strong> können zum besseren Verständnis beitragen.<br />
Auf je<strong>der</strong> Seite sollte das Firmenlogo o<strong>der</strong> ein an<strong>der</strong>es Merkmal zur<br />
Identifikation vorhanden sein.<br />
Der Inhalt einer Website ist oft sehr vielfältig. Hierzu gehören Informationen<br />
über das Unternehmen sowie natürlich das angebotene Produkt, Vertriebsunterstützung<br />
und Servicefunktionen, sowie Beratungs- und Hilfefunktionen.<br />
Zusätzlich können Karriere- und Ausbildungsinformationen und Daten über<br />
eine entsprechende Marktforschung präsentiert werden. Angebote des<br />
67 Der Nutzwert ist <strong>der</strong> subjektive Wert eines Gutes, <strong>der</strong> durch die Tauglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung<br />
(den Nutzen) bestimmt wird.<br />
68 Deutsch: Seiten-Landkarte. Darstellung <strong>der</strong> Website-Struktur, häufig in Form eines Inhalts-<br />
verzeichnisses.<br />
66
Mehrwertes bzw. des Zusatznutzens (z.B. zusätzlich angebotene Informationen)<br />
werden vom Kunden gern gesehen.<br />
Spezielle Ergebnisse zu Merkmalsausprägungen auf Webseiten fanden Forscher<br />
<strong>der</strong> Universität Göttingen heraus. In einer Conjointanalyse 69 [vgl. I-<br />
COM (2/2002): 25 ff] untersuchten sie hinsichtlich <strong>der</strong> Position <strong>der</strong> Navigationsleiste,<br />
<strong>der</strong> Mehrwertverfügbarkeit und <strong>der</strong> Produktdarstellung drei verschiedene<br />
Gruppen <strong>von</strong> Nutzertypen: weibliche Shopbesucher, Webexperten<br />
und Webanfänger. Dabei stellten sie deutliche Unterschiede zwischen den<br />
beson<strong>der</strong>s bevorzugten Präferenzen <strong>der</strong> jeweiligen Gruppen fest: Weibliche<br />
Shopbesucher präferieren beson<strong>der</strong>s eine einfache und eindeutige Navigation<br />
innerhalb des jeweiligen Web-Shops. Dies sehen sie als wichtigstes Kriterium<br />
an. Für Webanfänger ist hingegen ein internetspezifischer Mehrwert<br />
beson<strong>der</strong>s interessant. Für Webexperten ist, zusätzlich zum Mehrwert, auch<br />
eine genaue Produktbeschreibung grundlegend, während die Position <strong>der</strong><br />
Navigationsleiste für diese Gruppe nur eine relativ geringe Wichtigkeit<br />
besitzt.<br />
Laut <strong>der</strong> aufgeführten Untersuchungsergebnisse lautet dies für die Anwendung<br />
in <strong>der</strong> Praxis, dass eine ausführliche und illustrierte Produktdarstellung<br />
jeweils den höchsten Teilnutzenwert erzielt. Außerdem sollte ein relevanter<br />
Mehrwert angeboten und sich die Navigationsleiste im linken Bereich <strong>der</strong><br />
Webseite befinden.<br />
4.5.2 Kundenvertrauen<br />
Ohne das Vertrauen <strong>der</strong> Kunden in das Unternehmen sowie in die Funktionalität<br />
<strong>der</strong> Webseiten kann ein Unternehmen mit seinem Internetauftritt nicht<br />
erfolgreich sein. Um solch ein Vertrauen zu erreichen, sind entsprechende<br />
(überzeugende) vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. Im Internet wird<br />
Vertrauen insbeson<strong>der</strong>e durch eine gute Web-Usability bewirkt – indem die<br />
Anwen<strong>der</strong> und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden. Die<br />
Vertrauensbildung muss insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> Interaktion beginnen und<br />
konsequent fortgesetzt werden.<br />
Das sog. „Prinzip des Vertrauens“ haben Manhartsberger und Musil in ihrem<br />
gleichnamigen Buch „Web Usability. Das Prinzip des Vertrauens“ formuliert.<br />
69 Die Conjointanalyse (deutsch: Verbund-Analyse) ist das am weitesten verbreitete Verfahren<br />
zur dekompositionellen Präferenzmessung (Erfragung <strong>von</strong> Gesamturteilen über<br />
verschiedene Objektalternativen).<br />
67
Dabei stützen sie sich im Wesentlichen auf drei Komponenten, welche im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Interaktion liegen [vgl. MANHARTSBERGER, MUSIL (2002):<br />
44 ff]:<br />
Technik<br />
Inhalt<br />
Präsentation<br />
Die Technik ist diejenige <strong>der</strong> drei Komponenten, die sich am greifbarsten<br />
umsetzen lässt. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang <strong>der</strong> Faktor <strong>der</strong><br />
Sicherheit: Mit den Daten <strong>der</strong> Benutzer muss verantwortungsvoll umgegangen<br />
werden, und <strong>der</strong> Benutzer sollte über die Art und Weise <strong>der</strong> Verwendung<br />
seiner Daten informiert werden 70 . Im Übrigen müssen die entsprechenden<br />
Regelungen des gesetzlichen Datenschutzes eingehalten werden.<br />
Ein weiterer technischer Aspekt, <strong>der</strong> einem Website-Besucher sofort positiv<br />
auffällt, sind schnelle Ladezeiten. Entsprechende Websites werden häufiger<br />
besucht als langsame Sites.<br />
Eine exzellente Navigation sollte unter Verwendung passend gewählter<br />
Begriffe genau aufzeigen, wo sich verfügbare Navigationselemente befinden.<br />
Durch die Angabe des gesamten Navigationspfades wird dem Besucher<br />
deutlich, wo er sich gerade befindet. Außerdem sollten je<strong>der</strong>zeit Rück- und<br />
Quersprünge innerhalb <strong>der</strong> Struktur möglich sein.<br />
Durch eine angemessene Personalisierung 71 <strong>der</strong> Daten erfolgt im System<br />
eine Wie<strong>der</strong>erkennung des Benutzers, wodurch dieser seine Daten nur einmal<br />
einzugeben braucht.<br />
An erster Stelle bezüglich des Inhalts einer Unternehmens-Website steht<br />
natürlich das Angebot eines guten Produktes zu einem fairen Preis. Gleichzeitig<br />
müssen aber auch alle an<strong>der</strong>en Inhalte <strong>der</strong> jeweiligen Webseiten für<br />
den Besucher relevant sein. Das heißt, <strong>der</strong> Benutzer muss, entsprechend<br />
seiner Ziele, die zum Thema zugehörige Information an den richtigen Stellen<br />
vorfinden. Dies kann durch einen transparenten Auswahlmechanismus (z.B.<br />
durch lokale Suchmaschinen) ermöglicht werden.<br />
70 Hierzu zählt auch die Deklaration <strong>der</strong> Verschlüsselung <strong>von</strong> Daten.<br />
71 Wird im Verlauf <strong>der</strong> Arbeit auch als „Individualisierung“ bezeichnet.<br />
68
Wichtig ist die Aufgabenorientiertheit einer Website. Das bedeutet, dass die<br />
Anordnung <strong>der</strong> Inhalte insgesamt nach den (bekannten) Wünschen <strong>der</strong> Benutzer<br />
auszurichten ist: Preise, Nebenkosten, akzeptierte Zahlungsmethoden<br />
und Versandbedingungen müssen gut sichtbar angegeben sein, sowie Lieferund<br />
Umtauschgarantien übernommen werden. Hilfreich können auch das<br />
Vorschlagen nächster Schritte durch das System sein, sowie das automatische<br />
Heraussuchen <strong>von</strong> Artikeln, die den Besucher interessieren. Entsprechende<br />
Filtermechanismen des Systems können dies technisch ermöglichen<br />
(Personalisierung). In diesem Zusammenhang sollten die Kunden jedoch<br />
(nur) nach notwendigen Informationen befragt werden, wobei diese Notwendigkeit<br />
auch erläutert werden muss.<br />
Mit dem Unternehmen sind gute Kommunikationsmöglichkeiten (unter<br />
Beachtung <strong>der</strong> „Nettiquette“ 72 ) zu gewährleisten. Werbung sollte dezent und<br />
nur dann eingesetzt werden, wenn sie zum Kontext passt.<br />
Im Inhalt, <strong>der</strong> auf den verschiedenen Webseiten dargestellt wird, sollte für<br />
den Besucher eine adäquate Unternehmenskultur- sowie Organisation sichtbar<br />
werden. Für das Unternehmen bedeutet dies gegebenenfalls, dass interne<br />
Abteilungen an die durch das Internet verän<strong>der</strong>ten Prozesse angepasst werden.<br />
Wenn notwendig, müssen in diesen Bereichen entsprechende Umstrukturierungen<br />
erfolgen.<br />
Die Präsentation muss intuitiv sein. Sie sollte den Verständnis- und Erfahrungsraum<br />
<strong>der</strong> Benutzer beachten, ihre Kenntnisse und Erwartungen einbeziehen<br />
und vertraute Konzepte verwenden 73 . Web-adäquate Kürzung und<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>von</strong> Texten, Verkleinerung und in ihrer Farbtiefe reduzierte<br />
Bil<strong>der</strong>, Verwendung <strong>von</strong> Produktmarken sowie das Deutlichmachen sicherer<br />
Transaktionen machen eine gute Präsentation aus. Für den Kunden kann<br />
zudem eine sichtbare Aktualität <strong>der</strong> einzelnen Webseiten (Angabe des letzten<br />
Än<strong>der</strong>ungsdatums) bedeutsam sein.<br />
Der Surfer im Internet erscheint relativ anonym 74 : Er hat die Möglichkeit,<br />
sich ohne Störungen Informationen über Produkte zu beschaffen und diese<br />
ohne Beeinflussung zu vergleichen. Schließlich kann <strong>der</strong> Besucher das onli-<br />
72<br />
„Nettiquette“: offizielle Umgangsformen im Netz (in Anlehnung an den Begriff „Etikette“).<br />
73<br />
siehe Kapitel 7.1: „Nutzerprofil“<br />
74<br />
Freiwillig (durch Eingabe persönlicher Daten z.B. bei Kaufaktionen) und unfreiwillig<br />
(durch Hinterlassen <strong>von</strong> Datenspuren) kann ein Benutzer in unterschiedlichem Ausmaß<br />
identifiziert werden.<br />
69
ne-Geschäft auch ohne einen abgeschlossenen Kauf problemlos wie<strong>der</strong><br />
verlassen. Auch wenn das Interesse <strong>der</strong> Unternehmen hauptsächlich im<br />
Verkauf ihrer Produkte und Leistungen liegt, sollten diese Aspekte für den<br />
Kunden weiterhin gewährleistet sein und somit zum Erhalt seines Vertrauens<br />
in die Unternehmenspräsentation beitragen.<br />
4.5.3 Kundenbindung<br />
Für online-Geschäfte ist es nicht nur <strong>von</strong> Bedeutung, wie oft und wie lange<br />
ein Besucher bei einer Website bleibt. Wichtigster Faktor aus Sicht des<br />
Unternehmens ist, dass dieser Besucher etwas kauft und damit zum Kunden<br />
wird – und es möglichst auch bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte ein<br />
Unternehmen bei <strong>der</strong> Veröffentlichung seiner Webseiten einige Eigenschaften<br />
beachten, die das Internet <strong>von</strong> traditionellen Medien unterscheidet. Diese<br />
sind aber beson<strong>der</strong>s im Rahmen <strong>der</strong> Internetnutzung maßgeblich und können<br />
zusätzlich zu einer längerfristigen Bindung <strong>der</strong> Kunden an das Unternehmen<br />
beitragen [vgl. ALBERS u. a. (2001): 169 – 173]:<br />
Informationsangebot<br />
Interaktivität<br />
Integration<br />
Individualisierung<br />
Mit Hilfe <strong>von</strong> Webseiten können sämtliche Informationen über das Unternehmen<br />
schneller und auf vielfältigere Art und Weise an den Besucher übermittelt<br />
werden. Dazu dienen „Newsletter“ 75 , Produktwerbungen, <strong>der</strong><br />
je<strong>der</strong>zeitige Zugang zum Unternehmensprofil sowie Nutzwertanalysen über<br />
den Produktlebenszyklus.<br />
Unterstützt werden die Übermittlung und <strong>der</strong> Austausch <strong>von</strong> Informationen<br />
durch interaktive Kommunikation: Das Unternehmen kann auf seinen Webseiten<br />
zum Beispiel online-Diskussionsforen, „Chat-rooms“ 76 und virtuelle<br />
„Communities“ 77 bereitstellen.<br />
75 Deutsch: Mitteilungsblatt (Zusendung per E-Mail)<br />
76 Deutsch: Plau<strong>der</strong>-Räume<br />
77 Deutsch: Gemeinschaften<br />
70
Zusätzlich wird <strong>der</strong> Kunde soweit in das Unternehmen integriert, dass er das<br />
Versenden seiner bestellten Produkte mit verfolgen kann und außerdem<br />
Kenntnis <strong>von</strong> neuen Produktentwicklungen erhält.<br />
Durch Individualisierung erfolgen personalisierte Angebote und zielgerichtete<br />
E-Mail-Kampagnen. In Verbindung mit günstigen Zusatzleistungen (z.B.<br />
online-Hilfestellungen, internetbasierte Beschwerdecenter) kann dadurch die<br />
Kundenbindung erhöht werden.<br />
Methoden und Abläufe des mo<strong>der</strong>nen elektronischen Marketings gleichen zu<br />
großen Teilen denen des traditionellen Marketings. Die online-<br />
Kommunikation und insbeson<strong>der</strong>e die Verwendung und Nutzung <strong>von</strong> Webseiten<br />
durch Unternehmen sowie Kunden ermöglicht vielfältige zusätzliche<br />
Wege. Zwar erfor<strong>der</strong>n diese einen entsprechenden Aufwand seitens des<br />
Unternehmens, welcher jedoch durch Einsatz des elektronischen Marketings<br />
ökonomisch gelöst wird.<br />
Durch Internetauftritte, die im Rahmen einer guten Usability kundenorientiert<br />
gestaltet sind, können Unternehmen und Gewerbetreibende in die Öffentlichkeit<br />
treten, sich am Markt profilieren, Kunden gewinnen und auf<br />
diese Art und Weise ihr Hauptziel, die Steigerung ihres Umsatzes, bewirken.<br />
71
5 Psychologische Grundlagen<br />
Die Psychologie untersucht das Bewusstsein, das Verhalten sowie das Erleben<br />
des <strong>Mensch</strong>en, wobei innere (im Individuum angesiedelte) und äußere,<br />
in <strong>der</strong> Umwelt lokalisierte Ursachen und Bedingungen, eine Rolle spielen<br />
[vgl. ZIMBARDO, GERRIG (1999): 2]. Um psychische Phänomene zu<br />
kategorisieren, werden psychologische Grundlagen in ihre Bestandteile<br />
zerlegt.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten sind bestimmte psychologische<br />
Wirkungen <strong>von</strong> beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Aus diesem Grund werden in diesem<br />
Kapitel zuerst entsprechende fundamentale Faktoren erläutert, und anschließend<br />
auf spezielle Faktoren hinsichtlich <strong>der</strong> Rezeption <strong>von</strong> Webseiten Bezug<br />
genommen.<br />
5.1 Biologische Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung<br />
Bei <strong>der</strong> Rezeption <strong>von</strong> Webseiten durch die Benutzer steht die Aufnahme<br />
und Verwertung <strong>von</strong> Informationen im Vor<strong>der</strong>grund. Das zentrale Organ <strong>der</strong><br />
biologischen Informationsverarbeitung ist das Gehirn. Es steuert die wesentlichen<br />
Prozesse <strong>der</strong> Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Verhalten.<br />
Dabei können schon geringe Informationsmengen ausreichen, um ein komplexes<br />
Verhalten zu erzeugen und zu steuern. [vgl. MALLOT (1999): 3 ff]<br />
Um solche Vorgänge zu erklären, werden in diesem Abschnitt verschiedene<br />
psychologische Aspekte erläutert:<br />
< Denken (Wahrnehmung, Bewusstsein und Aufmerksamkeit, Gedächtnis,<br />
Lernen und Verstehen)<br />
< Fühlen und Wollen (Emotion und Motivation, Gewöhnen und<br />
Erwarten, Entscheiden)<br />
< Handeln und Fehler<br />
Da <strong>der</strong> Bildschirminhalt meist zuerst visuell bemerkt wird, nehmen die<br />
entsprechenden Abläufe und Gesetzmäßigkeiten <strong>der</strong> visuellen Wahrnehmung<br />
Einfluss auf die Rezeption einer Webseite. Für die Gestaltung einer<br />
72
Benutzeroberfläche sind diese Vorgänge <strong>von</strong> beson<strong>der</strong>er Bedeutung [vgl.<br />
GLASER (1994): 23] und werden aus diesem Grunde nachfolgend detailliert<br />
beschrieben.<br />
5.1.1 Visuelle Wahrnehmung<br />
Wahrnehmung ist ein konstruktiver Prozess, in dem Sinnesreize aus <strong>der</strong><br />
Umwelt aufgenommen und im Gehirn verarbeitet sowie Empfindungen ein<br />
Sinn verliehen wird. Dieser Vorgang dient hauptsächlich zur Steuerung<br />
zielgerichteter Bewegungen, durch welche Handlungsmöglichkeiten entdeckt<br />
werden, die für den <strong>Mensch</strong>en <strong>von</strong> Nutzen sein können.<br />
Der Prozess <strong>der</strong> Wahrnehmung glie<strong>der</strong>t sich in drei Stufen [vgl.<br />
ZIMBARDO (1995): 159 ff]:<br />
Sensorische Empfindung<br />
Wahrnehmung im engeren Sinn<br />
Klassifizierung<br />
Auf <strong>der</strong> Stufe <strong>der</strong> sensorischen Empfindung werden physikalische Reize aus<br />
<strong>der</strong> Umwelt gesammelt und durch Transformation in auswertbare Informationen<br />
umgewandelt.<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> Wahrnehmung werden die bereits gesammelten Informationen<br />
ausgewertet. Hier erfolgt eine innere Repräsentation eines Gegenstandes<br />
(z.B. die Elemente einer Webseite), woraufhin ein Perzept 78 des äußeren<br />
Reizes gebildet wird.<br />
Durch Klassifizierung wird das Wahrgenommene in das bereits vorhandene<br />
Wissen eingefügt und eingeordnet.<br />
Stufe 1: Sensorische Empfindung<br />
78 Ein Perzept ist we<strong>der</strong> <strong>der</strong> physikalische Gegenstand an sich, noch sein alleiniges Abbild in<br />
einem Rezeptor – son<strong>der</strong>n ein durch verschiedene Faktoren beeinflusstes erfahrenes<br />
Phänomen.<br />
73
Beim Sehen handelt es sich um den am weitesten entwickelten, komplexesten<br />
und wichtigsten aller menschlichen Sinne. Er ist Teil <strong>der</strong> sensorischen<br />
Empfindung und Voraussetzung zur Aufnahme <strong>von</strong> auf Webseiten visuell<br />
dargestellten Informationen 79 . Aus diesem Grund werden die Abläufe beim<br />
Prozess <strong>der</strong> sensorischen Empfindung nachfolgend genauer beschrieben.<br />
Der gesamte Vorgang des Sehens glie<strong>der</strong>t sich in drei Phasen (die Ausführungen<br />
folgen [ZIMBARDO (1995): 172 ff]):<br />
Aufnahme <strong>von</strong> Informationen über das Auge<br />
Weitertransport <strong>der</strong> Informationen zum Gehirn<br />
Verarbeitung <strong>der</strong> Informationen im Gehirn<br />
Grundlegend für den Prozess des Sehens sind physiologische Voraussetzungen<br />
und Vorgänge im Inneren des Auges 80 . Bereits an dieser Stelle erfolgt<br />
eine erste Verarbeitung <strong>der</strong> eingehenden Informationen. Hierbei erfüllt die<br />
Netzhaut (Retina) die wichtigste Funktion: Sie wandelt Lichtenergie in<br />
neurale Reaktionen bzw. Signale um. Diese werden dann später im Gehirn<br />
weiter verarbeitet. Während <strong>der</strong> Umwandlung <strong>der</strong> Lichtenergie werden die<br />
auf <strong>der</strong> Netzhaut befindlichen Stäbchen und Zapfen 81 tätig. Die Stäbchen<br />
sind in <strong>der</strong> Peripherie <strong>der</strong> Retina angeordnet und zuständig für das Hell-<br />
Dunkel-Sehen. Zapfen sind verantwortlich für das Farbensehen. Letztere<br />
befinden sich in großer Dichte im Zentrum <strong>der</strong> Retina, in <strong>der</strong> Sehgrube<br />
(Fovea) – dem gelben Fleck (Stäbchen sind an dieser Stelle nicht vorhanden).<br />
Die <strong>von</strong> hier ausgehenden Informationen werden weniger stark zusammengefasst<br />
als die <strong>von</strong> den Stäbchen ausgehenden Informationen. Diese beiden<br />
Faktoren führen dazu, dass <strong>der</strong> gelbe Fleck die Stelle des schärfsten Sehens<br />
ist. Farbe sowie räumliche Einzelheiten, die auf diese Stelle projiziert bzw.<br />
mit dieser Stelle fokussiert werden, können beson<strong>der</strong>s gut erkannt werden.<br />
Der aus dem Auge herausführende Sehnerv transportiert die visuellen Impulse<br />
zum Gehirn. Dort befindet sich im hinteren Bereich <strong>der</strong> visuelle Cortex<br />
79 Durch technische Möglichkeiten haben mittlerweile auch Blinde die Möglichkeit, Webseiten<br />
zu rezipieren. Darauf wird hier jedoch nicht näher eingegangen.<br />
80 Darauf soll im Rahmen dieser Arbeit im Einzelnen nicht näher eingegangen werden.<br />
81 Stäbchen und Zapfen befinden sich in den Photorezeptoren, die Bestandteil <strong>der</strong> Zellschich-<br />
ten <strong>der</strong> Retina sind.<br />
74
(Hirnrinde), ein spezieller Bereich zur Verarbeitung <strong>der</strong> <strong>von</strong> den Augen<br />
kommenden Informationen.<br />
Die Nervenbahnen <strong>von</strong> jedem <strong>der</strong> beiden Augen führen in Hirnregionen auf<br />
dieselbe Seite und zusätzlich in die jeweils gegenüber liegenden Hirnhälften.<br />
Durch diese gleichzeitige Überführung <strong>von</strong> Informationen in verschiedene<br />
Teile des Cortex werden verschiedene parallel ablaufende visuelle Analysen<br />
ermöglicht, durch die wie<strong>der</strong>um eine getrennte Auswertung <strong>von</strong> Informationen<br />
über Ort und Inhalt eines Reizes möglich ist.<br />
Durch die kortikale Verarbeitung <strong>der</strong> Informationen aus beiden Augen werden<br />
die Wahrnehmung <strong>von</strong> Farbe, Tiefe, Umriss sowie das Wie<strong>der</strong>erkennen<br />
vertrauter Muster möglich. Es gibt außerdem Unterschiede zwischen einem<br />
physikalischen Objekt in <strong>der</strong> wirklichen Welt und seinem optischen Abbild<br />
auf <strong>der</strong> Retina, dem Netzhautbild: Dieses wird im Augenhintergrund zweidimensional<br />
abgebildet, während die Umwelt in Wirklichkeit dreidimensional<br />
ist. Erst durch verschiedene interpretatorische Vorgänge wird<br />
diese Dreidimensionalität wahrgenommen.<br />
Das, was wir sehen bzw. glauben zu sehen, erfolgt durch eine Verarbeitung<br />
<strong>der</strong> wahrgenommenen Informationen im Gehirn. Hier entstehen das Farbensehen<br />
und die Kontrastbildung.<br />
Farbe an sich, so wie <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> sie sieht, gibt es nicht. Sie existiert we<strong>der</strong><br />
in Gegenständen noch im Licht. Farben sind Ergebnisse menschlicher Erfahrungen.<br />
„Farbiges Sehen“ ist eine psychische Qualität, die nur durch eine<br />
Dekodierung <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Lichtquelle enthaltenen Informationen im Gehirn<br />
möglich ist. Entscheidend sind die Wellenlängen. Das für den <strong>Mensch</strong>en<br />
sichtbare Licht besteht aus elektromagnetischer Energie in Wellenlängen<br />
zwischen 400 und 700 Nanometern.<br />
Aber warum nimmt <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> trotzdem Farbe wahr? Zur Erklärung gibt es<br />
in <strong>der</strong> Psychologie zwei verschiedene Theorien des „Farbensehens“: Die um<br />
ca. 1800 entstandene Young-Helmholtzsche-Dreifarbentheorie, sowie die<br />
Gegenfarbentheorie <strong>von</strong> Ewald Hering (spätes 19. Jahrhun<strong>der</strong>t). Aufgrund<br />
des heutigen Wissensstandes werden beide Theorien nicht mehr als wi<strong>der</strong>sprüchlich,<br />
son<strong>der</strong>n als zwei aufeinan<strong>der</strong> aufbauende Stufen <strong>der</strong> Verarbeitung<br />
dargestellt, die folgen<strong>der</strong>maßen erklärt werden [vgl. ZIMBARDO<br />
(1995): 177]: Es gibt drei Arten <strong>von</strong> Zapfen. Diese reagieren jeweils auf<br />
Licht mit an<strong>der</strong>er Wellenlänge unterschiedlich sensibel. Dadurch kommt die<br />
Wahrnehmung verschiedener Farben zustande. Durch kurze Wellenlängen<br />
entsteht die Farbe <strong>von</strong> blau, durch mittlere Wellenlängen grün, und durch<br />
75
lange Wellenlängen entsteht <strong>der</strong> Eindruck <strong>der</strong> Farbe rot 82 . Die Zellen <strong>der</strong><br />
Retina kombinieren schließlich den Ertrag dieser drei Zapfentypen auf unterschiedliche<br />
Weise.<br />
Ein Kontrast ist <strong>der</strong> Intensitätsunterschied zwischen einem Reiz und seinem<br />
jeweiligen Reizhintergrund. Je größer dieser Unterschied wird, desto deutlicher<br />
wird <strong>der</strong> Kontrast(effekt). Kontraste sind notwendig, um überhaupt<br />
verschiedene Objekte bzw. Unterschiede zwischen benachbarten Regionen<br />
wahrnehmen zu können. Dies wird möglich bzw. deutlicher, wenn Informationen<br />
genau dann weitergeleitet werden, wenn benachbarte Zapfen auf <strong>der</strong><br />
Netzhaut unterschiedliche Lichtinformationen erhalten. Verschiedene Arten<br />
<strong>von</strong> Zellen projizieren einen hohen Grad <strong>von</strong> Sehschärfe sowie den visuellen<br />
Gesamteindruck [vgl. ZIMBARDO (1995): 179].<br />
Zur Erklärung <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>von</strong> Mustern und Formen dient das Raum-<br />
Frequenz-Modell. Es beruht auf <strong>der</strong> Annahme, dass das Nervensystem visuelle<br />
Bil<strong>der</strong> und Szenen in eine an<strong>der</strong>e Repräsentationsform transformiert.<br />
Reizkonstellationen werden analysiert, indem das visuelle System des <strong>Mensch</strong>en<br />
eine Art Fourier-Analyse <strong>der</strong> entdeckten Muster <strong>von</strong> Hell-Dunkel-<br />
Folgen durchführt.<br />
Stufe 2: Wahrnehmung im engeren Sinn<br />
Die zweite Wahrnehmungsstufe des gesamten Wahrnehmungsprozesses<br />
beginnt bei <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> im Gehirn vorhandenen Informationen. Die<br />
Wahrnehmung wird organisiert, indem Sinneseindrücke zusammengefügt<br />
und dadurch das Sehen <strong>von</strong> zusammenhängenden Szenen möglich wird.<br />
Die Frage ist, wie Objekte o<strong>der</strong> Regionen überhaupt als solche wahrgenommen<br />
werden können? Basierend auf dem Netzhautbild, welches aus vielen<br />
einzelnen Rezeptoren zusammengesetzt wird, entsteht das Bild, welches <strong>der</strong><br />
<strong>Mensch</strong> wahrnimmt. Vorerst ist dieses aber ein Mosaik aus Millionen <strong>von</strong><br />
Pünktchen. Das „zukünftige“ Bild wird erst durch mehrere Wahrnehmungsprozesse<br />
(Organisationsgesetze [vgl. ZIMBARDO (1995): 188 ff]) erschlossen,<br />
die für die gesamte Wahrnehmung <strong>von</strong> Objekten o<strong>der</strong> Regionen eine<br />
große Rolle spielen:<br />
82 Die Entwicklung <strong>der</strong> für das „Sehen“ <strong>von</strong> rot, grün und blau notwendigen Proteine wird<br />
<strong>von</strong> Genen gesteuert.<br />
76
Glie<strong>der</strong>ung in Bereiche<br />
Unterscheidung <strong>von</strong> Figur und Grund<br />
Prinzip <strong>der</strong> Geschlossenheit<br />
Prinzip <strong>der</strong> Gruppierung<br />
Prinzip <strong>der</strong> guten Gestalt<br />
Bezugsrahmen<br />
Die Glie<strong>der</strong>ung in Bereiche ist die erste Aufgabe <strong>der</strong> Wahrnehmungsorganisation.<br />
Hier wird festgelegt, welche <strong>der</strong> Mosaikpünktchen zusammen gehören<br />
bzw. in größere Regionen zusammengefasst werden können. Als hilfreiche<br />
und zugleich wichtigste Informationen fungieren hierbei Farbe und<br />
Textur (Oberflächenstruktur). Durch abrupte Än<strong>der</strong>ungen in den Eigenschaften<br />
dieser Faktoren werden Grenzen zwischen Regionen o<strong>der</strong> Objekten<br />
gefunden, womit eine Zuordnung <strong>der</strong> Mosaikpünktchen zu bestimmten<br />
Formen vorgenommen werden kann.<br />
Aufbauend auf die Zuordnung zu Bereichen erfolgt die Unterscheidung<br />
zwischen Figur (etwas Gegenstandsartiges) und Grund (Hintergrund, <strong>von</strong><br />
dem sich die Figuren abheben). Figuren entstehen, indem Grenzen zwischen<br />
Hell und Dunkel als Rän<strong>der</strong> interpretiert werden und somit <strong>der</strong> dadurch<br />
entstehende Umriss die Figur markiert. Der Grund scheint sich vollständig<br />
um und hinter diesen Umrissen zu erstrecken.<br />
Beim Prinzip <strong>der</strong> Geschlossenheit werden nicht vorhandene Grenzen unvollständiger<br />
Figuren automatisch gedanklich ergänzt. Dadurch werden solche<br />
Figuren als vollständig gesehen, und es entsteht <strong>der</strong> Eindruck einer Geschlossenheit<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Form.<br />
Die Gruppierung <strong>von</strong> Objekten erfolgt aufgrund <strong>von</strong> drei Prinzipien [vgl.<br />
ZIMBARDO (1995): 190], die <strong>von</strong> Gestaltpsychologen als Wahrnehmungs-<br />
77
zw. Gestaltgesetze 83 formuliert wurden: Das Gesetz <strong>der</strong> Ähnlichkeit, das<br />
Gesetz <strong>der</strong> Nähe sowie das Gesetz des gemeinsamen Schicksals:<br />
< Laut dem Prinzip <strong>der</strong> Ähnlichkeit werden Elemente, die einan<strong>der</strong><br />
ähnlich sind, unter sonst gleichen Bedingungen als zusammen<br />
gehörend wahrgenommen.<br />
< Durch das Prinzip <strong>der</strong> Nähe, welches als ein spezieller Fall des<br />
Prinzips <strong>der</strong> Ähnlichkeit anzusehen ist, werden die nächstgelegenen<br />
bzw. benachbarten Reizelemente (unter sonst gleichen Bedingungen)<br />
zusammen gruppiert.<br />
< Das Prinzip des gemeinsamen Schicksals wendet das Prinzip <strong>der</strong><br />
Ähnlichkeit auf sich bewegende Objekte an. Es sagt aus, dass alle<br />
diejenigen Elemente als zusammengehörig wahrgenommen<br />
werden, die sich in <strong>der</strong>selben Richtung mit <strong>der</strong>selben Geschwindigkeit<br />
bewegen.<br />
Basierend auf <strong>der</strong> Annahme, dass <strong>der</strong> Prozess <strong>der</strong> Wahrnehmung durch<br />
Zerlegung in immer kleinere Teilprozesse nicht vollständig verstehbar sei<br />
[vgl. ZIMBARDO (1995): 190], wurden die oben genannten drei Gestaltgesetze<br />
aufgestellt und folgen<strong>der</strong> Satz geprägt: „Eine Gestalt ist mehr als die<br />
Summe ihrer Einzelteile.“ 84<br />
Das Prinzip <strong>der</strong> guten Gestalt bestimmt die Organisation <strong>von</strong> Grenzen zu<br />
bestimmten Formen. Hierbei sind Einfachheit, Symmetrie und Regelmäßigkeit<br />
beson<strong>der</strong>s wichtig. Formen, die gemäß diesen Faktoren gestaltet sind,<br />
werden vom visuellen System schneller und ökonomischer kodiert, da sie<br />
leichter und genauer wahrgenommen werden können. Außerdem kann sich<br />
<strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> besser an solche Formen erinnern und diese leichter beschreiben.<br />
Voraussetzung zur Bildung des Bezugsrahmens ist, dass das visuelle System<br />
die Tendenz besitzt, einzelne Teile so zu organisieren, dass sie in Beziehung<br />
zu umfassenden räumlichen Kontexten stehen. Durch solche Integrationsprozesse<br />
werden Figuren relativ zu einem Bezugsrahmen wahrgenommen.<br />
Dadurch entstehen Eindrücke wie zum Beispiel waagerecht, horizontal o<strong>der</strong><br />
diagonal.<br />
83 In <strong>der</strong> Literatur werden beide Begriffe verwendet. Die Anzahl <strong>der</strong> Gesetze bzw. <strong>der</strong> Faktoren<br />
ist je nach Autor, bedingt durch unterschiedliche Auffassungen <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Psychologen, unterschiedlich.<br />
84 Nach Christian <strong>von</strong> Ehrenfels in: FITZEK, SALBER (1996)<br />
78
Die beschriebenen Organisationsgesetze erklären die Wahrnehmung des<br />
<strong>Mensch</strong>en nicht vollständig. Wahrnehmung wird auch durch bereits erworbene<br />
Erfahrungen sowie durch Wissen beeinflusst. Wenn ein Konflikt zwischen<br />
Wahrnehmung und Wissen entsteht, setzt sich jedoch die Wahrnehmung<br />
durch [vgl. ZIMBARDO (1995)].<br />
Die Wahrnehmung <strong>von</strong> Gegenständen im dreidimensionalen Raum wird<br />
durch die Tiefenwahrnehmung gesteuert. Zur Annäherung und Entfernung<br />
<strong>von</strong> Objekten im Raum sind genaue Informationen über Tiefe (Entfernung)<br />
und Richtung <strong>der</strong> Objekte notwendig. Alle Informationen über die räumliche<br />
Tiefe werden zu einer einzelnen, zusammen hängenden dreidimensionalen<br />
Interpretation <strong>der</strong> Umwelt zusammengefügt.<br />
Stufe 3: Klassifizierung<br />
Auf <strong>der</strong> dritten Stufe <strong>der</strong> Wahrnehmung erfolgt ein Konstruktionsprozess, in<br />
dem Gesehenes und Wissen in Übereinstimmung gebracht wird. Dies dient<br />
insbeson<strong>der</strong>e dem Gebrauch <strong>von</strong> Gegenständen sowie <strong>der</strong> Beziehung <strong>von</strong><br />
Objekten untereinan<strong>der</strong> und zum Betrachter. Einflussfaktoren sind höhere<br />
geistige Prozesse wie Gedächtnis, Erwartung, Motivation, Persönlichkeitseigenschaften,<br />
soziale Erfahrungen sowie räumlicher und zeitlicher Kontext.<br />
Während <strong>der</strong> Klassifikation werden Objekte identifiziert und ggf. als Teile<br />
bedeutsamer Kategorien, die aus <strong>der</strong> Erfahrung bereits bekannt sind, eingeordnet.<br />
Die wichtigsten Prozesse im Ablauf <strong>der</strong> Klassifikation sind <strong>der</strong> Bottom-upsowie<br />
<strong>der</strong> Top-down-Prozess (siehe Abbildung 5.1): Im Bottom-up-Prozess<br />
wird durch die Rezeptoren sensorische Information in das System aufgenommen<br />
und diese dann zur Filterung und Analyse weitergeleitet. Gleichzeitig<br />
wirken sich im Top-down-Prozess Erfahrungen (und Erwartungen),<br />
Wissen sowie Motivationen auf das Objekt <strong>der</strong> Wahrnehmung aus. Dieses<br />
wird dann interpretiert und klassifiziert.<br />
Beide Verarbeitungsprozesse interagieren ständig miteinan<strong>der</strong>. Dadurch<br />
beeinflussen und bestimmen sie die Art <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Umwelt.<br />
Durch Wahrnehmungsprozesse kann <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> aus seinem sich ständig<br />
verän<strong>der</strong>nden und häufig chaotischen Umfeld Bedeutungen erschließen und<br />
79
diese zu geordneten Zusammenhängen strukturieren [vgl. ZIMBARDO,<br />
GERRIG (1999): 105]. Wahrnehmung ist nicht vorhersehbar o<strong>der</strong> steuerbar.<br />
Top-down-<br />
Prozesse Prozesse<br />
Bottom-up-Prozesse<br />
Mentale Prozesse<br />
Organisation<br />
Erfahrungen<br />
Mustererkennung<br />
Tiefe<br />
Sensorische<br />
Prozesse<br />
Wissen<br />
Konstanz<br />
Motivation<br />
Klassifikation<br />
(Merkmale <strong>der</strong> Funktion)<br />
Wahrnehmung<br />
(Merkmale des Gegenstandes)<br />
Empfindung<br />
(Merkmale des Netzhautbildes)<br />
Stimulation durch die Umwelt<br />
Abbildung 5.1: Klassifikationsprozesse [vgl. ZIMBARDO (1995): 162]<br />
Die erläuterten Vorgänge, insbeson<strong>der</strong>e die Funktionsweise <strong>der</strong> Organisationsgesetze,<br />
spielen auch bei <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>von</strong> Webseiten eine große<br />
Rolle. Denn mit Hilfe dieser Gesetze können Prozesse beschrieben werden,<br />
die während <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Formen und Elemente auf Webseiten ablaufen.<br />
Während <strong>der</strong> Gestaltung kann die entsprechende Anwendung <strong>der</strong><br />
80
Gesetze die (durch die Betreiber gewünschte) Wahrnehmung des zukünftigen<br />
Benutzers unterstützen und die Usability <strong>der</strong> Webseiten för<strong>der</strong>n. Um alle<br />
Vorgänge während <strong>der</strong> Informationsaufnahme und -verarbeitung <strong>von</strong> Webseiten<br />
zu erklären, werden in den nächsten Abschnitten weitere diesbezügliche<br />
psychologische Faktoren beschrieben.<br />
5.1.2 Bewusstsein und Aufmerksamkeit<br />
Das Bewusstsein ist ein Zustand <strong>der</strong> Bewusstheit, innerhalb dessen <strong>von</strong> den<br />
ständig eintreffenden Reizen aus <strong>der</strong> Umwelt das ausgeblendet wird, was im<br />
Moment nicht <strong>von</strong> Bedeutung ist. Der <strong>Mensch</strong> kann sich so auf den Reiz<br />
bzw. die Inhalte konzentrieren, die gerade für ihn wichtig sind. Diese können<br />
nun analysiert und interpretiert werden.<br />
Solche höheren geistigen Prozesse sind nur im Zustand des Bewusstseins<br />
möglich. Es gibt darüber hinaus allerdings auch einen Mechanismus unterhalb<br />
<strong>der</strong> Bewusstseinsschwelle: Er überwacht den ignorierten Input bezüglich<br />
bedeutungsvoller Information, indem auf bereits im Gedächtnis gespeicherte<br />
Informationen zurückgegriffen wird. Um den „akzeptierten“ Input<br />
möglichst sinnvoll zu strukturieren und angemessene Handlungen zu treffen,<br />
wird hierbei bereits vorhandenes Wissen <strong>von</strong> Erinnerungen abgeleitet. Durch<br />
das Bewusstsein erstellt sich <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> seine persönliche Konstruktion <strong>der</strong><br />
Wirklichkeit [vgl. ZIMBARDO (1995): 224].<br />
Die Aufmerksamkeit ist ein Zustand konzentrierter Bewusstheit, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Bereitschaft des zentralen Nervensystems, auf Stimulation zu reagieren,<br />
begleitet wird [vgl. ZIMBARDO (1995): 226 ff]. Die Konzentration richtet<br />
sich auf verschiedene bestimmte Inputs. Nur diese können verarbeitet werden.<br />
Reize, die keine Aufmerksamkeit erhalten, und außerdem unterhalb <strong>der</strong><br />
oben beschriebenen Bewusstseinsschwelle liegen, gehen verloren.<br />
Aufmerksamkeit ist Voraussetzung für eine bewusste Wahrnehmung sowie<br />
eine entsprechende weitere Informationsverarbeitung. Sie ist nur stufenweise<br />
möglich. Das, worauf sich die Aufmerksamkeit gerade richtet, ist abhängig<br />
<strong>von</strong> äußeren und inneren Faktoren, wird jeweils besser und länger verarbeitet<br />
und ermöglicht zudem eine detailiertere Erinnerung.<br />
Äußere Reize för<strong>der</strong>n beson<strong>der</strong>s dann die Aufmerksamkeit, wenn sie neu,<br />
unerwartet, auffällig, beson<strong>der</strong>s o<strong>der</strong> intensiv sind. Sie werden dann je nach<br />
den Voraussetzungen, Fähigkeiten, Aufgabenstellungen und Wünschen einer<br />
Person verwertet. Die Verarbeitungsfunktion besitzt jedoch nur eine be-<br />
81
grenzte Kapazität: Bei Eintreffen zweier bedeutungsvoller Informationen<br />
wird die eine durch die an<strong>der</strong>e beeinträchtigt (z.B. Ansehen <strong>von</strong> zwei Bil<strong>der</strong>n).<br />
Wenn jedoch beide Aufgaben genügend verschieden sind (z.B. Ansehen<br />
eines Bildes und gleichzeitiges Hören <strong>von</strong> Tönen), ist auch eine geteilte/aufgeteilte<br />
Aufmerksamkeit möglich.<br />
5.1.3 Behalten und Erinnern<br />
Das Behalten und das Erinnern wird durch drei verschiedene Funktionen<br />
beschrieben [vgl. ZIMBARDO (1995): 314]: Bei <strong>der</strong> Kodierung wird die<br />
eintreffende Reizenergie in einen neuralen Code übersetzt, den das Gehirn<br />
verarbeiten kann. Durch Speicherung wird dieses enkodierte Material über<br />
die Zeit aufbewahrt. Der Abruf <strong>von</strong> Information bedeutet das Wie<strong>der</strong>auffinden<br />
dieser zu einem späteren Zeitpunkt.<br />
Zum Erinnern (bzw. dem vorherigen Speichern) dienen drei (hierarchische)<br />
Gedächtnissysteme [vgl. ZIMBARDO (1995): 315 ff]:<br />
Sensorisches Gedächtnis<br />
Kurzzeitgedächtnis<br />
Langzeitgedächtnis<br />
Das sensorische Gedächtnis bewahrt flüchtige Eindrücke sensorischer Reize<br />
wie zum Beispiel Bil<strong>der</strong>, Töne o<strong>der</strong> Strukturen auf. Es wird für ein bis zwei<br />
Sekunden nach einem Sinneseindruck wirksam. Danach wird <strong>der</strong> Reiz durch<br />
die Wie<strong>der</strong>erkennung <strong>von</strong> Mustern einer bestimmten Kategorie zugeordnet.<br />
Nach dieser Verarbeitung kann die Übertragung in das Kurzzeitgedächtnis<br />
erfolgen.<br />
Wenn Informationen im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, kann <strong>der</strong><br />
<strong>Mensch</strong> sich an das erinnern, was er vor kurzem erfahren hat. Die Behaltensdauer<br />
beträgt bei bewusster Verarbeitung des Materials o<strong>der</strong> bei Wie<strong>der</strong>holung<br />
über 20 Sekunden, ohne Aufmerksamkeit ist die Zeitspanne jedoch<br />
geringer. Bei <strong>der</strong> Übergabe <strong>von</strong> Informationen aus den beiden an<strong>der</strong>en Gedächtnissen<br />
werden diese überarbeitet, organisiert und überdacht. Dies führt<br />
zu einer Aufrechterhaltung sowie ständigen Erneuerung <strong>der</strong> Informationen.<br />
82
Im Langzeitgedächtnis werden Informationen für den Abruf zu einem späteren<br />
Zeitpunkt organisiert und aufbewahrt. Das effektivste Hilfsmittel ist<br />
hierbei die bildhafte Vorstellung.<br />
5.1.4 Lernen und Verstehen<br />
Lernen ist ein bewusst o<strong>der</strong> unbewusst ablaufen<strong>der</strong> kognitiver individueller<br />
Prozess, <strong>der</strong> zu Verän<strong>der</strong>ungen im Wissen und Verhalten führt. Lernen baut<br />
auf Erfahrung auf, also dem, was dem <strong>Mensch</strong>en im Laufe seines Lebens<br />
während seiner Interaktion mit <strong>der</strong> Umwelt wi<strong>der</strong>fährt: Informationen werden<br />
aufgenommen, ausgewertet und durch Äußerungen <strong>von</strong> Reaktionen<br />
umgesetzt und angewendet. Für die Denkprozesse des Lernenden ist vor<br />
allem <strong>der</strong> Wert einer Information <strong>von</strong> entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung (Prägnanz<br />
<strong>von</strong> Reizen für den Organismus sowie seinen Erwartungen). Informativ<br />
werden Reize in diesem Zusammenhang beson<strong>der</strong>s durch Auffälligkeit,<br />
Intensität und Redundanzarmut [vgl. ZIMBARDO, GERRIG (1999): 206 ff].<br />
Zur Erklärung des Lernprozesses werden (je nach Lernumfeld, Lernablauf;<br />
Lernerfolg u. s. w.) drei verschiedene Hauptströmungen <strong>von</strong> Lerntheorien<br />
herangezogen [vgl. HOLZINGER (2001): 110 ff]:<br />
Behaviorismus<br />
Kognitivismus<br />
Konstruktivismus<br />
Die Theorie des Behaviorismus sagt aus, dass das Lernen Reiz-Reaktions-<br />
Mechanismen sind, <strong>der</strong>en Hauptziel das Erbringen <strong>von</strong> Leistung ist. Der<br />
Behaviorismus beschäftigt sich ausschließlich mit beobachtbaren und messbaren<br />
Daten und schließt Dinge wie Emotionen, Ideen und ähnliches aus.<br />
Im Kognitivismus wird Lernen als ein Prozess <strong>der</strong> Informationsverarbeitung<br />
verstanden. Ziel ist das Erlangen <strong>von</strong> Wissen durch Problemlösefertigkeiten<br />
und Konzeptlernen. Die Denk- und Verarbeitungsprozesse des Lernenden<br />
stehen hierbei im Mittelpunkt.<br />
Mit dem Konstruktivismus ist Lernen eine individuelle, aktive und nicht<br />
voraussagbare Wissenskonstruktion. Diese Theorie betont beson<strong>der</strong>s die<br />
subjektive Interpretation <strong>von</strong> Sinneswahrnehmungen, wobei neues Wissen<br />
83
immer auf das bereits bestehende Vorwissen konstruiert wird. Lernziel ist<br />
das Erreichen <strong>von</strong> Kompetenz.<br />
Für das Multi-Media-Lernen sind vor allem die Gestaltpsychologie aus dem<br />
Bereich des Kognitivismus sowie das zentrale Thema <strong>der</strong> Interaktion im<br />
Konstruktivismus <strong>von</strong> Bedeutung.<br />
Das Verstehen erfolgt auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>von</strong> klassifizierten Wahrnehmungen<br />
komplexer Wissensstrukturen im Gedächtnis: Informationen wird mehr<br />
Sinn verliehen, indem sie in größere bereits vorhandene Wissensbestandteile<br />
integriert und dann gespeichert werden 85 . Dadurch ergeben sich sog. Schemata,<br />
die aus verschiedenen Themen, Quellen, Gegenständen u. s. w. bestehen<br />
[vgl. ZIMBARDO (1995): 202].<br />
Verstehen ist wie das Wahrnehmen und Erinnern ein konstruktiver und<br />
zugleich rekonstruktiver Prozess, um einer neuen Information möglichst viel<br />
Sinn zu verleihen. Hierbei verlässt sich <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> auf bereits existierende<br />
kognitive Strukturen [vgl. ZIMBARDO (1995): 365].<br />
Verstehen funktioniert beson<strong>der</strong>s gut mit Hilfe des visuellen Denkens – dem<br />
Sich-Vorstellen <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n: Hierbei werden zuvor wahrgenommene und im<br />
Gedächtnis gespeicherte Informationen „wie<strong>der</strong> gesehen“. Visuelles Denken<br />
verleiht den menschlichen Kognitionen zusätzlich Komplexität und ist beson<strong>der</strong>s<br />
bei räumlichen o<strong>der</strong> geographischen Beziehungen nützlich [vgl.<br />
ZIMBARDO (1995): 366 ff und ANDERSON (1996): 124]. So können zum<br />
Beispiel mentale Bil<strong>der</strong> zu relativen Größen- und Lagevergleichen herangezogen<br />
werden. Durch solch eine kognitive Repräsentation des physikalischen<br />
Raumes entsteht eine sog. kognitive Landkarte. Visuelle Vorstellungen sind<br />
<strong>der</strong> visuellen Wahrnehmung sehr ähnlich. Beim visuellen Vorstellen <strong>von</strong><br />
Problemlösungen stößt <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong> jedoch schnell an Grenzen.<br />
5.1.5 Emotion und Motivation<br />
Emotionen sind physiologische Erregungen, Gefühle sowie kognitive Prozesse<br />
und Verhaltensweisen, die komplexe Verän<strong>der</strong>ungen in den Einstellungen<br />
und Handlungen eines <strong>Mensch</strong>en bewirken können. Sie treten beson<strong>der</strong>s<br />
in Situationen auf, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wer-<br />
85 Das gleiche gilt für das Verän<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Ignorieren <strong>von</strong> Wissensstrukturen auf Grund <strong>von</strong><br />
Diskrepanzen durch einen neuen Input sowie für sog. Skripte. Letztere sind zuständig<br />
für aufeinan<strong>der</strong> bezogene spezifische Ereignisse wie Handlungen und Abfolgen.<br />
84
den. Es wird angenommen, dass Emotionen zur Motivation <strong>der</strong> Bewältigung<br />
<strong>von</strong> Umweltanfor<strong>der</strong>ungen sowie <strong>der</strong> Anpassung an diese dienen [vgl.<br />
ZIMBARDO (1995): 443].<br />
Die Motivation ist ein Ingangsetzen, Steuern und Aufrechterhalten <strong>von</strong><br />
körperlichen und psychischen Aktivitäten [ZIMBARDO (1995): 407 ff]. Sie<br />
wird mit sozial bedingten handlungsverursachenden Faktoren assoziiert, wie<br />
zum Beispiel Bedürfnissen, Wünschen, Zielen u. s. w. Motivationen werden<br />
zum Teil erlernt und können bewusst o<strong>der</strong> unbewusst sein. Indikatoren wie<br />
Aktivitäts- und Leistungsniveau zeigen das Vorhandensein sowie die Stärke<br />
eines Motivs an.<br />
5.1.6 Gewöhnen und Erwarten<br />
Gewöhnen (Habituation) ist die Anpassung an einen sich nicht verän<strong>der</strong>nden<br />
Reiz [vgl. ZIMBARDO (1995): 77]. Dabei nimmt die Aufmerksamkeit ab,<br />
wenn immer das gleiche Material gezeigt wird. Wird ein neuer Reiz gezeigt,<br />
wird wie<strong>der</strong> mehr Zeitaufwand beim Hinsehen verwendet (Dishabituation).<br />
Je<strong>der</strong> neue und unerwartete Reiz löst also eine Orientierungsreaktion aus,<br />
<strong>der</strong>en Reaktionsstärke sich bei Wie<strong>der</strong>holung verringert. Gewöhnen ist<br />
außerdem eine elementare Form des Lernens [ZIMBARDO, GERRIG<br />
(1999): 87].<br />
Die Gewohnheit ist hingegen eine erlernte Verhaltensweise, die in bestimmten<br />
Situationen mit hoher Verlässlichkeit auftritt und relativ festgelegt ist<br />
[vgl. ZIMBARDO, GERRIG (1999): 521].<br />
Erwartungen sind Antizipationen wahrscheinlicher Ereignisse bei bestimmten<br />
Handlungen und <strong>der</strong>en Werte in bestimmten Situationen; und außerdem<br />
Kompetenzen bezüglich <strong>von</strong> Wissen und Fähigkeiten, um bestimmte Kognitionen<br />
und Verhaltensresultate herzustellen [vgl. ZIMBARDO (1995): 500 f].<br />
Es wird angenommen, dass ein Großteil <strong>der</strong> menschlichen Motivation durch<br />
persönliche Erwartungen und Vorstellungen bestimmt werden [vgl.<br />
ZIMBARDO, GERRIG (1999): 323].<br />
5.1.7 Entscheiden<br />
Eine Entscheidung ist ein mehr o<strong>der</strong> weniger überlegtes, abwägendes, zielorientiertes<br />
sowie konfliktbewußtes Handeln [JUNGERMANN (1998): 3].<br />
85
Sie hat Konsequenzen zur Folge, die durch eigene Ziele, mögliche Alternativen<br />
sowie sonstige Umstände beeinflusst werden [JUNGERMANN (1998):<br />
17 ff]. Es gibt einstufige o<strong>der</strong> mehrstufige Entscheidungen; bei letzteren<br />
hängt je<strong>der</strong> Schritt vom Ergebnis des vorherigen ab [vgl. JUNGERMANN<br />
(1998): 27].<br />
Die Entscheidungsfindung ist ein Prozess, in dem zwischen Alternativen<br />
ausgewählt wird und ggf. bestimmte Optionen zurückgewiesen werden<br />
[ZIMBARDO (1995): 369]. Dieser Vorgang ist <strong>von</strong> dem Rahmen, in dem<br />
ein Entscheidungsproblem auftritt, abhängig. Dieser Rahmen kann bereits<br />
die Art <strong>der</strong> Wahrnehmung sowie die Auswahl einer Option beeinflussen.<br />
Viele Entscheidungen werden unter Unsicherheit getroffen – nichtrationale<br />
Einflüsse spielen hier eine große Rolle: Komplexe Situationen können vereinfacht<br />
werden, indem Alternativen o<strong>der</strong> relevante Fakten teilweise vernachlässigt<br />
werden, o<strong>der</strong> bestimmte Tatsachen aufgrund <strong>von</strong> Optimismus<br />
o<strong>der</strong> negativen vorgefassten Meinungen nicht beachtet werden. Auch Stresssituationen<br />
sind <strong>von</strong> Bedeutung: In solchen Fällen kann es vorkommen, dass<br />
die Suche nach relevanten Fakten bzw. das Nachdenken darüber einfach<br />
abgebrochen wird [vgl. ZIMBARDO (1995): 373 ff].<br />
Die Art und <strong>der</strong> Umfang des kognitiven Aufwands in Entscheidungssituationen<br />
sind unterschiedlich. Demnach können vier verschiedene Ebenen <strong>von</strong><br />
Entscheidungen aufgeführt werden [JUNGERMANN (1998): 29 – 36]:<br />
Routinisierte Entscheidungen<br />
Stereotype Entscheidungen<br />
Reflektierte Entscheidungen<br />
Konstruktive Entscheidungen<br />
Routinisierte Entscheidungen sind ein Resultat früher getroffener Entscheidungen<br />
und werden häufig wie<strong>der</strong>holt. Dies ist möglich, weil die vorhandenen<br />
Optionen stets gleich sind. Zwischen diesen wird automatisch o<strong>der</strong><br />
routinemäßig ausgewählt. Der kognitive Aufwand ist gering: Die gegebene<br />
Situation wird mit den gespeicherten entsprechenden vorhandenen Situationen<br />
verglichen und bei hinreichend hoher Ähnlichkeit wird das gespeicherte<br />
Entscheidungsschema aktiviert. Die gewohnte Wahl wird getroffen. Stellt<br />
sich jedoch keine Ähnlichkeit ein, wird die routinisierte Entscheidung abgebrochen<br />
und auf eine höhere Ebene <strong>der</strong> Aufmerksamkeit gewechselt. Erst<br />
86
eine bewusste Wahrnehmung <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung führt zur Entwicklung einer<br />
neuen Routine.<br />
Ein Problem hierbei ist, dass <strong>Mensch</strong>en dazu neigen, Aufgaben nach einem<br />
bekannten Schema zu lösen, obwohl im Einzelfall ein an<strong>der</strong>es Schema erfor<strong>der</strong>lich<br />
wäre. Dadurch entstehen häufig Fehler (die evtl. nicht als solche<br />
erkannt werden).<br />
Stereotype Entscheidungen beziehen sich auf bestimmte Entscheidungsbereiche,<br />
das heißt, die möglichen Optionen sind Bestandteil eines klar definierten<br />
Themas. Die (minimalen) Bewertungen erfolgen nach einem erlernten<br />
Bewertungsschema, wobei die Präferenzen jedoch nicht durch bewusste<br />
Analysen, son<strong>der</strong>n durch Erfahrungen und Gefühle entstehen. Diese werden<br />
durch die Art <strong>der</strong> jeweiligen Optionen ausgelöst. Beson<strong>der</strong>s bekannte und<br />
vertraute Optionen haben Einfluss auf positive Entscheidungen.<br />
Bei reflektierten Entscheidungen denkt <strong>der</strong> Betreffende bewusst nach, indem<br />
er nach passenden Informationen in seinem Gedächtnis o<strong>der</strong> seiner Umgebung<br />
sucht. Die jeweiligen Merkmalsausprägungen einer Option werden<br />
durch genaue Analysen relevanter Merkmale sowie hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Wünschbarkeit überprüft. Da für solch eine Entscheidung noch keine abrufbaren<br />
Präferenzen vorhanden sind, ist hier ein wesentlich höherer kognitiver<br />
Aufwand notwendig.<br />
Reflektierte Entscheidungen betreffen meist wichtige Probleme mit affektiven<br />
sowie motivationalen Faktoren.<br />
Bei konstruktiven Entscheidungen sind noch keine möglichen Optionen<br />
vorhanden o<strong>der</strong> nicht hinreichend genau definiert. Die Suche nach geeigneten<br />
Informationen sowie den entsprechenden Entscheidungen erfor<strong>der</strong>t den<br />
höchsten kognitiven Aufwand.<br />
Die Wahl <strong>der</strong> jeweiligen Entscheidungsmethode ist abhängig vom Problem<br />
sowie <strong>der</strong> Anzahl bereits bearbeiteter ähnlicher Probleme.<br />
5.1.8 Handeln und Fehler<br />
Der <strong>Mensch</strong> besitzt Ziele und plant die dafür entsprechenden zu erledigenden<br />
Aufgaben. Dabei werden Grobziele und Teilziele entwickelt sowie Pläne<br />
zur Realisierung aufgestellt. Während <strong>der</strong> Handlung wird das anfängliche<br />
87
Vorhaben weiterentwickelt, verfeinert und ggf. korrigiert. Vorraussetzungen<br />
für eine sichere Handlungssteuerung sind eine exakte Orientierung, das<br />
Erkennen bestimmter Handlungsmöglichkeiten im räumlichen Umfeld sowie<br />
eine genaue Koordination zwischen dem Wahrnehmungs- und dem Handlungssystem<br />
[vgl. GUSKI (2000)].<br />
Handlungen werden fortgesetzt, bis ein Resultat entsteht, welches mit dem<br />
zuvor gesetzten Ziel auf hinreichende Übereinstimmung verglichen wird.<br />
Diese Vergleiche erfolgen abschließend, aber auch schon vor sowie während<br />
<strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Handlung [vgl. ZIMBARDO, GERRIG (1999): 725 f].<br />
<strong>Mensch</strong>liche Handlungen können mehr o<strong>der</strong> weniger bewusst sowie mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger automatisiert ablaufen. Hierbei gibt es drei verschiedene Regulationstypen<br />
86 , bei denen jeweils unterschiedliche Fehler auftreten können<br />
[vgl. BRODBECK, RUPIETTA (1994): 198 – 203]:<br />
Hochautomatisierte Operationen<br />
Routinehandlungen<br />
Bewusste Handlungen<br />
Hochautomatisierte Operationen werden unbewusst reguliert und sind in<br />
übergeordnete Routinehandlungen eingebunden. Bei eventuell auftretenden<br />
Fehlern handelt es sich um reine Bewegungsfehler.<br />
Routinehandlungen passen sich aufgrund eines flexiblen Handlungsgrundmusters<br />
an die jeweilige Situation an. Ein Minimum an bewusster Kontrolle<br />
ist hierbei jedoch notwendig. Fehler können Gewohnheitsfehler, Unterlassensfehler<br />
o<strong>der</strong> Erkennensfehler sein.<br />
Erst bei bewussten Handlungen kommt konzentriertes Denken zum Einsatz.<br />
Hier können Denk-, Merk-, Vergessens- sowie Urteilsfehler auftreten.<br />
Wenn die im <strong>Mensch</strong>en bereits gespeicherten Repräsentationen überhaupt<br />
nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, liegt ein Wissensfehler<br />
vor.<br />
86 Handlungen beruhen (teilweise) auf Entscheidungen. Letztere sind jedoch eher kognitiv<br />
beeinflusst, während Handlungen motorisch bestimmt sind. Die Beschreibung <strong>der</strong> Regulationstypen<br />
dient <strong>der</strong> Erklärung evtl. auftreten<strong>der</strong> Handlungsfehler.<br />
88
Bei dem Prozess <strong>der</strong> Bewältigung <strong>von</strong> Fehlern lassen sich drei Schritte unterscheiden:<br />
Fehlerentdeckung, Fehlerdiagnose sowie Fehlerkorrektur.<br />
Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen psychologischen<br />
Vorgänge laufen während <strong>der</strong> biologischen Informationsaufnahme und<br />
Informationsverarbeitung ab. Diese Kenntnisse können bei <strong>der</strong> Rezeption<br />
<strong>von</strong> Webseiten in beson<strong>der</strong>er Weise genutzt werden. Im Folgenden wird<br />
genauer darauf eingegangen.<br />
5.2 Informationsaufnahme und -verarbeitung bei Webseiten<br />
Abläufe wie Wahrnehmung, Gedächtnis o<strong>der</strong> Motivation funktionieren nach<br />
bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Bei <strong>der</strong> Nutzung <strong>von</strong> elektronischen Medien<br />
wie Webseiten gibt es Beson<strong>der</strong>heiten. So ist zum Beispiel das Lesen am<br />
Bildschirm wesentlich anstrengen<strong>der</strong> und ineffektiver als <strong>von</strong> Papier, wodurch<br />
online-Nutzer schneller ermüden und sich Inhalte zudem schwerer<br />
merken können. Durch das permanente Starren auf den Bildschirm und den<br />
Mangel an Bewegung fühlen sie sich manchmal sogar körperlich unwohl<br />
[vgl. TEKOM (5/2001): 17 – 22].<br />
Die Rezeption <strong>von</strong> online-Informationen ist in Stufen aufgebaut [vgl.<br />
HOLZINGER (2001): 106] und sieht im Allgemeinen folgen<strong>der</strong>maßen aus:<br />
< Informationsaufnahme durch Darbietung <strong>der</strong> Informationen<br />
< Informationsverarbeitung<br />
< Informationssicherung durch Wie<strong>der</strong>holung<br />
< Informationsspeicherung<br />
< Informationsanwendung durch Nutzung<br />
< Informationsverlust durch Vergessen<br />
Wenn Betreiber <strong>von</strong> Webseiten diese psychologischen Abläufe für ihre Ziele<br />
nutzen möchten, und die Seiten <strong>von</strong> den Benutzern optimal aufgenommen,<br />
verarbeitet und möglichst im Gedächtnis bleiben sollen, sind bei <strong>der</strong> Gestaltung<br />
verschiedene Faktoren zu beachten, welche nachfolgend erläutert werden.<br />
89
5.2.1 Wahrnehmungspsychologische Zusammenhänge<br />
Durch ein Web-Design, welches den psychologischen Voraussetzungen <strong>von</strong><br />
Nutzern entspricht, werden die Aufnahme sowie die Verarbeitung optischer<br />
Informationen erleichtert. In dieser Hinsicht gibt es einige verschiedene<br />
psychophysiologische Aspekte, die schon während <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong><br />
Webseiten beachtet werden sollten:<br />
Informationsverarbeitung im Gehirn<br />
Unterscheidung <strong>von</strong> Figur und Grund<br />
Gruppierung<br />
Gedächtnis<br />
Lernen<br />
Entscheiden<br />
Die einzelnen Gehirnhälften bearbeiten jeweils unterschiedliche Aufgaben.<br />
Während die linke Hirnhemisphäre für verbales, rechnendes und analytisches<br />
Denken zuständig ist, ist die rechte Seite eher für nonverbales, bildhaftes<br />
sowie ganzheitliches Denken verantwortlich. Um eine möglichst einfache<br />
und schnelle Verarbeitung <strong>der</strong> wahrgenommenen Informationen zu erreichen,<br />
müssen diese vom Auge direkt in die entsprechende Gehirnhälfte gelangen.<br />
Für die Gestaltung <strong>von</strong> Webseiten bedeutet dies, dass ganzheitliche Strukturen<br />
wie die Navigationsleiste, Fotos und Abbildungen sowie das Firmenlogo<br />
im linken Blickfeld <strong>der</strong> Seite positioniert werden – Texte auf <strong>der</strong> rechten<br />
Seite [vgl. BEIER, V. GIZYCKI (2002): 34].<br />
Der <strong>Mensch</strong> glie<strong>der</strong>t sein Wahrnehmungsfeld in Figur und Grund. Demzufolge<br />
sollten Webseiten so gestaltet sein, dass <strong>der</strong> Besucher diese Elemente<br />
sofort optisch trennen kann: Objekte auf dem Bildschirm sind entsprechend<br />
<strong>der</strong> Gestaltgesetze klar als Figuren herauszubilden. Dies kann durch einschließende<br />
Linien und geschlossene Farbflächen unterstützt werden. Dabei<br />
sollten glie<strong>der</strong>nde und aufteilende Elemente jedoch nicht selbst zu Figuren<br />
werden, son<strong>der</strong>n eher zu Hintergründen.<br />
90
Da Text als Figur wahrgenommen wird und dessen Hintergrund als Grund,<br />
kann eine schnelle und sichere Orientierung erreicht werden, wenn <strong>der</strong> Text<br />
möglichst als geschlossene Figur erkennbar ist. Dies kann durch genügend<br />
Platz zwischen Text und Seitenrand bzw. an<strong>der</strong>en Seitenelementen, Absätzen<br />
im Text sowie durch Umrahmungen und Schattierungen erzielt werden.<br />
Solche Elemente verhin<strong>der</strong>n, dass die Seite als undifferenzierte Fläche<br />
wahrgenommen wird.<br />
Durch Gruppierung werden nah beieinan<strong>der</strong> liegende Objekte (durch ähnliche<br />
Formen, Farbtöne und Helligkeiten) als zusammengehörig gesehen.<br />
Wenn Inhalte und Elemente gemäß ihrer Funktionen gruppiert werden, kann<br />
<strong>der</strong> Benutzer zwischen diesen entsprechende Bezüge herstellen, Informationen<br />
schnell aufnehmen und diese sinnvoll verarbeiten.<br />
Erhalten alle Seiten einer Website das gleiche Aussehen bezüglich <strong>der</strong> Texte<br />
und Grafiken sowie dem Schriftsatz, und werden wesentliche Fixpunkte wie<br />
Navigationsleiste und Logo auf je<strong>der</strong> Seite an <strong>der</strong> gleichen Stelle positioniert,<br />
ergeben die dadurch entstehenden Muster logische Zusammenhänge. Das auf<br />
diese Art und Weise entstehende einheitliche Erscheinungsbild vermittelt<br />
dem Besucher Vertrautheit.<br />
Die Zeilenlängen <strong>der</strong> Texte sollten am sensorischen Gedächtnis orientiert<br />
werden, da dieses nur eine geringe Speicherdauer hat (also entsprechend<br />
kurz sein). Dies gewährleistet eine optimale Lesbarkeit.<br />
Auch das Kurzzeitgedächtnis hat nur ein Merkpotential <strong>von</strong> ca. sieben Objekten.<br />
Dies können sieben Buchstaben o<strong>der</strong> sieben Sätze sein. Wenn nun die<br />
angebotene Information geglie<strong>der</strong>t und danach in maximal sieben Rubriken<br />
zusammengefasst und in die Menüleiste integriert wird (bei gleichzeitiger<br />
Verwendung <strong>von</strong> kurzen Textabschnitten), kann die Gesamtmenge <strong>der</strong> Informationen<br />
optimal erfasst werden. Mit zunehmen<strong>der</strong> Komplexität lässt<br />
jedoch das Merkpotential nach: Ab einer gewissen Fülle <strong>von</strong> Informationen<br />
(z.B. mehrere Sätze) werden diese nur noch in ihrem Sinn, nicht in ihrem<br />
genauen Wortlaut erfasst [vgl. ANDERSON (1996): 141 ff]. Aufgrund <strong>der</strong><br />
geringen Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses müssen anfallende Zwischeninformationen<br />
ständig präsent gehalten werden. Der Benutzer wird entlastet,<br />
indem im Hintergrund Webseiten geöffnet bleiben, die sofort wie<strong>der</strong> nutzbar<br />
sind [vgl. GLASER (1994): 37 f].<br />
Mit Hilfe des Langzeitgedächtnisses werden Verknüpfungen mit zuvor<br />
gespeicherten Informationen hergestellt. Diese Tatsache kann auch bei <strong>der</strong><br />
91
Erstellung <strong>von</strong> Webseiten genutzt werden: Hier sollten bekannte Elemente<br />
aus <strong>der</strong> Werbewelt verwendet werden, wie zum Beispiel bestimmte Schlüsselbil<strong>der</strong>,<br />
Farben o<strong>der</strong> Logos. Wenn ein Objekt mehrere verbale o<strong>der</strong> vom<br />
Benutzer verbal codierte Elemente enthält, sind diese in Zeilen und Spalten<br />
anzuordnen [vgl. GLASER (1994): 40].<br />
Es ist zu beobachten, dass auf Webseiten Elemente auf eine Art und Weise<br />
gestaltet werden, die nicht intuitiv ist. Hierzu gehört beispielsweise, dass<br />
Grafiken die Funktion <strong>von</strong> Links erhalten, es optisch aber keinerlei Hinweise<br />
für diese Funktionalität gibt. Diese Gestaltungsvariante wird sehr häufig<br />
verwendet und ist mittlerweile zu einem Standard geworden. Hier haben<br />
<strong>Mensch</strong>en, die Webseiten sehr viel benutzen, gelernt, dass Grafiken oft die<br />
beschriebene Funktion besitzen, klicken diese zielgerichtet an und gelangen<br />
schnell an weitere Informationen 87 . Hier muss bezüglich <strong>der</strong> Usability einer<br />
Webseite genau darauf geachtet werden, ob es sich bei <strong>der</strong> entsprechenden<br />
Zielgruppe (sofern bekannt) um erfahrene Webbenutzer handelt o<strong>der</strong> nicht.<br />
An<strong>der</strong>nfalls sollte auf solche Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen bestimmte<br />
Informationen ausschließlich über <strong>der</strong>artige Grafiken erreicht werden<br />
können, verzichtet werden.<br />
Während <strong>der</strong> Rezeption <strong>von</strong> Webseiten trifft <strong>der</strong> Benutzer ständig Entscheidungen<br />
darüber, was er als nächstes tun möchte. Beson<strong>der</strong>s deutlich wird<br />
dies bei <strong>der</strong> Navigation: Vor dem Anklicken jedes einzelnen Hyperlinks<br />
denkt <strong>der</strong> Benutzer über diese Handlung nach, was mehr o<strong>der</strong> weniger bewusst<br />
erfolgt. Einen bestimmten Navigationsweg, den <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> sehr<br />
häufig benutzt, verfolgt er durch automatisches Anklicken, wobei nur sehr<br />
geringe kognitive Leistungen erbracht werden müssen. Diese nehmen zu, je<br />
unbekannter eine Webseite bzw. die auf ihr dargestellten Informationen und<br />
<strong>der</strong>en Anordnung für einen Benutzer sind. Unbekannte Websites erfor<strong>der</strong>n<br />
vom Anwen<strong>der</strong> reflektierte bis konstruktive Entscheidungen. Der Aufwand<br />
dafür kann verringert werden, indem die Site eine optimale Navigation (inkl.<br />
Navigationshilfen, wie z.B. „Sitemaps“) erhält, und die Beschreibung <strong>der</strong><br />
entsprechenden Links die jeweiligen Ziele klar verdeutlichen.<br />
87 Gleichzeitig führt dies zum Anklicken <strong>von</strong> Grafiken, bei denen sich herausstellt, dass es<br />
sich in diesem Fall um keinen Link handelt.<br />
92
5.2.2 Kognitive Zusammenhänge<br />
Die einzelnen Webseiten sind durch sog. Links miteinan<strong>der</strong> verbunden und<br />
können so vielfältig sein, dass ein für den <strong>Mensch</strong>en kaum noch nachvollziehbares<br />
Informationsnetz entsteht. Trotzdem können sich die Besucher in<br />
großen Teilen <strong>der</strong> Websites zurechtfinden. Dies wird möglich durch Einsatz<br />
mentaler Modelle, welche Form und Ablauf <strong>der</strong> Informationsverarbeitung<br />
und -speicherung beschreiben. Mit ihrer Hilfe können kognitive Vorgänge<br />
während <strong>der</strong> Nutzung <strong>von</strong> Webseiten erklärt werden: Hierbei wird die für<br />
eine Handlung (o<strong>der</strong> Antwort auf eine Frage) nötige Information als Einzelfall<br />
berechnet. Dabei werden die einzelnen Sachverhalte so codiert, dass sie<br />
auf <strong>der</strong> Basis <strong>von</strong> Grundkomponenten sowie Ableitungsregeln rekonstruiert<br />
werden. Mentale Modelle beruhen auf <strong>der</strong> Annahme, dass <strong>Mensch</strong>en das<br />
Bedürfnis haben, die Objekte ihrer Wahrnehmung sowie Gedankenwelt zu<br />
kategorisieren. Solch ein semantisches Netzwerk besteht aus zwei<br />
entscheidenden, zusammengehörenden Komponenten:<br />
Objekte<br />
Verbindungen zwischen den Objekten<br />
Objekte stellen faktisches Wissen dar. Sie bilden Begriffe, Eigenschaften<br />
und Ereignisse ab, <strong>der</strong>en Bedeutung sich aus <strong>der</strong> Stellung – Art und Anzahl<br />
<strong>der</strong> Verbindungen im Netzwerk – ergibt. Jede Eigenschaft existiert innerhalb<br />
eines Netzwerkes nur einmal.<br />
Die Verbindungen zwischen den Objekten müssen eindeutig sein. Sie kennzeichnen<br />
Wissensstrukturen durch Beziehungen sowie Assoziationen. Deren<br />
Stärke wird durch räumliche Nähe sowie <strong>der</strong> Stärke <strong>der</strong> Verbindungen ausgedrückt.<br />
Da das Denken ein bewusstes Operieren mit solchen mentalen Modellen ist,<br />
können mit ihrer Hilfe Wissensstrukturen veranschaulicht und <strong>der</strong>en Zustandekommen<br />
sowie evtl. Verän<strong>der</strong>ungen dargestellt werden. Ziel <strong>der</strong> Darstellung<br />
<strong>von</strong> Wissensstrukturen ist es, zu verdeutlichen, welche Assoziationen<br />
im Bezug auf ein Objekt vorliegen und wie sie miteinan<strong>der</strong> zusammenhängen.<br />
Somit können Rückschlüsse über Gemeinsamkeiten o<strong>der</strong> Unterschiede<br />
getroffen werden.<br />
93
So, wie mit Hilfe semantischer Netzwerke kognitive Vorgänge während <strong>der</strong><br />
Nutzung <strong>von</strong> Webseiten erklärt werden, könnten im Gegenzug auch Webseiten<br />
entsprechend kognitiver Modelle <strong>von</strong> Webnutzern gestaltet werden:<br />
Durch entsprechende Umfragen (und evtl. Analysen <strong>von</strong> Zugriffshäufigkeiten)<br />
kann ein Unternehmen <strong>von</strong> seinen Kunden erfahren, welche Produkteigenschaften<br />
als wichtig o<strong>der</strong> weniger wichtig empfunden werden.<br />
Dementsprechend kann das jeweilige Produkt innerhalb <strong>der</strong> Website bis<br />
herunter auf eine einzelne Webseite so positioniert werden, dass dies dem<br />
semantischen Netzwerk <strong>der</strong> Kunden entspricht und somit sein Zielpublikum<br />
in Zukunft besser erreichen kann. Das heißt also, dass als beson<strong>der</strong>s wichtig<br />
empfundene Bereiche leicht und vor allem möglichst direkt zu erreichen sein<br />
sollten88 Ein gute. Gestaltung und Strukturierung <strong>von</strong> Websites aktiviert beim Benutzer<br />
das optimale mentale Modell für die jeweilige Aufgabe. Es schafft Sinn,<br />
Ordnung und Zusammenhänge.<br />
5.2.3 Rezeption <strong>von</strong> Texten auf Webseiten<br />
Traditionelle Print-Texte werden auf verschiedene Art und Weise gelesen:<br />
Der Leser kann einen bestimmten linearen Leseweg einhalten (monosequenzierte<br />
Texte), einen Text nur teilweise rezipieren (mehrfachsequenzierte<br />
Texte), o<strong>der</strong> auf bestimmte Textteile einzeln zugreifen (unsequenzierte<br />
Texte).<br />
Die Rezeption <strong>von</strong> online-Texten gestaltet sich an<strong>der</strong>s. Online-Texte verfügen<br />
über die technischen Raffinesse, dass mehrere eigenständige Textbausteine<br />
durch Verknüpfungen netzförmig und dezentral miteinan<strong>der</strong> verbunden<br />
und gleichzeitig zueinan<strong>der</strong> in Beziehung gesetzt sind. Zusätzlich ist hier<br />
die Integration unterschiedlichster Medientypen möglich: Sachverhaltskomplexe<br />
können gegenstandsgerecht präsentiert werden (z.B. durch Animationen,<br />
Ton etc.). Dadurch ist die Darstellung nicht mehr ausschließlich Text<br />
[vgl. BEIßWENGER (2000): 33 ff]. Dem Nutzer werden vielfältige weitere<br />
Möglichkeiten im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Textrezeption ermöglicht. So<br />
kann er sich die verschiedensten Informationsangebote nach seinen individuellen<br />
Bedürfnissen erarbeiten.<br />
88 An dieser Stelle treten Schwierigkeiten auf, wie z.B.: Wie sieht das semantische Netzwerk<br />
<strong>der</strong> Kunden aus? Wie kann da<strong>von</strong> genau Kenntnis erlangt werden? Wie kann das jeweilige<br />
Netzwerk angemessen abgebildet werden? Diese noch offenen Fragen könnten<br />
interessante Forschungsansätze darstellen.<br />
94
Im Unterschied zu Print-Texten werden die Texte am Bildschirm nicht<br />
durchgängig gelesen, son<strong>der</strong>n eher nachgeschlagen. Das liegt vor allem<br />
daran, dass lineares Lesen am Bildschirm (durch die geringere Auflösung<br />
und Flimmern) sehr viel mühsamer ist. Dadurch entsteht das sog. „Browsing“<br />
89 , bei dem nicht zielgerichtet gesucht, son<strong>der</strong>n nach möglicherweise<br />
Interessantem o<strong>der</strong> Informativem gestöbert wird. Und selbst wenn <strong>der</strong> Nutzer<br />
sein ursprüngliches Informationsziel nicht erreicht hat, gilt das „Browsing“<br />
als erfolgreich, wenn etwas (an<strong>der</strong>es) Interessantes entdeckt wurde.<br />
Die Grenze zwischen kreativer Informationsaufnahme und chaotischem<br />
Informationsverhalten ist hier fließend. Beson<strong>der</strong>s dieses individuelle<br />
Durchkreuzen <strong>von</strong> verschiedenen, miteinan<strong>der</strong> vernetzten Informationsangeboten<br />
macht die An<strong>der</strong>sartigkeit <strong>der</strong> Informationsaufnahme in Datennetzen<br />
aus. Das „Überschreiten“ <strong>von</strong> online-Texten ist spielerisch einfach, und die<br />
Entscheidung, was wann in welcher Reihenfolge rezipiert wird, ist alleinige<br />
Sache des Nutzers.<br />
Doch gerade durch die nicht-lineare Organisation <strong>der</strong> Texte wird ein erster<br />
Überblick über <strong>der</strong>en Aufbau und Umfang schwierig, denn es besteht die<br />
Möglichkeit, dass <strong>der</strong> Leser durch Hyperlinks abgelenkt wird. Dies kann<br />
schließlich zur Desorientierung im Textsystem führen.<br />
Online-Publikationen können ggf. weitere entscheidende Nachteile mit sich<br />
bringen: Da es je<strong>der</strong> Person möglich ist, unkontrolliert Inhalte im Internet zu<br />
veröffentlichen, kann <strong>der</strong> Leser nicht mehr eindeutig <strong>der</strong>en Qualität beurteilen.<br />
Entscheidungen über die Richtigkeit <strong>der</strong> Angaben, <strong>der</strong> Beständigkeit <strong>der</strong><br />
Veröffentlichung sowie <strong>der</strong>en Zitierfähigkeit werden fraglich. Dies kann zu<br />
Verunsicherungen beim Leser führen und dafür sorgen, dass das Internet<br />
zwar als schnelle Informationsquelle genutzt wird, einzelne Informationen<br />
jedoch unter Umständen ihre Glaubwürdigkeit verlieren.<br />
Doch was aus <strong>der</strong> einen Sicht als Nachteil beschrieben werden kann, gilt aus<br />
an<strong>der</strong>er Sicht als Vorteil. Durch die <strong>Vernetzung</strong> <strong>der</strong> Texte entsteht die Möglichkeit<br />
einer neuen „Linearität“ <strong>der</strong> Lesbarkeit: Der Leser kann sich durch<br />
ein individuelles Verfolgen <strong>der</strong> Hyperlinks seinen eigenen, für ihn maßgeschnei<strong>der</strong>ten<br />
Text schaffen und genau die Informationen fokussieren, die für<br />
ihn in diesem Augenblick <strong>von</strong> Wichtigkeit sind.<br />
Für die Benutzer <strong>von</strong> Webseiten ist es beson<strong>der</strong>s wichtig, die präsentierten<br />
Informationen optimal aufnehmen und verarbeiten zu können. Dafür bilden<br />
89 Siehe Kapitel 7.1.3: „Verhalten auf Webseiten“<br />
95
die Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Psychologie die entsprechenden Grundlagen. Werden<br />
diese beachtet und entsprechend angewendet, ist eine gute Usability <strong>von</strong><br />
Webseiten bereits zu großen Teilen gewährleistet.<br />
96
6 Gesetze und Normen als formale Basis<br />
<strong>der</strong> Usability<br />
Die Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Psychologie wurden im Rahmen des Arbeitsschutzes<br />
in Gesetzen, Normen und Richtlinien umgesetzt. Diese können für Einsteiger<br />
wie für Fortgeschrittene als Basis sowie als weitere Wegweiser dienen.<br />
Um Softwareprodukte o<strong>der</strong> Webseiten auf ihre Usability zu überprüfen,<br />
können bzw. müssen verschiedene formale Grundlagen berücksichtigt werden:<br />
Gesetze<br />
Normen<br />
Richtlinien<br />
Ein Gesetz ist eine Rechtsquelle, welche sich an die Mitglie<strong>der</strong> einer staatlichen<br />
Gemeinschaft wendet und <strong>der</strong>en Verhalten hinsichtlich einer Vielzahl<br />
<strong>von</strong> Fällen regelt. Gesetze werden vom Parlament in verfassungsmäßigen<br />
Gesetzgebungsverfahren verabschiedet [vgl. BUND.DE (2003)].<br />
Normen sind Regeln, die den Stand <strong>der</strong> Technik beschreiben und häufig als<br />
Definition in Gesetzestexten, Sicherheitsvorschriften und Ähnlichem herangezogen<br />
werden. Normen beschreiben vereinbarte Standards, die durch<br />
Vertreter <strong>der</strong> Wissenschaft, <strong>der</strong> Industrie o<strong>der</strong> Abnehmer bzw. Verwen<strong>der</strong><br />
<strong>von</strong> Industrieprodukten formuliert wurden. Ihre Befolgung ist grundsätzlich<br />
freiwillig 90 . Ein Nichtbefolgen wird lediglich de facto 91 geahndet. Die Einhaltung<br />
<strong>von</strong> Normen kann jedoch für das wirtschaftliche Überleben eines<br />
Unternehmens entscheidend sein.<br />
Deutsche sowie internationale Normen erhalten eine gewisse Verbindlichkeit<br />
aufgrund weltweiter Anerkennung sowie <strong>der</strong> entsprechenden Übereinkunft<br />
ihrer Autoren [vgl. FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA<br />
(2000)].<br />
90 Verpflichtend sind Normen nur dann, wenn sie Teil eines Gesetzes sind.<br />
91 de facto: ohne rechtliche Grundlage<br />
97
Richtlinien, insbeson<strong>der</strong>e VDI-Richtlinien, sind Leitlinien o<strong>der</strong> Standards,<br />
die vom Verein Deutscher Ingeneure sowie <strong>von</strong> großen bzw. führenden<br />
Herstellern aufgestellt werden. Sie dienen vor allem den firmeneigenen<br />
Entwicklern, werden zum Teil aber auch veröffentlicht. Damit stellen sie<br />
Empfehlungen dar, in denen praxisorientiertes (aktuelles) Technikwissen<br />
und oft auch ein bestimmtes Erscheinungsbild (beson<strong>der</strong>s in Designrichtlinien)<br />
formuliert werden.<br />
Beson<strong>der</strong>s durch Normen und Richtlinien können Software sowie Webseiten<br />
in ihrer Darstellung und ihren Interaktionsmöglichkeiten vereinheitlicht und<br />
somit die Konsistenz <strong>der</strong> Anwendungen erhöht werden. Im Übrigen bieten<br />
solche Empfehlungen die Möglichkeit, die Erfahrungen vieler Spezialisten in<br />
die Gestaltung benutzerfreundlicher Oberflächen einzubringen.<br />
6.1 Entstehung und Bedeutung<br />
Diejenigen Normen und Gesetze, die hinsichtlich <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten<br />
relevant sind und zum Einsatz kommen, entstanden im Rahmen <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> (europäischen) Arbeitsschutzgesetze: 1996 trat das (deutsche)<br />
„Arbeitsschutzgesetz“ als deutsche Umsetzung europäischen Rechts in<br />
Kraft. Es regelt die Durchführung <strong>von</strong> Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Sicherheit und des Gesundheitsschutzes <strong>der</strong> Beschäftigten<br />
bei <strong>der</strong> Arbeit. Dieses Gesetz wurde kurz nach seinem Inkrafttreten durch<br />
die „Bildschirmarbeitsverordnung“ konkretisiert. In ihr wurde erstmalig <strong>der</strong><br />
Gesundheitsschutz bei <strong>der</strong> Bildschirmarbeit gesetzlich geregelt. In dieser<br />
Verordnung sind körperliche sowie psychische Aspekte festgehalten. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
§ 4 <strong>der</strong> Bildschirmarbeitsverordnung beinhaltet Gestaltungsanfor<strong>der</strong>ungen<br />
für die Bildschirmarbeit, unter an<strong>der</strong>em auch das Zusammenwirken<br />
<strong>von</strong> <strong>Mensch</strong> und Arbeitsmittel. Die Bildschirmarbeitsverordnung ist Teil <strong>der</strong><br />
„EU-Bildschirmrichtlinie“ (90/270/EWG), welche grundsätzliche Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an die Systemgestaltung stellt, wie zum Beispiel Arbeitsplatzausstattung<br />
und -umgebung, sowie die Gestaltung <strong>der</strong> <strong>Mensch</strong>-Maschine-<br />
Schnittstelle bezüglich Software, System und Ergonomie.<br />
Eine in dieser Hinsicht relevante Richtlinie ist die „VDI-Richtlinie<br />
5005“ <strong>von</strong> 1990. Sie vermittelt zwischen dem Entwickler einer Anwendung<br />
und <strong>der</strong>en Endbenutzer, indem in ihr drei Kriterien zur Umsetzung ergono-<br />
98
mischer Anfor<strong>der</strong>ungen festgehalten werden: Aufgabenangemessenheit,<br />
Handlungsflexibilität sowie Kompetenzför<strong>der</strong>lichkeit. Konkretisiert werden<br />
diese Faktoren beson<strong>der</strong>s durch Normen zur Bildschirmgestaltung wie in <strong>der</strong><br />
„DIN 66234 – Bildschirmarbeitsplätze“. In ihr sind Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
festgehalten (Teil 8). Dieser Teil ging 1996 ein in die Europäische<br />
Norm „DIN EN ISO 9241 Teil 1 – 17 92 : Ergonomische Anfor<strong>der</strong>ungen für<br />
Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“ 93 . In dieser Norm ist hinsichtlich<br />
<strong>von</strong> Softwareentwicklung beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> Teil 10 interessant. In ihm wurden<br />
die aus Teil 8 <strong>der</strong> DIN 66234 übernommenen Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
noch um zwei zusätzliche Grundsätze (Individualisierbarkeit und Lernför<strong>der</strong>lichkeit)<br />
erweitert. Die „Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung“ stellen den<br />
bekanntesten Teil <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241 dar.<br />
6.1.1 Übersicht über die gesamte DIN EN ISO 9241<br />
Die „DIN EN ISO 9241 – Ergonomische Anfor<strong>der</strong>ungen für Bürotätigkeiten<br />
mit Bildschirmgeräten“ besteht aus insgesamt 17 Teilen, die (mit Ausnahme<br />
des Teil 1) jeweils vier verschiedenen Kategorien zugeordnet sind [vgl.<br />
GÖRNER u. a. (1999): 9 ff]:<br />
Teil 1 Allgemeine Einführung<br />
Allgemeine Leitsätze:<br />
Teil 2 Anfor<strong>der</strong>ungen an die Arbeitsaufgaben – Leitsätze<br />
Teil 10 Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
Teil 11 Anfor<strong>der</strong>ungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze<br />
Hardware:<br />
Teil 3 Anfor<strong>der</strong>ungen an visuelle Anzeigen<br />
Teil 4 Anfor<strong>der</strong>ungen an Tastaturen<br />
Teil 7 Anfor<strong>der</strong>ungen an visuelle Anzeigen bzgl. Reflexionen<br />
Teil 8 Anfor<strong>der</strong>ungen an Farbdarstellungen<br />
Teil 9 Anfor<strong>der</strong>ungen an Eingabegeräte außer Tastaturen<br />
Software:<br />
92 DIN: Deutsches Institut für Normung; EN: Europäische Norm; ISO: International Organization<br />
for Standardization (internationale Normierungsorganisation)<br />
93 Diese europäische Norm hat den Status einer deutschen Norm.<br />
99
Teil 10 Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
Teil 12 Informationsdarstellung<br />
Teil 13 Benutzerführung<br />
Teil 14 Dialogführung mittels Menüs<br />
Teil 15 Dialogführung mittels Kommandosprachen<br />
Teil 16 Dialogführung mittels direkter Manipulation<br />
Teil 17 Dialogführung mittels Bildschirmformularen<br />
Arbeitsumgebung:<br />
Teil 5 Anfor<strong>der</strong>ungen an Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung<br />
Teil 6 Anfor<strong>der</strong>ungen an die Arbeitsumgebung<br />
Die Norm DIN EN ISO 9241 verfolgt eine ergonomische Gestaltung <strong>von</strong><br />
Bildschirmarbeitsplätzen, wobei beson<strong>der</strong>s die individuellen Bedürfnisse <strong>der</strong><br />
Benutzer berücksichtigt werden: In Anlehnung an geltende Arbeitsschutzgesetze<br />
sollen zum einen mögliche Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz<br />
verringert werden. Zum an<strong>der</strong>en bietet diese Norm Hilfestellungen für die<br />
Konzeption, die Gestaltung sowie die Bewertung <strong>von</strong> Bildschirmarbeitsplätzen<br />
und <strong>der</strong> hier eingesetzten Software. Der Benutzer soll in die Lage versetzt<br />
werden, seine Aufgaben sicherer, effektiver, effizienter und zu seiner<br />
Zufriedenheit zu lösen.<br />
6.1.2 Die einzelnen Teile <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241<br />
Wie bereits aufgeführt, sind die einzelnen Teile dieser Norm verschiedenen<br />
Kategorien zugeordnet. Die Teile 3, 4, 7, 8 und 9 sind Bestandteil <strong>der</strong> Kategorie<br />
Hardware. Da diese für die Usability <strong>von</strong> Benutzungsoberflächen nicht<br />
relevant sind, wird in dieser Arbeit nicht näher auf sie eingegangen.<br />
Teil 2, einer <strong>der</strong> Leitsätze innerhalb <strong>der</strong> Norm, beschreibt das Ziel ergonomischer<br />
Bemühungen: Unter Beachtung <strong>von</strong> Gesundheit und Sicherheit sollen<br />
optimale Arbeitsbedingungen (auch für den privaten Nutzer) erreicht werden.<br />
Gleichzeitig sind technologische und wirtschaftliche Effizienz und Effektivität<br />
zu berücksichtigen. Die Durchführung <strong>der</strong> Arbeitsaufgabe soll für den<br />
Benutzer erleichtert werden, indem dieser während <strong>der</strong> Ausführung <strong>der</strong><br />
Aufgabe bei <strong>der</strong> Verbesserung seiner Fertigkeiten und Fähigkeiten unterstützt<br />
wird. Insgesamt soll das allgemeine Wohlbefinden des Nutzers geför<strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
100
Der Teil 11 wird <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Benutzerfreundlichkeit bzw. <strong>der</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
eingeführt. Diese Prinzipien sind in <strong>der</strong> Einführung in die Usability<br />
94 ausführlich definiert und erläutert.<br />
Nachfolgend werden die einzelnen Teile <strong>der</strong> Kategorie Software kurz beschrieben.<br />
Eine differenzierte Betrachtung <strong>der</strong> Inhalte ist im Rahmen dieser<br />
Arbeit nicht notwendig – beson<strong>der</strong>s deshalb, weil sich die einzelnen Inhalte<br />
in den Grundsätzen zur Dialoggestaltung (Teil 10) wi<strong>der</strong>spiegeln 95 .<br />
< Teil 12 behandelt die Darstellung <strong>von</strong> Informationen auf Bildschirmen.<br />
Hier gibt es Empfehlungen zur Organisation <strong>der</strong> Informationen<br />
zum Beispiel durch Fenster und Tabellen, sowie zur<br />
Anwendung <strong>von</strong> Kodierungstechniken wie Farben o<strong>der</strong> Abkürzungen<br />
[vgl. GÖRNER (1999): 29 ff].<br />
< In Teil 13 <strong>der</strong> ISO-Norm werden Möglichkeiten <strong>der</strong> Konzeption<br />
und Gestaltung <strong>von</strong> Benutzerführungen vorgestellt. Spezielle<br />
Aspekte in diesem Zusammenhang sind die Unterstützung des<br />
Benutzers bei Interaktionen, För<strong>der</strong>ung effizienter Benutzung,<br />
Vermeidung unnötiger mentaler Belastungen, Unterstützung bei<br />
<strong>der</strong> Behandlung <strong>von</strong> Fehlersituationen sowie die Unterstützung<br />
unterschiedlicher Fähigkeiten <strong>von</strong> Benutzern [vgl. GÖRNER<br />
(1999): 35 ff].<br />
< Teil 14 beinhaltet bedingte 96 Empfehlungen sowie Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an Menüs wie Menüstruktur (z.B. Ebenen, Gruppierung,<br />
Reihenfolge), Navigation, Auswahl und Ausführung in Menüs<br />
sowie ihre Darstellung (z.B. Unterscheidbarkeit, bildhafte Optionen)<br />
[vgl. GÖRNER (1999): 48 ff].<br />
< Teil 15 beinhaltet bedingte Empfehlungen sowie Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
für Benutzer-Rechner-Dialoge mit Hilfe <strong>von</strong> Kommandosprachen<br />
(Befehle in syntaktischer Anordnung). Sie beziehen sich<br />
zum Beispiel auf Struktur, Darstellung (z.B. Abkürzungen), Ein-<br />
Ausgabebetrachtungen (z.B. Fehlerkorrektur) sowie Rückmeldungen<br />
und Hilfen [vgl. GÖRNER (1999): 137 ff].<br />
< Teil 16 beschreibt die Gestaltung <strong>von</strong> Dialogen unter Nutzung<br />
94<br />
Der Begriff „Gebrauchstauglichkeit“ wird in Abschnitt 3.2: „Definition <strong>von</strong> Usability“<br />
behandelt.<br />
95<br />
Die „Grundsätze zur Dialoggestaltung“ werden im folgenden Kapitel 6.2 ausführlich<br />
erläutert.<br />
96<br />
„Bedingt“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Empfehlungen und Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
unter <strong>der</strong> Voraussetzung bestimmter Randbedingungen gelten.<br />
101
direkter Manipulationsmöglichkeiten, wie beispielsweise das<br />
Zeigen auf bestimmte Elemente und <strong>der</strong>en Verschieben innerhalb<br />
<strong>der</strong> Benutzeroberfläche [vgl. GÖRNER (1999): 140 ff].<br />
< Teil 17 beinhaltet bedingte Empfehlungen sowie Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
für das Ausfüllen <strong>von</strong> Formularen. Hier werden Themen wie<br />
Struktur (z.B. Anordnung), Eingabeüberlegungen (z.B. Auswahleingaben),<br />
Rückmeldungen und Navigation innerhalb mehrerer<br />
Formulare behandelt [vgl. GÖRNER (1999): 241 ff].<br />
Der Teil 10 <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241 beschreibt die „Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
97 “. Durch die Universalität dieser Kriterien sind diese auch für<br />
den Entwurf und die Gestaltung <strong>von</strong> Software sowie Webseiten beson<strong>der</strong>s<br />
relevant 98 (wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird). Diese Grundsätze können<br />
und sollten auf das Webdesign übertragen werden, da sie als Grundvoraussetzungen<br />
einer ergonomischen und damit benutzerfreundlichen Website<br />
gelten. Im Folgenden werden die Inhalte dieser Grundsätze sowie Empfehlungen<br />
zu ihrer Anwendung dargestellt.<br />
6.2 Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung<br />
Nachfolgend werden die einzelnen Grundsätze des Teil 10 <strong>der</strong> DIN EN ISO<br />
9241 aufgeführt und beschrieben. Zum Verständnis sind zuerst einige allgemeine<br />
Empfehlungen bezüglich des jeweiligen Grundsatzes erläutert. Anschließend<br />
werden jeweils beson<strong>der</strong>e Möglichkeiten <strong>der</strong> Anwendung bezüglich<br />
<strong>von</strong> Webseiten aufgelistet:<br />
6.2.1 Aufgabenangemessenheit<br />
„Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt,<br />
seine Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen.“ 99<br />
97 Ein Dialog beschreibt die Interaktion zwischen einem Benutzer und einem Dialogsystem<br />
zum Erreichen eines bestimmten Ziels. Der Begriff „Dialog“ stammt vermutlich noch<br />
aus <strong>der</strong> Zeit, in <strong>der</strong> Interaktionstechniken vor allem sprachlich vermittelt wurden. Mit<br />
dem Aufkommen grafischer Benutzungsoberflächen traten diese jedoch in den Hintergrund.<br />
98 Der Teil 10 <strong>der</strong> DIN EN ISO ist mittlerweile beson<strong>der</strong>s prominent.<br />
99 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.2 (1996)<br />
102
Der Benutzer wird bei <strong>der</strong> Lösung seiner Arbeitsaufgabe nur mit Informationen<br />
und Daten bzw. Tätigkeiten konfrontiert, die für die Erledigung <strong>der</strong><br />
Arbeitsaufgabe notwendig sind. Unnötige Arbeitsschritte, wie das Verlangen<br />
<strong>von</strong> nicht-relevanten Pflichtangaben in Formularen o<strong>der</strong> Ähnlichem, müssen<br />
vermieden werden. Ein- und Ausgaben sowie <strong>der</strong>en Gestaltung bzw. Darstellung<br />
sollten grundsätzlich an die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst sein.<br />
Wichtige Einflussfaktoren hierbei sind die entsprechenden Benutzerbelange<br />
sowie dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten.<br />
Nach Möglichkeit sollte das System bestimmte Ausführungen selbst erledigen<br />
können (z.B. automatisches Setzen <strong>der</strong> Positionsmarke innerhalb <strong>von</strong><br />
Formularen auf das nächste Eingabefeld). Wie<strong>der</strong>kehrende Arbeiten bzw.<br />
Eingaben des Benutzers sollten durch Speicherung <strong>der</strong> Daten minimiert<br />
werden. Es können auch Standardwerte (z.B. ein Datum) mit <strong>der</strong> Möglichkeit<br />
<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung vorgegeben werden. Bei alternativen Möglichkeiten kann<br />
ein Auswahlmenü zur Verfügung gestellt werden. Aufgerufene<br />
Hilfeinformationen müssen in direktem Bezug zur gegenwärtigen Aufgabe<br />
stehen.<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< minimale Ladezeiten <strong>der</strong> Grafiken<br />
< Speichern <strong>von</strong> Zwischenergebnissen während einer längeren online-Transaktion<br />
< Ansprechpartner für persönliche Fragen, Anregungen etc.<br />
6.2.2 Selbstbeschreibungsfähigkeit<br />
„Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn je<strong>der</strong> einzelne Dialogschritt<br />
durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist o<strong>der</strong><br />
dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird.“ 100<br />
Der Benutzer muss je<strong>der</strong>zeit nachvollziehen können, was das System bis zur<br />
aktuellen Situation durchgeführt hat, welche Arbeitsschritte er als nächstes<br />
ausführen kann und wie sich diese auf seine Arbeitsaufgabe auswirken.<br />
Durch unmittelbares Anzeigen <strong>der</strong> eingegebenen Daten erfolgt nach je<strong>der</strong><br />
Handlung eine zweckmäßige Rückmeldung. Bei evtl. schwerwiegenden<br />
Folgen einer Handlung muss eine vorherige Bestätigung angefor<strong>der</strong>t werden<br />
100 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.3 (1996)<br />
103
(ggf. mit Erläuterung). Diese wird beson<strong>der</strong>s beim endgültigen Löschen <strong>von</strong><br />
Daten o<strong>der</strong> dem endgültigen Versenden einer Produktbestellung notwendig.<br />
Für alle Texte wird eine einheitliche Terminologie verwendet, die für den<br />
Benutzer verständlich und an seine Kenntnisse angepasst. Dies schließt<br />
Unterschiede in Art und Umfang ein. Es sollten immer ganze Sätze verwendet<br />
werden, die ggf. mit Beispielen versehen sind. Wird eine Eingabe vom<br />
Benutzer erwartet, muss ein entsprechen<strong>der</strong> Hinweis erfolgen.<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Bezeichnungen <strong>der</strong> Hyperlinks müssen <strong>der</strong>en Ziel eindeutig erkennen<br />
lassen<br />
< Kontextspezifische Bedienhinweise bei online-Hilfen (siehe Abbildung<br />
6.1)<br />
Abbildung 6.1: „Deutsche Post“ – Ausschnitt aus <strong>der</strong> online-Hilfe mit Tipps zur Navigation<br />
in dieser Site.<br />
URL: http://www.deutschepost.de/dpag?lang=de_DE&xmlFile=30605<br />
104
6.2.3 Steuerbarkeit<br />
„Ein Dialog ist steuerbar, wenn <strong>der</strong> Benutzer in <strong>der</strong> Lage ist, den Dialogablauf<br />
zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen,<br />
bis das Ziel erreicht ist.“ 101<br />
Abbildung 6.2: „Space Art“ – Sehr gute Möglichkeit <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong> „Thumbnails 102 “:<br />
Am unteren Seitenrand werden alle auf dieser Seite verfügbaren Grafiken in einem kleinen<br />
Format angezeigt. Durch Anklicken werden diese dann in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> Seite größer darge-<br />
stellt (kann bei Bedarf durch nochmaliges Anklicken in voller Bildschirmgröße angezeigt<br />
werden).<br />
URL: http://www.space-art.de/german/start_space-art.htm<br />
101 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.4 (1996)<br />
102 Deutsch: Daumennägel (in Anlehnung an die Größe solcher Grafiken)<br />
105
Die Geschwindigkeit des Dialogs sollte unter <strong>der</strong> Kontrolle bzw. dem Einfluss<br />
des Benutzers stehen. Zum Beispiel dürfen Eingabefel<strong>der</strong> erst dann<br />
geän<strong>der</strong>t werden, wenn die Eingabe vom Benutzer bestätigt wurde. Dialoge<br />
sollten unterbrochen und Eingaben gelöscht werden können. Die Art <strong>der</strong><br />
Anzeige <strong>der</strong> Daten bzw. Informationen muss durch den Benutzer beeinflussbar<br />
sein (z.B. textliche o<strong>der</strong> bildliche Darstellung <strong>von</strong> Dateiauflistungen).<br />
Über die Nutzung alternativer Ein- und Ausgabegeräte (z.B. Maus o<strong>der</strong><br />
Tastatur bei Formularen) muss <strong>der</strong> Benutzer frei entscheiden können.<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Darstellung umfangreicher Grafiken als jeweils kleine Bil<strong>der</strong>, die<br />
bei Bedarf vergrößert werden können („Thumbnails“, siehe Abbildung<br />
6.2)<br />
< Möglichkeit <strong>der</strong> Unterbrechung und späteren Fortsetzung <strong>von</strong> Dateidownloads<br />
< Möglichkeit <strong>der</strong> Begrenzung <strong>von</strong> Treffern einer Suchmaschine<br />
6.2.4 Erwartungskonformität<br />
„Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen<br />
des Benutzers entspricht, zum Beispiel seinen Kenntnissen aus dem<br />
Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie den allgemein<br />
anerkannten Konventionen.“ 103<br />
Alle Informationen werden einheitlich dargestellt: Gleiche Elemente sehen<br />
auf allen Webseiten gleich aus und sind stets an <strong>der</strong>selben Stelle zu finden.<br />
Entsprechend erfüllen dieselben Tasten bzw. Eingaben die gleichen Funktionen.<br />
Der verwendete Wortschatz muss dem Benutzer vertraut sein. Werden<br />
erwartete Antwortzeiten überschritten, sollte dem Benutzer eine entsprechende<br />
Information darüber angezeigt werden.<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Unterstreichen <strong>von</strong> Text ausschließlich bei Hyperlinks<br />
< Link zurück zur Startseite oben links<br />
< Benutzung eines „Warenkorbs“ im online-Shop darf noch keinen<br />
Kauf auslösen<br />
103 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.5 (1996)<br />
106
6.2.5 Fehlertoleranz<br />
„Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz<br />
erkennbar fehlerhafter Eingaben entwe<strong>der</strong> mit keinem o<strong>der</strong> mit minimalem<br />
Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann.“ 104<br />
Das System unterstützt den Benutzer beim Vermeiden sowie (ggf.) Entdecken<br />
<strong>von</strong> Eingabefehlern; Benutzereingaben dürfen nicht zu Systemabbrüchen<br />
führen. Auftretende Fehler müssen angezeigt und erläutert werden, ggf.<br />
mit Vorschlägen zu Korrekturmöglichkeiten. Letztere sollten bei Bedarf<br />
zeitlich aufgeschoben werden können. Bei automatischen Korrekturen müssen<br />
entsprechende Hinweise erfolgen. Daten werden vor ihrer Verarbeitung<br />
vom System überprüft.<br />
Abbildung 6.3: „Telekom“ – Hier wird verständlich darauf hingewiesen, dass <strong>der</strong> Benutzer<br />
weitere Suchbegriffe eingeben sollte.<br />
URL: http://oetb.teleauskunft.de/DB4Web/es/oetb2ort/oetb_1.htm<br />
104 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.6 (1996)<br />
107
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Fehlermeldungen in <strong>der</strong> Sprache des Benutzers anzeigen (siehe<br />
Abbildung 6.3)<br />
< Automatische Überprüfung <strong>der</strong> Daten vor dem Absenden auf<br />
Vollständigkeit und Plausibilität<br />
< Beibehalten bereits eingegebener Informationen beim Rückwärtsbewegen<br />
innerhalb <strong>der</strong> Website (Daten dürfen nicht scheinbar verloren<br />
gehen)<br />
6.2.6 Individualisierbarkeit<br />
„Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an<br />
die Erfor<strong>der</strong>nisse <strong>der</strong> Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkeiten<br />
und Vorlieben des Benutzers zulässt.“ 105<br />
Im System sollte es Anpassungsmöglichkeiten an die Erfor<strong>der</strong>nisse <strong>der</strong><br />
Arbeitsaufgabe und Vorlieben des Benutzers sowie seinem individuellen<br />
Wissen und seinen Fähigkeiten geben. Eine Möglichkeit sind hier alternative<br />
Formen <strong>der</strong> Darstellung (z.B. unterschiedliche Schriftgrößen). Für den Anwen<strong>der</strong><br />
ist es hilfreich, wenn <strong>der</strong> Umfang sowie Detaillierungsgrad <strong>von</strong><br />
Erläuterungen entsprechend dem Benutzerwissen verän<strong>der</strong>bar ist. Für unterschiedliche<br />
Arbeitsaufgaben sollten unterschiedliche Dialogtechniken auswählbar<br />
sein.<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Personalisierung (siehe Abbildung 6.4)<br />
105 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.7 (1996)<br />
108
Abbildung 6.4: „Amazon“ – Individuelle Empfehlungen in einem Webangebot durch Perso-<br />
nalisierung.<br />
URL: http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/stores/your/store-home/-<br />
/0/ref=cs_nav_tab_2/302-7842247-4891253<br />
6.2.7 Lernför<strong>der</strong>lichkeit<br />
„Ein Dialog ist lernför<strong>der</strong>lich, wenn er den Benutzer beim Erlernen des<br />
Dialogsystems unterstützt und anleitet.“ 106<br />
Nützliche Regeln und grundlegende Konzepte <strong>der</strong> Website sollten dem<br />
Benutzer zugänglich gemacht (z.B. durch eine Sitemap), sowie relevante<br />
106 DIN EN ISO 9241-10 Abschnitt 3.8 (1996)<br />
109
Lernstrategien unterstützt werden (z.B. Umschalten zwischen Hilfeinformation<br />
und passenden Beispielen).<br />
Empfehlungen für Webseiten:<br />
< Darstellung <strong>der</strong> Website-Struktur<br />
< Möglichkeit <strong>von</strong> Probebuchungen, -käufen etc.<br />
6.3 Bewertung <strong>der</strong> Normen und ihre Anwendbarkeit<br />
Ein häufiges Problem in <strong>der</strong> Anwendung <strong>von</strong> Normen und den in ihnen<br />
festgelegten Standards ist, dass sie dazu tendieren, etliche Jahre hinter den<br />
tatsächlichen Gegebenheiten hinterherzuhinken. Meist sind sie zudem so<br />
allgemein formuliert, dass sie keine wirkliche Hilfe sind [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 40].<br />
Insbeson<strong>der</strong>e in ergonomischen Normen sind technische Genauigkeit, also<br />
explizite Angaben o<strong>der</strong> Meßmethoden, nicht möglich. Gleichzeitig stellen<br />
ergonomische Normen aber einen ungefähren Stand <strong>der</strong> arbeitswissenschaftlichen<br />
Forschung sowie die jeweilige Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet<br />
dar (diese Faktoren können sich jedoch im Laufe <strong>der</strong> Entwicklung verän<strong>der</strong>n).<br />
Das Ziel ergonomischer Normen ist, dass in <strong>der</strong> Entwicklung neuer Produkte<br />
auch ergonomischen Zielsetzungen Nachdruck verliehen wird. Diese sind<br />
allgemein gehalten, da sich die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse und Arbeitsweisen<br />
nicht in eine Vorschrift pressen lassen. Aber gerade dadurch<br />
bieten Normen den notwendigen Spielraum für verschiedene individuelle<br />
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnisse <strong>der</strong> Endanwen<strong>der</strong>.<br />
Normen können Hinweise und Anregungen während des Entwurfs des Produktes<br />
geben und bereits erprobte Lösungsmöglichkeiten vorschlagen. Die<br />
Befolgung <strong>von</strong> Normen kann jedoch die ergonomische Güte eines Produktes<br />
nicht sicherstellen. Das richtige Vorgehen in diesem Fall ist eine jeweils<br />
gelungene Anpassung an individuell vorliegende Arbeitsverhältnisse, was<br />
stets aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Benutzer zu betrachten ist. Normen sollen keine Prüflisten<br />
darstellen, die mit „richtig“ o<strong>der</strong> „falsch“ abgearbeitet werden können.<br />
Der Teil 10 <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241 enthält ergonomische Grundsätze in<br />
allgemeiner Form, welche bezüglich verschiedener Aufgaben und Arbeitssituationen,<br />
bestimmter Anwendungen und Techniken sowie unterschiedlicher<br />
110
Umgebungen frei angewendet werden können. Zwischen den einzelnen<br />
Grundsätzen bestehen Beziehungen, die nicht unabhängig <strong>von</strong>einan<strong>der</strong> sind,<br />
son<strong>der</strong>n sich gegenseitig beeinflussen: Bei <strong>der</strong> Anwendung des Teils 10 <strong>der</strong><br />
DIN EN ISO 9241 müssen die Vorteile <strong>der</strong> einzelnen Grundsätze bezüglich<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Arbeitsaufgabe sowie den verschiedenen Benutzergruppen<br />
herausgearbeitet und gegenüber den an<strong>der</strong>en abgewogen und verschieden<br />
gewichtet werden.<br />
Die Verwendung <strong>von</strong> Normen kann nicht ohne weiteres in jedem Fall ihrer<br />
Anwendung eine optimale Benutzbarkeit garantieren. Für jede neue Entwicklung<br />
<strong>von</strong> Software o<strong>der</strong> Webseiten müssen <strong>der</strong>en zukünftige Anwendungen,<br />
Zielgruppen, Arbeitsumgebungen sowie technische Möglichkeiten<br />
neu betrachtet und dementsprechend verarbeitet werden.<br />
111
7 Usability in <strong>der</strong> Nutzer-Website-<br />
Wechselwirkung<br />
Das Aussehen <strong>von</strong> Webseiten richtet sich nicht nur nach psychologischen<br />
o<strong>der</strong> wirtschaftlichen Aspekten. Im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Usability stehen immer<br />
die Anwen<strong>der</strong>, ihre Ziele, Interessen und Wünsche. Aber gerade <strong>der</strong> (einzelne)<br />
Benutzer ist oft eine unbekannte Größe. Um diese greifbar zu machen,<br />
wird in diesem Kapitel auf Merkmale <strong>von</strong> Nutzern eingegangen sowie <strong>der</strong>en<br />
Verhalten auf Webseiten erläutert. Im Anschluss werden Strukturen <strong>von</strong><br />
Websites sowie verschiedene Arten <strong>von</strong> Webseiten beschrieben – Maßnahmen,<br />
mit denen Webangebote auf die Bedürfnisse und Interessen <strong>der</strong> Benutzer<br />
zugeschnitten werden.<br />
7.1 Nutzerprofil<br />
Webseiten, die usability-tauglich sein sollen, sind stets für die Benutzer zu<br />
gestalten. Hierbei gibt es verschiedene Faktoren, die beachtet werden müssen.<br />
Um diese zu spezifizieren, werden nachfolgend individuelle sowie<br />
allgemeine Voraussetzungen <strong>von</strong> Nutzern sowie <strong>der</strong>en Verhalten auf Webseiten<br />
erläutert.<br />
7.1.1 Individuelle Voraussetzungen<br />
Während <strong>der</strong> Nutzung <strong>von</strong> Webseiten spielen für jeden einzelnen Nutzer<br />
verschiedene individuelle Bedingungen eine Rolle:<br />
Kulturell geprägtes Wissen<br />
Nutzerprofil<br />
Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale<br />
Kulturell geprägtes Wissen entsteht durch Erfahrungen, die ein <strong>Mensch</strong> im<br />
Laufe seines Lebens je nach Herkunft (unterschiedliche Kontinente, Nationalitäten,<br />
Gesellschaften) macht, sowie durch die Einflüsse <strong>der</strong> Umgebung,<br />
in <strong>der</strong> er lebt. Kulturelle Faktoren sind je nach Kulturkreis und Nationalität<br />
112
charakterisiert, wie zum Beispiel Sprachstile, Leserichtungen, Farbwirkungen<br />
o<strong>der</strong> spezifische Bedeutungen <strong>von</strong> Zeichen. Zusätzlich gibt es auch<br />
firmen- bzw. berufsspezifisches Wissen wie Fachsprachen o<strong>der</strong> Corporate<br />
Identities.<br />
Die jeweils anvisierte Zielgruppe wird durch verschiedene Faktoren charakterisiert.<br />
Mit <strong>der</strong>en Hilfe kann ein Nutzerprofil beschrieben werden. Hierzu<br />
gehören Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivation <strong>der</strong> Webbenutzer.<br />
Um ein genaues Nutzerprofil zu erstellen, ist eine Adressatenanalyse hilfreich,<br />
bei <strong>der</strong> folgende Benutzermerkmale nachgefragt werden [vgl. LOHSE<br />
(2001) 16 – 18]:<br />
Altersstruktur: eine o<strong>der</strong> mehrere Altersgruppen?<br />
welche Altersgruppen?<br />
Bildungsstand: intellektuelle Ebene<br />
Hintergrundwissen<br />
Berufliches Niveau: Geschäftsleute, Künstler etc.<br />
Soziales Umfeld: Gesellschaftsschicht<br />
etc.)<br />
(Arbeiter, Selbständige<br />
Materielles Umfeld: finanzielle Mittel und Möglichkeiten<br />
ggf. Kaufverhalten: Bevorzugung bestimmter Produkte (z.B. Markenartikel)<br />
Technische<br />
Webkenntnisse:<br />
Kenntnis <strong>von</strong> Hilfsprogrammen, Fachbegriffen<br />
etc.<br />
Mit diesen Benutzermerkmalen korrelieren verschiedene Aufgaben- und<br />
Tätigkeitsmerkmale: Schwierigkeit und Komplexität <strong>der</strong> Arbeitsaufgaben,<br />
Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit <strong>der</strong> Benutzer, Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Benutzerunterstützung, Verfügbarkeit des Systems sowie Häufigkeit <strong>der</strong><br />
Benutzung 107 [vgl. WANDMACHER (1993): 7 f].<br />
Bei Zusammenführung <strong>der</strong> Benutzermerkmale mit den Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmalen<br />
kann eine Analyse <strong>der</strong> Zielgruppe erstellt werden, welche<br />
die Basis für eine angemessene Benutzer- bzw. Aufgabenorientierung <strong>der</strong><br />
Webseiten darstellt. Hierbei werden die Ergebnisse <strong>der</strong> Analyse umso genauer,<br />
je mehr individuelle Faktoren bekannt sind. Doch genau dieser Sach-<br />
107 Auf diese Aufgabenmerkmale wird detailliert im Kapitel 6: „Gesetze und Normen als<br />
formale Basis <strong>der</strong> Usability“ eingegangen.<br />
113
verhalt stellt bei <strong>der</strong> Gestaltung sowie <strong>der</strong> Bewertung <strong>von</strong> Webseiten ein<br />
Problem dar: Die Vielzahl möglicher Eigenschaften <strong>von</strong> Benutzern und<br />
Benutzergruppen sind zum Teil inkompatibel, zum Teil unbekannt. Um<br />
dieses Problem zu lösen, wird nachfolgend eine Möglichkeit vorgestellt, mit<br />
<strong>der</strong>en Hilfe verschiedene Benutzer-, Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale auf<br />
einen Nenner gebracht werden können.<br />
7.1.2 Möglichkeiten zur generellen Umsetzung <strong>von</strong> unterschiedlichen<br />
individuellen Faktoren<br />
Soll eine Webseite auf eine begrenzte, genau spezifizierbare Zielgruppe<br />
zugeschnitten werden, müsste eine Adressatenanalyse durchgeführt und<br />
entsprechend angewendet werden. In <strong>der</strong> Praxis wird dies jedoch selten <strong>der</strong><br />
Fall sein. Im Gegenteil: In <strong>der</strong> Regel werden mit einer Webseite so viele<br />
Besucher wie möglich anvisiert, und diese besitzen meist unterschiedlichste<br />
Voraussetzungen und Eigenschaften.<br />
Eine Lösung kann hier eine Überbrückung <strong>der</strong> Differenzen zwischen den<br />
Nutzerprofilen durch ein gutes und natürliches Design sein. Donald A. Norman<br />
hat ein Konzept zu <strong>der</strong> Psychologie <strong>von</strong> Gebrauchsgegenständen erstellt,<br />
welches hier wegen seines generellen Praxisbezuges direkt auf Webseiten<br />
anwendbar ist. Norman entwirft ein Modell (siehe Abbildung 7.1), in welchem<br />
er die Zusammenhänge zwischen Designer, System und Benutzer<br />
darstellt [vgl. NORMAN (1989): 14 ff]:<br />
Designmodell<br />
Designer Benutzermodell Benutzer<br />
Systembild<br />
System<br />
Abbildung 7.1: Konzeptuelle Modelle [nach NORMAN (1989): 28]<br />
Interaktion<br />
114
Das Designmodell ist das konzeptuelle Modell des Designers. Das Benutzermodell<br />
ist ein konzeptuelles Modell, welches die Wünsche, Ziele und<br />
Handlungen des Benutzers beschreibt; es dient dem Entwurf <strong>von</strong> interaktiven<br />
Systemen. Das Systembild stellt den für den Benutzer sichtbaren Teil<br />
des Gerätes bzw. <strong>der</strong> Benutzungsoberfläche dar.<br />
Gemäß Donald A. Norman entsteht gutes und natürliches Design durch die<br />
Verwendung <strong>von</strong> zwei zentralen Prinzipien:<br />
Konzeptuelles Modell<br />
Sichtbarkeit<br />
Konzeptuelle Modelle sind Denkmodelle, die <strong>Mensch</strong>en <strong>von</strong> sich selbst,<br />
an<strong>der</strong>en, <strong>der</strong> Umwelt sowie den Dingen, mit denen sie Umgang haben,<br />
erstellen. Sie werden durch Erfahrung und Anleitung gebildet. Ein gutes<br />
konzeptuelles Modell ermöglicht es uns, Auswirkungen unserer Handlungen<br />
vorherzusehen.<br />
Sichtbarkeit wird erreicht, indem die wichtigsten Teile und Elemente eines<br />
Systems die richtige Botschaft hinsichtlich <strong>von</strong> Handlungen vermitteln. Das<br />
heißt, es müssen an dieser Stelle natürliche Signale (Hinweise) verwendet<br />
werden, welche vom Benutzer interpretiert werden können, ohne dass er<br />
bewusst darüber nachdenken muss.<br />
An diesem Punkt ist man wie<strong>der</strong> bei dem Konzept <strong>der</strong> „Affordance“, welches<br />
bereits in Kapitel 3: „Einführung in Usability“ beschrieben wurde. Hier<br />
ist zu beobachten, dass man beim Thema Usability immer wie<strong>der</strong> auf das<br />
Prinzip <strong>der</strong> Intuitivität stößt.<br />
Individualität bezüglich einzelner Nutzer o<strong>der</strong> Nutzergruppen ist nur bedingt<br />
umsetzbar. Intuitivität jedoch kann, durch Schaffung eines gemeinsamen<br />
Nenners, für eine sehr viel größere Anzahl <strong>von</strong> Nutzern erreicht werden.<br />
Entscheidend hierbei ist das richtige „Mapping“ 108 , welches im Idealfall zu<br />
unmittelbarem Verständnis führt. Das heißt, dass zu (geplanten) Handlungen<br />
bestimmte beabsichtigte Vorgänge folgen. Dieser Ablauf wird unterstützt<br />
durch enge und natürliche Beziehungen zwischen <strong>der</strong> Bedienungsvorrich-<br />
108 „Mapping“ bedeutet eine gewisse Beziehung zwischen zwei Dingen, wie zum Beispiel<br />
eine Betätigung und ihr reales Ergebnis.<br />
115
tung und ihrer Funktion 109 sowie durch angemessene Rückmeldungen zu den<br />
eigenen Handlungen.<br />
Konzeptuelle Modelle dienen dem Entwurf <strong>von</strong> interaktiven Systemen.<br />
Hinsichtlich <strong>von</strong> Webseiten sollen die eben aufgeführten Prinzipien mit<br />
Hilfe einiger Beispiele belegt werden: A) Buttons werden ähnlich wie bereits<br />
aus <strong>der</strong> Technik bekannte Knöpfe dargestellt 110 , da Benutzer durch den<br />
(langen) Gebrauch technischer Geräte wissen, dass solche gedrückt werden<br />
müssen, um eine Funktion auszulösen. B) Formulare auf Webseiten stellen<br />
Eingabefel<strong>der</strong> und -zeilen dar, wie sie in ähnlicher Form aus<br />
Papierformularen bekannt sind. Dies assoziiert das Eintragen <strong>von</strong> Text. C)<br />
Leser erhalten mehr Informationen über einen bestimmten Begriff, indem sie<br />
diesen zuerst auswählen und ihn danach (beispielsweise in einem Buch)<br />
nachschlagen. Das gleiche geschieht auf Webseiten – <strong>der</strong> Nutzer wählt einen<br />
Begriff durch Betätigen eines Links aus – das „Nachschlagen“ wird durch<br />
das Hypertextsystem übernommen.<br />
Bestimmend für eine gute Usability <strong>von</strong> Webseiten ist, dass das Design-<br />
Modell mit dem Benutzer-Modell übereinstimmt und im entsprechenden<br />
Systembild visualisiert wird. Hierbei können allerdings Designkonflikte<br />
auftreten – Differenzen zwischen Design, Funktion, und Intuitivität. Es gilt,<br />
diese Differenzen zu überwinden, einen kooperativen Ausgleich zwischen<br />
allen Standpunkten zu erzielen und somit das für den Benutzer am besten<br />
geeignete Systembild zu entwerfen.<br />
7.1.3 Benutzerziele und Benutzerverhalten auf Webseiten<br />
Benutzer verhalten sich auf Webseiten sehr unterschiedlich. Je nach mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger vorhandenen Aufgabenzielen wenden sie verschiedene Navigationsstrategien<br />
an [nach HOLZINGER (2001): 262]:<br />
< Beim „Searching“ 111 wird explizit nach einem vorgegebenen Ziel<br />
gesucht.<br />
< Beim „Scanning“ 112 wird ein großes Informationsgebiet oberflächlich<br />
überflogen.<br />
109<br />
Hierbei können äußere Analogien und kulturelle Standards genutzt werden.<br />
110<br />
Der Begriff „Button“ stammt aus <strong>der</strong> englischen Sprache und bedeutet übersetzt „Knopf“.<br />
111<br />
„Searching“: suchend<br />
112<br />
„Scanning“: abtasten, Webseiten überfliegen<br />
116
Beim „Exploring“ 113 versucht <strong>der</strong> Benutzer, den Umfang aller<br />
verfügbaren Informationen zu einem bestimmten Thema herauszufinden.<br />
< Beim „Browsing” 114 navigiert <strong>der</strong> Nutzer orientierungslos und<br />
unstrukturiert durch Websites.<br />
Während dieser verschiedenen Arten <strong>von</strong> Navigationsstrategien verfolgen<br />
die Benutzer verschiedene Ziele und Interessen, wie Beschaffen <strong>von</strong> Informationen,<br />
Kaufen (und Verkaufen), Unterhaltung o<strong>der</strong> Zeit vertreiben.<br />
Jared M. Spool hat die Handlungen und Ziele <strong>von</strong> Nutzern auf Webseiten<br />
genauer kategorisiert, wobei Hierarchie hinsichtlich des jeweiligen kognitiven<br />
Aufwandes entsteht [vgl. SPOOL (1999): 6]:<br />
< Auf <strong>der</strong> untersten Handlungsstufe werden einfache Tatsachen herausgefunden<br />
(BSP: Kann ich ein bestimmtes Produkt für weniger<br />
als 15 Euro kaufen?).<br />
< Auf <strong>der</strong> zweiten Stufe vergleichen die Benutzer verschiedene<br />
Tatsachen (BSP: Ist dieses Produkt billiger bei A o<strong>der</strong> bei B?).<br />
< Auf <strong>der</strong> dritten Stufe versucht <strong>der</strong> Nutzer, Beurteilungen zu treffen<br />
(BSP: Ist dieses Produkt für meine Anwendungsziele geeignet?).<br />
< Auf <strong>der</strong> obersten Handlungsstufe werden die getroffenen Beurteilungen<br />
miteinan<strong>der</strong> verglichen (BSP: Welches ist das beste<br />
Produkt für unter 15 Euro?).<br />
Die genauen Ausprägungen <strong>der</strong> Wünsche und Interessen <strong>von</strong> Benutzern<br />
können sehr komplex sein und sich schnell verän<strong>der</strong>n. So kann es passieren,<br />
dass die Benutzer während des Auswahlprozesses ihre Ziele verfeinern, in<br />
eine an<strong>der</strong>e Strategie <strong>der</strong> Navigation wechseln o<strong>der</strong> diese abbrechen. Die<br />
Ziele selbst können <strong>von</strong> langer Dauer sein o<strong>der</strong> schon nach kurzer Zeit verworfen<br />
werden [vgl. MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 22 ff].<br />
7.2 Die Struktur <strong>von</strong> Webseiten<br />
Auf Webseiten kann ein komplexes System vielfältiger Inhalte präsentiert<br />
und diese jeweils verschieden dargestellt werden 115 . Nachfolgend werden<br />
113 „Exploring“: auskundschaftend<br />
114 „Browsing“ bedeutet so viel wie: <strong>von</strong> Webseite zu Webseite blättern, stöbern<br />
115 Hier sind evtl. Urheberrechte zu beachten.<br />
117
konzeptuell die Zielsetzung <strong>von</strong> Webseiten und <strong>der</strong>en Planung sowie die<br />
strukturelle Darstellung <strong>der</strong> Inhalte erläutert.<br />
7.2.1 Die Zielsetzung als Gerüst<br />
Um die Usability <strong>von</strong> Webseiten zu überprüfen, muss genau bekannt sein,<br />
was mit diesen Seiten vermittelt werden soll. Hier hilft im Vorfeld eine<br />
genaue Zielsetzung. Um Ziele sowie Zielsetzungen zu bestimmen und in<br />
späteren Usability-Evaluationen genau überprüfen zu können, ist es ratsam,<br />
in einem ersten Schritt alle Absichten genau zu definieren: Was soll vermittelt<br />
werden? Wie und womit soll dies vermittelt werden?<br />
Um eine bessere Umsetzung <strong>der</strong> Ziele sowie eine geeignete spätere Überprüfung<br />
zu gewährleisten, können diese ersten Überlegungen operationalisiert<br />
werden. Das heißt, dass das primäre Grobziel auf einzelne Detailziele herunter<br />
gebrochen wird und auf diese Art und Weise alle späteren Elemente einer<br />
Website eindeutig bestimmt werden. Hierbei müssen evtl. Ungewissheiten<br />
ausgeschlossen werden, um eine spätere sinnvolle Anwendung sowie Messbarkeit<br />
zu erreichen. Die Gesamtheit aller Teilziele definiert die spätere<br />
Website. Durch solch eine Operationalisierung kann die gesamte Zieldefinition<br />
auf Vollständigkeit überprüft werden.<br />
In dieser Phase <strong>der</strong> Vorbereitung ist zu beachten, dass noch nicht auf die<br />
eigentlichen Inhalte eingegangen wird. Deren Auswahl erfolgt anhand <strong>der</strong><br />
Definitionen <strong>der</strong> einzelnen Teilziele erst in einem zweiten Schritt: In diesem<br />
werden die Inhalte den verschiedenen Zieldefinitionen zugeordnet [LOHSE<br />
(2001): 20 ff]. Wichtig ist, dass hierbei stets <strong>der</strong> Bezug zur eigentlichen<br />
Intention <strong>der</strong> Webseiten beibehalten und die Gestaltung an den Benutzer<br />
angepasst wird.<br />
Webseiten sind für den Benutzer Hilfsmittel, mit denen er mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
definierte Aufgaben bearbeiten kann. Dabei glie<strong>der</strong>t sich die Bearbeitung<br />
solcher Aufgaben mit Hilfe eines Computersystems in zwei Problemkategorien<br />
[vgl. WANDMACHER (1993): 6 f]: Das Sachproblem ist abhängig <strong>von</strong><br />
<strong>der</strong> eigentlichen Aufgabe, den jeweiligen Benutzermerkmalen sowie <strong>der</strong><br />
Funktionalität des Systems. Das Interaktionsproblem stellt die Verwendung<br />
des Systems bzw. <strong>der</strong> Webseiten als Werkzeug zur Aufgabenbearbeitung dar.<br />
Durch eine optimale Einheit <strong>von</strong> Merkmalen <strong>der</strong> Benutzungsoberfläche<br />
sowie <strong>der</strong> Funktionalität verschmelzen beide Probleme zu einem Minimum –<br />
und stellen eine gute Web-Usability dar.<br />
118
7.2.2 Aufbau<br />
Webseiten sind auf unterschiedlichste Art und Weise aufgebaut. Entscheidend<br />
ist, dass <strong>der</strong> Benutzer sich in den Verzweigungen <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Seiten zurecht findet. Nachfolgend werden die Formen <strong>der</strong> Website-<br />
Strukturen erläutert [vgl. LOHSE (2001): 37 f]:<br />
Hierarchische Struktur<br />
Sequenzielle Struktur<br />
Netzstruktur<br />
Bei <strong>der</strong> hierarchischen Struktur (siehe Abbildung 7.2) werden die einzelnen<br />
Seiten auf Ebenen gruppiert, unter denen die Informationen jeweils nach<br />
inhaltlichen Gesichtspunkten angeordnet sind. Dadurch entsteht eine Hierarchie<br />
<strong>von</strong> oben nach unten. Solch eine Struktur ist beson<strong>der</strong>s bei größeren<br />
Websites geeignet, da <strong>der</strong> Benutzer hier leichter die inhaltlichen Zusammenhänge<br />
erkennen kann, welche Verbindungen zwischen den einzelnen Seiten<br />
bestehen und wie die Seiten jeweils zu erreichen sind.<br />
Bereich<br />
1<br />
Start<br />
Bereich<br />
2<br />
Abbildung 7.2: Beispiel für eine hierarchische Struktur<br />
Info<br />
1<br />
Bereich<br />
3<br />
Info<br />
2<br />
119
In <strong>der</strong> sequenziellen Struktur (siehe Abbildung 7.3) werden die einzelnen<br />
Webseiten linear angeordnet. Dadurch ist die einzige Möglichkeit <strong>der</strong> Navigation<br />
das schrittweise Erreichen <strong>der</strong> jeweils nächsten Seite. Diese Art <strong>der</strong><br />
Strukturierung eignet sich beson<strong>der</strong>s für Informationen, die <strong>von</strong>einan<strong>der</strong><br />
abhängig sind und optimal in einer bestimmten Reihenfolge konsumiert<br />
werden sollen.<br />
Abbildung 7.3: Sequenzielle Struktur<br />
Start<br />
Seite<br />
1<br />
Seite<br />
2<br />
Die Netzstruktur (siehe Abbildung 7.4) ermöglicht eine beson<strong>der</strong>s große<br />
Variationsbreite <strong>der</strong> Navigation. Durch Quersprünge zwischen den einzelnen<br />
Seiten kann <strong>der</strong> Benutzer selbst bestimmen, zu welcher Seite er mit Hilfe<br />
eines einzigen Mausklicks gelangt. Solch eine Netzstruktur kann, beson<strong>der</strong>s<br />
bei einem sehr umfangreichen Seitenangebot, für den Benutzer schnell unübersichtlich<br />
werden und zu Orientierungsschwierigkeiten führen. In dieser<br />
Situation sind für die Benutzer „Sitemaps“ hilfreich. Durch sie wird die<br />
Struktur <strong>der</strong> Seiten bzw. <strong>der</strong> Inhalte modellhaft visualisiert 116 .<br />
116 Vgl. Kapitel 8.1.3: „Inhaltsverzeichnisse“<br />
120
Info<br />
1<br />
Abbildung 7.4: Netzstruktur<br />
Start<br />
Info<br />
2<br />
Info<br />
4<br />
Info<br />
3<br />
In <strong>der</strong> Praxis werden die aufgeführten Website-Strukturen häufig miteinan<strong>der</strong><br />
vermischt, so dass zum Beispiel ein Gefüge aus Netzstruktur und hierarchischer<br />
Struktur zustande kommt. Je nach Inhalt <strong>der</strong> Seiten kann dies<br />
durchaus sinnvoll sein. Entscheidend ist, dass sich <strong>der</strong> Benutzer innerhalb<br />
<strong>der</strong> Website gut zurecht findet und je<strong>der</strong>zeit weiß, an welchem Punkt <strong>der</strong><br />
Struktur er sich gerade befindet, welche Möglichkeiten es noch gibt und wie<br />
er zu den jeweiligen Seiten gelangen kann.<br />
Unter Verwendung <strong>der</strong> beschriebenen Strukturen werden Websites aufgebaut.<br />
Gleichzeitig verfolgen die Betreiber unterschiedliche inhaltliche Absichten,<br />
welche nachfolgend dargestellt werden.<br />
7.3 Arten <strong>von</strong> Websites<br />
Websites bzw. <strong>der</strong>en Betreiber wollen mit ihren Inhalten verschiedene Intentionen<br />
verwirklichen. Hier können generell (beispielhaft) kommerzielle Ziele,<br />
Informationsübermittlung, Präsentation o<strong>der</strong> Serviceangebote genannt werden.<br />
Eine genauere Einordnung <strong>von</strong> Websites in verschiedene Kategorien wird<br />
durch eine Charakterisierung <strong>der</strong> Sites bezüglich ihrer Inhalte und Nutzungszwecke<br />
vorgenommen [vgl. MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 290 ff].<br />
121
Nachfolgend werden diese Kategorien im Einzelnen beschrieben, wobei<br />
bereits auf Anfor<strong>der</strong>ungen an die Websites hinsichtlich <strong>der</strong> Gestaltung und<br />
des Designs Bezug genommen wird.<br />
7.3.1 Identitäts-Sites<br />
Identitäts-Sites dienen primär dazu, ein Unternehmen bekannt zu machen,<br />
seine Image-Werte zu verstärken und eine visuelle Visitenkarte zu veröffentlichen.<br />
Ziel einer Identitäts-Site ist es, darzustellen, um welches Unternehmen<br />
es sich hier handelt und wofür dieses steht (siehe Abbildung 7.5).<br />
Abbildung 7.5: „Helicopter Tours“<br />
URL: http://www.hubschrauber-rundflug-berlin.de/homepage.htm<br />
Für diese Webauftritte gibt es mehrere Klassen <strong>von</strong> Benutzern [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 302 f]:<br />
< Potentielle Besucher dieser Unternehmen sind an Standort, Anfahrtsplänen,<br />
Öffnungszeiten und Telefonnummern interessiert.<br />
122
Bewerber möchten sich vor allem über das Unternehmensprofil<br />
und offene Stellen 117 informieren.<br />
< Sog. „Freaks“ interessieren sich für bestimmte Marken und Produktpräsentationen.<br />
< Analysten möchten Meldungen über das Unternehmen, die Zusammensetzung<br />
des Vorstands und Jahresberichte einsehen.<br />
< Journalisten suchen Fotos vom Unternehmen und seinen Mitarbeitern<br />
sowie Presseaussendungen.<br />
< Die Gruppe <strong>der</strong> „Unbedarften“ sucht Telefonnummern o<strong>der</strong> E-<br />
Mail-Adressen <strong>von</strong> Freunden, die in diesem Unternehmen arbeiten.<br />
Die Anfor<strong>der</strong>ung an Identitäts-Sites besteht darin, ein einheitliches bzw.<br />
firmenspezifisches Design 118 zu verwenden. Außerdem müssen evtl. vorhandene<br />
externe Links eindeutig als solche gekennzeichnet werden.<br />
7.3.2 Informations-Sites<br />
Auf Informations-Sites steht das Abrufen und Konsumieren <strong>von</strong> Informationen<br />
im Vor<strong>der</strong>grund (siehe Abbildung 7.6). Beson<strong>der</strong>s deutlich wird dies<br />
zum Beispiel bei Nachrichten-Sites o<strong>der</strong> Nachschlagewerken. Die Qualität<br />
dieser Seiten ist abhängig vom jeweiligen (erfüllten) Informationsbedarf, <strong>der</strong><br />
Relevanz und Glaubwürdigkeit, <strong>der</strong> Adäquatheit <strong>von</strong> Produktbeschreibungen<br />
(bei entgeltlicher Information) sowie <strong>der</strong> Schnelligkeit, mit <strong>der</strong> ein Besucher<br />
über die entsprechenden Seiten einen Überblick gewinnen kann. Informations-Sites<br />
dienen zum „Scannen“ 119 genau so wie zum intensiven Lesen,<br />
sowie zum entgeltlichen Herunterladen <strong>von</strong> Dateien o<strong>der</strong> Programmen.<br />
An Informations-Sites gibt es eine Vielzahl <strong>von</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen: Auf je<strong>der</strong><br />
Ebene einer Site sollte ein guter Überblick über das Informationsangebot<br />
vorhanden und letzteres durch möglichst viele Arten zugänglich sein. Hilfreich<br />
sind Hinweise, wie ein Benutzer zu einer speziellen Information<br />
kommt, sowie Rubrikentitel mit Angaben zum Inhalt 120 und Quellenangaben.<br />
Weiterhin können zum Beispiel Auswahlmöglichkeiten nach Aktualität <strong>der</strong><br />
117<br />
Für diese Besucher können Bewerbungsbögen zum Herunterladen <strong>von</strong> großem Nutzen<br />
sein.<br />
118<br />
siehe Abschnitt 4.3.2: „Gestaltung“<br />
119<br />
siehe Abschnitt 7.1.3: „Verhalten auf Webseiten“<br />
120<br />
Solche Angaben können sein: Handelt es sich bei <strong>der</strong> vorliegenden Information um einen<br />
sachlichen Artikel o<strong>der</strong> um einen Kommentar o<strong>der</strong> eine Meinung? Außerdem Kenntlichmachen<br />
<strong>der</strong> Tiefe des Inhalts, sowie Anbieten <strong>von</strong> verwandten Beiträgen o<strong>der</strong><br />
Themen am Ende des Kapitels sowie Kontaktmöglichkeiten zu Experten.<br />
123
Information, Thema, Region etc. geschaffen werden. Hierzu ist eine gute<br />
Kategorisierung notwendig.<br />
Abbildung 7.6: „Universität Pa<strong>der</strong>born“<br />
URL: http://www.upb.de/cs/studium/<br />
7.3.3 Shopping-Sites<br />
Mit Hilfe <strong>von</strong> Shopping-Sites werden Produkte o<strong>der</strong> Dienstleistungen angeboten<br />
und verkauft (siehe Abbildung 7.7). Ziel dieser Seiten ist es, im Internet<br />
potentielle Kunden zum Abschluss eines Geschäfts zu bewegen und ggf.<br />
<strong>der</strong>en Kaufprozess mit zu beeinflussen. Letzteres trifft insbeson<strong>der</strong>e auf<br />
Nutzer zu, die nur ungenaue Vorstellungen <strong>von</strong> einem Produkt haben (im<br />
Gegensatz zu Kunden, die genau wissen, was sie wollen).<br />
Hier haben sich gut kategorisierte Kataloge, Suchfunktionen und Empfehlungen<br />
bewährt. Entscheidend für den Kauferfolg ist, dass ein möglichst<br />
124
ealistischer Eindruck vom jeweiligen Produkt entsteht, da dieser den Kauf<br />
entscheidet 121 .<br />
Abbildung 7.7: „Brigitte Hachenburg exclusiv“<br />
URL: http://www.brigitte-hachenburg.<br />
de/main.php?info=main_coll&bereich=34&colnr=340300311&gruppe=5<br />
7.3.4 Community-Sites<br />
Community-Sites sind Gemeinschaftsseiten, auf denen <strong>der</strong> Austausch <strong>von</strong><br />
Informationen und Meinungen Gleichgesinnter im Vor<strong>der</strong>grund steht (siehe<br />
Abbildung 7.8). Das Vorhaben <strong>der</strong> Betreiber solcher Seiten ist es, <strong>Mensch</strong>en<br />
zusammenzubringen und zum Verweilen und Mitmachen einzuladen. Häufig<br />
sind <strong>der</strong>artige Kommunikationselemente auch in an<strong>der</strong>e Arten <strong>von</strong> Sites<br />
integriert.<br />
Community-Sites müssen klar vermitteln, wie man in die Gemeinschaft<br />
eintreten kann, welche evtl. Aufnahmebedingungen es gibt und außerdem<br />
die Regeln des Miteinan<strong>der</strong>s erklären (für potentielle Teilnehmer ist es zudem<br />
immer interessant, wenn sie bereits vor einem Beitritt etwas über die<br />
121 Vgl. die Ausführungen zur Conjointanalyse in Kapitel 4.5.1: „Intentionsrealisierung“<br />
125
Mitglie<strong>der</strong> erfahren können). Der Vorgang <strong>der</strong> Veröffentlichung <strong>von</strong> Mitglie<strong>der</strong>beiträgen,<br />
welche evtl. durch einen Mo<strong>der</strong>ator ausgewählt werden,<br />
muss genau beschrieben sein. Eine Zensur <strong>der</strong> Kommunikation bzw. <strong>von</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Beiträgen schadet im Allgemeinen. Werbung sollte<br />
klar als solche erkennbar sein und ist grundsätzlich nur wenig zu verwenden.<br />
Aus technischer Hinsicht müssen Mechanismen zum gesicherten Kennenlernen<br />
(bezüglich Datenschutz) bereitgestellt werden.<br />
Abbildung 7.8: „Ägyptologie-Community“<br />
URL: http://www.aegyptologie.com/<br />
7.3.5 Unterhaltungs-Sites<br />
Unterhaltungs-Sites dienen ausschließlich zur persönlichen Zerstreuung. In<br />
ihnen werden überwiegend verschiedene Spiele angeboten (siehe Abbildung<br />
7.9). Der einzige Zweck solcher Internetauftritte liegt für den Anwen<strong>der</strong><br />
darin, dort Spaß zu haben und möglichst viel Zeit zu verbringen [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 306].<br />
126
Die beliebtesten Spiele sollten schon auf <strong>der</strong> ersten Ebene angeboten werden.<br />
Auf <strong>der</strong> jeweils nächsten Ebene folgen Aussagen über das Schwierigkeitsniveau<br />
und die Dauer des Spiels, die Bedienung, Spielregeln und dem ungefähren<br />
Ablauf. Bei komplizierten Spielen bietet sich ein Demo o<strong>der</strong> ein<br />
Modus zum Üben an. Für die Nutzer sind Angaben darüber, ob ein bestimmtes<br />
Spiel allein o<strong>der</strong> gemeinsam mit an<strong>der</strong>en Teilnehmern gespielt wird,<br />
sowie Bewertungen an<strong>der</strong>er Spieler sehr nützlich. Von großem Interesse sind<br />
auch Angaben darüber, ob und wie ein jeweiliger Spielstand unterbrochen<br />
und abgespeichert werden kann, sowie Tipps, Tricks und Lösungsbeschreibungen<br />
zum jeweiligen Spiel. Aussagen über (technische) Bedingungen und<br />
notwendiges Material sind Voraussetzung. Werbung o<strong>der</strong> erzwungene Interaktion<br />
sollte möglichst nicht eingesetzt werden.<br />
Abbildung 7.9: „Online-Spiele“<br />
URL: http://www.onlinespiele.org/index.html<br />
127
7.3.6 Lern-Sites<br />
Lern-Sites dienen vor allem dazu, Inhalte zu vermitteln und gleichzeitig<br />
Lernerfolge zu überprüfen (siehe Abbildung 7.10). Dies kann durch Selbsttests<br />
<strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> erfolgen, o<strong>der</strong> über Tests, bei <strong>der</strong>en Bestehen <strong>der</strong> Übende<br />
in die nächste Lernstufe aufsteigen kann. Ziel solcher Lern-Sites ist es,<br />
dem Lernenden auf elektronischem Wege schnell und benutzergerecht Informationen<br />
und Verstehensmöglichkeiten anzubieten.<br />
Abbildung 7.10: „Mathe Prisma“ – Ausschnitt aus einer Lern-Site, auf <strong>der</strong> durch eine<br />
Ampel visuell dargestellt wird, ob Lösungen richtig o<strong>der</strong> falsch sind.<br />
URL: http://www.math.uni-wuppertal.de/teach/MathePrisma/Module/Primz/<br />
Um mit einem Lernprogramm sinnvoll zu arbeiten, muss <strong>der</strong> Lernende zuerst<br />
die erfor<strong>der</strong>lichen Anmeldeformalitäten erfahren und welche Vorkenntnisse<br />
notwendig sind bzw. für welchen Wissenslevel dieses Programm ge-<br />
128
eignet ist. Der Anfang einer Lerneinheit innerhalb einer Website muss für<br />
den Benutzer problemlos zu finden sein und außerdem <strong>der</strong>en ungefähre<br />
Übungsdauer mitteilen. Weiter ist über notwendige Lernmittel zu informieren.<br />
Verschiedene Lernstile sollten berücksichtigt werden und die Übungsaufgaben<br />
sollten (z.B. durch Verlinkungen) <strong>von</strong> den Inhalten des eigentlichen<br />
Lernstoffes logisch getrennt sein. Wie bei den Spiele-Seiten sollte dem<br />
Benutzer auch hier die Möglichkeit gegeben werden, Pausen einzulegen,<br />
Systemzustände abzuspeichern und evtl. individuelle Kommentare einfügen<br />
zu können. Durch den Einsatz <strong>von</strong> Multimedia besteht die Möglichkeit,<br />
vielfältige Lernmethoden zu unterstützen. Dies ist jedoch in einem angemessenen<br />
Rahmen zu erfolgen und darf die Benutzer in ihren Lernschritten und<br />
dem jeweiligen Lerntempo nicht überfor<strong>der</strong>n [vgl. MANHARTSBERGER,<br />
MUSIL (2002): 301].<br />
7.3.7 Intranet und Extranet<br />
Das Intranet ähnelt technisch dem Internet und beinhaltet Webseiten, welche<br />
in einem geschützten Bereich hinter einer „Firewall“ 122 gesichert sind. Ein<br />
Intranet wird meist als unternehmensinternes Netzwerk betrieben und ist<br />
nicht aus dem Internet zugänglich.<br />
In einem Extranet kann auf die jeweiligen Webseiten auch über das Internet<br />
zugegriffen werden. Ihre Benutzung ist aber nur für bestimmte Benutzergruppen<br />
mit Hilfe <strong>von</strong> Passwörtern möglich. Der Zugang ist durch Zertifikate<br />
und ähnliche Mechanismen geschützt, <strong>der</strong> Datentransport erfolgt verschlüsselt,<br />
häufig über speziell gesicherte Leitungen.<br />
In beiden Systemen sind zum Beispiel anspruchsvollere Datenbankabfragen<br />
o<strong>der</strong> die Veröffentlichung <strong>von</strong> speziellen „Plug-ins“ 123 erfor<strong>der</strong>nden Informationen<br />
möglich. Mitteilungen, Berichte und Ähnliches können zielgruppenspezifische<br />
Inhalte und Formulierungen beinhalten. Die in Intranet und<br />
Extranet notwendige Datensicherheit darf die Benutzer in ihrer Arbeit nicht<br />
behin<strong>der</strong>n.<br />
Die unterschiedlichen Strukturen und Arten <strong>von</strong> Websites entstehen durch<br />
die Gestaltung <strong>der</strong> Betreiber bzw. Hersteller und die verschiedenen Inhalte,<br />
122<br />
„Firewalls“ (deutsch: Brandschutzmauer) werden als Schwelle zwischen zwei Netzen<br />
betrieben.<br />
123<br />
„Plug-ins“: Erweiterungen eines Browsers, um Dateiformate anzeigen zu können, die <strong>der</strong><br />
jeweilige Browser nicht standardmäßig anzeigt.<br />
129
die diese vermitteln wollen. Webseiten sollen, beson<strong>der</strong>s wenn sie für bestimmte<br />
Benutzergruppen konzipiert sind, charakteristische Interessen und<br />
Ziele dieser erreichen. Es kann jedoch keine Zuordnung einzelner Webseitenarten<br />
zu bestimmten Benutzerprofilen (wie sie in Abschnitt 7.1.1: „Individuelle<br />
Voraussetzungen“ erläutert wurden) vorgenommen werden. Denn<br />
<strong>von</strong> individuellen Benutzereigenschaften und -voraussetzungen lässt sich<br />
nicht auf Interessen und Ziele schließen.<br />
Im folgenden Kapitel werden Empfehlungen zur Gestaltung sowie zum<br />
Design <strong>von</strong> Webseiten aufgezeigt.<br />
130
8 Gestaltung und Design<br />
Der Maßstab für den Erfolg einer Webseite ist die Akzeptanz durch die<br />
Benutzer. Solange sie das Gefühl haben, für das Erreichen ihres Zieles auf<br />
dem richtigen Weg zu sein, klicken sie sich weiter durch die Seiten [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 22]. Um beim Nutzer dieses sichere<br />
Gefühl zu bewirken, sind in <strong>der</strong> Gestaltung und dem Design einer Website<br />
verschiedene Aspekte zu beachten, die <strong>von</strong> <strong>der</strong> Navigation über das Layout<br />
bis hin zur guten Formulierung <strong>von</strong> Texten reichen. In diesem Kapitel sollen<br />
diese Faktoren erläutert werden.<br />
8.1 Die Navigation in einer Website<br />
Die Navigationsstruktur entspricht dem grundsätzlichen Aufbau einer Website<br />
124 . Sie ist eines <strong>der</strong> wichtigsten Elemente für eine benutzerfreundliche<br />
Bedienung, denn durch sie kann unterstützt werden, dass <strong>der</strong> Nutzer stets<br />
den Überblick über seinen Standort behält und schnell und zielsicher an die<br />
gewünschte Information gelangt. Allerdings können zu viele Verzweigungen<br />
zur Desorientierung („Lost-in-Hyperspace-Problem“ 125 ) führen. Aus diesem<br />
Grund sollte <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> Auswahlmöglichkeiten möglichst optimiert<br />
werden [vgl. HOLZINGER (2001): 262]. Verschiedene Arten <strong>von</strong><br />
Navigationsmöglichkeiten (z.B. Navigationsleiste, Inhaltsverzeichnisse)<br />
bieten eine hohe Flexibilität, stellen aber gleichzeitig erhöhte Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an das Navigationssystem, wenn <strong>der</strong> Benutzer die Orientierung nicht<br />
verlieren soll. Hinsichtlich einer guten Usability bedeutet dies, dass es bei<br />
<strong>der</strong> Gestaltung einige Aspekte gibt, die beachtet werden sollten: Der Nutzer<br />
sollte <strong>von</strong> je<strong>der</strong> Seite mit Hilfe eines entsprechenden Links zu einer Stelle<br />
(z.B. <strong>der</strong> Heimat-Seite) gelangen können, die ihm das Gesamtangebot<br />
darbietet. Informationen sind logisch zusammenzufassen und einzelne<br />
Webseiten dementsprechend eindeutig zu glie<strong>der</strong>n. Eine wesentliche Rolle<br />
bezüglich des Auffindens <strong>von</strong> Informationen spielt auch, ob die Besucher<br />
124 Hiermit sind die hierarchische, die sequenzielle und die Netzstruktur gemeint, wie sie<br />
bereits im vorangegangenen Kapitel 7.2.2: „Aufbau <strong>von</strong> Webseiten“ beschrieben<br />
wurden.<br />
125 Deutsch: Verloren im „Hyperspace“; Hier steht <strong>der</strong> Benutzer vor offenen Fragen wie: Wo<br />
kam ich her? Wie kam ich hier hin? Wie geht es <strong>von</strong> hier aus weiter?<br />
131
dens <strong>von</strong> Informationen spielt auch, ob die Besucher einzelne Seiten sequenziell<br />
o<strong>der</strong> gezielt (mit Hilfe einer lokalen Suchmaschine) nach Informationen<br />
durchsuchen, die jeweilige Site mittels einer Internetsuchmaschine erreichen<br />
o<strong>der</strong> ob sie die Adresse einer bestimmten Seite bereits kennen (z.B. ein<br />
„Bookmark“ 126 gesetzt haben) [vgl. LOHSE (2001): 40 ff].<br />
Eine gute Navigation wird durch den Einsatz verschiedener entsprechen<strong>der</strong><br />
Elemente erreicht, <strong>von</strong> denen im Folgenden die Gängigsten 127 beschrieben<br />
werden.<br />
8.1.1 Navigationsleisten<br />
Navigationsleisten stellen die klassische Navigationsform dar. Am häufigsten<br />
werden permanente Leisten am linken und oberen Bildrand verwendet.<br />
Abbildung 8.1: „HARIBO“ – Fast ausschließlich durch Grafiken gestaltete Navigation einer<br />
Startseite.<br />
URL: http://www.haribo.com/planet/sprachauswahl.html<br />
126 Deutsch: Lesezeichen (Webadressen können im Browser abgespeichert werden)<br />
127 Es gibt eine Reihe weiterer Navigationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel sog. „Smartmaps“<br />
o<strong>der</strong> „Hyperbolic trees“ (beson<strong>der</strong>e Form <strong>von</strong> Sitemaps), auf die hier nicht näher<br />
eingegangen wird.<br />
132
Die einzelnen Elemente einer Navigationsleiste bestehen aus Texten o<strong>der</strong><br />
Grafiken. Deren Gestaltung richtet sich nach dem jeweiligen Inhalt einer<br />
Webseite: Seiten mit eher sachlichem Inhalt verwenden häufig Auswahlpunkte,<br />
die nur aus Texten bestehen. Kleinere Websites mit einem insgesamt<br />
eher künstlerischen Layout können beson<strong>der</strong>s gut grafische Auswahlelemente<br />
(Buttons) nutzen (siehe Abbildung 8.1) [vgl. LOHSE (2001): 47 f]. Diese<br />
sollten jedoch stets zum Gesamtlayout passen.<br />
Durch eine Anordnung <strong>der</strong> Navigationselemente können Inhalte bereits an<br />
dieser Stelle entsprechend dem (groben) Aufbau <strong>der</strong> Site geglie<strong>der</strong>t werden.<br />
Ein häufig verwendetes Steuerelement innerhalb einer Navigationsleiste sind<br />
„Pulldown-Menüs“ 128 . Durch ihre Beschaffenheit bieten sie eine breitere<br />
Vielfalt <strong>von</strong> Auswahlmöglichkeiten und ermöglichen dem Benutzer (durch<br />
gleichzeitig integrierte Hyperlinks) durch „Überspringen“ <strong>von</strong> Ebenen o<strong>der</strong><br />
Seiten zudem, schneller zu seinen gewünschten Informationen zu gelangen.<br />
Bei <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong> Navigationsleisten ist es notwendig, dass am Ende<br />
längerer Seiten die wichtigsten Navigationsmöglichkeiten (mindestens einen<br />
„Zurück zum Anfang“-Link) noch einmal angezeigt werden, da sich die<br />
Leiste beim „Scrollen“ 129 verschiebt und die oben angebrachten Navigationselemente<br />
nur noch teilweise o<strong>der</strong> gar nicht mehr sichtbar sind.<br />
Anstelle <strong>von</strong> Navigationsleisten wird häufig auch eine für den Benutzer<br />
ähnlich aussehende Variante <strong>der</strong> Navigation verwendet, die aber an<strong>der</strong>e<br />
technische Möglichkeiten besitzt: „Frames“ 130 sind Navigationsleisten, die<br />
im Fenster des Internet-Browsers ständig sichtbar sind und auch beim oben<br />
beschriebenen „Scrollen“ stets an <strong>der</strong>selben Stelle verbleiben (in diesem Fall<br />
wird nur die Kernseite bewegt). Der Nachteil dieser Navigationsmöglichkeit<br />
ist, dass Benutzer, die nicht über die zugehörige Einstiegsseite auf die entsprechende<br />
Seite gelangen, son<strong>der</strong>n die Webseite über den Link einer Internetsuchmaschine<br />
finden, den Frame nicht sehen können, da in diesen Fällen<br />
nur die Kernseite angezeigt wird. Sofern innerhalb <strong>der</strong> Kernseite kein entsprechen<strong>der</strong><br />
Link (z.B. zur Startseite) eingebunden ist, haben Besucher auf<br />
dieser Webseite keine Navigationsmöglichkeiten und können somit nur diese<br />
einzelne Seite einsehen.<br />
128 „Pulldown-Menüs“ sind Menüs, bei denen ausgehend <strong>von</strong> einem Oberbegriff weitere<br />
Unterbegriffe aufgeblättert, angezeigt und ausgewählt werden können.<br />
129 Deutsch: rollen. Durch bewegen <strong>der</strong> Rollbalken des Browser kann eine Seite nach oben,<br />
unten sowie seitlich verschoben werden.<br />
130 Deutsch: Rahmen<br />
133
Grundsätzlich sollten sich <strong>der</strong> Umfang und die Gestaltung <strong>von</strong> Navigationssystemen<br />
sowie <strong>der</strong> Einsatz möglicher Auswahloptionen (z.B. „Pulldown-<br />
Menüs“) am gesamten Inhalt sowie <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Website orientieren.<br />
8.1.2 Hyperlinks<br />
Die bereits erwähnten Hyperlinks sind die technischen Verbindungen <strong>der</strong><br />
Seiten. Sie müssen korrekt funktionieren. Das heißt, Verweise, die auf nichtverfügbaren<br />
Seiten enden, wirken auf den Benutzer frustrierend und können<br />
diesen veranlassen, die jeweilige Website nicht wie<strong>der</strong> zu besuchen. Text-<br />
Links sollten in jedem Fall schnell als solche erkannt werden (Konvention 131 :<br />
unterstrichen und farblich vom Fließtext herausgehoben) und einen inhaltlichen<br />
Bezug zum Ziel vermitteln. Hyperlinks können auf Ziele innerhalb<br />
einer Seite verweisen, auf an<strong>der</strong>e Seiten <strong>der</strong>selben Website, sowie auf Seiten<br />
an<strong>der</strong>er Websites (externer Link).<br />
Auf <strong>der</strong> Einstiegsseite einer Website sollten ausschließlich die Hauptlinks<br />
angebracht werden – und diese möglichst sinnvoll. Auf diese Weise wird ein<br />
einfaches und klares Bild dieser Seite vermittelt. Auf allen folgenden Seiten<br />
müssen jeweils Links zur Startseite vorhanden sein sowie Rücksprungmöglichkeiten<br />
auf vorhergehende Seiten. Letzteres ist beson<strong>der</strong>s wichtig, da das<br />
Betätigen des Back-Buttons des Browsers zu keinem Ergebnis innerhalb <strong>der</strong><br />
Site führt, wenn <strong>der</strong> Besucher über eine Suchmaschine auf eine Webseite<br />
gelangt ist (sog. Quereinstieg). Durch Verweise innerhalb einer Seite kann<br />
das Betätigen <strong>der</strong> Browser-Rollbalken ersetzt werden, und <strong>der</strong> Benutzer<br />
gelangt beson<strong>der</strong>s auf langen Seiten schneller und ohne Suchen zur gewünschten<br />
Textpassage. Zweckmäßig sind außerdem Hilfe-Links, hinter<br />
denen weitere Suchmöglichkeiten und Tipps zur Benutzung des jeweiligen<br />
Webangebots zu finden sind, sowie Links mit <strong>der</strong> Möglichkeit zu einer<br />
Kontaktaufnahme mit dem Autor einer Seite, um Kommentare, Anregungen<br />
und Ähnliches mitteilen zu können.<br />
8.1.3 Inhaltsverzeichnisse<br />
Wie in einem Buch sind Inhaltverzeichnisse auch auf Webseiten für den<br />
Benutzer eine gute Möglichkeit, einen vollständigen Überblick über den<br />
Inhalt <strong>der</strong> Site zu gewinnen. Aufgrund <strong>der</strong> technischen Funktionen des Hy-<br />
131 Entsprechende technische Möglichkeiten sind in den meist genutzten Browsern voreinge-<br />
stellt.<br />
134
pertextsystems eröffnen solche Inhaltsverzeichnisse hier neue Möglichkeiten<br />
und können an<strong>der</strong>s repräsentiert werden, wie zum Beispiel durch „Sitemaps“<br />
und „Imagemaps“.<br />
„Sitemaps“ bestehen aus Verweisen auf Webseiten, die in einem grafischen<br />
Baum entsprechend <strong>der</strong> (vereinfachten) Websitehierarchie aufgeführt sind<br />
(siehe Abbildung 8.2). Sie bieten zum einen eine ausgezeichnete Orientierung<br />
und zum an<strong>der</strong>en die Möglichkeit, durch Anklicken <strong>der</strong> Links sofort zu<br />
den gewünschten Seiten und Informationen zu gelangen. Je größer die Website<br />
ist, umso sinnvoller und hilfreicher wird eine Sitemap.<br />
Abbildung 8.2: „AG Blömer“ – Ausschnitt aus einer häufig verwendeten Form einer Sitemap.<br />
Die Darstellung orientiert sich an Inhaltsverzeichnissen aus dem Print-Bereich.<br />
URL: http://webserv.upb.de/cs/ag-bloemer/sitemap/<br />
„Imagemaps“ sind Grafiken, mit Hilfe <strong>der</strong>er durch Auswählen bestimmter<br />
gekennzeichneter Bereiche auf die zugehörige Seite verwiesen wird (z.B.<br />
Landkarten mit Informationen über bestimmte Regionen).<br />
135
8.1.4 Informationen suchen und finden<br />
Für Benutzer, die sich noch nicht sicher sind, welches Aufgabenziel sie auf<br />
einer Website genau verfolgen, gibt es noch die Möglichkeit <strong>von</strong> Rundreisen<br />
(„Guided Tour“ 132 ) und Suchmaschinen. Das Angebot einer „Guided<br />
Tour“ (siehe Abbildung 8.3) durch einzelne Seiten ist beson<strong>der</strong>s bei sehr<br />
umfangreichen Websites sinnvoll 133 .<br />
Abbildung 8.3: „WDR“ – Der Beginn einer geführten Tour durch eine Website.<br />
URL: http://www.wdr.de/unternehmen/guided.html<br />
Für Rundreisen werden beson<strong>der</strong>s wichtige Seiten und Funktionen eines<br />
Webangebotes vom Hersteller zusammengestellt. Der Besucher kann dann<br />
132 Deutsch: Geführte Rundreise<br />
133 In diesem Fall wird das Webangebot mit Hilfe technischer Möglichkeiten didaktisch<br />
aufbereitet.<br />
136
durch einen entsprechenden „Startlink“ (z.B. auf <strong>der</strong> Einstiegsseite) sequenziell<br />
<strong>von</strong> einer Information zur nächsten gelangen.<br />
Suchmaschinen sind meist durch eine o<strong>der</strong> mehrere Formularzeilen visualisiert,<br />
in die Suchbegriffe eingegeben werden können. Diese werden dann<br />
durch die Suchmaschine aufgespürt, und dem Benutzer wird eine Liste <strong>von</strong><br />
Verweisen auf Webseiten angezeigt. Lokale Suchmaschinen (siehe Abbildung<br />
8.4) sind ab einem größeren Umfang <strong>von</strong> Texten und Inhalten innerhalb<br />
einer Website empfehlenswert: Eine Volltextsuche ist insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
Veröffentlichung <strong>von</strong> Dokumenten wie Produktkatalogen, Artikelsammlungen,<br />
aktuellen Meldungen und Ähnlichem sehr hilfreich [vgl. LOHSE (2001):<br />
51]. Der Benutzer kann so beson<strong>der</strong>s schnell an das gewünschte Ziel seiner<br />
Informationssuche gelangen.<br />
Abbildung 8.4: „Die Welt“ – Eine detaillierte lokale Suchmaschine zum Auffinden <strong>von</strong><br />
Artikeln im Archiv.<br />
URL: http://www.welt.de/finden/<br />
137
Eine sinnvoll strukturierte Navigation allein genügt für eine gute Web-<br />
Usability nicht. Der zweite sofort sichtbare Faktor bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong><br />
Webseiten ist das Design. Es unterstützt und verbessert die Erkennbarkeit<br />
einzelner Elemente sowie den Gesamteindruck einer Seite. Wie ein angemessenes<br />
und zugleich ansprechendes Design erzielt werden kann, wird im<br />
Folgenden erläutert.<br />
8.2 Das Layout einer Webseite<br />
Das Layout, die Text- und Bildgestaltung einer Webseite, hat einen wesentlichen<br />
Einfluss auf die Akzeptanz <strong>der</strong> gesamten Site durch die Besucher. Da<br />
das „Äußere“ einer Seite in <strong>der</strong> Regel das erste ist, was ein Besucher wahrnimmt,<br />
wird häufig schon bei einem hier entstehenden ersten Eindruck die<br />
Entscheidung getroffen, ob eine Seite gefällt o<strong>der</strong> nicht. Die Farbgestaltung<br />
und <strong>der</strong> Aufbau einer Webseite müssen auf den Benutzer angenehm wirken,<br />
zwischen Texten und Grafiken, dem Einsatz multimedialer Elemente sowie<br />
<strong>der</strong> (gezielten) Verwendung <strong>von</strong> leeren Bereichen sollte eine gewisse Harmonie<br />
bestehen.<br />
Grundsätzlich ist eine durchgängig konsistente Struktur aller wichtigen<br />
Elemente wie Navigationsleisten, Logos, Überschriften und Ähnlichem,<br />
erfor<strong>der</strong>lich. Texte müssen leicht lesbar sein 134 . Durch die Verwendung <strong>von</strong><br />
Grafiken o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en visuellen o<strong>der</strong> akustischen Elementen soll das Verständnis<br />
<strong>der</strong> Texte unterstützt werden o<strong>der</strong> diese sogar vollständig ersetzen.<br />
Alle Elemente müssen attraktiv, informativ und produktiv nutzbar sein.<br />
Nachfolgend werden Anregungen zur usability-unterstützenden Gestaltung<br />
einzelner Bestandteile einer Webseite gegeben.<br />
8.2.1 Atmosphäre<br />
Die Atmosphäre, die eine Webseite vermittelt, bestimmt häufig den Gesamteindruck,<br />
den <strong>der</strong> Benutzer während <strong>der</strong> Arbeit mit einer Website erlangt<br />
(siehe Abbildung 8.5): Eine sachliche und geradlinige Anordnung <strong>der</strong> Elemente<br />
sowie <strong>der</strong>en Ausrichtung aneinan<strong>der</strong> wirken formell. Solch eine<br />
Struktur wird beson<strong>der</strong>s in geschäftlichen Bereichen verwendet. Wird diese<br />
134 browserabhängig<br />
138
Gestaltung durch avantgardistische o<strong>der</strong> futuristische Elemente aufgelockert,<br />
werden Leistungsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten <strong>von</strong> Produkten<br />
assoziiert [vgl. LOHSE (2001): 57 f]. Letztere Variante stellt gleichzeitig<br />
einen Mittelweg zwischen geschäftlicher Sachlichkeit und künstlerischem<br />
Anspruch dar.<br />
Die Betreiber <strong>von</strong> Webseiten müssen sich schon vor Beginn <strong>der</strong> Gestaltung<br />
<strong>der</strong> Seiten genau überlegen, was sie mit ihrem Internetauftritt bezwecken<br />
und welche Stimmung sie in diesem Zusammenhang vermitteln möchten 135 .<br />
Dieses Vorhaben muss dann beständig und wi<strong>der</strong>spruchsfrei in <strong>der</strong> Entwicklung<br />
umgesetzt werden.<br />
Abbildung 8.5: „Ferrari Deutschland“ – Zusätzlich zur bekannten Marke suggeriert die<br />
Aufmachung dieser Webseite edlen Luxus.<br />
URL: http://www.ferrari-deutschland.de/site_deutschland/<br />
8.2.2 Farben<br />
Durch einen zielgerichteten Einsatz <strong>von</strong> (Hintergrund-)Farben auf Webseiten<br />
können Inhalte visualisiert und gleichzeitig gegeneinan<strong>der</strong> abgegrenzt wer-<br />
135 siehe Abschnitt 7.2.1: „Die Zielsetzung als Gerüst“<br />
139
den. Farben dienen <strong>der</strong> Ästhetik, sind Stimmungsmacher und wirken unbewusst<br />
auf uns ein. Verschiedene Bedeutungen <strong>von</strong> Farben werden vom<br />
<strong>Mensch</strong>en in Natur und Kultur erlernt. Ein systematischer Farbeinsatz auf<br />
Webseiten unterstützt gewünschte Ziele sowie die Wie<strong>der</strong>erkennbarkeit des<br />
gesamten Erscheinungsbildes durch die Benutzer 136 . Farben dienen zur visuellen<br />
Unterscheidung und Trennung <strong>von</strong> Bereichen. Navigation und<br />
Benutzerführung werden auf diese Art erleichtert, und es wird eine gute<br />
Lesbarkeit bzw. Erkennbarkeit <strong>von</strong> Texten und Bil<strong>der</strong>n gewährleistet.<br />
Ein gezielter Farbeinsatz (siehe Abbildung 8.6) in optimaler Qualität und<br />
Quantität verbessert nicht nur die Benutzerführung, son<strong>der</strong>n reduziert auch<br />
die Augenbelastung [vgl. DRWEB.DE (2002)].<br />
Abbildung 8.6: „comdirect“ – Die Verwendung <strong>der</strong> Farben auf dieser Börsen-Webseite<br />
lässt alle Elemente und Texte gut erkennen und lesen.<br />
URL: http://informer2.comdirect.de/index.html<br />
136 Die Verwendung <strong>von</strong> Farben aus den 256 Standard-Bildschirmfarben sparen außerdem<br />
Speicher und Ladezeit.<br />
140
Farben sind insbeson<strong>der</strong>e bei ihrer Verwendung auf Webseiten in mehrfacher<br />
Weise verän<strong>der</strong>bar:<br />
< Farbtemperatur warm o<strong>der</strong> kalt<br />
< Helligkeit hell o<strong>der</strong> dunkel<br />
< Sättigung satte Farben sind voll gegenüber Pastelltönen<br />
< Umfeld Hintergrund beeinflusst Wahrnehmung<br />
< Jeweilige Proportion und gesamte Menge<br />
Um diese Möglichkeiten entsprechend einer verbesserten Web-Usability zu<br />
nutzen und umzusetzen, gibt es mehrere Gestaltungshinweise 137 , die entsprechend<br />
verschiedener Farbwirkungen eine unterschiedliche Rolle spielen:<br />
Grundsätzlich ist weniger mehr. Webseiten, die sehr bunt sind, lenken vom<br />
Wesentlichen ab, und ihr Nutzer kann einzelne Bereiche, Elemente o<strong>der</strong><br />
Daten nicht mehr fokussiert wahrnehmen. Um eine gute Erkennbarkeit sowie<br />
Orientierung zu gewährleisten, sollte ein Farbklima aus zwei Grundfarben<br />
erstellt und insgesamt nicht mehr als zehn verschiedene Farben verwendet<br />
werden. Gut kombinierbar sind unterschiedliche Farben mit jeweils<br />
ähnlicher Farbtemperatur. Soll aber eine Farbe gestalterisch auffallen, muss<br />
sie sich in ihrer Temperatur <strong>von</strong> ihrem Umfeld unterscheiden. Warme, helle<br />
Farben kommen dem Betrachter scheinbar entgegen, während kalte, dunkle<br />
Farben eher zurückweichen. Objekte in hellen Farben werden meist zuerst<br />
und auch länger betrachtet als Elemente in dunklen Farben. Es ist jedoch zu<br />
beachten, dass Minimal- und Maximalkontraste anstrengen. Vor allem<br />
Kombinationen <strong>von</strong> komplementären Farben 138 benötigen sehr viel Aufmerksamkeit.<br />
Zudem belasten sie die Augen.<br />
Bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> primären Elemente einer Webseite gibt es Farbwirkungen,<br />
die genau beachtet werden sollten [vgl. MANHARTSBERGER,<br />
MUSIL (2002): 192 ff]:<br />
Vor<strong>der</strong>grund, insbeson<strong>der</strong>e Texte<br />
137 Diese beruhen auf entsprechenden psychologischen Vorgängen, vgl. Kapitel 5.1: „Biologische<br />
Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung“<br />
138 Komplementäre Farben sind Farben, die sich auf dem Farbkreis gegenüber liegen.<br />
141
Hintergrund<br />
Bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong> Texten ist das wichtigste Ziel eine gute Lesbarkeit:<br />
Zwischen Schriftfarbe und Hintergrund ist ein starker Hell-Dunkel-Kontrast<br />
beson<strong>der</strong>s wichtig. Im Allgemeinen ist eine Positivdarstellung (dunkle<br />
Schrift auf hellem Hintergrund) besser lesbar als eine Negativdarstellung<br />
(helle Schrift auf dunklem Hintergrund). Farben stark verschiedener Wellenlängen<br />
(z.B. Komplementärfarben) sollten in Texten vermieden werden, da<br />
sie beim Leser den Eindruck eines Flimmerns verursachen.<br />
Häufigen Webbenutzern bereits bekannt sind die Konventionen für die farbliche<br />
Gestaltung <strong>von</strong> Hyperlinks. So sollten bestimmte Farben für Links bzw.<br />
bereits besuchte Links weiterhin eingehalten werden. Zum einen entsprechen<br />
sie weitgehend eben genannten Empfehlungen, zum an<strong>der</strong>en werden sie<br />
bereits so lange und häufig eingesetzt, dass <strong>der</strong> Benutzer sie inzwischen<br />
kennt und die Links entsprechend benutzen kann: Blau für Hyperlinks (Blau<br />
nicht für an<strong>der</strong>e Textelemente verwenden), Rot für aktivierte Hyperlinks,<br />
Violett für bereits besuchte Textlinks 139 .<br />
Hintergründe mit großen Flächen sind in strahlungsarmen Farben mit geringer<br />
Sättigung 140 zu gestalten, damit das Anschauen angenehmer für die<br />
Augen wird. Beson<strong>der</strong>s geeignet sind in diesem Fall Pastelltöne. Bezüglich<br />
<strong>der</strong> Hintergrundfarbe ist außerdem <strong>der</strong> Simultankontrast zu beachten. So<br />
wirkt zum Beispiel reines Grau auf verschiedenfarbigen Hintergründen<br />
jeweils an<strong>der</strong>s.<br />
Die Verwendung <strong>von</strong> Mustern o<strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>n zur Hintergrundgestaltung verschlechtert<br />
im Allgemeinen die Lesbarkeit, da <strong>der</strong> Kontrast ungleichmäßig,<br />
und das Auge beim Lesen abgelenkt werden. Wenn solche Elemente aus<br />
Gestaltungsgründen eingesetzt werden sollen, ist unbedingt darauf zu achten,<br />
dass <strong>der</strong> Kontrast innerhalb des Musters möglichst niedrig bleibt. Auch ein<br />
Hintergrundbild sollte kontrastarm zu den an<strong>der</strong>en Farbelementen sein und<br />
eine möglichst geringe Sättigung besitzen (z.B. hellgrau).<br />
139 Diese farblichen Gestaltungen <strong>von</strong> Hyperlinks sind Konvention (siehe Browsereinstellungen),<br />
sie sind aber nicht in jedem Fall ergonomisch.<br />
140 Je intensiver eine Farbe ist, desto stärker ist die Farbsättigung (Anteile <strong>von</strong> rot, grün und<br />
blau). So ist zum Beispiel ein kräftiges Blau stärker gesättigt als türkis. Die Farbhelligkeit<br />
bezieht sich hingegen auf den prozentualen Anteil <strong>von</strong> weiß in einer Farbe<br />
(Hellblau ist heller als Dunkelblau).<br />
142
Es gibt eine statistische Beliebtheitsskala <strong>von</strong> Farben, die sich je nach gelten<strong>der</strong><br />
Mode, Marketingentscheidungen und persönlichem Umfeld immer<br />
wie<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>t: An erster Stelle rangiert (im westlichen Kulturkreis) gegenwärtig<br />
blau, gefolgt <strong>von</strong> rot, grün und schwarz. Weiter hinten folgt weiß,<br />
braun gilt hingegen als wenig attraktiv [vgl. HELLER (2002)].<br />
Gleichzeitig gibt es einige langfristig bleibende Farbwirkungen. So wird im<br />
westlichen Kulturkreis rot als sehr stark wahrgenommen. Deshalb sollte<br />
diese Farbe auf Websites nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weiß wird<br />
häufig als Hintergrundfarbe verwendet. Sie erweckt im Allgemeinen einen<br />
Eindruck <strong>von</strong> Ordentlichkeit und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz dazu kann<br />
Schwarz unerwünschte Assoziationen hervorrufen, da diese Farbe häufig<br />
<strong>von</strong> vielen Un<strong>der</strong>ground- o<strong>der</strong> Erotik-Sites verwendet wird [vgl.<br />
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002): 193].<br />
Grundsätzlich sollte bei <strong>der</strong> Auswahl und dem Einsatz verschiedener Farben<br />
auf einer Webseite stets ein Bezug zum Inhalt und zu den Vorlieben <strong>der</strong><br />
Zielgruppe hergestellt, sowie das Prinzip <strong>der</strong> Konsistenz eingehalten werden.<br />
8.2.3 Anordnung <strong>der</strong> Elemente<br />
Die Anordnung <strong>der</strong> einzelnen Elemente auf einer Webseite sowie <strong>der</strong>en<br />
Ausrichtung zueinan<strong>der</strong> bestimmen (zusätzlich zur Atmosphäre) den Gesamteindruck,<br />
den ein Webangebot hinterlässt.<br />
Abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Anordnung <strong>der</strong> Elemente können zwei Layout-Arten<br />
unterschieden werden: Ein symmetrischer Stil, bei dem die Anzahl <strong>der</strong> Elemente<br />
gleich ist (z.B. jeweils die <strong>von</strong> Grafiken und Texten), suggerieren<br />
einen eher formellen und sachlichen Eindruck (siehe Abbildung 8.7). Ein<br />
eher informativer Eindruck wird durch ein asymmetrisches Layout vermittelt,<br />
bei dem die Anzahl <strong>der</strong> Elemente auf einer Seite ungleich ist. In <strong>der</strong> Praxis<br />
wird häufig eine Kombination aus beiden Stilen verwendet [vgl. LOHSE<br />
(2001): 58 f]. Grundsätzlich sollte aber die Anordnung <strong>der</strong> Elemente stets<br />
ausgewogen sein. Eine verbesserte Darstellung wird zusätzlich erreicht,<br />
indem Elemente bzw. Informationen entsprechend ihrer inhaltlichen Aussagen<br />
gemäß den Gestaltgesetzen 141 gruppiert werden.<br />
141 Siehe Kapitel 5: „Psychologische Grundlagen“<br />
143
Abbildung 8.7: „BND“ – Die Anzahl <strong>der</strong> Grafiken und Texte ist jeweils nahezu gleich. Ein<br />
insgesamt sehr sachlicher und informativer Stil.<br />
URL: http://www.bundesnachrichtendienst.de/ueber/index.htm<br />
8.2.4 Grafiken<br />
Auf Webseiten können standardmäßig (browserabhängig) drei Arten <strong>von</strong><br />
Rastergrafiken 142 verwendet werden, wobei hauptsächlich GIF- und JPEG-<br />
Grafiken genutzt werden:<br />
GIF-Grafik<br />
JPEG-Grafik<br />
PNG-Grafik<br />
142 Vektorgrafiken werden selten benutzt.<br />
144
Am häufigsten werden GIF-Grafiken (Graphic Interchange Format) verwendet.<br />
Sie besitzen eine sehr hohe Komprimierungsfähigkeit, ohne dass dabei<br />
Qualitätsverluste auftreten. Dafür haben sie aber nur eine geringe Ausgangsqualität<br />
und Farbtiefe. Sie können maximal 256 Farben darstellen. GIF-<br />
Grafiken werden deshalb vor allem für Design-Elemente wie zum Beispiel<br />
Schaltflächen o<strong>der</strong> Hintergründe verwendet, o<strong>der</strong> für Bil<strong>der</strong> mit geringer<br />
Farbqualität sowie für Animationen.<br />
Bei einer JPEG-Grafik (Joint Picture Experts Group), auch JPG genannt, ist<br />
eine Komprimierung zwar möglich, aber je stärker diese vorgenommen wird,<br />
umso größer sind gleichzeitig die Qualitätsverluste im Bild. JPG-Grafiken<br />
können bis zu 16 Millionen Farben darstellen und sind somit beson<strong>der</strong>s für<br />
Fotos geeignet.<br />
Die PNG-Grafik ist eine Mischung aus GIF und JPG. Sie kann verlustfrei<br />
(aber nicht fein abgestuft) komprimiert werden und ist für alle Arten <strong>von</strong><br />
Bil<strong>der</strong>n geeignet. Dieses Format hat sich aber bislang nicht durchgesetzt [vgl.<br />
LOUIS (2001): 271].<br />
Es gibt verschiedene Bild-Anzeigeverfahren, die in ihrer Verwendung für<br />
den Benutzer eine wichtige Rolle spielen. So können GIF-Grafiken „noninterlaced“<br />
o<strong>der</strong> „interlaced“ angezeigt werden 143 . Im „non-interlaced-<br />
Verfahren“ wird die Grafik zeilenweise an den Webbrowser geschickt und<br />
kann erst nach vollständigem Laden angezeigt werden. Beim „interlaced-<br />
Verfahren“ erfolgt eine paketweise Übertragung <strong>der</strong> GIF-Grafik, wobei die<br />
Pakete jeweils nur jede achte Zeile enthalten. Dadurch wird ein schrittweiser<br />
Bildaufbau möglich. Da bei dieser Methode schon während des Bildaufbaus<br />
sofort erste Bildfragmente angezeigt werden, reduziert dieses Verfahren<br />
beim Benutzer negative psychologische Wirkungen, die aufgrund des Wartens<br />
auf ein vollständiges Bild auftreten können [vgl. LOHSE (2001): 89].<br />
Durch den Einsatz des „interlaced-Verfahrens“ und <strong>der</strong> damit verbundenen<br />
scheinbar kürzeren Ladezeit <strong>von</strong> Grafiken wird die Usability einer Webseite<br />
unterstützt und die Zufriedenheit des Nutzers geför<strong>der</strong>t.<br />
Grafiken sollten grundsätzlich optimiert und ihre Ladezeiten minimiert<br />
werden, denn die Geschwindigkeit <strong>der</strong> Übertragung bzw. des jeweiligen<br />
143 Auch bei PNG-Grafiken sowie bei JPG-Grafiken („progressive JPG“) möglich.<br />
145
Seitenaufbaus ist ein großer Einflussfaktor bei <strong>der</strong> Akzeptanz einer Webseite.<br />
Beson<strong>der</strong>s bei <strong>der</strong> Einstiegsseite werden häufig nicht mehr als 5 bis 10 Sekunden<br />
Ladezeit akzeptiert [vgl. LOHSE (2001): 83]. Grafiken werden am<br />
besten so eingesetzt, dass sich aus <strong>der</strong> Dateigröße und <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Anzeige<br />
ein benutzerfreundlicher Kompromiss ergibt.<br />
Schönheit <strong>von</strong> Grafiken allein genügt nicht. Sie müssen einen erkennbaren<br />
Nutzen haben und in direktem Bezug zur vermittelnden Information stehen.<br />
Eine optimale Verwendung ist dann gegeben, wenn die jeweilige Grafik<br />
besser als alle an<strong>der</strong>en Elemente die vom Benutzer gewünschte Information<br />
vermittelt. So können beispielsweise grafische Navigationselemente die<br />
Erkennung und somit das navigieren vereinfachen, und an<strong>der</strong>e Elemente wie<br />
Texte lassen sich durch eine Ergänzung mit einer Grafik besser vom Nutzer<br />
einprägen. Sehr beliebt und stets ein Blickfang sind 3-D-Grafiken.<br />
Zu beachten ist jedoch, dass <strong>der</strong> Maßstab insgesamt stets lautet: Genau das<br />
einsetzen, was für den Benutzer hilfreich und gut ist.<br />
8.2.5 Multimediale Elemente<br />
Neben Grafiken werden weitere multimediale Elemente verwendet, wie<br />
Animationen (stumm ablaufende Bildfolgen), Video- o<strong>der</strong> Audiodateien. Die<br />
Verwendung solcher Elemente ist vor allem <strong>von</strong> den technischen Möglichkeiten<br />
abhängig sowie vom jeweils zu vermittelnden Stil einer Webseite.<br />
Grundsätzlich sind sie in geringem Umfang einzusetzen und nur dann, wenn<br />
sie Texte ersetzen können o<strong>der</strong> zum besseren Verständnis dieser beitragen<br />
sowie im Zusammenhang mit den zu vermittelnden Informationen stehen.<br />
Dies trifft insbeson<strong>der</strong>e auf Animationen zu: Häufige Animationen verwirren<br />
den Besucher und lenken seine Aufmerksamkeit <strong>von</strong> den eigentlichen<br />
Informationen ab. Bannerwerbung wird meist als störend empfunden 144 .<br />
8.2.6 Leere Bereiche<br />
Wenn eine Webseite mit Elementen wie Grafiken, Textbereichen o<strong>der</strong> Navigationselementen<br />
überladen und die Abstände zwischen diesen zu gering<br />
sind, wird das Erkennen beim Benutzer erheblich erschwert. Ungenutzte<br />
Bereiche, in denen nur die Hintergrundfarbe vorhanden ist, besitzen eine<br />
wichtige Funktion: Durch unbeschriebene Bereiche wird die menschliche<br />
144 Von den Werbetreibenden ist dies (im Sinne einer Ablenkung) ein gewünschter Effekt.<br />
146
Wahrnehmung besser auf die eigentlichen Elemente gelenkt und <strong>der</strong> Benutzer<br />
wird nicht durch eine überfrachtete Oberflächengestaltung belastet (siehe<br />
Abbildung 8.8).<br />
Abbildung 8.8: „berlin-tourismus-online“ – Diese Webseite lässt genügend Platz zwischen<br />
den einzelnen Elementen und unterstützt den natürlichen Lesefluss.<br />
URL: http://www.berlin-tourismus-online.de/<br />
Eine in diesem Sinne gut gestaltete Webseite unterstützt den Benutzer auf<br />
seiner Suche nach Informationen. Denn dadurch kann das übliche Lesemuster<br />
<strong>von</strong> oben links nach rechts unten durch bestimmte Positionierung <strong>von</strong><br />
Elementen gezielt manipuliert und somit die Aufmerksamkeit auf einzelne<br />
Elemente erhöht werden. Ziel ist, die Aufmerksamkeit des Benutzers so zu<br />
beeinflussen, wie es vom Hersteller einer Website gewünscht wird.<br />
8.2.7 Gestaltung <strong>von</strong> Texten und Schriften<br />
Die lateinische Schrift wird in zwei verschiedenen Typen verwendet – Serifen-<br />
und Sans-Serifen-Schriftarten – Schriften mit o<strong>der</strong> ohne Serifen (kleine<br />
147
Abschlussstriche an einem Buchstaben). Bei <strong>der</strong> Entscheidung, welcher<br />
Schrifttyp auf Webseiten verwendet werden soll, gibt es bislang keine einheitliche<br />
Aussage. Im Allgemeinen besteht jedoch die Auffassung, dass auf<br />
Webseiten nur Sans-Serifen-Schriftarten wie zum Beispiel Arial verwendet<br />
werden sollten, da diese ein klares Schriftbild ergeben. Serifen (wie z.B. bei<br />
Times New Roman) werden auf dem Bildschirm aufgrund <strong>der</strong> Auflösung,<br />
die im Gegensatz zu Papier erkennbar 145 ist, pixelig dargestellt. Je nach dem,<br />
welcher Schrifttyp letztendlich genutzt wird, sollten auf Webseiten grundsätzlich<br />
nur Schriftarten eingesetzt werden, die auf allen Rechnern installiert<br />
sind (z.B. Arial, Helvetica, Times New Roman). Zusätzliche Attribute wie<br />
Fett o<strong>der</strong> Kursiv sind selten zu verwenden, und Unterstreichungen sind<br />
ausschließlich Textlinks vorbehalten.<br />
Zusätzlich zu den Standardschriftarten gibt es Dekorations- und Phantasieschriftarten,<br />
<strong>der</strong>en Verwendung die Atmosphäre einer Seite sehr beeinflussen<br />
kann. Solche Möglichkeiten sind aber nur bei Initialen o<strong>der</strong> Kurztexten<br />
einzusetzen, da das Lesen längerer <strong>der</strong>artig gestalteter Texte schwierig und<br />
sehr anstrengend wird. Um eine gute, ausgeglichene Gestaltung einer einzelnen<br />
Seite zu gewährleisten, sowie für die Einhaltung <strong>der</strong> Konsistenz auf <strong>der</strong><br />
gesamten Website dürfen nicht mehr als zwei bis drei verschiedene Schriftarten<br />
eingesetzt werden [vgl. LOHSE (2001): 68].<br />
Die Textausrichtung kann dabei links- o<strong>der</strong> rechtsbündig, zentriert o<strong>der</strong><br />
Blocksatz sein. Für die Gestaltung des gesamten Textes gibt es in HTML<br />
mehrere technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel Tabellen. Mehrspaltig<br />
sollten aber nur kurze Texte sein, um eine sichere Orientierung zu gewährleisten.<br />
Bei längeren Texten bieten sich sinnvoll eingesetzte Marginalien<br />
(Anmerkung am Rande eines Textes) an, da diese einerseits das Textbild<br />
auflockern, an<strong>der</strong>erseits die Aufmerksamkeit des Lesers auf wichtige Textteile<br />
lenken und insgesamt eine gute Orientierung ermöglichen.<br />
8.2.8 Formulierung <strong>von</strong> Texten<br />
Das Internet besitzt vielfältige multimediale Möglichkeiten. Trotzdem erweist<br />
es sich zu großen Teilen vorrangig als Textmedium. In diesem sucht<br />
<strong>der</strong> Nutzer nach Informationen, welche er auf möglichst effiziente Weise<br />
bekommen möchte. 79% <strong>der</strong> Webnutzer lesen Webseiten nicht, son<strong>der</strong>n<br />
145 Die Rasterung auf Papier ist so hoch, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann.<br />
148
überfliegen diese nur und suchen dabei nach Schlüsselwörtern und zentralen<br />
Aussagen [vgl. I-COM (3/2002): 29].<br />
Aus einem angenehm und passend gestalteten Text wird noch keine gute<br />
Informationsquelle. Diese entsteht erst durch die Korrektheit <strong>der</strong> gebotenen<br />
Informationen. Weitere entscheidende Kriterien sind ein präziser Text und<br />
eine objektive Sprache. Hinsichtlich dieser beiden Aspekte gibt es bereits<br />
eine Reihe <strong>von</strong> Regeln, welche die Verständlichkeit <strong>von</strong> Informationen und<br />
<strong>der</strong>en Strukturen (ganze Texte und einzelne Sätze) för<strong>der</strong>n und auch auf<br />
Webtexte angewendet werden können. Diese Regeln kommen aus <strong>der</strong> nichtvisualisierten<br />
Radio-Sprache und wurden <strong>von</strong> Wibke Weber hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Verwendung auf Webseiten untersucht [vgl. I-COM (3/2002): 29 ff].<br />
Im Radio kann <strong>der</strong> Zuhörer jedes Wort nur einmal hören. Und was er im<br />
Moment des Hörens nicht erfasst, ist verloren. Natürlich können Texte im<br />
Web beliebig oft gelesen werden. Trotzdem ist <strong>der</strong> Vergleich zum Radio<br />
möglich: Wie<strong>der</strong>holtes Lesen o<strong>der</strong> auch das „Zurücklesen“ in Texten ist das<br />
Gegenteil <strong>von</strong> „Scannen“, die Tätigkeit, die bei <strong>der</strong> Rezeption <strong>von</strong> Texten im<br />
Web am meisten ausgeführt wird. Und <strong>der</strong> Benutzer möchte nicht „Zurücklesen“,<br />
im Gegenteil. Im Web gibt es eine Vielzahl <strong>von</strong> Angeboten: Wenn<br />
ein Text nicht gefällt, wechselt <strong>der</strong> Benutzer zu einer an<strong>der</strong>en Seite.<br />
Um dies zu verhin<strong>der</strong>n, können die erwähnten Regeln aus <strong>der</strong> Radio-Sprache<br />
für das Schreiben im Web genutzt werden:<br />
< pro Satz möglichst nur eine neue Information<br />
< kurze Sätze<br />
< Verben nach vorn (tragen die Hauptinformation)<br />
< zentrale Begriffe wie<strong>der</strong>holen, Redundanz schaffen<br />
< häufige Synonyme vermeiden<br />
Wenn Texte entsprechend dieser Empfehlungen formuliert werden, ist dies<br />
zuerst einmal ungewohnt, da solche Texte nicht <strong>der</strong> Alltagssprache entsprechen.<br />
Aber für den Webnutzer und -Leser wird es mit Hilfe dieser Formulierungen<br />
einfacher, relevante Informationen in Webtexten (selbst beim Überfliegen)<br />
zu erfassen und dauerhaft aufzunehmen. Und wenn sich <strong>der</strong> Nutzer<br />
sicher sein kann, seine gesuchten Informationen schnell und effektiv auf<br />
einer bestimmten Seite zu finden und aufzunehmen zu können, wird er diese<br />
bei Bedarf gerne wie<strong>der</strong> besuchen.<br />
149
9 Zusammenfassung und Ausblick<br />
Wie in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, handelt es sich bei <strong>der</strong> Usability<br />
<strong>von</strong> Webseiten nicht nur um die Gestaltung <strong>von</strong> Benutzungsoberflächen.<br />
Zusätzlich spielen Aspekte vieler Fachgebiete eine Rolle: ökonomische<br />
Interessen, psychologische Grundlagen, Normen und Richtlinien, medienwissenschaftliche<br />
Bezüge sowie die Wünsche und Vorstellungen <strong>der</strong> Benutzer.<br />
Die jeweiligen usability-relevanten Bezüge und Sachverhalte <strong>der</strong> einzelnen<br />
Themengebiete wurden bestimmt, beschrieben und interdisziplinär<br />
bearbeitet.<br />
Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte noch einmal zusammenfassend<br />
dargestellt.<br />
Aus Sicht <strong>der</strong> Medien soll eine Webseite Informationen bereitstellen, Wissen<br />
vermitteln und die Kommunikation mit an<strong>der</strong>en Nutzern unterstützen. Wie<br />
in dieser Arbeit dargestellt wurde, fungieren Webseiten bzw. die in ihnen<br />
veröffentlichten Informationen unter Umständen als Meinungsmacher und<br />
können, durch eine gleichzeitige starke Frequentierung, auch als Machtinstrument<br />
dienen. Bedingt durch die Möglichkeit <strong>der</strong> freien, nahezu unkontrollierten<br />
Veröffentlichung <strong>von</strong> Inhalten wird es für den Benutzer mittlerweile<br />
immer schwerer, hier noch zwischen „wahrer“ und „falscher“ Information<br />
zu unterscheiden. Was auf <strong>der</strong> einen Seite als Nachteil erscheint, bietet<br />
auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite jedoch neue Möglichkeiten und Chancen.<br />
Für Unternehmen sind Webseiten ein Instrument innerhalb des mo<strong>der</strong>nen<br />
elektronischen Marketings, mit dem sie sich (zusätzlich) auf dem globalen<br />
Markt präsentieren und so eine größere Anzahl an potentiellen Kunden<br />
erreichen können. In <strong>der</strong> Art und Weise <strong>der</strong> medialen Darstellung werden<br />
Ziele und Strategien <strong>von</strong> Unternehmen deutlich. Sie spiegeln sich in unterschiedlichem<br />
Ausmaß in den jeweiligen Internetauftritten wi<strong>der</strong>. In dieser<br />
Arbeit wurde veranschaulicht, dass für die Gestaltung <strong>der</strong> Webseiten die aus<br />
dem traditionellen Marketing bereits bekannten Möglichkeiten <strong>der</strong> Unternehmenspräsentation<br />
und Vermittlung <strong>von</strong> Botschaften angewendet werden<br />
können.<br />
Für Unternehmen ist letztendlich entscheidend, wie viele <strong>der</strong> gelegentlichen<br />
Besucher in Kunden umgewandelt werden. Um dies zu erreichen, gibt es<br />
150
entsprechende ökonomische Strategien, wie Intentionsrealisierung, Aufbau<br />
<strong>von</strong> Kundenvertrauen und Möglichkeiten zur langfristigen Kundenbindung.<br />
Diese Methoden wurden in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit beschrieben. Sie können,<br />
aufbauend auf eine benutzerfreundliche Gestaltung und Funktionalität, bei<br />
dem Einsatz <strong>von</strong> Webseiten angewendet werden und ökonomische Interessen<br />
unterstützen.<br />
Als Grundlage für die Aufnahme <strong>von</strong> Informationen auf Webseiten dienen<br />
psychologische Erkenntnisse <strong>der</strong> visuellen Wahrnehmung und biologischen<br />
Informationsverarbeitung. Diese wurden herausgearbeitet. Hier wurde deutlich,<br />
dass für die Gestaltung <strong>von</strong> Webseiten beson<strong>der</strong>s die Gestaltgesetze<br />
interessant sind. Sie erklären die Funktionsweise einer optimalen Wahrnehmung<br />
(<strong>der</strong> Anordnungen) <strong>von</strong> Objekten. Eine grundlegende Erkenntnis in<br />
diesem Zusammenhang wird deutlich im Satz: „Eine Gestalt ist mehr als die<br />
Summe ihrer Einzelteile.“ 146 Bezüglich <strong>von</strong> Webseiten bedeutet dies, dass<br />
für eine gute Gestaltung eine zweckmäßige additive Ansammlung <strong>von</strong> Objekten<br />
nicht genügt, son<strong>der</strong>n die einzelnen Elemente in ihrer gesamten Anordnung<br />
ein stimmiges Bild ergeben müssen.<br />
Wie beschrieben wurde, können biologische Erkenntnisse, wie beispielsweise<br />
die Unterscheidung <strong>von</strong> Figur und Grund, die Gesetze <strong>der</strong> Gruppierung<br />
o<strong>der</strong> mentale Modelle, bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong> Webseiten in beson<strong>der</strong>er<br />
Weise genutzt werden.<br />
Psychologische Erkenntnisse können unter Umständen schwer nachvollziehbar<br />
und anwendbar sein. An dieser Stelle geben verschiedene Gesetze und<br />
Normen zur Gestaltung <strong>von</strong> Bildschirmoberflächen mehrere Empfehlungen;<br />
sie beinhalten psychologische Aspekte sowie Erkenntnisse arbeitswissenschaftlicher<br />
Forschung, die als Wegweiser zur Gestaltung dienen und bei <strong>der</strong><br />
Bewertung <strong>von</strong> Webseiten hilfreich sind. Beson<strong>der</strong>s die Grundsätze <strong>der</strong><br />
Dialoggestaltung aus <strong>der</strong> DIN EN ISO 9241 Teil 10 geben Hinweise, wie<br />
eine Bildschirmoberfläche benutzerfreundlich gestaltet werden kann. Bezüglich<br />
<strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong> Webseiten wurden zu jedem formalen Grundsatz<br />
konkrete Empfehlungen erarbeitet.<br />
Das Layout einer Webseite hat mit seinen Farben und Elementen einen<br />
wesentlichen Einfluss auf die Akzeptanz durch die Besucher. Diese wird<br />
146 Nach Christian <strong>von</strong> Ehrenfels in: FITZEK, SALBER (1996)<br />
151
unterstützt durch eine optimale Navigation, eine gut funktionierende Suchmaschine,<br />
relevante Inhalte und weitere spezielle Faktoren, wie sie im Einzelnen<br />
in dieser Arbeit aufgezeigt wurden.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten gibt es ein Problem: Um benutzerfreundliche<br />
Webseiten zu gestalten, müssen die Eigenschaften, Voraussetzungen,<br />
Wünsche und Interessen <strong>von</strong> Nutzern beachtet werden. Diese sind<br />
vielfältig, inkompatibel, teilweise unbekannt und insgesamt nur schwer auf<br />
einen Nenner zu bringen.<br />
Hierfür wurde in dieser Arbeit <strong>der</strong> Lösungsansatz „natürliches Design“<br />
vorgeschlagen, mit dessen Hilfe die verschiedenen Nutzerinteressen<br />
und -eigenschaften auf einen Nenner gebracht werden können: Unterstützt<br />
durch natürliche Bezüge zwischen <strong>der</strong> Gestaltung eines Bedienungselementes<br />
und seiner jeweiligen Funktion können durch den Benutzer bestimmte<br />
(vom Hersteller beabsichtigte) Handlungen folgen. Durch die Gestaltung<br />
solch eines natürlichen Designs kann eine intuitiv nutzbare Webseite erstellt<br />
und für die Nutzer eine einfache Bedienung erzielt werden.<br />
Die Benutzer sind an die sich schnell verän<strong>der</strong>nden Informationen, die durch<br />
die Medien vermittelt werden, gewöhnt. Dadurch haben die Verbraucher oft<br />
nur noch wenig Geduld und bieten eine verringerte Aufmerksamkeitsdauer<br />
an. Im Internet ist mittlerweile, aufgrund <strong>der</strong> Vielzahl präsentierter Webseiten,<br />
eine Fülle <strong>von</strong> sehr ähnlichen Angeboten vorhanden. Die Betreiber <strong>von</strong><br />
Webseiten wollen sich mit ihren Internetauftritten präsentieren, Werbung<br />
zeigen, Produkte und Leistungen verkaufen und sich vor allem <strong>von</strong> Mitbewerbern<br />
abheben. Infolgedessen wird häufig <strong>der</strong> Fehler gemacht, dass möglichst<br />
neuartige technische und optische Raffinessen eingebunden werden.<br />
Zum Abschluss dieser Arbeit wird noch einmal betont, dass bei <strong>der</strong> Gestaltung<br />
sowie Bewertung <strong>von</strong> Webseiten die Benutzer, sowie eine benutzerfreundliche<br />
Bedienung <strong>der</strong> Webseiten, im Vor<strong>der</strong>grund stehen.<br />
In dieser Arbeit erfolgte, im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Vernetzung</strong> <strong>von</strong> <strong>Konzepten</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Mensch</strong>-Computer-Interaktion, eine umfassende interdisziplinäre Bearbeitung<br />
sowie Integration <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong> Webseiten beteiligten Fachgebiete.<br />
Für zukünftige Untersuchungen bieten sich im Rahmen <strong>der</strong> <strong>der</strong> Usability <strong>von</strong><br />
Webseiten weitere Themenbereiche an:<br />
152
Internationalisierung <strong>von</strong> Webseiten<br />
< Accessibility<br />
< „Mobiles Web“<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Internationalisierung <strong>von</strong> Webseiten gibt es Ansätze, spezielle<br />
Eigenheiten <strong>von</strong> mehreren Kulturen für ein internationales Publikum<br />
zu gestalten. Hierzu gehören zum Beispiel verschiedene Leserichtungen<br />
sowie unterschiedliche Bedeutungen <strong>von</strong> Farben und Symbolen. Eine spannende<br />
Frage hierbei ist, ob solche Spezialisierungen, die einer Internationalität<br />
dienen sollen, wie<strong>der</strong> zu „lokal geprägten“ Gestaltungen werden. Entsprechende<br />
Untersuchungen sowie Lösungen hierzu wären interessant.<br />
Accessibility bedeutet Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Bezüglich <strong>der</strong><br />
Gestaltung sowie Bewertung <strong>von</strong> Webseiten werden Lösungen für eine<br />
barrierefreie Nutzung für <strong>Mensch</strong>en mit Behin<strong>der</strong>ungen erarbeitet (z.B.<br />
Webnutzung für sehbehin<strong>der</strong>te Anwen<strong>der</strong>). Im „Mobilen Web“ werden<br />
Webseiten auf Geräte mit kleinen Anzeigeformaten wie zum Beispiel WAP-<br />
Handys 147 und PDAs 148 übertragen. Die spezifische Aufgabe für beide Bereiche<br />
ist, dass zwar dieselben Inhalte vermittelt werden sollen, diese jedoch für<br />
die entsprechende Anwendung bzw. Benutzergruppe angemessen und mit<br />
entsprechenden Funktionen umgestaltet werden müssen.<br />
Die genannten Problemstellungen (insbeson<strong>der</strong>e Accessibility und „Mobiles<br />
Web“) befinden sich noch im Anfangsstadium <strong>der</strong> Forschung. Gleichzeitig<br />
entwickeln sie sich gegenwärtig zu Aufgabengebieten, innerhalb denen<br />
Lösungen hinsichtlich <strong>der</strong> Benutzerfreundlichkeit stark nachgefragt werden.<br />
Die genannten Themenbereiche bieten interessante und aktuelle Untersuchungsgegenstände.<br />
147 Wireless Application Protocol<br />
148 Personal Digital Assistants<br />
153
ALBERS u. a. (2001):<br />
Sönke Albers, Michel Clement, Kay Peters, Bernd Skiera (Hrsg.)<br />
Marketing mit interaktiven Medien. Strategien zum Markterfolg<br />
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation, 3.<br />
Auflage<br />
ANDERSON (1996):<br />
John R. An<strong>der</strong>son<br />
Kognitive Psychologie<br />
Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, 2. Auflage<br />
BACHOFER (1998):<br />
Michael Bachofer<br />
Wie wirkt Werbung im Web? Blickverhalten, Gedächtnisleistung und<br />
Imageverän<strong>der</strong>ung beim Kontakt mit Internet-Anzeigen<br />
Stern Anzeigenabteilung<br />
BECKER (1998):<br />
Jochen Becker<br />
Marketing-Konzeption. Grundlagen des strategischen und operativen<br />
Marketing-Managements<br />
Verlag Franz Vahlen München, 6. Auflage<br />
BEIßWENGER (2000):<br />
Michael Beißwenger, Universität Dortmund<br />
Aspekte <strong>der</strong> Produktion und Rezeption <strong>von</strong> Hypertextangeboten im<br />
World Wide Web<br />
Vortrag, gehalten im Deutschen Seminar <strong>der</strong> Universität Zürich, sowie<br />
im Institut für Germanistik <strong>der</strong> Universität Koblenz<br />
BRODBECK, RUPIETTA (1994):<br />
Felix C. Brodbeck, Walter Rupietta<br />
Fehlermanagement und Hilfesysteme<br />
In: Einführung in die Software-Ergonomie. Gestaltung graphischinteraktiver<br />
Systeme: Prinzipien, Werkzeuge, Lösungen<br />
Eberleh, Oberquelle, Oppermann (Hrsg.)<br />
Walter de Gruyter Berlin<br />
BUND.DE (2003):<br />
Das Dienstleistungsportal des Bundes<br />
URL: http://www.bund.de/Wir-ueber-uns-Wissen/Deutsche-<br />
Demokratie/Parlament/Gesetzgebung/Was-ist-ein-Gesetz-.4705.htm<br />
Letzter Zugriff: 16.05.2003<br />
154
DRWEB.DE (2002):<br />
Workshop Typografie – Teil 4: Farbe und Screendesign<br />
URL: http://www.drweb.de/webdesign/wahrnehmung4.shtml<br />
Letzter Zugriff: 16.05.2003<br />
DUMAS, REDISH (1999):<br />
Joseph S. Dumas, Janice C. Redish<br />
A Practical Guide to Usability Testing<br />
Intellect Books Oregon, 2. Auflage<br />
EN ISO 9241-10 (1996):<br />
Ergonomische Anfor<strong>der</strong>ungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten.<br />
Teil 10: Grundsätze <strong>der</strong> Dialoggestaltung.<br />
Deutsche Fassung <strong>der</strong> ISO 9241-10: 1996<br />
Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
EN ISO 9241-11 (1998):<br />
Ergonomische Anfor<strong>der</strong>ungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten.<br />
Teil 11: Anfor<strong>der</strong>ungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze.<br />
Deutsche Fassung <strong>der</strong> ISO 9241-11: 1998<br />
Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
FITZEK, SALBER (1996):<br />
Herbert Fitzek, Wilhelm Salber<br />
Gestaltpsychologie. Geschichte und Praxis<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt<br />
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA (2000):<br />
Vorlesung Software-Ergonomie<br />
URL: http://www1.informatik.uni-jena.de/Lehre/SoftErg/vor_r100.htm<br />
Letzter Zugriff: 16.05.2003<br />
GABLER (1993):<br />
Gabler Wirtschaftslexikon Wiesbaden, 13. Auflage<br />
GLASER (1994):<br />
Wilhelm R. Glaser<br />
<strong>Mensch</strong>liche Informationsverarbeitung<br />
In: Einführung in die Software-Ergonomie. Gestaltung graphischinteraktiver<br />
Systeme: Prinzipien, Werkzeuge, Lösungen<br />
Eberleh, Oberquelle, Oppermann (Hrsg.)<br />
Walter de Gruyter Berlin<br />
155
GÖRNER u. a. (1999):<br />
Claus Görner, Andreas Beu, Franz Koller<br />
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.)<br />
Der Bildschirmarbeitsplatz. Softwareentwicklung mit DIN EN ISO<br />
9241<br />
Beuth Verlag Berlin<br />
GUSKI (2000):<br />
Rainer Guski<br />
Wahrnehmung. Eine Einführung in die Psychologie <strong>der</strong> menschlichen<br />
Informationsaufnahme<br />
Verlag W. Kohlhammer Stuttgart, 2. Auflage<br />
HAMPEL (2002):<br />
Thorsten Hampel<br />
Virtuelle Wissensräume. Ein Ansatz für die kooperative Wissensorganisation<br />
Dissertation im Fachbereich Mathematik/Informatik <strong>der</strong> Universität<br />
Pa<strong>der</strong>born, März 2002<br />
HELLER (2002):<br />
Eva Heller<br />
Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, kreative Farbgestaltung<br />
Rowohlt Taschenbuch Verlag Hamburg<br />
HOLZINGER (2001):<br />
Andreas Holzinger<br />
Basiswissen Multimedia. Band 2: Lernen<br />
Vogel Verlag Würzburg<br />
HUNZIKER (1996):<br />
Peter Hunziker<br />
Medien, Kommunikation und Gesellschaft. Einführung in die Soziologie<br />
<strong>der</strong> Massenkommunikation<br />
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2. Auflage<br />
I-COM (2/2002):<br />
Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien<br />
Günter Silberer, Jan-Fre<strong>der</strong>ik Engelhardt, Nils Wasmuth<br />
E-Shopmerkmale aus Kundensicht – Ergebnisse einer Conjointanalyse<br />
156
I-COM (3/2002):<br />
Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien<br />
Wibke Weber<br />
Was Online-Texte vom Radio lernen können<br />
INTERNET & RECHT (2003):<br />
Internet for Jurists<br />
URL: http://www.internet4jurists.at/intern10.htm<br />
Letzter Zugriff: 16.05.2003<br />
JUNGERMANN u.a.(1998):<br />
Helmut Jungerman, Hans-Rüdiger Pfister, Katrin Fischer<br />
Die Psychologie <strong>der</strong> Entscheidung. Eine Einführung<br />
Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg<br />
KEIL-SLAWIK, SELKE u.a. (1998):<br />
Reinhard Keil-Slawik, Harald Selke<br />
Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur in<br />
Kompetenzentwicklung ´98. Forschungsstand und Forschungsperspektiven<br />
Waxmann Verlag Münster<br />
KOTLER u.a. (2001):<br />
Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saun<strong>der</strong>s, Veronica Wong<br />
Grundlagen des Marketing<br />
Pearson Studium München<br />
LOHSE (2001):<br />
Hartwig Lohse<br />
Webdesign. Planung und Umsetzung erfolgreicher Web-Seiten<br />
Deutscher Taschenbuch Verlag München<br />
LOUIS (2001):<br />
Dirk Louis<br />
FrontPage 2002. Das Handbuch<br />
Wilhelm Heyne Verlag München<br />
MALLOT (2000):<br />
Hanspeter A. Mallot<br />
Sehen und die Verarbeitung visueller Information. Eine Einführung<br />
Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft Braunschweig, 2. Auflage<br />
157
MANHARTSBERGER, MUSIL (2002):<br />
Martina Manhartsberger, Sabine Musil<br />
Web Usability. Das Prinzip des Vertrauens<br />
Galileo Press Bonn, 2. Auflage<br />
MC LUHAN (1995):<br />
Marshall Mc Luhan<br />
Die magischen Kanäle – Un<strong>der</strong>standing Media<br />
Verlag <strong>der</strong> Kunst Dresden, 2. Auflage<br />
MÜNKER, ROESLER (2002):<br />
Stefan Münker, Alexan<strong>der</strong> Roesler<br />
Vom Mythos zur Praxis. Auch eine Geschichte des Internet<br />
In: Praxis Internet. Kulturtechniken <strong>der</strong> vernetzten Welt.<br />
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main<br />
NIELSEN (2000):<br />
Jakob Nielsen<br />
Erfolg des Einfachen<br />
Markt + Technik Verlag München<br />
NIELSEN, MACK (1994):<br />
Jakob Nielsen, Robert L. Mack<br />
Executive Summary<br />
In: Usability Inspection Methods<br />
John Wiley & Sons, Inc. New York<br />
NORMAN (1989):<br />
Donald A. Norman<br />
Dinge des Alltags. Gutes Design und Psychologie für Alltagsgegenstände<br />
Campus Verlag Frankfurt<br />
SPOOL u.a. (1999):<br />
Jared M. Spool, Tara Scanlon, Will Schroe<strong>der</strong>, Carolyn Sny<strong>der</strong>, Terri<br />
DeAngelo<br />
Web Site Usability. A Designer´s Guide<br />
Morgan Kaufmann Publishers, San Franzisko<br />
158
TEKOM (5/2001):<br />
Technische Kommunikation. Fachzeitschrift für technische Dokumentation<br />
und Informationsmanagement<br />
Hansjörg Zimmermann<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen, Zielgruppen, menschliche Wahrnehmung. Web-<br />
Usability – Pflicht o<strong>der</strong> Kür?<br />
TEKOM (1/2002):<br />
Technische Kommunikation. Fachzeitschrift für technische Dokumentation<br />
und Informationsmanagement<br />
Jens Heuer<br />
Aufgabe, Sinn und Ziel <strong>von</strong> Usability-Testing. Denken Sie an Ihre Anwen<strong>der</strong><br />
TULODZIECKI (1997):<br />
Gerhard Tulodziecki<br />
Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer<br />
handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik<br />
Verlag Julius Klinkhardt Bad Heilbrunn, 3. Auflage<br />
TUTT (2002):<br />
Lars Tutt<br />
Marketing für virtuelle Märkte. Strategien und Instrumente<br />
Gabler Edition Wissenschaft<br />
WANDMACHER (1993):<br />
Jens Wandmacher<br />
Software-Ergonomie<br />
Walter de Gruyter Verlag Berlin<br />
WEBER (1993):<br />
Wolfgang Weber<br />
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre<br />
Gabler Verlag Wiesbaden, 2. Auflage<br />
ZIMBARDO (1995):<br />
Philip G. Zimbardo<br />
Psychologie.<br />
Springer-Verlag Berlin, 6. Auflage<br />
ZIMBARDO, GERRIG (1999):<br />
Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig<br />
Psychologie<br />
Springer-Verlag Berlin, 7. Auflage<br />
159