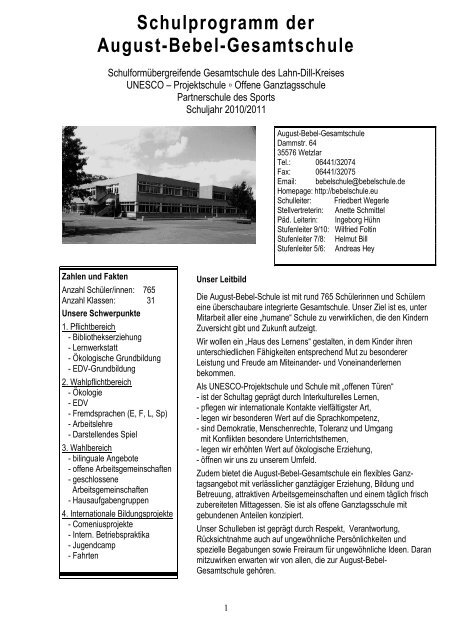Schulprogramm der August-Bebel-Gesamtschule
Schulprogramm der August-Bebel-Gesamtschule
Schulprogramm der August-Bebel-Gesamtschule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zahlen und Fakten<br />
<strong>Schulprogramm</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong><br />
Schulformübergreifende <strong>Gesamtschule</strong> des Lahn-Dill-Kreises<br />
UNESCO – Projektschule ▫ Offene Ganztagsschule<br />
Partnerschule des Sports<br />
Schuljahr 2010/2011<br />
Anzahl Schüler/innen: 765<br />
Anzahl Klassen: 31<br />
Unsere Schwerpunkte<br />
1. Pflichtbereich<br />
- Bibliothekserziehung<br />
- Lernwerkstatt<br />
- Ökologische Grundbildung<br />
- EDV-Grundbildung<br />
2. Wahlpflichtbereich<br />
- Ökologie<br />
- EDV<br />
- Fremdsprachen (E, F, L, Sp)<br />
- Arbeitslehre<br />
- Darstellendes Spiel<br />
3. Wahlbereich<br />
- bilinguale Angebote<br />
- offene Arbeitsgemeinschaften<br />
- geschlossene<br />
Arbeitsgemeinschaften<br />
- Hausaufgabengruppen<br />
4. Internationale Bildungsprojekte<br />
- Comeniusprojekte<br />
- Intern. Betriebspraktika<br />
- Jugendcamp<br />
- Fahrten<br />
Unser Leitbild<br />
1<br />
<strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong><br />
Dammstr. 64<br />
35576 Wetzlar<br />
Tel.: 06441/32074<br />
Fax: 06441/32075<br />
Email: bebelschule@bebelschule.de<br />
Homepage: http://bebelschule.eu<br />
Schulleiter: Friedbert Wegerle<br />
Stellvertreterin: Anette Schmittel<br />
Päd. Leiterin: Ingeborg Hühn<br />
Stufenleiter 9/10: Wilfried Foltin<br />
Stufenleiter 7/8: Helmut Bill<br />
Stufenleiter 5/6: Andreas Hey<br />
Die <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-Schule ist mit rund 765 Schülerinnen und Schülern<br />
eine überschaubare integrierte <strong>Gesamtschule</strong>. Unser Ziel ist es, unter<br />
Mitarbeit aller eine „humane“ Schule zu verwirklichen, die den Kin<strong>der</strong>n<br />
Zuversicht gibt und Zukunft aufzeigt.<br />
Wir wollen ein „Haus des Lernens“ gestalten, in dem Kin<strong>der</strong> ihren<br />
unterschiedlichen Fähigkeiten entsprechend Mut zu beson<strong>der</strong>er<br />
Leistung und Freude am Miteinan<strong>der</strong>- und Voneinan<strong>der</strong>lernen<br />
bekommen.<br />
Als UNESCO-Projektschule und Schule mit „offenen Türen“<br />
- ist <strong>der</strong> Schultag geprägt durch Interkulturelles Lernen,<br />
- pflegen wir internationale Kontakte vielfältigster Art,<br />
- legen wir beson<strong>der</strong>en Wert auf die Sprachkompetenz,<br />
- sind Demokratie, Menschenrechte, Toleranz und Umgang<br />
mit Konflikten beson<strong>der</strong>e Unterrichtsthemen,<br />
- legen wir erhöhten Wert auf ökologische Erziehung,<br />
- öffnen wir uns zu unserem Umfeld.<br />
Zudem bietet die <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> ein flexibles Ganztagsangebot<br />
mit verlässlicher ganztägiger Erziehung, Bildung und<br />
Betreuung, attraktiven Arbeitsgemeinschaften und einem täglich frisch<br />
zubereiteten Mittagessen. Sie ist als offene Ganztagsschule mit<br />
gebundenen Anteilen konzipiert.<br />
Unser Schulleben ist geprägt durch Respekt, Verantwortung,<br />
Rücksichtnahme auch auf ungewöhnliche Persönlichkeiten und<br />
spezielle Begabungen sowie Freiraum für ungewöhnliche Ideen. Daran<br />
mitzuwirken erwarten wir von allen, die zur <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<br />
<strong>Gesamtschule</strong> gehören.
<strong>Schulprogramm</strong> <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong><br />
1. Leitbild<br />
2. Zahlen und Fakten<br />
2.1 Lage, Einzugsgebiet<br />
2.2 Bestandsaufnahme: Schülerzahlen, Statistik, Räume<br />
2.3 Kooperationspartner<br />
2.4 Evaluation: Befragung von 1998<br />
3. Profil<br />
3.1 Lernen und Leistung<br />
3.2 Unser För<strong>der</strong>netzwerk<br />
3.3 Lernwerkstatt<br />
3.4 Ganztagsschule<br />
3.5 Unesco-Projektschule<br />
Internationale Bildungsprojekte<br />
3.6 Partnerschule des Sports<br />
3.7 Stand <strong>der</strong> Entwicklung zur Teamschule<br />
3.8 Projekt BIWAQ<br />
4. Arbeitsschwerpunkte<br />
4.1 Rhythmisierung<br />
4.2 Teamentwicklung<br />
4.3 Gymnasiale Oberstufe<br />
4.4 Sanierung des Schulgebäudes<br />
4.5 Kooperation mit außerschulischen Partnern<br />
4.6 Internationale Projekte<br />
4.7 Bildungsstandards und Schulcurriculum<br />
4.8 Klassenraumgestaltung<br />
5. Evaluation<br />
2
2. Zahlen und Fakten<br />
2.1 Lage/Einzugsgebiet<br />
Die Rahmenbedingungen unserer pädagogischen Arbeit ergeben sich aus dem<br />
Selbstverständnis <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> als Lebensraum, <strong>der</strong> sich eng an<br />
den Bezugsrahmen des gesellschaftlichen Umfeldes hält. Dazu gehört, dass wir den<br />
außerschulischen Lebensraum unserer Kin<strong>der</strong> kennen und die Wechselbeziehung <strong>der</strong><br />
beiden Räume berücksichtigen.<br />
Der Einzugsbereich und die Zusammensetzung unserer Schülerschaft haben sich in<br />
den letzten Jahren einhergehend mit Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Schulentwicklung im<br />
Raume Wetzlar verän<strong>der</strong>t. Während „früher“ fast ausschließlich Kin<strong>der</strong> aus den<br />
Grundschulen in Nie<strong>der</strong>girmes und Naunheim kamen, kommen inzwischen die<br />
meisten unserer Schüler aus an<strong>der</strong>en Stadtgebieten.<br />
Die Schule hat seit fünf Jahren eine Begrenzung <strong>der</strong> Aufnahmekapazität, weil für die<br />
Anzahl <strong>der</strong> Anmeldungen für den jeweiligen Jahrgang 5 die notwendigen Räume<br />
nicht vorhanden waren. Da die Schule sich aber nach wie vor auch als Schule vor Ort<br />
versteht, werden vorzugweise alle Kin<strong>der</strong> aus den Grundschulen in Nie<strong>der</strong>girmes und<br />
Naunheim aufgenommen. Die Aufnahme aus an<strong>der</strong>en Bereichen ist begrenzt auf das<br />
Gebiet <strong>der</strong> Stadt Wetzlar mit Ausnahme des Stadtteiles Steindorf, da man von dort<br />
die <strong>Gesamtschule</strong> Solms erreichen kann. Bei <strong>der</strong> Aufnahme wird darüber hinaus<br />
angestrebt, bei <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> Schülerschaft ein soziologisches „Abbild“<br />
<strong>der</strong> Wetzlarer Wohnbevölkerung zu erreichen. Wegen des hohen Anteiles von<br />
ausländischen Familien im Stadtteil Nie<strong>der</strong>girmes ist es trotzdem so, dass <strong>der</strong> Anteil<br />
von Kin<strong>der</strong>n mit Migrationshintergrund bei uns höher ist als im Wetzlarer<br />
Durchschnitt.<br />
Vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Heterogenität unserer Schülerschaft wird deutlich, dass wir<br />
in unserer pädagogischen, erziehenden Ausrichtung einen Schwerpunkt auf sozialintegrative<br />
Maßnahmen legen, flexible Formen des Lernens anbieten und auch<br />
organisatorisch anpassungsfähig die z. T. divergierenden Strukturen auffangen<br />
müssen. Als zweites „Standbein“ muss fachbezogene Leistungsorientierung die<br />
Gewähr dafür bieten, dass allen Schülerinnen und Schülern ein verlässliches Angebot<br />
auf ihrem je eigenen Leistungs- und Interesseniveau gemacht werden kann, das ihre<br />
Zukunftsperspektiven erhöht und sie befähigt, auch die persönliche Konkurrenz zu<br />
bestehen, sowie auch <strong>der</strong> Konkurrenz zu an<strong>der</strong>en Schulen standzuhalten.<br />
Gelingt neben <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Persönlichkeitsentwicklung die Ausbildung soli<strong>der</strong><br />
Fachkenntnisse und eine entsprechende Sachkompetenz, bekommen die<br />
Schülerinnen und Schüler Vertrauen und Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten.<br />
3
2.2 Bestandsaufnahme: Schülerzahlen, Statistiken, Räume<br />
Die Schülerzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Seit 2004 ist die<br />
Aufnahmekapazität <strong>der</strong> Schule auf fünf Klassen begrenzt. Seitdem können nicht mehr<br />
alle Kin<strong>der</strong> aufgenommen werden, die die Schule besuchen möchten. Zur Zeit<br />
werden 765 Schülerinnen und Schüler in 31 Klassen unterrichtet.<br />
Die 30 Klassenräume <strong>der</strong> Schule sind alle mit Klassen belegt. Darüber hinaus wurde<br />
ein Fachraum zum Klassenraum umgewandelt.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Naturwissenschaften sind zwei Chemieräume neu gestaltet. Die<br />
Ausstattung <strong>der</strong> restlichen vier Fachräume und <strong>der</strong> beiden Hörsäle bedarf dringend<br />
<strong>der</strong> Verbesserung. Neben den naturwissenschaftlichen Fachräumen verfügt die<br />
Schule über je zwei Kunst- und Musikräume, drei Arbeitslehreräume und eine<br />
Schulküche.<br />
Für den EDV-Unterricht und spezielle Schulungen verfügt die Schule über zwei<br />
Räume mit insgesamt 20 Rechnern, die alle einen Internetzugang besitzen.<br />
In <strong>der</strong> neu eröffneten Lernwerkstatt gibt es weitere Computerarbeitsplätze sowie<br />
vielfältige Möglichkeiten zum individuellen Lernen.<br />
Im sportlichen Bereich ist das Angebot an Übungsflächen als gut zu bezeichnen.<br />
Neben vier Hallenflächen verfügt die Schule gemeinsam mit <strong>der</strong> Werner-von-<br />
Siemens-Schule über eine Gerätturnhalle. Die Außensportanlagen sind im letzten Jahr<br />
komplett erneuert bzw. erweitert worden.<br />
Die räumliche Situation für den Ganztagsbereich hat sich in den letzten Jahren<br />
wesentlich verbessert. Die Schule verfügt über eine Mensa mit 150 Sitzplätzen. In<br />
einer Produktionsküche wird das Mittagessen täglich frisch vor Ort hergestellt.<br />
Es fehlen noch weitere Räumlichkeiten für den Ganztagsbereich,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Rückzugsmöglichkeiten für die Schüler und Lehrerarbeitsplätze.<br />
Ein wesentlicher Indikator für eine erfolgreiche schulische Arbeit und die Qualität von<br />
Unterricht sind zum Einen die erreichten Abschlüsse, zum An<strong>der</strong>en aber auch die<br />
erfolgreiche Mitarbeit in weiterführenden Schulen o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> beruflichen Ausbildung.<br />
Der weitere Werdegang an weiterführenden Schulen lässt sich relativ problemlos<br />
eruieren (Koordinator, Stufenleiter). Schwieriger o<strong>der</strong> z.T. unmöglich ist eine<br />
Evaluation bei den Schülern, die eine berufliche Ausbildung beginnen. Hier ist man<br />
weitgehend auf Befragungen im Rahmen von Klassentreffen angewiesen.<br />
Insgesamt lässt sich aussagen, dass die Abgänger <strong>der</strong> ABS in den letzten Jahren in<br />
<strong>der</strong> Regel überaus erfolgreich an weiterführenden Systemen und in <strong>der</strong> beruflichen<br />
Ausbildung abschnitten.<br />
4
2.3 Kooperationspartner<br />
Die Schule hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu ihrem Umfeld geöffnet und<br />
arbeitet mit folgenden außerschulischen Kooperationspartnern eng zusammen:<br />
Stadtbezirkskonferenz (Projekt Soziale Stadt)<br />
Kirchengemeinden in Naunheim und Nie<strong>der</strong>girmes (Projekt Kisongo, Café<br />
Dreieck)<br />
Jugendbildungswerk <strong>der</strong> Stadt Wetzlar (SV-Schulung, Klassenprojekte,<br />
Ostercamp)<br />
Volkshochschule <strong>der</strong> Stadt Wetzlar (Ganztagsbereich, Ostercamp)<br />
TSG Nie<strong>der</strong>girmes (Sportbereich)<br />
SC Nie<strong>der</strong>girmes (Sportbereich)<br />
KTV Wetzlar (Kunstturnleistungszentrum)<br />
Turntalentschule Wetzlar (Kunstturnleistungszentrum)<br />
Internationaler Bund Wetzlar (Mensa, Fahrradwerkstatt, vertiefte berufliche<br />
Orientierung)<br />
Institut Sprache und Bildung (Vertiefte berufliche Orientierung)<br />
Nachbarschaftshilfe Nie<strong>der</strong>girmes<br />
Jugendamt <strong>der</strong> Stadt Wetzlar<br />
Ambulanz <strong>der</strong> Rehbergklinik und an<strong>der</strong>en therapeutischen Einrichtungen<br />
Diverse Partnern in Wirtschaft und Handwerk (Praxistag, Praktikum,<br />
Berufserkundung)<br />
ESV Wetzlar<br />
AGGAS (Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schulen – Polizei)<br />
2.4 Zusammenfassung <strong>der</strong> Befragung von 1998<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Erstellung des <strong>Schulprogramm</strong>s wurde im Jahr 1998 eine umfangreiche<br />
Befragung von Eltern, Lehrern und Schülern durchgeführt und wissenschaftlich<br />
ausgewertet. (Prof. Todt, 1998)<br />
Dabei wurden unseren Schülern ein vergleichsweise niedriges Konfliktpotential sowie<br />
mehrheitlich prosoziale Einstellungen (z.B. hinsichtlich <strong>der</strong> Internationalität <strong>der</strong><br />
Schule) bescheinigt.<br />
Innerhalb des Kollegiums wurden die ausgesprochene Schülerorientierung, eine hohe<br />
Kooperationsbereitschaft und ein guter „Teamgeist“ hervorgehoben.<br />
Die Eltern lobten das gute Sozialklima an <strong>der</strong> Schule.<br />
5
Im Zuge <strong>der</strong> Schulinspektion in diesem Schuljahr wird es eine erneute Befragung<br />
<strong>der</strong> Schüler, Lehrer und Eltern geben, <strong>der</strong>en Ergebnisse zur Evaluation und<br />
Weiterentwicklung herangezogen werden sollen.<br />
3. Profil<br />
3.1 Lernen und Leistung: Prüfungen und Abschlüsse<br />
Die <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> ist eine 5-zügige integrierte <strong>Gesamtschule</strong>, in <strong>der</strong><br />
alle Kin<strong>der</strong> von <strong>der</strong> 5.-10. Klasse gemeinsam lernen.<br />
In <strong>der</strong> Klasse 5 werden alle Fächer im Klassenverband unterrichtet (Ausnahme<br />
Religion/ Ethik/ muttersprachlicher Unterricht)<br />
Ab <strong>der</strong> Klasse 6 werden (im Moment noch) die Schüler in Englisch und Mathematik<br />
auf 3 Kursniveaus (A, B, C-Kurse) aufgeteilt. In Klasse 7 können die Schüler im<br />
Wahlpflichtbereich 1 ein Neigungsfach wählen, wobei zur Zeit Französisch, Latein,<br />
Ökologie, Arbeitslehre, Hauswirtschaft und Textiles Gestalten zur Wahl stehen.<br />
Im 8.Schuljahr wird das Fach Deutsch in Erweiterungs- und Grundkurse aufgeteilt.<br />
Im Jahrgang 9 gibt es eine abschlussbezogene Klasse (SCHUB/ 9P), in <strong>der</strong> die<br />
Schüler in allen Fächern im Klassenverband und möglichst praxis- und<br />
projektorientiert lernen können.<br />
Diese Schüler haben einen Praxistag pro Woche, an dem sie in einen Betrieb gehen<br />
und dort ein Praktikum absolvieren können.<br />
In Klasse 9 haben unsere Schüler im Wahlpflichtbereich II die Wahl zwischen einer<br />
3. Fremdsprache (Spanisch), EDV, Darstellendes Spiel, Sport, Arbeitslehre und<br />
Ökologie. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit einen Praxistag zu absolvieren. Die<br />
Naturwissenschaften werden nun auch in E und G-Kurse differenziert.<br />
An unserer Schule legen alle Schüler im Jahrgang 9 die Hauptschulabschlussprüfung<br />
und im Jahrgang 10 in <strong>der</strong> Regel die Realschulabschlussprüfung ab, auch wenn sie<br />
im Anschluss an die Klasse 10 eine weiterführende Schule besuchen. Dadurch sind<br />
alle unsere Schüler einerseits mit Projekt- und Präsentationsprüfungen vertraut, und<br />
haben zum an<strong>der</strong>en unabhängig davon, wie ihre Schullaufbahn weiter verläuft, ihre<br />
Qualifikation sichtbar nachgewiesen und damit einen Schulabschluss gesichert.<br />
Die Abschlüsse <strong>der</strong> Jahrgänge 2008 und 2009 im Überblick:<br />
Übergang<br />
Klasse 11<br />
Fachober-<br />
schule<br />
Mittlerer<br />
Abschluss<br />
6<br />
Hauptschul-<br />
abschluss<br />
Ohne<br />
Abschluss<br />
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009<br />
Absolut 43 33 20 23 20 14 18 26 11 4<br />
Prozentual 37,7 33,0 19,2 23,0 17,5 14,0 20,5 26,0 9,6 4,0
3.2 Unser För<strong>der</strong>netzwerk<br />
Das prinzipielle Ziel ist es, sowohl den Unterricht als auch das gesamte<br />
schulische Miteinan<strong>der</strong> so zu gestalten, dass je<strong>der</strong> Schüler die ihm<br />
angemessene För<strong>der</strong>ung erhält.<br />
Wenn dies aus den unterschiedlichsten Gründen heraus nicht zu gelingen<br />
droht, gibt es ein tragfähiges Netz an Maßnahmen und Einrichtungen zur<br />
Hilfestellung.<br />
Die koordinierende Person ist in <strong>der</strong> Regel <strong>der</strong> Klassenlehrer, <strong>der</strong> je nach Bedarf mit<br />
<strong>der</strong> Klassenkonferenz und För<strong>der</strong>gesprächen mit Kind und/o<strong>der</strong> Eltern das Netzwerk<br />
einschaltet.<br />
Im Einzelnen besteht dieses Netzwerk aus den folgenden Schwerpunkten:<br />
Der Trainingsraum ist allen Kin<strong>der</strong>n zugänglich, die während einer<br />
Unterrichtsstunde nicht in <strong>der</strong> Lage sind, Unterrichtsstörungen zu vermeiden. Im<br />
Trainingsraum bespricht eine Fachkraft die Situation mit dem Kind, för<strong>der</strong>t Einsichten<br />
und gibt Hilfestellungen für einen Rückkehrplan, mit dem das Kind zu einer<br />
Verständigung mit dem entsendenden Lehrer kommen kann. (Frau van Staveren)<br />
Arbeitsgemeinschaften zur Lern- und Leistungsför<strong>der</strong>ung, fachbezogen o<strong>der</strong><br />
allgemein, sind in <strong>der</strong> Regel auch allen Kin<strong>der</strong>n zugänglich, die einen Bedarf<br />
anmelden. Dies gilt auch für die tägliche Hausaufgabenbetreuung, die entwe<strong>der</strong><br />
in offener Form für alle o<strong>der</strong> in gebundener Form (mit Anmeldung) für die Jahrgänge<br />
5 bis 7 in kleinen Gruppen angeboten wird. Dabei geht es nicht ausschließlich um<br />
die Bearbeitung von Defiziten son<strong>der</strong>n auch um die weitergehende För<strong>der</strong>ung<br />
beson<strong>der</strong>er Interessen. Mehr Informationen hierzu finden sich unter dem Punkt<br />
„Ganztagsschule“. (Herr Hey)<br />
Jedem Kind steht zu je<strong>der</strong> Zeit eine individuelle Möglichkeit zur Schullaufbahn-<br />
und Berufsberatung zur Verfügung. Neben den Klassenlehrern wird dies durch die<br />
Stufenleiter, den Koordinator und den Berufsberater, <strong>der</strong> einmal wöchentlich eine<br />
Sprechstunde abhält, geleistet.<br />
Allen Schülern ab <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 8 wird die Teilnahme an einem vierzehntägigen<br />
Ostercamp angeboten. In Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Volkshochschule Wetzlar, dem<br />
Jugendbildungswerk <strong>der</strong> Stadt Wetzlar und <strong>der</strong> Stadt Wetzlar wird das vom<br />
Hessischen Kultusministerium geför<strong>der</strong>te Camp in den Osterferien durchgeführt.<br />
Leistungsschwächen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden<br />
zielgerichtet und individuell bearbeitet. Gemeinsame Mahlzeiten und pädagogisch<br />
begleitete Musik-, Sport- und Erlebnisangebote sorgen für eine motivierende und<br />
lernför<strong>der</strong>liche Atmosphäre. (Frau Schmittel)<br />
Alle Jahrgangsteams (s. auch dort) haben ein eigenes För<strong>der</strong>konzept mit selbst<br />
verwalteten Ressourcen, das auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Jahrgangskin<strong>der</strong> zugeschnitten<br />
ist. In diesen För<strong>der</strong>konzepten finden sich zum Beispiel klassenweises<br />
Methodentraining, Sozialtrainingsmaßnahmen wie auch fachbezogene<br />
Leistungsför<strong>der</strong>ung mit ausgewählten Gruppen. Die Konzeptionen sind im Anhang<br />
beigefügt. (Teamsprecher)<br />
7
In zwei Arbeitsgemeinschaften werden Schüler von einer Schulmediatorin zu<br />
Streitschlichtern herangebildet, die in den Pausen und ggf. auch mit einem<br />
Klassenverband dazu beitragen können, Streitigkeiten zur Zufriedenheit aller zu<br />
regeln helfen. (Frau Jacobsen)<br />
Kin<strong>der</strong> mit einem beson<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>schwerpunkt<br />
Für Kin<strong>der</strong> mit einem beson<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>schwerpunkt steht eine Reihe von<br />
Einrichtungen bereit, die ihrer speziellen Problemlage Rechnung tragen.<br />
Sozialtraining<br />
Für beson<strong>der</strong>s schwierige Klassensituationen kann die Hilfe einer Sozialtrainerin/eines<br />
Sozialtrainers in Anspruch genommen werden. Diese Person arbeitet sowohl<br />
allgemein als auch problembezogen mehrere Stunden lang mit <strong>der</strong> Klasse. Einzelne<br />
Kin<strong>der</strong>, in <strong>der</strong> Regel aus dem 5. o<strong>der</strong> 6. Schuljahr, denen die Einglie<strong>der</strong>ung in den<br />
Sozialverband beson<strong>der</strong>s schwer fällt, erhalten über einen ihnen angemessenen<br />
Zeitraum eine wöchentliche Trainingsstunde, in <strong>der</strong> sie Selbstbeobachtung und<br />
Kontrollmechanismen erlernen. (Frau Jacobsen, Herr Muelenz, Frau van Staveren)<br />
Einglie<strong>der</strong>ungshilfe für Seiteneinsteiger<br />
Kin<strong>der</strong>, die aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland kommen, erhalten in nach<br />
Lernstand differenzierenden Gruppen neben sprachlicher För<strong>der</strong>ung Hilfestellung<br />
dabei, sich in unserem Schulsystem einglie<strong>der</strong>n zu können. (hierzu: im Anhang die<br />
ausführliche Konzeption) (Frau Kutscha, Frau Ufer)<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> lese-rechtschreibschwachen Kin<strong>der</strong><br />
Nach einer Überprüfung aller Kin<strong>der</strong> des 5. Schuljahres werden diejenigen, bei denen<br />
durch die Fachkraft eine Lese-Schreibschwäche im Sinne <strong>der</strong> LRS festgestellt wird, in<br />
kleinen Gruppen zu maximal fünf Kin<strong>der</strong>n individuell geför<strong>der</strong>t. Der Schwerpunkt <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung liegt in den Jahrgängen 5 und 6 und umfasst <strong>der</strong>zeit 10 Stunden. Für die<br />
Fortführung dieser Maßnahme mit weiterhin bedürftigen Kin<strong>der</strong>n in den Jahrgängen<br />
7 und 8 sind weitere 2 Stunden angesetzt. Die ausführliche Konzeption, die auch die<br />
begleitenden Maßnahmen des Regelunterrichts beschreibt, findet sich im Anhang.<br />
(Frau Böcher, Frau Halama)<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Berufsreife<br />
Schülerinnen und Schüler, <strong>der</strong>en Orientierung auf schulische Erfor<strong>der</strong>nisse schwach<br />
ist, werden absehbar die Schule nach dem 9. Schuljahr mit einem beruflichen Ziel<br />
verlassen. Den meisten von ihnen gelingt dies nicht ohne eine intensive persönliche<br />
Hilfestellung. Die jahrgangsweise in den Klassen 8 und 9 stattfindenden<br />
Betriebspraktika und Praxistage bieten ihnen zwar in <strong>der</strong> Regel die Erkenntnis, dass<br />
sie in praktischen Bereichen zu guten o<strong>der</strong> sehr guten Leistungen in <strong>der</strong> Lage sind,<br />
die Übertragung auf schulische Konsequenzen ist ihnen aber wenig möglich. Hier<br />
setzt im Vorfeld bereits ab Klasse 7 die Arbeit <strong>der</strong> Fachkraft vom Internationalen<br />
Bund an, die mit durchschnittlich 15 Wochenstunden den Kin<strong>der</strong>n bei ihrer<br />
Orientierung (Abschlusswünsche, berufliche Wünsche, schulische Erfor<strong>der</strong>nisse)<br />
behilflich ist.<br />
Über das Bildungswerk <strong>der</strong> Hessischen Wirtschaft steht uns eine weitere Fachkraft<br />
mit 40 Stunden zur Verfügung, die mit Kin<strong>der</strong>n aus dem 8. und 9. Schuljahr in enger<br />
Zusammenarbeit mit Elternhaus und Schule eine Berufseinstiegsbegleitung (BEB)<br />
leistet.<br />
8
Auch durch die Unterrichtsorganisation wird diese Verbindung von Schule und Beruf<br />
(SchuB) unterstützt. Die Klasse 9 P wird von den Jugendlichen besucht, die das Ziel<br />
haben, einen guten Hauptschulabschluss zu erreichen und anschließend entwe<strong>der</strong><br />
eine Ausbildung zu beginnen o<strong>der</strong> eine erweiterte Qualifizierung in <strong>der</strong> Berufsschule<br />
zu erreichen. Ein Teil des Unterrichtsangebots bezieht sich auf praktische<br />
Aufgabenstellungen (Beispiel: Planung, Finanzierung, Bau des Spielehauses auf dem<br />
Schulhof), daneben arbeitet je<strong>der</strong> Schüler wöchentlich an dem Praxistag in einem<br />
Betrieb.<br />
Die Durchführung eines Praxistages in <strong>der</strong> Woche steht auch den Schülern offen, die<br />
in den Regelklassen mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses verblieben sind.<br />
Die Koordination dieser Maßnahmen liegt in den Händen des Leiters für die<br />
Jahrgangsstufe 9/10, Herrn Foltin.<br />
För<strong>der</strong>ung und Hilfestellung für Kin<strong>der</strong> mit son<strong>der</strong>pädagogischem<br />
För<strong>der</strong>bedarf<br />
Ein Teil unserer Kin<strong>der</strong> leidet unter erheblichen persönlichen und familiären<br />
Problemen, die sich im sozialen Verhalten und mangeln<strong>der</strong> psychischer Stabilität<br />
und in ihrem Leistungsbild nie<strong>der</strong>schlagen. Diesen Kin<strong>der</strong>n einerseits eine<br />
Unterstützung dabei zu sein, dass auch sie mit Freude und Zuversicht Erfolge<br />
erzielen können und zum an<strong>der</strong>en dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen aller<br />
an<strong>der</strong>en gewahrt bleiben, ist das Ziel aller in <strong>der</strong> Schule Arbeitenden. Dabei spielt es<br />
zunächst keine Rolle, ob ein amtlich festgestellter son<strong>der</strong>pädagogischer För<strong>der</strong>bedarf<br />
vorliegt o<strong>der</strong> nicht.<br />
Zwei För<strong>der</strong>lehrer, die Leiterin des Trainingsraums und die pädagogische Leiterin<br />
begleiten diese Kin<strong>der</strong> in enger Zusammenarbeit mit Klassen- und Fachlehrern und<br />
dem Elternhaus mit gezielten Maßnahmen auf ihrem Weg in die Stabilisierung.<br />
Mit zwei Wochenstunden steht ein psychologischer Berater zur Verfügung, <strong>der</strong> in<br />
seinen Sprechstunden sowohl das Kollegium als auch einzelne Schüler und/o<strong>der</strong> ihre<br />
Eltern unterstützt.<br />
Das Ziel, dem Kind und <strong>der</strong> Familie ein tragfähiges Netzwerk über die Schule hinaus<br />
zu bieten, setzt eine gute Zusammenarbeit mit Jugendhilfeeinrichtungen, den<br />
psychologischen Praxen, insbeson<strong>der</strong>e hier <strong>der</strong> Ambulanz <strong>der</strong> Rehbergklinik und <strong>der</strong><br />
Klinik „Rehbergpark“, Ergotherapeuten und nicht zuletzt hilfsbereiten Einzelpersonen<br />
voraus. Diese Zusammenarbeit funktioniert auf allen Ebenen, bedarf aber des<br />
ständigen Ausbaus. Die Präzisierung dieser Konzeption findet sich im Anhang.<br />
(Frau Jacobsen, Herr Muelenz)<br />
Eine Intensivierung qualifizierter Schulsozialarbeit ist zur Unterstützung des<br />
För<strong>der</strong>netzwerks dringend angeraten.<br />
Alle Maßnahmen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung sind miteinan<strong>der</strong> vernetzt, so dass sie nach dem<br />
Bedarf des einzelnen Kindes koordiniert angewendet werden können. Die beson<strong>der</strong>e<br />
Leistung liegt bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, die durch die Nutzung<br />
des Netzwerks die Verantwortung für die Kin<strong>der</strong> ihrer Klasse wahrnehmen.<br />
(Verantwortlich: Frau Hühn)<br />
9
3.3 Lernwerkstatt<br />
Unsere Lernwerkstatt ist eine material- und anregungsreiche Lernumgebung, in <strong>der</strong><br />
Schüler selbständig und mit vielen Sinnen lernen und arbeiten können. Die<br />
Einrichtung einer Lernwerkstatt trägt <strong>der</strong> Erkenntnis Rechnung, dass Lernen ein<br />
individueller Vorgang ist. Sie bietet durch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit ihrer<br />
Lernmaterialien sowie tägliche betreute Öffnungszeiten (von 8:00 Uhr- 14:30 Uhr)<br />
Raum und Zeit für die Individualisierung von Lernprozessen.<br />
In dem ca. 200 m 2 große Raum mit Gruppen- und Einzelarbeitstischen, <strong>der</strong> bis jetzt<br />
ca. 450 Lernmaterialien (vom Übungsheft, über Lernsoftware, Audio CDs,<br />
Brettspielen bis zum Selbstbaumodell), 6 internetfähige Rechner und ein<br />
„Smartboard“ beherbergt, sowie eine direkte Verbindung zur Schülerbibliothek mit<br />
ca. 4400 Medien besitzt, möchten wir ein Umfeld schaffen, das zum eigenständigen<br />
Lernen einlädt.<br />
Eigenständiges Lernen erfor<strong>der</strong>t ein hohes Maß an Selbstständigkeit und<br />
Verantwortungsübernahme auf Seiten <strong>der</strong> Schüler. Sie arbeiten in <strong>der</strong> Lernwerkstatt<br />
in <strong>der</strong> Regel freiwillig und meist ohne direkte Kontrolle. Dabei lernen sie nach und<br />
nach, selbst – so weit wie möglich- Verantwortung für ihren Lernprozess zu<br />
übernehmen. Um das zu trainieren, nehmen alle Schüler des 5. Jahrgangs ab dem<br />
Schuljahr 2009/2010 im Rahmen des Klassenunterrichts gemeinsam mit ihrem<br />
Klassenlehrer an einem speziell an den Möglichkeiten <strong>der</strong> Lernwerkstatt<br />
ausgerichteten Methodenworkshop teil, <strong>der</strong> im 6. und 7. Schuljahr weitergeführt<br />
werden soll. Innerhalb ihrer ersten drei Schuljahre sollen die Schüler so die<br />
Möglichkeit erhalten ein Methodenrepertoire für „Selbständiges Lernen“ sukzessive<br />
einüben und aufbauen zu können.<br />
Dieses Ziel erreicht man aber nicht an einem isolierten Ort in <strong>der</strong> Schule o<strong>der</strong> in<br />
einem „Workshop“, dieses Prinzip <strong>der</strong> Eigenverantwortung und Selbstständigkeit<br />
muss zentral im Schulleben, im Klassen –und Fachunterricht, verankert und ein<br />
wesentlicher Bestandteil unserer Schulkultur werden.<br />
Unsere Lernwerkstatt ist ein Teil davon.<br />
(Verantwortlich: Frau Berkenkamp)<br />
3.4 Ganztagsschule<br />
Die <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-Schule als offene Ganztagsschule mit gebundenen Anteilen<br />
gibt allen Kin<strong>der</strong>n und ihren Eltern die Möglichkeit einer täglichen Betreuung von<br />
7.30 bis 16.30 Uhr. Es gibt jährlich eine Vielzahl offener, gebundener und wählbarer<br />
Angebote, die gemeinsam ein flexibles System des ganztägigen Aufenthalts in <strong>der</strong><br />
Schule bilden.<br />
In <strong>der</strong> 5. Klasse arbeitet die Schule nach einem neuen Tagesrhythmus (siehe Punkt<br />
4.1). In <strong>der</strong> 6. Klasse beginnt je<strong>der</strong> Morgen mit einer Stunde offenen Anfangs, in <strong>der</strong><br />
die Kin<strong>der</strong> sowohl Aufgaben erledigen als auch spielen o<strong>der</strong> sich einer Arbeitsgruppe<br />
(Methodentraining, fachspezifisches För<strong>der</strong>angebot, Englisch bilingual o<strong>der</strong><br />
Sozialtraining) anschließen können. Gedacht ist dies als sanfter Einstieg in den<br />
Schultag.<br />
Für alle Kin<strong>der</strong> steht von 13.00 bis 14.30 Uhr die offene Hausaufgabenhilfe zur<br />
Verfügung, die durch eine Lehrkraft betreut wird und von denen genutzt wird, die<br />
nur punktuell eine Unterstützung brauchen o<strong>der</strong> die Zeit bis zur folgenden<br />
Veranstaltung überbrücken möchten.<br />
10
Zu dieser Zeit werden auch die offenen Arbeitsgemeinschaften (EDV, Spiele,<br />
Sport u.a.) angeboten, für die eine feste Anmeldung nicht erfor<strong>der</strong>lich ist und die<br />
gelegentlich o<strong>der</strong> auch regelmäßig besucht werden können.<br />
In <strong>der</strong> Regel beginnen die Arbeitsgemeinschaften mit fester Anmeldung um 14.30<br />
Uhr und dauern bis 16.00 Uhr.<br />
Die Versorgung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist durch die Cafeteria mit einem reichhaltigen<br />
Frühstücksangebot und durch die Mensa mit einem täglich frisch zubereiteten<br />
Mittagessen (zwei Wahlmenüs) sichergestellt.<br />
In den Klassen 5 und 6 sind uns unter an<strong>der</strong>em zwei Dinge beson<strong>der</strong>s wichtig. Zum<br />
einen ist dies das Erleben <strong>der</strong> Schule als Lebensraum, zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> Aufbau<br />
stabiler Gemeinschaften, in denen die Sozialkompetenz beständig wachsen kann.<br />
Deshalb gibt es nicht nur den offenen Anfang, son<strong>der</strong>n auch den obligatorischen<br />
wöchentlichen Schultag bis 16.00 Uhr. An diesem Tag gehen die Klassen mit<br />
ihrem Klassenlehrer gemeinsam zum Mittagessen, das an einem eingedeckten Tisch<br />
mit Gruppenversorgung (Schüsseln statt Einzelausgabe des Essens) stattfindet. Nach<br />
einer angemessenen freien Spielpause, in <strong>der</strong> auch die offenen<br />
Arbeitsgemeinschaften besucht werden können, erledigen die Kin<strong>der</strong> ihre<br />
Hausaufgaben gemeinsam unter Anleitung des Klassenlehrers. Anschließend finden<br />
bis 16 Uhr weitere unterrichtliche Aktivitäten statt.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e Eltern, die selber nachmittags arbeiten gehen, melden ihre Kin<strong>der</strong> als<br />
Ganztagskin<strong>der</strong> an. Diese Kin<strong>der</strong> gehen täglich gemeinsam mit einem Betreuer<br />
zum Essen und erledigen dann unter seiner Aufsicht die Hausaufgaben. Je nach<br />
Interesse o<strong>der</strong> Bedarf besuchen sie im Anschluss eine <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaften.<br />
Manchen Kin<strong>der</strong>n fällt es schwer, sich mittags zielgerichtet an die Hausaufgaben zu<br />
setzen, manche Eltern fühlen sich mit <strong>der</strong> Hilfestellung hierbei überfor<strong>der</strong>t. Deshalb<br />
werden aus den Jahrgängen 5 bis 7 halbjährlich etwa zwischen 100 und 150<br />
Anmeldungen für die feste Hausaufgabenbetreuung abgegeben. In kleinen<br />
Gruppen erledigen diese Kin<strong>der</strong> unter <strong>der</strong> Aufsicht und <strong>der</strong> Anleitung von<br />
Honorarkräften ihre Aufgaben, lassen sie nachsehen und trainieren für Tests und<br />
Arbeiten.<br />
Das breite Angebot an Arbeitsgemeinschaften vermag unterschiedliche<br />
Zielsetzungen abzudecken.<br />
Ein Teil davon wurde eingerichtet, um Schülerinnen und Schülern eine Hilfestellung<br />
bei <strong>der</strong> Bewältigung schulischer Schwierigkeiten o<strong>der</strong> spezielle Beratung zu bieten.<br />
Ein Beispiel hierfür ist die Nacharbeits-AG, in denen Kin<strong>der</strong> dazu veranlasst werden,<br />
Versäumnisse <strong>der</strong> vergangenen Wochen zu bearbeiten, ein an<strong>der</strong>es sind die<br />
Abgänger-Beratungen.<br />
Die übrigen Angebote sprechen die beson<strong>der</strong>en Interessen <strong>der</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler an, können ihnen dabei helfen, sinnvolle Freizeitgestaltungen zu finden o<strong>der</strong><br />
sich mit Gleichgesinnten weiterzubilden. Hier können Stärken in den Bereichen des<br />
Sports, des Spiels, <strong>der</strong> Kreativität und des Handwerks, <strong>der</strong> Musik, <strong>der</strong> Sprachen, <strong>der</strong><br />
Technik, des Kochens und sozialer Kompetenzen entwickelt o<strong>der</strong> ausgebaut werden.<br />
Die meisten Angebote werden von Honorarkräften gemacht. Beson<strong>der</strong>s erfreulich ist<br />
es, dass daran zunehmend auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule beteiligt<br />
sind, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an ihre Mitschüler weitergeben.<br />
(Verantwortlich: Herr Hey)<br />
11
3.5 Unesco-Projektschule und internationale Bildungsprojekte<br />
Schulische Erziehung im Sinne <strong>der</strong> UNESCO ist Erziehung zu Toleranz und<br />
Völkerverständigung, zu gegenseitigem Respekt und Interesse aneinan<strong>der</strong>. Dabei<br />
wird an unserer Schule u. a. die Zusammensetzung unserer Schülerschaft als Chance<br />
genutzt, z. B. Völkerverständigung nicht nur über einen wie auch immer interessant<br />
gestalteten Unterricht über ferne Län<strong>der</strong> und fremde Sitten zu erreichen, son<strong>der</strong>n<br />
über das konkrete Erleben und ggf. auch Ertragen <strong>der</strong> kulturellen Beson<strong>der</strong>heit des<br />
Nachbarschülers und <strong>der</strong> Nachbarschülerin. Nicht kritikloses Hinnehmen z. B. des<br />
Kopftuchtragens <strong>der</strong> moslemischen Mitschülerin ist dabei das Ziel, son<strong>der</strong>n das<br />
Beziehen des eigenen Standpunktes bei gleichzeitiger Toleranz gegenüber dem<br />
Gegenstandpunkt.<br />
Darüber hinaus sind UNESCO-Themen Bestandteil des schulischen Curriculums.<br />
Als UNESCO-Arbeit nach außen zählen folgende Vorhaben:<br />
- Internationale Bildungsprojekte<br />
- Jugendbegegnungscamps<br />
- Unterstützung von UNESCO-Projekten in Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
- Unterstützung von Kin<strong>der</strong>heimen in Rumänien<br />
Fest verankert in unserem Programm sind die jährliche Teilnahme am<br />
Internationalen Jugendforum in Krakau (Jahrgangsstufe 9) und die Teilnahme an <strong>der</strong><br />
Jugendbegegnung im Europahaus in Aurich (Jahrgangsstufe 10).<br />
Seit vier Jahren organisiert die Schule Internationale Betriebspraktika mit<br />
Partnerschulen in Lund/Schweden und Hamar/Norwegen.<br />
In Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> evangelischen Kirchengemeinde in Nie<strong>der</strong>girmes<br />
unterstützten wir die Arbeit einer Schule in Kisongo/Tansania.<br />
Jährlich vor Weihnachten unterstützen wir Kin<strong>der</strong> in rumänischen Kin<strong>der</strong>heimen mit<br />
<strong>der</strong> Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.<br />
Alle UNESCO-Vorhaben sind im Unterricht bzw. in vor- und nachbereitenden<br />
Arbeitsgemeinschaften verankert.<br />
(Verantwortlich: Herr Hormann, Herr Wegerle)<br />
3.6 Partnerschule des Sports<br />
Die <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> versteht sich als Partner für Vereine und Verbände<br />
des Sports.<br />
Für die Schwerpunktsportart Kunstturnen ist ein Lehrertrainer vorhanden.<br />
Sportför<strong>der</strong>ung soll sowohl <strong>der</strong> Ausbildung allgemeiner schulsportlicher als auch <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> leistungssportlichen Aktivitäten dienen - Leistungssport und Schule<br />
sind nicht Gegensätze, son<strong>der</strong>n ergänzen sich sinnvoll. Die Schule eröffnet<br />
Möglichkeiten, Unterricht und Training im Rahmen des Konzeptes <strong>der</strong> offenen<br />
Ganztagsschule möglichst optimal zu kombinieren.<br />
12
Konzeption:<br />
Sportlich orientierte Kin<strong>der</strong> sind in einer Klasse zusammen gefasst und dort integriert.<br />
Die Schülerinnen und Schüler werden während ihres Schul- und Trainingstages von<br />
einer Kraft im freiwilligen sozialen Jahr begleitet. Sind die Kin<strong>der</strong> im Programm<br />
Kunstturnen tätig, übernimmt unser Lehrertrainer die Koordination zum<br />
Kunstturnleistungszentrum.<br />
Nach Möglichkeit werden zwei Trainingseinheiten vormittags im Stundenplan<br />
integriert. Die Kin<strong>der</strong> gehen zusammen mit ihrer Betreuerin zum Mittagessen und<br />
erledigen anschließend zusammen ihre Hausaufgaben. Für Wettkämpfe und<br />
Ka<strong>der</strong>maßnahmen werden sie großzügig beurlaubt. Die eventuell versäumten<br />
Lerninhalte werden individuell nachgearbeitet.<br />
Im Ganztagsprogramm gibt es darüber hinaus eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften<br />
im breitensportlichen Bereich. Sportlich orientierte Schülerinnen und Schüler haben<br />
ebenfalls die Möglichkeit, im Wahlpflichtbereich Sport als vertiefendes Fach zu<br />
wählen.<br />
(Verantwortlich: Herr Hey)<br />
3.7 Stand <strong>der</strong> Entwicklung zur Teamschule<br />
Dem Gedanken des Netzwerkes für jeden Schüler entsprechend wurde im Schuljahr<br />
2007/08 erstmals in Jahrgangsteams gearbeitet.<br />
Kern des jeweiligen Teams sind die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, die<br />
Fachlehrer ordnen sich je nach ihrem schwerpunktmäßigen Unterrichtseinsatz o<strong>der</strong><br />
auch nach persönlichen Gesichtspunkten den einzelnen Teams zu.<br />
Die gemeinsame und breite Fürsorge für die Schüler des Jahrgangs ist das<br />
vorrangige Ziel <strong>der</strong> Teamarbeit. Ohne dass die beson<strong>der</strong>e Verantwortung des<br />
Klassenlehrers aufgehoben ist, sollen sich doch die organisatorischen und personellen<br />
Bedingungen verbessern. Die Teams erhalten dafür sowohl personelle als auch<br />
materielle Ressourcen zur eigenen Verfügung.<br />
Eckdaten zur Teambildung, abgestimmt auf <strong>der</strong> Gesamtkonferenz vom<br />
9.4.2008:<br />
- Je<strong>der</strong> gehört einem Team an, Informationen aus an<strong>der</strong>en Teams, in denen<br />
ich unterrichte, kann ich über die Teamsprecher erhalten.<br />
- So sehr die Ziele und Vorstellungen in einem Team auch differieren mögen:<br />
Eines steht fest: Wir lassen keinen Schüler völlig zurück (Minimalziel).<br />
- Teams erstellen gemeinsam einen Jahresarbeitsplan.<br />
- Teams treffen eigenständige Entscheidungen (z.B. För<strong>der</strong>maßnahmen,<br />
Organisation und inhaltliche Definition von Unterrichtsstunden und <strong>der</strong>en<br />
Verteilung …).<br />
13
- Teams rufen ihre Ressourcen nach gemeinsamen Überlegungen ab<br />
(Ressourcen sind: Stunden aus dem Betreuungstopf, Einsatz von Honorarkräften<br />
für beson<strong>der</strong>e Aufgaben, finanzielle Mittel).<br />
- Teams bilanzieren ihre Arbeit einmal jährlich, wobei das wesentliche Ziel (s.<br />
oben) im Mittelpunkt steht.<br />
- Teams geben ihre Erkenntnisse aus <strong>der</strong> Bilanzierung in einer<br />
Gesamtkonferenz weiter und machen ggf Vorschläge für weitere<br />
Entwicklungsschritte<br />
Der von dem jeweiligen Team gewählte Teamsprecher ist <strong>der</strong> Ansprechpartner<br />
sowohl für die Angehörigen an<strong>der</strong>er Teams als auch für die Schulleitung.<br />
Für beson<strong>der</strong>e unterrichtliche Arbeitsformen o<strong>der</strong> auch klassenübergreifende<br />
Versammlungen zum Beispiel <strong>der</strong> Klassensprecher o<strong>der</strong> einer Arbeitsgruppe stehen<br />
den Teams vier große Flurräume zur Verfügung, die „Aquarien“, so genannt, weil sie<br />
auch von außen einsehbar sind.<br />
(Verantwortlich: Frau Hühn)<br />
3.8 Projekt BIWAQ<br />
Mit dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier)<br />
gewährt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
Zuwendungen für Projekte in den Programmgebieten des<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ungsprogramms „Soziale Stadt" (Bundesprogramm 2007).<br />
Im Rahmen dieses Programmes hat <strong>der</strong> Internationale Bund (IB) mit <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<br />
<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> das Projekt "Chancen in Nie<strong>der</strong>girmes" beantragt. Der Antrag<br />
wurde bewilligt.<br />
Ein Schwerpunkt des Projektes ist die Umwandlung <strong>der</strong> Schulmensa in ein<br />
Schulrestaurant. Der IB hat einen Chefkoch, einen Souschef und vier Hilfskräfte<br />
eingestellt. Seit Beginn dieses Schuljahres sind vier Ausbildungsplätze zum Koch<br />
hinzugekommen, die auch unseren Schülern zugute kommen.<br />
Das Schulrestaurant bietet täglich zwei Menues mit reichhaltiger Salattheke an. Im<br />
Café Flamingo gibt darüber hinaus diverse Snacks und Getränke.<br />
Gemeinsam mit <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Schule wurde als zweiter<br />
Projektschwerpunkt eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Ein Zweiradmeister und zwei<br />
Hilfskräfte leiten Schülerinnen und Schüler bei <strong>der</strong> Reparatur ihrer Zweirä<strong>der</strong> an.<br />
(Verantwortlich: Herr Wegerle)<br />
14
4. Arbeitsschwerpunkte<br />
4.1 Rhythmisierung<br />
Die in <strong>der</strong> vorherigen Fassung des <strong>Schulprogramm</strong>s aus dem Jahr 2009<br />
beschriebenen Überlegungen wurden konkretisiert. In <strong>der</strong> Gesamtkonferenz wurde<br />
am 25.05.2010 beschlossen, im Schuljahr 2010/2011 mit <strong>der</strong> neuen Rhythmisierung<br />
in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 5 zu beginnen und in <strong>der</strong> Folge bis zur Jahrgangsstufe 10<br />
wachsen zu lassen. Die schulischen Gremien haben zugestimmt.<br />
Der Tagesrhythmus für die Jahrgangsstufe 5 wird entsprechend dieses<br />
Stundenplanbeispieles gestaltet:<br />
Std Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
0. 07:50 –<br />
08:20<br />
oA oA oA oA oA<br />
1. 08:20 –<br />
09:00<br />
Übungszeit Übungszeit Übungszeit Übungszeit Übungszeit<br />
Pause 20` 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause<br />
2. 09:20 –<br />
10:00<br />
Ma Bio E D E<br />
3. 10:00 –<br />
10:40<br />
Ma Bio E D E<br />
Pause 20 ` 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause 20 `Pause<br />
4. 11:00 –<br />
11:40<br />
E Ma Spo Reli Ma<br />
5. 11:40 – Gl 40<br />
40<br />
Reli 40<br />
12:20<br />
`Mittagspause `Mittagspause<br />
`Mittagspause<br />
6. 12:20 – 40<br />
D Gl 40 `Mittagspause Mu<br />
13:00 `Mittagspause<br />
7. 13:00 –<br />
13:40<br />
D D Gl KL Mu<br />
8. 13:40 –<br />
14:20<br />
Ku Zusatz Zusatz Sp Zusatz<br />
9. 14:20 –<br />
15:00<br />
Ku Zusatz Zusatz Sp Zusatz<br />
AG 15:00 –<br />
16:30<br />
Arbeitsgemeinschaften<br />
Die Erfahrungen mit dem neuen Modell werden in je<strong>der</strong> Gesamtkonferenz vorgestellt<br />
und diskutiert.<br />
(Verantwortlich: Team 5, Herr Wegerle)<br />
4.2 Fortführung <strong>der</strong> Teamentwicklung<br />
Die an <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer<br />
repräsentieren ein hohes Maß an Kompetenzen sowohl in pädagogischer als auch<br />
organisatorischer Hinsicht. Wenn ein solches System zentral organisiert wird, können<br />
diese Fähigkeiten nur begrenzt entfaltet werden. Selbstverständlich werden Pläne<br />
unter pädagogischen Gesichtspunkten gemacht, allerdings ohne dass die<br />
15
Erfor<strong>der</strong>nisse kleinerer Arbeitseinheiten im Detail immer Berücksichtigung finden<br />
können.<br />
Ein wesentliches Ziel bei <strong>der</strong> Entwicklung zu einer Teamschule ist es, die in einem<br />
Kollegium vorhandenen Ressourcen nutzbar werden zu lassen, was zum einen den<br />
Schülerinnen und Schülern des Teams aber auch den Teamkollegen zugute kommt,<br />
wenn sie ihre eigenen Ideen und Vorstellungen leichter umsetzen können.<br />
Entscheidend hierfür ist die Bemessung eines größtmöglichen<br />
Entscheidungsspielraums bezogen auf ein gemeinsames Ziel.<br />
Alle Kolleginnen und Kollegen (auch die mit einer Leitungsfunktion versehenen)<br />
befinden sich hier in einem Lernprozess, in dem sowohl das Einfor<strong>der</strong>n als auch das<br />
Gewähren von Ressourcen immer wie<strong>der</strong> kritisch bedacht wird. Ebenso ist auch die<br />
Arbeit in einem Team selbst bereits eine nicht immer leicht zu bewältigende Aufgabe,<br />
vor allem in Anbetracht dessen, dass bisherige Formen <strong>der</strong> Zusammenarbeit eher<br />
nach sehr persönlichen Gesichtspunkten o<strong>der</strong> punktuell geschahen. Wir bezeichnen<br />
dies als Aufbauphase, die wir nicht als abgeschlossen betrachten können.<br />
Die Konsolidierung <strong>der</strong> Teams läuft in den Jahrgängen unterschiedlich ab, so dass die<br />
nächsten Etappenziele nicht in jedem Fall die gleichen sind.<br />
Als Entwicklungsraster sind die folgenden Stationen denkbar:<br />
- Konsolidierung <strong>der</strong> Teams: Verfahrensfragen, Problembewältigung,<br />
Grundsatzentscheidungen<br />
- Fortschreitende Selbstständigkeit <strong>der</strong> Teams mit weitreichenden<br />
Entscheidungsmöglichkeiten nach Anfrage (die Teams müssen dies wollen)<br />
- Eigenständige pädagogische und personelle Entscheidungen: Rhythmisierung,<br />
Stundenplangestaltung, Betreuungskräfte und mehr<br />
Die Bildung von Jahrgangsteams allerdings bedeutet immer auch eine Beschränkung<br />
<strong>der</strong> Möglichkeiten in <strong>der</strong> Gestaltung des schulischen Alltags, da die Versorgung <strong>der</strong><br />
Lerngruppen mit Lehrern in den Fächern, die nur mit geringer Wochenstundenzahl<br />
unterrichtet werden, erfor<strong>der</strong>lich macht, dass ein Teil <strong>der</strong> Fachkollegen in nahezu<br />
allen Jahrgängen und damit in allen Teams unterrichtet. Eine Konzentration auf die<br />
Aufgaben eines Teams ist daher schwierig. Und für die Schüler bedeutet dies, dass<br />
sie weiterhin viele verschiedene Lehrer haben.<br />
Deshalb ist <strong>der</strong> Gedanke an die Bildung vertikaler Teams (von Klasse 5 bis Klasse 10)<br />
weiterhin präsent. Dies bedeutet allerdings auch, dass wir die jetzige Form<br />
<strong>der</strong> äußeren Differenzierung überdenken müssen.<br />
(Verantwortlich: Frau Hühn)<br />
4.3 Gymnasiale Oberstufe an <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong><br />
Die ABS ist im Raum Wetzlar eine stark nachgefragte Schule. Dazu trägt sicherlich<br />
die bei uns beson<strong>der</strong>s ausgeprägte individuelle Beratung und För<strong>der</strong>ung jedes<br />
einzelnen Schülers bei. Dies auch im Bereich <strong>der</strong> Jahrgangsstufen 11 bis 13<br />
fortzusetzen ergibt sich als logische Konsequenz aus unserer gesamten Arbeit und ist<br />
uns ein Anliegen.<br />
Unsere geplante kleine, überschaubare Oberstufe soll Schüler und Schülerinnen zur<br />
Studierfähigkeit führen und gleichzeitig ein an <strong>der</strong>en Bedürfnissen ausgerichtetes<br />
pädagogisches Profil haben. So können die Ressourcen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler<br />
16
optimal genutzt und ausgebildet werden. Gerade für Kin<strong>der</strong> mit<br />
Migrationshintergrund wird dies einen auf ihre teilweise spezielle Situation<br />
zugeschnittenen Zugang zum gymnasialen Bildungsweg bedeuten. Für Wetzlar und<br />
Umgebung wird ein neues schulisches Angebot geschaffen, das eine Alternative auf<br />
dem Weg zum allgemeinbildenden Abitur bietet.<br />
Schülerinnen und Schüler werden bereits vor Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 bis<br />
zum Abitur pädagogisch begleitet und können in einem überschaubaren Rahmen<br />
lernen. Bewährte Lehr- und Lernmethoden werden fortgesetzt, das Augenmerk auf<br />
individualisiertes Lernen weiterhin gelegt.<br />
Diese Oberstufe wird nicht nur von den Kin<strong>der</strong>n besucht werden, die bereits seit <strong>der</strong><br />
Klasse 5 an unserer Schule sind, son<strong>der</strong>n auch von den Schülern an<strong>der</strong>er Schulen.<br />
Eine enge Zusammenarbeit mit diesen Partnerschulen ist geplant, um den Übergang<br />
von Klasse 10 in Klasse 11 bereits am Ende <strong>der</strong> Sekundarstufe I zu begleiten. Damit<br />
soll die deutliche Schnittstelle in <strong>der</strong> schulischen Laufbahn, die häufig mit erheblichen<br />
Umstellungsproblemen verbunden ist, entschärft werden.<br />
Die Oberstufe wird eine kleine dreizügige allgemeinbildende Oberstufe sein. Sie wird<br />
unabhängig sein, aber in enger Kooperation mit dem beruflichen Gymnasium <strong>der</strong><br />
benachbarten Werner-von-Siemens-Schule (WvSS) arbeiten. Durch diese<br />
Zusammenarbeit können personelle und räumliche Kapazitäten besser genutzt<br />
werden, ohne dass erhöhte Kosten entstehen. Zudem kann unseren Schülern<br />
dadurch ein größeres Grundkursangebot gemacht werden. Das Leistungskursangebot<br />
wird die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, POWI und / o<strong>der</strong> Geschichte,<br />
Chemie, Physik und Sport umfassen. Mit den beiden Schulen werden eine Europa-<br />
und eine UNESCO-Schule mit internationalen Projekten, Austauscherfahrungen und<br />
Betriebspraktika miteinan<strong>der</strong> verbunden. Gemeinsam kann die Bandbreite<br />
internationaler Projekte noch attraktiver gestaltet werden. Der bilinguale Unterricht<br />
<strong>der</strong> Mittelstufe wird in Verbindung mit <strong>der</strong> Vorbereitung und Durchführung<br />
internationaler Vorhaben seine Fortführung in <strong>der</strong> gymnasialen Oberstufe finden.<br />
(Verantwortlich: Herr Mai, Frau Schmittel, Herr Wegerlel)<br />
4.4 Sanierung des Schulgebäudes<br />
Die erste Phase <strong>der</strong> Sanierung ist erfolgreich abgeschlossen. Für die Jahre 2012 und<br />
2013 sind jeweils Bauphasen von den Osterferien bis zu den Sommerferien und von<br />
den Sommerferien bis zu den Herbstferien geplant, bei denen jeweils ein Viertel <strong>der</strong><br />
Schule (mit Überlappungen) geräumt werden muss. Aktuelle Informationen werden<br />
jeweils in den Gremien gegeben. Planungsunterlagen werden an geeigneter Stelle<br />
ausgehängt.<br />
Die für die Auslagerung nötigen Container werden auf dem Schulhof aufgestellt, so<br />
dass <strong>der</strong> Bereich des Kleinfeldsportplatzes zwischenzeitlich erneuert werden kann.<br />
Auf Antrag des Fachbreiches Biologie wird an <strong>der</strong> Außenseite <strong>der</strong> Aula Richtung<br />
Biologieraum ein Vivarium mit in die Planung aufgenommen.<br />
(Verantwortlich: Herr Wegerle)<br />
17
4.5 Kooperation mit außerschulischen Partnern<br />
4.5.1 Projekt BIWAQ<br />
Das Projekt BIWAQ (Mensa, Cafeteria) in Kooperation mit dem Internationalen Bund<br />
Wetzlar läuft Mitte 2012 aus. Im laufenden Schuljahr müssen Überlegungen und<br />
Planungen stattfinden, wie dieses Projekt ersetzt werden kann.<br />
(Verantwortlich: Herr Wegerle)<br />
4.5.2 „Schule als interkultureller Lernort“<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> „Modellregion Integration“ <strong>der</strong> Stadt Wetzlar hat sich die<br />
Arbeitsgruppe „Schule als interkultureller Lernort“ <strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong><br />
und <strong>der</strong> Kestnerschule gebildet, die sich gemeinsam für Kin<strong>der</strong> mit<br />
Migrationshintergrund einsetzen möchte. Zusammen mit Vertretern <strong>der</strong> sozialen<br />
Stadt Wetzlar und des Auslän<strong>der</strong>beirats sollen Abschlusschancen verbessert werden.<br />
Dazu hat sich die Gruppe drei Aufgabenschwerpunkte gesetzt: die Einführung von<br />
Nachhilfeangeboten von SchülerInnen für SchülerInnen, ein Programm zur<br />
Unterstützung von Jungen mit Migrationshintergrund und die Kontaktaufnahme zu<br />
den türkischen Vereinen in Wetzlar. Dafür wurde das Projekt „peergroup education“<br />
gestartet, das mit zwei Teilen, dem Buddy-Projekt (ältere SchülerInnen werden<br />
„Buddys“, d.h. Paten für jüngere) und dem WuSL-Projekt (ältere SchülerInnen<br />
erteilen jüngeren Nachhilfe), die Ziele <strong>der</strong> Arbeitsgruppe umsetzen möchte.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die KollegInnen <strong>der</strong> Erziehungshilfe und die Sozialpädagogin <strong>der</strong><br />
Schule engagieren sich hier. Finanzielle Unterstützung erfährt das Projekt durch das<br />
hessische Finanzministerium für schulische Sozialarbeit und Schulungen, Träger des<br />
Projektes ist das diakonische Werk Lahn-Dill.<br />
(Verantwortlich: Frau Schmittel)<br />
4.5.3 Offene Jugendarbeit<br />
Die Kirchengemeinde Naunheim hat zwei neue Gemeindepädagogen eingestellt. Es<br />
ist geplant, mit Beginn des neuen Schulhalbjahres die Kooperation wie<strong>der</strong><br />
aufzunehmen und ein ähnliches Konzept wie das ursprüngliche „Café Dreieck“ zu<br />
entwickeln.<br />
(Verantwortlich: Herr Wegerle)<br />
4.5.3 Osterferiencamp<br />
Das Osterferiencamp in Kooperation mit <strong>der</strong> Stadt Wetzlar ist bisher zweimal erprobt<br />
und findet Ostern 2011 zum dritten Mal statt. Nach den Osterferien findet eine<br />
Evaluation statt und es wird beraten, ob dieses Vorhaben fester Bestandteil des<br />
<strong>Schulprogramm</strong>es wird.<br />
(Verantwortlich: Frau Schmittel, Frau van Staveren)<br />
18
4.6 Internationale Projekte<br />
4.6.1 St.-Jakobs-Weg<br />
Unter dem Motto "Heimat, Fremde - globale Welt" geht eine Klasse den St.-Jakobs-<br />
Weg in verschiedenen Etappen. Sie richtet ihr Augenmerk auf geschichtliche und<br />
kulturelle Beson<strong>der</strong>heiten und untersucht die Unterschiede bei Nationalitäten und<br />
Religionen. Das Projekt ist ein Pilotprojekt für künftige Internationale<br />
Bildungsprojekte.<br />
(Verantwortlich: Frau Nerger)<br />
4.6.2 Projekte mit Skandinavien<br />
Unsere bisherigen Projektpartner in Norwegen (Hamar) und Schweden (Lund) sind<br />
z.Z. nicht in <strong>der</strong> Lage, internationale Projekte mit uns durchzuführen. Es wird Kontakt<br />
zu einer neuen Partnerschule in Schweden (Partille) aufgenommen, um zukunftsträchtige<br />
Projekte zu entwickeln. Ein erster Austausch findet bereits in diesem<br />
Schuljahr statt.<br />
(Verantwortlich: Herr Freiheit, Frau Böcher)<br />
4.6.3 Model International Criminal Court<br />
Das Projekt MICC findet zweimal jährlich in Kreisau, Polen statt und bringt junge<br />
Menschen aus Deutschland, Polen und einem dritten Land, im letzten Jahr aus Israel<br />
und Palästina, zusammen. Im Dezember 2009 war erstmals eine Schülergruppe <strong>der</strong><br />
<strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> unter <strong>der</strong> Leitung von Agnes Adamietz eingeladen.<br />
Das Ziel des MICC ist es auf <strong>der</strong> einen Seite das Bewusstsein für Menschenrechte zu<br />
stärken und Schüler über die Möglichkeiten zu <strong>der</strong>en Schutz zu informieren. Auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite wird ein starker Fokus auf den internationalen und interkulturellen<br />
Dialog gelegt, <strong>der</strong> das Verständnis unter den Jugendlichen för<strong>der</strong>n soll.<br />
Die ersten Erfahrungen waren überaus positiv. Die ABS nimmt im laufenden<br />
Schuljahr erneut an diesem Projekt teil. Nach einer erneuten Auswertung wird<br />
entschieden, ob die Teilnahme fest im <strong>Schulprogramm</strong> verankert wird.<br />
(Verantwortlich: Frau Adamietz)<br />
4.7 Bildungsstandards und Schulcurriculum<br />
Die bisher gültigen Lehrpläne bzw. Rahmenpläne werden ab dem 01.08.2011 durch<br />
das „Neue Kerncurriculum – Bildungsstandards und Inhaltsfel<strong>der</strong>“ abgelöst.<br />
Die Schule muss entsprechend ihrer Gegebenheiten ein spezifisches Schulcurriculum<br />
erstellen. Das Schulcurriculum muss bis zum nächsten Schuljahreswechsel noch nicht<br />
vorliegen.<br />
Im laufenden Schuljahr informiert sich je<strong>der</strong> Kollege/jede Kollegin über Kerncurricula<br />
und Bildungsstandards in seinem Fach. Es ist Aufgabe <strong>der</strong> Fachkonferenzen<br />
19
festzulegen, anhand welcher Inhalte welche Kompetenzen im Unterricht erworben<br />
werden müssen.<br />
(Verantwortlich: Jede(r), Fachbereichsleitungen, Herr Wegerle)<br />
4.8 Klassenraumgestaltung<br />
Das aktuelle Team 5 entwickelt und erprobt eine Unterrichtseinheit zum Thema<br />
„Verantwortungsvoller Umgang mit Heimtieren“, die neben <strong>der</strong> Arbeit in <strong>der</strong><br />
Lernwerkstatt auch die Pflege von Fischen im Aquarium vorsieht. In diesem<br />
Zusammenhang werden Aquarien angeschafft und jeweils an die kommenden 5er<br />
übergeben.<br />
(Verantwortlich: Team 5)<br />
5. Evaluation<br />
Ziel des <strong>Schulprogramm</strong>s und seiner Evaluation ist die Qualität schulischer Arbeit an<br />
<strong>der</strong> <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-<strong>Gesamtschule</strong> zu sichern und zu verbessern<br />
Evaluation hilft,<br />
� alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass <strong>der</strong> Alltag <strong>der</strong> Schule verän<strong>der</strong>bar ist;<br />
� Annahmen und Vermutungen zu überprüfen;<br />
� neue Fragen zu entdecken und sich alten Fragen zu stellen;<br />
� einen realistischen Umgang mit <strong>der</strong> eigenen Praxis herzustellen.<br />
Interne Evaluation<br />
• Beurteilung und Bewertung durch schulinterne Gremien<br />
• für jede hessische Schule vorgeschrieben<br />
Externe Evaluation<br />
• Beurteilung und Bewertung durch das IQ<br />
Interne Evaluation<br />
A. Für die allgemeinen Zielfestlegungen des <strong>Schulprogramm</strong>s<br />
Die interne Evaluation beginnt mit <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> bzw. <strong>der</strong> Verständigung über<br />
die Fragestellungen, d. h. was man genauer und verlässlich wissen möchte.<br />
Es müssen Fragenkataloge und die entsprechenden Messinstrumente entwickelt<br />
werden, die die Grundlage <strong>der</strong> Evaluation darstellen. Weiterhin muss vereinbart<br />
werden, wie und in welchen Zeitabschnitten die Evaluierung erfolgt.<br />
Wer erarbeitet diese Grundlagen?<br />
Projektgruppe aus Schulleitung, Lehrer/innen, Eltern und Schüler<br />
Ziel: Erarbeitung einer Evaluationsgrundlage:<br />
- Fragestellungen<br />
- Messinstrumente<br />
- Zeitrahmen<br />
- zu beteiligende Gremien<br />
- Umsetzungsplan<br />
20
Welche Gremien bestimmen über die Evaluationsgrundlage?<br />
- Schulleitung<br />
- Gesamtkonferenz<br />
- Schulelternbeirat<br />
- Schülervertretung<br />
- Schulkonferenz<br />
B. Für die konkreten projektbezogenen Ziele im <strong>Schulprogramm</strong><br />
Die entsprechenden begleitenden bzw. erarbeitenden Arbeitsgruppen, Gremien<br />
erstatten einmal jährlich, bis zum 30. Mai einen schriftlichen Bericht<br />
an die<br />
- Schulleitung<br />
- die Gesamtkonferenz<br />
- den Schulelternbeirat<br />
- die Schülervertretung<br />
über<br />
- die Zielerreichung/-einhaltung<br />
- die Fortschritte<br />
- die Hemmnisse<br />
- das weitere Vorgehen<br />
- neue Zielvorgaben/-formulierungen<br />
- Fortschreibung des <strong>Schulprogramm</strong>s<br />
Diese jährliche Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem <strong>Schulprogramm</strong> führt zu einer stetigen<br />
Aktualisierung.<br />
(Verantwortlich: Frau Hühn)<br />
21
Vereinbarungen zum Schulleben<br />
Wir alle, die zur <strong>August</strong>-<strong>Bebel</strong>-Schule gehören, wollen<br />
- in unserer Schule lernen können und Lernen ermöglichen,<br />
- uns gegenseitig achten und respektieren,<br />
- eine Schule, in <strong>der</strong> je<strong>der</strong> Verantwortung trägt,<br />
- eine Schule, in <strong>der</strong> wir uns wohlfühlen.<br />
Damit wir alle lernen können und uns wohlfühlen,<br />
- bemühen wir uns um einen ungestörten Unterricht,<br />
- vermeiden o<strong>der</strong> schlichten wir Streitereien,<br />
- gehen wir freundlich miteinan<strong>der</strong> um und beleidigen o<strong>der</strong> provozieren niemanden,<br />
- besprechen wir Probleme miteinan<strong>der</strong>,<br />
- versuchen wir, die Beson<strong>der</strong>heiten an<strong>der</strong>er zu verstehen und zu akzeptieren,<br />
- lassen wir an<strong>der</strong>e zu Wort kommen und auch ausreden.<br />
Zum alltäglichen Zusammenleben gehört auch, dass alle<br />
- sich verpflichten, nichts in die Schule mitzubringen, wodurch an<strong>der</strong>e bedroht o<strong>der</strong><br />
belästigt werden könnten,<br />
- sich so in <strong>der</strong> Schule bewegen, dass niemand gestört und gefährdet wird,<br />
- sich in <strong>der</strong> Cafeteria zum Kauf von Speisen und Getränken in einer Reihe anstellen<br />
und diese Reihenfolge einhalten,<br />
- beachten, dass mitgebrachte Handys ausgeschaltet und verstaut sind,<br />
- sich verpflichten, die Toiletten nur ihrem Zweck entsprechend zu nutzen,<br />
- das Rauchverbot beachten,<br />
- den Bereich <strong>der</strong> abgestellten Zweirä<strong>der</strong> meiden,<br />
- darauf achten, dass niemand etwas auf den Boden wirft, spuckt, Wände o<strong>der</strong> Möbel<br />
beschmiert o<strong>der</strong> etwas zerstört,<br />
- darauf achten, dass jede Gruppe für den Raum, den sie verlässt, verantwortlich ist.<br />
Wir dulden nicht,<br />
dass in unserer Schule jemand in seinen Rechten beeinträchtigt wird.<br />
22