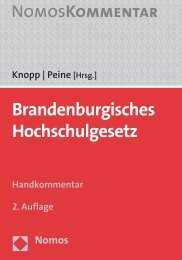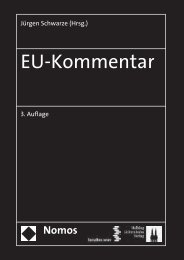2. Rechtsnatur
2. Rechtsnatur
2. Rechtsnatur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
D. Altrechtliche Grunddienstbarkeiten und Gemeindenutzungsrecht 139<br />
Keine Titel sind Beschreibungen und Aufzeichnungen, die nur bestehende ZustÌnde<br />
wiedergeben wollen. Darunter fallen insbesondere EintrÌge in ˛ffentlichen Bˇchern, wie<br />
z. B. dem Grundsteuerkataster, Hypotheken- und Grundbuch. Insoweit handelt es sich<br />
nur um Beweisanzeichen fˇr den Bestand des Rechts.<br />
<strong>2.</strong> <strong>Rechtsnatur</strong><br />
Gemeindenutzungsrechte k˛nnen grundsÌtzlich privatrechtlicher oder ˛ffentlichrechtlicher<br />
Natur sein. Eine Vermutung besteht weder in der einen noch der anderen<br />
Richtung. 192 Nutzungsrechte an unverteilten Gemeindegrˇnden sind auch dann nicht<br />
bereits privatrechtlich, wenn sie im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs eingetragen<br />
sind. 193 Entscheidend ist vielmehr, ob ein Privatrechtstitel, wie etwa ein Pachtvertrag, eine<br />
Dienstbarkeit, ein NieÞbrauch oder eine Reallast zugrunde liegt, und das Nutzungsrecht<br />
von dem VerhÌltnis, in dem der Berechtigte zu der Gemeinde steht, unabhÌngig ist. 194<br />
Ausschlaggebendes Merkmal fˇr den privatrechtlichen Charakter eines NutzungsverhÌltnisses<br />
ist es insbesondere, wenn der Besitz eines Anwesens fˇr sich ^ unabhÌngig von dem<br />
VerhÌltnis des Besitzers zur Gemeinde ^ die Nutzungsberechtigung gewÌhrt und der Besitzer<br />
des Anwesens als solches ˇber das vertragliche Recht, wie ˇber sein Anwesen selbst,<br />
unter Ausschluss jeder gemeindlichen Einwirkung frei verfˇgen kann.<br />
Es ist sonach zu unterscheiden, ob die Nutzungsrechte im Gemeindeverband, in den<br />
˛ffentlich-rechtlichen Beziehungen der Gemeindemitglieder zur Gemeinde wurzeln,<br />
oder ob sie v˛llig unabhÌngig von dem VerhÌltnis der Gemeindezugeh˛rigkeit lediglich<br />
ein privatrechtliches RechtsverhÌltnis zwischen den Berechtigten und der Gemeinde als<br />
Eigentˇmerin der belasteten Grundstˇcke darstellen. 195 Zum Nachweis des privatrechtlichen<br />
Charakters von Nutzungsrechten an unverteilten Gemeindegrˇnden genˇgen<br />
nicht einzelne Handlungen, sondern ist ein geschlossenes Bild erforderlich, das<br />
keinen Zweifel daran lÌsst, dass nicht etwa UnregelmÌÞigkeiten vorgekommen und unbeachtet<br />
geblieben sind. Auch eine unrichtige Auffassung und Sachbehandlung durch die<br />
Beh˛rden oder die Rechtler in einzelnen FÌllen vermochte die wirkliche Natur der Nutzungsrechte<br />
nicht zu Ìndern. 196 Beim Fehlen sicherer Anhaltspunkte fˇr die privatrechtliche<br />
Natur neigt die Rechtsprechung dazu, Nutzungsrechte an unverteilten Gemeindegrˇnden<br />
als ˛ffentlich-rechtliche anzusehen. 197 Auch die Bezeichnung ,,Nutzanteil an den<br />
noch unverteilten Gemeindegrˇnden‘‘ spricht dafˇr, dass die Nutzungsrechte als ˛ffentlich-rechtliche<br />
im Gemeindeverband wurzeln. 198<br />
Gemeinderechte ˛ffentlich-rechtlicher Natur verleihen subjektive, im Verwaltungsrechtsweg<br />
verfolgbare Individualrechte. 199 Sie geh˛ren nicht in das Grundbuch, weil<br />
dieses nur dazu bestimmt ist, ˇber die privatrechtlichen VerhÌltnisse eines Grundstˇcks<br />
oder einer ihm gleichstehenden Gerechtigkeit Auskunft zu geben, dagegen nicht auch<br />
ˇber ˛ffentlich-rechtliche VerhÌltnisse. 200 77<br />
78<br />
79<br />
Auch wenn Zweifel bestehen, ob ein Nutzungsrecht<br />
dem privaten oder dem ˛ffentlich-rechtlichen Recht angeh˛rt, darf es nicht in<br />
192 BayObLGZ 1961, 374/376 u. BayObLGZ 1982, 400/406.<br />
193 BayObLGZ 1960, 447/450 u. BayObLG, MittBayNot 1990, 33 = Rpfl 1990, 54; vgl. auchWidtmann/Grasser/Glaser,Art.80Rn.4.<br />
194 BayObLGZ 1962, 374/376 u. BayObLGZ 1964, 210/211; s. ferner Sprau, vor Art. 57 Rn. 43.<br />
Vgl. auch Honisch, MittBayNot 1959, 43 Fn.1.<br />
195 S. nur BayObLGZ 1960, 447/450; BayObLG, MittBayNot 1990, 33 = Rpfl 1990, 54 u. Glaser,<br />
MittBayNot 1988, 113.<br />
196 BayObLGZ 1982, 400/413 f.<br />
197 BayObLGZ 1960, 447/450 f.; BayObLGZ 1961, 374/376 u. BayObLGZ 1980, 400/406 f. sowie<br />
BayVGH, BayVBl.1958, 278.<br />
198 BayVGH, BayVBl.1958, 278 u. BayObLGZ 1982, 400/417.<br />
199 BayVGH 38, 61; BayVGH 51, 41 u. BayVGH n. F. 9, 105.<br />
200 St. Rspr., s. nur BayObLGZ 1960, 447/451 u. BayObLGZ 1964, 210/211. Vgl. auch Honisch,<br />
MittBayNot 1959, 43/44.<br />
76
80<br />
140 4. Teil. Das Grundstˇck und seine Nutzung durch Dritte<br />
das Grundbuch eingetragen werden. Dennoch war es unter der Herrschaft des bayerischen<br />
Hypothekengesetzes ˇblich, Gemeinderechte jeder Art, wenn sie mit einem Anwesen<br />
verbunden waren, im Interesse der VollstÌndigkeit der Beschreibung des Grundstˇcks<br />
im Titel des Hypothekenbuchblattes (Bestandsverzeichnis) und in Ûbereinstimmung mit<br />
dem Vortrag im Grundsteuerkataster in das Hypothekenbuch aufzunehmen. Von dort<br />
wurden diese Rechte bei der Anlegung des Grundbuchs, da ihre rechtliche Natur sich im<br />
einzelnen Fall nur aufgrund zeitraubender, schwieriger Untersuchungen und Wˇrdigung<br />
der tatsÌchlichenVerhÌltnisse sowie der geschichtlichen Entwicklung hÌtte feststellen lassen,<br />
zur Beschleunigung des Anlegungsverfahrens in das Grundbuch ˇbernommen. 201<br />
Dies hatte zur Folge, dass viele Gemeinderechte im Bestandsverzeichnis der berechtigten<br />
Grundstˇcke eingetragen wurden, die wegen ihrer ˛ffentlich-rechtlichen Natur an sich<br />
nicht in das Grundbuch geh˛ren.<br />
Auch heute noch werden die aus dem Hypothekenbuch in das Grundbuch ˇbernommenen<br />
Gemeinderechte dort weiterhin eingetragen und verfahrensrechtlich wie privatrechtliche<br />
Berechtigungen behandelt, solange sich nicht ihre ˛ffentlich-rechtliche Eigenschaft<br />
klar erweist. Die GrundbuchÌmter haben ohne besonderen Anlass derart eingetragene<br />
Gemeinderechte nicht daraufhin zu ˇberprˇfen, ob sie privatrechtlicher Natur<br />
sind. 202 Erst wenn die ˛ffentlich-rechtliche Natur klar erwiesen ist, ist ein eingetragenes<br />
Gemeinderecht als inhaltlich unzulÌssig von Amts wegen zu l˛schen (§ 53 I 2 GBO). 203<br />
Der Nachweis kann durch Berichtigungsbewilligung des Berechtigten erbracht werden,<br />
aber auch durch eine Gerichtsentscheidung, die die ˛ffentlich-rechtliche Natur des Rechts<br />
feststellt. 204 M˛glich ist ferner die Vorlage einer Abl˛sungsvereinbarung nach Art. 82 I<br />
GO. 205 Ein eingetragenes (˛ffentlich-rechtliches) Nutzungsrecht unterliegt auch nicht<br />
dem ˛ffentlichen Glauben des Grundbuchs nach § 892 BGB. 206<br />
3.Wesen und Erscheinungsformen, Lastentragung<br />
Die Eintragung eines Nutzungsrechtes im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs lÌsst<br />
zwar keinen Schluss auf seine privatrechtliche Natur zu, wohl aber dient sie als Beweiszeichen<br />
fˇr den Bestand des Rechts und, wenn das Recht bei einem bestimmten Grundstˇck<br />
vermerkt ist, als Hinweis auf die Radizierung des Rechts. 207 Die Radizierung bedeutet,<br />
dass das Recht mit dem Eigentum an einem Anwesen verbunden ist, dessen Bestandteil<br />
(§ 96 BGB) bildet und somit dessen rechtliches Schicksal teilt. 208 81<br />
Umgekehrt spricht man<br />
von einem grundstˇcksgleichen oder walzenden Recht, wenn dieses frei verÌuÞerlich<br />
und vererblich ist. Radizierte Rechte sind ohne eigene Nummer oder unter einer Strichnummer<br />
im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblattes fˇr ein bestimmtes Anwesen eingetragen,<br />
wÌhrend walzende Rechte unter einer eigenen Nummer und ohne Hinweis auf<br />
ein berechtigtes Grundstˇck eingetragen sind. Soweit Gemeindenutzungsrechte radiziert<br />
sind, k˛nnen sie nicht auf einem unbebauten Grundstˇck ruhen und gehen deshalb mit<br />
der Zerst˛rung des Wohnhauses unter, und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass<br />
es nicht wieder aufgebaut wird. Das Nutzungsrecht bleibt dagegen aufrechterhalten,<br />
wenn das Anwesen in einem Zeitraum von fˇnf bis zehn Jahren wieder aufgebaut wird.<br />
Erforderlich sind eine objektive, d. h. baurechtlich gegebene Wiederaufbaum˛glichkeit<br />
201 BayObLGZ 1960, 447/452 f. u. BayObLGZ 1964, 210/211 = MittBayNot 1964, 193 = NJW<br />
1964, 1573.<br />
202 BayObLG ebenda sowie BayObLGZ 1970, 21/23 = MittBayNot 1970, 19 = Rpfl 1970, 167.<br />
203 BayObLGZ 1970, 45 u. BayObLG, MittBayNot 1990, 33 = NJW-RR 1989, 659.<br />
204 S. nurWidtmann/Grasser/Glaser,Art.80Rn.4.<br />
205 BayObLGZ 1970, 45/49 = MittBayNot 1970, 21 = Rpfl 1970, 168 u. BayObLG, MittBayNot<br />
1978, 109 = Rpfl 1978, 316.<br />
206 Glaser, MittBayNot 1988, 113.<br />
207 BayObLGZ 1970, 21/23 u. BayObLGZ 1982, 400/405.<br />
208 BayObLGZ 1960, 447/450; BayObLGZ 1964, 210/211 u. BayObLGZ 1970, 21/23.
D. Altrechtliche Grunddienstbarkeiten und Gemeindenutzungsrecht 141<br />
und subjektiv ein Wiederaufbauwille. Dieser muss sich auf den Wiederaufbau und nicht<br />
nur allgemein auf eine Bebauung richten. 209<br />
Die Gemeindenutzungsrechte stehen, auch als radizierte, je fˇr sich einem einzelnen<br />
Rechtler zu, sind also Individualrechte. Es gibt keine Rechtlergemeinschaft, die als solche<br />
TrÌgerin der Summe der Nutzungsrechte wÌre. 210 SchlieÞen sich die Rechtler zusammen,<br />
so entsteht zwar eine bˇrgerlich-rechtliche Vereinigung; es beurteilt sich dabei nach<br />
bˇrgerlichem Recht, in welchem Umfang der Vorstand (Obmann) einer solchen Vereinigung<br />
die einzelnen Rechtler gegenˇber der Gemeinde vertreten, insbesondere verbindliche<br />
ErklÌrungen abgeben kann. Die Individualrechte richten sich daher nicht nur gegen<br />
die Gemeinde, sondern auch gegen jeden anderen Rechtler und gegen jeden Dritten, der<br />
Bestand und Umfang des Nutzungsrechtes bestreitet. 211 Bei Streitigkeiten ˇber Gemeindenutzungsrechte,<br />
fˇr die die Verwaltungsgerichte zustÌndig sind, werden deshalb nicht<br />
beteiligte Rechtler nicht beigeladen. 212<br />
Gemeindenutzungsrechte gewÌhren einen Rechtsanspruch.Werden dagegen Nutzungen<br />
des Gemeindeverm˛gens ohne Bestehen eines Anspruchs freiwillig und stets widerruflich<br />
an alle Gemeindeangeh˛rigen verteilt, so kann es sich nicht um Gemeindenutzungsrechte<br />
handeln. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Einwohner in widerruflicher<br />
Weise ihre Kˇhe auf einen Gemeindeanger treiben dˇrfen.<br />
Der Anspruch auf Nutzungen besteht als Naturalanspruch; die Rechtler brauchen sich<br />
nicht gegen ihrenWillen mit Geld abfinden lassen. 213<br />
Nach Art. 81 GO mˇssen die Rechtler sich in den MaÞe, der ihrem Anteil an der tatsÌchlichen<br />
Gesamtnutzung entspricht, an den Lasten und Ausgaben beteiligen, die auf<br />
dem Gemeindegrundstˇck ruhen. 214 Davon abweichende Regelungen und abweichendes<br />
Herkommen zur Tragung der Lasten und Abgaben sind nicht zu berˇcksichtigen. 215 MaÞgeblich<br />
ist der 1. 4.1928, wenn die Verteilungsregelung zu diesem Zeitpunkt bereits bestand.Wer<br />
zeitweilig auf die Nutzungen verzichtet, hat fˇr die Dauer dieses Verzichts auch<br />
keine Lastentragungspflicht. Lasten sind die auf dem Gegenstand des Nutzungsrechts ruhenden<br />
Steuern und sonstigen Abgaben sowie sonstige ˛ffentlich-rechtliche Lasten. Die<br />
Berechtigten sind ferner verpflichtet, fˇr die Nutzungen Gegenleistungen an die Gemeinde<br />
zu entrichten, soweit sich ein diesbezˇgliches Herkommen gebildet hat. Die Verpflichtung<br />
muss am 18.1.1952 bestanden haben. 216 Die H˛he der Gegenleistungen bemisst sich<br />
nach dem WertverhÌltnis zwischen Nutzungen und Gegenleistungen am 1. 1. 1938. Die<br />
Gegenleistungen k˛nnen in Geldzahlungen, aber auch in Sach- oder Dienstleistungen,<br />
insbesondere in Hand- und Spanndiensten bestehen. 217 Geldzahlungen werden im VerhÌltnis<br />
1: 1 umgewertet.<br />
Bei gemessenen Nutzungsrechten steht den Nutzungsberechtigten nur eine bestimmte,<br />
genau festgelegte Menge oder ein sonst genau bestimmtes MaÞ an Nutzungen<br />
zu. Bei ungemessenen Nutzungsrechten gebˇhrt den Rechtlern dagegen in den Grenzen<br />
ihres Eigenbedarfs der Gesamtertrag. 218 Hinsichtlich des RechtsverhÌltnisses mehrerer<br />
Gemeindenutzungsberechtigter untereinander gilt, dass jeder Rechtler zum gleichen Anteil<br />
zur Nutzung der Grundstˇcke bzw. des Ertrages berechtigt ist, sofern keine Einteilung<br />
der Nutzungsrechte in abgestufte und unabgestufte Rechte erfolgt ist.<br />
209 BayVGH, BayVBl.1996, 759.<br />
210 BayObLGZ 1987, 400/413; BayVGH 10, 13/17 u. Widtmann/Grasser/Glaser, Art. 80 Rn.1. Zum<br />
Zinsabschlag bei Rechtlergemeinschaften in der Form eines nichtrechtsfÌhigen Vereins vgl. OFD<br />
Mˇnchen,Vfg. v. 7. 7.1993, DB 1993, 1851.<br />
211 BayObLGZ 1982, 400/413.<br />
212 BayVGH, BayVBl.1958, 278.<br />
213 Vorbeck,Wesen und Inhalt gemeindlicher Nutzungsrechte, 1965, S. 40 f. m. w. N.<br />
214 BayVGH, BayVBl.1996, 115.<br />
215 BayVGH, BayVBl.1997, 753 a. A. nochVGH n. F. 23, 69/71.<br />
216 Bauer/B˛hle/Ecker,Art.81GORn.6.<br />
217 Bauer/B˛hle/Ecker,Art.81GORn.6.<br />
218 Vorbeck,Wesen und Inhalt gemeindlicher Nutzungsrechte, 1965, S. 83 ff.<br />
82<br />
83<br />
84<br />
85<br />
86
87<br />
88<br />
89<br />
142 4. Teil. Das Grundstˇck und seine Nutzung durch Dritte<br />
Aus der Grundstˇcksbezogenheit von gemeindlichen Nutzungsrechten folgt, dass<br />
Nutzungsrechte an im Eigentum der Gemeinde stehenden beweglichen Verm˛gensgegenstÌnden<br />
ausgeschlossen sind. Auch am ˛ffentlichen, dem Gemeingebrauch dienenden<br />
Eigentum der Gemeinde, z. B. ˛ffentlichen StraÞen und PlÌtzen, k˛nnen Gemeindenutzungsrechte<br />
nicht entstehen. 219 Die Nutzungsrechte sind ferner markungsgebunden, d. h.<br />
sie sind dazu bestimmt, einer mit ihrem Schwerpunkt in dieser Markung gelegenen bÌuerlichen<br />
Wirtschaftseinheit oder sonstigen Einrichtungen zu dienen. Dies hat zur Folge,<br />
dass jede Ønderung dieser notwendigen Beziehung das Nutzungsrecht in seinem Wesen<br />
verÌndern wˇrde. 220<br />
Die Gemeindenutzungsrechte betreffen in der Praxis vor allem Holznutzungsrechte,<br />
221 Weide- und Ackernutzungsrechte sowie Obstbaum- und Fischnutzungsrechte.<br />
222 Hinsichtlich der Forstrechte ist allerdings das Gesetz ˇber die Forstrechte<br />
vom 3. 4. 1958 223 zu beachten. Besonderheiten gelten ferner fˇr Holznutzungsrechte der<br />
an K˛rperschaftswaldungen beteiligten Berechtigten und fˇr selbstÌndige Fischereirechte.<br />
224<br />
Nutzungsrechte sind nur begrˇndet, wenn ein besonderer Rechtstitel oder eine ununterbrochene<br />
Ausˇbung mindestens bis zum 18.1.1952 vorliegt. Nutzungsrechte mˇssen<br />
ununterbrochen ausgeˇbt worden sein; sie verjÌhren nach den zu diesem Zeitpunkt<br />
geltenden allgemeinen Vorschriften, also nach dreiÞig Jahren. 225 Da die Gemeindeordnung<br />
am 18.1.1952 in Kraft trat, muss das Recht seit dreiÞig Jahren vor diesem Zeitpunkt,<br />
also seit dem 18.1.1922, ausgeˇbt worden sein. Die Ausˇbung muss tatsÌchlich, d. h. in der<br />
Natur erfolgt sein. 226 Es genˇgt nicht, dass der Rechtler das Recht sozusagen ,,verbal‘‘<br />
ausgeˇbt hat oder ausˇbt. Eine Rechtsausˇbung durch zeitweise Ûberlassung an Dritte ist<br />
dagegen m˛glich; sie darf aber nicht auf Dauer gerichtet sein. 227 Erforderlich ist eine<br />
ununterbrochene Ausˇbung ,,kraft Rechtsˇberzeugung‘‘. Ein eigenmÌchtiger, vom Berechtigten<br />
angemaÞter Bezug von Nutzungen kommt als Grundlage fˇr die gewohnheitsrechtliche<br />
Entstehung von Nutzungsrechten daher nicht in Betracht. Desgleichen<br />
vermag eine den HauptgrundsÌtzen des Gemeinderechts ˇber die Nutzungsrechte widersprechende<br />
Rechtsˇberzeugung kein rechtsbegrˇndendes Herkommen zu bilden. Unterbrechungen<br />
der Nutzungsausˇbung sind unschÌdlich, wenn die Berechtigten sie nicht zu<br />
vertreten haben. Hierzu zÌhlen vor allem tatsÌchliche Hinderungsgrˇnde durch ÌuÞere<br />
UmstÌnde, wie z. B. Krieg und MaÞnahmen der Besatzungsmacht etc. Nutzungsrechte,<br />
die nicht ausschlieÞlich landwirtschaftlichen Zwecken dienen, erl˛schen nicht durch die<br />
Einstellung des landwirtschaftlichen Betriebs (Art.80 II 3 GO).<br />
219 Glaser, MittBayNot 1988, 113/114 m. w. N.<br />
220 BayVGH 2, 12 u.Widtmann/Grasser/Glaser,Art.80Rn.6.<br />
221 Zum Bezug von Bau- und Brennholz sowie vonWaldstreu s. BayObLGZ 1995, 339/346 f.<br />
222 Glaser, MittBayNot 1988, 113/114.<br />
223 BayRS 7902^7-L; s. zur Durchfˇhrungsverordnung BayRS 7902^8-E.<br />
224 S. dazu Sprau, Art. 40 Rn. 24 ff. Auch alte Fischereirechte fallen in eine der Kategorien des<br />
selbstÌndigen Fischereirechts (Art. 8 BayFiG), des Fischereirechts, das dem Eigentˇmer des GewÌssers<br />
zusteht (vgl. Art.11 I BayFiG), und des Fischereirechts, das zugunsten des jeweiligen Eigentˇmers<br />
eines Grundstˇcks besteht (Art.11 III BayFiG). Es handelt sich um selbstÌndige dingliche Rechte mit<br />
Grundstˇcksnatur. Das Recht der Waldgenossen ist geregelt in der Verordnung ˇber Waldgenossenschaften<br />
(WGV) v. 14.11.1996. Die Waldgenossenschaften sind ˛ffentlich-rechtliche Zwangsgenossenschaften.<br />
Es wird zwischen Eigentˇmergenossenschaften, bei denen die Waldgrundstˇcke auf<br />
eine Waldgenossenschaft selbst zu Eigentum ˇbertragen werden (§ 3 WGV), und den so genannten<br />
Betriebsgenossenschaften, bei denen die bisherigen Nutzungsberechtigten unmittelbar Eigentum<br />
bzw. Miteigentum an dem Waldgrundstˇck erlangen (§ 4 WGV), unterschieden. Die rechtsgeschÌftliche<br />
VerÌuÞerung von in die Waldgenossenschaft einbezogenen Grundstˇcken kann satzungsmÌÞig<br />
beschrÌnkt werden (§ 4 II WGV). Es handelt sich um ˛ffentlich-rechtliche VerfˇgungsbeschrÌnkungen.<br />
225 BayVGH 10, 13/15.<br />
226 BayVGH, BayVBl.1984, 210.<br />
227 Vgl. Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 80 GO Rn.15.
D. Altrechtliche Grunddienstbarkeiten und Gemeindenutzungsrecht 143<br />
4. InhaltsÌnderung und Ûbertragung<br />
Nicht nur eine Neubegrˇndung von Nutzungsrechten, sondern auch eine Erweiterung<br />
sowie eine Ønderung oder Aufteilung in der Nutzungsart sind unzulÌssig (Art. 80 I<br />
GO). Grund ist, dass derartige Sonderrechte einzelner mit der dem Gemeinwohl dienenden<br />
Zweckbestimmung des Gemeindeverm˛gens nicht mehr vereinbar sind. Auch eine<br />
Erweiterung stellt hinsichtlich der erweitertenTeile eine Neubegrˇndung dar. Unter Aufteilung<br />
ist die Zerlegung eines einheitlichen Nutzungsrechtes in zwei oder mehrere selbstÌndige<br />
Nutzungsrechte zu verstehen. Da bei der Aufteilung Rechte entstehen, die bisher<br />
nicht bestanden haben, stellt sie ebenfalls eine Neubegrˇndung dar. 228 Nicht im Gesetz<br />
erwÌhnt ist die Lostrennung eines mit einem Grundstˇck verbundenen Nutzungsrechts<br />
von diesem Grundstˇck. Diese Lostrennung fˇhrt zum Untergang des Nutzungsrechts.<br />
229 Dagegen erl˛schen radizierte Nutzungsrechte nicht durch den Wegfall der Eigenschaft<br />
einer Haus- und HofstÌtte als Mittelpunkt einer bÌuerlichen Wirtschaft, wohl<br />
aber durch den Untergang der Haus- und HofstÌtte. 230<br />
Die Gemeindenutzungsrechte sind ihrem Ursprung nach bloÞe Anteilsrechte an ErtrÌgen<br />
bestimmter gemeindlicher Grundstˇcke. Aus diesem Umstand sowie aus dem Verbot<br />
der Neubegrˇndung von Nutzungsrechten folgt auch, dass im Falle der VerÌuÞerung<br />
rechtsbelasteten gemeindlichen Grundbesitzes die Rechte nicht etwa auf die von der<br />
Gemeinde erworbenen Ersatzgrundstˇcke als Belastungen ˇbergehen oder ˇbertragen<br />
werden k˛nnen. 231 Das Nutzungsrecht erlischt mit Ûbertragung des Grundeigentums.<br />
Dennoch ist die Gemeinde nicht verpflichtet, die Zustimmung der Rechtler einzuholen.<br />
Der VerÌuÞerungsvertrag ist nach h. M. auch ohne Zustimmung der Nutzungsberechtigten<br />
wirksam. 232 Die Rechtler mˇssen es hinnehmen, wenn die Menge der ErtrÌgnisse<br />
dadurch zusammenschrumpft, dass sich die genutzte FlÌche durchVerÌuÞerungen verkleinert.<br />
233 Dies gilt ebenso, wenn sich die Bewirtschaftung des belasteten gemeindlichen<br />
Grundbesitzes Ìndert. 234 Insoweit passen sich die Nutzungsbefugnisse nicht der neuen<br />
Bewirtschaftungsart an, sondern das alte Nutzungsrecht kann auf Dauer nicht mehr ausgeˇbt<br />
werden und erlischt deshalb. Gemeindenutzungsrechte sind in den jeweiligen<br />
Rechtsgrundlagen unabÌnderlich festgelegt. 235<br />
Handelt die Gemeinde bei VerÌuÞerung oder bei Herbeifˇhrung einer Ønderung ausnahmsweise<br />
rechtswidrig, so kann sie zur EntschÌdigung verpflichtet sein. 236 Das ist<br />
dann der Fall, wenn die VerÌuÞerung eine vorsÌtzliche sittenwidrige SchÌdigung der<br />
Rechtler (§ 826 BGB) darstellt.<br />
Gemeindenutzungsrechte sind grundsÌtzlich ihrer Natur nach ˇbertragbar. Diesgilt<br />
auch fˇr radizierte Gemeinderechte. 237 Der Ûbergang des Nutzungsrechtes erfolgt bei radizierten<br />
Rechten mit der Ûbertragung des Grundstˇcks.Wird nur ein Teil des Anwesens<br />
verÌuÞert, mit dem das Nutzungsrecht verbunden ist, so bleibt das Nutzungsrecht mit<br />
demjenigen Grundstˇcksteil verbunden, der wesentliche Grundlage fˇr die Ausˇbung des<br />
Nutzungsrechtes bildet. Dies ist in der Regel das WohngebÌude des gesamten Anwesens.<br />
238 Bei einer Aufteilung dieses Bauwerks inWohnungs- und Teileigentumseinheiten,<br />
228 Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 80 GO Rn. 2<strong>2.</strong><br />
229 BayVGH, BayVBl.1958, 278.<br />
230 BayVGH, BayVBl.1966, 28<strong>2.</strong><br />
231 BayVGH, Fundstelle 1962 Rn.147; Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 80 GO Rn. 24 u. Widtmann/Grasser/<br />
Glaser, Art.82Rn.1.<br />
232 Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 82 GO Rn. 5; a. A. H˛lzl/Hien/Huber, Art. 82 Anm. IV 1.<br />
233 A. A. Widtmann/Grasser/Glaser, Art. 82 Rn.1, wonach bei fehlender Zustimmung Schadensersatzansprˇche<br />
bestehen; Ìhnlich Rambeck, BayBgm. 1957, 2 u. Honisch, MittBayNot 1959, 83/91.<br />
234 S. nur Glaser, MittBayNot 1988, 113/114.<br />
235 BayVGH 15, 106.<br />
236 Vgl. Fundstelle 87 Rn. 223 u. Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 82 GO Rn. 6.<br />
237 BayVGH 11, 130 u. BayObLGZ 1964, 210/21<strong>2.</strong><br />
238 LG Nˇrnberg-Fˇrth, MittBayNot 1988, 139 m.w.N.<br />
90<br />
91<br />
92<br />
93
94<br />
95<br />
96<br />
97<br />
144 4. Teil. Das Grundstˇck und seine Nutzung durch Dritte<br />
insbesondere in den Alt- und den Neubau, bleibt berechtigt und verpflichtet der Eigentˇmer<br />
des ursprˇnglichen GebÌudes. Aus der Verbindung des Rechts mit dem Eigentum<br />
an einem Anwesen folgt, dass die Eigentˇmer von neuerrichteten weiteren GebÌuden<br />
nicht mitberechtigt werden. 239<br />
Art. 80 III GO schrÌnkt die Ûbertragung von radizierten Nutzungsrechten auf ein<br />
anderes Anwesen, die HÌufung von mehr als einem vollen Nutzungsrecht auf einem Anwesen<br />
und die Zerstˇckelung eines einheitlichen Nutzungsrechtes in Bruchteile, die<br />
verschiedenen Berechtigten ˇberlassen werden, ein. Trotz der grundsÌtzlichen ZulÌssigkeit<br />
dieser VorgÌnge geht die Vorschrift vom Prinzip der Markungsgebundenheit von<br />
Gemeindenutzungsrechten und der Grundstˇcksbezogenheit radizierter Nutzungsrechte<br />
aus. 240 Ûbertragung, HÌufung und Zerstˇckelung sind deshalb nur innerhalb derselben<br />
Gemeinde zulÌssig. Die Ûbertragung ist ferner nur gestattet, wenn das Anwesen,<br />
auf welches das Nutzungsrecht ˇbertragen werden soll, das Haus- und Hofgrundstˇck<br />
eines ausˇbenden Land- oder Forstwirts ist. Damit sollte ein Handel mit Gemeindenutzungsrechten<br />
verhindert werden, der hÌufig auÞerhalb ihrer ursprˇnglichen Zweckbestimmung<br />
erfolgt ist. So wurden und werden z. B. Holzeinschlagsrechte nur deshalb erworben,<br />
weil ihr Besitz mit einer Kfz-Erlaubnis fˇr allgemein gesperrte Wege verbunden<br />
ist. 241 Die Ûbertragung eines Nutzungsrechtes auf einen Nichtlandwirt oder Nichtforstwirt<br />
ist daher ausgeschlossen und auch nicht mehr genehmigungsfÌhig. Ferner muss auch<br />
bei Ûbertragung an einen ausˇbenden Land- oder Forstwirt ein wichtiger Grund fˇr die<br />
Ûbertragung gegeben sein. Der wichtige Grund wird im Bereich der Nutzungsrechte<br />
selbst liegen mˇssen, nicht jedoch in Gesichtspunkten auÞerhalb derselben. Insbesondere<br />
wird ein wichtiger Grund dann bestehen, wenn die Ûbertragung, HÌufung oder Zerstˇckelung<br />
zu einer besseren Ausnutzung der Rechte, vor allem auch zu einer besseren<br />
Pflege und sachgerechteren Bewirtschaftung fˇhrt. 242<br />
Die Ûbertragung, HÌufung und Zerstˇckelung von Nutzungsrechten bedˇrfen der<br />
Zustimmung der Gemeinde. 243 Die Zustimmung ist eine Ermessensentscheidung. Sie<br />
bedarf nicht mehr der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbeh˛rde. 244<br />
Verboten ist die Ûbertragung eines Nutzungsrechtes auf eine juristische Person des<br />
Privatrechts oder eine Gesellschaft des Handelsrechts. Dieses Verbot, das vor allem eingetragene<br />
Vereine, Stiftungen, Aktiengesellschaften, GmbHs, Unternehmergesellschaften<br />
und Limiteds, aber auch Genossenschaften betrifft, folgt aus dem Wesen des Nutzungsrechtes,<br />
das auf Personen aus dem bÌuerlichen Lebensbereich beschrÌnkt ist.<br />
Im Gegensatz zur Ûbertragung ist eine vorˇbergehende Ûberlassung eines Gemeindenutzungsrechts<br />
an einen Dritten zur Ausˇbung zulÌssig. Sie kann entgeltlich oder unentgeltlich<br />
erfolgen. Rechtsgrund k˛nnen ein RechtsgeschÌft unter Lebenden und eine<br />
Verfˇgung von Todes wegen sein. Die Ûberlassung zur Ausˇbung darf jedoch nicht wirtschaftlich<br />
dazu fˇhren, dass eine Ûbertragung vorliegt. 245 Dies ist stets der Fall, wenn die<br />
Nutzungsdauer mehr als dreiÞig Jahre betrÌgt. 246 Im Ûbrigen kommt es auf die Ausgestaltung<br />
der Nutzungsˇberlassung im Einzelfall an. Eine Zustimmung der Gemeinde<br />
zur Ûberlassung der Ausˇbung auf begrenzte Zeit ist, sofern sich aus Titel oder Herkommen<br />
nichts Gegenteiliges ergibt, nicht erforderlich.<br />
239 BayVGH, BayVBl.1958, 278/281; vgl. auch LG Mˇnchen II, MittBayNot 1985, 130/131.<br />
240 S. auch Glaser, MittBayNot 1988, 115.<br />
241 S. dazu Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 80 GO Rn. 34 u. BayVGH, BayVBl.1993, 687.<br />
242 BayVGH, BayVBl. 1993, 687/688 u. Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 80 GO Rn. 36.<br />
243 Anders noch BayVGH n. F. 11, 130.<br />
244 Gesetz zur Ønderung des Kommunalrechts v. 26. 7. 2004, GVBl. S. 272/273.<br />
245 S. nurVorbeck,Wesen und Inhalt gemeindlicher Nutzungsrechte, 1965, S.107.<br />
246 Vgl. den Rechtsgedanken des § 544 BGB.
D. Altrechtliche Grunddienstbarkeiten und Gemeindenutzungsrecht 145<br />
5. Abl˛sung und Aufhebung<br />
Soweit Gemeindenutzungsrechte zugunsten einzelner Gemeindeeinwohner bestehen,<br />
k˛nnen diese gemÌÞ Art. 82 GO abgel˛st bzw. aufgehoben werden. In beiden FÌllen sind<br />
die Berechtigten von der Gemeinde angemessen zu entschÌdigen. 247<br />
Die vertragliche Abl˛sung einzelner Nutzungsrechte erfolgt durch Vereinbarung<br />
zwischen den Berechtigten und der Gemeinde. Sie ist ein ˛ffentlich-rechtlicher Vertrag.<br />
248 Auf diese Weise k˛nnen, soweit Einzelvereinbarungen mit allen Rechtlern abgeschlossen<br />
werden, auch alle Nutzungsrechte abgel˛st werden. 249 Es handelt sich um eine<br />
Abl˛sung der Nutzungsrechte in EinzelvorgÌngen. Die Nutzungsrechte gehen auf die<br />
Gemeinde ˇber. Unberˇhrt bleibt ferner die M˛glichkeit des Verzichts durch einzelne<br />
Rechtler. In diesem Fall geht das Nutzungsrecht ebenfalls auf die Gemeinde ˇber. Die Gemeinde<br />
kann diese Rechte nicht auf Dritte ˇbertragen. Haben sich die Rechtlicher als eingetragener<br />
Verein organisiert, ersetzt eine Zustimmung des Vereins nicht die Zustimmung<br />
der einzelnen Nutzungsberechtigten.<br />
Die Abl˛sung sÌmtlicher Nutzungsrechte in einem Rechtsvorgang erfolgt durch Verwaltungsakt<br />
der Gemeinde (sog. verfˇgte Gesamtabl˛sung). 250 Dieser Verwaltungsakt<br />
ist jedoch mitwirkungsbedˇrftig. Die erforderliche Zustimmung kann durch Abstimmung<br />
im Rahmen einer Rechtlerversammlung unter Aufnahme einer amtlichen Niederschrift<br />
oder durch schriftliche ErklÌrung der einzelnen Rechtler gegenˇber der Gemeinde<br />
erfolgen. 251 Erforderlich ist die Zustimmung der Mehrheit der betroffenen Rechtler,<br />
wobei jedoch nicht nach K˛pfen, sondern nach dem Umfang der Anteile am Gesamtnutzungsrecht<br />
abgestimmt wird. 252 In diesem Fall gehen sÌmtliche Nutzungsrechte, die<br />
abgel˛st werden, unter (Art. 82 I 4 GO), und zwar mit Unanfechtbarkeit der Abl˛sungsverfˇgung.<br />
253 Ein Ûbergang auf die Gemeinde, der nur eine Erh˛hung des Stimmrechts<br />
der verbleibenden Rechtler bei der Abl˛sung einzelner Rechte verhindern soll, ist bei der<br />
Gesamtabl˛sung nicht erforderlich.<br />
Insbesondere fˇr diejenigen FÌlle, in denen weder durch Einzelvereinbarungen mit bestimmten<br />
Rechtlern noch durch Mehrheitsbeschluss der Rechtler die Nutzungsrechte abgel˛st<br />
werden k˛nnen, besteht die M˛glichkeit der Aufhebung der Nutzungsrechte, d. h.<br />
ihrer Beseitigung durch einen Hoheitsakt der Rechtsaufsichtsbeh˛rde (Art. 82 II GO).<br />
Auch insoweit handelt es sich um einen mitwirkungsbedˇrftigenVerwaltungsakt, der auf<br />
Antrag der Gemeinde ergeht. Diese kann ihren Antrag nur darauf grˇnden, dass sie die<br />
belasteten FlÌchen ganz oder teilweise aus Grˇnden des Gemeinwohls zur Erfˇllung<br />
˛ffentlicher Aufgaben ben˛tigt. Beispiele sind die Errichtung und Erweiterung von<br />
gemeindlichen Schulen, KrankenhÌusern, Friedh˛fen, ˛ffentlichen StraÞen,Versorgungsanlagen,VerwaltungsgebÌuden<br />
und SportplÌtzen. Angesichts der Bedeutung, die der Gesetzgeber<br />
der F˛rderung des Wohnungsbaus beigemessen hat (§§ 1I,III,IVWoFG)kann<br />
auch die Errichtung von Wohnungen zum Wohle der Allgemeinheit erfolgen und damit<br />
ein Aufhebungsverlangen der Gemeinde rechtfertigen. 254<br />
Dabei darf der Zugriff auf die mit Gemeinderechten belasteten Grundstˇcke nicht nur<br />
zweckmÌÞig sein; vielmehr muss die Gemeinde die Grundstˇcke ben˛tigen. Dazuist<br />
247 Ausfˇhrlich Bauer, BayVBl.1996, 289 ff.<br />
248 BayObLGZ 1961, 373/377.<br />
249 Bauer/B˛hle/Ecker,Art.82GORn.1u.10.<br />
250 BayObLGZ 1961, 373/379 u. BayObLGZ 1966, 447/468 (Gerichtshof f. Kompetenzkonflikte);<br />
ebenso Bauer, BayVBl.1996, 289/290; a. A. H˛lzl/Hien/Huber, Art. 82 Anm. I 2 b (Verwaltungsakt<br />
und ˛ffentlich-rechtlicher Vertrag).<br />
251 Zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten empfehlen Bauer/B˛hle/Ecker, Art.82GORn.14<br />
die schriftliche Zustimmung von jedem Rechtler.<br />
252 Ebenso Bauer, BayVBl.1996, 289/291.<br />
253 Ebenso Bauer, BayVBl.1996,289/292;a.A.Ilg, BayBgm. 1954, 202 (erst mit Zahlung der EntschÌdigung).<br />
254 Vgl. allg. Bauer/B˛hle/Ecker, Art. 82 GO Rn. 17.<br />
98<br />
99<br />
100<br />
101<br />
102
103<br />
146 4. Teil. Das Grundstˇck und seine Nutzung durch Dritte<br />
zu fordern, dass sie die ˛ffentliche Aufgabe ohne Inanspruchnahme der belasteten Grundstˇcke<br />
entweder ˇberhaupt nicht, lediglich mit unverhÌltnismÌÞigem Mehraufwand oder<br />
nur unter besonderen Schwierigkeiten erfˇllen k˛nnte. Hierzu zÌhlt auch, dass die Gemeinde<br />
anderweitigen Grundbesitz nur zu unangemessenen Bedingungen, d. h. insbesondere<br />
zu einem so hohen Kaufpreis erwerben mˇsste, dass sie das geplante Vorhaben<br />
nicht mehr durchfˇhren k˛nnte. SchlieÞlich muss es sich um ein Bedˇrfnis der Gemeinde<br />
handeln, nicht anderer Gebietsk˛rperschaften wie z. B. des Freistaats Bayern, eines Bezirks<br />
oder Landkreises.<br />
Die Abl˛sung und die Aufhebung stellen sich gegenˇber den Rechtlern als Enteignung<br />
dar, und zwar auch gegenˇber denjenigen, die der Abl˛sung zustimmen. Die Gemeinde<br />
hat deshalb eine angemessene EntschÌdigung zu leisten, die in der Regel in<br />
Geld durch Zahlung eines einmaligen Betrages erfolgt (Art. 83 GO). Ûber die H˛he der<br />
EntschÌdigung entscheiden im Streitfall die ordentlichen Gerichte (Art. 83 III GO). 255 Als<br />
Grundlage einer angemessenen EntschÌdigung gilt im allgemeinen der Wert des Fˇnfundzwanzigfachen<br />
des durchschnittlichen jÌhrlichen Reinertrags der Nutzungen, die in<br />
den der Abl˛sung oder Aufhebung unmittelbar vorhergehenden fˇnfzehn Jahren gezogen<br />
worden sind oder bei ungehinderter rechtmÌÞiger Ausˇbung des Rechts hÌtten gezogen<br />
werden k˛nnen. 256 Unter engenVoraussetzungen besteht ein Anspruch auf Abfindung in<br />
Grundstˇcken (Art. 83 I 2 GO). Praktisch bedeutsam ist nur die ExistenzgefÌhrdung eines<br />
landwirtschaftlichen Betriebs durch den Wegfall von NutzungsflÌchen. Eine Zuweisung<br />
eines Grundstˇcks gegen denWillen des betroffenen Rechtlers ist umgekehrt ebenso nicht<br />
m˛glich. 257 Vereinbarungen ˇber Art und H˛he der EntschÌdigung sind jedoch zulÌssig.<br />
Deshalb kann unabhÌngig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 83 I 2 GO eine<br />
Abl˛sung durch Grundstˇcke vereinbart werden. Ein zwischen der Gemeinde und der<br />
Rechtlermehrheit geschlossener diesbezˇglicher Vertrag bindet jedoch die ˇberstimmte<br />
Minderheit nicht. 258 Jeder Rechtler hat vielmehr, da die Gemeindenutzungsrechte Individualrechte<br />
sind, fˇr sich dieWahl, ob er Abfindung in Geld oder in Grundstˇcken fordern<br />
will. 259<br />
255 Zu Besonderheiten der Landabfindung s. Art. 83 I 2 GO sowie Waldgrundstˇcken Art. 83 IV<br />
GO (Bildung einer Waldgenossenschaft).<br />
256 Art. 83 II GO; s. dazu Bauer/B˛hle/Ecker,Art.83GORn.5.<br />
257 Widtmann/Grasser/Glaser, Art.83Rn.1.<br />
258 Pabst, MittBayNot 1954, 149/151.<br />
259 Vgl.Vorbeck,Wesen und Inhalt gemeindlicher Nutzungsrechte, 1965, S.116 ff.