Praxisheft "Bausteinplanung neu gedacht. Das ... - Kirche gestalten
Praxisheft "Bausteinplanung neu gedacht. Das ... - Kirche gestalten
Praxisheft "Bausteinplanung neu gedacht. Das ... - Kirche gestalten
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Teil A: DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 61. Neu <strong>gedacht</strong> 62. <strong>Bausteinplanung</strong> – was bringt’s? 63. Passen Sie Ihre <strong>Bausteinplanung</strong> an Ihre Wünsche an 64. Wir wollen loslegen – Übersicht über Arbeitsschritteund Systematik der <strong>Bausteinplanung</strong> 85. Wie soll das aussehen, wenn’s fertig ist? –Beispiel für die Ergebnissicherung im Formular 9Teil ATeil B: SCHRITT FÜR SCHRITT –METHODISCHE GESTALTUNG 101. Grundlagenarbeitsschritt: Ausgangssituation:Was gibt es bei uns? 111.1. Vertiefung: Einblicke in die Angebote durch„Insider-Berichte“ 111.2. Vertiefung: Persönliche Bewertung und Wünsche 121.3. Vertiefung: Blick „über den Tellerrand“ 132. Grundlagenarbeitsschritt: Beschreibung des Bausteins 142.1. Vertiefung: Beschreiben der theologischen Leitgedanken 152.2. Vertiefung: Theologisches Profil des Bausteins undder Angebote (Gewichtung) 16EXKURS: Leicht zu verwechseln! Ziele, Maßnahmen,Umsetzungsplanung 183. Grundlagenarbeitsschritte: Konkretes Ziel und Merkmale 204. Grundlagenarbeitsschritt: Maßnahmen 22Teil BTeil C: WICHTIGES AM ENDE 241. Jetzt geht’s in den Plan für die kirchliche Arbeit 242. Auswertung „leicht gemacht“ 243. Neue Amtszeit und bereits bearbeitete Bausteine 254. Öffentlichkeitsarbeit, Visitation, Leitbild, <strong>Kirche</strong>nbezirksundGesamtkirchengemeindeebene 255Teil C
Sie müssen die <strong>Bausteinplanung</strong> nicht jedes Jahr machen. Wenndas Gremium sich auf einen anstehenden Baustein thematischnicht einlassen kann, weil z.B. ein anderes Thema alle Energie aufsich zieht, dann ist es sinnvoll, die <strong>Bausteinplanung</strong> kurz zu halten,einen anderen Bausteinals vorgesehen zu bearbeiten(der z.B. das gerade relevanteThema aufnimmt)Richtiger ZEITPUNKTund richtiger BAUSTEIN?oder auszusetzen.Sie können die <strong>Bausteinplanung</strong> in zwei Richtungen <strong>gestalten</strong>:Wenn Sie Verbesserungen oder <strong>neu</strong>e Impulse in der Gemeindeanstreben („Handeln“), dann sollten Sie neben wahrnehmendenArbeitsschritten genügend Zeit für das Finden von Zielen und Maßnahmeneinplanen. Ein Gremium, das zufrieden ist mit dem Statusquo, kann die <strong>Bausteinplanung</strong> aber auch „nur“ zu einer besserenWahrnehmung der Gemeinde und ihrer Angebote, der Mitarbeitendensowie des gemeinsamen Anspruchs an die Gemeindearbeitnutzen. Praktisch heißtdas, es wird eine „halbe“ZIEL:<strong>Bausteinplanung</strong> gemacht Weiterentwicklung oder(ohne die Ziel- und Maßnahmenarbeitsschritte).WahrnehmungBei der <strong>Bausteinplanung</strong> geht es in erster Linie nicht um dasBefüllen eines Formulars, sondern um einen gewinnbringendenProzess aus verschiedenen Arbeitsschritten und Fragestellungen.Wählen Sie aus diesen die für Sie passenden Arbeitsschritteaus (dabei helfen Ihnen die Übersichten Teil A, 4. und Teil B) oderergänzen Sie <strong>neu</strong>e. Entsprechend kann eine <strong>Bausteinplanung</strong>lang oder kurz werden,mehr oder weniger theologischin die Tiefe gehen, Welche Arbeitsschritte sindPROZESS:für uns sinnvoll?viel oder wenig Textarbeitbeinhalten.Die <strong>Bausteinplanung</strong> kann vom Gremium „von null an“ gemeinsamerarbeitet werden, was die Partizipation sowie die intensiveAuseinandersetzung aller Gremiumsmitglieder mit demArbeitsbereich fördert. Einige Gemeinden bevorzugen dagegenaus Zeit-, Struktur- oder Verantwortungsgründen 6 die <strong>Bausteinplanung</strong>mit Vorarbeit: Einzelne Gremiumsmitglieder und/oderverantwortliche Mitarbeitende erarbeiten vorab manche Arbeitsschritte.Im Gesamtgremium kann diese Vorarbeit dann alsDiskussionsgrundlage dienen, die abgeändert, ergänzt und be-6 Zum Beispiel bei einem sehr großen KGR oder wenn es einen für den Baustein verantwortlichenAusschuss gibt. Siehe auch Teil C, 4.schlossen wird. Mischformenzwischen beidenArbeitsweisen sind möglich.BEARBEITUNG:Gemeinsam erarbeiten oderVorarbeiten nötig?Mit der Beteiligung von ehren- und hauptamtlichen (Mit-)Verantwortlichenan der <strong>Bausteinplanung</strong> wurden sehr positiveErfahrungen gemacht: Verbesserte Wahrnehmung und Kommunikationzwischen Gremium und Mitarbeitenden, gegenseitigeWertschätzung, innovativesPotential und gemeinsamesTragen von Gremium oder auchBETEILIGUNG:Entscheidungen.Mitarbeitende?Verantwortlich für die Leitung des Prozesses sind die beidenVorsitzenden, die diese auch delegieren können. Es hat sich aberauch die Begleitung durcheinen externen Bausteinmoderatorbewährt.intern oderMODERATION:extern?Die Evaluation der bei der jeweiligen <strong>Bausteinplanung</strong> gefundenenZiele und Maßnahmen 7 muss nicht zeitintensiv sein. So, wieSie im Gremium sonstige Veranstaltungen und Maßnahmen auswerten(etwa in einer Austauschrunde zu Beginn der folgendenSitzung), können Sie z.B. auch mit den durchgeführten Maßnahmender <strong>Bausteinplanung</strong>und deren Zielerreichung Wie und wann wollen wirverfahren. 8grundsätzlich unsere <strong>Bausteinplanung</strong>enauswerten?1. Klären Sie die „Rahmenbedingungen“ Ihrer <strong>Bausteinplanung</strong>en(gelbe Kästchen/Aufzählungszeichen) einmalim Gremium oder unter den Vorsitzenden.2. Bei der Vorbereitung einer anstehenden <strong>Bausteinplanung</strong> solltensich die Vorsitzenden die lila Kästchen/Aufzählungszeichen vergegenwärtigen.97 Es geht hier nicht um ein Überarbeiten der „Beschreibung“ und der „Leitgedanken“ undnicht um das er<strong>neu</strong>te Finden von Zielen und Maßnahmen!8 Weitere Hinweise hierzu: Siehe Teil C, 2.9 Bedenkenswert ist ferner: 1. Was hat sich beim Vorgehen bisher bewährt/nicht bewährt?2. Welche ergänzenden Referenten/Berater sind nötig? 3. Was wollen wir einfließen lassen(<strong>Bausteinplanung</strong>en von letzter Amtsperiode, Leitbilder, Visitationsergebnisse etc.)?7Teil ATeil C Teil B
4. Wir wollen loslegen – Übersicht über Arbeitsschritte und Systematik der <strong>Bausteinplanung</strong>Es müssen nicht alle Arbeitsschritte bearbeitet werden, stellen Sie sich Ihr Vorgehen zusammen!Verantwortlich: Ein oder zwei Personen, die die Verantwortung für den Baustein übernehmen, d.h. das Gremium über Aktuelles im Baustein(z.B. die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen) informieren.Ausgangssituation: Was gibt es bei uns?Vertiefende Arbeitsschritte möglich, siehe Teil BLeitfrage: Welche Angebote (Veranstaltungen, Gruppen, Dienste etc.) gibt es bei uns im Baustein?<strong>Das</strong> ist zu tun: Sammeln der bisherigen Angebote im BausteinGewinn: Wahrnehmung der bestehenden AngeboteWAHRNEHMENBeschreibung des Bausteins 10Vertiefende Arbeitsschritte möglich, siehe Teil BLeitfrage: Wie würden wir einem Außenstehenden unseren Baustein erklären, d.h. um was es bei uns in diesem Baustein geht, was hiergeschieht, was/wen wir erreichen wollen und was uns wichtig ist?<strong>Das</strong> ist zu tun: Beschreiben unseres Bausteins, Reflexion seiner Aufgabe, seiner Charakteristika und seiner grundlegenden Ziele/seines AnspruchsGewinn: Einigung auf ein gemeinsames Grundverständnis des Bausteins, das als „Leitsatz“ für den Baustein dienen kannDimensionenLeitgedanken 10= vertiefender Arbeitsschritt zur BeschreibungEvang. GlaubenswissenEvang. GlaubenslebenLeitfrage: Was wollen wir mit dem Baustein erreichen bzw. was ist uns wichtig im Blickauf evang. Glaubenswissen, evang. Glaubensleben, christliche Gemeinschaft, diakonischeZuwendung, christliche Kultur und Traditionen, Mitwirkung in der Gesellschaft, Weitergabedes Evangeliums?Christl. GemeinschaftDiakon. Zuwendung<strong>Das</strong> ist zu tun: Als Vertiefung oder Alternative zum vorherigen Arbeitsschritt kann hierChristl. Kultur und TraditionenMitwirkung in der GesellschaftWeitergabe des Evangeliumsdie christliche Seite des Bausteins anhand verschiedener Dimensionen des kirchlichenAuftrags noch differenzierter beschrieben und reflektiert werden.Gewinn: Einigung auf grundlegende Gedanken, die als gemeinsamer Anspruch das Gremiumleiten können. Differenzierte Wahrnehmung der christlichen Seite des Bausteins.HANDELNKonkretes ZielLeitfrage: Was wollen wir im Baustein in der nächstenZeit erreichen?<strong>Das</strong> ist zu tun: Diskussion des Handlungsbedarfs,der Veränderungspotentiale und -wünsche und Einigungauf ein gemeinsames Ziel (= ein gewünschterzukünftiger Zustand)Gewinn: Durch ein gemeinsames Ziel können Maßnahmenpassend gefunden werden, bekommt Handelneine Richtung und wird transparent.Merkmale: Woran merken wir, dass das Ziel erreicht ist?Leitfragen: Woran merken wir konkret, dass das Ziel erreicht ist (u.U. lässt sichdies sogar in Zahlen fassen)? Wie genau sieht der Zustand aus, mit dem wir zufriedenwären?<strong>Das</strong> ist zu tun: Vorstellen des Zustandes, wenn das anvisierte Ziel zufriedenstellenderreicht ist. Festhalten der relevanten Kennzeichen (= Merkmale) diesesZustandesGewinn: Gemeinsame Vorstellung vom Zielzustand wird erreicht; das Ziel wirdkonkreter; das Gremium weiß, wenn es sein Ziel erreicht hat und es „zufriedensein kann“.Maßnahmen: Was soll unternommen werden, um das Ziel zu erreichen?Leitfragen: Was soll unternommen werden, um das Ziel zu erreichen? Welche Handlungen/Aktionen sollen initiiert werden?<strong>Das</strong> ist zu tun: Diskussion und Einigung auf Handlungen/Aktionen, durch die man dem Ziel näher kommt.Gewinn: Einigung auf zielgerichtete Maßnahmen, die die Gemeinde voranbringen können.810Gegenwart und Zukunft sind bei diesem Arbeitsschritt nicht trennbar. Beides ist durch die Leitfrage (automatisch) im Blick.
5. Wie soll das aussehen, wenn‘s fertig ist? – Beispiel für die Ergebnissicherung im FormularEv. <strong>Kirche</strong>ngemeinde Musterhausen Planung der kirchlichen Arbeit im Jahr 2014Gottesdienst Baustein 0100.00Verantwortlich:Pfarrer MustermannAusgangssituation: Was gibt es bei uns?Sonntagsgottesdienste mit parallelem Kindergottesdienst, Kasualgottesdienste (Beerdigung, Taufe, Hochzeit), Konfirmation, Kinokirche (2/Jahr),Familiengottesdienste (2/Jahr), Schülergottesdienste.Teil ABeschreibung des BausteinsUnsere Gottesdienste in Musterhausen laden in ihrer Vielfalt alle ein, Ruhe, Begegnung, Trost und Zuspruch im Glauben an Jesus Christus zufinden und Fragen Raum zu geben. Sie bieten Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und Gott zu feiern. Dabei bringen sich viele ein. GottesWort wirkt in uns nach.DimensionenLeitgedankenEvangelisches Glaubenswissen Im Gottesdienst werden in Predigt, Sakrament, Lied, Gebet und Bekenntnis die Inhalte evangelischenGlaubens vermittelt und zum weiteren Nachdenken angeregt (Standardtext).Evangelisches Glaubensleben Im Gottesdienst wird die Gegenwart Gottes gefeiert und der persönliche Glaube gestärkt (Standardtext).Christliche Gemeinschaft Im Gottesdienst findet die Gemeinschaft sowohl mit Gott als auch mit den Mitchristen und Mitchristinnenihren Ausdruck. Dies wird auch durch die Gestaltung des Gottesdienstes unterstützt (Standardtext).Diakonische Zuwendung Im Gottesdienst wird deutlich, dass die Botschaft des Evangeliums Menschen in ihrer Schwäche undBedürftigkeit ernst nimmt und zur Mitmenschlichkeit auffordert (Standardtext).Christl. Kultur und Traditionen Im Gottesdienst wird die christliche Bedeutung des Sonntags als Gedenk- und Ruhetag im Leben deseinzelnen Menschen und der Gemeinschaft mit Leben erfüllt (Standardtext).Mitwirkung in der Gesellschaft Der Gottesdienst ermöglicht Glaubens- und Lebensorientierung für alle Gemeindeglieder und vermitteltchristliche Grundwerte für die Gesellschaft (Standardtext).Weitergabe des Evangeliums Der Gottesdienst ist attraktiv für Menschen außerhalb der Kerngemeinde und lädt zum Glauben ein(Standardtext).Konkretes ZielMerkmale: Woran merken wir, dass das Ziel erreicht ist?Der Sonntagsgottesdienst wird bis in einem Jahr für Kinder und Eltern sind häufiger gemeinsam im Gottesdienst (mindestensjunge Familien attraktiver.6 Mal/Jahr); mehr Kinder besuchen den Kindergottesdienst; Elternbesuchen öfter den Gottesdienst, während ihre Kinder im Kindergottesdienst sind.Maßnahmen: Was soll unternommen werden, um das Ziel zu erreichen?Wir beginnen testweise den Sonntagsgottesdienst um 10:30 Uhr statt um 9:00 Uhr; Erhöhung der Anzahl der Familiengottesdienste(4/Jahr); Werbung für Kindergottesdienst inklusive Einladung an die Eltern; Kinderkirche führt ihr Krippenspiel im Sonntagsgottesdienstauf (4. Advent).9Teil C Teil B
Teil BSchritt für Schritt – methodische GestaltungDieser Praxisteil ergänzt die Übersicht Teil A, 4. um konkrete, methodischeAnregungen, wie Sie Ihre <strong>Bausteinplanung</strong> <strong>gestalten</strong>können. Außerdem werden hier Tipps und Hinweise weitergegeben,was Sie beachten sollten. Dabei gilt grundsätzlich: Gestalten Sie die<strong>Bausteinplanung</strong> bewusst und richten Sie sie an Ihren Wünschenaus!<strong>Das</strong> Vorgehen in dieser Arbeitshilfe ist als Anregung <strong>gedacht</strong> undnicht als Pflicht. Je nach Anzahl der Teilnehmenden bei der <strong>Bausteinplanung</strong>,je nach Bedarf vor Ort und je nachdem, ob Sie mit„Vorarbeit“ arbeiten wollen oder ohne (siehe Teil A, 3.), kann essinnvoll sein, Vorgehensweisen abzuändern oder Methodenund Arbeitsschritte durch andere zu ersetzen bzw. zu ergänzen!WahrnehmenHandelnGrundverständnisIST-Situationerfassenerarbeiten,Ziel vereinbaren Maßnahmen planen1 2 3 4„Leitsatz“GrundlagenarbeitsschritteAusgangssituation:Was gibt es bei uns?(Teil B, 1.)(Kartenabfrage,20 min)Beschreibung desBausteins(Teil B, 2.)(kurze Texte verfassenund darauszu einem gelangen,60–120 min)Konkretes Ziel undMerkmale(Teil B, 3.)(Wahrnehmungbisheriger Ergebnisse,Brainstorming undPriorisierung, Formulierung,45–90 min)Maßnahmen(Teil B, 4.)(Brainstorming undPriorisierung, Umsetzungsplanung,30–60 min)Mögliche Vertiefungen (alternativ wählbar)Einblicke in dieAngebote durch„Insider-Berichte“(Teil B, 1.1.)(Impulsberichteje 5 min + 15 minAussprache)PersönlicheBewertung undWünsche(Teil B, 1.2.)(Kartenabfrage,30 min)Blick „über denTellerrand“(Teil B, 1.3.)(World Café, 60 min)Beschreibender theologischenLeitgedanken(Teil B, 2.1.)(Leitgedankenanpassen inKleingruppe undPlenum,60–120 min)TheologischesProfil des Bausteinsund derAngebote(Gewichtung)(Teil B, 2.2.)(Einschätzen,Interpretieren,30–60 min)10
1. Grundlagenarbeitsschritt: Ausgangssituation: Was gibt es bei uns?Leitfrage: Welche Angebote (Veranstaltungen, Gruppen,Dienste etc.) gibt es bei uns im Baustein?Gewinn: Wahrnehmung der bestehenden AngeboteZeitaufwand: ca. 20 minFormular: Die Angebote sollten ins Formular übernommenwerden. Wenn es sehr viele Angebote sind, könnensie zu Angebots-Gruppen zusammengefasstwerden.Es hat sich bewährt, zusätzlich zu diesem Grundlagenarbeitsschrittmindestens einen vertiefenden Arbeitsschritt zumachen.1. SammelnSammeln Sie die unterschiedlichen Angebote (Veranstaltungen,Gruppen, Dienste etc.), die Ihre Gemeinde im Baustein anbietet,für alle sichtbar auf je einer Karte an einer Moderationswand odermit dem Beamer. Leitfrage dabei ist: Welche Angebote (Veranstaltungen,Gruppen, Dienste etc.) gibt es bei uns im Baustein?2. Kurzer Austausch/RückfragenUm was geht es bei den einzelnen Angeboten?Was fällt auf?Welche Angebote sind ähnlich? Wo sind Unterschiede?Teil A1.1. Vertiefung: Einblicke in die Angebote durch „Insider-Berichte“Leitfrage:Gewinn:Wie ist der aktuelle Stand in unserenAngeboten?Gute Kenntnis der Situation in den Bausteinangeboten,gegenseitige Wahrnehmung undWertschätzung von Gremium und Mitarbeitenden1. Berichte der „Insider“Ein/mehrere Mitarbeitende (oder informierte Gremiumsmitglieder)berichten aus den Angeboten des Bausteins, z.B.:Um was geht es?Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Welche Probleme gibt es?Welche besonderen Vorhaben, Projekte etc. stehen an?Welche Wünsche und Ideen haben die Mitarbeitenden/Teilnehmenden?Zeitaufwand: pro Angebot 5 min, Austausch ca. 15 minWelche Unterstützung brauchen die Mitarbeiten-Formular: Bei Bedarf können die wichtigsten Ergebnissedieser Vertiefung im Formular (in der Spalte„Ausgangssituation: Was gibt es bei uns?“)aufgenommen werden.den vom Gremium?Visualisieren Sie die wichtigsten Punkte für die ArbeitsschritteTeil B, 3. und Teil B, 4.2. AustauschAustausch zwischen Gremium und den Berichtenden, Rückfragen,Für diese Vertiefung ist es nötig, dass die BausteinangeboteRückmeldungen etc.(Teil B, 1.) bereits vor der <strong>Bausteinplanung</strong> gesammelt wurden,um die entsprechenden Mitarbeitenden einladen zu können.Hier geht es nur ums Wahrnehmen! Ziele und Maßnahmenwerden später überlegt!Stimmen aus der GemeindeDie Bausteinarbeit ist eine Chance für das Leitungsgremium, sich mehr Zeit als gewohntfür die geleistete Arbeit und künftige Ziele zu nehmen. Wir haben durch sie dieganze Gemeindearbeit einmal gründlich und konkret durchleuchtet. Dabei waren dieZielformulierungen für uns wichtig und nötig zur Konzentration unserer Arbeit. Eineaufwendige, aber lohnende Arbeit – wenn es gut moderiert wird.Gemeinde Oberholzheim11Teil C Teil B
1.2. Vertiefung: Persönliche Bewertung und WünscheLeitfragen: Was gefällt mir/gefällt mir nicht am Baustein undseinen Angeboten? Was wünsche ich mir?Gewinn: Wertschätzung des Bestehenden, Wahrnehmungvon möglichen Veränderungspotentialen und bereitsbestehenden WünschenZeitaufwand: ca. 30 minFormular: Bei Bedarf können die wichtigsten Ergebnissedieser Vertiefung im Formular (in der Spalte„Ausgangssituation: Was gibt es bei uns?“) aufgenommenwerden.1. SammelnIn Einzelarbeit wird auf Kärtchen in Stichworten gesammelt:Am Baustein und an seinen Angeboten gefällt mir …Am Baustein und an seinen Angeboten gefällt mir nicht …Ich wünsche mir …2. Vorstellen der ErgebnisseIm Plenum stellt jeder seine Kärtchen vor und pinnt sie für allesichtbar thematisch geordnet an eine Moderationswand.Hier geht es nur ums Wahrnehmen! Ziele und Maßnahmenwerden später überlegt!Betrachten Sie abschließend das Gesammelte:Welche Rückfragen gibt es?Was fällt auf?12
1.3. Vertiefung: Blick „über den Tellerrand“Leitfragen: Welche Trends gibt es in Gemeinde und Gesellschaft,die für unsere Arbeit im Baustein wichtigsein könnten? In welcher Situation sind dieGemeindeglieder, die wir mit diesem Bausteinansprechen wollen? Was würde sich ein Gemeindeglied,das nicht so sehr ins Gemeindelebeninvolviert ist, vom Baustein wünschen? Wasbräuchte es von unserer Gemeinde bzw. unseremBaustein?Gewinn: Gemeinde als Teil dieser Welt nimmt verschiedenePerspektiven ein, um passend und mit weitemBlick agieren zu können.Zeitaufwand: ca. 60 minFormular: Bei Bedarf können die wichtigsten Ergebnissedieser Vertiefung im Formular (in der Spalte„Ausgangssituation: Was gibt es bei uns?“) aufgenommenwerden.sprüche des Gesprächs auf dem Papier festhalten. Es gibt insgesamtdrei Gesprächsrunden. Nach jeder Gesprächsrunde gehendie Teilnehmenden zu einem Tisch, an dem sie noch nicht waren,und mischen sich dabei <strong>neu</strong>.An jedem Tisch ist eine Person der „Gastgeber“, der die Tischenicht wechselt. Er begrüßt die Teilnehmenden, führt in die Arbeitsweiseein und fasst Gespräche aus vorhergehenden Rundeneinleitend zusammen, so dass die <strong>neu</strong>e Gruppe darauf aufbauenddiskutieren und Dinge ergänzen kann.2. Präsentation der ErgebnisseIm Plenum stellen die „Gastgeber“ die Ergebnisse an ihren Tischenanhand der Plakate vor.Teil ADiese Vertiefung kann mit der Methode des „World-Cafés“ erfolgen:1. Diskussion an verschiedenen TischenDie Teilnehmenden sitzen im Raum verteilt an drei Tischen (jeweils3–5 Personen), an denen jeweils eine andere Frage zu diskutierenist:Tisch a: Welche Trends gibt es in Gemeinde und Gesellschaft,die für unsere Arbeit im Baustein wichtig sein könnten?Tisch b: In welcher Situation sind die Gemeindeglieder, die wirmit diesem Baustein ansprechen wollen (berufliche und schulischeSituation, Bildung, Freizeitverhalten, familiäre Konstellationen,Verpflichtungen, typische Probleme/Freuden, was ihnenwichtig ist etc.)?Tisch c: Was würde sich ein Gemeindeglied, das nicht so sehrins Gemeindeleben involviert ist, vom Baustein wünschen? Wasbräuchte es von unserer Gemeinde bzw. unserem Baustein?Die Tische sind mit einem Flipchart-Papier oder einer beschreibbarenPapiertischdecke und Markern belegt. Diese dienen dazu,dass die Teilnehmenden wichtige Inhalte/Aspekte/Fragen/Wider-Diesen Arbeitsschritt können auch sozialräumliche Überlegungenaus Visitationen, Milieustudien etc. vertiefenund ergänzen.13Teil C Teil B
2. Grundlagenarbeitsschritt: Beschreibung des BausteinsLeitfrage: Wie würden wir einem Außenstehenden unserenBaustein erklären, d.h. um was es bei uns indiesem Baustein geht, was hier geschieht, was/wen wir erreichen wollen und was uns wichtigist?Gewinn: Einigung auf ein gemeinsames Grundverständnisdes Bausteins, das als „Leitsatz“ für denBaustein dienen kannZeitaufwand: 60–120 minFormular: Die hier erarbeitete Beschreibung oder der Standardtextsollten übernommen werden.Sowohl in diesem Grundlagenarbeitsschritt als auch inder folgenden Vertiefung (siehe Teil B, 2.1.) geht es umdie inhaltlichen Grundlagen des Bausteins. Aus zeitlichen undmethodischen Gründen empfiehlt es sich, sich für einen derbeiden Arbeitsschritte zu entscheiden (außer Sie wolleninhaltlich sehr intensiv einsteigen).Meist wählen Gemeinden die „Beschreibung des Bausteins“, weilman hier eher frei, individuell und schwerpunktbezogen arbeitet.<strong>Das</strong> „Beschreiben der theologischen Leitgedanken“ ist schematischer,behandelt aber die theologische Seite des Bausteinsintensiver, differenzierter und umfassender.nis. Um eigenes Denken und Wahrnehmen zu ermöglichen, sollteer jedoch nicht vorschnell übernommen werden! Sammeln Siedaher zuerst anhand der Leitfrage, was Ihnen wichtig ist, undbetrachten Sie erst danach den Text und ergänzen Sie ihn entsprechend.Der Standardtext macht aufgrund seiner unterschiedlichenQualität manchmal viel Ergänzung nötig!2. Einigung auf eine BeschreibungIm Plenum werden die Beschreibungen der Kleingruppen wahrgenommen,diskutiert und zu einer Beschreibung zusammengefügt.Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass die Beschreibungeiner Kleingruppe als Vorlage genommen wird und durch für allewichtige (!) Aspekte der anderen Kleingruppe/-n ergänzt wirdbzw. um Aspekte gekürzt wird.Gruppe AGruppe BBeschreibung A Beschreibung BPlenum: Beschreibung1. Erstellen von Beschreibungen in KleingruppenEs werden zwei bis drei Kleingruppen gebildet, die jeweils aufFlipchart-Papier o.Ä. eine Bausteinbeschreibung (ca. 2-3 Sätze)formulieren. Stellen Sie sich dabei vor, Sie müssten für den GemeindebriefIhren Baustein in einem kurzen Abschnitt erklären:Wie würden wir einem Außenstehenden unseren Baustein erklären,d.h. um was es bei uns in diesem Baustein geht, was hier geschieht,was/wen wir erreichen wollen und was uns wichtig ist?Es erleichtert die Arbeit, wenn die Gruppen diese Frage ausgedruckterhalten.10Der Standardtext für die Beschreibung 11 oder ein bereitsin der letzten Amtsperiode erarbeiteter Text kann denGruppen als Anregung dienen und bringt i.d.R. eine Zeiterspar-11 Die Standardtexte finden Sie unter www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de in dendownloadbaren Formularen oder im Handbuch – Plan für die kirchliche Arbeit, 8.2. (dortfehlt die Überschrift „Beschreibung des Bausteins“: Es ist der fettgedruckte Text unter derBausteinüberschrift gemeint).„Verrennen“ Sie sich hier nicht in theologische Fachdiskussionenoder bloße Formulierungsdebatten!Die Beschreibung sollte auf alle Ihre Angebote im Bausteinpassen!Gegenwart und Zukunft sind bei diesem Arbeitsschritt nichttrennbar. Beides ist durch die Leitfrage (automatisch) im Blick.Wenn Sie ein Leitbild/-motto der Gemeinde haben, finden SieElemente davon in Ihrer fertigen Bausteinbeschreibung. IhrLeitbild/-motto kann Ihnen außerdem bei der Erstellung IhrerBeschreibung helfen. 1212 Vgl. weitere Hinweise unter Teil C, 4.14
2.1. Vertiefung: Beschreiben der theologischen LeitgedankenLeitfrage: Was wollen wir mit dem Baustein erreichen bzw.was ist uns wichtig im Blick auf evang. Glaubenswissen,evang. Glaubensleben, christlicheGemeinschaft, diakonische Zuwendung, christlicheKultur und Traditionen, Mitwirkung in derGesellschaft, Weitergabe des Evangeliums?Gewinn: Einigung auf grundlegende Gedanken, die alsgemeinsamer Anspruch das Gremium leitenkönnen. Differenzierte Wahrnehmung der christlichenSeite des Bausteins.Zeitaufwand: 60–120 minFormular: Die hier erarbeiteten Leitgedanken oder derStandardtext sollten übernommen werden.Es kann helfen, sich zwischen dieser Vertiefung unddem vorherigen Grundlagenarbeitsschritt „Beschreibungdes Bausteins“ zu entscheiden! Siehe dazu die Ausführungenbei Teil B, 2. unter .Gegenwart und Zukunft sind bei diesem Arbeitsschritt nichttrennbar. Beides ist durch die Leitfrage (automatisch) im Blick.„Verrennen“ Sie sich hier nicht in theologische Fachdiskussionenoder bloße Formulierungsdebatten!1. Dimensionen und Leitgedanken wahrnehmenJeder erhält eine Kopie der sog. „Dimensionen des kirchlichenAuftrags“ 13 mit den „Standardtexten der Leitgedanken“ 14 . WennSie in der letzten Amtsperiode bereits Leitgedanken zum Bausteinerarbeitet haben, dann kopieren Sie stattdessen diese.Machen Sie sich gemeinsam mit den Dimensionen und Leitgedankentextenvertraut: Lesen Sie die Texte; vergegenwärtigenSie sich, wie die sieben 15 Dimensionen grob voneinander abzugrenzensind; klären Sie evtl. aufkommende Fragen.Damit das Ganze etwas „mit Leben“ gefüllt wird, könnenSie sich bei jeder Dimension bzw. jedem Leitgedankengemeinsam darüber austauschen: An welchen Stellen wird dieseDimension in unserem Baustein besonders sichtbar?13 Die Dimensionen werden erklärt im Handbuch – Plan für die kirchliche Arbeit, 3.3.2.14 Die Standardtexte finden Sie unter www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de in dendownloadbaren Formularen zur <strong>Bausteinplanung</strong> oder im Handbuch – Plan für diekirchliche Arbeit, 8.2. (die Leitgedanken-Standardtexte tragen dort die mittlerweilegeänderte Überschrift „Zielsetzungen“).15 Zur einfacheren Darstellung wird in diesem Heft von „sieben Dimensionen“ statt der eigentlichenfünf ausgegangen, d.h., die zwei Unterteilungen werden als „Dimensionen“gewertet. Dies hat sich auch für die praktische Arbeit vor Ort bewährt.2. Bearbeitung der Dimensionen in KleingruppenEs sind nun alle Leitgedanken auf Kleingruppen verteilt zu bearbeiten.Pro Kleingruppe beschäftigt man sich je nach Anzahlder Teilnehmenden mit 1-3 Dimensionen bzw. Leitgedanken. DieKleingruppen bilden sich aufgrund von Interesse an der/den jeweiligenDimension/-en.Die Kleingruppen betrachten nun ihre Leitgedanken samt der/denentsprechenden Dimension/-en und diskutieren: Was müsste amText geändert werden, dass er als unsere Antwort gelten kann aufdie Frage „Was wollen wir mit dem Baustein erreichen bzw. was istuns wichtig im Blick auf die jeweilige Dimension?“? Es erleichtertdie Arbeit, wenn die Gruppen diese Frage ausgedruckt erhalten.Je nach Bedarf wird der Leitgedankentext dann entsprechend abgeändertund ergänzt. Visualisiert wird dies z.B. durch Festhaltendes „Endprodukts“ auf Flipchart-Papier oder durch Eingabe inden Laptop und Projektion mit dem Beamer.3. Präsentation und Endredaktion im PlenumGehen Sie im Plenum der Reihe nach die unterschiedlichen Dimensionendurch.Dabei stellt zuerst ein Mitglied der jeweiligen Kleingruppe denerarbeiteten Textvorschlag und die Überlegungen dazu vor. Anschließendwird gemeinsam diskutiert, inwiefern der Vorschlagfür alle so passt, was noch unklar ist und wo Änderungen vorzunehmensind. Je nachdem wird der Vorschlag dann zur gemeinsamEndfassung abgeändert.DimensionenEvangelischesGlaubenswissenEvangelischesGlaubenslebenChristlicheGemeinschaftDiakonischeZuwendungChristl. Kulturund TraditionenMitwirkungin der GesellschaftWeitergabedes Evangeliums15Teil ATeil C Teil BLeitgedankenIm In unserem Gottesdienst werden in Predigt, Sakrament, Lied, Gebeevangelischen Glaubens lebensnah und lebensdienlich vermittelt und zangeregt.Im In unserem Gottesdienst wird die Gegenwart Gottes gefeiert, und dsowie Trost und Hoffnung in unterschiedlichen Situationen des Lebensverschiedene Ausdrucksformen des Glaubens erlebt (singen, hören, beIm Vor, in und nach unserem Gottesdienst erlebt man findet die Gemeauch mit den Mitchristen und Mitchristinnen ihren Ausdruck. Dies wirdGottesdienstes unterstützt.Im In unserem Gottesdienst wird sichtbar und hörbar deutlich, dass dieMenschen in ihrer Schwäche und Bedürftigkeit ernst nimmt und zur MiGottesdienste sind zentrale Elemente der christlichen Kultur. Unseren„Unterbrechungen“ und Ruhepunkte des Alltags, unseren Kasualien alÜbergängen des Lebens sowie unseren Gottesdiensten an WeihnachtVerkündigung der Eckpfeiler unseres Glaubens kommt hierbei zentraleIm Gottesdienst wird die christliche Bedeutung des Sonntags als Gedeeinzelnen Menschen und der Gemeinschaft mit Leben erfüllt.Der Unser Gottesdienst ermöglicht Glaubens- und Lebensorientierungvermittelt christliche Grundwerte für die Gesellschaft.Der Unser Gottesdienst ist attraktiv für Menschen außerhalb der Kerngein. Wichtig ist uns, mit unseren Gottesdiensten auf Menschen in ihrenLebenszusammenhängen zuzugehen (Sportvereingottesdienst, Gottes
2.2. Vertiefung: Theologisches Profil des Bausteins und der Angebote (Gewichtung)Leifragen: Wie stark ist die jeweilige Dimension momentanim Baustein vertreten? Wie stark sollte die jeweiligeDimension zukünftig im Baustein vertretensein?Gewinn: Differenzierte Wahrnehmung der christlichenSeite des Bausteins und seines theologischenProfils; Identifikation von Veränderungspotentialenim Blick auf dieses Profil.Zeitaufwand: 30–60 minFormular: Die Ergebnisse dieser Vertiefung haben keinen„extra Raum“ im Formular (im früheren Formularwurden sie als „Gewichtungsbalken“ dargestellt).Sie können jedoch als „konkretes Ziel“ins <strong>neu</strong>e Formular eingehen.1. Dimensionen und Leitgedanken wahrnehmenDie sog. „Dimensionen des kirchlichen Auftrags“ 16 und die„Standardtexte der Leitgedanken“ 17 (oder individuell formulierteLeitgedanken aus Arbeitsschritt Teil B, 2.1. bzw. der letztenAmtszeit) werden z.B. durch Overhead-Projektor oder Beamerfür alle gut sichtbar vergrößert.Machen Sie sich gemeinsam mit den Dimensionen und Leitgedankentextenvertraut: Lesen Sie die Texte; vergegenwärtigen Siesich, wie die sieben 18 Dimensionen grob voneinander abzugrenzensind; klären Sie evtl. aufkommende Fragen.Damit das Ganze etwas „mit Leben“ gefüllt wird, könnenSie sich bei jeder Dimension bzw. jedem Leitgedankengemeinsam darüber austauschen: An welchen Stellen wird dieseDimension in unserem Baustein besonders sichtbar?2. Profil des Bausteins: GewichtenEs geht hier nicht um „Noten“ für Ihren Baustein, sonderndarum, welches theologische Profil er hat, d.h. welcheDimensionen im Baustein besonders ausgeprägt sind. Deshalbist es sogar kontraproduktiv, überall hohe Gewichtungen zu vergeben!Die SOLL-Einschätzung muss im Vergleich zur IST-Einschätzungnicht höher, sondern kann auch gleich oder geringersein!16 Die Dimensionen werden erklärt im Handbuch - Plan für die kirchliche Arbeit, 3.3.2.17 Die Standardtexte finden Sie unter www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de in dendownloadbaren Formularen zur <strong>Bausteinplanung</strong> oder im Handbuch - Plan für diekirchliche Arbeit, 8.2. (die Leitgedanken-Standardtexte tragen dort die mittlerweile geänderteÜberschrift „Zielsetzungen“).18 Zur einfacheren Darstellung wird in diesem Heft von „sieben Dimensionen“ statt dereigentlichen fünf ausgegangen, d.h., die zwei Unterteilungen werden als „Dimensionen“gewertet. Dies hat sich auch für die praktische Arbeit vor Ort bewährt.Stimmen aus der GemeindeWir haben die <strong>Bausteinplanung</strong> während der jährlichen <strong>Kirche</strong>ngemeinderatsseminarezur Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung wichtigerArbeitsfelder unserer <strong>Kirche</strong>ngemeinde genutzt. <strong>Das</strong> hat allen Beteiligtensehr viel gebracht!Gemeinde Tettnang16
Jeder erhält eine Kopie der folgenden Gewichtungstabelle, die er zügig ausfüllt:Halten Sie Ihre persönliche Einschätzung fest, indem Sie entsprechend viele Kästchen ausmalen.IST-ZUSTANDSOLL-ZUSTANDWie stark ist die jeweilige Dimension momentan imBaustein vertreten?Dimension gering starkWie stark sollte die jeweilige Dimension zukünftig imBaustein vertreten sein?Dimension gering starkTeil AEvangelisches GlaubenswissenEvangelisches GlaubenslebenChristliche GemeinschaftDiakonische ZuwendungChristl. Kultur und TraditionenMitwirkung in der GesellschaftWeitergabe des EvangeliumsEvangelisches GlaubenswissenEvangelisches GlaubenslebenChristliche GemeinschaftDiakonische ZuwendungChristl. Kultur und TraditionenMitwirkung in der GesellschaftWeitergabe des EvangeliumsEs wird nun aus allen individuellen Gewichtungen für jede Dimensionder Durchschnittswert für den IST-Zustand und für den SOLL-Zustand berechnet (z.B. indem Sie der Reihe nach dem Moderatordie Anzahl Ihrer ausgemalten Kästchen zurufen, während er darausmit dem Taschenrechner den Durchschnittswert ermittelt). DiesesDurchschnittsergebnis wird auf einer Overhead-Folie mit der Gewichtungstabellegrafisch festgehalten.2. Interpretieren und Abwägen des HandlungsbedarfsDie entstandene „Durchschnitts“-Tabelle wird gemeinsam betrachtetund interpretiert.Wenn es bei einer Dimension deutliche (!) Unterschiede zwischenIST- und SOLL-Zustand gibt, ist zu überlegen, ob diese Dimensionin Zukunft noch mehr gefördert bzw. heruntergefahren werden soll(sie muss aber nicht!):Wenn Ihnen diese Förderung/Reduzierung der Dimension sinnvollund motivierend erscheint, dann können Sie dies als „konkretesZiel“ nehmen, das Sie anschließend ausformulieren undzu dem Sie sich Merkmale überlegen (Sie „springen“ also zuTeil B, 3., Teilabschnitt 4.).Wenn Sie sich unsicher sind, ob diese Förderung/Reduzierungder Dimension wirklich Ihr „konkretes Ziel“ für die kommendeZeit sein soll und Sie noch in andere Richtungen denken wollen,dann bearbeiten Sie Teil B, 3. komplett und ergänzen dieDimensionen-Förderung/-Reduzierung als mögliches Ziel indessen Teilabschnitt 3.17Teil C Teil B
EXKURS: Leicht zu verwechseln!Ziele, Maßnahmen, UmsetzungsplanungUnterscheiden Sie deutlich zwischen Ziel (Teil B, 3.) und Maßnahme (Teil B, 4.):Sehr konkret wenig konkretGrundlegender Anspruch, längerfristige Ziele des BausteinsGrundlagenarbeitsschritt „Beschreibung des Bausteins“ (Teil B, 2.)Vertiefung „Beschreiben der theologischen Leitgedanken“ (Teil B, 2.1.)Konkretes Ziel = gewünschter zukünftiger Zustand, den man durch einHandeln erreichen möchteMerkmale = Kennzeichen/Aspekte des Zielzustandes, die ihn genauerbeschreiben.Grundlagenarbeitsschritt „Konkretes Ziel und Merkmale“ (Teil B, 3.)Maßnahmen = konkrete Handlungen/Aktionen/Angebote/VorhabenGrundlagenarbeitsschritt „Maßnahmen“ (Teil B, 4.)Umsetzungsplanung der Maßnahmen = Welche Schritte sind zurUmsetzung der Maßnahme erforderlich?Siehe den Abschnitt dazu bei Teil B, 4., Teilabschnitt 3Findet keinen Niederschlag im Formular! Delegieren und Mitarbeitende beteiligen!An den folgenden Beispielen sehen Sie, dass Ziel und Maßnahme nicht verwechselt werden sollten.Wenn man z.B. „Wir beginnen testweise den Sonntagsgottesdienst um 10:30 Uhr statt um 9:00 Uhr“ als Ziel statt als Maßnahme festlegt,dann …1. … weiß das Gremium (oder Außenstehende) nicht, was mit dem späteren Gottesdienst erreicht werden soll Intransparenz.2. … verstellt man sich den Blick für Handlungsoptionen neben der späteren Uhrzeit.3. … macht man beim Arbeitsschritt „Maßnahmen“ letztlich das, was eine Umsetzungsplanung tun sollte und teilweise in der Hand vonMitarbeitenden/einer AG o.Ä. sinnvoller aufgehoben ist.18
BeispieleZielMögliche MaßnahmenUmsetzungsplanung der MaßnahmenMerkmaleDer Sonntagsgottesdienst wird bisWir beginnen testweise den Sonntags-Bekanntmachung der Uhrzeit in Gemein-in einem Jahr für junge Familiengottesdienst um 10:30 statt um 9:00 Uhrdebrief, Zeitung und Abkündigungenattraktiver.Wir richten eine Krabbelecke einAbsprache mit OrganistenKinder und Eltern sind häufiger gemeinsamErhöhung der Anzahl der Familiengot-im Gottesdienst (mind. 6 Mal/Jahr); mehrtesdienste (4/Jahr)Kinder besuchen den Kindergottesdienst;Neue Gestaltung der FamiliengottesdiensteEltern besuchen öfter den Gottesdienst, wäh-Werbung für Kindergottesdienst inkl.rend ihre Kinder im Kindergottesdienst sind.Einladung an die ElternKinderkirche führt ihr Krippenspiel imSonntagsgottesdienst auf (4. Advent)Einladung der Konfi-ElternTeil AWir sprechen bis in einem Jahr Kin-Wir richten eine Jungschar einMitarbeitende ansprechender mit einem regelmäßigen christli-Wir veranstalten eine KinderbibelwocheKonzeption, Ablauf und Themen derchen Freizeitangebot an.Wir bieten eine AG in der Schule anJungschar überlegenCa. 10 Kinder nehmen beinahe jedes Mal amWir laden den Jugendreferenten aus demEinladungen verfassen/verschickenAngebot teil, ca. 8 kommen gelegentlich.Nachbarort ein, der uns Ideen gibt und300 Euro Materialkosten bereitstellenMöglichkeiten aufzeigtWir erhalten das Bestehende.Es ist momentan nichts zu unternehmenDie Angebote bleiben bestehen, genügendEs ist eine Nachfolge für die Leitung desMitarbeitende sind vorhanden und sie mel-Männer-Vespers zu suchen, da Herr XYden keine größeren Probleme oder Einbrü-nächstes Jahr aufhören möchteche der Teilnehmendenzahlen.Die Mitarbeitenden des Senioren-Der Seniorenkreis soll aufgelöst werden,…kreises werden zeitnah bei ihremweil er schlecht besucht und vorberei-Wunsch nach Entlastung unterstützt.tungsintensiv ist sowie wenig Entwick-Die betroffenen Mitarbeitenden äußern Zu-lungspotential birgtfriedenheit.Unsere unterschiedlichen Angebote(des Bausteins „Allgemeine Gemeindearbeit“und darüber hinaus)sind bis in 1 ½ Jahren mehr vernetztals bisher und der Informationsflusszwischen ihnen ist gewährleistet.Die Mitarbeitenden kennen sich, kommengelegentlich ins Gespräch und wissen überAktuelles der Gemeinde Bescheid.Die diakonische Dimension der Konfirmandenarbeitwird ab dem nächstenKonfirmandenjahrgang gestärkt.Die Konfirmanden besuchen eine diakonischeEinrichtung. Sie werden selbst 2–3 Maldiakonisch tätig.Ein Team von Mitarbeitenden und Gremiumsmitgliedernerarbeitet Vorschlägefür reduzierende Maßnahmen, die nichtauf Kosten der Teilnehmenden gehenZusätzliche Mitarbeitende findenWir veranstalten jährlich ein MitarbeiterfestWir erstellen eine Pinnwand, auf der aktuelleInfos angeschrieben werdenIm Gemeindebrief gibt es die Rubrik„Aktuelles“ und es stellt sich in jederAusgabe eine Gruppe vorUnser „<strong>Kirche</strong>nkaffee“ wird abwechselndvon verschiedenen Gruppen organisiertWir besuchen das AltenheimTheoretische Diakonieeinheit machenWir backen Plätzchen und besuchen imAdvent Menschen der GemeindeEine Kleingruppe überlegt sich weiterediakonische Aktionen……19Teil C Teil B
3. Grundlagenarbeitsschritte: Konkretes Ziel und MerkmaleLeitfragen: Was wollen wir im Baustein in der nächsten Zeiterreichen?Woran merken wir konkret, dass das Ziel erreichtist (u.U. lässt sich dies sogar in Zahlen fassen)?Wie genau sieht der Zustand aus, mit dem wirzufrieden wären?Gewinn: Durch ein gemeinsames Ziel können Maßnahmenpassend gefunden werden, bekommt Handelneine Richtung und wird transparent. DurchMerkmale wird eine gemeinsame Vorstellungvom Zielzustand erreicht; das Ziel wird konkreter;das Gremium weiß, wenn es sein Ziel erreicht hatund es „zufrieden sein kann“.Zeitaufwand: 45–90 minFormular: <strong>Das</strong> gefundene Ziel sollte samt Merkmalen insFormular übernommen werden.1. Wahrnehmung des bisher ErarbeitetenEs ist wichtig, den Arbeitsschritt „Konkretes Ziel“ nicht losgelöstvom bisher Erarbeiteten anzugehen! Daher sollen nun bisherigeErgebnisse nochmals betrachtet werden.Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass Sie bisherige Ergebnisseauf Leinwänden/Tischen im Raum verteilt „ausstellen“. Danngeht jeder für sich durch den Raum und nimmt an den verschiedenenStellen nochmals das bisher Erarbeitete eingehend wahr.Dabei sollten alle bereits folgende Frage „im Hinterkopf“ haben:Was wollen wir im Baustein in der nächsten Zeit erreichen?2. BrainstormingGehen Sie in Kleingruppen zu dritt zusammen und diskutierenSie: Was wollen wir im Baustein in der nächsten Zeit erreichen?Einigen Sie sich auf höchstens 2–3 Ziele, die Sie stichwortartigauf je eine Karte schreiben.Wenn Sie nach den bisherigen Arbeitsschritten nur nochwenig Zeit, Energie und Kreativität übrig haben, dannmachen Sie diesen Abschnitt in einer späteren Sitzung. FixierenSie aber gleich den Termin!Ein Ziel muss nicht immer Neues anvisieren, sondernkann auch Bestehendes erhalten, manches reduzieren oderPositives weiter ausbauen (siehe die Beispiele im Exkurs).Wenn Ihnen hier eine Maßnahme (= konkrete Handlung, sieheExkurs) einfällt, kommen Sie leicht auf das dahinterliegendeZiel, indem Sie sich fragen: Was wollen wir mit der Maßnahmeerreichen?Stimmen aus der GemeindeDer größte Gewinn war für uns die gemeinsame Planung mit denhaupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des entsprechendenArbeitsfeldes. So fand beispielsweise zum ersten Mal eingemeinsames Gespräch mit Kindergarteneltern, Erzieherinnen und dem<strong>Kirche</strong>ngemeinderat statt. Wir bekamen Einblick in die Kindergartenarbeitund haben erfahren, was den Eltern und Erzieherinnen wichtig ist. <strong>Das</strong>half uns dabei, gemeinsame Ziele für unsere Arbeit zu entwickeln undunsere Zusammenarbeit zu verbessern.Gemeinde Mitteltal20
3. EntscheidenStellen Sie Ihre Kärtchen im Plenum vor und ordnen Sie sie ggf.an einer Moderationswand oder auf dem Boden (falls Maßnahmenaufgeführt sind statt Ziele, dann fragen Sie nach dem Zielhinter der Maßnahme und ergänzen Sie dieses auf einem weiterenKärtchen).Tauschen Sie Ihre Meinungen zu den Zielen aus und überlegenSie sich, inwiefern die Ziele zu den Gegebenheiten vor Ort passen(realistische Ziele). Zum Beispiel sollten Sie sich beim Ziel„Wir sprechen Kinder mit einem regelmäßigen christlichen Freizeitangebotan“ fragen: Wie viele Kinder gibt es überhaupt impassenden Alter in unserer Gemeinde/im Ort?Hier können Ihnen Auswertungen aus dem PC-Programm DaviPrealistische Einblicke geben.Priorisieren Sie nun die Ziele: Jeder hat gleich viele Klebepunkte,die er an die Ziele verteilen kann, die er angehen möchte (kumulierenist möglich, aber nicht mehr als zwei Punkte auf einmal).Einigen Sie sich anhand der Priorisierung auf ein, höchstenszwei Ziele.Überlasten Sie sich nicht mit zu vielen Zielen!4. Zielformulierung und MerkmaleFormulieren Sie gemeinsam Ihr Ziel aus. Beachten Sie dabei,dass Ziele sprachlich so formuliert werden, als wäre der Zustandschon erreicht ( Indikativ; kein „wollen/ sollen“). Legen Sie,wenn möglich, einen Zeitpunkt fest, wann das Ziel erreicht seinsoll.Gemeinsames kurzes Brainstorming und Austausch zu denMerkmalen:Stellen Sie sich den Zustand vor, wenn das anvisierte Ziel zufriedenstellenderreicht ist: Woran merken wir konkret, dass dasZiel erreicht ist (u.U. lässt sich dies sogar in Zahlen fassen)?Wie genau sieht der Zustand aus, mit dem wir zufrieden wären?Halten Sie die wichtigsten Kennzeichen dieses Zustandes (=Merkmale) fest.Teil AWenn zu Beginn der <strong>Bausteinplanung</strong> bereits eine Idee füreine Maßnahme (= konkrete Handlung, Aktion, konkretesAngebot, Vorhaben, siehe Exkurs) vorhanden ist und diese allgemeineZustimmung findet, dann können Sie so vorgehen:1. Überlegen Sie sich: Was wollen wir mit der Maßnahme erreichen?2. Gehen Sie dann entsprechend dem oben genannten Schritt „4.Zielformulierung und Merkmale“ vor.3. Es ist sinnvoll, den nächsten Arbeitsschritt „Maßnahmen“ trotzdemzu bearbeiten. Vielleicht fallen Ihnen zu Ihrem Ziel nochweitere oder gar bessere Maßnahmen ein!21Teil C Teil B
4. Grundlagenarbeitsschritt: MaßnahmenLeitfragen: Was soll unternommen werden, um das Ziel zuerreichen? Welche Aktionen/Handlungen solleninitiiert werden?Gewinn: Einigung auf zielgerichtete Maßnahmen, die dieGemeinde voranbringen können.Zeitaufwand: 30-60 minFormular: Die erarbeiteten Maßnahmen sollten ins Formularübernommen werden.Wenn Sie nach den bisherigen Arbeitsschritten nur nochwenig Zeit, Energie und Kreativität übrig haben, dann machenSie diesen Abschnitt in einer späteren Sitzung. Fixieren Sieaber sofort den Termin.2. Auswählen im PlenumTauschen Sie Ihre Meinungen zu den Maßnahmen aus.Inwiefern passen die Maßnahmen zu den Gegebenheiten undRessourcen (Personen, Finanzen, Räumlichkeiten etc.) vor Ort?Hier können Ihnen z.B. Auswertungen aus dem PC-ProgrammDaviP und der Plan für die kirchliche Arbeit realistische Einblickegeben.Priorisieren Sie durch Abstimmen (z.B. durch Klebepunktevergabe),welche Maßnahmen angestoßen werden sollen.Überlasten Sie sich nicht mit zu vielen oder zu großen Maßnahmen!Spätestens in diesem Arbeitsschritt sollte ein „Baustein-Verantwortlicher“ bestimmt und im Formular in derZeile „verantwortlich“ eingetragen werden, der das Gremiumüber Aktuelles im Baustein (z.B. über die Umsetzung der Zieleund Maßnahmen) informiert. Wenn Sie mit diesem Arbeitsschrittnicht fertig werden, d.h. keine konkreten Umsetzungsschrittefestgelegt haben, dann hat der Baustein-Verantwortlichedie Aufgabe, die <strong>Bausteinplanung</strong> zur Fertigstellung wieder aufdie Tagesordnung zu bringen!3. UmsetzungsplanungBei den Maßnahmen geht es für den KGR als Leitungsgremiumnicht um ein „Machen/Durchführen“, sondernum das „Entscheiden“! Der KGR ist zwar verantwortlich für seineZiele und Maßnahmen, er muss sie aber qua Amtes nicht selbstumsetzen. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen solltedurch die Umsetzenden, nicht durch das Gremium geschehen.Maßnahmen, die andere Mitarbeitende in ihrem Verantwortungsbereichbetreffen, sollten mit diesen gemeinsam entwickelt oderzumindest abgesprochen werden (siehe Exkurs).1. BrainstormingÜberlegen Sie im Plenum oder in Kleingruppen: Was soll unternommenwerden, um das Ziel zu erreichen? Welche Aktionen/Handlungen sollen initiiert werden?Sammeln Sie Ihre Ideen auf Kärtchen an einer Moderationswandoder auf einem Flipchart.Es muss bei den Maßnahmen nichts Neues begonnenwerden! Maßnahmen können auch Bestehendes erhalten,manches reduzieren oder weiter ausbauen (siehe die Beispieleim Exkurs).Machen Sie sich Gedanken dazu, wie Sie im Blick auf die Maßnahmenweiter vorgehen wollen:Bis wann sollte die Maßnahme umgesetzt sein?Welche Schritte sind zur Umsetzung der Maßnahme von unsererSeite her erforderlich und was ist delegierbar?Wer übernimmt welchen der von uns anzugehenden Schritte?Wer ist zu informieren bzw. im Weiteren zu beteiligen?Wer ist der Baustein-Verantwortliche? Falls Sie diese Personerst jetzt bestimmen, dann tragen Sie sie im Formular in derZeile „verantwortlich“ ein!Wann wird der Baustein-Verantwortliche dem Gremium vonden Fortschritten bei der Umsetzung berichten?22
Hier ein Beispiel, das die vielen Aspekte der Umsetzungsplanung verdeutlicht:(wenn Sie Ihre Planung ganz detailliert machen wollen, können Sie selbst etwas Ähnliches erstellen)MaßnahmeVerantwortlich fürWas ist zu tun?Wer ist verantwort-Bis wann zuden Baustein?lich?erledigen?Wann berichten?Wir richten bis ineinem Jahr eineJungschar ein.KGR Fr. Müller.Sie berichtet von denMitarbeitendeansprechenKGR Fr. Müller,Pfarrerin KirchnerAnfang OktoberTeil AUmsetzungsfortschrit-Konzeption, Ablauf undMitte Novemberten in der Sitzung imThemen der JungscharDezember.überlegenMitarbeitende überlegendies, Moderation/Koordination durch einKGR Fr. MüllerKGR-MitgliedEinladungen verfassen/verschickenWenn genauerStarttermin feststehtEin KGR-Mitgliedfragt Hr. Herbst an, ob KGR Hr. Kaiserer Einladung verfassenkönnteAuftrag an Sekretärinzum VersandPfarrerin Kirchner300 Euro Materialkostenbereitstellen<strong>Kirche</strong>npfleger MaierFür nächsten HaushaltsplanStimmen aus der GemeindeDie <strong>Bausteinplanung</strong> hat uns eine intensivere Beschäftigung mit den Zielenund Inhalten unserer Arbeitsbereiche gebracht. Es wurden <strong>neu</strong>e Ideenentwickelt und wir sind darauf gekommen, was uns an Angeboten fehltund was wir vielleicht lassen können. Es ist unbedingt zu empfehlen, die<strong>Bausteinplanung</strong> mit einem geschulten externen Moderator zu machen.Gemeinde Bad Mergentheim23Teil C Teil B
3. Neue Amtszeit und bereits bearbeiteteBausteineIn einer <strong>neu</strong>en Amtszeit bietet es sich an, auch einen bereits bearbeitetenBaustein nochmals zu planen. Denn vielleicht haben sichseither Dinge verändert und das (teilweise) <strong>neu</strong>e Gremium hat andereSchwerpunkte und Ideen! Außerdem kann man so in Ansätzendie Arbeit des bisherigen Gremiums kennenlernen.Sie können sich bei einer solchen <strong>Bausteinplanung</strong> ebenfalls andieser Praxishilfe orientieren. Dabei können Sie besonders im Blickauf die Arbeitsschritte Teil B, 2. und Teil B, 2.1. Zeit sparen, indemSie die bereits erarbeiteten Texte als Diskussionsgrundlage benutzen,sie gemeinsam entsprechend der Leitfragen (siehe Teil A, 4.)ergänzen und abändern. Weitere, etwas zeitintensivere Vorgehensmöglichkeitensind direkt unter Teil B, 2. ( ), Teil B, 2.1., und TeilB, 2.2. aufgeführt).4. Öffentlichkeitsarbeit, Visitation, Leitbild,<strong>Kirche</strong>nbezirks- und Gesamtkirchengemeindeebene1. Lassen Sie die Menschen in Ihrer Gemeinde an Ihren Gedankenund Planungen teilhaben. Zeigen Sie ihnen, dass in der Gemeindeund im Gremium „was geht“. Sie können dazu die Ergebnisseder <strong>Bausteinplanung</strong> leicht in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit nutzen,indem Sie Teile oder das ganze Formular im Gemeindebrief,Internet etc. veröffentlichen.2. Wie Gemeindeerfahrungen zeigen, hilft Ihnen die <strong>Bausteinplanung</strong>für die Visitation. Sie können Ihre Bausteinergebnissez.B. im Gemeindebericht und beim Gemeindeforum einbringen,ersparen sich so Arbeit und kommen vielleicht sogarmit dem ein oder anderen über die Ergebnisse ins Gespräch.Zugleich können Ergebnisse bzw. Fragestellungen aus der Visitationden Bausteinen zugeordnet werden und hier bei dernächsten <strong>Bausteinplanung</strong> mitbedacht werden.Teil AStimmen aus der GemeindeDie <strong>Bausteinplanung</strong> fördert ein ganzheitliches Denken bei der Gemeindearbeit,denn sie animiert dazu, dass nicht nur über das fürdas nächste Jahr zu verteilende Geld gesprochen wird, sondern auchüber die Inhalte. So hat die <strong>Bausteinplanung</strong> uns dazu gebracht, imGremium für jedes <strong>neu</strong>e <strong>Kirche</strong>njahr einen Schwerpunkt zu wählenund konkrete Ziele zu formulieren. Auch wenn wir am Anfang alleerst noch eher skeptisch waren, hat sich das auf unser gemeinsamesArbeiten positiv ausgewirkt.Gemeinde Jesingen25Teil C Teil B
3. Wenn Sie bereits ein Leitbild/-motto haben, werden Sie besondersin Ihren „Bausteinbeschreibungen“, teilweise auchin Ihren „Leitgedanken“ (wennn Sie diesen Arbeitsschritt gemachthaben), wesentliche Elemente davon wiederfinden.Wenn Sie dagegen erst einen Leitbildprozess o.Ä. in IhrerGemeinde planen, dann lassen Sie Ihre beplanten Bausteineeinfließen (Sie können so z.B. die „Baustein-Beschreibungen“auf verbindende, zentrale Gedanken untersuchen)! Sprechen SieIhren Leitbildmoderator darauf an!4. Grundsätzlich ist eine <strong>Bausteinplanung</strong> im <strong>Kirche</strong>nbezirk/ KBAund in großen Gesamtkirchengemeinderäten denkbar. Esist dabei allerdings anhand von Zuständigkeiten, OrganisationsundHaushaltsplanstruktur genau zu prüfen, inwiefern, in welchemRahmen, wie und durch wen hier die <strong>Bausteinplanung</strong> sinnvoll ist.In einigen <strong>Kirche</strong>nbezirken und großen Gesamtkirchengemeindenhat sich ein Vorgehen mit „Vorarbeit“ bewährt (siehe TeilA, 3.): Die verantwortlichen Ausschüsse oder Bausteinverantwortlichenerarbeiten ausgewählte Arbeitsschritte der <strong>Bausteinplanung</strong>vorab. Im Gesamtgremium kann diese Vorarbeit dannals Diskussionsgrundlage dienen, abgeändert, ergänzt und beschlossenwerden.Stimmen aus der GemeindeZwischen Kirchturmsanierung und Neuanstellungen tat es richtiggut, mit dem <strong>Kirche</strong>ngemeinderat einige Stunden bewusst inhaltlichzu arbeiten. Der Baustein Gottesdienst war dabei ein guter Einstieg.Der Mustertext hatte bald seine Attraktivität verloren und wir rangengemeinsam um jedes Wort in der eigenen Formulierung. Doch nachder Planung wartet die Umsetzung des wohlklingenden Satzes.Gemeinde Ofterdingen26
Teil AImpressum:Herausgeber: Evangelischer Oberkirchenrat, StuttgartRedaktion: Pfarrerin Diane Schneider, <strong>Kirche</strong>nverwaltungsamtsrat Jörg StolzMitarbeit: Evang. Bildungszentrum, Gemeindeentwicklung und Gottesdienst: Diakon Hans-Martin HärterEvang. <strong>Kirche</strong>ngemeindetag in Württemberg: Pfarrer Klaus-Peter Lüdke, Vorsitzender der Bezirkssynode Dieter Oehler<strong>Kirche</strong>npflegervereinigung: <strong>Kirche</strong>npflegerin Renate WalterBausteinmoderatoren: <strong>Kirche</strong>npfleger Kai MünzingDekane: Immanuel J. A. NauVerwaltungsstellen: Harald SchweikertGestaltung und Herstellung: Evangelisches Medienhaus GmbH, StuttgartBestellung: Evangelisches Bildungszentrum,Gemeindeentwicklung und Gottesdienst, Referat <strong>Kirche</strong>ngemeinderatsarbeit und EhrenamtKontaktdaten siehe unter: www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de27Teil C Teil B


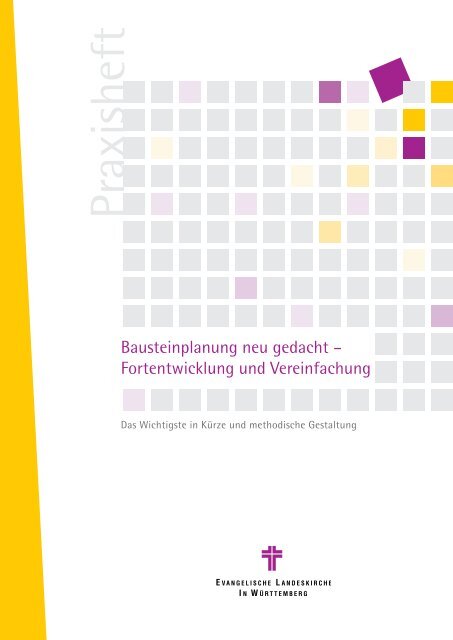
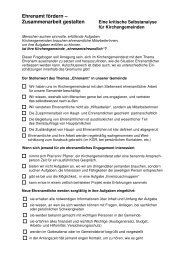




![Beginnen – Anknüpfen – Gestalten ] Arbeitshilfe für](https://img.yumpu.com/6650997/1/184x260/beginnen-anknupfen-gestalten-arbeitshilfe-fur.jpg?quality=85)
