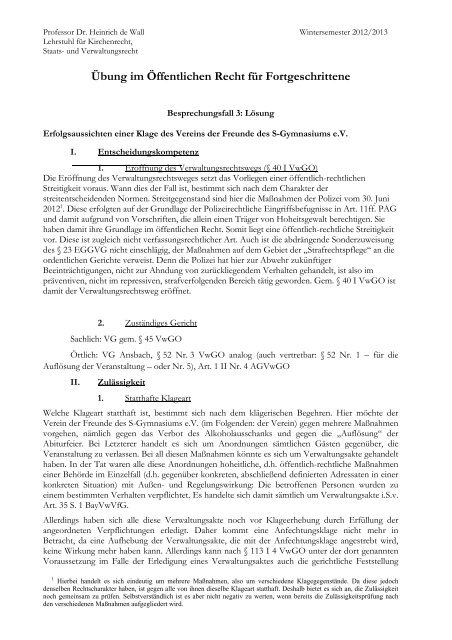O tempora, o mores!
O tempora, o mores!
O tempora, o mores!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Professor Dr. Heinrich de WallLehrstuhl für Kirchenrecht,Staats- und VerwaltungsrechtWintersemester 2012/2013Übung im Öffentlichen Recht für FortgeschritteneBesprechungsfall 3: LösungErfolgsaussichten einer Klage des Vereins der Freunde des S-Gymnasiums e.V.I. Entscheidungskompetenz1. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs (§ 40 I VwGO)Die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges setzt das Vorliegen einer öffentlich-rechtlichenStreitigkeit voraus. Wann dies der Fall ist, bestimmt sich nach dem Charakter derstreitentscheidenden Normen. Streitgegenstand sind hier die Maßnahmen der Polizei vom 30. Juni2012 1 . Diese erfolgten auf der Grundlage der Polizeirechtliche Eingriffsbefugnisse in Art. 11ff. PAGund damit aufgrund von Vorschriften, die allein einen Träger von Hoheitsgewalt berechtigen. Siehaben damit ihre Grundlage im öffentlichen Recht. Somit liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeitvor. Diese ist zugleich nicht verfassungsrechtlicher Art. Auch ist die abdrängende Sonderzuweisungdes § 23 EGGVG nicht einschlägig, der Maßnahmen auf dem Gebiet der „Strafrechtspflege“ an dieordentlichen Gerichte verweist. Denn die Polizei hat hier zur Abwehr zukünftigerBeeinträchtigungen, nicht zur Ahndung von zurückliegendem Verhalten gehandelt, ist also impräventiven, nicht im repressiven, strafverfolgenden Bereich tätig geworden. Gem. § 40 I VwGO istdamit der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.2. Zuständiges GerichtSachlich: VG gem. § 45 VwGOÖrtlich: VG Ansbach, § 52 Nr. 3 VwGO analog (auch vertretbar: § 52 Nr. 1 – für dieAuflösung der Veranstaltung – oder Nr. 5), Art. 1 II Nr. 4 AGVwGOII.Zulässigkeit1. Statthafte KlageartWelche Klageart statthaft ist, bestimmt sich nach dem klägerischen Begehren. Hier möchte derVerein der Freunde des S-Gymnasiums e.V. (im Folgenden: der Verein) gegen mehrere Maßnahmenvorgehen, nämlich gegen das Verbot des Alkoholausschanks und gegen die „Auflösung“ derAbiturfeier. Bei Letzterer handelt es sich um Anordnungen sämtlichen Gästen gegenüber, dieVeranstaltung zu verlassen. Bei all diesen Maßnahmen könnte es sich um Verwaltungsakte gehandelthaben. In der Tat waren alle diese Anordnungen hoheitliche, d.h. öffentlich-rechtliche Maßnahmeneiner Behörde im Einzelfall (d.h. gegenüber konkreten, abschließend definierten Adressaten in einerkonkreten Situation) mit Außen- und Regelungswirkung: Die betroffenen Personen wurden zueinem bestimmten Verhalten verpflichtet. Es handelte sich damit sämtlich um Verwaltungsakte i.S.v.Art. 35 S. 1 BayVwVfG.Allerdings haben sich alle diese Verwaltungsakte noch vor Klageerhebung durch Erfüllung derangeordneten Verpflichtungen erledigt. Daher kommt eine Anfechtungsklage nicht mehr inBetracht, da eine Aufhebung der Verwaltungsakte, die mit der Anfechtungsklage angestrebt wird,keine Wirkung mehr haben kann. Allerdings kann nach § 113 I 4 VwGO unter der dort genanntenVoraussetzung im Falle der Erledigung eines Verwaltungsaktes auch die gerichtliche Feststellung1 Hierbei handelt es sich eindeutig um mehrere Maßnahmen, also um verschiedene Klagegegenstände. Da diese jedochdenselben Rechtscharakter haben, ist gegen alle von ihnen dieselbe Klageart statthaft. Deshalb bietet es sich an, die Zulässigkeitnoch gemeinsam zu prüfen. Selbstverständlich ist es aber nicht negativ zu werten, wenn bereits die Zulässigkeitsprüfung nachden verschiedenen Maßnahmen aufgegliedert wird.
persönliche Schutzbereich ist eindeutig eröffnet: Ein Verein ist eine Vereinigung i.S.v. Art. 9 I GG.Fraglich ist jedoch, ob auch der sachliche Schutzbereich eröffnet ist. Schon seinem Wortlaut nach,aber auch nach seiner systematischen Stellung im Verhältnis zu den übrigen Grundrechten schütztArt. 9 I GG zwar das Bilden und den Bestand einer Vereinigung, nicht aber jede beliebige Handlungeiner solchen. Denn es ist keine Rechtsfertigung dafür erkennbar, warum ein und dasselbe Verhalten(z.B. Organisation einer Veranstaltung) nur und gerade deshalb einen herausgehobenengrundrechtlichen Schutz genießen soll, weil es von einer Vereinigung anstatt von natürlichenPersonen verantwortet wird. Damit fallen Betätigungen eines Vereins grds. nicht in denSchutzbereich von Art. 9 I GG. Auch die Veranstaltung der Abiturientenverabschiedung wird nichtdadurch besonders schützenswert, dass sie von einem Verein und nicht von einzelnen natürlichenPersonen durchgeführt wird. Der Schutzbereich des Art. 9 I GG ist damit nicht einschlägig.- Mögliche Verletzung von Art. 2 I GG?Allerdings kommt eine Verletzung der allgemeinen Handlungsfreiheit gem. Art. 2 I GG in Betracht.Das Recht, zu tun und zu lassen, was man möchte, ist wesensmäßig auf juristische Personen ebensoanwendbar wie auf natürliche Personen. Gem. Art. 19 III GG kann sich damit auch der Verein aufdie allgemeine Handlungsfreiheit berufen. Die Veranstaltung und die freie Gestaltung von Festen,d.h. auch die Entscheidung darüber, ob und wenn ja welche Getränke angeboten werden, und wanneine Veranstaltung beendet wird, ist von diesem Grundrecht geschützt. Es ist damit nicht vonvorneherein ausgeschlossen, dass der Verein sowohl durch das Verbot, Alkohol auszuschenken, alsauch durch die vorzeitige Auflösung der Veranstaltung in seinem Grundrecht aus Art. 2 I GGverletzt wird. Der Verein ist damit klagebefugt.3. VorverfahrenEin Widerspruchsverfahren ist gem. § 68 I 2 VwGO i.V.m. Art. 15 I, II AGVwGO nicht statthaft.4. Fortsetzungsfeststellungsinteresse, § 113 I 4 VwGO analogEin berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Maßnahmen (§ 113 I 4VwGO) liegt darin begründet, dass der Verein eine gleichartige Feier auch im kommenden Jahrveranstalten will und damit eine Wiederholung der Maßnahmen droht.5. KlagefristDie Klage müsste auch noch fristgerecht erhoben werden können. Dabei stellt sich zuerst die Frage,welche Frist gewahrt werden muss. Da sich die angegriffenen Verwaltungsakte bereits vorKlageerhebung erledigt haben und damit kein Bedürfnis besteht, über ihre FortgeltungRechtssicherheit zu gewinnen, findet § 74 I 2 VwGO für die Fortsetzungsfeststellungsklage inanaloger Anwendung von § 113 I 4 VwGO keine Anwendung (nicht völlig unstrittig, a.A. mit guterBegründung noch vertretbar). Damit kommt eine Verfristung nach dieser Norm grds. nicht inBetracht. Allerdings darf der Rechtsschutz durch die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht weiterreichen als der Rechtsschutz durch eine Anfechtungsklage, da der Zweck derFortsetzungsfeststellungsklage (nur) darin besteht, dem Kläger in bestimmten, besonderenSituationen den an sich durch die Anfechtungsklage zur Verfügung stehenden Rechtsschutz trotzErledigung des VA zu erhalten. Eine Fortsetzungsklage ist damit ausgeschlossen, wenn der VAbereits vor Erledigung bestandskräftig geworden war. Dies ist hier jedoch eindeutig zu verneinen,weil sich die Maßnahmen sofort erledigt haben, so dass bei Erledigung weder die Frist des § 74VwGO noch die hier mangels Rechtsbehelfsbelehrung wohl eher einschlägige Frist des § 58 IIVwGO bereits abgelaufen war. Wann Zeitablauf zum Ausschluss der Klagemöglichkeit führt,bestimmt sich damit nach den Grundsätzen der Verwirkung. Da die Ereignisse laut SV erst ca. 4Monate zurückliegen, greifen diese nicht ein. Erst nach einem Jahr geht man entsprechend demRechtsgedanken des § 58 II VwGO i.d.R. davon aus, dass nicht mehr mit einem Rechtsbehelfgerechnet werden muss. (Hinweis: Eine knappere Darstellung ist nicht zu beanstanden, da Verfristung oderVerwirkung i.E. eindeutig zu verneinen ist)3
6. Beteiligten und ProzessfähigkeitDer eingetragene Verein als Kläger ist juristische Person und damit gem. § 61 Nr. 1 VwGObeteiligtenfähig. Er ist als solcher nicht gem. 62 I VwGO prozessfähig und muss deshalb gem. § 62III VwGO i.V.m. § 26 II BGB durch den Vorstand vertreten werden.Der Freistaat Bayern als Beklagter ist gem. § 61 Nr. 1 VwGO beteiligtenfähig. Er ist nichtprozessfähig und muss deshalb gem. § 62 III VwGO, Art. 16 AGVwGO, § 3 II LABV (i.d.R. durchdie Ausgangsbehörde) vertreten werden.Zwischenergebnis: Die Sachentscheidungsvoraussetzungen liegen vor.Objektive KlagehäufungDer Verein möchte hier gegen eine Mehrzahl polizeilicher Maßnahmen (Verbot desAlkoholausschanks, „Veranstaltungsauflösung“ durch Verweisung sämtlicher Anwesender vomGelände) vorgehen. Damit stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Begehren in objektiverKlagehäufung geltend gemacht werden können. Da die Maßnahmen in engem zeitlichen undsachlichen Zusammenhang stehen, der Beklagte jeweils der Freistaat Bayern ist und für alle Klagendas VG Ansbach zuständig ist, liegen die Voraussetzungen des § 44 VwGO vor: Die verschiedenenpolizeilichen Maßnahmen können damit gemeinsam in einem Verfahren angegriffen werden.I. BegründetheitDie Klagen des Vereins sind begründet, wenn sie gegen den richtigen Beklagten gerichtet ist, diepolizeilichen Maßnahmen rechtswidrig waren und Verein durch sie in seinen eigenen Rechtenverletzt wurde, § 113 I 4 VwGO analog.1. Passivlegitimation § 78 I Nr.1 VwGO:Richtiger Beklagter ist jeweils der Freistaat Bayern als Rechtsträger der Polizei, vgl.Art. 1 II POG.2. Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmena) Rechtmäßigkeit des generellen Verbots, Alkohol auszuschenkenaa) RechtsgrundlageVersammlungsrechtliche Rechtsgrundlage, Art. 15 IV BayVersGArt. 15 IV BayVersG ist als Rechtsgrundlage nicht einschlägig. DerAnwendungsbereich des Gesetzes ist nicht eröffnet: Bei der Zusammenkunfthandelt es sich nicht um eine Versammlung gem. Art. 2 I BayVersG, weil sienicht „überwiegend“ der Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildungund -kundgabe dient (s. oben).- Polizeirechtliche Standardbefugnis (-)- Art. 11 I, II PAGbb) Formelle Rechtmäßigkeit- Zuständigkeit:• sachlich: Aufgabeneröffnung, Art. 2, 3 PAGDie Polizei handelte zur Abwehr von Körperverletzungen zwischen den Teilnehmern der Feiersowie von Lärm- und sonstigen Belästigungen in der Zukunft und damit präventiv zur Abwehr vonzumindest abstrakten Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Der polizeilicheAufgabenbereich ist damit nach Art. 2 I PAG eröffnet.4
Da Sicherheitsbehörden (Gemeinden, Landratsämter…) an Samstag-Nachmittagen nicht besetztsind, war eine Gefahrenabwehr durch sie konkret nicht möglich. Damit lagen auch dieVoraussetzungen für die Zuständigkeit der Polizei gegenüber sonstigen Behörden, insbesondere denSicherheitsbehörden gem. Art. 3 PAG, vor.• örtlich: Art. 3 POG (+)- Verfahren: Anhörung entbehrl., Art. 28 II Nr. 1 VwVfGcc) Materielle Rechtmäßigkeit(1) Befugnis: Subsumtion unter Art. 11 I, II PAG• Handeln zur Verhinderung bzw. Unterbindung vonOrdnungswidrigkeiten, Art. 11 II Nr. 1 PAGDie Befugnis zur Unterbindung des Alkoholausschanks könnte sich aus Art. 11 II Nr. 1 PAG i.V.m.§ 9 I, § 28 I Nr. 10 JSchG ergeben. Die Herausgabe von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren undvon Branntwein an Jugendliche unter 18 Jahren stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, vgl. § 9 I i.V.m. §28 I Nr. 10 JSchG, denn es handelte sich bei der Feier um eine öffentliche Veranstaltung (vgl.Bearbeiterhinweis). Allerdings war es zur Verhinderung dieser Ordnungswidrigkeit unmittelbar nurnotwendig, den Ausschank von Alkohol an Personen unterhalb der Altersgrenzen, nicht denAusschank von Alkohol überhaupt zu verbieten. Für ein generelles Verbot liefert Art. 11 II Nr. 1i.V.m. §§ 9, 28 JSchG somit keine Befugnis. Die Befugnis für ein generelles Verbot muss deshalbanderweitig begründet werden.Sie könnte jedoch ebenfalls aus Art. 11 I Nr. 1 PAG hergeleitet werden, wenn das Lärmen derbetrunkenen Schüler den Tatbestand von § 117 OWiG oder das auf übermäßigen Alkoholkonsumzurückzuführende Ansprechen von Spaziergängern den Tatbestand von § 118 OWiG erfüllenwürde. Ein Verstoß gegen § 117 OWiG ist nur dann zu bejahen, wenn der Lärm geeignet ist, dieAllgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen. Bei „normalem“ Partylärm zurTagzeit, noch dazu auf einem Gelände, das gerade zur Veranstaltung von Feiern bestimmt ist, wirdman die Schwelle der erheblichen Belästigung noch nicht als überschritten ansehen können (a.A.noch vertretbar, letztlich Frage der Interpretation des Sachverhalts).Ein Verstoß gegen § 118 OWiG setzt eine grob ungehörige Handlung voraus. Darunter ist eineHandlung zu verstehen, die in gravierender Weise gegen anerkannte Regeln von Sitte, Anstand undOrdnung verstößt. Dies kann bei einfachem, unmotivierten Ansprechen von Passanten – wenn esnicht beleidigenden oder nötigenden Charakter hat, wofür sich aus dem SV keine eindeutigenHinweise ergeben –, noch nicht bejaht werden, selbst wenn der Handelnde erkennbar betrunken ist.Zwar weicht ein solches Verhalten von der Norm und den Regeln des Anstandes ab. Jedoch kannman diese Abweichung noch nicht als gravierend bezeichnen. Im zwischenmenschlichenZusammenleben muss ungewünschtes, als unpassend empfundenes Ansprechen grds.hingenommen werden.Auch unter diesen Gesichtspunkten dient das Alkoholverbot damit nicht der Abwehr oderUnterbindung von Ordnungswidrigkeiten.• Handeln zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit von Personenunter dem Gesichtspunkt des Alkoholmissbrauchs, Art. 11 II Nr. 3 PAGMöglicherweise könnte sich jedoch eine Befugnis zum Handeln aus Art. 11 II Nr. 3 PAG ergeben:Übermäßiger Alkoholgenuss kann einen pathologischen Zustand herbeiführen (spätestens ab demEintritt einer Alkoholvergiftung) und damit die Gesundheit von Personen gefährden. Jedoch gehthierbei die Gefährdung der Gesundheit nicht von Dritten oder äußeren Umständen, sondern voneigenem Verhalten aus. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob bzw. wann dieses zum Anlass fürpolizeiliches Einschreiten genommen werden darf, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Polizeiberechtigt (und möglicherweise sogar verpflichtet) ist, den Menschen vor sich selbst zu schützen.Dies wird jedenfalls dann zu verneinen sein, wenn von einer eigenverantwortlichen Entscheidung5
des Betroffenen für die Selbstschädigung auszugehen ist. Bei erwachsenen, voll geschäftsfähigenPersonen reicht die Einsichtsfähigkeit so weit, die Gefahren und Wirkungen von Alkohol beurteilenzu können. Auch ist davon auszugehen, dass Erwachsene in der Lage sind, ihr Verhalten frei zusteuern. Bei ihnen ist deshalb von einer freien Entscheidung für den Alkoholkonsum auszugehen.Das Recht auf eigenverantwortliches Handeln und Selbstbestimmung schließt es hier daher aus, dieBetroffenen „vor sich selbst“ zu schützen. Daher darf auch unter diesem Gesichtspunkt nur dieAbgabe von Alkohol an (möglicherweise) noch nicht hinreichend eigenverantwortlichhandlungsfähige Minderjährige, nicht aber an Erwachsene untersagt werden (Hinweis: da es sich hierbeiletztlich um eine Güterabwägung mit der allgemeinen Handlungsfreiheit der Betroffenen handelt, kann das Problemauch im Rahmen der „Verhältnismäßigkeit“ diskutiert werden).• Handeln zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit unter demGesichtspunkt drohender Körperverletzungen, Art. 11 II Nr. 3 PAGEine Befugnis zum Handeln könnte jedoch dann bejaht werden, wenn eine „Gefahr“ für dieGesundheit von Menschen durch Körperverletzungen bestünde. Von einer „Gefahr“ wird nachallgemeiner Meinung gesprochen, wenn eine Beeinträchtigung des Schutzgutes in absehbarer Zeitmit hinreichender Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Allerdings lehrt die Lebenserfahrung, dass es ingrößeren Menschenansammlungen bei übermäßigem Alkoholkonsum mit nicht geringerWahrscheinlichkeit zu körperlichen Auseinandersetzungen und körperlicher Gewalt kommt. Derbisherige Verlauf der Feier, in dem es schon einmal zu einer Schlägerei kam, zeigt, dass auch imkonkreten Fall eine nicht unbeträchtliche Wahrscheinlichkeit erneuter körperlicherAuseinandersetzungen besteht. Diese Gefahr geht von übermäßig betrunkenen Jugendlichen ebensoaus wie von übermäßig betrunkenen Erwachsenen. Insofern kann eine Befugnis für das generelleVerbot weiteren Alkoholausschanks grds. bejaht werden (a.A. vertretbar mit der Begründung, dassklare Hinweise auf zukünftige gewalttätige Auseinandersetzungen dem SV nicht zu entnehmen sind).• Handeln zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oderOrdnung i.S.v. Art. 11 I PAG unter dem Gesichtspunkt desalkoholbedingten Lärmens und PersonenansprechenDamit bleibt zu prüfen, ob das alkoholbedingte Lärmen oder Personenansprechen, auch wenn esnicht die Schwelle zur Ordnungswidrigkeit überschreitet, dennoch eine Gefahr für die öffentlicheSicherheit oder Ordnung i.S.v. Art. 11 I PAG darstellen könnte.Unter öffentlicher Sicherheit versteht man die Unversehrtheit der Rechtsordnung, der individuellenRechte und Rechtsgüter des Einzelnen und die Unversehrtheit des Staates und seiner Einrichtungen.Da sich das Lärmen und Ansprechen von Personen hier unterhalb der Schwelle der §§ 117, 118OWiG bewegt, und auch i.Ü. durch das Recht nicht untersagt wird, stellt es weder eineBeeinträchtigung der Unversehrtheit der Rechtsordnung noch eine Beeinträchtigung der „Rechte“der Betroffenen dar. Damit droht durch es keine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit. Eskönnte jedoch eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung darstellen.Unter „öffentlicher Ordnung“ versteht man die Gesamtheit derjenigen ungeschriebenen (d.h.sozialen, nicht rechtlichen) Regeln für das Verhalten in der Öffentlichkeit, deren Befolgung nachden gegenwärtig im Polizeibezirk herrschenden Verhältnissen als unerlässliche Voraussetzung einesgeordneten Gemeinschaftslebens angesehen wird. Nach den gegenwärtigen sozialen Anschauungenverstößt auch übermäßiger Alkoholgenuss mit seinen Folgen (lautes, extrovertiertes Verhalten) nichtgegen eine zwingend zu befolgende Norm des sozialen Miteinanders. Zwar ist ein solches Verhaltennicht sozial erwünscht, es ist aber häufig in der Öffentlichkeit zu beobachten und wird alsBegleiterscheinung öffentlicher Vergnügungen (Volksfeste, Kirchweihen, Musikfestivals…)allgemein toleriert, solange es nicht in Verstöße gegen die Rechtsordnung umschlägt. Es stellt damitnoch keinen Verstoß gegen die „öffentliche Ordnung“ dar.Zwischenergebnis: Wegen der hinreichenden Wahrscheinlichkeit weiterer körperlicher6
Auseinandersetzungen, veranlasst durch weiteren Alkoholkonsum, können die Voraussetzungen vonArt. 11 I, II PAG bezogen auf ein generelles Alkoholverbot bejaht werden. (Unter allen anderenGesichtspunkten liefert Art. 11 PAG nur eine Befugnis zum Verbot des Alkoholausschanks anJugendliche nach Maßgabe des JSchG.)(2) Maßnahmerichtung• Art. 7 PAGDie Maßnahme ist gem. Art. 7 PAG gegen den Verursacher einer Gefahr oder, wenn die Gefahrvon einer Sache ausgeht, gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten (vgl. Art. 8 PAG).Hier geht die Gefahr nicht von einer Sache aus, so dass Art. 8 PAG nicht einschlägig ist. Zu klärenist damit, ob der Vereinsvorsitzende, an den die Maßnahme gerichtet war, als „Verursacher“ derGefahr, d.h. der Ordnungswidrigkeiten nach dem JSchG oder der erhöhten Wahrscheinlichkeit fürKörperverletzungen, angesehen werden kann.Als Veranstalter i.S.v. § 28 JSchG ist der Vorsitzende jedenfalls im Hinblick auf denordnungswidrigen Ausschank alkoholischer Getränke an Minderjährige Verursacher i.S.v. Art. 7 IPAG. Fraglich ist das aber für die erhöhte Wahrscheinlichkeit für KörperverletzungenVon „Verursachung“ kann jedenfalls nur dann gesprochen werden, wenn das Verhalten desAdressaten „conditio sine qua non“ für die Gefahr war (sog. äquivalente Kausalität). Dies wird manhier bejahen können, denn die erhöhte Wahrscheinlichkeit körperlicher Auseinandersetzungenentsteht gerade durch vermehrten Alkoholkonsum und dieser wiederum wird durch denunbeschränkten Alkoholausschank, für den der anwesende Vereinsvorsitzende als Vertreter desVereins die Verantwortung trägt, begünstigt. Würde jedoch alleine die äquivalente Kausalitätgenügen, um von „Verursachung“ zu sprechen, hätte dies eine zu weitreichende polizeirechtlicheEinstandspflicht für Gefahren zur Folge. Deshalb ist eine weitere Eingrenzung der Zurechnung vonNöten. Die h.L. zieht dazu das Kriterium der „unmittelbaren Verursachung“ heran: „Verursacher“einer Gefahr i.S.v. Art. 7 I PAG ist danach nur der, der durch sein Verhalten die Gefahrenschwelle„unmittelbar überschreitet“. Hier wird man bezüglich des Ausschanks von Alkohol an Erwachsenenicht von einer „unmittelbaren Verursachung“ der Gefahr von Körperverletzungen durch diePersonen am Alkoholausschank sprechen können. Denn die Gefahrenschwelle wird hier erst durchden Alkoholkonsum und das problematische Verhalten der Konsumenten überschritten. Dies istaber jedenfalls bei Erwachsenen als selbst verantwortet anzusehen ist und deshalb denAusschenkenden nicht mehr zuzurechnen. I.Ü. wird der Ausschank von Alkohol an Erwachsene,solange diese nicht erkennbar betrunken sind, als sozialadäquat angesehen. Im Hinblick auf denAusschank von Alkohol an Erwachsene ist der für den Ausschank verantwortlicheVereinsvorsitzende damit nicht als „Verursacher“ der Gefahr anzusehen.Auch unter dem Gesichtspunkt der „Zweckveranlassung“, deren Berechtigung i.ü. umstritten ist,kann hier keine Verantwortlichkeit des Vereinsvorsitzenden Aus. Art. 7 I PAG abgeleitet werden.Dazu müsste es „objektiver Zweck“ des Alkoholausschankes sein, dass Personen sich derartbetrinken, dass sie die abzuwehrende Gefahr verursachen. Das kann man beim reinenAlkoholausschank aber nicht behaupten (a.A. noch vertretbar).• Art. 10 PAGDamit ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, den Vereinsvorsitzenden alsNichtverantwortlichen in Anspruch zu nehmen. Dazu müssten die Voraussetzungen von Art. 10 IPAG vorliegen, also jedenfalls eine gegenwärtige, erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheitoder Ordnung bestehen. Eine Gefahr ist gegenwärtig, wenn eine Beeinträchtigung der Schutzgüterschon eingetreten ist und noch andauert oder zumindest unmittelbar bevorsteht. Von einererheblichen Gefahr spricht man, wenn die Verletzung besonders zentraler, bedeutsamer Rechte oderRechtsgüter droht. Durch körperliche Auseinandersetzungen drohen zwar Gefahren für diezentralen Rechtsgüter „Leben“ und „körperliche Unversehrtheit“. Jedoch liefert der SV keinehinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Gefahr unmittelbar bevorstand: Anzeichendafür, dass binnen Kurzem wieder eine schwerere Schlägerei ausbrechen könnte, lassen sich dem SV7
nicht entnehmen. Die Voraussetzungen von Art. 10 I PAG liegen damit nicht vor. DerVereinsvorsitzende konnte nicht als Nichtverantwortlicher in Anspruch genommen werden.3) Ermessen (Art. 5 PAG), Verhältnismäßigkeit (Art. 4 PAG)Hinweise auf Ermessensfehler, die über die bereits genannten Fehler hinausgehen, liegen nicht vor.Entsprechendes gilt für die Verhältnismäßigkeit. (Bereits o. wurde angegeben, dass einzelnePrüfungspunkte auch hier abgehandelt werden können).Zwischenergebnis: Das Verbot des Alkoholausschanks war rechtswidrig, soweit es darüberhinausging, die Alkoholabgabe an Kinder und Jugendliche nach Maßgabe des § 9 JSchG zuunterbinden.b) Rechtmäßigkeit der „Auflösung der Veranstaltung“aa) RechtsgrundlageWiederum ist die für die „Auflösung einer Versammlung“ in Betracht kommende Rechtsgrundlagedes Art. 15 IV BayVersG nicht einschlägig, weil die Veranstaltung nicht die Merkmale desVersammlungsbegriffes gem. Art. 2 I BayVersG erfüllt.Damit stellt sich die Frage, welcher polizeirechtlichen Befugnisnorm die Maßnahme zugeordnetwerden könnte. Das Polizeirecht enthält keine spezielle Befugnisnorm für die „Auflösung“ vonAnsammlungen. Inhaltlich handelt es sich dabei aber um die Aufforderung gegenüber allenAnwesenden, sich von dem Ort des Geschehens zu entfernen. Eine Befugnis der Polizei, Personenzum Verlassen eines Ortes zu verpflichten, ist in Art. 16 PAG (Platzverweis) normiert. In diesemkönnte daher die einschlägige Rechtsgrundlage für die Maßnahme zu sehen sein.bb) Formelle Rechtmäßigkeit- Zuständigkeit: Art. 2 I, 3 PAG, Art. 3 POG- Verfahren s. oben: kein Verstoß ersichtlichcc) Materielle Rechtmäßigkeit(1) Befugnis: Voraussetzungen von Art. 16 PAGDie Befugnis für die hier an sämtliche Anwesende ergangene Aufforderung, den Ort desGeschehens zu verlassen, könnte sich aus Art. 16 S. 1 PAG ergeben. Danach kann die Polizei „zurAbwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen“.Voraussetzung für einen Platzverweis ist also (wiederum) eine Gefahr für die öffentliche Sicherheitoder Ordnung. Damit stellt sich erneut die Frage, in welcher Hinsicht das Trinken der Schüler eineGefahr für die öffentliche Sicherheit begründen kann.Ordnungswidrigkeiten gem. § 28 I Nr. 10 JSchG jedenfalls drohen nicht mehr, da der Ausschankbeendet wurde.Es könnten aber Verstöße gegen § 9 I JSchG drohen, wenn man diesen so verstehen muss, dass erdie Abgabe von Alkohol an Jugendliche in der Öffentlichkeit unterhalb der Altersgrenzen Jedemuntersagt, nicht nur den von § 28 I Nr. 10 JSchG in Bezug genommenen Veranstaltern undGewerbetreibenden. Versteht man die Norm so, so besteht bei gleichzeitiger Anwesenheit vonminderjährigen und erwachsenen Schülern durchaus eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit füreinen Verstoß. Denn nach der Lebenserfahrung ist es in einer solchen Situation wahrscheinlich, dassAlkohol von über 16-Jährigen an unter 16-Jährige weitergegeben wird (Hinweis: Ausführungen hierzukönnen nicht verlangt werden, da es sich um eine außerhalb des allgemeinen Prüfungsstoff liegende Problematik derAnwendung von § 9 JSchG handelt).Eine Gefahr für Rechtsgüter des Einzelnen – in Gestalt von Gesundheitsgefährdungen – kannebenfalls bejaht werden. Allerdings begründen diese wegen der gebotenen Rücksicht auf dasSelbstbestimmungsrecht der Betroffenen nur bei Minderjährigen eine polizeirechtliche Gefahr (s.oben) (Hinweis: da es sich hierbei letztlich um eine Güterabwägung handelt, kann das Problem auch im Rahmen8
der „Verhältnismäßigkeit“ diskutiert werden).Nach wie vor besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für körperliche Auseinandersetzungen inFolge des exzessiven Alkoholgenusses.Dagegen kann das Lärmen und das Zugehen auf Dritte noch nicht als Gefahr für die öffentlicheSicherheit oder Ordnung eingestuft werden (s. oben).(2) MaßnahmerichtungWer tauglicher Adressat eines Platzverweises sein kann, ist umstritten. Eine M.M. geht davon aus,dass dem Art. 16 PAG selbst keine Regelung darüber zu entnehmen ist, so dass die Art. 7ff PAGzur Anwendung kommen. Danach könnte hier nur der tauglicher Adressat eines Platzverweises sein,der durch sein Verhalten eine der genannten Gefahren begründet (Art. 7 PAG), d.h. eine solcheunmittelbar verursacht. Dies wären jedenfalls all diejenigen Schüler nicht, die nur wenig oder garkeinen Alkohol zu sich nehmen und keine Anstalten machen, solchen an Minderjährigeweiterzugeben. Eine a.A. legt Art. 16 PAG so aus, dass sich aus diesem selbst der Kreis dermöglichen Adressaten ergibt. Auf Art. 7, 8, 10 PAG sei deshalb nicht mehr zurückzugreifen (vgl.Art. 7 IV, 8 IV, 10 III PAG). Danach ist tauglicher Adressat jeder, dessen Anwesenheit an einembestimmten Ort ursächlich für eine Gefahr ist, unabhängig davon, ob er diese durch ein Verhaltenverursacht hat oder nicht. Letztlich wird man offen lassen können, welcher von beiden Auslegungenzu folgen ist. Denn von der Anwesenheit der zuletzt beschriebenen Gruppe von Partygästen(erwachsen, nicht übermäßig trinkend, keinen Alkohol an Jugendliche unterhalb der Altersgrenzenweitergebend) am Ort des Geschehens geht keine Gefahr aus (a.A. vertretbar mit dem Argument,dass sich die Gefahren aus der Gruppendynamik der Feier ergeben, an der auch die sich an sich sichunauffällig Verhaltenden Anteil haben). Auch die Voraussetzungen von Art. 10 PAG liegen nichtvor. Sie waren damit nicht zulässiger Adressat eines Platzverweises.Zwischenergebnis: Die Auflösung der Veranstaltung war insoweit rechtswidrig, als sie auch gegenPersonen gerichtet war, von deren Anwesenheit am Ort des Geschehens keine Gefahr für dieSicherheit oder Ordnung ausging.3) Ermessen (Art. 5 PAG), Verhältnismäßigkeit (Art. 4 PAG)Hinweise auf Ermessensfehler, die über die bereits genannten Fehler hinausgehen, liegen nicht vor.Entsprechendes gilt für die Verhältnismäßigkeit. (Bereits o. wurde angegeben, dass einzelnePrüfungspunkte auch hier abgehandelt werden können).3. Verletzung des Vereins in eigenen RechtenDamit schließt sich die Frage an, ob der Verein durch die Maßnahmen in eigenen Rechten verletztwurde, obwohl er nicht unmittelbarer Adressat der Maßnahmen war. Denn dies waren für dasAusschankverbot der Vereinsvorsitzende, für die „Auflösung“ der Veranstaltung alle Teilnehmer derVeranstaltung. Gleichwohl ist die Durchführung der Veranstaltung und ihre besondereAusgestaltung im Rechtsverkehr dem „Veranstalter“ zuzurechnen, der ebenso gut wie einenatürliche Person auch eine juristische Person sein kann. Die Entscheidung darüber, welcheLeistungen auf der Veranstaltung angeboten werden und wie lange diese durchgeführt wird, ist vonder allgemeinen Handlungsfreiheit des Veranstalters aus Art. 2 I GG umfasst. Damit bedeutet eshier einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Vereins als Veranstalter, wenn derAusschank von Alkohol unterbunden und die Veranstaltung vor der vorgesehenen Zeit für beendeterklärt wurde. Dieser Eingriff ist nicht gerechtfertigt, da er nicht von den im Polizeirechtenthaltenen Rechtsgrundlagen gedeckt wird (s. oben). Der Verein wird damit durch die Maßnahmenin seiner allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt.Ergebnis: Die Klage gegen das Verbot des Alkoholausschanks ist begründet, soweit über dieUnterbindung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 9, 28 JSchG hinausging. Die Klage gegen die„Auflösung“ der Veranstaltung ist begründet, soweit diese gegen Erwachsene gerichtet war, diekeine Bereitschaft zu Gewalttätigkeiten oder sonstigen Rechtsverletzungen erkennen ließen. BeideKlagen haben damit teilweise Aussicht auf Erfolg.9