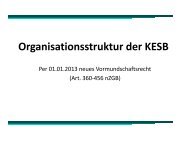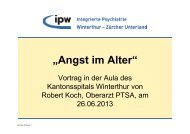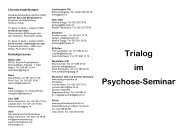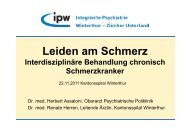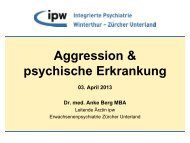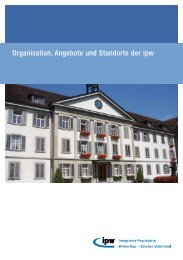Jahresbericht 2006 (PDF, 1 MB) - Integrierte Psychiatrie Winterthur ...
Jahresbericht 2006 (PDF, 1 MB) - Integrierte Psychiatrie Winterthur ...
Jahresbericht 2006 (PDF, 1 MB) - Integrierte Psychiatrie Winterthur ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Impressum<br />
Herausgeberin ipw <strong>Integrierte</strong> <strong>Psychiatrie</strong> <strong>Winterthur</strong><br />
Redaktion Dr. med. Toni Berthel, Christine Gäumann, Susanne Gimmi, Peter Roth<br />
Visuelles Konzept und Layout formerei gmbh Felicitas Högger<br />
Fotos Niklaus Spoerri, Fotoarchiv ipw<br />
Korrektorat Susanne Brülhart<br />
Druck und Ausrüstung Bühler Druck AG<br />
Ein politischer Massstab in der <strong>Psychiatrie</strong> 4<br />
Die Vernetzung steht im Mittelpunkt 5<br />
Die Patienten sind zufriedener 7<br />
Plattform Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommission 8<br />
Stadt <strong>Winterthur</strong> und ipw: Zusammenarbeit im Feld der Suchtarbeit 11<br />
Wider die Schwellenangst: Klassenbesuche auf der BSJ 12<br />
Der Sozialdienst ipw: Schnittpunkt Gemeinde 15<br />
Hier treffen sich <strong>Psychiatrie</strong>, Medizin und Sozialarbeit: Das Forum für Sozialpsychiatrie Effretikon 16<br />
052 224 33 99 18<br />
Die aufsuchende Hilfe in der Alterspsychiatrie 21<br />
ipw Streiflichter <strong>2006</strong> 22<br />
Kennzahlen <strong>2006</strong> 24<br />
Betriebsrechnung <strong>2006</strong> 26<br />
Personalstatistik <strong>2006</strong> 27<br />
Leitende Mitarbeitende 28<br />
Geschäftsleitung ipw 30<br />
Aufsichtskommission für die Kantonalen Psychiatrischen Kliniken 30<br />
Organigramm 31
Ein politischer Massstab in der <strong>Psychiatrie</strong><br />
Das «Kind ipw» wächst und gedeiht. Den räumlichen An-<br />
passungen für die Aufnahme der Akutangebote der Erwach-<br />
senenpsychiatrie folgte die Anpassung der betrieblichen<br />
Strukturen in Form einer modernen Matrixorganisation.<br />
Mit der Einführung und dem Aufbau eines professionellen<br />
Qualitätsmanagements für alle Betriebsabläufe auf stra-<br />
tegischer und operativer Ebene optimiert die ipw nun ihre<br />
grosse Aufbauarbeit während der letzten sechs Jahre.<br />
Dieser nie endende Prozess der Verbesserung von Qua-<br />
lität, die konsequente Ausrichtung auf eine ambulante<br />
Behandlungsstrategie und die Intensivierung der Zusam-<br />
menarbeit mit den Netzwerkpartnern bilden vorerst die<br />
weiteren Schwerpunkte in der ipw.<br />
Mit der Integration aller grundversorgenden Angebote<br />
unter einem Dach, der ausgesprochenen Gemeinde- und<br />
Patientennähe sowie mit der weiteren Spezifizierung der<br />
Angebote nach den Bedürfnissen der Patientinnen und<br />
Patienten leistet die ipw einen wichtigen Beitrag an die<br />
Gleichstellung von <strong>Psychiatrie</strong> und Somatik – und damit an<br />
die Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen.<br />
Ein Beispiel hierfür ist die Teilöffnung der geschlossenen<br />
Akutstationen der Erwachsenenpsychiatrie in der Klink<br />
Schlosstal. Erste Versuche zeigten: eine Win-win-Situ-<br />
ation. Die offenen Türen zollen Respekt gegenüber den<br />
Patientinnen und Patienten und appellieren an deren Ei-<br />
genverantwortung. Die Folge ist eine entspannte Atmo-<br />
sphäre auf den Stationen, welche sich entlastend auf das<br />
Personal auswirkt.<br />
Ich freue mich, dass wir mit dem bestehenden Modell ipw<br />
politisch einen Massstab in der <strong>Psychiatrie</strong> setzen konn-<br />
ten, welcher nicht nur in <strong>Winterthur</strong>, sondern auch über<br />
die Kantonsgrenzen Anerkennung findet. Dass die Um-<br />
setzung der gemeindenahen Versorgung während mei-<br />
ner Amtszeit als Gesundheitsdirektorin gelungen und nun<br />
weitgehend abgeschlossen ist, erfüllt mich mit Genug-<br />
tuung. Ich danke allen Beteiligten ganz herzlich für ih-<br />
ren grossen Einsatz<br />
Verena Diener, Regierungsrätin<br />
Vorsteherin der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich<br />
Die Vernetzung steht im Mittelpunkt<br />
Die seit 2001 zur ipw zusammengefassten kantonalen Ein-<br />
richtungen sind Teil der regionalen Netzwerkversorgung<br />
für die <strong>Psychiatrie</strong>region <strong>Winterthur</strong> mit rund 190‘000<br />
Einwohnern. Der <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> zeigt Ihnen anhand<br />
verschiedener Beispiele auf, wie und wo die Vernetzungs-<br />
arbeit stattfindet und an welchen Schnittstellen gearbei-<br />
tet wird.<br />
Unter dem Thema «Vernetzung» stand auch der im Ok-<br />
tober <strong>2006</strong> durchgeführte «Mitarbeitertag» für das Per-<br />
sonal aus allen Berufsgruppen. Der Stand der heutigen<br />
Vernetzung wurde von den Teilnehmenden positiv ge-<br />
wertet, doch hat sich die Vernetzungsarbeit noch nicht<br />
überall zur Selbstverständlichkeit entwickelt. Eine sol-<br />
che muss bewusst gesucht und gepflegt werden, bedeu-<br />
tet Mehrarbeit und nimmt damit Zeitressourcen in An-<br />
spruch. Für die Geschäftsleitung ipw ist die Vernetzung<br />
mit den Partnern nicht nur eine Worthülse, sondern ein<br />
grosses Anliegen und eine zwingende Voraussetzung für<br />
eine optimale Versorgung der psychisch kranken Men-<br />
schen in der <strong>Psychiatrie</strong>region. Wichtiges Bindeglied ist<br />
die Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommisson <strong>Winterthur</strong>, die den<br />
Austausch zwischen allen Partnern im <strong>Psychiatrie</strong>netz-<br />
werk und die strategische Steuerung sicherstellt. Seitens<br />
der ipw ist die Koordinations- und Beratungsstelle der<br />
Pulsnehmer für die Vernetzung. Sie pflegt den täglichen<br />
Austausch mit allen Institutionen, Foren, Fachstellen,<br />
Psychiatern, Psychotherapeuten, der Spitex und vielen an-<br />
deren Organisationen. Sie nimmt Anliegen auf, entwickelt<br />
Lösungsansätze und initiiert die Umsetzung. Ausseror-<br />
dentlich wertvoll ist für uns zudem die ausgezeichnete<br />
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Departementen<br />
und Dienststellen der Stadt <strong>Winterthur</strong>. Diese ermöglicht<br />
eine zielgerichtete und ressourcenschonende Lösung an-<br />
stehender Fragen.<br />
Im Namen der Geschäftsleitung ipw danke ich unseren<br />
Netzwerkpartnern für die offene und zielorientierte Zu-<br />
sammenarbeit. Den Mitarbeitenden der ipw gebührt ein<br />
herzliches Dankeschön für ihr unermüdliches Engage-<br />
ment im Alltag und, ganz speziell, für die Bewältigung al-<br />
ler zusätzlichen Aufgaben. Ich freue mich auf eine weiter-<br />
hin gute, sprich vernetzte, Zusammenarbeit.<br />
Peter Roth, Verwaltungsdirektor ipw
Dr. med. Andreas Andreae: «Einweisungen gegen<br />
den eigenen Willen sind deutlich gesunken.»<br />
Die Patienten sind zufriedener<br />
Nach den betrieblichen Pionierjahren war <strong>2006</strong> ein Jahr<br />
der Konsolidierung und Ausdifferenzierung. Es war auch<br />
der Zeitpunkt erreicht, zu evaluieren, ob wichtige Ziele<br />
der ipw erreicht wurden. Insbesondere interessierte uns,<br />
ob sich die erwarteten Vorteile des gemeindenahen Ver-<br />
sorgungsprinzipes eingestellt hatten, vor allem, nachdem<br />
2005 auch die Akutstationen der Erwachsenenpsychia-<br />
trie als letzte Versorgungselemente vom traditionellen<br />
Standort Rheinau in unsere neue Klinik auf Stadtgebiet<br />
verlegt worden waren.<br />
Unsere von der Hochschule für Angewandte Psychologie<br />
Zürich analysierten statistischen Daten, Outcomemes-<br />
sungen und Umfrageergebnisse weisen auf eine umfas-<br />
sendere Zusammenarbeit aller Versorgungsakteure in<br />
der Region hin. Bedeutung und Gewinn einer systema-<br />
tisch geförderten gemeindenahen Kooperation und Ko-<br />
ordination, wie sie die ipw als Leistungsauftrag versteht,<br />
werden von den befragten Vertretern von öffentlichen<br />
und privaten Angeboten aller Versorgungsebenen auf<br />
breiter Ebene bestätigt.<br />
Bevölkerung nutzt gemeindenahe Angebote<br />
Die statistischen Versorgungsindikatoren zeigen, dass<br />
nach dem Abschluss der Angebotsneustrukturierung 2005<br />
wichtige Versorgungsziele zum Tragen kommen. Heute<br />
bevorzugt der kantonsweit höchste Prozentsatz der sta-<br />
tionär behandlungsbedürftigen Bevölkerung in der Re-<br />
gion das verfügbare gemeindenahe Angebot. Vor allem<br />
Patienten mit Depressions- und Angststörungen lassen<br />
sich heute in der Regionsklinik behandeln, nachdem für<br />
sie früher ausserregionale Behandlungen mit längeren<br />
Aufenthalten typisch waren. Dies führt zu einem ausge-<br />
wogeneren, weniger stigmatisierenden Profil der statio-<br />
nären Regionsversorgung mit Vorteilen in der Koopera-<br />
tion mit Patienten, Angehörigen und Primärversorgern.<br />
Auch gelingt es heute im Kernbereich der Versorgungs-<br />
aufgaben gut, Patienten mit chronischen psychotischen<br />
Erkrankungen in ihrem Lebensumfeld zu stabilisieren<br />
und Rückfälle mit Akuthospitalisationen zu vermindern.<br />
Sie machen deshalb nur noch einen kleinen Teil der sta-<br />
tionären Akutpatienten aus.<br />
Aufsuchende Behandlungsangebote nötig<br />
Wie die Analyse weiter zeigt, stehen die gemeindenahen<br />
Akutstationen inzwischen gut gefügt in der Kette mit den<br />
anderen ipw-Angeboten, zum Beispiel dem Kriseninter-<br />
ventionszentrum, der Tagesklinik und den ambulanten<br />
Angeboten, insbesondere auch dem psychiatrischen Case<br />
Management. Die Akutbehandlungen konzentrieren sich<br />
auf immer kürzere intensive Interventionen und auf schwere<br />
Krankheitszustände. Dank abgestufter Rehabilitations-<br />
settings sind Patienten in gebesserter Verfassung bald<br />
wieder zu Hause. Patienten und Behandelnde finden auch<br />
vermehrt zu guten kooperativen Behandlungswegen.<br />
Deshalb sind Einweisungen gegen den eigenen Willen<br />
(FFE) deutlich gesunken. Viele Patienten veranlassen<br />
selbst die Zuweisung, und die Aus- und Übertritte erfol-<br />
gen häufiger als früher in gegenseitigem Einverständnis.<br />
Und besonders erfreulich: Die Patienten äussern sich zu-<br />
nehmend zufriedener.<br />
Noch sind aber einige Ziele nicht oder nur teilweise er-<br />
reicht. Noch immer gibt es zu viele stationäre Behand-<br />
lungen, und die meisten reissen einen Patienten emp-<br />
findlich aus seinem sozialen Gefüge. Die stabilisierenden<br />
und vorbeugenden Möglichkeiten wirksamer ambu-<br />
lanter und tagesklinischer Settings, auch für andere<br />
Patientengruppen, zum Beispiel mit Suchtproblemen,<br />
sind bei Weitem nicht ausgeschöpft. Zudem gehören zu<br />
einer durchgreifenden gemeindenahen Versorgung fle-<br />
xible aufsuchende Behandlungsangebote, um am Wohn-<br />
ort belasteten Patienten direkt und frühzeitig Hilfe zu<br />
leisten. Die ipw als Programm zur Entwicklung einer<br />
integrierten Versorgung wird solche Verbesserungen im<br />
Auge behalten müssen. Zurzeit konzentriert sie sich auf<br />
ein ausgebautes Case Management, um tragfähige Be-<br />
handlungspfade in der gemeindenahen Versorgung auch<br />
für instabile chronisch Kranke zu ermöglichen.<br />
Dr. med. Andreas Andreae, Ärztlicher Direktor ipw
Plattform Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommission<br />
Die Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommission <strong>Winterthur</strong> (RPK-<br />
Win) bildet eine Plattform für die Koordination und die<br />
Zusammenarbeit aller Dienstleistungserbringer und Be-<br />
troffenen in der <strong>Psychiatrie</strong>region <strong>Winterthur</strong>. Sie stellt<br />
sich in den Dienst einer zeitgemässen psychiatrischen<br />
Versorgung und pflegt den Informationsaustausch dies-<br />
bezüglicher Themen und Fragestellungen in der Region.<br />
Insbesondere bespricht sie Fragen der Kooperation und<br />
Koordination von Leistungserbringern und erarbeitet<br />
Lösungen. Die Kommission setzt sich für ein besseres Ver-<br />
ständnis in der Bevölkerung ein, für Anliegen der psych-<br />
iatrischen Versorgung und der darin tätigen Organisa-<br />
tionen und hilft so, die Stigmatisierung von psychisch<br />
Kranken abzubauen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten<br />
nimmt die RPKWin Aufträge der Gesundheitsdirektion<br />
entgegen und kann von dieser als Konsultativorgan bei-<br />
gezogen werden.<br />
Organisation<br />
Die Mitglieder der Regionalen <strong>Psychiatrie</strong>kommission<br />
<strong>Winterthur</strong> sind Vertreterinnen und Vertreter von Institu-<br />
tionen und Interessengruppen aus dem Kreis der Dienst-<br />
leistungserbringer und der Betroffenen in der Psychia-<br />
trieregion. Sie treffen sich in der Regel zweimal jährlich<br />
zu einer Sitzung. Hier erörtern sie die Versorgungslage,<br />
entscheiden über Projekte und Vorhaben und informie-<br />
ren über Entwicklungen in den einzelnen Organisationen.<br />
Ein leitender Ausschuss koordiniert die Arbeit der Regi-<br />
onalen <strong>Psychiatrie</strong>kommission. Im Jahr <strong>2006</strong> wurde ei-<br />
ne Geschäftsstelle eingerichtet, welche die RPKWin in<br />
ihrer Tätigkeit fachlich und organisatorisch unterstützt.<br />
Die Stelle eruiert den Bedarf an spezifischen Dienstleis-<br />
tungen in der <strong>Psychiatrie</strong>region, bezeichnet Angebots-<br />
lücken und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Ebenso ge-<br />
währleistet sie die Vernetzung mit den Akteuren an der<br />
Versorgungsfront und übernimmt die laufende Kommu-<br />
nikation ins gesamte Netzwerk.<br />
Schwerpunkte<br />
Netzwerkarbeit ist dann wirkungsvoll, wenn es gelingt, ak-<br />
tuelle Themen nicht nur aufzugreifen, sondern auch aktiv<br />
zu bearbeiten. In diesem Sinne führte die Regionale Psychi-<br />
atriekommission bereits zwei Impulstagungen durch: 2004<br />
zur «Migrationspsychiatrie» und <strong>2006</strong> zum Thema «Jun-<br />
ge Erwachsene und <strong>Psychiatrie</strong>». Beide Tagungen waren<br />
gut besucht. Einzelne Themen werden weiterbearbeitet.<br />
So wurde etwa an der ersten Tagung festgestellt, dass es<br />
zwar Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund<br />
gibt, Informationen darüber aber oft fehlen. Daraus ent-<br />
stand der Wunsch nach einer Internetplattform. Eine sol-<br />
che ist nun seit Ende <strong>2006</strong> online. Sie enthält viele wert-<br />
volle Links: www.psychiatrie-winterthur.ch.<br />
Schwerpunktthemen der RPKWin waren in letzter Zeit die<br />
Überprüfung des Bedarfs an psychiatrischer Spitex sowie<br />
an Wohnangeboten für Jugendliche und junge Erwach-<br />
sene mit psychischen Problemen. Wir haben festgestellt,<br />
dass es zwar immer wieder zu Engpässen kommt, eine<br />
Intervention jedoch zurzeit nicht nötig ist. Weiter wurden<br />
offensichtliche Schwachstellen bei der Vermittlung von<br />
Therapieplätzen diskutiert und konkrete Lösungsvor-<br />
schläge erarbeitet. Auch beim Thema Arbeitsintegrati-<br />
on sind wir aktiv und unterstützen die Bestrebungen bei<br />
der interinstitutionellen Zusammenarbeit.<br />
Mit der Regionalen <strong>Psychiatrie</strong>kommission besteht in der<br />
<strong>Psychiatrie</strong>region <strong>Winterthur</strong> eine sinn- und wirkungs-<br />
volle Organisation, die sicherstellt, dass sich die Region<br />
im Sinne des kantonalen <strong>Psychiatrie</strong>konzeptes vernetzt<br />
und integrierend weiterentwickeln kann.<br />
Ernst Schedler, Leiter Soziale Dienste Stadt <strong>Winterthur</strong> und<br />
Präsident Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommission <strong>Winterthur</strong><br />
Ernst Schedler ist Vorsitzender der Regionalen <strong>Psychiatrie</strong><br />
kommission <strong>Winterthur</strong>. Hier wird die Versorgungslage erörtert,<br />
werden Themen aufgegriffen und entsprechende Projekte initiiert.
Stadt <strong>Winterthur</strong> und ipw:<br />
Zusammenarbeit im Feld der Suchtarbeit<br />
10 Suchterkrankungen sind komplexe, komplizierte und häu- Im Bereich der Früherkennung und Frühintervention 11<br />
Dr. med. Toni Berthel: «Die Hilfsmassnahmen für Sucht und<br />
Prävention müssen aufeinander abgestimmt werden.»<br />
fig chronische Erkrankungen. Dabei sehen wir in unseren<br />
Einrichtungen Menschen mit einer Vielzahl von körper-<br />
lichen, psychischen und sozialen Problemen, die für unse-<br />
re Behandlungsstrategien berücksichtigt werden müssen.<br />
Die Arbeit mit Substanzmissbrauchern und -abhängigen,<br />
aber auch die Prävention von solchen Erkrankungen, ist<br />
immer eine komplexe Querschnittsaufgabe. Sie basiert<br />
auf unterschiedlichsten Rechtsgrundlagen und Finanzie-<br />
rungsprinzipien. Es sind hier dadurch eine Vielzahl von<br />
unterschiedlichen Berufskategorien, aber auch staatli-<br />
che, halbstaatliche und private Anbieter in die Hilfestel-<br />
lungen und Interventionen involviert.<br />
Für eine Erfolg versprechende Arbeit mit Menschen mit<br />
Suchtproblemen müssen die Hilfsmassnahmen aufein-<br />
ander abgestimmt sein. In <strong>Winterthur</strong> wird dies seit nun<br />
beinahe vier Jahrzehnten in der beispielhaften Zusam-<br />
menarbeit zwischen Sozialdepartement und der heutigen<br />
<strong>Integrierte</strong>n <strong>Psychiatrie</strong> <strong>Winterthur</strong> erfolgreich praktiziert.<br />
Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen klären<br />
In der Stadt sind die Suchthilfeeinrichtungen zur Haupt-<br />
abteilung «Prävention und Suchthilfe», in der ipw zum<br />
Bereich «Adoleszenz & Sucht» zusammengefasst. In ei-<br />
ner gemeinsamen Geschäftsleitung, bestehend aus dem<br />
Leiter der Sozialen Dienste des Sozialdepartements und<br />
dem Verwaltungsdirektor ipw, wird die «Unternehmens-<br />
strategie» dieser Betriebe festgelegt. Von den Angeboten<br />
wird die Beratungsstelle für Drogenprobleme BSD<br />
seit mehr als dreissig Jahren gemeinsam geführt. Die<br />
<strong>Winterthur</strong>er Fachstelle für Alkoholprobleme WFA und<br />
das Zentrum für heroingestützte Behandlung Ikarus wer-<br />
den von der Stadt betrieben, die Behandlungen jedoch von<br />
der ipw ärztlich geleitet und auch verantwortet. Ebenfalls<br />
in diese Struktur eingebettet sind die Suchtpräventions-<br />
stelle der Stadt und Region <strong>Winterthur</strong> sowie die Wohnan-<br />
gebote der Stadt und die Drogenanlaufstelle.<br />
Bei der Prävention, Behandlung und Therapie sowie der<br />
Überlebenshilfe und Schadenminderung gibt es eine Viel-<br />
zahl von Schnittstellen. Hier müssen Aufgaben, Verant-<br />
wortlichkeiten und Kompetenzen geklärt und die Zusam-<br />
menarbeit definiert werden.<br />
wurden an der Schnittstelle zwischen der städtischen<br />
Suchtprävention und der Beratungsstelle für Jugend-<br />
liche BSJ interessante Ansätze zur Früherkennung von<br />
Suchtproblemen, aber auch von psychischen Leiden ent-<br />
wickelt. Gemeinsam werden beispielsweise in Schulen<br />
Informationen zu Drogen und Fragen des Jugendalters<br />
vermittelt und Kontakte zu Lehrpersonen aufgebaut. Wir<br />
suchen einen unkomplizierten Zugang zu den Jugend-<br />
lichen und versuchen so, die Schwelle zur Inanspruch-<br />
nahme der Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten<br />
zu senken. Junge Menschen mit seelischen Problemen<br />
finden so rasch und leicht fachgerechte Hilfe.<br />
Leerläufe verhindern<br />
Auch die Behandlung von chronisch kranken Abhängigen,<br />
die zusätzlich an psychischen Problemen leiden, wird<br />
durch eine enge Zusammenarbeit verbessert oder teil-<br />
weise erst möglich. In den medizinischen Betrieben BSD<br />
und Ikarus werden die Patienten mit Methadon oder He-<br />
roin substituiert. In den Wohneinrichtungen des Beglei-<br />
teten Wohnens BeWo erhalten sie Wohnraum und wer-<br />
den in ihrer Wohnkompetenz gefördert und unterstützt.<br />
Patient, Betreuer des BeWo und Arzt oder Therapeut der<br />
BSD vereinbaren gemeinsam Ziele, sprechen ihre Auf-<br />
gaben ab, gewährleisten eine adäquate Behandlung und<br />
verhindern so unkoordinierte, ineffiziente und vor allem<br />
teure Leerläufe.<br />
Die Zusammenarbeit in einem solchen strukturierten und<br />
verbindlichen Netzwerk lohnt sich. Patienten erhalten ei-<br />
ne bessere Behandlung, Mitarbeitende erleben sich und<br />
ihre Arbeit als wirksamer, und der Kostenträger bezahlt<br />
weniger für eine gute Leistung.<br />
Dr. med. Toni Berthel, Stv. Ärztlicher Direktor ipw<br />
Co-Leiter Bereich Adoleszenz & Sucht ipw
Wider die Schwellenangst: Klassenbesuche auf der BSJ<br />
12 Die Früherkennung adoleszentenspezifischer Problem- werden muss. Diese praktische Übung und Erfahrung<br />
13<br />
und Störungsentwicklungen gehört zu den Aufgaben der<br />
Beratungsstelle für Jugendliche an der Trollstrasse 18.<br />
In der Umsetzung dieses Auftrages verlangt das vom<br />
Fachteam innovative Massnahmen. Beispielsweise wer-<br />
den sogenannte Komm-Strukturen durch Geh-Struktu-<br />
ren ergänzt und erweitert. Wir wollen damit erreichen,<br />
dass die Jugendlichen ihre Probleme rechtzeitig erken-<br />
nen und aus eigener Initiative den Weg zu uns in die Be-<br />
ratungsstelle finden, um hier die bestehenden Ressour-<br />
cen und Strukturen zu nutzen.<br />
Seit zwei Jahren besuchen uns zum Beispiel alle ersten<br />
Klassen der Kantonsschule Büelrain für jeweils zwei<br />
Stunden. Die Schülerinnen und Schüler lernen in Gross-<br />
und Kleingruppen durch das Gespräch im Plenum auf<br />
eine abwechslungsreiche Art und Weise unsere Stel-<br />
le kennen. Eine Gruppenarbeit erfolgt in den Büros der<br />
Therapeutinnen und Therapeuten; so lernen die jungen<br />
Leute nebenher auch unsere Räumlichkeiten kennen. Die<br />
Gruppenarbeit besteht darin, aus einer Fülle von vorge-<br />
gebenen Kärtchen, auf welchen verschiedene Probleme<br />
von Jugendlichen genannt sind, zum Beispiel Schwierig-<br />
keiten mit den Eltern oder in der Schule, jene Probleme<br />
auszuwählen, mit denen sie nicht in die Beratungsstelle<br />
gehen würden. Diese ausgewählten Karten werden im<br />
Plenum ausgelegt und geben interessanten Gesprächs-<br />
stoff innerhalb der Klasse ab. Diskutiert werden die<br />
Argumente, die für oder auch gegen eine Anmeldung<br />
in der Beratungsstelle sprechen. Daraus ergeben sich<br />
meistens auch die Ressourcen der Schülerinnen und<br />
Schüler: Den einen hilft zum Beispiel ein Gespräch mit<br />
den Eltern oder Kollegen, anderen hilft der Sport, wie-<br />
der andere wählen den Weg zur Beratungsstelle. In der<br />
Diskussion sollen die Betroffenen merken, dass sie mit<br />
all ihren Sorgen und Problemen zu uns in die Beratungs-<br />
stelle kommen können.<br />
Vertrauen und Akzeptanz fördern<br />
In einem zweiten Teil bei den Schülerbesuchen geht es<br />
um Stress. Die Begriffe Distress, also der negative, un-<br />
angenehme Stress, und Eustress, der angenehme, an-<br />
treibende Stress, werden erläutert anhand eines Selbst-<br />
beurteilungsbogens, der unter Zeitdruck ausgefüllt<br />
trägt dazu bei, dass eine aktive Auseinandersetzung<br />
mit dem Umgang von Stress stattfindet. Alle Übungen,<br />
Inputs und Gespräche finden in einer entspannten<br />
Atmosphäre statt.<br />
Die sieben bis neun Klassenbesuche werden bei uns von<br />
zwei Therapeuten beider Geschlechter betreut. Für uns<br />
ist diese Arbeit zwar mit einem gewissen Aufwand ver-<br />
bunden, der sich aber jederzeit lohnt und hilft, unsere<br />
drei Hauptziele zu erreichen:<br />
Abbau der Schwellenangst: Die Jugendlichen gehen aus<br />
unserer Beratungsstelle mit einem guten Gefühl. Die<br />
Chance erhöht sich, dass sie, im Falle einer eigenen Kri-<br />
se oder der einer Kollegin oder eines Kollegen, unsere<br />
Stelle aufsuchen.<br />
Vernetzung mit dem Primärerfasser: Die Lehrpersonen<br />
lernen unsere Institution kennen, machen ihre Schüle-<br />
rinnen und Schüler frühzeitig auf unsere Stelle aufmerk-<br />
sam oder melden sich selber, wenn sie bei Schwierigkeiten<br />
mit einem Jugendlichen Beratung brauchen.<br />
Teammitglieder der Beratungsstelle als fachkompetente Be-<br />
rater: Die Jugendlichen können auch dann vorbeikommen,<br />
wenn sie zum Beispiel eine Arbeit zu einem jugendspezi-<br />
fischen Thema schreiben müssen. Die Lehrpersonen ziehen<br />
uns als Referenten bei Projekttagen und -wochen bei.<br />
Bereits nach zweimaligem Durchführen dieses «Besuchs-<br />
marathons» der ersten Gymi-Klassen hat sich gezeigt,<br />
dass sich sowohl die Jugendlichen selber wie auch die<br />
Lehrpersonen vermehrt bei uns melden. Es scheint uns<br />
gelungen zu sein, bei beiden Zielgruppen Vertrauen und<br />
Akzeptanz aufzubauen.<br />
Carina Galli,<br />
Angebotsleiterin Beratungsstelle für Jugendliche BSJ<br />
Christine Gäumann,<br />
Co-Leiterin Bereich Adoleszenz & Sucht ipw<br />
Carina Galli & Christine Gäumann<br />
Bauen Kontakte zu den Lehrpersonen auf: Christine Gäumann (l.)<br />
und Carina Galli beim Schulhaus Büelrain in <strong>Winterthur</strong>.
Der Sozialdienst ipw: Schnittpunkt Gemeinde<br />
1 Der Sozialdienst ipw arbeitet in der Gemeinde auf zwei untereinander, zum andern jedoch Problem- und Frage- 1<br />
Anna Wurst ist für den Sozialdienst ipw oft unterwegs<br />
bei den Behörden.<br />
Ebenen. Der klassische Fall ist die Zusammenarbeit mit<br />
verschiedenen Dienstleistern, wie zum Beispiel Spitex,<br />
Haushilfe, Mahlzeitendienst, psychiatrischer Spitex, Pro<br />
Senectute, Wohnberatung, Beratungsstellen etc. – dann,<br />
wenn es um einen Patienten geht. Ein (vereinfachtes) Bei-<br />
spiel aus der Gerontopsychiatrie: Frau H. meldet sich bei<br />
der Sozialarbeiterin des Gerontopsychiatrischen Ambu-<br />
latoriums und der Tagsklinik GAT. Sie macht sich grosse<br />
Sorgen um ihren Vater, Herrn S. Dieser lebe immer iso-<br />
lierter, verlasse die Wohnung immer seltener, gehe nicht<br />
mehr einkaufen, und nur sie, die Tochter, helfe dem Vater.<br />
Sie ist nun am Rand ihrer Kräfte und weiss nicht mehr<br />
weiter.<br />
Zusammen mit dem ärztlichen Dienst der ipw besuchen<br />
wir Herrn S. Sein Wunsch ist es, so lange wie möglich in<br />
seiner Wohnung leben zu können. Wir beschliessen ge-<br />
meinsam, als ersten Schritt die «Haushilfe» zu organi-<br />
sieren, um ihn im Haushalt zu unterstützen. Da Herrn S.<br />
auch die Regelung seiner Finanzen und Administration<br />
immer schwerer fällt, wird ein weiterer Termin mit der<br />
Sozialarbeiterin abgemacht, bei dem es dann um die Klä-<br />
rung dieser Fragen gehen soll. Beim zweiten Treffen er-<br />
klärt sich Herr S. schliesslich für einen dritten Termin<br />
mit einer Mitarbeiterin der Pro Senectute bereit, welche<br />
Treuhanddienste anbietet. Parallel dazu versuchen wir<br />
Herrn S. zu motivieren, sich in eine gerontopsychiatrische<br />
Behandlung zu begeben.<br />
Lebenssituation und Lebensbedingungen verbessern<br />
Die individuelle Lebenssituation von Herrn S. kann ver-<br />
bessert werden, indem ihm dort Unterstützung ange-<br />
boten wird, wo er sie annehmen kann. Auch die Tochter<br />
wird dadurch entlastet. So kann die Sozialarbeiterin mit<br />
Herrn S. erste Kontakte zu anderen Institutionen knüpfen,<br />
die dann ihrerseits, je nach Bedarf, weitere Dienste in-<br />
volvieren werden.<br />
Auf interinstitutioneller Ebene arbeitet der Sozialdienst<br />
der Gerontopsychiatrie ipw in der Fachgruppe des Al-<br />
tersforums der Stadt <strong>Winterthur</strong> mit. Hier vernetzen sich<br />
Mitarbeitende sämtlicher im Altersbereich tätigen Insti-<br />
tutionen. Themen sind zum einen die Zusammenarbeit<br />
stellungen älterer Menschen in <strong>Winterthur</strong>. Erkennen die<br />
Mitglieder der Fachgruppe besondere Versorgungslücken,<br />
können Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich aus Ver-<br />
treterinnen und Vertretern der verschiedenen Dienstleis-<br />
tungsstellen zusammensetzen. So wurde zum Beispiel,<br />
ausgehend von immer wiederkehrenden Schwierigkeiten<br />
in der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, das<br />
Konzept ZIA (Zusammenarbeit der Institutionen im Al-<br />
tersbereich) entwickelt. Dank dieses ZIA-Konzeptes kön-<br />
nen wir bei Fragestellungen rund um alte Menschen mit<br />
komplexen sozialen und gesundheitlichen Problemen viel<br />
schneller und gezielter reagieren.<br />
Auf Patientenebene zielt die Arbeit des Sozialdienstes<br />
auf eine Verbesserung der individuellen Lebenssituati-<br />
on. Auf der interinstitutionellen Ebene dagegen geht es<br />
um generelle Verbesserungen der Lebensbedingungen.<br />
Damit haben beide Ebenen das Ziel, die «soziale Inte-<br />
gration» von Menschen in ihrem Lebensumfeld, der Ge-<br />
meinde, zu fördern.<br />
Anna Wurst, Teamleiterin Sozialdienst ipw
Hier treffen sich <strong>Psychiatrie</strong>, Medizin und Sozialarbeit:<br />
Das Forum für Sozialpsychiatrie Effretikon<br />
1 hinter dem Namen zu sehen, ist für die alltägliche<br />
1<br />
Die Vernetzung zwischen Sozial- und Gesundheitswesen<br />
muss aktiv und systematisch gepflegt werden, damit sich<br />
ein integratives Verständnis und Handeln in der Ver-<br />
sorgung psychisch erkrankter Menschen entwickeln<br />
können. Das Forum für Sozialpsychiatrie Effretikon ist<br />
ein solcher Vernetzungsort.<br />
Um die Vernetzung der Fachstellen und Fachgruppen<br />
und die Förderung der Zusammenarbeit geht es in den<br />
beiden von der Koordinations- und Beratungsstelle ipw<br />
moderierten Foren für Sozialpsychiatrie – das eine in<br />
<strong>Winterthur</strong>, das andere in Effretikon. Die in den Foren<br />
vertretenen Fachpersonen aus Sozial- und Gesundheits-<br />
wesen treffen sich viermal pro Jahr. Sie tauschen sich<br />
über aktuelle Entwicklungen, Fach- und Bedarfsfragen<br />
in der Versorgung psychisch kranker Menschen aus. Im<br />
letzten Jahr behandelte das Gremium in Effretikon unter<br />
anderen die Themen Arbeitsintegration, Angebote der IV<br />
und Beihilfe zum Suizid. Bei Versorgungslücken ist die<br />
Regionale <strong>Psychiatrie</strong>kommission <strong>Winterthur</strong> ein wich-<br />
tiger Ansprechpartner.<br />
Sibylle Schröder<br />
Sibylle Schröder, Leiterin Forum für Sozialpsychiatrie<br />
Effretikon, Leiterin Soziales & Netzwerk ipw<br />
Andreas Fehlmann, Beratungs- und Sozialdienst<br />
Reformierte Kirchgemeinde Effretikon<br />
Die ipw habe ich über Yvonne Hänni von der Koor-<br />
dinations- und Beratungsstelle kennengelernt. Sie<br />
fragte mich damals, ob ich bei ihrem Projekt für<br />
den 10. Oktober, «Tag des psychisch kranken Men-<br />
schen», mitmachen möchte. Ich sagte gerne zu<br />
und half beratend und praktisch am Anlass mit.<br />
Seitdem stehe ich mit der ipw in Kontakt. Dank ihr<br />
haben wir heute das Forum für Sozialpsychiatrie<br />
Effretikon – für mich eine wichtige Drehscheibe<br />
für den Informationsaustausch aus den Bereichen<br />
<strong>Psychiatrie</strong>, Medizin und Sozialarbeit.<br />
Neben der Vernetzungsarbeit und der Fachkompe-<br />
tenz, die ich als Chance und Stärke betrachte, sehe<br />
ich jedoch in der zunehmenden Professionalisierung<br />
auch die Gefahr, dass der einzelne Mensch als Kli-<br />
ent mit seinen Anliegen und Bedürfnissen zuneh-<br />
mend in der Menge untergeht und immer weniger<br />
einzeln angeschaut werden kann.<br />
Andreas Fehlmann<br />
Olé Fabech, Stellenleiter Schweizerisches<br />
Arbeiterhilfswerk – Integro<br />
Die Bearbeitung von gemeinsamen Themen durch<br />
das Forum ermöglicht, dass sehr unterschiedliche<br />
Angebote aufeinandertreffen. Miteinander zu spre-<br />
chen, sich kennenzulernen und einmal das Gesicht<br />
Arbeit sehr wichtig.<br />
Die Leitung des Forums fand eine ausgeglichene<br />
Balance zwischen den lokalen Bedürfnissen und der<br />
Motivation zur aktiven Teilnahme im Forum. Fach-<br />
referate, Diskussionen und Gruppenarbeiten ermög-<br />
lichen einen breiten und fundierten Austausch, der<br />
wohl ohne das Forum nicht stattfinden würde.<br />
Andreas Risch, Betriebsleiter Spitex-Zentrum<br />
Illnau-Effretikon<br />
Das Forum für Sozialpsychiatrie ist eine gute Platt-<br />
form, um sich gegenseitig kennenzulernen. Die<br />
Spitex erhält an diesem Forum vielseitige Infor-<br />
mationen über Angebot und Entwicklung der ipw.<br />
Eine vernetzte Zusammenarbeit kann dadurch ge-<br />
fördert werden.<br />
Das Spitex-Leistungsangebot ist weniger differen-<br />
ziert als das Informationsangebot der ipw. Um dieses<br />
Angebot zum Nutzen unserer Klienten anwenden zu<br />
können, müssten wir zusätzlich ein psychiatrisches<br />
Betreuungskonzept erarbeiten.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen der Spitex und der<br />
ambulanten Betreuung in der ipw funktioniert gut.<br />
Was uns fehlt, ist ein Angebot der ipw, das bei der<br />
häuslichen Betreuung von Klienten, die nicht in Be-<br />
handlung bei der ipw sind, beratende Hilfeleistung<br />
bietet.<br />
Olé Fabech<br />
Urs Gröbli, Abteilungsleiter Fürsorge,<br />
Sozialamt Effretikon<br />
Ich schätze die Zusammenarbeit mit den vielen ver-<br />
schiedenen ipw-Stellen. Es ist spürbar, dass die Mit-<br />
arbeitenden der ipw versuchen, transparent und part-<br />
nerorientiert zu arbeiten. So denken sie sich auch in<br />
unsere Aufgaben und Funktionen hinein. Kurz: Case<br />
Management ist bei der ipw keine Floskel!<br />
Am Forum in Effretikon finde ich den informellen<br />
Kontakt und den (Fach-)Austausch mit den Tätigen<br />
in unserem Einzugsgebiet gut und wertvoll. Ebenso<br />
wichtig für mich ist die Vermittlung von Informati-<br />
onen, zum Beispiel über die ipw-Angebote, die für<br />
das gute Gelingen der Zusammenarbeit wesent-<br />
lich ist.<br />
Urs Gröbli<br />
Dr. med. Robert Knecht, Facharzt für <strong>Psychiatrie</strong><br />
und Psychotherapie<br />
Ich bin froh, dass die ipw hier in der Peripherie die<br />
Aufgaben erfüllt und dass ich mich auf deren Mit-<br />
arbeitende verlassen kann. Ich habe den Eindruck,<br />
dass hier eine gute Art von Konzentrations- und<br />
Koordinationsarbeit geleistet wird.<br />
Andreas Risch
052 224 33 99<br />
1 8:00 Uhr morgens. Das Triagehandy klingelt. Auf dem Dis- Engagement und Improvisationsdenken<br />
1<br />
play erscheint «Klinik Schlosstal». Die Stimme einer un-<br />
serer Mitarbeiterinnen an der ipw-Telefonzentrale kün-<br />
det den Arbeitstag an: «Guten Morgen. Sie haben heute<br />
den Triagedienst. Das Telefon ist auf Sie umgeschaltet.»<br />
Man trifft die letzten Vorbereitungen, holt die Triage-<br />
mappe und informiert sich im kantonalen Bettenspiegel<br />
via Internet über die aktuelle Bettensituation. Die ersten<br />
Telefonate kommen herein.<br />
Mit dem Triagetelefon für die niedergelassenen Ärztinnen<br />
und Ärzte in der <strong>Psychiatrie</strong>region <strong>Winterthur</strong> wollen wir<br />
die stationäre Akutpsychiatrie so gut es geht entlasten.<br />
Entstanden ist diese Stelle, weil man erkannt hat, dass<br />
ein beträchtlicher Teil der Patientinnen und Patienten bei<br />
einer Ersteinweisung nicht korrekt zugewiesen wird. Oft<br />
wurden diese mit den unterschiedlichsten Diagnosen in<br />
die Akutpsychiatrie eingewiesen, obwohl man mit etwas<br />
mehr Aufwand bei der Abklärung diverse stationäre Auf-<br />
enthalte hätte verhindern können.<br />
Einfacheres Einweisungsprozedere<br />
Die Zuweisenden suchen unter 052 224 33 99 vorwiegend<br />
kurzfristige Beratungen und adäquate Platzierungsmög-<br />
lichkeiten. Allgemeine Fragen können wir meistens an un-<br />
sere Teilinstitutionen weiterleiten. Ist die Situation unklar,<br />
beurteilen wir die Lage aufgrund eines Abklärungs-<br />
gespräches. Manchmal müssen wir jemanden akut ent-<br />
lasten, zum Beispiel, weil eine familiäre Situation eskaliert.<br />
Dann werden die Betroffenen ins Kriseninterventions-<br />
zentrum gebeten, wo vielleicht durch ein Paar- oder Fa-<br />
miliengespräch erste Wogen geglättet werden. Oft reicht<br />
es auch, einen ambulanten Termin zu vereinbaren, oder<br />
es ist offensichtlich, dass der Patient in die Klinik muss.<br />
Bei prekärer Bettenlage in unserer Region organisieren<br />
wir zum Teil eine ausserregionale Hospitalisierung. Nach<br />
unserem Rückruf braucht der Arzt meist nur noch ein Zu-<br />
weisungsschreiben zu verfassen und dem Patienten zu<br />
sagen, wie es weitergeht. Neben einer Vereinfachung des<br />
Einweisungsprozederes ermöglicht die Dienstleistung der<br />
Triage dem Arzt auch ein kompetentes Auftreten nach aus-<br />
sen. Zudem sparen wir Kosten, wenn ein Patient gleich<br />
zu Beginn an die richtige Stelle verwiesen wird.<br />
Das ipw-Triageteam, bestehend aus sechs Oberärztinnen<br />
und -ärzten, sucht stets nach individuellen Lösungen. Es<br />
ist uns ein Anliegen, mit dieser Dienstleistung die Struk-<br />
turen in der <strong>Psychiatrie</strong> für die Niedergelassenen trans-<br />
parenter zu machen, damit man sich darin rascher orien-<br />
tieren kann. Die Triageärzte fangen so oft auch den Frust<br />
ab, den der Arzt oder die Ärztin gelegentlich bei der Suche<br />
nach der richtigen Stelle für seine Klienten erfährt.<br />
Die Triagierung der Anrufe ist für uns eine nebenamt-<br />
liche Aufgabe. Innerhalb der ipw tragen alle Triageärzte<br />
mehrere Hüte. Wir müssen die manchmal sehr komplexe<br />
Problematik durch gezielte Fragen schnell einschätzen<br />
können. Des Weiteren braucht es neben Fachkompetenz<br />
viel Engagement, einen offenen Geist, Anpassungsfähig-<br />
keit und Improvisationsdenken.<br />
Dr. med. Jasminka Cvetanovic, Oberärztin ipw Triage<br />
Dr. med. Jasminka Cvetanovic während des Triagediensts.
Die aufsuchende Hilfe in der Alterspsychiatrie<br />
20 Mit dem Gerontopsychiatrischen Ambulatorium und der Vertrauen von Frau M. und ihrem Mann zu gewinnen. Mit 21<br />
Johannes Irsiegler<br />
Dr. med. Johannes Irsiegler bei einem Hausbesuch.<br />
Tagesklinik GAT besteht im Raum <strong>Winterthur</strong> bereits seit<br />
vielen Jahren ein gut integriertes und geschätztes Ange-<br />
bot für ältere Menschen mit psychischen Problemen. Das<br />
GAT stützt sich bei der Behandlung seiner Patienten auf<br />
drei Säulen: die Tagesklinik, das Ambulatorium und die<br />
aufsuchende Hilfe in Form der Mobilen Equipe und des<br />
Konsiliar- und Liaisonpsychiatrischen Dienstes. Gerade<br />
in der Altersarbeit ist es wichtig, als bedürfnisorientierte<br />
Institution die Möglichkeit der aufsuchenden Hilfe anzu-<br />
bieten. Diese ist seit Langem in unserem Behandlungs-<br />
konzept integriert. Mobile Equipe meint hierbei die Hilfe<br />
für betagte Menschen mit umfassenden psychosozialen<br />
Problematiken. Mindestens zwei Personen aus unserem<br />
interdisziplinären Team besuchen dabei den Patienten in<br />
seinem vertrauten Wohnumfeld, beurteilen die Situation<br />
und klären ab, welche weiteren Massnahmen getroffen<br />
werden müssen. Der Konsiliar- und Liaisonpsychiatrische<br />
Dienst ist eine fachärztliche Beurteilung oder Behandlung<br />
eines Patienten im Auftrag des behandelnden Arztes. Die<br />
aufsuchende Hilfe ist ein gefragtes Angebot: So fanden<br />
im Jahr <strong>2006</strong> 13 Einsätze der Mobilen Equipe und 116 Ein-<br />
sätze des Konsiliar- und Liaisonpsychiatrischen Diens-<br />
tes statt. Einsatzorte waren <strong>Winterthur</strong> und das gesamte<br />
Zürcher Weinland.<br />
Einschätzung aus unterschiedlichen Perspektiven<br />
Folgendes Beispiel soll die Arbeitsweise der Mobilen<br />
Equipe erläutern: Frau M., eine betagte Frau, die alleine<br />
in einer kleinen Wohnung lebt, geht seit geraumer Zeit<br />
nicht mehr vor die Türe. Mit ihrem Mann hat sie Streit,<br />
einen festen Hausarzt hat sie seit Jahren nicht mehr. In<br />
dieser Situation wendet sich der Sohn an eine städtische<br />
Beratungsstelle und ersucht dort um Hilfe. Von dort er-<br />
folgt nach einer ersten Abklärung die Anfrage an uns,<br />
ob wir Frau M. einen Besuch abstatten könnten, um uns<br />
ein Bild über die Situation zu machen. Frau M. wird vor-<br />
gängig telefonisch kontaktiert. Sie ist mit einem Besuch<br />
einverstanden. Der Besuch erfolgt durch einen Arzt und<br />
eine Pflegekraft. Wir fanden bei ihr zu Hause eine kom-<br />
plex schwierige psychosoziale Situation vor. Dass zwei<br />
Fachpersonen diese aus unterschiedlichen beruflichen<br />
Perspektiven beobachten und einschätzen können, ist<br />
hierbei äusserst wertvoll. Zunächst geht es darum, das<br />
der Zeit wird es möglich, Frau M. in unser Ambulatorium<br />
einzuladen. Wir können sie begleiten, sie schliesslich mit<br />
einem Hausarzt bekannt machen und vormundschaft-<br />
liche Hilfen in die Wege leiten. Die enge Kooperation im<br />
interdisziplinären Team ist dabei eine unerlässliche Vor-<br />
aussetzung für fachliche Qualität. Ebenso die gute Zu-<br />
sammenarbeit mit den verschiedenen professionellen<br />
und freiwilligen Betreuungsangeboten für betagte Men-<br />
schen in <strong>Winterthur</strong>.<br />
Schulung für Professionelle und Freiwillige<br />
Zur Förderung der Vernetzung in diesem Sinne bietet<br />
das GAT auch Schulungen zu Problemfeldern aus dem<br />
Bereich der Alterspsychiatrie an. Im letzten Jahr fanden<br />
drei solche Veranstaltungen für professionelle und frei-<br />
willige Helfer statt, zwei in <strong>Winterthur</strong> und eine in einer<br />
Weinländer Gemeinde. Beide Veranstaltungen waren gut<br />
besucht, und der gegenseitige Austausch trug wiederum<br />
dazu bei, die Zusammenarbeit weiter zu festigen.<br />
Dr. med. Johannes Irsiegler, Oberarzt<br />
Gerontopsychiatrisches Ambulatorium und Tagesklinik GAT
ipw Streiflichter <strong>2006</strong><br />
22 Ambulanz & Krise<br />
23<br />
Mit einem Tag der offenen Tür hat das Kriseninterven-<br />
tionszentrum KIZ am 4. November sein fünfjähriges Be-<br />
stehen gefeiert. Interessierte hatten Gelegenheit, durch<br />
Betriebsführungen, Informationen über das Angebot, Üben<br />
von Stressbewältigungstechniken und Kurzvorträge das<br />
KIZ und seine Mitarbeitenden kennenzulernen.<br />
Die Tagesklinik im Gemeindepsychiatrischen Zentrum GEZ<br />
an der Rudolfstrasse hat am 1. Oktober ihren Betrieb als<br />
Akuttagesklinik nach einem neuen Konzept eröffnet. Die<br />
Akuttagesklinik bietet von den zwanzig Plätzen neu zehn<br />
Plätze für Akutbehandlungen und zehn Plätze für Psycho-<br />
therapie / Rehabilitation an. Zudem wurde das gruppenthe-<br />
rapeutische Programm um diverse störungsspezifische<br />
Therapiegruppen erweitert, welche für den Patienten mo-<br />
dulartig zusammengesetzt werden können.<br />
Adoleszenz & Sucht<br />
Im Sommer <strong>2006</strong> startete die Spezialsprechstunde «Can-<br />
nabis» in der Beratungsstelle für Drogenprobleme. Unter<br />
dem Motto «Zu viel des Guten» versteht sich das Ange-<br />
bot als Früherkennungsprogramm für Jugendliche und<br />
junge Erwachsene mit problematischem Cannabiskon-<br />
sum. Analog zum Programm Cannabis wurde eine Alko-<br />
holsprechstunde entwickelt.<br />
Die Beratungsstelle für Jugendliche BSJ und die Bera-<br />
tungsstelle für Drogenprobleme BSD entwickelten ein<br />
Abklärungs- und Behandlungsprogramm für ADHS (Auf-<br />
merksamkeits-Defizit- und Hyperaktivitäts-Störung) für<br />
Jugendliche und Erwachsene.<br />
Die Stadt <strong>Winterthur</strong> erarbeitete in Kooperation mit den<br />
Bezirksgemeinden und der ipw im <strong>2006</strong> ein suchtpoli-<br />
tisches Strategiekonzept für die Jahre 2007 bis 2011. In<br />
der Projektsteuerungsgruppe ist die Direktion der ipw<br />
und in der Projektarbeitsgruppe die Bereichsleitung des<br />
Bereichs Adoleszenz & Sucht vertreten.<br />
Erwachsenenpsychiatrie<br />
Am 1. Juni haben die ursprünglich geschlossenen Akut-<br />
stationen B und C mit der Teilöffnung der Türen begonnen.<br />
Eine Auswertung über sieben Monate hat gezeigt, dass<br />
beide Stationen während rund zwei Drittel der Zeit ge-<br />
öffnet geführt werden konnten. Die Öffnung stiess prak-<br />
tisch überall auf grosse Akzeptanz.<br />
Schwerpunkt <strong>2006</strong> in der Psychotherapiestation Villa<br />
war die Ausdifferenzierung des therapeutischen Ange-<br />
botes durch eine individuellere, altersangepasste Be-<br />
handlung und eine aktivere Begleitung des familiären<br />
Umfeldes der Patienten. In der Villa zeigte sich eine Zu-<br />
nahme der Bettenbelegung um zehn Prozent. Fast wich-<br />
tiger ist aber, dass die Zielgruppe – junge Erwachsene –<br />
besser erreicht wurde.<br />
Gerontopsychiatrie<br />
Im Dezember startete die ipw ein gemeinsames For-<br />
schungsprojekt mit dem Lehrstuhl Gerontopsychologie<br />
von Prof. Dr. Mike Martin und dem Lehrstuhl Sozial- und<br />
Gesundheitspsychologie von Prof. Dr. Rainer Hornung von<br />
der Universität Zürich. Thema des Forschungsprojekts:<br />
«Dyadischer Austausch und Wohlbefinden lang verhei-<br />
rateter Paare, bei denen der Ehemann an Demenz er-<br />
krankt ist.»<br />
Im Juli wurde von der FMH der Schwerpunkt «Geronto-<br />
psychiatrie» eingeführt. Hierbei wurde der Bereich Ge-<br />
rontopsychiatrie der ipw, unter der Leitung von Dr. med.<br />
Jacqueline Minder, als Schwerpunkt-Weiterbildungsstät-<br />
te anerkannt.<br />
Im Rahmen eines Teaching / Coaching-Auftrages des<br />
Sozialpsychiatrischen Forums <strong>Winterthur</strong> wurden im<br />
Jahr <strong>2006</strong> rund 130 Mitarbeitende der Spitex in der Region<br />
Zürich für den psychiatrischen Notfall geschult. Ebenso<br />
wurden fünf interne und zwanzig Pflegende aus anderen<br />
Institutionen in einem Grundkurs in Gerontopsychiatrie<br />
erfolgreich weitergebildet.<br />
Ärztliche Direktion<br />
Der Beitrag «Intensive Case Management im Modellpro-<br />
jekt <strong>Integrierte</strong> <strong>Psychiatrie</strong> <strong>Winterthur</strong>: Evaluation eines<br />
3-jährigen Pilotversuches» – in Form eines Posters –<br />
wurde am Jahreskongress <strong>2006</strong> der Schweizerischen<br />
Gesellschaft für <strong>Psychiatrie</strong> und Psychotherapie (SGPP)<br />
in Biel mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Dieselbe Arbeit<br />
hatte bereits 2005 am Jahreskongress der Deutschen<br />
Gesellschaft für <strong>Psychiatrie</strong>, Psychotherapie und Nerven-<br />
heilkunde (DGPPN) in Berlin den 2. Preis erhalten. Dort<br />
wurde er unter 430 Arbeiten vergeben.<br />
Pflege<br />
Im Rahmen der veränderten Ausbildungsverfahren bei<br />
den Pflegeberufen eröffnete die ipw am 20. Februar in<br />
den Räumlichkeiten der Klinik Schlosstal eine Lernwerk-<br />
statt. Hier können die Lernenden /Studierenden in einem<br />
geschützten Rahmen pflegerisches Handeln üben, reflek-<br />
tieren und verschiedene Lösungsmöglichkeiten erproben.<br />
Die Infrastruktur der Lernwerkstatt dient zudem der Fort-<br />
bildung von ipw-Mitarbeitenden aus allen Berufen.<br />
Im Sinne der innerbetrieblichen Vernetzung führte die ipw<br />
unter der Leitung des Pflegedienstes am 29. November<br />
mit grossem Erfolg einen ersten Mitarbeitertag durch. Ziel<br />
war, bei den Mitarbeitenden durch Fachvorträge, Kaffee-<br />
Gesprächsrunden mit Geschäftsleitungsmitgliedern und<br />
diversen Workshops das Verständnis für die Arbeit der an-<br />
deren Berufsgruppen zu sensibilisieren bzw. die berufliche<br />
und zwischenmenschliche Vernetzung zu fördern.<br />
Zum internationalen UNO-Tag der Freiwilligen am 5. De-<br />
zember veranstaltete die Pflege ipw in Zusammenarbeit<br />
mit dem <strong>Psychiatrie</strong>verbund <strong>Winterthur</strong> und Zürcher Un-<br />
terland, mit Fachleuten und Freiwilligen ein Forum zum<br />
Thema «Die gesellschaftliche Stellung der Freiwilligen-<br />
arbeit in der Schweiz».<br />
Management & Logistik<br />
Für den <strong>Psychiatrie</strong>verbund Zürich und <strong>Winterthur</strong> Un-<br />
terland PVZ (<strong>Psychiatrie</strong>zentren Hard und Rheinau, ipw)<br />
wurde per 1. Juli eine offizielle Geschäftsstelle geschaffen.<br />
Die Zusammenarbeit der Verbundskliniken soll dadurch<br />
intensiviert und die Effizienz der einzelnen Häuser durch<br />
die sinnvolle Nutzung von Synergien gesteigert werden.<br />
Der Sitz der Geschäftsstelle ist in der Klinik Schlosstal.<br />
Am 3. April wurde in den Restaurants der Klinik Schloss-<br />
tal ein neues Kassensystem zur bargeldlosen Bezahlung<br />
der Konsumationen eingeführt. Im Vorfeld erhielten al-<br />
le ipw-Mitarbeitenden einen Personalausweis, welcher<br />
nicht nur zur Identifikation, sondern gleichzeitig als Zah-<br />
lungsmittel, in Form einer aufladbaren Kreditkarte, und<br />
als Zutrittsberechtigung zu elektronisch abgesicherten<br />
Türen dient.<br />
Die ipw ist seit dem 3. April rauchfrei. Der Verkauf von<br />
Tabakwaren am Kiosk der Klinik Schlosstal in Wülflin-<br />
gen wurde konsequenterweise eingestellt. Für die Pati-<br />
entinnen und Patienten steht auf den Stationen weiterhin<br />
ein Raucherzimmer zur Verfügung.<br />
Das SAP-Teilmodul IS-H wurde per 1. Januar <strong>2006</strong> ope-<br />
rativ in Betrieb genommen. Die Software beinhaltet die<br />
Grundlagen für eine benutzerfreundliche Erhebung und<br />
Erfassung aller relevanten Patienten- und Falldaten. Zu-<br />
dem dient es der Vereinfachung bei der Hinterlegung von<br />
neuen Tarifen und macht eine bessere Überwachung von<br />
Kostengutsprachen möglich. Das Modul mit den komple-<br />
xen Anwendungsmöglichkeiten stellte bei der Einführung<br />
hohe Ansprüche an alle Beteiligten.
Kennzahlen <strong>2006</strong><br />
Stationäre Behandlung<br />
2 2<br />
Bereich Austritte Pflegetage<br />
Austritte (Fälle) nach Regionen<br />
Region Anzahl in %<br />
<strong>Winterthur</strong> 1‘309 80.7<br />
Zürich 75 4.6<br />
Unterland 127 7.9<br />
Oberland 62 3.8<br />
Horgen 16 1.0<br />
Kanton Zürich 1589 98.0<br />
Übrige Schweiz 31 1.9<br />
Ausland 2 0.1<br />
Total 1‘622 100.0<br />
Bettenbestand<br />
Bettenbelegung<br />
in %<br />
Durchschnittliche<br />
Aufenthaltsdauer<br />
in Tagen<br />
Erwachsenenpsychiatrie 698 18‘247 48 104.1 26.1<br />
Kriseninterventionszentrum 523 4‘074 12 93.0 7.8<br />
Psychotherapiestation Villa 43 5‘486 16 93.9 127.6<br />
Gerontopsychiatrie Akut 135 5‘352 14 104.7 39.6<br />
Gerontopsychiatrie Rehabilitation 208 25‘238 72 96.0 121.3<br />
Geriatrische Langzeitpflege 15 1‘035 5 60.3 69.0<br />
Total 1‘622 59‘432 167 97.5 36.7<br />
Teilstationäre Behandlung<br />
Ambulante Behandlung<br />
Austritte Behandlungstage Behandlungsplätze Belegung in %<br />
Akuttagesklinik Erwachsenenpsychiatrie 119 4‘464 20 89.3<br />
Tagesklinik Gerontopsychiatrie 52 2‘583 10 103.3<br />
Total 171 7‘047 30 94.0<br />
Anzahl Konsultationen<br />
Psychiatrische Poliklinik am KSW 3‘947<br />
Kriseninterventionszentrum 499<br />
Ambulatorium Erwachsenenpsychiatrie 5‘378<br />
Ambulatorium Gerontopsychiatrie 1‘340<br />
Beratungsstelle für Jugendliche 2‘593<br />
Psychotherapiestation Villa 22<br />
Beratungsstelle für Drogenprobleme 12‘118<br />
Ikarus: Methadon-Programm 996<br />
Ikarus: Heroin-Programm 2‘691<br />
Konsiliar- und Liaisondienst am KSW 831<br />
<strong>Winterthur</strong>er Fachstelle für Alkoholprobleme 2‘718<br />
Total Konsultationen 33‘133<br />
Anzahl Gutachten<br />
Fachstelle für psychiatrische Gutachten 113
Betriebsrechnung <strong>2006</strong><br />
2 Rechnung <strong>2006</strong> Budget <strong>2006</strong> Rechnung 2005<br />
Frauen Männer Total Davon Davon<br />
Durch- 2<br />
in 1000 CHF<br />
Besoldungen 31‘924 31‘437 34‘421<br />
Sozialleistungen 4‘818 4‘932 5‘182<br />
Arzthonorare 101 41 50<br />
Personalnebenkosten 1‘114 1‘156 1‘337<br />
Personalkosten 37‘957 37‘566 40‘990<br />
Medizinischer Aufwand 1‘532 1‘496 1‘814<br />
Lebensmittelaufwand 1‘587 1‘289 1‘621<br />
Haushaltaufwand 265 352 361<br />
Unterhalt und Reparaturen 1‘362 1‘386 1‘093<br />
Anlagenutzung 6‘571 6‘501 7‘017<br />
Energie und Wasser 613 533 488<br />
Zinsaufwand auf Umlaufvermögen 537 527 602<br />
Verwaltungs- und Informatikaufwand 1‘358 1‘607 1‘555<br />
Übriger patientenbezogener Aufwand 2‘699 2‘575 0<br />
Entsorgung 0 0 54<br />
Übriger Betriebsaufwand 187 155 3‘185<br />
Einlagen in Rücklagen 43 0 69<br />
Sachkosten 16‘754 16‘421 17‘859<br />
Total Aufwand 54‘711 53‘987 58‘849<br />
Erträge aus med., pfleg. und therap. Leistungen 13‘781 17‘901 14‘387<br />
Erträge Arzthonorare, Gutachten, Zeugnisse 487 37 100<br />
Übrige Spitaleinzelleistungen 0 0 611<br />
Wertberichtigungen – 209 – 7 0<br />
Erträge aus Leistungen am Patienten 208 415 146<br />
Erträge aus Poli- und Tageskliniken 6‘242 0 6‘056<br />
Miet- und Kapitalzinsertrag 83 127 292<br />
Erträge aus Leistungen an Personal / Dritte 2‘400 2‘278 1‘972<br />
Total Ertrag 22‘992 20‘751 23‘564<br />
Betriebsergebnis (Kantonsbeitrag) – 31‘719 – 33‘236 – 35‘285<br />
Kostendeckung 42% 38% 40%<br />
Investitionsrechnung 1‘561 2‘065 4‘940<br />
Personalstatistik <strong>2006</strong> Stand 31. Dezember <strong>2006</strong><br />
Ausländer<br />
Frauen und<br />
Männer<br />
Personal<br />
in<br />
Ausbildung<br />
schnittlicherPersonalbestand<br />
<strong>2006</strong><br />
Ärztlicher Direktor, Leitende Ärztinnen u. Ärzte 1 5 6 2 – 5.8<br />
Oberärztinnen und -ärzte 9 9 18 5 – 14.5<br />
Spitalärztinnen und -ärzte – 1 1 1 – 0.6<br />
Assistenzärztinnen und -ärzte 18 16 34 20 – 31.0<br />
Psychologinnen / Psychologen 24 7 31 5 10 23.4<br />
Kader Pflegebereich 12 6 18 5 – 18.4<br />
Dipl. Pflegefachfrauen / -männer 94 35 129 53 2 111.3<br />
Pflegefachfrauen / -männer DN I 21 3 24 7 16 19.9<br />
Pflegeassistentinnen und -assistenten 3 – 3 – – 3.6<br />
Pflegerisches Hilfspersonal 3 2 5 2 1 4.8<br />
Labor / Röntgen / Apotheke 2 – 2 – – 1.3<br />
Physio- und Bewegungstherapie 8 4 12 3 3 9.3<br />
Ergo- und Kunsttherapie 11 1 12 2 – 8.2<br />
Medizinische Sekretariate 19 – 19 – – 12.2<br />
Sozialdienst 12 3 15 2 – 12.0<br />
Andere medizinische Fachbereiche 5 1 6 1 1 2.8<br />
Verwaltung 18 12 30 4 1 25.5<br />
Ökonomie / Hausdienst / Transportdienst 38 13 51 27 3 47.5<br />
Technischer Dienst / Gärtnerei 2 17 19 3 3 18.1<br />
Kinderkrippe 5 – 5 1 – 2.7<br />
Gesamtes Personal 305 135 440 143 40 372.9<br />
Anzahl Beschäftigte nach Herkunft<br />
Schweiz 297<br />
Deutschland 61<br />
Österreich 13<br />
Serbien 17<br />
Italien 7<br />
Kroatien 7<br />
Philippinen 6<br />
Finnland 3<br />
Portugal 3<br />
Sri Lanka 3<br />
Bolivien 2<br />
Bosnien-Herzegowina 2<br />
Bulgarien 2<br />
Indien 2<br />
Kosovo 2<br />
Spanien 2<br />
Tschechische Republik 2<br />
Belgien 1<br />
Japan 1<br />
Kuba 1<br />
Mazedonien 1<br />
Niederlande 1<br />
Rumänien 1<br />
Schweden 1<br />
Slowenien 1<br />
Ukraine 1<br />
Total 440
Leitende Mitarbeitende Stand Februar 2007<br />
Hans Dubach, Leiter Pflege, Stv. Bereichsleiter<br />
Andrea Martini, Teamleiterin<br />
Dr. med. Bernadette Ruhwinkel, Oberärztin<br />
Finanzen & Betriebswirtschaft: Ralph Keller<br />
Patientenadministration / Empfang: Verena Maier<br />
Materialwirtschaft / Transportdienst: Beat Götschi<br />
2 Ambulanz & Krise<br />
BSD Beratungsstelle für Drogenprobleme<br />
Thomas Waffenschmidt, Stationsleiter<br />
Techn. Dienst / Gebäudeunterhalt: Walter Seeh<br />
2<br />
Bereichsleitung:<br />
Angebotsleitung:<br />
Ursula Zimiker, Stationsleiterin<br />
Gärtnerei: Alfred Nägeli<br />
Dr. med. Sebastian Haas, Leitender Arzt, Bereichsleiter<br />
Budimir Toskovic, Leiter Pflege, Stv. Bereichsleiter<br />
Dr. med. Michael Braunschweig, Oberarzt<br />
Dr. med. Thomas Heinsius, Oberarzt<br />
Mirjana Kovacevic, Teamleiterin<br />
Dr. Toni Berthel, Stv. Ärztlicher Direktor (Leitung a.i.)<br />
Christine Gäumann, Leitende Sozialarbeiterin<br />
WFA <strong>Winterthur</strong>er Fachstelle für Alkoholprobleme<br />
Kurt Schätti, Betriebsleiter<br />
Dr. med. Gerhard Scheidegger, Oberarzt<br />
GAT Gerontopsych. Ambulatorium & Tagesklinik<br />
Angebotsleitung:<br />
Andrea Martini, Teamleiterin<br />
Dr. med. Johannes Irsiegler, Oberarzt<br />
Dr. med. Katerina Laxdal, Oberärztin<br />
Reinigungsdienst / Wäscheversorgung: Patrizia Gasser<br />
Küchenchef: Lars Leonhardt (Leitung a.i.)<br />
Restauration: Giovanna Demont<br />
Kinderkrippe: Cinzia Catrambone<br />
Ärztliche Direktion<br />
PsychPol Psychiatrische Poliklinik am KSW<br />
Angebotsleitung:<br />
Dr. med. Michèle Abelovsky, Oberärztin<br />
Dr. med. Margaretha Gisler, Oberärztin<br />
Dr. med. Thomas Heinsius, Oberarzt<br />
Ikarus Zentrum für heroin- und methadongestützte<br />
Behandlung<br />
Käti Schneider, Betriebsleiterin<br />
Dr. med. Lucija Babic-Hohnjec, Oberärztin<br />
Peter Elfner, Psychologe<br />
Therapieangebote<br />
Angebotsleitung:<br />
Dr. med. Bernadette Ruhwinkel, Oberärztin<br />
Dominique Schai, Psychologin<br />
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Andreas Andreae<br />
Stv. Ärztlicher Direktor: Dr. med. Toni Berthel<br />
Soziales & Netzwerk<br />
Angebotsleitung: Sibylle Schröder,<br />
Leitende Sozialarbeiterin<br />
Dr. med. Jan Martz, Oberarzt<br />
Erwachsenenpsychiatrie<br />
Markus Halmer, Stationsleiter<br />
Koordinations & Beratungsstelle: Sibylle Schröder<br />
GEZ Gemeindepsychiatrisches Zentrum<br />
Angebotsleitung:<br />
Dr. med. Michael Braunschweig, Oberarzt<br />
Daniela Gamper, Therapeutische Leiterin<br />
Klaus Raupp, Leiter Case Management<br />
Ursula Widmer, Teamleiterin<br />
KIZ Kriseninterventionszentrum<br />
Angebotsleitung:<br />
Mirjana Kovacevic, Teamleiterin<br />
Gregor Harbauer, Therapeutischer Leiter<br />
Dr. med. Jasminka Cvetanovic, Triage-Oberärztin<br />
Bereichsleitung:<br />
Dr. med. Thomas Ihde, Leitender Arzt, Bereichsleiter<br />
Annette Wild, Leiterin Pflege, Stv. Bereichsleiterin<br />
Robert Haberl, Stationsleiter<br />
Dr. med. Benjamin Dubno, Oberarzt<br />
Akutangebote<br />
Angebotsleitung:<br />
Dr. med. Benjamin Dubno, Oberarzt<br />
Annette Wild, Leiterin Pflege<br />
Dr. med. Fabian Alvarez, Oberarzt<br />
Barbara Gressly, Stationsleiterin<br />
Brigitt Meier, Stationsleiterin<br />
Rehabilitationsangebote<br />
Angebotsleitung:<br />
Hans Dubach, Leiter Pflege<br />
Dubravka Mirosavljevic, Stationsleiterin<br />
Ruedi Amsler, Stationsleiter<br />
Anita Brunner, Stv. Leiterin Ergo- & Kunsttherapie<br />
Geschützte Angebote<br />
Angebotsleitung:<br />
Ursula Zimiker, Stationsleiterin<br />
Dr. med. Melanie Huber, Oberärztin<br />
Volker Stief, Psychologe<br />
Sozialdienst: Anna Wurst, Teamleiterin<br />
Case Management Arbeitsintegration: Barbara Koch<br />
Fachstelle für Psychiatrische Gutachten<br />
Leitung: Dr. med. Ulrich Giebeler, Leitender Arzt<br />
Behandlungsevaluation<br />
Leitung: Christopher Schuetz, Leitender Psychologe<br />
Therapien<br />
Physio & Bewegungstherapie: Frank Vroomen<br />
Ergo & Kunsttherapie: Heidi Nolan<br />
Medizinischer Dienst ipw<br />
Adoleszenz & Sucht<br />
Bereichsleitung:<br />
Dr. med. Toni Berthel, Stv. Ärztlicher Direktor,<br />
Co-Bereichsleiter<br />
Christine Gäumann, Leitende Sozialarbeiterin,<br />
Co-Bereichsleiterin<br />
Dr. med. Axel Guntermann, Oberarzt<br />
Dr. med. Gerhard Scheidegger, Oberarzt<br />
Dr. med. Lucija Babic-Hohnjec<br />
BSJ Beratungsstelle für Jugendliche<br />
Angebotsleitung:<br />
DAS Depressions- & Angststation<br />
Angebotsleitung:<br />
Robert Haberl, Stationsleiter<br />
Angela Müller, Psychologin<br />
Martin Huwiler, Sozialarbeiter<br />
Dr. med. Barbara Hernandez, Oberärztin<br />
Villa Psychotherapiestation für junge Erwachsene<br />
Angebotsleitung:<br />
Dr. med. Thomas Ihde, Leitender Arzt (Leitung a.i.)<br />
Gerontopsychiatrie<br />
Assessment & Demenz<br />
Angebotsleitung:<br />
Thomas Waffenschmidt, Stationsleiter<br />
Dr. med. Christian Kandler, Oberarzt<br />
Nicole Fitz, Stationsleiterin<br />
Barbara Rutschmann, Stv. Leiterin Physio-<br />
& Bewegungstherapie<br />
Management & Logistik<br />
Verwaltungsdirektor: Peter Roth<br />
Stv. Verwaltungsdirektorin / HRManagement:<br />
Yvonne Haller<br />
Dr. med. Christian Kandler, Oberarzt mbA<br />
Pflegedienst<br />
Leiter Pflegedienst ipw: Helmut Bernt<br />
Stv. Leiter Pflegedienst: Budimir Toskovic<br />
Entwicklung und Fortbildung Pflege: Iris Bütler,<br />
Ursula Bregenzer<br />
Ausbildung: Jacqueline Molina, Hans Peter Hunkeler<br />
Seelsorge<br />
Reformierte Seelsorge: Manfred Amez-Droz,<br />
Elsbeth Plaz-Lutz, Marcel Schmid<br />
Katholische Seelsorge: Christoph Klein<br />
Carina Galli, Therapeutische Mitarbeiterin<br />
Bereichsleitung:<br />
Personal: Beatrice Renner, Teamleiterin<br />
Dr. med. Axel Guntermann, Oberarzt<br />
Dr. med. Jacqueline Minder, Leitende Ärztin,<br />
Qualitätsmanagement: Patrick Samson<br />
Bereichsleiterin<br />
Kommunikation: Susanne Gimmi
30<br />
Geschäftsleitung ipw Stand März 2007<br />
Geschäftsleitung ipw: Dr. med Sebastian Haas, Christine Gäumann, Dr. med. Thomas Ihde, Dr. med. Toni Berthel,<br />
Dr. med. Andreas Andreae, Peter Roth, Yvonne Haller, Helmut Bernt, Dr. med. Jacqueline Minder (v.l.)<br />
Vorsitz<br />
Peter Roth Verwaltungsdirektor (Vorsitz)<br />
Andreas Andreae, Dr. med. Ärztlicher Direktor (Stv. Vorsitz)<br />
Mitglieder<br />
Helmut Bernt Leiter Pflegedienst<br />
Toni Berthel, Dr. med. Stv. Ärztlicher Direktor, Co-Leiter Bereich Adoleszenz & Sucht<br />
Christine Gäumann Co-Leiterin Bereich Adoleszenz & Sucht<br />
Sebastian Haas, Dr. med. Leiter Bereich Ambulanz & Krise<br />
Yvonne Haller Stv. Verwaltungsdirektorin /HR-Management<br />
Thomas Ihde, Dr. med. Leiter Bereich Erwachsenenpsychiatrie<br />
Jacqueline Minder, Dr. med. Leiterin Bereich Gerontopsychiatrie<br />
Aufsichtskommission<br />
für die Kantonalen Psychiatrischen Kliniken<br />
Marianne Delfosse, Dr. iur. Direktionsassistentin Gesundheitsdirektion (Vorsitz)<br />
Albert Berbier Gemeindepräsident Embrach<br />
Yvonne Blöchlinger Geschäftsführerin Patientenstelle Zürich<br />
Erwin Carigiet, Dr. iur. Departementssekretär Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich<br />
Maja Ingold Stadträtin, Departement Soziales der Stadt <strong>Winterthur</strong><br />
Kerstin Knebel Gemeinderätin Rheinau<br />
Bernadette Lusser, Dr. med. FMH <strong>Psychiatrie</strong> und Psychotherapie<br />
Martin Sieber, Prof. Dr. phil. Fachpsychologe für Psychotherapie FSP<br />
Christian Zürni, Dr. med. FMH Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
Matrixorganisation ipw: Angebots- und Supportbereiche<br />
Netzwerk- und integrierte Versorgung durch die kantonalen, kommunalen,<br />
gemeinnützigen und freien Angebote in der <strong>Psychiatrie</strong>region <strong>Winterthur</strong>.<br />
Management & Logistik<br />
Stab<br />
Finanzen<br />
Personaldienst<br />
Technischer Dienst<br />
Gastronomie<br />
Reinigung<br />
Transportdienst<br />
Pflegedienst<br />
Ausbildung<br />
Entwicklung &<br />
Fortbildung<br />
Ärztliche Direktion<br />
Soziales & Netzwerk<br />
Behandlungsevaluation<br />
Therapien<br />
Medizinischer Dienst<br />
Ambulanz & Krise<br />
PsychPol<br />
Poliklinik am KSW<br />
GEZ<br />
Gemeindepsychiatrisches<br />
Zentrum<br />
KIZ<br />
Kriseninterventionszentrum<br />
Adoleszenz & Sucht<br />
BSJ<br />
Beratungsstelle für<br />
Jugendliche<br />
BSD *<br />
Beratungsstelle für<br />
Drogenprobleme<br />
WFA **<br />
<strong>Winterthur</strong>er<br />
Fachstelle für<br />
Alkoholprobleme<br />
Ikarus **<br />
Zentrum für<br />
opiatgestützte<br />
Behandlung<br />
KoBe Koordinations- und Beratungsstelle<br />
FPG Fachstelle für psychiatrische Gutachten<br />
* Trägerschaft Stadt <strong>Winterthur</strong> und Kanton Zürich<br />
** Trägerschaft Stadt <strong>Winterthur</strong><br />
Erwachsenenpsychiatrie<br />
Akutangebote<br />
Akutstationen<br />
B und C<br />
DAS<br />
Depressions- &<br />
Angststation<br />
Villa<br />
Psychotherapiestation<br />
für junge<br />
Erwachsene<br />
RPKWin<br />
Regionale<br />
<strong>Psychiatrie</strong>kommission<br />
<strong>Winterthur</strong><br />
Gerontopsychiatrie<br />
GAT<br />
Gerontopsych.<br />
Ambulatorium &<br />
Tagesklinik<br />
Geschützte<br />
Angebote<br />
Akutstation A<br />
Therapieangebote<br />
Psychotherapiestation<br />
Rehabilitations-<br />
angebote<br />
Rehastationen<br />
A und B<br />
Assessment &<br />
Demenz<br />
Assessmentstation,<br />
Demenzstation<br />
31
ipw <strong>Integrierte</strong> <strong>Psychiatrie</strong> <strong>Winterthur</strong><br />
Wieshofstrasse 102, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 224 33 33 / 052 224 33 34<br />
www.ipwin.ch, info@ipwin.ch<br />
KIZ Kriseninterventionszentrum<br />
Bleichestrasse 9, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 224 37 00 / 052 222 89 30<br />
E-Mail: kiz@ipwin.ch<br />
GEZ Gemeindepsychiatrisches Zentrum<br />
Rudolfstrasse 19, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Ambulatorium und Akuttagesklinik<br />
Telefon / Fax: 052 224 37 37 / 052 212 03 82<br />
E-Mail: gez@ipwin.ch<br />
PsychPol Psychiatrische Poliklinik am KSW<br />
Haldenstrasse 63, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 266 28 84 / 052 266 45 13<br />
E-Mail: pp@ipwin.ch<br />
Klinik Schlosstal für <strong>Psychiatrie</strong> und Psychotherapie<br />
Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie<br />
Wieshofstrasse 102, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 224 35 00 / 052 224 35 02<br />
E-Mail: aerztesekretariat@ipwin.ch<br />
GAT Gerontopsychiatrisches Ambulatorium<br />
und Tagesklinik<br />
Salstrasse 48, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 222 22 45 / 052 222 01 89<br />
E-Mail: gat@ipwin.ch<br />
BSJ Beratungsstelle für Jugendliche<br />
Trollstrasse 18, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 267 68 55 / 052 267 68 54<br />
E-Mail: bsj@ipwin.ch<br />
Villa Psychotherapiestation für junge Erwachsene<br />
Eichwaldstrasse 21, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 266 28 98 / 052 266 28 97<br />
E-Mail: villa@ipwin.ch<br />
BSD Beratungsstelle für Drogenprobleme<br />
Trägerschaft Stadt <strong>Winterthur</strong> und Kanton Zürich<br />
Tösstalstrasse 19, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 267 59 00 / 052 267 62 29<br />
E-Mail: bsd@ipwin.ch<br />
WFA <strong>Winterthur</strong>er Fachstelle für Alkoholprobleme<br />
Trägerschaft Stadt <strong>Winterthur</strong><br />
Technikumstrasse 1, 8400 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 267 66 10 / 052 267 66 20<br />
E-Mail: wfa@ipwin.ch<br />
IKARUS Zentrum für heroin- und<br />
methadongestützte Behandlung<br />
Trägerschaft Stadt <strong>Winterthur</strong><br />
Theaterstrasse 3, 8400 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 267 63 99 / 052 267 63 98<br />
E-Mail: ikarus@ipwin.ch<br />
KoBe Koordinations- und Beratungsstelle,<br />
Zentraler Sozialdienst,<br />
Case Management Arbeitsintegration<br />
Albanistrasse 24, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 266 49 00 / 052 266 48 60<br />
E-Mail: koordinationsstelle@ipwin.ch<br />
FPG Fachstelle für psychiatrische Gutachten<br />
Albanistrasse 24, Postfach 144, 8408 <strong>Winterthur</strong><br />
Telefon / Fax: 052 266 48 60<br />
E-Mail: fpg@ipwin.ch<br />
0