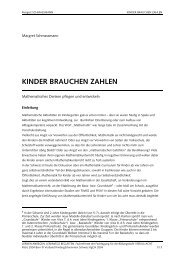Österreichisches Rechenschwächemagazin Nr 3 - Das ...
Österreichisches Rechenschwächemagazin Nr 3 - Das ...
Österreichisches Rechenschwächemagazin Nr 3 - Das ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
R<strong>Österreichisches</strong>echenschwächeMagazinwww.rechenschwaeche.atATS 14,–/1 Euro<strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001Halbjahres-Schrift des Vereins für Lern- und DyskalkulietherapieLerchenfelder Str. 125/13, 1070 Wien, Tel.: 01/526 48 46, rechnen@inode.atFrüherkennung vonmathematischen Lernschwierigkeitenvon Prof. Jens Holger LorenzJe eher Anzeichen einer möglichen (!) Rechenschwächenachgegangen wird, um sogünstiger ist die Prognose. Werden die Ursachenerst spät erkannt, dann sind nicht nurdie eventuell unzureichend entwickelten kognitivenFaktoren zu stärken, die der Lernschwierigkeitzugrunde liegen, sondern es istauch ein breiter Bereich falsch oder unzureichendaufgebauter mathematischer Begriffevon Grund auf neu zu bilden – ein mühseligesUnterfangen für alle Beteiligten.1. Kognitive Voraussetzungen fürein sicheres Rechnen im KopfBeobachten sich Erwachsene beim Rechnen,dann stellen sie fest, dass sie diese Rechnungenin einem vorgestellten Zahlenraumdurchführen. Dieser Zahlenraum in der Anschauungbildet die Zahlbeziehungen ab, dieZahlen besitzen darin ihren Ort – 50 liegtetwa in der Mitte zwischen 0 und 100, 18liegt zwischen 10 und 20, aber näher an der20 etc. – und arithmetische Operationensind meist Bewegungen in diesem Raum:Sprünge nach rechts für die Addition, nachlinks für die Subtraktion, ☛ S. 4Zum Autor:Jens Holger Lorenzist einer der führendenExperten zum ThemaRechenstörungenim deutschsprachigenRaum. Jahrgang 1947, studierte erzunächst Mathematik und Physik mit Diplomin Mathematik 1970, später Pädagogik(Promotion 1979) und Psychologie(Diplom 1982). 1990 erfolgte die Habilitationin Didaktik der Mathematik; imselben Jahr beendete Lorenz seine Ausbildungzum analytischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten.Seit 1995 unterrichteter als Professor für Didaktik derMathematik an der Pädagogischen HochschuleLudwigsburg, seit 1980 ist er Leiterder Beratungsstelle für Lernschwierigkeitenin Mathematik an den HochschulenBielefeld bzw. Ludwigsburg. Seine Arbeitsschwerpunkte:Lernstörungen im Mathematikunterricht,arithmetisches Denkenvon Kindern, Kognitionspsychologie,Hochbegabung, Entwicklung von Unterrichtsmaterialienfür die Grundschule.Wie kann ich einem rechenschwachenKind im Klassenverband helfen?Bei der Entstehung einer Rechenstörungkönnen die unterschiedlichsten Faktoreneine Rolle spielen. Ein wichtiger Faktorist der Unterricht selbst in all seinen Dimensionen.Daher unsere wiederholte Forderung,die weitreichenden Möglichkeiten zurVermeidung von Rechenstörungen durchdifferenzierten Unterricht auszuschöpfen.Dafür wären freilich massive Anstrengungenin der Lehreraus- und –fortbildung, in derunterrichtsbegleitenden Forschung, aberauch geänderte organisatorische Rahmenbedingungenin den Schulen notwendig.Vorbeugen ist immer besser als „Heilen“.Aber freilich darf man beides nicht gegeneinanderausspielen. Es stellt sich also auchdie Frage: Was tun, wenn – vielleicht sogartrotz aller vorbeugenden Maßnahmen – einoder mehrere Kinder in der Klasse unter einermassiven Rechenstörung leiden? ☛ S. 2Editorial„Österreich ist von einem Dyskalkulie-Boom weiter entfernt als der Neusiedlervom Bodensee“, meinten wir noch in derletzten Ausgabe unseres Magazins – mitetwas Wehmut in die Schweiz blickend,wo manche vor einem solchen Boomglauben warnen zu müssen.Nun sind in der Schweiz die Maßnahmenfür rechenschwache Kinder vonKanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeindehöchst unterschiedlich geregelt.Es gibt aber tatsächlich Gemeinden, diefür rechenschwache Kinder bis zu 100Fördereinheiten finanzieren.Von dergleichen kann man hierzulandetatsächlich nur träumen. Dennoch: Estut sich was. Kein „Dyskalkulie-Boom“zwar, bei weitem nicht. Aber seit unserVerein vor 6 Jahren begonnen hat, ingrößerem Maßstab auf den ProblemkreisRechenstörungen aufmerksam zu machen;seit wir in Vorträgen und Publikationen,seit einem Jahr auch durch unserMagazin, über mathematische Lernstörungeninformieren; seit wir mit einigerBeharrlichkeit auf politischer Ebeneein Nachdenken über längst fällige schulischeund gesellschaftspolitische Maßnahmenfür Rechenschwache einfordern:Seither haben sich die Rahmenbedingungenunserer Arbeit doch in einigen Punktenerheblich zum Besseren gewandelt.• An pädagogischen Instituten werden(auch durch unsere Mitwirkung) ☛ S. 2InhaltFrüherkennung von mathematischenLernschwierigkeiten.................................1,4-5Wie kann ich einem rechenschwachenKind im Klassenverband helfen? .................1-3Literaturhinweise ...........................................6Veranstaltungshinweise ..................................7Was wir für Sie tun können ............................8Aus Fehlern lernen .........................................8© <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – 3/2001 S. 1
Rechenschwachen Kindern im Klassenverband helfenvermehrt Fortbildungsveranstaltungenzum Thema Rechenstörungen angeboten.• Rechenstörungen finden verstärktBeachtung im Rahmen von Akademielehrgängenfür die Betreuung von Kindernmit Lernstörungen. An der PädakGraz-Seckau soll dieses Angebot aufgrundder großen Nachfrage im kommendenJahr noch wesentlich erweitertwerden.• Gerade in den letzten beiden Jahrensind eine Reihe von Büchern zum Themaerschienen – nachdem zuvor zwar Regalefüllend über Lese-Rechtschreibstörungen,aber nur sehr selten über Rechenstörungenpubliziert wurde. Diese Neuerscheinungensind zwar höchst unterschiedlicherQualität. Sie belegen aber injedem Fall das im gesamten deutschsprachigenRaum enorm gestiegene öffentlicheInteresse an Rechenstörungen.• Die „Eingemeindung“ von Rechenstörungenals „Unterfall von Legasthenie“findet zwar da und dort nochimmer statt. Es wird aber mehr und mehrerkannt, dass im Interesse der Betroffenendem eigenständigen Charakter mathematischerLernstörungen auch durcheigenständige, individualisierte FördermaßnahmenRechnung getragen werdenmuss.All das gäbe durchaus Anlass zur Hoffnung– wäre da nicht auf der anderen Seiteder bildungspolitische „Zeitgeist“. Derscheint nämlich eine sachliche Debatteüber die Notwendigkeit neuer schulischerund außerschulischer Maßnahmengar nicht erst zuzulassen. „Einsparen“heißt das Diktat der Stunde. Allen Elternund LehrerInnen, die dieses Diktat nichtwiderspruchslos hinnehmen wollen, giltunser Angebot zur Zusammenarbeit. UnserMagazin will auch das sein: ein Forumfür all jene, die mit den Rahmenbedingungenfür Rechenschwache nicht zufriedensind und auf eine Besserung hinarbeitenwollen. In diesem Sinne: SchreibenSie uns! Leserbriefe, Gastartikel, Berichteüber Initiativen von Eltern oder inSchulen: Es gibt viele Möglichkeiten, etwaszu tun – und es gibt viel zu tun!Michael GaidoschikHerausgeberFortsetzung von S. 1Mit einfachen Rezepten können wir hierleider nicht dienen: Es gibt sie nicht. JederEinzelfall bedarf der individuellen Überlegung.Dennoch möchte der Verein für LernundDyskalkulietherapie den KollegInnenin den Klassen einige Vorschläge unterbreiten– und hiermit auch zur Diskussion stellen.1Beiallen Unterscheidungen, die manaufgrund der Vielfalt der so bezeichnetenStörungen treffen muss: „Rechenschwäche“ist grundsätzlich „therapierbar“.Eine solche „Dyskalkulie-Therapie“verlangt aber so gut wie immer Einzelförderung.Es ist daher kaum denkbar,eine bereits ausgeprägte Rechenstörungalleine durch Maßnahmen imKlassenverband zu überwinden.2Bessere Rahmenbedingungen für dieVerwirklichung dyskalkulietherapeutischerMaßnahmen bieten dagegenFörder- und Stützunterricht. Soll derFörder- bzw. Stützunterricht in dieserWeise wirksam werden, bedarf es freilicheiner umfassenden Diagnostik sowieentsprechend ausgebildeter Förderkräfte.Beides ist – nicht nur unseres Erachtens– im heimischen Schulwesenderzeit in keinster Weise sichergestellt.3<strong>Das</strong>s eine Rechenstörung im Klassenverbandkaum je therapiert werden kann,heißt freilich nicht, dass die Klassenlehrerin1 dem rechenschwachen Kind nichthelfen könnte. Die erste, wichtigsteund unmittelbar wirksame Hilfsmaßnahmedurch die Klassenlehrerin:Verständnis, Verständnis, Verständnis.<strong>Das</strong> setzt freilich voraus, dass die Lehrerindas Problem frühzeitig richtig erkennt.Sie muss also erkennen, dass hinternden Leistungsausfällen dieses Kindesnicht Faulheit, nicht Dummheit,kein böser Wille steckt – sondern eineRechenstörung. Und sie muss wissen,dass diese Rechenstörung, vermitteltüber den „Teufelskreis Lernstörung“,auch psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeitendes Kindes nach sichziehen kann.4Die Klassenlehrerin muss dem rechenschwachenKind dabei helfen,sein Scheitern richtig zu verstehen:nicht als Ausdruck mangelnder „Gescheitheit“(„Ich bin zu dumm für Mathe!“)oder einer besonderen „Unbegabung“(„Mathematik ist nichts fürmich“). Sondern als Folge ganz bestimmtermangelhafter Lernvoraussetzungen,ganz bestimmter früherer Missverständnisse,ganz bestimmter fehlerhafterLösungswege. Für all das ist dasKind nicht verantwortlich: <strong>Das</strong> mussihm ebenso vermittelt werden wie dieTatsache, dass es seine Schwierigkeitenbewältigen kann.5Die Klassenlehrerin sollte im Rahmenihrer Möglichkeiten versuchen, dieEltern umfassend über das Problemihres Kindes aufzuklären. Denn „Rechenschwäche“ist in der breiteren Öffentlichkeitnach wie vor nahezu unbekannt.Also ist die Gefahr groß, dass Elternden Charakter der Schwierigkeitenzunächst verkennen und deshalb falschdamit umgehen – trotz bester Absichtenzum Schaden des Kindes.6Wird im Förderunterricht und/oderdurch geeignete außerschulische Maßnahmenan der Überwindung der Rechenstörunggearbeitet, dann stellen sichgewiss auch bald erste Fortschritte ein.Dennoch bleibt zumeist ein langer Weg,bis das Kind den Anschluss an die Klassewiederfindet. In dieser Zeit nun mussdem Kind deutlich gemacht werden,dass es selbst das Maß für den Lern-Fortschritt ist - und nicht die Klasse.Anerkennung und Lob verdient das1Ich verwende in diesem Artikel für Lehrpersonen durchwegs nur die weibliche Form. Männer wie ich sind in pädagogischen Berufen nuneinmal in der Minderheit. Und den wenigen Lehrern darf man wohl zumuten, sich mit angesprochen zu fühlen – so wie ihre Kolleginnensich ja auch angesprochen fühlen müssen, wenn andernorts stets nur von „dem Lehrer” die Rede ist ...Offenlegung nach Mediengesetz: Medieninhaber, Verleger: Verein für Lern- und Dyskalkulietherapie, Obmann: Mag. Michael Gaidoschik,Adresse: Lerchenfelder Str. 125/13, 1070 Wien, Tel.: 01/526 48 46, rechnen@inode.at, www.rechenschwaeche.at. – GrundlegendeRichtung: Verbesserung der Rahmenbedingungen für rechenschwache Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Information und Fortbildungauf dem Gebiet von Rechenstörungen, Schärfung des öffentlichen Problembewusstseins für Rechenstörungen.Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich: Verein für Lern- und Dyskalkulietherapie.Redaktion: Mag. Michael Gaidoschik. – MitarbeiterInnen dieser Nummer: Prof. Dr. Jens Holger Lorenz, Mag. Eva Maria Laßnitzer,Mag. Michael Gaidoschik. – Satz: Johannes Schneider, 1020 Wien, Natasa Vizin, 1020 Wien. – Preis dieser Nummer: ATS 14,–/ 1EuroBankverbindung: Bank Austria, Kto. <strong>Nr</strong>.: 238 118 431 00 – Druck, Vervielfältigung: Druckerei Fischer, 1010 Wien.S. 2 © <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – <strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001
Rechenschwachen Kindern im Klassenverband helfenKind also dafür, dass es gemessen an seinemAusgangsniveau dazugelernt hat.Kommt diese Anerkennung hingegendeshalb zu kurz, weil doch gemessen ander Klasse immer noch ein Rückstandbleibt, so kann dies schlimme Folgen fürdie weitere Motivation haben. <strong>Das</strong>schließt selbstverständlich die Notengebungmit ein.7Eben weil sämtliche Maßnahmen Zeitbrauchen, stellt sich stets auch die Frage:Was kann kurzfristig unternommen werden,um rechenschwache Kinder im Unterrichtzu entlasten? Diese Frage ist deshalbso dringend, weil eine ständigeÜberlastung in der Schule den Aufholprozessselbst immer wieder entscheidendbremst, vielleicht sogar gänzlichverunmöglicht.aDiebeste Möglichkeit, das rechenschwacheKind zu entlasten, besteht darin,es von jenen Stoffbereichen zu befreien,die es in Folge seiner Rechenstörungzu einem gegebenen Zeitpunktgar nicht sinnvoll bewältigen kann.Stattdessen sollte das Kind in jenen Bereichenarbeiten können, die bei seinenderzeitigen Voraussetzungen tatsächlichlangfristigen Lernzuwachs versprechen.Eine solche „Differenzierung“ müssteauch Hausübungen sowie Probearbeitenumfassen.bBei zahlreichen Stoffinhalten derGrundschulmathematik besteht dieMöglichkeit, das rechenschwache Kinddurch Verzicht auf anspruchsvollereVerfahren zu entlasten (Beispiel: schriftlicheDivision nur mit Aufschreiben derMultiplikation und RestermittlungcEinedurch schriftliche Subtraktion, wie inDeutschland bis in den Sekundarschulbereichhinein üblich).Entlastung ist kurzfristig auchdurch das Bereitstellen zusätzlicherHilfsmittel im Klassenunterricht erreichbar.Dabei muss allerdings sorgfältigüberprüft werden, ob das Kindin der Verwendung dieser Hilfsmittelnicht gerade jene falschen Denkweisenverfestigt, welche durch die klassenexternenMaßnahmen überwundenwerden sollen.Genau das aber ist der Fall bei allenZählhilfen: Rein zählendes „Rechnen istein wesentliches Erkennungsmerkmalfür einen bestimmten Typus von Rechenstörungen.Zugleich muss es einZiel jeder Dyskalkulietherapie sein, demKind effizientere Lösungswege zu vermitteln.Dabei geht es in keinem Fall um ein„Zählverbot“. Ein Kind, das auch inhöheren Klassen vorwiegend durch Abzählenan den Fingern „rechnet“, drücktdarin ja nur aus, dass es noch über keineanderen Möglichkeiten verfügt. Ihmdiese seine einzige Möglichkeit zu verbieten(oder auch nur zu „empfehlen“,es „doch ohne Finger zu versuchen“),heißt nur, es in die Enge zu treiben.<strong>Das</strong> Zählen verbieten ist also keinWeg; das Kind „einfach zählen lassen“aber auch nicht. Es geht vielmehrdarum, dem Kind Schritt für SchrittAlternativen zum Zählen aufzuzeigen –und das wird bei einem rechenschwachenKind in der Regel nur außerhalbdes Klassenverbandes, in geduldiger undoft kleinstschrittiger Einzelarbeit gelingen.Dieser Lernprozess wird aber wesentlichbehindert, wenn parallel dazu dasKind in der Klasse durch die Bereitstellungvon Zählhilfen (oder die Ermutigung:„Zähl’s doch an den Fingernab!“) zum rein zählenden Verknüpfengeradezu angehalten wird.Natürlich: Aufgaben auf dem Niveaudes aktuellen „Schulstoffes“ sind andersfür dieses Kind nicht lösbar. Doch sinnvollerals Rechnungen zu stellen, die nurauf langfristig nicht zielführenden Wegengelöst werden können, wäre es eben,die Aufgaben vorübergehend jenem Niveauanzupassen, welches das Kind bereitsohne Zählen lösen kann.8In vielen Fällen wird der Rückstand desrechenschwachen Kindes – trotz noch sointensiver klassenexterner Förderung –nur mit einem zusätzlichen Schuljahraufzuholen sein.Ohne dass man die Frage einer Klassenwiederholungauf Mathematik reduzierendürfte: Für die Überwindungeiner Rechenstörung ist die Wiederholungeiner frühen Klasse zweifelsfrei hilfreicherals das „Mitschleppen“ eineshoffnungslos überforderten Kindes mitder „Perspektive“, dass es ja „immernoch die vierte Klasse wiederholen könne“.Verhängnisvoll wäre freilich die Erwartung,dass alleine das „noch einmal inder Klasse Sitzen“ ausreichen könnte,die Rechenstörung zu bewältigen: Solldie Wiederholung dem Kind langfristigweiterhelfen, so muss es während dieseszusätzlichen Jahres auch gezielt undkonsequent außerhalb der Klasse gefördertwerden.Michael GaidoschikDistr. Bulls © Bill Watterson© <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – <strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001 S. 3
Jens Holger Lorenz: Früherkennung von mathematischen LernschwierigkeitenFortsetzung von S. 1wiederholte Sprünge für die Multiplikationund Zerlegungen für die Division. Der eigeneZahlenraum unterscheidet sich in der Regelvon demjenigen anderer Menschen,denn es handelt sich um individuelle Konstruktionen,die bereits im Vorschulalteroder in den Eingangsklassen mit Hilfe derVeranschaulichungsmittel durchgeführtwurden.Um nun diese Vorstellung des Zahlenraumesausbilden, nutzen und mit ihm imKopf rechnen zu können, bedarf es einigerkognitiven Fähigkeiten. Diese können unzureichendentwickelt sein, so dass sich dasRechnenlernen erschwert und arithmetischeOperationen nur durch schematisches, aberunverstandenes Auswendiglernen verinnerlichtwerden. Meist bleiben diese Kinder sogenannteZähler, d.h. sie rechnen in denEingangsklassen (und darüber hinaus) anden Fingern oder mit Hilfe anderer Ersatzmaterialien.Die vom Kind zu erbringenden und imallgemeinen auch hinreichend entwickeltenFähigkeiten liegen• im visuellen Bereich• im Gedächtnis und• im Sprachbereich, da sich die Verständigungmit Erwachsenen (Eltern, Lehrerin)und Klassenkameraden darüber vollzieht.Diese Fähigkeiten und mögliche Einschränkungensind aber frühzeitig diagnostizierbar,bereits lange vor Schuleintritt. Aus diesemGrund wird zur Zeit an der PädagogischenHochschule Ludwigsburg ein Früherkennungstestfür Rechenschwierigkeiten entwickelt,der bereits im Alter von 4-5 Jahreneingesetzt werden kann.2. Hinweise im Vorschulalter2.1 Visuelles Gedächtnis undGliederungEinige Spiele des Vorschulalters verlangenvon den Kindern jene Fähigkeiten, die ihnenspäter im Mathematikunterricht abverlangtwerden.• Bei Memory-Spielen müssen die Kinder eineeinmal gesehene Form wiedererkennen,d.h., sie müssen sie in genau derselbenForm als solche von anderen, ähnlichenunterscheiden und ihre Lage imPlättchenhaufen erinnern.• Beim Puzzle scheint zwar korrigierendesAusprobieren möglich, aber eine schlichteVersuch-Irrtum-Strategie lässt kaum einPuzzle lösen. Vielmehr gelingt es nurdann, wenn die Kinder sich an möglichstpassende Anlegelinien erinnern und soden Versuchsaufwand minimieren.• Beim Bauen mit Klötzen ist es in der Regelden Kindern überlassen, was sie auftürmen.In diesem freien Spiel ist lediglich zubeobachten, ob sie Längenbeziehungenabschätzen können (Vorstellungsfähigkeit).Schwieriger und diagnostisch relevanterwird es, wenn eine Zielvorgabe gemachtwird, die es nachzubauen gilt. AlsVarianten kommen in Betracht:! Aufbau der Figur vor den Augen desKindes und anschließendes Verdecken,so dass bei Bedarf nachgesehen werdenkann.! Die Figur wird einmal aufgebaut, danneingerissen und das Kind muss sie mitdenselben Steinen nachlegen.! Die Figur wird unter einem Tuch aufgebaut,das Kind darf die Figur ertasten,aber nicht sehen (Aufbau eines visuellenVorstellungsbildes durch Tasten).! Lediglich eine Zeichnung oder ein Fotowird vorgegeben.! Als schwierigste Aufgabe erhält dasKind lediglich die Umrisszeichnungenin den drei Achsen (Aufsicht, Seitsicht,Frontsicht)Figuren aus der Zeichnung nachbauen......mit Bauklötzen...mit SteckwürfelnHinweis: In der Grundschule sollten dieseAnforderungen und Übungen auch mit demarithmetischen Veranschaulichungsmaterialdurchgeführt werden.• Ähnliche Anforderungen bestehen beimNachzeichnen. Die einfachste Form isteine möglichst sinnfreie Strichzeichnung,die aus dem Gedächtnis nachgemalt werdenmuss. Hierbei sind Lagebeziehungenund Streckenlängen diagnostisch bedeutsam.2.2 Visuelles OperierenNicht nur das visuelle Erinnern wird im späterenUnterricht verlangt, sondern das Operierenmit vorgestellten Inhalten, das Verändernin der Anschauung. Zwar kann mannur mit etwas in der Vorstellung operieren,was sich im Gedächtnis halten lässt, aberbeim Verändern des Inhaltes handelt es sichum eine gesonderte und keinesfalls trivialeFähigkeit. Sie lässt sich beim Spielen mit Lego-bzw. Duplo-Steinen, der Fischertechniketc. beobachten. Hier liegt das Augenmerkauf der planerischen Gestaltung:• Wie viele Steine einer bestimmten Artbenötige ich noch?• Wie muss die Grundfläche aussehen, damitich das Oberteil aufsetzen kann?• Welche Steine müssen weggenommenoder hinzugefügt werden, wenn ich an einerStelle etwas ändern möchte?Es betrifft die Fähigkeit, sich das Objekt inder Vorstellung aus verschiedenen Perspektivenanzusehen und abzuändern, ohne dieHandlung konkret auszuführen. In der Anschauungfindet ein Probehandeln statt.Auch Würfeldrehungen liegt diese Anforderungzugrunde. Nachdem das Kind dieLageveränderungen beim Drehen des Würfelsbeobachten konnte, dreht es ihn nununter einem Tuch:• Was liegt oben, wenn ich ihn nach vornekippe?• Ihn nach links kippe?• Ihn zweimal nach hinten drehe?• Ihn nach vorne und dann nach rechtsdrehe?• Liegt das selbe oben, wenn ich ihnnach rechts und dann noch vorne drehe?Würfel in der Vorstellung drehen„Wo ist der schwarze Kreis, wenn ichden Würfel erst nach links, dann nachvorne kippe?“S. 4 © <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – <strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001
Jens Holger Lorenz: Früherkennung von mathematischen Lernschwierigkeiten2.3 SpracheIm Kindergartenalter wird die kindlicheSprachkompetenz und das Sprachgedächtnisdurch das Ausführen komplexer Arbeitsanweisungenerprobt und geübt. Kinder fallenmit Störungen im auditiven Gedächtnis auf,wenn ihnen dies unzureichend gelingt oderwenn sie Weihnachtslieder und GeburtstagsoderMuttertagsgedichte nicht auswendiglernen können. Erst später bemerken danndie Eltern überrascht die Schwierigkeitenbeim Einmaleins und der Automatisierungder Zahlensätze im Zahlenraum bis 20.Bestimmte Unzulänglichkeiten der Spracheweisen auf Schwierigkeiten des quantitativenund räumlichen Verstehens hin:• Vergleiche wie größer-kleiner, länger-kürzer,mehr-weniger etc. gelingen nicht;• räumliche und zeitliche Beziehungen(liegt auf ..., unter, über, vor, nach, links,rechts, hinter, unter,...) werden nicht richtigwiedergegeben;• Berichte über zeitliche Abläufe stimmennicht, und anderes mehr.Weisen Kinder in diesem Bereich Problemeauf, dann liegt nicht notwendig eine Sprachstörungzugrunde. Es handelt sich möglicherweiseum die Auswirkungen gestörterräumlicher Orientierung, die sich in derSprache bemerkbar machen. Damit könnensich Schwierigkeiten nicht nur später beiTextaufgaben entwickeln sondern im arithmetischenAnfangsunterricht generell: DieKinder führen die geforderten Handlungennicht richtig aus und entwickeln dementsprechendunzureichende (begriffliche) Vorstellungender Rechenoperationen.3. Hinweise in der 1. Klasse• Sie finden die Aufgaben auf ihrer HeftoderSchulbuchseite oder der Tafel nichtwieder.• Sie haben Schwierigkeiten, Größenbeziehungenzu erkennen („Wie viele Bleistiftebenötige ich, bis ich an derTischkante ankomme?“,„Wie viele Schritte braucheich bis zur Tür?“)Wie viele Bleistifte?„Wie oft kann ich den Bleistift hinter einanderlegen, bis ich an die andere Tischkantekomme?“• Kinder mit Orientierungsstörungen kehrenmanchmal (nicht immer!) die Operationsrichtungum (14+3=11) oderlesen/schreiben Zahlen invertiert (13-31).• Häufig gelingt ihnen die räumlich-zeitlicheAbfolge einer Geschichte, eines Erlebnissesnicht, die Erzählung wirkt verworren.• Am Ende der 1. Klasse sind jene Kinderals auffällig anzusehen, die den Zahlenraumbis 10 noch nicht automatisierthaben und die Zahlzerlegungen nichtbeherrschen. Insbesondere die zählendenRechner sind zu beobachten, dasich das Zählen als alleinige Strategiezu verfestigen droht.4. Hinweise in der 2. Klasse• Zu Beginn der 2. Klasse ist auf jene Kinderzu achten, die noch Schwierigkeitenmit dem Zehnerübergang besitzen undentsprechende Verallgemeinerungen(7+5, 17+5, 27+5, ...) nicht vollziehen.• Auch Schwierigkeiten mit der Bündelungweisen auf Störungen der Anschauungund der Handlungsverallgemeinerung imSinne des Abstraktionsvermögens hin.• <strong>Das</strong> Gedächtnis wird beim Einmaleins gefordert,so dass Probleme in diesem Bereichauf entsprechende Defizite deuten.Meist ist aber das Umgekehrte zu beobachten:Kinder mit Problemen der räumlichenOrientierung und der Vorstellungsfähigkeithaben bereits im Vorschulalterein gutes Gedächtnis kompensatorischausgebildet, so dass gerade rechenschwacheKinder beim Einmaleins eine (täuschende)Leistungssteigerung zeigen.Sich anbahnende Rechenschwäche zeigtsich also in vielerlei Gestalt, in unterschiedlichenSituationen, bei diversen Gelegenheiten.Und nicht erst in der Schulebei Rechenfehlern. Sie frühzeitig zu erkennengehört zu den zentralen Aufgabender Grundschullehrerinnen und –lehrer,aber auch der Erzieher in den vorschulischenEinrichtungen. Dann können zu einerZeit prophylaktische Förderungsmaßnahmeneingeleitet werden, die einemissglückte Schulbiographie verhindernhelfen. Aber: Nicht alle Frühhinweisesollten in panische Aktivität münden,sondern zu weiterer, genauerer BeobachtungAnlass geben.<strong>Das</strong> rechtzeitige Erkennen von Rechenschwierigkeitenist die genuine Aufgabe derLehrperson in den Eingangsklassen. Elternvermögen die entsprechenden Hinweise ausUnkenntnis nicht zu deuten oder tun sie alsEigentümlichkeiten des Kindes ab.In der Anfangsphase fallen die kritischenSchülerinnen bzw. Schüler durch ihren Umgangmit schulischem Material auf.• Bei visuellen Störungen gelingt es ihnennicht, Objekte nach räumlichen Kategorienzu ordnen und zu klassifizieren („ist rotund rund“, „ist viereckig und klein“, „hatmehr Ecken als ...“).• Sie behalten bildliche Darbietungen nurkurzzeitig im Gedächtnis.• Ihre Zeichnungen sind nicht altersgemäßund die Anordnung auf dem Blatt erscheintunausgewogen bis bizarr.LiteraturBarth, K. (1997): Lernschwächen früh erkennen, München: Reinhardt.Ganser, B. (1995): Rechenschwäche, Donauwörth: Auer.Grissemann, H. & Weber, A. (1990): Grundlagen und Praxis der Dyskalkulietherapie.Bern: Huber.Ermittlung der Lernbasis durch systematische item-Variation. HeilpädagogischeForschung, 14(2), 89-96.Lorenz. J.H. (1984): Teilleistungstörungen; in J.H. Lorenz (Hrsg.): Lernschwierigkeiten:Forschung und Praxis (S. 75-94), Köln: Aulis.Lorenz, J.H. (1987): Lernschwierigkeiten und Einzelfallhilfe, Göttingen: Hogrefe.Lorenz, J.H. (1992): Anschauung und Veranschaulichungsmittel im Mathematikunterricht,Göttingen: Hogrefe.Lorenz, J.H. & Radatz, H. (1993): Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht,Hannover: Schroedel.Radatz, H. (1980). Fehleranalysen im Mathematikunterricht. Braunschweig: Vieweg.© <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – <strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001 S. 5
Rezensionen: Lorenz/Radatz; Akademie für Lehrerfortbildung; DillingenLiteratur über RechenstörungenJens Holger Lorenz/Hendrik Radatz:Handbuch des Fördernsim MathematikunterrichtSchrödel-Schulbuchverlag, Hannover 1993Unter den vielen Büchernund Arbeiten, die unserGastautor Jens Holger Lorenzzum Thema Rechenstörungenverfasst hat, könnenwir dieses gemeinsammit Hendrik Radatz schon1993 vorgelegte Handbuchallen Lehrerinnen und Lehrernals Einstiegslektüre nachAkademie für Lehrerfortbildung Dillingen:Rechenstörungen.Diagnose – Förderung – MaterialienAuer Verlag, Donauwörth 1999Akadamie für Lehrerfortbildung undPersonalführung:Rechenstörungen.Unterrichtspraktische FörderungAuer Verlag, Donauwörth 2000Zwei insgesamt höchst wertvolle, aberdoch recht uneinheitliche Beiträge zumThema. Der ältere, erstmals 1995 vorgelegteBand ist die Dokumentation zu einemvierwöchigen Fortbildungslehrgang, derunter der Leitung von Bernd Ganser fürdeutsche BeratungslehrerInnen an GrundundHauptschulen angeboten wurde. VerschiedeneAutoren haben dafür Beiträgeüber den Stand der wissenschaftlichen Forschung,über Diagnostik und Förderungvon Kindern mit Rechenstörungen, überdie Möglichkeiten der Prävention im Mathematikunterrichtsowie unterschiedlichsteFördermaterialien einschließlich Computereinsatzverfasst. Der jüngere Band will dazueine „streng praxisorientierte Ergänzung“liefern.Der „Theorieteil“ bietet auf der einenSeite höchst lehrreiche, gerade auch praktischhilfreiche Artikel wie jenen von Hans-Dieter Gerster über das zählende Rechnenund Wege, von diesem wegzukommen.Und auf der anderen Seite undifferenzierte,wissenschaftlich in dieser Form haltloseEmpfehlungen für den Einsatz von Edukinestetikzur Überwindung von Rechenschwächen.Auch die umfangreiche, reichillustrierte Auflistung von Fördermaterialienbietet neben sehr viel Brauchbarem auchdas eine oder andere Problematische. IhrHauptmangel liegt aber wohl darin, dassdas selbstgesteckte Ziel – eine Orientierungshilfein der „verwirrenden Materialflut“zu geben – während der Zusammenstellungwohl aus den Augen geraten ist.Dabei weisen die Autoren selbst zu rechtdarauf hin, dass in der Förderarbeit mit rechenschwachenKindern vom Prinzip der„Variation der Veranschaulichung“ abzuratenist!Eine gewisse Beliebigkeit der Förderempfehlungenbei Vernachlässigung derFehleranalyse ist auch dem „Praxisband“vorzuwerfen. So werden aufmehr als 40 Seiten unter derÜberschrift „Mathematikund Bewegung“ neben einigensinnvollen auch etlicheÜbungen vorgeschlagen, dieim Falle einer Rechenstörungals eher kontraproduktiv eingeschätztwerden müssen.Die unter dem Titel „Förderungdes Zahlenbegriffs“ vorgestelltenBewegungsübungen etwa sind imwesentlichen ein Training des Zählens. Eswird hier also gerade jener „Zahlenbegriff“gefördert, den rechenschwache Kinder inder Regel ohnedies einseitig für das Ganzeder Zahl nehmen – und mit dem sie früheroder später Schiffbruch erleiden!Auch die Autorinnen des Beitrags überMaßnahmen zum „Stolperstein Zahlbegriff“scheinen sich nicht recht im Klarendarüber zu sein, was genau nun eigentlichrechenschwache Kinder im Zahlenraum 10scheitern lässt. Abgesehen davon, dass diesemKernbereich gerade 5 Seiten gewidmetwie vor nur wärmstens ans Herz legen. <strong>Das</strong>Buch ist gut verständlich, hie und da mitangenehm ironischem Einschlag geschriebenund bietet auf 241 Seiten einen gutenÜberblick über das vielschichtigePhänomen„Rechenschwäche“. DieAutoren verfolgen dabeieinen dezidiert pädagogischenAnsatz: „Wir wollenalle Schüler einbeziehen,die einer Förderungjenseits des Standardunterrichtsbedürfen.“ Für diesenach Lorenz/Radatz immerhin15 % (!) aller Grundschüler findenLehrerInnen im „Handbuch“ eine Füllevon Informationen zur informellen Diagnose,zu Fördermöglichkeiten in ausgewähltenInhaltsbereichen (Maßnahmen gegendas zählende „Rechnen“, schriftlicheRechenverfahren, Sachrechnen), zu hilfreichenund weniger hilfreichen Arbeitsmitteln,zum Training der allgemeinen kognitivenVoraussetzungen des Mathematik-Lernens...Zu vielen Bereichen würde mansich noch mehr und genauere Anregungenwünschen – aber man kann einem Buchwohl nicht vorwerfen, dass es nicht zehnBücher ist.MGsind: Neben sinnvollen Anregungen (Erarbeitungeiner „spontanen“, nicht zählendenFingerdarstellung der Zahlen bis 10) findensich auch solche, vor deren Befolgung derRezensent nur warnen kann. So wird unteranderem empfohlen, auf einzelne Perlen einerRechenmaschine zu tippen und zu fragen:„Wie heißt diese Perle/Zahl?“ Damitschlagen die Autorinnen allen Ernstes vor,die einer Rechenstörung zumeist zugrundeliegendeVerwechslung von Zahl (Wieviel?)und Ort (der Wievielte?) auch noch zu befördern!Von solchen Fahrlässigkeiten abgesehen:Es fehlt gänzlich an systematischenÜberlegungen dazu, in welchen Schrittenein zunächst auf den ordinalenAspekt der Zahlfixiertes Kind zu einerEinsicht in quantitativeBeziehungen hingeführtwerden kann. Geradedarauf käme es für dieÜberwindung des „StolpersteinsZahlbegriff“aber an.Auch den Anregungenzur Überwindung der weiteren „Stolpersteine“(Stellenwertsystem, Zehnerübergang,Platzhalter, Multiplikation/Division,schriftliche Rechenverfahren, Sachaufgaben)hätte ein Mehr an Systematik gutgetan.In Summe wurden hier aber eine ganzeReihe von didaktisch richtigen Unterrichtsmaßnahmenzusammengetragen. Komplettiertwird der Band durch die Darstellungeiniger „exemplarischer Förderstunden“ aufBasis der vorgeschlagenen Fördermaßnahmensowie einer Reihe von „Förderfällen“,die über einen längeren Zeitraum hin dargestelltwerden.MGS. 6 © <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin – <strong>Nr</strong>. 3, Frühjahr 2001
VeranstaltungshinweiseVeranstaltungshinweiseFortbildungs-Reihe am Pädagogischen Institut der Stadt Wien:Rechenstörungen – Eine unterrichtspraktische EinführungReferent: Mag. Michael GaidoschikStart am Mittwoch, 26. September 2001, 15 bis 18.15 UhrFolge-Termine jeweils mittwochs 15 bis 18.15 Uhr: 10. und24. Oktober sowie 7. NovemberInhaltliche Schwerpunkte:• Früherkennung von Rechenstörungen in der Eingangsklasse• Möglichkeiten der Vermeidung von Rechenstörungen imUnterricht• Hilfe bei bereits ausgeprägten RechenstörungenTeilnahme nur für Wiener LehrerInnen, persönliche Anmeldung per Formular des PI der Stadt Wien, Burggasse 14 - 16, 1070 Wien oderper Internet unter www.pi-wien.at unter der Veranstaltungsnummer 2001103136002.Weitere Veranstaltungen mit ReferentInnen des Vereins für Lern- und DyskalkulietherapieBei entsprechender Anzahl von InteressentInnen stellen wir gerne (nach Maßgabe unserer Terminmöglichkeiten) ReferentInnen für LehrerundElternfortbildungen. Anfragen unter 01 - 526 48 46 sowie per e-mail an rechnen@inode.atDistr. Bulls © Bill Watterson9. Juni, Universität Zürich-Irchel: Brennpunkt Dyskalkulie – Eine interdisziplinäre Herausforderung5. Tagung des Verbandes Dyslexie SchweizReferate unter anderem zu folgenden Themen:Mathematisches Denken aus der Sicht der kognitiven Entwicklungspsychologie; Pädagogisch-psychologische Aspekte des Mathematikunterrichts;Neurologische und neuropsychologische Grundlagen der Rechenstörungen; Entwicklungspsychopathologie der Störungen des mathematischenLernens; Grundlagen der Förderung und Therapie rechenschwacher Kinder: Wege und Irrwege; Lernmedien zur Praxis der DyskalkulietherapieUnter den ReferentInnen:Dr. Michael von Aster,Prof. Jens Holger Lorenz,Prof. Hans Grissemann,Dipl. Math. MargretSchmassmannDie Tagung steht offen fürBetroffene (Eltern), Fachleuteund Interessierte. Tagungsgebührenfür NichtmitgliederFr. 150,–, für StundentInnenmit Ausweis Fr. 80,–Anmeldeschluss 25. Mai 2001Nähere Informationen undOnline-Anmeldung unterwww.verband-dyslexie.choder beim Verband DyslexieSchweiz, Postfach 1270,CH-8021 ZürichAbsenderName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bitte leserlich schreibenVerein für Lern-undDyskalkulietherapieLerchenfelderstr. 125/131070 WienPorto✂
Postgebühr bar bezahltWas wir für Sie tun könnenDer Verein für Lern- und Dyskalkulietherapie betreibt in Wien undGraz „Institute zur Behandlung der Rechenschwäche“. Die MitarbeiterInnender Institute sind ein Team aus PädagogInnnen, PsychologInnenund MathematikerInnen, die über ihre Berufspraxis hinaus einespezielle Ausbildung in Dyskalkulie-Therapie absolviert haben.Im Rahmen der Institute bieten wir an:• kostenlose Information und Beratung über Rechenschwäche und dieMöglichkeiten ihrer Behandlung im Rahmen der Telefon-Sprechstunden• Versand von Informationsbroschüren und Fachartikeln• Vorträge und Seminare• diagnostische Gespräche zur Detail-Abklärung bei Verdacht auf Rechenschwächenach Terminvereinbarung und gegen Kostenbeitrag• auf Basis solcher diagnostischer Gespräche: individuelle Beratungsgesprächemit Eltern, bei deren Zustimmung auch mit LehrerInnenrechenschwacher Kinder und Jugendlicher• Durchführung von Rechenschwäche-TherapienAus Fehlern lernen...Aus den Fehlern rechenschwacher Kinderlässt sich viel lernen: Darüber, wie dieseKinder denken, wenn sie rechnen; dass siedabei sehr wohl einer „inneren Logik“folgen; dass man ihnen also auch helfenkann, wenn man diese Logik entschlüsseltund deren fehlerhafte Grundlagen mitden Kindern aufarbeitet.Zuweilen darf man über die Fehlerrechenschwacher Kinder aber auch nochschmunzeln. Dazu lädt diese Kolumnemit Beiträgen aus unserer Praxis ein. DieVornamen wurden von der Redaktionnatürlich geändert, die Sprüche nicht ...Sie erreichen uns:in Wien:1070, Lerchenfelder Str. 125/13Tel.: 01 - 526 48 46Fax: 01 - 526 48 47Telefon-Sprechstunden täglichvon 12 bis 13.30 Uhrin Graz:8020, Kleegasse 3/BO 2Tel. und Fax: 0316 - 766 344Telefon-SprechstundenMo, Mi und Dovon 12 bis 14 UhrFrage: „Was ist eine Primzahl?“Sandra, 11, freudig erregt, weil sie’s zuwissen meint: „Primzahl, das kommt vonPrimel, das ist eine Frühlingszahl!“Frage: „Von 250 Schilling wird ein Fünftelgespart. Wie viel Geld ist das?“Melanie, 10: „Da rechne ich mal. 250 mal5. Weil: Wenn man spart, dann wird esmehr Geld!“e-mail: rechnen@inode.atHomepage: www.rechenschwaeche.at✂Bitte schicken Sie mir gegen Porto- und Versandspesen (Erlagschein wird bei Versand beigelegt):❐ <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin, Heft Nummer 1❐ <strong>Österreichisches</strong> Rechenschwäche Magazin, Heft Nummer 2❐ Elternratgeber „Hilfe, mein Kind kann nicht rechnen“❐ Kommentierte Literaturliste zum Thema Rechenschwäche❐ Übersichtsfolder: Wie erkennt man eine Rechenstörung in der Volksschule?❐ Übersichtsfolder: Wie erkennt man eine Rechenstörung in der HS/AHS?❐❐Ich bitte auch weiterhin um die kostenlose Zusendung desÖsterreichischen Rechenschwäche Magazins.Ich bitte weiterhin um Zusendung des Österreichischen Rechenschwäche-Magazins zum Förder-Abo-Preis von ATS __________ (Bitte Betrag Ihrer Wahl einsetzen).Frage: „Fritz bekommt jede Woche 5 SchillingTaschengeld. Er spart das Geld 4 Wochenlang. Wieviel Geld hater dann gespart?“Doris, 8, schnell entschlossen:„100 Schilling hat erdann!“„Wie bist du draufgekommen?Hast du dafür gerechnet?“„Da braucht man nichtrechnen, das fällt in dasGehirn ein!“Frage: „Florian hat 5 Geschwister.Wie viele Mitgliederhat die ganze Familie?“Jasmin, 9, starrt konzentriertauf den Text, dann:„Da kann man nichts rechnen.Da steht ja nur eineZahl, man braucht zweiZahlen zum Rechnen!“S. 8