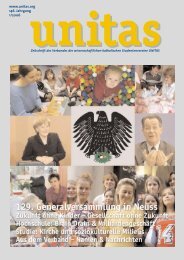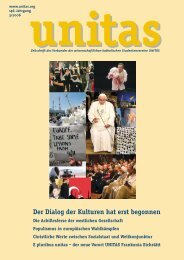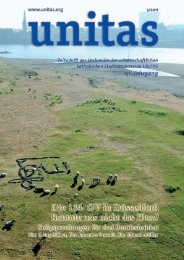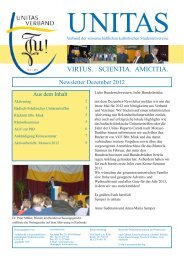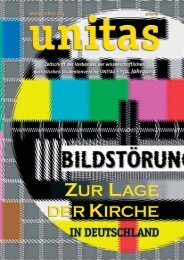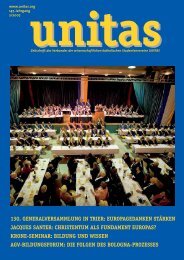BBR. REINHARD MARX: NEUER ERZBISCHOF VON ... - Unitas
BBR. REINHARD MARX: NEUER ERZBISCHOF VON ... - Unitas
BBR. REINHARD MARX: NEUER ERZBISCHOF VON ... - Unitas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.unitas.org<br />
147. Jahrgang<br />
unitas<br />
Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS<br />
<strong>BBR</strong>. <strong>REINHARD</strong> <strong>MARX</strong>:<br />
<strong>NEUER</strong> <strong>ERZBISCHOF</strong> <strong>VON</strong> MÜNCHEN UND FREISING<br />
EINLADUNG ZUR 131. GENERALVERSAMMLUNG IN KÖLN<br />
WALTER KELLER 90: UNITARISCHER LEUCHTTURM<br />
<strong>VON</strong> DER UNITAS-REISE IN DIE EUROPA-REGION NEISSE<br />
AGV-SEMINARE MIT PROMINENTEN GESPRÄCHSPARTNERN<br />
Doppelnummer<br />
3-4/2007
146<br />
INHALT<br />
Gott mit dir im Land der Bayern >147<br />
Das Interview: Ein Bundesbruder in Nahost > 149<br />
Vorortsübergabe in Stuttgart > 152<br />
AGV: Berlin-Seminar prominent besetzt >154<br />
Integration: Herausforderung für unser Gemeinwesen > 158<br />
Berichte vom AHB-/HDB-Tag in der Europa-Region Neiße > 162<br />
Walter Keller: Ein unitarisches Leben > 171<br />
Stiftung „UNITAS 150 plus“: Vermögen angewachsen > 175<br />
<strong>Unitas</strong> coloniensis: Von Straßburg nach Köln >176<br />
Akkreditierung: Aus dem Hochschulpolitischen Beirat > 182<br />
Pesch-Preis: Von Heinrich Pesch bis heute > 189<br />
Einladung zur 131. Generalversammlung in Köln > 193<br />
AGV-Wallfahrt auf den Spuren des Alten Testaments >202<br />
Berichte aus dem Verband > 210<br />
Namen & Nachrichten > 219<br />
Kirche auf Sendung: Bald ein eigener Kirchenkanal? > 226<br />
125 Jahre unitas-Zeitschrift > 234<br />
In memoriam > 236<br />
Vorgestellt: Bücher / Medien > 239<br />
Geburtstage von Dezember bis März 2008 >244<br />
Einladung zum Krone-Seminar 2008 in Berlin >248<br />
Herausgeber und Verlag<br />
Neue Adresse<br />
Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine e.V.,<br />
Aachener Str. 29, 41564 Kaarst (Büttgen), Tel. 02131 / 27 17 25, Fax 0 21 31 / 27 59 60,<br />
Homepage: www.unitas.org, E-Mail: vgs@unitas.org, stiftung@unitas.org<br />
Vorort<br />
W.K.St.V. UNITAS Palatia Darmstadt<br />
Gutenbergstraße 5, 64289 Darmstadt, Tel. 065151 / 790 90 30,<br />
E-Mail: palatia@unitas.org, vop@unitas.org<br />
Vorortspräsident<br />
Johannes Günther, Böblinger Straße 516, 70569 Stuttgart, Tel. 0711 / 6 87 29 45,<br />
Mobil: 0179 / 3 87 84 72, E-Mail: johannes_guenther@yahoo.de, vop@unitas.org<br />
Verbands-Konten<br />
PAX-Bank Köln, Nr. 28 796 013, BLZ 370 601 93<br />
Spendenkonten<br />
Stiftung UNITAS 150plus: Pax-Bank e.G., Köln, Kto.-Nr. 444 555, BLZ 370 601 93,<br />
Bank für Sozialwirtschaft, Kto.-Nr. 80 61 000, BLZ 370 205 00<br />
Soziales Projekt: Spk Bonn, Kto.-Nr. 71 61, BLZ 380 500 00, Verwendungszweck: Osek<br />
Schriftleitung<br />
Dr. Christof M. Beckmann, Hülsmannstr. 74, 45355 Essen-Borbeck,<br />
Tel. 0208 / 46 84 99 61 (d), FAX 0208 / 46 84 99 69,<br />
E-Mail: unitas@unitas.org, kipnrw@aol.com<br />
Hermann-Josef Großimlinghaus (Bonn), Rheinstraße 12, 53179 Bonn,<br />
Tel. 0228 / 21 14 87, 0228 / 10 32 68 (d), E-Mail: H.Grossimlinghaus@DBK.de<br />
Der Bezugspreis der unitas beträgt halbjährlich 2,50 EUR zzgl. Zustellgebühr. Für Mitglieder<br />
des UNITAS-Verbandes ist er im jährlichen Verbandsbeitrag von 60,- EUR enthalten.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers<br />
und der Redaktion dar.<br />
Fotos: Hermann-Josef Großimlinghaus, Jürgen Schmiesing, Helmut Mann, Andy Dohmen,<br />
Reinhold Schönemund, privat<br />
Druck<br />
DZE Druckzentrum, Essen<br />
Redaktionsschluss für die Ausgabe 1/2008: 9. Februar 2008<br />
unitas 3-4/2007<br />
unitas<br />
Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen<br />
katholischen Studentenvereine UNITAS<br />
ISSN-Nr.0344-9769<br />
Editorial<br />
Liebe Leser,<br />
liebe Bundesschwestern<br />
und Bundesbrüder!<br />
1388 ins Leben gerufen, ist die Universität zu Köln eine der ältesten<br />
Europas. Hier lehrten und studierten Albertus Magnus und<br />
unser Verbandspatron Thomas von Aquin. Die vierte Universität<br />
im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation nach Prag, Wien<br />
und Heidelberg wurde 1789 von den Franzosen geschlossen und<br />
1919 wiederbegründet. Doch bis heute zeigt das seit 1392 nachgewiesene<br />
Universitätssiegel die Kölner Stadtpatrone, die Heiligen<br />
Drei Könige oder Weisen, die dem Jesuskind auf dem Schoß seiner<br />
Mutter Maria ihre Reverenz erweisen. Ihr Thron zeigt sie selbst als<br />
„Sedes Sapientiae - Sitz des Weisheit“ – ein Motiv, das uns bereits<br />
auf die kommenden Wochen einstimmen kann.<br />
Das Bild zeigt uns Gottsucher am Ziel: Geführt vom Stern, erreichen<br />
die Gelehrten das Zentrum ihrer Bemühungen. Es ist ihnen<br />
mehr wert als alles andere, als alle Weltklugheit, alles Faktenwissen,<br />
als alle anderen Theorien und Ideen. Alle ihre Talente und<br />
Gaben legen sie am Thron der Weisheit nieder – ein Zeichen<br />
dafür, dass diese nichts gegen das sind, was sie gefunden haben,<br />
dass sie bereits selbst mit viel Größerem beschenkt sind.<br />
Das Motiv lässt uns bereits ins kommende Jahr schauen. Nicht das<br />
Fest Epiphanie allein erwartet uns, auch die Stadt, die einst ihre<br />
Bürgeruniversität unter dieses Zeichen stellte und heute die<br />
Heimat von 85.000 Studenten ist. Bei der nächsten Generalversammlung<br />
im „Heiligen Köln“ lässt sich ein Zeichen für die<br />
oben beschriebene Haltung setzen. Mit einem ambitionierten<br />
Thema und einem vollen Programm laden uns unsere Bundesbrüder<br />
und -schwestern in der Domstadt ein. Alle Hinweise dazu<br />
finden sich in dieser Doppelausgabe. Ganz wichtig: Wegen des<br />
frühen GV-Termins Anfang Mai und der Fünf-Wochenfrist zur<br />
Einreichung der GV-Anträge und Resolutionen bis zum 27.03.2008<br />
ist dringend erforderlich, GV-Anträge bereits im WS 2007/2008<br />
vorzubereiten und zu beschließen.<br />
Eine gute Adventszeit, ein frohmachendes Weihnachtsfest, viel<br />
Freude und Erfolg im Neuen Jahr!<br />
semper in unitate,<br />
Dr. Christof M. Beckmann ( M3, B2, M5 )
Gott mit Dir im Land der Bayern!<br />
ROM/TRIER/MÜNCHEN. Papst Benedikt<br />
XVI. hat am 30. November, dem<br />
Fest des Hl. Andreas, Bundesbruder<br />
Bischof Reinhard Marx von Trier zum<br />
Erzbischof von München und Freising<br />
ernannt. Der Termin des Amtsantritts<br />
stand bei Redaktionsschluss noch<br />
nicht fest.<br />
Für den UNITAS-Verband übermittelte<br />
Verbandsgeschäftsführer Dieter Krüll dem<br />
73. Nachfolger des Heiligen Korbinian noch<br />
am selben Tag herzliche Glück- und Segenswünsche:<br />
„Über diese Auszeichnung durch<br />
den Heiligen Vater und das damit zum<br />
Ausdruck gebrachte Vertrauen sind wir als<br />
Deine Bundesbrüder stolz und dankbar. Wir<br />
sind sicher, dass Du auch in Deiner neuen<br />
Aufgabe ein beeindruckender Zeuge für<br />
unseren Glauben und ein tatkräftiger Repräsentant<br />
unserer Kirche sein wirst. Durch<br />
unseren Einsatz und unser Gebet wollen<br />
wir auch in Zukunft Dein Wirken begleiten<br />
und unterstützen“, erklärte der Verbandsvorstand<br />
in bundesbrüderlicher Verbundenheit<br />
et semper in unitate.<br />
Der ernannte neue Erzbischof in<br />
München ist Nachfolger von Kardinal Friedrich<br />
Wetter (79), der das fast zwei Millionen<br />
Katholiken zählende Erzbistum ein Vierteljahrhundert<br />
lang als Oberhirte geleitet hat.<br />
Benedikt XVI., selbst 1977- 1982 Erzbischof<br />
von München und Freising, setzte ihn für<br />
die Zeit der Sedisvakanz als Apostolischen<br />
Administrator der Erzdiözese ein. Über die<br />
Nachfolge war seit Monaten spekuliert<br />
worden. Auch der Name von Bbr. Marx war<br />
unter anderem genannt worden. Viele allerdings<br />
schlossen eine Berufung aus dem<br />
Norden kategorisch aus – nun ist er der<br />
erste Nicht-Bayer in der 186-jährigen Geschichte<br />
auf dem neben Köln bedeutendsten<br />
Bischofsstuhl in Deutschland. Mit seiner<br />
Ernennung, so die WELT, sei die „derzeit<br />
brisanteste Personalie im deutschen<br />
Katholizismus entschieden.“<br />
„I do my best !“<br />
Er gehe mit großer Offenheit in die bayerische<br />
Landeshauptstadt, machte der<br />
zukünftige Erzbischof selbst am Tag seiner<br />
Ernennung deutlich. Zugleich hoffe er, dass<br />
die Bayern auch einen Westfalen akzeptieren<br />
könnten. „Man lernt ein Bistum und die<br />
Menschen nur kennen, wenn man sie<br />
liebt.“ Das habe er sich auch für München<br />
vorgenommen. Freimütig räumte er ein,<br />
dass ihm in Bayern „eigentlich alles fremd<br />
sei“. Er versicherte zugleich, er habe keine<br />
Vorurteile und fügte hinzu: „I do my best.“<br />
Mit Blick auf sein bisheriges Bistum Trier<br />
sagte Marx, er sei „ein wenig traurig und<br />
wehmütig“ darüber, es verlassen zu müssen,<br />
denn Deutschlands älteste Diözese sei<br />
ihm zu einer zweiten Heimat geworden.<br />
Seine Berufung durch Benedikt XVI. auf den<br />
Münchener Bischofsstuhl nannte Marx<br />
einen großen Vertrauensbeweis, der ihn tief<br />
bewege. Der Wunsch des Papstes sei für ihn<br />
eine „Einladung des Herrn selbst“. Mit seiner<br />
neuen Aufgabe verbunden sind der<br />
Vorsitz in der Freisinger Bischofskonferenz<br />
und in der Regel auch die Kardinalswürde.<br />
„Reinhard Marx wurde am 21. September<br />
1953 in Geseke, Kreis Lippstadt in<br />
Nordrhein-Westfalen geboren und wuchs<br />
unter drei Geschwistern auf. In dem Sohn<br />
eines gewerkschaftlich engagierten Schlossermeisters<br />
vereint sich bodenständige<br />
Frömmigkeit mit echter Neugier auf die<br />
Mitmenschen und ihre Lebenswelten.<br />
Schon als Kleinkind stand sein Berufswunsch<br />
Priester fest, starke Pfarrerpersönlichkeiten<br />
in seinem Heimatort prägten<br />
ihn. Seinen Eltern habe er besonders viel zu<br />
danken, bekannte er einmal im Gespräch<br />
mit der unitas-Redaktion. Wo andere ihre<br />
Zimmer mit Bildern von Pop- oder Sportstars<br />
schmückten, habe er das Bild von<br />
Papst Johannes XXIII. an die Wand gehängt.<br />
Von ihm sind sein Denken und Glauben<br />
nachhaltig beeinflusst, auch von Augustinus,<br />
Thomas von Aquin, Franz von Assisi<br />
und Ignatius von Loyola.<br />
Nach dem Abitur 1972 studierte Reinhard<br />
Marx Theologie und Philosophie in<br />
Paderborn und Paris. 1979 weihte ihn der<br />
Erzbischof von Paderborn, Johannes<br />
Joachim Degenhardt, zum Priester. Nach<br />
zweijähriger Tätigkeit in der Seelsorge in<br />
Bad Arolsen wurde er Geistlicher Rektor<br />
und 1989 Direktor der St.-Klemens-Kommende<br />
in Dortmund, des Sozialinstituts der<br />
Erzdiözese Paderborn. Erzbischof Degenhardt<br />
beauftragte ihn mit der Seelsorge in<br />
der Berufs- und Arbeitswelt.<br />
Bereits 1975 hatte sich Reinhard Marx in<br />
Paderborn der UNITAS Hathumar angeschlossen.<br />
Mit der Fortsetzung des<br />
Studiums 1981-1989 in Münster und<br />
Bochum wurde er bei UNITAS Winfridia<br />
aktiv. Mit seiner Dissertation „Ist Kirche<br />
anders? Möglichkeiten und Grenzen einer<br />
soziologischen Betrachtungsweise“ wurde<br />
er an der Ruhr-Universiät Bochum zum<br />
Doktor der Theologie promoviert. 1996<br />
Professor für Christliche Gesellschaftslehre<br />
an der Katholisch-Theologischen Fakultät<br />
der Universität Paderborn, ernannte ihn<br />
Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof<br />
von Pedena, einem erloschenen Bistum in<br />
Istrien, und zum Weihbischof im Erzbistum<br />
Paderborn. An seinem 43. Geburtstag, dem<br />
21. September 1996, weihte ihn Erzbischof<br />
Degenhardt im Hohen Dom zu Paderborn<br />
zum Bischof und ernannte ihn zum<br />
Bischofsvikar für Gesellschaft, Kultur und<br />
Wissenschaft. Seit 1999 ist Marx Vorsitzender<br />
der von der Deutschen Bischofskonferenz<br />
und vom Zentralkomitee der<br />
deutschen Katholiken gemeinsam getragenen<br />
Kommission „Justitia et Pax“ (Gerechtigkeit<br />
und Frieden). 2001 wurde er in das<br />
Paderborner Metropolitankapitel aufgenommen.<br />
>><br />
unitas 3-4/2007 147
Am 20. Dezember 2001 ernannte Papst<br />
Johannes Paul II. Reinhard Marx zum<br />
Bischof von Trier, wo er zu Ostern, am 1. April<br />
2002, im Dom in sein Amt eingeführt<br />
wurde. Zu seinem bischöflichen Wahlspruch<br />
wählte er „Ubi spiritus Domini ibi<br />
libertas – Wo der Geist des Herrn wirkt, da<br />
ist Freiheit“, ein Wort aus dem 2. Brief des<br />
Apostels Paulus an die Gemeinde von<br />
Korinth. In der Deutschen Bischofskonferenz<br />
führt er den Vorsitz der Kommission<br />
für gesellschaftliche und soziale Fragen<br />
und ist Stellvertretender Vorsitzender der<br />
Kommission Weltkirche.<br />
Bereits 2001, unmittelbar nach seiner<br />
Ernennung zum Bischof von Trier, machte<br />
der ernannte Erzbischof von München und<br />
Freising deutlich: „Zur Kirche, zum<br />
Evangelium, zu Jesus Christus gibt es keine<br />
Alternative.“ Die Menschen müssten wieder<br />
sagen können, sie seien eigentlich<br />
gerne Christen, „nicht gezwungen oder<br />
gelangweilt, sondern mit ganzem Herzen“.<br />
Wie lebendiger Glaube weitergegeben werden<br />
könne, ist für Reinhard Marx eine zentrale<br />
Frage: „Wer Christus nicht gefunden<br />
hat, hat etwas verpasst in seinem Leben.“<br />
Das irdische Leben bekomme erst Tiefe,<br />
Qualität und Würde, „wenn es den Himmel<br />
gibt, wenn Gott existiert und mein Leben<br />
ganz in ihm geborgen ist“, erklärte er in der<br />
Predigt zum Osterfest 2007. Ohne den Blick<br />
auf den Himmel würde Europa nicht nur<br />
den Glauben, sondern auch seine kulturellen<br />
Grundlagen verlieren. Menschliche<br />
Kultur entstehe dann, wenn der Blick über<br />
das Irdische, Sichtbare und Materielle hinausgehe,<br />
„wenn Transzendenz gewagt<br />
wird“. Nur dann könnten sich Kunst, Musik,<br />
Literatur, Denken, Geist und Leben entwikkeln.<br />
Auch soziales und politisches<br />
Engagement müsse stets spirituell verankert<br />
sein: „Mystik und Politik“, so Marx,<br />
seien für ihn zwei Seiten einer Medaille. Die<br />
katholische Soziallehre, so der Sozialethiker,<br />
interessiere sich grundsätzlich für den<br />
Aufbau einer gerechteren Gesellschaft in<br />
den verschiedenen Lebenswelten der<br />
Menschen. Der Sohn Gottes sei Mensch<br />
geworden, „um uns Menschen den Weg in<br />
das Leben in Fülle zu ermöglichen.“<br />
148<br />
unitas 3-4/2007<br />
Der Mann aus dem Westen<br />
Als „barock und neo-sozial“ in der Presse<br />
charakterisiert, gilt der „Mann aus dem<br />
Westen“ als „umgänglich, schlagfertig, frei<br />
von Berührungsängsten und diskussionsfreudig“.<br />
Erstaunen weckt bei Medienleuten<br />
seine Liebe zu einer guten Zigarre ebenso<br />
wie seine spontane Heiterkeit. Er sei „genervt“<br />
vom „verbreiteten innerkirchlichen<br />
Griesgram“, so der TAGESSPIEGEL.„In grundlegenden<br />
ethischen Fragen sattelfest, um<br />
eine deftige Stellungnahme selten verlegen,<br />
auf Bankenkongressen und im Fernsehen<br />
ebenso präsentabel wie in der Caritas-<br />
Suppenküche, dazu in Rom wohlgelitten“, so<br />
formulierte etwa Daniel Deckers in der FAZ.<br />
Zugleich wird er theologisch, kirchenpolitisch<br />
und vor allem auch liturgisch als konservativ<br />
kategorisiert. Gerne wird verwiesen<br />
auf seine Bonmots: „Wir können doch nicht<br />
von den Meinungsumfragen abhängig<br />
machen, was wir glauben sollen“ oder „Wer<br />
den Zeitgeist heiratet, ist morgen schon<br />
Witwer.“ Nicht vergessen wird sein klares<br />
Wort bei der Suspendierung des Theologieprofessors<br />
Gotthold Hasenhüttl. Marx<br />
habe, so im Portrait des KNA-Chefredakteurs<br />
Ludwig Ring-Eifel, im Bistum Trier<br />
Verwaltung und Seelsorge „mit einer<br />
schneidigen Strukturreform aufgemischt“<br />
und sei dabei mitunter angeeckt. Marx sei<br />
als „Denker des Sozialen kein Umverteilungs-Nostalgiker<br />
nach Art eines „Herz-<br />
Jesu-Marxisten“, vielmehr deckten sich<br />
seine Vorstellungen zum Umbau des Sozialstaats<br />
in Richtung mehr Eigenverantwortung<br />
und Subsidiarität mit Kernaussagen<br />
des neuen CSU-Grundsatzprogramms.<br />
Große Herausforderungen<br />
Ein „handfestes Problem“ hat Reinhard<br />
Marx bereits geklärt: Auch als Münchner<br />
Erzbischof wolle er seine Mitgliedschaft bei<br />
Borussia Dortmund nicht aufgeben, erklärte<br />
er im Bayerischen Rundfunk. Dies sei für ihn<br />
ein Ausdruck „westfälischer Treue“. Zugleich<br />
wollte er nicht völlig ausschließen, auch<br />
noch einem anderen Fußballverein beizutreten.<br />
Er wolle sich nach seinem Umzug zunächst<br />
mal die Münchner Vereine ansehen.<br />
Doch kommen dort auf den neuen Erzbischof,<br />
nur ein Jahr älter als der jüngste<br />
unter Bayerns Bischöfen, der Eichstätter<br />
Benediktiner Gregor Maria Hanke, in Bayern<br />
zweifellos noch ganz andere Herausforderungen<br />
und Entscheidungen zu. Auseinandersetzungen<br />
um Fragen der Zukunft der<br />
katholischen Schwangerenkonfliktberatung,<br />
um das Krisenmanagement zur<br />
Sanierung der Deutschordenswerke, um<br />
den Erhalt der katholischen Universität<br />
Eichstätt-Ingolstadt oder die Neuordnung<br />
der theologischen Fakultäten und die Gestalt<br />
der Laienräte haben hier manche<br />
Narben hinterlassen. Doch auch wenn die<br />
Außensicht zunächst sicher einige Zeit<br />
beanspruchen wird – viele im Verband<br />
haben den unerschütterlichen Glauben und<br />
die Weltzugewandtheit des langjährigen<br />
Verbandsseelsorgers kennengelernt, mit<br />
denen er diese Herausforderungen angehen<br />
wird. Diese Fähigkeiten schätzen nicht nur<br />
die Bundesbrüder, mit denen er die Priestergemeinschaft<br />
ins Leben rief, die sich unter<br />
dem Namen Papst Johannes XXIII. regelmäßig<br />
trifft, das theologische Gespräch, das<br />
Gebet und die Gemeinschaft in besonderer<br />
Weise pflegt. Diese Erfahrung prägt bis<br />
heute auch viele Bundesgeschwister und<br />
die Pilger, die er auf den AGV-Wallfahrten<br />
oft begleitet hat.<br />
Zu seiner UNITAS und ihren Prinzipien<br />
hat sich der zukünftige Erzbischof Reinhard<br />
Marx überall und immer klar bekannt. Er<br />
schätzt ihr Erbe des sozialen Katholizismus,<br />
seine programmatischen Worte zum christlichen<br />
Europa bei der 130. Generalversammlung<br />
in Trier gaben der Verbandsarbeit eine<br />
größere Dimension. Wenn er nun dem Ruf<br />
des Hl. Vaters nach München folgt, begleiten<br />
ihn die besten Segenswünsche seiner<br />
Bundesschwestern und Bundesbrüder:<br />
„Gott mit Dir im Land der Bayern!“ CB<br />
Das Erzbistum<br />
München und Freising<br />
Das mit mehr als 1,8 Millionen Katholiken<br />
größte unter den sieben bayerischen Bistümern<br />
und neben Köln die bedeutendste<br />
Diözese in Deutschland erstreckt sich<br />
über eine Fläche von 12.000 Quadratkilometern<br />
vorwiegend auf Oberbayern.<br />
Sie ging hervor aus dem Hochstift Freising,<br />
das der heilige Bonifatius 739 errichtete.<br />
Nach der Säkularisation 1821 wurde<br />
der Bischofssitz nach München verlegt<br />
und die Erhebung zum Erzbistum verfügt.<br />
Offizielle Bischofskirche ist der<br />
Münchner Liebfrauendom, dazu kommt<br />
aus historischen Gründen als Konkathedrale<br />
der Freisinger Mariendom. Auf dem<br />
Gebiet der Erzdiözese liegen 662 Pfarreien<br />
und 93 Nebenstellen mit knapp<br />
1.100 Priestern. In der Trägerschaft des<br />
Erzbistums befinden sich außerdem 19<br />
Schulen. Bistumspatron ist der heilige<br />
Korbinian, der im 8. Jahrhundert das<br />
Christentum nach Altbayern brachte. Seit<br />
der Erhebung zum Erzbistum haben mit<br />
Kardinal Friedrich Wetter 13 Erzbischöfe<br />
die Kirche von München und Freising geleitet,<br />
unter ihnen Kardinal Michael Faulhaber<br />
(1917 bis 1952), Joseph Wendel (1952<br />
bis 1960), Julius Döpfner (1961 bis 1976)<br />
sowie Joseph Ratzinger, der jetzige Papst<br />
Benedikt XVI. (1977 bis 1982).
Das Interview<br />
„SEIT ICH IM NAHEN OSTEN BIN, WEISS ICH ERST<br />
WIRKLICH, WIE GUT ES UNS IN DEUTSCHLAND GEHT.“<br />
Bbr. Thomas Birringer ist Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-<br />
Stiftung für die Palästinensischen Autonomiegebiete. Sein Büro hat er in<br />
Ramallah im Westjordanland. In einem Interview für die UNITAS äußert<br />
er sich aktuell zu seinen Aufgaben, den Perspektiven im Nahost-Konflikt,<br />
aber auch zu persönlichen Fragen im Blick auf sein Arbeitsfeld.<br />
Die Fragen stellte Bbr. Hermann-Josef Großimlinghaus<br />
? Thomas,<br />
Du leitest das Auslandsbüro<br />
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in<br />
Ramallah. Es gibt sicher attraktivere<br />
und weniger risikobehaftete Auslandsvertretungen<br />
der KAS. Was hat Dich<br />
bewogen, gerade diese Herausforderung<br />
anzunehmen?<br />
Der Posten in Ramallah ist gar nicht so<br />
unattraktiv. Die Mischung aus außenpolischer<br />
Beratung und „politischer Entwicklungshilfe“,<br />
die für die Arbeit eines Auslandsbüros<br />
der KAS überall auf der Welt<br />
kennzeichnend ist, ist hier besonders ausgeprägt.<br />
Eigenständig politisch arbeiten in<br />
einer Region, die im Mittelpunkt des Interesses<br />
steht, ist schon eine Herausforderung.<br />
Gerade auf diese Eigenverantwortlichkeit<br />
kam es mir aber an, nachdem ich in<br />
unterschiedlichen Tätigkeiten in der Politik<br />
und bei einem Wirtschaftsverband das<br />
Handwerkszeug dafür gelernt hatte. Als<br />
Volkswirt mit Entwicklungsländerschwerpunkt<br />
hat mich der Nahe Osten dabei<br />
schon lange interessiert.<br />
? Was<br />
will die KAS mit ihrer Arbeit in den<br />
palästinensischen Autonomiegebieten<br />
erreichen und wie setzt sie diese Ziele<br />
um?<br />
Zunächst einmal wollen wir zu einer<br />
friedlichen Beilegung des Konfliktes zwischen<br />
Israel und den Palästinensern beitragen.<br />
Hierfür haben wir als Deutsche eine<br />
besondere Verantwortung, aber es ist auch<br />
im Interesse einer Verständigung zwischen<br />
dem Westen und der arabischen Welt. Dazu<br />
gehört für uns nicht zuletzt, beim Aufbau<br />
eines lebensfähigen palästinensischen Gemeinwesens<br />
zu helfen, mit individueller<br />
Freiheit, rechtsstaatlichen Strukturen, Demokratie<br />
und Marktwirtschaft. Das ist im<br />
Interesse der Palästinenser wie auch Israels.<br />
Wir tun dies mit verschiedenen lokalen<br />
Partnern zusammen. Die Arbeitsfelder reichen<br />
von der Beratung und Beobachtung<br />
des Parlaments, dem Justizsektor (Aus-<br />
bildung von Richtern und Staatsanwälten<br />
sowie rechtspoltische Arbeit im Bereich der<br />
Rechtsvereinheitlichung) über Korruptionsbekämpfung,<br />
Meinungsforschung und der<br />
Weiterbildung von Kommunalpolitikern<br />
auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips<br />
bis hin zum Aufbau eines Jugendparlaments<br />
und der Förderung einer unabhängigen<br />
Medienlandschaft. Schließlich<br />
fördern und beraten wir den führenden<br />
Wirtschaftsverband im Hinblick auf das<br />
Konzept der sozialen Marktwirtschaft und<br />
wollen so zur Verbesserung der ökonomischen<br />
Bedingungen beitragen – eine wichtige<br />
Stütze jeder friedlichen Entwicklung.<br />
? Zurzeit<br />
müssen die Menschen in den<br />
Palästinensergebieten mit zwei Konflikten<br />
leben. Einmal dem internen<br />
Konflikt zwischen Hamas und Fatah,<br />
zum anderen dem andauernden Konflikt<br />
mit Israel. Hinzu kommt, dass<br />
beide Regierungen derzeit relativ<br />
schwach sind. Kann es vor diesem Hintergrund<br />
zu einer ernsthaften Wiederbelebung<br />
des Friedensprozesses kommen?<br />
Gibt es überhaupt realistische<br />
Perspektiven für eine Friedensregelung?<br />
Die Analyse stimmt, beide Regierungen<br />
sehen zunächst schwach aus und die palästinensische<br />
beherrscht zudem nur einen<br />
Teil des Landes. Man könnte noch die<br />
Schwäche der amerikanischen Regierung<br />
hinzu addieren und die Lage sähe noch<br />
düsterer aus. Aber der Zustand auf beiden<br />
Seiten bietet auch Chancen: Hintergrund<br />
ist zunächst die arabische Friedensinitiative.<br />
Die arabischen Nachbarstaaten Israels<br />
bieten dem Land zum ersten Mal wirklichen<br />
Frieden an – wenn man sich mit den<br />
Palästinensern einigt. Auch die Araber rükken<br />
zusammen in Anbetracht der drohenden<br />
iranischen Atombombe. Für Israel ist<br />
Iran die eigentliche strategische Herausforderung.<br />
Dieser kann man besser begegnen,<br />
wenn die Probleme vor der Haustür<br />
gelöst sind.<br />
Bbr. Thomas Birringer<br />
geb. am 07.06.1968 in Trier<br />
1987 Abitur<br />
1987 - 1989 Ausbildung<br />
zum Bankkaufmann<br />
1989 - 1990 Wehrdienst<br />
1990 - 1997 Studium der Volkswirtschaftslehre<br />
und der Politikwissenschaften<br />
an der Universität Trier und<br />
der Loughborough University of<br />
Technology (England)<br />
1997 Diplom-Volkswirt<br />
1997 - 1999 Wissenschaftl. Mitarbeiter<br />
an der Universität Trier,<br />
Lehrstuhl für Europäische Wirtschaftspolitik<br />
1999 - 2001 Referent in der Thüringer<br />
Staatskanzlei, Erfurt, Abt.<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Tätigkeit als<br />
Redenschreiber<br />
2001 - 2005 Referent beim Bundesverband<br />
deutscher Banken, Berlin,<br />
Hauptgeschäftsführerbüro und<br />
Grundsatzfragen<br />
Seit Juni 2005 Landesbeauftragter<br />
der Konrad-Adenauer-Stiftung für<br />
die Palästinensischen Autonomiegebiete,<br />
Ramallah<br />
Am 1.2.1992 bei der UNITAS<br />
Trebeta Trier recipiert und dort<br />
am 14.04.1997 auch philistriert<br />
unitas 3-4/2007 149<br />
>>
Auch der israelische Ministerpräsident<br />
Olmert selbst könnte die Friedensverhandlungen<br />
in Annapolis nutzen wollen, um<br />
endlich Profil zu gewinnen, nicht länger nur<br />
als Machtpolitiker ohne Programm zu gelten.<br />
Und die offizelle Regierung der Palästinenser<br />
in Ramallah unter Premierminister<br />
Salam Fayyad ist die pragmatischste und<br />
friedensorientierteste Führung, die die<br />
Palästinenser je hatten. Mit dieser Technokratenregierung<br />
ist mehr machbar, als es<br />
mit Fatah und erst recht mit Hamas möglich<br />
wäre. Letztere hat freilich den Gaza-<br />
Streifen unter Kontrolle, Abbas hat dort<br />
nichts mehr zu sagen. Doch die Verhandlungen<br />
mit Israel führt ohnehin die PLO,<br />
und die spricht für alle Palästinenser, in<br />
Gaza, der Westbank und im Exil. Ihr Vorsitzender<br />
ist wiederum Mahmoud Abbas.<br />
? Amnesty<br />
150<br />
International hat gerade in<br />
diesen Tagen darauf aufmerksam gemacht,<br />
dass die Eskalation des Machtkampfes<br />
zwischen Hamas und Fatah<br />
die Menschenrechtslage in den palästinensischen<br />
Gebieten massiv verschlechtert,<br />
dass die Zivilbevölkerung<br />
im Gaza-Streifen und im Westjordanland<br />
regelrecht zwischen den Fronten<br />
zerrieben werde. Können die Palästinenser<br />
wieder aus der Sackgasse der<br />
Zweiteilung ihrer Gebiete herauskommen?<br />
Abbas kann die<br />
Macht im Gaza-Streifen<br />
dann zurück gewinnen,<br />
wenn er einen politischen<br />
Horizont aufzeigen<br />
kann. Außerdem<br />
muss er eine Verbesserung<br />
der Lebensbedingungen<br />
der Palästinenser<br />
in Westbank<br />
und Gaza erreichen.<br />
Besonders im Gaza-<br />
Streifen leidet die Zivilbevölkerung<br />
immens.<br />
Etwa drei Viertel der<br />
Menschen dort sind<br />
inzwischen von direkter<br />
ausländischer<br />
Nahrungsmittelhilfe abhängig. So schlecht<br />
ging es den Palästinensern noch nie. Gaza<br />
wird von Israel als feindliches Gebiet eingestuft<br />
und komplett abgeschnitten, so lange<br />
dort Hamas regiert.<br />
Zwischen den Extremisten der Hamas<br />
in Gaza einerseits und der offiziellen Regierung<br />
und Fatah andererseits herrscht<br />
immer noch Funkstille. Kein Wunder, denn<br />
Hamas hatte bei ihrer Machtübernahme in<br />
Gaza viele besonders unbeliebte Fatah-<br />
Milizionäre umgebracht. Die Strategie<br />
scheint nun eher darin zu bestehen, die<br />
Menschen im Gaza-Streifen davon zu überzeugen,<br />
dass sich der moderate Weg aus-<br />
unitas 3-4/2007<br />
zahlt, der in der Westbank bereits beschritten<br />
wird. Dann, so hofft man, hat Hamas<br />
auch in Gaza keine Chancen mehr und spätestens<br />
mit den nächsten Wahlen ist der<br />
Spuk vorbei – sofern Wahlen stattfinden.<br />
? Der<br />
Lateinische Patriarch Michel Sabbah<br />
und sein Koadjutor Erzbischof<br />
Fouad Twal haben jüngst gefordert, die<br />
Hamas als Dialogpartner für eine<br />
Friedenslösung im Nahen Osten einzubeziehen.<br />
Die Bewegung dürfe nicht<br />
marginalisiert werden, sondern man<br />
müsse ihr helfen, ein „gemäßigtes<br />
Ufer“ zu erreichen. Teilst Du diese Meinung<br />
und können die Palästinenser<br />
noch zu einer „Regierung der Nationalen<br />
Einheit“ finden, die auch von Israel<br />
als Verhandlungspartner akzeptiert<br />
werden kann?<br />
Die gewaltsame Machtübernahme der<br />
Hamas in Gaza war letztlich ein Putsch der<br />
Islamisten gegen sich selbst, denn sie<br />
waren ja an der damaligen „Regierung der<br />
nationalen Einheit“ beteiligt und stellten<br />
den Ministerpräsidenten. Vor diesem<br />
Putsch gab es zu dieser Frage noch eine<br />
ernsthafte Diskussion. Damals dachten<br />
viele, man könne Hamas durch Beteiligung<br />
und Gespräche in die moderate Richtung<br />
hinüberziehen. Ich hatte auch damals<br />
Bbr. Thomas Birringer (rechts) mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses<br />
des Deutschen Bundestags Ruprecht Polenz (Mitte).<br />
schon Zweifel: Viele gute Worte von Hamas-Leuten<br />
hatten auch taktische Hintergründe.<br />
Hamas ist Teil einer gesamtislamistischen<br />
Bewegung. Die werden nicht<br />
einfach ihre Ideologie verabschieden, sondern<br />
allenfalls ihre Taktik ändern. Und nun,<br />
durch den Putsch in Gaza, die Morde dort<br />
und die Unterdrückung von Pressefreiheit<br />
und Opposition jetzt in Gaza, disqualifiziert<br />
Hamas sich fortlaufend selbst.<br />
Die Möglichkeit, dass Hamas sich<br />
soweit bewegt, Israel anzuerkennen, sehe<br />
ich daher auf absehbare Zeit nicht. Das<br />
wäre aber Voraussetzung für einen ernsthaften<br />
Dialog.<br />
? Wie<br />
stark schätzt Du das Potenzial und<br />
den Einfluss der Islamisten unter den<br />
Palästinensern ein?<br />
Bei den – wirklich freien und fairen –<br />
Parlamentswahlen im Januar 2006 hat die<br />
Hamas zwar die absolute Mehrheit der<br />
Sitze erreicht, das aber wegen des Wahlrechts<br />
mit „nur“ 46 Prozent der Stimmen.<br />
Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung geförderten<br />
und recht verlässlichen Umfragen<br />
zeigen: Davon waren etwa die Hälfte<br />
Proteststimmen: Wähler, die der als korrupt<br />
geltenden Fatah einen möglichst wirksamen<br />
Denkzettel verpassen wollten.<br />
Damit bleiben als wirkliches Potenzial<br />
der Islamisten etwa 25 Prozent, rund ein<br />
Viertel der Palästinenser. Daran dürfte sich<br />
seit den Wahlen auch nicht viel geändert<br />
haben, denn diese Leute machen ihre Einstellung<br />
nicht von tagespolitischen Ereignissen<br />
abhängig. Ein Viertel ist zwar keine<br />
Mehrheit, aber es sind immer noch Viele,<br />
deutlich mehr als vor wenigen Jahren.<br />
Tendenz weiter steigend.<br />
? Seit<br />
den Osloer Verträgen von 1994 ist<br />
der Friedensprozess kaum vorangekommen.<br />
Jetzt scheint wieder etwas<br />
Bewegung in die Sache zu kommen.<br />
Gibst Du diesen Bemühungen eine<br />
neue Chance? Kann in der<br />
Schwäche beider Seiten auch eine<br />
Chance liegen? Und: Welche<br />
Rollen können Deutschland und<br />
die EU dabei spielen?<br />
Ja, in der Schwäche kann eine<br />
Chance liegen. Olmert muss sich<br />
profilieren, Abbas etwas vorweisen.<br />
Vielleicht ist es auch gar nicht<br />
schlecht, dass alle mit sehr niedrigen<br />
Erwartungen zu der<br />
Konferenz von Annapolis fahren.<br />
Dann ist man auch nicht so<br />
schnell enttäuscht. Dieses Heft<br />
der „<strong>Unitas</strong>“ wird wohl nach<br />
dem Gipfeltreffen in den USA erscheinen,<br />
dann wissen die Leser<br />
mehr als ich jetzt. Die Chancen<br />
sind durchwachsen, aber vorhanden.<br />
Auf jeden Fall haben<br />
Deutschland und die Europäische Union ein<br />
lebhaftes Interesse daran, diesen Konflikt<br />
beizulegen, damit er nicht zu uns herüberschwappt.<br />
Daher sollten wir uns entsprechend<br />
engagieren. Deutschland genießt<br />
auf beiden Seiten hohe Glaubwürdigkeit.<br />
Und wir sollten unser politisches Gewicht,<br />
und nicht unser Geld dabei in die Waagschale<br />
werfen.<br />
? Immer<br />
mehr, vor allem jüngere Menschen<br />
in den Palästinensergebieten<br />
und auch in Israel sehen keine<br />
Hoffnung mehr für einen baldigen<br />
Frieden; sie wollen das Land verlassen.
Dazu gehören auch viele Christen. Wie<br />
kann man den Exodus aufhalten?<br />
Wenn die Menschen dort ein gutes und<br />
sicheres Leben führen können, dann bleiben<br />
sie, ganz einfach. Zu einem guten<br />
Leben gehörten wirtschaftliche Perspektiven<br />
und ein politischer Horizont der<br />
Stabilität. Und dazu gehört die Freiheit, sich<br />
zu entfalten: ökonomisch, politisch und<br />
nicht zuletzt religiös.<br />
Die Christen im Heiligen Land sind inzwischen<br />
eine kleine Minderheit. Von einst<br />
fast 30 Prozent vor 60 Jahren<br />
ist ihr Bevölkerungsanteil<br />
unter den Palästinensern<br />
auf etwa drei Prozent<br />
gesunken. Gründe sind<br />
vor allem die höhere Geburtenrate<br />
bei den Moslems<br />
und die Auswanderung.<br />
Die christlichen Palästinenser<br />
stellen oft die bildungsbürgerlicheMittelschicht<br />
dar. Sie können als<br />
Ärzte oder Lehrer leichter<br />
weggehen als andere. Aber<br />
sie würden eben auch dringend<br />
gebraucht, als moderater,<br />
stabiler Kern der<br />
Gesellschaft. Schließlich<br />
war Palästina nicht zuletzt<br />
wegen der vielen Christen<br />
immer ein Brückenland zwischen<br />
Europa und der arabischen<br />
Welt.<br />
Inzwischen gibt es aber<br />
einen Teufelskreis: Je kleiner<br />
die Minderheit ist, desto unangenehmer<br />
wird es, ihr anzugehören. Auch wenn diese<br />
nicht im eigentlichen Wortsinn verfolgt<br />
wird. Immer mehr Christen gehen, weil sie<br />
einer schrumpfenden Gemeinschaft angehören.<br />
Wenn sich dies so fortsetzt, werden<br />
die Heiligen Stätten der Christenheit bald<br />
zu einem „Disneyland“ ohne einheimische<br />
Gemeinden.<br />
? Als<br />
Christen muss uns das Heilige Land,<br />
das Ursprungsland unseres Glaubens,<br />
natürlich besonders am Herzen liegen.<br />
Können wir als katholische Studentenverbände<br />
einen – wie auch immer gearteten<br />
– Beitrag leisten, den Menschen<br />
im Heiligen Land zu helfen und wieder<br />
eine lebenswerte Zukunft in ihrer<br />
Heimat zu bieten?<br />
Natürlich liegt der Schlüssel zu einer<br />
besseren Zukunft in einer politischen Lösung.<br />
Und dazu können wir ja durchaus<br />
einen Beitrag leisten. Ich glaube, wir sollten<br />
uns, jeder in seinem Beruf und seinem<br />
Umfeld, dafür einsetzen, dass der Nahostkonflikt<br />
nicht immer weiter abgeschrieben<br />
oder von Fundamentalisten instrumentalisiert<br />
wird. Ein resigniertes „Die eini-<br />
gen sich sowieso nie“ wäre das Schlimmste.<br />
Außerdem gibt es eine Menge einzelner<br />
Projekte, die den Christen im Heiligen Land<br />
zu Gute kommen. Nicht zuletzt einige deutsche<br />
Einrichtungen sorgen im Kleinen dafür,<br />
dass die Menschen sich nicht verlassen<br />
fühlen. So unterhält der katholische<br />
Deutsche Verein vom Heiligen Land beispielsweise<br />
nicht nur Pilgerhäuser, sondern<br />
auch eine Mädchenschule in Ost-Jerusalem<br />
und ein Pflegeheim in einem Nachbarort.<br />
Dazu kommt, dass besonders viele<br />
Christen in Jerusalem und Bethlehem vom<br />
Der Saarländische Ministerpräsident Peter Müller (3.v.l.) zu Gast<br />
bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah.<br />
Tourismus leben. Jede Pilgerreise ist auch<br />
ein Stück Solidarität. Vor allem aber lohnt<br />
sich ein Besuch!<br />
? Die<br />
KAS bietet Studierenden die Möglichkeit,<br />
für zwei bis drei Monate ein<br />
Praktikum in ihrem Länderbüro in Ramallah<br />
zu absolvieren. Was können<br />
Studenten hier Besonderes lernen und<br />
ist ein solcher Aufenthalt mit Risiken<br />
behaftet?<br />
Wenn man sich vorsichtig verhält und<br />
bestimmte Orte meidet, ist der Aufenthalt<br />
nicht gefährlich. Derzeit ist es in Ramallah<br />
sehr sicher.<br />
Unter den Bedingungen eines solchen<br />
Konfliktes zu arbeiten, schult meiner Meinung<br />
nach die Urteilsfähigkeit und man<br />
lernt, komplizierte politische Zusammenhänge<br />
zu analysieren. Außerdem kann man<br />
eine Menge erleben, als politisch interessierter<br />
Mensch mitten im Nahostkonflikt,<br />
als Deutscher in Israel und Palästina, als<br />
Europäer im Orient und als Christ im<br />
Heiligen Land. Mich jedenfalls hat das Land<br />
nach meinem ersten Besuch nicht mehr<br />
losgelassen.<br />
Wir sind auf jeden Fall offen für Interessierte,<br />
die das Grundstudium hinter sich<br />
haben in Fächern wie Politikwissenschaft<br />
oder Nahoststudien, aber auch Wirtschaft,<br />
Jura und anderen verwandten Fachrichtungen.<br />
Und zwei bis drei Monate sollte so<br />
ein Praktikum schon dauern, man braucht<br />
Einarbeitungszeit. Schließlich werden unsere<br />
Praktikanten voll in die Arbeit des<br />
Büros integriert.<br />
? Wir<br />
befinden uns in der Adventszeit<br />
und Weihnachten, das Fest des Friedens,<br />
ist nun nicht mehr<br />
fern. Bethlehem, der Geburtsort<br />
Jesu, ist nur wenige<br />
Kilometer von Ramallah<br />
entfernt. Welche besonderen<br />
Gefühle und Gedanken<br />
bewegen Dich vor<br />
Ort in dieser Zeit?<br />
Bethlehem ist von den<br />
größeren palästinensischen<br />
Städten diejenige mit dem<br />
höchsten christlichen Bevölkerungsanteil.<br />
Alles, was<br />
eben zu den Christen im<br />
Heiligen Land gesagt<br />
wurde, gilt dort in besonderem<br />
Maße. Es wäre schade,<br />
wenn eines Tages zu Weihnachten<br />
in der Geburtskirche<br />
keine Einheimischen<br />
mehr säßen.<br />
Soweit ist es aber nicht.<br />
Daher denke ich an Weihnachten<br />
auch an die Freunde<br />
dort, an der Universität zum Beispiel,<br />
eine christliche Einrichtung, mit der wir zusammenarbeiten.<br />
Ich denke an eine palästinensische<br />
Stadt mit allen ihren Problemen,<br />
wie die fehlende Bewegungsfreiheit der<br />
Menschen. Es ist für Palästinenser nicht<br />
mehr so leicht, aus anderen Landesteilen zu<br />
Weihnachten nach Bethlehem zu fahren.<br />
? Möchtest<br />
Du unseren Bundesschwestern<br />
und Bundesbrüdern zu Weihnachten<br />
einen besonderen Wunsch für die<br />
Festtage mitgeben?<br />
Ich habe ja nicht mein ganzes Leben im<br />
Ausland verbracht, sondern lebe erst seit<br />
zweieinhalb Jahren nicht mehr in Deutschland,<br />
in Europa. Deshalb wünsche ich uns,<br />
dass wir wieder zu schätzen wissen, dass<br />
wir in Deutschland in Frieden und Sicherheit<br />
leben. Seit ich im Ausland, im Nahen<br />
Osten bin, weiß ich erst wirklich, wie gut es<br />
uns in Deutschland und Europa geht;<br />
auch was es heißt, einfach so, ohne<br />
Kontrolle, über Staatsgrenzen fahren zu<br />
können. Vielleicht ist Weihnachten, sind die<br />
Tage der Besinnung eine Gelegenheit, sich<br />
dessen klar zu werden und dafür dankbar<br />
zu sein.<br />
unitas 3-4/2007 151
Vorortsübergabe in Stuttgart<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. MATTHIAS FISCHER<br />
Der 14. Juli 2007 war für die UNITAS<br />
Palatia Darmstadt ein besonderer<br />
Feiertag: Erstmals in seiner Geschichte<br />
übernahm der Verein den<br />
Vorort des UNITAS-Verbandes. Die<br />
feierliche Übergabe von der UNITAS<br />
Frankonia Eichstätt an die Darmstädter<br />
fand in Fellbach-Schmiden bei<br />
Stuttgart statt, und eine große Schar<br />
Bundesgeschwister und Gäste begleitete<br />
dieses Ereignis.<br />
Als Rahmen für die feierliche Vorortsübergabe<br />
wurde das bereits zur Tradition<br />
gewordene unitarische Stuttgarter Gartenfest<br />
genutzt, das seit vielen Jahren von Bbr.<br />
Norbert Scherhag ausgerichtet wird. Es gab<br />
zwei Gründe für die Entscheidung, die<br />
Vorortsübergabe in Stuttgart stattfinden<br />
zu lassen: Zum einen liegt die baden-württembergische<br />
Landeshauptstadt geografisch<br />
in der Mitte zwischen Eichstätt und<br />
Darmstadt. Zum anderen studiert der neue<br />
Vorortspräsident Johannes Günther mittlerweile<br />
nicht mehr in Darmstadt, sondern<br />
in Stuttgart. Um das Amt als Vorortspräsident<br />
für den W.K.St.V. UNITAS Palatia<br />
antreten zu können, ließ Bbr. Günther sich<br />
wieder bei der Palatia in Darmstadt reaktivieren.<br />
Er hat bereits seine Fuxenzeit und<br />
darüber hinaus auch sein Vordiplom als<br />
Aktiver der Palatia in Darmstadt hinter sich<br />
gebracht.<br />
So wurden die Gäste am Samstagnachmittag<br />
bei Kaffee und Kuchen auf den Terrassen<br />
des Maximilian-Kolbe-Hauses auf<br />
das herzlichste willkommen geheißen. Diese<br />
Gelegenheit nutzten viele Bundesschwestern,<br />
Bundesbrüder und Gäste, um<br />
152<br />
unitas 3-4/2007<br />
Die Vorortsübergabe wurde im Rahmen eines feierlichen Kommerses vorgenommen:<br />
Der bisherige Vorortspräsident Christian Schmidt gibt die Verbandsstandarte weiter an seinen<br />
Nachfolger Johannes Günther, der von Verbandsgeschäftsführer Krüll auf seine neue Aufgabe verpflichtet<br />
wird.<br />
sich über die Ereignisse seit dem letzten<br />
Gartenfest auszutauschen. Auch Petrus<br />
war der UNITAS wohl gesonnen: Nach<br />
einem doch bisher recht verregneten Sommer<br />
verdiente das Wetter sich pünktlich<br />
zum Gartenfest endlich das Attribut „sommerlich“.<br />
Bbr. Christian Poplutz, Vorsitzender des<br />
Beirates für Gesellschaftspolitik im UNITAS-<br />
Verband, hielt zum Auftakt einen Vortrag<br />
mit dem Titel „Opus iustitiae pax, der<br />
Friede, ein Werk der Gerechtigkeit (Jes 32, 17)<br />
– Anmerkungen zur Friedenslehre der<br />
Kirche.“ Im Anschluss an dieses hervorragende<br />
Referat fand in der Dreifaltigkeitskirche<br />
in direkter Nachbarschaft zum<br />
Veranstaltungsort der Festgottesdienst<br />
statt. Die Kirche wurde von 1956 bis 1958<br />
erbaut, nachdem insbesondere vertriebene<br />
Katholiken aus dem Sudetenland in das<br />
damalige Dorf Schmiden gekommen waren.<br />
Unter größten Opfern und viel Eigenarbeit<br />
entstand ein stattlicher, wenn auch<br />
bescheidener Bau nach Plänen des Architekten<br />
Otto Linder, die freilich wegen<br />
Geldmangel nur unvollständig ausgeführt<br />
werden konnten. Da die Katholikenzahl in<br />
Schmiden inzwischen auf rund 3500 anstieg,<br />
mussten in der Folgezeit vorrangig<br />
Gemeindezentrum und Kindergarten erstellt<br />
werden, bis die Kirche selbst 1993 bis<br />
1995 gründlich saniert und sakralkünstlerisch<br />
ausgestattet werden konnte.<br />
Der geistliche Beirat des Vorortes<br />
2006/2007, des W.K.St.V. UNITAS Frankonia<br />
Eichstätt, Bbr. Domdekan Klaus Schim-<br />
möller, zelebrierte den Festgottesdienst, bei<br />
dem vier Chargenteams den Altar umrahmten.<br />
Neben dem alten und dem neuen<br />
Vorort, UNITAS Frankonia Eichstätt und<br />
UNITAS Palatia Darmstadt, hatten die<br />
Vereine UNITAS Hohenstaufen Stuttgart<br />
und UNITAS Hetania Würzburg eine<br />
Chargenabordnung gesandt. Neben der<br />
sehr feierlichen Gestaltung der Eucharistiefeier<br />
hat wohl vor allen Dingen die<br />
Predigt Eindruck gemacht. Bbr. Schimmöller<br />
hat versucht, jeden der Anwesenden<br />
an seine persönliche Berufung zu erinnern.<br />
Dabei sei es eben nicht ausreichend,<br />
Mitglied einer katholischen Vereinigung –<br />
wie etwa der UNITAS – zu sein. Vielmehr sei<br />
es nötig, dass ein jeder von uns an jedem<br />
Tag nach seiner ganz eigenen Nachfolge<br />
suche.<br />
Nach der gemeinsamen Eucharistie<br />
rückte der Höhepunkt des Tages näher: die<br />
feierliche Vorortsübergabe im Rahmen des<br />
Festkommerses. Im großen Saal des<br />
Maximilian-Kolbe-Hauses versammelten<br />
sich hierzu ca. 130 Bundesschwestern, Bundesbrüder<br />
und Gäste. Doch bevor Verbandsgeschäftsführer<br />
Dieter Krüll die Verbandsstandarte<br />
an den neuen Vorort übergab,<br />
stand ein weiteres großes Ereignis an.<br />
Die UNITAS Hohenstaufen Stuttgart konnte<br />
im Rahmen der Vorortsübergabe einen<br />
neuen Bundesbruder an die UNITAS binden<br />
und somit einen neuen Fuxen für die<br />
Aktivitas rezipieren. Nachdem dieses Ereignis<br />
mit einem gebührenden Applaus<br />
bedacht worden war, stand nun endlich der<br />
absolute Höhepunkt des Abends an. Zu-
„WER GLAUBT, IST NICHT ALLEIN“ (PAPST BENEDIKT XVI.)<br />
Grundsatzerklärung von Vorortspräsident<br />
Johannes Günther<br />
Als neuer Vorort des UNITAS-Verbandes ist es uns, dem W.K.St.V. UNITAS Palatia<br />
Darmstadt wichtig, dass der Verband nicht nur weiter besteht und wächst, sondern<br />
vielmehr auch, dass der Verband in einer sehr schnelllebigen Zeit weiter an dem festhält,<br />
was ihn von den anderen Studentenverbindungen und -vereinen unterscheidet.<br />
Wesensmerkmal für den UNITAS-Verband und die Unitarier ist ein Leben aus dem<br />
katholischen Glauben heraus, das im Prinzip Virtus grundgelegt ist. Die Ausgestaltung<br />
dieses Grundsatzes findet in den einzelnen Vereinen mehr oder weniger intensiv statt.<br />
Leider ist es oft so, dass das Leben aus dem Glauben zwar gestaltet wird, jedoch von<br />
außen kaum oder gar nicht erkennbar ist. Dadurch verlieren diese Vereine und auch<br />
der Verband stark an Anziehungskraft. Angesichts der momentanen Situation des<br />
UNITAS-Verbandes mit einer zurückgehenden Mitgliederzahl gilt es aber, diese<br />
Außenwirkung zu stärken. Die Inhalte sind zwar vorhanden, sie müssen aber auch<br />
„verkauft“ werden. Aus diesem Grund soll es Ziel unseres Vorortsjahres werden, dafür<br />
zu sorgen, dass die UNITAS gerade auch von Außenstehenden immer mehr als das<br />
erkannt wird, was sie wirklich ist: Eine freundschaftlich verbundene Gemeinschaft von<br />
Studenten und Akademikern, die ihr Studium und ihr Leben nach dem katholischen<br />
Glauben ausrichtet. Zur Erreichung dieses Ziels muss selbstverständlich auch darauf<br />
geachtet werden, dass dieser Kern und diese Inhalte in unserer sehr schnelllebigen Zeit<br />
nicht verloren gehen.Wenn wir junge Menschen dazu bringen wollen, sich an die UNI-<br />
TAS zu binden, dann muss auch klar sein, an was sie sich binden.<br />
Um dieses Gesamtziel zu erreichen, wollen wir Veränderungen auf mehreren<br />
Gebieten anstreben:<br />
� Verstärkte Arbeit in der Außendarstellung des Verbandes<br />
� Verbesserung der Pressearbeit<br />
� Verbesserung der Verbandshomepage und der Vereinsseiten<br />
� Bewahrung der Stärken im Verband<br />
� Das katholische Prinzip darf nicht durchbrochen werden<br />
� Es ist nicht mit der Virtus vereinbar, wenn in einer Stadt zwei oder mehr Vereine<br />
existieren, die am Existenzminimum dahinvegetieren und sich dann noch gegenseitig<br />
bekämpfen<br />
� Katholische Ausrichtung der Verbandsveranstaltungen. (Man darf bei allem Feiern<br />
nicht die Gottesdienste vernachlässigen.)<br />
� Stärkung der „Corporate Identity“<br />
� Bereitstellung eines Designs von Seiten des Verbandes, etwa für Flyer oder Poster,<br />
mit denen die Vereine Kommilitonen zu Veranstaltungen einladen können. Diese<br />
könnten etwa in einem Designwettbewerb von Aktiven (oder AHAH) entworfen<br />
werden.<br />
� Ebenso wäre es möglich, einen Wettbewerb für einen kurzen Imagefilm auszurufen,<br />
der in den kostenfreien Internetforen für Kurzfilme verbreitet werden könnte.<br />
Bei alldem muss aber gelten:<br />
„Du kannst mit deinem Leben ein besseres Bekenntnis ablegen als mit deinen Lippen.“<br />
[Oliver Goldsmith, (1728 – 1774)]<br />
nächst dankte Bbr. Dieter Krüll dem alten<br />
Vorort, der UNITAS Frankonia Eichstätt und<br />
insbesondere dem neuen Alt-Vorortspräsidenten<br />
Bbr. Christian Schmidt, der während<br />
seines Vorortsjahres sogar sein Examen<br />
ablegte. Der Vorort UNITAS Frankonia Eichstätt<br />
habe im vergangenen Jahre sehr gute<br />
Arbeit geleistet. Eingerahmt von den<br />
Strophen des unitarischen Bundesliedes<br />
übergab der scheidende Vorortspräsident<br />
die Verbandsstandarte dem Verbandsgeschäftsführer.<br />
Die Standarte wurde dann an<br />
den neuen Vorortspräsidenten des UNITAS-<br />
Verbandes, Bbr. Johannes Günther, weiter<br />
gereicht. Mit den Worten „Ich stelle fest, der<br />
W.K.St.V. UNITAS Palatia Darmstadt ist der<br />
neue Vorort“, besiegelte der Verbandsgeschäftsführer<br />
die Amtsübergabe. Somit<br />
ist die Palatia Darmstadt zum ersten Mal in<br />
ihrer Geschichte Vorort des UNITAS-Verbandes.<br />
Schließlich fand der Abend seinen Ausklang<br />
beim traditionellen Gartenfest der<br />
UNITAS Hohenstaufen Stuttgart. Aufgrund<br />
der stetig steigenden Teilnehmerzahl findet<br />
dieses Gartenfest schon lange nicht mehr<br />
im Garten der Familie Scherhag statt.<br />
Der Vorsitzende des gesellschaftspolitischen<br />
Beirats, Bbr. Christian Poplutz, bei seinem<br />
Festvortrag .<br />
Der Vorsitzende des Altherrenzirkels Stuttgart,<br />
Bbr. Norbert Scherhag, bei seinem Grußwort.<br />
Dieses Jahr konnte durch die Veredlung dieser<br />
Veranstaltung mit der Vorortsübergabe<br />
die größte Teilnehmerzahl seit ihren Anfängen<br />
verzeichnet werden. Mit einem Spanferkel<br />
sowie dem einen oder anderen Kaltgetränk<br />
war für das leibliche Wohl aller Anwesenden<br />
hervorragend gesorgt. Doch<br />
wurden die Kehlen nicht nur von Gerstensaft<br />
befeuchtet, sondern auch dazu genutzt,<br />
studentisches Liedgut zum Besten zu<br />
geben. Einige Bundesbrüder wählten die<br />
Vorortsübergabe und das anschließende<br />
Gartenfest als Rahmen für einen Zipftausch,<br />
wobei an diesem Abend gleich zwei<br />
neue Leibverhältnisse eingegangen wurden.<br />
Nachdem am nächsten Tag die Aufräumarbeiten<br />
abgeschlossen waren, brach<br />
der neue Vorort mit dem „Dienstwagen“ in<br />
ein sicherlich anstrengendes, aber vor allen<br />
Dingen spannendes und lehrreiches Jahr<br />
als oberster Repräsentant des UNITAS-<br />
Verbandes auf.<br />
unitas 3-4/2007 153
„Wenn ein Auto vorbeifährt, hören wir<br />
die Geräusche. So dünn sind die Wände“,<br />
sagt Robert Wessels. Er ist Referent im Katholischen<br />
Büro in Berlin und steht mit den<br />
Teilnehmern des Berlin-Seminars der Arbeitsgemeinschaftkatholischer<br />
Studentenverbände<br />
(AGV) in der Kapelle im Erdgeschoss<br />
des Hauses der Deutschen<br />
Bischofskonferenz an der<br />
Hannoverschen Straße. Als<br />
Wessels diesen Satz sagt,<br />
lächelt er verschmitzt. Kein<br />
Wunder, steckt doch dahinter<br />
mehr als eine bloße Beobachtung.<br />
Es ist gewissermaßen ein<br />
Arbeitsprogramm. Denn wenn<br />
man als katholische Interessenvertretung<br />
in der deutschen<br />
Hauptstadt wahrgenommen<br />
werden will, muss man in der<br />
Tat sehr hellhörig sein. Man<br />
muss mitbekommen, was sich<br />
um einen herum im politischen<br />
154<br />
Die Teilnehmer des „Berlin-Seminars“ der AGV mit Bundesministerin Dr. Annette Schavan (6.v.l.) im Berliner Reichstag. Der UNITAS-Verband war<br />
vertreten durch die Vorortsschriftführer Matthias Fischer (2.v.l.) und Christoph Baumann (2.v.r.), den stv. AGV-Vors. Claus Broekmans (l.), den AGV-<br />
Ehrenvors. Hermann-Josef Großimlinghaus (r.), den AGV-Pressereferenten Sebastian Sasse (3.v.l.) und Lina Brockhaus (5.v.l.). Rechts hinter Annette<br />
Schavan: der AGV-Vorsitzende Markus R. T. Cordemann (CV).<br />
Norbert Lammert: „Ich kenne nichts<br />
Spannenderes als die Politik!“<br />
AGV-DIALOGPROGRAMM WIEDER PROMINENT BESETZT<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. SEBASTIAN SASSE<br />
unitas 3-4/2007<br />
Berlin abspielt. Und man muss wissen, bei<br />
welcher Gelegenheit man sich zu Wort<br />
meldet. Das Katholische Büro verfügt hier<br />
über eine jahrzehntelange Erfahrung. Seit<br />
der Gründung der Bundesrepublik sorgt es<br />
Kanzleramtsminister Dr. Thomas De Maiziére (2.v.l.) im Gespräch mit<br />
Vertretern der Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV).<br />
dafür, dass die Stimme der Deutschen<br />
Bischofskonferenz bei allen wichtigen<br />
Gesetzgebungsverfahren gehört wird. Denn<br />
wenn man etwas erreichen will, muss man<br />
dort präsent sein, wo die Entscheidungen<br />
getroffen werden. – Kein<br />
schlechter Tipp zu Beginn des<br />
Seminars, schließlich wollen<br />
auch die Spitzen der katholischen<br />
Korporationsverbände<br />
bei ihren Gesprächen mit Vertretern<br />
aus Politik, Kirche und<br />
Medien ihre Positionen glaubwürdig<br />
vermitteln.<br />
„Wir betreiben hier Lobbyarbeit.<br />
Über die Jahre haben<br />
wir in diesem Feld viel Kompetenz<br />
erworben. Der Erfolg<br />
unserer Arbeit hängt von der<br />
Qualität unserer Argumente<br />
ab. Das wissen unsere Gesprächspartner<br />
zu schätzen“,<br />
beschrieb Wessels die Strategie
Kompetente Gesprächspartner beim Dialogprogramm der<br />
AGV: (von oben) der stellv. Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios<br />
und Publizist Peter Hahne (links daneben der stv. AGV-<br />
Vorsitzende Bernd Schulte (KV), Bundestagspräsident Dr.<br />
Norbert Lammert (rechts daneben der stv. AGV-Vorsitzende<br />
Bbr. Claus Broekmans) sowie der Direktor der Stiftung<br />
Wissenschaft und Politik Prof. Dr. Volker Perthes und seine<br />
Mitarbeiterin Dr. Susanne Dröge.<br />
des Verbindungsbüros. Humorvoll und<br />
anhand vieler Anekdoten erläuterte er, wie<br />
man professionelle Lobbyarbeit betreibt.<br />
De Maziére: „Wir können nichts<br />
schlechter gebrauchen, als<br />
erstklassige Fachidioten!“<br />
Dass die AGV ebenfalls über einen guten<br />
Namen in der deutschen Hauptstadt verfügt,<br />
zeigte sich bei allen Gesprächen, die sie<br />
mit Vertretern aus Politik, Kirche und Medien<br />
in diesen Tagen führte. „Sie sind aber<br />
gut vorbereitet“, lobte denn auch Kanzleramtsminister<br />
Dr. Thomas de Maiziére (CDU)<br />
die Diskussionskultur der Studenten. Und in<br />
der Tat, die Palette der Themen, die von den<br />
Verbandsvertretern angesprochen wurden,<br />
war vielfältig. Sie reichte von den Auswirkungen<br />
der Globalisierung über eine<br />
Bilanz der EU-Ratspräsidentschaft bis hin zu<br />
den Herausforderungen des<br />
Klimawandels. De Maiziére ließ<br />
es sich zum Schluss aber auch<br />
nicht nehmen, einen konkreten<br />
Rat an die Studenten zu geben:<br />
„Blicken Sie über das Studienfach<br />
hinaus. Lieber zwei Semester<br />
mehr studieren, als keine<br />
Erfahrung haben. Wir können<br />
nichts schlechter gebrauchen,<br />
als erstklassige Fachidioten.“<br />
Hier sehe er auch eine wichtige<br />
Aufgabe für die Verbände, den<br />
Horizont ihrer Mitglieder zu<br />
erweitern. Besonders wichtig<br />
sei es, den natur- und ingenieurwissenschaftlichenNachwuchs<br />
zu stärken.<br />
AGV: Stichtag beim<br />
Stammzellengesetz<br />
nicht verschieben<br />
Im Gespräch mit Bundesforschungsministerin<br />
Dr. Annette<br />
Schavan (CDU) zeigten<br />
die AGV-Vertreter sich besorgt<br />
über die gegenwärtige Diskussion,<br />
einen neuen Stichtag<br />
für die Einfuhr und Verwendung<br />
embryonaler Stammzellen<br />
festzulegen. Stattdessen<br />
sprachen sie sich dafür aus, am<br />
bisherigen Stichtag festzuhalten<br />
und die Förderung der<br />
ethisch unbedenklichen Forschung<br />
an adulten Stammzellen<br />
zu verstärken. Jede Embryonen<br />
verbrauchende Forschung<br />
ist nach Auffassung der<br />
AGV ethisch bedenklich.<br />
Schavan erklärte, sie sei innerlich<br />
sehr zerrissen, werde<br />
aber nach reiflicher Überlegung<br />
für eine Verschiebung des<br />
Stichtages beim Stammzellengesetz<br />
plädieren. Ein Bekenntnis, das die<br />
Ministerin dann einige Tage später in einem<br />
Interview mit der Tageszeitung<br />
„Die Welt“ der<br />
breiten Öffentlichkeit<br />
mitteilte. Ihre Begründung:<br />
Man befände sich<br />
in einem „ethischen Dilemma“.<br />
Denn um in der<br />
Forschung mit adulten<br />
Stammzellen Fortschritte<br />
erzielen zu können, benötige<br />
man embryonale<br />
Stammzellen. Gleichwohl<br />
sprach sich Schavan dafür<br />
aus, dass auch weiterhin<br />
der Lebensschutz<br />
der wissenschaftlichen<br />
Forschung Grenzen setze.<br />
Sie plädiere für eine Verschiebung<br />
des Stichtages,<br />
solange er in der Ver-<br />
gangenheit liege und keinen Anreiz für den<br />
Verbrauch von Embryonen biete. Bisher gilt<br />
der 1. Januar 2002 als Stichtag. Das bedeutet:<br />
Es dürfen in der Forschung nur<br />
embryonale Stammzellen verwendet<br />
werden, die im Ausland vor diesem Datum<br />
gewonnen worden sind.<br />
Verbände sollen zu<br />
„Studium generale“ beitragen<br />
In ihrem Gespräch diskutierten die<br />
Spitzen der katholischen Korporationsverbände<br />
mit der Ministerin aber nicht nur<br />
über dieses wichtige ethische Thema, auf<br />
ihrer Agenda stand vor allem auch die<br />
Situation an den Hochschulen nach der<br />
großen Studienreform. Hier zeigten sich die<br />
Studenten beunruhigt, dass ihre Mitglieder<br />
über immer weniger Freizeit verfügten, in<br />
der sie sich in den Korporationen sozial engagieren<br />
können. Das Studium, so wurde<br />
deutlich gemacht, sei eine wichtige Phase<br />
der Persönlichkeitsbildung. Persönlichkeit<br />
entwickele man aber nicht in erster Linie bei<br />
Seminaren und in Vorlesungen, sondern vor<br />
allem durch soziale und politische Aktivitäten.<br />
Schavan unterstrich, dass sie diese<br />
Auffassung teile. Auch plädiere sie dafür,<br />
dass Studenten die Möglichkeit bekämen,<br />
über ihre Fachgrenzen hinweg zu blicken.<br />
Die Verbände könnten zu einem solchen<br />
„Studium generale“ einen wesentlichen Beitrag<br />
leisten. Die Ministerin schlug vor, ein<br />
solches Angebot in Zusammenarbeit mit<br />
den Hochschulgemeinden zu machen.<br />
Im Gespräch mit der Beauftragten der<br />
SPD-Bundestagsfraktion für Kirchen und<br />
Religionsgemeinschaften, Kerstin Griese,<br />
wiesen die Vertreter der katholischen Studentenverbände<br />
noch einmal auf den skandalösen<br />
Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD<br />
hin, nach dem nicht nur Mitglieder revanchistischer<br />
Burschenschaften, sondern auch<br />
Angehörige des CV nicht Mitglied der SPD<br />
sein könnten. Zwar sei dieser später – was<br />
den CV betrifft – revidiert worden, doch<br />
zeige sich hier, wie wenig in sozialdemo- >><br />
Die SPD-Kirchenbeauftragte Kerstin Griese betont, wie wichtig der<br />
SPD das Gespräch mit den Kirchen und Glaubensgemeinschaften ist.<br />
unitas 3-4/2007 155
156<br />
Bei strahlendem Herbstwetter blieb auch noch etwas Zeit, bei einer<br />
Bootsfahrt das Regierungsviertel kennen zu lernen – hier auf der Höhe<br />
des Reichstagsgebäudes. Des Weiteren bot das Rahmenprogramm eine<br />
abendliche Führung durch das Kanzleramt und durch das<br />
Reichstagsgebäude mit Besteigen der Kuppel.<br />
kratischen Kreisen über die Geschichte des<br />
deutschen Verbindungswesens bekannt sei.<br />
Griese machte deutlich, dass sie die Ablehnung<br />
nationalistischer Verbindungen<br />
unterstütze, gleichwohl die katholischen<br />
Verbände nicht dazu rechne. Hier müsse<br />
man in Zukunft mehr differenzieren. Ansonsten<br />
zeigte sich Griese den Verbänden<br />
gegenüber aufgeschlossen und ermutigte<br />
sie dazu, ihre Arbeit erfolgreich fortzusetzen.<br />
Die SPD sei in ihrer Programmatik<br />
toleranter und offener geworden, betonte<br />
Griese mit Blick auf das neue Grundsatz-<br />
In der „Ständigen Vertretung“, einer rheinisch<br />
geprägten Restauration am Schiffbauerdamm,<br />
ließen es sich die Vororte nicht nehmen, die<br />
Seminarteilnehmer mit adäquatem Stoff zu<br />
versorgen. Hier zapft der CV-VOP Daniel Eck<br />
persönlich eine Runde Kölsch.<br />
unitas 3-4/2007<br />
programm ihrer Partei.<br />
In dem Text<br />
werde sehr deutlich<br />
gesagt, dass die Sozialdemokraten<br />
sich<br />
zum jüdisch-christlichen<br />
und zum humanistischen<br />
Erbe<br />
Europas und zur<br />
Toleranz in Fragen<br />
des Glaubens bekennen.<br />
WerteorientierteGrundhaltung<br />
Einen Einblick in<br />
die Medienszene der<br />
Hauptstadt erhielten<br />
die Seminarteilnehmer<br />
von Peter<br />
Hahne, dem stellvertretenden Leiter des<br />
Hauptstadtstudios des ZDF. Der bekennende<br />
evangelische Christ Hahne, der<br />
mit seinem Buch „Schluss mit lustig“ mehrere<br />
Monate lang die deutschen Bestsellerlisten<br />
anführte, plädierte für einen<br />
Wertewandel. Die 68er hätten auf ganzer<br />
Linie versagt. Nun<br />
liege es vor allem an<br />
der jungen Generation,<br />
diese Fehler<br />
auszubügeln. Wichtig<br />
sei, dass sich<br />
immer wieder engagierte<br />
Christen zu<br />
Wort meldeten.<br />
Auch in den Medien<br />
seien sie gefordert.<br />
Hahne begeisterte<br />
vor allem durch seinen<br />
mitreißenden<br />
Optimismus. Christen<br />
sollten sich nicht<br />
verstecken, sondern<br />
sich offensiv in der<br />
Öffentlichkeit zu<br />
Wort melden und<br />
die Gesellschaft mitgestalten.<br />
„Ich kenne nichts<br />
Spannenderes als<br />
die Politik“, warb<br />
Bundestagspräsident<br />
Dr. Norbert<br />
Lammert (CDU) für<br />
ein anderes Berufsfeld.<br />
„Ich kann Ihnen<br />
nur raten, sich zu<br />
engagieren“, erklärte<br />
der oberste<br />
deutsche Parlamentarier.<br />
Gleichzeitig<br />
wies er die oft anzutreffende<br />
Klage über<br />
die Politikverdrossenheit<br />
in Deutsch-<br />
land zurück. Er sei davon überzeugt, dass die<br />
große Mehrheit der deutschen Bevölkerung<br />
mit der parlamentarischen Demokratie<br />
zufrieden sei.<br />
Dass man Politik nicht nur als Parlamentarier,<br />
sondern auch als Wissenschaftler<br />
gestalten kann, zeigte Prof. Dr. Volker<br />
Perthes, Leiter der „Stiftung Wissenschaft<br />
und Politik“, in der Diskussion mit den Studenten.<br />
Dieses Institut, durch öffentliche<br />
Mittel finanziert, berät die Bundesregierung<br />
in der Außen- und Sicherheitspolitik. „Wir<br />
sind in unserer wissenschaftlichen Arbeit<br />
aber vollkommen unabhängig. Wir erledigen<br />
keine Auftragsarbeiten“, so der<br />
Nahost-Experte Perthes. Schließlich machte<br />
er deutlich, dass die Politikberatung ein<br />
attraktives Arbeitsfeld für den akademischen<br />
Nachwuchs sei.<br />
Neben diesen interessanten Begegnungen<br />
beeindruckte die Teilnehmer auch<br />
die Magie des Ortes. Ob Kanzleramt oder<br />
Reichstag, die Schaltzentralen der Macht<br />
verströmen eine ganz eigene Ästhetik. Eine<br />
Erfahrung, die man machen muss, wenn<br />
man wissen will, wie und wo in Berlin<br />
politische Entscheidungen zustande<br />
kommen.<br />
Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert (5.v.l.) stellte sich nach dem Gespräch<br />
noch mit den Seminarteilnehmern zum „Gruppenfoto mit Dame.“<br />
Zum Abschluss des Seminars feierte der CV-Seelsorger Domvikar Ulrich<br />
Bonin zusammen mit den Teilnehmern eine Messe in der Kapelle der<br />
Katholischen Akademie.
Die Katholische Akademikerarbeit<br />
Deutschlands (KAD) hat sich auf ihrer Mitgliederversammlung<br />
am 17. Nov. 2007 mit<br />
den Entwicklungen in der Familienpolitik<br />
auseinandergesetzt und dazu folgende<br />
Stellungnahme beschlossen:<br />
„Die KAD begrüßt und unterstützt nachdrücklich<br />
alle Bestrebungen, der Familienpolitik<br />
in Deutschland einen höheren<br />
Stellenwert zu geben. Diese tragen der immer<br />
deutlicher werdenden Erkenntnis Rechnung,<br />
dass unser Gemeinwesen ohne Kinder<br />
und ohne verantwortungsbewusste<br />
Eltern keine gesicherte Zukunft mehr hat.<br />
Das gilt nicht nur für unsere soziale Sicherung<br />
im Rahmen einer Mehr-Generationen-<br />
Solidarität, sondern auch für<br />
alle anderen Bereiche unserer<br />
gesellschaftlichen Entwicklung<br />
wie der Wirtschaft und<br />
der Kultur.<br />
Es ist Aufgabe der Familienpolitik,<br />
die Gründung von<br />
Familien und die Übernahme<br />
von Elternverantwortung<br />
umfassend zu erleichtern und<br />
zu fördern. Dabei muss sie beachten,<br />
dass die Familien<br />
selbst entscheiden können,<br />
wie sie ihre Aufgaben wahrnehmen<br />
und untereinander<br />
aufteilen wollen.<br />
„Politik hat den Menschen<br />
nicht vorzuschreiben,<br />
wie sie leben sollen, sondern<br />
Rahmenbedingungen zu schaffen,<br />
damit junge Menschen – so wie sie es<br />
wollen – sich für Familie entscheiden<br />
können“ (Koalitionsvereinbarung).<br />
Anders als es dieser Grundvorstellung<br />
für eine Familienpolitik in einem demokratischen<br />
Staat und einer pluralen Gesellschaft<br />
entspricht, sieht die KAD bei den<br />
derzeit verfolgten Schwerpunktsetzungen<br />
in der Familienpolitik eine nicht mehr hinzunehmende<br />
Einseitigkeit in der Bevorzugung<br />
erwerbstätiger Mütter und Väter und<br />
eine Vernachlässigung der finanziellen Unterstützung<br />
von Familien, deren selbst erwirtschaftetes<br />
Einkommen nicht ausreicht,<br />
STATEMENT<br />
KAD: Familienpolitik<br />
geht nicht ohne Eltern<br />
mit Kinderlosen in vergleichbaren Lebensverhältnissen<br />
mithalten zu können.<br />
Kinderarmut muss in erster Linie durch<br />
adäquate Familienleistungen bekämpft<br />
werden, nicht durch Propagierung einer<br />
gleichzeitigen Erwerbstätigkeit von Müttern<br />
und Vätern.<br />
Die KAD unterstützt alle Maßnahmen,<br />
die es Familien ermöglichen, ihren Aufgaben<br />
in der Familie auch bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit<br />
gerecht werden zu können.<br />
Die KAD sieht es auch als notwendig an, für<br />
die Vereinbarkeit von Studium und Elternverantwortung<br />
bessere Bedingungen zu<br />
schaffen. Ein bedarfsgerechter Ausbau von<br />
Angeboten der Tagesbetreuung für Kinder<br />
ist auch an Universitäten notwendig.<br />
Die KAD hält es aber für nicht vertretbar,<br />
wenn die Finanzierung von Maßnahmen für<br />
berufstätige Eltern zu Lasten der direkten<br />
Förderung von Familien geht, die ihre Kinder<br />
selbst betreuen und erziehen, wie es bei der<br />
Reduzierung des für zwei Jahre gezahlten<br />
Erziehungsgeldes auf ein Jahr Elterngeld der<br />
Fall war.<br />
Wahlfreiheit setzt nicht nur eine gute<br />
Infrastruktur von Betreuungsangeboten<br />
voraus, sondern auch wirtschaftliche Sicherheit<br />
für Familien, die ihre Elternverantwortung<br />
in einem größeren Umfang ohne<br />
Erwerbstätigkeit oder neben dem Studium<br />
wahrnehmen möchten.<br />
Für die finanzielle Förderung von Familien<br />
muss der Grundsatz, dass Familien umso<br />
stärker zu fördern sind, je geringer das<br />
eigene Einkommen und je größer die Kinderzahl<br />
ist, wieder den gleichen Stellenwert<br />
wie eine an den Opportunitätskosten orientierte<br />
Entlastung der Familien und eine Besserstellung<br />
durch steuerliche Maßnahmen<br />
haben.<br />
Die KAD hält am Ehegattensplitting fest,<br />
weil es der Bedeutung der Ehe ebenso gerecht<br />
wird wie dem Grundsatz einer leistungsgerechten<br />
Besteuerung.<br />
Die KAD hält die Betreuung und Erziehung<br />
von Kindern durch die eigenen<br />
Eltern auch deshalb für besonders förderungswürdig,<br />
weil die Eltern die Verantwortung<br />
für die Vermittlung von Religion<br />
und Lebensvorstellungen tragen, die bei den<br />
Kindern eine tragfähige Grundlage für<br />
eigene Orientierung und das Finden einer<br />
Antwort auf die Sinnfrage des eigenen<br />
Lebens legen. Diese Aufgabe können<br />
öffentliche Betreuungs- und Erziehungsinstanzen<br />
zwar unterstützen,<br />
den Eltern aber nicht<br />
abnehmen.<br />
Je stärker die Angebote<br />
der Betreuung und Erziehung<br />
von Kindern ausgeweitet<br />
werden und je<br />
mehr Zeit die Kinder<br />
außerhalb des Elternhauses<br />
verbringen, desto<br />
wichtiger ist es, dass im<br />
Kernbereich der Erziehung<br />
die Zuständigkeit der<br />
Eltern auch durch die<br />
Förderung ihrer Erziehungskompetenzunterstützt<br />
wird. Deshalb fordert<br />
die KAD alle Bundesländer,<br />
aber auch die<br />
Kirchen auf, der Elternbildung<br />
einen wesentlich höheren Stellenwert<br />
zu geben, als es heute der Fall ist.<br />
Die KAD sieht in der Förderung und<br />
Unterstützung von Familien die zentrale<br />
Aufgabe für die Zukunft von Kirche, Gesellschaft<br />
und Staat. Sie fordert alle Verantwortlichen<br />
auf, in ihren jeweiligen Aufgaben<br />
und Tätigkeitsfeldern ihren Beitrag dazu zu<br />
leisten, dass sich auch in Zukunft junge<br />
Paare in Deutschland ohne unzumutbare<br />
Belastungen und mit Unterstützung ihrer<br />
Mitbürger und Mitbürgerinnen für Kinder<br />
und die Übernahme von Elternverantwortung<br />
entscheiden können.“<br />
unitas 3-4/2007 157
158<br />
Integration – Herausforderung<br />
für unser Gemeinwesen<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. SEBASTIAN SASSE<br />
„40 Jahre lang haben wir<br />
darüber gestritten, ob Deutschland<br />
ein Einwanderungsland ist<br />
oder nicht“, beschrieb Armin<br />
Laschet (CV) die Debatte der<br />
vergangenen Jahrzehnte im<br />
Gespräch mit der AGV. Der nordrhein-westfälische<br />
Minister für<br />
Generationen, Familie, Frauen<br />
und Integration machte deutlich,<br />
dass diese ideologisch<br />
geprägte Diskussion nun aber<br />
vorbei sei und ein Paradigmenwechsel<br />
sich vollzogen habe.<br />
Nordrhein-Westfalen sei auf<br />
diese neue Situation besonders<br />
gut vorbereitet: Laschet ist bis-<br />
unitas 3-4/2007<br />
AGV: KATHOLISCHE STUDENTENVERBÄNDE<br />
KÖNNEN ZU BEWUSSTSEINSWANDEL BEITRAGEN<br />
Integration – es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht dieses Thema in den Medien auftaucht:<br />
Die Bundeskanzlerin lädt zum Integrationsgipfel, der Bundesinnenminister zur<br />
Islam-Konferenz ein. Die Fernseh-Diskussionen sind Legion, in denen Woche um Woche<br />
darum gestritten wird, wie eine angemessene Integrationspolitik auszusehen habe. Und<br />
selbst in den Feuilleton-Spalten der großen Tageszeitungen ist das Thema angekommen.<br />
Doch in diesen Debatten geht es nicht immer sachlich zu, zunehmend beherrscht ein emotionaler<br />
Zug die Diskussionen. Ängste werden offenbar: Der linksliberale Intellektuelle<br />
Ralph Giordano gibt angesichts des geplanten Baus einer Groß-Moschee in Köln-Ehrenfeld<br />
seiner Angst vor einer schleichenden Islamisierung Deutschlands Ausdruck. Vertreter muslimischer<br />
Verbände wiederum sehen ihre Religionsfreiheit gefährdet. Man erkennt: Angesichts<br />
dieser Vielfalt von Meinungen wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten.<br />
Phrasen helfen hier nicht weiter, Orientierung tut not. Hier sind auch die katholischen<br />
Korporationsverbände gefordert. Dieser Herausforderung stellte sich die Arbeitsgemeinschaft<br />
der katholischen Studentenverbände (AGV) im Rahmen ihres Dialogprogramms<br />
vom 12. – 14. Juni bei einem Seminar in Köln, Bonn und Düsseldorf. In Gesprächen mit<br />
Vertretern aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Medien gingen die Spitzen der Studentenverbände<br />
der Frage nach, wie eine angemessene Integrationspolitik auszusehen habe.<br />
Selbst beim Gruppenfoto hat Minister Armin Laschet (vorne in der Mitte)<br />
sein Ohr immer am Puls der Zeit.<br />
her der einzige Integrationsminister<br />
in Deutschland. „Es ist von erheblichem<br />
gesellschaftlichem Interesse, dass Integration<br />
gelingt“, ist der Christdemokrat<br />
überzeugt. Deswegen müsse die Politik<br />
auch alle Kräfte bündeln, um dieses Ziel zu<br />
erreichen.<br />
Eine erste wichtige Etappe sei in Form<br />
des nationalen Integrationsplans erreicht,<br />
der im Rahmen des Integrationsgipfels bei<br />
Bundeskanzlerin Merkel erarbeitet worden<br />
sei. Es dürfe aber auch nicht vergessen<br />
werden, dass es nicht nur darum gehe, die<br />
Integration der bereits hier lebenden Einwanderer<br />
zu gestalten. Auch weiterhin<br />
müsse Deutschland sich darum bemühen,<br />
hochqualifizierte Einwanderer ins Land zu<br />
holen. Der Minister betonte aber auch: „Es<br />
ist ganz klar: Unsere demografischen<br />
Probleme werden wir nicht allein durch Einwanderung<br />
lösen können. Dann müssten<br />
3,4 Millionen junge Menschen in den<br />
nächsten Jahren zu uns kommen. Das ist<br />
unrealistisch.“<br />
Wie aber sieht nun gelungene<br />
Integrationspolitik vor Ort<br />
aus? Laschet betonte, dass die<br />
Politik nur Rahmenbedingungen<br />
setzen könne. Denn letztlich<br />
sei Integration ein Prozess,<br />
der auch mit vielen Gefühlen<br />
verbunden sei, die man nicht<br />
zentral steuern könne. Der<br />
Minister setzt hier auf das Subsidiaritätsprinzip:<br />
Eine wichtige<br />
Rolle käme den kleinen Einheiten<br />
zu. In der Nachbarschaft,<br />
am Arbeitsplatz, im Freundeskreis<br />
oder im Sportverein –<br />
überall dort, wo sich die Menschen<br />
direkt begegneten, könne
auch Integration stattfinden. Diese Entwicklung<br />
müsse von der Politik unterstützt<br />
und durch Begleitmaßnahmen flankiert<br />
werden: Als wichtigsten Punkt nannte<br />
Laschet hier die Sprachförderung. In NRW<br />
werden mittlerweile alle Kinder, bevor sie<br />
eingeschult werden, Sprachtests unterzogen.<br />
So könnten frühzeitig Mängel festgestellt<br />
und behoben werden.<br />
Laschet: Mehr Menschen mit<br />
Migrationshintergrund in den<br />
öffentlichen Dienst<br />
Ein entscheidender Punkt sei schließlich,<br />
dass die Einwanderer sich mit dem<br />
deutschen Staat identifizierten. „In den<br />
USA ist es ganz selbstverständlich, dass bei<br />
einer Einbürgerungsfeier die Flagge gehisst<br />
und die Nationalhymne gesungen wird.<br />
Dahin müssen auch wir kommen“, beschrieb<br />
Laschet sein Ziel. Ebenso sei es<br />
wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund<br />
verstärkt im öffentlichen<br />
Dienst tätig würden – ob als Polizisten,<br />
Lehrer oder Beamte in den einzelnen Behörden.<br />
„Das baut Kontaktschwierigkeiten<br />
ab. Außerdem dienen diese Personen als<br />
Vorbild“, ist sich Laschet sicher.<br />
Nach Ansicht des Ministers kommen<br />
auch den Religionsgemeinschaften besondere<br />
Aufgaben zu: Viele christliche<br />
Kirchengemeinden leisteten einen wichtigen<br />
Beitrag zum interreligiösen Dialog vor<br />
allem mit den Muslimen. Laschet hofft,<br />
dass bald auch mit ihnen ein Staatsvertrag<br />
geschlossen werden kann. Im Moment<br />
stelle jedoch die Tatsache, dass es bei<br />
den Muslimen keine zentrale Organisation<br />
gebe, die als Ansprechpartner dienen<br />
könne, ein Problem dar. Er sei aber sicher,<br />
dass sich dieses Problem in Zukunft lösen<br />
lasse.<br />
Über die Frage, welche Herausforderung<br />
die Integration an die Kirche stellt,<br />
ging es auch in dem Gespräch mit dem<br />
Bischof von Essen, Dr. Felix Genn. Während<br />
der Islam immer stärker werde, nehme die<br />
Bindung vieler Katholiken an ihre Kirche<br />
immer mehr ab.<br />
Der interreligiöse Dialog könne nur<br />
funktionieren, wenn beide Seiten sich<br />
akzeptierten. So berichtete Genn: „Ich habe<br />
eine katholische Schule besucht, wo eine<br />
muslimische Schülerin in der Messe eine<br />
Fürbitte vortragen sollte. Ich habe gesagt,<br />
dass das so nicht funktioniere. Und zwar<br />
aus Respekt vor dem Glauben dieser Muslima.“<br />
Jede Seite müsse die Grenzen, die die<br />
Anhänger der jeweils anderen Religionsgemeinschaft<br />
nicht überschreiten könnten,<br />
anerkennen. Nur auf diese Weise sei ein<br />
echter Dialog möglich.<br />
Um einen solchen Prozess in Gang<br />
setzen zu können, müsse auf katholischer<br />
Zum Rahmenprogramm des Seminars gehörte auch eine Führung<br />
durch die Ausgrabungen unter dem Kölner Dom.<br />
Seite klar sein, was den katholischen Glauben<br />
ausmache. Hier seien jedoch vielfache<br />
Defizite festzustellen. In diesem Zusammenhang<br />
schilderte Genn die Situation in<br />
seinem Bistum: Das Ruhrbistum ist noch<br />
jung und wurde erst 1958 gegründet.<br />
Lebten damals 1,6 Millionen Katholiken in<br />
der Diözese, sind es nun nur noch 940.000.<br />
Die sich daraus ergebenden sinkenden<br />
Kirchensteuereinnahmen machten Umstrukturierungsmaßnahmen<br />
notwendig:<br />
Gemeinden mussten zusammengelegt,<br />
Kirchen geschlossen werden. War bis in die<br />
60er Jahre hinein das katholische Milieu<br />
mit seinen Vereinen und Verbänden in der<br />
Region stark ausgeprägt, sind nun starke<br />
Erosionen zu verzeichnen. Jedes Jahr treten<br />
rund 9.000 Katholiken aus der Kirche aus.<br />
2006 waren es nur 766. Ob sich hier eine<br />
Trendwende andeute, sei aber, so Genn,<br />
noch nicht abzuschätzen. Rund 90 Prozent<br />
der Katholiken besuchten nur noch punktuell<br />
die Messe, der Rest habe einen hohen<br />
Altersdurchschnitt. Angesichts dieser Situation<br />
stelle sich die Frage, wie in Zukunft<br />
kirchliches Leben auszusehen<br />
habe.<br />
Laut Genn stellen<br />
diese Herausforderungen<br />
aber keinen<br />
Grund zur Verzweiflung<br />
dar, vielmehr<br />
böten sie eine Chance,<br />
sich darauf zu<br />
besinnen, was es<br />
eigentlich bedeutet,<br />
katholisch zu sein. Es<br />
sei gut, dass Menschen<br />
heute nicht<br />
mehr nur zur Kirche<br />
gingen, weil es in<br />
ihrem Milieu so üblich<br />
sei, sondern aus freier<br />
Entscheidung. „Ich bin in einem katholischen<br />
Eifeldorf aufgewachsen. Katholisch<br />
zu sein, war da einfach selbstverständlich.<br />
Als einmal ein fremder Knecht ins<br />
Dorf kam, wurde die Bäuerin gefragt:<br />
,Ist der evangelisch?‘ Die Antwort lautete:<br />
,Nein, der ist arbeitslos.‘ Man hat überhaupt<br />
nicht gewusst, was evangelisch sein<br />
bedeutet.“<br />
Genn: Kirche muss flexibler<br />
auf Bedürfnisse der Menschen<br />
eingehen<br />
Diese Zeiten seien nun vorbei. Die<br />
Kirche müsse nach neuen Wegen suchen,<br />
die Menschen anzusprechen. Im Moment<br />
werde vielfach von einer Renaissance des<br />
Religiösen gesprochen. Diese Erfahrung<br />
mache auch er bei vielen Begegnungen, so<br />
der Bischof. In zahlreichen Gesprächen,<br />
auch mit Vertretern der Wirtschaft, erlebe<br />
er, dass diese Menschen ganz konkret nach<br />
Antworten der Kirche auf ihre Fragen >><br />
Bischof Dr. Felix Genn mit den Seminarteilnehmern nach dem Gespräch im Gästehaus der<br />
Deutschen Bischofskonferenz in Bonn.<br />
unitas 3-4/2007 159
suchten: „Ich habe aber die Sorge, dass wir<br />
als Kirche zu biedermeierhaft darauf<br />
reagieren.“ Viele Gemeinden seien zu sehr<br />
mit sich selbst beschäftigt, anstatt sich zu<br />
überlegen, wie sie auf die Menschen<br />
zugehen könnten. „Wenn Jugendliche bis<br />
Sonntagmorgen in der Disko sind, werden<br />
sie nicht morgens in die Messe gehen.<br />
Warum gibt es deswegen am Sonntag<br />
nicht abends noch einmal ein Messe?“, so<br />
Genn. Man müsse lernen, flexibler auf die<br />
Bedürfnisse der Menschen einzugehen. In<br />
Bochum zum Beispiel habe ein Pfarrer<br />
zu einer speziellen Messe für Über-30-<br />
Jährige eingeladen. Die Kirche sei voll<br />
gewesen. Außerdem hätten sich im Anschluss<br />
drei Gesprächskreise gebildet, die<br />
inzwischen zu einer festen Einrichtung<br />
geworden seien.<br />
Im Hinblick auf die katholischen Korporationsverbände<br />
bemerkte der selbst nicht<br />
korporierte Bischof: „Ich habe nie etwas<br />
gegen den Elite-Begriff gehabt. Es kommt<br />
auf eine geistige Elite an, die den Mut hat,<br />
den Glauben nach außen zu tragen.“ Hier<br />
seien die angehenden katholischen Akademiker<br />
in spezieller Weise gefordert: „Sie<br />
werden später in ganz unterschiedlichen<br />
Berufen sein und von dort aus die Gesellschaft<br />
mitgestalten.“<br />
Auch Professor Dr. Michael Rutz (CV),<br />
Chefredakteur des „Rheinischen Merkurs“,<br />
stellte in seinem Gespräch mit der AGV<br />
konkrete Forderungen an die katholischen<br />
Korporationsverbände. Sie hätten eine<br />
wichtige Multiplikatorenfunktion und<br />
müssten dazu beitragen, dass sich in der<br />
deutschen Gesellschaft ein Bewusstseinwandel<br />
vollziehe: „Deutschland ist ein Einwanderungsland<br />
und gleichzeitig ein Auswanderungsland“,<br />
skizzierte Rutz die Lage.<br />
Es reiche nicht mehr aus, in den Kategorien<br />
des Nationalstaates zu denken. Gut<br />
ausgebildete Menschen, also gerade auch<br />
Der Chefredakteur des „Rheinischen Merkur“, Prof. Dr. Michael Rutz<br />
(links), im Gespräch mit Seminarteilnehmern auf der Dachterrasse des<br />
Verlagsgebäudes (in der Mitte: der stv. AGV-Vors. Bbr. Claus Broekmans<br />
und Bsr. Lina Brockhaus).<br />
160<br />
unitas 3-4/2007<br />
Akademiker, würden heute, wenn sie nach<br />
attraktiven Betätigungsfeldern suchten,<br />
nicht mehr an den Ländergrenzen halt<br />
machen. Es herrsche daher ein globaler<br />
Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Die<br />
Korporationsverbände müssten ihre Mitglieder<br />
auf diese neue Situation besser<br />
vorbereiten, als dies bisher geschehe. Auch<br />
forderte er dazu auf, sich für Hochschulreformen<br />
einzusetzen, die Deutschland als<br />
Studienort für qualifizierte ausländische<br />
Studenten attraktiv mache.<br />
Stahl: Studium erfordert<br />
in der Zukunft ein gutes<br />
Zeitmanagement<br />
Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen<br />
Landtagsfraktion, Helmut Stahl,<br />
zeigte gegenüber den Vertretern der<br />
katholischen Studentenverbände auf, wie<br />
sein Bundesland auf diese Herausforderungen<br />
reagiert habe. Die Umstellung auf<br />
das Bachelor-/Master-System habe dazu<br />
geführt, dass die Abschlüsse nun international<br />
vergleichbar seien. „Das ist ein wichtiger<br />
Vorteil im globalen Wettbewerb um<br />
die klügsten Köpfe“, betonte Stahl. „Es ist<br />
deswegen jetzt auch angemessen, dass die<br />
jungen Menschen durch Studienbeiträge<br />
einen eigenen Beitrag leisten.“ Auch dass<br />
das neue Abschlusssystem einen strikteren<br />
Studienablauf vorschreibe, wertete Stahl<br />
als Vorteil: „Die Studenten haben sich zu<br />
allen Zeiten ihre Nischen gesucht. Es<br />
kommt eben auf ein gutes Zeitmanagement<br />
an. Das ist eine wichtige Erfahrung<br />
auch für das spätere Berufsleben“, zeigte<br />
sich der Christdemokrat überzeugt.<br />
Stahl gab ferner einen Einblick in den<br />
Alltag eines Parlamentariers. „Als Vorsitzender<br />
der Regierungsfraktion habe ich<br />
Mehrheiten für bestimmte Zwecke zu<br />
organisieren“, beschrieb Stahl seine Aufgabe.<br />
Dabei sei es<br />
immer schwieriger,<br />
den Spagat zwischen<br />
einer festen Grundsatzüberzeugung,<br />
die<br />
für ihn als Christdemokraten<br />
das christliche<br />
Menschenbild<br />
bilde, und dem legitimen<br />
Anspruch der<br />
Bürger auf eine pragmatische<br />
Politik zu<br />
schaffen. Als Volkspartei<br />
müsse die CDU<br />
alle Menschen ansprechen.<br />
Auch die,<br />
die sich als eher<br />
kirchenfern verstün-<br />
den. Trotzdem setze<br />
er sich dafür ein, dass<br />
die CDU sich zu ihren<br />
christlichen Wurzeln<br />
bekenne. Allerdings<br />
könne man nicht mit<br />
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Stahl<br />
(oben) und der Staatssekretär für Bundesund<br />
Europaangelegenheiten Michael Mertes<br />
erläuterten den Entwurf für das neue CDU-<br />
Grundsatzprogramm.<br />
dem Grundsatzprogramm unter dem Arm<br />
Politik machen. Man müsse die Bürger mit<br />
Argumenten überzeugen.<br />
Mertes: Eine Partei kann<br />
nicht christlicher sein<br />
als die Gesellschaft<br />
Über die Frage, welche Bedeutung dem<br />
„C“ in der Politik der CDU zukommen solle,<br />
diskutierte auch Michael Mertes mit den<br />
AGV-Vertretern. Der NRW-Staatssekretär<br />
für Bundes- und Europaangelegenheiten,<br />
der auch der CDU-Grundsatzprogrammkommission<br />
angehört, machte deutlich,<br />
dass die öffentliche Diskussion über Grundwerte<br />
heute oft unter falschen Vorzeichen<br />
geführt werde. Der Wert der Toleranz werde<br />
hier meist falsch interpretiert. „Es ist keine<br />
Kunst, tolerant zu sein, wenn man keinen<br />
eigenen Standpunkt hat“, so Mertes. Vor<br />
diesem Hintergrund sei es ein deutliches<br />
Zeichen, wenn die CDU in ihrem neuen<br />
Grundsatzprogramm eine klare Stellung<br />
beziehe, indem sie Freiheit, Gerechtigkeit<br />
und Solidarität als ihre Grundwerte be-
Der Terrorismusexperte Rolf Tophoven (2.v.l.), sieht einen Zusammenhang zwischen einer gelungenen<br />
Integrationspoltik und der Vorbeugung gegen Terrorismus.<br />
zeichne. Gleichwohl müsse immer beachtet<br />
werden, dass solche programmatischen<br />
Erklärungen nur die Rahmenrichtlinien für<br />
die praktische Politik bildeten. Hier gelte es<br />
zu bedenken: „Eine Partei kann nicht<br />
christlicher sein als die Gesellschaft.“<br />
Ein ähnliches Problem zeige sich auch in<br />
der Europapolitik. Grundsätzlich stimmten<br />
die Deutschen in ihrer großen Mehrheit<br />
den Grundwerten, die den europäischen<br />
Einigungsprozess geprägt hätten, zu. Nur<br />
der praktischen Umsetzung ständen sie<br />
zunehmend kritisch gegenüber. Von der<br />
deutschen EU-Ratspräsidentschaft seien<br />
allerdings positive Signale ausgegangen.<br />
Gemeinsam mit den Bundesländern habe<br />
sich etwa Bundeskanzlerin Merkel stark für<br />
einen Abbau der Überregulierung, die vor<br />
allem kleinen und mittleren Unternehmen<br />
zusetzen, eingesetzt.<br />
Im Gespräch mit dem Leiter des Essener<br />
Instituts für Terrorismusforschung und<br />
Sicherheitspolitik Rolf Tophoven (CV) ging<br />
es schließlich um die Frage, ob die Integrationspolitik<br />
von den Gefahren, die vom<br />
internationalen Terrorismus auf die westlichen<br />
Gesellschaften ausgehen, beeinflusst<br />
wird. Der Terrorismusexperte stellte<br />
klar, dass auch Deutschland keine Insel der<br />
Glückseligen sei und im Visier des militanten<br />
islamistischen Terrorismus liege;<br />
dies hätten bereits mehrere bei uns vereitelte<br />
Anschläge bewiesen.<br />
Er sieht durchaus einen positiven Zusammenhang<br />
zwischen einer gelungenen<br />
Integration und der Prävention von Terroranschlägen.<br />
„Terroristen reisen heute oft<br />
nicht mehr in westliche Zielländer ein,<br />
sondern werden vor Ort bereits langfristig<br />
rekrutiert und leben unauffällig mitten<br />
unter uns“, stellte Tophoven fest. Desorientierung,<br />
Frustration, Ausgegrenztheit<br />
und andere Enttäuschungen in der westlichen<br />
Welt machten diese Menschen empfänglich<br />
für Hassprediger. Je mehr sich<br />
jedoch Menschen mit Migrationshintergrund<br />
mit unserer Gesellschaftsordnung<br />
identifizieren könnten, je mehr sie unsere<br />
Kultur verstünden, umso schwieriger dürfte<br />
es sein, sie zu radikalisieren und für<br />
Terroranschläge zu gewinnen.<br />
Und Tophoven ist überzeugt: „Die ideologische<br />
Auseinandersetzung mit dem<br />
radikalisierten Islam und seinen Anhängern<br />
muss hier bei uns geführt werden.“ Dies sei<br />
eine riesige Herausforderung, nicht zuletzt<br />
aufgrund der Parallelgesellschaften, in denen<br />
viele Muslime in Deutschland lebten.<br />
„Wir müssen von ihnen fordern, das<br />
politische Virus des Dschihad aus den<br />
Köpfen vieler, besonders junger Muslime zu<br />
vertreiben“, so sein Postulat. Dies verlange<br />
von uns Dialogbereitschaft. Aber auch die<br />
Muslime in unserer Gesellschaft hätten<br />
eine Bringschuld: „Sie müssen beim Aufkeimen<br />
radikaler Tendenzen mit unseren<br />
Sicherheitsdiensten zusammenarbeiten.“<br />
Die Integrationspolitik ist, so wurde den<br />
Teilnehmern des AGV-Seminars in allen<br />
Gesprächen immer wieder verdeutlicht, ein<br />
weites Feld. Aber es wurde auch klar: Diese<br />
Herausforderungen müssen angenommen<br />
werden, denn es geht hier um die Zukunftsfähigkeit<br />
der deutschen Gesellschaft. Zur<br />
Lösung dieser vielfältigen Probleme können<br />
auch die katholischen Studentenverbände<br />
einen Beitrag leisten, indem sie mit auf<br />
einen Bewusstseinswandel hinwirken.<br />
Pax-Bank wirbt um katholische Studenten<br />
Bbr. Winfried Hinzen (vorne in der Mitte), geschäftsführendes Vorstandsmitglied der<br />
Pax-Bank, und Michael Ruland (rechts daneben) informierten den AGV-Vorstand und<br />
die Vertreter der Vororte im Rahmen des Mitte Juni durchgeführten AGV-Seminars in<br />
Köln über das spezielle Angebot der Pax-Bank für Studierende, insbesondere auch<br />
über die Vermittlungsmöglichkeiten von Studienkrediten in Zusammenarbeit mit der<br />
KfW. „Wir bieten professionelle Finanzdienstleistungen mit Mehrwert“, betonte Bbr.<br />
Hinzen. Als katholische Bank für Christen gehe die Pax-Bank auch im Finanzleben<br />
besonders auf die persönlichen Bedürfnisse ihrer Kunden ein und fördere sie auf<br />
vielfältige Weise. „Der Mensch steht bei uns im Vordergrund!“, lautet die Maxime.<br />
Seit nunmehr 90 Jahren sei dieser hohe Qualitätsanspruch und eine zukunftsfähige<br />
Identität auf der Basis christlich-katholischer Werte das Fundament der Kundenbeziehungen.<br />
Die Pax-Bank verfüge über ein interessantes Netzwerk, das künftig<br />
auch jungen Nachwuchskräften aus den katholischen Studentenverbänden zur Verfügung<br />
stehen soll, kündigte Bbr. Hinzen an.<br />
Mehr Infos: www.pax-bank.de Stichwort: „Pax et Studia“<br />
unitas 3-4/2007<br />
161
Einblicke in die Europaregion „Neiße“<br />
ALTHERRENBUNDS-/HOHEDAMENBUNDSTAG IN DER ABTEI ST. MARIENTHAL<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. HEINRICH SUDMANN<br />
1234 von der böhmischen Königin Kunigunde<br />
gegründet, besteht die Zisterzienserinnenabtei<br />
St. Marienthal bis heute ununterbrochen<br />
als Kloster am Ausgang des<br />
Neißetals. Sie liegt in unmittelbarer Nähe<br />
der Grenzen zu Polen und Tschechien.<br />
An diesem geschichtsträchtigen Ort<br />
trafen sich Bundesbrüder und Bundesschwestern<br />
zum diesjährigen Altherrenbunds-/Hohedamenbundstag.<br />
Das Kloster<br />
und die Region bestimmten auch den Inhalt<br />
des thematischen Teils der Tagung:<br />
„Aus der Geschichte Aufbruch in die Zukunft.“<br />
Mit Vorträgen, Besichtigungen und<br />
Gesprächen zur Historie der Region und zur<br />
Entwicklung des Klosters zu einem Internationalen<br />
Begegnungszentrum wurde das<br />
Tagungsthema umgesetzt.<br />
Vom alten Kloster<br />
zum Internationalen<br />
Begegnungszentrum<br />
Mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft<br />
der Abtei machte die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer die Priorin, Sr. M. Hildegard<br />
Zeletzki, Ocist., vertraut. Aus eigenem<br />
Erleben schilderte sie, wie groß die<br />
Herausforderung für die Schwestern war,<br />
sich der Renovierung<br />
und Umwidmung der<br />
alten Wirtschaftsgebäude<br />
des Klosters zu<br />
einem InternationalenBegegnungszentrum<br />
zu stellen. „Wir<br />
haben im Konvent der<br />
Schwestern lange mit<br />
uns gerungen und<br />
dann aber doch diesen<br />
Plänen zugestimmt.“<br />
Es ist sicher gestellt,<br />
dass die Schwestern<br />
von St. Marienthal<br />
durch Einbindung<br />
der Äbtissin und der<br />
Priorin in den Stiftungsrat<br />
und den Vorstand<br />
der Stiftung InternationalesBegegnungszentrum<br />
St.<br />
Marienthal (IBZ) Ent-<br />
162<br />
unitas 3-4/2007<br />
Priorin Sr. Hildegard Zeletzki hat als Dank<br />
für ihren Vortrag über die Zisterzienserinnenabtei<br />
St. Marienthal einen<br />
Blumenstrauß erhalten.<br />
Priorin Sr. Hildegard Zeletzki bei ihrem Vortrag über die Zisterzienserinnenabtei St. Marienthal.<br />
Rechts daneben: die Vorsitzenden von Hohedamen- und Altherrenbund, Bsr. Dr. Claudia Bellen-<br />
Kortevoß und Bbr. Heinrich Sudmann.<br />
scheidungen mitbestimmen und auch ihre<br />
Zielvorstellungen in die inhaltliche Arbeit<br />
einbringen können. Allerdings ist aufgrund<br />
des Alters vieler Schwestern und nur<br />
weniger Neueintritte die Mitwirkung an<br />
der täglichen Arbeit in den Bildungsveranstaltungen<br />
und Begegnungen nur<br />
sehr begrenzt möglich.<br />
Die heutige Nutzung<br />
der Klostergebäude<br />
und die Arbeit<br />
des Internationalen<br />
Begegnungszentrums<br />
vermittelte den Teilnehmern<br />
der Stiftungsdirektor<br />
des IBZ,<br />
Dr. Michael Schlitt. Beeindruckend,<br />
wie aus<br />
einer Idee, die vor allem<br />
von Prof. Dr. Clemens<br />
Geißler, ehem.<br />
Leiter des Instituts für<br />
Entwicklungsplanung<br />
und Strukturforschung<br />
in Hannover,<br />
entwickelt worden ist,<br />
eine Begegnungs- und<br />
Bildungsstätte entstanden<br />
ist, in der im<br />
Jahre 2006 insgesamt<br />
19284 Übernachtungen<br />
gezählt werden<br />
konnten. Das Zentrum<br />
ist zudem von großer wirtschaftlicher Bedeutung<br />
für die Region. Das IBZ hat für 60<br />
Projekte in den Jahren 2006 und 2007 eine<br />
Förderung von 3.757.764 Euro erhalten.<br />
Möglich wurde dieses Werk durch eine<br />
Vernetzung vieler Zuwendungsgeber, die<br />
alle von der Idee einer einmaligen Chance<br />
für die Region und die internationale Begegnung<br />
überzeugt werden konnten. Dazu<br />
zählen u. a. die Deutsche Bundesstiftung<br />
Umwelt, die Deutsche Stiftung Umweltschutz,<br />
weitere Stiftungen, die Sächsische<br />
Staatskanzlei und Landesministerien, das<br />
Bundesministerium für Familie, Senioren,<br />
Frauen und Jugend, die Bundesanstalt für<br />
Arbeit, die Europäische Union, die Bundeszentrale<br />
für politische Bildung und die<br />
regionalen Kreise und Städte.<br />
Dr. Schlitt konnte nicht ohne Stolz<br />
darauf verweisen, dass zur Verwirklichung<br />
der Ziele der Stiftung 2006 und 2007 ca.<br />
170 Veranstaltungen ebenso beitrugen<br />
wie zahlreiche Projekte (PONTES; Bekämpfung<br />
von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit;<br />
Bodenbildung; Außerschulische<br />
Jugendarbeit; Qualifizierung<br />
von Jugendlichen in Schülerfirmen;<br />
Familienbildung, Weiterentwicklung der<br />
Energieökologischen Modellstadt Ostritz,<br />
Chancengleichheit für Männer und Frauen<br />
usw.).
Bbr. Dr. Otto Paleczek gab einen<br />
Überblick über die Geschichte<br />
unitarischen Lebens in Breslau<br />
und Prag.<br />
Region als Basis<br />
für Kooperation<br />
Die geschichtliche Einordnung der<br />
derzeitigen Gestaltung einer europäischen<br />
Nachbarschaft in der Europaregion Neiße<br />
war Gegenstand des einführenden Vortrags<br />
von Bbr. Dr. Raimund Paleczek. In Abgrenzung<br />
zu nationalistischen Tönen aus<br />
Warschau und Prag legte er dar, dass Ostmitteleuropa<br />
in seiner Geschichte nie<br />
monoethnisch, sondern ganz im Gegenteil<br />
polyethnisch geprägt war.<br />
„Die Euroregion Neiße vereint dabei als<br />
einzige ein Gebiet, das drei Staaten mit vier<br />
Amtssprachen umfasst: Deutsch, Polnisch,<br />
Tschechisch, Sorbisch.“ Ausführlich<br />
wurden anhand vieler<br />
Details die historischen Traditionen<br />
und Prägungen benannt,<br />
aus denen die heutige Europaregion<br />
Neiße-Nisa-Nysa erwachsen<br />
ist. Es ist ein Raum, der<br />
kulturell gemeinsame Wurzeln<br />
und Entwicklungen aufweist.<br />
Raimund Paleczek wörtlich:<br />
„Die Identitäten von Landschaft<br />
und Menschen haben Traditionen<br />
geschaffen, die durch das verhängnisvolle<br />
und unmenschliche<br />
Ideologiengemisch von<br />
Nationalismus, Sozialismus und<br />
Kommunismus während eineinhalb<br />
Jahrhunderten zwischen<br />
1850 und 2000 (Jugoslawien,<br />
Kosovo) das Bewusstsein darüber<br />
verschüttet haben. Diese historischen<br />
und für die eigene Identität<br />
bestimmenden Traditionen gilt es, neu<br />
zu entdecken. Das hat man erfreulicherweise<br />
in der Euroregion Neiße schon früh erkannt.“<br />
UNITAS in Breslau und Prag<br />
Einen Einblick in unitarisches Leben in<br />
der Geschichte in diesem Raum gab Bbr. Dr.<br />
Otto Paleczek. Auf der Grundlage von<br />
Bbr. Dr. Raimund Paleczek befasste<br />
sich in seinem Vortrag mit der<br />
Einordnung der Region in eine<br />
europäische Nachbarschaft.<br />
Recherchen von Bbr.<br />
Ottmar Burska stellte<br />
er zunächst die<br />
Entstehung katholischerKorporationen<br />
in Breslau im<br />
19. Jahrhundert dar.<br />
Wenn hier schon<br />
vor 1900 Verbindungen<br />
mit dem<br />
Namen UNITAS entstanden,<br />
handelte<br />
es sich um Vereine<br />
aus dem KV und TCV.<br />
Mit der Gründung<br />
der Guestfalia-UNITAS<br />
1909<br />
in Breslau entstand<br />
dort der erste<br />
UNITAS-Verein. 1919 folgte die Sigfridia-<br />
UNITAS. 1921 wurde mit der Ottonia-UNITAS<br />
ein dritter UV-Verein gegründet, der<br />
allerdings später wieder suspendiert wurde.<br />
Herausragende Persönlichkeit der Breslauer<br />
UNITAS war Kardinal Bertram, dessen<br />
Weg der Referent nachzeichnete. Als<br />
weiteren Bundesbruder aus Breslau stellte<br />
Otto Paleczek Weihbischof Dr. Heinrich<br />
Grzondziel vor.<br />
Mit der Gründung der UNITAS Staffelstein<br />
1922 in Prag entstand auch hier<br />
unitarisches Leben, das noch heute im<br />
Altherren-Verein Praha existiert.<br />
Rege Diskussion: Hier meldet sich Bbr. Dr. Franz Kutny zu Wort.<br />
Die Geschichte der Breslauer UNITAS hat<br />
sich nach dem 2.Weltkrieg in der Guestfalia-<br />
Sigfridia in Frankfurt am Main fortgesetzt.<br />
Verbandsfragen<br />
Wie bei jedem Altherrenbunds-/Hohedamenbundstag<br />
wurden auch in St. Marienthal<br />
Entwicklungen und Ereignisse aus<br />
dem UNITAS-Verband diskutiert. Mit der<br />
Vorsitzenden des HDB, Bsr. Dr. Claudia<br />
Bellen-Kortevoß, Verbandsgeschäftsführer<br />
Bbr. Dieter Krüll und dem Vorsitzenden des<br />
Altherrenbundes, Bbr. Heinrich Sudmann,<br />
diskutierten die Teilnehmer insbesondere<br />
über die Entwicklung der Stiftung UNITAS<br />
150 plus, das mögliche Zusammenspiel<br />
dieser Stiftung mit dem UNITAS-<br />
Bildungswerk, dem Verein für den<br />
Heinrich-Pesch-Preis und dem Hausbauverein<br />
und über das Thema des<br />
nächsten Altherrenbunds-/Hohedamenbundstages.<br />
Der Verbandsgeschäftsführer konnte<br />
einerseits über eine erfreuliche Entwicklung<br />
der Stiftung berichten, deren Kapital<br />
bald die 500.000 Euro erreicht haben<br />
dürfte, musste mit Bedauern aber auch<br />
darauf hinweisen, dass dieser Betrag ganz<br />
überwiegend von einem kleineren Teil der<br />
Mitglieder des Verbandes aufgebracht<br />
worden ist. Er forderte die Teilnehmer auf,<br />
das erste Projekt der Stiftung, „Studienförderung“,<br />
mit der Bereitstellung kostenfreier<br />
Zimmer für Studentinnen und Studenten<br />
zum Anlass zu nehmen, immer<br />
wieder auf die Stiftung UNITAS 150 Plus<br />
hinzuweisen.<br />
Im Hinblick auf mögliche Verwaltungsvereinfachungen<br />
in Bereich von Stiftung<br />
und Zweckvereinen machte der Vorsitzende<br />
des UNITAS-Bildungswerkes, Bbr.<br />
Wolfgang Hener, darauf aufmerksam, dass<br />
auch in – falls notwendig – neuen Strukturen<br />
oder Kooperationsformen<br />
sichergestellt sein<br />
sollte, dass das besondere<br />
Engagement von Bundesschwestern<br />
und Bundesbrüdern<br />
für bestimmte<br />
Schwerpunkte der Verbandarbeit<br />
wie der Verankerung<br />
der Katholischen Soziallehre<br />
im UNITAS-Verband erhalten<br />
bleibt.<br />
Die Teilnehmer sprachen<br />
sich dafür aus, den Beschluss<br />
der Trierer Generalversammlung<br />
aufzugreifen, und das<br />
Thema „Europa“ in die Veranstaltungen<br />
des Verbandes zu<br />
integrieren. Es wurde unterstrichen,<br />
dass eine größere<br />
Attraktivität des Verbandes<br />
erreicht werden könnte, wenn<br />
seine Arbeit durch bestimmte<br />
Inhalte breiter vermittelt würde.<br />
Einladung nach Stuttgart<br />
Der Altherrenbunds/Hohedamenbundstag<br />
2008 findet vom 19. 09. – 21. 09.<br />
2008 in Stuttgart statt. Alle Bundesschwestern<br />
und Bundesbrüder sind eingeladen,<br />
diesen Termin schon jetzt zu<br />
reservieren.<br />
unitas 3-4/2007 163
St. Marienthal und die Oberlausitz<br />
ERINNERUNGEN AN DIE REISE ZUM ALTHERRENBUNDS-/HOHEDAMENBUNDS-TAG<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. HELMUT J. MANN<br />
Freitag, 21. September: Aufbruchstimmung.<br />
In Düsseldorf ging die Busreise los,<br />
die uns über Siegburg/Bonn, Frankfurt/<br />
Main und Würzburg nach St. Marienthal<br />
bringen sollte. Der größte Teil der Mitreisenden<br />
nutze den Stopp in Würzburg, um<br />
an dem feierlichen Gottesdienst aus Anlass<br />
der Vollendung des 90. Lebensjahres unseres<br />
Verbands-Ehrenseniors Walter Keller<br />
in der Hofkirche der Würzburger Residenz<br />
und danach am Festkommers zu Ehren des<br />
Jubilars teilzunehmen. (Gesonderter Bericht<br />
auf S. 171)<br />
Nach einer kurzen Nacht ging es über<br />
Bamberg, Bayreuth, Chemnitz, Dresden und<br />
Bautzen weiter und gegen Abend erreichten<br />
wir das Kloster Marienthal, unseren Standort<br />
bis zum kommenden Mittwoch. Der<br />
Sonntag galt dem Altherrenbunds-/Hohedamenbunds-Tag<br />
mit verschiedenen Vorträgen<br />
und der Diskussion über aktuelle<br />
Verbandsfragen. (Gesonderter Bericht auf<br />
S. 160). Die Hl. Messe an diesem Tag feierten<br />
wir in der Klosterkirche, zelebriert vom<br />
Hausgeistlichen.<br />
Eine Führung durch das Klosterareal<br />
machte uns mit den Örtlichkeiten vertraut.<br />
Marienthal liegt 14 Kilometer südlich von<br />
Görlitz äußerst idyllisch im Tal der Neiße.<br />
Mit der natürlichen Schönheit konkurriert<br />
der farbenprächtige Barock der weitläufigen<br />
Anlage, die 1234 als erstes Zisterzienserinnenkloster<br />
in Sachsen gegründet wurde<br />
und im 17. und 18. Jahrhundert ihr heutiges<br />
Aussehen erhielt.<br />
Kloster Marienthal<br />
vor großen<br />
Herausforderungen<br />
Der Zisterzienserorden ist ein benediktinischer<br />
Reformorden. Benedikt versteht das<br />
Kloster als Ort der Begegnung mit Gott.<br />
„Das Kloster soll womöglich so angelegt<br />
sein, dass sich alles Notwendige innerhalb<br />
der Klostermauern befindet, nämlich Wasser,<br />
Mühle, Garten und die verschiedenen<br />
Werkstätten, in denen gearbeitet wird. So<br />
brauchen die Mönche nicht draußen herumzulaufen,<br />
was ihren Seelen ja durchaus<br />
nicht zuträglich wäre...” (aus dem 66. Kapitel<br />
der Regel des Hl. Benedikt).<br />
164<br />
unitas 3-4/2007<br />
Das Zisterzienserinnenkloster Marienthal<br />
Die friedliche Wende in Deutschland<br />
stellte den Konvent vor neue Herausforderungen<br />
und große Veränderungen, denen<br />
sich die Schwestern mit viel Offenheit<br />
stellten. Sie gründeten das „Internationale<br />
Begegnungszentrum St. Marienthal” (IBZ)<br />
und stifteten dafür die leer stehenden<br />
Wirtschaftsgebäude. Wichtigste Ziele sind:<br />
Versöhnung und Völkerverständigung im<br />
Dreiländereck über kulturelle und konfessionelle<br />
und Landesgrenzen hinaus.<br />
Um 1740 vom Kloster erbaut, hat die<br />
historische Klosterschenke nach grundlegender<br />
Sanierung ihre Ursprünglichkeit<br />
weitestgehend zurückerhalten. Davon zeugen<br />
das beeindruckende Fachwerk in der<br />
Außenfassade, die<br />
freigelegten Holzkonstruktionen.<br />
Im<br />
Innern die dezente<br />
Farbgebung der<br />
einzelnen Gasträume<br />
und nicht<br />
zuletzt der hundertjährigeKastaniengarten.<br />
Seit<br />
dem Himmelfahrtstag<br />
1998 lädt das<br />
historische Gasthaus<br />
in alter Tradition<br />
wieder Spaziergänger,Fußund<br />
Radwanderer,<br />
Besucher des Klosters<br />
St. Marienthal,<br />
des Internationalen<br />
Begegnungszentrums<br />
sowie Familien,<br />
Vereine und<br />
Die Klosterkapelle<br />
Reisegruppen zu gemütlicher Gastlichkeit<br />
mit Oberlausitzer Küche und Klosterspezialitäten<br />
ein.<br />
Die ursprünglich gotische Kirche (geweiht<br />
1244) brannte 1683 mit den anderen<br />
Klostergebäuden nieder. Für den Wiederaufbau<br />
im Barockstil (1684) wurden die<br />
Umfassungsmauern wieder benutzt. In der<br />
Westwand liegt im Dachgiebel ein nach<br />
außen zugemauertes gotisches Westfenster.<br />
1859 wurde die Kirche nochmals<br />
umgebaut und im Nazarener Stil ausgemalt.<br />
Nach einem Hochwasser (1897)<br />
musste die gesamte Innenausstattung<br />
erneuert werden (beendet 1921). Die Kirche<br />
lädt ein zur Teilnahme am Gottesdienst, am<br />
Chorgebet, zu<br />
Andacht und<br />
Stille und zu<br />
geistlichen Konzerten.<br />
Urkunden<br />
bezeugen, dass<br />
es bereits vor<br />
1700 eine Kreuzkapelle<br />
in St. Marienthal<br />
gab.<br />
Die heutige<br />
Kapelle mit ihrer<br />
Rokokoausstattung<br />
wurde 1756<br />
geweiht. Sie wurde<br />
dadurch zu einem<br />
Ort hervorgehobener„Begegnung“<br />
von innen<br />
und außen,<br />
von Kloster und<br />
Welt – unter dem
Zeichen des Kreuzes. Ein überlebensgroßes<br />
realistisch gestaltetes<br />
Kruzifix (um 1515) inmitten<br />
eines (späteren) Strahlenkranzes<br />
beherrscht den Raum,<br />
in dem außer dem Michaelsaltar<br />
alles auf dieses Kreuz ausgerichtet<br />
ist. Die Kuppelwölbung<br />
der Kreuz- und Michaeliskapelle<br />
zieren Deckengemälde.<br />
Das eine Gemälde erzählt von<br />
der Erhöhung der „Eisernen<br />
Schlange in der Wüste“, das<br />
andere von der „Auffindung und<br />
Erhöhung des wahren Kreuzes“<br />
durch die Kaiserin Helena in<br />
Jerusalem. In der Kapelle befindet<br />
sich auch die Gruft der<br />
Sängerin Henriette Sontag<br />
(* 3. 1. 1806, † 1854). Henriette<br />
Sontag (eigentlich Gertrude<br />
Walpurgia) war eine begnadete<br />
und begabte Sängerin. Auf dem<br />
Höhepunkt ihrer Karriere erkrankte<br />
sie während einer Gastspielreise<br />
auf dem amerikanischen Kontinent<br />
tödlich. Dem sardischen Grafen Carlo<br />
Rossi, ihrem Gemahl gelang es, seiner verstorbenen<br />
Frau ihren letzten Wunsch zu<br />
erfüllen. Ein Jahr nach ihrem Tod überführte<br />
er ihre sterblichen Reste nach Marienthal,<br />
wo sie im Kloster ihre letzte Ruhestätte<br />
fand. Auch Graf Rossi wurde hier an ihrer<br />
Seite beigesetzt.<br />
Das Abteigebäude ist der Wohnsitz der<br />
Äbtissin und zugleich Eingang zum Kloster<br />
(Klosterpforte). Der erste Bau ist vermutlich<br />
im 13. Jahrhundert errichtet worden. Er<br />
wurde beim großen Brand 1683 zerstört.<br />
Anschließend erfolgte unter Äbtissin Anna<br />
Friedrich der Wiederaufbau im Barockstil<br />
unter Benutzung alter Bauteile. Das Stiftsamt<br />
ist die Verwaltung der wirtschaftlichen<br />
Belange des Klosters.<br />
Der Klosterflügel, in dem das Stiftsamt<br />
untergebracht ist, hatte Vorgängerbauten.<br />
Über dem Stiftsamt befindet sich das Parlatorium,<br />
das Sprechzimmer der Schwestern.<br />
Nach mehreren Bauphasen wurde das<br />
heutige Gebäude ab 1743 unter der Äbtissin<br />
Theresia Senfftleben im Barockstil errichtet.<br />
Die Propstei war der Wohnsitz des Propstes.<br />
Der Propst – ein Zisterzienserpater – war<br />
Hausgeistlicher des Klosters und vertrat die<br />
Äbtissin bei weltlichen Aufgaben, z. B. auf<br />
Landtagen. Das Gebäude entstand aus<br />
mehreren Bauabschnitten nach 1683. Heute<br />
dient sie zur Beherbergung von Gästen.<br />
Auch der jetzige Hausgeistliche – ein<br />
Weltpriester – hat dort seine Wohnung.<br />
Nach Abschluss des ersten Teils der<br />
AHB-/HDB-Tagung, der mit hervorragenden<br />
Vorträgen und fruchtbaren Gesprächen<br />
über Verbandsfragen voll gepackt war,<br />
konnten unsere Ausflüge in die Oberlausitz<br />
beginnen. Unser Standort war weiterhin St.<br />
Marienthal.<br />
Die ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters Marienthal wurden umgebaut<br />
zu einem Internationalen Begegnungszentrum.<br />
Auf der Fahrt nach Görlitz haben unsere<br />
Reiseführer uns schon viele Informationen<br />
geliefert über eine Region, die für einige<br />
Bundesbrüder und ihre Ehefrauen alte<br />
Heimat war. Es war sehr interessant zu<br />
sehen, wie die Wunden, die der Braunkohlebergbau<br />
in die Landschaft geschlagen hat,<br />
beseitigt werden und wie daraus Ferienregionen<br />
und Erholungsziele entstehen.<br />
Görlitz – Kronjuwel<br />
der Oberlausitz<br />
Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands,<br />
genau auf 15 Grad östlicher Länge an<br />
der Lausitzer Neiße<br />
gelegen, darf sich, da<br />
sie den Zweiten Weltkrieg<br />
beinahe unbeschadet<br />
überstanden<br />
hat, als das Kronjuwel<br />
der Oberlausitz bezeichnen,<br />
auch wenn<br />
die Bauten aus Mittelalter<br />
und Renaissance<br />
inzwischen<br />
reichlich Patina angesetzt<br />
hatten. Es ist<br />
teilweise aber auch<br />
überwältigend zu<br />
sehen, was in den<br />
beinahe 20 Jahren<br />
seit der Wiedervereinigung<br />
geschafft<br />
wurde.<br />
Die Dresdener Semperoper<br />
Die Stadtrundfahrt<br />
hatte im Westen<br />
der Nikolaivorstadt<br />
das kunsthistorisch bedeutende Heilige<br />
Grab (1481 – 1504) als Ziel. Die Architektur,<br />
Plastik und gestaltete Landschaft vereinende<br />
Anlage ist eine Kopie des Heiligen<br />
Grabes von Jerusalem und symbolisiert die<br />
Stätten der Passion Christi.<br />
Sie gilt als erster Versuch<br />
von Landschaftsgestaltung<br />
in Europa.<br />
Als nächste Etappe war<br />
ein Rundgang durch das<br />
historische Görlitz vorgesehen.<br />
Die Straßenzüge und<br />
Bauten um den Postplatz<br />
stammen vorwiegend aus<br />
dem späten 19. Jahrhundert.<br />
Nur die Frauenkirche<br />
am Marienplatz ist aus der<br />
Spätgotik (1459 – 1486).<br />
Gleich neben der Kirche<br />
steht das jetzige Kaufhaus<br />
Karstadt, 1913, vor dem<br />
Ersten Weltkrieg erbaut.<br />
Von hier blickt man<br />
zum Dicken Turm (vor 1305)<br />
mit dem 1477 in Sandstein<br />
gehauenen Stadtwappen.<br />
Hinter dem Reichenbacher<br />
Turm öffnet sich weit der vom Barock<br />
geprägte Obermarkt mit seinen bemerkenswerten<br />
Bürgerhäusern. Spätgotische, Renaissance-<br />
und Barockhäuser geben auch<br />
dem Untermarkt mit dem Rathaus und der<br />
Ratsapotheke seine Atmosphäre.<br />
Auf der Peterstraße verlässt man den<br />
Obermarkt und geht zur Pfarrkirche Sankt<br />
Peter und Paul (1423 – 1497), der spätgotischen<br />
Nachfahrin einer um 1230 geweihten<br />
spätromanischen Basilika. Am 12. Oktober<br />
1997 wurde der Neubau der Sonnenorgel<br />
eingeweiht, ein Nachbau der auf den<br />
Tag genau 300 Jahre vorher von der Stadt<br />
Görlitz beim Orgelbauer Eugenio Casparini<br />
bestellten Orgel. In der 14,40 Meter hohen<br />
und 10,30 Meter breiten Orgelfassade fallen<br />
die mit 7,82 Meter hohen Pfeifen auf. Über<br />
den gesamten Prospekt sind siebzehn sog.<br />
Sonnen verteilt, die um goldene Sonnenge- >><br />
unitas 3-4/2007 165
sichter strahlenförmig mit gleich langen, an<br />
der Rückseite jedoch verschieden tief ausgeschnittenen<br />
Pfeifen einer zwölffachen<br />
Pedalmixtur versehen sind und damit dem<br />
Instrument den Namen Sonnenorgel gegeben<br />
haben. Jede Sonne erzeugte jeweils<br />
einen Ton der Pedalmixtur und ist außerdem<br />
mit einem Acht-Zoll-Trompetenregister<br />
kombiniert, dessen einzelne Pfeifen auf die<br />
siebzehn am Orgelgehäuse befindlichen Engelsfiguren<br />
verteilt sind (die restlichen neun<br />
Töne der Mixtur und Trompete kamen auf<br />
einer eigenen Windlade im Inneren der<br />
Orgel zu stehen). Dieses einzigartige Register<br />
verfügte über eine eigene Traktur, die<br />
am Spieltisch als Sperrventil funktioniert.<br />
Als weitere ungewöhnliche Besonderheit<br />
wurde in die Orgel ein „Glöcklein – Thon“,<br />
ein „Cymbelstern“ (umlaufende Sonne),<br />
Nachtigall, Vogel-Gesang und ein Kuckuck<br />
eingebaut. Zur Freude der Benutzer der<br />
Orgel wurden die alten Registernamen in<br />
ihrer damaligen Orthographie belassen.<br />
Diese einzigartige Orgel wurde uns durch<br />
eine Führerin erklärt und durch ein kleines<br />
Orgelkonzert zu Gehör gebracht. Rechts der<br />
Kirche steht über dem Steilabfall zur Neiße<br />
das wehrhafte Waidhaus oder Renthaus, der<br />
älteste Profanbau der Stadt.<br />
Ein kleiner Spaziergang führte die Reisegruppe<br />
zum Abendessen durch den<br />
deutsch-polnischen Grenzübergang auf der<br />
Brücke des Grenzflusses Neiße in das landestypische<br />
Restaurant KAPRYS mit polnisch-schlesischen<br />
Spezialitäten.<br />
Am nächsten Tag ging unsere Exkursion<br />
in den hintersten Winkel von Deutschland,<br />
in das Dreiländereck mit Polen und der<br />
Tschechischen Republik nach Zittau, 1238<br />
erstmals urkundlich erwähnt.<br />
Auf den Spuren<br />
des Zittauer Fastentuchs<br />
Zittau ist heute Hochschulstadt sowie<br />
ein wichtiges Kultur- und Industriezentrum.<br />
Auf dem Programm stand ein Stadtrundgang<br />
und die Besichtigung des „Großes<br />
Zittauer Fastentuch 1472“. Um 1000 wird<br />
erstmals von dem Brauch berichtet, in der<br />
Fastenzeit Altäre, Reliquien, Bilder, ja ganze<br />
Altarräume mit großen Tüchern zu verdecken.<br />
Sie wurden im Chor aufgehängt, um<br />
der Gemeinde den Blick auf das Allerheiligste<br />
zu verwehren. Diese Textilien nannte<br />
man Fastentücher (Velum quadragesimale),<br />
aber auch Hungertücher oder Schmachtlappen.<br />
Die Verhüllung war für die mittelalterlichen<br />
Gläubigen eine Bußübung. Sie<br />
verzichteten auf den Augenschein der Heiligen<br />
Messe. Zur körperlichen kam die eucharistische<br />
Abstinenz. Die Wendung „am Hungertuch<br />
nagen“ für „darben, ärmlich leben,<br />
kümmerlich vegetieren“ ist zumindest indirekt<br />
mit dem Fastentuch-Gebrauch verbunden.<br />
Ursprünglich schmucklos und einfarbig,<br />
wurden die Tücher bald bestickt oder<br />
166<br />
unitas 3-4/2007<br />
bemalt. Die volkstümlichen Darstellungen<br />
aus dem Alten und Neuen Testament<br />
dienten zur Glaubensunterweisung der<br />
meist analphabetischen Gemeindemitglieder.<br />
Einst in Europa weit verbreitet, sind<br />
Fastentücher u. a. durch den reformatorischen<br />
Bildersturm selten geworden. Erhalten<br />
geblieben sind einige dieser Zeugnisse<br />
mittelalterlicher Frömmigkeit nur<br />
noch in Kärnten, Tirol, im westfälischen<br />
Münsterland und Zittau. Zu den bedeutendsten<br />
gehören die bemalten Fastentücher<br />
von Gurk (1458) und Haimburg (1504)<br />
in Kärnten sowie das Große Zittauer<br />
Fastentuch (1472) und das Kleine Zittauer<br />
Fastentuch (1573). Das große Zittauer<br />
Fastentuch ist das einzige seiner Art in<br />
Deutschland und mit 8,20 Meter Höhe und<br />
6,80 Meter Breite das drittgrößte überlieferte<br />
Fastentuch überhaupt. Im Museum<br />
„Kirche zum Heiligen Kreuz“ wird es in der<br />
größten Museumsvitrine der Welt gezeigt<br />
(„Guinness Buch der Rekorde“). Das Fastentuch<br />
zeigt die Erschaffung der Welt, die<br />
ersten Menschen, Noahs Arche, Jakob und<br />
Josef, Wirken, Sterben und Auferstehung<br />
Jesu – 90 Bilder in zehn Reihen erzählen<br />
Geschichten aus dem Alten und Neuen<br />
Testament („Zittauer Bibel“). Jedem Bild ist<br />
eine gereimte Erklärung in Mittelhochdeutsch<br />
zugeordnet.<br />
Die biblischen Szenen malte vor über<br />
500 Jahren ein unbekannter Meister als anschauliche<br />
Christenlehre mit Tempera auf<br />
ein 56 Quadratmeter großes Leinengewebe<br />
Abendessen im gemütlichen Kellergewölbe des<br />
Dresdener Restaurants Wenzel.<br />
(nasse Tüchleinmalerei). Im spätmittelalterlichen<br />
Zittau, damals „die Reiche“ unter<br />
den Oberlausitzer Städten, wurde das Tuch<br />
1472 vom Gewürz- und Getreidehändler<br />
Jacob Gürtler gestiftet. In der St. Johanniskirche<br />
war es 200 Jahre lang im Gebrauch. In<br />
der Fastenzeit hing es zwischen Langhaus<br />
und Chor und trennte so den Altarraum von<br />
der Gemeinde.<br />
Sein späterer Verbleib blieb rätselhaft.<br />
1840 entdeckte man es in der Zittauer Ratsbibliothek<br />
wieder, zusammengerollt unter<br />
einem Bücherregal. 1842 gelangte der Fund<br />
nach Dresden, 1876 zurück nach Zittau, wo<br />
er nur sieben Mal öffentlich gezeigt wurde,<br />
zuletzt 1933.<br />
Vor Kriegsende auf dem Oybin ausgelagert,<br />
fiel das Tuch 1945 sowjetischen<br />
Soldaten in die Hände. In vier Teile zerschnitten,<br />
diente es kurzzeitig als Badestubenverkleidung.<br />
Danach im Wald zurückgelassen,<br />
rettete es ein Oybiner Holzsammler.<br />
Jahrzehntelang verblieb es dann<br />
im Museumsdepot als von sowjetischen<br />
Soldaten geschändetes sakrales Zeugnis in<br />
der DDR tabuisiert.<br />
Auf der anschließenden Fahrt nach<br />
Oybin konnten wir die „Zittauer Bimmelbahn“,<br />
eine noch immer dampfbetriebene<br />
Schmalspurbahn, im regulären Betrieb der<br />
DB bewundern. Leider hat der Regengott im<br />
Hauptort des Zittauer Gebirges, in Oybin,<br />
einige Tränen über uns vergossen. Den<br />
Spaziergang auf den Berg Oybin und die<br />
Besichtigung der Burg- und Klosterruine<br />
Oybin haben sich die wetterfesten Bundesschwestern,<br />
Bundesbrüder und deren<br />
mitreisende Angehörigen aber nicht vermiesen<br />
lassen.<br />
Nächstes Ziel: der Kreis Löbau, bekannt<br />
durch gut erhaltene „Umgebindehäuser“.<br />
Das in den Dörfern noch landschaftsbestimmendeUmgebindehaus<br />
entstand<br />
aus der Verschmelzung<br />
des slawischen<br />
Blockhauses mit dem<br />
fränkischen Fachwerkbau.<br />
Zu erkennen<br />
an der in sich geschlossenenBlockstube<br />
und ihrer Abdeckung,<br />
die nicht als<br />
Dielung des Obergeschosses<br />
dient. Die<br />
Ständer des Umgebindes<br />
haben keine<br />
Verbindung mit der<br />
Blockstube und tragen<br />
das Rahmenbalkenwerk,<br />
auf dem das<br />
Obergeschoß errich-<br />
tet ist. Das Haus ist<br />
strohgedeckt. Bei seinem<br />
Bau wurden<br />
Baustoffe verwendet,<br />
die in der Natur reichlich<br />
zur Verfügung stehen: Feldsteine für die<br />
Mauern, Holz für die Blockstube und die<br />
Fachwerkverbindungen sowie Lehm und<br />
Stroh.<br />
Etwa 10 Kilometer südlich von Löbau<br />
liegt die kleine Stadt Herrnhut, Namensgeber<br />
und Stammsitz der Herrnhuter Brüdergemeinde.<br />
Die Evangelische Brüder-
Unität ist eine ökumenisch offene Kirche. In<br />
Europa hat sie 30.000 Mitglieder. Diese sind<br />
verwaltungsmäßig aufgeteilt in drei selbstständige<br />
Kirchenprovinzen in Tschechien, in<br />
Großbritannien sowie in Kontinentaleuropa<br />
(Deutschland, Niederlande, Schweiz, Dänemark,<br />
Schweden, Estland und Lettland). Die<br />
Brüder-Unität entstand Mitte des 15. Jahrhunderts<br />
aus der böhmischen Reformation<br />
heraus. Anfang des 18. Jahrhunderts kam es<br />
in Herrnhut (Oberlausitz) zur Neugründung<br />
unter Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Bis<br />
heute gehören viele ihrer Mitglieder zugleich<br />
auch der evangelischen Kirche an. Die<br />
Brüder-Unität ist der Evangelischen Kirche<br />
in Deutschland (EKD) angegliedert und<br />
zugleich Gastmitglied in der Vereinigung<br />
evangelischer Freikirchen (VEF).<br />
Die Brüder-Unität hat kein<br />
eigenes Bekenntnis. Sie bekennt<br />
mit den anderen Kirchen Jesus<br />
Christus als ihren Herrn und<br />
Heiland.<br />
Zu Gast<br />
bei der Herrnhuter<br />
Brüdergemeinde<br />
Die Gemeinschaft legt einen<br />
besonderen Akzent auf ihr Gemeindeleben.<br />
Die Mitglieder<br />
kennen sich persönlich und versuchen<br />
sich in allen Lebenslagen<br />
gegenseitig zu stützen. Die internationale<br />
Ausstrahlung in<br />
fünf Kontinenten macht die<br />
Brüdergemeinde für viele<br />
attraktiv und erweitert ihren<br />
Horizont. Bekannt ist die Brüder-<br />
Unität unter anderem für die Herausgabe<br />
der Losungen, einem<br />
seit 1731 in ununterbrochener<br />
Folge erscheinenden Andachtsbuch,<br />
das für jeden Tag des Jahres<br />
zwei Bibeltexte und einen<br />
Liedvers bzw. ein Gebet enthält.<br />
Die Unität hat verschiedene<br />
Namen: Brüder-Unität leitet sich<br />
vom lateinischen »<strong>Unitas</strong><br />
Fratrum« ab, dem Namen der<br />
Böhmischen Brüder, von denen<br />
die Herrnhuter Brüdergemeinde<br />
abstammt. Der Name leitet sich<br />
vom Ursprungsort Herrnhut in<br />
Sachsen ab. Moravian Church ist der<br />
englische Name, der ebenfalls auf den<br />
Ursprung in Böhmen und Mähren hinweist<br />
(Spanisch: lglesia Morava, Französisch:<br />
Eglise morave).<br />
Am Mittwoch traten wir frohgelaunt<br />
nach einem gut sortierten Frühstück mit<br />
Zutaten und Erzeugnissen aus der Region,<br />
überwiegend aus ökologischem Anbau, die<br />
Heimreise über Dresden an, nicht ohne<br />
daran zu erinnern, dass der Volksmund das<br />
Sprichwort kennt: „Wenn Engel reisen, lacht<br />
der Himmel (Freudentränen)!“<br />
Zu viele Worte über Dresden zu verlieren<br />
hieße Eulen nach Athen tragen. Beim<br />
Stadtrundgang im Elbflorenz sind wir an der<br />
neuen Synagoge vorbei über die Brühlsche<br />
Terrasse, die sich über dem Elbufer auf den<br />
Resten der Dresdner Festung erstreckt,<br />
gegangen. Sie verdankt ihren Namen dem<br />
sächsischen Minister Graf Heinrich von<br />
Brühl (1700 – 1763). Seit 1814 ist dieser<br />
Bereich der Stadt öffentlich und hat sich<br />
bald zur Flaniermeile mit dem Namen<br />
„Balkon Europas“ entwickelt. An der Frauenkirche<br />
vorbei, Richtung Semperoper, passierten<br />
wir den „Langer Gang“ mit dem<br />
berühmten 101 m langen Fürstenzug aus<br />
24000 Meissner Porzellankacheln und die<br />
Hofkirche am Theaterplatz. Von der Semper-<br />
Die Dresdener Hofkirche und der Zwinger<br />
oper gingen wir direkt zum Zwinger, ein in<br />
der Welt einzigartiges Meisterwerk höfischen<br />
Barocks und Dresdens berühmtestes<br />
Baudenkmal. August der Starke beauftragte<br />
Daniel Pöppelmann mit dem Bau einer<br />
Orangerie, aus der bis 1732 der heutige Zwinger<br />
hervorgegangen ist. Der Zwinger war<br />
nie als Residenz oder zu sonstigen Wohnzwecken<br />
gedacht. Er diente allein den repräsentativen<br />
Ansprüchen Augusts des Starken.<br />
High noon wurde uns von dem an der<br />
Ostseite des Zwingers errichteten Glockenspiel-Pavillon<br />
auf dem Glockenspiel mit<br />
Glocken aus Meissner Porzellan intoniert.<br />
Über den Theaterplatz zurück würdigten<br />
wir das Taschenbergpalais mit einem<br />
Mittagessen im Sophienkeller. Körperlich<br />
gestärkt und regeneriert genehmigten wir<br />
uns einen Augenschmaus im Neuen Grünen<br />
Gewölbe an der dort untergebrachten<br />
Pretiosensammlung. Und obwohl wir schon<br />
am Vormittag kurz in der Frauenkirche<br />
waren, gönnten wir unserem Gehörsinn<br />
und unseren Seelen um 18 Uhr eine<br />
Abendandacht mit anschließender zentraler<br />
Kirchenführung.<br />
Donnerstag am frühen Morgen starteten<br />
wir unsere Rückfahrt über Würzburg,<br />
Frankfurt/Main, Siegburg/Bonn nach Düsseldorf.<br />
Hier endete unsere Reise, die noch<br />
von unserem lieben Bundesbruder<br />
Helmut Voss vorbereitet<br />
wurde, der bei einem tragischen<br />
Verkehrsunfall mit jugendlichen<br />
Verkehrsrowdies leider sein Leben<br />
verloren hat. Die weitere<br />
Organisation und Durchführung<br />
wurde daher dem Reiseunternehmen<br />
Poppe & Co. in Mainz<br />
übertragen, die das Busunternehmen<br />
Karibu Reisen verpflichtete.<br />
Unterwegs besuchten wir<br />
noch die Zisterzienserabtei Osek<br />
und das von Abt Bernhard Thebes<br />
im Drei-Länder-Eck Deutschland,<br />
Polen und Tschechien initiierte<br />
Projekt eines Begegnungshauses<br />
für Kinder in Dlouha<br />
Louka, das der UV in den letzten<br />
Jahren als Soziales Verbandsprojekt<br />
unterstützt hat. Die an<br />
dieser Reise teilnehmenden Unitarier<br />
haben sich dafür ausgesprochen,<br />
ein Treffen von Aktiven<br />
aus dem UNITAS-Verband mit<br />
polnischen und tschechischen<br />
Studenten in dem unweit des<br />
Klosters errichteten Begegnungshaus<br />
zu organisieren. Dieser Gedanke<br />
wurde auch inspiriert<br />
durch die GV in Trier, bei der wir<br />
uns den Europagedanken und<br />
die christlichen Wurzeln Europas<br />
besonders auf die Fahne<br />
geschrieben haben. Es ist uns<br />
spontan allerdings noch keine<br />
Lösung eingefallen, wie man mit<br />
interessierten jungen Menschen aus den<br />
beiden benachbarten Ländern Polen und<br />
Tschechien für ein solches Begegnungsprojekt<br />
Kontakt aufnehmen kann. (Vgl. auch<br />
gesonderten Bericht auf S. 168)<br />
Von den Reiseteilnehmern wurde lang<br />
anhaltender Dank dem Busfahrer und dem<br />
unitarischen Dreigestirn, Frau Marianne<br />
Hübers von der Geschäftsstelle und den<br />
Bundesbrüdern Dieter Krüll und Heinrich<br />
Sudmann gespendet, die die Reise organisatorisch<br />
vorbereitet und begleitet<br />
hatten.<br />
unitas 3-4/2007 167
Unitarier besuchen das Soziale<br />
Projekt in Osek<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. DIETER KRÜLL<br />
Am letzten Tag der unitarischen Besichtigungsreise zum Altherren-<br />
und Hohedamenbundstag im Kloster Marienthal,<br />
durch die Oberlausitz und Dresden stand die Besichtigung des<br />
aktuellen Sozialen Projekts des UNITAS-Verbandes, das Begegnungshaus<br />
für Kinder in Dlouka-Louka in der Nähe des<br />
Klosters Osek in Nord-Böhmen (Tschechien), auf dem Reiseprogramm.<br />
Fünfundvierzig Unitarier, zum Teil mit ihren Damen,<br />
machten sich mit dem Reisebus von Dresden aus auf den Weg<br />
nach Süden. Osek liegt etwa 50 Kilometer Luftlinie südlich von<br />
Dresden unmittelbar hinter dem Bergkamm des Erzgebirges<br />
(westlich von Teplice) in Tschechien.<br />
Wir benutzten nicht die Bundesstraße<br />
170 / E55 Dresden-Prag über Altenberg im<br />
Erzgebirge, über die sich viele Jahrzehnte<br />
lang der Verkehr auf kurvenreicher Strecke<br />
hatte quälen müssen, sondern die soeben<br />
neu eröffnete Autobahn A 17 weiter östlich<br />
über Prina, Bad Gottleuba nach Usti (Aussig),<br />
von wo wir dann über Landstraßen<br />
Richtung Westen nach Osek gelangten.<br />
Wir hatten leider einen sehr nebligen,<br />
dunstigen Tag erwischt. Aber wir durften<br />
zufrieden sein, hatten wir doch die Tage<br />
zuvor fast meist herrlichen Sonnenschein<br />
genießen dürfen. Die heftigen Regenfälle<br />
setzten erst am Nachmittag während<br />
unserer Rückreise nach Düsseldorf ein.<br />
168<br />
unitas 3-4/2007<br />
An der Landesgrenze nach Tschechien<br />
für uns die erste Überraschung: Tschechien<br />
gehört zwar inzwischen zur EU, ist aber<br />
noch nicht dem Schengener Abkommen<br />
beigetreten. Passkontrolle im Herzen Europas,<br />
für uns sehr ungewohnt und an der<br />
noch provisorischen Grenzstation, in karger<br />
Landschaft und Nebeldunst auch etwas<br />
beklemmend, ein wenig wie in alten Zeiten<br />
des Eisernen Vorhangs.<br />
Prompt Probleme: Ein Mitreisender hat<br />
seinen Personalausweis nicht dabei. Die<br />
Ausstellung eines Ersatzpapiers gegen<br />
Zahlung von EUR 8,00 ist zwar grundsätzlich<br />
möglich, aber irgendein Nachweis<br />
der Identität muss her. Die Kreditkarte hat<br />
In einem ehemaligen Gasthaus des Örtchens Dlouha-Louka befindet sich heute das vom UNITAS-<br />
Verband geförderte „Begegnungshaus für Kinder“ (gelbes Gebäude). Im Hintergrund sehen wir die<br />
kleine Dorfkirche.<br />
Verbandsgeschäftsführer Dieter Krüll mit Pater Schabel vor dem<br />
Kloster Osek<br />
kein Foto und könnte daher jedem gehören.<br />
Mein rheinisch fröhlicher Hinweis: „Ich<br />
kenn däm!“ bewirkt nichts, auch kein<br />
Lächeln. Aber gottlob habe ich die Teilnehmerliste<br />
der Busreise dabei, die den<br />
Kreditkarteninhaber als Mitreisenden ausweist.<br />
Nach 20 Minuten Aufenthalt geht es<br />
weiter nach Osek.<br />
Abt Bernhard dankt<br />
allen Unitariern<br />
für die geleistete Hilfe<br />
Als unser Bus mit Verspätung in den Hof<br />
der Zisterzienser-Abtei einfährt, steht dort<br />
bereits der Bus einer anderen Reisegruppe<br />
der katholischen Frauengemeinschaft aus<br />
Dresden, die mit Pater Schabel um zehn Uhr<br />
einen Gottesdienst feiern möchte. Pater<br />
Schabel vertritt Abt Bernhard (Thebes), der<br />
wegen seines Blasenkrebsleidens leider im<br />
Krankenhaus in Dresden liegt. Man hatte<br />
mir noch kurz vorher gesagt, er liege wohl<br />
im Sterben. Doch als ich mit ihm nach unserem<br />
Besuch telefonierte, war sein Stimme<br />
fest und dynamisch wie eh und je. Er dankt<br />
allen Unitariern sehr herzlich für ihre Hilfe<br />
beim Sozialen Projekt Osek und wünscht<br />
allen Gottes reichen Segen. Inzwischen<br />
steht Abt Bernhard sogar wieder am Altar in<br />
Osek, dem Herrn sei Dank!<br />
Pater Schabel (er ist der erste Neupriester<br />
des Klosters Osek nach der Wende,<br />
geweiht Pfingsten 2007) verschiebt kurzer<br />
Hand die Messe auf elf Uhr, besteigt unseren<br />
Bus und fährt mit uns in nördlicher<br />
Richtung den steilen Hang des Erzgebirges<br />
hinauf nach Dlouha-Louka (Weiße Wiese).<br />
Wir passieren einen Gedenkstein für dreißig<br />
verunglückte Bergleute, die im inzwischen<br />
geschlossenen Kohleschacht bei<br />
Osek ihr Leben lassen mussten. Vorbei an
Holzkreuzen verunglückter Autofahrer<br />
(einige Mitreisende sollen<br />
still gebetet haben, aber unser<br />
Fahrer Andreas Frank fuhr stets<br />
umsichtig und sicher) erreichen wir<br />
auf enger Straße Dlouha Louka. Der<br />
Ort war vor der Wende 1990 bis auf<br />
wenige Bewohner und Häuser fast<br />
ausgestorben. Heute siedeln sich<br />
immer mehr Wochenend-Urlauber<br />
hier an, obwohl das offiziell gar<br />
nicht erlaubt ist.<br />
So stand auch das ehemalige<br />
Gasthaus/Hotel mit dem angrenzenden<br />
Dorfkirchlein leer und war<br />
dem langsamen Verfall preisgegeben,<br />
bis Abt Bernhard den<br />
kühnen Entschluss fasste, hier ein<br />
„Begegnungshaus für Kinder“ zu<br />
errichten. Er hatte nämlich in Osek<br />
die Erfahrung gemacht, dass die<br />
erwachsenen Bewohner derart<br />
durch den Kommunismus und<br />
seine Verfolgungen geprägt waren,<br />
dass für sie Gott und der Glaube an<br />
Jesus Christus eine Bedrohung darstellt<br />
(siehe auch den Artikel „Kommunismus<br />
steckt noch immer in<br />
den Köpfen der Menschen“, UNITAS<br />
1/2007, S. 36). Nur sehr wenige<br />
Bürger besuchen den Gottesdienst<br />
in der Klosterkirche. Alle Versuche,<br />
sich den anderen zu nähern, scheiterten<br />
bisher, obwohl man dem Abt<br />
ansonsten freundlich begegnet<br />
und sein segensreiches Wirken für<br />
die Erhaltung der Klosteranlage respektiert.<br />
Bei Ferienaufenthalten auch<br />
Jesus Christus kennen lernen<br />
Umso erstaunlicher ist, dass die Menschen<br />
in und um Osek es zulassen, dass ihre<br />
Kinder – neugierig wie diese sind – Kontakt<br />
zum Kloster und zum Abt aufnehmen. Dies<br />
scheint die einzige Chance zu sein, wenigstens<br />
mit langem Atem die Heilslehre Jesu<br />
Christi wieder in Tschechien zu verbreiten.<br />
Dabei soll das Begegnungshaus für Kinder<br />
in Dlouha-Louka helfen, nämlich Ferien und<br />
Erholungsangebote in diesem Haus und in<br />
der herrlichen Wald- und Heidelandschaft<br />
Blick in einen Schlafraum und die Küche des Begegnungshauses<br />
hoch oben auf dem Kamm des Erzgebirges<br />
mit einer nahe liegenden Trinkwasser-Talsperre<br />
zu nutzen, um nebenbei Kindern von<br />
Jesus Christus zu erzählen und seine Heilslehre<br />
nahe zu bringen.<br />
Ein mühsamer und äußerst schwieriger<br />
Weg, der nur mit schier grenzenlosem<br />
Gottvertrauen – wie es der Abt vorlebt – gelingen<br />
kann. Wer aber den Zustand des<br />
Klosters Osek und auch dieses ehemaligen<br />
Gasthauses in Dlouha Louka vor dem Eingreifen<br />
des Abtes gekannt hat und mit dem<br />
heutigen Zustand vergleicht, mag nicht<br />
glauben, dass dies nur ein Mann mit seiner<br />
unendlichen Energie und dem Vertrauen<br />
auf Gottes Hilfe bewerkstelligen konnte.<br />
Die Gebäude sind gesichert und in<br />
passablem Zustand. Es bleibt noch<br />
viel zu tun, aber deutlich mehr als<br />
ein Grundstein wurde gelegt.<br />
Abt Bernhard ist gelernter Bauingenieur.<br />
Er hat das alte Gasthaus<br />
und das Kirchlein, das durch einen<br />
gemauerten Gang mit dem Haus<br />
verbunden ist, von Grund auf saniert.<br />
Im Erdgeschoss liegen die Gemeinschaftsräume,<br />
die Küche, der<br />
Speisesaal usw. Im Obergeschoss<br />
wurden ein Schlafsaal und mehrere<br />
Einzel- bzw. Doppelzimmer mit<br />
Duschen in modernem Standard<br />
neu errichtet.<br />
Das geräumige Dachgeschoss<br />
mit der Balkenkonstruktion des<br />
neuen Daches schreit geradezu<br />
nach einem weiteren Ausbau.<br />
Die Unitarier konnten das ganze<br />
Haus und die von Unitariern und<br />
anderen finanzierte Innenausstattung<br />
bewundern. Ein großer Mehrstoff-Heizkessel<br />
(Vissmann), der mit<br />
Öl, aber auch mit Holz befeuert<br />
werden kann, das die jugendlichen<br />
Bewohner selbst sammeln können.<br />
Die Bestuhlung, Tische, Betten<br />
waren von solider und optisch sehr<br />
ansprechender Qualität. Eine moderne<br />
Groß-Kücheneinrichtung (Nirosta-Stahl)<br />
war zu bewundern, die<br />
große Waschmaschine wurde<br />
zunächst unten im Tal im Kloster aufgestellt,<br />
um das dort verfügbare Personal besser<br />
nutzen zu können. Kurz, unser Geld<br />
scheint hervorragend investiert worden zu<br />
sein. Zur Kostenersparnis wurden viele<br />
Gegenstände aus tschechischer Produktion<br />
erworben, die bei akzeptabler Qualität erheblich<br />
preisgünstiger waren. Die Teilnehmer<br />
der Reisegruppe waren wirklich hellauf<br />
begeistert.<br />
Aktivenfahrt nach Dlouha Louka<br />
Nun fehlt nur noch eines: Das Haus<br />
muss zum Leben erweckt und von Menschen<br />
(Personal) und Jugendlichen (Gästen)<br />
bezogen und genutzt werden. Hier kam sofort<br />
die Idee auf, ob nicht der Vorort/Verband<br />
im kommenden Sommer ein Aktiventreffen<br />
oder gar einen gemeinsamen Sommerurlaub<br />
in Dlouha-Louka organisieren<br />
und abhalten könnte. Die Bundesbrüder in<br />
Prag und Oppeln könnten den Kontakt zu<br />
tschechischen und polnischen Studierenden<br />
herstellen, die ebenfalls teilnehmen<br />
könnten.<br />
Damit wäre ein Anfang gemacht, der<br />
auch der europäischen Idee und der Völkerverständigung<br />
im Herzen Europas (Dreiländereck)<br />
dienen würde. Wer hat hilfreiche<br />
Ideen für solch ein Projekt? Meldet Euch, >><br />
unitas 3-4/2007 169
hier könnt Ihr persönlich etwas<br />
tun.<br />
Zum Abschluss besichtigten<br />
wir die absolut<br />
schlicht gehaltene Kirche.<br />
Zentrum des Kirchenraums<br />
ist der Altar, ein „Moses-<br />
Altar“ aus Steinbrocken des<br />
Erzgebirges vom Abt Bernhard<br />
persönlich gemauert.<br />
Beeindruckend! Die Gruppe<br />
sang gemeinsam ein Lied,<br />
ein Reise-Segensspruch<br />
wurde verlesen und Pater<br />
Schabel erbat den Schutz<br />
Gottes für die Rückreise und<br />
segnete uns alle.<br />
Zwischenzeitlich machte<br />
Bbr. Thomas Staroszinski den<br />
Vorschlag, dass sein Sohn,<br />
der Dozent an der FH Nürtingen (Kunsttherapie)<br />
ist, die Wand hinter dem Altar<br />
gestalten und ausmalen könnte.Wir wissen<br />
noch nicht, ob Abt Bernhard damit einverstanden<br />
ist. Man sieht aber, der Funke ist<br />
übergesprungen.<br />
Zurück in Osek besuchten wir noch kurz<br />
die riesige, barocke Abtei-Kirche, die auch<br />
innen noch sehr gut erhalten ist und von<br />
alter Macht und Herrlichkeit des Ordens in<br />
früherer Zeit Zeugnis gibt. Dort wartete seit<br />
über einer Stunde die Dresdener Frauengemeinschaft,<br />
für deren Geduld wir uns<br />
sehr herzlich bedankten. Alle gemeinsam<br />
sangen wir „Großer Gott wir loben Dich“, in<br />
Haus „Egypta“ soll Kindern Kriegstrauma<br />
nehmen - 5/1997<br />
Für Haus Egypta: Ein tolles Ergebnis - 1/1998<br />
Besuch im Haus Egypta - 2/1998<br />
Keine Zuschauer, sondern Akteure / Robert<br />
Schuman-Haus Markkleeberg - 3/1998<br />
Haus Egypta: Auf halbem Weg zum Ziel<br />
- 1/1999<br />
Haus Egypta: Eingeweiht und schon bezogen<br />
- 4/1999<br />
Freudiges Ereignis in Sarajewo: Kinderheim<br />
„Haus Egypta“ eingeweiht - 5/1999<br />
Unser neues Soziales Projekt: Jungen Menschen<br />
in Kolumbien eine Chance - 6/1999<br />
(dieses Projekt wurde nicht realisiert)<br />
Unser Projekt: Das „Centro de Formacion<br />
Juvenil y Popular“ in Caracas - 3/2000<br />
Nachrichten aus Venezuela (Caracas)<br />
- 4/2000<br />
170<br />
unitas 3-4/2007<br />
Die Barockkirche des Zisterzienserklosters Osek<br />
das auch die Dresdener mit einstimmten.<br />
Leider konnten wir an dem Gottesdienst<br />
nicht teilnehmen, da wir noch die lange<br />
Rückreise nach Düsseldorf vor uns hatten<br />
(die Letzten kamen nach ein Uhr nachts ans<br />
Ziel).<br />
Zu einem Imbiss gingen wir ins Refektorium<br />
des Klosters, wo wir von fleißigen<br />
Damen mit heißen Getränken und Kuchen<br />
reichhaltig bewirtet wurden. Als wir uns<br />
bald verabschieden mussten, erhielt jeder<br />
Mitreisende im Fließbandverfahren drei<br />
Tüten mit Reiseproviant (belegte Brote,<br />
kalte Schnitzel, Obst), die wir bei der langen<br />
Rückreise gut gebrauchen konnten.<br />
Erster Scheck an Salesianer Don Bosco<br />
übergeben / Bald UNITAS-Caracas?<br />
- 5/2000<br />
Was soll in „unserem“ Jugendzentrum in<br />
Caracas geschehen? - 1/2001<br />
Grünes Licht für Baubeginn in Caracas<br />
- 2/2001<br />
Das Jugendzentrum in Caracas geht ins<br />
Internet - 4/2001<br />
Venezuela: Kirche wehrt sich gegen<br />
Repressalien - 4/2001<br />
Zeitwende in Venezuela: Der Staat, die<br />
Kirche und das UNITAS-Projekt - 4/2002<br />
Was wurde aus unserem Kinderdorf-Projekt<br />
in Markkleeberg? - 1/2003<br />
Neues Soziales Projekt: Hilfe für Schülerinternat<br />
in Prijedor/Bosnien-Herzegovina<br />
- 2/2003<br />
Bosnien-Herzegowina / Diözese Banja-Luka<br />
/ Stadt Prijedor - 1/2004<br />
Der Besuch in Osek und<br />
Dlouha-Louka war für alle<br />
ein unvergessliches Erlebnis,<br />
den niemand bereut hat. Es<br />
war gut, dass wir unser<br />
Soziales Projekt gesehen<br />
haben und mit dem Gefühl<br />
heimreisen konnten, dass wir<br />
Unitarier hier etwas sehr<br />
Gutes getan haben und<br />
hoffentlich noch tun werden.<br />
Jeder Unitarier ist von Abt<br />
Bernhard und Pater Schabel<br />
herzlich eingeladen, jederzeit<br />
im Kloster zu Besuch zu sein<br />
und auch dort zu übernachten.<br />
Dieses Ziel ist eine<br />
Reise wert, schaut einmal<br />
vorbei.<br />
Nun fehlen noch 10.000 Euro<br />
Die UNITAS hat bei Beginn des Projekts<br />
Finanzmittel in Höhe von EUR 60.000,00<br />
zugesagt. Bisher wurden ca. EUR 52.000,00<br />
durch Spenden aufgebracht und über<br />
Renovabis nach Osek gezahlt.<br />
Ich bitte alle Unitarier, die restliche<br />
Summe oder möglichst etwas mehr bis<br />
zum Jahresende zu spenden, damit dieses<br />
wertvolle Projekt weiter Erfolg haben<br />
kann. Allen Spendern möchte ich für Ihre<br />
Großherzigkeit auch im Namen von Abt<br />
Bernhard sehr herzlich danken.<br />
Soziale Projekte des UNITAS-Verbandes<br />
ARTIKEL IN DER VERBANDSZEITSCHRIFT AB AUSGABE 5/1997<br />
Prijedor: Das Soziale Verbandsprojekt<br />
Braucht unsere Hilfe! - 3/2004<br />
Prijedor in Bosnien-Herzegowina: Die<br />
aktuelle Aktion zum Sozialen Projekt -<br />
4/2004<br />
Das Ziel fast erreicht! Bericht über unser<br />
Projekt in Prijedor - 1/2005<br />
„Auftrag erfüllt!“ – Bericht des Beauftragten<br />
für das Soziale Projekt in Projedor<br />
- 2-3/2005<br />
Neues Soziales Projekt des UNITAS-Verbands<br />
„Begenungshaus für Kinder in<br />
Osek/Dlouha-Louka“ - 4/2005<br />
Neues aus Caracas: In Venezuela geht es<br />
weiter - 3/2006<br />
Venezuela: Unser Projekt ist feierlich eingeweiht<br />
- 2/2007<br />
Zusammenstellung: Dieter Krüll
Walter Keller – Ein unitarisches Leben<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. FRITZ FLACH, WÜRZBURG<br />
Breslau im Jahre 1917. Der Erste Weltkrieg<br />
zieht sich jetzt schon ins vierte<br />
Jahr. Die Bevölkerung hat die katastrophale<br />
Nahrungsmittelversorgung<br />
im so genannten „Steckrübenwinter“<br />
einigermaßen überstanden, es nähert<br />
sich ein weiterer leidvoller Winter, der<br />
durch Lebensmittelknappheit und<br />
Rationierung des Heizmaterials die<br />
Bevölkerung in Lethargie und Depression<br />
versinken lässt.<br />
In dieser durch Hunger, Leid und Tod<br />
gekennzeichneten Zeit erblickt in der Familie<br />
Keller ein weiterer Sohn den Septembersonnenschein,<br />
der auf den Namen<br />
Walter nach protestantischem Ritus getauft<br />
wird. In seiner neunköpfigen Familie wächst<br />
er wohlbehütet und gerüstet für den Gang<br />
durchs Leben heran. Vor allem seine Mutter<br />
legt das Fundament für die Entfaltung der<br />
religiösen Gaben. Mit zehn Jahren ist Walter<br />
soweit, dass er und mit ihm alle Geschwister<br />
zum katholischen Glauben konvertieren.<br />
Die weitere Kindheit und Jugendzeit<br />
ist geprägt durch die dreijährige<br />
Schulzeit am Missionsgymnasium der<br />
Oblaten in Striegau, wo er vom damaligen<br />
Adolf Kardinal Bertram (s. Bild) das Sakrament<br />
der Firmung empfängt. Noch ist nicht<br />
vorauszusehen, dass der Firmling sich einmal<br />
der gleichen Korporation wie sein Bischof<br />
anschließen wird. Das Matthias-<br />
Gymnasium in Breslau, das auch schon<br />
Joseph Freiherr von Eichendorff besucht<br />
hatte, ist die nächste Schule, wo ihm dann<br />
1937 das Zeugnis der Reife überreicht wird.<br />
Damit steht dem jungen Abiturienten<br />
der Weg zum Studium offen – zumindest<br />
theoretisch. Da er aus seiner Gegnerschaft<br />
zum nationalsozialistischen Gedankengut<br />
keinen Hehl macht und als Anti-Nazi verschrien<br />
ist, droht ihm die Zwangsexmatrikulation.<br />
Deshalb entscheidet er sich bereits<br />
im Zweitem Semester notgedrungen<br />
zur freiwilligen Meldung beim Militär. Ab<br />
1938 bei der Wehrmacht wird er ein Jahr<br />
später, dem Sterbejahr seines Vaters, an der<br />
Grenze bei Gleiwitz stationiert. Die Grausamkeit<br />
des Krieges erlebt er im Polen-,<br />
Frankreich- und Russlandfeldzug, bis er bei<br />
der Invasion im September 1944 zunächst<br />
in belgische Gefangenschaft gerät und<br />
dann in ein englisches Lager überstellt<br />
wird. Hier zeigt sich die Entfaltung seiner<br />
Glaubensstärke, die ihm in die Wiege gelegt<br />
und von seiner Mutter intensiviert wurde:<br />
Für alle sichtbar trägt er das Kreuz zum<br />
Gottesdienst quer durch das Lager hin zum<br />
Altar. Keinerlei Rücksicht nimmt er dabei<br />
auf ausgediente Alt-Nazis, die in ihrem Innersten<br />
dem braunen Sumpf verhaftet<br />
sind. Ihr verdorbenes Gedankengut lässt<br />
diesen christlichen Bekennermut nicht zu,<br />
es regt sich in ihnen der Plan eines<br />
Meuchelmordes, dem ein englischer Offizier<br />
einen Strich durch die Rechnung<br />
macht.<br />
Zugleich ist dieses Leben in Gefangenschaft<br />
aber auch der Beginn einer neuen<br />
Freundschaft und Quelle für einen neuen<br />
Lebensbund: Hier lernt er Ludwig Freibüter<br />
und somit die UNITAS kennen, die für ihn<br />
neben dem Beruf sein Leben ausfüllen wird.<br />
Nach der Entlassung aus dem Lager in die<br />
neu gewonnene Freiheit studiert Walter in<br />
München Jura und leistet sein Referendariat.<br />
Hier sucht er die Korporation auf,<br />
von deren Prinzipien er überzeugt ist. Als<br />
tätiger Christ, der mit den Gaben des Geistes<br />
und der Seele beschenkt ist, der andererseits<br />
allem Äußerlichen und Peripheren<br />
abhold ist, kommt für ihn nur ein neustudentischer<br />
Verein in Frage: Am 14. Dezember<br />
1947 wird er in die UNITAS Albertus-<br />
Magnus zu München rezipiert und im Februar<br />
1953 philistriert. Kneipen werden<br />
keine geschlagen, Bundesbruder Keller<br />
kann auch darauf verweisen, nie in einer<br />
Wichs gesteckt zu haben. Dennoch gilt er<br />
bis heute als aufmerksamer Konkneipant,<br />
der voll Inbrunst die alten Studentenweisen<br />
cum pectore intoniert und über Jahr-<br />
zehnte hinweg die Corona mit einem rechten<br />
und ausgedehnten Grußwort erfreut.<br />
Die ersten Berufsjahre verbringt er bei<br />
der Allianz in Frankfurt und der LVA in Düsseldorf.<br />
Als 1959 die Frühlingssonne ihre<br />
ersten Strahlen nach Würzburg schickt, da<br />
treffen sie auch im Rheinland unseren<br />
Walter und flüstern ihm das Frankenlied in<br />
die Ohren: „…ins Land der Franken fahren.“<br />
So tritt er denn auch im März in der mainfränkischen<br />
Metropole seinen Dienst bei der<br />
LVA-Unterfranken an und wird gleichzeitig<br />
vom Vorsitzenden Dr. Alois Bulitta beim<br />
Altherrenverein UNITAS-Würzburg als B-<br />
Philister aufgenommen und aktiv. Sein Herz<br />
pocht in erster Linie für die Aktivitas, die<br />
nach mehreren Vereinsgründungen wieder<br />
in einem Coetus zusammengeführt ist:<br />
UNITAS-Würzburg. Sie bedarf dringend<br />
eines Verbindungshauses und dazu<br />
wird das Studentenhilfswerk gegründet.<br />
Als Direktor in der Rentenversicherungsanstalt<br />
und so auch in<br />
Neu- und Umbauten involviert, ist<br />
der neue B-Philister der prädestinierte<br />
Vorsitzende des SHW und<br />
engagiert sich mit dem Zeitaufwand,<br />
der ihm sein Beruf noch ermöglicht.<br />
Unter optimaler Mitwirkung<br />
der Vorstandsmitglieder und<br />
mit finanzkräftiger Unterstützung<br />
vor allem auch des Lohrer Altherrenzirkels<br />
gelingt es, das Haus in der<br />
Schellingstraße zu erwerben. Mit Begeisterung<br />
und Andacht kann das<br />
neue Domizil durch Bundesbruder<br />
Weihbischof Alfons Kempf im Juni<br />
1961 eingeweiht werden. Gleichzeitig<br />
rekonstituiert sich mit Enthusiasmus<br />
die Bavaria, um aufzubrechen in ein<br />
neues, erlebnisreiches Jahrzehnt. Als<br />
neustudentischer Unitarier fühlt<br />
Walter sich eher zur Hetania hingezogen,<br />
da die ausgedehnten und<br />
intensiven Festivitäten nach alter<br />
Bavarentradition seinem Gemüt<br />
nicht so liegen. Um ihn zu zitieren:<br />
„Die Hetanen sind die Bräveren.“<br />
Dennoch akzeptiert er nicht nur die beiden<br />
Ausrichtungen, sondern gestaltet sie auch<br />
auf Verbandsebene tatkräftig mit.<br />
Seine Vorstandstätigkeit in Würzburg<br />
wird beendet durch ein höhere Position im<br />
UNITAS-Verband: Auf der 85. GV in Tübingen<br />
1962 wird Bundesbruder Keller als<br />
Nachfolger von Dr. Ludwig Florian zum Verbandsgeschäftsführer<br />
gewählt und ist 23<br />
Jahre in diesem Amt segensreich tätig für<br />
seinen Studentenverband. Da sein unitarisches<br />
Herz in Würzburg schlägt und er die<br />
Verbandsgeschäftsstelle hierher verlegt,<br />
profitiert auch die Würzburger Korporation<br />
immens davon und ist in Verbandsangelegenheiten<br />
immer bestens informiert. >><br />
unitas 3-4/2007 171
Für sein hohes Engagement ist auch<br />
großer Bedarf gegeben, denn ab Mitte der<br />
60er Jahre schwappt aus den USA einerseits<br />
die Hippie-, andererseits die Protestbewegung,<br />
die in der Studentenschaft<br />
reichlich Nahrung findet. In Deutschland<br />
führt zudem der durch Georg Picht ausgelöste<br />
Alarm über einen – immerhin schon<br />
vor über 40 Jahren – Bildungsnotstand zu<br />
einer Abiturientenschwemme und später<br />
zu vermehrter Akademikerarbeitslosigkeit.<br />
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund<br />
SDS schafft es, auch in die Aktivitates<br />
Streit und Hader zu bringen und Lücken im<br />
Verband aufzureißen. So ist es bezeichnend,<br />
dass unsere Bavaria prompt 1970<br />
zerrüttet ist, als der SDS sich selbst auflöst<br />
und ein Teil davon zur bewaffneten<br />
Schwerstkriminalität abwandert. Gar so<br />
schlimm wird es für unseren Verbandsgeschäftsführer<br />
nicht, er hält das Ruder fest in<br />
der Hand und lenkt das UNITAS-Schiff<br />
vorbei an den scharfen Klippen einer sog.<br />
Kulturrevolution. Dies hauptsächlich durch<br />
das unbeugsame Beharren auf den unitarischen<br />
und letztlich christlichen<br />
Werten. Mainzer Modell<br />
und kurzfristige Aufnahmen<br />
von Damen (z. B. Hathumar-Paderborn)<br />
sind Auswirkungen<br />
brisanter verbandsinternerAuseinandersetzungen<br />
am Ende der 60er Jahre,<br />
lassen aber auch erahnen,<br />
dass er nicht mit sturer Gewalt<br />
versucht, andere Gewalten<br />
zu brechen, sondern<br />
feinfühlig auf sich immer<br />
wieder ändernde Bedürfnisse<br />
der studierenden Jugend<br />
zu antworten weiß.<br />
Trotz etlicher Verluste an<br />
Vereinen ist der Verband an-<br />
fangs 1980 saniert. Es ist<br />
nicht übertrieben zu sagen,<br />
dass sich unser damaliger<br />
Verbandsgeschäftsführer<br />
historisch um die UNITAS<br />
verdient gemacht hat.<br />
Für seine vielfältigen Verdienste neben<br />
dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse<br />
am Bande und der Lorenz-Werthmann-Medaille<br />
der Caritas wird Walter im Mai 1986<br />
zum Ehrenmitglied des Altherrenvereins<br />
und im September 1992 der Aktivitas ernannt.<br />
Soweit er überhaupt Ehrungen zulässt,<br />
sieht er sie als Verpflichtungen an,<br />
sich nicht nur weiterhin, sondern noch<br />
intensiver für seine Klientel einzusetzen. So<br />
war sein segensreicher und großherziger<br />
Geist um dauerhaftes Wohlergehen seines<br />
Verbandes besorgt und bemüht. Dies geschah<br />
vor allem auch vor Ort auf Vereinsebene,<br />
so wie wir es in Würzburg hautnah<br />
erleben durften. Seine nahezu unübersehbaren<br />
B-Philisterschaften (ich zähle ca.<br />
16 Altherrenvereine) und seine Ehrenmitgliedschaften<br />
in diversen Vereinen zeugen<br />
von den unablässigen Besuchsfahrten, die<br />
172<br />
unitas 3-4/2007<br />
ihn quer durch Deutschland und auch nach<br />
Österreich führten. Die Gesamtkilometerzahl<br />
und der Nikotinverbrauch im Dienste<br />
der UNITAS wird jedenfalls nicht mehr zu<br />
ermitteln sein und steigt ins Unermessliche.<br />
Dabei war schon die Regel, dass er<br />
nicht nach einer Kneipe am Ort übernachtet,<br />
sondern nach Würzburg zurückfährt.<br />
Dies aus gutem Grund: entweder war<br />
hier am nächsten Tag ebenfalls z. B. ein<br />
Vereinsfest oder er musste gleich zum<br />
nächsten Verein. Ein Blick in seinen Terminkalender<br />
zeigt noch heute ein volles Programm,<br />
wie es für einen Neunzigjährigen<br />
ausgefüllter nicht sein kann. In den letzten<br />
Jahren konzentriert sich dies allerdings in<br />
der Hauptsache auf seine Herzenskorporation,<br />
die Hetania. Einen Alten Herren mit<br />
solch einer selbst aufgelegten Verpflichtung<br />
wird unser Verein wohl vergeblich ein<br />
zweites Mal suchen. Dabei weiß jeder AH<br />
zumindest aus seiner eigenen Aktivenzeit,<br />
wie zermürbend beispielsweise fünf Konvente<br />
im Semester sein können. Walter<br />
Keller erträgt es mit stoischer Ruhe.<br />
Zur Feier des 90. Geburtstag gehörte für den UNITAS-Ehrensenior<br />
zuerst die Dankmesse in der Würzburger Hofkirche<br />
Dazu möchte ich aber auch eine weitere<br />
Charaktereigenschaft hier nicht unterschlagen,<br />
die man ihm auf den ersten Blick<br />
nicht zutraut bzw. die nicht von jedermann<br />
erkannt wird. Dies ist seine feine Ironie<br />
dort, wo etwas kurz und bündig ohne tierischen<br />
Ernst auf den Punkt zu bringen ist.<br />
Ich denke nur an seine Einstellung zu<br />
Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten,<br />
die für ihn nur „alte Gemäuer“ sind. Nehmen<br />
wir Essen und Trinken, so ist ihm zum<br />
ersten die Zeit zu schade dafür. Von der Unbedarftheit<br />
her gesehen ist sein Leben<br />
vergleichbar dem eines Franziskus von<br />
Assisi, dem das Geben seliger ist als das<br />
Nehmen. Was das Trinken angeht – bekanntlich<br />
ein Glas Bier am Abend – so ist<br />
der Satz von ihm und seiner Schwester<br />
Kläre überliefert: „Wir sind froh über jedes<br />
Glas Wein, das wir nicht trinken müssen.“<br />
Die Politik beurteilt er als Träger des CSU-<br />
Ehrenabzeichens wie folgt: „Alle Parteien<br />
sind von Übel, ich habe mich aber dem geringeren<br />
Übel angeschlossen.“ Und kirchlich<br />
sieht er sich „als der letzte Römling“, bei<br />
dem selbst Bischöfe ihr Placet einholen<br />
müssen, der aber auf den Papst nichts kommen<br />
lässt. Der verstorbene Bundesbruder<br />
Prälat Prof. Dr. Rudolf Schnackenburg hat<br />
ihm jedes Mal von weitem zugerufen, dass<br />
er noch katholisch sei. Dafür hatte Walter<br />
eine freundschaftliche Beziehung zu ihm.<br />
Ich selbst habe es aus dem Munde Rudolfs<br />
vernommen, dass er einmal in seiner leisen<br />
Art betonte: „Der Walter ist tatsächlich ein<br />
wahrer Freund.“ Ein wichtiges Erlebnis<br />
möchte ich noch hervorheben: Sein Bewusstsein,<br />
auf Erden nur Gast zu sein und<br />
ohne Ruhe zur himmlischen Heimat hin zu<br />
wandeln. Dies kam einmal im Jahr sehr<br />
stark zum Ausdruck durch die ununterbrochene<br />
Teilnahme an unserer UNITAS-<br />
Wallfahrt zum Kreuzberg. Im Herbst Anfang<br />
Oktober in der Rhön, egal ob die Sonne<br />
mit ihren letzten Strahlen die weit durchglänzte<br />
Natur noch einmal<br />
aufheizt, ob es regnet oder<br />
stürmt und die „Wall-Leut“<br />
am Kreuzberggipfel beim<br />
sonntäglichen Kreuzweg<br />
erbärmlich frieren lässt:<br />
Pilger Walter Keller geht<br />
unbeirrt seinen Weg,<br />
bekleidet mit dem grauen<br />
Mantel, gestärkt durch ein<br />
karges Mahl und abends das<br />
obligate Glas Klosterbier,<br />
dafür aber bestärkt im<br />
Glauben an Gott und seinen<br />
verherrlichten Sohn Jesus<br />
Christus. Was er sich als<br />
einzigen Luxus erlaubt, ist<br />
die Zigarette nach all den<br />
körperlichen Strapazen. Und<br />
selbst wenn er nun diese<br />
Last nicht mehr auf sich<br />
nehmen kann, so sorgt er<br />
dennoch dafür, dass die<br />
Corona am Samstagabend<br />
an adäquatem Stoff nicht darben muss.<br />
Vieles wäre noch zu ergänzen und zu<br />
vertiefen – allein: es fehlt der Platz dazu.<br />
Rückblickend ist für Walter Keller neben<br />
aller äußeren Bedingtheit auch heute<br />
unitarisch das maßgeblich, was klare und<br />
eigentliche Motivation für seinen Eintritt<br />
vor nahezu 60 Jahren war: „Bestechend für<br />
mich war die eindeutige Zielsetzung und<br />
Aufgabenstellung des UNITAS-Verbandes,<br />
seine religiöse Einstellung, seine Stellung<br />
zu Kirche, Papst und Bischöfen, sein soziales<br />
Engagement, seine Toleranz, bei der sich<br />
jeder so entfalten kann und angenommen<br />
wird, wie er von Gott geschaffen wurde,<br />
und die Ablehnung jeden Standesdünkels.“<br />
Dies ist und bleibt der wesenhafte und<br />
ursprüngliche Antrieb der hervorragenden<br />
und achtenswerten Wirksamkeit unseres<br />
Bundesbruders, sowohl auf Verbands- wie<br />
auf Vereinsebene.
90 Jahre Walter Keller<br />
200 GÄSTE BEIM RUNDEN GEBURTSTAG IN WÜRZBURG<br />
Ein großes Fest, angemessen und<br />
würdig. Es galt zu danken, sich zu<br />
freuen und zu gratulieren. Den Auftakt<br />
machte natürlich das große Danken<br />
in der Heiligen Messe in der Hofkirche<br />
der Fürstbischöflichen Residenz,<br />
die bis auf den letzten Platz<br />
besetzt war. Verstärkt durch die Teilnehmer<br />
der Reise zum diesjährigen<br />
Altherrenbunds- / Hohedamenbundstages<br />
im böhmischen Marienthal,<br />
feierten rund 200 Gäste den Dankgottesdienst<br />
anlässlich des 90. Geburtstags<br />
unseres langjährigen Verbandsgeschäftsführers<br />
und Ehrenseniors<br />
Bbr. Walter Keller.<br />
Dass vor allem diese Messe dem Jubilar<br />
am Herzen liegt, seine besondere Verbundenheit<br />
zu Glauben und Kirche, sprach<br />
auch der Zelebrant an, dem Walter Keller<br />
seit Jahren freundschaftlich verbunden ist:<br />
Bbr. Domdekan Klaus Schimmöller (Eichstätt),<br />
durch zahlreiche Bundesbrüder als<br />
Konzelebranten und Ministranten unterstützt,<br />
stellte in seiner Predigt das unitarische<br />
Vereinsgebet in den Mittelpunkt,<br />
das für Walter „zum Brevier seines Lebens<br />
geworden“ sei: ,,... ut te tote virtute diligant<br />
et, qua tibi placita sunt, tota dilectione<br />
perficiant.“<br />
Im Anschluss an den Segen feierte die<br />
Menge mit einem Ständchen und<br />
„UNITAS“-Rufen ihren Gastgeber auf dem<br />
Residenzplatz, bevor sich die große Kolonne<br />
den Rennweg hinauf zum Luisengarten<br />
zum großen Festkommers begab. Hier<br />
füllte sich das Foyer rasch mit der am Büffet<br />
adäquat verköstigten großen Gästeschar.<br />
Chargierte von zehn Vereinen traten zum<br />
Kommers im großen, vollbesetzten Saal des<br />
Luisengartens an. Als<br />
Überraschungsgast unter<br />
zahlreichen Ehrengästen<br />
war Bbr. Dr. Anton Schlembach,<br />
emeritierter Bischof<br />
von Speyer (Bild rechts),<br />
nach Würzburg<br />
gekommen, um seinem<br />
langjährigen Freund die<br />
Ehre zu geben. Dessen<br />
ereignisreiches Leben und<br />
seine großen Verdienste<br />
führte der souverän<br />
präsidierende Kommersleiter<br />
Bbr. Christoph Jaugstetter<br />
v/o Igel der Corona<br />
noch einmal vor Augen.<br />
Die Festrede mit dem<br />
Titel „Traditione Religione<br />
Fides“ hatte Walter Kellers Nachfolger im<br />
Amt als Verbandsgeschäftsführer, Bbr.<br />
Ministerialdirektor a. D. Dr. Wolfgang Burr,<br />
nur zu gerne übernommen (s. folgende<br />
Seite). Routiniert und commentfest geleitet,<br />
zog die Veranstaltung durch bis zu den<br />
Grußworten: Als Vertreter der<br />
Kirche von Würzburg hob<br />
Domkapitular Prälat Karl Rost<br />
in sehr persönlich gehaltenen<br />
Worten die aufopferungsvolle<br />
Sorge des Jubilars um seine<br />
pflegebedürftige Schwester<br />
hervor und überreichte eine<br />
Glückwunschurkunde des<br />
Diözesanbischofs. Für den<br />
UNITAS-Verband sprach der<br />
Hohe Vorortspräsident Bbr.<br />
Johannes Günther v/o Rocky<br />
die Glückwünsche aus; eine<br />
ausführliche Würdigung des<br />
Jubilars überließ er dem Verbandsgeschäftsführer<br />
Bbr. Dieter Krüll v/o Rübe.<br />
Gemeinsam überreichten sie Walter ein<br />
Gemälde des Vaters der UNITAS, Hermann<br />
Ludger Potthoff.<br />
Eine außergewöhnliche Ehrung erfuhr<br />
der überzeugte Neustudent durch die Aktivitas,<br />
die mit ihrem Geschenk ihre Wertschätzung<br />
zum Ausdruck brachte: Sechzig<br />
Jahre nach seiner Rezipierung erhielt Bbr.<br />
Keller einen Ehrenzipfel seiner Hetania mit<br />
der Inschrift Valet ancora virtus. Der Senior<br />
des kommenden Semesters, Bbr. Christian<br />
Zerzer v/o Admiral, dankte für die treue<br />
Teilnahme Walters am Leben der Aktivitas<br />
und seine unschätzbare Unterstützung<br />
durch Rat und Tat. Bbr. Fritz Flach überreichte<br />
dem Jubilar für den Würzburger<br />
AHV das Jesus-Buch des Papstes als Hörbuch<br />
auf CD – samt dazu gehörendem CD-<br />
Player, bevor Walter Keller selbst das letzte<br />
Wort an diesem Abend gebührte. Herzlich<br />
bedankte er sich für die Glückwünsche und<br />
das gelungene Fest. Mit einem feierlichen<br />
Salamander klang der Kommers aus.<br />
Am folgenden Nachmittag schloss<br />
sich eine Festakademie im festlich geschmückten<br />
und gut gefüllten Kneipsaal<br />
auf dem Hetanen-Haus an. Mit dieser<br />
Veranstaltung erwiesen die Würzburger<br />
Unitarier ihrem Ehrenmitglied nochmals<br />
im „kleinen“ Kreis die Ehre. Hier ließ es sich<br />
der Jubilar nicht nehmen, bis tief in die<br />
Nacht im Kreise seiner Aktivitas die Feierlichkeiten<br />
ausklingen zu lassen.<br />
Jürgen Schmiesing /<br />
Christof Beckmann<br />
unitas 3-4/2007 173
Einige Bundesbrüder, so der Festredner<br />
Bbr. Dr. Wolfgang Burr (Bild oben), „hätten<br />
bereits erwogen, in Vorbereitung … einen<br />
Abendkurs in Latein für Fortgeschrittene<br />
bzw. für Anfänger zu belegen“. In launigen<br />
Worten erinnerte er an den „Altlateiner“<br />
Walter Keller, der vor genau 70 Jahren, 1937,<br />
am kath. Staatlichen St. Matthiasgymnasium<br />
in Breslau sein Maturum abgelegt<br />
hatte. Doch vom Jubilar gebeten, die Festrede<br />
„bitte auf Hochdeutsch und nicht auf<br />
Latein“ zu halten sowie die Formulierungen<br />
in nicht allzu lustige Wendungen“ zu fassen,<br />
brachte Bbr. Burr in seiner Laudatio man-<br />
174<br />
unitas 3-4/2007<br />
„Traditione Religione Fides“<br />
LAUNIGE UND ERNSTE WORTE IN DER LAUDATIO <strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. DR. WOLFGANG BURR<br />
KLARTEXT<br />
Bbr. Walter Keller wurde auf der GV in<br />
Tübingen 1962 im Alter von 49 Jahren<br />
zum Geschäftsführer gewählt und übte<br />
ab 1. 1. 1963 das Amt 23 Jahre aus.<br />
Freimütig berichtet der junggebliebene<br />
Ehrensenior im Interview der aktuellen<br />
Ausgabe der Vereinszeitschrift „Der Hetane“<br />
aus seinem Leben. Gefragt, was er<br />
mit Blick auf 60 Jahre Mitgliedschaft bei<br />
der UNITAS mitgeben will und jungen<br />
Bundesbrüdern rät, antwortete er:<br />
„Den Aktiven kann ich nur empfehlen,<br />
dass sie festhalten an den Prinzipien, an<br />
unserer Idee der UNITAS und an den Wertvorstellungen,<br />
die uns zu eigen sind. Diese<br />
Dinge müssen gewahrt bleiben. Nur das<br />
macht uns zur UNITAS. Das ist das Wichtigste<br />
vor allen äußeren oder organisatorischen<br />
Dingen. Diese sind sekundär.<br />
Wichtig ist nur die geistige Haltung und<br />
das katholische Prinzip. Das muss uneingeschränkt<br />
aufrecht erhalten bleiben.<br />
Da gibt es kein Abweichen davon.“<br />
ches auf den Punkt. So blieben bis heute die<br />
Würdigungen in der Verbandszeitschrift<br />
anlässlich des 80. Geburtstages gültig.<br />
Damals habe Bbr. Alois Fürst zu Löwenstein<br />
unter dem Titel „Ein Fels im Fluss im Wandel<br />
der Zeit“ ein „kritisches, umfassendes und<br />
abgewogenes Bild“ des Jubilars gezeichnet,<br />
das wie die Laudatio von Bbr. Bernhard<br />
Mihm – „gelungene, angemessene und<br />
nicht zu übertreffende Lebensbilder“ – noch<br />
heute nachlesenswert und diskussionswürdig<br />
bleibe. (Vgl. UNITAS 5/1997, S. 199f.)<br />
In knappen Stichworten ließ Burr die<br />
Lebensstationen Walter Kellers Revue passieren<br />
und erhellte den historischen Hintergrund<br />
der Zeit. Der Jubilar teile den gemeinsamen<br />
Erlebnishintergrund vieler Zeitgenossen<br />
aus der Gründungszeit der Europäischen<br />
Union: „Sie alle stammen aus dem<br />
Territorium des Hl. Römischen Reiches. Ihre<br />
Herkunft sind aber nationale Grenzräume,<br />
sie stammen aus umstrittenen Gebieten,<br />
die oftmals Spielräume großer politischer<br />
Spannungen und zahlreicher Konflikte waren.“<br />
Den Vätern des neuen Europa, dem<br />
Tridentiner Alcide de Gasperi, dem Lothringer<br />
Bbr. Robert Schuman und dem Rheinländer<br />
Konrad Adenauer stellte Bbr. Burr den<br />
Schlesier Walter Keller zur Seite. Er teile wie<br />
sie die Liebe zu ihrer Heimat, sei wie sie geistig<br />
von derselben Katholizität durchdrungen,<br />
die den Nationalsozialismus nie als<br />
Religionsersatz erkennen konnte. „Charakterlich<br />
gefestigt und geprägt von der<br />
Enzyklika ,Rerum novarum‘ des Papstes Leo<br />
XIII., d. h. von einem sozialen, nicht sozialistischen<br />
Menschenbild geprägt, waren und<br />
sind sie in christlicher Tradition verankert.“<br />
Sie suchten stets „eine echte lebensfähige<br />
Gemeinschaft, die von Einzelpersönlichkeiten<br />
geprägt und geformt ist“, betonte<br />
Bbr. Burr. In dieser Tradition habe auch ihr<br />
Glaube Stärkung erfahren. Solche Tradition,<br />
verbunden mit religiöser Überzeugung,<br />
schaffe Treue, erklärte er im Blick auf das<br />
Femegericht, das Walter Keller auf viele<br />
Bitten hin in Band V des UNITAS-Handbuchs<br />
unter dem Titel „Drei Unitarier entgehen<br />
nationalsozialistischer Lynchjustiz“ geschildert<br />
hatte. „Lieber Walter, wir alle wissen,<br />
dass Du mit einem Lob Deiner Person nicht<br />
glücklich leben kannst. Aber gegen Anerkennung<br />
darfst und kannst auch Du Dich<br />
nicht wehren. Im Namen der hohen Festkorona<br />
und aller Unitarier spreche ich Dir<br />
für Dein damaliges Verhalten unserer aller<br />
Anerkennung aus.“<br />
Bbr. Keller sei – wie es Bbr. Hasenberg in<br />
seinem Buch „125 Jahre UNITAS-Verband“<br />
(Köln 1981) genannt hat – „ein treuer Wahrer<br />
unseres unitarischen Erbes“, unterstrich der<br />
Festredner. Er sei seiner traditio bis heute<br />
treu geblieben: „Er war aber nie ein Fundamentalist,<br />
er hat stets das Ganze gesehen. In<br />
der Tradition verhaftet, blieb ihm stets der<br />
klare Sinn für die Realität.“ Das Bild sei aber<br />
unvollständig ohne sein kirchliches und<br />
soziales Engagement. So unterstütze er seit<br />
vielen Jahren zwei Bistümer in Indien, ein<br />
Priesterseminar in Indonesien, Klöster in<br />
Portugal, Spanien, Italien, in der Schweiz<br />
und in Belgien. Besonders seien viele UNI-<br />
TAS-Vereine dem „donator permanens“<br />
dankbar. Keine Einladung, kein Schreiben an<br />
ihn bleibe unbeantwortet und fast immer<br />
sei den Antwortschreiben eine Zuwendung<br />
für die Aktivenkasse beigefügt: „Im Namen<br />
aller, die von Dir unterstützt wurden, insbesondere<br />
im Namen aller Aktivitates<br />
möchte ich Dir in Anlehnung an Dein ,fröhliches<br />
bayerisches Grüß Gott‘ ein herzliches<br />
,Vergelt's Gott‘ sagen!“ Walter Keller, so<br />
Wolfgang Burr, gehöre in die Reihe der<br />
„unitarischen Leuchttürme, die auf Verbandsebene<br />
in der Dunkelheit Ziel und in<br />
stürmischer Zeit Richtung wiesen“, an<br />
denen heute kein Verbandshistoriker<br />
vorbeikomme.„Wenn ich die Person unseres<br />
lieben Walter beschreiben dürfte, dann<br />
würde ich dies wie folgt zusammenfassen:<br />
Er glaubt an die Botschaft des Evangeliums,<br />
er setzt sein Vertrauen in die demokratische<br />
Freiheit, er lebt in der Hoffnung auf die<br />
Gnade des Herrn und er handelt nach dem<br />
Imperativ der Pflicht.“<br />
Silberne Ehrennadel<br />
für Bbr. Dr. Aretz<br />
Eine verdiente Auszeichnung und fröhliche<br />
Mienen: Bbr. Staatssekretär a. D. Dr.<br />
Jürgen Aretz wurde bei der Festakademie<br />
am Samstag auf dem Hetanen-Haus<br />
für seine Verdienste um die UNITAS<br />
durch den stellvertretenden Verbandsgeschäftsführer<br />
Bbr. Dr. Markus Heubes die<br />
Silberne Ehrennadel des Verbandes übergeben.<br />
Der Ehrensenior des Verbandes,<br />
Walter Keller, freute sich, als erster Gratulant<br />
die Ehrenurkunde zu überreichen.
Stiftung UNITAS 150 PLUS<br />
STIFTUNGSVERMÖGEN IST AUF ÜBER EUR 500.000 ANGEWACHSEN!<br />
Liebe Bundesschwestern,<br />
liebe Bundesbrüder,<br />
diese überaus erfreuliche Nachricht will ich<br />
Euch nicht vorenthalten. Kuratorium und<br />
Vorstand der Stiftung danken allen Stiftern<br />
und Spendern sehr herzlich für die bisher<br />
gezeigte Großzügigkeit. Fundraising-Fachleute<br />
sagen mir immer wieder, dass ein<br />
solches Ergebnis in so kurzer Zeit (gerade<br />
mal zwei Jahre) hervorragend und ein<br />
deutlicher Beleg dafür ist, dass die Unitarier<br />
und Unitarierinnen eine tiefe Verbundenheit<br />
zu ihrer UNITAS und damit zu den<br />
unitarischen Zielen der Stiftung haben.<br />
Wir alle können mächtig stolz sein auf<br />
dieses Ergebnis, und zwar auch diejenigen,<br />
die bisher noch nichts dazu beitragen<br />
konnten, weil ihre wirtschaftliche Situation<br />
dies nicht erlaubt hat. Schließlich<br />
stammen ca. 206.000 EUR aus dem Vermögen<br />
des UNITAS-Verbandes und damit<br />
aus Beitragseinnahmen aller Bundesschwestern<br />
und Bundesbrüder.<br />
UNITAS<br />
Stiftung<br />
Der Zuschuss des Verbandes war möglich,<br />
da der letzten Beitragserhöhung um EUR<br />
10,00 p. a. keine wesentlichen Kostensteigerungen<br />
gegenüber standen und der<br />
Zuschuss des Verbandes an den ZHBV<br />
vorübergehend ausgesetzt wurde. Allerdings<br />
verliert der Verband von Jahr zu<br />
Jahr 100 bis 120 Mitglieder durch Tod oder<br />
(in geringem Umfang) durch Austritt.<br />
Fast 40 Prozent unsere Mitglieder sind<br />
über 70 Jahre alt. 100 Mitglieder weniger<br />
bedeutet einen Einnahmenausfall von<br />
EUR 6.000 pro Jahr, so dass der Effekt der<br />
letzten Beitragserhöhung etwa im Jahre<br />
2010 durch Mitgliederschwund aufgezehrt<br />
sein wird.<br />
Hier wollte und will die Stiftung ansetzen<br />
und zukünftig – ein ausreichendes Stiftungsvermögen<br />
vorausgesetzt – Leistungen<br />
des Verbandes z. B. an den Hausbauverein<br />
UNITAS e.V. (ZHBV) übernehmen, so<br />
dass die Wohnheimförderung nicht mangels<br />
Einnahmen zurückgefahren werden<br />
muss. Denn das Zimmerangebot in unitarischen<br />
Verbindungshäusern ist nach wie<br />
vor die beste Möglichkeit, junge Studierende<br />
für die UNITAS zu gewinnen.<br />
Diesem Ziel dient bekanntlich auch die<br />
erste kleine Fördermaßnahme der Stiftung:<br />
„Wohnheimförderung für begabte<br />
Studienanfänger“, für die wir zuletzt in<br />
einem Spendenbrief geworben haben. Ich<br />
hoffe sehr, dass die Philologen und Geistlichen,<br />
die Werbeplakate der Stiftung zu<br />
diesem Förderprojekt auch an Schulen,<br />
Kirchengemeinden und Jugendgruppen<br />
verteilt haben.<br />
Mit dem Projekt „Wohnheimförderung<br />
für begabte Studienanfänger“ können<br />
nämlich mehrere Ziele verfolgt und erreicht<br />
werden:<br />
1. Studienanfänger werden bei der Zimmersuche,<br />
auch finanziell, unterstützt.<br />
2. Die Aktivitates unserer Vereine erhalten<br />
Unterstützung bei der Keilarbeit.<br />
3. Unsere Stifter und Spender erfahren die<br />
Sinnhaftigkeit ihrer Spende.<br />
Die Förderbedingungen waren auf der<br />
Rückseite der letzten Ausgabe der UNITAS<br />
Nr. 2/2007 abgedruckt. Bitte dort nachschlagen.<br />
Nochmals: Wir sind dankbar und mit dem<br />
bisherigen Spendenergebnis sehr zufrieden!<br />
Zur letzten GV angefertigte<br />
Statistiken zeigen aber, dass – entgegen<br />
der ursprünglichen Kalkulation (2.000<br />
Spender von ca. 5.500 Mitgliedern) – zu<br />
diesem Zeitpunkt nur 732 Unitarier in das<br />
Stiftungsvermögen einmal oder mehrmals<br />
eingezahlt haben.<br />
Andererseits hatte ich unverbesserlicher<br />
Optimist gehofft, dass der Aufruf der 128.<br />
GV-Bonn an alle Bundesschwestern und<br />
Bundesbrüder ein größeres Echo finden<br />
würde, in einem einmaligen Kraftakt (und<br />
nicht auf Dauer angelegt) durch Zahlung<br />
von jeweils EUR 200,00 in den Jahren<br />
2005, 2006 und 2007 die Zukunft der<br />
UNITAS zu sichern.<br />
Unsere Prinzipien und der Lebensbund der<br />
unitarischen Gemeinschaft sind so wertvoll,<br />
dass wir heute in Solidarität mit zukünftigen<br />
Generationen nichts unversucht<br />
lassen dürfen, die UNITAS zu erhalten<br />
und zu fördern. Dies ist das eigentliche<br />
Ziel der Stiftung.<br />
Die Statistiken zeigen auch, dass vor allem<br />
die älteren Bundesschwestern und Bundesbrüder<br />
im Rentenalter mit etwa zwei<br />
Dritteln an der Zahl der Spender und den<br />
Einnahmen beteiligt sind, obwohl diese<br />
häufig nur noch über ein geringeres Renten-Einkommen<br />
verfügen und die Spendenquittungen<br />
steuerlich nicht mehr<br />
nutzen können.<br />
Die noch im aktiven Berufsleben stehenden<br />
Bundesgeschwister halten sich dagegen<br />
zurück. Ich bin davon überzeugt,<br />
dass als Ursache nicht Ablehnung der<br />
UNITAS, sondern Unkenntnis über das Bestehen<br />
und die Ziele der Stiftung zu nennen<br />
ist, da dieser Personenkreis weniger<br />
Zeit findet, die Verbandszeitschrift intensiv<br />
zu lesen.<br />
Unklar bleibt, warum die Spenderquote in<br />
den UNITAS-Vereinen so unterschiedlich<br />
ist. Dies könnte reiner Zufall sein oder<br />
auch an den Bemühungen der Vereins-<br />
vorstände liegen, auf die Ziele der Stiftung<br />
erklärend und werbend hinzuweisen. Es<br />
wäre schön, wenn die Vorsitzenden der<br />
Vereine, ihre Mitglieder erneut auf die<br />
Stiftung ansprechen würden, denn letztendlich<br />
profitieren auch die Vereine von<br />
der Stiftung.<br />
Da die Werbung für die Stiftung in 2005<br />
aus technischen Gründen erst im vierten<br />
Quartal 2005 anlaufen konnte, werden wir<br />
nicht umhin kommen, neben der dritten<br />
Rate der von der GV beschlossenen Spendenaktion<br />
für 2007 auch in 2008 zu<br />
weiteren Zuwendungen an die Stiftung<br />
aufzurufen (Nachholung der meist fehlenden<br />
Rate aus 2005). Das bisherige Einzahlungsergebnis<br />
von gut EUR 500.000 ist<br />
zudem geschönt dadurch, dass eine<br />
größere Zahl von Bundesbrüdern alle drei<br />
Raten auf einmal, also bereits EUR 600,00,<br />
gezahlt haben.<br />
Unser gemeinsames Ziel muss ein Stiftungsvermögen<br />
von rd. 1,5 Mio. EUR bleiben,<br />
da nur eine solch stattliche Summe<br />
dauerhaft auskömmliche Erträge für die<br />
UNITAS abwirft.<br />
Informationsmaterial zur Stiftung und zur<br />
UNITAS, zur besonderen, steuerlichen Abzugsfähigkeit<br />
von Stiftungseinlagen und<br />
Spenden sowie Spendenflyer der Stiftung<br />
können in der Verbandsgeschäftsstelle abgerufen<br />
werden (Tel. 02131-271725 / E-Mail:<br />
stiftung@UNITAS.org oder vgs@UNITAS.org ).<br />
Die Bankverbindungen der Stiftung<br />
UNITAS 150 PLUS lauten:<br />
Pax-Bank e.G. Köln,<br />
Konto.-Nr. 32230016, BLZ 370 601 93 oder<br />
Bank für Sozialwirtschaft Köln,<br />
Konto.-Nr. 8061000, BLZ 370 205 00<br />
Bei Einzahlungen bitten wir alternativ<br />
anzugeben:<br />
• „Zustiftung“, wenn Zuwendungen zum<br />
dauerhaften Stiftungskapital gewollt<br />
sind (z. Z. zum Aufbau des Stiftungskapitals<br />
vordringlich).<br />
• „Spende“, wenn die Zuwendung von<br />
Spendenmitteln zur kurzfristigen Verwendung<br />
für Förderzwecke beabsichtigt<br />
ist (ggf. Zweck angeben).<br />
Jeder, auch ein kleiner Betrag ist<br />
wertvoll und wir wissen, dass nicht alle<br />
sich eine Spende leisten können.<br />
Nochmals herzlichen Dank an alle Stifter<br />
und Spender für die Unterstützung<br />
der Stiftung.<br />
semper in unitate<br />
Dieter Krüll, VGF<br />
(Vorsitzender des Stiftungsvorstands)<br />
unitas 3-4/2007 175
UNITAS Coloniensis:<br />
Von Straßburg nach Köln<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>.<br />
PROF. HERBERT HÖMIG<br />
UNITAS-Straßburg<br />
Die Kölner Universität gibt<br />
als drittälteste Universität im<br />
deutschen Sprachraum nach<br />
Wien und Heidelberg stolz das<br />
Gründungsjahr 1388 an. 1988<br />
beging sie die Sechshundertjahrfeier<br />
ihrer ersten Gründung.<br />
Dabei gedachte man<br />
auch ihrer Wiederbegründung<br />
1919, nachdem die alte Kölner<br />
Alma mater durch die französische<br />
Besatzungsmacht am 2.<br />
April 1798 aufgehoben worden<br />
war. Der letzte Rektor, Ferdinand<br />
Franz Wallraf (1748-1824),<br />
hatte nach dem Wiener Kongress<br />
von 1814/15 vergeblich<br />
ihre Wiederherstellung gefordert.<br />
Stattdessen wurde die<br />
benachbarte Universität Bonn<br />
durch eine Kabinettsordre des<br />
preußischen Königs Friedrich<br />
Wilhelms III. vom 26. Mai 1818<br />
errichtet. Die Abneigung des<br />
protestantischen Preußen gegen<br />
das traditionell katholische Köln sprach<br />
dabei mit. Anstelle der alten Universität in<br />
der Domstadt fiel die Wahl der Regierung<br />
auf Bonn. Man entschloss sich, an das nur<br />
kurze Erbe der von Kurfürst Maximilian<br />
Franz, dem jüngsten Sohn der Kaiserin<br />
Maria Theresia, begründeten „Maxischen<br />
Akademie“ in Bonn anzuknüpfen.<br />
Die Wurzeln der Kölner UNITAS lassen<br />
sich bis in die frühere Kaiser-Wilhelms-<br />
Universität in Straßburg vor 1918 zurückverfolgen.<br />
Einschlägige Nachrichten verdanken<br />
wir den BbrBbr. Dr. Joseph Klersch<br />
(UNITAS Sigfridia und UNITAS Erwinia) und<br />
Dr.-Ing. Rudolf Schmidt (UNITAS Erwinia<br />
und UNITAS-Salia), die den Spuren der in<br />
Straßburg und Köln ansässigen Vereine<br />
nachgegangen sind. So ist der Weg der<br />
UNITAS von Straßburg nach Köln sehr<br />
konkret zu verfolgen. Er begann 1872, als<br />
fünf junge Freiburger Unitarier nach Straßburg<br />
kamen. Am 21. Oktober 1898 trafen sie<br />
sich im Hause von AH Prof. Dr. Wilhelm<br />
Hahn, damals Vorsitzender des Straßburger<br />
Philisterzirkels, um die Bildung einer neuen<br />
Korporation zu beraten. Als Vorsitzender<br />
des Coetus, dem bereits drei Füchse angehörten,<br />
wurde stud. iur. Karl Joder gewählt.<br />
176<br />
unitas 3-4/2007<br />
Fünf Tage später fand der erste Konvent<br />
statt, wenige Wochen danach das erste<br />
Vereinsfest im Priesterseminar. Zu diesem<br />
Zeitpunkt verfügte man bereits über<br />
Schärpen, Baretts und Schläger.<br />
Die Funktion des zunächst noch nicht<br />
vorhandenen AHV für UNITAS Straßburg,<br />
auch UNITAS Argentinensis genannt, übte<br />
noch eine Zeitlang der Straßburger Zirkel<br />
aus, unterstützt von zahlreichen Unitariern<br />
aus dem Elsaß, Lothringen, dem Saargebiet<br />
und anderen Gebieten Westdeutschlands.<br />
Schon 1899/1900 hatte UNITAS Straßburg<br />
den Vorort des Verbandes inne. Die Vorortspräsidenten<br />
hießen F. Hinsler und<br />
P. Halfmann. Doch begann die eigentliche<br />
Blüte der Korporation erst nach 1900,<br />
nachdem andere Unitarier an die Universität<br />
im damaligen „Reichsland Elsass-<br />
Lothringen“ kamen. Bald gewann man<br />
acht Neofüchse. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass die Atmosphäre angesichts<br />
des sogenannten Akademischen Kulturkampfes<br />
in Straßburg keineswegs für<br />
katholische Vereine günstig gewesen ist.<br />
Schlagende Verbindungen und Korps<br />
standen den katholischen Verbänden<br />
besonders feindselig gegenüber. Umso<br />
mehr Beachtung verdient der Umstand,<br />
dass die Straßburger Unitarier zu Kaisers<br />
Geburtstag und zu den Universitätsfesten<br />
um die Jahrhundertwende in aller<br />
Öffentlichkeit – die Chargen im Vollwichs –<br />
wie berichtet wurde, mit Pferd und Wagen<br />
auffuhren.<br />
Im Hinblick auf die Entwicklung von<br />
UNITAS Straßburg ist zu erwähnen, dass<br />
die Universität erst 1903 eine katholischtheologische<br />
Fakultät erhielt. Dorthin<br />
wurden auch mehrere Unitarier berufen,<br />
unter anderen der angesehene Kirchenhistoriker<br />
Prof. Dr. Albert Ehrhard. 1904/5<br />
war Straßburg zum zweiten Mal Vorort<br />
unter dem Präsidenten stud. phil. Wilhelm<br />
Krause, der auch die Generalversammlung<br />
von 1905 leitete. In den Jahren<br />
danach geriet die Korporation vorübergehend<br />
in die sogenannte Couleurkrise,<br />
von der sie sich um 1909 allmählich<br />
wieder erholte.
Ein für den Verband wichtiges Datum<br />
aus dieser Zeit ist noch zu vermelden: 1911<br />
wurde Robert Schuman (1886-1963), der<br />
zuvor in Bonn und Berlin studiert hatte, in<br />
Straßburg philistriert, nachdem er dort zum<br />
Doktor der Rechte promoviert worden war.<br />
Sein lebenslanges Bekenntnis zur UNITAS<br />
ist über den Verband hinaus bekannt. Nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg gehörte der<br />
zeitweilige französische Ministerpräsident<br />
und Außenminister neben Alcide de<br />
Gasperi, Jean Monnet und Konrad<br />
Adenauer zu den Vorkämpfern der<br />
europäischen Einigung.<br />
Der Weg<br />
zur Kölner UNITAS<br />
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs<br />
bedeutete das Ende der deutschen „Reichsuniversität“<br />
und das praktische Ende von<br />
UNITAS Straßburg, nachdem das Elsass<br />
wieder zu Frankreich zurückgekehrt war.<br />
Die Lage in Köln nach dem Ersten Weltkrieg<br />
war in mancher Hinsicht derjenigen in<br />
Straßburg in deutscher Zeit, also vor der<br />
Jahrhundertwende, vergleichbar. In Köln<br />
gab es seit Oktober 1913 ein UNITAS-<br />
Kränzchen, aber noch keine Universität.<br />
Viele Bonner Studenten wohnten freilich in<br />
Köln, die täglich nach Bonn fuhren. Senior<br />
des Kränzchens, zu dem die UNITAS<br />
Sigfridia Bonn fünf Mitglieder abgestellt<br />
hatte, war Bbr. Joseph Klersch (1893-1969),<br />
der später noch eine bedeutende Rolle in<br />
der Kölner UNITAS spielen sollte.<br />
Die neuere Geschichte des Kölner Hochschulwesens<br />
begann mit der 1901 begründeten<br />
Kölner Handelshochschule, die<br />
ihre Existenz u. a. den Bestrebungen des<br />
Kaufmanns Gustav v. Mevissens (1815-1899)<br />
verdankte, der durch eine größere Stiftung<br />
private Mittel zu ihrem Aufbau zur Verfügung<br />
stellte. Es dauerte aber noch<br />
dreizehn Jahre, bis der erste Kommilitone<br />
der Handelshochschule zur UNITAS stieß.<br />
Bald kamen noch zwei weitere, die dann<br />
schon an der 1912 ins Leben gerufenen<br />
Kölner Hochschule für Kommunale Verwaltung<br />
am Kölner Hansaring studierten.<br />
Letztere löste die Gründung von 1901 ab.<br />
Im Sommer 1914 verzeichnete das Kränzchen<br />
sieben Aktive und vier Generaldispensierte.<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die<br />
Kölner Universität unter maßgeblicher<br />
Förderung durch den Oberbürgermeister<br />
Konrad Adenauer wiederbegründet. Erster<br />
Rektor war der Nationalökonom Christian<br />
Eckert (1874-1952), der zuvor die Handelsakademie<br />
geleitet hatte. Der Festakt fand<br />
am 19. Juni 1919 im Kölner Gürzenich statt.<br />
Adenauers Appell, „das hohe Werk<br />
dauernder Völkerversöhnung<br />
und Völkergemeinschaft<br />
zum Heile<br />
Europas zu fördern“,<br />
sollte die Universität in<br />
ihrem Charakter prägen,<br />
eine Forderung,<br />
die erst nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg ihre<br />
Chance haben sollte.<br />
Am Tag darauf begann<br />
der ordentliche<br />
Studienbetrieb an vier<br />
Fakultäten. Die Alma<br />
Mater Colonienis war<br />
zunächst in der Süd-<br />
stadt am Rheinufer untergebracht, ehe sie<br />
zum Wintersemester 1934/35 in ein neues<br />
Gebäude am inneren Grüngürtel umzog.<br />
Die Neubegründung der Universität veranlasste<br />
den UNITAS-Verband, auf der<br />
Generalversammlung in Münster zu beschließen,<br />
das Vereinsleben in Köln zu<br />
fördern. Am 9. September 1918 stellte die<br />
GV 750 Mark zur Verfügung, die den drei<br />
Aktiven, die die Chargen stellten, den Start<br />
erleichtern sollten. Bbr. Klersch hatte schon<br />
dafür gesorgt, dass UNITAS Köln in die<br />
Matrikel der Universität aufgenommen<br />
worden war, ehe die Universität überhaupt<br />
eröffnet wurde. Über einen mangelnden<br />
Zulauf von Studenten hatte Köln nicht zu<br />
klagen, als das Millionenheer von Soldaten<br />
aus dem Krieg heimkehrte. Auch frühere<br />
Straßburger Studenten gingen in großer<br />
Zahl nach Köln. Allgemein war damals die<br />
Überzeugung verbreitet, dass Köln die<br />
frühere Rolle der sogenannten Reichsuniversität<br />
als westlichste Hochschule innerhalb<br />
Deutschlands übernehmen solle.<br />
Ein restauratives Moment im Selbstverständnis<br />
der Dozenten und Studenten<br />
war also unverkennbar. Der Vorsitzende des<br />
Kölner Altherrenzirkels, AH Studienprofessor<br />
Alphons Maehser(1879-1936), hatte<br />
einst in Münster, Frankfurt/Main und<br />
Straßburg studiert. Als Vorsitzender des Altherrenzirkels<br />
beantragte er auf der Frankfurter<br />
GV im Juni 1919, UNITAS Köln ausdrücklich<br />
mit der ideellen Fortsetzung der<br />
aufgegebenen UNITAS Straßburg zu beauf-<br />
unitas 3-4/2007 177<br />
>>
tragen. Dies prägte die Kölner Korporationen<br />
in den nachfolgenden Jahren der<br />
Weimarer Republik. Äußeres Zeichen für die<br />
damals angestrebte Zielsetzung war der<br />
Umstand, dass die alte Straßburger Fahne<br />
und der Wichs, die anlässlich einer Primiz in<br />
Andernach im Jahre 1914 zurückgeblieben<br />
war, sich jetzt in Köln befand. Die Fahne<br />
erhielt den Zusatz „Köln“.<br />
Die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge<br />
sind aufschlussreich. Charakteristisch<br />
für die Zeit war der bewusste Rückgriff<br />
auf die – kurzlebige – Straßburger Tradition,<br />
etwa auf dem Publikationsfest von<br />
UNITAS Köln am 24./26. Oktober 1919, das<br />
zugleich als 21. Stiftungsfest von UNITAS<br />
Straßburg begangen wurde. Die Stärke der<br />
Aktivitas war beachtlich, sie umfasste 14<br />
Burschen, 20 Füchse, sechs Aktive und<br />
einen Hospitanten, was insgesamt einem<br />
verbreiteten Interesse an Korporationen in<br />
der damaligen Studentenschaft an den<br />
deutschen Hochschulen entsprach. Nachwuchssorgen<br />
gab es damals kaum. Die<br />
UNITAS wie auch das katholische Verbandswesen<br />
insgesamt erlebten damals einen<br />
Aufschwung. So war es nicht verwunderlich,<br />
dass es nach 1919 nicht bei einer<br />
einzigen UNITAS-Korporation in Köln blieb.<br />
Noch im Wintersemester 1919/20 dachte<br />
man daran, einen weiteren Verein ins Leben<br />
zu rufen. Es war die UNITAS Rheinmark, bei<br />
deren Gründung die Bonner Rhenania<br />
Hilfestellung bot. Der Name entsprach der<br />
damaligen politischen Situation, insbesondere<br />
der gefährdeten politischen<br />
Situation der Rheinlande, in denen sich bis<br />
1923 separatistische Bestrebungen bemerkbar<br />
machten, die sich gegen die Einheit des<br />
Reiches, das seit 1919 Republik war, richteten.<br />
Die Gründung der zweiten Korporation<br />
war der Anlass, die Mutterkorporation<br />
UNITAS Köln ihrerseits umzubenennen. Sie<br />
hieß seit dem Wintersemester 1919/20<br />
UNITAS Erwinia, nach dem Namen des<br />
mittelalterlichen Erbauers des Straßburger<br />
Münsters, Erwin von Steinbach (1244-1318),<br />
den einst Goethe in seinem berühmten<br />
Aufsatz von 1772 „Von deutscher Baukunst“<br />
gefeiert hat. Die Erwinia entwickelte sich<br />
rasch und konnte sogar zwölf Mitglieder an<br />
eine Tochterkorporation, UNITAS Rheinmark,<br />
abgeben. Dass die Erwinia, die in den<br />
Weimarer Jahren stets altstudentisch<br />
orientiert blieb, schon 1924 einen Hausbauverein<br />
gründete, der bald die Rheinmark<br />
folgte, ist bemerkenswert.<br />
Die Deutschritter-UNITAS und die<br />
UNITAS Landshut (nach der Burg Landshut<br />
an der Mosel) wurden 1920, im Jahr des<br />
Kölner Katholikentages, angesichts des<br />
großen Zuspruchs der katholischen Korporationen<br />
in der Studentenschaft begründet.<br />
Im Gründungsbericht von UNITAS Landshut<br />
heißt es: „UNITAS Landshut sind wir genannt<br />
nach der Burg Landshut auf den<br />
178<br />
unitas 3-4/2007<br />
weinreichen Moselhöhen. Eine ‚Landshut’<br />
wollen wir sein in der Westmark Deutschlands,<br />
Hüter des unitarischen Gedankens,<br />
deutscher Sitte und alter studentischer<br />
Bräuche.“ 1927 folgte UNITAS Falkenstein,<br />
die jedoch Ende 1933 in der UNITAS Rheinmark<br />
aufging.<br />
1925 fand die 62. Generalversammlung<br />
des Verbandes in Köln statt. Sie fiel in eines<br />
der sogenannten guten Jahre der Weimarer<br />
Republik, als auch die vielbeachtete Jahrtausendausstellung<br />
der Rheinlande von<br />
Mai bis August stattfand. Die Ausstellung<br />
war der tausendjährigen Zugehörigkeit der<br />
Rheinlande zum Reich gewidmet – ein<br />
politischer Akzent, der angesichts der<br />
separatistischen Umtriebe zu Beginn der<br />
zwanziger Jahre gesetzt wurde, allerdings<br />
in heutiger Sicht auch nicht zu überschätzen<br />
ist. Der kulturgeschichtliche<br />
Aspekt überwog, keineswegs der nationalistische<br />
der dreißiger Jahre. Die GV in der<br />
Pfingstwoche 1925 setzte ihren Schwerpunkt<br />
auf die Klärung der inneren und<br />
äußeren Formen des Verbindungslebens.<br />
Sie besiegelte den sogenannten Couleur-<br />
Streit innerhalb des Verbandes.<br />
Zurück zur Kölner UNITAS. Die 1929<br />
einsetzende Weltwirtschaftskrise verhinderte<br />
die Realisierung der Hausbau-Pläne<br />
von 1924. Es gelang der Altherrenschaft<br />
jedoch, 1930 eine Wohnung in der Trajanstraße<br />
anzumieten, die als vorläufiges<br />
Vereinsheim diente. Um so aufschlussreicher<br />
ist die Nachricht, dass die Aktivitas
der Erwinia sich Ende 1929 ein eigenes<br />
Ruderboot, einen Vierer mit Rollsitzen,<br />
anschaffte. Auch in anderen Korporationen<br />
betrieb man Sport – anscheinend in<br />
größerem Ausmaß als heute.<br />
UNITAS im Dritten Reich<br />
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten<br />
1933 brachte einen gewaltigen<br />
Einschnitt für das Leben der Kölner UNITAS.<br />
Nach der Statistik von Bbr. Dr. Klersch hatte<br />
die Erwinia sieben, die Rheinmark sechs, die<br />
Landshut 14, die Deutschritter-UNITAS und<br />
die Falkenstein je acht Aktive. Bedeutsam<br />
für die künftige Entwicklung war das nationalsozialistische<br />
Studentenrecht, das die<br />
deutsche Studentschaft ähnlich gleich- >><br />
unitas 3-4/2007 179
schalten sollte, wie das unter anderem mit<br />
den verschiedenen Richtungsgewerkschaften<br />
nach dem 1. Mai 1933 geschah. Eine<br />
wesentliche Veränderung für die Kölner<br />
UNITAS-Korporationen bedeutete der Bezug<br />
eines Hauses im Wintersemester 1933/34 in<br />
der Hardefuststraße 3 – nicht allzu weit vom<br />
heutigen UNITAS-Haus am Pantaleonswall<br />
32 entfernt. Es bot Wohnraum für 30 Studenten.<br />
Nach den damaligen Vorschriften<br />
musste das Haus als „Kameradschaftshaus“<br />
mit politischen Schulungen geführt werden.<br />
Die UNITAS versuchte zunächst ihr<br />
traditionelles Verbindungsleben fortzusetzen<br />
und beging insbesondere die regelmäßigen<br />
Vereinsfeste.<br />
Ursprünglich hatte das Regime beabsichtigt,<br />
die Studentenvereine zu kasernieren,<br />
diese Absicht aber nach dem sogenannten<br />
Röhm-Putsch vom Juni 1934<br />
aufgegeben. Die Kameradschaftshäuser<br />
waren eine Erfindung des „Hauptamtes für<br />
politische Erziehung der deutschen Studentschaft“.<br />
Dahinter stand die Absicht, die<br />
zahlreichen Verbindungshäuser der verschiedenen<br />
Verbände zu verstaatlichen,<br />
und darin sogenannte Wohnkameradschaften<br />
einzurichten. Die Kölner UNITAS<br />
musste sich dem äußerlich anpassen.<br />
Schließlich wurde der UNITAS-Verband, der<br />
sich als überkonfessioneller Studentenverband<br />
organisieren musste, am 26. Juli<br />
1938 als staatsfeindliche Organisation<br />
aufgelöst.<br />
Bbr. Dr. Joseph Klersch berichtet, dass er<br />
das übriggebliebene Vermögen von RM<br />
3,48 in der berüchtigten Gestapo-Zentrale<br />
in der Elisenstraße abgeben musste, aber<br />
froh war, dass der dortige Beamte, ein<br />
Weinheimer S.C.er ihn ohne weitere Komplikationen<br />
wieder ziehen ließ. Damit ging<br />
auch das Vermögen und das Haus in der<br />
Hardefuststraße verloren. Die damalige<br />
180<br />
unitas 3-4/2007<br />
politische Atmosphäre war unter anderem<br />
dadurch gekennzeichnet, dass Bbr. Dr.<br />
Klersch die alte Straßburger Vereinsfahne<br />
als sogenannte Leihgabe im Rheinischen<br />
Landesmuseum unterbringen konnte. Die<br />
verbotenen unitarischen Vereinsfeste<br />
fanden künftig bei den Dominikanern in<br />
der Lindenstraße statt, unter dem Schutz<br />
des damaligen Provinzials Bbr. Dr. Laurenz<br />
Siemer OP (1888-1956). Letzterer stand nach<br />
dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom<br />
20. Juli 1944 auf der Fahndungsliste<br />
der Gestapo.<br />
Bbr. Dr. Peter Joseph Hasenberg<br />
(Deutschritter-UNITAS)<br />
(1909-1984), der in seinem<br />
Dienst als Soldat davon<br />
rechtzeitig erfuhr, konnte<br />
die Dominikaner warnen. Im<br />
Steckbrief hieß es: „Sucht<br />
den Provinzial des Dominikanerordens,<br />
Josef Siemer,<br />
genannt Pater Laurentius,<br />
der sich führend an der Vorbereitung<br />
des Attentats auf<br />
den Führer vom 20. Juli 1944<br />
beteiligt hat. Es gelang ihm unmittelbar der<br />
Verhaftung zu entfliehen.“ Bis Kriegsende<br />
konnte sich Bbr. Siemer in Schwichteler bei<br />
Oldenburg versteckt halten. Nach 1945 war<br />
er einer der bekanntesten Kanzelredner in<br />
Köln.<br />
Wiederaufbauzeit<br />
und Gegenwart<br />
Die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges<br />
in Köln, wo fast achtzig Prozent des<br />
Stadtgebietes ausgelöscht waren, kamen<br />
einem totalen Zusammenbruch gleich.<br />
Dass der Dom innerhalb der Trümmerwüste<br />
noch stand, obwohl er große<br />
Schäden erlitten hatte, ist von den Zeitgenossen<br />
oft als Symbol der Hoffnung<br />
empfunden worden. Das erste unitarische<br />
Treffen von zwölf Bundesbrüdern nach dem<br />
Ende der Kampfhandlungen fand schon im<br />
Juli 1945 im Dominikanerkloster Walberberg<br />
statt, organisiert von Bbr. Dr. Peter<br />
Hasenberg, der dort als Bibliothekar eine<br />
vorübergehende Bleibe gefunden hatte.<br />
Bald entstand in Köln ein neuer Altherrenzirkel<br />
unter der Leitung von Baurat Peter<br />
Hoffmann (1903-1990) (UNITAS Landshut),<br />
der auch in Walberberg dabei gewesen war,<br />
und Anfang 1947 ein sogenannter UNITAS-<br />
Club innerhalb der Katholischen Studentengemeinde.<br />
Ihm gehörten<br />
24 Studenten, darunter 15<br />
Kölner an, die am 23. März<br />
1947 zusammen mit dem<br />
Altherrenzirkel ihr erstes<br />
Vereinsfest feierten.<br />
Die nächste Stufe der<br />
Wiederbelebung der Kölner<br />
UNITAS erfolgte, nachdem<br />
die Gründungsverbote der<br />
englischen Besatzungsmacht<br />
aufgehoben worden<br />
waren. Am 17. Mai 1947<br />
konnten neben UNITAS<br />
Erwinia, die am 3. Juni 1947 mit sieben<br />
Aktiven ihr Eigenleben wieder bekann,<br />
UNITAS Landshut und UNITAS Rheinmark<br />
wiederbegründet werden. Die neustudentisch<br />
geprägte UNITAS St. Martin<br />
hatte sich schon im November 1946 ohne<br />
Bindung an einen Verband gebildet, musste<br />
aber 1957 aufgelöst werden.<br />
An der Spitze des AHV von UNITAS<br />
Erwinia stand zunächst wieder AH Dr.<br />
Klersch, der nach einiger Zeit sein Amt an<br />
Bbr. Vermessungsrat Franz Remmer<br />
übergab. Verdienter Ehrensenior der Aktivitas<br />
war AH Dr. Josef Marner von der<br />
UNITAS-Salia, Bonn, der in Köln wohnte.<br />
Geistiger Mentor war AH Msgr. Prof. Dr.<br />
theol. Josef Hünermann, Regens des Priesterseminars<br />
in Aachen. Manche Alte Herren<br />
erinnern sich noch der Karnevalsfeste von<br />
Erwinia und Rheinmark im Fürstenhof am
Dom, die wesentlich von eigenen Kräften<br />
getragen wurden.<br />
In den fünfziger Jahren hatten sich die<br />
drei alten Kölner Korporationen zwar<br />
wieder konsolidiert, doch verfügte man<br />
noch nicht über ein eigenes Haus, obwohl<br />
schon 1947 ein neuer Hausbauverein<br />
gegründet worden war. Die Veranstaltungen<br />
fanden deshalb in wechselnden<br />
Kölner Gaststätten und Restaurants wie der<br />
Funkenburg am Sachsenring, im Hahnenbräu<br />
am Rudolfplatz, in den Zunftstuben<br />
am Kolpingplatz, im „Haus der Begegnung“<br />
in der Jabachstraße oder im Konferenzzimmer<br />
von AH Dr. Joseph Klersch im<br />
Hochhaus am Hansaring statt. Das „Studentenwohnheim<br />
UNITAS“ wurde erst 1964<br />
eingeweiht, nachdem führende Unitarier<br />
öffentliche Mittel für den Bau hatten<br />
gewinnen können. Die Bauleitung hatte<br />
Bbr. Peter Hoffmann.<br />
Mit dem Bau des UNITAS-Hauses begann<br />
die letzte Epoche in der Geschichte<br />
der Kölner UNITAS. Noch heute zeigt die<br />
Statistik, dass es in Köln insgesamt sieben<br />
Korporationen gegeben hat. Die jüngste<br />
Verbindung war UNITAS Nibelung, 1927 an<br />
der Pädagogischen Akademie in Bonn<br />
begründet, 1948 wieder reaktiviert. 1960<br />
wurde sie nach Köln verlagert, u. a. weil die<br />
dortige Pädagogische Hochschule stärker<br />
katholisch geprägt war als die Hochschule<br />
in Bonn. Unter der Führung der Bbr. Prof. Dr.<br />
Josef Esterhues und des Ministerialrates Dr.<br />
August Klein nahm die Korporation einige<br />
Jahre einen beachtlichen Aufschwung, bis<br />
sie in den siebziger Jahren, nachdem sie<br />
zweimal den Vorort des Verbandes innehatte,<br />
unter beträchtlichem Mitgliederschwund<br />
litt.<br />
Bei den meisten anderen Korporationen<br />
war es nicht anders. Hinzu kam die Krise der<br />
deutschen Hochschulen im Gefolge der<br />
Achtundsechziger Bewegung, die der Existenz<br />
des traditionellen Korporationswesens<br />
nicht günstig war. In den achtziger Jahren<br />
gab es dann nur noch eine aktive Korporation,<br />
UNITAS Landshut, nachdem am 2. Januar<br />
1971 die Erwinen geschlossen zur<br />
Landshut übergetreten waren. Die Altherrenvereine<br />
blieben bestehen. Doch führten<br />
Auseinandersetzungen über die äußeren<br />
Formen des Verbindungslebens unter den<br />
aktiven Unitariern Ende der achtziger Jahre<br />
dazu, dass eine Gruppe UNITAS Nibelung<br />
für mehr als ein Jahrzehnt reaktivierte.<br />
Auch eine Wiederbelebung der Erwinia<br />
stand damals zur Debatte. Gegenwärtig ist<br />
UNITAS Nibelung zum dritten Mal suspendiert<br />
worden. Zurzeit bestehen in Köln<br />
UNITAS Landshut und UNITAS Theophanu,<br />
die erste weibliche Korporation der Kölner<br />
UNITAS. Sie benutzen gemeinsam das Haus<br />
Pantaleonswall 32.<br />
Zusammenstellung der Kölner Couleurpostkarten:<br />
Christof Beckmann >><br />
unitas 3-4/2007 181
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. PROF.<br />
DR. HUBERT BRAUN<br />
Die Hochschulen sind seit einigen<br />
Jahren mit vom Staat vorgegebenen<br />
Verfahren wie „Akkreditierung“ und<br />
„Qualitätssicherung“ konfrontiert.<br />
Der Hochschulpolitische Beirat hält es<br />
für geboten, Studenten und Alte Herren<br />
über Zweck und Bedeutung dieser<br />
neuartigen staatlichen Vorgaben zu<br />
informieren.<br />
Bei Berichten in der Presse über die<br />
Hochschulen stolpert man immer häufiger<br />
– auch im Zusammenhang mit dem „Bologna-Prozess“<br />
– über Stichworte wie „Akkreditierung<br />
von Studiengängen“, „Externe<br />
und Interne Evaluation“, und dies unter<br />
dem Vorzeichen einer notwendigen „Sicherung<br />
der Qualität der deutschen Hochschulen“.<br />
Man fragt sich: Was soll das eigentlich?<br />
Sind die deutschen Hochschulen inzwischen<br />
so schlecht, dass ihre Qualität kontrolliert<br />
und gesichert werden muss? Wer<br />
sich für das Hochschulwesen interessiert,<br />
muss wissen, was das bedeutet!<br />
Ein Angelpunkt dieser Thematik ist<br />
auch hier letztlich die Einführung der<br />
graduierten Studiengänge (Bachelor,<br />
Master) im „Bologna-Prozess“. Dabei<br />
182<br />
unitas 3-4/2007<br />
AUS DEM BEIRAT FÜR<br />
HOCHSCHULPOLITIK<br />
„Qualitätssicherung“<br />
und „Akkreditierung“:<br />
Was ist das?<br />
scheint zunächst das Thema „Qualitätssicherung“<br />
und „Akkreditierung“ eher etwas<br />
uninteressantes Technokratisches zu<br />
sein. Das wäre ein Irrtum! Tatsächlich<br />
bedeuten diese Maßnahmen einen tiefen<br />
Eingriff in das Hochschulwesen und im<br />
Grunde auch in die politisch viel beschworene<br />
Autonomie der Hochschulen.<br />
Vorab aber zwei Feststellungen:<br />
1. Hier handelt es sich um ein zentrales<br />
Anliegen der deutschen Hochschulpolitik.<br />
2. Das so genannte Qualitätssicherungssystem<br />
hat zwei tragende Säulen:<br />
Akkreditierung und Evaluation.<br />
Dieser Bericht beschränkt sich auf die<br />
Akkreditierung.<br />
I. Warum bedarf es eines Qualitätssicherungsverfahrens<br />
für<br />
die deutschen Hochschulen?<br />
In der Tradition des deutschen Hochschulwesens<br />
war es eine Selbstverständlichkeit,<br />
dass die Hochschulen durch die<br />
qualifizierte Auswahl ihrer Professoren im<br />
Berufungsverfahren, durch die Forschung<br />
und die Einbeziehung der Forschungsergebnisse<br />
in die Lehre sowie den darauf<br />
basierenden Ansprüchen in den Prüfungen<br />
für eine gute Qualität ihrer Absolventen<br />
sorgten.<br />
Nach dem Hochschulrahmengesetz<br />
(HRG) von 1976 sah der Staat die Notwendigkeit,<br />
durch studiengangspezifische<br />
Rahmenordnungen (§ 9 HRG), gültig für<br />
alle Länder und Hochschulen, die Studiengänge<br />
durch fachlich-inhaltliche Mindeststandards,<br />
Regelstudienzeiten, Anzahl der<br />
Semesterwochenstunden sowie Vorgaben<br />
zum Prüfungsverfahren (z. B. Fristen, Art der<br />
Prüfungsleistungen etc.) zu koordinieren<br />
und zu regulieren. Das Anliegen war, vor<br />
allem bei der Explosion der Studentenzahlen<br />
nach 1970 die Voraussetzungen zu<br />
schaffen, dass ein Studium in der für jeden<br />
Studiengang festgesetzten „Regelstudien-<br />
zeit“ (an der Universität in der Regel vier<br />
Jahre, an der Fachhochschule FHS 3/3,5<br />
Jahre) erfolgreich abgeschlossen werden<br />
könnte, um damit bei den begrenzten<br />
finanziellen Möglichkeiten dem Andrang<br />
zu den Hochschulen gerecht zu werden.<br />
Der Staat verlangte die Anpassung der<br />
Prüfungsordnungen an die neuen Rahmenordnungen,<br />
um die angestrebte Studienreform<br />
zu erreichen. Ein Bemühen, das<br />
relativ wenig erfolgreich war. Die Hochschulen<br />
haben dieses Verfahren schließlich<br />
als zu zeitaufwändig, innovationshemmend<br />
kritisiert und nicht mehr akzeptiert.<br />
Der „Bologna-Prozess“ gab die Möglichkeit,<br />
einen völlig neuen Ansatz zu verfolgen.<br />
Das Instrument der Rahmenprüfungsordnungen<br />
war für diese neuen und<br />
anders strukturierten Bachelor- und Masterstudiengänge<br />
mit anderen Regelstudienzeiten<br />
(drei bis vier und ein bis zwei<br />
Jahre) und neuen Inhalten schlecht<br />
geeignet (Modularisierung, Leistungspunktesystem,<br />
u.a.).<br />
II. Grundlagen<br />
der Akkreditierung<br />
Die Kultusministerkonferenz hat in<br />
rascher Folge ein Akkreditierungssystem<br />
begründet und weiterentwickelt, um die<br />
Voraussetzungen für die Einführung der<br />
neuen Studienstruktur zu schaffen und<br />
deren Qualität zu sichern:<br />
� Beschluss vom 3.12.1998: Ein Akkreditierungsverfahren<br />
für die probeweise
eingeführten Bachelor-/Master-Studiengänge,<br />
� Beschluss vom 1.3.2002: Künftige Entwicklung<br />
der länder- und hochschulübergreifenden<br />
Qualitätssicherung in<br />
Deutschland,<br />
� Beschluss vom 10.10.2003: Ländergemeinsame<br />
Strukturvorgaben gem. § 9<br />
Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von<br />
Bachelor- und Master-Studiengängen,<br />
� Gesetz vom 15.2.2005: „Stiftung zur<br />
Akkreditierung in Deutschland“, und<br />
zuletzt<br />
� Beschluss vom 14./15.06.2007: „Weiterentwicklung<br />
des Akkreditierungssystems“<br />
III. Das deutsche<br />
Akkreditierungssystem<br />
(Programmakkreditierung)<br />
Die umfassenden Regelungen zum Akkreditierungsverfahren<br />
werden in sechs<br />
Punkten holzschnittartig dargelegt:<br />
1. Ziele der Akkreditierung,<br />
2. Organisation des Systems,<br />
3. das Verfahren,<br />
4. Akkreditierung und staatliche Genehmigung,<br />
5. Mindestvoraussetzungen für die Akkreditierung,<br />
6. heutiger Stand der Akkreditierung.<br />
1. Ziele der Akkreditierung<br />
(1) Sie soll Mindestausbildungsstandards<br />
sichern und verlässliche Informationen<br />
über die Qualität eines Studiengangs<br />
geben.<br />
(2) Sie soll die mit der Einführung des Graduierungssystems<br />
(Bachelor-/Master-<br />
Studiengänge) vorgesehene Studienreform<br />
qualitativ und quantitativ (ca.<br />
11.000 Studiengänge) rasch voranbringen.<br />
(3) Sie soll im Zusammenwirken von Staat,<br />
Hochschulen und der Berufspraxis<br />
(Wirtschaft) erfolgen, aber so, dass die<br />
Länder ihrer Verantwortung für die<br />
Studienangebote gerecht werden.<br />
(4) Das Akkreditierungssystem gilt für alle<br />
Hochschulen und langfristig für alle<br />
Studiengänge.<br />
(5) Die Einbeziehung von Vertretern der<br />
Berufspraxis sorgt für die „Beschäftigungsfähigkeit“<br />
der Absolventen.<br />
(6) Das deutsche Akkreditierungssystem<br />
wird in ein internationales Netzwerk<br />
der Qualitätssicherung eingebettet<br />
(z. B. European Association for Quality<br />
Assurance in Higher Education (ENQA),<br />
Consortium for Accreditation in Higher<br />
Education, u. a.).<br />
(7) Die Akkreditierung ist neben der Evaluation<br />
das wichtigste Instrument zur<br />
Qualitätssicherung der Studiengänge.<br />
(8) Weitere Stichworte für den Akkreditierungsprozess<br />
sind:<br />
� Europäische Verflechtung der neuen<br />
Studiengänge auf der Grundlage des<br />
„Bologna-Prozesses“,<br />
� Schaffung einer Vielfalt von neuen<br />
Studiengängen (Differenzierung)<br />
� Profilbildung, Wettbewerb<br />
2. Die Organisation<br />
des Systems<br />
Das Akkreditierungsverfahren ist dezentral<br />
organisiert mit einer Oberinstanz,<br />
dem Akkreditierungsrat und den die Anträge<br />
bearbeitenden Akkreditierungsagen-<br />
turen.<br />
(1) Der Akkreditierungsrat trägt<br />
die zentrale Verantwortung<br />
und Steuerung des Systems:<br />
� er akkreditiert die Agenturen,<br />
d. h. er verleiht ihnen<br />
das Recht, Studiengänge<br />
zu akkreditieren,<br />
� er gibt die Mindeststandards<br />
und den Verfahrensrahmen<br />
vor,<br />
� er kontrolliert, ob diese<br />
Vorgaben eingehalten<br />
werden,<br />
� er übernimmt die internationale<br />
Abstimmung<br />
und Koordinierung im Bereich<br />
der Qualitätssicherung.<br />
Seine Organe sind der Rat (4 VertreterInnen<br />
der Hochschulen, 4 Ländervertreter,<br />
5 Vertreter der Berufspraxis, 2 Studierende,<br />
2 ausländische Experten, 1 Agenturvertreter),<br />
der Vorstand und der Stiftungsrat<br />
(VertreterInnen der Länder und<br />
HRK).<br />
(2) Die akkreditierten Agenturen haben<br />
insbesondere die Aufgabe:<br />
� Überprüfung und Feststellung der<br />
Mindeststandards durch Überprüfung<br />
der von den Hochschulen gestellten<br />
Anträge auf Einrichtung neuer Bachelor-/Master-Studiengänge.<br />
� Einbeziehung interner und externer<br />
Evaluationsergebnisse.<br />
� Funktion und Studierbarkeit der Studiengänge,<br />
Beschäftigungsfähigkeit<br />
der Absolventen in möglichen Berufsfeldern,<br />
� Akkreditierung der Studiengänge, Akkreditierung<br />
unter Auflagen oder Ablehnung<br />
aufgrund der einschlägigen<br />
Vorgaben des Akkreditierungsrats<br />
oder von Kultusministerkonferenz-<br />
(KMK)-beschlüssen.<br />
Die Akkreditierungsagenturen werden<br />
nur dann selbst akkreditiert, wenn sie<br />
unabhängig sind, eine verlässliche Infrastruktur<br />
haben, nicht gewinnorientiert<br />
arbeiten, nicht nur nationale, sondern auch<br />
internationale Kompetenz einbeziehen und<br />
transparent unter Beteiligung von Hochschulen<br />
und der Berufspraxis arbeiten. Sie<br />
sind dem Akkreditierungsrat berichtspflichtig<br />
und werden von diesem überwacht.<br />
Nach fünf Jahren wird die Akkreditierung<br />
überprüft und es kann Reakkreditierung erfolgen.<br />
Das System lässt die Agenturen in<br />
unterschiedlicher Trägerschaft zu (in der<br />
Regel gemeinnütziger Verein oder Stiftung).<br />
Sie haben divergierende Ausrichtungen,<br />
entweder sie betrachten sich als<br />
umfassend zuständig für alle Fachrichtungen,<br />
oder sie sind auf bestimmte Bereiche<br />
konzentriert (z. B. Heilberufe, Ingenieur-,<br />
Naturwissenschaften). Zurzeit gibt es sechs<br />
akkreditierte Agenturen (ZEVA, FIBAA,<br />
ASIIN, ACQUIN, ANPGS, AQAS).<br />
3. Das Verfahren<br />
Den Akkreditierungsagenturen obliegt<br />
die Durchführung. Der Begutachtungsprozess<br />
wird von ihnen unter Einrichtung<br />
einer „peer group“ (fachliches Gutachterteam)<br />
organisiert und begleitet.<br />
Die Anträge der Hochschulen müssen<br />
Angaben zu folgenden Punkten enthalten:<br />
1. Begründung für den Studiengang,<br />
2. Struktur des Studiums und fachlichinhaltliche<br />
Anforderungen,<br />
3. Personelle, räumliche, sächliche Ausstattung,<br />
4. Qualitätssicherungsmaßnahmen (z.B.<br />
Evaluation),<br />
5. Studiengangsbezogene Kooperationen.<br />
Die Agenturen akkreditieren einen Studiengang<br />
ohne Vorbehalt (immer auf 5 Jahre,<br />
dann bedarf er der Reakkreditierung),<br />
oder unter Auflagen (Frist 18 Monate), oder<br />
der Antrag wird abgelehnt. Die Entscheidungen<br />
sind dem Akkreditierungsrat mitzuteilen,<br />
der die Einhaltung der vorgegebenen<br />
Kriterien prüft.<br />
4. Akkreditierung<br />
und staatliche Genehmigung<br />
Die Akkreditierung eines Studiengangs<br />
ersetzt allerdings nicht die staatliche Genehmigung.<br />
unitas 3-4/2007 183<br />
>>
Die Einrichtung neuer Studiengänge,<br />
aber auch Änderungen der Prüfungsordnung<br />
bedurften schon immer prinzipiell<br />
der staatlichen Genehmigung. Umfasste<br />
sie früher auch inhaltliche Aspekte, so<br />
kontrolliert sie jetzt die Gewährleistung der<br />
Finanzierung, die Einbindung in die Landeshochschulplanung<br />
(u.U. Zielvereinbarung),<br />
und die Einhaltung der KMK- oder landesspezifischen<br />
Bedingungen.<br />
Es ist systemlogisch, dass diese staatliche<br />
Genehmigung in allen Ländern entweder<br />
die Akkreditierung zur Voraussetzung<br />
hat oder diese begleitend oder nachträglich<br />
erfolgen muss.<br />
5. Mindestvoraussetzungen<br />
für eine Akkreditierung<br />
(1) „Systemsteuerung der Hochschule“,<br />
d. h. die Hochschule hat ein eigenes<br />
Verständnis von Qualität im Studium<br />
und kann dies dokumentieren.<br />
(2) „Bildungsziele des Studiengangkonzepts“,<br />
d. h. der Studiengang orientiert<br />
sich an wissenschaftlichen fachlichen<br />
und überfachlichen Bildungszielen.<br />
(3) „Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs<br />
in das neue Studiensystem“<br />
(Bologna), d. h. der Studiengang entspricht<br />
den von den Ländern beschlossenen<br />
Anforderungen qualitativ<br />
(B. von 21.04.2005) und strukturell<br />
(B. v. 10.10.2003).<br />
(4) Der Studiengang soll „methodische und<br />
generische Kompetenzen“ vermitteln.<br />
(5) Die Realisierung muss gesichert sein.<br />
(6) Die Prüfungen basieren auf definierten<br />
Bildungszielen.<br />
(7) Der Studiengang, -verlauf und Prüfungen<br />
müssen transparent dokumentiert<br />
sein, und die Qualität wird durch ein<br />
internes Qualitätsmanagement gesichert.<br />
6. Stand der Akkreditierung<br />
Zum Stand der Akkreditierung informiert<br />
das Schaubild in diesem<br />
Artikel. Quelle: Akkreditierungsrat, Stand:<br />
16.06.2007.<br />
184<br />
unitas 3-4/2007<br />
IV. Zur Problematik des<br />
Akkreditierungsverfahrens<br />
1. Warum eigentlich Akkreditierung<br />
in Deutschland?<br />
Das Akkreditierungswesen wurde dort<br />
eingeführt, wo Hochschulen vor allem auch<br />
von privaten Institutionen betrieben werden<br />
und sich dadurch eine sehr heterogene<br />
Qualität dieser Einrichtungen ergibt. Das<br />
Musterbeispiel sind die USA. Diese Tatsache<br />
machte dort ein System zur Sicherung von<br />
Mindeststandards erforderlich, an dem<br />
auch die Berufsverbände beteiligt sind.<br />
Daher ist dieses System eigentlich für<br />
Deutschland mit seinen vorwiegend staatlich<br />
finanzierten Hochschulen und einem<br />
tradierten Qualitätsverfahren (siehe Einleitung<br />
unter I.) befremdend. Und nicht nur<br />
das! Es bedeutet letztlich, dass bildungspolitisch<br />
die traditionellen Qualitätsmaßstäbe<br />
und -garantien als nicht mehr ausreichend<br />
angesehen werden und diese<br />
durch den „Bologna-Prozess“ obsolet geworden<br />
sein sollen.<br />
2. Kosten- und<br />
Verfahrensprobleme<br />
Die Kritik der Hochschulen bezieht sich<br />
zunächst darauf, dass die Kosten erheblich<br />
sind. Sie liegen für einen konsekutiven<br />
Studiengang bei ca. 10.000 bis ca. 15.000<br />
Euro. Sie sind von den Hochschulen zu<br />
tragen, d. h., die Kosten fallen in der Regel<br />
bei den Fachbereichen oder Instituten an<br />
und führen dadurch zu einer erheblichen<br />
Einschränkung der Ausgaben für Forschung<br />
und Lehre.<br />
Ferner wird das Verfahren als zu aufwändig<br />
bezeichnet. Der verwaltungsmäßige<br />
und fachspezifische Arbeitsaufwand<br />
ist enorm, so dass andere Aufgaben<br />
(z. B. Forschung) vernachlässigt werden<br />
müssen. Dabei sind bis jetzt von ca. 11.000<br />
zu erwartenden Studiengängen erst rd.<br />
2500 akkreditiert und gut die Hälfte nur<br />
unter Auflagen.<br />
Schließlich ist ein entscheidender Gesichtspunkt,<br />
dass das Verfahren den Hochschulen<br />
zu wenig Steuerungsüberblick und<br />
-flexibilität gibt, da das System immer nur<br />
einen bestimmten Sektor begutachtet. Die<br />
Verantwortung der Hochschulen für die<br />
Qualität der Studiengänge wird dadurch<br />
eher beeinträchtigt.<br />
3. Weiterentwicklung<br />
der Programmakkreditierung<br />
Die genannten Probleme haben dazu<br />
geführt, dass auch die KMK die Notwendigkeit<br />
der Weiterentwicklung erkannt hat.<br />
Dem lag auch die Einsicht zugrunde, dass<br />
eigentlich nur die Hochschulen vor allem in<br />
der Lage sind, hohe Qualität von Studium<br />
und Lehre zu gewährleisten. Die Eigenverantwortung<br />
muss als tragende Säule der<br />
Ausbildung wieder stärker berücksichtigt<br />
werden.<br />
Die KMK ist daher einem Vorschlag des<br />
Akkreditierungsrats gefolgt, das derzeitige<br />
Verfahren probeweise durch die „Systemakkreditierung“<br />
zu ergänzen. Im Ergebnis<br />
wird bei dieser Akkreditierungsform auf<br />
eine Begutachtung einer Agentur verzichtet,<br />
wenn der Hochschule bescheinigt<br />
werden kann, dass sie durch ihr internes<br />
Qualitätssicherungssystem in der Lage ist,<br />
die Qualitätsziele zu gewährleisten.<br />
Dies bedeutet – jedenfalls teilweise –<br />
eine Rückkehr zum tradierten deutschen<br />
Hochschulverständnis.<br />
Die KMK hat diesen Vorschlag unter<br />
gewissen Bedingungen für geeignet erklärt<br />
(B. v. 14./15.06.2007), allerdings mit der<br />
Maßgabe, dass beide Verfahren – Programm-<br />
und Systemakkreditierung – auf<br />
lange Zeit nebeneinander durchgeführt<br />
werden müssen.<br />
Anmerkung: Dem Bericht liegen u. a. die<br />
Beschlüsse der KMK sowie Veröffentlichungen<br />
der HRK (z. B. Bologna-Reader I<br />
und II) sowie Internet-Veröffentlichungen<br />
des Akkreditierungsrats zugrunde.
Guardini-Stiftung feierte<br />
20 Jahre in Berlin<br />
BERLIN. Die Guardini-Stiftung hat in Berlin<br />
ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Spitzenvertreter<br />
aus Kirche und Politik würdigten<br />
am 20. Oktober deren Engagement für<br />
einen Dialog zwischen Kunst, Wissenschaft<br />
und Religion. Benannt ist sie nach dem<br />
katholischen Theologen Bbr. Romano<br />
Guardini (1885-1968). Von 1923 bis 1939 hielt<br />
er an der damaligen Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität vielbeachtete Vorträge über<br />
Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung.<br />
Dessen Wirken führt die Stiftung<br />
unter anderem mit einer Professur an<br />
der Humboldt-Universität fort.<br />
In ökumenischem Geist entspreche sie<br />
dem wachsenden Bedürfnis nach Orientierung,<br />
sagte in seinem Grußwort der<br />
Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff,<br />
Vorsitzender der Kommission für Wissenschaft<br />
und Kultur in der Bischofskonferenz.<br />
Die Stiftung wurde im Rahmen der Vorbereitung<br />
des Berliner Katholikentags 1990<br />
als eingetragener Verein gegründet. 2004<br />
errichtete sie mit Hilfe weiterer Förderer ein<br />
Kolleg und die Stiftungsprofessur, die der<br />
Philosoph Ludger Honnefelder übernahm.<br />
Dessen Nachfolger ist seit dem Wintersemester<br />
der Innsbrucker Jesuit und Philosoph<br />
Edmund Runggaldier. Er will einen Schwerpunkt<br />
auf das Verhältnis von „Orientierungswissen<br />
und praktischer Rationalität“<br />
setzen – so der Titel der Ringvorlesung. Inzwischen<br />
ist die Guardini-Stiftungsprofessur<br />
für Religionsphilosophie und Katholische<br />
Weltanschauung für weitere fünf<br />
Jahre gesichert. Die beiden Liechtensteiner<br />
Stiftungen, die die Professur bereits seit<br />
2004 fördern, haben eine weitere Unterstützung<br />
zugesagt.<br />
Die Geldquellen<br />
der Studenten<br />
BONN. Studenten in Deutschland verfügten<br />
2006 durchschnittlich über 770 Euro im<br />
Monat. Nach Alter und Einkommensquellen<br />
zeigen sich jedoch deutliche Verschiebun-<br />
gen, wie das Deutsche Studentenwerk in<br />
seiner 18. Sozialerhebung ermittelte. Studenten<br />
bis zum 21. Lebensjahr erhalten 64<br />
Prozent ihres Einkommens von den Eltern,<br />
nur ein Zehntel wird selbst verdient. Je jünger<br />
die Studierenden, desto niedriger das<br />
Einkommen und desto höher die Finanzspritzen<br />
aus dem Elternhaus. Mit zunehmendem<br />
Alter des studierenden Nachwuchses<br />
steigen die Einnahmen der Studenten<br />
und sinkt der Anteil, den Eltern<br />
beisteuern. So erwirtschaften Studierende<br />
zwischen 24 und 25 Jahren ein Viertel ihrer<br />
Einnahmen selbst, über die Hälfte wird<br />
allerdings noch von den Eltern beigesteuert.<br />
Bei den 30-Jährigen und Älteren haben 53<br />
Prozent ein eigenes Einkommen. Die Eltern<br />
beteiligen sich finanziell nur noch mit<br />
knapp einem Fünftel.<br />
Geisteswissenschaften<br />
nicht aus Unis verdrängen<br />
BILDUNG<br />
BERLIN. Bundesbildungsministerin Annette<br />
Schavan (CDU) hat davor gewarnt, die<br />
Geisteswissenschaften aus den Universitäten<br />
zu verdrängen. Die Geisteswissenschaften<br />
sorgten für die Grundlagen des gebildeten<br />
Menschen vor jeder Spezialisierung.<br />
Die Ministerin äußerte sich zum Auftakt eines<br />
zweitägigen Kongresses des Deutschen<br />
Kulturrates über „Kultur als Arbeitsfeld und<br />
Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler“.<br />
Bildung müsse an den Hochschulen wie<br />
in den Schulen viel stärker nach der kulturellen<br />
Substanz fragen, betonte Schavan.<br />
Dazu gehöre wesentlich der Beitrag der<br />
Geisteswissenschaften. Weiter betonte die<br />
CDU-Politikerin, auch die Theologie gehöre<br />
in die Universitäten. Sie sei nicht nur schön,<br />
sondern „von hohem Nutzen und sinnvoll in<br />
einer Welt, in der die Menschen so ungewöhnlich<br />
viel eingreifen können in das<br />
menschliche Leben“.<br />
Nach Berechnungen des Deutschen<br />
Hochschulverbandes haben die Geisteswissenschaften<br />
in Deutschland in den vergangenen<br />
zehn Jahren allerdings 663 Professorenstellen<br />
verloren. Mit Blick auf einen<br />
Rückgang von 11,6 Prozent sprach die Berufsvertretung<br />
der deutschen Hochschulprofessoren<br />
deshalb am Montag von einer<br />
Krise der Sprach- und Kulturwissenschaften<br />
im Land. Diese könne auch von dem von der<br />
Bundesregierung ausgerufenen Jahr der<br />
Geisteswissenschaften nicht verdeckt<br />
werden. Insgesamt verloren die Universitäten<br />
laut Verband im gleichen Zeitraum<br />
1.451 Professorenstellen. Die Zahl der Studierenden<br />
erhöhte sich in demselben<br />
Zeitraum um 0,5 Prozent. Die auf Zahlen des<br />
Statistischen Bundesamtes beruhende Aus-<br />
wertung zeigt einen überproportionalen<br />
Abbau von Professuren in der klassischen<br />
Philologie (-35 Prozent) und in den Erziehungswissenschaften<br />
(-34,8 Prozent). Vom<br />
Rückgang betroffen sind allerdings auch die<br />
Ingenieurwissenschaften mit einem Minus<br />
von 356 Professuren (-13,3 Prozent), die<br />
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften<br />
mit 96 Professuren (-16,9 Prozent), die<br />
Mathematik und Naturwissenschaften mit<br />
264 Professuren (-4,3 Prozent) und die Humanmedizin<br />
mit 86 Professuren (-2,7 Prozent).<br />
Im Aufwind befinden sich der Statistik<br />
zufolge lediglich die Rechts-, Wirtschaftsund<br />
Sozialwissenschaften (+ 5,6 Prozent)<br />
und die Kunstwissenschaft (+ 9,4 Prozent).<br />
Der Deutsche Hochschulverband ist die<br />
bundesweite Berufsvertretung der<br />
deutschen Universitätsprofessoren und des<br />
wissenschaftlichen Nachwuchses mit über<br />
22.000 Mitgliedern.<br />
Konfuzius-Institut<br />
in Hamburg gegründet<br />
HAMBURG. In Hamburg ist das bundesweit<br />
sechste Konfuzius-Institut eröffnet<br />
worden. Es will die chinesische Sprache und<br />
Kultur vermitteln sowie den Austausch<br />
zwischen China und Deutschland fördern.<br />
Konfuzius-Institute gibt es in Deutschland<br />
bereits in Berlin, Hannover, Düsseldorf sowie<br />
an der Universität Erlangen-Nürnberg; ein<br />
weiteres wurde in Frankfurt am Main<br />
gegründet. China fördert im Rahmen einer<br />
vor drei Jahren begonnenen kulturellen Auslandsinitiative<br />
die Gründung von Konfuzius-<br />
Instituten. Sie sind mit den deutschen<br />
Goethe-Instituten und den British Councils<br />
vergleichbar, im Unterschied zu diesen aber<br />
jeweils an Hochschulen im Gastland angegliedert.<br />
Weltweit gibt es mittlerweile<br />
mehr als 170 Konfuzius-Institute. Der Philosoph<br />
und Universalgelehrte Konfuzius lebte<br />
im sechsten und fünften vorchristlichen<br />
Jahrhundert in China. Er übt bis heute entscheidenden<br />
Einfluss auf das Denken in<br />
Ostasien aus.<br />
Mehr: www.konfuzius-institut-hamburg.de.<br />
Bundesregierung verstärkt<br />
Demenz-Forschung massiv<br />
BERLIN. Die Bundesregierung will die Lage<br />
von Demenzkranken verbessern. Das Konzept<br />
eines Nationalen Forschungszentrums<br />
Demenz wird der Bund in den nächsten<br />
Jahren mit 50 bis 60 Millionen Euro finanzieren.<br />
Nach Angaben der Regierung sind<br />
über eine Million Menschen in Deutschland<br />
an Demenz erkrankt. Bis zum Jahr 2030 wird<br />
unitas 3-4/2007 185<br />
>>
diese Zahl voraussichtlich auf 1,5 Millionen<br />
ansteigen. Experten mahnen seit längerem<br />
auch angesichts der demografischen Entwicklung<br />
eine Stärkung der stationären und<br />
ambulanten Versorgung von Demenzkranken<br />
an. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft<br />
startete derweil einen bundesweiten<br />
Jugendwettbewerb „Alzheimer & You“. Er<br />
solle die „Enkelgeneration“ für die Alzheimer-Krankheit<br />
sensibilisieren und für die<br />
aktive Unterstützung der Erkrankten gewinnen.<br />
Näheres: www.bmbf.de, www.bmg.bund.de<br />
und unter www.alzheimerandyou.de.<br />
Wissenschaftsfreiheit<br />
auch an katholischen Unis<br />
BRÜSSEL. Der belgische Kardinal Godfried<br />
Danneels hat die Freiheit der Wissenschaft<br />
an katholischen Universitäten verteidigt.<br />
Dass es dabei zu Auseinandersetzungen<br />
zwischen wissenschaftlichen und kirchlichen<br />
Positionen kommen könne, sei normal.<br />
Auch Thomas von Aquin sei wegen einiger<br />
seiner Positionen gemaßregelt worden.<br />
Universitäten seien kein Propagandamittel<br />
des Glaubens. Mit Blick auf Gespräche<br />
zwischen dem Vatikan und der<br />
katholischen Universität Löwen über die<br />
Bioethik sagte der Kardinal, dieser Forschungszweig<br />
sei nur ein Teil der universitären<br />
Arbeit. Er könne nicht erkennen, warum<br />
deswegen die Katholizität der gesamten<br />
Hochschule infrage gestellt werden<br />
solle. Im Juni war berichtet worden, Reproduktionsmediziner<br />
der Universität Löwen<br />
seien in den Vatikan einbestellt worden. Dabei<br />
sei es unter anderem darum gegangen,<br />
dass sich die an die Universität angeschlossene<br />
Klinik für das von der Kirche abgelehnte<br />
Forschungsklonen ausgesprochen<br />
habe. Dabei werden menschliche Embryonen<br />
zerstört. Bereits im Jahr 2002 hatte<br />
Papst Johannes Paul II. die katholischen Universitäten<br />
dazu aufgerufen, die kirchliche<br />
Lehre insbesondere zur Bioethik zu achten.<br />
Andernfalls könnten sie nicht für sich in<br />
Anspruch nehmen, katholisch zu sein.<br />
Zunahme christlicher<br />
Fundamentalisten an Unis<br />
MÜNSTER. Christliche Fundamentalisten<br />
werben nach Erkenntnissen katholischer<br />
Hochschulseelorger an deutschen Unis<br />
immer stärker um Mitglieder für ihre<br />
Gruppen. Viele Studierende fühlten sich von<br />
den Bewegungen angesprochen, die einen<br />
absoluten Wahrheitsanspruch verträten<br />
und die Bibel wörtlich auslegten, sagte der<br />
Vorsitzende der Konferenz für Katholische<br />
Hochschulpastoral in Deutschland (KHP),<br />
Jürgen Janik bei der Jahrestagung von 100<br />
Priestern, Pastoral- und Gemeindereferenten.<br />
Der Erfolg der fundamentalistischen<br />
Gruppen liege laut Janik in den „einfachen<br />
Antworten“, die sie auf die Fragen des<br />
186<br />
unitas 3-4/2007<br />
Lebens geben. „Die Studierenden führen ein<br />
Alltagsleben, in dem die Wissenschaft fast<br />
alles infrage stellt. Da wächst das Bedürfnis<br />
nach Orientierung“, so der Darmstädter<br />
Pfarrer. Die Gruppen schotteten sich sehr<br />
von anderen ab und feierten sehr emotionale<br />
Gottesdienste. Das trage zu einem<br />
starken Gemeinschaftsgefühl bei. Die Hochschulgemeinden<br />
dagegen regten vielmehr<br />
zum kritischen und politischen Dialog an.<br />
Dennoch müsse die Kirche auf die Zunahme<br />
an Fundamentalisten reagieren und über<br />
ihre eigenen, eher rational ausgerichteten<br />
Gottesdienste und Gemeinschaftsangebote<br />
nachdenken.<br />
In den katholischen Hochschulgemeinden<br />
kommen laut KHP fünf Prozent der Studierenden<br />
zusammen. Bei den fundamentalistischen<br />
Gruppen handelt es sich nach<br />
Einschätzung der KHP je zur Hälfte um<br />
katholische und freikirchliche. Sie kommen<br />
meist aus dem spanisch-, italienisch- und<br />
französischsprachigen Raum. Als katholische<br />
Beispiele für „exklusive Gruppen“<br />
nannte Janik die Bewegung Emmanuel,<br />
Jugend 2000 und die Gemeinschaft Chemin<br />
Neuf. Er scheue sich, sie fundamentalistisch<br />
zu nennen, weil sie selbst den Anspruch<br />
hätten, katholisch zu sein, betonte der<br />
Theologe. Entscheidend sei, dass sie sich<br />
nicht von der Hochschulseelsorge abschotteten.<br />
Die Hochschulseelsorger hatten<br />
kritisiert, dass der Kölner Kardinal Bbr.<br />
Joachim Meisner die Seelsorgeleitung der<br />
Hochschulgemeinde in Bonn der Gemeinschaft<br />
Chemin Neuf übertragen hatte.<br />
Solche Gruppen mit eigenem Charisma sollten<br />
offen gegenüber anderen Katholiken<br />
bleiben, betonte Janik.<br />
Immer mehr Deutsche<br />
studieren im Ausland<br />
WIESBADEN. Immer mehr Deutsche studieren<br />
im Ausland. Im Jahr 2005 waren es nach<br />
Angaben des Statistischen Bundesamtes in<br />
Wiesbaden etwa 75.800 und damit 9.300<br />
oder 14 Prozent mehr als im Jahr 2004.<br />
Während laut Statistik 1995 auf 1.000<br />
deutsche Studierende an inländischen<br />
Hochschulen 24 deutsche Studierende an<br />
Hochschulen im Ausland kamen, waren es<br />
im Jahr 2005 bereits 44. Die drei beliebtesten<br />
Zielländer waren im vorvergangenen<br />
Jahr die Niederlande, Großbritannien und<br />
Österreich.<br />
Gute Chancen<br />
für Theologen an Unis<br />
FRANKFURT. Angesichts einer hohen Zahl<br />
an Pensionierungen sei für die Zeit bis zum<br />
Jahr 2011 mit einem Nachwuchsmangel an<br />
Theologischen Fakultäten zu rechnen. Dies<br />
erklärte Prof. Karl Gabriel vom Institut für<br />
Christliche Sozialwissenschaften in Münster<br />
bei einem Workshop in Frankfurt, bei<br />
dem er die Ergebnisse einer Studie „Zur Lage<br />
des wissenschaftlichen Nachwuchses in der<br />
Katholischen Theologie“ vorstellte. Veranstalter<br />
des Workshops waren neben anderen<br />
der Katholisch-Theologische Fakultätentag,<br />
die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG) und die Bischofskonferenz. Mit<br />
20 Fakultäten und 35 Einrichtungen der<br />
Lehrerbildung sei die katholische Theologie<br />
an den Universitäten in Deutschland breit<br />
vertreten, so Gabriel. Über 360 Professorinnen<br />
und Professoren und mehr als 200<br />
wissenschaftliche Mitarbeiter seien an den<br />
Hochschulen in dem Fach tätig. Es gehöre zu<br />
den klassischen Disziplinen und genieße<br />
auch international einen guten Ruf.<br />
Deutsche Hochschulen<br />
steigern Drittmittel<br />
WIESBADEN. Die deutschen Hochschulen<br />
haben ihre Drittmittel-Einnahmen um 5,6<br />
Prozent steigern können. Nach Angaben des<br />
Statistischen Bundesamtes erhielten sie<br />
2005 von privaten und öffentlichen Einrichtungen<br />
3,66 Milliarden Euro. Damit lagen<br />
die durchschnittlichen Drittmittel-Einnahmen<br />
eines Professors bei knapp über<br />
100.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung<br />
pro Kopf von 6,4 Prozent gegenüber<br />
2004. Die Höhe der eingeworbenen Drittmittel<br />
ist je nach Hochschulart, Fächergruppe<br />
sowie Lehr- und Forschungsbereich<br />
sehr unterschiedlich. Wie bereits im Vorjahr<br />
erzielten die Universitätsprofessoren mit<br />
durchschnittlich 165.500 Euro (plus 6,6 Prozent)<br />
weitaus mehr Drittmittel als ihre Kollegen<br />
an anderen Hochschularten. Die Pro-<br />
Kopf-Drittmittel-Einnahmen an den Fachhochschulen<br />
betrugen 14.300 Euro (plus 16<br />
Prozent). Auch 2005 waren der Statistik<br />
zufolge die Mediziner und die ingenieurwissenschaftlichen<br />
Lehr- und Forschungsbereiche<br />
am erfolgreichsten. Vergleichsweise<br />
geringe Drittmittel-Einnahmen verbuchten<br />
die Sprach- und Kulturwissenschaften<br />
sowie die Rechts-,Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaften. Die meisten Drittmittel<br />
unter den Universitäten (ohne Medizinische<br />
Einrichtungen) erzielten die Technische<br />
Hochschule Aachen (131 Millionen<br />
Euro), die Universität Stuttgart (106 Millionen<br />
Euro) und die Technische Universität<br />
München (105 Millionen Euro).<br />
Grünes Licht für den<br />
1.000. neuen Studiengang<br />
BONN. Die Bonner „Agentur für Qualitätssicherung<br />
durch Akkreditierung von<br />
Studiengängen“ (AQAS) hat dem Masterstudiengang<br />
Neuere Fremdsprachen und<br />
Fremdsprachendidaktik der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen als 1.000 neuem Studiengang<br />
an deutschen Hochschulen das<br />
Gütesiegel verliehen. AQAS akkreditiert seit<br />
fünf Jahren Bachelor- und Masterstudiengänge<br />
aller Fachrichtungen. Dabei wird die<br />
Qualität und die Vereinbarkeit mit nationa
len und europäischen Standards begutachtet.<br />
In den Gutachtergruppen arbeiten<br />
Wissenschaftler, Vertreter der Berufspraxis<br />
sowie Studierende zusammen. Im Rahmen<br />
des 1999 gestarteten Bologna-Prozesses soll<br />
durch die Einführung von Bachelor- und<br />
Masterstudiengängen das Studium europaweit<br />
vergleichbar gemacht werden.<br />
Studie sieht<br />
Trendwende bei Bildung<br />
BERLIN. Nach den schlechten Ergebnissen<br />
beim Pisa-Test sieht die Studie „Bildungsmonitor<br />
2007“ erstmals eine klare Trendwende<br />
in der Bildung. Die beim Institut der<br />
deutschen Wirtschaft Köln (IW) in Auftrag<br />
gegeben Studie der Initiative neue Soziale<br />
Marktwirtschaft (INSM) bezieht sich auf das<br />
Berichtjahr 2005. Sie erscheint zum vierten<br />
Mal und bewertet anhand von über 100<br />
Indikatoren das gesamte Bildungssystem,<br />
vom Kindergarten bis zur Hochschule. Trotz<br />
steigender Studentenzahlen sei der Anteil an<br />
Mathematikern, Naturwissenschaftlern und<br />
Technikern rückläufig; er decke nicht mehr<br />
den Bedarf der Wirtschaft. Auch bei dem in<br />
der Pisa-Studie beklagten engen Zusammenhang<br />
von sozialer Herkunft und Bildungserfolg<br />
sieht das IW noch keine Fortschritte.<br />
Kritisch bewertet es auch die Situation<br />
bei Betreuung und Integration. Als<br />
Fortschritt wertet das IW die Internationalisierung<br />
des Bildungswesens durch frühen<br />
Fremdsprachenunterricht, die steigende<br />
Zahl ausländischer Studenten, das Zurückgehen<br />
der Studienzeitdauer in Deutschland<br />
und die Halbierung der Zahl von Frühpensionierungen<br />
bei Lehrern seit 2004, den Ausbau<br />
an Ganztagsschulen und eine Qualifizierung<br />
des Personals im Elementarbereich.<br />
Studenten flüchten<br />
häufig vor Lernstress<br />
MÜNSTER. Studenten flüchten sich nach<br />
Angaben von Psychotherapeuten im Lernstress<br />
häufig in Ablenkungsmanöver. Sogar<br />
Haushaltsaufgaben wie Putzen, Spülen,<br />
Staubsaugen erschienen in der Drucksituation<br />
verlockender als ernsthaftes Arbeiten<br />
am Schreibtisch, so Experten der Psychotherapie-Ambulanz<br />
der Universität Münster.<br />
Viele Studierende hätten Probleme, sich<br />
ihre Zeit selbst einzuteilen. So werde das<br />
Lernen regelmäßig bis kurz vor den Prüfungstermin<br />
verschoben. Gegen das Aufschiebeverhalten<br />
bieten Therapeuten<br />
Übungen an. Die Betroffenen könnten mittels<br />
erprobter Techniken lernen, ihr Arbeitsverhalten<br />
gezielt zu beobachten und realistische<br />
Lernvorsätze zu fassen, hieß es. So gelinge<br />
es auf Dauer, sich den Lernstoff rechtzeitig<br />
anzueignen. Außerdem ließen sich<br />
Semester- oder Abschlussarbeit effizienter<br />
planen. Mehr unter<br />
http://www.uni-muenster.de/Psychologie/<br />
einrichtungen/pta.html.<br />
Philologenverband gegen<br />
weniger Unterrichtsstunden<br />
FRANKFURT. Der Deutsche Philologenverband<br />
(DPhV) hält nichts von einer Verringerung<br />
der Unterrichtsstunden an Gymnasien.<br />
Schon jetzt liege Deutschland mit seinem<br />
Unterrichtsvolumen hinter fast allen anderen<br />
Industriestaaten zurück: Rund 9.500<br />
Vollzeitstunden in Deutschland stünden in<br />
Frankreich und England 11.500 beziehungsweise<br />
12.000 gegenüber. Viele Fächer würden<br />
immer weniger unterrichtet. Für weitere<br />
Kürzungen müsste man bei den Kernfächern<br />
eingreifen. Die Konsequenz wäre,<br />
dass die Hochschulen nicht mehr auf das<br />
Abitur setzten, sondern auf eigene Eingangsprüfungen.<br />
Wohngemeinschaften<br />
besonders beliebt<br />
WORMS. Nach Angaben des Deutschen<br />
Studentenwerks (DSW) sind Wohngemeinschaften<br />
bei deutschen Studenten die beliebteste<br />
Wohnform. Danach leben 25 Prozent<br />
aller Studierenden in einer solchen Gemeinschaftswohnung,<br />
23 Prozent weiterhin<br />
bei ihren Eltern, je 20 Prozent allein oder mit<br />
ihrem Partner zusammen. Elf Prozent der<br />
Studierenden haben einen Platz in Wohnheimen.<br />
Bei den Studenten, die bei ihren Eltern<br />
lebten, gebe es einen deutlichen Männer-<br />
Überschuss: Während von den weiblichen<br />
Studierenden 19 Prozent weiter im Elternhaus<br />
wohnten, seien es bei den Männern<br />
26 Prozent. Allerdings scheine das so<br />
genannte „Hotel Mama“ eher eine Notlösung<br />
zu sein, denn die Eltern-Wohner<br />
seien mit ihrer Wohnsituation am unzufriedensten.<br />
Im Durchschnitt gäben<br />
Studenten für die Miete 266 Euro im Monat<br />
aus, so das DSW.<br />
Philologenverband:<br />
Lehrerversorgung dramatisch<br />
BERLIN. Als „so schwierig wie seit 35 Jahren<br />
nicht mehr“ hat der Bundesvorsitzende des<br />
Deutschen Philologenverbandes, Heinz-<br />
Peter Meidinger, die Lehrerversorgung an<br />
deutschen Schulen zu Beginn dieses Schuljahres<br />
bezeichnet. Laut einer Umfrage des<br />
DPhV fehlten derzeit an deutschen Schulen<br />
rund 16.000 Lehrer. Besonders dramatisch<br />
sei die Lage an beruflichen Schulen, an Gymnasien<br />
und Realschulen in Süddeutschland<br />
und in den so genannten Mangelfächern,<br />
wozu neben Mathematik, Physik, Latein, Religion<br />
inzwischen in Bayern auch Fremdsprachen<br />
und sogar Deutsch zählen. Allein<br />
in Baden-Württemberg fehlten 900 Berufsschullehrer,<br />
in Bayern fast 1000 sowie über<br />
600 Gymnasiallehrer, aber auch in Hessen,<br />
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und<br />
Berlin sei die Personaldecke zum Zerreißen<br />
gespannt. Zwar könne nach Auskunft der<br />
Kultusministerien der Pflichtunterricht<br />
weitgehend abgedeckt werden, Tatsache sei<br />
aber – so der DPhV-Vorsitzende –, dass inzwischen<br />
immer mehr Lehrkräfte ohne<br />
ausreichende Qualifikation bzw. Seiteneinsteiger<br />
ohne jegliche Lehrerfahrung<br />
eingestellt würden, um Unterrichtsausfall<br />
zu vermeiden. So liege die Quote der Seiteneinsteiger<br />
bei den Neueinstellungen bundesweit<br />
inzwischen bei fast 20 Prozent, an<br />
bestimmten Schularten in einzelnen Bundesländern<br />
sogar deutlich über 50 Prozent.<br />
Die Versorgungssituation in den Mangelfächern<br />
verschärfe sich zudem dadurch,<br />
dass zahlreiche Lehramtsstudenten naturwissenschaftlicher<br />
Fächer kurzfristig in die<br />
Diplomstudiengänge wechseln, weil die<br />
Wirtschaft deutlich lukrativere Berufsperspektiven<br />
bietet. Erst in drei bis vier Jahren<br />
werde in den alten Bundesländern durch die<br />
dann ansteigenden Lehramtsabsolventenzahlen<br />
und den Wegfall der 13. Jahrgangsstufe<br />
an den Gymnasien ein Entlastungseffekt<br />
eintreten. Gleichzeitig werde aber<br />
dann in den neuen Bundesländern der<br />
Lehrermangel massiv zunehmen, da zu<br />
diesem Zeitpunkt die Pensionierungen stark<br />
ansteigen, während dort in den letzten<br />
Jahren kaum mehr Lehrernachwuchs ausgebildet<br />
worden sei.<br />
Deutlich mehr Schüler<br />
besuchen Privatschulen<br />
BERLIN. Immer mehr Jungen und Mädchen<br />
in Deutschland lernen auf einer Privatschule.<br />
Im Schuljahr 2006/2007 besuchten<br />
656.000 Schüler private allgemeinbildende<br />
Schulen. Nach Angaben des „Statistischen<br />
Jahrbuchs 2007“ sind das gegenüber<br />
2000/2001 mit 96.000 deutlich mehr (17,2<br />
Prozent). Jetzt besuchen sieben Prozent aller<br />
Schüler in allgemeinbildenden Schulen<br />
nichtstaatliche Einrichtungen in kirchlicher<br />
oder anderer privater Trägerschaft sowie<br />
rund 236.000 Schüler private berufliche<br />
Schulen.<br />
Lehrer in Deutschland<br />
überdurchschnittlich alt<br />
WIESBADEN. Die Lehrer in Deutschland sind<br />
im Primar- und Sekundarbereich I im internationalen<br />
Vergleich überdurchschnittlich<br />
alt. Im Jahr 2005 war über die Hälfte der<br />
Lehrkräfte durchschnittlich 50 Jahre und<br />
älter, während in den zur Organisation für<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(OECD) zählenden Industriestaaten<br />
weniger als ein Drittel in diese Altersgruppe<br />
gehörte. Nach Angaben des<br />
Statistischen Bundesamts waren die Lehrer<br />
in 15 Bundesländern älter als im OECD-<br />
Durchschnitt. Im Ländervergleich wiesen im<br />
Primarbereich Bremen (65,6 Prozent) und<br />
das Saarland (62,5 Prozent) die höchsten<br />
Anteile an älteren Lehrkräften auf, im<br />
Sekundarbereich I ebenfalls Bremen (65,2<br />
Prozent) sowie Hessen (55,9 Prozent).<br />
unitas 3-4/2007 187<br />
>>
Forum Hochschule und Kirche:<br />
100.000 POSTKARTEN FÜR MEHR ANSTRENGUNG FÜR CHANCENGLEICHHEIT<br />
UND FAMILIENPOLITISCHE AUSGEWOGENHEIT IN DER BAFÖG-NOVELLE<br />
Arbeitsgemeinschaft Katholischer<br />
Hochschulgemeinden (AKH) fordert in<br />
einer bundesweiten Postkartenkampagne<br />
Verbesserungen an der geplanten<br />
BAföG-Novelle der Regierungskoalition<br />
UNITAS ist Unterstützer<br />
Zum Beginn des Wintersemesters hat<br />
die Arbeitsgemeinschaft Katholischer<br />
Hochschulgemeinden (AKH) gemeinsam<br />
mit weiteren Partnern eine breite bundesweite<br />
Postkarten-Kampagne zur geplanten<br />
BAföG-Novelle im Bundestag gestartet. Die<br />
125 in der AKH zusammengeschlossenen<br />
Hochschulgemeinden fordern eine Anhebung<br />
der Freibeträge und Bedarfssätze um<br />
acht bzw. zehn Prozent zum 1. Januar 2008.<br />
Bisher ist die Regierungskoalition lediglich<br />
zu einer Anpassung dieser Beträge um fünf<br />
Prozent bereit. Deutliche Verbesserungen<br />
fordert die AKH auch beim neu geplanten<br />
Kinderbetreuungszuschlag. Hier sollen<br />
mindestens 200 Euro pro Kind bezahlt<br />
werden statt wie bisher vorgesehen 113<br />
Euro.<br />
188<br />
unitas 3-4/2007<br />
„Studierende mit Kind<br />
haben durch die Einführung<br />
des Elterngeldes einen<br />
Verlust an staatlicher<br />
Unterstützung während<br />
der ersten beiden Erziehungsjahre<br />
in Höhe von<br />
7.200 Euro hinnehmen<br />
müssen. Wenn die Unionsparteien<br />
und die SPD nun<br />
ein ‚familienfreundliches’<br />
BAföG gestalten möchten,<br />
dann müssen sie deutlich<br />
mehr Geld in die Hand<br />
nehmen“, erklärt Tobias<br />
Weber, Vorsitzender der<br />
AKH. Er kann auch nicht<br />
nachvollziehen, weshalb<br />
gleichzeitig mit der Einführung<br />
des Kinderbetreuungszuschlags<br />
der Darlehensteilerlass<br />
für Akademikerinnen<br />
und Akademiker<br />
gestrichen werden soll,<br />
die in der Rückzahlungsphase<br />
des BAföG-Darlehens<br />
wegen Kindererziehung<br />
auf eine volle Erwerbstätigkeit<br />
verzichten.<br />
„Es kann<br />
doch nicht<br />
sein, dass<br />
die Bundesregierung die<br />
eine Form der Familiengründung<br />
gegen eine<br />
andere ausspielt. Am Geld<br />
kann das ja nicht liegen,<br />
denn diese familienpolitisch<br />
sinnvolle Leistung<br />
kostet den Staat lediglich<br />
rund 34 Millionen Euro im<br />
Jahr“, sagt der Kölner Student<br />
der Theater-, Filmund<br />
Fernsehwissenschaft.<br />
Die vom Bundesbildungsministeriumvorgeschlagene<br />
Streichung des<br />
Darlehensteilerlasses hatte<br />
in der Anhörung des Bundestags-Bildungsausschusses<br />
im Mai diesen Jahres<br />
bei keinem einzigen Experten<br />
Zustimmung gefunden.<br />
Die Erhöhung der Freibeträge<br />
und Bedarfssätze<br />
um acht bzw. zehn Prozent<br />
wurde bereits vom Beirat<br />
für Ausbildungsförderung<br />
des Ministeriums und von<br />
zahlreichen Fachorganisa-<br />
tionen immer wieder gefordert. „Die<br />
derzeitige Haushaltslage des Bundes<br />
rechtfertigt nun in keiner Weise mehr die<br />
Aufschiebung dieser längst fälligen<br />
Anpassungen“, meint Tobias Weber.<br />
Unter dem Dach des Forum Hochschule<br />
und Kirche setzt sich die Arbeitsgemeinschaft<br />
Katholischer Hochschulgemeinden<br />
(AKH) in verschiedenen Zusammenhängen<br />
für mehr Beteiligungs- und Chancengerechtigkeit<br />
in unserem Bildungssystem ein.<br />
Die Kampagne wird von den Evangelischen<br />
StudentInnengemeinden (ESG), der Katholischen<br />
Studierenden Jugend (KSJ), der<br />
Arbeitsgemeinschaft Studierende der<br />
Katholischen Theologie (AGT) und dem<br />
UNITAS-Verband mitgetragen und auch<br />
von der Gewerkschaft Erziehung und<br />
Wissenschaft (GEW) sowie dem Deutschen<br />
Studentenwerk (DSW) unterstützt. Bundesweit<br />
werden über 100.000 Postkarten verteilt,<br />
die an den Haushalts- und Bildungsausschuss<br />
des Deutschen Bundestages<br />
adressiert sind.<br />
Parallel läuft eine E-Mail-Kampagne im<br />
Internet (www.fhok.de).
Von Heinrich Pesch damals<br />
bis nach Nigeria heute<br />
Die Entstehung der modernen<br />
Katholischen Soziallehre<br />
Als sich Ende des 18. und im Laufe des<br />
19. Jahrhunderts die bisherige gesellschaftliche<br />
Ordnung fast völlig auflöste und neue<br />
politische und wirtschaftliche Strukturen<br />
und Mentalitäten, also die moderne Gesellschaft,<br />
entstanden, war die Kirche<br />
ökonomisch machtlos und befand sich<br />
geistig am Rand der Gesellschaft. Die<br />
Päpste des 19. Jahrhunderts sahen sich in<br />
einen Abwehrkampf gegen einen von<br />
atheistischen, laizistischen und relativistischen<br />
Strömungen bestimmten „Zeitgeist“<br />
gedrängt, auf den sie mit einem dezidierten<br />
„Antimodernismus“ reagierten. Die<br />
Kirche ging aber keineswegs zugrunde, wie<br />
ihre Gegner gehofft, ja prophezeit hatten,<br />
sondern es kam zu einer überraschenden<br />
kirchlichen Erneuerung. Diese war nicht nur<br />
nach innen gerichtet, sondern die Kirche<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. PROF. DR. LOTHAR ROOS<br />
fand auch die Kraft, sich mit den Problemen<br />
der Welt, insbesondere der immer stärker<br />
werdenden „sozialen Frage“ zu beschäftigen.<br />
Der Freiburger Sozialhistoriker Clemens<br />
Bauer stellt rückblickend auf diese<br />
Zeit fest, die Kirche habe durch die unter<br />
Leo XIII. (1878-1903) beginnende „systematische“<br />
Erneuerung ihrer Soziallehre ihre<br />
damalige politische und soziale „Standortlosigkeit“<br />
überwunden und wieder einen<br />
soziologisch „festen Platz“ in der modernen<br />
Gesellschaft gefunden. 1<br />
Franz Hitze<br />
und Heinrich Pesch<br />
Unter den katholischen Akademikerverbänden<br />
war es besonders der UNITAS-<br />
Verband, der nicht unwesentlich bei der<br />
Formung des sozialen und politischen<br />
Katholizismus mitgewirkt hat. Hier ist als<br />
Pioniereder Christlichen Soziallehre<br />
<strong>BBR</strong>. PRÄLAT PROF. DR. FRANZ HITZE<br />
(1851-1921)<br />
Erster Inhaber des Lehrstuhls für Christliche<br />
Sozialwissenschaften in Münster,<br />
katholischer Sozialtheoretiker und<br />
Sozialpolitiker, mit Franz Brandts und<br />
Bbr. Ludwig Windthorst Begründer des<br />
„Volksvereins für das katholische<br />
Deutschland“ (1890) und des Deutschen<br />
Caritasverbandes.<br />
<strong>BBR</strong>. PATER DR. HEINRICH PESCH SJ<br />
(1854-1926)<br />
Jesuit, Nationalökonom, Mitbegründer<br />
einer modernen katholischen Sozialphilosophie.<br />
Begründer des Solidarismus.<br />
Nach ihm ist der vom UNITAS-<br />
Verband verliehene Preis für besondere<br />
Leistungen auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften<br />
und für beispielhafte<br />
tätige soziale Arbeit benannt.<br />
erster Bbr. Franz Hitze zu nennen, der<br />
bereits als Student am 6. Juli 1875 auf Bitten<br />
der Kommilitonen seiner Würzburger Verbindung<br />
über „Die soziale Frage und der<br />
moderne Sozialismus in Deutschland“<br />
referierte. Fünfzehn Jahre später war aus<br />
dem damaligen Würzburger Studenten<br />
einer der drei Mitbegründer – zusammen<br />
mit Franz Brandts und Ludwig Windthorst –<br />
des 1890 in Mönchengladbach gegründeten<br />
„Volksvereins für das katholische<br />
Deutschland“ geworden. Seit 1884 finden<br />
wir ihn im Deutschen Reichstag, wo er später<br />
Georg von Hertling als sozialpolitischer<br />
Sprecher des Zentrums nachfolgte. 1893<br />
wurde Franz Hitze zum ersten Lehrstuhlinhaber<br />
eines neuen theologischen<br />
Faches „Christliche Gesellschaftslehre“<br />
nach Münster berufen.<br />
Während Franz Hitze in erster Linie für<br />
die konkrete praktische Umsetzung der<br />
Soziallehre der Kirche in den katholischen<br />
Verbänden und in der damaligen Politik mit<br />
großem Erfolg wirkte, wurde ein anderer<br />
Unitarier, Heinrich Pesch, der erste bedeutende<br />
wissenschaftliche Repräsentant dieser<br />
Soziallehre. Heinrich Pesch (1876-1926)<br />
studierte zunächst in Bonn Rechts- und<br />
Staatswissenschaften, trat dann unter dem<br />
Einbruch des Kulturkampfes in den Jesuitenorden<br />
ein, lernte während seinem Theologiestudium<br />
in Lancashire (England) die<br />
dortige Situation der Arbeiterschaft hautnah<br />
kennen. Als Spiritual am Priesterseminar<br />
in Mainz (1892-1900) kam er mit dem<br />
geistigen Erbe Bischof Kettelers in Kontakt.<br />
Dabei wurde ihm klar, dass die Kirche ihren<br />
Beitrag zur Lösung der sozialen Frage nur<br />
leisten konnte, wenn – wie dies schon bei<br />
Ketteler der Fall war – die wirtschaftlichen<br />
Tatbestände und Zusammenhänge richtig<br />
gesehen würden. Dies veranlasste ihn, noch<br />
im vorgerückten Alter bei Adolph Wagner in<br />
Berlin Nationalökonomie zu studieren<br />
(1901-1903). Pesch ging es zunächst darum,<br />
eine sozialanthropologische Grundlage des<br />
menschlichen Wirtschaftens zu entwerfen,<br />
in der die individualistischen und kollektivistischen<br />
Fehlinterpretationen vermieden<br />
wurden. Er wendet sich gegen eine rein<br />
sachhafte Betrachtung des Wirtschaftens<br />
und setzt beim „Menschen inmitten der Gesellschaft“<br />
an. Auf der Suche nach einer<br />
griffigen Kurzformel, die sich sowohl vom<br />
Individualismus wie vom Kollektivismus<br />
absetzt, wählte er den Begriff „Solidarismus“.<br />
2 Auf dieser Grundlage gelang es<br />
Heinrich Pesch, in seinem fünfbändigen<br />
Hauptwerk „Lehrbuch der Nationalökono-<br />
unitas 3-4/2007 189<br />
>>
190<br />
Heinrich<br />
Pesch-<br />
Preisträger<br />
1992<br />
Bbr. Dr. Rudolf Seiters<br />
2003<br />
Bbr. Dr. Ludwig Freibüter<br />
unitas 3-4/2007<br />
1988<br />
Bbr. Prof. Dr. Franz H. Mueller<br />
und Dr. Wilhelm Paul Link<br />
(Bild r. mit Bbr. Prof. Lothar Roos)<br />
1992<br />
Bischof Joachim Reinelt<br />
2003<br />
Bbr. Dr. Anton Rauscher<br />
1988<br />
Dr. Norbert Blüm<br />
1997<br />
Bbr. Bischof Franjo Komarica<br />
2004<br />
Bbr. Dr. Johannes Stemmler
mie“ 3 erstmals eine Wirtschaftstheorie zu<br />
entwerfen, in der die sozialethischen<br />
Vorgaben einer christlich-naturrechtlichen<br />
Sozialanthropologie mit den „Sachgesetzlichkeiten“<br />
des Wirtschaftens überzeugend<br />
verbunden wurden. Pesch hatte sich<br />
während seines Theologiestudiums dazu<br />
entschlossen, „der Hebung des Arbeiters<br />
mein Leben zu widmen“ (Selbstbiografie). Er<br />
hat dies nicht primär durch praktisches<br />
sozial-politisches Handeln getan, sondern<br />
durch das erste große wissenschaftlichsystematische<br />
Werk einer christlichen Wirtschaftsethik,<br />
die für die katholisch-soziale<br />
und katholisch-politische Bewegung im<br />
Kaiserreich und in der Weimarer Republik<br />
zu einem unersetzlichen Grundlagenwerk<br />
wurde.<br />
Die Gründung des Fördervereins<br />
Heinrich-Pesch-Preis e.V.<br />
Der UNITAS-Verband hat seitdem in<br />
vielfältiger Weise versucht, die mit Franz<br />
Hitze und Heinrich Pesch verbundene Tradition<br />
lebendig zu erhalten und konkrete Verantwortung<br />
für die geistige Entwicklung<br />
anhand neuer Fragestellungen in Kirche<br />
und Gesellschaft zu übernehmen. Es ist hier<br />
nicht der Platz, um alle anderen dafür<br />
wichtigen Namen zu nennen. Einer davon<br />
war Bbr. Heinrich Krone, der – wie einmal<br />
formuliert wurde – „treue Paladin Adenauers“<br />
– dessen Name bis zum heutigen<br />
Tag im „Krone-Kreis“ des UNITAS-Verbandes<br />
lebendig geblieben ist. Gerade auch<br />
über all das, was bisher unter diesem<br />
Namen geschehen ist, ließe sich ein umfangreicher<br />
Artikel schreiben. Im Krone-<br />
Kreis geht es vor allem darum, den<br />
heutigen Aktiven die nötigen geistigen<br />
Grundlagen zu vermitteln, um selber im<br />
Sinne von Franz Hitze und Heinrich Pesch<br />
tätig zu werden.<br />
Mit der gleichen Stoßrichtung, nur<br />
inhaltlich mit anderen Schwerpunkten,<br />
haben am 22. Mai 1982 in Bonn einige<br />
Unitarier den Heinrich-Pesch-Preis e.V.,<br />
Förderverein des „Verband der wissenschaftlichen<br />
katholischen Studentenvereine<br />
UNITAS e.V. für Sozialwissenschaft<br />
und soziale Tätigkeit e.V.“ gegründet. Er<br />
konnte also 2007 auf sein 25-jähriges<br />
Bestehen zurückblicken. Dies hätte Anlass<br />
sein können, den Heinrich-Pesch-Preis in<br />
diesem kleinen Jubiläumsjahr zum zehnten<br />
Mal zu verleihen. Die letzte Mitgliederversammlung<br />
vom 26.4.2005 kam jedoch zu<br />
der aufgrund der Finanzlage notwendigen<br />
Feststellung „dass in nächster Zeit keine<br />
weitere Preisverleihung möglich sein wird.“<br />
.<br />
Die bisherigen Preisträger<br />
Zunächst seien nochmals die bisherigen<br />
Preisträger in Erinnerung gerufen: Dr.<br />
Wilhelm Paul Link (1986), Generalpräses des<br />
Kolpingwerkes in Südamerika, für besondere<br />
Verdienste um die Weiterentwicklung<br />
und Vermittlung der Katholischen Soziallehre<br />
in Lateinamerika; Bundesminister a. D.<br />
Dr. Norbert Blüm (1988), für besondere Verdienste<br />
um die Gestaltung einer menschenwürdigen<br />
gesellschaftlichen Ordnung<br />
auf der Grundlage der Katholischen<br />
Soziallehre; † Bbr. Prof. Dr. Franz H. Mueller<br />
(1988), St. Paul, Minnesota, für besondere<br />
Verdienste um die Verbreitung und interkulturelle<br />
Vermittlung der Katholischen<br />
Soziallehre im interdisziplinären Dialog;<br />
Bbr. Bundestagsvizepräsident a. D. Dr.<br />
Rudolf Seiters (1992), für besondere Verdienste<br />
um die politischen, rechtlichen und<br />
ethischen Grundlagen der Wiedervereinigung<br />
Deutschlands; Bischof Joachim<br />
Reinelt (1992), Bischof von Dresden-Meißen,<br />
für besondere Verdienste um die Wahrung<br />
der Grundrechte der Person in der Zeit<br />
der Unterdrückung und um die religiösgeistige<br />
und sozialethische Begleitung des<br />
Prozesses der Wiedervereinigung Deutschlands;<br />
Bbr. Dr. Franjo Komarica (1997),<br />
Bischof von Banja Luka, für besondere<br />
Verdienste um die Wahrung der Würde und<br />
Rechte aller Menschen unter schwierigsten<br />
Bedingungen; † Bbr. Minrat. a. D. Dr. Ludwig<br />
Freibüter (2003), für besondere Verdienste<br />
um die gesellschaftspolitische Verwirklichung<br />
und bildungsmäßige Vermittlung<br />
der Katholischen Soziallehre; Bbr. Prof. Dr.<br />
Dr. h. c. mult. Anton Rauscher SJ (2003), für<br />
hervorragende Verdienste um die historisch-systematische<br />
Fundierung, die wissenschaftliche<br />
Vertiefung im interdisziplinären<br />
und internationalen Dialog und<br />
die akademische Vermittlung der Katholischen<br />
Soziallehre; Bbr. Dr. Johannes<br />
Stemmler (2004), für besondere Verdienste<br />
um die ethische Fundierung unternehmerischen<br />
Handelns und die interkulturelle<br />
Vermittlung der Katholischen Soziallehre.<br />
Katholische Soziallehre<br />
für Bosnien-Hercegowina<br />
Laut § 2 der Satzung wird der Zweck des<br />
Vereins, die „Förderung von Wissenschaft<br />
und Forschung und praktische Tätigkeit im<br />
Bereich gesellschaftlichen Zusammenlebens...,<br />
insbesondere durch die Durchführung<br />
wissenschaftlicher Veranstaltungen<br />
und Forschungsvorhaben, Vergabe von<br />
Forschungsaufträgen, durch die Unterstützung<br />
von praktischer Tätigkeit im<br />
sozialen Bereich“ und eben „durch die<br />
Vergabe des Heinrich-Pesch-Preises“<br />
verwirklicht.<br />
Als Bbr. Bischof Franjo Komarica von<br />
Banja Luka am 2. Mai 1997 den Heinrich-<br />
Pesch-Preis erhielt, sagte ihm der Verein ein<br />
Stipendium im Wert von 5.000 DM für<br />
einen Priester zu, um ein Studium der Katholischen<br />
Soziallehre an der Theologischen<br />
Fakultät in Zagreb zu beginnen. Aufgrund<br />
der schwierigen politischen und<br />
kirchlichen Lage dauerte es über fünf Jahre,<br />
bis er 2002, wie er selbst schreibt, „einen<br />
jungen, sehr fleißigen und vielseitigen<br />
Priester“ fand, „der bereit ist, neben anderen<br />
Verpflichtungen in der Pfarrei auch<br />
das Studium der Katholischen Soziallehre<br />
an der Theologischen Fakultät in Zagreb zu<br />
beginnen“. Inzwischen konnte ich Zvonko<br />
Brezovski, Pfarrer in Vrbanja / Bosna i Hercegovina<br />
bei einer Tagung in Zagreb persönlich<br />
kennen lernen. Er ist sehr dankbar<br />
für unsere Unterstützung. Er mußte die im<br />
Krieg zerstörte Kirche mit viel Mühe und<br />
der Mithilfe seiner Gemeinde und anderer<br />
wieder aufbauen. Neben seinen pastoralen<br />
und sozialen Aufgaben setzt er derzeit<br />
seine Studien im Fach „Christliche Gesellschaftslehre“<br />
in Zagreb bei Prof. Baloban<br />
fort.<br />
unitas 3-4/2007 191<br />
>>
Katholische Soziallehre:<br />
Hoffnung für Afrika<br />
Weiterhin hat der Förderverein bisher<br />
vier nigerianische Priester, die in Bonn im<br />
Fach „Christliche Gesellschaftslehre“ promoviert<br />
wurden, mit namhaften Beträgen<br />
bei der Veröffentlichung ihrer Doktorarbeit<br />
unterstützt: Im Jahr 2002 erhielt Fr. Dr.<br />
Casimir C. Nzeh einen Druckkostenzuschuss<br />
von 1.397,68 Euro für die Drucklegung<br />
seiner Doktorarbeit mit dem Titel<br />
„From Clash o Dialog of Religions: A Socio-<br />
Ethical Analysis of the Christian-Islamic<br />
Tension in a Pluralistic Nigeria“; ein Jahr<br />
später stellte der Förderverein Fr. Dr.<br />
Nwokedi Francis Ezumezu 420 Euro zur<br />
Verfügung, um zwanzig Exemplare seiner<br />
Dissertation mit dem Thema „Freedom as<br />
responsibility: Social market economy in<br />
the light of catholic social Teaching for<br />
Nigerian society“ gezielt für Personen und<br />
Institutionen zur Verbreitung der Katholischen<br />
Soziallehre in Nigeria einzusetzen.<br />
An diese Tradition anknüpfend haben wir in<br />
diesem Jahr die Veröffentlichung der Doktorarbeiten<br />
von Fr. Dr. Michael Ndubueze<br />
Diochi mit dem Thema „The Quest for<br />
Integral Development in Nigeria“ mit<br />
1362,52 Euro unterstützt, sowie von Fr.<br />
Polycarp Chuks Obikwelu mit dem Thema<br />
„Contextual Application of Christian Social<br />
Teaching on Political Ethics in the Light of<br />
the Pronouncements of the Symposium of<br />
the Episcopal Conferences of Africa and<br />
Madagascar (SECAM) in the Era of Globalisation“<br />
mit 1.292,24 Euro.<br />
Von den nigerianischen Priestern, die an<br />
der Bonner Fakultät seit dem Beginn der 80er<br />
Jahre ihr Promotionsstudium im Fach<br />
Christliche Gesellschaftslehre begonnen<br />
haben, konnte ich immer wieder – nachdem<br />
sie die Geschichte des sozialen und<br />
politischen Katholizismus in Deutschland<br />
studiert hatten – die Feststellung hören: Die<br />
Situation, die wir heute in Kirche und<br />
Gesellschaft in Nigeria antreffen, ähnelt in<br />
erstaunlicher Weise dem, was sich in der<br />
Frühzeit der Industriegesellschaft im 19.<br />
Jahrhundert in Deutschland abspielte, und<br />
worauf die damals entstehende Soziallehre<br />
der Kirche eine Antwort zu geben versuchte.<br />
Fanz Hitze und Heinrich Pesch sind also<br />
nicht nur den oben Genannten, sondern<br />
durch sie vielen Katholiken und anderen in<br />
Nigeria gut bekannt.<br />
Der erste Bonner Promovend war<br />
Objora F. Ike (s. Bild), heute Professor für<br />
Christliche Gesellschaftslehre im Priesterseminar<br />
in Enugu und an der dortigen<br />
staatlichen Universität. Er ist inzwischen<br />
auch Honorarprofessor an der Universität<br />
Frankfurt und vielen hier in Deutschland<br />
nicht unbekannt.<br />
Indem unser Förderverein in den zurückliegenden<br />
Jahren schwerpunktmäßig<br />
die Publikation der genannten Disserta-<br />
192<br />
unitas 3-4/2007<br />
tionen unterstützt hat, schließt sich sozusagen<br />
der Kreis von der Situation in<br />
Deutschland zurzeit Heinrich Peschs zur<br />
heutigen Situation in Nigeria. Dort ist die<br />
Kirche, wie man immer wieder hört, die fast<br />
einzige und größte Hoffnung der Menschen<br />
auf Besserung der Verhältnisse.<br />
Zukünftige Aufgaben<br />
und Projekte<br />
Um die Arbeit des Heinrich-Pesch-Preis<br />
e.V. auch in Zukunft wie bisher weiterführen<br />
zu können, brauchen wir die<br />
Mithilfe weiterer, vor allem auch jüngerer<br />
Bundesbrüder und Bundesschwestern.<br />
Sobald es unsere Mittel erlauben, möchten<br />
wir zum zehnten Mal den Heinrich-Pesch-<br />
Preis verleihen. Aus diesem Anlass ist in der<br />
UNITAS-Buchreihe auch eine Publikation<br />
geplant, in der die Laudationes und die<br />
Dankreden sämtlicher Preisträger aufgeführt<br />
werden. Damit würde sowohl ein<br />
Stück Zeitgeschichte als auch ein wichtiger<br />
Teil der Arbeit des UNITAS-Verbandes<br />
innerhalb der eigenen Reihen, aber auch<br />
öffentlich deutlicher bewusst werden. Das<br />
Buch könnte zusätzlich Informationen über<br />
Thema und Bedeutung der von uns<br />
geförderten Dissertationen auf dem Gebiet<br />
der Katholischen Soziallehre enthalten. Vor<br />
allem aber kommt es darauf an, innerhalb<br />
unseres Verbandes die christlich-soziale<br />
Tradition, auf die wir stolz sein können, zu<br />
wahren und auch anhand neuer Fragestellungen<br />
weiterzuführen. Anders gesprochen:<br />
Wir freuen uns auf weitere Mitglieder.<br />
Anmerkungen:<br />
1 vgl. Bauer, Clemens: Deutscher Katholizismus.<br />
Entwicklungslinien und Profile,<br />
Frankfurt a. M. 1964, S. 25-27.<br />
2 vgl. Rauscher, Anton: Der soziale und politische<br />
Katholizismus. Entwicklungslinie<br />
in Deutschland 1803-1963, hrsg. von<br />
Anton Rauscher Bd. I., S. 340-368.<br />
3 Pesch, Heinrich: Lehrbuch der Nationalökonomie,<br />
5 Bde., Freiburg i. Br. 1904-1923.<br />
Christliche Hoffnung<br />
gegen neuzeitliche Ideologien<br />
VATIKAN. Papst Benedikt XVI. stellt in seiner<br />
am 30. November veröffentlichten<br />
zweiten Enzyklika „Spe salvi“ (Auf Hoffnung<br />
hin sind wir gerettet / Röm 8,24)<br />
die christliche Hoffnung weltlichen Zukunftsverheißungen<br />
und einer blinden<br />
Fortschrittsgläubigkeit gegenüber. Alle<br />
Versuche und Theorien, menschliche<br />
Vernunft und Freiheit ohne Gott zum<br />
Maßstab einer vollkommenen Weltordnung<br />
zu machen, hätten sich als unzureichend<br />
erwiesen, so der Papst.<br />
Ausführlich setzt sich Benedikt XVI. in<br />
dem Lehrschreiben mit den Ideen der<br />
Französischen Revolution wie auch mit<br />
Kant, Marx und Engels bis hin zu Adorno<br />
und Horkheimer auseinander. Marx habe<br />
zwar die gesellschaftlichen Missstände<br />
der Ausbeutung präzise analysiert und<br />
den Weg zum Umsturz aufgezeigt. Aber<br />
er habe die menschliche Freiheit ignoriert,<br />
die „immer auch Freiheit zum Bösen<br />
bleibt“; zudem habe er nicht gesagt, wie<br />
es weitergehen könne – und damit trostlose<br />
Zerstörungen hinterlassen. Wissenschaft<br />
und politische Theorien hätten<br />
sich als überfordert erwiesen, was die Erlösungserwartung<br />
des Menschen betrifft,<br />
betont Benedikt XVI. in seinem 80seitigen<br />
Lehrschreiben. Letztlich sei Gott<br />
das Fundament der Hoffnung, und<br />
Hoffnung sei das Kennzeichen des Christentums<br />
Vernunft und Glauben brauchten<br />
einander: „Der Mensch braucht Gott,<br />
sonst ist er hoffnungslos.“ Das Christentum<br />
ist nach den Worten des Papstes<br />
keine sozialrevolutionäre Botschaft und<br />
Jesus kein Freiheitskämpfer. Vielmehr<br />
habe Christus die Begegnung mit Gott<br />
gebracht und damit die Begegnung mit<br />
einer Hoffnung, so Benedikt XVI. in seinem<br />
theologisch und philosophisch anspruchsvollen<br />
Schreiben.<br />
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,<br />
Kardinal Karl Lehmann, würdigte<br />
die Enzyklika als „großes und eindrucksvolles<br />
Dokument des katholischen<br />
und weithin auch des christlichen Verständnisses<br />
über die Hoffnung“. Es seien<br />
„viele Erkenntnisse aus der Diagnose<br />
unserer Gegenwart, den theologischen<br />
Disziplinen, philosophischen Überlegungen<br />
und verschiedenen Zeugnissen aus<br />
Geschichte und Gegenwart“ eingegangen.<br />
Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische<br />
Kirche Deutschlands (VELKD)wertete<br />
die Enzyklika als einen „erfreulichen<br />
Text“. Das Schreiben lese sich wie eine<br />
Einladung zum Gespräch über Glaube,<br />
Liebe und Hoffnung, erklärte der Catholica-Beauftragte<br />
der VELKD, Bischof Friedrich<br />
Weber. Die lutherische Kirche könne<br />
dem Inhalt über weiteste Strecken vorbehaltlos<br />
zustimmen. Das Lehrschreiben<br />
belege die ökumenische Einsicht, „dass<br />
die evangelisch-lutherische und die<br />
römisch-katholische Kirche sehr viel<br />
mehr eint als trennt“.
EINLADUNG<br />
131. GENERALVERSAMMLUNG DES VERBANDES<br />
DER WISSENSCHAFTLICHEN KATHOLISCHEN<br />
STUDENTENVEREINE UNITAS<br />
VOM 1. BIS 4. MAI 2008 IN KÖLN<br />
AUS ANLASS DES 110-JÄHRIGEN JUBILÄUMS <strong>VON</strong><br />
UNITAS-ERWINIA ZU STRASSBURG UND KÖLN<br />
„Dialog der Kulturen im Zeichen der Globalisierung“<br />
Tagungsort für alle Veranstaltungen:<br />
MATERNUSHAUS – Kongresszentrum des Erzbistums Köln, Kardinal-Frings-Straße 1–3, 50668 Köln,<br />
Tel. (0221) 16 31-0, Fax (0221) 16 31-215, Mail: info@maternushaus.de, www.maternushaus.de.<br />
Die Gottesdienste, der Begrüßungsabend und der Kommers finden an den im Programmablauf (siehe unten)<br />
angegebenen Orten statt. Für alle Veranstaltungen gilt: s. t. !<br />
Donnerstag, 1. Mai 2008 – Fest Christi Himmelfahrt<br />
Programmablauf<br />
Anreise und Anmeldung ab 11 Uhr im Tagungsbüro Maternushaus. Die Zuweisung der Aktivenunterkunft erfolgt ausschließlich bei<br />
der Anmeldung; zugleich können Fahnen und Wichs im Tagungshotel deponiert werden.<br />
10:00 Sitzung des Verbandsvorstandes und der Verbandsamtsträger<br />
Raum Adelheid<br />
12:30 gemeinsames Mittagessen<br />
14:00 Eröffnung der GV und 1. Plenarsitzung – Maternussaal<br />
15:00 Begleitprogramm<br />
15:45 Kaffeepause<br />
16:00 Getrennte Sitzungen: Aktiventag im Maternussaal / Hohedamenbund im Raum Adelheid / Altherrenbund im<br />
Dreikönigssaal / Finanzkommission im Raum Laurentius<br />
18:15 Verbandsmesse in St. Gereon, Christophstr. 1, 50670 Köln<br />
Festlicher Eröffnungsgottesdienst zum Hochfest Christi Himmelfahrt<br />
Zelebrant: Geistlicher Beirat Bbr. Kaplan Helmut Wiechmann<br />
Conzelebraten wenden sich bitte an Bbr. Hartmut Fritze – Tel. 0221-7408017<br />
Begrüßung und einführende Worte zur Basilika St. Gereon durch Pfarrer Andreas Brocke<br />
Gedenken der verstorbenen Bundesschwestern und Bundesbrüder durch den Verbandsgeschäftsführer Bbr. Dieter Krüll<br />
20:15 Begrüßungsabend mit gemeinsamem Abendessen im Kölner Brauhaus Früh am Kölner Dom<br />
Für das rheinisch-kölsche Lokalkolorit in Text und Ton sorgen Wim Mergenbaum und Bbr. Hans Leo Neu.<br />
unitas 3-4/2007 193<br />
>>
194<br />
Freitag, 2. Mai 2008<br />
09:00 Empfang für den Verbandsvorstand im Historischen Rathaus der Stadt Köln<br />
09:00 Morgenlob in der Hauskapelle<br />
10:00 Begleitprogramm<br />
10:00 2. Plenarsitzung – Maternussaal<br />
11:00 Kaffeepause<br />
11:15 2. Plenarsitzung (Fortsetzung)<br />
13:00 gemeinsames Mittagessen<br />
14:00 3. Plenarsitzung – Maternussaal<br />
15:00 Begleitprogramm<br />
15:30 Kaffeepause<br />
15:45 3. Plenarsitzung (Fortsetzung)<br />
18:00 gemeinsames Abendessen<br />
18:00 Abmarsch der Chargenteams zum Abendessen im Kölner Gürzenich<br />
19:30 Einlass in den großen Festsaal des Kölner Gürzenich<br />
20:00 Festkommers im Großen Saal des Kölner Gürzenich<br />
Gürzenichstraße, Eingang Martinstr. 29-37, 50667 Köln<br />
Festvortrag: Interreligiöse und interkulturelle Kompetenz als Grundlage eines Dialogs der Kulturen<br />
Festredner: Prof. Dr. Alexander Thomas, Institut für Psychologie, Universität Regensburg<br />
Samstag, 3. Mai 2008<br />
09:30 Morgenlob in der Hauskapelle<br />
09:30 Sitzung des ZHBV im Raum Adelheid<br />
11:00 Podiumsdiskussion im Maternussaal<br />
Thema: Interkulturell kompetent: Leitbild für Christen in einer globalisierten Welt –<br />
Kritische Anmerkungen zu Theorie und Praxis des Dialogs der Kulturen<br />
Podiumsteilnehmer:<br />
Bbr. Winfried Hinzen, Dipl.-Kfm. (Vorstand Pax-Bank e.G., Vorstandsmitglied des Bundes Katholischer Unternehmer)<br />
Werner Höbsch, Dipl.-Theol. (stv. Leiter der Abtlg. Liturgie und Verkündigung im Generalvikariat des Erzbistums Köln)<br />
Prof. Dr. Alexander Thomas (Institut für Psychologie, Universität Regensburg)<br />
Bbr. Tobias Wagner, Drs. NL, MIB (Vice President – Credit Suisse SOVP, Zürich)<br />
Moderation: Astrid Wirtz, Journalistin, Kölner Stadt-Anzeiger<br />
13:00 gemeinsames Mittagessen im Tagungshotel<br />
14:00 4. Plenarsitzung – Maternussaal (nur soweit erforderlich und angekündigt!)<br />
15:00 Begleitprogramm vorzugsweise für die Delegierten der GV<br />
19:30 Einlass in den Maternussaal<br />
20:00 Festball mit Bankett im Maternussaal<br />
Sonntag, 4. Mai<br />
09:50 Einführende Worte zur Geschichte der Basilika St. Kunibert<br />
durch Pfarrer Frank N. Müller, Ehrenmitglied von UNITAS-Rheinfranken Düsseldorf<br />
10:00 Pontifikalamt in St. Kunibert, Kunibertsklostergasse 2 (Altstadt)<br />
Zelebrant: Seine Eminenz Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln – Ehrenmitglied des UNITAS-Verbandes<br />
und Conzelebranten (Conzelebraten wenden sich bitte an Bbr. Hartmut Fritze Tel. 0221 – 7408017)<br />
11:45 Kaffeepause im Foyer<br />
12:00 Festakt im Maternussaal<br />
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Altherrenbundes Bbr. Heinrich Sudmann, Ministerialdirigent a.D.<br />
Festvortrag: Der Beitrag des Christentums zum weltweiten Dialog<br />
Festredner: Abtprimas Dr. Notker Wolf, OSB, Rom<br />
13:30 Ende der Generalversammlung: Verabschiedung der Teilnehmer durch die Vorsitzende<br />
des Hohedamenbundes Bsr. Dr. Claudia Bellen-Kortevoß<br />
14:00 Imbiss zum Abschluss, Abreise der Teilnehmer<br />
Satzungsmäßige Hinweise<br />
Gemäß der Verbandssatzung sind Anträge zur Generalversammlung bis Mittwoch, den 26. März 2008 schriftlich in doppelter<br />
Ausfertigung beim Vorort W.K.St.V. UNITAS-Palatia zu Darmstadt, VOP Johannes Günther, Gutenbergstr. 5, 64289 Darmstadt,<br />
Tel. 06151-7909030 / Telefax 06151-7909050, E-Mail: vop@UNITAS.org einzureichen. Den schriftlich formulierten Anträgen sind<br />
eine Begründung sowie eine Protokollabschrift über den Beschluss des Antrages durch das jeweilige Gremium beizufügen.<br />
Teilnahmeberechtigt an den Plenarsitzungen sind alle Verbandsmitglieder (Vereine / § 4 (1) VS) des UNITAS-Verbandes und<br />
deren Mitglieder. Stimmberechtigt bei den Plenarsitzungen ist gem. § 9 (7) VS je ein bevollmächtigter Vertreter eines aktiven<br />
Studentenvereines oder eine bevollmächtigte Vertreterin eines Studentinnenvereines, des Weiteren je ein bevollmächtigter Vertreter<br />
eines Altherrenvereines bzw. eine bevollmächtigte Vertreterin eines Hohedamenvereines. Jeder offizielle Vertreter ist nur<br />
für einen Verein stimmberechtigt. Die Meldung aller offiziellen Vertreter muss bis zum 26. März 2008 an den Hohen Vorort des<br />
UNITAS-Verbandes e.V., den W.K.St.V. UNITAS-Palatia zu Darmstadt (s.o.) erfolgen. Vereine, die keinen Bevollmächtigten abgeordnet<br />
haben, besitzen kein Stimmrecht.<br />
unitas 3-4/2007
Bonn – Darmstadt – Kaarst – Köln<br />
im November 2007<br />
Mit unitarischem Bundesgruß<br />
Johannes Günther<br />
Vorortspräsident<br />
Heinrich Sudmann Dieter Krüll Dr. Claudia Bellen-Kortevoß<br />
Vorsitzender des AHB Vorstand des e.V. Vorsitzende des HDB<br />
und VGF<br />
Karl Heinz Wagner<br />
Örtlicher Vorbereitungsausschuss<br />
Organisatorische Hinweise<br />
Die Unterbringung der Aktiven/Gäste erfolgt im CITY-HOSTEL Jugendherberge Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Köln,<br />
Tel. 0221-767081; Fax 0221-761555. Dort stehen Zwei- und Mehrbettzimmer zur Verfügung. Die Zuteilung der Zimmer wird bei<br />
der Anmeldung im Maternushaus / Tagungsbüro (nicht in der Jugendherberge) geregelt.<br />
Die Kosten der Unterbringung der Aktiven und deren Gäste übernimmt bei ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung<br />
der Verband. Für jede angemeldete Person wird eine Kaution i. H. von 50,- € erhoben. Bei Nichtteilnahme verfällt die Kaution.<br />
Für die Hohen Damen und Alten Herren stehen eine begrenzte Anzahl von reservierten Ein- und Zweibettzimmern im<br />
Tagungshotel: Maternushaus ( ��� ), Kardinal-Frings-Str. 1-3, 50668 Köln,<br />
Tel: 0221-1631-0, Fax 0221-1631215 und im<br />
Hotel: Kolpinghaus International ( ��� ), St. Apernstr. 32, 50667 Köln,<br />
Tel. 0221-20930; Fax 0221-2578081<br />
zum Preis pro Person und Nacht von € 65,00 im Einzelzimmer und<br />
von € 47,50 im Doppelzimmer (Maternushaus)<br />
von € 42,50 im Doppelzimmer (Kolpinghaus)<br />
bereit. Die Vergabe erfolgt nach Bestelleingang. Das Kolpinghaus International und das Maternushaus verfügen über ausreichende<br />
Parkmöglichkeiten.<br />
Für den Fußweg vom Hauptbahnhof Köln bis zum Maternushaus wie auch zwischen Maternushaus und Kolpinghaus benötigt<br />
man knapp 15 Minuten.<br />
Die Anmeldung der Aktiven und deren Gäste, sowie die der Hohen Damen, der Alten Herren und Gäste erfolgt über das Internet:<br />
www.GV2008.de oder mittels der nachfolgend abgedruckten Anmeldeformulare an die Verbandsgeschäftsstelle: UNITAS-<br />
Verband e.V., Aachener Str. 29, D 41564 Kaarst. Fax 02131-275960; E-Mail: vgs@UNITAS.org. Die Anmeldeformulare können<br />
aus dem Internet: www.GV2008.de heruntergeladen werden.<br />
Auch in Köln und Umgebung wohnende Bundesschwestern und Bundesbrüder, die keine Unterkunft benötigen, müssen ihre<br />
Teilnahme an der GV über das Internet: www.GV2008.de oder mittels der nachfolgend abgedruckten Anmeldeformulare an die<br />
Verbandsgeschäftsstelle: UNITAS-Verband e.V., Aachener Str. 29, D-41564 Kaarst, Fax 02131-275960; E-Mail: vgs@UNITAS.org<br />
schriftlich anmelden und den GV-Beitrag entrichten.<br />
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ohne Entrichtung des GV-Beitrags ist nicht möglich.<br />
Alle in Köln eintreffenden, ebenso die in Köln und Umgebung wohnenden GV-Teilnehmer werden gebeten, sich umgehend im<br />
Tagungsbüro: Foyer des Maternushauses zu melden. Das gilt auch, wenn keine Übernachtungsmöglichkeit gebucht wurde. Sie<br />
erhalten dort alle erforderlichen GV-Unterlagen, insbesondere Delegiertenkarten, das Tagungsabzeichen, Gutscheine für die<br />
Mahlzeiten und die Teilnahmeausweise für das Begleitprogramm.<br />
Wer nicht im Maternushaus / Hotel Kolpinghaus International übernachten möchte, kann ein Zimmer über KölnTourismus GmbH<br />
Tel. 0221/221-30400, Fax 0221/221-30410, Internet: www.koelntourismus.de; info@koelntourismus.de buchen oder unmittelbar<br />
eines der örtlichen Hotels ansprechen.<br />
Das Tagungshaus verfügt über eine gute Küche zu günstigen Preisen. Schon aus terminlichen Gründen bietet es sich an, das<br />
Angebot der Küche wahrzunehmen. Allerdings müssen die Veranstalter die Zahl der Essen verbindlich anmelden. Daher bitten<br />
wir bei der Anmeldung, die gewünschten Mahlzeiten anzugeben und im voraus zu zahlen. Über die gebuchten Leistungen<br />
werden bei der Ankunft im Tagungsbüro Gutscheine ausgegeben.<br />
Hinweis zum Begleitprogramm (vergl. unten Anmeldung):<br />
Durch eigene Veranstaltungen des Doms, die jetzt noch nicht bekannt sind, können kurzfristig Änderungen im Begleitprogramm<br />
eintreten.<br />
unitas 3-4/2007 195<br />
>>
196<br />
Anmeldung für Aktive / Gäste (Sammelbestellung des Aktivenvereins)<br />
Wir (Ich) nehme/n an der 131. GV in Köln mit insges. _______ Personen teil.<br />
Name des UV-Vereines: ____________________________________<br />
Chargieren beim Kommers und ggf. Gottesdienst: ja _____ nein _____<br />
Teilnehmer der Aktivitates:<br />
Namen, Vornamen Übernachtungen: ______ Do/Frei ______ Frei/Sa ______ Sa/So<br />
______________________________________________<br />
______________________________________________<br />
______________________________________________<br />
______________________________________________ (ggf. Liste einreichen!)<br />
GV – Beitrag für Aktive /Gäste € 30,- pro Person Aktive/Gäste ______ Personen ____ €<br />
Kaution für die Unterkunft: € 50,- pro Person Aktive/Gäste ______ Personen ____ €<br />
Teilnahme an Veranstaltungen<br />
Donnerstag, 1. Mai 2008<br />
Verbandsmesse in St. Gereon ______ Personen<br />
Begrüßungsabend im Brauhaus Früh mit<br />
gemeinsamen Abendessen Selbstzahler ______ Personen<br />
Freitag, 2. Mai 2008<br />
Kommers im Gürzenich ______ Personen<br />
Samstag, 3. Mai 2008<br />
Podiumsdiskussion ______ Personen<br />
Ball mit festlichem Buffet € 15,00 (incl. Essen) ______ Personen ______ €<br />
Sonntag, 4. Mai 2008<br />
Pontifikalamt in St. Kunibert ______ Personen<br />
Festakt im Maternushaus ______ Personen<br />
Teilnahme an folgenden Mahlzeiten im Maternushaus:<br />
Donnerstag, 1. Mai 2008<br />
Mittagessen € 5,90 ______ Personen ______ €<br />
(Rhein. Schnittbohnensuppe mit Ochsenbrust)<br />
Freitag, 2. Mai 2008<br />
Tagespauschale: € 14,90<br />
(2 Kaffeepausen, Mittagessen, Abendessen) ______ Personen ______ €<br />
Samstag, 3. Mai 2008<br />
Mittagessen € 5,90 ______ Personen ______ €<br />
(Gaisburger Marsch mit Knopfspätzle)<br />
Sonntag, 4. Mai 2008<br />
Imbiss nach dem Festakt € 5,90 ______ Personen ______ €<br />
Begleitprogramm<br />
Siehe vorab die Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen dieses Begleitprogramms in diesem Heft oder unter<br />
www.GV2008.de.<br />
Nähere Informationen zu den Treffpunkten finden sich im Tagungsbüro und ebenfalls unter www.GV2008.de. Treffpunkt ist in der<br />
Regel die Kreuzblume am Rande der Domplatte und/oder der Eingang zum „Dom-Forum“, beide gegenüber dem Hauptportal<br />
des Doms.<br />
Die Führungen kosten jeweils:<br />
– für teilnehmende Aktive und deren Gäste je Person 6,00 €<br />
(für AHAH, HDHD und Gäste 10,00 €)<br />
unitas 3-4/2007
Buchung:<br />
Donnerstag, 01. 05. 2008 Teilnahme Personen Preis<br />
15:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b) Typisch Kölsch O ________ ______ €<br />
c) Köln grüßt Jerusalem O ________ ______ €<br />
d) Museum Ludwig O ________ ______ €<br />
Freitag, 03.05. 2008<br />
10:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b)…handelt wie ein Kölner! O ________ ______ €<br />
c) Kölsche Mädcher O ________ ______ €<br />
d) Tot in Köln – Melatenfriedhof O ________ ______ €<br />
e) Stadtführung per Bus<br />
(bitte nur Gehbehinderte!) O ________ ______ €<br />
15:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b) Unter den Füßen des Doms O ________ ______ €<br />
c) ....handelt wie ein Kölner! O ________ ______ €<br />
d) Kölsche Mädcher O ________ ______ €<br />
e) Typisch Kölsch O ________ ______ €<br />
f) Nazis in Köln – nein danke? O ________ ______ €<br />
16:00 h Dem Dom aufs Dach!° O ________ ______ €<br />
(Teilnahme nur von trittsicheren, höhenfesten Personen)<br />
Samstag, 04.05.2008<br />
(Die Termine am Samstagnachmittag sollen bitte vorzugsweise den Delegierten zur Verfügung stehen!)<br />
10:00 h St. Maria im Kapitol<br />
(nur begrenzte Teilnehmerzahl) O ________ ______ €<br />
15:00 h a) Dem Dom aufs Dach! O ______ €<br />
(Teilnahme nur von trittsicheren, höhenfesten Personen)<br />
b) Der Dom von innen O ______ €<br />
c) Unter den Füßen des Doms O ______ €<br />
d) Köln grüßt Jerusalem O ______ €<br />
e) Typisch Kölsch O ______ €<br />
________<br />
Gesamtpreis aller gebuchten Führungen €<br />
=======<br />
Gesamt-Zusammenstellung:<br />
GV-Beitrag, Kaution, x Essen, x Teilnahme am Begleitprogramm:<br />
_________ x GV-Beitrag Aktive / Gäste pro Person 25,00 € = EUR _________<br />
_________ x Kaution Aktive/Gäste für Unterkunft pro Pers. 50,00 € = EUR _________<br />
_________ x Essen im Maternushaus (wie oben gebucht) = EUR _________<br />
_________ x Bankett mit Ball 15,00 € = EUR _________<br />
_________ x Buchungen Begleitprogramm je 06,00 € = EUR _________<br />
_________________<br />
Vorauszahlung Gesamt: = EUR<br />
==============<br />
Diesen Beitrag bitte bis zum 26. März 2008 überweisen auf das Konto:<br />
UNITAS-Verband e.V. Kto-Nr.: 28 796 021 – Pax-Bank e.G., Köln (BLZ: 370 601 93)<br />
Absender:<br />
W.K.St.V. UNITAS- ____________________________ E-Mail: ____________________________<br />
Str. / PLZ / Ort: __________________________________________________________________________<br />
Bankverbindung<br />
Kto/BLZ/Bank: ______________________________________________________________<br />
Datum, Unterschrift: ______________________________________________________________<br />
Auch in Köln und Umgebung wohnende Bundesschwestern und Bundesbrüder, die keine Unterkunft benötigen,<br />
müssen ihre Teilnahme an der GV über das Internet: www.GV2008.de oder mittels der abgedruckten Anmeldeformulare<br />
an die Verbandsgeschäftsstelle: UNITAS-Verband e.V., Aachener Str. 29, D 41564 Kaarst. Fax 0 21 31 / 27 59 60; E-Mail:<br />
vgs@UNITAS.org schriftlich anmelden und den GV-Beitrag entrichten.<br />
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ohne Entrichtung des GV-Beitrags ist nicht möglich.
198<br />
Anmeldung für die Hohen Damen, Alten Herren und Gäste<br />
Ich nehme an der 131. GV in Köln mit ___ Personen teil.<br />
Name, Vorname Übernachtung:<br />
______________________________________________ Einzelzimmer: ______ Do/Frei ______ Frei/Sa ______ Sa/So<br />
______________________________________________ Doppelzimmer: ______ Do/Frei ______ Frei/Sa ______ Sa/So<br />
______________________________________________ GV–Beitrag - HD / AH € 60,- ______Pers. ____ €<br />
Teilnahme an Veranstaltungen<br />
Donnerstag, 1. Mai 2008<br />
Verbandsmesse in St. Gereon<br />
Begrüßungsabend im Brauhaus Früh mit<br />
______ Personen<br />
gemeinsamen Abendessen<br />
Freitag, 2. Mai 2008<br />
Selbstzahler ______ Personen<br />
Kommers im Gürzenich<br />
Samstag, 3. Mai 2008<br />
______ Personen<br />
Podiumsdiskussion ______ Personen<br />
Ball mit festlichem Buffet € 40,00 (incl. Essen) ______ Personen ____ €<br />
Sonntag, 4. Mai 2008<br />
Pontifikalamt in St. Kunibert ______ Personen<br />
Festakt im Maternushaus ______ Personen<br />
Teilnahme an folgenden Mahlzeiten im Maternushaus:<br />
Donnerstag, 1. Mai 2008<br />
Mittagessen<br />
(Rhein. Schnittbohnensuppe mit Ochsenbrust)<br />
Freitag, 2. Mai 2008<br />
€ 7,90 ______ Personen _____ €<br />
Tagespauschale: € 34,90<br />
( 2 Kaffeepausen, Mittagessen, Abendessen) ______ Personen _____ €<br />
Samstag, 3. Mai 2008<br />
Mittagessen<br />
(Gaisburger Marsch mit Knopfspätzle) € 7,90 ______ Personen _____ €<br />
Sonntag, 4. Mai 2008<br />
Imbiss nach dem Festakt € 7,90 ______ Personen _____ €<br />
Begleitprogramm<br />
Siehe vorab die Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen dieses Begleitprogramms in diesem Heft oder unter<br />
www.GV2008.de. Nähere Informationen zu den Treffpunkten finden sich im Tagungsbüro und ebenfalls unter www.GV2008.de.<br />
Treffpunkt ist in der Regel die Kreuzblume am Rande der Domplatte und/oder der Eingang zum „Dom-Forum“, beides gegenüber<br />
dem Hauptportal des Doms.<br />
Die Führungen kosten jeweils für teilnehmende AH/HD und Gäste je Person 10,00 € (für Aktive und deren Gäste 6,00 €)<br />
Hinweis zum Begleitprogramm:<br />
Durch eigene Veranstaltungen des Doms, die jetzt noch nicht bekannt sind, können kurzfristig Änderungen im Begleitprogramm<br />
eintreten.<br />
Buchung:<br />
Donnerstag, 01. 05. 2008 Teilnahme Personen Preis<br />
15:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b) Typisch Kölsch O ________ ______ €<br />
c) Köln grüßt Jerusalem O ________ ______ €<br />
d) Museum Ludwig O ________ ______ €<br />
Freitag, 03.05. 2008<br />
10:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b) …handelt wie ein Kölner! O ________ ______ €<br />
c) Kölsche Mädcher O ________ ______ €<br />
d) Tot in Köln - Melatenfriedhof O ________ ______ €<br />
e) Stadtführung per Bus<br />
( bitte nur Gehbehinderte! ) O ________ ______ €<br />
unitas 3-4/2007
Teilnahme Personen Preis<br />
15:00 h a) Der Dom von innen O ________ ______ €<br />
b) Unter den Füßen des Doms O ________ ______ €<br />
c) ...handelt wie ein Kölner! O ________ ______ €<br />
d) Kölsche Mädcher O ________ ______ €<br />
e) Typisch Kölsch O ________ ______ €<br />
f) Nazis in Köln – nein danke? O ________ ______ €<br />
16:00 h Dem Dom aufs Dach! O ________ ______ €<br />
(Teilnahme nur von trittsicheren, höhenfesten Personen)<br />
Samstag, 04.05.2008<br />
(Die Termine am Samstagnachmittag sollen bitte vorzugsweise den Delegierten zur Verfügung stehen!)<br />
10:00 h St. Maria im Kapitol<br />
(nur begrenzte Teilnehmerzahl) O ________ ______ €<br />
15:00 h a) Dem Dom aufs Dach! O ______ €<br />
(Teilnahme nur von trittsicheren, höhenfesten Personen)<br />
b) Der Dom von innen O ______ €<br />
c) Unter den Füßen des Doms O ______ €<br />
d) Köln grüßt Jerusalem O ______ €<br />
e) Typisch Kölsch O ______ €<br />
_________<br />
Gesamtpreis aller gebuchten Führungen €<br />
========<br />
Gesamt-Zusammenstellung:<br />
GV-Beitrag und Vorauszahlung:<br />
_______ x HD / AH GV-Beitrag 60,00 € = EUR ________<br />
Unterkunft im Einzelzimmer Maternushaus oder Kolpinghaus<br />
_______ x pro Person und Nacht 65,00 € = EUR ________<br />
Unterkunft im Doppelzimmer Maternushaus<br />
_______ x pro Person und Nacht 47,50 € = EUR ________<br />
Unterkunft im Doppelzimmer Kolpinghaus<br />
_______ x pro Person und Nacht 42,50 € = EUR ________<br />
_______ x Essen im Maternushaus (wie oben gebucht) = EUR ________<br />
_______ x Bankett mit Ball 40,00 € = EUR ________<br />
_______ x HD / AH / Gäste Buchungen Begleitprogramm je 10,00 € = EUR ________<br />
________________<br />
Vorauszahlung Gesamt: = EUR<br />
==============<br />
Diesen Beitrag bitte bis zum 26. März 2008 überweisen auf das Konto:<br />
UNITAS-Verband e.V., Konto-Nr.: 28 796 021 Pax-Bank e.G. , Köln (BLZ 370 601 93)<br />
Absender:<br />
Name, Vorname: _____________________________________________________<br />
Str. / PLZ / Ort: _____________________________________________________<br />
Tel. / E-Mail: _____________________________________________________<br />
Bankverbindung<br />
Kto-Nr./ BLZ / Bank: _____________________________________________________<br />
Datum, Unterschrift: _____________________________________________________<br />
Auch in Köln und Umgebung wohnende Bundesschwestern und Bundesbrüder, die keine Unterkunft benötigen,<br />
müssen ihre Teilnahme an der GV über das Internet: www.GV2008.de oder mittels der abgedruckten Anmeldeformulare<br />
an die Verbandsgeschäftsstelle: UNITAS-Verband e.V., Aachener Str. 29, D-41564 Kaarst. Fax 02131 / 27 59 60; E-Mail:<br />
vgs@UNITAS.org schriftlich anmelden und den GV-Beitrag entrichten.<br />
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ohne Entrichtung des GV-Beitrags ist nicht möglich.<br />
Wer nicht im Maternushaus / Hotel Kolpinghaus International übernachten möchte kann ein Zimmer über KölnTourismus<br />
GmbH, Tel. 0221/ 221-30400, Fax 0221/ 221-30410, Internet: www.koelntourismus.de; info@koelntourismus.de buchen<br />
oder unmittelbar eines der örtlichen Hotels ansprechen.<br />
Dringender Hinweis: Wegen des frühen GV-Termins Anfang Mai und der Fünf-Wochenfrist zur Einreichung der GV-Anträge<br />
und Resolutionen bereits am 27.03.2007 ist dringend erforderlich, GV-Anträge bereits im WS 2007/2008 vorzubereiten und<br />
zu beschließen. Das gilt auch für AHV/HDV und AHZ, die z.B. ihre Mitgliederversammlungen anlässlich des Vereinsfestes im<br />
Januar 2008 dazu nutzen sollten.<br />
unitas 3-4/2007 199
Colonia claudia ara agrippinensium CCAA –<br />
Köln und was wir Kölner Unitarier zu bieten haben!<br />
Nach dem Abschluss der herausragenden<br />
GV 2007 in Trier schrieben wir auf<br />
der Website www.GV2008.de, dass wir<br />
unseren verehrten Gästen und den lieben<br />
Bundesschwestern und -brüdern<br />
den „touristischen Mund“ doch schon<br />
etwas wässrig machen wollten. Nun<br />
steht die Anmeldung an und wir freuen<br />
uns, ein reichhaltiges Begleitprogramm<br />
präsentieren zu können:<br />
Eine Vorbemerkung: Was früher Damenprogramm<br />
hieß, nennen wir nun Begleitprogramm,<br />
weil sicher nicht alle Teilnehmer<br />
an der Generalversammlung, auch an den<br />
Plenar- und Ausschusssitzungen, teilnehmen<br />
müssen. Alle die möchten, sind zur Teilnahme<br />
an den Veranstaltungen des Begleitprogramms<br />
sehr herzlich eingeladen.<br />
Und noch eine Vorbemerkung: die GV<br />
2008 findet an einem kirchlichen und einem<br />
touristischen „Hochfest“ statt, dem 1.<br />
Mai, Fronleichnam, und einem mit dem<br />
Wochenende verbindenden Brückentag! Die<br />
Stadt und ihre wahren und vermeintlichen<br />
Heiligtümer werden richtig gut besucht<br />
sein! Wir erbitten daher die alsbaldige<br />
Anmeldung per Post mittels der Anmeldeformulare<br />
oder direkt im Internet auf<br />
www.UNITAS.org.<br />
Die hier folgenden Erläuterungen sollen<br />
Euch die Auswahl der Veranstaltungen und<br />
200<br />
unitas 3-4/2007<br />
WICHTIGE HINWEISE ZUM BEGLEITPROGRAMM DER GV 2008<br />
damit das Ausfüllen des Anmeldebogens<br />
erleichtern.<br />
Der Kölner stellt sein Licht und das<br />
seiner Stadt nicht gerne unter den Scheffel,<br />
zugegeben. Und Köln (www.koeln.de)<br />
braucht natürlich niemanden, es verkauft<br />
sich schon von selbst: im Internet findet<br />
jeder über www.koeln.de, was ihm in dieser<br />
Stadt gefallen könnte.<br />
So hat Köln wichtige Museen (z. B. Rautenstrauch-Joest<br />
Museum für Völkerkunde,<br />
www.museenkoeln.de) und Kunstsammlungen<br />
(so die Sammlung Ludwig,<br />
www.museenkoeln.de), Tage kann man dort<br />
verbringen. Köln beherbergt zudem in<br />
Gestalt der zwölf großen romanischen<br />
Kirchen ein weltweit einmaliges Ensemble<br />
prächtiger Sakralbauwerke des Hohen<br />
Mittelalters (www.romanische-kirchenkoeln.de).<br />
Aber: Wir möchten Köln so präsentieren,<br />
wie Ihr es nicht im Touristenbüro von der<br />
Stange buchen könnt. „Wat nix koß, dat eß<br />
och nix“, heißt es auch in Köln, und bundesbrüderliche<br />
Solidarität mit den Aktiven<br />
kommt ja von Herzen, geht – auch hier! –<br />
aber durch das Portemonnaie! Danke für<br />
das Verständnis!<br />
Das Begleitprogramm bietet daher zu<br />
den klassischen Terminen im Rahmen der<br />
Generalversammlung am Donnerstagnachmittag,<br />
Freitagmorgen, Freitagnachmittag<br />
und Samstagnachmittag nicht nur einen für<br />
alle gemeinsamen Programmpunkt, sondern<br />
jeweils verschiedene: So wollen wir<br />
möglich machen, dass jeder in den Genuss<br />
einer Veranstaltung aus allen drei nachfolgend<br />
genannten Programmschwerpunkten<br />
kommt. Die Restriktionen der von<br />
uns nicht zu beeinflussenden Besichtigungszeiten<br />
haben wir berücksichtigt.<br />
Die Termine am Samstagnachmittag<br />
würden wir dabei gerne vornehmlich für die<br />
Teilnehmer der Plenarsitzungen reservieren.<br />
Wir möchten als Programmschwerpunkte<br />
den Dom, die Stadt und ein paar<br />
Spezialitäten präsentieren, in Schlagworten<br />
aus der Sprache unserer einstigen „Eroberer“,<br />
die wir dann gerne assimiliert haben -<br />
die Sprache und die Römer!:<br />
– Colonia cathedralis<br />
– Colonia coloniensis<br />
– Colonia specialis<br />
Colonia cathedralis<br />
Im Zentrum nicht nur der öffentlichen<br />
Wahrnehmung dieser Stadt, sondern auch<br />
unseres Programms steht der Dom. Die<br />
im 13. begonnene und im 19. Jahrhundert<br />
vollendete Kathedrale lässt sich von<br />
unten, von oben und von innen ansehen.<br />
(www.koelner-dom.de; www.domforum.de)<br />
„Unter den Füßen des Doms“ bezeichnet<br />
die Besichtigung der Fundamente dieser<br />
riesigen Kirche und der Ausgrabungen unter<br />
ihrem Boden. Keine Angst, es ist dort unten<br />
zwar kühl, aber hell und weit; die Domfundamente<br />
gehen 17 Meter tief, sind jedoch<br />
nicht ganz zu sehen.<br />
„Dem Dom auf’s Dach“ geht es zuerst<br />
mittels Aufzug fast 40 Meter in die Höhe.
Wer mit will, muss schon trittfest sein und<br />
darf keine Höhenangst haben – aber der<br />
Blick in die Stadt, in die Ferne, aber auch in<br />
den Innenraum ist einmalig und atemberaubend!<br />
„Der Dom von innen“ umfasst einen Gang<br />
durch die Kathedrale, den Chor mit dem<br />
Dreikönigschrein (ganz aus der Nähe!), den<br />
Lochner-Altar, aber auch im „Domforum“<br />
eine Multimediashow zur Kathedrale.<br />
Die Vormittagsführungen werden im<br />
Dom mit der Andacht (mit Orgelspiel) um<br />
zwölf Uhr ihr Ende finden.<br />
Wer nach einer Führung noch „Dampf“<br />
hat, mag auch einen Blick in die Domschatzkammer<br />
(www.domschatzkammer-koeln.de, geöffnet<br />
täglich von 10 bis 18 Uhr) werfen!<br />
Colonia coloniensis<br />
Unter diesem Rubrum steht die Stadtführung,<br />
die einfach dazu gehört.Wir haben<br />
sie – ohne die unvermeidlichen Highlights,<br />
die jeder gesehen haben muss, links liegen<br />
zu lassen – mit etwas speziellem „gewürzt“.<br />
Und immer ist etwas Zeit eingeplant, ein<br />
Kölsch oder einen Kaffee zu trinken und<br />
deren Folgen loszuwerden. Unser Bbr. Edmund<br />
Tandetzki v/o Ede, im Nebenberuf<br />
Stadtführer, führt Regie!<br />
„Interkulturell, typisch Kölsch“ wird eine<br />
Stadtführung, die schwerpunktmäßig zeigt,<br />
wie sich verschiedene Kulturen von Ubiern,<br />
Römern, Juden, Normannen, und schließlich<br />
auch Türken in Köln niedergeschlagen<br />
haben und teilweise noch lebendig sind.<br />
„Köln und seine Frauen“ ist zweifellos der<br />
Höhepunkt kultureller Präsenz in der Stadt,<br />
aber diese Stadtführung zeigt natürlich<br />
nicht nur die Spuren berühmter Frauen in<br />
der Stadt. Die Herren werden staunen! Die<br />
Damen auch!<br />
„… der handelt wie ein Kölner!“ soll in<br />
früheren Zeiten den Kaufleuten ein Warnzeichen<br />
vor Kölner Geschäftssinn gewesen<br />
sein. Seit Römerzeiten ist Köln Handelsmetropole.<br />
Die Farben der Hanse zieren noch<br />
heute das Stadtwappen! Im Stadtbild sollen<br />
Zeugen dieser Kölschen Eigenart aufgezeigt<br />
werden (www.geldgeschichte.de).<br />
Stadtführung per Bus/Busfahrt soll es<br />
denen, die nicht so gut zu Fuß sind, ermöglichen,<br />
die Highlights der Stadt in Ruhe anzusehen<br />
und dabei die nicht ganz geringen<br />
Distanzen einfach und angenehm zu überwinden.<br />
Die Vormittagsführungen werden im<br />
Dom mit der Andacht (mit Orgelspiel) um<br />
zwölf Uhr ihr Ende finden.<br />
Colonia specialis<br />
Wer Köln kennt und eine allgemeine<br />
Stadtführung nicht mehr „nötig“ hat, sollte<br />
sich für eine der nachfolgenden Veranstaltungen<br />
interessieren.<br />
„Köln grüßt Jerusalem“ beginnt schon an<br />
den Flügeln des Südportals der Kathedrale,<br />
die das himmlische Jerusalem zeigen. Die<br />
verbliebenen Zeugnisse jüdischen Lebens in<br />
Köln sehen wir ebenso wie die<br />
beeindruckende Gestaltung der Umgebung<br />
von „Museum Ludwig“ und der „Philharmonie“.<br />
„Frauengräber auf dem Melatenfriedhof“,<br />
ein Geheimtipp für Kenner, zeigt ein<br />
stadtbekannter Spezialist, Bbr. Josef Abt.<br />
Grabdenkmäler als Zeugen kölnischer Kultur,<br />
auch ein paar „unitarische“ Gräber.<br />
„Nazis in Köln – nein danke!?“ Die Nazis<br />
mochten Köln nicht! Juden und andere<br />
waren aber auch in Köln ihre Opfer. Die Stolpersteine,<br />
Messehallen, und das LD-Haus erinnern<br />
und berühren uns (www.nsdok.de).<br />
Die Vormittagsführungen werden im<br />
Dom mit der Andacht (mit Orgelspiel) um 12<br />
Uhr ihr Ende finden.<br />
Veranstaltungen mit<br />
begrenzter Teilnehmerzahl:<br />
„Museum Ludwig“: Frau Schmidt führt uns<br />
in eine Sammlung moderner Kunst, die<br />
ihresgleichen sucht, ausgebreitet in einer<br />
atemberaubenden Architektur des Museumsbaus,<br />
der auch die weltbekannte Philharmonie,<br />
einen Konzertsaal der Extraklasse<br />
integriert hat. Das Gesehene lassen wir<br />
wirken, wenn wir anschließend im Muse-<br />
umscafé noch zu Kaffee oder Tee zusammenbleiben.<br />
(www.ludwigmuseum.de;<br />
www.koelner-philharmonie.de)<br />
„St. Maria im Kapitol“: Die Kirche, erbaut im<br />
Römischen Kapitols-Tempel, dessen Reste<br />
schon Plektrudis als Palast dienten, erinnert<br />
viele an Bethlehem. Frau Dr. Hagendorff-<br />
Nussbaum wird uns führen, die profunde<br />
Kennerin dieser Kirche schlechthin. Es<br />
könnte sogar noch eine Überraschung<br />
geben! (www.romanische-kirchen-koeln.de)<br />
Wichtige organisatorische<br />
Details<br />
Jeder Teilnehmer erhält bei Anmeldung<br />
im Tagungsbüro im Maternushaus<br />
(www.maternushaus.de) die Teilnahmeausweise<br />
für die von ihm gebuchten Veranstaltungen<br />
und dazu einen Stadtplan,<br />
aus dem der Zeitplan und die Treffpunkte/Anfangs-<br />
und Endpunkte der Führungen<br />
ersichtlich sind, ebenso wie die<br />
öffentlichen Verkehrsmittel, die diese mit<br />
den Hotels und den anderen Tagungsorten<br />
verbinden. Wer möchte, kann sich das<br />
alles zu gegebener Zeit auch von<br />
www.GV2008.de herunterladen.<br />
Die Führungen sollen und können dabei<br />
in Gruppen von ca. 20 Personen stattfinden.<br />
Wir werden das je nach Stand der<br />
Anmeldungen steuern und Teilnehmer, für<br />
die es ausnahmsweise nicht nach Wunsch<br />
geht, telefonisch benachrichtigen und<br />
ihnen Alternativen anbieten. Bei den<br />
teilnahmebegrenzten Veranstaltungen ist<br />
überdies auf der Website www.gv2008.de<br />
ersichtlich, wenn die Grenze erreicht ist.<br />
Die Veranstaltungen dauern ca. zwei<br />
Stunden, einer von uns Kölner BsrBbr. wird<br />
als Unitarier gut erkenntlich jede Führung<br />
begleiten und für alle Fragen zur Verfügung<br />
stehen, die Antwort auf die eine oder andere<br />
aber vielleicht schuldig bleiben!!<br />
WICHTIG: Alle Termine des Anmeldebogens<br />
verstehen sich am Treffpunkt sine tempore.<br />
Treffpunkt ist allgemein das Domforum,<br />
Domkloster 3; gegenüber dem Hauptportal<br />
des Doms; die Entfernung zum Tagungsbüro<br />
ist zu Fuß ca. 15 Minuten. Abweichende<br />
Treffpunkte (z. B. Melatenfriedhof) werden<br />
im Tagungsbüro angegeben.<br />
Eine Hommage schließlich an Trier:<br />
Das Römische Erbe kann Köln zwar nicht<br />
verstecken – das wollen wir eigentlich auch<br />
gar nicht so gerne –, aber wir stellen es nicht<br />
in den Vordergrund, Rom und dessen<br />
Präsenz in Germanien konnte Trier, das Rom<br />
des Nordens, präsentieren. Ihr alle habt es ja<br />
schon genossen!<br />
Helmut Schmidt /<br />
Franz-Josef Schelnberger<br />
unitas 3-4/2007 201
Mit Moses ins gelobte Land<br />
AGV-STUDENTENWALLFAHRT AUF DEN SPUREN DES ALTEN<br />
TESTAMENTS NACH ÄGYPTEN, JORDANIEN UND ISRAEL<br />
<strong>VON</strong> HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS<br />
„When Israel was in Egypt Land“ schallt ein bekannter Gospelsong beim Abschlussabend<br />
der diesjährigen Wallfahrt der Arbeitsgemeinschaft katholischer<br />
Studentenverbände (AGV) durch das altehrwürdige Gemäuer des Paulus-Hauses<br />
in Jerusalem. Das Lied erzählt davon, wie Gott seinen Propheten Moses entsendet,<br />
um dem Pharao kurz und knapp mitzuteilen: „Let my people go!“ Was<br />
hier so lautstark gepriesen wird, gehört zu den Urbildern des Christentums – der<br />
Exodus, die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, niedergeschrieben<br />
in den fünf Büchern Mose. Auf den Spuren dieser unvergesslichen alttestamentlichen<br />
Erzählungen liegen elf erlebnisreiche Tage hinter den 22 Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern der Pilgerreise, die vom 4. bis 15. September den Nahen<br />
Osten bereist haben.<br />
Was die biblischen Texte aus der<br />
Frühgeschichte Israels berichten, hat sich<br />
zu einem nicht geringen Teil in der<br />
Sinaiwüste und in deren<br />
westlichen und östlichen<br />
Nachbargebieten zugetragen.<br />
Nach schmachvoller<br />
Unterdrückung ziehen<br />
frühisraelitische Stämme<br />
aus dem „Sklavenhaus“<br />
Ägypten in Richtung Sinaigebiet<br />
fort und werden<br />
„am Meer“ wunderhaft vor<br />
einer nachjagenden Streitwagenabteilung<br />
des Pharao<br />
gerettet. Die Schar<br />
wandert in der Wüste umher,<br />
hungrig und durstig<br />
murrt sie, weil sie nur<br />
Wasser und fades Manna<br />
erhält, und sehnt sich<br />
nach Ägyptens Fleischtöpfen<br />
zurück. Dann begegnet<br />
ihnen am „Berg<br />
Horeb“ in einer gewaltigen<br />
Erscheinung der<br />
Gott Jahwe, in dessen<br />
Namen Moses schon zum<br />
Auszug aus Ägypten aufgerufen<br />
hatte. Jahwe<br />
offenbart sich ihnen als<br />
Befreier und nimmt sie<br />
durch seine Gebote in<br />
Pflicht, er wird ihr Gott<br />
und sie sein Volk. Darauf<br />
zieht die Schar weiter ins<br />
verheißene Land westlich<br />
und östlich des Jordan. –<br />
Unsere Pilgerroute folgt<br />
diesem Weg durch den<br />
Sinai und Jordanien bis<br />
hinauf nach Jerusalem.<br />
202<br />
unitas 3-4/2007<br />
Vom Flughafen Düsseldorf sind wir am<br />
frühen Morgen nach Sharm el Sheikh<br />
aufgebrochen. Von dem Touristenzentrum<br />
Die Dreifaltigkeitskapelle auf dem 2285 Meter hohen Gipfel des „Moses-<br />
Berges“ • Ein besonderes Erlebnis: Die Feier der Eucharistie bei Sonnenuntergang<br />
auf dem vor der archaischen Bergkulisse des Sinai.<br />
Kaplan Swen Beckedahl predigt von den Zehn Geboten und Gottes<br />
Bundesschluss mit den Israeliten.<br />
Die AGV-Pilgergruppe vor dem „Schlangenkreuz“<br />
auf dem Berg Nebo. Es erinnert an die<br />
von Moses erhöhte bronzene Schlange (Num<br />
33,47) und das Kreuz Christi und stellt eine<br />
Verbindung zwischen dem Alten und dem<br />
Neuen Bund her.<br />
an der südlichen Sinaiküste sehen wir<br />
allerdings nicht viel mehr als den Flughafen;<br />
denn unser Bus bringt uns gleich<br />
über gut ausgebaute Straßen<br />
durch die bizarre Bergwelt in<br />
die Nähe des Katharinenklosters<br />
im Zentralsinai. Unterwegs<br />
machen wir Rast bei<br />
einer Beduinenfamilie, bekommen<br />
frisch gebackenes<br />
Fladenbrot und Tee. Selbstverständlich<br />
gibt es die<br />
„Gastfreundschaft“ nicht umsonst.<br />
„Bakschisch“ heißt das<br />
magische Wort, das in Ägypten<br />
– mehr als in anderen<br />
Ländern des Orients – zu<br />
jeder kleinen Dienstleistung<br />
gehört, wie wir in den folgenden<br />
Tagen noch häufig erfahren<br />
werden.<br />
Im Hotel beim St. Catherine-Village<br />
angekommen,<br />
führt der erste Weg in den<br />
Swimming-Pool, denn selbst<br />
auf 1500 Metern Höhe zeigt<br />
das Thermometer am späten<br />
Nachmittag noch Temperaturen<br />
von über 25 Grad<br />
Celsius. Nach dem Eröffnungsgottesdienst<br />
unserer<br />
Wallfahrt und einem reichhaltigen<br />
orientalischen Büfett<br />
gibt am Abend eine<br />
Vorstellungsrunde Gelegenheit,<br />
die Mitpilger etwas<br />
näher kennen zu lernen.<br />
Erstmals wird auch die<br />
Gitarre ausgepackt, doch die<br />
Sangesfreude hält sich noch<br />
in Grenzen.
Am nächsten Morgen wartet schon<br />
eine kleine Kamelherde vor unserem Hotel.<br />
Auf ihrem Rücken brechen wir von der so<br />
genannten „Ebene der Vorbereitung“, wo<br />
schon die frühen christlichen Pilger das 40tägige<br />
Lager der Israeliten lokalisierten, auf<br />
zu einer halbtägigen Trekking-Tour in die<br />
Bergeinsamkeit des Zentralsinai, bekommen<br />
einen ersten Eindruck vom „Erlebnis<br />
Wüste“. Einmal birgt sie mit ihrer Weite<br />
und Verlassenheit, mit ihrer Öde und<br />
Lebensfeindlichkeit etwas Bedrohliches<br />
und Erschreckendes. Zum anderen hat sie<br />
mit ihrer Grenzenlosigkeit und ihren bizarren<br />
Formen etwas Erhabenes, Faszinierendes<br />
und Schönes.<br />
Gottes Grundgesetz:<br />
Die Zehn Gebote<br />
Am späten Nachmittag machen wir uns<br />
an den schweißtreibenden Aufstieg auf<br />
den Gottesberg Horeb, rund 800 Meter<br />
Höhenunterschied sind zu überwinden, das<br />
letzte Stück auf mehr als 600 unregelmäßigen,<br />
in den Fels gehauenen Treppenstufen.<br />
Für die anstrengende Wanderung<br />
werden wir auf dem Gipfel mit einer<br />
großartigen Aussicht über die gesamte<br />
Per Schiff: Im Zentralsinai gehört eine Trekking-Tour mit „Wüstenschiffen“<br />
zu den besonderen Erlebnissen. • Mit einer Zweimast-Segelyacht<br />
geht es über das Rote Meer zur einzigen jordanischen Hafenstadt<br />
Aqaba.<br />
Wo Gott, der Tradition zufolge, dem Moses in einem brennenden Dornbusch erschien,<br />
gründete Kaiser Justinian 548 n. Chr. das Katharinenkloster.<br />
Sinai-Halbinsel belohnt. Hier sind wir fast<br />
alleine und können die Stille und Weite genießen.<br />
Dann beginnt<br />
auch schon der Sonnenuntergang.<br />
Die<br />
Felsen sind in ein<br />
goldenes Licht getaucht,<br />
die Sonne verfärbt<br />
sich langsam rot<br />
und versinkt schließlich<br />
als Feuerball am<br />
Horizont hinter der<br />
majestätischen Bergwelt.<br />
Höchst einprägsam<br />
spiegeln die aus<br />
rötlichem Granit bestehendengewaltigen<br />
Gesteinsmassen<br />
des Sinai die Macht<br />
der biblischen Geschichte<br />
wider. Hier<br />
kann man sich die<br />
Theophanie Jahwes<br />
gut vorstellen. Unvergesslich<br />
bleibt die<br />
Messe, die unser<br />
geistlicher Begleiter,<br />
Kaplan Swen Beckedahl<br />
aus Gelsenkirchen,<br />
vor dieser atemberaubenden<br />
Kulisse<br />
mit uns auf dem Gipfel<br />
gefeiert hat. Dann<br />
machen wir uns durch<br />
die Dunkelheit auf<br />
den Rückweg, über<br />
uns ein fantastischer<br />
Sternenhimmel, wie<br />
wir ihn in unseren<br />
Breiten nicht bestaunen<br />
können. Nach<br />
einem späten Abend-<br />
essen sinken die meisten von uns müde ins<br />
Bett.<br />
Am darauf folgenden Morgen dann der<br />
nächste Höhepunkt: Wir besuchen das fast<br />
1500 Jahre alte Katharinenkloster am Fuß<br />
des Horeb. Ist der „Mosesberg“ Mittelpunkt<br />
und Herz des Sinai, so ist das Kloster sein<br />
Gedächtnis. Im Jahr 527 n. Chr. von Kaiser<br />
Justinian erbaut, ruht es seit bald eineinhalb<br />
Jahrtausenden zwischen den Granitfelsen.<br />
Das ganze Gebilde muss man als<br />
Verschmelzung all’ dessen begreifen, was<br />
im Bewusstsein noch gegenwärtig ist und<br />
nie vergessen werden soll: Da befindet sich<br />
der Brunnen, an dem Moses den sieben<br />
Töchtern des Jetro begegnete; hier lebt<br />
auch die Erinnerung an den „Brennenden<br />
Dornbusch“ und natürlich an die Übergabe<br />
der Gesetzestafeln. Der Architekt hat die<br />
Basilika des Klosters als ein Atrium, einen<br />
Vorhof konzipiert, der zur kleinen „Kapelle<br />
des Brennenden Dornbuschs“ führt. Themen<br />
wie „Auszug“, „Wüstenwanderung“,<br />
„Sinaioffenbarung“ und „Bundesschluss“<br />
machen uns bewusst, dass wir uns hier an<br />
einem der wichtigsten Ursprünge der<br />
biblischen Religionsgeschichte befinden.<br />
Dann verlassen wir den Zentralsinai,<br />
fahren auf einer der landschaftlich schönsten<br />
Strecken der Halbinsel hinab an das<br />
Rote Meer, wo wir uns einen Tag lang beim<br />
Baden im Meer (Wassertemperatur 29 Grad<br />
Celsius) oder im gekühlten Swimming-Pool<br />
des Hotels von den Strapazen des Vortages<br />
erholen können. Zehn Unentwegte machen<br />
sich auch hier noch zu einer Wanderung in<br />
das Küstengebirge auf.<br />
Auf einem alten Segelschiff, einem<br />
Zweimaster, überqueren wir am folgenden >><br />
unitas 3-4/2007 203
Orient pur: Eine Nacht in einem Beduinencamp im Wadi Rum gehört mit<br />
zur „Erfahrung Wüste“. Dazu gehört auch eine Lektion in beduinischem<br />
Tanz mit unserem jordanischen Reiseführer Chaleb (unteres Bild rechts).<br />
Tag das Rote Meer nach Aqaba, dem einzigen<br />
Hafen Jordaniens. Von dort geht es ins<br />
Wadi Rum, das zu den großartigsten und<br />
faszinierendsten Landschaften gehört. Hier<br />
setzen wir unsere „Erfahrung Wüste“ mit<br />
einer Übernachtung in einem Beduinenlager<br />
fort: Ein schmackhaftes arabisches<br />
Zwei Wallfahrtsteilnehmer mit einem Offizier<br />
in der malerischen Uniform der jordanischen<br />
Beduinenpolizei im Wadi Rum.<br />
204<br />
unitas 3-4/2007<br />
Abendessen, der Versuch, beduinische<br />
Tänze zu erlernen, Gespräche am Lagerfeuer<br />
bei einer gemütlich blubbernden<br />
Schischa – einer Wasserpfeife – und<br />
wieder dieser sternenübersäte Himmel,<br />
wie man ihn nur in der Wüste erleben<br />
kann, lassen unseren ersten Tag in Jordanien<br />
mit einem Stück Wüstenromantik zu<br />
Ende gehen.<br />
Bei einer Jeep-Tour erkunden wir am<br />
nächsten Tag die einzigartige Landschaft<br />
des Wadi Rum mit seinen bizarr verwitterten<br />
bunten Sandsteinformationen,<br />
die auch dem Film „Lawrence von Arabien“<br />
als Kulisse dienten. Während der Fahrt<br />
machen wir Stopps bei einigen der besonderen<br />
Sehenswürdigkeiten, etwa Al-<br />
Khazali, wo in einer engen Schlucht alte,<br />
thamudische Felszeichnungen zu sehen<br />
sind, oder die Felsbrücke beim Djebel<br />
Burdah, die wir mühsam erklimmen.<br />
Auf der Königsstraße<br />
nach Amman<br />
Weiter geht es auf den Spuren der Bibel<br />
in nördlicher Richtung auf der berühmten<br />
Königsstraße durch Jordanien. Der Königsweg<br />
ist eine der ältesten, wichtigsten und<br />
schönsten Straßen des Nahen Ostens. Er<br />
war ursprünglich eine Handelsroute, aber<br />
Während der Jeep-Tour im Wadi Rum: Pausen für ein Bibelgespräch und<br />
den Aufstieg auf die Felsenbrücke beim Djebel Burdah.<br />
auch Könige mit ihren Heeren benutzten<br />
diesen Weg für ihre Eroberungen. Die erste<br />
Erwähnung als Königsstraße finden wir im<br />
4. Buch Mose (Num 20,17 und 21,22).<br />
Wer Jordanien bereist, bewegt sich auf<br />
biblischem Terrain. Das Volk des Exodus<br />
stieß nach der Wüstenwanderung durch<br />
transjordanisches Gebiet bis zum Nebo vor,<br />
wo Mose das „Gelobte Land“ schauen, aber<br />
nicht betreten durfte. Ein Teil der zwölf<br />
Stämme Israels fand im Land jenseits des<br />
Jordan seine Siedlungsgebiete. Mehr oder<br />
weniger parallel zu Israel und Juda<br />
entstanden in Jordanien die Staatsgebilde<br />
von Ammon, Moab und Edom.<br />
Petra – geheimnisvolle Stadt<br />
der Nabatäer<br />
Archäologisch ist das Land äußerst<br />
reich. Am spektakulärsten ist wohl unser<br />
nächstes Ziel: Petra, die in Stein gehauene<br />
Hauptstadt der Nabatäer, die ihre Faszination<br />
bis heute behalten hat und erst jüngst<br />
zu einem der sieben „neuen“ Weltwunder<br />
gewählt wurde. Die Stadt präsentiert sich<br />
noch nach über 2000 Jahren als eine<br />
mitreißende Komposition aus Landschaft<br />
und Architektur. Sie ist die wohl außergewöhnlichste<br />
und beeindruckendste Ruinenstadt<br />
im Großraum um das Mittelmeer.
El-Chazne, im Volksmund das „Schatzhaus des Pharao“: Diese ganz<br />
aus dem Fels gehauene, reiche Fassade ist das berühmteste Beispiel<br />
für den hellenistischen Einfluss in Petra.<br />
Petra – das bedeutet Orient und Hellenismus,<br />
Kunst und Natur, Romantik und Abenteuer,<br />
Beduinen und Touristen gleichzeitig<br />
erleben zu können. Bei einer ganztägigen<br />
Wandertour erkunden wir die inmitten<br />
Das monumentale Urnengrab wurde in<br />
byzantinischer Zeit in eine Kirche umgerüstet.<br />
einer grandiosen landschaftlichen<br />
Kulisse gelegene<br />
Felsenstadt –<br />
trotz Staub, Hitze und<br />
langer Wege ein faszinierendes<br />
und unvergessliches<br />
Erlebnis.<br />
In die Stadt gelangt<br />
man durch den Siq, einen<br />
verschlungenen engen,<br />
manchmal nicht einmal<br />
zwei Meter breiten Bergeinschnitt,<br />
gesäumt von etwa 100 Meter<br />
hohen, senkrecht aufragenden Felswänden.<br />
Nach rund zwei Kilometern weitet sich die<br />
Schlucht plötzlich in einen Talkessel. Vor<br />
uns glänzt in der Morgensonne die 40<br />
Meter hohe prachtvolle, in den rötlichen<br />
Fels gehauene Fassade von „el-Chazneh“,<br />
dem so genannten Schatzhaus des Pharao,<br />
vermutlich das Grabmal eines nabatäischen<br />
Königs oder einer Königin. Von dem<br />
Buntsandstein der Gebirgsformation leitet<br />
sich der semitische Name der Stadt ab:<br />
Reqem, „die Farbenprächtige“.<br />
Vor uns liegt die<br />
Unterstadt mit hunderten<br />
in den Stein gemeißelten<br />
Höhlen und<br />
Gebäuden, hoch aufragenden<br />
Tempeln, kunstvollen<br />
Königsgräbern<br />
und Grabanlagen, einem<br />
römischen Theater,<br />
in dem bis zu 8000<br />
Zuschauer Platz fanden,<br />
monumentalen Treppenaufgängen,Kultstätten,<br />
Torbögen und<br />
gepflasterten Straßen.<br />
Von den rund 3000<br />
Sehenswürdigkeiten der<br />
Felsenstadt können wir<br />
natürlich nur einen<br />
kleinen Teil besuchen.<br />
Ein etwas abseits gelegener Grabtempel diente in byzantinischer Zeit<br />
christlichen Eremiten offensichtlich als Kapelle: Im Innern fand man eine<br />
geostete Altarnische mit eingemeißelten Kreuzen. Daher der Name ed-Deir –<br />
„Das Kloster“.<br />
Petra ist ebenfalls ein Stück „Heiliges<br />
Land“, denn auch hier dürften die Israeliten<br />
durchgezogen sein. Bezeichnungen wie<br />
Mosesquelle, Moses-Bach (Wadi Musa) und<br />
der Aaronsberg (Djebel Haroun), der biblische<br />
Berg Hor, auf dem Moses’ Bruder<br />
Aaron begraben sein soll, sind nicht erst<br />
neuzeitlichen Ursprungs.<br />
In den Anfängen war Petra ein Lagerplatz<br />
von Beduinen, die einen regen Handel<br />
betrieben. Hierher kamen die Karawanen,<br />
schwer beladen mit Waren. Innerhalb von<br />
zwei Jahrhunderten wurde aus dem semitischen<br />
Gemeinwesen eine blühende Metropole<br />
– vor allem eine Manifestation des<br />
Reichtums aus dem Weihrauchhandel mit<br />
Südarabien. Die Stadt hatte mehrere tausend<br />
Einwohner, ein Gewirr von Straßen<br />
und Wegen durchzog die Wohnviertel, die<br />
ebenso zahlreich waren wie die Nekropolen.<br />
Mehr als 200 Zisternen und Felskanäle<br />
versorgten die Menschen mit<br />
Wasser.<br />
Vor dem Theater beginnt ein in den<br />
Berg gehauener Prozessionsweg, der uns in >><br />
In einer Seitenschlucht unterhalb des Deir-Plateaus haben Eremiten<br />
alte Grabhöhlen als Zellen benutzt. In einer dieser Höhlen feiern wir<br />
eine beeindruckende Messe.<br />
unitas 3-4/2007 205
einem Schweiß treibenden<br />
Aufstieg in einer guten halben<br />
Stunde auf die Gipfelplatte<br />
eines Felsens zum „hohen<br />
Opferplatz“ führt, der die Stadt<br />
überragt. Der Lohn: ein<br />
fantastischer Rundblick über die<br />
Felsenlandschaft um Petra.<br />
Wir stoßen auch auf christliche<br />
Spuren: Berichten antiker<br />
Autoren zufolge gab es schon<br />
im 4. Jh. in Petra Kirchen. So<br />
wurde das monumentale Urnengrab<br />
aus nabatäischer Zeit<br />
446 unter dem Bischof Jason in<br />
eine Kirche umfunktioniert.<br />
Zweifellos wurde auch der<br />
Grabtempel ed-Deir, eines der<br />
schönsten Bauwerke Petras, zu<br />
dem eine Felsentreppe mit<br />
mehr als 800 Stufen hinauf<br />
führt, für die christliche Praxis<br />
verändert, wie immer noch<br />
sichtbare gemalte Kreuze an der<br />
Vorderwand belegen. In der<br />
näheren Umgebung findet man<br />
eine Einsiedelei und Mönchszellen,<br />
die ebenso mit Kreuzen<br />
dekoriert sind. In einer dieser<br />
Höhlen feiern auch wir die<br />
heilige Messe. Der Aarons-Berg<br />
nahe Petra besaß einen großen<br />
Kloster- und Pilgerkomplex, der<br />
Aaron geweiht war und zu dem<br />
eine Basilika und eine Kapelle gehörten. Die<br />
Anlage war mindestens bis zum 7./8. Jh. im<br />
Gebrauch. Schließlich gibt es auch am<br />
Rande des Stadtzentrums Ausgrabungen<br />
Bibelgespräch im alten Gemäuer der Kreuzfahrerburg<br />
von Kerak • Die kärglichen Reste der<br />
ehemaligen Herodes-Festung Machärus, in der<br />
Johannes der Täufer eingekerkert und enthauptet<br />
wurde.<br />
206<br />
unitas 3-4/2007<br />
Die Ruinenstätte des antiken Gerasa vermittelt ein anschauliches Bild einer römischen Stadt des 2. Jh. n. Chr.: Der<br />
Cardo, die Hauptstraße, durchzieht den Ort in Nord-Süd-Richtung (oben links). • Das Südtheater war Schauplatz<br />
für das kulturelle Leben – Theater, musikalische Darbietungen und sportliche Wettkämpfe fanden hier statt<br />
(oben rechts). • Vom Cardo aus führen Stufen zur byzantinischen Kathedrale empor (unten links). • Das Südtor<br />
wurde anlässlich eines Besuchs von Kaiser Hadrian im Winter 129/130 errichtet (unten rechts).<br />
christlicher Kirchen mit zum Teil noch<br />
erhaltenen Mosaiken.<br />
Am Abend können wir uns dann in<br />
einem türkischen Bad, einem Hamam, von<br />
den Strapazen der ganztägigen Bergwanderung<br />
regenerieren. Das Dampfbad und<br />
die anschließende Massage tun unseren<br />
müden Gliedern gut.<br />
Am folgenden Tag geht es mit einigen<br />
Stopps weiter in Richtung Amman. Wir<br />
besuchen als Erstes die sich in eindrucksvoller<br />
Lage erhebende Kreuzritterburg von<br />
Kerak. Wir bewundern das tief in den<br />
bunten Sandstein des jordanischen<br />
Gebirgslandes eingeschnittene und ins<br />
Tote Meer einmündende Wadi Mujib, das<br />
auch als der jordanische „Grand Canyon“<br />
bezeichnet wird. Der in seinem Talgrund<br />
fließende Bach erscheint in der Bibel und in<br />
antiken Berichten als Arnon und bildete<br />
einst die natürliche Grenze zwischen den<br />
Ammonitern und den Moabitern. Am<br />
Nachmittag erreichen wir das Bergland von<br />
Moab, wo sich auf der Höhe eines 700<br />
Meter hohen, steil abfallenden Bergkegels<br />
die kargen Überreste von Machärus, einer<br />
der Zitadellen von Herodes dem Großen, erheben.<br />
Herodes Antipas erbte sie von<br />
seinem Vater. Hier wird die Erzählung von<br />
der Gefangenhaltung und Hinrichtung Johannes<br />
des Täufers, dessen Haupt man der<br />
Salomé und ihrer Mutter Herodias auf einer<br />
Schale bringt, lokalisiert. Hoch oben auf<br />
dem Felsplateau hören wir die Geschichte<br />
aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 14,1 ff.),<br />
während der Blick nach Westen über das<br />
Tote Meer bis zu dem sich im Dunst<br />
verlierenden judäischen Bergland schweift.<br />
Dass heute nur noch wenige Überreste<br />
zu sehen sind, liegt an der gründlichen<br />
Zerstörung der Anlage durch die<br />
Römer, die hier unter Lucilius Bassus im<br />
Jahre 72 n. Chr. den jüdischen Aufstand<br />
der Zeloten niederschlugen und die<br />
Festung schleiften.<br />
Die Landkarte mit der ältesten<br />
Darstellung vom Heiligen Land<br />
Letzte Station für heute ist das Städtchen<br />
Madaba, das vor allem durch seine<br />
Mosaiken berühmt wurde. In der Georgskirche<br />
betrachten wir die wohl älteste<br />
Landkarte des gesamten „Heiligen Landes“<br />
(Palästina, Jordanien, Libanon, Sinai und<br />
Ägypten mit dem Nildelta) – im Zentrum<br />
Jerusalem. Die Karte wurde um die Mitte<br />
des 6. Jh. aus etwa zwei Millionen Mosaiksteinen<br />
zusammengesetzt. Schon im vierten<br />
Jahrhundert war Madaba als Bischofssitz<br />
ein wichtiges Zentrum des Christentums.<br />
Auch heute leben hier noch viele<br />
Christen und bis 2010 soll am Ort eine<br />
Katholische Universität entstehen, die<br />
einzige im Land. Wir schließen den Tag mit<br />
einem Gottesdienst in der griechischkatholischen<br />
Kirche des Ortes.
Die jordanische Hauptstadt Amman,<br />
die wir am Abend erreichen, ist heute eine<br />
hochmoderne Metropole. Bis in die zweite<br />
Hälfte des 19. Jh. war sie ein unbedeutender<br />
kleiner Ort, dessen Bevölkerung sich seither<br />
mehr als vertausendfacht hat. Auch der<br />
Staat Jordanien selbst ist noch sehr jung.<br />
Anfang der zwanziger Jahre des vorigen<br />
Jahrhunderts zum Emirat unter britischer<br />
Mandatsverwaltung erklärt, erlangte er<br />
erst 1946 seine Unabhängigkeit.<br />
So sind die historischen Sehenswürdigkeiten<br />
in der Hauptstadt auch eher spärlich<br />
– sie stammen überwiegend noch aus der<br />
Zeit, als Amman unter dem Namen Philadelphia<br />
zur Dekapolis gehörte. Wir fahren<br />
auf den Zitadellenhügel mit den Ruinen<br />
eines wahrscheinlich dem Herkules geweihten<br />
Tempels und den Resten einer<br />
byzantinischen Kirche aus dem 5. oder 6.<br />
Jh., in denen wir eine Morgenandacht<br />
halten. Am Fuß des Hügels sehen wir das<br />
Theater aus der Römerzeit und besuchen<br />
anschließend noch das archäologische<br />
Museum. Wichtigstes Exponat ist wohl die<br />
Mescha-Stele, die zu den wenigen<br />
außerbiblischen Quellen gehört, die über<br />
die Geschichte Moabs Aufschluss geben.<br />
Sie berichtet, wie der Moabiterkönig<br />
Mescha im 9. Jh. v. Chr. das israelitische Joch<br />
abschüttelte.<br />
Von Amman aus geht es zu einem<br />
weiteren Höhepunkt unserer Reise: Die<br />
antike Römerstadt Gerasa, das heutige<br />
Gemütlich eine Wasserpfeife zu rauchen, gehört zum<br />
orientalischen Lebensstil und kommt auch in Deutschland<br />
zunehmend in Mode, speziell unter jungen Leuten.<br />
• Bei einem Bad im Toten Meer kann man sogar Zeitung<br />
lesen. Das konzentrierte Salzwasser hält den Körper<br />
oben.<br />
Jerash, ist die wohl am besten<br />
und am vollständigsten erhaltene<br />
römische Provinzstadt der<br />
Welt. Gerasa wurde im 4. Jh. v.<br />
Chr. gegründet, von Pompejus 63.<br />
n. Chr. erobert, trat dem Städtebund<br />
der Dekapolis bei und erlebte<br />
in der römischen Epoche<br />
seine Blütezeit. Schon im 4. Jh.<br />
nach Christus wurde die Stadt<br />
Bischofssitz. Zahlreiche Kirchenruinen<br />
bezeugen das christliche<br />
Leben in damaliger Zeit.<br />
Auf dem Berg Nebo:<br />
Das verheißene Land<br />
sehen und sterben<br />
Am Nachmittag erreichen wir<br />
den Berg Nebo, der als der Ort<br />
gilt, von dem aus Moses einen<br />
Blick ins „Gelobte Land“ werfen<br />
durfte, bevor er starb, ohne es<br />
betreten zu haben (Deu 34,1-5).<br />
Am Fuße des Hügels soll er begraben<br />
sein; sein Grab wurde<br />
allerdings bis heute nicht gefunden.<br />
Schon im 4. Jh. gab es hier einen<br />
Kirchenbau, der in byzantinischer<br />
Zeit um ein Kloster und ein<br />
Pilgerzentrum erweitert wurde.<br />
Nach einer Messe in der teilrekonstruierten<br />
und mit einem<br />
Schutzdach versehenen<br />
Basilika, die ebenfalls<br />
einige der schönsten, zur<br />
frühchristlichen Epoche<br />
zählenden Mosaiken<br />
enthält, kehren wir nach<br />
Amman zurück. Unser<br />
Abendessen nehmen wir<br />
heute im rustikalstilvollen<br />
Ambiente einer<br />
restaurierten Karawanserei,<br />
Kan Zaman, ein.<br />
Zum Kaffee oder einem<br />
kleinen Arak können wir<br />
wieder eine Wasserpfeife<br />
rauchen und bei orientalischer<br />
Live-Musik etwas<br />
relaxen.<br />
Heute verlassen wir das<br />
Haschemitische Königreich Jordanien<br />
und fahren hinauf nach<br />
Jerusalem – dem letzten Höhepunkt<br />
unserer Reise. Doch zunächst<br />
geht es noch in das einsame, staubtrockene<br />
Wadi al-Kharrar, der Ort<br />
mit den spektakulärsten archäologischen<br />
Funden der letzten Jahre in<br />
Jordanien. Es handelt sich um die<br />
östlich des Jordans neu lokalisierte<br />
Taufstelle Jesu. Dieser Ort trägt<br />
nach Auffassung von Experten den<br />
Angaben der Bibel Rechnung, nach<br />
denen Johannes „in Bethanien auf<br />
Betanien – die Taufstelle jenseits des Jordan: Bei den<br />
Ausgrabungen der Ruinen eines byzantinischen Klosters<br />
(5./6. Jh.) soll es sich um die Überreste von „Bethabara“<br />
handeln. Die Kirche soll an der Stelle gestanden haben,<br />
wo der Überlieferung zufolge die Taufe Jesu stattgefunden<br />
hat. • Messe am Ufer des Jordan: Das Taufbecken vor<br />
dem Altartisch weist symbolisch auf die Taufe Jesu hin. •<br />
Der Jordan ist heute wesentlich schmäler als zu Zeiten<br />
Jesu, da auf seinem Weg zum Toten Meer der größte Teil<br />
seines Wassers zu Bewässerungszwecken abgepumpt<br />
wird.<br />
der anderen Seite des Jordan“ (Joh 1,28) –<br />
von Jerusalem aus gesehen – taufte. In<br />
dieser Gegend wurden die Fundamente von<br />
Kirchen, Klöstern und Pilgerunterkünften<br />
freigelegt, außerdem drei gepflasterte<br />
Becken aus spätrömischer Zeit, so groß wie<br />
Swimming-Pools, die mit dem Wasser umliegender<br />
Quellen gefüllt wurden. Offenkundig<br />
wurden hier viele Menschen<br />
gleichzeitig, im Wasser stehend, getauft.<br />
Diese Ausgrabungen, die 1996 begonnen<br />
wurden, sind der Öffentlickeit erst seit dem<br />
Besuch von Papst Johannes Paul II. im<br />
Jubiläumsjahr 2000 zugänglich. Auf einer<br />
neu errichteten Plattform direkt am >><br />
unitas 3-4/2007 207
(Von oben) Das christliche Viertel der Jerusalemer<br />
Altstadt mit den beiden schwarzen Kuppeln der Grabeskirche,<br />
die die heiligsten Orte der Christenheit umschließt:<br />
Kalvaria mit seiner Karfreitagstrauer und das<br />
leere Grab des Auferstandenen mit dem Osterjubel. • Die<br />
großen Steinquader in der westlichen Stützmauer des<br />
Tempelbergs sind das einzige, was den Juden vom herodianischen<br />
Tempel geblieben ist: heute ihre heiligste<br />
Stätte, wo Jahwe allgegenwärtig ist. • Die goldene Kuppel<br />
des muslimischen Felsendoms ist das weithin sichtbare<br />
Wahrzeichen Jerusalems. Zusammen mit der ihm<br />
gegenüber stehenden Al-Aqsa-Moschee ist er nach<br />
Mekka und Medina die drittheiligste Stätte des Islam.<br />
Von hier soll Mohammed nach einer alten Legende in<br />
den Himmel entrückt worden sein.<br />
Jordanufer feiern wir eine Messe, meditieren<br />
an diesem authentischen Ort das<br />
Evangelium von der Taufe Jesu.<br />
Als wir gegen Mittag über die Allenby-<br />
Brücke (in Jordanien: King Hussein-Bridge)<br />
die Grenze nach Israel überqueren wollen,<br />
erleben wir beinahe eine böse Überraschung.<br />
Am Abend beginnt das jüdische<br />
Neujahrsfest, Rosh Ha-Shana, und die<br />
208<br />
unitas 3-4/2007<br />
Israelis haben deshalb ihre Grenzabfertigung<br />
schon geschlossen.<br />
Normalerweise geht dann hier<br />
nichts mehr, aber nach ein paar<br />
Telefonaten wird die Grenze doch<br />
noch einmal für uns geöffnet. Nun<br />
geht alles im Eilschritt. Unser<br />
Gepäck wird gar nicht mehr<br />
kontrolliert und die Passkontrolle<br />
ist nur eine kurze Formalität. So<br />
schnell und unkompliziert bin ich<br />
noch nie nach Israel eingereist.<br />
Dies gibt uns etwas mehr Zeit,<br />
bei der Oase En Gedi noch eine<br />
Badepause am Toten Meer einzulegen<br />
– immer ein besonderes<br />
Erlebnis, sich von dem erstaunlichen<br />
Wasser ohne Schwimmbewegungen<br />
tragen zu lassen. Das<br />
tiefstliegende Gewässer der Welt<br />
hat einen so hohen Salzgehalt<br />
(über 30 Prozent), dass man nicht<br />
untergehen kann.<br />
Vom Alten zum Neuen<br />
Bund: Am Ziel in<br />
Jerusalem<br />
Nun endlich fahren wir hinauf<br />
nach Jerusalem, von 400 Metern<br />
unter dem Meeresspiegel auf<br />
800 Meter darüber. Von der<br />
Höhe des Ölbergs blicken wir<br />
auf das beeindruckende<br />
Panorama der Altstadt und<br />
des Zionsbergs, also<br />
sozusagen auf das biblische<br />
Jerusalem. Wir begrüßen die<br />
„Heilige Stadt“ mit Psalm 122,<br />
wie es schon die Pilger seit<br />
frühesten Zeiten tun. Wir<br />
gehen den Hang des Ölbergs<br />
hinunter zum Garten<br />
Getsemane, verrichten in der<br />
„Kirche der Nationen“ unser<br />
Abendgebet.<br />
Von der Terrasse unseres<br />
Quartiers, des direkt gegenüber<br />
dem Damaskus-Tor gelegenen<br />
Paulus-Hauses des<br />
Deutschen Vereins vom Heiligen<br />
Land, der unsere Pilgerreise<br />
auch organisiert hat,<br />
haben wir wenig später dann<br />
nochmals einen fantastischen<br />
Blick auf die verwinkelte<br />
Altstadt und ihre Sehenswürdigkeiten.<br />
Das alte Stadttor ist mit<br />
Lichterketten geschmückt, denn nicht<br />
nur die Juden feiern ihr Neujahrsfest,<br />
sondern für die Muslime beginnt mit<br />
Sonnenuntergang auch der Fastenmonat<br />
Ramadan. So können wir die<br />
vielen Menschen beider Religionen<br />
beobachten, die entweder zur Klagemauer<br />
oder auf den Tempelberg eilen,<br />
erleben an den nächsten beiden<br />
Tagen das Geschehen hautnah vor Ort mit.<br />
An der Klagemauer können wir wegen des<br />
Festes viel mehr Gläubige treffen als zu<br />
sonstigen Zeiten, überwiegend orthodoxe<br />
Juden in ihren traditionellen Trachten. Sie<br />
begrüßen mit Gebet, Gesang und Tanz das<br />
neue Jahr. Wenig später strömen dann die<br />
Muslime auf den Haram esh-Sharif, das<br />
Plateau, auf dem vormals der salomonische<br />
und der herodianische Tempel standen und<br />
heute der Felsendom und die El-Aqsa-<br />
Moschee ihren Platz haben. Denn hier gibt<br />
es in der Zeit des Ramadan jede Nacht für<br />
Bedürftige ein Abendessen, das von wohlhabenden<br />
Muslimen gespendet wurde.<br />
Und natürlich folgen wir auch dem<br />
Kreuzweg Jesu über die einzelnen Stationen<br />
an der Via Dolorosa und besuchen auf<br />
dem Zion den Abendmahlssaal und die<br />
Dormitio-Abtei.<br />
„Jerusalem, die Stadt ist einfach unglaublich“,<br />
sagt ein Mitpilger. Der Felsendom,<br />
die Gläubigen an der Klagemauer, die<br />
unzähligen Kirchen und Kapellen oder der<br />
Bazar in der Altstadt mit seinen engen Gassen<br />
und dem bunten Treiben in den Läden,<br />
mit den vielen Straßenhändlern und dem<br />
Stimmengewirr aus aller Herren Länder –<br />
Eindrücke, die erst einmal verarbeitet<br />
werden müssen. Besonders bewegend ist<br />
Ein besonders bewegender Moment war für die<br />
Pilgergruppe die Eucharistiefeier und das Gebet im<br />
Heiligen Grab.
für uns vor allem der Gottesdienst im<br />
Heiligen Grab.<br />
Wer heute das Heilige Land<br />
besucht, der kommt nicht umhin,<br />
sich mit der politischen und sozialen<br />
Wirklichkeit der hier lebenden<br />
Menschen, insbesondere der Christen<br />
auseinanderzusetzen.<br />
Solidarität mit den Christen<br />
im Heiligen Land<br />
Eine Diskussionsrunde mit Vertretern<br />
der Konrad-Adenauer- und<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bbr. Thomas<br />
Birringer und Knut Dethlefsen,<br />
und der Journalistin Gabriele Fröhlich<br />
vom Jerusalem-Büro der Katholischen<br />
Nachrichten-Agentur, zeigt<br />
auf, dass ein Frieden für die Menschen<br />
im Heiligen Land noch in weiter<br />
Ferne liegt. Solange nicht bei<br />
allen Beteiligten der politische Wille<br />
zu einer tragfähigen und beiden<br />
Seiten gerecht werdenden Lösung<br />
gegeben ist, bleibt die Lage instabil. Wie<br />
eine Zeitbombe tickt die anhaltende Abwanderung<br />
von Christen aus dem Ursprungsland<br />
ihres Glaubens. Stoppen ließe<br />
sich der Exodus nur durch eine Verbesserung<br />
der Lebensbedingungen und der politischen<br />
Zukunftsaussichten. Erzbischof<br />
Bei einer Diskussion im Paulus-Haus wurde die aktuelle Situation<br />
in Israel und Palästina mit Vertretern politischer Stiftungen<br />
erörtert. • An der katholischen Bethlehem-Universität stellten<br />
Studenten ihre Lage und Sicht der Dinge dar.<br />
Zum Abschluss der Reise wurde die Pilgergruppe von Erzbischof Fouad Twal empfangen, der Anfang Mai nächsten<br />
Jahres als neuer Lateinischer Patriarch von Jerusalem feierlich in sein Amt eingeführt wird. Rechts daneben:<br />
Der AGV-Ehrenvorsitzende Hermann-Josef Großimlinghaus, der die Reise organisiert und geleitet hat.<br />
Fouad Twal, der uns zum Abschluss unserer<br />
Reise im Lateinischen Patriarchat empfängt,<br />
betont, dass der christliche Glaube<br />
von seinen Wurzeln abgeschnitten wäre,<br />
wenn es bald keine lebendigen Gemeinden<br />
mehr gäbe, sondern die Pilger nur noch<br />
museale Erinnerungsstücke an den heiligen<br />
Stätten vorfinden würden.<br />
Daher sei es sehr wichtig,<br />
dass wieder mehr Pilger<br />
ins Heilige Land reisen und<br />
dabei auch die christlichen<br />
Gemeinschaften vor Ort besuchten.<br />
Diesen werde auf<br />
diese Weise klar, dass sie<br />
nicht vergessen seien und<br />
dass die Weltkirche sich mit<br />
ihnen solidarisch zeige.<br />
Bei unserem Besuch in<br />
Bethlehem, der Geburtsstadt<br />
Jesu, beten wir in der<br />
Geburtsgrotte und auf den<br />
Hirtenfeldern für Frieden im<br />
Nahen Osten und für die<br />
Menschen, die dort leben.<br />
Bedrückend die „Sicherheitsmauer“,<br />
die mit acht<br />
Metern noch zwei Meter<br />
höher ist als die Berliner<br />
Mauer und die in besonderer<br />
Weise die Perspektivlosigkeit<br />
großer Bevölkerungsteile<br />
in den palästinensischenAutonomiegebieten<br />
sichtbar macht.<br />
Hohe Arbeitslosigkeit – in<br />
manchen Orten bis zu 80<br />
Prozent, eine zunehmende<br />
Verarmung der Bevölkerung,<br />
Demütigungen an<br />
den Checkpoints, erschrekkende<br />
Defizite bei der medi-<br />
zinischen Versorgung kennzeichnen die<br />
aktuelle soziale Lage.<br />
Bei einem Treffen mit Studierenden der<br />
Bethlehem-Universität geben diese sich in<br />
der offiziellen Diskussion zwar patriotisch,<br />
versichern, dass sie im Lande bleiben und<br />
einen palästinensischen Staat mit aufbauen<br />
wollen. Beim Mittagessen hören wir im<br />
persönlichen Gespräch aber, dass viele<br />
Absolventen zu weiteren Studien ins Ausland<br />
gehen, meist in die USA, aber nur sehr<br />
wenige unter den derzeit gegebenen<br />
Umständen in ihre Heimat zurückkehren.<br />
Wer will es ihnen verdenken?<br />
Nach zwölf Tagen geht eine spannende<br />
und erlebnisreiche Zeit zu Ende. Beim traditionellen<br />
geselligen Abschlussabend lassen<br />
einige der Teilnehmer in gereimter und vertonter<br />
Form unsere Reise und ihre Highlights<br />
noch einmal in heiterer Form Revue<br />
passieren. Wir haben fantastische Landschaften<br />
erlebt und erwandert, sind fremden<br />
Menschen und Kulturen begegnet. Vor<br />
allem aber haben wir Glauben und Kirche<br />
im gemeinschaftlichen Erlebnis der Pilgerschaft<br />
neu und intensiver erfahren als<br />
sonst im studentischen Alltag üblich. Wir<br />
haben die Bibel neu gelesen und verstehen<br />
sie – nachdem wir uns mit Altem und<br />
Neuem Testament konkret vor Ort beschäftigt<br />
haben – vielleicht jetzt ein wenig besser.<br />
Ein Teilnehmer bekennt zum Schluss:<br />
„Diese Pilgerreise hat mir spirituell noch<br />
mehr gegeben als der Weltjugendtag in<br />
Köln.“<br />
Hinweis: 2008 wird die Studenten-Wallfahrt<br />
der AGV 25 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr<br />
wird deshalb die Pilgerreise – wie im<br />
Jahr 1983 – nach Rom und Assisi führen.<br />
Infos ab Januar 2008: www.agvnet.de<br />
unitas 3-4/2007 209
ESSEN. „Ach, Sie wollen sicher zu unserem<br />
Franz Stock! Das ist ja auch ein toller Mann<br />
– woll?“ Schon bei der Parkplatzsuche vor<br />
dem Franz-Stock-Museum im Fresekenhof<br />
ist klar: Hier in Neheim sind sie stolz auf<br />
ihren Landsmann. 19 Mitglieder des Essener<br />
UNITAS-Zirkels konnten bei der Zirkelreise<br />
Mitte Juli erspüren, was der Gefangenenpriester<br />
bis heute in seiner Heimat bedeutet.<br />
Mit bislang vielfach Unbekanntem<br />
machte die vom AHZ-Vorsitzenden Bbr.<br />
Martin Gewiese geplante Fahrt in den<br />
heutigen Teil der Stadt Arnsberg vertraut.<br />
Auch der Besuch in dem ehemaligen Off-Lag<br />
für französische kriegsgefangene Offiziere<br />
in Soest war beeindruckend.<br />
Die Führung von Horst Leise vom Franz-<br />
Stock-Komitee für Deutschland durch die<br />
informative Dauerausstellung im Fresekenhof<br />
stellt nicht nur das Wirken von Abbé<br />
Stock vor. 1904 in Neheim als Erstes von<br />
neun Kindern einer Arbeiterfamilie geboren,<br />
war er früh von der Katholischen Jugendbewegung<br />
geprägt. Nach drei Semestern<br />
seines Theologiestudiums, die er in Paris<br />
verbracht hatte, war Stock prädestiniert für<br />
die Aufgaben des Rektors der deutschen Gemeinde<br />
in Paris, zunächst 1934-1939, dann<br />
von 1940-1948. Hier sorgte er zunächst auch<br />
für Flüchtlinge, später auch für die seelsorgliche<br />
Betreuung der Häftlinge in den Pariser<br />
Gefängnissen der deutschen Besatzungstruppen.<br />
Die Franzosen gaben Franz<br />
Stock die Bezeichnung „L'Aumônier de<br />
l'enfer“ („Der Seelsorger der Hölle“) und<br />
„L'Archange en enfer“ („Der Erzengel in der<br />
Hölle“) – denn bis 1945 musste er auf dem<br />
Mont Valérien in Suresne über 1.200 Erschießungen<br />
beiwohnen. Das erlebte<br />
Grauen setzte er vielfach in Malerei um, die<br />
210<br />
unitas 3-4/2007<br />
AUS DEM VERBAND<br />
UV-Zirkel Essen auf den<br />
Spuren von Abbé Franz Stock<br />
hier dokumentiert ist. 1945 gründete er ein<br />
Priesterseminar im Gefangenenlager Dépôt<br />
501 bei Chartres, das er bis 1947 als Regens<br />
leitete. Im „Stacheldrahtseminar“ lernten<br />
949 Dozenten, Priester, Brüder und Seminaristen<br />
aus Deutschland und Österreich.<br />
Franz Stock starb 1948, erst 44 Jahre jung, in<br />
Paris. Nuntius Giuseppe Roncalli, der spätere<br />
Papst Johannes XXIII., nahm selbst die Einsegnung<br />
vor. Vieles aus diesen Jahren zeigt<br />
die Ausstellung mit vielen originalen Gegenständen<br />
aus Franz Stocks Besitz, aber<br />
ebenfalls die Auswirkungen seines Lebens<br />
und Wirkens auf die deutsch-französische<br />
Verständigung. Auch das Bild von unserem<br />
Bbr. Robert Schuman fehlte hier nicht.<br />
Im Elternhaus von Franz Stock<br />
Ebenfalls nicht nur als „Museum“,<br />
sondern auch als Begegnungszentrum sieht<br />
sich Stocks Elternhaus in der heutigen<br />
Franz-Stock-Straße. Hier empfing Pfarrer i. R.<br />
Leo Reiners die UNITAS-Gruppe. Inmitten<br />
der bretonischen Möbel, der Bücher und<br />
Bilder von Franz Stock aus seiner Wohnung<br />
in Paris, die nach seinem Tod hierher kamen,<br />
ließ Pfarrer Reiners die unmittelbare Nähe<br />
des hier als Kind aufgewachsenen Priesters<br />
spüren, der inmitten von Tod und Unrecht in<br />
jedem Häftling Christus selbst sah. Nach<br />
dem Tod der Eltern und dem Tod von Franz<br />
Stock hatte in diesem Haus dessen Schwester<br />
Franziska mit ihrem Mann Pierre Savi,<br />
Kunstmaler und Referent der Kulturabteilung<br />
der Französischen Botschaft in Bonn,<br />
gewohnt. Seine jüngste Schwester Theresia<br />
übertrug das Haus vor genau zehn Jahren<br />
der Kirche als Stiftung. Heute ist hier auch<br />
das Archiv mit Briefen, Fotos und Dokumenten<br />
sowie das Atelier seines Schwagers<br />
Pierre Savi untergebracht. Von Franz Stock<br />
habe er schon in frühen Jahren viel gehört,<br />
bekannte Pfarrer Reiners, der hier 34 Jahre<br />
als Seelsorger wirkte:„Doch ich war stolz, als<br />
ich als Pfarrer nach Neheim geschickt<br />
wurde, in die Gemeinde, in der Franz Stock<br />
groß geworden ist!“ Dass sein eigener Vater<br />
auch Unitarier war, verschwieg Pfarrer<br />
Reiners ebenfalls nicht und alle Besucher<br />
trugen sich an Franz Stocks eigenem<br />
Schreibtisch gerne in das Gästebuch ein.<br />
Die „Französische Kapelle"<br />
im OfLag Soest<br />
Mehr als nur eine Ergänzung erfuhr<br />
dieser Besuch nach dem gemeinsamen Mittagessen<br />
im Marienhospital in Soest durch<br />
die Führung von Barbara Köster in der<br />
ehemaligen Wehrmachtskaserne am Meiningser<br />
Weg. In ihr war 1940 das OfLag VI A,<br />
eines von 15 Lagern für französische kriegsgefangene<br />
Offiziere in Deutschland eingerichtet.<br />
Das heute aufgelassene und verfallen<br />
wirkende Areal, das später auch<br />
Flüchtlinge aus Schlesien aufnahm und bis<br />
1994 als Belgische Kaserne diente, vermittelt<br />
noch heute etwas von der Trost- und<br />
Hoffnungslosigkeit, der sich die hier einst<br />
Gefangenen ausgesetzt sahen. In den für<br />
800 Menschen gebauten Kasernenblöcken<br />
waren zunächst 1.400, zuletzt 5.000 Gefangene<br />
eingepfercht. Bis zu fünf Jahren<br />
verbrachten sie hier streng bewacht hinter<br />
Stacheldraht, die sie versuchten, durch ein<br />
intensives kulturelles und auch religiöses<br />
Leben zu füllen. Davon zeugen bis heute die<br />
Ausstellungsstücke, die ein reger Förderverein<br />
hier seit gut zehn Jahren zusammengetragen<br />
hat, vor allem aber auch die von<br />
den Kriegsgefangenen selbst ausgestattete,<br />
einzigartige Kapelle, die ein beeindruckendes<br />
Bildprogramm zeigt. Ausgestaltet<br />
wurde sie vor allem durch den berühmten<br />
Architekten, Landschaftsmaler und Lithographen<br />
Guillaume Gillet, Gefangener dort<br />
von 1940-1945.<br />
Mit vielen neuen Eindrücken sammelten<br />
sich die Teilnehmer der Fahrt wieder in<br />
Soest, wanderten durch die Altstadt mit<br />
ihren Kirchen und probierten zum Ausklang<br />
des Tages die Eisspezialitäten im Park an<br />
einer historischen Mühle. Ihr Fazit „Eine sehr<br />
bereichernde Fahrt!“ gaben sie mit großem<br />
Applaus an den Organisator der Fahrt<br />
weiter. CB<br />
Kontakt: Franz-Stock-Komitee für Deutschland,<br />
Hauptstr. 11, 59755 Arnsberg, Tel.<br />
02932/22050, info@franz-stock.de, Internet:<br />
www.franz-stock.de.
Bbr. Robert Schuman – Ein Porträt<br />
RÜCKSCHAU AUF EINEN GELUNGENEN VORTRAGSABEND<br />
BEI DER UNITAS RUPERTO CAROLA IN HEIDELBERG<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. SEBASTIAN LUGER<br />
In diesem Jahr feiern wir den 50. Jahrestag<br />
der Römischen Verträge, durch welche<br />
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
gegründet wurde und die gleichzeitig<br />
einen der wichtigen Grundsteine unserer<br />
heutigen Europäischen Union darstellen.<br />
Anlässlich dieses für alle Europäerinnen<br />
und Europäer freudigen Geburtstagsereignisses<br />
fand sich im vergangenen Semester<br />
ein passender Anlass, sich Gedanken über<br />
Europa, über seine Vergangenheit, Gegenwart<br />
und Zukunft zu machen. Nicht nur auf<br />
der diesjährigen GV in Trier war das<br />
europäische Sujet mit der Überschrift<br />
„Christentum als Fundament Europas?“ in<br />
aller Munde. Ebenso veranstaltete die<br />
UNITAS in Heidelberg im vergangenen<br />
Sommersemester vor diesem Hintergrund<br />
zwei Wissenschaftliche Sitzungen zum<br />
Thema Europa: Ein gut recherchierter<br />
Aktivenvortrag erhellte die Geschichte der<br />
Europäischen Union von den Anfängen bis<br />
heute samt ihrer Gremien und Ämter.<br />
Eine zweite WS befasste sich mit einer<br />
wichtigen europäischen Persönlichkeit,<br />
die einen fundamentalen Beitrag zu<br />
dem Europa, wie wir es heute kennen,<br />
leisten konnte und die allen Unitarierinnen<br />
und Unitariern nicht nur ein Begriff ist,<br />
sondern auch als Beispiel dienen kann. Die<br />
Rede ist von Bbr. Robert Schuman, u. a.<br />
erster Präsident des Straßburger Parlaments<br />
und einer der Vordenker in der<br />
europäischen Sache. Daher erhielt er den<br />
ehrenvollen Namen „Pater Europae“ – Vater<br />
Europas.<br />
Wir hatten die Ehre<br />
und das große Glück, als<br />
Referenten Bbr. Dr. Karl-<br />
Heinz Debus, Archivar<br />
im Landesarchiv in Speyer<br />
und ausgesprochener<br />
Kenner der Persönlichkeit<br />
Robert Schumans,<br />
für einen Vortrag<br />
auf dem UNITAS-Haus<br />
in Heidelberg gewinnen<br />
zu können. Der bis zum<br />
letzten Platz besetzte<br />
Vortragssaal zeigte, dass<br />
Leben und Wirken von<br />
Bbr. Robert Schuman<br />
heute auf großes Interesse<br />
stößt. Bbr. Dr. Karl-<br />
Heinz Debus verstand<br />
es, ein lebendiges Bild der Persönlichkeit<br />
unseres Bundesbruders zu zeichnen,<br />
machte das interessierte Auditorium mit<br />
dessen Zielen und Ideen bekannt und<br />
skizzierte Schumans innere Haltung im<br />
Hinblick auf Politik, Kultur und Christentum.<br />
So war der Vortrag betitelt mit:<br />
„Robert Schuman – Lothringer, Europäer,<br />
Christ“.<br />
Als Jugendlicher aufgewachsen in<br />
einem stark christlich geprägten Elternhaus,<br />
war Robert Schuman seit seiner<br />
Studienzeit Unitarier mit Leib und Seele.<br />
Und dieser Gedanke der UNITAS, der Einheit,<br />
war der rote Faden, der sich durch sein<br />
Leben zog. Schuman studierte Rechtswissenschaften<br />
in Bonn, München, Berlin<br />
und Straßburg. In späteren Jahren als Jurist<br />
und politischer Verantwortlicher verstand<br />
er sich als pragmatischer Realpolitiker, der<br />
sich um ein vereintes Europa bemühte. Ein<br />
besonderes Anliegen war ihm die deutschfranzösische<br />
Aussöhnung und die Entwicklung<br />
tiefer Freundschaft beider Länder.<br />
In Schumans Gedanken zur Einheit Europas<br />
galten die Begriffe Unité et Paix – Einheit<br />
und Frieden als die Schlüsselworte. Der<br />
Friede ist, wie Robert Schuman sagte: „(…)<br />
nicht nur das Unterlassen des Krieges, nicht<br />
nur Versöhnung und Verständnis für<br />
andere, sondern ist und muss stets mehr<br />
werden: Zusammenarbeit und Vertrauen<br />
zwischen den Völkern, zwischen allen<br />
Völkern.“ Diese friedfertigen Worte<br />
stammten aus dem Munde eines Mannes,<br />
der nur knapp durch glückliche<br />
Umstände dem Konzentrationslager entgehen<br />
konnte.<br />
Ein aufmerksames Auditorium<br />
Bbr. Karl-Heinz Debus zeichnete ein lebendiges<br />
Bild von Bbr. Robert Schuman<br />
Bbr. Dr. Debus hob in seinem Vortrag<br />
weiterhin hervor, dass Schuman die<br />
europäische Einheit zunächst im wirtschaftlichen,<br />
darüber hinaus im militärischen,<br />
außenpolitischen und parlamentarischen<br />
Bereich gesehen habe, ebenso im<br />
kulturellen, wobei er jedoch die Eigenständigkeit<br />
der über mehr als tausend Jahre<br />
gewachsenen Kulturen betonte. Speziell im<br />
wirtschaftlichen Bereich, als Verfechter<br />
einer Internationalisierung der europäischen<br />
Schwerindustrie, entstand durch<br />
den nach ihm benannten „Schuman-Plan“<br />
die Montanunion als Fundament einer<br />
beginnenden europäischen Föderation. Als<br />
erster Präsident des europäischen Parlaments<br />
in Straßburg in den Jahren 1958 bis<br />
1960 wurde ihm der Ehrentitel „Vater<br />
Europas“ zu teil.<br />
Robert Schuman war<br />
überzeugter Christ, aktiv in<br />
kirchlichem Leben. Dies<br />
machte sich auch in seiner<br />
Einstellung zur Rolle der<br />
Kirche in Gesellschaft und<br />
Politik bemerkbar. Er vertrat<br />
die Meinung, dass sich die<br />
Politik nicht das Christentum<br />
zu ihrem Werkzeug machen<br />
könne, vielmehr müssten<br />
gläubige Christen die Alltagspolitik<br />
durch ihr Engagement<br />
positiv beeinflussen.<br />
Zeugnis von Schumans<br />
tiefem Glauben gibt folgender<br />
kleiner Vergleich, den er<br />
immer wieder betonte, nämlich,<br />
dass sich die Zeit seiner >><br />
unitas 3-4/2007 211
Inhaftierung durch die Nationalsozialisten<br />
(1940/41) vom Fest Kreuzeserhöhung bis<br />
zum Karsamstag, also mit der mönchischen<br />
Fastenzeit decke.<br />
Im Hinblick auf Robert Schumans<br />
Lebensweg, seinen Verdiensten an einem<br />
friedlichen, geeinten Europa und seinem<br />
beherzten Eintreten für das Christentum,<br />
sollte er allen Europäern ein strahlendes<br />
Vorbild sein. Eine mögliche Seligsprechung,<br />
die derzeit angestrebt wird, müsste alle<br />
Unitarierinnen und Unitarier mit Freude<br />
erfüllen und bescherte möglicherweise<br />
unserer UNITAS einen weiteren Vereinspatron.<br />
Die Ausführungen müssen aus Gründen<br />
der Kompaktheit unvollständig sein<br />
und konnten sich an dieser Stelle exemplarisch<br />
nur auf ein paar ausgewählte Kernpunkte<br />
des Vortragsabends beziehen,<br />
welcher von Bbr. Dr. Debus immer wieder<br />
mit der einen oder anderen unbekannteren,<br />
interessanten, auch erheiternden Anekdote<br />
aus dem Leben unseres Bbr. Robert Schuman<br />
gewürzt wurde. Durch die angeregte<br />
Diskussion im Anschluss an den Vortrag<br />
konnte auch der Bogen zu neuesten<br />
europäischen Ereignissen und Entwicklungen<br />
gespannt werden.<br />
So bleibt an dieser Stelle, Bbr. Dr. Debus<br />
nochmals für seine WS mit solch aktuellem<br />
Inhalt herzlich zu danken, welche die<br />
ZuhörerInnen begeistern konnte! Auch im<br />
kommenden Semester wird es bei der<br />
UNITAS in Heidelberg wieder sehr interessante<br />
Vortragsabende mit hochkarätigen<br />
Referenten geben. Zum Schluss schon im<br />
Voraus herzliche Einladung hierzu an alle<br />
Interessierten!<br />
212<br />
Hohenstaufen-<br />
Stammtisch<br />
STUTTGART. Seit Mitte September gibt<br />
es in Stuttgart wieder einen regelmäßigen<br />
Stammtisch: Zusammen mit<br />
ein paar jungen Alten Herren hat die<br />
Aktivitas unter Senior Martin Knuttel<br />
einen Vorschlag aufgegriffen, der des<br />
öfteren angesprochen wurde. An<br />
jedem 2. Donnerstag im Monat finden<br />
künftig die Treffen um 20 Uhr im<br />
Paulaner in Stuttgart (Rotebühlplatz,<br />
Ecke Clawer Straße) statt. Die Einladung<br />
gilt allen Unitariern, Aktiven<br />
und der Altherrenschaft.<br />
Kontakt: Bbr. Martin Knittel, E-Mail:<br />
mk@innovate-gmbh.de.<br />
unitas 3-4/2007<br />
GV-Pre-Party<br />
der UNITAS Theophanu in Köln<br />
KÖLN. „Wer hat an der Uhr gedreht…?“ So<br />
lautete das Motto der GV Pre-Party, zu der<br />
am 27. Oktober 2007 die UNITAS Theophanu<br />
nach Köln geladen hatte. Die Idee zu<br />
dieser Veranstaltung kam einigen Mitgliedern<br />
schon vor geraumer Zeit, als sie mit<br />
großer Begeisterung von der GV 2007 aus<br />
Trier zurückkehrten. Die Frage lautete: Wie<br />
können wir die Zeit bis zur GV<br />
2008 im heimatlichen Köln<br />
überbrücken und der Aktivitas<br />
aller UNITAS-Vereine bereits<br />
im Vorfeld einen Eindruck<br />
davon vermitteln, was sie<br />
nächstes Jahr in Köln erwarten<br />
wird?<br />
Die Antwort war schnell<br />
gefunden und die Idee der<br />
GV Pre-Party geboren. Dafür<br />
wurde schließlich das Motto<br />
„Wer hat an der Uhr gedreht…?“<br />
gewählt. Zum einen,<br />
weil die GV 2008 in großen<br />
Schritten näher rückt und<br />
zum anderen, weil in jener<br />
Partynacht des 27. Oktober<br />
2007 die Uhren um eine Stunde<br />
zurückgestellt werden und<br />
die Gäste somit eine Stunde<br />
länger feiern können.<br />
Die GV Pre-Party rückte<br />
immer näher und am Samstagnachmittag<br />
konnten wir<br />
bereits die ersten unitarischen<br />
Gäste auf dem Haus begrüßen.<br />
Nach einer kleinen, spontanen<br />
Führung durch die wunderschöne<br />
Domstadt wurde<br />
das erste Fass angeschlagen und die Feier<br />
konnte beginnen. Ganz besonders gefreut<br />
hat uns, dass neben der Aktivitas auch<br />
einige Alte Herren den Weg auf das Haus<br />
gefunden haben. Viele Unitarier haben<br />
keine Mühen und Kosten gescheut und<br />
sind für die Party unter anderem aus<br />
Hamburg, Nürnberg, Marburg, Trier,<br />
Münster, Erfurt, Rotterdam, Bonn, Eichstätt<br />
und Darmstadt angereist. Unter den<br />
Partygästen durften wir auch Alt-VOP<br />
Christian Schmidt sowie VOS Matthias<br />
Fischer begrüßen. Insgesamt haben sich<br />
130 Partygäste zusammen gefunden, einen<br />
schönen Abend zu verbringen. Wir haben<br />
uns sehr über die Gäste und das positive<br />
Feedback auf die Feier gefreut. Das Bier ist<br />
geflossen, die Musik war laut und das<br />
Ordnungsamt hat uns kein Geld geklaut…<br />
Herzlichen Dank an jeden, der zu diesem<br />
wunderschönen Ereignis beigetragen<br />
hat. Es war wirklich ein gelungener Einstieg<br />
für die GV 2008 in Köln und mit Zuversicht<br />
und großer Vorfreude schauen die gastgebenden<br />
Kölner UNITAS-Vereine diesem<br />
Ereignis entgegen.<br />
Renu Agrawal, Anke Mecklenbrauck<br />
(UNITAS Theophanu Köln)<br />
Vorfreude auf die 131. GV in Köln: Beste Stimmung<br />
in der Domstadt
Für „Durch die Wüste“ hat Karl May kein Monopol...<br />
Der Schein trügt: Die Bundesbrüder<br />
Martin Derda und Helmut S. Ruppert<br />
(beide UNITAS Rheinmark Köln) bildeten<br />
nicht das Vorauskommando für<br />
die vielleicht heimlich nach Ausbruch<br />
der Bier-Anarchie bei der letzten<br />
GV beschlossene Gründung einer<br />
„UNITAS Deutsch-Südwest zu Windhoek/Namibia“,<br />
auch wenn auf<br />
den Fotos – aufgenommen vor der<br />
deutschen lutherischen Christuskirche<br />
und dem berühmten Reiterdenkmal<br />
der ehemaligen kaiserlichen Schutztruppe<br />
auf dem „Kaiser-Wilhelm-<br />
Hügel“ in Windhoek – beide mit unserem<br />
UNITAS-Zirkel winken...<br />
Beide Bundesbrüder unternahmen vielmehr<br />
mit ihren Ehefrauen eine 3.500-<br />
Kilometer-Tour durch Nord- und Nordwest-<br />
Namibia – selbst abwechselnd am Steuer<br />
des Leihwagens ein nicht gerade strapazenfreier<br />
Sonntagsspaziergang... – Das Gebiet<br />
zwischen der Metropole Windhoek und<br />
der angolanischen Grenze am Kunene-<br />
Fluss, einer Region von der Größe der alten<br />
Bundesrepublik, lernten sie bei dieser Safari<br />
recht gut kennen.<br />
Bbr. Martin Derda, der im heimischen<br />
Bergisch Gladbach Geschäftsführer der<br />
größten Klinik der Stadt, des katholischen<br />
Marien-Krankenhauses ist, nutzte die Gelegenheit,<br />
sich über die gesundheitliche<br />
Situation und den Stand der Krankenhausversorgung<br />
zu informieren. Trotz des<br />
Zwei Rheinmärker in Namibia: Die Bundesbrüder Martin Derda und Helmut Ruppert (rechts) vor der<br />
Christuskirche in Windhoek und ihre kleine UNITAS-Demonstration oben vor dem Reiterstandbild.<br />
hohen Standards gerade der katholischen<br />
Gesundheitseinrichtungen leiden die nur<br />
1,8 Millionen Einwohner (etwa die Einwohnerzahl<br />
Münchens) zu einem hohen<br />
Prozentsatz unter der AIDS-Pandemie;<br />
einzelne Gebiete sollen bis zu 65 Prozent<br />
durchseucht sein.<br />
Koloniale Vergangenheit an<br />
einem faszinierenden Reiseziel<br />
Bbr. Helmut S. Ruppert, der in seiner Zeit<br />
als leitender Mitarbeiter des deutschen<br />
Auslandsrundfunks (Deutsche Welle) und<br />
als Chefredakteur der KNA bereits mehrfach<br />
das Land besucht und bereist hatte,<br />
nutzte die Gelegenheit, um der deutschen<br />
kolonialen Vergangenheit Namibias nachzuspüren,<br />
so wie sie dem Besucher am<br />
originalsten in der „deutschen Kleinstadt“<br />
Swakopmund begegnet.<br />
Fazit der unitarischen Exkursion: Namibia<br />
ist ein faszinierendes Reiseziel mit<br />
touristisch gut entwickelter Infrastruktur.<br />
Freilich bleibt angesichts der Kontraste<br />
zwischen dem Steinzeitleben des Nomadenvolkes<br />
der Himba oder San und dem<br />
luxurösen Schicki-Micki-Tourismus in den<br />
Nobellodges auch so manches Fragezeichen<br />
über den Zustand der Gesellschaft<br />
bestehen. Vielleicht sollte man doch einmal<br />
über eine unitarische Filiale in dem Land<br />
zwischen Atlantik und Kalahari nachdenken<br />
– nicht zuletzt auch, um so dem<br />
kleinen Häuflein katholischer Christen ein<br />
wenig Rückenwind zu geben...<br />
HSR<br />
unitas 3-4/2007 213
Volles Haus im Ruhrpott<br />
RUHRANEN ERREICHEN WICHTIGES ZWISCHENZIEL<br />
BORBECK. „Volles Haus!“ meldet die<br />
UNITAS Ruhrania an den Universitäten<br />
Duisburg-Essen und Bochum.<br />
Zum Start des Wintersemesters<br />
2007/08 sind neun Kommilitonen in<br />
das UNITAS-Zentrum Ruhr gezogen.<br />
„Wir hatten über das Internet inseriert<br />
und eine unerwartet große Nachfrage“,<br />
freut sich der derzeitige Vorsitzende<br />
Daniel Muschellik mit seinen<br />
Bundesbrüdern über die neuen<br />
Mitbewohner aus dem Münsterland,<br />
Sachsen, Ostwestfalen, Schwaben<br />
oder Hessen.<br />
War es in den letzten Septemberwochen<br />
noch ziemlich hektisch zugegangen,<br />
ist die im Mai 2006 mit viel<br />
Eigenarbeit begonnene Totalrenovierung<br />
nun innen fast ganz abgeschlossen.<br />
Mit Zimmergrößen bis 29<br />
Quadratmetern und erschwinglichen<br />
Preisen scheint die UNITAS an<br />
der Ruhr in eine Marktlücke gestoßen<br />
zu sein. Neun brandneue Buden<br />
mit mehreren Bädern stehen nun in<br />
den beiden oberen Stockwerken des<br />
„Feldschlößchens“ zur Verfügung.<br />
Und in der Gemeinschaftsküche<br />
hinter der eigenwilligen Fassade ist<br />
Spagettikochen, so interessierte<br />
Topfgucker, zurzeit voll im Trend. Vor<br />
allem aber gilt es für die Studis, sich<br />
in Fächern wie Medizin,Wirtschaftsinformatik<br />
oder Osteuropakunde an<br />
den Universitäten in Duisburg, Essen und<br />
Bochum zurechtzufinden.<br />
Graue Haare inklusive<br />
Noch gibt es immer noch viel zu tun<br />
rund um Haus und Hof. Die Organisation<br />
der Dauerbaustelle hatte es in sich: Vor<br />
allem beim Innenputz, bei dem mehr als 25<br />
Tonnen Material an die Wände kamen. Das<br />
über 100-jährige Haus – innen weitgehend<br />
Fachwerk – saugte mit großer Geschwindigkeit<br />
die Feuchtigkeit aus dem dick aufgebrachten<br />
Mörtel, was beträchtliche Rissbildung<br />
folgerte. Die Nacharbeitungszeit<br />
und der Baustopp für alle anderen Gewerke<br />
ließ den angepeilten Zeitplan fast vollends<br />
zusammenstürzen. Und doch haben es die<br />
Ruhranen irgendwie schließlich geschafft:<br />
Als Dauergäste mit „Goldenen Kundenkarten“<br />
in umliegenden Baumärkten brachten<br />
sie zuletzt selbst in mehreren Arbeits-<br />
einsätzen nicht nur über 1000 Quadratmeter<br />
Tiefengrund, schließlich auch noch<br />
genauso viel Farbe an die Wand und<br />
Lampen an die Decken. Pünktlich während<br />
des Einzugs des ersten neuen Hausbewohners<br />
kam der zweite Anstrich und der<br />
komplette Laminat-Fußboden. Selbst Zimmertüren<br />
stellten sich schließlich ein. Und<br />
die Schränke der selbstmontierten Einbauküche<br />
sind noch nicht wieder von der<br />
Wand herunter gekommen.<br />
Pächter ist gefunden<br />
Ermöglicht hatte dies nicht zuletzt die<br />
Entwicklung der Verhandlungen mit geeigneten<br />
Pächtern für die geplante öffentliche<br />
Gastronomie im Erdgeschoss. Über vier<br />
Monate dauerten die Gespräche des örtlichen<br />
Hausbauvereins mit den letzten<br />
potenziellen Partnern. Ungezählte Stunden<br />
hatten die HBV-Verantwortlichen für die<br />
Abrechnung und Kostenkontrolle der zahlreichen<br />
Gewerke aufgewendet. Schließlich<br />
ermöglichte die Verabredung über einen<br />
Baukostenzuschuss die volle Konzentration<br />
der Baumaßnahmen auf den als Studentenhaus<br />
genutzten Teil des Hauses. Ein<br />
Ruhranen-CC gab bei einer Klausurtagung<br />
zudem grünes Licht für den Anbau eines<br />
eigenfinanzierten Wintergartens im Bereich<br />
des Biergartens, der damit die Gastronomiefläche<br />
noch deutlich vergrößert. Am<br />
Lukas-Tag kam es im Oktober mit den beiden<br />
zukünftigen Betreibern zum lange vorbereiteten<br />
Handschlag: Die ausgemachten<br />
Profis betreiben u. a. das „alpincenter“, die<br />
Skihalle in Bottrop und weitere gut laufende<br />
Lokale im Umfeld, verfügen über ausgezeichnete<br />
Kontakte und bringen in das<br />
Projekt große Investitionen ein. Nach derzeitigem<br />
Stand wollen sie das Haus zum<br />
April 2008 eröffnen. Sie sind bereits mit<br />
Hochdruck an den Ausbau gegangen und<br />
Anstoß in Essen: Bauleiter, Gastronomen und<br />
HBV-Vertreter der UNITAS Ruhrania<br />
setzen auf ein erfolgreiches breites Angebot.<br />
„Ein Umstand, der unser Haus noch<br />
attraktiver machen wird“, hoffen die Bundesbrüder<br />
der Ruhrania, die sich jetzt schon<br />
auf viele Gäste freuen: „Wenn es endlich<br />
losgeht, wird das nicht zu übersehen sein!“<br />
UNITAS-Profil bilden<br />
Währenddessen hat die über ein Jahr<br />
wieder durch die Region nomadisierende<br />
Ruhrania, die in ihrer fast 100-jährigen<br />
Vereinsgeschichte nie zuvor ein eigenes<br />
Haus nutzten konnte, in ihrem neuen<br />
Zentrum den geregelten Semesterbetrieb<br />
aufgenommen. „Ohne den UNITAS-Zirkel<br />
Essen wäre dies nie möglich gewesen“,<br />
stellt Alt-Senior Sebastian<br />
Sasse heraus. „Und doch ist es noch<br />
für uns eine ungewohnte Situation“,<br />
so sein Nachfolger Bbr. Daniel<br />
Muschellik. Jetzt gilt es im eigenen<br />
Haus auch verstärkt unitarisches<br />
Profil auszubauen. Die Bundesbrüder<br />
rechnen mit der Sogwirkung<br />
des stark vom ZHBV und Verband<br />
unterstützten Unternehmens in<br />
der ganzen Region. „Alle Zirkel<br />
im Umkreis sind herzlich eingeladen,<br />
dieses Haus als ihr Haus<br />
zu entdecken und zu nutzen“, so<br />
die Aktiven, HBV und örtlicher<br />
Hausbauverein.<br />
Toller Saal entstanden<br />
Dies besonders im neuen Veranstaltungssaal<br />
unter dem Dach, für den die<br />
Statik mit Stahlträger und mächtigen<br />
Leimbindern verstärkt wurde: Neben den<br />
gemeinsamen Gottesdiensten und Feiern<br />
zu den Patronatsfesten im Dezember und<br />
Januar begleitet eine Reihe von Vortragsund<br />
Gesprächsabenden mit geistlichen<br />
Bundesbrüdern den gemeinsamen Weg<br />
durch den Advent. Hilfe ist noch bei der<br />
Ausstattung des Hauses gefragt:„Nicht nur<br />
schöne alte Kronleuchter bekommen hier<br />
einen Ehrenplatz“, so der unitarische Ortsverein<br />
an der Ruhr.<br />
Zum Stand der Dinge am „Feldschlösschen“<br />
und zu den laufenden Aktivitäten gibt es<br />
immer wieder aktualisierte Informationen<br />
im Internet unter<br />
www.unitas-ruhrania.org.<br />
unitas 3-4/2007 215
UNITAS Hathumar auf Tour<br />
GOLDENE SEPTEMBERTAGE IN SACHSEN<br />
<strong>VON</strong> DR. CHRISTOF BECKMANN<br />
Zuletzt waren sie 2006 gemeinsam in<br />
Santiago de Compostela. Doch in diesem<br />
Jahr lag das Ziel näher: Barocke<br />
Pracht, gotische Strenge, Renaissance-<br />
Prunk, Klassik, Jugendstil und Plattenbau<br />
– rund 40 Unitarier aus Ostwestfalen<br />
sammelten bei ihrer Tour vom<br />
24.-28. September unzählige Eindrücke,<br />
die noch lange nachwirken werden.<br />
Die Busreise nach Sachsen und<br />
Thüringen, von Bbr. Ernst Raach und<br />
seiner Frau Ursula umsichtig vorbereitet,<br />
verwöhnte die Mitfahrer nicht nur<br />
mit goldener Septembersonne.<br />
„Ich wünsche euch Supertage hier bei<br />
uns“ – ein wildfremder pensionierter Musiker<br />
wollte es einfach dringend loswerden:<br />
Mitten in der Leipziger Innenstadt schwärmte<br />
er von den wiederentdeckten Schönheiten<br />
seiner Heimat. Noch habe er selbst nicht<br />
einmal alles sehen können, was sich zwischen<br />
den im Abbruch befindlichen großen<br />
Kästen langsam zeigt: Eine Innenstadt voll<br />
Charme, Intimität und bunten Geschäften<br />
zwischen alten und rekonstruierten Zeugen<br />
einer langen Geschichte schält sich aus dem<br />
Betonkorsett eines einst hochgepriesenen<br />
sozialistischen Städtebaus. Alte Plätze,<br />
Fassaden, Straßenzüge und Passagen zeigen<br />
wieder ihr Gesicht. Dies noch stärker in<br />
Dresden, dem Hauptziel dieser detailliert<br />
geplanten Fahrt, die von Beginn an mit den<br />
Spuren der christlichen Vergangenheit, aber<br />
auch mit besonders unitarisch interessanten<br />
Orten vertraut machte.<br />
Auf den Spuren<br />
der Hl. Elisabeth<br />
Erster Zwischenstopp auf der in Paderborn<br />
gestarteten Reise: Die 1170 erbaute<br />
Creuzburg im Werratal, mit ihrer Ringmauer<br />
von über 340 Metern eine der größten<br />
216<br />
unitas 3-4/2007<br />
romanischen Burganlagen Deutschlands.<br />
Von hier ist die sagenhafte Errichtung eines<br />
Kreuzes durch den Mönch und unitarischen<br />
Verbandspatron, den Hl. Bonifatius überliefert.<br />
Im Jahr der Wiederkehr des 800. Geburtstags<br />
der Heiligen Elisabeth war die<br />
Creuzburg auch in anderer Hinsicht ein<br />
besonderes Etappenziel: Hier, an ihrem<br />
Lieblingsort, verbrachte die ungarische<br />
Königstochter und Landgräfin von Thüringen<br />
ihre Kindheit. Hier mag sie oft über<br />
die 1225 errichtete siebenbogige Steinbrücke<br />
über die Werra gezogen sein, an der<br />
die 1499 St. Libori geweihte gotische Kapelle<br />
die Unitarier zum Verweilen einlud. Für Paderborner<br />
ein wichtiger Platz, denn spontan<br />
und vielstimmig erklingt bald das Preislied<br />
auf den Patron des Erzbistums. Nicht weit<br />
davon hebt sich die mächtige Wartburg<br />
schemenhaft gegen den Himmel. In Eisenach<br />
soll der Legende nach Meister Klingsor<br />
aus Ungarn 1206 ihre Geburt vorausgesagt<br />
haben, hier schloss die damals Vierzehnjährige<br />
1221 in der Georgenkirche ihre Ehe<br />
mit Landgraf Ludwig IV. Vorbei geht es an<br />
Erfurt, wo 1235 im Dom ihre Heiligsprechung<br />
proklamiert wurde, vorbei an Weimar, wo ihr<br />
Franz Liszt als Hofkapellmeister das<br />
Oratorium „Die Heilige Legende der Heiligen<br />
Elisabeth“ widmete.<br />
Auf der Weiterfahrt nach Dresden geht<br />
es zum Schloss Moritzburg. Parkanlage und<br />
der streng symmetrische Bau faszinieren,<br />
mächtige Geweihe zeugen von der Jagdleidenschaft<br />
der lebenshungrigen wie feierfreudigen<br />
Erbauer, die auf dem umgebenden<br />
See selbst veritable Seeschlachten nachstellten.<br />
Rund 25 Kilometer außerhalb von<br />
Dresden bezog die unitarische Reisegruppe<br />
schließlich ihr Quartier. In Weinböhla hatte<br />
Bbr. Ernst Raach eine unschlagbar günstige<br />
Übernachtung organisiert, unseren Standort<br />
für fünf Tage. Ein erster Abend rund um die<br />
Semperoper stimmt auf die kulturträchtige<br />
Atmosphäre dieser Tage ein.<br />
Leipzig: In der Akademiker-<br />
Gedächtniskirche<br />
Und auf ein weiteres Hauptziel der<br />
Reise, das wir am nächsten Tag in Leipzig-<br />
Gohlis erreichen: Wir sind in einem großen<br />
Jugendstilquartier mit der Gemeindereferentin<br />
von St. Georg verabredet. Sie öffnet<br />
uns die Türe einer geduckt am Rande eines<br />
Platzes liegenden Kirche. Es ist die Akademiker-Gedächtniskirche,<br />
auf die Artikel der<br />
Bundesbrüder Henry C. Brinker und Dr. Lambert<br />
Stamer in der unitas-Zeitschrift des<br />
Jahres 2006 aufmerksam gemacht haben.<br />
Schweigend und gespannt ziehen wir in das<br />
Gotteshaus, feiern mit dem mitgereisten<br />
Pastor Josef Mersch und mit Bbr. Winfried<br />
Tilles gemeinsam Andacht im Gedenken der
Opfer aller Kriege und der verstorbenen Bundesbrüder,<br />
beten um Frieden in aller Welt.<br />
In den funkelnden Glasfenstern des<br />
berühmten Thorn-Prikker leuchten Wappen<br />
und Buchstaben, die Namen der 1922 an der<br />
Finanzierung beteiligten und in der Akademischen<br />
Bonifatius-Einigung zusammengeschlossenen<br />
universitären Verbände. Marien-<br />
und Georgs-Altar haben der KV und<br />
der CV gestiftet, die ursprünglich an anderer<br />
Stelle stehende Auferstehungsgruppe ist<br />
die Stiftung des UV. Ein kurzer Vortrag<br />
macht uns mit den Zeitumständen und<br />
Kunstwerken bekannt, bevor wir zur Begegnung<br />
im Pfarrzentrum der Gemeinde<br />
geladen sind.<br />
Ein strahlender Pfarrer Klaus Hecht<br />
bewirtet uns mit Kaffee und Kuchen. Er<br />
freut sich sehr über die Gäste, fragt nach<br />
den Hintergründen unseres Besuches. Engagiert<br />
berichtet er aus der Geschichte der<br />
in einem gutbürgerlichen Viertel u. a. von<br />
Jesuiten geleiteten Pfarrei, die in der Diaspora<br />
entstand, mit vielen Schwierigkeiten<br />
zu kämpfen und im DDR-Sozialismus einen<br />
schweren Stand hatte. Dennoch gingen seit<br />
1931 allein aus ihr 26 Priester, Patres und 15<br />
Ordensschwestern hervor. 1998 feierte die<br />
Gemeinde ihr 75. Kirchweihjubiläum –<br />
nichtahnend, dass das Entstehen der Kirche<br />
untrennbar mit unseren Studentenverbänden<br />
verbunden ist. Keine Schrifttafel,<br />
kein Informationsblatt berichtet darüber.<br />
Wir legen einen ansehnlichen Spendenbetrag<br />
zusammen und vereinbaren, dass wir<br />
den Kontakt nicht verlieren wollen.<br />
Kontraste:<br />
Krieg und Frieden<br />
Die Stadtrundfahrt führt uns zu einem<br />
denkbar harten Kontrast: Das schon zur<br />
Bauzeit umstrittene Völkerschlachtdenkmal<br />
mit dem Erzengel Michael<br />
unter dem Schriftzug<br />
„Gott mit uns“ zwingt uns<br />
unter eingetrübtem Himmel<br />
in Diskussionen. Beeindruckt<br />
und nachdenklich<br />
stimmt uns der Gang<br />
durch die Altstadt mit der<br />
Kreuzkirche und der Thomaskirche,<br />
an der J.S. Bach<br />
als Kantor wirkte. Vor<br />
allem aber der Besuch in<br />
der evangelischen Nikolaikirche,<br />
wo engagierte<br />
Führungen nicht nur mit<br />
den Ereignissen der jüngsten<br />
Geschichte konfrontieren.<br />
Einfühlsam nutzen sie hier die<br />
wunderschön in blassem Grün, weiß und<br />
rosa renovierte Geburtsstätte der friedlichen<br />
Revolution, um die Besucher mit der<br />
christlichen Botschaft bekannt zu machen,<br />
erzählen die biblischen Geschichten und<br />
verweben sie mit dem, was ein tätiger<br />
Glaube vermag.<br />
Ein Muss:<br />
Auerbachs Keller<br />
Stille Freude eint uns seit Tagen<br />
bereits im Gedanken an einen<br />
besonderen Höhepunkt der Fahrt.<br />
Denn am Abend grüßen uns die<br />
bewegten Figuren von Mephisto,<br />
Dr. Faustus und drei eleganten Studenten:<br />
Bereits die Statuen in der<br />
Mädlerpassage stimmen uns ein<br />
auf den Besuch in den Gewölben<br />
von Auerbachs Keller. 1525 als<br />
Weinausschank gegründet, hat ihn<br />
Goethe in seinem „Faust“ verewigt.<br />
Davon berichtet uns eine<br />
stimmgewaltig vorgetragene Fasskellerführung.<br />
Vom Goethekeller<br />
mit seiner schaurig-schönen Hexenritt-<br />
Skulptur geht es noch ein weiteres Stockwerk<br />
in die Tiefe, um den magischen „Verjüngungstrunk“<br />
zu verkosten, der die<br />
Mutigsten auf das Große Fass jagt und uns<br />
alle merklich aufgemuntert zum Abendessen<br />
entlässt. Hier berichtet nicht nur ein<br />
gekonnt Dialekt näselnder Bbr. Lothar<br />
Wengerzink überaus humorvoll von seinen<br />
Kinderjahren in Sachsen, sondern bald<br />
erklingen auch bekannte studentische Weisen<br />
in der für uns eigens reservierten Stube.<br />
An der Elbe:<br />
Natur pur erleben<br />
Abenden wie diesen muss viel frische<br />
Luft folgen: Dies beherzigend, ist uns die<br />
geführte Fahrt nach Schloss und Park<br />
Pillnitz an der Elbe in der sächsischen<br />
Schweiz eine willkommene Abwechslung.<br />
Die ehemalige Sommerresidenz der sächsischen<br />
Könige, die Orangerie mit Ringrenngebäude,<br />
Chinesischem und Englischem<br />
Pavillon, mit den mächtigen Baumriesen<br />
und seinen Blumen- und Staudenrabatten<br />
ist eine reine Augenweide. Staunend bewundern<br />
wir die berühmte baumgroße<br />
Kamelie mit ihrem fahrbaren Glashaus, die<br />
1776 aus Japan importiert wurde. Nächstes<br />
Fahrtziel ist die bizarre Felslandschaft des<br />
Elbsandsteingebirges. Mutig erklettern wir<br />
die schmalen Steigen und in den Fels<br />
gehauenen Treppen einer ehemaligen<br />
Höhenfestung böhmischer Raubritter, in der<br />
die Bewohner des Umlandes später Schutz<br />
gegen die Schweden suchten. >><br />
unitas 3-4/2007 217
Weiter geht es zur Festung Königstein<br />
mit ihren unterirdischen Kasematten. Einst<br />
unbezwingbar, thront sie als eine der<br />
architektonisch und historisch wertvollsten<br />
Bergfestungen Europas auf ihrem schroff<br />
aufragenden Tafelberg. Ihr Brunnenhaus<br />
lockt die technisch Interessierten und lässt<br />
den Blick in einen der tiefsten Brunnen<br />
Sachsens werfen. Mit herber Schönheit<br />
präsentiert sich die renovierte alte Garnisonskirche,<br />
hoch über dem Steilabhang<br />
wandern wir die Befestigungen entlang und<br />
schauen weit ins Land, um in der<br />
urgemütlichen Burgstube zu geselliger<br />
Runde zusammenzukommen.<br />
Dresden:<br />
Die Perle am Strom<br />
Alt und Neu in besonderer Mischung<br />
begegnen uns am nächsten Tag, als die berühmte<br />
Canaletto-Silhouette der sächsischen<br />
Landeshauptstadt aus dem Nebel<br />
über der träge fließenden Elbe taucht. Wir<br />
sehen Dampfschiffanleger, Zwinger, Brühlsche<br />
Terrassen, Kulturpalast und Taschenbergpalais,<br />
Kunstakademie und Altmarkgalerie,<br />
den vor genau 100 Jahren fertiggestellten<br />
Fürstenzug, einzelne moderne<br />
Fassaden aus Glas und poliertem Granit.<br />
Doch vieles andere ist unerwartet durchaus<br />
auch modern: Was auf den ersten Blick als<br />
auferstandener Beweis einer durch und<br />
durch prachtvollen und selbstbewussten<br />
Residenzstadt erscheint, ist in Wirklichkeit<br />
brandneu und vielfach Kulisse. Ob Gebäude<br />
der Renaissance oder Neo-Renaissance,<br />
früh- oder spätbarocke Palais – sie alle sind,<br />
kaum zu erkennen, perfekt wieder neu<br />
218<br />
unitas 3-4/2007<br />
hergestellt. Wo früher große Plätze<br />
gähnten, ist inzwischen eine Straßenbebauung<br />
entstanden, die seit<br />
dem Krieg nicht mehr so existierte.<br />
Letzte Lücken und Ruinen sind<br />
überall zu sehen – auch sie werden<br />
einst geschlossen sein. Damit fügt<br />
sich auch die gefeierte Frauenkirche<br />
in ein städtisches Ensemble, das wie<br />
ein gigantisches Puzzle insgesamt<br />
völlig neu entsteht. Die ehrwürdige<br />
Dame mit ihrem hohen Tambour<br />
empfängt uns mit schwelgendem<br />
Stuck, rasenden Farben und großer Geste, in<br />
ihr wimmelt ein vielsprachiger Besucherstrom<br />
aus aller Welt.<br />
Auf den Spuren von<br />
Hermann Ludger Potthoff<br />
Sehr viel ruhiger geht es an einem<br />
weiteren unitarisch interessanten Ziel der<br />
Fahrt zu. Nach dem Gruppenfoto auf den<br />
Elbterrassen treten wir an einer bescheidenen<br />
Seitentüre ein: Wie ein<br />
ankerndes Schiff liegt die der<br />
Heiligsten Dreifaltigkeit geweihte<br />
spätbarocke Hofkirche hoch über<br />
dem Ufer. Sie war die<br />
Hauskirche des ehemals<br />
katholischen Herrscherhauses<br />
und ist heutige<br />
Kathedrale des Bistums<br />
Dresden-Meißen. In der<br />
Gruft ruhen die sterblichen<br />
Überreste von 47 Mitgliedern<br />
des kurfürstlichen,<br />
später königlichen Hauses<br />
Wettin, in der Bischofsgruft<br />
werden die Bischöfe des Bistums<br />
bestattet. Hierhin war unser aus<br />
Essen-Werden stammender Verbandsgründer<br />
Hermann Ludger<br />
Potthoff (1830-1888) von seinem<br />
Kölner Erzbischof 1863 zum Dienst<br />
„ausgeliehen“ und für die Seelsorge<br />
in der Diaspora freigestellt worden, hier<br />
wirkte er 23 Jahre in der Caritasarbeit und<br />
als Oberhofprediger am Königlichen Hof,<br />
von hier aus arbeitete er als Generalpräses<br />
für seine sich im Westen und Süden<br />
Deutschlands langsam ausbreitende<br />
UNITAS. Auch daran denken wir bei den<br />
brausenden und wispernden Klängen der<br />
1750 begonnenen letzten und größten<br />
Silbermann-Orgel, an der – wie eigens für<br />
uns – ein prächtiges Konzert gegeben wird.<br />
Mit ihrer 2002 abgeschlossenen Restaurierung<br />
steht die Orgel mit ihren 47 Manualen<br />
wieder in der ersten Reihe der berühmten<br />
Barockorgeln.<br />
„Semper“ in unitate:<br />
Brilliant konzertant<br />
Und musikalisch geht es weiter zu<br />
einem der nächsten Höhepunkte unserer<br />
Reise: Bbr. Henry C. Brinker, Marketing-Chef<br />
der Semperoper, der uns mit Frau Dorthee<br />
und Tochter schon in Leipzig besuchte, hat<br />
uns Karten für einen Kammerkonzertabend<br />
der Sächsischen Staatskapelle mit den<br />
Solistinnen Kateryna Titova (Klavier) und<br />
Susanne Branny (Violine) im prächtig<br />
illuminierten Gebäude vermittelt. Ein<br />
Quintett Ludwig van Beethovens grüßt vom<br />
Rhein und aus Wien, Antonio Vivaldis<br />
„Jahreszeiten“ werfen ihre Strahlen aus<br />
dem entfernten Italien – alles gemeinsam<br />
gibt eine Melange, die sich in der ganzen<br />
Stadt widerspiegelt und durch die aus<br />
Ruinen Wiedergeborene hallt. Eindrücke, die<br />
sich zur Nacht in gemeinsamer unitarischer<br />
Runde in Weinböhla verdichten. Auf der<br />
Rückreise erwarten uns unerwartete Kostbarkeiten,<br />
als wir in Gotha vor der größten<br />
frühbarocken deutschen Schlossanlage, vor<br />
Schloss Friedenstein Halt machen. Porträts<br />
von der Hand Lukas Cranachs, der hier geboren<br />
wurde, erinnern uns an die Zeit der<br />
Reformation, ungezählte Schauobjekte<br />
verblüffen uns in der Raritätenkammer, gut<br />
erhalten präsentiert sich das Ekhof-Theater<br />
mit seiner originalen Bühnentechnik, die<br />
Stadt mit ihrem schmucken Rathaus und<br />
bunten Giebeln empfängt uns im Regen.<br />
Durch die Thüringische Pforte geht es<br />
heimwärts, gefüllt mit vielfältigen Eindrücken<br />
einer hervorragend vorbereiteten,<br />
humorvoll geführten unitarischen Reise.<br />
Bleibt einer lieben und traditionsreichen<br />
Hathumar in der Bischofsstadt Paderborn<br />
mit ihrem Organisator Bbr. Ernst und Ursula<br />
Raach zuletzt zu sagen: Großer Respekt vor<br />
den Aktiven einer UNITAS-Korporation, die<br />
ohne Aktivitas zeigen, dass UNITAS lebt.
Kirche auf Sendung:<br />
EIGENER KIRCHEN-KANAL BALD AUF SENDUNG IM TV?<br />
<strong>VON</strong> <strong>BBR</strong>. DR.<br />
CHRISTOF BECKMANN<br />
Noch Ende August hatte die mächtige<br />
WDR-Intendantin Monika Piel die<br />
Kirchen vor der Einrichtung eines<br />
eigenen Fernsehprogramms gewarnt.<br />
„Das Geld für solche Spartenprogramme<br />
wäre wahrscheinlich zum<br />
Fenster hinausgeworfen“, sagte sie<br />
am 29. August 2007 in einem Interview<br />
mit der Bonner Wochenzeitung<br />
„Rheinischer Merkur“. Solche Pläne<br />
gefährdeten auch die Sendezeit der<br />
Kirchen im öffentlich-rechtlichen<br />
Programm. Jetzt scheinen Dinge auf<br />
den Weg gebracht.<br />
Mit ihrer damals geäußerten Haltung<br />
teilte die WDR-Chefin die Einschätzung der<br />
Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg<br />
(rbb), Dagmar Reim, bis 2006 Beraterin<br />
der Publizistischen Kommission der<br />
Deutschen Bischofskonferenz. Auch sie<br />
hatte erklärt, mit einem Kirchenkanal<br />
würde die katholische Kirche eine privilegierte<br />
Position im öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunk aufs Spiel setzen. „23 Stunden<br />
mit erhebenden Predigten eines Missionars<br />
des mittleren Westens reichen nicht aus“,<br />
hatte sie mit Blick auf religiöse Sender in<br />
den USA geäußert. Genau dort hielt sich<br />
zur selben Zeit der Trierer Bbr. Bischof Dr.<br />
Reinhard Marx auf. Vom 28. August bis zum<br />
8. September unternahm er, von seinem<br />
Trierer Kommunikationsdirektor Monsignore<br />
Stephan Wahl begleitet, als Vorsitzender<br />
der Kommission für gesellschaftliche<br />
Fragen der Deutschen Bischofskonferenz<br />
eine Studien- und Informationsreise<br />
zu Gesprächen in Los Angeles, San Francisco<br />
und Washington D.C. Auf der Agenda der<br />
Reise: Gucken, wie es dort die anderen<br />
machen …<br />
Katholische Christen müssten noch<br />
deutlicher und profilierter ihre Standpunkte<br />
in die öffentliche Diskussion einbringen,<br />
betonte Bbr. Marx. Deshalb sei es<br />
auch notwendig, das Engagement der<br />
Katholischen Kirche in den elektronischen<br />
Medien zu verstärken. Dazu führte er u. a.<br />
mehrere Gespräche mit amerikanischen<br />
Medienexperten. „Davon können auch wir<br />
in Europa eine Menge lernen, etwa wenn es<br />
darum geht, Inhalte der katholischen<br />
226<br />
unitas 3-4/2007<br />
Soziallehre in den politischen Prozess der<br />
EU einzubringen“, so der Delegierte der<br />
deutschen Bischöfe bei der europäische<br />
Bischofskonferenz (COMECE).<br />
Der Vorsitzende der Publizistischen<br />
Kommission, Bischof Dr. Gebhard Fürst<br />
(Rottenburg-Stuttgart) zeigte sich des<br />
„Spagats“ bewusst, den die deutschen<br />
Bischöfe im Falle einer Entscheidung für<br />
einen Spartenkanal wagen. Es wäre der<br />
Versuch, ein neues Angebot zu etablieren,<br />
„ohne die öffentlich-rechtlichen Anstalten<br />
zu vergrätzen“, äußerte er am 9. September.<br />
„Wir wollen nicht um jeden Preis auf die<br />
Showbühne“, unterstrich der katholische<br />
Medienbischof.<br />
Im Trend:<br />
Glaube in den Medien<br />
Auf der aber muss sich die Kirche<br />
zunehmend behaupten: Denn Religion und<br />
Glaube nehmen einen deutlich prominenteren<br />
Raum in den Medien ein, wie u. a.<br />
Medienexperten am Rande der Internationalen<br />
Funkausstellung in Berlin erörterten.<br />
Die Gründe scheinen vielfältig:<br />
Deutscher Papst und Weltjugendtag,<br />
Wertedebatte und Herausforderung des<br />
Islam. Das Fernseh-Publikum suche wieder<br />
mehr verbindliche Autoritäten, betonte hier<br />
der Medienwissenschaftler Jürgen Grimm.<br />
Zwar bleibe Verkündigung mit Anspruch<br />
auf absolute Wahrheit für das Medium<br />
Fernsehen weiter problematisch, doch dürften<br />
sich die Kirchen in den Medien dem<br />
Dialog mit anderen Weltanschauungen<br />
nicht verweigern.<br />
Noch vor wenigen Jahren wäre nicht<br />
möglich gewesen, was Prominente heute in<br />
Talk-Shows über ihr Verhältnis zur Religion<br />
verraten: Ob Bundesminister Horst Seehofer<br />
(CSU) von stillen Tagen im Kloster<br />
berichtet oder sich Comedian Hape Kerkeling<br />
als Sinnsucher auf dem Jakobsweg präsentiert<br />
– Bekenntnisse wie diese könnten<br />
die Einstellungen eines Millionen-Publikums<br />
prägen, meint Ulrich Fischer, ZDF-<br />
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz.<br />
Von Religion hörten die meisten<br />
Deutschen zumeist nur noch en passant<br />
am Fernsehen. Auch Medienmacher erweisen<br />
sich zunehmend als Sinnsucher:<br />
Während etwa ZDF-Moderator Stephan<br />
Kulle über seine Konversion zur Katholischen<br />
Kirche berichtet, sprechen sich<br />
selbst bekennende Atheisten wie Hans-<br />
Ulrich Jörges, stellvertretender Chefredakteur<br />
des Magazins „Stern“, für ein<br />
offensiveres Zugehen der Kirchen auf die<br />
Menschen aus. Die mit ihrer Botschaft<br />
„eigentlich konkurrenzlosen“ Kirchen seien<br />
unverzichtbar in der Wertebildung und<br />
ethischen Ausbildung, erklärte er bei einer<br />
Diskussionsrunde des Fachverbands der<br />
Konfessionellen Presse im Rahmen der<br />
Jahrestagung des Verbands der deutschen<br />
Zeitschriftenverleger am 16. November in<br />
Berlin. Zudem gebe es außerhalb der<br />
Gotteshäuser eine Sehnsucht nach<br />
Gemeinschaftserlebnis, auf die die Kirchen<br />
reagieren könnten. Sie seien aber nicht<br />
vorne dabei, wenn es darum gehe, nach<br />
Sinn suchende Menschen abzuholen.<br />
„Medienbischof“ Dr. Gebhard Fürst<br />
(Rottenburg-Stuttgart), Vorsitzender<br />
der Publizistischen Kommission<br />
der Deutschen Bischofskonferenz<br />
Zum Thema „Kirche und TV“ war in den<br />
veröffentlichten Protokollen der Herbstvollversammlung<br />
der Deutschen Bischofskonferenz<br />
vom 24. bis 27. September 2007 in<br />
Fulda noch wenig zu erkennen: In einem<br />
eigenen Tagesordnungspunkt unter „Gesellschaft<br />
und Soziales“ konzentrierte sich<br />
der Bericht von Medienbischof Dr. Gebhard<br />
Fürst im Wesentlichen auf die Neuordnung<br />
der Ausbildungsgänge des Instituts zur<br />
Förderung des Publizistischen Nachwuchses<br />
(ifp), das in München zusammengeführt<br />
werden soll. Die 1968 im Auftrag der<br />
Deutschen Bischofskonferenz gegründete<br />
Journalistenschule bietet studienbegleitende<br />
Ausbildung, Volontärskurse für die kirchliche<br />
wie die säkulare Presse sowie spezielle
Ausbildung für Theologinnen und Theologen<br />
an. Im veröffentlichten Bericht der<br />
Herbstvollversammlung spielte die Frage<br />
eines eigenen Fernsehkanals keine Rolle.<br />
Nicht den<br />
Sekten überlassen<br />
Ausgerechnet beim ifp-Jahrestreffen<br />
am 4. November 2007 in Ludwigshafen<br />
aber gab es neuen Zündstoff in der Frage:<br />
Vor mehr als 250 Absolventen der verschiedenen<br />
Ausbildungszweige empfahl<br />
der Präsident des Verbandes Privater<br />
Rundfunk und Telekommunikation (VPRT)<br />
Jürgen Doetz den Kirchen, mit einem<br />
eigenen Sender in die digitale Fernsehwelt<br />
einzusteigen. „Überlassen Sie das Digitalfernsehen<br />
nicht dem Alpenverein, dem<br />
Anglerverein und den Sekten.“ Angesichts<br />
des zunehmenden Engagements nichtkirchlicher<br />
Glaubensgemeinschaften im<br />
Internet müssten sich die Kirchen verstärkt<br />
um ihre „mediale Auffindbarkeit“ bemühen,<br />
riet der Interessenvertreter des<br />
privaten Rundfunks. Er wisse auch, dass<br />
aus diesen Gründen Wirtschaftsunternehmen<br />
bereit seien, in ein kirchliches<br />
Fernsehangebot zu investieren, berichtete<br />
Doetz.<br />
Warnende Worte kamen bei der Veranstaltung<br />
allerdings aus der öffentlichrechtlichen<br />
Ecke: Der ARD-Vorsitzende Fritz<br />
Raff und Claudia Nothelle, designierte Fernsehdirektorin<br />
des Rundfunks Berlin-Brandenburg<br />
(RBB), rieten dazu, mögliche<br />
Konsequenzen eines eigenen Kirchenkanals<br />
für die Präsenz der Kirchen im öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunk genau zu prüfen und<br />
das bisher so gute Miteinander nicht zu<br />
gefährden. Ein eigenes Kirchenprogramm<br />
stehe in Konkurrenz zu den bisherigen<br />
Vereinbarungen, bekräftigte Raff die<br />
Position der öffentlich-rechtlichen Sender.<br />
Trotz persönlicher Sympathien für das<br />
Bestreben der Bischöfe, in der digitalen<br />
Welt in einer wie auch immer gearteten<br />
Form vertreten zu sein, halte er ein Vollprogramm<br />
jedoch für problematisch. „Ich<br />
kann nachvollziehen, dass die Kirchen den<br />
Markt nicht völlig den Sekten überlassen<br />
wollen“, meinte Claudia Nothelle. Die Frage<br />
eines kirchlichen Angebotes sei jedoch eine<br />
Frage der Qualität und des Umfangs. Ein<br />
eigener Kanal bedeute ein „anderes Miteinander“<br />
von Kirche und öffentlich-rechtlichem<br />
Rundfunk, so Nothelle. Sie halte es<br />
weiterhin für wichtig, dass Kirche hier<br />
präsent sei.<br />
Bei der Herbsttagung der Katholischen<br />
Redakteure im Privatfunk (KAPRI) am 5.<br />
November in der Katholischen Akademie<br />
Stuttgart konkretisierte Medienbischof<br />
Gebhard Fürst, dass die Frage nach einem<br />
eigenen Fernsehkanal aber durchaus auf<br />
der Agenda bleibe und aktiv angegangen<br />
worden ist. Noch sei vor allem zu prüfen,<br />
wie ein 24-Stunden-Programm zu füllen sei,<br />
welchen Anspruch und welche Ausrichtung<br />
der Sender haben solle. Dazu sei eine<br />
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben<br />
und auf dem Weg. Nicht zuletzt scheine<br />
jetzt schon deutlich, dass man mit einem<br />
Drei-Millionen-Euro-Etat pro Jahr nicht<br />
ganz auskommen werde: „Das dürfte auch<br />
ein bisschen teurer werden.“ Das Geld aber<br />
sei nicht das Problem, so der Bischof<br />
und erinnerte an die großen Gemeinschaftsleistungen<br />
der deutschen Diözesen<br />
der letzten Jahre – etwa bei der Entschuldung<br />
des Erzbistums Berlin. Im Mittelpunkt<br />
der Fragen stehe vor allem, wer die Verantwortung<br />
für das Programm und das betriebliche<br />
Management übernehme.<br />
Kein Amtsblatt<br />
mit laufenden Bildern<br />
Bei dem in der Diskussion stehenden<br />
TV-Spartenkanal dürfe es auf keinen Fall<br />
um ein „Amtsblatt mit laufenden Bildern<br />
gehen“, mahnte Bischof Fürst knapp zwei<br />
Wochen später in Berlin. Ziel sei ein<br />
katholisches Fernsehen „mit langer Leine“,<br />
ohne dass dies kirchliche Inhalte verwischen<br />
dürfe. Er wisse durchaus, dass dies<br />
auch Sprengstoff bergen könne. Kirche<br />
müsse aber „ein wenig die Nische verlassen“,<br />
in der sich die diözesanen Kirchenzeitungen<br />
gelegentlich gern aufhielten. Die<br />
Erstellung der Machbarkeitsstudie sei zu<br />
etwa 75 Prozent abgeschlossen. Der Kanal<br />
solle voraussichtlich ein zusätzliches Angebot<br />
zum bisherigen Medien-Engagement<br />
der katholischen Kirche sein. Derzeit<br />
noch immer völlig offen sei die Trägerstruktur<br />
eines solchen Fernsehens. Er hoffe auf<br />
eine Beteiligung möglichst vieler oder aller<br />
Diözesen. Bereits bei der nächsten Vollversammlung<br />
der Bischofskonferenz Mitte<br />
Februar wolle er die Studie den anderen Bischöfen<br />
vorlegen, berichtete Deutschlandradio<br />
Kultur am 18. November.<br />
Zapp zur Kirche<br />
Kirche auf Sendung mit eigenem Programm:<br />
Noch so eine Art „Verkaufssender“<br />
mehr? Oder ein anderes „katholisches<br />
Phoenix“? Kirche auf Kanal 42 oder noch<br />
weiter hinten auf der Fernbedienung der<br />
Zapper-Republik? Unprofessionell dargebotene<br />
Erweckungstalks? Gnadenlos auf<br />
kalten Meeresboden versenkte Kirchensteuermittel?<br />
Trotz solcher Fragen und üblicher<br />
Drohszenarien der etablierten Programme<br />
ist eines klar: Die Kirche ist von Natur aus<br />
„auf Sendung“. Und ein gutes Programm,<br />
das viele erreicht, könnte auch vieles<br />
bewegen. Unter anderem nicht zuletzt die<br />
Einsicht, dass man nicht nur von einer<br />
„missionarischen Kirche“ reden darf. Man<br />
sollte auch mit den Menschen sprechen.<br />
Und in einer Medienwelt geht man am<br />
besten genau in die Welt, in der die<br />
Menschen sind. Es bleibt spannend.<br />
unitas 3-4/2007 227
Bischof Bbr. Reinhard Marx:<br />
Weltverantwortung leben<br />
BERLIN. Die alte Säkularisierungsthese<br />
„Religion verschwindet“ habe sich selbst<br />
erledigt, sagte der Trierer Bischof Bbr. Reinhard<br />
Marx 21. Oktober 2007 in Berlin. Die<br />
Kontroversen um Kreuze in den Schulen, um<br />
Kopftücher und um den Gottesbezug in der<br />
Europäischen Verfassung hätten allen<br />
signalisiert: Sogar in westlichen Gesellschaften<br />
ist Religion präsent. „Sie aus dem<br />
Diskurs auszuschließen und nur dem religiösen<br />
Gefühl zuzuschieben, geht nicht“,<br />
bekräftigte Marx im Atrium der Deutschen<br />
Bank. Dorthin hatte das von Mitgliedern des<br />
Opus Dei geführte Feldmark-Forum am<br />
Mittwochabend 300 Gäste geladen.<br />
Bereits in der Bibel habe es den ersten<br />
Säkularisierungsschub gegeben, so der<br />
Bischof in seinem Vortrag „Herausforderungen<br />
des Säkularismus als Chancen für<br />
die Kirche“. Die Entsakralisierung der Sterne<br />
und Elemente durch den Gott Israels sei eine<br />
Errungenschaft gewesen. Er halte sich nicht<br />
mit Klagen über kleinere Kirchengemeinden<br />
auf. „Wir sollten uns einmischen! Die<br />
Säkularisierungsthese funktioniert nicht<br />
mehr. Das haben andere schon früh gesehen.<br />
In der Bibel heißt es nicht ohne<br />
Grund: ,Der Dummkopf sagt: Es gibt keinen<br />
Gott.‘ Dabei machte der Trierer Bischof klar,<br />
dass er weltweit keine Alternative zum säkularen<br />
Staat sieht. „Aber der Raum der Religion<br />
kann durch nichts ersetzt werden. Das<br />
Beziehungsgeflecht muss nur neu geknüpft<br />
werden.“ Es sei angesagt, mitten in der Welt<br />
Zeugnis zu geben. In dem Kontext verstehe<br />
er gut, wie der Gründer des Opus Dei, der hl.<br />
Josefmaria, von einer leidenschaftlichen<br />
Liebe zur Welt sprechen konnte.<br />
Marx plädierte für eine Doppelstrategie,<br />
um die Weltverantwortung des Christen zu<br />
leben. Zum einen müsse die Kirche öffentlich<br />
auftreten. Die Kirchliche Soziallehre<br />
habe sich stets dagegen ausgesprochen,<br />
dass die Kirche die politischen Institutionen<br />
beherrschen solle. Wohl aber wolle sie sie<br />
beeinflussen, mit allen anderen Menschen<br />
guten Willens. Wir sollten öfter im gesellschaftlichen<br />
Diskurs daran erinnern: „Wenn<br />
das Christentum aus unseren Städten<br />
verschwindet, dann gibt es auch keine<br />
christliche Kultur mehr.“<br />
Es seien eben nicht alle Religionen<br />
gleich. „Das Gemeinwesen kann sich nicht<br />
davor drücken, dass es Unterschiede gibt<br />
zwischen den christlichen Kirchen, die seit<br />
Jahrhunderten das Gemeinschaftsleben in<br />
Deutschland geprägt haben und einem religiösen<br />
Verein, der vor kurzem von zehn Leuten<br />
gegründet worden ist.“ Für die religiöse<br />
Situation in Deutschland gelte: „Wir gehen<br />
228<br />
unitas 3-4/2007<br />
einen sehr langen Weg.“ Der evangelische<br />
Bischof Huber habe richtig die Selbstsäkularisierung<br />
der Christen kritisiert. Und Kardinal<br />
Martini habe im Gespräch mit Umberto<br />
Eco bekräftigt: „Die Kirche befriedigt keine<br />
Bedürfnisse, sie feiert Geheimnisse!“<br />
Wenn er, Bischof Marx, manchmal kleinliche<br />
Klagen über dieses und jenes höre,<br />
sage er:„Ja, was ist denn der Ersatz für Christus?<br />
– Wollt ihr Christus austauschen gegen<br />
die Coladose und den Laptop?“ Der moderne<br />
Staat lebe von Voraussetzungen, die er<br />
selbst nicht schaffen könne. „Der Einzelne<br />
hat sich zu entscheiden!“<br />
Assisi-Basilika bald<br />
auch virtuell zugänglich<br />
NEWS<br />
LEIPZIG. Die Basilika des heiligen Franz von<br />
Assisi in Italien können Interessierte seit<br />
Ende 26. September auch virtuell besuchen.<br />
Gemeinsam mit dem Kunsthistorischen<br />
Institut Florenz konzipierten zwei Studierende<br />
der Hochschule für Technik, Wirtschaft<br />
und Kultur Leipzig eine Online-Ausstellung<br />
zu einer der berühmtesten Kirchen<br />
der Welt. Die Ausstellung ist in italienischer,<br />
englischer und deutscher Sprache abrufbar.<br />
Das Datum ist bewusst gewählt: Am 26.<br />
September 1997 wurde das umbrische<br />
Assisi von einem schweren Erdbeben erschüttert.<br />
Damals wurden rund 200 Quadratmeter<br />
Fresken von unschätzbarem<br />
kunsthistorischem Wert zerstört. Weitere<br />
Informationen beim Kunsthistorischen<br />
Institut Florenz unter www.khi.fi.it sowie<br />
bei der Leipziger Hochschule unter<br />
www.htwk-leipzig.de.<br />
Deutsche Priesterseminare:<br />
Zunahme bei Neueintritten<br />
MÜNCHEN. Die Priesterseminare in<br />
Deutschland erleben einen bescheidenden<br />
Aufschwung. Nach der Jahresstatistik über<br />
die Zahl der Neueintritte zum Stichtag 31.<br />
Oktober 2007 haben sich bisher 199 Priesteramtskandidaten<br />
angemeldet. Im Vorjahr<br />
waren es im Vergleichszeitraum 1906. November<br />
2007. Der Münchner Regens Dr.<br />
Franz Joseph Baur, Vorsitzender der Deutschen<br />
Regentenkonferenz, zeigte sich angesichts<br />
des Aufwärtstrends bei Neuzugängen<br />
erfreut und sagte: „Der Vergleich mit den<br />
Vorjahren zeigt eine gewisse Stabilität in<br />
der Gesamtzahl und sogar eine leichte<br />
Zunahme bei den Neueintritten.“<br />
Die Gesamtzahl der Seminaristen ist mit<br />
894 annähernd gleich wie im Vorjahr (897).<br />
Bei den Neueintritten lässt sich seit dem<br />
Jahr 2004 ein kontinuierlicher Aufwärts-<br />
trend erkennen. In der Statistik über die neu<br />
geweihten Priester wird diese positive Entwicklung<br />
allerdings erst in den kommenden<br />
Jahren zum Tragen kommen. Vorerst wurde<br />
mit 111 Weihen ein Tiefststand erreicht –<br />
1998 hatten noch 171 Seminaristen die<br />
Priesterweihe empfangen.<br />
Weltweit ist die Zahl der Priester um 169<br />
gewachsen, wie die Nachrichtenagentur<br />
„Fides“ der Kongregation für die Evangelisierung<br />
der Völker berichtete. Während die<br />
Zahl der Diözesanpriester um 769 anstieg<br />
(+839 in Amerika, +591 in Afrika, +541 in<br />
Asien, -1.189 in Europa und -13 in Ozeanien),<br />
ging die Zahl der Ordenspriester um 600<br />
zurück (+236 in Asien, +27 in Afrika, -695 in<br />
Europa, -136 in Amerika und -32 in<br />
Ozeanien).<br />
Umfrage: Mehrheit gegen<br />
Kruzifixe in Klassenzimmern<br />
MÜNCHEN. Laut einer „Focus“-Umfrage hat<br />
sich die Mehrheit der Befragten Mitte<br />
September gegen Kruzifixe in allen deutschen<br />
Klassenzimmern ausgesprochen.<br />
Einen Vorstoß für Kreuze in allen Schulen<br />
hatte CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla<br />
formuliert, Unions-Fraktionschef Volker<br />
Kauder (CDU) unterstützte ihn. Bei der<br />
Umfrage im Auftrag des „Focus“ äußerten<br />
sich 56 Prozent ablehnend. Im Osten<br />
Deutschlands betrug dieser Anteil sogar 79<br />
Prozent, im Westen 51 Prozent. Für das<br />
christliche Symbol in allen Schulen plädierten<br />
28 Prozent der Befragten. Während<br />
bei den befragten Katholiken eine Mehrheit<br />
von 56 Prozent zustimmte, waren es bei den<br />
Protestanten lediglich 20 Prozent.<br />
Bischöfe drängen auf<br />
weitere Reformen in der Türkei<br />
FULDA. Die katholischen deutschen Bischöfe<br />
dringen auf eine Wiederaufnahme<br />
des Reformprozesses in der Türkei. Zugleich<br />
übten sie Ende September scharfe Kritik an<br />
einem Urteil des Obersten Gerichts der Türkei<br />
gegen die griechisch-orthodoxe Kirche.<br />
Berechtigte Anliegen der religiösen Minderheiten<br />
bräuchten endlich eine Lösung, die<br />
den Standards eines demokratischen<br />
Rechtsstaats entspreche, betonte Kardinal<br />
Karl Lehmann nach Abschluss der Herbst-<br />
Vollversammlung der Bischöfe in Fulda.<br />
Empört zeigte sich Lehmann über die<br />
Entscheidung der obersten türkischen<br />
Richter vom Juni, die dem Ökumenischen<br />
Patriarchen von Konstantinopel das Recht<br />
auf Verwendung seines Patriarchentitels<br />
abgesprochen hatten. Zugleich verweigerte
das Gericht eine Anerkennung des Patriarchats<br />
als juristische Person. Die deutschen<br />
Bischöfe, so Lehmann, wiesen entschieden<br />
den Anspruch eines weltlichen Gerichts<br />
zurück, sich in die inneren Angelegenheiten<br />
der orthodoxen Kirche einzumischen. Schon<br />
heute sei das Ökumenische Patriarchat tagtäglich<br />
mit großen Einschränkungen konfrontiert.<br />
Die deutschen Bischöfe verlangten<br />
die Wiedereröffnung der seit 1971 geschlossenen<br />
theologischen Hochschule des<br />
Patriarchats auf der Marmarainsel Chalki<br />
und die Beendigung der systematischen<br />
Enteignung kirchlicher Gebäude und<br />
Grundstücke, unterstrich der Kardinal.<br />
Hurrelmann fordert mehr<br />
Unterstützung für Familien<br />
AACHEN. Der Sozialwissenschaftler Klaus<br />
Hurrelmann hat sich dafür ausgesprochen,<br />
Familien in Deutschland stärker zu unterstützen.<br />
Neben mehr Sachleistungen müsse<br />
es auch finanzielle Anreize für Eltern geben,<br />
die sich um eine Verbesserung ihrer Erziehungskompetenz<br />
bemühten, sagte er<br />
Mitte Oktober bei einem Caritas-Kongress<br />
unter dem Motto „Erziehung und Bildung“<br />
in Aachen. Vor allem sozial schwache Familien<br />
sollten gefördert werden: Während<br />
Kinder aus gut situierten Familien in der<br />
Regel gestärkt ins Leben gehen könnten,<br />
erführen Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen<br />
viele Beeinträchtigungen in ihrer<br />
Entwicklung, so der Bielefelder Forscher.<br />
Gesundheitliche, soziale und psychische<br />
Störungen häuften sich in diesen Schichten<br />
deutlich. Jungen seien stärker benachteiligt<br />
als Mädchen. In Deutschland leben nach<br />
Hurrelmanns Angaben rund zwei Millionen<br />
Kinder in relativer Armut, deren Eltern in<br />
wirtschaftlichen Schwierigkeiten keine<br />
souveränen Erzieher mehr seien, unterstrich<br />
der Wissenschaftler. Als Sachleistungen<br />
regte er Nachmittagsbetreuung, kostenlose<br />
Mahlzeiten in Schulen und Kindergärten<br />
und finanzielle Unterstützung für besuchte<br />
Elternseminare an.<br />
Immer mehr Deutsche<br />
wandern aus wirtschaftlichen<br />
Gründen aus<br />
BONN. Immer mehr Deutsche wandern aus,<br />
weil sie sich im Ausland bessere berufliche<br />
Chancen erhoffen. Im vergangenen Jahr<br />
habe die Zahl der Auswanderer aus der<br />
Bundesrepublik mit 155.000 die Höchstmarke<br />
seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht,<br />
so die Angaben aus der gemeinsamen<br />
Jahrestagung der Auswandererberater des<br />
katholischen Raphaels-Werks, der Diakonie<br />
und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).<br />
Rund 70 Prozent hätten wirtschaftliche und<br />
berufliche Gründe für diesen Schritt genannt.<br />
Vor allem der europäische Arbeitsmarkt<br />
biete den Auswanderern Chancen.<br />
Die Schweiz beispielsweise habe einen<br />
großen Arbeitskräftebedarf. In das Land sind<br />
2006 mit gut 18.200 die meisten Deutschen<br />
ausgewandert, gefolgt von den USA und<br />
Österreich. Aber auch Großbritannien,<br />
Polen, Spanien und Frankreich seien als Ziele<br />
in Europa beliebt. Der Trend zur Auswanderung<br />
werde durch eine fortschreitende<br />
Globalisierung unterstützt. Gut<br />
99.000 Menschen kehrten im vergangenen<br />
Jahr nach Deutschland zurück, unter ihnen<br />
viele Ältere, die in Deutschland eine bessere<br />
Betreuung und Pflege erwarten.<br />
Als Fachverband des Deutschen Caritasverbandes<br />
berät das Raphaels-Werk Auswanderer,<br />
Auslandstätige, Flüchtlinge, binationale<br />
Paare und Rückkehrer. Bundesweit<br />
gibt es 22 Anlaufstellen sowie eine Onlineberatung.<br />
Venezuelas Bischöfe rufen<br />
zu sozialem Frieden auf<br />
CARACAS. Angesichts anhaltender Proteste<br />
hat die Kirche Venezuelas die Regierung<br />
aufgefordert, den sozialen Frieden zu wahren.<br />
„Die Demonstrationen sind ein legitimer<br />
Ausdruck der politischen Pluralität“,<br />
mahnten die Bischöfe in einem am 10. November<br />
veröffentlichten Appell. Darin rufen<br />
sie alle politischen Gruppierungen zu Respekt<br />
und Toleranz auf. Die Bischöfe verurteilen<br />
zudem die Ausschreitungen bei<br />
Studentenprotesten, bei denen es Verletzte<br />
und Festnahmen gab. Sicherheitskräfte<br />
lösten u. a. am 23. Oktober eine Demonstration<br />
von Studenten gegen die geplante<br />
Verfassungsreform auf. Dabei ging die<br />
Polizei mit Tränengas in der Nähe des<br />
Parlaments gegen mehrere tausend Demonstranten<br />
vor, teilweise kam es zu heftigen<br />
Zusammenstößen.<br />
Die Verfassungsreform ist ein Projekt<br />
des umstrittenen Präsidenten Hugo Chavez,<br />
der zuletzt Mitte November durch einen<br />
heftigen Schlagabtausch mit dem spanischen<br />
König Juan Carlos vor laufenden<br />
Kameras zur Aufmerksamkeit sorgte. Die<br />
Reform soll Anfang Dezember per Volksabstimmung<br />
beschlossen werden und ihm<br />
u. a. die Möglichkeit auf unbegrenzte Wiederwahl<br />
im höchsten Staatsamt geben. Seit<br />
Monaten kommt es zu Zusammenstößen<br />
zwischen Anhängern von Präsident Hugo<br />
Chávez und Gegnern der geplanten Verfassungsreform.<br />
Die Kirche sieht die politische Freiheit<br />
und das Recht auf Meinungsäußerung<br />
gefährdet. Gegen sie nahmen inzwischen<br />
staatliche Maßnahmen an Schärfe zu:<br />
Kirchliche Einrichtungen und Katholische<br />
Ordensgemeinschaften, die über Grundeigentum<br />
verfügen, müssen seit Ende<br />
August den Nachweis erbringen, dass auf<br />
ihrem Grund und Boden in den letzten fünf<br />
Jahren ein beträchtlicher landwirtschaftlicher<br />
Ertrag erwirtschaftet worden ist.<br />
Sollte das nicht der Fall sein, steht eine<br />
Zwangsenteignung ins Haus. Diese Maßnahme<br />
trifft insbesondere religiöse Bildungseinrichtungen<br />
und größere Zentren,<br />
die als Besinnungshäuser und Jugendzentren<br />
konzipiert sind. Während die Polizei<br />
ersten Übergriffen tatenlos zusieht, haben<br />
betroffene kirchliche Träger Selbsthilfegruppen<br />
zum Schutz und zur Abwehr von<br />
Eindringlingen gebildet. Die staatlichen<br />
Behörden verstärken das Anwerben von<br />
Spitzeln, die kirchliche Zusammenkünfte,<br />
Glaubensgesprächskreise und Bildungsveranstaltungen<br />
auf mögliche kritische Bemerkungen<br />
hin überwachen.<br />
Im Januar 2007 hatte Präsident Chávez<br />
den Beginn einer neuen Etappe seiner „bolivarischen<br />
Revolution“ ausgerufen. Sie geht<br />
einher mit einer starken Konzentration der<br />
Macht in den Händen des Präsidenten. Als<br />
Ziel hat der Präsident die Schaffung eines<br />
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ ausgegeben,<br />
dessen Bestandteile aber im Einzelnen<br />
noch zu entwickeln seien. Präsident<br />
Chávez ließ vom Parlament ein Ermächtigungsgesetz<br />
für 18 Monate erteilen und<br />
kündigte eine umfassende Verfassungsreform<br />
an, die unter anderem seine Wiederwahl<br />
auf Lebenszeit garantieren soll. Seine<br />
„Bewegung Fünfte Republik“ und die<br />
anderen ihn unterstützenden Parteien<br />
sollen in der „Sozialistischen Einheitspartei<br />
Venezuelas“ aufgehen. Den katholischen Bischöfen<br />
im Land warf der Präsident vor,<br />
Handlanger der US-Regierung zu sein.<br />
Namentlich der verstorbene Kardinal Antonio<br />
Ignacio Velasco von Caracas steckte<br />
hinter dem Staatsstreich von 2002. Dessen<br />
Nachfolger Kardinal Jorge Urosa Savino<br />
sprach angesichts der Diskussionen über die<br />
Verfassung von einer zunehmenden Spaltung<br />
des Landes. Nachdrücklich haben die<br />
katholischen Bischöfe in Venezuela inzwischen<br />
die geplante Verfassungsreform<br />
verurteilt und als „moralisch unannehmbar“<br />
bezeichnet. Das Projekt verletze die Grundrechte,<br />
gefährde die Freiheit und den sozialen<br />
Frieden, bekräftigten sie am 20. Oktober<br />
ihre Sorge einer Machtkonzentration bei<br />
Präsident Hugo Chávez. Zudem sehen sie<br />
die Meinungs- und Religionsfreiheit in<br />
Gefahr. Diese Äußerungen bezeichnete<br />
Chávez zwei Tage später als „wahrhaftige >><br />
unitas 3-4/2007 229
Schande“: „Möge ihnen Gott ihre Ignoranz<br />
und Tollheit vergeben“, sagte der Präsident<br />
in einer Telefonbotschaft an ein Treffen der<br />
Sozialistischen Einheitspartei PSUV. Chavez<br />
forderte ihm wohlgesonnene Bischöfe auf,<br />
für sich selbst zu sprechen und nicht im<br />
Schulterschluss mit der Bischofskonferenz<br />
zu schweigen. Der Erzbischof von Caracas,<br />
Kardinal Jorge Urosa Savino, betonte im<br />
Gegenzug, die Kirche handle nicht im<br />
Interesse einiger weniger, sondern ungeachtet<br />
von Parteiinteressen im Namen und<br />
zum Wohl der gesamten venezolanischen<br />
Gesellschaft. 80 Prozent aller Radio- und<br />
Fernsehsender stehen gegenwärtig im<br />
Staatsdienst, nur 20 Prozent – überdies zu<br />
Zeiten mit geringen Einschaltquoten – sind<br />
oppositionellen Kräften vorbehalten.<br />
Umstrittenes tschechisches<br />
Kirchengesetz bleibt in Kraft<br />
PRAG. Kirchliche Schulen, Krankenhäuser,<br />
Altenheime oder Caritas-Einrichtungen in<br />
der Tschechischen Republik brauchen auch<br />
künftig eine Genehmigung des Kultusministeriums.<br />
Das tschechische Verfassungsgericht<br />
in Brünn erklärte Mitte November<br />
ein entsprechendes Kirchengesetz<br />
von 2005 für verfassungskonform. Das<br />
umstrittene Gesetz, das eine linke Parlamentsmehrheit<br />
aus Sozialdemokraten und<br />
Kommunisten verabschiedet hatte, regelt<br />
die Registrierung von Glaubensgemeinschaften<br />
und ihren Organisationen.<br />
Der christdemokratische Minister ohne<br />
Geschäftsbereich Cyril Svoboda bedauerte<br />
die Gerichtsentscheidung.<br />
Die katholische Bischofkonferenz erklärte,<br />
nun müsse man einen Weg finden,<br />
eine „Benachteiligung von Kirchen und<br />
Religionsgemeinschaften“ zu verhindern.<br />
25 überwiegend christdemokratische<br />
und konservative Abgeordnete und Senatoren<br />
hatten Verfassungsklage gegen das Gesetz<br />
eingereicht. Sie waren der Ansicht, die<br />
Regelung schränke die Unabhängigkeit der<br />
Kirche zu stark ein. Auch die Tschechische<br />
Bischofskonferenz und Vertreter anderer<br />
Religionsgemeinschaften sprachen sich gegen<br />
das Gesetz aus, weil es sie unter „Vormundschaft<br />
des Staates“ stelle. Der Prager<br />
Kardinal Bundesbruder Miloslav Vlk hatte<br />
kritisiert, Glaubensgemeinschaften in<br />
Tschechien würden nun „wie Kleingärtnerverbände“<br />
behandelt.<br />
Der größte Streit zwischen Staat und<br />
Kirche tobt seit 15 Jahren um den berühmten<br />
Prager Veitsdom, der unter den<br />
Kommunisten zum „Eigentum des ganzen<br />
Volkes“ erklärt worden war und derzeit von<br />
der ebenfalls auf der Prager Burg ansässigen<br />
Präsidentenkanzlei verwaltet wird. Tschechien<br />
gilt als eines der am meisten säkularisierten<br />
Länder des ehemaligen Ostblocks.<br />
Keine 30 Prozent der Bevölkerung bekennen<br />
sich zur katholischen Kirche. Andere Kirchen<br />
und Religionsgemeinschaften sind nahezu<br />
bedeutungslos.<br />
230<br />
unitas 3-4/2007<br />
ROM: Paulusjahr 2008/2009<br />
ROM. Vom 28. Juni 2008 bis zum 29. Juni<br />
2009 wird ein Jubeljahr zum 2000. Geburtstag<br />
des Völkerapostels Paulus begangen. Zur<br />
Eröffnung des „Paulinischen Jahres“ soll in<br />
der Basilika Sankt Paul vor den Mauern<br />
unter der Leitung von Lorin Maazel Händels<br />
„Messias“ aufgeführt werden, am Ostersonntag<br />
2009 wird Gustav Mahlers Auferstehungssymphonie<br />
erklingen. Auf dem<br />
Programm stehen zahlreiche Veranstaltungen<br />
zu Ökumene, Liturgie, Gebet, Kunst,<br />
Geschichte und Archäologie, pastorale<br />
Initiativen und Wallfahrten. Romwallfahrer<br />
werden auf den Spuren des Heiligen Paulus<br />
durch Rom pilgern können – von der Basilika<br />
Sankt Paul vor den Mauern, wo er begraben<br />
liegt, bis zu den Trevi-Brunnen, wo er enthauptet<br />
worden sein soll. Die täglich von bis<br />
zu 4.000 Pilgern besuchte Basilika wird ihre<br />
Heilige Pforte öffnen, jeden Dienstag- und<br />
Donnerstagnachmittag wird eine besondere<br />
Liturgie gefeiert. Im linken Seitenschiff<br />
der Basilika werden Ausstellungen Leben<br />
und Werk des heiligen Paulus näher<br />
beleuchten. Gezeigt und erklärt werden<br />
unter anderem Darstellungen der zahlreichen<br />
Reisen des Apostels, Ausgrabungen,<br />
Briefe, die Geschichte der Basilika sowie<br />
Gedenkbriefmarken und -medaillen zum<br />
Jubeljahr.<br />
Bischöfe: „Ohne Familie<br />
hat Europa keine Zukunft“<br />
FATIMA. „Wenn es die Familie verliert, wird<br />
Europa seine Zukunft verlieren“, erklärten<br />
die Vorsitzenden der 36 europäischen Bischofskonferenzen,<br />
die im Oktober in Fatima<br />
(Portugal) zusammenkamen, um über<br />
Ehe, Familie, Ökumene und die Europäische<br />
Union zu beraten. Die Mitglieder des Rates<br />
der Europäischen Bischofskonferenzen<br />
(CCEE), die aus Anlass der Marienerscheinungen<br />
vor 90 Jahren im portugiesischen<br />
Wallfahrtsort ihre diesjährige Vollversammlung<br />
abhielten, weihten ganz Europa<br />
der Jungfrau Maria.<br />
Kardinal Giovanni Battista Re, Präfekt<br />
der Kongregation für die Bischöfe, hatte zuvor<br />
daran erinnert, dass das Haus Europa<br />
auf tragfähigen Prinzipien erbaut werden<br />
müsse, „die es erhellen und ihm eine<br />
Seele geben können“. In Europa gebe es<br />
zahlreiche Probleme und es fehlten auch<br />
nicht die Kräfte, „die die Christen und ihre<br />
Werte an den Rand zu drängen versuchen“.<br />
Wenn Gott nicht wieder Zugang erhalte in<br />
das Leben dieses Kontinents; wenn nicht<br />
für eine religiöse Wiederbelebung, eine<br />
solide christliche Gewissensbildung und<br />
die Wiedererlangung der kulturellen<br />
Dimension des Glaubens gearbeitet werde,<br />
könnten die anstehenden Probleme nicht<br />
gelöst werden, mahnte Kardinal Re. Der<br />
Präfekt forderte daher die Bischöfe auf, ihre<br />
Europa-Initiativen auf nationaler Ebene<br />
miteinander in Einklang zu bringen, um<br />
dem pastoralen Handeln der Kirche mehr<br />
Wirksamkeit zu verleihen – sowohl hinsichtlich<br />
der Wahrung der menschlichen<br />
und christlichen Werte als auch zur Bewahrung<br />
des Erbes jener Christen, die den<br />
Kontinent geprägt haben.„Dies ist nicht die<br />
Stunde der Entmutigung. Dies ist die<br />
Stunde des Engagements!“<br />
Die Vorsitzenden der europäischen<br />
Bischofskonferenzen beleuchteten die Situation<br />
der Institution Ehe und Familie in<br />
den Ländern Europas aus rechtlicher, institutioneller,<br />
sozialer und pastoraler Sicht.<br />
Das Szenario „sei besorgniserregend und<br />
kontrastreich zugleich.“ Einerseits belegten<br />
Umfragen, dass Ehe und stabile Familiensituationen<br />
zu den wichtigsten Prioritäten<br />
der Jugendlichen in Europa gehören, andererseits<br />
nähmen jedoch in der Realität<br />
religiöse wie zivile Eheschließungen ab. „Es<br />
steigt die Zahl der Trennungen und Scheidungen,<br />
der allein Erziehenden sowie die<br />
Zahl der außerehelich geborenen Kinder.<br />
Die traditionelle Form der Familie ist in<br />
Krise geraten. Die Familien leben heutzutage<br />
in einem Umfeld, das von Individualismus<br />
und Säkularisierung geprägt ist. Die<br />
Ehe wird häufig lediglich als ein Vertrag<br />
zwischen zwei Personen betrachtet. Die<br />
steigende Zahl von Gesetzen, welche die<br />
traditionelle, christliche Wirklichkeit von<br />
Ehe und Familie bedrohen, ist Besorgnis<br />
erregend. Wenn es die Familie verliert, wird<br />
Europa seine Zukunft verlieren.“ Zu den<br />
positiven Entwicklungen, die die Bischöfe<br />
ausmachten, gehöre die Tatsache, dass<br />
zahllose Familien „ihre Berufung mit Konsequenz<br />
und Freude“ leben. „Immer mehr<br />
junge Paare entscheiden sich zu einem<br />
Leben der Ehe in Fülle und möchten mehr<br />
Kinder. Auch seitens der Politik sind positive<br />
Zeichen und Aufmerksamkeit für die<br />
Situation der Familien zu beobachten. Vor<br />
allem die demografische Lage und der<br />
Beitrag der Familie zum gesellschaftlichen<br />
Zusammenhang und zur Erziehung der<br />
Kinder führen zu einem neuen Bewusstsein<br />
hinsichtlich der grundlegenden Bedeutung<br />
der Familie“, so die Bischöfe.
Angesichts der aktuellen Lage von Ehe<br />
und Familie in Europa erinnerten sie an die<br />
„Pflicht“ der Kirche und der Christen, „in der<br />
Förderung und Verteidigung des wahren<br />
Wohls des Menschen aktiv zu werden, für<br />
die Achtung des einzigartigen Platzes der<br />
Institution Familie und der Ehe als erste und<br />
grundlegende Zelle der Gesellschaft einzutreten<br />
und gegen die Relativierung dieses<br />
Modells gegenüber allen, die sich für seine<br />
Gleichwertigkeit mit anderen Formen des<br />
Zusammenlebens aussprechen. … Die Kirche<br />
in Europa bekräftigt mit Entschiedenheit,<br />
dass die Zukunft der Gesellschaft Europas<br />
auf der Familie basiert. Hierzu sind<br />
Gewissensbildung notwendig, die Eröffnung<br />
neuer Seelsorge-Zentren, neue Seelsorge-Programme<br />
und die Zuhilfenahme<br />
der technischen Entwicklungen.“<br />
Im kommenden Jahr wird die Vollversammlung<br />
des CCEE vom 30. September bis<br />
zum 3. Oktober in Budapest (Ungarn) stattfinden.<br />
Der Rat der europäischen Bischofskonferenzen<br />
(CCEE) vereint die Vorsitzenden<br />
der derzeit 36 Bischofskonferenzen Europas.<br />
Vorsitzender ist Kardinal Péter Erdö,<br />
Erzbischof von Esztergom-Budapest, Primas<br />
von Ungarn. Vizevorsitzende sind Kardinal<br />
Josip Bozanic, Erzbischof von Zagreb, und<br />
Kardinal Jean-Pierre Ricard, Erzbischof von<br />
Bordeaux. Generalsekretär des CCEE ist<br />
Msgr. Aldo Giordano. Das Sekretariat hat<br />
seinen Sitz in St. Gallen (Schweiz).<br />
Bischof Marx: Statt längerem<br />
Arbeitslosengeld lieber Arbeit<br />
finanzieren<br />
TRIER. Der katholische Sozialbischof Bbr.<br />
Reinhard Marx vermutet hinter der Debatte<br />
um eine längere Zahlung von Arbeitslosengeld<br />
I eine gehörige Portion Populismus. In<br />
einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur<br />
(KNA) warnte der Trierer<br />
Bischof am 31. Oktober davor, die eigentlichen<br />
Probleme des Arbeitsmarktes zu vernachlässigen.<br />
Statt für längeres Arbeitslosengeld<br />
solle das Geld lieber für Qualifizierungsmaßnahmen<br />
oder zur Finanzierung<br />
von Arbeit für Ältere bereitgestellt werden.<br />
Marx forderte bessere Voraussetzungen<br />
dafür, ältere Arbeitslose wieder in Arbeit zu<br />
bringen. Auch die beruflichen Chancen für<br />
gering qualifizierte Arbeitnehmer und Jugendliche<br />
ohne Abschluss müssten dringend<br />
verbessert werden. „Wenn ich höre,<br />
dass knapp zehn Prozent der Jugendlichen<br />
das allgemeine Schulsystem ohne Abschluss<br />
verlassen, bin ich sehr besorgt“,<br />
sagte er.<br />
Zugleich sprach sich der Trierer Bischof<br />
dafür aus, über einen sogenannten Dritten<br />
Arbeitsmarkt oder Sozialen Arbeitsmarkt<br />
nachzudenken. Ziel müsse sein, auch die<br />
Schwächsten über Arbeit in die Gesellschaft<br />
zu integrieren. Marx regte auch ein neues<br />
Nachdenken über Kombilöhne an. Der<br />
Markt selbst werde die Probleme dieser<br />
Menschen nicht lösen.<br />
Die Debatte über das Arbeitslosengeld I<br />
nannte der Bischof zwar verständlich. Eine<br />
verlängerte Zahlung verschiebe aber die<br />
Problematik möglicherweise häufig nur um<br />
wenige Monate. Zudem könnte von einer<br />
Verlängerung auch das Signal ausgehen,<br />
dass man vor der Aufgabe kapituliere, ältere<br />
Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt zu<br />
integrieren. Er sehe eher Verbesserungsbedarf<br />
beim Arbeitslosengeld II, das Menschen<br />
sehr schnell in Armut führen könnte.<br />
Erzbischof Dr. Jean-Claude<br />
Périsset neuer Apostolischer<br />
Nuntius in Deutschland<br />
BONN/BERLIN. Der Vorsitzende der Deutschen<br />
Bischofskonferenz, Karl Kardinal<br />
Lehmann, hat Erzbischof Dr. Jean-Claude<br />
Périsset im Namen der deutschen Bischöfe<br />
zu seiner Ernennung zum neuen Apostolischen<br />
Nuntius in Deutschland gratuliert.<br />
Der zurzeit in Rumänien und Moldawien<br />
tätige Apostolische Nuntius bringe eine fast<br />
35-jährige Erfahrung im diplomatischen<br />
Dienst des Heiligen Stuhls mit. „Für unser<br />
Land sind auch die ökumenischen<br />
Erfahrungen, die Sie im Lauf Ihres Lebens<br />
gewinnen konnten, von großer Bedeutung“,<br />
so Lehmann in seinem Glückwunschschreiben.<br />
Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, am<br />
13. April 1939 in Estavayer-le-Lac im Kanton<br />
Freiburg in der Schweiz geboren, studierte<br />
Philosophie und Theologie in Sarnen und<br />
Freiburg. Am 28. Juni 1964 empfing er die<br />
Priesterweihe in Freiburg. Nach seiner<br />
Promotion zum Doktor des Kirchenrechts in<br />
Rom trat er 1973 in den diplomatischen<br />
Dienst des Heiligen Stuhls ein. Er war in den<br />
Apostolischen Nuntiaturen im südlichen<br />
Afrika, in Peru, Frankreich, Pakistan und<br />
Japan tätig sowie im Staatssekretariat in<br />
Rom in der Sektion für die Beziehungen mit<br />
den Staaten. Am 16. November 1996 zum<br />
Titularbischof von Accia und zum außerordentlichen<br />
Sekretär des Päpstlichen Rates<br />
zur Förderung der Einheit der Christen<br />
ernannt. Nach der Bischofsweihe durch<br />
Papst Johannes Paul II. am 6. Januar 1997<br />
wurde er am 12. November 1998 wurde<br />
Périsset zum Titularerzbischof von Iustiniana<br />
Prima und zum Apostolischen Nuntius<br />
in Rumänien ernannt. Seit dem 22. März<br />
2003 ist er zusätzlich Apostolischer Nuntius<br />
in Moldawien. Außer seiner Muttersprache<br />
Französisch spricht Erzbischof Dr. Périsset<br />
deutsch, italienisch, spanisch, englisch und<br />
rumänisch. Er folgt in seinem neuen Amt<br />
Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender nach, der<br />
am 30. September in den Ruhestand<br />
getreten ist.<br />
Laien wollen bei Bischofsbestellungen<br />
mehr mitreden<br />
BONN. Das Zentralkomitee der deutschen<br />
Katholiken (ZdK) will eine stärkere Mitwirkung<br />
der Gläubigen bei Bischofsbestellungen.<br />
Im Rahmen der Konkordate würden<br />
zurzeit nicht alle Möglichkeiten der Mitwirkung<br />
ausgeschöpft, erklärte das oberste<br />
katholische Laiengremium am 19. Oktober<br />
in Bonn. Vor der Wiederbesetzung eines<br />
Bischofsstuhls sind nach Vorstellung des<br />
ZdK die Priester-, Diözesanpastoral- und<br />
Diözesanräte an der Aufstellung eines<br />
Kriterienkatalogs für die Kandidaten zu beteiligen.<br />
Die Mitglieder der diözesanen Räte<br />
sollten einzeln befragt und um Nennung<br />
geeigneter Kandidaten gebeten werden.<br />
Auch der Nuntius solle gewählte Laienvertreter<br />
auf überdiözesaner Ebene befragen.<br />
Weiter plädiert das Laien-Komitee<br />
dafür, verstärkt über Beratungsmöglichkeiten<br />
durch Personen aus den ortskirchlichen<br />
Gremien auch beim eigentlichen<br />
Wahlvorgang – der Wahl aus der päpstlichen<br />
Dreierliste – nachzudenken. Gegenwärtig<br />
seien aber nur Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
in Erwägung zu ziehen, die keine<br />
Änderungen an den bestehenden Konkordaten<br />
nötig machten.<br />
Erste Fakultät für Pflegewissenschaft<br />
bundesweit<br />
VALLENDAR. An der Philosophisch-Theologischen<br />
Hochschule in Vallendar (PTHV) ist<br />
am 18. Oktober die bundesweit erste,<br />
eigenständige Fakultät für Pflegewissenschaft<br />
im Universitätsrang offiziell eröffnet<br />
worden – ein Novum in der deutschsprachigen<br />
Universitätslandschaft. Die Fakultätsgründung<br />
erfolgte in enger Kooperation<br />
und mit finanzieller Unterstützung<br />
der Franziskanerinnen aus Waldbreitbach.<br />
Prälat Franz Josef Gebert, Vorsitzender des<br />
Diözesan-Caritasverbandes Tier, nannte die<br />
Eröffnung der Fakultät einen „Meilenstein“<br />
für das Bistum Trier und rief dazu auf, die<br />
Pflegewissenschaft neu in den Blick zu<br />
nehmen. „Die Pflege darf nicht mehr ‚nur’<br />
die Magd der Medizin sein“, so Prälat<br />
Gebert. Diese Sicht entspreche in keinem<br />
Fall mehr dem Stand der Dinge. Vielmehr<br />
müsse Pflege auf Augenhöhe mit der<br />
Medizin betrachtet werden. Der Dienst am<br />
Nächsten und Schwachen gehöre zu den<br />
Grundvollzügen der Kirche. Prof. Dr.<br />
Hermann Brandenburg thematisierte in<br />
seiner Antrittsvorlesung die aktuellen >><br />
unitas 3-4/2007 231
Herausforderungen und Grundlegungen<br />
der Gerontologischen Pflege. Er wird den<br />
bundesweit ersten Lehrstuhl für Gerontologische<br />
Pflege in Vallendar besetzen.<br />
Erzdiözese Freiburg bewirbt<br />
sich um Katholikentag 2012<br />
MANNHEIM. Die Erzdiözese Freiburg hat<br />
sich mit dem Standort Mannheim um die<br />
Ausrichtung des 98. Deutschen Katholikentags<br />
im Jahr 2012 beworben. 1902 war Mannheim<br />
bereits einmal Ort des Katholikentreffens.<br />
Die Erzdiözese Freiburg war zuletzt<br />
mit Karlsruhe 1992 Austragungsort. 2008<br />
wird der 97. Katholikentag in Osnabrück<br />
stattfinden. Für 2010 ist der Zweite Ökumenische<br />
Kirchentag in München geplant.<br />
„Konstantin“ wurde<br />
zur Rekordausstellung<br />
TRIER. Mit einem unerwarteten Rekord ist<br />
am 4. November die Ausstellung „Konstantin<br />
der Große“ in Trier zu Ende gegangen. In<br />
fünf Monaten wurden etwa 353.974 Tickets<br />
verkauft; das entsprach rund 800.000<br />
Einzelbesuchen in den drei an der Ausstellung<br />
beteiligten Museen, dem Rheinischen<br />
Landesmuseum, dem Bischöflichen Domund<br />
Diözesanmuseum und dem Stadtmuseum<br />
Simeonstift. Zum Abschluss der<br />
Ausstellung feierte der Trierer Bischof Bbr.<br />
Dr. Reinhard Marx einen Gottesdienst im<br />
Trierer Dom. Die Verantwortlichen der Ausstellung<br />
seien „begeistert und überwältigt“<br />
vom großen Zuspruch, erklärte Marx in<br />
seiner Predigt und dankte allen Haupt- und<br />
Ehrenamtlichen, die sich im Rahmen der<br />
Ausstellung engagiert hatten. Die Ausstellung<br />
sei weit mehr als eine „museale Veranstaltung“<br />
gewesen. Vielmehr habe sie auch<br />
neu die Frage gestellt, welche Bedeutung<br />
der christliche Glaube heute und in Zukunft<br />
für Europa haben könne.<br />
232<br />
unitas 3-4/2007<br />
Die Entscheidung Konstantins, Christ zu<br />
werden, habe im 4. Jahrhundert einen „Qualitätssprung<br />
in der Geschichte Europas“<br />
bedeutet. „Es war vielleicht die wichtigste<br />
Aufklärung; es war etwas Großes, etwas<br />
Wunderbares“, betonte Bischof Marx. Die<br />
Ausstellung und insbesondere auch die<br />
zahlreichen Begleitveranstaltungen hätten<br />
zur stärkeren Auseinandersetzung mit der<br />
Zeit Konstantins beigetragen, und hiervon<br />
ausgehend mit der Frage, auf welchem<br />
Fundament die europäische Gesellschaft<br />
aufgebaut sei, was Europa verbindet: „Diese<br />
Wende hat bis heute prägenden Charakter<br />
für Europa. Das verbindende Element, der<br />
rote Faden in der europäischen Geschichte<br />
war der christliche Glaube. Und diese<br />
Geschichte ist noch nicht zu Ende“, sagte<br />
Bischof Marx. Er rief die Gläubigen dazu auf,<br />
sich immer wieder neu die Frage nach der<br />
eigenen Identität zu stellen und zu überlegen,<br />
was der christliche Glaube auch zur<br />
Zukunft Europas beitragen könne. An die<br />
Trierer appellierte der Bischof, sich immer<br />
wieder neu bewusst zu machen, „wie großartig<br />
die Geschichte der Stadt Trier ist.“<br />
Solidarität mit<br />
verfolgten Christen<br />
BERLIN. Zur Solidarität mit den Christen im<br />
Nahen Osten hat der Vorsitzende der<br />
Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal<br />
Lehmann, am Donnerstag in Berlin aufgerufen.<br />
Die Lage der Christen in Israel,<br />
Ägypten, Palästina und dem Irak steht in<br />
diesem Jahr im Mittelpunkt der Initiative<br />
„Solidarität mit verfolgten und bedrängten<br />
Christen“ der Deutschen Bischofskonferenz.<br />
Mit ihr wollen die deutschen Bischöfe die<br />
Aufmerksamkeit von Kirchengemeinden<br />
und Öffentlichkeit auf die Situation jener<br />
Christen lenken, deren Menschenrechte,<br />
besonders das Recht auf Religionsfreiheit,<br />
eingeschränkt und missachtet werden,<br />
erklärte Kardinal Lehmann bei der Vorstellung<br />
des diesjährigen Schwerpunktthemas.<br />
Eine von Kardinal Lehmann in<br />
Berlin präsentierte Arbeitshilfe der<br />
Deutschen Bischofskonferenz schildert<br />
beispielhaft die Situation von Christen in<br />
Israel, Ägypten, Palästina und dem Irak.<br />
„Ohne die Solidarität und die Unterstützung<br />
der Schwesterkirchen aus dem Ausland<br />
können die Christen in dieser Region<br />
mittelfristig nicht überleben“, so Lehmann.<br />
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz<br />
unterstrich, dass die unterschiedlichen<br />
politischen und gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen in diesen<br />
Ländern eine pauschale Beurteilung der<br />
Situation der dort lebenden Christen verbieten.<br />
Generell seien Christen in dieser Region<br />
jedoch vielfältigen Benachteiligungen<br />
und Bedrängnissen ausgesetzt und viele<br />
verließen deshalb ihre Heimatländer: „Die<br />
ältesten christlichen Gemeinden stehen<br />
mancherorts vor dem Aus“, erklärte Kardinal<br />
Lehmann. Sein Statement im Wortlaut<br />
sowie weitere Informationen zur Initiative<br />
„Solidarität mit verfolgten und bedrängten<br />
Christen“ im Internet unter www.dbk.de.<br />
Die Informationsbroschüre „Solidarität mit<br />
verfolgten und bedrängten Christen –<br />
Naher Osten“ (Arbeitshilfe Nr. 210) kann<br />
beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz<br />
bestellt werden (Fax: 0228/103-<br />
330; E-Mail: broschueren@dbk.de).<br />
Papst Benedikt zu Studenten:<br />
„Schwimmt gegen den Strom!“<br />
ROM. Katholische Studierende sollten<br />
„gegen den Strom schwimmen“, erklärte<br />
Papst Benedikt XVI. am 9. November vor<br />
einer 120-köpfigen Delegation der italienischen<br />
Studentenföderation (FUCI), die er<br />
in der Sala Clementina in Audienz empfing:<br />
„Wer ein Jünger Christi sein möchte, ist dazu<br />
aufgerufen, gegen den Strom zu schwimmen.<br />
Er darf sich nicht von Stimmen angezogen<br />
fühlen, die von verschiedenen<br />
Seiten herkommen und die ein arrogantes<br />
und gewalttätiges Verhalten propagieren,<br />
das geprägt ist von Rücksichtslosigkeit und<br />
der Suche nach Erfolg mit allen Mitteln.<br />
Man kann in der heutigen Gesellschaft eine<br />
manchmal ungezügelte Tendenz feststellen,<br />
sich auf die äußere Erscheinung zu beschränken,<br />
leider auf Kosten des Seins.“<br />
Papst Benedikt XVI. sprach auch über das<br />
Verhältnis zwischen Vernunft und Glaube.<br />
Eine wissenschaftlich fundierte Diskussion<br />
könne nur an „geeigneten und gut<br />
ausgestatten Universitäten“ durchgeführt<br />
werden. Dabei kritisierte der Papst die<br />
aktuelle Situation vieler Universitäten in<br />
Italien.<br />
Stellenanzeige<br />
Auf Stellen als Vorstandsassistent /<br />
Trainee Personalberatung (m/w) macht<br />
Bundesbruder Thomas Haupt von der<br />
„GfM Gesellschaft für Managementberatung<br />
AG“ aufmerksam. Er sucht für<br />
seine Gesellschaft in Berg b. Neumarkt<br />
i. d. OPf. – ca. 25 Kilometer südöstlich<br />
von Nürnberg und direkt an der<br />
Autobahn A3 gelegen – zwei weitere<br />
Mitarbeiter. Mehr im Internet unter<br />
www.gfm-consult.de.<br />
Kontakt:<br />
Ursula Haupt, Leiterin Research,<br />
Tel. 09189 / 41222-26,<br />
E-Mail: U.Haupt@gfm-consult.<br />
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen<br />
per E-Mail an<br />
personalberatung@gfm-consult.de<br />
oder per Post an:<br />
GfM Gesellschaft für Managementberatung<br />
AG, Geschäftsbereich<br />
Personalberatung, Neumarkter Str. 25,<br />
D-92348 Berg b. Neumarkt i. d. OPf.
BUND KATHOLISCHER RECHTSANWÄLTE ZIEHT POSITIVE BILANZ<br />
Jahrestagung in Bonn stand im Zeichen von Kooperationen<br />
Die Jahrestagung des Bundes Katholischer<br />
Rechtsanwälte (BKR), die alljährlich<br />
in Bonn stattfindet, widmete<br />
sich diesmal unter dem Motto „Wir<br />
steuern Recht“ dem Thema der Kooperation<br />
zwischen Rechtsanwälten<br />
und Steuerberatern. Hierzu konnte<br />
der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dieter<br />
Trimborn v. Landenberg (CV), zahlreiche<br />
Berufsträger beider Professionen<br />
begrüßen, die ein abwechslungsreiches<br />
Programm erwartete.<br />
Rechtsanwältin Katharina Willerscheid<br />
(Steuerberaterkammer Köln) und Rechtsanwalt<br />
Albert Vossebürger (Rechtsanwaltskammer<br />
Köln) eröffneten die Tagung am 17.<br />
November im Arminen-Haus mit einem<br />
gemeinsamen Referat über berufsrechtliche<br />
Aspekte der Zusammenarbeit. Für die<br />
Rechtsanwälte gilt seit Mitte 2007 ein<br />
neues Berufsrecht, das die Eröffnung von<br />
Zweigstellen erlaubt, was im Hinblick auf<br />
Bürogemeinschaften mit Steuerberatern<br />
von besonderem Interesse sein dürfte. Bei<br />
den Steuerberatern gibt es neuerdings sog.<br />
Fachberater, die – wie Fachanwälte – ein<br />
besonderes Spezialwissen nachgewiesen<br />
haben.<br />
Es folgten Erfahrungsberichte über<br />
praktizierte Kooperationen von Steuerberaterin<br />
Jutta Stüsgen vom Bund katholischer<br />
Unternehmer und Rechtsanwalt<br />
Ulrich Vahlhaus (CV). Hier wurde klar, dass<br />
die Kommunikation das A und O einer funktionierenden<br />
Kooperation ist. Die Partner<br />
sollten die gleiche Arbeitsweise und auch<br />
Honorarpolitik verfolgen, um Irritationen<br />
bei den gemeinsamen Mandanten zu vermeiden.<br />
„Schließlich geht es darum, dass in<br />
einer Kooperation zwei zum Wohle aller –<br />
also auch des Mandanten – zusammenarbeiten“,<br />
stellte Frau Stüsgen in ihrem<br />
Referat klar. In einem dritten Block wurden<br />
praxisnahe Tipps zum Marketing und zu<br />
Lösungsansätzen bei der Finanzbuchhaltung<br />
gegeben.<br />
Auch das Feiern kam nicht zu kurz. Beim<br />
abendlichen BKR-Kommers im bis auf den<br />
letzten Platz besetzten Kneipsaal - darunter<br />
viele Aktive der UNITAS, begrüsste der präsidierende<br />
Senior der gastgebenden<br />
Arminen, Roland Beerenbrinker (KV), sehr<br />
herzlich den Vorsitzenden des Kolpingwerks<br />
Deutschland, Thomas Dörflinger<br />
MdB, als Festredner. In seinem Vortrag<br />
„Zwischen Kirche und Staat – Haben katholische<br />
Verbände ein Zukunft?“, bekräftigte<br />
Dörflinger (Bild Mitte) die Zukunftsfähigkeit<br />
der katholischen Verbände, die allerdings in<br />
einer zunehmend säkularen Gesellschaft<br />
stets an ihrem Profil arbeiten müssten.<br />
Es sei zu beobachten, dass viele Vereine<br />
stark mit sich selbst beschäftigt seien, was<br />
besonders bei der Lektüre der Vielzahl der<br />
Verbandszeitschriften auffalle. Stattdessen<br />
könnten durch Kooperationen Kräfte gebündelt<br />
und der Zusammenhalt aufgrund<br />
der gemeinsamen Wertebasis gestärkt<br />
werden. Ein Beispiel sei die Schulung von<br />
Betriebs- und Personalräten aus dem Kolpingwerk<br />
durch Mitglieder des BKR. „Hier<br />
gibt es einige Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten“,<br />
so Dörflinger wörtlich.<br />
In seinem Grusswort betonte der Vertreter<br />
des AHB-Vorstandes des CV, Rechtsanwalt<br />
Ulf Reermann (R-M), den interkorporativen<br />
Ansatz des BKR, der Mitglieder aus<br />
dem UV, KV und CV vereine: „Nur wenn wir<br />
geschlossen auftreten, werden wir in der<br />
Öffentlichkeit wahrgenommen. Die Art und<br />
Weise der Zusammenarbeit im BKR sind<br />
dafür sicherlich ein, wenn nicht das<br />
Paradebeispiel.“<br />
Der Verbandsgeschäftsführer des UNI-<br />
TAS-Verbandes, Dipl.-Kfm. Dieter Krüll betonte<br />
in seinem Grusswort ebenfalls den<br />
positiven Wert des BKR für das katholische<br />
Korporationswesen. „Wir haben doch alle<br />
das gleiche Fundament: Die Kraft des<br />
katholischen Glaubens!“ stellte Krüll fest<br />
und appellierte an die Festcorona den gemeinsamen<br />
Weg weiter zu gehen.<br />
Im Rahmen der Mitgliederversammlung<br />
konnte der Vorstand ein positives Fazit<br />
ziehen, nachdem die Mitgliederzahl im<br />
abgelaufenen Jahr auf über 180 angestiegen<br />
ist und die Jahrestagung gut besucht<br />
war. Im kommenden Jahr wird der BKR sein<br />
zehnjähriges Bestehen feiern. Die inhaltliche<br />
Arbeit soll sich noch mehr mit dem<br />
beruflichen Selbstverständnis befassen.<br />
Ziel ist die Erarbeitung eines Ethik-Kodex,<br />
der für alle Mitglieder verbindlich sein soll.<br />
Der Vorsitzende des BKR dankte allen,<br />
die zum erfolgreichen Gelingen der Jahrestagung<br />
beigetragen haben, insbesondere<br />
den Aktiven der Gastgeber.<br />
Mehr zum BKR unter:<br />
www.bkr-netzwerk.de<br />
Der Termin der nächsten Jahrestagung<br />
wurde bereits festgelegt. Die nächste<br />
Jahrestagung des BKR findet am 15.<br />
November 2008 wieder in Bonn statt.<br />
unitas 3-4/2007 233
„Meine lieben unitarischen Freunde!<br />
Es sind nun über 20 Jahre her, daß die<br />
<strong>Unitas</strong> in ihrer derzeitigen Gestalt ins<br />
Leben gerufen wurde. Mit dem innigsten<br />
Dank gegen Gott erinnern wir uns all<br />
der Freuden und geistigen Vortheile,<br />
welche unsere Studien und unser Leben<br />
dem academischen Freundeskreise<br />
verdanken, der in Bonn, Münster und<br />
Tübingen uns die Heimath ersetzte.“<br />
234<br />
135 Jahre „unitas“:<br />
Von der „Roma“ bis zur Online-Ausgabe<br />
Mit diesen Worten richtete sich Bbr.<br />
Hermann Ludger Potthoff mit der in Dresden<br />
gedruckten „ROMA“ an seine Bundesbrüder.<br />
Das Titelblatt der ersten Ausgabe<br />
trägt das Datum 1. Januar 1872. 135 Jahre sind<br />
seitdem vergangen – eine lange Zeit und<br />
kaum zu zählende Ausgaben berichten seitdem<br />
über das, was auch spätere Generationen<br />
noch einmal zur Hand nehmen<br />
können. Was nicht bedeutet, dass die Zeitschrift<br />
erst seit 135 Jahren erscheint, denn<br />
die „unitas“ gehört zu den ältesten katholischen<br />
Periodika ihrer Art. Leser dieser Tage<br />
mögen sich darüber wundern, dass der Kopf<br />
unseres aktuellen Titelblattes inzwischen<br />
den 147. Jahrgang ausweist. Dies allerdings<br />
führt sich auf die in den Anfangsjahren<br />
ausgetauschten „Festbriefe“ zurück, die seit<br />
der ersten Generalversammlung in Düsseldorf<br />
1860 anlässlich der unitarischen Vereinsfeste<br />
zwischen den Coeten der UNITAS<br />
ausgetauscht wurden. Auf Antrag des aus<br />
unitas 3-4/2007<br />
Werden stammenden Hermann Ludger<br />
Potthoff, der die 1847, vor 160 Jahren, in Bonn<br />
gegründete „Ruhrania“ 1855 zur UNITAS<br />
umgeformt hatte und seit 1863 als Hofprediger<br />
an der Hofkirche in Dresden tätig war,<br />
beschloss die GV 1871 in Bonn-Poppelsdorf<br />
unter anderem die Herausgabe eines „Vereinsorgans<br />
für die Mitglieder der „clerikalen<br />
und akademischen UNITAS“. Potthoff wurde<br />
die Schriftleitung übertragen.<br />
Vor 125 Jahren:<br />
Die erste „ROMA / Correspondenz“<br />
Der Name der am 1. Januar 1872 als<br />
Treuebekenntnis zu Papst Pius IX. unter<br />
dem Namen ROMA erschienenen Zeitung<br />
klang damals vielen allerdings zu anspruchsvoll.<br />
Potthoff nahm die Kritik auf<br />
und nannte die Zeitschrift ab 1873 „Correspondenz<br />
der UNITAS“, versah sie mit dem<br />
Untertitel „cor unum et anima una“, legte<br />
aber sein Amt als Schriftleiter im Mai nieder.<br />
Vizepräses J. Eich übernahm die Redaktion.<br />
Die „Correspondenz des Priester-<br />
Vereins <strong>Unitas</strong>“ (Frühjahr 1874) und die „XP<br />
– Correspondenz der <strong>Unitas</strong>“ (August / Oktober<br />
1874) liefen mit der Auflösung der<br />
„klerikalen <strong>Unitas</strong>“ aus. Fortan erschienen<br />
die Ausgaben unter dem Titel „Correspondenzblatt“<br />
(CB, dann KB), redigiert von<br />
den Präsides der zwischen Bonn, Münster<br />
und Würzburg wechselnden Vororte.
Vor 100 Jahren:<br />
Die Redaktion kommt nach Essen<br />
Mit dem aktuellen Jahrgang 2007<br />
jährte sich zum 110. Mal die Einrichtung des<br />
Verbandsamtes eines Schriftleiters. Denn<br />
im Juli 1897 wurde auf Beschluss der 41. GV<br />
in Würzburg ein Alter Herr zum Schriftleiter<br />
gewählt. Die Redaktion übernahm mit<br />
Jahrgang 52/1898 Dr. Joseph Prill (*9.6.1852<br />
in Beuel bei Bonn, † 8.10.1935 in Lohmar),<br />
Päpstlicher Hausprälat und Professor, der<br />
bei UNITAS-Salia Bonn aktiv gewesen war.<br />
Als Religionslehrer am Essener Burggymnasium<br />
hatte er im Todesjahr von Hermann<br />
Ludger Potthoff 1888 in dessen Geburtsort<br />
Werden den ersten Altherrenzirkel des<br />
UNITAS-Verbandes gegründet. Von 1898 bis<br />
1903 lag die Schriftleitung nun in seinen<br />
Händen und ab 1900 erschien das „Korrespondenzblatt“<br />
erstmals unter dem Namen<br />
„<strong>Unitas</strong>, Organ des wissenschaftlichen<br />
katholischen Studentenvereins <strong>Unitas</strong>“.<br />
1903 wechselte die Redaktion nach Köln: Bis<br />
1906 war Dr. Joseph Heß Schriftleiter. Es<br />
folgten Pfr. Aloys Hülster (1906-14), Rechtsanwalt<br />
Dr. Joseph Thöne und Werner<br />
Ohlendorf, zunächst als Kriegsvertreter<br />
wieder Pfr. Hülster (1915-1921), 1921-33<br />
Werner Ohlendorf, 1933-1952 Dr. Karl Rüdinger,<br />
1953-1962 Dr. Peter Josef Hasenberg<br />
(Köln), 1963/64 Reinhard Brands, 1965-67<br />
Karl-Josef Baum, 1968-1989 Dr. Walter Ebel<br />
(Kiel), 1989-1992 Hermann Josef Großimlinghaus<br />
(Bonn), 1992-1996 Dr. Rudolf<br />
Hammerschmidt (Bonn), 1996-1999 Franz<br />
Josef Hesse (Gronau), der die Ausgaben bei<br />
der Lensing-Druckerei fertigen ließ.<br />
100 Jahre später:<br />
„<strong>Unitas</strong>“ wieder in Essen<br />
Genau 100 Jahre nach der Übernahme<br />
des Blattes durch Joseph Prill kehrte die<br />
Zeitschrift wieder in die Heimat des Verbandsgründers<br />
Hermann Ludger Potthoff<br />
zurück. Seit 1999 zeichnet Dr. Christof Beckmann<br />
(Essen-Borbeck) für die Schriftleitung<br />
verantwortlich. Die inzwischen achtjährige<br />
Redaktionsgemeinschaft mit Hermann-<br />
Josef Großimlinghaus reduzierte die Zahl<br />
der jährlichen Ausgaben von zunächst<br />
sechs auf vier, ließ den Druck vom Essener<br />
Sutter-Verlag/DZS besorgen und gab die<br />
Zeitschrift erstmals in Farbe heraus. Der<br />
Umfang umfasst 220-260 Seiten pro Jahr.<br />
Vor dem Sommer 2003 ging die Zeitung<br />
zunächst mit einer Auswahl von Artikeln<br />
online und ist seit Ausgabe 1/2006 im pdf-<br />
Format über die Verbandshomepage<br />
www.unitas.org für jeden Internetnutzer<br />
vollständig weltweit zu lesen.<br />
unitas 3-4/2007 235
Bbr. Helmut Führer<br />
MÜNSTER/ESSEN. Unser lieber Bundes- und<br />
Vereinsbruder StD a. D. Helmut Führer, einer<br />
der Wiederbegründer der UNITAS Ruhrania<br />
nach dem Krieg, ist am 19. Juni 2007 in<br />
Münster an den Folgen seiner schweren<br />
Erkrankung gestorben. Die UNITAS verliert<br />
mit ihm einen herausragenden Unitarier,<br />
der sich besonders um die Ruhrania<br />
verdient gemacht hat.<br />
Helmut Führer wurde am 19. September<br />
1926 in Ibbenbüren geboren. Als sein Vater<br />
1936 zum Oberregierungsrat in Naumburg<br />
an der Saale befördert wurde, besuchte er<br />
dort die Katholische Volksschule und anschließend<br />
bis zur Einberufung als Luftwaffenhelfer<br />
im Februar 1943 das humanistische<br />
Domgymnasium in Naumburg.<br />
Mit der Einberufung zum Reichsarbeitsdienst<br />
im März 1944 wurde ihm mit der<br />
Entlassung aus der 7. Klasse des Gymnasiums<br />
der Reifevermerk zuerkannt.<br />
Nach der Kapitulation 1945 war Bbr.<br />
Führer vom Wintersemester 1945/46 bis<br />
zum Sommersemester 1947 an der Universität<br />
in Jena immatrikuliert und studierte<br />
Physik, reine und angewandte Mathematik,<br />
sowie Chemie und Geografie. Da er wegen<br />
des Krieges nur einen Reifevermerk besaß,<br />
musste er eine Ergänzungsprüfung am<br />
Endes des ersten Semesters in den Schulfächern<br />
ablegen und erhielt am 19. März<br />
1946 das Zeugnis der Reife.<br />
Im Sommer 1947 wechselte Helmut<br />
Führer von Jena nach Münster, um dort sein<br />
Studium fortzusetzen. Um die Voraussetzungen<br />
für die Zulassung zu erfüllen, musste<br />
er im Winter 1947/48 im Bautrupp der<br />
Universität Dienst tun. Vom Sommersemester<br />
1948 konnte er dann endlich sein<br />
Studium in reiner und angewandter<br />
Mathematik und Physik fortsetzen und im<br />
März 1952 vor dem wissenschaftlichen<br />
Prüfungsamt in Münster mit dem ersten<br />
Staatsexamen für das Lehramt an höheren<br />
Schulen erfolgreich abschließen.<br />
236<br />
unitas 3-4/2007<br />
�IN<br />
MEMORIAM<br />
Seinen Vorbereitungsdienst leistete er<br />
im ersten Jahr am Gymnasium Dionysianum<br />
in Rheine ab und wechselte dann zum<br />
Studienseminar II in Münster. Nach dem<br />
zweiten Staatsexamen wurde er an das<br />
Gymnasium Paulinum versetzt, an dem er<br />
Mathematik und Physik bis zu seiner Pensionierung<br />
im Jahre 1990 unterrichtete.<br />
Seine besondere Liebe galt dort besonders<br />
der Astronomie, die er mit großem Engagement<br />
am Paulinum von 1959 an aufgebaut<br />
hat. Und es gelang ihm immer wieder, mit<br />
seinen astronomischen Untersuchungen<br />
die Schüler zu faszinieren und zu eigenen<br />
Experimenten anzuregen.<br />
Sein besonderer Verdienst ist es, am altsprachlichen<br />
Paulinum mit seinen klassisch-humanistischen<br />
Bildungsgängen den<br />
mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fächern einen ebenbürtigen Stand zu<br />
verschaffen. Aus heutiger sicht ist das eine<br />
Selbstverständlichkeit, für die damalige<br />
Zeit aber eine große Leistung.<br />
Pädagoge mit Leib und Seele<br />
am Paulinum in Münster<br />
Helmut Führer war im wahrsten Sinne<br />
des Wortes ein Pädagoge, der mit Leib und<br />
Seele hinter dem Stand, was er lehrte. Mit<br />
Geschick hat er den Schülern vor allem das<br />
Auffinden mathematischer Vorgehensweisen<br />
und Methoden nahe gebracht. Seine<br />
größte Stärke war das, was in den naturwissenschaftlichen<br />
Fächern besonders<br />
schwierig und wichtig ist: Er konnte so<br />
erklären, dass jeder es nachhaltig verstehen<br />
konnte. Deshalb sind viele Schülergenerationen<br />
noch heute dankbar für den Unterricht,<br />
den sie bei Helmut Führer erleben<br />
durften.<br />
1964 wurde er in das Wissenschaftliche<br />
Prüfungsamt für das Lehramt an Gymnasien<br />
berufen. Ein Jahr später erfolgte die<br />
Beförderung zum Oberstudienrat. Neben<br />
seinem Unterricht bildete Helmut Führer<br />
von 1966 an als Fachleiter für Mathematik<br />
am Studienseminar in Münster bis zu<br />
seiner Pensionierung Generationen von<br />
jungen Mathematiklehrern aus.<br />
1970 erfolgte die Ernennung zum<br />
Studiendirektor als Fachleiter am Bezirksseminar<br />
in Münster. In den nachfolgenden<br />
Jahren hat Helmut Führer in vielen Kursen<br />
Altphilologen auf die Erweiterungsprüfung<br />
im Fach Mathematik für das Lehramt am<br />
Gymnasium erfolgreich vorbereitet und<br />
damit einen damals wichtigen Beitrag zur<br />
Behebung des extremen Lehrermangels in<br />
Mathematik am Gymnasium geleistet.<br />
Auch die UNITAS verdankt ihm sehr viel:<br />
1948 trat Helmut Führer in die UNITAS<br />
Sugambria in Münster als junger Fuchs ein.<br />
Und als die UNITAS Ruhrania im selben Jahr<br />
nach dem zweiten Weltkrieg wiederbegründet<br />
wurde, wechselte er als erster<br />
Fuchs in die neue Ruhrania. Am 1. Januar<br />
1954 wurde er philistriert.<br />
Als im Jahre 1981 die Aktivitas der<br />
Ruhrania sich auflöste, blieb aber der Altherrenverein<br />
mit einem neuen Vorstand<br />
bestehen. Helmut Führer übernahm damals<br />
das Amt des Schriftführers und war<br />
maßgeblich bei der Wiederbegründung der<br />
Aktivitas im Ruhrgebiet im Jahre 1991<br />
beteiligt. Er gehörte zu den maßgeblichen<br />
Befürwortern und konnte sich gegen<br />
kritische Stimmen erfolgreich durchsetzen.<br />
Sein aus solider Sachkenntnis und eine aus<br />
Weitsicht geprägten Einschätzung und<br />
seine stets noble Haltung profilierten ihn<br />
zu einem glaubwürdigen und überzeugenden<br />
Ruhranen. Von ihm stammt auch die<br />
Geschichte der UNITAS Ruhrania zwischen<br />
den Jahren 1950-1990. In den letzten Jahren<br />
konnte er leider aus gesundheitlichen<br />
Gründen nicht mehr aktiv an den Veranstaltungen<br />
teilnehmen.<br />
In seinen letzten Lebensjahren und vor<br />
allem letzten Monaten galt sein besonderes<br />
Interesse der astronomischen Domuhr<br />
im Paulus Dom zu Münster. Sein Anliegen<br />
war es, eine neue Schrift über diese geniale<br />
astronomische Domuhr zu verfassen, die<br />
die Besonderheiten mit den gegenläufigen<br />
Umläufen endlich richtig erklärt und für<br />
jeden verständlich macht. Leider blieb dieses<br />
Werk unvollendet. Bbr. Helmut Führer<br />
ist am 25.06.07 in Münster auf dem Zentralfriedhof<br />
beerdigt worden. Viele Bundesbrüder<br />
und eine große Zahl von Ruhranen<br />
haben ihm das letzte Geleit gegeben.<br />
Jörg Lahme,<br />
Vorsitzender des Altherrenvereins<br />
Bbr. Walter Carl Nitsch<br />
NEUSS. Architekt Dipl.-Ing. Walter Carl<br />
Nitsch aus Neuss, aktiv seit März 1948<br />
bei UNITAS Assindia Aachen und anschließend<br />
bei UNITAS Rheinfranken Düsseldorf,<br />
ist am 11.10.2007 verstorben. Philis-
triert zum 4. März 1951, war er in den Zirkeln<br />
in Düsseldorf und Neuss prägend aktiv.<br />
Der Name des angesehenen Neusser<br />
Architekten ist eng mit der im Vorjahr abgeschlossenen<br />
Restaurierungsphase des<br />
St.-Quirinus-Münsters verbunden. „Er hat<br />
mit seiner gekonnten Arbeit die Grundlage<br />
für das gesamte Projekt gelegt", erinnert<br />
Msgr. Dr. Hans Dieter Schelauske, damals<br />
als Oberpfarrer an St. Quirin, an die gemeinsame<br />
Zeit. Walter Nitsch wurde 85<br />
Jahre alt. Die feierlichen Exequien wurden<br />
in St. Quirin gehalten, in jener Münsterkirche,<br />
die ihr gelungenes „Lifting“ zu<br />
einem guten Teil dem Architekten aus<br />
Leidenschaft verdankt, der an der Universität<br />
auch Kunst-und Kirchengeschichte<br />
gehört hatte. Von 1982 bis 1986 hat er<br />
bereits federführend die gründliche Gesamtsanierung<br />
der Dreikönigenkirche geleitet.<br />
Walter Nitsch wurde am 25. Juni 1922 in<br />
Trier geboren. Da sein Großvater aus Schlesien<br />
stammte, bezeichnete er sich als „Ein-<br />
Viertel-Schlesier". Nach Krieg und Studium<br />
fand er seine erste Anstellung im Trierer<br />
Architekturbüro von Heinrich Otto Vogel.<br />
1951 wechselte er zu Heinz Thoma nach<br />
Düsseldorf. 1955 machte sich Nitsch als<br />
Architekt in der nordrhein-westfälischen<br />
Landeshauptstadt selbstständig und zog<br />
1965 nach Neuss, wo er seitdem mit seiner<br />
Frau Marion in Gnadental lebte. Aus der<br />
Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter<br />
hervor. In seinem Beileidsschreiben an die<br />
Familie würdigte Verbandsgschäftsführer<br />
Dieter Krüll einen „treuen Unitarier und<br />
Querdenker“.<br />
Bbr. Bernhard Zurholt<br />
MÜNSTER. Am 4. August 2007 gaben eine<br />
größere Anzahl von Unitariern ihrem am 31.<br />
Juli 2007 verstorbenen Bundesbruder Bernhard<br />
Zurholt v. Cato auf dem Friedhof seines<br />
Heimatortes Eggerode das letzte Geleit.<br />
Bernhard Zurholt, am 21. November<br />
1930 geboren, stammte aus einer münsterländischen<br />
Bauernfamilie. Nach dem Abitur<br />
in Meppen ging er zunächst nach Freiburg,<br />
um Altphilologie zu studieren, wechselte<br />
jedoch nach einem Semester das Studien-<br />
fach und wandte sich der Jurisprudenz zu.<br />
Im SS 1950 wurde er in die UNITAS Lichtenstein<br />
in Freiburg rezipiert. Vom WS 1952/53<br />
an setzte er sein Studium an der Universität<br />
Münster fort. Hier schloss er sich der kurz<br />
zuvor wiedergegründeten UNITAS Frisia an.<br />
Im SS 1956 war er deren Senior. Nach Abschluss<br />
seiner juristischen Ausbildung mit<br />
dem Assessorexamen war er beim Westfälisch-Lippischen<br />
Landwirtschaftverband<br />
in Münster beschäftigt. Daneben bekleidete<br />
er jahrelang das Amt des Ehrenseniors<br />
in der UNITAS Frisia und war außerdem<br />
stellvertretender Vorsitzender des AHV<br />
UNITAS Frisia. Er besaß eine tiefe Frömmigkeit<br />
und lebte persönlich sehr anspruchslos.<br />
Das Zeitgeschehen beobachtete<br />
er stets mit kritischer Aufmerksamkeit<br />
und scheute sich auch nicht, im größeren<br />
Kreis seine Meinung unmissverständlich zu<br />
äußern. Somit wurde er seinem Biernamen<br />
Cato auch im späteren Leben voll und ganz<br />
gerecht. Die unitarische Gemeinschaft war<br />
für ihn so etwas wie eine Ersatzfamilie. Es<br />
gab in Münster über mehrere Jahrzehnte<br />
wohl keine unitarische Veranstaltung, die<br />
er nicht besuchte. Noch sechs Wochen vor<br />
seinem Tode war er – wenigstens noch für<br />
kurze Zeit und bereits von schwerer Krankheit<br />
gezeichnet – bei einem Treffen des<br />
AHV-Frisia in Münster erschienen. Nun hat<br />
ihn der Herrgott zu sich geholt. Er möge<br />
ruhen in Gottes ewigem Frieden.<br />
Heinrich Avenwedde, Münster<br />
Bbr. Konrad Müller<br />
MITTELBERG/SCHWARZENBERG. Am 10.<br />
September verstarb kurz vor seinem 71. Geburtstag<br />
völlig unerwartet Bundesbruder<br />
Konrad Müller, Pfarrer in Mittelberg und<br />
Schwarzenberg im Allgäu. Bundesbruder<br />
Konrad Müller, geboren am 28.9.1936, trat<br />
1954 der UNITAS Guelfia München bei und<br />
wurde dort im darauf folgenden Jahr<br />
geburscht. 1959 trat er zur neu gegründeten<br />
UNITAS Vindelicia in Augsburg über<br />
und wurde 1961 nach seiner Priesterweihe<br />
in Dillingen/Donau philistriert.<br />
Nach seinen Kaplansjahren ging Bbr.<br />
Konrad Müller für zwölf Jahre nach Bolivien<br />
(1965-77). In die Diözese Augsburg und<br />
seine Allgäuer Heimat zurückgekehrt, hielt<br />
er zu seiner bolivianischen Pfarrei engen<br />
Kontakt. In ihr hatte er einen Teil seines<br />
Herzens zurückgelassen. Aus dieser Verbundenheit<br />
heraus engagierte sich Bbr.<br />
Müller für Misereor und den fairen Handel<br />
der Industrieländer mit den Ländern der<br />
dritten Welt. Aus seinem sozialen Engagement<br />
heraus nahm er auch immer wieder<br />
kritisch Stellung zu Entwicklungen in Staat<br />
und Kirche in unserem Lande. Wie sehr<br />
seine Gemeindemitglieder ihren Herrn<br />
Pfarrer schätzten, zeigte die überwältigende<br />
Zahl der Trauergäste. Unter diesen<br />
waren auch Bundesbrüder der Vindelicia,<br />
der der Verstorbene immer die Treue<br />
gehalten hatte, vor allem als Vereinsfest-<br />
Zelebrant.<br />
Karl-Heinz Sieber, AHZ-X<br />
P. Karl Kronenberg MSF<br />
WÜRZBURG/BETZDORF. Der älteste geistliche<br />
Bundesbruder von UNITAS-Würzburg,<br />
StD a. D. P. Karl Kronenberg MSF, verstarb im<br />
Alter von 93 Jahren in Betzdorf. Nach<br />
seinem Eintritt in den Orden der Missionare<br />
der Heiligen Familie wurde er 1947 zum<br />
Priester geweiht und am 23. Februar 1952<br />
bei der Hetania rezipiert, was die Ordensoberen<br />
an und für sich nicht gerne sahen.<br />
Nach seinen Examina und der Philistrierung<br />
1958 war er im Lehramt tätig am<br />
Gymnasium des Ordens in Biesdorf/Eifel.<br />
Der wohl eher unbekannte Orden hat<br />
übrigens seit 2000 eine Niederlassung im<br />
Kloster Bronnbach im Taubertal (ehemalige<br />
Zisterzienserabtei und früher im Besitz von<br />
Bbr. Fürst von Löwenstein-Wertheim; polnische<br />
Ordensangehörige geben der ausgedehnten<br />
Klosteranlage wieder ihren<br />
geistlichen Charakter). Seinen Lebensabend<br />
verbrachte er im Missionshaus in Betzdorf/Siegerland.<br />
Aus seinen Erinnerungen,<br />
die er mir zukommen ließ, hier ein kleiner<br />
Ausschnitt:<br />
„Nach meiner Profess hatte ich Kontakt<br />
mit der heute Seligen Edith Stein im Kölner<br />
Karmel; wir unterhielten uns meist über<br />
Gott und die Analogia entis... Weil ich einen<br />
Tag und viereinhalb Stunden zu spät<br />
geboren wurde, musste ich als 23-Jähriger<br />
1937 zwei Jahre beim Kommiss dienen in<br />
Bad Kreuznach, der Weinstadt. Dort trank<br />
ich zum ersten Mal in meinem Leben Wein. >><br />
unitas 3-4/2007 237
In Bochum, meiner Heimat, trank man nur<br />
Bier, dazwischen einen Klaren. Trockener<br />
Wein soll gut sein für die Nieren... 1939<br />
wurden wir in Berlin zur Reichs-Sporthalle<br />
zu einer Kundgebung beordert. Ich stand<br />
zwei Meter vom Hauptgang entfernt, als<br />
der dicke Göring, dahinter Himmler und mit<br />
weibischem Gang Hitler vorbeigingen.<br />
Gegen die Redewut des Hitler betete ich im<br />
Stillen für mich zum Hl. Michael: „Heil'ger<br />
Ritter, Blitz, Gewitter, hau in Splitter den<br />
Satanszwitter.“ ... Später in Russland erhielt<br />
ich eine Abschrift der Predigt von Kardinal<br />
Galen über die Tötung der geistig Behinderten.<br />
Auf Besitz der Predigt stand Todesstrafe.<br />
Die Division war schlau und erklärte,<br />
es wären gefälschte Briefe, man solle sie abgeben.<br />
1948 kam ich nach der Priesterweihe<br />
für drei Semester nach Bonn zur Uni mit<br />
den Fächern Latein, Griechisch und Französisch.<br />
In Würzburg, wo ich in St. Benedikt<br />
wohnte, hielt ich im frz. Seminar eine Vorlesung<br />
über einen altfranzösischen Text.<br />
Die wollten mich gleich als Lektor für Altfranzösisch<br />
behalten. Ich hätte gern Latein<br />
weiter studiert. Aber mein Provinzialoberer<br />
sagte: Latein geben kann jeder Brevierbeter.<br />
Sie machen sofort Englisch und Französisch.<br />
Bei der UNITAS war ich Fuxmajor,<br />
vielleicht weil ich im Krieg Hauptmann der<br />
Reserve war. Für die Füxe gab ich Order aus,<br />
einen Tanzkurs zu absolvieren. Ob es das<br />
heute noch gibt?“<br />
Fritz Flach, AHVx UNITAS-Würzburg<br />
Bbr. Hans Zenk<br />
BAMBERG. Knapp 40 Jahre lang zwischen<br />
1948 und 1986 verbindet sich der Name<br />
Hans Zenk in Bamberg mit dem Komplex<br />
Musik in Chor und Orchester, Liedgut und<br />
Kammermusik. Als Musiklehrer am Neuen<br />
Gymnasium hat er 1948 nach seinem Studium<br />
an der Staatlichen Hochschule für<br />
Musik als Kinder und Jugendliche begeisternder<br />
Musikerzieher gewirkt. 1959 wurde<br />
er als Studienrat wegen seiner erworbenen<br />
Verdienste zum Dozenten für Musikpädagogik<br />
an die damals neu gegründete Pädagogische<br />
Hochschule berufen, wo er sich<br />
durch die Engführung seines Begriffes, was<br />
Musik sei, bei den sich dem Jazz und Beat<br />
zuwendenden Studenten nicht nur Freunde<br />
machte. 1986 ging er in den wohlverdien-<br />
238<br />
unitas 3-4/2007<br />
ten Ruhestand. In der UNITAS Bamberg<br />
bzw. München hatte er keine Aktivenzeit<br />
erlebt, so dass er erst nach zweisemestriger,<br />
freiwilliger Reaktivierung im WS 1949/50<br />
zum A-Philister werden konnte. Zwischen<br />
1958 und 1964 leitete er mit klaren und<br />
strengen Vorgaben den AHV der inzwischen<br />
zur Henricia mutierten Bamberger<br />
UNITAS. Sein fundamentalistisch geprägtes<br />
Weltbild forderte dabei des Öfteren den<br />
Widerspruch aus den Reihen der damals<br />
sehr starken Aktivitas heraus, so dass er<br />
sich 1964 nicht mehr zur Wiederwahl bereit<br />
erklärte und sich immer mehr ins Private<br />
zurückzog. In der persönlichen Begegnung<br />
jedoch ließ er das Interesse an seiner<br />
UNITAS immer wieder positiv aufscheinen.<br />
Er verstarb nach geduldig ertragener Leidenszeit<br />
am 27. 10. 2007 im 86. Lebensjahr.<br />
Die Henricia dankt ihm für sein geradliniges<br />
Engagement in einer Zeit des sich<br />
abzeichenenden Umbruchs der späten<br />
sechziger Jahre. Requiescat in pace!<br />
Dr. Dieter Heim<br />
Bbr. Josef Braun<br />
WÜRZBURG. An der Jubelkneipe im SS 2007<br />
konnte StD a. D. Josef Braun v/o Sepp wegen<br />
seiner schweren Krankheit leider nicht<br />
mehr teilnehmen. Im Geist jedoch – so<br />
versicherte er mir – sei er bei seiner Würzburger<br />
Korporation zugegen. Eine Woche<br />
später traf dann die Nachricht von seinem<br />
Tod bei mir ein.<br />
Bbr. Braun wurde am 1. Juli 1917 in<br />
Chudiwa im Böhmerland (damals: österreich-ungarische<br />
Monarchie; heute: Tschechien)<br />
geboren. Nach der Matura 1936 am<br />
von Jesuiten geleiteten Bischöflichen Gymnasium<br />
in Mariaschein/Erzgebirge studierte<br />
er zunächst in Budweis und Prag Philosophie<br />
und Theologie. Eingezogen in die<br />
Wehrmacht wurde er in Russland zweimal<br />
schwer verwundet. Da man ihm nach<br />
seiner Genesung bedeutete, dass das Reich<br />
keine Akademiker, sondern Offiziere benötige,<br />
kam er nach einem Offizierslehrgang<br />
wiederum an die russische Front, wo er von<br />
1944 bis 1950 im Ural und in Westsibirien<br />
harte Jahre in Gefangenschaft verbrachte.<br />
Nach der Vertreibung seiner Familie<br />
fand er in Regensburg einen Studienplatz<br />
für Latein, Deutsch, Geschichte und Erd-<br />
kunde und wurde zunächst am 6. Juni 1950<br />
bei UNITAS-Regensburg rezipiert, übernahm<br />
gleich im WS 50/51 die Charge des<br />
Conseniors, wechselte aber im SS 51 nach<br />
Würzburg, wo er der Hetania beitrat und<br />
deren scientia durch zwei Wissenschaftliche<br />
Sitzungen bereicherte. Als Mitarbeiter<br />
auf Burg Rothenfels, einer katholischen<br />
Jugend- und Bildungsstätte bei Marktheidenfeld,<br />
lernte er seine Frau Hildegund<br />
kennen. Da ihr Vater CVer war, kam ihr seine<br />
UNITAS-Nadel bekannt vor. Nachdem er<br />
sich auf ihr Nachfragen hin als Unitarier<br />
vorstellte, war er ihr sofort sympathisch;<br />
vom UV hatte sie gehört, dass er katholisch<br />
und schwarz sei. Die Hochzeit fand dann<br />
1953 statt.<br />
Nach der Philistrierung und der Anstellung<br />
am Lohrer Gymnasium war er in<br />
Marktheidenfeld Mitgründer des Historischen<br />
Vereins, war in vielfacher Weise<br />
schriftstellerisch tätig und ist Mitherausgeber<br />
einiger historischer Bücher und<br />
Editionen. Hauptsächlich aber engagierte<br />
er sich sogleich im wiederbegründeten<br />
Lohrer Zirkel und gehörte mit zu den<br />
treibenden Kräften, die ohne Unterlass vor<br />
allem bei den Klerikern für Nachwuchs in<br />
der Altherrenschaft sorgten. Vor allem aber<br />
lag ihnen die Aktivitas in Würzburg am<br />
Herzen: So wurde die erste Wichs nach dem<br />
Krieg gespendet und mit Nachdruck setzte<br />
sich diese kleine Riege für den Erwerb eines<br />
Hauses – dieses Hauses – ein und leistete<br />
nicht geringe finanzielle Unterstützung. Er<br />
betonte mir gegenüber, dass es Hauptanliegen<br />
war, eine blühende und intakte<br />
Hetania zu haben, die sich in ihrem Haus<br />
geborgen und von der Altherrenschaft<br />
gestützt wissen sollte. Meine Schilderungen<br />
hin und wieder vom unitarischen<br />
Leben auf dem Haus rufen bei ihm Begeisterung<br />
und Zufriedenheit darüber hervor,<br />
dass sein Anliegen und sein Herzenswunsch<br />
in Erfüllung gegangen und<br />
realisiert ist.<br />
Fritz Flach, AHVx UNITAS-Würzburg<br />
Bbr. Augustin Leistenschläger<br />
BAD KISSINGEN. Sein irdisches Leben gab<br />
Konrektor Augustin Leistenschläger (UNI-<br />
TAS-Hetania) aus Bad Kissingen kurz vor
seinem 72. Geburtstag in die Hände seines<br />
Schöpfers zurück. Rezipiert wurde er am 27.<br />
November 1958 bei der Hetania und engagierte<br />
sich als Consenior und Fuxmajor.<br />
Nach seiner Philistrierung 1961 war er beruflich<br />
nahezu 40 Jahre als Lehrer tätig. Mit<br />
seiner Ehefrau Margot, mit der er drei<br />
Töchter und sechs Enkel hatte, war er<br />
Mitglied im Altherrenzirkel Bad Neustadt.<br />
Vor vier Wochen hatten wir uns noch bei<br />
der UNITAS-Wallfahrt auf dem Kreuzberg<br />
getroffen. Obwohl er erst einen Tag aus<br />
dem Krankenhaus von der Chemotherapie<br />
entlassen war, hatte er es sich nicht<br />
nehmen lassen, traditionsgemäß daran<br />
teilzunehmen. In Arnshausen bei Bad<br />
Kissingen gaben ihm die Chargen und die<br />
Mitglieder des Rhöner Altherrenzirkels das<br />
letzte Geleit.<br />
Fritz Flach<br />
Bbr. Josef Dittrich<br />
MENDEN. Verstorben ist Studiendirektor<br />
a. D. Josef Dittrich v/o Bandura (UNITAS-<br />
Hetania) in Menden. Geboren am 8. August<br />
1918 im fränkischen Schweinfurt studierte<br />
er in Würzburg und wurde 1948 bei der<br />
Hetania rezipiert. Nach seiner Philistrierung<br />
siedelte Sepp Dittrich im April 1951 von<br />
Bayern nach Menden im Sauerland um.<br />
Hier hat er sich 30 Jahre lang, für die Ausbildung<br />
der Schüler des dortigen Heilig-<br />
Geist-Gymansiums eingesetzt. Als Lehrer<br />
für Griechisch, Latein und Geschichte hat er<br />
das altsprachliche Profil dieser Schule<br />
nachhaltig geprägt. Dieses Urgestein aus<br />
den Anfängen der Schule war mit seiner<br />
liebenswürdig humorvollen fränkischen Lebensart<br />
die gute Seele des Gymnasiums.<br />
Schüler und Kollegen nannten in liebevoll<br />
„Sepp“. Dabei war er als Lehrer durchaus<br />
streng und fordernd, aber auch warmherzig<br />
und stets ansprechbar für Probleme seiner<br />
Schüler. Auch die früheren Internatsschüler<br />
fanden bei ihm einen wohlwollend hilfsbereiten<br />
Ansprechpartner. Bei seinen Kollegen<br />
genoss Josef Dittrich ein hohes<br />
Ansehen. Wohl kurz nach seiner Übersiedlung<br />
nach Menden, wo er für seine<br />
Familie ein kleines Einfamilienhaus er-<br />
stellte, übernahm er die Schriftführung des<br />
hiesigen UNITAS-Altherrenzirkels „Hönnetal“<br />
und war auch in diesem eine „Seele“.<br />
An den Vereinsveranstaltungen, zu denen<br />
er bis etwa 1976 als Schriftführer einlud,<br />
nahm er mit seiner ebenfalls sehr liebenswürdigen,<br />
süddeutsch-lebendigen Frau<br />
regelmäßig teil. Als diese verstarb, lebte der<br />
pensionierte Studiendirektor lange Jahre<br />
allein, zuletzt in einem Altenheim, da seine<br />
zwei Töchter in den USA verheiratet sind<br />
und seine zwei Söhne weiter entfernt<br />
wohnen. Er trug dieses Schicksal tapfer, bis<br />
ihn der Tod am 11. Oktober 2007 von dieser<br />
Erde nahm und wohl zu seiner geliebten<br />
Gattin führte.<br />
Wir erinnern uns gern an diesen lieben<br />
Bundesbruder und seine ebenso liebe<br />
Gattin.<br />
Franz-Josef Spiekermann UNITAS-AHZ<br />
„Hönnetal“ / Fritz Flach, AHVx UNITAS<br />
Würzburg<br />
Bbr. Pfarrer Eugen Boden<br />
CASTROP-RAUXEL. Am 25. Oktober 2007<br />
verstarb nach jahrelangem Siechtum im<br />
St.-Rochus-Hospital in Castrop-Rauxel Bbr.<br />
Pfarrer und Geistlicher Rat Eugen Boden.<br />
Am Vorabend des Festes Christi Himmelfahrt<br />
im Mai 1991, wenige Stunden vor der<br />
Feier der Erstkommunion in der Gemeinde,<br />
hatte er einen schweren Hirninfarkt erlitten,<br />
von dem er sich nie mehr erholen<br />
sollte. Während sein körperlicher Zustand<br />
in den ersten Jahren wieder einigermaßen<br />
hergestellt wurde und er in der Vikarie<br />
seiner Pfarrei Heilig-Kreuz durch seine<br />
Haushälterin gepflegt werden konnte,<br />
wurde, vor allem nach deren Tod, eine<br />
langjährige stationäre Pflege notwendig.<br />
So verbrachte er die letzten Jahre seines<br />
Lebens in Krankheit und Leid im Pflegeheim<br />
St. Josef in Castrop-Rauxel (Habinghorst).<br />
Am 16. Oktober 1924 in Siegen geboren<br />
und am 21. März 1953 in Paderborn zum<br />
Priester geweiht, verbrachte Eugen Boden,<br />
der ein Neffe des Mainzer Weihbischofs<br />
Josef Maria Reuss (1906-1985) war, sein<br />
ganzes priesterliches Leben in Castrop-<br />
Rauxel. Dort war er zunächst von 1953 bis<br />
1965 Vikar an St. Lambertus unter Bbr.<br />
Dechant Hermann Inkmann<br />
(1906-1978), von 1965 bis 1968 dann<br />
Pfarrvikar der neu errichteten Pfarrvikarie<br />
Heilig-Kreuz sowie nach der Erhebung zur<br />
Pfarrei deren erster Pfarrer von 1968 bis<br />
(offiziell) 1993. Zusammen mit vielen Mitarbeitern<br />
hat er der neuen Gemeinde ein<br />
ganz eigenes Gesicht geben, wobei vor<br />
allem seine Persönlichkeit und sein Glaube<br />
sehr prägend waren. Eugen Boden, rezipiert<br />
am 20. Februar 1951 bei UNITAS-Hathumar<br />
Paderborn, war ein weithin geschätzter<br />
Priester und Seelsorger, der mit Sachverstand<br />
und pastoraler Klugheit, aber auch<br />
mit viel Humor und tiefer Frömmigkeit das<br />
Evangelium verkündete. Er liebte die Natur,<br />
betrieb aktiv Sport und lebte vor allem mit<br />
der Philosophie und Literatur seiner Zeit. Es<br />
war mehr als ein Dilemma, dass ihm, der<br />
ein hochintelligenter „Meister der Wortes“<br />
war, diese Möglichkeit mehr als 16 Jahre<br />
genommen wurde. Erst viele Jahre nach<br />
seiner Erkrankung konnte er, und war er<br />
wohl auch wieder innerlich bereit, sitzend<br />
die Heilige Messe zu zelebrieren, wozu er<br />
ganz gelegentlich Besucher zuließ. Nur<br />
wenige Male kehrte er in seine geliebte<br />
Pfarrei zurück, letztmalig zu seinem 75. Geburtstag.<br />
Sein Goldenes Priesterjubiläum<br />
sowie seinen 80. Geburtstag konnte er nur<br />
noch im ganz kleinen Kreis am Altar des<br />
Pflegeheims St. Josef begehen.<br />
Nach einem beeindruckenden Totengebet<br />
und Requiem, zu welchem er in<br />
seiner Pfarrkirche aufgebahrt war, wurde<br />
Eugen Boden unter großer Anteilnahme am<br />
30. Oktober 2007 in der Priestergruft des<br />
Katholischen Friedhofes an der Wittener<br />
Straße in Castrop-Rauxel beigesetzt. Dort<br />
erwartet er die Auferstehung neben<br />
seinem Freund Bbr. Pfarrer Heinrich<br />
Jeibmann (1929-1997).<br />
Lambert Stamer<br />
Neues Gesamtverzeichnis<br />
2007<br />
Das neue Gesamtverzeichnis wird<br />
nicht als Buch gedruckt, wohl aber<br />
als CD erscheinen, teilt die Verbandsgeschäftsführung<br />
mit.<br />
Das Gesamtverzeichnis 2007 kann<br />
gegen 12 Euro bei der Verbandsgeschäftsstelle<br />
bestellt werden (Preis:<br />
10.00 Euro, Versand: 2.00 Euro).<br />
Adresse:<br />
Verband der wissenschaftlichen<br />
katholischen Studentenvereine e.V.,<br />
Aachener Str. 29,<br />
41564 Kaarst (Büttgen),<br />
Tel. 02131 / 271725, Fax 02131 /<br />
275960, E-Mail: vgs@unitas.org.<br />
unitas 3-4/2007 239<br />
>>
240<br />
unitas 3-4/2007<br />
Gedenkt unserer toten Bundesbrüder<br />
Bbr. OstR i. R. Peter Bell aus Königstein/Ts.,<br />
geboren am 18.10.1934, aktiv<br />
seit Januar 1956 bei UNITAS Guestfalia-<br />
Sigfridia Frankfurt und philistriert zum<br />
1.1.1962, ist am 8.9.2007 gestorben.<br />
Bbr. Akademischer Direktor i. R. Dr. Enno<br />
Peter Brunner aus München, geboren am<br />
2.7.1936, aktiv seit Februar 1954 bei<br />
UNITAS Rheinpfalz und später bei<br />
UNITAS München, philistriert zum<br />
1.1.1964, ist am 8.7.2007 gestorben.<br />
Bbr. Direktor i. R. Ottmar Dietrich aus Göttingen,<br />
geboren am 2.4.1934, rezipiert bei<br />
UNITAS Salia-Bonn und aktiv bei UNITAS<br />
Rheno-Danubia Freiburg und UNITAS<br />
Göttingen, philistriert zum 10.7.1958, ist<br />
am 5.10.2007 verstorben.<br />
Bbr.Pfr.i.R.Paul Finger aus Saarbrücken,<br />
geboren am 10.3.1932, aktiv ab März 1960<br />
bei UNITAS Rhenania Bonn und UNITAS<br />
Trebeta Trier, philistriert zum Januar 1965<br />
und am 26. Juli 1964 zum Priester<br />
geweiht, ist am 19.8.2007 gestorben.<br />
Verstorben ist Bbr. Peter Flitsch aus Bonn,<br />
geboren am 27.1.1966, rezipiert im Februar<br />
1987 bei UNITAS München und<br />
philistriert zum Januar 1994.<br />
Bbr. Hauptschulrektor i. R. Otmar Geissler<br />
aus Lauda-Königshofen, geboren am<br />
16.1.1941, rezipiert im Juli 1960 bei UNITAS<br />
Pirminia Karlsruhe und AH seit Januar<br />
1969, ist am 31.8.2007 gestorben.<br />
Bbr. Dr. rer. pol. Dipl.-Kaufmann Paul<br />
Görtzen aus Kleve, geboren am 10.3.1928,<br />
aktiv bei UNITAS Langobardia Hannover<br />
seit Juni 1966 und phlistriert zum<br />
21.6.1966, ist am 19.11.2006 verstorben.<br />
Bbr. Schulamtsdirektor i. R. Peter Heller<br />
v/o Suso aus Burgthann, geboren am<br />
29.6.1941, aktiv seit Mai 1963 bei UNITAS<br />
Frankonia Eichstätt, UNITAS Rheno-<br />
Palatia Erlangen-Nürnberg und UNITAS<br />
Ratisbona Regensburg, philistriert zum<br />
Januar 1965, ist am 26.7.2007 verstorben.<br />
Bbr. Internist i. R. Dr. med. Heinrich Heidemeyer<br />
aus Essen, geboren am 2.5.1929,<br />
rezipiert bei UNITAS Willigis Mainz im<br />
Juli 1950 und philistriert zum 20.7.1957, ist<br />
am 31. Juli 2007 gestorben.<br />
Bbr.Prof.Dr.rer.Nat.Hermann Hinrichs<br />
aus Konstanz, geboren am 21.6.1922, aktiv<br />
seit Juni 1949 bei UNITAS Cheruskia<br />
Gießen, ist am 16.9.2007 verstorben.<br />
Bbr. OstR i. R. Herbert Hohmann aus<br />
Petersberg, geboren am 27.9.1925 und<br />
aktiv seit Dezember 1951 bei UNITAS<br />
Rheno-Meonania Frankfurt, philistriert<br />
zum Januar 1955, ist am 28.9.2007 gestorben.<br />
Bbr. Realschullehrer i. R. Klaus Wilhelm<br />
Löhrer aus Aachen, geboren am 6.9.1927,<br />
rezipiert im Juni 1949 bei UNITAS Assindia<br />
Aachen und philistriert zum 1.1.1976,<br />
ist am 22.4.2007 verstorben.<br />
Bbr. Realschulrektor i. R. Bernhard Nonte<br />
aus Mettingen, geboren am 29.10.1928,<br />
aktiv bei UNITAS Rolandia-Burgundia<br />
Münster seit Juni 1952 und philistriert<br />
zum 1.1.1955, ist am 1.9.2007 verstorben.<br />
Bbr. Prof. Dr. Dipl.-Phys. Peter Schmidt aus<br />
Marburg, geboren am 7.5.1930, rezipiert<br />
bei UNITAS Göttingen und aktiv bei<br />
UNITAS Franko-Saxonia Marburg, philistriert<br />
am 1.1.1957, ist am 17.6.2007 gestorben.<br />
Bbr. Regierungsdirektor a. D. Dieter<br />
Seyfert aus Unterschleißheim, geboren<br />
am 22.10.1935, rezipiert im November<br />
1954 bei UNITAS Franko-Palatia Erlangen<br />
und aktiv bei UNITAS Henricia Bamberg,<br />
ist am 16. Juni 2007 verstorben.<br />
Bbr. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stork aus<br />
Kaarst, geboren am 28.1.1936, rezipiert im<br />
Januar 1957 bei UNITAS Braunschweig<br />
und philistriert zum Juni 1962, ist am<br />
23.8.2007 gestorben.<br />
Bbr.Pfr.i.R.Hermann Tiehen aus Dohren,<br />
geboren am 29.9.1913, rezipiert im Juni<br />
1933 bei UNITAS Rolandia-Burgundia<br />
Münster, philistriert zum Januar 1937 und<br />
zum Priester geweiht am 17. Dezember<br />
1938, ist am 28.10.2007 gestorben.<br />
Bbr. Pfr. Herbert Weber aus Zuzenhausen,<br />
geboren am 10.7.1949, rezipiert im<br />
Februar 1971 bei UNITAS Albertina<br />
Freiburg, philistriert zum Januar 1973 und<br />
am 5. Mai 1975 zum Priester geweiht,<br />
ist am 8.8.2007 verstorben.<br />
Bbr. Prof. Dr. Leonard Palzkill aus<br />
Gusterath, geboren am 28.9.1923,<br />
rezipiert im Juli 1958 bei UNITAS<br />
Deutschritter Köln und aktiv bei UNITAS<br />
Trebeta Trier, philistriert zum Januar 1958,<br />
ist am 30.9.2007 gestorben.<br />
Bbr. StD Lothar Mähringer aus Hallstadt,<br />
geboren am 30.12.1930, aktiv seit Juni<br />
1952 bei UNITAS München und Philister<br />
seit Januar 1956, ist am 29.12.2006<br />
verstorben.<br />
Bbr. Dr. agr. Hermann Peters aus Dülmen,<br />
geboren am 8.5.1927, aktiv seit Juni 1951<br />
bei UNITAS Rhenania Bonn und philistriert<br />
zum Januar 1954, ist am 7. Juli 2007<br />
gestorben.<br />
Bbr. Dr. med. Alfred Piechotta aus Bad<br />
Königshofen, geboren am 14.5.1911, aktiv<br />
seit Juni 1935 bei UNITAS Guestfalia-<br />
Sigfridia Breslau/Frankfurt, philistriert<br />
zum 1.1.1942, ist am 9.7.2007 gestorben.<br />
Bbr. OStR i. R. Heinrich Pill aus Heusweiler,<br />
geboren am 12.10.1934, rezipiert bei<br />
UNITAS Tuisconia Hamburg im Juni 1958<br />
und aktiv bei UNITAS Nicolaus-Cusanus<br />
Saarbrücken, philistriert zum 1.1.1964, ist<br />
am 12.9.2007 verstorben.<br />
Bbr. Dr. med. Wilhelm Schmelter aus Witten,<br />
geboren am 4. April 1922, aktiv seit<br />
Juni 1946 bei UNITAS Rhenania Bonn und<br />
bei UNITAS Franko-Saxonia Marburg, ist<br />
am 30.6.2007 gestorben.<br />
Bbr. Mittelschullehrer i. R. Raimund<br />
Schmelz aus Damme, geboren am<br />
13.8.1927, aktiv seit September 1949 bei<br />
UNITAS Winfridia Münster, ist am<br />
6.10.2007 verstorben.<br />
Bbr. Vors. Richter i. R. Dr. iur. Konrad<br />
Schneller aus Osnabrück, geboren am<br />
1.5.1937, aktiv seit Juni 1957 bei UNITAS<br />
Wiking-Sugambria Münster und bei<br />
UNITAS Winfridia Münster, philistriert<br />
zum Januar 1962, ist am 15.7.2007 verstorben.<br />
Bbr. Apotheker Paul Schumacher aus<br />
Sulzbach, geboren am 4.10.1925, rezipiert<br />
zum Mai 1949 bei UNITAS Reichenau<br />
Freiburg, philistriert zum Januar 1952, ist<br />
am 5.9.2007 verstorben.<br />
Bbr. Dr. med. Leopold Stiedl aus Wien,<br />
ist am 23.1.2007 verstorben. Er war aktiv<br />
bei UNITAS Kreuzritter Wien.<br />
Bbr. Realschulrektor i. R. Wolfgang<br />
Weigand aus Donaueschingen, geboren<br />
am 13.9.1927, aktiv seit Juni 1947 bei<br />
UNITAS Rheno-Danubia Freiburg und AH<br />
seit 26.11.1958, ist am 14.7.2007 verstorben.<br />
Bbr. Kinderarzt Dr. med. Robert Weitz<br />
aus Aachen, geboren am 3.4.1940, rezipiert<br />
im Juni 1960 bei UNITAS Rhenania<br />
Bonn und aktiv bei UNITAS Eckhardia<br />
Freiburg, philistriert zum Januar 1966, ist<br />
am 10.9.2007 gestorben.<br />
Bbr. Akademischer Direktor i. R. Dr.<br />
Enno Peter Brunner aus München, geboren<br />
am 2.7.1936, aktiv seit Februar 1954<br />
bei UNITAS Rheinpfalz und später bei<br />
UNITAS München, philistriert zum<br />
1.1.1964, ist am 8.7.2007 gestorben.<br />
Requiescant<br />
in pacem!
Die Botschaft Jesu geht auch die<br />
Ungläubigen an<br />
Christian Nürnberger: Jesus für Zweifler.<br />
1. Auflage 2007, 272 Seiten, gebunden. 19,95<br />
Euro, ISBN 978-3-579-06967-8.<br />
Lange Jahre war der Journalist Christian<br />
Nürnberger der Meinung, dass das Christentum<br />
„nur noch Gerede und Geschwätz“<br />
sei, eine von der Aufklärung widerlegte<br />
Religion, die sich selbst überlebt hat. In<br />
seinem Buch „Jesus für Zweifler“ kommt der<br />
Agnostiker Nürnberger zu dem Schluss, dass<br />
die Botschaft Jesu für die Menschen ein<br />
Segen ist.<br />
Das Buch versteht sich als ein persönliches<br />
Zeugnis der Auseinandersetzung mit<br />
dem christlichen Glauben und anderen,<br />
vermeintlichen Heilsangeboten wie Kommunismus,<br />
New Economy und Konsumglaube.<br />
Christian Nürnberger, ein mit dem<br />
christlichen Glauben aufgewachsener<br />
Mensch, ist kein Atheist, er bezeichnet sich<br />
als Agnostiker, als jemand, der nicht weiß,<br />
was nach dem Tod passiert: „Ich bin ein<br />
radikaler Skeptiker, der allem misstraut.“<br />
Seinen Glauben habe er als Theologiestudent<br />
verloren, doch ein ideologieloser „postmoderner<br />
Gewohnheits-Nihilist“ habe er<br />
nicht werden wollen. So befasste er sich<br />
aufs Neue mit der Botschaft Jesu und der<br />
Bibel. Herausgekommen ist das Buch „Jesus<br />
für Zweifler“, in dem Nürnberger aus der<br />
Perspektive eines Menschen schreibt, der<br />
auf die segensreichen Worte von Jesus<br />
Christus hofft, weil die Welt ohne Gott eine<br />
sinnlose Welt ist, in der das Leben eines<br />
jeden Menschen völlig gleichgültig ist.<br />
Der globalisierten Welt des „Marktradikalismus“<br />
etwa stellt Nürnberger einen<br />
anspruchsvollen Gott entgegen, der sagt:<br />
„Ich habe für euch ein anderes Gesetz,<br />
etwas Besseres als diese Konkurrenzgesellschaft,<br />
die beständig mehr Verlierer als<br />
Gewinner produziert.“ „Teil- und Freizeit-<br />
�<br />
BÜCHER/MEDIEN<br />
christen“ genügen diesem Gott nicht, sagt<br />
Nürnberger. Die Botschaft Jesu sei ein Segen<br />
für die Welt, und habe auch den Ungläubigen<br />
viel zu sagen.<br />
Die Nazarener und der Koran<br />
Joachim Gnilka: Die Nazarener und der<br />
Koran. Eine Spurensuche, Herder-Verlag, 176<br />
Seiten, 14.90 ¤, ISBN 978-3-451-29668-0<br />
Die Teilnehmer der AHB-/HDB-Tagung<br />
2005 in Regensburg werden sich noch gut<br />
an Bbr. Prof. Gnilka und seinen Vortrag „Bibel<br />
und Koran – was sie verbindet, was sie<br />
trennt“ erinnern (vgl. UNITAS 4/2005; „Bibel<br />
und Koran“, Herder-Verlag, 6. Auflage 2007).<br />
Jetzt hat der international angesehene<br />
Bibelwissenschaftler Prof. Gnilka ein Buch<br />
über „Die Nazarener und der Koran“ veröffentlicht.<br />
Er geht von den Bibelzitaten des<br />
Alten und (hier vordringlich) des Neuen<br />
Testaments im Koran aus, und stellt zum<br />
einen fest, „dass der Koran keine unmittelbare<br />
Kenntnis kanonischer neutestamentlicher<br />
Schriften voraussetzt“ (S. 103). Zum<br />
anderen weist er nach, „dass matthäische<br />
Überlieferungen (im Koran) in Erscheinung<br />
treten, paulinische hingegen fehlen“ (S. 103).<br />
Woher bezieht also der Koran seine Ausführungen<br />
über den jüdischen und den<br />
christlichen Glauben? Warum gibt es diese<br />
eindeutige Fixierung auf judenchristliche<br />
Überlieferungen? Bbr. Gnilka beobachtet,<br />
dass die Christen im Koran unter dem<br />
Namen „Nasara“ erscheinen, was er bewusst<br />
mit „Nazarener“ und nicht mit<br />
„Christen“ übersetzt (vgl. S. 16). Die Nazarener<br />
waren aber eine stark an der jüdischen<br />
Gesetzgebung orientierte frühchristliche<br />
Gruppierung, die auch im Neuen Testament<br />
Erwähnung findet. Alle diese Spuren führen<br />
Bbr. Gnilka in die Frühzeit der Jerusalemer<br />
Christengemeinde, in die Auseinandersetzungen<br />
zwischen Juden- und Heidenchristentum,<br />
zwischen Petrus und Jakobus<br />
auf der einen und Paulus auf der anderen<br />
Seite. Bbr. Gnilka analysiert die unterschiedlichen<br />
Glaubensauffassungen der frühen<br />
Christen über den einen Gott und über<br />
Jesus Christus sowie ihre Einstellung zum<br />
jüdischen Gesetz. Er untersucht die Auseinandersetzungen<br />
mit dem Judentum in der<br />
Zeit bis zum Ausbruch des Jüdisch-Römischen<br />
Krieges und die überlieferten Zeugnisse<br />
danach. Sein äußerst informatives und<br />
spannend zu lesendes Buch endet mit einer<br />
aktuellen wissenschaftlichen Auseinandersetzung<br />
über die ältesten Inschriften des<br />
Jerusalemer Felsendoms aus dem letzten<br />
Jahrzehnt des siebten Jahrhunderts.<br />
Thomas Lohmann<br />
Meisterwerke der Baukunst von der Antike bis<br />
heute. Festgabe für Elisabeth Kieven. Christina<br />
Strunck (Hg.), Studien zu internationalen<br />
Architektur- und Kunstgeschichten Band 43,<br />
544 Seiten, 820 Abbildungen, davon 521 in<br />
Farbe. ISBN 978-3-86568-186-7, Einführungspreis<br />
78,00 Euro, ab 1.01.2008: 98,00 Euro.<br />
Einen opulenten Band legte jetzt zum<br />
Jahresende der Verlag von unserem Bbr.<br />
Michael Imhof in Petersberg bei Fulda vor:<br />
Im Mittelpunkt steht die Baugeschichte der<br />
Stadt, die die Geschichte der Architektur<br />
und Kunst wie kaum eine andere prägte.<br />
Der mit über 800 großartigen Illustrationen<br />
versehene Prachtband entführt den<br />
Leser nach Rom, die Hauptstadt eines Weltreiches<br />
und ins Zentrum des Christentums.<br />
100 Kurzporträts stellen die Hauptwerke der<br />
römischen Architektur von der Antike bis<br />
heute vor, einleitende Essays geben jeweils<br />
einen Überblick zu den großen Epochen der<br />
römischen Kunst und stellen die Bauwerke<br />
in die Gesamtentwicklung und Kulturgeschichte.<br />
Die Autorenschaft versammelt mehr als<br />
70 Kunsthistoriker aus Deutschland, Italien,<br />
England und den USA, die das Spektrum der >><br />
unitas 3-4/2007 241
aktuellen Italienforschung repräsentieren.<br />
Mit ihrer Arbeit ehren sie die Direktorin der<br />
Bibliotheca Hertziana, des Max-Planck-Instituts<br />
für Kunstgeschichte in Rom, Elisabeth<br />
Kieven. Ihr ist dieses über 540 großformatige<br />
Seiten umfassende Werk anlässlich<br />
ihres 60. Geburtstags als Festgabe zugeeignet.<br />
Für diese umfängliche Darstellung der<br />
bleibenden Zeugnisse von Künstlern und<br />
Mäzenen, Baumeistern und Bauherren,<br />
hatte Verleger Bbr. Imhof eine eigene Fotokampagne<br />
in Rom durchgeführt. In sanftem<br />
Licht präsentieren sich die Blicke in die<br />
vielen Kirchen, vielfach doppelseitige Innenaufnahmen<br />
von Kuppelgewölben und<br />
Deckenfresken bringen das ganze Bild. Den<br />
historischen Aufnahmen, Risszeichnungen<br />
und Plänen ist zum Vergleich die aktuelle<br />
Ansicht gegenübergestellt: Die meist im<br />
zauberhaften Licht der frühen Morgenstunden<br />
festgehaltenen Motive bringen die<br />
Plastizität der Gebäude hervorragend zum<br />
Vorschein, die nach dem Heiligen Jahr 2000<br />
weitgehend vollständig in neuem Gewand<br />
erstrahlen.<br />
Das Ergebnis ist ein süchtig machender<br />
Streifzug durch die Jahrhunderte der Architektur<br />
der Ewigen Stadt, vom Rom der Gründungszeit<br />
bis zu den aktuell diskutierten<br />
Bauten unserer Tage. Ein lebendiges Denkmal<br />
für die Stadt der lebendigen Denkmäler<br />
– das nicht nur den Italienliebhaber restlos<br />
begeistern wird.<br />
Christof Beckmann<br />
Konstantin<br />
und Europa<br />
Bistum Trier (Hrsg.): Konstantin und Europa;<br />
48 S. mit zahlr. farbigen Abb., ISBN 978-3-<br />
7902-0219-9, 9,90 Euro. Erhältlich beim<br />
Paulinus-Verlag, Tel. 0651 / 4608-121, E-Mail:<br />
media@paulinus.de) und allen Buchhandlungen.<br />
Zur Konstantinausstellung in Trier hat<br />
das Bistum Trier ein Magazin mit dem Titel<br />
„Konstantin und Europa“ herausgebracht, in<br />
dem Parallelen zwischen dem Römischen<br />
Reich zur Zeit Konstantins und dem<br />
heutigen Europa thematisiert werden.<br />
Prominente Politiker, wie Bundesbildungsministerin<br />
Annette Schavan und der EU-<br />
242<br />
unitas 3-4/2007<br />
Kommissionspräsident José Manuel Barroso<br />
kommen dabei genauso zu Wort, wie<br />
Theologen und Historiker oder der Trierer<br />
Bischof Bbr. Dr. Reinhard Marx. Zahlreiche<br />
farbige Abbildungen machen das Magazin<br />
zum idealen Begleiter der Konstantinausstellung,<br />
die einen wahren Besucheransturm<br />
verzeichnet.<br />
Das Heft zeigt erstaunliche Parallelen<br />
zwischen der Zeit Konstantins und der<br />
heutigen Situation Europas auf. Die Nationalstaaten<br />
innerhalb der EU sind – wie einst<br />
die römischen Teilreiche – auf ihren Vorteil<br />
bedacht, aus der Türkei, Osteuropa und<br />
Nordafrika drängen die Menschen in die EU.<br />
Gleichzeitig wird, ganz im Gegensatz zur<br />
Zeit Konstantins, das Christentum nicht<br />
gefördert, sondern die christlichen Wurzeln<br />
Europas bestritten. Angesichts dieser Parallelen<br />
geht das Buch der Frage nach: Können<br />
wir aus der Geschichte lernen?<br />
Vorschule des Betens<br />
von Bbr. Guardini<br />
Romano Guardini: Klassiker des Christentums.<br />
Vorschule des Betens, 196 Seiten, gebunden,<br />
Weltbild, ISBN-10: 3828949460,<br />
ISBN-13: 9783828949461, 9.95 Euro<br />
Ein Klassiker des Christentums ist neu<br />
aufgelegt: Die „Vorschule des Betens“ unseres<br />
Bundesbruders Romano Guardini<br />
(1885-1968), der zu den großen katholischen<br />
Religionsphilosophen und Theologen des<br />
20. Jahrhunderts gehört.<br />
Als 33-Jähriger wurde<br />
Guardini mit einem Schlag<br />
berühmt, als 1918 sein<br />
schmales Werk „Vom Geist<br />
der Liturgie“ erschien. 1927<br />
erschienen das kleine Werk<br />
„Von heiligen Zeichen“<br />
und wurde für den<br />
geistigen Führer der liturgischen<br />
Erneuerung ein<br />
heute kaum mehr<br />
vorstellbarer Erfolg. Als<br />
diese Bewegung um die<br />
Jahre 1939 bis 1944 in eine<br />
Krise geriet veröffentlichte<br />
Romano Guardini auf Bitten<br />
des Mainzer Bischofs<br />
Albert Stohr eine Stellungnahme,<br />
in der er Liturgismus,<br />
Praktizismus, liturgischer Dilettantismus<br />
und Konservatismus als Gefahren<br />
für die Liturgie benannte. In dieses Umfeld<br />
reiht sich 1943 sein Werk „Vorschule des<br />
Betens“. Guardini fragte sich schon sehr<br />
früh, ob der heutige Mensch die überlieferten<br />
Texte des betenden gottesdienstlichen<br />
Feierns überhaupt noch verstehen<br />
könne, erläutert Kardinal Lehmann<br />
in seinem Nachwort zur aktuellen Neuauflage.<br />
Bbr. Guardini zeigte in seinem Buch<br />
„Vom Geist der Liturgie“ und spätere Veröffentlichungen<br />
seine Überzeugung auf,<br />
nach der die<br />
Menschen durch<br />
die Gestaltung<br />
der liturgischen<br />
Handlungen und<br />
die Art des deutenden<br />
und bildendenSprechens<br />
in das<br />
heilige Geschehenhineingeführt<br />
werden<br />
müssen. In seiner<br />
„Vorschule<br />
des Betens“ formuliert Guardini: „Beten ist<br />
eine innere Notwendigkeit, Gnade und Erfüllung<br />
– Beten ist aber auch Pflicht, Mühe<br />
und Überwindung. So gibt es das Erlebnis,<br />
aber auch seine Schule.“ Sein Weg ist der<br />
der einfachen Dinge: Vorbereitung und Ordnung<br />
des Gebetes (Übung, Sammlung,<br />
äußere Ordnung), die Wirklichkeit Gottes<br />
und Grundakte des Gebetes (Gott der<br />
Heilige, Anbetung, Lob, Bitte, Dank), die<br />
Heiligste Dreifaltigkeit und das Gebet (die<br />
Beziehung zu den göttlichen Personen), das<br />
mündliche Gebet (Wortformen im Gebet),<br />
das innerliche oder betrachtende Gebet<br />
(auch: das mystische Gebet), die Vorsehung<br />
(der Zusammenhang des Gebetslebens mit<br />
der Vorsehung), das Gebet zu den Heiligen<br />
und zur Mutter des Herrn, das Gebet in der<br />
Zeit des Unvermögens (Schwierigkeiten aus<br />
dem inneren Wandel des Lebens und aus<br />
Krisen des Glaubens), der Gesamtzusammenhang<br />
des christlichen Gebetslebens<br />
(das persönliche Gebet, die<br />
Liturgie, die Volksandacht).<br />
Damit bleibt seine Arbeit<br />
eine wichtige Heranführung<br />
zum liturgischen<br />
Geschehen. Kardinal Lehmann:<br />
„Es ist ein tiefer Versuch,<br />
die anthropologischen,<br />
religiösen Grundvoraussetzungen<br />
zur Sprache<br />
zu bringen, die man<br />
früher, als sie einfach im<br />
Beten selbst lebten und<br />
funktionierten, weniger befragte,<br />
aber nun in der Krise<br />
ausdrücklich machen muss.<br />
… Die Sprache des Buches ist<br />
einfach, in der Art Guardinis:<br />
ruhig meditierend,<br />
ohne Hast, zielstrebig und sprachlich<br />
schön.“ Heute noch spricht sein vor über 60<br />
Jahren geschriebenes Buch den Leser unmittelbar<br />
und frisch an.<br />
Bbr. Romano Guardinis Buch „Vorschule<br />
des Betens“ erscheint in der Reihe „Klassiker<br />
des Christentums“, die gemeinsam vom<br />
Rheinischen Merkur und dem Weltbild Verlag<br />
herausgegeben wird. Sie widmet sich<br />
neben Guardini bislang Paul Gerhardt,<br />
Thomas von Kempen, Thomas Morus, Martin<br />
Luther, Ignatius von Loyola und Dietrich<br />
Bonhoeffer.<br />
CB
Arbeit von<br />
bleibendem Wert<br />
Lebensbilder und Kurzbiografien des<br />
W.K.St.V. UNITAS-Rhenania Bonn, herausgegeben<br />
anlässlich des 95. Stiftungsfestes, hrsg.<br />
von Wolfgang Burr, Martin Hinzmann und<br />
Martin Nawrath, (Band 25 der UNITAS-<br />
Schriftenreihe (Neue Folge), Unitarische<br />
Lebensbilder Band 5), Bonn/Siegburg (2007)<br />
Zum 90. Stiftungsfest des W.K.St.V.<br />
UNITAS Rhenania Bonn waren bereits 2002<br />
„Studien und Dokumente zur Geschichte<br />
der UNITAS-Rhenania“ veröffentlicht worden.<br />
Einer der Mitherausgeber war Bbr.<br />
Bernhard Klein gewesen, Vorsitzender des<br />
Altherrenvereins der UNITAS Rhenania.<br />
Dem am 22. Februar 2005 plötzlich verstorbenen<br />
Bundesbruder haben nun die<br />
Herausgeber des aktuellen Bandes ein<br />
neues Werk gewidmet. Herausgekommen<br />
ist eine imposante, über 270 Seiten<br />
zählende Arbeit, deren über vier Jahre<br />
währender Aufwand im Detail kaum zu<br />
unterschätzen ist. Denn wer sich mit Biografien<br />
beschäftigt und auf Vollständigkeit<br />
und den treffenden Ton bemüht ist, der<br />
ahnt, welcher Aufwand in diesem von<br />
Wolfgang Burr, Martin Hinzmann und<br />
Martin Nawrath herausgegebenen Opus<br />
liegt.<br />
Die zum 95. Stiftungsfest erschienene<br />
Zusammenstellung verdankt sich der Absicht,<br />
eine Vorarbeit für eine zum 100.<br />
Stiftungsfest geplante Vereinsgeschichte<br />
vorzulegen. Das Ziel haben die Autoren<br />
hoch gesteckt: Es geht um nicht mehr und<br />
nicht weniger, als die Lebensdaten aller<br />
Rhenanen zu sammeln und zu dokumentieren.<br />
Dazu lieferten Angehörige verstorbener<br />
Bundesbrüder ebenso wichtige<br />
Informationen wie öffentliche, kirchliche<br />
und staatliche Archive. „Mit diesem<br />
vorliegenden Band“, so die Herausgeber,<br />
„wird nach den ,Studien und Dokumenten‘<br />
ein weiterer Steinbruch zur Geschichte der<br />
Rhenania erschlossen, aus dem in fünf<br />
Jahren die geplante Vereinsgeschichte<br />
unserer Rhenania aufbauen kann.“ Für<br />
einen Steinbruch allerdings sieht das<br />
Ergebnis durchaus bereits nach einem<br />
brauchbaren Gebäude aus, das für alle<br />
Unitarier durchaus Interessantes bietet.<br />
Ausführlich vorgestellt werden unter anderem<br />
die Bundesbrüder Gabriel Adriány,<br />
Ludwig Freibüter, Herbert Hömig, Bernhard<br />
Klein und Lothar Roos, für die als Autoren<br />
die Bundesbrüder Markus Lingen, Hermann-Josef<br />
Scheidgen, Theodor Brunnbauer<br />
und Wolfgang Burr verantwortlich<br />
zeichnen. Eine Liste bislang veröffentlichter<br />
Lebensbilder von Rhenanen ergänzen<br />
Lebensbeschreibungen in alphabetischer<br />
Reihenfolge. Im Zuge der Datensammlung<br />
recherchierte Fotos mit auf 20 Seiten abgedruckten<br />
Gruppenbildern aus dem Vereinsleben<br />
runden das Werk ab.<br />
Faszinierend bleibt vor allem die Vielfalt<br />
der unitarischen Lebensläufe: Hier treten<br />
dem Leser Geistliche und Juristen, Pädagogen,<br />
Politiker, Bürgermeister, Professoren<br />
und Landwirte aus rund 100 Jahren entgegen<br />
– Zeitzeugen und Mitgestalter ihrer<br />
Jahre. Viele Porträtaufnahmen machen die<br />
in den Kurzdarstellungen vor allem um<br />
zahlreiches Datenmaterial bemühte Darstellung<br />
zusätzlich lebendig. Da ein solches<br />
Werk niemals vollständig sein wird, bitten<br />
die Autoren um Ergänzungen, Korrekturen<br />
und Lieferung weiterer Fotos. Eines steht<br />
jetzt bereits fest: Für die UNITAS Rhenania<br />
und alle Leser wird dieser Band 5 der Reihe<br />
„Unitarische Lebensbilder“ eine Arbeit von<br />
dauerndem Wert bleiben.<br />
Christof Beckmann<br />
Das Lexikon<br />
der Verbindungen<br />
Hartmut H. Jess hat sein „SCC Specimen<br />
corporationum cognitarum“, ein Lexikon<br />
fast aller jemals existenten Verbindungen,<br />
jetzt in zweiter Auflage neu herausgegeben<br />
– diesmal im Selbstverlag. Die CD-ROM<br />
enthält eine Darstellung von weltweit<br />
15.000 Verbindungen/Vereinen aus den<br />
Bereichen akademisch, technisch, pennal,<br />
sowie jüdische Korporationen, Damenverbindungen,<br />
Kameradschaften, Einjährige,<br />
Absolvia-Abituria, fraternities-sororities,<br />
Goliarden, Tunas, Respublicas. Insgesamt<br />
sind 28.000 Verbindungsnamen systematisch<br />
erschlossen, 10.000 verschiedene<br />
Zirkel und 7.500 Wappen, 16.500 Farben<br />
und 8.700 Wahlsprüche zugeordnet.<br />
Findices erschließen das umfangreiche<br />
Material und helfen bei der Suche nach<br />
einer Verbindung, nach Verbänden,<br />
Wappen, Städten und Ländern. Die Folio-<br />
Sammlung stellt alle ermittelbaren Daten<br />
zu den einzelnen Verbindungen mit<br />
Wappen, Zirkel, Chronik, Farben, Wahlspruch<br />
und Quellen zusammen. Neu ist der<br />
Zirkel-Almanach. Hier werden die Verbindungszeichen<br />
alphabetisch dargestellt –<br />
ein unentbehrliches Hilfsmittel z. B. bei der<br />
Einordnung von Zufallsfunden. Neu gegenüber<br />
der ersten Auflage sind der „Zirkel-<br />
Almanach“ und der „Findex Wappen“: Hier<br />
sind alle rd. 6.500 Wappen des SCC in einer<br />
Excel-Datei – in 15 Spalten frei sortierbar –<br />
gesammelt. Die verschiedenen Wappenfelder<br />
sind wegen Platzmangels nicht in<br />
heraldischer Breite blasoniert, sondern in<br />
Kurzform beschrieben und können auch bei<br />
einer Kenntnis von nur wenigen Feldern<br />
(z. B. „oben links“, „Herzschild“, „Vierung“)<br />
durch geeignete Sortierung zur Identifikation<br />
des Wappens führen. Beigefügt ist<br />
eine umfangreiche Datei von Stadt und<br />
Länderwappen, die immer wieder auf Verbindungswappen<br />
– manchmal auch nur in<br />
Teilen – verwendet werden. Der „Findex<br />
Wappen“ ist nach dem jeweils dargestellten<br />
Motiv (z. B. Löwe, Adler, Blume)<br />
sortiert.<br />
Für Couleurkarten-Freunde enthält die<br />
CD-ROM ein besonderes Schmankerl: Die<br />
von Dr. Michael Polgar im Internet unter<br />
www.couleurkarte.arg eingerichtete Sammlung<br />
mit rd. 21.000 Karten ist in das SCC<br />
2005 eingearbeitet. Die CD-ROM ist zum<br />
Preis von 55,- Euro zzgl. Versandkosten bei<br />
Zahnarzt Hartmut H. Jess, Marktpassage,<br />
37688 Beverungen, specimen@gmx.de zu<br />
beziehen.<br />
Im Garten des Klosters im Mittelalter, von<br />
Annette Both, Landesinstitut für Lehrerfortbildung,<br />
Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung<br />
Sachsen-Anhalt, Herausgeber:<br />
Verein des Klosters und der Kaiserpfalz<br />
Memleben e.V., Illustrationen: Thomas<br />
Siebenhaar, 80 Seiten, 67 Zeichnungen, ISBN<br />
978-3-86568-214-7, Euro 9,95<br />
Auf liebevolle und verständliche Art<br />
zeigt dieses kleine Buch eine der großen<br />
Kulturleistungen der Klöster: Sie achteten<br />
die Schönheit und Geheimnisse der Natur,<br />
doch sie erforschten auch ihre Nutzbarkeit.<br />
Benediktinischer Geist prägte unsere Landschaften<br />
und Gewohnheiten – dies wird besonders<br />
deutlich am Beispiel der Gartenbaukultur.<br />
Der Band beschreibt das Aussehen<br />
der Klostergärten, zeigt die unterschiedliche<br />
Bewirtschaftung und Lebensweise<br />
im Mittelalter im Gegensatz zu<br />
heute. Dabei spielen auch Fragen der Essund<br />
Kochgewohnheiten, des Anbaus von<br />
Gemüsen, Obst, Kräutern und anderer<br />
„Wundermittel“ sowie das Kranksein im<br />
Mittelalter eine wichtige Rolle. Das Werk ist<br />
mit anschaulichen Aquarellzeichnungen<br />
bebildert. >><br />
unitas 3-4/2007 243
248<br />
Zeitschrift des Verbandes<br />
der wissenschaftlichen<br />
kath. Studentenvereine<br />
UNITAS<br />
Aachener Str. 29<br />
41564 Kaarst (Büttgen)<br />
ISSN 0344 - 9769<br />
unitas 3-4/2007<br />
<strong>Unitas</strong>, Aachener Str. 29, 41564 Kaarst (Büttgen),<br />
PVSt; DPAG, Entgelt bezahlt.<br />
Krone-Seminar 2008<br />
vom 13. bis 16. März im Ernst-Lemmer-Institut in Berlin<br />
Europa: Mythos und Wirklichkeit<br />
Welche Zukunft hat Europa? – Enttäuschungen und Hoffnungen<br />
Nachdem sich der UNITAS-Verband auf der 130. Generalversammlung in Trier eindeutig zum christlichen Fundament Europas<br />
bekannt hat, bietet das Krone-Seminar 2008, ausgehend von den faktischen Gegebenheiten, die Gelegenheit, zu einer<br />
konkretisierenden Auseinandersetzung mit dem europäischen Einigungswerk. Die Tagung richtet den Blick auf die Realität,<br />
um die Entwicklung des europäischen Gedankens zu verstehen und gleichzeitig Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft<br />
aufzuzeigen.<br />
Vier Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:<br />
1. Wie entstand die europäische Einigungsbewegung und welche Interessen waren damit verbunden?<br />
2. Kann die katholische Soziallehre die Entwicklung Europas beeinflussen?<br />
3. Welche beruflichen Perspektiven bietet Europa jungen Berufsanfängern?<br />
4. Wie steht es um die Chancen für eine europäische Verfassung, die ihren Namen verdient?<br />
Das Programm, das wie gewohnt auch den Rahmen für ein Treffen mit den Mitgliedern des Krone-Kreises bietet, wird auf der<br />
Homepage des Seminars unter www.krone-seminar.de veröffentlicht. Dort besteht auch die Möglichkeit der Online-<br />
Anmeldung.<br />
Tagungsleitung: Bbr. Stefan Evers, Berlin<br />
Bbr. Martin Hinzmann, Bonn<br />
Tagungsort: Ernst-Lemmer-Institut, Suarezstr. 15-17, 14057 Berlin-Charlottenburg<br />
Das Seminar richtet sich an Studenten und Akademiker, insbesondere an Mitglieder des Verbandes der wissenschaftlichen<br />
katholischen Studentenvereine UNITAS. Es wird vorausgesetzt, dass sich jede Anmeldung verbindlich auf die Teilnahme am<br />
gesamten Seminar bezieht.<br />
Für Studenten wird kein Kostenbeitrag erhoben. Ein Antrag auf Fahrtkosten kann gestellt werden, wenn diese nicht vom<br />
örtlichen Altherrenverein übernommen werden.<br />
Teilnehmer mit eigenem Einkommen tragen ihre Fahrtkosten selbst und zahlen einen Beitrag in Höhe von 200 Euro (Ehepaare<br />
350 Euro), in dem Verpflegungs- sowie Unterbringungskosten (Einzelzimmer) enthalten sind.<br />
Das Programm liegt auch in der Geschäftsstelle des UNITAS-Verbandes, Aachener Str. 29, 41564 Kaarst vor:<br />
Tel. 02131 / 27 17 25, Fax 02131 / 27 59 60, E-Mail: vgs@UNITAS.org. Wer die Online-Anmeldung nicht in Anspruch nehmen<br />
möchte, kann seine Anmeldung auch an die Verbandsgeschäftsstelle richten.