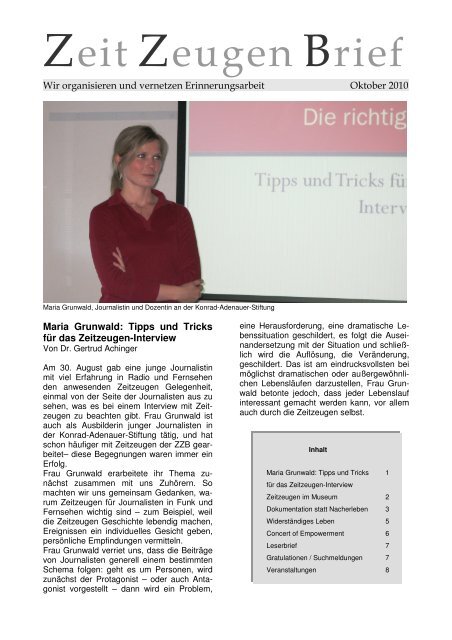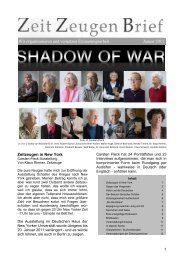ankündigung - NTNU
ankündigung - NTNU
ankündigung - NTNU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeit Zeugen Brief<br />
Wir organisieren und vernetzen Erinnerungsarbeit Oktober 2010<br />
Maria Grunwald, Journalistin und Dozentin an der Konrad-Adenauer-Stiftung<br />
Maria Grunwald: Tipps und Tricks<br />
für das Zeitzeugen-Interview<br />
Von Dr. Gertrud Achinger<br />
Am 30. August gab eine junge Journalistin<br />
mit viel Erfahrung in Radio und Fernsehen<br />
den anwesenden Zeitzeugen Gelegenheit,<br />
einmal von der Seite der Journalisten aus zu<br />
sehen, was es bei einem Interview mit Zeitzeugen<br />
zu beachten gibt. Frau Grunwald ist<br />
auch als Ausbilderin junger Journalisten in<br />
der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig, und hat<br />
schon häufiger mit Zeitzeugen der ZZB gearbeitet–<br />
diese Begegnungen waren immer ein<br />
Erfolg.<br />
Frau Grunwald erarbeitete ihr Thema zunächst<br />
zusammen mit uns Zuhörern. So<br />
machten wir uns gemeinsam Gedanken, warum<br />
Zeitzeugen für Journalisten in Funk und<br />
Fernsehen wichtig sind – zum Beispiel, weil<br />
die Zeitzeugen Geschichte lebendig machen,<br />
Ereignissen ein individuelles Gesicht geben,<br />
persönliche Empfindungen vermitteln.<br />
Frau Grunwald verriet uns, dass die Beiträge<br />
von Journalisten generell einem bestimmten<br />
Schema folgen: geht es um Personen, wird<br />
zunächst der Protagonist – oder auch Antagonist<br />
vorgestellt – dann wird ein Problem,<br />
eine Herausforderung, eine dramatische Lebenssituation<br />
geschildert, es folgt die Auseinandersetzung<br />
mit der Situation und schließlich<br />
wird die Auflösung, die Veränderung,<br />
geschildert. Das ist am eindrucksvollsten bei<br />
möglichst dramatischen oder außergewöhnlichen<br />
Lebensläufen darzustellen, Frau Grunwald<br />
betonte jedoch, dass jeder Lebenslauf<br />
interessant gemacht werden kann, vor allem<br />
auch durch die Zeitzeugen selbst.<br />
Inhalt<br />
Maria Grunwald: Tipps und Tricks 1<br />
für das Zeitzeugen-Interview<br />
Zeitzeugen im Museum 2<br />
Dokumentation statt Nacherleben 3<br />
Widerständiges Leben 5<br />
Concert of Empowerment 6<br />
Leserbrief 7<br />
Gratulationen / Suchmeldungen 7<br />
Veranstaltungen 8
Für das Gelingen von Interviews verriet uns<br />
Frau Grunwald eine Reihe von Tipps für die<br />
Zeitzeugen, die ich zusammengefasst wiedergebe:<br />
die Zeitzeugen sollten vor Beginn<br />
des Interviews mit den Journalisten klären,<br />
welches Ereignis in ihrem Lebenslauf behandelt<br />
werden soll, und was dabei persönliche<br />
Herausforderung und was Auflösung war.<br />
Die Zeitzeugen sollten sich hinsichtlich allgemeiner<br />
Daten und Fakten auf die Journalisten<br />
verlassen und sich ganz auf ihre persönlichen<br />
Erlebnisse konzentrieren. Beide Ebenen<br />
sind bei einer Geschichte wichtig, die<br />
Zeitzeugen können jedoch besonders authentisch<br />
die emotionalen Aspekte einer Situation<br />
schildern.<br />
Die Zeitzeugen sollten sich das Ereignis, über<br />
das sie sprechen wollen, schon vor dem Interview<br />
möglichst genau vergegenwärtigen<br />
und sich Einzelheiten in Erinnerung rufen. Sie<br />
sollten in der „Sprechsprache“ und nicht in<br />
einem gestelzten Deutsch reden – einfach<br />
und konkret. Sie sollten dabei an die fünf<br />
Sinne denken, sich vergegenwärtigen, was<br />
sie gesehen, gehört, gefühlt, gerochen und<br />
geschmeckt haben.<br />
Zeitzeugen sollten sich überlegen, ob sie ihre<br />
Darlegungen durch authentische Erinnerungsstücke<br />
und Anschauungsmaterial – Fotos,<br />
typische Alltagsgegenstände, Gang mit<br />
dem Interviewer an historische Orte – noch<br />
plastischer machen können.<br />
Die Zeitzeugen sollten Emotionen nicht ausblenden,<br />
aber ihre eigenen Grenzen von Anfang<br />
an deutlich machen.<br />
In der Diskussion wurden einige typische<br />
Kommunikationsprobleme zwischen Zeitzeugen<br />
und Journalisten angesprochen: Diese<br />
betreffen am häufigsten Unklarheit darüber,<br />
was die jeweilige Rolle von Zeitzeuge und<br />
Journalist ist und was das eigentliche Thema<br />
des Interviews sein soll. Die Zeitzeugen sollten<br />
darauf bestehen, dass die Journalisten<br />
ihre Absichten und Motive von vornherein<br />
offen legen. Es wurde außerdem die Kontrolle<br />
des Ergebnisses eines Interviews angesprochen.<br />
Frau Grunwald sagte dazu ganz<br />
klar, dass eine nachträgliche Änderung eine<br />
Interviews durch den Zeitzeugen nicht möglich<br />
und üblich ist, deshalb sei ein Vertrauensverhältnis<br />
zwischen den Beteiligten notwendig.<br />
Schließlich wurde noch angesprochen,<br />
dass Journalisten manchmal feste Vorerwartungen<br />
haben und auf bestimmten Aussagen<br />
der Zeitzeugen bestehen – das ist<br />
nach Frau Grunwald ganz unprofessionell.<br />
Sie betonte, dass alle diese Fragen in der<br />
2<br />
Zeitzeugen im Museum<br />
Schulung junger Journalisten angesprochen<br />
würden. Ingesamt ein aufschlussreicher<br />
Nachmittag mit einer sehr liebenswerten<br />
Vertreterin der Journalistenzunft.<br />
Zeitzeugen im Museum<br />
Von Steffi de Jong, Doktorandin<br />
An einem sehr heißen Tag Anfang Juli traf ich<br />
mich in der Geschäftsstelle der Zeitzeugenbörse<br />
mit Frau Geffers. Ich hatte schon viel<br />
über die Zeitzeugenbörse gelesen und gehört<br />
und war sehr gespannt, sie nun endlich auch<br />
aus erster Hand kennen zu lernen. Ich wurde<br />
sehr nett empfangen und bei Kaffee erzählte<br />
mir Frau Geffers lange, wie alles angefangen<br />
hat und welche Aufgaben die Zeitzeugenbörse<br />
heute wahrnimmt. Die Fragen danach,<br />
welche Funktion Zeitzeugen in der gegenwärtigen<br />
Geschichtskultur übernehmen, beschäftigt<br />
mich schon längere Zeit; genau genommen<br />
seit ich vor ungefähr zwei Jahren mit<br />
meinen Dissertationsprojekt über die Funktion<br />
und Darstellung von Zeitzeugen in Museen<br />
begonnen habe. Wie kam es zu diesem<br />
Thema?<br />
Im Frühling 2008 besuchte ich im Rahmen<br />
der Forschungen für meine Masterarbeit – es<br />
ging darin um die von Museen vermittelten<br />
Europabilder – die Ausstellung Es ist unsere<br />
Geschichte! des Brüsseler Museum of Europe.<br />
Das Thema der Ausstellung, die zum 50.<br />
Jahrestag der Römischen Verträge organisiert<br />
wurde, ist die Geschichte der Europäischen<br />
Integration von 1945 bis heute. Wie<br />
der Titel der Ausstellung schon andeutet, will<br />
das Museum zeigen, dass diese Geschichte<br />
– auch – eine Geschichte der einfachen Bürger<br />
ist. Dargestellt wird die Integrationsgeschichte<br />
deshalb unter anderem durch siebenundzwanzig<br />
Bürger der Europäischen<br />
Union, deren persönliche Geschichten mit<br />
und in Europa die Besucher sich an siebenundzwanzig,<br />
über die ganze Ausstellung verteilten,<br />
Videostationen ansehen und anhören<br />
können.<br />
Dort erzählen zum Beispiel die Deutschen<br />
Inge und Klaus Stürmer von ihrer Flucht aus<br />
der DDR im Jahre 1962 oder die Belgierin<br />
Rita Jeusette von ihrer Beteiligung am Streik<br />
in der Nationalen Waffenfabrik im belgischen<br />
Herstal, wo Arbeiterinnen 1966 um Lohngleichstellung<br />
kämpften. Bereits im zweiten<br />
Raum der Ausstellung blicken diese Stellvertreter<br />
der europäischen Integrationsgeschichte<br />
dem Besucher von einem Gruppenfoto<br />
entgegen.
Dieses Foto ist so<br />
konzipiert, dass es<br />
Reminiszenzen mit<br />
den offiziellen Gruppenfotos<br />
von Politikern,<br />
die bei EU-<br />
Gipfeln aufgenommen<br />
werden, hervorruft.<br />
Gleich zu Beginn<br />
der Ausstellung<br />
Foto: Steffi de Jong<br />
wird also ein enge<br />
Verwandtschaft zwischen einer Geschichte<br />
‚von unten’ und der Geschichte der Entscheidungsträger<br />
aufgestellt. Meine Analyse der<br />
Ausstellung Es ist unsere Geschichte! führte<br />
zu der Idee, die Rolle, die Zeitzeugen generell<br />
in zeithistorischen Museen spielen zu<br />
untersuchen. In welchen Museen kommen<br />
Zeitzeugen vor? Auf welche Art und Weise<br />
werden sie dargestellt und in die Ausstellung<br />
integriert? Welcher Stellenwert wird der individuellen<br />
Erinnerung und dem individuellen<br />
Zeitzeugnis in der musealen Geschichtsdarstellung<br />
zugesprochen? Und in welchem<br />
Verhältnis stehen die Zeitzeugnisse zu den<br />
traditionellen Museumsobjekten?<br />
Ich fing an, durch Europa zu reisen, um mir<br />
anzusehen, wie Museen mit persönlicher<br />
Erinnerung umgehen. Tatsächlich setzen<br />
immer mehr Museen in ihren Ausstellungen<br />
Zeitzeugenvideos oder zumindest Audio-<br />
Stationen mit Interviews von Zeitzeugen ein.<br />
Einige Museen benutzen die Interviews lediglich<br />
als Vertiefungsebenen zu einem ansonsten<br />
von Objekten getragenen Narrativ. So<br />
sind zum Beispiel im Haus der Geschichte in<br />
Bonn oder im Königlichen Museum der Armee<br />
und der Militärgeschichte in Brüssel die<br />
wenigen Videointerviews eher hinter einer<br />
Überfülle von Objekten versteckt. Andere<br />
Museen wiederum räumen den Interviews<br />
eine zentrale Position in der musealen Geschichtsdarstellung<br />
ein. Eines der eindrucksvollsten<br />
Beispiele hierfür ist das Museo Diffuso<br />
in Turin, ein kleines Stadtmuseum über<br />
den Zweiten Weltkrieg und die Widerstandsbewegung,<br />
in welchem das Geschichtsnarrativ<br />
fast ausschließlich von Zeitzeugenvideos<br />
getragen wird. Am umfangreichsten kommen<br />
Interviews mit Zeitzeugen aber wohl in den<br />
Dauerausstellungen von KZ-Gedenkstätten<br />
vor. Kaum eine Gedenkstätte in der man sich<br />
nicht wenigstens über Audioguide Auszüge<br />
aus Interviews mit ehemaligen Gefangenen<br />
anhören kann.<br />
Dass der individuellen Erinnerung, der Geschichte<br />
des einfachen Bürgers die Möglich-<br />
Dokumentation statt Nacherleben<br />
keit zuerkannt wird, im Museum stellvertretend<br />
für umfassendere Geschichtsprozesse<br />
zu stehen, ist eine Entwicklung der letzten<br />
zehn Jahre. Zurückzuführen ist sie auf einen<br />
in den 1960er Jahren einsetzenden Prozess,<br />
während dessen Zeitzeugen ein immer höherer<br />
Stellenwert in der populären Kultur zuerkannt<br />
wurde. Dazu beigetragen haben Großereignissen<br />
wie der Eichmannprozess 1961,<br />
Videointerviewprojekten, wie das Fortunoff<br />
Video Archive for Holocaust Testimonies oder<br />
Steven Spielbergs Shoah Visual History<br />
Foundation, aber auch ein verstärktes Auftreten<br />
von Zeitzeugen in Fernsehdokumentation<br />
sowie eine immer umfassendere Geschichtswerkstättenbewegung<br />
und natürlich<br />
die Gründung von Zeitzeugenbörsen.<br />
Dokumentation statt Nacherleben<br />
Wie sich Wissenschaftler eine Ausstellung<br />
zur Vertreibung der Deutschen vorstellen<br />
Von Marius Krohn, Historiker<br />
Professor Schulze Wessel versprach den<br />
etwa 150 Historikern, Journalisten und anderen<br />
Interessierten ein konkretes Konzept für<br />
eine Ausstellung über die Vertreibung der<br />
Deutschen am Ende und nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg. Diese Ausstellung sei seit etwa<br />
1999 beschlossene Sache, aber auch nach<br />
der Gründung einer Stiftung „Flucht, Vertreibung,<br />
Versöhnung“ habe man noch nichts<br />
gehört. Die Autoren wollen ihr Konzept als<br />
Anstoß einer internationalen inhaltlichen Diskussion<br />
verstanden wissen.<br />
Im Mittelpunkt stehe die Beantwortung der<br />
„grundlegenden Frage:“ „Was waren die Ursachen,<br />
was die Folgen der Vertreibung?“ Im<br />
Jahre 2005 hatte es mit der Ausstellung „Erzwungene<br />
Wege“, die der Bund der Vertriebenen<br />
maßgeblich gestaltet hatte, einen Versuch<br />
gegeben, die Geschichte der Zwangsmigration<br />
am Ende und nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg zu erzählen. Schulze Wessel<br />
sprach dieser Ausstellung allerdings ab, die<br />
grundlegende Frage beantwortet zu haben.<br />
Statt nach konkreten historischen Hintergründen<br />
und Akteuren zu fragen, habe man dort<br />
im Nationalismus und dem Streben nach ethnischer<br />
Einheitlichkeit eine gewissermaßen<br />
übermenschliche Triebfeder ausgemacht, die<br />
alle europäischen Zwangsmigrationen verursacht<br />
habe. Diese Einschätzung wird in der<br />
historischen Wissenschaft allerdings m. E.<br />
weder einhellig noch mehrheitlich geteilt.<br />
Schulze Wessel berief sich auf das Stiftungsgesetz,<br />
nach der die geplante Ausstellung<br />
3
das „Gedenken an Flucht und Vertreibung im<br />
20. Jahrhundert im historischen Kontext des<br />
Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen<br />
Expansions- und Vernichtungspolitik<br />
und ihrer Folgen“ wach halten solle. Die Autoren<br />
der „konzeptionellen Überlegungen“ halten<br />
dafür eine Zweiteilung des Angebots für<br />
am geeignetsten. Grob könnte man sagen,<br />
dass die Ausstellung in Theorie und Wirklichkeit<br />
geteilt werden soll. Hier als „Problemorientierte<br />
Zugänge“ und „Orte von Flucht, Vertreibung<br />
und Integration“ bezeichnet. Als<br />
erstes die vier „problemorientierten Zugänge“.<br />
Im ersten Zugang „Staat – Nation – Rasse“,<br />
soll versucht werden, den Zeitgeist im Europa<br />
des frühen Zwanzigsten Jahrhunderts auf<br />
diese und ähnliche Begriffe einzufangen. Es<br />
soll deutlich werden, dass es zwar in den<br />
Staaten, aus denen später die Deutschen<br />
vertrieben wurden, ein Streben nach ethnischer<br />
Einheitlichkeit gab, dass man aber mit<br />
den Minderheiten lebte und Pläne für deren<br />
Aussiedlung oder gar Vernichtung zumindest<br />
nicht mehrheitsfähig waren. Hierin unterscheide<br />
sich der Nationalismus dieser Staaten<br />
ganz entschieden von dem rassischen<br />
Staatsverständnis der Nationalsozialisten, die<br />
ja nicht nur im eigenen Staat die „rassische“<br />
Einheitlichkeit um den Preis der Ermordung<br />
der „Fremden“ anstrebten, sondern sogar den<br />
„Lebensraum“ anderer Völker für sich beanspruchten<br />
und die dort lebenden Volksgruppen<br />
lediglich als zu versklavende und zu vernichtende<br />
Übergangsbevölkerung betrachteten.<br />
Aus diesen Unterschieden leitet sich auch<br />
der zweite Zugang ab, eine Auseinandersetzung<br />
mit dem Zusammenleben der verschiedenen<br />
Volksgruppen, vor allem in den Staaten<br />
des Ostens und Südostens, in denen die<br />
Nationen keineswegs nur aus jeweils einem<br />
Staatsvolk bestanden. Dabei geht es den<br />
Autoren darum zu zeigen, dass sich zwar das<br />
Zusammenleben vor dem Zweiten Weltkrieg<br />
nicht reibungslos gestaltete, dass es aber<br />
Möglichkeiten des Ausgleichs gegeben habe.<br />
Die Nationalsozialisten hätten aber in den<br />
von der Wehrmacht eroberten Gebieten<br />
durch die Förderung und Ausnutzung der<br />
Nationalitätenkonflikte den Hass zwischen<br />
den Volksgruppen angefacht, der dann,<br />
durch die Jahre der extremen politischrassistischen<br />
und kriegerischen Gewalt verstärkt<br />
und entgrenzt, auf die Deutschen zurückgefallen<br />
sei.<br />
4<br />
Dokumentation statt Nacherleben<br />
Der dritte Zugang soll die Integration der Vertriebenen<br />
in den Ankunftsgesellschaften in<br />
den Blick nehmen. Die Autoren betrachten<br />
hier die Integration als eine Eingliederung der<br />
Zuwanderer in die einheimische Bevölkerung<br />
als einen Vorgang der gegenseitigen kulturellen<br />
und sozialen Anpassung.<br />
Der vierte Zugang, der unter der Überschrift<br />
„Erinnerung und Begegnung“ steht, soll gewissermaßen<br />
der Selbstbespiegelung dienen.<br />
Hier wird nach dem Umgang der Nachkriegsgesellschaften<br />
mit dem Thema Flucht und<br />
Vertreibung gefragt. In dieser Abteilung wäre<br />
dann auch Platz, wie Schulze Wessel auf<br />
eine Nachfrage hin bestätigte, die Geschichte<br />
der Ausstellung selbst zu betrachten.<br />
Der zweite große Teil der Ausstellung soll,<br />
wie die Überschrift „Orte von Flucht, Vertreibung<br />
und Integration“ schon andeutet, mit<br />
Hilfe ausgewählter Städte bzw. Orte der Veranschaulichung<br />
der vergangenen Wirklichkeit<br />
dienen. Auf der Tagung wurden als Beispiele<br />
Breslau, Aussig a.d. Elbe und das litauische<br />
Vilnius genannt. Diesen Beispielen sollen<br />
nach dem Willen der Autoren noch viele weitere<br />
folgen. „Mit dem Prinzip einer topografischen<br />
Modularisierung wird also keine mehr<br />
oder weniger abstrakte 'Großerzählung'<br />
angestrebt, sondern die Verbindung einzelner<br />
mikroregionaler und -lokaler Geschichten.“,<br />
wie es Schulze Wessel in<br />
schönstem Historikerdeutsch ausdrückt. Es<br />
soll kurz gesagt darum gehen, den einzelnen<br />
Menschen mit ihren Schicksalen darzustellen.<br />
Es soll deutlich werden, dass deren Lebensgeschichte<br />
Kapitel hat, die vor und nach der<br />
Vertreibung geschrieben worden sind.<br />
Als Ausstellungsform stellen sich die Autoren<br />
eine Dokumentationsausstellung vor. Das<br />
heißt, dass Ausstellungsobjekte in den Hintergrund<br />
treten und eher veranschaulichenden<br />
Charakter haben sollen. Der Besucher<br />
soll nicht nacherleben, sondern an Hand von<br />
Dokumenten (Interviews, Verordnungen, historische<br />
Selbstzeugnisse wie Tagebücher<br />
und Briefe u.a.m.) Informationen über das<br />
Geschehen erhalten.<br />
Problematisch erscheint mir vor allem der<br />
„theoretische“ Teil des Konzepts. Das Leid<br />
des Einzelnen danach zu unterscheiden,<br />
welchen Plan seine Peiniger verfolgten, mag<br />
für Wissenschaftler eine geistige Herausforderung<br />
sein, dem Opfer oder dessen Angehörigen<br />
wird das aber kaum gerecht. Mir<br />
stellt sich auch die Frage, wie das alles so<br />
ausgestellt werden soll, dass das Publikum<br />
sich überhaupt darauf einlässt. Das ist für
den Kurator einer Ausstellung allen inhaltlichen<br />
Debatten zum Trotz die wichtigste Frage.<br />
Ich kann mir im Augenblick nur Textmassen<br />
vorstellen. Die Überlegungen für den<br />
zweiten Teil halte ich dagegen für gelungen,<br />
nur unterscheiden sie sich nicht wesentlich<br />
von dem Konzept der Ausstellung „Erzwungene<br />
Wege“.<br />
Das Konzeptpapier und die Kommentare<br />
finden Sie unter:<br />
http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/index.asp?pn=texte&id=1350"http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/index.asp?pn=texte&id=1350_<br />
Sie finden auch auf der Hauptseite<br />
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/<br />
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/<br />
auf der rechten Seite eine Weiterleitung zur<br />
Diskussion<br />
Widerständiges Leben?<br />
Von Klaus Schwerk, Zeitzeuge<br />
Eine knappe halbe Stunde, am Dienstag,<br />
dem 14. September, hat sie berichtet, was sie<br />
auf 270 Seiten in einer „politischen Autobiografie“<br />
niedergeschrieben hat – Clara Welten<br />
alias Christiane Zimmerling, 43 Jahre alt.<br />
Eigentlich war es doch gar nicht so neu, was<br />
sie über ihr Leben als Kind und Jugendliche<br />
in der DDR erzählte, möchte man meinen.<br />
Aber als sie endete, konnte ich nicht anders,<br />
als tief durchatmen, um so die aufgelaufene<br />
Spannung abzubauen, die sich in mir entwickelt<br />
hatte. Was für ein Leben!<br />
Kind eines Kirchenmusikers und einer Krankenschwester,<br />
geboren in Zeitz und – ich<br />
konnte nicht schnell genug mitschreiben und<br />
weiß nicht, wo – dort oder andernorts mit<br />
sieben eingeschult – der Anfang eines – ich<br />
kann’s nicht anders benennen – wahnsinnigen<br />
Lebensweges. Ihr Elternhaus, geprägt<br />
durch die konsequente und kompromisslose<br />
Aufrichtigkeit der Bekennenden Kirche während<br />
der Hitlerzeit, „Du sollst nicht andere<br />
Götter haben neben mir.“ Das war das Erste<br />
Gebot für Israel und Christenheit, und nationaler<br />
wie internationaler Sozialismus waren<br />
„Gegengötter“ mit Gegenkonzepten. Auf dieser<br />
Basis lebte ihre Familie und handelte entsprechend.<br />
Die siebenjährige Schülerin war<br />
als einzige nicht „organisiert“ und damit –<br />
vermutlich – für die Schule, zumindest aber<br />
für die Klassenlehrerin ein „Stein des Anstoßes“.<br />
Wir wissen, wie „hundertprozentige<br />
Planerfüllung“ gefordert, belohnt und im<br />
Widerständiges Leben?<br />
Versagensfall sanktioniert wurde. Das Kind<br />
und die Jugendliche blieben hart und konsequent,<br />
wenn’s um den geforderten Kotau<br />
ging: beim Flaggenappell, beim Wehrkundeunterricht,<br />
bei all den vielen „Kleinigkeiten“ ,<br />
mit denen das Leben selbst der Jüngsten<br />
„auf Vordermann“ getrimmt und ihr Vater immer<br />
wieder zum Schulleiter „zitiert“ wurde.<br />
Der Vater – das erzählte sie nicht, aber als<br />
Vater von sechs ungemein „nonkonformen“<br />
Kindern kann ich es mühelos nachempfinden<br />
– hat die Tochter, die ja wirklich ein Kind war<br />
(„strafunmündig“ nach unserem Rechtsverständnis),<br />
nicht etwa mit dem Ausweg, sie sei<br />
eben nur ein bisschen aufmüpfig oder so anbiedernd<br />
mit den Schergen in Schutz genommen.<br />
Kein Wunder, dass sehr bald die<br />
Familie im Fadenkreuz der Staatssicherheit<br />
stand. („Fadenkreuz“ – zum Abschuss freigegeben!)<br />
Kann man so, im dauernden Widerstand<br />
gegen alle Welt, leben?<br />
Vater und Tochter – die Mutter und die andere<br />
Schwester nicht – haben sehr bald nach<br />
der Wende ihre Stasi-Akten eingesehen. Sie<br />
offenbarten die nicht neue und doch immer<br />
wieder entsetzliche Erkenntnis, wie teuflisch<br />
eng das Geflecht der gegenseitigen Bespitzelung<br />
war – Schwärzung der Echtnamen sind<br />
ja nur ein unbeholfener und schließlich vergeblicher<br />
Versuch, einem Daten- und Persönlichkeitsschutz<br />
zu entsprechen. Drei Mitschülerinnen<br />
allein waren auf drei Aspekte ihres<br />
Lebens „angesetzt“ wie Egel, und als „Operativer<br />
Vorgang“ gab die Einsatzleitung die<br />
Weisung: „Zerstörung des Objekts“. – Wer<br />
kann da noch einfach durchatmen?<br />
Man sollte, wenn man den nötigen Mut hat,<br />
sich jene 270 Seiten Bericht in Gänze zumuten.<br />
Es ist nicht möglich, in gebotener Kürze<br />
und Angemessenheit eine Zusammenfassung<br />
zu geben.<br />
Doch eine Frage bleibt nach diesem Bericht,<br />
und einer der Juroren, der ihr den Preis für<br />
ihre Biografie zusprach, hat sie formuliert:<br />
Darf ich meinen Kindern erzieherische Vorstellungen<br />
vermitteln, die sie in Widersprüche<br />
zum herrschenden System führen?<br />
Clara Welten hat ihren Widerstand nicht aus<br />
Abhängigkeit oder Gehorsam dem Vater gegenüber<br />
durchgehalten, sondern aus Überzeugung,<br />
so habe ich sie verstanden - und ist<br />
daran (fast) zerbrochen. Gespräche mit Gesinnungsgenossen<br />
aus jener DDR-Zeit brachte<br />
sie zu Fragen, ob es nicht wirklich auch<br />
Alternativen gegeben hätte, ehrenwerte und<br />
nicht opportunistische. Diese Fragen im Buch<br />
waren es, dass ihr Vater sich von ihr distan-<br />
5
ziert hatte bis zur<br />
Weigerung der Eltern,<br />
sich an dem<br />
Dokumentarfilm zu<br />
beteiligen, „weil sie<br />
nicht noch einmal<br />
alles durchmachen<br />
wollten„. Und sie hat<br />
ihren Namen – um<br />
ihre Familie zu<br />
Foto: Clara Welten<br />
schützen – durch ein<br />
Pseudonym getarnt:<br />
„Welten„ nennt sie sich, weil „Zwei Welten„ ihr<br />
Leben prägten.<br />
Ich hätte gern verhindert, was im nachfolgenden<br />
Gespräch ausführlich zum Ausdruck<br />
kam: die Anklage gegen einen Vater, der<br />
seine Tochter in diese unbeschreibliche Lage<br />
durch seine radikale Sicht gebracht hat. Aber<br />
er ist ihr Vater, und es war keine Frage, dass<br />
sowohl sie wie er tiefe Wunden lebenslang zu<br />
tragen haben und darunter leiden. Aber er ist<br />
und bleibt ihr Vater, und warum haben die<br />
Rückfragenden, die Anklagenden nicht an<br />
dies bei ihren Beiträgen bedenken können?<br />
Waren sie zu unmittelbar angerührt, dass sie<br />
jedes Mitgefühl für eine Tochter verloren hatten,<br />
die als Folge ihres vatergeprägten Lebens<br />
die Solidarität des Vaters verloren hat?<br />
Es wäre unserem Ansatz glaubwürdiger Zeitzeugenschaft<br />
angemessen gewesen, an diesem<br />
Punkt zu schweigen. Aber uns fielen nur<br />
Beispiele und kleinliche Anmerkungen aus<br />
unserem Leben ein, kamen uns nur fade Erklärungen<br />
wie „Aber man muss doch überleben!“<br />
in den Sinn.<br />
Auf dem Weg zur U-Bahn ging mir plötzlich<br />
die Strophe durch den Sinn: „Die Freiheit und<br />
das Himmelreich gewinnen keine Halben...<br />
(Ja, ja, ich weiß: Ernst Moritz Arndt und alles,<br />
was ihm nun angehängt worden ist. Und<br />
trotzdem!)<br />
Concert of Empowerment<br />
Von Wolf Kampmann, Journalist<br />
Berlin – die geschundene Stadt, die immer<br />
wieder am Rande des Untergangs steht und<br />
doch stets aus den Ruinen ihrer wechselnden<br />
Identität aufersteht. Berlin, die zerstörte und<br />
wieder aufgebaute, geteilte und wieder vereinte,<br />
von der Subkultur eroberte und luxussanierte<br />
Stadt.<br />
Berlin, die Stadt, die ihre Erinnerung tilgt wie<br />
das Stadtschloss und den Palast der Republik.<br />
Die scheinbar geschichtslose Stadt, die<br />
längst selbst Fanal der Geschichte ist. Es ist<br />
Concert of Empowerment<br />
leicht, aus Washington geflogen zu kommen,<br />
der Welt zu verkünden: Ich bin ein Berliner,<br />
und sich wieder in den Flieger zu setzen.<br />
Doch was heißt es für die Berliner, Berliner<br />
zu sein?<br />
Berlin ist Veränderung. 1848, 1871, 1918,<br />
1933, 1938, 1945, 1953, 1961, 1989 – die<br />
Stadt sollte und wird niemals zur Ruhe kommen.<br />
Berlin ist eine offene Wunde, die sich<br />
immer wieder schließt. Eine Metropole, die –<br />
mehrfach zur Hauptstadt ausgerufen – doch<br />
niemals zur Residenz erstarrt.<br />
Berlin ist vor allem seine Menschen. Icke,<br />
dette, kieke mah, Herz und Schnauze! Wannsee<br />
und Müggelsee, Alex und Kudamm, Telespargel<br />
und Langer Lulatsch, Neukölln und<br />
Marzahn, Dahlem und Mitte. Türken, Russen,<br />
Araber, Polen, Vietnamesen, Angolaner,<br />
Griechen, Italiener, Amerikaner, Schwaben,<br />
Sachsen, Rheinländer und eine Handvoll<br />
Ureinwohner. Viele sind hinzugekommen, nur<br />
wenige waren schon immer da. Unzählige<br />
Gassenhauer und Moritaten, Operetten und<br />
Musicals sind über Berlin geschrieben worden.<br />
Doch Paul Lincke und Eduard Künneke<br />
treffen heute ebenso wenig den Ton der<br />
Stadt wie Ideal oder Linie 1. Zehn Jahre nach<br />
der Jahrtausendwende und zwei Jahrzehnte<br />
nach Wiedervereinigung hat sich der Moloch<br />
an der Spree abermals gewandelt. Arm aber<br />
sexy ist ein Slogan, der vereint. Nicht nur Ost<br />
und West, sondern auch Jung und Alt, Heute<br />
und Gestern, Migrant und Alteingesessenen.<br />
Dieses Berlin braucht eine neue Stimme,<br />
neue Melodien, einen neuen Ton. Das „Concert<br />
of Empowerment“ ist ein Projekt, das es<br />
in dieser Form noch nie gab. Initiatorin ist die<br />
Sängerin Jocelyn B. Smith. Sie ist Berlinerin<br />
und ist es gleichzeitig auch nicht. Die Amerikanerin<br />
lebt seit 25 Jahren in der deutschen<br />
Hauptstadt, wahrte jedoch stets genug Abstand,<br />
um niemals ihre Liebe und Leidenschaft<br />
für den Berliner Puls zu verlieren. Seit<br />
sie in Berlin ankam, stellt sie sich unentwegt<br />
die Frage, in welcher Stadt sie eigentlich lebt.<br />
Gemeinsam mit dem Saxofonisten und Komponisten<br />
Volker Schlott, einem Urgestein der<br />
Berliner Jazzszene, schenkt sie Berlin ein<br />
einzigartiges Oratorium, das erinnerte Gegenwart<br />
und gegenwärtige Erinnerung vereint.<br />
Getragen wird diese Vision von drei Generationen<br />
von Berlinern, drei Chören, die nur<br />
für diese spezielle Aufführung zusammenkommen.<br />
Ein Chor von Zeitzeugen des Zweiten<br />
Weltkriegs, die Zerstörung und Wiederaufbau<br />
mitgelebt haben, ein Chor mit Obdachlosen,<br />
die wissen, was der Kampf ums<br />
6
7<br />
Leserbrief / Gratulationen / Suchmeldungen<br />
tägliche Überleben in der multikulturellen<br />
Überflussgesellschaft bedeutet, und ein Jugendchor,<br />
der sich seine eigene Problemwelt<br />
gerade erst erkämpft. Einige dieser insgesamt<br />
etwa 70 Stimmen werden bald verhallen,<br />
andere haben ihre Blüte erst noch vor<br />
sich. Hier geht es nicht um Versöhnung oder<br />
Ausgleich, auch nicht um die Aufrechnung<br />
zwischen Opfern und Tätern, sondern um<br />
einen Dialog im allerletzten Augenblick, bevor<br />
er endgültig zum Erliegen kommt und einzigartige<br />
gelebte Erinnerung für immer in die<br />
Grube fährt. Das „Concert of Empowerment“<br />
ist die ebenso starke wie zerbrechliche Vision<br />
einer Künstlerin, die viel mehr zu geben hat,<br />
als sie selbst sagen kann. Das zutiefst<br />
menschliche Konzept des Scheiterns, das<br />
aus der Mitte der modernen Leistungsgesellschaft<br />
genauso verdrängt wurde wie der Ur-<br />
Berliner aus der Mitte der modernen Hauptstadt,<br />
ist ständiger Begleiter des Projektes.<br />
Seine Protagonisten sind vielfach selbst gescheitert,<br />
ohne je unterzugehen. Am 9. und<br />
10. November wird das Konzert an historischer<br />
Stätte, der „Schwangeren Auster“, die<br />
im Wandel der Jahrzehnte ihrerseits zum<br />
steinernen Zeitzeugen wurde, gemeinsam mit<br />
dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin aufgeführt<br />
werden. Das „Concert of Empowerment“<br />
ist eine einmalige Chance. Die Chance,<br />
sich ohne Bezichtigungen gemeinsam zu<br />
erinnern, Erfahrungen auszutauschen, kollektiv<br />
zu träumen von einer imaginären Vergangenheit<br />
und besseren Zukunft. Vor allem ist<br />
es aber auch die unwiederbringliche Möglichkeit,<br />
von innen und außen verstanden zu<br />
werden.<br />
Jocelyn B. Smith & Zeitzeugenchor - "wings<br />
of the dawn" - concert of empowerment"<br />
Text: Jocelyn B Smith / P. Coelho "krieger<br />
des lichts"/ Prof. J. J.Hurtak<br />
Musik : V. Schlott/ JBS<br />
Mitwirkende : Deutsche Sinfonie Orchester<br />
Dirigent : Prof. B. Wefelmeyer<br />
Chor 1 : Gropiusjugendchor<br />
Chor 2 : Different Voices of Berlin<br />
Chor 3 : Zeitzeugen und Kinder aus dem<br />
Projekt " Wir das ich in Dir"<br />
www.wethemeinyou.com<br />
Das Konzert wird am Abend des 10. November<br />
2010 im Haus der Kulturen der Welt stattfinden.<br />
Freie Karten für den Eintritt können<br />
bei der Zeitzeugenbörse e.V. reserviert werden.<br />
Bitte senden Sie uns dazu schriftlich per<br />
Brief, Fax oder E-Mail Ihren Namen, Telefon-<br />
Nr. (ggf. E-Mail Adresse) und Anschrift mit<br />
Angaben der Personenzahl.<br />
Leserbrief<br />
zum Septemberbrief 2010<br />
von Lothar Scholz, Zeitzeuge<br />
Guten Tag, liebe Freunde!<br />
Der Artikel von Klaus-Dieter Pohl trifft den<br />
Nagel auf den Kopf! Zu diesem Thema hat<br />
Horst Schüler (85) im Mai 2010 in Dresden<br />
eine Veranstaltung mit ca. 100 ehemaligen<br />
Gulag-Häftlingen und Dresdner Bürgern<br />
durchgeführt, bei der festgestellt wurde: Es<br />
gibt keine Ossies und Wessies und kein<br />
Westdeutschland, das sich von Ostdeutschland<br />
unterscheidet. Wir fahren nicht mehr<br />
nach drüben, sondern nach Sachsen oder<br />
Brandenburg oder auch nicht in den Westen,<br />
sondern Bayern, Hessen oder Holstein! Die<br />
Mauer in den Köpfen muss weg!<br />
Noch weiter: Wir ehemaligen Häftlinge sind<br />
nicht von den Russen verschleppt worden,<br />
denn die Russen sind Menschen wie Du und<br />
ich! Nein, das waren die Kommunisten<br />
Wir Wir gr gratulieren gr tulieren . . . .<br />
allen im Oktober geborenen Zeitzeugen<br />
01.10. Werner Salomon, 05.10. Inge Lempert,<br />
10.10. Margit Siebner, 15.10. Harri Firchau,<br />
16.10. Hans-Joachim Grimm, 18.10.<br />
Eleonore Eckmann, 28.10. Klaus Schwerk,<br />
28.10. Helga Cent-Velden, 28.10. Saskia von<br />
Brockdorff, 29.10. Brigitte Melchior, 30.10.<br />
Heinrich Polthier<br />
Suchmeldungen<br />
Nr. 127/10 - "Todesspiel" Fußballspiel in<br />
Kiew 1942 zwischen einer ukrainischen<br />
Mannschaft und der deutschen Luftwaffe<br />
Nr. 129/10 - Die Volksgruppe der Sinti und<br />
Roma - Schicksal im Nationalsozialismus und<br />
Leben heute<br />
Nr. 131/10 - Ehemalige Wehrmachtssoldaten,<br />
die als Wachpersonal farbige französische<br />
Kriegsgefangene in den Frontstalags<br />
bewacht haben<br />
Nr. 141/10 - Wehrmachtsangehörige während<br />
der Leningrader Blockade 1941-1944
8<br />
Veranstaltungen der Zeitzeugenbörse<br />
HALBKREIS<br />
Dienstag, den 26.10.2010, 15.00 Uhr<br />
Reife Jahre 1944-45<br />
W. Lindeke (Jg. 28) macht den Versuch, seine Gefühle und Erwartungen vom 15jährigen Kriegsfreiwilligen<br />
über die Einberufung als Hitlers Kindersoldat (Luftwaffenhelfer) und die Wandlung von<br />
jugendlich begeisterter Illusion über als notwendig erachtete Realität bis zur Desillusionierung in<br />
amerikanischer Gefangenschaft in der Normandie deutlich zu machen.<br />
Im 2. Teil des Halbkreises können Zeitzeugen über ihre Aktivitäten im Rahmen der Zeitzeugenbörse<br />
(Gespräche mit Lehrern, Schülern und Journalisten) berichten. Ganz besonders sind hierzu<br />
diejenigen eingeladen, die von Juli bis Oktober vermittelt wurden. Einige Namen seien hier benannt:<br />
Herr Schwerk, Frau Hertlein, Herr Pohl, Frau Naß, Frau Kubitza, Herr Eckert, Herr Wenzel.<br />
Weitere Zeitzeugen sind willkommen!<br />
ANKÜNDIGUNG<br />
Dienstag, 12.Oktober 2010, 17.00 Uhr<br />
Tunnel 57<br />
Vortrag von Winfried Schweitzer<br />
1964! „Tokio“ war das Stichwort, um von Ost nach West durch einen 145 m langen Tunnel unter<br />
der Bernauer Straße zu kommen. Die Aktion „Tunnel 57“ wurde Egon Schulze zum Verhängnis. Er<br />
starb im Kugelhagel seiner eigenen Kameraden.<br />
Der Vortragende Winfried Schweitzer war am Tunnelbau beteiligt und wird aus eigener Erfahrung<br />
berichten.<br />
Moderation: Eva Geffers<br />
Veranstaltungsort: Landeszentrale für politische Bildung, 10787 Berlin, An der Urania 4 - 10<br />
Ecke Kurfürstenstraße<br />
Verkehrsverbindungen: U1, U2, U3 Wittenbergplatz/Nollendorfplatz, Bus 100, M29, 187, Haltestelle Schillstraße,<br />
Bus 106, M19, M46 - Haltestelle An der Urania<br />
Impressum<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder!<br />
V.i.S.d.P.: Eva Geffers. Redaktion: Eva Geffers, Lektor: Dr. Klaus Riemer, Layout: Karin Rölle, ZeitZeugenBörse e.V., Ackerstr. 13,<br />
10115 Berlin, Tel: 030-44046378, Fax: 030-44046379, Mail: info@zeitzeugenboerse.de, web: www.zeitzeugenboerse.de<br />
Büro: Mo, Mi, Fr 10 –13 Uhr, Druck: Typowerkstätten Bodoni, Linienstrasse 71, 10119 Berlin. Tel: 030-2825137, Fax: 030-28387568,<br />
Mail: info@bodoni.org, Redaktionsschluss für die Novemberausgabe ist der 15. Oktober 2010. Kürzungen und redaktionelle Bearbei-<br />
tungen der eingesandten Beiträge bleiben der Redaktion vorbehalten. Den Wunsch nach Kontrolle vor der Veröffentlichung bitte extra<br />
und mit Tel.-Nr. vermerken. Wenn Sie den ZeitZeugenBrief statt per Post per E-Mail erhalten wollen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail!<br />
Über Spenden freuen wir uns sehr: Bank für Sozialwirtschaft BLZ 10020500, Kontonummer: 3340701