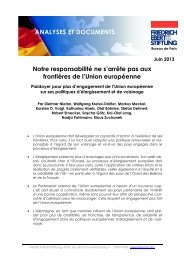Die Gewerkschaften in Frankreich - Friedrich Ebert Stiftung
Die Gewerkschaften in Frankreich - Friedrich Ebert Stiftung
Die Gewerkschaften in Frankreich - Friedrich Ebert Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INTERNATIONALE POLITIKANALYSE<strong>Die</strong> <strong>Gewerkschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong>Geschichte, Organisation, HerausforderungenJEAN-MARIE PERNOTOktober 2010<strong>Die</strong> Gewerkschaftsbewegung <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> ist <strong>in</strong> acht Dachverbände unterschiedlicherGröße aufgesplittert, die zusammen knapp zwei Millionen Mitglieder haben.<strong>Die</strong>s entspricht acht Prozent der abhängig Beschäftigten (1975: 20 Prozent). DerOrganisationsgrad im öffentlichen <strong>Die</strong>nst und <strong>in</strong> den staatlichen bzw. vor e<strong>in</strong>igenJahren privatisierten Unternehmen beträgt knapp über 15 Prozent gegenüber fünfProzent <strong>in</strong> der Privatwirtschaft. Arbeiter und Angestellte s<strong>in</strong>d die gewerkschaftlicham schwächsten organisierte soziale Schicht.Infolge s<strong>in</strong>kender Mitgliederzahlen und heftiger ideologischer Ause<strong>in</strong>andersetzungenhaben sich die <strong>Gewerkschaften</strong> <strong>in</strong> den letzten zwanzig Jahren zunehmend <strong>in</strong>die vom Gesetzgeber e<strong>in</strong>gerichteten unternehmens<strong>in</strong>ternen Gremien (Betriebsräteund Personaldelegierte, Ausschüsse für Hygiene, für Sicherheit am Arbeitsplatz, fürArbeitsbed<strong>in</strong>gungen, für Weiterbildung u.a.) zurückgezogen. <strong>Die</strong>s führte zu e<strong>in</strong>er»Über<strong>in</strong>stitutionalisierung« der Gewerkschaftsvertreter, die kaum noch zu autonomenVerhandlungspraktiken fähig s<strong>in</strong>d. Dabei s<strong>in</strong>d die <strong>Gewerkschaften</strong> durchaus<strong>in</strong> der Lage, außerhalb der Betriebe erfolgreich zu Massendemonstrationen aufzurufen.Doch s<strong>in</strong>d diese nur kurzlebig und nicht geeignet, ihre Verhandlungsfähigkeitim täglichen Dialog mit den Arbeitgebern und der Regierung zu stärken.<strong>Die</strong> französischen <strong>Gewerkschaften</strong> stehen heute vor drei entscheidenden Herausforderungen:Sie müssen e<strong>in</strong>e eigene Agenda für Verhandlungen und kollektivesHandeln zurückgew<strong>in</strong>nen; sie müssen ihre gesellschaftliche Basis erneuern und hier<strong>in</strong>sbesondere junge Beschäftige und Frauen gew<strong>in</strong>nen; und sie müssen sich zusammenschließen,um zu überleben und um Vere<strong>in</strong>barungen im Interesse ihrer Mitgliederdurchzusetzen.
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHInhalt<strong>Die</strong> französische Gewerkschaftsbewegung – Entwicklung und Besonderheiten . . . . . 3E<strong>in</strong>e zerstückelte Gewerkschaftsbewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4E<strong>in</strong>e Gewerkschaftsbewegung für Aktivisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Sozialpartnerschaft auf Sparflamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6E<strong>in</strong> besonderer <strong>in</strong>terner Organisationsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Macht und Legitimität – die Herausforderungen e<strong>in</strong>er gewerkschaftlichenNeuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<strong>Die</strong> Wiedererlangung e<strong>in</strong>er gewissen Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<strong>Die</strong> Erneuerung der soziologischen Basis der Gewerkschaftsbewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Neue Repräsentationsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Für weitere Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICH<strong>Die</strong> französische Gewerkschaftsbewegung –Entwicklung und BesonderheitenWie überall <strong>in</strong> Europa entsprang die französische Gewerkschaftsbewegunggegen Ende des 19. Jahrhundertdem Arbeitermilieu, um sich von dort auf andere Berufsgruppenauszubreiten. Heute vertritt sie mit Ausnahmee<strong>in</strong>iger weniger Berufe (die staatliche Autorität verkörpernund denen die gewerkschaftliche Organisation deshalbuntersagt ist, wie das Militär oder Präfekten) fastalle Erwerbskategorien. <strong>Die</strong> Gewerkschaftsbewegung istjedoch nicht nur e<strong>in</strong> Akteur, sondern auch e<strong>in</strong> Produktder Geschichte: Ihre Struktur und ihre wichtigsten soziologischenund ideologischen Charakteristika spiegelndie Besonderheiten der historischen Entwicklung <strong>Frankreich</strong>swider.<strong>Die</strong> Gewerkschaftsbewegung (ohne die <strong>Gewerkschaften</strong>der Landwirte und der Freiberufler) besteht aus achtOrganisationen unterschiedlicher Größe sowie e<strong>in</strong>igenunabhängigen <strong>Gewerkschaften</strong> (mehrheitlich im Privatsektor).Es gibt zwei große Gewerkschaftsverbände, dieConfédération générale du travail (CGT) und die ConfédérationDémocratique du Travail (CFDT); e<strong>in</strong>en mittelgroßen,die CGT-Force ouvrière (CGT-FO); zwei kle<strong>in</strong>ereGewerkschaftsverbände, die Confédération Francaisedes Travailleurs Chrétiens (CFTC) und die Union naitonaledes syndicats autonomes (UNSA); e<strong>in</strong>en Gewerkschaftsverbandfür leitende Angestellte, der ebenfalls e<strong>in</strong>e beschränkteMitgliederzahl aufweist; die ConfédérationFrançaise de l’Encadrement (CFE-CGC); sowie e<strong>in</strong>en relativneuen Verband von bescheidener Größe, Union syndicaleSolidaires (US Solidaires), der <strong>Gewerkschaften</strong> unterdem Banner »Solidaires« versammelt. Und schließlichder mehrheitlich aus Lehrpersonal bestehende GewerkschaftsbundFédération syndicale Unitaire (FSU), der amRande auch <strong>in</strong> anderen Erwerbskategorien des Staatesund der Gebietskörperschaften vertreten ist. Zusammenzählen diese Organisationen knapp zwei Millionen Mitglieder,was ca. acht Prozent der französischen Gehaltsempfängerentspricht.Knapp über 15 Prozent der Beschäftigten des öffentlichen<strong>Die</strong>nstes s<strong>in</strong>d gewerkschaftlich organisiert (Staat,Gebietskörperschaften und Gesundheitssektor), knapp15 Prozent derjenigen der großen staatlichen Unternehmen(oder solchen, die es bis vor kurzem waren) und ungefährfünf Prozent der Beschäftigten im Privatsektor. Besondersdie Industrie, die von 1945 bis 1980 e<strong>in</strong>e wesentlicheKomponente der Gewerkschaftslandschaft bildete,ist heute <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht sehr geschwächt, auch wenngewisse traditionelle kollektive Aktionen mit ger<strong>in</strong>ger Beteiligungweitergeführt werden.Der gewerkschaftliche Organisationsgrad betrug <strong>in</strong> derMitte der 1970er Jahre 20 Prozent. Seitdem s<strong>in</strong>d die Zahlenstark e<strong>in</strong>gebrochen.Grafik 1: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad imPrivatsektor <strong>in</strong> den letzten 50 Jahren30%25%20%15%10%5%0%1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005Quellen: DARES, Französisches Arbeitsm<strong>in</strong>isterium (2007)Tabelle 1: <strong>Die</strong> wichtigsten französischen Gewerkschaftsverbände,geschätzte MitgliederzahlenCGTCFDTConfédération générale dutravailConfédération françaisedémocratique du travailca. 700 000ca. 700 000CGT-FO CGT – Force ouvrière ca. 300 000CFTCCFE-CGCUNSAConfédération des travailleurschrétiensConfédération française del’encadrement – Confédérationgénérale des cadresUnion naitonale des syndicatsautonomesca. 30 000ca. 80 000ca. 120 000US Solidaires Union syndicale Solidaires ca. 80 000FSU Fédération syndicale unitaire ca. 120 000Quelle: Andolfatto, Labbé (2007)Allerd<strong>in</strong>gs darf von der ger<strong>in</strong>gen Mitgliederzahl nicht aufdie Präsenz der <strong>Gewerkschaften</strong> <strong>in</strong> den Betrieben undam Arbeitsplatz geschlossen werden: Während Frank-3
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHreich beim gewerkschaftlichen Organisationsgrad dasSchlusslicht der EU bildet, so liegt das Land <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blickauf die gewerkschaftliche Präsenz am Arbeitsplatz aufdem zehnten Rang <strong>in</strong>nerhalb der EU. <strong>Die</strong> Untersuchung»REPONSE« des französischen Arbeitsm<strong>in</strong>isteriums weistaußerdem auf e<strong>in</strong>e Verstärkung dieser Präsenz zwischendem Ende der Neunziger und der Mitte der 2000er Jahreh<strong>in</strong>. In den Jahren 2004–2005 zählten 38 Prozent allerBetriebe mit mehr als 20 Angestellten m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>enGewerkschaftsvertreter, verglichen mit 33 Prozent <strong>in</strong> denJahren 1998–1999. <strong>Die</strong> Tatsache, dass die Präsenz zugenommenhat, während die Mitgliederzahlen auf niedrigemNiveau stagnieren, wirft jedoch Fragen h<strong>in</strong>sichtlichder Qualität und der Dichte dieser Präsenz auf.Tabelle 2: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad imPrivatsektor, alle <strong>Gewerkschaften</strong> (<strong>in</strong> Prozent) Bei den Wahlen zum Arbeitsgericht 2008 erreichte dieCGT 33,8 Prozent, die CFDT 22,1 Prozent, FO 15,9 Prozent,die CFTC 8,9 Prozent und die CGC 8,2 Prozent derStimmen. Bei den Wahlen zur Paritätischen Verwaltungskommissionender staatlichen Beamtenschaft 2006/07/08 erreichtendie CGT 15,6 Prozent, die CFDT 11,3 Prozent,FO 13,0 Prozent, die CFTC 2,2 Prozent, CFE-CGC 4,2 Prozent,die UNSA 16,8 Prozent und Solidaires 9,9 Prozentder Stimmen (zur langfristigeren Entwicklung der Ergebnissesiehe die Daten im Anhang).In den Jahren 1980–1982 betrug die Wahlbeteiligung umdie 80 Prozent. Seitdem ist sie langsam zurückgegangenund lag <strong>in</strong> jüngeren Jahren bei 70 Prozent.Quellen: DARES, DGAFPIndustrie 6,1Baugewerbe 2,2Handel 2,8Transport, Telekommunikation 5,6Banken und Versicherungen 8,9<strong>Die</strong>nstleistungen für Unternehmen 4,2Bildung, Gesundheitssektor, Sozialhilfe (Privatsektor) 7,0Gastgewerbe, private <strong>Die</strong>nstleistungen 4,6Gesamt 5,0Quelle: EPCV, INSEE (2001–2005)E<strong>in</strong>e zerstückelte Gewerkschaftsbewegung<strong>Die</strong>se Zerstückelung der gewerkschaftlichen Organisationen<strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> geht zurück auf Brüche <strong>in</strong> den zwei Bewegungen,welche die <strong>Gewerkschaften</strong> hervorgebrachthaben: die säkulare Gewerkschaftsbewegung des Arbeitermilieus(mehrheitlich sozialistisch) und die christlicheGewerkschaftsbewegung. Erstere wird von der CGT vertreten,dem ältesten Gewerkschaftsverband <strong>Frankreich</strong>s(gegründet 1895).<strong>Die</strong> ger<strong>in</strong>ge Mitgliederzahl hat jedoch nicht zu e<strong>in</strong>em völligenVerlust der Legitimität der <strong>Gewerkschaften</strong> geführt,da diese sich heute stärker auf regelmäßige betriebs<strong>in</strong>terneWahlen stützt. Dabei werden die Mitglieder derBetriebsräte, die Personaldelegierten oder die Vertreterder paritätischen Kommissionen im öffentlichen Sektorüber gewerkschaftliche Listen gewählt – zum<strong>in</strong>dest imersten Wahlgang. <strong>Die</strong> Wahlbeteiligung wird somit zumIndikator für die Unterstützung der <strong>Gewerkschaften</strong>,während die Wahlergebnisse der verschiedenen <strong>Gewerkschaften</strong>ihren jeweiligen repräsentativen Charakter widerspiegeln: Bei den Betriebsratswahlen 2005–2006 erreichte dieCGT 22,9 Prozent, die CFDT 20,3 Prozent, die CFTC6,8 Prozent, die CGT-FO 12,7 Prozent und die CFE-CGC6,5 Prozent.Nach dem Zweiten Weltkrieg gab der seit der Befreiungvorherrschende kommunistische Flügel <strong>in</strong> der CGT denTon an. Zwischen 1946 und 1948 kam es zu e<strong>in</strong>er regelrechtenZersplitterung der Zentrale und mehrere neueOrganisationen wurden gegründet: die CGT-Force ouvrière(reformistisch), die FEN (Fédération de l’éducationnationale), der ehemalige Lehrerverband der CGT, dersich von der Mutterorganisation trennte, und schließliche<strong>in</strong>e ganze Reihe kle<strong>in</strong>erer <strong>Gewerkschaften</strong>, die sichfür die Unabhängigkeit entschieden (<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> derBeamtenschaft). Innerhalb der Lehrergewerkschaft FENkam es 1993 zu e<strong>in</strong>em weiteren Bruch: e<strong>in</strong>e Hälfte gründetedie UNSA, die andere Hälfte schuf die kämpferischereFSU.Parallel zu dieser Zerstückelung der laizistischen <strong>Gewerkschaften</strong>kam es auch <strong>in</strong> der christlichen Gewerkschaftsbewegungzu e<strong>in</strong>em Bruch. Der Französische Bund christ-4
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHlicher Arbeiter (Confédération française des travailleurschrétiens – CFTC) wurde im Jahr 1919 gegründet. Nachdem Zweiten Weltkrieg erfuhr er e<strong>in</strong>en soziologischenund ideologischen Wandel. 1964 wurde er <strong>in</strong> CFDT(Confédération française démocratique du travail) umbenannt,mit e<strong>in</strong>er l<strong>in</strong>ksreformistischen Programmatik. E<strong>in</strong>traditionalistischer Flügel lehnte die Säkularisierung abund hielt die Werte der ursprünglichen CFTC aufrecht.Seit se<strong>in</strong>er gesetzlichen Anerkennung im Jahr 1966 istdieser rechtsorientierte Ableger marg<strong>in</strong>al geblieben, hatsich aber <strong>in</strong> der französischen Gewerkschaftslandschafthalten können.In der Folge der Studentenbewegung vom Mai 1968 radikalisiertedie CFDT ihre Positionen und zog damit e<strong>in</strong>emilitante Generation an sich heran, die die Hoffnungender 1968er Jahre verkörperte. Nach der Wirtschaftskriseder 1970er Jahre mäßigte sie im Laufe der Achtziger ihrePolitik und g<strong>in</strong>g von e<strong>in</strong>em radikalen Diskurs zu e<strong>in</strong>emmoderaten Reformismus über, der auf Kompromisssucheund Verhandlungen setzte. In den Neunzigern und denJahren 2000 verließ der kämpferische Flügel nach undnach die CFDT und schuf e<strong>in</strong>e Reihe von <strong>Gewerkschaften</strong>unter der Bezeichnung SUD (Solidaires unitaires etdémocratiques), die sich 2004 mit anderen zusammenschlossenund die Union Syndicale Solidaires gründeten.<strong>Die</strong>ser Verband, der stark von der im kollektiven Handeln<strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> immer noch sehr präsenten anarchistischenTradition geprägt ist, hat die französische Gewerkschaftslandschaftweiter zersplittert.Mit der Gründung der Angestelltengewerkschaft CGCim Jahre 1944 kam noch e<strong>in</strong>e berufsgruppenbed<strong>in</strong>gteSpaltung dazu. Im Laufe der Jahre sah sich die CGC zunehmendmit der Konkurrenz der <strong>in</strong>nerhalb der Arbeiterverbändeentstehenden Managementvere<strong>in</strong>igungen(unions des cadres) konfrontiert, und ihre Mitgliederzahleng<strong>in</strong>gen langsam zurück. <strong>Die</strong>s veranlasste sie dazu,ihre Basis auf technische Angestellte (agents de maîtrise)auszuweiten (1981 änderte sie ihren Namen vonCGC zu CFE-CGC, Confédération française de l’encadrement).Trotz dieser Entwicklung konnte sie den Mitgliederschwundnicht stoppen und ist heute <strong>in</strong> ihrer Existenzbedroht.Während <strong>in</strong> anderen Ländern Spaltungen und Zusammenschlüsse<strong>in</strong> der Regel alternierten, hielt <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong>seit 1947 der Prozess der Zersplitterung an, auf den zuke<strong>in</strong>er Zeit e<strong>in</strong> Ruf nach mehr E<strong>in</strong>heit folgte. Das französischeSystem der Anerkennung der Repräsentativitätund die nach dem Kriegsende e<strong>in</strong>geführte Methode derSozialverhandlungen haben diesen Trend zusätzlich verstärkt.<strong>Die</strong> im August 2008 verabschiedeten Gesetzesrevisionen(Gesetz vom 20. August 2008) haben hier e<strong>in</strong>eReihe von Änderungen bewirkt – unter anderem höhereAnforderungen an die betriebliche Repräsentativität –die zweifellos die größten Herausforderungen der kommendenJahre darstellen werden (siehe auch Tabelle 6im Anhang).E<strong>in</strong>e Gewerkschaftsbewegung für AktivistenViele Organisationen, wenige Mitglieder – das sche<strong>in</strong>t dieGewerkschaftsbewegung <strong>Frankreich</strong>s auf den Punkt zubr<strong>in</strong>gen. H<strong>in</strong>zu kommen äußerst konfliktgeladene Beziehungenzwischen den verschiedenen Komponenten derBewegung. <strong>Die</strong>se Fragmentierung wird manchmal fürden schwachen gewerkschaftlichen Organisationsgradmitverantwortlich gemacht, doch ist sie bei weitem nichtder e<strong>in</strong>zige Grund. <strong>Die</strong> soziologische Struktur der Belegschaftenund der Gewerkschaftsbewegung selbst sowiedie Instabilität des Systems der beruflichen Beziehungens<strong>in</strong>d weitere tragende Faktoren.Im Unterschied zu ihren wichtigsten Nachbarn ist diefranzösische Gewerkschaftsbewegung nicht aus e<strong>in</strong>ergroßen konzentrierten Arbeiterklasse hervorgegangen.Bis <strong>in</strong> die Mitte des 20. Jahrhunderts war <strong>Frankreich</strong>durch e<strong>in</strong>e große Bauernschaft und e<strong>in</strong>e entsprechendstarke landwirtschaftliche Produktion geprägt. Das ländliche<strong>Frankreich</strong> wurde erst relativ spät (<strong>in</strong> den 1960erund 1970er Jahren) <strong>in</strong> die Lohnarbeit der Industrie unddes <strong>Die</strong>nstleistungssektors <strong>in</strong>tegriert und hat somit zurHeterogenität e<strong>in</strong>er zerstückelten und soziologisch betrachtetune<strong>in</strong>heitlichen Arbeiterklasse beigetragen. DerMangel an Arbeitskräften für die Industrie wurde durchdas aktive Anwerben ausländischer Arbeitnehmer sowiee<strong>in</strong>e stetig steigende E<strong>in</strong>wandererpopulation kompensiert.Aufgrund dieser heterogenen Zusammensetzungder Lohnarbeiterschaft gelang es der Gewerkschaftsbewegungnie, den Beschäftigten <strong>in</strong> soziologischer H<strong>in</strong>sichte<strong>in</strong> repräsentatives Muster oder <strong>in</strong> ethischer H<strong>in</strong>sichte<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Werteorientierung zu bieten, für diesie sich hätte stark machen können. Das Verhältnis derfranzösischen <strong>Gewerkschaften</strong> zur Arbeiterklasse ist somitfragil – e<strong>in</strong>e Schwäche, die <strong>in</strong> den 1980er Jahren besondersdeutlich wurde, als die Arbeiter <strong>in</strong> großer Zahl5
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHTabelle 3: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad nach Berufsklassen (<strong>in</strong> Prozent)Alle Sektoren Staat und öffentliche Unternehmen Privatbetriebe2001–2005 1996–2000 2001–2005 1996–2000 2001–2005 1996–2000Kader 14,9 14,0 26,7 25,2 7,7 6,9Mittlere Berufe 9,6 10,2 14,5 16,9 6,7 5,8Angestellte 5,3 5,3 9,4 8,6 2,9 3,2Arbeiter 5,9 6,0 17,6 11,7 4,6 5,4Quelle: EPCV, INSEE (2001–2005). Der hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad bei den Kaderberufen rührt nicht zuletzt daher,dass die zahlenstarke und gewerkschaftlich sehr aktive Berufsgruppe der Lehrer dieser Kategorie zugeschrieben wird.aus den <strong>Gewerkschaften</strong> austraten. Bis heute bilden dieArbeiter, zusammen mit den Angestellten, die gewerkschaftlicham schwächsten organisierte soziale Gruppe<strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong>.Gegen Ende der 1970er Jahre lag der gewerkschaftlicheOrganisationsgrad <strong>in</strong>sgesamt bei über 20 Prozent.Rund zehn Jahre später hatten sämtliche <strong>Gewerkschaften</strong>die Hälfte ihrer Mitglieder verloren (die CGT sogarnoch mehr). Mitte der 1990er Jahre wurde der vorläufigeTiefpunkt erreicht. Nur im öffentlichen <strong>Die</strong>nst undden staatlichen Unternehmen konnte e<strong>in</strong>e signifikantePräsenz aufrechterhalten werden. Seitdem tun sich die<strong>Gewerkschaften</strong> schwer, durch Steigerung der MitgliederzahlenE<strong>in</strong>fluss und Legitimität zurückzugew<strong>in</strong>nen.<strong>Die</strong> Beschäftigten haben sich an das System der Gewerkschaftsdelegiertengewöhnt, das auf e<strong>in</strong>er beschränktenZahl gewerkschaftlich aktiver Mitarbeiter <strong>in</strong> den dafürbestimmten unternehmens<strong>in</strong>ternen Gremien beruht: Betriebsräte(comités d’entreprise / CE), Personaldelegierte(délégués du personnel / DP) und Ausschüsse für Hygiene,Sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen (comitésd’hygiène et de sécurité et de conditions de travail/ CHS-CT) s<strong>in</strong>d heute für e<strong>in</strong>en Großteil der gewerkschaftlichenAktivität verantwortlich. Wenn bedeutendesoziale Probleme auftreten, br<strong>in</strong>gen die Berufstätigen ihrenProtest durch Demonstrationen <strong>in</strong> den Straßen zumAusdruck – e<strong>in</strong>e punktuelle und durchaus nicht immer<strong>in</strong>effiziente Weise, das Kräfteverhältnis deutlich zu machen.So s<strong>in</strong>d die <strong>Gewerkschaften</strong> zwar <strong>in</strong> der Lage, diesegroßen, aber kurzlebigen Protestbewegungen <strong>in</strong>s Lebenzu rufen, doch im täglichen Dialog mit den Arbeitgebernund der Regierung verleiht ihnen diese Protestpräsenznicht mehr Handlungskapazität.Sozialpartnerschaft auf SparflammeDer Staat spielt <strong>in</strong> der Triade »Staat-Arbeitgeber-Arbeitnehmer«e<strong>in</strong>e zentrale Rolle. <strong>Die</strong>s geht teilweise auf dielange zentralistische Tradition <strong>Frankreich</strong>s zurück, dochspielen auch andere Charakteristika des französischenKapitalismus e<strong>in</strong>e maßgebliche Rolle.Der Mangel an Verhandlungskultur, der den französischen<strong>Gewerkschaften</strong> häufig vorgeworfen wird, ist <strong>in</strong>Wirklichkeit e<strong>in</strong> nationales Kulturgut, weitgehend geteiltund genährt von e<strong>in</strong>er Arbeitgeberschaft, die ihr Verhältniszur Gewerkschaftsbewegung stets nur als e<strong>in</strong> Instrumentbetrachtete. <strong>Die</strong> Geschichte der französischen Arbeitgebervere<strong>in</strong>igungist e<strong>in</strong>e endlose Chronik von Mobilisierungengegen die Arbeitnehmer und gegen jeglichestaatliche E<strong>in</strong>mischung <strong>in</strong> die Angelegenheiten der Unternehmen.Auch die Tarifverträge haben e<strong>in</strong>e bewegte Geschichte.Nach zwei fruchtlosen Versuchen (1919, 1936) begannensie erst ab Mitte der 1950er Jahre, sich <strong>in</strong> denwichtigsten Wirtschaftszweigen auszubreiten. <strong>Die</strong> Arbeitgeberschaftentschloss sich damals zu Verhandlungen,gab jedoch den kulantesten gewerkschaftlichenGesprächspartnern deutlich den Vorzug. Zu Beg<strong>in</strong>n der1950er Jahre wurden paritätische Verwaltungsmodellefür die Zusatzrenten (und die gesundheitlichen Zusatzversicherungen)e<strong>in</strong>geführt, die später auf die Arbeitslosenversicherungausgeweitet wurden. Allerd<strong>in</strong>gs waren <strong>in</strong>diesen paritätischen Modellen lange Zeit nur die am wenigstenrepräsentativen <strong>Gewerkschaften</strong> vertreten (FO,CFTC, CFE-CGC).6
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHGrafik 2: Streiktage für 1000 Beschäftigte, 2000–2004, EU-Staaten250200150100500219,7134,7103,577,260,2 55,3 45,2 57,845,5 44 41,4 40,5 32,7 44,2 27,5 22,3 19,9 18,3 15,4 11 9,118,96 4 3,1 2,1EspagneItalieQuelle: M. Carley, OERI (2005).AutricheNorvègeHongrieF<strong>in</strong>landeIrlandeDanemarkSuèdeFranceIn <strong>Frankreich</strong> wurden nur wenige soziale Fortschritteauf dem Verhandlungsweg erzielt. Stattdessen kam eswiederholt zu Brüchen, die unter dem Druck der sozialenMobilisierung <strong>in</strong> den Phasen gesellschaftlichen Aufruhrserzwungen wurden: die Personaldelegierten, die40-Stunden-Woche, der bezahlte Urlaub im Jahr 1936,die Betriebsräte, die Sozialversicherung, die Tarifverträgebei Kriegsende, die Anerkennung der <strong>Gewerkschaften</strong> <strong>in</strong>den Unternehmen, der Monatslohn, das Recht auf beruflicheWeiterbildung.<strong>Die</strong>se Tradition e<strong>in</strong>er verhandlungsunwilligen Arbeitgeberschaftgeht nicht auf e<strong>in</strong>e charakterliche Eigenheitder französischen Arbeitgeber zurück, sondern auf dieStruktur des Kapitals: Der französische Kapitalismus istbis heute immer auch e<strong>in</strong> Familienkapitalismus gewesen,<strong>in</strong> dem der Besitzer die Angelegenheiten des Betriebsdirekt verwaltet. Wie man <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> zu sagenpflegte: <strong>Die</strong> Fabrik liegt nicht weit vom Schloss. <strong>Die</strong>se Besitzstrukturist Verhandlungen nicht förderlich. Sie schufde facto e<strong>in</strong>e Arbeitgeberschaft von Gottes Gnaden, dienoch im 20. Jahrhundert aus der Nostalgie des ancienrégime e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>gefleischten sozialen Konservativismusschöpfte. Letzterer vermengte sich häufig mit e<strong>in</strong>em imgesellschaftlichen Katholizismus entsprungenen Paternalismus.Besonders ausgeprägt war er im Norden <strong>Frankreich</strong>s(Textil<strong>in</strong>dustrie), im Osten, <strong>in</strong> der Region Champagneund im Stahl<strong>in</strong>dustriebecken. <strong>Die</strong>s konnte bis zumE<strong>in</strong>satz von antigewerkschaftlichen Milizen führen, wieRoumanieRoyaume UniSlovénieChyprePortugalMaltePays-BasEstonieLuxembourgAllemagneLituaniePologneTous paysUENouveaux membresAnciens membressie im Konzern Peugeot Citroën S. A. noch zu Beg<strong>in</strong>ndieses Jahrzehnts anzutreffen waren.So wurde letztendlich der Staat zum zentralen Erzeugersozialer Normen. Durch se<strong>in</strong>e Kontrolle über die Gehälterdes umfangreichen öffentlichen <strong>Die</strong>nstes und den M<strong>in</strong>destlohnim Privatsektor mit der Schaffung des salairem<strong>in</strong>imum <strong>in</strong>terprofessionnel garanti (SMIG / GarantierterBerufsklassenübergreifender M<strong>in</strong>destlohn), geschaffen1950, im Jahr 1968 umgewandelt <strong>in</strong> salaire m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>terprofessionnel de croissance (SMIC / BerufsklassenübergreifenderWachstumsorientierter M<strong>in</strong>destlohn) sowiedurch se<strong>in</strong> großzügig genutztes Recht, Tarifverträgeauszuweiten, hat der Staat <strong>in</strong> der Festlegung der LohnundGehaltsnormen e<strong>in</strong>e enorme Macht aufgebaut.Für die <strong>Gewerkschaften</strong> wurde er somit zum wichtigstenGesprächspartner, war es doch <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durchDruck auf die Regierungen, dass den Arbeitgebern verpflichtendeNormen aufgezwungen werden konnten –zum<strong>in</strong>dest solange sich der Staat als sozialer Regulatorverstand. Als er sich <strong>in</strong> den 1980er Jahren zurückzuziehenbegann, fanden sich die <strong>Gewerkschaften</strong>, die bereitsdurch schrumpfende Mitgliederzahlen geschwächtwaren, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er äußerst ungünstigen Zweierkonstellationmit den Arbeitgebern wieder.Nachdem <strong>Frankreich</strong> bis <strong>in</strong> die 1980er Jahre zu den führendenStreiknationen gehört hatte, folgte auch dasfranzösische System dem <strong>in</strong>ternationalen Trend und die7
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHKonflikte zwischen Sozialpartnern nahmen ab. Entgegendem Mythos des »Streiklandes <strong>Frankreich</strong>« ist die Anzahljährlicher Streiktage <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> eher niedriger als beise<strong>in</strong>en großen Nachbarn.Tatsächlich war das Streikvolumen <strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> <strong>in</strong> jüngsterZeit verhältnismäßig ger<strong>in</strong>g. Allerd<strong>in</strong>gs weisen diefranzösischen Streiks gewisse Besonderheiten auf: Seitrund zwanzig Jahren s<strong>in</strong>d sie sehr stark auf den <strong>Die</strong>nstleistungssektorund öffentliche Unternehmen konzentriert,<strong>in</strong>sbesondere das Transportwesen. So s<strong>in</strong>d Streiksallgeme<strong>in</strong> betrachtet zwar eher seltener als <strong>in</strong> vielen andereneuropäischen Ländern, doch die »sichtbaren« Streikshalten das zählebige falsche Image e<strong>in</strong>es »übertrieben«streikanfälligen Landes aufrecht. <strong>Die</strong> Arbeitskonflikte äußernsich auf unterschiedlichste Art, am Arbeitsplatz wieauch außerhalb (Demonstrationen, Arbeitsniederlegungen,Überstundenverweigerung usw.), und weisen e<strong>in</strong>sehr fragmentiertes Muster auf. Streiks s<strong>in</strong>d zwar seltenergeworden, doch mobilisieren sie <strong>in</strong> der Regel weitausmehr Beschäftigte als früher. <strong>Die</strong> französische Streikpraxisillustriert die starke Atomisierung der Sozialbeziehungen<strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong>. Sowohl bei Verhandlungen wie auch beiKonflikten s<strong>in</strong>d die Streitgegenstände immer mehr dezentralisiertund die Haltung ist zunehmend defensiv.E<strong>in</strong> besonderer <strong>in</strong>terner Organisationsmodus<strong>Die</strong> Organisationsmodi der <strong>Gewerkschaften</strong> s<strong>in</strong>d starkhistorisch geprägt und nur bed<strong>in</strong>gt auf Anpassungen ane<strong>in</strong>e stetig sich wandelnde Wirtschaftsstruktur zurückzuführen.Zwei Besonderheiten s<strong>in</strong>d hervorzuheben: erstensder hohe Anteil berufsgruppenübergreifender Strukturenim <strong>in</strong>ternen Betrieb der Gewerkschaftszentralen,und zweitens die extreme Fragmentierung der Berufsfelder<strong>in</strong>nerhalb der Organisationen.Der Organisationsmodus der CGT <strong>in</strong> ihren Anfängen(1895 bis 1914) hat die französische Gewerkschaftsbewegungnachhaltig geprägt. <strong>Die</strong> Verbände, die nachder CGT entstanden – sei es durch Abspaltung, sei esaus e<strong>in</strong>er anderen Tradition heraus – übernahmen ihreOrganisationsweise. <strong>Die</strong>se weist die Besonderheit auf,dass sie <strong>in</strong> der <strong>in</strong>ternen Struktur der Gewerkschaftsbündedas Gleichgewicht zwischen Berufs- und Regionalverbänden(unions départementales) aufrechterhält, d. h. dasssie die berufliche und die berufsübergreifende gewerkschaftlicheIntervention legitimiert.<strong>Die</strong>se duale Struktur hat zu e<strong>in</strong>er bürokratischen Verdoppelunggeführt und Spannungen zwischen den beidenPolen erzeugt, da die Aufgaben und Verantwortlichkeitennicht die gleichen s<strong>in</strong>d und die Beziehungen zu denBasisgewerkschaften und den täglichen gewerkschaftlichenAktivitäten recht unterschiedliche Gesellschaftsvisionenhervorgebracht haben. Gleichzeitig hat dieserDualismus etwas Künstliches, denn das Gewicht der Berufsverbändeübersteigt das der Regionalorganisationenbei weitem. Er verleiht der Zentrale größeres Gewicht, dadiese nicht nur die verschiedenen Modalitäten der Arbeitder Berufsverbände koord<strong>in</strong>ieren, sondern auch die Kohärenzzwischen dieser und den lokalen, berufsübergreifendenAnsätzen sicherstellen muss. In der CGT und derFO wird diese symbolische Verbandsbildung durch e<strong>in</strong>estarke <strong>in</strong>terne föderalistische Verfasstheit ausbalanciert.Unter Föderalismus verstehen diese Organisationen e<strong>in</strong>ehohe Betriebs- und Entscheidungsautonomie der E<strong>in</strong>zelkomponentender Zentrale, <strong>in</strong>sbesondere der Berufsorganisationen.<strong>Die</strong> Verbände, die Departementalunionenund die Basisgewerkschaften verfügen über e<strong>in</strong>enbreiten Entscheidungsspielraum. <strong>Die</strong>se Tradition relativerDezentralisierung war <strong>in</strong> der CGT lange Zeit kaum sichtbar,weil ihre Mitglieder der sehr zentralistisch organisiertenkommunistischen Partei angehörten. Erst als <strong>in</strong> jüngerenJahren die Kontrolle der kommunistischen Parteiüber die CGT nachließ, trat die Dezentralisierung erneut<strong>in</strong> den Vordergrund. Im Gegensatz dazu funktionierendie CFDT und die CFTC mehrheitlich nach dem Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip:Jede Organisationsebene hat ihren eigenenZuständigkeitsbereich, aber die Zentrale bleibt tonangebend.So ist die CFDT entgegen überkommener Vorstellungviel stärker zentralisiert als die CGT oder die ForceOuvrière. Bei Letzteren liegt die Macht der Verbandszentraleeher dar<strong>in</strong>, Initiativen anzustoßen und Vorschlägezu machen, als e<strong>in</strong>e verb<strong>in</strong>dliche Richtung vorzugeben.Der strukturelle Dualismus hat auch zur umfassenderenPolitisierung der Gewerkschaftsbewegung beigetragen,denn die lokale Ebene nötigt sie zum gesellschaftlichenBrückenschlag und zw<strong>in</strong>gt die Gewerkschaft – im Pr<strong>in</strong>zip– aus der Dimension des Betriebs herauszutreten undden berufsübergreifenden Aspekten der gewerkschaftlichenAktion Rechnung zu tragen. <strong>Die</strong> Zentrale ihrerseitsmuss die Lebensbed<strong>in</strong>gungen sämtlicher Beschäftigtenberücksichtigen, umfassende gesellschaftliche Ziele festlegenund die Werte der Solidarität und des Zusammenhaltsfördern.8
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICH<strong>Die</strong> zweite organisatorische Besonderheit der französischenGewerkschaftsverbände ist die extreme Streuungder Berufsverbände, die anders als <strong>in</strong> den meistenGewerkschaftsbewegungen Europas ke<strong>in</strong>e Fusionsprozessedurchlaufen haben: die CFDT zählt 15 Verbände,die CGT 33, die FO 26 und die CFTC 14. Das Gewichtder Geschichte und die <strong>in</strong>stitutionalisierten Korporatismenhaben <strong>in</strong> den föderalen Organisationen zu Parzellierungengeführt, die mit der wirtschaftlichen Realitätnur noch wenig zu tun haben. Auch die verbands<strong>in</strong>ternenBeziehungen wurden im Laufe der Zeit schwächer,je mehr die wichtigen Tarifverhandlungen vom Verband<strong>in</strong>s Unternehmen transferiert wurden. <strong>Die</strong> Zersplitterungexistiert nicht nur zwischen den Gewerkschaftsorganisationen,sondern noch häufiger <strong>in</strong>nerhalb derselben, <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Fragmentierung der Aktionsfelder und der Komponentender Verbände selbst.Macht und Legitimität – die Herausforderungene<strong>in</strong>er gewerkschaftlichen Neuordnung<strong>Die</strong> französische Gewerkschaftsbewegung steht heutevor drei zentralen Herausforderungen: Wiedererlangunge<strong>in</strong>er gewissen Autonomie (vertraglich und organisatorisch),Erneuerung ihrer gesellschaftlichen Basis und strategischeNeuordnung nach der Reform der gesetzlichenBestimmungen zur Anerkennung und Repräsentativität.<strong>Die</strong> Wiedererlangung e<strong>in</strong>er gewissen AutonomieDer Mitgliedermangel hat zu e<strong>in</strong>em Rückgang der gewerkschaftlichenRessourcen und damit zu e<strong>in</strong>er starkenAbhängigkeit von externen F<strong>in</strong>anzierungsquellen geführt,die nicht immer sehr transparent s<strong>in</strong>d. BedeutendeMittel kommen vom Staat, mit der Bereitstellung vonFunktionären und der F<strong>in</strong>anzierung der Weiterbildungsprogrammeder Organisationen. <strong>Die</strong> paritätische Verwaltunggewisser Gremien (<strong>in</strong>sbesondere die für beruflicheWeiterbildung) ist e<strong>in</strong>e weitere, weniger bekannteGeldquelle für die gewerkschaftlichen Budgets. Auch private,ja gar undurchsichtige F<strong>in</strong>anzierungen werden regelmäßiggenannt, was dem Ruf der gesamten Gewerkschaftsbewegungschadet. <strong>Die</strong> Wiedererlangung der gewerkschaftlichenAutonomie wird größtenteils über dieF<strong>in</strong>anzierung ihrer Aktivitäten erreicht werden, doch istdies nicht der e<strong>in</strong>zige Bereich: <strong>Die</strong> Tarifverhandlungens<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> weiterer Abhängigkeitsfaktor.Der französische Sozialdialog sche<strong>in</strong>t auf den erstenBlick rege und mannigfaltig zu se<strong>in</strong>. Erst bei näheremH<strong>in</strong>schauen werden se<strong>in</strong>e Fragilität und die ger<strong>in</strong>ge Initiativfähigkeitder Gewerkschaftsbewegung sichtbar. AufEbene der Zentrale beschränkt sich diese im Wesentlichenauf e<strong>in</strong>e Begleitung der Entscheidungen des Staates;auf Unternehmensebene gleichen die Verhandlungene<strong>in</strong>er gesetzlichen Pflichtübung und s<strong>in</strong>d oft fest <strong>in</strong>den Händen der Arbeitgeber.<strong>Die</strong> vom französischen Arbeitsm<strong>in</strong>isterium veröffentlichteJahresbilanz der Sozialverhandlungen präsentiertauf dem Feld der berufsübergreifenden Vere<strong>in</strong>barungen<strong>in</strong> den Branchen und Unternehmen e<strong>in</strong>drückliche Zahlen.Tatsächlich werden zahlreiche Themen besprochen, dochdie wenigsten Gespräche führen zu handfesten Verträgen.So wurden im Jahr 2008 zwei neue nationale Vere<strong>in</strong>barungenunterzeichnet: die erste ist e<strong>in</strong>e Umsetzunge<strong>in</strong>er EU-Vere<strong>in</strong>barung (Stress am Arbeitsplatz, Vere<strong>in</strong>barungvom 2. Juli 2008), die zweite ist e<strong>in</strong>e Neuformulierungder Arbeitsmarktregeln gemäß den Wahlversprechendes französischen Präsidenten (Vere<strong>in</strong>barung vom11. Januar 2008). Weitere Themen, wie die »Beschwerlichkeitder Arbeit«, kamen ebenfalls zur Sprache, jedochohne Resultate zu zeitigen. <strong>Die</strong> Frage der »Beschwerlichkeitder Arbeit« ist für den berufsübergreifenden Sozialdialog<strong>in</strong> <strong>Frankreich</strong> emblematisch: Das 2003 verabschiedeteRentengesetz sah Verhandlungen zur Berücksichtigungder »Beschwerlichkeit der Arbeit« als Faktor bei derRentenberechnung vor. Doch die beiden ArbeitgeberverbändeMEDEF und CGPME zeigten sich unnachgiebig,und so stecken die Verhandlungen seit sieben Jahren <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Sackgasse. Nun warten die Arbeitgeberverbändeauf e<strong>in</strong>en Regierungsbeschluss, von dem sie annehmen,dass er für sie günstiger ausfallen wird als e<strong>in</strong> Kompromissmit den Gewerkschaftsverbänden.Auf Branchenebene wurden im Jahr 2008 mehr als1 100 Texte unterzeichnet – zu Löhnen und Gehältern(mehrheitlich), zur beruflichen Weiterbildung, zur Zusatzrente,zu den Lohnklassen, zur Gleichstellung vonMann und Frau, usw. <strong>Die</strong> Lohnverhandlungen betreffenüberwiegend die gesetzlichen Erhöhungen des SMIC,denn der M<strong>in</strong>destlohn vieler Branchen liegt unter demSMIC. E<strong>in</strong> weiteres Problem ist die extreme Streuung derTarifverträge: Zurzeit zählt <strong>Frankreich</strong> nicht weniger als276 Branchen mit mehr als 5 000 Beschäftigten, und rund400 Branchen mit teilweise sehr ger<strong>in</strong>gen Beschäftigtenzahlen.Nachdem die Arbeitgeberschaft sich jahrzehnte-9
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHGrafik 3: Betriebliche Vere<strong>in</strong>barungen, 1983–200840 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 000019831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008lang gegen Verhandlungen auf Branchenebene sträubte,wusste sie sie <strong>in</strong> jüngeren Jahren <strong>in</strong> vielen Fällen zu ihrenGunsten zu wenden, <strong>in</strong>dem sie die Berufsgruppen nachihren Bedürfnissen aufteilte und die Beschäftigten untere<strong>in</strong>ander»spaltete«. <strong>Die</strong> <strong>Gewerkschaften</strong> haben sichkaum gegen diesen Prozess zur Wehr gesetzt und ihnteilweise sogar begleitet.Auf Betriebsebene werden jährlich mehr als 25 000 Vere<strong>in</strong>barungengeschlossen, <strong>in</strong> rund zehn Prozent der Unternehmenmit mehr als zehn Angestellten. <strong>Die</strong>s betrifftungefähr sieben Millionen Beschäftigte (von den <strong>in</strong>sgesamt16 Millionen im Privatsektor). 80 Prozent dieserVere<strong>in</strong>barungen werden heutzutage von Gewerkschaftsvertreternoder von <strong>Gewerkschaften</strong> beauftragten Beschäftigtenunterzeichnet. <strong>Die</strong> restlichen 20 Prozent derVere<strong>in</strong>barungen werden direkt mit den Betriebsräten geschlossen– e<strong>in</strong> Anteil, der stetig zunimmt.In den Unternehmen s<strong>in</strong>d jährliche Verhandlungen überLöhne und Gehälter, Arbeitszeit, Integration von Beschäftigtenmit Beh<strong>in</strong>derungen, berufliche Gleichstellung vonMann und Frau gesetzlich vorgeschrieben. Alle drei Jahremüssen zudem Verhandlungen über Stellenplanung undbetriebliche Sparpläne stattf<strong>in</strong>den. Im Jahre 2008 machtenVere<strong>in</strong>barungen zu Löhnen und Gehältern 36 Prozentder unterzeichneten Verträge aus. 29 Prozent betrafendie Arbeitszeitregelung im Anschluss an die Revisionender 35-Stunden-Woche, welche die Regierung durchdas Gesetz vom 20. August 2008 e<strong>in</strong>geführt hatte. Sokam es im letzten Quartal zu <strong>in</strong>tensiven Neuverhandlungenüber die bestehenden Arbeitszeitvere<strong>in</strong>barungen –auf Initiative der Arbeitgeber, versteht sich – nachdemder 35-Stunden-Woche durch die Gesetzesrevision e<strong>in</strong>neuer Schlag versetzt worden war.<strong>Die</strong> große Anzahl dieser »Vere<strong>in</strong>barungen« sagt wenigaus über ihren qualitativen Beitrag zur Entstehung vonsozialen Kompromissen. <strong>Die</strong> Themen s<strong>in</strong>d aufschlussreich:Löhne und Prämien, Arbeitszeit und betrieblicheSparpläne machen 83 Prozent der unterzeichneten Verträgeaus. Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen wurden <strong>in</strong> 1,5 Prozentder Fälle behandelt, berufliche Gleichstellung zwischenMann und Frau <strong>in</strong> 5,6 Prozent. Letztere Themen gewannen<strong>in</strong> jüngerer Zeit <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>schlägiger staatlicher Politikenan Gewicht. Sie stellen ernsthafte Herausforderungendar, stehen aber bei den <strong>Gewerkschaften</strong> nicht obenauf der Tagesordnung.<strong>Die</strong> Bereitschaft der Gewerkschaftsorganisationen zurUnterzeichnung der vorgelegten Verträge ist ebenfallsaufschlussreich.Tabelle 4: Bereitschaft der wichtigsten <strong>Gewerkschaften</strong>,die betrieblichen Vere<strong>in</strong>barungen zu unterzeichnen –Prozentsatz der unterzeichneten Verträge, sofern dieGewerkschaft präsent ist (<strong>in</strong> Prozent)CGT CFDT FO CFTC CFE-CGC2008 82,9 91,4 87,5 87,9 89,92007 82,8 91,7 86,7 88,9 91,22006 83,1 91,7 87,7 89,9 91,810
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICH<strong>Die</strong>se hohe Bereitschaft bedeutet entweder, dass das Betriebsleben<strong>in</strong> französischen Unternehmen von e<strong>in</strong>em bemerkenswertenKonsens geprägt ist, oder aber dass die<strong>Gewerkschaften</strong> e<strong>in</strong>en Teil ihrer vertraglichen Autonomieverloren haben. Das Schrumpfen des Mitgliedernetzwerks,se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>gliederung <strong>in</strong> die Betriebsräte und die Hygieneausschüsse(CHS-CT) haben zu e<strong>in</strong>er fortschreitendstärkeren <strong>in</strong>stitutionellen B<strong>in</strong>dung der Gewerkschaftsvertretergeführt. Aufgrund der hohen Anzahl von Verhandlungens<strong>in</strong>d sie zu professionellen Aktivisten geworden,abgeschnitten vom Alltag ihrer Wähler und kaum nochzu autonomen Vertretungspraktiken fähig.<strong>Die</strong> Rückeroberung e<strong>in</strong>er eigenen Agenda für Verhandlungenund kollektives Handeln ist für die heutige Gewerkschaftsbewegunge<strong>in</strong>e entscheidende Herausforderung,sowohl <strong>in</strong> ihrem Verhältnis zu den Arbeitgebern alsauch <strong>in</strong> ihrer Beziehung zum Staat.<strong>Die</strong> Erneuerung der soziologischen Basis der Gewerkschaftsbewegung<strong>Die</strong> Mitarbeiter des öffentlichen <strong>Die</strong>nstes und die Beamtenschafthaben seit der Nachkriegszeit <strong>in</strong> der französischenGewerkschaftsbewegung e<strong>in</strong>e zentrale Rollegespielt. In den 1980er und 1990er Jahren nahm ihreBedeutung noch zu, da der E<strong>in</strong>bruch der Mitgliederzahlenzuerst den Privatsektor betraf. Auch heute wird dasaktive Herzstück der <strong>Gewerkschaften</strong> (mit Ausnahmeder CFTC und der CFE-CGC) aus den Mitarbeitern desöffentlichen <strong>Die</strong>nstes (Staat, Gebietskörperschaften,Gesundheitswesen) und der staatlichen (oder ehemalsstaatlichen) Unternehmen wie EDF-GDF, SNCF, RATP, AirFrance, La Poste, France Telecom usw. gebildet. Auch dieneuen Organisationen, UNSA und Solidaires, s<strong>in</strong>d diesbezüglichke<strong>in</strong>e Ausnahme – sie s<strong>in</strong>d sogar mehr noch alsdie anderen <strong>Gewerkschaften</strong> von Beamten dom<strong>in</strong>iert. Inder Beamtenschaft schufen die <strong>Gewerkschaften</strong> e<strong>in</strong>st diezentralen Hebel ihrer Macht, und daran hat sich trotz Privatisierungenund geschrumpfter Mitgliederzahlen seitherwenig geändert. Der öffentliche und verstaatlichteSektor zählte im Jahr 1982 2,2 Millionen Beschäftigte,2007 waren es nur noch 710 000. <strong>Die</strong> besonders starkvon Beschäftigten mit Beamtenstatus geprägte CGT zähltimmer noch e<strong>in</strong> Fünftel ihrer Mitglieder <strong>in</strong> fünf Unternehmendes öffentlichen <strong>Die</strong>nstes, die <strong>in</strong>sgesamt nicht mehrals 3,3 Prozent der französischen Berufstätigen beschäftigen:SNCF, RATP, EDF, GDF und La Poste.Im Privatsektor s<strong>in</strong>d die <strong>Gewerkschaften</strong> mehrheitlich <strong>in</strong>den großen Unternehmen oder zum<strong>in</strong>dest bei den Auftraggebernkonzentriert, während sie im Zuliefersektorkaum präsent s<strong>in</strong>d. Dabei weist genau jener Sektor diemeisten unsicheren Arbeitsstellen auf (Zeitarbeit, befristeteArbeitsverträge, unfreiwillige Teilzeit). <strong>Die</strong>se bildenheutzutage e<strong>in</strong>en wachsenden Anteil der Beschäftigung<strong>in</strong> der Industrie und im <strong>Die</strong>nstleistungssektor. Im Jahr2007 machten die befristeten Arbeitsverträge 14,4 Prozentder Gesamtbeschäftigung und 75 Prozent der Neue<strong>in</strong>stellungenaus. Der Zuliefersektor beschäftigt auchviele junge Berufstätige – e<strong>in</strong>e Gruppe, die <strong>in</strong> der Gewerkschaftslandschaftebenfalls unterrepräsentiert ist.<strong>Die</strong> meisten <strong>Gewerkschaften</strong> werden <strong>in</strong> absehbarer Zukunfte<strong>in</strong> Drittel, manche sogar die Hälfte ihrer Mitglieder<strong>in</strong> den Ruhestand verabschieden. <strong>Die</strong> Generationenerneuerungfällt ihnen schwer, da sie <strong>in</strong> den Branchen,<strong>in</strong> denen der Nachwuchs am zahlreichsten ist, kaum vertretens<strong>in</strong>d. Im Handel, besonders <strong>in</strong> den großen Handelsketten,ist die gewerkschaftliche Präsenz fragil. TrotzFortschritten <strong>in</strong> den letzten Jahren s<strong>in</strong>d auch die Frauen<strong>in</strong> den <strong>Gewerkschaften</strong> immer noch untervertreten. Vielevon ihnen betrachten die Gewerkschaftsbewegung alsMännersache.<strong>Die</strong> Erneuerung der gesellschaftlichen Basis der Gewerkschaftsbewegungist heute e<strong>in</strong>e absolute Notwendigkeitgeworden, nicht nur aus demographischen Gründen,sondern auch, weil die soziale Zusammensetzung der<strong>Gewerkschaften</strong> der tatsächlichen der Arbeitnehmerschaftnicht entspricht. <strong>Die</strong> <strong>Gewerkschaften</strong> spielen weiterh<strong>in</strong>e<strong>in</strong>e aktive Rolle <strong>in</strong> den Unternehmen und öffentlichen<strong>Die</strong>nsten, <strong>in</strong> denen sie präsent s<strong>in</strong>d. Doch s<strong>in</strong>d sienicht länger der b<strong>in</strong>dende Kitt der Arbeitnehmerschaft,sondern spiegeln vielmehr deren Zersplitterung wider. Siehaben sich <strong>in</strong> gewisse Nischen der Arbeitswelt zurückgezogenund s<strong>in</strong>d nicht mehr wie früher der soziale Akteur,der die Strategien der Unternehmen und der staatlichenPolitiken bee<strong>in</strong>flussen kann.Neue RepräsentationsregelnIm Anschluss an e<strong>in</strong>e vom MEDEF, der CGPME, der CGTund der CFDT ausgearbeitete »geme<strong>in</strong>same Stellungnahme«ließ die Regierung im August 2008 e<strong>in</strong> Gesetzverabschieden, das die Regeln zur Anerkennung und Repräsentativitätder <strong>Gewerkschaften</strong> sowie die Validierungsbestimmungender Sozialverträge revidierte. <strong>Die</strong>11
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHTabelle 5: Stimmenanteil der <strong>Gewerkschaften</strong> bei Betriebswahlen (<strong>in</strong> Prozent)Betriebsratswahlen nach Jahren1966196719761977198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006Wahlbeteiligung 72,1 71,2 65,1 65,4 66,4 66,2 65,7 64,5 64,8 64,8 63,8CGT 48,9 39,8 25 22,5 22,3 20,7 22,5 23 23,5 23,4 22,9CFDT 18,6 19,6 20,5 20,4 20,9 21,1 21,3 22,9 22,7 21,2 20,3CFTC 2,3 2,9 4,1 4,4 4,7 4,8 5,0 5,5 5,8 6,4 6,8CGT-FO 7,9 9,2 12,0 11,9 11,9 12,2 12,1 12,3 12,7 12,6 12,7CFE-CGC 4,1 5,4 6,0 6,0 5,7 6,1 6,1 6,0 5,8 6,3 6,5Andere <strong>Gewerkschaften</strong> 3,6 6,4 5,7 5,9 6,4 5,9 6,4 6,5 7,0 7,3 8,2Nicht gewerkschaftlich organisiert 14,6 16,5 27,7 28,9 28,2 27,3 26,6 23,8 22,5 22,8 22,6Wahlen zum ArbeitsgerichtAlle Beschäftigten1979 1982 1987 1992 1997 2002 2008Wahlbeteiligung 73,2 58,7 47,6 40,4 34,5 31,5 25,5CGT 42,4 36,8 36,3 33,4 33,2 32,1 33,8CFDT 23,1 23,5 23,0 23,7 25,5 25,2 22,1FO 17,4 17,8 20,5 20,4 20,6 18,3 15,9CFTC 6,9 8,4 8,3 8,5 7,6 9,6 8,9CGC 5,2 9,6 7,4 6,9 5,9 7,0 8,2UNSA – – – – 0,7 5,0 6,2Solidaires – – – – 0,3 1,5 3,8Verschiedene 4,8 3,8 4,3 4,3 6,3 1 1,0Paritätische Verwaltungskommissionen der staatlichen Beamtenschaft1980–81–821989–90–911992–93–941995–96–971997–98–992000–01–022003–04–052005–06–07CGT 19,5 17,4 16,6 16,1 16,2 15,8 16,9 16 15,6CFDT 17,5 17,6 17 14,4 14,4 13,9 11,6 11,3 11,3FO 15,3 16,6 16,2 13,8 14,1 14,0 13,6 13,1 13,0CFTC 3,0 3,3 3,1 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2CFE-CGC 2,5 2,2 2,9 1,9 2,7 3,1 3,4 4,1 4,2FEN (UNSA) 29,2 27,3 19,5* 16,4 14,6 15,9 16,0 17,2 16,8Solidaires 9,3 9,9Verschiedene 13,0 15,4 11,1 16,9 16,8 16,6 17,1 6,7 6,8FSU – – 13,5 18 19 18,5 19,2 19,9 20,22006–07–0814
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHTabelle 6: <strong>Die</strong> Spaltungen der französischen Gewerkschaftsbewegung1947CGTHeuteCGT1948CGTForce ouvrièreCGT-FOFEN1993FSUDiversautonomesUNSA1965HeuteCFTCCFTC1989–2003CFDTSolidaires1944 1981HeuteCGCCFE-CGCCFE-CGC15
JEAN-MARIE PERNOT | DIE GEWERKSCHAFTEN IN FRANKREICHFür weitere InformationenAmossé T. / Bloch-London C. / Wolff L. (2008): Les relations sociales en entreprise, Paris, La Découverte.Andolfatto D. (dir) (2004): Les syndicats en France, Paris, La documentation française, nouvelle édition 2007.Bévort A. / Jobert A. (2008): Sociologie du travail: les relations professionnelles, Paris, éditions A. Col<strong>in</strong>.Denis J. M. (dir) (2005): Le conflit en grève?, Paris, La Dispute.Groux G. / Pernot J. M. (2008): La grève, Paris, Presses de sciences po.IRES (2009): La France du travail, Paris, éditions de l’Atelier.Karila-Cohen P. / Wilfert B. (1998): Leçons d’histoire sur le syndicalisme en France, Paris, PUF.Mouriaux R. (1998): Crises du syndicalisme français, Paris, Monchrestien.Pernot J. M. (2005): Syndicats, lendema<strong>in</strong>s de crise? Paris, Gallimard, collection Folio-Actuel, nouvelle édition 2010.16
Über den AutorDr. Jean-Marie Pernot, Doktor der politischen Wissenschaften,Forschungsbeauftragter für politische Wissenschaften amIRES (Institut de recherches économiques et sociales).Impressum<strong>Friedrich</strong>-<strong>Ebert</strong>-<strong>Stiftung</strong>Internationale Politikanalyse | Abteilung Internationaler DialogHiroshimastraße 28 | 10785 Berl<strong>in</strong> | DeutschlandVerantwortlich:Dr. Gero Maaß, Leiter Internationale PolitikanalyseTel.: ++49-30-269-35-7745 | Fax: ++49-30-269-35-9248www.fes.de/ipaBestellungen/Kontakt hier:<strong>in</strong>fo.ipa@fes.de<strong>Die</strong> <strong>in</strong> dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Ansichtens<strong>in</strong>d nicht notwendigerweise die der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Ebert</strong>-<strong>Stiftung</strong>.ISBN 978-3-86872-452-3<strong>Die</strong>se Publikation wird auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaftgedruckt.