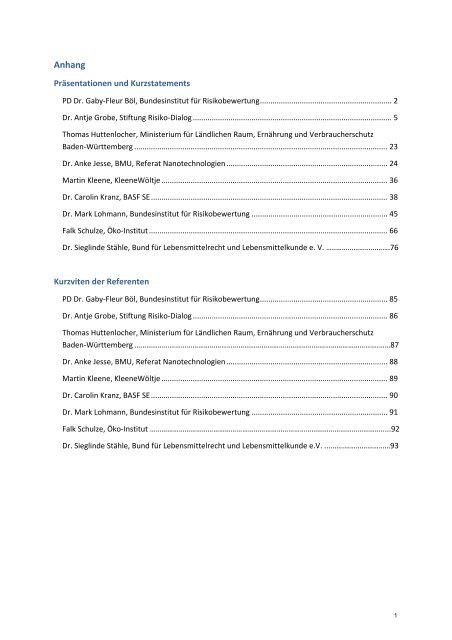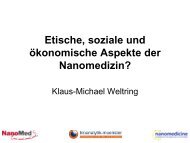Anhang zum Bericht - Nanoportal Baden-Württemberg
Anhang zum Bericht - Nanoportal Baden-Württemberg
Anhang zum Bericht - Nanoportal Baden-Württemberg
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Anhang</strong>Präsentationen und KurzstatementsPD Dr. Gaby‐Fleur Böl, Bundesinstitut für Risikobewertung ............................................................... 2Dr. Antje Grobe, Stiftung Risiko‐Dialog ............................................................................................... 5Thomas Huttenlocher, Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz<strong>Baden</strong>‐Württemberg ......................................................................................................................... 23Dr. Anke Jesse, BMU, Referat Nanotechnologien ............................................................................. 24Martin Kleene, KleeneWöltje ............................................................................................................ 36Dr. Carolin Kranz, BASF SE ................................................................................................................. 38Dr. Mark Lohmann, Bundesinstitut für Risikobewertung ................................................................. 45Falk Schulze, Öko‐Institut .................................................................................................................. 66Dr. Sieglinde Stähle, Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. …..……………………….76Kurzviten der ReferentenPD Dr. Gaby‐Fleur Böl, Bundesinstitut für Risikobewertung ............................................................. 85Dr. Antje Grobe, Stiftung Risiko‐Dialog ............................................................................................. 86Thomas Huttenlocher, Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz<strong>Baden</strong>‐Württemberg ……………………………………………………………………………………………………………….……87Dr. Anke Jesse, BMU, Referat Nanotechnologien ............................................................................. 88Martin Kleene, KleeneWöltje ............................................................................................................ 89Dr. Carolin Kranz, BASF SE ................................................................................................................. 90Dr. Mark Lohmann, Bundesinstitut für Risikobewertung ................................................................. 91Falk Schulze, Öko‐Institut ………………………………………………………………………………………………………….....92Dr. Sieglinde Stähle, Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. ...…….……………………931
vollständige und nachvollziehbare Risikokommunikation macht das BfR Wissenschaft fürPolitik, Wirtschaft, Verbände, Nichtregierungsorganisationen, Medien und die Verbraucherschaftsicht- und nutzbar. Gerade im Hinblick auf neue Technologien wie der Nanotechnologiebestehen hierbei besondere Herausforderungen. Allen Beteiligten soll die Möglichkeit gegebenwerden, sich eine mündige Meinung über Auswirkungen neuer Technologien zu bilden undihnen somit einen verantwortungsvollen Umgang damit zu ermöglichen. Hierzu ist unteranderem ein Verständnis dafür nötig, wie Verbraucher bestimmte Risiken wahrnehmen.Um zu erfassen, wie Nanotechnologie von der deutschen Bevölkerung beurteilt wird, hat dasBfR ein Forschungsprojekt zur Wahrnehmung der Nanotechnologie in der Bevölkerungdurchgeführt. Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung in Verbindung mit einer qualitativpsychologischenGrundlagenstudie gibt Aufschluss darüber, welche Faktoren dieWahrnehmung von Menschen beeinflussen, welche sozialen Dynamiken beim ThemaNanotechnologie von Bedeutung sind und in welche Richtungen sich die öffentlicheMeinungsbildung zur Nanotechnologie entwickeln könnte. Dabei wurden Risiken bzw. dieRisikofelder, die in der öffentlichen Wahrnehmung manifest, latent oder potenziell vorhandensind, aufgedeckt sowie Wirkungsfaktoren für die Risikokommunikation in diesem neuenRisikofeld beschrieben. Der überwiegende Anteil der 1.000 Befragten schätzt den Nutzen derNanotechnologie höher ein als ihr Risiko (66%) und hat insgesamt ein gutes oder sehr gutesGefühl bei dieser Technologie (77%). Während die Anwendung der Nanotechnologie imLebensmittelbereich eher als sensibler Bereich bezeichnet wird, ist der Zuspruch im BereichTextilien sowie Farben und Lacke hoch (86%).Da Risikokommunikation weit über eine reine Information <strong>zum</strong> Stand der wissenschaftlichenForschung und das Wissen über gesundheitliche Risiken hinausgeht, wurde eine BfR-Verbraucherkonferenz Nanotechnologie initiiert. Grundlage der Risikokommunikationsaktivitätendes BfR ist der partizipative Dialog. Die Durchführung einer Verbraucherkonferenzsetzte diesen Auftrag in die Praxis um, indem Verbraucher bereits im Vorfeld einer breitenverbrauchernahen Anwendung der Nanotechnologie direkt in die Diskussion der Chancen undRisiken einbezogen wurden und ihr Votum als vorgebildete Laien öffentlich verkündeten.Weiterhin wurde vom BfR eine Delphi-Befragung zu Risiken nanotechnologischer Anwendungenin den Bereichen Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände durchgeführt. Zieldieses Projektes, bei dem es sich um eine mehrstufige Expertenbefragung handelt, war es,das Technologiefeld Nanotechnologie anhand potenzieller Risiken vorzustrukturieren und damitdie Grundlage für zukünftige Risikobewertungen zu nanotechnologischen Anwendungen zulegen. Auf der Grundlage des verfügbaren Wissens zu Exposition und Gefährdungspotenzialwurden nanotechnologische Anwendungen nach der Höhe des wahrscheinlichen Risikosunterteilt.In einem weiteren BfR-Projekt zur Analyse der Medienberichterstattung wurde anhand von1.696 Artikeln aus neun Zeitungen (Financial Times Deutschland, Frankfurter AllgemeineZeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, taz, Welt, Zeit, Focus und Spiegel) inden Jahren 2000 bis 2007 untersucht, wie die Thematik Nanotechnologie im massenmedialenDiskurs aufgegriffen wird, welche Akteure sich mit welchen Positionen an der Debatte beteiligenund welche Argumentationsmuster und sprachliche Bilder die Debatte prägen. Bislang wird dasThema in den Medien mit durchschnittlich zwei <strong>Bericht</strong>en pro Zeitung pro Monat eherwissenschaftlich und sachlich behandelt sowie Nutzen und Vorteile herausgestellt.3
In einer Internetanalyse der Jahre 2001 bis 2008 wurden 501 Beiträge aus online Foren undweblogs ausgewertet. Diese besondere Gruppe von Verbrauchern, die in Internetforen aktivsind, beurteilt Nanoprodukte vorwiegend aus Nutzenaspekten heraus. Hohe Akzeptanz habenhierbei Nanoprodukte im Themenfeld Medizin, Textilien und Fahrzeuge, während noch nichtanwendungsreife Produkte, beispielsweise aus dem Lebensmittelbereich, eher skeptischbeurteilt werden.Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist in allen relevanten wissenschaftlichen Gremien,die sich auf nationaler (z.B. Nano-Kommission), europäischer (z.B. EFSA) oder internationalerEbene (z.B. OECD) mit der Regulierung der Nanotechnologie befassen, vertreten. Allegenannten Aktivitäten haben das gemeinsame Ziel, den sicheren und verantwortungsvollenUmgang mit der Nanotechnologie und ihren Produkten zu gewährleisten.Auf der homepage des BfR finden sich folgende Dokumente zur Nanotechnologie:Gesamtübersicht im A-Z-Index zu Nanotechnologienhttp://www.bfr.bund.de/cd/3862?index=78&index_id=7585Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/276/ausgewaehlte_fragen_und_antworten_zur_nanotechnologie.pdfStellungnahme zu Nanotechnologie und Lebensmittelnhttp://www.bfr.bund.de/cm/216/die_datenlage_zur_bewertung_der_anwendung_der_nanotechnologie_in_lebensmitteln.pdfForschungsstrategie Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/220/nanotechnologie_gesundheits_und_umweltrisiken_von_nanomaterialien_forschungsstrategie_endfassung.pdfDelphi-Expertenbefragung zur Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/238/bfr_delphi_studie_zur_nanotechnologie.pdfVerbraucherkonferenz zur Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/238/bfr_verbraucherkonferenz_nanotechnologie.pdfBevölkerungsbefragung zur Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/238/wahrnehmung_der_nanotechnologie_in_der_bevoelkerung.pdfMedienanalyse zur Nanotechnologiehttp://www.bfr.bund.de/cm/238/risikowahrnehmung_beim_thema_nanotechnologie.pdfWahrnehmung der Nanotechnologie in Diskussionen im Internethttp://www.bfr.bund.de/cm/238/wahrnehmung_der_nanotechnologie_in_internetgestuetzten_diskussionen.pdf4
Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg –ExpertenworkshopStuttgart, 09. Dezember 2010, Haus der WirtschaftKennzeichnungDr. Antje GrobeStiftung Risiko-Dialog, St. GallenUniversität StuttgartQuelle: Wettbewerb Nano & Art5Dr. Antje Grobe 1
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche Kommunikationsmix1. Was ist Kennzeichnung?7Dr. Antje Grobe 3
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixVoraussetzungen:- Definition- Kriterien- Zuordnung / Klassifizierung- EU-weite Regulierung12Dr. Antje Grobe 8
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche Kommunikationsmix3. Wollen die Verbraucher eine Kennzeichnungvon Nanoprodukten?13Dr. Antje Grobe 9
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixStudie der Universität Stuttgart„Nanotechnologien: Was Verbraucher wissenwollen“Grobe, et al. (2008)14Dr. Antje Grobe 10
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixWas wollen Verbraucherinnen undVerbraucher wissen?Worüber wollen Verbraucherinnen und Verbraucherinformiert werden? (N=100)Funktion und Wirkung57Risiken allgemein47Inhaltsstoffe36Überprüfbarkeit32Langzeitnutzen30Forschungsbereiche240 10 20 30 40 50 6015Dr. Antje Grobe 11
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixWie wollen Verbraucherinnen und Verbraucherinformiert werden? (Grobe et al. 2008)Gewünschte Informationskanäle (N=100)TV53Printmedien46Internet40Labelling38Packungsrückseite28Werbung180 10 20 30 40 50 6016Dr. Antje Grobe 12
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche Kommunikationsmix4. Wie könnte ein Informationsmix fürVerbraucherinnen und Verbraucheraussehen?17Dr. Antje Grobe 13
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixBAG (2010)Konsumenten-Informationen zuNano-ProduktenErgebnisse der BAG NANO-Dialogplattform18Dr. Antje Grobe 14
BAG-Dialogplattform (2010)Anregungen: Allgemeine Konsumenten-InformationInformationskanal Einstiegs- und Überblick-Info Vertiefende InformationenInternetplattform(Behörden)MedienÖffentlicheVeranstaltungenSchulenUniversitätenZentrale und neutrale Internetplattform• Grundlagenwissen• Funktion in Produkten• Informationen zur Sicherheit• Nutzung von Animationen• Grafiken und FilmenThema: Funktion und Sicherheit vonNanotechnologien und Nanomaterialien• Dokumentarfilme• Wissenschafts- und Technik-Shows• Animationen für TV oder Internet• Zeitungsartikel mit Grafiken• Messestände mit Präsentationen, Shows• Infomaterialien für die breite Öffentlichkeit• Erweiterung von Lernangeboten• UnterrichtsmaterialienWeiterführende Links zu• Aktivitäten der Behörden,• Industrie-Verbänden• Konsumentenorganisationen• Forschungsprojekten• Produkt-Liste• Informationen zu SubstanzenTV-Beiträge / Zeitungsartikel zurVertiefung von• Anwendungsbereichen• Forschungsprojekten• Produkt-Vergleichstests• Bürger-/Konsumenten-Dialoge• PodiumsdiskussionenErgebnisse in Form vonKonsumentenanliegen undEmpfehlungen an die Politik• Projekte und Wettbewerbe19Dr. Antje Grobe15
BAG-Dialogplattform (2010)Anregungen: Produktspezifische Konsumenten-InformationInformationskanal Einstiegs- und Überblick-Info Vertiefende InformationenKennzeichnung(Labeling)Verpackung /BeipackzettelPoint of Sale (POS)Internet (Hersteller derProdukte)Produkt-Infoline /Hotline• „(Nano)“-Kennzeichnung• gilt bereits ab 2012 EU-weit bei KosmetikaEinfache Hinweise zu• Funktion / Eigenschaften• Gebrauch / Reinigung / Wartung• EntsorgungEinfache Hinweise über einen Bar-Code-Scanner / Info-Computer am POS abzurufen:• Funktion / Eigenschaften• Gebrauch / Reinigung / Wartung• EntsorgungEinfach verständliche Grafiken, Animationenund kurzen Texten <strong>zum</strong> Produkt:• Funktion / Eigenschaften• Gebrauch / Reinigung / Wartung• Entsorgung• Häufig gestellten Fragen und Antworten• Persönliche KontaktaufnahmeEinfache, konsumentennahe Informationenzu Nano-Produkten von Herstellern undKonsumentenorganisationen• „Weitere Informationen unterwww.xyz.ch“• Weitere Hinweise z.B. zuTestergebnissen,•„Weitere Informationen unterwww.xyz.ch“• Beratung im Fachhandel• Filme und Präsentationen zurFunktion, Auswirkungen aufMensch und Umwelt, Sicherheit(ggf über Bar-Code-Scanner / Info-Computer)„Weiterlesen>>“-Button mit• Testergebnissen• Links zu Forschungsprojekten,• Möglichkeiten zurKontaktaufnahme bei spezifischenFragestellungenVertiefende, konsumentennaheInformationen zu Nano-Produktenvon Experten der Hersteller oderKonsumentenorganisation20Dr. Antje Grobe16
Kennzeichnung Voraussetzungen Verbraucherwünsche KommunikationsmixKernfragen, die im Dialog geklärt werden sollten1. Was ist Kennzeichnung?2. Voraussetzungen?3. Wollen Verbraucherinnen und Verbraucher dieKennzeichnung?4. Wie könnte ein Informationsmix für Verbraucherinnenund Verbraucher aussehen?21Dr. Antje Grobe 17
Willkommen im DialogDr. Antje GrobeStiftung Risiko-DialogZürcherstrasse 12CH- 8400 WinterthurTel. ++41 52 262 76 11Fax ++41 52 262 76 29www.risiko-dialog.chantje.grobe@risiko-dialog.chBüro Grobe StuttgartLindenstraße 1070563 StuttgartTel. ++ 49 711 78262540Fax.++ 49711 7826253422Dr. Antje Grobe
Kurzstatement Thomas HuttenlocherMinisterium für Ländlichen Raum, Ernährung undVerbraucherschutz <strong>Baden</strong>-Württemberg (MLR)Verbraucherpolitik und NanotechnologieVerbraucher bewerten die Risiken der Nanotechnologie je nach Anwendungsbereich sehrunterschiedlich. Die Einstellung gegenüber Innovationen ist grundsätzlich positiv. Beispielsweisewerden Autolacke, Fassadenstriche oder neue Materialien in der Bauwirtschaftals eher unproblematisch eingeschätzt. Verbraucher sind vor allem dann kritisch, wennNanopartikel in Lebensmittel, Kosmetika, Haushaltsprodukten und Textilien, also körpernaheingesetzt werden.Die verbraucherpolitischen Aktivitäten des MLR im Bereich Nanotechnologie, Verbraucherschutzund Verbraucherinformation sollen den Verbrauchern helfen, die Wahlmöglichkeitzwischen verschiedenen Produkten auf dem Markt zu ermöglichen.Für eine fundierte Konsumentscheidung müssen sich Verbraucher über Vor- und Nachteile,über Chancen und Risiken eines Produktes informieren können. Transparente Informationenüber die Produktion und über die Inhaltsstoffe von Produkten sind dabei eine wichtigeBasis für die Bewertung und persönliche Kaufentscheidung eines mündigen Verbrauchers.Nanoproduktkataster / Datenbank für ProduktinformationenEin Produktkataster für den deutschsprachigen Raum würde die Transparenz bezüglichder Produkte und nanoskalaren Inhaltsstoffe für die Verbraucher fördern. Eine für alleInteressierten niederschwellig zugängliche Datenbank könnte den Verbrauchern ganzkonkrete, produktbezogene Informationen zur Verfügung stellen.Für ein amtliches Produktregister, wie es derzeit in der Diskussion ist, ergeben sich in derPraxis erfahrungsgemäß große Probleme bei der Aufbereitung und Bereitstellung vonVerbraucherinformationen. Daher würde das MLR die Einrichtung eines nichtamtlichenanbieterunabhängigen und nicht kommerziellen Produktkatasters <strong>zum</strong> Beispiel bei einerwissenschaftlichen Einrichtung unterstützen. Als Vorbild kann die in den USA beim "Woodrow-Wilson-Center"(Washington DC, USA) eingerichtet Datenbank mit nanotechnologiebasiertenVerbraucherprodukten dienen.23
Hot Spotsim NanoDialog der deutschenBundesregierungDr. Anke JesseExpertenworkshop am 9.12.2010„Nanotechnologie und Verbraucherkommunikation“StuttgartReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien241
Die NanoKommissionNanoKommissionNano-DialogUmsetzung desPrinzipienpapiersRegulierungThemengruppe 1 Themengruppe 3NutzenpotenzialeThemengruppe 2„GREEN NANO“Nachhaltige Nanotechnologien„VorläufigeRisikoabschätzung“Themengruppe 4ArbeitsgruppeReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien252
Themengruppe 1 –PrinzipienpapierZiele und mögliche Ergebnisse• Ziele• Ergebnisse1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenziale undRisiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –NachhaltigeNanotechnologien– Kritische Begleitung desUmsetzungsprozesses(VCI)– Erweiterung„Empfehlungen fürpraxisnahe Leitfäden“(Umwelt- undVerbraucherschutz)– Einbindung weitererBranchen in dieUmsetzung der Prinzipien– „Methode“ Monitoring &Empfehlungen– <strong>Bericht</strong> zur Umsetzung &Empfehlungen– ÜberarbeiteteEmpfehlungen fürPraxisleitfäden– Mitarbeit der Industrie zuspeziellen ProduktenReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien263
Themengruppe 2 –Nutzenpotenziale und RisikenZielsetzung und Ergebnisse• Zielsetzung• Erwartetes Ergebnis1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenzialeund Risiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –NachhaltigeNanotechnologien– Entwicklung einer nachvollziehbarenMethodezur Bewertung derNutzenpotenziale &Risiken vonNanoprodukten– Testen der Methodik an 2konkreten Beispielen undErarbeitung einerDarstellung derNutzenpotenziale undRisiken– Integriertes Prüfraster zurBewertung vonNutzenpotenzialen undRisiken von Nanomaterialienund –Produkten– Konkrete Darstellungenvon Nutzenpotenzialenund Risiken von 2Nanoprodukten.Referat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien274
Themengruppe 3 –RegulierungZielsetzung1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenziale undRisiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –NachhaltigeNanotechnologienUmsetzungen desVorsorgeprinzipsidentifizieren auf Ebenevon Strategien,Konzepten undInstrumentenErarbeitung vonRegulierungskriterienEmpfehlungenzur vorsorgeorientiertenRegulierung vonNanomaterialienBeschreibung vonRegulierungslücken /-BedarfenReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien285
Themengruppe 3 –RegulierungKonzeptpapier1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenziale undRisiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –NachhaltigeNanotechnologienKonkrete Ebene:Abstrakte Ebene:– Erarbeitung von Maßstäben, zur Beurteilung, obeine Regulierung „ausreichend“ ist oder nicht– Analyse von Regulierungund Debatten anhand der Maßstäbe undAbleitung von Schlussfolgerungen→Identifizierung von Regulationsbedarf,Regulierungskriterien→Regulierung von Nanomaterialien und –technologien im Sinne von Nachhaltigkeit undVorsorgeprinzip:ThemenlisteReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien296
Themengruppe 4 –vorläufige RisikobewertungZiele und Ergebnisse– Ziele• Ergebnisse / Produkte1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenziale undRisiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –NachhaltigeNanotechnologien– Weiterentwicklung dervorläufigenRisikobewertung zu einerschlüssigen Methode– Verbindung derErgebnisse derBewertung mitMaßnahmen desRisikomanagements– OperationalisiertesKriterienset, im ges.Konsens gewichtet,Indikatoren zurBewertung– Fehlliste „Messmethoden“– Vorschläge für möglicheMaßnahmen inVerbindung mitKategorien vonVerwendungen28.03.2011Referat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien307
Themengruppe 4 –vorläufige RisikobewertungZielsetzung1. Umsetzung desPrinzipienpapiers2. Nutzenpotenziale undRisiken vonNanoprodukten3. Regulierung4. „VorläufigeRisikoabschätzung“5. „GREEN NANO“ –Nachhaltige• Fortsetzung der eigenen Arbeiten aus der erstenDialogphase– Vorläufige Bewertung von Risiken vonNanomaterialien• „einfache“ Indikatoren für Risiken• Nichtwissen über Eigenschaften, Verwendungen undVerhalten– Betrachtung Arbeiten anderer (z.B. SchweizerVorsorgeraster)• Verbindungen zu Arbeiten der anderenThemengruppen – TG 2Nanotechnologien28.03.2011Referat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien318
Arbeitsgruppe –„GREEN NANO“Aufgabe, Fokus und ZielZiel:Potential vonNanomaterialienfür eine nachhaltigeEntwicklung herausarbeitenFokus:gesellschaftlichen Diskussion und demProzess der Entwicklung von LeitbildernAufgabe:Vorstellung und Diskussion über die Funktion von Leitbildernfür Technologieentwicklung und die Funktion eines Leitbilds für„Nanotechnologien“28.03.2011Referat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien329
Hot Spots• Nano-Produktregister fürBehörden und/oderÖffentlichkeit• Labelling – Thematik• Regulierung auf nationaler undEU Ebene• Risikokommunikation• ForschungReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien33
Organisation eines Dialogs• Welche Zielsetzung des Dialogs ?• Welche Organisationsform ?• Welche Leitung ?Referat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien34
Hot Spots - NanoKommissionVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Dr. Anke Jesseanke.jesse@bmu.bund.deReferat IG II 6Nanotechnologie und synthetische Nanomaterialien3512
Martin KleeneNanotechnologie und Kommunikation: alles im grünen Bereich?Statement für den Expertenworkshop „Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg“9. Dezember 2010, Stuttgart„Nano-Dialog“ verweist auf zwei Begriffe, die zur Zeit sehr weit interpretiert werden. „Nano“begegnet uns inzwischen in vielfältigen Verwendungsformen: „Nano – die Welt von morgen“(3Sat-Magazin), der Tata Nano (das „billigste“ Auto der Welt) oder der iPod nano sindBeispiele dafür, dass der Zusatz „Nano“ gerne genutzt wird, um Zukunft und High Tech zusignalisieren. Die wissenschaftlich-technologische Definition, die dem OberbegriffNanotechnologien zu Grunde liegt, wird dabei kaum deutlich. Auch „Dialog“ ist nicht gleich„Dialog“ und erfährt eine fast schon inflationäre Verwendung vor allem im Umfeldgesellschaftspolitisch relevanter und umstrittener Projekte (Gorleben, Stuttgart 21). DieVerwendung des Gütesiegels „Dialogprozesss“ besagt noch nicht, in welcher Qualität einDialog geführt wird. Sind es lediglich Anfragen, auf die geantwortet wird? Oder besteht dieChance, durch eine gegenseitige Bezugnahme Argumente weiter zu entwickeln und zueinvernehmlichen Lösungen zu kommen? Der verbraucherorientierte Nano-Dialog in <strong>Baden</strong>-Württemberg steht vor der konzeptionellen Aufgabe, die Intensität und die Qualität desDialogs so zu definieren, dass Einstellungen und Erwartungen der Verbraucher ebensoberücksichtigt werden können wie Fragen der Risikoeinschätzung und des technologischbegründeten Nutzenpotentials von Nanotechnologie.Studien zeigen, dass der Informationsstand in der Bevölkerung zu Nanotechnologien immernoch gering ist (die eingangs erwähnte Verwendung von „Nano“ als Präfix oder Suffix bringtkeinen Erkenntnisgewinn). Die Relevanz für den eigenen Lebensstil wird als nicht so hochbewertet, die meisten Anwendungsbereiche werden positiv gesehen (bis auf Bedenken beiLebensmitteln, Kosmetik und militärischer Nutzung) und die Risiko-Nutzen-Abwägung fälltauch in den Medien überwiegend positiv aus. Sollten vor Jahren Befürchtungen bestandenhaben, dass Nanotechnologie in der öffentlichen Wahrnehmung eine ähnliche Brisanzentwickelt wie Gentechnologie, so ist das bislang (noch) nicht eingetreten. Im Rückblick wirktdie Kommunikation zu Nanotechnologie, wie sie in den Jahren 2005 bis 2008 realisiertwurde, sehr proaktiv. Das ist jetzt nicht mehr so deutlich sichtbar. Liegt es daran, dassNanotechnologie doch nicht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht? Können alsoKommunikationsbemühungen reduziert werden? Das wäre eine fatale Schlussfolgerung.Denn die Schadens- und Risikopotenziale von Nanotechnologien stehen ebenso imWiderspruch zur „ruhigen“ Öffentlichkeit wie ihr möglicher Nutzen. Eine kritische öffentlicheDebatte, ausgelöst durch produktspezifische Probleme in der Anwendung oder Fragen zurRisikoabschätzung, kann jederzeit entstehen. Um so relevanter sind Aktivitäten, die sich umKontinuität und Intensivierung der Kommunikation und der Dialogprozesse zuNanotechnologiebemühen.136
Welche Qualität kann solch ein verbraucherorientierter Dialogprozess haben? Im„Aktionsplan 2010“ der Nano-Initiative der Bundesregierung (2006) heisst es: „DieÖffentlichkeit soll aktiv in den Dialogprozess zu möglichen Chancen und Risiken derNanotechnologie einbezogen werden, um die in der Bevölkerung festzustellendenInformationslücken hinsichtlich der Nanotechnologie zu schließen“. Ist also„Informationsvermittlung“ Ziel des Dialogs? Geht es dabei nicht auch um Sorgen undForderungen der Verbraucher, wie sie bei Dialogveranstaltungen zu Nanotechnologie (z.B.bei der ersten Verbraucherkonferenz) ermittelt wurden, um in einem stetigen Prozessdiskutiert und umgesetzt zu werden? Die Qualität eines Dialogprozesses wird auch durchKontinuität und Interaktion bestimmt. Dann entsteht daraus ein dichter dialogischer Prozess,der Einstellungen und Erwartungen der Verbraucher angemessen berücksichtigt.Mit „Web 2.0“ ergeben sich neue Chancen für öffentliche Dialogprozesse. PolitischeÖffentlichkeit organisiert sich neu, quer zu etablierten, tradierten Institutionen und Formenvon Öffentlichkeit. Es „empowert“ Individuen, ihre Protest – und Einflussmöglichkeiten zunutzen. Hinzu kommt eine zunehmende Professionalisierung und Stabilisierung vonProtestpotenzial im Internet. Das kann jederzeit aktiviert werden, auch zu Nanotechnologie.Noch gibt es überwiegend eine differenzierte Diskussion, selbst unter Kritikern, die auch imKontext des Potentials von Nanotechnologie für eine nachhaltige Entwicklung geführt wird.Dagegen sind institutionelle Informationen zu Nanotechnologie sehr produkt- undtechnikorientiert, was sich jedoch schnell zu einer grundsätzlichen Debatte entwickeln kann,die auch den gesellschaftlichen Kontext und die soziale Dimension aufgreift. Es ist ausStudien bekannt, dass die Einstellung zu Nanotechnologie umso kritischer ist, je informierterdie Befragten sind. Und es werden noch mehr Informationen zu Funktionen und Wirkung,Risiken und Inhaltsstoffen eingefordert. Web 2.0 kann dazu führen, dass aus vereinzeltenkritischen NGO-Aktivitäten eine Welle wird, die sich verselbständigt. Aus der alten „one-tomany“oder „one-to-some-to-many“ – Kommunikation ist eine „many-to-many“ –Kommunikation geworden, die die Art und Form der Kommunikation grundlegend verändert.Es gibt Nano-Dialog- und Informationsangebote im Internet, die darauf bereits Bezugnehmen: www.safenano.org oder auch www.nanoandme.org sind umfassend und partizipativangelegt. Angebote dieser Art können wichtige reale Dialogprozesse (Veranstaltungen,Workshops) ergänzen. Sie bieten auch deshalb einen Mehrwert, weil sie das follow up unddie Konsequenzen aus Dialogveranstaltungen transparent und nachhaltig aufgreifen undbegleiten können. Dann kann daraus ein „nachhaltiger“ Dialogprozess werden, der Kritik undBedenken ebenso berücksichtigt wie technologische Fortschritte und Produktanwendungen.237
Empfehlungen fürNano-Dialoge in<strong>Baden</strong>-WürttembergDr. Carolin KranzBASF SECommunications & Government RelationsTel.: 0621 60 43360E-mail: carolin.kranz@basf.comStuttgart, den 9.12.2010Nano-Dialog in <strong>Baden</strong>-Würrtemberg38
Herausforderungen für Unternehmen undPolitikSicherheitGesetzgebungAkzeptanzBesteht ein GesundheitsoderUmweltrisiko?Sind unsere Produktesicher?Wie testen wirNanomaterialien?Wie könnnen gesetzlicheRahmenbedingungen sein,die ausreichend Sicherheitgewähren undInnovationen nichtbehindern?Wie erreichen wir einsoziales Umwelt das offenfür neue Technologien undForschritt ist ?39
Ausgewählte Nano-Dialoge mit BASFBeteiligung2006: Nano 2005: BUND 2006: BUND 2008:Kommission TagungTagung Bürgerdialoge2010: Nanotruck 2010: BASF 2010: BUND Nanocare2006: 2007: VCI Forum 2004: NanotruckDialogforum TagungEconsense 2010: IGBCEZukunft2009: NanotruckNano 2006: IKWChancen nutzen- 2005: VCI Dialog „Nano 2008: in Safety for 2009:Risiken2010: CDU/CSUDialogstaffel 2010: Öko-Kosmetik“Success BürgerdialogemanagenBundestagsfraktiArbeitsschutzInstitutNanocareon2007: Euro-2007: Deutscher 2008: Nanotruck 2007: CEFIC Nano-Forum 2009: BUNDEv. KirchentagStakeholderdialog2007: Nano 2008: BUNDTagungKommission Tagung2008: BASFDialogforumNano2006: Nanotruck2005: Nanotruck2009: BASFDialogforumNano40
Empfehlungen für NanoDialoge in <strong>Baden</strong>Württemberg• Doppelarbeit vermeiden. Neue Dialoge auf bestehende Dialogeaufbauen oder in bestehende „Dialoglandschaften“ integrieren.• Der Weg in die Zukunft ist eine Balance zwischen Chancen undRisiken. Dialoge zu Chancen mit Dialogen zu Risiken verbinden.• Das Interesse der Bürger an Dialogen ist gering. Geeignete Formenfinden, die die Zielgruppen ansprechen. Beteiligung muss Spaßmachen.• Die Wissenschaft einbinden. Dialoge nicht nur Unternehmenüberlassen. Wissenschaftler haben eine deutlich höhereGlaubwürdigkeit.• Dialoge brauchen Kontinuität und Schutz. In eintägigen,öffentlichen Veranstaltungen werden nur Positionen ausgetauscht.Kompromisse entstehen nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre.• Die Meinungsbildung findet jetzt statt. Dialoge müssen jetzt geführtwerden.41
Nanotechnologie in der öffentlichenMeinungFrage: Haben Sie schon einmal von Nanotechnologie gehört? (%)706560545046403035JaNein20100DeutschlandEUQuelle: Eurobarometer 2010 73.142
Nanotechnologie in der öffentlichenMeinungNanotechnologie ist für Sie und Ihre Familie gesundheitlich unbedenklich.Deutschland264430JaNeinWeiß ich nichtEU2733400% 20% 40% 60% 80% 100%Quelle: Eurobarometer 2010 73.143
Nanotechnologie in der öffentlichenMeinungNanotechnologie ist förderlich für die nationale Wirtschaft.Deutschland571825JaNeinWeiß ich nichtEU4519360% 20% 40% 60% 80% 100%Quelle: Eurobarometer 2010 73.144
BUNDESINSTITUTFÜR RISIKOBEWERTUNGMethoden zur Ermittlung derRisikowahrnehmung amBeispiel der NanotechnologieDr. Mark LohmannFachgruppe für Risikoforschung, -wahrnehmung, -früherkennung und -folgenabschätzungAbteilung für Risikokommunikation45
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)Risikobewertung und Risikokommunikation‣ Stellungnahmen zu möglichen gesundheitlichen Risikenvon Lebensmitteln, Verbraucherprodukten und Chemikalien‣ Unterstützung durch 14 nationale Expertenkommissionen‣ Aufgabenbereiche:• Lebensmittelsicherheit• Produktsicherheit• Chemikaliensicherheit‣ Ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter‣ 14 nationale Referenzlaboratorien‣ Eigene ForschungBeteiligte Abteilungen für die Risikobewertung und -kommunikation in der Nanotechnologie:RisikokommunikationLebensmittelsicherheitChemikaliensicherheitSicherheit vonverbrauchernahenProduktenExperimentelleToxikologieSeite 246
Es gibt keine zuverlässigen Angaben über die Anzahl vonNanoprodukten auf dem MarktLand Zugang ProduktmeldungUrheberQuelleÖsterreichNiederlandenichtöffentlichnichtöffentlichhalböffentlich Nanotrust http://epub.oeaw.ac.at/ita/nanotrustdossiers/dossier009.pdfhalböffentlich RIVM ReportDekkers et al 2007Schweiz halböffentlich öffentlich Bundesamt fürGesundheit BAGGroßbritannien im Aufbau im Aufbau UK Food StandardAgency (FSA)http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/00510/05626/index.html?lang=de#topnanotechnology database22 March 2010http://interactive.bis.gov.uk/nanoFrankreichnichtöffentlichnicht bekannt AFSSA Nanotechnologies et nanoparticulesdans l’alimentation humaine etanimaleEuropa öffentlich halböffentlich BEUC, The EuropeanConsumers’Organisation;ANEC, The EuropeanConsumer Voice inStandardisationhttp://www.anec.org/attachments/ANEC-PT-2009-Nano-015.xlsEuropäischeIndustrieöffentlichnichtöffentlichNanoshopIndustrywww.nanoshop.comSeite 347
Gefahr ≠ RisikoGefahr („Hazard“):Ein biologisches, chemisches oder physikalisches Agens in einemLebensmittel oder Futtermittel, ... das eine Gesundheitsbeeinträchtigungverursachen kannRisiko:Eine Funktion der Wahrscheinlichkeit einer die Gesundheitbeeinträchtigenden Wirkung und der Schwere dieser Wirkung als Folgeder Realisierung einer GefahrRisiko = Toxizität x ExpositionSeite 448
Klassische RisikobewertungUnsicherheitenGefahren- / Hazardidentifizierung• Unterschiedliche Studienergebnisse• Extrapolation auf die menschliche ZielpopulationDosis-Wirkungsbeziehung• Extrapolation der im Experiment genutzten Dosisauf die für den Menschen relevante Dosis• ModellauswahlExpositionsabschätzung• Charakterisierung des Kontaminationsszenarios• Charakterisierung des Expositionsszenarios• Identifizierung der ZielpopulationRisikocharakterisierungSeite 549
Unsicherheiten bei der Bewertung von GesundheitsrisikenStudie zur Bewertung von Agenzien bezüglich ihrer HumankanzerogenitätInternational Agency for Research on Cancer (IARC) im Auftrag der WHO, 2008KlassifizierungAbsoluteZahlenAngabenin %Ist für den Menschen krebserregend 105 11Ist für den Menschen wahrscheinlich krebserregend 66 7Ist für den Menschen möglicherweise krebserregend 248 27Eine Klassifizierung ist nicht möglich 515 55Ist für den Menschen wahrscheinlich nicht krebserregend 1 0935 100Seite 650
Nanomaterial, Nanoobjekt, Nanostruktur, Nanopartikel,…-Es existiert keine eindeutige Begriffsdefinition-Derzeitige allgemeingültige Definition:Nanomaterialien sind Materialien, die entweder in ein, zwei oder drei äußeren Dimensionennanoskalig (näherungsweise 1 bis 100 nm) sind.Problematik:- Es existiert keine Standardisierung der Größenbestimmung (z.B. TransmissionsElektronenmikroskopie, Dynamische Lichtstreuung, Rasterkraftmikroskopie)- Die Verteilung der Partikelgröße in Nanomaterialien muss berücksichtigt werden (welcheDefinition soll verwendet werden: z.B. % Vol., % Gewicht?)- Berücksichtigung von Verbundsystemen von NanoobjektenEntscheidend für die Risikoforschung:‣ Physikalisch-Chemische Eigenschaften‣ Biologische Eigenschaften‣ OberflächenmodifikationRisikobewertung bis zu einer oberen Grenzgröße von 300nmSeite 751
Punktuelle Daten <strong>zum</strong> Gefährdungspotential liegen vorEine kritische Betrachtung von Studien ist essentiellBeispiel:‣ Schwere Schädigungen der Lunge bei Arbeiterinnen aus China, diegegenüber Nanopartikel enthaltendem Beschichtungsmaterial exponiertwaren‣ Bei nanoskaligem Titandioxid, Carbon-Nanotubes und bei amorphenKieselsäuren (Siliziumdioxid) gibt es Hinweise auf krebserzeugendeWirkung im Tier‣ Nanoskalige Silberpartikel führten bei längerer und wiederholterAufnahme zu Lungenfunktionsschäden bei RattenSeite 852
Risikobewertung für den Einsatz von NanomaterialienEine Aussage <strong>zum</strong> Risikopotential ist kaum möglich, da wesentliche Daten fehlen:‣ Kinetik‣ Subchronische und chronische Toxizität‣ ExpositionEs gilt das ALARA-Prinzip(As Low As ReasonablyAchievable)Seite 953
Nanosilber gehört nicht in Lebensmittel,Textilien und Kosmetika‣ Der Einsatz von Silber oder nanoskaligem Silber als Oberflächenbiozid wird vom BfRals verzichtbar angesehen‣ Lückenhafte Datenlage bezüglich der Resistenzausbreitung bei Anwendung vonSilberkationen und Nanosilbermaterialien‣ Im Hinblick auf nanoskaliges Silber oder nanoskalige Silberverbindungen wirdempfohlen, auf die Verwendung bis <strong>zum</strong> Vorliegen einer abschließendenSicherheitsbewertung zu verzichtenAnwendung in der Medizin:Für die Beurteilung der bakteriziden Wirkung ist die Konzentration an freigesetztem Silberüber die Zeit sowie die Freisetzung sehr kleiner Nano-Ag-Partikel (
FazitHinweis auf die unklare Terminologie „Nano“‣ Keine standardisierten Messmethoden‣ Definition ausschließlich über die Größe ist unzureichendHinweis auf die derzeit unzureichende Risikobewertung‣ Zu wenige, nur punktuelle Untersuchungen‣ Keine allgemeinen Aussagen möglich‣ Keine quantitative Charakterisierung von Expositionsszenarien möglich‣ Keine Langzeitstudien (Bioakkumulation)‣ Bedenken bei der Verwendung von NanosilberSeite 1155
Methoden zur Ermittlung vonInformationsbedürfnissen und InformationserfordernissenExperteLaieDelphi-BefragungVerbraucherkonferenzRepräsentativeBevölkerungsumfrageErmittlung von:‣ Kenntnisstand‣ Informationsbedürfnissen‣ InformationserfordernissenAnalyse vonMedien & InternetSeite 1256
Delphi-ExpertenbefragungEndberichtBedeutung von Bewertungselementen zur Charakterisierung vonRisiken von Nanoanwendungen im Bereich LebensmittelZwischenbericht1.DelphiRundeAnnahmen &Fragen1.Expertenrunde2.DelphiRunde2.ExpertenrundeAuszüge aus der BfR-Delphi-Studiezur Wahrnehmung der Nanotechnologie 2006Einschätzung der These:Die orale Aufnahme von Nanopartikeln produziert eine systemische Exposition desOrganismus (n=65 Antworten)Expertenaussagen z.B. über‣ Gesundheitsrisiken‣ Konsumentenakzeptanz‣ MarktrelevanzSeite 1357
Über welche Medienkanäle sollte kommuniziert werden?Bsp.: Bedeutung unterschiedlicher Medien für die bisherige Verbreitungvon Informationen zur NanotechnologieAuszüge aus der BfR-Repräsentativerhebung zur Wahrnehmung der Nanotechnologie 2007Seite 1458
Welche Rolle spielen Vertrauen & Glaubwürdigkeit?Bsp.: Vertrauenswürdigkeit von Personengruppen und Institutionen bei der Verbreitungvon Informationen zur NanotechnologieAuszüge aus der BfR-Repräsentativerhebung zur Wahrnehmung der Nanotechnologie 2007Seite 1559
Wesentliche Faktoren für die RisikowahrnehmungEigenschaften der ZielgruppeEin häufiger Gesellschaftstypzeigt eine:Selektive RisikowahrnehmungNutzen-Risiko-BilanzSoziale RisikoverstärkungWas zu einem bestimmten Zeitpunkt <strong>zum</strong> Risiko wird, hängtstark von der Medienberichterstattung ab, wenn es politischbearbeitet wird oder wenn professionelle Akteure sich derSache annehmen (z.B. Wissenschaftler, Ärzte)!Seite 1660
Einfluss der Medien auf die RisikowahrnehmungBfR-Bekanntheitsumfrage (2008), n = 1024, Angaben in %„Wo oder durch wen haben Sie von der Thematik gehört oder gelesen?“Gammelfleisch4,02,098,0Pestizide inObst undGemüse4,012,388,0Blei imSpielzeug4,03,593,7Cumarin inWeihnachtsgebäck4,72,693,8Medien soziales und berufliches Umfeld FachmedienSeite 1761
VerbraucherkonferenzVerfahren:o Akquise potentieller Teilnehmero Akquise von Sachverständigeno Vorbereitungswochenendeno ÖffentlicheAbschlusskonferenzo AbschlussberichtZiel:o Abbau von Informationsdefiziten unddifferenzierte Meinungsbildungo Erstellung eines Verbrauchervotumso Übergabe des Verbrauchervotums anEntscheidungsträger ausVerbraucherschutz, Politik,Wissenschaft und IndustrieMögliche Forderungen der Verbrauchergruppe:o Generelle Kennzeichnungspflichto Klare Definition der Begriffeo Entwicklung neuer Analyse- und Messverfahreno Festlegung von Standards und Grenzwerteno Studien zu Gesundheitsauswirkungen und proaktiveRisikobewertungo Mehr finanzielle Mittel für RisikoforschungEinsatz wird positiv / kritisch gesehen bei Anwendung XSeite 1862
Repräsentative Umfrage, Medien- und InternetanalyseErkenntnisse aus einer Bevölkerungsumfrage:‣ Wie verbreitet sind Informationen?‣ Wie wird das Verhältnis von Risiko und Nutzen wahrgenommen?‣ Welche Informationswege spielen für die Verbreitung des Wissens eine Rolle?‣ Wie wird die Bedeutung für den Standort Deutschland eingeschätzt?‣ Welche quantitative Bedeutung haben die unterschiedlichen Formen des Umgangsmit Informationen?Methode: z.B. CATI-Befragung mit einem Stichprobenumfang von n= ca. 1000Erkenntnisse aus einer Medien- & Internetanalyse‣ In welchem Umfang und mittels welcher Platzierung (Ressort) wird überLebensmittelverpackungen berichtet? Gibt es im Zeitverlauf Änderungen im Umfang der<strong>Bericht</strong>erstattung, und wie können sie erklärt werden?‣ Wie wird über Lebensmittelverpackungen berichtet? Welche Themen undInterpretationsmuster kommen in der <strong>Bericht</strong>erstattung vor? Gibt es einen Risiko Chancen-Diskurs?‣ In welchem Umfang sind politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche undwissenschaftliche Akteure in der <strong>Bericht</strong>erstattung präsent? Wie positionieren sich dieseAkteure?‣ Welche Argumente pro und contra werden genannt?‣ Gibt es Unterschiede zu der Risiko- und Nutzenwahrnehmung in internetgestütztenDiskussionen?Seite 1963
Zusammenfassung relevanter Faktoren für dieRisikokommunikationWissenschaftliche Faktoren‣ Ermittlung der gesundheitsschädlichen Eigenschaften‣ Bestimmung der Dosis-/Wirkungsbeziehung‣ Ermittlung der Exposition‣ Darstellung der UnsicherheitenPsychosoziale Faktoren‣ Ermittlung des Kenntnisstandes bei Experten und Laien‣ Ermittlung des Nutzen-Risiko Verhältnisses‣ <strong>Bericht</strong>erstattung in den Medien/Internet‣ Berücksichtigung verschiedener Gesellschaftstypen‣ Ermittlung der Informationsbedürfnisse und Informationserfordernisse‣ Bestimmung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit‣ Identifizierung geeigneter MultiplikatorenSeite 2064
Befragungsdaten als Basis für dieModell- und ZielgruppenbildungNutzung von Kausalmodellen zur Vorhersage von Verhalten(Bsp. Kaufentscheidung)NutzenVertrauenAffektiveBewertungKaufentscheidungR² = 0,61RisikoKaufentscheidung für Brot, hergestellt mittels Nanotechnologie;Modifiziert nach Siegrist et al; Public acceptance of nanotechnology foods and food packaging: The influence of affect and trust; Appetite 49 2007Die Risikowahrnehmung ist ein Faktor von mehreren, die die Kaufbereitschaftvorhersagt. Weitere wichtige Faktoren sind vor allem die Nutzenwahrnehmung,aber auch affektive Bewertungen und Vertrauen.Seite 2165
Produktregister für f NanomaterialienFalk SchulzeÖko-InstitutNano-Dialog<strong>Baden</strong>-WürttembergExpertenworkshopStuttgart, 9. Dezember 2010www.oeko.de661
Agenda• Hintergrund• Bereits bestehende Registrierungspflichten• Aktuelle Prozesse• Ziele eines Produktregisters• Wesentliche Bestandteile eines Produktregisters• Fazit• Bundesländer: Regulierungsoptionen?www.oeko.de672
Hintergrund• Bei der gesellschaftlichen Debatte um Nanomaterialien (NM) stelltsich im Hinblick auf Nutzen und Risiken die Frage, welche Produkte(v.a. verbrauchernahe Produkte) NM enthalten.• Häufige Unkenntnis von Behörden/VerbraucherInnen über NM inHalbfertig- und Endprodukten; zusätzlich werden Produkte mit „Nano“beworben, die keine NM enthalten.• Die Verwendung von NM – wie auch die Verwendung von zahlreichenanderen Stoffen – in einem Endprodukt bedarf nicht in jedem Falleiner gesonderten Kennzeichnung oder Information.• Keine verbindlichen Regelungen zu Definitionen und Meldepflichten(Ausnahme: EU-KosmetikVO).www.oeko.de• Einige Rechtsvorschriften erfordern die Zulassung eines Stoffes fürdas Inverkehrbringen (so z.B. bei Verpackungsmaterialien); es gibtaber keine eigene Marktzulassung für das Endprodukt.683
Bereits bestehendeRegistrierungspflichtenwww.oeko.de• Registrierungspflicht nach REACH:- Nur eingeschränkt (Tonnenschwelle):- Registrierung unterhalb einer Tonne/Jahr nicht vorgesehen- bis 2013/2018 keine systematische Risikoermittlung vonnanoskaligen „phase-in-Stoffen“ im Bereich zwischen 1 t und100 t (marktrelevante „phase-in-Stoffe“ aber in der Regel > 100t)• Registrierungspflicht nach EU-KosmetikVO:- Umfangreiche Kennzeichnungs- und Meldepflicht- Katalogisierung von NM und Veröffentlichung• Registrierungspflicht nach Novel-Food-VO:- Vermittlungsverfahren: Europäisches Parlament fürKennzeichnungspflicht694
Welche Regulierungsprozesselaufen aktuell?• EU-Ebene:- Debatte zu Register für Nanomaterialien und/ oderNanoprodukte- anstehende Revision von REACH• National:- Gesetzesentwürfe und -initiativen zur Regelung einesNanoproduktregisters z.B. in Frankreich, UK und Schweden(Kanada)www.oeko.de705
Ziele eines Nanoproduktregisters1. Monitoring: Eine staatliche Stelle soll Hersteller und Inverkehrbringerund die von ihnen hergestellten oder in Deutschland in Verkehrgebrachten Nanomaterialien selbst sowie in Gemischen undHalbfertig- und Endprodukten eindeutig identifizieren können.2. Gefahrenvorsorge: Die Zulassungsverfahren für Materialien oderProdukte beinhalten in der Regel keine nano-spezifischenPrüfmethoden oder Grenzwerte; ein Nanoproduktregister würdeaufzeigen, welche Ergänzungen bei den Verfahren notwendig sind.www.oeko.de3. Gefahrenabwehr: Bei Hinweisen auf mögliche Gefährdungen derSchutzgüter durch ein Nanomaterial oder Nanoprodukt kann diezuständige Behörde frühzeitig den Hersteller oder denInverkehrbringer darüber informieren und geeignete Maßnahmenergreifen.716
Wesentliche Bestandteile einesNanoproduktregisterswww.oeko.de• Anwendungsbereich- Persönlich: Hersteller, Inverkehrbringer, Importeur- Sachlich: Herstellung und erstmaliges Inverkehrbringen vonNanomaterialien sowie der sie enthaltenden Gemische; Produktion,erstmaliges Inverkehrbringen oder der Import von Halbfertig- undEndprodukten, die Nanomaterialien enthalten.- Ausnahme: Regelungsbereiche mit vergleichbaren Meldepflichten• Definitionen- Anschlussfähigkeit der Definition an die wissenschaftliche Diskussion- Definition <strong>zum</strong> NP soll möglichst breite Erzeugnispalette abdecken- Trotzdem den Fokus auf den „Kern“ der Nanomaterialien richten- Kosten/Aufwand der Firmen für die Meldung muss angemessen sein• Meldeverfahren- Gestuftes Meldeverfahren („entlang der Herstellungskette“)727
Fazitwww.oeko.de• Ein Register für Nanoprodukte ist rechtlich realisierbar, schafftTransparenz und gewährleistet Risikovorsorge.• Die Notwendigkeit hierfür erschießt sich v.a. aus dem Fehlenexpliziter Informations- oder Kennzeichnungspflichten.• Vorschlag eines gestuften Verfahrens zur Registrierung vonNanomaterialien vom Ausgangsmaterial bis <strong>zum</strong> Endprodukt.• Eine staatliche Stelle wird in die Lage versetzt, sowohl dieHersteller als auch die in Verkehr gebrachten Produkte und diedarin enthaltenen Nanomaterialien eindeutig zu identifizieren.• Mögliche Belastungen für die Umwelt oder Menschen könnenbesser abgeschätzt und die Hersteller frühzeitig über auftretendeProbleme mit den Produkten informiert werden.738
Bundesländer:Regulierungsoptionen?• These: (Regulierungs-)Relevanz auf Landesebene gering- Derzeitige Prozesse (s.o.) fokussieren auf EU-Ebene• Gesetzgebungskompetenz für Einführung einesNanoproduktregisters läge beim Bund- Argument: Wahrung der Rechtseinheit• Was bleibt den Bundesländern?- EU-Ebene: Lobbyarbeit über Landesvertretung in Brüssel,Stellungnahmerecht im Ausschuss der Regionenwww.oeko.de- Bundesebene (Bundesrat): Initiativrecht des Bundesrats(Gesetzentwürfe), Einspruchs-/Zustimmungsrechte- Landesebene: mögliche Verwaltungszuständigkeit749
Vielen Dank für f r Ihre Aufmerksamkeit!www.oeko.de7510
Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop09. Dezember 2010, Stuttgart„Kennzeichnung von Nanomaterialienim Lebensmittelbereich“Dr. Sieglinde StähleBund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. , BerlinBLL e.V.= Dach- und Spitzenverband der deutschen Lebensmittelkette= 90 Branchenverbände und ca. 300 Lebensmittelunternehmen= Sprecher und Informationsvermittler der Branche76
Positionen der Lebensmittelwirtschaft zurNanotechnologie• Nanotechnologie ist für Lebensmittelwirtschaft eine in die Zukunftgerichtete Technologie• innovative „Nano“-Lebensmittel (z.B. fließfähiges Ketchup, lila Milch,Pizza mit Aromafreisetzung, Schokoriegel mit Titandioxidüberzügen…)gibt es nicht im europäischen Markt• aktuelle Anwendung: in zugelassenem Umfang SiO 2 als Rieselhilfsmittel• gravierende Unterschiede hinsichtlich der realen Marktbedeutung(Exposition) und der öffentlichen Wahrnehmung• lebensmittelrechtliche Rahmenbedingungen gewährleistenLebensmittelsicherheit• rechtliche Grundlagen zur Produktkenntlichmachung undVerbraucherinformation sind gegeben• Vertrauensbildung durch Kommunikation und verlässliche Verfahren„Sachstands- und Positionspapier des BLL“[http://www.bll.de/themen/nanotechnologie/]2Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201077
„Nanomaterialien“ als Lebensmittelzutaten ?• „nano“ ist lebensmittelimmanent- es gibt natürliche Nanostrukturen (z.B. Proteine)- bei traditionellen Lebensmittelherstellungsverfahren könnenNanostrukturen oder Nanopartikel entstehenz.B.- Vermahlungsprozesse (z.B. Partikel in Mehlen)- Maccerationsprozesse (z.B. Trubmicellen ca. 0,5 µm)- Emulgationsverfahren (z.B. Mayonnaise)- Homogenisierung (z.B. Milch-Fettkügelchen 0,1 – 1 µm)• etablierte anerkannte Stoffe/Zutaten sind (definitionsgemäß) alsnanostrukturiert einzustufen (z.B. SiO 2 ); Freisetzung von Nanopartikelnin geringem Umfang möglich• es gibt Technologien zur Erzielung funktioneller Zutatenim Nano-Maßstab aus bekannten Substraten(Mizellen, Liposomen Solubilisate, Verkapselungen) Nanotechnologie3Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201078
Problem: fehlende, verbindliche Definition „Nanomaterial“- Definition ISO/TS 27687 (August 2008)- granuläre Nanopartikel (< 100 nm)- nanostrukturierte Materialien- Definition EU-Kosmetik-Verordnung- unlösliche, synthetische Partikel- Definitionsvorschlag EU-Novel Food Verordnung- Nanoeigenschaften von technisch hergestelltem Material …derzeitiger Konsultationsprozess auf EU-Ebene- Ziel: allgemeine verbindliche Definition für Regulierungen- EU-Vorschlag: rein geometrische / numerische Beschreibung von Nanomaterial (?)Forderungen der Lebensmittelwirtschaft!Kriterien: - kongruent zu internationalen Konventionen(Dimension 1-100 nm gem. ISO/ TS 27687)- wissenschaftlich fundiert, sachlich und abgrenzend- Löslichkeitseigenschaften (unlöslich)- Genese (synthetisch, technisch hergestellt)- spezifische Eigenschaften (verdaulich)konkrete Beschreibung der „ENM“ (engineered nanomaterials)4rechtssichere Anwendung der einschlägigen (Kenntlichmachungs-) RegelungenNano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“ Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201079
Potentielle Anwendungen von Nanomaterialien (ENM)im Lebensmittelbereich• bei Lebensmittelbedarfsgegenständenzur Lebensmittelberührung, nicht <strong>zum</strong> Verzehr bestimmt(„nano outside“)-Prozessmaterialien, Sensoren-Packstoffe• als Lebensmittel<strong>zum</strong> Verzehr bestimmt („nano inside“)- (neuartige) funktionelle Lebensmittelzutat ) = „Novel Food“- Lebensmittelzusatzstoffjeweils zulassungspflichtige Anwendungen !5Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201080
Regelungsrahmen im Lebensmittelbereich: „Nano Risiko“ !?!• Lebensmittelsicherheit ist unabdingbare Marktvoraussetzunggesetzlich festgelegte Voraussetzungen für das Inverkehrbringenvon Lebensmitteln und LebensmittelbedarfsgegenständenGrundsatz:Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeitliegt in der Verantwortung des Lebensmittelherstellers / Inverkehrbringers[LFGB und VO (EU) Nr. 178/2002]Anwendung des Vorsorgeprinzips!bei Innovationen wie u. a. Nanomaterialien gilt: Verbote mit Erlaubnisvorbehaltspezifische Regelungen:- Zulassung von Lebensmittelzusatzstoffen [VO (EU) Nr. 1331/2008]- Zulassung nach Neuartiger Lebensmittel (Novel Food) [EU-Novel-Food–VO (E)]- Zulassung von Nano-Komponenten für Bedarfsgegenstände [EU-Kunststoff-Regelungen PIM]keine eigenverantwortliche Risikobewertung durch Inverkehrbringereinzelfallbezogene, transparente behördliche Genehmigungsverfahren nachSicherheitsbewertungVeröffentlichung der Zulassungen unter Festlegung von Anwendungsform,Verwendungsbedingungen und besonderer Kenntlichmachung (Verkehrsbezeichnung)6Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201081
Lebensmittelrechtliche RahmenbedingungenAnwendung des geltenden bzw. zukünftigen Lebensmittelrechts aufNanomaterialien gewährleistet / führt zuumfassende Sicherheitsbewertungen alsMarktvoraussetzung; und Transparenz„faktisches“ Moratorium durch Zulassungspflichtbei neuartigen Lebensmitteln und LebensmittelzusatzstoffenTransparenz, behördliche Prüfungen und Veröffentlichung beiZulassungsverfahreneinzelfallbezogenen Lösungen auch zur Verbraucherinformation /Produktkenntlichmachung[pauschale Kenntlichmachungsverpflichtung von Nanomaterial alsLebensmittelzutaten]7Voraussetzung: Klare Definition / Sprachregelung ![siehe auch: Regulierungsbericht der NanoKommission (Februar 2011)]Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“ Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201082
Chancen und Risiken• Lebensmittelwirtschaft unterstützt- (Weiter-) Entwicklung von Instrumentarien zur Sicherheitsbewertung- Prinzipien <strong>zum</strong> verantwortungsvollen Umgang (CoP)• Lebensmittelwirtschaft fordert- sachliche Kommunikation und produktbezogene Verbraucherinformation- Vertrauensbildung und Verantwortungsübernahme bezüglich Zulassung- reelle (Markt-)Chancen für Innovationen- souveräne Verbraucherentscheidungen• Lebensmittelwirtschaft kritisiert Forderungen- nach pauschaler, diskriminierender Kenntlichmachung sicherer Produkte(keine „Warnhinweise“ !)- nach weiteren lebensmittelbezogenen Regelungen- nach systemwidriger, unverhältnismäßiger Produktregistrierung8Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201083
Vielen Dank9Nano-Dialog <strong>Baden</strong>-Württemberg - Expertenworkshop“Dr. Sieglinde Stähle, BLL Berlin09.12.201084
PD Dr. Gaby-Fleur Böl, Bundesinstitut für Risikobewertung, BerlinVitaGaby-Fleur Böl leitet seit 2006 die interdisziplinär zusammengesetzte Abteilung Risikokommunikationam Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin und lehrt als Privatdozentinan der Universität Potsdam. Sie studierte Biochemie in Hannover, promovierte an der dortigenMedizinischen Hochschule <strong>zum</strong> Thema Zelluläre Signaltransduktion und habilitierte über denZusammenhang von Ernährung und Krebs am Deutschen Institut für Ernährungsforschung inPotsdam-Rehbrücke. Im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist die AbteilungRisikokommunikation des BfR unter anderem zuständig für den partizipativen Dialog mitbeteiligten Interessengruppen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, öffentlichenInstitutionen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und der Verbraucherschaft.Schwerpunkte der Risikokommunikation des BfR liegen im Bereich der Risikowahrnehmung, demUmgang mit gefühlten Risiken und wissenschaftlicher Unsicherheit sowie der Evaluierung vonRisikokommunikationsmaßnahmen beispielsweise im Bereich neuer Technologien wie derNanotechnologie oder der Abgrenzung von Nahrungsergänzungsmitteln zu Arzneimitteln.KontaktBundesinstitut für RisikobewertungThielallee 88-9214195 BerlinFon: ++49-30-18412-3229Fax: ++49-30-18412-1243Website: http://www.bfr.bund.deE-mail: gaby-fleur.boel@bfr.bund.de85
Dr. Antje Grobe M.A., Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen, SchweizUniversität St. Gallen, SchweizUniversität Stuttgart, DeutschlandAntje Grobe ist Mitglied der Geschäftsführung und seit über 15 Jahren für die Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen tätig. Als Konfliktmanagerin und Dialogmoderatorin führte sie StakeholderundBürgerdialoge <strong>zum</strong> Energie-Mix, zur Gentechnologie, Stammzellenforschung,Hirnforschung und <strong>zum</strong> Klimawandel durch. Seit 2004 leitet sie den BereichNanotechnologien und begleitete eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Arbeitssicherheit,Verbraucherschutz und Umweltschutz in der Schweiz, in Deutschland und auf EU-Ebene.Antje Grobe lehrt an der Universität St. Gallen und der Universität Stuttgart Dialog-Management und leitet Forschungsprojekte im Bereich Risikobewertung undRisikowahrnehmung. Hierunter war 2006 das Deutsche Expertendelphi zur Nanotechnologieim Auftrag des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) in Berlin, 2007-2008 die Studie„Risk governance of nanotechnology applications in food and cosmetics“ im Auftrag desInternational Risk Governance Councils (IRGC), Genf, 2008 die Studie „Nanotechnologien:Was Verbraucher wissen wollen“ im Auftrag des Verbraucherinitiative Bundesverbandes e.V.sowie die Studie „NanoMedizin“ im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dr. Antje Grobebegleitet seit 2006 die Arbeit der NanoKommission der Deutschen Bundesregierung.ContactDr. Antje GrobeMitglied der GeschäftsleitungStiftung Risiko-DialogZürcherstrasse 12CH - 8400 WinterthurTel: ++41 522 62 76 11Fax: ++41 522 62 76 29www.risiko-dialog.chOffice Dr. Antje GrobeLindenstraße 10DE - 70563 StuttgartTel: ++49 (0)711 78 26 25 40Fax: ++49 (0)711 78 26 25 34Mobil: ++49 (0)171 45 18 18 6Mail: antje.grobe@risiko-dialog.ch86
Kurzlebenslauf von Thomas HuttenlocherThomas Huttenlocher, Jahrgang 1964, ist im baden-württembergischen Ministerium fürLändlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz Experte für verbraucherpolitischeFragen der Themenfelder Energie, Mobilität und neue Technologien. Er befasst sich seiteinigen Jahren unter anderem auch mit den verbraucherpolitischen Aspekten derNanotechnologie.Er vertritt die verbraucherpolitischen Interessen <strong>Baden</strong>-Württembergs in zahlreichen Bund-Länder-Arbeitsgruppen. Seit 2008 ist er Mitglied des "London-Forums", einemBeratergremium der Europäischen Kommission.Bereits seit 2000 ist er in verschiedenen Funktionen im Ministerium, davor war er alsGeschäftsführer zweier staatlicher Forstämter innerhalb der Landesforstverwaltung <strong>Baden</strong>-Württemberg tätig.Nach dem Abitur studierte er zunächst Elektrotechnik an der Technischen UniversitätMünchen und der Universität Stuttgart, anschließend Forstwirtschaft an der HochschuleRottenburg.87
Dr. Anke Jesse leitet das Referat Nanotechnologien im BMUVon der Jurastudentin zur Ministerialrätin mit dem Aufgabengebiet Nanotechnologien? „Ichwollte nie Richterin oder Anwältin werden, sondern an Schnittstellen arbeiten“, kommentiertDr. Jesse ihre Karriere. Nach zehn Jahren Politikberatung und –management führte sie ihrWeg 2005 ins Bundesumweltministerium nach Berlin, wo sie im Dezember 2008 Leiterin desneu geschaffenen Referats Nanotechnologien wurde. „Ich bin Teamplayerin“, sagt die 50-jährige Juristin, „nur so kann ich der Komplexität dieses Querschnittthemas gerecht werden.“Dabei schätzt sie an ihrer Arbeit, dass sie immer wieder über den Tellerrand hinaus schauenmuss: „Das habe ich mein ganzes Leben lang gerne gemacht“. Dr. Jesse hat den Vorsitz derdeutschen Delegation bei der OECD Arbeitsgruppe zu synthetischen Nanomaterialien(WPMN). Auf der Tagesordnung steht dort <strong>zum</strong> Beispiel ein aufwändiges Testprogramm, beidem ausgewählte Nanomaterialien in Arbeitsteilung mit den anderen beteiligten Staatenexemplarisch auf ihre Eigenschaften, wie <strong>zum</strong> Beispiel das Umweltverhalten, untersuchtwerden. Um die Risikovorsorge zu verbessern, plädiert Dr. Jesse für vermehrte LangzeitundLifecycle-Studien. Auch eine verstärkte Regulierung hält sie für angebracht: „Ichwünsche mir die Rückverfolgbarkeit von Nanomaterialien in der gesamten Lebenskette, dieREACH-Verordnung leistet das bisher aus meiner Sicht nicht ausreichend“.88
CV Martin KleeneMartin Kleene, Jahrgang 1959, ist Unternehmensberater und führt zusammen mit GregorWöltje das auf Nachhaltigkeits- und Kommunikationsstrategien spezialisierteBeratungsunternehmen KleeneWöltje (www.kleenewoeltje.de). Martin Kleene lebt inMünchen, wo er auch Lehrbeauftragter am Institut für Kommunikationswissenschaft derLudwig-Maximilians-Universität ist. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Utopia Stiftung sowieAufsichtsrat der Utopia AG und hat Utopia, Deutschlands größte Internetplattform fürnachhaltigen Konsum und nachhaltigen Lebensstil, 2007 mitgegründet (www.utopia.de).Nach einem Studium der Soziologie und Wirtschaftsanthropologie in Bielefeld und an derSorbonne in Paris startete er bei Caritas international ins Berufsleben und hat dort von 1986bis 1994 die Kommunikationsabteilung aufgebaut und geleitet. 1995 wechselte er <strong>zum</strong>Beratungsunternehmen Kohtes Klewes (heute: Ketchum Pleon), war als geschäftsführenderGesellschafter tätig und unter anderem auf Kommunikationsstrategien undUnternehmenskommunikation spezialisiert, was er ab 2002 nach seinem Ausscheiden auchbei Kleene Communications Consulting fortsetzte. Im Rahmen seiner Beratungstätigkeitenhat er sich intensiv mit der Kommunikation gesellschaftspolitisch relevanter Themenbeschäftigt. Die Erfahrungen im NGO-Bereich und sein langjähriges Know-how als Beraternutzt er inzwischen ausschließlich für nachhaltige Projekte, unter anderem im Rahmen der2009 gegründeten Unternehmensberatung KleeneWöltje. Dabei berücksichtigt er besondersdie Chancen und Herausforderungen, die mit dem Internet und „Web 2.0“ zusammenhängen.Publikationen:Martin Kleene / Gregor Wöltje, „Grün Schlau Sexy. Wie Nachhaltigkeit unwiderstehlich wirdund warum kein Weg daran vorbei führt“, Hamburg 2009, tellusMartin Kleene, „Die Revolution der Nachhaltigkeitskommunikation“, in: Forum NachhaltigWirtschaften, 03-2010, S. 26-2789
Dezember 2010Dr. Carolin KranzBASF SECommunications & Government RelationsZOA/WU – C10067056 LudwigshafenGermanyE-mail: carolin.kranz@basf.comCarolin Kranz ist verantwortlich für die politische Kommunikation des Themas Nanotechnologiein der Abteilung Communications & Government Relations der BASF SE.Sie ist Mitglied im unternehmensinternen Nano Core Team, dem verantwortlichenGremium für das gruppenweite Umwelt- und Sicherheitsmanagement sowie für dieKommunikation des Themas.Nach einem Grundstudium der Chemie an der Universität Stuttgart, schloss sie 1990ihr Studium mit dem diplôme d’ingénieur an der Ecole Européenne des HautesEtudes des Industries Chimiques de Strasbourg in Frankreich ab. 1994 promoviertesie an der Universität des Saarlandes im Fachbereich Organische Chemie über photochromeMaterialien.Danach startete sie ihre berufliche Laufbahn im „Farbenlabor“ der BASF in Ludwigshafen.1998 wechselte sie in die Unternehmenskommunikation mit SchwerpunktIssues Management. 2001 setzte sie ihre Tätigkeit im neu gegründeten SustainabilityCenter der BASF fort, bevor sie 2006 ihre Tätigkeit im Bereich der politischen Kommunikationund Unternehmenskommunikation aufnahm.Carolin Kranz vertritt extern die politischen Interessen der BASF und koordiniert dieKommunikation der BASF <strong>zum</strong> Thema Nanotechnologie. Sie ist in den Nanotechnologie-Gremiendes Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) und des europäischenChemieverbands Cefic vertreten. Seit Beginn des NanoDialogs der Bundesregierung2006 arbeitet sie in einer Themengruppe mit. Sie leitet das BASF DialogForum Nano,in dem BASF seit 2008 den Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu aktuellenpolitischen und gesellschaftlichen Themen sucht.90
Dr. Mark LohmannBundesinstitut für Risikobewertung, Fachgruppenleitung Risikoforschung, -wahrnehmung,-früherkennung und –folgenabschätzung, Abteilung Risikokommunikation, BerlinHr. Lohmann studierte und promovierte im Fach Biochemie an der Goethe-Universität inFrankfurt/Main. Anschließend war er von 2001-2006 als Projektleiter am Bioinformatikzentrumin Köln (Cologne University Bioinformatics Center, CUBIC) für die Koordination von Forschungs-und Lehrtätigkeiten im Bereich der computergestützten Simulation von metabolischenNetzwerken zuständig. Es folgte eine vierjährige Tätigkeit als Projektmanager für Forschungsvorhabenin der Bioverfahrenstechnik und Leiter des Labors für Lebensmittelsensorikam Technologie Transfer Zentrum in Bremerhaven (ttz Bremerhaven). Hr. Lohmannist seit August 2010 Leiter der Fachgruppe für Risikoforschung, -wahrnehmung,-früherkennung und –folgenabschätzung am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin.Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist die Bewertung und Entwicklung von Methoden füreine zielgruppenspezifische, partizipative Risikokommunikation im Hinblick auf mögliche gesundheitlicheRisiken von Lebensmitteln, Produkten oder Chemikalien.KontaktBundesinstitut für RisikobewertungFachgruppenleitung Risikoforschung, -wahrnehmung, -früherkennung und–folgenabschätzung Abteilung RisikokommunikationThielallee 88-9214195 Berlin, GermanyTel. +49 30 18412-3931Fax +49 30 18412-1243Website: www.bfr.bund.de91
Falk Schulze, Öko-Institut e.V., DarmstadtFalk Schulze LL.M. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Umweltrecht undGovernance im Büro Darmstadt des Öko-Institut e.V. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt inden Bereichen des europäischen und nationalen Umweltrechts. Ein wesentlicher Fokusseiner Tätigkeit ist auf querschnittsorientierte rechtliche Fragestellungen des Klimaschutzesund seiner verschiedenen Instrumente gerichtet. Dabei nimmt die Analyse und Entwicklungvon Instrumenten zur Anwendbarkeit von Entwicklungstechnologien wie CCS (CarbonCapture and Storage) und Nanotechnologien einen wichtigen Raum ein.Falk Schulze studierte von 1993 bis 1999 Rechtswissenschaften an den UniversitätenDresden, Valladolid/Spanien und Bonn. Nach dem Studium erwarb er im ZusatzstudiengangUmweltrecht der Universität Lüneburg den Titel des „Master in Environmental Law“.“Ausbildung & Berufserfahrung• Seit 2004: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut, Bereich Umweltrecht &Governance• 2001-2003: Referendariat, Kammergericht Berlin; Abschluss Zweites Staatsexamen• 2000-2001: Freier Mitarbeiter, Anwaltskanzlei Scheier, Köln• 1999-2000: Masterstudiengang Umweltrecht, Universität Lüneburg; AbschlussMagister Legum• 1993-1999: Studium Rechtswissenschaft, Dresden, Valladolid (Spanien), Bonn;Abschluss Erstes Staatsexamen92
KurzvitaDr. Sieglinde StähleWissenschaftliche LeitungBund für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkunde e.V. (BLL)Jahrgang 1959Studium der Lebensmitteltechnologie,Universität Hohenheim1984 Abschluss Diplom-Lebensmittelingenieurin1989Tätigkeit in der Fruchsaft-Industrie, bereichProduktentwicklungPromotion in der Obst- und Gemüsetechnologieseit 1990Zuständigkeitenvertritt den BLL inverschiedenen Gremien derStandardisierung, u. a.Bund für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkunde e. V. (BLL),Wissenschaftliche LeitungBereiche Lebensmittelhygiene,Lebensmittelbedarfsgegenständeund insoweit auch für aktuelle Themen wieNanotechnologie- NanoDialog der Bundesregierung- DIN Deutsches Institut für Normung e. V.- Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission- Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie- BfR-Kommission für Bedarfsgegenstände93