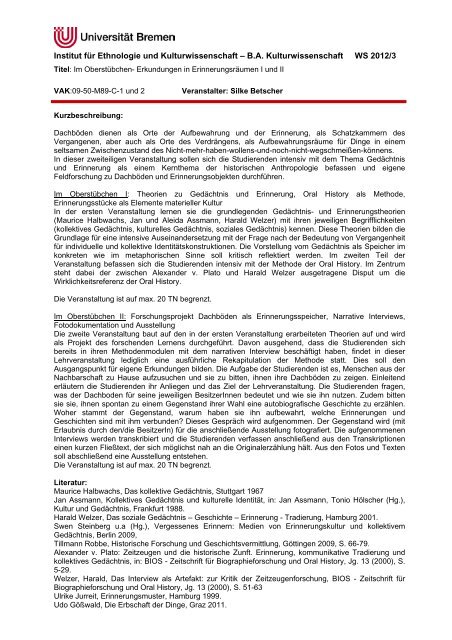BA Kulturwissenschaft WS 2012/3 - Institut für Ethnologie und ...
BA Kulturwissenschaft WS 2012/3 - Institut für Ethnologie und ...
BA Kulturwissenschaft WS 2012/3 - Institut für Ethnologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Ethnologie</strong> <strong>und</strong> <strong>Kulturwissenschaft</strong> – B.A. <strong>Kulturwissenschaft</strong> <strong>WS</strong> <strong>2012</strong>/3<br />
Titel: Im Oberstübchen- Erk<strong>und</strong>ungen in Erinnerungsräumen I <strong>und</strong> II<br />
VAK:09-50-M89-C-1 <strong>und</strong> 2 Veranstalter: Silke Betscher<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Dachböden dienen als Orte der Aufbewahrung <strong>und</strong> der Erinnerung, als Schatzkammern des<br />
Vergangenen, aber auch als Orte des Verdrängens, als Aufbewahrungsräume <strong>für</strong> Dinge in einem<br />
seltsamen Zwischenzustand des Nicht-mehr-haben-wollens-<strong>und</strong>-noch-nicht-wegschmeißen-könnens.<br />
In dieser zweiteiligen Veranstaltung sollen sich die Studierenden intensiv mit dem Thema Gedächtnis<br />
<strong>und</strong> Erinnerung als einem Kernthema der historischen Anthropologie befassen <strong>und</strong> eigene<br />
Feldforschung zu Dachböden <strong>und</strong> Erinnerungsobjekten durchführen.<br />
Im Oberstübchen I: Theorien zu Gedächtnis <strong>und</strong> Erinnerung, Oral History als Methode,<br />
Erinnerungsstücke als Elemente materieller Kultur<br />
In der ersten Veranstaltung lernen sie die gr<strong>und</strong>legenden Gedächtnis- <strong>und</strong> Erinnerungstheorien<br />
(Maurice Halbwachs, Jan <strong>und</strong> Aleida Assmann, Harald Welzer) mit ihren jeweiligen Begrifflichkeiten<br />
(kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, soziales Gedächtnis) kennen. Diese Theorien bilden die<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage nach der Bedeutung von Vergangenheit<br />
<strong>für</strong> individuelle <strong>und</strong> kollektive Identitätskonstruktionen. Die Vorstellung vom Gedächtnis als Speicher im<br />
konkreten wie im metaphorischen Sinne soll kritisch reflektiert werden. Im zweiten Teil der<br />
Veranstaltung befassen sich die Studierenden intensiv mit der Methode der Oral History. Im Zentrum<br />
steht dabei der zwischen Alexander v. Plato <strong>und</strong> Harald Welzer ausgetragene Disput um die<br />
Wirklichkeitsreferenz der Oral History.<br />
Die Veranstaltung ist auf max. 20 TN begrenzt.<br />
Im Oberstübchen II: Forschungsprojekt Dachböden als Erinnerungsspeicher, Narrative Interviews,<br />
Fotodokumentation <strong>und</strong> Ausstellung<br />
Die zweite Veranstaltung baut auf den in der ersten Veranstaltung erarbeiteten Theorien auf <strong>und</strong> wird<br />
als Projekt des forschenden Lernens durchgeführt. Davon ausgehend, dass die Studierenden sich<br />
bereits in ihren Methodenmodulen mit dem narrativen Interview beschäftigt haben, findet in dieser<br />
Lehrveranstaltung lediglich eine ausführliche Rekapitulation der Methode statt. Dies soll den<br />
Ausgangspunkt <strong>für</strong> eigene Erk<strong>und</strong>ungen bilden. Die Aufgabe der Studierenden ist es, Menschen aus der<br />
Nachbarschaft zu Hause aufzusuchen <strong>und</strong> sie zu bitten, ihnen ihre Dachböden zu zeigen. Einleitend<br />
erläutern die Studierenden ihr Anliegen <strong>und</strong> das Ziel der Lehrveranstaltung. Die Studierenden fragen,<br />
was der Dachboden <strong>für</strong> seine jeweiligen BesitzerInnen bedeutet <strong>und</strong> wie sie ihn nutzen. Zudem bitten<br />
sie sie, ihnen spontan zu einem Gegenstand ihrer Wahl eine autobiografische Geschichte zu erzählen.<br />
Woher stammt der Gegenstand, warum haben sie ihn aufbewahrt, welche Erinnerungen <strong>und</strong><br />
Geschichten sind mit ihm verb<strong>und</strong>en? Dieses Gespräch wird aufgenommen. Der Gegenstand wird (mit<br />
Erlaubnis durch den/die BesitzerIn) <strong>für</strong> die anschließende Ausstellung fotografiert. Die aufgenommenen<br />
Interviews werden transkribiert <strong>und</strong> die Studierenden verfassen anschließend aus den Transkriptionen<br />
einen kurzen Fließtext, der sich möglichst nah an die Originalerzählung hält. Aus den Fotos <strong>und</strong> Texten<br />
soll abschließend eine Ausstellung entstehen.<br />
Die Veranstaltung ist auf max. 20 TN begrenzt.<br />
Literatur:<br />
Maurice Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis, Stuttgart 1967<br />
Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis <strong>und</strong> kulturelle Identität, in: Jan Assmann, Tonio Hölscher (Hg.),<br />
Kultur <strong>und</strong> Gedächtnis, Frankfurt 1988.<br />
Harald Welzer, Das soziale Gedächtnis – Geschichte – Erinnerung - Tradierung, Hamburg 2001.<br />
Swen Steinberg u.a (Hg.), Vergessenes Erinnern: Medien von Erinnerungskultur <strong>und</strong> kollektivem<br />
Gedächtnis, Berlin 2009,<br />
Tillmann Robbe, Historische Forschung <strong>und</strong> Geschichtsvermittlung, Göttingen 2009, S. 66-79.<br />
Alexander v. Plato: Zeitzeugen <strong>und</strong> die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung <strong>und</strong><br />
kollektives Gedächtnis, in: BIOS - Zeitschrift <strong>für</strong> Biographieforschung <strong>und</strong> Oral History, Jg. 13 (2000), S.<br />
5-29.<br />
Welzer, Harald, Das Interview als Artefakt: zur Kritik der Zeitzeugenforschung, BIOS - Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Biographieforschung <strong>und</strong> Oral History, Jg. 13 (2000), S. 51-63<br />
Ulrike Jurreit, Erinnerungsmuster, Hamburg 1999.<br />
Udo Gößwald, Die Erbschaft der Dinge, Graz 2011.
Hilke Doering: Dingkarrieren. Sammelstück, Lagerstück, Werkstück, Ausstellungsobjekt. Zur<br />
Konstruktion musealer Wirklichkeit, in: Beier, Rosemarie: Geschichtskultur in der zweiten Moderne,<br />
Frankfurt 2000.<br />
Dies. <strong>und</strong> Stefan Hirschauer: Die Biographie der Dinge. Eine Ethnographie musealer Repräsentation, in<br />
K. Amann, S. Hirschauer: Die Befremdung der eigenen Kultur, Ffm 1997.