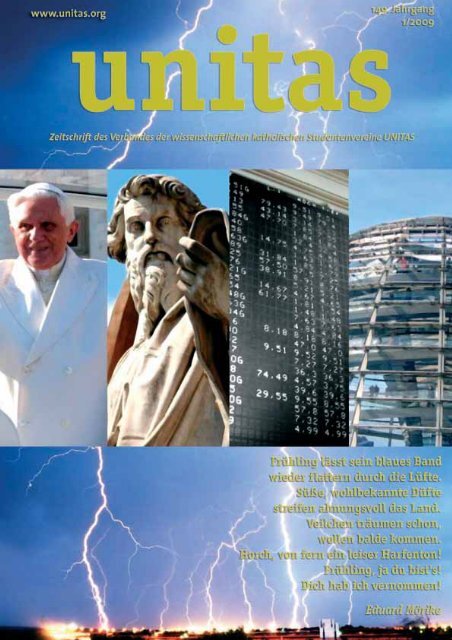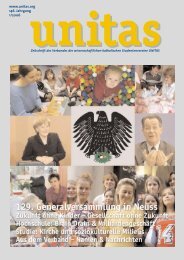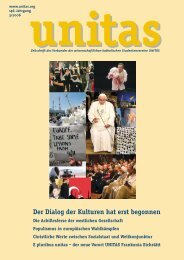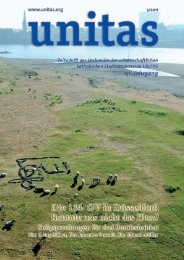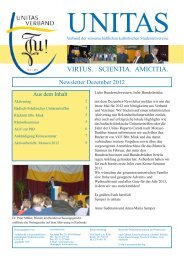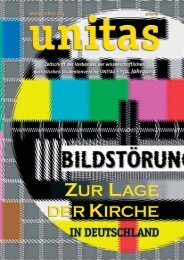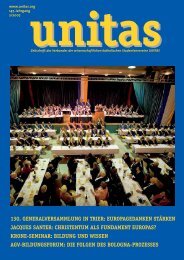(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas
(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas
(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
INHALT Dokumentiert: Der Papstbrief an die Bischöfe > 03<br />
Herausgeber und Verlag<br />
Verband der wissenschaftlichen katholischen <strong>Studenten</strong>vereine e.V.,<br />
Aachener Str. 29, 41564 Kaarst (Büttgen), Tel. 02131 / 27 17 25, Fax 0 21 31 / 27 59 60,<br />
Homepage: www.unitas.org, E-Mail: vgs@unitas.org, stiftung@unitas.org<br />
Vorort<br />
W.K.St.V. UNITAS Landshut Köln<br />
Pantaleonswall 32, 50676 Köln, Tel.: 0221 / 92 32 054,<br />
E-Mail: landshut@unitas.org, vop@unitas.org<br />
Vorortspräsident<br />
Benedikt Schwedhelm, Pantaleonswall 32, 50676 Köln, Tel.: 0221 / 92 32 054,<br />
Mobil: 0177 / 7196882, E-Mail: benedikt_schwedhelm@gmx.de; vop@unitas.org<br />
Verbands-Konten<br />
PAX-Bank Köln, Nr. 28 796 013, BLZ 370 601 93<br />
Spendenkonten<br />
Stiftung UNITAS 150plus: Pax-Bank e.G., Köln, Kto.-Nr. 444 555, BLZ 370 601 93,<br />
Bank für Sozialwirtschaft, Kto.-Nr. 80 61 000, BLZ 370 205 00<br />
Soziales Projekt: Spk Bonn, Kto.-Nr. 71 61, BLZ 380 500 00, Verwendungszweck: Osek<br />
Schriftleitung<br />
Dr. Christof M. Beckmann, Hülsmannstr. 74, 45355 Essen-Borbeck,<br />
Tel. 0201 / 66 47 57 (p), 0208 / 46 84 99 61 (d), FAX 0208 / 46 84 99 69,<br />
E-Mail: unitas@unitas.org, kipnrw@aol.com<br />
Hermann-Josef Großimlinghaus (Bonn), Rheinstraße 12, 53179 Bonn,<br />
Tel. 0228 / 21 14 87, 0228 / 10 32 68 (d), E-Mail: H.Grossimlinghaus@DBK.de<br />
Der Bezugspreis der unitas beträgt halbjährlich 2,50 EUR zzgl. Zustellgebühr. Für Mitglieder<br />
des UNITAS-Verbandes ist er im jährlichen Verbandsbeitrag von 60,- EUR enthalten.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers<br />
und der Redaktion dar.<br />
Fotos: C. Beckmann, H.-J. Grossimlinghaus, L'Osservatore Romano, Reinhold Reisch,<br />
Reinhold Schönemund, privat.<br />
Druck<br />
DZE Druckzentrum, Essen<br />
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/<strong>2009</strong>: 18.05.<strong>2009</strong><br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
In memoriam Bbr. Walter Keller > 06<br />
Europa: EU-Parlamentspräsident Prof. Pöttering > 08<br />
60 Jahre Bundesrepublik: Friedrich Nowottny > 10<br />
Die Krise als Chance: Kirche und Wirtschaft > 15<br />
<strong>AGV</strong>: Sozialpolitische Standpunkte & Wahlprüfsteine > 20<br />
AHB-/HDB-Tag: Die Zukunft des Sozialstaats > 27<br />
Aktiventag in Essen: Stammzellforschung > 32<br />
Schönstatt und die UNITAS: P. Josef Kentenich > 46<br />
Bbr. Eduard Müller: Ehrung für „Lübecker Märtyrer“ > 52<br />
Lebendiges Christentum: Denkanstoss zur GV > 56<br />
unitas<br />
Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen<br />
katholischen <strong>Studenten</strong>vereine UNITAS<br />
ISSN-Nr.0344-9769<br />
Aus dem Verband > 59<br />
Namen & Nachrichten > 70<br />
In memoriam > 76<br />
FORUM / Leserbriefe > 79<br />
Bücher / Medien > 81<br />
Geburtstage von März bis Juni > 83<br />
Einladung zum AHB-/HDB-Tag in Münster > 88<br />
Liebe Leser,<br />
liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder!<br />
... „Frühling lässt sein blaues Band...“ – oft genug in diesen<br />
Wochen will einem sogar keine naturromantische Ader pulsen.<br />
Eher schwillt einem der Kamm. So scheint es manchen im Verband<br />
zu gehen, die sich im Internet zu den Themen unserer Zeit<br />
heftige Argumenteschlachten lieferten. Was da durch den Wolf<br />
gedreht wurde, nahm Bezug auf so einige „wohlbekannte Düfte“,<br />
die „ahnungsvoll das Land“ streiften. Und viele Veilchen, die sich<br />
anschickten, sich langsam träumend ans Licht zu recken, sind im<br />
Schockverfahren mit Donner und Blitz geweckt worden. Dabei<br />
ging der leise Harfenton des Frühlings im Getrampel einer berittenen<br />
Medienartillerie unter und verstummte im unaufhörlichen<br />
Kartätschenlärm der Nachrichtenlage: „Schwarzer Freitag<br />
reloaded“ hieß es, Börsenkrach und Inflationsgefahr bestimmten<br />
die Debatte, Millionenabfindungen für Versager, Staatsinterventionen<br />
und der drohende Abgrund bestimmten die Debatten.<br />
Säfte treiben, Knospen knallen<br />
Aber längst nicht nur das. Denn wer wollte sich mit Weltuntergangsstimmungen<br />
aufhalten, als das Thema langsam allen<br />
auf den Geist zu gehen drohte und erschöpft behandelt schien?<br />
Dankbar und engagiert von den Meinungsbildnern der Republik<br />
aufgenommen, kam da das Thema um die so genannten „Traditionalisten“<br />
gerade recht: Die hochpeitschenden medialen<br />
Wogen der Erregung schwappten wie ein Tsunami über dem<br />
Vatikan zusammen. Und wer als Normalgläubiger nicht komplett<br />
abtauchte, der kam heftig ins Schwimmen. Bissige Kommentare,<br />
humorig-befriedigte Experten, die es schon immer besser wussten,<br />
Klingelalarm bei Beratungs- und Austrittsstellen – die Papstkirche<br />
mit dem Rücken zur Wand. Und als ob das nicht reichte,<br />
nahm das angeschlagene Kirchenschiff nach kurzer Spielpause<br />
gleich noch mehr Wasser: Während Millionen Afrikaner vor<br />
Freude über päpstlichen Besuch schon auf den Straßen tanzten,<br />
ereiferte man sich in der zweiten Halbzeit öffentlich über ein<br />
offensichtlich gestörtes Verhältnis der Kirche zur sexuellen Aufklärung<br />
– es traf zwar kaum das Thema der Reise, war auch nichts<br />
Neues, aber auf jeden Fall noch weniger stimmungsfördernd.<br />
Denn auch die Politik schiebt derzeit kaum Glücksfaktoren in<br />
Sichtweite: Die Herausforderungen sind gewaltig, aber der Ehrgeiz<br />
der Großen im Stellungsgefecht auch. Im Super-Wahljahr<br />
werden Freund-Feind-Bilder sortiert und reaktiviert, während die<br />
in randständiger Radikalisierung wachsenden Polit-Sekten kaum<br />
zur Beruhigung der Gemüter beitragen. Schon gar nicht entsetzliche<br />
Verbrechen wie die Schulmorde, die zahllose Menschen tief<br />
berührt haben.<br />
Dies alles sollte uns nicht vom Nachdenken abhalten – im<br />
Gegenteil. Darüber, wo wir gefordert sind in allen diesen Fragen.<br />
Auch darüber, was es bedeutet, über alle Zeitthemen hinaus einer<br />
Gemeinschaft mit dem Namen „UNITAS“ anzugehören – ein<br />
hoher Anspruch. Gerade im Gespräch unter vielen Generationen:<br />
Was Begegnung und Austausch von Jung und Alt möglich macht,<br />
lässt sich etwa auf den Seiten des Kondolenzbuches nachspüren,<br />
das zum Tode unseres Ehrenseniors Walter Keller im Internet<br />
eröffnet wurde. Es ist ein Dank, wie er für viele wichtige und gute<br />
Begegnungen in unserem Leben gilt. Und dem wir uns jederzeit<br />
anschließen können.<br />
Wir sehen uns bei der 132. Generalversammlung in Marburg.<br />
semper in unitate,<br />
Dr. Christof M. Beckmann ( M3, B2, M5 )<br />
Editorial
„ER WIRD UNS LEITEN – AUCH IN TURBULENTEN ZEITEN...“<br />
Dokumentiert: Der Papstbrief an die Bischöfe<br />
Auch dem Vatikan können Fehler unterlaufen: Das räumte Papst Benedikt XVI. in einem persönlichen Brief an die Bischöfe weltweit zur<br />
umstrittenen Rücknahme von Exkommunikationen ein. Dabei kündigt er Konsequenzen an. In dem am 12. März <strong>2009</strong> im Vatikan veröffentlichten<br />
Brief bekräftigte der Papst nachdrücklich seinen Willen zur Versöhnung, beklagt aber auch die „Feindseligkeit“, die ihm im<br />
Streit um die Pius-Bruderschaft und den Holocaust-Leugner Richard Williamson entgegengeschlagen sei. Im Folgenden dokumentieren<br />
wir den Wortlaut des Briefes nach der autorisierten Fassung des Pressesaals des Heiligen Stuhls.<br />
„BRIEF SEINER HEILIGKEIT PAPST BENEDIKT XVI.<br />
AN DIE BISCHÖFE DER KATHOLISCHEN KIRCHE<br />
IN SACHEN AUFHEBUNG DER EXKOMMUNIKATION<br />
DER VIER VON ERZBISCHOF LEFEBVRE GEWEIHTEN BISCHÖFE<br />
Liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst!<br />
Die Aufhebung der Exkommunikation für die vier von Erzbischof<br />
Lefebvre im Jahr 1988 ohne Mandat des Heiligen Stuhls geweihten<br />
Bischöfe hat innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche aus<br />
vielfältigen Gründen zu einer Auseinandersetzung von einer Heftigkeit<br />
geführt, wie wir sie seit langem nicht mehr erlebt haben. Viele<br />
Bischöfe fühlten sich ratlos vor einem Ereignis, das unerwartet gekommen<br />
und kaum positiv in die Fragen und Aufgaben der Kirche<br />
von heute einzuordnen war. Auch wenn viele Hirten und Gläubige<br />
den Versöhnungswillen des Papstes grundsätzlich positiv zu werten<br />
bereit waren, so stand dagegen doch die Frage nach der Angemessenheit<br />
einer solchen Gebärde angesichts der wirklichen Dringlichkeiten<br />
gläubigen Lebens in unserer Zeit. Verschiedene Gruppierungen<br />
hingegen beschuldigten den Papst ganz offen, hinter das Konzil<br />
zurückgehen zu wollen: eine Lawine von Protesten setzte sich in<br />
Bewegung, deren Bitterkeit Verletzungen sichtbar machte, die über<br />
den Augenblick hinausreichen. So fühle ich mich gedrängt, an Euch,<br />
liebe Mitbrüder, ein klärendes Wort zu richten, das helfen soll, die<br />
Absichten zu verstehen, die mich und die zuständigen Organe des<br />
Heiligen Stuhls bei diesem Schritt geleitet haben. Ich hoffe, auf<br />
diese Weise zum Frieden in der Kirche beizutragen.<br />
Eine für mich nicht vorhersehbare Panne bestand darin, daß die<br />
Aufhebung der Exkommunikation überlagert wurde von dem Fall<br />
Williamson. Der leise Gestus der Barmherzigkeit gegenüber vier<br />
gültig, aber nicht rechtmäßig geweihten Bischöfen erschien plötzlich<br />
als etwas ganz anderes: als Absage an die christlich-jüdische<br />
Versöhnung, als Rücknahme dessen, was das Konzil in dieser Sache<br />
zum Weg der Kirche erklärt hat. Aus einer Einladung zur Versöhnung<br />
mit einer sich abspaltenden kirchlichen Gruppe war auf diese<br />
Weise das Umgekehrte geworden: ein scheinbarer Rückweg hinter<br />
alle Schritte der Versöhnung von Christen und Juden, die seit dem<br />
Konzil gegangen wurden und die mitzugehen und weiterzubringen<br />
von Anfang an ein Ziel meiner theologischen Arbeit gewesen war.<br />
Daß diese Überlagerung zweier gegensätzlicher Vorgänge eingetreten<br />
ist und den Frieden zwischen Christen und Juden wie auch den<br />
Frieden in der Kirche für einen Augenblick gestört hat, kann ich nur<br />
zutiefst bedauern. Ich höre, daß aufmerksames Verfolgen der im<br />
Internet zugänglichen Nachrichten es ermöglicht hätte, rechtzeitig<br />
von dem Problem Kenntnis zu erhalten. Ich lerne daraus, daß wir<br />
beim Heiligen Stuhl auf diese Nachrichtenquelle in Zukunft aufmerksamer<br />
achten müssen. Betrübt hat mich, daß auch Katholiken,<br />
die es eigentlich besser wissen konnten, mit sprungbereiter Feindseligkeit<br />
auf mich einschlagen zu müssen glaubten. Um so mehr<br />
danke ich den jüdischen Freunden, die geholfen haben, das Mißverständnis<br />
schnell aus der Welt zu schaffen und die Atmosphäre<br />
der Freundschaft und des Vertrauens wiederherzustellen, die – wie<br />
zur Zeit von Papst Johannes Paul II. – auch während der ganzen Zeit<br />
meines Pontifikats bestanden hatte und gottlob weiter besteht.<br />
Eine weitere Panne, die ich ehrlich bedaure, besteht darin, daß<br />
Grenze und Reichweite der Maßnahme vom 21. 1. <strong>2009</strong> bei der<br />
Veröffentlichung des Vorgangs nicht klar genug dargestellt worden<br />
sind. Die Exkommunikation trifft Personen, nicht Institutionen.<br />
Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag bedeutet die Gefahr eines<br />
Schismas, weil sie die Einheit des Bischofskollegiums mit dem Papst<br />
in Frage stellt. Die Kirche muß deshalb mit der härtesten Strafe, der<br />
Exkommunikation, reagieren, und zwar, um die so Bestraften zur<br />
Reue und in die Einheit zurückzurufen. 20 Jahre nach den Weihen ist<br />
dieses Ziel leider noch immer nicht erreicht worden. Die Rücknahme<br />
der Exkommunikation dient dem gleichen Ziel wie die Strafe selbst:<br />
noch einmal die vier Bischöfe zur Rückkehr einzuladen. Diese Geste<br />
war möglich, nachdem die Betroffenen ihre grundsätzliche Anerkennung<br />
des Papstes und seiner Hirtengewalt ausgesprochen hatten,<br />
wenn auch mit Vorbehalten, was den Gehorsam gegen seine<br />
Lehrautorität und gegen die des Konzils betrifft.<br />
Damit komme ich zur Unterscheidung von Person und Institution<br />
zurück. Die Lösung der Exkommunikation war eine Maßnahme<br />
im Bereich der kirchlichen Disziplin: Die Personen wurden von der<br />
Gewissenslast der schwersten Kirchenstrafe befreit. Von dieser disziplinären<br />
Ebene ist der doktrinelle Bereich zu unterscheiden. Daß<br />
die Bruderschaft Pius’ X. keine kanonische Stellung in der Kirche hat,<br />
beruht nicht eigentlich auf disziplinären, sondern auf doktrinellen<br />
Gründen. Solange die Bruderschaft keine kanonische Stellung in der<br />
Kirche hat, solange üben auch ihre Amtsträger keine rechtmäßigen<br />
Ämter in der Kirche aus. Es ist also zu unterscheiden zwischen der<br />
die Personen als Personen betreffenden disziplinären Ebene und der<br />
doktrinellen Ebene, bei der Amt und Institution in Frage stehen. Um<br />
es noch einmal zu sagen: Solange die doktrinellen Fragen nicht<br />
geklärt sind, hat die Bruderschaft keinen kanonischen Status in der<br />
Kirche und solange üben ihre Amtsträger, auch wenn sie von der<br />
Kirchenstrafe frei sind, keine Ämter rechtmäßig in der Kirche aus.<br />
Angesichts dieser Situation beabsichtige ich, die Päpstliche<br />
Kommission „Ecclesia Dei“, die seit 1988 für diejenigen Gemeinschaften<br />
und Personen zuständig ist, die von der Bruderschaft Pius’<br />
X. oder ähnlichen Gruppierungen kommend in die volle Gemeinschaft<br />
mit dem Papst zurückkehren wollen, in Zukunft mit der<br />
Glaubenskongregation zu verbinden. Damit soll deutlich werden,<br />
daß die jetzt zu behandelnden Probleme wesentlich doktrineller<br />
Natur sind, vor allem die Annahme des II. Vatikanischen Konzils und<br />
des nachkonziliaren Lehramts der Päpste betreffen. Die kollegialen<br />
Organe, mit denen die Kongregation die anfallenden Fragen bearbeitet<br />
(besonders die regelmäßige Kardinalsversammlung an den<br />
Mittwochen und die ein- bis zweijährige Vollversammlung), garantieren<br />
die Einbeziehung der Präfekten verschiedener römischer<br />
Kongregationen und des weltweiten Episkopats in die zu fällenden<br />
Entscheidungen. Man kann die Lehrautorität der Kirche nicht im<br />
Jahr 1962 einfrieren – das muß der Bruderschaft ganz klar sein. >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 3
Aber manchen von denen, die sich als große Verteidiger des Konzils<br />
hervortun, muß auch in Erinnerung gerufen werden, daß das II.<br />
Vaticanum die ganze Lehrgeschichte der Kirche in sich trägt. Wer<br />
ihm gehorsam sein will, muß den Glauben der Jahrhunderte annehmen<br />
und darf nicht die Wurzeln abschneiden, von denen der<br />
Baum lebt.<br />
Ich hoffe, liebe Mitbrüder, daß damit die positive Bedeutung wie<br />
auch die Grenze der Maßnahme vom 21. 1. <strong>2009</strong> geklärt ist. Aber nun<br />
bleibt die Frage:War das notwendig? War das wirklich eine Priorität?<br />
Gibt es nicht sehr viel Wichtigeres? Natürlich gibt es Wichtigeres<br />
und Vordringlicheres. Ich denke, daß ich die Prioritäten des Pontifikats<br />
in meinen Reden zu dessen Anfang deutlich gemacht habe. Das<br />
damals Gesagte bleibt unverändert meine Leitlinie. Die erste Priorität<br />
für den Petrusnachfolger hat der Herr im Abendmahlssaal unmißverständlich<br />
fixiert: „Du aber stärke deine Brüder“ (Lk 22, 32).<br />
Petrus selber hat in seinem ersten Brief diese Priorität neu formuliert:„Seid<br />
stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach<br />
der Hoffnung fragt, die in euch ist“ (1 Petr 3, 15). In unserer Zeit, in der<br />
der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht wie eine<br />
Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität,<br />
Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den<br />
Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu<br />
dem Gott, der am Sinai gesprochen hat; zu dem Gott, dessen Gesicht<br />
wir in der Liebe bis zum Ende (Joh 13, 1) – im gekreuzigten und<br />
auferstandenen Jesus Christus erkennen. Das eigentliche Problem<br />
unserer Geschichtsstunde ist es, daß Gott aus dem Horizont der<br />
Menschen verschwindet und daß mit dem Erlöschen des von Gott<br />
kommenden Lichts Orientierungslosigkeit in die Menschheit hereinbricht,<br />
deren zerstörerische Wirkungen wir immer mehr zu sehen<br />
bekommen.<br />
Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu<br />
führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und<br />
des Petrusnachfolgers in dieser Zeit. Aus ihr ergibt sich dann von<br />
selbst, daß es uns um die Einheit der Glaubenden gehen muß. Denn<br />
ihr Streit, ihr innerer Widerspruch, stellt die Rede von Gott in Frage.<br />
Daher ist das Mühen um das gemeinsame Glaubenszeugnis der<br />
Christen – um die Ökumene – in der obersten Priorität mit eingeschlossen.<br />
Dazu kommt die Notwendigkeit, daß alle, die an Gott<br />
glauben, miteinander den Frieden suchen, versuchen einander<br />
näher zu werden, um so in der Unterschiedenheit ihres Gottesbildes<br />
doch gemeinsam auf die Quelle des Lichts zuzugehen – der interreligiöse<br />
Dialog. Wer Gott als Liebe bis ans Ende verkündigt, muß das<br />
Zeugnis der Liebe geben: den Leidenden in Liebe zugewandt sein,<br />
Haß und Feindschaft abwehren – die soziale Dimension des christlichen<br />
Glaubens, von der ich in der Enzyklika „Deus caritas est“<br />
gesprochen habe.<br />
Wenn also das Ringen um den Glauben, um die Hoffnung und<br />
um die Liebe in der Welt die wahre Priorität für die Kirche in dieser<br />
Stunde (und in unterschiedlichen Formen immer) darstellt, so gehören<br />
doch auch die kleinen und mittleren Versöhnungen mit dazu.<br />
Daß die leise Gebärde einer hingehaltenen Hand zu einem großen<br />
Lärm und gerade so zum Gegenteil von Versöhnung geworden ist,<br />
müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber nun frage ich doch: War und<br />
ist es wirklich verkehrt, auch hier dem Bruder entgegenzugehen,„der<br />
etwas gegen dich hat“ und Versöhnung zu versuchen (vgl. Mt 5, 23f)?<br />
Muß nicht auch die zivile Gesellschaft versuchen, Radikalisierungen<br />
zuvorzukommen, ihre möglichen Träger – wenn irgend möglich –<br />
zurückzubinden in die großen gestaltenden Kräfte des gesellschaftlichen<br />
Lebens, um Abkapselung und all ihre Folgen zu vermeiden?<br />
Kann es ganz falsch sein, sich um die Lösung von Verkrampfungen<br />
und Verengungen zu bemühen und dem Raum zu geben, was sich an<br />
Positivem findet und sich ins Ganze einfügen läßt? Ich habe selbst in<br />
den Jahren nach 1988 erlebt, wie sich durch die Heimkehr von vorher<br />
von Rom sich abtrennenden Gemeinschaften dort das innere Klima<br />
verändert hat; wie die Heimkehr in die große, weite und gemeinsame<br />
Kirche Einseitigkeiten überwand und Verkrampfungen löste, so<br />
daß nun daraus positive Kräfte für das Ganze wurden. Kann uns eine<br />
4<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Gemeinschaft ganz gleichgültig sein, in der es 491 Priester, 215<br />
Seminaristen, 6 Seminare, 88 Schulen, 2 Universitäts-Institute, 117<br />
Brüder und 164 Schwestern gibt? Sollen wir sie wirklich beruhigt von<br />
der Kirche wegtreiben lassen? Ich denke zum Beispiel an die 491<br />
Priester. Das Geflecht ihrer Motivationen können wir nicht kennen.<br />
Aber ich denke, daß sie sich nicht für das Priestertum entschieden<br />
hätten, wenn nicht neben manchem Schiefen oder Kranken die Liebe<br />
zu Christus da gewesen wäre und der Wille, ihn und mit ihm den<br />
lebendigen Gott zu verkünden. Sollen wir sie einfach als Vertreter<br />
einer radikalen Randgruppe aus der Suche nach Versöhnung und<br />
Einheit ausschalten? Was wird dann werden?<br />
Gewiß, wir haben seit langem und wieder beim gegebenen Anlaß<br />
viele Mißtöne von Vertretern dieser Gemeinschaft gehört –<br />
Hochmut und Besserwisserei, Fixierung in Einseitigkeiten hinein<br />
usw. Dabei muß ich der Wahrheit wegen anfügen, daß ich auch eine<br />
Reihe bewegender Zeugnisse der Dankbarkeit empfangen habe, in<br />
denen eine Öffnung der Herzen spürbar wurde. Aber sollte die<br />
Großkirche nicht auch großmütig sein können im Wissen um den<br />
langen Atem, den sie hat; im Wissen um die Verheißung, die ihr<br />
gegeben ist? Sollten wir nicht wie rechte Erzieher manches Ungute<br />
auch überhören können und ruhig aus der Enge herauszuführen<br />
uns mühen? Und müssen wir nicht zugeben, daß auch aus kirchlichen<br />
Kreisen Mißtönendes gekommen ist? Manchmal hat man<br />
den Eindruck, daß unsere Gesellschaft wenigstens eine Gruppe<br />
benötigt, der gegenüber es keine Toleranz zu geben braucht; auf die<br />
man ruhig mit Haß losgehen darf. Und wer sie anzurühren wagte –<br />
in diesem Fall der Papst –, ging auch selber des Rechts auf Toleranz<br />
verlustig und durfte ohne Scheu und Zurückhaltung ebenfalls mit<br />
Haß bedacht werden.<br />
Liebe Mitbrüder, in den Tagen, in denen mir in den Sinn kam, diesen<br />
Brief zu schreiben, ergab es sich zufällig, daß ich im Priesterseminar<br />
zu Rom die Stelle aus Gal 5, 13 – 15 auslegen und kommentieren<br />
mußte. Ich war überrascht, wie direkt sie von der Gegenwart<br />
dieser Stunde redet:„Nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das<br />
Fleisch, sondern dient einander in Liebe! Das ganze Gesetz wird in<br />
dem einen Wort zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben<br />
wie dich selbst! Wenn ihr einander beißt und zerreißt, dann<br />
gebt acht, daß ihr euch nicht gegenseitig umbringt.“ Ich war immer<br />
geneigt, diesen Satz als eine der rhetorischen Übertreibungen anzusehen,<br />
die es gelegentlich beim heiligen Paulus gibt. In gewisser<br />
Hinsicht mag er dies auch sein.<br />
Aber leider gibt es das „Beißen und Zerreißen“ auch heute in der<br />
Kirche als Ausdruck einer schlecht verstandenen Freiheit. Ist es verwunderlich,<br />
daß wir auch nicht besser sind als die Galater? Daß uns<br />
mindestens die gleichen Versuchungen bedrohen? Daß wir den<br />
rechten Gebrauch der Freiheit immer neu lernen müssen? Und daß<br />
wir immer neu die oberste Priorität lernen müssen: die Liebe? An<br />
dem Tag, an dem ich darüber im Priesterseminar zu reden hatte,<br />
wurde in Rom das Fest der Madonna della Fiducia – unserer Lieben<br />
Frau vom Vertrauen – begangen. In der Tat – Maria lehrt uns das<br />
Vertrauen. Sie führt uns zum Sohn, dem wir alle vertrauen dürfen. Er<br />
wird uns leiten – auch in turbulenten Zeiten. So möchte ich am<br />
Schluß all den vielen Bischöfen von Herzen danken, die mir in dieser<br />
Zeit bewegende Zeichen des Vertrauens und der Zuneigung, vor<br />
allem aber ihr Gebet geschenkt haben. Dieser Dank gilt auch allen<br />
Gläubigen, die mir in dieser Zeit ihre unveränderte Treue zum<br />
Nachfolger des heiligen Petrus bezeugt haben. Der Herr behüte uns<br />
alle und führe uns auf den Weg des Friedens. Das ist ein Wunsch, der<br />
spontan aus meinem Herzen aufsteigt, gerade jetzt zu Beginn der<br />
Fastenzeit, einer liturgischen Zeit, die der inneren Läuterung besonders<br />
förderlich ist und die uns alle einlädt, mit neuer Hoffnung auf<br />
das leuchtende Ziel des Osterfestes zu schauen.<br />
Mit einem besonderen Apostolischen Segen<br />
verbleibe ich im Herrn Euer<br />
[Benedictus PP. XVI]<br />
Aus dem Vatikan, am 10. März <strong>2009</strong>
VATIKANSTADT (Fidesdienst) –<br />
„Wenn ihr euch aus Christus<br />
speist und in Ihm lebt, wie der<br />
Apostel Paulus, dann werdet<br />
ihr nicht umhin können, von<br />
Ihm zu sprechen und Ihn<br />
unter vielen eurer Freunde<br />
und Altersgenossen bekannt<br />
zu machen und dafür zu sorgen,<br />
dass sie Ihn lieben. Die<br />
Kirche zählt auf euch, wenn es um diese anspruchsvolle Sendung<br />
geht: lasst euch von den Schwierigkeiten und Prüfungen nicht entmutigen“,<br />
heißt es in der Botschaft des Papstes zum 24. Weltjugendtag,<br />
der am 5. April, dem Palmsonntag, in den Diözesen<br />
gefeiert wird. Er steht unter dem Pauluswort „Denn wir haben unsere<br />
Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt“ (1 Tim 4,10).<br />
„Liebe Freunde, wie Paulus, zeugt vom<br />
Auferstandenen! … Macht ihn allen bekannt,<br />
unter euren Altersgenossen und unter den<br />
Erwachsenen, die auf der Suche nach der<br />
,großen Hoffnung‘ sind, die ihrem Leben<br />
Sinn gibt“, so der Heilige Vater weiter,<br />
„Wenn Jesus eure Hoffung geworden ist,<br />
dann sagt dies auch den anderen mit eurer<br />
Freude und mit eurem geistlichen, apostolischen<br />
und sozialen Engagement.Von Christus<br />
bewohnt, nachdem ihr euren ganzen Glauben<br />
auf ihn setzt und ihm euer ganzes Vertrauen<br />
schenkt, verbreitet diese Hoffnung auch um<br />
euch herum“. Der Papst fordert die Jugendlichen<br />
auf, Entscheidungen zu treffen, die<br />
ihren Glauben zum Ausdruck bringen und<br />
sich nicht von „Trugbildern“ verführen zu<br />
lassen, nicht der „Logik egoistischer Interessen“<br />
zu verfallen: „Der wahre Christ ist nie<br />
traurig, auch wenn er Prüfungen verschiedener<br />
Art gegenüber steht, denn die Gegenwart<br />
Jesu ist das Geheimnis seiner Freude und<br />
seines Friedens“.<br />
Die Frage der Hoffnung<br />
Mit Bezug auf das WJT-Thema <strong>2009</strong> betont Papst Benedikt XVI.,<br />
dass die Frage der Hoffnung in Wirklichkeit im Mittelpunkt unsers<br />
Lebens als Menschen und unserer Sendung als Christen steht, insbesondere<br />
in der heutigen Zeit: „Wir empfinden alle das Bedürfnis<br />
nach Hoffnung, doch nicht nach irgendeiner Hoffnung, sondern<br />
nach einer festen und glaubwürdigen Hoffnung, wie ich es auch in<br />
der Enzyklika „Spe salvi“ betont habe. Vor allem die Jugend ist eine<br />
Zeit der Hoffnung, den sie blickt mit vielen Erwartungen in die<br />
Zukunft“. In diesem Lebensabschnitt träten auch grundlegende existenzielle<br />
Fragen zutage und angesichts von Hindernissen, die<br />
manchmal unüberwindbar erscheinen frage man sich: „Wo soll ich<br />
die Hoffnung hernehmen und wie kann ich im Herzen diese<br />
Flamme am Brennen erhalten?“<br />
Gegen die Orientierungslosigkeit<br />
„Wie ich in der bereits zitierten Enzyklika „Spe salvi“ geschrieben<br />
habe, können Politik,Wissenschaft,Technik,Wirtschaft und jede<br />
andere materielle Ressource allein nicht die große Hoffnung schen-<br />
Botschaft des Papstes an die Jugendlichen<br />
zum Weltjugendtag am Palmsonntag<br />
ken, nach der wir uns sehnen. Diese Hoffnung kann nur Gott sein,<br />
der das Ganze umfasst und der uns geben und schenken kann, was<br />
wir allein nicht vermögen' (Nr. 31)“. Zu den hauptsächlichen Folgen<br />
des Gottvergessens gehöre die Orientierungslosigkeit, die unsere<br />
heutige Gesellschaft kennzeichne, „mit den Folgen der Einsamkeit<br />
und der Gewalt, der Unzufriedenheit und des Verlusts der Zuversicht,<br />
die nicht selten zu Verzweiflung führen“, so der Papst weiter.<br />
Er weist darauf hin, dass „die Hoffnungskrise vor allem die neue<br />
Generationen betrifft, die in einem soziokulturellen Kontext leben,<br />
in dem es keine Gewissheit, keine Werte und keine soliden Bezugspunkte<br />
gibt und die sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, die<br />
die eigenen Kräfte übersteigen.“<br />
Hier wendet sich der Papst auch an die vielen Jugendlichen, die<br />
„vom Leben verletzt, von einer persönlichen Unreife eingeschränkt<br />
sind, die oft Folge einer familiären Leere ist, einer permissiven Erziehung<br />
ohne feste Regeln und negativer<br />
oder traumatischer Erfahrungen. „Für<br />
einige – und leider sind es nicht wenige –<br />
ist der fast obligatorische Ausweg die<br />
entfremdende Flucht in gefährliche oder<br />
gewaltsame Verhaltensweisen, in die Abhängigkeit<br />
von Drogen und Alkohol, und<br />
in viele Formen der jugendlichen<br />
Unzufriedenheit“. Damit man diesen<br />
Jugendlichen die Hoffnung verkünden<br />
könne, so der Papst, sei eine Neuevangelisierung<br />
notwendig, „die den<br />
neuen Generationen hilft, zu erkennen,<br />
dass das wahre Gesicht Gottes die Liebe<br />
ist“. An die Jugendlichen „auf der Suche<br />
nach einer festen Hoffnung“ wendet sich<br />
der Papst mit den Worten des heiligen<br />
Paulus, der an die verfolgten Christen im<br />
damaligen Rom schrieb: „Der Gott der<br />
Hoffnung aber erfülle euch mit aller<br />
Freude und mit allem Frieden im<br />
Glauben, damit ihr reich werdet an<br />
Hoffnung in der Kraft des Heiligen<br />
Geistes“ (Röm, 15,13).<br />
Durch die Erfahrung des Glaubens wachsen<br />
Paulus habe sich als „Zeugen der Hoffnung“ inmitten vieler<br />
Schwierigkeiten und vielfältiger Prüfungen befunden und doch nie<br />
die Hoffnung verloren, die in ihm durch die Begegnung mit dem<br />
auferstandenen Christus auf dem Weg nach Damaskus entstanden<br />
war. „Wie er einst dem jungen Paulus begegnetet, so will Jesus<br />
auch jedem von euch begegnen, liebe Jugendliche“, so Papst<br />
Benedikt XVI.:„Wenn wir im Gebet unseren Glauben zum Ausdruck<br />
bringen, dann begegnen wir ihm bereits in der Finsternis, denn er<br />
will sich uns schenken. Das inständige öffnet das Herz, damit wir<br />
ihn empfangen können“. In diesem Zusammenhang erinnert der<br />
Papst auch an die Erfahrung in „Gruppe und Bewegungen, bei<br />
Treffen und gemeinsamen Wegen, bei denen wir lernen, wie wir<br />
beten können und damit wie wir durch die Erfahrung des Glaubens<br />
wachsen“. Maria als Mutter der Hoffnung, sei Beistand auf diesem<br />
Weg: „Sie, die die Hoffnung Israels verkörpert hat, die der Welt den<br />
Erlöser geschenkt hat, und am Fuß des Kreuzes voller Hoffnung<br />
war, ist für uns Vorbild und Beistand. Vor allem möge Maria<br />
Fürsprache für uns halten und uns aus der Finsternis unserer<br />
Schwierigkeiten zur strahlenden Morgenröte der Begegnung mit<br />
dem Auferstandenen leiten“.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 5
Die Prinzipien in vorbildlicher Weise vorgelebt<br />
DER EHRENSENIOR, BBR. WALTER KELLER, WURDE IN MÜNCHEN ZU GRABE GETRAGEN<br />
Der Ehrensenior des UNITAS-Verbandes,<br />
Bbr. Ltd. Dir. a.D. Walter Keller,<br />
ist am Sonntag, 1. März <strong>2009</strong>, nach<br />
einer Herzoperation, die er zunächst<br />
gut überstanden hatte, im gesegneten<br />
Alter von 91 Jahren verstorben<br />
und zu seinem Schöpfer heimgegangen.<br />
Eine große Trauergemeinde gab<br />
Walter Keller am 5. März in München<br />
das letzte Geleit. Elf Chargenteams<br />
waren zur Messe angetreten und<br />
führten den langen Trauerzug an, der<br />
den verstorbenen Ehrensenior des<br />
Verbandes auf dem Nordfriedhof zur<br />
letzten Ruhe begleitete.<br />
„Dilexit ecclesiam!“<br />
Der Geistliche Beirat des Verbandes, Kpl.<br />
Helmut Wiechmann, sprach als Zelebrant<br />
des Requiems in der Allerheiligen-Kirche in<br />
München-Schwabing in seiner Predigt über<br />
die christliche Auferstehungshoffnung und<br />
nahm die unitarische Gemeinschaft ins<br />
Gebet. Er skizzierte ein erfülltes Leben „in absoluter<br />
Treue und Gradlinigkeit in Welt und<br />
Kirche“: Geprägt vom Glauben seiner Mutter<br />
und der Menschen im Lande der Hl. Hedwig,<br />
Schlesien, habe sich Walter Keller nicht nur<br />
im Beruf, sondern auch in Familie und<br />
UNITAS als präsent und stets bereit gezeigt,<br />
kompetent in der Sache und treu im Kleinen<br />
zu dienen:„Über sein Leben darf man schreiben:<br />
DILEXIT ECCLESIAM – Er liebte die<br />
Kirche! Sein Glaube prägte sein Leben und<br />
das Leben so vieler“, so der Zelebrant.<br />
Besonders erinnerte die Predigt an die<br />
lebenslange Freundschaft, die Walter Keller<br />
in diesem Geist mit Bbr. Ludwig Freibüter<br />
verband. Dabei verwies Bbr. Wiechmann<br />
6<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
auf ein „geistiges Testament“ des Verstorbenen,<br />
das dieser anlässlich seines 90. Geburtstags<br />
den Aktiven ans Herz legte: Darin<br />
hatte er deutlich herausgestellt, dass Fragen<br />
nach Organisation und Strukturen nur<br />
sekundär seien.„Wichtig ist nur die geistige<br />
Haltung und das katholische Prinzip. Das<br />
muss uneingeschränkt aufrecht erhalten<br />
bleiben“, erklärte Bbr. Keller damals. Der<br />
Verstorbene lebe nun in der Welt des Friedens<br />
der <strong>Unitas</strong> und der Caritas, so Bbr.<br />
Wiechmann. „Sein letzter Atemzug ist<br />
hineingenommen in den Heiligen Atem<br />
Gottes, den Atem des ewigen Lichtes, dass<br />
die Dunkelheit unseres Lebens erhellt, in<br />
den Atem der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit.“<br />
Wer im Kleinen getreu war,<br />
dem werde ER auch im Großen getreu sein.<br />
Nachruf des<br />
Verbandsgeschäftsführers<br />
Auch Verbandsgeschäftsführer Bbr.<br />
Dieter Krüll würdigte in einer Ansprache<br />
nach dem Gottesdienst in der Allerheiligen-Kirche<br />
den Verstorbenen und sein<br />
Leben für die UNITAS. „Der Wissenschaftliche<br />
Katholische <strong>Studenten</strong>verband <strong>Unitas</strong><br />
e.V. und alle Bundesbrüder und Bundesschwestern<br />
trauern um ihren hochverehrten<br />
Ehrensenior Bbr. Ltd. Dir. a. D. Walter<br />
Keller, einen lieben, treuen Freund und<br />
Bundesbruder, der unsere unitarischen<br />
Prinzipien Virtus, Scientia, Amicitia in vorbildlicher<br />
Weise gelebt und vorgelebt hat“,<br />
erklärte der Verbandsgeschäftsführer. „In<br />
tief empfundener Dankbarkeit verneigen<br />
wir uns vor diesem großen Unitarier, dem<br />
der <strong>Unitas</strong>-Verband unendlich viel zu verdanken<br />
hat.“<br />
In seiner biografischen Skizze stellte<br />
Bbr. Krüll insbesondere den „Irrsinns und<br />
die Grausamkeit des Weltkrieges“ heraus,<br />
die Bbr. Walter Keller in Polen, Frankreich<br />
und beim Russlandfeldzug erfahren hatte.<br />
Prägend sei gewesen, dass er in englischer<br />
Kriegsgefangenschaft in Schottland mit<br />
zwei weiteren Unitariern nur dank des<br />
Eingreifens des Lagergeistlichen die Verschwörung<br />
eines Femegerichts unbelehrbarer<br />
Nazis am 20. April 1945 überlebte. Im<br />
Lager hatte er in Bbr. Dr. Ludwig Maria<br />
Freibüter einen gleichgesinnten, aufrech-<br />
ten Katholiken kennengelernt, dem er als<br />
Unitarier und Freund bis zu dessen Tod am<br />
20. August 2004 sein Leben lang verbunden<br />
bleiben sollte. Bbr. Krüll erinnerte an Bbr.<br />
Freibüters Bericht von der gemeinsamen<br />
Kriegsgefangenschaft: „In einer von den<br />
Engländern zugeteilten Baracke findet nun<br />
regelmäßig das heilige Messopfer statt.<br />
Und jeden Morgen wandert Walter Keller<br />
zum Gespött vieler Mitgefangener mit dem<br />
großen Kreuz quer durch das Lager zu dieser<br />
Baracke, um dort den Altar aufzubauen.<br />
Wer versteht heute noch, welch ein Bekennermut<br />
dazu gehörte.“<br />
Sozial, tolerant, frei<br />
Was eine solche Vita der Kriegsgeneration<br />
bedeute, „können wir uns heute überhaupt<br />
nicht mehr vorstellen“, erklärte Bbr.<br />
Krüll. Doch beeindruckende Fakten eines<br />
langen und erfüllten Lebens sagten nur<br />
wenig aus über den Menschen Walter<br />
Keller und die Triebfeder seines Handelns<br />
und seiner Arbeit in und für die <strong>Unitas</strong>, so<br />
der Verbandsgeschäftsführer.<br />
Dazu zitierte er aus einem Interview<br />
mit seinem Amtsvorgänger aus dem Jahr<br />
1992:„Die Motivation für den Eintritt in den<br />
<strong>Unitas</strong>-Verband ist klar und eindeutig.<br />
Bestechend für mich war die eindeutige
Zielsetzung und Aufgabenstellung des<br />
<strong>Unitas</strong>-Verbandes, seine religiöse Einstellung,<br />
seine Stellung zur Kirche, zu Papst<br />
und Bischöfen, sein soziales Engagement,<br />
seine Toleranz, bei der sich jeder so entfalten<br />
kann und angenommen wird, wie er<br />
von Gott geschaffen wurde, und die Ablehnung<br />
jeden Standesdünkels!“ Und an anderer<br />
Stelle sagte Bbr. Keller: „Im <strong>Unitas</strong>-<br />
Verband ist heute noch eine Orientierung<br />
und geistige Auseinandersetzung möglich;<br />
er vermittelt das richtige Menschen- und<br />
Weltbild sowie eine Werteordnung, die das<br />
Leben in Freiheit und in der Bindung an<br />
Gott ermöglicht.“<br />
Loyalität, Mut, Disziplin<br />
Sein Credo habe er in den unitarischen<br />
Prinzipien „virtus, scientia, amicitia“ verwirklicht<br />
gesehen. „Die Botschaft unserer Prinzipien<br />
war seine Mission, der er alles unterordnete.<br />
Walter Keller war im Namen Jesu ein<br />
Menschenfischer in der <strong>Unitas</strong>“, erklärte Bbr.<br />
Dieter Krüll und zitierte aus einer Festrede<br />
von Bbr. Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein<br />
zum 80. Geburtstag des Ehrenseniors:<br />
„Walter Keller und <strong>Unitas</strong>, das ist eines. Und<br />
Du warst uns Vorbild. Vorbild, weil Du vieles<br />
von dem, was ich selber als richtig und wegweisend<br />
kannte und annahm, vorgelebt<br />
hast. Du hast ein Vorbild gegeben an Treue,<br />
Treue zu Deiner Kirche, Treue zu Deinem Verband,<br />
Treue zu Deiner Nation, an Loyalität,<br />
der Loyalität gegenüber den Jungen. Du hast<br />
Mut bewiesen und Disziplin.“<br />
„Nein, es ist genug, ich möchte zu<br />
mei-nem Herrgott gehen“, habe Bbr. Walter<br />
Keller bei einem Besuch am 1. Februar <strong>2009</strong><br />
in dem neuen Münchener Heim beim<br />
Scherzen über seinen zu erwartenden 100.<br />
Geburtstag in einigen Jahren erklärt. „Da<br />
war keinerlei Angst oder gar Bitterkeit,<br />
nein, nur tiefes Vertrauen und das Wissen<br />
um das ewige Leben in der Herrlichkeit<br />
seines Gottes“, unterstrich der Verbandsgeschäftsführer<br />
aus einer Ansprache.<br />
„Wir werden sein Vorbild stets in unseren<br />
Herzen bewahren! Wie es sicherlich<br />
sein Wunsch gewesen wäre möchte ich<br />
dem lieben Walter heute nachrufen: Vivat,<br />
floreat, crescat <strong>Unitas</strong> ad multos annos!<br />
Dies ist unser Versprechen, lieber Walter!“,<br />
unterstrich Bbr. Krüll in seinem Nachruf.<br />
Anfang Mai werde die UNITAS bei der<br />
Verbandsmesse anlässlich der 132. Generalversammlung<br />
des Verbandes in Marburg<br />
des Verstorbenen in besonderer Weise im<br />
Gebet gedenken.<br />
Statt Kränzen bat die Familie in Walters Sinne um<br />
eine Spende, entweder an die Stiftung UNITAS 150<br />
PLUS (PAX-Bank Köln, Kto. 32230016, BLZ:<br />
37060193; Spende Walter Keller) oder an das<br />
Soziale Projekt der <strong>Unitas</strong> (<strong>Unitas</strong>-Verband<br />
Soziales Projekt, Sparkasse KölnBonn, Kto. 7161, BLZ<br />
37050198; Stichwort: Osek / Spende Walter Keller).<br />
Die unitarische Trauergemeinde gab ihrem Ehrensenior in München das letzte Geleit.<br />
IN MEMORIAM WALTER KELLER<br />
Der gebürtige Breslauer, am 21. September im Kriegsjahr 1917 geboren und Schüler<br />
am Missionsgymnasium der Oblaten in Striegau, empfing das Sakrament der<br />
Firmung durch Adolf Kardinal Bertram und besuchte das Matthias-Gymnasium in<br />
Breslau bis zum Abitur 1937. Der bekennende Gegner der Nationalsozialisten meldete<br />
sich im zweiten Semester notgedrungen zum Militär, ist ab 1938 Soldat und<br />
Offizier. Bei der Invasion im September 1944 zunächst in belgischer Gefangenschaft,<br />
dann in ein englisches Lager überstellt, studiert er nach der Freilassung 1945 in<br />
München Jura. Dort wird er 1947 in die UNITAS Albertus-Magnus rezipiert, ist<br />
anschließend in Freiburg bei UNITAS Paulus und dann als Gründungssenior bei<br />
UNITAS Rheinfranken in Düsseldorf aktiv.<br />
Sein Beruf führte ihn zur Allianz in Frankfurt, der LVA in Düsseldorf und 1959 nach<br />
Würzburg zur LVA-Unterfranken. Der Direktor in der Rentenversicherungsanstalt wird<br />
auf der 85. GV in Tübingen 1962 als Nachfolger von Dr. Ludwig Florian zum Verbandsgeschäftsführer<br />
gewählt und ist bis 1985 in diesem Amt tätig. 1983 wurde er<br />
nach Ludwig Freibüter sen. (1959) und Dr. Ludwig Florian (1973) dritter Ehrensenior<br />
des Verbandes. Für seine Verdienste bereits 1973 mit der Goldenen UNITAS-Nadel<br />
ausgezeichnet, wurde Bbr. Walter Keller für seine vielfältigen Engagements neben<br />
dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse am Bande auch mit der Lorenz-Werthmann-<br />
Medaille der Caritas und dem Komturkreuz des Päpstlichen Sivesterordens geehrt.<br />
Seine B-Philisterschaften in 16 Altherrenvereinen und seine Ehrenmitgliedschaften<br />
in mehreren Vereinen zeugen von seinem großen Einsatz für die UNITAS. Zu seinem<br />
90. Geburtstag ehrte ihn der UNITAS-Verband mit einem großen Fest (vgl. „Walter<br />
Keller – Ein unitarisches Leben“, in: unitas 3-4/2007).<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 7
„Mehr Lust auf Europa!“ –<br />
EU-PARLAMENTSPRÄSIDENT PROF. DR. HANS-GERT PÖTTERING<br />
APPELLIERT ZUM EINSATZ FÜR EUROPÄISCHE WERTEGEMEINSCHAFT<br />
„Wir wählen in Deutschland am 7. Juni<br />
unsere Abgeordneten des Europäischen<br />
Parlaments. Europa wird immer<br />
bedeutsamer für die Vertretung unserer<br />
Werte und Interessen in der Welt!<br />
Dabei steht das Europäische Parlament<br />
im Mittelpunkt und deswegen<br />
ist es mein Rat an die Bürgerinnen<br />
und Bürger, diese Chance, Europa mitzugestalten,<br />
auch am 7. Juni wahrzunehmen.“<br />
Seinen leidenschaftlichen Appell richtete<br />
Prof. Hans-Gert Pöttering, Präsident des<br />
Europaparlaments, im Gespräch mit der<br />
Verbandszeitschrift vor allem an die Jugend<br />
und motivierte zu aktivem Einsatz für den<br />
europäischen Gedanken: „Die Europäische<br />
Union bedeutet für die junge Generation<br />
Chancen. Sie können überall dort arbeiten,<br />
wo sie möchten, die jungen Menschen kön-<br />
8<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
nen studieren, wo sie möchten, Europa gibt<br />
Unterstützung für die Ausbildung in anderen<br />
Ländern der Europäischen Union. Die<br />
Europäische Union ist in sich heute grenzenlos,<br />
wir haben eine gemeinsame europäische<br />
Währung: In vielen Ländern der<br />
Europäischen Union ist dies eine große<br />
Chance für die junge Generation im 21.<br />
Jahrhundert“, so Pöttering und forderte:<br />
„Mehr Lust auf Europa!“<br />
Europa –<br />
eine Wertegemeinschaft<br />
Prof. Pöttering, der seit 1979 dem Europäischen<br />
Parlament angehört, sprach am<br />
25. Februar beim Sozialpolitischen Aschermittwoch<br />
der Kirchen im Ruhrgebiet im<br />
Essener Dom zum Thema „Europa als<br />
Wertegemeinschaft – Die europäische<br />
Perspektive, Werte, Politik, Wirtschaft“ und<br />
betonte, die Europäische Union (EU) sei<br />
nicht nur eine geografische oder wirtschaftliche<br />
Gemeinschaft. „Die Würde des<br />
Menschen muss immer Maßstab<br />
allen Handelns sein, das ist der Kern<br />
unserer europäischen Überzeugung“,<br />
betonte der Vorsitzende des<br />
Parlaments und ehemalige Fraktionsvorsitzende<br />
der Europäischen<br />
Volkspartei (EVP). Aus diesem Selbstverständnis<br />
entsprängen Menschenrechte,<br />
Demokratie, Freiheit und<br />
Frieden genauso wie die christlichen<br />
Prinzipien von Gerechtigkeit und<br />
Solidarität.<br />
Die Entwicklung der Europäischen<br />
Union von den Römischen<br />
Verträgen 1957 bis zur heute 27<br />
Länder und 500 Millionen Menschen<br />
umfassenden Gemeinschaft zeige in<br />
ihrer Ost-Erweiterung, „dass sich das<br />
christliche Menschenbild gegen den<br />
totalitären Kommunismus durchgesetzt<br />
hat“, erklärte Pöttering. Er bedauerte,<br />
dass es nicht gelungen sei,<br />
den Gottesbezug in der Europäischen<br />
Verfassung zu verankern.<br />
„Doch wir sollten uns als Christen<br />
immer für unsere Prinzipien und<br />
Wertvorstellungen einsetzen, ob es<br />
in der Verfassung steht oder nicht“,<br />
unterstrich der Politiker. Europäer<br />
dürften nicht schweigen, wenn<br />
Menschenrechte und die Würde des<br />
Menschen verletzt würden. „Wir<br />
müssen uns öffnen für die Menschen in<br />
Europa und in der Welt, die noch keine<br />
Chance haben, in Freiheit zu leben.“ Hier<br />
nannte Pöttering Tibet genauso wie die<br />
Christen im Sudan und die Notwendigkeit<br />
einer Friedensregelung im Nahen Osten.<br />
Soeben von einem Aufenthalt im Gaza-<br />
Streifen und Israel zurückgekehrt, betonte<br />
er das „Recht auf Frieden“, und zwar auf<br />
beiden Seiten.„Die Würde der Menschen ist<br />
gleich, sowohl die der Israelis als auch die<br />
der Palästinenser“, unterstrich der Parlamentspräsident.<br />
Der Friedensprozess<br />
müsse weitergehen.<br />
Dialog der Kulturen<br />
angemahnt<br />
Nachdrücklich forderte Pöttering einen<br />
Dialog der Kulturen. „Unsere Zukunft wird<br />
in einem großen Maße davon abhängen,<br />
wie wir mit den Kulturen in der Welt zusammenarbeiten,<br />
vor allem mit dem<br />
Islam“, so die Überzeugung des CDU-<br />
Politikers. Er nannte es eine „politische und
moralische Pflicht“, einen Zusammenprall<br />
der Kulturen zu verhindern. Wenn Muslime<br />
in Europa in Moscheen beten könnten,<br />
müsse es auch Christen erlaubt sein, in islamischen<br />
Ländern ihren Glauben zu leben.<br />
Eine „Einbahnstraße“ dürfe es beim Dialog<br />
der Kulturen nicht geben. „Hier ist eine<br />
Toleranz gefordert, die das Respektieren<br />
anderer Kulturen beinhaltet“, so Pöttering.<br />
„Im Vatikan gibt es auch keine Moschee“,<br />
hatten sich Politiker bei seinem jüngsten<br />
Besuch in Saudi-Arabien herausgeredet,<br />
kritisierte Pöttering. Diese Sichtweise<br />
könne allenfalls für Orte wie Mekka oder<br />
Medina gelten, nicht aber für ein ganzes<br />
Land, habe er entgegnet. In vielen muslimischen<br />
Ländern lebten Hunderttausende<br />
christliche Gastarbeiter, die Gottesdienst<br />
feiern wollten, betonte der Parlamentspräsident.<br />
Warnung vor<br />
nationalen Egoismen<br />
Angesichts der Finanzkrise warnte der<br />
Parlamentspräsident vor nationalen Egoismen.<br />
„Der Markt ist kein Selbstzweck, er<br />
muss dem Menschen dienen“, sagte der<br />
Politiker. In der augenblicklichen Finanzund<br />
Wirtschaftskrise dürfe es keinen<br />
„Rückfall in den Nationalismus“ geben.<br />
Alleingänge bei der Unterstützung einzelner<br />
Wirtschaftsbereiche zerstörten den<br />
europäischen Binnenmarkt. Subventionen<br />
für einzelne Unternehmen oder die Errichtung<br />
von Zollschranken müssten unbedingt<br />
auf europäischer Ebene entschieden<br />
werden, um Europas Binnenmarkt zu bewahren.<br />
Hauptleidtragender sei sonst<br />
wegen des hohen Exports Deutschland.<br />
Pöttering warnte vor unbegrenzter Verschuldung,<br />
einer damit verbundenen Inflationsgefahr<br />
und forderte für das Bankensystem<br />
„Transparenz und eine verantwortungsvolle<br />
Kontrolle“:„Diese Gesetzgebung<br />
müssen wir in den nächsten Monaten verabschieden.“<br />
Mit Blick auf die Wirtschaft<br />
unterstrich er die zentrale Rolle der sozialen<br />
Marktwirtschaft. „Wir sind für den Markt,<br />
weil der Markt den Menschen Freiheit ermöglicht,<br />
aber der Markt ist kein Wert an<br />
sich und kein Zweck in sich, sondern er<br />
muss dem Menschen dienen. Und deswegen<br />
treten wir für die Soziale Marktwirtschaft,<br />
die im Übrigen auch in dem Vertrag<br />
von Lissabon, dem Reformvertrag der Europäischen<br />
Union, Eingang gefunden hat.“<br />
Gefragt zur Rolle der Kirchen im europäischen<br />
Einigungsprozess, machte Pöttering<br />
deutlich, dass ihr Beitrag unverzichtbar<br />
sei:„Die Kirchen sollten sich zu allen Fragen<br />
der Gesellschaftspolitik äußern und dazu<br />
gehört auch die europäische Einigung“,<br />
erklärte der Parlamentspräsident. „Die<br />
Kirchen sollten immer positiv-kritisch die<br />
Europapolitik begleiten. Das wäre mein<br />
Wunsch.“<br />
Robert Schuman<br />
ist ein Vorbild<br />
Bereits zu früherer Gelegenheit hatte<br />
sich Hans-Gert Pöttering im Interview mit<br />
der „<strong>Unitas</strong>“ zur Bedeutung des französischen<br />
Politikers und Bundesbruders<br />
Robert Schuman<br />
(1886 bis 1963) geäußert,<br />
für den am 23. Juni<br />
2004 nach 14-jährigen<br />
Vorarbeiten im Bistum<br />
Metz das Verfahren zur<br />
Seligsprechung im Vatikan<br />
aufgenommen worden<br />
war. Nachdrücklich<br />
unterstrich der Nachfolger<br />
des ersten EU-<br />
Parlamentspräsidenten<br />
die große Rolle des „Vaters<br />
Europas“ für die Gegenwart<br />
und Zukunft:„Robert<br />
Schuman ist ein großes<br />
Vorbild, weil er ein Mann<br />
des Friedens, des Ausgleichs<br />
und der Versöhnung<br />
war. Wenn er<br />
heilig gesprochen werden<br />
würde, würde es seinem Leben entsprechen.<br />
Aber dann sollte man nicht<br />
weitere Politiker heiligsprechen. Er sollte<br />
der krönende Abschluss sein“, erklärte<br />
Pöttering.<br />
Gerne erinnerte sich Pöttering im Gespräch<br />
mit der Verbandszeitschrift noch der<br />
125. UNITAS-Generalversammlung 2002 in<br />
Münster. Damals hatte der damalige EVP-<br />
Fraktionsvorsitzende als Festredner beim<br />
Festkommers in der Halle Münsterland<br />
gesprochen.<br />
C. Beckmann<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, geboren<br />
am 15. September 1945 in Bersenbrück /<br />
Niedersachsen.<br />
Studium der Rechtswissenschaften,<br />
Politik und Geschichte an den Universitäten<br />
Bonn und Genf sowie am Institut<br />
des Hautes Études Internationales, Genf.<br />
Studienaufenthalt an der Columbia<br />
University, New York, 1976 zweites juristisches<br />
Staatsexamen; 1974 Promotion,<br />
1974 bis 1980 europapolitischer Sprecher<br />
der Jungen Union Niedersachsen. 1976<br />
bis 1979 wissenschaftlicher Angestellter,<br />
zahlreiche Veröffentlichungen zur europäischen<br />
Politik, Berufung zum Honorarprofessor<br />
an der Universität Osnabrück<br />
im September 1995.<br />
Seit 1990 CDU-Kreisvorsitzender im<br />
Landkreis Osnabrück. Mitglied des<br />
Europäischen Parlaments seit 1979; 1981-<br />
1991 Landesvorsitzender der Europa-<br />
Union Niedersachsen, 1984 bis 1994 Vorsitzender<br />
des Unterausschusses „Sicherheit<br />
und Abrüstung“; 1994 bis 1999 stellvertretender<br />
Fraktionsvorsitzender der<br />
Europäischen Volkspartei, 1996-1999<br />
Leitung der Arbeitsgruppe „Erweiterung<br />
der Europäischen Union“. 1997-1999<br />
Präsident der Europa-Union Deutschland.<br />
Mitglied im Ausschuss für auswärtige<br />
Angelegenheiten, Menschenrechte,<br />
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik,<br />
Fraktionsvorsitzender der<br />
EVP im Europäischen Parlament.<br />
Am 16. Januar 2007 wurde Prof. Hans-<br />
Gert Pöttering zum Präsidenten des<br />
Europäischen Parlaments gewählt.<br />
Weitere Quellen: Bistum Essen,<br />
Foto: Nicole Cronauge<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 9
60 Jahre Bundesrepublik Deutschland<br />
FRIEDRICH NOWOTTNY BEIM NEUJAHRSEMPFANG DER UNITAS-SALIA<br />
VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS<br />
Wie jedes Jahr hatte die UNITAS-Salia Bonn zu ihrem Neujahrsempfang<br />
am 23. Januar wieder einen Ehrengast eingeladen:<br />
Friedrich Nowottny, ehemaliger WDR-Intendant und langjähriger<br />
Moderator des ARD-Fernsehmagazins „Bericht aus Bonn“, blickte<br />
zurück auf die vergangenen 60 Jahre seit der Gründung der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Schon lange, bevor der populäre Medienmann<br />
eintraf, war der große Saal des Salia-Hauses bis auf den letzten<br />
Platz gefüllt. Manche konnten das Geschehen nur noch vom<br />
Foyer aus verfolgen. So freute sich Senior Robert Weichselbaum,<br />
rund 100 Gäste begrüßen zu können, darunter den Altherrenbunds-<br />
Vorsitzenden Heinrich Sudmann und Verbandsgeschäftsführer<br />
Dieter Krüll. Anekdotenreich und mit zahlreichen Aperçus ließ<br />
Friedrich Nowottny in Schlaglichtern die ersten 60 Jahre der<br />
Bundesrepublik Revue passieren.<br />
Nowottny lenkte zunächst den Blick auf<br />
die Haltung der Deutschen zu Politik und<br />
Politikern. Er sieht eine „gewisse Skepsis,<br />
wenn sie auf die Akteure der Politik schauen“.<br />
Sie seien oft verdrossen. Sie seien<br />
manchmal interessiert, aber nicht sehr.<br />
Politik werde eher beiläufig wahrgenommen.<br />
Doch dies kann nach Auffassung des<br />
Redners nicht verwundern angesichts der<br />
Kompliziertheit heutiger Probleme und der<br />
vorgeschlagenen Lösungswege. „Kein<br />
Mensch, außer vielleicht im Regierungsviertel<br />
in Berlin-Mitte und früher in Bonn,<br />
beschäftigt sich den ganzen Tag mit<br />
Politik.“ Dafür gebe es die Politiker, und die<br />
Bürger gingen davon aus, „dass Politik<br />
gefälligst funktionieren sollte“. Doch da<br />
bestünden oft Zweifel, ob dies auch tatsächlich<br />
der Fall ist.<br />
Zwischen Politikern<br />
und ihren Wählern habe<br />
es immer eine natürlichkritische<br />
Distanz gegeben,<br />
sagte Nowottny. Und dies<br />
sei auch gut so. Dennoch<br />
hält er die Beteiligung an<br />
den Wahlen zum Deutschen<br />
Bundestag im internationalen<br />
Vergleich für<br />
bemerkenswert hoch.<br />
Zwischen 1953 und 1987<br />
lag sie in den hohen 80er-<br />
Werten, 1972 bei der so<br />
genannten „Willy-Wahl“ –<br />
gemeint ist Willy Brandt –<br />
sogar bei 91 Prozent. Seit<br />
der Wiedervereinigung<br />
bröckeln die hohen Werte<br />
10<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
allerdings. „Unsere Brüder und Schwestern<br />
in den neuen Bundesländern wählen weniger<br />
als die Wessis“, so die Feststellung des<br />
Polit-Journalisten. Die ersten gesamtdeutschen<br />
Wahlen am 2.12.1990 kamen auf Beteiligungswerte<br />
von 77,8 Prozent; 2002<br />
waren es 79,1 Prozent und 2005 77,7 Prozent.<br />
Der Redner hob hervor, dass bei der ersten<br />
Bundestagswahl im Jahr 1949 78,5 Prozent<br />
der Deutschen zur Wahlurne gegangen<br />
waren, also mehr als bei der Wahl 2005.<br />
Abgeordnete sind<br />
ganz normale Menschen<br />
Friedrich Nowottny glaubt aber, dass<br />
Politikerverdrossenheit nur eine sehr pau-<br />
Friedrich Nowottny bei seinem lebendigen Rückblick auf die<br />
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer<br />
Gründung im Jahr 1949<br />
schale und ungenaue Einschätzung ist<br />
für die schwindende Bereitschaft, wählen<br />
zu gehen. Inzwischen habe sich ja auch<br />
herumgesprochen, dass die Abgeordneten,<br />
ganz normale Menschen sind mit sehr<br />
unterschiedlichen Charaktereigenschaften,<br />
mit ganz unterschiedlichen Temperamenten<br />
und Begabungen, zumeist mit einem<br />
ausgeprägten Selbstwertgefühl. „Manche<br />
sollen sogar Machtgelüste haben“, spottete<br />
der ehemalige WDR-Intendant. Natürlich<br />
gebe es auch die Idealisten, „die ehrliche<br />
Haut“, aber ebenso die „skrupellosen Ehrgeizlinge“<br />
und die Abgeordneten, „die<br />
schon mal mit den Versuchungen zu kämpfen<br />
haben, die ihnen in Berlin und anderswo<br />
begegnen. „Allerdings wird es in unserem<br />
medienbestimmten Politikalltag für<br />
Politiker immer schwerer,<br />
ihr Tun im Verborgenen<br />
abzuwickeln“, so der<br />
erfahrene Journalist, der<br />
die bundesdeutsche Medienkultur<br />
maßgeblich<br />
mitgeprägt hat.<br />
Nowottny bedauerte<br />
in diesem Zusammenhang,<br />
dass es heute immer<br />
weniger Stammtische<br />
gebe. Dort habe<br />
man sich früher so richtig<br />
„abarbeiten“ können.<br />
„Also wenn sie einen<br />
haben, schätzen sie sich<br />
glücklich, räsonieren Sie,<br />
schimpfen oder loben<br />
Sie, wenn es um die<br />
Agenda 2010 oder das
Rauchverbot, um die Suche nach Abgaswerten<br />
oder die Verschrottungsprämien für<br />
acht Jahre alte Autos geht“, ermuntere der<br />
Redner die Zuhörer zum politischen Disput<br />
am Stammtisch.<br />
Abgeordnete müssen um geplante Vorhaben<br />
häufig werben und kämpfen – erst<br />
in den Parteien und dann bei den Wählern.<br />
Dabei geraten sie nicht selten intern und<br />
extern unter Druck: „Sie müssen ihr Verhalten<br />
abwägen, gelegentlich rechtfertigen;<br />
sie müssen oft dem Druck der<br />
Lobbyisten-Regimenter widerstehen“, stellte<br />
Nowotny fest. Die Zahl der Lobbyisten<br />
hat sich in Berlin gegenüber der Bonner Zeit<br />
verdreifacht und ist dort inzwischen ein<br />
wichtiger Wirtschaftszweig geworden. Und<br />
Friedrich Nowottny fordert: „Bei allem, was<br />
Abgeordnete tun, sollten sie daran denken,<br />
dass sie Vertreter des ganzen Volkes sind –<br />
gemäß Artikel 38 (1) des Grundgesetzes ‚an<br />
Aufträge und Weisungen nicht gebunden<br />
und nur ihrem Gewissen unterworfen‘.“<br />
Manchmal sei die Frage zu hören: „Verlangt<br />
man heute nicht einfach zu viel von<br />
der Politik?“ Doch das Mitgefühl des Vollblutjournalisten<br />
hält sich in Grenzen. Auch<br />
der erste Kanzler des damals noch geteilten<br />
Landes, Konrad Adenauer, habe seine<br />
Schwierigkeiten gehabt mit der CDU und<br />
der CSU, mit der Opposition, mit den<br />
Ländern und dem Bundesrat, mit Parteifreunden,<br />
mit der Wirtschaft und ihrer<br />
Lobby und mit den Besatzungsmächten, die<br />
die eigentlichen Herren im Lande waren.<br />
„Aber Konrad Adenauer war eine Autorität<br />
und bereit, autoritär und verantwortungsbewusst<br />
ohne Netz und doppelten Boden<br />
zu handeln, wo ihm das notwendig erschien“,<br />
so Nowottnys Antwort auf die Ausgangsfrage.<br />
Die Zahl seiner Freunde habe Adenauer<br />
immer überschaubar gehalten. Er habe<br />
seine ganz spezielle Sicht zum Thema<br />
„Freundschaft und Feindschaft in der Politik“<br />
gehabt. Freund und Feind waren bei<br />
ihm klar definiert in der Steigerung „Feind,<br />
Erzfeind, Parteifreund“. „Warum mir in diesem<br />
Zusammenhang gerade der Name<br />
Ypsilanti einfällt, weiß ich nicht“, spöttelte<br />
Friedrich Nowottny.<br />
Politikergenerationen seit 1949<br />
Dann blickte er zurück auf die verschiedenen<br />
Politikergenerationen seit der Gründung<br />
der Bundesrepublik. Die erste Bundesregierung<br />
sei noch von Persönlichkeiten<br />
dominiert worden, deren Auffassungen<br />
und Verhaltensformen den Werteskalen<br />
des 19. Jahrhunderts entsprochen hätten.<br />
Ihr folgte die „Front- und Kriegsgeneration“<br />
– Überlebende des II. Weltkriegs. „Es war<br />
gestern schon eindrucksvoll zu sehen, wie<br />
der alte Schmidt immer noch aus dieser<br />
Zeit geprägt ist“, bekannte der Redner fast<br />
etwas wehmütig im Blick auf<br />
eine Veranstaltung am<br />
Vortag in Hamburg anlässlich<br />
des 90. Geburtstags von<br />
Alt-Kanzler Helmut Schmidt.<br />
Dann folgten die so<br />
genannten „Flakhelfer“ und<br />
die „Volksstürmer“, zu denen<br />
sich auch Nowottny zählt.<br />
„Wir haben ja Kriegserfahrungen<br />
zu verarbeiten,<br />
die wir mit fünfzehn, sechzehn<br />
Jahren gemacht haben“,<br />
so der fast Achtzigjährige.<br />
Dann hätten sich –<br />
zunächst unmerklich und<br />
dann immer auffälliger – die<br />
68er in die politische Szene<br />
des Landes eingemischt.„Die<br />
Damen und Herren, die<br />
damals in den 70er und 80er<br />
Jahren diesen Staat abschotten<br />
wollten, genießen<br />
ja zumeist heute die staatlichen<br />
Pensionsregelungen<br />
und erinnern sich mit großem<br />
Vergnügen an die Zeiten,<br />
zu denen sie versucht<br />
haben, die Axt an dieses<br />
Staatsgebilde zu legen“, lautete<br />
der ironische Kommentar<br />
des Pioniers des Infotainments<br />
im deutschen Fernsehen.<br />
Es kam zu einer für<br />
Bonn und den Rest der<br />
Republik für die damalige<br />
Zeit neuen „Demonstrationskultur“,<br />
etwa gegen die<br />
Notstandsgesetze und die<br />
Nachrüstung. Die RAF habe<br />
versucht, die Bundesrepublik<br />
zu liquidieren, was ihr Gott<br />
sei Dank nicht gelungen sei.<br />
„Die heute gelegentliche<br />
Beweihräucherung dieser<br />
Terroristenbande kann ich<br />
überhaupt nicht begreifen“,<br />
ärgerte sich Nowottny.<br />
In der Folgezeit versammelten<br />
sich dann die Versprengten<br />
von links, aber<br />
auch das Protestpotenzial<br />
aus den bürgerlichen Lagern bei den<br />
„Grünen“, die 1983 in das Parlament einzogen.<br />
Die heutige Politikergeneration sieht<br />
Friedrich Nowottny als eine Mischung, die<br />
man nach Gutdünken als „Internet-,<br />
Google- oder Globalisierungsgeneration“<br />
bezeichnen könne. Der scharfzüngige Medienmann<br />
konnte sich an dieser Stelle die<br />
spöttische Bemerkung nicht verkneifen,<br />
dass bei manchen jungen, aufstrebenden<br />
Nachwuchspolitikern das Bemühen zu<br />
beobachten sei, „auf möglichst kurzem<br />
Wege an die Schaltstellen der Politik zu<br />
kommen nach dem Karrieremuster ‚Kreis-<br />
saal, Hörsaal, Plenarsaal‘.“<br />
„Wenn wir das heutige<br />
parlamentarische<br />
Getümmel in Bund und<br />
Ländern sehen, dürfen<br />
wir eines nicht vergessen:<br />
In den Bundestagen<br />
der Gründerzeit<br />
wurde auch mit harten<br />
Bandagen um die neue<br />
Staatsordnung gerungen“,<br />
erinnerte Nowottny.<br />
1949 saßen<br />
noch acht Parteien im<br />
Parlament und kämpften<br />
dort um Geltung,<br />
„darunter Kommunisten<br />
und alte Nazis“.<br />
Dies habe sich später<br />
durch die Einführung<br />
der Fünf-Prozent-Klausel<br />
etwas entspannt.<br />
Gerungen wurde in<br />
den ersten Jahren um<br />
grundsätzliche Fragen<br />
des neuen Staatswesens,<br />
etwa um eine<br />
neue Wirtschaftsordnung,<br />
um eine neue<br />
Bündnispolitik angesichts<br />
des heraufziehenden<br />
„Kalten Krieges“,<br />
um eine neue soziale<br />
Ordnung. Zwölf<br />
Millionen Flüchtlinge<br />
mussten in das Land<br />
integriert werden: „Ich<br />
halte das immer noch<br />
für eine der herausragenden<br />
Leistungen dieser<br />
Gesellschaft“, betonte<br />
Nowottny. Dies<br />
sei völlig in Vergessenheit<br />
geraten. „Frieden<br />
auf dem Kontinent erhob<br />
sich nur mühsam<br />
aus den Trümmern<br />
des Krieges, und man<br />
versuchte an neue Ufer<br />
zu kommen.“<br />
Turbulente Zeiten in den ersten<br />
Jahren des Bundestages<br />
Es seien stürmische Zeiten im Bundestag<br />
unten am Rhein gewesen. Der Präsident<br />
habe es dabei äußerst schwer gehabt,<br />
Ordnung zu schaffen, Beleidigungen<br />
zu ahnden und Tumulte zu unterbinden.<br />
Damals sei es ganz normal gewesen, den<br />
gegnerischen Debattenredner als „Verleumder“<br />
oder „Kriegshetzer“ zu beschimpfen.<br />
„Der langjährige Fraktionschef der SPD,<br />
Herbert Wehner, schien gar Ordnungsrufe<br />
zu sammeln wie andere Briefmarken“,<br />
bemerkte Friedrich Nowottny. >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 11
Der gelernte Journalist konnte natürlich<br />
auch nicht umhin, die Rolle der Medien in<br />
der Politik näher zu beleuchten. Er verwies<br />
auf die Flut von Informationen, mit denen<br />
die Medien von allen Seiten gefüttert werden<br />
und aus denen die wesentlichen Nachrichten<br />
herausgefiltert werden müssen.<br />
Täglich erreichen die Deutsche Presse-<br />
Agentur rund 500 Faxe, 500 E-Mails und<br />
ungezählte Telefonate. Hinzu kommen<br />
Berichte von Korrespondenten aus dem Inund<br />
Ausland, aus Pressekonferenzen und<br />
oft genug auch Indiskretionen.<br />
Politik und Medien sind aufeinander<br />
angewiesen<br />
Dann sind da noch die Netzwerke und<br />
Seilschaften der Politiker, vornehmlich mit<br />
der Wirtschaft und mit Journalisten. „Diese<br />
sind so gut wie unsichtbar, aber sie funktionieren<br />
ganz gut“, stellte Nowottny fest.<br />
Medien und Politik seien aufeinander angewiesen<br />
und die Medienvertreter seien<br />
dankbar für jede Schlagzeile, die ihnen über<br />
die alltäglichen Themen hinaus etwas<br />
Besonderes biete. Als Beispiel nannte er die<br />
Fürther Landrätin Pauli: „Glauben Sie denn,<br />
diese Dame hätte ohne Medienhilfe die<br />
CSU-Szene in München so durcheinander<br />
wirbeln können – mit dem Sturz des Regierungschefs,<br />
mit Wahlen, die die CSU so<br />
schlecht haben aussehen lassen wie nie<br />
zuvor in der Geschichte?“<br />
12<br />
Zur Person<br />
Friedrich Nowottny wurde am 16. Mai<br />
1929 in Hindenburg, Oberschlesien<br />
(heute Zabrze, Polen) geboren. Nach<br />
seinem Schulabschluss arbeitete er<br />
von 1946 bis 1948 bei der britischen<br />
Besatzungsmacht in Bielefeld. Dort<br />
begann er auch 1948 seine Medienkarriere<br />
als freier Mitarbeiter bei der<br />
Tageszeitung Freie Presse, wo er zum<br />
Ressortleiter aufstieg. 1962 wechselte<br />
Nowottny zum Saarländischen Rundfunk<br />
und wurde Leiter der Fernsehabteilung<br />
für Wirtschaft und Soziales.<br />
1967 ging er zum WDR als stellv. Leiter<br />
des Studio-Bonn, dessen Chef er 1973<br />
wurde. Bis 1985 moderierte er genau<br />
1000-mal die Sendung „Bericht aus<br />
Bonn“ und machte das Polit-Magazin<br />
zur Institution. Von 1985 bis 1995 war<br />
Friedrich Nowottny Intendant des<br />
WDR, 1991 und 1992 gleichzeitig<br />
Vorsitzender der ARD. Heute arbeitet<br />
der fast Achtzigjährige noch als freier<br />
Journalist und Medienberater.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Netzwerke und Seilschaften<br />
funktionieren nach Auffassung<br />
des alt gedienten Medienexperten<br />
überall dort, wo es um<br />
Macht und Einfluss geht – in<br />
der Politik und im Zusammenspiel<br />
von Politik, Medien und<br />
Wirtschaft. „Verlassen Sie sich<br />
darauf: Wer im politischen<br />
Alltag – und nicht nur da –<br />
einen Konkurrenten in ein<br />
schiefes Licht stellen möchte,<br />
der findet jemanden in den<br />
Medien, der ihm dabei hilft“,<br />
betonte Nowottny.<br />
Eher kritisch bewertete er<br />
den starken Einfluss von Voraussagen<br />
und Umfragen in der<br />
heutigen „Prognosegesellschaft“.<br />
So legten viele Wirtschaftsforschungsinstitutejeden<br />
Tag neue Zahlen auf den<br />
Tisch. Sage das Institut A eine<br />
günstige Konjunkturentwicklung<br />
voraus, widerspreche das<br />
Institut B sofort vehement; beides<br />
werde gedruckt mit dem<br />
Anspruch der Seriosität. „Was<br />
diese Institute schon angerichtet<br />
haben im Zusammenwirken<br />
mit den Medien, geht auf keine<br />
Kuhhaut“, empörte sich Nowottny.<br />
Gleiches gelte für die „Zielgenauigkeit“<br />
der Demoskopen,<br />
die uns täglich mit neuen Erkenntnissen<br />
beglückten. Wenn man heute<br />
sage, Angela Merkel strebe die Farbkombination<br />
schwarz/gelb an, würde dies dem<br />
von den Meinungsforschern veröffentlichten<br />
Bild der Gegenwart entsprechen. Aber<br />
niemand wisse, ob die Kanzlerin dies<br />
wirklich wolle. „Denn die große Koalition<br />
hat auch viele Vorteile für sie. Sie kann<br />
an Dingen mitwirken, mit denen sie in<br />
der eigenen Partei nie durchgekommen<br />
ist“, hielt Friedrich Nowottny dem entgegen.<br />
„Es ist nicht ganz einfach, im Wettlauf<br />
um die höchstmögliche Beliebtheit bei den<br />
Wählern immer die vorderen Plätze zu belegen“,<br />
sagte der alte Fahrensmann. Auch in<br />
den eigenen Parteien werde mit Argusaugen<br />
verfolgt, wie es um das Ansehen der<br />
Spitzenleute bestellt sei, denn das eigene<br />
Mandat hänge auch vom Erfolg der Führungspersonen<br />
ab. „Denken Sie nur daran,<br />
wie viele sozialdemokratische Abgeordnete<br />
sich in Hessen eben noch im Landtag<br />
wähnten und nun sauer sind, dass sie durch<br />
das schlechte Abschneiden der SPD nicht<br />
mehr in das Parlament gekommen sind.<br />
Und wie viele bei der CDU vergeblich<br />
gehofft haben, einen Riesensieg ihrer Partei<br />
feiern zu können, und nun feststellen mussten,<br />
dass das Ergebnis für Roland Koch auch<br />
nicht sehr viel besser war als das Resultat,<br />
Nach der Verabschiedung des Grundgesetzes gründet der<br />
Parlamentarische Rat auf seiner letzten Sitzung am 23. Mai<br />
1949 die Bundesrepublik Deutschland • Beurkundungsseite<br />
des Grundgesetzes<br />
das er ein Jahr zuvor hatte“, untermauerte<br />
Nowottny seine These.<br />
Machtspiele gehören<br />
zum Geschäft<br />
Probleme mit dem Führungspersonal<br />
seien in der Geschichte der Bundesrepublik<br />
schon häufig mit offenem oder verstecktem<br />
Mobbing geregelt worden.<br />
„Machtspiele gehören zum politischen<br />
Geschäft dazu“, bemerkte Friedrich Nowottny<br />
und erinnerte an die Art und Weise,<br />
wie die CDU-Vorsitzende Angela Merkel<br />
ihren damaligen Fraktionschef Friedrich<br />
Merz aus seinem Amt „gekegelt“ habe,<br />
ohne dass dieser sich groß dagegen wehren<br />
konnte.<br />
Das Ziel, für die eigene Sache in der<br />
Politik Aufmerksamkeit zu mobilisieren,<br />
war – so die Beobachtung des ehemaligen<br />
Chefs der größten deutschen Fernsehanstalt<br />
– in den Gründerjahren einfacher als<br />
heute. Es war alles etwas behäbiger.<br />
Damals habe noch nicht der Konkurrenzkampf<br />
getobt, den wir in jüngerer Zeit erleben.<br />
„Für einige Sekunden in den TV-Hauptnachrichtensendungen,<br />
für einen Platz in<br />
den Talkshows, gleichgültig in welchem<br />
Programm, für Präsenz in den Radionach-
ichten werden heute ungewöhnlicheAnstrengungen<br />
unternommen.<br />
Wer in den Morgensendungen<br />
des Radios<br />
und des Fernsehens<br />
Interviews gab oder gibt,<br />
dem gehörten die Nachrichten<br />
bis zu den Mittagsstunden“,<br />
hob Nowottny<br />
hervor. Ein „Musterexemplar“<br />
für diese<br />
„Fleiß-Frühaufsteher“ sei<br />
Hans-Dietrich Genscher<br />
gewesen. Er habe um<br />
sechs Uhr Deutschlandfunk<br />
gehört, sei dann<br />
bereits um halb sieben<br />
mit einer Stellungnahme<br />
zu irgendeinem Thema<br />
auf Sendung gewesen<br />
und habe bis zwölf die<br />
Nachrichten beherrscht.<br />
Vom Liebling<br />
zum Prügelknaben<br />
Die Mächtigen der Politik lassen sich<br />
gerne von der Sonne der Öffentlichkeit bescheinen.<br />
Schwindet nämlich die Macht<br />
und verbleicht der Glanz der Erfolge, so<br />
schwindet auch die Anhänglichkeit der<br />
Parteifreunde und der Medien: „Eben noch<br />
hoch gelobt und hoch geschrieben, findet<br />
sich mancher Politiker schon kurze Zeit später<br />
auf der Liste der Absteiger. Vom Liebling<br />
zum Prügelknaben, das ist ein ganz kurzer<br />
Weg“, erklärte Nowottny.<br />
Als Beispiele aus der Vergangenheit<br />
nannte er Ludwig Erhard, den „Vater des<br />
Wirtschaftswunders“. Und Rainer Barzel –<br />
CDU-Vorsitzender und Fraktionschef der<br />
Union im Bundestag, ein aufopferungsvoller<br />
Parteisoldat und Kanzlerkandidat. Sie seien<br />
dem Druck nicht gewachsen gewesen, der<br />
von den eigenen Parteifreunden und von<br />
der politischen Großwetterlage ausgegan-<br />
Das Museum König in Bonn – 1948/49 Tagungsort des<br />
Parlamentarischen Rates<br />
Die deutschen Bundeskanzler seit 1949:<br />
(obere Reihe, v. l.) Konrad Adenauer (1949-1963), Ludwig Erhard (1963-1966),<br />
Kurt-Georg Kiesinger (1966-1969), Willy Brandt (1969-1974);<br />
(untere Reihe, v. l.) Helmut Schmidt(1974-1982), Helmut Kohl (1982-1998),<br />
Gerhard Schröder (1998-2005), Angela Merkel (seit 2005)<br />
gen sei. Auch Karl Schiller und Alex Möller,<br />
beide Sozialdemokraten, gehören nach<br />
Auffassung von Friedrich Nowottny in diese<br />
Reihe. Schiller sei ein großartiger Wirtschaftsminister<br />
und Möller ein hervorragender<br />
Finanzminister gewesen. Beide seien<br />
aber an den Forderungen ihrer Partei zerbrochen<br />
und politisch gescheitert.<br />
Der langjährige Moderator des „Berichts<br />
aus Bonn“ erinnerte sich, dass kein<br />
Kanzler von den Medien gestürzt wurde,<br />
wie so gern behauptet werde. Dies sei<br />
zumeist von den Rivalen und Konkurrenten<br />
aus den eigenen Parteien besorgt worden.<br />
So war Konrad Adenauer zwar in erster<br />
Linie sein eigenes Opfer, weil er nicht abtreten<br />
wollte. Aber die CDU habe ihn am Ende<br />
eben auch „abserviert“. Obwohl Ludwig<br />
Erhard als Wirtschaftsminister für die<br />
Union viele Wahlen gewonnen hat, ist er als<br />
Kanzler an der eigenen Partei gescheitert.<br />
Kurt-Georg Kiesinger, Kanzler der ersten<br />
großen Koalition zwischen 1966 und 1969,<br />
verlor seine Parteiämter<br />
nach der Gründung der<br />
sozial-liberalen Koalition<br />
zwischen SPD und FDP im<br />
Jahr 1969, weil er diese<br />
neue Konstellation nicht<br />
verhindern konnte. Willy<br />
Brandt hatte sein Amt<br />
aus Gründen aufgegeben,<br />
die mit dem DDR-Spion<br />
Guillaume nicht wirklich<br />
überzeugend zu erklären<br />
waren; vielmehr fürchteten<br />
die SPD und ihre<br />
Abgeordneten im Bundestag<br />
um ihren Erfolg<br />
und ihre Mandate.<br />
Schließlich verlor Helmut<br />
Schmidt in der SPD mit<br />
dem Nachrüstungsbeschluss<br />
indirekt die Mehr-<br />
heit und wurde durch ein konstruktives<br />
Misstrauensvotum am 1. Oktober<br />
1982 von Helmut Kohl abgelöst.<br />
Kohl war dann der erste Bundeskanzler,<br />
der – so Nowottny –<br />
„durch das Wahlvolk in die Wüste<br />
geschickt wurde“. Gerhard Schröder<br />
war der zweite.<br />
Kohl war kein Medienkanzler:<br />
„Ich weiß, wovon ich rede“, bekräftigte<br />
Friedrich Nowottny diese Erkenntnis.<br />
„Im Gegensatz zum<br />
Selbstverständnis von Gerhard<br />
Schröder, der ja glaubte – um seine<br />
eigenen Worte zu zitieren – ‚Bild,<br />
BamS und Glotze‘ zu seinen Helfern<br />
machen zu können, um so sein<br />
Mandat auf Ewigkeit sichern zu<br />
können.“ Kohl habe die Welt hingegen<br />
schlicht und einfach nach<br />
Freund und Feind sortiert – auch bei<br />
den Medien. Dem Spiegel, einstmals<br />
Themenvorgeber der Nation, habe<br />
er seit 1976 jedes Interview verweigert.<br />
Anderen Wochenblättern sei es ebenso<br />
gegangen.<br />
Helmut Kohl habe seine Stärke aus seiner<br />
Partei, der CDU bezogen, „die er kraftvoll<br />
geführt habe „mit dem dichtesten<br />
Netzwerk, das ein einzelner Mensch überhaupt<br />
haben konnte“. Er sei auch „König der<br />
Telefonherrschaft“ gewesen, wusste Nowottny<br />
zu berichten. „Wenn irgendein<br />
Kreisvorsitzender auf einem Parteitag 15<br />
Stimmen bringen konnte, rief er ihn an, weil<br />
er glaubte, diesen Mann für sich gewinnen<br />
zu müssen.“ Manchmal hätten die Angerufenen<br />
geglaubt, sie seien einem Stimmenimitator<br />
aufgesessen.<br />
Medien liegen Kanzlerin<br />
zu Füßen<br />
Die aktuelle Kanzlerin Angela Merkel<br />
hat sich nach Einschätzung von Friedrich<br />
Nowottny außerordentlich schnell mit den<br />
Spielregeln der Berliner Machtinstrumente<br />
vertraut gemacht. Die Masse ihrer publizistischen<br />
Bemühungen lasse erkennen, dass<br />
sie nicht nur Kanzlerin, sondern gleichzeitig<br />
auch CDU-Vorsitzende ist, die den permanenten<br />
Wahlkampf nicht scheut. Glaube<br />
man den Meinungsumfragen, so hat sie<br />
großen Erfolg damit: „Die Medien liegen<br />
der Kanzlerin zu Füßen und Angela Merkel<br />
wird glänzend bedient.“<br />
Schon in den Jahren als Oppositionsführerin<br />
habe Merkel gezeigt, dass sie eine<br />
„Langstreckenläuferin“ sei. „Sie hat die<br />
Fähigkeit, Vergangenheit hinter sich zu lassen,<br />
auch die eigene“, stellte der Redner<br />
fest. Sie passe ihr Handeln geschmeidig<br />
den erkennbaren Gestaltungsmöglichkeiten<br />
an. Dabei scheine sie auch in Kauf zu<br />
nehmen, in den Wirtschaftskreisen der<br />
eigenen Partei verdächtigt zu werden, eine >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 13
Sozialdemokratisierung der CDU zu betreiben.<br />
Friedrich Nowottny hält diesen Vorwurf<br />
für übertrieben. Merkel komme es<br />
nach seiner Meinung darauf an, zunächst<br />
einmal die große Koalition über die Runden<br />
zu bringen. Dafür mache sie viele Zugeständnisse.<br />
Noch bis vor kurzem habe sie<br />
propagiert: „Mindestlohn wird es mit mir<br />
nicht geben!“ Und jetzt haben wir bereits<br />
Mindestlöhne für mindesten vier Millionen<br />
Arbeitnehmer.<br />
Verlässliche politische Stabilität<br />
Der erfahrene Beobachter der politischen<br />
Szene hob hervor, „dass wir mit der<br />
zweiten deutschen Republik mehr Glück<br />
hatten als mit der ersten“. Im Gegensatz zu<br />
den Jahren 1919 bis 1933 gab es nach 1949<br />
eine „verlässliche politische Stabilität“.<br />
Parteien von ganz rechts und ganz links, die<br />
versuchen, die Politikverdrossenen aufzufangen,<br />
werde es auch in Zukunft geben.<br />
„Sie haben die Grundlagen der Bundesrepublik<br />
Deutschland aber nicht zerstören<br />
können“, so Friedrich Nowottny. Allerdings<br />
wagte er keine Prognose, ob dies so bleibe.<br />
Wirtschaftlich wurde Deutschland nach<br />
dem Zusammenbruch zu einer weltweit<br />
führenden, stabilen Industrienation. Die<br />
Älteren haben 1948 eine Währungsreform<br />
und die damit verbundene vollständige<br />
Geldentwertung überstanden. Und alle<br />
haben gelernt, mit dem Euro umzugehen.<br />
Der Neujahrs-Empfang bietet auch immer eine gute Gelegenheit<br />
zur Begegnung und zum Gespräch<br />
14<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
„Ich finde, auch daraus<br />
wurde eine<br />
großartige Erfolgsgeschichte.<br />
Ohne den<br />
Euro sähe die heutige<br />
Finanzkrise noch sehr<br />
viel schlimmer aus,<br />
als es ohnehin schon<br />
der Fall ist“, lobte<br />
Nowottny.<br />
Er erwähnte weiter<br />
den immensen<br />
Kraftaufwand der<br />
bundesrepublikanischen<br />
Gesellschaft,<br />
der zur Wiedervereinigung<br />
der beiden<br />
deutschen Staaten<br />
notwendig war. Die<br />
Deutschen seien<br />
auch nicht Opfer der<br />
weltweiten Globalisierung geworden, wobei<br />
er ausdrücklich den Kapitalmarkt ausnahm.<br />
Für die Kompetenz der Banker fand<br />
er nur Spott. Schon als junger Wirtschaftsredakteur<br />
habe er immer gesagt: „Bankiers<br />
unterscheiden sich von uns nur dadurch,<br />
dass sie den besseren Schneider haben.“<br />
Den Menschen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland bescheinigte Nowottny, viele<br />
Krisen überstanden und gegen Ängste angekämpft<br />
zu haben, „so wie wir das auch<br />
jetzt tun“.Wir hätten unsinnige, von der Politik<br />
vorgegebene Rahmenbedingungen<br />
verarbeitet, ohne in die Knie<br />
zu gehen. Deutschland blieb<br />
nach 1945 von Kriegen verschont<br />
– die längste Friedensperiode<br />
seit der Zeit<br />
Bismarcks. „Jetzt müssen wir<br />
mit neuen Bedrohungen fertig<br />
werden: Der Terrorismus,<br />
der Einsatz deutscher Soldaten<br />
im Balkankonflikt und<br />
in Afghanistan schaffen<br />
neue, unkalkulierbare Risiken<br />
auch für unser Land“,<br />
sagte Friedrich Nowottny.<br />
Der Senior der UNITAS-Salia, Robert Weichselbaum,<br />
bedankt sich bei Friedrich Nowottny mit einem Wein-Geschenk.<br />
Links: der AHV-Vors. Dr. Winfried Gottschlich<br />
Und weiter:„Wir alle hatten<br />
und haben oft den Mut,<br />
mit zum Teil scharfer Kritik<br />
zu begleiten, was die da<br />
oben angerichtet und uns<br />
beschert haben. Ich finde,<br />
das gehört einfach dazu.“ In<br />
einem stabilen, demokratischen<br />
Gemeinwesen müssten<br />
die vom Volk Gewählten<br />
und damit auch dem Volk<br />
Verantwortlichen damit<br />
rechnen, oft im Mittelpunkt<br />
kritischer Auseinandersetzungen<br />
zu stehen.<br />
Im Blick auf die aktuellen<br />
Konjunkturprogramme betonte<br />
der frühere Wirt-<br />
schaftsredakteur: „Den Sozialstaat tragen<br />
wir alle.“ Er sei die Grundlage der Stabilität<br />
unseres Landes. Wer diese Stabilität aufs<br />
Spiel setze, gleichgültig ob als Gesetzgeber<br />
oder durch Missbrauch, „muss sicher mit<br />
unserem Einspruch rechnen“.<br />
Politik vollzieht sich – so Nowottny –<br />
überall auf der Welt im Spannungsfeld von<br />
Machtansprüchen. Es sei Sache der Politik,<br />
die sich daraus oft ergebenden Spannungszustände<br />
aufzufangen und zu lösen. Aber<br />
eben nicht nur der Politik allein. „Schauen<br />
wir ihr also auf die Finger und zögern wir<br />
nicht, auch schon mal auf den Tisch zu<br />
hauen, und zwar so, dass diejenigen, die wir<br />
meinen, es auch hören können“, lautete der<br />
Appell des streitbaren Redners. Wahlenthaltung<br />
sei hingegen keine geeignete<br />
Antwort.<br />
„Das Grundgesetz ist ein<br />
großartiges Papier“<br />
Friedrich Nowottny bezeichnete das<br />
Grundgesetz, dessen Verkündigung sich am<br />
23. Mai <strong>2009</strong> zum 60. Mal jährt, als eine<br />
gute und solide Grundlage für unser Gemeinwesen.<br />
Es sei das noch immer vorzeigbare<br />
und verpflichtende Ergebnis der Arbeit<br />
des Parlamentarischen Rates, der im September<br />
1948 im Bonner Museum König<br />
seine Arbeit aufgenommen hatte. „Das<br />
Grundgesetz ist ein großartiges Papier; ich<br />
rate jedem, es zu lesen“, gab der vielfach<br />
ausgezeichnete Journalist dem Auditorium<br />
als Empfehlung mit auf den Weg.<br />
Zum Schluss des Vortrags zitierte Nowottny<br />
Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die<br />
Würde des Menschen ist unantastbar.“<br />
Dieser eindrucksvolle Satz müsse in unserem<br />
Bewusstsein lebendig bleiben und<br />
unser Handeln bestimmen, auch das Handeln<br />
derer, die Politik in unserem Auftrag<br />
machen.
Die Krise als Chance<br />
ERZBISCHOF BBR. DR. REINHARD MARX<br />
PLÄDIERT FÜR EINE ERNEUERUNG<br />
DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT<br />
VON BBR. CHRISTOF BECKMANN<br />
In diesen Tagen ist er viel unterwegs:<br />
Der Münchner Erzbischof, Bbr. Reinhard<br />
Marx (55), seit 2006 deutscher Vertreter<br />
in der EU-Bischofskommission COMECE<br />
und bei ihrer Vollversammlung am<br />
20. März in Brüssel zum neuen Vizepräsidenten<br />
gewählt. „Es ist wichtig, dass<br />
wir als Europäische Union in der Wirtschafts-<br />
und Finanzkrise den Blick auf<br />
die armen Länder der Erde und auf die<br />
soziale Ungerechtigkeit in Europa nicht<br />
verlieren. Dafür will ich mich auf europäischer<br />
Ebene weiter engagieren“,<br />
erklärte Marx nach seiner Wahl.<br />
„Europa sollte nicht protektionistischen<br />
Tendenzen folgen, sondern die Krise als<br />
Lernort begreifen, damit die armen<br />
Länder eine Chance bekommen.“<br />
Der katholische „Sozialbischof“, wie er<br />
oft bezeichnet wird, schöpft aus jahrlangem<br />
praktischem Einsatz für die<br />
Katholische Soziallehre. Im Sozialinstitut<br />
seines Heimatbistums Paderborn, in der<br />
Kommende in Dortmund, brachte er<br />
Manager, Unternehmer, Gewerkschafter,<br />
Arbeitnehmer, Schüler und Auszubildende<br />
zusammen, vermittelte Grundlage und<br />
brachte sie ins Gespräch über das, was das<br />
Wirtschaften ausmacht, welche Rolle der<br />
Mensch spielt, welcher Verantwortung<br />
sich diejenigen stellen, die Arbeit schaffen<br />
und mit Hilfe ihrer Mitarbeiter ihre<br />
Produkte und Dienstleistungen am Markt<br />
platzieren.<br />
Falsches Menschenbild<br />
Dass dieser Markt inzwischen aus dem<br />
Leim geht, dass vertraute Ordnungen durch<br />
einen von gierigen Zockern ausgelösten<br />
Spekulations-Tsunami über Bord gespült<br />
werden, hat der frühere Professor für<br />
Christliche Gesellschaftslehre vielfach wortgewaltig<br />
beklagt. Lange bevor die Blase<br />
platzte, hatten christliche Sozialethiker<br />
immer wieder gemahnt, den wuchernden<br />
Globalisierungskapitalismus an die Leine zu<br />
legen und verlässliche Regeln aufzustellen.<br />
Die Ursachen der derzeitigen Wirtschaftskrise<br />
beruhten nicht zuletzt auf einem<br />
falschen Menschenbild, erklärte Reinhard<br />
Marx jetzt vor rund 3.800 Teilnehmern beim<br />
6. Kongress christlicher Führungskräfte in<br />
Düsseldorf. Das dem Kapitalismus zugrunde<br />
liegende Menschenbild vom „homo<br />
oeconomicus“, der allein an seine eigenen<br />
Interessen denkt, habe die Welt zum<br />
Schlechteren verändert.<br />
Die Chance der Krise nutzen<br />
Aber Reinhard Marx lamentiert nicht.<br />
Im Gegenteil. „In jeder Krise steckt eine<br />
Chance“, unterstreicht er im Gespräch nachdrücklich<br />
– auch wenn die Dimensionen der<br />
Krise mit ihren vielschichtigen Folgen insgesamt<br />
noch nicht zu überschauen seien.<br />
„Ich habe die große Sorge,<br />
dass möglicherweise noch<br />
nicht begriffen wird, wie<br />
wir aus der Krise lernen<br />
können. Das ist allerdings<br />
auch meine große Hoffnung,<br />
dass diese Krise zu<br />
einem Lernort wird, wo<br />
man wirklich auch mal in<br />
die Tiefe der Probleme<br />
hineingeht.“ Es sei eine<br />
Systemkrise, es seien Regeln<br />
verletzt worden, es<br />
sei nicht langfristig und<br />
nicht nachhaltig gedacht<br />
worden, so Marx. „Aber es<br />
ist auch eine moralische<br />
Krise, manche Menschenbilder,<br />
manche Wertvorstellung<br />
waren falsch. Sie<br />
haben sich durchgesetzt, sie haben dominiert<br />
– und da muss man auch was<br />
korrigieren. Ich hoffe sehr, dass die Krise<br />
auch eine Chance ist, es in Zukunft besser<br />
zu machen.“<br />
Bewährte Werte<br />
und Tugenden<br />
Eindeutig plädiert der Erzbischof für eine<br />
Rückbesinnung auf bewährte Werte und<br />
Tugenden, auf verlässliche Ordnungsrahmen.<br />
„Wir von der katholischen Soziallehre<br />
wissen: Man braucht Strukturreformen,<br />
Verfahren und Überlegungen, wie man die<br />
Soziale Marktwirtschaft immer wieder neu<br />
organisiert, so dass es auch funktioniert,<br />
dass es zu guten Ergebnissen führt und<br />
dass es auch dem Menschen dient. Und wir<br />
brauchen auf der anderen Seite eine Gesinnungsreform,<br />
auch den ethischen Impuls<br />
für den Einzelnen, dass er in seinem<br />
Bereich versucht, das Gute durchzusetzen,<br />
nach Recht und Gerechtigkeit zu handeln.“<br />
So erinnert er an die Tugenden des<br />
„ehrbaren Kaufmanns“, daran, dass nicht<br />
Bbr. Erzbischof Dr. Reinhard Marx überreicht Papst Benedikt XVI.<br />
ein Exemplar seines Buches „Das Kapital“<br />
Foto: L’Osservatore Romano<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 15<br />
>>
der Staat für alles in Haftung genommen<br />
werden könne, dass Eigeninitiative ermöglicht<br />
und entfaltet werden müsse.<br />
Beides, die moralische Verantwortung des<br />
Einzelnen, aber auch die Verantwortung der<br />
Allgemeinheit, seien<br />
aufeinander bezogen:<br />
„Dies müssen wir neu<br />
auf den Weg bringen.<br />
Beides ist wichtig und<br />
man kann das eine<br />
nicht gegen das<br />
andere stellen.“ Mit<br />
moralischen Appellen<br />
komme man nicht<br />
weiter: „Man muss<br />
wirklich wissen: Wo<br />
muss man was verändern?“<br />
Hier kommt eines<br />
seiner Lieblingsbilder<br />
ins Spiel. Es ist die<br />
Geschichte vom<br />
Mann, der auf dem<br />
Weg nach Jericho unter die Räuber fiel.<br />
Hilfeleistung sei richtig, sagt Reinhard Marx.<br />
Die Verantwortung des Einzelnen bleibe<br />
gefragt und müsse gestärkt werden. Doch<br />
andererseits müsse die Straße nach Jericho<br />
schlicht sicher gemacht werden: „Wir<br />
brauchen eben auch die ordnungspolitischen<br />
Rahmenbedingungen, ohne die<br />
wir eine gerechte Gesellschaft nicht<br />
schaffen können. Und dazu gehört eine<br />
vernünftige, erneuerte Soziale Marktwirtschaft,<br />
zu der ich keine Alternative<br />
sehe!“<br />
Die Krise an den internationalen Finanzmärkten<br />
und die Wirtschaftskrise<br />
haben Deutschland mit aller Wucht erfasst.<br />
Wir erleben weltweit eine Besorgnis<br />
erregende Situation. Die Menschen machen<br />
sich Gedanken um ihre Zukunft, die<br />
Zukunft ihrer Familien und um die Zukunft<br />
unseres Landes. Angesichts dieser tiefen<br />
Verunsicherung stehen wir vor grundlegenden<br />
Fragen der gesellschaftlichen und<br />
wirtschaftlichen Ordnung, denen sich die<br />
Kirche vor dem Hintergrund ihres politischdiakonischen<br />
Auftrags stellen muss. (…) Ich<br />
möchte einige Punkte nennen, die in diesem<br />
Zusammenhang wichtig sind.<br />
16<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Wider die Resignation<br />
Dass deren Regeln so unterlaufen und<br />
verletzt werden konnten, sieht er neben den<br />
wirtschaftlichen Konsequenzen auch in<br />
anderer Hinsicht als problematisch.<br />
Politisch und<br />
wirtschaftlich Handelnde,<br />
aber auch „die großen Experten“<br />
hätten in den letzten<br />
Jahren Dinge propagiert,<br />
die sich als falsch erwiesen.<br />
„Insofern kann man verstehen,<br />
dass da auch<br />
manche resignieren und<br />
sagen: Was ist da überhaupt<br />
– schau ich noch durch?“<br />
Doch Marx warnt vor Mutlosigkeit.<br />
Die Krise sei alles<br />
andere als ein Naturgesetz<br />
oder unabänderliches Verhängnis.<br />
„Gerade da müssten,<br />
meine ich, Christen<br />
sagen: Nein – es gibt immer<br />
einen Durchblick!“<br />
Für die von der Kirche vertretenen gesellschaftlichen<br />
und wirtschaftlichen<br />
Grundlinien selbst scheine sich inzwischen<br />
wachsender Zuspruch abzuzeichnen. Er<br />
selbst, so Reinhard Marx, stelle etwa im<br />
Blick auf die Katholische Soziallehre und zu<br />
den Reaktionen auf sein 2008 veröffentlichtes<br />
Buch „Das Kapital“ fest: „Die großen<br />
Prinzipien, die großen Leitideen, ordnungspolitischen<br />
Rahmenbedingungen für eine<br />
globale Gestaltung der Welt nach den<br />
Prinzipien des Weltgemeinwohls, auch um<br />
eine globale Finanzarchitektur, sind richtig.<br />
Sie haben sich bewährt. Viele Wissenschaftler<br />
und Führungskräfte sagen: Die<br />
große Richtung stimmt.“<br />
Ein Signal von Hamburg?<br />
Die – noch – diffuse Lage sei jetzt in<br />
gründlicher Art und Weise zu analysieren.<br />
Damit die Folgen abschätzbar und nachhaltige<br />
Lösungen gefunden werden. „Wir<br />
werden auf jeden Fall dazu ermutigen, weil<br />
tatsächlich alles, was Menschen machen,<br />
auch vom Menschen gestaltet und geändert<br />
werdet kann zum Guten“, so Marx.<br />
„Wenn wir Christen nicht diese Überzeugung<br />
haben, dass Menschen die Welt<br />
besser machen können, im Kleinen wie im<br />
Großen, dann weiß ich nicht, woher die<br />
Hoffnung kommen soll.“<br />
Resignation angesichts der Unübersichtlichkeit<br />
der Lage sei fehl am Platz, gibt<br />
er zu verstehen. Auf die Frage, ob das<br />
Bischofstreffen an der Elbe als „Signal von<br />
Hamburg“ verstanden werden könne,<br />
antwortet der Münchner Erzbischof: „Ich<br />
denke schon! Wir als Christen sollten auf<br />
jeden Fall – und wir als Bischöfe erst recht –<br />
ein Signal der Ermutigung aussenden und<br />
sagen: Wir können etwas machen! Es ist<br />
eine schwere Krise, aber es ist nicht das<br />
Ende der Welt. Wir fangen an, wir müssen<br />
immer wieder etwas Neues in Gang<br />
bringen. Und das können wir auch. Und wir<br />
haben das Instrument in der Katholischen<br />
Soziallehre.“<br />
„Ordnung braucht ihre Entsprechung in der<br />
Ausbildung von Werten und Grundhaltungen!“<br />
VON ERZBISCHOF DR. ROBERT ZOLLITSCH<br />
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert<br />
Zollitsch, hat sich bei der Herbst-Vollversammlung der deutschen Bischöfe zur<br />
aktuellen Finanzkrise geäußert. Hier sein leicht gekürztes Statement:<br />
1. Freiheit braucht Ordnung!<br />
Die Krise nährt den Ruf nach staatlicher<br />
Ordnung, damit ist die Erwartung<br />
einer besseren und gerechteren Ordnung<br />
verknüpft. Das Fehlen funktionsfähiger<br />
Finanzmärkte und die Verunsicherung<br />
durch die Wirtschaftkrise haben die Idee<br />
der Ordnungspolitik belebt. Gleichzeitig<br />
wächst das Misstrauen gegen die Freiheit.<br />
Auch wenn wir deren Missbrauch nicht<br />
ausschließen können, dürfen wir sie aber<br />
deshalb nicht grundlegend beschränken. Es<br />
braucht ein Vertrauen darauf, dass die Freiheit<br />
im Ganzen mehr Dynamik zum Guten<br />
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch<br />
als zum Schlechten auslöst. Aufgabe des<br />
Staates ist es, die Rahmenbedingungen für
die freie Entfaltung des Einzelnen zu<br />
setzen.<br />
Die Dauerspannung zwischen Freiheit<br />
und Ordnung spiegelt auch das Verhältnis<br />
von Markt und Staat wider. In Deutschland<br />
haben wir uns für das Modell der Sozialen<br />
Marktwirtschaft entschieden, weil es ihr<br />
gelingt, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem<br />
Ausgleich zu verbinden und der Freiheit<br />
eine Ordnung zu geben. Sie impliziert<br />
eine Verpflichtung zu wertebasiertem<br />
Handeln in einem Wirtschaftsprozess, in<br />
dem Markt und Wettbewerb dem Menschen<br />
dienen sollen. Die Erfahrungen der<br />
aktuellen Krise zeigen erneut, dass die<br />
international agierenden Unternehmen,<br />
die so genannten Global Player, der nationalen<br />
Ordnungspolitik auf immer mehr Gebieten<br />
entwachsen sind. Deshalb braucht<br />
auch das globalisierte Wirtschaftssystem<br />
einen ordnenden Rahmen. Die Grundprinzipien<br />
der Sozialen Marktwirtschaft bieten<br />
eine Orientierung für die zu schaffenden<br />
Rahmenbedingungen des internationalen<br />
Finanz- und Wirtschaftssystems.<br />
2. Freiheit braucht<br />
Verantwortung!<br />
Während die einen also nach dem starken<br />
Staat rufen, der ordnend eingreifen soll,<br />
beklagen andere den Verlust moralischer<br />
Selbstverpflichtung, weshalb jegliches Regelwerk<br />
nur ins Leere zielen kann. So stellt<br />
sich letztlich die Frage, ob die Rahmenordnung<br />
der Ort der Moral ist oder die ethische<br />
Gesinnung des Einzelnen.<br />
Die öffentliche Wahrnehmung konzentriert<br />
sich oft auf übermäßiges Gewinnstreben<br />
und mangelndes Verantwortungsbewusstsein.<br />
Erlauben sie mir hierzu zwei<br />
Anmerkungen:<br />
Zum einen hat die Krise natürlich viel<br />
mit menschlichen Schwächen wie Gier und<br />
Verantwortungslosigkeit zu tun. Dies sind<br />
aber nicht die alleinigen Ursachen. Die<br />
meisten Mitarbeiter in der Banken- und Fi-<br />
nanzbranche haben<br />
ganz seriös ihre<br />
Arbeit getan und<br />
mit der Entstehung<br />
der Krise wenig<br />
oder gar nichts zu<br />
tun. Viele von ihnen<br />
sind selbst von der<br />
Krise massiv betroffen.<br />
Zum anderen<br />
darf bei aller Kritik<br />
auch nicht vergessen<br />
werden, dass<br />
ein gesundes Gewinnstreben<br />
die<br />
zentrale Antriebskraft<br />
für jeden Akteur<br />
in der Wirtschaft ist. Das Gewinnprinzip<br />
ist Grundlage einer funktionierenden<br />
Wirtschaft. Letztlich ist doch auch der Griff<br />
nach dem günstigsten Produkt im Supermarkt<br />
von diesem Gewinnstreben geleitet.<br />
Dennoch ist die Zügellosigkeit der Interessen<br />
nicht bloß ein Märchen. Die Krise hat<br />
gezeigt, dass die Idee der Haftung an<br />
Bedeutung verloren hat, Leichtgläubigkeit<br />
und Laxheit um sich gegriffen haben und<br />
die Erfahrung: „wenn nicht ich so handle,<br />
tun es eben die anderen“ zu weniger Verantwortungsbewusstsein<br />
beigetragen hat.<br />
Sicher hat die Komplexität und Dynamik<br />
der internationalen Märkte und ihrer Instrumente<br />
diese Entwicklung unterstützt,<br />
doch muss in Zukunft – das scheint mir eine<br />
der Lehren aus der Krise zu sein – die Verantwortung<br />
des Einzelnen, der Unternehmen<br />
sowie der verschiedenen Interessengruppen<br />
und ihrer Vertreter in den Vordergrund<br />
rücken.<br />
Ordnung braucht ihre Entsprechung in<br />
der Ausbildung von Werten und Grundhaltungen<br />
wie Verantwortung, Rechenschaft,<br />
Konsequenz, Transparenz, Vertrauen und<br />
langfristige Orientierung. Denn gerade angesichts<br />
der Dynamik und Komplexität der<br />
globalisierten Wirtschaft wird nicht alles,<br />
was von Rechts wegen zulässig ist, auch<br />
ethisch vertretbar sein. Freiheit braucht<br />
Moral!<br />
3. Gerechtigkeit!<br />
Diese grundsätzlichen Überlegungen<br />
können auch Orientierung für die dringend<br />
erforderliche Neuordnung der Finanzwirtschaft<br />
sein, die derzeit von der<br />
Frage überlagert wird, wie den Auswirkungen<br />
der Finanzmarktkrise – vor allem auf<br />
die nationale Wirtschaft – am besten zu begegnen<br />
sei. Damit die Antworten nicht<br />
kurzatmig und kurzsichtig sind, sondern<br />
auch in Zukunft tragfähig, müssen sie am<br />
Prinzip der Gerechtigkeit und dem Wohle<br />
aller ausgerichtet sein.<br />
Dies gilt angesichts der gewaltigen<br />
Staatsverschuldung zum Beispiel für die<br />
Frage der Generationengerechtigkeit.<br />
Durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise<br />
stehen wir weltweit vor einer ungeahnten<br />
Schuldenexplosion. Es ist einsichtig,<br />
dass um einer notwendigen konjunkturellen<br />
Stabilisierung willen eine langfristig<br />
wirksame Staatsverschuldung in Kauf genommen<br />
werden muss, weil der Verzicht<br />
auf diese Maßnahmen an anderer Stelle<br />
eine Verschärfung der Probleme zur Folge<br />
hätte, die insbesondere die wirtschaftlich<br />
Schwächeren und Armen stark schädigen<br />
würde. Doch ist gleichzeitig immer zu bedenken,<br />
dass wir diese Staatsverschuldung<br />
den nächsten Generationen vererben. Ich<br />
habe die Sorge, dass die gewaltige Staatsverschuldung<br />
in einigen Jahren durch eine<br />
Inflation zurückgeführt wird, mit allen<br />
negativen wirtschaftlichen und sozialen<br />
Auswirkungen.<br />
Auch scheint mir wichtig, dass die Maßnahmen<br />
zur Stützung der Konjunktur<br />
zugleich auch möglichst zielgenau über die<br />
bloße Konjunkturbelebung hinausgehende<br />
sinnvolle Ergebnisse zeitigen sollten. Ich<br />
denke hier insbesondere an die Bereiche<br />
Bildung, verbesserte Infrastruktur, Energieeinsparung<br />
oder erneuerbarer Energien.<br />
Wir müssen bei derzeitigen Ausgaben<br />
insbesondere die Interessen der nächsten<br />
Generation im Blick haben!<br />
Auch wenn unser Blick sich zurzeit vor<br />
allem auf die eigenen Probleme und die<br />
unserer nächsten Nachbarn und stärksten<br />
Wirtschaftspartner richtet, dürfen wir die<br />
Schwellen- und Entwicklungsländer nicht<br />
vergessen, die darauf angewiesen sind, ihre<br />
Produkte auf unseren Märkten zu verkaufen.<br />
Ein neuer Protektionismus, aber auch<br />
ein Nachlassen im Kampf gegen Armut und<br />
Hunger sowie die Folgen des Klimawandels<br />
können nicht die Antwort auf diese Krise<br />
sein.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 17
Die deutschen Bischöfe zur Finanzkrise<br />
ERZBISCHOF MARX: „KIRCHE MUSS GESELLSCHAFT ORIENTIERUNG GEBEN“<br />
Die Frühjahrs-Vollversammlung der<br />
deutschen Bischöfe, die sich vom 2. bis<br />
5. März in Hamburg versammelt hatten,<br />
hat sich bei einem Studien-Halbtag mit der<br />
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise befasst.<br />
Bbr. Erzbischof Dr. Reinhard Marx,<br />
Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche<br />
und soziale Fragen der Deutschen<br />
Bischofskonferenz legte anschließend<br />
Eckpunkte einer kirchlichen Bewertung<br />
der Krise vor, die die UNITAS nachstehend<br />
(leicht gekürzt) dokumentiert:<br />
„Am Ende des Studienhalbtages stellt<br />
sich die Frage nach dem kirchlichen<br />
Sprechen und Handeln in der Krise: Muss<br />
sich die Kirche nicht selbst bewusst werden,<br />
auf welchen Schatz sie mit der Katholischen<br />
Soziallehre und ihrer einmaligen Tradition<br />
sozialethischer Verkündigung zurückgreifen<br />
kann? Das Erbe der Katholischen Soziallehre<br />
ist insofern auch eine Herausforderung<br />
an uns selbst. Die große Linie der Sozialenzykliken<br />
hat sich bewährt und besitzt<br />
gerade aus heutiger Perspektive eine<br />
geradezu zeitlose Gültigkeit.<br />
Bbr. Erzbischof Dr. Reinhard Marx<br />
Worauf kommt es jetzt also an? Im Folgenden<br />
will ich versuchen, mit Blick auf die<br />
Ergebnisse des heutigen Tages erste Eckpunkte<br />
einer kirchlichen Bewertung der<br />
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zu<br />
formulieren.<br />
1.<br />
Ausgang unserer Bewertung ist das<br />
christliche Verständnis vom Menschen:<br />
Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.<br />
Unser Blick richtet sich deshalb zunächst<br />
auf all diejenigen, die national und international<br />
am meisten von der derzeitigen<br />
Krise betroffen sind. Denn eine solche Krise<br />
ist nicht nur eine Frage der Stabilität und<br />
18<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Effizienz eines wirtschaftlichen Systems,<br />
etwa im Zuge von Wachstumseinbußen<br />
oder einem gefährdeten Finanzmarkt, sondern<br />
sie ist insbesondere eine Frage der Gerechtigkeit.<br />
Uns bewegt die Krise nicht aus<br />
wirtschaftstheoretischem Interesse, sondern<br />
weil es uns um die Menschen geht –<br />
die Menschen, die in Deutschland besonders<br />
von der Krise betroffen sind, und die<br />
Menschen, die anderswo wegen der Krise<br />
hungern! Deshalb müssen wir uns fragen,<br />
welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um<br />
zukünftige Krisen möglichst zu vermeiden.<br />
Natürlich ist das Risiko von Finanz- und<br />
Wirtschaftskrisen nicht generell auszuschließen,<br />
aber soziale Gerechtigkeit und<br />
Gemeinwohl verpflichten uns, alles zu tun,<br />
um die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit<br />
von Finanzkrisen zu reduzieren.<br />
2.<br />
Eine grundlegende Voraussetzung der<br />
Prävention ist allerdings, die Ursachen<br />
und den Verlauf der Finanzmarktkrise zu<br />
verstehen. Die Ursachen sind vielfältig: die<br />
Verselbstständigung von Finanzmarktprodukten,<br />
eine fehlerhafte Geschäftspolitik<br />
und zu große Risikobereitschaft<br />
von Banken, eine unzureichende<br />
staatliche Aufsicht,<br />
falsche politische Anreize<br />
und staatliche Geldpolitik<br />
sowie nicht zuletzt auch<br />
individuelles Versagen, das<br />
sich unter anderem in überhöhten<br />
Renditeerwartungen<br />
niedergeschlagen hat.<br />
Daneben hat aber auch<br />
das Zusammentreffen an sich<br />
guter Ideen zu Fehlentwicklungen<br />
geführt, wie etwa die<br />
Verbindung von Wohnungseigentumspolitik<br />
und laxer<br />
Kreditvergabe in den USA<br />
oder aber die leistungsorientierte<br />
Entlohnung, die erst<br />
in Verbindung mit kurzfristigenGewinnerwartungen<br />
zu schlechten Ergebnissen geführt hat.<br />
Auch wenn wir das ganze Ausmaß noch<br />
nicht absehen können, wissen wir: Es gibt<br />
eine Krise im System! Es handelt sich dabei<br />
auch um eine moralische Krise: Freiheit,<br />
Verantwortung und Ordnung sind aus dem<br />
Gleichgewicht geraten. Keiner von uns will<br />
deshalb ein neues System, aber wir brauchen<br />
eine Erneuerung im Sinne einer<br />
Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft.<br />
3.<br />
Auf den internationalen Finanzmärkten<br />
bestehen strukturelle Schwächen<br />
und Defizite, die einer dringenden Reform<br />
und Neuordnung bedürfen. Es ist nicht<br />
Aufgabe der Bischöfe, konkrete Reformvorschläge<br />
zu machen, dennoch seien einige<br />
Felder kurz benannt, auf denen<br />
Handlungsbedarf besteht:<br />
Die Weiterentwicklung der Bankenregulierung<br />
ist eine drängende Aufgabe.<br />
Hierbei geht es vor allem um eine effiziente<br />
Bankenaufsicht, die Finanzmarktprodukte<br />
und Finanzinstitute wirkungsvoll überwacht.<br />
Löcher in der Regulierung müssen<br />
erkannt, analysiert und geschlossen werden;<br />
dazu gibt es geeignete Instrumente,<br />
die auch angewandt werden müssen.<br />
Aufgabe der Bankenregulierung ist es, die<br />
Stabilität und Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes<br />
zu sichern; eine wesentliche<br />
Voraussetzung hierfür ist die Solvenz der<br />
Banken. Daher muss dafür Sorge getragen<br />
werden, dass die Risiken der Finanzinstitute<br />
mit angemessenem Eigenkapital unterlegt<br />
sind. Dies zu umgehen, darf nicht mehr<br />
möglich sein.<br />
Sicher gehört zur Funktionsfähigkeit<br />
des Finanzmarktes die Erwartung, dass<br />
beim Zusammenbruch einer Bank letzten<br />
Endes der Staat einspringt und die Einlagen<br />
zu einem gewissen Maß sichert. Doch darf<br />
diese Erwartungshaltung nicht dazu führen,<br />
dass Risiken ungeniert eingegangen<br />
werden können und die Idee der Haftung<br />
an Bedeutung verliert, weil im Zweifelsfall<br />
andere für den Schaden aufkommen.<br />
Eine weitere Fehlentwicklung waren<br />
überhöhte und zum Teil unrealistische Renditeerwartungen,<br />
die vor allem auf eine unzureichende<br />
Abwägung von Ertrag und<br />
Risiko zurückgehen. Wie mehrfach angeklungen,<br />
darf trotz aller Kritik nicht vergessen<br />
werden, dass ein gesundes Gewinnstreben<br />
die Grundlage einer funktionierenden<br />
Wirtschaft ist. Doch ist auch der Gewinn<br />
einer gewissen Ordnung verpflichtet.
Gewinn um jeden Preis trägt nicht über den<br />
Tag hinaus und vernachlässigt die Perspektive<br />
langfristigen, zukunftsfähigen Handelns.<br />
Auch die Gehaltstrukturen der Manager<br />
scheinen reformbedürftig. Bei Bonuszahlungen<br />
werden leistungsorientierte Zulagen<br />
vereinbart, die wohl weniger am<br />
langfristigen Erfolg orientiert, sondern<br />
primär auf Quartalsberichte und kurzfristige<br />
Gewinne fixiert sind, die sich dann<br />
oftmals nur durch eine exzessive, aber<br />
verborgene Risikoübernahme maximieren<br />
lassen. Für die Zukunft müssen Leistungsbewertungen<br />
und Vergütungssysteme mit<br />
Blick auf ihre Anreizstrukturen neu überdacht<br />
werden.<br />
Außerdem scheint ein kritischer Blick<br />
auf die Geld- und Zinspolitik der Notenbanken<br />
erforderlich. Lange Zeit galt die<br />
Geldpolitik der US-Notenbank als vorbildlich,<br />
mit billigem Geld den Konsum und<br />
einen scheinbaren Wohlstand zu fördern,<br />
tatsächlich wurde jedoch über die Verhältnisse<br />
gelebt, wie sich jetzt zeigt. Es wurde<br />
dabei außer Acht gelassen, dass es Aufgabe<br />
der Notenbanken ist, für Geldstabilität zu<br />
sorgen. Gerade im europäischen und internationalen<br />
Rahmen muss an dieser Position<br />
festgehalten werden.<br />
4.<br />
Neben diesen sehr konkreten Aspekten<br />
zur Neuordnung der Finanzmärkte ist<br />
aber auch eine Rückbesinnung auf grundlegende<br />
ordnungspolitische und sozialethische<br />
Überlegungen erforderlich. In<br />
Krisenzeiten wird der Ruf nach einem<br />
starken Staat immer lauter. Dabei dürfen<br />
aber die Grenzen des Staates und der Wert<br />
einer freiheitlichen sozialen Marktordnung<br />
nicht übersehen werden. Der Staat muss einen<br />
Ordnungsrahmen setzen, dieser allein<br />
reicht aber nicht aus. Schon im gemeinsamen<br />
Text der Deutschen Bischofskonferenz<br />
und des Rates der Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland „Demokratie braucht<br />
Tugenden“ haben wir festgestellt: „Die Vorstellung,<br />
in einer Ordnung der Freiheit<br />
könne jeder ohne Rücksicht auf das Ganze<br />
seinen Interessen nachgehen, weil die<br />
Regeln aus eigener Kraft im Stande seien,<br />
einen vernünftigen Ausgleich zu bewirken,<br />
ist zwar weit verbreitet [...]. Aber sie ist<br />
illusionär. Freiheitliche Institutionen, so<br />
klug sie auch entworfen sein mögen,<br />
können nicht aus sich heraus das notwendige<br />
Minimum an Gemeinwohlorientierung<br />
[...] gewährleisten.“ (S. 16) Mit der<br />
Freiheit muss persönliche Verantwortung<br />
korrespondieren. Die Idee der Sozialen<br />
Marktwirtschaft verknüpft beides untrennbar<br />
miteinander und verpflichtet so zur<br />
Ausbildung von Werten und Grundhaltungen.<br />
Gerade dies ist in letzter Zeit zu<br />
kurz gekommen! Nicht nur Demokratie,<br />
auch Soziale Marktwirtschaft braucht<br />
Tugenden!<br />
5.<br />
Damit stehen wir aber auch in Zukunft<br />
fest auf dem Fundament der Sozialen<br />
Marktwirtschaft, weil es ihr gelingt, wirtschaftlichen<br />
Erfolg mit sozialem Ausgleich<br />
zu verbinden und der Freiheit eine Ordnung<br />
zu geben. Allerdings zeigen die Erfahrungen<br />
der Krise, dass die international<br />
agierende Finanzwirtschaft der nationalen<br />
Ord-nungspolitik immer mehr entwächst<br />
und das globalisierte Wirtschaftssystem<br />
ebenfalls einen ordnenden Rahmen<br />
braucht. Es besteht jetzt die Notwendigkeit,<br />
im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft<br />
Einfluss auf die Ausgestaltung der internationalen<br />
Ordnung zu nehmen. Dabei<br />
müssen wir auch die außerökonomischen<br />
Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft<br />
im Blick haben: Das christliche Verständnis<br />
vom Menschen und die Idee der Demokratie<br />
sind der geistige Nährboden, auf<br />
dem sich die Soziale Marktwirtschaft entwickelt<br />
hat. Gerade deshalb könnte die<br />
Katholische Soziallehre Maßstab für die<br />
Gestaltung einer Weltwirtschaftsordnung<br />
sein. Europa, aber auch die transatlantische<br />
Wertegemeinschaft, müssen auf diesem<br />
Weg eine Vorreiterrolle spielen.<br />
6.<br />
Neben der Neuordnung der Finanzmärkte<br />
kommt es in Zukunft aber auch<br />
darauf an, den Auswirkungen der Krise entgegenzuwirken.<br />
Das<br />
rasche Eingreifen der<br />
Bundesregierung und<br />
der Staats- und Regierungschefs<br />
der EU sowie<br />
die Einberufung<br />
des Finanzmarktgipfels<br />
der G20-Staaten<br />
im November 2008<br />
haben gezeigt, dass in<br />
einer Situation, in der<br />
ein Kollaps der Finanzwirtschaft<br />
drohte,<br />
schnelle und entschlosseneMaßnahmen<br />
dringend notwendig<br />
waren. Doch<br />
stellt sich nach einer<br />
ersten Stabilisierung des Systems die Frage:<br />
Wie soll es weitergehen? Wir müssen jetzt<br />
Lösungen entwickeln, die langfristig tragfähig<br />
sind. Die Krise macht ja unsere<br />
bisherigen wirtschafts- und sozialpolitischen<br />
Überlegungen nicht alle hinfällig.<br />
Bereits eingeschlagene und bewährte<br />
Wege dürfen jetzt nicht vorschnell über<br />
Bord geworfen werden. Ordnungspolitische<br />
Vernunft und sozialethische Ziele<br />
dürfen nicht unter die Räder der Erwartungen<br />
kommen, denen die Verantwortlichen<br />
in Politik und Wirtschaft derzeit gegenüber<br />
stehen. Gerade in der jetzigen Situation<br />
wird die Gefahr der Dominanz partikularer<br />
Interessen erneut virulent, auf die wir<br />
bereits mit dem Impulstext „Das Soziale<br />
neu denken“ hingewiesen haben. Dies gilt<br />
national mit Blick auf große Konzerne im<br />
Gegensatz zu kleinen und mittelständischen<br />
Unternehmen, auf internationaler<br />
Ebene vor allem im Hinblick auf einen zunehmenden<br />
Protektionismus, mit dem<br />
Schwellen- und Transformationsländer<br />
zurückgedrängt und damit die positiven<br />
Effekte der Globalisierung untergraben<br />
werden. Auch in Europa darf der Protektionismus<br />
die grundlegenden Errungenschaften<br />
des Binnenmarktes nicht aufs<br />
Spiel setzen.<br />
7.<br />
Bisher steht bei allen Maßnahmen<br />
primär die Krisenbewältigung im Vordergrund.<br />
Angesichts der Schuldenberge,<br />
die im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise<br />
immens erhöht wurden, stellt<br />
sich aber auch die Frage, wie diese Verschuldung<br />
wieder abgebaut werden soll.<br />
Eine offene Diskussion unter den Aspekten<br />
der Generationen- und Beteiligungsgerechtigkeit<br />
ist jedoch dringend erforderlich, um<br />
geeignete Kriterien der Lastenverteilung zu<br />
entwickeln. Es ist zu vermeiden, dass die<br />
Verschuldungsfrage über eine Inflation mit<br />
allen damit verbundenen sozialen Verwerfungen<br />
gelöst wird. Darüber hinaus dürfen<br />
auch die großen Herausforderungen des 21.<br />
Jahrhunderts – Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung<br />
und Klimawandel –, die<br />
sich in besonderem Maße auf die Armen<br />
der Welt auswirken, nicht aus dem Blick<br />
geraten.<br />
Wir müssen jetzt Konsequenzen ziehen,<br />
die Krise als Chance begreifen und als<br />
Lernort nutzen: Es reicht nicht aus, die Krise<br />
zu überwintern und danach weiterzumachen<br />
wie bisher. Wir müssen die Wirtschafts-<br />
und Finanzmärkte neu ordnen und<br />
Verantwortung zur Leitwährung machen!<br />
In der aktuellen Situation sind wir gefordert,<br />
der Gesellschaft Richtschnur zu<br />
geben! Wir müssen einerseits darauf<br />
drängen, dass die notwendigen Reformen<br />
vorangetrieben werden, wir müssen aber<br />
auch die Verantwortung der Akteure<br />
einfordern! Selten gab es in der Gesellschaft<br />
so fruchtbaren Boden für christliche<br />
Werte und Grundhaltungen! Kommen wir<br />
als Kirche also unserer Verpflichtung nach,<br />
Partner im Dialog über den Aufbau eines<br />
wertgebundenen Ordnungsrahmens zu<br />
sein!“<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 19
<strong>AGV</strong> verabschiedet Positionspapier<br />
zu sozialpolitischen Fragen<br />
VORORTE TRAFEN SICH ZU KLAUSURTAGUNG IM SCHWARZWALD<br />
VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS UND TILL KAESBACH (KV)<br />
Fünfzig Zentimeter Schnee, ein altes<br />
Schwarzwaldhaus, das man mit dem<br />
Auto selbst mit Schneeketten nicht<br />
mehr erreichen kann, sondern nur<br />
noch mit einem Raupenfahrzeug –<br />
genau der richtige abgeschiedene Ort<br />
für eine Klausurtagung. Vom 5. bis 7.<br />
Dezember 2008 hatte die Arbeitsgemeinschaft<br />
katholischer <strong>Studenten</strong>verbände<br />
(<strong>AGV</strong>) sich in das Hercynen-<br />
Berghaus – in 1100 Metern Höhe am<br />
Feldberg im Hochschwarzwald gelegen<br />
– zu ihrer traditionellen Mitgliederversammlung<br />
im Advent zurückgezogen.<br />
In der vorweihnachtlichen<br />
Hüttenatmosphäre stand vor allem in<br />
zweiter Lesung der Entwurf eines<br />
„Positionspapiers für eine verantwortungsvolle<br />
Sozialpolitik im 21. Jahrhundert“<br />
zur Diskussion und wurde<br />
schließlich einstimmig verabschiedet.<br />
„Für manchen mag sich nicht auf den<br />
ersten Blick erschließen, warum sich ausgerechnet<br />
die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
mit Sozialpolitik befassen“, erklärte<br />
der stellvertretende <strong>AGV</strong>-Vorsitzende Bernd<br />
Schulte (KV). Die <strong>AGV</strong> sei jedoch der Ansicht,<br />
20<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Konzentrierte Arbeit in der Mitgliederversammlung<br />
dass sich ihre Verantwortung, an der gesellschaftlichen<br />
Meinungsbildung zu partizipieren,<br />
über die Hochschule hinaus erstrekken<br />
müsse. „Auch <strong>Studenten</strong> und gerade<br />
junge Akademiker sind von der Ausgestaltung<br />
einzelner sozialpolitischer Regelungen<br />
Die Teilnehmer der Klausurtagung vor der verschneiten Schwarzwaldkulisse. Der UNITAS-Verband<br />
war vertreten durch VOP Benedikt Schwedhelm (6.v.r.), die Leiterin des Beirats für Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Nachwuchs Lina Brockhaus (5.v.r.), den stv. <strong>AGV</strong>-Vorsitzenden Claus Broekmans (4.v.r.), den <strong>AGV</strong>-<br />
Ehrenvorsitzenden Hermann-Josef Großimlinghaus (l. außen) und den ehemaligen <strong>AGV</strong>-Vorsitzenden<br />
Hans-Achim Michna (3.v.r.).<br />
elementar betroffen“, hob Schulte hervor.<br />
Darüber hinaus wolle die <strong>AGV</strong> mit ihrem<br />
aktuellen Positionspapier die sozialpolitische<br />
Debatte stimulieren und ihren Beitrag<br />
dazu leisten.<br />
Zu den Kernbereichen der Sozialpolitik –<br />
Arbeitsmarkt, Rente, Gesundheit und Pflege<br />
– formulieren die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
auf der Grundlage der katholischen<br />
Soziallehre mit ihren Prinzipien der<br />
Subsidiarität und Solidarität eindeutige<br />
Thesen. Im Mittelpunkt steht dabei ein klares<br />
Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft.<br />
Dem Einzelnen muss soviel Freiheit<br />
wie möglich zugestanden werden bei<br />
gleichzeitigem Aufspannen eines Netzes<br />
von Sozialleistungen, das engmaschig genug<br />
ist, um die Schwachen und Benachteiligten<br />
aufzufangen. Konkret leitet sich<br />
daraus für die <strong>AGV</strong> der Grundsatz „Arbeit<br />
muss sich lohnen“ ab, der sich in den Standpunkten<br />
zum Niedriglohnsektor, zum Kündigungsschutz<br />
und zum Mindestlohn widerspiegelt.<br />
Anreize für häusliche<br />
Pflege schaffen<br />
Besondere Beachtung findet in dem<br />
Positionspapier die Generationengerechtigkeit.<br />
So schließt sich die <strong>AGV</strong> dem dreistufi-
gen Rentenmodell der KAB „Solidarische<br />
Alterssicherung“ an. „In einer<br />
solidarischen Gesellschaft ist auch<br />
das Ehrenamt unverzichtbares Element“,<br />
unterstrich Bernd Schulte.<br />
Die <strong>AGV</strong> fordert, gerade im Bereich<br />
der Pflege über Kompensationsmodelle<br />
Anreize für die häusliche<br />
Betreuung durch Verwandte zu<br />
geben. Der Gesetzgeber wird aufgefordert,<br />
Regelungen zu schaffen, die<br />
eine berufliche Auszeit zur Pflege<br />
möglich machen.<br />
Um die Kostenprogression im<br />
Gesundheitswesen aufzuhalten,<br />
erachten die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
das zweigliedrige System<br />
aus privater und gesetzlicher<br />
Krankenversicherung bei Festhalten<br />
an der Familienmitversicherung für<br />
geeignet, auch in Zukunft umfassende<br />
Gesundheitsleistungen<br />
bereitzustellen.<br />
„Die <strong>AGV</strong> tritt auch für mehr<br />
Chancengleichheit ein“, stellte<br />
Bernd Schulte bei der Präsentation<br />
des Positionspapiers fest. Den<br />
Schlüssel hierfür sehe sie in einer<br />
verbesserten Bildung. Die schulische<br />
Ausbildung solle dabei gebührenfrei<br />
bleiben. Hingegen befürworteten<br />
die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
– wie schon früher<br />
in einem eigenen Positionspapier<br />
zur Bildungs- und Hochschulpolitik<br />
vertreten – Studienbeiträge bis zu<br />
500 Euro zur Aufbringung der von<br />
den Hochschulen dringend benötigten<br />
Finanzmittel. „Allerdings nur<br />
unter der Voraussetzung, dass sie<br />
nicht zur Entlastung der öffentlichen<br />
Haushalte genutzt und Studierende<br />
aus sozial schwachen Familien<br />
nicht benachteiligt werden“,<br />
betonte der Münsteraner Jurastudent.<br />
Der vollständige Text des Positionspapiers<br />
„Verantwortungsvolle Sozialpolitik<br />
im 21. Jahrhundert“ ist als Heft<br />
Nr. 11 in der <strong>AGV</strong>-Schriftenreihe STAND-<br />
PUNKTE veröffentlicht und findet sich im<br />
Internet auf der <strong>AGV</strong>-Homepage unter<br />
folgendem Link:<br />
www.agvnet.de (➞ Publikationen)<br />
Verbände schauen<br />
hoffnungsvoll in die Zukunft<br />
In den Berichten der einzelnen Verbandsvertreter<br />
war insgesamt eine positive<br />
Tendenz erkennbar. <strong>Unitas</strong>-Vorortspräsident<br />
Benedikt Schwedhelm sprach von einer<br />
„sehr guten Stimmung innerhalb des<br />
<strong>Unitas</strong>-Verbandes“ und einem guten Zusammenhalt<br />
der Vereine, RKDB-Ringpräsident<br />
Hanno Dockter konnte auf zwei erfolg-<br />
Die Klausurtagung dient dem besseren Kennenlernen zwischen den<br />
Vororten in ungezwungener Atmosphäre: bei der gemeinsamen Arbeit,<br />
bei einer Schneewanderung in der Umgebung des Feldbergs und<br />
in geselliger Runde bei einer Spontankneipe (links: der Präside des<br />
Abends, der stv. <strong>AGV</strong>-Vorsitzende Bernd Schulte).<br />
reiche Reaktivierungen von Korporationen<br />
in Freiburg und Trier verweisen. Der KV geht<br />
aktiv die Frage an, wie in Zukunft ehrenamtliches<br />
Engagement in Verband und Vereinen<br />
vor dem Hintergrund der Auswirkungen des<br />
Bologna-Prozesses sichergestellt werden<br />
kann. Eine bundesweite Fuxentagung soll<br />
dem Ideenaustausch zu diesem Problemfeld<br />
dienen.<br />
Die <strong>AGV</strong> setzte bei ihrer Klausurtagung<br />
auch Eckdaten für ihre inhaltliche Arbeit im<br />
kommenden Jahr: „<strong>2009</strong> feiern wir das 60jährige<br />
Bestehen der Bundesrepublik<br />
Deutschland, vor 20 Jahren fiel die Mauer<br />
und die Auswirkungen der weltweiten<br />
Finanzkrise werden uns<br />
sicher weiter beschäftigen“,<br />
listete <strong>AGV</strong>-Vize Bbr. Claus<br />
Broekmans einige Themenstellungen<br />
auf. Die Arbeitsgemeinschaft<br />
richte in ihrem<br />
DIALOGPROGRAMM mit hochkarätig<br />
besetzten Seminaren in<br />
München und Hamburg den<br />
Focus auf diese Themen. Speziell<br />
werde sie sich mit den Herausforderungen<br />
des Extremismus<br />
auf unsere Demokratie und dem<br />
Zusammenhang von Globalisierung<br />
und Bildung befassen. Auch<br />
kündigte Bbr. Broekmans an,<br />
dass die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
eine gemeinsame<br />
Erklärung zur im September des<br />
nächsten Jahres anstehenden<br />
Bundestagswahl mit so genannten<br />
„Wahl-Prüfsteinen“ zur Beurteilung<br />
der einzelnen Kandidaten<br />
erarbeiten werden (s. S. 22).<br />
Die nächste <strong>Studenten</strong>-<strong>Wallfahrt</strong><br />
der <strong>AGV</strong> führt im September<br />
<strong>2009</strong> auf den Spuren des<br />
Apostels Paulus und der frühen<br />
Christen in die Türkei (s. S. 26).<br />
Neuer Beirat soll<br />
Vorstand unterstützen<br />
Claus Broekmans informierte<br />
ferner darüber, dass die <strong>AGV</strong><br />
einen Beirat eingerichtet hat, in<br />
den vor allem ehemalige Vorstandsmitglieder<br />
ihre Erfahrungen<br />
und ihre heutige berufliche<br />
Kompetenz einbringen und so<br />
die Arbeit des Vorstands unterstützen<br />
sollen. Zunächst wurden<br />
Dr. Michael Güntner (CV), Büroleiter<br />
beim Vorsitzenden der<br />
CDU/CSU-Bundestagsfraktion<br />
Volker Kauder, Hans-Achim Michna<br />
(UV), hessischer Landesausländerbeauftragter,<br />
Andreas<br />
Kraus (CV), stellv. Leiter der Presseabteilung<br />
des Verbandes der<br />
Automobilindustrie, und Matthias<br />
Belafi (KV), Geschäftsführer<br />
der Kommission für gesellschaftliche<br />
und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,<br />
in dieses Gremium berufen.<br />
In den Grußworten bei einer vom stellvertretenden<br />
<strong>AGV</strong>-Vorsitzenden Bernd<br />
Schulte souverän geleiteten Spontankneipe<br />
wurde die sehr freundschaftliche und ungezwungene<br />
Atmosphäre des Treffens im<br />
Schwarzwald gelobt, aber auch die Notwendigkeit<br />
für die Verbände hervorgehoben,<br />
in der <strong>AGV</strong> konstruktiv zusammenzuarbeiten,<br />
wenn die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
sich im politischen, kirchlichen<br />
und gesellschaftlichen Raum Gehör verschaffen<br />
wollen.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 21
Wahl-Prüfsteine<br />
GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER IN DER ARBEITS-<br />
GEMEINSCHAFT KATHOLISCHER STUDENTENVERBÄNDE<br />
(<strong>AGV</strong>) ZUSAMMENGESCHLOSSENEN VEREINIGUNGEN<br />
ZUR BUNDESTAGSWAHL AM 27. SEPTEMBER<br />
Die Arbeitsgemeinschaft katholischer<br />
<strong>Studenten</strong>verbände (<strong>AGV</strong>) hat bei<br />
ihrer Mitgliederversammlung am 11.<br />
März <strong>2009</strong> in einer Erklärung zur bevorstehenden<br />
Bundestagswahl Ende<br />
September <strong>2009</strong> so genannte „Wahl-<br />
Prüfsteine“ verabschiedet, die aus<br />
christlicher Sicht als Kriterien für die<br />
Beurteilung und damit letztlich die<br />
Wählbarkeit der Kandidaten dienen<br />
sollen. Das gemeinsame Papier von<br />
CV, KV, UNITAS-Verband und RKDB<br />
wird nachstehend dokumentiert:<br />
Nicht jeder ist wählbar!<br />
(1) Wir sind auf der Suche nach christlichen<br />
Politikern. Dabei haben wir keine bestimmte<br />
parteipolitische Präferenz.<br />
Als Folge der geistigen<br />
Säkularisation, der Lösung<br />
von religiösen Bindungen in<br />
unserer pluralistischen Gesellschaft,<br />
gibt es heute immer<br />
weniger Persönlichkeiten,<br />
Männer und Frauen, in<br />
der Politik, die aus festen<br />
christlichen Bindungen kommen<br />
und so von ihrem Glauben<br />
und von einem christlichen<br />
Menschenbild geprägt<br />
sind. Die Zahl der Politiker, für<br />
die Glaube und politisches<br />
Engagement ganz selbstverständlich<br />
eng und unmittelbar verflochten<br />
sind, nimmt ständig ab. Überzeugte Christen<br />
sind im eigentlich politischen Feld eher<br />
die Ausnahme geworden.<br />
Doch gerade sie werden nach Auffassung<br />
der katholischen <strong>Studenten</strong>verbände<br />
22<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
heute dringender denn je gebraucht, um<br />
christliche Grundhaltungen überzeugend<br />
und nachhaltig in die politische Willensbildung<br />
einzubringen; denn unsere Zeit ist gekennzeichnet<br />
von zahlreichen schwerwiegenden<br />
Problemen und Wandlungen. Die<br />
ökonomischen, ökologischen und sozialen<br />
Herausforderungen erfordern neue und<br />
mutige Lösungswege und Entscheidungen,<br />
die sowohl in das gesellschaftliche wie<br />
das persönliche Leben tief eingreifen können.<br />
Hier einige Beispiele:<br />
� Trotz gewisser Erfolge auf dem Arbeitsmarkt<br />
haben wir nach wie vor eine<br />
hohe Arbeitslosigkeit mit großen sozialen<br />
und zum Teil auch psychologischen<br />
Problemen für die Betroffenen. Die Zahl<br />
der Arbeitslosen wird durch die Auswirkungen<br />
der aktuellen Finanz- und Bankenkrise<br />
sogar wieder steigen. Daher<br />
muss schnellstens ein neues Vertrauen<br />
zwischen den Wirtschaftspartnern auf<br />
der Basis moralischer Prinzipien aufge-<br />
„Die Leitidee der repräsentativen Demokratie,<br />
Regierungsmacht auf Zeit mit der Chance oder<br />
Gefahr des Wechsels durch Wahl besitzt eine<br />
automatische Scheuklappenwirkung gegen die<br />
Zukunft. Niemand wagt, um einer verantwortlichen<br />
Zukunftsvorsorge willen Vorschläge zu<br />
machen, die eine Belastung in der Gegenwart<br />
mit sich bringen könnte. Die Zukunft wird zu<br />
Gunsten der Gegenwart vernachlässigt.“<br />
(Richard von Weizsäcker)<br />
baut werden. Dies erfordert effektive<br />
Konzepte zur Reform des Weltfinanzund<br />
Handelssystems mit Regelungen für<br />
die Märkte, die nicht lediglich Spielball<br />
grenzenlosen und bedenkenlosen Gewinnstrebens<br />
sein dürfen, sondern eines<br />
ordnungspolitischen Rahmens bedürfen.<br />
� Die Schere zwischen den Armen und<br />
Reichen innerhalb unserer Gesellschaft,<br />
aber auch zwischen den entwickelten<br />
und sich entwickelnden Ländern geht<br />
nach wie vor auseinander und erfordert<br />
weiter unsere solidarische Hilfe. Es bedarf<br />
wirksamer Konzepte im Kampf gegen<br />
Armut, um national und international<br />
eine größere Verteilungsgerechtigkeit<br />
zu erreichen.<br />
� Die Strukturelemente unseres Sozialstaats<br />
– die soziale Altersvorsorge, die<br />
gesetzliche Krankenversicherung, die<br />
Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe<br />
– müssen weiter an die bevölkerungsbedingten<br />
Mehrbelastungen der<br />
kommenden Jahrzehnte angepasst werden.<br />
� Die zunehmende Verschuldung der öffentlichen<br />
Haushalte darf nicht dazu<br />
führen, dass die Gesellschaft von heute<br />
auf Kosten der Generation von morgen<br />
lebt.<br />
� Die Tatsache, dass in der Bundesrepublik<br />
Deutschland jährlich schätzungsweise<br />
über 200.000 ungeborene Kinder getötet<br />
werden (Statistik der offiziell gemeldeten<br />
Abtreibungen für 2008:<br />
115.000), führt drastisch die Notwendigkeit<br />
vor Augen, das Bewusstsein weiter<br />
zu stärken, dass es keinen Unterschied<br />
zwischen geborenem und ungeborenem<br />
Leben gibt.<br />
1 Die katholischen <strong>Studenten</strong>verbände haben<br />
in einem Positionspapier ihren Standpunkt<br />
zu aktuellen sozialpolitischen Fragen<br />
dargelegt. Vgl. Arbeitsgemeinschaft<br />
katholischer <strong>Studenten</strong>verbände: STAND-<br />
PUNKTE Nr. 11 – Positionspapier zu einer<br />
verantwortungsbewussten Sozialpolitik<br />
im 21. Jahrhundert, Bonn <strong>2009</strong>.
� Die modernen Fortpflanzungshilfen<br />
und die neuen Möglichkeiten zu genetischen<br />
Eingriffen stellen uns vor große<br />
ethische und rechtliche Fragen, die einer<br />
raschen Antwort bedürfen, wenn<br />
die Würde der menschlichen Person gewahrt<br />
werden soll.<br />
� Angesichts des sich abzeichnenden<br />
Klimawandels müssen möglichst rasch<br />
vernünftige Maßnahmen gegen die<br />
möglichen Ursachen und Folgen ergriffen<br />
werden. Ideologische Scheuklappen,<br />
fiskalische und wirtschaftspolitische<br />
Verantwortungslosigkeit, aber<br />
auch übereilter Aktionismus dürfen dieses<br />
Ziel nicht behindern.<br />
(2) Wir als junge Erwachsene erachten die<br />
bevorstehenden Wahlen zum 17. Deutschen<br />
Bundestag am 27. September <strong>2009</strong> als zentrale<br />
politische Richtungsentscheidung. In<br />
der kommenden Legislaturperiode müssen<br />
Entscheidungen getroffen werden, die unsere<br />
Zukunft und die kommender Generationen<br />
irreversibel zum Guten oder zum<br />
Schlechten beeinflussen werden. Die in der<br />
Arbeitsgemeinschaft katholischer <strong>Studenten</strong>verbände<br />
zusammengeschlossenen<br />
Vereinigungen legen daher im Blick auf die<br />
kommende Wahlentscheidung der Öffentlichkeit<br />
folgende Überlegungen vor:<br />
Von der Zuschauer- zur<br />
Teilnehmer-Demokratie<br />
(3) In den vergangenen Jahren ist immer<br />
wieder öffentliche Kritik an Politikern, Parteien<br />
und Parlament laut geworden, insbesondere<br />
unter jüngeren Bundesbürgern.<br />
Man spricht nicht selten von „Politiker-“<br />
oder „Parteien-Verdrossenheit“. Rückzug ins<br />
Private, eine apolitische Haltung oder sogar<br />
die Abwanderung zu extremistischen<br />
Gruppierungen als Protesthaltung sind oftmals<br />
die Folgen.<br />
Meinungsumfragen,<br />
die über längere Zeiträume<br />
erhoben wurden,<br />
belegen nach wie vor eine<br />
bemerkenswert hohe Präferenz<br />
der Bundesbürger<br />
für die demokratische<br />
Staatsform.<br />
Immer mehr Wähler<br />
stoßen sich allerdings an<br />
der Diskrepanz zwischen<br />
dem Anspruch und dem<br />
tatsächlichen Wirken der<br />
Parteien und ihrem vom<br />
Grundgesetz vorgegebenen<br />
Auftrag. Dort wird<br />
ihnen in Artikel 21 lediglich<br />
ein Mitwirkungsrecht<br />
an der politischen Willensbildung<br />
des Volkes<br />
eingeräumt. Ihre Praxis<br />
legt jedoch gelegentlich den Verdacht<br />
nahe, dass der Verfassungsgrundsatz, wonach<br />
alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht,<br />
dem nachgeordnet sei.<br />
Eine solche Entwicklung steht in zunehmendem<br />
Widerspruch zur Gültigkeit des<br />
Artikels 38 des Grundgesetzes, wonach die<br />
Abgeordneten des Deutschen Bundestags<br />
„an Aufträge und Weisungen nicht gebun-<br />
Der Arbeitsgemeinschaft katholischer<br />
<strong>Studenten</strong>verbände (<strong>AGV</strong>) gehören an:<br />
Der Cartellverband der katholischen<br />
deutschen <strong>Studenten</strong>verbindungen<br />
(CV), der Kartellverband katholischer<br />
deutscher <strong>Studenten</strong>vereine (KV),<br />
der Verband der wissenschaftlichen<br />
katholischen <strong>Studenten</strong>vereine<br />
UNITAS (UV), der Ring katholischer<br />
deutscher Burschenschaften (RKDB)<br />
und der Technische Cartell-Verband<br />
(TCV).<br />
Die <strong>AGV</strong> repräsentiert in ihren fünf<br />
Mitgliedsverbänden rund 10.000<br />
katholische Studierende. Sie ist Plattform<br />
für gemeinsame Projekte und<br />
Initiativen der Verbände und vertritt<br />
die Interessen katholischer <strong>Studenten</strong><br />
gegenüber Staat, Kirche, Hochschule<br />
und Gesellschaft. In diesem Jahr kann<br />
die Arbeitsgemeinschaft auf ihr<br />
40-jähriges Bestehen zurückblicken.<br />
Mehr Informationen unter:<br />
www.agvnet.de<br />
den und nur ihrem Gewissen unterworfen“<br />
sind. Kurzfristige wahltaktische Gesichtspunkte<br />
und Parteiräson erhalten häufig bei<br />
Sach- wie bei Personalentscheidungen den<br />
Vorzug vor Qualität und Solidität. Unter<br />
den Stichworten „Ausgewogenheit“ oder<br />
„demokratischer Konsens“ verbirgt sich<br />
nicht selten ein hohes Maß an Überanpassung<br />
und Gemeinplatzkultur. Dies lässt<br />
Konturen verblassen und führt zu einer<br />
Orientierungs- und Identitätsschwäche der<br />
Parteien. Ohne starke Persönlichkeiten gibt<br />
es keine starken Parteien.<br />
(4) Hinzu kommt, dass die anstehenden<br />
Probleme immer komplexer und komplizierter<br />
und somit für die meisten Bürger<br />
immer schwieriger durchschaubar und<br />
nachvollziehbar sind. Die häufig schon<br />
bestehende Kluft zwischen Repräsentanten<br />
und Repräsentierten muss wieder geschlossen<br />
werden. Eine parlamentarische<br />
Demokratie bedarf der Identifikation des<br />
Bürgers mit seinem Staat und dessen politischen<br />
Entscheidungsprozessen.<br />
Eine Partizipation des Einzelnen bedingt<br />
jedoch, dass entscheidende Sachverhalte<br />
und Fragestellungen offen dargelegt<br />
werden, anstatt sie hinter nebulösen<br />
Formulierungen und politischen Floskeln<br />
zu verbergen. Vermeintlich einfache Antworten<br />
auf komplizierte Problemstellungen<br />
sind meist eher der Medientauglichkeit<br />
als der Sache selbst geschuldet.<br />
Politik muss also dem Bürger auch komplexe<br />
Antworten erklären, anstatt ihn mit<br />
plakativen Phrasen abzuspeisen. Wir brauchen<br />
eine „Teilnehmer-“ und keine „Zuschauer-Demokratie“!<br />
Demokratie braucht glaubwürdige<br />
Repräsentanten<br />
(5) Die Demokratie ist in hohem Maße darauf<br />
angewiesen, dass im Volk moralische<br />
Konventionen und Traditionen wirksam<br />
sind, die für den Bestand des Gemeinwesens<br />
unerlässlich sind. Zu den notwendigen<br />
demokratischen Tugenden gehört an<br />
erster Stelle die Bereitschaft, das eigene,<br />
partikulare Interesse dem Gemeinwohl einoder<br />
unterzuordnen.<br />
Eine Demokratie ist auf Dauer nur funktionsfähig,<br />
wenn sie sich auf den Konsens<br />
darüber berufen kann, dass dem Wohl aller<br />
Priorität zukommen muss. Diese Einsicht<br />
drückt sich auch im Prinzip der Solidargemeinschaft<br />
aus: Der Stärkere soll dem<br />
Schwächeren beistehen.<br />
Das demokratische System stellt die<br />
Unvollkommenheit des Menschen in Rechnung.<br />
Deshalb verzichtet es auf absolute<br />
Wahrheiten oder vollkommene Lösungen >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 23
und belässt es bei der Vorläufigkeit oder<br />
Kompromisshaftigkeit von Entscheidungen.<br />
Demselben Motiv entspringt das Misstrauen<br />
gegen die Macht und die Mächtigen;<br />
deshalb werden wirksame Kontrollmechanismen<br />
eingesetzt.<br />
Gewiss können Politiker keine „Übermenschen“<br />
sein. Aber dennoch legt ihnen<br />
ihr Amt eine besondere Verpflichtung auf.<br />
Wenn sie sich zum Repräsentativ-System<br />
bekennen, muss dieses durch sie auch<br />
seine Glaubwürdigkeit gewinnen. Wer ein<br />
Mandat übernimmt, zehrt von einem<br />
Vorschuss an Vertrauen, das er rechtfertigen<br />
muss. Wenn er glaubwürdig bleiben<br />
will, muss deutlich werden, dass er sich<br />
nicht korrumpieren lässt und dass er nicht<br />
seine eigenen Interessen in den Vordergrund<br />
stellt. Wenn er vom Volk Opfer und<br />
Verzicht verlangt, muss er selbst dafür<br />
Beispiele geben.<br />
Auch in der Demokratie wird Herrschaft<br />
ausgeübt. Da solche Macht aber immer nur<br />
stellvertretend für das Volk wahrgenommen<br />
werden kann, kommt es darauf an,<br />
dass sich die jeweils Verantwortlichen als<br />
glaubwürdig erweisen. Sobald sich Misstrauen<br />
gegen die „Obrigkeiten“ ausbreitet,<br />
droht dem Staat eine Vertrauenskrise, die<br />
ihn in seinen Wurzeln trifft.<br />
Vor diesem Hintergrund<br />
stellen wir uns als<br />
katholische <strong>Studenten</strong>verbände<br />
angesichts der<br />
bevorstehenden Bundestagswahl<br />
die Frage, wie<br />
wir uns als Christen in<br />
unserer pluralistischen,<br />
säkularisierten Gesellschaft<br />
und Lebenswelt<br />
Gehör verschaffen können,<br />
um unser Verständnis<br />
der lebensdienlichen,<br />
unverzichtbaren Grundwerte<br />
und deren letztlich<br />
religiöse Substanz glaubwürdig<br />
zu bezeugen und praktisch werden<br />
zu lassen.<br />
Politisches Handeln<br />
im Geist des Evangeliums<br />
(6) Dazu gehört in erster Linie die Besinnung<br />
auf jene Grundlagen, von denen<br />
Christen bestimmt sein müssen, wenn sie<br />
ihre Verantwortung für die Welt wahrnehmen.<br />
In den Aussagen des II. Vatikanischen<br />
Konzils heißt es:„Das Erlösungswerk Christi<br />
zielt an sich auf das Heil des Menschen, es<br />
umfasst aber auch den Aufbau der gesamten<br />
zeitlichen Ordnung. Daraus ergibt sich<br />
für den Christen die Notwendigkeit, die<br />
zeitliche Ordnung im Geiste des Evangeliums<br />
zu vervollkommnen und zu durchdringen“<br />
(Apostolicam Actuositatem, 5).<br />
24<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Dabei lässt er<br />
sich zum einen von<br />
den Grundsätzen<br />
einer christlichen<br />
Ethik leiten, zum<br />
anderen von der<br />
grundlegenden<br />
Verpflichtung des<br />
einzelnen, über<br />
den unmittelbar individuellen Bereich<br />
hinaus die aus der Sozialnatur des Menschen<br />
erwachsene Verpflichtung für die<br />
Gesellschaft als Ganze zu sehen und zu<br />
beachten.<br />
Dies heißt aber auch, dass der Christ<br />
das Handeln des einzelnen Politikers und<br />
der Parteien im Geiste des Evangeliums<br />
prüfen soll. Diese Prüfung hat den Glauben<br />
zum Maßstab, nicht als konkretes Handlungsprogramm,<br />
sondern als normative<br />
Orientierung.<br />
Politik muss auf<br />
Zukunft angelegt sein<br />
(7) Wir fordern eine neue Besinnung auf die<br />
Werte der Freiheit und auf die Tugend der<br />
zwischenmenschlichen Gerechtigkeit. Dabei<br />
muss die Würde des Menschen das Maß<br />
aller Dinge sein. Angesichts von Umweltzerstörung,<br />
Bedrohung des Weltfriedens<br />
und neuer Technologien fordern<br />
wir mutigere, kompromisslosere<br />
und manchmal<br />
auch unbequeme Entscheidungen,<br />
um den Menschen in<br />
unserem Land und weltweit<br />
die Hoffnung auf ein menschenwürdiges<br />
Leben zu erhalten<br />
bzw. zu ermöglichen.<br />
Die dazu notwendigen Konzeptionen<br />
einer freiheitlichen<br />
und die Forderung nach sozialer<br />
Gerechtigkeit respektierenden<br />
Politik müssen – sollen<br />
sie nicht Reißbrettspiele<br />
bleiben – auf Zukunft angelegt<br />
sein, die länger dauert als bis zum<br />
nächsten Wahltermin. Gelingen wird dies<br />
aber nur, wenn solche Konzepte auf den<br />
christlichen Strukturprinzipien von Staat<br />
und Gesellschaft aufbauen:<br />
� Personalität – damit die Würde des<br />
Menschen, das Recht und die Freiheit<br />
der Person gewahrt bleiben;<br />
� Solidarität – damit alle Menschen sich<br />
verantwortlich füreinander wissen und<br />
danach handeln;<br />
� Subsidiarität – damit die Freiheit des<br />
einzelnen gesichert wird gegenüber<br />
dem Zugriff des Systems.<br />
� Nachhaltigkeit – damit künftige Generationen<br />
nicht ihrer Möglichkeiten beraubt<br />
werden.<br />
Wahlprüfsteine<br />
(8) Wir begrüßen das Bestreben der politischen<br />
Parteien in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, Grundwerte als Maßstäbe für<br />
das politische Handeln zu formulieren.<br />
Diese Werte dürfen jedoch nicht Theorie<br />
bleiben, sondern müssen in die Praxis umgesetzt<br />
werden.<br />
Alle Bürger, insbesondere die Politiker,<br />
müssen diese Werte leben, und das heißt:<br />
Ihr tagespolitisches Handeln muss von<br />
Werten geformt werden. Nur so können<br />
Politiker Vorbildcharakter gerade für die<br />
jungen Menschen gewinnen.<br />
Kandidaten konkret auf ihre<br />
Ziele und Haltungen<br />
ansprechen<br />
(9) Das demokratische Gemeinwesen<br />
braucht vertrauenswürdige und verantwortliche<br />
Repräsentanten, die Führungsaufgaben<br />
so verlässlich wahrnehmen, dass<br />
die Bürger sich an Person und Position<br />
orientieren können. Der Kampf um den<br />
Erwerb und die Erhaltung politischer Macht<br />
ist ein notwendiges Element im politischen<br />
Prozess. Politiker müssen dabei das Vertrauen<br />
der Bürger erwerben. Der demokratische<br />
Staat ist darauf angewiesen, dass<br />
Politiker sich an ethischen Maßstäben messen<br />
und sich von anderen darauf ansprechen<br />
lassen.<br />
Die <strong>AGV</strong> fordert daher alle christlichen<br />
Wähler, insbesondere die Studentinnen<br />
und <strong>Studenten</strong> ihrer Mitgliedsverbände,<br />
auf, sich im Blick auf dieses Ziel konkret mit<br />
den einzelnen Kandidaten für den nächsten<br />
Bundestag auseinander zu setzen und sich<br />
von den Bewerbern um ein politisches<br />
Mandat und ihrer Glaubwürdigkeit ein<br />
möglichst umfassendes Bild zu machen. Sie<br />
sollen versuchen, die Kandidaten persönlich<br />
zu befragen, sei es in einer Sprechstunde<br />
im Wahlkreis oder bei einer Wahlkampfveranstaltung.<br />
(10) Entsprechende Ansatzpunkte als Kriterien<br />
für die Beurteilung und damit letztlich<br />
die Wählbarkeit der Kandidaten sind nach<br />
Auffassung der <strong>AGV</strong>:<br />
� Dass sie ihre Verpflichtung dem Gemeinwohl<br />
gegenüber nicht durch einseitige<br />
Abhängigkeit von gesellschaftlichen<br />
Interessengruppen beeinträchtigen<br />
lassen;
� dass sie willens und in der Lage sind, in<br />
Gewissensfragen unbeeinflusst von<br />
Partei- und sonstigen Zwängen nur ihrem<br />
christlich geprägten Gewissen verpflichtet<br />
zu votieren;<br />
� dass sie bereit sind, Entscheidungsprozesse<br />
und Beweggründe ihres Handelns<br />
transparenter, befragbarer und<br />
für den Bürger beeinflussbarer zu machen<br />
und so der Gefahr einer Ablösung<br />
der politischen Entscheidungsfindung<br />
von den Bürgern entgegenwirken;<br />
� dass sie Zukunftsperspektiven entwickeln,<br />
die den Menschen im Mittelpunkt<br />
sehen und dem Machbarkeitsdenken<br />
die Grenze der Verantwortbarkeit<br />
entgegenhalten;<br />
� dass sie die Herausforderungen der<br />
Zukunft – Umbau der sozialen Sicherungssysteme,<br />
eine verantwortungsbewusste<br />
Finanzpolitik und die Bewahrung<br />
der Schöpfung – nicht zugunsten<br />
der Gegenwart vernachlässigen<br />
� dass sie dem Schutz und dem Wohl des<br />
Lebens – des ungeborenen, des behinderten<br />
und des entrechteten – den<br />
uneingeschränkten Vorrang vor wahltaktischen<br />
und politisch-strategischen<br />
Erwägungen einräumen und eindeutige<br />
Aussagen gegen die Abtreibung treffen;<br />
� dass sie der Gefahr der Manipulation<br />
unseres Erbgutes durch die immensen<br />
Fortschritte in der Gentechnologie<br />
durch klare rechtliche Vorschriften entgegenwirken<br />
und so die Würde und<br />
Einzigartigkeit des Menschen sicherstellen;<br />
� dass sie sich zur persönlichen Aufgabe<br />
machen, eine von Nächstenliebe geprägte,<br />
sozial gerechte Gesellschaft aufzubauen,<br />
die weder Ellbogenmentalität<br />
in ihren Mittelpunkt stellt, noch<br />
Gleichgültigkeit zulässt, sondern vielmehr<br />
die sozial Schwachen, am Rande<br />
unserer Gesellschaft<br />
lebende Menschen, insbesondere<br />
Minderheiten,<br />
nicht ausgrenzt und ihre<br />
Rechte wahrt;<br />
� dass sie für die Durchsetzung<br />
der Menschenrechte<br />
in allen Teilen der<br />
Welt eintreten und nicht<br />
nur in solchen Fällen, für<br />
die eine öffentliche Meinung<br />
mobilisierbar ist;<br />
� dass sie in der Zusammenarbeit<br />
mit der so genannten<br />
„Dritten Welt“<br />
Perspektiven für eine gemeinsame<br />
Zukunft in<br />
wechselseitiger Solidarität fördern, wobei<br />
Entwicklungspolitik in erster Linie<br />
als „Option für die Armen“ verstanden<br />
wird und den Menschen hilft, ihre eigenen<br />
Kräfte zu entfalten;<br />
� dass sie familienpolitisch den auflöserischen,<br />
liberalistischen und zentrifugalen<br />
Entwicklungen in unserer Gesellschaft<br />
entgegenwirken, indem sie dafür<br />
sorgen, dass alte Menschen respektiert<br />
und nicht abgeschoben werden und<br />
dass junge Menschen nicht entmutigt<br />
werden, sodass der Wert „Familie“ wieder<br />
neue Geltung bekommt;<br />
� dass sie bildungspolitisch solche Ziele<br />
verfolgen, die auch dem akademischen<br />
Nachwuchs noch Chancen eröffnen<br />
und die den <strong>Studenten</strong> personal begreifen<br />
und ihm an Hochschulen und Universitäten<br />
Bildung statt reiner Fach-<br />
Ausbildung vermitteln;<br />
� dass sie alles tun, dass die Menschen –<br />
unabhängig ihres Glaubens, ihrer Rasse<br />
und ihrer politischen Überzeugung – in<br />
innerem und äußerem Frieden leben<br />
können;<br />
� dass sie mithelfen, den Glauben an Freiheit<br />
und Menschenwürde als elementaren<br />
Beitrag zum Frieden und als Zukunftsperspektive<br />
zu begreifen.<br />
(11) Wir fordern alle Wahlberechtigten, insbesondere<br />
die studentische Jugend auf, sich aktiv<br />
an der nächsten Bundestagswahl zu beteiligen<br />
und ihr Wahlrecht wahrzunehmen.<br />
Ein demokratischer Staat braucht eine ihm<br />
entsprechende demokratische Gesellschaft,<br />
die von ihren Rechten Gebrauch macht, sich<br />
die Grundentscheidungen der Demokratie<br />
zueigen macht und aus ihnen lebt.<br />
(12) Gleichzeitig appellieren wir an das<br />
Gewissen der Mitglieder unserer Verbände<br />
sowie aller übrigen Bürger, nur solche Kandidaten<br />
zu wählen, die christlich verantwortbare<br />
Positionen glaubwürdig in Wort<br />
und Tat vertreten. Ob ein Christ einen bestimmten<br />
Kandidaten oder eine bestimmte<br />
Partei wählen kann, bestimmen diese selbst,<br />
nämlich inwieweit sie in ihrem Programm<br />
und in ihrer praktischen Politik christliche<br />
Werte berücksichtigen.<br />
(13) Nicht zuletzt wollen wir auch darauf<br />
hinweisen, dass die Art und Weise, wie ein<br />
Wahlkampf geführt wird,<br />
Ausdruck einer christlichen<br />
Grundhaltung sein kann. Die an<br />
der Wahl beteiligten Parteien<br />
und ihre Kandidaten fordern<br />
wir auf, den Wahlkampf sachlich<br />
zu führen, die Meinungen<br />
der Gegner zu tolerieren und zu<br />
respektieren. Obwohl Streit um<br />
die Sache und auch um die<br />
Macht zu den legitimen Erscheinungsformen<br />
der Demokratie<br />
gehört, dürfen die auszutragenden<br />
Gegensätze nicht zu<br />
einem Freund-Feind-Verhältnis<br />
entarten, indem der politische<br />
Gegner diffamiert und verletzt<br />
wird.<br />
München, den 11. März <strong>2009</strong><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 25
26<br />
Arbeitsgemeinschaft katholischer <strong>Studenten</strong>verbände (<strong>AGV</strong>)<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
<strong>Studenten</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> <strong>2009</strong><br />
„Auf den Spuren des Apostels Paulus und der frühen Christen“<br />
vom 02. bis 13. September <strong>2009</strong><br />
in die Türkei<br />
Die 12-tägige <strong>Studenten</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> der <strong>AGV</strong> folgt im ausklingenden Paulus-Jahr<br />
noch einmal den Spuren des Völkerapostels, dieses Mal nach Kleinasien. Auf dem<br />
Gebiet der heutigen Türkei bildeten sich die ersten christlichen Gemeinden, von<br />
denen die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe und die Sendschreiben aus der<br />
Offenbarung des Johannes Zeugnis geben. Diese Abschnitte aus dem Neuen<br />
Testament bilden den geistlich-inhaltlichen Rahmen der Pilgerreise. Aber auch die<br />
schwierige aktuelle Situation der kleinen christlichen Gemeinden in der heute<br />
überwiegend muslimischen Türkei wird uns beschäftigen.<br />
Unser erstes Ziel ist Ephesus und seine Umgebung, wo Paulus bereits 54 n. Chr.<br />
der Bevölkerung den neuen Glauben brachte. Hier besuchen wir das einmalige<br />
Ausgrabungsgelände mit der Marienkirche, in der 431 das III. Ökumenische<br />
Konzil stattfand, das Marienhaus auf dem Nachtigallenberg, wo die Mutter Jesu<br />
der Überlieferung nach ihre letzten Jahre verbracht haben soll, und die Reste der<br />
Johannesbasilika, wo seit dem 2. Jh. das Grab des Evangelisten Johannes verehrt<br />
wurde, der zusammen mit Maria nach Ephesus gekommen sein soll.<br />
Der Apostel Paulus<br />
Ein besonderes Erlebnis wird die mehrtägige Bootsfahrt mit einem Motorsegler,<br />
einer Gület, sein. Vor der Kulisse der imposanten Bergwelt des Lykischen Taurus<br />
mit Gipfeln von weit über 3.000 Metern Höhe genießen wir die zerklüftete Küste mit ihren vielfältigen Reizen, werfen Anker<br />
in malerischen Buchten, können an herrlichen Sandstränden baden und machen Landausflüge zu interessanten Orten, etwa nach<br />
Myra, der Stadt des hl. Nikolaus. Auch hier folgen wir dem Apostel Paulus, der auf seinen Reisen mehrfach diese Region mit<br />
dem Schiff besucht hat.<br />
Den Abschluss der Pilgerreise bildet ein Besuch in Istanbul, dem einstigen Byzanz und Konstantinopel, wo wir noch einmal den<br />
Zauber des Orients mit seiner Anziehungskraft in besonderer Weise erleben werden.<br />
Teilnehmerbeitrag für Studierende aus dem UNITAS-Verband: 590,- EUR<br />
Teilnehmerbeitrag für sonstige Studierende und Auszubildende: 850,- EUR<br />
Teilnehmerbeitrag für Jungakademiker/-innen: 1.100,- EUR<br />
Programm und ausführliche Informationen sind im Internet unter www.agvnet.de unter der Rubrik „<strong>Wallfahrt</strong>en“ oder<br />
unter www.unitas.org unter der Rubrik „Aktuelles“ zu finden oder können bei der <strong>AGV</strong>-Geschäftstelle, Luisenstr. 36, 53129<br />
Bonn, angefordert werden.<br />
CV • KV • UV • RKDB • TCV
THEMA DES ALTHERRENBUNDS-/HOHEDAMENBUNDSTAGES <strong>2009</strong> IN MÜNSTER:<br />
Die Zukunft des Sozialstaates<br />
angesichts von Globalisierung und<br />
demografischem Wandel<br />
VON BBR. HEINRICH SUDMANN<br />
Die Geschichte der Bundesrepublik<br />
Deutschland ist nicht zuletzt auch eine<br />
Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft.<br />
Neben der großen Aufbauleistung<br />
nach den Zerstörungen des<br />
Zweiten Weltkrieges steht der Ausbau des<br />
Sozialstaates, der ganz entscheidend zur<br />
Identifikation der Bürger mit ihrem Staat<br />
und zu weitgehend sozialem Frieden beigetragen<br />
hat. Es ist heute fast selbstverständlich,<br />
dass viele sich bei Krankheit und<br />
Schicksalsschlägen nicht mehr sorgen müssen,<br />
in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet<br />
zu sein. Die Alterssicherung wird<br />
unter dem Anspruch einer Sicherung des<br />
erworbenen Lebensstandards beurteilt. Wir<br />
haben uns daran gewöhnt, immer mehr<br />
fordern und mit immer höheren Leistungen<br />
rechnen zu können.<br />
Das ist in den letzten Jahren anders geworden:<br />
Die einmaligen Bedingungen der<br />
Wiederaufbauphase nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg haben sich entscheidend verändert.<br />
Viele Bedingungen, die die angesprochene<br />
Entwicklung ermöglicht haben, gelten<br />
nicht mehr.<br />
„Der bisherige Erfolg der westlichen<br />
Sozial- oder Wohlfahrtsstaaten beruhte<br />
� auf dem dynamischen Zusammenhang<br />
zwischen einem starken, d.h. entscheidungs-<br />
und steuerungsfähigen Staat,<br />
� einer die Dispositionsfreiheit der Unternehmer<br />
sichernden, ihre Produktion<br />
fortwährend steigernden Marktwirtschaft,<br />
� dem Ausbau eines die Folgeprobleme<br />
der Wirtschaftsdynamik auffangenden<br />
und die Lebensbedingungen der Gesamtbevölkerung<br />
stabilisierenden Sozialsektors<br />
und den Leistungen der<br />
privaten Haushalte, insbesondere der<br />
Familien.<br />
Alle bisherigen theoretischen Bemühungen<br />
zum Verständnis der Sozialund<br />
Wohlfahrtsstaatlichkeit setzen den<br />
Nationalstaat als entscheidende Bedingung<br />
voraus. 1<br />
Symptome einer Krise<br />
Unseren derzeitigen Zustand beschreibt<br />
Franz-Xaver Kaufmann mit dem<br />
Satz: „Es ist ungemütlich geworden im<br />
deutschen Sozialstaat.“ 2 Wir alle kennen<br />
und beobachten Entwicklungen, die das<br />
deutlich machen:<br />
� die Diskussion um die Sicherheit unserer<br />
Renten;<br />
� ausbleibende oder nur geringfügige<br />
Rentenerhöhungen;<br />
� Heraufsetzung des Rentenalters;<br />
� Kürzungen im Bereich der Sozialhilfe<br />
und der Arbeitslosenversicherung;<br />
� die Diskussion um die Krankenversicherung<br />
und die Reform des Gesundheitswesens;<br />
� die Frage nach der Zukunftsfähigkeit<br />
der Pflegversicherung;<br />
� Ausdehnung der sozialen Systeme auf<br />
alle Lebensbereiche;<br />
� die Klage über die Höhe der Lohnnebenkosten;<br />
� die hohe Staatsverschuldung mit 1605<br />
Milliarden Euro direkten Schulden;<br />
� strukturelle Arbeitslosigkeit mit ca. vier<br />
Mio. Betroffenen.<br />
Es gibt keine Kriterien für eine Begrenzung<br />
der Umverteilung im Sinne einer größeren<br />
sozialen Gerechtigkeit. „So gesehen<br />
ist es durchaus verständlich, dass über soziale<br />
Unausgewogenheit und soziale<br />
Gerechtigkeit auch dann noch mit Erfolg<br />
räsoniert werden kann, wenn der Staatsanteil<br />
am Bruttoinlandsprodukt 47 Prozent<br />
erreicht, der Sozialstaat davon rund 60 Prozent<br />
für sich beansprucht und die Verschuldung<br />
des Gesamtstaates kontinuierlich<br />
wächst.“ 3<br />
„Wie groß die Widersprüche inzwischen<br />
sind, zeigt uns die Entwicklung der Schuldenquote.<br />
Sie verbindet Wachstum und<br />
Verschuldung des Staates. Steigt die Schuldenquote,<br />
so bedeutet dies, dass die Verschuldung<br />
schneller wächst als die Wirtschaftsleistung<br />
des Landes. Im Jahr 1970<br />
betrug die Schuldenquote 18 Prozent des<br />
Bruttoinlandsprodukts. 1981 war sie auf 31<br />
Prozent gestiegen, 1990 auf 42 Prozent, im<br />
Jahr 2000 auf 60 Prozent. Heute beträgt sie<br />
68 Prozent. In diesen Zahlen wird die<br />
Vergeblichkeit des Versuchs deutlich, durch<br />
Staatsverschuldung Wachstum zu fördern.“<br />
4 Biedenkopf fasst zusammen: „Die<br />
Lasten steigen, und die Leistungen, zu<br />
denen wir fähig sind, gehen zurück.“<br />
Auf der anderen Seite irritieren viele<br />
Bürger steigende Aktienkurse, hohe Managergehälter<br />
und die Senkung der Steuern<br />
für Unternehmer und Spitzenverdiener.<br />
Eine völlig neue Dimension hat die Entwicklung<br />
mit der Bankenkrise, dem Rückgang<br />
der Konjunktur und milliardenschweren<br />
Sanierungsprogrammen erreicht. Damit<br />
erscheinen Korrekturen der letzten Jahre<br />
zur Reduzierung der entstandenen Probleme<br />
wie die Gesundheitsreform und die<br />
Heraufsetzung des Rentenalters auf 67<br />
Jahre geradezu als Tropfen auf dem heißen<br />
Stein.<br />
Beide „Reformen“ zeigen zudem auch,<br />
dass unsere politische und gesellschaftliche<br />
Situation nur Kompromisse zulässt und<br />
nicht, wie es immer wieder gefordert wird,<br />
eine grundlegende Neuordnung mit einer >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 27
gemeinsamen Perspektive für alle verschiedenen<br />
Reformansätze. So beschreibt Klaus-<br />
Dirk Henke (FAZ vom 17. 2. 2007) das Ergebnis<br />
der Gesundheitsreform wie folgt: „Die<br />
verquere wirtschaftliche, politische und<br />
begriffliche Ausgangslage hat mit dazu beigetragen,<br />
dass es in den Eckpunkten der<br />
nunmehr verabschiedeten Gesundheitsreform<br />
zu der Fondslösung gekommen ist.<br />
Mit der Dichotomie zwischen Bürgerversicherung<br />
und Kopfpauschale befand sich<br />
die Koalition bereits in einer Kompromissfalle.<br />
Denn es musste sichergestellt werden,<br />
dass nach der<br />
nächsten Bundestagswahl<br />
eine ‚linke‘ Regierung<br />
in Richtung der<br />
gewünschten Steuerlösung<br />
gehen kann und<br />
dass umgekehrt eine<br />
‚rechte‘ Regierung den<br />
Paradigmenwechsel zu<br />
einem Prämienmodell<br />
fortführen kann.“<br />
Auch bei der Rentenreform<br />
kommt die<br />
Diskussion trotz mehrerer<br />
Reformvorhaben<br />
nicht zur Ruhe. Während<br />
die einen in der Heraufsetzung<br />
der Altersgrenze<br />
den einzigen<br />
Weg sehen, „der das<br />
Rentensystem aus heutiger<br />
Sicht auf halbwegs<br />
schonende Weise weiter<br />
befestigen kann“ (FAZ<br />
vom 1. 6. 2007) fordern<br />
die anderen, so jüngst<br />
im Einvernehmen mit den Gewerkschaften<br />
die stellv. SPD-Vorsitzende Andrea Nahles,<br />
die Änderung oder den Verzicht auf diesen<br />
Reformansatz.<br />
Ursachen<br />
Demografischer Wandel<br />
Zu den volkswirtschaftlichen Erkenntnissen,<br />
die eigentlich Allgemeingut sind,<br />
aber trotzdem immer wieder aus dem Auge<br />
verloren werden, gehört die Tatsache, dass<br />
wir alle aus dem jeweils aktuell erwirtschafteten<br />
Volkseinkommen unseren Lebensbedarf<br />
bestreiten müssen. Das gilt<br />
sowohl für die noch nicht im Arbeitsleben<br />
Stehenden, für die aktiv im Erwerbsleben<br />
Stehenden als auch für die schon aus der<br />
aktiven Beteiligung an der Erwirtschaftung<br />
des Sozialprodukts Ausgeschiedenen.<br />
Wir stehen vor der Situation, dass eine<br />
immer geringer werdende Zahl von aktiv<br />
Erwerbstätigen und Produzierenden das<br />
Sozialprodukt mit einer immer größeren<br />
Zahl von nicht im Erwerbsleben Stehenden<br />
teilen muss. Daraus ergeben sich im Hin-<br />
28<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
blick auf die Zukunft Fragen, wie z.B.: Bis zu<br />
welchem Anteil wird diese Solidaritätspflicht<br />
ohne Widerstand geleistet? Bis zu<br />
welchem Punkt gefährdet diese Pflicht zur<br />
Solidarität auf Seiten der Erwerbstätigen<br />
die Motivation zur Arbeit nicht und bleiben<br />
entsprechende Regelungen zur sozialen<br />
Sicherung politisch mehrheitsfähig? Man<br />
kann auch fragen: Wie viel soziale Sicherheit<br />
kann eine immer größere Zahl älterer<br />
Wähler erzwingen, ohne die Belastbarkeit<br />
eines Wirtschafts- und Sozialsystems zu<br />
überfordern?<br />
Auch wenn es viele noch nicht wahrhaben<br />
wollen, steht doch fest: Wir alle, ob wir<br />
heute kinderlos bleiben oder Verantwortung<br />
als Eltern übernehmen, können von<br />
einer sozial gesicherten Zukunft nur ausgehen,<br />
wenn die Zahl der Kinder ausreicht,<br />
auch zukünftig die aus dem Arbeitsleben<br />
Ausgeschiedenen ebenso wie die noch<br />
nicht im Arbeitslebenden Stehenden mit zu<br />
versorgen.<br />
Die Altersgruppe, die in Deutschland<br />
am stärksten wächst, sind die 80- bis 100-<br />
Jährigen. Nach den Zahlen des Statistischen<br />
Bundesamtes nimmt Deutschlands<br />
Bevölkerung ab, seine Menschen werden<br />
älter, und es werden noch weniger Kinder<br />
geboren. Am 31. 12. 2007 hatte Deutschland<br />
rund 82.218.000 Einwohner. Das waren<br />
97.000 weniger als Ende 2006. Der Bevölkerungsrückgang<br />
im Jahre 2007 ist darauf<br />
zurückzuführen, dass dem Geburtendefizit<br />
von 142.000 Personen lediglich ein Zuwanderungsüberschuss<br />
von 44.000 Personen<br />
gegenüberstand.<br />
Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter<br />
von 20 bis 64 Jahren sinkt von derzeit<br />
50 Millionen bis 2050 um rund 22 Prozent<br />
auf 39 Millionen. 2005 kamen auf 100<br />
Menschen im Alter zwischen 20 und 65<br />
Jahren 32 Rentner. Bis 2050 wird sich dieser<br />
Wert auf 64 verschlechtern. Wenn man diesen<br />
Stand auf 32 halten wollte, müsste man<br />
das Rentenalter auf 74 bis 75 Jahre im Jahr<br />
2050 anheben. Der Anteil der unter 20-<br />
Jährigen und der Anteil der über 64-Jährigen<br />
beträgt heute jeweils 20 Prozent. 2050<br />
wird allerdings jeder Dritte in Deutschland<br />
65 oder älter sein. Das hat gravierende<br />
Auswirkungen auf unser Alterssicherungssystem.<br />
Ein Beispiel: Wenn man die<br />
Renten angesichts der angesprochenen<br />
Entwicklung stabil<br />
halten wollte, müsste man den<br />
Beitragssatz von jetzt 20 Prozent<br />
in den nächsten 20 Jahren<br />
auf 40 Prozent verdoppeln, will<br />
man den Beitragssatz konstant<br />
halten, würden sich die Renten<br />
halbieren.<br />
Im Übrigen ist das Problem<br />
der geringen Geburtenzahl zu<br />
einem nicht geringen Teil<br />
durch das Rentensystem selbst<br />
hervorgerufen. Die Beitragsbezogenheit<br />
führt nämlich<br />
dazu, dass Beitragszahler<br />
Rentenansprüche erwerben,<br />
und Mütter (und Vä-ter), die<br />
einige Jahre keine Beiträge<br />
zahlen, auch geringere Ansprüche<br />
erwerben. Durch die<br />
„Bestrafung“ von Eltern gräbt<br />
sich unser Rentensystem seine<br />
eigenen Wurzeln ab.<br />
Die deutschen Bischöfe nennen in ihrer<br />
Schrift „Das Soziale neu denken – Für eine<br />
langfristig angelegte Reformpolitik“ als<br />
schwerwiegende Probleme für die Entwicklung<br />
des Sozialstaates zwei Ungleichgewichte:<br />
„das Ungleichgewicht im politischen<br />
Prozess zwischen gut organisierten<br />
und daher einflussreichen Interessen einerseits<br />
und schlecht organisierbaren, aber in<br />
besonderer Weise der Unterstützung des<br />
Staates bedürftiger Interessen andererseits,<br />
sowie das Ungleichgewicht zwischen<br />
den aktuellen Problemen und Forderungen<br />
einerseits und den absehbaren, möglicherweise<br />
schwer wiegenden Problemen und<br />
Forderungen der Zukunft andererseits“.<br />
Diese Punkte gehören zu grundlegenden<br />
Problemen in unserer Gesellschaft, die<br />
eine Veränderung zum Besseren blockieren.<br />
So erscheint es nur schwer möglich, bei den<br />
derzeitigen Einstellungen und Machtkonstellationen<br />
in unserer Gesellschaft eine<br />
Mehrheit zu organisieren, die zu grundlegenden<br />
Veränderungen bereit wäre.<br />
In seinem schon zitierten Buch beschäftigt<br />
sich Biedenkopf zentral mit<br />
dem Problem der „Entgrenzung“: „Sie<br />
tritt in allen Bereichen des staatlichen,
des gesellschaftlichen und des individuellen<br />
Lebens auf. Ihre Symptome zeugen<br />
vom Verlust eindeutiger Maßstäbe, von<br />
der Auflösung staatlicher Zuständigkeiten<br />
und der schwindenden Autorität der<br />
Gesetze.“ 5<br />
Obwohl das Ziel ständiger Steigerung<br />
des Wirtschaftswachstums immer problematischer<br />
wird und letztlich dazu führt,<br />
dass wir es mit Schulden zu Lasten der<br />
kommenden Generation finanzieren, bleibt<br />
die Politik „in vertrauten Gefilden. Man entdeckt<br />
immer neue soziale Unausgewogenheiten<br />
und erklärt die soziale<br />
Gerechtigkeit zum Herzensanliegen. Wo<br />
immer derzeit politisch diskutiert und<br />
gestritten wird, geht es gerade nicht um die<br />
Zukunft der heute Aktiven, ihrer Eltern und<br />
um eine mögliche Ausbeutung der Enkel. Es<br />
geht um die Fortsetzung des 20. Jahrhunderts.<br />
Seine Gesetze, Erfahrungen und<br />
lieb gewonnenen Wohltaten sollen möglichst<br />
lange auch für das 21. Jahrhundert<br />
gültig bleiben“. 6<br />
Es gibt also nicht nur quantitative<br />
Probleme, sondern offensichtlich auch<br />
Einstellungen und Haltungen, die sich im<br />
Hinblick auf notwendige Reform als<br />
Blockaden erweisen.<br />
Die Reformunfähigkeit unserer Gesellschaft<br />
sieht etwa Paul Nolte in „postmodernen<br />
Illusionen“, die er in seinem Buch:<br />
„Generation Reform – Jenseits der blockierten<br />
Republik“ wie folgt beschreibt: „Die<br />
Deutschen setzen ihren Glauben an die<br />
wundersame Vermehrung von Wohlstand,<br />
Freizeit und Freiheit ohne irgendwie entstehende<br />
Kosten jetzt in vergrößertem Maßstab<br />
fort. Man könnte es das Rumpelstilzchen-Modell<br />
nennen: Irgendwie würde<br />
es schon gelingen, aus Dreck Gold zu<br />
machen. Weniger arbeiten, weniger produzieren,<br />
weniger investieren, sowohl betrieblich<br />
als auch privat, weniger Kinder großziehen<br />
– und dennoch mehr kaufen, mehr<br />
Urlaub machen, mehr Sicherheit im Alter<br />
genießen. Ein ganzes Bündel von Illusionen<br />
verdichtet sich im Laufe der Jahre zu diesem<br />
Rumpelstilzchen-Syndrom.“ 7<br />
Erwerbsarbeit ist ein Auslaufmodell<br />
und ein Verteilungsproblem. Hier geht es<br />
um die These vom Ende der Arbeitsgesellschaft.<br />
Entsprechend geht es nicht mehr<br />
um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern<br />
um eine gerechtere Verteilung der vorhandenen<br />
Arbeit. Entsprechend werden<br />
Kürzungen der Arbeitszeit angestrebt, was<br />
gleichzeitig mehr Freizeit bedeutet.<br />
Weniger Erwerbsarbeit ermöglicht gesellschaftlichen<br />
Fortschritt. Die verkürzte<br />
Arbeitszeit schafft für Männer mehr Möglichkeiten,<br />
sich auch um Haushalt und<br />
Kinder zu kümmern. Dadurch wird gleichzeitig<br />
die Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
gefördert. Die Vermutung, dass<br />
kürzere Arbeitszeiten auch zu zusätzlichem<br />
gesellschaftlichem Engagement führen<br />
würden, haben sich allerdings als Illusion<br />
erwiesen.<br />
Liberalisierung heißt Bindungslosigkeit<br />
und laissez faire. Der Druck steigt, eine fehlende<br />
Liberalisierung nachzuholen und auf<br />
weitere Bereiche auszudehnen. Das führte<br />
zu einer Tendenz zum Ego-Utilitarismus.<br />
Alternde Arbeitsgesellschaft<br />
Eine Überkompensation, die aus dem zum<br />
Komplex gewordenen Liberalitätsdefizit<br />
resultierte, führte zumal bei prägenden<br />
Generationen der bundesdeutschen Geschichte<br />
u.a. zu einer falschen Toleranz<br />
gegenüber bestimmten Formen der „verblödenden<br />
und gewaltfördernden Massenkultur“.<br />
Später sind wir noch reicher, deshalb<br />
dürfen wir jetzt ruhig Schulden machen.<br />
Die Erwartung, dass das erschütterte Fortschrittsbewusstsein<br />
nicht dauerhaft anhalten<br />
werde, führten zu einem Über-die-<br />
Verhältnisse-Leben und zum Schuldenmachen<br />
zulasten der kommenden Generationen.<br />
Angesichts der Grenzen des Wachstums<br />
lohnen sich Investitionen und Dynamik<br />
ohnehin nicht mehr. Weil die „Grenzen<br />
des Wachstums“ erreicht seien, sollte es nur<br />
noch darum gehen, Bestandsschutz zu<br />
betreiben. „Entschleunigung“ wurde zum<br />
Signalwort der Zeit.<br />
Die „Privatisierung des Privaten“ wurde<br />
insbesondere auch für die Entscheidung<br />
für Familie und Kinder eingefordert: Die<br />
Entscheidung für Familie und Kinder ist<br />
eine reine Privatsache. Dabei wurde übersehen,<br />
dass diese Entscheidungen Folgen<br />
hatten, die durchaus nicht nur eine<br />
Privatangelegenheit einzelner Männer<br />
und Frauen waren. Viele Folgen privater<br />
Entscheidungen wie Kinderlosigkeit und<br />
Scheidungen hatte die Allgemeinheit zu<br />
tragen.<br />
„Sich an die eigene Nase zu fassen<br />
haben die Deutschen offensichtlich verlernt.<br />
Schuld sind immer die Anderen. 8 So konnte<br />
ein gesellschaftlich-kulturelles Klima gedeihen,<br />
in dem Verantwortlichkeit für das eigene<br />
Handeln kaum mehr existiert.“<br />
„Es ist an der Zeit, sich von den Illusionen<br />
des Rumpelstilzchen-Modells zu<br />
verabschieden. Das Paradies auf Erden werden<br />
wir so schnell nicht<br />
erreichen, und die harmonisierenden<br />
Utopien der<br />
Konfliktvermeidung und<br />
Konfliktüberwindung haben<br />
uns Schaden zugefügt.<br />
Wir können nicht alle<br />
Vorteile gewinnen, ohne<br />
bestimmte Lasten, Kosten,<br />
Nachteile damit in Kauf zu<br />
nehmen.“ 9<br />
Weil viele die Notwendigkeit,<br />
den Sozialstaat<br />
neu zu denken, für sich<br />
noch nicht akzeptiert<br />
haben, steht im Mittelpunkt<br />
konkreter politischer<br />
Maßnahmen häufig eine<br />
Bewirtschaftung des Mangels.<br />
Wenn die Arbeit weniger<br />
wird, muss die wenige<br />
Arbeit neu verteilt werden. Paul Nolte<br />
beschreibt das Problem als Equilibrium-<br />
Syndrom: eine Gesellschaft, in der sich alles<br />
im Ausgleich befindet, und wo nicht, dann<br />
möglichst gleichmäßig aus- und angeglichen<br />
werden muss.<br />
Viele sehen in dem ständigen Ausbau<br />
des Sozialstaates eine der Ursachen für<br />
seine Überforderung. Die Kritiker des „Weiter<br />
so!“ berufen sich auf die Ausgangspositionen<br />
aus den Aufbaujahren unseres<br />
Sozialstaates. Ein häufig zitiertes Dokument<br />
ist die Rothenfelser Denkschrift, die<br />
1955 von Hans Achinger, Hans Muthesius.<br />
Ludwig Neundörfer und Joseph Höffner<br />
verfasst wurde.<br />
Dabei geht es vor allem um die Grenzen<br />
staatlicher Sozialpolitik und die Subsidiarität:<br />
„1. Der Staat dient der sozialen Sicherung<br />
dadurch am meisten, dass er die persönliche<br />
Verantwortung seiner Bürger, das<br />
Sorgen und das Vorsorgen der Familie und<br />
der anderen kleinen Lebenskreise sowie die<br />
genossenschaftliche Selbsthilfe anerkennt<br />
und sich entfalten lässt.<br />
2. Sofern gewisse Notstände durch die<br />
verschiedenen Formen der Selbsthilfe<br />
nicht behoben werden können, wird die<br />
staatliche Sozialhilfe ihre vordringlichste<br />
Aufgabe in der Hilfe zur Selbsthilfe sehen<br />
müssen. Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet soziale<br />
Investition, nicht soziale Redistribution.“<br />
10 >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 29
Auch Ludwig Erhard betonte immer<br />
wieder sein Credo: Wirtschaftliche Freiheit<br />
und totaler Versicherungszwang vertragen<br />
sich wie Feuer und Wasser. „Man will offenbar<br />
nicht erkennen, dass wirtschaftlicher<br />
Fortschritt und leistungsmäßig fundierter<br />
Wohlstand mit einem System kollektiver<br />
Sicherheit unvereinbar sind.“ 11<br />
Aktuell formuliert Heike Göbel: „Auf<br />
Dauer kann es nicht gelingen, die notwendige<br />
Zustimmung zur Marktwirtschaft<br />
über das Versprechen einer immer ausgeklügelteren<br />
und ausgreifenderen staatlichen<br />
Organisation des Sozialen zu<br />
gewährleisten. Auf diesem Weg kommen<br />
zwangsläufig jene abhanden, die bereit<br />
sind, Risiken zu tragen und zu investieren in<br />
ihre Ausbildung, in Qualifikationen, in neue<br />
Ideen.“ 12<br />
Gegen diese Feststellungen setzte Helmut<br />
Kohl den Satz: Ich will Wahlen gewinnen,<br />
nicht den Ludwig-Erhard-Preis.<br />
Globalisierung<br />
Eine entscheidende Bedingung für ein<br />
Erstarken des Sozialstaates ist eine in großem<br />
Umfang national gestaltbare Politik.<br />
Diese Voraussetzung ist in den letzten<br />
Jahren stark infrage gestellt worden.<br />
Gerade die jüngsten Entwicklungen in der<br />
Finanzwelt, im internationalen Warenaustausch<br />
und in den Volkswirtschaften in<br />
allen Ländern zeigen, wie stark nationales<br />
Handeln inzwischen von internationalen<br />
Geschehnissen beeinflusst wird.<br />
Die Globalisierung gewinnt immer größeren<br />
Einfluss auf die Entwicklungen auch<br />
in unserem Land. Das gilt<br />
� für die Märkte für Güter und Dienstleistungen,<br />
� für die Arbeitsmärkte und<br />
� für die Kapitalmärkte.<br />
Galt in der Nachkriegszeit und in den<br />
Aufbaujahren noch die Regel, dass steigende<br />
Wirtschaftskraft auch größere Spielräume<br />
für den Sozialstaat bot, so haben<br />
sich hier in den letzten Jahren wichtige<br />
Veränderungen vollzogen. „Die Erweiterung<br />
der Europäischen Union und die<br />
zunehmende Globalisierung der Märkte<br />
haben den Unternehmen die Möglichkeit<br />
eröffnet, sich den Belastungen durch<br />
Steuern und Abgaben zu entziehen.<br />
Praktisch heißt das: In Zukunft geht es bei<br />
der Begrenzung des Sozialstaates immer<br />
weniger um die Belastbarkeit der Wirtschaft<br />
im bisherigen Sinne. Es geht zunehmend<br />
um die Belastbarkeit ihrer Bereitschaft<br />
zu Leistungen. Der Sozialstaat ist<br />
dabei, einen wesentlichen Teil seiner wirtschaftlichen<br />
Grundlagen zu verlieren. Denn<br />
30<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
mit den Unternehmen verlassen auch Arbeitsplätze<br />
das Land, durch die nicht nur<br />
Einkommen, sondern auch Steuern und<br />
Abgaben erarbeitet werden.“ 13<br />
Was geschieht,<br />
wenn nichts geschieht<br />
Biedenkopf weist darauf hin, dass die<br />
Bedingungen, noch etwas zu ändern, immer<br />
schlechter werden. Er begründet das<br />
damit, dass die geburtenstarken Jahrgänge<br />
zwischen 2015 und 2030 in Rente gehen.<br />
Diese werden sich dann zunehmend mit<br />
ihren Problemen in der Gegenwart beschäftigen<br />
und nur noch wenig Interesse<br />
für die Gestaltung der Zukunft aufbringen.<br />
Damit schwinden dann aber auch die<br />
Voraussetzungen dafür, Mehrheiten für<br />
notwendige Veränderungen zu finden.<br />
„Bis dahin werden die Schulden des<br />
Staates weiter – und schneller – gewachsen,<br />
die Last der Ansprüche auf Renten- und<br />
Pensionszahlungen noch drückender geworden,<br />
die Arbeitslosigkeit, vor allem die<br />
Langzeitarbeitslosigkeit, noch höher gestiegen<br />
sein.“ 14<br />
Wege aus der Krise<br />
Vielen Menschen ist inzwischen bewusst,<br />
dass ein Lösungsansatz für die aufgezeigten<br />
Probleme des Sozialstaates nicht<br />
mehr nur innerhalb des Systems gefunden<br />
werden kann. Deshalb müssen wir grundsätzlich<br />
über die Kultur unseres Lebens, Arbeitens<br />
und Wirtschaftens neu nachdenken.<br />
Dazu schreibt Kurt Biedenkopf: „Wo<br />
immer der Versuch gemacht wird, durch<br />
einen Kompromiss den Bedürfnissen der<br />
Freiheit ebenso zu entsprechen wie denen<br />
nach Planung aller wesentlichen Lebensverhältnisse,<br />
gerät die Gesamtordnung aus<br />
dem Gleichgewicht. Sie wird zunehmend<br />
widersprüchlich. Konkret: Eine Gesamtordnung,<br />
deren Wirtschaft prinzipiell marktwirtschaftlich<br />
und deren Sozialordnung<br />
prinzipiell planwirtschaftlich gestaltet<br />
wird, ist nicht gleichgewichtsfähig. Denn<br />
die beiden Ordnungsformen sind nicht miteinander<br />
vereinbar.“ 15<br />
„Am wichtigsten ist die Überwindung<br />
der wirtschaftlichen Ausgangslage. Durch<br />
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, mehr<br />
Investitionen in Bildung und Wissenschaft,<br />
eine zunehmende Geburtenrate, mehr qualifizierte<br />
Einwanderer, die auch Steuern und<br />
Sozialversicherungsbeiträge zahlen, weniger<br />
Abwanderung, mehr Teilkapitalbildung<br />
in der sozialen Sicherung und durch höhere<br />
Beiträge und Abgaben der älteren Menschen<br />
ließe sich die schwierige Ausgangslage<br />
(bei der Gesundheitsreform, d.V.) verbessern“<br />
(Klaus-Dirk Henke, FAZ vom<br />
17.2.2007).<br />
Wir können nicht mehr auf ein Wirtschaftswachstum<br />
setzen, das durch Schuldenmachen<br />
finanziert wird. Wir können<br />
den Menschen nicht mehr versprechen,<br />
dass ihnen auch zukünftig ein lückenloses<br />
Netz der sozialen Sicherheit angeboten<br />
wird. Eigenvorsorge und größere Bereitschaft<br />
zu Leistung und Verantwortung sind<br />
erforderlich.<br />
Berechnungen, wie sie heute verstärkt<br />
zur Rentabilität von Beitragszahlungen im<br />
Verhältnis zur späteren Rente angestellt<br />
werden, verbieten es, weitere Lasten von<br />
der Gegenwart in die Zukunft zu verschieben.<br />
Deshalb muss eine weitere Schuldenaufnahme<br />
auf jeden Fall verhindert werden.<br />
Bundesfinanzminister Steinbrück<br />
muss unterstützt werden, wenn er bestrebt<br />
ist, jede Nettoneuverschuldung zu vermeiden.<br />
Die entscheidenden Stichwörter für einen<br />
Neuanfang:<br />
� mehr Verantwortung des Einzelnen;<br />
� Gemeinwohlorientierung statt ausschließlicher<br />
Interessenwahrnehmung;<br />
� Förderung der Familien;<br />
� Subsidiarität.<br />
Das Nachdenken über einen Neuanfang<br />
kann sich nicht auf Deutschland beschränken.<br />
Wie unser Wirtschaftsleben und der<br />
Arbeitsmarkt immer stärker im Rahmen der<br />
EU ihre Ausprägung finden, so müssen wir<br />
– auch wenn für weite Bereiche der<br />
Sozialpolitik noch die Nationalstaaten verantwortlich<br />
sind – eine Gesamtstrategie<br />
zur Ausgestaltung der sozialen Dimension<br />
der EU entwickeln. Wir brauchen den Austausch<br />
von Informationen und die gegenseitige<br />
Absprache bei der inhaltlichen Ausformung<br />
und Umsetzung des Europäischen<br />
Sozialmodells, wie es auch das Zentralkomitee<br />
der deutschen Katholiken (ZdK) in<br />
einer Erklärung vom 25. November 2006<br />
gefordert hat.<br />
Wie schwer es ist, den Gedanken der<br />
Verantwortung des Einzelnen für sich<br />
selbst und für andere mit einer Priorität<br />
gegenüber einer die Freiheit einschränkenden<br />
Politik des Staates durchzusetzen,<br />
zeigen die Ergebnisse einer Umfrage, die<br />
der Tagesspiegel Anfang Dezember 2006<br />
veröffentlichte: 34 Prozent der Befragten<br />
gaben an, sie würden lieber in Freiheit<br />
leben, wo sich jeder ungehindert entfalten<br />
kann. Dagegen würden 58 Prozent lieber in<br />
einer Gesellschaft leben, in der möglichst<br />
große Gerechtigkeit in dem Sinne herrscht,<br />
dass die sozialen Unterschiede nicht zu<br />
groß sind.<br />
Es scheint, dass wir es geschafft haben,<br />
den „kleinen Leuten“ das Gefühl zu vermit-
teln, dass sie ohne von großen<br />
Interessenverbänden wie den<br />
Gewerkschaften definierten<br />
und wahrgenommenen Interessen<br />
nicht zu „ihrem Recht“<br />
kommen können. Die entscheidende<br />
Frage für die Zukunft ist<br />
aber, wie es gelingen kann,<br />
jedem Bürger dieses Landes<br />
Eigenverantwortung und Motivation<br />
zur Leistung ebenso wie<br />
das erforderliche Wissen und<br />
Können zu vermitteln.<br />
Die erste Voraussetzung<br />
dafür ist die Stärkung der<br />
Erziehungskraft der Familien.<br />
Das betrifft ganz besonders<br />
den Bereich der Grundorientierungen<br />
und Sinnfragen.<br />
Wir brauchen mehr Entlastung der Eltern<br />
sowie Eltern- und Familienbildung, die zu<br />
einer ganzheitlichen Erziehung der Kinder<br />
befähigt. Wir brauchen aber auch ein qualitativ<br />
hochwertiges und quantitativ bedarfsgerechtes<br />
Angebot der Tagesbetreuung<br />
von Kindern auch in den ersten<br />
Lebensjahren.<br />
Der Kindergarten muss mehr und mehr<br />
auch Lern- und Bildungsaufgaben übernehmen.<br />
Gerade unter dem Gesichtspunkt,<br />
dass viele Kinder in Deutschland<br />
nicht mehr ausreichend Deutsch können,<br />
gehört die Förderung der Deutschkenntnisse<br />
zu den Aufgaben, die so früh wie<br />
möglich und so umfassend wie nötig geleistet<br />
werden müssen.<br />
Die Erziehungskraft der Familien stärken<br />
Wer die Familie stärken und ihr Zeit zur<br />
Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben lassen<br />
will, darf bei der Vermeidung von Familienarbeit<br />
nicht nur auf die Erwerbstätigkeit<br />
beider Elternteile setzen, wie es derzeit<br />
offensichtlich verfolgt wird. Es ist richtig,<br />
dass an erster Stelle die Entlastung von<br />
Eltern bei der Besteuerung stehen muss:<br />
Selbst erwirtschaftetes Einkommen, das für<br />
die Aufgaben in der Familie und für die Kinder<br />
gebraucht wird, darf nicht mit Steuern<br />
belastet sein. Deshalb sind hohe Grundfreibeträge<br />
und Freibeträge für Kinder unverzichtbar.<br />
Sie sind nach meiner Auffassung<br />
auch zielgenauer als die Ausweitung<br />
des Ehegattensplittings zu einem Familiensplitting,<br />
wie es aus mir nicht rational nach-<br />
Jede Begabung so früh wie möglich entdecken und fördern<br />
vollziehbaren Gründen immer wieder neu<br />
diskutiert und gefordert wird.<br />
Über eine familiengerechte Besteuerung<br />
hinaus müssen wir berücksichtigen,<br />
dass es in unteren und mittleren Einkommensbereichen<br />
eine große Zahl von<br />
Familien gibt, die von Steuerfreistellungen<br />
nur wenig oder nichts haben, weil sie die<br />
angebotenen Steuerfreibeträge und<br />
Steuervergünstigungen nicht ausschöpfen<br />
können. Diesen Familien muss durch direkte<br />
Geldleistungen geholfen werden.<br />
Deshalb ist es geradezu unsinnig, wenn<br />
diskutiert wird, zu Gunsten eines Ausbaus<br />
struktureller Angebote für Familien das<br />
Kindergeld zu kürzen. Das hieße nämlich<br />
konkret: die Familien noch ärmer machen,<br />
damit sie umso<br />
mehr ihre originären<br />
Aufgaben an<br />
staatliche Einrichtungen<br />
abtreten.<br />
Über die Familienpolitikhinaus<br />
muss der BildungspolitikerhöhteAufmerksamkeit<br />
geschenkt<br />
werden. „Eine Wissensgesellschaft<br />
lebt davon, jede<br />
Begabung zu entdecken und so früh wie<br />
möglich zu fördern: Es kann gar nicht<br />
genug gut ausgebildete Menschen geben.<br />
Wenn Menschen länger leben und arbeiten,<br />
ist es ein Gebot ökonomischer und<br />
sozialer Vernunft, in allen Phasen des<br />
Lebens neue Kompetenzen zu erwerben.<br />
Lebenslanges Lernen wird zur besten<br />
Versicherung gegen die Wechselfälle des<br />
Lebens. Wenn sich das Wissen rascher als<br />
früher erneuert und künftige Berufe<br />
anspruchsvoller werden, dann ist die Frage<br />
einer optimalen Bildung und Ausbildung<br />
die soziale Frage des 21. Jahrhunderts.“ 16<br />
Das sollte dann auch alle Bürger, wie es<br />
ebenfalls gefordert wird, verstärkt dazu<br />
befähigen, Eigenverantwortung<br />
wahrzunehmen und ihre<br />
Kräfte und Anlagen frei zu entwickeln.<br />
Eine zukünftige Sozialordnung<br />
muss Subsidiarität<br />
wieder stärker berücksichtigen,<br />
als es in der Entwicklung der<br />
letzten Jahrzehnte der Fall war.<br />
Das setzt aber nicht nur leistungsbereite,<br />
zur Übernahme<br />
von Verantwortung fähige<br />
Staatsbürger voraus, sondern<br />
auch Strukturen, in denen sich<br />
dezentral Solidarität entfalten<br />
kann. Diese müssen gefördert<br />
und ausgebaut werden.<br />
Der Wechsel von der<br />
Versorgung zu einem Mehr an Eigenverantwortung<br />
lässt sich nur verwirklichen,<br />
wenn eine Mehrheit der Bürger dazu bereit<br />
ist. Solange jeder Schritt der Anpassung<br />
staatlicher Leistungen an die tatsächlichen<br />
Möglichkeiten zum Verlust politischer<br />
Mehrheiten führt, können wir eine neue<br />
tragfähige Sozialordnung nicht erwarten.<br />
Deshalb hat die Deutsche Bischofskonferenz<br />
Recht, wenn sie zum Schluss ihrer<br />
Stellungnahme „Das Soziale neu denken“<br />
feststellt: „Es geht nicht nur um einzelne<br />
Maßnahmen und kurzsichtige Anpassungsreformen.<br />
Was jetzt ansteht, sind ein<br />
Wandel der Mentalitäten und eine gemeinsame<br />
Neubesinnung auf Grundlagen,<br />
Werte und Ziele des Zusammenlebens in<br />
einer Zeit des Wandels und der Krise und<br />
das heißt immer auch: der Gefahren und<br />
der Chancen.“<br />
Anmerkungen:<br />
1 Franz-Xaver Kaufmann: Herausforde-<br />
2<br />
rungen des Sozialstaates, Frankfurt 1997,<br />
S. 11<br />
ebd. S. 7<br />
3 Kurt Biedenkopf: Die Ausbeutung der<br />
Enkel, Berlin 2006, S. 71<br />
4 Ebenda S. 111<br />
5 Kurt Biedenkopf: a.a.O. S. 30<br />
6 Ebenda, S. 40<br />
7 Paul Nolte: Generation Reform, München<br />
2004, S. 26<br />
8 Paul Nolte: a.a.O. S. 17 ff.<br />
9 Paul Nolte: a.a.O. S. 31<br />
10 zitiert bei Biedenkopf: a.a.O. S. 65<br />
11 Heike Göbel, FAZ vom 14. 10. 2006, S. 15<br />
12 Ebenda<br />
13 Kurt Biedenkopf: a.a.O. S. 74 f.<br />
14 Ebenda S. 45<br />
15 Kurt Biedenkopf: a.a.O. S. 15<br />
16 Beschluss der Grundsatzprogramm-Kommission<br />
der CDU Deutschlands vom 7.<br />
Mai 2007, Nr. 94<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 31
Menschenwürde, der moralische Status von Embryonen<br />
und die Forschung mit embryonalen Stammzellen<br />
Unter dem Generalthema „Naturwissenschaft<br />
und Glaube“ stand der UNITAS-<br />
Aktiventag vom 14. bis 16. November 2008<br />
in Essen. Angesichts der fortschreitenden<br />
medizinischen Forschung stand das hervorragend<br />
besuchte Treffen in der Ruhrgebietsmetropole<br />
unter dem Titel „Stammzellenforschung<br />
– Chancen – Grenzen –<br />
Konsequenzen“. Mittelpunkt der dichtesten<br />
deutschen Universitätslandschaft<br />
sollte der Blick auf die ethische Einordnung,<br />
medizinische, politische, juristische<br />
und theologische Aspekte gerichtet, Bewusstsein<br />
für ein entscheidendes Thema<br />
unserer Zeit geschaffen und Aufmerksamkeit<br />
auf die damit verbundenen Folgen<br />
gelenkt werden.<br />
Den Auftakt machte Prof. Dr. Ulrich Eibach,<br />
apl. Professor für Systematische<br />
Theologie und Ethik, Evangelisch-theologische<br />
Fakultät der Rheinischen Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität Bonn, Pfarrer am<br />
Universitätsklinikum Bonn und Beauftragter<br />
der „Evangelischen Kirche im Rheinland“<br />
für Fortbildung in Krankenhausseelsorge<br />
und Fragen der Ethik in Biologie<br />
und Medizin a.D. Der Biologe, Theologe<br />
und Ethiker begann mit einer Beurteilung<br />
der Stammzellforschung aus christlichethischer<br />
Sicht, gab mit seinem Vortrag<br />
eine umfassende Grundlage zum Thema<br />
und erörterte Begriff und Inhalt der Menschenwürde<br />
im Zusammenhang „verbrauchender“<br />
Embryonenforschung, an die sich<br />
32<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
VON PROF. DR. ULRICH EIBACH<br />
hohe medizinische Erwartungen knüpften.<br />
Eindeutig stellte er die Gottebenbildlichkeit<br />
des Menschen heraus, dem keine<br />
Menschenwürde zugesprochen werden<br />
könne, sondern die ihm bereits von Beginn<br />
an zukomme. Wir dokumentieren seinen<br />
Vortrag im Folgenden im Wortlaut:<br />
1. Forschung mit<br />
embryonalen Stammzellen:<br />
Deutsche Rechtslage<br />
Das deutsche Embryonenschutzgesetz<br />
(EschG1990) untersagt einen verbrauchenden<br />
Umgang mit menschlichen Embryonen<br />
und damit die Herstellung von Stammzelllinien<br />
aus Embryonen. 2002 hatte der<br />
deutsche Bundestag in einem „Stammzellgesetz“<br />
beschlossen, dass die Herstellung<br />
von Stammzellen aus Embryonen in<br />
Deutschland „grundsätzlich verboten“<br />
bleibt, der Import von Stammzellen aus<br />
dem Ausland aber „ausnahmsweise“ zulässig<br />
sei, wenn keine ethisch unbedenklichen<br />
Alternativen gegeben sind, um die angestrebten<br />
Ziele der Forschung zu erreichen.<br />
Diese Ziele sollen „hochrangiger“ Art sein.<br />
Die Stammzellen müssen vor dem 1. Januar<br />
2002 im Ausland hergestellt sein. Diese<br />
„Stichtagsregelung“ war ein mühsam gefundener<br />
Kompromiss, der die Achtung der<br />
Menschenwürde allen embryonalen Lebens<br />
festhalten und doch eine Möglichkeit offen<br />
halten sollte, mit embryonalen Stammzellen<br />
zu forschen. Zunächst zeigten sich<br />
die deutschen Forscher mit dieser Regelung<br />
zufrieden, doch stellte sich bald heraus,<br />
dass die in anderen Ländern nach diesem<br />
Stichtag hergestellten Stammzelllinien<br />
„besser“ waren. Deshalb forderten viele<br />
Forscher schon bald eine Aufhebung der<br />
Stichtagsregelung. Daraufhin beschloss der<br />
Deutsche Bundestag Anfang des Jahres<br />
mehrheitlich, diese Stichtagsregelung auf<br />
den 1. Januar 2007 zu verlegen.<br />
Es ist fraglich, ob diese als einmalig ausgegebene<br />
Verschiebung des Stichtags Bestand<br />
haben wird, denn es zeigt sich schon<br />
heute, dass Stammzelllinien „altern“ und<br />
damit irgendwann „untauglich“ werden<br />
und dass neuere Stammzelllinien immer<br />
die „besseren“ sein werden und dass so ein<br />
Druck entsteht, den Stichtag immer wieder<br />
zu verschieben. Es stellt sich daher die<br />
Frage, ob diese erste Verschiebung des<br />
Stichtags nicht einer rechtlichen Billigung<br />
eines verbrauchenden Umgangs mit Embryonen<br />
im Ausland wenigstens nahe und<br />
weitere Verschiebungen ihr gleich kommen.<br />
Im Ausland ist dann ethisch erlaubt,<br />
was in Deutschland ethisch und rechtlich<br />
verboten ist. Wieso dürfen Embryonen<br />
nicht auch in Deutschland zur Gewinnung<br />
von embryonalen Stammzellen verbraucht<br />
werden? Kommt der Import von embryonalen<br />
Stammzellen aus dem Ausland<br />
nicht einer ethischen und rechtlichen<br />
Billigung des verbrauchenden Umgangs<br />
mit menschlichen Embryonen gleich und<br />
soll dann doch in Deutschland verboten<br />
sein? Das ist sicher eine kaum begründbare<br />
Doppelmoral. Hinzu kommen Fragen wie<br />
die, ob es wirklich keine Alternativen zur<br />
embryonalen Stammzellforschung gibt.<br />
Das wird von vielen Zellbiologen angesichts<br />
der Erfolge in der Forschung mit adulten<br />
Stammzellen und insbesondere seit der<br />
Herstellung von totipotenten Stammzellen<br />
aus Körperzellen durch deren Reprogrammierung<br />
bestritten. Viele behaupten zwar,<br />
dass eine Forschung mit embryonalen<br />
Stammzellen trotzdem als Kontrollforschung<br />
wichtig sei, doch ist man sich weitgehend<br />
einig, dass die mit der embryonalen<br />
Stammzellforschung angestrebten „hochrangigen<br />
Ziele“ der Heilung schwerer<br />
Krankheiten letztlich nur über den Weg der<br />
adulten Stammzellforschung zu erreichen<br />
sind, mit der die Risiken bei der Übertragung<br />
embryonaler Stammzellen, vor allem
das Risiko der Tumorbildung, weitgehend<br />
ausgeschlossen werden kann. Die Forschung<br />
mit embryonalen Stammzellen<br />
dient also nur dazu, die Entwicklung von<br />
Heilverfahren mit körpereigenen Stammzellen<br />
zu beschleunigen und zu verbessern.<br />
Auch als solche ist sie derzeit nur eine Form<br />
der Grundlagenforschung, in der deutsche<br />
Forscher durch den neuen Stichtag nicht<br />
benachteiligt und Deutschland nicht um<br />
ökonomische Chancen gebracht werden<br />
sollen.<br />
Die Stichtagsregelung ist ein mühsam<br />
gefundener Kompromiss, der die Achtung<br />
der Menschenwürde allen embryonalen<br />
Lebens festhalten und doch eine Möglichkeit<br />
offen halten will, mit embryonalen<br />
Stammzellen zu forschen.Würde man diese<br />
Stichtagsregelung einmal oder vielleicht<br />
gar stetig anpassen oder gar fallen lassen,<br />
so käme das einer rechtlichen Billigung<br />
eines verbrauchenden Umgangs mit Embryonen<br />
zu Forschungszwecken wenigstens<br />
nahe oder gar gleich. Eine einmalige<br />
Änderung des Stichtags wird kaum Bestand<br />
haben, wenn man davon ausgeht, dass<br />
Stammzelllinien „altern“ und damit irgendwann<br />
„untauglich“ werden und dass<br />
es immer „bessere“ Stammzellen geben<br />
wird. Wird es daher dazu kommen, dass<br />
man das Stammzellgesetz oder gar das<br />
EschG abschafft? Handelt es sich bei der<br />
alten wie der neuen Stichtagsregelung um<br />
den Sieg wissenschaftlicher und ökonomischer<br />
Interessen über bisherige ethische<br />
und rechtliche Grundüberzeugungen, die<br />
das EschG festschreiben wollte?<br />
2. Welchem menschlichen Leben<br />
kommt Menschenwürde zu?<br />
Eingriffe der Biomedizin ins Leben berühren<br />
immer mehr grundlegende Fragen<br />
des Menschenbilds, der Ethik und des<br />
Rechts. Der Diskussion über eine verbrauchende<br />
Forschung mit Embryonen, über die<br />
damit gewonnenen embryonalen Stammzellen,<br />
die Selektion kranker Embryonen bei<br />
der „Präimplantationsdiagnostik“ (PID) u. a.<br />
kommt deshalb besondere Bedeutung zu,<br />
weil hier grundsätzliche ethische und verfassungsrechtliche<br />
Fragen zur Diskussion<br />
stehen, die eine weit über die Forschungen<br />
mit Embryonen hinausgehende Bedeutung<br />
haben. Diese Fragen ergeben sich nicht nur<br />
aus den Fortschritten der Biomedizin, sondern<br />
ebenso aus dem Wandel der Lebensund<br />
Wertvorstellungen in den von der technischen<br />
Zivilisation geprägten säkularen<br />
Gesellschaften. Dabei spielt insbesondere<br />
die „Verheißung“ eine Rolle, durch die<br />
Forschungen an und mit menschlichen<br />
Embryonen viele der bisher unheilbaren<br />
Krankheiten in Zukunft heilen und durch<br />
die PID ein gesundes Kind garantieren zu<br />
können. Durch diese „Verheißungen“ der<br />
Medizin entstehen zugleich Ansprüche an<br />
die Mediziner (z.B. Anspruch auf ein „gesundes“<br />
Kind), die diese wiederum zur<br />
Legitimation ihrer eigenen wissenschaftlichen<br />
und ökonomischen Interessen ins<br />
Feld führen. Stehen bisher als grundlegend<br />
erachtete ethische und rechtliche Auffassungen<br />
der Durchsetzung dieser Interessen<br />
entgegen, so führt dies zu der Forderung,<br />
diese so zu verändern, dass die Erfüllung<br />
dieser Interessen möglich wird. Dies erscheint<br />
insbesondere plausibel, wenn es<br />
sich um Versprechen zur Heilung von<br />
schweren Krankheiten handelt.<br />
Diejenigen, die daran festhalten, dass<br />
der Medizin nur solche Mittel und Wege der<br />
Forschung und Therapie erlaubt sind, die<br />
nicht gegen wesentliche ethische und<br />
rechtliche Normen und Werte verstoßen,<br />
kommen dann schnell in den Geruch, unbarmherzige<br />
„Prinzipienreiter“ zu sein, die<br />
kein Verständnis für leidende Menschen<br />
haben. Als solche immer unbedingt zu<br />
beachtende Prinzipien gelten insbesondere<br />
die unbedingte Achtung der Menschenwürde,<br />
das Verbot von Lebensunwerturteilen<br />
und das Verbot, menschliches Leben<br />
zu töten. Damit gerät eine solche Prinzipethik<br />
schnell in Konflikt mit einer utilitaristischen<br />
„Ethik der Interessen an Heilung“.<br />
Um diesen Konflikt aufzulösen, liegt es<br />
nahe, die Geltung dieser Prinzipien für<br />
bestimmte Bereiche des menschlichen<br />
Lebens in Frage zu stellen.<br />
Ein verbrauchender, also die Tötung einschließender<br />
Umgang mit menschlichem<br />
Leben als reines „biologisches Forschungsmaterial“<br />
und als Mittel zu Zwecken<br />
(Interessen) anderer Menschen kann auf<br />
zweierlei Weise gerechtfertigt werden, einmal<br />
dadurch, dass man bestimmte Stadien<br />
menschlichen Lebens wertmäßig so einstuft,<br />
dass sie nicht oder nur sehr eingeschränkt<br />
unter dem Schutz der Menschenwürde<br />
nach Artikel 1.1 des Grundgesetzes<br />
stehen. Dann würde derartiges menschliches<br />
Leben auch nicht unter den Schutz<br />
des Gebots fallen, Menschenleben nicht zu<br />
töten. Voraussetzung dieser Begründung<br />
ist die Unterscheidung eines angeblich<br />
bloß biologisch menschlichen Lebens einerseits<br />
vom Menschsein im „eigentlichen“<br />
Sinne andererseits, also das, was Verfassungsrechtler<br />
als „Antiäquivalenztheorie“<br />
von Leben und Menschsein, dem Menschenwürde<br />
zukommt, bezeichnen. Nach<br />
ihr wird die Achtung der Menschenwürde<br />
nicht mehr in erster Linie im Schutz des<br />
Lebens konkret, sondern der Schutz gilt nur<br />
den Eigenschaften, die das Menschsein<br />
ausmachen sollen. Diese Position ermöglicht<br />
es, angeblich noch bloß biologischmenschliches<br />
Leben gegen andere Güter<br />
und Interessen abzuwägen. Sie ist allerdings<br />
genötigt, Kriterien zu benennen und<br />
zu begründen, ab wann in der Entwicklung<br />
des biologisch-menschlichen Lebens diesem<br />
das Prädikat „Mensch“ und deshalb<br />
auch Menschenwürde und dementspre-<br />
chende Schutzrechte zukommen, oder,<br />
wenn man behauptet, dass diese Schutzrechte<br />
je nach Grad der Lebensentwicklung<br />
abgestuft zu denken sind, welche Schutzrechte<br />
dem jeweiligen Entwicklungsstand<br />
des Lebens zukommen und gegen welche<br />
fremdnützigen Zwecke sie jeweils abgewogen<br />
werden dürfen.<br />
Soweit man den Begriff „Menschenwürde“<br />
nicht als eine rechtlich untaugliche<br />
„Leerformel“ betrachtet, herrscht weitgehend<br />
Einigkeit, dass sie quantifizierbar ist<br />
und dass sie daher nicht gegen andere<br />
Grundrechte abgewogen werden darf. Strittig<br />
bleibt dann aber, worin die Menschenwürde<br />
besteht und welchem menschlichen<br />
Leben sie zukommt. In diesen Fragen<br />
bestehen teils unüberbrückbare Differenzen,<br />
selbst im Bereich der Theologie und<br />
der Kirchen. Hier sind sie vor allem dadurch<br />
bedingt, dass man sich selbst dort philosophische<br />
Positionen zueigen macht, die die<br />
Menschenwürde nicht mehr in erster Linie<br />
von der Gottebenbildlichkeit her, sondern<br />
von den Qualitäten eines gesund geborenen<br />
Menschen her inhaltlich füllen.<br />
Anzuerkennen ist, dass das Prädikat<br />
„Menschenwürde“ sich nicht aus dem Gegebensein<br />
von biologisch-menschlichem<br />
Leben an sich unmittelbar ableiten lässt.<br />
Dies käme einem „naturalistischen Fehlschluss“<br />
gleich. Daraus folgern viele, dass<br />
menschliches Leben sich nicht von seinem<br />
Anfang an als Mensch, sondern sich zum<br />
Menschsein hin entwickelt, ja dass von<br />
Menschsein und einer ihm entsprechenden<br />
Würde nur dann gesprochen werden, wenn<br />
die Voraussetzungen für eine Geburt und<br />
die Qualitätsmerkmale für ein selbstständiges<br />
Leben als geborener Mensch vorliegen.<br />
Diese Bedingungen können unterschiedlich<br />
bestimmt werden. Auf jeden Fall muss die<br />
Einnistung in die Gebärmutter, die Nidation<br />
vollzogen sein, die in sich in reines<br />
Naturfaktum und keinesfalls ein spezifisch<br />
menschliches oder gar ein personales Geschehen<br />
ist. Eigentlich aber müsste bei diesem<br />
Denkansatz das Geborenwerden als<br />
hirnorganisch einigermaßen gesundes Leben<br />
das entscheidende biologische und<br />
psychosoziale Geschehen sein. Auf jeden<br />
Fall folgt aus dieser Position, dass menschlichem<br />
Leben, das nicht von einer Mutter<br />
geborenen werden wird, kein Menschsein<br />
und keine Menschenwürde zukommt. Bei<br />
der künstlichen Befruchtung (IVF) entstandene<br />
überzählige Embryonen, die vom<br />
Transfer in den Mutterleib ausgeschlossen<br />
werden, haben die Potenzialität, in die irdische<br />
Lebenswelt geboren zu werden, nicht,<br />
aber nicht aufgrund fehlender biologischer<br />
Fähigkeiten, sondern aufgrund menschlichen<br />
Entscheidens und Handelns nicht. Das<br />
Recht, ein Mensch zu sein und entsprechend<br />
behandelt zu werden, wird dann<br />
nicht nur vom Vorhandensein bestimmter<br />
biologischer und seelisch-geistiger Eigenschaften<br />
abhängig gemacht, sondern letzt- >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 33
lich auch von menschlichem Entscheiden<br />
und Handeln, durch das dem Leben die<br />
Bedingungen zum Geborenwerden zugesprochen<br />
oder vorenthalten werden. Das<br />
Menschsein und die Menschenwürde werden<br />
damit zum Gegenstand menschlicher<br />
Zuschreibungen, auch wenn diese sich an<br />
biologischen Fakten wie der Nidation, der<br />
Geburt, dem hirnorganischen Zustand, der<br />
selbstständigen Lebensfähigkeit orientieren.<br />
Menschsein und Menschenwürde<br />
demnach kommen menschlichem Leben<br />
nur von dem Ziel des Lebens her zu, dem<br />
selbstständigen Leben in<br />
dieser irdischen Welt. Dieses<br />
Ziel des Menschenlebens<br />
kann bar jeder theologischen<br />
Bestimmung erfasst<br />
werden, wird nicht im vollendeten<br />
Sein in der Gemeinschaft<br />
mit Gott gesehen,<br />
sondern rein innerweltlich<br />
als „In-der-Welt-Sein“ als<br />
selbstständig lebensfähiger<br />
Mensch. Von einer solchen<br />
Ausgangsbasis aus ist es<br />
nicht verwunderlich, dass<br />
man gegen einen verbrauchenden<br />
Umgang mit<br />
menschlichen Embryonen,<br />
die die biologische Potenzialität,<br />
ein erwachsener<br />
Mensch zu werden, zwar haben,<br />
aber aufgrund menschlichen<br />
Entscheidens und<br />
Handelns nicht mehr haben<br />
sollen, keine grundsätzlichen<br />
ethischen Bedenken<br />
mehr geltend machen kann.<br />
Diese Position übernimmt<br />
also die „Antiäquivalenz-Theorie“<br />
von menschlichem Leben<br />
und Menschenwürde und folgt damit<br />
philosophischen Positionen, die das<br />
Vorliegen der Menschenwürde von dem<br />
Vorhandensein empirisch feststellbarer<br />
Qualitäten des Lebens abhängig machen,<br />
und die in der westlichen Welt in dem<br />
Maße – auch bei Juristen – Zustimmung<br />
finden, wie die religiöstranszendente Begründung<br />
der Menschenwürde verblasst<br />
und als rational nicht begründbare, weil<br />
den Glauben an Gott voraussetzende<br />
„Gruppenmoral“ abgetan wird. Das Verständnis<br />
von Menschenwürde in Artikel 1<br />
des GG’es ist aber maßgeblich mit geprägt<br />
durch die jüdisch-christliche Vorstellung<br />
von der Gottebenbildlichkeit des Menschen.<br />
Diese gründet in der besonderen Beziehung<br />
Gottes zum Geschöpf Mensch. Der<br />
Mensch konstituiert sich weder in seinem<br />
Leben noch in seiner Würde selbst. Er „verdankt“<br />
sein Leben, sein Personsein und<br />
seine Würde anderen, letztlich nicht den<br />
Eltern, sondern Gott. Die menschliche<br />
Würde, sein Personsein gründet darin, dass<br />
menschliches Leben durch einen Schöpfungsakt<br />
Gottes ins Dasein gerufen wird<br />
und mit dieser Erschaffung immer zugleich<br />
34<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
von Gott zu seinem Partner und zu irdischer<br />
und ewiger Gemeinschaft mit Gott<br />
bestimmt ist, also immer als Person geschaffen<br />
und angeredet ist. In seinem irdischen<br />
Leben wird der Mensch dieser Bestimmung<br />
zur Gottebenbildlichkeit nie gerecht,<br />
er bleibt hier immer Gottebenbild<br />
im „Fragment“. Die Gottebenbildlichkeit<br />
wird erst in der Gemeinschaft mit Gott im<br />
„ewigen Leben“ vollendet, ist also im strikten<br />
Sinne eine in Gott gründende und<br />
zukünftige Größe, die aber schon diesem<br />
irdischen Leben von Gott zugesagt ist.<br />
Demnach sind Personsein und Menschenwürde<br />
keine empirischen Qualitäten,<br />
sondern „transzendente“ Größen, die – von<br />
Gott her – dem ganzen leiblichen, dem organismischen<br />
Leben von seinem Beginn bis zu<br />
seinem Tod unverlierbar zugesprochen sind.<br />
Kein menschliches Leben muss erst Lebensqualitäten<br />
vorweisen, die erweisen, dass<br />
es der Prädikate Person und Menschenwürde<br />
würdig ist. Deshalb muss ihm die<br />
Menschenwürde auch nicht erst von Menschen<br />
zuerkannt werden, vielmehr ist sie<br />
von allen Menschen zugleich mit dem<br />
Gegebensein von Leben in allen Stadien des<br />
Lebens anzuerkennen, unabhängig vom<br />
Grad seiner körperlichen und seelisch-geistigen<br />
Fähigkeiten. In diesem Begründetsein<br />
der Menschenwürde in „Transzendenz“, in<br />
Gott, ist der Grund zu suchen, dass alles<br />
Leben einer totalen ge- und verbrauchenden<br />
Verfügung von Menschen entzogen sein<br />
soll. Es kann dem Menschen nach dieser<br />
christlichen Sicht nur verboten sein, die Bestimmung<br />
zum Menschsein, zum Personsein,<br />
zum Partnersein Gottes vom göttlichen<br />
Schöpfungsakt des Lebens abzulösen und zu<br />
behaupten, es gäbe Stadien menschlichen<br />
Lebens, die nicht unter dieser göttlichen<br />
Bestimmung stehen, und der Mensch dürfe<br />
eigenmächtig definieren, ab wann und bis<br />
wann menschliches Leben unter dieser Bestimmung<br />
stehe und ihm deshalb Würde<br />
zukomme. Dann wird Gottes Handeln durch<br />
menschliches Handeln ersetzt, dem Menschen<br />
die Definitionshoheit über das Leben<br />
überantwortet, zu sagen, ab wann und bis<br />
wann menschliches Leben unter der Verheißung<br />
steht, zur Gottebenbildlichkeit bestimmt<br />
zu sein. Dies kann dem Menschen<br />
nur verboten sein, weil er sich damit ein uneingeschränktes<br />
Verfügungsrecht über<br />
menschliches Leben anmaßt.<br />
Der Mensch hat<br />
davon auszugehen, dass<br />
alles menschliche Leben<br />
von seinem Beginn an<br />
unter dieser Bestimmung<br />
und Verheißung Gottes<br />
steht, Ebenbild Gottes zu<br />
sein; er hat in seinem Entscheiden<br />
und Handeln<br />
dieser Verheißung zu entsprechen,<br />
und das heißt,<br />
jedem menschlichen Leben<br />
in einer entsprechenden<br />
Achtung zu begegnen<br />
und ihm gegenüber<br />
die Haltung der Fürsorge<br />
für das Leben einzunehmen,<br />
die auf jeden Fall<br />
immer Entscheidungen<br />
und Handlungen ausschließt,<br />
die das Leben<br />
bewusst schädigen oder<br />
gar töten. Dass das<br />
Werden menschlichen Lebens<br />
– gerade zu seinem<br />
Beginn – in hohem Maße<br />
scheitert und dem Tod<br />
ausgeliefert ist, kann<br />
nicht rechtfertigen, dass der Mensch von<br />
sich aus auch daran mitwirken darf, dass<br />
Leben sich nicht weiter zum erwachsenen<br />
Menschsein entwickeln darf.<br />
Es ist zwar umstritten, inwieweit dieses<br />
christlich geprägte Verständnis von Menschenwürde<br />
ohne diese religiösen Voraussetzungen<br />
zu begründen ist. Jedoch ist<br />
auch in der deutsches Rechtsverständnis<br />
maßgeblich prägenden Philosophie I. Kants<br />
festgehalten, dass die Freiheit und mit<br />
ihr die Würde des Menschen keine<br />
empirischen Größen, sondern transzendentale<br />
Ideen sind, und dass das Prädikat<br />
Person dem Menschen als „Natur- und<br />
Gattungswesen“, also allem biologisch<br />
menschlichen Leben zuzuordnen ist. Das<br />
Gegebensein von Leben gebietet uneingeschränkte<br />
Achtung vor seiner Würde, die<br />
es verbietet, menschliches Leben bloß als<br />
Mittel zum Zweck, insbesondere fremdnützigen<br />
Zwecken, zu ge- und verbrauchen. Insofern<br />
stimmt Kants Begründung der Menschenwürde<br />
wenigstens in ihren praktischen<br />
Konsequenzen mit der kurz angedeuteten<br />
christlichen Sicht vollkommen<br />
überein.
Nach dieser Sicht ist die Achtung der<br />
Menschenwürde an keine anderen empirischen<br />
Voraussetzungen gebunden als das<br />
Gegebensein von artspezifischem Leben,<br />
das sich zu einem erwachsenen Menschenleben<br />
entwickeln kann. Die Vorstellung,<br />
dass menschliches Leben sich erst zum<br />
Menschen – im Sinne von Person – entwickelt,<br />
erst mit dem Auftauchen bestimmter<br />
Qualitäten Mensch wird, ist daher auszuschließen.<br />
Menschliches Leben ist zwar<br />
immer – vom Beginn bis zum Tod – ein<br />
Leben im Werden und Wandel, doch hat es<br />
in diesem kontinuierlichen Werdeprozess<br />
immer den Status eines Menschen. Es gibt<br />
kein Werden zum Menschen, sondern nur als<br />
Mensch. Verfassungsrechtlich bedeutet das,<br />
dass der ganze Lebensträger (= Organismus)<br />
vom Beginn bis zu seinem Tod unverlierbar<br />
unter dem Schutz der Menschenwürde<br />
steht, dass der Sinn des Artikels 1,1<br />
GG sich in erster Linie gemäß Artikel 2,2 im<br />
uneingeschränkten Schutz des Lebens vor<br />
schädigenden Verfügungen durch andere,<br />
insbesondere vor der Tötung konkretisiert<br />
(= „Äquivalenz-Theorie“ von Würde und<br />
Leben). Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht<br />
(BVG) – bisher noch –<br />
immer das Konzept einer abgestuften<br />
Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens<br />
abgelehnt.<br />
3. Beginn menschlichen<br />
Lebens aus biologischer<br />
und anthropologischer Sicht<br />
Geht man von der kurz dargelegten theologischen<br />
Begründung der „Äquivalenz-<br />
Theorie“ von Leben und Menschenwürde<br />
aus, so besteht die erste entscheidende<br />
Frage darin, wann biologisch-menschliches<br />
Leben beginnt. Diese Frage können Theologie,<br />
Philosophie und Rechtswissenschaften<br />
nicht aufgrund ihrer eigenen<br />
Erkenntnisse klären. Sie sind dazu an die<br />
Biologie verwiesen. An die Biologie werden<br />
also Fragen herangetragen mit der Absicht,<br />
durch ihre Erkenntnisse zu einer näheren<br />
Bestimmung des Geltungsbereichs ethischer<br />
und rechtlicher Normen zu kommen,<br />
nicht aber, um ethische Aussagen direkt<br />
aus biologischen Erkenntnissen abzuleiten.<br />
Die Notwendigkeit, das Ende menschlichen<br />
Lebens zeitlich genau zu definieren, ergab<br />
sich erst, als man todgeweihten Menschen<br />
Organe zum Zweck der Organtransplantation<br />
entnehmen wollte, und die Notwendigkeit,<br />
den Beginn menschlichen Lebens<br />
genau zu definieren, ergab sich erst, als<br />
man durch IVF Embryonen außerhalb des<br />
Mutterleibes durch Menschen Hand erzeugen<br />
konnte und als man beabsichtigte, mit<br />
menschlichen Embryonen, die bei der IVF<br />
überzählig waren, verbrauchende Forschungen<br />
anzustellen. In beiden Fällen<br />
stand also der Gebrauch menschlichen<br />
Lebens zu fremdnützigen Zwecken und das<br />
Tötungsverbot zur Diskussion.<br />
Für die Frage nach dem Beginn des Lebens<br />
ist entscheidend, dass aus menschlichen<br />
Keimzellen nur menschliches Leben<br />
entstehen kann, dass die Embryonalentwicklung<br />
nie in erster Linie eine Wiederholung<br />
der Phylogenese, der Embryo mithin<br />
von Anfang an menschliches Leben ist.<br />
Dieser Werdeprozess stellt von seinem<br />
Beginn an eine Kontinuität dar. Er vermittelt<br />
durch dieses leibliche Leben eine Identität<br />
als derselbige Mensch, auch wenn der<br />
Mensch diese Identität erst später rückblickend<br />
erkennen kann. Muss man in diesem<br />
Werdeprozess des Lebens Anfang und<br />
Ende aufgrund bestimmter Interessen oder<br />
aus ethischen und rechtlichen Gründen<br />
zeitlich genau festlegen, so sind diese<br />
Definitionen primär bestimmt durch diese<br />
Fragestellungen. Dabei muss man von einer<br />
biologischen Definition von individuellem<br />
Leben ausgehen. Bei höheren Lebewesen<br />
mit geschlechtlicher Fortpflanzung sind<br />
dafür folgende Kriterien entscheidend: (1)<br />
Es muss eine genetische Individualität vorliegen.<br />
Die Entstehung von neuem Leben ist<br />
ein Prozess, der mit dem Eindringen des<br />
Spermiums ins Ei beginnt und mit der<br />
Bildung des neuen individuellen Genoms<br />
aus mütterlichem und väterlichem Erbgut<br />
die entscheidende Zäsur zur Konstitution<br />
neuen Lebens überschreitet. (2) Es muss ein<br />
zu einer Ganzheit integriertes, also organismisches<br />
Lebensgeschehen gegeben sein, das<br />
zu einer eigenständigen Lebensdynamik<br />
fähig ist (Stoffwechsel, Wachstum u. a.), so<br />
dass aus ihm ein erwachsener Organismus<br />
werden kann. Dieser Entwicklungsprozess<br />
wird mit der Bildung der Zygote zugleich in<br />
Gang gesetzt. Es wird oft behauptet, frühe<br />
Embryonen erfüllten dieses zweite Kriterium<br />
nicht, sie seien ein bloßer „Zellhaufen“.<br />
Eine organismische Ganzheit wird aber<br />
nicht nur durch spezielle integrierende<br />
Systeme wie das Nerven- und das Herzkreislaufsystem<br />
bewirkt, sondern schon<br />
durch unmittelbare physiologische Interaktionen<br />
der Zellen. Dass nur aus einem Teil<br />
dieser Zellen der Embryo, aus anderen das<br />
„Nährgewebe“ (Trophoblast) wird, widerspricht<br />
dem auch nicht, weil dieses Differenzierungsgeschehen<br />
nicht präformistisch<br />
determiniert ist, man also nicht vorweg<br />
sagen kann, welche der Zellen zu was werden.<br />
Andere im Entwicklungsgeschehen<br />
aufweisbare Zäsuren sind nicht vergleichbar<br />
mit dem Neuanfang von individuellem<br />
Leben, der mit der vollendeten Bildung der<br />
Zygote gegeben ist. Sicher sind die abgeschlossene<br />
Einnistung (Nidation) in die<br />
Gebärmutter (etwa 14 Tage nach der Befruchtung)<br />
und vor allem die Geburt entscheidende<br />
Ereignisse in der Entwicklung<br />
des Lebens, aber sie können bei gesamtbiologischer<br />
Betrachtung keine Leben<br />
konstituierenden Zäsuren darstellen, weil<br />
sich selbst bei hoch organisierten Wirbeltieren<br />
eine Entwicklung in der Gebärmutter<br />
nur bei den Säugetieren voll-<br />
zieht. Spezifisch menschlich ist dieses biologische<br />
Faktum aber nicht, so dass sich aus<br />
ihm keine philosophisch- und theologisch<br />
personalen Beziehungen ableiten lassen.<br />
Auch die Herausbildung innerembryonaler<br />
Qualitäten, wie die Unfähigkeit zur Zwillingsbildung,<br />
die Herausbildung der Körperachse,<br />
des Neuralrohrs und anderes, sind<br />
keine derart entscheidenden Zäsuren. All<br />
dies sind nur Entwicklungsschritte innerhalb<br />
des Lebensprozesses. Nur durch die<br />
Bildung der Zygote wird neues individuelles<br />
Leben konstituiert.<br />
Jede andere Festlegung des Beginns<br />
menschlichen Lebens und seines der<br />
Menschenwürde entsprechenden Schutzes<br />
macht diesen nicht nur abhängig vom<br />
Vorliegen bestimmter Eigenschaften, sondern<br />
unverkennbar auch von den jeweiligen<br />
wissenschaftlichen, therapeutischen<br />
und sonstigen Interessen und Erfordernissen<br />
an einem verbrauchenden Umgang<br />
mit Embryonen, denen entsprechend der<br />
„Rubikon“ zum verbrauchenden Umgang<br />
sowohl hinsichtlich der Ziele wie auch des<br />
anvisierten Entwicklungszeitraums, bis zu<br />
dem mit Embryonen geforscht werden<br />
darf, immer mehr erweitert werden wird.<br />
Eine Grenzziehung bis zum 14. Tag der<br />
Entwicklung (natürlicherweise abgeschlossene<br />
Einnistung in die Gebärmutter) erscheint<br />
dann willkürlich (wird auch in dem<br />
„Übereinkommen über Menschenrechte<br />
und Biomedizin“ des Europarats nicht mehr<br />
genannt) und wird auf längere Frist, wenn<br />
man entsprechende „hochrangige“ wissenschaftliche<br />
und therapeutische Zielsetzungen<br />
an einer weitergehenden Forschung<br />
mit Embryonen geltend macht, kaum als<br />
unbedingte Grenze zu begründen und als<br />
solche einhaltbar sein. Der Embryo ist ein in<br />
jeder Hinsicht für wissenschaftliche und<br />
therapeutische Zielsetzungen hoch interessantes<br />
Forschungsobjekt. Deshalb wird sich<br />
ein verbrauchender Umgang mit Embryonen<br />
auch nicht auf eng umgrenzte Ziele,<br />
wie z. B. die Gewinnung von Stammzellen,<br />
begrenzen lassen.<br />
4. Relativierung des<br />
Tötungsverbots im<br />
Umgang mit menschlichen<br />
Embryonen?<br />
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tötung<br />
menschlichen Lebens zu rechtfertigen, einmal<br />
den dargestellten Weg, Stadien des<br />
Lebens wertmäßig so einzustufen, dass sie<br />
nicht unter dem uneingeschränkten Schutz<br />
der Menschenwürde stehen. Verbunden ist<br />
damit fast immer, dass man die Menschenwürde<br />
an das Vorliegen bestimmter empirisch<br />
feststellbarer Lebensqualitäten bindet.<br />
Damit ist eine weitreichende Veränderung<br />
des für den unbedingten Schutz allen<br />
menschlichen Lebens grundlegenden Verständnisses<br />
von Menschenwürde eingelei- >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 35
tet. Dieser Schritt kann letztlich unkontrollierbare<br />
Folgen für den Schutz des Lebens in<br />
allen Lebensbereichen haben, auch den des<br />
geborenen, insbesondere des hirnorganisch<br />
versehrten und des schwerstpflegebedürftigen<br />
Lebens, z. B. dementer Menschen.<br />
Es könnte durch den Verlust von<br />
Lebensqualitäten zum Verlust der Menschenwürde<br />
kommen. Lebensunwerturteile<br />
müssten dann mehr oder weniger als<br />
rechtens anerkannt werden. Die Relativierung<br />
des Tötungsverbots für Menschenleben,<br />
dem keine Menschenwürde zukommen<br />
soll. ergibt sich notwendig aus diesem<br />
veränderten Verständnis von Menschenwürde.<br />
Die andere, und letztlich weniger gefährliche<br />
Möglichkeit, einen verbrauchenden<br />
Umgang mit menschlichem Leben zu<br />
rechtfertigen, besteht darin, das Tötungsverbot<br />
in bestimmten kontrollierbaren<br />
„Ausnahmesituationen“ außer Kraft zu setzen,<br />
ohne dass man das Menschsein dieses<br />
Menschenlebens bestreitet. Als solche werden<br />
Konfliktsituationen anerkannt, in denen<br />
das Leben durch andere Menschen ernsthaft<br />
bedroht ist, also Situationen der<br />
Notwehr. Gedacht wird auch an tragische<br />
Leidenssituationen, in denen das Leiden mit<br />
medizinischen und sonstigen Mitteln nicht<br />
erträglich gestaltet werden kann und in<br />
denen dann eine Tötung des Lebens erwogen<br />
wird. Ob und inwiefern beim Schwangerschaftsabbruch<br />
aus psychosozialer Notlage<br />
oder aufgrund einer Krankheit des<br />
Feten und bei einer PID eine solche unausweichliche<br />
Situation vorliegt, kann hier<br />
nicht näher erörtert werden. Faktisch werden<br />
beide an sich zu unterscheidenden<br />
Argumente für einen „tödlichen“ Umgang<br />
mit menschlichem Leben meist miteinander<br />
kombiniert. Leitend ist dabei fast<br />
immer die Infragestellung dessen, dass das<br />
menschliche Leben, das man zu „selektieren“<br />
oder zu Forschungszwecken zu verbrauchen<br />
gedenkt, nicht unter dem uneingeschränkten<br />
Schutz der Menschenwürde<br />
steht. Dies ist auch bei allen Formen des<br />
Schwangerschaftsabbruchs deutlich.<br />
Bei keinem todbringenden Verbrauch<br />
von menschlichem Leben zu wissenschaftlichen<br />
Zwecken, auch solchen mit therapeutischer<br />
Zielsetzung, liegt eine solche<br />
Konflikt- oder Notwehrsituation zwischen<br />
Leben und Leben vor. Die therapeutischen<br />
Möglichkeiten, die sich aus solcher<br />
Forschung ergeben sollen, sind völlig offen<br />
und liegen überwiegend in einer mehr oder<br />
weniger fernen Zukunft. Von einer Konfliktsituation<br />
zwischen Leben und Leben kann<br />
hier also nicht geredet werden. Es ist ein<br />
rein theoretisch konstruierter Konflikt, kein<br />
echter Lebenskonflikt. Sicher gibt es in der<br />
Medizin Situationen, in denen durch die<br />
Überschreitung des Tötungsverbots anderen<br />
gegenwärtig lebenden kranken Menschen<br />
geholfen oder gar ihr Leben gerettet<br />
werden könnte, z.B. dadurch, dass man ster-<br />
36<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
benden Menschen, die ohnehin in absehbarer<br />
Zeit tot sein werden und die als Organspender<br />
in Frage kommen, schon vor ihrem<br />
Hirntod Organe entnimmt. Hier könnte<br />
man berechtigterweise von einer solchen<br />
Konfliktsituation zwischen Leben und<br />
Leben reden.<br />
Beispiel: Herr K., 38 Jahre alt, Vater von<br />
zwei Kindern unter zehn Jahren, hat um<br />
meinen Besuch gebeten. Infolge einer<br />
Hepatitis-C-Infektion ist sein Leben von<br />
einem Leberversagen bedroht. Die einzige<br />
Chance, sein Leben zu erhalten,<br />
besteht darin, dass ihm innerhalb von<br />
etwa zwei Tagen eine Leber transplantiert<br />
wird. Tags darauf werde ich in die<br />
Neurochirurgie gerufen. Ein 20-jähriger<br />
Mann ist mit einem schweren Schädel-<br />
Hirn-Trauma eingeliefert worden und<br />
liegt im Sterben. Die Eltern haben um<br />
ein Gespräch gebeten. Auf der Intensivstation<br />
erfahre ich, dass Herr S. noch<br />
weiter intensiv behandelt wird, weil er<br />
als Organspender in Frage komme. Man<br />
habe den Eltern diese Möglichkeit angedeutet.<br />
Die klinischen Anzeichen seien<br />
jetzt so eindeutig, dass man die Hirntoddiagnostik<br />
einleiten könne. Mein<br />
Gespräch mit den Eltern berührt auch<br />
die Möglichkeit der Organentnahme. Ich<br />
denke dabei an Herrn K. Das Organ des<br />
jungen Mannes könnte, wenn es einigermaßen<br />
passt, dessen Leben retten,<br />
vorausgesetzt, der Tod tritt bald ein. Unvermeidlich<br />
drängt sich die Frage auf,<br />
warum man eigentlich, wenn der Tod<br />
ohnehin notwendig bald eintreten wird,<br />
nicht jetzt schon mit einer Organentnahme<br />
beginnen darf, wenn ein<br />
anderes Leben damit gerettet werden<br />
kann. Aber schon nach dem Gespräch<br />
mit mir kommen die Eltern zum Entschluss,<br />
einer Organentnahme nicht<br />
zuzustimmen.<br />
Zwischen dem Umgang mit menschlichem<br />
Leben am Lebensanfang und am<br />
Lebensende bestehen – bei nicht zu leugnenden<br />
Unterschieden – viele Parallelen. So<br />
ist bei Herrn S. z.B. das Bewusstsein bereits<br />
erloschen und die „Potenzialität“ zu überleben<br />
aufgrund eines „schicksalhaften Geschehens“<br />
nicht mehr gegeben. Es besteht<br />
am Ende des Lebens aber Einigkeit darüber,<br />
dass diese Tatsachen nicht dazu berechtigen,<br />
den noch lebenden „Körper“ als<br />
Mittel zu fremdnützigen Zwecken wie die<br />
Organgewinnung oder zu wissenschaftlich-therapeutischen<br />
Forschungen zu gebrauchen<br />
und ihn dadurch schwer zu schädigen<br />
oder gar zu töten. Es gibt kein Recht<br />
auf Leben und Gesundheit, das um den<br />
Preis der schweren Schädigung oder gar<br />
Tötung anderer Menschen eingefordert<br />
werden kann.<br />
Überträgt man diese Überlegungen auf<br />
den Umgang mit Embryonen und anerkennt,<br />
dass auch frühe Embryonen unter<br />
dem uneingeschränkten Schutz der Menschenwürde<br />
stehen, so kann der Tatbestand,<br />
dass es rechtswidrig, entgegen den<br />
Bestimmungen des EschG’es erzeugte<br />
„überzählige“ Embryonen gibt, die ohnehin<br />
dem Tode geweiht sind, einen Verbrauch als<br />
„biologischer Rohstoff“, als reines Mittel zu<br />
fremdnützigen Zwecken keinesfalls ethisch<br />
rechtfertigen. Der dann einzig angemessene<br />
Umgang mit solchen überzähligen“<br />
Embryonen wäre der, dass man sie sterben<br />
lässt wie Menschenleben, das nicht mehr<br />
zu retten ist (z. B. bei spontanen Aborten,<br />
bei notwendig sterbenden Menschen).<br />
Sterbenlassen und Töten sind nicht nur am<br />
Lebensende, sondern auch am Lebensanfang<br />
grundsätzlich zu unterscheiden.<br />
Selbst wenn der Tod von Embryonen unvermeidbar<br />
ist, kann es noch einen ihrer Würde<br />
angemessenen achtungsvollen Umgang<br />
mit ihnen geben, wie wir ihn heute auch<br />
bei Spontanaborten, Spätabtreibungen und<br />
Totgeburten immer mehr pflegen (z. B.<br />
keine einfache Beseitigung mit „Organ-<br />
Abfällen“ aus menschlichen Körpern, sondern<br />
besondere anonyme „Sammel-Bestattungen“<br />
auf Friedhöfen).<br />
Auch das zusätzliche Argument, dass<br />
ein solcher verbrauchender Umgang mit<br />
Embryonen nur auf „hochrangige“ therapeutische<br />
Ziele eingegrenzt werden soll<br />
(vorausgesetzt man kann definieren, was<br />
darunter abgesehen von den jeweiligen<br />
Gruppeninteressen zu verstehen ist), vermag<br />
nicht darüber hinwegzutäuschen,<br />
dass damit gegenüber der ursprünglichen<br />
Zweckbestimmung der Embryonen, die<br />
Geburt eines Kindes zu ermöglichen, ein<br />
ethisch gesehen grundsätzlich anderer<br />
Zweck das Handeln bestimmt. Eine solche<br />
Änderung der Zweckbestimmung in einen<br />
fremdnützigen Verbrauch stellt ein ethisches<br />
Novum im wissenschaftlich-medizinischen<br />
Umgang mit menschlichem Leben<br />
dar. An die Stelle der Bestimmung zum<br />
Leben tritt die Bestimmung zum tödlichen<br />
Verbrauch. Er ist bisher auch zu hochrangigen<br />
therapeutischen Zwecken nur nach<br />
dem Tod des Menschenlebens ethisch<br />
erlaubt und rechtlich gebilligt (z.B. Organentnahme,<br />
Sektionen). Im Wissen darum<br />
argumentieren fast alle Befürworter einer<br />
verbrauchenden Forschung mit Embryonen<br />
nie allein mit der Relativierung des Tötungsverbots<br />
in einer Notwehr- und Konfliktsituation,<br />
sondern meist primär mit der<br />
Relativierung des moralischen Status früher<br />
menschlicher Embryonen, der wenigstens<br />
so niedrig angesetzt wird, dass diese<br />
nicht unter dem uneingeschränkten Schutz<br />
der jedem Menschenleben zukommenden<br />
Würde und damit auch nicht unter den des<br />
Tötungsverbot zu stehen kommen.
5. Ethik der Achtung –<br />
Menschenwürde gegen<br />
eine Ethik des Heilens?<br />
Es ist eine schiefe Alternative, wenn<br />
man eine Ethik, die Prinzipien geltend<br />
macht, gegen eine an den Folgen des<br />
Handelns orientierte Verantwortungsethik,<br />
in unserem Fall eine „Ethik des Heilens“,<br />
ausspielt. Die Aufgabe der Medizin, Krankheiten<br />
zu heilen und Leiden zu lindern, wurzelt<br />
in der Achtung der Menschenwürde<br />
allen Menschenlebens, die nur solche<br />
Mittel erlaubt sein lässt, die nicht das<br />
Lebensrecht anderen Menschenlebens verletzen<br />
(GG Art.2). Die Beachtung dieses<br />
ethischen Prinzips bildet die Grundlage der<br />
„Erklärung von Helsinki“ (1964, 7. Fassung<br />
2000) zur medizinischen Forschung an<br />
Menschen. Sie entstand auf dem Boden der<br />
Erkenntnisse aus den Nürnberger Prozessen<br />
gegen Ärzte im „Dritten Reich“. Der Arzt<br />
V. v. Weizsäcker hat in diesem Zusammenhang<br />
1947 darauf hingewiesen, dass der<br />
ungeheure Kampf der Medizin für die<br />
Gesundheit einerseits und der experimentelle<br />
und vernichtende Umgang mit angeblich<br />
„bloß biologischem“ und „lebensunwertem“<br />
Leben andererseits nur die zwei<br />
Seiten ein- und derselben Medaille seien,<br />
nämlich der Glorifizierung der Gesundheit<br />
und des diesseitigen Lebens als höchste<br />
Güter und eines transzendenzlosen, gottlosen<br />
Verständnisses vom Menschsein, das<br />
keine ewige Vollendung irdischen Lebens<br />
und daher keinen einzigartigen Wert des<br />
Menschenlebens mehr anerkenne und deshalb<br />
Leben auch als Mittel zu fremdnützigen,<br />
angeblich „höheren“ Zwecken verbrauchen<br />
kann, wenn es ohnehin nicht zu heilen,<br />
„wertlos“ im Sinne von „nutzlos“ und<br />
dem Tod geweiht ist.<br />
Es ist eine Illusion zu glauben, dass die<br />
durch Krankheit, Altern und Tod aufgeworfenen<br />
Probleme sich durch weitere technische<br />
Fortschritte der Medizin lösen lassen.<br />
Es gibt hinreichend Indizien, dass sie sich<br />
damit immer mehr verschärfen, dass die<br />
Zahl der unheilbar kranken und pflegebedürftigen<br />
Menschen sich dadurch stetig erhöht<br />
und dies zu sozialen und ökonomischen<br />
Problemen führen wird, die immer<br />
mehr zur Infragestellung der Menschenwürde<br />
und Menschenrechte der unheilbaren<br />
und hilfsbedürftigsten Menschen führen<br />
werden. Dann wird ganz deutlich werden,<br />
dass sich die Humanität einer Gesellschaft<br />
weniger daran zeigt, ob sie diese<br />
oder jene Krankheit medizinisch-technisch<br />
besser behandeln kann, als vielmehr daran,<br />
wie sie mit den „Unheilbaren“ umgeht. Angesichts<br />
dieser absehbaren Entwicklung<br />
sind alle medizinischen Methoden und wissenschaftlich-therapeutischenExperimente,<br />
die nur durch eine Veränderung des Verständnisses<br />
von Menschenwürde in Richtung<br />
einer „Anti-Äquivalenz-Theorie“ von<br />
Menschenwürde und Leben gerechtfertigt<br />
werden können, ethisch und rechtlich<br />
äußerst bedenklich, ja sie sollten verboten<br />
bleiben, weil sie die Türen zu Lebensunwerturteilen<br />
und weitergehenden Verfügungen<br />
über Menschenleben und einem<br />
sehr eingeschränkten Schutz des unheilbar<br />
kranken und schwerstpflegebedürftigen<br />
Lebens öffnen.<br />
Dazu gehört neben jedem verbrauchenden<br />
Umgang mit Embryonen nicht zuletzt<br />
auch die Prä-Implantations-Diagnostik<br />
(PID), da sie zu ihrer Entwicklung notwendig<br />
Embryonen verbrauchen muss, sie notwendig<br />
„überzählige“, auch gesunde<br />
Embryonen erzeugt und vor allem, weil die<br />
PID ein medizinisch-diagnostisches Verfahren<br />
darstellt, eine „mangelnde Lebensqualität“<br />
festzustellen, die die bewusste Tötung<br />
von Menschenleben rechtfertigen soll.<br />
Eine rechtliche Billigung der PID würde<br />
daher gleichbedeutend sein mit der Billigung<br />
von „negativen Lebenswerturteilen“,<br />
die das Lebensrecht in Frage stellen. Damit<br />
ist deutlich, dass die Anerkennung der<br />
Menschenwürde (GG Art. 1) und der ihr entsprechenden<br />
Menschenrechte, bis hin zum<br />
Lebensrecht (Art. 2), vom Gegebensein bestimmter<br />
Lebensqualitäten abhängig gemacht<br />
und zugleich gegen GG Art. 3,3 verstoßen<br />
wird, nach dem niemand aufgrund<br />
einer Behinderung benachteiligt werden<br />
darf. Gerade die rechtliche Billigung von<br />
negativen „Lebenswerturteilen“ und entsprechenden<br />
Selektionsverfahren im vorgeburtlichen<br />
Bereich kann auf lange Frist – bei<br />
wachsendem sozial-ökonomischen Druck,<br />
der von den schwerstpflegebedürftigen<br />
Menschen ausgeht – nicht ohne Auswirkungen<br />
auf das geborene Leben, insbesondere<br />
auf behinderte und hirnorganisch<br />
geschädigte Menschen (z. B. Demenzen)<br />
bleiben. Es entsteht also zugleich die Frage,<br />
ob solche Urteile und mit welchen Begründungen<br />
sie nur auf bestimmte Stadien<br />
am Anfang des Lebens begrenzt, ob sie<br />
nicht auf alle Stadien des vorgeburtlichen<br />
und des geborenen Lebens, wenigstens<br />
aber auf alle Grenzbereiche des Lebens ausgedehnt<br />
werden dürfen, zumal Argumentationen,<br />
die in einem Bereich des Lebens<br />
und der Medizin als zutreffend anerkannt<br />
werden, in anderen, aber ähnlich gelagerten<br />
Lebenssituationen nicht grundsätzlich<br />
falsch sein können.<br />
Wenn der Gesetzgeber Menschenleben<br />
unabhängig von seinen Lebensqualitäten<br />
unter den uneingeschränkten Schutz der<br />
Menschenwürde stellen will, dann muss er<br />
es von Anfang dieses Lebens an bis zu seinem<br />
Ende tun. So gesehen ist die Alternative<br />
zwischen einer Ethik, die Prinzipien geltend<br />
macht (z.B. uneingeschränkte Achtung<br />
der Würde allen Menschenlebens, des<br />
Tötungsverbots), und einer (Verantwortungs-)Ethik,<br />
die von den Folgen her denkt<br />
(z. B. „Ethik des Heilens“), nicht aufrecht zu<br />
erhalten, denn das Insistieren auf der<br />
uneingeschränkten Beachtung grundle-<br />
gender ethischer Prinzipien wie der Menschenwürde<br />
allen leibhaften Menschenlebens<br />
und dem Tötungsverbot dient dem<br />
Schutz des Lebens aller Menschen, insbesondere<br />
des Lebens der schwächsten Menschen,<br />
die ihre (Menschen-)Rechte nicht<br />
oder nicht mehr selbst geltend machen<br />
können, und dem Gelingen des Lebens aller<br />
Menschen in der Gemeinschaft der Menschen,<br />
sie sind also keine abstrakten oder<br />
gar lieblosen und lebensfeindlichen Prinzipien,<br />
sondern dienen dem Leben, schützen<br />
es, und dienen nicht zuletzt der „moralischen<br />
Gesundheit“ einer Gesellschaft,<br />
indem in der Gesellschaft nicht die Kräfte<br />
der Liebe und der Achtung vor unheilbarem<br />
Menschenleben ausgehöhlt werden, ohne<br />
Literatur des Verfassers zum Thema:<br />
U. Eibach: Gentechnik und Embryonenforschung<br />
– Leben als Schöpfung<br />
aus Menschenhand? Wuppertal (R.<br />
Brockhaus) 2. Aufl. 2005<br />
die letztlich keiner leben kann. Es wäre<br />
gefährlich, wenn man alle Hoffnung auf<br />
das medizintechnische „Wegmachen“ von<br />
Krankheiten setzt und zu diesem Zweck<br />
diejenigen moralischen Grundlagen in der<br />
Gesellschaft untergräbt, die die Sorge für<br />
ein menschenwürdiges Leben in den gerade<br />
durch die Erfolge der Medizin immer<br />
häufiger werdenden Zuständen langer<br />
chronischer Krankheit und Pflegebedürftigkeit<br />
gebieten. Alle „Ethik des Heilens“ wurzelt<br />
in der Achtung der Menschenwürde<br />
und Menschenrechte allen Menschenlebens<br />
und ist ihr uneingeschränkt ein-<br />
und unterzuordnen. Nur bei einer uneingeschränkten<br />
Beachtung dieses und anderer<br />
fundamentaler ethischer Grundsätze<br />
wird sich die fortschreitende wissenschaftliche<br />
Beherrschung menschlichen Lebens<br />
nach ethischen Kriterien steuern lassen<br />
und die Ethik sich nicht in die Position<br />
abgedrängt sehen, dass sie die wissenschaftlichen<br />
und therapeutischen Zielsetzungen<br />
der Biomediziner primär ethisch<br />
so legitimiert, dass sie in der Gesellschaft<br />
akzeptiert und vom Gesetzgeber rechtlich<br />
gebilligt werden. >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 37
6. Schlussfolgerungen für die<br />
embryonale Stammzellforschung<br />
Das Stammzellgesetz von 2002 stellt<br />
einen politischen Kompromiss dar, mit dem<br />
die meisten Bundestagsabgeordneten gemäß<br />
dem EschG ein verändertes Verständnis<br />
von Menschenwürde abwehren und<br />
doch die Forschung mit im Ausland gewonnenen<br />
embryonalen Stammzellen ermöglichen<br />
wollten. Damit sollte ein weitergehender<br />
verbrauchender Umgang mit<br />
Embryonen (etwa zum Zweck der PID) verhindert<br />
werden und ein „Rechtsfrieden“<br />
erhalten werden. Dieses Bemühen ist politisch<br />
anerkennenswert. Der Kompromiss ist<br />
aber auf ethischer Ebene kaum begründbar,<br />
weil er letztlich – insbesondere aufgrund<br />
der Verschiebung des Stichtags von 2002<br />
auf 2007 – einer ethischen Billigung eines<br />
verbrauchenden Umgangs mit Embryonen<br />
im Ausland nahe oder gleich kommt, sie für<br />
Deutschland aber ethisch ablehnt.<br />
38<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Die einzig ethisch schlüssige Forderung<br />
wäre, eine Herstellung von embryonalen<br />
Stammzellen und damit einen verbrauchenden<br />
Umgang mit Embryonen auch in<br />
Deutschland zu erlauben, der dann aber<br />
wohl kaum auf die Gewinnung von Stammzellen<br />
zu begrenzen wäre und keinesfalls<br />
nur die Selektion von Embryonen bei der<br />
PID einschließen würde. Ein solcher Schritt<br />
impliziert aber ein verändertes Verständnis<br />
von Menschenwürde im Sinne der „Antiäquivalenztherorie“<br />
von Menschenwürde<br />
und Leben, die behauptet, dass es biologisch<br />
menschliches Leben gibt, das aufgrund<br />
fehlender Lebensqualitäten nicht<br />
unter dem Schutz der Menschenwürde<br />
steht. Dieser Schritt hat weitgehende<br />
Folgen auch für den Schutz schwer behinderten<br />
und schwer kranken, vor allem hirnorganisch<br />
versehrten Menschenlebens.<br />
Wer diese Veränderung des Verständnisses<br />
von Menschenwürde aufgrund z.B.<br />
christlicher Überzeugungen ablehnt und<br />
damit auch an der Geltung des Tötungsverbots<br />
für alles menschliche Leben festhält,<br />
der kann auch eine Herstellung von<br />
embryonalen Stammzellen und damit eine<br />
Tötung von Embryonen zu diesem Zweck<br />
nur ethisch ablehnen und muss auch den<br />
politisch-rechtlichen Kompromiss sehr kritisch<br />
sehen. Dies hat nichts mit einer verantwortungslosen<br />
„Prinzipienreiterei“ zu<br />
tun, die kein Verständnis für leidende<br />
Menschen hat, denen von der Forschung<br />
mit embryonalen Stammzellen Heilung<br />
versprochen wird. Vielmehr dient die uneingeschränkte<br />
Beachtung dieser ethischen<br />
Prinzipien – auch in der Gesetzgebung –<br />
dem Schutz und der Achtung des Lebens<br />
aller, insbesondere aber des Lebens der<br />
unheilbaren Menschen. Zudem gibt die<br />
Entwicklung der Forschung mit Stammzellen<br />
denen recht, die medizinisch aussichtsreiche<br />
Therapien nur auf der Basis der<br />
Arbeit mit adulten Stammzellen gegeben<br />
sehen.<br />
Autologe adulte koronare Stammzelltransplantation<br />
VON PD DR. CHRISTIANA MIRA SCHANNWELL<br />
Ganz im Gegensatz zur Gewinnung von Stammzellen aus Embryonen macht die Entwicklung von Therapien aus<br />
adulten Stammzellen längst erheblich größere Fortschritte: Dies zeigte der lebendige und anschauliche Vortrag von<br />
Dr. Christiana Mira Schannwell, Privatdozentin an der Uni-Klinik in Düsseldorf, beim Aktiventag in Essen. Gerade erst<br />
mit einem begehrten US-amerikanischen „Research Award“ geehrt, verzeichneten die von ihr vorgestellten und in<br />
Deutschland entwickelten neuen Verfahren zur Behandlung von Herzinfarktpatienten eine sprunghafte Anwendung weltweit.<br />
Alle Daten zur Therapie mit Stammzellen nach einem akuten Herzinfarkt zeigten Spitzenergebnisse zu Verträglichkeit,<br />
Wohlbefinden des Patienten, Krankheitsverlauf und -dauer. Nebeneffekte seien nicht zu beobachten. Vor allem:<br />
Für den Einsatz von adulten Zellen aus dem Knochenmark des Menschen gebe es – im Gegensatz zu den embryonalen<br />
Stammzellen – keine ethischen Probleme. Im Folgenden dokumentieren wir Ihren Vortrag.<br />
Am 30. März 2001 wurde am Düsseldorfer<br />
Heinrich-Heine-Universitätsklinikum<br />
durch Professor Dr. B. E. Strauer weltweit<br />
der erste Patient nach einem Herzinfarkt<br />
mit adulten Stammzellen behandelt. Das<br />
Verfahren wurde von Professor Dr. B. E.<br />
Strauer entwickelt.<br />
Vor mehreren Jahren gelang es bei dem<br />
experimentellen Herzinfarkt der Maus,<br />
durch Injektion von körpereigenen Mausstammzellen<br />
eine Regeneration des Herzmuskelgewebes<br />
zu erreichen. Dies war der<br />
Ansatz, auch in der Klinik, beim akuten und<br />
chronischen Infarkt des Patienten, eine<br />
Myokardregeneration mit körpereigenen<br />
Stammzellen zu erreichen.<br />
1,3 Millionen Menschen in Deutschland<br />
haben eine Herzschwäche, pro Jahr kommen<br />
in Deutschland 116.000 Patienten mit<br />
Herzschwäche dazu. Die Herzschwäche hat<br />
eine schlechte Prognose: nach fünf Jahren<br />
ohne adäquate Behandlung sind 50 Prozent<br />
der Patienten bereits verstorben.<br />
Die Herzschwäche ist durch das Unvermögen<br />
des Herzens gekennzeichnet, sich<br />
selbst und andere Organe ausreichend mit<br />
Blut und Sauerstoff zu versorgen. Herzschwäche<br />
entsteht am häufigsten durch<br />
Herzinfarkte, Bluthochdruck und Herzmuskelentzündungen.<br />
Sie ist eine der gravierendsten<br />
Erkrankungen in Deutschland<br />
und trägt zur hohen Sterblichkeit der Herzkrankheiten<br />
bei. Neben Allgemeinmaßnahmen<br />
(Meiden von Kochsalz, Flüssigkeitsrestriktion,<br />
milde Bewegungen etc.)<br />
sind medikamentöse Maßnahmen sinnvoll<br />
(z. B. herzunterstützende Medikamente,<br />
Entwässerungsmedikamente). Wenn diese<br />
Maßnahmen nicht greifen, so kann durch<br />
eine Reihe von anderen Verfahren eine Besserung<br />
der Herzschwäche additiv erreicht
werden: Einsatz bestimmter Masken-Beatmungsverfahren,<br />
die nächtlich eingesetzt<br />
werden, dosierte Trainingsprogramme, die<br />
bei Herzschwäche, nicht zuletzt auch durch<br />
eine Freisetzung von die Herzkraft stärkenden<br />
Stammzellen erreicht werden. Ferner<br />
lässt sich in den Endstadien, durch maschinelle<br />
Verfahren eine Behandlung der Herzinsuffizienz<br />
erreichen.<br />
Akuter Herzinfarkt<br />
Die akute Behandlung des Herzinfarktes<br />
hat zum Ziel, eine möglichst rasche<br />
Wiedereröffnung der verschlossenen Herzkranzarterie<br />
(= Infarktgefäß) zu erreichen.<br />
Durch die Verfügbarkeit von Ballonverfahren<br />
und Stent-Techniken ist es möglich<br />
geworden, den akuten Verschluss einer<br />
Herzkranzarterie, der zum Herzinfarkt führte,<br />
rückgängig zu machen und das Gefäß<br />
wieder zu öffnen. Allerdings wird damit<br />
lediglich die Durchblutung wieder hergestellt,<br />
der untergegangene Herzmuskel<br />
wird dadurch nicht regeneriert. Somit stellt<br />
das Ballonverfahren mit seinen Alternativen<br />
(Stent, Laser etc.) eine sehr wirksame,<br />
wenn aber auch nur symptomatische<br />
Therapiemöglichkeit im akuten und Postinfarktstadium<br />
dar. Eine Kausaltherapie<br />
wäre wünschenswert, indem zum Beispiel<br />
das zugrunde gegangene Herzmuskelgewebe<br />
wieder regeneriert würde.<br />
Durch die akute Wiedereröffnung des<br />
Infarktgefässes soll die Infarktzone begrenzt,<br />
eine durch Umbauvorgänge verursachte<br />
Ausdehnung des Infarktareals gebremst<br />
und schlussendlich akute und langfristige<br />
Komplikationen verhindert werden.<br />
Trotz der Verbesserungen der Therapiemaßnahmen<br />
steht die Nekrose (= Absterben)<br />
von Herzmuskelzellen nach wie vor im<br />
Mittelpunkt des Krankheitsgeschehens,<br />
weil sie einen irreversiblen Verlust an<br />
kontraktiler Substanz bedeutet.<br />
Das Herz verfügt nicht über die Möglichkeit,<br />
einmal verlorengegangenes Herz-<br />
muskelgewebe sowie kleine Herzgefäße<br />
wie Arteriolen und Kapillaren zu ersetzen.<br />
Die eintretende Defektheilung mit Narbenbildung<br />
führt im chronischen Infarktstadium<br />
in 30 Prozent der Patienten zu einem<br />
fehlerhaften strukturellen Umbau des Restventrikels<br />
aufgrund einer kontraktilen<br />
Überlastung der Herzmuskelzellen mit<br />
einer konsekutiven progredienten Pumpfunktionsverschlechterung<br />
(Remodeling).<br />
Trotz einer adäquaten medikamentösen<br />
Mehrfachtherapie stellt die Herzschwäche<br />
eine den Patienten in seiner Lebensqualität<br />
einschränkende, in seiner Lebenserwartung<br />
limitierende sowie das Gesundheitswesen<br />
durch Folgekosten belastende Erkrankung<br />
dar.<br />
Für das neue therapeutische Verfahren,<br />
die intrakoronare autologe Stammzelltherapie,<br />
wird in schonender Weise etwa 80<br />
ml Knochenmarkblut aus dem Beckenkamm<br />
entnommen. Die mononukleäre<br />
Zellfraktion des Knochenmarks kann außerhalb<br />
des Körpers von den übrigen Knochenmarkzellen<br />
separiert werden. Diese mononukleären<br />
Zellen werden ca. vier Stunden<br />
später bei einer erneuten Herzkatheteruntersuchung<br />
direkt in die eröffnete Herzkranzarterie<br />
– welche relevant eingeengt<br />
war oder vormals den Herzinfarkt ausgelöst<br />
hatte – zurückgegeben.<br />
Eine wichtige Voraussetzung der Wirksamkeit<br />
der Stammzelltherapie ist die<br />
Erreichbarkeit der sogenannten Randzone<br />
durch die mononukleären Knochenmarkzellen,<br />
d. h. derjenigen Zone, die im Randgebiet<br />
des Infarktes zum gesunden Gewebe<br />
besteht. Man weiß, dass in dieser<br />
Zone die Zellerneuerungsraten viermal so<br />
hoch sind wie im normalen Herzmuskel.<br />
Mittels der in Düsseldorf entwickelten<br />
Ballontechnik war es möglich gewesen,<br />
die unter „Good Manufactoring Practice“-<br />
Bedingungen, entsprechend den Paul-<br />
Ehrlich-Bedingungen aufgearbeiteten<br />
Knochenmarkzellen konzentriert in die<br />
Randzone zu injizieren und zu transplantieren,<br />
so dass damit eine Anreicherung dieser<br />
Zellen dort deponiert werden kann. Dies<br />
war eine wichtige Voraussetzung, dass die<br />
Zelltherapie Wirkung entfaltete.<br />
Der genaue Wirkmechanismus der Zellen<br />
ist allerdings noch nicht vollständig erforscht.<br />
Zum einen veränderen und beschleunigen<br />
die Stammzellen lokal den<br />
Umbau des Gewebes, zum anderen bildeten<br />
sie kleine Gefäße, die dann zu einer<br />
besseren Durchblutung führen.<br />
Systematische Nachuntersuchungen<br />
aller Patienten nach der Stammzelltransplantation<br />
nach akutem Herzmuskelinfarkt<br />
haben ergeben, dass der Effekt noch nach<br />
Jahren messbar ist. Es konnte eine Verbesserung<br />
der Pumpfunktion und Durchblutung<br />
des Herzmuskels sowie eine signifikante<br />
Reduktion der Infarktgröße dokumentiert<br />
werden. Die Stammzelltherapie<br />
beim akuten Herzinfarkt war in quasi allen<br />
Fällen wirksam, wenn auch nicht immer<br />
gleichermaßen ausgeprägt, dass sie zu einer<br />
Verbesserung der Herzleistung führt, zu<br />
einer Verbesserung der Durchblutung; die<br />
Stammzelltherapie beim akuten Herzinfarkt<br />
in quasi allen Fällen wirksam ist,<br />
wenn auch nicht immer gleichermaßen<br />
ausgeprägt, dass sie zu einer Verbesserung<br />
der Herzleistung führt, zu einer Verbesserung<br />
der Durchblutung und zu einer<br />
Verbesserung des Herzstoffwechsels bei<br />
ehemals nekrotischem, d.h. abgestorbenem<br />
Herzmuskelgewebe. Eine erneute Verschlechterung<br />
der Herzpumpfunktion<br />
wurde bisher 7,5 Jahre nach der ersten<br />
intrakoronaren autologen Stammzelltransplantation<br />
nicht gesehen.<br />
Diese Therapie ist gefahrlos zu<br />
handhaben und verbessert nachweislich<br />
Durchblutung, Herzkraft und Herzgröße.<br />
Bei keinem der Patienten bzw.<br />
keiner der Patientinnen, die bisher mit<br />
eigenen Knochenmarkstammzellen intrakoronar<br />
behandelt worden sind, wurden<br />
bisher Nebenwirkungen festgestellt, die<br />
mit der Stammzelltherapie zusammenhängen.<br />
>><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 39
Chronisch ischämische<br />
Herzerkrankung<br />
Auf der Basis der Randzonenüberlegungen<br />
und des überzeugenden Erfolgs der<br />
intrakoronaren autologen Stammzelltherapie<br />
nach akutem Herzinfarkt wurde<br />
die zweite Indikation geschaffen, nämlich<br />
die Behandlung des chronischen Herzinfarktes<br />
mittels Knochenmarksstammzellen.<br />
Chronischer Herzinfarkt bedeutet,<br />
dass die Patienten viele Jahre vor der jetzigen<br />
Stammzelltherapie einen Herzinfarkt<br />
durchgemacht hatten und in der Folgezeit<br />
eine Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen,<br />
Herzversagen oder Luftnot und<br />
andere Symptome erlitten. In den Spätstadien<br />
resultieren die Summe der strukturellen<br />
und funktionellen Umbauvorgänge<br />
mit Herzerweiterung, weiterer Funktionsabnahme<br />
(„Remodeling“).<br />
Auch wenn es in den letzten Jahren<br />
möglich geworden ist, durch die Summe<br />
der verfügbaren medikamentösen und interventionellen<br />
Therapiemaßnahmen eine<br />
Reduktion der Sterblichkeit zu<br />
erreichen, so ist nach wie vor das<br />
Pumpversagen und der akute<br />
rhythmogene Herztod derartig<br />
sterblichkeitspotent, dass immer<br />
noch mehr als die Hälfte<br />
aller Herztodesfälle auf dem<br />
Boden von Herz-Kreislauferkrankungen<br />
auftreten. Damit ist die<br />
Todesrate an Herz-Kreislauferkrankungen<br />
doppelt so hoch<br />
wie die Summe aller malignen<br />
Tumoren (Geschwulstformen).<br />
Es wurde demzufolge eine<br />
Behandlungsstudie in der Düsseldorfer<br />
Universitätsklinik initiiert<br />
und abgeschlossen, die als<br />
IACT-Studie (Intracoronary Autologous<br />
Bone Marrow Cell Transplantation<br />
in Chronic Coronary<br />
Artery Disease) in die Weltliteratur<br />
eingegangen ist. Es konnte<br />
erstmals gezeigt werden, dass<br />
auch im chronischen Infarktstadium<br />
durch die intrakoronare<br />
Gabe autologer, angereicherter<br />
mononukleärer Zellen aus dem<br />
Knochenmark eine deutliche<br />
(30 Prozent) Regeneration des<br />
infarzierten Muskelbereichs erreicht<br />
werden kann und dass<br />
damit Beschwerden, Medikamentenverbrauch,<br />
Leistungsfähigkeit der Patienten<br />
und Herzinfarktkomplikationen vermindert<br />
werden konnten.<br />
Die Methode der intrakoronaren autologen<br />
Stammzelltransplantation ist wie bei<br />
den Patienten nach akutem Herzinfarkt.<br />
Aus dem Beckenkamm wird das Knochenmarkblut<br />
entnommen und die mononukleären<br />
Zellen von den übrigen Knochenmarkszellen<br />
separiert. Ca. vier Stunden spä-<br />
40<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
ter bei einer erneuten Herzkatheteruntersuchung<br />
wird die autologe Stammzellsuspension<br />
direkt in die Arterie – welche<br />
vormals den Herzinfarkt ausgelöst hatte –<br />
zurückgegeben.<br />
Bei Patienten mit einem akuten und einem<br />
länger zurückliegenden Herzinfarkt<br />
führte die intrakoronare autologe Stammzelltransplantation<br />
zu einer Verbesserung<br />
der Durchblutung und zu einer Verbesserung<br />
der Pumpfunktion, und dadurch<br />
bedingt zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit<br />
der Patienten.<br />
Dilatative<br />
Herzmuskelerkrankung<br />
Bei der therapieresistenten Herzinsuffizienz,<br />
also der Herzschwäche in fortgeschrittenen<br />
Stadien, auf dem Boden<br />
einer dilatativen Kardiomyopathie (einem<br />
vergrößerten Herzen ohne Nachweis einer<br />
koronaren Herzerkrankung oder eines Bluthochdrucks)<br />
konnte in Düsseldorf erstmalig<br />
durch eine Stammzelltherapie<br />
(körpereigene Stammzellen werden<br />
verwendet) eine deutliche<br />
Besserung der Pumpfunktion<br />
und eine Verbesserung der<br />
Lebensqualität erreicht werden.<br />
Bei Patienten mit Herzschwäche<br />
wird versucht mit den<br />
unterschiedlichsten Maßnahmen<br />
die Herzschwäche ursächlich<br />
zu behandeln. Dies ist jedoch<br />
leider häufig nicht möglich oder<br />
gelingt nicht erfolgreich. Dadurch<br />
kann die Herzleistung in<br />
Zukunft weiter eingeschränkt<br />
bleiben oder auch noch im Laufe<br />
der Zeit schlechter werden.<br />
Wieder erfolgt die Entnahme des<br />
Knochenmarkblutes aus dem<br />
Beckenkamm. Durchschnittlich<br />
wird 80 ml Knochenmarkblut<br />
entnommen und die mononukleäre<br />
(Zellen mit nur einem<br />
Kern) Zellfraktion des Knochenmarks<br />
außerhalb des Körpers<br />
von den übrigen Knochenmarkzellen<br />
getrennt. Die mononukleären<br />
Zellen (20 ml Stammzellsuspension)<br />
werden intrakoronar<br />
sowohl in die rechte Herzkranzarterie<br />
als auch in die linke<br />
Koronararterie distal des mittels low-dose<br />
PTCA aufgedehnten Ballons gegeben.<br />
Während der Transplantation (Übertragung<br />
von Zellen) der autologen (aus dem<br />
Körper entstanden, nicht von außen eingebracht)<br />
Zellen wird der Herzschlag der<br />
Patienten vorübergehend durch eine medikamentöse<br />
Behandlung leicht gesteigert,<br />
um die Implantation der Zellen in das<br />
schlecht pumpende Herzmuskelareal zu<br />
verbessern. Diese Form der Therapie (Be-<br />
handlung) wird „intrakoronare (in das<br />
Herzkranzgefäß) autologe Stammzelltherapie“<br />
genannt.<br />
Eine Kontroll-Untersuchung wird nach<br />
drei Monaten, nach zwölf Monaten und<br />
nach 60 Monaten durchgeführt. Die Resultate<br />
der Düsseldorfer ABCD (Autologous<br />
Bone Marrow Cells in Dilated cardiomyopathy)-Studie<br />
zeigen eindrucksvoll sowohl<br />
eine Verbesserung der Auswurffraktion, der<br />
Lebensqualität und Reduktion der Sterblichkeit.<br />
PD Dr. Dr. Christiana Mira Schannwell, Heinrich-Heine-Universität<br />
Düsseldorf, Medizinische<br />
Klinik und Poliklinik B, Stellvertretende<br />
Klinikdirektorin und Oberärztin der Klinik für<br />
Kardiologie, Pneumologie und Angiologie<br />
Mögliche Beschwerden,<br />
unerwünschte Ereignisse<br />
und Risiken<br />
Neben dem erwarteten Nutzen können<br />
mögliche Risiken nicht 100 Prozent ausgeschlossen<br />
werden. Die Patienten unterziehen<br />
sich invasiven (in den Körper eindringenden)<br />
Standardeingriffen (Knochenmarkspunktion,<br />
Herzkatheteruntersuchung), welche<br />
für diese Therapieform notwendig sind. Alle<br />
diese Eingriffe werden in dem Düsseldorfer<br />
Universitätsklinikum jedoch routinemäßig<br />
durchgeführt und sind in der Regel ohne<br />
wesentliche Nebenwirkungen durchführbar.<br />
Über die Eingriffe und die damit verbundenen<br />
Risiken werden die Patienten<br />
gesondert aufgeklärt.<br />
Die Zellen werden in einem Labor (Institut<br />
für Transplantationsdiagnostik und<br />
Zelltherapeutika), welches für den Einsatz<br />
von Zelltherapieverfahren am Menschen<br />
zugelassen ist, in circa vier Stunden kultiviert.<br />
Sämtliche Voruntersuchungen haben<br />
zeigen können, dass dieses Verfahren sicher<br />
ist und keine unerwünschten Nebenwirkungen<br />
auftreten.
Mit dem in der Düsseldorfer Kardiologie<br />
entwickeltem Verfahren der adulten autologen<br />
Stammzelltransplantation wurden in<br />
Düsseldorf selbst bereits ca. 450 Patienten<br />
und weltweit ca. 6.000 Patienten erfolgreich<br />
behandelt. Die derzeitigen Indikationen<br />
aus kardialer Sicht betreffen den akuten<br />
Herzinfarkt, das chronische Postinfarktstadium<br />
(bis zu 14 Jahre nach Infarkt), sowie<br />
die chronische Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz)<br />
auf dem Boden von Herzmuskelerkrankungen<br />
(Myokarditis, dilatative<br />
Kardiomyopathie). Es ist zu erwarten, dass<br />
auch andere Herzerkrankungen, zum Beispiel<br />
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen,<br />
durch die autologe Stammzelltransplantation<br />
erheblich gebessert<br />
werden können.<br />
Zwischenzeitlich konnte auch nachgewiesen<br />
werden, dass eine wiederholte<br />
Gabe von autologen Stammzellen zu einer<br />
additiven Verbesserung bei allen Patienten<br />
geführt hat.<br />
Periphere arterielle Verschlusskrankheit<br />
(Raucherbein, Schaufensterkrankheit)<br />
Weltweit erstmalig im Jahre 2005 konnte<br />
im Universitätsklinikum Düsseldorf die<br />
Stammzelltherapie beim diabetischen Fuss<br />
und bei der fortgeschrittenen peripheren<br />
Verschlusskrankheit (Schaufensterkrankheit,<br />
Raucherbein) eingesetzt werden: Durch die<br />
kombinierte intraarterielle und intramuskuläre<br />
Transplantation von autologen adulten<br />
Knochenmarksstammzellen gelang es, die<br />
Gehstrecke der behandelten Patienten um<br />
ein Vielfaches zu steigern, die Beinschmerzen<br />
zu beseitigen sowie das „offene“ Bein<br />
zum Abheilen zu bringen. Derzeit wurden<br />
über 50 Patienten mit diesem in der Düsseldorfer<br />
Klinik entwickelten Verfahren erfolgreich<br />
behandelt. Es konnte gezeigt werden,<br />
dass die Durchblutung und außerdem die<br />
Gehstrecke verbessert werden konnte.<br />
Wenn auch die Wirkmechanismen dieser<br />
Zelltherapie bis heute nicht eindeutig<br />
geklärt sind (Zytokininduzierte Muskelzellregeneration?,<br />
und/oder Gefäßneubildung?,<br />
Mobilisierung intrinsischer Stammzellen?)<br />
ist davon auszugehen, dass damit<br />
eine wirksame Kausaltherapie verfügbar<br />
geworden ist, die nicht nur zur Linderung<br />
der Beschwerden, Verbesserung der Leistungsfähigkeit<br />
und Abnahme der Infarktkomplikationen<br />
führt, sondern auch eben<br />
durch den kausaltherapeutischen Ansatz<br />
zu Reduktion herz- und gefäßbedingter<br />
Spätschäden mit Abnahme der Hospitalisationsfrequenz,<br />
mit Medikamentenreduktion<br />
und weniger Herztodesfällen. Auch<br />
unter Kostengesichtspunkten ist daher<br />
diese neuartige Therapieform, die zwischenzeitlich<br />
von den Krankenkassen mit<br />
einer eigenen DRG-Ziffer ausgestattet<br />
wurde, zu begrüßen und wichtig.<br />
Zusammenfassung<br />
1. Für den Einsatz adulter Stammzellen<br />
aus dem Knochenmark des Menschen<br />
gibt es, im Gegensatz zu embryonalen<br />
Stammzellen, keine ethischen Probleme.<br />
2. Die klinische Therapie wird mittels<br />
üblicher Herzkathetertechniken durchgeführt<br />
(PTCA). Der Zeitfaktor beträgt<br />
ca. 30 bis 40 Minuten.<br />
3. Bei schwerer Herzschwäche steigt die<br />
körperliche Leistungsfähigkeit nach der<br />
Therapie deutlich an. Die spiroergometrische<br />
Sauerstoffaufnahme nimmt um<br />
zehn bis 15 Prozent zu.<br />
4. Die Auswurffraktion des linken Ventrikels<br />
nimmt um acht bis 15 Prozent zu.<br />
5. Die Herzmuskeldurchblutung (Myokardszintigraphie)<br />
sowie die Glucoseaufnahme<br />
(PET) steigen erheblich an,<br />
als Folge einer neu entstandenen<br />
Durchblutungszunahme sowie eines<br />
verbesserten Stoffwechsels.<br />
6. Nebeneffekte wurden bislang nicht<br />
beobachtet, die Therapie ist gut verträglich,<br />
Herzrhythmusstörungen oder<br />
Entzündungszeichen treten nicht auf.<br />
Die bisher in Düsseldorf an über 400<br />
Patienten durchgeführten Therapien repräsentieren<br />
eine gute Basis für weitere klinische<br />
Therapieansätze. Größere Studien und<br />
Weiterentwicklungen, insbesondere im<br />
Hinblick auf die koronar injizierte Stammzellenmenge,<br />
Vitalitätstest und verbesserte<br />
Transplantationstechniken.<br />
Wissenswertes über Stammzellen<br />
Im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen sind adulte Stammzellen ethisch nicht umstritten<br />
und werden vom eigenen Körper nicht abgestoßen.<br />
Berichte über die Stammzellforschung erobern immer wieder die Schlagzeilen. Dabei unterscheiden<br />
Wissenschaftler zwei völlig unterschiedliche Arten der Hoffnungsträger: embryonale<br />
und adulte Stammzellen. Vergleicht man die menschliche Erbinformation mit einer Bibliothek,<br />
so hat jede Körperzelle den kompletten Bücherbestand zur Verfügung. Fertige Körperzellen in<br />
der Haut oder in Darmschleimhaut, im Gehirn oder in der Leber „benutzen“ aber nur wenige<br />
Kapitel. Damit lesen sie zum Beispiel die Information, bestimmte Eiweiße wie Insulin oder Verdauungsenzyme<br />
zu produzieren. Diese Zellen sind auf die Aufgabe, die sie ausüben, spezialisiert.<br />
Meist büßen sie damit ihre Fähigkeit ein, sich zu teilen. Sterben zum Beispiel Hautzellen<br />
ab, können sie nicht selbst für Nachschub sorgen. Stammzellen dagegen sind nicht spezialisiert<br />
– oder, besser gesagt, ihre Spezialisierung besteht darin, dass sie ihre Fähigkeit zur Vermehrung<br />
nicht einbüßen. Teilen sie sich, bleibt immer eine Tochterzelle Stammzelle. Die andere Zelle bildet<br />
weiter spezialisierte Zellen, zum Beispiel Vorläuferzellen für Blut oder Haut.<br />
Embryonale Stammzellen<br />
Aus einer befruchteten Eizelle entwickelt sich ein ganzes Lebewesen. Diese Fähigkeit nennen<br />
Forscher Totipotenz. Bis die befruchtete Eizelle sich dreimal geteilt hat, behalten alle Zellen diese<br />
Fähigkeit bei. Nach weiteren Zellteilungen – im Mutterleib etwa nach drei Tagen – entsteht das<br />
so genannte Keimbläschen (Blastozyste). Es enthält embryonale Stammzellen, die über 200 verschiedene<br />
Zelltypen bilden können – aber kein ganzes Lebewesen mehr. Wissenschaftler sprechen<br />
von „Pluripotenz“. Embryonale Stammzellen gelten als heiß begehrte „Tausendsassas“.<br />
Forscher hoffen, aus ihnen eines Tages Ersatzzellen oder gar ganze Organe nachzuzüchten. Zu<br />
Forschungszwecken gewinnt man sie aus überzähligen befruchteten Eizellen. Für die<br />
Gewinnung der Stammzellen geht der frühe Embryo zu Grunde. Deshalb ist die Forschung mit<br />
embryonalen Stammzellen umstritten. Kritiker befürchten, dass Embryonen gezielt als<br />
„Ersatzteillager“ für kranke Menschen missbraucht werden. In Deutschland ist die Forschung an<br />
menschlichen embryonalen Stammzellen daher nur unter strengen Auflagen erlaubt.<br />
Adulte Stammzellen<br />
Die so genannten adulten Stammzellen verfügen ebenfalls über ein hohes Regenerationspotenzial,<br />
sind aber nicht so flexibel wie embryonale Stammzellen. Forscher fanden sie in<br />
den unterschiedlichsten Organen, zum Beispiel im Knochenmark, im Fettgewebe, im Blut und<br />
im Gehirn. Sie sorgen permanent für Nachschub an Körperzellen. So bilden beispielsweise die<br />
Stammzellen im Knochenmark lebenslänglich verschiedene Blutzellen. Eine adulte Stammzelle<br />
kann jedoch nur noch bestimmte Zelllinien hervorbringen und nicht mehr alle 200 Typen, auch<br />
keinen neuen Menschen. Forscher nennen diese Fähigkeit „Multipotenz“.<br />
„Die biotechnologische Revolution kann auch ohne (die viel diskutierten) embryonalen<br />
Stammzellen stattfinden,“ schrieb die Deutsche Medizinische Wochenschrift darauf in ihrem<br />
Editorial (2001).<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 41
Neue Akademische<br />
Vereinigung in<br />
Moskau gegründet<br />
MOSKAU. Jetzt lebt auch in der russischen<br />
Hauptstadt Moskau das Korporationsstudententum:<br />
Bereits im vergangenen Jahr<br />
gründete sich unter dem Vorsitz von Philipp<br />
Rowe (CV) die Akademische Vereinigung<br />
Moscovia. Nachdem sich in der russischen<br />
Hauptstadt lebende Verbindungsstudenten<br />
der verschiedensten Verbände auf Initiative<br />
des Bonner Corpsstudenten Thomas<br />
Fasbender (C! Borussia Bonn) schon vor<br />
mehreren Jahren zu einem Moskauer<br />
Farbenstammtisch zusammengefunden<br />
hatten, entschlossen sich die Akademiker<br />
im April 2008, eine verbandsübergreifende<br />
Vereinigung ins Leben zu rufen. Man einigte<br />
sich auf die Bundesfarben Schwarz, Rot,<br />
Gold plus rotem Stern und wählte den<br />
Wahlspruch „Nicht der Pflicht nur zu genügen“<br />
wie auch das gleichnamige Lied als<br />
Bundeshymne. Unter dem Namen Moscovia<br />
will die Vereinigung für alle deutschsprachigen<br />
Verbindungsstudenten in Moskau<br />
offen sein und versteht sich dabei auch<br />
als Plattform zum Austausch und zur<br />
gegenseitigen Unterstützung.<br />
42<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
HOCHSCHULNEWS<br />
Korporationsstudententum an der Moskwa: Deutsche<br />
und Österreicher gründen Akademische Vereinigung in<br />
Russland • Stammtisch der Moscovia<br />
Seit der Gründung ist sowohl die Zahl<br />
der Mitglieder, als auch die Zahl derjenigen,<br />
die regelmäßig über das Verbindungsleben<br />
in Moskau informiert werden<br />
möchten, stark angestiegen. „Zurzeit gibt<br />
es bereits 29 Mitglieder aus fast allen<br />
Verbänden. Neben Deutschen und Österreichern<br />
gehören zu den Mitgliedern auch<br />
Russen, die an deutschsprachigen Hochschulen<br />
studiert haben und dort aktiv<br />
waren“, erläuterte Rowe.<br />
Die A.V. Moscovia veranstaltet regelmäßig<br />
Stammtische, Kneipen und weitere<br />
Veranstaltungen. „So können wir studentisches<br />
Brauchtum auch fern der Heimat<br />
pflegen und Korporierten in Moskau die<br />
Möglichkeit gegeben, den Kontakt zum<br />
Verbindungsstudententum und zur Heimatverbindung<br />
aufrecht zu halten“, erklärte<br />
Rowe. Neuankömmlinge in Moskau<br />
erhielten so einen schnellen Zugang zur<br />
deutschen und österreichischen Gemeinde<br />
vor Ort. Bisheriger Höhepunkt der jungen<br />
Vereinigung war die „Österreich-Kneipe“<br />
am 30. Oktober 2008 in der Deutschen<br />
Botschaft in Moskau. Deutsche, österreichische<br />
und russische Verbindungsstudenten<br />
würdigten so gemeinsam den Nationalfeiertag<br />
der Republik Österreich.<br />
Dr. Wolfgang Leitner (Franco-<br />
Bavaria Wien im ÖCV) brachte in<br />
seiner Ansprache vor allem den<br />
Nicht-Österreichern in der Corona<br />
die historischen Begleitumstände<br />
und die Bedeutung<br />
dieses Tages näher. Als nächste<br />
Veranstaltungen sind unter<br />
anderem eine gemeinsame<br />
Fahrt nach St. Petersburg sowie<br />
eine „Deutschland-Kneipe“ geplant.<br />
Die wirtschaftlichen Beziehungen<br />
zwischen dem<br />
deutschsprachigen Kulturraum<br />
und der Russischen Föderation<br />
kann man als außerordentlich<br />
gut bezeichnen. Deutschland ist<br />
Russlands wichtigster Handelspartner<br />
und mit über 4.600<br />
deutschen Unternehmen im<br />
Land gehören die Deutschen zur<br />
größten Geschäftsgemeinde in<br />
Russland. In der 14-Millionen-<br />
Stadt Moskau leben, arbeiten<br />
und studieren deutsche und<br />
österreichische Manager, Geschäftsleute<br />
und Austauschstudenten,<br />
darunter auch zahlreiche<br />
Korporationsstudenten.<br />
Weitere Informationen und<br />
die Termine der nächsten Veran-<br />
staltungen beim Vorsitzenden Philipp<br />
Rowe,E-Mail: ro-we@rufil-consulting.de.<br />
Andreas Kraus (CV)<br />
Konrad-Adenauer-Stiftung<br />
fördert mehr Studierende<br />
BERLIN. In den beiden letzten Jahren hat<br />
die Konrad-Adenauer-Stiftung so viele<br />
Studierende wie noch nie in ihre Begabtenförderung<br />
aufgenommen. Damit hat sie<br />
erheblich zum Erfolg der Initiative von<br />
Bildungsministerin Dr. Annette Schavan zur<br />
Steigerung der Stipendiatenzahl beigetragen.<br />
Ihr Ministerium hatte 2006 die Mittel<br />
für die Begabtenförderwerke deutlich erhöht<br />
und damit den Auftrag verbunden, die<br />
Zahl der geförderten Studierenden auf ein<br />
Prozent eines Jahrgangs zu steigern.<br />
„Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat ihre<br />
Aufgabe erfüllt und sogar noch übertroffen“,<br />
sagte der Vorsitzende der Stiftung,<br />
Prof. Dr. Bernhard Vogel. Besonders erfreut<br />
habe ihn die verstärkte Aufnahme von Studierenden<br />
aus bildungsfernen Schichten,<br />
also vornehmlich aus Familien mit Migrationshintergund<br />
und aus Arbeiterfamilien.<br />
2008 fördert die Konrad-Adenauer-Stiftung<br />
2.604 Stipendiatinnen und Stipendiaten,<br />
sowohl deutsche Studierende, deutsche<br />
Graduierte als auch ausländische Studierende<br />
und Graduierte. Die Zahl von 1.938<br />
geförderten deutschen Studierenden aller<br />
Fachrichtungen liegt um über 60 Prozent<br />
höher als im Jahr 2005, im Jahr vor Beginn<br />
der Initiative des Bildungsministeriums.<br />
Die individuelle Förderung begabter,<br />
leistungsbereiter und wertorientierter Studierender<br />
versteht die Konrad-Adenauer-<br />
Stiftung als Beitrag zur Bildung zukünftiger<br />
Führungseliten und damit als Investition in<br />
Deutschlands Zukunft. Neben der finanziellen<br />
Unterstützung bietet ein umfangreiches<br />
Seminarprogramm den Stipendiaten<br />
Gelegenheiten, die Grenzen ihres Faches zu<br />
überschreiten und gesellschaftliche Probleme<br />
interdisziplinär zu erörtern. 10.000<br />
Altstipendiaten nehmen heute wichtige<br />
Aufgaben in Wissenschaft und Politik, in<br />
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur wahr.<br />
Mehr: www.kas.de.
EU-Kommission startet neue<br />
Phase von „Erasmus Mundus“<br />
BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat Mitte<br />
Februar offiziell den Startschuss für das<br />
neue weltweite Austauschprogramm für<br />
Studierende und Lehrpersonal gegeben. Bis<br />
2013 sollen mit rund 950 Millionen Euro für<br />
„Erasmus Mundus“ deutlich mehr Mittel zur<br />
Verfügung stehen als für das erste Programm<br />
dieser Art, teilte die EU-Kommission<br />
mit. Nach dem Vorbild des Erasmus-Programms<br />
für Gastaufenthalte von EU-<strong>Studenten</strong><br />
und -Lehrkräften in anderen europäischen<br />
Staaten können mit „Erasmus Mundus“<br />
besonders begabte Studierende und<br />
Lehrkräfte aus Nicht-EU-Staaten Förderung<br />
für Aufenthalte in der EU bekommen. Ziel<br />
ist, den Austausch europäischer Hochschulen<br />
mit anderen Erdteilen zu intensivieren.<br />
Zwischen 2004 und 2008 wurden nach<br />
Angaben der EU-Kommission rund 10.000<br />
Stipendien in einem Umfang von rund 609<br />
Millionen Euro vergeben. Künftig sollen<br />
auch Doktoranden an dem Programm teilnehmen<br />
können. Für europäische <strong>Studenten</strong><br />
solle mehr Geld bereitstehen. EU-<br />
Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner<br />
sagte, das Programm sichere akademisches<br />
Spitzenniveau und helfe den Studierenden,<br />
eine gemeinsame Vision für die Welt zu entwickeln.<br />
Gewerkschaft fordert<br />
43 Milliarden Euro mehr<br />
für Bildung<br />
HANNOVER. Mehr Geld für Bildung fordert<br />
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
(GEW). Auf der Bildungsmesse<br />
„didacta“ in Hannover bezifferte der GEW-<br />
Vorsitzende Ulrich Thöne am 10. Februar<br />
den zusätzlichen Bedarf auf 43 Milliarden<br />
Euro. Wenn die Qualität von Bildung in<br />
Deutschland verbessert und internationale<br />
Standards erreicht werden sollten, müsse<br />
auch so viel Geld wie in anderen Staaten<br />
investiert werden. Die Summe könne bereit<br />
gestellt werden, wenn Deutschland seine<br />
Bildungsausgaben auf sieben Prozent des<br />
Bruttoinlandsprodukts anhöbe. Die Ausgaben<br />
seien dringend notwendig, um aus<br />
dem Krippenprogramm eine Erfolgsgeschichte<br />
zu machen und die Akademiker-<br />
Quote auf deutlich über 40 Prozent der<br />
Menschen eines Jahrgangs ansteigen zu<br />
lassen, unterstrich der GEW-Vorsitzende.<br />
„Bonner Modell“: Uni-Beginn<br />
immer zum 1. Oktober<br />
BONN. Ein „Bonner Modell“ zur europaweiten<br />
Harmonisierung der Semesterzeiten<br />
hat die Uni Bonn vorgeschlagen. Danach<br />
soll das 15 Wochen lange Wintersemester<br />
künftig immer in der Woche vom<br />
1. Oktober beginnen, teilte die Hochschule<br />
am 10. Februar in der Bundesstadt mit. Der<br />
Vorlesungsbeginn zum 14 Wochen langen<br />
Sommersemester solle in die Woche fallen,<br />
in der der 1. April liegt. Durch die Vorverlegung<br />
der Semester sei sichergestellt, dass<br />
<strong>Studenten</strong> bei Aufnahme und Beendigung<br />
eines Auslandssemesters keinen Zeitverlust<br />
hinnehmen müssten.<br />
Ein Semesterbeginn bereits Anfang<br />
September komme nicht infrage, so die Uni.<br />
Das kollidiere mit anderen Terminen der<br />
<strong>Studenten</strong> und Lehrenden wie Prüfungsterminen,<br />
Exkursionen, Sprachkursen und<br />
berufsqualifizierenden Praktika. Auch sei<br />
für viele Disziplinen dies der ideale Monat<br />
für Forschungsaufenthalte und Tagungen,<br />
gerade auch in denjenigen Ländern, in<br />
denen das Semester die Vorlesungen bereits<br />
im September beginne. „Eine Harmonisierung<br />
der Semesterzeiten in Europa ist<br />
ein integraler Bestandteil des Bologna-<br />
Prozesses und dringend geboten“, so Uni-<br />
Rektor Matthias Winiger. Dennoch müssten<br />
die Vorlesungsphasen „zwischen Lissabon<br />
und London nicht am selben Tag beginnen“.<br />
Ein gewisser Spielraum, der örtliche und<br />
fachspezifische Bedingungen berücksichtige,<br />
müsse möglich sein.<br />
Hochschulrektorenkonferenz<br />
verteidigt Bologna-Prozess<br />
BERLIN. Die Hochschulrektorenkonferenz<br />
(HRK) hat grundsätzliche Kritik am Bologna-<br />
Prozess zurückgewiesen. Es gebe zwar<br />
Umsetzungsprobleme, sagte Präsidentin<br />
Margret Wintermantel Ende Januar in<br />
Berlin. Die Ziele<br />
seien aber unstrittig.<br />
Sie könne<br />
nicht sehen, dass<br />
der Reformprozess<br />
die bisherige Identität deutscher Universitäten<br />
gefährde. Angestrebt wird eine Vereinheitlichung<br />
des Europäischen Hochschulraums<br />
(EHR); dies geht mit tiefgreifenden<br />
Reformen des deutschen Hochschulwesens<br />
einher. Neben anderen Kritikern<br />
hatte der Mainzer katholische Theologieprofessor<br />
Marius Reiser unlängst beklagt, dass<br />
der Prozess „die endgültige Abkehr vom<br />
Prinzip der Autonomie und der Unabhängigkeit<br />
der Wissenschaft“ bedeute. Der<br />
54-jährige Experte für Neues Testament<br />
hatte aus Protest gegen den Bologna-Prozess<br />
seinen Lehrstuhl aufgegeben. Laut HRK<br />
sind derzeit insgesamt 75 Prozent des<br />
Lehrangebots an Hochschulen auf Bachelor<br />
und Master umgestellt. Bis 2010 soll der<br />
Europäische Hochschulraum hergestellt<br />
sein. Als weitere Ziele nannte Wintermantel<br />
eine Verbesserung der internationalen akademischen<br />
Mobilität und der Anerkennung<br />
von Studienabschlüssen, eine stärkere Abstimmung<br />
auf den Arbeitsmarkt, eine<br />
Qualitätssicherung sowie die Förderung<br />
eines lebenslangen Lernens. Ferner sollen<br />
die Curricula verschlankt und stärker aufeinander<br />
abgestimmt werden, um ein erfolgreiches<br />
Studium zu gewährleisten.<br />
KMK-Präsident will frühkindliche<br />
Bildung verbessern<br />
BERLIN. Mecklenburg-Vorpommerns Kultusminister<br />
Henry Tesch (CDU) will als<br />
neuer Vorsitzender der Kultusministerkonferenz<br />
die frühkindliche Bildung ausbauen<br />
und die Erzieherinnenausbildung<br />
verbessern. Als weitere Schwerpunkte seiner<br />
KMK-Präsidentschaft für <strong>2009</strong> nannte<br />
Tesch am 19. Januar bei der Amtsübernahme<br />
in Berlin den Hochschulzugang für<br />
beruflich qualifizierte Bewerber. Der 46jährige<br />
gebürtige Schweriner Bildungspolitiker<br />
und ehemalige Gymnasialdirektor<br />
sagte, Erzieherinnen sollten künftig ein<br />
Studium absolvieren können. Es gehe um<br />
„die Besten für die Jüngsten“. Dazu müssten<br />
sich die Länder wie bei der Lehrerausbildung<br />
auf Standards einigen.<br />
Der neue KMK-Präsident sprach sich<br />
auch für eine größere Durchlässigkeit des<br />
Bildungssystems aus. Künftig sollten auch<br />
beruflich hoch qualifizierte Bürger zu einem<br />
Studium berechtigt sein. Er hoffe, dieses<br />
Thema noch in diesem Jahr abschließend<br />
regeln zu können. Deutschland hat im<br />
Vergleich zu anderen Industrieländern eine<br />
unterdurchschnittliche Zahl an <strong>Studenten</strong><br />
und Hochschulabsolventen. Mit dem<br />
Konjunkturpakt II legt der Bund den<br />
Schwerpunkt auf Bildung: Der Bund stellt<br />
6,5 Milliarden Euro an Investitionssumme<br />
für den Ausbau und die Sanierung von Kindergärten,<br />
Schulen und Hochschulen bereit.<br />
Gegen EU-Hochschulranking<br />
BERLIN. Gegen die Einführung einer europäischen<br />
Hochschul-Rangliste haben sich<br />
CDU und CSU ausgesprochen. Mit dem geplanten<br />
Hochschulranking versuche die<br />
Europäische Kommission, die Bildungspolitik<br />
der Mitgliedsstaaten aus Brüssel zu<br />
steuern und die europäischen Hochschulsysteme<br />
nach ihren Vorstellungen anzugleichen,<br />
erklärte der bildungs- und forschungspolitische<br />
Sprecher der CDU/CSU-<br />
Bundestagsfraktion, Alexander Dobrindt<br />
(CSU), Mitte Januar in Berlin. Zwar seien<br />
Vergleiche und Rankings grundsätzlich<br />
sinnvoll, doch sei die EU-Kommission kein<br />
unparteiischer Schiedsrichter, sondern verfolge<br />
offen eigene strategische Bildungsziele<br />
und vergebe Fördermittel in Milliardenhöhe.<br />
Durch eine Rangliste könne sie<br />
deshalb „massiv in die Hochschulpolitik der<br />
Mitgliedsstaaten eingreifen und die Hochschulen<br />
mehr und mehr gleichschalten“.<br />
Die Europäische Kommission hatte im<br />
Dezember eine Ausschreibung für ein<br />
neues Ranking-Verfahren für Universitäten<br />
gestartet. Es soll Forschung, Lehre und<br />
Qualität des Hochschullebens miteinander<br />
vergleichen. Erste Ergebnisse des geplanten<br />
Pilotprojekts werden für Anfang 2011 erwartet.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 43<br />
>>
Viele angehende Bio-Lehrer<br />
bezweifeln Evolutionslehre<br />
HAMBURG. Jeder achte angehende Biologie-Lehrer<br />
zweifelt nach einer Studie des<br />
Dortmunder Professors Dittmar Graf an<br />
Darwins Evolutionslehre. Bei einer Umfrage<br />
unter 1.200 Erstsemestern hätten „erschreckend<br />
viele angegeben“, sie glaubten<br />
nicht an gemeinsame Ahnen aller Lebewesen,<br />
sagte der Dortmunder Biologie-<br />
Didaktiker am 20. Februar gegenüber „Spiegel<br />
online“. Er befragte Lehramtsstudenten<br />
in Dortmund, Siegen und Hildesheim.<br />
Laut Graf handelt es sich dabei nicht<br />
nur um religiöse Eiferer. Zwar hingen religiöse<br />
Überzeugung und Evolutionsskepsis<br />
zusammen, doch viel stärker wirke ein naives<br />
Wissenschaftsbild. Gleichwohl sei der<br />
Trend zum Gedankengut des Kreationismus<br />
ungebrochen. Die aus Amerika stammende<br />
Lehre legt die biblische Schöpfungsgeschichte<br />
streng wörtlich in biologischer<br />
Weise aus.<br />
Vatikan warnt vor genetischer<br />
Auslese von Menschen<br />
VATIKANSTADT. Der Vatikan hat sich gegen<br />
eine genetische Auslese von Menschen gewandt.<br />
Der vatikanische Chef-Ethiker Erzbischof<br />
Rino Fisichella warnte am 17. Februar<br />
anlässlich eines Fachkongresses über<br />
„Neue Chancen der Genetik und das Risiko<br />
der Eugenik“ vor einem „langsamen, aber<br />
unaufhaltsamen“ Abdriften zur Eugenik.<br />
Der Begriff selbst sei gebannt, doch werde<br />
die genetische Auslese von Menschen mit<br />
dem besten Gewissen praktiziert, sagte der<br />
Präsident der Päpstlichen Akademie für das<br />
Leben. Der Kurien-Erzbischof bezog sich<br />
dabei auf neue Möglichkeiten von Gen-<br />
Untersuchungen.<br />
Ein subtiler Sprachgebrauch vereint mit<br />
einer guten Publicity und unterstützt von<br />
starken Wirtschaftsinteressen verschleiere<br />
die Gefahren der Gen-Diagnostik. Der<br />
Ethiker wandte sich gegen den Anspruch<br />
der Technologie, ein „normales Leben“<br />
sicherstellen zu wollen. Niemand könne<br />
sich anmaßen, Regeln und Ziel eines sogenannten<br />
normalen Lebens für einen<br />
Menschen zu definieren.<br />
Studie: Armut ist Haupthindernis<br />
für frühkindliche Bildung<br />
BRÜSSEL. Armut ist nach Einschätzung<br />
einer neuen EU-Studie bereits in der frühkindlichen<br />
Phase Haupthindernis für einen<br />
erfolgreichen Bildungsweg. Sozial schwache<br />
Familien, allein Erziehende und Eltern mit<br />
Migrationshintergrund nutzten am wenigsten<br />
die Bildungs- und Betreuungsangebote<br />
für Kleinkinder. Danach lebt in Europa nahezu<br />
jedes sechste Kind unter sechs Jahren an<br />
44<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
der Armutsgrenze. In Estland, Italien,<br />
Litauen, Luxemburg, Polen und Portugal sei<br />
die Armutsentwicklung besonders Besorgnis<br />
erregend. In Großbritannien lebte sogar<br />
jedes fünfte Kleinkind in Armut.<br />
Die Studie untersucht die Strategien<br />
frühkindlicher Bildung in 30 Ländern Europas.<br />
Im EU-Raum besuchten 2006 demnach<br />
87 Prozent der Vierjährigen eine Vorschuleinrichtung.<br />
Ziel der EU-Kommission ist, den<br />
Anteil bis 2020 auf 90 Prozent zu steigern.<br />
Hochwertige Vorschulerziehung bringe erhebliche<br />
Vorteile für ein lebenslanges Lernen,<br />
heißt es in der Untersuchung. Zum Erfolg<br />
eines frühkindlichen Bildungsangebotes<br />
zählten ein gutes Betreuungsverhältnis, die<br />
angemessene Ausbildung des Bildungspersonals<br />
und die Beteiligung der Eltern.<br />
„Kulturweit“: Neuer<br />
Freiwilligendienst<br />
BERLIN. Das Auswärtige Amt hat 13. Februar<br />
den internationalen Freiwilligendienst<br />
„Kulturweit“ gestartet. Er basiert auf den<br />
Regeln des Freiwilligen Sozialen Jahres und<br />
gilt damit auch als Ersatz für den Wehrdienst.<br />
Im Rahmen des neuen Freiwilligendienstes<br />
können sich 18- bis 26-Jährige<br />
sechs oder zwölf Monate in der auswärtigen<br />
Kultur- und Bildungspolitik engagieren.<br />
Die Deutsche UNESCO-Kommission koordiniert<br />
die Durchführung von „Kulturweit“.<br />
Partner sind der Deutsche Akademische<br />
Austausch Dienst (DAAD), das Deutsche<br />
Archäologische Institut (DAI) das Goethe-<br />
Institut (GI) und der Pädagogische Austauschdienst<br />
(PAD). Die Partnerorganisationen<br />
bieten den Freiwilligen Einsatzstellen<br />
in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Mittelund<br />
Osteuropa mit vielfältigen Aufgaben<br />
an. Typische Einsatzfelder sind z. B.: Einsatz<br />
in einer deutschen Schule (Hausaufgabenbetreuung,<br />
Schultheater, Unterstützung<br />
des schulischen Angebotes) und Organisation<br />
von Projekten in einer Außenstelle<br />
des Deutschen Akademischen Austausch<br />
Diensts, des Goethe-Instituts oder des<br />
Deutschen Archäologischen Instituts.<br />
Durch den Dienst können junge Menschen<br />
an Kultur- und Bildungsarbeit im<br />
Ausland unmittelbar teilnehmen. Mit dem<br />
Freiwilligendienst will das Auswärtige Amt<br />
bürgerschaftliches Engagement, interkulturelle<br />
Kompetenz und Weltoffenheit der jungen<br />
Menschen fördern. Er unterstützt die<br />
Arbeit der deutschen Kulturmittler im Ausland.<br />
Die Freiwilligen erwerben im direkten<br />
Kontakt mit neuen Kulturen und Gesellschaften<br />
internationale Erfahrung für ihre<br />
persönliche und berufliche Entwicklung.<br />
Die Freiwilligen sind während ihres Einsatzes<br />
umfassend versichert: Auslandskranken-,<br />
Haftpflicht- und Unfallversicherung<br />
sowie Sozialversicherung in Deutschland<br />
werden übernommen. Die Freiwilligen<br />
erhalten finanzielle Unterstützung. Neben<br />
der Übernahme der oben genannten Versicherungskosten<br />
wird ein Zuschuss für<br />
Kost und Logis (ca. 200,- Euro/Monat),<br />
Taschengeld (ca. 150,- Euro/Monat) sowie<br />
ein einmaliger Zuschuss zum Flugticket<br />
gewährt. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich<br />
online auf www.kulturweit.de.<br />
Jugendforscher warnt<br />
vor Protestbewegungen<br />
OSNABRÜCK. Der Jugendforscher Klaus<br />
Hurrelmann warnt vor einer Rebellion Jugendlicher<br />
wegen des immensen Schuldenbergs,<br />
den der Bund derzeit anhäuft. Der<br />
„Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Hurrelmann<br />
am 11. Februar, die politische Protesthaltung<br />
schlage sich derzeit zwar noch in<br />
einem „resignativen Zurückziehen in privatere<br />
Bereiche“ nieder. „Aber ich würde<br />
durchaus die Prognose wagen, dass es in ein<br />
paar Jahren nicht mehr so still sein wird und<br />
dass dann ein Funke genügt, um Unzufriedenheit<br />
auszulösen“, mahnte er. Nachdrücklich<br />
sprach sich Hurrelmann für ein<br />
Schulfach „Finanzen“ aus: „Wir haben Schulen,<br />
in denen Wirtschaft,Technik und rechtliche<br />
Fragen kaum vorkommen.“ Es sei überhaupt<br />
nicht nachvollziehbar, dass diese<br />
Bereiche ausgeklammert würden. Man könne<br />
„mit Fug und Recht von einem ökonomischen<br />
Analphabetismus sprechen“.<br />
Jüdischer Religionsunterricht<br />
hat zentrale Rolle<br />
BERLIN. Der Historiker Michael Brenner hält<br />
jüdischen Religionsunterricht in der Schule<br />
für unersetzlich. Das Fach habe eine zentrale<br />
Rolle für den Fortbestand jüdischen<br />
Lebens in Deutschland, schreibt Brenner<br />
in der „Jüdischen Allgemeinen“ vom<br />
29. Januar. Der Religionsunterricht in der<br />
Schule sei für viele junge Juden die einzige<br />
Möglichkeit, Wissen über ihre Religion zu<br />
erhalten und ihre Identität zu stärken.<br />
Brenners Beitrag auf der Titelseite der<br />
Zeitung trägt die Überschrift „Pro Reli“.<br />
Toleranz im Umgang mit anderen setze<br />
„das Wissen um das Eigene“ voraus, betont<br />
Brenner. Die schulische Vermittlung grundlegenden<br />
Wissens über das jüdische Leben<br />
sei insbesondere wichtig in einer Situation,<br />
in der die meisten jüdischen Schüler Eltern<br />
hätten, die selbst solche Inhalte nicht<br />
weitergeben könnten. In Berlin steht ein
Volksentscheid über eine Gleichstellung<br />
des Religions- mit dem Ethikunterricht<br />
bevor. Kirchen und Jüdische Gemeinde wollen,<br />
dass die Schüler den konfessionellen<br />
Unterricht als Alternative zum staatlichen<br />
Ethikfach wählen können. Gegen starke<br />
Proteste hatte Berlins Regierender Bürgermeister<br />
Klaus Wowereit inzwischen die<br />
Abstimmung auf den 26. April gelegt. Die<br />
Mehrkosten für den Termin, der nun nicht<br />
an die Europawahl gekoppelt ist, werden<br />
auf 1,4 Millionen Euro beziffert. Die Bürgerinitiative<br />
„Pro Reli“ unter dem Vorsitz von<br />
Bbr. Dr. Christoph Lehmann (UNITAS Berlin)<br />
hatte für den gleichzeitigen Urnengang mit<br />
der Europawahl gesetzt, da die Wahlbeteiligung<br />
größer ist.<br />
Schutz des arbeitsfreien Sonntags:<br />
Europaabgeordnete bringen<br />
schriftliche Erklärung ein<br />
BRÜSSEL. Das Sekretariat der Bischofskonferenzen<br />
der Europäischen Gemeinschaft<br />
(COMECE), die Evangelische Kirche in<br />
Deutschland (EKD)<br />
und die Church of<br />
England begrüßten<br />
am 11. Februar <strong>2009</strong><br />
die Initiative einiger<br />
Mitglieder des Europäischen<br />
Parlaments, eine<br />
schriftliche Erklärung<br />
„zum Schutz des<br />
arbeitsfreien Sonntags als tragendem Element<br />
des europäischen Sozialmodells und<br />
Teil des europäischen Kulturerbes“ zur Entscheidung<br />
zu bringen. Diese wäre ein wichtiges<br />
Bekenntnis des Europäischen Parlaments<br />
zum Sozialen Europa, so die Stellungnahme.<br />
Nun komme es darauf an, die notwendige<br />
Mehrheit für diese überparteiliche<br />
Resolution zu finden, die am 2. Februar <strong>2009</strong><br />
von fünf Europaparlamentariern aus den<br />
politischen Gruppen der EVP, PSE, ALDE und<br />
UEN eingebracht worden ist. „Die Finanzund<br />
Wirtschaftskrise hat die Grenzen einer<br />
Ökonomisierung aller Lebensbereiche deutlich<br />
gemacht. Konsum ohne Maß entspricht<br />
weder dem Modell nachhaltigen Wirtschaftens<br />
noch ist er ein Leitbild für die menschliche<br />
Entwicklung“, heißt es in der gemeinsamen<br />
Stellungnahme. „Männer und<br />
Frauen, die sonntags arbeiten, sind in ihren<br />
sozialen Beziehungen benachteiligt. Ihr<br />
Familienleben, ihre persönliche Entfaltung,<br />
sogar ihre Gesundheit werden nachweislich<br />
beeinträchtigt.“ Als europäisches Kulturerbe<br />
mit langer Tradition und von hohem Wert<br />
sei der arbeitsfreie Sonntag für die Vereinbarkeit<br />
von Berufs- und Familienleben ein<br />
entscheidender Faktor. Für die familiären<br />
Beziehungen, aber auch für das soziale und<br />
kulturelle Leben sei es von bleibender Bedeutung,<br />
eine der wenigen Zeiten zu bewahren,<br />
die Kinder und Eltern gemeinsam<br />
verbringen können. In den vergangenen<br />
Jahren war der Schutz des Sonntags in zahlreichen<br />
Mitgliedstaaten mit dem bloßen<br />
Verweis auf Möglichkeiten der Konsumsteigerung<br />
weiter verringert worden. Um angenommen<br />
zu werden, muss die schriftliche<br />
Erklärung bis zum 7. Mai <strong>2009</strong> von der Mehrheit<br />
der Europaparlamentarier (d.h. von 394<br />
Abgeordneten) unterschrieben werden.<br />
UDE: Neues Exzellenznetzwerk<br />
bringt Service-Revolution im<br />
Internet<br />
DUISBURG / ESSEN. Guter Service spielt<br />
nicht nur im Restaurant, im Taxi oder beim<br />
Friseur eine große Rolle. Perfekte Dienstleistungen<br />
sind immer mehr auch im<br />
Internet gefragt. Hier können die Nutzer<br />
durch so genannte Software-Services beispielsweise<br />
Flüge buchen, online einkaufen<br />
oder Kontakte in sozialen Netzwerken pflegen.<br />
Bekannte Anbieter solcher Programme<br />
sind Google, YouTube, Expedia, Amazon,<br />
eBay und facebook. Was aber verbirgt sich<br />
dahinter? Wie können Anwender solche<br />
Dienste künftig noch besser nutzen und an<br />
ihre individuellen Bedürfnisse anpassen?<br />
Dieser Aufgabe widmet sich das europäische<br />
Exzellenznetzwerk S-Cube, das von der<br />
Arbeitsgruppe Software Systems Engineering<br />
(SSE) der Universität Duisburg-<br />
Essen koordiniert wird.<br />
Innerhalb von vier Jahren soll S-Cube<br />
die Grundpfeiler für eine multidisziplinäre<br />
Forschungsgemeinschaft legen, die die<br />
Software-Service-Entwicklung in Europa<br />
entscheidend vorantreibt, denn diese Forschung<br />
ist wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der EU. „Das heutige Angebot<br />
und die skizzierten Beispiele sind nur<br />
die Spitze des Eisbergs. Die Zahl sowie die<br />
Vielfalt der Dienstleistungen nehmen stetig<br />
zu. So wird sich die Bedeutung von Software-Services<br />
sowohl im privaten als auch<br />
im geschäftlichen Umfeld rasant weiterentwickeln.<br />
Die Art und Weise, wie wir das<br />
servicebasierte Internet der Zukunft nutzen,<br />
wird sich wesentlich verändern“, prognostiziert<br />
Projektkoordinator Prof. Dr.<br />
Klaus Pohl von der Arbeitsgruppe SSE. Innovative<br />
Software-Services entstehen zunehmend<br />
durch die Kombination unterschiedlicher<br />
Software-Bausteine und existierender<br />
Services. „Diese Herausforderungen<br />
können nicht von einer einzelnen Gruppe<br />
oder Forschungsdisziplin bewältigt werden.<br />
Sie erfordern die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
von Software Engineering,<br />
Geschäftsprozessmanagement, Service-<br />
Oriented Computing, Verteilte Systeme und<br />
Middleware“, unterstreicht Pohl. Ein wesentliches<br />
Element der Arbeiten im Exzellenznetzwerk<br />
S-Cube sei daher, Synergien<br />
zwischen unterschiedlichen Forschungsrichtungen<br />
zu nutzen.<br />
Erarbeitet werden neue Ansätze für<br />
selbstanpassbare Software-Services, moderne<br />
Techniken für die Qualitätssicherung<br />
sowie Methoden für die Erhebung und das<br />
Management von Anforderungen an innovative<br />
Services. Professor Pohls Team arbeitet<br />
hierzu mit mehr als 70 Forschern und<br />
über 50 Doktoranden aus 16 Forschungseinrichtungen<br />
in zehn europäischen Ländern<br />
zusammen. S-Cube wird von der Europäischen<br />
Kommission mit 8,5 Millionen<br />
Euro gefördert. Mehr: www.s-cube-network.eu;www.sse.uni-due.de.<br />
Frankreichs Universitätsrektoren<br />
kritisieren Vatikan-Abkommen<br />
PARIS. Die Rektoren der französischen<br />
Universitäten haben scharf gegen die mit<br />
Rom ausgehandelte Anerkennung von<br />
katholischen Bildungsabschlüssen protestiert.<br />
In einem offenen Brief an Staatspräsident<br />
Nicolas Sarkozy werten die<br />
Rektoren das Abkommen mit dem Vatikan<br />
als schweren Schlag gegen das französische<br />
Universitätssystem.<br />
Jede katholische Universitätseinrichtung<br />
in Frankreich sei eine „universitäre<br />
Fremdeinpflanzung“, die der direkten Unterweisung<br />
des Vatikan unterstehe, so die<br />
Rektoren. Die Anerkennung ihrer Abschlüsse<br />
sei inakzeptabel und provoziere Widerstand<br />
seitens der „Verteidiger der republikanischen<br />
Werte“. Damit lebe die Debatte<br />
über den Laizismus wieder auf.<br />
Ende Dezember hatten Frankreich und<br />
der Vatikan ein Abkommen zur gegenseitigen<br />
Anerkennung von Studienabschlüssen<br />
und Diplomen vereinbart. Darin erkennt<br />
der Heilige Stuhl im Rahmen des Bologna-<br />
Prozesses für ein einheitliches europäisches<br />
Hochschulwesen die von den staatlichen<br />
Behörden Frankreichs bestätigten akademischen<br />
Abschlüsse an. Frankreich wiederum<br />
bestätigt die Diplome der katholischen<br />
Universitäten, kirchlichen Fakultäten und<br />
entsprechenden höheren Lehranstalten.<br />
Gericht: Prager Veitsdom<br />
gehört dem Staat<br />
PRAG. Der berühmte Prager Veitsdom<br />
ist vom höchsten tschechischen Gericht<br />
endgültig dem Staat zugesprochen worden.<br />
Gegen das Urteil gebe es keine<br />
Rechtsmittel mehr. Der Streit darüber, ob<br />
das wichtigste böhmische Gotteshaus<br />
dem Staat oder der katholischen Kirche<br />
zusteht, dauert schon 16 Jahre. Der<br />
Prager Kardinal, Bbr. Miloslav Vlk, hatte<br />
in der Vergangenheit wiederholt erklärt,<br />
in dem Rechtsstreit nicht nachgeben zu<br />
wollen und angekündigt, notfalls den<br />
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof<br />
in Straßburg anzurufen.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 45
Schönstatt und die UNITAS<br />
DER UNITARIER JOSEF KENTENICH,<br />
GRÜNDER DER SCHÖNSTATTBEWEGUNG<br />
VON BBR. HARALD BRAUN<br />
In diesem Jahr feiert der Wissenschaftliche<br />
Katholische <strong>Studenten</strong>verein<br />
UNITAS Rolandia Münster ein<br />
besonderes Jubiläum: Im Sommer<br />
<strong>2009</strong> jährt sich die Gründung des<br />
Vereins zum 90. Mal. Aus dem Geist<br />
der Jugendbewegung und geprägt<br />
durch die Erlebnisse des Ersten<br />
Weltkrieges bildete sich am 17. Juli<br />
1919 in Münster ein neustudentisch<br />
ausgerichteter sechster UNITAS Verein<br />
mit den bewährten Prinzipien: virtus,<br />
scientia und amicitia.<br />
Doch was hat das mit Josef Kentenich,<br />
dem Gründer der Schönstattbewegung, zu<br />
tun? Die UNITAS Rolandia Münster kann im<br />
Jahr <strong>2009</strong> nicht nur ihr 90. Stiftungsfest<br />
feiern, sondern auch die neunzigjährige<br />
Mitgliedschaft ihres im Seligsprechungsprozess<br />
stehenden Bundesbruders: Josef<br />
Kentenich. Am Mittwoch, dem 3. Dezember<br />
1919, trat – so nachzulesen im „Schwarzen<br />
Brett der UNITAS“ – „Kentenig Josef, theol.,<br />
Vallendar, Schönstattstraße“ 1 als „Auswärtiger<br />
Inaktiver“ in die neu gegründete<br />
UNITAS Rolandia Münster ein.<br />
Wie kam es dazu? Was hat<br />
den Pallottinerpater Kentenich<br />
bewogen, mitten in der<br />
Gründungsphase Schönstatts<br />
einem katholischen <strong>Studenten</strong>verein<br />
beizutreten? Welche<br />
Umstände haben dazu geführt,<br />
dass Josef Kentenich in<br />
die UNITAS, einen studentischen<br />
„Lebensbund“, eintrat,<br />
dem er bis zu seinem Tod im<br />
Jahre 1968 als Mitglied treu<br />
blieb?<br />
Nachdem der UNITAS Verband<br />
die Mitgliedschaft<br />
Kentenichs in den letzten Jahren<br />
mehrfach in verschiedenen<br />
Beiträgen veröffentlicht<br />
hat 2 , werden im Folgenden die<br />
näheren Umstände beleuchtet,<br />
die zum Eintritt in die UNITAS Rolandia<br />
Münster geführt haben. Darüber hinaus<br />
wird ein Versuch unternommen, den Gründen<br />
für den Eintritt in die UNITAS „auf die<br />
Spur“ zu kommen.<br />
46<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Die Gründung der<br />
Schönstattbewegung<br />
Nachdem der Pallottinerstudent<br />
Josef Kentenich am 8. Juli 1910 zum<br />
Priester geweiht worden war, wurde er<br />
zunächst zum Lehrer der Nachwuchsschule<br />
der Pallottiner in Ehrenbreitstein<br />
ernannt. Nach Zusammenschluss der<br />
Schule mit dem Institut der unteren<br />
Klassen in Vallendar wurde Kentenich<br />
im Oktober 1912 zum Spiritual des<br />
Studienheims in Schönstatt (ein Ortsteil<br />
von Vallendar) berufen.<br />
Am 27. Oktober 1912 trug Josef Kentenich<br />
erstmals seine geistlichen Instruktionen<br />
den Schülern der beiden oberen<br />
Klassen vor. Dieser Vortrag wurde von<br />
ihm später als „Vorgründungsurkunde“ bezeichnet<br />
und stellt das früheste Dokument<br />
der beginnenden Schönstattgeschichte dar.<br />
„Wir wollen lernen, uns unter dem Schutze<br />
Mariens selbst zu erziehen zu festen, freien<br />
priesterlichen Charakteren.“ Das Ideal Kentenichs,<br />
vom „neuen Menschen in der<br />
neuen Gemeinschaft“ fand in den Worten<br />
der geistlichen Instruktionen seinen tiefen<br />
Ausdruck.<br />
Kentenich war bestrebt, für die Umsetzung<br />
seines Ideals „eine innere Organisation“<br />
zu schaffen, „wie sie bekanntlich an<br />
verschiedenen Gymnasien und Universitäten<br />
bestehen“. Im Jahre 1912/13 kam es<br />
Die Gründer der UNITAS Rolandia Münster<br />
im Wintersemester 1990/20<br />
zunächst zur Gründung eines Missionsvereins<br />
für die Oberklassen, dem im<br />
Sommer 1913 eine Abteilung für die mittleren<br />
Klassen folgte. Im Frühjahr 1914 entstand<br />
im Studienheim Schönstatts durch<br />
Genehmigung der Provinzleitung der Pallottiner<br />
und Approbation des Bischöflichen<br />
Ordinariats Trier eine Marianische Kongregation,<br />
die anfänglich nur den Schülern<br />
der oberen Klassen („Congregatio maior“),<br />
später auch den Schülern der mittleren<br />
Klassen („Congregatio minor“) offen stand.<br />
Im Juli 1914 überließ die Provinzleitung<br />
der jungen Marianischen Kongregation auf<br />
Bitten Kentenichs die im Tal gelegene ungenutzte<br />
„Michaels-Kapelle“ als Versammlungsort.<br />
1915 erhielten die Jugendlichen die<br />
Kopie eines Marienbildes des Tessiner<br />
Malers Luigi Crosio (1835 bis 1915), die fortan<br />
das zentrale Gestaltungselement der Kongregationskapelle<br />
bildete. In Anlehnung an<br />
die Marianische Kongregation des Jesuitenpaters<br />
Jakob Rem (1546 bis<br />
1618) wird Maria im so genannten<br />
„Kapellchen von Schönstatt“<br />
mit dem Titel der „Mater<br />
ter admirabilis“ („Dreimal Wunderbare<br />
Mutter“) angesprochen<br />
und verehrt. Wenige Wochen<br />
nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges<br />
versammelte Josef<br />
Kentenich am 18. Oktober 1914<br />
die Mitglieder (Sodalen) der<br />
Marianischen Kongregation im<br />
alten Michaelskapellchen, um<br />
die Kongregationsarbeit für das<br />
neue Schuljahr mit einem Vortrag<br />
zu eröffnen. In diesem<br />
Vortrag formulierte Kentenich<br />
das so genannte „Liebesbündnis“,<br />
ein Bündnis zwischen der<br />
Gottesmutter und dem beginnenden<br />
Schönstattwerk, repräsentiert<br />
in der Person des Gründers<br />
und in den Sodalen der Marianischen<br />
Kongregation. Das Ereignis des 18. Oktober<br />
1914 markiert die Gründung der Schönstattbewegung<br />
und wird daher auch als<br />
Gründungsurkunde bezeichnet. 3
Kentenichs Kontakt mit der<br />
UNITAS<br />
Bereits im Jahre 1917 kam Josef Kentenich<br />
durch den Versand der von ihm gegründeten<br />
Zeitschrift „Mater ter admirabilis“<br />
(MTA) an die im Feld stehenden Mitglieder<br />
der Marianischen Kongregation von<br />
Schönstatt mit der UNITAS in Berührung. 4<br />
Der Unitarier Prof. Dr. Josef Kuckhoff MdR<br />
gab eine Feldgabe 5 von Mitgliedern des<br />
UNITAS-Verbandes heraus und verschickte<br />
diese – ebenso wie Kentenich – in mehreren<br />
tausend Exemplaren an die an der Front<br />
stehenden <strong>Studenten</strong>.<br />
Ebenfalls 1917 (im Januar) hatte Kentenich<br />
in Düsseldorf anlässlich einer vom<br />
Generalpräses der Katholischen Jungmännervereine<br />
einberufenen wissenschaftlichen<br />
Tagung über Jugendführung, an der<br />
zahlreiche Jugendseelsorger aus ganz<br />
Deutschland teilnahmen, engeren Kontakt<br />
mit Bbr. Prof. Dr. Josef Mausbach MdR 6 .<br />
Mausbach war einer der Referenten der<br />
Tagung. Kentenich und Mausbach waren<br />
sich einig, dass in die <strong>Studenten</strong>arbeit auch<br />
die Akademikerinnen einbezogen werden<br />
müssten.<br />
Den entscheidenden Anstoß zum Eintritt<br />
Josef Kentenichs in die UNITAS gab<br />
dann allerdings offenbar ein junger Schönstätter:<br />
Alois Zeppenfeld.<br />
Alois Zeppenfeld –<br />
Schönstätter und Unitarier<br />
Kontakt mit Schönstatt<br />
über die Außenorganisation<br />
Alois Zeppenfeld wurde am 1. Dezember<br />
1896 in Dortmund-Hörde geboren. Er lernte<br />
die Marianische Kongregation im Winter<br />
1916/17 an der Front durch einen Schönstätter<br />
Sodalen kennen, schloss sich ihr in<br />
der so genannten „Congregatio militaris“,<br />
der „Außenorganisation“ an und wurde<br />
einer ihrer Abteilungsführer (sog. „Turma<br />
Zeppenfeld“). 7 Zeppenfeld legte am 8. Dezember<br />
1917 seine Weihe an die Mater ter<br />
admirabilis ab und trat hiermit formell der<br />
Marianischen Kongregation bei. Als Leutnant<br />
d. R. kehrte der ehemalige Kompanieführer<br />
– ausgezeichnet mit dem Eisernen<br />
Kreuz I – im November 1918 aus dem<br />
Krieg zurück. Noch auf dem Rückmarsch<br />
mit seiner Kompanie bat er Josef Kentenich<br />
in einem Brief um Exerzitien in Schönstatt<br />
für Anfang Januar 1919. Kentenich kam der<br />
Bitte Zeppenfelds zunächst nicht nach; er<br />
antwortete ihm: „Zu meinem Bedauern<br />
kann ich vorerst nur versprechen, dass wir<br />
die Mater ter admirabilis nicht eingehen<br />
lassen. Die anderen angeschnittenen Fragen<br />
sind noch nicht spruchreif.“ 8 Die Absage<br />
Kentenichs hemmte jedoch nicht den<br />
Tatendrang Zeppenfelds, die Außenorganisation<br />
auch nach den Kriegsjahren weiter<br />
fortleben zu lassen. Er ließ nicht locker und<br />
unternahm im Frühjahr 1919 einen erneuten<br />
Anlauf, Kentenich für eine Begleitung<br />
der Außenorganisation zu gewinnen. Diesmal<br />
hatte er mehr Erfolg. Kentenich kam<br />
dem Drängen der Auswärtigen nach und<br />
gab im April 1919 sein Einverständnis zu<br />
Bildung neuer Gruppen.<br />
Der junge Josef Kentenich<br />
Umgehend nahm Zeppenfeld – wie<br />
schon so oft – das Heft in die Hand und<br />
schrieb mehrere Aufrufe an die ehemaligen<br />
Abteilungsmitglieder der Außenorganisation.<br />
Was dann folgte, waren die<br />
Vorbereitungen für einen Sodalentag, der<br />
in Absprache mit Josef Kentenich am 19.<br />
und 20. August 1919 in Dortmund-Hörde<br />
stattfinden sollte. 9 Innerhalb kürzester Zeit<br />
entwickelte sich so zwischen Alois Zeppenfeld<br />
und Kentenich ein intensiver Kontakt,<br />
der in der Gründung des Apostolischen<br />
Bundes seinen Fortgang fand.<br />
Gründungsmitglied<br />
des Apostolischen Bundes<br />
Alois Zeppenfeld war unter den Gründungsmitgliedern<br />
des Apostolischen Bundes<br />
zweifellos die treibende Kraft. Aufgrund<br />
seiner umtriebigen Persönlichkeit,<br />
seines Organisationstalents, seiner – teils<br />
forschen und burschikosen – Art, die Dinge<br />
beim Namen zu nennen, aber insbesondere<br />
aufgrund seiner Liebe und Treue zur Mater<br />
ter admirabilis, war er das ideale<br />
„Zugpferd“, um die Hörder-Sodalentagung<br />
zu organisieren, durchzuführen und nachzubereiten.<br />
Die nachfolgenden Ausschnitte<br />
aus dem Wirken Zeppenfelds können dies<br />
verdeutlichen:<br />
Am 7. August 1919 traf sich Alois Zeppenfeld<br />
zur Vorbereitung der Hörder-Tagung<br />
mit anderen Teilnehmern der<br />
bevorstehenden Versammlung. Einer<br />
der Teilnehmer, Willi Girke, beschreibt<br />
Zeppenfeld in einem Brief vom 8.<br />
August 1919 an Albert Eise, den Präfekten<br />
der Marianischen Kongregation,<br />
als prächtigen Menschen, urgemütlich<br />
und von scharfem Verstand<br />
und klarem Urteil 10 .<br />
Pater Heinrich Schulte, ehemaliger<br />
Präfekt der Marianischen Kongregation<br />
und Teilnehmer der Hörder<br />
Tagung, schreibt in einem Bericht vom<br />
11. März 1957 über den Sodalentag: „Es<br />
ist nun das unbestreitbare Verdienst<br />
von Alois Zeppenfeld, dass er die ganze<br />
Sache in Bewegung brachte. Für ein<br />
paar Jahre war er es wohl, der am<br />
stärksten für Leben und Bewegung in<br />
der neu entstehenden Organisation<br />
sorgte. Er schrieb Briefe über Briefe,<br />
drängte und protestierte, bis P. Kentenich<br />
schließlich aus seiner Zurückhaltung<br />
heraustrat und das Zeichen<br />
gab zum Beginn der Arbeit. [...] Alois<br />
Zeppenfeld übernahm es, in seiner<br />
Heimatstadt Dortmund-Hörde diese<br />
Tagung vorzubereiten. [...]<br />
Alois Zeppenfeld hatte gut gesorgt.<br />
Jeder wurde in einer gut katholischen<br />
Familie untergebracht, die<br />
zudem auf jede Vergütung verzichtete.<br />
Alois hatte ihnen in seiner forschen<br />
Art schon beigebracht, welch ein großes<br />
Werk es sei, an dem sie dadurch mithelfen<br />
dürften.“ 11<br />
Schulte berichtet weiter in seinen<br />
Erinnerungen 12 , dass Alois Zeppenfeld am<br />
Abend des 19. August 1919 die Begrüßungsansprache<br />
im Kolpinghaus gehalten und<br />
dabei die anwesenden Schönstätter<br />
freundschaftlich als „Trottel“ und „Schafsnasen“<br />
beschimpft habe, da sie die Auswärtigen<br />
nach dem Krieg im Stich gelassen<br />
hätten. Schulte erinnert sich weiter,<br />
Zeppenfeld habe für die hl. Messe am<br />
Morgen des 20. August 1919 einen Franziskanerpater<br />
gewinnen können; die Leitung<br />
der sich daran anschließenden Tagung<br />
habe wieder in den Händen Alois Zeppenfelds<br />
gelegen. Auch Willi Waldbröl, ein<br />
anderer Tagungsteilnehmer, beschreibt –<br />
schon in direkter Zeitnähe des Geschehens<br />
am 1. September 1919 – in seinem Brief an<br />
Albert Eise die Ereignisse der Hörder-Tagung<br />
und hebt dabei die Initiative<br />
Zeppenfelds hervor. 13 >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 47
Nach dieser Versammlung bat Kentenich<br />
den Initiator Alois Zeppenfeld, nach<br />
Schönstatt zu kommen, um den Statutenentwurf<br />
des Apostolischen Bundes durchzusprechen.<br />
In der Zeitschrift „MTA“ veröffentlichte<br />
Zeppenfeld im<br />
November 1919 einen<br />
Abteilungsbrief, darin<br />
enthalten den Statutenentwurf<br />
des Apostolischen<br />
Bundes, wie er<br />
inzwischen mit Kentenich<br />
abgesprochen war.<br />
Der Abteilungsbrief<br />
schließt mit folgenden<br />
Worten: „Für heute soll’s<br />
genug sein. Caritas<br />
Christi urget nos! Das ist<br />
fortan unser Kampfesruf.<br />
[...] Diese Liebe wird<br />
von jetzt an der lebendige<br />
Pulsschlag unseres<br />
Herzens, die treibende<br />
Kraft, ‚allen alles zu werden,<br />
um alle selig zu<br />
machen’. [...] Gott befohlen!“<br />
14 Zeppenfeld hatte intensiv die geistliche<br />
Ausrichtung durch Josef Kentenich<br />
aufgenommen.<br />
Mitglied der UNITAS<br />
Rolandia Münster<br />
Nach den großen Ferien legte Alois<br />
Zeppenfeld auf dem Staatlichen Gymnasium<br />
in Dortmund die Reifeprüfung 15 ab<br />
und begann im Herbst 1919 sein Theologiestudium<br />
in Münster. 16 Besondere Aktivitäten<br />
entfaltete dort die UNITAS in der<br />
Nachkriegsphase des Ersten Weltkrieges:<br />
Sechs aktive UNITAS Vereine sorgten für ein<br />
florierendes unitarisches Leben und keilten<br />
die katholischen Neustudenten für einen<br />
Beitritt in ihren Verein. Darüber hinaus galt<br />
unter den <strong>Studenten</strong>verbindungen Münsters<br />
die UNITAS in der Hochschulpolitik als<br />
besonders aktiv. 17<br />
Zeppenfeld muss in Münster schnell<br />
mit der UNITAS in Kontakt gekommen sein,<br />
denn er trat bereits am 13. Oktober 1919 in<br />
die UNITAS Rolandia ein. 18 In einem Vereinsbericht<br />
der Rolandia von November 1919<br />
heißt es: „Trotz aller Schwierigkeiten [...]<br />
gelang es uns doch, fünf neue Mitglieder zu<br />
erwerben, die zum Teil nur durch unser<br />
Programm angezogen waren, die Herren:<br />
[...] theol. Zeppenfeld [...].“ 19<br />
Die UNITAS Rolandia war als sechster<br />
UNITAS-Verein in Münster (M6) am 17. Juli<br />
1919 als so genannte „neustudentische“<br />
Korporation gegründet worden. Im UNITAS<br />
Handbuch heißt es dazu: „Nach dem Krieg<br />
strömten dem UNITAS-Verband vor allem<br />
<strong>Studenten</strong> zu, die für die alten Formen des<br />
studentischen Lebens wenig Sinn hatten.<br />
Geprägt vom Geist der Jugendbewegung,<br />
wollten diese aus dem Kriegsinferno zu-<br />
48<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
rückgekehrten <strong>Studenten</strong> die Prinzipien der<br />
UNITAS bewusst nach der Form der Gründer<br />
leben. Angesprochen von den Gedanken<br />
einer gemeinsamen Eucharistie, dem<br />
betont wissenschaftlichen Streben und der<br />
Verpflichtung zu sozialem<br />
Engagement in<br />
der UNITAS lehnten sie<br />
alle Formen altstudentischen<br />
Lebens ab.“ 20<br />
Ein Vereinsbericht<br />
der UNITAS Rolandia<br />
führt im August 1919<br />
dazu aus: „Leben und<br />
Freude wurzeln in<br />
Gott; deshalb suchen<br />
die Rolanden bewusst<br />
die Gottesnähe, und<br />
das findet Ausdruck in<br />
monatlicher Kommunion<br />
und auch in häufigeren<br />
Vorträgen und<br />
Besprechungen religiöser<br />
Art, um so den tiefen<br />
Gehalt unseres<br />
katholischen Glaubens ganz zu erfassen.<br />
Die Rolanden sind Unitarier ohne Kneipe<br />
und Komment, aber nicht ohne Fröhlichkeit.“<br />
21<br />
Im Januar 1920 wurde Alois Zeppenfeld<br />
– zusammen mit sechs anderen Unitariern –<br />
„nach erfolgreichem Examen und auf Grund<br />
ihrer ganzen Persönlichkeit die Burschenrechte<br />
verliehen.“ 22 Dabei zeigte sich Zeppenfels<br />
Engagement – wie bei der Gründung<br />
des Apostolischen Bundes – auch in<br />
der UNITAS. In mehreren Wissenschaftlichen<br />
Sitzungen und Vorträgen referierte er<br />
zu folgenden Themen: „Kirche und Gebildete“,<br />
„Wissenswertes für den Volksbildner“,<br />
„Innenpolitik des Vereins“<br />
und „Die Arbeiterbewegung,<br />
vorwärts – rückwärts“. Auch die<br />
Übernahme unitarischer Ämter<br />
war für Zeppenfeld selbstverständlich:<br />
Im Jahre 1920 wurde<br />
er Vorsitzender der Münsteraner<br />
UNITAS-Vereine, deren Vorsitz<br />
die Rolandia in diesem Jahr<br />
innehatte. Im WS 1920/21<br />
wurde Zeppenfeld zum Senior<br />
der UNITAS Rolandia Münster<br />
gewählt. Im Sommer 1921 setzte<br />
er sein Theologiestudium in<br />
Paderborn fort und schloss sich<br />
der ebenfalls neustudentisch<br />
ausgerichteten UNITAS Angrivaria<br />
an, der er als Generaldispensierter<br />
bis zum Jahre<br />
1924 angehörte.<br />
Alois Zeppenfeld wurde am<br />
10. August 1924 in Paderborn<br />
zum Priester geweiht und<br />
starb am 12. September 1954 in<br />
Bochum. Sein Grab befindet<br />
sich auf dem Propstei-Friedhof<br />
in Wattenscheid.<br />
Die Mitgliedschaft<br />
Josef Kentenichs<br />
Nachweise in den unitarischen<br />
Verzeichnissen<br />
Die Mitgliedschaft Josef Kentenichs ist<br />
in den Verzeichnissen der UNITAS mehrmals<br />
dokumentiert. Diese namentlichen<br />
Nennungen sollen zunächst kurz wiedergegeben<br />
werden, bevor wir uns den damit<br />
verbundenen inhaltlichen Fragen zuwenden:<br />
Erstmalig erwähnt das „Schwarze<br />
Brett der UNITAS“ im Dezember 1919 seinen<br />
Eintritt in die UNITAS Rolandia Münster. In<br />
einem Vereinsbericht heißt es: „Sechs neue<br />
Mitglieder sprangen ein, die Herren: […], P.<br />
Kentenig, […].“ 23<br />
Der hier anfänglich eingeführte<br />
Schreibfehler wird bis März 1920 in den namentlichen<br />
Nennungen Kentenichs weitergeführt<br />
und dann korrigiert. Im Januar<br />
1920 wird Kentenich in den Vereinslisten<br />
der UNITAS-Vereine als „Auswärtiger Inaktiver“<br />
benannt. Dort ist nachzulesen:<br />
„Vereinslisten. (Vor Weihnachten.)<br />
I. Füchse.<br />
II. Aktive Burschen.<br />
III. Hospitanten.<br />
IV. Ortsanwesende Inaktive.<br />
V. Ortsanwesende Generaldispensierte.<br />
VI. Ortsanwesende Extralozierte.<br />
VII. Auswärtige Inaktive.<br />
UNITAS Rolandia I. […]. II. […]. VII. […],<br />
Kentenig, […].“ 24<br />
Dasselbe Verzeichnis listet ihn in einer<br />
Studierendenübersicht als rezipiertes Mitglied<br />
der UNITAS auf und benennt dabei<br />
den 3. Dezember 1919 als genaues Auf-<br />
P. Kentenich in Audienz bei Papst Paul VI.
nahmedatum: „Studierende. Kentenig Josef<br />
°theol.° Vallendar, Schönstattstraße (3.12.19)<br />
M6.“ 25 Im März 1920 ist Josef Kentenich<br />
wieder in der Vereinsliste der UNITAS<br />
Rolandia als „Auswärtiger Inaktiver“ aufgeführt<br />
– diesmal mit korrekter Schreibweise<br />
„Kentenich“. 26<br />
Neben den damaligen unitarischen<br />
Publikationen ist die Mitgliedschaft Josef<br />
Kentenichs auch in den Gesamtverzeichnissen<br />
des UNITAS-Verbandes nachzulesen.<br />
Im Gesamtverzeichnis des Jahres 1925 wird<br />
er wie folgt benannt: „M6 * Kentenich Jos. °<br />
Pater, P.S.M. ° Vallendar (Rhein), Schönstatt<br />
(H 19).“ 27 Für die Jahre 1927 28 und 1930 29 findet<br />
sich in den Gesamtverzeichnissen des<br />
UNITAS Verbandes der identische Wortlaut.<br />
Letztmalig findet Josef Kentenich im<br />
Gesamtverzeichnis der UNITAS im Jahre<br />
1968 Berücksichtigung. Darin heißt es:<br />
„Kentenich, Josef – Pater SAC – 5424 W.<br />
Bluemound Road, Milwaukee 8 Wisc. / USA<br />
(H 19) M6“ 30 .<br />
Hintergründe zum Eintritt<br />
Josef Kentenichs in die UNITAS<br />
Die genauen Umstände,<br />
die zur Mitgliedschaft<br />
Kentenichs in der<br />
UNITAS Rolandia Münster<br />
geführt haben, liegen<br />
in Ermangelung entsprechender<br />
Zeitdokumente<br />
(noch) im Dunkeln. 31<br />
Im Herbstsemester<br />
des Jahres 1919 wurden<br />
in die UNITAS Rolandia<br />
insgesamt acht neue<br />
Bundesbrüder aufgenommen.<br />
Fünf davon<br />
waren Theologiestudenten, einer Priester<br />
(Josef Kentenich) und zwei <strong>Studenten</strong> der<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.<br />
Nach den Verzeichnissen der UNITAS wurde<br />
Kentenich am Mittwoch, den 3. Dezember<br />
1919, in die UNITAS Rolandia Münster rezipiert.<br />
Ausweislich der damaligen Studierendenverzeichnisse<br />
fanden alle anderen<br />
Aufnahmen in die Rolandia an einem<br />
Montag statt: Drei Bundesbrüder wurden<br />
am 13. Oktober 1919 rezipiert, ein Bundesbruder<br />
wurde am 20. Oktober 1919 in die<br />
Rolandia aufgenommen; einen Monat später<br />
wurde am 10. November 1919 ein<br />
Bundesbruder und am 24. November 1919<br />
zwei weitere Bundesbrüder Mitglied dieses<br />
UNITAS-Vereins. Es ist davon auszugehen,<br />
dass die Rolandia immer an Montagen eine<br />
Veranstaltung hatte (Konvent, Wissenschaftliche<br />
Sitzung etc.) und die Bewerber<br />
in diesem Rahmen feierlich in den Verein<br />
aufgenommen wurden.<br />
Josef Kentenichs Aufnahme ist aufgrund<br />
des Eintrittsdatums auffällig: Er ist<br />
der einzige „Rolande“, der in dieser Zeit<br />
„mittwochs“ dem UNITAS-Verein beigetreten<br />
ist. Über die Gründe hierfür kann nur<br />
spekuliert werden: Möglich, dass die Mitgliedschaft<br />
nicht langfristig geplant war<br />
und eventuell ad hoc während Kentenichs<br />
Aufenthalt in Münster entschieden wurde;<br />
möglich auch, dass er für eine Teilnahme an<br />
den turnusmäßigen Montagen verhindert<br />
war und deshalb der Mittwoch gewählt<br />
wurde. Sicher ist lediglich, dass sich Josef<br />
Kentenich am Mittwoch, den 3. Dezember<br />
1919 in Münster aufgehalten hat und an<br />
diesem Tag der UNITAS Rolandia beigetreten<br />
ist.<br />
Da keine weiteren<br />
Quellen über einen Aufenthalt<br />
Josef Kentenichs<br />
für Anfang Dezember<br />
1919 in Münster vorliegen,<br />
bleibt die Frage, ob<br />
Kentenich womöglich in<br />
Abwesenheit der Rolandia<br />
beigetreten sein<br />
könnte? Dazu ist Folgendes<br />
zu sagen: Nach<br />
dem Aufnahmeritus der<br />
UNITAS ist ein persönliches<br />
Erscheinen des<br />
Neumitglieds bei der<br />
Rezipierung zwingend erforderlich. Die<br />
Verpflichtung auf die Prinzipien der UNITAS<br />
und die Bereitschaft, diese zu achten und<br />
die Rechte und Pflichten als Unitarier zu<br />
wahren, stellen einen Akt dar, der nicht in<br />
Abwesenheit vollzogen werden kann. Insofern<br />
kann eine Aufnahme Kentenichs in<br />
Abwesenheit ausgeschlossen werden.<br />
Die Aufnahme als „Auswärtiger Inaktiver“<br />
trug der Tatsache Rechnung, dass<br />
Kentenich nicht in Münster gewohnt, sondern<br />
zu dieser Zeit in Vallendar seinen<br />
Wohnsitz hatte. Aufgrund dieses Umstandes<br />
kam zum damaligen Zeitpunkt nur<br />
eine Aufnahme mit dem Status eines<br />
„Auswärtigen Inaktiven“ in Frage. 32 Mit<br />
Josef Kentenich teilten noch acht weitere<br />
Bundesbrüder der UNITAS Rolandia den<br />
Status eines „Auswärtigen Inaktiven“.<br />
Josef Kentenich war zum Zeitpunkt seiner<br />
Aufnahme in die UNITAS Rolandia<br />
Münster 34 Jahre alt und bereits neun Jahr<br />
Priester. Wie kam es dazu, dass er als „Akademiker“,<br />
d. h. nach Beendigung des Stu-<br />
diums, in die UNITAS eingetreten ist? Nach<br />
der Neugründung der Rolandia am 17. Juli<br />
1919 war der junge Verein auf den Eintritt<br />
von <strong>Studenten</strong> angewiesen. Nur so war ein<br />
aktives Vereinsleben möglich; umso mehr,<br />
als die Rolandia neustudentisch ausgerichtet<br />
war und per se um Neumitglieder intensiver<br />
werben musste als andere UNITAS<br />
Vereine. Darüber hinaus fehlte es der<br />
Rolandia kurz nach der Gründung zunächst<br />
an Alten Herren, die im Zusammenschluss<br />
eines Altherrenvereins die Aktivitas – auch<br />
finanziell – unterstützen konnten. Die Aufnahme<br />
von Priestern unterschied sich dahingehend,<br />
als dass diese (bis zum heutigen<br />
Tag) keinen Vereinsbeitrag zu entrichten<br />
hatten. Deren Unterstützung war somit<br />
mehr von „geistlicher Natur“. Die Aufnahme<br />
des „Priesters Josef Kentenichs“ in<br />
die UNITAS diente – von Seiten des Vereines<br />
her – diesem Ziel einer ideellen Unterstützung<br />
und reihte sich ein in die<br />
Aufnahme zahlreicher anderer Priester und<br />
Ordensleute. Hinzu kam, dass der UNITAS-<br />
Verband am Anfang des letzten Jahrhunderts<br />
noch stark an den Theologie Studierenden<br />
ausgerichtet war; lag doch die<br />
Öffnung des ehemaligen „Theologenverbandes“<br />
für andere Fakultäten erst 32<br />
Jahre zurück.<br />
Zu den Beweggründen<br />
Josef Kentenichs<br />
Um es vorweg zu nehmen: Die Motive<br />
Josef Kentenichs, mitten in der Gründungsphase<br />
Schönstatts in einen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>verein und damit in einen<br />
„Lebensbund“ einzutreten, lassen sich nur<br />
vermuten. Dennoch kann aus dem damaligen<br />
Lebensgefüge Kentenichs heraus ein<br />
Versuch unternommen werden, den Gründen<br />
„auf die Spur“ zu kommen.<br />
Die „erste Spur“ ist zweifellos bei der<br />
persönlichen Situation Kentenichs selbst zu<br />
suchen: Nachdem er am 18. Juli 1919 von der<br />
Aufgabe als Spiritual freigestellt worden<br />
war, konnte er sich – soweit dies sein angeschlagener<br />
Gesundheitszustand hergab –<br />
den neuen Aufgaben zur „Gründung eines<br />
apostolischen <strong>Studenten</strong>-, Lehrer- und Akademikerbundes“<br />
widmen. In einem Brief<br />
Anfang August 1919 schreibt Kentenich an<br />
Josef Fischer:„Da nun meine Hauptkraft der<br />
Seelsorge auswärtiger <strong>Studenten</strong> gehört,<br />
bin ich gerne bereit, Ihre persönlichen<br />
Fragen zu beantworten, [...].“ 33 Zweifellos<br />
galt seine „Seelsorge auswärtiger <strong>Studenten</strong>“<br />
auch der Person, die eine zentrale Rolle<br />
im Gründungsgeschehen des Apostolischen<br />
Bundes hatte: Alois Zeppenfeld.<br />
Wie bereits erwähnt, wurde Zeppenfeld<br />
unmittelbar nach Aufnahme seines Theologiestudiums<br />
Unitarier bei der Rolandia.<br />
Kentenich stand seit längerem mit ihm in<br />
Kontakt und war dem Mitbegründer des<br />
Apostolischen Bundes mehr als wohlgeson- >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 49
Eine kleine Marienkapelle, ein großer <strong>Wallfahrt</strong>sort<br />
in Vallendar bei Koblenz am Rhein und<br />
eine weltweite apostolische Bewegung –<br />
das ist Schönstatt. Gründer der Bewegung,<br />
die hier ihren Ursprungsort hat, ist Pater Josef<br />
Kentenich. Zusammen mit Jugendlichen der<br />
Marianischen Kongregation schloss er 1914 in<br />
dieser Kapelle ein Liebesbündnis mit Maria.<br />
nen. Alois Zeppenfeld war zu dieser Zeit<br />
die treibende Kraft und Dreh- und Angelpunkt<br />
des Apostolischen Bundes. Die<br />
„Seelsorge auswärtiger <strong>Studenten</strong>“, wie<br />
Kentenich es formulierte, konnte so ihren<br />
Niederschlag auch bei dem Theologiestudenten<br />
Zeppenfeld finden. Zeppenfeld<br />
war ein engagierter Unitarier. Es liegt nahe<br />
zu vermuten, dass er es war, der Kentenich<br />
im Umfeld einer seelsorgerlichen Reise<br />
nach Münster den Beitritt zur Rolandia<br />
nahe gebracht hat.<br />
Hinzu kam die Affinität Kentenichs zu<br />
wesentlichen Elementen des UNITAS-Verbandes.<br />
Im Unterschied von anderen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>verbänden war die UNI-<br />
TAS durch ihre marianische und stark kirchlich<br />
gesinnte Ausrichtung mit „Maria Immaculata“<br />
als Patronin besonders für Theologen<br />
attraktiv. Hinzu kam der zweite Patron<br />
Heiligabend 1965: Bbr. P. Kentenich feiert die Messe<br />
im Urheiligtum<br />
50<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
der UNITAS: Thomas von Aquin, mit dem<br />
Kentenich durch sein neuscholastisches<br />
Studium gut vertraut war und dessen Verhältnisbestimmung<br />
von Gott und Welt wesentlich<br />
die theologische Sicht der „Zweitursachen“<br />
34 prägte, wie sie für die Schönstatt-Bewegung<br />
typisch werden sollte.<br />
Neben dieser spirituell-theologischen<br />
Prägung der UNITAS können als Elemente<br />
einer möglichen Identifikation Kentenichs<br />
mit der UNITAS auch deren „Internationalität“<br />
und das „soziale Engagement“ benannt<br />
werden. Die deutsche Nationalität<br />
war und ist bis heute keine Voraussetzung<br />
für die Aufnahme in einen UNITAS-Verein;<br />
frühe unitarische Tradition war es hingegen,<br />
caritativ tätig zu sein und für soziale<br />
Gerechtigkeit einzustehen. Dementsprechend<br />
hat die UNITAS stets Standesdünkel<br />
abgelehnt und war immer offen für jeden<br />
katholischen <strong>Studenten</strong>, unabhängig von<br />
seiner finanziellen Lage und gesellschaftlichen<br />
Herkunft. 35 Die Herkunft Kentenichs<br />
aus einfachsten sozialen Verhältnissen<br />
stellte hier ebenfalls kein Hindernis dar.<br />
Gerade die neustudentische Ausrichtung<br />
des Münsteraner UNITAS-Vereins<br />
Rolandia spielt hier womöglich auch eine<br />
Rolle: sowohl für Zeppenfelds Eintritt als<br />
auch für den Josef Kentenichs. Hier fanden<br />
sich vornehmlich Männer, die – oftmals<br />
gerade aus dem Krieg zurückgekehrt –<br />
keinerlei Ambitionen zu militärischen<br />
Gesten in Kleidung und Sitte hatten (dies in<br />
deutlicher Absetzung von anderen unitarischen<br />
Vereinen und anderen <strong>Studenten</strong>verbänden)<br />
und froh waren, dem Wahnsinn<br />
des Ersten Weltkrieges lebend entkommen<br />
zu sein. Einer wie auch immer gearteten<br />
Militarisierung von Politik und Gesellschaft<br />
stand man hier äußerst kritisch gegenüber.<br />
Europa aus dem Geist Jesu Christi und in<br />
voller Identifikation mit der katholischen<br />
Kirche zu prägen, war Motivation des Zusammenschlusses<br />
in den neustudentischen<br />
Vereinen in diesen frühen Nachkriegsjahren.<br />
Neben den hier benannten unitarischen<br />
„Spuren“ dürften weitere Anknüpfungspunkte<br />
für die Mitgliedschaft<br />
Josef Kentenichs<br />
in der UNITAS auch in der bewussten<br />
Fühlungnahme des<br />
Gründers mit zahlreichen<br />
katholischen Strömungen<br />
des deutschen Katholizismus<br />
nach dem Ersten Weltkrieg<br />
zu suchen sein. In der<br />
Gründungsphase Schönstatts<br />
stellten sich die Fragen:<br />
„Wo können wir Fuß<br />
fassen und wo können wir<br />
Kontakt aufnehmen zu anderen<br />
katholischen Organisationen?“<br />
Kentenichs Teilnahme<br />
an der Jugendführertagung<br />
im Januar 1917<br />
Das Gnadenbild im Urheiligtum von Schönstatt:<br />
Maria, die „Dreimal Wunderbare<br />
Mutter“<br />
in Düsseldorf und seine dortige Begegnung<br />
mit Bbr. Mausbach gehört in diesen Zusammenhang.<br />
Solche Begegnungen boten für Kentenich<br />
zum einen die Möglichkeit, die eigene<br />
Zielsetzung präziser in den Blick zu bekommen,<br />
zum anderen trieb ihn – wie viele der<br />
jungen Schönstätter – der Eifer, die frühen<br />
Erfahrungen der eigenen Bewegung in weitere<br />
Kreise hineinzutragen. Da <strong>Studenten</strong><br />
und Akademiker von Anfang an im Fokus<br />
Josef Kentenichs standen, und „Schönstatt<br />
als katholische Lebensbewegung [...] als ‚universell’<br />
gedacht und konzipiert“ 36 worden<br />
war, lag es nahe, den „Schönstätter Geist“<br />
mit geistesverwandten studentischen Bewegungen<br />
zu kommunizieren. Im Jahre 1956<br />
schreibt Kentenich selbst über jene Zeit:„[…];<br />
der Blick auf Menschen und Verhältnisse<br />
hielt Ausschau nach greifbaren Anknüpfungspunkten,<br />
nach Hilfen und Werkzeugen,<br />
die jeweils und zur rechten Zeit und am<br />
rechten Platz eingesetzt werden sollten,<br />
[…].“ 37 Sicher gilt dies auch im Hinblick auf<br />
Kentenichs Kontakt zur UNITAS.<br />
Die von Vinzenz Pallotti, dem Gründer<br />
der Pallottiner, übernommene „Grundidee<br />
einer föderativen Zusammenarbeit aller<br />
apostolischen Kräfte der Kirche“ zur Gründung<br />
eines „Weltapostolatsverbandes“, der<br />
nicht nur für kirchliche Gemeinschaften,<br />
sondern „auch für Vereine offen“ sein sollte<br />
38 , mag ebenfalls den Schritt des Eintrittes<br />
in einen unitarischen Verein befördert<br />
haben. Dass es dann gerade die UNI-<br />
TAS Rolandia traf, dürfte – wie oben erwähnt<br />
– der freundschaftlichen und seelsorgerlichen<br />
Nähe von Josef Kentenich zu<br />
Alois Zeppenfeld geschuldet sein.
Pallottiner und<br />
Schönstätter in der UNITAS<br />
Josef Kentenich war nicht der einzige<br />
Pallottiner bzw. Schönstätter in der UNITAS.<br />
Immer wieder fanden Mitglieder dieser<br />
Gemeinschaften Zugang zu unitarischen<br />
Vereinen. Nur einige seien hier erwähnt:<br />
Bereits im Wintersemester 1916 trat als<br />
Pallottinerstudent der spätere Spiritual in<br />
Vallendar, Pater Johannes Valerius SAC, in<br />
Frankfurt der UNITAS bei. Im WS 1918/19<br />
wurde Pater Eugen Weber SAC, später<br />
Bbr. P. Kentenich mit dem Münsteraner Bischof<br />
Bbr. Heinrich Tenhumberg (vorne rechts), der seit<br />
seiner Studienzeit mit der Schönstatt-Bewegung<br />
verbunden war<br />
Direktor des Studienhauses der Pallottiner<br />
in Südafrika, als 28-jähriger Priester in die<br />
UNITAS Frisia zu Münster rezipiert. Im SS<br />
1933 fanden Pater Dr. Wilhelm Bange SAC,<br />
später Vize-Provinzial, und Pater Albert<br />
Renn SAC, später Standesleiter der männ-<br />
lichen Schönstattjugend in Paderborn und<br />
Spiritual, ihren Weg in die UNITAS Berlin.<br />
Der wohl bekannteste unitarische<br />
Schönstätter war jedoch der ehemalige<br />
Bischof von Münster, Bbr. Heinrich Tenhumberg.<br />
Wie Bischof Tenhumberg zur<br />
UNITAS gelangte, lässt sich nicht mehr feststellen.<br />
Eines steht jedoch fest: Im Rahmen<br />
seiner Freisemester studierte Tenhumberg,<br />
zusammen mit seinem Freund Karl Leisner,<br />
in Freiburg und trat dort im Jahre 1936 in<br />
die UNITAS Eckhardia ein. Noch im selben<br />
Jahr legte er seine Weihe an die Mater ter<br />
admirabilis in Schönstatt ab. Schon in seinem<br />
zweiten unitarischen Semester übernahm<br />
er in Freiburg das Amt des Fuchsmajors.<br />
Nach Münster zurückgekehrt trat<br />
er dort der UNITAS Burgundia bei und<br />
wurde später – bereits als Weihbischof –<br />
Geistlicher Beirat des gesamten UNITAS-<br />
Verbandes. Mehr noch als Kentenich, der<br />
zeitlebens inaktives Mitglied des Verbandes<br />
blieb, repräsentierte Tenhumberg die<br />
selbstverständliche Vereinbarkeit von<br />
Mitgliedschaft in der UNITAS und Schönstättischer<br />
Bindung.<br />
Schlussbetrachtung<br />
Anmerkungen/Quellen:<br />
1 Schwarzes Brett der UNITAS, Nummer 4, 60 (1920) 74.<br />
2 Zuletzt in: UNITAS, Nummer 4, 145 (2005) 198f.<br />
3 Zum Ganzen vgl. Engelbert Monnerjahn, P. Josef Kentenich, Ein Leben<br />
für die Kirche, Vallendar 1975.<br />
4 Vgl. W. Burr (Hrsg.), UNITAS Handbuch, Bd. IV, Bonn 2000, 342ff.<br />
5 Aufwärts, Eine Feldgabe von Mitgliedern des Verbandes der wiss. kath.<br />
<strong>Studenten</strong>vereine UNITAS, Gladbach 1917, 176.<br />
6 Josef Mausbach studierte Theologie in Münster, promovierte dort und<br />
nahm ebenfalls in Münster eine Professur für Moraltheologie und<br />
Apologetik an.<br />
7 Vgl. Engelbert Monnerjahn, P. Josef Kentenich, Ein Leben für die Kirche,<br />
Vallendar 1975, 95ff.<br />
8 Ebd. 97.<br />
9 Die Ausführungen zum Sodalentag in Dortmund-Hörde sind weitgehend<br />
entnommen: Heinrich M. Hug (Hrsg.), Hörde 1919 – Größe und<br />
Grenze einer Versammlung, Schönstatt 2008, 69ff.<br />
10 Vgl. ebd. 72.<br />
11 Ebd. 94-96.<br />
12 Vgl. ebd. 100f.<br />
13 Vgl. ebd. 86-91.<br />
14 Ebd. 110.<br />
15 Vgl. Fritz Ernst, Die Bedeutung der Hörder Tagung 1919 für die<br />
Apostolische Bewegung von Schönstatt, Paderborn 1959, 31.<br />
16 In den Jahren 1919/20 fand an den deutschen Universitäten ein sog.<br />
Zwischensemester insbesondere für Kriegsrückkehrer statt. Der<br />
Zeitraum lag von Herbst bis Weihnachten und von Weihnachten bis<br />
zum Sommersemester. Das Herbstsemester in Münster wurde mit der<br />
Rektoratsübergabe am 15. September 1919 eröffnet.<br />
17 Im Jahre 1919 war AStA-Vorsitzender der Unitarier stud. rer. pol.<br />
Heinrich Hollenberg.<br />
18 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 3, 60 (1919) 50.<br />
Die Mitgliedschaft Josef Kentenichs in<br />
der UNITAS ist zweifelsfrei belegt. Am<br />
Mittwoch, dem 3. Dezember 1919 trat er in<br />
den Wissenschaftlichen Katholischen <strong>Studenten</strong>verein<br />
UNITAS Rolandia Münster<br />
ein. Die genaueren Hintergründe seines<br />
Eintritts und seine Beweggründe hierfür<br />
liegen leider (noch) im Dunkeln. Sie können<br />
derzeit nur vermutet werden.<br />
Klar ist jedoch eins: Das Bindeglied zwischen<br />
Josef Kentenich und der UNITAS ist<br />
Alois Zeppenfeld gewesen. Nur durch ihn<br />
kann er zu der neustudentisch ausgerichteten<br />
UNITAS Rolandia gekommen sein.<br />
Josef Kentenich war kein aktiver Unitarier.<br />
Als „Auswärtiger Inaktiver“ war es ihm<br />
nicht möglich, an einem Vereinsleben teilzunehmen.<br />
Sein kritischer Gesundheitszustand<br />
in den Nachkriegsjahren und sein<br />
Einsatz für den Aufbau des Schönstattwerkes<br />
ließen ein aktives unitarisches<br />
Leben auch nicht zu. Dennoch ist Kentenich<br />
der UNITAS insofern treu geblieben, als<br />
dass die Mitgliedschaft in der UNITAS bis zu<br />
seinem Tod fortbestanden hat. Anfang der<br />
50er-Jahre führte der UNITAS-Verband eine<br />
„Bereinigung der Kartei“ durch, weshalb<br />
von da an all diejenigen nicht weitergeführt<br />
wurden, die sich im Rahmen dieser<br />
Aktion nicht zurückgemeldet hatten.<br />
Kentenich muss dieser Anfrage allerdings<br />
nachgekommen sein, da sich nach diesem<br />
Zeitpunkt in der Tat seine korrekte Adresse<br />
im amerikanischen Exil in den Verbandsverzeichnissen<br />
der UNITAS findet.<br />
Die UNITAS kann stolz darauf sein, Josef<br />
Kentenich, den Gründer der Schönstattbewegung,<br />
in ihren Reihen zu haben<br />
und ihn einen Bundesbruder nennen zu<br />
dürfen.<br />
19 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 2, 60 (1919) 28.<br />
20 W. Burr (Hrsg.), UNITAS Handbuch. Bd. II, Bonn 1996, 40f.<br />
21 UNITAS, Organ des Verbandes der wissenschaftlichen kathol. <strong>Studenten</strong>vereine<br />
UNITAS, Nr. 6, 59 (1919) 279.<br />
22 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 4, 60 (1920) 68.<br />
23 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 3, 60 (1919) 44.<br />
24 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 4, 60 (1920) 72.<br />
25 Ebd. 74.<br />
26 Schwarzes Brett der UNITAS, Nr. 6, 60 (1920) 118.<br />
27 Gesamtverzeichnis des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>vereine UNITAS, o.O. 1925, 65.<br />
28 Gesamtverzeichnis des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>vereine UNITAS, o.O. 1927, 87.<br />
29 Gesamtverzeichnis des Verbandes der wissenschaftlichen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>vereine UNITAS, o.O. 1930, 71.<br />
30 Gesamtverzeichnis, Verband der wissenschaftlichen katholischen<br />
<strong>Studenten</strong>vereine UNITAS, o.O. 1968, 144.<br />
31 Nach Auskunft der UNITAS Rolandia Münster sind Vereinsdokumente<br />
aus dem Jahre 1919 nicht auffindbar.<br />
32 Im Jahr 1919 wurden bei der UNITAS Rolandia Münster alle<br />
„Auswärtigen“ als inaktiv deklariert.<br />
33 Heinrich M. Hug (Hrsg.), Hörde 1919 – Größe und Grenze einer Ver-<br />
sammlung, Schönstatt 2008, 83.<br />
34 Vgl. CAUSA SECUNDA. Textbuch zur Zweitursachenlehre bei P. Josef<br />
Kentenich, hrsg. vom Josef-Kentenich-Institut, Freiburg i. Br. 1979.<br />
35 Vgl. W. Burr (Hrsg.), UNITAS Handbuch, Bd. I, Bonn 1995, 26.<br />
36 Vgl. Hubertus Brantzen u. a. (Hrsg.), Schönstatt-Lexikon, Vallendar-<br />
Schönstatt 1996, 401f.<br />
37 Heinrich M. Hug, (Hrsg.), Hörde 1919 – Größe und Grenze einer Versammlung,<br />
Schönstatt 2008, 12.<br />
38 Vgl. Hubertus Brantzen u. a. (Hrsg.), Schönstatt-Lexikon, Vallendar-<br />
Schönstatt 1996, 422ff.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 51
Bbr. Eduard Müller: Ehrung für „Lübecker Märtyrer“<br />
Weihbischof Hubert Berenbrinker (rechts)<br />
und Bürgermeister Burkhard Deppe nahmen<br />
die Umwidmung der Straße zum Eduard-Müller-<br />
Weg vor.<br />
Foto: www.clementinum-paderborn.de<br />
BAD DRIBURG/PADERBORN. In Bad Driburg<br />
gibt es ab sofort einen „Eduard-Müller-<br />
Weg“. Damit ehrt die Stadt Kaplan Bbr.<br />
Eduard Müller, der von 1931 bis 1935 im dortigen<br />
Clementinum sein Abitur erworben<br />
hatte und unter nationalsozialistischer<br />
Herrschaft hingerichtet wurde. Zur<br />
offiziellen Umbenennung der<br />
Straße, die vom Clemensheim hinauf<br />
zur Waldkapelle führt, war am<br />
Dienstag, 3. Februar, der Paderborner<br />
Weihbischof Hubert Berenbrinker<br />
nach Bad Driburg gekommen.<br />
Bbr. Eduard Müller gehört zu<br />
den so genannten „Lübecker<br />
Märtyrern“. Diese Gruppe von<br />
Geistlichen brachte Predigten des<br />
damaligen Bischofs von Münster,<br />
Clemens August Graf von Galen,<br />
unter das Volk, in denen dieser sich<br />
gegen die Ermordung physisch<br />
und psychisch Kranker durch die<br />
Nationalsozialisten wandte. Auf<br />
Gruppenabenden wurde zudem offen über<br />
die Sinnlosigkeit des Krieges diskutiert. Die<br />
beteiligten Geistlichen wurden verhaftet<br />
und 1943 wegen „landesverräterischer<br />
Feindbegünstigung“, „Wehrkraftzersetzung“,<br />
„Vergehen gegen das Rundfunkgesetz“<br />
und das „Heimtückegesetz“ zum<br />
Tode verurteilt und hingerichtet. Seit 2004<br />
läuft in Rom das Seligsprechungsverfahren<br />
für die Lübecker Märtyrer.<br />
Der Rat der Stadt Bad Driburg hatte<br />
kürzlich den einstimmigen Beschluss gefasst,<br />
eine Straße nach dem ehemaligen<br />
Clementiner Bbr. Eduard Müller zu benen-<br />
52<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
nen. Zugleich wurde im Rathaus eine<br />
Ausstellung zu den Lübecker Märtyrern eröffnet,<br />
die bis Ende Februar <strong>2009</strong> zu sehen<br />
war. Die Ausstellung kam auf Initiative des<br />
Clementinums Paderborn und des Fördervereins<br />
St. Klemens zu Stande.<br />
Von 1928 an konnten im Bad Driburger<br />
Clementinum Männer, die Priester werden<br />
wollten, auf dem zweiten Bildungsweg<br />
das Abitur erlangen. 1997 wurde die vom<br />
Clemens-Hofbauer-Hilfswerk für Priesterspätberufe<br />
e.V. getragene Schule wegen<br />
rückläufiger Schülerzahlen geschlossen.<br />
Seither besuchen die Schüler das Westfalenkolleg<br />
Paderborn und wohnen in der<br />
Theodor-Heuss-Straße im Clementinum<br />
Paderborn. Das Clemens-Hofbauer-Hilfswerk<br />
ist aber weiterhin Träger des ehemaligen<br />
Gebäudes in Bad Driburg, das jetzt<br />
an das Kolpingbildungszentrum vermietet<br />
ist.<br />
Bbr. Eduard Müller –<br />
beliebter Seelsorger<br />
Bundesbruder Eduard Müller, geboren<br />
am 20. August 1911 in Neumünster, kam aus<br />
armen Verhältnissen. Der Vater hatte die<br />
Familie mit sieben Kindern früh verlassen,<br />
die Mutter schlug sich mit Gelegenheits-<br />
Ein Kohlenkeller wird zum Jugendheim. Kaplan Müller<br />
und die Pfarrjugend)<br />
arbeiten durch. Müller lernte Tischler, war in<br />
der katholischen Jugendbewegung aktiv<br />
und wäre gerne Priester geworden. Seinen<br />
Wunsch, Priester zu werden, musste er über<br />
den mühsamen Weg privater Lateinstunden,<br />
Spätberufenenkonvikt mit Abitur,<br />
dann Studium in Münster, verwirklichen.<br />
Der Neumünsteraner Kaplan und Bundesbruder<br />
Dr. Bernhard Schräder (später Weihbischof<br />
in Schwerin) förderte ihn und<br />
besorgte Geldgeber für seine Schulbildung.<br />
1936 legte Bbr. Müller sein Abitur am<br />
Spätberufenen-Kolleg in Bad Driburg ab<br />
und nahm in Münster das Studium der<br />
Theologie auf. 1940 wurde er in Osnabrück<br />
zum Priester geweiht und kam noch im<br />
gleichen Jahr nach Lübeck.<br />
Als Adjunkt in der Lübecker Herz-Jesu-<br />
Gemeinde wurde er von Pfarrer Msgr. Dr.<br />
Albert Bültel, ebenfalls Bundesbruder und<br />
pastor primarius in Lübeck, sehr gefördert.<br />
Müller war besonders bei der Jugend und<br />
bei den einfachen Leuten beliebt. Er legte<br />
Hand an, wenn ein Handwerker gebraucht<br />
wurde. Seine erfolgreiche Jugendarbeit veranlasste<br />
die HJ, die Hitlerjugend, ihn um<br />
Mitarbeit zu bitten. Er aber blieb bei seiner<br />
Gemeindejugend.<br />
Müller sah sich als „Soldat“ des „Königs“<br />
Christus. In einem Brief an den<br />
Bischof schrieb er kurz vor der Hinrichtung:<br />
„Knapp zwei Jahre durfte ich als Priester<br />
ihrer Diözese helfen am Aufbau des Reiches<br />
Gottes. Und wenn ich an Gottes Thron stehen<br />
darf, dann werde ich auch dort helfen<br />
am Aufbau des Reiches Gottes in unserem<br />
lieben Vaterland und besonders in unserer<br />
Diözese.“ Der junge Priester hatte keine<br />
politischen Ambitionen. Er war sich aber im<br />
Klaren, dass Nationalsozialismus und<br />
Christentum unvereinbar waren. Wie bei<br />
Bbr. Johannes Prassek konnte ihm die<br />
Anklage keine öffentliche Kritik an der NS-<br />
Herrschaft vorwerfen. Trotzdem wurde er<br />
am 22. Juni 1942 festgenommen und zum<br />
Tode verurteilt.<br />
1942/43: Prozess<br />
vor dem Volksgerichtshof<br />
Der Prozess gegen die vier Geistlichen,<br />
Bundesbruder Kaplan Johannes Prassek<br />
(* 13. 8. 1911 in Hamburg), Bundesbruder Ad-
junkt Eduard Müller (* 20. 8. 1911 in Neumünster),<br />
gegen Vikar Hermann Lange<br />
(* 16. 4. 1912 zu Leer in Ostfriesland) und<br />
Pastor Karl Friedrich Stellbrink dauerte<br />
kaum zwei Tage (22./23. April). In der Anklage<br />
gegen die drei katholischen Geistlichen,<br />
die gemeinsam an der Lübecker<br />
Herz-Jesu-Kirche in der Seelsorge tätig<br />
waren, hieß es: „Ihnen ist zur Last gelegt,<br />
seit 1940 oder Anfang 1941 ständig<br />
deutschsprachige Sendungen des feindlichen<br />
Rundfunks<br />
abgehört und verbreitet<br />
und dadurch<br />
die Feindpropaganda<br />
gefördert zu haben.<br />
Sie haben ferner<br />
seit Frühjahr oder<br />
Sommer 1941 auf<br />
Anordnung Ihrer vorgesetztenKirchenbehörde<br />
regelmäßig<br />
Gruppenabende veranstaltet,<br />
die der<br />
religiösen Vertiefung<br />
der Teilnehmer dienen<br />
sollten und zu<br />
denen sich auf Einladung<br />
durch die<br />
Angeklagten überwiegend<br />
junge Männer<br />
einfanden, die<br />
zum Teil der Wehrmacht<br />
angehörten<br />
und die weitere Gäste einführten; sie sind<br />
weiter beschuldigt, auf diesen Gruppenabenden<br />
durch Hetze gegen den nationalsozialistischen<br />
Staat und zwar auch durch<br />
Verteilung von Schriften, dem Kriegsfeind<br />
Vorschub geleistet und Vorbereitung zum<br />
Hochverrat begangen zu haben.“<br />
Das Urteil des Volksgerichtshofes vom<br />
23. April 1942 lautete: „Im Namen des deutschen<br />
Volkes ... Die Angeklagten haben jeder<br />
Rundfunkverbrechen, landesverräteri-<br />
sche Feindbegünstigung und<br />
Zersetzung der Wehrkraft begangen.<br />
Wer den Staat angreift,<br />
kämpft damit unmittelbar<br />
gegen die geschlossene<br />
und einige Gemeinschaft der<br />
Deutschen ... Die Angeklagten<br />
sind hartnäckige, fanatisierte<br />
und auch gänzlich unbelehrbare<br />
Hasser des nationalsozialistischen<br />
Staates. Für solche<br />
Verbrecher am Volksganzen<br />
wie die Angeklagten Prassek,<br />
Lange und Müller es sind, kann<br />
es nur die härteste Strafe<br />
geben, die das Gesetz zum<br />
Schutz des Volkes zulässt, die<br />
Todesstrafe!“<br />
Von einem Gerichtsprozess<br />
konnte keine Rede sein. Das<br />
Urteil stand bereits vorher fest.<br />
Bbr. Eduard Müller wies im<br />
Prozess vor dem Volksgerichtshof<br />
alle Anschuldigungen von sich. Wahrscheinlich<br />
war er wirklich kaum an den<br />
Handlungen der anderen beteiligt. Nach<br />
der Urteilsverkündigung schrieb er: „So<br />
habe ich die Erwartung und Hoffnung, dass<br />
ich in keinem Stück werde zuschanden werden,<br />
sondern dass in allem Freimut, wie<br />
immer, auch jetzt Christus an meinem<br />
Leibe verherrlicht werde, sei es durch Leben,<br />
sei es durch Tod. Denn für mich ist das<br />
Leben Christus und das Sterben Gewinn.“<br />
Das Gebet lautete:<br />
„Herr, hier sind<br />
meine Hände. Lege<br />
darauf, was du<br />
willst. Nimm hinweg,<br />
was du willst.<br />
Führe mich, wohin<br />
du willst. In allem<br />
geschehe dein<br />
Wille.“ (Vgl. <strong>Unitas</strong><br />
1/2005)<br />
Wenige Tage<br />
nach der Gerichtsverhandlungwurden<br />
die vier Verurteilten<br />
in das Zuchthaus<br />
Hamburg-<br />
Holstenglacis verlegt<br />
(s. Erinnerungstafel<br />
am Gefängnis).<br />
Die letzten Monate<br />
verbrachten sie in<br />
Einzelhaft, durften aber Besuche (u. a. von<br />
ihrem Bischof Wilhelm Berning) empfangen.<br />
Am Mittag des 10. November 1943<br />
erhielten die Häftlinge Nachricht, dass ihre<br />
Hinrichtung am gleichen Abend sein<br />
werde. Die Notiz lautete: „Heute 18 Uhr<br />
Urteilsvollstreckung: Tod durch Enthauptung.“<br />
Die Geistlichen schrieben Abschiedsbriefe,<br />
kurz vor 18 Uhr wurden die Häftlinge<br />
aus dem Gebet gerissen, und einer nach<br />
dem anderen gefesselt zum Schafott geführt<br />
und durch das Fallbeil hingerichtet.<br />
Im Abstand von drei Minuten sterben zuerst<br />
Eduard Müller (32), dann Hermann<br />
Lange (31), dann Johannes Prassek (31) und<br />
zuletzt Karl-Friedrich Stellbrink (49). Die<br />
Leichen von Hermann Lange und Karl<br />
Friedrich Stellbrink wurden im Ohlsdorfer<br />
Krematorium eingeäschert. Die sterblichen<br />
Überreste unserer Bundesbrüder Johannes<br />
Prassek und Eduard Müller sind verschwunden.<br />
Die Märtyrer von Lübeck –<br />
Auf dem Weg<br />
zur Seligsprechung<br />
Das gemeinsame Gedenken an die „vier<br />
Lübecker Märtyrer“ ist heute eine feste ökumenische<br />
Angelegenheit der Lübecker<br />
Christen. In der Hamburger St. Ansgar-Gemeinde/Kleiner<br />
Michel wird die Erinnerung<br />
an die Martyrer und Glaubenszeugen wach<br />
gehalten. Die Gefängniskirche in ihrer<br />
Hinrichtungsstätte erhielt im Gedenken an<br />
die vier Lübecker Geistlichen den Namen<br />
„Kapelle des 10. November“. Das am 10. Mai<br />
2004 im Erzbistum Hamburg begonnene<br />
Verfahren für das Seligsprechungsverfahren<br />
der drei Kapläne Prassek, Müller und<br />
Lange wurde am 10. November 2005 abgeschlossen.<br />
Die 2.110 Seiten umfassenden<br />
Prozessakten wurden für den zweiten und<br />
entscheidenden Teil des Verfahrens an die<br />
vatikanische Kongregation für Selig- und<br />
Heiligsprechungen nach Rom geschickt.<br />
Wie viel Zeit bis zur Entscheidung vergehen<br />
wird, ist derzeit nicht absehbar.<br />
Am 9. November 2003, einen Tag vor<br />
dem 60. Todestag des Seelsorgers, wurde<br />
das katholische Gemeindehaus in Neumünster,<br />
wo Bbr. Müller geboren und aufgewachsen<br />
war, mit einer Gedenkfeier in<br />
„Eduard-Müller-Haus“ benannt (Bild oben).<br />
Heute finden in dem Pfarrzentrum in der<br />
Linienstraße jährlich rund 150 überregionale<br />
Veranstaltungen statt.<br />
CB<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 53
VOR ZEHN JAHREN:<br />
Bischof Dr. Franjo Komarica – unser Ehrenmitglied<br />
Zehn Jahre ist es her und es war ein<br />
festlicher Tag in Bonn: Beim Vereinsfest<br />
Maria Immaculata am 6. Dezember<br />
1998 wurde Dr. Franjo Komarica,<br />
Bischof von Banja Luka, die Ehrenmitgliedschaft<br />
im UNITAS-Verband<br />
zuerkannt. Wenige Tage vor dem<br />
50. Jahrestag der Verkündung der<br />
Menschenrechte würdigte die UNITAS<br />
damals mit einem Festakt im Collegium<br />
Albertinum die Verdienste des<br />
engagierten Oberhirten aus Bosnien-<br />
Herzegowina für seinen unermüdlichen<br />
Kampf für Gerechtigkeit und<br />
Frieden.<br />
Der UNITAS-Verband schätze sich glükklich,<br />
dass er den Antrag angenommen und<br />
ihm die Ehre erwiesen habe, Ehrenmitglied<br />
des UV zu sein, stellte der damalige<br />
Vorsitzende des Altherrenbundes, Günther<br />
Ganz, bei der Festveranstaltung das eigentliche<br />
Gewicht der höchsten Auszeichnung<br />
des Verbandes heraus. In Anwesenheit des<br />
Botschafters von Kroatien, Prof. Dr. Zoran<br />
Jasic, des Botschafters von Bosnien-Herzegowina,<br />
Magister Anton Balkowic, sowie<br />
weiterer Kultur- und Militärattachés der<br />
Länder erinnerte Bbr. Ganz an den Wahlspruch<br />
des Bischofs „Der Herr ist meine<br />
Stärke und mein Lied“ aus dem 118. Psalm.<br />
Es sei das „Wissen um den Beistand Gottes<br />
auch in größter Not, das gläubigen Menschen<br />
Kraft gibt, allen Schrecknissen unserer<br />
Zeit zu widerstehen und durch mutiges<br />
und besonnenes Verhalten anderen Men-<br />
54<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
schen Vorbild und Beispiel zu<br />
geben“, unterstrich Ganz in<br />
seiner Laudatio vor rund 120<br />
Bundesbrüdern, -schwestern<br />
und Gästen im großen Saal<br />
des Collegium Albertinum.<br />
Die vom amtierenden<br />
Vorortspräsidenten Johannes<br />
Schmitz (Aachen) überreichte<br />
Ernennungsurkunde<br />
würdigte Bischof Komaricas<br />
„beispielhaftes Eintreten für<br />
die Achtung der unveräußerlichen<br />
Würde jedes Menschen<br />
ungeachtet seiner<br />
Religions- oder Volkszugehörigkeit,<br />
sein unbeugsames<br />
Ausharren als Oberhirte seiner Diözese in<br />
den Zeiten der Bedrängnis, Unterdrückung<br />
und Verfolgung, seinen mutigen und<br />
besonnenen Einsatz zur Verhinderung des<br />
Ausbruchs größerer kriegerischer Zusammenstöße<br />
in seiner Heimat und seinen<br />
unermüdlichen Kampf für die ethnische<br />
Aussöhnung in Bosnien-Herzegowina.“ Tief<br />
bewegt nahm Bischof Komarica die Urkunde<br />
als neuer Bundesbruder entgegen.<br />
Bischof Komarica –<br />
ein mutiger Christ<br />
Bischof Dr. Komarica, 1946 in Banja Luka<br />
geboren, studierte im österreichischen<br />
Innsbruck Theologie und Kirchenmusik,<br />
promovierte 1978 im Fach Liturgiewissenschaften<br />
und lehrte bis<br />
1986 an der Theologischen<br />
Hochschule in<br />
Sarajevo. 1985 wurde er<br />
Weihbischof in Banja<br />
Luka, vor 20 Jahren dann,<br />
1989, Bischof – in einem<br />
damals noch multikulturellen<br />
und multiethnischen<br />
Gebiet. Komarica<br />
nutzte die Möglichkeiten<br />
seines Amtes seit den<br />
ersten Auflösungserscheinungen<br />
des kommunistisch<br />
regierten, noch gemeinsamen<br />
Staates der<br />
Serben, Bosnier und Kroaten,<br />
leitete viele Initiativen für eine lebendigere<br />
Kirche in seinem Bistum ein. Als<br />
Vertreter der römisch-katholischen Kirche<br />
im ehemaligen Jugoslawien war er lange<br />
Zeit das jüngste Mitglied der Bischofskonferenz<br />
in Rom. Seit 1992 Mitglied des<br />
Päpstlichen Rates für den Dialog der<br />
Kirchen, setzte er sich immer für ein gutes<br />
Verhältnis zu den anderen Konfessionen<br />
seines Landes ein.<br />
1992 bis 1995, während des Krieges in<br />
Bosnien-Herzegowina, kamen 80 Prozent<br />
des Bistums Banja Luka (Bild oben: Die<br />
Bischofskathedrale) unter die Kontrolle<br />
der bosnischen Serben, die mit „ethnischen<br />
Säuberungen“ ein Regime der Unterdrückung<br />
und Vertreibung errichteten.<br />
In dieser Zeit wurde Bischof Dr. Komarica<br />
zum mutigen Streiter für die Menschenrechte<br />
und die Würde jedes Menschen,<br />
rettete durch besonnene Verhandlungen<br />
und Appelle unzähligen Menschen,<br />
Katholiken, Orthodoxen und Moslems, das<br />
Leben. Dem Druck der serbischen Behörden<br />
beugte er sich nicht. Auch der zynischen<br />
Aufforderung, die Stadt „um seiner<br />
Sicherheit willen“ zu verlassen, folgte er<br />
nicht.<br />
Von Mai bis Dezember<br />
1995 unter Hausarrest gestellt,<br />
machte Bischof Komarica<br />
durch Appelle weltweit<br />
auf die brutale Verletzung<br />
der Menschenrechte<br />
und auf die materielle<br />
Not in seinem Land<br />
aufmerksam und suchte<br />
die politisch Verantwortlichen<br />
der Welt mit Briefen<br />
und Denkschriften aufzurütteln.<br />
Der Balkankrieg<br />
war für die Region Banja<br />
Luka verheerend: 25.000<br />
Katholiken fielen den serbischen<br />
Aggressoren zum<br />
Opfer. Sie wurden aus ihren Häusern<br />
getrieben, misshandelt und ermordet.<br />
Gleichzeitig wurden 98 Prozent der<br />
Kirchen und Klöster zerstört, Priester und<br />
Ordensleute mussten fliehen oder wurden<br />
umgebracht. Bei der Unterzeichnung des<br />
Friedensvertrags von Dayton warnte er<br />
die Verantwortlichen vor neuen Ungerechtigkeiten,<br />
die das Abkommen mit sich<br />
bringe.
Friedensstreiter Gottes<br />
Bereits im Mai 1997 war Bischof Komarica<br />
mit dem Heinrich-Pesch-Preis ausgezeichnet<br />
worden. Bei der Verleihung<br />
äußerte der Vorsitzende des nach dem<br />
Jesuiten, Sozialethiker und Unitarier<br />
benannten Preises, Bbr. Professor Lothar<br />
Roos: „Sie haben angesichts der unermesslichen<br />
Leiden, die Sie persönlich, die ihnen<br />
anvertrauten Gläubigen und viele andere<br />
der auf dem Gebiet Ihrer Diözese lebenden<br />
Menschen durch die zurückliegenden kriegerischen<br />
Ereignisse erdulden mussten, das<br />
Beispiel eines wahrhaft guten Hirten gegeben.<br />
Sie haben durch ihr Ausharren, Ihre sozial-karitative<br />
Tätigkeit gegenüber den<br />
Notleidenden ohne Unterschied der ethnischen<br />
Zugehörigkeit und Religion und durch<br />
ihr Eintreten für die Würde und Rechte aller<br />
Menschen, öffentlich kundgemacht, wofür<br />
die Soziallehre der Kirche steht.“<br />
Der Bischof bekannte sich auch in Essen<br />
öffentlich zur UNITAS und bekundete<br />
sein Interesse für die Geschichte und<br />
Prinzipien des Verbandes: Bei einer gemeinsamen<br />
Veranstaltung von UNITAS Ruhrania<br />
und Junger Union, Stadtbezirk Ruhrhalbinsel,<br />
hatte er am 29. Oktober 1997 nach<br />
einer gemeinsamen Messe einen Vortrag in<br />
der bis auf den letzten Platz gefüllten<br />
Unterkirche von St. Gertrud gehalten. Das<br />
christliche Abendland verrate seine Wurzeln,<br />
erklärte er damals, wenn statt Prinzipien<br />
nur Interessen die Politik bestimmten.<br />
„Europa ist sehr herzkrank“, so Bischof<br />
Komarica. Die Lage in Bosnien-Herzegowina<br />
bleibe ein Krebsgeschwür des Kontinents,<br />
eine „furchtbare Tragödie und die<br />
größte Schande seit dem Ende des Zweiten<br />
Weltkrieges.“ Im „Haus Europa“ dürfe seine<br />
Heimat nicht „wie ein Abstellraum“ behandelt<br />
werden. Nach dem Vortrag hatten<br />
ihm die Bundesbrüder der UNITAS Ruhrania<br />
bei einem Abendessen im Restaurant<br />
„Herzegowina“ die Ehrenmitgliedschaft<br />
angetragen. Komarica unterstrich seinerzeit:„Die<br />
UNITAS ist eine großartige Idee. Es<br />
ist schade, dass sie sich noch nicht bei uns<br />
entwickelt hat. Haltet an ihr fest, füllt sie<br />
mit Leben!“<br />
Europa braucht<br />
ein Fundament<br />
Bischof Komarica zeigte sich in Bonn bei<br />
der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft<br />
sehr bewegt: „Wir sind hier aus vielen<br />
Völkern Europas. Und wir fühlen uns dem<br />
Prinzip der Solidarität verpflichtet.“ Es<br />
bedeute gemeinsames Füreinander-Einstehen,<br />
das Gefühl einer inneren Zugehörigkeit<br />
vieler untereinander und werde in der<br />
Form der christlichen Nächstenliebe am<br />
konkretesten. „Solidarität begegnet uns in<br />
Christus in ihrer vollkommensten Form“, erklärte<br />
er und erinnerte zugleich daran, dass<br />
Christsein sich auch darin zeige, ob man<br />
gewillt sei, Opfer zu bringen. Der Kontinent<br />
Europa, in dem seine dezimierten Landsleute<br />
um das „Recht auf Heimat“ kämpften,<br />
brauche insgesamt diese christlich verstandene<br />
Solidarität, um nicht den zerstörerischen<br />
Kräften ausgeliefert zu werden. Mit<br />
einer gewissen Skepsis fragte er: „Quo<br />
vadis, Europa?“ Wohin Europa steuere, welchen<br />
Weg es einschlage, hänge entscheidend<br />
von den großen Völkern ab. Europa<br />
erwarte die neue Besinnung auf verbindende<br />
Grundlagen und Werte. Ohne sie bleibe<br />
Europa eine Utopie. Von den kleinsten<br />
Gemeinschaften, aus den Familien und<br />
Vereinen, sei die „Hoffnung Europa“ aufzubauen.<br />
„Sind wir gerüstet für unseren<br />
Einsatz auf der Baustelle Europa und für die<br />
Arbeit im Weinberg des Herrn?“<br />
UNITAS ist gefordert<br />
Gerade die UNITAS-Mitglieder seien<br />
mit ihren Prinzipien herausgefordert, sich<br />
an den geistigen Auseinandersetzungen<br />
um das Fundament Europas aktiv zu beteiligen.<br />
Angesichts der gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten<br />
müsse die UNITAS kraftvoll und optimistisch<br />
nach ihren Möglichkeiten wirken.<br />
„Auch eine kleine Gruppe überzeugter<br />
Christen kann viel erreichen“, meinte er mit<br />
Verweis auf den Burscheneid. Unitarier<br />
seien zu gesellschaftlicher Einflussnahme<br />
berufen und dürften sich im vielstimmigen<br />
Konzert der Meinungsmacher und Entscheidungsträger<br />
nicht verstecken. Sie<br />
seien die entscheidenden, betonte Bischof<br />
Komarica. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“,<br />
versicherte das neue Ehrenmitglied<br />
seinerzeit. Er fühle sich unter<br />
„echten Bundesbrüdern“. Wann immer<br />
Bundesbrüder seine Heimat in der heutigen<br />
„Serbischen Republik Bosnien“ besuchten,<br />
seien sie herzlich in seinem Bischofshaus<br />
eingeladen.<br />
Bbr. Komarica:<br />
Vielfach ausgezeichnet<br />
Bischof Franjo Komarica, den die Fraktion<br />
der Europäischen Volkspartei im<br />
Europa-Parlament mit der Robert-Schuman-Medaille<br />
ehrte,<br />
ist seit 2002 Präsident<br />
der Bosnisch-<br />
Herzegowinschen Bischofskonferenz.<br />
Im<br />
selben Jahr wurde<br />
ihm die Auszeichnung<br />
der Coudenhove-Kalergi-Stiftung<br />
verliehen, 2005<br />
wurde ihm der Franz-<br />
Werfel-Menschenrechtspreis<br />
(s. Bild)<br />
zuerkannt, 2006 der Aschaffenburger<br />
Mutigpreis. In einem Interview mit Radio<br />
Vatikan rief er Anfang August 2008 überra-<br />
schend zum Gebet für den als Kriegsverbrecher<br />
angeklagten Radovan Karadzic<br />
auf. Der frühere Führer der bosnischen<br />
Serben, für den bald in Den Haag ein<br />
Prozess beginnt, sei eigentlich ein „armer<br />
Mann“ und nur ein Rädchen in einer Tötungs-<br />
und Vertreibungs-Maschinerie gewesen,<br />
erklärte er. Was verbrecherisch und<br />
unmenschlich war, müsse man verurteilen<br />
– das sei die Sünde –, aber den Sünder<br />
müsse man retten, für die Sünder müsse<br />
man beten. Für Besorgnis erregend halte er,<br />
dass noch immer viele Verbrecher frei, viele<br />
Mörder auch in den einflussreichen, gesellschaftlichen<br />
und politischen Funktionen<br />
seien.„Wir wollen kämpfen für eine bessere<br />
Zukunft – gerade, weil wir erlebt haben, wie<br />
wenig einfach das menschliche Leben gilt,<br />
wollen wir uns einsetzen für das Gedeihen<br />
des Lebens.“<br />
UNITAS in<br />
Bosnien engagiert<br />
1999 hatte der UNITAS-Verband den<br />
Wiederaufbau eines großen Kinderheims in<br />
Sarajewo abschließen können. Mehr als<br />
600.000 DM Spenden kamen in drei Jahren<br />
für das Haus „Egypta“ zusammen, das ehemalige<br />
Mutterhaus des auch im Bistum<br />
Essen vertretenen Ordens der „Dienerinnen<br />
vom Kinde Jesu“ (Kroatische Gemeinde in<br />
Borbeck-Vogelheim), in dem<br />
50 Waisenkinder eine neue<br />
Heimat fanden.<br />
Wenig später hatte der<br />
UNITAS-Verband Bbr. Franjo<br />
Komarica mit einem weiteren<br />
sozialen Verbandsprojekt<br />
unterstützt. Ab 2003<br />
wurde ein ehemaliges Presbyterium<br />
in Prijedor, Diözese<br />
Banja Luka/Bosnien-<br />
Herzegowina, mit 112.000<br />
Euro zu einem Internat für 20 Schüler aus<br />
entfernten Bergregionen umgebaut.<br />
CB<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 55
„Lebendiges Christentum –<br />
der Katholische Glaube in einer postmodernen Gesellschaft“<br />
– EIN DENKANSTOß ZUR VORBEREITUNG AUF DIE DIESJÄHRIGE GENERALVERSAMMLUNG –<br />
VON BSR. EDITH BREIL<br />
UND BSR. LISA STEINHAGE<br />
„Sind wir noch Papst?“, fragte die<br />
ZDF-Moderatorin Maybritt Illner in<br />
ihrer Sendung am fünften Februar<br />
dieses Jahres. Und: „Religion im Rückwärtsgang?“.<br />
Um Antwort auf diese<br />
Fragen rangen an diesem Abend u.a.<br />
Erzbischof Robert Zollitsch, der Journalist<br />
Peter Frey und der Kirchenkritiker<br />
Henryk M. Broder. Hat der Papst<br />
auf der einen Seite richtig und auf<br />
der anderen Seite glaubwürdig gehandelt?<br />
Darf eine deutsche Bundeskanzlerin<br />
den Vatikan kritisieren? Und<br />
vor allem: Ist die Katholische Kirche<br />
tatsächlich ein Verein voller rückwärtsgewandter<br />
Betonklötze? Die<br />
Diskussion um die Rücknahme der<br />
Exkommunikation eines Mitglieds der<br />
umstrittenen Pius-Bruderschaft, das<br />
öffentlich den Holocaust geleugnet<br />
hatte, hatte dabei nicht nur in<br />
Deutschland, sondern in aller Welt<br />
hohe Wellen geschlagen. Der Papst<br />
stand in der Kritik und die Katholische<br />
Kirche im Mittelpunkt der Diskussion.<br />
Sie hatte vermeintlich einmal mehr<br />
an Glaubwürdigkeit eingebüßt.<br />
Zwar fand die Debatte ihren Ursprung<br />
in der Äußerung eines Einzelnen – sie zeigt<br />
jedoch auch, dass das Verhalten der Katholischen<br />
Kirche viele bewegt und zum Mitdiskutieren<br />
anregt, und zwar Mitglieder,<br />
Andersgläubige und Nichtgläubige gleichermaßen.<br />
Und sie weist auf ein Problem<br />
hin, welchem sich die Katholische Kirche<br />
immer wieder von Neuem stellen muss: ist<br />
die Kirche in der Art, wie sie sich heute präsentiert,<br />
überhaupt noch zeitgemäß? Kann<br />
sie sich in Zeiten, in denen Menschen stets<br />
nach neueren und schnelleren Lösungen<br />
streben, in der Gesellschaft behaupten? Ist<br />
sie in Zeiten materieller Werte konkurrenzfähig?<br />
Kirche und Gesellschaft legen ein<br />
unterschiedliches Tempo vor – und dabei<br />
scheint die aktive Teilnahme am kirchlichen<br />
Leben hinter der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen<br />
Leben immer weiter zurück<br />
zu fallen.<br />
56<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Welle der Entrüstung über dem Vatikan: Der Medien-Hype um die Aufhebung der Exkommunikation<br />
der Traditionalisten-Bischöfe hatte einen Tsunami missverständlicher Berichterstattung ausgelöst.<br />
Aufgeregte Verunsicherung prägte auch das innerkirchliche Bild. Das Bildmotiv stammt von<br />
der Homepage der UNITAS Ruhrania, die ein Dossier mit Hintergrundinformationen und Kommentaren<br />
zu den Vorgängen auf ihre Homepage gesetzt hatte.<br />
Die Sprache der Zahlen<br />
Jahr für Jahr entscheiden sich Menschen<br />
gegen die Kirche und vollenden diese<br />
Entscheidung mit ihrem Kirchenaustritt.<br />
Dabei verläuft die Entwicklung bei den<br />
Kirchenaustritten seit dem Jahre 1960 in<br />
Phasen. Während es zu Beginn der 1960er<br />
Jahre noch etwa 25.000 Kirchenaustritte<br />
jährlich waren, stieg die Zahl in den 1970-er<br />
Jahren immens an – die umfassenden<br />
gesellschaftlichen Veränderungen machten<br />
auch vor der Kirchenzugehörigkeit nicht<br />
halt. So beschlossen in dieser Zeit jährlich<br />
mehr als 50.000 Menschen, der Kirche den<br />
Rücken zu kehren. Die Zahl der Austritte<br />
nahm in den 1980er Jahren weiter zu,<br />
erreichte Anfang der 1990er Jahre ihren<br />
Höhepunkt (sicher auch im Kontext der<br />
Einführung des Solidaritätszuschlags nach<br />
der Wiedervereinigung) und hat sich bis<br />
heute auf einem jährlichen Niveau von<br />
etwa 100.000 stabilisiert.<br />
Doch wie sieht es mit denjenigen aus,<br />
die in der Kirche verbleiben? Aktiv am religiösen<br />
Leben nimmt nur ein geringer Prozentsatz<br />
der Mitglieder teil. Denn auch die<br />
Zahl der Gottesdienstteilnehmer nimmt<br />
immer weiter ab. Anfang der 1960er Jahre<br />
besuchte noch fast jeder zweite Katholik<br />
den sonntäglichen Gottesdienst, Mitte der<br />
1980er Jahre jeder vierte. Waren es im Jahr<br />
1990 noch etwas über 20 Prozent der Gläubigen,<br />
die regelmäßig sonntags einem Gottesdienst<br />
beiwohnten, so verzeichnet man<br />
für das Jahr 2006 nur noch 14 von 100 Mitglieder,<br />
die sich sonntags zur Teilnahme an<br />
der Heiligen Messe versammeln. Das Verhalten<br />
einiger katholischer Gläubiger<br />
scheint sich gewandelt zu haben: sie hinterfragen<br />
die Teilnahme an einem Gottesdienst,<br />
die früher als Bestandteil des gesellschaftlichen<br />
Lebens selbstverständlich war,<br />
und entscheiden sich Sonntag für Sonntag<br />
bewusst für oder gegen den Kirchgang.<br />
Überhaupt: Sie hinterfragen nicht nur die<br />
Teilnahme am Gottesdienst, sondern auch<br />
das Denken und Handeln katholischer<br />
Würdenträger in der heutigen Welt. Es sind<br />
Themen wie Umweltschutz, Gerechtigkeit<br />
und Solidarität, die viele Menschen bewegen,<br />
aber auch alltägliche Dinge wie Ehe<br />
und Familie. Und diese Menschen fragen<br />
sich, welche Einstellung die Kirche vertritt<br />
und was sie unternimmt, um ihren Mitgliedern<br />
unterstützend zur Seite zu stehen.<br />
Sie suchen nach dem Sinn ihres eigenen<br />
Lebens und sie möchten sich an Werten<br />
orientieren, nach denen es sich lohnt, zu
streben. Sie hoffen, sie glauben, sie lieben –<br />
und am Ende bleibt die alles entscheidende<br />
Frage stehen: „Bin ich glücklich?“<br />
Die Jagd nach dem Glück<br />
Gott hat dem Menschen ein natürliches<br />
Verlangen nach Glück in das Herz gelegt.<br />
Dieses Verlangen prägt das Verhalten aller<br />
Menschen gleichermaßen – doch scheinen<br />
die meisten dabei nicht der Ansicht der<br />
Kirche zu folgen, nach der nur Gott dieses<br />
Glück zu stillen vermag. Das Glück lauert<br />
eher auf der nächsten Party, auf dem<br />
Sportplatz oder im Entspannungskurs der<br />
Volkshochschule. Es gilt, dem Glück hinterher<br />
zu sprinten. Je schneller dabei der<br />
Laufschritt, desto besser, und je abwechslungsreicher<br />
die Strecke, desto<br />
wahrscheinlicher wird es, das<br />
Glück zu finden. So hetzen<br />
wir von Freizeittermin zu<br />
Freizeittermin, von einem<br />
Treffen mit Freunden zum<br />
nächsten, und dabei sind wir<br />
viel zu schnell unterwegs, um das<br />
Glück überhaupt zu bemerken. Es scheint<br />
vielen Menschen nicht in den Sinn zu kommen,<br />
das Glück in der Langsamkeit zu<br />
suchen, im Innehalten und Nachdenken.<br />
Und dieses Glück wird nicht mehr von<br />
einem selbst, geschweige denn von der<br />
Kirche definiert, sondern von der Gesellschaft<br />
als Ganzes und der sozialen Umwelt<br />
eines jeden Einzelnen.<br />
Eine Möglichkeit, wieder ein Gespür für<br />
das eigene Glück zu entwickeln, bestünde<br />
jedoch vielleicht im Besuch eines sonntäglichen<br />
Gottesdienstes. Nur eine einzige<br />
Stunde in der Woche, die man ausschließlich<br />
dem Glauben widmet – und doch für<br />
viele bereits eine Stunde zu viel. Denn diese<br />
Zeit ist vermeintlich verloren und könnte<br />
doch viel gewinnbringender eingesetzt<br />
werden, beim Sport etwa, beim gemütlichen<br />
Beisammensein mit der Familie. Es<br />
ist sicherlich unbestritten: Sport ist gesund<br />
und eine lustige Runde im Kreise von<br />
Gleichgesinnten erfreut das Gemüt. Nicht<br />
umsonst tritt in der unitarischen Gemeinschaft<br />
zu den Prinzipien der virtus und der<br />
scientia auch die amicitia hinzu. Und doch<br />
gewinnen viele Aktivitäten enorm an Wert,<br />
wenn sie unterbrochen werden durch ruhige<br />
und besinnliche Momente.<br />
Die Zeichen der Zeit<br />
Ist es nun der Kirche geschuldet, dass<br />
ruhige und besinnliche Momente bei vielen<br />
losgelöst vom Glauben an Gott stattfinden?<br />
Oder ist es der Gesellschaft geschuldet, die<br />
blindlings losrennt, obwohl die Kirche gute<br />
Orientierung bieten könnte, welches Tempo<br />
und welcher Weg womöglich geeignet sein<br />
könnten? „Der christliche Glaube ist in<br />
besonderer Weise zukunftsfähig, und zwar<br />
nicht durch eine zuerst vom Menschen her<br />
versuchte Anpassungsstrategie, sondern<br />
von innen heraus“, schreibt Karl Kardinal<br />
Lehmann in seiner Veröffentlichung aus<br />
dem Jahr 2005 „Neue Zeichen der Zeit –<br />
Unterscheidungskriterien zur Diagnose der<br />
Situation der Kirche in der Gesellschaft und<br />
zum kirchlichen Handeln heute“.<br />
„Die bleibende Neuheit des christlichen<br />
Glaubens muss freilich immer wieder gefunden<br />
werden. Dies ist nur möglich, wenn<br />
man sich den jeweiligen Herausforderungen<br />
stellt. Man möchte wissen, welche<br />
Stunde geschlagen hat“, heißt es dort weiter.<br />
Demnach soll man also aufmerksam<br />
Das Schiff Petri in Seenot – oder Leuchtturm in<br />
der Brandung? In neccessariis UNITAS –<br />
Orientierung und Gemeinschaft sind gefragt.<br />
Collage: Homepage der UNITAS Ruhrania /<br />
www.UNITAS-ruhrania.org.<br />
durch die Welt gehen, um die Herausforderungen<br />
zu erkennen, die die aktuelle Stunde<br />
mit sich bringt. In allen Situationen wird<br />
dann die immerwährende Aktualität des<br />
christlichen Glaubens Orientierung bieten<br />
und Lösungswege aufzeigen. Das Zweite<br />
Vatikanische Konzil hat vor diesem Hintergrund<br />
versucht, neue Entwicklungen aufzunehmen<br />
und diese im Licht des Evangeliums<br />
zu deuten. Die insgesamt über 3.000<br />
Teilnehmer entschieden zugunsten der<br />
Religionsfreiheit in der bürgerlichen Staatsordnung<br />
und machten sich stark für einen<br />
verstärkten Dialog mit Anders- oder Nichtgläubigen.<br />
Um die Zeichen der Zeit richtig<br />
zu deuten, stößt man jedoch direkt zu<br />
Beginn auf ein grundlegendes Problem.<br />
Welche Zeichen sind wirklich wichtig und<br />
welche Zeichen werden auch zukünftig<br />
Bestand haben und sollten deshalb aufmerksam<br />
betrachtet werden? Im Zeitalter<br />
zunehmender Verflechtungen zwischen<br />
geografischen Einheiten, aber auch zwischen<br />
Denk- und Glaubensrichtungen, erscheint<br />
es immer schwieriger aus der Flut<br />
von Informationen diejenigen herauszufischen,<br />
die für die jeweilige Situation der<br />
Kirche und ihrer Mitglieder einer Diskussion<br />
und einer möglichen Anpassung bedürfen.<br />
Die Werte einer Gesellschaft können<br />
ihren Ursprung jedoch immer nur in<br />
den Werten des einzelnen Individuums finden<br />
– und so wird die Vorstellung, welche<br />
Zeichen der Zeit beachtet werden müssen,<br />
von jedem einzelnen Mitglied der Kirche<br />
und dessen Wahrnehmung geprägt.<br />
In neccessariis UNITAS<br />
Wir Unitarier sehen uns von jeher als<br />
Teil dieser Gemeinschaft und jeder einzelne<br />
prägt mit seinem Denken und seinem<br />
Handeln das Bild der Kirche mit. „In necessariis<br />
UNITAS, in dubiis libertas, in omnibus<br />
caritas.“ Die grundlegende Identität des<br />
Verbandes vereint neue und langjährige<br />
Mitglieder gleichermaßen. Sie scheint<br />
ebenso wie die Kirche eine Aktualität aus<br />
ihrem Wesen heraus zu besitzen und bietet<br />
gleichzeitig die Möglichkeit für jeden einzelnen,<br />
seine Vorstellungen und Neuerungen<br />
darzulegen und zur Diskussion zu stellen.<br />
Die UNITAS als Katholischer Verband,<br />
der versucht, neue Mitglieder zu begeistern<br />
und diese zur aktiven Mitarbeit anzuregen.<br />
Wenn nun die Kirche keine Lösungen mehr<br />
aufzuzeigen weiß für aktuelle Probleme,<br />
weiß denn die unitarische Gemeinschaft<br />
Lösungen anzubieten und junge Menschen<br />
zu begeistern?<br />
Herausforderungen stellen<br />
Wer sich engagiert, darf und soll auch<br />
mitreden. Sei es in der kleinen Gemeinschaft<br />
der Unitarier oder in der großen Gemeinschaft<br />
der Kirche. Und vor diesem<br />
Hintergrund erscheint die Meinung einer<br />
kleinen Gruppe von Menschen, die sich weigern,<br />
wichtige Teile des Zweiten Vatikanischen<br />
Konzils anzuerkennen unwichtig<br />
im Vergleich zu der großen Gruppe an<br />
Gläubigen, die bereit sind, nach vorne zu<br />
blicken und sich den Herausforderungen<br />
der Gegenwart zu stellen. Es gilt, sich immer<br />
wieder zu hinterfragen und Anpassungen<br />
vorzunehmen, wenn sich gesellschaftliche<br />
Entwicklungen ergeben, die eben<br />
solche Anpassungen erforderlich machen.<br />
Der UNITAS-Verband als Wissenschaftlicher<br />
Katholischer <strong>Studenten</strong>- und Akademikerverband<br />
bietet mit seiner Vielfalt an<br />
Charakteren und Meinungen eine Diskussionsplattform<br />
für aktuelle Themen unserer<br />
Zeit. Und die Frage zum Verhältnis von<br />
Kirche und Gesellschaft scheint nicht nur<br />
angesichts der Diskussion in den Medien<br />
aktueller denn je.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 57
Mit Ethik am Rechtsberatungsmarkt bestehen<br />
BKR FEIERT ZEHNJÄHRIGES BESTEHEN – MARIE-LUISE DÖTT HIELT FESTREDE<br />
BONN. Die Jahrestagung des Bundes<br />
Katholischer Rechtsanwälte (BKR), der am<br />
15.11.2008 in Bonn sein zehnjähriges Bestehen<br />
feierte, stand ganz im Zeichen der<br />
Berufsethik. Auf dem Haus der gastfreundlichen<br />
Farbenbrüder des K.St.V. Arminia im<br />
KV begann die Tagung mit der Mitgliederversammlung,<br />
in der der Vorsitzende Dieter<br />
Trimborn v. Landenberg einmal mehr auf<br />
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken konnte.<br />
Neben steigenden Mitgliederzahlen und<br />
soliden Finanzen hat der BKR auch inhaltlich<br />
an Profil gewonnen.<br />
Als Ergebnis einer verbandsinternen<br />
Diskussion über die Grundlagen der Berufsausübung<br />
wurde einstimmig der Ethik-<br />
Kodex des BKR verabschiedet. Neben den<br />
gemeinsamen Werten sind dort verbindliche<br />
Verhaltensregeln festgelegt, die teilweise<br />
über die Berufspflichten hinausgehen.<br />
Beispielsweise verpflichten sich die<br />
Rechtsanwälte des BKR zu Beginn des<br />
Mandats über die Vergütungsfrage aufzuklären,<br />
damit die Anwaltskosten kalkulierbar<br />
sind. Auch sind die Mitglieder bereit,<br />
pro-bono-Fälle zu bearbeiten.<br />
Nach dem Mittagessen, an dem auch<br />
die parallel tagenden Delegierten der Katholischen<br />
Akademikerarbeit Deutschlands<br />
58<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
(KAD) teilnahmen, ging es weiter mit einem<br />
Seminar zum Thema „Anwaltliches Marketing“,<br />
gehalten von Prof. Dr. Christoph Hommerich,<br />
dem Vorstand des Soldaninstitutes<br />
für Anwaltmanagement in Essen. Er stellte<br />
heraus, dass Dienstleistungsmarketing das<br />
Ziel verfolgen müsse, Vertrauen aufzubauen<br />
und zu stabilisieren. In Zeiten der Deregulierung<br />
von Märkten komme es darauf<br />
an, dieses Vertrauen durch ethische Normen<br />
verbindlich abzusichern. Neben der<br />
Kompetenz auf seinem Rechtsgebiet muss<br />
der Rechtsanwalt heute auch seine Wahrnehmung<br />
in der Öffentlichkeit pflegen, z.B.<br />
durch Bildung von Netzwerken. Der Referent<br />
verstand es, durch viele anschauliche<br />
Beispiele Anregungen zur Umsetzung in<br />
der eigenen Kanzlei zu geben.<br />
Festkommers mit<br />
Marie-Luise Dött<br />
Den glanzvollen Höhepunkt bildete der<br />
abendliche Festkommers im historischen<br />
Kneipsaal, der bei Kerzenlicht in bester couleurstudentischer<br />
Tradition von Aktiven der<br />
Arminia geleitet wurde. In einem Grußwort<br />
für den Altherrenvorstand des CV stellte Ulf<br />
Reermann fest, dass es dem BKR gelungen<br />
sei, ein korporationsübergreifendes Netz-<br />
werk zu schaffen, das Vorbildcharakter für<br />
vergleichbare Austauschrunden katholischer<br />
<strong>Studenten</strong>verbände habe.<br />
Die Festrede hielt Marie-Luise Dött MdB<br />
(CDU) und Vorsitzende des Bundes<br />
Katholischer Unternehmer, die die von<br />
ihrem Verband erarbeiteten „Zehn Gebote<br />
für Unternehmer“ vorstellte.<br />
Nach dem offiziellen Teil erwartete die<br />
Gäste, darunter eigens aus Österreich und<br />
Ungarn angereiste Kollegen, ein Mitternachtsbuffet<br />
und manch angeregtes Gespräch<br />
mit alten und neuen Freunden.<br />
Die nächste Jahrestagung findet am<br />
14.11.<strong>2009</strong> wieder in Bonn statt. Mehr<br />
Informationen über den BKR sind über die<br />
Geschäftsstelle zu erhalten: Bund Katholischer<br />
Rechtsanwälte e.V., Postfach 1449,<br />
56804 Cochem, (Tel.:02671-91566-2, Fax: - 1),<br />
E-Mail: info@bkr-netzwerk.de.<br />
INFO: Der Bund Katholischer Rechtsanwälte, hervorgegangen<br />
aus einer Initiative im UNITAS-Verband, ist<br />
ein Zusammenschluss von katholischen Rechtsanwälten,<br />
Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern,<br />
der seit 1998 besteht. Derzeit hat er über 180<br />
Mitglieder. Der BKR versteht sich als Netzwerk von<br />
Gleichgesinnten, die ihre Arbeit am christlichen<br />
Menschenbild und Wertesystem orientieren.<br />
Mehr: http://www.bkr-netzwerk.de/
Jubiläums-<strong>Wallfahrt</strong><br />
zum Kreuzberg <strong>2009</strong><br />
Zum fünfundzwanzigsten Mal wird in<br />
diesem Jahr die UNITAS-<strong>Wallfahrt</strong> zum<br />
Kreuzberg in der Rhön, dem heiligen Berg<br />
der Franken, stattfinden. Alle Unitarier<br />
sind vom 2. bis 4. Oktober <strong>2009</strong> mit ihren<br />
Familien, Freunden und Bekannten eingeladen,<br />
sich mit auf den Weg zu machen zu<br />
diesem traditionellen <strong>Wallfahrt</strong>sort.<br />
Freitag, 2. Oktober:<br />
Bis 19:00 Uhr Eintreffen mit PKW in<br />
Stralsbach, Gasthof „Weißes Rössel“<br />
20:00 Uhr Wortgottesdienst zur Eröffnung<br />
in der Pfarrkirche Burkardroth<br />
Samstag, 3. Oktober:<br />
08:30 Uhr Aufbruch zum Kreuzberg ab<br />
Marktplatz Burkardroth<br />
19:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kreuzbergkirche;<br />
anschl. gemütliches Beisammensein<br />
Stammtisch-Termine<br />
des AHZ Buchen<br />
BUCHEN / ODENWALD. Die Mitglieder des<br />
AHZ-Buchen treffen sich jeden zweiten Freitag<br />
im Monat im Hotel „Prinz Carl“. Im Sommer<br />
ist eine Besichtigung des neuen Römermuseums<br />
in Osterburken geplant. Der Termin<br />
hierzu wird noch bekannt gegeben.<br />
Am 3. Oktober kommen die Unitarier<br />
der Region zum Badisch-Fränkischen Unitariertreffen<br />
im Kinder- und Jugenddorf Klinge<br />
in Seckach zusammen. Am 11. Dezember<br />
versammeln sich die Bundesbrüder zum<br />
traditionellen Wildessen im Hotel „Prinz<br />
Carl“ (Hochstadtstraße 1, 74722 Buchen<br />
(Odenwald), Tel. 06281/5269-0).<br />
Wir freuen uns viele Bundesbrüder auf<br />
unseren Treffen willkommen zu heißen.<br />
Hermann Schmerbeck, AHZ-X<br />
AUS DEM VERBAND<br />
Sonntag, 4. Oktober:<br />
08:30 Uhr Laudes; anschließend Frühstück<br />
10:00 Uhr Kreuzweg zum Gipfel<br />
11:30 Uhr Mittagessen<br />
12:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kreuzbergkirche<br />
14:00 Uhr Gemeinsame Rückfahrt mit<br />
dem Bus nach Burkardroth<br />
Die Kreuzbergwallfahrt unter der bewährten<br />
geistlichen Leitung unseres Bundesbruders<br />
Domdekan Klaus Schimmöller<br />
„Nutzt eure Chancen!“<br />
Journalistin Astrid Wirtz vom Kölner Stadtanzeiger<br />
zu Gast bei der UNITAS Theophanu<br />
KÖLN. Am 22. Januar <strong>2009</strong> durfte die UNI-<br />
TAS Theophanu Köln die Journalistin Astrid<br />
Wirtz vom Kölner Stadtanzeiger begrüßen.<br />
Aktive, HDHD, AHAH und Gäste hörten zum<br />
Thema „Die Rolle der Frau in den Medien“<br />
einen sehr interessanten und lebendigen<br />
Vortrag.<br />
Obwohl das Kulturgut „Zeitung“ an Attraktivität<br />
bei der jüngeren Generation verloren<br />
habe und das Internet als Haupt-Informationslieferant<br />
diene, sei, so Astrid Wirtz,<br />
hat bislang in jedem Jahr einen tiefen und<br />
nachhaltigen Eindruck vor allem auch bei<br />
den Aktiven hinterlassen. Eingebettet in<br />
die reizvolle Herbstlandschaft der Rhön<br />
bietet sie im gemeinsamen Unterwegssein<br />
zugleich Kontemplation, Gebet, Meditation<br />
und damit die Hinführung zur Mitte. Sie ist<br />
von jedem ohne Rücksicht auf das Alter zu<br />
bewältigen und man kann auch in Etappen<br />
teilnehmen, da jederzeit Begleitfahrzeuge<br />
zur Verfügung stehen, die auch das Gepäck<br />
befördern. Jeder Teilnehmer erhält noch<br />
genaue Informationen.<br />
Für die Aktiven übernimmt der Verband<br />
die Übernachtungskosten. Wegen<br />
der Anfahrtskosten mögen sich die<br />
Aktiven an ihren AHV wenden.<br />
Da die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr<br />
ansteigt, ist es wichtig, sich für die Übernachtung<br />
frühzeitig anzumelden (wer<br />
zuerst kommt, …), und zwar bis spätestens<br />
15. Juli <strong>2009</strong> bei Bbr. Fritz Flach,<br />
Matthias-Ehrenfried-Straße 6, 97074<br />
Würzburg, Tel. 0931 / 870276, E-Mail:<br />
fritz@flach-online.de<br />
die Zeitung noch immer fester Bestandteil<br />
des Lebens vieler Menschen. Besonders im<br />
Berufsfeld des Journalismus steige der<br />
Anteil der Frauen an, jedoch seien immer<br />
noch wenig Frauen in Führungspositionen<br />
tätig, was meist mit den Lebens- und<br />
Familiensituationen zusammenhänge. Vor<br />
allem das Vereinbaren von Karriere und<br />
Familie bzw. Kinderwunsch sei hier ein großes<br />
Problem, welches in der Natur der<br />
Tätigkeiten eines/r Journalisten/in liege. Oft<br />
müsse man sich entscheiden und es heiße:<br />
Karriere oder Familie. Doch an ihrer eigenen<br />
Biografie zeigte Frau Wirtz, dass man<br />
Lösungen finden und Chancen nutzen kann.<br />
Männer und Frauen seien heute flexibler<br />
und aufgeschlossener.<br />
Frau Wirtz appellierte an ihre Zuhörer,<br />
ihre Chancen zu nutzen, egal ob Mann oder<br />
Frau, und für das zu kämpfen, was einem am<br />
Herz liege.<br />
Veronika Hebben<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 59<br />
>>
Bbr. Erzbischof Dr. Reinhard Marx<br />
macht UNITAS Mut für die Zukunft<br />
MÜNCHEN. Trotz seines übervollen<br />
Terminkalenders nahm sich Bbr. Erzbischof<br />
Dr. Reinhard Marx am Samstag,<br />
13. Dezember 2008, am Nachmittag<br />
und Abend Zeit, das Vereinsfest<br />
Maria Immaculata gemeinsam<br />
mit den Bundesbrüdern seiner<br />
Kirchenprovinz zu feiern.<br />
Das Vereinsfest in St. Joseph, München<br />
Schwabing, an dem mehr als 80 Bundesbrüder<br />
mit ihren Angehörigen – insgesamt<br />
ca. 150 Personen – teilnahmen, begann mit<br />
den Vorstellungen der UNITAS-Vereine aus<br />
München, Augsburg und Regensburg durch<br />
die Senioren und die Vorsitzenden der Altherrenvereine.<br />
Diese schilderten dem Erzbischof<br />
die Anzahl der Aktiven und AHAH,<br />
ihre unitarische Vergangenheit und die<br />
aktuellen Veranstaltungen, so dass er sich<br />
ein genaues Bild über das unitarische Leben<br />
in seiner Kirchenprovinz machen konnte.<br />
Bbr. Dr. Dr. Thomas Lohmann, stellvertretender<br />
Vorsitzender des Altherrenbundes,<br />
stellte die Lebensdaten und den unitarischen<br />
Werdegang von Bbr. Reinhard Marx<br />
vor und dann folgten die Gedanken von Bbr.<br />
Reinhard Marx, auf die alle Teilnehmer<br />
sehnsüchtig gewartet hatten, um „ihren“<br />
Bundesbruder und Erzbischof näher kennen<br />
zu lernen.<br />
Bbr. Erzbischof Dr. Reinhard Marx bedankte<br />
sich ganz herzlich für die Einladung<br />
zum Vereinsfest, der er gerne gefolgt sei. In<br />
seinem ersten Jahr als Erzbischof der Erzdiözese<br />
München und Freising habe er viele<br />
60<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Einladungen von den verschiedensten Seiten<br />
erhalten. Viele wollten den neuen Erzbischof<br />
treffen. Da es sein eigener Wunsch<br />
sei, sich die Diözese bald vertraut zu<br />
machen, habe er inzwischen fast alle Landkreise<br />
und Dekanate besucht. Alle Einladungen<br />
könne er aber nicht annehmen.<br />
Hin und wieder erhalte er auch schon den<br />
Konzelebranten: P. Siegfried ofmCap, Erzbischof<br />
Bbr. Marx und Bbr. Pfr. Peter Krauss (v.l.)<br />
Volles Haus in St. Joseph, München-<br />
Schwabing: Bbr. Reinhard Marx, Erzbischof<br />
von München und Freising, feierte mit<br />
Münchener und Augsburger Unitariern das<br />
Vereinsfest<br />
v.l.: MUV-Senior Martin Steinberg, Thomas Lohmann, Reinhard Marx, P. Siegfried ofmCap, AHV-X<br />
Peter Koniczek<br />
wohlmeinenden Ratschlag, auf seine Gesundheit<br />
zuachten und sich nicht zu übernehmen.<br />
Oft würde dieser Ratschlag freilich<br />
direkt mit einer neuen weiteren Einladung<br />
und dem Wunsch eines Besuches<br />
des Erzbischofs verbunden.<br />
Lebensfreude in der<br />
unitarischen Gemeinschaft<br />
Auch wenn er als Erzbischof nicht mehr<br />
so intensiv am unitarischen Leben teilnehmen<br />
könne wie zu seinen studentischen<br />
Zeiten, fühle er sich der unitarischen Gemeinschaft<br />
immer noch sehr verbunden. Er<br />
ermunterte die Unitarier, das Leben und<br />
das Engagement für die UNITAS nicht vorrangig<br />
als Übernahme von Last und von<br />
Verantwortung zu verstehen. Im Vordergrund<br />
sollte eher die Freude stehen, etwas<br />
in und mit der unitarischen Gemeinschaft<br />
gestalten und formen zu können.
In seinem ersten Jahr als Erzbischof sei<br />
er in der Erzdiözese München und Freising<br />
sehr wohlwollend und freundlich aufgenommen<br />
worden. In keinem der Briefe, die<br />
Mitten unter Bundesbrüdern: Bbr. Reinhard Marx,<br />
Erzbischof von München und Freising,<br />
er zu seiner Einführung erhalten habe, sei<br />
Unmut darüber zu spüren gewesen, dass<br />
nun ein Westfale Erzbischof in München<br />
und Freising geworden sei. Sein erster Eindruck,<br />
dass Bayern und Westfalen sich gut<br />
verstehen, habe sich bestätigt.<br />
Kein Ende<br />
der Kirche in Sicht<br />
In seiner Ansprache ging Erzbischof<br />
Marx auch auf die Situation der UNITAS<br />
und der katholischen Kirche insgesamt ein.<br />
Bereits in seiner aktiven Zeit in den 70er<br />
Jahren habe es Stimmen gegeben, die der<br />
UNITAS keine große Zukunft und ihr baldi-<br />
ges Ende vorausgesagt hätten. Genauso<br />
habe es in der Geschichte der Kirche Situationen<br />
gegeben, die Anlass zu der Annahme<br />
lieferten, vom alsbaldigen Ende der<br />
Kirche auszugehen. Erzbischof Marx erinnerte<br />
hier an die Verschleppung von<br />
Papst Pius VI. 1799 im Zuge der französischen<br />
Besetzung des Kirchenstaates nach<br />
Valence in Frankreich, wo dieser bald darauf<br />
verstarb. Es habe zwar einige Zeit gedauert,<br />
bis sich die katholische Kirche von diesem<br />
Schlag erholt habe, aber bereits 100 Jahre<br />
später habe die Kirche, vor allem dank der<br />
zahlreichen tatkräftigen Laienbewegungen,<br />
so stark wie selten zuvor wieder da<br />
gestanden.<br />
Den Kern<br />
der Botschaft verkünden<br />
Voraussetzung dafür sei eine innere<br />
Öffnung und Wandlung. Dies gelte für die<br />
Kirche wie für die UNITAS. Dabei gehe es<br />
nicht darum, sich allem und jedem anzugleichen,<br />
bis jeder meinte mitmachen zu<br />
können. Vielmehr gelte es, den Kern der<br />
christlichen Botschaft engagiert und mit<br />
Freude zu leben und zu verkünden. Er<br />
ermunterte die unitarische Familie, sich<br />
dafür in München, Augsburg und Regensburg,<br />
aber nicht nur dort, gemeinsam zu<br />
engagieren. Dann brauche sich auch die<br />
UNITAS um ihre<br />
Zukunft nicht zu<br />
sorgen.<br />
Die anschließende<br />
hl. Messe<br />
feierte Bbr. Marx<br />
zusammen mit den<br />
Bundesbrüdern,<br />
ihren Angehörigen<br />
und der Gemeinde<br />
St. Joseph. In seiner<br />
Predigt stellte er<br />
Maria und Johannes<br />
den Täufer als<br />
Vorbild gerade im<br />
Advent vor. Nach<br />
dem gemeinsamen<br />
Abendessen<br />
Nach der Messe in St. Joseph<br />
Der Tölzer Geigenverein hatte die musikalische<br />
Gestaltung des Nachmittags und der<br />
Hl. Messe übernommen.<br />
mit Südtiroler Jause und Wein folgte ein<br />
bayerischer Adventsabend mit der Aufführung<br />
der Heiligen Nacht von Ludwig<br />
Thoma durch Bbr. Markus Fürst und den<br />
Tölzer Geigenverein, der bereits die musikalische<br />
Gestaltung des Nachmittags und der<br />
Hl. Messe übernommen hatte.<br />
Semper in unitate: Beim stimmungsvollen<br />
Ausklang<br />
Der offizielle Teil endete mit einem besonderen<br />
Dank an Bbr. Reinhard Marx und<br />
an die Organisatoren, besonders an das<br />
Ehepaar Bbr. Hermann Rötzer, der inoffizielle<br />
endete etwas später bei den Resten von<br />
Wein und Jause.<br />
Text: Bernhard Freitag, Thomas Lohmann,<br />
Bilder: Oskar Hilner und Dr. Karl-Heinz Gorges >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 61
62<br />
Bbr. Prof. Dr.<br />
Josef Anton Stüttler<br />
VORARLBERG/ÖSTERREICH.<br />
Nach langer schwerer Krankheit ist Bbr.<br />
Prof. Dr. Josef Anton Stüttler am 25. Februar<br />
<strong>2009</strong> in seinem Geburts- und<br />
Wohnort Tschagguns in Vorarlberg<br />
gestorben. Bbr. Stüttler war von 1972-<br />
1996 als Professor für die Lehrgebiete<br />
Sozialphilosophie und Politikwissenschaft<br />
einschließlich Sozialpolitik an<br />
der Katholischen Hochschule NRW,<br />
Abt. Köln tätig. Zuvor war er wissenschaftlicher<br />
Assistent an der Kommende<br />
in Dortmund und seit 1970<br />
zunächst hauptamtlich und dann als<br />
freier Mitarbeiter in der Zentrale des<br />
Kolpingwerkes Referent für Gesellschaftspolitik.<br />
In diesen Jahren hat Josef Anton<br />
Stüttler insbesondere im Kolping-werk<br />
und im Bund der Deutschen Katholischen<br />
Jugend mit seiner klaren Position<br />
und seinem fundierten Wissen die<br />
damals entwickelten Grundlagenpapiere<br />
mit geprägt. Der 1956 in Innsbruck<br />
rezipierte Bundesbruder war ein<br />
beeindruckender Mensch mit Ecken<br />
und Kanten. Prof. Dr. Maximilian<br />
Buchka formulierte das in seinen<br />
„Erinnerungen an Prof. Dr. Anton<br />
Stüttler“: „Mit ihm ist eines der letzten<br />
‚Originale‘ von uns gegangen, über die<br />
wir in der Anfangszeit der Katholischen<br />
Hochschule noch reichlich verfügten. …<br />
Sie waren Persönlichkeiten, die die Dozentenkonferenzen<br />
nicht zum ‚administrativen<br />
Tagesgeschäft‘ werden ließen,<br />
sondern die dafür sorgten, dass<br />
eine geistige Auseinandersetzung um<br />
die Hochschulideale stattfand.“<br />
Mir ist Bundesbruder Stüttler seit<br />
meinen Jahren beim BDKJ immer ein<br />
guter Freund und überaus wertvoller<br />
Ratgeber gewesen.<br />
Heinrich Sudmann<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Die Reisegruppe der Unitarier vor dem Matthias-Gymnasium in Breslau<br />
100 Jahre UNITAS Guestfalia-Sigfridia<br />
FRANKFURT. Zusammen mit dem AHZ UNI-<br />
TAS-Taunus unternahm der AHV UNITAS<br />
Guestfalia-Sigfridia als Auftakt zu seinem<br />
besonderen Jubiläum seine 14. Fahrt in Folge<br />
– diesmal ins eindrucksvolle Breslau.<br />
Vom 25.-29. September 2008 wandelten<br />
wir auf den Spuren unserer Väter, die 1909<br />
die Guestfalia-UNITAS und 1919 die Sigfridia-UNITAS<br />
in Breslau gegründet hatten.<br />
Unter sachkundiger Führung und bei herrlichem<br />
Wetter lernten wir unsere „Geburtsplätze“<br />
kennen, u. a. das Matthiasgymnasium,<br />
die Universität aus dem Jahre 1702, den<br />
mit fast 200 Metern Länge größten Barockbau<br />
Schlesiens, und seine prächtige Aula<br />
Leopoldina, das Vincenzheim und den<br />
Schweidnitzer Keller im historischen Rathaus,<br />
Stätten der WSWS und Convente.<br />
Einen besonderen Höhepunkt bildeten<br />
Bischofspalais und Dom, wo 1927 der Festgottesdienst<br />
zur GV mit unserem Bbr. Kardinal<br />
A. Bertram stattfand. Zwei Ziele der<br />
damaligen Exbummel wie der 700 m hohe<br />
Zobten, der Hausberg Breslaus, und das im<br />
Krieg nicht zerstörte St. Hedwigskloster in<br />
Trebnitz, 25 km nördlich von Breslau, standen<br />
auch auf dem Programm.<br />
Die Traditionskorporation UNITAS<br />
Guestfalia-Sigfridia feiert ihr 100-jähriges<br />
Stiftungsfest am 20. und 21. Juni <strong>2009</strong> in<br />
Frankfurt/Main.<br />
Hans-Leo Pabel, x-hc<br />
60 Jahre UNITAS Willigis Mainz<br />
MAINZ. Der 1926 gegründete W.K.St.V.<br />
UNITAS Mainz begeht am 20./21. Juni <strong>2009</strong><br />
nicht nur sein 83. Stiftungsfest, sondern zugleich<br />
das 60. Jahr seiner Rekonstituierung<br />
am 6.3.1949 unter dem neuen Namen<br />
UNITAS WILLIGIS Mainz.<br />
Mit dem Namen des Erzbischofs und<br />
Erzkanzlers des Reiches Willigis sollte zum<br />
Ausdruck gebracht werden, dass der Verein<br />
stets so fest für den Glauben eintreten und<br />
zugleich in Staat und Gesellschaft seinen<br />
Beitrag leisten will, wie Willigis dies mit dem<br />
Bau des Domes, der vor 1000 Jahren eingeweiht<br />
wurde und seitdem das Wahrzeichen<br />
von Mainz ist, und mit seiner Treue als kaiserlicher<br />
Berater getan hat.<br />
Der W.K.St.V. UNITAS Willigis Mainz und<br />
sein AHV würden sich sehr freuen, wenn<br />
viele Bundesbrüder und Bundesschwestern<br />
aus Nah und Fern aus Anlass dieses besonderen<br />
Stiftungsfestes ihre Mitfreude durch<br />
Teilnahme beim Festkommers am 20.6. im<br />
Kurfürstlichen Schloss und/oder am 21.6. bei<br />
der Festmesse und der anschließenden Akademischen<br />
Morgenfeier bezeugen wollten.<br />
Günther Ganz
UNITAS-SALIA BONN FEIERTE DAS DREI-KÖNIGS-FEST IM KÖLNER DOM<br />
„... mitten im kalten Winter ...“<br />
… diese Zeile aus dem Weihnachtslied<br />
„Es ist ein Ros entsprungen“ geht so geschmeidig<br />
über die Zunge. Ob wir das Lied<br />
auch am Tag der Heiligen Drei Könige im<br />
Kölner Dom gesungen haben, weiß ich gar<br />
nicht mehr. Gepasst hätte jedenfalls das<br />
Bild vom Blümlein im kalten Winter, also<br />
von etwas Schönem und Großartigem, das<br />
einem widerfährt, obwohl die Umstände<br />
gar nicht danach sind.<br />
Der 6. Januar brachte den Kölnern die<br />
kälteste Nacht seit Jahren. Im Hohen Dom<br />
gefror das Weihwasser. Trotz der klirrenden<br />
Vor dem Drei-Königs-Schrein im Kölner Dom: (von links)<br />
die Bundesbrüder VOP Benedikt Schwedhelm, sein Vater<br />
Walter Schwedhelm, der AHV-Vorsitzende Dr. Winfried<br />
Gottschlich und Senior Robert Weichselbaum<br />
Kälte strömten die Gläubigen zum abendlichen<br />
Pontifikalamt mit Prozession zum<br />
Drei-Königs-Schrein. Auch eine Gruppe der<br />
UNITAS-Salia in der Stärke von 15 Personen<br />
hatte sich auf den Weg nach Köln gemacht.<br />
Die Messe zelebrierte der Pariser Kardinal<br />
André Vingt-Trois. Einhellige Meinung der<br />
unitarischen Pilgerschar war, dass sie den<br />
Dom noch nie so feierlich erlebt hat: Die<br />
sechs Bischöfe am Altar, die dicken Weihrauchschwaden,<br />
der stimmgewaltige Chor,<br />
die funkelnden Lichter der Weihnachtsbäume,<br />
die Kerzen oben im Ostchor und<br />
natürlich der golden leuchtende Drei-<br />
Königs-Schrein. Die Luft war eisig, aber die<br />
Atmosphäre erwärmte das Herz<br />
und inspirierte den Geist.<br />
Kardinal Vingt-Trois hob in seiner<br />
Predigt hervor, dass sich die<br />
Heiligen Drei Könige auf Kenntnisse<br />
der Astronomie gestützt und im<br />
Lichte der Vernunft auf die Suche<br />
gemacht hätten. Im Kind von<br />
Bethlehem hätten sie dann das<br />
Licht Gottes gefunden.Wahrscheinlich<br />
hat sich Bbr. Benedikt Schwedhelm<br />
von den Heiligen Drei Königen<br />
leiten lassen und deshalb das<br />
Thema „Glaube und Wissenschaft“<br />
für das Kölner Vorortsjahr gewählt.<br />
Höhepunkt des Abends war<br />
dann die Prozession zum Drei-<br />
Königs-Schrein.<br />
Nach dem Pontifikalamt im Dom:<br />
In geselliger Runde im Gewölbekeller des<br />
Brauhaus Früh<br />
Inzwischen waren gut zwei Stunden<br />
vergangen und die Kälte forderte ihren<br />
Tribut. Nun hatten wir uns ein warmes<br />
Plätzchen, eine kräftige Stärkung und ein<br />
leckeres Kölsch wahrlich verdient. Was ist<br />
da besser geeignet, als der Gewölbekeller<br />
des Brauhauses Früh? Draußen fiel inzwischen<br />
das Thermometer auf minus 15 Grad<br />
Celsius. In der sternklaren Nacht fühlten<br />
sich die Bundesbrüder wie die Könige<br />
selbst.<br />
Dr. Winfried Gottschlich<br />
Frankfurter Verbindungen präsentieren sich neu an der Goethe-Universität<br />
FRANKFURT. Eine Initiative der Vereinigung<br />
der Akademikerverbände Frankfurt Rhein/<br />
Main (VAV) und der Johann-Wolfgang<br />
Goethe-Universität realisierte in den vergangen<br />
zwei Monaten das Projekt „Schaukästen<br />
für die Frankfurter Verbindungen“.<br />
Vorausgegangen war am 17. Januar 2008<br />
eine gemeinsame Vereinbarung von Uni-<br />
Präsident Prof. Dr. Rudolf Steinberg und dem<br />
VAV-Vorsitzenden Dr. Günter Paul über die<br />
Förderung der Zusammenarbeit zwischen<br />
Frankfurt am Main und der VAV. Ziel der<br />
Vereinbarung ist, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
zum gegenseitigen Nutzen<br />
die Beziehungen zwischen Ehemaligen,<br />
Freunden, Studierenden, und Mitarbeitern<br />
der Universität zu intensivieren und den<br />
Informationsaustausch insgesamt zu verbessern.<br />
Am 11. Dezember wurde der erste<br />
Schaukasten der Frankfurter Verbindungen<br />
auf dem Uni-Campus Riedberg bestückt.<br />
Der gleiche ist für das Klinikum vorgesehen.<br />
Zu sehen sind Kurzporträts der Verbindungen<br />
und Vereine – unter ihnen auch der<br />
UNITAS Rheno-Moenania Frankfurt. Auf<br />
dem Campus Westend wurden die Schaukästen<br />
im Januar montiert und Informationen<br />
in Bockenheim aufgehängt.<br />
Gegner der Korporationen haben bereits<br />
kurz darauf den erste Kasten beklebt und<br />
besprüht. Auch der AStA der Universität ist<br />
inzwischen aufmerksam geworden und beschäftigt<br />
die Hochschulleitung mit Anfragen<br />
über die Verbindungen, die dieser<br />
Vereinbarung angehören. Der AStA hat starke<br />
Bedenken, unterstellt eine Ungleichbehandlung<br />
der Studierendenschaft und<br />
bezeichnet die Kooperation mit Hochschulen<br />
als klares Indiz für „Vetternwirtschaft“.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 63<br />
>>
Der Präsident des rheinland-pfälzischen Landtages, Joachim Mertes, zu Gast bei UNITAS Trebeta in Trier<br />
Die Mischung macht’s! –<br />
Das Wintersemester der UNITAS Trebeta<br />
VON BBR. GEREON HELMES<br />
TRIER. Im Winter ist es kalt und dunkel.<br />
Wenn man morgens das Haus verlässt und<br />
einem der Nieselregen die Sicht durch die<br />
Brillengläser erschwert, in einen überfüllten<br />
Bus steigt, um den noch volleren Hörsaal<br />
zu erreichen, dann ist der Moment gekommen:<br />
Man freut sich auf den Abend.<br />
Man freut sich auf eine unitarische Runde.<br />
Im Semester ist die erste Gelegenheit die<br />
Semesterankneipe. Die Spannung auf das<br />
bevorstehende Semester entlädt sich in<br />
brausendem Gesang und dem Klirren der<br />
Krüge. Der Anfang ist gemacht.<br />
Zu Gast: Christa Klaß, MdEP<br />
Bei einem Vortrag durch die Europaabgeordnete<br />
Christa Klaß ergründete die<br />
Trebeta die Zukunft der Machtverhältnisse<br />
auf unserem Kontinent und fragte sich:<br />
„Brüssel, unsere neue Hauptstadt?“ Mit<br />
Frau Klaß besuchte uns eine gestandene<br />
64<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Politikerin, die uns Mut zusprach, die<br />
Herausforderungen der Zukunft anzunehmen,<br />
den deutschen Pessimismus abzulegen<br />
und an uns zu glauben. Wir erlebten<br />
eine Vollblutpolitikerin, die sich mit großem<br />
Engagement für die bessere Vermittlung<br />
des europäischen Gedankens einsetzt. Und<br />
dies betont in der Tradition von Bbr. Robert<br />
Schuman.<br />
Wir fechten nicht, aber wir spielen Fußball.<br />
Und so konnten wir unsere durch studentische<br />
Speisekultur gestählten Körper<br />
mit der Teilnahme am UNITAS-West-Turnier<br />
in Köln und dem Sieg im Turnier der katholischen<br />
Trierer Korporationen bewegen.<br />
Als Höhepunkt des Semesters ist die<br />
Philistrierungskneipe zu nennen. Den<br />
Hausgottesdienst zelebrierten die Bundesbrüder<br />
Andreas Müller und Hermann-Josef<br />
Reckenthäler, ein Gründungsmitglied der<br />
Trierer UNITAS.<br />
Mit dem Präsidenten des rheinlandpfälzischen<br />
Landtags, Joachim Mertes,<br />
diskutierten wir nach den Weihnachtsferien<br />
über den Zustand des deutschen<br />
Landtagspräsident Joachim Mertes<br />
Parteiensystems. Im Superwahljahr <strong>2009</strong><br />
sieht er für die Partei „Die Linke“ eine wichtige<br />
Wegmarke. In diesem Jahr entscheidet<br />
sich, ob sie sich nachhaltig in allen Parlamenten<br />
festsetzt oder nicht. Als Sozialdemokrat<br />
sei es schwierig, verlorene Schafe<br />
wieder einzufangen, da man Populismus<br />
nur mit noch größerem Populismus bekämpfen<br />
könne, so der Landtagspräsident.<br />
Dies sei nicht im Sinne einer verantwortungsbewussten<br />
Politik. In guter Atmosphäre<br />
stellte sich Mertes, der erstmals eine<br />
<strong>Studenten</strong>verbindung besuchte, den Fragen<br />
und freute sich zahlreiche Anregungen<br />
mit nach Mainz nehmen zu können.
Die Klausurphase beginnt und pünktlich<br />
wird das Semesterprogramm strammer.<br />
Ein Stiftungsfest bringt alle zusammen.<br />
Alte Herren kehren an ihren Studienort<br />
zurück, um mit der Aktivitas auf das<br />
Bestehen einer Gemeinschaft anzustoßen,<br />
die man erfinden müsste, wenn es sie nicht<br />
schon gebe. Mit Monsignore Dr. Georg<br />
Bätzing, dem Regens des Bischöflichen<br />
Priesterseminars zu Trier, konnten wir den<br />
Leiter der Institution gewinnen, aus dem<br />
die Trierer UNITAS einst entstanden ist. Der<br />
Regens berichtete über die aktuelle Situa-<br />
tion der Trierer Kirche und nahm Stellung<br />
zur Frage: „Manager oder Gottesmann. Zur<br />
Zukunft des priesterlichen Dienstes.“<br />
Bevor die Semester-Exkneipe die Erinnerungen<br />
an den Stress und die Anstrengungen<br />
des Semesters dahinraffte, besuchte<br />
die Trebeta mit einer Tagesfahrt die<br />
NSDAP-Ordensburg Vogelsang in der Eifel.<br />
Das Gelände, das bis 2005 als Truppenübungsplatz<br />
des belgischen Militärs genutzt<br />
wurde, ist seit 2006 der Öffentlichkeit<br />
zugänglich. Durch den gut erhaltenen<br />
Impressionen vom 52. Stiftungsfest im Kneipsaal des alten Winzerhauses der Trebeten<br />
Flottes Semester an der Ruhr<br />
UNITAS RUHRANIA MACHTE DAS „KLEEBLATT“ VOLL<br />
ESSEN. Mit der wohl ersten je geschlagenen<br />
„Altfrid-Kneipe“ machte<br />
UNITAS Ruhrania bereits im August<br />
2008 einen vorgezogenen Semesterstart,<br />
freute sich über zwei Burschungen<br />
und legte bis Februar <strong>2009</strong> mit<br />
vier Rezipierungen gleich nach: Der<br />
Ex-Convent zog ein zufriedenes Fazit.<br />
Dass sich das Leben der UNITAS an<br />
der Ruhr weiterentwickelt, stellt das<br />
angelaufene Semester auf dem Ende<br />
Mai 2008 eingeweihten „Feldschlößchen“<br />
deutlich unter Beweis. Gleich zur Antrittskneipe<br />
im Oktober sangen sich<br />
viele Gäste und Bundesbrüder durch<br />
die bestens vorbereiteten Ritualien, erstmals<br />
geschlagen von Senior Christoph<br />
Weyer. Der von Bundeslied und Nationalhymne<br />
eingerahmte Höhepunkt: Die<br />
Aufnahme von Neumitglied Damian<br />
Juretzki. Zwei weitere <strong>Studenten</strong> stellten<br />
formvollendet ihren Antrag auf einem<br />
Bierdeckel.<br />
Alles neu auf dem Haus<br />
Hatten im Sommer im Haus noch<br />
Austauschstudenten aus Frankreich und<br />
Polen gewohnt, gab es nun auch erstmals<br />
ein Programm für die neu zusammengefundene<br />
Hausgemeinschaft: Gemeinsam<br />
erkundeten sie den Stadtteil und besuch-<br />
Bau gewann man einen Einblick in die<br />
nationalsozialistische Architektur, die Art<br />
der Ideologievermittlung und den heute<br />
immer noch schwer zu erfassenden Zeitgeist<br />
des Dritten Reichs.<br />
Die Trebeta blickt auf ein gelungenes<br />
Semester zurück, das mit einem bunten<br />
Programm die Gemeinschaft stärkte.<br />
Im Winter ist es kalt und dunkel, aber in<br />
einer Pekesche friert man nicht.<br />
ten die historische Dauerausstellung auf<br />
Schloss Borbeck, der ehemaligen Residenz<br />
der Fürstäbtissinnen, von der aus das<br />
Reichstift Essen fast 1000 Jahre lang von<br />
Frauen regiert wurde. Gut besucht war<br />
auch eine ausgezeichnete Wissenschaftliche<br />
Sitzung, die lange vor dem Wahlsieg<br />
von US-Präsident Barack Hussein Obama<br />
Regina und Bbr. Andreas Rydzek (Bildvordergrund) hatten sich spontan und tatkräftig der dringend<br />
notwendigen Renovierung der im Januar 1960 von dem damaligen Ehrensenior Prälat Heinrich<br />
Portmann zuerst gesegneten Ruhranen-Fahne angenommen. Paramentenstickerin Frau Antonie<br />
Bürger in Erwitte restaurierte das kostbare Tuch mit dem Paulus-Dom zu Münster.<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 65<br />
>>
dessen Wahlsieg mit einer Probeabstimmung<br />
im UNITAS-Haus „Feldschlößchen“<br />
vorwegnahm. Eine gemeinsame<br />
WS mit dem AHZ Essen war dem<br />
Thema „Mystik“ gewidmet, zu dem Bbr.<br />
Dr. med. Otto Hermanns referierte. Zum<br />
Martinsfest versammelten sich die<br />
Aktiven mit dem AHZ Wuppertal-Niederberg<br />
zum Martinsgansessen in Essen-<br />
Werden.<br />
Aktiventag band alle Kräfte<br />
Insbesondere hielten den Verein die<br />
Vorbereitungen des Aktiventags zum<br />
Thema „Naturwissenschaft und Glaube“<br />
Mitte November in Atem. Nach einer ganzen<br />
Reihe von Planungsgesprächen und<br />
Arbeitseinsätzen stand die Logistik. Ein<br />
Einsatz, der sich lohnte: Über 100 Aktive<br />
hatten sich zum Bundestreffen an der Ruhr<br />
angesagt, die Unterbringung und Exkursion<br />
nach Werden machten mit der Region vertraut,<br />
die Wissenschaftsarbeit im Don<br />
Bosco-Gymnasium konnte sich sehen lassen<br />
und über 200 Gäste feierten den Festkommers<br />
auf Schloss Borbeck – zahlreiche<br />
Artikel in der Presse berichteten.<br />
Während als letzter Bauabschnitt ein<br />
über 50 Quadratmeter großer Wintergarten<br />
am „Feldschlößchen“ entstand, trafen<br />
sich die Ruhranen mit Krankenhauspfarrer<br />
Berthold Boenig aus Oberhausen zur<br />
Besinnung im Advent, stürzten sich aber<br />
auch in verdiente Fidulitäten: Sie schwangen<br />
wie jedes Jahr zu Anfang Dezember das<br />
Tanzbein beim traditionellen Barbaraball<br />
des örtlichen CV-Zirkels „Kohle“ im Schloss,<br />
eine Nikolaus-Kneipe würdigte den Schutzpatron<br />
der <strong>Studenten</strong> und das Vereinsfest<br />
brachte nach der Messe eine hervorragende<br />
Morgensitzung von Bbr. Rüdiger Duckheim<br />
zum Thema „Maria Immaculata et<br />
Assumpta – Typos des erlösten Menschen“;<br />
eine gute Gelegenheit, dem langjährigen<br />
Antreiber des Vereins zum bestens bestandenen<br />
Diplomtheologen zu gratulieren.<br />
Eine zünftige Feuerzangenbowle zum<br />
gleichnamigen Film und eine professionell<br />
vorbereitete rauschende Silvesterparty mit<br />
fast 100 Besuchern markierten den Jahresabschluss,<br />
ein Neujahrsempfang versammelte<br />
Mitglieder aus den UNITAS-Zirkeln<br />
der Region zum Start ins Jahr <strong>2009</strong>.<br />
Wissenschaft<br />
mit aktuellen Themen<br />
Engagierte Debatten brachte eine Wissenschaftliche<br />
Sitzung zum bevorstehenden<br />
50. Jahrestag der Verkündigung des II.<br />
Vatikanischen Konzils, mit der unerwartet<br />
die wesentlichen Themen der Ereignisse<br />
der folgenden Wochen vorweggenommen<br />
wurden. Bei der gut besuchten Veranstaltung<br />
legte Referent Pastor Heinrich Grafflage<br />
von St. Dionysius Essen-Borbeck den<br />
66<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Aktiven besonders das Konzilsdokument<br />
„Nostra Aetate“ ans Herz, stellte sich den<br />
Fragen zur „Alten Messe“ und traditionalistischen<br />
Strömungen in der Kirche.<br />
Zum Höhepunkt des Semesters wurde<br />
das 98. Stiftungs- und Vereinsfest Ende<br />
Januar. Intensive Debatten prägten den CC<br />
am Nachmittag, der sich sehr grundsätzlich<br />
Fragen stellte. Sie galten etwa dem Umgang<br />
mit den unterschiedlichen Traditionen,<br />
in die sich der aktive UNITAS-Verein im<br />
Revier bewusst gestellt hat, aber auch sehr<br />
praktischen Aspekten: Besonders unterstrichen<br />
wurden der große Einsatz unterschiedlicher<br />
Kreise um den Bau und Betrieb<br />
des 2008 eingeweihten neuen UNITAS-<br />
Zentrums, die Verpflichtungen gegenüber<br />
dem Gesamtverband, die Formen der<br />
Unterstützung für das Wachsen einer jungen<br />
Generation in der Region und die gute<br />
Entwicklung der Hausgemeinschaft.<br />
Fahnenweihe<br />
zum 98. Stiftungsfest<br />
Zur eigenen gottesdienstlichen Feier<br />
wandelte sich der Conventsaal mit schnellen<br />
Handgriffen rasch zur Kapelle: Vor der<br />
Segnung der restaurierten Münster-Fahne<br />
griff der Altherrenvereins-Vorsitzende Kaplan<br />
Helmut Wiechmann das Thema der<br />
Tradition auf, erinnerte an die Bedeutung<br />
des Zeichens für die Gemeinschaft. Das<br />
Kreuz und die Nachfolge Jesu seien das<br />
bestimmende Element des unitarischen<br />
Lebensbundes – auch in Zukunft müsse die<br />
ursprünglich aus Münster stammende<br />
Fahne dafür immer stehen, betonte der<br />
Geistliche Beirat des Verbandes, segnete<br />
das Tuch und die Gottesdienstgemeinde.<br />
Ihr gab er mit dem aus dem Lukas-<br />
Evangelium entnommenen Wort „Wer im<br />
Geringsten treu ist, der ist auch im Großen<br />
treu“ (16,10) einen wichtigen Gedanken<br />
mit: Sich Einzuüben „Im Kleinen treu“ zu<br />
sein. In den Fürbitten nahm die Gemeinde<br />
die Lebenden und Verstorbenen ins Gebet.<br />
Die Feier schloss mit dem Te Deum.<br />
Den Festvortrag nach dem gemeinsamen<br />
Abendessen in der Hausgastronomie<br />
widmete Bbr. P. Benedikt Kisters vom Redemptoristenkloster<br />
Bottrop-Kirchhellen<br />
dem ältesten Verbandspatron der UNITAS,<br />
dem Hl. Thomas von Aquin (1225 bis 1274).<br />
Vor zahlreichen Gästen zeichnete er dessen<br />
Leben nach und umriss die äußeren Bedingungen<br />
der rastlosen Forscher- und Lehrtätigkeit<br />
des Kirchenlehrers aus dem Orden<br />
der Dominikaner. Deutlich strich Pater<br />
Benedikt die bleibenden Leistungen des<br />
Wissenschaftlers heraus, der als solcher als<br />
Erster in den Kreis der Heiligen gezählt<br />
wurde: Im dem von ihm geschaffenen versöhnten<br />
Gleichgewicht von Theologie und<br />
Philosophie, von Glaube und Wissenschaft,<br />
liege auch wesentlich Grundlage und<br />
Antrieb für die Gemeinschaft und<br />
Prinzipien der UNITAS, so der Festredner,<br />
dem die Corona mit großem Applaus für<br />
seine Ausführungen dankte.<br />
Im hochoffiziellen Teil erlebte die Corona<br />
mit dem Bundeslied die feierliche<br />
Aufnahme von zwei Neumitgliedern: Neue<br />
Ruhranen sind Philipp Ast (21) aus Neuss,<br />
Student der Wirtschaftsinformatik, und<br />
Benedikt Koch (22) aus Essen-Bergerhausen,<br />
angehender Wirtschaftsingenieur an<br />
der FH Gelsenkirchen mit dem Schwerpunkt<br />
„Facility Management“. Nicht nur<br />
zwei neue Aktive schlossen sich der UNITAS<br />
Ruhrania an: Auch Bauingenieur Heinrich<br />
Loosen wurde vom AHV-Vorsitzenden<br />
ebenso offiziell in die Altherrenschaft aufgenommen<br />
und vom Essener Zirkel mit<br />
einer Erinnerungsurkunde ausgestattet.<br />
Themen weiterer Wissenschaftlicher<br />
Sitzungen waren „Paulus und der Kopftuchstreit“<br />
(Bbr. StR i. R. Richard Laudage) und<br />
„Franz Kafka im Wandel unserer Tage“ (Bbr.<br />
stud. mus. ecc. Christoph Weyer, X), bevor<br />
ein gelungenes Semester bei der Ex-Kneipe<br />
unter den Tisch geschlagen wurde. Gäste<br />
von UNITAS Rhenania Bonn, UNITAS Rheinfranken<br />
und UNITAS Hetania erlebten eine<br />
weitere Neuaufnahme: Matthias Meyke,<br />
Student der Kirchenmusik, machte das<br />
Kleeblatt der Neu-Ruhranen in einem erfolgreichen<br />
WS 2008/09 voll. Zum Sommersemester<br />
sind alle neun Zimmer im<br />
„Feldschlößchen“ wieder komplett vermietet.<br />
Zum Treiben an der Ruhr und über vielfältige<br />
Themen informiert die neugestaltete<br />
Homepage des Vereins: Innerhalb von<br />
sieben Monaten verzeichnete sie inzwischen<br />
über 9.000 Besucher.<br />
Adresse: www.unitas-ruhrania.org.
Die prachtvolle „neue alte“ Fahne der Vindelicen<br />
VON BBR. KARLHEINZ SIEBER<br />
Wie es sich gehört: mit einer Keilkneipe<br />
schlug am 18.10.1958 die Geburtsstunde der<br />
UNITAS Vindelicia. Allerdings erfolgte die<br />
Gründung nicht, wie der Historiker sagen<br />
würde, „aus wilder Wurzel“, sondern mit<br />
und durch Bundesbrüder, die der UNITAS<br />
Guelfia München angehörten, aber in und<br />
um Augsburg wohnten und wegen der<br />
ungünstigen Zugverbindungen nur unter<br />
Mühen am Vereinsleben in München teilnehmen<br />
konnten. Es ehrt die Guelfia, die<br />
wir Augsburger deshalb unsere Mutterkorporation<br />
nennen, dass sie die Neugründung<br />
in Augsburg durch einen regelrechten<br />
eigenen Aderlass möglich machte.<br />
Zwölf Bundesbrüder aus den Reihen der<br />
Guelfia und ein neu hinzugekommener bildeten<br />
die Aktivitas des SS 1959: German<br />
Baumgärtner, Norbert Beier, Hans-Georg<br />
Benkart, Theo Fischer, Martin Geiger, Winfried<br />
Kiefer, Hans Masching, Ludwig Mayr,<br />
Peter Mayr, Klaus Nowotny, Hugo Seiter,<br />
Hans Stöffel und Konrad Müller. Drei dieser<br />
Bundesbrüder sind bereits verstorben, drei<br />
sind aus der Korporation ausgetreten, und<br />
sechs sind bis heute Mitglieder.<br />
Drei Bundesbrüder aus dem Gründungsteam<br />
waren beim Stiftungsfest anwesend:<br />
Der erste Senior, Bbr. Norbert Beier,<br />
der Consenior und Scriptor, Bbr. Dr. Klaus<br />
Nowotny, und Hans Masching, Consenior<br />
des WS 1959/60. An diesen Beginn zu erinnern<br />
und die amicitia als eines unserer<br />
Verbandsprinzipien zu feiern, war Aufgabe<br />
des Stiftungsfestes, das, wie es gute unitarische<br />
Tradition ist, einen feierlichen Gottesdienst<br />
und einen Festkommers umfasste.<br />
Den Gottesdienst in der Kirche St.<br />
Wolfgang in Augsburg-Spickel zelebrierte<br />
unser Bbr. Bischof em. Manfred Müller, der<br />
trotz seines fortgeschrittenen Alters spontan<br />
seine Zusage gegeben hatte. Wir Augsburger<br />
Unitarier haben ja Erfahrung mit<br />
den Gottesdiensten „unseres“ Bischofs und<br />
50 Jahre UNITAS Vindelicia<br />
Augsburg<br />
wussten, dass wir uns wieder einmal auf<br />
eine ebenso würdige wie gehaltvolle Messe<br />
freuen durften, die, über die liturgischen<br />
Texte hinaus, wesentlich von der fordernden<br />
Predigt bestimmt war, in der Bbr.<br />
Müller einen Vergleich zwischen Leben und<br />
Wirken des Nobelpreisträgers Max Planck<br />
und den Prinzipien der UNITAS: virtus,<br />
scientia, amicitia, exemplifizierte. Über<br />
„scientia“ wird man bei einem so hoch<br />
dekorierten Naturwissenschaftler nicht<br />
lange sinnieren müssen. Weniger bekannt<br />
dürfte vielen Zuhörern der persönliche Mut<br />
Plancks den Nationalsozialisten gegenüber<br />
gewesen sein, mit dem er ihm Nahestehende<br />
zu schützen versuchte, und die Ernsthaftigkeit<br />
und Aufrichtigkeit seines Forschens<br />
und vor allen Dingen Denkens über<br />
den eigenen Horizont der<br />
Physik hinaus.<br />
Immer wieder flocht<br />
Bbr. Müller dabei auch liebevolle<br />
und ehrende Gedanken<br />
an einen anderen<br />
unserer lieben Bundesbrüder<br />
ein, Weihbischof<br />
em. Rudolf Schmid, der seines<br />
hohen Alters wegen<br />
nicht am Stiftungsfest teilnehmen<br />
konnte, durch die<br />
immer wiederkehrenden<br />
Hinweise aber präsent gesetzt<br />
wurde und so auf<br />
eine geistige Weise teil-<br />
STIFTUNGSFEST AM 29.11.<strong>2009</strong><br />
Bbr. Bischof em. Manfred Müller<br />
nehmen konnte. Den kräftigen Gesang „ad<br />
maiorem dei gloriam“ begleitete unser Bbr.<br />
Michael Stocker v Orlando gekonnt vom<br />
Orgeltisch aus. Bei der schwachbrüstigen,<br />
in Teilen schon defekten Orgel war wirkliches<br />
Können gefragt.<br />
Neue Vereinsfahne<br />
Nicht weit weg von der Kirche, im Atrium<br />
der Handwerkskammer Schwaben, fand<br />
das Stiftungsfest seine Fortsetzung. Einen<br />
ebenso realen Blickpunkt wie auch einigendes<br />
Symbol stellte unsere restaurierte<br />
Vereinsfahne dar, die im Festsaal vor dem<br />
Präsidium in fast luftiger Höhe hing und die<br />
Geschichte der Vindelicia repräsentierte.<br />
Ehe jedoch Essen und Kommers über<br />
die Bühne gehen konnten, hatte der Vorsitzende<br />
des Altherrenvereins, StD i. R. Karlheinz<br />
Sieber, zu einem kurzen Konvent<br />
gebeten zur Regelung der Beitragsverhältnisse<br />
im Altherrenverein, die der Kassier,<br />
Bbr. Werner Haible, auf der Basis eines<br />
Kassenberichts erläuterte. Die Tatsache,<br />
dass dieser Tagesordnungspunkt praktisch<br />
ohne Diskussion abgearbeitet und die vorgeschlagene<br />
Lösung einstimmig angenommen<br />
wurde, zeigte, wenn auch vielleicht<br />
aus einer eher ungewohnten Optik,<br />
auch ein Stück „amicitia“. Diese bewährte<br />
sich, wie der Vorsitzende ausführte, auch in<br />
dem hohen Spendenaufkommen für die<br />
4.500,- Euro teure Restaurierung unserer<br />
schon in die Jahre gekommenen und verschlissenen<br />
Vereinsfahne, so dass eine<br />
zugesagte Bürgschaft für die Kosten der<br />
Fahnenerneuerung nicht in Anspruch<br />
genommen werden musste. Durch eine<br />
Einzelspende in Höhe von 750,- Euro konnte<br />
eine zusätzliche Pekesche angeschafft wer- >><br />
Bunte Chargia formierte sich: vorne UNITAS München,<br />
das Präsidium hinten<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 67
den, die auch einen etwas „stärkeren“<br />
Chargierten der Vindelicia elegant aussehen<br />
lässt.<br />
Die Großzügigkeit der räumlichen Verhältnisse<br />
bewährte sich schon während des<br />
Altherrenkonvents, denn die Damen konnten,<br />
ohne sich ausgeschlossen fühlen zu<br />
müssen, warme oder kalte Getränke in<br />
einem Nebenraum zu sich nehmen und<br />
miteinander Gespräche führen und Kontakte<br />
knüpfen, was vielleicht in Begleitung<br />
der jeweiligen Herren jedenfalls in der<br />
stattgehabten Weise, nicht möglich gewesen<br />
wäre.<br />
Inzwischen hatte wohl jeder Hunger.<br />
Mancher wird vielleicht, in Erwartung des<br />
abendlichen Buffets, das Mittagessen<br />
bescheidener gehalten oder gar ausfallen<br />
lassen haben, und so wurde dem vom Koch<br />
des Hauses lecker zubereiteten und ansehnlich<br />
präsentierten umfangreichen italienischen<br />
Buffet wacker zugesprochen. Am<br />
Nachtischbüffet bedienten sich sogar den<br />
ganzen Abend hindurch Jung und Alt. Auch<br />
hier bewährte sich wieder die Großzügigkeit<br />
der Räumlichkeiten, denn das Büffet<br />
war in einem großen Foyer aufgebaut, so<br />
dass man gemütlich und ohne Drängeleien<br />
anstehen und seine mehr oder minder<br />
gefüllten Teller in den Saal tragen konnte.<br />
Manche Nachspeise, etliche Tassen Kaffee<br />
oder Tee und viele kalte Getränke wurden in<br />
diesem Foyer auch im Stehen eingenommen,<br />
so dass eine wohltuende Entzerrung<br />
stattfand und sich zwanglos Gesprächsgruppen<br />
bilden konnten.<br />
Festkommers mit Gästen<br />
Den Höhepunkt des Abends bildete aber<br />
natürlich der Festkommers, der von Bbr.<br />
Martin Rudert (x), Bbr. Markus Wamser (xx)<br />
und Bbr. Jürgen Immler (xxxx) geschlagen<br />
wurde. Es war uns eine große Freude, Abordnungen<br />
befreundeter Augsburger Korporationen<br />
in Vollwichs begrüßen zu dürfen:<br />
von der KDStV Algovia im CV, der Burschenschaft<br />
Rheno-Palatia und der Landsmannschaft<br />
Suevia. Und natürlich freuten<br />
Das Präsidium: Martin Rudert (X), Markus Wamser (XX)<br />
und Jürgen Immler (XXXX)<br />
68<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Der Bierorgler Bbr. Werner Haible, stv. Vors. des AHV<br />
wir uns besonders über die Vertreter e. l.<br />
Schwesterkorporation UNITAS München, in<br />
der, seit der Vereinigung, auch unsere<br />
Mutterkorporation Guelfia anwesend war.<br />
Der Vorortspräsident Benedikt Schwedhelm<br />
Nachdem der Einzug mit klangvoller<br />
Hilfe unseres Bierorglers Bbr. Werner Haible<br />
würdig und ansehnlich vonstatten gegangen<br />
und der Kommers mit kräftigem Gesang<br />
auch musikalisch ansprechend eröffnet<br />
worden war, gaben uns die Vertreter<br />
sämtlicher anwesender befreundeter Korporationen<br />
die Ehre ihrer Grußworte, die<br />
teils launig und teils sinnig-hintersinnig<br />
auf den runden Geburtstag der UNITAS<br />
Vindelicia anspielten. Wenn auch nur ein<br />
Bruchteil der guten Wünsche in Erfüllung<br />
geht, dann steht der Vindelicia eine glänzende<br />
Zukunft bevor.<br />
Glückwünsche<br />
zum Fest<br />
Den Glückwünschen<br />
schlossen sich der Vorortspräsident,<br />
Bbr. Benedikt<br />
Schwedhelm, als<br />
Vertreter des Verbandes,<br />
und der stellvertretende<br />
Vorsitzende des Altherrenbundes,<br />
Bbr. Dr. Dr. Lohmann,<br />
der die Vindelica<br />
auch seine Heimat nennen<br />
kann, für den Altherrenbund<br />
an. Für den Altherrenverein<br />
der Vindelicia als<br />
Organisator des Stifungs-<br />
festes sprach schließlich dessen Vorsitzender,<br />
Bbr. Karlheinz Sieber, der einen kurzen<br />
Rückblick auf die Geschichte der Vindelicia<br />
gab. Ein wesentlicher Teil seiner Ausführungen<br />
beschäftigte sich mit Grundgedanken<br />
unseres Verbindungslebens:<br />
„Was ist an dieser UNITAS Vindelicia<br />
dran, dass ihr acht Bundesbrüder aus dem<br />
Jahre 1958 und viele andere, die später in<br />
unsere Korporation eintraten, z.T. bis zum Tod<br />
die Treue gehalten haben und noch immer<br />
halten? Oder dass der Festredner des heutigen<br />
Abends spontan seine Reise zu einem<br />
wissenschaftlichen Kongress in Brasilien um<br />
einen Tag verschiebt, um zu uns sprechen zu<br />
können?“ Den zugrunde liegenden „unitarischen<br />
Wesenskern“ benannte Bbr. Sieber<br />
dann mit einer zunächst überraschenden<br />
Definition: „Ein Unitarier ist ein anständiger<br />
Katholik. Ein Unitarier ist ein neugieriger<br />
Mensch, den interessiert, was um ihn herum<br />
in den vielfältigen Bereichen der Wissenschaft<br />
über die Lebensbedingungen auf<br />
unserem Planeten erforscht und entdeckt<br />
wird. Ein Unitarier freut sich, wenn seine<br />
Verbindung ihm die Gelegenheit vermittelt,<br />
mit Gleichgesinnten ... in vertrautem Kreis<br />
beisammen zu sein.“<br />
Der Stv. Vorsitzende des AHB, Bbr. Dr. Thomas<br />
Lohmann<br />
Der Vors. des AHV, Karlheinz Sieber v/o Taurus
Mit der Überleitung<br />
„Doch Wunder gibt es<br />
immer wieder“ kam er<br />
schließlich auf die Tatsache<br />
zu sprechen, dass<br />
die 2.000 suspendierte<br />
Aktivitas 2004 wieder erstanden<br />
ist und heute<br />
mit neun jungen Bundesbrüdern<br />
in Blüte steht.<br />
Dieser Neubeginn ist mit<br />
dem Namen des jetzigen<br />
Diakons und früheren<br />
<strong>Studenten</strong> der Theologie<br />
Benedikt Gruber verbunden und insofern<br />
eine glückliche Fügung, als Benedikt –<br />
gewissermaßen ins Blaue hinein – eine<br />
katholische <strong>Studenten</strong>verbindung suchte,<br />
deren Zusammenkünfte stets donnerstags<br />
stattfanden, an jenem Tag, an dem er im<br />
Priesterseminar Ausgang hatte. Unter allen<br />
Augsburger katholischen <strong>Studenten</strong>verbindungen<br />
trifft sich nur die Vindelica am<br />
Donnerstag – und so begann das aktive<br />
Leben wieder.<br />
Der Beifall, der allen Rednern reichlich<br />
gespendet wurde, machte deutlich, dass die<br />
Worte die beabsichtigte Wirkung erreicht<br />
hatten.<br />
Festredner Bbr. Prof. Dr. Jochen Litterst<br />
Unitarische Scientia<br />
Wie es sich für eine wissenschaftliche<br />
<strong>Studenten</strong>verbindung gehört, war eines der<br />
zentralen Ereignisse des Abends ein wissenschaftlicher<br />
Vortrag, gehalten von dem<br />
der Vindelicia zugehörigen, jetzt aber in<br />
Braunschweig lebenden und an der dortigen<br />
Technischen Universität lehrenden Bbr.<br />
Prof. Dr. Jochen Litterst vom Institut der<br />
Physik der kondensierten Materie. „Citius –<br />
altius – fortius in der Physik. Wozu?“ lautete<br />
der Titel seines anspruchsvollen Vortrages,<br />
der vor allem deshalb imponierte,<br />
weil ein auf der Höhe modernster Forschung<br />
stehender Wissenschaftler nicht<br />
blinden Zukunftsglauben predigte oder<br />
utopische Möglichkeiten aus dem Entwicklungspotenzial<br />
der Physik vorstellte. Vielmehr<br />
zeigten seine vielfältigen Rückgriffe<br />
auf antike Erkenntnisse, in welcher ungebrochenen<br />
Tradition auch die moderne<br />
Physik steht und in welchem Maße Er-<br />
Zusammen 300 Semester Vindeliciae:<br />
Norbert Beier, Dr. Claus Nowotny, Hans Masching<br />
kenntnisse dieser scheinbar längst vergangenen<br />
und damit angeblich überholten Zeit<br />
im „System“ der Physik, in ihren nach wie<br />
vor vorhandenen Problemen, in ihrem<br />
Streben nach Wahrheit und wissenschaftlicher<br />
Sicherheit und in der Interaktion zwischen<br />
den Forschungsinhalten und dem<br />
Forscher noch heute gültig und virulent<br />
sind. Geschickt ließ der Referent diese Überlegungen<br />
in eine kurze Erläuterung der<br />
wohl modernsten physikalisch-technischen<br />
Anlage der Gegenwart ausklingen: das<br />
„Large Hadron Collider Projekt“, dessen<br />
befürchtete Möglichkeit, „schwarze Löcher“<br />
zu produzieren, die am Ende die Erde vernichten<br />
könnten, erst jüngst in entsprechenden<br />
(sicher nicht unitarischen) Kreisen<br />
für Zukunftsängste gesorgt hatte.<br />
Der Vortrag war insgesamt ein Musterbeispiel<br />
für das unitarische Prinzip der<br />
„scientia“. Die Disziplin, mit der alle Anwesenden<br />
den wahrhaftig anspruchsvollen,<br />
akustisch leider nicht optimal vermittelten<br />
Vortrag verfolgten und der lang<br />
anhaltende, herzliche Applaus verdeutlichten,<br />
dass das zunächst etwas spröde anmutende<br />
Thema des Vortrags nicht nur bestens<br />
aufbereitet worden war, sondern dass<br />
die Botschaft eines „demütigen“ Physikers<br />
die Herzen der Zuhörer erreicht hatte.<br />
Die Chargen mit Bbr. Bischof Müller<br />
nach dem Kommers<br />
Der Rest des offiziellen Teiles gehörte<br />
wieder dem studentischen Comment mit<br />
Liedern, einem zünftigen Salamander, den<br />
Dankesworten und sinnigen Bemerkungen.<br />
Und in den großzügig gewährten Colloquien<br />
bewährte sich die unitarische amicitia<br />
ein ums andere Mal. Viele der ca. 80<br />
Anwesenden nutzten die Gelegenheit zu<br />
Gesprächen und Plausch mit Unitariern, die<br />
z.T. von weit her angereist waren, die schon<br />
länger nicht mehr an einer Veranstaltung<br />
teilgenommen hatten oder die man, wie<br />
unsere lieben Münchner AHV-Gäste, die<br />
respektabel vertreten waren, der Umstände<br />
wegen eben selten trifft. Erstaunlich, wie<br />
lange unser Bbr. Bischof em. Manfred<br />
Müller unter uns blieb und mit wie vielen<br />
Unitariern, Damen und Gästen, er sich<br />
unterhielt; in der guten alten Zeit hätte<br />
man, lobend und ohne Hintersinn gesagt:<br />
leutselig unterhielt. Als Senior eine solch<br />
bedeutende Veranstaltung zu leiten und<br />
durch seine Reden und sein Wesen zu gestalten,<br />
war sicher eine nicht übliche<br />
Herausforderung, die Bbr. Martin Rudert<br />
mit verständlicher Nervosität, aber, wie<br />
seine Conchargen auch, mit Bravour bestanden<br />
hat.<br />
Der Ausklang zog sich lange hin, ein<br />
Zeichen dafür, wie sehr es die Teilnehmer<br />
genossen, in einem angenehmen Ambiente,<br />
in lockerer Atmosphäre und eben<br />
unter Freunden zu plaudern (Das Nachspeisenbüffet<br />
war, wenn auch stetig<br />
kleiner werdend, immer noch aufgebaut!)<br />
Die Letzten, the braves of the braves, verließen<br />
den Tagungsort gegen 1.00 Uhr<br />
morgens.<br />
Wenn es eines Beweises bedurft hätte,<br />
was unsere Prinzipien in der Praxis taugen:<br />
Dieser Nachmittag und Abend hätten ihn<br />
erbracht. Wie zur Belohnung tauchten nach<br />
dem Ende des offiziellen Teiles noch einige<br />
eingeladene Spähfüchse auf – ein hoffnungsvolles<br />
Zeichen in die Zukunft.<br />
Dass dem Zelebranten, Bbr. Bischof em.<br />
Manfred Müller, dem unermüdlich planenden<br />
und arbeitenden Vorsitzenden des Altherrenvereins,<br />
Bbr. Karlheinz Sieber, dem<br />
Organisten Bbr. Michael Stocker, dem<br />
Bierorgler Bbr. Werner Haible, dem vorzüglichen<br />
Referenten des Abends, Bbr.<br />
Prof. Dr. Jochen Litterst und dem den<br />
Kommers schlagenden Präsidium<br />
jeweils eigener und besonderer<br />
Dank gebührt, versteht sich von<br />
selbst.<br />
Ein herzlicher Dank, der sich vielfach<br />
schon zwischen den Zeilen findet,<br />
sei aber auch noch einmal an<br />
alle die ausgesprochen, die in den<br />
Sielen oder im Verborgenen gearbeitet<br />
haben, die mit Spenden und Rat<br />
zur Stelle waren, die sich auch unattraktiven<br />
Arbeiten nicht verweigert<br />
haben und all denen, die durch ihr<br />
Dasein, ihre Gesprächsbereitschaft und ihre<br />
Freude die wohltuende Atmosphäre gestaltet<br />
und erhalten haben.<br />
Möge sich das erfüllen, was alle Redner<br />
der Vindelicia gewünscht haben: „Vivat floreat<br />
crescat UNITAS Vindelicia ad multos<br />
annos.“<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 69
Bbr. Erzbischof Marx<br />
Ehrenbürger von Geseke<br />
GESEKE. Bbr. Reinhard Marx (55), Erzbischof<br />
von München und Freising, wurde am 27.<br />
Dezember 2008 in Geseke die Ehrenbürgerschaft<br />
seiner westfälischen Geburtsstadt<br />
verliehen. Durch seine Popularität habe<br />
Marx die 21.000 Einwohner zählende westfälische<br />
Stadt über die Grenzen Deutschlands<br />
hinaus bekannt gemacht, so die Begründung<br />
des einstimmigen Stadtratsbeschlusses<br />
vom 2. September 2008. Er setze<br />
sich trotz beruflicher Belastung weiter für<br />
die Belange von Geseke ein und pflege trotz<br />
der großen Entfernung engsten Kontakt zu<br />
seiner westfälischen Heimatstadt sowie zu<br />
diversen heimischen Vereinen und Institutionen.<br />
An der Verleihung der Ehrenbürgerurkunde<br />
im Festsaal des Gymnasiums<br />
Antonianum durch Bürgermeister Franz<br />
Holtgrewe nahmen neben den Honoratioren<br />
der Stadt auch zahlreiche Bürger<br />
Gesekes teil. Grußworte für die Geseker<br />
Geistlichkeit, die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft<br />
von 1412 e.V., die Geseker<br />
Vereine und den Freundes- und Bekanntenkreis<br />
von Marx sprachen Pfarrer<br />
Uwe Schläger, Bbr. Oberst Dr. Friedel Bergmann,<br />
Hans-Peter Busch und Heidrun<br />
Schnieders.<br />
Laudatio von Erzbischof Becker<br />
Erzbischof Becker würdigte Marx in seiner<br />
Laudatio als einen Mann festen Glaubens.<br />
Er lebe seinen Glauben aus einer klaren<br />
Beziehung zum gekreuzigten und auferstandenen<br />
Herrn Jesus Christus: „Es ist<br />
dieser Glaube, der ihn fasziniert und herausfordert:<br />
Gottes Geschichte mit dem<br />
Menschen, das Ringen um Freiheit und Gerechtigkeit<br />
in der Welt. Es ist dieser Glaube,<br />
der ihn zieht, weit über sich hinaus, über<br />
seine Heimat, seine Denkmuster, ihn in die<br />
Weite führt, neugierig werden lässt gegenüber<br />
Neuem und Fremden, ihn fragen und<br />
suchen lässt.“ Mit seinem<br />
sozialen Engagement<br />
nach den Prinzipien<br />
der katholischen<br />
Soziallehre bringe Marx<br />
„zentrale christliche Positionen<br />
in den gesellschaftlichen<br />
Diskurs ein<br />
– und das ist notwendig“,<br />
sagte Becker. „Er<br />
verweist auf die Unterscheidung<br />
zwischen<br />
Marktwirtschaft und<br />
Kapitalismus, plädiert<br />
für die Stärkung der<br />
Familien. Er ruft nach<br />
Zügeln, die der Markt<br />
braucht, nach Moral, ohne die jeder Staat<br />
verkommt.“<br />
Bild (v.l.): P. Fritz Kretz, Sr. Basina Kloos, Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, Erzbischof Reinhard Marx,<br />
Landtagspräsident Joachim Mertes, Rektor Heribert Niederschlag und Diözesanadministrator<br />
Robert Brahm feierten die Ehrendoktorwürde, Quelle: www.bistum-trier.de<br />
Marx selbst erklärte in seiner Dankesrede,<br />
er habe schon als Kind entdeckt, dass<br />
Geseke auf der Welt einmalig sei. Geseke sei<br />
für ihn Heimatstadt, auf die er stolz sei. Er<br />
freue sich über die ihm erteilte Würde, denn<br />
als neuer Ehrenbürger könne er eindeutig<br />
sagen: „Ich bin Geseker, ich bin jetzt Bürger<br />
von Geseke, egal wo ich wohne und lebe“.<br />
Den neuen Ehrenbürger ehrten die St.<br />
Sebastianus-Schützenbruderschaft, die Musiker<br />
der Stadtkapelle und des Tambourkorps<br />
mit einem großen Zapfenstreich.<br />
Dabei erklang auf ausdrücklichem Wunsch<br />
von Marx nicht nur das „Westfalenlied“,<br />
sondern auch die Bayernhymne.<br />
Ehrendoktorwürde<br />
der Hochschule Vallendar<br />
Für seine Verdienste um die Soziallehre<br />
ist der Erzbischof von München und Freising<br />
am 22. Januar mit der<br />
Ehrendoktorwürde der<br />
Philosophisch-Theologischen<br />
Hochschule des<br />
Pallottinerordens in Vallendar<br />
ausgezeichnet<br />
worden. „Er engagiert<br />
sich für Arbeitslose und<br />
Menschen am Rand der<br />
Gesellschaft. So wird<br />
die Kirche als eine caritative<br />
und solidarische<br />
Gemeinschaft erfahren“,<br />
hieß es in der Begründung<br />
der von der<br />
Ordensgemeinschaft<br />
der Pallottiner und der<br />
Waldbreitbacher Sankt Elisabeth GmbH<br />
getragenen Hochschule. Seiner Mithilfe sei<br />
es zu zu verdanken, dass die Hochschule,<br />
bisher ausschließlich für <strong>Studenten</strong> der<br />
Theologie, um eine pflegewissenschaftliche<br />
Fakultät erweitert werden konnte. Er<br />
ermöglichte damit die unmittelbar bevorstehende<br />
Anerkennung als Katholische<br />
Hochschule. Für Bbr. Marx war es die erste<br />
Ehrenpromotion.<br />
Laudatio des Ministerpräsidenten<br />
„Sie sind ein Christ des Wortes und der<br />
Tat“, sagte der nordrhein-westfälische<br />
Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) in<br />
seiner Laudatio anlässlich der Verleihung.<br />
Marx' Handeln gebe den Menschen Mut<br />
und Hoffnung: „Machen Sie weiter!“ Marx<br />
bringe „immer wieder ins Bewusstsein,<br />
dass das Potenzial der Sozialen Marktwirtschaft<br />
noch lange nicht ausgeschöpft<br />
ist“. Marx bringe immer wieder ins Bewusstsein,<br />
dass „das Potenzial der Sozialen<br />
Marktwirtschaft noch lange nicht ausgeschöpft<br />
ist. Und dass die inneren Wahrheiten<br />
der christlichen Soziallehre Bestand<br />
haben.“<br />
Der CDU-Politiker erinnerte in diesem<br />
Zusammenhang an die Gründergeneration<br />
der Bundesrepublik: „Ihr Kapital war<br />
die Soziale Marktwirtschaft, die gegründet<br />
war in der Ablehnung eines freibeuterischen<br />
Kapitalismus, in der Ablehnung eines<br />
menschenverachtenden Sozialismus, und<br />
die gegründet war auf den Fundamenten<br />
der Christlichen Soziallehre.“ Die Gesellschaft,<br />
die die Soziallehre vorzeichne, sei<br />
eine Gesellschaft, für die Wirtschaft mehr<br />
sei als Geld. „Und in der Kredit nicht nur<br />
etymologisch etwas mit Glaubwürdigkeit<br />
und Vertrauen zu tun hat“, so Rüttgers.<br />
CB<br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 75
OStD a. D. Dr. Karl Brackertz<br />
WÜRZBURG/BERLIN. Heimgegangen in<br />
Gottes Frieden ist am 21. Januar <strong>2009</strong> Oberstudiendirektor<br />
a. D. Dr. Karl Brackertz (UNI-<br />
TAS-Arminia und UNITAS-Würzburg) aus<br />
Estenfeld bei Würzburg im 95. Lebensjahr.<br />
Im Februar 1932 wurde er bei UNITAS-Arminia<br />
zu Berlin rezipiert, wo er sich nach einem<br />
Zwischensemester bei der Norica zu Innsbruck<br />
als Fuxmajor und Schriftführer engagierte.<br />
Nach Staatsexamen und Promotion<br />
zum Dr. phil. wurde er 1939 zum Kriegsdienst<br />
eingezogen und kehrte 1947 aus russischer<br />
Kriegsgefangenschaft zurück. Von<br />
1953 bis 1962 leitete er das Kant-Gymnasium<br />
in Berlin-Spandau und anschließend für<br />
sechs Jahre die deutsche Schule in Barcelona,<br />
bis er als Oberstudiendirektor am<br />
Siemensgymnasium wiederum in Berlin<br />
pensioniert wurde. Beseelt vom christlichen<br />
Erziehungs- und Bildungsideal stand nach<br />
Nazi- und Kriegszeit die Neubesinnung und<br />
Reform der Pädagogik im Mittelpunkt seiner<br />
Arbeit. Bezogen auf unsere heutige<br />
Diskussion und Suche nach pädagogischer<br />
Neuorientierung zeigen seine Ausführungen<br />
beim Festvortrag auf dem Stiftungsfest<br />
der UNITAS-Berlin am 8. Februar 1953 eine<br />
bemerkenswerte Aktualität:„Es fehlt denen,<br />
die diesen Neubau ausführen wollen, an<br />
einem Plan, der von einem für alle verpflichtenden<br />
Leitbild beherrscht ist, an einem<br />
absoluten Zentrum, das die Maßstäbe für<br />
Ziel und Weg der gesteckten Aufgabe liefern<br />
könnte. Und so begnügt man sich mit einem<br />
provisorischen Bau, an dem man ständig<br />
Veränderungen vornimmt. Man ist fast<br />
versucht, an den Turmbau zu Babel zu denken,<br />
so groß ist die geistige Zerklüftung der<br />
untereinander dissoziierenden Weltanschauungen,<br />
Wertsysteme und Parteien, die<br />
bei der Gestaltung des Werkes mitbestimmen<br />
wollen.“ (UNITAS 4/1953).<br />
Mit seiner Ehefrau Beate, die er als Volksschullehrerin<br />
in Berlin kennen lernte, konnte<br />
76<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
�IN<br />
MEMORIAM<br />
er am 31. Mai 2002 im Kreis der beiden<br />
Söhne Michael und Rainer und der Tochter<br />
Claudia nebst vier Enkelkindern das Goldene<br />
Ehejubiläum feiern. Seine zutiefst unitarische<br />
Überzeugung und das Durchdrungensein<br />
von unseren Prinzipien prägten<br />
auch seine Familie und führten dazu, dass er<br />
mit seinen Söhnen, beide rezipiert bei UNI-<br />
TAS-Berlin, ein unitarisches Triumvirat gründen<br />
konnte.<br />
Die Suche nach einem adäquaten Alterssitz<br />
führte das Ehepaar nach Estenfeld,<br />
wo Bbr. Brackertz B-Philister bei der Hetania<br />
wurde und sich dem Würzburger Altherrenzirkel<br />
anschloss. Anfangs unterrichtete der<br />
großartige Kenner alter Sprachen noch am<br />
Würzburger Röntgen-Gymnasium Latein<br />
und an der Volkshochschule Spanisch und<br />
widmete sich dann den Erstübersetzungen<br />
griechischer Originaltexte, so den Traumbüchern<br />
des Artemidor von Daldis, des Achmed<br />
ben Sirin und der Volks-Traumbücher<br />
des byzantinischen Mittelalters (erschienen<br />
bei dtv). Eines der dort veröffentlichten<br />
Traumbilder traf auch auf unseren geistreichen<br />
und mit feinsinnigem Humor begabten<br />
Bundesbruder selbst zu: „Kühles Wasser<br />
aus einer Quelle zu schöpfen, verheißt ein<br />
langes Leben.“<br />
Fritz Flach, UNITAS-Würzburg<br />
Bbr. Pfarrer Josef Panzer<br />
BAMBERG. Unter großer Anteilnahme seiner<br />
Pfarrangehörigen und vieler Fahnenabordnungen<br />
der ansässigen Vereine wurde<br />
unser plötzlich verstorbener Bbr. Pfarrer Josef<br />
Panzer aus Litzendorf am 5. Dezember<br />
2008 im Priestergrab am Chor der Dientzenhofer-Pfarrkirche<br />
St. Wenzeslaus zur<br />
letzten Ruhe gebettet.<br />
Im Trauergottesdienst, an dem die<br />
Chargen der Aktivitas von UNITAS Henricia<br />
Bamberg in Vollwichs und mit Fahne teilgenommen<br />
haben, erinnerte AHx Bbr. Roland<br />
Weißhaupt an die Verdienste, die sich Bbr.<br />
Panzer in über 50-jähriger Treue zur Henricia<br />
erworben hat. Im Februar 1955 hatte er sich<br />
der UNITAS bei der Henricia angeschlossen<br />
und war am 12. März 1961 zum Priester<br />
geweiht worden. Seit seinem Eintritt in den<br />
Ruhestand betätigte er sich gerne als<br />
Zelebrant bei den Semestergottesdiensten<br />
und schätzte das Gespräch in der Runde der<br />
Aktiven, wo seine klare Aussage und sein<br />
sicherer Standort allseits geschätzt wurden.<br />
Über 30 Jahre arbeitete er als unermüdlicher<br />
Seelsorger in seiner Pfarrei, zu der vier<br />
Filialkirchen zählen, und initiierte aus seiner<br />
Leidenschaft für die Orgelmusik viele<br />
Konzerte in der prächtigen Barockkirche mit<br />
Mitgliedern der weltbekannten Bamberger<br />
Symphoniker. Requiescat in pace !<br />
Dieter Heim, Bamberg<br />
UNITAS in Paderborn trauert<br />
um Johannes Gradys<br />
PADERBORN. Bbr. Pfarrer i. R. Johannes<br />
Gradys ist am 16. Dezember 2008 heimgegangen<br />
zu Gott. Verwandte und Freunde<br />
trauern um einen liebenswürdigen Mitmenschen<br />
und Bundesbruder. Johannes<br />
Gradys wurde am 24. Juni 1923, am Johannistag,<br />
in Stadtoldendorf im Bistum<br />
Hildesheim geboren. Nach seinem Abitur in<br />
Holzminden 1942 wurde er zum Kriegsdienst<br />
eingezogen und geriet bei Kriegsende<br />
in russische Gefangenschaft. Erst<br />
1949 konnte er in seine Heimat zurückkehren.<br />
Er begann dann seine theologischen<br />
Studien in Münster und Paderborn. Am 6.<br />
März 1955 wurde er in Hildesheim zum<br />
Priester geweiht.<br />
Danach wirkte er segensreich als Vikar<br />
und Pastor in verschiedenen Orten des weiten<br />
Hildesheimer Bistums. Zuletzt war er<br />
Pfarrer in Bodenwerder an der Weser.<br />
Aufgrund seiner angegriffenen Gesundheit<br />
wurde er 1984 in den Ruhestand ver-
setzt. 1985 kam er als Pensionär nach Paderborn<br />
und wirkte lange Zeit nach Kräften in<br />
der Seelsorge der Bonifatius-Gemeinde mit.<br />
In dieser Zeit nahm er als Mitglied unserer<br />
Paderborner unitarischen Familie an<br />
vielen unserer Veranstaltungen teil, er war<br />
häufig Zelebrant unserer Gottesdienste.<br />
Auch sonst war sein geistliches Wort geschätzt,<br />
zum Beispiel bei den Fahrten des<br />
Volksbundes Kriegsgräberfürsorge und in<br />
anderen Gruppierungen seiner neuen Heimat.<br />
In den letzten Jahren zwang ihn der<br />
schlechtere Gesundheitszustand leider<br />
zum Verzicht auf viele Tätigkeiten.<br />
Wir danken ihm an dieser Stelle, dass er<br />
für uns und viele andere da war.<br />
Josef Kitten,<br />
für die UNITAS in Paderborn<br />
Bbr. Dr. med.<br />
Hubertus Schmidt<br />
HAGEN. Der AHZ Hagen ist traurig über den<br />
Verlust seines treuen Mitglieds Bbr. Dr.<br />
med. Hubertus Schmidt, der am 18.12.2008<br />
in der Nachbarstadt Ennepetal-Voerde mit<br />
82 Jahren verstorben ist. Er stammte aus<br />
Soest (*02.08.1926) und fand im Sommersemester<br />
1950 als Mitglied Nr. 776 zur traditionsreichen<br />
UNITAS Sugambria in Münster,<br />
die ihn mit dem Amt des Conseniors im<br />
Wintersemester 1951 betraute.<br />
Nach dem Physikum setzte er sein Medizinstudium<br />
in Innsbruck fort und beendete<br />
es in Münster, wo er 1955 philistriert<br />
wurde. Nach der Promotion ging er als<br />
Wissenschaftlicher Assistent an die Medizinische<br />
Universitätsklinik in Würzburg, wo<br />
er die internistische Facharztanerkennung<br />
am Luitpold-Krankenhaus erwarb. Dann<br />
zog es ihn wieder nach Westfalen.<br />
An der Klinik Königsfeld der Deutschen<br />
Rentenversicherung Westfalen in Ennepetal<br />
wirkte er über viele, viele Jahre, erst als<br />
Chefarzt, dann als Leitender Medizinal-<br />
Direktor. Hier hatte er Patienten mit Herz-,<br />
Kreislauf-, Gefäß- und orthopädischen Erkrankungen<br />
sach- und fachgerecht zu betreuen,<br />
damit sie nach der Rehabilitation<br />
wieder in ihr Berufs- und Privatleben fanden.<br />
Seine verständnisvolle Art wird schon<br />
allein viel zur Heilung beigetragen haben.<br />
Zusammen mit seiner lieben Frau<br />
Hanne hatte er zwei Töchter und einen<br />
Sohn, denen dann sechs Enkel und zwei Ur-<br />
enkel folgten. Als Vater war er ruhig und<br />
ausgeglichen. „Erziehen ist Begleiten!“, das<br />
war immer seine Richtschnur. Im Ruhestand<br />
traf ihn als Arzt ein hartes Schicksal:<br />
Er hatte fast zehn Jahre lang unter der<br />
Parkinson-Krankheit zu leiden und war auf<br />
die Pflege seiner lieben Frau angewiesen,<br />
die ihn auch zu unseren Veranstaltungen<br />
begleitete.<br />
Sechs unitarische Freunde kamen am<br />
Tag vor Weihnachten aus Hagen zu seiner<br />
Totenmesse und Beisetzung in Ennepetal.<br />
Von ihm ging immer eine positiv gestimmte,<br />
liebenswürdige Heiterkeit aus, eine angenehme,<br />
warme Menschlichkeit. Zusammen<br />
mit den Angehörigen können auch wir<br />
nur sagen: Wir haben in Hubertus einen lieben<br />
Menschen verloren. R. i. p.<br />
Dr. Thankmar Sauerland, AHZ Hagen<br />
Bbr. Gisbert Gehling<br />
PADERBORN. Am 22. September 2008 ist in<br />
Paderborn Bbr. Gisbert Gehling nach kurzer<br />
schwerer Krankheit verstorben. Bbr. Gehling<br />
ist am 20. Juni 1927 in Herten geboren<br />
und in Coesfeld aufgewachsen. Unterbrochen<br />
durch die Zeit als Luftwaffenhelfer<br />
im zweiten Weltkrieg absolvierte er im<br />
Jahre 1947 das Abitur in Coesfeld. Im Dezember<br />
1948 begann er das Studium der<br />
Rechtswissenschaften an der Westfälischen<br />
Landesuniversität in Münster.<br />
Am 24. Januar 1950 trat Bbr. Gehling der<br />
UNITAS Winfridia bei. In den Jahren 1953<br />
und 1954 war Bbr. Gehling der erste Vorortspräsident<br />
der UNITAS. Nach Abschluss<br />
des Studiums im Jahre 1952 und der Referendarzeit<br />
im Jahre 1956 war Bbr. Gehling<br />
zunächst bei dem Amtsgericht Sulingen als<br />
Rechtsanwalt zugelassen, seit Juni 1958 bei<br />
dem Amts- und Landgericht Paderborn. Die<br />
Bestellung zum Notar erfolgte im November<br />
1961. Beruflich war Bbr. Gehling als<br />
Rechtsanwalt und Notar mit Tätigkeitsschwerpunkt<br />
im Zivilrecht bis zum Jahre<br />
2003 tätig.<br />
Seit 1955 war Bbr. Gisbert Gehling mit<br />
Christa Gehling, geb. Jungeblodt, verheiratet.<br />
Neben dem Beruf galt sein Engagement<br />
und Aufmerksamkeit insbesondere<br />
der wachsenden Familie mit 10 Kindern, deren<br />
väterlicher Mittelpunkt er war. In den<br />
letzten Jahren galt seine besondere Freude<br />
den 25 Enkelkindern.<br />
In Paderborn wirkte Bbr. Gehling als<br />
langjähriger Vorsitzender der UNITAS<br />
Hathumar dabei mit, den unitarischen<br />
Gedanken auch in Ostwestfalen hochzuhalten.<br />
Sozial engagierte sich Bbr.<br />
Gehling ca. 30 Jahre lang als Vorsitzender<br />
des erzbischöflichen Familienerholungswerkes.<br />
Insbesondere für diese Tätigkeit<br />
erhielt er zum 70. Geburtstag den päpstlichen<br />
Silvesterorden.<br />
Egon Wenzel, Nottuln<br />
Bbr. Franz Dehn<br />
MARBURG/WÜRZBURG. Am 13. Januar<br />
<strong>2009</strong> verstarb unser lb. Bundesbruder<br />
Lehrer a. D. Franz Dehn, UNITAS Franko-<br />
Saxonia Marburg und UNITAS Würzburg<br />
aus Thüngen, im Alter von 69 Jahren. Er<br />
wurde im WS 1969 in Marburg rezipiert und<br />
studierte Lehramt für Grund- und Hauptschule.<br />
Beruflich tätig war er in Thüngen,<br />
wurde B-Philister bei UNITAS Würzburg und<br />
war mit seiner Ehefrau Karin gern gesehener<br />
Gast im Würzburger Zirkel, bis eine<br />
Krankheit sein Betätigungsfeld einschränkte.<br />
Vor drei Jahren kam eine weitere heimtückische<br />
Krankheit hinzu.<br />
Bei meinen Besuchen am Krankenbett,<br />
versicherte er mir immer wieder, wie wichtig<br />
ihm die UNITAS und deren Prinzipien<br />
seien und dass er lebenslang an ihnen festgehalten<br />
habe.<br />
Ein gütiger und menschenfreundlicher<br />
Gott möge ihn aufnehmen in seine himmlische<br />
Herrlichkeit.<br />
Fritz Flach, UNITAS Würzburg<br />
Bbr. Dr. Max Schüle<br />
ROTTWEIL/HÜFINGEN. Die Nachricht vom<br />
Tode unseres lieben Bundesbruders Dr. Max<br />
Schüle erfüllte uns mit großer Trauer. Bbr.<br />
Max war der Nestor unseres Altherrenzirkels<br />
Schwarzwald-Baar.<br />
Geboren am 25.3.1914, trat er im Juni<br />
1933 nach dem Abitur der wissenschaftlich<br />
katholischen <strong>Studenten</strong>verbindung UNITAS<br />
Eckhardia Freiburg bei.<br />
Seit der Neuorganisation der Altherrenzirkel<br />
gehörte Bbr. Max dem Zirkel Schwarzwald-Baar<br />
an und hielt bis in die letzten<br />
Jahre – seit er nicht mehr gehen konnte – >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 77
immer telefonischen Kontakt mit der<br />
Vereinsführung, besonders aber mit den<br />
„jungen“ Eckharden. Am 28. Januar <strong>2009</strong> ist<br />
er gestorben.<br />
Wir werden seiner im Gebet gedenken<br />
und wünschen ihm, er möge ruhen in<br />
Gottes Frieden.<br />
Alois Batsch<br />
Für den AHZ Schwarzwald-Baar<br />
Dr. Ernst-Ulrich Fahlbusch<br />
WARENDORF. Ulrich wurde am 7. Juli 1955 in<br />
Warendorf als zweites Kind der Eheleute Dr.<br />
Friedrich und Elisabeth Fahlbusch geboren.<br />
1974 legte er am Gymnasium Laurentianum<br />
das Abitur ab und studierte in Münster Medizin.<br />
Dort wurde er im Juni 1975 Bundesbruder<br />
der UNITAS Rolandia und zum<br />
1.1.1980 philistriert. Nach seinem Wehrdienst<br />
(zuletzt Hauptmann d.R.) absolvierte<br />
er die Facharztausbildung für Allgemeinmedizin<br />
und übernahm die Hausarztpraxis<br />
seines Vaters, die er Tag und Nacht bis zu<br />
seinem unerwarteten Tod führte. Dr. med.<br />
Ernst-Ulrich Fahlbusch engagierte sich besonders<br />
im UNITAS-Altherrenzirkel Warendorf,<br />
im Bürgerschützenverein und in der<br />
Marktbogengemeinschaft. Muße bereitete<br />
ihm das Geigenspiel, Großzügigkeit und Familiensinn<br />
zeichneten ihn aus. R.i.p.<br />
Prof. Dr. Ing.<br />
Roland Kammel<br />
BERLIN. Bbr. Dr. Ing. Roland Kammel,<br />
Hochschullehrer an der TU Berlin, ist am<br />
17. Januar <strong>2009</strong> gestorben. Geboren am<br />
10. Januar 1925 in Schatzlax/Riesengebirge,<br />
hatte er sich im Juni 1950 der UNITAS<br />
Assindia in Aachen angeschlossen.<br />
Als Universitätsprofessor am TU-Institut<br />
für Metallische Werkstoffe, legte er<br />
zahlreiche Publikationen vor und war seit<br />
1981 Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft<br />
für Galvano- und Oberflächentechnik<br />
(DGO). Den Ehrendoktor verliehen<br />
ihm die Keio-Universität in Tokio und die<br />
Universität in Kosice, Slowakei.<br />
Bbr. Kammel ertrug seine vielen schweren<br />
Krankheiten mit bewundernswert heiterer<br />
Haltung. An seinem 84. Geburtstag<br />
wollte er wie so oft in die Philharmonie,<br />
musste aber am Vortag, bereits sehr ge-<br />
78<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
schwächt, in die Charlottenburger Schlosspark-Klinik<br />
gebracht werden. Dort ist er,<br />
umgeben von seinen nächsten Angehörigen,<br />
ruhig entschlafen.<br />
Er war ein engagierter Forscher, anerkannt,<br />
geehrt und ausgezeichnet auf den<br />
Gebieten der Galvanotechnik und der<br />
Hydrometallurgie. Zu Wissenschaftlern in<br />
aller Welt hatte er enge Kontakte. Seine<br />
Vortragsreisen führten ihn in alle Kontinente.<br />
Er war ein liebevoller und gütiger<br />
Mensch, ein erfolgreicher Lehrer, tolerant<br />
und großzügig im Umgang mit seinen<br />
<strong>Studenten</strong> und Mitarbeitern, um den seine<br />
Familie und Freunde im In- und Ausland<br />
trauern.<br />
Bbr. Hans Witz<br />
LÖRRACH. Am 1.März diesen Jahres verstarb<br />
in Lörrach Bundesbruder Hans Witz, der am<br />
28.7.1911 in Freiburg im Breisgau geboren<br />
worden war. Seine Schulzeit absolvierte er<br />
an der damaligen Oberrealschule in<br />
Lörrach. Nach dem Abitur 1931 studierte er<br />
Germanistik, Anglistik und Romanistik an<br />
den Universitäten in Basel und Freiburg, wo<br />
er im Juni 1931 in der UNITAS Eckhardia rezipiert<br />
worden ist. Philistriert wurde er am<br />
1.Januar 1935. Erste Erfahrungen im Lehrberuf<br />
sammelte er an seiner früheren<br />
Schule. 1941 holte ihn der Krieg ein. Dem<br />
Einsatz in Russland folgte Gefangenschaft<br />
und Zwangsarbeit in der Ukraine, von wo er<br />
erst 1949 zurückkehrte. Es folgten berufliche<br />
Stationen an der Handelsschule in Lörrach,<br />
in Rastatt und Walldürn. 1957 heiratete<br />
er seine Frau Mathilde. Nach seiner<br />
Rückkehr an die Handelsschule in Lörrach<br />
wurde er 1959 Oberstudienrat und 1973<br />
Studiendirektor. Und trug wesentlich bei<br />
zum Aufbau des kaufmännischen Schulwesens<br />
im Kreis Lörrach. 1976 wurde er pensioniert.<br />
Im Lörracher Altherrenzirkel war er<br />
immer ein gerne gesehener Gast, der der<br />
Runde oft durch sein immenses Wissen aus<br />
der Verlegenheit half. Regelmäßig versorgte<br />
er die Bundesbrüder mit sorgfältig erarbeiteten<br />
Wortfamilien und etymologischen<br />
Worterklärungen. Nachdem seine Frau<br />
2002 gestorben war, lebte er noch Jahre<br />
alleine in seiner Wohnung, zuletzt in einem<br />
Pflegeheim. Wir werden ihm immer ein<br />
ehrendes Gedenken bewahren.<br />
Grischa M. Freimann<br />
Gedenkt unserer<br />
verstorbenen Bundesbrüder<br />
Bbr. Realschullehrer i.R. Heinz Deitermann<br />
aus Haselünne, geboren am<br />
27.5.1937, rezipiert bei UNITAS Ravensberg<br />
in Vechta im November 1963 und<br />
philistriert zum 1.4. 1966, ist am 1.1.<strong>2009</strong><br />
gestorben.<br />
Bbr. Schulleiter und Lehrer i.R. Friedrich<br />
Kinski aus Bad Honnef, geboren am<br />
31.5.1924, aktiv seit Juni 1954 und philistriert<br />
zum 1.1.1956, ist am 17.12.<strong>2009</strong> verstorben.<br />
Bbr. Wirtschaftsberater und Steuerberater<br />
Dipl.-Kfm. Lothar Mader aus<br />
München, geboren am 21.11.1931, rezipiert<br />
im Juni 1955 bei UNITAS München<br />
und philistriert zum 1.1.1958, ist am<br />
16.9.2008 verstorben.<br />
Bbr. StD a.D. Walter Metzger aus Freiburg,<br />
geboren am 15.1.1912, aktiv seit<br />
Juni 1932 bei UNITAS Rheno-Danubia<br />
Freiburg, ist am 22.1.<strong>2009</strong> verstorben.<br />
Bbr. Dipl.-Ing. Ernst Schamberg aus<br />
Voerde, geboren am 23.11.1928, rezipiert<br />
im Juni 1952 bei UNITAS Silesia Aachen<br />
und AH seit 1.1.1956, ist am 31.12.2008<br />
verstorben.<br />
Bbr. Dipl.-Kfm. und Steuerberater Dr.<br />
Ferdinand Schuster aus Ravensburg,<br />
geboren am 30.1.1936, rezipiert im<br />
Januar 1956 bei UNITAS Rheno-Palatia<br />
Mannheim und philistriert zum 1.1.1961,<br />
ist nach drei im letzten Jahr erlittenenen<br />
Schlaganfällen am 22.1.<strong>2009</strong> gestorben.<br />
Bis zuletzt war er im UNITAS-<br />
Zirkel Ravensburg aktiv.<br />
Bbr. Tierarzt Werner Steinigeweg aus<br />
Lehrte, geboren am 3.1.1948 und aktiv<br />
seit Dezember 1967 bei UNITAS Langobardia<br />
Hannover, AH seit 1.1.1974, ist am<br />
15.1.<strong>2009</strong> verstorben.<br />
Bbr. StD a.D. Heinrich Traugott Veith aus<br />
Karlsruhe, geboren am 3.9.1927, rezipiert<br />
im Februar 1950 bei UNITAS Bavaria und<br />
anschließend aktiv bei UNITAS Heidelberg,<br />
philistriert zum 1.1.1953, ist am<br />
5.8.2008 verstorben.<br />
R.i.P.
Auch „Pro Ethik“<br />
Leserbrief zu „Berlin: Nachrichten<br />
aus Skandalistan“,<br />
in „UNITAS“3-4/2008, S. 222<br />
Berlin ist neben Bremen das einzige<br />
Bundesland in der Bundesrepublik, das<br />
Religion nicht als Pflichtwahlfach anbietet,<br />
sondern man kann es als Zusatzwahlfach<br />
belegen. Als Pflichtfach steht hier bis jetzt<br />
Ethik auf den Stundenplänen der Schüler.<br />
Als überzeugter Christ müsste man<br />
demnach auch die von unserem <strong>Unitas</strong>-<br />
Verband begrüßte „Pro Reli“-Aktion für gut<br />
heißen, sodass die Schüler zwischen Religionsunterricht<br />
und Ethik wählen können.<br />
Ich betrachte das Ganze jedoch etwas<br />
differenzierter. Natürlich wäre es gut, wenn<br />
jungen Menschen, die sich für eine Religion<br />
interessieren, diese ihnen auch im Unterricht<br />
nahe gebracht würde, und sie sich somit<br />
für Religionsunterricht entscheiden<br />
könnten. Ich bin jedoch der Meinung, dass<br />
dem Religionsunterricht der Ethikunterricht<br />
nicht weichen darf. Berlin ist eine große<br />
Metropole, die im Vergleich zu den meisten<br />
Regionen Deutschlands sehr viel multikultureller<br />
ist und somit ganz anderen Herausforderungen<br />
gewachsen sein muss, was die<br />
Integration und das friedliche Miteinander<br />
verschiedener Kulturen angeht.<br />
Wie uns schon die Ringparabel in „Nathan<br />
der Weise“ lehrt, werden die meisten<br />
Menschen in eine Religion hineingeboren<br />
und leben ein Leben, das ihnen von den älteren<br />
Generationen vorgelebt wird. Somit<br />
können gerade Kinder und Jugendliche<br />
reichlich wenig dafür, welchen Glauben sie<br />
leben. Ein Beispiel für die positiven Auswirkungen<br />
des Ethikunterrichts: Im Unterricht<br />
reden Remzi, der einer islamisch-türkischen<br />
Familie entstammt, und Michael, der<br />
einen eher konservativ-christlichen Hintergrund<br />
hat, miteinander über Religion,<br />
Ethik und Moral. Der eine lernt etwas über<br />
die westliche Weltanschauung, der andere<br />
über interessante Gegebenheiten fremder<br />
Kulturen mit denen er bisher noch nicht in<br />
Kontakt geraten ist. Es entsteht unter der<br />
Leitung von professionell geschultem Lehrpersonal<br />
ein Dialog, der sehr wichtig für<br />
eine heranwachsende Generation in einer<br />
Viel-Völker-Stadt ist. So trägt der Ethik-<br />
Unterricht massiv zu einer Völkerverständigung<br />
und einem friedlichen Nebeneinander<br />
von Kulturen bei.<br />
Des Weiteren ist Berlin ohnehin wohl<br />
das „heidnischste“ Pflaster, das es in<br />
Deutschland zu finden gibt. Durch die freie<br />
Wahl zwischen Ethik und Religion wird man<br />
den „Ungläubigen“ auch nicht dazu bewegen<br />
können, katholischen oder evangelischen<br />
Religionsunterricht zu wählen. Wer<br />
wirklich Interesse hat, besucht schon jetzt<br />
den zusätzlich angebotenen Religionsunterricht.<br />
Im Gegensatz zu vielen deutschen<br />
Berlinern stehen Bürger aus islamischen<br />
Ländern schon in den Startlöchern und warten<br />
darauf, dass der Islam in den Schulen<br />
gelehrt werden kann und somit ist mit dem<br />
Wegfall von Ethik die Integration einer<br />
neuen Generation dann um ein Weiteres<br />
stark beeinträchtigt.<br />
Wenn Religion als Wahlpflicht eingeführt<br />
wird, muss in meinen Augen der Ethik-<br />
Unterricht erhalten bleiben, da sich der<br />
Religionsunterricht als Wahlpflichtfach<br />
ansonsten nicht positiv, sondern eher negativ<br />
auf das gesamte Zusammenleben der<br />
Berliner Schüler auswirken würde.<br />
Tobias Böcher, Bonn<br />
Der Papst hat den<br />
Kampf aufgenommen<br />
Ein undiplomatischer Blick auf<br />
die Kirche im Februar <strong>2009</strong><br />
Von Bernhard Mihm, Paderborn<br />
In der Ausgabe der Tageszeitung „DIE<br />
WELT“ vom 19. Februar <strong>2009</strong> hat der Generalsekretär<br />
des Zentralkomitees der deutschen<br />
Katholiken Stefan Vesper einen Aufsatz<br />
veröffentlicht, der offenlegt, worum es<br />
in der Kirchenkrise geht, die den Monat<br />
Februar des Jahres <strong>2009</strong> prägt. Vesper<br />
nimmt Benedikt XVI. persönlich gegen jede<br />
Verdächtigung des Antisemitismus in<br />
Schutz, räsoniert über Organisationsfragen<br />
im Vatikan und kommt dann auf sein<br />
eigentliches Thema zu sprechen: „Das<br />
Konzil“. Bereits diese Wortwahl, die keineswegs<br />
nur Vesper eigen ist, verrät einen problematischen<br />
Zug: Als ob es in der Kirchengeschichte<br />
nur ein einziges Konzil, nämlich<br />
das von 1961 bis 1965, gegeben habe und die<br />
Kirchengeschichte somit in zwei Hauptabschnitte<br />
eingeteilt werden könnte, in „vorkonziliar“<br />
und „nachkonziliar“. In Wirklichkeit<br />
gab es 21 als solche anerkannte ökumenische,<br />
das heißt nicht konfessionsüberspannende,<br />
sondern weltweite, allgemeine<br />
(„katholische“) Konzilien, von denen jedes<br />
seine eigene und bleibende Bedeutung hat.<br />
Schon als Kardinal Ratzinger hat deshalb<br />
der jetzige Papst in einer Rede in<br />
Lateinamerika davor gewarnt, das Konzil<br />
1961/65, offiziell das „Zweite Vatikanische<br />
Konzil“ oder „II. Vaticanum“, als „Superkonzil“<br />
oder gar „Superdogma“ zu begreifen,<br />
das alles Vorherige zur Disposition habe<br />
stellen wollen oder können. Der Münchener<br />
Erzbischof Bbr. Dr. Reinhard Marx, einer der<br />
wenigen wirklich medientauglichen und<br />
zugleich mutigen Mitglieder des deutschen<br />
Episkopates, hat in der Spurfolge dieses<br />
Ratzinger-Diktums neulich im Bayerischen<br />
Fernsehen geäußert, es gehe nicht an, zu<br />
behaupten, „vor dem Konzil sei alles<br />
schlecht gewesen und nach dem Konzil alles<br />
gut geworden“. Selbstverständnis und Lehre<br />
der katholischen Kirche speisen sich aus<br />
allen 21 Konzilien und daneben übrigens mit<br />
derselben Verbindlichkeit zahllosen Äußerungen<br />
der Päpste, die an keine konziliare<br />
Mitwirkung gebunden sind und sich ebenso<br />
verbindlich verlautbaren können wie eine<br />
Kirchenversammlung der genannten Art.<br />
Der Generalsekretär des ZdK schreibt in<br />
der „WELT“ weiter, „das Konzil“ müsse nicht<br />
nur konsequent geachtet, sondern „im<br />
Leben der Kirche weiter verwirklicht werden.“<br />
Inhaltlich sieht Vesper beim II. Vaticanum<br />
die „Öffnung zur modernen Welt“.<br />
Nun hat „Welt“ in der christlichen Verkündigung<br />
eine ambivalente Bedeutung: Einerseits<br />
ist sie die gute Schöpfung Gottes, zu<br />
deren Pflege und Ausgestaltung der Mensch<br />
vor Gott berufen, ja verpflichtet ist.<br />
Andererseits bedeutet „Welt“ gerade in der<br />
Rede Jesu in den Evangelien und in den sie<br />
entfaltenden Apostelbriefen ein Contra zum<br />
Reich Gottes. In einer kritischen Auseinandersetzung<br />
mit dem Konzilsdokument<br />
„Gaudium et Spes“ hat bereits beim Bamberger<br />
Katholikentag 1966 der heutige Papst<br />
dargelegt, beim II. Vaticanum sei die „Inkarnation“<br />
als christliche Zentralkategorie neu<br />
entdeckt und zum Ausgangspunkt „der ganzen<br />
theologischen Konstruktion“ geworden.<br />
Der „absteigende“ Gott sei in der Weltzuwendung<br />
zu finden. Wörtlich heißt es in diesem<br />
Vortrag: „Der Christus ... hat die ganze<br />
Leidenschaft des wahrhaft Menschlichen in<br />
den Dienst des Göttlichen gestellt, in den<br />
Dienst jenes Gottes, der selbst ein zürnender<br />
und eifersüchtiger, in allem aber ein liebender<br />
Gott ist. Aus solchen Erkenntnissen<br />
wurde ein menschliches, ein vitales, ein<br />
weltfrohes und, wie man nun gerne sagte:<br />
ein inkarniertes Christentum abgeleitet, das<br />
sich nicht in Abtötung, Weltflucht und Jenseitserwartung<br />
verliert, sondern weltfroh<br />
sich mitten in das Heute hineinbegibt ...“.<br />
Ratzinger hat in seinem letztzitierten Satz<br />
Begrifflichkeiten angeführt, die nun bei<br />
Vesper wieder auftauchen und eine herausragende<br />
Stellung einnehmen: „Fromm und<br />
fröhlich“ überschreibt er seinen Aufsatz,<br />
und in der dritten Zeile der Überschrift<br />
steht: „Helfen können jetzt nur frische und<br />
moderne Ideen.“<br />
In seinem Bamberger Vortrag hat indessen<br />
(schon 1966 !) der jetzige Papst das<br />
Defizitäre solcher Theologie aufgewiesen:<br />
„Aber an dieser Stelle setzt dann auch die<br />
Kritik an ... Der Theologie war inzwischen<br />
bewusst geworden, dass die Idee der<br />
Inkarnation in der Bibel keineswegs jene<br />
absolute Stellung einnimmt, die sie in der<br />
katholischen Spiritualität jetzt zu gewinnen<br />
anfing. ... Entgegen dem, was der Optimismus<br />
der Inkarnationsidee bisweilen ausdrücklich<br />
versichert hatte, gibt es im Neuen<br />
Testament einen deutlichen Vorrang des<br />
Kreuzesthemas vor dem Inkarnationsthema,<br />
ja die Inkarnationsthematik ist in der >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 79
Bibel selbst schon Kreuzestheologie, denn<br />
Inkarnation heißt ja Selbstpreisgabe Gottes<br />
und ist so der erste und entscheidende<br />
Schritt ins Kreuz hinein. ... Man begann sich<br />
allmählich zu fragen, ob denn nicht die Idee<br />
des inkarnierten Christentums, d. h. eines<br />
irdisch engagierten Glaubens und einer<br />
irdisch engagierten Kirche schlussendlich<br />
auf eine Restauration des Mittelalters hinauslaufe,<br />
das in seiner Ver-quickung von<br />
Imperium und Sacerdotium ein Höchstmaß<br />
des Christlichen erzielt hatte, aber gerade ob<br />
dieser Verquickung uns heute im hohen Maß<br />
bedenklich und fragwürdig erscheinen<br />
muss. So begannen allmählich die Parolen<br />
vom Heimholen und vom Taufen (der Welt,<br />
B.M.) fragwürdig zu werden; die Idee der<br />
weltlichen Welt wurde modern, d. h. der<br />
Gedanke, dass der christliche Auftrag gar<br />
nicht in der Verchristlichung der Welt bestehe,<br />
sondern vielmehr die Freisetzung der<br />
Welt in ihre Weltlichkeit hinein, Anerkenntnis<br />
der Welt als Welt, die eben als solche zu<br />
belassen und zu respektieren sei. Damit verbindet<br />
sich ein neues Geschichtsbild, das<br />
übrigens in der Eröffnungsansprache des<br />
Konzils durch Papst Johannes XXIII. deutlich<br />
aufklang: ... das Ganze aber führt bei dem<br />
Papst des Konzils zu einer Theologie der<br />
Hoffnung, die fast an naiven Optimismus zu<br />
grenzen scheint: ... Wenn es sich bei Johannes<br />
ganz um einen Optimismus aus dem<br />
Glauben heraus handelt, so ist doch klar,<br />
dass die Verwechslung mit dem Fortschritts-<br />
Optimismus der Zeit nahe lag, und dass auch<br />
hier die klärende Auseinandersetzung<br />
unentbehrlich war.“ Der damalige Theologieprofessor<br />
stellt in der Folge fest und begründet,<br />
warum diese Auseinandersetzung<br />
auf dem Konzil selbst nicht stattfand. Aber<br />
noch ein einziger Satz in dem Bamberger<br />
Vortrag muss zitiert werden: „Eine Weltzuwendung<br />
der Kirche, die ihre Abwendung<br />
vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu<br />
einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu<br />
ihrem Ende führen.“<br />
Der Pontifikat Benedikt XVI. scheint mir<br />
immer mehr zu einer Umsetzung der Einsichten<br />
des Theologen von damals in Regierungshandeln<br />
des Papstes von heute zu<br />
werden.<br />
Der abschließend zitierte Satz von Bamberg<br />
ist wesentlich auch für die aktuelle<br />
Auseinandersetzung um die Priesterbruderschaft<br />
St. Pius. Ebenso wie der gegenwärtige<br />
Mainstream in der Kirche der westlichen<br />
Länder ist die Bruderschaft fixiert auf eine<br />
von der Abwendung vom Kreuz bestimmte<br />
Inkarnationsidee. Anschließend an politische<br />
Strömungen in Frankreich seit dem 19.<br />
Jahrhundert und zugleich die deutsche<br />
„Reichstheologie“ der 30er Jahre aufnehmend,<br />
erstrebt die Bruderschaft die Restauration<br />
des Mittelalters. Wer die Publikationen<br />
ihres staats- und sozialwissenschaftlichen<br />
„Civitas-Institutes“ mit Sitz in Heusenstamm<br />
bei Frankfurt am Main verfolgt,<br />
kann das unschwer erkennen. Bestenfalls<br />
ein Ständestaatsmodell nach dem Muster<br />
Österreichs unter Engelbert Dollfuß und<br />
Kurt von Schuschnigg könnte den aufgestellten<br />
Kriterien für ein gottgefälliges Ge-<br />
80<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
meinwesen genügen; im Hintergrund steht<br />
immer das Sacrum Imperium als Letztideal.<br />
Aber der genannte Mainstream trägt die<br />
Züge eines „Führens zum Ende der Kirche“<br />
ebenso an sich. Diese Art von „Weltzuwendung“<br />
unterwirft die Kirche letzten<br />
Endes den Gesetzen und Inhalten der<br />
Zivilreligion und setzt sie den 68-er Ideen<br />
von einer „Demokratisierung aller Lebensbereiche“<br />
schutzlos aus. Da gibt es keine<br />
Wahrheit mehr, sondern nur noch Wahrheiten,<br />
keinen Glauben, sondern nur noch<br />
Meinungen. Der Relativismus, nicht von ungefähr<br />
ein Lieblingsthema dieses Papstes,<br />
feiert fröhliche Urständ.<br />
Die Kirchenpolitik Benedikts XVI., um<br />
diesen der Sache nicht gerecht werdenden<br />
Ausdruck zu verwenden, hat nun folgende<br />
erkennbare Ziele: Überwindung des modernen<br />
Relativismus und Überwindung inkarnations-theologischer<br />
Einseitigkeiten<br />
sowohl beim katholischen Mainstream als<br />
auch bei den Randgruppen, die sich um den<br />
Namen Pius X. gesammelt haben. Dabei hat<br />
es der Papst bei beiden Parteiungen mit<br />
einer Mixtur von Irrungen und Wirrungen<br />
einerseits und berechtigten Anliegen andererseits<br />
zu tun. Da nun aber die Seite „Pius<br />
X.“ der Moderne fern –, die des Mainstreams<br />
ihr aber nahe steht, wird das Bemühen des<br />
Papstes in kirchenfremde oder kirchengegnerische<br />
politische Debatten gezogen, deren<br />
Schlagseite erkennbar sehr einseitig ist.<br />
Kann und darf das aber den Papst daran hindern,<br />
jene theologische und letztlich geistliche<br />
Sanierungsarbeit zu tun, die er als für<br />
das Überleben der Kirche notwendig<br />
erkennt?<br />
Wer den Heiligen Vater gegenwärtig<br />
zum Opfer innervatikanischer Abläufe erklärt,<br />
mag das aus Wohlwollen oder im Zug<br />
diplomatischer „Schadensminderung“ tun,<br />
verkennt aber dabei, worum es in Wirklichkeit<br />
geht: der bedeutende Theologe auf dem<br />
Stuhl Petri geht aufs Ganze. Und weil die<br />
Protagonisten einer weltoptimistischen<br />
Inkarnationsidee, deren Klärung auf dem II.<br />
Vaticanum eben offen geblieben ist, genau<br />
das sehen, leisten sie wütende Gegenwehr.<br />
Im Schutz der „political correctness“ angesichts<br />
des borniert hineingezogenen Auschwitz-Themas<br />
wähnen sie eine für sie<br />
unangreifbare Stellung in dieser Auseinandersetzung<br />
um ganz andere Themen.<br />
Warum, so frage ich abschließend, ist der<br />
Kampf in den deutschsprachigen Ländern so<br />
besonders verbittert? Ich sehe drei<br />
Antworten:<br />
Jahrhunderte lang bis 1803 existierte mit<br />
der „Reichskirche“ ein corpus catholicorum<br />
im deutschsprachigen Raum, das die<br />
Menschen von dem weit entfernt liegenden<br />
Rom faktisch mediatisierte. Beim Aufbruch<br />
der Nationalstaatsidee Anfang des 19.<br />
Jahrhunderts mutierte das Selbstverständnis<br />
und Selbstbewusstsein dieser<br />
„Reichskirche“ beinahe zwanghaft zu nationalkirchlichen<br />
Vorstellungen („Febronianismus“).<br />
Dies wirkt noch fort.<br />
Nach dem Ende der „Reichskirche“ und<br />
im Zug der Säkularisierung verloren die<br />
Katholiken in Deutschland wesentliche<br />
Quellen von Bildung und Kultur. Hohe<br />
Schulen und Universitäten gingen massenweise<br />
zugrunde. In der Folge gewann der<br />
Protestantismus die Führerschaft im intellektuellen<br />
Leben, und im Katholizismus<br />
wuchs ein Minderwertigkeitskomplex. Dieser<br />
hielt sich am längsten in der Theologie.<br />
Deutsche Universitätsgelehrsamkeit auf<br />
protestantischer Seite kontrastierte mit<br />
„Schultheologie“ auf katholischer Seite. Der<br />
Protestantismus aber hatte immer schon die<br />
Eigentümlichkeit, sich der jeweils „modernen<br />
Welt“ zu öffnen und einem Fortschritts-<br />
Optimismus zu huldigen.<br />
In seinem bereits ausführlich gewürdigten<br />
Bamberger Vortrag hat Joseph Ratzinger<br />
auch einen bemerkenswerten Blick auf die<br />
„Deutsche Jugendbewegung“ gerichtet:<br />
„Nicht erst das Konzil, sondern vorher schon<br />
die Jugendbewegung war der Ausdruck des<br />
Willens, mit der Gestrigkeit des Christentums<br />
Schluss zu machen: Man hatte es satt,<br />
ob des Christseins als zurückgeblieben und<br />
weltfremd verlacht zu werden, entschlossen,<br />
Christentum mitten im Heute zu leben<br />
und einzusenken in die Welt unseres Heute.“<br />
Ein Kult des „Neuen“, des „Jungen“, des<br />
„Modernen“ war ja überhaupt ein Merkmal<br />
dieses sich als „Aufbruch aus dem Verstaubten“<br />
verstehenden geistesgeschichtlich<br />
ungemein wirkungsvollen Phänomens<br />
am Beginn des 20. Jahrhunderts. Dazu nur<br />
ein Exkurs aus Andeutungen: Die „Deutsche<br />
Jugendbewegung“ hatte einen scharf rechten<br />
Flügel, der den National-Sozialismus mit<br />
prägte, ebenso wie einen weit links stehenden.<br />
Antisemitische Gewalttäter waren von<br />
ihr ebenso geprägt wie Helden des Zionismus.<br />
Die katholische Ausprägung gebar jene<br />
„Reichstheologie“, die in romantischer Sehnsucht<br />
nach dem Mittelalter besonders<br />
„modern“ sein wollte. An die Akademikertagungen<br />
in Maria Laach um 1933 sei<br />
erinnert. Und nachdem „das Reich“ als werthaltige<br />
Idee 1945 völlig kompromittiert war,<br />
trat an seine Stelle eben „die Welt“ mit allen<br />
bereits im Anschluss an die Bamberger<br />
Ratzinger-Rede erörterten Problematiken.<br />
Der Klerus der Zeit nach 1945, insbesondere<br />
der 60er Konzilsjahre aber war zutiefst von<br />
dieser „Deutschen Jugendbewegung“ geprägt.<br />
Und so nahm er die Idee eines Konzils,<br />
den Verlauf und die Ergebnisse des II. Vaticanums<br />
auf und stilisierte es zu „Dem (!)<br />
Konzil“.<br />
Joseph Ratzinger war gewiss in diese geistige<br />
Welt hineingeboren, und so hat er auch<br />
als Theologe begonnen. Sein geistliches<br />
ebenso wie sein intellektuelles Format<br />
machten ihn aber letztlich von all dem unabhängig.<br />
So wuchs der Abstand zwischen<br />
ihm und dem kirchlichen Mainstream in der<br />
Heimat. Und letztlich reibt man sich hierzulande<br />
an nichts anderem als diesem Format!<br />
Ratzinger-Zitate nach: Florian Trenner (Hg.): Joseph<br />
Ratzinger/Benedikt XVI. Priester aus innerstem<br />
Herzen. Beiträge im Klerusblatt in fünf Jahrzehnten,<br />
München: Klerusblatt-Verlag, 2107, S. 82 ff.
Auf der Suche nach<br />
der Wahrheit des<br />
Neuen Testaments<br />
Volker Eid: Und es ist doch wahr. Auf der Suche<br />
nach der Wahrheit des Neuen Testaments,<br />
Weltbild Buchverlag, Deutsche Erstausgabe /<br />
320 Seiten, Euro 14,95, ISBN 978-3-86800-<br />
042-9, erhältlich unter www.weltbild.de und<br />
in allen Weltbild-Filialen<br />
Wurde Jesus wirklich zu Weihnachten<br />
in Betlehem geboren? Wer waren die drei<br />
Reisenden aus dem Morgenland: Könige,<br />
Weise, Magier? Was verbirgt sich hinter<br />
dem Stern, dem sie zur Krippe folgten? Und<br />
standen Ochs und Esel tatsächlich mit im<br />
Stall? Diese Fragen und viele mehr zum<br />
Leben Jesu beantwortet jetzt das neue<br />
Werk zur Bibel „Und es ist doch wahr“.<br />
Vor 50 Jahren erschien der Weltbestseller<br />
„Und die Bibel hat doch recht“ und<br />
revolutionierte die Sicht auf das Alte<br />
Testament. Jetzt macht sich ein Kenner der<br />
christlichen Archäologie auf die spannende<br />
Suche nach der Wahrheit des Neuen Testaments.<br />
In seinem Buch macht sich Prof. Dr.<br />
Volker Eid, emeritierter Professor für Moraltheologie<br />
an der Universität Bamberg, mithilfe<br />
aktueller Erkenntnisse der Wissenschaft<br />
auf die Spuren der historischen<br />
Person Jesus von Nazaret. Leicht verständlich<br />
geschrieben fesselt das Buch und gibt<br />
gleichzeitig einen fundierten Einblick in das<br />
Leben Jesu, wie es wirklich war.<br />
Der Autor, ein Kenner Israels und der<br />
christlichen Archäologie. Der Theologieprofessor<br />
Volker Eid zeichnet den Lebensweg<br />
Jesu nach, beginnend in Betlehem und<br />
Nazaret. Was hatte er an sich, das so viele<br />
Menschen begeisterte? Wie konnte er so<br />
faszinierend von einem unerhört menschenfreundlichen<br />
Gott erzählen? Warum<br />
wusch Pontius Pilatus seine Hände in<br />
Unschuld, als Jesus hingerichtet wurde?<br />
Und schließlich: Warum nahm die Geschichte<br />
nach Jesu Tod kein Ende? Wie<br />
konnte aus seinem kleinen Anhängerkreis<br />
�<br />
BÜCHER/MEDIEN<br />
eine Weltreligion werden? Volker Eid: „Die<br />
Wahrheit des Jesus von Nazaret kann entdeckt<br />
werden in der Auseinandersetzung<br />
mit der Kunde, die in den christlichen Traditionen<br />
aufbewahrt wurde.“<br />
Neben Bibeltexten stützt sich Volker Eid<br />
auf historische Quellen und die Erkenntnisse<br />
von Archäologie und sozialgeschichtlicher<br />
Forschung. Zahlreiche Fotos und Illustrationen<br />
führen den Leser an die Originalschauplätze<br />
der Geschichte zurück. So entsteht<br />
ein lebendiges Bild des Heiligen<br />
Landes zur Zeit Jesu. CB<br />
Die große Synopse<br />
zur Welt-, Kultur- und<br />
Kirchengeschichte<br />
Stephan Kotzula: Kirchengeschichte in Daten<br />
& Fakten, St. Benno-Verlag Leipzig, 266<br />
Seiten, 14, 50 Euro, ISBN 978-3-7462-2487-9<br />
Dr. theol. Stephan Kotzula, geb. 1947 und<br />
1974 zum Priester geweiht, ist Krankenhausgeistlicher,<br />
Männerseelsorger und<br />
Ehebandsverteidiger beim Konsistorium<br />
des Erzbistums Berlin. Jetzt hat er ein „Buch<br />
zum Weiterschreiben“ vorgelegt: „Kirchengeschichte<br />
in Daten & Fakten“ heißt das<br />
neue, synoptisch aufgebaute Standardwerk.<br />
In sieben Spalten, die das ungewöhnliche<br />
Querformat erklären, werden in zeitsynoptischer<br />
Übersicht alle wichtigen Ereignisse<br />
der Kirchen- und Weltgeschichte<br />
von der Spätantike bis zur Gegenwart geboten.<br />
„Glaubensverbreitung und -entfaltung“,<br />
„Ordens- und Heiligengeschichte“,<br />
„Spiritualität“, „Liturgie“ sowie „christliche<br />
Kunst und Musik“ sind die Kategorien, die<br />
facettenreich über die jeweilige Zeit informieren.<br />
Die ausgewählten Fakten werden<br />
kurz und prägnant, aber auch verständlich<br />
geschildert und erklärt. Besonders hilfreich<br />
für den Alltagsnutzen dieses Nachschlagewerks<br />
sind die umfangreichen Personenund<br />
Sachregister, die einen noch schnelleren<br />
Zugriff auf die historischen Daten ermöglichen.<br />
Dabei wurde großer Wert auf<br />
eine übersichtliche Gestaltung gelegt. CB<br />
Spes nostra firma<br />
Thomas Marschler, Christoph Ohly (Hg.):<br />
Spes nostra firma. Festschrift für Joachim<br />
Kardinal Meisner zum 75. Geburtstag. Münster,<br />
Aschendorff Verlag 2008, 472 Seiten, 49<br />
Euro. ISBN-13: 978-3402004371.<br />
„Spes nostra firma“ (Unsere Hoffnung<br />
steht fest), diesen Wahlspruch von Bbr.<br />
Joachim Kardinal Meisner trägt eine Festschrift,<br />
die dem Kölner Erzbischof aus Anlass<br />
seines 75. Geburtstages am 25. Dezember<br />
2008 gewidmet wurde. Die Autoren<br />
dieses Werks, das dem völlig überraschten<br />
Jubilar überreicht wurde, sind Priester und<br />
Diakone des Erzbistums Köln, die während<br />
der 20-jährigen Amtszeit Kardinal Meisners<br />
ihr Promotions- oder Habilitationsstudium<br />
absolvieren konnten und dazu freigestellt<br />
worden waren – unter ihnen Weihbischof<br />
Rainer Woelki, Generalvikar Dominik<br />
Schwaderlapp sowie der Leiter des<br />
Katholischen Büros in Berlin, Prälat Karl<br />
Jüsten. Mit der Festschrift danken die<br />
Autoren dem Erzbischof dafür, dass er<br />
akademischen Fragen interessiert und<br />
Talenten immer fördernd begegnet sei.<br />
Wissenschaftliche Beiträge aus fast allen<br />
theologischen Teilfächern sowie aus einigen<br />
der Theologie benachbarten Disziplinen<br />
dokumentieren in origineller Weise<br />
die lebendige Vielfalt heutiger theologischer<br />
Forschung im Kölner Erzbistum. Papst<br />
Benedikt XVI. hat der Festschrift ein sehr<br />
persönlich gestaltetes Grußwort zuteil<br />
werden lassen, in dem das kraftvolle Glaubenszeugnis<br />
und der unermüdliche Einsatz<br />
Kardinal Meisners im geistlichen Dienst<br />
Würdigung und Anerkennung erfahren.<br />
Herausgeber sind der Augsburger Dogmatikprofessor<br />
Thomas Marschler und der<br />
Münchner Kirchenrechtler Bundesbruder<br />
Dr. Christoph Ohly. „In einer Zeit des bedrückenden<br />
Priestermangels ist es keine<br />
Selbstverständlichkeit, wenn eine Diözese in<br />
steter Regelmäßigkeit junge Priester und >><br />
unitas 1/<strong>2009</strong> 81
Diakone durch Freistellung vom regulären<br />
Dienst für eine fortgeschrittene akademische<br />
Qualifikation auswählt“, schreiben sie<br />
im Vorwort.„Damit ist unsere Festschrift zunächst<br />
ein Zeichen der Dankbarkeit für die<br />
Großzügigkeit, mit der Kardinal Meisner diese<br />
sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen<br />
Projekte ermöglicht und begleitet<br />
hat.“ In der Vielfalt der Themen und Artikel<br />
solle „zugleich etwas von der lebendigen<br />
Vielfalt des Forschens und geistigen Arbeitens<br />
sichtbar werden, das in unserer Gegenwart<br />
im jüngeren Kölner Klerus zu finden<br />
ist.“ Ein solches Zeichen sei gerade in einer<br />
Zeit von Bedeutung, in der die Reflexion wissenschaftlicher<br />
Theologie als unverzichtbare<br />
Dimension religiösen Lebens angesichts<br />
vieler Sorgen um kirchliche Finanzen<br />
und Strukturen zuweilen in den Hintergrund<br />
gedrängt zu werden scheint. CB<br />
Christliche Symbole<br />
in Kirchen, Kunst<br />
und Architektur<br />
Pater Eckhard Bieger SJ: Das Bilderlexikon der<br />
christlichen Symbole, St. Benno-Verlag Leipzig,<br />
284 Seiten, durchgehend mit Farbabbildungen<br />
gestaltet, 19,90 Euro, ISBN 978-3-<br />
7462-2486-2<br />
Welche Bedeutung das Lamm in der<br />
Kunst hat, warum Kirchtürme achteckig<br />
sind und was der Delphin mit Christus zu<br />
tun hat – diese und viele Fragen mehr klärt<br />
P. Eckhard Bieger SJ in einem außergewöhnlich<br />
prächtig illustrierten „Bilderlexikon der<br />
christlichen Symbole“. Das Werk des Kommunikationswissenschaftlers,<br />
Theologen<br />
und langjährigen Beauftragten der Deutschen<br />
Bischofskonferenz beim ZDF bietet<br />
mit über 1000 Begriffen und farbigen Abbildungen<br />
auf fast 300 Seiten eine große<br />
Fülle von Erklärungen zur Symbolsprache,<br />
die sich in Bildern und Mosaiken, im<br />
Kirchenbau und in der Gestaltung von Taufbecken,<br />
Altären wiederfinden. Alle christlichen<br />
Symbole, aber auch Zeichen aus anderen<br />
Religionen und Kulturen, die Eingang<br />
ins Christentum gefunden haben, werden<br />
von dem bekannten Autor und Theologen<br />
verständlich und fundiert erklärt. Er erschließt<br />
die Symbolsprache auf eine Weise,<br />
die neue Zugänge zur kirchlichen Tradition<br />
schafft und die Augen öffnet für den<br />
Reichtum der Bilder unserer christlichen<br />
82<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
Kultur. Ergänzt werden die Erläuterungen<br />
durch einen ausführlichen Überblick über<br />
die Geschichte der Kirchenarchitektur, der<br />
die Symbole in ihren jeweiligen historischen<br />
Kontext vorstellt. Die zahlreichen<br />
informativen Bilder gewähren ungewöhnliche<br />
Einblicke in die schönsten Kirchen<br />
Deutschlands und machen das großformatige<br />
Lexikon damit besonders anschaulich<br />
und wertvoll. CB<br />
Nachdenken über<br />
Schöpfung und Kirche<br />
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.: „Gottes<br />
Projekt – Nachdenken über Schöpfung und<br />
Kirche“, hrsg. von Karl-Heinz Kronawetter<br />
und Michael Langer, mit einem Vorwort von<br />
Bischof Egon Kapellari, 140 Seiten, Pustet<br />
Verlag, 16,90 Euro.<br />
„Gottes Projekt – Nachdenken über<br />
Schöpfung und Kirche“ lautet der Titel eines<br />
neuen Buches von Joseph Ratzinger, das<br />
jetzt im Regensburger Pustet Verlag erschienen<br />
ist. Es versammelt sechs unveröffentlichte<br />
Texte zur Schöpfungstheologie,<br />
Vorlesungen, die der heutige Papst 1985 auf<br />
Einladung von Bischof Dr. Egon Kapellari bei<br />
den renommierten St. Georgener Gesprächen<br />
im Bischöflichen Bildungshaus Stift St.<br />
Georgen in Kärnten gehalten hat. Der Text<br />
der äußerst lebendigen Vorträge war lange<br />
Zeit verschollen, bis Tonbandmitschnitte auf<br />
einem Dachboden auftauchten. Ein Fund,<br />
der sich als Glücksfall mit brandaktuellen<br />
Bezügen erweist: Die Kärntner Vorlesungen<br />
sind sowohl als Kommentar zum Darwin-<br />
Jahr wie zur Diskussion um die Konzilstreue<br />
von Papst Benedikt XVI. zu lesen.<br />
In seinen schöpfungstheologischen Betrachtungen<br />
zeigt der damalige Kurienkardinal<br />
Joseph Ratzinger, dass der Mensch<br />
nicht irgendein Zufallsprodukt der Erde sei,<br />
sondern ein Projekt Gottes. Darin gründe<br />
auch die Unverletzlichkeit der Menschenwürde.<br />
So zeigt er Gottes Projekt, das christliche<br />
Welt- und Menschenbild, in klarer,<br />
nachvollziehbarer Sprache auf und verhilft<br />
dem Leser zu einem vertieften Verständnis<br />
der Schöpfung und des Umgangs mit ihr.<br />
Hinter allen großen „Projekten des Lebendigen“<br />
stehe die schöpferische Vernunft:<br />
„Sie zeigen uns den Schöpfergeist, heute<br />
leuchtender und strahlender denn je.“ Der<br />
Mensch, der „aus Erde geformt“ wird, erfahre<br />
durch den biblischen Text, „dass dies den<br />
Menschen überhaupt betrifft, dass alle<br />
Menschen Erde sind“. Gleich am Anfang der<br />
Bibel werde so gesagt, „dass es nur einen<br />
Menschen in den vielen Menschen gibt,<br />
sodass die Absage an jeden Rassismus, jede<br />
Teilung der Menschheit ein biblisches Urwort<br />
und Grundwort ist“.<br />
Herausgegeben wurde „Gottes Projekt“<br />
vom apl. Prof. für Religionspädagogik und<br />
Kerygmatik Michael Langer, dem em. Prof.<br />
für Bibl. Einleitungswissenschaften Prof.<br />
Georg Schmuttermayr und dem Kärntner<br />
Kulturreferenten Karlheinz Kronawetter. Die<br />
Einleitung verfasste Bischof Dr. Egon<br />
Kapellari. Das Buch ist dem Bruder des<br />
Papstes, Georg Ratzinger, zum 85. Geburtstag<br />
gewidmet. CB<br />
Heilige für jeden Tag<br />
Andreas Rode: Das Jahresbuch der Heiligen.<br />
Große Gestalten für jeden Tag Leben und<br />
Legenden. Zuständigkeiten, Attribute und<br />
Erkennungsmerkmale. Mit einer Einführung<br />
von Abt Odilo Lechner. Bildauswahl von<br />
Günter Lange Großformat. 1040 Seiten.<br />
Durchgehend vierfarbig, über 80 Farbtafeln.<br />
Gebunden mit Leseband. Goldfolienprägung<br />
auf feinem Einbandmaterial. Euro 49,95,<br />
ISBN 978-3-466-36803-7<br />
Ein voluminöses „Jahresbuch der Heiligen“<br />
hat Andreas Rode jetzt im Kösel-Verlag<br />
vorgelegt. Es stellt dem kirchlichen Kalender<br />
folgend für jeden Tag die Vita eines Heiligen<br />
ausführlicher vor. Der Bogen reicht dabei<br />
von altchristlichen Märtyrern bis zu Heiligen<br />
unserer Zeit. Ergänzend dazu werden<br />
Legenden erzählt oder Originaltexte präsentiert.<br />
Wissenswertes über Brauchtum, Verehrung,<br />
Patronate und Erkennungsmerkmale<br />
werden ergänzt durch die Darstellung<br />
des jeweiligen Heiligen in der Kunst: Über<br />
80 ganzseitige Bilder werden von dem emeritierten<br />
Bochumer Religionspädagogen<br />
Prof. Dr. Günter Lange, einem renommierten<br />
Kenner christlicher Kunst, erschlossen. So ist<br />
ein Werk von 1040 Seiten entstanden, das<br />
sich für den eigenen Gebrauch ebenso eignet<br />
wie als wertvolles Geschenk. Das Geleitwort<br />
stammt von dem Altabt von St. Bonifaz-München<br />
und Andechs, P. Odilo Lechner<br />
OSB, der Autor Andreas Rohde gehört dem<br />
Wingolfsbund an. CB
88<br />
Zeitschrift des Verbandes<br />
der wissenschaftlichen<br />
kath. <strong>Studenten</strong>vereine<br />
UNITAS<br />
Aachener Str. 29<br />
41564 Kaarst (Büttgen)<br />
ISSN 0344 - 9769<br />
unitas 1/<strong>2009</strong><br />
<strong>Unitas</strong>, Aachener Str. 29, 41564 Kaarst (Büttgen),<br />
PVSt; DPAG, Entgelt bezahlt.<br />
UNITAS – Altherrenbunds-/Hohedamenbundstag <strong>2009</strong><br />
in Münster<br />
„Zukunft des Sozialstaates angesichts von Globalisierung<br />
und demografischem Wandel“<br />
25. – 27. September <strong>2009</strong><br />
Tagungsort: Stadthotel Münster, Aegidiistr. 21, 48143 Münster, Tel. 0251-4812-0<br />
Programm<br />
Freitag, 25.09. 19.00 Uhr Ankunft in Münster<br />
20.00 Uhr Festkommers anlässlich des 150-jährigen Bestehens der UNITAS in Münster<br />
im Stadthotel Münster<br />
Samstag, 26.09. 10.00 Uhr Vortrag<br />
zum Tagungsthema mit Diskussion<br />
12.00 Uhr Mittagsimbiss im Tagungshotel<br />
14.00 Uhr Vortrag<br />
zum Tagungsthema mit Diskussion<br />
16.00 Uhr Kaffeepause<br />
16.30 Uhr UNITAS aktuell<br />
Gedankenaustausch mit dem Vorstand des <strong>Unitas</strong>-Verbandes<br />
bis 18.00 Uhr<br />
19.00 Uhr Gesellschaftsabend im Mühlenhof-Freilichtmuseum<br />
Abendessen und Geselligkeit im historischen Gräftenhof<br />
bis 23.00 Uhr<br />
Sonntag, 27.09. 09.30 Uhr Pontifikalamt<br />
in der St. Ludgeri-Kirche, Ludgeristr.<br />
11.00 Uhr Festakademie<br />
im Zwei-Löwen-Klub Münster, Am Kanonengraben<br />
Festvortrag zum Tagungsthema<br />
anschl. Mittagsimbiss und Verabschiedung<br />
Auf ein Wiedersehen im Kreise der UNITAS freuen sich<br />
Dr. Claudia Bellen-Kortevoß Heinrich Sudmann Hendrik Koors<br />
Vorsitzende des HDB Vorsitzender des AHB Vorsitzender des AHZ Münster<br />
Organisatorische Hinweise:<br />
Die verehrten Bundesschwestern und Bundesbrüder können vom 25.09.<strong>2009</strong> bis 27.09.<strong>2009</strong> im Stadthotel Münster<br />
(www.stadthotel-muenster.de) ein Einzelzimmer zu Euro 81,--/86,-- bzw. ein Doppelzimmer zu Euro 105,--/110,-- pro Zimmer/Nacht<br />
inklusive eines Frühstücksbuffets aus dem Kontingent „<strong>Unitas</strong> Münster“ buchen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bei<br />
Münster-Marketing (www.muenster.de) oder anderen Hotelreservierungsportalen Übernachtungsmöglichkeiten zu buchen.<br />
Die Tagungspauschale in Höhe von Euro 30,-- p.P. beinhaltet den jeweiligen Mittagsimbiss und die Tagungsgetränke.<br />
Die schriftliche Anmeldung erfolgt an die <strong>Unitas</strong>-Verbandsgeschäftsstelle, Aachener Straße 29, 41564 Kaarst, oder über<br />
www.ahb-hdb-tag.de. Mit der verbindlichen Anmeldung wird die Tagungspauschale fällig, diese ist auf das Konto des AHZ <strong>Unitas</strong><br />
Münster 026549660, BLZ 40070024, Deutsche Bank PGK AG, zu überweisen.