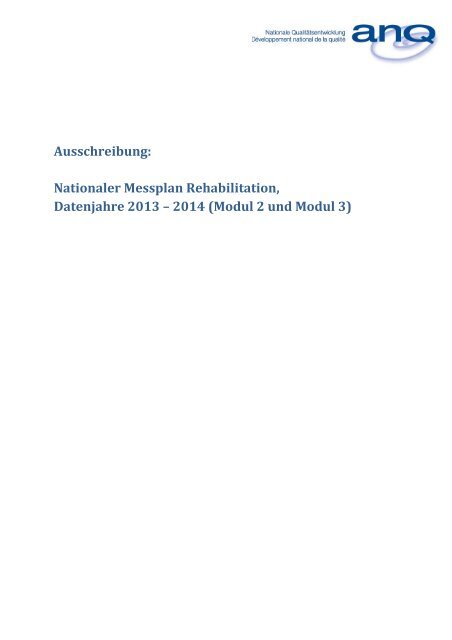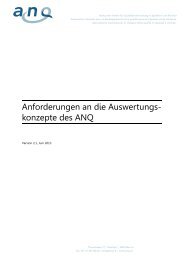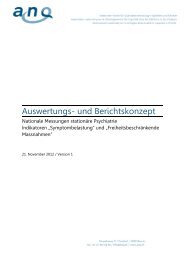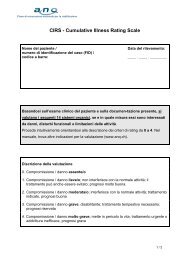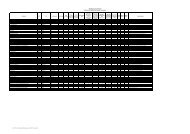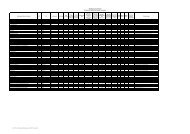Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ
Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ
Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Ausschreibung</strong>:<br />
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>,<br />
<strong>Datenjahre</strong> 2013 – 2014 (Modul 2 und Modul 3)
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
Inhalt<br />
1 Ausgangslage ........................................................................................................................ 2<br />
1.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>) ............ 2<br />
1.2 Der Nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> 2013 - 2014 ...................................................... 2<br />
2 Ziel des Mandats und Leistungen des Auftragsnehmers ...................................................... 4<br />
2.1 Ziel des Mandats und Übersicht über die Aufgaben....................................................... 4<br />
2.2 Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten .................................................... 4<br />
2.3 Datenerhebung und Datenlieferung ............................................................................... 5<br />
2.4 Datenbereinigung und Aufbereitung der Datenlieferungen ............................................ 6<br />
2.5 Auswertung .................................................................................................................... 6<br />
2.6 Berichtserstellung ........................................................................................................... 7<br />
2.7 Veröffentlichung der Ergebnisse .................................................................................... 8<br />
3 Rahmenbedingungen und Organisation der <strong>Ausschreibung</strong> ................................................. 9<br />
3.1 Zielgruppe der <strong>Ausschreibung</strong>........................................................................................ 9<br />
3.2 Bewerbungsverfahren und Vertrag ................................................................................. 9<br />
3.3 Offerte .......................................................................................................................... 10<br />
3.4 Zuschlagskriterien ........................................................................................................ 10<br />
3.5 Zeitplan ......................................................................................................................... 10<br />
3.6 Kostendach und Zahlungsmodalitäten ......................................................................... 11<br />
3.7 Kontakt ......................................................................................................................... 11
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
1 Ausgangslage<br />
1.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>)<br />
Der Zweck des <strong>ANQ</strong> ist die Koordination und Durchführung von Qualitätsmessungen auf nationaler<br />
Ebene in der stationären Akutsomatik, <strong>Rehabilitation</strong> und Psychiatrie: Der <strong>ANQ</strong> gibt den<br />
Kliniken die gesamtschweizerisch durchzuführenden Messungen in Form von Messplänen vor.<br />
Er koordiniert deren Umsetzung von der Datenerhebung über die Auswertung, das Verfassen<br />
der Berichte bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse für eine breite Öffentlichkeit. Mit der<br />
Dokumentation der Qualität (Vergleich mit nationalen Referenzwerten) wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung<br />
und Verbesserung geleistet (Statuten des <strong>ANQ</strong> vom 24. November 2009).<br />
1.2 Der Nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> 2013 - 2014<br />
Der nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> kommt in der stationären <strong>Rehabilitation</strong> zur Anwendung.<br />
In der Schweiz gibt es 53 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken, davon 20 in der lateinischen Schweiz (18 in<br />
der Westschweiz und 2 im Tessin). Diese verzeichneten im Jahr 2009 rund 58‘000 Austritte.<br />
Der <strong>Messplan</strong> umfasst insgesamt 10 Instrumente und ist in drei Module gegliedert:<br />
Modul 1: Nationale Patientenzufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 2: Muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 3: Kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 1 ist nicht Gegenstand der <strong>Ausschreibung</strong>.<br />
Bei den Messungen in Modul 2 und Modul 3 handelt es sich um eine Vollerhebung und die Daten<br />
werden bei sämtlichen Patienten der aufgeführten Diagnosegruppen erhoben. Bei der<br />
Mehrheit der eingesetzten Instrumente erfolgen die Messungen bei Ein- und Austritt durch das<br />
medizinische oder therapeutische Personal (Fremdbeurteilung). Bei drei Instrumenten wird der<br />
Fragebogen durch den Patienten ausgefüllt. Ein- und Austrittsmessung gehen in die jeweilige<br />
Score-Berechnung nach Massgabe allfälliger Richtlinien ein (Tabelle 1) 1<br />
Tabelle 1: <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> für die <strong>Rehabilitation</strong> 2013 – 2014 (ohne Modul 1)<br />
Module Patienten Zeitpunkt Typ<br />
Modul 2:<br />
Allgemeine Messung, mit Obligatorium<br />
Hauptziele (HZ) und Zielerreichung (ZE)<br />
gemäss ICF-Ansatz<br />
DG-m<br />
DG-n<br />
E / A; ScB FB / SB<br />
Diagnosespezifische Messung, mit Obligatorium bei muskuloskelettalen Patienten und<br />
Wahlpflicht bei neurologischen Patienten<br />
Functional Independence Measurement<br />
(FIM)<br />
1 Die Richtlinien werden im Messhandbuch dargelegt.<br />
DG-n E / A; ScB FB<br />
2
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
Module Patienten Zeitpunkt Typ<br />
Erweiterter Barthel-Index (EBI) DG-n E / A; ScB FB<br />
Health Assessment Questionnaire<br />
(HAQ)<br />
Modul 3:<br />
DG-m E / A; ScB FB<br />
Allgemeine Messungen, mit Wahlpflicht (Wahl abhängig vom Gesundheitszustand)<br />
6-Minuten-Gehtest DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />
Fahrrad-Ergometrie DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />
Diagnosespezifische Messungen, obligatorisch bei den gegebenen Diagnosen<br />
MacNew Heart DG-k-spez E / A; ScB SB<br />
Chronic Respiratory Questionnaire<br />
(CRQ)<br />
DG-p-spez E / A; ScB SB<br />
Feeling-Thermometer DG-p / DG-p-spez E / A; ScB SB<br />
Legende: DG-m=Diagnosegruppe muskuloskelettale Patienten; DG-n=Diagnosegruppe neurologische<br />
Patienten; DG-k=Diagnosegruppe kardiale Patienten; DG-p=Diagnosegruppe pneumologische Patienten;<br />
DG-k-spez= Patienten mit Bypass & Klappe, Kombinierte kardiovaskuläre Operationen, Herzinsuffizienz<br />
(EF
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
2 Ziel des Mandats und Leistungen des Auftragsnehmers<br />
2.1 Ziel des Mandats und Übersicht über die Aufgaben<br />
Ziel ist, die nationalen einheitlichen Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong> auszuwerten und<br />
die vergleichenden Ergebnisse (Vergleich von klinikspezifischen Ergebnissen mit nationalen<br />
Referenzwerten) im Rahmen von jährlichen Gesamtberichten darzustellen.<br />
Die vom Auftragnehmer erwarteten Leistungen umfassen im Einzelnen:<br />
‐ Erstellung eines Datenhandbuchs mit Vorgaben bezüglich Datenlieferung, Variablen und<br />
der anzuwendenden Prüflogik. Organisation der Datenlieferung von den Kliniken an das<br />
Auswertungsinstitut.<br />
‐ Datenbereinigung und Aufbereitung der elektronisch gelieferten Daten sowie Analyse<br />
der Datenqualität. Erstellen eines Datenqualitätsberichts.<br />
‐ Erarbeitung eines Auswertungskonzepts und Auswertung (inkl. Diskussion der Risikoadjustierung).<br />
‐ Berichterstellung (jährlicher Gesamtbericht).<br />
Der <strong>ANQ</strong> (Projektleitung, Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong>) steht dem Auftragnehmer während<br />
der Projektdauer als Ansprechperson zur Verfügung und begleitet die Arbeiten.<br />
2.2 Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten<br />
Zur Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten des nationalen <strong>Messplan</strong>s folgt an<br />
dieser Stelle eine Auflistung von Arbeiten, welche vom <strong>ANQ</strong> geleistet werden:<br />
‐ Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Kliniken (Klinikleitungen,<br />
Qualitätsbeauftragte) über den <strong>Messplan</strong> in der lateinischen und deutschen<br />
Schweiz (inkl. Erlass von Empfehlungen zur Projektorganisation in den Kliniken).<br />
‐ Organisation und Durchführung von Workshops für Kliniken (Klinikleitungen, Qualitätsbeauftragte,<br />
IT-Verantwortliche) zum Thema IT-Systeme für die elektronische Datenerfassung<br />
in Zusammenarbeit mit IT-Systemanbieter.<br />
‐ Verfassen eines Messhandbuchs: Definition und Handhabung der Instrumente zuhanden<br />
der Kliniken (Klinikleitungen, Qualitätsbeauftragte, medizinisch-therapeutische Personal).<br />
‐ Organisation und Durchführung von Schulungen in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften<br />
(inkl. Schulungsunterlagen) für die Kliniken (Qualitätsbeauftragte, medizinisch-therapeutisches<br />
Personal) auf Basis eines „Train-the-trainers“-Konzepts.<br />
‐ Projektkoordination mit den Partnern des <strong>ANQ</strong> (H+, Versicherungen und Kantone) inkl.<br />
vertragliche Anpassungen des Qualitätsvertrags (Anhang 5b und Anhang 7).<br />
‐ Projektkoordination mit den Kliniken: Registrierung der Kliniken zu den Messungen aus<br />
Modul 2 und Modul 3 (inkl. Einverständniserklärung zur Datenlieferung an das Auswertungsinstitut)<br />
und Bearbeitung von Dispensgesuchen sowie Information und Unterstützung<br />
der Kliniken bei der Umsetzung des <strong>Messplan</strong>s.<br />
4
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
2.3 Datenerhebung und Datenlieferung<br />
Der <strong>ANQ</strong> gibt den Kliniken vor, dass die Daten elektronisch erhoben und die Eingaben rudimentär<br />
geprüft werden 3 . Damit soll eine möglichst hohe Datenqualität schon bei der Eingabe sichergestellt<br />
werden. Die Kliniken sind vertraglich verpflichtet (Qualitätsvertrag), die Vorgaben des<br />
<strong>ANQ</strong> zu implementieren; sie sind für die Datenqualität der Datenlieferung verantwortlich. Sie<br />
bestimmen auch den Systemanbieter für die Datenerfassung und Datenprüfung selbst. Der<br />
<strong>ANQ</strong> wird die Kliniken dazu anhalten, eine für die klinikseitige Durchführung des <strong>Messplan</strong>s<br />
geeignete Projektstruktur aufzubauen.<br />
Das für die Auswertung zuständige Institut erstellt in Zusammenarbeit mit dem <strong>ANQ</strong> ein Datenhandbuch,<br />
das sich an die Qualitätsbeauftragten und IT-Verantwortlichen der Kliniken richtet.<br />
Dieses enthält zum einen die Vorgaben bezüglich Datenlieferung (Inhalt, Format und Periodizität).<br />
Hierzu gehört auch die Beachtung einer datenschutzkonformen Übermittlung der Daten.<br />
Im Datenhandbuch festzulegen sind zudem die Spezifikationen der zu erhebenden Daten (Variablenliste,<br />
Wertebereich, Ausprägungen und Definition von fehlenden Werten) zuhanden der<br />
Kliniken bzw. Systemanbieter. Dabei gilt es die entsprechenden Vorgaben laufender Projekte<br />
(ST-Reha-Projekt) und bestehender Datensammlungen (BFS) zu berücksichtigen.<br />
Ausserdem ist im Datenhandbuch eine Prüflogik definiert, welche die Kliniken bei der Eingabe<br />
der Daten vor fehlenden Angaben (Vollständigkeit des Datensatzes) und offensichtlichen Fehlangaben<br />
(Validität der Angaben) schützt. Der Aufwand für die Implementation dieser Prüflogik<br />
durch die Kliniken bzw. Systemanbieter soll in einem günstigen Verhältnis zum erwarteten Nutzen<br />
stehen.<br />
Die Organisation der Datenerhebung und Datenlieferung betrifft sowohl die Daten aus den 9<br />
Instrumenten der Module 2 und 3 des Nationalen <strong>Messplan</strong>s als auch Daten, welche für die<br />
Auswertung benötigt werden:<br />
a) Daten aus der Medizinischen Statistik des BFS: Diese werden von den Kliniken bereits<br />
obligatorisch erhoben und periodisch dem BFS zugestellt. Ein Teil der Daten aus der<br />
Medizinischen Statistik des BFS werden für das ST-Reha-Projekt genutzt.<br />
b) Daten zur Komorbidität: Wie im ST-Reha-Projekt werden sie mit der Cumulative Illness<br />
Rating Scale (CIRS) erfasst.<br />
c) Angaben zu den Kontextfaktoren: Im Pilotprojekt wurde das Vorliegen von rehaerschwerenden<br />
persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren, inkl. Wohn- und Arbeitssituation<br />
erfasst. 4<br />
d) Angaben zur ätiologischen Zuordnung der Diagnose: in der Medizinischen Statistik des<br />
BFS werden gemäss vorliegenden Informationen lediglich die Hauptdiagnosen dokumentiert.<br />
Im Pilotprojekt wurden die Ätiologie der Haupt- und Nebendiagnosen erfasst. 4<br />
3 Ein besonderes Augenmerk gilt dem Einsatz allfälliger Papierfragebogen bei den Patienten. Bei hohen<br />
Fallzahlen sollten die Kliniken die Erhebung der Patientenantworten direkt in ein elektronisches System<br />
(Computer oder Tablet) bevorzugen; dieses ökonomischere Vorgehen erzielt eine höhere Datenqualität<br />
(höherer Rücklauf, vollständige Angaben).<br />
4 Die Projektleitung <strong>ANQ</strong> und der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> werden die Liste der zu erfassenden<br />
Variablen im Rahmen der Beschreibung des Instruments der Zieldokumentation für das Messhandbuch<br />
präzisieren.<br />
5
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
e) Angaben zu den Gründen, welche zum Abbruch der Dateneingabe geführt haben. Im<br />
Pilotprojekt wurden Tod, Verlegung auf andere Station, Ablehnung der Kostengutsprache<br />
als Abbruchgründe erfasst. 4<br />
f) Kennzahlen zur Beschreibung der <strong>Rehabilitation</strong>skliniken: Als Basis dient die Publikation<br />
des BFS zu den Kennzahlen der Schweizer Spitäler, welche 2011 in der fünften<br />
Ausgabe erschienen ist und erstmals Daten von allen Spitälern und Kliniken umfasst.<br />
Vom Auswertungsinstitut ist schliesslich zu prüfen, ob zusätzliche Daten, welche für eine Risikoadjustierung<br />
benötigt werden, erhoben werden. Das Auswertungsinstitut erstellt im Rahmen<br />
des Auswertungskonzepts einen entsprechenden Vorschlag.<br />
2.4 Datenbereinigung und Aufbereitung der Datenlieferungen<br />
Das Auswertungsinstitut ist für die Sicherstellung einer hohen und homogenen Datenqualität<br />
ex-post verantwortlich. Es unterbreitet im Rahmen der Offerte das entsprechende methodische<br />
Vorgehen. Dies beinhaltet auch eine Beschreibung allfälliger Unterstützungsleistungen an die<br />
Kliniken (Schnittstellenmanagement; Empfehlungen zur Verbesserung der Datenqualität).<br />
Zudem verfasst das Institut auf Grundlage der Daten des ersten halben Messjahres (6 Monate)<br />
einen Bericht zur Datenqualität für den <strong>ANQ</strong> (Datenqualitätsbericht). Hier interessiert sowohl<br />
der Anteil der erfassten Patienten (Rücklauf) und die Vollständigkeit der erfassten Fälle (bzw.<br />
Drop-outs) als auch die Validität der Angaben. Neben der Darstellung des methodischen Vorgehens<br />
zur Sicherstellung einer hohen und homogenen Datenqualität, enthält er einen Ergebnisteil<br />
mit Gesamtergebnissen und gegebenenfalls klinikspezifischen Ergebnissen (z.B. beim<br />
Vorliegen von statistisch signifikanten Unterschieden). In Ergänzung umfasst der Datenqualitätsbericht<br />
eine Auflistung von Schlussfolgerungen und allfällige Empfehlungen bezüglich Datenerhebung,<br />
-bereinigung und -aufbereitung und geplanten Auswertungen.<br />
Der Datenqualitätsbericht soll mit Blick auf die Umsetzung von allgemeinen und gegebenenfalls<br />
klinikspezifischen Empfehlungen mit dem Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> besprochen werden.<br />
Die Kliniken werden vom <strong>ANQ</strong> in summarischer Weise über den Datenqualitätsbericht (Ergebnisse<br />
und Empfehlungen) und die allenfalls geplanten Massnahmen informiert. Die Kliniken<br />
können auf Anfrage Einblick in eine pseudonymisierte Version des Datenqualitätsberichts erhalten;<br />
eine formelle Möglichkeit, zum Datenqualitätsbericht Stellung zu nehmen, ist nicht vorgesehen.<br />
2.5 Auswertung<br />
Das Auswertungsinstitut erarbeitet basierend auf dem Datenreglement des <strong>ANQ</strong> (Artikel 8, Artikel<br />
9 und Artikel 11) ein Auswertungskonzept. Für diese Arbeiten soll auch das Grundlagenpapier<br />
„Anforderungen an die Auswertungskonzepte“ berücksichtigt werden.<br />
Ein Entwurf des Auswertungskonzepts ist Teil der Offerte: Es umfasst eine Darstellung des methodischen<br />
Vorgehens bei der Bereinigung und Aufbereitung der Daten (vgl. Abschnitt 2.4).<br />
Darüber hinaus sollen sowohl das methodische Vorgehen als auch die thematischen Schwerpunkte<br />
der Auswertung dargelegt werden. Beispielsweise ist zu überlegen, inwieweit statt einzelner<br />
Items ausgewählte Skalen oder gar nur die Veränderungen von Globalwerten (Scores)<br />
ausgewertet werden. Bei der Beschreibung des thematischen Schwerpunktes können neben<br />
6
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
der Priorisierung von Fragestellungen auch Vorschläge eingebracht werden. Erwartet wird zudem<br />
eine kritische Diskussion der Risikoadjustierung inklusive der zu verwendenden Variablen<br />
und des Modells (vgl. Ausführungen zu den zusätzlichen Variablen am Ende des Abschnitts<br />
2.3).<br />
Ein besonderer Fokus liegt auf der vergleichenden Darstellung der Ergebnisse. 5 Dabei sollen<br />
die klinikspezifischen Ergebnisse mit nationalen Referenzwerten bzw. Bandbreiten verglichen<br />
werden. Der Auftragnehmer erarbeitet konzeptionelle Vorschläge für die Bestimmung von „nationalen<br />
Referenzwerten“ oder Bandbreiten.<br />
Im Hinblick auf die Erstellung des zweiten Berichts (Datenjahr 2014, siehe Abschnitt 2.6) sollten<br />
im Entwurf des Auswertungskonzepts bereits auch Jahresvergleiche konzeptionell angedacht<br />
werden.<br />
Die Entwürfe des Auswertungskonzepts werden nach Vertragsabschluss mit dem Qualitätsausschuss<br />
<strong>Rehabilitation</strong> besprochen und entsprechend angepasst. Im Anschluss daran werden<br />
sie gestützt auf Artikel 8 des Datenreglements vom <strong>ANQ</strong> den Kliniken zur Stellungnahme unterbreitet.<br />
Das gegebenenfalls angepasste Auswertungskonzept wird dem Vorstand des <strong>ANQ</strong> zur<br />
Genehmigung präsentiert (circa Mitte 2013).<br />
Während der Auswertungsarbeiten wird die Bereitschaft erwartet, den <strong>ANQ</strong> in regelmässigen<br />
Abständen über den Verlauf der Arbeiten und besondere Fragestellungen zu informieren (Koordination,<br />
Absprachen).<br />
2.6 Berichtserstellung<br />
Der Auftragnehmer hat zwei Gesamtberichte zu erstellen: einen für das Datenjahr 2013 sowie<br />
einen für das Datenjahr 2014; letzterer umfasst neben den Klinikvergleichen auch ein Jahresvergleich.<br />
Der Gesamtbericht umfasst Erläuterungen zu den Methoden (inkl. Lesehilfen zu den<br />
Graphiken), Angaben zur Datenqualität (Rücklauf, Gruppenbildung) und einen Ergebnisteil nach<br />
Klinik und Gesamtergebnissen. Für das Datenjahr 2014 enthält er zusätzlich einen Jahresvergleich.<br />
Die Gesamtberichte sollen auf den Praxisnutzen fokussieren und den Kliniken Hinweise<br />
geben für qualitätssichernde und –entwickelnde Massnahmen: Deshalb sollen auch Schlussfolgerungen<br />
und gegebenenfalls Empfehlungen an die Kliniken (Leitung, Qualitätsmanagement)<br />
formuliert werden.<br />
Die Kliniken haben die Möglichkeit, zu den Ergebnissen schriftlich Stellung zu nehmen. Die<br />
Stellungnahmen sollen im Gesamtbericht berücksichtigt werden. Der Auftragnehmer erarbeitet<br />
einen Vorschlag zur Berücksichtigung und allfälligen Integration der Stellungnahmen in den<br />
Gesamtbericht. Dieser beinhaltet die Klärung der inhaltlichen Grundlage für die Stellungnahmen<br />
(klinikspezifische Ergebnisse ohne vergleichende Darstellung versus Entwurf des Gesamtberichts),<br />
die Darstellung der Stellungnahmen (d.h. zitieren versus zusammenfassen), Angaben<br />
über die zur Stellungnahme zugelassenen Autoren (d.h. Klinikleitung versus Qualitätsbeauftragte).<br />
Sollten die Ergebnisse in den Gesamtberichten ohne namentliche Bezeichnung der Kliniken<br />
publiziert werden (pseudonymisierte Darstellung), sind jährliche klinikspezifische Berichte zwin-<br />
5 Aufgrund der Vielzahl an Auswertungen waren die Berichte aus der Pilotphase wenig übersichtlich und<br />
die wichtigen Ergebnisse konnten kaum von weniger wichtigen Ergebnissen unterschieden werden.<br />
7
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
gend vorzusehen (inkl. Vergleich mit nationalen Referenzwerten). Ihre Erstellung hat mit Blick<br />
auf die Kosten in hohem Masse automatisiert zu erfolgen. Die Erstellung zusätzlicher Berichte<br />
muss separat budgetiert bzw. beim Vorstand des <strong>ANQ</strong> beantragt werden.<br />
Die Gesamtberichte sind in französischer, italienischer und deutscher Sprache vorzulegen. Sie<br />
sind in einer adressatengerechten Sprache zu verfassen (keine wissenschaftliche Publikation).<br />
Adressaten der Gesamtberichte sind die involvierten Mitarbeitenden und Verantwortlichen der<br />
Kliniken, die Partner des <strong>ANQ</strong> sowie der <strong>ANQ</strong> selbst.<br />
Ob die Ergebnisse im Gesamtbericht mit namentlicher Bezeichnung der Kliniken dargestellt<br />
werden, wird in Kenntnis der Datenqualität und der Ergebnisse durch den Vorstand des <strong>ANQ</strong><br />
entschieden. Massgebend für die Beurteilung sind die Empfehlungen der SAMW.<br />
Auch in Zusammenhang mit den Arbeiten zur Berichtserstellung wird die Bereitschaft des Auftragnehmers<br />
erwartet, mit dem <strong>ANQ</strong> zu kooperieren.<br />
2.7 Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse über den <strong>ANQ</strong> und die Kliniken hinaus für eine breitere<br />
Öffentlichkeit ist vorgesehen; aber nicht Gegenstand der vorliegenden <strong>Ausschreibung</strong>. Der <strong>ANQ</strong><br />
entscheidet allein und ausschliesslich über die Form und Art der Publikation der Gesamtbericht<br />
bzw. Auszüge davon. Die Publikation erfolgt unter Nennung der am Auftrag beteiligten Institute<br />
bzw. Autoren. Die Nutzung für allfällige weitere Forschungsarbeiten muss durch den <strong>ANQ</strong> ausdrücklich<br />
bewilligt werden.<br />
8
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
3 Rahmenbedingungen und Organisation der <strong>Ausschreibung</strong><br />
3.1 Zielgruppe der <strong>Ausschreibung</strong><br />
Die <strong>Ausschreibung</strong> richtet sich an in- und ausländische Organisationen (Unternehmen, Forschungseinrichtungen,<br />
andere Organisationen), welche Kernkompetenzen in der Analyse und<br />
Interpretation von medizinischen Daten (Risikoadjustierung, Vergleich mit nationalen Referenzwerten<br />
und weitere methodische Kompetenzen) und in der Berichtsfassung (Verständlichkeit<br />
und Nachvollziehbarkeit) nachweisen.<br />
Wichtig ist Erfahrung in der Durchführung von komplexen Grossprojekten (insbesondere dezentrale<br />
Datenerfassung, Mehrsprachigkeit, Auswertung). Ausgewiesene adäquate Kommunikationskompetenzen<br />
(Umgang mit Kliniken, Umgang mit <strong>ANQ</strong>) sowie mündliche und schriftliche<br />
Sprachkompetenzen (Landessprachen D, F und I, Verständlichkeit der Berichte) werden vorausgesetzt.<br />
Kenntnisse der Schweizer Spitallandschaft und Schweizer Gesundheitspolitik runden<br />
das Profil des Auftragnehmers bzw. des vorgesehenen Projektteams ab.<br />
Das vorgesehene Projektteam sollte ebenso über wissenschaftliche Kompetenzen auf dem<br />
Gebiet der muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> sowie auf dem Gebiet der<br />
kardiologischen und pneumologischen <strong>Rehabilitation</strong> aufweisen. Die Kompetenzen können beispielsweise<br />
in Form eines externen „wissenschaftlichen Beirats“ eingebunden werden.<br />
Verlangt wird eine termingerechte und exakte Arbeitsweise sowie Sensibilität für und Rücksicht<br />
auf Belange des Datenschutzes.<br />
3.2 Bewerbungsverfahren und Vertrag<br />
Die angeschriebenen Institute sind eingeladen, Ihr Interesse bis Ende April 2012 beim <strong>ANQ</strong> zu<br />
bekunden und dann fristgerecht eine Offerte einzureichen (27. Mai 2012 (24 Uhr)). Weitere Interessenten<br />
werden gebeten mit Vinciane Vouets, Projektleitung <strong>Rehabilitation</strong> <strong>ANQ</strong>, Kontakt<br />
aufzunehmen.<br />
Die Offertsteller reichen ihre Offerte termingerecht bis zum 27. Mai 2012 (24 Uhr) beim <strong>ANQ</strong><br />
ein.<br />
Der <strong>ANQ</strong> trifft eine Vorselektion und lädt die nominierten Offertsteller zu einer kurzen Präsentation<br />
beim Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> ein; diese Kurzpräsentation erfolgt am Morgen des<br />
21. Juni 2012 in Bern. Der Qualitätsausschuss unterbreitet dem Vorstand einen begründeten<br />
Entscheidungsvorschlag.<br />
Eine Information der Mitbewerber erfolgt nach der Vorselektion sowie nach dem Entscheid des<br />
Vorstandes des <strong>ANQ</strong>.<br />
Mit dem designierten Auftragnehmer wird ein Leistungsvertrag abgeschlossen. Der Abschluss<br />
eines Leistungsvertrags ist für August / September 2012 anvisiert. Der Vertrag kann unmittelbar<br />
in Kraft treten; Vertragsende ist voraussichtlich Sommer 2015. Eine Erneuerung des Vertrags<br />
ist möglich (Anschlussvertrag für die <strong>Datenjahre</strong> 2015 und 2016).<br />
Grundsätzlich ist es möglich eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden (z.B. bei der Beteiligung von<br />
ausländischen Instituten). Gegenüber dem <strong>ANQ</strong> und den Spitälern und Kliniken ist jedoch eine<br />
zuständige Organisation zu bestimmen, welche die Koordinationsarbeit mit allfälligen Subkontrakten<br />
übernimmt.<br />
9
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
3.3 Offerte<br />
In der Offerte sollen der Forschungsansatz (theoretischer Referenzrahmen) sowie die inhaltlichen<br />
und methodischen Bezüge zu früheren Arbeiten kurz dargestellt werden. Zudem ist das<br />
methodische Vorgehen bei der Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen detailliert zu erläutern.<br />
Ebenso sollen die gewählten thematischen Schwerpunkte ausführlich beschreiben. Hinzu<br />
kommt die Darstellung der Kommunikation zwischen dem Auftragnehmer, dem <strong>ANQ</strong> (Projektleitung,<br />
Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong>) und den Kliniken. Die Offerte beinhaltet schliesslich<br />
eine Budgetierung der Kosten (Personalkosten, Materialkosten etc.) und einen Arbeits- und<br />
Zeitplan mit Meilensteinen.<br />
In den Anhang der Offerte gehören eine Beschreibung des Anbieters sowie eine Beschreibung<br />
von ausgewählten Referenzprojekten. Ebenso erwartet wird eine Beschreibung der Organisation<br />
des Projektteams (Rollen und Zuständigkeiten). Des Weiteren sollen im Anhang die CV der<br />
einzelnen Teammitglieder einschliesslich ihrer beruflichen Qualifikationen bzw. Erfahrungen<br />
aufgeführt werden.<br />
Die Offerte kann in Deutsch oder Französisch eingereicht werden. Falls mehrere Dokumente<br />
eingereicht werden, sollen diese zu einer pdf-Datei zusammengefasst werden. Die Offertstellung<br />
erfolgt unentgeltlich.<br />
3.4 Zuschlagskriterien<br />
Den Zuschlag für das Mandat erhält derjenige Offertsteller, welcher den folgenden Punkten am<br />
besten entspricht.<br />
‐ Eigenschaften des Auswertungsinstituts und Kompetenzen des für das Projekt vorgesehenen<br />
Teams (u.a. Unabhängigkeit von der rehabilitativen Leistungserbringung)<br />
‐ Kenntnis der <strong>Rehabilitation</strong> oder Erfahrung in ähnlichen Aufgabenstellungen<br />
‐ Verständnis des Auftrags (Gesamtkonzeption)<br />
‐ Statistische Kenntnisse (insbesondere Risikoadjustierung, Benchmarking)<br />
‐ Qualität der Offerte (Inhalt, Klarheit, Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Organisation)<br />
‐ Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Kliniken und dem <strong>ANQ</strong><br />
‐ Preis-/Leistungsverhältnis<br />
‐ Auskünfte über Referenzen<br />
3.5 Zeitplan<br />
Für die einzelnen Arbeitsschritte gelten die folgenden Termine:<br />
‐ Ende April: Frist für die Bekundung des Interesses an einer Offerterstellung<br />
‐ 27. Mai 2012 (24 Uhr): Einreichung der Offerte<br />
‐ 21. Juni 2012: Präsentation der Offerten (Auswahl) beim Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong><br />
‐ Ende Juli 2012 (spätestens Anfang September): Bekanntgabe des Auswertungsinstituts<br />
‐ August / September 2012: Vertragsabschluss zwischen <strong>ANQ</strong> und Auftragnehmer<br />
10
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
‐ Oktober 2012: Abgabe des Datenhandbuchs<br />
‐ April 2013: Abgabe des Auswertungskonzepts für die Vernehmlassung bei den Kliniken<br />
‐ September 2013: Abgabe und Diskussion des Datenqualitätsberichts<br />
‐ Frühling: 2014: Gesamtbericht für das Datenjahr 2013<br />
‐ Sommer 2015: Gesamtbericht für das Datenjahr 2014 (inkl. Jahresvergleichen)<br />
Wir möchten Sie bitten, sich bereits heute den 21. Juni 2012 für die Präsentation Ihrer Offerte<br />
zu reservieren.<br />
3.6 Kostendach und Zahlungsmodalitäten<br />
Die <strong>Ausschreibung</strong> erfolgt ohne Kostendach.<br />
Die Zahlungsmodalitäten werden bilateral zwischen dem <strong>ANQ</strong> und dem Auftragnehmer im<br />
Rahmen des Leistungsvertrags geregelt.<br />
3.7 Kontakt<br />
Auskunft erhalten Sie bei Vinciane Vouets, Projektleiterin <strong>ANQ</strong> unter der Telefonnummer 031<br />
357 38 40 sowie unter der Email-Adresse vinciane.vouets@anq.ch.<br />
Postanschrift: <strong>Nationaler</strong> Verein für Qualitätssicherung in Spitälern und Kliniken / Association<br />
nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques, Thunstrasse 17,<br />
Postfach, 3000 Bern 6.<br />
11
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />
Anhang:<br />
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: Umsetzungskonzept<br />
12
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>:<br />
Umsetzungskonzept<br />
Vom <strong>ANQ</strong>-Vorstand verabschiedete Version
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Inhalt<br />
1 Zusammenfassung ................................................................................................................ 1<br />
2 Ausgangslage ........................................................................................................................ 3<br />
2.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>) ............ 3<br />
2.2 Stationäre <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz ........................................................................ 3<br />
2.3 Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong> ...................................................................... 4<br />
2.3.1 Pilotprojekte muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> ........................ 4<br />
2.3.2 Pilotprojekt kardiologische <strong>Rehabilitation</strong> .............................................................. 5<br />
2.3.3 Qualitätsmanagement pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> ................................................... 5<br />
2.3.4 Lessons learned aus den Pilotprojekten ............................................................... 5<br />
3 Auftrag und Vorgehensweise ................................................................................................ 8<br />
3.1 Auftrag des Qualitätsausschusses <strong>Rehabilitation</strong> .......................................................... 8<br />
3.2 Ergebnisse der Arbeitsgruppen ...................................................................................... 9<br />
3.2.1 Arbeitsgruppe 1A .................................................................................................. 9<br />
3.2.2 Arbeitsgruppe 1B ................................................................................................ 11<br />
3.2.3 Arbeitsgruppe 2 ................................................................................................... 12<br />
3.2.4 Begleitgruppe m & n ............................................................................................ 13<br />
3.3 Rahmenbedingungen für den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> .............................. 14<br />
3.3.1 Inhaltliche Rahmenbedingungen ......................................................................... 14<br />
3.3.2 Organisatorische Rahmenbedingungen .............................................................. 15<br />
3.3.3 Finanzielle Rahmenbedingungen ........................................................................ 17<br />
3.3.4 Terminliche Rahmenbedingungen ...................................................................... 18<br />
4 <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> ..................................................................................... 20<br />
4.1 Einleitung ...................................................................................................................... 20<br />
4.2 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......................................... 20<br />
4.2.1 Der Fragebogen für die nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......... 21<br />
4.2.2 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung ......................................... 21<br />
4.2.3 Methodische Aspekte .......................................................................................... 21<br />
4.2.4 Organisation der nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ................. 22<br />
4.3 Bereichsspezifische Messpläne ................................................................................... 22<br />
4.3.1 Modul 2: <strong>Messplan</strong> für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> 22<br />
4.3.2 Modul 3: <strong>Messplan</strong> für die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> ...................... 24<br />
4.3.3 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung (Modul 2 und Modul 3) .... 26<br />
4.3.4 Methodische Aspekte (Modul 2 und Modul 3) ..................................................... 27<br />
4.3.5 Handbuch zur Messung und Schulungskonzept (Modul 2 und Modul 3) ............ 28
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4.3.6 Organisation der bereichsspezifischen Messungen (Modul 2 und Modul 3) ....... 29<br />
4.4 Auswertung, Berichterstattung und Veröffentlichung (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) 30<br />
4.4.1 Berichtswesen ..................................................................................................... 30<br />
4.4.2 Veröffentlichung der Ergebnisse ......................................................................... 31<br />
4.5 Kosten, Finanzierung und Taxzuschlag (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) .................... 31<br />
4.6 Zeitplan und Meilensteine (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) ......................................... 33<br />
4.7 Weiterentwicklung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> ......................................................... 34<br />
5 Anhang ................................................................................................................................ 37<br />
5.1 Personenverzeichnis .................................................................................................... 37<br />
5.1.1 Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> ...................................................................... 37<br />
5.1.2 Arbeitsgruppe 1A ................................................................................................ 37<br />
5.1.3 Arbeitsgruppe 1B ................................................................................................ 37<br />
5.1.4 Arbeitsgruppe 2 ................................................................................................... 37<br />
5.2 Qualitätssicherung in der Krankenversicherung ........................................................... 38<br />
5.2.1 Art. 58 KVG: Qualitätssicherung ......................................................................... 38<br />
5.2.2 Art.77 KVV: Qualitätssicherung ........................................................................... 38<br />
5.3 Qualitätsvertrag ............................................................................................................ 38<br />
5.4 Datenreglement <strong>ANQ</strong> (Version 1.0).............................................................................. 42<br />
5.5 Anforderungen an die Auswertungskonzepte des <strong>ANQ</strong> ............................................... 45<br />
5.6 Pilotprojekt .................................................................................................................... 48<br />
5.6.1 Modul „Muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>“ ............................................................ 49<br />
5.6.2 Modul „Neurologische <strong>Rehabilitation</strong>“ ................................................................. 49<br />
5.7 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......................................... 50<br />
5.7.1 Ankündigungsschreiben ...................................................................................... 50<br />
5.7.2 Begleitschreiben .................................................................................................. 51<br />
5.7.3 Fragebogen ......................................................................................................... 51<br />
5.8 Modul 2: Messinstrumente ........................................................................................... 52<br />
5.8.1 Zieldokumentation und Zielerreichung ................................................................ 52<br />
5.8.2 Functional Independence Measure (FIM) ........................................................... 53<br />
5.8.3 Erweiterter Barthel-Index (EBI) ........................................................................... 54<br />
5.8.4 Health Assessment Questionnaire (HAQ) ........................................................... 58<br />
5.9 Modul 3: Messinstrumente ........................................................................................... 61<br />
5.9.1 6-Minuten-Gehtest .............................................................................................. 61<br />
5.9.2 Ergometrie ........................................................................................................... 61<br />
5.9.3 MacNew Heart .................................................................................................... 62<br />
5.9.4 Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) .......................................................... 68<br />
ii
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
5.10 Weitere Instrumente ..................................................................................................... 72<br />
5.10.1 Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) ..................................................... 72<br />
iii
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
1 Zusammenfassung<br />
Der nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> umfasst insgesamt 10 Instrumente und ist modularisiert:<br />
Modul 1 beinhaltet die Erhebung der Patientenzufriedenheit anhand eines Kurzfragebogens in<br />
allen Fachbereichen der stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Der Kurzfragebogen (fünf Fragen) kann in<br />
Kombination mit allfällig bestehenden Patientenzufriedenheitsmessungen eingesetzt werden.<br />
Befragt werden alle erwachsenen Patienten, welche in einer maximal zwei Monate dauernden<br />
Zeitperiode aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik ausgetreten sind. Die Datenerhebung ist zeitlich mit<br />
der entsprechenden Datenerhebung im Akutbereich koordiniert.<br />
Die Zufriedenheitsbefragung ist eine mit einer Mindeststichprobe kombinierte Periodenmessung.<br />
Basis des Auswertungsberichts sind die während der maximal zweimonatigen Beobachtungsperiode<br />
erhobenen Daten. Organisation, Durchführung und Berichtsfassung erfolgen analog<br />
der entsprechenden Befragung in der Akutmedizin.<br />
Modul 2 des nationalen <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> beinhaltet die Qualitätsmessungen in der<br />
muskuloskelettalen und neurologischen stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Als Instrument vorgesehen<br />
ist die Zieldokumentation in Anlehnung an die ICF-Philosophie (inkl. Beurteilung der Zielerreichung).<br />
Diese wird entweder mit dem EBI oder FIM (Wahlpflicht für neurologische Patienten)<br />
oder mit dem HAQ (muskuloskelettale Patienten) kombiniert.<br />
Modul 3 des nationalen <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> beinhaltet die Qualitätsmessungen in der kardialen<br />
und pulmonalen stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Sowohl in der kardialen als auch pulmonalen<br />
<strong>Rehabilitation</strong> sind der 6-Minuten-Gehtest und eine Ergometrie vorgesehen. Zusätzlich eingesetzt<br />
werden der krankheitsorientierte MacNew Heart bei bestimmten kardiovaskulären Patientengruppen,<br />
ein Feeling-Thermometer bei Patienten mit pneumologischer Problematik sowie<br />
der CRQ-Fragebogen bei COPD-Patienten.<br />
An allen Patienten mit einer muskuloskelettalen, neurologischen, kardialen oder pulmonalen<br />
Problematik werden zwei oder mehr fachbereichsspezifische Messungen (Modul 2 bzw. Modul<br />
3) durchgeführt. Die Messung erfolgt bei Eintritt und Austritt (Vollerhebung).<br />
Die eingesetzten 9 Instrumente des Moduls 2 und 3 1 und ihre Anwendung werden in einem<br />
Handbuch dokumentiert. Die Anwendung der Instrumente durch das medizinische und therapeutische<br />
Personal wird im Rahmen von Veranstaltungen geschult.<br />
Organisation der Datenerhebungen, Auswertung und Berichtsfassung erfolgen unabhängig von<br />
der Patientenzufriedenheitsbefragung (Modul 1). Basis der jährlichen Gesamtberichte für Modul<br />
2 und Modul 3 bilden die Daten eines Jahres (12 Monate).<br />
Die Sicherstellung einer hohen Datenqualität bei der Dateneingabe in den Kliniken bis hin zur<br />
Datenbereinigung durch das Auswertungsinstitut hat einen hohen Stellenwert. Eine hohe Datenqualität<br />
ist unabdingbar für das Gelingen des Projekts und die angestrebte Veröffentlichung<br />
der Ergebnisse mit namentlicher Bezeichnung der Kliniken.<br />
Für die Messungen, die Auswertung und Berichterstellung in allen drei Modulen entstehen Aufwendungen<br />
von insgesamt --------Franken. Die externen Messkosten, die dem <strong>ANQ</strong> belastet<br />
1 Modul 2: Dokumentation der Ziele (inkl. Zielerreichung), Functional Independence Measurement (FIM),<br />
Erweiterter Barthel-Index (EBI), Health Assessment Questionnaire (HAQ); Modul 3: 6-Minuten-Gehtest,<br />
Fahrrad-Ergometrie, MacNew Heart, Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), Feeling Thermometer.<br />
1
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
werden, belaufen sich auf ------- Franken. Auf Basis der Verträge und Reglemente wurden<br />
klinikinterne Messkosten in der Höhe von -------- Franken (Referenzjahr 2009) errechnet;<br />
diese dürften deutlich unter die tatsächlich zu erwartenden Umstellungskosten in den Kliniken<br />
liegen.<br />
Es resultiert ein gesamter Taxzuschlag (Kantons- plus Versichereranteil) von ---- Franken<br />
(gerundet). Dieser wird auf die Kantone (----- Franken) und Versicherer (------ Franken) aufgeteilt.<br />
Messbeginn ist Anfang 2013 für das Modul 2 und 3; die Patientenzufriedenheitsmessung soll im<br />
Frühsommer 2013 auf Basis der Austritte in den Monaten April und Mai durchgeführt werden<br />
(die entsprechende Messung im Akutbereich erfolgt auf Basis der Austritte im Monat September).<br />
2
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
2 Ausgangslage<br />
2.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>)<br />
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG Art. 58 „Qualitätssicherung“) und dessen Verordnung<br />
(KVV Art. 77 „Qualitätssicherung“) fordern Massnahmen zur Sicherung und Förderung der Qualität<br />
der Leistungen. Um die Anforderungen des KVG und des KVV umzusetzen, unterzeichneten<br />
die Tarifpartner (H+ „Die Spitäler der Schweiz“ und santésuisse „Die Schweizer Krankenversicherer“)<br />
am 15. Dezember 1997 den sogenannten „Rahmenvertrag“. Diesem sind rund 350<br />
Leistungserbringer beigetreten. Der Rahmenvertrag regelt die Zusammenarbeit bei der Umsetzung<br />
der partnerschaftlich ausgehandelten strategischen Ziele bezüglich des Qualitätsmanagements.<br />
Zur Schaffung von verbindlichen Strukturen und um Projekte national zu koordinieren,<br />
wurde die nationale Koordinations- und Informationsstelle für Qualitätssicherung (KIQ) gegründet.<br />
Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken <strong>ANQ</strong> ist 2009 aus der<br />
Zusammenlegung des KIQ und des interkantonalen Vereins für Qualitätssicherung und -<br />
förderung (IVQ) entstanden. Unter dem Namen „<strong>Nationaler</strong> Verein für Qualitätsentwicklung in<br />
Spitälern und Kliniken“ <strong>ANQ</strong> (<strong>ANQ</strong> = Association nationale pour le développement de qualité<br />
dans les hôpitaux et les cliniques) besteht ein Verein im Sinne vom Artikel 60 ff. ZGB mit Sitz in<br />
Bern. Die Mitglieder des Vereins <strong>ANQ</strong> sind der Spitalverband H+, die Kantone, santésuisse und<br />
die Eidgenössischen Sozialversicherer.<br />
Der Zweck des <strong>ANQ</strong> ist die Koordination, Durchführung und Publikation von Qualitätsmessungen<br />
auf nationaler Ebene im stationären Bereich. Dabei sind Messungen in der Akutsomatik,<br />
<strong>Rehabilitation</strong> und Psychiatrie einheitlich umzusetzen. Der <strong>ANQ</strong> ist auch für die Vorgabe der<br />
gesamtschweizerisch durchzuführenden Messungen verantwortlich. Mit der Dokumentation der<br />
Qualität (Vergleich mit nationalen Referenzwerten) wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung und<br />
Verbesserung geleistet (Statuten des <strong>ANQ</strong> vom 24. November 2009).<br />
Die Finanzierung und Umsetzung der Qualitätsmessungen im stationären Bereich gemäss den<br />
Vorgaben des <strong>ANQ</strong> wurde 2011 im Rahmen des nationalen Qualitätsvertrages von dem <strong>ANQ</strong>,<br />
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren<br />
(GDK), H+, santésuisse und den Eidgenössischen Sozialversichern geregelt. Alle Kantone und<br />
fasst alle Leistungserbringer und Versicherer sind diesem Vertrag beigetreten; der Rahmenvertrag<br />
aus dem Jahr 1997 (siehe oben) wird damit hinfällig.<br />
Darüber hinaus wurde 2011 ein Datenreglement in Kraft gesetzt, welches den Umgang mit den<br />
im Rahmen des nationalen Qualitätsvertrages erhobenen Daten der beteiligten Partner regelt.<br />
Es legt zudem die Rahmenbedingungen für die Auswertung und Publikation der Daten fest. Im<br />
selben Jahr noch wurde ein Grundlagenpapier erstellt, das die Anforderungen an die messspezifischen<br />
Auswertungskonzepte formuliert.<br />
2.2 Stationäre <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz<br />
Aus der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (BFS 2011) geht hervor, dass die Schweiz<br />
53 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken zählt, davon 20 in der lateinischen Schweiz (18 in der Westschweiz<br />
3
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
und 2 im Tessin). Diese verzeichneten im Jahr 2009 rund 58‘000 Austritte. 2 Durchschnittlich<br />
weisen die Kliniken je rund 1‘000 Austritte jährlich aus (Minimum: rd. 350 Austritte; Maximum:<br />
rd. 2‘000 Austritte; geschätzt auf Basis der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser, Datenjahr<br />
2009). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einer <strong>Rehabilitation</strong>sklinik beträgt gemäss<br />
Obsan (2011) 25 Tage; die mediane Aufenthaltsdauer 21 Tage (d.h. die Hälfte der Behandlungen<br />
dauert weniger, die andere Hälfte länger als 21 Tage).<br />
2.3 Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die Wahl von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren und die Anforderungen an Klinikvergleiche<br />
werden in der Schweiz seit rund 10 bis 15 Jahren diskutiert. Diese Diskussionen, an denen<br />
sich die verschiedensten Gremien und Arbeitsgruppen seitens der Kranken- und Sozialversicherer<br />
sowie der Leistungserbringer beteiligt haben, bilden die Grundlage für die Entwicklung<br />
und Umsetzung der <strong>ANQ</strong>-Pilotprojekte.<br />
Der <strong>ANQ</strong> (ehemals KIQ) hat zusammen mit Kliniken mehrere Projekte zur Entwicklung und<br />
Umsetzung rehabilitationsspezifischer Ansätze in den verschiedenen Bereichen der <strong>Rehabilitation</strong><br />
im Sinne von Vergleichsmessungen durchgeführt:<br />
2.3.1 Pilotprojekte muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
Im Fachbereich der neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> wurde in den Jahren 2007 bis 2009 ein Pilotprojekt<br />
zur Dokumentation von ICF (International Classification of Functioning, Disability and<br />
Health) basierten Zielsetzungsprozessen (inkl. Zielerreichung) durchgeführt. Dabei wird das<br />
Erreichen der Behandlungsziele als Nachweis für den <strong>Rehabilitation</strong>serfolg (Qualitätsindikator)<br />
erhoben. 12 Kliniken haben dieses auf prozessorientierte Qualitätskriterien basierende Konzept<br />
mitentwickelt und umgesetzt.<br />
Parallel dazu wurde im Fachbereich der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> ein auf dem Ansatz<br />
der Funktionsfähigkeit basierendes Konzept (ohne Integration des Zielsetzungsprozesses) entwickelt<br />
und umgesetzt. Daran haben sich 13 Kliniken beteiligt. Mit dem ergebnisorientierten<br />
Konzept soll die Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf als<br />
<strong>Rehabilitation</strong>serfolg (Qualitätsindikator) nachgewiesen werden.<br />
Die während der Pilotphase erhobenen Daten wurden den Kliniken zum einen in Form von jährlichen<br />
klinikspezifischen Berichten zur Verfügung gestellt. Zum anderen wurden die Daten klinikvergleichend<br />
ausgewertet und in Form von schriftlichen Berichten präsentiert.<br />
Die beiden Pilotprojekte sowie die Auswertung der Daten wurden in Zusammenarbeit mit der<br />
Firma RehabNET AG durchgeführt.<br />
2 Zwischen 2005 und 2009 ist die Zahl der Kliniken und Austritte kontinuierlich gestiegen. In der aktuellsten<br />
Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (BFS 2012) ist jedoch ein deutlicher Rückgang der Klinik-<br />
und Austrittstahlen dokumentiert: danach gibt es in der Schweiz 41 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken, welche<br />
im Jahr 2010 rund 45‘000 Austritte verzeichneten. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS)<br />
füllen Kliniken mit mehreren Aktivitätsbereichen (Akutmedizin, Psychiatrie, <strong>Rehabilitation</strong>, Geriatrie)<br />
bzw. Standorten neu nur einen Fragebogen aus – statt einen pro Aktivitätsbereich bzw. Standort. Ausserdem<br />
wurden 2010 <strong>Rehabilitation</strong>sabteilungen administrativ in die Allgemeinspitäler eingegliedert,<br />
was den Rückgang der Einrichtungen erklärt. Davon vergleichsweise stark betroffen waren die Kantone<br />
Jura, Neuenburg, Solothurn, Tessin, Wallis und Waadt (Mitteilung des BFS vom 23. Dezember 2011<br />
sowie 17. Januar 2012).<br />
4
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Im Pilotprojekt muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong> konnten Erhalt und Verbesserung der Funktionsfähigkeit<br />
und auch statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Kliniken nachgewiesen<br />
werden. Es zeigte sich jedoch, dass klinikvergleichende Darstellungen der Ergebnisse von<br />
Funktionsfähigkeitsmessungen nicht geeignet waren, Verbesserungsprozesse anzustossen.<br />
Ausserdem waren insbesondere ältere Patienten nicht in der Lage die Fragebogen auszufüllen.<br />
Die Experten waren sich einig, dass über den Ansatz der Zieldokumentation (inkl. Beurteilung<br />
der Zielerreichung bei Austritt und Nachhaltigkeit der Zielerreichung) bessere Qualitätsindikatoren<br />
gewonnen werden können – vorausgesetzt, es würden adäquate Ziele gesetzt und die Einschätzung<br />
der Zielerreichung objektiviert (z.B. mit Assessments).<br />
Aufgrund der Erfahrungen aus den beiden Pilotprojekten wurde Ende 2009 die Entwicklung des<br />
ICF basierten Ansatzes weitergeführt: Das Konzept der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> wurde<br />
an dasjenige der neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> angepasst. Im Januar 2010 begann eine<br />
sechsmonatige Testphase mit überarbeiteter Zieldokumentation für die muskuloskelettale und<br />
neurologische <strong>Rehabilitation</strong>. Betreffend Umsetzung und Machbarkeit des gemeinsamen Konzepts<br />
zeigten die Auswertungen ein durchwegs positives Ergebnis. Im Frühjahr 2011 hat der<br />
Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> die flächendeckende Einführung des gemeinsamen Konzepts<br />
für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> empfohlen.<br />
Weiterführende Informationen zu den Pilotprojekten muskuloskelettale und neurologische finden<br />
sich im Anhang (Anhang, Abschnitt 5.6, Seite 48).<br />
2.3.2 Pilotprojekt kardiologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
Auf Initiative von Vertretern von kardiologischen <strong>Rehabilitation</strong>skliniken übernahm im Frühjahr<br />
2008 der <strong>ANQ</strong> (bzw. der KIQ) zusammen mit einer breit abgestützten Expertengruppe die Aufgabe,<br />
ein Konzept zur Messung ergebnisrelevanter Qualitätsindikatoren im Bereich der kardialen<br />
<strong>Rehabilitation</strong> im Hinblick auf eine flächendeckende Einführung zu erstellen. 2010 legte der<br />
<strong>ANQ</strong> ein für die Umsetzung taugliches Konzept vor, das aufgrund damaliger finanzieller Unsicherheiten<br />
nicht umgesetzt werden konnte.<br />
2.3.3 Qualitätsmanagement pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
Im Sommer 2010 sind Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie (SGP) auf<br />
den <strong>ANQ</strong> zugekommen und haben ihr Konzept „Qualitätsmanagement Pulmonale <strong>Rehabilitation</strong>“<br />
zur Erfassung von ergebnisorientierten Qualitätsindikatoren präsentiert.<br />
Mit dem von SGP vorgeschlagenen Konzept sollen einheitliche Indikatoren erfasst werden, um<br />
die Qualität und die Effizienz der pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> abzubilden. In einer ersten Phase<br />
sollten die Erhebungen in der stationären Behandlung und im weiteren Verlauf auch in der ambulanten<br />
<strong>Rehabilitation</strong> erfolgen. Ergänzend sollten die erhobenen Daten für Forschungsprojekte<br />
genutzt werden. Das Konzept wurde am 11. März 2010 von den grossen pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong>skliniken<br />
(Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi, Luzerner Höhenklinik Montana, Klinik<br />
Barmelweid und Zürcher Höhenklinik Wald) verabschiedet (vgl. Dokument der SGP vom 11.<br />
März 2010).<br />
2.3.4 Lessons learned aus den Pilotprojekten<br />
Die Pilotprojekte haben folgende allgemeinen Erkenntnisse zutage gefördert, welche im Hinblick<br />
auf den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> relevant sind:<br />
5
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
1. Es ist von Vorteil, mit einem minimalen Set an Messungen zu beginnen, welches<br />
schrittweise weiterentwickelt und ergänzt wird.<br />
2. Die Messlogistik ist einfach zu halten: sie soll für die Kliniken keine unverhältnismässigen<br />
Aufwendungen nach sich ziehen (zum Beispiel für doppelte Datenerfassungen, teure<br />
IT-Schnittstellen).<br />
3. Eine gute Datenqualität ist eine zentrale Voraussetzung für verlässliche Aussagen und<br />
die Akzeptanz einer transparenten Darstellung von vergleichenden und klinikspezifischen<br />
Ergebnissen.<br />
4. Zur Sicherstellung der Datenqualität sind klare Vorgaben für den Erfassungsprozess, die<br />
Kontrolle der Daten bereits bei der Erfassung in der Klinik (Messhandbuch/Manual),<br />
Rückmeldungen an die beteiligten Kliniken über die erzielte Datenqualität durch das<br />
Messinstitut sowie Schulungen notwendig.<br />
5. Ein Bekenntnis zur Qualität sowie zur Notwendigkeit von entsprechenden Massnahmen<br />
– dies schliesst eine Bereitstellung notwendiger Ressourcen mit ein – auf allen Hierarchiestufen<br />
der Klinik unterstützt die Implementierung nachhaltiger Verbesserungsprozesse.<br />
6. Die institutionalisierte regelmässige Diskussion von Prozessoptimierungen und Ergebnissen<br />
und die Teilnahme an klinikübergreifenden Diskussionen (Foren/Workshops) fördert<br />
die Implementierung der Verbesserungen.<br />
7. Das Auswertungs- und Berichtswesen (klinikspezifische und vergleichende Berichte) im<br />
Pilotprojekt muss u.a. bezüglich der Risikoadjustierung und anderen statistischen Auswertungen,<br />
Tabellen und Grafiken, Lesehilfen, Verständlichkeit der Texte, Übersichtlichkeit<br />
und Möglichkeit zur Kommentierung überprüft werden.<br />
In Bezug auf die Wahl der Instrumente kann aus den Pilotprojekten gefolgert werden, dass die<br />
in der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> eingesetzten Instrumente insgesamt dazu geeignet<br />
waren, Erhalt und Verbesserung der Funktionsfähigkeit nachzuweisen; sie vermochten jedoch<br />
nicht, Verbesserungsprozesse anzustossen. Mit dem ICF-basierten Zielsetzungsprozess (inkl.<br />
Zielerreichung) konnten zum einen die Ergebnisse des medizinischen und therapeutischen Behandlungsprozess<br />
unabhängig von der Diagnose und der spezifischen Patientengruppe abgebildet<br />
werden. Zum anderen wurden in einem vergleichsweise hohen Mass Verbesserungsprozesse<br />
angestossen:<br />
1. Der Zielsetzungsprozess (inkl. Zielerreichung) war als klinikvergleichender Nachweis der<br />
Qualität (Qualitätsindikator) nutzbar.<br />
2. Der Zielsetzungsprozesse (inkl. Zielerreichung) war für die Kliniken hilfreich bei der Analyse<br />
des <strong>Rehabilitation</strong>sprozesses und deren Verbesserung.<br />
3. Für die Durchführung des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) brauchte es eine<br />
minimale Standardisierung. Dennoch blieben die Kliniken vergleichsweise frei in der Gestaltung<br />
der Behandlungsprozesse. Eine minimale klinikübergreifende Standardisierung<br />
des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) war trotz unterschiedlicher Behandlungsprozesse<br />
möglich.<br />
6
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4. Die begleitende regelmässige Diskussion der Zielsetzungs- und Behandlungsprozesse<br />
im Rahmen von Workshops / Foren wurde als wichtige Rahmenbedingung des Qualitätskonzepts<br />
betrachtet.<br />
5. Die Angemessenheit der für die <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung festgelegten Ziele wird sichergestellt<br />
durch<br />
a. die Einbettung des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) in ein umfassendes<br />
Hauptziel- und Unterzielkategoriensystem gemäss den ICF-Kategorien der WHO. 3<br />
b. die Festlegung von individuellen Behandlungszielen unter Einbezug des Patienten<br />
(und allenfalls Angehörigen).<br />
c. die Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit und Behinderung des Patienten sowie<br />
der Kontextfaktoren (persönliche Merkmale 4 und Umwelt 5 des Patienten).<br />
d. die Untermauerung der Adäquatheit der Ziele durch Funktionsmessungen.<br />
Die unzureichende Überprüfbarkeit der Angemessenheit der festgelegten Ziele sowie das Fehlen<br />
von Richtlinien zur Beurteilung der Zielerreichung sind Schwächen des Konzepts. Richtlinien<br />
zur Überprüfung der Angemessenheit von festgelegten Zielen und zur Beurteilung der Validität<br />
der angegebenen Zielerreichungsgrade (z.B. anhand von Goal Attainment Scaling 6 ) sollen<br />
für das Messhandbuchs und die Schulungen erarbeitet werden (vgl. Abschnitt 4.3.5, Seite<br />
28).<br />
3 Vgl. http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/<br />
4 Als persönliche Merkmale gelten zum Beispiel Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Lebensstil,<br />
Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Beruf, persönliche Erfahrung, charakteristische<br />
Verhaltensmuster (individuelle Bewältigungsstrategien). Gemäss Bucher (2011) sind personenbezogene<br />
Faktoren in der ICF derzeit (noch) nicht klassifiziert. Die Erstellung einer Klassifikation<br />
der persönlichen Kontextfaktoren durch die Arbeitsgruppe „ICF“ der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin<br />
und Prävention DGSP erweitert mit Experten aus Deutschland und der Schweiz ist jedoch in<br />
Gange (vgl. http://www.sar-gsr.ch/jmuffin/upload/Referat_Peter_O_Bucher.pdf).<br />
5 Als Umweltfaktoren gelten zum Beispiel technische Hilfsmittel zum persönlichen Gebrauch im täglichen<br />
Leben, Hilfsmittel zur persönlichen Mobilität drinnen und draussen, bauliche oder technische Massnahmen<br />
für private Nutzung, Unterstützung durch Dienste oder Bezugspersonen, Einstellung und Motivation<br />
von Personen aus dem Umfeld des Patienten.<br />
6 Goal Attainment Scaling (GAS) ist ein Instrument, das dazu dient, die Erreichung gegebener Ziele zu<br />
überprüfen. Es setzt die Festlegung eines oder mehrerer Ziele voraus. Für jedes Ziel werden dann Indikatoren<br />
festgelegt, mit deren Hilfe die Zielerreichung überprüft werden kann. Die Überprüfung der Ziele<br />
erfolgt mittels einer 5-stufigen Antwortskala (1=“viel weniger als erwartet“, 2=“weniger als erwartet“,<br />
3=“erwartet“, 4=“mehr als erwartet“, 5=“viel mehr als erwartet). Vergleiche Literaturverzeichnis.<br />
7
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
3 Auftrag und Vorgehensweise<br />
3.1 Auftrag des Qualitätsausschusses <strong>Rehabilitation</strong><br />
Der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> umfasst 9 Vertreterinnen und Vertreter, von Fachgesellschaften,<br />
Versicherern und Kantonen 7 . Im Dezember 2010 wurde er vom Vorstand des <strong>ANQ</strong><br />
beauftragt, bis spätestens Ende 2011 ein Umsetzungskonzept für die flächendeckende Messung<br />
von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren in der stationären <strong>Rehabilitation</strong> zu erarbeiten,<br />
das mit der Leistungsfinanzierung in der <strong>Rehabilitation</strong> (ST-Reha-Projekt) 8 kompatibel ist.<br />
Der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> beschloss, die verschiedenen Konzepte in der <strong>Rehabilitation</strong><br />
aufzugreifen und in die Arbeiten zur Erstellung des Umsetzungskonzepts zu integrieren.<br />
Dazu hat er die Bildung von drei Arbeitsgruppen initiiert: die Arbeitsgruppe 1A, die Arbeitsgruppe<br />
1B sowie die Arbeitsgruppe 2.<br />
‐ Die Arbeitsgruppe 1A hatte den Auftrag, das Konzept „Dokumentation der Zielsetzung<br />
(inkl. Zielerreichung) um einfache und klare Outcome-Indikatoren unter Berücksichtigung<br />
bestehender Ansätze zu ergänzen. Die zusätzlichen Outcome-Indikatoren sollten<br />
die Beurteilung der Zielerreichung untermauern. Ergänzend sollte ein Instrument zur<br />
Überprüfung der Nachhaltigkeit der Partizipationsziele entwickelt werden. Mitglieder die<br />
Arbeitsgruppe 1A sind Experten aus Pilotkliniken mit muskuloskelettaler oder neurologischem<br />
<strong>Rehabilitation</strong>. 7 Die Arbeitsgruppe traf sich zu acht Arbeitssitzungen.<br />
‐ Die Arbeitsgruppe 1B bestehend aus Experten der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong><br />
7 wurde beauftragt, bestehende Konzepte mit Blick auf die flächendeckende Einführung<br />
von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren anzugleichen. Das Qualitätsmanagement-Konzept<br />
der SGP diente zusammen mit dem bestehenden Konzept in der kardiologischen<br />
<strong>Rehabilitation</strong> als Basis für die Angleichung beider Konzepte, welche im Rahmen<br />
von drei Sitzungen erarbeitet wurde.<br />
‐ Arbeitsgruppe 2 hatte den Auftrag, Vorschläge für fachübergreifende Ergebnisindikatoren<br />
in der <strong>Rehabilitation</strong> unter Berücksichtigung bestehender und angewandter Methoden<br />
zu unterbreiten. Mitglieder die Arbeitsgruppe 2 sind Experten aus Pilotkliniken mit<br />
neurologischer oder muskuloskelettaler <strong>Rehabilitation</strong> sowie Experten aus Kliniken mit<br />
kardialer und pulmonaler <strong>Rehabilitation</strong> 7 . Die Arbeitsgruppe 2 erarbeitete ihr Ergebnis im<br />
Rahmen von drei Sitzungen.<br />
Die Geschäftsstelle hat die Sitzungen der drei Arbeitsgruppen organisiert und durchgeführt und<br />
die Vorschläge mit der Begleitgruppe m & n besprochen. Diese war im Rahmen des Pilotprojekts<br />
aus der Zusammenlegung zweier Begleitgruppen zur Begleitgruppe m & n entstanden.<br />
Ihre Aufgabe war es, das Pilotprojekt muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> über<br />
7 Eine Mitgliederliste befindet sich im Anhang Abschnitt 5.1<br />
8 ST-Reha ist die Kurzbezeichnung des Projekts „Schweizerisches Tarifsystem <strong>Rehabilitation</strong>“. Seit 2004<br />
bearbeiten H+ und die Medizinaltarifkommission UVG (MTK) das Tarifprojekt im Bereich der stationären<br />
<strong>Rehabilitation</strong>. Es bezweckt die Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlagen und der neuen Spitalfinanzierung<br />
(Leistungsfinanzierung). Im Jahr 2009 konnte als Meilenstein ein Patientenklassifikationssystem<br />
(PCS) für die neurologische und muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong> entwickelt werden, das anhand<br />
des Schweregrads einer Erkrankung die Behandlungskosten schätzt. Gegenwärtig wird im Rahmen<br />
einer Pilotphase das PCS probeweise in Kliniken eingeführt. (vgl.<br />
http://www.hplus.ch/de/tarife_preise/andere_stationaere_tarife/st_reha/).<br />
8
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
den Abschluss des Pilotprojekts hinaus zu begleiten und weiterzuentwickeln. Die Begleitgruppe<br />
umfasst Vertreter von Pilotkliniken mit neurologischer oder muskuloskelettaler <strong>Rehabilitation</strong> 9 .<br />
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen wurden in die erste Version des Umsetzungskonzepts<br />
für die landesweiten Messungen in der <strong>Rehabilitation</strong> eingearbeitet, welches im Juni 2011<br />
dem QA <strong>Rehabilitation</strong> präsentiert wurde. Zusätzlich wurden Grundlagen, insbesondere zum<br />
Datenerfassungs- und Auswertungssystem (Basis dazu bildeten drei Richtofferten), zur geplanten<br />
nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> (Basis hierzu bildete die nationale Zufriedenheitsbefragung<br />
im Akutbereich) sowie zur Finanzierung erarbeitet. Die kritische Diskussion<br />
dieser Grundlagen erfolgte an den Sitzungen im September 2011 und November 2011.<br />
3.2 Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />
3.2.1 Arbeitsgruppe 1A<br />
Nach Meinung der Arbeitsgruppe 1A soll die Beurteilung der Zielerreichung durch das medizinische<br />
Personal (vgl. 2.3.4, Seite 5) durch die Anwendung von verschiedenen Assessments objektiviert<br />
werden (Tabelle 1). Darunter befinden sich ebenso Instrumente mit einem breiten Anwendungsspektrum<br />
wie dem FIM, dem EBI und dem HAQ als auch Instrumente, welche diagnosespezifisch<br />
eingesetzt werden, um Boden- und Deckeneffekte von FIM, EBI und HAQ aufzufangen.<br />
Vorgeschlagen wird zudem eine Patientenzufriedenheitsbefragung mit einem kurzen<br />
Fragebogen (vgl. Abschnitt 3.2.3, Seite 12).<br />
Darüber hinaus schlug die Arbeitsgruppe 1A vor, dass die Verwendung von weiteren Assessments<br />
von den Kliniken in einer Liste 10 deklariert werden. Damit will die Arbeitsgruppe 1A<br />
Transparenz gegenüber anderen Leistungserbringern, den Versicherern und Kantonen schaffen<br />
sowie den fachlichen Austausch unter den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken fördern.<br />
Die Arbeitsgruppe hatte zudem anfänglich empfohlen, die Zieldokumentation (inkl. Zielerreichung<br />
bei Austritt aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik) durch eine Befragung der Patienten zur Nachhaltigkeit<br />
der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung mehrere Wochen nach Austritt aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />
zu ergänzen. Der QA <strong>Rehabilitation</strong> hat in Rücksprache mit der Arbeitsgruppe die Entwicklung<br />
eines entsprechenden ICF-kompatiblen Patientenfragebogens (abgestimmt auf die<br />
ICF-Partizipationsziele Wohnen, soziokulturelle Aktivitäten und Arbeiten) aus mehreren Gründen<br />
vorzeitig terminiert (vgl. Abschnitt 3.3.1.3). Der Stand der Arbeiten wird von der Arbeitsgruppe<br />
1A in einem Arbeitspapier festgehalten 11 .<br />
Im Pilotprojekt wurden die Daten mittels webbasierten Datenerfassungsmasken mit umfassenden<br />
Prüfroutinen erfasst (RehabNET_MAS©). Die Integration der Datenerfassungsmasken in<br />
das klinikeigene IT-System, das Programmieren von allfälligen Schnittstellen bzw. die doppelte<br />
Dateneingabe wird von den am Pilotprojekt teilnehmenden Kliniken als aufwändig bezeichnet.<br />
Aus Sicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 1A sind Schnittstellen so zu gestalten, dass Daten<br />
aus dem klinikeigenen System einfach exportiert werden können, zum Beispiel in eine Excel-<br />
Tabelle.<br />
9 Ein Teil der Mitglieder waren in der Arbeitsgruppe 1A, 1B oder 2.<br />
10 Erstellung der Liste gestützt auf den Sammelbändern zu Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong> (Neurologie,<br />
2009; Bewegungsapparat, 2011; Kardiologie und Pneumologie, 2009) von Stefan Schädler et al.,<br />
Peter Oesch et al. sowie Gilbert Büsching et al.<br />
11 Das Arbeitspapier wird dem <strong>ANQ</strong> voraussichtlich im März 2012 vorgelegt.<br />
9
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Tabelle 1: Messinstrumente für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> (Vorschlag<br />
Arbeitsgruppe 1A)<br />
Messungen in der muskuloskelettalen<br />
und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong><br />
Obligatorische Messungen<br />
Patienten<br />
Patientenzufriedenheitsbefragung DG-m<br />
DG-n<br />
Hauptziele (HZ) und Zielerreichung (ZE)<br />
gemäss ICF-Ansatz<br />
Nachhaltigkeit der Zielerreichung (ZE+)<br />
gemäss ICF-Ansatz a)<br />
Allgemeine Messungen mit Wahlpflicht<br />
Functional Independence Measurement<br />
(FIM)<br />
Diagnosegruppe<br />
DG-m<br />
DG-n<br />
DG-m<br />
DG-n<br />
Zeitpunkt<br />
E=Eintritt<br />
A=Austritt<br />
ScB=Score-<br />
Berechnung<br />
Mehrere Wochen<br />
nach A<br />
HZ bei E; ZE bei<br />
A; ScB<br />
ZE bei A; ZE+;<br />
ScB<br />
Typ<br />
SB=Selbstbeurt.<br />
FB=Fremdbeurt.<br />
SB<br />
[FB / SB]<br />
SB<br />
DG-n E / A; ScB FB<br />
Erweiterter Barthel-Index (EBI) DG-n E / A; ScB FB<br />
Health Assessment Questionnaire<br />
(HAQ)<br />
Diagnosespezifische Messungen mit Wahlpflicht<br />
DG-m E / A SB / FB<br />
Early Functional Abilities (EFA) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />
Efficiency Pattern Analysis (EPA) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />
Koma-Remissions-Scale (KRS) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />
Unified Parkinson Diesease Rating<br />
Scale (UPDRS)<br />
Parkinson E / A; ScB FB<br />
Spinal Cord Independence Measure Paraplegie E / A; ScB FB<br />
(SCIM)<br />
a) Der QA <strong>Rehabilitation</strong> hat die Entwicklung der entsprechenden Befragung in Rücksprache mit der Arbeitsgruppe<br />
vorzeitig terminiert.<br />
b) Zur Früh-<strong>Rehabilitation</strong> ist anzumerken, dass die Abgrenzung zwischen rehabilitativen von DRG abgedeckten<br />
Fällen im Akutbereich und von anderen früh-rehabilitativen Leistungen noch nicht abschliessend<br />
geklärt ist. Das Projekt der SwissDRG zur Leistungsfinanzierung (ST-Reha) wird bezüglich den entsprechenden<br />
Begriffen und Abgrenzungen Klarheit schaffen.<br />
Aus Sicht der Arbeitsgruppe 1A sind aufgrund der Erfahrungen im Pilotprojekt separate Institute<br />
mit einem entsprechenden spezifischen Know-how im Bereich der Datenerfassung bzw. Daten-<br />
10
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
auswertung zu beauftragen. Die Auswertung der Daten soll durch Institute bzw. Personen mit<br />
reha-spezifischem Wissen erfolgen.<br />
Die Arbeitsgruppe 1A ist des Weiteren der Auffassung, dass der Aufwand für Kliniken, welche<br />
mehrere Reha-Fachbereiche haben, sehr hoch würde, wenn für die muskuloskelettale und neurologische<br />
<strong>Rehabilitation</strong> einerseits und die kardiologische und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> andererseits<br />
zwei verschiedene Konzepte für die Erhebung von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren<br />
umgesetzt werden müssten. Sie favorisiert deshalb eine flächendeckende Umsetzung des<br />
Konzepts der Dokumentation der Zielsetzungen (inkl. Überprüfung der Erreichung der Partizipationsziele<br />
und deren Nachhaltigkeit). Diese Meinung wird auch von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe<br />
2 vertreten.<br />
3.2.2 Arbeitsgruppe 1B<br />
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 1B halten fest, dass sich die ICF-Ansatz in den letzten 15 Jahren<br />
in der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> nicht durchgesetzt hat. Ziele auf dieser Basis<br />
zu formulieren sei sehr schwierig und bringe den Patienten in der kardialen und pulmonalen<br />
<strong>Rehabilitation</strong> keinen Zusatznutzen. Die Erfassung der Symptombelastung und Funktionseinschränkung<br />
mit Assessments ist aus Sicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 1B zweckmässiger<br />
für Qualitätsvergleiche.<br />
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 1B schlagen vor, sich in der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong><br />
längerfristig auf gemeinsame Outcome-Indikatoren zu einigen – obschon Patienten der<br />
pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> als deutlich schwerer krank gelten als Patienten der kardialen <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
In Tabelle 2 sind die von der Arbeitsgruppe vorgesehenen Instrumente für die kardiale<br />
und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> aufgeführt.<br />
Darüber hinaus wurde der BODE-Index erwähnt – jedoch nicht diskutiert. Der BODE-Index ist<br />
eine Matrix zur Beurteilung des Mortalitätsrisikos bei COPD-Patienten aufgrund von fünf Variablen<br />
(FEV1, 6-Minuten-Gehtest, Luftnot (MMRC Dispnea Scala) und Body Mass Index).<br />
Die Ergebnisse der Qualitätsmessungen sollen in Bezug auf gewählte Krankheitsbilder unter<br />
Berücksichtigung des Alters, der Komorbiditäten und des Schweregrads der Erkrankung auswertet<br />
werden. Wünschenswert ist aus Sicht der Arbeitsgruppenmitglieder, dass die im Rahmen<br />
des Qualitätsmanagements erhobenen Daten, welche den individuellen Verlauf der <strong>Rehabilitation</strong><br />
beschreiben, unmittelbar im Klinikalltag nutzbar sind, zum Beispiel im Rahmen der Austrittberichterstattung.<br />
Die Frage der Standardisierung bzw. Vereinheitlichung der Messprotokolle (zum Beispiel 6-<br />
Minuten-Gehtest, Ergometrie) im Hinblick auf die vom <strong>ANQ</strong> angestrebten Klinikvergleiche wurden<br />
kontrovers diskutiert: Nach Meinung der Arbeitsgruppe 1B wäre ein Vergleich der Ergebnisse<br />
zwischen den Kliniken wissenschaftlich nicht haltbar: Zum einen sei das Patientengut<br />
nicht vergleichbar und zum anderen seien die Messprotokolle klinikspezifisch. Befürchtet werden<br />
ausserdem Sanktionen gegen Leistungserbringer, welche aufgrund von Fehlinterpretationen<br />
verhängt werden sowie datenschutzbezogene Probleme. Die Arbeitsgruppenmitglieder<br />
monieren zudem, dass Auswertung und Veröffentlichung weitgehend unklar seien.<br />
Die Durchsetzung landesweit einheitlicher Messprotokolle wurde von den Arbeitsgruppenmitgliedern<br />
1B vereinzelt begrüsst, mehrheitlich herrschte jedoch die Meinung vor, dass die Vorgabe<br />
eines einheitlichen Protokolls von den Kliniken nicht akzeptiert würde und die Standardi-<br />
11
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
sierung / Vereinheitlichung der Messprotokolle sehr aufwändig sei. Die Einführung eines zusätzlichen<br />
Protokolls wird als ethisch und medizinisch fragwürdig eingeschätzt, weil die Patienten im<br />
Rahmen der Assessments an die Leistungsgrenzen geführt werden.<br />
Tabelle 2: Messinstrumente für die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
(Vorschlag Arbeitsgruppe 1B)<br />
Messungen in der kardialen und<br />
pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong><br />
Patienten<br />
Diagnosegruppe<br />
Zeitpunkt<br />
E=Eintritt<br />
A=Austritt<br />
ScB=Score-<br />
Berechn.<br />
Allgemeine Messungen mit Wahlpflicht (Wahl abhängig vom Gesundheitszustand)<br />
6-Minuten-Gehtest DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />
Fahrrad-Ergometrie DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />
Typ<br />
SB=Selbstbeurt<br />
eilung<br />
FB=Fremdbeurt<br />
eilung<br />
Diagnosespezifische Messungen (obligatorisch, d.h. zusätzlich zur allgemeinen Messung)<br />
MacNew Heart (Quality of Life Assessment)<br />
Bypass & Klappe,<br />
Kombinierte kardiovaskuläreOperationen,Herzinsuffizienz<br />
(EF
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Des Weiteren erachtet es die Arbeitsgruppe 2 als wichtig, dass intensiv nach prädiktiven Faktoren<br />
in der <strong>Rehabilitation</strong> geforscht wird, damit das <strong>Rehabilitation</strong>s-Potential des Patienten und<br />
die Indikationsqualität eingeschätzt werden kann. Aus Sicht der Arbeitsgruppenmitglieder wäre<br />
es sinnvoll, dass der <strong>ANQ</strong> dazu die Plattform zur Verfügung stellt und diese Entwicklung unterstützt.<br />
3.2.4 Begleitgruppe m & n<br />
Die Datenerfassungsmasken der Zieldokumentation in der Neurologie wurden von den Mitgliedern<br />
der Begleitgruppe m & n insgesamt als kompliziert erachtet. In Anlehnung an die einfacheren<br />
Datenerhebungen in der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> werden im Hinblick auf die flächendeckende<br />
Einführung des <strong>ANQ</strong>-Messsystems (gegenwärtig RehabNET) folgende Vereinfachungen<br />
und Vereinheitlichungen von der Begleitgruppe m & n vorgeschlagen:<br />
‐ Die Unterziele sollen in der Klinik zwar dokumentiert, aber nicht im nationalen System<br />
erfasst werden (wie im Rahmen des Grundlagenpapiers zur Weiterentwicklung des<br />
Konzepts muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>). Es wäre zu prüfen, ob die Unterziele für die<br />
Identifikation von Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren nützlich wären (Prädiktive Faktoren).<br />
‐ Die Erhebung der Komorbiditäten ist zur Beschreibung des Case-Mix bzw. für die Risikoadjustierung<br />
ein wichtiger Faktor. Die Begleitgruppe schlägt vor, das die Komorbiditäten<br />
mit dem vergleichsweise einfachen Instrument aus dem Pilotprojekt muskuloskelettale<br />
<strong>Rehabilitation</strong> erhoben werden anstatt mit dem CIRS (Cummulative Illness Rating<br />
Scale).<br />
‐ Die Erhebung der Kontextfaktoren hat sich bewährt und ist ein zentrales Element bei der<br />
Festlegung von Zielen und beim Vergleich von Patienten. Sie sollen in die Zielsetzung<br />
einfliessen, nicht aber separat dokumentiert werden.<br />
‐ Hauptzielwechsel sollen innerhalb des Systems dokumentiert werden können. Für die<br />
Beurteilung des Zielerreichungsgrads und die (klinikvergleichende) Auswertung ist aber<br />
nur das zuletzt dokumentierte Hauptziel relevant.<br />
‐ Der Zielerreichungsgrad kann zwei-stufig (Muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>) bzw. dreistufig<br />
(Neurologische <strong>Rehabilitation</strong>) erfasst werden. In der Auswertung wird jedoch nur<br />
eine zwei-stufige Antwortskala benutzt, wobei die mittlere Antwortkategorie („teilweise<br />
erreicht“) in „nicht erreicht“ umkodiert wird. Die Begleitgruppe betont, dass es für die Beurteilung<br />
der Zielerreichung („erreicht“ – „teilweise erreicht“ – „nicht erreicht“) Richtlinien<br />
braucht. 12<br />
Des Weiteren befürwortet die Begleitgruppe m & n die kurze Patientenzufriedenheitsbefragung<br />
und findet das Thema der prädiktiven Faktoren ebenfalls wichtig. Die Zusammenarbeit des<br />
<strong>ANQ</strong> mit Hochschulen und dem Nationalfonds sowie die Koordination von Forschungsprojekten<br />
zu prädiktiven Faktoren wird als wünschenswert erachtet.<br />
12 Dabei sind die Goal Attainment Scaling (GAS) und die von Dr. med. Hanspeter Rentsch entwickelte<br />
Systematik der Hauptziele und Schlüsselprobleme genutzt worden (vgl. Rentsch, Indikatoren und Evaluation<br />
der Zielsetzungsprozesse, Kursunterlagen, SAR, 11.11.2011).<br />
13
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
3.3 Rahmenbedingungen für den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
In diesem Abschnitt werden die vom QA <strong>Rehabilitation</strong> in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle<br />
festgelegten inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen für den<br />
nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> sowie seine Entwicklungsperspektiven dargestellt.<br />
3.3.1 Inhaltliche Rahmenbedingungen<br />
3.3.1.1 Modularisierung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong><br />
Grundsätzlich empfiehlt der QA <strong>Rehabilitation</strong> die Übernahme des ICF-Ansatzes der Zieldokumentation<br />
(inkl. Beurteilung der Zielerreichung bei Austritt) für alle Bereiche der <strong>Rehabilitation</strong><br />
bzw. alle Kliniken. Aufgrund der geringen Verbreitung des Ansatzes insbesondere in der stationären<br />
kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> und des fehlenden Nachweises seiner klinischen<br />
Nützlichkeit soll die Integration des ICF-Ansatzes in diesem Bereich zu einem späteren Zeitpunkt<br />
erneut geprüft werden. Bis dahin sind für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
bzw. die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> separate Messkonzepte vorzusehen.<br />
Als fachübergreifende Outcome-Messung wird ein Kurzfragebogen zur Erfassung der Patientenzufriedenheit<br />
– die sogenannte nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> empfohlen.<br />
Wie im Akutbereich, soll auch der rehabilitationsspezifische Kurzfragebogen in Ergänzung zu<br />
allfälligen bestehenden Patientenzufriedenheitsbefragungen eingesetzt werden können.<br />
3.3.1.2 Beschränkung auf ein Instrumenten-Kernset<br />
Im QA <strong>Rehabilitation</strong> besteht ein Konsens darüber, dass vorerst nur eine minimale Anzahl an<br />
Instrumenten in den <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> aufgenommen wird – ein sogenanntes Kernset<br />
(vgl. Abschnitt 4.3.1, Seite 22 sowie Abschnitt 4.3.2, Seite 24). Dies hatte zur Folge, dass einige,<br />
von den Arbeitsgruppen vorgeschlagene Instrumente nicht in den vorliegenden <strong>Messplan</strong><br />
aufgenommen wurden. 13 Mit dem Kernset sollen möglichst viele Fälle erfasst werden, deren<br />
Ergebnisse mit Referenzwerten verglichen werden können. Die Palette weiterer freiwillig anwendbarer<br />
Instrumente wird dabei nicht eingeschränkt.<br />
Bei der Wahl der Instrumente wurde darauf geachtet, dass sie in Wissenschaft und Fachgremien<br />
anerkannt sowie in der klinischen Praxis weit verbreitet sind und bei vergleichsweise grossen<br />
Patientengruppen zweckmässig eingesetzt werden können. Damit wird es möglich, aussagekräftige<br />
Ergebnisse für eine grosse Anzahl an Patienten zu erhalten. Dies gewährleistet, dass<br />
für Dispensgesuche wenig Anlass entsteht und der Schulungsaufwand massvoll bleibt. Wünschenswert<br />
ist darüber hinaus die Vermeidung von Lizenzkosten. Schliesslich sind mit Blick auf<br />
die Datenqualität (hoher Rücklauf und vollständig ausgefüllte Fragebogen insbesondere bei<br />
fremdsprachigen Patientengruppen) Fragebogen vorzuziehen, welche vom medizinischtherapeutischen<br />
Personal ausgefüllt werden.<br />
3.3.1.3 Vorläufiger Verzicht auf eine Überprüfung der Nachhaltigkeit der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung<br />
und auf Assessmentlisten<br />
Das Thema der Nachhaltigkeit ist ein aus Sicht des QA <strong>Rehabilitation</strong> sehr wichtiges Thema.<br />
Dank der Arbeitsgruppe 1A hat innerhalb der rehabilitationsspezifischen Fachgesellschaften die<br />
Auseinandersetzung mit dem Thema angestossen werden können. Der QA <strong>Rehabilitation</strong> sieht<br />
es nun primär als Aufgabe der Fachgesellschaften, die Arbeiten am Thema Nachhaltigkeit in<br />
13 vgl. Tabelle 1, Seite 10 sowie Tabelle 2, Seite 12.<br />
14
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen voranzutreiben (Pilotierung und umfassende<br />
wissenschaftliche Evaluation des Instruments). Vor diesem Hintergrund hat der QA <strong>Rehabilitation</strong><br />
in Rücksprache mit der Arbeitsgruppe 1A den Auftrag vorzeitig zurückgezogen. Ein von der<br />
Arbeitsgruppe 1A verfasstes Arbeitspapier zu Handen des <strong>ANQ</strong> soll den Stand der Arbeiten<br />
(Patientenfragebogen) dokumentieren. 14<br />
Die Listen, in denen die Kliniken die von ihnen eingesetzten Assessments deklarieren, werden<br />
ebenfalls nicht weiterverfolgt. Ihre Nützlichkeit wurde mit Blick auf die Aufgaben des <strong>ANQ</strong> als<br />
fraglich eingeschätzt. 15<br />
3.3.1.4 Datenqualität<br />
Das Erzielen einer hohen Datenqualität hat für den <strong>ANQ</strong> eine hohe Priorität: Sie ist eine zentrale<br />
Voraussetzung für verlässliche Aussagen und die Akzeptanz einer transparenten Darstellung<br />
von vergleichenden und klinikspezifischen Ergebnissen (inkl. Risikoadjustierung). Zur Sicherstellung<br />
einer hohen Datenqualität werden <strong>ANQ</strong>-seitig während der Umsetzung des Projekts<br />
verschiedene Vorkehrungen getroffen: Die meisten Instrumente werden vom therapeutischmedizinischen<br />
Personal ausgefüllt. Dies gewährleistet einen hohen Rücklauf und vollständige<br />
Angaben auch bei Patienten mit Migrationshintergrund oder bei Patienten, die den Fragebogen<br />
nicht selber ausfüllen können. Die Vorgabe der elektronischen Datenerfassung in Kombination<br />
mit einer einfachen Prüflogik gewährt, dass die Angaben in der Klinik vollständig erhoben werden<br />
und valide sind (vgl. Abschnitt 3.3.2.2 sowie Abschnitt 4.3.4). Die Erstellung eines Handbuchs<br />
zu den Messungen (vgl. Abschnitt 4.3.5) und die Schulung ihrer Anwendung (vgl. Abschnitt<br />
4.3.5) trägt zur Erhöhung der Validität und der Reliabilität der Angaben bei. Eine systematische<br />
inhaltliche Plausibilisierung der Angaben vor deren nationalen Auswertung stellt eine<br />
hohe und homogene Datenqualität sicher (vgl. Abschnitt 4.3.4). Darüber hinaus sei erwähnt,<br />
dass im Tarifsystem von SwissDRG eine Kodier-Revision der medizinischen Dokumentation<br />
vorgegeben ist. Damit wird einer manipulativen Anwendung der Instrumente zur Beschönigung<br />
der Leistungsqualität (<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>) bzw. zur Erhöhung der Einnahmen<br />
vorgebeugt (ST-Reha-Projekt).<br />
3.3.2 Organisatorische Rahmenbedingungen<br />
3.3.2.1 Separate <strong>Ausschreibung</strong> von Datenerfassung und Auswertung<br />
Eine separate <strong>Ausschreibung</strong> von a) Datenerfassung und b) Datenauswertung und Berichtswesen<br />
wurde im QA <strong>Rehabilitation</strong> im Allgemeinen bevorzugt. Damit wird es möglich, für beide<br />
Aufgaben einen Anbieter mit den geforderten einschlägigen Kompetenzen zu finden. Für die<br />
Entwicklung eines Datenerfassungssystems (mit einer Prüflogik) und seine Implementierung in<br />
der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik sind Kernkompetenzen im IT-Bereich notwendig; dies hatte sich im<br />
Pilotprojekt bewährt. Für die Auswertung der Daten sind Kompetenzen in der Analyse und Interpretation<br />
von rehabilitationsmedizinischen Daten (Risikoadjustierung, Vergleich mit Referenzwerten)<br />
essentiell. Für die Berichterstellung werden ausgewiesene Fähigkeiten in der laienverständlichen<br />
Darstellung umfassender und komplexer medizinischen Sachverhalte vorausgesetzt.<br />
14 Das Arbeitspapier soll im Frühling 2012 dem <strong>ANQ</strong> vorgelegt werden.<br />
15 Eine Liste von Assessmentverfahren ist auf den Webseiten des Instituts für Qualitätssicherung in Prävention<br />
und <strong>Rehabilitation</strong> GmbH der Deutschen Sporthochschule Köln unter dem folgenden Link zu<br />
finden: http://www.assessment-info.de.<br />
15
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
3.3.2.2 Organisation der Datenerfassung<br />
Im Hinblick auf die Organisation der Datenerfassung hat der QA <strong>Rehabilitation</strong> drei Szenarien<br />
diskutiert. Er entschied sich für Szenario (2), bei dem die unternehmerische Freiheit der Kliniken<br />
in einem akzeptablem Mass bewahrt werden kann trotz Vorgabe der elektronischen Datenerfassung<br />
(inklusiver einer rudimentären Prüflogik) zwecks Sicherstellung einer hohen Datenqualität:<br />
(1) Vorgabe des Datenerfassungssystems (bzw. Systemanbieters): Der <strong>ANQ</strong> gibt den Kliniken<br />
ein bestimmtes (webbasiertes) Datenerfassungssystem vor, womit die Daten bereits<br />
bei der Erfassung geprüft werden. Alternativ können die Daten in die bestehenden Klinikinformationssysteme<br />
erfasst und über eine vorgegebene prüfende Schnittstelle an die<br />
<strong>ANQ</strong>-Datenbank gesendet werden. Dies entspricht insgesamt dem Vorgehen im Pilotprojekt<br />
<strong>Rehabilitation</strong>.<br />
(2) Vorgabe der elektronischen Datenerfassung: Der <strong>ANQ</strong> gibt den Kliniken vor, dass die<br />
Daten mittels eines (webbasierten) Datenerfassungssystems erhoben werden, das zeitgleich<br />
die Eingaben prüft. Alternativ können die Daten in das bestehende Klinikinformationssystem<br />
erfasst und zeitgleich geprüft werden. Die Kliniken bestimmen den Systemanbieter<br />
für die Datenerfassung und Datenprüfung selber. Die Erstellung von Vorgaben<br />
für die Datenprüfung in den Kliniken sowie die zentrale umfassende Überprüfung der<br />
Datenqualität und die Aufbereitung des <strong>ANQ</strong>-Datensatzes sind Aufgaben des Auswertungsinstituts.<br />
(3) Empfehlung zur elektronischen Datenerfassung: Der <strong>ANQ</strong> beschränkt sich auf eine<br />
Empfehlung, die Daten elektronisch zu erfassen und die Eingaben zeitgleich zu prüfen<br />
(webbasiertes Erfassungssystem bzw. KIS). Die zentrale umfassende Überprüfung der<br />
Datenqualität erfolgt ex-post und ist zusammen mit der Aufbereitung des <strong>ANQ</strong>-<br />
Datensatzes Aufgabe des Auswertungsinstituts.<br />
Grundsätzlich sind doppelte Eingaben von Daten zu vermeiden 16 . Dies erscheint bei allen drei<br />
Szenarien machbar. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass die Daten schon bei der Dateneingabe<br />
geprüft und frühzeitig im Prozess eine hohe Datenqualität sichergestellt werden<br />
kann – nicht zuletzt deshalb, damit die Kliniken diese Daten für die klinischen Prozesse nutzen<br />
können.<br />
Eine durchgängig hohe Datenqualität kann bei den Szenarien (1) und (2) am ehesten sichergestellt<br />
werden. Bei Szenario (1) dürfte die Datenqualität homogener sein als bei Szenario (2).<br />
Szenario (1) kann vergleichsweise kostengünstiger als Szenario (2) bereitgestellt werden, da<br />
Skaleneffekte bei der Entwicklung, der Konfiguration und dem Unterhalt genutzt werden können.<br />
Vom <strong>ANQ</strong> geforderte Anpassungen bei den Datenerhebungen können zudem zentral auf<br />
Systemebene erfolgen und sind entsprechend kostengünstiger. Szenario (2) bietet demgegenüber<br />
mehr unternehmerische Freiheit (insb. Wahl des Systems, Gestaltung der Prozesse) und<br />
dürfte auf eine vergleichsweise höhere Akzeptanz stossen. Zu bedenken gilt, dass mit der Einführung<br />
der Leistungsfinanzierung (ST-Reha) die Kliniken die Daten elektronisch erfassen müs-<br />
16 Aus Sicht der Kliniken und Systemanbieter ist schliesslich ein besonderes Augenmerk auf den Einsatz<br />
allfälliger Papierfragebogen bei den Patienten zu legen. Bei hohen Fallzahlen ist die Erhebung der Patientenantworten<br />
direkt in ein elektronisches System (Computer oder Tablet) zu bevorzugen; dieses ökonomischere<br />
Vorgehen erzielt eine höhere Datenqualität (höherer Rücklauf, vollständige Angaben).<br />
16
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
sen. Bei Szenario (3) erfolgt die Sicherstellung einer national durchgängig homogenen und guten<br />
Datenqualität ex-post, was mit einer aufwändigen Zusammenarbeit des Auswertungsinstituts<br />
mit den Kliniken einhergeht.<br />
3.3.3 Finanzielle Rahmenbedingungen<br />
Bei der Erstellung des Kostenrahmens für den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> sind folgende<br />
Rahmenbedingungen zu beachten:<br />
(1) Gleichbehandlung der Fachbereiche: Das Konzept zur Finanzierung des <strong>ANQ</strong> und der<br />
Qualitätsmessungen ab 2011 legt fest, dass der <strong>ANQ</strong> über alle medizinische Fachbereiche<br />
(Akutsomatik, <strong>Rehabilitation</strong> und Psychiatrie) grundsätzlich die gleiche Strategie<br />
verfolgt und dass das Finanzierungsmodell für alle Fachbereiche gilt. Der separate<br />
Taxzuschlag pro Austritt deckt die Messkosten der Leistungserbringer (Messinstrumente,<br />
Messlogistik, Schulungen, Auswertungen, Berichte, Publikationen) über zwei Jahre<br />
(Anschubfinanzierung).<br />
(2) Vorgaben des Nationalen Qualitätsvertrags: Insbesondere Artikel 10 (Nationale Messkoordination:<br />
der <strong>ANQ</strong> stellt den Leistungserbringern die Messinstrumente kostenlos zur<br />
Verfügung), Artikel 12 (Finanzierungsgrundsatz: Qualitätsmessungen sind mit dem Tarif<br />
abgegolten), Artikel 13 (Übergangsfinanzierung der Qualitätsmessungen: Versicherer<br />
und Kantone zahlen einen Taxzuschlag pro Austritt an die Leistungserbringer für eine<br />
zweijährige Übergangsphase) und Artikel 14 (Finanzierung der <strong>ANQ</strong>-Leistungen: Höhe<br />
des Beitrags der Leistungserbringer an den <strong>ANQ</strong> für die Koordination der Messungen).<br />
(3) <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> Akutsomatik: Die budgetierten Gesamtkosten für den <strong>Messplan</strong><br />
Akutsomatik, welcher 6 Instrumente 17 umfasst, belaufen sich auf rund --------Franken.<br />
Der Taxzuschlag für den nationalen <strong>Messplan</strong> Akutsomatik beträgt ----- Franken und<br />
deckt sowohl die internen als auch die externen Messkosten der Leistungserbringer (Referenzjahr<br />
2009: rund 1.1 Mio. Austritte, Medizinische Statistik der Krankenhäuser, BFS<br />
2011). Für die internen Messkosten der Leistungserbringer ist im Bereich Akutsomatik<br />
ein Anteil von 52.2% des Taxzuschlags vorgesehen; der <strong>ANQ</strong> erhält den restlichen Betrag<br />
von 47.8% zur Deckung der externen Messkosten.<br />
(4) <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> Psychiatrie: Die budgetierten Gesamtkosten für den <strong>Messplan</strong><br />
Psychiatrie belaufen sich auf rund -------- Franken für den Einsatz von insgesamt 4<br />
Instrumenten. 18 Die Höhe des Taxzuschlags für den <strong>Messplan</strong> Psychiatrie beläuft sich<br />
auf ------- Franken (Referenzjahr 2009: rund 62‘500 Austritte, Medizinische Statistik der<br />
Krankenhäuser, BFS 2011). Dabei leisten die Versicherer -----Franken (45%) und die<br />
Kantone ------Franken (55%) an den Taxzuschlag. Ein Betrag von ------ Franken (52.2%)<br />
steht den Leistungserbringern für die klinikinternen Messkosten zur Verfügung. Der <strong>ANQ</strong><br />
erhält für die anfallenden klinikexternen Messkosten einen Betrag von ----- Franken<br />
(47.8%).<br />
17<br />
Patientenzufriedenheitsbefragung, Wundinfektionsmessung Swiss Noso, Rehospitalisationen und Reoperationen<br />
SQLape©, Prävalenzmessung Sturz und Dekubitus mit LPZ©.<br />
18<br />
Basisdokumentation, BSCL, HONOS und Zwangsmassnahmen; ohne Patientenzufriedenheitsbefragung.<br />
17
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
(5) <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: Der <strong>Messplan</strong> umfasst insgesamt 10 Instrumente<br />
(Patientenzufriedenheitsbefragung, muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong>,<br />
kardiologische und pneumologische <strong>Rehabilitation</strong>) für einen vergleichsweise heterogenen<br />
Fachbereich mit rund 58‘000 Austritten aus 53 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken (Referenzjahr<br />
2009).<br />
Im Bereich der <strong>Rehabilitation</strong> lassen sich aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl an geplanten<br />
Messungen weniger Skaleneffekte erzielen als im Bereich der Psychiatrie, welcher gemessen<br />
an den Austrittszahlen eine ähnliche Grössenordnung aufweist. Ein deutlicher Mehraufwand<br />
für die Messungen im Bereich der <strong>Rehabilitation</strong> ist dadurch begründet (vgl. Tabelle 5,<br />
Seite 32).<br />
3.3.4 Terminliche Rahmenbedingungen<br />
Der QA <strong>Rehabilitation</strong> hat folgende drei Szenarien (Zeitpläne) diskutiert und sich für einen<br />
Messbeginn Anfang 2013 entschieden (Szenario 3):<br />
(1) Messbeginn am 1. Juli 2012: In Szenario 1 wird davon ausgegangen, dass die Messungen<br />
(Modul 2 und Modul 3) am 1. Juli 2012 beginnen; zeitgleich beginnt die zweijährige<br />
Übergangsphase für die Finanzierung der Messungen über den Taxzuschlag (vgl. Abschnitt<br />
3.3.3). Zwischen dem Entscheid des Vorstandes des <strong>ANQ</strong> bzw. der Information<br />
der <strong>Rehabilitation</strong>skliniken und dem Messbeginn würden im günstigsten Fall 3 Monate<br />
vergehen; zwischen abschliessender Klärung der Finanzierung und Messbeginn nochmals<br />
weniger. Eine fristgerechte Vorbereitung der Messung seitens <strong>ANQ</strong> (z.B. Verfahren<br />
zur Wahl des Auswertungsinstituts, Vorbereitung und Durchführung von Schulungen für<br />
Modul 2 und Modul 3, Erstellen des Messhandbuchs) und seitens der Versicherer und<br />
Kantone (u.a. Durchführung des Verfahrens zur vertraglichen Anpassungen am Qualitätsvertrag)<br />
wäre kaum möglich. Schwierig wäre es zudem für die <strong>Rehabilitation</strong>skliniken<br />
(Implementation der Datenerfassungssysteme) und das Auswertungsinstitut (Vorgaben<br />
für die Datenerfassung).<br />
(2) Rollende Einführung der Module: In Szenario 2 wird 2012 nur die nationale Zufriedenheitsbefragung<br />
<strong>Rehabilitation</strong> (Modul1) durchgeführt. Der Messbeginn bei den Modulen<br />
2 und 3 erfolgt Anfang 2013. Die zweijährige Übergangsphase für die Finanzierung der<br />
Messungen über den Taxzuschlag beginnt Anfang Juli 2012. Für die Vorbereitung der<br />
Messungen (Modul 2 und 3) durch den <strong>ANQ</strong>, die Versicherer und Kantone bestünde<br />
ausreichend Zeit. Ausserdem ist es durch die vorgängige Präsentation des <strong>Messplan</strong>s<br />
und durch den Einbezug sprachregionaler Strukturen während der Vorbereitung der<br />
Messung möglich Akzeptanz insbesondere in der französisch- und italienischsprachigen<br />
Schweiz zu schaffen.<br />
(3) Messbeginn ist Anfang 2013 für das Modul 2 und 3; der Zeitpunkt der Durchführung der<br />
Patientenzufriedenheitsmessung wird mit der entsprechenden Messung im Akutbereich<br />
koordiniert. Die Patientenzufriedenheitsbefragung in der <strong>Rehabilitation</strong> soll auf Basis der<br />
Austritte in den Monaten April und Mai erfolgen. Die zweijährige Übergangsphase für die<br />
Finanzierung der Messungen über den Taxzuschlag beginnt Anfang 2013.<br />
Der QA <strong>Rehabilitation</strong> rät von einer freiwilligen Durchführung der Patientenzufriedenheitsmessung<br />
im Herbst 2012 (finanziert über die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag)<br />
ab.<br />
18
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Der Vorstand des <strong>ANQ</strong> hat am 25. Januar 2012 entschieden, dass die Messungen aus Modul 2<br />
und 3 Anfang 2013 beginnen und dass die Patientenzufriedenheitsmessung im Frühsommer<br />
2013 auf Basis der Austritte in den Monaten April und Mai durchgeführt wird (die entsprechende<br />
Messung im Akutbereich erfolgt auf Basis der Austritte im Monat September).<br />
19
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4 <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4.1 Einleitung<br />
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regularien des <strong>ANQ</strong>, die Pilotprojekte des <strong>ANQ</strong> das<br />
Konzept der Expertengruppe kardiale <strong>Rehabilitation</strong> und dasjenige der Schweizerischen<br />
Pneumologischen Gesellschaft (SGP) sowie die Ergebnisse der vom <strong>ANQ</strong> eingesetzten Arbeitsgruppen<br />
bilden die Grundlagen für den vorliegenden nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
Der nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> ist in drei Modulen gegliedert:<br />
Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 2: Muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 3: Kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die Organisation der Datenerhebung, Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse der<br />
nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> erfolgt separat von derjenigen in Modul 2 und<br />
Modul 3.<br />
Der <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> kommt in der stationären <strong>Rehabilitation</strong> zur Anwendung. Während<br />
das Modul nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> grundsätzlich in allen Bereichen<br />
der stationären <strong>Rehabilitation</strong> eingesetzt werden kann, ist die Anwendung des Moduls muskuloskelettale<br />
und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> sowie des Moduls kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
nur in den entsprechenden Bereichen vorgesehen.<br />
Wo die Umsetzung der <strong>ANQ</strong>-Messvorgaben aufgrund der Leistungserbringungsstrukturen (z.B.<br />
Paraplegiologie, onkologische, pädiatrische oder andere <strong>Rehabilitation</strong>sangebote) erschwert<br />
bzw. anders gestaltet ist, sieht Art. 4 Abs. 2 des Qualitätsvertrags die Möglichkeit vor, ein Dispensgesuch<br />
an den <strong>ANQ</strong> zur teilweisen Befreiung von der Umsetzung der <strong>ANQ</strong>-Messvorgaben<br />
einzureichen und über alternative Messvorgaben zu informieren. Die Gesuche bearbeitet der<br />
<strong>ANQ</strong> Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> zuhanden des Vorstandes des <strong>ANQ</strong>.<br />
4.2 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die patientenseitige Beurteilung der Leistungsqualität einer Klinik ist ein wichtiger und anerkannter<br />
Qualitätsindikator (Patientenzufriedenheit). Am häufigsten werden derzeit für umfassende<br />
Patientenbefragungen der Fragebogen von MECON measure & consult GmbH 19 sowie<br />
das System PZ-Benchmark® 20 eingesetzt.<br />
Basis für die Entwicklung des rehabilitationsspezifischen Fragebogens und Befragungskonzepts<br />
war die nationale Zufriedenheitsbefragung im Akutbereich, welche im November 2011 zum ersten<br />
Mal durchgeführt wurde. Fragebogen und Befragungskonzept wurden an die Besonderheiten<br />
der <strong>Rehabilitation</strong> angepasst. Bei der Weiterentwicklung sollen auch die Erkenntnisse aus<br />
der Patientenzufriedenheitsbefragung im Akutbereich berücksichtigt werden.<br />
19 Vgl. http://www.mecon.ch/d_di_pa_re.cfm?a_lang=d<br />
20 Vgl. http://www.marty-mafo.ch/pz.php<br />
20
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4.2.1 Der Fragebogen für die nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Der Fragebogen liegt in drei Landessprachen vor (Deutsch, Französisch, Italienisch). Dank seiner<br />
Fokussierung auf wenige, jedoch für alle <strong>Rehabilitation</strong>skliniken relevante Themen, können<br />
die Kliniken den nationalen Fragebogen in Ergänzung zu den bestehenden Patientenzufriedenheitsbefragungen<br />
einsetzen. Die klinikspezifischen Befragungsergebnisse können mit nationalen<br />
Referenzwerten verglichen werden.<br />
Der nationale Fragebogen umfasst fünf Fragen: Bei den ersten zwei Fragen wird die allgemeine<br />
Zufriedenheit mit der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung erfasst. Anhand zwei weiterer Fragen beurteilen<br />
die Patienten die Verständlichkeit der Information der Ärztinnen und Ärzte sowie die Betreuung<br />
durch das therapeutische Personal, das Pflegefachpersonal und den Sozialdienst während<br />
des Aufenthalts. Schliesslich beurteilen die Patienten, ob sie sich in der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />
respekt- und würdevoll behandelt fühlten. Dank der allgemeinen Gültigkeit der Fragen sollte<br />
eine klinikspezifische Auswertung ohne Differenzierung nach <strong>Rehabilitation</strong>sbereichen möglich<br />
sein.<br />
Eine sprachliche und inhaltliche Validierung des Fragebogens ist geplant, ebenso die Weiterentwicklung<br />
des Verfahrens durch eine Expertengruppe. Das Validierungsverfahren im Rahmen<br />
der Entwicklung des Fragebogens für die nationale Zufriedenheitsbefragung Akutmedizin zeigte<br />
unter anderem, dass sich die Fragen aus dem nationalen Fragebogen Akutmedizin mit differenzierteren<br />
Fragen aus anderen Patientenbefragungen kombinieren lassen.<br />
4.2.2 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung<br />
Mit Blick auf die Auswertung werden klinik- und personenbezogene Angaben erhoben (Klinik-<br />
Nummer, Fall-Nummer sowie Geburtsjahr, Geschlecht und Versicherungsstatus).<br />
Eine Erhebung von eindeutigen Identifikatoren für den Fall (Patient) zur Verknüpfung der Daten<br />
aus der nationalen Zufriedenheitsbefragung mit den Daten aus den anderen Modulen (Modul 2:<br />
muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong>; Modul 3: kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong>)<br />
ist nicht vorgesehen.<br />
4.2.3 Methodische Aspekte<br />
Zielgruppe der Befragung sind die in einem vorgängig definierten Zeitfenster austretenden stationär<br />
behandelten erwachsenen Patienten (>= 18 Jahre alt). Patienten, welche in der Zeitperiode<br />
mehr als einmal aus der Klinik entlassen wurden, werden nur nach dem ersten Austritt befragt.<br />
Der Versand des schriftlichen Fragebogens erfolgt 2 bis 7 Wochen nach dem Austritt aus der<br />
<strong>Rehabilitation</strong>sklinik (mit frankiertem Rückantwortcouvert); online und telefonische Befragung<br />
sind grundsätzlich erlaubt; müssen aber die für die schriftliche Befragung gesetzten Bedingungen<br />
einhalten. Auf ein Erinnerungsschreiben wird verzichtet.<br />
Es werden solange Fragebogen an die austretenden Patienten verschickt bis für die betreffende<br />
<strong>Rehabilitation</strong>sklinik mind. 50 auswertbare Fragebögen beim Messinstitut eingetroffen sind<br />
(Mindestichprobe). Ein zweimonatiges Zeitfenster wird für die meisten Kliniken als ausreichend<br />
betrachtet. Befragt werden Patienten, welche in den Monaten April und Mai aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />
ausgetreten sind. Die Messmonate sind mit der Patientenbefragung im Akutbereich<br />
abgestimmt, damit vermieden wird, dass ein Patient zweimal durch <strong>ANQ</strong> befragt wird (Gefahr,<br />
21
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
beurteilte Institution zu verwechseln). Im Akutbereich werden die im September austretenden<br />
Patienten befragt (2012).<br />
Die Rücklaufquote berechnet sich aus auswertbaren Fragebogen (Zähler) und verschickten<br />
Fragebogen (Nenner). Die Rücklaufquote wird als wichtiger Indikator für die Qualität der Daten<br />
betrachtet und soll angegeben werden.<br />
Voraussetzung für eine gruppenstatistische Auswertung nach <strong>Rehabilitation</strong>sklinik (inkl. Gesamtergebnissen)<br />
ist das Erreichen der Mindeststichprobengrösse von 50 auswertbaren Fragebogen.<br />
Bei unzureichender Rücklaufquote (auch bei erreichter Mindestzahl an auswertbaren<br />
Fragebögen) soll keine gruppenstatistische Auswertung nach <strong>Rehabilitation</strong>sklinik erfolgen.<br />
4.2.4 Organisation der nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die Befragung wird mit einer Kombination aus zentralen und dezentralen Instituten abgewickelt.<br />
Die Hauptaufgaben des zentralen Messinstituts sind die Koordination der Abwicklung der Befragungen<br />
in den einzelnen <strong>Rehabilitation</strong>skliniken, die Einrichtung der zentralen Datenbank,<br />
die Auswertung und Berichterstellung (vgl. Abschnitt 4.4, Seite 30). Dabei richtet sich das zentrale<br />
Institut nach den Vorgaben des <strong>ANQ</strong> (Datenreglement, Auswertungs- und Publikationskonzept).<br />
Für die Abwicklung der Messung in den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken sind die dezentralen Messinstitute<br />
zuständig. Diese werden jeweils von den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken selber bestimmt. Die dezentralen<br />
Messinstitute wickeln die Befragung in Zusammenarbeit mit den Spitälern nach den<br />
Vorgaben des zentralen Messinstituts ab. Sie stellen den Spitälern die Fragebogen und entsprechende<br />
Begleitschreiben bereit, verarbeiteten die retournierten Fragebogen und sind für<br />
den Datentransfer an das zuständige zentrale Messinstitut verantwortlich.<br />
Es ist geplant, eine Offerte bei den für die Abwicklung der nationalen Zufriedenheitsbefragung<br />
Akutmedizin zuständigen zentralen Messinstituten einzufordern (Nutzung von Synergien).<br />
4.3 Bereichsspezifische Messpläne<br />
4.3.1 Modul 2: <strong>Messplan</strong> für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />
Der <strong>Messplan</strong> m & n basiert auf den in der muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong><br />
weit verbreiteten ICF-Ansatz. Die Erfassung der Behandlungsziele (Partizipationsziele) und<br />
die Beurteilung des Zielerreichungsgrades werden durch klassische Outcome-Indikatoren, welche<br />
die Funktions- bzw. Leistungsfähigkeit messen, ergänzt (Tabelle 3).<br />
Als Qualitätsindikator dient der bei Austritt (bzw. Austrittswoche) erreichte Zielerreichungsgrad.<br />
Der Zielerreichungsgrad wird vom medizinischen und therapeutischen Team auf einer drei- oder<br />
zweistufigen Antwortskala beurteilt. Miterhoben wird für jeden Patienten das bei Eintritt festgelegte<br />
Hauptziel des <strong>Rehabilitation</strong>saufenthalts (Partizipationsziel). Partizipationsziele sind<br />
Wohnen (6 Hauptzielkategorien), Arbeit (5 Hauptzielkategorien) und soziokulturelles Leben (2<br />
Hauptzielkategorien). Im Anhang sind die Instrumente dokumentiert (vgl. Abschnitt 5.8, Seite<br />
52).<br />
Im Rahmen des Pilotprojekts des <strong>ANQ</strong> wurde das Instrument der Dokumentation der Ziele (inkl.<br />
Zielerreichung) bereits eingesetzt. Es hatte sich als Outcome-Instrument bewährt und vermochte<br />
darüber hinaus, Qualitätsverbesserungen anzustossen. Das lizenzfreie Instrument wird von<br />
22
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
den Fachgesellschaften anerkannt. 21 Ein Grossteil von anerkannten Schweizer Kliniken wendet<br />
dieses Instrument in einer ähnlichen Form bereits an. Eine deutschsprachige Version ist im Anhang<br />
dokumentiert.<br />
Zusätzlich eingesetzt wird der Health Assessment Questionnaire (HAQ) für Patienten mit einer<br />
muskuloskelettalen Diagnose. Der Fragebogen bildet mit 24 Fragen das Ausmass der Selbständigkeit<br />
und der Verwendung von Hilfsmitteln in den Bereichen Ankleiden, Körperpflege,<br />
Mobilität und Essen von muskuloskelettaler Patienten zum Befragungszeitpunkt ab. Erfasst<br />
werden ebenfalls die Selbständigkeit beim Heben, Greifen oder Öffnen von Gegenständen sowie<br />
beim Einkaufen und Haushalten. Das Ausfüllen des HAQ durch das medizinischtherapeutische<br />
Personal braucht ca. 10 Minuten.<br />
Kliniken mit neurologischen Patienten haben die Pflicht, entweder den Functional Independence<br />
Measure (FIM) für alle Patienten mit einer neurologischen Diagnose anzuwenden, oder den<br />
erweiterten Barthel-Index (EBI). Die Anwendung des gewählten Instruments erstreckt sich in<br />
der Klinik jeweils auf alle Patienten mit neurologischer Diagnose. Mit dem FIM oder dem EBI<br />
wird das Vorliegen von funktionellen Einschränkungen von Patienten bei Alltagsaktivitäten (Ankleiden,<br />
Körperpflege, Mobilität, Essen und kognitive Fähigkeiten) zum Befragungszeitpunkt<br />
erfasst. Der FIM verendet hierzu 18 Fragen (7-stufige Antwortskala), der EBI 16 Fragen (4stufige<br />
Antwortskala mit variierender Punktezahl). Für das Ausfüllen des FIM durch das medizinisch-therapeutische<br />
Personal werden 15 bis 30 Minuten veranschlagt; für den EBI wird ein<br />
Zeitbedarf von 15 Minuten angegeben.<br />
Die Wahlpflicht bei neurologischen Patienten (Einsatz von FIM oder EBI) schmälert insgesamt<br />
die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken. Sie erhöht jedoch die Vergleichbarkeit<br />
der Ergebnisse zwischen denjenigen Kliniken, welche das gleiche Instrument anwenden.<br />
Darüber hinaus fördert sie die Akzeptanz. Unter gewissen Bedingungen sind die Ergebnisse<br />
von FIM und EBI kompatibel. 22<br />
Die Messungen mit den Outcome-Instrumenten HAQ, FIM und EBI erfolgen bei Eintritt und Austritt<br />
durch das medizinische oder therapeutische Personal (Fremdbeurteilung). Der HAQ kann<br />
zwar auch durch die Patienten selbst ausgefüllt werden; der QA <strong>Rehabilitation</strong> rät aus Datenqualitätsgründen,<br />
den Fragebogen durch das medizinische oder therapeutische Personal ausfüllen<br />
zu lassen (vgl. Abschnitt 3.3.1.2, Seite 14). Ein- und Austrittsmessung gehen in die jeweilige<br />
Score-Berechnung nach Massgabe allfälliger Richtlinien ein. 23<br />
Hier sei mit Blick auf die Sicherstellung einer hohen Datenqualität ergänzt, dass die Angaben<br />
aus der Zieldokumentation (inkl. Zielerreichungsgrad) dank den Outcome-Instrumenten HAQ,<br />
FIM und EBI validiert werden können.<br />
HAQ, FIM und EBI sind international anerkannte Instrumente für Outcome-Messungen, die ohne<br />
Lizenzgebühren verwendet werden können. 24 Ein Grossteil von Schweizer Kliniken wendet<br />
diese Instrumente bereits an und es liegen übersetzte Versionen vor. Im Rahmen des ST-Reha-<br />
21<br />
Vgl. die Webseiten SwissReha (Akkreditierungsverfahren) und SAR.<br />
22<br />
Vgl. Entwicklung eines Patientenklassifikationssystems (PCS) für die <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz.<br />
23<br />
Die Richtlinien werden im Messhandbuch dargelegt.<br />
24<br />
Schädler, S. et al (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>. Band 1: Neurologie. 2., vollständig überarbeitete<br />
und erweiterte Auflage, Huber, Bern.<br />
Oesch, P. et al (2007): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>. Band 2: Bewegungsapparat. 2., vollständig<br />
überarbeitete und erweiterte Auflage, Huber, Bern.<br />
23
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Projekts wird nach Angaben von H+ die Vorgabe einer offiziellen Sprachversion geprüft (u.a.<br />
Bereinigung urheberrechtlicher Probleme bezüglich FIM, Anschaffung einer französischen und<br />
italienischen Version des HAQ). Die deutschsprachigen Versionen sind im Anhang dokumentiert.<br />
Die Vorgaben des <strong>ANQ</strong> bezüglich der Instrumente und Messzeitpunkte schränken den Einsatz<br />
von freiwilligen weiteren Instrumenten, die zum Beispiel in Einklang mit klinikinternen Richtlinien<br />
stehen, oder die Wiederholung von Messungen bei längerer Klinikaufenthaltsdauer nicht ein.<br />
Tabelle 3: <strong>Messplan</strong> in der muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> (Modul 2)<br />
Modul 2 Patienten<br />
Allgemeine Messung, mit Obligatorium<br />
Hauptziele (HZ) und Zielerreichung (ZE)<br />
gemäss ICF-Ansatz<br />
Diagnosegruppe<br />
DG-m<br />
DG-n<br />
Zeitpunkt<br />
E=Eintritt<br />
A=Austritt<br />
ScB=Score-<br />
Berechnung<br />
HZ bei E; ZE bei<br />
A; ScB<br />
Typ<br />
SB=Selbstbeurt.<br />
FB=Fremdbeurt.<br />
FB / SB<br />
Diagnosespezifische Messung, mit Obligatorium bei muskuloskelettalen Patienten und<br />
Wahlpflicht bei neurologischen Patienten<br />
Functional Independence Measurement<br />
(FIM)<br />
DG-n E / A; ScB FB<br />
Erweiterter Barthel-Index (EBI) DG-n E / A; ScB FB<br />
Health Assessment Questionnaire<br />
(HAQ)<br />
DG-m E / A; ScB FB<br />
4.3.2 Modul 3: <strong>Messplan</strong> für die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul 3 basiert auf klassische Outcome-Indikatoren, welche die physiologische Funktions- bzw.<br />
Leistungsfähigkeit messen in Kombination mit einer krankheitsspezifischen Lebensqualitätsbefragung<br />
(Tabelle 4). In der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> spielen Partizipationsziele<br />
aufgrund der gesundheitlichen Problematik der Patienten eine untergeordnete Rolle.<br />
Bei Eintritt und Austritt erfolgt je nach Gesundheitszustand eine Messung der Leistungsfähigkeit<br />
anhand des 6-Minuten-Gehtests (für vergleichsweise schwer erkrankte Patienten) oder der<br />
Fahrrad-Ergometrie (für vergleichsweise weniger schwer erkrankte Patienten). Die Messungen<br />
werden durch das medizinisch-therapeutische Personal nach Massgabe von allfälligen Richtlinien<br />
der Fachgesellschaften durchgeführt (vgl. Anhang 5.9). Für die Durchführung des 6-<br />
Minuten-Gehtests sind je nach Gesundheitszustand des Patienten rund 15 bis 20 Minuten vorzusehen;<br />
die Durchführung einer Ergometrie benötigt rund 1 Stunde.<br />
24
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die Leistungstests (6-Minuten-Gehtest, Ergometrie) sind international etablierte und wissenschaftlich<br />
validierte Instrumente für Outcome-Messungen. 25 Die Anwendung des 6-Minuten-<br />
Gehtests bzw. der Ergometrie ist in der Schweiz weit verbreitet und ein Kriterium des Akkreditierungsverfahrens<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiale <strong>Rehabilitation</strong> (SAKR) bzw.<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie (SPG).<br />
Zusätzlich soll bei Vorliegen bestimmter kardiovaskulärer Erkrankungen (Bypass & Klappe,<br />
Kombinierte kardiovaskuläre Operationen, Herzinsuffizienz (EF
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Der MacNew Heart ist international etabliert und liegt als validierte englische, deutsche, französische<br />
und italienische Sprachversion vor. 26 Die deutschsprachige Version ist im Anhang dokumentiert<br />
(vgl. Anhang 5.9.3). Ob der in Schweizer <strong>Rehabilitation</strong>skliniken bislang wenig verwendete<br />
MacNew Heart als Kriterium im Akkreditierungsverfahren der SAKR eingesetzt wird,<br />
wird gegenwärtig diskutiert. Bei der Anwendung des Fragebogens fallen Lizenzkosten an, deren<br />
Höhe mit dem Lizenzgeber verhandelt werden muss.<br />
Bei COPD I-IV Patienten werden zusätzlich zum 6-Minuten-Gehtest bzw. der Ergometrie der<br />
Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) und das sogenannte Feeling Thermometer<br />
eingesetzt. Der CRQ als Fragebogen mit standardisierten Dyspnoe-Fragen zur Selbstbeurteilung<br />
umfasst insgesamt 20 Fragen (7-stufige Antwortskalen) zu Tätigkeiten, welche bei Menschen<br />
mit Lungenproblemen Kurzatmigkeit (Dyspnoe) hervorrufen können, zum Thema Müdigkeit,<br />
zur Stimmungslage sowie zur Bewältigung der Krankheit. Wie beim MacNew Heart wird<br />
auch hier der Gesundheitszustand in den letzten zwei Wochen vor der Befragung abgebildet.<br />
Das Ausfüllen des Fragebogens durch den Patienten beansprucht etwa 20 Minuten.<br />
Der CRQ ist ein international etabliertes Instrument für die patientenorientierte Einschätzung<br />
der Ergebnisqualität und die SGP empfiehlt ihn im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens. 27<br />
Die deutsche Version (Selbstbeurteilung) ist validiert und im Anhang dokumentiert (vgl. Anhang<br />
5.9.4). Bei der Anwendung fallen Lizenzkosten an, deren Höhe mit dem Lizenzgeber verhandelt<br />
werden muss.<br />
4.3.3 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung (Modul 2 und Modul 3)<br />
Für die Auswertung sind in Modul 2 und Modul 3 erhobenen Angaben mit den Daten aus der<br />
Medizinischen Statistik des BFS zu verknüpfen. Diese werden von den Kliniken bereits obligatorisch<br />
erhoben und periodisch dem BFS zugestellt. Die Daten aus der Medizinischen Statistik<br />
des BFS werden ebenfalls für das ST-Reha-Projekt genutzt. 28<br />
Die Medizinische Statistik des BFS ist in Variablen für die Lieferungsmeldung, Allgemeine Angaben,<br />
Minimaldaten sowie Zusatzdaten für bestimme Patientengruppen (Neugeborene, Psychiatrie,<br />
weitere Zusatzdaten) gegliedert. Sie umfasst u.a. Angaben zur Identifizierung des Betriebs<br />
(z.B. BUR-Nummer, Name) sowie Falldaten (z.B. eindeutige Fallidentifikationsnummer,<br />
soziodemographische Angaben, Eintrittsmerkmale, Aufenthaltsmerkmale, betriebswirtschaftliche<br />
Merkmale, Austrittsmerkmale, Haupt- und Nebendiagnosen, Haupt- und weitere Behandlungen).<br />
Bei der Auswertung wird die Komorbidität der Patienten berücksichtigt. Wie im ST-Reha-Projekt<br />
werden sie mit der Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) erfasst (vgl. Abschnitt 5.10, Seite<br />
72) 29 .<br />
26 Höfer, S. et al. (2008): Psychometric properties of the MacNew heart disease health-related quality of<br />
life instrument in patients with heart failure. Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 14, Issue<br />
4, pages 500-506, August 2008.<br />
27 http://www.pneumo.ch/de/informationen-fuer-fachpersonen/pulmonale-rehabilitation.html<br />
28 Zwecks Gewährleistung der Anonymität sind im Rahmen des PCS Reha Projekts (Pilotphase 2011)<br />
Geburtsdatum, Wohnregion und Nationalität des Patienten nicht Teil des Lieferumfangs der Daten.<br />
29 Im Pilotprojekt des <strong>ANQ</strong> wurde zunächst der CIRS und später eine vereinfachte Version des CIRS<br />
eingesetzt. Eine vergleichende Auswertung ergab, dass beide Instrumente ähnlich aussagekräftig sind.<br />
Ein Wechsel des Instruments müsste in Absprache mit den Verantwortlichen des ST-Reha-Projekts erfolgen.<br />
26
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Mit Blick auf die Auswertung sind zudem Kennzahlen zur Beschreibung der <strong>Rehabilitation</strong>skliniken<br />
zu berücksichtigen. Als Basis dient die Publikation des BFS zu den Kennzahlen der<br />
Schweizer Spitäler, welche 2011 in der fünften Ausgabe erschienen ist und erstmals Daten von<br />
allen Spitälern und Kliniken umfasst. In der Statistik sind die <strong>Rehabilitation</strong>skliniken als eigener<br />
Betriebstyp dargestellt. Die Daten geben einen Überblick über Struktur, Patienten, Leistungen,<br />
Angebot, Personal und finanzielle Situation der Spitäler. Die Angaben basieren auf den Daten<br />
der Jahre 2008 und 2009.<br />
Die separate Erhebung von Kontextfaktoren (reha-erschwerende persönliche Faktoren und<br />
Umweltfaktoren, inkl. Wohn- und Arbeitssituation, Rauchen, Alkoholkonsum) und Diagnosegruppen<br />
wird in Zusammenarbeit mit dem Auswertungsinstitut geprüft. Sofern sich aussagekräftige<br />
Diagnosegruppen aufgrund der Medizinischen Statistik bilden lassen, erübrigt sich deren<br />
separate Erhebung.<br />
4.3.4 Methodische Aspekte (Modul 2 und Modul 3)<br />
In Modul 2 und Modul 3 ist jeweils eine Vollerhebung geplant, in welche alle während eines Jahres<br />
austretenden stationär behandelten erwachsenen Patienten mit einer Eintritts- und Austrittmessung<br />
erfasst werden. Patienten, welche in der Zeitperiode mehr als einmal aus einer <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />
entlassen werden, werden erneut erfasst und bilden einen neuen Fall.<br />
Die Erhebung der Daten erfolgt während des Aufenthaltes in der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik und wird<br />
schriftlich dokumentiert (Papier, elektronisch). Der <strong>ANQ</strong> erlässt Vorgaben (Handbuch / Manual)<br />
für die Erhebung und Dokumentation der Daten.<br />
Die Rücklaufquote (Drop out-Fälle) wird als wichtiger Indikator für die Qualität der Daten betrachtet<br />
und soll in den Berichten ausgewiesen werden. Die Bruttorücklaufquote berechnet sich<br />
aus dem Verhältnis zwischen Datensätzen mit Messungen (Zähler) und Gesamtzahl der Datensätze<br />
basierend auf die Medizinische Statistik (Nenner), differenziert nach Klinik und Patientengruppen<br />
(z.B. Diagnosen, Behandlungen).<br />
Die Anforderungen an die Datenqualität und die Risikoadjustierung sowie die Voraussetzungen<br />
für gruppenstatistische Auswertungen und allfällige weitere Aspekte werden in Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut ergänzt, präzisiert und in Rücksprache mit dem QA <strong>Rehabilitation</strong> abschliessend<br />
geregelt:<br />
a) Eine hohe Datenqualität ist eine Voraussetzung für den Vergleich der Ergebnisse aus<br />
den Qualitätsmessungen mit Referenzwerten (vgl. Abschnitt 3.3.1.4). Aus diesem Grund<br />
müssen die Daten elektronisch erfasst und zeitgleich geprüft werden. Ergänzend wird<br />
das Auswertungsinstitut in Zusammenarbeit mit dem <strong>ANQ</strong> Vorgaben bezüglich Datenlieferung<br />
sowie Spezifikationen für die zu erhebenden Daten (inkl. Prüflogik) zu Handen<br />
der Kliniken erlassen. Die Prüflogik umfasst in erster Linie Einzelfeldtests (vollständige<br />
Angaben, gültige Werte) sowie gegebenenfalls Kreuztests (valide Angaben) innerhalb<br />
eines Datensatzes eines Outcome-Instruments bzw. Fragebogens. Aus Sicht des QA<br />
<strong>Rehabilitation</strong> ist eine weitere Prüfung der Daten durch das auswertende Institut zur Sicherstellung<br />
einer homogenen und hohen Datenqualität sowie zur Vorbeugung von Manipulationen<br />
erforderlich. Im Vordergrund steht die Plausibilisierung zwischen den verschiedenen<br />
Datensätzen bzw. Outcome-Instrumenten oder Fragebogen eines einzelnen<br />
27
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Patienten (valide Angaben) sowie die systematische Dokumentation der Datenqualität<br />
anhand von Indikatoren (Rücklauf, Vollständigkeit / Anteil fehlender Werte). 30 Wichtig<br />
sind in diesem Zusammenhang Hinweise des Auswertungsinstituts, wie die allfälligen<br />
Mängel bei der Datenqualität durch geeignete Massnahmen behoben werden können.<br />
b) Eine hohe Datenqualität ist eine Voraussetzung für die vom <strong>ANQ</strong> angestrebte Risikoadjustierung.<br />
Die Risikoadjustierung soll ein bezüglich der Zusammensetzung der Patienten<br />
(Case Mix) fairer Vergleich der untersuchten <strong>Rehabilitation</strong>skliniken mit den nationalen<br />
Referenzwerten ermöglichen. Zudem soll sie gewährleisten, dass die Ergebnisse<br />
primär die Behandlungsqualität in der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik (inkl. allfälliger Rahmenbedingungen),<br />
und nicht die Zusammensetzung der Patienten, wiederspiegeln. Als Variablen<br />
für die Risikoadjustierung kommen primär Merkmale der Patientenstruktur in Frage<br />
wie Diagnosegruppe und Dauer der Diagnose 31 , Schweregrad der Erkrankung, Alter<br />
sowie allenfalls Kontextfaktoren (Wohn- und Arbeitssituation vor der Erkrankung bzw.<br />
dem Unfall, Rauchen, Alkohol). Eine kritische Diskussion der Risikoadjustierung inklusive<br />
der dazu verwendeten Variablen und des Modells ist zwingend und soll durch das<br />
Auswertungsinstitut geleistet werden.<br />
c) Für die gruppenstatistische Auswertung nach <strong>Rehabilitation</strong>sklinik (inkl. Gesamtergebnissen)<br />
soll nach Meinung des QA <strong>Rehabilitation</strong> das Erreichen der Mindeststichprobengrösse<br />
von 100 auswertbaren Datensätzen vorausgesetzt werden. Bei einem ungenügenden<br />
Rücklauf erfolgt keine gruppenstatistische Auswertung nach <strong>Rehabilitation</strong>sklinik.<br />
Voraussetzung für eine gruppenstatistische Auswertung nach anderen Merkmalen<br />
(z.B. Diagnosegruppen) ist das Erreichen der Mindeststichprobengrösse von 50 auswertbaren<br />
Datensätzen. Bei ungenügendem Rücklauf erfolgt keine entsprechende gruppenstatistische<br />
Auswertung.<br />
4.3.5 Handbuch zur Messung und Schulungskonzept (Modul 2 und Modul 3)<br />
Eine Schulung in der Handhabung der Messinstrumente und eine Dokumentation der Instrumente<br />
und ihrer Anwendung (Messhandbuch / Manual) werden als unabdingbar zur Förderung<br />
der Datenqualität bzw. einer hohen Validität und Reliabilität der Angaben erachtet. Dies gilt in<br />
besonderem Ausmass für die Zieldokumentation. Auch bei den anderen Instrumenten (FIM,<br />
EBI, HAQ, 6-Minuten-Gehtest, Ergometrie sowie MacNew Heart und CRQ) müssen trotz teils<br />
grosser Verbreitung Richtlinien und Vorgaben für die Anwendung formuliert und im Rahmen<br />
von Schulungen instruiert werden. 32 Darüber hinaus sollen im Messhandbuch die Instrumente<br />
dokumentiert werden.<br />
30<br />
Vgl. Hasler, Silvio (2009): Plausibilisierungskonzept der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser<br />
(Version 5.0). BFS, Bern.<br />
31<br />
Die ätiologische Zuordnung hatte sich im Pilotprojekt bewährt. Vgl. auch die Diagnosegruppen in Kool,<br />
J. (2009): Entwicklung eines Patientenklassifikationssystem PCS für die <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz.<br />
ZHAW.<br />
32<br />
z.B. Definition von Wiedereintritt, Richtlinien für Testwahl (Gehtest oder Ergometrie), Festlegen der<br />
Testprozeduren (Gehtest und Ergometrie), Definition von Zeitfenstern für die Durchführung der Tests<br />
bzw. der Befragungen, Instruktionen für das Ausfüllen des Fragebogens zu Handen des Personals bzw.<br />
der Patienten, Instruktionen für die Annahme der Fragebogen und erste Datenkontrollen vor Ort.<br />
28
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Ein zu erarbeitendes Schulungskonzepts legt die Rahmenbedingungen für das Schulungsangebot<br />
fest. Inhalt des Schulungskonzepts sind Wahl und Vorbereitung des Lehrpersonals,<br />
Schulungstage (Anzahl, Dauer, Ort, Sprache), Unterlagen und Ablauf.<br />
Das Messhandbuch und die Schulungen werden in den drei Landessprachen vorgelegt bzw.<br />
durchgeführt. Handbuch, Schulungskonzept und Schulung sollen in enger Zusammenarbeit mit<br />
den Fachgesellschaften erstellt bzw. organisiert werden.<br />
4.3.6 Organisation der bereichsspezifischen Messungen (Modul 2 und Modul 3)<br />
Die Organisation der bereichsspezifischen Messung (Modul 2 und Modul 3) erfolgt unabhängig<br />
von derjenigen für die nationale Patientenzufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> (Modul 1);<br />
diese wurde in Abschnitt 4.2.4, Seite 22, dargestellt.<br />
4.3.6.1 Organisation der Datenerhebung<br />
Der <strong>ANQ</strong> gibt den Kliniken vor, dass die Daten elektronisch erhoben und die Eingaben rudimentär<br />
geprüft werden. Die Kliniken bestimmen den Systemanbieter für die Datenerfassung und<br />
Datenprüfung selber (vgl. Szenario 2, Seite 16).<br />
Der <strong>ANQ</strong> plant, Unternehmen mit Kernkompetenzen im IT-Bereich und Erfahrung im Gesundheitswesen<br />
(insbesondere Datenerhebungen) zu einem Workshop mit Klinikvertretern einzuladen.<br />
Dort sollen Klinikvertreter die Möglichkeit haben, sich ein Bild über die Produkte zu machen<br />
und auf Voranmeldung ein Einzelgespräch mit den anwesenden Systemanbietern führen<br />
zu können. Die Durchführung des Workshops ist für die zweite Maihälfte bzw. Anfang Juni geplant.<br />
Das für die Auswertung zuständige Messinstitut erlässt in Zusammenarbeit mit dem <strong>ANQ</strong> Vorgaben<br />
bezüglich Datenlieferung (Inhalt, Format und Periodizität) sowie Spezifikationen für die<br />
zu erhebenden Daten (Variablenliste, Wertebereich, Ausprägungen und Definition von fehlenden<br />
Werten; inkl. Prüflogik) zu Handen der Kliniken 33 . Das Auswertungsinstitut erhält die Daten<br />
in elektronischer Form von den Systemanbietern bzw. Kliniken.<br />
Das Auswertungsinstitut ist seinerseits für die Sicherstellung einer hohen und homogenen Datenqualität<br />
verantwortlich; eine engmaschige Überprüfung der Datenqualität mit zeitnahen<br />
Rückmeldungen an die Kliniken wird möglicherweise nicht notwendig sein.<br />
4.3.6.2 Organisation der Auswertung und Berichterstattung<br />
Das für die Auswertung und Berichtserstattung zuständige Messinstitut soll Kernkompetenzen<br />
in der Analyse und Interpretation von rehabilitationsmedizinischen Daten (Risikoadjustierung,<br />
Vergleich mit nationalen Referenzwerten und weitere methodische Kompetenzen) und in der<br />
Berichtsfassung (Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit) nachweisen. Wichtig erscheint auch<br />
der Nachweis von Erfahrung in der Durchführung von komplexen Grossprojekten (insbesondere<br />
dezentrale Datenerfassung, Mehrsprachigkeit, Auswertung). Weitere wichtige Kriterien sind<br />
ausgewiesene adäquate Kommunikationskompetenzen (Umgang mit Kliniken, Umgang mit<br />
<strong>ANQ</strong>) sowie mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen (Landessprachen, Verständlichkeit<br />
der Berichte).<br />
33 Im Rahmen des PCS Reha Projekts (Pilotprojekt 2011) wurden entsprechende Vorgaben für den Bereich<br />
der muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> bereits verfasst.<br />
29
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Die Aufgaben des auswertenden Instituts sind im Einzelnen:<br />
‐ Bestimmung des Inhalts, Formats und Periodizität der Datenlieferung und Bestimmung<br />
der Spezifikationen der Variablen inkl. Prüflogik unter Einbezug der laufenden Projekte<br />
(insbesondere ST-Reha-Projekt)<br />
‐ Die Organisation der Datenlieferung (Messdaten, Medizinische Statistik der Krankenhäuser,<br />
BFS) von den Kliniken an das Messinstitut<br />
‐ Datenbereinigung und Aufbereitung der gelieferten Daten (inkl. Datenqualitätsmonitoring<br />
und Massnahmen zur Behebung von allfälligen Mängeln)<br />
‐ Auswertung (Auswertungskonzept; Risikoadjustierung; Auswertung)<br />
‐ Berichterstellung (Publikationskonzept; Berichterstellung)<br />
4.4 Auswertung, Berichterstattung und Veröffentlichung (Modul 1, Modul 2 und Modul<br />
3)<br />
Massgebend für die Auswertung und Veröffentlichung der Daten ist das Datenreglement des<br />
<strong>ANQ</strong>, das die relevanten Bestimmungen für die Auswertung, Berichterstattung und Veröffentlichung<br />
der Qualitätsmessungen (vgl. insbesondere Artikel 5 bis Artikel 12) festlegt. Es stützt sich<br />
unter anderem auf die Empfehlungen der SAMW über die Erhebung, Analyse und Veröffentlichung<br />
von Daten über die medizinische Behandlungsqualität. 34 Danach können Ergebnisse von<br />
Qualitätsmessungen veröffentlicht werden, wenn die Indikatoren relevant sind, die Daten korrekt<br />
erhoben wurden, der Bericht inhaltlich und formal korrekt ist und die Ergebnisse verständlich<br />
dargestellt und nachvollziehbar interpretiert sind.<br />
Darüber hinaus gibt das Grundlagenpapier „Anforderungen an die Auswertungskonzepte“, das<br />
bislang im Akutbereich eingesetzt wurde (vgl. Abschnitt 5.5, Seite 45), weitere Hinweise bezüglich<br />
der zu erstellenden messungsspezifischen Auswertungs- und Publikationskonzepte.<br />
4.4.1 Berichtswesen<br />
Der Auftragnehmer soll ein Gesamtbericht über die Befragung zuhanden des <strong>ANQ</strong> verfassen<br />
auf Basis der Messdaten eines Messjahrs bzw. den beiden Messmonaten im Modul 1 (nationale<br />
Patientenzufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong>). Der Gesamtbericht umfasst Erläuterungen zu<br />
den Methoden (inkl. Lesehilfen zu den Graphiken), Angaben zur Datenqualität (Rücklauf, Gruppenbildung)<br />
und einen Ergebnisteil nach Klinik und Gesamtergebnissen. Darüber hinaus sollen<br />
kantonsspezifische Auswertungen erstellt werden (Datenreglement, Art. 11 Abs. 2). Im Fokus<br />
der Auswertungen steht der Vergleich von Kliniken mit nationalen Referenzwerten.<br />
Sollten die klinikspezifischen Ergebnisse ohne namentliche Bezeichnung publiziert werden<br />
(pseudonymisierte Darstellung), sind jährliche klinikspezifische Berichte zwingend vorzusehen<br />
(inkl. Vergleich mit nationalen Referenzwerten). Ihre Erstellung hat mit Blick auf die Kosten in<br />
hohem Masse automatisiert zu erfolgen. Mit den klinikspezifischen Berichten (inkl. Vergleich mit<br />
nationalen Referenzwerten) werden Leistungen der Kliniken für die externe Qualitätssicherung<br />
honoriert.<br />
34 Empfehlungen der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW) für die Erhebung,<br />
Analyse und Veröffentlichung von Daten über die medizinische Behandlungsqualität<br />
(http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/SAMW_Empfehlungen_Qualität_dt.pdf)<br />
30
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
4.4.2 Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Gemäss Datenreglement werden die Ergebnisse der vergleichenden Qualitätsmessungen mit<br />
namentlicher Bezeichnung der Kliniken veröffentlicht. Voraussetzung hierzu ist, dass die Empfehlungen<br />
der SAMW erfüllt sind.<br />
In der Akutsomatik hatten fundierte Bedenken an der Qualität der Daten aus dem ersten Messjahr<br />
dazu geführt, dass die klinikspezifischen Ergebnisse ohne namentliche Bezeichnung der<br />
Kliniken veröffentlicht wurden.<br />
4.5 Kosten, Finanzierung und Taxzuschlag (Modul 1, Modul 2 und Modul 3)<br />
Die im <strong>Messplan</strong> enthaltenen Instrumente sind von den Fachgesellschaften anerkannt und Teil<br />
von Behandlungskonzepten (State-of-the-art). Dabei muss eingeräumt werden, dass die einzelne<br />
Instrumente nicht immer weit verbreitet (z.B. MacNew Heart) und teils auch lizenzpflichtig<br />
sind (z.B. MacNew Heart, CRQ).<br />
Wo möglich wird auf bestehende Datensammlungen (z.B. Medizinische Statistik der Krankenhäuser<br />
BFS, Krankenhausstatistik BFS) zurückgegriffen. Um noch mehr Synergien bei der Datenerhebung<br />
zu nutzen, wird eine enge Koordination mit ähnlich gelagerten Projekten angestrebt<br />
(z.B. ST-Reha-Projekt sowie nationalen Patientenzufriedenheitsbefragung im Akutbereich).<br />
Damit strebt der <strong>ANQ</strong> ein gutes Aufwand- und Leistungsverhältnis an.<br />
Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Messkosten, welche beim <strong>ANQ</strong> und in den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken<br />
anfallen. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie diese Kosten finanziert werden und wie<br />
sich das auf den Taxzuschlag niederschlägt:<br />
Der Aufwand des <strong>ANQ</strong> für den <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> gliedert sich in Personalkosten bei der<br />
Geschäftsstelle (z.B. Projektleitung, Honorare, Übersetzungen), in Infrastrukturkosten (z.B.<br />
Raummieten für Sitzungen und Workshops) und in eine Position für Unvorgesehenes (Basis:<br />
2% der Aufwendungen des <strong>ANQ</strong> und der Kliniken). Der <strong>ANQ</strong> trägt zudem die sogenannten klinikexternen<br />
Messkosten – im Unterschied zu den klinikinternen Kosten einer Messung – der<br />
drei Module. Nicht enthalten sind darin die Aufwendungen für die Umsetzung der Messungen in<br />
den Kliniken (IT-Lösung, Personalaufwand für die klinikinterne Projektkoordination, die Datenerfassung<br />
und Schulung). Die klinikexternen Messkosten für Modul 1 beinhalten die Messorganisation,<br />
Auswertung und Berichterstellung und wurden auf Basis der Erfahrung im Rahmen der<br />
nationalen Zufriedenheitsbefragung im Akutbereich kalkuliert. Die Aufwendungen des <strong>ANQ</strong> für<br />
Modul 1 werden auf ----- Franken geschätzt.<br />
Die externen Messkosten in Modul 2 und 3 beinhalten jeweils die Konzeption der Schulung, die<br />
Organisation der Datenerhebung (inkl. Datenkontrolle und Plausibilisierung), Lizenzkosten, die<br />
Auswertung der Daten sowie die Erstellung eines Gesamtberichts und automatisierter klinikindividueller<br />
Berichte. Die Kalkulation der Kosten basiert auf den Kosten für den <strong>Messplan</strong> Psychiatrie.<br />
Insgesamt wird mit einem Messaufwand von ------- Franken für Modul 2 bzw. ----------<br />
Franken für Modul 3 gerechnet. Die gesamten klinikexternen Messkosten (Personal <strong>ANQ</strong><br />
plus Infrastrukturkosten <strong>ANQ</strong> plus Messkosten Modul 1, 2 und 3) belaufen sich somit auf ---------<br />
Franken.<br />
31
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
Tabelle 5: Aufwand und Finanzierung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong><br />
Position Betrag<br />
(in 1000 Franken)<br />
A) Aufwand<br />
Anteil<br />
(%)<br />
A1) Aufwand <strong>ANQ</strong> (klinikexterne Messkosten) 919.6 47.8%<br />
Personalkosten <strong>ANQ</strong> 133.2<br />
Infrastrukturkosten <strong>ANQ</strong> 14.5<br />
Externe Messkosten Modul 1 63.6<br />
Externe Messkosten Modul 2 337.7<br />
Schulungskonzeption 15.0<br />
Auswertung und vergleichender Bericht (inkl.<br />
Datendefinition, -transfer & -plausibilisierung)<br />
305.0<br />
Lizenzkosten 0<br />
Klinikspezifische Berichte 17.7<br />
Externe Messkosten Modul 3 352.7<br />
Schulungskonzeption 15.0<br />
Auswertung und vergleichender Bericht (inkl.<br />
Datendefinition, -transfer & -plausibilisierung)<br />
305.0<br />
Lizenzkosten 15.1<br />
Klinikspezifische Berichte 17.7<br />
Unvorgesehenes 18.0<br />
A2) Aufwand Kliniken (alle Kliniken) 1‘004.4 52.2%<br />
Anpassungen des KIS, Koordination und Schulung<br />
der Messung, zusätzlicher Erhebungsaufwand<br />
A3) Aufwand insgesamt (A1+A2) 1‘924.0 100%<br />
B) Finanzierung<br />
Kantone 1‘058.2 55%<br />
Versicherer 865.8 45%<br />
Aufgrund des im Finanzierungskonzept festgehaltenen Prinzips der Gleichbehandlung und des<br />
Qualitätsvertrags (vgl. Abschnitt 3.3.3, Seite 17) entspricht der Aufwand, welche beim <strong>ANQ</strong> anfällt<br />
einem Kostenanteil von 47.8%. Der Kostenanteil für die klinikinternen Kosten beträgt<br />
32
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
52.2%, was einem Aufwand von -------- Franken entspricht. 35 Die abgeleiteten Gesamtkosten<br />
für den <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> betragen -------- Franken.<br />
Finanziert werden die Messpläne von den Kantonen und Versicherern mit einem vertraglich<br />
festgelegten kantonalen Anteil von 55% und Versicherer-Anteil von 45% (vgl. Abschnitt 3.3.3,<br />
Seite 17). Demzufolge tragen die Kantone -------- Franken und die Versicherer -------<br />
Franken des Aufwands für den <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>. Bei jährlich rd. 58‘000 Austritten beträgt<br />
der gesamte Taxzuschlag (Kantons- plus Versichereranteil) ------- Franken (siehe Tabelle<br />
6). 36<br />
Tabelle 6: Finanzierung des <strong>Messplan</strong>s über den Taxzuschlag<br />
Damit ist der Taxzuschlag für den <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> deutlich höher als für den <strong>Messplan</strong><br />
Psychiatrie (ohne Messkosten für die Patientenzufriedenheitsbefragung). Er enthält jedoch die<br />
Kosten für die Patientenzufriedenheitsbefragung und deckt eine vergleichsweise hohe Anzahl<br />
an geplanten Messungen ab (10 Instrumente in der <strong>Rehabilitation</strong> gegenüber 4 Instrumenten in<br />
der Psychiatrie).<br />
4.6 Zeitplan und Meilensteine (Modul 1, Modul 2 und Modul 3)<br />
Der QA <strong>Rehabilitation</strong> schlägt angesichts des Vorbereitungsbedarfs vor, mit sämtlichen Messungen<br />
erst ab 2013 zu beginnen.<br />
Für die Vorbereitung der Messung (Vorgaben für die Datenerfassung, Auswahl von Systemanbietern<br />
für die Datenerfassung; Organisation der Datenerfassung und Implementation in den<br />
Kliniken, Organisation und Durchführung von Schulungen, Erstellen des Messhandbuchs) besteht<br />
ausreichend Zeit, ebenso für die abschliessende Klärung der Finanzierung (Taxzuschlag)<br />
und die notwendigen vertraglichen Anpassungen (Qualitätsvertrag, Anhang 5b) und Genehmigungsprozesse<br />
durch die Partner des <strong>ANQ</strong> und die Leistungserbringer. Ausserdem ist es durch<br />
35 Ein Vergleich der kalkulierten klinikinternen Messkosten (52.2% der Gesamtkosten) mit Erfahrungswerten<br />
aus den Pilotprojekten des <strong>ANQ</strong> zeigt, dass in den Kliniken für die Umstellung gut doppelt so hohe<br />
effektive Kosten anfallen dürften.<br />
36 Als Basis zur Berechnung der Kosten bzw. des Taxzuschlags wurde das Datenjahr 2009 der Medizinischen<br />
Statistik der Krankenhäuser des BFS genommen (vgl. Fussnote 2).<br />
33
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
die vorgängige Präsentation des <strong>Messplan</strong>s und durch den Einbezug sprachregionaler Strukturen<br />
während der Vorbereitung der Messung (Übersetzungen, Schulungen) möglich Akzeptanz<br />
insbesondere in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz zu schaffen.<br />
Die Meilensteine zur Umsetzung:<br />
‐ Februar 2012: Vernehmlassung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> bei den im QA vertretenen<br />
Fachgesellschaften und interne Meinungsbildung bei den Partnern des <strong>ANQ</strong>.<br />
‐ März 2012: Unterbreitung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> beim Vorstand des <strong>ANQ</strong>; Antrag<br />
zur Annahme des <strong>Messplan</strong>s und zur <strong>Ausschreibung</strong> von Modul 1 sowie von Modul 2<br />
und 3; Information der <strong>Rehabilitation</strong>skliniken (<strong>Messplan</strong>, Zeitplan, Finanzierung).<br />
‐ Ab März 2012: Verfassen der <strong>Ausschreibung</strong> für Modul 1 sowie für Modul 2 und 3; Systematische<br />
Dokumentation der Messinstrumente (Lizenzkosten, Sprachversionen,<br />
Score-Berechnungen, Richtlinien für die Anwendung); Erarbeitung eines Handbuchs<br />
(Manual) durch die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit dem QA <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
‐ April 2012: <strong>Ausschreibung</strong>en Modul 1 sowie Modul 2 und 3; Erarbeitung eines Schulungskonzepts;<br />
Klärung der Lizenzen durch die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit<br />
dem QA <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
‐ Mai 2012 / Juni 2012: Sicherstellung der Finanzierung bei den Partnern des <strong>ANQ</strong>. Versand<br />
des Anhangs 5b zum Qualitätsvertrag an die Partner.<br />
‐ Mai 2012 / Juni 2012: Unterbreitung des Vorschlags bezüglich Wahl des Auswertungsinstituts<br />
für Modul 1 sowie Modul 2 und 3.<br />
‐ Juni 2012: Verabschiedung des Schulungskonzepts und des Handbuchs durch den<br />
<strong>ANQ</strong> Vorstand.<br />
‐ Drittes Quartal 2012: Umsetzung der Schulung.<br />
4.7 Weiterentwicklung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong><br />
Mit Blick auf die Weiterentwicklung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> sollen u.a. folgende Themen<br />
geprüft werden:<br />
‐ Die Prüfung der Aufnahme einer weiteren fachübergreifenden Messung (z.B. Patientensicherheit<br />
in der <strong>Rehabilitation</strong>).<br />
‐ Die Prüfung von bereichsspezifischen Messinstrumenten in Bereichen, welche durch<br />
den vorliegenden <strong>Messplan</strong> noch nicht adäquat abgedeckt werden (z.B. für die <strong>Rehabilitation</strong><br />
von Paraplegiepatienten).<br />
‐ Die Prüfung der Einführung des Zieldokumentationsprozesses (inkl. Überprüfung der<br />
Zielerreichung) in den <strong>Messplan</strong> für die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong>. Dies entspräche<br />
einer Angleichung des muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Messplan</strong>s mit<br />
demjenigen der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong>.<br />
‐ Die Prüfung der verwendeten Messinstrumente (z.B. die Streichung eines Instruments,<br />
das sich nachweislich nicht bewährt hat) und die Prüfung allfälliger zusätzlicher Messinstrumente<br />
(z.B. die Wahl von einem Schwerpunktthema).<br />
34
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />
‐ Die Prüfung der Aufnahme einer Messung zur Überprüfung der Nachhaltigkeit der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung<br />
(Nachweis des langfristigen Nutzens der Behandlung) auf Antrag<br />
der Fachgesellschaften.<br />
‐ Die Prüfung von weitergehenden Vereinheitlichungen bzw. Standardisierungen bei der<br />
Anwendung der vorgegebenen Instrumente.<br />
‐ Die Prüfung der Identifikation von prädiktiven Faktoren (Erhebung von Behandlungspotential<br />
und Indikationsqualität).<br />
Grundsätzlich sollte bei Aufnahme eines neuen Instruments geprüft werden, ob nicht ein bereits<br />
angewendetes Instrument gestrichen wird.<br />
35
<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>
Anhang<br />
5 Anhang<br />
5.1 Personenverzeichnis<br />
5.1.1 Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong><br />
Herr PD Dr. med. Stefan Bachmann, Vertreter SWISSREHA; Chefarzt, KLINIKEN VALENS,<br />
<strong>Rehabilitation</strong>szentren Valens und Walenstadtberg, Valens; Herr Dr. med. Fabio Baronti, Vertreter<br />
SGNR; Klinik Bethesda, Tschugg; Herr Pascal Besson, stellvertretend für Frau Christa<br />
Leutert, Vertretung H+, Beobachter-Status; Frau Annette Egger, Vertreterin Kantone; Qualitätsbeauftragte,<br />
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt; Frau Dr. med. Ruth Fleisch, Vertreterin IG<br />
Kardio; Chefärztin, Klinik Schloss Mammern; Frau Barbara Lüscher, Vertreterin Versicherer;<br />
Zentralstelle für Medizinaltarife UVG (ZMT), Luzern; Herr Dr. med. Hans-Peter Rentsch, Vertreter<br />
SAR; Herr Gianni Rossi, Vorsitzender QA <strong>Rehabilitation</strong>, Vorstand <strong>ANQ</strong>; Direktor, Clinica<br />
Hildebrand, Brissago; Herr Dr. med. Alexander Turk, Vertreter SGP; Chefarzt, Zürcher Höhenklinik<br />
Wald; Herr Dr. med. Marcel Weber, Vertreter SGPMR; Stadtspital Triemli, Zürich.<br />
(Stand Ende 2011)<br />
5.1.2 Arbeitsgruppe 1A<br />
Herr Dr. med. Javier Blanco, muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>, Zürcher Höhenklinik Wald; Herr<br />
Dr. med. Pierre Combremont, Klinik Bethesda Tschugg; Frau Ida Dommen, Leitung Therapien<br />
<strong>Rehabilitation</strong>, Kantonsspital Luzern; Herr Dr. Peter Erhart, Leiter Klinikentwicklung & Qualitätscontrolling,<br />
Rehaklinik Bellikon; Herr Dr. med. Daniel Eschle, neurologische <strong>Rehabilitation</strong>,<br />
RehaClinic Zurzach; Frau M. Glombik, muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>, Züricher Höhenklinik<br />
Davos; Frau PD Dr. med. Margret Hund, Neurologische <strong>Rehabilitation</strong>, Zürcher Höhenklinik<br />
Wald; Frau Yvonne Keller, Medizincontrollerin, Berner Reha-Zentrum Heiligenschwendi; Herr<br />
Dr. med. Thomas Mietzsch, Leitender Arzt, <strong>Rehabilitation</strong>szentrum Valens; Herr Dr. med.<br />
Hanspeter Rentsch, Experte; Herr Klaus Schmitt, Schweizer Paraplegiker Zentrum Nottwil; Frau<br />
Dr. med. Marina Sokcevic, Fachärztin Physikalische Medizin und <strong>Rehabilitation</strong>, Reha Rheinfelden;<br />
Herr Dr. med. Claude Vaney, Chefarzt Neurologie, Berner Klinik Montana; Herr Dr. med.<br />
Christoph Widmer, muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>, RehaClinic Zurzach; Frau Evelyne Wiederkehr,<br />
ehemals Vorsitzende der Klinikleitung, aarReha Schinznach.<br />
5.1.3 Arbeitsgruppe 1B<br />
Herr Dr. med. Matthias Hermann, Züricher Höhenklinik Wald; Herr Dr. med. Wilfried Kottmann,<br />
<strong>Rehabilitation</strong>szentrum Seewis; Herr Dr. med. Christoph Schmidt, Klinik Barmelweid; Herr Dr.<br />
med. Armin Stucki, Berner Reha-Zentrum Heiligenschwendi; Herr Dr. med. Alexander Turk,<br />
Zürcher Höhenklinik Wald.<br />
5.1.4 Arbeitsgruppe 2<br />
Herr Dr. med. Oliver Bergamin, Leiter Q-Management, Klinik Bethesda Tschugg; Herr Dr. med.<br />
Stephan Eberhard, Chefarzt Medizin, Berner Klinik Montana; Herr Dr. Peter Erhart, Leiter Klinikentwicklung<br />
& Qualitätscontrolling, Rehaklinik Bellikon; Herr Dr. med. Christian Günter, Kardiologe,<br />
Klinik Schloss Mammern; Herr Dr. med. Thomas Mietzsch, Leitender Arzt; <strong>Rehabilitation</strong>szentrum<br />
Valens; Herr Richard Ploner, Verwaltungsleiter, Rehazentrum Seewis; Frau Dr.<br />
med. Marina Sokcevic, Fachärztin Physikalische Medizin & <strong>Rehabilitation</strong>, Reha Rheinfelden;<br />
Herr Dr. med. Alexander Turk, Chefarzt Pneumologie, Zürcher Höhenklinik Wald; Frau Evelyne<br />
Wiederkehr, ehemals Vorsitzende der Klinikleitung, aarReha Schinznach.<br />
37
Anhang<br />
5.2 Qualitätssicherung in der Krankenversicherung<br />
5.2.1 Art. 58 KVG: Qualitätssicherung<br />
Abs. 1 Der Bundesrat kann nach Anhören der interessierten Organisationen systematische wissenschaftliche<br />
Kontrollen zur Sicherung der Qualität oder des zweckmässigen Einsatzes der<br />
von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen vorsehen.<br />
Abs. 2 Er kann die Durchführung der Kontrollen den Berufsverbänden oder anderen Einrichtungen<br />
übertragen.<br />
Abs. 3 Er regelt, mit welchen Massnahmen die Qualität oder der zweckmässige Einsatz der Leistungen<br />
zu sichern oder wiederherzustellen ist. Er kann insbesondere vorsehen, dass:<br />
a. vor der Durchführung bestimmter, namentlich besonders kostspieliger Diagnose- oder<br />
Behandlungsverfahren die Zustimmung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin<br />
eingeholt wird;<br />
b. besonders kostspielige oder schwierige Untersuchungen oder Behandlungen von der obligatorischen<br />
Krankenpflegeversicherung nur vergütet werden, wenn sie von dafür qualifizierten<br />
Leistungserbringern durchgeführt werden. Er kann die Leistungserbringer näher<br />
bezeichnen.<br />
5.2.2 Art.77 KVV: Qualitätssicherung<br />
Abs. 1 Die Leistungserbringer oder deren Verbände erarbeiten Konzepte und Programme über die<br />
Anforderungen an die Qualität der Leistungen und die Förderung der Qualität. Die Modalitäten<br />
der Durchführung (Kontrolle der Erfüllung und Folgen der Nichterfüllung der Qualitätsanforderungen<br />
sowie Finanzierung) werden in den Tarifverträgen oder in besonderen Qualitätssicherungsverträgen<br />
mit den Versicherern oder deren Verbänden vereinbart. Die Bestimmungen<br />
haben den allgemein anerkannten Standards zu entsprechen, unter Berücksichtigung<br />
der Wirtschaftlichkeit der Leistungen.<br />
Abs. 2 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, das BAG über die jeweils gültigen Vertragsbestimmungen<br />
zu informieren. Das BAG kann über die Durchführung der Qualitätssicherung eine<br />
Berichterstattung verlangen.<br />
Abs. 3 In den Bereichen, in denen kein Vertrag abgeschlossen werden konnte oder dieser nicht den<br />
Anforderungen von Absatz 1 entspricht, erlässt der Bundesrat die erforderlichen Bestimmungen.<br />
Er hört zuvor die interessierten Organisationen an.<br />
Abs. 4 Das Departement setzt nach Anhören der zuständigen Kommission die Massnahmen nach<br />
Artikel 58 Absatz 3 des Gesetzes fest.<br />
5.3 Qualitätsvertrag<br />
I. Ingress<br />
Art. 1 Zweck<br />
Abs. 1 Die Parteien regeln mit diesem Vertrag die Finanzierung und die Umsetzung der Qualitätsmessungen<br />
inklusive Messzwang und Transparenz gemäss den Vorgaben des Nationalen<br />
Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>).<br />
Abs. 2<br />
Gestützt auf die bundesrechtlichen Vorgaben (namentlich Art. 22a, Art. 43, Art. 49 des KVG<br />
und Art. 76, Art. 77 der KVV; Art. 54 UVG und UVV; Art. 25 MVG und MVV sowie Art. 2 IVV<br />
und Art. 2 GgV) vereinbaren die Parteien was folgt:<br />
38
Anhang<br />
II. Geltungsbereich und Vertragsbestandteile<br />
Art. 2 Geltungsbereich<br />
Abs. 1 Dieser Vertrag gilt für die Vertragsparteien<br />
a. H+ und alle beigetretenen Spitäler und Kliniken gemäss Art. 39 KVG (ohne Einrichtungen<br />
nach Abs. 3), nachfolgend Leistungserbringer genannt<br />
b. santésuisse und alle beigetretenen Krankenversicherer KVG sowie UV, IV und MV<br />
c. GDK und alle beigetretenen Kantone<br />
d. <strong>ANQ</strong><br />
Abs. 2 Dieser Vertrag regelt Aufgaben, Rechte und Pflichten der Parteien sowie der beigetretenen<br />
Leistungserbringer, Versicherer und Kantone im Zusammenhang mit der Umsetzung der nationalen<br />
Qualitätsmessungen gemäss den Vorgaben des <strong>ANQ</strong>.<br />
Art. 3 Vertragsbestandteile<br />
Als integrierte Bestandteile gehören zu diesem Vertrag:<br />
‐ Liste der beigetretenen Leistungserbringer (Anhang 1). Die Liste wird periodisch aktualisiert und<br />
auf dem Internet veröffentlicht (www.anq.ch).<br />
‐ Liste der beigetretenen Versicherer (Anhang 2) Die Liste wird periodisch aktualisiert und auf dem<br />
Internet veröffentlicht (www.anq.ch).<br />
‐ Liste der beigetretenen Kantone (Anhang 3). Die Liste wird periodisch aktualisiert und auf dem<br />
Internet veröffentlicht (www.anq.ch).<br />
‐ Zuschläge der Versicherer und Kantone an die Akutspitäler und Beiträge der Akutspitäler an den<br />
<strong>ANQ</strong> (Anhang 4).<br />
‐ Beiträge der <strong>Rehabilitation</strong>s- und Psychiatriekliniken an den <strong>ANQ</strong> (Anhang 5).<br />
‐ <strong>ANQ</strong> Regelung im Umgang mit den erhobenen Daten (Anhang 6).<br />
‐ <strong>ANQ</strong> <strong>Messplan</strong> 2011-2015 gemäss Finanzierungskonzept vom 08.10.10 (Anhang 7).<br />
‐ <strong>ANQ</strong> Vereinsstatuten vom 24.11.09 (Anhang 8).<br />
III. Umsetzung der nationalen Qualitätsmessungen<br />
Art. 4 Verpflichtung zur Messung<br />
Abs. 1 Die Leistungserbringer verpflichten sich, die nationalen Qualitätsmessungen gemäss den<br />
Vorgaben des <strong>ANQ</strong> fristgerecht umzusetzen. Die Vorgabe der Messstrategie für national koordinierte<br />
Messungen ergebnisrelevanter Qualitätsindikatoren obliegt dem <strong>ANQ</strong>. Für die<br />
Messmethodik und die praktische Durchführung der Messungen kann der <strong>ANQ</strong> Messorganisationen<br />
beauftragen.<br />
Abs. 2 Kann ein Leistungserbringer aus objektiven Gründen Messungen nicht durchführen, hat er<br />
ein begründetes schriftliches Dispensgesuch an den <strong>ANQ</strong> zu stellen. In diesem ist darzulegen,<br />
aus welchen Gründen eine oder mehrere der vorgegebenen Messungen nicht durchgeführt<br />
werden können und welche alternativen Messungen umgesetzt werden. Der Vorstand<br />
des <strong>ANQ</strong> beurteilt das Gesuch abschliessend und beantwortet es schriftlich. Er leitet den<br />
Kostenträgern (Versicherer und Kantone) eine Kopie zu.<br />
Abs. 3 Die Kostenträger sorgen dafür, dass die Pflicht zur Umsetzung der <strong>ANQ</strong>-Messvorgaben in<br />
entsprechenden Verträgen (z.B. Tarifverträge, kantonale Leistungsaufträge) aufgenommen<br />
wird.<br />
39
Anhang<br />
Art. 5 Sanktionen<br />
Werden die nationalen Qualitätsmessungen gemäss Art. 4 Abs. 1 dieses Vertrags von einem Leistungserbringer<br />
nicht, nur teilweise oder nicht fristgerecht umgesetzt und wurde vom <strong>ANQ</strong> einem allfälligem<br />
Dispensgesuch dieses Leistungserbringers nicht stattgegeben, sind Kantone und Versicherer berechtigt,<br />
den gemäss Anhang 4 geschuldeten Betrag nicht zu leisten oder den von ihnen geleisteten Beitrag gemäss<br />
Anhang 4 zurückzufordern.<br />
Art. 6 Erfassung der Daten<br />
Die Verantwortung für die vollständige und richtige Erhebung der notwendigen Daten für die Messung<br />
obliegt den Leistungserbringern. Sie haben die Pflicht, die Daten fristgerecht gemäss den formalen und<br />
inhaltlichen Vorgaben des <strong>ANQ</strong> zur Analyse den vom <strong>ANQ</strong> bezeichneten Messorganisationen zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
Art. 7 Auswertung der Daten<br />
Der <strong>ANQ</strong> nimmt die gesamtschweizerischen Datenauswertungen nach den zu Beginn der jeweiligen<br />
Messung festgelegten Bedingungen, gemäss Statuten (Anhang 8) und den „Regelungen im Umgang mit<br />
den erhobenen Daten“ (Anhang 6) vor.<br />
IV. Umgang mit Daten<br />
Art. 8 Allgemeines<br />
Die in Art. 7 genannten Regelungen halten die Rechte und Pflichten der an den Qualitätsmessungen<br />
beteiligten Partner fest und beschreiben die Bestimmungen zu Datenschutz, Dateneigentum, Datenbearbeitung,<br />
Datenaufbewahrung, Einsichtsrecht, Geheimhaltung und Publikation.<br />
Art. 9 Transparenz / Veröffentlichung der Daten<br />
Abs. 1 Die Leistungserbringer willigen ein, dass der <strong>ANQ</strong> die Messergebnisse zielgruppenspezifisch<br />
und transparent veröffentlicht. Die Vertragsparteien erhalten die detaillierten Messergebnisse<br />
auf Ebene des einzelnen Spitals bzw. der einzelnen Klinik mit Kommentaren der<br />
Leistungserbringer zu den Auswertungen. Dritte werden in geeigneter Weise über das Ergebnis<br />
der Messung orientiert.<br />
Abs. 2 Der <strong>ANQ</strong> anerkennt die Standards für die Publikation von Qualitätsdaten der Schweizerischen<br />
Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) gemäss den Empfehlungen<br />
„Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Daten über die medizinische Behandlungsqualität“<br />
vom 24. Juni 2009.<br />
Abs. 3 Der <strong>ANQ</strong> legt für jede Messung eine Bandbreite oder Referenzwerte fest, innerhalb derer die<br />
Resultate in der Regel liegen sollen. An den Messungen beteiligte Leistungserbringer, die<br />
statistisch über/unter den Referenzwerten liegen, werden namentlich genannt bzw. jene, die<br />
innerhalb der Referenzwerte liegen, alphabetisch aufgelistet. Einzelheiten werden gemäss<br />
dem Verfahren in Art. 7 festgelegt.<br />
V. Leistungen des <strong>ANQ</strong><br />
Art. 10 Nationale Messkoordination<br />
Der <strong>ANQ</strong> gibt die Messstrategie für national koordinierte Messungen ergebnisrelevanter Qualitätsindikatoren<br />
vor. Der <strong>ANQ</strong> erarbeitet den entsprechenden Mess- und Finanzplan zur Umsetzung der Strategie.<br />
Der <strong>ANQ</strong> koordiniert und begleitet die Umsetzung der nationalen Messungen und stellt den Leistungserbringern<br />
die Messinstrumente kostenlos zur Verfügung. Der <strong>ANQ</strong> beauftragt Messorganisationen und<br />
Institute mit der praktischen Durchführung der Messungen und mit der Auswertung der Daten. Der <strong>ANQ</strong><br />
veröffentlicht die Daten.<br />
40
Anhang<br />
Art. 11 Amtssprachen<br />
Der <strong>ANQ</strong> stellt die Messinstrumente, die für die Messumsetzung notwendigen Dokumente sowie die Publikationen<br />
der Messergebnisse in den Amtssprachen des Bundes, Deutsch, Französisch und Italienisch,<br />
zur Verfügung.<br />
VI. Kosten und Finanzierung<br />
Art. 12 Finanzierungsgrundsatz<br />
Die Qualitätssicherung und Qualitätsmessung der Leistungserbringung ist mit dem Tarif abgegolten. Die<br />
Versicherer und Kantone beteiligen sich im Rahmen der anrechenbaren Kosten an der Qualitätssicherung<br />
und –messung nach diesem Vertrag.<br />
Art. 13 Übergangsfinanzierung der Qualitätsmessungen<br />
Abs. 1 Zur Finanzierung der Qualitätsmessungen des <strong>ANQ</strong> zahlen die beigetretenen Versicherer<br />
und Kantone einen Zuschlag pro Austritt während einer Übergangsphase von zwei Jahren<br />
gemäss den Bestimmungen in Anhang 4. Anrecht auf den Zuschlag haben diejenigen Leistungserbringer,<br />
welche dem nationalen Qualitätsvertrag beitreten und die vom <strong>ANQ</strong> vorgegebenen<br />
Messungen in der stationären Versorgung gemäss aktuellem <strong>Messplan</strong> (Anhang 7)<br />
umsetzen.<br />
Abs. 2 Die Zuschläge der Versicherer und der Kantone an die Leistungserbringer pro Austritt sind<br />
in den Anhängen geregelt.<br />
Abs. 3 Nach der zweijährigen Übergangsphase wird der Zuschlag pro Austritt durch die Versicherer<br />
und Kantone nicht mehr geleistet. Dieser ist dann Teil der anrechenbaren Kosten. Vorbehalten<br />
bleiben Änderungen im <strong>ANQ</strong> <strong>Messplan</strong> und damit verbundene (neue) zusätzliche Kosten<br />
der Qualitätsmessung. Sie bedingen eine einvernehmliche Anpassung im Sinne von Art. 18<br />
Abs. 2.<br />
Art. 14 Finanzierung der <strong>ANQ</strong>-Leistungen<br />
Abs. 1 Zur Finanzierung der Leistungen des <strong>ANQ</strong> gemäss Ziffer V entrichten die Leistungserbringer<br />
ab dem Jahr 2011 einen jährlichen Beitrag an den nationalen Verein. Der Beitrag der Leistungserbringer<br />
an den <strong>ANQ</strong> ist in Anhang 4 und Anhang 5 geregelt.<br />
Abs. 2 Die Höhe des zu leistenden Betrags der Leistungserbringer an den <strong>ANQ</strong> legt der Vorstand<br />
des <strong>ANQ</strong> fest. Der festgelegte Betrag gilt mindestens für die Dauer von zwei Jahren.<br />
Abs. 3 Dem Vorstand obliegt es, die Beiträge der Leistungserbringer an den <strong>ANQ</strong> im Detail zu regeln<br />
resp. die Abläufe und Bedingungen für die Leistung des jährlichen Beitrags festzusetzen.<br />
Abs. 4 Der <strong>ANQ</strong> führt eine Projektrechnung für die Messungen. Sofern Überschüsse resultieren,<br />
entscheidet die <strong>ANQ</strong> Mitgliederversammlung über die Verwendung der Mittel.<br />
Abs. 5 Der <strong>ANQ</strong> liefert den übrigen Vertragsparteien für die Jahre 2011/12 einen Rechenschaftsbericht<br />
ab.<br />
Art. 15 Finanzierung der <strong>ANQ</strong>-Struktur<br />
Die Struktur des <strong>ANQ</strong> (Sekretariat, Gremien, Mitgliederverwaltung) wird mit Mitgliederbeiträgen gemäss<br />
Vereinsstatuten (Anhang 8) finanziert. Die Finanzierung der Vereinsstruktur ist nicht Gegenstand des<br />
vorliegenden Vertrags.<br />
VII. Beitritt/Rücktritt zum Vertrag, Kündigung und Anpassung des Vertrages<br />
Art. 16 Beitritt und Rücktritt der Leistungserbringer, Kantone und Krankenversicherer (KVG)<br />
Abs. 1 Leistungserbringer, Versicherer und Kantone treten dem Vertrag durch schriftliche Erklärung<br />
gegenüber dem <strong>ANQ</strong> bei. Der <strong>ANQ</strong> führt Beitrittslisten (Anhänge 1 - 3) und informiert seine<br />
Mitglieder und die Vertragsparteien über die Mutationen.<br />
41
Anhang<br />
Abs. 2<br />
Leistungserbringer, Versicherer und Kantone können unter Berücksichtigung einer sechsmonatigen<br />
Frist jeweils auf das Ende eines Kalenderjahres vom Qualitätsvertrag zurück treten.<br />
Ein Rücktritt vom Qualitätsvertrag kann erstmals per 31.12.2012 erfolgen. Der Rücktritt<br />
ist schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle des <strong>ANQ</strong> zu erklären.<br />
Art. 17 Kündigung des Vertrags<br />
Abs. 1 Die Vertragspartner können unter Berücksichtigung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist<br />
jeweils auf das Ende eines Kalenderjahres den Qualitätsvertrag kündigen. Der Qualitätsvertrag<br />
kann erstmals per 31.12. 2012 gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber<br />
der Geschäftsstelle des <strong>ANQ</strong> zu erklären.<br />
Abs. 2<br />
Kündigt ein Vertragspartner, bedeutet dies die Auflösung des Vertrags auf das Ende der<br />
Kündigungsfrist.<br />
Art. 18 Vertragsanpassung<br />
Abs. 1 Vertragsanpassungen bedürfen der Schriftform.<br />
Abs. 2 Die Anhänge können im Einvernehmen der Parteien geändert werden, ohne dass der Qualitätsvertrag<br />
geändert oder gekündigt wird.<br />
VIII. Schlussbestimmungen<br />
Art. 19 Inkrafttreten und Dauer des Vertrags<br />
Abs. 1 Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Jede Vertragspartei erhält ein unterzeichnetes<br />
Original-Exemplar des Vertrages. Eine Kopie des Vertrages wird dem Bundesamt für<br />
Gesundheit gestützt auf Art.77 Abs. 2 KVV zur Kenntnisnahme zugestellt.<br />
Abs. 2 Für Leistungserbringer, Versicherer und Kantone, die dem Vertrag gemäss Art. 16 Abs. 1 bis<br />
Ende 2011 beitreten, gilt der Vertrag rückwirkend ab Inkrafttreten des Vertrags.<br />
Art. 20 Massgebende Sprache<br />
Der Qualitätsvertrag und seine Anhänge werden auch in französischer und italienischer Übersetzung zur<br />
Verfügung gestellt. Massgebend bei der Vertragsauslegung ist der deutsche Text.<br />
Art. 21 Geltung des Rahmenvertrags von 15. 12.1997<br />
Der „Rahmenvertrag betreffend Qualitätsmanagement“ zwischen H+ und dem Konkordat der Schweizerischen<br />
Krankenversicherer (KSK; heute santésuisse) vom 15. Dezember 1997 wird für diejenigen Parteien<br />
hinfällig, die dem vorliegenden Qualitätsvertrag beigetreten sind.<br />
Art. 22 Anwendbares Recht<br />
Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Der Vertrag ist zivilrechtlicher Natur. Gerichtsstand ist<br />
Bern.<br />
5.4 Datenreglement <strong>ANQ</strong> (Version 1.0)<br />
Präambel<br />
Gestützt auf Art. 18 Abs. 3 der Statuten des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und<br />
Kliniken (<strong>ANQ</strong>) vom 24. November 2009 legt der Vorstand des Vereins nationale Regeln zur Transparenz<br />
und zum Umgang mit Daten im Rahmen seiner Tätigkeiten fest. Er erlässt zu diesem Zweck das vorliegende<br />
Datenreglement. Der Begriff „Spitäler und Kliniken“ umfasst die stationären Leistungserbringer der<br />
Akutsomatik, Psychiatrie und <strong>Rehabilitation</strong> sowie die Geburtshäuser und spezialisierten Einrichtungen<br />
für Palliative Care jedoch keine Pflegeheime.<br />
42
Anhang<br />
Das Datenreglement berücksichtigt die Bestimmungen des Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)<br />
vom 19. Juni 1992 (SR 235.1) und der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG)<br />
vom 14. Juni 1993 (SR 235.11) sowie die Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen<br />
Wissenschaften (SAMW) über die Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Daten über die<br />
medizinische Behandlungsqualität in der Version vom 19. Mai 2009.<br />
Art. 1 Zweck<br />
Das Datenreglement des <strong>ANQ</strong> regelt:<br />
‐ den Umgang mit den im Rahmen des nationalen Qualitätsvertrages erhobenen Daten und deren<br />
Veröffentlichung,<br />
‐ beschreibt die Rechte und Pflichten der im Umgang mit den Daten beteiligten natürlichen und juristischen<br />
Personen,<br />
‐ die Rahmenbedingungen für die Publikation der Daten<br />
Art. 2 Geltungsbereich<br />
Abs.1 Das Datenreglement gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, die an der Erhebung,<br />
Bereinigung, Auswertung, Veröffentlichung und Aufbewahrung von Daten im Rahmen der<br />
durch den <strong>ANQ</strong> durchgeführten Messungen beteiligt sind.<br />
Abs. 2<br />
Der <strong>ANQ</strong> macht das Datenreglement allen in den Messungen involvierten natürlichen und<br />
juristischen Personen bekannt. Er erklärt das Datenreglement zum integrierten Bestandteil<br />
der Verträge zu Erhebungen, Auswertungen und Veröffentlichungen von Daten.<br />
Art. 3 Begriffsdefinitionen<br />
Die folgenden Ausdrücke bedeuten:<br />
a. Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person<br />
beziehen;<br />
b. Spital/Klinikdaten: alle Angaben zu administrativen und organisatorischen Eigenschaften, die sich<br />
auf ein bestimmtes oder bestimmbares Spital bzw. auf eine bestimmte oder bestimmbare Klinik<br />
beziehen (betrifft nicht Patientendaten);<br />
c. Rohdaten: erhobene Daten vor der Bereinigung;<br />
d. bereinigte Daten: Daten, welche auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und entsprechend<br />
bereinigt wurden und die die jeweiligen Anforderungen an die Datenqualität erfüllen, wie sie in<br />
den jeweiligen themenspezifischen separat geführten Messkonzepten festgelegt sind;<br />
e. Pseudonymisierte Personendaten: Daten, bei denen die Identifikationsmerkmale durch ein Pseudonym<br />
(Code) ersetzt wurden. Ohne Kenntnis der Verknüpfung zwischen Pseudonym und Identifikationsmerkmalen<br />
sind keine Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich;<br />
f. Anonymisierte Personendaten: Daten, die keine Informationen oder Codes beinhalten, die Rückschlüsse<br />
auf eine natürliche Person zulassen;<br />
g. Datensammlung: Sammlung von Datensätzen von anonymisierten Personendaten sowie nichtanonymisierten<br />
Spital- und Klinikdaten, die eine bestimmte Messung betreffen;<br />
Art. 4 Datenschutz und Datensicherheit<br />
Abs. 1 Allen natürlichen und juristischen Personen, die an <strong>ANQ</strong>-Messungen beteiligt sind, obliegt in<br />
ihrem Aufgabenbereich die Einhaltung der anwendbaren eidgenössischen und kantonalen<br />
Vorschriften zum Datenschutz.<br />
Abs. 2 Der <strong>ANQ</strong> sorgt für eine datenschutzkonforme Konzeption der Messung und befolgt die Gesetzgebung<br />
über die Forschung am Menschen.<br />
Abs. 3<br />
Alle natürlichen und juristischen Personen, die an der Erhebung, Bereinigung, Auswertung,<br />
Veröffentlichung und Aufbewahrung von Daten beteiligt sind, sind für die Vorkehrung von<br />
43
Anhang<br />
angemessenen organisatorischen und technischen Maßnahmen gegen den Zugriff Unbefugter<br />
auf die Daten verantwortlich.<br />
Art. 5 Datenerhebung und Pseudonymisierung<br />
Abs. 1 Die Spitäler und Kliniken sind verantwortlich für die korrekte und vollständige Erhebung der<br />
Daten sowie für deren fristgerechte Übermittlung. Sie führen die Datenerhebung selbst oder<br />
in Zusammenarbeit mit externen Messorganisationen entsprechend dem vom <strong>ANQ</strong> für die<br />
jeweilige Messung festgelegten Messkonzept durch.<br />
Abs. 2 Die Spitäler und Kliniken pseudonymisieren Personendaten vor der Übermittlung an die<br />
Messorganisation.<br />
Art. 6 Datenbereinigung<br />
Die Messorganisationen prüfen – allenfalls zusammen mit den Kliniken und Spitälern – die pseudonymisierten<br />
Personendaten auf Vollständigkeit, plausibilisieren und bereinigen diese nach dem für die jeweilige<br />
Messung durch den <strong>ANQ</strong> definierten Messkonzept und bilden daraus die bereinigten Daten.<br />
Art. 7 Datenweitergabe an den <strong>ANQ</strong><br />
Die Messorganisationen übermitteln innert der für die jeweilige Messung vertraglich festgelegten Frist die<br />
bereinigten Datensammlungen mit anonymisierten Personendaten sowie Spital- und Klinikdaten der Geschäftsstelle<br />
<strong>ANQ</strong> oder einer von ihr bezeichneten Stelle.<br />
Art. 8 Datenauswertung<br />
Der <strong>ANQ</strong> lässt die Daten klinikindividuell und national vergleichend von einer externen Stelle auswerten.<br />
Die zu den jeweiligen Messungen gehörenden Auswertungs- und Publikationskonzepte müssen vom<br />
Vorstand <strong>ANQ</strong> genehmigt werden. Vorgängig wird eine Vernehmlassung bei den Mitgliedern und Beobachtern<br />
des <strong>ANQ</strong> durchgeführt.<br />
Art. 9 Veröffentlichung von Daten<br />
Abs. 1 Der <strong>ANQ</strong> veröffentlicht national vergleichende Auswertungen mit Messergebnissen und namentlicher<br />
Bezeichnung der Spitäler und Kliniken in den drei Landessprachen. Die Veröffentlichung<br />
erfolgt gemäss dem im Auswertungs- und Publikationskonzept festgelegten Inhalten,<br />
Methoden und Darstellungen für die darin genannten Zielgruppen.<br />
Abs. 2 Die Spitäler und Kliniken erhalten die Publikationsvorlagen vorgängig mit einer angemessenen<br />
Frist zur Stellungnahme. Sie haben die Möglichkeit Kommentare zu ihren Daten abzugeben,<br />
die vom <strong>ANQ</strong> in der Publikation berücksichtigt werden.<br />
Abs. 3 Die Spitäler und Kliniken, die Kantone, der Verband der Krankenversicherer santésuisse, die<br />
Medizinaltarifkommission UVG (MTK) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhalten<br />
die definitive Publikationen des <strong>ANQ</strong> rechtzeitig vor deren Veröffentlichung.<br />
Abs. 4 Die Spitäler und Kliniken dürfen eigene Auswertungen ihrer Daten veröffentlichen. Vergleichende<br />
Darstellungen mit anderen Spitälern oder Kliniken dürfen sie erst nach Veröffentlichung<br />
der Messergebnisse durch den <strong>ANQ</strong> vornehmen.<br />
Art. 10 Aufbewahrung von Daten<br />
Abs. 1 Die Spitäler und Kliniken bewahren ihre Rohdaten aus einer Messung sowie die Pseudonymisierungs-Codes<br />
zum Zweck einer allfälligen Revision mindestens bis zwölf Monate nach<br />
Abschluss der Erhebung auf.<br />
Abs. 2 Der <strong>ANQ</strong> nimmt die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen<br />
vor, um die Daten gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung sowie gegen den Zugriff<br />
unberechtigter Personen zu schützen Der Zugriff auf die Daten ist ausschliesslich für<br />
Mitarbeitende der Geschäftsstelle des <strong>ANQ</strong> möglich und wird protokolliert.<br />
Abs. 3 Kündigt ein Spital oder eine Klinik den nationalen Qualitätsvertrag, so verbleiben die Daten<br />
aus den bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Messungen in der Datensammlung des<br />
44
Anhang<br />
<strong>ANQ</strong> und dürfen in Auswertungen weiterhin genutzt werden, jedoch nur für aggregierte Darstellungen<br />
ohne namentliche Nennung des Spitals oder der Klinik.<br />
Abs. 4 Bei allfälliger Auflösung des <strong>ANQ</strong> bestimmen die Vereinsmitglieder über die Weitergabe<br />
oder Vernichtung der Datensammlungen. Bei einer allfälligen Weitergabe der Datensammlungen<br />
müssen die Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die betrieblichen<br />
Geheimnisse der Leistungserbringer gewährleistet werden.<br />
Art. 11 Weiterverwendung von Daten außerhalb Auswertungs- und Publikationskonzept des<br />
<strong>ANQ</strong><br />
Abs.1 Der Vorstand <strong>ANQ</strong> ist befugt, vollständig anonymisierte Daten, die weder Rückschlüsse auf<br />
natürliche Personen-, noch auf ein Spital oder eine Klinik zulassen, zu Forschungszwecken<br />
an Organisationen weiterzugeben. Die Bedingungen an die Auswertung und Publikation sind<br />
jeweils vertraglich zu vereinbaren.<br />
Abs. 2 Ein Kanton ist befugt, diejenige kantonsspezifische Auswertung der Daten einer Messung zu<br />
erhalten und zu veröffentlichen, die sein Territorium betreffen. Für Auswertungen, die über<br />
den im Auswertungs- und Publikationskonzept festgelegten Rahmen hinausgehen, haben<br />
die Kantone die Zustimmung der betroffenen Spitäler und Kliniken einzuholen.<br />
Abs. 3 Mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Spitäler oder Kliniken darf der <strong>ANQ</strong> auch Datensammlungen<br />
an Dritte weiter geben, die Rückschlüsse auf Spitäler oder Kliniken zulassen.<br />
Abs. 4 Messorganisationen, die auch Forschung betreiben, dürfen anonymisierte Daten für eigene<br />
Auswertungen und Publikationen verwenden, soweit keine Daten veröffentlicht werden, die<br />
Rückschlüsse auf einzelne Spitäler oder Kliniken erlauben. Die Bedingungen zu Auswertung<br />
und Publikation sind mit dem <strong>ANQ</strong> vertraglich zu vereinbaren.<br />
Art. 12 Qualitätssicherung<br />
Der Vorstand <strong>ANQ</strong> kann Überprüfungen der Qualität der Datenerfassung und -bereinigung veranlassen.<br />
Er bestimmt die Form und Inhalte der Überprüfung sowie die Berichterstattung und bezeichnet eine dafür<br />
qualifizierte Organisation. Der von ihm bezeichneten Organisation ist von den Spitälern und Kliniken sowie<br />
Messorganisationen Einsicht in die Daten und Erhebungs- sowie Bearbeitungsprozesse zu gewähren.<br />
Dabei ist sie zur Geheimhaltung und Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.<br />
Art. 13 Beschlussfassung und Änderung des Reglements<br />
Abs.1 Änderungen des Datenreglements des <strong>ANQ</strong> können jeweils nur auf Beginn der nächsten<br />
Messperiode durch den Vorstand des <strong>ANQ</strong> vorgenommen werden.<br />
Abs. 2 Die Vereinsmitglieder erhalten die Möglichkeit zu allen Reglementsänderungen im Rahmen<br />
einer Vernehmlassung Stellung zu nehmen.<br />
Abs. 3 Laufende Messungen werden jeweils unter dem bei Vertragsabschluss geltendem Datenreglement<br />
zu Ende geführt.<br />
Art. 14 Inkrafttreten<br />
Dieses Datenreglement wurde vom Vorstand <strong>ANQ</strong> am 21.09.2011 genehmigt. Es tritt per sofort in Kraft.<br />
Bern, 05-10-2011<br />
5.5 Anforderungen an die Auswertungskonzepte des <strong>ANQ</strong><br />
Zu jedem Messthema werden in Zusammenarbeit mit dem <strong>ANQ</strong> vom zuständigen Messinstitut ein Messkonzept,<br />
ein Auswertungskonzept sowie ein Publikationskonzept erstellt.<br />
Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die Anforderungen, welche ein messspezifisches Auswertungskonzept<br />
erfüllen soll.<br />
45
Anhang<br />
Die Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 37 dienen<br />
als Grundlage bei der Erstellung der Auswertungskonzepte.<br />
Die Spitäler werden in die Vernehmlassung der Auswertungskonzepte einbezogen. Sie bewerten insbesondere<br />
die Anwenderfreundlichkeit, die Verständlichkeit und den Nutzen der Konzepte.<br />
Der QA Akut nimmt zum Konzept Stellung und gibt dem Messinstitut entsprechende Rückmeldung. Anschliessend<br />
wird das Konzept durch den Vorstand des <strong>ANQ</strong> verabschiedet.<br />
Zielsetzungen der Konzepte<br />
Der Prozess der Datenerhebung, -übermittlung, -aufbereitung und -analyse ist nachvollziehbar dargestellt.<br />
Es ist dargestellt, wie der Datenschutz gewährleistet wird.<br />
Die Darstellung der berechneten Indikatoren sowie die Risikoadjustierung sind verständlich erklärt.<br />
Die Resultate der Messungen können im Kontext der Spitäler interpretiert und für die Qualitätsentwicklung<br />
nutzbar gemacht werden.<br />
Das Konzept beschreibt die Auswertung für die folgenden Ebenen:<br />
‐ Darstellung der spitalspezifischen Resultate<br />
‐ die vergleichende Darstellung (einzelne Spitäler, Spitalgruppen oder Regionen)<br />
‐ die national vergleichende Darstellung für die Veröffentlichung<br />
‐ Die Auswahl der zur Veröffentlichung geeigneten Indikatoren ist getroffen und begründet.<br />
‐ Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Bandbreiten oder Referenzwerte bestimmt werden.<br />
Adressaten<br />
Das Auswertungskonzept richtet sich an:<br />
‐ die in die <strong>ANQ</strong>-Messungen involvierten Personen aus den Spitälern und Kliniken<br />
‐ die Partner des <strong>ANQ</strong>.<br />
Bei der Formulierung und Gestaltung der Konzepte ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Adressaten<br />
in den jeweiligen Messthemen nicht Fachexperten sind.<br />
Inhaltliche Anforderungen an die Konzepte<br />
Der Inhalt und Ablauf der Datenerhebung wird in den wesentlichen Punkten beschrieben. Es ist ersichtlich,<br />
welche Bestrebungen zur Erreichung einer guten Datenqualität unternommen werden.<br />
Die Datenübermittlung, z.B. Datentransfer des Spitals zum Auswertungsinstitut oder Übermittlung der<br />
Resultate vom Auswertungsinstitut an die Geschäftsstelle <strong>ANQ</strong>, ist nachvollziehbar beschrieben.<br />
37<br />
Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Daten über die medizinische Behandlungsqualität. Version<br />
19.5.2009 http://www.samw.ch/de/Publikationen/Empfehlungen.html<br />
46
Anhang<br />
Darstellung der spitalspezifischen Resultate<br />
Die Darstellung der spitalspezifischen Resultate (Tabellen, Grafiken) ist beschrieben und es ist ersichtlich,<br />
in welcher Form die Resultate den Spitälern zugestellt werden. Grafiktypen und deren Interpretation<br />
sind beschrieben.<br />
Die Risikoadjustierung ist in den wesentlichen Zügen beschrieben. Es ist ersichtlich, welche Variablen zur<br />
Adjustierung verwendet und welche statistischen Analysen und Modelle gewählt wurden. Zudem finden<br />
sich Hinweise zur Interpretation.<br />
Die Spitäler haben die Möglichkeit die Resultate zu kommentieren.<br />
Um die Spitäler in ihrer Qualitätsarbeit zu unterstützen, sind Ausführungen zur Interpretation der Resultate<br />
sowie Hinweise wie mögliches Verbesserungspotential identifiziert werden kann, aufgeführt. Unter der<br />
Voraussetzung, dass Einzelfallanalysen möglich sind, werden spezifische Kriterien aufgeführt, wie Einzelfälle<br />
analysiert werden können.<br />
Vergleichende Darstellung der Gesamtresultate<br />
Neben der spitalspezifischen Darstellung ist auch die vergleichende Darstellung (Tabellen, Grafiken)<br />
beschrieben. Ob Spitäler einzeln oder in Gruppen vergleichend dargestellt werden sollen, wird begründet.<br />
Je nach Messthema und Stichprobengrösse der Spitäler soll begründet werden, warum sich welche Darstellung<br />
empfiehlt.<br />
Weiter wird aufgezeigt, welche Indikatoren sich für einen Spitalvergleich eignen und welche Grössen<br />
(Mittelwerte, Perzentile, Vertrauensintervall, Standardabweichung, etc.) sich dazu eignen.<br />
Die Spitäler haben die Möglichkeit die vergleichenden Resultate zu kommentieren. Diese Kommentare<br />
werden bei einer Veröffentlichung transparent gemacht.<br />
National vergleichende Darstellung der Resultate zur Veröffentlichung<br />
Die Veröffentlichung der Resultate ist ein sehr sensibler Bereich. Mögliche Risiken von Fehlinterpretationen<br />
oder falschen Rückschlüssen sollen vermieden oder möglichst minimiert werden. Sind diesbezüglich<br />
spezifische Risiken vorhanden, werden diese differenziert aufgeführt. Die Auswahl der zur Veröffentlichung<br />
geeigneten Indikatoren ist begründet. Werden in einer Messung mehre Indikatoren erhoben, jedoch<br />
auf deren Veröffentlichung verzichtet, sollen die Gründe für den Verzicht beschrieben sein. Für die<br />
Veröffentlichung ist der vergleichende Aspekt von Bedeutung. Der dargestellte Vergleich ist je für die<br />
beiden Zielgruppen Partner des <strong>ANQ</strong> und die breite Öffentlichkeit verständlich und nachvollziehbar erklärt,<br />
Hinweise zur Interpretation sind aufgeführt.<br />
Das Festlegen von Bandbreiten oder Referenzwerten mit dem Ziel, Spitäler ausserhalb dieses Spektrums<br />
transparent zu machen, wird allgemein kontrovers diskutiert. Im Auswertungskonzept wird aus der Sicht<br />
der Fachexperten Stellung zu diesem Thema genommen und es werden Möglichkeiten aufgeführt, wie<br />
solche Werte bestimmt werden könnten.<br />
Die Verfahren, welche zur Sicherstellung des Datenschutzes gemäss Datenreglement des <strong>ANQ</strong>38 angewendet<br />
wurden, sind beschrieben.<br />
Strukturelle Anforderungen<br />
Die Auswertungskonzepte werden nach dem nachfolgenden Raster strukturiert:<br />
‐ Ausgangslage<br />
38 Das Datenreglement wurde im Jahr 2011 neu überarbeitet.<br />
47
Anhang<br />
‐ Beschreibung der Datenerhebung, -übermittlung, -aufbereitung und -analyse<br />
‐ Darstellung der spitalspezifischen Resultate<br />
‐ Vergleichende Darstellung der Gesamtresultate<br />
‐ Veröffentlichung der Resultate<br />
‐ die Logos des <strong>ANQ</strong>, Messinstitut und/oder Auswertungsinstituts sind aufgeführt<br />
‐ der Umfang beträgt max. 10 Seiten DIN A4<br />
‐ die Auswertungskonzepte des <strong>ANQ</strong> haben ein identisches Layout (wird wenn nötig durch die Geschäftsstelle<br />
erledigt).<br />
5.6 Pilotprojekt<br />
Am Pilotprojekt haben im Modul „muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>“ und „neurologische <strong>Rehabilitation</strong>“ 13<br />
bzw. 12 Kliniken teilgenommen (Tabelle 7).<br />
Tabelle 7: Teilnehmende Kliniken<br />
Teilnehmende Kliniken<br />
nach Kantonen<br />
Klinik<br />
Modul<br />
Muskuloskelettale<br />
Reha<br />
Modul<br />
Neurolog.<br />
Reha<br />
Aargau Reha Rheinfelden X<br />
Reha Zurzach X<br />
aarReha Schinznach X<br />
Rehaklinik Bellikon X<br />
Appenzell AR Rheinburg-Klinik Walzenhausen X X<br />
Basel Stadt Rehab Basel X X<br />
Bethesda-Spital X<br />
Bern Berner Klinik Montana X X<br />
Graubünden Zürcher Höhenklinik<br />
Reha Zentrum Heiligenschwendi X<br />
Bethesda Tschugg X<br />
Davos<br />
Luzern Kantonsspital Luzern X<br />
St. Gallen Klinik Valens X X<br />
Tessin Clinica Hildebrand X X<br />
Waadt Hôpital de Nestlé (CHUV) X<br />
Wallis Rehazentrum Leukerbad X<br />
Zug Klinik Adelheid X X<br />
Zürich Zürcher Höhenklinik Wald X X<br />
X<br />
48
Anhang<br />
5.6.1 Modul „Muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>“<br />
Aufgrund der Tatsache, dass das Fachgremium „Scientific Committee der SW!SS-Reha“ für die Konzipierung<br />
eines Pilotprojektes in der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet<br />
hatte und diese vertraglich von den Krankenversicherern im Kanton Aar-gau und Solothurn anerkannt<br />
waren, wurde für diesen Bereich deren Grundkonzeption für die Umsetzung und Auswertung für 13 grosse<br />
und renommierte Kliniken übernommen: Ins Konzept des Pilotprojektes wurde die Messung der Funktionsfähigkeit<br />
der physischen, psychischen und sozialen Gesundheit für zwei Körperregionen – Lendenwirbelsäule<br />
(LWS) und untere Extremität (UEX) – unabhängig von der Diagnose aufgenommen. Das<br />
Messkonzept beruht auf der Annahme, dass die <strong>Rehabilitation</strong> zur Verbesserung und Erhaltung der<br />
Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf einen wesentlichen Beitrag liefert und dieser <strong>Rehabilitation</strong>serfolg<br />
nachgewiesen werden soll.<br />
Für Patienten mit einer Symptomatik an der Lendenwirbelsäule wurde der NASS und für Patienten mit<br />
einer Symptomatik an den unteren Extremitäten der WOMAC als indikationsspezifischer Patientenfragebogen<br />
eingesetzt. In Ergänzung der indikationsspezifischen Patientenbefragungen wurde der Fragebogen<br />
zur allgemeinen Gesundheit (SF-36) eingesetzt. Die Patientenbefragungen wurden als adäquat erachtet,<br />
da der Patient Experte ist in der Beurteilung seiner Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf. Ausserdem<br />
wird das medizinische Fachpersonal entlastet und die Selbstbeurteilung garantiert eine vom Leistungserbringer<br />
unabhängige Sicht.<br />
Die Abbildung des Case-Mix erfolgte über die Variablen Alter, Geschlecht, Komorbidität und Funktionseinschränkungen<br />
bei Eintritt. Die Daten wurden von allen Kliniken online im Assessment-System der<br />
Firma RehabNET eingegeben oder die Fragebogen konnten eingescannt werden. Damit eine möglichst<br />
fehlerfreie Eingabe der Daten erreicht werden konnte, wurden den Kliniken Schulungen angeboten, Eingaberichtlinien<br />
abgegeben sowie auf der Homepage die wichtigsten „FAQ“ aufgeschaltet.<br />
Ausgewertet wurden der Unterschied zwischen Ein- und Austritt, wobei der Durchschnitt über alle Items<br />
gebildet wurde. Die damit verbundene Nivellierung der Scores hin zu Mitte erschwerte qualitative Aussagen.<br />
Validität und Reliabilität der verwendeten Patientenfragebogen waren nur für spezifische Patientengruppen<br />
bekannt. Ob sie bei anderen Patientengruppen genauso aussagekräftig waren, war fraglich.<br />
Der Ansatz im Modul muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong> fokussiert klar auf der Ergebnisqualität und es<br />
waren somit nur schwer Rückschlüsse auf allfällige Massnahmen zur Verbesserung der Prozesse möglich.<br />
Damit die Kliniken auf der Ebene des Einzelpatienten zur Steuerung der Versorgung dennoch Hinweise<br />
erhalten könnten, hätten die Kliniken die Möglichkeit gehabt, die Ergebnisse der Patientenbefragung<br />
bei Eintritt als Sofortfeedback für die Gestaltung des klinikinternen Behandlungsprozesses zu nutzen.<br />
Diese Möglichkeit wurde im klinischen Alltag jedoch kaum genutzt (Zeitmangel, Aufwand für Datenanalyse,<br />
fehlende Erfahrung mit Auswertungen).<br />
Obwohl im Pilotprojekt meist statistisch signifikante Verbesserungen nachgewiesen, der sehr unterschiedliche<br />
Case-Mix der teilnehmenden Kliniken mit dem Alter, der Komorbidität und den Funktionseinschränkungen<br />
bei Eintritt gut beschrieben sowie kulturelle Unterschiede aufgezeigt werden konnten, wurde<br />
das Konzept für die Weiterentwicklung hin zur flächendeckenden Einführung nicht weiterverfolgt.<br />
5.6.2 Modul „Neurologische <strong>Rehabilitation</strong>“<br />
Patienten mit Bedarf an neurologischer <strong>Rehabilitation</strong> weisen meist multifaktorielle Krankheits-bilder auf.<br />
Es gibt kaum geeignete und breit anwendbare Assessment-Instrumente. Für das Pilotprojekt <strong>Rehabilitation</strong><br />
Modul „neurologische <strong>Rehabilitation</strong>“ wurde die ICF-basierte Dokumentation der Ziele und Messung<br />
des Zielerreichungsgrades gewählt. Damit können die Ergebnisse der therapeutischen / medizinischen<br />
Leistung während des stationären Aufenthaltes (Ziele der Versorgung) beurteilt werden, unabhängig von<br />
der Diagnose und der spezifischen Patientengruppe. Die Ziele der Behandlung werden individuell unter<br />
Einbezug des Patienten (allenfalls auch Angehörige) gesetzt und die Ressourcen / Behinderungen des<br />
Patienten sowie alle relevanten Kontextfaktoren berücksichtigt. Wenn bei der Zielsetzung alle die den<br />
Patienten beeinflussenden relevanten Faktoren berücksichtigt, gibt es keinen Grund, dass die Zielerreichungsgrade<br />
von diesen Faktoren abhängt. Das Ausmass der Zielerreichung ist ein Indikator für die Behandlungsqualität.<br />
Ein weiterer Vorteil des ICF-Ansatzes ist, dass es nur wenige Leitlinien zur Durchfüh-<br />
49
Anhang<br />
rung des Zielsetzungsprozesses braucht (minimaler Standard) und die Kliniken vergleichsweise frei in der<br />
Gestaltung ihrer Behandlungsprozesse sind.<br />
Der Prozess der Zielfestlegung und die Messung der Zielerreichung haben einen zentralen Stellenwert im<br />
gewählten Qualitätskonzept. Das Festlegen von adäquaten Zielen und eine möglichst objektive Beurteilung<br />
der Zielerreichung sind Voraussetzung, um den Zielerreichungsgrad als Qualitätsindikator zu betrachten.<br />
Im Rahmen des Pilotprojektes wurden deshalb Workshops mit Gruppen von ähnlichen Kliniken<br />
veranstaltet, in denen die Analyse der Zielerreichungsgrade den Ausgangspunkt bildete, um über die<br />
Zielsetzungs- und Behandlungsprozesse zu diskutieren sowie Verbesserungspotentiale gemeinsam zu<br />
erörtern. Dabei wurde erkannt, dass eine minimale Standardisierung der Behandlungsprozesse notwendig<br />
ist. Ausserdem zeigte sich der grosse Nutzen des ICF-Ansatzes für den klinischen Alltag39 und es<br />
wurden Weiterbildungen zur ICF-Philosophie angeregt. Die begleitende regelmässige Diskussion der<br />
zugrundeliegenden Zielsetzungsprozesse und Interventionen im Rahmen von Workshops werden als<br />
zwingende Rahmenbedingung des gewählten Qualitätskonzeptes betrachtet und sind bei einer flächendeckenden<br />
Einführung entsprechend zu beachten.<br />
Im Rahmen der Konzipierung des Projektes einigte man sich auf drei Ziele: Wohnen, Arbeit und soziokulturelles<br />
Leben. Jedes Ziel lässt sich mit ICF-basierten und standardisierten Hauptziel- und Unterzielkategorien<br />
beschreiben. Das Hauptziel Wohnen umfasst sechs Hauptzielkategorien, das Hauptziel Arbeit<br />
deren fünf und das Hauptziel soziokulturelles Leben deren zwei. Für jede gewählte Hauptzielkategorie<br />
konnten bis zu sechs Unterziele dokumentiert werden, die wiederum in Unterzielkategorien unterteilt waren.<br />
Das Erreichen der Unterziele (zu denen auch die Funktionsfähigkeit gehört) wird als Voraussetzung<br />
zur Erreichung des Hauptzieles erachtet.<br />
Pro Patient mit Diagnose „Neurorehabilitation“ wurden zu Beginn der <strong>Rehabilitation</strong> mindestens eine<br />
Hauptzielkategorie und die dazugehörigen Unterziele festgelegt. Dazu erfassten die Kliniken bei Austritt<br />
die Zielerreichung bezogen auf das gewählte Hauptziel und auf die dazugehörigen Unterziele.<br />
Mit Blick auf die Auswertung erfolgte die Erhebung weiterer Variablen wie Geschlecht, Indikationsgruppe,<br />
Diagnose, Gesundheitsprobleme und Wohnsituation. Darüber hinaus wurden fünf den <strong>Rehabilitation</strong>sprozess<br />
beeinflussende und leicht messbare Variablen erhoben, mit denen der Case-Mix abgebildet bzw.<br />
eine Risikoadjustierung erfolgen könnte: Alter, Komorbidität, Selbstständigkeit bei Eintritt (mit FIM oder<br />
EBI motorische Subskala), Selbstständigkeit bei Eintritt (FIM oder EBI kognitive Subskala) und die Kontextfaktoren.<br />
Alle Kliniken erfassten die Daten online im Assessment-System der Firma RehabNET. Schulungen, Eingaberichtlinien<br />
sowie die Aufschaltung von „FAQ“ stellten eine möglichst fehlerfreie Eingabe der Daten<br />
durch die Kliniken sicher.<br />
Die Analyse der Zielerreichung zeigte, dass die Zielerreichung dort hoch ist, wo bei Austritt eine konkrete<br />
Lösung vorliegen muss (Zielkategorie Wohnen). Wo das konkrete Ziel bei Austritt noch nicht erreicht<br />
werden musste (Arbeit), fiel der Zielerreichung vergleichsweise tief aus. Beim Hauptziel soziokulturelles<br />
Leben zeichneten sich die Zielerreichungsgrade durch eine grosse Heterogenität aus.<br />
5.7 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
5.7.1 Ankündigungsschreiben<br />
Das Ankündigungsschreiben wird auf dem Briefpapier des <strong>ANQ</strong> präsentiert. Die Aushändigung an die<br />
Patientin bzw. den Patienten erfolgt noch während des Aufenthaltes durch die <strong>Rehabilitation</strong>sklinik.<br />
39 Über die Analyse der Zielerreichung können die Kliniken lernen, Patientencharakteristika und Kontextfaktoren<br />
besser zu gewichten, um reelle Ziele zu setzen, welche im stationären Aufenthalt erreichbar sind.<br />
50
Anhang<br />
Bern, Monat 2012<br />
Ankündigung Nationale Patientenzufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient<br />
Im Auftrag des nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in den Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>) führen<br />
alle Schweizer <strong>Rehabilitation</strong>skliniken eine Befragung zur Patientenzufriedenheit durch. Alle Patientinnen<br />
und Patienten, welche eine <strong>Rehabilitation</strong>sklinik im Monat 1 und Monat 2 2012 verlassen, sind eingeladen,<br />
an der Befragung teilzunehmen. Die Meinung der Patienten dient als Grundlage zur Verbesserung<br />
der Qualität der Behandlung und Betreuung.<br />
Den kurzen Fragebogen erhalten Sie voraussichtlich in ca. zwei bis vier Wochen von Ihrer <strong>Rehabilitation</strong>sklinik.<br />
Ihre Meinung ist wichtig! Nur durch eine hohe Beteiligung der Patientinnen und Patienten ist<br />
gewährleistet, dass sich Ihre Klinik und der <strong>ANQ</strong> ein richtiges Bild machen können über die Qualität der<br />
Behandlung und Betreuung.<br />
Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig und beansprucht ca. 5 bis 10 Minuten. Ihre Antworten werden<br />
vertraulich behandelt. Die Ergebnisse sind anonym und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne<br />
Personen zu.<br />
Möchten Sie die Befragung lieber auf elektronischem Weg durchführen? Wenn ja, so geben Sie bitte Ihre<br />
E Mailadresse beim Empfang ab. So können wir Ihnen den Fragebogen elektronisch zustellen.<br />
Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für die Beantwortung der Fragen nehmen. Wir wünschen Ihnen alles<br />
Gute für Ihre Gesundheit und freuen uns auf Ihre Antworten.<br />
Freundliche Grüsse<br />
Thomas Straubhaar, Präsident <strong>ANQ</strong><br />
5.7.2 Begleitschreiben<br />
Das Begleitschreiben wird vom zentralen Messinstitut verfasst und auf dem Briefpapier der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />
präsentiert. Der Versand des Begleitschreibens, des <strong>ANQ</strong>-Fragebogens und eines allfälligen<br />
zusätzlichen Patientenzufriedenheits-Fragebogens erfolgt durch das dezentrale Befragungsinstitut nach<br />
den Vorgaben des zentralen Befragungsinstituts.<br />
5.7.3 Fragebogen<br />
Neben den 5 Fragen sind zusätzliche Variablen zu erheben, wie Geburtsjahr, Geschlecht, Versicherungsstatus,<br />
Klinik- und Fallnummer. Der Fragebogen umfasst auch eine Anleitung / ein Lesebeispiel<br />
zum Beantworten der Fragen.<br />
1) Würden Sie für dieselbe Behandlung wieder in diese <strong>Rehabilitation</strong>sklinik kommen?<br />
[11-stufig: auf keinen Fall/auf jeden Fall]<br />
2) Wie beurteilen Sie die Qualität der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung, die Sie erhalten haben?<br />
[11-stufig: sehr schlecht/ausgezeichnet]<br />
3) Wenn Sie Fragen an Ihre Ärztin oder ihren Arzt stellten, bekamen Sie verständliche Antworten?<br />
[11-stufig: nie/immer; ich habe keine Fragen gestellt]<br />
4) Wie fanden Sie die Betreuung durch das therapeutische Personal, durch das Pflegepersonal und den<br />
Sozialdienst während Ihres Aufenthaltes?<br />
[11-stufig: sehr schlecht/ausgezeichnet]<br />
5) Wurden Sie während Ihres <strong>Rehabilitation</strong>saufenthaltes mit Respekt und Würde behandelt?<br />
[11-stufig: nie / immer]<br />
51
Anhang<br />
5.8 Modul 2: Messinstrumente<br />
5.8.1 Zieldokumentation und Zielerreichung<br />
Die Zieldokumentation bildet die wichtigsten Inhalte eines rehabilitativen Leistungsauftrages ab. Sie führt<br />
im <strong>Rehabilitation</strong>s-Team zu einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamen Zielorientierung. Die Ziele<br />
beziehen sich auf die Dauer des stationären Aufenthaltes.<br />
Die klinikinternen Prozesse sollen gewährleisten, dass die <strong>Rehabilitation</strong>sziele adäquat gewählt worden<br />
sind, das heisst:<br />
‐ die Ziele werden so gewählt, dass sie während des stationären Aufenthaltes erreicht werden<br />
können<br />
‐ die Ziele berücksichtigen alle Ressourcen, Kontextfaktoren und das <strong>Rehabilitation</strong>spotential des<br />
Patienten<br />
‐ der Einbezug des Patienten im Zielsetzungsprozess ist klinikintern festgelegt und dokumentiert<br />
‐ die Ziele berücksichtigen die zeitlichen und finanziellen Ressourcen während des stationären<br />
Aufenthalts<br />
‐ der Zielsetzungsprozess wird nachvollziehbar in der Patientenakte dokumentiert<br />
Bei der Zielbeurteilung soll die Leistungsfähigkeit (Capacity) des Patienten beurteilt werden. Die klinikinternen<br />
Prozesse sollen sicherstellen, dass die Beurteilung der Ziele möglichst objektiv erfolgt. Das heisst,<br />
dass<br />
‐ die Anforderungen zur Zielerreichung (Unterziele) klinikintern festgelegt und dokumentiert werden<br />
‐ der Einbezug des Patienten im entsprechenden Beurteilungsprozess klinikintern festgelegt und<br />
dokumentiert ist<br />
5.8.1.1 Dokumentation der Hauptziele (inkl. Zielerreichung)<br />
Festlegung des Hauptziels der Behandlung zu Beginn des Klinikaufenthalts sowie Erfassung des Zielerreichungsgrads<br />
am Ende des Aufenthalts.<br />
Als Hauptziele sind möglich: Wohnen, Arbeit und Soziokulturelles Leben jeweils auf einer mehrstufigen<br />
Antwortskala:<br />
Hauptziel Wohnen mit einer 6-stufigen Antwortskala (Hauptzielkategorien a. bis f.):<br />
a) Integration in eine Pflegeinstitution<br />
b) Betreutes Wohnen in Institution<br />
c) Wohnen zuhause mit Unterstützung durch im gleichen Haushalt lebende Bezugspersonen (mit<br />
oder ohne externe Unterstützung)<br />
d) Selbstständiges Wohnen mit externer Unterstützung<br />
e) Selbstständiges Wohnen<br />
f) Selbstständiges Wohnen mit zusätzlichen Aufgaben<br />
Arbeit mit einer 5-stufigen Antwortskala (Hauptzielkategorien a. bis e.):<br />
a) Beschäftigung/Nischenarbeit in geschütztem Rahmen<br />
b) Berufliche Umorientierung<br />
c) Berufliche Umschulung<br />
d) Teilzeitarbeit in der ursprünglichen oder zuletzt ausgeübten Tätigkeit (inkl. Schule)<br />
e) Vollzeitarbeit in der ursprünglichen oder zuletzt ausgeübten Tätigkeit (inkl. Schule)<br />
52
Anhang<br />
Soziokulturelles Leben mit einer 2-stufigen Antwortskala Hauptzielkategorien (a. und b.):<br />
a) Unterstützte Teilnahme am öffentlichen Leben<br />
b) Selbstständige Teilnahme am öffentlichen Leben<br />
Beurteilung der Zielerreichung gegen Ende des Aufenthalts auf einer zwei-stufigen Antwortskala<br />
(0=erreicht; 1= nicht erreicht).<br />
?? Ergänzend sollen die Kontextfaktoren gemäss ICF-Ansatz („Produkte und Technologie“, Natürliche<br />
und vom Menschen veränderte Umwelt“, „Unterstützung und Beziehungen“, „Einstellungen“, etc.) auf<br />
einer drei-stufigen Antwortskala (-1=hemmend; 0=neutral; 1=fördernd) erfasst werden. ??<br />
5.8.1.2 Score-Berechnung<br />
-<br />
5.8.1.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten.<br />
5.8.1.4 Weitere Informationen<br />
Quelle: Tipp von Rentsch.<br />
5.8.2 Functional Independence Measure (FIM)<br />
5.8.2.1 Fragebogen<br />
Bewerten Sie untenstehende Aktivitäten. (Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Antwort an!)<br />
Punkte 7 6 5 4 3 2 1<br />
Selbstpflege<br />
1. Essen/Trinken<br />
2. Körperpflege<br />
3. Baden/Duschen/ Waschen<br />
4. Ankleiden oben<br />
5. Ankleiden unten<br />
Inkontinenz<br />
7. Blasenkontrolle<br />
8. Darmkontrolle<br />
Mobilität / Transfer<br />
Völlige<br />
Selbständigkeit<br />
Eingeschränkte<br />
Selbständigkeit<br />
Supervision<br />
oder Vorbereitung<br />
Kontakthilfe<br />
Mässige<br />
Hilfestellung<br />
Ausgeprägte<br />
Hilfestellung<br />
Totale<br />
53<br />
Hilfestellung
Anhang<br />
9. Bett/Stuhl/Rollstuhl<br />
10. Toilettensitz<br />
11. Dusche/Badewanne<br />
Fortbewegung<br />
12. Gehen/Rollstuhl<br />
13. Treppensteigen<br />
Kommunikation<br />
14. Verstehen<br />
15. Ausdruck (sich verständlich machen)<br />
Soziales<br />
16. Soziales Verhalten<br />
17. Problemlösung<br />
18. Gedächtnis<br />
Quelle: Schädler (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 1: Neurologie.<br />
5.8.2.2 Score Berechnung<br />
Der FIM liefert einen Wert zwischen 18 und 126. Wenn eine mehrmalige Messung erfolgt - z.B. bei Eintritt<br />
und bei Austritt - kann die Veränderung in FIM-Punkten berechnet werden. Denkbar ist auch die Berechnung<br />
von Mittelwerten über Variablengruppen.<br />
5.8.2.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten.<br />
5.8.2.4 Weitere Informationen<br />
Quelle: Schädler (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 1: Neurologie.<br />
5.8.3 Erweiterter Barthel-Index (EBI)<br />
5.8.3.1 Fragebogen<br />
1. Essen und Trinken<br />
0 Nicht möglich. Oder: Ernährung über Magensonde (PEG oder Nasensonde), die nicht selbständig<br />
bedient werden kann.<br />
2 Essen muss vorbereitet werden (z.B. Zurechtschneiden von Fleisch und Gemüse).<br />
3 Essen (ohne Vorbereitung) mit Hilfsmitteln alleine möglich, z.B. Frühstücksbrett, verdickte<br />
Griffe etc. Oder: Magensonde kann selbständig bedient werden.<br />
4 Selbständig.<br />
2. Persönliche Pflege (Gesicht waschen, Kämmen, Rasieren, Zähneputzen)<br />
0 Nicht möglich.<br />
54
Anhang<br />
1 Unterstützung durch eine Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig.<br />
2 Mit geringer Unterstützung möglich (z.B. Aufschrauben der Zahnpastatube). Oder: Keine<br />
direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen Abläufen nötig.<br />
3 Persönliche Pflege mit Hilfsmitteln alleine möglich, z.B. Verlängerungsgriff für Kamm,<br />
Waschlappen, Bürste.<br />
4 Selbständig (in allen oben genannten Bereichen; als selbständig werden auch solche Patienten<br />
eingestuft, die z.B. ihr Haar nicht stilgerecht flechten können.<br />
3. An-/Ausziehen (einschl. Schuhe binden, Knöpfe schliessen)<br />
0 Nicht möglich.<br />
1 Unterstützung beim An- oder Ausziehen der meisten, aber nicht aller Kleidungsstücke nötig.<br />
Oder: zeigt effektive Mitarbeit, obwohl eine Unterstützung beim An- und Ausziehen aller<br />
Kleiderstücke nötig ist.<br />
2 Unterstützung nur bei wenigen Prozeduren (z.B. Hilfe beim Schuhe binden, beim Knöpfe<br />
auf- oder zumachen, beim Anziehen von elastischen Strümpfen oder Hilfsmitteln wie z.B.<br />
Schienen). Oder: Keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision<br />
bei einige Abläufen nötig.<br />
4 Selbständig (erlaubt sind z.B. auch Strumpfanzieher).<br />
4. Baden / Duschen / Körper waschen<br />
0 Nicht möglich.<br />
1 Unterstützung durch eine Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig (z.B. Unterstützung<br />
bei erforderlichen Transfers oder beim Abtrocknen nötig; kann sich oben herum<br />
waschen, benötigt jedoch Hilfe beim Waschen der unteren Körperpartie).<br />
2 Mit geringer Unterstützung möglich (z.B. Aufschrauben der Bade-Utensilien). Oder: Keine<br />
direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen Abläufen nötig.<br />
3 Hilfsmittel nötig (wie z.B. Lift, Bade- oder Duschsitz), die jedoch selbständig bedient werden<br />
können.<br />
4 Selbständig.<br />
5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt<br />
0 Nicht möglich.<br />
1 Unterstützung einer Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig.<br />
2 Keine direkte Unterstützung, aber Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einige Abläufen<br />
nötig (z.B. Muss erinnert werden, die Bremse festzustellen).<br />
4 Selbständig.<br />
6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund<br />
0 Nicht möglich (weder Gehen noch Fortbewegung mit Rollstuhl).<br />
1 Benötigt Rollstuhl oder Gehwagen, den er aber weitgehend selbständig bedienen kann (d.h.:<br />
bewältigt längere Strecken, stösst nicht an Hindernisse, kann Kurven fahren, wenden etc.<br />
und benötigt allenfalls in seltenen Fällen geringe Unterstützung). Oder Patient kann kürzere<br />
Strecken (kleiner 50 m) gehen, aber nur mit einer Hilfsperson oder mit Geländer.<br />
2 Kann selbständig kürzere Strecken (kleiner 50 m) ohne Hilfsperson oder Geländer gehen,<br />
benötigt jedoch für längere Strecken (grösser 50 m) einen Rollstuhl oder Gehwagen oder<br />
Supervision.<br />
55
Anhang<br />
3 Kann selbständig längere Strecken (grösser 50 m) ohne Gehwagen oder Geländer gehen,<br />
benötigt aber Stock, Krücke, Schienen oder ähnliches.<br />
4 Selbständiges Gehen auch über längere Strecken ohne jegliche Hilfe oder Hilfsmittel möglich.<br />
7. Treppen auf- / absteigen<br />
0 Nicht möglich.<br />
1 Möglich, aber nur mit erheblicher Unterstützung durch eine Person (z.B. Hilfe beim Hochheben<br />
eines Beines).<br />
2 Möglich, aber geringe Unterstützung oder Supervision durch eine Person.<br />
4 Selbständig möglich (zugelassen sind Festhalten am Geländer, Benutzen von Stock, Krücke<br />
oder ähnlichem).<br />
8. Benutzung der Toilette (Transfer, An- / Auskleiden, Körperreinigung, Wasserspülen)<br />
0 Nicht möglich (weder Gehen noch Fortbewegung mit Rollstuhl).<br />
1 Unterstützung einer Hilfsperson bei einigen, aber nicht allen Abläufen nötig (z.B. selbständiger<br />
Transfer, jedoch Hilfe beim An- / Auskleiden).<br />
2 Keine direkte Unterstützung, jedoch Erinnerung / Aufforderung / Supervision bei einigen<br />
Abläufen nötig (muss z.B. erinnert werden, die Wasserspülung zu bedienen)<br />
4 Selbständig bzw. Selbständigkeit bei diesen Tätigkeiten nicht nötig (z.B. weil komplette Versorgung<br />
mit Windeln oder Puffi / Dauerkatheter erfolgt, die Toilette also gar nicht benutzt<br />
wird).<br />
9. Stuhlkontrolle<br />
0 Nicht möglich.<br />
2 Es kommt zu gelegentlicher Inkontinenz (mindesten einmal pro Woche, aber nicht täglich)<br />
und er kann sich nicht selbständig mit Windeln versorgen und nicht selbständig reinigen.<br />
Oder: es ist gelegentlich (mindestens einmal pro Woche, aber nicht täglich) die Unterstützung<br />
einer Person bei der Stuhlregulierung erforderlich (z.B. Klistier).<br />
3 Gestörte Stuhlkontrolle, kann jedoch Windeln selbständig wechseln, sich selbständig reinigen<br />
oder selbständig stuhlregulierende Massnahmen vornehmen.<br />
4 Normale Stuhlkontrolle (auch: Stuhlinkontinenz, die seltener als einmal pro Woche vorkommt).<br />
10. Harnkontrolle<br />
0 Komplette oder sehr häufige Inkontinenz (mehrmals täglich) und kann Windeln nicht selbständig<br />
wechseln. Oder: kann Versorgung von Puffi oder Dauerkatheter nicht selbständig<br />
durchführen bzw. sich nicht selbst einmalkatheterisieren.<br />
1 Inkomplette Inkontinenz (maximal 1 x täglich), kann sich nicht selbständig mit Windeln / Urinalkondom<br />
versorgen und sich nicht selbständig reinigen.<br />
3 Komplette oder inkomplette Inkontinenz, benötigt aber keinerlei Hilfe (beim Wechseln von<br />
Windeln / Urinalkondom, beim sich Säubern, bei der Puffi- oder Dauerkatheterversorgung<br />
bzw. bei der Einmalkatheterisierung.<br />
4 Normale Harnkontinenz.<br />
11. Verstehen<br />
0 Nicht möglich. Selbst einfache Instruktionen oder Fragen werden nicht verstanden; ist auch<br />
nicht in der Lage Geschriebenes zu verstehen oder durch Mimik oder Gestik vermittelten<br />
Aufforderungen zuverlässig nachzukommen.<br />
56
Anhang<br />
1 Versteht einfache Instruktionen (z.B. „Nehmen Sie bitte Tablette ein“), in gesprochener oder<br />
geschriebener oder mimischer oder gestischer Form.<br />
3 Versteht komplexe Sachverhalte (z.B. „bevor Sie mit dem Essen beginnen, nehmen Sie<br />
diese Tablette ein“), jedoch nicht immer ganz zuverlässig. Oder kann nur Geschriebenes zuverlässig<br />
verstehen.<br />
4 Normales Verstehen (umfasst auch Patienten, die auf Hörhilfen angewiesen sind, nicht jedoch<br />
Patienten, die nur Geschriebenes verstehen).<br />
12. Verständlichkeit<br />
0 Kann sich nie oder fast nie verständlich machen.<br />
1 Kann nur einfache alltägliche Sachverhalte (z.B. Hunger, Durst, etc.) ausdrücken, sei es mit<br />
oder ohne Hilfsmittel (z.B. Geschriebenes, Kommunikator).<br />
3 Kann sich praktisch über alles verständlich machen, jedoch nur mit Hilfsmitteln (z.B. Geschriebenes,<br />
Kommunikator).<br />
4 Kann sich ohne Hilfsmittel praktisch über alles verständlich machen (grammatikalische Fehler,<br />
leichte Wortfindungsschwierigkeiten bzw. leicht undeutliches Sprechen sind zulässig).<br />
13. Soziale Interaktion<br />
0 Ist immer oder fast immer unkooperativ (z.B. widersetzt sich pflegerischen Bemühungen),<br />
aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen.<br />
2 Ist gelegentlich unkooperativ, aggressiv, distanzlos oder zurückgezogen.<br />
4 Normale soziale Interaktion.<br />
14. Problemlösen<br />
Beispiele von Störungen des Problemlösens im Alltag sind: vorschnelles Handeln (z.B. Aufstehen aus<br />
dem Rollstuhl, ohne vorher die Bremsen zu fixieren); unflexibles Verhalten (z.B. Schwierigkeiten sich an<br />
einen veränderten Tagesablauf anzupassen); Nichteinhalten von Terminen; Schwierigkeiten bei der<br />
selbstständigen Einnahme der Medikamente (die nicht durch motorische Behinderung bedingt sind); gestörte<br />
Einsicht in die Defizite bzw. ihre Alltagskonsequenzen.<br />
0 Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen erhebliche Hilfestellung.<br />
2 Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen geringe Hilfestellung.<br />
4 Benötigt aufgrund oben aufgeführter Störungen keinerlei Hilfestellung.<br />
15. Gedächtnis / Lernfähigkeit / Orientierung<br />
0 Ist desorientiert oder verwirrt und zeigt eine starke Weglauftendenz.<br />
1 Ist desorientiert oder verwirrt, zeigt jedoch keine Weglauftendenz; allerdings hat er Schwierigkeiten<br />
sich in der Klinik zurechtzufinden. Oder: kann neue Informationen überhaupt nicht<br />
behalten (z.B. kennt seine Bezugspersonen in der Klinik auch nach mehreren Kontakten<br />
nicht, vergisst Gesprächsinhalte, Abmachungen, Aufbewahrungsort von Gegenständen) und<br />
kann externe Gedächtnishilfen (z.B. Kalender, Notizblock) nicht einsetzen.<br />
2 Muss häufig erinnert werden.<br />
3 Muss nur gelegentlich erinnert werden.<br />
4 Keine alltagsrelevante Beeinträchtigung. Oder: kann externe Gedächtnishilfen wirksam einsetzen.<br />
Oder: benötigt trotz Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen wegen dieser Störungen<br />
keinen zusätzlichen (pflegerischen) Aufwand (z.B. völlig immobiler Patient mit schwerer<br />
Orientierungsstörungen).<br />
57
Anhang<br />
16. Sehen / Neglect<br />
0 Findet sich aufgrund der Sehstörung / des Neglects auch in bekannter Umgebung (z.B. eigenes<br />
Zimmer oder Station) nicht ausreichend zurecht. Oder: übersieht bzw. stösst häufig<br />
an Hindernisse bzw. Personen.<br />
1 Findet sich in bekannter Umgebung zurecht und übersieht nicht bzw. stösst nicht oder nur<br />
selten an Hindernisse bzw. Personen an; er findet sich jedoch in unbekannter Umgebung<br />
(z.B. Klinikbereich ausserhalb der Station) nicht zurecht.<br />
3 Hat schwere Lesestörung, findet sich jedoch in bekannter und unbekannter Umgebung gut<br />
zurecht, sei es mit oder ohne Hilfen (z.B. Blindenhund, Stock). Oder: benötigt für gute Leseleistungen<br />
spezielle Hilfsmittel (z.B. Leselupe, Grossdruckbücher, besondere Leselampe,<br />
Zeilenlineal).<br />
4 Keine alltagsrelevante Beeinträchtigung (Brillenträger werden dieser Kategorie zugeordnet).<br />
Oder: benötigt trotz Sehstörungen oder Neglect wegen dieser Störungen keinen zusätzlichen<br />
(pflegerischen) Aufwand (z.B. völlig immobiler Patient mit schwerer Sehstörung).<br />
Quelle: Schädler (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 1: Neurologie.<br />
5.8.3.2 Score Berechnung<br />
Berechnung bei Ein- und Austritt.<br />
5.8.3.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten.<br />
5.8.3.4 Weitere Informationen<br />
Quelle: Oesch (2011): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 2: Bewegungsapparat.<br />
5.8.4 Health Assessment Questionnaire (HAQ)<br />
5.8.4.1 Fragebogen<br />
Kann von Fachpersonen oder Patienten ausgefüllt werden.<br />
Die folgenden Fragen betreffen Einschränkungen der Lebensqualität durch ihre Krankheit. Sie sind für die<br />
medizinische Betreuung sehr wichtig.<br />
Bitte kreuzen Sie jene Antwort an, die am besten ihre Möglichkeiten in der vergangenen Woche beschreibt.<br />
Tätigkeiten<br />
Ankleiden und Körperpflege<br />
1. Können Sie sich selber ankleiden, Kleider zuknöpfen und<br />
Schuhe binden?<br />
2. Können Sie ihre Haare waschen?<br />
Ohne Schwierigkei-<br />
1 2 3 4<br />
ten<br />
mit leichten Schwie-<br />
rigkeiten<br />
mit grossen Schwie-<br />
rigkeiten<br />
Unmöglich<br />
58
Anhang<br />
Aufstehen<br />
3. Können Sie von einem Stuhl ohne Armlehne aufstehen?<br />
4. Können Sie ins Bett gehen und aufstehen?<br />
Essen<br />
5. Können Sie das Fleisch mit dem Messer schneiden?<br />
6. Können Sie ein gefülltes Glas zum Munde führen?<br />
7. Können Sie einen Milchkarton (Tetrapack) öffnen?<br />
Gehen<br />
8. Können Sie auf ebener Strasse gehen?<br />
9. Können Sie Treppen steigen?<br />
Hilfsmittel<br />
10. Bitte kreuzen Sie die Hilfsmittel an, die Sie gewöhnlich für diese Tätigkeiten gebrauchen.<br />
a) Gehstock<br />
b) Krücken<br />
c) Rollstuhl<br />
d) Hilfsmittel zum Ankleiden (langer Schuhlöffel, Knöpfer, Strumpfanzieher, usw.)<br />
e) Spezialstuhl<br />
f) Andere (welche): ……………………………………….<br />
Hilfe anderer Personen<br />
11. Bitte kreuzen Sie die Tätigkeiten an, bei denen Sie gewöhnlich Hilfe einer anderen Person benötigen<br />
a) Ankleiden / Körperpflege<br />
b) Aufstehen<br />
c) Essen<br />
d) Gehen<br />
Bitte kreuzen Sie jene Antwort an, die am besten ihre Möglichkeiten in der vergangenen Woche beschreibt.<br />
Tätigkeiten<br />
Körperpflege<br />
12. Können Sie sich ganz waschen und abtrocknen?<br />
13. Können Sie ein Vollbad nehmen?<br />
14. Können Sie auf die Toilette gehen?<br />
1 2 3 4<br />
Ohne Schwierigkeiten<br />
mit leichten Schwierig-<br />
keiten<br />
mit grossen Schwierig-<br />
keiten<br />
Unmöglich<br />
59
Anhang<br />
Heben<br />
15. Können Sie einen 2 kg schweren Gegenstand (z.B. einen<br />
Sack Kartoffeln) über Kopfhöhe heben, bzw. herunternehmen?<br />
16. Können Sie sich bücken, um ein Kleidungsstück vom Boden<br />
aufzuheben?<br />
Greifen und Öffnen<br />
17. Können Sie eine Autotüre öffnen?<br />
18. Können Sie ein Konfitürenglas öffnen, welches schon einmal<br />
offen war?<br />
19. Können Sie einen Wasserhahn auf- und zudrehen?<br />
Andere Tätigkeiten<br />
20. Können Sie einkaufen gehen?<br />
21. Können Sie in ein Auto ein- und aussteigen?<br />
22. Können Sie Haushaltarbeiten (z.B. Staub saugen) oder Gartenarbeiten<br />
verrichten?<br />
Hilfsmittel<br />
23. Bitte kreuzen Sie die Hilfsmittel an, die Sie gewöhnlich für diese Tätigkeiten benötigen.<br />
a) Toiletten-Sitzerhöhung<br />
b) Schraubendeckelöffner<br />
c) Sitz für Badewanne<br />
d) Hilfsmittel zum Greifen (z.B. Greifzange, Schlüsselgriffe)<br />
Hilfe anderer Personen<br />
24. Bitte kreuzen Sie die Tätigkeiten an, bei denen Sie gewöhnlich Hilfe einer anderen Person benötigen.<br />
a) Körperpflege<br />
b) Heben<br />
c) Greifen und Öffnen<br />
d) Einkaufen und Haushaltarbeiten<br />
Quelle: Schädler (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 1: Neurologie.<br />
5.8.4.2 Score-Berechnung<br />
Der Health Assessment Questionnaire (HAQ) erfasst die Selbständigkeit in den Alltagsaktivitäten und<br />
besteht aus 8 Kategorien (1. Ankleiden / Körperpflege; 2. Aufstehen; 3. Essen; 4. Gehen; 5. Körperpflege;<br />
6. Heben; 7. Greifen und Öffnen; 8. Einkaufen und Haushaltarbeiten). Jede Kategorie wird mit 2 oder<br />
3 Fragen auf einer 4-stufigen Antwortskala erfasst (0 = ohne Schwierigkeiten; 1 = mit leichten Schwierigkeiten;<br />
2 = mit grossen Schwierigkeiten; 3 = Unmöglich). Ergänzend wird die Person zum Einsatz von<br />
Hilfsmitteln oder Beanspruchung von Hilfspersonen befragt.<br />
60
Anhang<br />
Als Score für jede der 8 Kategorien gilt der höchste Wert der 2 oder 3 Fragen zur jeweiligen Kategorie.<br />
Sollte eine Person in der entsprechenden Kategorie Hilfsmittel oder Hilfe beanspruchen, beträgt die minimale<br />
Punktezahl 2.<br />
Der Gesamtscore ist der Durchschnitt der Scores für die erfassten Kategorien. Er nimmt einen Wert zwischen<br />
0 und 3 an.<br />
Berechnung bei Ein- und Austritt.<br />
5.8.4.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten<br />
5.8.4.4 Weitere Informationen<br />
Quelle: Oesch (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 2: Bewegungsapparat.<br />
5.9 Modul 3: Messinstrumente<br />
5.9.1 6-Minuten-Gehtest<br />
Der 6-Minuten-Gehtest misst die körperliche Leistungsfähigkeit anhand der in sechs Minuten maximal<br />
zurückgelegten Gehstrecke in Metern.<br />
5.9.1.1 Prozedere<br />
Messung Gehstrecke und Verwendung von Gehhilfen.<br />
5.9.1.2 Score-Berechnung<br />
Differenz aus Messung bei Eintritt und Austritt.<br />
5.9.1.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten<br />
5.9.1.4 Weitere Informationen<br />
Büsching (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 3: Kardiologie und Pneumologie.<br />
5.9.2 Ergometrie<br />
5.9.2.1 Prozedere<br />
Messung der erbrachten Leistung in Watt sowie der Dauer der Gesamtbelastung.<br />
5.9.2.2 Score-Berechnung<br />
Differenz aus Messung bei Eintritt und Austritt.<br />
5.9.2.3 Kosten<br />
Keine Lizenzkosten<br />
5.9.2.4 Weitere Informationen<br />
Büsching (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 3: Kardiologie und Pneumologie.<br />
61
Anhang<br />
5.9.3 MacNew Heart<br />
5.9.3.1 Fragebogen<br />
Der Fragebogen kann ausschliesslich mit der schriftlichen Genehmigung durch die Macnew.org<br />
genutzt werden.<br />
Wir würden Ihnen nun gerne einige Fragen stellen, wie Sie sich WÄHREND DER LETZTEN 2 WOCHEN<br />
gefühlt haben. Bitte kreuzen Sie jenes Feld an, welches zu Ihrer Antwort passt.<br />
1. Wie oft haben sie sich in den letzten 2 Wochen frustriert, ungeduldig oder ungehalten gefühlt?<br />
(1) die ganze Zeit<br />
(2) die meiste Zeit<br />
(3) einen Grossteil der Zeit<br />
(4) manchmal<br />
(5) selten<br />
(6) kaum<br />
(7) nie<br />
2. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen wertlos oder unzulänglich gefühlt?<br />
(1) die ganze Zeit<br />
(2) die meiste Zeit<br />
(3) einen Grossteil der Zeit<br />
(4) manchmal<br />
(5) selten<br />
(6) kaum<br />
(7) nie<br />
3. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen sehr zuversichtlich und sicher gefühlt, mit Ihrem<br />
Herzproblem umgehen zu können?<br />
(1) Nie<br />
(2) Wenige Male<br />
(3) Manchmal<br />
(4) Ziemlich oft<br />
(5) Meistens<br />
(6) Fast immer<br />
(7) Immer<br />
4. Wie oft haben Sie sich im Allgemeinen in den letzten 2 Wochen entmutigt oder deprimiert gefühlt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
5. Wie oft in den vergangenen 2 Wochen fühlten Sie sich entspannt und ohne Druck?<br />
(1) Nie<br />
62
Anhang<br />
(2) Wenige Male<br />
(3) Manchmal<br />
(4) Ziemlich oft<br />
(5) Meistens<br />
(6) Fast immer<br />
(7) Immer<br />
6. Wie oft in den letzten 2 Wochen fühlten Sie sich erschöpft oder mit wenig Energie?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
7. Wie glücklich und zufrieden sind Sie in den letzten 2 Wochen mit Ihrem persönlichen Leben gewesen?<br />
(1) Sehr unzufrieden; die meiste Zeit unglücklich<br />
(2) Im Allgemeinen unzufrieden, unglücklich<br />
(3) Irgendwie unzufrieden, unglücklich<br />
(4) Im Allgemeinen zufrieden<br />
(5) Die meiste Zeit glücklich<br />
(6) Die meiste Zeit sehr glücklich<br />
(7) Absolut glücklich, hätte nicht zufriedener sein können<br />
8. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen rastlos gefühlt oder so, als ob Sie Schwierigkeiten<br />
hätten, ruhig zu werden.<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) Nie<br />
9. Wie stark war Ihre Atemnot in den letzten 2 Wochen während Ihrer alltäglichen Aktivitäten?<br />
(1) Extreme Atemnot<br />
(2) Sehr hohe Atemnot<br />
(3) Ziemliche Atemnot<br />
(4) Etwas Atemnot<br />
(5) Wenig Atemnot<br />
(6) Keine Atemnot<br />
10. Wie oft in den letzten zwei Wochen haben Sie sich zum Weinen gefühlt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
63
Anhang<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
11. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen abhängiger gefühlt als vor Ihrem Herzproblem?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
12. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen außerstande gefühlt, Ihren üblichen gesellschaftlichen<br />
Aktivitäten oder denen mit Ihrer Familie nachzukommen?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
13. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen so gefühlt, als ob andere nicht mehr dasselbe Vertrauen<br />
in Sie haben wie vor Ihren Herzproblemen?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
14. Wie oft haben Sie in den letzten 2 Wochen Brustschmerzen bei alltäglichen Aktivitäten verspürt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
15. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen unsicher gegenüber sich selbst gefühlt oder ein<br />
Mangel an Selbstbewusstsein verspürt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
64
Anhang<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
16. Wie oft waren Sie in den letzten 2 Wochen wegen schmerzenden oder müden Beinen beunruhigt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
17. Wie stark waren Sie in den letzten 2 Wochen wegen Ihres Herzproblems beim Sport oder beim körperlichen<br />
Training eingeschränkt?<br />
(1) Sehr stark eingeschränkt<br />
(2) Stark eingeschränkt<br />
(3) Ziemlich eingeschränkt<br />
(4) Mässig eingeschränkt<br />
(5) Irgendwie eingeschränkt<br />
(6) Ein wenig eingeschränkt<br />
(7) Absolut nicht eingeschränkt<br />
18. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen besorgt oder verängstigt gefühlt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
19. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen schwindlig oder benommen gefühlt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
20. Wie stark haben Sie sich in den letzten 2 Wochen wegen Ihres Herzproblems im Allgemeinen eingeschränkt<br />
oder reduziert gefühlt?<br />
(1) Sehr stark eingeschränkt<br />
(2) Stark eingeschränkt<br />
65
Anhang<br />
(3) Ziemlich eingeschränkt<br />
(4) Mässig eingeschränkt<br />
(5) Irgendwie eingeschränkt<br />
(6) Ein wenig eingeschränkt<br />
(7) Absolut nicht eingeschränkt<br />
21. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen unsicher darüber gefühlt, wieviel Gymnastik oder<br />
körperliche Aktivitäten Sie machen sollten?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
22. Wie oft haben Sie in den letzten 2 Wochen Ihre Familie als zu besorgt und zu beschützend empfunden?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
23. Wie oft in den letzten 2 Wochen fühlten Sie sich, als ob Sie eine Last für andere wäre<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
24. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen wegen Ihres Herzproblems von Aktivitäten mit anderen<br />
Leuten ausgeschlossen gefühlt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
25. Wie oft haben Sie sich in den letzten 2 Wochen unfähig gefühlt, wegen Ihres Herzproblems soziale<br />
Kontakte zu pflegen?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
66
Anhang<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
26. In welchem Ausmaß waren Sie im Allgemeinen in den letzten 2 Wochen wegen Ihres Herzproblems<br />
bei Ihrer täglichen körperlichen Belastung eingeschränkt?<br />
(1) Sehr stark eingeschränkt<br />
(2) Stark eingeschränkt<br />
(3) Ziemlich eingeschränkt<br />
(4) Mässig eingeschränkt<br />
(5) Irgendwie eingeschränkt<br />
(6) Ein wenig eingeschränkt<br />
(7) Absolut nicht eingeschränkt<br />
27. Wie oft in den letzten 2 Wochen hatten Sie das Gefühl, dass Ihr Herzproblem den Sexualverkehr<br />
einschränkt oder beeinträchtigt?<br />
(1) Die ganze Zeit<br />
(2) Die meiste Zeit<br />
(3) Einen Grossteil der Zeit<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Selten<br />
(6) Kaum<br />
(7) nie<br />
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.<br />
5.9.3.2 Score Berechnung<br />
Scoring of the MacNew is straight-forward. The maximum possible score in any domain is 7 [high HRQL]<br />
and the minimum is 1 [poor HRQL]. Missing responses do not contribute to the score and item 27, 'sexual<br />
intercourse', may be excluded without altering the domain score as each domain score is calculated as<br />
the average of the responses in that domain. For example, if only 10 of the 14 Emotional items are answered,<br />
the Emotional Score is the average of 10 responses. If more than 50% of the items for a domain<br />
are missing, the score for that domain is not calculated, that is, it is considered to be missing. The instrument<br />
also has a global HRQL score which can be calculated as the average over all scored items unless<br />
one of the domains is completely missing. In addition to the 11 studies reported below which provide psychometric<br />
data, the MacNew has been successfully administered, to our knowledge, in at least 12 clinical<br />
and/or experimental studies to more than 5,200 patients with heart disease<br />
Quelle: unbekannt<br />
5.9.3.3 Kosten<br />
Für die Nutzung des Fragebogens ist grundsätzlich eine kostenpflichtige Lizenz notwendig, deren Höhe<br />
von Nutzergruppen abhängig ist.<br />
67
Anhang<br />
5.9.3.4 Weitere Informationen<br />
http://www.assessment-info.de/assessment/seiten/datenbank/vollanzeige/vollanzeigede.asp?vid=467#Analysedesign<br />
http://www.macnew.org/cms/<br />
5.9.4 Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)<br />
5.9.4.1 Fragebogen<br />
1. Wie stark war Ihre Kurzatmigkeit in den vergangenen zwei Wochen, während Sie Grundbedürfnisse<br />
wie Baden, Duschen, Essen oder sich Ankleiden erfüllten?<br />
(1) Extreme Kurzatmigkeit<br />
(2) Starke Kurzatmigkeit<br />
(3) Ziemliche Kurzatmigkeit<br />
(4) Mässige Kurzatmigkeit<br />
(5) Leichte Kurzatmigkeit<br />
(6) Sehr leichte Kurzatmigkeit<br />
(7) Gar keine Kurzatmigkeit<br />
(8) Nicht ausgeübt<br />
2. Wie stark war Ihre Kurzatmigkeit in den vergangenen zwei Wochen, während Sie Spazieren gingen?<br />
(1) Extreme Kurzatmigkeit<br />
(2) Starke Kurzatmigkeit<br />
(3) Ziemliche Kurzatmigkeit<br />
(4) Mässige Kurzatmigkeit<br />
(5) Leichte Kurzatmigkeit<br />
(6) Sehr leichte Kurzatmigkeit<br />
(7) Gar keine Kurzatmigkeit<br />
(8) Nicht ausgeübt<br />
3. Wie stark war Ihre Kurzatmigkeit in den vergangenen zwei Wochen, wenn Sie Gefühle hatten wie<br />
Wut oder Aufregung?<br />
(1) Extreme Kurzatmigkeit<br />
(2) Starke Kurzatmigkeit<br />
(3) Ziemliche Kurzatmigkeit<br />
(4) Mässige Kurzatmigkeit<br />
(5) Leichte Kurzatmigkeit<br />
(6) Sehr leichte Kurzatmigkeit<br />
(7) Gar keine Kurzatmigkeit<br />
(8) Nicht ausgeübt<br />
4. Wie stark war Ihre Kurzatmigkeit in den vergangenen zwei Wochen, während Sie Alltagspflichten wie<br />
z. B. Hausarbeiten oder Lebensmittel einkaufen erledigten?<br />
(1) Extreme Kurzatmigkeit<br />
(2) Starke Kurzatmigkeit<br />
(3) Ziemliche Kurzatmigkeit<br />
(4) Mässige Kurzatmigkeit<br />
(5) Leichte Kurzatmigkeit<br />
68
Anhang<br />
(6) Sehr leichte Kurzatmigkeit<br />
(7) Gar keine Kurzatmigkeit<br />
(8) Nicht ausgeübt<br />
5. Wie stark war Ihre Kurzatmigkeit in den vergangen zwei Wochen, während Sie am gesellschaftlichen<br />
Leben teilnahmen?<br />
(1) Extreme Kurzatmigkeit<br />
(2) Starke Kurzatmigkeit<br />
(3) Ziemliche Kurzatmigkeit<br />
(4) Mässige Kurzatmigkeit<br />
(5) Leichte Kurzatmigkeit<br />
(6) Sehr leichte Kurzatmigkeit<br />
(7) Gar keine Kurzatmigkeit<br />
(8) Nicht ausgeübt<br />
6. Wie oft fühlten Sie sich während der letzten zwei Wochen frustriert oder waren ungeduldig?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
7. Wie oft verspürten Sie in den letzten zwei Wochen ein Gefühl der Angst oder Panik, wenn Sie<br />
Schwierigkeiten mit dem Atmen hatten?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
8. Wie sieht es mit der Erschöpfung aus? Wie müde haben Sie sich während der letzten zwei Wochen<br />
gefühlt?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
9. Wie oft war es Ihnen in den vergangenen zwei Wochen peinlich, weil Sie husten oder schwer atmen<br />
mussten?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
69
Anhang<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
10. Wie oft waren Sie in den vergangenen zwei Wochen zuversichtlich und sicher, dass Sie mit Ihrer<br />
Krankheit umgehen können?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
11. Wie viel Lebensenergie hatten Sie in den letzten zwei Wochen?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
12. Wie oft waren Sie während der letzten zwei Wochen wütend, besorgt oder deprimiert?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
13. Wie oft hatten Sie während der letzten zwei Wochen das Gefühl, Ihre Atemprobleme vollständig unter<br />
Kontrolle zu haben?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
14. Wie oft waren Sie in den letzten zwei Wochen locker und entspannt?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
70
Anhang<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
15. Wie oft haben Sie sich in den letzten zwei Wochen mit wenig Lebensenergie gefühlt?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
16. Wie oft fühlten Sie sich in den vergangenen zwei Wochen im Allgemeinen mutlos oder niedergeschlagen?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
17. Wie oft haben Sie sich in den letzten zwei Wochen erschöpft oder lustlos gefühlt?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
18. Wie glücklich oder zufrieden waren Sie in den letzten zwei Wochen mit Ihrem Leben?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
19. Wie oft waren Sie in den vergangenen zwei Wochen verstört oder ängstlich, wenn Sie Schwierigkeiten<br />
mit dem Atmen hatten?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
71
Anhang<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
20. Wie oft waren Sie in den letzten zwei Wochen im Allgemeinen ruhelos, angespannt oder nervös?<br />
(1) Immer<br />
(2) Sehr oft<br />
(3) Oft<br />
(4) Manchmal<br />
(5) Nicht sehr oft<br />
(6) Fast nie<br />
(7) Gar nie<br />
5.9.4.2 Score Berechnung<br />
Die Antwortwerte pro Domäne werden summiert [Zähler] und durch die Anzahl Fragen geteilt [Nenner].<br />
Der Totalscore berechnet sich aus dem Durchschnitt der 4 Domänen-Scores.<br />
5.9.4.3 Kosten<br />
Für die Nutzung des Fragebogens ist grundsätzlich eine kostenpflichtige Lizenz notwendig.<br />
5.9.4.4 Weitere Informationen<br />
Büsching (2009): Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong>: Band 3: Kardiologie und Pneumologie.<br />
5.10 Weitere Instrumente<br />
5.10.1 Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)<br />
Die 14 Items der Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) werden von den Ärztinnen und Ärzten mit einer<br />
5-stufigen Antwortskala beurteilt (0 = keine Komorbidität; 1 = milde Komorbidität: normale Aktivität nicht<br />
beeinflusst, sehr gute Prognose; 2 = leichte Komorbidität: normale tägl. Aktivitäten sind beeinflusst, Behandlung<br />
indiziert, gute Prognose; 3 = schwere Komorbidität: Einschränkungen vorhanden, schnelle Behandlung<br />
notwendig, Prognose unsicher; 4 = sehr schwere Komorbidität: lebensbedrohliche Situation,<br />
akut behandlungsbedürftig, Prognose schlecht).<br />
1. Herz<br />
2. Bluthochdruck und Gefässe<br />
3. Blutbildendes und lymphatisches System<br />
4. Lunge und Atemwege<br />
5. HNO und Auge<br />
6. Oberer Gastrointestinaltrakt<br />
7. Unterer Gastrointestinaltrakt<br />
8. Leber, Galle und Pankreas<br />
9. Nieren<br />
72
Anhang<br />
10. Urogenitaltrakt<br />
11. Bewegungsapparat und Haut<br />
12. Nervensystem<br />
13. Endokrinium, Stoffwechselstörungen und Brustdrüse<br />
14. Psychische Störungen<br />
Quelle: Kool, J. (2009): Entwicklung eines Patientenklassifikationssystems (PCS) für die <strong>Rehabilitation</strong><br />
in der Schweiz.<br />
73