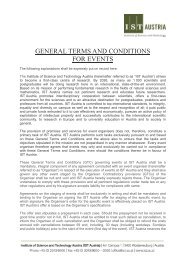Das Labor als Kristall - IST Austria
Das Labor als Kristall - IST Austria
Das Labor als Kristall - IST Austria
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EMBARGO bis 28. November, 15 Uhr CET<br />
<strong>Das</strong> <strong>Labor</strong> <strong>als</strong> <strong>Kristall</strong><br />
Klosterneuburg, 28. November 2012<br />
Zahlen und Fakten zum Lab Building East • Weitere Baumaßnahmen<br />
in den kommenden Jahren<br />
<strong>Das</strong> Lab Building East steht im östlichen Campusteil des Institute of Science and Technology<br />
<strong>Austria</strong> (<strong>IST</strong> <strong>Austria</strong>) in Klosterneuburg und umrahmt gemeinsam mit dem Zentralgebäude, dem<br />
Bertalanffy Foundation Building und dem voestalpine Building den Teich und die Grünflächen in<br />
der Mitte des Campusgeländes. Der Bau mit seinen knapp 7.000 Quadratmetern<br />
Bruttogeschoßfläche verteilt auf sechs Geschosse (inklusive Kellergeschoß und der<br />
Haustechnik im Dachgeschoß) ist auf experimentelle Forschung im Bereich der Life Science und<br />
der Physik für bis zu zwölf Forschungsgruppen ausgelegt. Bilder finden Sie unter<br />
http://alturl.com/a64m5 (45 MB).<br />
Der Baukörper: „Form Follows Energy“<br />
Die Gebäude-Geometrie, entworfen von Architektenbüro Frank und Partner, basiert auf der<br />
Leitidee: „Form Follows Energy“. Die Hülle wurde so kompakt wie möglich gestaltet. Ihr an einen<br />
<strong>Kristall</strong> erinnernder Aufbau optimiert das Verhältnis von Fläche zu Volumen. Die glatte<br />
Fassadenverkleidung aus Aluminium unterstreicht die Klarheit des Baukörpers. Die südliche<br />
Fassade wurde überhängend ausgeführt, was zu einer Reduktion des Bedarfs an Kühlenergie<br />
führt. In den Sommermonaten gelangt so nur wenig direktes Sonnenlicht in das Gebäudeinnere.<br />
Zugleich wurden auf dem nach Südosten hin abgeschrägten Dach Photovoltaik-Elemente<br />
angebracht.
Der Innenraum: Kommunikativ, tageshell und flexibel<br />
Der Haupteingang des Gebäudes liegt an der Südostseite. <strong>Das</strong> Innere wird durch das verglaste<br />
Atrium erschlossen, das über das Dach und das angeschlossene Treppenhaus von Tageslicht<br />
durchflutet wird und die Eingangszone für MitarbeiterInnen und BesucherInnen bildet. Im<br />
zentralen Eingangsbereich befindet sich ein Seminarraum, zusätzlich sind im Erdgeschoss<br />
Serviceabteilungen wie Mikroskopie, Wasch- und Medienküchen untergebracht, die von allen<br />
Forschungsgruppen gemeinsam genutzt werden. Die Elektronenmikroskopie ist im<br />
Untergeschoß untergebracht.<br />
Die Obergeschosse sind in eine <strong>Labor</strong>zone, einen in der Mitte gelegenen Servicebereich und in<br />
Büroflächen unterteilt. Alle Gänge werden durch Tageslicht erhellt. Um Verweilflächen für<br />
spontane Besprechungen zu schaffen, weiten sich die Gänge an den Enden auf. Bereiche rund<br />
um das Atrium werden teilweise <strong>als</strong> Galerien ausgeführt, um die Kommunikation auch zwischen<br />
den Geschossen zu ermöglichen.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Labor</strong>einrichtungskonzept basiert auf einem System der flexiblen Verbauung mit<br />
Energieversorgungsständerwänden und <strong>Labor</strong>tischen. Dadurch entfallen bei zukünftigen<br />
Änderungen in der Einrichtung zusätzliche bauliche Maßnahmen in den Wänden. Die Achsmaße<br />
der <strong>Labor</strong>räume wurde von den Architekten so konzipiert, dass sie möglichst viele<br />
Einrichtungsvarianten abdecken.<br />
Hohe ökologische Ansprüche<br />
Bereits beim Bau konnte der CO2-Ausstoß durch den Einsatz von Öko-Beton – verglichen mit<br />
herkömmlichen Beton ist der CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent geringer – deutlich reduziert<br />
werden. <strong>Das</strong> Gebäude ist gemäß dem Passivhaus-Standard ausgelegt. Die nachhaltige<br />
Energienutzung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Durch die energieeffiziente<br />
Gestaltung der Hülle und die Fassadengestaltung in Form des südlichen „Überhangs“ gelangt in<br />
den Sommermonaten nur wenig direktes Sonnenlicht ins Innere. Auch Fixlamellen und ein<br />
außen liegender Sonnenschutz reduzieren die Kühlenergie nachhaltig. Umgekehrt gewährleistet<br />
in den Wintermonaten der niedrige Sonnenstand ein tiefes Vordringen von Sonnenlicht in das<br />
Gebäudeinnere.
Die Grundtemperatur im Gebäude wird durch eine sogenannte Betonkernaktivierung erzeugt.<br />
Den mehr <strong>als</strong> 45 Tiefbohrungen – mit einer Bohrtiefe von jeweils einhundert Metern – wird<br />
entsprechend dem jeweiligen Gebäudebedarf Kälte oder Wärme für die Versorgung dieser<br />
Betonkerntemperierung entnommen. Die somit erzeugte Jahresenergie beträgt ca. 360.000<br />
Kilowattstunden. Dadurch können ca. 72.000 kg CO2 pro Jahr – verglichen mit fossilen<br />
Energieträgern – eingespart werden. Allein diese jährliche CO2-Reduktion entspricht dem<br />
durchschnittlichen jährlichen Ausstoß von rund 18 Einfamilienhäusern.<br />
In großen Bereichen des nach Süden geneigten Dachs sind Photovoltaik-Elemente angeordnet,<br />
die jährlich rund 60.000 kWh erzeugen. Die CO2-Einsparung durch die Photovoltaikanlage<br />
beträgt rund weitere 12.500 kg/Jahr.<br />
Zusätzlich wurde die nachhaltige Energienutzung des Gebäudes durch technische Maßnahmen<br />
optimiert. So wurden die Lüftungen mit doppelten Wärmerückgewinnungsanlagen und<br />
intelligenten Mess- und Regelungseinrichtungen (zB. bedarfsoptimierte Lüftung während und<br />
außerhalb der Betriebszeiten) ausgestattet und eine energiesparende LED Beleuchtungen<br />
eingesetzt. Die Kälteerzeugung – eine wesentliche Anforderung in naturwissenschaftlichen<br />
<strong>Labor</strong>s – setzt unter anderem auf das „Free Cooling“, ein System, das die Kälte der Außenluft<br />
nutzt.<br />
<strong>Das</strong> Lab Building East erreicht mit den umgesetzten Maßnahmen in der Gesamtmenge<br />
betrachtet in den nächsten 20 Jahren eine CO 2 Einsparung gegenüber vergleichbaren<br />
Gebäuden von rund 2.160 Tonnen. Dies entspricht dem jährlichem CO 2 Ausstoß von rund 540<br />
Einfamilienhäusern oder einer Einsparung von ca. 800.000 Liter Heizöl. Die eingesparte<br />
Energiemenge würde beispielhaft ausreichen um mit einem Mittelklasse PKW rund 13 Mio. km<br />
zurücklegen oder rund 323 mal den Äquator der Erde zu umrunden.
<strong>Das</strong> Projekt<br />
2009 wurde von der Niederösterreichischen Landesimmobilienges.m.b.H. ein zweistufiges<br />
Verhandlungsverfahren für Generalplanerleistungen für ein naturwissenschaftliches <strong>Labor</strong><br />
ausgelobt. Der Zuschlag ging an die Bietergemeinschaft ARGE SCIENCE LAB unter der<br />
Federführung von Architekten Frank + Partner ZT GmbH. Die Projektsteuerung liegt bei der<br />
HYPO NOE Real Consult. Im Herbst 2010 wurde mit dem Bau begonnen und zwei Jahre später<br />
fristgerecht fertig gestellt. In Summe wurden ca. 5.000m³ Beton (ca. 12.000 Tonnen), 630<br />
Tonnen Stahl und rund 250 km Kabeln verbaut. Weiters wurden alleine für die Lüftung 5.200m²<br />
Blech und 2,2 km Spirorohre (samt über 2.000 Stk. dazugehörige Formrohre) verarbeitet, die<br />
Innenräume wurden mit ca. 50 Tonnen Farbe gestrichen.<br />
<strong>Das</strong> Generalplanerteam des Lab Building East<br />
Architektur: Architekten Frank + Partner ZT GmbH<br />
Statik: DI Dr. Fuld Ziviltechniker GmbH<br />
Technische Gebäudeausrüstung: Von der Heyden Planungsgesellschaft für haustechnische<br />
Anlagen GesmbH & Co.KG | Subplaner <strong>Labor</strong>planung: Vitroplan <strong>Labor</strong>technik GmbH<br />
Bauphysik: AMiP Industrial Engineering GmbH<br />
Weitere Baumaßnahmen<br />
An der Westseite der Zufahrtsstraße wird seit August 2012 das Lab and Office Building West<br />
errichtet, dessen Bau im Herbst 2015 abgeschlossen werden soll. <strong>Das</strong> aus zwei Blöcken mit<br />
jeweils sechs Geschosse (inklusive Kellergeschoß und dem zurückgesetzten Geschoß für die<br />
Haustechnik am Dach) bestehende Gebäude mit seinen rund 11.500 Quadratmetern<br />
Bruttogeschoßfläche wird für die Anforderungen von bis zu 300 ForscherInnen auf Gebieten der<br />
Mathematik, der Physik und der Chemie ausgelegt. Der südlich gelegene Büroblock wird mit<br />
dem nördlich gelegenen <strong>Labor</strong>block, durch eine Brücke verbunden, die <strong>als</strong> Kommunikationsraum<br />
dient – ein Konzept, dass sich bereits bei der Verbindung zwischen dem Zentralgebäude und<br />
dem Bertalanffy Foundation Building bewährt hat.
Weiters wird zwischen Bertalanffy Foundation Building und dem Lab Building East bis 2014 die<br />
Preclinical Facility errichtet, in der die Zucht- und Pflegeeinrichtungen für Nagetiere<br />
untergebracht wird, die für die experimentelle Forschung benötigt werden.<br />
Weitere Informationen:<br />
Oliver Lehmann, Media Relations<br />
E-Mail: oliver.lehmann@ist.ac.at | Phone: +43/(0)2243/9000-1006 | Mobile: +43/(0)676/40 12 562<br />
<strong>IST</strong> <strong>Austria</strong><br />
<strong>Das</strong> Institute of Science and Technology <strong>Austria</strong> (<strong>IST</strong> <strong>Austria</strong>) in Klosterneuburg ist ein Forschungsinstitut mit eigenem<br />
Promotionsrecht. <strong>Das</strong> 2009 eröffnete Institut widmet sich der Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften,<br />
Mathematik und Computerwissenschaften. <strong>Das</strong> Institut beschäftigt ProfessorInnen nach einem Tenure-Track-Modell<br />
und Post-DoktorandInnen sowie PhD StudentInnen in einer internationalen Graduate School. Neben dem Bekenntnis<br />
zum Prinzip der Grundlagenforschung, die rein durch wissenschaftliche Neugier getrieben wird, hält das Institut die<br />
Rechte an allen resultierenden Entdeckungen und fördert deren Verwertung. Der erste Präsident ist Thomas<br />
Henzinger, ein renommierter Computerwissenschaftler und vorm<strong>als</strong> Professor der University of California in Berkeley,<br />
USA, und der EPFL in Lausanne, Schweiz. www.ist.ac.at