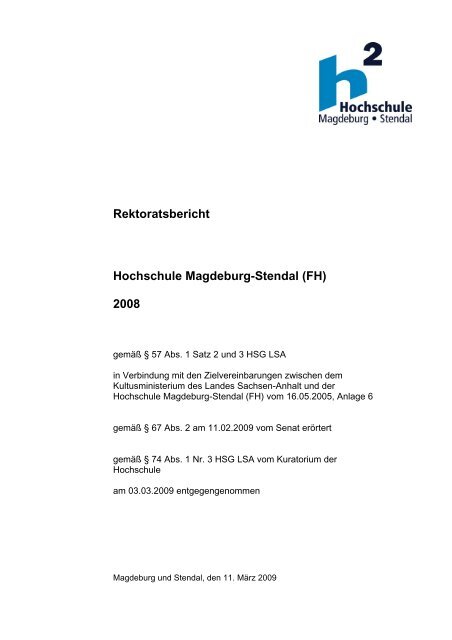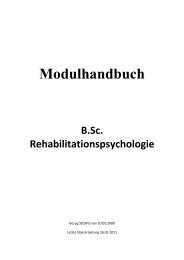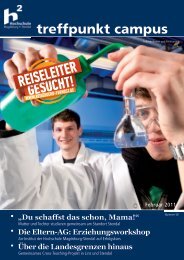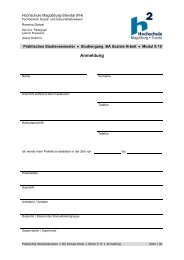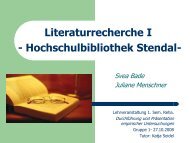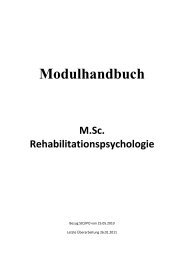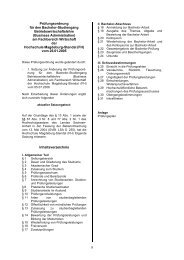Rektoratsbericht 2008 (547 KB) - Hochschule Magdeburg-Stendal
Rektoratsbericht 2008 (547 KB) - Hochschule Magdeburg-Stendal
Rektoratsbericht 2008 (547 KB) - Hochschule Magdeburg-Stendal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Rektoratsbericht</strong><br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
<strong>2008</strong><br />
gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 HSG LSA<br />
in Verbindung mit den Zielvereinbarungen zwischen dem<br />
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt und der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 16.05.2005, Anlage 6<br />
gemäß § 67 Abs. 2 am 11.02.2009 vom Senat erörtert<br />
gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 3 HSG LSA vom Kuratorium der<br />
<strong>Hochschule</strong><br />
am 03.03.2009 entgegengenommen<br />
<strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong>, den 11. März 2009
1 Lehre, Studium, Weiterbildung............................................................................... 4<br />
1.1 Ausbildungskapazität und Struktur des Lehrangebots .............................................. 4<br />
1.1.1 Kapazitätsberechnung ............................................................................................... 4<br />
1.1.2 Steuerung der Kapazitäten ........................................................................................ 5<br />
1.2 Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master) .................................................... 6<br />
1.2.1 BA-Studiengänge....................................................................................................... 6<br />
1.2.2 MA-Studiengänge ...................................................................................................... 6<br />
1.2.3 Akzeptanz der Abschlüsse ........................................................................................ 7<br />
1.3 Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden,<br />
Absolventenquote ...................................................................................................... 8<br />
1.3.1 Auswahl von Studienbewerbern ................................................................................ 8<br />
1.3.2 Betreuung der Studierenden...................................................................................... 8<br />
1.3.3 Absolventenquote und Abbrecherquote .................................................................... 8<br />
1.4 Weiterbildung/Lebenslanges Lernen ......................................................................... 9<br />
1.5 Hochschulbibliothek................................................................................................. 11<br />
1.6 Zentrum für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI)............................ 12<br />
2 Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer,<br />
Regionalbezug ....................................................................................................... 14<br />
2.1 Drittmittelaufkommen F & E und Weiterbildungsmaßnahmen................................. 14<br />
2.2 Innovation/Wissens- und Technologietransfer und Existenzgründung<br />
Entwicklung der Strukturen Technologietransfer ..................................................... 14<br />
2.2.1 KAT – Ausbau von vier leistungsfähigen ingenieurwissenschaftlichen<br />
Kompetenzfeldern an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)............................ 14<br />
2.2.2 Schutzrechtsarbeit <strong>2008</strong> an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) und<br />
Ergebnisse............................................................................................................... 16<br />
2.2.3 Entwicklung von Existenzgründungsvorhaben <strong>2008</strong> ............................................... 16<br />
3 Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung.................................. 18<br />
3.1 Qualitätsbestimmung und -entwicklung in Studium, Lehre und Forschung............. 18<br />
3.2 Akkreditierung.......................................................................................................... 19<br />
3.3 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren ........................................ 19<br />
4 Internationalisierung ............................................................................................. 21<br />
4.1 Internationaler Hochschulraum................................................................................ 21<br />
4.1.1 Auslandsstudium ..................................................................................................... 21<br />
4.1.2 Projektbezogene Kooperationen ............................................................................. 22<br />
4.1.3 Ausländerstudium .................................................................................................... 22<br />
4.1.4 Mitteleinwerbung...................................................................................................... 22<br />
4.1.5 Das Projekt German Jordanien University............................................................... 23<br />
5 Tätigkeitsbericht im Rahmen der Zielsetzungen Chancengleichheit<br />
und Familiengerechtigkeit .................................................................................... 25<br />
5.1 „Familienzimmer“ als familienfreundliches und<br />
chancengleichheitsfördendes Projekt ...................................................................... 25<br />
5.2 Auditierung............................................................................................................... 25<br />
5.3 Weitere Maßnahmen zu Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit ................. 26<br />
6 Hochschulmarketing ............................................................................................. 27<br />
6.1 Hochschulübergreifendes Marketing – Beteiligung am Landesmarketing............... 27<br />
6.2 Hochschulspezifisches Marketing............................................................................ 28<br />
Seite 2
6.2.1 Grundlagen .............................................................................................................. 28<br />
6.2.2 Studierendenmarketing............................................................................................ 30<br />
6.2.2.1 Vor dem Studium: .................................................................................................... 30<br />
6.2.2.2 Zu Beginn des Studiums:......................................................................................... 31<br />
6.2.2.3 Während des Studiums ........................................................................................... 31<br />
6.2.2.4 Zum Ende des Studiums ......................................................................................... 32<br />
6.2.2.5 Nach dem Studium .................................................................................................. 32<br />
7 Verhältnis Staat und <strong>Hochschule</strong> – Flexibilität und<br />
Eigenverantwortung .............................................................................................. 33<br />
7.1 Stärkung interner Selbststeuerung .......................................................................... 33<br />
7.1.1 Stand der hochschulinternen Mittelverteilung sowie der Einführung einer<br />
„leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM)“.......................................................... 33<br />
7.1.2 Entwicklungsstand des Controllings/Kosten- und Leistungsrechnung .................... 33<br />
7.1.2.1 Kosten – und Leistungsrechnung (KLR).................................................................. 33<br />
7.1.2.2. Controlling................................................................................................................ 34<br />
7.1.2.2.1 Kennzahlensystem .................................................................................................. 34<br />
7.1.2.2.2 Interne Planungsmodelle ......................................................................................... 35<br />
7.1.2.2.3 Sonstige operative und konzeptionelle Arbeiten im Controllingbereich................... 35<br />
7.1.3 Aufbau der Leistungserfassung und Leistungsmessung im Rahmen des<br />
akademischen Controlling/Benchmarking ............................................................... 36<br />
7.1.3.1 Leistungserfassung.................................................................................................. 36<br />
7.1.3.2 Benchmarking.......................................................................................................... 37<br />
7.2 Hochschulbau, Flächenmanagement, Bauunterhalt und Liegenschaften ............... 37<br />
7.2.1 Sachstand zur Einführung des Facility Managements und interner<br />
Flächenmanagementmodelle zur wirtschaftlichen Flächennutzung ........................ 37<br />
7.2.2 Sachstand zu den Großen Baumaßnahmen ........................................................... 38<br />
7.2.3 Sachstand zu den Kleinen Baumaßnahmen ........................................................... 38<br />
7.2.4 Sachstand zum Bauunterhalt................................................................................... 39<br />
7.2.5 Entwicklungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung......................................... 39<br />
8 Fachbereiche.......................................................................................................... 40<br />
8.1 Angewandte Humanwissenschaften........................................................................ 40<br />
8.2 Bauwesen ................................................................................................................ 42<br />
8.3 Ingenieurwesen und Industriebereich...................................................................... 44<br />
8.4 Kommunikation und Medien .................................................................................... 51<br />
8.5 Sozial- und Gesundheitswesen ............................................................................... 53<br />
8.6 Wasser- und Kreislaufwirtschaft .............................................................................. 56<br />
8.7 Wirtschaft................................................................................................................. 58<br />
Anhang ................................................................................................................................. 62<br />
Anhang 1: „Entwicklung der Drittmittelaufkommen gelistet nach<br />
Fachbereichen/Instituten in den Jahren 2003 – <strong>2008</strong>/Stand Januar 2009“ ............. 62<br />
Anhang 2: Entwicklung der Studierendenzahlen für die akademischen Studienjahre<br />
1999 bis WS <strong>2008</strong>/09 .............................................................................................. 63<br />
Anhang 3: Career Center .......................................................................................................... 65<br />
Anhang 4: Bachelor-Studiengänge an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH).................... 68<br />
Anhang 5: Master-Studiengänge an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)....................... 69<br />
Anhang 6: Weiterbildungsangebote an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) .................. 70<br />
Seite 3
1 Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
1.1 Ausbildungskapazität und Struktur des Lehrangebots<br />
Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen erreichte <strong>2008</strong> einen vorläufigen Höhepunkt1 und<br />
wird in den folgenden Jahren noch ansteigen, da auch 2009 Studierende aus den letzten<br />
Diplomstudiengängen zeitgleich mit den Absolventen der ersten Bachelorstudiengänge ihr Studium<br />
abschließen werden.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat die Herausforderung, den doppelten Abiturjahrgang<br />
sowohl 2007/08 als auch <strong>2008</strong>/09 zu bewältigen, erfolgreich angenommen. Sie hat die<br />
hierfür zusätzlich benötigte Ausbildungskapazität nicht nur als Last, sondern auch als Chance<br />
begriffen, nämlich die Wahrnehmung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gerade in den<br />
Bereichen zu schärfen, in denen langfristig Auslastungsprobleme entstehen könnten. So hat die<br />
<strong>Hochschule</strong> zum WS 2007/08 die laut Kapazitätsverordnung vorgegebene Zulassungszahl um<br />
160 Studienplätze erhöht. Davon wurden 133 besetzt. Auch für <strong>2008</strong>/09 wurden weitere zusätzliche<br />
Studienplätze angeboten, da die „zweite“ Welle von der <strong>Hochschule</strong> erwartet wurde2.<br />
Der Hochschulpakt, der von Bund und Ländern zur Bewältigung des zusätzlich erwarteten Studierendenbergs<br />
vorerst bis 2010 aufgelegt wurde, gibt den neuen Bundesländern die Möglichkeit,<br />
zusätzliche Mittel zu erhalten, wenn sie die Studierendenzahlen auf dem Niveau von 2005<br />
halten. Dies bedeutet aber auch, dass die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) aufgrund der<br />
heruntergefahrenen Studienplätze auch in den kommenden Jahren eine Überlast zumindest auf<br />
dem bisherigen Niveau fahren muss. Die Tatsache, dass von den Studienanfängern in den<br />
grundständigen Studiengängen (1. Fachsemester) im Jahr <strong>2008</strong> nur etwa 85 % die Bedingung<br />
des Hochschulpaktes (1. Hochschulsemester) erfüllten, macht dieses Problem deutlich: Um die<br />
Bedingungen des Hochschulpakts zu erfüllen, müssen wesentlich mehr Studierende als im<br />
Hochschulstrukturplan vorgesehen zugelassen werden, sodass die Überlast unter diesen Bedingungen<br />
„konserviert“ wird. Da dieser Prozentsatz jährlich schwankt und nicht prognostizierbar<br />
ist, wird deutlich, dass die Erfüllung der Zielzahl des Hochschulpakts nur sehr indirekt von<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gesteuert werden kann.<br />
Im Hinblick auf die demographische Entwicklung3 in den neuen Ländern sollten die <strong>Hochschule</strong>n<br />
also nicht an ihren aktuellen Studierendenzahlen gemessen werden, sondern an ihrer Leistungsfähigkeit,<br />
wobei der im Hochschulstrukturplan festgelegten Zielzahl an Studienplätzen eine<br />
besondere Bedeutung zukommt.<br />
1.1.1 Kapazitätsberechnung<br />
Die Kapazitätsberechnung für die Aufnahmekapazitäten an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) folgt den Vorgaben des Kultusministeriums und sorgt für eine den Personalkapazitäten<br />
entsprechende Zuordnung von Studienanfängern in den Fachbereichen und deren Studiengängen.<br />
Der Wegfall der CNWs als gesetzliche Vorgabe und deren Ersetzung durch die quantitativen<br />
Studienpläne der jeweiligen Curricula erfordern eine ganz neue strategische Steuerung<br />
seitens der <strong>Hochschule</strong>. Die Aufnahmekapazität in grundständigen BA-Studiengängen ist dabei<br />
einer der wichtigsten Parameter. Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erfüllte die Zahl der<br />
Studienanfänger in grundständigen Angeboten in den Jahren 2006, 2007 und <strong>2008</strong> deutlich<br />
über die angesetzten 1.053 Studienplätze hinaus.4 <strong>2008</strong> wurden 1.409 Studierende in die<br />
grundständigen Studiengänge immatrikuliert, wovon 1.208 Studierende zum ersten Mal ihr<br />
Studium an einer <strong>Hochschule</strong> begonnen haben. Somit wurde die Zielzahl der <strong>Hochschule</strong> im<br />
Rahmen des Hochschulpakts 2020 um mehr als 10 % übertroffen.<br />
1 Detaillierte Informationen (Grafiken) dazu im Anhang 2 Entwicklung der Studierendenzahlen für die akademischen<br />
Studienjahre 1999 bis WS 08/09<br />
2 <strong>Rektoratsbericht</strong> der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) 2007; S. 14<br />
3 Zu den Marketingaktivitäten der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vgl. Kapitel 6<br />
4 Vgl. Aufnahmekapazitäten der staatlichen <strong>Hochschule</strong>n im Studienjahr <strong>2008</strong>/09, Kultusministerium des Landes<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Seite 4
Bezüglich der Fächergruppen gemäß den Vorgaben der Zielvereinbarungen bzw. des Hochschulstrukturplans<br />
ist und bleibt die Ausbildung gewährleistet.<br />
1.1.2 Steuerung der Kapazitäten<br />
Für die langfristige Steuerung der Kapazitäten innerhalb der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) kommt seit 2007 ein internes Kapazitätsmodell zum Einsatz, das inzwischen gemeinsam<br />
mit den Fachbereichen mit Daten gefüllt und <strong>2008</strong> bereits einmal aktualisiert wurde. Das interne<br />
Kapazitätsmodell wurde hochschulweit kommuniziert. Er dient als Entscheidungsbasis für die<br />
Einrichtung neuer Studiengänge und wird zur Grundlage für die Dienstleistungsvereinbarungen<br />
zwischen Fachbereichen. Sukzessive werden mit den Fachbereichen Vereinbarungen über das<br />
interne Kapazitätsmodell geschlossen.<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> war vor allem für die Positionierung innerhalb der zweiten Stufe des Bologna-<br />
Prozesses wichtig. Fragen der Ausrichtung der Masterstudiengänge im Sinne von Durchlässigkeit,<br />
Berufsbefähigung und bundesweiter und internationaler Konkurrenzfähigkeit werden nicht<br />
nur in den Fachbereichen, sondern auch hochschulweit intensiv diskutiert.<br />
Die Weiterbildung hat sich inzwischen als dritte Säule neben Lehre und Forschung etabliert,<br />
denn es sind zahlreiche neue Strukturen und Weiterbildungsangebote entstanden. Das Zentrum<br />
für Weiterbildung ist inzwischen eine bekannte und nachgefragte Anlauf- und Koordinationsstelle<br />
in der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH).<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat ihr Studienprogramm schon zum WS 2005/06 flächendeckend<br />
im Sinne des Bologna-Prozesses umgestellt, sodass die gegenwärtige Ausbildungsstruktur<br />
durch ein bereits mehrjährig laufendes, umfangreiches Bachelor-Programm und<br />
ein inzwischen fast vollständig angelaufenes Master-Programm geprägt wird. Zu 90 % gibt es<br />
derzeit konsekutive Master-Angebote für die Bachelorstudiengänge.<br />
<strong>2008</strong> sind die letzten Diplomstudiengänge in der RSZ ausgelaufen, allerdings bedeutete das in<br />
der Realität, dass die Abschlussarbeiten der alten Diplomstudiengänge und der neuen Bachelorstudiengänge<br />
aufgrund der unterschiedlichen Studienlänge alle in das Jahr <strong>2008</strong> fielen, was<br />
eine enorme zusätzliche Belastung für alle Kolleginnen und Kollegen darstellte. Da die Betreuung<br />
von Abschlussarbeiten nicht kapazitätswirksam ist, war die Herausforderung besonders<br />
hoch, wurde jedoch mit hohem Engagement gemeistert.<br />
Die Masterprogramme der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) sind inzwischen zunehmend<br />
interdisziplinär. Diese Studiengänge werden für Studierende der beteiligten Disziplinen geöffnet,<br />
sodass Interdisziplinarität als entscheidendes Kriterium nicht nur von den Lehrenden, sondern<br />
auch von den Studierenden gelebt wird, was immer mehr zum essentiellen Kriterium beruflicher<br />
Praxis wird. Diese Masterprogramme vor allem lassen abgesicherte Aussagen über die überregionale<br />
Attraktivität der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) zu.<br />
Als Herausforderungen für die Verwaltung bei der Umstellung auf die gestuften Studiengänge<br />
stellt sich vor allem die komplette Neuerstellung aller Studiendokumente für die neuen Studiengänge<br />
dar. Die Erarbeitung von Musterordnungen für die neuen Bachelor- und Master-Studiengänge<br />
in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, dem Dezernat für Studentische und Akademische<br />
Angelegenheiten, der Senatskommission für Studium und Lehre sowie dem Prorektorat<br />
für Studium und Lehre machte die zeitnahe und flächendeckende Erstellung und Aktualisierung<br />
der Prüfungs- und Studienordnungen erst möglich. Nur ein Fakt soll die enorme Arbeitslast in<br />
diesem Bereich illustrieren: zu fast jedem Studiengang existiert inzwischen eine erste Änderungssatzung,<br />
die sich zumeist aus den Ergebnissen der Akkreditierung ableiten ließ. So wurden<br />
<strong>2008</strong> 18 Änderungssatzungen von Prüfungs- und Studienordnungen beschlossen und veröffentlicht.<br />
Weiterhin wurden 12 weitere Prüfungs- und Studienordnungen für neue Studiengänge<br />
in den Gremien der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) beschlossen.<br />
Das ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) erfordert die Erarbeitung des<br />
Diploma Supplements für alle Studiengänge. Es liegt für die neuen Studiengänge vollständig<br />
vor und wird zusammen mit Zeugnissen und Abschlussurkunden an die Absolventen ausgereicht.<br />
Seite 5
1.2 Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master)<br />
1.2.1 BA-Studiengänge<br />
Entsprechend der Zielvereinbarung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit dem Kultusministerium<br />
wurden inzwischen alle 24 benannten grundständigen BA-Studiengänge5 eingeführt.<br />
Außerdem wurde auf Wunsch der Staatskanzlei (PSC) zum WS <strong>2008</strong>/09 ein Bachelorstudiengang<br />
„Soziale Dienste in der Justiz“ eingerichtet, der sich eng an den B.A. Soziale Arbeit<br />
anlehnt. Vom Ministerium für Wirtschaft wird der Bachelorstudiengang „Angewandtes Innovationsmanagement<br />
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ gefördert, der ebenfalls <strong>2008</strong> begann<br />
und auf bereits länger laufende Weiterbildungsprogramme mit Zertikatsabschluss aufsetzt.<br />
Dieser Bachelor ist als berufsbegleitendes Fernstudium konzipiert.<br />
Über die Zielvereinbarung hinaus wurde am Fachbereich Bauwesen zum WS <strong>2008</strong>/09 ein<br />
neuer grundständiger Studiengang eingeführt: der Bachelorstudiengang Berufsbildung, Fachgebiet<br />
Bautechnik (in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>). Nach einigen<br />
Irritationen bezüglich der Interpretation von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, die<br />
die Beteiligung von Fachhochschulen an Studiengängen des Lehramts für Berufsbildung<br />
betreffen, steht der Abschluss entsprechender Studiendokumente und eines Kooperationsvertrages<br />
kurz vor dem Abschluss. Die Genehmigung zur Durchführung des Studiengangs an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) durch das Kultusministerium ist nach Abschluss der<br />
Akkreditierung des gemeinsamen Studiengangs in Aussicht gestellt.<br />
In Ausführung der Koalitionsvereinbarung wurde die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
durch das Kultusministerium gebeten, einen BA-Studiengang „Bildung, Erziehung und<br />
Betreuung im Kindesalter – Leitung von Kindertageseinrichtungen“ zum WS <strong>2008</strong>/09 einzurichten.<br />
Der Studiengang ist nach § 9 HSG LSA genehmigt. Das Ministerium hat in seiner Stellungnahme<br />
vom 25.01.<strong>2008</strong> festgestellt, dass die Vorleistungen hinsichtlich der Personalkapazitäten<br />
für diesen Studiengang in der nächsten Zielvereinbarung über die Stellenentwicklung an<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) (ab 2010) Berücksichtigung finden werden. Damit gab<br />
es <strong>2008</strong> Planungssicherheit, und die Planung des Studiengangs wurde intensiv im Fachbereich<br />
Angewandte Humanwissenschaften unter Beteiligung von sachsen-anhaltinischen Trägern,<br />
Kita-Leiter/-innen, Vertreter/-innen aus dem Sozial- und Kultusministerium und Gewerkschaftsvertreter/-innen<br />
vorangetrieben. Leider hat die Bewerberlage für die Kernprofessur „Pädagogik<br />
der frühen Kindheit“ eine zweite Ausschreibungsrunde erforderlich gemacht, sodass der Start<br />
des Studiengangs auf das SoS 2009 verschoben werden musste. Die Curriculumsentwicklung<br />
und die Vorbereitung der Akkreditierungsunterlagen wurden aber in <strong>2008</strong> soweit vorangetrieben,<br />
dass alle Dokumente im Januar bzw. Februar 2009 die Gremien passiert haben.<br />
1.2.2 MA-Studiengänge<br />
Die i.d.R. verzögerte Einführung der MA-Studiengänge6 gegenüber dem Startbeginn der BA-<br />
Studiengänge ergibt sich aus der konsekutiven Studienstruktur, weshalb die Einführung der<br />
MA-Studiengänge den BA-Studiengängen zeitversetzt folgt. Mit den oben genannten Einführungszeitpunkten<br />
erfüllt die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) alle in der Zielvereinbarung<br />
genannten Verpflichtungen zur BA-/MA-Struktur.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) sieht sich ihren Absolventinnen und Absolventen<br />
gegenüber in der Pflicht, ihnen ein spezifisches, dem aktuellen Markt angepasstes Programm<br />
an Masterstudiengängen anzubieten. Innerhalb der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gab<br />
es in den letzten zwei Jahren eine intensive Auseinandersetzung über die strategische Ausrichtung,<br />
vor allem der MA-Studiengänge, die neben der fachbezogenen Diskussion in den<br />
Fachbereichen vor allem auch in der hochschulweiten MasterPlanerRunde unter Leitung des<br />
Prorektorats für Studium und Lehre geführt wurde.<br />
In Folge solcher Diskussionen wurden einzelne Masterprogramme komplett überarbeitet und<br />
unter Berücksichtigung der gesamten Hochschullandschaft des Landes Sachsen-Anhalt deut-<br />
5 eine genaue Auflistung der BA-Studiengänge ist im Anhang 4 zu finden<br />
6 eine genaue Auflistung der MA-Studiengänge ist im Anhang 5 zu finden<br />
Seite 6
lich in ihrem Profil geschärft. Zu nennen seien hier der MA Soziale Dienste in der alternden<br />
Gesellschaft (ehemals MA Soziale Arbeit) oder der MA Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung<br />
(ehemals MA Gesundheitsförderung und –management).<br />
Wie bereits ausgeführt, fokussiert eine strategische Ausrichtung für die Masterprogramme vor<br />
allem auf Interdisziplinarität, sodass die MA-Studiengänge sich nicht der intensiven Vertiefung<br />
einer einmal gewählten Fachrichtung widmen, sondern eher der Annäherung an benachbarte<br />
Fachdisziplinen.<br />
Damit treffen in den Masterprogrammen Studierende mit unterschiedlichen grundständigen<br />
Abschlüssen aufeinander. Interdisziplinarität als Kernidee für Masterprogramme gehört zur<br />
Strategie der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), stellt aber die Trennung in konsekutive und<br />
nicht-konsekutive Programme grundsätzlich in Frage, da diese Unterscheidung, so sie überhaupt<br />
Sinn macht, nur von den Studierenden aus gedacht werden kann, jedoch nicht für einzelne<br />
Studiengänge. Je nach grundständigem Studiengang kann dasselbe Masterprogramm für<br />
den einen Studierenden eine konsekutive Fortsetzung seiner akademischen Bildung sein, während<br />
es für den Kommilitonen eine nicht-konsekutive Fortsetzung ist. Die Einteilung der Studienprogramme<br />
erscheint in dieser Hinsicht überdenkenswert.<br />
Die Übergangsquoten zwischen Bachelor und Master differieren je nach Fachgebiet und fachspezifischen<br />
Erfordernissen; es wird deshalb keine hochschulweite Quotierung, sondern lediglich<br />
eine fachspezifische geben. Die Interdisziplinarität macht darüber hinaus eine fachspezifische<br />
Quotierung überflüssig. Es gibt darüber hinaus auch Planungen für MA-Studiengänge<br />
jenseits der Zielvereinbarungen, die vor allem im Bereich der Weiterbildung angesiedelt sein<br />
werden (siehe dazu den Hochschul-Entwicklungsplan <strong>2008</strong>-2010).<br />
Neben derzeit dezidiert berufsbegleitend angelegten Studiengängen gibt es weitere, vor allem<br />
MA-Studiengänge, die individuell eine Berufstätigkeit ermöglichen, weil sie Teilzeitoptionen<br />
nicht nur wegen einer speziellen sozialen Situation ermöglichen, sondern explizit wegen paralleler<br />
Berufstätigkeit.<br />
1.2.3 Akzeptanz der Abschlüsse<br />
Zur Berufsfähigkeit bzw. zu den Karriereoptionen der Absolventinnen und Absolventen können<br />
derzeit noch keine Aussagen gemacht werden. Die Umstellung auf BA-Studiengänge wurde<br />
zum WS 2005/06 vollzogen, sodass die Absolventen die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
erst nach dem SoS <strong>2008</strong> verlassen werden. Insofern ist noch keine repräsentative Absolventenzahl<br />
vorhanden. Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) befindet sich im Dialogprozess<br />
mit Arbeitgebern, um die Akzeptanz für die neuen Abschlüsse zu erhöhen.<br />
Das Fehlen klarer Standards bezüglich der Studienstruktur in Bachelor- und Masterprogrammen<br />
hinsichtlich Länge und vergebener Credits sowohl im Land als auch bundesweit als auch<br />
sogar innerhalb von Fächergruppen erweist sich in der Praxis als echtes Problem, wenn ein<br />
sechssemestriger Bachelor mit 180 Credits auf einen dreisemestrigen Master mit 90 Credits<br />
trifft.<br />
Die Vorgabe der Kultusministerkonferenz, dass für den Master-Abschluss 300 Credits erworben<br />
sein müssen, erweist sich, unter dem Aspekt der Mobilität, der ja eine zentrale Stellung innerhalb<br />
des Bologna Prozesses einnimmt, als Bumerang. Auch wenn die jeweiligen konsekutiven<br />
Programme jeder <strong>Hochschule</strong> natürlich die 300 Credits erfüllen, so bleibt die Einschränkung<br />
beim Wechsel zwischen <strong>Hochschule</strong>n. Sicher ist das kein Massenphänomen, sondern bleibt<br />
eher eine Randerscheinung.<br />
Derzeit geht die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit dem Problem sehr pragmatisch um.<br />
Die dreisemestrigen Master sehen einen Passus vor, der es sechssemestrigen Bachelor-Absolventen<br />
ermöglicht, zusätzliche 30 Credits vor Beginn des Masterstudiums zu erwerben. Damit<br />
gehen wir als „aufnehmende“ <strong>Hochschule</strong> in die Offensive. Den Fachbereichen, die sechssemestrige<br />
Bachelor anbieten, wird empfohlen, in Einzelfällen den Bachelor-Studierenden die<br />
Möglichkeit einzuräumen, durch zusätzliche Leistungen die fehlenden 30 Credits zu erwerben.<br />
Allerdings ist das hochproblematisch, da dieser Mehraufwand erstens nicht durch unsere Kapazität<br />
gedeckt ist und zweitens ein planmäßiges Überschreiten der Regelstudienzeit bedeutet.<br />
Aus unserer Sicht wären an dieser Stelle bildungspolitische Vorgaben sehr hilfreich gewesen.<br />
Deshalb hat die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) dieses Problem bereits an die Hochschulrektorenkonferenz<br />
(HRK) herangetragen.<br />
Seite 7
Besonders erfolgreich war die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in der Anerkennung der<br />
Qualifikation ihrer Absolventen des Masterstudiengangs "Rehabilitationspsychologie". Diese<br />
erfüllen in Absprache mit den Ministerien (MK und MS) des Landes Sachsen-Anhalt die Zugangsvoraussetzungen<br />
nach § 5(2) Ziff. 1a PsychThG und sind somit für eine entsprechende<br />
weiterführende Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten qualifiziert.<br />
Ferner stellen die Abschlüsse im Bachelor-Studiengang "Rehabilitationspsychologie" bzw. im<br />
von ihm abgelösten Diplom-Studiengang "Rehabilitationspsychologie", die ebenfalls an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erworben werden bzw. wurden, eine Zugangsvoraussetzung<br />
zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten dar.<br />
1.3 Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden,<br />
Absolventenquote<br />
1.3.1 Auswahl von Studienbewerbern<br />
Trotz der mit dem reformierten Hochschulzulassungsgesetz möglich gewordenen Auswahl der<br />
Studierenden hat die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im WS <strong>2008</strong>/09 lediglich in 3 der 9<br />
NC-Studiengänge eine Auswahl durchgeführt. Es handelt sich um Gebärdensprachdolmetschen,<br />
Journalistik/Medienmanagement und Rehabilitationspsychologie. Hier werden neben der<br />
Abiturnote ein fachspezifischer Studierfähigkeitstest, studiengangspezifische Berufsausbildung<br />
bzw. -tätigkeit und Auslandserfahrungen als weitere Kriterien für die Auswahl herangezogen.<br />
In allen anderen NC-Studiengängen wurden die Plätze nur nach Abiturnote und Wartesemestern<br />
vergeben, da die Wirkung der aufwendigen Auswahlverfahren durch das gleichzeitig<br />
schlechte Annahmeverhalten konterkariert wurde. Die Annahmequote war so gering, dass am<br />
Ende für die zu vergebenden 60 % der Plätze Zulassungen für den gesamten in Frage kommenden<br />
Bewerberkreis erteilt wurden, der seinerseits aber nur durch die Abiturnote bestimmt<br />
war.<br />
Aus diesem Grunde wurde im WS <strong>2008</strong>/09 nach zweijährigen Erfahrungen auf Auswahlgespräche<br />
(Rehabilitationspsychologie) verzichtet. Das bereits seit mehreren Jahren festzustellende<br />
schlechte Annahmeverhalten der Bewerber hat sich im WS <strong>2008</strong>/09 fortgesetzt. Da davon alle<br />
<strong>Hochschule</strong>n betroffen sind, könnte nur durch eine zentrale Servicestelle, die die Bewerbungen<br />
vorsortiert und Ortspräferenzen berücksichtigt, der Aufwand für die einzelnen <strong>Hochschule</strong>n<br />
minimiert werden.<br />
Um Gründe für die Nichtannahme vergebener Studienplätze zu erfahren, wurde im Jahr 2006<br />
eine Befragung der „abgesprungenen“ Bewerber durchgeführt. Da die Rücklaufquote hoch war<br />
und für einige Fachbereiche statistisch relevante Ergebnisse entstanden sind, wird diese Befragung<br />
in Zukunft zweijährlich durchgeführt. Versetzt dazu wird es eine Befragung der Erstsemester<br />
zu ihrer Motivation, den Studienplatz anzunehmen, geben. Durch diesen wechselnden<br />
Rhythmus sollte sich in der Zukunft eine gute Datenlage ergeben, um auf die Studierendenentwicklung<br />
angemessen reagieren zu können.<br />
1.3.2 Betreuung der Studierenden<br />
Die Betreuung der Studierenden im neuen Studiensystem benötigt besondere Aufmerksamkeit.<br />
Eine konkrete Maßnahme war die unkomplizierte Einrichtung eines seit Sommer 2006 laufenden<br />
Tutorienprogramms der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) – finanziert aus den Langzeitstudiengebühren<br />
–, das vor allem Bachelor-Studierenden effektiv hilft. In <strong>2008</strong> wurden 54<br />
Tutorien finanziert.<br />
1.3.3 Absolventenquote und Abbrecherquote<br />
Durch die Umstellung auf das gestufte Studiensystem war die Beobachtung der relevanten<br />
Daten sehr erschwert. Absolventenquoten können für die BA-Studiengänge noch nicht aussagekräftig<br />
berechnet werden7, da es den Studierenden der ersten Matrikel der sechssemestrigen<br />
7 Es besteht nur die Regelstudienzeitquote bzw. eine Abbrecherquote innerhalb der Regelstudienzeit. Siehe auch<br />
7.1.2.2.1<br />
Seite 8
Studiengänge erst zum Ende des SoS <strong>2008</strong> möglich war, ihren Abschluss zu machen. Die<br />
Studierenden der siebensemestrigen Studiengänge befinden sich gegenwärtig noch in der<br />
Regelstudienzeit. Ähnliche Probleme treffen genau genommen auch auf die Bewertung der<br />
Abbrecherquote zu. Natürlich ermittelt die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) nach ihren<br />
Definitionen8 verschiedene vorläufige Quoten, welche auch mit den Fachbereichen analysiert<br />
und diskutiert werden. Ministerium und Landesrektorenkonferenz werden zusätzlich ein Verfahren<br />
zur gesicherten statistischen Erhebung von Abbrecherquoten entwickeln, sodass auch eine<br />
Vergleichbarkeit der studiengangsspezifischen Größen über die <strong>Hochschule</strong>n hinweg gewährleistet<br />
ist.<br />
1.4 Weiterbildung/Lebenslanges Lernen<br />
Im Rahmen der Weiterbildung erfolgte <strong>2008</strong> der strukturelle und inhaltliche Auf- und Ausbau<br />
entsprechend den Zielvereinbarungen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit dem Kultusministerium<br />
Sachsen-Anhalt und der Umsetzung des Weiterbildungskonzepts der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH).<br />
Im Februar <strong>2008</strong> wurde die Gründung des Zentrums für Weiterbildung durch den Senat der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) beschlossen. Das Zentrum ist – strukturell gesehen –<br />
eine zentrale Einrichtung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH). Es agiert hochschulintern<br />
als Schnittstelle zwischen der Hochschulleitung und den Fachbereichen. <strong>Hochschule</strong>xtern<br />
nimmt das Zentrum für Weiterbildung eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft/Gesellschaft<br />
ein. Das Zentrum ist eine Servicestelle für alle Weiterbildungsfragen<br />
innerhalb und außerhalb der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit koordinierender Funktion.<br />
Die operativen Aufgaben des Zentrums für Weiterbildung sind Bedarfsanalysen, Programmplanungen,<br />
didaktische Methodenberatung, Beratung in der Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Finanzierungsberatung, Qualitätssicherung, Kursentwicklung, Lernberatung, Dozentenvermittlung<br />
und eigene Forschungstätigkeit.<br />
Im Rahmen des strukturellen Aufbaus und der weiteren Verankerung der Kernaufgabe Weiterbildung<br />
an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wurde im Oktober <strong>2008</strong> die Bildung einer<br />
Senatskommission für Weiterbildung beschlossen. Sie widmet sich der internen interdisziplinären<br />
Vernetzung der Weiterbildungsangebote der Fachbereiche mit den Strukturen der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH). Diese interdisziplinäre Kommission arbeitet gemeinsam<br />
am Aufbau, der Durchsetzung und am Erfolg der wissenschaftlichen Weiterbildung der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH). Sie entwickelt gemeinsam operationale Ziele und ist an der<br />
Formulierung eines Marketingkonzeptes für wissenschaftliche Weiterbildung für die <strong>Hochschule</strong><br />
beteiligt. Dieses Marketingkonzept ist im Einklang mit dem Weiterbildungskonzept zu sehen,<br />
welches periodisch überarbeitet wird.<br />
Weiterhin bestellte die Hochschulleitung im November <strong>2008</strong> zwei Rektoratsbeauftragte für<br />
Weiterbildung aus den Reihen der Professorinnen und Professoren, die jeweils für den Standort<br />
<strong>Magdeburg</strong> und den Standort <strong>Stendal</strong> zuständig sind. Die Rektoratsbeauftragten sollen<br />
Strukturen und Prozesse hochschulweit und fachbereichsübergreifend entwickeln und etablieren.<br />
Wichtig dabei ist, dass es sich um lehrende und forschende Kollegen handelt, die ihre<br />
direkten Erfahrungen in den Lösungsprozess einbringen.<br />
Die Rektoratsbeauftragten haben Stabsstellencharakter und unterstützen direkt die Hochschulleitung,<br />
indem sie als Bindeglied zwischen dem akademischen Bereich der Fachbereiche, den<br />
Gremien der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) und der Verwaltung agieren. Die Rektoratsbeauftragten<br />
sind klar der Senatskommission für Weiterbildung zugeordnet, arbeiten dort aktiv<br />
sowie inhaltlich gestaltend mit und leiten diese. Sie berichten jährlich im Senat. Eine enge und<br />
intensive Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung ist selbstverständlich.<br />
Im Zentrum für Weiterbildung wurde <strong>2008</strong> im Rahmen der Kursentwicklung das Studium<br />
Generale konzeptionell erarbeitet und umgesetzt. Die zentrale Aufgabe des Studium Generale<br />
ist die fächerübergreifende Weiterbildung an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) durch<br />
die Schaffung inter- und transdisziplinärer Lehrangebote mit dem Ziel, die Studierenden dann<br />
8 Vgl. hierzu Kapitel A 7.1.2.2.1<br />
Seite 9
zu befähigen, über ihre Spezialausbildung hinaus allgemeine Folgen der Anwendung technischer<br />
und wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beurteilen und reflexiv-verantwortungsbewusst<br />
handlungskompetent zu sein. Das Studium Generale folgt zwei Hauptlinien. Zum einen wird der<br />
akademische Bereich betont, der darauf fokussiert, fachspezifische und allgemeinbildende<br />
Aspekte unter anderem in Auseinandersetzung zwischen Mensch und Gesellschaft interdisziplinär<br />
umzusetzen. Zum anderen wird deutlich, dass die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
im Rahmen des Studium Generale durchaus Serviceleistungen einschließen könnte/sollte. Der<br />
Erwerb persönlicher Fähigkeiten, wie soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und Methodenkompetenz<br />
sowie Beratung entsprechend der weiteren beruflichen Planung für die Studierenden<br />
wären gute Beispiele für ein verantwortungsbewusstes Handeln der <strong>Hochschule</strong> gegenüber<br />
ihren Studierenden, die den Kriterien des Studium Generale per definitionem entsprechen.<br />
Die Kurse des Studium Generale sind grundsätzlich nicht-obligatorische Lehrveranstaltungen.<br />
Als Orientierungsangebote können sie vor, während und nach dem Studium von Studierenden<br />
und Mitarbeitern der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) sowie öffentlich von externen<br />
Teilnehmern besucht werden. Der Umsetzung des Studium Generale ging eine Ermittlung von<br />
Bildungsbedarfen unter Studierenden und Mitarbeitern der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) voraus, die im Ergebnis ein hochschulspezifisches Bedarfsprofil erkennen ließ. Das Profil<br />
ist in Sprachen, Kreatives, Computer und Programme, Beruf und Zukunft, Persönliche Fähigkeiten,<br />
Fachwissen sowie Mensch und Gesellschaft zu kategorisieren. Die Rücklaufquote lag<br />
bei ca. 17 % (526 Fragebögen) aller Studierenden. Die Ergebnisse zu den „gewünschten“<br />
Rahmenbedingungen sind eindeutig: 86 % der Studierenden wollen das Studium Generale in<br />
ihren Stundenplänen integrieren. 68,5 % der Studierenden favorisieren Seminare und 65 % der<br />
befragten Studierenden Übungen (Mehrfachnennungen möglich). Dementsprechend werden<br />
kleinere Lerngruppen von circa 20 Teilnehmern pro Kurs favorisiert (vgl. Studie „Wünschen Sie<br />
sich Wissen“, April/Mai <strong>2008</strong>).<br />
Die Befragung hatte ferner zum Ziel, Studierende zur Teilnahme am Studium Generale zu<br />
gewinnen, in dem man ihnen die Kompetenz und Möglichkeit einräumt, ihr Studium über das<br />
Angebot des jeweiligen Studiengangs hinaus selbst flexibel gestalten zu können - eine Marketingstrategie,<br />
die sich auszeichnete. Im WS <strong>2008</strong> wurden 19 Kurse im Studium Generale<br />
angeboten, in die sich 217 Studenten einschrieben.<br />
Träger des Studium Generale ist das Zentrum für Weiterbildung, das in der Planung und<br />
Umsetzung von Kursen zum Themengebiet ‚Beruf und Zukunft’ vom „Transferzentrum –<br />
Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte in<br />
KMU des Landes Sachsen-Anhalt“ tatkräftig unterstützt wird. Das Transferzentrum, welches seit<br />
Januar <strong>2008</strong> als Projekt des Ministerium für Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) durchgeführt wird, hat die Aufgabe, Angebote in Kooperation<br />
mit der Wirtschaft auf der Grundlage des Profils der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
zu entwickeln und umzusetzen sowie regionale Netzwerke aufzubauen.<br />
<strong>2008</strong> wurde die interne Weiterbildung der Mitarbeiter der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
als weitere inhaltliche Aufgabe des Zentrums für Weiterbildung konzeptionell ausgebaut. An<br />
den Standorten <strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong> fanden Englischkurse für Mitarbeiter statt, die als<br />
Anfänger-Kurse (A1 Advanced Beginners), Mittelstufen-Kurs (A2 Intermediate), Fortgeschrittenen-Kurs<br />
(B1 Upper Intermediate) angeboten und von einer Vielzahl von Mitarbeitern angenommen<br />
wurden. Im WS nahmen insgesamt 42 Mitarbeiter beider Standorte an den Kursen teil.<br />
Seit Oktober <strong>2008</strong> wurde mit der Vorbereitung hochschuldidaktischer Kurse für Lehrende der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) begonnen. Die Initiierung dieser internen Weiterbildung<br />
an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) geht auf das Bestreben und die Erarbeitung eines<br />
Konzepts zurück, welches vom Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft im letzten Quartal<br />
<strong>2008</strong> inhaltlich begleitet wurde und ab SoS 2009 für alle Lehrenden der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) angeboten werden soll.<br />
Das Ziel des Angebots hochschuldidaktischer Kurse ist es, die Lehrkompetenz auf Seiten aller<br />
Lehrenden zu erhöhen, die Karrierechancen des wissenschaftlichen Nachwuchses zu verbessern<br />
und die Studierzufriedenheit der Studierenden sowie die Erhöhung deren Leistungs- und<br />
Motivationspotenziale zu erhöhen.<br />
Seite 10
Für die Qualitätssicherung aller Angebote in der Weiterbildung wurde/wird ein Evaluationsbogen<br />
erarbeitet und eingesetzt.<br />
Die Formate in der Weiterbildung9 sind Bestandteil einer Weiterbildungsordnung, die in enger<br />
Zusammenarbeit des Zentrums für Weiterbildung mit der Verwaltung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) entstand. Zu jedem Format existiert ein Modell, welches den Prozessablauf<br />
und die Zuständigkeit von der Idee bis zur Umsetzung eines Weiterbildungsangebots regelt. Die<br />
Formate und Modelle in der Weiterbildung wurden dem Arbeitskreis Weiterbildung sowie der<br />
Kommission für Studium und Lehre vorgestellt und bilden einen Kernpunkt der Weiterbildungsordnung.<br />
Ein erster Entwurf der gesamten Weiterbildungsordnung wurde in einer ersten Lesung<br />
in der Kommission für Studium und Lehre diskutiert. Die Weiterbildungsordnung soll möglichst<br />
im Frühjahr 2009 beschlossen werden.<br />
Eine weitere konzeptionelle Aufgabe wird 2009 in der Erarbeitung eines Modells zur Anrechnung<br />
beruflicher Qualifikationen bestehen. Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) stellt es<br />
sich zur Aufgabe, auch Personen ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung die Möglichkeit<br />
zu eröffnen, nach individueller Prüfung einschlägiger und nachweisbarer beruflicher<br />
Qualifikationen und Kompetenzen einen akademischen Abschluss zu erwerben.<br />
1.5 Hochschulbibliothek<br />
Die Hochschulbibliothek als eine wichtige zentrale Einrichtung der Informationsversorgung<br />
bietet mit ihren Dienstleistungen eine Grundvoraussetzung für die Sicherung qualitativer<br />
Standards von Forschungsaufgaben und wissenschaftlicher Ausbildung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH). So ist ihr Gesamtbestand auf ca. 227.000 Lehrbücher, Monographien,<br />
Wörterbücher, Lexika, Gesetzessammlungen, audiovisuelle Medien, Normen und<br />
Periodika sowie 326 fortlaufend gehaltene Zeitschriften angewachsen.<br />
Dem Trend, in Bibliotheken nicht nur Printmedien vorzuhalten, sondern ebenso elektronische<br />
Publikationen anzubieten, wandten wir uns im Jahr <strong>2008</strong> verstärkt zu. Es wurden für beide<br />
Standorte 1142 e-books in Paketform zu den Themengebieten Wirtschaftswissenschaften,<br />
Technik und Informatik, Geisteswissenschaften sowie Medizin erworben/angeschafft. Die<br />
Hochschulangehörigen haben damit die Möglichkeit, in wissenschaftlicher Fachliteratur<br />
unabhängig von unseren Öffnungszeiten zu recherchieren und zu arbeiten, auch von ihrem<br />
heimischen Arbeitsplatz aus.<br />
Für den Standort <strong>Magdeburg</strong> kam der Erwerb einer Online-Ausgabe eines Handwörterbuches<br />
zur französischen Sprache, das wir bereits in Printform besitzen, mit der Lizenz für 5 gleichzeitige<br />
Zugriffe hinzu. Dieses ist sofort vom Fachbereich Kommunikation für dortige Lehrveranstaltungen<br />
genutzt worden. Daneben bietet die Bibliothek mehrere wichtige Datenbanken zur<br />
Nutzung an.<br />
Im Zusammenhang mit der Neuausstattung der Benutzerbereiche der Bibliothek im Sommer<br />
<strong>2008</strong> mit neuen Arbeitsplätzen (IGEL-Lösung statt vorheriger ThinClient-Lösung, für die es<br />
keinen Nachkauf gab) ist in der ersten Etage der Bibliothek ein spezieller Arbeitsplatz für den<br />
Zugriff auf FIZ-Technik geschaffen worden. Dabei handelt es sich um hochwertige technischwissenschaftliche<br />
Datenbanken.<br />
Die Onlinedienste der Bibliothek sind <strong>2008</strong> einmal um die Benachrichtigung der Nutzer von<br />
bereitliegenden Vorbestellungen per Mail erweitert worden (damit entfällt ein Teil der Portokosten<br />
der Bibliothek), andererseits um die Möglichkeit der Nutzer, in ihren Konten sehen zu<br />
können, wie oft sie ihre entliehenen Medien verlängert haben. Damit wurde eine größere<br />
Leihsicherheit für Nutzer erreicht.<br />
Die von der Bibliothek seit Jahren angebotenen Führungen sind schwerpunktmäßig auf die<br />
Befähigung der Nutzer zum Umgang mit Katalogrecherchen konzentriert worden, dabei hat sich<br />
9 Eine detaillierte Auflistung aller Weiterbildungsangebote an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ist im<br />
Anhang 6 nachzulesen.<br />
Seite 11
insbesondere die Schulung Studierender vor der Erstellung von Abschlussarbeiten über<br />
Recherchetechniken bewährt.<br />
Überlegungen sowie Vergleiche bzgl. einer Lösung des Problems des bargeldlosen Gebühreneinzuges<br />
in der Hochschulbibliothek haben bis zum Jahresende <strong>2008</strong> ihren Abschluss in der<br />
Entscheidung für ein Gebühreinzugsgerät, das mit den hier auf dem Campus verwendeten<br />
Karten von Intercard funktioniert, gefunden.<br />
Als erschwerend für die kontinuierliche Arbeit in der Bibliothek erwiesen sich <strong>2008</strong> sowohl der<br />
Wegfall einer festen Mitarbeiterin aus dem Ausleihbereich als auch die Handhabung des<br />
Einsatzes von Studierenden als geringfügig beschäftigte Mitarbeiter. Der Vorlauf für die<br />
dringend notwendige Nachbesetzung der Mitarbeiterstelle einer Diplombibliothekarin im Jahre<br />
2009 wurde durch die Ausschreibung noch im Jahr <strong>2008</strong> geschaffen. Damit wurde die Grundlage<br />
für eine fundierte Personalwahl gelegt.<br />
Das organisatorisch der Bibliothek angegliederte Hochschularchiv konnte im Jahr <strong>2008</strong> den<br />
Prozess der Sicherung des ihm übergebenen Schriftgutes der <strong>Hochschule</strong> durch Mikroverfilmung<br />
sowie Digitalisierung der Studentenakten aus <strong>Stendal</strong> weiterführen. Dies bedeutet<br />
weniger Papierlast im Archiv und dennoch dauerhafte und sichere Aufbewahrung wichtiger<br />
Daten und Unterlagen.<br />
1.6 Zentrum für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI)<br />
Einige Prozesse stellen die <strong>Hochschule</strong>n und deren IuK-Dienstleister vor neue Herausforderungen.<br />
Dazu gehören insbesondere der Bologna-Prozess, steigende Studierendenzahlen und<br />
damit verbundene Änderungen von Organisationsabläufen in den <strong>Hochschule</strong>n. Ein integriertes<br />
Informationsmanagement wird bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine wichtige<br />
Schlüsselrolle einnehmen. Diese Thematik wurde (angeregt und geleitet durch den Kanzler) in<br />
enger Zusammenarbeit mit allen Dezernentinnen und Dezernenten aufgegriffen, ausführlich<br />
diskutiert, und es wurden gemeinsam Lösungen und Wege aufgezeigt.<br />
Schwerpunkt der Aktivitäten im Berichtszeitraum bildeten die Planung und Einführung eines IT-<br />
Servicemanagements, welches in 2009 in Betrieb gehen soll. Es erfolgten die Grundkonfiguration<br />
aller Module, die Erfassung der Daten des ZKI-Dienstleistungskatalogs und der Test mit<br />
einem Fachbereich.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt war die Ablösung der unterschiedlichen und auf viele Server verteilten<br />
Nutzerauthentifizierung durch Umstellung auf zentrale LDAP-Nutzerauthentifizierung. Alle<br />
Dienste, die eine Authentifizierung verlangen wie LSF, WLAN, VPN, PC-Pools des ZKI, Web-<br />
Seiten der <strong>Hochschule</strong>, ftp/Downloadserver, u. a. m., nutzen nun ausschließlich den zentralen<br />
LDAP-Server. Ziel dieser Maßnahme sind die Vermeidung von Inkonsistenzen im Datenbestand,<br />
Erhöhung der Verfügbarkeit (z. B. durch redundanten LDAP-Server) und eine wesentliche<br />
Vereinfachung der Administration und Aktualisierung der Daten. Im Zuge der Umstellung<br />
auf die zentrale LDAP-Authentifizierung wurde die gesamte Windows-Domäne des ZKI<br />
umgestellt.<br />
Parallel dazu wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von zentralen Servern und<br />
Diensten durch Virtualisierung, Einrichtung redundanter Systeme und Datenhaltung im SAN<br />
(Speichernetzwerk) realisiert. Videokonferenzen auch mit internationaler Beteiligung werden<br />
immer mehr durchgeführt. Hier unterstützten wir bei der Vorbereitung und Durchführung mit den<br />
neuen HD Videokonferenzsystemen (Lifesize).<br />
In den Pools des ZKI wurden das Betriebssystem (103 Arbeitsplätze von Windows 2000 auf<br />
Windows XP) und Anwendungssoftware auf neue Releasestände umgestellt. In der Bibliothek<br />
wurden im Juli <strong>2008</strong> fünfunddreißig Thin Clients und der zugehörige Terminalserver durch<br />
neue, leistungsfähigere und durch das ZKI betreute Technik ersetzt.<br />
Zu den laufenden Aufgaben in <strong>2008</strong> gehörten der Ersatz und Einrichtung von PCs oder die<br />
Begleitung der Einführung neuer IT-Dienste in der Verwaltung und im Rektorat.<br />
In diesem Jahr erfolgte die Umstellung der elearning-Plattform WebCt auf die Plattform Moodle.<br />
Die Umstellung verlief problematisch, da sich seitens der umstellenden Firma doch Schwierigkeiten<br />
mit der Bereitstellung der Kurse in Moodle ergaben. Deshalb konnten <strong>2008</strong> in Moodle<br />
noch nicht alle der alten Kurse zur Verfügung gestellt werden. Durch eine Lizenzverlängerung<br />
Seite 12
erreicht wurden laufende Kurse in WebCT abgesichert. Das neue elearning-System „Moodle“<br />
wurde bisher gut angenommen. Dazu haben sicherlich auch die angebotenen Schulungen<br />
beigetragen, die weitergeführt und ausgebaut werden. Außerdem ist die Bereitschaft der<br />
Dozenten, dieses System zu nutzen, sehr hoch.<br />
Das ZKI hat ein neues Informationsssystem eingeführt. In den Häusern am Standort <strong>Magdeburg</strong><br />
und am Standort <strong>Stendal</strong> wurden Displays angebracht, die den Studierenden schnell einen<br />
Überblick erlauben, welche Lehrveranstaltungen gerade stattfinden bzw. welche Pools und wie<br />
viele Rechner zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die Veranstaltungen im jeweiligen Haus<br />
werden dazu aktuell aus HIS-LSF eingebunden, sodass Änderungen sofort nach außen<br />
sichtbar gemacht werden.<br />
Im Zuge der Sanierung des Gebäudes 3 auf dem <strong>Stendal</strong>er Campus wurden zwei neue PC-<br />
Pools mit insgesamt 54 PC-Arbeitsplätzen geschaffen. Die Seminarräume im neuen Gebäude<br />
verfügen über Medientische, die eine automatische Ansteuerung des Beamers von einem Thin-<br />
Client, einem DVD-Player und einem externen Laptop ermöglichen. Eine große Herausforderung<br />
war die Inbetriebnahme der Medien- und Steuerungstechnik Audimax. Das als Neu- bzw.<br />
Anbau am Standort <strong>Stendal</strong> an das Gebäude 3 realisierte Audimax mit 200 Sitzplätzen beinhaltet<br />
modernste Präsentationstechnik. Das Anwendungsspektrum reicht von Vorlesungen über<br />
Podiumsdiskussionen bis hin zu Videokonferenzen und Livestream. Zahlreiche hochschulinterne<br />
und externe Veranstaltungen konnten inzwischen im Audimax unter modernsten technischen<br />
Voraussetzungen erfolgreich durchgeführt werden.<br />
Das ZKI befasste sich eingehend mit der Thematik IT-Sicherheit und akuten Sicherheitsvorfällen.<br />
Eine exemplarische IT-Sicherheits-Risikoanalyse im Fachbereich Bauwesen konnte<br />
abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der Sicherheitsrahmenrichtlinie wurden fortgeführt. Mit<br />
der hochschulweiten Einführung von VPN (virtuelles privates Netz) für IT-Managementzugänge<br />
wurden vom ZKI die Vorraussetzungen geschaffen, um sichere Zugänge zu dezentralen<br />
Servern zu ermöglichen.<br />
Ende des Jahres <strong>2008</strong> wurde auf dem Campus <strong>Magdeburg</strong> eine neue WLAN-Infrastruktur<br />
installiert. Zusammen mit dem Managementsystem sind die neuen Accesspoints die Grundlage<br />
für eine neue, wesentlich sichere und schnellere WLAN-Generation, die im Jahr 2009 mit einem<br />
einfacheren und komfortableren Nutzerzugang vollendet werden soll. Ein Konzept zum Einsatz<br />
von Thin-Clients (Igel) und Applikationsservern in der Zentralverwaltung ist in der Entwicklung.<br />
Die Arbeitsplätze der Nutzer sollen sicherer funktionieren und die systemtechnische Betreuung<br />
soll erleichtert werden.<br />
Es wurde an einem Projektantrag „campus2go“ gearbeitet. Die Finanzierung sollte über<br />
Landesmittel erfolgen. Als wesentliche Inhalte wurden die Erweiterung und Verstetigung von<br />
online-Services, der mobile Zugriff auf Ressourcen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
mit (fast) allen mobilen IT-Systemen (z.Bsp. iPhone) von jedem Ort und die Etablierung eines<br />
Datawarehouse gesehen. Das Projekt muss überarbeitet und inhaltlich gekürzt werden, da nicht<br />
genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die LDVK (LandesDV-Kommission), die mit<br />
der Begutachtung beauftragt war, empfahl im Projektansatz die Fokussierung auf die Mobilität<br />
und Sicherheit mobiler IT-Systeme.<br />
Um die medientechnische Ausstattung der zentralen Hörsäle und Seminarräume auf aktuellen<br />
Stand zu bringen, wurde ein Konzept zu deren Neuausstattung entwickelt. Es wurde zur<br />
pauschalen Prüfung an die DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) gesandt. Diese befürwortete<br />
das Konzept prinzipiell. Die Umsetzung ist für 2009 geplant.<br />
Immer umfangreicher wird die medientechnische Beratung von Studierenden und Lehrenden,<br />
da die Vielfalt von technischen „Standards“ und deren Anwendungsmöglichkeiten kaum noch zu<br />
überblicken sind.<br />
Seite 13
2 Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer,<br />
Regionalbezug<br />
2.1 Drittmittelaufkommen F & E und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
Die Auflistung zur genauen<br />
• Entwicklung der Drittmittelaufkommen F & E<br />
• der Entwicklung der Weiterbildungsmaßnahmen und<br />
• der Summen Drittmittelaufkommen F & E und Weiterbildungsmaßnahmen<br />
nach Jahren und Fachbereichen/Instituten sortiert, finden sich im Anhang 1 unter Tabellen und<br />
Grafiken „Entwicklung der Drittmittelaufkommen, gelistet nach Fachbereichen/Instituten in den<br />
Jahren 2003 – <strong>2008</strong>“.<br />
2.2 Innovation/Wissens- und Technologietransfer und<br />
Existenzgründung Entwicklung der Strukturen<br />
Technologietransfer<br />
2.2.1 KAT – Ausbau von vier leistungsfähigen ingenieurwissenschaftlichen<br />
Kompetenzfeldern an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Um die avisierte Breitenwirkung von KAT und die praktische Umsetzung im Land zu forcieren,<br />
betreibt die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), neben dem weiteren Ausbau der vielfältigen<br />
belastbaren Kompetenzfelder (vgl. <strong>Rektoratsbericht</strong> 2007), seit Mitte des Jahre <strong>2008</strong> den<br />
Aufbau von Industrielaboren10.<br />
Industrielabore sind Labore der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), gegebenenfalls Komplementärlabore<br />
zu leistungsfähigen An-Instituten der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), die<br />
folgende Merkmale erfüllen:<br />
� Bearbeitung von Fragestellungen aus der Industriepraxis<br />
� Arbeit an konkreten, industriellen Bauteilen<br />
� Anwendung industrierelevanter Prozesse/Verfahren<br />
� Nutzung von Maschinen/Anlagen/Geräten aus der Industrie bzw. Prototypen für den<br />
Industrieeinsatz<br />
� Direkte Überführbarkeit der Arbeitsergebnisse<br />
� Durchführung der Arbeiten ggf. durch Mitarbeiter der Industrieunternehmen<br />
Der besondere Vorteil der Hochschulnähe ist durch folgende Merkmale gegeben:<br />
� Begleitung der Arbeiten durch ausgewiesene Experten (Professoren, Wissenschaftler)<br />
� Verfügbarkeit von modernstem Zusatzequipment (Spezialausrüstungen, Messgeräte<br />
etc.)<br />
� Nutzung der Infrastruktur der <strong>Hochschule</strong><br />
� Möglichkeit der Einbeziehung von Studenten in Abhängigkeit vom quantitativen und<br />
qualitativen Arbeitsaufwand<br />
� Unterstützung durch weiterführende ingenieurwissenschaftliche Methoden (Simulationen,<br />
Berechnungen etc.)<br />
10 Ein Industrielabor im Sinne des verwendeten Begriffs und des regionalen Auftrages an die Fachhochschulen ist<br />
eine Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung der <strong>Hochschule</strong>, die für Unternehmen der regionalen<br />
Wirtschaft eine zentrale Funktion als Informationslieferant/Testbedingung für die Bereiche Forschung,<br />
Entwicklung, prototypische Erprobung und Produktion hat.<br />
Seite 14
Die grundsätzliche Zielstellung liegt in der Nutzung innovativer, industrieller Fertigungssysteme<br />
zur prototypischen Erprobung der Herstellung neuer Produkte mittels „industrieller“ Fertigungsverfahren,<br />
die ausschließlich im Industrielabor zur Verfügung stehen. Dies ist eine entscheidende<br />
Voraussetzung zur signifikanten Reduktion der erforderlichen Zeit bis zur Markteinführung<br />
und somit auch für die zeitnahe Realisierung von Innovationen in der regionalen Wirtschaft.<br />
Voraussetzung für den Aufbau der Industrielabore waren bereits existierende belastbare<br />
Kompetenzfelder mit fortgeschrittenen wissenschaftlichen Vorarbeiten sowie bestehenden<br />
Partnernetzwerken, vorzugsweise mit der regionalen Wirtschaft. Unter diesen Aspekten werden<br />
die Kompetenzfelder Innovativer Maschinenbau durch funktionsoptimierten Leichtbau, Zerstörungsfreie<br />
Prüfverfahren für die Qualitätssicherung in Sachsen-Anhalts KMU sowie Innovative<br />
Fertigungsverfahren, CNC-Systeme und nachhaltige Produkte zu Industrielaboren ausgebaut.<br />
Die genannten Kompetenzfelder sind durch ein hohes Innovationspotential, nachweisbare<br />
Anwendungsrelevanz im Globalen Markt und speziell in der regionalen Wirtschaft, einen<br />
weitreichenden Erfahrungsschatz der verantwortlichen Wissenschaftler und bestehende<br />
Synergiepotentiale im Rahmen interdisziplinärer F&E-Aktivitäten gekennzeichnet.<br />
Neben den bereits verfügbaren wissenschaftlichen Kompetenzen, gegebenenfalls mit Alleinstellungsmerkmalen,<br />
sind speziell auch der hohe regionale Vernetzungsgrad in der Wirtschaft<br />
sowie die wissenschaftliche interdisziplinäre Kooperation innerhalb der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) von grundlegender Bedeutung für die nachhaltige Effektivität der im Aufbau<br />
befindlichen Industrielabore.<br />
Durch die verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen Innovationen und Synergien<br />
generiert werden. Die zu entwickelnden primär bedarfsorientierten, definitiv anwendungsrelevanten<br />
Lösungen werden konsequent in die regionale Wirtschaft getragen, wodurch die<br />
Verankerung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in der Region intensiviert und Nutzen für<br />
die Wirtschaft verifiziert wird.<br />
Im Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau werden die vorhandenen Kernkompetenzen im<br />
Bereich Glasfaser (GF)- und Kohlefaserverbundwerkstoffe (CF) weiterentwickelt. Als flankierende<br />
Maßnahme werden Leistungen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in den Innovativen<br />
Regionalen Wachstumskern ALFA über das An-Institut Zentrum für Faserverbunde<br />
Haldensleben eingebracht. Für das KAT-Kompetenzzentrum Ingenieurwissenschaften/Nachwachsende<br />
Rohstoffe ergeben sich durch die Möglichkeit der Nutzung dieser Kompetenzen<br />
im Bereich Faserverbundwerkstoffe Synergien, insbesondere für die Werkstoffentwicklung.<br />
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Institut für Maschinenbau bietet dafür hervorragende<br />
Voraussetzungen.<br />
Schwerpunkte der Arbeiten <strong>2008</strong> im KAT-Kompetenzfeld „Nachwachsende Rohstoffe“ waren<br />
Projekte zur Einführung von Biowerkstoffen, einer innovativen Werkstoffgruppe, in Anwendungen<br />
der Automobil- und Gebrauchsgüterindustrie sowie in der Medizintechnik. Hierzu wurden<br />
technische Gespräche und Erstbemusterungen bei mehr als 40 Unternehmen durchgeführt,<br />
darüber hinaus wurden die Werkstoffe auf führenden Industrie- und Branchenmessen (Hannover<br />
Messe, MATERIALICA) präsentiert. Die erfolgreichen F&E-Aktivitäten im Bereich Biowerkstoffe<br />
waren Grund für die Aufnahme des KAT-Kompetenzzentrums in den „Branchenführer<br />
Innovative Biowerkstoffe“, der die in Deutschland agierenden führenden Produzenten und<br />
Forschungseinrichtungen auf diesem Arbeitsgebiet aufführt. Neue Werkstoffentwicklungen am<br />
KAT-Kompetenzzentrum Ingenieurwissenschaften/Nachwachsende Rohstoffe waren die Basis<br />
für die Akquisition eines EU-Projektes (Akronym: HEELLESS) als Forschungsdienstleister im<br />
Programm „Forschung für KMU“ im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms.<br />
Ebenfalls mit hoher Priorität wurden Projekte zur Koppelnutzung (energetische und stoffliche<br />
Nutzung) nachwachsender Rohstoffe mit Unternehmen der Biokraftstoffindustrie Sachsen-<br />
Anhalts bearbeitet. Diese Projekte haben zum Ziel, die Wertschöpfung bei der Herstellung von<br />
Biokraftstoffen der 1. Generation, in der Sachsen-Anhalt eine Spitzenstellung einnimmt, auch<br />
Seite 15
unter erschwerten Rahmenbedingungen (gestiegene Rohstoff- und Energiepreise für die<br />
Erzeuger, Erhöhung der Besteuerung für Biokraftstoffe) zu erhöhen.<br />
2.2.2 Schutzrechtsarbeit <strong>2008</strong> an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
und Ergebnisse<br />
Im Rahmen der Verwertungsförderung SIGNO durch das BMWi und das Kultusministerium<br />
Sachsen-Anhalt wurde die im Jahr 2002 in der BMBF-Verwertungsoffensive für <strong>Hochschule</strong>rfindungen<br />
begonnene und in der Förderphase II im Zeitraum 2004 bis 2007 erfolgreich fortgesetzte<br />
Zusammenarbeit des Hochschulverbundes Sachsen-Anhalt mit der ESA Patentverwertungsagentur<br />
Sachsen-Anhalt GmbH (ESA PVA) unter Berücksichtigung der in den Phasen I<br />
und II erreichten Ergebnisse und gesammelten Erfahrungen kontinuitätswahrend auch im Jahr<br />
<strong>2008</strong> weitergeführt. Die Zusammenarbeit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit der ESA<br />
PVA ist dabei durch einen Kooperationsvertrag und eine Zielvereinbarung mit Leistungsplan<br />
vertraglich geregelt.<br />
Von der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wurden der ESA PVA neun Erfindungsmeldungen<br />
zur Prüfung und Bewertung vorgelegt. In drei Fällen wurde die Freigabe empfohlen, vier<br />
Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Für die Erfindung „Gestengesteuertes MIDI-Instrument“<br />
folgte die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) der Empfehlung der Inanspruchnahme<br />
und die ESA PVA wurde mit der Verwertung betraut. Nach erfolgter Patentanmeldung (DE 10<br />
<strong>2008</strong> 020 340) laufen derzeit Bemühungen einer internationalen Verwertung in Zusammenarbeit<br />
mit Brainshell (PVA für das Land Brandenburg).<br />
Für die Erfindung „Miniaturreibschweißspindel“ wurde die Patentanmeldung in Auftrag gegeben,<br />
die Unterlagen werden derzeit durch den Patentanwalt erstellt.<br />
Für die im Jahr 2007 erfolgte Erfindungsmeldung „Planare Antenne“ wurden die Patentanmeldung<br />
vorgenommen (Planare Antenne auf elektrisch leitender Grundfläche mit weichmagnetischer<br />
Antennenstruktur, DE 10 <strong>2008</strong> 045 605) und die ESA PVA mit der Verwertung beauftragt.<br />
Für das „Verfahren zum Betrieb einer Kläranlage“ (DE 10 2007 034 133) konnte auf der<br />
Grundlage der Patentanmeldung ein Förderprojekt eingeworben werden. Ziel ist es, in Zusammenarbeit<br />
mit einem Industriepartner den praktischen Nachweis der Wirtschaftlichkeit der<br />
Erfindung zu erbringen und eine Regelungskomponente einschließlich Software zu entwickeln.<br />
Bei positivem Ausgang ist das Unternehmen an einer Lizenznahme interessiert.<br />
Die Verwertung der 2007 zum Patent angemeldeten Erfindungen „Einrichtung zur laserbasierten<br />
Werkstückmessung an Drehmaschinen“ (DE 10 2007 061 887, innere Priorität von DE 10<br />
2007 008 014) und „Einrichtung zur laserbasierten Vermessung von Werkstücken, Baugruppen<br />
und Werkzeugen“ (DE 10 2007 061 886) wird im Paket angestrebt. Ein erster positiver Prüfbescheid<br />
des DPMA unterstützt die Verwertungsbemühungen.<br />
Die Verwertungsanstrengungen für die Erfindungen<br />
• Verfahren zur Wandstärkenmessung (DE 10 2006 034 458)<br />
• Waschbecken mit integrierter Armatur (DE 201 11 512),<br />
• Urbane Wohnstruktur für Binnengewässer (DE 20 2006 003 256),<br />
• Schotstopper für Segelboote (DE 10 2007 058 466),<br />
werden fortgesetzt.<br />
2.2.3 Entwicklung von Existenzgründungsvorhaben <strong>2008</strong><br />
Als zentrale Kontakt-, Beratungs- und Qualifizierungsstelle für Existenzgründer an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) fungiert das Team des Businessplan Wettbewerbes des<br />
Lehrbereichs Klein- und Mittelständische Unternehmen und Existenzgründung am Standort<br />
<strong>Stendal</strong>. Das wissenschaftliche Team erfasst, betreut und qualifiziert seit 2005 im Rahmen<br />
einer Initiative des MWA Existenzgründer aus dem Land Sachen-Anhalt. Die angebotenen<br />
Leistungen richten sich dabei sowohl am Gründungsprozess als auch am individuellen Qualifi-<br />
Seite 16
zierungsbedarf der Gründer aus. Um das Leistungspotential hinsichtlich der Qualität und<br />
Effektivität der Gründungsförderung nachhaltig zu optimieren, kooperiert das Team des<br />
Businessplan Wettbewerbes seit <strong>2008</strong> mit dem Business Angels Netzwerk Sachsen-Anhalt.<br />
Gemeinsam wurden im Jahr <strong>2008</strong> 145 Gründer und Gründerinnen bei ihren insgesamt 85<br />
Vorhaben durch Mitarbeiter der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) begleitet und gefördert.<br />
Die Bandbreite der Teilnehmenden reichte von Interessierten mit ernsthaften Gründungsabsichten<br />
bis hin zu bereits im Gründungsprozess fortgeschrittenen Gründern bzw. Jungunternehmern.<br />
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden <strong>2008</strong> bereits 20 Gründungen realisiert. Der<br />
Evaluierungsprozess zu Gründungsgeschehen im Jahr <strong>2008</strong> ist bislang noch nicht abgeschlossen.<br />
Konkrete Daten werden in Kürze verfügbar sein.<br />
Um das Gründungsklima für Studierende, Absolventen, wissenschaftliche Mitarbeiter und<br />
Professoren fortwährend zu verbessern, Gründungsprozesse zu beschleunigen und zu sichern,<br />
wurden im Berichtszeitraum verschiedenste Maßnahmen angeboten. Dies waren unter<br />
anderem Workshops und Seminare zum Thema Gründung, Gründer-Coachings sowie weitere<br />
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die Veranstaltung von Diskussionsrunden am<br />
Standort <strong>Magdeburg</strong> sowie die Beteiligung an Messen.<br />
Die durchgeführten Aktivitäten dienten der Sensibilisierung, der Motivierung und der Qualifizierung<br />
von potentiellen Existenzgründern aus der Region sowie von Studierenden und Absolventen<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH).<br />
Beiträge zur weiteren Stärkung der Gründungsdynamik leisteten im letzten Jahr auch wieder<br />
zahlreiche Kooperationen im ego.-Netzwerk des Landes Sachsen-Anhalt sowie durch das<br />
Businessplan Team geworbene Sponsoren, die den Gründern auch finanzielle Anerkennung<br />
zukommen ließen.<br />
Seite 17
3 Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung<br />
3.1 Qualitätsbestimmung und -entwicklung in Studium, Lehre und<br />
Forschung<br />
Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass Qualität immer nur mit den Beteiligten, also mit den<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), erreichbar ist.<br />
Deshalb wurden z. B. folgende Initiativen gestartet bzw. fortgeführt:<br />
Die Dekane der Fachbereiche wurden zu ihrer Einschätzung und ihren Bedürfnissen im Bereich<br />
QM befragt.<br />
Neue Kollegen werden mit Prozessen und Strukturen der <strong>Hochschule</strong> vertraut gemacht; so<br />
wurde begonnen, Neuberufene an der <strong>Hochschule</strong> zu einer Einführungsveranstaltung „Welcome<br />
on Board“ einzuladen, um die Fachexperten auch in Hochschulstrukturen einzuweihen.<br />
Diese Veranstaltung wurde <strong>2008</strong> zum zweiten Mal durchgeführt und hat geradezu euphorische<br />
Begeisterung ausgelöst. Neue Mitarbeiter werden hochschulweit mit ihrem Aufgabenprofil und<br />
einigen biografischen Daten vorgestellt.<br />
Die Aufgabenbereiche einzelner Funktionsträger in der akademischen Selbstverwaltung wurden<br />
dezidiert festgeschrieben (Studiendekane, Studienfachberater).<br />
Die wichtigste offene Frage nach der strukturellen Ein- und Anbindung der Qualitätssicherung<br />
über alle Bereiche der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hinweg wurde <strong>2008</strong> dahingehend<br />
entschieden, dass aus Hochschulpaktmitteln eine Stelle für Qualitätsmanagement ausgeschrieben<br />
wurde, die direkt dem Rektorat unterstellt ist. Die Einstellung wird erst 2009 erfolgen.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) arbeitet seit 09.11.2005 mit einer Evaluationsordnung,<br />
die folgende Ziele verfolgt:<br />
• Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung durch kontinuierliche Reflektion der<br />
Lehre und das Herausarbeiten der Stärken und Schwächen der betrachteten Lehrveranstaltungen,<br />
• Schaffung einer Grundlage für einen konstruktiven Dialog in der <strong>Hochschule</strong> sowie für<br />
konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Lehrangebotes in den Studiengängen<br />
im Interesse der Profilbildung der Fachbereiche,<br />
• Sicherung der Qualität und Effektivität der Forschungsaktivitäten an der <strong>Hochschule</strong>,<br />
• Strategische Konzeption und Umsetzung eines nachhaltigen Forschungsmanagements.<br />
Zu den Elementen der Evaluation gehören<br />
• die studentische Lehrevaluation,<br />
• die interne und externe Evaluation,<br />
• die Evaluation der Forschung.<br />
Besondere Aufmerksamkeit wird der studentischen Lehrevaluation gewidmet. Seit dem SoS<br />
<strong>2008</strong> werden neue Evaluationsbögen nach HILVE-II benutzt und ein geändertes Procedere<br />
eingesetzt. Allein im SoS <strong>2008</strong> wurden 425 Lehrveranstaltungen evaluiert, für die 8536 Bögen<br />
ausgewertet wurden. Eine Arbeitsgruppe Evaluation widmet sich dem Thema verstärkt vor<br />
allem unter dem Gesichtspunkt, mit welchen geeigneten Instrumenten auf erkannte Schwächen<br />
reagiert werden kann. Derzeit erhalten die Dekanate eine Zusammenfassung der Ergebnisse.<br />
Parallel dazu wird gerade an einem Konzept zur Hochschuldidatik gearbeitet, das das Qualitätsverständnis<br />
in der Lehre befördern soll. In diesem Zusammenhang wäre eine hochschulübergreifende<br />
Initiative, vom MK oder dem WZW koordiniert, sehr wünschenswert.<br />
Das Leitbild, in dem der Qualitätsgedanke mit hoher Priorität festgeschrieben ist, befindet sich<br />
derzeit noch in der hochschulweiten Diskussion und ist noch nicht öffentlich.<br />
Seite 18
Ein weiteres – in den zurückliegenden Jahren das wichtigste – Element der Qualitätssicherung<br />
war die Programmakkreditierung. Die erfolgreich durchgeführten Programmakkreditierungen<br />
beinhalteten die externe Begutachtung des jeweiligen Curriculums und der hochschulischen<br />
Rahmenbedingungen. Die Akkreditierungsberichte sind zum überwiegenden Teil sehr positiv<br />
und in Teilen sogar enthusiastisch und bezeugen ein hohes Qualitätsniveau der an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) eingerichteten Studiengänge.<br />
Seit 2007 begleitet die Hochschulleitung die Arbeit von Berufungskommissionen intensiv. Sie<br />
führte ein auf allen Stufen des Berufungsprozesses stattfindendes Controlling ein, das eine<br />
frühe Rückkopplung mit den Berufungskommissionen ermöglicht.<br />
Die Qualitätssicherung im Bereich der Forschung erfolgt in der überwiegenden Mehrheit durch<br />
externe Evaluation und Bewertung der Anwendungsrelevanz. Im Bereich der kooperativen<br />
Forschung mit Partnern der Wirtschaft erfolgt die Qualitätssicherung über den Umsetzungserfolg<br />
und den Innovationsgewinn. Dieser ist in vielen Fällen nur deskriptiv zu charakterisieren.<br />
3.2 Akkreditierung<br />
Zum Stand der Akkreditierung kann für das Jahr <strong>2008</strong> folgendes berichtet werden:<br />
BA-Studiengänge<br />
16 Studiengänge haben sich bereits einer Akkreditierung unterzogen und diese erfolgreich<br />
bestanden. Von den 24 in der Zielvereinbarung genannten Studiengängen sind somit 66 %<br />
erfolgreich akkreditiert. Für die fehlenden Studiengänge aus den Fachbereichen „Wirtschaft“<br />
und „Kommunikation und Medien“ erfolgt gerade die Erarbeitung der Akkreditierungsunterlagen,<br />
deren Einreichung fest für 2009 geplant ist.<br />
MA-Studiengänge<br />
10 Masterstudiengänge sind bereits erfolgreich akkreditiert. Für die Berechnung der Quote<br />
reicht hier der Bezug zu den 19 MA-Studiengängen der Zielvereinbarung nicht aus, denn der<br />
Umstand der versetzten Einführung der MA-Studiengänge erfordert eine differenzierte Betrachtung.<br />
Für die geplanten und terminierten MA-Studiengänge liegen zurzeit schon positive<br />
Akkreditierungsbescheide vor bzw. werden die Akkreditierungsunterlagen bereits vorbereitet.<br />
Der Aufwand hierfür ist personell und finanziell enorm. Der personelle Einsatz ist neben dem<br />
Tagesgeschäft der Lehre und Forschung sehr schwer leistbar und, weil eindeutig professorale<br />
Aufgabe, auch schwerlich delegierbar.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wird bis 2010 alle laufenden Studiengänge programmakkreditiert<br />
haben.<br />
3.3 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren<br />
Die Langzeitstudiengebühren wurden ausschließlich zur Verbesserung der Lehre und Erhöhung<br />
der Qualität des Studienangebotes genutzt.<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2008</strong> wurden insgesamt ca. 410 T€ durch Erhebung von Langzeit-studiengebühren<br />
eingenommen. Entgegen den ursprünglichen Annahmen sind die Einnahmen weiter<br />
gestiegen. Durch Gewährung von Ratenzahlungen wurden Härtefälle ausgeglichen. Dadurch<br />
wurden teilweise Einnahmen aus 2007 erst <strong>2008</strong> realisiert.<br />
Die Einnahmen aus Langzeitstudiengebühren wurden nicht nur zur Aufstockung des Budgets<br />
eingesetzt, sondern insbesondere für folgende Programme:<br />
• Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek an beiden Standorten,<br />
• Bildung von Meisterklassen,<br />
• Organisation eines Tutorenprogramms<br />
• Organisation eines „studium generale“ (Beginn: WS <strong>2008</strong>)<br />
• Eine Personalstelle im Dezernat Studentische Angelegenheiten zur Erhöhung des Services<br />
für die Studierenden.<br />
Seite 19
Dadurch sind insgesamt ca. 117.000 EURO zur Verbesserung der Lehr- und Studienbedingungen<br />
eingesetzt worden. Für das „studium generale“ werden ab 2009 erheblich höhere Mittel zur<br />
Verfügung gestellt, da es weiter ausgebaut werden wird.<br />
Das zentrale Tutorienprogramm der <strong>Hochschule</strong> erweitert zum einen das Studienangebot,<br />
indem es über das Curriculum hinaus relevante Tutorien anbietet, zum anderen vertieft es<br />
durch Begleitung curricularer Veranstaltungen den Durchdringungsgrad des Fachgegenstands.<br />
Besonders diese zweite Variante der Tutorien trägt maßgeblich zur Qualitätsverbesserung in<br />
der Lehre bei.<br />
Für eine weitaus kleinere Gruppe von Studierenden relevant, aber nicht weniger wichtig, ist die<br />
Exzellenzförderung herausragender und in besonderer Weise leistungsfähiger Studierender in<br />
sog. Meisterklassen. Diese sind vor allem in den Bachelorstudiengängen angesiedelt. <strong>2008</strong><br />
wurde eine Meisterklasse im Bereich Design etabliert.<br />
Seite 20
4 Internationalisierung<br />
Im Rahmen der durch den Senat verabschiedeten Internationalisierungsstrategie hat sich die<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) zur Umsetzung der folgenden Schwerpunkte verpflichtet:<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) verpflichtet sich, allen interessierten Studierenden<br />
einen qualifizierten, studienintegrierten Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Die <strong>Hochschule</strong><br />
setzt sich dabei zum Ziel, dass Studierende aller Fachbereiche solche internationalen Studienkomponenten<br />
absolvieren (pro Matrikel 30 % der Studierenden).<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) verpflichtet sich, die Anbahnung und Durchführung<br />
internationaler projektbezogener Kooperationen (Curriculumentwicklung, gemeinsame Studiengänge,<br />
Forschungsvorhaben, Partnerschaft mit Institutionen der Wirtschaft et. al.) zu fördern,<br />
die auf Langzeitwirkung hin ausgelegt sind.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) verpflichtet sich, ausländischen Studierenden<br />
qualifizierte Studienmöglichkeiten vorzuhalten und eine Ausländerquote von 10 % im Rahmen<br />
der gesetzlichen Möglichkeiten anzustreben.<br />
Aus diesen Verpflichtungen lassen sich die in den Zielvereinbarungen zwischen der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) und dem Kultusministerium genannten Ziele ableiten. Im Folgenden<br />
soll auf den Stand der Umsetzung der oben genannten Schwerpunkte eingegangen werden.<br />
4.1 Internationaler Hochschulraum<br />
4.1.1 Auslandsstudium<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hält für ihre Studierenden eine große Anzahl von<br />
Studienplätzen im Rahmen von Austauschprogrammen mit Partneruniversitäten, insbesondere<br />
in der Europäischen Union sowie in den USA, bereit.<br />
Eine herausgehobene Rolle bei der Auslandsmobilität spielt das Erasmus-Programm. Im<br />
akademischen Jahr 2007/<strong>2008</strong> konnten 49 Studierende der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) ein Auslandsstudium im Rahmen des Erasmus-Programms absolvieren.<br />
Seit 2006/2007 ist ein nicht unerheblicher Rückgang der am Programm teilnehmenden Studenten<br />
zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf einen signifikanten Rückgang der im Studienbereich<br />
Fachkommunikation (Übersetzen/Dolmetschen) zugelassenen Studenten zurückzuführen<br />
ist.<br />
Einen Spitzenplatz unter allen <strong>Hochschule</strong>n des LSA nimmt die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) seit Mitte der 90er Jahre und weiterhin auch im Berichtszeitraum bei den durch<br />
das Erasmus-Programm (früher Leonardo-Programm) geförderten studentischen Auslandspraktika<br />
in EU-Ländern ein.<br />
Das ZAH unterstützt die Auslandsmobilität der Studenten durch das Angebot einer regelmäßigen<br />
Auslandsstudienberatung. Dabei geht es um die Bereitstellung von Informationen zu<br />
• Bewerbungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren für die Teilnahme an<br />
Austauschprogrammen oder für eine Bewerbung als Free Mover<br />
• Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten<br />
• Informationen zur sprachlichen Vorbereitung<br />
• Informationen für die eigenständige Praktikumsplatzsuche<br />
• Informationen zu Formalitäten wie Krankenversicherung und Visa-Beantragung<br />
Ausblick: Der Rückgang der Teilnehmer am Erasmus-Programm (Auslandsstudium) macht<br />
deutlich, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, damit auch Studierende aus wenig auslandsmobilen<br />
Studienrichtungen, wie den Ingenieurwissenschaften oder auch der BWL sowie der<br />
technischen Betriebswirtschaft stärker am Programm partizipieren. Dazu beitragen können eine<br />
stärkere curriculare Verankerung von Auslandsstudienabschnitten, umfassende Information<br />
interessierter Studenten über die Modalitäten der Anerkennung von im Ausland erbrachten<br />
Studienleistungen, eine gute fremdsprachliche Vorbereitung der Studierenden, die Internationalisierung<br />
der Curricula sowie die konsequente Anwendung von ECTS.<br />
Seite 21
4.1.2 Projektbezogene Kooperationen<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat mit zahlreichen <strong>Hochschule</strong>n weltweit Kooperationsvereinbarungen<br />
abgeschlossen. Diese Vereinbarungen werden überwiegend für den<br />
Austausch von Studierenden genutzt.<br />
Mit einer kleineren Zahl von Erasmus-Partner-Universitäten findet auch ein Austausch von<br />
Lehrenden statt. 2007/<strong>2008</strong> waren 10 Lehrende der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) als<br />
Erasmus-Gastdozenten für Kurzdozenturen an europäischen Partnerhochschulen.<br />
Eine projektbasierte Zusammenarbeit erfolgt nur mit wenigen Partneruniversitäten insbesondere<br />
mit Universitäten in Peru, Jordanien und Kuba sowie mit britischen, kanadischen und<br />
finnischen Universitäten, im Rahmen von aus EU-Mitteln geförderten Curriculumentwicklungsprojekten.<br />
Ausblick: Durch die bestehenden zahlreichen Partnerschaften ist eine gute Grundlage für eine<br />
Intensivierung der projektbasierten internationalen Zusammenarbeit gegeben. Eine entsprechende<br />
Ausweitung dieser Aktivitäten ist auch unter dem Aspekt der damit verbundenen<br />
Qualitätssteigerung des Studierendenaustauschs wünschenswert.<br />
4.1.3 Ausländerstudium<br />
Im Berichtszeitraum ist der Anteil der ausländischen Studierenden von 349 im WS 2007/08 auf<br />
307, davon 59 in <strong>Stendal</strong>, im WS <strong>2008</strong>/09 zurückgegangen.<br />
Unter den 307 ausländischen Studierenden sind 65 Austauschstudierenden des Standortes<br />
<strong>Magdeburg</strong>. Diese stellen einen im Vergleich mit anderen <strong>Hochschule</strong>n überdurchschnittlich<br />
hohen Anteil der ausländischen Studierenden. Zum WS <strong>2008</strong>/09 war erstmals auch eine<br />
größere Gruppe von nicht-europäischen Studierenden unter den ausländischen Studierenden.<br />
Die insgesamt 12 entsendenden Länder waren neben den EU-Ländern Russland, China, die<br />
USA, Jordanien und Peru.<br />
Das ZAH der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) bietet eine Reihe von zielgruppenspezifischen<br />
Serviceleistungen, die sich insbesondere an Austauschstudierende wenden. Diese sind<br />
im Einzelnen:<br />
• Studieneinführende Maßnahmen (Orientierungswoche) auf zentraler Ebene durch das<br />
Zentrum für Auslandsbeziehungen<br />
• Vermittlung von Wohnraum<br />
• Information und Beratung zum Studium und Leben an beiden Hochschulstandorten vor<br />
Einreise und studienbegleitend (die Studienfachberatung erfolgt durch Vertreter der jeweiligen<br />
Studiengänge)<br />
• Beratung in ausländerrechtlichen Angelegenheiten<br />
• Beratung zu den Deutsch-als-Fremdsprache-Angeboten (DaF)<br />
• Durchführung von Deutschland-kundlichen Exkursionen<br />
Ausblick: Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität für ausländische Studieninteressenten<br />
und Studierende sind notwendig. Dies sind unter anderem:<br />
• Zielgruppenorientierter Internetauftritt<br />
• Gezielte Rekrutierung von ausländischen (Voll-) Studenten, z. B. durch Messebesuche<br />
• Bereitstellung von ECTS-Information Packages<br />
• Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots<br />
• Aufbau einer hochschulinternen zielgruppenspezifischen Beratung/Informationsvermittlung<br />
zu Anerkennungs- und Zulassungsfragen<br />
4.1.4 Mitteleinwerbung<br />
Ein Aufgabenbereich des ZAH, Standort <strong>Magdeburg</strong>, ist die Einwerbung von Drittmitteln des<br />
DAAD zur Durchführung von internationalen Aktivitäten. Dies geschieht zum einen durch eigene<br />
Drittmittelprojekte, zum anderen durch Beratungsangebote für potentielle Antragsteller aus den<br />
Fachbereichen.<br />
Seite 22
Für das Haushaltsjahr 2007 (die Daten für <strong>2008</strong> liegen erst im Frühjahr 2009 vor) wurden ZAHseitig<br />
neben den Stipendien für Studierende die folgenden Mittel eingeworben:<br />
Erasmus 2007/08: 184.055,00 €<br />
Stibet: 10.835,00 €<br />
Ostpartnerschaften: 5.000,00 €<br />
Die Fachbereiche haben folgende DAAD-Drittmittel eingeworben:<br />
11.821,00 Euro für Studienreisen, Doppeldiplomstudiengänge und HS-Partnerschaften mit<br />
Entwicklungsländern. 3.800,00 Euro entfallen auf den Fachbereich SGW, der Rest auf den<br />
Fachbereich Wasserwirtschaft.<br />
4.1.5 Das Projekt German Jordanien University<br />
Das größte Bildungsexportprojekt der Bundesrepublik wird seit vier Jahren vom „Projektbüro<br />
GJU“ an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> aus (FH) koordiniert. Fachlich untergliedert sich<br />
das Projekt in folgende Netzwerke:<br />
- Logistik<br />
- Design<br />
- Betriebswirtschaft / Management<br />
- Chemie/Pharmatechnik/Biomedizintechnik<br />
- Energietechnik<br />
- Informatik<br />
- Wasserwirtschaft<br />
- Instandhaltungsingenieurwesen<br />
- Wirtschaftsingenieurwesen<br />
- Mechatronik<br />
- Architektur<br />
- Umwelttechnik<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> war insofern ein besonderes, da zum ersten Mal Studierende der GJU ihr<br />
Auslandsstudium an deutschen Fachhochschulen aufnahmen. An der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) nahmen im Oktober neun jordanische Studierende ihr Studium auf: Chemie/<br />
Pharmatechnik (5) und Wirtschaftsingenieurwesen (4).<br />
Im Februar <strong>2008</strong> sind erste Gespräche geführt worden, um Curricula und Betreuungsstandards<br />
an aufnehmenden <strong>Hochschule</strong>n zu vereinbaren. Daraufhin wurden Memoranden of Understanding<br />
mit den aufnehmenden <strong>Hochschule</strong>n unterzeichnet, die die Grundlage für den Studierendenaustausch<br />
bilden sollten.<br />
Prof. Dr. Peter Uecker wurde im Februar zum Vizepräsidenten gewählt und damit verantwortlich<br />
für Internationales. Im Mai fand der erste Teil eines Verwaltungsaustausches zwischen GJU<br />
und der <strong>Hochschule</strong> statt. Die Leiterin der Finanzabteilung, die Leiterin des Präsidialbüros und<br />
die Referentin des Vizepräsidenten für Qualitätssicherung und Akkreditierung weilten eine<br />
Woche an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), um Verwaltungsstrukturen und –abläufe<br />
kennenzulernen.<br />
Während des Sommersemesters studierte die jordanische Schwimmerin Leila Al-Ghul an der<br />
<strong>Hochschule</strong> und trainierte im Olympiastützpunkt <strong>Magdeburg</strong> gemeinsam mit Olympiateilnehmern<br />
des SCM, um sich auf die Olympischen Spiele in Turin vorzubereiten.<br />
Im Sommer besuchte die Direktorin der GJU-Bibliothek die Bibliotheken der <strong>Hochschule</strong>n<br />
Deggendorf, Regensburg und <strong>Magdeburg</strong>, bevor sie in die Planung zum neuen Bibliotheksgebäude<br />
auf dem Campus in Madaba einstieg.<br />
Seite 23
Zum dritten Mal fand eine Summer School für jordanische Studierende in <strong>Magdeburg</strong> statt. 28<br />
GJU-Studenten verbrachten im August drei Wochen in <strong>Magdeburg</strong>, in denen sie Deutsch- und<br />
Landeskundekurse absolvierten.<br />
Verbuchte Drittmittel:<br />
Projektmittel GJU<br />
Sommerschulen, Stipendien<br />
672.000 €<br />
Deutschlandaufenthalt und Reisekosten <strong>2008</strong>: 174.935 €<br />
Drittland und SurPlace-Stipendien 111.100 €<br />
Kultusministerium Sachsen-Anhalt 45.000 €<br />
Mittel der IHK für Leila Al-Ghul 1.500 €<br />
Summe (gerundet) 1.004.535 €<br />
Seite 24
5 Tätigkeitsbericht im Rahmen der Zielsetzungen<br />
Chancengleichheit und Familiengerechtigkeit<br />
5.1 „Familienzimmer“ als familienfreundliches und<br />
chancengleichheitsfördendes Projekt<br />
Im WS 2007/<strong>2008</strong> führte die Projektgruppe „Familienfreundliche <strong>Hochschule</strong>“ unter der Leitung<br />
von Prof. Hungerland eine Bedarfsanalyse zur Notwendigkeit familienunterstützender Maßnahmen<br />
am Hochschulstandort <strong>Stendal</strong> durch. Dabei wurde als Problem sowohl von Studierenden<br />
als auch von Beschäftigten vor allem die Unterbringung der Kinder zu Abendvorlesungen und<br />
Wochenendseminaren genannt. Dieses Problem könne durch ein ergänzendes Betreuungsangebot<br />
an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gelöst werden. Eine solche Betreuung<br />
wurde im Laufe des Jahres <strong>2008</strong> nach dem Vorbild des seit 11 Jahren erfolgreich arbeitenden<br />
Projekts „Kinderzimmer“ (KiZi) am Standort <strong>Magdeburg</strong> realisiert.<br />
Anfang Mai <strong>2008</strong> wurde das „Familienzimmer“ (FaZi) im Rahmen des Aktionstages der<br />
Bündnisse für Familien der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei der Eröffnung des neuen Hochschulgebäudes<br />
Haus 3 Anfang Juni <strong>2008</strong> wurde auch das FaZi offiziell eröffnet. Im Haus 3 am<br />
Standort <strong>Stendal</strong> wurde dafür ein Raum zur Verfügung gestellt und mit Mitteln der <strong>Hochschule</strong><br />
möbliert. Die Betreuung der Kinder wird von Studierenden der Studiengänge „Angewandte<br />
Kindheitswissenschaften“ und „Rehabilitationspsychologie“ abgedeckt. Die Arbeit wird den<br />
betreuenden Studierenden als studienbegleitende Praktikumszeiten angerechnet.<br />
Das Projekt „Familienzimmer“ unterstützt auf kostenneutrale Weise ein Studium bzw. die<br />
Berufstätigkeit vor allem von Frauen mit Kindern, welche immer noch stark von der Vereinbarkeitsproblematik<br />
betroffen sind. Die verlässliche und flexible Kinderbetreuung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) geht auf deren besondere zeitliche Anforderungen der<br />
Lehrveranstaltungen und Gremiensitzungen in den Abendstunden und an den Wochenenden<br />
ein.<br />
Gerade für die <strong>Stendal</strong>er Studiengänge mit einem hohen Frauenanteil sowohl unter den<br />
Studierenden als auch unter den Beschäftigten stellt die Einrichtung des „Familienzimmers“<br />
einen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der Chancengleichheit für Männer und Frauen dar.<br />
5.2 Auditierung<br />
Zur Erhebung und längerfristigen Etablierung familienförderlicher Maßnahmen wird die Auditierung<br />
der <strong>Hochschule</strong> zur „Familiengerechten <strong>Hochschule</strong>“ angestrebt. Das audit berufundfamilie<br />
der Hertie-Stiftung ist ein allgemein anerkanntes „Gütesiegel“, das seit 10 Jahren an zertifizierte<br />
Unternehmen vergeben wird und das eine hohe Werbewirksamkeit besitzt. Ziel des audits ist<br />
es, eine tragfähige Balance zwischen den betrieblichen Interessen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) und den familiären Interessen sowohl der Beschäftigten als auch der Studierenden<br />
zu erreichen. Diese sollen langfristig an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) verankert<br />
werden. Mit Hilfe eines standardisierten Verfahrens werden bei der Auditierung alle wichtigen<br />
Handlungsfelder zur Vereinbarkeit von Arbeiten, Studieren und Familie bearbeitet. Dabei<br />
werden VertreterInnen aller Betroffenengruppen in workshops in diesen Prozess eingebunden.<br />
Die Ergebnisse des Modellprojekts „Bevölkerungsmagnet <strong>Hochschule</strong>“, das von der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gemeinsam mit dem Nexus-Institut für Kooperationsmanagement<br />
und interdisziplinäre Forschung“ von September 2005 bis November 2006 durchgeführt<br />
worden war, sollen ebenfalls Berücksichtigung finden.<br />
Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hatte Ende April <strong>2008</strong> zugesichert, die Auditierung<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), deren Kosten sich auf cirka 10 T€ plus Mehrwertsteuer,<br />
zu 70 % zu bezuschussen. Die Hochschulleitung hatte beschlossen, die Restkosten<br />
zu übernehmen.<br />
Ein Kostenvoranschlag einer lizensierten Auditorin der Hertie-Stiftung, die bereit ist, den<br />
Prozess durchzuführen, sobald die Finanzierung gesichert sei, liegt der Hochschulleitung vor.<br />
Leider setzte das Ministerium seine mündlich erteilte Zusage zur Kostenübernahme im August<br />
einstweilen aus. Sobald eine Finanzierung gesichert ist, wird das Verfahren „Auditierung“<br />
wieder aufgenommen.<br />
Seite 25
5.3 Weitere Maßnahmen zu Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit<br />
Weitere Maßnahmen zu Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit sind dem Gleichstellungskonzept<br />
zu entnehmen, das im Rahmen des Qualitätsmanagements der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Auftrag und unter Federführung der Prorektorin für Studium und<br />
Lehre in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Personalratsvorsitzenden<br />
und der AG Frauen erstellt wurde.<br />
Seite 26
6 Hochschulmarketing<br />
6.1 Hochschulübergreifendes Marketing – Beteiligung am<br />
Landesmarketing<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) beteiligt sich intensiv an beiden hochschulübergreifenden<br />
Kampagnen, die zum einen aus der Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpakts<br />
2020 im Land Sachsen-Anhalt – „Attraktivität und Marketing der Studienbedingungen“ zum<br />
anderen an der unter Federführung von Scholz & Friends (Berlin) für die neuen Länder<br />
entwickelten Strategie.<br />
Der erste hat zum Ziel, die Attraktivität der <strong>Hochschule</strong>n für westdeutsche Studierwillige zu<br />
vermarkten. Gleichzeitig soll die Attraktivität durch Best-practice-Beispiele erhöht werden. Diese<br />
sollen durch die Entwicklung in hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen allen <strong>Hochschule</strong>n<br />
zugute kommen. Die Themen dieser Arbeitsgruppen lauten:<br />
• „Vom ersten Kontakt bis zur Einschreibung“<br />
• „Fachliche Betreuung während des Studiums“<br />
• „Leben in der Stadt (Stadt/<strong>Hochschule</strong>)“<br />
• „Hochschulmarketing im Internet-Content und Werkzeuge“ sowie<br />
• „Karriereservice“<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat die Leitung der Arbeitsgruppe „Karriereservice“<br />
übernommen. Nach der Auftaktsitzung am 23.10.08 hat mittlerweile eine weitere Arbeitssitzung<br />
am 21. November <strong>2008</strong> stattgefunden. Im Vordergrund stand zum einen die Sensibilisierung<br />
der Anwesenden für die Aspekte ihrer Arbeit für das Hochschulmarketing. Des Weiteren wurde<br />
das Projekt „Transferzentrum – Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung für<br />
Fach- und Führungskräfte in KMU des Landes Sachsen-Anhalt“, welches vom Wirtschaftsministerium<br />
gefördert wird, vorgestellt. Zentrale Fragestellung der Diskussion war und wird in den<br />
folgenden Sitzungen sein, welche Unterstützung seitens der <strong>Hochschule</strong>n – neben der qualitativ<br />
hochwertigen Ausbildung – notwendig ist, um den Berufsstart der Absolventinnen und Absolventen<br />
so effizient wie möglich zu gestalten. Hierbei spielen z. B. die Vermittlungstätigkeit als<br />
solche, die Vermittlung zusätzlicher Fremdsprachenkenntnisse oder auch ein Studium Generale<br />
(s. u.) eine zentrale Rolle.<br />
An der Arbeit der weiteren Arbeitsgruppen nehmen selbstverständlich Mitglieder der <strong>Hochschule</strong><br />
teil. Die Koordination findet dann wiederum hausintern statt.<br />
Die Kampagne für die neuen Länder der Marketingagentur Scholz & Friends umfasst folgende<br />
Maßnahmen:<br />
• Darstellung der ostdeutschen <strong>Hochschule</strong>n in SchülerVZ und Implementierung einer<br />
Studienplatzsuchmaschine<br />
• Filmbeiträge über die <strong>Hochschule</strong>n (Studieren in Fernost) zur Brechung der Vorbehalte<br />
gegenüber dem Studieren in Ostdeutschland)<br />
• Best practice Wettbewerbe mit den Themen:<br />
- Konzept für „Studienanfänger“<br />
- Konzept für einen „Campus Day“<br />
- Konzept für „Kooperation Stadt/<strong>Hochschule</strong>“<br />
- Konzept „Karriereservice“<br />
Sowohl an der Auftaktveranstaltung am 04.09.<strong>2008</strong> wie auch beim ersten ganztägigen Workshop<br />
war die <strong>Hochschule</strong> vertreten. Mittlerweile sind die Vorbereitungen für die Präsentation im<br />
SchülerVZ und auch die Suche nach geeigneten Tutoren angelaufen. Gleichzeitig bereitet die<br />
<strong>Hochschule</strong> ihren Beitrag für den ersten Wettbewerb vor.<br />
Seite 27
Beide Dachkampagnen zielen in vorderster Linie auf die Gewinnung westdeutscher Studierwilliger<br />
im Rahmen der Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern zum Hochschulpakt<br />
2020 ab.<br />
Herr Dr. Biggeleben, der das Projekt für die neuen Länder leitet, wird die Kampagne Anfang<br />
April in der <strong>Hochschule</strong> vorstellen, um alle Hochschulmitglieder zu weiteren Aktivitäten anzuregen.<br />
6.2 Hochschulspezifisches Marketing<br />
6.2.1 Grundlagen<br />
Die noch vorzustellende hochschuleigene Strategie orientiert sich mit Ausnahme einiger<br />
weniger Aspekte an der Landesperspektive bzw. der Konzeption des Hochschulmarketings im<br />
Rahmen des Hochschulpakts 2020 für die neuen Länder insgesamt.<br />
Während Hochschulmarketing im Regelfall mehrere Zielgruppen im Blick hat, fokussiert die<br />
<strong>Hochschule</strong> im Augenblick auf die Zielgruppe der potentiellen Studierenden, die der Studierenden<br />
sowie die der Eltern. Im Vordergrund hierbei stehen die potentiellen Studierenden (national<br />
wie international), da sich zum einen die Zahl der potentiellen Studierenden, die in Ostdeutschland<br />
geboren wurde, halbieren wird, zum anderen die besten Studierenden geworben werden<br />
sollen. Gleichzeitig kommt den eingeschriebenen Studierenden der <strong>Hochschule</strong> eine besondere<br />
Bedeutung im Rahmen des Hochschulmarketings zu, da sie mit ihrem Urteil nicht nur in<br />
Rankings zur externen Kommunikation der Leistungen der <strong>Hochschule</strong> beitragen, sondern in<br />
verschiedenen Kommunikationsformen insbesondere im Internet zur Einschätzung der <strong>Hochschule</strong><br />
beitragen und beitragen können.<br />
Um Aufschlüsse über die Zielgruppe der potentiellen Studierenden zu erhalten, wurden im<br />
Rahmen der Marktforschung mehrfach die räumliche Herkunft der Bewerber und Bewerberinnen<br />
sowie der Studienanfänger und Studienanfängerinnen untersucht sowie Studien zur<br />
Motivation Studierwilliger herangezogen. Hierzu wurde auch insbesondere das Mobilitätsverhalten<br />
der Studierwilligen analysiert. Die <strong>Hochschule</strong> hat diesbezüglich auch eine Erstsemesterbefragung<br />
zu Studienplatzwahlmotiven durchgeführt und ausgewertet.<br />
Drei Zielstellungen sind im nationalen Zusammenhang für unsere Maßnahmen relevant:<br />
• Studienanfänger aus den westdeutschen Bundesländern attrahieren,<br />
• die Studierquote in Ostdeutschland erhöhen sowie<br />
• die Übergangsquote erhöhen (Abwanderung von Studierwilligen bzw. Nettoexport senken)<br />
Für den internationalen Raum werden die Anstrengungen fortgesetzt und ausgedehnt. Um<br />
vielen ausländischen Studierwilligen ein Studium zu ermöglichen, wird die über lange Jahre<br />
geübte Praxis einer (kostenpflichtigen) Ausbildung in deutscher Sprache fortgesetzt. gleichzeitig<br />
werden vermehrt Kooperationen mit ausländischen <strong>Hochschule</strong>n geschlossen, welche den<br />
Zweck des Studierendenaustauschs zum Ziel haben (siehe 5. Internationalisierung). Für<br />
ausländische Studierende wird die Möglichkeit geboten, die deutsche Sprache als Wahlpflichtfach<br />
zu belegen, um zu verhindern, dass sie z. B. zusätzlich Prüfungen in anderen Sprachen<br />
absolvieren müssen. Gleichzeitig senkt dies die Abbrecherquoten ausländischer Studierender.<br />
Insofern zielen die – noch vorzustellenden - Maßnahmen rein räumlich nicht nur auf Westdeutschland<br />
ab. Dennoch wird den westdeutschen Bundesländern besondere Bedeutung zu<br />
kommen, in denen doppelte Jahrgänge ihr Abitur absolvieren werden.<br />
Aus dem Marketing-Mix mit seinen Teilbereichen – Preis-, Produkt-, Distributions- und Kommunikationspolitik<br />
– werden an dieser Stelle die beiden Bereiche Produkt- und Kommunikationspolitik<br />
hauptsächlich dargestellt. Insbesondere die zusätzlichen Teilaspekte des Dienstleistungsmarketings,<br />
welche für die <strong>Hochschule</strong> wichtig sind, finden in der Ausstattungspolitik, dem<br />
Prozessmanagement und der Personalpolitik ihre Beachtung.<br />
Seite 28
Produktpolitik:<br />
Unbestritten ist die Tatsache, dass ein attraktives Studienangebot Erfolgsfaktor Nummer 1 im<br />
Wettbewerb um die Studierenden ist. Diese Fragestellungen werden in den Fachbereichen<br />
intensiv diskutiert, da dort die einschlägige Fachkompetenz zu finden ist. Insofern wurden neue<br />
innovative Studiengänge, die sich an den Bedarfen von Wirtschaft und Gesellschaft orientieren,<br />
eingeführt, weitere werden geplant.<br />
Die Verbesserung der angebotenen Studiengänge fand und findet nicht nur in den Überarbeitungen<br />
der Prüfungs- und Studienordnungen ihren Niederschlag, sondern auch darin, dass die<br />
meisten Studiengänge an der <strong>Hochschule</strong> bereits akkreditiert sind (siehe hierzu auch 9.6).<br />
Darüber hinaus steht die Qualität der Vermittlung der Lehrinhalte durch studentische Evaluation<br />
(siehe ebenfalls 9.6) oder z. B. zusätzliche Tutorate im Vordergrund der Arbeit. Gleichzeitig<br />
finden Qualitätsverbesserungen im Service innerhalb der <strong>Hochschule</strong> statt, was beispielhaft an<br />
Online-Informationssystemen (Notenverwaltung, Stundenplan etc.) sichtbar wird.<br />
Kommunikationspolitik:<br />
Der internen Kommunikation dienen die neugeschaffene Marketing AG, der ständige Austausch<br />
der Mitglieder der Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Arbeitsthemen des Landes und z. B.<br />
die für April geplante hochschulöffentliche Präsentation der Marketing-Strategie von Scholz &<br />
Friends, die ebenfalls der Sensibilisierung der Hochschulmitglieder dienen soll.<br />
Im Speziellen:<br />
Leitung der Arbeitsgruppe „Karriereservice“ und Teilnahme an den weiteren fünf Arbeitsgruppen<br />
im Lande<br />
Teilnahme und Kooperation mit Scholz & Friends (Neue Länder)<br />
Die externe Kommunikation von internem Leistungsvermögen ist nur möglich, wenn ein<br />
Datenpool zur Leistungsfähigkeit existiert.<br />
Die Vorarbeiten zur Leistungserfassung haben hierzu mit der Einführung der Leistungsorientierten<br />
Mittelverteilung und dem Benchmarking schon vor drei Jahren begonnen. Die externe<br />
Kommunikation von Leistungen der Hochschulangehörigen wird mittlerweile auch in der LOM<br />
monetär belohnt, sodass von dieser Seite schon Anreize aufgebaut sind. Nach dieser Vorlaufphase<br />
verfügt die <strong>Hochschule</strong> über eine erste Datenbasis für Ihre Arbeit (vgl. hierzu 9.6).<br />
Der externen Kommunikation dienen neben den traditionellen Maßnahmen (neuer Internetauftritt,<br />
Presseartikel, hochschuleigene Zeitung (Treffpunkt Campus) etc. insbesondere die neuen<br />
Webseiten www.Studieren-im-Gruenen.de. Hier beschreiben westdeutsche Studierende ihr<br />
Studierendenleben an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in authentischer Weise und<br />
informieren hierbei auch über die Ausstattung der <strong>Hochschule</strong>. Die <strong>Hochschule</strong> freut sich, dass<br />
die externe Kommunikation von Scholz & Friends sowie Aperto (Agentur für Internetkommunikation)<br />
ausdrücklich gelobt wurde, der Internetauftritt www.Studieren-im-Gruenen.de als stateof-art<br />
für Ostdeutschland bezeichnet wurde.<br />
Das Hauptaugenmerk der <strong>Hochschule</strong> setzt sich somit aus dem Ziel der Qualitätsverbesserung<br />
von Studienangeboten und der Optimierung von Verfahrensablaufen (Prozessmanagement),<br />
die speziell Studienbewerbern und Studierenden zugute kommen sowie der Kommunikation der<br />
hochschulinternen Leistungen, die intern wie extern stattfindet, zusammen.<br />
Ohne die Gesamtheit der Zielgruppen aus den Augen zu verlieren, stehen aber zugegebenermaßen<br />
die Zielgruppen der potentiellen Studierwilligen sowie die Studierenden im Vordergrund.<br />
Geht man hypothetisch davon aus, dass erstens bei der Zielgruppe potentieller Studierender<br />
bezüglich des Studiums im allgemeinen sowie bezüglich der Qualität der Ausbildung und<br />
Erfolgsaussichten eines Studiums große Unsicherheiten bestehen und gerade die Qualität nicht<br />
quantifizierbar ist, gilt es für eine erfolgreiche Strategie gerade diese Zweifel auszuräumen. Aus<br />
Sicht des potentiellen Studierenden stellen zweitens Aussagen von Studierenden und/oder<br />
ehemaligen Studierenden eine zentrale Informationsquelle dar. Drittens lässt sich empirisch<br />
feststellen, dass sich Unzufriedenheit wesentlich schneller herumspricht als Zufriedenheit.<br />
Insofern gilt es, die Studierenden für die Qualität Ihrer Ausbildung zu sensibilisieren.<br />
Seite 29
Erste Erfolge der Arbeit in der <strong>Hochschule</strong> werden in der Bewertung einzelner Studiengänge in<br />
StudiVZ sichtbar.<br />
6.2.2 Studierendenmarketing<br />
Die Marketingstrategie11 der <strong>Hochschule</strong> bezogen auf die Studierenden lässt sich vom Ablauf<br />
in fünf Phasen (in Analogie zum Kundenlebenszyklus) gliedern:<br />
• Vor dem Studium<br />
• Zu Beginn des Studiums<br />
• Während des Studiums<br />
• Am Ende des Studiums<br />
• Nach dem Studium<br />
Diese fünf Phasen werden im Folgenden erläutert und mit bereits realisierten Beispielen<br />
untersetzt.<br />
6.2.2.1 Vor dem Studium:<br />
Zielstellung der Maßnahmen ist zum einen die Bekanntheit der <strong>Hochschule</strong> zu erhöhen, zum<br />
anderen das Annahmenverhalten zu verbessern:<br />
Bekanntheit erhöhen<br />
Um die Zahl der Bewerbungen zu erhöhen, muss der Bekanntheitsgrad der <strong>Hochschule</strong> erhöht<br />
werden, wozu das Leistungsangebot und die Ausstattung kommunizieren wird. Gleichzeitig wird<br />
die angesprochene Unsicherheit bezüglich des Umfelds des Studienorts reduziert bzw. die<br />
Hemmschwellen werden abgebaut. Beispiele hierfür sind:<br />
• Studieren im Grünen (www.Studieren-im-Gruenen.de)mit Multiplikatorwirkung, z. B. unter<br />
www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/835752/ oder DIE ZEIT am 10.4.08<br />
http://www.zeit.de/<strong>2008</strong>/16/Seitenhieb?from=rss<br />
• Schnupperstudium (http://www.hsmagdeburg.de/hochschule/einrichtung/studienberatg/schuelerinteresse/termschnupper/<br />
• Möglichkeit der online-Bewerbung<br />
• Tage der offenen Hochschultür an beiden Standorten<br />
• Zielgruppenorientierter Internetauftritt (www.hs-magdeburg.de)<br />
• Projekttage für potentielle Studierende<br />
• Herbstkurs für Mädchen mit Interesse an technischen Studiengängen (siehe: www.hsmagdeburg.de/hochschule/einrichtung/studienberatg/schuelerinteresse/herbstkurs/<br />
)<br />
• Studienwerbung, Studienberatung, Verteilen von Info-material/Studienführer, Flyer etc. an<br />
Gymnasien und Fachoberschulen<br />
• Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit hinsichtlich der Berufswahl<br />
• Kinder-Uni (www.kinderuni-stendal.de), Pfifikus (www.hsmagdeburg.de/hochschule/einrichtung/ver-alu/veranst/kiwo),<br />
wobei insbesondere auch die<br />
Eltern als Multiplikatoren gedacht sind.<br />
• Sprachkurse zum Erwerb studiengangsspezifischer Voraussetzungen (Zeitraum August/September,siehe:http://www.fachkommunikation.hsmagdeburg.de/kommu/projekt01/index.php?idcatside=29<br />
• Teilnahme an regionalen und überregionalen Bildungsmessen<br />
11 Müller-Böling, D.: 10 Jahre Hochschulmarketing: schon hinter sich oder noch vor uns?; in: Meffert, H. und Müller-<br />
Böling, D. (Hrsg.): Hochschulmarketing – Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Wettbewerb;<br />
Dokumentation der Tagung v. 15.01.2007; CHE Arbeitspapier Nr. 98, November 2007, S.15<br />
Seite 30
- mit Gemeinschaftsstand der <strong>Hochschule</strong>n LSA, z. B.: Perspektiven in <strong>Magdeburg</strong>,<br />
Chance in Halle, Einstieg-Abi in Berlin, Azubi & Studententage in Leipzig und in Hannover<br />
- mit eigenem Stand der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), z. B.: Regionale Wirtschaftstage<br />
Bitterfeld-Wolfen, Berufsfindungsmesse der IHK und der Agentur für Arbeit<br />
<strong>Magdeburg</strong>, Hochschulmessen der Agenturen für Arbeit Halberstadt, Dessau, <strong>Magdeburg</strong>,<br />
Halle, <strong>Stendal</strong>, Sangerhausen etc., Studien- und Berufsbörse in Haldensleben und<br />
Weferlingen usw.)<br />
• regelmäßige Teilnahme an Projekttagen zur Studienorientierung an Gymnasien und<br />
Fachoberschulen<br />
• regelmäßige Teilnahme an Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler (organisiert durch<br />
Elternvertreter, Krankenkassen, VDI o. ä.)<br />
• "Das verschmähte Paradies" Vier Seiten in ZEIT CAMPUS (Nr. 5, <strong>2008</strong>), in denen es<br />
maßgeblich um die <strong>Hochschule</strong> und die Stadt <strong>Magdeburg</strong> geht.<br />
http://www.zeit.de/campus/<strong>2008</strong>/05/ost-west-unis<br />
• Zusammenarbeit mit der Stadt (MMKT)<br />
• Beilage in DIE ZEIT (2009 noch offen)<br />
• Zusammenarbeit mit Stadtmagazin DATEs<br />
• Produktion von "Studieren in <strong>Magdeburg</strong>"; dient als Erstsemesterstarthilfe und zur Werbung<br />
der Neuen (Versand mit Einladungsschreiben zu Bewerbertagen usw.)<br />
• Zusammenarbeit mit Volksstimme (Campusseite: seit Ende September wöchentlich und<br />
fast im gesamten Verbreitungsgebiet im nördlichen und mittleren Sachsen-Anhalt)<br />
Annahmeverhalten verbessern<br />
Damit Bewerber, denen somit schon die <strong>Hochschule</strong> bekannt ist, ihren zugesagten Studienplatz<br />
auch annehmen, haben sich die Dekanate der Fachbereiche entschlossen, den Studienplatzzusagen<br />
Begrüßungsschreiben beizulegen. Bewerber aus dem weiteren Umfeld der <strong>Hochschule</strong><br />
werden zu Bewerbertagen12 eingeladen und nutzen dieses Angebot auch rege. Zusätzlich<br />
werden weitere Informations– und Dienstleistungsangebote vorgehalten, die z. B. die Wohnraumsuche<br />
etc. erleichtern. Hierbei steht die Transparenzerhöhung zum Abbau von Unsicherheiten<br />
beim Wechsel von der Schule zur <strong>Hochschule</strong> im Vordergrund.<br />
Zentral hierbei ist die Frage der Qualität des „Erstkontakts“, die insbesondere für die Studienberatung<br />
entscheidend ist.<br />
Um den Übergang von der Schule zur <strong>Hochschule</strong> und damit mögliche Unsicherheiten zu<br />
beseitigen, wird überlegt, weitere Angebote zur Qualifikation anzubieten, um Leistungsschwächen<br />
einiger Studierwilliger aufgrund der unterschiedlichen Vorausbildungen abzubauen.<br />
6.2.2.2 Zu Beginn des Studiums:<br />
Um eine Willkommensatmosphäre gleich zu Beginn zu schaffen, werden die Erstsemester nach<br />
den traditionellen Immatrikulationsfeiern in <strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong> von den Ansprechpartnern<br />
der Fachbereiche in Empfang genommen. Sie werden mit ersten Informationsschriften und<br />
kleinen Willkommensgeschenken der regionalen Unternehmen versorgt. Gleichzeitig steht das<br />
Studentenwerk für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich werden Einführungstage und –wochen<br />
genutzt, um über das kommende Studium (Inhalte, Anforderungen) und hierzu notwendige<br />
Kenntnisse (z. B. Bibliothek, Rechenzentrum, Prüfungs- und Studienordnung, Hochschulsport<br />
etc.) zu informieren.<br />
6.2.2.3 Während des Studiums<br />
Aus der Vielzahl der Aktivitäten, die neben den regelmäßigen Evaluationen der Lehre und den<br />
Studienfachberatungen stattfinden, seien einige neue Maßnahmen beispielhaft herausgegriffen,<br />
die verdeutlichen sollen, dass die Betreuung und die Qualität im Vordergrund stehen. Für die<br />
ausländischen Studierenden wurde ein Patenschaftsprogramm entwickelt, in dem Bürgerinnen<br />
12 www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtung/pressestelle/pressemitteilg/mitteilungansehen?schluessel=331<br />
Seite 31
und Bürger den jungen Menschen gewissermaßen als Paten für das „tägliche“ Leben in einer<br />
fremden Umgebung zur Seite stehen. Um Unterschiede in der Vorausbildung zu kompensieren,<br />
werden zusätzliche freiwillige Tutorate angeboten, womit der Studienerfolg erhöht werden und<br />
in der Folge die Abbrecherquote positiv beeinflusst werden kann.<br />
Im Rahmen eines Studium Generale13 werden verschiedene Qualifikationen und über die<br />
Studieninhalte hinausgehende Kenntnisse vermittelt.<br />
Selbstverständlich wird an den Freizeitangeboten (Hochschulsport, Attraktivität der Hochschulstadt<br />
und der Umgebung, Campus-Kino, Campusfest, Sommerfest, Hochschulball u. v. a. m.)<br />
intensiv gearbeitet. Dies wurde unlängst in einer bundesweiten Umfrage zum Hochschulsport<br />
positiv evaluiert.<br />
6.2.2.4 Zum Ende des Studiums<br />
Im Hinblick auf die umfangreiche Absolventenberatung und –vermittlung, die seit Jahren mit<br />
großem Erfolg an der <strong>Hochschule</strong> durch das Career Center (www.hsmagdeburg.de/service/careercenter/)<br />
betrieben wird, sei aufgrund des Umfangs der Hinweis auf<br />
das Internetangebot (www.hs-magdeburg.de/service/careercenter/stud/) und den Anhang 3<br />
erlaubt.<br />
Die zuletzt genannten drei Punkte spiegeln die Qualität der Ausbildung, des Service und des<br />
Lebens am Studienort wider.<br />
6.2.2.5 Nach dem Studium<br />
Selbstverständlich hält die <strong>Hochschule</strong> auch nach dem Studium über verschiedene Maßnahmen<br />
Kontakt zu ihren ehemaligen Studierenden. Die Alumni-Konzeption wird gegenwärtig<br />
umgesetzt, um die Arbeit in den Fachbereichen zu unterstützen. Dies umso mehr, da der<br />
Aufbau eines umfangreichen Weiterbildungsangebots voranschreitet. Besondere Beachtung<br />
fand eines der Weiterbildungsangebote im Rahmen der Bildungsreise der Bundeskanzlerin am<br />
9.10.<strong>2008</strong> (www.hs-magdeburg.de/aktuelles/galerie/buka<strong>2008</strong>/).<br />
Wie beschrieben zielt dieser fünfphasige Kommunikationsansatz der <strong>Hochschule</strong> in hohem Maß<br />
auf die Studierenden und deren Eltern ab, die die Rolle der Multiplikatoren übernehmen<br />
(sollen).<br />
Um die externe Kommunikation zusätzlich auch personell zu unterstützen, hat die <strong>Hochschule</strong><br />
mittlerweile zusätzliche Stellen in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Studienberatung besetzt.<br />
Eine Stelle für Qualitätsmanagement (insbesondere im Hinblick auf den Ablauf des Studiums –<br />
im Sinne eines Prozessmanagements) wurde ausgeschrieben und wird demnächst besetzt<br />
werden.<br />
Im Rahmen der internen Kommunikation, die federführend durch die neugeschaffene Marketing<br />
AG betrieben wird, soll daraufhin gearbeitet werden, dass die Aktivitäten der <strong>Hochschule</strong><br />
gewissermaßen durch die „Brille der Studierenden“ gesehen wird.<br />
13 www.hs-magdeburg.de/weiterbildung/studium_generale/index_html/document_view<br />
Seite 32
7 Verhältnis Staat und <strong>Hochschule</strong> – Flexibilität und<br />
Eigenverantwortung<br />
7.1 Stärkung interner Selbststeuerung<br />
Im Folgenden wird – um Wiederholung zu vermeiden - nur auf die jüngsten Arbeiten im Bereich<br />
der internen Selbststeuerung eingegangen, da die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) zur<br />
Jahresmitte den umfassenden „Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung der<br />
Elemente der Selbststeuerung an der HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)“ gemäß der Zielvereinbarungen<br />
abgegeben hat. Hervorzuheben ist, dass die Umstellung von Diplomstudiengängen auf<br />
das gestufte System in den Ansätzen der Selbststeuerung große Probleme aufwirft. Zum einen<br />
sind die Daten im Rahmen der Zeitreihenanalyse (z. B. durchschnittliche Studiendauer) nicht<br />
mehr vergleichbar, zum anderen gibt es noch zu wenig zuverlässige Vergleichszahlen für das<br />
Benchmarking. Der anfängliche Aufwand bei der Analyse der neuen Daten sollte nicht unterschätzt<br />
werden.<br />
Für wichtige – die Strategie der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) determinierende –<br />
Themen wurden die Positionen von Rektoratsbeauftragten geschaffen. Diese Positionen<br />
nehmen Professorinnen oder Professoren ein, die sich längerfristig eines zentralen Themas der<br />
<strong>Hochschule</strong> annehmen. Letztes Jahr wurden für die Weiterbildung zwei Rektoratsbeauftragte,<br />
für die Internationalisierung und für Kapazitätsfragen jeweils eine Person gefunden. Diese<br />
Beauftragten sollen das jeweilige Thema in Verbindung mit der Hochschulleitung und entsprechenden<br />
Senatskommissionen über einen längeren Zeitraum begleiten. Die Vorteile liegen in<br />
einer Diffundierung von Wissen in der <strong>Hochschule</strong> und der Intensivierung der Zusammenarbeit<br />
zwischen den in der Verwaltung und in Lehre und Forschung Tätigen.<br />
Es ist selbstverständlich, dass die Fachbereiche z. B. monatlich über die monetären (Stand der<br />
verfügbaren Haushaltsmittel) und nichtmonetären (Balanced Scorecard) Daten informiert<br />
werden. Bei Abweichungen der Ist- von den Plangrößen finden Gespräche mit der Hochschulleitung<br />
statt.<br />
7.1.1 Stand der hochschulinternen Mittelverteilung sowie der Einführung<br />
einer „leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM)“<br />
Das für das Jahr 2007 entworfene und im „Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung<br />
der Elemente der Selbststeuerung an der HS <strong>Magdeburg</strong> – <strong>Stendal</strong> (FH)“ vom 30.06.<strong>2008</strong> zur<br />
leistungsorientierten Mittelverteilung ausführlich dargestellte Modell ist zur Mittelverteilung <strong>2008</strong><br />
genutzt wurden. Erstmalig konnte für <strong>2008</strong> die Kennzahl „außenwirksame Leistungen“ genutzt<br />
und 5 % der Mittel darüber verteilt werden. Bis auf die Investitionsmittel und kleinere Beträge<br />
sind alle den Fachbereichen zur Verfügung gestellten Mittel über dieses Modell verteilt worden.<br />
Entsprechend den erhobenen Daten in diesem System können Entwicklungen der einzelnen<br />
Jahre für die Fachbereiche und auf <strong>Hochschule</strong>bene entnommen werden.<br />
Die Datenerhebung für <strong>2008</strong> ist abgeschlossen, damit die Mittel für 2009 verteilt werden<br />
können. Großer Vorteil dieses schnellen Verfahrens ist die Tatsache, dass Leistungsveränderungen<br />
des Vorjahrs schon im aktuellen Jahr Auswirkungen haben.<br />
7.1.2 Entwicklungsstand des Controllings/Kosten- und Leistungsrechnung<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> wurde genutzt, um die bestehenden Steuerungselemente laut „Bericht über die<br />
konzeptionelle Anlage und die Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)“ vom 30.06.<strong>2008</strong> kontinuierlich zu verfeinern und anzuwenden.<br />
7.1.2.1 Kosten – und Leistungsrechnung (KLR)<br />
Die KLR wird an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) als kontinuierlicher Prozess durch<br />
das Controlling verantwortlich ausgeführt. Im Jahr <strong>2008</strong> galt es, die zwischen den <strong>Hochschule</strong>n<br />
des Landes Sachsen-Anhalt abgesprochene weitgehend einheitliche KLR -Konzeption für die<br />
Seite 33
Verrechnung des Haushaltjahres 2007 umzusetzen. Dabei traten Fragen zur Behandlung<br />
bestimmter Geschäftsprozesse auf (wie neue Regelung zur Behandlung der gWg im Rahmen<br />
der Abschreibungen, Wertigkeit von BA- und MA-Studiengängen im Vergleich zu Diplomstudiengängen,<br />
Umgang mit bestimmten Geschäftsvorfällen wie Förderung der Berufungsfähigkeit<br />
von Frauen), die im Kontext der Controller zur Findung einer praktikablen Lösung besprochen<br />
wurden.<br />
Die Nutzung der Ergebnisse der KLR ist weiterhin nur eingeschränkt möglich. Die <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) befindet sich noch in der Umstellungsphase von Diplomabschlüssen<br />
auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Damit werden im Rahmen der Vollkostenrechnung der<br />
KLR die Gesamtkosten über alle zu bedienenden Studiengänge verteilt. Das hat zur Folge,<br />
dass auf keinem der bestehenden Studiengänge die Kosten für eine Vollbesetzung ausgewiesen<br />
werden. Dies erschwert die Bewertung und eine Trendanalyse. Erst mit dem kompletten<br />
Umstieg auf Bachelor-Studiengänge und der Etablierung aller geplanten Master –Studiengänge<br />
werden belastbare Ergebnisse vorliegen.<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> wurden weitere Anforderungen an die KLR als Vollkostenrechnung bekannt. Für<br />
den „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in Forschung, Entwicklung und Innovation“<br />
sowie für die Abrechnung der EU-Projekte wird von der EU eine Vollkostenrechnung gefordert.<br />
Es bedarf demzufolge einer Änderung der Konzeption zur KLR. Es muss eine Trennung von<br />
wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit erfolgen. Dies hat zur Folge, dass es keine<br />
pauschalen Verrechnungen für Forschungskosten mehr geben kann, sondern die Gemeinkosten<br />
und die Kosten der Professoren über eine Zeitaufschreibung sowie über entsprechende<br />
Verteilschlüssel den konkreten Projekten zuzurechnen sind.<br />
Zwischen den <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt wurden dazu bereits Lösungsmöglichkeiten<br />
diskutiert, die von der Einführung der Finanzbuchhaltung (FIBU) in der Buchhaltung bis zu einer<br />
Methodenzertifizierung der KLR/Vollkostenrechnung reichten. Die Controller favorisieren eine<br />
landeseinheitliche Methodenzertifizierung der KLR/Vollkostenrechnung, die auch perspektivisch<br />
den Prüfungen der EU standhält. Die Einführung der FIBU erfordert genau wie die kamerale<br />
Buchhaltung für die notwendige Trennungsrechnung eine KLR/Vollkostenrechnung. Somit<br />
reicht es nicht, allein die FIBU einzuführen. Die Entscheidung der Kanzler dazu steht noch aus.<br />
7.1.2.2. Controlling<br />
7.1.2.2.1 Kennzahlensystem<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> galt es, den zwischen den <strong>Hochschule</strong>n des Landes abgestimmten Kennzahlenkatalog<br />
zu untersetzen. Die Daten, speziell für die Balanced Scorecard , werden entsprechend<br />
den gesetzten Berichtsterminen erhoben und der Hochschulleitung, den Dekanen und den<br />
Verantwortlichen der Zentralen Einrichtungen und der Verwaltung zur Verfügung gestellt.<br />
Lediglich für den Kennzahlenbereich „internationale Beziehungen“ gibt es zu einigen Daten<br />
noch Erfassungsmodalitäten (Organisation zentrale oder dezentrale Erfassung) zu klären. Die<br />
Dekane der Fachbereiche erhalten darüber hinaus Zeitreihen mit der Entwicklung einzelner<br />
Studiengänge zu Studierenden, Anfängern und Bewerbern, Absolventen und Studierdauer.<br />
Für die Kennziffer Abbrecherquote wird intern nach einer belastbaren Definition gesucht.<br />
Zurzeit werden 3 Erhebungen vorgenommen bzw. angestrebt:<br />
• Ermittlung des Schwundfaktors (für BA-STG erstmalig nach Abschluss des WS <strong>2008</strong>/09,<br />
da dann ein Zyklus im BA-Bereich abgeschlossen ist). Der Schwundfaktor dient gleichzeitig<br />
als Faktor in der Kapazitätsberechnung zur Ermittlung der Aufnahmekapazität.<br />
• Verfolgung der Anfänger im 1. Fachsemester (z. B. vom WS 2005/2006 (erstmalige<br />
Immatrikulation im BA) in den WS 2006/07, WS 2007/08, WS <strong>2008</strong>/09). Hierbei zeigt sich,<br />
zu welchem Zeitpunkt der Studienabbruch erfolgt.<br />
Seite 34
• Abbrecher des letzten akademischen Jahres ins Verhältnis gesetzt zu den<br />
Gesamtstudierenden des WS plus der Anfänger des SoS dieses akademischen Jahres.<br />
Bei dieser Datenerhebung werden zusätzlich die Gründe des Abbruchs aufgezeigt.<br />
Die „Verbleibsquoten“ gemäß 2. wurden mit den Dekanen mittlerweile besprochen und die<br />
unterschiedlichen Entwicklungen in allen Bachelor-Studiengängen diskutiert. In den Studiengängen,<br />
deren Verbleibsquoten tendenziell am schnellsten sinken, wurden bereits Gegenmaßnahmen<br />
ergriffen.<br />
7.1.2.2.2 Interne Planungsmodelle<br />
Die erarbeiteten internen Planungsmodelle: Kapazitätsmodell, Flächenmodell, Ermittlung des<br />
Vergaberahmens zur W-Besoldung und LOM wurden im Jahr <strong>2008</strong> kontinuierlich aktualisiert<br />
und genutzt bzw. weiter aufgebaut.<br />
Kapazitätsmodell:<br />
Die in der Lehre bei der Umsetzung der BA- und MA-Studiengänge gemachten Erfahrungen<br />
führten teilweise zu Änderungen von Lehrveranstaltungen und Betreuungsdaten (CNW). Diese<br />
Änderungen wurden im Kapazitätsmodell eingearbeitet. Über das Modell erhielten die Dekane<br />
sowie die Hochschulleitung detaillierte Informationen, welcher personelle Aufwand sich daraus<br />
ergibt. Damit ist die <strong>Hochschule</strong> in der Lage sicher zu stellen, dass die vom Land übergebenen<br />
Kapazitäten eingehalten und effektiv eingesetzt werden. Nachdem das erste Anfängermatrikel<br />
die neuen Studiengänge durchlaufen hat, wird an einer Dienstleistungsverflechtungsmatrix<br />
gearbeitet, die die langfristigen Dienstleistungen zwischen den Fachbereichen abbildet und<br />
diese stellenwirksam darstellt. Darüber hinaus mussten die ersten Änderungen der Bachelorstudiengänge<br />
erfasst werden, die im Zuge der Akkreditierungsbegutachtung und im Interesse<br />
einer besseren „Studierbarkeit“ nötig waren.<br />
Flächenmodell:<br />
Die Erarbeitung des Flächenmodells ist noch nicht abgeschlossen. Das Modell ist verknüpft mit<br />
dem aktuellen Kapazitätsmodell. Die zusätzlich notwendigen Angaben für das Flächenmodell<br />
sind mit den Fachbereichen gemeinsam <strong>2008</strong> erhoben wurden und werden im ersten Halbjahr<br />
2009 in ein Flächenbedarfsmodell je Fachbereich münden.<br />
Vergaberahmen W-Besoldung:<br />
Die Arbeit mit diesem Modell obliegt dem Personaldezernat und dem Prorektor für HS-Entwicklung<br />
und - Marketing. Das Personaldezernat sorgt für die ständige Aktualität der Daten. Die<br />
geltende W-Besoldung hat die Erwartungen nur zum Teil erfüllt. Die Attraktivität des Professorenamtes<br />
wurde nicht gerade gestärkt. Dies lässt sich am schleppenden Verlauf zahlreicher<br />
Berufungsverfahren ablesen. Weder das W2 Grundgehalt noch das W3 Grundgehalt sind mit<br />
der freien Wirtschaft wettbewerbsfähig, noch bietet der schmale Vergaberahmen die Möglichkeit<br />
einer relevanten Leistungszulage. Außerdem ist eine Schieflage zu anderen Positionen des<br />
öffentlichen Dienstes zu erkennen. Wettbewerbsfähige <strong>Hochschule</strong>n müssen auch finanziell so<br />
ausgestattet sein, dass sie konkurrenzfähig sind. Eine Abschaffung des Besoldungsdurchschnitts<br />
allein wird nur die Berechnung und Planung des Vergaberahmens unnötig machen.<br />
Höhere Zahlungen werden deshalb nicht möglich, da die Budgets der <strong>Hochschule</strong>n zu knapp<br />
bemessen sind. Die Evaluationen der ersten Zielvereinbarungen, die dieses Jahr zum ersten<br />
Mal stattfinden, werden durch den Aufbau der Leistungserfassung und Leistungsmessung<br />
unterstützt.<br />
7.1.2.2.3 Sonstige operative und konzeptionelle Arbeiten im Controllingbereich<br />
Neben den an dieser Stelle bereits im letzten Rektorbericht genannten operativen sowie<br />
kontinuierlich auftretenden Aufgaben ergaben sich für das Controlling <strong>2008</strong> folgende Aktivitäten:<br />
• Im Rahmen der Verbesserung des Berichtswesens aus der KLR wurde von der<br />
Controllerin der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) gemeinsam mit dem Controller<br />
der <strong>Hochschule</strong> Harz (FH) ein Bericht des Controllingprogramms HISCOB zu Lehrkos-<br />
Seite 35
ten überarbeitet und der HIS GmbH mit der Bitte um Etablierung dieses Berichtes im<br />
Programm HISCOB zur Verfügung gestellt.<br />
• Das Controlling nahm im Jahr <strong>2008</strong> an einem Benchmarking der Zentralen Verwaltung<br />
teil, das von der HIS GmbH durchgeführt wurde. Im Ergebnis des Benchmarking für das<br />
Controlling wurde die Notwendigkeit der Einführung eines DATA WAREHOUSES erkannt,<br />
das infolge dezentraler Zugriffsmöglichkeiten zu einer effizienteren und schnelleren<br />
Information der Entscheidungsträger führt. Die Einführung könnte von der HIS<br />
GmbH unterstützt werden, bedarf aber innerhalb der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) trotzdem noch eines zusätzlichen Personalbedarfs in der Einführungsphase.<br />
• Beratung der Controllerinnen und Controller zu der Trennungsrechnung/Vollkostenrechnung<br />
für den „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in Forschung,<br />
Entwicklung und Innovation“. Siehe auch Punkt 7.1.2.1<br />
7.1.3 Aufbau der Leistungserfassung und Leistungsmessung im Rahmen<br />
des akademischen Controlling/Benchmarking<br />
7.1.3.1 Leistungserfassung<br />
Die Leistungserfassung an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) geschah <strong>2008</strong> primär für<br />
zwei Zwecke:<br />
1. Für die Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM) und Balanced Scorecard<br />
2. für Kriterien für die W-Besoldung.<br />
Die Leistungsmessung erfolgt über geeignete Indikatoren: Die leichte Erhebbarkeit und die<br />
Nutzbarkeit für hochschulinterne und hochschulübergreifende Vergleiche stellen zentrale<br />
Anforderungen an derartige Leistungsindikatoren dar. Die zeitnahe, periodengerechte Erfassung<br />
- in der Regel am Ende der alten oder zu Beginn der neuen Zeitperiode - stellt eine<br />
weitere Anforderung an die Leistungsmessung dar. Wichtig ist auch die Bereitschaft der<br />
Befragten zur aktiven Mitarbeit, die in Anlehnung an Brüggemeier umso höher sein wird, je<br />
besser es gelingt, die Chancen von Leistungsmessungen zu kommunizieren, wie z. B. Transparenz<br />
herzustellen, welche Leistungen einer <strong>Hochschule</strong> wo in welchem Maße erbracht werden,<br />
denn: „Ohne Leistungstransparenz lässt sich aber das eigene Profil nicht bestimmen; von<br />
einem Leistungs- und Profilvergleich mit anderen <strong>Hochschule</strong>n ganz zu schweigen.“<br />
Die Leistungserfassung für die Leistungsorientierte Mittelverteilung ist schon in früheren<br />
Berichten umfangreich besprochen worden, sodass auf eine tiefergehende Beschreibung<br />
verzichtet wird.<br />
Bei der Erfassung der Daten wurde – wie oben bereits genannt – Wert auf eine einfache<br />
Erhebung gelegt, und deshalb wurden die Daten – soweit möglich – der hochschulinternen<br />
Statistik entnommen. In den Fällen, wo dies nicht möglich war - das betrafen das Oberziel<br />
außenwirksame Leistungen und das ‚Forschungsziel’ Anzahl der Veröffentlichungen - wurden<br />
die Daten mit einem für diesen Zweck entwickelten Erfassungsbogen erhoben, der <strong>2008</strong> noch<br />
einmal überarbeitet wurde.<br />
Es ist geplant, 2009 die außenwirksamen Leistungen und Anzahl der Veröffentlichungen online,<br />
dezentral und möglichst tagesaktuell in einem speziellen LSF-Modul der Hochschul-Informations-System<br />
GmbH (HIS) zu erfassen. Das verlangt nach einer grundlegenden Überarbeitung<br />
der derzeit vorliegenden Version des betreffenden LSF-Eingabetools. <strong>2008</strong> konnte dies – wie<br />
angedacht – noch nicht realisiert werden.<br />
Zu 2. Leistungserfassung für Kriterien für die W-Besoldung<br />
Die Erfassung von Daten für die leistungsbezogene Entlohnung von Professoren im Rahmen<br />
der W-Besoldung steht noch am Beginn. Grundsätzlich soll sich der Leistungsanteil im Rahmen<br />
der W-Besoldung an den vier folgenden Kategorien orientieren: Lehre und Prüfungen; Selbstverwaltung;<br />
Forschung, Entwicklung und andere wissenschaftlichen Leistungen; sonstige<br />
Leistungen.<br />
Seite 36
Dabei können die außenwirksamen Leistungen und Anzahl der Veröffentlichungen, die für die<br />
leistungsorientierte Mittelverteilung erhoben wurden, auch für die Kategorie Forschung,<br />
Entwicklung und andere wissenschaftliche Leistungen im Rahmen der W-Besoldung genutzt<br />
werden. Das vermeidet Doppelerhebungen und damit zusätzlichen Erhebungsaufwand. Die<br />
Einheit, auf welche die Leistungen sich dann beziehen, sind dabei dann eben die Professoren,<br />
die der W-Besoldung unterliegen, und nicht die Fachbereiche. Im Hinblick auf die Kategorie<br />
‚Lehre und Prüfungen’ liegen für <strong>2008</strong> Ergebnisse der jährlichen Lehrevaluation vor.<br />
2009 wird es darum gehen, ein erstes vorläufig anwendbares Kriteriensystem zu entwickeln,<br />
das wir ähnlich wie bei der LOM als evolutives Modell verstehen werden, d. h. es stellt kein<br />
starres Konzept dar, sondern unterliegt der kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung.<br />
7.1.3.2 Benchmarking<br />
Benchmarking im Hochschulbereich meint zweierlei: einerseits den Vergleich der Leistungen<br />
von <strong>Hochschule</strong>n bzw. von Fachbereichen unterschiedlicher <strong>Hochschule</strong>n (z. B. hinsichtlich der<br />
Studiendauer ihrer Erstabsolventen, des Anteils ausländischer Studierender, ihres Frauenanteils<br />
beim wissenschaftlichen Hauptpersonal usw.) und andererseits den internen Vergleich der<br />
Leistungen der Fachbereiche einer <strong>Hochschule</strong>. In der bereits erwähnten Leitungsorientierten<br />
Mittelverteilung an die Fachbereiche ist implizit bereits ein Benchmarking zwischen den<br />
Fachbereichen enthalten, denn die Zuweisung finanzieller Mittel erfolgt auf der Basis der Werte<br />
von Leistungsindikatoren (Absolventenquote, eingeworbene Drittmittel, Forschungsleistungen<br />
usw.), wobei je Indikator jenen Fachbereichen mehr Mittel zugewiesen werden, die im Vergleich<br />
zu anderen Fachbereichen in diesem Leistungsbereich besser abschneiden.<br />
Hinsichtlich des Vergleichs der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit anderen <strong>Hochschule</strong>n<br />
lässt sich berichten, dass fortlaufend Benchmarking-Vergleiche der <strong>Hochschule</strong> und ihrer<br />
Fachbereiche mit anderen <strong>Hochschule</strong>n durchgeführt werden, wobei teilweise Indikatoren<br />
verwendet werden, die im Rahmen der LOM erfasst werden wie die Frauenanteile Studierender<br />
bzw. Frauenanteile am wissenschaftlichen Personal oder die Anteile ausländischer Studierender<br />
und ausländischer Absolventen.<br />
Darüber finden Vergleiche im Hinblick auf die folgenden beispielhaft aufgelisteten Merkmale<br />
statt:<br />
• Fachstudiendauer<br />
• Betreuungsrelationen<br />
• Erstausbildungsquote<br />
• laufende Finanzausstattung je Studierendem und je Professor sowie für ein Studium<br />
• Drittmittel je Professor.<br />
Diese Vergleiche dienen der Eigen-Orientierung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) –<br />
und ihrer Fachbereiche – im Sinne eines „wissen wollen, wo man steht“, aber auch des<br />
Erkennens von Stärken und gegebenfalls der Nutzbarmachung für Marketingzwecke. Die<br />
Vergleichsdaten werden amtlichen Statistiken entnommen, wie sie vom Statistischen Bundesamt,<br />
insbesondere in den Publikationen ‚Nicht-monetäre und monetäre hochschulstatistische<br />
Kennzahlen’, und vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt veröffentlicht werden.<br />
7.2 Hochschulbau, Flächenmanagement, Bauunterhalt und<br />
Liegenschaften<br />
7.2.1 Sachstand zur Einführung des Facility Managements und interner<br />
Flächenmanagementmodelle zur wirtschaftlichen Flächennutzung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) führt seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit der Ottovon-Guericke<br />
Universität ein komplexes Facility Managementsystem. Die aufwendige graphische<br />
und numerische Datenerhebung und die Anpassung der Software an die Bedürfnisse der<br />
Seite 37
<strong>Hochschule</strong>n und Universitäten führen zu einem langwierigen Einführungsprozess, der zurzeit<br />
noch anhält und das Dezernat IV auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.<br />
Das Flächen- und Raummanagement der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wird über<br />
dieses CAFM-System betrieben. Im Jahr 2009 sollen das Störungs- und Wartungsmanagement<br />
in das CAFM-System integriert werden. Über ein WEB-Portal soll für alle Mitarbeiter die<br />
Möglichkeit geschaffen werden, Störungsmeldungen abzusetzen und den Bearbeitungsstand zu<br />
verfolgen. Die graphischen und numerischen Flächendaten sollen über das WEB-Portal allen<br />
Mitarbeitern zugänglich gemacht werden. Die dazu notwendigen Vorarbeiten und Abstimmungen<br />
sind im Jahr <strong>2008</strong> abgeschlossen worden, sodass die Einführung Anfang 2009 beginnen<br />
konnte. Auf der Basis der Kapazitätsberechnungen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
wird zurzeit das Flächenmodell der <strong>Hochschule</strong> erarbeitet. Die Ergebnisse werden im ersten<br />
Halbjahr 2009 vorliegen.<br />
7.2.2 Sachstand zu den Großen Baumaßnahmen<br />
Sanierung Haus 3 der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong><br />
Die Sanierung des Gebäudes 3 der Tauentzienkaserne wurde im April <strong>2008</strong> abgeschlossen.<br />
Die Baukosten betrugen 5,13 Mio. €. Die Nutzung erfolgte mit dem Sommersemester <strong>2008</strong>,<br />
sodass sich die Studienbedingungen am Standort <strong>Stendal</strong> wesentlich verbessert haben.<br />
Sanierung Haus 1 der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong><br />
Die Maßnahme „Sanierung Haus 1“ der Tauentzienkaserne ist sowohl in der Dringlichkeitsliste<br />
des Ministeriums aufgenommen worden als auch Bestandteil des geplanten Konjunkturprogramms<br />
II der Bundesregierung.<br />
Unabhängig von den oben genannten Baumaßnahmen strebt die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) die unentgeltliche Übertragung der Grundstücke in das Körperschaftsvermögen im<br />
Sinne des § 108 Abs. 3 HSG-LSA an.<br />
7.2.3 Sachstand zu den Kleinen Baumaßnahmen<br />
Kleine Baumaßnahmen im Zuge der Hochschulstrukturreform<br />
Im Zuge der Hochschulstrukturreform sind an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vier<br />
kleine Baumaßnahmen notwendig geworden. Die Maßnahmen „Umzug der Geotechniklabore<br />
von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 1“ mit Baukosten von rund 275 T€ und der „Umzug<br />
des Wasserbaulabors von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 3“ mit Baukosten von rund<br />
385 T€ sind zur Nutzung für die Lehre übergeben worden. Die Maßnahme „Umzug Großversuchstechnik<br />
von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 1“ ist im Jahr <strong>2008</strong> begonnen<br />
worden, nachdem die Finanzierung geklärt war. Die Übergabe an den Fachbereich ist für 2009<br />
geplant ist.<br />
Die Maßnahme „Umzug der Straßenbaulabore von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 1“<br />
ist vom Kultusministerium genehmigt worden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 350<br />
T€. Die Planungen dafür sollen 2009 beginnen.<br />
Weitere Kleine Baumaßnahmen<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> wurden folgende Baumaßnahmen begonnen:<br />
• Errichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Campus Herrenkrug<br />
• Anschluss eines CONE-Calorimeters in der Laborhalle 1<br />
• Neubau von Sportflächen auf dem Campus Herrenkrug<br />
Die Finanzierung des Kinderspielplatzes wird über Sponsoring abgesichert. Der Neubau der<br />
Sportflächen wurde über den Hochschulhaushalt finanziert.<br />
Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen sind vom Kultusministerium genehmigt worden<br />
und werden in Abhängigkeit der Finanzierung in den Folgejahren realisiert:<br />
Seite 38
• Erweiterung der Lüftungsanlage der Versuchskläranlage in Gerwisch<br />
• Einbau einer Solarthermieanlage für die WW-Bereitung der Mensa<br />
• Brandschutztechnische Ertüchtigung der Mensa<br />
• Einbau einer zentralen USV im ZKI <strong>Stendal</strong><br />
• Gestaltung der Außenanlagen in <strong>Stendal</strong><br />
Die Maßnahme „Neubau von Sportflächen am Campus <strong>Stendal</strong>“ wurde im Jahr <strong>2008</strong> abgeschlossen.<br />
In Abstimmung mit dem Kultusministerium werden in den Jahren <strong>2008</strong> und 2009 der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) für kleine Baumaßnahmen finanzielle Mittel in Höhe von<br />
1,15 Mio € zur Verfügung gestellt.<br />
7.2.4 Sachstand zum Bauunterhalt<br />
Im Rahmen des Bauunterhaltes wurden im Haushaltsjahr <strong>2008</strong> rund 340 T€ verbaut. Die<br />
Schwerpunkte lagen in der Instandsetzung baulicher und betriebstechnischer Anlagen. Im<br />
Ergebnis der durchgeführten Brandsicherheitsschauen wurden zusätzlich Rauchschutztüren im<br />
Hörsaalgebäude und in der Brandenburger Str. eingebaut. Weiterhin wurden im Rahmen des<br />
Bauunterhaltes das Außengelände für die Biogasanlage und die Überdachung des Lagers des<br />
Fachbereiches Bauwesen errichtet.<br />
Insgesamt muss festgestellt werden, dass nach fast 10jährigem Betrieb der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) am Campus Herrenkrug der Unterhaltungsaufwand an den technischen<br />
und baulichen Einrichtungen erheblich steigt und das Bauunterhaltsbudget diesem<br />
Umstand angepasst werden muss.<br />
7.2.5 Entwicklungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wendete im Jahr <strong>2008</strong> rund 2,15 Mio € für Bewirtschaftungskosten<br />
auf. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist dem weiteren Ausbau der<br />
Liegenschaft in <strong>Stendal</strong> und den Energiepreiserhöhungen geschuldet. Der Kostenschwerpunkt<br />
liegt dabei auf den Energiekosten, gefolgt von den Wartungskosten.<br />
Um die Kostenschwerpunkte zu untersuchen und Einsparpotentiale zu ermitteln, wurde Anfang<br />
2007 mit der Firma Siemens Building Technologies eine Grobanalyse zur Energieeinsparung<br />
durch bau- und betriebstechnische Veränderungen durchgeführt. Im Ergebnis dieser Analyse<br />
ergaben sich hauptsächlich Einsparpotentiale durch die Motivation der Mitarbeiter. Die zukünftige<br />
strategische Ausrichtung des Energiemanagements muss sich demzufolge auf den<br />
täglichen sparsamen Umgang mit Energie konzentrieren.<br />
Seite 39
8 Fachbereiche<br />
8.1 Angewandte Humanwissenschaften<br />
Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master)<br />
Aktuell sind drei Studiengänge am FB eingerichtet:<br />
Bachelor-Studiengang "Rehabilitationspsychologie" (B.Sc.)<br />
Master-Studiengang "Rehabilitationspsychologie" (M.Sc.)<br />
Bachelor-Studiengang "Angewandte Kindheitswissenschaften" (B.A.)<br />
Zu den etablierten Studiengängen<br />
Wie den Daten der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, erfreuten sich beide Bachelorstudiengänge<br />
einer sehr großen Nachfrage, die gegenüber dem Vorjahr sogar einen leichten<br />
Anstieg verzeichnen konnte. Hinsichtlich der Absolventenquoten lassen sich derzeit keine<br />
belastbaren Zahlen errechnen, da die jeweils erste Matrikel beider Studiengänge im SoS <strong>2008</strong><br />
gerade ihr sechstes Semester, also den frühesten Zeitpunkt für einen Studienabschluss,<br />
erreicht hatte.<br />
Die relativ hohe Absolventenquote aus dem Studiengang Rehabilitationspsychologie ist<br />
vermutlich in dem Anreiz begründet, ohne Zeitverlust direkt in den konsekutiven Masterstudiengang<br />
Rehabilitationspsychologie am Standort <strong>Stendal</strong> zu wechseln. Erfreulicherweise konnte<br />
sich aber auch ein kleiner Teil der Bachelor-Absovlenten erfolgreich in Psychologie-Masterstudiengänge<br />
anderer Universitäten Deutschlands immatrikulieren.<br />
Übersicht: Studiengänge des Fachbereichs Angewandte Humanwissenschaften<br />
WS 07/08 WS08/09<br />
Studien<br />
gang<br />
Studien- Bewerber AbsolvenStudienStudien- Bewerber AbsolvenStudienplätzeten (SoSdauer<br />
plätzetendauer<br />
07)<br />
(SoS 08)<br />
B.A.<br />
KiWi<br />
41 372 0 60 316 4 6<br />
B.Sc.<br />
Reha<br />
96 414 0 85 456 51 6<br />
M.Sc. Nicht be- 26 2 4 Nicht be- 68 12 5<br />
Reha schränktschränkt<br />
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Etablierung des konsekutiven Bachelor-<br />
/Masterstudiengangs Rehabilitationspsychologie war die Feststellung durch das Ministerium für<br />
Gesundheit und Soziales Sachsen-Anhalt im November <strong>2008</strong>, dass der Bachelorabschluss die<br />
Zulassungsvoraussetzung für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten<br />
und der Masterabschluss die Zulassungsvoraussetzung für die Ausbildung zum Psychologischen<br />
Psychotherapeuten jeweils nach PsychThG erfüllen. Diese Regelung eröffnet nicht nur<br />
den AbsolventInnen interessante Weiterbildungsoptionen, sondern liest sich zudem als eine<br />
offizielle Gleichstellung mit klinisch-psychologisch ausgerichteten universitären Masterstudiengängen.<br />
Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden, Absolventenquote<br />
B.A. Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
In der seit WS 2007/08 gültigen Auswahlsatzung werden vor allem die Bewerber berücksichtigt,<br />
die eine Berufstätigkeit oder Berufsausbildung mit inhaltlichem Bezug zum Studiengang<br />
vorweisen können. Diese Regelung hat zur Konsequenz, dass vor allem die jüngeren Studienbewerber<br />
nach Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung bzw. Wartezeit und die<br />
älteren Studienbewerber mit entsprechender Praxiserfahrung über das interne Auswahlverfah-<br />
Seite 40
en einen Studienplatz erhalten. Dies hatte bisher eine sehr interessante Zusammensetzung<br />
der jeweiligen Matrikel aus jungen und älteren praxiserfahrenen Studierenden zur Folge, die<br />
sowohl in der Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten als auch in der Umsetzung<br />
der Praxisanteile eine Perspektivenvielfalt verbürgt, die sich sehr förderlich auf die Lehr- und<br />
Lernatmosphäre auswirkt.<br />
B.Sc. Rehabilitationspsychologie<br />
Mit dem WS <strong>2008</strong>/09 trat eine neue Auswahlsatzung in Kraft, deren entscheidender Unterschied<br />
gegenüber der vorher gültigen in der Streichung der Auswahlgespräche liegt. Zwar<br />
wurden diese Auswahlgespräche durchaus als wichtiges Instrument zur Prüfung der Studienmotivation,<br />
aber auch der persönlichen Eignung für eine spätere klinisch-psychologische<br />
Tätigkeit eingeschätzt, jedoch führte die schlechte Annahmequote dazu, dass viele der zu den<br />
Auswahlgesprächen geladenen BewerberInnen, die aufgrund dieser Gespräche als weniger<br />
geeignet für dieses Studium eingestuft wurden, dennoch über das Nachrückrückverfahren einen<br />
Studienplatz erhielten. Vor dem Hintergrund des enormen personellen und zeitlichen Aufwands,<br />
der mit den Auswahlgesprächen verbunden war, wurde in der neuen Auswahlsatzung gänzlich<br />
darauf verzichtet.<br />
In der aktuellen Satzung werden Bewerber besonders berücksichtigt, die eine studiengangsbezogene<br />
Tätigkeit z. B. in Form eines Praktikums, eines freiwilligen sozialen Jahres oder eines<br />
Zivildienstes vorweisen können, über Auslandserfahrung im nicht-deutschsprachigen Ausland<br />
verfügen oder eine Berufsausbildung mit Studiengangsbezug abgeschlossen haben.<br />
Seite 41
8.2 Bauwesen<br />
Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
Zurzeit sind im FB Bauwesen folgende Studiengänge etabliert:<br />
• BA-Studiengang: Bauingenieurwesen – akkreditiert<br />
• BA-Studiengang: Sicherheit und Gefahrenabwehr – akkreditiert<br />
• MA-Studiengang: Sicherheit und Gefahrenabwehr – akkreditiert<br />
Im SoS 2009 laufen zwei bereits genehmigte und akkreditierte Masterstudiengänge an:<br />
• Energieeffizientes Bauen<br />
• Tief- und Verkehrsbau<br />
Seit 2007 ist im Fachbereich ein Dualer Bachelorestudiengang Bauingenieurwesen angesiedelt.<br />
Die gesamte Studien- und Ausbildungsdauer beträgt 9 Semester. Die Ausbildung wird vom<br />
Baubildungszentrum <strong>Magdeburg</strong> koordiniert.<br />
Der Zugang zum Bachelorestudiengang Bauingenieurwesen ist nicht reglementiert, was in<br />
Folge der konjunkturell bedingten Wirtschaftsbelebung in den letzten Jahren zur Überfüllung<br />
führte.<br />
Die Immatrikulation in den Bachelorestudiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr erfolgt auf<br />
der Grundlage der im Kalenderjahr 2005 eingeführten Eignungsfeststellungsprüfung. Durch das<br />
vorgenannte Auswahlverfahren konnte die Abbrecherquote von 50 % auf 10 % gesenkt werden.<br />
Es wurde eine deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Studienanfänger beobachtet.<br />
Der Zugang zu den Masterstudiengängen Bauingenieurwesen sowie Sicherheit und Gefahrenabwehr<br />
ist über das Erreichen einer Mindest-Abschlussnote im Bachelorestudium geregelt. Bei<br />
„Quereinsteigern“ entscheidet über die Zulassung im Einzelfall der Prüfungsausschuss (Als<br />
Zulassungsbedingung können dann weitere Qualifizierungsmaßnahmen in Schwerpunktfächern<br />
gefordert werden).<br />
Erfahrungen liegen noch nicht vor.<br />
Die Evaluation der Lehre erfolgt auf der Grundlage der hochschuleinheitlichen Evaluationsbefragungen.<br />
Des Weiteren findet eine „formfreie“ Evaluation der Lehre im Rahmen von Alumni-<br />
Treffen statt. Der Fachbereich nahm auch bei externen Evaluationen, wie CHE-Ranking, teil.<br />
Akkreditierung<br />
Alle Bachelor- und Masterstudiengänge (mit Ausnahme des dualen) sind akkreditiert (Bauingenuieurwesen<br />
bei ZEvA, SGA bei ASIIN) worden. Die Akkreditierung des dualen Studienganges<br />
Bauingenieurwesen wird erst nach Verringerung/Wegfall der Berufsschulpflicht angestrebt.<br />
Forschung<br />
In der Lehreinheit Bauingenieurwesen des Fachbereiches haben sich eine Reihe von Forschungsarbeiten<br />
etabliert. Dazu zählen u. a.:<br />
• Forschungsarbeit am Bouleterium in Patara, Türkei<br />
• Forschungsarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Gabii, Italien<br />
• Forschung mit der Deutschen Umweltstiftung – Lasttragende Strohballenbauweise<br />
• Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Bauwerkssanierung<br />
Seite 42
• Forschungsarbeit im Bereich der Erdbebensicherung in Zusammenarbeit mit dem Geoforschungszentrum<br />
Potsdam<br />
• Erdfallüberbrückung durch alternative Bauweisen in Kooperation mit der Bundesanstalt für<br />
Straßenwesen und Landesbetrieb Straßenwesen<br />
• Energieeffizientes Bauen<br />
Institutionell gesehen ist der Fachbereich Bauwesen in der Region ein fester Ansprechpartner<br />
für Unternehmen, Ämter und Institutionen des Landes. Dies erfolgt sowohl auf einer längerfristigen<br />
vertraglichen Grundlage als auch im Bedarfsfall. Beispiele hierfür sind die Zusammenarbeit<br />
mit der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, dem Landesbetrieb Hochwasserschutz, Gerichten<br />
des Landes, Landesbetrieb für Straßenwesen, Umweltbundesamt, Landesbetrieb Bau, Wasserstraßenneubauamt<br />
sowie einer Vielzahl von Unternehmen.<br />
Im Tiefbau/Straßenbaubereich existierte in Dessau eine weithin anerkannte Forschungstätigkeit,<br />
die durch die Hochschulstrukturreform eine Zäsur erfahren hat. Eine Nachberufung der<br />
Professur Straßenbau läuft zurzeit, die Großversuchstechnik wird aus Dessau nach <strong>Magdeburg</strong><br />
aktuell verlagert. Ziel des Fachbereiches ist es, nach Umsetzung der Großversuchstechnik, so<br />
schnell wie möglich an diese Tradition anzuschließen. Als weitere Schwerpunkte sollen die<br />
Gebiete Bauwerksschwingungen und Geothermie ausgebaut bzw. neu erschlossen werden.<br />
Als zukünftige Aufgabe sieht der Fachbereich auch die Konsolidierung der institutionellen<br />
Beziehungen sowie ihre Entwicklung zu geeigneten Netzwerken. Die Einwerbung von Drittmitteln<br />
soll durch die Profilierung der Forschungsschwerpunkte auf die Schwerpunkte der Masterstudiengänge<br />
und deren Einbindung ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang ist – auch<br />
vor dem Hintergrund der engen Zusammenarbeit des Fachbereichs mit der OvG-Universität –<br />
die Frage der Promotionsmöglichkeiten der Masterabsolventen zu klären.<br />
Im noch jungen Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr haben bereits erste Forschungstätigkeiten<br />
begonnen. Dies sind u. a.:<br />
• Bestimmung von sicherheitstechnischen Kennzahlen<br />
• Simulation von Gefahrensituationen bei der Personenrettung<br />
• Wasserverneblungstechnik<br />
• Brandschutz bei historischer Bausubstanz<br />
Dazu wurden Laborbereiche der OvG-Universität und des Instituts der Feuerwehr Sachsen-<br />
Anhalt in Heyrothsberge, die in den Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr integriert sind,<br />
genutzt. Insbesondere die Bedingungen im Institut der Feuerwehr sind hervorragend, da die<br />
dort vorhandene Labortechnik in den letzten Jahren auf einen sehr guten Stand gebracht<br />
wurde. Es zählt mittlerweile infolge seiner erstklassigen Versuchseinrichtungen hinsichtlich<br />
Einsatztechnik zur Brandbekämpfung und im Bereich der Brandschutzautomatik zu einer im<br />
europäischen Raum einzigartigen Forschungseinrichtung. Durch die enge Kooperation sind<br />
Studierende insbesondere in den aktuellen Schwerpunkten Wasserverneblungsanlagen<br />
eingebunden und mehrere Forschungsvorhaben werden in Kooperation bearbeitet.<br />
Im Fachbereich Bauwesen ist aus kostensparender Interaktion nur eine eng begrenzte Weiterentwicklung<br />
im Laborbereich vorgesehen, die die wenigen vorhandenen Nischen der anderen<br />
beiden Forschungseinrichtungen schließt. Hier ist z. B. die Stoffkennwertbestimmung zu<br />
Quelltermen und Stoffwerten zu bestimmten nachwachsenden Rohstoffen in Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut für Maschinenbau zu nennen.<br />
Hinsichtlich der Simulationstechnik sollen die rechentechnischen Möglichkeiten ausgeweitet<br />
werden.<br />
Schwerpunktmäßig sollen auch zukünftig die Einrichtungen des Instituts der Feuerwehr<br />
insbesondere im Masterbereich genutzt werden. Die Möglichkeit von Promotionen in diesem<br />
zukunftsfähigen Lehr- und Forschungsbereich muss geklärt werden.<br />
Seite 43
Internationalsierung<br />
Hochschulkontakte in Lehre und Forschung bestehen zu einer Vielzahl von Einrichtungen im<br />
Ausland. Hierzu zählen Kooperationen auf der Basis der Sokrates/Erasmus-Programme mit<br />
<strong>Hochschule</strong>n im EU-Ausland: TU Ostrava (Tschechen), Ka-Ho Saint-Lieven Hogeschool<br />
(Belgien), Universität Vilnius (Litauen), Technische Universität Zilina (Slovakei).<br />
Gegenstand der Kooperationen sind u. a.:<br />
• Studenten und Dozentenaustausch,<br />
• Durchführung von Bachelos- und Masterarbeiten,<br />
• gemeinsame Forschungsaktivitäten- gemeinsame Veröffentlichungen etc.<br />
Darüber hinaus gibt es Kooperationsvereinbarungen mit weiteren <strong>Hochschule</strong>n außerhalb des<br />
EU-Raumes:<br />
• TU Antalia (Türkei)<br />
• Ningbo Univerity of technology (China)<br />
• Jatong -Universität Chengdu (China)<br />
• Universität Perm (Russland)<br />
• Universität San Diego (USA)<br />
Die Kooperationsschwerpunkte entsprechen den zuvor genannten.<br />
Zurzeit wird eine Kooperationsvereinbarung mit Quingdao Technological University (China)<br />
vorbereitet, mit dem Ziel, den chinesischen Studenten den Zugang zu den Masterstudiengängen<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Rahmen eines Partnerschaftsverfahrens zu<br />
erleichtern.<br />
8.3 Ingenieurwesen und Industriedesign<br />
Strukturentwicklung/Forschung14<br />
Entwicklung der Fachbereiche, hochschul- und einrichtungsübergreifende Kooperation<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> ist die Liste der regionalen, nationalen Partnerunternehmen, mit denen kooperative<br />
Betätigungen (Forschungsprojekte, Konsultationen, Beratungen, Sponsoring u. ä.) stattfinden,<br />
z. B. um die folgenden ergänzt worden:<br />
Institut für Elektrotechnik:<br />
• General Elektronik GmbH, Haldensleben<br />
• National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”<br />
• Airbus Testzentrum (Maintenance Systems Service) Hamburg,<br />
• Centiveo GmbH, <strong>Magdeburg</strong>,<br />
• dibkom TZ - Technikzentrum GmbH<br />
• Breitscheidstraße 51, 39114 <strong>Magdeburg</strong><br />
• (<strong>2008</strong> gegründetes An-Institut)<br />
• Rehnig Antennentechnik GmbH & Co. KG<br />
• Werner-von-Siemens-Str. 25, 91413 Neustadt/Aisch (Sponsor Labortransport)<br />
• GTN GmbH & Co KG<br />
• Lindener Bergfeld 9, 31188 Holle (Sponsor Labortransport)<br />
• Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH Olefant 1-3, 51427 Bergisch Gladbach<br />
(Sponsor Labortransport)<br />
• BLANKOM Antennentechnik GmbH<br />
14 Der Fachbereich hat sich mittlerweile umbenannt in Ingenieurwisseschaften und Industriedesign (Genehmigte<br />
Änderung der Grundordnung).<br />
Seite 44
• Hermann-Petersilge-Straße 1, 07422 Bad Blankenburg (Sponsor Labortransport)<br />
• KWS Electronic Gmbh<br />
• Sportplatzstr. 1, 83109 Großkarolinenfeld (Sponsor Labortransport)<br />
• Kathrein Werke KG<br />
• Anton-Kathrein-Str.1-3, 83022 Rosenheim, (Sponsor Labortransport)<br />
• GSS Grundig Sat Systeme GmbH<br />
• Beuthener Str. 43, 90471 Nürnberg, (Sponsor Labortransport)<br />
• I2KT Institut für Informations- und Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG<br />
• Zackmuender Str. 4, 39218 Schoenebeck (Sponsor Labortransport)<br />
• WISI COMMUNICATIONS GMBH & CO. KG<br />
• Wilhelm-Sihn-Strasse 5-7, 75223 Niefern-Öschelbronn (Klärung Messverfahren für Schirmungsmaß<br />
von Koaxialkabeln)<br />
• Lagotec GmbH<br />
• Breitscheidstraße 51, 39114 <strong>Magdeburg</strong>, (Entwicklung eines Biofilm-Sensors)<br />
• AXING AG<br />
• Gewerbehaus Moskau, 8262 Ramsen, Schweiz (Entwicklung eines Koaxialkabels)<br />
• HWG Hallische Wohnungsgesellschaft mbH<br />
• Hansering 19, Halle, (Beratung bei Ausschreibung)<br />
• TU Braunschweig, Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierung, Petrinetz-Modellierung<br />
• Kernkraftwerk Brokdorf, Zuverlässigkeitsanalyse<br />
• Josch Strahlschweißtechnik GmbH, Teicha<br />
• Rusche Zubringertechnik, <strong>Magdeburg</strong><br />
Institut für Industrial Design:<br />
• AKT Altmärker Kunststoff-Technik GmbH, Gardelegen<br />
• SCHIESS GmbH, Aschersleben<br />
• DieMount GmbH, Wernigerode<br />
• Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Damme<br />
• (Rahmenvereinbarung der <strong>Hochschule</strong> mit GRIMME)<br />
Institut für Maschinenbau:<br />
• Fa. Leser GmbH@CoKG, Hohenwestedt<br />
• Jonson@Jonson Medical GmbH, Norderstedt<br />
• Annaburger Nutzfahrzeuge GmbH, Annaburg<br />
• Sigma Labor Zentrifugen GmbH, Osterode am Harz<br />
• Jogerst Stein-Technechnologie GmbH, Oberkirch<br />
• RCS GmbH Rail Components and Systems, Königsbrück<br />
• Frauenhofer Institut für Werkstoffmechanik, Halle<br />
• FKT Fassbender GmbH, Remagen/Draschwitz<br />
• Smo Sondermaschinen Oschersleben GmbH, Oschersleben<br />
• MAHREG Automotive Sachsen-Anhalt e.V, Barleben<br />
• Casa Floor Kattwinkel GmbH, Wuppertal<br />
• Polykum e.V., Schkopau<br />
• B&W Fahrzeugentwicklung GmbH, Oebisfelde<br />
• MA&T Organsiationsentwicklung GmbH, <strong>Magdeburg</strong><br />
• Harting Mitronics: EMV-Prüfung, Diekholzen/Rahden<br />
Seite 45
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
Strukturierte Ausbildungskonzepte und organisierte Veranstaltungen eines Promotionsstudiums<br />
liegen nicht vor, sind aber mit zunehmender Etablierung von Masterabsolventen beabsichtigt.<br />
Organisierte Kooperationen oder Lehrveranstaltungskonzeptionen mit Universitäten gestalten<br />
sich als schwierig, da in deren Zielvereinbarungen selbst kooperative Promotionsverfahren nicht<br />
erwähnt werden bzw. vorgesehen sind. Insofern sind nachstehende Promovenden aus dem<br />
Institut für Maschinenbau bemerkenswerte und anzuerkennende Ausnahmen, die eher der<br />
persönlichen Kooperation der beteiligten Betreuer zuzuschreiben ist als institutionalisierter<br />
gegenseitiger Akzeptanz der Einrichtungen.<br />
Übersicht über die realisierten kooperativen Promotionsverfahren<br />
Absolventen des Instituts für Elektrotechnik<br />
• Martin Bliss<br />
• Diplom (FH) 2007, promoviert zur Thematik „Solarsimulation“ von <strong>2008</strong> – 2011 an der<br />
Universität Longburgh (GB), Aufnahme durch Begutachtung unsererseits (Prof. Beyer),<br />
keine Zusatzprüfungen, keine Betreuung unsererseits<br />
• Stefan Bofinger<br />
• Diplom (FH) 2006, promoviert zur Thematik „PV-Anlagen und Netzeinbindung“ an der Ottovon-Guericke-Universität<br />
<strong>Magdeburg</strong> von 2007 – 2009, Zusatzprüfungen und Lehrveranstaltungen<br />
waren nötig, Erstgutachter von der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>,<br />
Zweitgutachter von der Universität Kassel, unsererseits besteht keine Integration in das<br />
Verfahren<br />
• Hardy Naumann<br />
• Diplom (FH) 2002, promoviert zur Thematik „Modellierung von Verbrennungsvorgängen“<br />
an der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>, (Fakultät für Maschinenbau), Zusatzqualifikation<br />
war notwendig, keinerlei Betreuung durch IWID<br />
• Andreas Schulze<br />
• Diplom (FH) 2005, promoviert an der Technischen Universität Braunschweig zur Thematik<br />
„Echtzeitanwendungen und Laufzeitanalysen“ (berufsbegleitend) bis ca. 2012, Zusatzqualifikation<br />
war notwendig, keine Betreuung durch uns<br />
Absolventen des Instituts für Maschinenbau<br />
• Frank Trommer<br />
• Diplom (FH) 2006, promoviert zur Thematik „Reibschweißverfahren“ von 2007 bis 2010 an<br />
der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>, Betreuung erfolgt kooperativ (Prof. Goldau),<br />
Eingangsprüfung war erforderlich<br />
• Ronny Stolze<br />
• Diplom (FH) 2007, promoviert zur Thematik „Rotationsfinishen“ von <strong>2008</strong> bis 2012 an der<br />
Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>, Betreuung erfolgt kooperativ (Prof. Goldau),<br />
Eingangsprüfung war erforderlich<br />
• Ronny Brinkmann<br />
• Diplom (FH) 2005, promoviert zur Thematik „Finishbearbeitung“ von <strong>2008</strong> bis 2011 an der<br />
Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>, Betreuung erfolgt kooperativ (Prof. Goldau),<br />
Eingangsprüfung ist erforderlich<br />
• Adrian Binsau<br />
• Diplom (FH) 2005, promoviert zur Thematik „Leichtbauoptimierung“ von 2009 bis 2012 an<br />
der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong>, Betreuung erfolgt kooperativ (Prof. Häberle),<br />
Eingangsprüfung ist erforderlich<br />
• Frank Rühle<br />
• Master <strong>2008</strong>, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-von-Guericke-Universität<br />
<strong>Magdeburg</strong> mit dem Ziel einer Promotion zur Thematik „Tribologische Werkstoffoptimierung“<br />
die Betreuungsentscheidung steht noch aus (evtl. Prof. Winkelmann), Eingangsprü-<br />
Seite 46
fung war nicht notwendig, allerdings erfolgte Einstufung trotzt ausgeschriebener E13 in E12<br />
mit der Begründung des FH-Masterabschlusses<br />
Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master);<br />
Laufende und vorgesehene (duale) Studiengänge<br />
<strong>2008</strong> ging der konsekutive Masterstudiengang Regenerative und Rationelle Gebäudeenergiesysteme<br />
los.<br />
Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden, Absolventenquote<br />
Entwicklungsstand und Erfahrungen mit Auswahlverfahren<br />
Die Zulassung zu Studiengängen des Institutes Industrial Design unterliegt einem gesonderten<br />
institutsinternen Auswahlverfahren (künstlerische Eignungsprüfung), was sich über die letzten<br />
Jahre bewährt hat und beibehalten wird.<br />
Die Bachelorstudiengänge Mechatronische Systemtechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen<br />
sind NC-Studiengänge. Für das Auswahlverfahren wurde eine Auswahlordnung<br />
erarbeitet, die neben der Abiturnote auch Berufsausbildung/-erfahrung und andere einschlägige<br />
Vorbereitung berücksichtigt. Aufgrund des schlechten Annahmeverhaltens wurde das Auswahlverfahren<br />
seit dem WS 2007/08 nicht mehr praktiziert. Die Auswahl erfolgt seitdem ausschließlich<br />
nach der Abiturnote, was den Prozess formal zentralisiert und damit den Fachbereich und<br />
die Institute entlastet.<br />
Trotz vereinfachten Verfahrens und auch trotz hoch übersteuerter Zusagen zeugt das Annahmeverhalten<br />
der Studierenden allerdings nach wie vor von einer gewissen Unberechenbarkeit,<br />
der allerdings durch <strong>Hochschule</strong> und Fachbereich auf unterschiedlichem Wege begegnet<br />
werden soll (Einladungstage, Dekanebriefe, Vorstellung der Studiengänge).<br />
Zur fachlichen Betreuung der Studierenden wurden im Institut für Maschinenbau für die<br />
Grundlagen- und Vertiefungsbereiche der Curricula Tutorien eingerichtet. Diese werden zum<br />
Teil auch von Studenten selbst durchgeführt.<br />
Weiterbildung/Lebenslanges Lernen<br />
Auch <strong>2008</strong> wurden im Rahmen des Programms „50+“ im Fachbereich IWID sechs Personen (3<br />
x MB, 2 x ET, 1 x ID) betreut und für eine eventuell mögliche längerfristige Tätigkeit „fit“<br />
gemacht. Teilweise gehen diese Tätigkeiten bis in das Jahr 2009, und der Fachbereich ist stolz<br />
darauf, damit einen außerordentlichen Verdienst an der Auszeichnung der <strong>Hochschule</strong> als<br />
„Unternehmen mit Weitblick“ zu haben.<br />
Erfolgreicher Abschluss und Neuimmatrikulation des Zusatzstudienganges Maschinenbau in<br />
Zusammenarbeit mit der Otto Benecke Stiftung e.V. und den ARGEN. Eine Ausdehnung dieser<br />
Studienangebote auf die Gebiete der Regenerativen Energien/Elektrotechnik ist in Zukunft<br />
beabsichtigt.<br />
Aus dem Wachstumskern ALFA heraus wurden von den Partnern RKW Sachsen-Anhalt GmbH,<br />
dem Zentrum für Faserverbunde GmbH und der MA&T Organisationsentwicklung folgende<br />
Verbundprojekte beantragt:<br />
1. PECOM: Projekt „Personalentwicklung für Unternehmen im Bereich Hochleistungs-<br />
verbunde/Composite“ im Rahmen der Ausschreibung „Regionale Qualifizierungsinitiative“<br />
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.<br />
2. Das Projekt wurde bewilligt.<br />
3. AUCOM: Ausbildungsinnovation im Composite-Clusterkern Haldensleben im Rahmen<br />
der 4. Förderrunde des Ausbildungsstrukturprogramms JOBSTARTER – Für die Zukunft<br />
ausbilden (BMBF). Die Bewilligung steht an. In diesem Zusammenhang soll in Koopera-<br />
Seite 47
tion mit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) die Einrichtung eines dualen Studienganges<br />
angestrebt werden.<br />
Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung<br />
Akkreditierung<br />
Sachstand der Akkreditierung<br />
Der Bachelorstudiengang Industrial Design und die Masterstudiengänge Interaction Design und<br />
Engineering Design wurden durch AQUIN bis 2011 akkreditiert.<br />
Die ingenieurtechnischen Bachelorstudiengänge:<br />
• Elektrotechnik (ET)<br />
• Mechatronische Systemtechnik (MST)<br />
• Maschinenbau (MB)<br />
• Wirtschaftsingenieurwesen (WIW)<br />
sind durch ASIIN bis September 2012 akkreditiert. Ihnen wurde darüber hinaus bestätigt, dass<br />
sie nicht nur den nationalen, sondern auch europäischen Standards (EUR-ACE®, Framework<br />
Standards for the Accreditation of Engineering Programms) entsprechen.<br />
Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer, Regionalbezug<br />
Mitwirkung bei Fördermaßnahmen zu Bildung, Forschung, Innovation<br />
Im Zuge der Einführung der Masterstudiengänge im Fachbereich Ingenieurwissenschaften und<br />
Industriedesign wurden umfangreiche Aktivitäten unternommen, um die Forschungslandschaften<br />
in den Instituten quantitativ und qualitativ zu stärken.<br />
Die Institute Maschinenbau, Elektrotechnik und Industrial Design erstellten einen gemeinsamen<br />
Forschungskatalog mit den Zielen:<br />
• Festlegung der Kernkompetenzen und Darstellung der Institutsvernetzungen,<br />
• Strategische Ausrichtung der Lehre und Forschung,<br />
• Bestimmung der Forschungsschwerpunkte unter Beachtung regionaler Ausrichtungen und<br />
Schwerpunkte,<br />
• Zusammenfassung des Forschungs- und Leistungsangebots des Fachbereiches IWID.<br />
Im Forschungskatalog IWID bilden die Kompetenzschwerpunkte<br />
• Innovative Technologien, Maschinen, Kompetenzen und Methoden,<br />
• Nachwachsende Rohstoffe/Verbundstoffe,<br />
• Erneuerbare Energien,<br />
die institutsübergreifenden Gebiete, in denen konkrete Projekte und Themen ihre Zuordnung<br />
finden können.<br />
Ein Hauptschwerpunkt des Jahres <strong>2008</strong> war der Aufbau der Industrielabore „Innovative<br />
Fertigungsverfahren“, „Funktionsoptimierter Leichtbau“, „Biowerkstoffe“ und „Zerstörungsfreie<br />
Prüfverfahren“. Eine Raumplanung wurde durchgeführt und erste Etappen wurden realisiert.<br />
Durch die Schaffung dieser Labore wurden die schon vorhandenen Kompetenzfelder gestärkt,<br />
und es können kurzfristig Entwicklungen und Forschungsarbeiten auf höchstem Niveau<br />
durchgeführt werden. Die besten jungen Absolventen der <strong>Hochschule</strong> erhalten hier das<br />
räumliche und technisch-technologische Umfeld, um wissenschaftlich arbeiten zu können.<br />
Unsere Bachelorstudenten und im Besonderen die Masterstudenten bearbeiten hochschuleigene<br />
konstruktive und produktionstechnische Projektaufgaben an innovativen Anlagen,<br />
Maschinen, Maschinenkomponenten. Die Analysen und Untersuchungen können mit moderns-<br />
Seite 48
ter Fertigungsmess- und Prozessmesstechnik durchgeführt werden. Die vernetzte leistungsfähige<br />
Rechentechnik unterstützt den Produkt- und Technologieerstellungsprozess.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ist ein aktiver Gestalter des Clusters Sondermaschinen-<br />
und Anlagenbau der Region. In verschiedenen Netzwerken und Verbundprojekten wie<br />
„Innovative Fügeverfahren durch Reibschweißen“, „Innovative Gleitlagertechnik“, „Bionik-<br />
Design“, „Transferverbund Medizintechnologie“ oder „Allianz Faserverbunde Haldensleben“<br />
arbeitet der Fachbereich IWID erfolgreich mit.<br />
Weitere Beispiele erfolgreicher Projekte und Projektanbahnungen in IWID sind:<br />
• Übergreifendes Projekt „FORMAT“, welches gegenwärtig vier Mitarbeiterstellen begründet<br />
und Drittmitteleinnahmen in Millionenhöhe erwarten lässt.<br />
• Integration in BMBF-Projekt „Energieeffiziente Stadt – Modellstadt für Erneuerbare Energien<br />
(MD-E4).<br />
• Thermoelektrisches Prüfverfahren mit magnetischer Auslesung (130 T€ 2009 und 2010).<br />
• Walzenstuhlentwicklung der Baureihe WS4 und WS8 (mit MMW Wittenberg, 100 T€ 2009<br />
und 2010).<br />
Internationalisierung<br />
Internationaler Hochschulraum<br />
Kooperations- und Austauschvereinbarungen<br />
Zusätzlich zu bereits bestehenden Kooperationen und Vereinbarungen wurde <strong>2008</strong> der<br />
folgende Vertrag unterzeichnet:<br />
• Kooperation mit Nayjing Institute of Technology, China (mit dem Institut für Elektrotechnik).<br />
Der Kooperationsvertrag mit der Massey University ist von deren Seite allerdings nicht unterzeichnet<br />
worden, da die Abteilung in Auckland zum 15.04.2009 geschlossen wird.<br />
Dennoch sind zwei Studenten der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Auslandssemester<br />
in Wellington vermittelt worden. Im Rahmen der GIDE-Partnerschaft (Institut für Industrial<br />
Design) werden folgende neue Kooperationspartner aktiviert:<br />
• Scuuola Universitaria Parificata della Svizzera Italiana, Canobbio, Switzerland<br />
• Design Faculty of Milan Politecnico, Italy<br />
• Facoltà del Design - Politecnico di Milano.<br />
Zur Anbahnung weiterer Kooperationen weilt Herr Prof. Ouyang, Mingsan von der Anhui<br />
University of Science and Technology, Institute for Automatic Control (China), für ein Jahr als<br />
Gastprofessor am Institut für Elektrotechnik.<br />
Im Institut für Maschinenbau hält sich für die Dauer von sechs Monaten ein Gastdozent, Herr<br />
Dr. Mohammed A. Nazzal, der German Jordanien University (GJU) auf.<br />
Im Rahmen der Kooperation und Projektverantwortung unserer <strong>Hochschule</strong> beim Aufbau der<br />
GJU halten sich auch die ersten Studierenden in unserem Fachbereich auf. Im konkreten Fall<br />
halten sich diese drei Studierenden im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (MB) und sechs<br />
Studierende im Studiengang Pharmatechnik des noch existierenden Institutes Chemie/Pharmatechnik<br />
auf.<br />
Im Rahmen des Erasmus-Programms weilten <strong>2008</strong> zwei Studierende der Universität Königsberg<br />
im Studiengang Maschinenbau.<br />
Aus einem Kooperationsprojekt “Technologietransfer“ sind 2 Studenten des Institutes Industrial<br />
Design in ein Praktikum nach Guangzhou in China vermittelt worden.<br />
Seite 49
Entwicklung von internationalen und englischsprachigen Studienangeboten<br />
Beide Gastprofessoren bzw. -dozenten der Institute ET und MB bieten im Rahmen ihres<br />
Aufenthaltes englischsprachige Wahlpflichtfächer an.<br />
Zur Vorbereitung der Studierenden auf ein Auslandsstudium "ready for take of" zur Förderung<br />
der studentischen Mobilität wurde ein Tutorium erstellt.<br />
In regelmäßigen Abständen gab es eine "connectivity"-Veranstaltung, in der Studierende über<br />
das Studieren im Ausland informiert sowie Vorträge und Erfahrungsberichte von "incomings"<br />
und "outgoings" gehalten werden.<br />
Seite 50
8.4 Kommunikation und Medien<br />
Die Studiengänge des Bereichs Kommunikation:<br />
Bachelor-StG Fachübersetzen<br />
• 7 Semester, davon 2 Auslandssemester<br />
• 17 Module<br />
Bachelor-StG Fachdolmetschen<br />
• 7 Semester, davon 2 Auslandssemester<br />
• 19 Module<br />
auslaufend:<br />
Diplom-StG Fachübersetzen<br />
Bachelor-StG Interkulturelle Wirtschaftskommunikation<br />
• 7 Semester<br />
• 14 Module<br />
Die Studiengänge des Bereichs Medien:<br />
Bachelor-StG Journalistik/Medienmanagement<br />
• 6 Semester, davon ein Auslandssemester<br />
• 13 Modulgruppen, Spezialisierung im 5. Semester<br />
BA-StG Bildjournalismus<br />
• 4 Semester<br />
• 11 Modulgruppen<br />
Master-StG Sozial- und Gesundheitsjournalismus (konsekutiv, gemeinsam mit dem FB SGW)<br />
• 4 Semester<br />
• 9 Modulgruppen<br />
• Gemeinsamer Studiengang mit dem Fachbereich SGW<br />
auslaufend:<br />
Diplom-StG Journalistik/Medienmanagement<br />
BA-Studiengänge<br />
Der Zugang zu den Bachelorstudiengängen Fachdolmetschen, Fachübersetzen und IKW ist nicht<br />
reglementiert. Die Immatrikulation in den Bachelorstudiengang J/MM erfolgt nach einem durch § 9<br />
HVVO (Grad der Qualifikation) geregelten Auswahlverfahren.<br />
Über die Zulassung zum BA-Studiengang Bildjournalismus und dem MA-Studiengang Gesundheitsjournalismus<br />
wird jeweils durch eine Eignungsprüfung entschieden. Dabei wertet eine<br />
Kommission den Nachweis berufsspezifischer Tätigkeit und eine einzureichende Arbeitsmappe und<br />
ein persönliches Gespräch.<br />
Seite 51
Qualitätsorientierung im Studium, Lehr und Forschung<br />
Die Evaluation der Lehre erfolgt auf der Grundlage der hochschuleinheitlichen Evaluationsbefragungen.<br />
Außerdem werden die Studiengänge durch die Befragung von Absolventen evaluiert, Beteiligung an<br />
externen Evaluationen (CHE-Ranking) und es werden Treffen mit den Vertretern der Studierenden<br />
(Runder Tisch Medien und Runder Tisch Kommunikation) durchgeführt.<br />
Akkreditierung<br />
Mit Ausnahme des StG IWK, der mit der Matrikel <strong>2008</strong> ausläuft, befinden sich alle BA-Studiengänge<br />
des Fachbereichs im Prozess der Akkreditierung.<br />
Forschung<br />
An folgenden Forschungsprojekten wurde gearbeitet:<br />
• die Entwicklung eines mobilen Labors für die Evaluation von klassischen Medienprodukten und<br />
interaktiven Produkten in Kooperation mit der Fachhochschule Anhalt,<br />
• eine Untersuchung zur medialen Öffentlichkeit in Bezug auf das Holocaust-Denkmal Berlin,<br />
• eine Studie zu Konsequenzen digitaler Fotografie für die Printmedien<br />
• Untersuchungen zur Translationswissenschaft (Endprodukt Lehrbuch)<br />
• Untersuchungen Korpus-Analyse<br />
• Lehrbuch für Gerichtsdolmetschen<br />
• ein Lehrkompendium zur Terminologiearbeit in Unternehmen/Funktionale Terminologie<br />
Internationalisierung<br />
Internationalisierung ist für den Fachbereich Kommunikation und Medien ein profilbestimmendes<br />
Prinzip und für viele Studienbewerber ein wesentliches Kriterium, sich für einen der Studiengänge<br />
im FB KM zu entscheiden.<br />
Ausdruck und Anwendung findet dieser Grundsatz unter anderem durch<br />
• die zum Pflichtprogramm zählenden Auslandssemester in den BA-Studiengängen,<br />
• die Kooperation mit Partnerhochschulen und gemeinsame internationale Studien- und<br />
Forschungsprojekte sowie Summer-Schools,<br />
• den kontinuierlichen Austausch von Studierenden und Dozenten,<br />
• die Entwicklung von internationalen Master-Studiengängen mit gemeinsamer Graduierung.<br />
Die Arbeitskontakte und Kooperationsbeziehungen zu <strong>Hochschule</strong>n im Ausland mit Austausch von<br />
Studierenden und Dozenten (Erasmus) sind zahlreich.<br />
Im Bereich Medien sind es vier (mit steigender Tendenz), im Bereich Kommunikation sind es 29.<br />
Seite 52
8.5 Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
Die Bachelorstudiengänge sind aufnahmebeschränkt. Der BA-Studiengang Gebärdensprachdolmetschen<br />
regelt die Aufnahme der Studierenden über ein gestaffeltes Aufnahmeverfahren.<br />
Dies hat sich teilweise bewährt. Die Kombination aus Studienvoraussetzungen, Intensivkursangebot<br />
und Aufnahmeprüfung scheint dafür zu sorgen, dass die Bewerber die Ernsthaftigkeit<br />
ihres Studieninteresses gründlicher erwägen, was u.a. auch dazu führt, dass es inzwischen<br />
deutlich niedrigere Bewerberzahlen gibt, die aber immer noch klar über dem verfügbaren<br />
Platzangebot liegen. Dennoch ist nach Einschätzung der Kolleginnen die Gebärdensprachkompetenz<br />
generell schwierig einzuschätzen. Die vergleichsweise hohe Abbrecherquote (übrigens<br />
in vielen Dolmetschstudiengängen) mag mit den speziellen körperlich-expressiven Fähigkeiten,<br />
die den Studierenden abverlangt werden, zusammenhängen. Diese besondere Anforderung an<br />
den BA-Studiengang wird wohl auch in Zukunft (so die Einschätzung der Fachkolleginnen und -<br />
kollegen) im Großen und Ganzen immer wieder dafür sorgen, dass es eine gewisse Zahl von<br />
Abgängen gibt.<br />
Weiterbildung, Lebenslanges Lernen<br />
Angebot bereits laufender berufsbegleitender Masterstudiengänge:<br />
1. Angewandte Gesundheitswissenschaften/Applied Health Sciences (7 Sem.)<br />
2. European Master of Development Studies of Social and Educational Sciences/European<br />
Perspectives of Social Inclusion (seit 2005 jedoch ohne Beteiligung<br />
einer deutschen Studiengruppe. Der FBR entscheidet im Februar 2009 über die Weiterführung<br />
dieses Studienganges. Derzeit verantwortlich sind MISTEL und Prof. Dr. Wolfgang<br />
Heckmann)<br />
3. Master Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis (seit WS <strong>2008</strong>/09)<br />
Angebot sich in Planung befindlicher berufsbegleitender Masterstudiengänge<br />
(Teilzeitstudiengänge) - Beginn: WS 09/10 bzw. SoS 2010)<br />
1. Interdisziplinäre Therapie psychiatrischer Störungen auf psychodynamischer Grundlage<br />
(in Kooperation mit Überregionale Weiterbildung für psychoanalytische Psychosen-Therapie<br />
an der Akademie für Psychoanalyse München e.V. und Asklepios-Klinikum Tiefenbrunn,<br />
gebührenpflichtig)<br />
2. Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen und Familien<br />
(gebührenpflichtig)<br />
Akkreditierung<br />
Sachstand<br />
Abgeschlossen:<br />
• Bachelor Soziale Arbeit<br />
• Bachelor Gesundheitsförderung<br />
• Bachelor Gebärdensprachdolmetschen<br />
Im Prozess:<br />
• Master Soziale Arbeit in der alternden Gesellschaft (positive Bewertung bei der Ortsbegehung<br />
im November <strong>2008</strong>), Prof. Dr. Jürgen Wolf<br />
• Master Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis, Akkreditierung in Vorbereitung<br />
(Abschluss bis September 2009 zusammen mit „Interdisziplinäre Therapie<br />
Seite 53
• psychiatrischer Störungen auf psychodynamischer Grundlage“ vorgesehen), Prof. Dr.<br />
Susanne Metzner, Prof. Dr. Manuela Schwartz<br />
• Interdisziplinäre Therapie psychiatrischer Störungen auf psychodynamischer Grundla-ge<br />
(Abschluß bis September 2009 zusammen mit „Master Methoden musiktherapeuti-scher<br />
Forschung und Praxis“ vorgesehen), Prof. Dr. Susanne Metzner<br />
• Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen und Familien,<br />
Prof. Dr. Meinrad Armbruster<br />
• Bachelor Soziale Dienste in der Justiz, Prof. Dr. Peter Schruth (wird noch vorbereitet)<br />
Re-Akkreditierungsverfahren<br />
• European Master of Development Studies of Social and Educational Sci-ences/European<br />
Perspectives of Social Inclusion (Prof. Dr. Heckmann, Peter Strauß)<br />
• European Master in Health Promotion (EUMAP) - Bachelor Angewandte<br />
Gesundheitswissenschaften (Abgabe der Akkreditierungsunterlagen für März 2009 vorgesehen,<br />
verantwortlich Claudia Wilk)<br />
Forschung Innovation, Wissens- und Technologietransfer, Regionalbezug<br />
Mitwirkung bei Fördermaßnahmen zu Bildung, Forschung, Innovation;<br />
Erarbeitung eines Konzepts zur Familienfreundlichen und Gesundheitsfördernden <strong>Hochschule</strong><br />
durch eine Arbeitsgruppe des Fachbereichs in Abstimmung mit den regionalen Bildungsträgern<br />
<strong>2008</strong> hat Prof. Dr. Goepel auf Anregung des Kultusministeriums zur Entwicklung von Kriterien<br />
zur Nachhaltigen Entwicklung ein Konzept erarbeitet (in Zusammenarbeit mit Prorektor Prof. Dr.<br />
Münch und Manfred Voigt). Das Papier sieht ein siebenschrittiges Verfahren vor, zu dem eine<br />
Stellungnahme des Ministeriums noch erwartet wird.<br />
1. Vorbereitung eines Hochschul-Symposiums zum Thema "Lebensraum Stadt“;<br />
2. Weiterführende öffentliche Ringvorlesung zum gleichen Thema während des SoS im<br />
Rahmen des Studium Generale;<br />
3. Weitere Ausgestaltung der Webseite "Lebenslust und Stadtgestaltung" (www.sgw.hsmagdeburg.de/lust)<br />
unter dem o.g. Rahmenthema;<br />
4. Erweiterung der Weiterbildung "Kommunales Gesundheitsmanagement" (www.sgw.hsmagdeburg.de/ggf)<br />
um ökologische, technologische und wirtschaftliche Themen nachhaltiger<br />
Stadtentwicklung und Ausschreibung für lokale Akteure in Sachsen-Anhalt zum<br />
WS 2009/10;<br />
5. Vorbereitung interdisziplinärer fachbereichsübergreifender Forschungs- und<br />
Entwicklungsprojekte an der <strong>Hochschule</strong> an den bestehenden An-Instituten;<br />
6. Planung eines interdisziplinären Masterstudienganges zum Thema "Zukunftsfähige und<br />
nachhaltige Gestaltung städtischer und ländlicher Lebensräume";<br />
7. Planung eines hochschulweiten Graduierten-Kollegs zu diesem Thema.<br />
Strukturentwicklung/Forschung<br />
Einrichtungsübergreifende Kooperationen<br />
• durch Promotionsverfahren Kooperationen mit verschiedenen Universitäten und Musik-<br />
bzw. Kunsthochschulen in Deutschland,<br />
• Drittmitteleinwerbung in Höhe von über 500.000 € im wesentlichen durch die Kolleginnen<br />
und Kollegen Beerlage, Hessmann, Geiger und Kreuter,<br />
• Auf der Basis von weiterbildenden Studiengängen gibt es Kooperationen mit „Überregionale<br />
Weiterbildung für psychoanalytische Psychosentherapie an der Akademie für Psychoanalyse<br />
München e.V.“ und „Asklepios-Klinikum Tiefenbrunn“ sowie mit den An-Instituten<br />
MAPP und MISTEL des Fachbereichs zur Organisation und Leitung verschiedener<br />
Master-Studiengänge.<br />
Seite 54
Von den zahlreichen Forschungsprojekten des FB SGW stellt die Archer Tongue Collection des<br />
International Council on Alcohol and Addictions (ICAA) mit Spezialbibliothek einen der europaweit<br />
umfangreichsten Bestände kulturwissenschaftlicher Alkohol- und Drogenliteratur dar. Diese<br />
wurde <strong>2008</strong> eingeweiht. Studierende und Graduierte mit den Arbeitsschwerpunkten Alkohol,<br />
Drogen, Sucht und Suchtkrankenhilfe können hier auf frühe und moderne Forschungsergebnisse<br />
zurückgreifen. Ein Forum für den fachlichen Austausch bietet zudem die interdisziplinäre<br />
Arbeitsgruppe Nachwuchswissenschaftler "Europäische Alkoholkulturen" der ICAA Library-<br />
DATA. Ihre derzeit sechs Mitglieder forschen zu historischen und zeitgenössischen Themen, so<br />
etwa der Sozialgeschichte der alkoholgegnerischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts,<br />
zur Genese und dem Wandel von Konsummustern, verschiedenen Modellen der Sozialprophylaxe<br />
und der Alkoholkrankentherapie in Deutschland. Zwei Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind<br />
Absolventinnen des Fachbereiches SGW (Gerlinde Pokladek und Jacqueline Tybora). Frau<br />
Pokladek und Frau Tybora promovieren derzeit an der OvG-Uni MD (am Fachbereich FGSE),<br />
erfahren an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) aber fachliche und organisatorische<br />
Unterstützung und gehören damit zu den ganz wenigen Absolventinnen an Fachhochschulen<br />
(aus den Diplom-Studiengängen Soziale Arbeit und Gesundheits-förderung), denen ein<br />
erfolgreicher Einstieg in ein Promotionsvorhaben an der OvGU <strong>Magdeburg</strong> gelungen ist.<br />
Internationalisierung<br />
Internationaler Hochschulraum<br />
Im Dezember <strong>2008</strong> wurde der FB im Rahmen einer Kooperation von Studierenden des<br />
Research Center of Health Promotion besucht.<br />
<strong>2008</strong> wurden darüber hinaus angefangen:<br />
• Entwicklung von internationalen und englischsprachigen Studienangeboten<br />
• Aktuelle Planung eines englischsprachigen Angebots mit 30 ECTS (vorgesehen ab WS<br />
2009/10) durch den Internationalisierungsbeauftragten des FB, Dr. Arnd Hofmeister; Entwicklung<br />
eines Flyers/Plakats mit der Presseabteilung der <strong>Hochschule</strong>, vorgesehen ist die<br />
Kontaktaufnahme und Verteilung des Flyers bei allen Erasmus-Partnern der <strong>Hochschule</strong><br />
• Ausweitung des Studentischen Projekts „Welcome“ des FB SGW für alle ausländischen<br />
Studierenden der <strong>Hochschule</strong> (skandinavische Woche ist ab 19.1.2009 am FB SGW, Frösi),<br />
Empfangswoche für alle ausländischen Studierenden zu Beginn des WS <strong>2008</strong>/09 inklusive<br />
Internetauftritt in Zusammenarbeit mit der Internationalisierungsbeauftragten der<br />
<strong>Hochschule</strong>, Prof. Dr. Ilona Wuschig.<br />
Seite 55
8.6 Wasser- und Kreislaufwirtschaft<br />
Studium und Lehre<br />
Die Bachelorstudiengänge:<br />
• Wasserwirtschaft (B.Eng.),<br />
• Kreislaufwirtschaft (B. Eng.) und<br />
• Statistik (B. Sc.)<br />
sowie der Master-Studiengang<br />
• Wasserwirtschaft (M. Eng.)<br />
sind im Jahr <strong>2008</strong> mit nur wenigen Auflagen, welche zwischenzeitlich erfüllt sind, akkreditiert<br />
worden.<br />
Der international orientierte Master-Studiengang<br />
• Ingenieurökologie (M. Sc.),<br />
welcher bereits im Jahr 2004 seine erste Akkreditierung erhielt, wurde reakkreditiert. In diesem<br />
Studiengang wird – beginnend mit dem Wintersemester <strong>2008</strong>/09 – in jedem Semester akkreditiert,<br />
um auf die zeitlich schwankende studentische Nachfrage flexibel reagieren zu können.<br />
Promotionen<br />
Auch im Jahr <strong>2008</strong> wurden von Absolventinnen und Absolventen des Fachbereiches Promotionen<br />
erfolgreich abgeschlossen und neue Verfahren begonnen.<br />
Ihr Verfahren abgeschlossen haben:<br />
• Mandy Sohr (Absolventin Statistik, Promotion an der OvG-Universität <strong>Magdeburg</strong>)<br />
• Zhang Dongqing (Absolventin Ingenieurökologie, Promotion an der Universität Dortmund)<br />
Folgende Ingenieurökologie-Absolventen haben das Promotionsverfahren begonnen:<br />
• Claudia Schulz-Fademrecht (TU München)<br />
• Andreas Marwitz (Universität Gießen)<br />
• Tom Shatwell (Humboldt-Universität Berlin)<br />
• Anne Becker (Universität Kassel)<br />
Die Aufnahme der M.Sc.-Absolventen als Doktoranden an den Universitäten erfolgte in einigen<br />
Fällen ohne Probleme und zusätzliche Auflagen, in anderen aber erst nach dem Bestehen von<br />
Tests bzw. Aufnahmeprüfungen. Die Ungleichbehandlung im Vergleich mit den Universitätsabsolventen<br />
ist also in vielen Fällen nach wie vor noch gegeben.<br />
Nur bei Zhang Dongqing (Prof. M. Voigt) und Anne Becker (Prof. V. Lüderitz) gestatteten die<br />
Universitäten eine Mitbetreuung und Mitprüfung durch Professoren der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH). Die meisten Universitäten schließen Derartiges leider weiterhin aus.<br />
Forschung<br />
Mit einer Drittmittelsumme von 476.860 € verbuchte der FB WK im Jahr <strong>2008</strong> einen neuen<br />
diesbezüglichen Rekord. Dabei ist auffällig, dass sich immer mehr Kollegen an der Mittelaquisition<br />
beteiligen und somit das Forschungsspektrum des Bereiches breiter wird. Die Forschungsschwerpunkte<br />
im Berichtszeitraum waren:<br />
Seite 56
• Naturnaher und konstruktiver Wasserbau<br />
• Hochwasserschutz<br />
• Ökologie und Renaturierung von Gewässern<br />
• Hydrologie<br />
• Abwasserbehandlung<br />
• Trinkwasseraufbereitung<br />
• Abfallwirtschaft sowie<br />
• Stoffstrom- und Ressourcenmanagement<br />
Die Ergebnisse der Forschungen wurden in 22 Artikeln in Fachzeitschriften und Buchkapiteln<br />
sowie in über 30 Beiträgen auf wissenschaftlichen Tagungen veröffentlicht.<br />
Das Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie (IWO), das die Forschungsprojekte des<br />
Fachbereiches koordiniert, gibt seit 2005 eine eigene Schriftenreihe, die „<strong>Magdeburg</strong>er<br />
Wasserwirtschaftlichen Hefte“ heraus, von denen im Jahr <strong>2008</strong> bereits Band 9 erschienen ist.<br />
Die Forschung in den Projekten des IWO wird in zunehmendem Maße über Doktoranden<br />
realisiert. Das Fehlen eines eigenen Promotionsrechtes wirkt sich hier sehr hinderlich aus,<br />
muss doch für jeden Doktoranden ein universitärer Fachbereich und Betreuer gefunden<br />
werden, auch wenn Betreffender an dem Forschungsprojekt gar nicht beteiligt ist. Der Fachbereich<br />
hat deshalb eine Initiative für ein eigenes Promotionsrecht ergriffen.<br />
Internationalisierung<br />
Der FB WK baut seine internationalen Kooperationen in Lehre und Forschung immer weiter<br />
aus. Zurzeit bestehen vertragliche Beziehungen zu folgenden ausländischen <strong>Hochschule</strong>n:<br />
• San Diego State University, USA<br />
• Indiana University, USA<br />
• Universität Alas Peruanas, Peru<br />
• Universität Holguin, Kuba<br />
• Universität La Laguna, Spanien<br />
Als nächster Schritt bei der Internationalisierung des Studienangebotes erfolgt der Aufbau eines<br />
internationalen Master-Studienganges „International sustainable water resources management“,<br />
für den unser FB die Federführung übernimmt. Partner sind die TU Kaiserslautern, die Universität<br />
La Laguna, die Universität Kluj (Rumänien) und die Universität Trondheim (Norwegen). Die<br />
Finanzierung dieses Studienganges wird über das Erasmu-mundus-Programm beantragt.<br />
Seite 57
8.7 Wirtschaft<br />
Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
Organisation des Studiums (Bachelor/Master)<br />
Der Fachbereich Wirtschaft mit seinen beiden Instituten (Institut für Management in <strong>Stendal</strong>,<br />
Institut für Technische Betriebswirtschaft in <strong>Magdeburg</strong>) hat zum WS <strong>2008</strong>/2009 folgende<br />
grundständigen Leistungsangebote:<br />
• Bachelor BWL Direktstudium<br />
• Bachelor BWL Fernstudium<br />
• Bachelor Dualer Studiengang BWL<br />
• Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen (bezahlt)<br />
• Masterstudiengang Direktstudium Risikomanagement<br />
• Masterstudiengang Fernstudium Innovatives Management (bezahlt)<br />
Die Diplomstudiengänge im Direkt- und Fernstudium sind regulär im Jahre <strong>2008</strong> ausgelaufen.<br />
Wegen Nichteinhaltung der Regelstudienzeit und der Größe der letzen Diplommatrikel werden<br />
die Studentenüberhänge auch noch in der Zeit nach <strong>2008</strong> spürbar bleiben. Außerdem erbrachte<br />
der Fachbereich Wirtschaft zahlreiche Transferleistungen aufgrund Dienstleistungsvereinbarungen<br />
für andere Fachbereiche der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) [insbes. FB IWID].<br />
Die Studierendenzahlen liegen für den gesamten Fachbereich zum WS <strong>2008</strong>/2009 (mit Stand<br />
vom 08.01.2009) bei 1.123 Studierenden und verteilen sich auf die einzelnen Studiengänge wie<br />
folgt:<br />
Studiengang Studierendenanzahl<br />
Angewandtes Innovationsmanagement BA 19<br />
BWL Direkt Bachelor 325<br />
BWL Kompakt B.A 34<br />
Dual BWL. Diplom 15<br />
BWL Direkt Diplom 131<br />
Dual BWL B.A. 61<br />
Fern BWL Diplom 142<br />
Fern BWL Bachelor 225<br />
Fern Sozialversicherungsmanagement Bachelor 67<br />
Innovatives Management Master 24<br />
Management im Gesundheitswesen Master 73<br />
Risikomanagement Master 7<br />
Gesamtimmatrikulierte 1.123<br />
Die Studierendenzahlen haben sich in den letzten Jahren konstant gesteigert. Die Bewerberzahlen<br />
waren in den vergangenen Jahren hoch und enthielten einen gleich bleibenden Anteil<br />
von etwa 30 % aus den alten Bundesländern. An kaum einer anderen <strong>Hochschule</strong> in den neuen<br />
Bundesländern wurde eine so große prozentuale Nachfrage aus den alten Bundesländern<br />
erreicht.<br />
Zum WS <strong>2008</strong>/2009 haben an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im FB Wirtschaft<br />
insgesamt zwei Masterstudiengänge:<br />
• der konsekutive Master im Direktstudium mit dem Titel „Risikomanagement“ und<br />
Seite 58
• der bezahlte Master im Fernstudium mit dem Titel „Innovatives Management“<br />
begonnen. Beide Studienangebote wurden rechtzeitig mit den ersten Absolventen der Bachelorstudiengänge<br />
eingeführt. Zielgruppen beider Masterstudiengänge sind:<br />
• die Bachelorabsolventen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Direkt- und Fernstudium<br />
• die Absolventen des dualen Kompaktstudienganges BWL<br />
• die Diplomabsolventen der vergangenen Absolventenjahrgänge, die zusätzlich und erneut<br />
einen attraktiven Masterabschluss an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) anstreben<br />
• die Absolventen der Wirtschaftsingenieurstudiengänge am Standort <strong>Magdeburg</strong>, die unter<br />
attraktiven Bedingungen die Möglichkeiten erhalten, einen weiteren und ergänzenden betriebswirtschaftlichen<br />
Abschluss zu machen.<br />
Der laufende duale Kompaktstudiengang Bachelor-BWL entwickelt sich gleichfalls erfreulich<br />
und soll in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Der bereits seit mehreren<br />
Semestern laufende Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen, der vor allem auf<br />
Teilnehmer aus dem Bereich Sozialversicherung abzielt, hat ebenfalls erfreulich hohe Studierendenzahlen.<br />
Seit dem SoS <strong>2008</strong> ist die bestehende Raumnot im Fachbereich durch Einweihung des zweiten<br />
Gebäudes auf dem Campus in <strong>Stendal</strong> kleiner geworden. Es ist zudem sehr erfreulich, dass<br />
noch zum Ende des Jahres <strong>2008</strong> die Baugenehmigung für das dritte Hochschulgebäude erteilt<br />
wurde.<br />
Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden, Absolventenquote<br />
Da die Bachelorstudiengänge im Direkt- und Fernstudium derzeit zulassungsfrei sind, werden<br />
keine Auswahlgespräche durchgeführt. Die Absolventenzahlen in den einzelnen Studiengängen<br />
entwickelten sich im SoS <strong>2008</strong> und im WS <strong>2008</strong>/09 wie folgt:<br />
Studiengang Absolventenzahl<br />
Angewandtes Innovationsmanagement BA noch keine Absolventen<br />
BWL Direkt Bachelor 5<br />
BWL Kompakt B.A 1<br />
Betr. (BA) Diplom 4<br />
BWL Direkt Diplom 64<br />
Dual BWL B.A. noch keine Absolventen<br />
Fern BWL Diplom 26<br />
Fern BWL Bachelor 5<br />
Fern Sozialversicherungsmanagement Bachelor 1<br />
Innovatives Management Master noch keine Absolventen<br />
Management im Gesundheitswesen Master 16<br />
Risikomanagement Master noch keine Absolventen<br />
Weiterbildung/lebenslanges Lernen<br />
Seit WS <strong>2008</strong>/2009 hat der Fachbereich Wirtschaft den Masterstudiengang „innovatives<br />
Management“ als bezahlten Studiengang im Fernstudium gestartet. Um die Attraktivität zu<br />
erhöhen, hat der Fachbereich Wirtschaft den Kreis der Adressaten vergrößert und unter<br />
anderem für Absolventen der technischen Studiengänge erweitert.<br />
Seite 59
Darüber hinaus gibt es am Fachbereich Wirtschaft ein vielfältiges Angebot von Zertifkatsstudiengängen,<br />
die teilweise am Standort <strong>Magdeburg</strong> und teilweise am Standort <strong>Stendal</strong> angeboten<br />
werden:<br />
• Angewandte Gesundheitswissenschaften (Zertifikat)<br />
• Management im Gesundheitswesen (Zertifikat)<br />
• KMU Management (Zertifikat)<br />
• Praxismanagement (Zertifikat und geplanter Bachelor)<br />
• Care Business Management – Management in Pflege- und Senioreneinrichtungen (Zertifikat)<br />
Zusammen mit dem Winkelmannmuseum wurde entsprechend dem 2007 unterzeichneten<br />
Vertrag im SoS <strong>2008</strong> der erste Durchlauf der „Kinderuniversität“ durchgeführt. Wirtschaft soll<br />
auch für Kinder begreifbar, spannend und erlebbar vermittelt werden. Lebenslanges Lernen<br />
sollte möglichst früh, also schon im Kindesalter, einsetzen und den <strong>Hochschule</strong>n kommt dabei<br />
eine überaus wichtige Funktion zu. Dieses Projekt realisiert sich zusammen mit dem Fachbereich<br />
Allgemeine Humanwissenschaften, der hier mit dem Studiengang Kindheitswissenschaften<br />
über die besten Grundvoraussetzungen verfügt.<br />
Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung<br />
Qualitätsbestimmung und –entwicklung in Studium, Lehre und Forschung, realisierte und<br />
vorgesehene Evaluationsvorhaben<br />
Die Lehrevaluation am Fachbereich wurde wie in den vergangenen Semestern kontinuierlich<br />
aufgrund von Fragebögen bei den Studierenden durchgeführt und ausgewertet.<br />
Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer<br />
Im Fachbereich Wirtschaft bestehen unter anderem folgende Forschungsaktivitäten:<br />
• der Businesswettbewerb Sachsen-Anhalt<br />
• die Arbeit des Konjunkturteams.<br />
Über das An-Institut IWIL und verschiedene betriebliche Kooperationspartner wurden regelmäßig<br />
Diplomanden/Bachelorabsolventen beispielsweise in den Bereichen Prozessoptimierung<br />
(mit IFC Haldensleben) und Lösungen zur Lager- und Transportlogistik (mit Graepel-STUV<br />
GmbH Seehausen) bei ihren Forschungen begleitet.<br />
Im Bereich Marketing wurden in Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsunternehmen<br />
Projektseminare zum Markenaufbau und zur Kommunikation durchgeführt. Daneben gab und<br />
gibt es Wirtschaftsanalysen zu einzelnen ausländischen Regionalmärkten (Kaliningrad, Ural,<br />
Ukraine, Balearen), die in Zukunft fortgesetzt werden. Die studentische Unternehmensberatung<br />
„Sapiente e.V.“ führte zusammen mit Lehrenden des Fachbereichs verschiedene Projekte für<br />
und in der Region durch und gestaltete auch <strong>2008</strong> zusammen mit der Stadt <strong>Stendal</strong> die<br />
„Manege der Wirtschaft“.<br />
Das Instrument der Feststellungsprüfung (Hochschulzugang ohne Abitur) wurde <strong>2008</strong> ebenfalls<br />
konsequent ausgebaut. Die konzeptuelle Planung des berufsbegleitenden Bachelorangebotes<br />
„Angewandtes Innovationsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ wurde<br />
<strong>2008</strong> abgeschlossen und wird zum SoS 2009 starten. Dieses Weiterbildungsangebot ist<br />
Bestandteil des mit Mitteln des ESF und des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes<br />
Sachsen-Anhalt geförderten Modellprojektes „Angewandtes Innovationsmanagement zur<br />
Generierung und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in KMU“.<br />
Internationalisierung<br />
Seite 60
Internationaler Hochschulraum<br />
Mit der chinesischen Shanxi-Universität wurden <strong>2008</strong> die inhaltlichen Voraussetzungen<br />
geschaffen, um ab SoS 2009 die erste Phase des neuen sog.“2 + 2 Projektes“ umzusetzen.<br />
Das bedeutet:<br />
2 Jahre Studium in China und 2 Jahre Studium in Deutschland mit 1 Semester Sprachkurs nach<br />
abgestimmten Curriculum; am Ende Erlangung eines Doppelabschlusses, dass heißt Bachelor<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) und Bachelor Shanxi-Universität.<br />
Seite 61
Anhang<br />
Anhang 1:<br />
„Entwicklung der Drittmittelaufkommen gelistet nach<br />
Fachbereichen/Instituten in den Jahren 2003 – <strong>2008</strong>/Stand Januar 2009“<br />
Seite 62
Anhang 2:<br />
Entwicklung der Studierendenzahlen für die akademischen Studienjahre<br />
1999 bis WS <strong>2008</strong>/09<br />
Die folgenden Grafiken geben einen Überblick über die Entwicklung der Studierendenzahlen für<br />
die akademischen Studienjahre, die das jeweilige Winter- und das folgende Sommersemester<br />
umfassen. Seit 2006 steigen die Bewerberzahlen wieder kontinuierlich an. Die Bewerberzahlen<br />
allein im WS <strong>2008</strong>/09 übertreffen die Zahlen des Vorjahressemesters nochmals um etwa 5 %,<br />
nachdem sie schon im vorhergehenden WS um 14 % gestiegen waren.<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Studienanfänger / Bewerber HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
(Standort SDL ab 2001 eingeflossen)<br />
3372 3424<br />
959<br />
1009<br />
3891 3818<br />
1297<br />
1273<br />
4569<br />
1582<br />
5335 5220<br />
1699<br />
2055<br />
4811<br />
1238<br />
5510<br />
1434<br />
6308 6210<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> WS 08/09<br />
akademisches Jahr und letztes Semester<br />
Stand 31.10.<strong>2008</strong><br />
1617<br />
Bewerber<br />
Anfänger<br />
Die Zahl der Studienanfänger, die im vorletzten WS schon um 9 % gestiegen war, wuchs im<br />
jetzigen WS nochmals um 9 %. Die Anfänger im ersten Hochschulsemester für das Jahr <strong>2008</strong>15<br />
liegen weit über den Vorgaben für die <strong>Hochschule</strong> aus dem Hochschulpakt.<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
3512<br />
Studierende an der HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
3877<br />
4307<br />
4525<br />
5035<br />
5649<br />
6443<br />
6213 6206 6209<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> WS<br />
08/09<br />
Durchschnitt akadem. Jahr und letztes Semester<br />
Stand 31.10.<strong>2008</strong><br />
15 Im Gegensatz zum akademischen Jahr (WS + darauffolgendes Sommersemester) definiert als SoS <strong>2008</strong> + WS<br />
<strong>2008</strong>/09<br />
6411<br />
1430<br />
Seite 63
Seit 2005 werden kontinuierlich über 6.000 Studierende an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) ausgebildet. Das sind etwa 13 Prozent aller Studierenden, die an den <strong>Hochschule</strong>n des<br />
Landes immatrikuliert sind. Bei einer Ausbildungskapazität von personalbezogenen 3.500<br />
Studienplätzen bedeuten diese Zahlen für die einzelnen Fachbereiche eine nicht unbeträchtliche<br />
Überlast.<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
448<br />
Absolventen gesamt HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Stand 31.10.<strong>2008</strong><br />
567<br />
600<br />
568<br />
665<br />
795 774<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
907<br />
1122<br />
Seite 64
Anhang 3:<br />
Career Center<br />
Die Organisation des Personaltransfers zwischen <strong>Hochschule</strong> und Wirtschaft erfolgt an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) über das Career Center.<br />
Das Career Center an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) organisiert die Vermittlung der<br />
Studierenden in Praktika, Diplomanden- bzw. Bachelorstellen oder Festeinstellungen in<br />
Wirtschaftsunternehmen, soziale Einrichtungen und Institutionen. Darüber hinaus werden die<br />
Studierenden individuell hinsichtlich Bewerbungsstrategien und Karriereplanung unterstützt und<br />
durch zusätzliche Weiterbildungsangebote in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für<br />
Weiterbildung auf das Berufsleben vorbereitet.<br />
Das Career Center besitzt ein weit verzweigtes Netzwerk an Unternehmenskontakten.<br />
Das primäre Ziel des Career Center ist es, akademisch ausgebildete junge Menschen im Land<br />
Sachsen-Anhalt zu halten, diese in Unternehmen im Land zu integrieren und somit dem Trend<br />
der Abwanderung von Fach- und Führungskräften entgegenzuwirken.<br />
Der Focus liegt hierbei auf der frühzeitigen Bindung der Studierenden an die hiesigen Unternehmen<br />
und dem Aufbau von partnerschaftlichen Beziehungen. Die AbsolventInnen werden<br />
speziell auf die Stellengesuche regionaler Unternehmen vermittelt und gezielt bei der Suche<br />
nach einem Arbeitsplatz in der Region unterstützt.<br />
Jährlich lädt das Career Center zur mittlerweile zur Tradition gewordenen Firmenkontaktmesse<br />
„Studierende treffen Wirtschaft“ ein. <strong>2008</strong> wurde diese im Rahmen des Campusfestes organisiert<br />
und durchgeführt. Der Zuspruch durch die regionale Wirtschaft ist deutlich angestiegen, so<br />
auch die Branchenvielfalt. In diesem Jahr hatten sich 49 Aussteller als potentielle Arbeitgeber<br />
vorgestellt.<br />
Das erfolgreiche Wirken des Career Centers und eine sich verschärfende Arbeitsmarktsituation<br />
im Land Sachsen-Anhalt, die sich in dem Problem widerspiegelt, dass sachsen-anhaltische<br />
Unternehmen hochqualifizierte Stellen nicht besetzen können, bestärkte das Interesse, das<br />
Career Center Modell im Verbund mit allen <strong>Hochschule</strong>n im Land zu erweitern.<br />
So initiierte das Wirtschaftsministerium an den sieben <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt die<br />
Gründung von „Transferzentren Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung<br />
für KMU im Land Sachsen-Anhalt“ als ein Verbundprojekt, finanziert aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen-Anhalt.<br />
Das Netzwerk der neu gegründeten Transferzentren verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen in Sachsen-Anhalt einerseits durch den Career Service zu<br />
stärken, andererseits durch bedarfsgerechte wissenschaftliche Weiterbildung von Fach- und<br />
Führungskräften in den Unternehmen.<br />
Hierbei geht es darum, Fach- und Führungskräften das nötige Fach- und Methodenwissen, aber<br />
auch soziale Kompetenzen zu vermitteln. Langfristig sollen Maßnahmen der Anpassungsqualifizierung<br />
die Leistungsfähigkeit der Personalstruktur steigern und die Innovationskraft der<br />
Unternehmen fördern.<br />
Über das Verbundprojekt können die Vermittlungs-, Beratungs- und Weiterbildungsleistungen<br />
stärker an den Bedarf der Unternehmen ausgerichtet und flächendeckend angeboten werden.<br />
Die sieben <strong>Hochschule</strong>inrichtungen werden zukünftig unter Nutzung des Stellenportals „Nachwuchsmarkt<br />
Sachsen-Anhalt“ ein vernetztes System zur landesweiten Vermittlung der Absolventen<br />
und Studierenden organisieren.<br />
Im Berichtszeitraum wurden vom Career Center betreut:<br />
• 905 Studierende bzw. Absolventen<br />
Seite 65
• 403 Arbeitgeber, davon 176 Arbeitgeber aus Sachsen-Anhalt, 207 Arbeitgeber bundesweit<br />
und 20 Arbeitgeber weltweit<br />
1149 (349) Stellenangebote, davon 667 (186) Festanstellungen, 415 (131) Praktikantenstellen,<br />
67 (32) qualifizierte Nebentätigkeiten, wurden akquiriert und den Stellensuchenden zur Verfügung<br />
gestellt. Die Klammerwerte beziehen sich auf Sachsen-Anhalt.<br />
253 Vermittlungen wurden getätigt, davon: 69 Festanstellungen, 96 Abschlussarbeiten inkl.<br />
Praktikum, 46 Praktika und 42 Nebenjob/Freiberufliche Tätigkeiten.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Job<br />
Abschlusspraktika<br />
Praktika<br />
Nebentätigkeiten<br />
Die abweichenden Zahlen zwischen Abschlusspraktika und Praktika resultieren aus der<br />
Umstellung auf Bachelor. <strong>2008</strong> gingen die letzten Diplomanden und die ersten Bachelor aus<br />
den Ingenieurwissenschaften in ihre Abschlussphase.<br />
Das Stellenportal „Nachwuchsmarkt Sachsen-Anhalt“ (www.nachwuchsmarkt.de)<br />
Im Jahr 2007 wurde das Onlineportal „Nachwuchsmarkt Sachsen-Anhalt“ entwickelt, welches<br />
nach einer dreimonatigen Testphase seit Ende 2007 die Arbeit des Career Centers unterstützt.<br />
Hierdurch erfuhr das Career Center eine wesentliche Verbesserung interner Prozesse, was<br />
schließlich zu einer gestiegenen Leistungsqualität und höherer Zufriedenheit bei Studierenden<br />
und Wirtschaftsunternehmen geführt hat.<br />
Im Portal finden Studierende und Absolventen Stellenangebote, eine Übersicht unterschiedlicher<br />
Firmenprofile und die Nutzer können zudem selbst ein individuelles Stellengesuch<br />
veröffentlichen. Das Portal ermöglicht Arbeitgebern einen direkten Zugriff auf die Profile bestens<br />
ausgebildeter Kandidaten.<br />
Der Nachwuchsmarkt ist 24-stündig einsatzbereit und von jedem Arbeitsplatz aus unkompliziert<br />
erreichbar. Für Studierende/AbsolventInnen, potentielle Arbeitgeber aber auch für die Mitarbeiterinnen<br />
im Career Center stellt dieses Portal eine enorme Vereinfachung des Vermittlungsprozesses<br />
dar. Dieses Instrument steigert die Erreichbarkeit aller Beteiligten.<br />
Das Leistungsangebot für Arbeitgeber:<br />
• Vermittlung von:<br />
- HochschulabsolventInnen in den Berufseinstieg<br />
- Studierende für qualifizierte Praktikantentätigkeiten<br />
- Studierende für die wissenschaftliche Bearbeitung von berufspraktischen Themen im<br />
Rahmen von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten<br />
- Studierende für Nebentätigkeiten<br />
• Beratung und Hilfe bei der Personalsuche und –auswahl<br />
• Organisation von Firmenkontaktmessen und Exkursionen, bei denen sich Studierende und<br />
potentielle Arbeitgeber frühzeitig kennen lernen<br />
• Bedarfsgerechte Weiterbildung zur Optimierung sozialer und fachübergreifender<br />
Kompetenzen<br />
• Unterstützung bei der Planung, Gestaltung und Durchführung von Weiterbildungsaktivitäten<br />
Seite 66
Wir bieten den Arbeitgebern:<br />
• Persönliche Beratung und individuelle Betreuung<br />
• Frühzeitigen Kontakt zu akademischen Nachwuchskräften<br />
• Passgenaue Bewerberprofile<br />
• Gezieltes Personalmarketing in der <strong>Hochschule</strong><br />
• Individuelle Angebote aus dem Wissenschaftssystem<br />
• Unkomplizierte Nutzung des Stellenportals „Nachwuchsmarkt.de“<br />
Leistungsangebot für Studierende und AbsolventInnen:<br />
• Vermittlung von:<br />
- Qualifizierten Stellen für den Berufseinstieg<br />
- Interessanten Praktikantenstellen in der Wunschbranche<br />
- Fachbezogene Themen für Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten aus der Berufspraxis<br />
- Wirtschaftsnahen Forschungsthemen für die Erstellung von Studienarbeiten<br />
- Qualifizierte Nebentätigkeiten und Hiwi-Stellen<br />
Wir bieten den Studierenden und AbsolventInnen:<br />
• persönliche Beratung und individuelle Betreuung<br />
• passgenaue Praktikantenstellen<br />
• höhere Berufseinstiegschancen<br />
• Verbesserung sozialer Kompetenzen durch Weiterbildungsangebote<br />
• Frühzeitige und direkte Kontaktaufnahme zu potentiellen Arbeitgebern<br />
• Aktuelle Informationen rund um das Thema Berufsvorbereitung und Berufseinstieg<br />
• Kurze Wege durch die unmittelbare Nähe zum Hochschulcampus<br />
• Kostenlose Nutzung des Stellenportals „Nachwuchsmarkt.de“<br />
Seite 67
Anhang 4:<br />
Bachelor-Studiengänge an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.A.<br />
Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Dualer Studiengang Betriebwirtschaftslehre<br />
Betriebswirtschaftlehre<br />
Fachdolmetschen<br />
Fachkommunikation (ehemals Fachübersetzen)<br />
Gebärdensprachdolmetschen<br />
Gesundheitsförderung und –management<br />
Industrial Design<br />
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation<br />
Journalistik/ Medienmanagement<br />
Soziale Arbeit<br />
Soziale Dienste in der Justiz<br />
Angewandtes Innovationsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen<br />
(KMU) [berufsbegleitendes Teilzeitstudium]<br />
Angewandte Gesundheitswissenschaften (Berufsbegleitendes Fernstudium)<br />
Rehabilitationspsychologie<br />
Sicherheit und Gefahrenabwehr<br />
Statistik<br />
Betriebswirtschaftslehre (Fernstudium)<br />
Betriebswirtschaftslehre/Sozialversicherungsmanagement (Fernstudium)<br />
Bauingenieurwesen<br />
Dualer Studiengang Bauingenieurwesen<br />
Elektrotechnik<br />
Mechatronische Systemtechnik (Systems Engineering)<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Maschinenbau<br />
Wasserwirtschaft<br />
Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Start SoS 2009<br />
Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von Kindertageseinrichtungen<br />
Seite 68
Anhang 5:<br />
Master-Studiengänge an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Das in der Zielvereinbarung festgeschriebene Angebot an MA-Studiengängen wird vollständig<br />
zu Beginn des SoS 2009 installiert sein. Derzeit angeboten werden bereits 16 MA-Studiengänge<br />
inkl. 7 weiterbildender Studiengänge:<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.Sc<br />
M.Sc.<br />
M.Sc.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.Sc.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
Interaction Design<br />
Sozial- und Gesundheitsjournalismus<br />
Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft<br />
Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung<br />
Engineering Design<br />
Ingenieurökologie<br />
Sicherheit und Gefahrenabwehr<br />
Rehabilitationspsychologie<br />
Risikomanagement<br />
Weiterbildend:<br />
Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen<br />
und Familien (weiterbildend)<br />
Interdisziplinäre Therapie psychiatrischer Störungen auf psychodynamischer<br />
Grundlage (weiterbildend)<br />
Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis (weiterbildend)<br />
Innovatives Management (weiterbildend)<br />
European Perspectives on Social Inclusion<br />
(weiterbildend)<br />
Gesundheitsförderung und- management in Europa (EUMAPH), (weiterbildend)<br />
Management im Gesundheitswesen (weiterbildend)<br />
Folgende Masterstudiengänge sind in <strong>2008</strong> genehmigt worden und starten zum SoS 2009:<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.Sc.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.A.<br />
Funkidentifikation/Nahbereichsfunktechnik<br />
Energieeffizientes Bauen<br />
Tief- und Verkehrsbau<br />
Maschinenbau<br />
Regenerative und Rationelle Gebäudeenergiesysteme<br />
Wasserwirtschaft<br />
European Master in Sign Language Interpreting<br />
Seite 69
Anhang 6:<br />
Weiterbildungsangebote an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Folgende Weiterbildungsangebote werden derzeit an der <strong>Hochschule</strong> geplant und durchgeführt,<br />
die als Formate für die Weiterbildung in weiterbildende Studiengänge, weiterbildende<br />
Studienprogramme und weiterbildende Studienangebote unterschieden werden.<br />
Weiterbildende Studiengänge (Bachelor/ Master):<br />
BA-Studiengang: Soziale Dienste in der Justiz<br />
BA-Studiengang: Angewandte Gesundheitswissenschaften<br />
BA-Studiengang: Angewandtes Innovationsmanagement für KMU<br />
MA-Studiengang: Tiefbau, Verkehrs- und Brückenbau<br />
MA-Studiengang: Innovatives Management<br />
MA-Studiengang: European Perspectives on Social Inclusion<br />
MA-Studiengang: Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft<br />
MA-Studiengang: Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis<br />
MA-Studiengang: Gesundheitsförderung und -management in Europa<br />
MA-Studiengang: Management im Gesundheitswesen<br />
MA-Studiengang: Sign Language Interpreting EUMASLI<br />
Genehmigte weiterbildende Studiengänge mit Start 2009 sind:<br />
BA-Studiengang: Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter - Leitung von Kindertageseinrichtungen<br />
MA-Studiengang: Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen<br />
und Familien<br />
MA-Studiengang: Interdisziplinäre Therapie psychiatrischer Störungen auf psychodynamischer<br />
Grundlage<br />
Weiterbildende Studienprogramme (Zertifikat):<br />
• Bildjournalismus<br />
• Innovationsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen<br />
• Praxismanagement Studienergänzung Gesundheitsförderung und Prävention mit besonderem<br />
Schwerpunkt in der Gesundheitsberatung Benachteiligter<br />
• Studienergänzung Maschinenbau<br />
• Simultandolmetschen<br />
• Dolmetschen und Übersetzen für Gerichte und Behörden<br />
• Gesundheitsförderung in Städten und Gemeinden<br />
• KMU Management<br />
• Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie<br />
Ausbildung in Psychologischer Psychotherapie<br />
Care Business Management<br />
• Angewandte Gesundheitswissenschaften<br />
Genehmigte weiterbildende Studienprogramme mit Start 2009 sind:<br />
• Sozialpädagogisches Empowerment in der Elternbildung<br />
• Kommunikations- und Medienkompetenz<br />
Weiterbildende Studienangebote (Kurse und Module):<br />
• alle Kurse im Studium Generale (z. B. Englisch, Verhandlungstraining, Rhetorik)<br />
• alle Mitarbeiterkurse im Rahmen der internen Weiterbildung<br />
• Sprachintensivkurse (Französisch, Englisch, Spanisch)<br />
Damit hat sich die Anzahl der <strong>2008</strong> durchgeführten Weiterbildenden Studiengänge und<br />
Studienprogramme (26) gegenüber der Anzahl von 2007 (17) um über 50 % erhöht.<br />
Seite 70