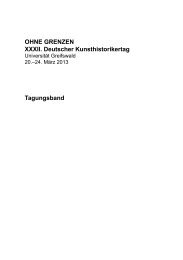Text PK Schuster für VDK - Verband Deutscher Kunsthistoriker eV
Text PK Schuster für VDK - Verband Deutscher Kunsthistoriker eV
Text PK Schuster für VDK - Verband Deutscher Kunsthistoriker eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Papierkorb der Geschichte oder Die Rückkehr aller Bilder<br />
Zur Rochade der Staatlichen Museen zu Berlin<br />
von Peter-Klaus <strong>Schuster</strong><br />
Der Protest von 1990<br />
Wie sehr wurde er gescholten, wie massiv wurde er attackiert, mein Vorgänger im Amt des<br />
Generaldirektors der Berliner Museen, Wolf-Dieter Dube, als er sich unmittelbar nach der<br />
Wiedervereinigung standhaft weigerte, den von ihm geplanten Neubau der Berliner<br />
Gemäldegalerie am Kulturforum aufzugeben, um statt dessen mit der Gemäldegalerie wieder<br />
auf die Museumsinsel zu gehen. Alle – und besonders ein angesehener Großkritiker der<br />
Frankfurter Allgemeinen Zeitung – sie alle forderten schon 1990, dass die Chance der<br />
Wiedervereinigung sofort ergriffen werde und dass die Gemäldegalerie, mit ihren kostbarsten<br />
Beständen ins Nachkriegs-Westberlin nach Dahlem verbracht, endlich wieder an ihren<br />
historischen Standort auf die Museumsinsel in die Mitte Berlins zurückkehren müsse. Ganz<br />
praktisch bedeutete diese damals vom gesamten deutschen Feuilleton, von allen einschlägigen<br />
Museumskuratoren wie natürlich auch vom Deutschen <strong>Kunsthistoriker</strong>-<strong>Verband</strong> – schon<br />
damals mit scharfem Protest – einmütig erhobene Forderung, dass bereits im Jahr 1990 hätte<br />
passieren sollen, was eben jetzt von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ihren Berliner<br />
Museen beschlossen wurde! Also, die einzigartige Berliner Gemäldegalerie soll wieder auf<br />
die Museumsinsel in das dort von Wilhelm von Bode eigens <strong>für</strong> sie geplante und 1904<br />
eröffnete Museums-Schloss, das einstige Kaiser Friedrich Museum und heutige Bode-<br />
Museum, zurückkehren!<br />
Was damals alle gefordert hatten, wird heute, so scheint es, von allen vehement abgelehnt.<br />
Kann man das verstehen? Eigentlich kaum, denn schon damals wollte die öffentliche, oder<br />
vielleicht richtiger, die veröffentlichte Meinung nicht bloß die Rückkehr der Gemäldegalerie<br />
auf die Museumsinsel. Vielmehr forderte sie bereits damals, was von den Berliner Museen<br />
soeben ebenfalls beschlossen wurde, einen Erweiterungsbau unmittelbar gegenüber dem<br />
Bode-Museum als Korrektur jenes Missstandes, zu dem Bodes extremer Sammlerehrgeiz ihn<br />
genötigt hatte.<br />
Dieser Missstand bestand seit jeher im Platzmangel <strong>für</strong> Bodes so reiche Sammlungen auf der<br />
Museumsinsel. Seine mit größter Kennerschaft und enzyklopädischer Ausführlichkeit<br />
beständig erweiterte Gemäldegalerie und die von ihm überhaupt erst begründete<br />
Skulpturensammlung, diese beiden Sammlungen Bodes ließen sich schon 1904 kaum mehr<br />
angemessen ausstellen. Das aber war Bodes ganz einzigartige Idee! Malerei und Skulptur,<br />
diese beiden Schwesterkünste, ihre zur gleichen Zeit entstandenen und sich wechselseitig<br />
beeinflussenden und erhellenden Bilder vom Menschen als Ausdruck eines verwandten<br />
Kunstwollens, sie müssen miteinander – oder doch zumindest in größter räumlicher Nähe<br />
zueinander – präsentiert werden.<br />
Im Erdgeschoß sah man deshalb in Bodes Museum bei bestem Seitenlicht die Skulpturen, im<br />
Geschoß darüber in den Sälen mit reichem Oberlicht die Gemälde. Zudem gab es Räume, in<br />
denen Bode Malerei und Skulptur gattungsübergreifend mit weiteren Ausstattungsstücken der<br />
Zeit höchst suggestiv und mit größtem Gespür <strong>für</strong> ästhetische Arrangements zusammenführte.<br />
Seite 1 von 9
1905, unmittelbar nach Eröffnung seines Museums, vom Direktor der Gemälde- wie der<br />
Skulpturensammlung zum Generaldirektor der Berliner Museen befördert, war es Bode ein<br />
Leichtes mit gesteigerter Machtfülle – und nun weitergehend noch unterstützt durch ein von<br />
ihm ingeniös gepflegtes Netzwerk aus Kaiser, Ministern, Gelehrten, Händlern und<br />
vermögenden Mäzenen – seine Sammelleidenschaft im prosperierenden Kaiserreich exzessiv<br />
auszudehnen – sehr zum Argwohn wie auch zur Bewunderung seiner Museumskollegen im<br />
In- und Ausland. Dieses intensive Sammlertum führte dazu, dass Bode im Pergamonmuseum,<br />
dem nächsten von ihm angeregten Museumsbau auf der Museumsinsel, den linken Flügel <strong>für</strong><br />
seine beiden Sammlungen reklamierte. Unter dem Titel „Deutsches Museum“ sollten dort die<br />
Nordalpinen Schulen der Malerei und Skulptur von den Altniederländern über Dürer,<br />
Holbein, Cranach, Niclaus Gerhaert und Riemenschneider bis zu Rembrandt und Schlüter<br />
ausgestellt werden. Den Südlichen Schulen, insbesondere der Malerei und Skulptur Italiens,<br />
blieb das heutige Bode-Museum vorbehalten. Wegen der beeindruckenden „Basilika“ nach<br />
Florentiner Vorbild in seinem Zentrum wurde das Bode-Museum ohnehin stets als das<br />
„Renaissance-Museum“ bezeichnet. Das „Deutsche Museum“ hingegen im linken Flügel des<br />
Pergamonmuseums, 1930 eröffnet und in seinen abermals übereinander angeordneten<br />
Ausstellungsräumen <strong>für</strong> Skulptur und Malerei weit nüchterner ausgestaltet als von Bode<br />
gewünscht, war durch eine Brücke über die Gleise der Stadtbahn direkt mit den Südlichen<br />
Schulen in Bodes Museum verbunden.<br />
Im Dialog dieser beiden Sammlungsgebäude hatte Bode sein Raumproblem einigermaßen<br />
gelöst. Mit der weitgehenden Zerstörung der Museumsinsel in den letzten Wochen des<br />
Zweiten Weltkrieges wurde auch Bodes Verbindung zwischen den beiden Museen zerstört.<br />
Nach der durchgehenden Nutzung des gesamten Pergamonmuseums ausschließlich <strong>für</strong> die<br />
archäologischen Sammlungen, wo<strong>für</strong> sich die Staatlichen Museen zu Berlin-Ost seit 1945 mit<br />
guten Gründen entschieden haben, dachte niemand mehr an eine Rückkehr der Gemälde und<br />
Skulpturen der Nordischen Schulen ins Pergamonmuseum. Vielmehr wollte die öffentliche<br />
Meinung 1990 mit größtem Nachdruck und völlig einstimmig eine Rückkehr der<br />
Gemäldegalerie in das Bode-Museum. Und zugleich wollte man einen Erweiterungsbau<br />
jenseits des Kupfergrabens genau gegenüber dem Bode-Museum auf jenem geräumigen<br />
Kasernengrundstück, auf dem einst die Wachregimenter <strong>für</strong> das Stadtschloss exerzierten.<br />
Es war Helmut Kohl, der dieses Gelände nach der Wiedervereinigung in weiser Voraussicht<br />
zur Erweiterung den Museen zur Verfügung gestellt hatte. Dem Plan seines damaligen<br />
Finanzministers, dort eine Finanzschule zu errichten, wurde von Kohl, so wird kolportiert, mit<br />
dem Argument widersprochen, das internationale Ansehen der Deutschen könne einzig durch<br />
großzügige Förderung der Kultur wieder gebessert werden. Einen notwendigen<br />
Erweiterungsbau des Bode-Museums <strong>für</strong> die nach Bodes Vorbild gemeinsame Aufstellung<br />
der so einzigartig reichen Berliner Gemälde- und Skulpturensammlungen auf eben diesem<br />
neugewonnenen Gelände, das den Museen damals noch nicht offiziell zugesprochen war und<br />
doch als deren zukünftiges Entwicklungsgelände allen sichtbar vor Augen lag, ein<br />
Erweiterungsbau auf diesem Kasernengelände und mit eben dem Budget, das <strong>für</strong> Dubes noch<br />
nicht begonnenen Neubau auf dem Kulturforum durchaus verfügbar war, das war der damals<br />
mit heftigstem Nachdruck vorgetragene Wunsch aller. Ein Wunsch, den sich die Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz im Einklang mit ihren Museen soeben völlig zu eigen gemacht hat.<br />
Eine Gemäldegalerie Alter Meister am Kulturforum, im einstigen Villenviertel Westberlins<br />
am Rande des Tiergartens, schien allen hingegen der völlig falsche Ort zu sein. Die<br />
allgemeine Meinung war eindeutig!<br />
Seite 2 von 9
Die neue Gemäldegalerie am Kulturforum<br />
Wolf-Dieter Dube zeigt sich von all dem völlig unbeeindruckt. Bestärkt durch eine von ihm<br />
einberufene internationale Expertenkommission und gestützt durch einen Beschluss des<br />
Stiftungsrates der Preußenstiftung fuhr Dube mit seinem Neubauprojekt einer Gemäldegalerie<br />
am Kulturforum unbeirrt fort. Und er hatte Recht! Er hatte ja, was selten genug der Fall ist,<br />
alle drei „Gottesgeschenke“ vereint, von denen jeder Bauherr nur träumen kann. Er hatte<br />
einen Bauplatz, er hatte einen nur <strong>für</strong> dieses Bauprojekt an diesem Bauplatz genehmigten und<br />
auskömmlichen Bauetat, und er hatte nach einem aufwendigen Architekturwettbewerb einen<br />
völlig unangefochtenen, überaus anerkannten ersten Preisträger <strong>für</strong> seine neue<br />
Gemäldegalerie, das Münchner Architekturbüro Hilmer & Sattler. Das Neubauprojekt im<br />
Hinblick auf eine damals noch völlig ungewisse Zukunft und Entwicklung der Museumsinsel<br />
aufzugeben, erschien Dube demgegenüber als völlig verantwortungslos.<br />
Gegen alle Ansinnen, sein noch nicht begonnenes Neubauprojekt einer Gemäldegalerie am<br />
Kulturforum zu stoppen, argumentierte er mit der erstaunlichen Bemerkung: Die Idee einer<br />
Rückkehr der Gemälde auf die Museumsinsel – und damit auch ins Bode-Museum – sei eine<br />
Idee, die sich erledigt habe. Sie gehöre „in den Papierkorb der Geschichte". Der besagte<br />
Großkritiker der FAZ war ob dieser Ansage wortreich wütend und zuletzt sprachlos! Und sehr<br />
viele Andere mit ihm!<br />
Gegen großen öffentlichen Druck, mit pragmatischer Klugheit und hoher Kompetenz <strong>für</strong><br />
Museumsbauten hat Dube seine Gemäldegalerie am Kulturforum mit seinen Münchner<br />
Architekten zu einem vorzüglichen Abschluss gebracht. Wäre diese neue Gemäldegalerie<br />
nicht am Kulturforum gebaut worden, hätten die Berliner Gemälde bis frühestens zur<br />
vollendeten Generalsanierung des Bode-Museums im Jahr 2006 weiterhin in ihrem höchst<br />
unvollkommenen Nachkriegsprovisorium in Dahlem ausharren müssen. So bezogen sie nun<br />
dank Dubes Entschlusskraft seit 1998 ein <strong>für</strong> die Präsentation von Gemälden geradezu ideal<br />
geeignetes Gebäude: moderne Architektur mit noblem Zuschnitt der Räume und herrlichem<br />
Oberlicht. Diese sehr geräumige neue Berliner Gemäldegalerie von Hilmer & Sattler ist unter<br />
Dubes wachsamem Auge zu einer der schönsten Pinakotheken <strong>für</strong> Gemälde Alter Meister<br />
geworden. Die Skulpturen fehlen freilich völlig. Für die Gemälde hingegen, so versichern die<br />
Kenner der Berliner Sammlung, passe das neue Haus wie ein Maßanzug.<br />
Dem Druck der Öffentlichkeit bei seinen Museumsentscheidungen nicht nachgegeben zu<br />
haben, wird zu den bleibenden Verdiensten Dubes zählen. Er hat den Staatlichen Museen zu<br />
Berlin ein großartiges Museumsgebäude an jenem Ort ermöglicht, an dem diese bereits mit<br />
Mies van der Rohes einzigartiger Neuen Nationalgalerie ihren wohl bedeutendsten Neubau<br />
überhaupt als ein Haus <strong>für</strong> die Kunst des 20. Jahrhunderts errichtet haben. Die anderen<br />
Museumsgebäude an diesem Kulturforum am Rande des Tiergartens sind eher problematisch,<br />
so das Kunstgewerbemuseum. Oder sie sind gescheitert wie die völlig verworrene<br />
Eingangshalle mit schräg angekippter Piazetta, die jeder Besucher des Kulturforums erst<br />
mühsam zu überwinden hat.<br />
Besucherzahlen und Kunstgenuss<br />
Man hat in dieser grotesken Unwirtlichkeit einen Grund <strong>für</strong> die seit ihrer Eröffnung eher nicht<br />
befriedigenden Besucherzahlen gesehen. Aber was sind schon befriedigende Besucherzahlen?<br />
Die Besucher der Gemäldegalerie am Kulturforum sind nicht weniger zahlreich als in der<br />
Seite 3 von 9
Alten Pinakothek in München und werden hierzulande nur von der Dresdner Gemäldegalerie<br />
übertroffen. So sagt es die Statistik. Und doch ist die nicht wirklich zufrieden stellende<br />
Wahrnehmung der Alten Meister nicht nur in Berlin ein Problem. Gegenüber der so<br />
erstaunlichen Entwicklung der Museumsinsel in der Publikumsgunst, gegenüber dem<br />
Triumph der Museumsinsel, ist das Kulturforum – mit der bezeichnenden Ausnahme der<br />
Neuen Nationalgalerie – völlig ins Hintertreffen geraten. Das hat man bei der Planung dieser<br />
Gemäldegalerie 1990 so noch nicht wissen können und nach ihrer so hoffnungsvollen<br />
Eröffnung 1998 so auch nicht erwartet. Es ist eine ideale Gemäldegalerie am falschen<br />
Standort!<br />
Angemessene Orte<br />
Hier beginnt, wenn man so will, das Verhängnis von Wolf-Dieter Dube. Er hat alles richtig<br />
gemacht. Und doch schlägt die Geschichte zurück und durchkreuzt die schönsten Planungen.<br />
Es gibt in Museumsdingen ganz offenbar keine endgültige Ablage im Papierkorb der<br />
Geschichte. Im Gegenteil, nichts ist in Berlin so interessant wie der Papierkorb der<br />
Geschichte. Berlin und die Faszination <strong>für</strong> Berlin, auch <strong>für</strong> die Kunst- und Museumsstadt<br />
Berlin, lebt von Geschichte und Geschichten. Das Kulturforum ist ein Ort, der <strong>für</strong> die Alten<br />
Meister überhaupt keine Geschichte bietet. Für sie ist es ein absolut geschichtsloser Ort und<br />
damit ein falscher Ort.<br />
Ganz anders verhält es sich mit der Kunst des 20. Jahrhunderts. Wenn man im Uhrzeigersinn<br />
dem Rundgang in der Gemäldegalerie folgt, beginnend mit den frühen Italienern, blickt man<br />
dort durch ein großes Fenster, mit dem Hilmer & Sattler die Besucher ihres Galeriegebäudes<br />
an allen Ecken zu einem Ausblick verlocken. Vom ersten Fenster blickt man auf die<br />
Sigismund Straße genau dort, wo Menzel bis zu seinem Tode 1905 sein Atelier hatte. Vom<br />
nächsten Ausblick an der linken Ecke der Gemäldegalerie an der Stauffenberg Straße sieht<br />
man den Bendlerblock, einst Sitz der Obersten Heeresverwaltung der Deutschen Wehrmacht,<br />
in dessen Innenhof 1944 der Widerstand gegen Hitler niedergeschossen wurde. Blickt man<br />
aus dem rechten Ausblick der Gemäldegalerie an der Stauffenberg Straße, die Rembrandt-<br />
Säle liegen hinter uns, so sieht man die Folgen der nationalsozialistischen Stadtplanung bis<br />
heute. Die großbürgerlichen Villen häufig jüdischer Familien, in Sichtweite wohnte einst<br />
James Simon, der großzügigste Mäzen, den die Berliner Museen je hatten, diese Villen<br />
wurden von den Nationalsozialisten abgerissen, um dort Platz <strong>für</strong> neue Botschaftsgebäude zu<br />
schaffen. Die kriegszerstörten Botschaften der einstigen Achsenmächte Italien und Japan sind<br />
in ihrem monumentalen Stil wieder hergestellt. Sie werden inzwischen jedoch verdeckt durch<br />
die neu gebauten Botschaften in eher postmodernem Stil von Österreich, Indien, Südafrika<br />
und weiteren Ländern. Der Ausblick vom rechten Eckfenster der Stauffenberg Straße sieht<br />
mithin ein Panorama der wiedergewonnenen Hauptstadtfunktion Berlins mit deutlichen<br />
Spuren ihrer Vergangenheit.<br />
Einen Ausblick an der vierten Ecke der Gemäldegalerie, dort wo im Inneren die<br />
spätmittelalterlichen Altäre ihren Platz haben, gibt es nicht. Man verlässt vielmehr dort nach<br />
vollendetem Rundgang die Galerie und kehrt zurück in die Einganghalle, um durch deren<br />
große Glaswände gleichsam wie ein campo santo des 20. Jahrhunderts das Kulturforum mit<br />
den spätexpressionistischen Kulturbauten Scharouns <strong>für</strong> die Staatsbibliothek, die<br />
Philharmonie und den Kammermusiksaal sowie Gutbrods weit nüchternes<br />
Kunstgewerbemuseum zu sehen. Und man blickt auf die mit Marmorklippen und<br />
Garagenaufbauten zersplitterte Schräge der Piazetta, die – was wenig gewusst wird – ein<br />
Seite 4 von 9
unvollendetes Werk des einstigen Zerokünstlers Heinz Mack ist. Dahinter erscheint der<br />
Potsdamer Platz, einst tabula rasa unmittelbar an der Mauer und nun wiederaufgebaut mit der<br />
ganzen pittoresken Vielfalt postmoderner Architektur. Man mag die schrapnellartig<br />
verstörende Piazetta gemeinsam mit dem Potpourri des Potsdamer Platzes als eine<br />
„architecture parlante“ verstehen <strong>für</strong> all die Verwerfungen, <strong>für</strong> das Großartige, Großmäulige,<br />
Exzentrische, Kosmopolitische und Katastrophale, was wir mit dem Berlin des 20.<br />
Jahrhunderts verbinden. Hier im modernen Westen Berlins haben bereits um 1900<br />
Intellektuelle und Künstler wie Fontane und Menzel gewohnt. Hier am Kulturforum und am<br />
benachbarten Ufer des Landwehrkanals befanden sich die entscheidenden Kunsthandlungen<br />
der Moderne, Cassirer und der Dada-Salon von Dr. Burkhard. Mies van der Rohe, dessen<br />
Neue Nationalgalerie seit 1968 als Tempel der Moderne und zugleich als architektonisches<br />
Jahrhundertwerk das Kulturforum so sehr auszeichnet, hatte einst ebenfalls wenige Schritte<br />
entfernt am Ufer des Landwehrkanals seine Wohnung gehabt.<br />
Hier am Potsdamer Platz mitsamt dem Kulturforum schlug einst das Herz des modernen<br />
Berlins. Wenn das Kulturforum als weiteres großes Museumsquartier der Staatlichen Museen<br />
zu Berlin überhaupt einen Sinn macht – und spätestens mit Hilmer & Sattlers wunderbar<br />
modernem Galeriegebäude als großzügiger Ergänzung zu Mies van der Rohes Neuer<br />
Nationalgalerie macht es wirklich Sinn – , dann eben als eine Museumsinsel der Moderne, als<br />
Museumsort <strong>für</strong> die Künste des 20. Jahrhunderts, dem im Kupferstichkabinett, der<br />
Kunstbibliothek und dem Kunstgewerbemuseum die ebenfalls in die Gegenwart<br />
fortsammelnden Schwestersammlungen mitsamt ihrem universalen Bild- und Formrepertoire<br />
als unerschöpfliche Anschauungsfelder und Wissensarchive der Kunstgeschichte verfügbar<br />
bleiben.<br />
Die Künste des 21. Jahrhunderts, die völlig Neues erproben und sich immer neu riskieren,<br />
haben auch zukünftig im Hamburger Bahnhof ihr Museum der Gegenwart unter der Regie der<br />
Nationalgalerie. Womit vorgegeben ist und vom Sammler auch gewünscht , dass die<br />
gegenwärtig im Hamburger Bahnhof gezeigte Sammlung Marx mit ihren Meisterwerken der<br />
Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer von der Nationalgalerie zu begründenden<br />
Galerie des 20. Jahrhunderts ebenso zu integrieren ist wie die ganz auf die klassischen<br />
Moderne, auf die internationale Kunst des Surrealismus konzentrierte Sammlung von Ulla<br />
und Heiner Pietzsch.<br />
Das Kulturforum am Potsdamer Platz ist als urbane Geschichtslandschaft der denkbar<br />
ungeeignetste Platz <strong>für</strong> die Alten Meister. Und das Publikum spürt das, wenn es in Mies van<br />
der Rohes Neue Nationalgalerie strömt, nicht nur zu den spektakulären Ausstellungen. Kaum<br />
weniger besucht sind die Sammlungspräsentationen, die Udo Kittelmann, mein Nachfolger im<br />
Amt des Direktors der Nationalgalerie, mit seinen Kollegen als ein großes Panorama zur<br />
Kunst und Bildkultur des 20. Jahrhunderts ganz aus den Beständen der Nationalgalerie und<br />
der ihr von Sammlern anvertrauten Dauerleihgaben, ergänzt mit weiteren Leihgaben aus den<br />
Schwestersammlungen der Staatlichen Museen als eine große Erzählung in drei Teilen,<br />
gleichsam als ein auf 6 Jahre verteiltes Triptychon des 20. Jahrhunderts inszeniert hat.<br />
Jenseits des etablierten Kanons in die Tiefe der Bestände gehend, haben Udo Kittelmann und<br />
seine Kollegen eine Sammlung der Nationalgalerie <strong>für</strong> das 20. Jahrhundert, <strong>für</strong> dieses so<br />
entscheidende Jahrhundert Berlins, an die Oberfläche gehoben. Eine Sammlung, die plötzlich<br />
so reich und so informativ ist, dass sie immer nur in Tranchen in Mies van der Rohe viel zu<br />
kleiner Neuen Nationalgalerie gezeigt werden kann.<br />
Seite 5 von 9
Ihrem 20. Jahrhundert muten also die Kunstliebhaber in Berlin mit unvermindertem Interesse<br />
an den einzelnen Jahrhundertschnitten zu, was sie den Alten Meistern im Bode-Museum nicht<br />
zumuten möchten, Konzentration oder gar nur Ausschnitte des Ganzen. Wenn dann ab 2014<br />
die Neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe wegen ihres inzwischen bautechnisch<br />
maroden Gesamtzustandes generalsaniert und geschlossen werden muss, wird es in Berlin bei<br />
den Staatlichen Museen auf Jahre hin keinen Überblick über das 20. Jahrhundert mehr zu<br />
sehen geben. Das lange 20. Jahrhundert, diese ebenso faszinierende wie quälende<br />
Vergangenheit unserer Gegenwart, ein Zentralbereich im Gedächtnis von Berlin, dieser<br />
Metropole des 20. Jahrhunderts, wird dann im größten und mit Abstand meist besuchten<br />
Museumskomplex in Deutschland verschwunden sein. Was eigentlich nicht sein kann und<br />
auch nicht sein muss!<br />
Die Berliner Situation der Museen und ihrer Sammlungen könnte – kriegs- und<br />
teilungsbedingt – nicht verquerer sein. Die Kunst gerade jenes Jahrhunderts, die Berlins<br />
einzigartigen Aufstieg und Fall und seine Wiedergeburt als eines der wichtigsten, der<br />
anregendsten und aufregendsten Zentren Europas wie keine andere begleitet und kritisch<br />
kommentiert hat, diese Kunst ist in Berlin mit merkwürdig akzeptierter<br />
Geschichtsvergessenheit bisher stets nur in Ausschnitten zu sehen.<br />
Es gibt – in wenigen Jahren wegen der notwendigen Schließung der Neuen Nationagalerie<br />
noch deutlicher als jetzt – keine Nationalgalerie des 20. Jahrhunderts! Es gibt, obwohl es sie<br />
geben müsste und am einzig richtigen Ort auch ein würdiges, modernes und großzügig<br />
bemessenes Gebäude vorhanden ist, keine Galerie des 20. Jahrhunderts, weil es sie dort am<br />
richtigen Ort und im richtigen Haus nicht geben darf. Weil dort nämlich – an einem <strong>für</strong> sie<br />
völlig geschichtslosen Ort, die weit weniger hilfsbedürftige, ja weltweit einzigartige<br />
Gemäldegalerie der Alten Meister in einem auch <strong>für</strong> sie hervorragend geeigneten modernen<br />
Gebäude präsentiert wird. Hingegen darf das Bode-Museum, das angestammte historische<br />
Gebäude der Gemäldegalerie auf der Museumsinsel, dieser museale Bedeutungsort <strong>für</strong> die<br />
Alten Meister, darf diese Gemälde nicht aufnehmen, weil das so kostbar wieder hergerichtete<br />
Gebäude nicht die Gesamtheit dieser prachtvollen Alten Meister zeigen kann, sondern vorerst<br />
nur ein erlesenes Konzentrat. Und der notwendige Erweiterungsbau zwar schon ein<br />
auskömmliches Grundstück an der richtigen Stelle, aber gegenwärtig keine Finanzierung hat.<br />
Die Ablehnung der erwünschten Rochade mit ihrer Forderung: Alter Meister zurück auf die<br />
Insel, Neue Meister ausführlich aufs Kulturforum, die Ablehnung dieser Rochade beruht auf<br />
einer doppelten Geschichtsvergessenheit. Wer wie Willibald Sauerländer als der<br />
verehrenswürdige Doyen der Kunstgeschichte, mit Rückgriff auf Alexander Kluge gegen<br />
diese Rochade argumentiert: Hier verdränge die Gegenwart wieder einmal die Vergangenheit<br />
– und wir dürfen es auch noch deutlicher sagen: hier verdränge ungesicherte aktuelle<br />
Kunstmarktkunst die gesicherten Werte der Kunstgeschichte; und wer dazu noch das Ethos<br />
und die Pflichten des bewahrenden Museumskurators beschwört, der verkennt, dass es bei<br />
dieser Rochade keineswegs um „Gegenwart versus Vergangenheit“ geht.<br />
Für die gegenwärtige Kunst muss man sich in dem so lebendigen Berlin nicht die größten<br />
Sorgen machen. Es geht vielmehr um eine doppelte Vergangenheit! Um eine, die noch ganz<br />
nahe ist, die noch weh tut, die in ihren Kunstwerken und Manifestationen noch ungesichert<br />
ist, die auch verführt und mit der in der Welt der Kunst und des Kunsthandels durchaus noch<br />
spekuliert wird, mit der Geschäfte gemacht werden und die dennoch die Kunst eines<br />
faszinierenden Jahrhunderts ist. Eines Jahrhunderts, dessen auch schreckliche Gegenwart<br />
nicht vergehen will und nicht vergehen soll und die es festzuhalten gilt, auch mit dem Risiko<br />
Seite 6 von 9
von Irrtum und Revision. Eine Vergangenheit, die genau dort ausgestellt werden sollte, wo<br />
diese Vergangenheit ganz gegenwärtig war und noch gegenwärtig ist, im alten und<br />
wiedergefundenen Westen Berlins, am Kulturforum am Potsdamer Platz als einer möglichst<br />
enzyklopädischen Museumsinsel der Moderne mitsamt ihrem dort umfassend archivierten<br />
Bildgedächtnis der Welt.<br />
Und es geht um eine Vergangenheit, die historisch noch weiter in der Vergangenheit<br />
zurückführt. Von welcher der Historiker aber weiß, dass sie keineswegs vergangen ist,<br />
sondern dass sie unseren Anschauungs- und Vorstellungsfundus noch heute entscheidend<br />
prägt. Es ist – mit Aby Warburg gesprochen – der „Leidschatz der Menschheit“, der auf der<br />
Berliner Museumsinsel von den Anfängen der Kultur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in<br />
beeindruckender Vollständigkeit versammelt ist. Es fehlt diesem, der Aufklärung, der<br />
Goethezeit, Schinkel und den Brüdern Humboldt mitsamt ihren Erben verdankten<br />
Universalmuseum der europäischen Welt mitsamt ihren Vorläufern, so wie es sich in den fünf<br />
miteinander korrespondieren Museumstempeln der Museumsinsel wieder präsentiert, es fehlt<br />
einzig Bodes großartige Gemäldegalerie mit den Alten Meistern. Einzig das europäische<br />
Leitmedium der Malerei wird in diesem Kontinuum vermisst, weil es dort in seinem<br />
angestammten Haus und in seinem angestammten Kontext nicht sein darf, weil es eben dort<br />
nicht sofort vollständig sein kann!<br />
Aber es muss dort sein, weil es nur dort seinen historischen Ort hat, was das<br />
Sammlungsgebäude wie seinen Kontext anbetrifft. Denn es ist ja keineswegs so, wie völlig<br />
ortsblinde Stimmen unserer Debatte sagen, dass die „Berliner Kulturbeauftragten“, wer immer<br />
das auch ist, mit der Rochade beabsichtigen, alle Höhepunkte der Kunst kulturvergessen auf<br />
der Museumsinsel wie auf einer Eventfläche zu konzentrieren, einzig um die Schaulust der<br />
Touristenströme zu befrieden. Man fasst es kaum, wie von den selbsternannten Hütern der<br />
Alten Meister das Wunder der Berliner Museumsinsel, mit ihren fünf Museen – in<br />
einhundertjähriger Bauzeit angelegt als Parcours durch die westliche und vorderöstlichen<br />
Kunst- und Kulturgeschichte – zu einer Schaubudennummer herabgewürdigt wird, in welcher<br />
nun auch noch – horribile dictu – die Alten Meister hineingepfercht werden sollen. Als wären<br />
die Gemälde der Alten Meister im Weltkulturerbe Museumsinsel nicht an ihrem wahren,<br />
angestammten und angemessenen Platz.<br />
Der Protest von 1990 mit seiner Forderung, die Gemäldegalerie müsse wieder auf die<br />
Museumsinsel zurückkehren, wusste noch genau, wo der historisch richtige Ort <strong>für</strong> die Alten<br />
Meister in Berlin ist. Dieser Wunsch, mit der Gemäldegalerie wieder in die Mitte Berlins zu<br />
gehen, erhielt von den Vertretern des einstigen Protestes vor wenigen Jahren eine neue<br />
Wendung mit dem Berliner Schloss. Im Zusammenhang mit der Debatte über den<br />
Wiederaufbau des Berliner Schlosses haben die munteren Eleven des besagten Großkritikers,<br />
gewiss nicht ohne dessen Zustimmung, in den Feuilletons wiederholt darüber räsoniert, ob<br />
man statt des Vorschlages der Berliner Museen, die Ethnologica und die asiatischen<br />
Sammlungen aus Dahlem im Neubau des Schlosses auszustellen, nicht doch besser die<br />
Gemäldegalerie im Obergeschoß des Schlosses mit entsprechendem Oberlicht etablieren<br />
sollte. Man wollte also auf die zu Zeiten der Globalisierung einmalige Chance verzichten, die<br />
im Abseits von Dahlem nur schwer zugänglichen außereuropäischen Sammlungen in der<br />
Mitte Berlins in einen beständigen Dialog mit den europäischen Sammlungen der<br />
Museumsinsel zu bringen. Der Kunst und Kultur Außer-Europas in diesem Humboldt-Forum<br />
so jenen Status des Weltkulturerbes zuzuerkennen, den sie dann <strong>für</strong> jedermann sichtbar mit<br />
den Sammlungen der europäischen Künste und Kulturen teilen, das schien weniger ins<br />
Seite 7 von 9
Gewicht zu fallen als der irrtümliche Glaube, dass <strong>für</strong> große Gemäldegalerien noch immer ein<br />
Schloss der angemessene Standort sei.<br />
Die anempfohlene Feudalisierung der Berliner Gemäldegalerie zu einer Schloss-Galerie<br />
geschah natürlich wider jedes bessere Wissen. Denn jeder weiß, dass gerade die Berliner<br />
Galerie nicht wie in München, Dresden, Wien, Madrid oder Paris aus der feudalen<br />
Sammelleidenschaft eines Herrscherhauses hervorgegangen ist. Gerade die Berliner<br />
Gemäldegalerie ist durch die außerordentliche Kennerschaft bürgerlicher Kunstgelehrter<br />
entstanden. Kein Ort ist <strong>für</strong> die Berliner Gemäldegalerie deshalb historisch weniger<br />
angemessen als das Schloss, dem sie ja bereits mit ihrem ersten Standort in Schinkels<br />
Museum eben als bürgerliche Kunsteinrichtung antithetisch kontrastiert war. Ferner beliebt<br />
man völlig zu vergessen, dass diese zutiefst durch bürgerliche Gelehrsamkeit, von Bürgern <strong>für</strong><br />
Bürger zusammengetragene Galerie, seit langem ja bereits ein ganz eigenes Schloss besitzt,<br />
eben das ihr von Bode bis ins Detail konzipierte Museumsschloss des Bode-Museums. Man<br />
muss die Gemäldegalerie dort nur einziehen lassen, um alle seine Schloss-phantasien auf das<br />
Schönste befriedigt zu finden.<br />
Nachdem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Gedanken der Translozierung der<br />
Gemäldegalerie ins neue Berliner Schloss nicht aufgegriffen hat und nachdem sie bereits<br />
unmittelbar nach der Wiedervereinigung ihre einmalige Chance zum Umzug in die Mitte<br />
Berlins hat verstreichen lassen, habe sie es auch nicht mehr verdient, ihren alten Fehler zu<br />
korrigieren! Sie wird deshalb nun mit den Folgen einer Gemäldegalerie am historisch falschen<br />
Ort, die dort nicht so besucht wird, wie sie es eigentlich verdient hätte, dauerhaft gestraft.<br />
Aber war es denn ein Fehler? War es wirklich nur ein Fehler? Ohne den „Fehler“ wären die<br />
Gemälde der Alten Meister noch lange im unwürdigen Nachkriegsprovisorium in Dahlem<br />
verblieben, denn auf der Museumsinsel war die Generalsanierung der Alten Nationalgalerie<br />
vordringlicher als das Bode-Museum, das erst 2006 wieder zur Aufnahme von Gemälden zur<br />
Verfügung stehen konnte. Ohne den „Fehler“ gäbe es zudem überhaupt kein Galeriegebäude.<br />
Und insbesondere keines, das <strong>für</strong> die Präsentation von Kunst so hervorragend geeignet und so<br />
überaus großzügig bemessen ist. Ohne diesen „Fehler“ von Wolf-Dieter Dube könnte die<br />
Rochade überhaupt nicht gedacht werden. Denn ohne irgendeine Wegwerfleistung kann<br />
dieses Gebäude sofort als Galerie <strong>für</strong> das 20. Jahrhundert genutzt werden<br />
Der Etat von 10 Millionen Euro, der von Kulturstaatsminister Bernd Neumann den<br />
Staatlichen Museen zur Umwidmung dieses Gebäudes <strong>für</strong> eine Galerie des 20. Jahrhunderts<br />
zur Verfügung gestellt wurde, erscheint den Kritikern nicht ausreichend. Aber von Udo<br />
Kittelmann ist nicht zu erwarten, dass er diese einmalige Chance durch kostspielige Wünsche<br />
verteuert, etwa durch das Absenken von Deckenhöhen und Oberlichtern einer<br />
Altmeistergalerie oder durch den Wunsch nach einer völlig neuen Raumeinteilung, die eine<br />
teuere Veränderung der Klimaanlage erforderlich machen würde. Udo Kittelmann ist bekannt<br />
da<strong>für</strong>, sich mit klaren Vorgaben klar zurechtzufinden. Ein Museum, so die berühmte<br />
Definition von Baselitz, ist ein Raum mit vier Wänden und einem Oberlicht. Wenn besondere<br />
Rauminstallationen <strong>für</strong> ein besonderes Kunstwerk nötig werden sollten, die den Etat<br />
ungebührlich belasten, werden die Freunde der Nationalgalerie gerne hilfreich sein. Nein,<br />
diese Gemäldegalerie ist mit minimalen Veränderungen bereits die so gewünschte Galerie des<br />
20. Jahrhunderts am richtigen Ort!<br />
Seite 8 von 9
Die historische Chance<br />
André Schmitz, Staatssekretär <strong>für</strong> Kultur im Berliner Senat, hat in unserer höchst erregten<br />
Debatte vor wenigen Tagen von einer „historischen Chance" gesprochen <strong>für</strong> die endliche<br />
Verwirklichung der Rochade, <strong>für</strong> die Rückkehr aller Bilder und Bildwerke, der Alten wie der<br />
Neuen Meister, an die ihnen gemäßen Orte. Historisch ist diese Chance, weil noch nie in und<br />
außerhalb Berlins so viele und so gewichtige Stimmen sich <strong>für</strong> die Berliner Gemäldegalerie<br />
der Alten Meister ausgesprochen haben, <strong>für</strong> ihre Sichtbarkeit und <strong>für</strong> ihre Unentbehrlichkeit.<br />
Mit der Formel „Erst ein neuer Ort <strong>für</strong> die Alten Meister“ wird auch deren Umzug auf die<br />
Museumsinsel an ihren historischen Ort im Bode-Museum plus Erweiterungsbau keineswegs<br />
abgelehnt. Gerne wird sogar zugestanden, die Idee des Umzuges sei ja völlig richtig. Aber<br />
wann, so lautet sogleich die entscheidende Einschränkung, wann wird es auf der<br />
Museumsinsel die da<strong>für</strong> benötigten Räume geben? „Erst ein neuer Ort <strong>für</strong> die Alten Meister“,<br />
mit dieser <strong>für</strong>sorglichen Formel wird der Rochade zugestimmt, um sie in Wahrheit zu<br />
verhindern. Aber wenn man die Alten Meister wirklich wieder an dem ihnen einzig<br />
angemessenen Ort auf der Berliner Museumsinsel haben will, dann muss man mit dem Wort<br />
von Horst Bredekamp, dem wirklich ortskundigen Ordinarius <strong>für</strong> Kunstgeschichte an der<br />
Humboldt Universität, ins Risiko springen. Dieses Springen wird umso gewisser zu einem<br />
guten Ende führen, wenn weiterhin so Viele so leidenschaftlich sich <strong>für</strong> die Alten Meister<br />
engagieren. Alle, die voller Sorge um eine nicht mehr gesicherte Präsenz sämtlicher Alten<br />
Meister die Rochade entschieden zurückweisen, sind eigentlich ihre wahren Unterstützer. Nur<br />
mit heftigstem und dauerhaftem Protest, der uns ganz deutlich macht, wie großartig und<br />
einzigartig die Berliner Sammlungen sind, und zwar die Gemäldegalerie ebenso wie die<br />
Skulpturensammlung, wird diese Rochade zum guten Ende kommen. Da<strong>für</strong> braucht es außer<br />
den gewährten Sondermitteln als nächsten notwendigen Schritt einen Wettbewerb <strong>für</strong> den so<br />
dringend benötigten Erweiterungsbau des Bode-Museums. Dieser muss <strong>für</strong> die Präsentation<br />
Alter Meister ebenso vollkommen werden wie das Gebäude von Hilmer & Sattler am<br />
Kulturforum.<br />
Für die Nationalgalerie und ihre Sammlung des 20. Jahrhunderts bedeutet dieser erste Schritt<br />
in Richtung Rochade, dass nun auch die noch sehr entwicklungsbedürftige Sammlung der<br />
Nationalgalerie <strong>für</strong> die Künste des 20. Jahrhunderts erstmals wieder darauf hoffen darf, erneut<br />
eine Statur zu entwickeln, die einer Nationalgalerie würdig und angemessen ist. Dies kann nur<br />
erreicht werden, wenn sie <strong>für</strong> die ihr zugedachten Schenkungen wie Leihgaben erstmals auch<br />
die benötigten Räume und damit auch eine dauerhafte Zukunft in Berlin anbieten kann. Ohne<br />
diese großzügigen Schenkungen und Leihgaben von privater Seite wird es angesichts der<br />
Notlage der öffentlichen Finanzen keine wirkliche Nationalgalerie des 20. Jahrhunderts, die<br />
diesen Namen verdient, geben können. Die Berliner Gemäldegalerie der Alten Meister ist<br />
vollendet, die Skulpturensammlung ebenso, die Sammlung der Neuen Nationalgalerie absolut<br />
nicht! Die Moderne benötigt die Hilfe der Alten Meister, das große Ansehen ihrer so<br />
außerordentlichen Qualität in den Berliner Sammlungen und die Unterstützung all jener, die<br />
jetzt so vehement ihre Stimme <strong>für</strong> diese einzigartigen Altmeistersammlungen der Berliner<br />
Museen erheben.<br />
(Juli 2012)<br />
Peter-Klaus <strong>Schuster</strong> ist Generaldirektor emeritus der Staatlichen Museen zu Berlin<br />
Die gekürzte Fassung dieses <strong>Text</strong>es wurde am 11. August 2012 in „Die Welt“ veröffentlicht.<br />
Seite 9 von 9