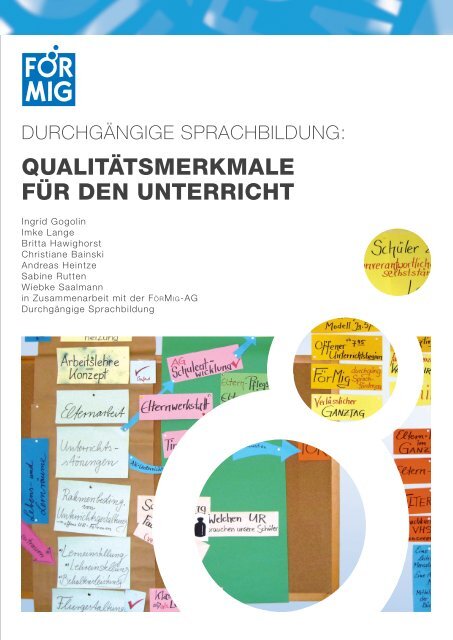qualitätsmerkmale für den unterricht - sprachenservicewahr.de
qualitätsmerkmale für den unterricht - sprachenservicewahr.de
qualitätsmerkmale für den unterricht - sprachenservicewahr.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Durchgängige Sprachbildung:Qualitätsmerkmale<strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong> UnterrichtIngrid GogolinImke LangeBritta HawighorstChristiane BainskiAndreas HeintzeSabine RuttenWiebke Saalmannin Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r FörMig-AGDurchgängige Sprachbildung
ImpressumEinleitungIngrid GogolinImke LangeBritta HawighorstChristian BainskiAndreas HeintzeSabine RuttenWiebke Saalmannin Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r FörMig-AGDurchgängige SprachbildungKontaktUniversität HamburgFörMig-KompetenzzentrumVon Melle-Park 820146 HamburgHamburg, Version November 2010Unterricht in sprachlich heterogenen Klassen gehörtimmer mehr zum Alltag von Lehrkräften. Noch nichtselbstverständlich sind erfolgreiche Handlungsstrategienim Umgang mit sprachlicher Heterogenität.„Welche Gegenstän<strong>de</strong> sollen bei <strong>de</strong>r Sprachbildung in<strong><strong>de</strong>n</strong> Blick genommen wer<strong><strong>de</strong>n</strong>? Wie kann ich sprachlicheHeterogenität in meiner Unterrichtsplanungberücksichtigen? Welches übergeordnete Ziel verbin<strong>de</strong>tunterschiedliche Ansätze und Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>?“ –Fragen wie diese stellen sich <strong>für</strong> viele Lehrkräfte immerwie<strong>de</strong>r neu.Die Qualitätsmerkmale Durchgängiger Sprachbildungkönnen eine Hilfestellung bieten. Es han<strong>de</strong>ltsich um eine Zusammenstellung von Merkmalen,Konkretisierungen, Beispielen und Hinweisen, wieSprachbildung in allen Fächern umgesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>kann. Beschrieben wer<strong><strong>de</strong>n</strong> Eigenschaften undBeson<strong>de</strong>rheiten eines bildungssprachför<strong>de</strong>rlichenUnterrichts. Unter „Qualität“ wird dabei verstan<strong><strong>de</strong>n</strong>:Allen Schülerinnen und Schülern einen Zugangzu Bildungssprache zu eröffnen und ihnen so dieChance zu geben, sich die sprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen,die Schule mit sich bringt, so weit wie möglichanzueignen.Die Qualitätsmerkmale Durchgängiger Sprachbildungrichten sich vor allem an Lehrkräfte <strong>de</strong>r SekundarstufeI.In dieser Einführung wird im ersten Teil <strong>de</strong>r Kontextvorgestellt, in <strong>de</strong>m diese Merkmale erarbeitet wur<strong><strong>de</strong>n</strong>.Im zweiten Teil wer<strong><strong>de</strong>n</strong> <strong>de</strong>r Aufbau <strong>de</strong>r Merkmaleskizziert und die einzelnen Merkmale erläutert.Abschließend wer<strong><strong>de</strong>n</strong> Möglichkeiten zur Arbeit mit<strong><strong>de</strong>n</strong> Merkmalen vorgestellt.Teil 1:Hintergrund und EntwicklungsgeschichteDie AG Durchgängige SprachbilungDie Qualitätsmerkmale Durchgängiger Sprachbildungsind <strong>de</strong>r Ertrag einer Arbeitsgruppe <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>llprogrammsFörMig (För<strong>de</strong>rung von Kin<strong>de</strong>rn undJugendlichen mit Migrationshintergrund). DiesemMo<strong>de</strong>llprogramm lag als ein Gedanke zugrun<strong>de</strong>,sprachliche Bildungsprozesse von Kin<strong>de</strong>rn und Jugendlichenüber Schnittstellen hinweg durchgängigzu planen und zu gestalten – zwischen <strong><strong>de</strong>n</strong> beteiligtenBildungsstufen, Lernbereichen und Institutionen.Die Arbeitsgruppe „Durchgängige Sprachbildung“hat sich im Mai 2006 gegrün<strong>de</strong>t, um sich mit einerDimension Durchgängiger Sprachbildung intensivzu befassen: Gemeinsame Zielperspektive war (undist es auch noch), Sprachbildung im Unterricht allerFächer umzusetzen. Fächerübergreifend soll Spracheals Medium <strong>de</strong>s Lehrens und Lernens bewusstverwen<strong>de</strong>t und geför<strong>de</strong>rt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Durch praktischeErfahrungen sollte das Ziel <strong>de</strong>r „Sprachbildung in allenFächern“ konzeptionell gefüllt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> und eineda<strong>für</strong> geeignete Praxis systematisch in <strong><strong>de</strong>n</strong> Schulalltagintegriert wer<strong><strong>de</strong>n</strong>.Sieben Mo<strong>de</strong>llschulen in fünf Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn habensich seit <strong>de</strong>m Schuljahr 2007/2008 dieser Aufgabe angenommen:die Gesamtschule Duisburg-Mei<strong>de</strong>rich,die Apollonia-von-Wie<strong>de</strong>bach-Schule in Leipzig, dieGesamtschule Rosenhöhe in Bielefeld, die GesamtschuleKirchdorf in Hamburg, die Eberhard-Klein-Schule in Berlin, die Herbert-Grillo-Gesamtschulein Duisburg und die Realschule Friedrichsgabe inNor<strong>de</strong>rstedt.In <strong>de</strong>r Arbeitsgruppe „Durchgängige Sprachbildung“arbeiteten Lehrkräfte aus <strong><strong>de</strong>n</strong> Mo<strong>de</strong>llschulen,Lan<strong>de</strong>skoordinatoren <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>llprogrammsFörMig und Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s FörMig-Programmträgersmit. Beabsichtigt war nicht, ein enges Korsett<strong>für</strong> Sprachbildung zu entwickeln, das alle Schulenin gleicher Weise umsetzen sollten. Als die Arbeitaufgenommen wur<strong>de</strong>, gab es keine ausgearbeitetenProgramme o<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle, wie eine DurchgängigeSprachbildung im Alltag einer gesamten Schule erfolgreichumgesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> kann. Es ging vielmehrdarum, die gemeinsamen Zielvorstellungen im Rahmen<strong>de</strong>r jeweiligen didaktischen Ausrichtungen und<strong>de</strong>r spezifischen pädagogischen Ziele <strong>de</strong>r beteiligtenSchulen zu entwickeln und zu erproben.Ein an<strong>de</strong>res Vorgehen wäre kaum möglich gewesen,da die Rahmenbedingungen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llschulen sehrunterschiedlich sind: Einige haben einen Anteil von90 o<strong>de</strong>r 100 Prozent an Kin<strong>de</strong>rn und Jugendlichenmit Migrationshintergrund, an<strong>de</strong>re einen Anteil von15 bis 20 Prozent. Unter <strong><strong>de</strong>n</strong> Mo<strong>de</strong>llschulen sindsolche, <strong>de</strong>ren Schülerinnen und Schüler in sehrbenachteiligter sozialer Lage leben, und Schulen,2 3
Einleitungdie ein eher bürgerliches Umfeld haben. Die größteSchule wird von über 1.400 Schülerinnen undSchülern besucht, die kleinste von gut 300. EinigeSchulen haben erst im Rahmen <strong>de</strong>r Arbeitsgruppebegonnen, sich mit <strong>de</strong>m Thema Sprachbildung auseinan<strong>de</strong>rzusetzen;an<strong>de</strong>re haben eine lange Tradition<strong>de</strong>r Sprachför<strong>de</strong>rung. Und genau diese Heterogenitäterwies sich als Schatz: Die Schulen haben sich inihrer Arbeit unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt,z. B. Sprachbildung mit sozialräumlicher Öffnungund sozialem Lernen zu verbin<strong><strong>de</strong>n</strong> o<strong>de</strong>r individualisiertesLernen mit Durchgängiger Sprachbildung zuverknüpfen. Von <strong><strong>de</strong>n</strong> vielfältigen Erfahrungen konntenalle Schulen wechselseitig profitieren.Von Erfahrungen und QualitätsmerkmalenDie Schulen haben im Schuljahr 2007/2008 begonnen,Durchgängige Sprachbildung in allen Fächernumzusetzen. Bei <strong><strong>de</strong>n</strong> gemeinsamen Treffen <strong>de</strong>rArbeitsgruppe wur<strong><strong>de</strong>n</strong> die Erfahrungen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llschulenzusammengetragen, Teilziele überprüft undSchwierigkeiten besprochen.Je vielfältiger die gelingen<strong><strong>de</strong>n</strong> Erfahrungen wur<strong><strong>de</strong>n</strong>,umso mehr stellte sich die Frage, was dieseErfahrungen verbin<strong>de</strong>t. Wie kann ein gelungenerbildungsprachför<strong>de</strong>rlicher Unterricht beschriebenwer<strong><strong>de</strong>n</strong>? – Durch die Diskussion dieser Fragen entstan<strong><strong>de</strong>n</strong>die „Merkmale“. Dieser Prozess war nichtimmer einfach. Die Merkmale und ihre Konkretisierungenwur<strong><strong>de</strong>n</strong> mehrmals überarbeitet, an <strong>de</strong>r Realitätüberprüft, mit weiteren Beispielen illustriert, imRahmen von Vorträgen, Workshops und Seminarenvorgestellt und nochmals überarbeitet. Die hier vorliegen<strong>de</strong>Fassung verbin<strong>de</strong>t die Erfahrungen aus<strong><strong>de</strong>n</strong> sieben FörMig-Mo<strong>de</strong>llschulen.Teil 2:Qualitätsmerkmale DurchgängigerSprachbildungAufbau <strong>de</strong>r sechs QualitätsmerkmaleDie Qualitätsmerkmale benennen Eigenschaften,die bei <strong>de</strong>r Umsetzung eines bildungssprachför<strong>de</strong>rlichenUnterrichts sinnvoll und notwendig sind. Siesind als Ziele formuliert.Wie lässt sich konkret überprüfen, dass ein MerkmalEingang in <strong><strong>de</strong>n</strong> Schullalltag gefun<strong><strong>de</strong>n</strong> hat? Hier sindErfahrungen aus <strong><strong>de</strong>n</strong> Mo<strong>de</strong>llschulen zusammengefasst.Die so genannten Konkretisierungen beschreibenHandlungen auf Lehrer- und Schülerseite, die<strong><strong>de</strong>n</strong> einzelnen Merkmalen zugeordnet sind. DieseHandlungen wur<strong><strong>de</strong>n</strong> in <strong><strong>de</strong>n</strong> Mo<strong>de</strong>llschulen erprobt.Die Konkretisierungen wer<strong><strong>de</strong>n</strong> durch ausgewählteBeispiele veranschaulicht.In <strong>de</strong>r Rubrik Tipps, Literatur & Links fin<strong><strong>de</strong>n</strong> sich Hinweisezur weiterführen<strong><strong>de</strong>n</strong> Lektüre.Zu <strong><strong>de</strong>n</strong> einzelnen QualitätsmerkmalenAllen sechs Qualitätsmerkmalen liegen die zwei folgen<strong><strong>de</strong>n</strong>Voraussetzungen zugrun<strong>de</strong>:• Die Bereitschaft, Sprachbildung durchgängig inallen Fächern umsetzen zu wollen, und• die Wertschätzung <strong>de</strong>r Mehrsprachigkeit <strong>de</strong>rSchülerinnen und Schüler – verbun<strong><strong>de</strong>n</strong> mit <strong>de</strong>rBereitschaft, Mehrsprachigkeit zu för<strong>de</strong>rn, wo esmöglich ist.Das erste Merkmal bezieht sich darauf, dassBildungssprache eine Art <strong>de</strong>r Sprachverwendungist, die sich von <strong>de</strong>m, wie Schülerinnen und Schülerin ihrem Alltag mit Sprache umgehen, mehr o<strong>de</strong>rweniger unterschei<strong>de</strong>t:Die Lehrkräfte planen und gestalten<strong><strong>de</strong>n</strong> Unterricht mit Blick auf dasRegister Bildungssprache und stellendie Verbindung von Allgemein- undBildungssprache explizit her.Eine gezielte För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Bildungssprache ist entschei<strong><strong>de</strong>n</strong>d<strong>für</strong> (schulischen) Bildungserfolg. Voraussetzungda<strong>für</strong> ist es, dass Lehrkräfte, Schülerinnenund Schüler lernen, zwischen Allgemein- und Bildungsspracheausdrücklich zu unterschei<strong><strong>de</strong>n</strong>.In <strong>de</strong>r Allgemeinsprache (auch: Alltagssprache) könnensich die Sprecher in <strong>de</strong>r Regel auf einen gemeinsamenKontext, auf das Hier und Jetzt beziehen. Sokönnen sie z. B. bei einem Versuch im Fach Chemiesagen: „Jetzt kippen wir das da rein.“ Wenn alle sehen,was geschieht, erübrigt es sich, alle Ereignissezu versprachlichen. Allgemein- o<strong>de</strong>r Alltagsspracheist dadurch charakterisiert, dass sie <strong><strong>de</strong>n</strong> Regeln <strong>de</strong>rMündlichkeit folgt.In bildungssprachlichen Situationen hingegen beziehensich die Sprecher auf Inhalte, die sich nichtim unmittelbaren, gemeinsamen Erlebniskontext befin<strong><strong>de</strong>n</strong>.Entsprechend muss z. B. die Schülerin o<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r Schüler in einer schriftlichen Versuchsbeschreibungsprachlich ausdrücken, worauf sie o<strong>de</strong>r er imdirekten Kontext durch Mimik und Gestik verweisenkonnte: „Die Lösung wird in <strong><strong>de</strong>n</strong> Kolben gefüllt.“Bildungssprachliche Äußerungen und Texte sindsowohl mündlich als auch schriftlich durch raumzeitlicheDistanz geprägt. Um diese Distanz zuüberwin<strong><strong>de</strong>n</strong>, sind sprachlich komplexe Strukturennotwendig, z. B. differenzieren<strong>de</strong> und abstrahieren<strong>de</strong>Ausdrücke („füllen“ statt „reinkippen“); Fachbegriffe,die sich von allgemeinsprachlichen Wörtern in ihrerBe<strong>de</strong>utung unterschei<strong><strong>de</strong>n</strong> („Lösung“ als Bezeichnung<strong>für</strong> eine Flüssigkeit, „Kolben“ als Bezeichnung<strong>für</strong> ein Gefäß); unpersönliche Konstruktionen („wirdgefüllt“ statt „wir kippen rein“) und vielfach fachgruppentypischeTextsorten (z. B. Versuchsbericht).Im ersten Merkmal sind daher Konkretisierungenzusammengefasst, wie Lehrkräfte die Schülerinnenund Schüler darin unterstützen können, wichtigeUnterschie<strong>de</strong> zwischen Allgemein- und Bildungssprachezu erkennen. Der Fokus liegt dabei auf <strong>de</strong>rUnterrichtsgestaltung. Es geht um eine bewusstePlanung, wann Allgemeinsprache bei <strong>de</strong>r Aneignungvon Inhalten sinnvoll ist (z. B. in <strong>de</strong>r Gruppenarbeit)und wann bildungssprachliche Äußerungen erwartetwer<strong><strong>de</strong>n</strong> (z. B. bei <strong>de</strong>r Präsentation <strong>de</strong>r Gruppenarbeit).Die jeweiligen Situationen sollten <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnenund Schülern explizit ver<strong>de</strong>utlicht wer<strong><strong>de</strong>n</strong>,damit sie die an sie gestellten Erwartungen aucherfüllen können.Das zweite Merkmal bezieht sich auf die Notwendigkeitund die Möglichkeiten, die sprachlichen Ressourcen<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen:Die Lehrkräfte diagnostizieren dieindividuellen sprachlichen Voraussetzungenund Entwicklungsprozesse.Die bewusste Planung von Unterricht im Hinblickauf das Register Bildungssprache ist dann möglich,wenn klar ist, welche Ressourcen die Schülerinnenund Schüler mitbringen und wo sie in ihrer Sprachentwicklungstehen. Die bewusste Unterstützungbeim Weg, sich das Register Bildungssprache anzueignen,ist möglich, wenn prozessbegleitenddokumentiert wird, welche sprachlichen Lernaufgabenals nächstes anstehen. Im Mo<strong>de</strong>llprogrammFörMig wur<strong><strong>de</strong>n</strong> Vorschläge <strong>für</strong> diese Form <strong>de</strong>rSprachdiagnostik entwickelt. Dabei geht es darum,das sprachliche Lernen gemeinsam zu planen – in<strong>de</strong>r Kommunikation <strong>de</strong>r Lehrkräfte untereinan<strong>de</strong>rund in <strong>de</strong>r Kommunikation zwischen Lehrkräften,Schülerinnen und Schülern. Wenn irgend möglich,ist auch eine Diagnostik <strong>de</strong>r familiensprachlichenKenntnisse und Fähigkeiten angebracht, <strong><strong>de</strong>n</strong>n auchsie gehören zu <strong><strong>de</strong>n</strong> Ressourcen <strong>für</strong> die Aneignungbildungssprachlicher Kompetenz. Aus <strong>de</strong>m ProgrammFörMig stehen einige Instrumente <strong>für</strong> die Diagnostikfamiliensprachlicher Fähigkeiten zur Verfügung.Aber auch an<strong>de</strong>re Wege, sich ein Bild darüberzu machen, können hilfreich sein – nicht zuletzt dasGespräch mit <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülern o<strong>de</strong>rEltern über ihre familiale Sprachpraxis.Das dritte Merkmal betont die Verantwortung allerLehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler in <strong>de</strong>r Ausbildungsprachlicher Kompetenzen in <strong><strong>de</strong>n</strong> BereichenHören, Lesen, Sprechen und Schreiben aktiv zu unterstützen– und diese Kompetenzen nicht als gegebenvorauszusetzen:Die Lehrkräfte stellen allgemein- undbildungssprachliche Mittel bereit undmo<strong>de</strong>llieren diese.Dieses Merkmal bezieht sich – in Ergänzung zumersten Merkmal – auf die Umsetzung im Unterrichtselbst. Für folgen<strong>de</strong> Bereiche sind hier Konkretisierungenzusammengetragen, wie Lehrkräfte Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>einsetzen können, um Schülerinnen und Schülerbeim Erwerb differenzierter sprachlicher Mittel zu unterstützen:Aufgabenstellungen, Wortschatzarbeit,Sprachrezeption (Hören und Lesen), Sprachproduktion(mündlich und schriftlich). Die Formulierung„mo<strong>de</strong>llieren“ ver<strong>de</strong>utlicht, dass die Lehrkräfte die jeweilsnotwendigen sprachlichen Mittel <strong>de</strong>m Entwicklungsstand<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler und <strong>de</strong>mUnterrichtsgegenstand entsprechend gestalten.4 5
EinleitungDas vierte Merkmal richtet <strong><strong>de</strong>n</strong> Blick auf die Aktivitäten<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler im Unterricht:Die Schülerinnen und Schüler erhaltenviele Gelegenheiten, ihre allgemeinundbildungssprachlichen Fähigkeitenzu erwerben, aktiv einzusetzen und zuentwickeln.Das vorhergehen<strong>de</strong> Merkmal fokussiert auf die Tätigkeiten<strong>de</strong>r Lehrkräfte im Unterricht. Hier stehendie Aktivitäten <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt.Allgemeinsprache ist nicht nur ‚mündlicheSprache‘ , son<strong>de</strong>rn kommt auch im Schriftlichen vor –etwa in privaten Briefen, in nie<strong>de</strong>rgeschriebenenDialogen, in Chats, im Internet o<strong>de</strong>r im SMS-Austauschper Mobiltelefon. Bildungssprache wie<strong>de</strong>rumist nicht auf <strong><strong>de</strong>n</strong> schriftlichen Ausdruck beschränkt,son<strong>de</strong>rn kommt auch im Sprechen vor – etwa beimVortrag o<strong>de</strong>r in formellen Situationen. Deshalb gehtes bei <strong><strong>de</strong>n</strong> Konkretisierungen sowohl um die Grundlagen<strong>für</strong> ein sprachför<strong>de</strong>rliches Unterrichtsklimaallgemein als auch um die einzelnen Bereiche Hören,Lesen, Sprechen und Schreiben. Die Gelegenheiten,sprachliche Fähigkeiten zu entwickeln, sindganzheitlich angelegt.Im fünften Merkmal geht es um Formen binnendifferenzierterAufgabenstellungen:Die Lehrkräfte unterstützen dieSchülerinnen und Schüler in ihrenindividuellen Sprachbildungsprozessen.Dieses Merkmal knüpft an das zweite Merkmal,die Diagnose individueller sprachlicher Voraussetzungen,an: Es geht um die anschließen<strong>de</strong> Unterstützung<strong>de</strong>r Sprachbildungsprozesse, die von <strong><strong>de</strong>n</strong>Schülerinnen und Schülern selbst, auch außerhalb<strong>de</strong>s Unterrichts vollzogen wer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Im Unterricht vonsprachlich heterogenen Gruppen spielen hier binnendifferenzierteAufgaben eine wichtige Rolle. Sowird sichergestellt, dass Anfor<strong>de</strong>rungen, die die Sache(<strong><strong>de</strong>n</strong> Inhalt) betreffen, bewältigt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> können –ohne dass die Bearbeitung an <strong><strong>de</strong>n</strong> sprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungenscheitert. Ergänzend ist es hilfreich, einreiches Angebot an sprachlichen Hilfsmitteln bereitzustellenund die Schülerinnen und Schüler dabeiRoutine erlangen zu lassen, wie sie souverän undautonom damit umgehen. So können die Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong>selbst auswählen, welche Hilfen sie wann nutzenwollen, um sich die Inhalte anzueignen und angemessenschriftlich o<strong>de</strong>r mündlich zu präsentieren.Das sechste Merkmal geht auf die Be<strong>de</strong>utung ein,<strong><strong>de</strong>n</strong> Lernstand und die Lernfortschritte zu erfassen:Die Lehrkräfte und die Schülerinnenund Schüler überprüfen und bewertendie Ergebnisse <strong>de</strong>r sprachlichenBildung.Dieses Merkmal betont die gemeinsame Verantwortungvon Lehrkräften und Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong> gegenüber<strong>de</strong>r sprachlichen Bildung. Konstruktive, dialogischeRückmeldungen und Korrekturen ermöglichen <strong><strong>de</strong>n</strong>Schülerinnen und Schülern nicht nur, aus Fehlernzu lernen, son<strong>de</strong>rn auch, ein positives Selbstbild alserfolgreich Lernen<strong>de</strong> zu entwickeln. So können siedie anstehen<strong><strong>de</strong>n</strong> sprachlichen Herausfor<strong>de</strong>rungenschrittweise bewältigen und ihren sprachlichen Bildungsprozesszunehmend selbst steuern.Die sechs Merkmale sind Teil eines Ganzen – einzelneMerkmale allein versprechen noch keinen Erfolg.Aber sie sind auch nicht ‚abzuarbeiten‘ wie einKochrezept. Sie verhalten sich vielmehr zueinan<strong>de</strong>rwie die Stoffstücke einer Patchwork<strong>de</strong>cke: Es fin<strong><strong>de</strong>n</strong>sich einige Stoffe häufiger wie<strong>de</strong>r als an<strong>de</strong>re,aber erst alle Stoffstücke zusammen ergeben einBild und sind groß genug, um die bildungssprachlichenAnfor<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r Schule abzu<strong>de</strong>cken.Die Anerkennung von Mehrsprachigkeit und dasZiel, sie – wo immer möglich – zu för<strong>de</strong>rn, bil<strong><strong>de</strong>n</strong>gleichsam <strong><strong>de</strong>n</strong> roten Fa<strong><strong>de</strong>n</strong>, mit <strong>de</strong>m die Stoffstückemiteinan<strong>de</strong>r vernäht sind. Hierbei geht es nicht zuletztdarum zu verwirklichen, was ohne je<strong><strong>de</strong>n</strong> Zweifelzu <strong><strong>de</strong>n</strong> wichtigsten Voraussetzungen <strong>für</strong> erfolgreichesLernen gehört: ein positives, motivieren<strong>de</strong>sund die Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong> kognitiv herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>s Klimazu schaffen, in <strong>de</strong>m sie beson<strong>de</strong>rs gut lernen können,weil sie lernen wollen.Die Nutzung: Planung, Reflexion undVerständigungDie Qualitätsmerkmale können vielfältig eingesetztwer<strong><strong>de</strong>n</strong>:• Möchte eine Schule o<strong>de</strong>r ein JahrgangsteamDurchgängige Sprachbildung in allen Fächernumsetzen, so bieten sie eine Einführung: DieMerkmale stecken die Bereiche ab, über die sichdas Kollegium o<strong>de</strong>r das Jahrgangsteam verständigensollte: Welche Erfahrungen haben wir zu<strong><strong>de</strong>n</strong> einzelnen Bereichen? Wer kann welche Expertiseeinbringen? Worauf können wir aufbauen?In welchen Gremien und Gruppen sollen die Bereichebesprochen wer<strong><strong>de</strong>n</strong>? Wozu wollen wir unseventuell Hilfe von außen holen?• Die Merkmale und Konkretisierungen ermöglicheneine Bestandsaufnahme: Welche Handlungensind bereits Teil <strong>de</strong>s Unterrichts? WelcheHandlungen sind noch nicht vertraut? WelcheKonkretisierungen interessieren uns beson<strong>de</strong>rs?Wo möchten wir als Team ansetzen?• Schließlich können die Merkmale zur systematischenPlanung eingesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>: Mit welchemBereich möchten wir beginnen? Was sind erreichbareZiele, auf die sich das Kollegium gemeinsamverständigen kann? Welche Wege beschreitenwir, um zu prüfen, ob wir unsere Ziele erreichen?Die Erfahrungen aus <strong><strong>de</strong>n</strong> sieben FörMig-Mo<strong>de</strong>llschulensind ermutigend. Keine <strong>de</strong>r sieben Schulenhat von Beginn an alle Qualitätsmerkmale in Angriffgenommen. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass eineschrittweise Umsetzung sinnvoll ist – zum Beispiel:• Es gibt an <strong>de</strong>r Schule Verfahren <strong>de</strong>r Sprachdiagnose,die eingesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> (Qualitätsmerkmal2)? Dann kann im Kollegium gemeinsamüberlegt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>, wie die Diagnoseergebnisse <strong>für</strong>die Unterrichts- und För<strong>de</strong>rplanung fächerübergreifendgenutzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> können (z. B. weiter mitQualitätsmerkmal 1).• Im Jahrgang wird gera<strong>de</strong> überlegt, wie <strong>de</strong>r Wortschatzin einzelnen Fächern geför<strong>de</strong>rt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>kann (Qualitätsmerkmal 3)? Dann kann gemeinsamüberlegt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>, welche fächerübergreifendnützlichen Hilfsmittel <strong>für</strong> die differenzierte För<strong>de</strong>rungallgemein- und bildungssprachlicher Re<strong>de</strong>mittelbereitgestellt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> können (z. B. weiter inQualitätsmerkmal 3 o<strong>de</strong>r weiter mit Qualitätsmerkmal4).Wenn Sie Fragen haben o<strong>de</strong>r mitLehrkräften aus <strong><strong>de</strong>n</strong> Mo<strong>de</strong>llschulenKontakt aufnehmen wollen, wen<strong><strong>de</strong>n</strong>Sie sich an das FörMig-Kompetenzzentrum<strong>de</strong>r Universität Hamburg(Kontakt siehe Impressum).6 7
QualitätsmerkmaleSprachbildung fin<strong>de</strong>t durchgängig in allenFächern statt. Die Lehrkräfte schätzenund för<strong>de</strong>rn die Mehrsprachigkeit <strong>de</strong>rSchülerinnen und Schüler.Durchgängige Sprachbildung: Qualitätsmerkmale <strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong> UnterrichtQ1Q2Q3Q4Q5Q6Die Lehrkräfte planen und gestalten <strong><strong>de</strong>n</strong> Unterricht mit Blick aufdas Register Bildungsspracheund stellen die Verbindung von Allgemein- und Bildungssprache explizit her.Die Lehrkräfte diagnostizieren die individuellen sprachlichen Voraussetzungen undEntwicklungsprozesse.Die Lehrkräfte stellen allgemein- und bildungssprachliche Mittel bereit undmo<strong>de</strong>llieren diese.Die Schülerinnen und Schüler erhalten viele Gelegenheiten, ihre allgemein- undbildungssprachlichen Fähigkeiten zu erwerben, aktiv einzusetzen und zu entwickeln.Die Lehrkräfte unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihren individuellenSprachbildungsprozessen.Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler überprüfen und bewerten dieErgebnisse <strong>de</strong>r sprachlichen Bildung.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q69
Qualitätsmerkmal 1Die Lehrkräfte planen und gestalten <strong><strong>de</strong>n</strong>Unterricht mit Blick aufdas RegisterBildungssprache und stellen die Verbindungvon Allgemein- und Bildungsspracheexplizit her.KonkretisierungDie Lehrkräfte kennen die Unterschie<strong>de</strong> zwischenverschie<strong><strong>de</strong>n</strong>en sprachlichen Registern – von <strong>de</strong>rAllgemein- bis zur Bildungssprache. Sie stellen imUnterricht explizit Verbindungen zwischen <strong><strong>de</strong>n</strong> Registernher. Sie planen <strong><strong>de</strong>n</strong> Unterricht daraufhin,die sprachlichen Fähigkeiten <strong>de</strong>r Schülerinnen undSchüler in Richtung Bildungssprache zu erweitern.Die Lehrkräfte berücksichtigen sprachliche Heterogenitätbei ihrer Unterrichtsplanung.Die Lehrkräfte analysieren die sprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen<strong>de</strong>s Unterrichts, <strong><strong>de</strong>n</strong> sie planen, und vergleichensie mit <strong>de</strong>m Vorwissen <strong>de</strong>r Schülerinnen undSchüler.Die Lehrkräfte setzen an <strong>de</strong>r Erfahrungswelt <strong>de</strong>rSchülerinnen und Schüler an und beziehen dieseein. Sie ermuntern die Schülerinnen und Schüler,dabei ihre herkunftssprachlichen Kenntnisse undFähigkeiten einzusetzen.Die Lehrkräfte geben <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülernregelmäßig Gelegenheit, sich zu einem Themaschriftlich und mündlich zu äußern und durch Vergleichedie Anfor<strong>de</strong>rungen an bei<strong>de</strong> Handlungsformenzu erkennen.BeispieleUm allen Beteiligten die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s sprachlichenLernens vor Augen zu halten, sind Lernplakatezur Bildungssprache nützlich.Die Lehrkräfte setzen sprachlernför<strong>de</strong>rliche Werkzeugeein, z. B. Filmleiste, Wortgelän<strong>de</strong>r,I<strong>de</strong>ennetz, Bil<strong>de</strong>rgeschichte, Strukturdiagramm.Tipps, Literatur & LinksAls Grundlage <strong>für</strong> die Verständigung zwischen Lehrkräftenüber sprachliche Mittel gibt es hilfreiche Instrumente,vgl. z. B.:http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/all/mut/diag/in<strong>de</strong>x.htmlPortmann-Tselikas, Paul R. und Schmölzer-Eibinger,Sabine (2008): Textkompetenz. In: FremdspracheDeutsch, Heft 39, S. 5-16Rösch, Heidi (Hrsg.) (2005): Deutsch als Zweitsprache.Sprachför<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r Sekundarstufe I.Grundlagen, Übungsi<strong>de</strong>en, Kopiervorlagen, Braunschweig:Schroe<strong>de</strong>lBainski, Christiane und Krüger-Potratz, Marianne(Hrsg.) (2008): Handbuch Sprachför<strong>de</strong>rung, Essen:Neue Deutsche Schule VerlagsgesellschaftDie Lehrkräfte überprüfen das Unterrichtsmaterialauf seine sprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen. Wenn nötig,ergänzen sie es um Hilfen zur Bewältigung <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen.Die Lehrkräfte stellen offene, problemorientierte Aufgaben,die komplexe Sprachhandlungen herausfor<strong>de</strong>rn.Die Lehrkräfte aktivieren das Vorwissen <strong>de</strong>r Schülerinnenund Schüler und stellen die sprachlichen Mitteldazu bereit, damit sie ein Unterrichtsthema <strong>de</strong>rSache nach verstehen und bewältigen können.Die Lehrkräfte nehmen ihre Schülerinnen und Schülermit auf <strong><strong>de</strong>n</strong> Weg <strong>de</strong>s bildungssprachlichen Lernens.Sie machen• die Unterschie<strong>de</strong> zwischen sachlichen undsprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen und• die situativ unterschiedlichen Anfor<strong>de</strong>rungen andas Sprechen und Schreiben, Hören und Lesen(Allgemein-/Bildungssprache)ausdrücklich zum Thema, und sie informieren über dieim aktuellen Unterricht jeweils im Zentrum stehen<strong>de</strong>(n)sachliche(n) und sprachliche(n) Anfor<strong>de</strong>rung(en).Hilfreich <strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong> sprachbewussten Umgang mit Aufgabenstellungenist es, Verstehenskontrollen undReformulierungsaufgaben einzuplanen.Es hat sich bewährt, das jeweilige sprachliche Zieleines Unterrichts ausdrücklich bekanntzugebenund, etwa durch einen Tafelanschrieb, präsent zuhalten (z. B.: Heute geht es um die Unterschie<strong>de</strong>zwischen Wörtern <strong>für</strong> „teilen“ im Fach Mathematikund im Alltag).Die Lehrkräfte machen Unterschie<strong>de</strong> zwischensachlichen und sprachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen ausdrücklichzum Thema, z. B.: „Heute beschreibenwir einen Versuch. Dabei wollen wir beson<strong>de</strong>rs aufKonditionalsätze achten.“Arbeitsblätter sind sprachlernför<strong>de</strong>rlich gestaltet,z. B. durch Angeben von Begriffsklärungen, vereinfachteTexte, vergrößerte Schrift, geglie<strong>de</strong>rten Text,didaktisierte Leseaufträge.Geeignete Raster zur Unterrichtsplanung fin<strong><strong>de</strong>n</strong> sich bei:• Gibbons, Pauline vgl. Krämer, Silke (2009):Scaffolding – ein Baugerüst <strong>für</strong> die Fachsprache.In: Unterricht Chemie, Heft 20, Nr. 111/112, S. 34• Tajmel, Tanja: Planungsrahmen zur sprachsensiblenUnterrichtsplanung. In: Dokumentation zurFachtagung „Bilanz und Perspektiven von FörMigSachsen“, 10.9.2009. Hrsg. vom SächsischenBildungsinstitut:http://www.sachsen-macht-schule.<strong>de</strong>/sbi/10111.htm• unter <strong>de</strong>m Schlagwort „Sheltered InstructionObeservation Protocol“:http://www.siopinstitute.net• Treetzen, Ursula (2008): Planungshilfe <strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong>sprachsensiblen Unterricht. In: Hawighorst, Britta:Durchgängige Sprachbildung an <strong>de</strong>r RealschuleFriedrichsgabe – Ein Porträt:http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/all/mo<strong>de</strong>ll/rsf/in<strong>de</strong>x.html10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q611
Qualitätsmerkmal 2 Qualitätsmerkmal 3Die Lehrkräfte diagnostizieren die individuellensprachlichen Voraussetzungen und Entwicklungsprozesse.Die Lehrkräfte stellen allgemein- undbildungssprachliche Mittel bereit undmo<strong>de</strong>llieren diese.KonkretisierungDie Lehrkräfte ermitteln zu Schuljahresbeginn<strong><strong>de</strong>n</strong> individuellen Entwicklungsbedarf ausgewählterSchülerinnen und Schüler.Die Lehrkräfte diagnostizieren und dokumentierenprozessbegleitend und kriteriengestützt die Sprachentwicklung<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler.Die Lehrkräfte erfassen schriftsprachliche Leistungenin Klassenarbeiten bzw. in ausführlichen Testsmit Hilfe von vereinbarten Kriterien bzw. geeignetenInstrumenten.Die Lehrkräfte gehen bei <strong>de</strong>r Diagnose vom Können<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler aus.Die Lehrkräfte nutzen die Resultate ihrer Diagnose<strong>für</strong> die Unterrichts- und För<strong>de</strong>rplanung.BeispieleDerzeitig vorhan<strong><strong>de</strong>n</strong>e Verfahren <strong>de</strong>r Sprachdiagnosesind <strong>für</strong> sehr unterschiedliche Zwecke geeignet. Sieunterschei<strong><strong>de</strong>n</strong> sich(a) nach <strong>de</strong>m Ziel: Will man eher grundlegen<strong>de</strong> Informationenüber Sprachfähigkeiten erhalten, o<strong>de</strong>rgeht es um eine spezifische Information, z. B. dieBeherrschung einer bestimmten grammatischenForm.(b) nach <strong>de</strong>m Alter <strong>de</strong>r Schüler: Ein Verfahren, das<strong>für</strong> Sechsjährige entwickelt wur<strong>de</strong>, ist bei <strong>de</strong>utlichälteren Schülern nicht aussagekräftig.(c) nach <strong>de</strong>r Qualität: Ein Verfahren, <strong>de</strong>ssen Gütegeprüft wur<strong>de</strong>, ist vertrauenswürdiger als eine pontanentwicklung.(d) nach <strong>de</strong>m Kontext, in <strong>de</strong>m es eingesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>soll: Ein Verfahren, das <strong>de</strong>m Austausch zwischenLehrkräften einer Klasse dient, erfüllt an<strong>de</strong>re Qualitätsmerkmaleals ein Verfahren zur individuellenDiagnostik.Tipps, Literatur & LinksEinen Überblick über Verfahren <strong>de</strong>r Sprachdiagnosegibt: Ehlich, Konrad (2005): Anfor<strong>de</strong>rungen an Verfahren<strong>de</strong>r regelmäßigen Sprachstandsfeststellungals Grundlage <strong>für</strong> die frühe und individuelle Sprachför<strong>de</strong>rungvon Kin<strong>de</strong>rn mit und ohne Migrationshintergrund.Eine Expertise <strong>für</strong> das Bun<strong>de</strong>sministerium<strong>für</strong> Bildung und Forschung, Bonn/Berlin: BMBFZu <strong><strong>de</strong>n</strong> im Rahmen von FörMig eingesetzten sprachdiagnostischenVerfahren vgl.: Lengyel, Drorit /Reich, Hans H. / Roth, Hans-Joachim / Döll, Marion(Hrsg.) (2009): Von <strong>de</strong>r Sprachdiagnose zurSprachför<strong>de</strong>rung. FörMig Edition, Band 5, Münsteru.a.: WaxmannZur Beobachtung und Analyse bildungssprachlicherEntwicklungen in Sekundarstufe I wur<strong>de</strong> im FörMig-Kontext ein neues Instrument entwickelt, vgl. Reich,Hans H. / Roth, Hans-Joachim / Lengyel, Droritu.a.: Prozessbegleiten<strong>de</strong> Diagnose <strong>de</strong>r Schreibentwicklung,erscheint in <strong>de</strong>r Reihe FörMig Material.Zur Beobachtung und Beschreibung von Kompetenzund Kompetenzzuwachs im Deutschen als Zweitsprachewur<strong><strong>de</strong>n</strong> ebenfalls im Rahmen von FörMigdie „Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache“in Kooperation von FörMig Sachsen undFörMig Schleswig-Holstein entwickelt:Sächsisches Bildungsinstitut (Hrsg.) (2009): NiveaubeschreibungenDeutsch als Zweitsprache <strong>für</strong> dieSekundarstufe I. Zur Beobachtung von Kompetenzund Kompetenzzuwachs im Deutschen als Zweitsprache.Transferfassung 2009. – Ra<strong>de</strong>beul. http://www.sachsen-macht-schule.<strong>de</strong>/sbi/10111.htmInstitut <strong>für</strong> Qualitätsentwicklung an Schulen (Hrsg.)(2009): Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache<strong>für</strong> die Sekundarstufe I. Zur Beobachtungvon Kompetenz und Kompetenzzuwachs im Deutschenals Zweitsprache. Erprobungsfassung 2009.– Kiel. http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/all/lpr/schleswig_holstein/kurz/in<strong>de</strong>x.htmlAufgabenstellungen/OperatorenKonkretisierungDie Lehrkräfte vermitteln und üben die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>reinzelnen Operatoren sach- und kontextbezogen.Die Lehrkräfte verwen<strong><strong>de</strong>n</strong> in Aufgabenstellungen dieOperatoren ein<strong>de</strong>utig.BeispieleDie Schülerinnen und Schüler reformulieren Aufgabenstellungenin<strong>de</strong>r Allgemeinsprache (Fokus:kognitives Erfassen <strong>de</strong>r erwarteten Handlung).Die Lehrkräfte führen zur sprachlichen Präzisierung.Die Lehrkräfte bieten Aufgabenstellungen auch immerschriftlich an.Tipps, Literatur & LinksListen mit sog. Operatoren fin<strong><strong>de</strong>n</strong> sich z. B. unter:http://www.sachsen-macht-schule.<strong>de</strong>/schule/Z6572.htmZentralabitur NRW:http://www.standardsicherung.nrw.<strong>de</strong>/abiturgost/fach.php?fach=1(je nach Bun<strong>de</strong>sland durchaus unterschiedlicheDefinitionen)Systematische WortschatzarbeitKonkretisierungWortfeldarbeit ist ein fester Bestandteil <strong>de</strong>s Unterrichts:Die Lehrkräfte entwickeln <strong><strong>de</strong>n</strong> Wortschatz<strong>de</strong>r Schülerinnen und Schülern systematisch (einmaligesEinführen genügt nicht, son<strong>de</strong>rn LernenimSpiralcurriculum).Die Lehrkräfte nutzen vielfältige Metho<strong><strong>de</strong>n</strong> <strong>de</strong>r Wortschatzarbeit.Die Lehrkräfte bieten <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülerneinen reichhaltigen Wortschatz und Sprachstrukturenan. Sie verbin<strong><strong>de</strong>n</strong> dies jeweils mit Einordnungsmöglichkeiten,die <strong><strong>de</strong>n</strong> Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong> helfen zuerkennen, in welchem Kontext Wörter und spezifischeSprachstrukturen angemessen sind.Die Lehrkräfte betten Wortschatzübungen in thematischeZusammenhänge ein und sorgen <strong>für</strong> einekontextbezogene Wortschatzarbeit.Die Lehrkräfte stellen <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und SchülernHilfsmittel auch in <strong><strong>de</strong>n</strong> Herkunftssprachen zurselbstständigen Erweiterung ihres Wortschatzes zurVerfügung.Die Lehrkräfte räumen <strong><strong>de</strong>n</strong> „Formwörtern“ (auch:„Strukturwörter“ o<strong>de</strong>r Partikel) im Unterricht einenerheblichen Stellenwert ein.Die Lehrkräfte sichern neuen Wortschatz und neueFachbegriffe grundsätzlich schriftlich ab.BeispieleDie Lehrkräfte stellen <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und SchülernZeit und ein- und mehrsprachige Hilfsmittel (wieNachschlagewerke/Glossare) zur Verfügung, umdie Be<strong>de</strong>utung von Begriffen zu klären.Die Lehrkräfte sorgen da<strong>für</strong>, dass <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnenund Schülern DaZ- und Nachschlagehandapparatein allen Unterrichtsräumen zur Verfügung stehen.Die Lehrkräfte visualisieren <strong><strong>de</strong>n</strong> Fachwortschatz(z. B. Lernplakate, Illustrationen, Skizzen, Gesten,Realia, Glossar).Die Lehrkräfte geben Äußerungen von Schülerinnenund Schülern viel Raum, greifen diese auf und nutzendiese zur Einführung <strong>de</strong>r Fachbegriffe.Die Lehrkräfte geben Nomen mit Artikel/Plural undVerben mit Infinitiv sowie konjugierten Formen in unterschiedlichenTempusformen an (z. B. durch Tafelanschrieb,auf Arbeitsblättern, im Glossar).12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q613
Qualitätsmerkmal 3Tipps, Literatur & LinksNodari, Claudio / Steinmann, Cornelia (2008): Fachdingsda.Fächerorientierter Grundwortschatz <strong>für</strong>das 5.-9. Schuljahr, Kanton Aargau: Lehrmittelverlag<strong>de</strong>s Kantons AargauStädtische Gesamtschule Duisburg-Mei<strong>de</strong>rich:Fachbereich Technik, Wörterliste <strong>für</strong> die Jahrgangsstufe5/6. In: Hawighorst, Britta: DurchgängigeSprachbildung in <strong>de</strong>r Gesamtschule Mei<strong>de</strong>rich – EinPorträt, vgl. http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/all/mo<strong>de</strong>ll/in<strong>de</strong>x.htmlOppolzer, Ursula (2006): Wortschatztraining vonA-Z, Buxtehu<strong>de</strong>: PersenLascho, Birgit (2009): Training Wortschatz – Aufsatz –Grammatik. 7. und 8. Klasse. Materialien <strong>für</strong> einenintegrativen Sprach<strong>unterricht</strong>, Buxtehu<strong>de</strong>: PersenSelimi, Naxhi (2010): Wortschatzarbeit konkret,Hohengehren: Schnei<strong>de</strong>rSprachrezeption - Hören:LehrerspracheKonkretisierungDie Lehrkräfte sind sprachliche Vorbil<strong>de</strong>r.Die Lehrkräfte setzen ihre Sprache bewusst einund achten auf angemessene Sprechweise und -geschwindigkeit.BeispieleDie Lehrkräfte bieten <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülernunterschiedliche Formulierungen an, wenn dasVerständnis durch die Sprache beeinträchtigt ist.Sprachrezeption - LesenKonkretisierungDie Lehrkräfte üben mit <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülernsystematisch wichtige Lesefertigkeiten ein.Die Lehrkräfte vermitteln <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen undSchülern Lesestrategien, die es ihnen ermöglichen,selbstständig Texte zu erschließen.BeispieleDie Lehrkräfte aktivieren das Vorwissen <strong>de</strong>r Schülerinnenund Schüler und stellen darüber Bezügezum Text her.Die Lehrkräfte stellen mit <strong>de</strong>m neu zu Erlernen<strong><strong>de</strong>n</strong>einen Kontext her.Die Lehrkräfte teilen <strong><strong>de</strong>n</strong> Text in Abschnitte undHauptaussagen/Schlüsselwörter und lassen dieSchülerinnen und Schüler diese pro Abschnittfin<strong><strong>de</strong>n</strong>/aushan<strong>de</strong>ln.Tipps, Literatur & LinksLesestrategien sind z. B. Die „Fünf-Schritt-Lesemetho<strong>de</strong>“:Deutschbuch, Arbeitsheft 5, Cornelsen2006, S.86 o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r „Textknacker“. In: Doppel-Klick, Sprach- und Lesebuch, Klasse 5-10, NRW,Cornelsen, 2009: S.218-221, vgl. http://www.cornelsen-eltern.<strong>de</strong>/sixcms/media.php/386/<strong><strong>de</strong>n</strong>_textknacker_wie<strong>de</strong>rholen_S178_179.pdfRosebrock, Cornelia / Nix, Daniel (2006): Grundlagen<strong>de</strong>r Lesedidaktik und <strong>de</strong>r systematischen schulischenLeseför<strong>de</strong>rung, Hohengehren: Schnei<strong>de</strong>rApollonia-von-Wie<strong>de</strong>bach Schule Leipzig: Leitfa<strong><strong>de</strong>n</strong>Sachtext/Leitfa<strong><strong>de</strong>n</strong> Vortrag:http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/handicap/lpr/sachsen/kurz/in<strong>de</strong>x.htmlSchiesser, Daniel / Nodari, Claudio (2007): För<strong>de</strong>rung<strong>de</strong>s Leseverstehens in <strong>de</strong>r Berufsschule, Bern:hep VerlagSträuli Arslan, Barbara (Hrsg.) (2005): Leseknick –Lesekick. Leseför<strong>de</strong>rung in vielsprachigen Schulen,Zürich: Lehrmittelverlag <strong>de</strong>s Kantons ZürichBertschi - Kaufmann, Andrea / Hagendorf Hammouche,Petra / Kruse, Gerd / Rank, Katharina /Riss, Maria / Sommer, Thomas (2007): Lesen. DasTraining, Donauwörth: Lernbuch Verlag bei FriedrichBertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.) (2007): Lesekompetenz– Leseleistung – Leseför<strong>de</strong>rung. GrundlagenMo<strong>de</strong>lle und Materialien, Donauwörth: FriedrichStudienseminar Koblenz (Hrsg.) (2009): Sachtextelesen im Fach<strong>unterricht</strong> <strong>de</strong>r Sekundarstufe, Seelze-Velber: KallmeyerGailberger, Steffen (2008): Leseför<strong>de</strong>rung durchHörbücher – eine verbal-auditive Leseför<strong>de</strong>rungstheorie<strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong> Deutsch<strong>unterricht</strong>. In: Lecke, Bodo(Hrsg.): Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik,Frankfurt/M: Peter LangSchoenbach, Ruth / Cziko, Christine / Greenleaf,Cynthia / Hurwitz, Lori (2006): Lesen macht schlau,Berlin: CornelsenSprachproduktion(mündlich und schriftlich)KonkretisierungDie Lehrkräfte geben Formulierungshilfen.Die Lehrkräfte unterstützen die Sprachproduktiondurch Visualisierungen (Schrift, Schaubil<strong>de</strong>r, Grafiken).Die Lehrkräfte unterstützen die Schülerinnen undSchüler durch Leitfä<strong><strong>de</strong>n</strong> zur Gestaltung von Textenund mündlichen Beiträgen.Die Lehrkräfte för<strong>de</strong>rn die Textsortenkompetenz <strong>de</strong>rSchülerinnen und Schüler und üben mit ihnen diejeweiligen fachspezifischen Textsorten ein.Die Lehrkräfte vermitteln die Fähigkeit, graphischeDarstellungen zu verbalisieren.BeispieleDie Lehrkräfte geben Satzanfänge, Satzmuster,standardisierte Sätze, Aufgabenanfänge, zusätzlichesWortmaterial, Mustertexte (z. B. als Tafelanschrieb)vor.Die Schülerinnen und Schüler übernehmen <strong>für</strong> AntwortenSchlüsselwörter aus Aufgaben- o<strong>de</strong>r Fragestellungen.Die Lehrkräfte stellen Mo<strong>de</strong>lltexte zur Verfügung, diedie Schülerinnen und Schüler abwan<strong>de</strong>ln können(z. B. generatives Schreiben).Tipps, Literatur & LinksApollonia-von-Wie<strong>de</strong>bach Schule Leipzig: Leitfa<strong><strong>de</strong>n</strong>Sachtext/Leitfa<strong><strong>de</strong>n</strong> Vortrag:http://www.blk-foermig.uni-hamburg.<strong>de</strong>/web/<strong>de</strong>/handicap/lpr/sachsen/kurz/in<strong>de</strong>x.htmlLeisen, Josef (1999): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>-Handbuch DFU,Bonn: Varus-VerlagSvantson, Ingemar (1995): Mindmapping und Gedächtnistraining,Offenbach: GABALSprechen: UnterrichtsgesprächKonkretisierungDie Lehrkräfte unterstützen das Sprechen <strong>de</strong>r Schülerinnenund Schüler durch Ermutigungen, durchUmformulierungen und Nachfragen (Micro-Scaffolding).Die Lehrkräfte geben Äußerungen von Schülerinnenund Schülern viel Raum, greifen diese auf und nutzendiese <strong>für</strong> <strong><strong>de</strong>n</strong> weiteren Unterricht.Die Lehrkräfte geben Gelegenheit zur Selbstkorrekturund zu konstruktivem Korrekturverhalten.BeispieleViele anschauliche Vorbil<strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>t man unter <strong>de</strong>mStichwort „Dialogisches Lernen“.Fachbegriffe wer<strong><strong>de</strong>n</strong> im Unterrichtsgespräch eingebun<strong><strong>de</strong>n</strong>.SchreibenKonkretisierungDie Lehrkräfte üben mit <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülernsystematisch wichtige Schreibfertigkeiten ein.Die Lehrkräfte schaffen Transparenz über <strong><strong>de</strong>n</strong>Schreibprozess und bieten Hilfestellungen und zielführen<strong>de</strong>Strategien <strong>für</strong> die einzelnen Schritte <strong>de</strong>sSchreibprozesses.Die Lernkräfte stellen Aufgaben, die zum produktivenSchreiben herausfor<strong>de</strong>rn.14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q615
Qualitätsmerkmal 3BeispieleDie Lehrkräfte stellen Mo<strong>de</strong>lltexte und Lösungenals Orientierungshilfe zur Verfügung (z. B. Leitfä<strong><strong>de</strong>n</strong>:Was? Warum? Wie? Wann? Mit welchem Ziel?)o<strong>de</strong>r <strong>für</strong> Textsortenwechsel, Perspektivwechsel undAdressatenwechsel.Qualitätsmerkmal 4Die Schülerinnen und Schüler erhalten vieleGelegenheiten, ihre allgemein- und bildungssprachlichenFähigkeiten zu erwerben, aktiveinzusetzen und zu entwickeln.Tipps, Literatur & LinksKniffka, Gabriele/Siebert-Ott, Gesa (2007): Deutschals Zweitsprache. Lehren und Lernen, Pa<strong>de</strong>rborn:SchöninghRuf, Urs / Keller, Stefan / Winter, Felix (Hrsg.) (2008):Besser lernen im Dialog, Seelze-Velber: KallmeyerRuf, Urs / Gallin, Peter (2005): Dialogisches Lernenin Sprache und Mathematik, Band 1: Austausch unterUngleichen, Seelze-Velber: KallmeyerRuf, Urs / Gallin, Peter (2005): Dialogisches Lernenin Sprache und Mathematik, Band 2: Spuren legen– Spuren lesen, Seelze-Velber: KallmeyerErziehungs<strong>de</strong>partement <strong>de</strong>s Kantons Basel-Stadt(Hrsg.) (2006): Sprachprofile <strong>für</strong> die VolksschuleBasel-Stadt. Ein Konzept zur Sprachför<strong>de</strong>rung inallen Fächern, Basel: Lehrmittelverlag <strong>de</strong>s KantonsBasel-StadtKonkretisierungDie Lehrkräfte schaffen ein Unterrichtsklima, in <strong>de</strong>msich die Schülerinnen und Schüler als fähige Sprachlernen<strong>de</strong>,als kompetent im Sprechen, Hören, Schreibenund Lesen erfahren können.Die Herkunftssprachen erhalten ihren selbstverständlichenRaum im Unterrichtsgeschehen – sie wer<strong><strong>de</strong>n</strong>nicht tabuisiert.Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheitund wer<strong><strong>de</strong>n</strong> ermuntert, ihre herkunftssprachlichenKenntnisse einzusetzen, um sprachenvergleichen<strong>de</strong>Übungen und Reflexionen durchzuführen.BeispieleEs wer<strong><strong>de</strong>n</strong> explizite Vereinbarungen zwischen Lehrkräftenund Schülerinnen und Schülern darüber hergestellt,wann es um das Deutsche geht und wannum Mehrsprachigkeit – z. B. kann in bestimmten Unterrichtsphasen,etwa in Gruppen- o<strong>de</strong>r Partnerarbeit,auf Herkunftssprachen zurückgegriffen wer<strong><strong>de</strong>n</strong>.Bei <strong>de</strong>r Einbeziehung von Mehrsprachigkeit wird mitExpertinnen und Experten zusammengearbeitet –z. B. mit <strong><strong>de</strong>n</strong> Eltern, Migrantenvereinen, Hochschuleno<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Partnern vor Ort.Tipps, Literatur & LinksViele Anregungen zum Einbezug <strong>de</strong>r Herkunftssprachenfin<strong><strong>de</strong>n</strong> sich bei Scha<strong>de</strong>r, Basil (2000): Sprachenvielfaltals Chance, Zürich: Orell FüssliMächler, Stefan (Hrsg.) (2001): Schulerfolg: keinZufall. Ein I<strong>de</strong>enbuch zur Schulentwicklung im multikulturellenUmfeld, Zürich: Lehrmittelverlag <strong>de</strong>sKantons ZürichHörenKonkretisierungDie Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit,sich über das, was sie hörend verstehen sollen, auszutauschen.Dabei nutzen sie, soweit möglich, auchihre herkunftssprachlichen Kenntnisse.Die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche (sozialen)Wirkungen die Betonung, Melodie etc. einerÄußerung hat.Die Schülerinnen und Schüler üben Strategien ein,die ihnen helfen, Schwierigkeiten <strong>de</strong>s Hörverstehenszu überwin<strong><strong>de</strong>n</strong>.BeispieleSprachenvergleichen<strong>de</strong> Hörübungen, wie z. B.:Schülerinnen und Schüler sprechen etwas in ihrerHerkunftssprache – alle an<strong>de</strong>ren sollen versuchen,dies zu schreiben; Vergleich von Satzmelodien in verschie<strong><strong>de</strong>n</strong>enSprachen: Woran hört man, dass etwasGesagtes eine Frage ist, ein zorniger Ausruf ist, einSchimpfwort, ein freundlicher Willkommensgruß …?SprechenKonkretisierungDie Lehrkräfte stellen Aufgaben, die komplexemündliche Schüleräußerungen ermöglichen.Der Sprechanteil <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler isthoch.Die Schülerinnen und Schüler haben Zeit, ihreBeiträge bewusst zu konstruieren.Die Schülerinnen und Schüler han<strong>de</strong>ln Be<strong>de</strong>utungenvon Lerninhalten aus – auch in ihren Herkunftssprachen.Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q616 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q617
Qualitätsmerkmal 4Die Schülerinnen und Schüler erfahren die (sozialen)Wirkungen, die etwas Gesagtes haben kann –abhängig davon, wie es betont wird und in welcherMelodie es gesprochen wird.BeispieleBereitstellen vielfältiger Texte (z.B. Sachtexte, literarischeTexte, Texte aus Zeitungen o<strong>de</strong>r Zeitschriften,mehrsprachige Texte)Qualitätsmerkmal 5Die Lehrkräfte unterstützen Schülerinnenund Schüler in ihren individuellen Sprachbildungsprozessen.BeispieleSprechintensive Metho<strong><strong>de</strong>n</strong> wie Murmelgruppeno<strong>de</strong>r kooperative Lernformen wer<strong><strong>de</strong>n</strong> eingesetzt.In Arbeitsgruppen dürfen die Schülerinnen undSchüler ihre stärkste Sprache benutzen.Die Schülerinnen und Schüler formulieren abgeschlosseneGedankengänge in offenen Aufgabenstellungen,in allen Phasen <strong>de</strong>s KooperativenLernen, bei Präsentationen.Festgelegte ‚Lesestun<strong><strong>de</strong>n</strong>’ im Stun<strong><strong>de</strong>n</strong>planLesewochenLesewettbewerbeLesetagebücherSchulisches LesekonzeptSchreibenKonkretisierungDie Lehrkräfte formulieren differenzierte Aufgabenstellungen<strong>für</strong> Schülerinnen und Schüler mitunterschiedlichen Sprachkompetenzen.Die Lehrkräfte stellen bei gleicher Aufgabenstellungunterschiedliche Hilfen zur Verfügung.Die Lehrkräfte stellen ein „Überangebot“ an sprachlichenMitteln bereit, aus <strong><strong>de</strong>n</strong>en die Schülerinnenund Schüler auswählen können.Tipps, Literatur & LinksUnter <strong>de</strong>m Suchbegriff „Graphic Organizer“ fin<strong><strong>de</strong>n</strong>sich im Internet zahlreiche grafische Vorlagen,mit <strong><strong>de</strong>n</strong>en Schülerinnen und Schüler ihre Gedankenstrukturiert festhalten können.Leisen, Josef (1999): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>-Handbuch DFU,Bonn: VarusRuf, Urs / Keller, Stefan / Winter, Felix (Hrsg.) (2008):Besser lernen im Dialog, Seelze-Velber: KallmeyerNach einer Frage <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler gibtdie Lehrkraft Zeit <strong>für</strong> Antworten (ein Tipp ist es, langsambis 20 zu zählen).LesenKonkretisierungDie Lehrkräfte för<strong>de</strong>rn gezielt die Lesemotivation <strong>de</strong>rSchülerinnen und Schüler.Leseaktivitäten <strong>de</strong>r Schülerinnen und Schüler sindfester Bestandteil <strong>de</strong>s Unterrichts.Die Lehrkräfte ermöglichen <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen undSchülern, Lesestrategien zu aktivieren, zu üben undanzuwen<strong><strong>de</strong>n</strong>.Die Lehrkräfte erhöhen systematisch die Lesemengevon literarischen und fachlichen Texten.Die Schülerinnen und Schüler nutzen, soweit möglich,auch ihre herkunftssprachlichen Kenntnisse <strong>für</strong>das Lesen, z. B. zur Aktivierung <strong>de</strong>s Vorwissens.KonkretisierungDie Lehrkräfte treffen mit <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülerndie Vereinbarung, in je<strong>de</strong>r Unterrichtsstun<strong>de</strong> etwaszu schreiben.Die Schülerinnen und Schüler haben Gelegenheit,Texte zu planen, über schriftliche Formulierungennachzu<strong><strong>de</strong>n</strong>ken und ihre Texte zu überarbeiten.Die Schülerinnen und Schüler schreiben zu vielen unterschiedlichenAnlässen. Sie haben vielfältige Gelegenheiten,unterschiedliche Textsorten zu erproben.Die Schülerinnen und Schüler nutzen, soweit möglich,auch ihre herkunftssprachlichen Kenntnisse <strong>für</strong>die Textproduktion.BeispieleSchülerinnen und Schüler formulieren Regeln <strong>für</strong>Grammatik sowie <strong>für</strong> das Erarbeiten und Verfassenvon Texten mit ihren eigenen Worten.SchreibkonferenzenDie Lehrkräfte stellen abgestufte sprachliche Lernhilfen<strong>für</strong> das Textverständnis und die Textproduktionzur Verfügung.Die Lehrkräfte richten <strong><strong>de</strong>n</strong> Unterricht <strong>für</strong> Seiteneinsteigerfrühzeitig auf <strong><strong>de</strong>n</strong> Erwerb fach- und bildungssprachlicherKompetenzen aus.Beispiele‚freie’ Aufgabenstellungen, vorgegebene Formulierungen,Reformulierungsaufgaben, Einsatz differenzierterArbeitsmaterialienSchülerinnen und Schüler können aus <strong>de</strong>m „Überangebot“an sprachlichen Mitteln begrün<strong>de</strong>t auswählen(Wortlisten, Überschriften als Textglie<strong>de</strong>rung, Fragenzum Textverständnis, Schlüsselbegriffe markieren,Hinweise auf Bildmaterial und Grafiken).Vergleichen<strong>de</strong> Sprachbetrachtungen wer<strong><strong>de</strong>n</strong> alsVerstehenshilfen <strong>für</strong> einzelne Schülerinnen undSchüler genutzt.Formulierungshilfen (Satzanfänge, Textbausteine,Mo<strong>de</strong>lltexte und Lösungen als Orientierungshilfen)Gibbons, Pauline (2006): Unterrichtsgespräche unddas Erlernen neuer Register in <strong>de</strong>r Zweitsprache. In:Mecheril, Paul / Quehl, Thomas (Hrsg.): Die Macht<strong>de</strong>r Sprachen. Englische Perspektiven auf die mehrsprachigeSchule, Münster: Waxmann, S. 262-290Roth, Hans-Joachim (2007): Scaffolding – ein Ansatzzur aufbauen<strong><strong>de</strong>n</strong> Sprachför<strong>de</strong>rung. In: KompetenzzentrumSprachför<strong>de</strong>rung Köln: NewsletterFebruar (2007), S. 33-35, vgl.http://www.kompetenzzentrum-sprachfoer<strong>de</strong>rung.<strong>de</strong>Kniffka, Gabriele / Neuer, Birgit (2008): „Wo geht‘shier nach Aldi?“ Fachsprachen lernen im kulturellheterogenen Klassenzimmer. In: Budke, Alexandra(Hrsg.): Interkulturelles Lernen im Geographie<strong>unterricht</strong>,Potsdam: Universitätsverlag, S. 121-135Quehl, Thomas / Scheffler, Ute (2008): Möglichkeitenfortlaufen<strong>de</strong>r Sprachför<strong>de</strong>rung im Sach<strong>unterricht</strong>.In: Bainski, Christiane / Krüger-Potratz, Marianne(Hrsg.): Handbuch Sprachför<strong>de</strong>rung, Essen: NeueDeutsche Schule Verlagsgesellschaft, S. 66 -7918 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q619
Qualitätsmerkmal 6Die Lehrkräfte und die Schülerinnen undSchüler überprüfen und bewerten dieErgebnisse <strong>de</strong>r sprachlichen Bildung.LehrkräfteKonkretisierungLehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler entwickelngemeinsam eine konstruktive Haltung gegenüber<strong>de</strong>m Fehler. Lehrkräfte erkennen Fehlerals Meilensteine auf <strong>de</strong>m Weg <strong>de</strong>r Entwicklung. Siegeben <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülern inhaltlich reiche,nachvollziehbare und <strong>für</strong> das weitere Lernenför<strong>de</strong>rliche Rückmeldungen.Die Lehrkräfte erfassen und bewerten (schrift-)sprachliche Leistungen kriterienorientiert.Auch das Korrekturverhalten <strong>de</strong>r Lehrkräfte ist kriterienorientiertsowie aufbauend und konstruktiv.Schülerinnen und Schülern wer<strong><strong>de</strong>n</strong> die Fortschritteim Aufbau (bildungs-)sprachlicher Kompetenzenbewusst gemacht.Die Lehrkräfte geben ihren Schülerinnen und SchülernHilfen und Instrumente an die Hand, mit <strong><strong>de</strong>n</strong>endiese auch selbst zur Einschätzung ihrer sprachlichenFähigkeiten und Fortschritte in <strong>de</strong>r Lage sind.BeispieleDie Schülerinnen und Schüler führen Portfolios <strong>für</strong>die Selbstevaluation von Sprachfähigkeiten.Kompetenzorientiertes KorrekturverhaltenKorrekturschleifen wer<strong><strong>de</strong>n</strong> in <strong><strong>de</strong>n</strong> Unterricht eingebaut.Den Schülerinnen und Schülern Anleitungen zurKorrektur von Schüleräußerungen und -präsentationengeben.Tipps, Literatur & LinksHilfreiche praktische Hinweise <strong>für</strong> die Formulierungkonstruktiver Rückmeldungen enthalten die Schriftenzum dialogischen Lernen (z. B. Ruf, Urs / Keller, Stefan/ Winter, Felix (Hrsg.) (2008): Besser lernen imDialog, Seelze-Velber: Kallmeyer).Winter, Felix / Schwarz, Johanna / Volkwein, Karin(2008): Unterricht mit Portfolio. Überlegungen zurDidaktik <strong>de</strong>r Portfolioarbeit. In: Schwarz, Johanna /Volkwein, Karin / Winter, Felix (Hrsg.): Portfolio imUnterricht. 13 Unterrichtseinheiten mit <strong>de</strong>m Portfolio,Seelze-Velber: Kallmeyer, S. 21-56Schülerinnen und SchülerKonkretisierungSchülerinnen und Schüler wer<strong><strong>de</strong>n</strong> ermutigt, auf dierichtige und angemessene sprachliche Form zuachten und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler inunterstützen<strong>de</strong>r Weise zu korrigieren.Schülerinnen und Schüler haben Gelegenheit zurSelbstkorrektur und zum Austausch untereinan<strong>de</strong>r.BeispieleNutzung von PortfoliosFör<strong>de</strong>rliche Tipps und Ratschläge nach mündlichenPräsentationen geben (z. B. „Bühnensprache verwen<strong><strong>de</strong>n</strong>“)GlossarBil<strong>de</strong>rgeschichte/BildsequenzBil<strong>de</strong>rgeschichten kombinieren Wort- und Textmaterial.Mit Hilfe von Bil<strong>de</strong>rgeschichten können zeitlicheAbläufe ver<strong>de</strong>utlicht wer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Bil<strong>de</strong>rgeschichten könnenvon <strong><strong>de</strong>n</strong> Lehrkräften vorbereitet wer<strong><strong>de</strong>n</strong> o<strong>de</strong>rdie Schülerinnen und Schüler visualisieren selberInhalte, um sich Inhalte zu erschließen.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.Didaktisierte LeseaufträgeLehrkräfte können zu Lesetexten Aufträge entwickeln,die <strong><strong>de</strong>n</strong> Kin<strong>de</strong>rn und Jugendlichen beim Lesenund Verstehen helfen – sie „didaktisieren“ Lesetexte.Gute Aufträge führen die Lesen<strong><strong>de</strong>n</strong> in <strong><strong>de</strong>n</strong> Texthinein und begleiten sie beim Lesen. Durch die regelmäßigeArbeit mit solchen didaktisierten Lesetextenkönnen Kin<strong>de</strong>r und Jugendliche ihre Lesekompetenzerweitern. Sie trainieren verschie<strong><strong>de</strong>n</strong>e Lesestile un<strong><strong>de</strong>n</strong>twickeln Lesestrategien, die sie selbstständig undschließlich auch ohne Anleitung einsetzen.Zum Weiterlesen: Neugebauer, C. (2005): Grundlagen:Didaktisierte Texte – Was ist das? In: SträuliArslan, B. (Hrsg.): Leseknick – Lesekick. Leseför<strong>de</strong>rungin vielsprachigen Schulen. Zürich: Lehrmittelverlag<strong>de</strong>s Kantons Zürich.FilmleisteMit Hilfe einer Filmleiste wer<strong><strong>de</strong>n</strong> zeitliche Abläufein einer Bil<strong>de</strong>rsequenz veranschaulicht, z. B. einVersuchsablauf. Eine Filmleiste kann Schülerinnenund Schüler dabei unterstützen, die zeitliche undlogische Reihenfolge beim Schreiben eines Texteszu sichern. Filmleisten können durch Wortlistenergänzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.Formwörter/Strukturwörter/PartikelIm Deutschen gibt es zahlreiche „kleine Wörter“(Formwörter, Strukturwörter, Partikel), die unflektierbarsind (vgl. Buscha, J. / Helbig, G. (2001): DeutscheGrammatik. München: Langenscheidt, S. 419).Diese Wörter haben oft eine entschei<strong><strong>de</strong>n</strong><strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung,um <strong><strong>de</strong>n</strong> Sinn eines Satzes zu erschließen.In <strong>de</strong>r Bildungssprache sind sie beson<strong>de</strong>rs wichtig.Beispiel: „Im Salzbergwerk Bad Friedrichshall wirdSteinsalz abgebaut. Das Salz lagert 40 m unterMeereshöhe, während Bad Friedrichshall 155 müber Meereshöhe liegt. Welche Strecke legt <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rkorbzurück?“ Der Schlüssel <strong>für</strong> die mathematischeVerbindung <strong>de</strong>r bei<strong><strong>de</strong>n</strong> Zahlen ist das Wort„während“.Glossar/FachglossarGlossare sind Listen von Wörtern und Erklärungen.Sie können z. B. im Fach<strong>unterricht</strong> eingesetzt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>.Dann enthalten sie <strong>für</strong> das Fach relevante Wörter undWortwendungen. Glossare können von Lehrkräftenzusammengestellt und gemeinsam im Unterricht erweitertwer<strong><strong>de</strong>n</strong> o<strong>de</strong>r von <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülerindividuell angelegt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Wichtig ist, dass nichtnur Fachbegriffe und ihre Übersetzung aufgenommenwer<strong><strong>de</strong>n</strong> (= Wörterbuch), son<strong>de</strong>rn diese auch intypische Satzkonstruktionen eingebettet sind. Glossarestehen <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülern im Unterrichtund zu Hause zur Verfügung.Graphic organizer„Graphic organizer“ sind grafische Strukturierungshilfen.Sie helfen <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülern ihreGedanken strukturiert zu sammeln, festzuhalten undsind Grundlage <strong>für</strong> Gespräche, Texte und Präsentationen.Siehe auch „I<strong>de</strong>ennetze“.Zahlreiche Druckvorlagen im Internet, z. B.: ed-Helper.com (o.J.): Graphic organizers. http://www.edhelper.com/teachers/graphic_organizers.htmI<strong>de</strong>ennetzAuch: Cluster, Begriffsnetz o<strong>de</strong>r Mind-Map. I<strong>de</strong>enwer<strong><strong>de</strong>n</strong> aufgeschrieben und die gedanklichen Verbindungendurch Linien o<strong>de</strong>r Pfeile dargestellt. I<strong>de</strong>ennetzegehören zu <strong><strong>de</strong>n</strong> nicht-linearen Brainstormingmetho<strong><strong>de</strong>n</strong>.Je nach Ziel können I<strong>de</strong>ennetzeauch schon Hierarchisierungsebenen enthalten(Mind-Map). Sie auch „Graphic organizer“.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q621
GlossarKompetenzorientiertesKorrekturverhaltenEin Korrekturverhalten, das auf „falsche“ Äußerungenmit modifizierter Wie<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>s Gesagten reagiert.Der Inhalt wird grammatisch richtig wie<strong>de</strong>rholt.Dieses Vorgehen wird auch als „motherese“ („mutterischesKorrigieren“) bezeichnet, da es sich an <strong>de</strong>mnatürlichen Spracherwerb orientiert.KonditionalsätzeBedingungssätze, in <strong><strong>de</strong>n</strong>en wenn-dann-Beziehungenformuliert wer<strong><strong>de</strong>n</strong>. In <strong>de</strong>r Fachsprachegehen Konditionalsätze häufig in Nominalisierungenauf und sind dann nicht mehr über Wörter wie„wenn“, „falls“, „sofern“ und „dann“ erkennbar.Beispiel: In <strong>de</strong>m Satz „Nach Abgießen <strong>de</strong>r Flüssigkeitwird ein Bo<strong><strong>de</strong>n</strong>satz sichtbar“ steckt <strong>de</strong>r Konditionalsatz„Wenn man die Flüssigkeit abgießt, dannsieht man einen Bo<strong><strong>de</strong>n</strong>satz“.Kooperative LernformenHier sind alle Formen <strong>de</strong>s Lernens gemeint, die eineplanmäßige und reflektieren<strong>de</strong> Zusammenarbeit inGruppen unterstützen, z. B. Platz<strong>de</strong>ckchen-Metho<strong>de</strong>.Siehe auch: Kooperatives Lernen.Kooperatives LernenBeim Kooperativen Lernen unterstützen sich Schülerinnenund Schüler gegenseitig bei <strong>de</strong>r Arbeitund gelangen gemeinsam zu Ergebnissen. Diesgeschieht in Partner- o<strong>de</strong>r Gruppenarbeit. Mit zahlreichenMetho<strong><strong>de</strong>n</strong> wird ein hohes Aktivierungsniveau<strong>de</strong>r Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong> erreicht mit nachhaltigen Erfolgen imkognitiven Bereich. Problemlöse- und Sozialkompetenzwer<strong><strong>de</strong>n</strong> gleichermaßen aufgebaut und führenhäufig zu einem positiveren Selbstbild <strong>de</strong>r Lernen<strong><strong>de</strong>n</strong>.Grundvoraussetzung <strong>für</strong> die erfolgreicheArbeit in Gruppen ist das Schaffen eines för<strong>de</strong>rlichensozialen Klimas mit positiven Abhängigkeiten unter<strong><strong>de</strong>n</strong> Gruppenmitglie<strong>de</strong>rn. Das Grundprinzip <strong>de</strong>sKooperativen Lernens ist „Denken – Austauschen –Vorstellen“ („Think – Pair – Share“).Zum Weiterlesen:Brüning, L. / Saum, T.: (2008): Erfolgreich Unterrichtendurch Kooperatives Lernen. Essen: NeueDeutsche Schule Verlagsgesellschaft.Kooperatives Lernen. Fremdsprache Deutsch, Heft41/2009.Ministerium <strong>für</strong> Schule und Weiterbildung <strong>de</strong>sLan<strong>de</strong>s Nordrhein-Westfalen (o.J.): KooperativesLernen. Grundlagen. http://www.learn-line.nrw.<strong>de</strong>/angebote/greenline/lernen/grund/gruen<strong>de</strong>.htmlKorrekturschleifenSchülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit,ihre Texte mehrfach zu überarbeiten. Hier bietensich Korrekturschleifen an, die jeweils auf eineÜberarbeitungsebene abzielen, z. B. erst auf <strong>de</strong>r inhaltlichenEbene (Kohärenz und Struktur), dann auf<strong>de</strong>r syntaktischen und grammatischen Ebene undschließlich auf <strong>de</strong>r Ebene Rechtschreibung und Zeichensetzung.LernplakateDas Lernplakat ist eine überwiegend bildliche Darstellungvon Lerninhalten und kann z. B. zur Verarbeitungo<strong>de</strong>r Darstellung von Informationen verwen<strong>de</strong>twer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Lernplakate können von Lehrkräftenerstellt wer<strong><strong>de</strong>n</strong> (Sprachhilfen, Beispielsätze, fachsprachlicheBegriffe) o<strong>de</strong>r von <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnenund Schülern. Bei <strong>de</strong>r Erstellung müssen die Kin<strong>de</strong>rund Jugendlichen <strong><strong>de</strong>n</strong> Inhalt vielfach diskutieren undsich über die darzustellen<strong><strong>de</strong>n</strong> Aussagen sowie Darstellungs-und Gestaltungsmerkmale einigen.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.LesefertigkeitenLesen ist ein Prozess, <strong>de</strong>r sich aus verschie<strong><strong>de</strong>n</strong>enSchritten und Handlungen zusammensetzt. Lesefertigkeitenwer<strong><strong>de</strong>n</strong> im Verlauf <strong>de</strong>r Bildungsbiografieauf- und ausgebaut.LesestrategienLesestrategien sind eine Folge zweckgerichteterHandlungen zum Erreichen eines bestimmten (Lese-)Ziels. Die strategische Kompetenz umfasst <strong>de</strong>mzufolgedie Fähigkeit, Handlungen zum Erreichen einesbestimmten Leseziels auszuwählen und bewusstanzuwen<strong><strong>de</strong>n</strong>, z. B. vor <strong>de</strong>m Lesen: Vorwissen aktivieren,Textart bestimmen, Kontext herstellen; während<strong>de</strong>s Lesens: Text in Sinnabschnitte einteilen,Verstan<strong><strong>de</strong>n</strong>es markieren; nach <strong>de</strong>m Lesen: Kernaussagenformulieren, Inhalt zusammenfassen, Textbeurteilen.Zum Weiterlesen: Ministerium <strong>für</strong> Schule und Weiterbildung<strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Nordrhein-Westfalen (o.J.):Lesestrategien – Einführung.http://www.learn-line.nrw.<strong>de</strong>/angebote/gslesemodule/modul2/lesetraeinfuer.html#fn1MurmelgruppenEine Aktivierungsmetho<strong>de</strong>, die sich z. B. nach Vorträgenanbietet: Mit <strong>de</strong>m Nachbarn o<strong>de</strong>r zu dritttauscht man sich leise über das Gehörte aus. Murmelgruppenkönnen ohne Themenvorgabe o<strong>de</strong>r zuLeitfragen stattfin<strong><strong>de</strong>n</strong>. Die Ergebnisse wer<strong><strong>de</strong>n</strong> nichtpräsentiert, helfen aber <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen und Schülernsich auf ein Klassengespräch vorzubereiten.OperatorenOperatoren sind Verben, die signalisieren, welcheTätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartetwer<strong><strong>de</strong>n</strong>. Sie intiieren eine Handlung, z. B. zusammenfassen,beschreiben, analysieren, vergleichen.Je nach Fach o<strong>de</strong>r Textsorte können Operatoren unterschiedlichakzentuiert sein. Siehe auch: Sprachhandlungen.ReformulierungsaufgabenSchülerinnen und Schüler formulieren die Aufgabenstellungin eigenen Worten. Dies muss nicht inganzen Sätzen geschehen, son<strong>de</strong>rn kann auch inForm von Skizzen o<strong>de</strong>r Tabellen geschehen. Aufgabenkönnen auch in Verbindung mit einem Auftragreformuliert wer<strong><strong>de</strong>n</strong>, z. B. einen Imperativ in „Ichsoll-Sätze“umzuformulieren. Reformulierungsaufgabenkönnen Unterschie<strong>de</strong> und Gemeinsamkeitenvon Alltags- und Bildungssprache ver<strong>de</strong>utlichen.SchreibkonferenzEine Metho<strong>de</strong> zur Textbesprechung in Gruppen mit<strong>de</strong>m Ziel, einen Textentwurf durch Überarbeitungzu verbessern. In Form eines Beratungsgesprächsgeben die Gruppenmitglie<strong>de</strong>rn zu vereinbartenAspekten Rückmeldungen auf einen Text.SpiralcurriculumIm Spiralcurriculum ist <strong>de</strong>r Unterrichtsstoff (z. B. themen-o<strong>de</strong>r fachspezifischer Wortschatz) nicht linearangeordnet, son<strong>de</strong>rn in Form einer Spirale. So wird<strong>de</strong>r Unterrichtsstoff im Laufe <strong>de</strong>s Schuljahres bzw.mehrerer Schuljahre mehrmals wie<strong>de</strong>rholt.Sprachhandlungen (Operatoren)Schulisch relevante Sprachhandlungen wer<strong><strong>de</strong>n</strong> inBildungsstandards und Lehrplänen benannt, z. B.Argumentieren, Begrün<strong><strong>de</strong>n</strong>, Berichten, Beschreiben,Beurteilen, Erklären. Mit <strong><strong>de</strong>n</strong> einzelnen Sprachhandlungensind bestimmte Anfor<strong>de</strong>rungen anTextgestaltung, stilistische Normen und sprachlicheMittel verbun<strong><strong>de</strong>n</strong>.StrukturdiagrammDas Strukturdiagramm ist die abstrakte Darstellungeines Sachverhaltes: Wichtige Fachbegriffe wer<strong><strong>de</strong>n</strong>in verzweigter Struktur so dargestellt, dass darausdie Logik und die innere Struktur eines Themas hervorgeht.Strukturdiagramme sind sowohl einsetzbarbei <strong>de</strong>r Textanalyse als auch bei <strong>de</strong>r Textproduktionund können das zusammenhängen<strong>de</strong> Sprechenund Schreiben unterstützen.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.Wortgelän<strong>de</strong>rEin Wortgelän<strong>de</strong>r besteht aus einzelnen Wort- undSatzelementen, die von <strong><strong>de</strong>n</strong> Schülerinnen undSchülern zu einem Text zusammengefügt wer<strong><strong>de</strong>n</strong>.Es eignet sich zum Einüben zusammenhängen<strong>de</strong>rBeschreibungen o<strong>de</strong>r Erläuterungen. Ineiner „Wortliste“ sind wichtige Wörter und Fachbegriffeaufgeführt, die z. B. bei Bild-, Geräte- o<strong>de</strong>rVersuchsbeschreibungen als Sprachstütze dienen.Eine Wortliste wird oft in Kombination mit an<strong>de</strong>rensprachstützen<strong><strong>de</strong>n</strong> Werkzeugen eingesetzt.Zum Weiterlesen mit Beispielen: Leisen, J. (2003)(Hrsg.): Metho<strong><strong>de</strong>n</strong>handbuch <strong>de</strong>s DeutschsprachigenFach<strong>unterricht</strong>s (DFU). 2. erweiterte Auflage.Bonn: Varus.22 23