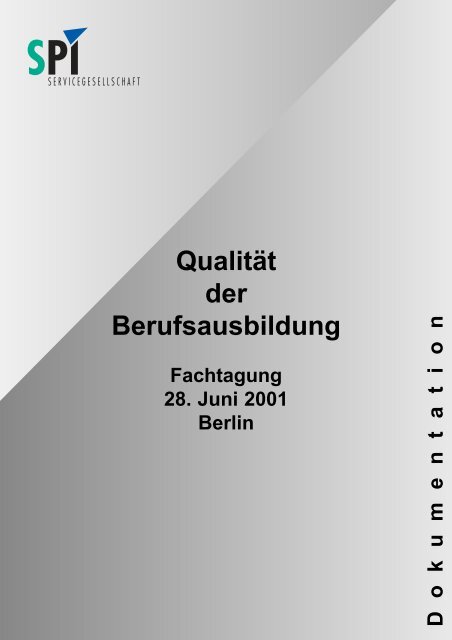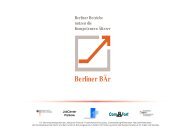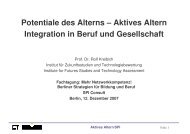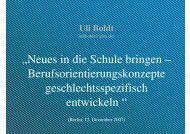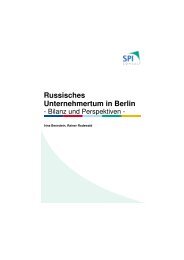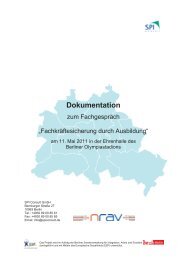Rainer Rodewald - Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde Berlin
Rainer Rodewald - Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde Berlin
Rainer Rodewald - Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Qualität<br />
der<br />
Berufsausbildung<br />
Fachtagung<br />
28. Juni 2001<br />
<strong>Berlin</strong><br />
D o k u m e n t a t i o n
Qualität<br />
der<br />
Berufsausbildung<br />
Fachtagung<br />
28. Juni 2001<br />
<strong>Berlin</strong>
Dokumentation der<br />
Fachtagung der<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
28. Juni 2001<br />
im AVZ Logenhaus <strong>Berlin</strong><br />
Herausgeber:<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Boppstraße 10<br />
10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 698 076 0<br />
Layout: Kerstin Dowidat<br />
Herstellung und Druck: MarkeThing
Begrüßung/Eröffnung<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Ist das Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?<br />
Impulsreferat 1<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Grußwort der Senatsverwaltung<br />
Staatssekretär Dr. Friedrich-Wilhelm Dopatka<br />
Welche ausbildungsrelevanten strukturellen Entwicklungen und<br />
Herausforderungen lassen sich für den Wirtschaftsraum <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg erkennen?<br />
Impulsreferat 2<br />
Sebastian Fischer<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
Workshop 1<br />
Wo liegt die Zukunft der Qualitätssicherung in der Berufsbildung?<br />
Thesen<br />
Dr. Susan Seeber<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Workshop 2<br />
Was muß die allgemeinbildende Schule leisten und wie muß sie sich<br />
entwickeln, um Jugendliche auf den Prozeß der<br />
Ausbildung vorzubereiten?<br />
Thesen<br />
Ulrich Thöne<br />
Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaften<br />
Prof. Dr. <strong>Rainer</strong> H. Lehmann<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Workshop 3<br />
Welche Anforderungen erwachsen aus der Informationsgesellschaft<br />
an das Berufsbildungssystem aus Sicht der Wirtschaft?<br />
Thesen<br />
Prof. Dr. Diepold<br />
Göttingen<br />
Friedhelm Rennhak<br />
Bereichsleiter der IHK zu <strong>Berlin</strong><br />
Wolfgang Krüger<br />
Schulleiter Werkberufsschule Siemens AG<br />
Inhalt<br />
Seite 1<br />
Seite 2<br />
Seite 36<br />
Seite 43<br />
Seite 56<br />
Seite 58<br />
Seite 61
Workshop 4<br />
Sind Ausbildung im Verbund, regionale<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong> und <strong>Netzwerk</strong>e die Konzepte der<br />
Zukunft?<br />
Thesen<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Norbert Bücker<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
Reinhard Selka<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
Plenum<br />
Präsentation der Workshop-Ergebnisse<br />
Workshop 1<br />
Rolf Heger<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Workshop 2<br />
Heide Dendl<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Workshop 3<br />
<strong>Rainer</strong> Hölmer<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Prof. Dr. Diepold<br />
Göttingen<br />
Workshop 4<br />
Sylvia Runge<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Abschlußreferat<br />
”Wohin die Reise geht?”<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Schlusswort<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Experten<br />
Teinehmer<br />
Ablaufplan<br />
Seite 66<br />
Seite 76<br />
Seite 78<br />
Seite 80<br />
Seite 81<br />
Seite 83<br />
Seite 83<br />
Seite 94<br />
Seite 98<br />
Seite 108<br />
Seite 118
Vorwort<br />
Das Duale System der Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland<br />
hat sich in den letzten Jahrzehnten, auch im europäischen Vergleich,<br />
als erfolgreiches System der Berufsausbildung bewährt. Es wird jedoch<br />
zunehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert, und die Frage nach<br />
der Zukunftsfähigkeit des dualen Systems wird lauter.<br />
Wie innovationsfähig ist das Bildungssystem angesichts der rasanten Entwicklungen<br />
im Arbeits- und Wirtschaftsprozess? Reicht die immer schnellere<br />
Entwicklung von neuen, immer differenzierteren Berufsbildern aus?<br />
Wie müssen sich die Ausbildungsinhalte und Rahmenpläne den veränderten<br />
Bedarfen anpassen? Sind Modularisierung und Zertifizierung tragfähige<br />
Reformansätze? Wie gelingt die notwendige Verzahnung von<br />
Ausbildung und Weiterbildung?<br />
Wenn das System der dualen Berufsausbildung auch zukünftig die tragende<br />
Säule zur Rekrutierung des Fachkräftenachwuchses bilden soll, sind<br />
grundlegende Reformen erforderlich. Eine zentrale Fragestellung in diesem<br />
Veränderungsprozess wird sein: Wie kann die Qualität der Berufsbildung<br />
gesichert werden?<br />
Dabei sind nicht nur die Ausbildungsinhalte und Rahmenpläne vor dem Hintergrund<br />
der veränderten Anforderungen zu betrachten, sondern auch der<br />
Prozeß der beruflichen Ausbildung, die angewandten Lehr- und Lernkonzepte,<br />
die Dauer der Ausbildung sowie die Durchlässigkeit zu anderen Bildungssystemen.<br />
Zudem werden die jeweils regionalen Bedingungen in die<br />
Diskussion mit einzubeziehen sein.<br />
Die SPI ServiceGesellschaft mbH ist seit 1997 als Dienstleister und Treuhänder<br />
in dem Bereich der Ausbildungsförderung tätig und organisiert im<br />
Auftrage des Landes <strong>Berlin</strong> zusätzliche Ausbildungsplätze. Hierbei kommt<br />
im besonderem Maße der konzeptionelle Ansatz der Ausbildung im Verbund<br />
zum Tragen.<br />
Darüber hinaus koordiniert die SPI ServiceGesellschaft mbH die Aktivitäten<br />
der regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> in <strong>Berlin</strong> und führt eine Reihe von Modellprojekten<br />
im Bereich der beruflichen Ausbildung durch.<br />
Mit unserer Veranstaltung „Qualität in der Berufsausbildung“ wollen wir den<br />
aktuellen Stand der Reformdiskussion in der beruflichen Bildung aufzeigen<br />
und gemeinsam mit Experten aus der Bildungsforschung, Ausbildungspraxis,<br />
Politik und Wirtschaft notwendige Handlungsansätze aufzeigen.<br />
Raimund Rilling<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH
Einen schönen guten Morgen, meine<br />
Damen und Herren, ich möchte sie alle herzlich<br />
willkommen heißen zu unserer Fachtagung<br />
Begrüßung/<br />
Eröffnung<br />
„Qualität der Berufsausbildung“<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Meine Damen und Herren, jede Tagung ist<br />
ein Abenteuer, von der Planung bis zur Umsetzung<br />
verändert sich dann letztendlich doch alles ein wenig, so auch unsere<br />
Tagung heute. Geplant war, dass unser Staatssekretär, Herr Dopatka,<br />
die Veranstaltung eröffnet, bisher ist er jedoch noch nicht erschienen. Ich<br />
hoffe, dass der Staatssekretär noch eintreffen wird, um dann, vielleicht etwas<br />
später, ein entsprechendes Grußwort zu halten.<br />
Ich denke mir, meine Damen und Herren, Ihnen zu Ehren sollten wir jedoch<br />
jetzt einfach anfangen.<br />
Vorab möchte ich Ihnen kurz noch einmal den Tagesablauf darstellen. Sie<br />
finden ihn zum Nachlesen aber auch in den entsprechenden Tagungsunterlagen<br />
wieder.<br />
Wir werden, sofern der Staatssekretär nicht rechtzeitig eintrifft, zunächst<br />
starten mit einem Input-Referat von Herrn Professor van Buer:<br />
„Ist das Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?“<br />
Dann, nach einer kleinen Pause, hören wir ein zweites Referat von Herrn<br />
Sebastian Fischer, der diesen Vortrag in Vertretung für Herrn Schulz-Hofen<br />
halten wird:<br />
„Welche ausbildungsrelevanten strukturellen Entwicklungen und<br />
Herausforderungen lassen sich für den Wirtschaftsraum<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg erkennen?“<br />
Im Anschluss daran werde ich dann die Essentials dieser beiden Referate,<br />
die wesentlichen Aspekte, zusammenfassen und versuchen, Sie zu motivieren,<br />
mit uns gemeinsam die zweite Hälfte der Veranstaltung zu gestalten.<br />
Dazu möchte ich sie einladen, in 4 parallel laufenden Arbeitsgruppen konkret<br />
mitzuarbeiten. Wir haben uns für diese Veranstaltung vorgenommen, in<br />
jeder Arbeitsgruppe, zu jedem Themenschwerpunkt, 5 Thesen zu erarbeiten,<br />
5 <strong>Berlin</strong>er Thesen zur Berufsbildungspolitik.<br />
Für den Zeitraum von 12.00 bis 13.00 Uhr haben wir eine kleine Mittagspause<br />
vorgesehen.<br />
Nach der Mittagspause werden Sie dann meine Kolleginnen und Kollegen<br />
in die Workshops begleiten und mit Ihnen und den von uns eingeladenen<br />
Experten in den jeweiligen Workshops, zu den 4 Themenfeldern arbeiten.<br />
1
Wir wollen im Anschluss an die Workshops so gegen 15.30 Uhr, eine Kaffeepause<br />
machen. Anschließend werden wir Ihnen die Ergebnisse aus den<br />
Workshops präsentieren.<br />
Wir hoffen, dass die Technik funktioniert und Sie diese Ergebnisse in Form<br />
von Thesen auch gleich gedruckt mit nach Hause nehmen können. Darüber<br />
hinaus ist aber auch geplant, dass wir im Anschluß an diese Veranstaltung<br />
eine Tagungsdokumentation erstellen.<br />
Noch etwas Organisatorisches: Wir haben vorne ein kleines Kästchen aufgestellt,<br />
mit der Bitte, dass Sie dort Ihre Visitenkarten abgeben, so dass<br />
Ihnen dann auch die Dokumentation richtig zugesandt werden kann.<br />
Ja, wie ich sehe, ist der Staatssekretär bisher noch nicht erschienen, so<br />
dass wir dann nun tatsächlich mit dem Vortrag von Herr Professor van Buer<br />
starten.<br />
Meine Damen und Herren, ich darf sie recht herzlich einladen zu der Fragestellung:<br />
„Ist das Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?“<br />
Herr Professor van Buer, Sie haben das Wort.<br />
Impulsreferat<br />
Meine Damen und Herren,<br />
als ich das Referat angenommen<br />
habe, habe ich mir keine allzu großen<br />
Sorgen über das Thema und<br />
über die Beantwortung der dort<br />
formulierten Fragen gemacht; sie<br />
lautet: „Ist das Berufsbildungssystem<br />
den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?“ Doch als ich<br />
anfing, darüber nachzudenken,<br />
hat mich der mittlere Schrecken angefallen. Denn ich musste anfangen,<br />
darüber nachzudenken, was ich eigentlich alles wissen müsste, um die<br />
Frage überhaupt beantworten zu können.<br />
Ist das Berufsbildungssystem<br />
den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Was ist mir bei all dem Schrecken eingefallen? Zumindest zwei Dinge:<br />
Erstens: Ich müsste wissen, was die Zukunft bringen wird. Manche glauben<br />
zwar, dies zu wissen. Aber die Frage nach deren Profession lautet „Sternendeuter“,<br />
„Wahrsager“ oder Ähnliches. Wenn man in die einschlägige<br />
wissenschaftliche Literatur hineinsieht - etwa zur Beantwortung der Frage,<br />
wie sich in Europa die Bildungssysteme entwickeln werden - , wird schnell<br />
sichtbar: Die Experten sprechen bewusst von Projektionen, nicht einmal von<br />
Prognosen. Das Einzige, was vergleichsweise sicher prognostiziert werden<br />
kann, ist die demographische Entwicklung in den Ländern, denn die<br />
Personen, die bis 2007 in das Bildungssystem eintreten werden, leben jetzt<br />
schon. Aber auch diese relativ sicheren demographischen Prognosen<br />
gelten nur unter der Voraussetzung, dass das eintritt, dass das bestehen<br />
2
leibt, was wir alle hoffen - Frieden; unter dieser Voraussetzung sind die<br />
demographischen Entwicklungen das Sicherste, was wir als Blick in die<br />
Zukunft haben. Alles Andere - <strong>Berlin</strong> erlebt es ja in letzter Zeit sehr deutlich<br />
- ist deutlich mehr von Unsicherheit, Unkalkulierbarkeit, - positiv formuliert -<br />
von Flexibilität und Entwicklung geprägt. Gerade deshalb ist vielleicht der<br />
Wunsch so stark, die Kalkulierbarkeit und damit die langfristige Steuerbarkeit<br />
gesellschaftlicher Realität zu erhöhen bzw. auch nur subjektiv zurückzugewinnen.<br />
Zweitens: Selbst wenn ich beschreibend wüsste, was die Zukunft - vermutlich<br />
- bringen wird, könnte man daraus nicht folgerichtig ableiten, welche<br />
Anforderungen an ein Berufsbildungssystem oder an ein anderes gesellschaftliches<br />
Subsystem wie den Arbeitsmarkt oder das Beschäftigungssystem<br />
abzuleiten seien. Denn dazu müsste ich wissen, was wir von der Zukunft<br />
erwarten, von ihr fordern, unter welcher Perspektive wir mögliche Entwicklungen<br />
betrachten und steuern wollen.<br />
Betrachte ich diese beiden Punkte ernsthaft, spricht vieles dafür, Ihnen zu<br />
sagen, dass ich die oben gestellte Frage nicht beantworten kann, und Sie<br />
schon jetzt in die - noch nicht verdiente - Kaffeepause zu schicken. Ich<br />
glaube, das würde mir zumindest der Veranstalter übel nehmen. Und so<br />
werde ich trotzdem den Versuch starten, Sie mit einigen Informationen zu<br />
konfrontieren, die aus meiner Sicht wichtig und nachdenkenswert sind,<br />
wenn man sich mit der obigen Frage beschäftigt.<br />
Bevor ich dies tue, bin ich gezwungen, einige weitere verunsichernde Vorbemerkungen<br />
zu machen.<br />
Die Beschäftigung mit der Titelfrage dieses Beitrages setzt eine Reihe von<br />
Annahmen voraus; und selbst dann ist nicht gesichert, dass ich diese Frage<br />
zumindest so weit beantworten kann, wie ich dies eingangs angedeutet<br />
habe - ganz unabhängig davon, ob man mit der Art, diese Frage zu beantworten,<br />
übereinstimmt und ob man der dann gegebenen Antwort folgt.<br />
Die Beschäftigung mit der Titelfrage setzt zunächst voraus zu verdeutlichen,<br />
von welchem Standpunkt und unter welcher Perspektive man auf<br />
diese Frage blickt, z. B.:<br />
● aus der Sicht der Bedürfnisse, die von den Anbietern an bezahlter<br />
Arbeit formuliert werden,<br />
● von den Bedürfnissen, die von den Individuen formuliert werden,<br />
die nach bezahlter Arbeit nachsuchen,<br />
● von der Bedürfnissen, die von der politischen Sphäre aus präzisiert<br />
werden etc.<br />
In meinem Beitrag gehe ich als theoretischem Hintergrund von dem Konzept<br />
der beruflichen Bildung aus, wie es im <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungsbericht<br />
1999 beschrieben ist 1 .<br />
Weiterhin setzt die Beschäftigung mit der Titelfrage voraus, dass man weiß<br />
– oder besser zu wissen glaubt – , welche Anforderungen die Zukunft an<br />
1 Vgl. VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 52ff.).<br />
3<br />
Zur Einleitung<br />
einige<br />
verunsichernde<br />
Vorüberlegungen
das Berufsbildungssystem stellen wird. Dies setzt wiederum voraus, dass<br />
man zu wissen glaubt, was die Zukunft von Gesellschaft, von Arbeit und Beruf<br />
in dieser Gesellschaft sein wird und wie die Individuen darauf reagieren<br />
werden.<br />
Angesichts dieser Wissenserfordernisse ist es nicht verwunderlich: In ihrer<br />
bildungspolitischen Analyse spricht die OECD (2001) für die erwartbaren<br />
Entwicklungen der ersten Dekade dieses neuen Jahrhunderts statt von<br />
„Prognosen“ bevorzugt von „Projektionen“; damit macht sie ganz bewusst<br />
den hohen Anteil der Subjektivität in den Urteilen der Experten sichtbar.<br />
Hinsichtlich der projizierten Zukunft für die nationalen Bildungssysteme entwickelt<br />
sie insgesamt sechs Szenarien: Diese reichen<br />
● von der Zementierung des strukturellen Status Quo,<br />
● über starke Veränderungen hinsichtlich Funktion dieser Bildungssysteme<br />
für Gesellschaft und Individuum,<br />
● bis hin zur fast vollständigen Demontage dieser Systeme (133ff.).<br />
Fast könnte man meinen, die Experten kommen zu dem Schluss: Alles ist<br />
möglich, und so genau wissen tun wir es auch nicht.<br />
Betrachtet man die einschlägige berufs- und wirtschaftspädagogische Diskussion<br />
zur Frage, ob und wenn ja, in welchem Zustand das deutsche Berufsbildungssystem<br />
die von außen an es herantretenden Einwirkungen<br />
überstehen wird, lauten die Antworten nicht nur unterschiedlich; sie reichen<br />
auch fast kontradiktorisch<br />
● von der Projektion, das Duale System der Berufsausbildung als<br />
zentraler Pfeiler werde die „Stürme der Zeit“ überstehen 2 ,<br />
● bis hin zu der gegenteiligen Prognose, es werde sich vor allem<br />
quantitativ extrem stark zurückentwickeln und nach und nach zu<br />
einem historischen Relikt werden 3 .<br />
Nun ist das Duale System nicht mit dem deutschen Berufsbildungssystem<br />
als Gesamtsystem gleichzusetzen; dies wird besonders deutlich wenn man<br />
mit Berufsbildung nicht - historisch bedingt quasi automatisch 4 – nur die<br />
nichtakademische Berufsausbildung meint, sondern das in den Hochschulen<br />
und Universitäten vermittelte Wissen und die dort aufgebauten Kompetenzen<br />
als akademische Berufsausbildung interpretiert. Zwar lernt derzeit<br />
etwas mehr als die Hälfte eines Jahrgangs im Dualen System – dies sind<br />
ca. drei Viertel derjenigen Gruppe eines Jahrgangs, die die nichtakademische<br />
Berufsausbildung durchläuft 5 . Allerdings hat sich die Struktur des<br />
„klassischen“ Dualen Systems stark differenziert, und auch die Finanzierungsmodalitäten<br />
sind ebenfalls stark unterschiedlich ausgeprägt 6 .<br />
Angesichts der angedeuteten Komplexität und der damit verknüpften Bandbreite<br />
möglicher Entwicklungslinien könnte ich jetzt meinen Beitrag schon<br />
schließen. Ich konfrontiere Sie mit einer kurzen, stark subjektiv gefärbten<br />
Stellungnahme und schließe mit der folgenden Aussage:<br />
2 Vgl. z. B. LEMPERT (1995).<br />
3 Vgl. z. B. die Diskussion in GREINERT (1998).<br />
4 Vgl. z. B. CZYCHOLL (1995).<br />
5 Vgl. z. B. BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000).<br />
6 Vgl. z. B. BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000, 119 ff.); für <strong>Berlin</strong> VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 274ff).<br />
4
Dies sei zwar meine Meinung. Allerdings – vorausgesetzt Sie akzeptierten<br />
mich als Experten. Genau wissen tue ich es auch nicht, und kommen könne<br />
dann doch alles anders.<br />
Wenn ich dies im Folgenden dann doch nicht so tue, bleibt angesichts der<br />
bisherigen Überlegungen trotzdem die Frage, ob meine Ausführungen der<br />
nächsten ca. 40 Minuten viel mehr seien als ‚das Lesen im Kaffeesatz‘.<br />
Dieses Urteil überlasse ich Ihnen. Ich hoffe, dass die Diskussionen in den<br />
vier Workshops diesen Zustand astrologischer Projektion nicht nur vollständig<br />
überwinden, sondern ihn erst gar nicht ansteuern. Und eigentlich<br />
bin ich sehr sicher: Der mit dieser Fachtagung gewollte Blick in die mögliche<br />
Zukunft der beruflichen Bildung - besonders der Art und Weise, wie sie<br />
in der hiesigen Region <strong>Berlin</strong>-Brandenburg (weiter-)entwickelt werden soll –<br />
verbreitert die Diskussionen über mögliche Alternativen und damit über<br />
Strategien zur Konstruktion gesellschaftlich konsensfähiger Zukunft, die<br />
den Individuen die Perspektiven und Chancen zu ihrer Entwicklung zwischen<br />
ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer gesellschaftlichen Integration<br />
öffnen.<br />
Die Beschäftigung mit der Titelfrage meines Beitrages, ob das deutsche<br />
Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft gewappnet sei, versuche<br />
ich entlang der folgenden vier Thesen:<br />
These 1:<br />
Der Umfang der Einflüsse auf die nationalen Berufsbildungssysteme sowie<br />
deren jeweilige Stärke und damit auf dessen Entwicklung nimmt insgesamt<br />
stark zu. Dies betrifft<br />
● sowohl die Einflüsse von außerhalb des Geltungsbereichs dieses<br />
Berufsbildungssystems - dort vor allem diejenigen aus der EU und<br />
deren angrenzenden Staaten –,<br />
● als auch von innerhalb Deutschlands - dort vor allem aus dem<br />
Arbeitsmarkt und Beschäftigungssystem, aber auch aus dem<br />
soziobiographischen Kontext der Jugendlichen.<br />
Dies führt dazu, dass der Transformationsdruck sich nicht nur teils dramatisch<br />
erhöht, sondern dass die eingeforderten Veränderungszyklen ebenfalls<br />
deutlich kürzer werden.<br />
Gleichzeitig ist allerdings auch zu beobachten: Bildungssysteme und damit<br />
auch das deutsche Berufsbildungssystem zeichnen sich tendenziell durch<br />
Änderungsresistenzen und damit nicht zuletzt durch zumindest Transformationsschwerfälligkeiten<br />
aus.<br />
Dies wiederum kann dazu führen: Die Differenz und damit auch die Separation<br />
zwischen der Transformationsgeschwindigkeit z. B. auf dem Arbeitsmarkt<br />
und im Beschäftigungssystem einerseits und der Änderungsferne<br />
des Berufsbildungssystems auf der anderen Seite führen zu einem<br />
schleichenden Bedeutungsverlust des Berufsbildungssystems im Gesamtkontext<br />
der Qualifizierung der (späteren) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-<br />
5<br />
Vier<br />
argumentationsleitende<br />
Thesen
nen für die bezahlte Arbeit sowie in der individuellen Lebensplanung der Jugendlichen<br />
und jungen Erwachsenen.<br />
These 2:<br />
Die Trends und Megatrends auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die Veränderung<br />
der Nachfrager nach bezahlter Arbeit, führen zu einer derzeit noch<br />
eher schleichenden, in der nächsten und näheren Zukunft allerdings starken<br />
Veränderung in der Struktur der individuellen Biographien – zunehmend<br />
weg von eher stabilen Berufs- und eher instabile und auch zeitlich stark<br />
segmentierte Erwerbsbiographien.<br />
Dies betrifft nicht nur den Aspekt der Berufseinmündung und damit die direkte<br />
Funktionalität der beruflichen Erstausbildung für die individuelle Lebensplanung;<br />
es trifft auch das Verhältnis von Erstausbildung – möglicher<br />
Weise der daran anschließenden Zweitausbildung – und des weiteren beruflichen<br />
bzw. berufsbezogenen Lernens im Rahmen der bildungspolitisch<br />
betonten Konzepte des lebensbegleitenden oder lebenslangen Lernens.<br />
These 3:<br />
Die Nachfrager und Nachfragerinnen nach beruflicher Bildung, hier besonders<br />
nach beruflicher Erstausbildung, ändern sich: Sie ändern sich in ihrem<br />
demographischen Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sie ändern sich in ihrer<br />
nationalen Zusammensetzung, sie ändern sich hinsichtlich ihrer Lernerfahrungen,<br />
die sie aus den verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen<br />
mitbringen, und sie ändern sich hinsichtlich der Lerneinstellungen und ihren<br />
Vorstellungen hinsichtlich dessen, wie sie die Lernangebote des beruflichen<br />
Regelsystems nutzen wollen bzw. werden.<br />
These 4:<br />
Aus den Veränderungen, die ich in den Thesen 1 - 3 angesprochen habe,<br />
vor allem auch aus den Interaktionen zwischen diesen Änderungen, ergibt<br />
sich eine Vielzahl von Anforderungen an das Berufsbildungssystem,<br />
● strukturelle<br />
● institutionell-organisatorische<br />
● curriculare und<br />
● lehr-lern- und ausbildungsmethodische<br />
Veränderungen und diese schnell und nachhaltig zu realisieren. Eine ist dabei<br />
von zentraler Bedeutung:<br />
Die Forderungen an die Qualität der Lern- und Entwicklungsangebote steigen,<br />
und der Druck auf den empirischen Nachweis steigt, dass die Qualitätsbehauptung<br />
realitätsangemessen sei. Gleichzeitig wird der Druck auf<br />
das Verhältnis von Preis und Leistung bei zuverlässiger Qualitätssicherung,<br />
starker ‚Kundenorientierung‘ und hoher Fristigkeit wachsen.<br />
Dies trifft nicht nur die privatwirtschaftlich agierenden Anbieter auf dem zunehmend<br />
vernetzten Aus- und Weiterbildungsmarkt, sondern auch die beruflichen<br />
Schulen, die in ihrer Funktion als auch privatwirtschaftlich agierende<br />
Kompetenzzentren verstärkt als neue Konkurrenten auf diesem Markt<br />
auftreten werden.<br />
6
Mit diesen vier Thesen erhebe ich nicht den Anspruch, die Veränderungslandschaft,<br />
in der das deutsche Berufsbildungssystem sich befindet und<br />
möglicher Weise sich auch neu platzieren muss, und deren mögliche Weiterentwicklung<br />
umfänglich abzubilden. Statt dessen sollten Sie diese Thesen<br />
als Leitlinien verstehen: Einerseits verweisen diese auf die vier Workshops<br />
dieser Fachtagung, anderseits folgen sie zwei generellen Hintergrundmustern,<br />
das jedes für sich allein bereits eine kaum noch zu überblickende<br />
Komplexität aufweist:<br />
● Die eine Leitlinie zielt auf den komplexen Zusammenhang<br />
zwischen Europa, den einzelnen Staaten, den dortigen Regionen<br />
und lokalen Einflüssen.<br />
● Die andere Leitlinie markiert das Verhältnis der verschiedenen<br />
systemischen Ebenen innerhalb einer Gesellschaft, in die das<br />
jeweilige Berufsbildungssystem eingebettet ist 7 .<br />
In der These 1 behaupte ich, dass der quantitative Umfang und Intensität<br />
der Einflüsse auf die nationalen Berufsbildungssysteme stark zunehme. Auf<br />
drei dieser Einflussbündel gehe ich im Folgenden kurz ein.<br />
Faktorenbündel 1<br />
„Trends und Megatrends auf dem Arbeitsmarkt und im<br />
Beschäftigungssystem“<br />
Bereits für die 90er Jahre und mit zunehmendem Druck für die erste Dekade<br />
dieses neuen Jahrhunderts wird in der Mehrzahl der wissenschaftlichen<br />
Analysen eine ganze Reihe von allgemeinen Trends und Megatrends hervorgehoben,<br />
die für den Arbeitsmarkt und das Beschäftigungssystem bestimmend<br />
sind bzw. zunehmend determinierend sein werden 8 . Diese<br />
Trends und Megatrends werden in dem Sinne als „allgemeine“ bezeichnet,<br />
als sie nicht nur nationale, sondern für die Industriestaaten weltweit beobachtbare<br />
Entwicklungslinien darstellen. Allerdings ist ebenfalls festzuhalten,<br />
dass sie von regionalen bzw. auch von lokalen Entwicklungen überlagert<br />
bzw. in Teilen sogar noch dynamisiert werden können 9 .<br />
7 Mit Bezug auf BRONFENBRENNER (1981) können für die folgenden Ausführungen vor allem die<br />
7 Exosystemebene als Ebene des Zusammenspiels der verschiedenen gesellschaftlichen<br />
7 Subsysteme, die Mesosystemebene als Ebene der institutionell-organisatorischen Konstruktion beruf-<br />
7 licher Bildung und Qualifizierung sowie die Mikrosystemebene als Ebene der Gestaltung der Lehr-<br />
7 und Ausbildungsumgebungen mit den dort stattfindenden Lehr- und Lernprozessen unterschieden<br />
7 werden (vgl. auch VAN BUER, WAHSE u.a. 1999, 55ff.).<br />
8 Vgl. z. B. ACHTENHAGEN (1995); VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 95ff.).<br />
9<br />
Für <strong>Berlin</strong> mit seiner spezifischen Bedingungsstruktur zu Beginn der 90er Jahre vgl. z. B. VAN BUER,<br />
WAHSE u. a. (1999, 107).<br />
7<br />
Das deutsche<br />
Berufsbildungssystem<br />
im Netz<br />
von exogenen<br />
internetionalen<br />
und nationalen<br />
Systemeinflüssen
Trends und Megatrends auf dem Arbeitsmarkt<br />
(in Anlehnung an und Erweiterung von ACHTENHAGEN 1995, 117)<br />
Exogene Faktoren:<br />
■ Demografische<br />
Trends:<br />
Brüche in der<br />
Alterspyramide<br />
■ Wachsende<br />
Heterogenität in<br />
■ Schulabschlüssen<br />
■ Alter<br />
■ Nationalität<br />
■ Individuation in den<br />
individuellen<br />
Wertemustern<br />
8<br />
Endogene Faktoren:<br />
■ Internationalisierung<br />
der Wirtschaft<br />
■ Wachsende Anzahl<br />
von Forschungsbefunden<br />
und<br />
deren Transformation<br />
in Technologien<br />
■ Wachsende<br />
Verwendung<br />
neuer Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien<br />
■ Weltweite<br />
Verwendung von<br />
Ressourcen und<br />
Umweltbedingungen<br />
Konsequenzen:<br />
■ Systemische<br />
Rationalisierung<br />
■ Herunterbrechen der<br />
hierarchischen<br />
Produktions- und<br />
Verwaltungssysteme<br />
im Sinne von “lean<br />
management” und<br />
“lean production”<br />
■ Wandel von der<br />
funktionalen in die<br />
prozessorientierte<br />
Arbeitsorganisation<br />
■ Anwachsen des<br />
tertiären Sektors und<br />
des Dienstleistungssektors<br />
und der<br />
Teilerwerbstätigkeit<br />
in allen Sektoren<br />
des Arbeitsmarktes<br />
■ Diskontinuität in der<br />
individuellen Berufs-<br />
und Erwerbstätigkeit
Im Folgenden gehe ich kurz nur auf einige ausgewählte Faktoren ein; dies<br />
sind diejenigen, die ich zur Beschäftigung mit der Titelfrage meines Vortrages<br />
besonders benötige.<br />
(a) Zu den exogenen Faktoren<br />
Als exogene Faktoren für die Entwicklung des Arbeitsmarktes werden vor<br />
allem die demografischen Entwicklungen sowie der zunehmende Bedeutungsverlust<br />
individuenübergreifender persönlicher Wertemuster angeführt.<br />
Hinsichtlich der demografischen Entwicklung ist besonders auf die Veränderung<br />
der Alterspyramiden zuungunsten der nachfolgenden Generation zu<br />
verweisen. Hinsichtlich der Entwicklung der Nachfrage nach bezahlter Arbeit<br />
wird diese Entwicklung die Bundesrepublik ab ca. 2007, spätestens ab<br />
2010 stärker treffen 10 . Dabei werden die neuen Bundesländer von diesem<br />
Rückgang an Angebot von qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen<br />
sowie von Auszubildenden besonders stark betroffen: So verweist<br />
das Gutachten von SEITZ (2001) zur demografischen Entwicklung und zum<br />
Infrastrukturaufbau in <strong>Berlin</strong>-Brandenburg auf zum Teil dramatische<br />
Entwicklungen: Diese werden in einigen Regionen Brandenburgs nicht nur<br />
zur Schließung von bis zu 60% der Schulen und beruflichen Oberstufenzentren<br />
führen; zudem werden sie auch die derzeit schon beobachtbare starke<br />
Migration der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Richtung des Strukturzentrums<br />
<strong>Berlin</strong> noch weiter verstärken.<br />
Damit verändern sich in dieser Region innerhalb der nächsten 10 Jahre, im<br />
Land Brandenburg spätestens nach 2006/2007, nicht nur die Bedingungen<br />
für die Rekrutierung von jungen Menschen für die berufliche Erstausbildung,<br />
sondern auch diejenigen für die Rekrutierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen<br />
aus dem Arbeitsmarkt heraus. Inwiefern durch regionale Mobilität -<br />
dieses auch über den nationalen Arbeitsmarkt hinaus - hier Entlastungen geschaffen<br />
werden können, ist derzeit kaum hinreichend präzise abschätzbar 11 .<br />
Zudem macht das durchaus nicht nur ironisch zu verstehende Schlagwort<br />
von der „Vergreisung der Gesellschaft“ auf die folgende Gefahr aufmerksam:<br />
Mit der quantitativen Veränderung der Altersgruppen ist nicht nur eine<br />
Verschiebung der politischen Repräsentanzen verknüpft. Im politischen<br />
Handeln wird sie vermutlich auch zu einer Bedeutsamkeitsverschiebung<br />
solcher Bereiche gesellschaftlichen und individuellen Handelns führen, die<br />
besonders die sich verkleinernde Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen<br />
betreffen - z. B. Jugendpolitik, Familienpolitik etc. Neben diesen<br />
erwartbaren Umorientierungen hinsichtlich der besonderen „Pflege“ der angesprochenen<br />
gesellschaftlichen Gruppen durch die Politik verändert sich<br />
zunehmend auch die Altersstruktur der Arbeitnehmer; in Verstärkung der<br />
Trends zum lebenslangen / lebensbegleitenden Lernen ergibt sich dadurch<br />
eine verstärkte Bedeutung des sog. Alterslernen nicht nur aus gesamtgesellschaftlicher<br />
Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der einzelbetrieblichen<br />
Pflege des Humankapitals mit ihren besonderen Problemen<br />
des Return of Investments 12 . Im Gesamtkontext der Nachfrage nach beruf-<br />
10 Vgl. z. B. ROLOFF (2000).<br />
11 Vgl. z. B. DIW (2000).<br />
12 Vgl. z. B. WEIß (1999).<br />
9
licher Bildung und Qualifizierung wird sich damit der Anteil der Nachfrage<br />
nach beruflicher Erstausbildung im Regelsystem stark zugunsten der Nachfrage<br />
nach beruflicher Fort- und Weiterbildung verschieben.<br />
Darüber hinaus verdeutlichen die nationalen und internationalen Jugendstudien,<br />
die auch den Altersbereich der jungen Erwachsenen umfassen,<br />
einen massiven Wechsel in den Wertemustern und Einstellungen. Darauf<br />
gehe ich später im Abschnitt 5 nochmals etwas genauer ein.<br />
(b) Zu den endogenen Faktoren<br />
Unter den endogenen Faktoren stelle ich in dem hier diskutierten Kontext<br />
den Aspekt der Globalisierung der Märkte sowie die Reaktion der unterschiedlichen<br />
Kundengruppen darauf besonders heraus: Wie stark dies auch<br />
auf den sog. „Bildungsmarkt“ zutrifft, wird nicht zuletzt von den (bildungs-)<br />
politischen Entscheidungen hinsichtlich der Europäisierung der Bildungsund<br />
Weiterbildungslandschaft abhängen. Besonders der Trend zur Modularisierung<br />
von Bildungsgängen und zu gesonderten Zertifizierung von Teilkompetenzen,<br />
internalisierten Wissenssegmenten (vgl. unten die Ausführungen<br />
zum Faktorenbündel 3) - vor allem auch derjenigen, die im Bereich<br />
des sog. informellen Lernens erworben wurden - werden zumindest zur Entregionalisierung<br />
dieser Bildungsmärkte und dort nicht nur im Bereich der<br />
Weiterbildung beitragen.<br />
Generell folgt aus diesen endogenen Faktoren zumindest zweierlei:<br />
● ein zunehmender Wandel von arbeits- in kapitalintensive<br />
Produktionsformen sowie<br />
● die massive Verschärfung des Wettbewerbs.<br />
In der Konsequenz ergeben sich für diesen Bereich daraus u. a. Trends zu<br />
spezifischer Profilbildung in der Palette der angebotenen Produkte und<br />
Dienstleistungen einerseits und gleichzeitig Entwicklungen hin zur systematischen<br />
Verknüpfung von Produkt- und Dienstleistungsangebot andererseits.<br />
Diese Konkurrenzverschärfung gilt nicht zuletzt auch für den Bereich<br />
der Anbieter von Bildung und Qualifizierung; denn nicht nur treten neue<br />
Agenten auf den Markt – z. B. die beruflichen Schulen, aber auch überregional<br />
agierende Anbieter – ; auch die Zyklen für das jeweilige spezielle Produkt-<br />
und Dienstleistungsangebot werden zeitlich kürzer; und der Druck auf<br />
die schnelle Implementation neuer Angebote wird größer.<br />
Insgesamt sind die Folgen für die berufliche Bildung und Weiterbildung und<br />
damit für das Berufsbildungssystem derzeit nur schwer überschaubar. Dies<br />
macht die Beschäftigung mit meiner Titelfrage nicht leichter. Trotzdem seien<br />
an dieser Stelle einige mögliche Konsequenzen bereits angedeutet, die sich<br />
besonders auf die Entwicklung neuer Curricula beziehen: In den letzten<br />
Jahren erhöhte sich einerseits der Druck auf eine schnellere Neuordnung<br />
der bestehenden Ausbildungsberufe, zum anderen auf die Schaffung neuer<br />
Ausbildungsberufe bzw. der Kombination bisheriger Ausbildungsberufe, die<br />
der Qualifizierung der Auszubildenden auf die neuen Tätigkeitsstrukturen<br />
besser gerecht werden 13 . Dieser Druck wird sich in den nächsten Jahren<br />
voraussichtlich eher verschärfen.<br />
13 Für <strong>Berlin</strong> vgl. Z. B. VAN BUER, Wahse u.a. (1999, 259); BERUFSBIL-DUNGSBERICHT (2000, 90ff.).<br />
10
Insgesamt zeichnet sich sowohl für die Ausbildungsberufe als auch für die<br />
berufliche Weiterbildung eine starke Erhöhung der curricularen Anforderungen<br />
ab – bei verstärkter Betonung der Markt- und Kundenorientierung in<br />
praktisch allen Ausbildungsberufen. Bei gleichzeitiger Erhöhung der zu<br />
erwerbenden Wissensqualitäten im beruflichen Bereich führt dies zu Forderungen<br />
nach systematischer Verstärkung<br />
● der Metakognitionen sowie<br />
● der Sozial- und Humankompetenzen 14 .<br />
(c) Zu den Konsequenzen aus den Trends und Megatrends<br />
Als Konsequenzen aus den angesprochenen Trends und Megatrends zeigt<br />
sich besonders die systemische Rationalisierung sowohl im Bereich der einzelbetrieblichen<br />
Entwicklung als auch im Bereich der Strukturierung der Arbeitsplätze<br />
selbst und der dort definierten Arbeits- und Tätigkeitsstrukturen.<br />
Zu beobachten ist vor allem eine stärkere Vernetzung der bisherigen getrennt<br />
organisierten innerbetrieblichen Funktionsbereiche und ein zunehmender<br />
Wechsel von der funktionsorientierten hin zur prozessorientierten<br />
Arbeitsorganisation; darauf komme ich im Abschnitt 3.2 noch zurück.<br />
Für das arbeitende Individuum führt diese Veränderung zur erhöhten Forderung<br />
an seine Bereitschaft zu lebenslangem bzw. lebensbegleitendem<br />
Lernen. Dabei stellen diese Investitionen für das Individuum zur Zeit allerdings<br />
– noch – in hohem Maße ‚Risiko’-Investitionen dar: Denn mit der individuellen<br />
Investition in berufliche Fort- und Weiterbildung geht nicht immer<br />
eine erhöhte Sicherung der individuellen Berufs- und Erwerbsbiographien<br />
einher 15 .<br />
Die systemischen Rationalisierungsstrategien durch die Betriebe blenden<br />
mehr und mehr die Frage nach der individuellen Sicherheit von Beruf und<br />
Erwerb als betriebswirtschaftliches Entscheidungskriterium aus. So ist es<br />
nicht verwunderlich: Die oben genannte Studie des Deutschen Instituts für<br />
Wirtschaftsforschung (DIW) von 1996 zu Weiterbildungserwartungen und<br />
faktischem individuellen Nutzen von Weiterbildung legt eine bemerkenswerte<br />
Paradoxie offen: Zwar hegt der überwiegende Teil der Fortbildungsteilnehmer<br />
subjektiv eine hohe individuelle Nutzenerwartung; allerdings findet<br />
diese nur für den kleineren Kreis dieser Teilnehmer ihre Entsprechung in objektiven<br />
Kriterien wie beruflichem Aufstieg, Einkommenszuwachs etc.<br />
Neben der systemischen Rationalisierung in den Betrieben wird auch das<br />
Niederbrechen hierarchisch gegliederter Produktions-, Dienstleistungs- und<br />
Verwaltungssysteme deutlich. Neben der daraus folgenden Umstellung von<br />
funktions- in prozessorientierte Arbeitsorganisationsformen geht auch der<br />
Verlust an innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten für das arbeitende Individuum<br />
einher. Eine individuelle Strategie ist, diesem Verlust an Möglichkeiten<br />
durch eine erhöhte Teilnahme an beruflicher Weiterbildung zu be-<br />
14 In den letzten Jahren wurden diese auch als „Schlüsselqualifikationen“ bezeichnet - mögen sie nun<br />
14 der „falsche Glanz des goldenen Schlüssels“ sein, wie GEIßLER es bereits 1990 formuliert, oder das<br />
14 leistungssteigernde Breitbandanabolikum zur Öffnung der Zukunft, wie es vor allem in den<br />
14 Stellungnahmen der Anbieter von bezahlter Arbeit formuliert wird (zur dieser komplexen Diskussion<br />
14 vgl. z. B. die Beiträge in WITTMANN & VAN BUER 1998).<br />
15 Vgl. z. B. die Befunde der Studie von BEHRINGER (1996).<br />
11
Exkurs<br />
gegnen, um im verschärften Konkurrenzkampf um die verknappten beruflichen<br />
Aufstiegsplätze z. B. ein breiter gefächertes oder ‚modernisiertes‘<br />
Kompetenzprofil anbieten zu können. In diesem spielen die Kompetenzen<br />
im Umgang mit den modernen Informations- und Kommunikationstechniken<br />
eine zunehmend größere Rolle. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung<br />
des Workshops 3 dieser Fachtagung sichtbar.<br />
Faktorenbündel 2 „Arbeitsorganisation“<br />
Aus den im Abschnitt 3.1 skizzierten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt<br />
und im Beschäftigungssystem entstehen zwar durchaus Chancen, die Humanisierung<br />
bezahlter Arbeit und damit auch das Verhältnis von bezahlter<br />
Arbeit, berufsbezogenem Lernen und individueller Entwicklung im Sinne<br />
von Humanisierung weiter voranzutreiben. Allerdings ist auch ein erhöhter<br />
Druck auf die Ökonomisierung von bezahlter Arbeit und der Entwicklung<br />
des Humankapitals zu verzeichnen; dieser wirkt sich nicht notwendiger Weise<br />
zugunsten der Arbeit-neh-mer und Arbeitnehmerinnen aus.<br />
Bevor ich auf die Veränderung von der funktions- in die prozessorientierte Arbeitsorganisation<br />
eingehe, sei mir an dieser Stelle ein kleiner Exkurs erlaubt:<br />
Der angesprochene Druck verschärft vor allem den Zeitrhythmus dieser Arbeit<br />
und die angestrebte Wertschöpfung aus dem Humankapital. Mit<br />
BAETHGE & OBERBECK (1986, 15) ist insgesamt festzuhalten: Diese Entwicklungen<br />
basieren - um ein schon geflügeltes Wort zu verwenden - auf<br />
„säkularen, irreversiblen Vergesellschaftungsprozessen der<br />
Arbeits- und Verkehrsformen“.<br />
Sie werden die zukünftige Entwicklung auch weiterhin in hohem Maße<br />
bestimmen. Zwar sind die Entwicklungen in den verschiedenen Segmenten<br />
des Arbeitsmarktes durchaus unterschiedlich. Insgesamt ist jedoch segmentübergreifend<br />
ein rapide steigender Einsatz der neuen Informationsund<br />
Kommunikationstechniken zu verzeichnen und damit eine massive<br />
Veränderung der auf dem Arbeitsmarkt eingeforderten Wissens- und Kompetenzprofile.<br />
Die hier nur angedeuteten Veränderungen sind keineswegs<br />
abgeschlossen; eher kann sogar mit Dynamisierungen gerechnet werden.<br />
Bei aller Differenziertheit der Trends sei hier kurz auf eine Entwicklung verwiesen,<br />
die sich über die verschiedenen Arbeitsmarktsegmente hinweg<br />
andeutet und die gut erkennbare Auswirkungen auf die berufliche (Aus-)<br />
Bildung haben wird:<br />
● Insgesamt wird sich die inhaltliche Komplexität der beruflichen<br />
Tätigkeiten für die Mehrheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br />
vergrößern; dies gilt besonders für den Beratungs- und<br />
Betreuungsbereich 16 .<br />
● Einfache Handlungssequenzen werden zunehmend automatisiert.<br />
In der Folge werden sie entweder zunehmend von den EDV-Tech-<br />
Ausniken übernommen, oder sie werden von den Kunden mit der<br />
sicht auf renditesteigernde Kosteneinsparungen selbst über<br />
nommen.<br />
16 Z. B. für den Bankenbereich vgl. WITTMANN (2000, 93ff.).<br />
12
● Weiterhin werden die Modelle, die diesen Tätigkeitsstrukturen<br />
hinterliegen und diese auch steuern, zunehmend abstrakter und<br />
erfahrungsentfernter. Sie nehmen selbst immer stärker wissensförmige<br />
Strukturen an; diese erfordern sowohl differenzierte<br />
Kenntnisse über die Merkmale dieses Wissens als auch ausgearbeitete<br />
Strategien im rationalen Umgang mit Wissen<br />
(sog. Metawissen 17 ).<br />
Diese Entwicklungen führen u. a. zu einer Komprimierung vieler beruflicher<br />
Tätigkeiten auf kompliziertere Entscheidungsfälle und sind mit einer - teils<br />
massiven - Verdichtung der Zeitstruktur verknüpft. Gleichzeitig steigt der Zugang<br />
zu entscheidungsrelevanten Informationen und damit auch der Druck<br />
auf schnelle Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung. Insgesamt<br />
erhöhen sich damit zum einen die Transparenz und zum anderen auch<br />
die Kontrolle des individuellen Arbeitshandelns - dies vor allem unter der<br />
Perspektive nachweisbar gesteigerter Produktivität, Effektivität und Effizienz.<br />
Neben der „Renaissance der Fachqualifikation“ im Sinne stark verbreiterter<br />
und intern hoch vernetzter individueller Kompetenzprofile ist ebenfalls die<br />
Nachfrage nach berufsübergreifenden Fähigkeiten stark gestiegen. Diese<br />
werden vor allem unter dem Begriff der „Schlüsselqualifikationen“ diskutiert 18 .<br />
Als besonders wichtige Schlüsselqualifikationen werden z. B. Kommunikationsfähigkeit,<br />
Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeit, vernetztes komplexes<br />
Denken etc. genannt. Sie markieren nicht primär die Entwertung berufsund<br />
tätigkeitsspezifischer Kompetenzen; statt dessen verweisen sie vor allem<br />
auf den bereits angesprochenen Aspekt des Umgangs mit Wissen und<br />
dessen Nutzung im Rahmen komplexer rationaler Planungs- und Evaluierungsmodelle<br />
durch die beruflich Tätigen selbst; dies gilt zunehmend nicht<br />
nur für die individuelle Einzelentscheidung, sondern besonders auch für das<br />
Ergebnis von Team- und Gruppenprozessen 19 .<br />
Vor diesem hier nur grob skizzierten Entwicklungshorizont stellt die Entwicklung<br />
und Pflege des Humankapitals in und mittels beruflicher Aus- und Weiterbildung<br />
nicht nur unter volkswirtschaftlicher Perspektive eine entscheidende<br />
Größe in der Sicherung Deutschlands als Wirtschaftsstandort dar;<br />
darüber hinaus sind Qualifizierung und (berufliche) Aus- und Weiterbildung<br />
in den Mittelpunkt einzelbetrieblicher strategischer Unternehmensplanungen<br />
gerückt 20 . Dabei wurde in den letzten Jahren das pädagogische Profil<br />
deutlich betont, vor allem in der Neubewertung des Verhältnisses von arbeitsplatz-,<br />
berufsspezifischen und berufsübergreifenden Qualifikationen<br />
und Kompetenzen 21 . Ihre Ursachen hat diese Umorientierung nicht zuletzt<br />
auch in den nur schwer prognostizierbaren Veränderungen der Arbeitsbedingungen<br />
bzw. in der Notwendigkeit, Rationalisierungsreserven disponibel<br />
zu halten. In diesem Kontext wird intensiv, teils auch kontrovers diskutiert,<br />
inwieweit Aspekte der vollen Entfaltung des menschlichen Arbeitsvermögens<br />
mit persönlichkeitsförderlicher Perspektive zur Zeit eine dominante<br />
17 Vgl. z. B. Analysen in BAETHGE & SCHIERSMANN (1998).<br />
18 Die einschlägigen Publikationen sind kaum noch überschaubar; vgl. z. B. die Beiträge in<br />
18 WITTMANN & VAN BUER (1998).<br />
19 Vgl. z. B. DÖRIG (1994); die Beiträge in WITTMANN & VAN BUER (1998).<br />
20 Vgl. z. B. WITTHAUS (1996); BODENHÖFER (1996).<br />
13
Rolle spielen (können) 22 . Durchaus im Gegensatz zu den optimistischen<br />
Prognosen im Rahmen von Modellen des lebenslangen / lebensbegleitenden<br />
Lernens 23 ist die Tendenz unübersehbar, gerade vor dem Hintergrund<br />
massiver Klagen seitens der Anbieter von bezahlter Arbeit angemessene<br />
Werthaltungen und Arbeitseinstellungen zunehmend als privates, marktfähiges<br />
Gut zu betrachten; diese habe der einzelne Nachfrager nach bezahlter<br />
Arbeit bereits bei seiner Berufseinmündung bzw. bei seinem Wiedereinstieg<br />
in das Beschäftigungssystem ‚mitzubringen‘. Berufliche, vor allem (inner-)<br />
betriebliche Weiterbildung als „Investition in Humankapital“ hat sich somit zu<br />
einem bevorzugten Instru-ment der Bewältigung und Neuorientierung sowie<br />
der Anpassung an veränderte Arbeitsbedingungen und zu einem Instrument<br />
der Umsetzung strategischer Unternehmensziele entwickelt 24 . Ihr wird eine<br />
Führungsrolle im technischen Wandel beigemessen 25 .<br />
Insgesamt ist festzuhalten: Vor allem aufgrund der Globalisierung der Märkte<br />
sowie aufgrund der Internationalisierung der Finanzströme sind die angesprochenen<br />
Megatrends und Trends im ganzen europäischen Raum wirksam.<br />
Dieser europäische Gesamtrahmen zeitigt zunehmend stärkere Wirkung<br />
auf die Entwicklung der einzelnen Regionen, da sich diese ihrerseits<br />
wiederum mehr und mehr vernetzen. Dabei sollten die regionalen Unterschiede<br />
in Entwicklung und Entwicklungsdynamik allerdings nicht unterschätzt<br />
werden; sie stellen neue Aufgaben und Herausforderungen<br />
● sowohl an die gesellschaftlichen Steuerungen,<br />
● an die Entwicklung von Wirtschaft und Industrie,<br />
● an die Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems,<br />
● an die Entwicklung des Weiterbildungs’marktes‘<br />
● sowie an die Planungen der Individuen.<br />
Ein wichtiges Steuerungsinstrument stellt die Pflege der qualifikatorischen<br />
Infrastruktur und damit die Entwicklung regionaler Angebote zur beruflichen<br />
Bildung und Weiterbildung dar. Dabei kommt es darauf an, diese primär<br />
nicht als kurzfristige Reaktionsstrategie, sondern als rationale mittel- und<br />
langfristige aktive Steuerungs- und Entwicklungsperspektive zu begreifen.<br />
Im Folgenden versuche ich, die Tiefe des angesprochenen Transformationsprozesses<br />
in Wirtschaft und Industrie und deren Konsequenzen für den<br />
Bedarf an beruflicher Weiterbildung noch weiter zu präzisieren; dazu skizziere<br />
ich einige der Veränderungen, zu denen die Umstellung von der bisher<br />
vorherrschenden funktions- und berufsorientierten Organisation hin zur prozessorientierten<br />
Arbeitsorganisation gehört und in der nächsten Zukunft<br />
wohl in noch verstärkterem Maße gehören wird.<br />
Dabei verwende ich im Wesentlichen die auf empirischen Studien und die<br />
auf der Aufarbeitung einschlägiger Literatur basierenden Analysen, die am<br />
Wirtschaftsforschungsinstitut der Universität Göttingen von BAETHGE und<br />
seinen Mitarbeitern vorgelegt wurden 26 . Zwar ist auch hier auf weitreichen-<br />
21 Vgl. z. B. SEEBER (2000).<br />
22 Vgl. z. B. WITTHAUS (1996, 409, 413).<br />
23 Vgl. z. B. OECD (2001).<br />
24 Vgl. z. B. BODEN-HÖFER (1996, 233); auch die Beiträge in SEEBER, KREKEL & VAN BUER 2000).<br />
25 Vgl. z. B. die Beiträge in VON LANDSBERG & WEIß (1995).<br />
26 Vgl. z. B. BAETHGE & SCHIERSMANN (1998).<br />
14
de regionale, sektorale und betriebsgrößenspezifische Entwicklungen zu<br />
verweisen; trotzdem stellen diese Veränderungen gerade auch bei den<br />
größeren Unternehmungen im Bereich der Finanzdienstleistungen wichtige<br />
Entwicklungslinien dar.<br />
BAETHGE & SCHIERSMANN fassen die Veränderungen, die mit der Umstellung<br />
von funktions- in prozessorientierte Arbeitsorganisation einhergehen,<br />
in fünf großen Kategorien zusammen; diese gliedern sie nochmals in<br />
unterschiedliche Dimensionen, die an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt<br />
werden. Insgesamt verweisen der Autor und die Autorin auf fünfzehn gravierende<br />
Veränderungen, die die prozessorientierte Arbeitsorganisation in der<br />
Regel mit sich bringt. Die fünf Großkategorien sind: das Aufgabenprofil<br />
einer Unternehmung, sein Anforderungsprofil, die Arbeitsbedingungen, die<br />
Betriebsorganisation und die Arbeitsorganisation.<br />
In dem jetzigen Beitrag geht es speziell um die möglichen Auswirkungen<br />
dieser Entwicklungen auf die berufliche Bildung und deren institutionellorganisatorische<br />
Verfasstheit, mittels derer bei den Nachfragern für zumindest<br />
spezifische Aspekte der veränderten Aufgaben- und Anforderungsprofile im<br />
Bereich der finanzdienstleistenden Unternehmungen spezifische Wissensund<br />
Kompetenzprofile aufgebaut werden sollen. Darüber hinaus spreche<br />
ich noch Veränderungen in der Arbeitsorganisation an; denn hier ergeben<br />
sich möglicherweise Konsequenzen für steigende Desiderate nach berufsübergreifenden<br />
(Schlüssel-) Qualifikationen oder nach neuen Kombinationen<br />
und Vernetzungen für berufsspezifische und berufsunspezifische Kompetenzen<br />
des einzelnen Arbeitnehmers bzw. der einzelnen Arbeitnehmerin.<br />
Für den hier diskutierten Zusammenhang stelle ich besonders heraus:<br />
Veränderungen im betrieblichen Aufgabenprofil<br />
Nach BAETHGE & SCHIERSMANN tritt an die Stelle eines bisher eher begrenzten<br />
Bündels konkreter Arbeitsvorrichtungen zunehmend ein breit gefasstes<br />
Bündel bei zunehmend „offeneren“ Aufgabenstellungen mit nicht immer<br />
sofort erkennbaren, routinemäßig abarbeitbaren Problemlösungen. Für<br />
den einzelnen Arbeitnehmer bedeutet dies ausgedehntere Tätigkeitsfelder<br />
sowie breitere arbeitsbezogene Kontakte vor allem auch mit Personen, die<br />
er bisher nicht näher oder gar nicht kannte (Kollegen oder Kunden). Die<br />
zeitliche Struktur der Arbeit verändert sich von bisher eher kontinuierlichen<br />
Mustern mit wiederkehrenden Inhalten und bereichsspezifischer Abwicklung<br />
hin zu starker Diskontinuität mit dynamischer Veränderung der Inhalte<br />
und prozessorientierter Aufgabenabwicklung.<br />
Veränderungen im betrieblichen Anforderungsprofil<br />
Der bisher vorherrschende Kanon erprobter Handlungsvollzüge wird mehr<br />
und mehr erweitert durch neue Erfahrungsdimensionen in unterschiedlichen<br />
Kommunikations-, Organisations- und Marktbereichen. Für breite Arbeitsmarktsegmente<br />
ist eine systematische Ausdehnung von Produktpaletten<br />
und Dienstleistungen aus einer Hand deutlich erkennbar. Diese Entwicklung<br />
führt zu einem „offeneren“ Set an Handlungsvollzügen, die sich stark<br />
15
an Kundenwünschen, Sichtweisen von Kollegen etc. orientieren. Fachlich<br />
wird zusätzlich zur Qualifikation als „Spezialist“ ein breites Spektrum an<br />
technischen, kaufmännischen, kommunikativ-sozialen und nicht zuletzt<br />
auch an kulturellen Kompetenzen gefordert, das flexibel erweitert und verändert<br />
wird bzw. werden kann.<br />
Zumindest zwei Hintergrundtrends sind derzeit beobachtbar: Zum einen<br />
werden die Produkt- und Dienstleistungsangebote in vielen Aspekten immer<br />
stärker vergleichbar; zum anderen vergleichen (mögliche) Kunden nicht zuletzt<br />
über die neuen Informations- und Kommunikationssysteme die von<br />
ihnen nachgefragten Produkte und Dienstleistungen stärker hinsichtlich<br />
Struktur, Qualität und Preis.<br />
Insgesamt spricht alles dafür, dass sie ihre sozial-emotionale Bindung an<br />
eine spezifische Unternehmung mehr und mehr aufgeben bzw. verlieren<br />
und zunehmend nach einem rein ökonomischen Kalkül der (primär kurzfristigen)<br />
Renditeoptimierung agieren. Hinsichtlich der nach wie vor von der<br />
einzelnen Unternehmung gewünschten Kundenbindung spielen vor diesem<br />
Hintergrund neben der‚ selbstverständlich‘ eingeforderten hohen Fachkompetenz<br />
kommunikativ-soziale und kulturelle Kompetenzen der Arbeitnehmer<br />
besonders im Beratungs- und Betreuungsbereich eine herausragende Rolle 27 .<br />
Damit verändert sich auch die in vielen Tätigkeitsbereichen bisher eher<br />
begrenzte Bedeutung von reflexivem Denken und von Metakognitionen<br />
stark in Richtung auf deren zentrale Rolle bei der Steuerung der „offenen“<br />
Aufgabenstellungen und der Konstruktion komplexer Problemlösungen.<br />
Veränderungen in der Arbeitsorganisation<br />
Die bisherige fach- bzw. aufgabenzentrierte Spezialisierung entlang berufstypischer<br />
Qualifikationen und Kompetenzen wird zunehmend durch kundenbzw.<br />
durch prozessorientierte Arbeitsorganisation abgelöst. U. a. bedeutet<br />
dies: Die bisherigen berufstypischen Einsatzkonzepte und Aufgabenprofile<br />
werden zunehmend zumindest aufgelockert, wenn nicht immer stärker abgelöst<br />
durch flexible und offene, d. h. durch je Projekt neu definierte Aufgabenprofile.<br />
Waren bisher Verantwortungsbereiche weitgehend vertikal gestaffelt, z. B.<br />
mittels der sog. ‚Dienstwege‘, werden sie nunmehr zunehmend durch Kooperationen<br />
auf gleicher Ebene, also querfunktional, abgelöst. Dies führt<br />
auch dazu, dass die bisherige vertikale Hierarchisierung entlang formal zugewiesener<br />
Verantwortungsbereiche zumindest partiell durch Stauchungen<br />
dieser Hierarchisierung ersetzt wird.<br />
Insgesamt machen die Ausführungen in diesem Abschnitt auf eine Reihe<br />
durchaus widersprüchlicher Entwicklungen aufmerksam: Sie changieren<br />
zwischen Ansätzen zur Humanisierung bezahlter Arbeit auf der einen Seite<br />
und Verschärfung des Return of Investment in das einzelbetriebliche Humankapital<br />
auf der anderen.<br />
Für den Bereich der beruflichen Erstausbildung wird auch erkennbar: Dort<br />
27 Vgl. z. B. WITTMANN (2000).<br />
16
geht es zunehmend nicht mehr nur um die ‚Modernisierung‘ der beruflichen<br />
Curricula innerhalb der traditionellen Ausbildungsberufe; stattdessen geht<br />
es mehr und um mehr die Frage nach möglichen Kombinationen der bisher<br />
getrennten Curricula. Des Weiteren sind die Forderungen nach einer breit<br />
angelegten ‚Anreicherung‘ der fachspezifischen Kompetenzen mit den bereits<br />
ironisch als Breitbandanabolika angesprochenen Schlüsselqualifikationen<br />
sowie mit kulturellen Kompetenzen unübersehbar. Weiterhin steigt die<br />
Bedeutung von Metakognitionen sowie von Einstellungen lebenslangen<br />
Lernens.<br />
Faktorenbündel 3 „Europa“<br />
Eine ganze Reihe von Einflüssen, die aus dem europäischen Kontext auf<br />
die nationalen Bildungs- und Berufsbildungssysteme einwirken, habe ich<br />
oben in den Abschnitten 3.1 und 3.2 bereits angesprochen. Da die Frage<br />
nach den Wirkungen dieses Kontextes auf das deutsche Berufsbildungssystem<br />
ein eigenes komplexes Diskussionsfeld darstellt, mache ich an<br />
dieser Stelle auf die folgenden Aspekte nur skizzenhaft aufmerksam:<br />
Auch wenn diese in weiten Bereichen derzeit erst teilweise erkennbar sind,<br />
verstärken sich in der Folge der zunehmenden Verknüpfung der nationalen<br />
Arbeitsmärkte und der zumindest steigenden Option hinsichtlich der überregionalen<br />
Mobilität der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 28 die Forderungen<br />
● nach transnationaler Standardisierung der Curricula bzw. von<br />
Teilcurricula sowie<br />
● nach übernational anerkannter Zertifizierung der von den<br />
Individuen erbrachten Leistungen gerade auch im Bereich der<br />
beruflichen Bildung und Qualifizierung 29 ;<br />
● darüber hinaus wachsen die Optionen hinsichtlich der Stärkung<br />
europäischer Komponenten in den beruflichen Curricula und<br />
hinsichtlich interkulturellen Kompetenzaufbaus 30 .<br />
Ein zentraler Aspekt in der Balance zwischen Standardisierung und Flexibilisierung<br />
der Curricula und Lehrangebote – sei es im beruflichen Regelsystem,<br />
sei es in den Weiterbildungsangeboten – ist deren Modularisierung 31 .Wie<br />
auch immer dieser Begriff präzisiert wird – vorherrschend ist dort eher die<br />
Uneinigkeit als Konsens 32 – , entscheidend für die in diesem Vortrag geführte<br />
Diskussion ist zumindest dreierlei:<br />
● Die inhaltlichen Lehrangebote, die vor allem im Bildungs- sowie im<br />
Berufsbildungs-Regelsystem bildungsgangsmäßig definiert sind<br />
und i. d. R. mit einer 0/1-Entscheidung am Ende dieser Bildungsgänge<br />
enden, müssen zwar ‚zerlegt‘ und hinsichtlich ihrer zeitlichen<br />
Sequenzierung sowie ihrer inhaltlichen Binnenstruktur möglichst<br />
präzise konstruiert werden. Gleichzeitig ist es jedoch auch<br />
erforderlich, sie in ihrer Verknüpfung untereinander genau auszulegen,<br />
um nicht im Aufbau deklarativen lexikalischen Wissens<br />
und stark segmentierter Wissensstrukturen verhaftet zu bleiben,<br />
28 Vgl. z. B. OECD (2001).<br />
29 Vgl. z. B. LAUR-ERNST (2000); BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000, 201ff.).<br />
30 Vgl. z. B. BUSSE (1994); EUROPÄISCHE KOMMISSION (1997); WEBER (1998).<br />
31 Vgl. z. B. VAN CLEVE (1996); für das United Kingdom als Beispiel vgl. KUHLEE (2000).<br />
32 Vgl. die Ausführungen z. B. in SQUARRA & HÖPPNER (2001).<br />
17
sondern komplexe und flexible Wissens- und Kompetenzstrukturen<br />
zu erzeugen 33 .<br />
● Die Qualitätssicherung des curricular Gewollten erfolgt über die<br />
Realisierung der Lehr- und Ausbildungsumgebungen und über die<br />
dort implementierten Lehr-Lern-Prozesse. Diese didaktischmethodische<br />
Perspektive verweist auf die Bedeutung komplexer Lehr-<br />
Lern-Arrangements für das Erreichen gerade komplexer<br />
Wissensstrukturen sowie von Metakognitionen 34 .<br />
● Sollen die Ansätze der Modularisierung und vor allem ihrer Zertifizierung<br />
nicht bereits mittelfristig ein ähnliches Schicksal wie<br />
dasjenige von Schulabschlüssen und Zeugniszensuren des<br />
Regelsystems erleiden, ist es unabdingbar, den Output dieser Module<br />
mittels intersubjektiv überprüfbarer realitätsangemessener<br />
Messungen festzustellen und damit die Stufe der „bloßen<br />
Behauptung“ zu verlassen 35 .<br />
Insgesamt rückt damit die Frage nach der Qualitätssicherung in das Zentrum<br />
der einschlägigen Diskussionen - dies nicht nur unter den Aspekten<br />
der Effektivierung und Effizienzsteigerung im Rahmen des Bildungscontrollings<br />
und der Bestimmung des Return of Investment, sondern auch unter<br />
dem Gesichtspunkt der individuellen Verwendungssicherheiten des Gelernten<br />
für die Konstruktion der Berufs- und Erwerbsbiographie 36 .<br />
Derzeit sind in der europäischen Modularisierungsdiskussion die Tendenzen<br />
relativ stark ausgeprägt, zugunsten transnationaler Zertifizierung systematisch<br />
eine Separierung zwischen der Definition der Module im Sinne des<br />
dort erzielten Outputs auf der einen Seite und der Qualitätssicherung durch<br />
die Lehr-Lern-Prozesse herzustellen. Zunächst scheint dies die Chancen zu<br />
verstärken, mittels ‚Bildungspässen‘ oder ähnlichen Zertifizierungssystemen,<br />
die derzeit i. d. R. noch unterhalb der Ebene der Ordnungsmittel angesiedelt<br />
sind, Wissensbereiche, (Teil-) Kompetenzen, Fertigkeiten (skills)<br />
u. ä. zumindest überregional, möglicher Weise auch europaweit, anerkannt<br />
zu zertifizieren. Die Fragen nach der Qualitätssicherung durch die Lehr-<br />
Lern-Prozesse sowie nach der Messqualität des Zertifizierten bleiben jedoch<br />
auch weiterhin bestehen und stellen sich bei einer solchen Strategie<br />
für die Zukunft noch verschärft; beantwortet sind sie derzeit weder umfänglich<br />
noch zufriedenstellend.<br />
Allerdings scheint der Trend hin zur Modularisierung sowie zur Zertifizierung<br />
dieser Module und zusätzlich von arbeitsmarktrelevantem Gelernte, das<br />
nicht in institutionalisierten formellen Kontexten, sondern im Rahmen sog.<br />
informellen Lernens erworben wurde, politisch akzeptiert und weitgehend<br />
unumkehrbar zu sein. Für das deutsche Berufsbildungssystem sowie die<br />
Angebote an berufsbezogenem Lernen und beruflicher Qualifizierung zwischen<br />
Arbeitsamtsmaßnahmen und privaten Anbietern im Bereich der Um-<br />
33 Als Beispiele vgl. ACHTEN-HAGEN, TRAMM u.a. (1992); die Überlegungen in SQUARRA &<br />
32 HÖPPNER (2001).<br />
34 Als Übersicht zu den komplexen Lehr-Lern-Arrange-ments in der beruflichen Bildung vgl. z. B.<br />
32 ACHTENHAGEN (1995); auch VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 77ff.); zu den Metakognitionen vgl.<br />
32 z. B. WITT (1996).<br />
35 Zu dieser Frage vgl. z. B. WOTTAWA & THIERAU (1990).<br />
36 Vgl. z. B. die Beiträge in SEEBER, KREKEL & VAN BUER (2000).<br />
18
qualifizierung und Fort- und Weiterbildung stellt sich die drängende Frage,<br />
wie diese Institutionen und Agenten mit den für sie noch vergleichsweise<br />
ungewohnten Desideraten nach Modularisierung und verlässlicher Outputmessung<br />
umgehen.<br />
Der Blick auf die Funktionen des Berufsbildungssystems hinsichtlich seiner<br />
‚Transmission‘<br />
● zwischen den allgemeinen Schulen zum einen und<br />
● dem Beschäftigungssystem und den im Rahmen von bezahlter<br />
Arbeit bzw. zur Reintegration in bezahlte Arbeit stattfindenden<br />
öffentlich (teil-)finanzierten, einzelbetrieblichen und / oder<br />
individuellen beruflichen Weiterbildungsinvestitionen zum anderen<br />
macht auf eine ganze Reihe von Problemen und Disfunktionalitäten in der<br />
Anpassung der verschiedenen Teilsysteme aufeinander aufmerksam 37 . Vor<br />
allem die Probleme an der sog. 1. Schwelle – dem Eintritt der Jugendlichen<br />
in das Berufsbildungssystem – und an der 2. Schwelle – dem Übergang in<br />
das Beschäftigungssystem – werden seit Jahren intensiv diskutiert und<br />
auch in verschiedenen Berufsbildungsberichten der Bundesregierung bzw.<br />
der Bundesländer vor allem unter quantitativer Perspektive dargestellt 38 .<br />
Hinsichtlich der Selektionsprozesse an der 1. Schwelle ist sinnvoll, auch<br />
nach den ‚Leistungen‘ der allgemeinen Schule hinsichtlich der Voraussetzungen<br />
zu fragen, die für erfolgreiches Lernen unter stark restringierten<br />
Zeitkontingenten in der beruflichen Bildung benötigt werden. Hier haben z.<br />
B. die TIMSS-Studien in Deutschland zumindest zu überraschtem Erstaunen<br />
geführt 39 . Vor diesem Hintergrund gewinnt der Workshop 3 dieser<br />
Fachtagung seine besondere Bedeutung.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Frage nach den Veränderungen<br />
in den individuellen Berufs- und Erwerbsbiographien zu beantworten –<br />
beginnend mit Befunden an der 2. Schwelle und darüber hinaus mit Ergebnissen<br />
aus berufsbiographischen sowie Panelstudien.<br />
An der 2. Schwelle, also am Übergang von der Berufsausbildung in das Beschäftigungssystem<br />
40 , weisen die entsprechenden Zahlen in den 90er Jahren<br />
bundesweit auf eine starke Verschlechterung der Situation hin: So hat<br />
sich insgesamt die Arbeitslosigkeit der erfolgreichen Absolventen des Dualen<br />
Systems stark erhöht 41 . Regional zwar sehr unterschiedlich, hat sich in<br />
der Bundesrepublik insgesamt ca. jeder vierte bis fünfte Jugendliche / junge<br />
Erwachsene nach seiner erfolgreich beendeten beruflichen Erstausbildung<br />
arbeitslos gemeldet 42 .<br />
Zwar liegen diese Zahlen im gesamteuropäischen Vergleich immer noch im<br />
unteren Drittel aller Staaten der Europäischen Union. Allerdings stabilisieren<br />
37 Vgl. z. B. GREINERT (1998).<br />
38 Vgl. z. B. BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000); für <strong>Berlin</strong> VAN BUER, WAHSE u. a. (1999, vor<br />
37 allem 211ff. und 378ff.).<br />
39 Vgl. z. B. BAUMERT, BOS & LEHMANN (2000); für Brandenburg als regionale Studie vgl.<br />
39 LEHMANN, PEEK u.a. (2000).<br />
40 und in Teilen auch gleich in die berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Umqualifizierung (quartärer<br />
39 Sektor des Bildungssystems)<br />
41 Vgl. auch BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000, 152ff.).<br />
42 Vgl. die Berufsbildungsberichte der Bundesregierung der den letzten Jahre; für <strong>Berlin</strong> vgl. VAN 42<br />
BUER, WAHSE u. a. (1999, 378ff.).<br />
19<br />
Zum deutschen<br />
Berufsbildungssystem<br />
in<br />
Reaktion auf die<br />
Verände-rung von<br />
der Berufs- und die<br />
Erwerbsbiographie
sie sich vor allem in den neuen Bundesländern und in <strong>Berlin</strong> auf hohem Niveau,<br />
so dass für die 90er Jahre von einer mehr als unbefriedigenden Dauersituation<br />
gesprochen werden kann: In diesen Regionen spielen Aspekte<br />
zusätzlicher Bildungsinvestitionen statt Eintritt in das Beschäftigungssystem<br />
eine wichtige Rolle: So beginnen ca. 2% eine neue Lehre, ca. 8% gehen in<br />
die Fachhochschule und Universität, ca. 1.5% gehen in eine weitere (berufliche)<br />
Schule und ca. 4% treten sofort in eine Fortbildung oder Umschulung<br />
ein 43 .<br />
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der künftigen Entwicklung<br />
der für Deutschland bisher so ‚typischen‘ Berufsbiographien und nach deren<br />
möglicher Transformation in Erwerbsbiographien 44 .<br />
Exkurs: Zu den Begriffen der Berufs- bzw. der Erwerbsbiographie:<br />
Der Begriff der Berufsbiographie verweist vor allem auf zweierlei:<br />
● Zum einen verweist er auf relativ feste Berufskulturen und deren<br />
Identitätsfunktion für das arbeitende Individuum.<br />
● Zum anderen wird damit die folgende Situation bezeichnet: Der<br />
beruflichen Ausbildung kommt für die spätere Arbeitstätigkeit eine<br />
stark bestimmende Funktion zu. Diese Tätigkeit findet dann für die<br />
große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung über das Arbeitsleben<br />
hinweg in demselben oder einem tätigkeitsaffinen Segment<br />
des Arbeitsmarktes statt. Die Frage, inwiefern die damit relativ<br />
starre Verknüpfung von Berufsbildungssystem und Beschäftigungssystem<br />
/ Arbeitsmarkt auch für die nächste Zukunft aufrecht<br />
erhalten werden kann, ist derzeit kaum mehr hinreichend präzise<br />
zu beantworten; denn diesbezüglich sind auch die gesellschaftlichen<br />
Positionen stark different.<br />
Der Begriff der Erwerbsbiographie hingegen verweist<br />
● auf das zunehmende Ersetzen der Berufskulturen durch Tätigkeitsstrukturen<br />
ohne entscheidende Identitätsbildung für den<br />
Einzelnen;<br />
● auf die Zunahme häufiger Wechsel von einer Tätigkeitsstruktur in<br />
eine deutlich veränderte über die gesamte Lebensspanne als<br />
Erwerbstätiger hinweg;<br />
● auf die zunehmende Unterbrechung der Erwerbstätigkeit durch<br />
Phasen von gewollter bzw. ungewollter Nichterwerbstätigkeit.<br />
Der Vergleich der wissenschaftlich-empirisch gesicherten Analysen und der<br />
öffentlich geführten Diskussionen zeigt eher geringe Übereinstimmungen<br />
auf; statt dessen werden eher große Differenzen in der Beurteilung der Entwicklung<br />
von der Berufs- in die Erwerbsbiographie in den 90er Jahren sichtbar:<br />
● Auf der einen Seite: Die wissenschaftlichen Analysen verweisen<br />
zwar auf bedeutsame Veränderungen in den Berufs- und Erwerbskarrieren<br />
in die angesprochene Richtung, markieren aber vor allem<br />
uneinheitliche Trends mit starken Unterschieden in den einzelnen<br />
Berufsgruppen und zudem geschlechtsspezifisch. Dabei betonen<br />
sie für Deutschland mehrheitlich die nach wie vor bisher relativ<br />
43 Zusätzlich gehen knapp 4% in den Wehr- bzw. Zivildienst, und knapp 5% werden Hausfrau / Haus-<br />
43 mann bzw. machen „Sonstiges“.<br />
44 Vgl. z. B. CORSTEN (2001).<br />
20
stabile Entwicklung von Berufsbiographien.<br />
● Auf der anderen Seite: Die öffentliche Diskussion in Deutschland<br />
neigt zu einer unübersehbaren Vergröberung und auch Dramatisierung<br />
der beobachtbaren Trends. In vielen Diskussionen wird der<br />
Umschlag von Berufs- in Erwerbsbiographien als bereits weitgehend<br />
vollzogen deklariert. Einschlägige wissenschaftliche<br />
Studien werten deutsche Verlaufsdaten über lange Zeiträume aus;<br />
darüber hinaus führen sie systematisch den Vergleich mit anderen<br />
Nationalökonomien durch. Hinsichtlich ihrer Perspektivität für die<br />
Investition in berufliche Weiterbildung können sie wie folgt<br />
zusammengefasst werden:<br />
Zum Blick in die jüngere Vergangenheit<br />
In einer groß angelegten Zeitreihenanalyse des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung<br />
in <strong>Berlin</strong> stellte sich heraus 45 : Vor allem für die Jahrgänge<br />
der zwischen 1949 und 1951 Geborenen, d.h. der jetzt ca. 50jährigen, ist<br />
über den individuellen Lebensverlauf in den ersten fünfzehn Jahren nach<br />
der beruflichen Erstausbildung eine bemerkenswerte Stabilität festzustellen.<br />
Der errechnete Stabilitätswert, der prinzipiell zwischen „0“ und „1“ variieren<br />
kann, liegt bei 0.70. Für die folgenden Jahrgänge sinkt er dann auf ca.<br />
0.65. Dieser Befund gilt nicht nur über die Gesamtheit des einzelnen Jahrganges<br />
hinweg, sondern auch für die individuellen Erwerbs- und Karrieremuster.<br />
Im Vergleich z. B. mit den Befunden aus den Vereinigten Staaten<br />
tritt diese besondere Stabilität für den deutschen Bereich noch deutlicher in<br />
den Vordergrund.<br />
Zum Blick in die Gegenwart<br />
Insgesamt liegt eine Vielzahl von soziologischen Analysen zur Funktion des<br />
Berufes bei der Konstruktion individueller Karrieren vor 46 . Zusammenfassend<br />
verweisen sie auf eine empirische Befundlage, die derzeit (noch) eher<br />
durch widersprüchliche als durch eindeutige generelle, arbeitsmarktsektoren-<br />
und branchenübergreifende und nicht zuletzt auch durch eindeutige geschlechtsunspezifische<br />
Trends geprägt ist. Die einschlägigen Studien legen<br />
insgesamt den folgenden Schluss nahe: Je nach Betonung unterschiedlicher<br />
Aspekte der erhobenen Daten kann stärker<br />
● auf den Wandel des Berufssystems und den gleitenden Übergang<br />
von lebenslangen Berufs- zu temporären Erwerbskarrieren oder<br />
● auf die Stabilität des erlernten Berufes für die weitere Biographie<br />
verwiesen werden.<br />
Auch zu Beginn dieses Jahrhunderts kann immer noch von dem „Paradox<br />
von Stabilität und Vielfalt“ gesprochen werden, wie es BERGER (1995)<br />
formuliert: Danach können als parallele Prozesse auf dem Arbeitsmarkt und<br />
im Beschäftigungssystem sowohl eine leicht wachsende Stabilität in einzelnen<br />
Berufsbiographien als auch eine leicht wachsende Zunahme an heterogenen<br />
Karrieren in Richtung auf Erwerbsbiographien festgestellt werden.<br />
Bedeutsam erscheint: Vor allem solche Gruppen von Erwerbspersonen,<br />
45 Vgl. MAYER (1996).<br />
46 Vgl. den ausführlichen Überblick über die einschlägige Literatur, den CORSTEN (2000) vorlegt.<br />
21
deren bisherige Ausbildungs- und Berufsbiographie durch Diskontinuität geprägt<br />
ist, werden auch in Zukunft verstärkt durch diese Diskontinuität und Irregularität<br />
bedroht sein. Gleichzeitig nimmt der Differenzierungsgrad der<br />
beruflichen Verlaufsmuster zu 47 . Mit einer Quote von mehr als 50% können<br />
die Übergänge von Auszubildenden aus dem wirtschaftsberuflichen Bereich<br />
in das Beschäftigungssystem als besonders stabil gelten; dies gilt besonders<br />
für den Bereich der sog. „Abiturientenberufe“, also auch dem Bereich<br />
der Finanzdienstleistungen 48 ; die Anteile eines diskontinuierlichen Übergangs<br />
lagen hier nur bei ca. 20% und damit am unteren Rand des Gesamtranges.<br />
Insgesamt lassen die vorliegenden, hier nur schlaglichtartig angesprochen<br />
wissenschaftlichen Befunde den Schluss zu: Für den Arbeitsmarkt und das<br />
Beschäftigungssystem in Deutschland stellt das Berufskonzept nach wie<br />
vor einen stark stabilisierenden Faktor bei der Konstruktion der individuellen<br />
Berufsverläufe dar. Gleichzeitig betonen sie die besondere Bedeutung des<br />
zielgerichteten ‚regulären‘ Einstiegs in die berufliche Ausbildung, dort besonders<br />
über das Duale System der Berufsausbildung. Damit wird der gesellschaftstragende<br />
Charakter des Berufskonzepts sowohl unter systemischer<br />
als auch unter individueller Perspektive sichtbar.<br />
Dies bedeutet nicht zuletzt auch: Wie auch immer z. Z. über das Verhältnis<br />
von beruflicher Erstausbildung und beruflicher Fort- und Weiter-bildung diskutiert<br />
und wie es in den nächsten Jahren bestimmt wird, die 1. Schwelle mit<br />
den dort stattfindenden Berufswahl- und Berufsfindungs- und -einmündungsprozessen<br />
verliert nicht, sondern sie gewinnt noch an Bedeutung. Im<br />
Rahmen dieser generellen erwartbaren Entwicklung nimmt auch die Bedeutung<br />
zu, die der empirisch nachgewiesenen Qualitätssicherung der Bildungsgänge<br />
im Berufsbildungssystem zukommt, dort vor allem auch der<br />
Varianten, in denen Bildungsträger als „Ersatz“ für die betriebliche Ausbildung<br />
oder als ein struktureller Bestandteil eines differenzierten kooperativen<br />
Systems wie in der Verbundausbildung fungieren. Diese Fragen werden<br />
im Workshop 1 und im Workshop 4 dieser Fachtagung besonders diskutiert.<br />
Gleichzeitig offenbart die berufliche Weiterbildung über die schon angesprochene<br />
individuell „trügerische“ Rendite hinaus einen weiteren ambivalenten<br />
Aspekt: Wenn sie die Funktion der Umschulung bzw. der Fortbildung an der<br />
Stelle einer nichtgelungenen Berufseinmündung tritt, kann ihr durchaus eine<br />
stigmatisierende Funktion zumindest in Richtung auf „Diskontinuität“ und<br />
„Irregularität“ zukommen.<br />
Die oben angesprochenen empirischen Befunde wurden mittels breit<br />
angelegter aufwendiger wissenschaftlicher Studien ge-wonnen. Diese<br />
lassen in nur begrenztem Ausmaß Analysen individueller Berufskarrieren<br />
zu. Die Befunde aus den Studien, die mit Daten aus der ersten Hälfte der<br />
90er Jahre arbeiten und den individuellen Übergang von der Ausbildung in<br />
die berufliche Tätigkeit thematisieren 49 , verweisen – zumindest für die 90er<br />
Jahre – ebenfalls auf einen vergleichsweise kontinuierlichen Übergang in<br />
47 Vgl. z. B. MÖNNICH & WITZEL (1994).<br />
48 Dies gilt besonders dann, wenn man die Zahl der Absolventen abrechnet, die nach der nichtaka-<br />
47 demischen Berufsausbildung eine akademische Ausbildung anschließen<br />
47 (vgl. auch die Ausführungen im Abschnitt 4.3 zur Rekrutierung im Bankenbereich).<br />
49 Vgl. z. B. STENDER (1997).<br />
22
das Beschäftigungssystem. In diesen Untersuchungen wird auch deutlich:<br />
<strong>Regionale</strong> Mobilität und hohe Weiterbildungsbereitschaft des Individuums<br />
helfen – dort allerdings nicht so sehr als Umschulung direkt nach der Berufsausbildung<br />
– , diesen Übergang zu optimieren. Wie stark diese Einstellungen<br />
ausgeprägt sind, hängt in hohem Maße von den Erfahrungen der Jugendlichen<br />
in ihrer Familie und nicht zuletzt auch in ihrer Ausbildung ab. Damit<br />
stellt sich die Frage, wie solche Grundeinstellungen auch durch gezielte<br />
Maßnahmen im Bildungssystem aufgebaut werden können, z. B. über Lehr-<br />
Lern- und Ausbildungsbedingungen, die besonders die Autonomie und<br />
Selbstverantwortlichkeit des Jugendlichen fordern und fördern.<br />
Zum Blick auf die mögliche nächste Zukunft<br />
Selbst wenn der Blick auf die Zukunft – vielleicht auch glücklicherweise -<br />
grundsätzlich verstellt ist und daher nur die Projektion auf eine möglicherweise<br />
eintretende Zukunft oder die gedankliche Konstruktion von denkbaren<br />
Alternativen möglicher Zukunft Sinn macht, so sei in diesem letzteren<br />
Sinn eine solche Formulierung gewagt:<br />
In Deutschland stellt der Beruf nach wie vor ein wichtiges Stabilitätskonzept<br />
für die Konstruktion individueller Karrieren dar. Da die Mehrzahl der verwendeten<br />
Daten aus den 80er Jahren bzw. aus dem Beginn der 90er Jahre<br />
stammen, ist derzeit nur schwer einschätzbar, ob sich seit etwa Mitte der<br />
90er Jahre die Situation deutlich ändert; denn dabei spielen nicht nur nationale,<br />
sondern auch europaweite Entwicklungen sowie (berufsbildungspolitische)<br />
Grundsatzentscheidungen in der EU eine nicht unbeträchtliche Rolle 50 .<br />
Viele Indikatoren zeigen auf einen eher gleitenden denn abrupten Übergang<br />
in Richtung auf erhöhte Instabilitäten und Diskontinuitäten in den individuellen<br />
Berufsbiographien hin. Dabei sind die Individuen, die auf eine nicht oder<br />
nur teilweise gelungene Berufseinmündung bzw. bereits auf einen diskontinuierlichen<br />
Berufsverlauf verweisen müssen, schon in den 90er Jahren<br />
stark von der Verlängerung dieses instabilen Zustandes betroffen.<br />
Insgesamt wird jedoch sichtbar: Derzeit ist wenig abzuschätzen, wie lange<br />
das Berufskonzept als grundlegende Philosophie vor allem des Dualen<br />
Systems der Berufsausbildung in Deutschland noch tragen wird; sichtbar<br />
wird dies vor allem<br />
● angesichts der Veränderungen in der Arbeitsorganisation und in<br />
den daraus folgenden Tätigkeitsstrukturen einerseits und<br />
● angesichts der sich abzeichnenden Einflüsse europäischer<br />
Konsensbildung auch in der beruflichen Bildung andererseits.<br />
Inwieweit das deutsche Berufsbildungssystem auf diese möglichen Entwicklungen<br />
vorbereitet ist bzw. diese auch ‚kontern‘ kann, ist derzeit ebenfalls<br />
kaum hinreichend präzise beantwortbar.<br />
In meiner These 3 habe ich die Vermutung formuliert, dass die Nachfrager<br />
und Nachfragerinnen nach beruflicher Bildung sich ändern; dies beträfe sowohl<br />
die Individuen als auch große Subgruppen.<br />
Auf einer eher globalen Ebene betrachtet, verdeutlichen die nationalen und<br />
50 Vgl. z. B. CEDEFOP (2000).<br />
23
Zum deutschen<br />
Berufsbildungssystem<br />
und zu<br />
den Veränderungen<br />
bei den Nachfragern<br />
und Nachfragerinnen<br />
nach<br />
beruflicher Bildung<br />
internationalen Jugendstudien, die auch den Altersbereich der jungen Erwachsenen<br />
umfassen, einen bedeutsamen Wechsel in den Wertemustern<br />
und Einstellungen. Hier zeigt sich besonders ein deutlicher Trend zur Individuation.<br />
Mit dem letzteren Begriff ist eine Entwicklung gekennzeichnet,<br />
nach der in einer Gesellschaft allgemein anerkannte Wertesysteme zunehmend<br />
in Frage gestellt und durch kleingruppenspezifische, häufig auch subkulturelle<br />
Systeme bzw. durch stark individuell geprägte Werthaltungen ersetzt<br />
werden. Wenn dies zutrifft, ist eine Konsequenz: Es wird zunehmend<br />
schwieriger, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene Konsens über zentrale<br />
Fragen der Konstruktion von Gesellschaft zu finden. Dazu gehören auch<br />
die Fragen nach der individuellen Bedeutung von bezahlter Arbeit, der Konstruktion<br />
der individuellen Berufs- bzw. Erwerbsbiographie, deren Einpassung<br />
in die anderen Lebensbereiche und -aufgaben sowie die subjektiv<br />
wahrgenommenen Möglichkeiten und Erfordernisse der Teilnahme an beruflicher<br />
Weiterbildung sowie deren Realisierung im Rahmen individueller<br />
Belastungsstrukturen.<br />
Jenseits dieser sehr allgemeinen Entwicklung wird es schon schwieriger,<br />
etwas detaillierter betrachtet eindeutige inhaltliche Trends zu identifizieren,<br />
die über die Tatsache hinaus gelten,<br />
● dass sich die Einstellungen der Jugendlichen zu Arbeit und Beruf<br />
in den letzten zwei Dekaden gewandelt haben und<br />
● dass sich diese Einstellungen und Bewertungen in Abhängigkeit<br />
von Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit in der Zeit nach Beendigung<br />
der beruflichen Ausbildung bzw. der Schulpflicht relativ schnell<br />
ändern können und kein zeitübergreifendes Merkmal mehr darstellen.<br />
Insgesamt deuten sich auf der einen Seite hohe Stabilitäten an; dies betrifft<br />
vor allem die nach wie vor hohe Favorisierung von beruflicher Ausbildung<br />
und beruflichen Tätigkeiten, in der primär konkrete Produkte erzeugt werden.<br />
Auf der anderen Seite werden aber auch starke Veränderungen sichtbar,<br />
die sich vor allem auf das zunehmend instrumentelle Verhältnis zur Arbeit<br />
im Rahmen der Lebensplanung beziehen.<br />
Auf zwei Phänomenbereiche gehe ich an dieser Stelle exemplarisch genauer<br />
ein:<br />
Bereich 1 „Werthaltungen von Jugendlichen gegenüber Beruf und<br />
Arbeit“<br />
In seinem Überblick über Befunde der Jugendforschung zu Arbeit und Beruf<br />
macht MERKENS (2001, 127ff.) zunächst auf methodologisch/methodische<br />
Probleme aufmerksam, die in diesem Forschungsbereich vorliegen. Diesem<br />
Autor zufolge sind sie neben statistischen Auswertungsproblemen vor allem<br />
auch in dem Umstand zu sehen,<br />
● dass viele der Studien nicht auf repräsentativen Stichproben<br />
basieren und<br />
● dass es nicht immer gelungen sei, die festgestellten Veränderungen<br />
von den veränderten Zusammensetzungen des jeweiligen<br />
Jahrgangs über die letzten drei Dekaden hinweg zu ‚bereinigen‘.<br />
24
So ist es nicht verwunderlich, dass der Autor in seiner Übersicht über die<br />
einschlägigen Befunde eher vorsichtig agiert und dabei häufig auf widersprüchliche<br />
Ergebnislagen aufmerksam macht. Trotzdem können einige<br />
Trends festgehalten werden 51 :<br />
● Wenn Jugendliche über Arbeit nachdenken, tun sie dies nach wie<br />
vor mehrheitlich in der Kategorie des Berufes 52 . Damit folgen sie<br />
zumindest derzeit nur langsam der im Beschäftigungssystem beobachtbaren<br />
Auflösung des Berufsbegriffs sowie der Berufsbilder<br />
zugunsten von Tätigkeitsstrukturen, die mit instabilen Erwerbsmustern<br />
verknüpft sind. Sichtbar wird hier besonders die nach wie<br />
vor identitätsstiftende Funktion des Berufskonzepts, auf die z. B.<br />
CORSTEN (2001) aufmerksam macht.<br />
● Jugendliche verbinden mit dem Begriff des Berufes, den sie für<br />
sich wählen, besonders die Merkmale einer interessanten und<br />
selbständigen Tätigkeit mit viel Freizeit und viel Kontakt mit<br />
anderen Menschen 53 . Demgegenüber scheinen Merkmale wie<br />
sichere Berufsstellung, hohes Einkommen, anerkannter und<br />
geachteter Beruf und viel Verantwortung in ihrer Bedeutung<br />
tendenziell zurückgesetzt. Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass<br />
individuelle Zufriedenheit mit dem Beruf in das Zentrum der<br />
Planung der eigenen Berufs- bzw. Erwerbsbiographie gerückt ist.<br />
MERKENS (2001, 135) stellt in seiner Zusammenfassung der<br />
Befunde heraus:<br />
„Ergebnisse, wie diese, lassen erkennen, daß das mit der Arbeit konkret Erreichte<br />
für die Jugendlichen wichtig ist. Sie sind offensichtlich eher auf Produkte<br />
fixiert und an der Erstellung von Produkten aus Materialien interessiert.<br />
So bleibt für sie der Prozeßcharakter eher zweitrangig. Vor allem wirkt<br />
die Instrumentalisierung der Arbeit in dem Sinne, daß man arbeitet, um etwas<br />
anderes zu erreichen, für sie obsolet. Damit deutet sich gegenüber den<br />
Arbeitsformen, die heute in der Industrie sowohl im gewerblichen als auch<br />
im kaufmännischen Bereich vorherrschen, ein Defizit an. Weder die Arbeit<br />
unter den Bedingungen der industriellen Produktion, die Optimierung der<br />
Arbeitsabläufe und Erkennen der Gesamtzusammenhänge abverlangt,<br />
noch die in den modernen Dienstleistungsberufen, welche Serviceorientierung<br />
als wichtiges Kriterium hat, die beide wiederum relativ abstrakt als Anforderungsmuster<br />
gegenüber der konkreten Tätigkeit bleiben, werden von<br />
den Jugendlichen geschätzt“.<br />
● Insgesamt zieht die Mehrzahl der Jugendlichen Berufe, in denen<br />
konkrete Produkte erstellt werden, denjenigen vor, in denen die<br />
Wissensförmigkeit der Berufskompetenz zentral ist und eher‚<br />
abstrakte‘ Phänomene wie nicht oder nur bedingt nachvollziehbare<br />
Handlungsfolgen gefordert sind.<br />
● Leistungsbereitschaft als abstraktes Kriterium wird zunehmend<br />
abgelehnt. Dies bedeutet aber nicht, dass generell die Leistungsbereitschaft<br />
der Jugendlichen zurückgegangen ist; statt dessen<br />
zeigt sich, dass diese sich auf konkrete Handlungen in einem für<br />
sie überschaubaren Zeitrahmen und auf für sie individuell Sinnhaftes<br />
beziehen muss.<br />
51 Vgl. auch VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 166ff.).<br />
52 Vgl. z. B. DÖHM & JUNGKUNZ (1997).<br />
53 Vgl. z. B. HERZ (1989).<br />
25
● Zwar stellen z. B. FERCHHOFF & KURZ (1994, 483) fest, dass<br />
sich die Einstellungen zu konventionellen Werten wie „ritueller<br />
Höflichkeit“, standardisierten Normen des „guten Benehmens“ und<br />
auch gegenüber den Arbeitstugenden wie „Pünktlichkeit“, „Sauberkeit“,<br />
„Genügsamkeit“, „Bedürfnisaufschub“ und „ritueller Fleiß“ in<br />
Richtung auf Distanz geändert hätten; allerdings seien gleichzeitig<br />
Werte wie Anerkennung von Leistungsorientierung, Aufstieg- und<br />
Karriereorientierung sowie Befriedigung und Selbsterfüllung im und<br />
durch den Beruf in ihrer Bedeutung gestiegen.<br />
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass solche generellen Trends nochmals<br />
subgruppenspezifisch variieren: So liegt nach wie vor ein klar erkennbares<br />
Nord-Süd-Gefälle vor, des Weiteren variieren diese Einstellungen mit<br />
dem Bildungsgrad 54 . Insgesamt spricht vieles dafür, dass die häufig implizit<br />
unterstellte Einheitlichkeit der Lebenslagen der Jugendlichen nicht zutrifft<br />
und dass der auch beobachtbaren zunehmenden Differenzierung und teilweisen<br />
Separierung der verschiedenen Lebenslagen ein bedeutsamer Einfluss<br />
auf die differentielle Herausbildung von Einstellungen gegenüber den<br />
oben angesprochenen Werten zukommt.<br />
In seiner Gesamtzusammenfassung kommt MERKENS (2001, 150) zu dem<br />
Schluss, dass<br />
„ ... mit dem Bildungsniveau die positive Einstellung zu Arbeit, Leistung und<br />
Technik zurückgeht (...),<br />
... die Akzeptanz von Arbeit, Leistung und Technik leicht zunimmt (insbesondere<br />
bei männlichen Jugendlichen),<br />
... die Zukunftsperspektiven negativ eingeschätzt werden“.<br />
Bereich 2 „sozialer Wandel von Jugend und Familie“<br />
Die obigen Bemerkungen machen deutlich: In einigen Bereichen folgt ein<br />
Großteil der Jugendlichen in ihren Einstellungen und Urteilen den teils rasanten<br />
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem<br />
nur bedingt und vor allem nicht mit derselben Geschwindigkeit, wie sie in<br />
diesen Subsystemen erkennbar ist. Generell kann man von dem Folgenden<br />
ausgehen: Die Vernetzung der verschiedenen Umwelten, in denen die Jugendlichen<br />
leben, hat zugenommen; und mit dieser Vernetzung wächst<br />
auch die Diversifikation in den individuell bedeutsamen Netzstrukturen. Als<br />
eines der gesellschaftlichen Subsysteme, das nach wie vor in dieser Gesellschaft<br />
als zentrales Instrument der Sozialisation angesehen wird, ist die<br />
Familie zu betrachten. An dieser Stelle kann nicht auf den sozialen Wandel<br />
eingegangen werden, den auch die Familie erfasst hat 55 . In dem hier diskutierten<br />
Kontext ist jedoch die Frage, welche Wirkungen von diesem Wandel<br />
auf die lern- und entwicklungsrelevanten Einstellungen ausgehen, die die<br />
Jugendlichen in das Berufsbildungssystem mitbringen.<br />
BUTZ (1997, 326ff.) fasst die Ergebnisse ihrer empirischen Studie aus <strong>Berlin</strong>,<br />
die auf Daten aus Mitte der 90er Jahren basiert, in den folgenden Punkten<br />
zusammen:<br />
● Zwar leben nach wie vor mehr als zwei Drittel der Jugendlichen in<br />
ihren Familien, wenn sie in das Berufsbildungssystem einmünden;<br />
54 Vgl. MERKENS (2001, 149).<br />
55 Vgl. z. B. BUTZ (1997, 122ff.).<br />
26
sie können daher auf durchaus traditionelle Strukturen als soziobiographischen<br />
Hintergrund verweisen. Aber aus der Sicht der<br />
Jugendlichen verschlechtert sich die Qualität ihrer Familie im Vergleich<br />
der verschiedenen Alterskohorten.<br />
● Die wahrgenommene Familienqualität beeinflusst nachhaltig die<br />
Zukunftseinschätzung der Jugendlichen.<br />
● In der Familie wird zu bedeutsamen Teilen die psychosoziale<br />
Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen aufgebaut. Sie kann als<br />
ein weitgehend zeitstabiles Persönlichkeitsmerkmal verstanden<br />
werden, wenn die Jugendlichen in die berufliche Bildung einmünden.<br />
Auch in sozial schwierigen Zeiten erweist sich diese<br />
Befindlichkeit als relativ stabil.<br />
● Das Problemverhalten der Jugendlichen wird mehr und mehr als<br />
schwierig wahrgenommen. Als schlecht empfundenes Familienklima<br />
stellt einen wichtigen Risikofaktor für das Auftreten von<br />
Problemverhalten Jugendlicher dar. Weiterhin steuert es bedeutsam<br />
die problemhafte und negativ orientierte psychosoziale<br />
Befindlichkeit von Jugendlichen.<br />
● Generell zeigt sich eine starke Interaktion zwischen familiären<br />
Bedingungen, Persönlichkeitsvariablen des Jugendlichen und<br />
seinen sozialen Ressourcen.<br />
Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass der soziale Wandel über die Entwicklung<br />
und das Lernen des Jugendlichen darauf wirkt, in welchem Ausmaß<br />
und auf welche Weise er die Lern- und Entwicklungsangebote in der<br />
institutionalisierten beruflichen Bildung nutzen kann und will. Vieles zeigt<br />
ebenfalls auf die folgenden Phänomene: Die Diskussion der letzten Jahre,<br />
die durchaus berechtigter Weise die Renovierung der Curricula und Lehr-<br />
Lern-Formen unter der Perspektive eines neuen Verhältnisses von Berufsbildungssystem<br />
und Arbeitsmarkt fokussiert hat, hat die Einflüsse aus dem<br />
sozialen Wandel der Familie und deren Beitrag zur individuellen Entwicklung<br />
der Jugendlichen nicht nur unterschätzt, sondern auch systematisch<br />
vernachlässigt. Diese Jugendlichen sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br />
von morgen, und sie bringen ihre Eintellungen und Urteile über ihren<br />
„Aufenthalt“ im Berufsbildungssystem und die anschließende Berufseinmündungsphase<br />
mit in die - wie auch immer berufliche oder erwerbsmäßig<br />
– organisierte bezahlte Arbeit mit.<br />
In meinen Ausführungen habe ich Sie mit einer ganzen Reihe von theoretischen<br />
Überlegungen, generellen Strukturaussagen und empirischen<br />
Befunden aus ganz unterschiedlichen Phänomenbereichen konfrontiert.<br />
Trotz der dabei angedeuteten Komplexität kann ich nur darauf verweisen,<br />
dass ich nur einen kleinen Ausschnitt möglicher Einflüsse auf das deutsche<br />
Berufsbildungssystem angesprochen habe. Wie versprochen – habe ich jedoch<br />
nicht versucht, die Titelfrage meines Beitrages bisher zu beantworten.<br />
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, meine These 1 zu untermauern: Die<br />
Vielzahl und die Stärke der Einflüsse auf das deutsche Berufsbildungssystem<br />
haben zugenommen. Weiterhin habe ich zu zeigen versucht: Vor allem<br />
die gesellschaftlichen Subsysteme, die das Berufsbildungssystem‚ umge-<br />
27<br />
Ein nachdenklicher<br />
Schluss
en‘, verändern sich teils in höchst dynamischer Weise. Dabei sind diese<br />
Veränderungen nicht homogen, und sie zeigen auch nicht immer in die selbe<br />
Richtung. Darüber hinaus gelten sie auch nicht immer für die Gesamtheit<br />
der Betroffenen, sondern teils nur für Subgruppen. Dies ist die eine Seite.<br />
Auf der anderen Seite zeigt der Blick in die letzte Dekade, dass das Berufsbildungssystem<br />
sich strukturell durch eine starke Stabilität auszeichnet und<br />
dabei gleichzeitig in einigen Teilaspekten wie den Curricula vieler Ausbildungsberufe<br />
auch durch eine vergleichsweise hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.<br />
So scheint die derzeitige Situation durch eine Paradoxie gekennzeichnet zu<br />
sein – Dynamik und Transformation der gesellschaftlichen Subsysteme, in<br />
die das Berufsbildungssystem seine Absolventen entlässt, auf der einen<br />
Seite und hohe Stabilität und in Teilen auch nicht zu übersehende Änderungsresistenz<br />
im Berufsbildungssystem selbst auf der anderen Seite.<br />
Damit stellt sich für mich die Frage, ob ich es mir trotz meiner einleitenden<br />
Bemerkungen zutrauen sollte, die Titelfrage meines Beitrages zumindest in<br />
Teilen zu beantworten, ohne dabei mehr zu tun als das eingangs schon beschworene<br />
„Lesen im Kaffesatz“ zu produzieren.<br />
Gestatten Sie mir daher abschließend einen stark subjektiv gefärbten Ausklang<br />
meiner Überlegungen –- dies im Sinne einer Projektion:<br />
Die Struktur des deutschen Berufsbildungssystems ist äußerst differenziert;<br />
angesichts der Vielzahl der Funktionen, die dieses System zu erfüllen hat,<br />
ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil 56 . In Teilen ist es jedoch vielleicht<br />
auch zu diversifiziert, und dieser Aspekt sollte neu überdacht werden.<br />
Aber die derzeitige Struktur enthält bereits die Grundkomponenten, die<br />
systematisch qualitätsvolle Entwicklungsangebote an Jugendliche ermöglichen.<br />
Diese gilt es zwischen Marktorientierung und individuellen Bedürfnissen<br />
der Nachfrager und Nachfragerinnen nach beruflicher Bildung ausbalanciert<br />
weiterzuentwickeln, möglichst empirisch gesichert nachgewiesen<br />
und nicht nur als pure Daseinsbehauptung in die öffentliche Debatte geworfen.<br />
Dabei spielt das Zusammenspiel der verschiedenen Steuerungsebenen in<br />
der beruflichen Bildung eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig wird es mit<br />
entscheidend sein, wie die institutionell-organisatorischen Umgebungsbedingungen<br />
in den verschiedenen Lehr- und Ausbildungsinstitutionen ausgestattet<br />
werden; gedacht ist dabei nicht an eine pauschale Inputfinanzierung,<br />
sondern an eine qualitätsbezogene Prozess- und Outputfinanzierung.<br />
Folgt man den bildungspolitischen Analysen der OECD (2001), wird der entscheidende<br />
Faktor jenseits der Strukturentwicklung des Berufsbildungssystems<br />
in der Weiterentwicklung des Personals liegen, also in der Mitarbeiterentwicklung.<br />
Wie diese sich in den nächsten Jahren darstellen wird, ist derzeit<br />
nur in Ansätzen erkennbar: Die Prognosen reichen für die beruflichen<br />
Schulen von ihrem Zusammenbruch über die Rekrutierung von Quereinstei-<br />
56 Vgl. z. B. die Ausführungen in VAN BUER, WAHSE u.a. (1999, 59ff.).<br />
28
gern um fast jeden Preis mit erwartbaren starken Qualitätsverlusten bis hin<br />
zu der Perspektive, den relativen Stellenwert der verschiedenen Lehr- und<br />
Ausbildungsinstitutionen neu zu überdenken. Für die Bildungsträger wird<br />
sich der Druck auf die Personalentwicklung als systemischer Komponente<br />
der Unternehmensentwicklung wesentlich verschärfen – bei i. d. R. nur geringer<br />
Kapitaldeckung und auch bei Subventionsbedingungen, in denen<br />
Ressourcen für die Mitarbeitentwicklung in nur geringem Ausmaß vorgesehen<br />
sind. Für die Betriebe die Situation zu beschreiben, würde einen eigenen<br />
Beitrag benötigen.<br />
Ist also das deutsche Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft<br />
gewachsen? Radio Eriwan würde antworten: Im Prinzip ja, - vielleicht sogar<br />
nur vielleicht – , aber ...<br />
Meine persönliche Antwortprojektion lautet: Strukturell sollte das deutsche<br />
Berufsbildungssystem in der Lage sein, die erwartbaren Anforderungen aktiv<br />
anzugehen und Lösungsmuster zu entwickeln. Dies ist möglich, wenn die<br />
verschiedenen politischen Steuerungsebenen strukturelle Anpassungen aktiv<br />
vorbereiten helfen und dabei das Vertrauen der verschiedenen Agenten<br />
verstärken. Letztendlich entscheidend wird sein, welche Art der Qualitätsentwicklung<br />
in den einzelnen Lehr- und Ausbildungsinstitutionen implementiert<br />
und stabilisiert wird. Diese Qualitätsentwicklung erfordert allerdings<br />
zum einen die Produktion hinreichenden Nachwuchses (quantitativer Aspekt)<br />
und zum anderen einen teils radikalen Wechsel in den Einstellungen<br />
der Agenten und einen kontinuierlichen Aufbau ihrer Fachkompetenz und<br />
didaktischer Kompetenz (qualitativer Aspekt) (für die Verbundausbildung<br />
vgl. z. B. SEEBER, VAN BUER & BARTH 2001).<br />
Abschließend sei eine Unsicherheit allerdings nicht unangesprochen – und<br />
diese heißt Europa und die dortigen politischen Entscheidungen hinsichtlich<br />
der Favorisierung bestimmter nationaler Berufsbildungssysteme als Entwicklungsmodelle<br />
für andere Staaten. Und trotzdem ist Europa gerade für<br />
das deutsche Berufsbildungssystem auch eine Chance – wenn es sich aktiv<br />
darauf einlässt.<br />
29
Literatur
ACHTENHAGEN, Frank (1995): Berufliche Ausbildung. In: VAN BUER, J.<br />
& JUNGKUNZ, D. (Hrsg.), Berufsbildung in den neunziger Jahren.<br />
Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Adolf Kell.<br />
Reihe: Studien aus der Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik an<br />
der Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong>. Bd. 2. <strong>Berlin</strong>, 147-208.<br />
ACHTENHAGEN, F., TRAMM, T. u.a. (1992). Lernhandeln in komplexen<br />
Situationen. Wiesbaden: Gabler.<br />
BAETHGE, M. & OBERBECK, H. (1986): Zukunft der Angestellten. Neue<br />
Technologien und berufliche Perspektiven in Büro und Verwaltung.<br />
Frankfurt a.M./NewYork: Campus.<br />
BAETHGE, M. & SCHIERSMANN, C. (1998): von der betrieblichen<br />
Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung. In: ARBEITS-<br />
GEMEINSCHAFT QUALIFIKATIONS-ENTWICKLUNGS-<br />
MANAGEMENT BERLIN (Hrsg.), Kompetenzentwicklung ’98:<br />
Forschungsstand und Forschungsperspektiven. Münster et al.:<br />
Waxmann, 15-87.<br />
BAUMERT. J., BOS, W. & LEHMANN, R. (2000): TIMSS/III. Dritte<br />
Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie -<br />
Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der<br />
Schullaufbahn. 2 Bände. Opladen: leske + budrich.<br />
BEHRINGER, F. (1996): Zum indivdiuellen Nutzen beruflicher<br />
Weiterbildung: Subjektive Einschätzungen und objektive Veränderungen.<br />
In: BARDELEBEN, R. VON, BOLDER, A. & HEID,<br />
H. (Hrsg.): Kosten und Nutzen beruflicher Bildung. Beiheft 12 zur<br />
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Stuttgart: Steiner,<br />
84-104.<br />
BERGER, J. (1995): Warum arbeiten die Arbeiter? Neomarxistische und<br />
neodurkheimischianische Erklärungen. In: Zeitschrift für Soziologie,<br />
Heft 6, 407-421.<br />
BERUFSBILDUNGSBERICHT (2000). Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung bmb+f. Bonn.<br />
BODENHÖFER, H.-J. (1996): Bildungscontrolling in der schlanken<br />
Organisation. In: WEILNBÖCK-BUCK, I., DYBOWSKI, G. & BUCK,<br />
B. (Hrsg.): Bildung - Organisation - Qualität. Zum Wandel in den<br />
Unternehmen und den Konsequenzen für die Berufsbildung. Bericht<br />
zur beruflichen Bildung. Heft 202. <strong>Berlin</strong>, 231-242.<br />
BRONFENBRENNER, U. (1981): Die Ökologie der menschlichen<br />
Entwicklung. Stuttgart: Verlagsgemeinschaft Ernst Klett.<br />
BUER, J. VAN, WAHSE, J. u.a. (1999): Berufsbildungsbericht <strong>Berlin</strong> 1999.<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen sowie<br />
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport. <strong>Berlin</strong>.<br />
BUSSE, G. (1994). Europafähigkeit, Europaqualifikation, internationale<br />
Qualifikation. In: Berufsbildung. Heft 1, 14-16.<br />
Butz, P. (1997): Familie und Jugend im sozialen Wandel. Dargestellt<br />
am Beispiel Ost- und Westberlins. Hamburg: Kovac.<br />
CEDEFOP (2000): Lernen in unserer Zeit. Die Berufsbildungspolitik auf<br />
europäischer Ebene. Luxemburg.<br />
32
CLEVE, B. VAN (1996). Modularisierung in der beruflichen Erstausbildung<br />
- europäische Perspektiven. In: BUER, J. VAN, SQUARRA, D.,<br />
SEEBER, S. & APEL, U. (Hrsg.), Entwicklung der Wirtschaftspädagogik<br />
in den osteuropäischen Ländern I „Berufsbildung<br />
zwischen Staat und Markt“. Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik<br />
aus der Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong>.<br />
Bd. 9.1, 107-130.<br />
CORSTEN, M. (2001): Berufsbildungsforschung in der Soziologie. In:<br />
BUER, J. VAN, KELL, A. & WITTMANN, E. (Hrsg.), Berufsbildungsforschung<br />
in ausgewählten Wissenschaften und multidisziplinären<br />
Forschungsbereichen. Frankfurt a. M.: Lang, 53-106.<br />
CZYCHOLL, R. (1995): Bericht über die Veränderungen der Forschungslandschaft<br />
einschließlich ihrer institutionellen Struktur und Rahmenbedingungen.<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung: Forschung im Dienst<br />
von Praxis und Politik. Festveranstaltung zum 25jährigen Bestehen<br />
des Bundesinstituts für Berufsbildung am 7./8. September 1995.<br />
Dokumentation. Bielefeld: Bertelsmann.<br />
DIW (2000): Arbeitsmarkteffekte der Zuwanderungen nach Deutschland.<br />
DIW-Wochenbericht 21/2000, 327-332.<br />
DÖHM, S. & JUNGKUNZ, D. (1997): Arbeitseinstellungen kaufmännischer<br />
Auszubildender. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik,<br />
Heft 4, 464-479.<br />
DÖRIG, R. (1994): Das Konzept der Schlüsselqualifikationen. Ansätze,<br />
Kritik und konstruktivistische Neuorientierung auf der Basis der<br />
Erkenntnisse der Wissenspsychologie. Dissertation an der Hochschule<br />
St. Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften.<br />
Hallstadt: Rosch-Buch.<br />
EUROPÄISCHE KOMMISSION (1997): Europa verwirklichen durch die<br />
allgemeine und berufliche Bildung. Bericht der Studiengruppe<br />
allgemeine und berufliche Bildung. Luxemburg: Amt für amtliche<br />
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft.<br />
FERCHHOFF, W. & KURZ, T. (1994): Jugend, Beruf und Gesellschaft. Zur<br />
Ausdifferenzierung der Berufsrollen in der modernen Gesellschaft.<br />
In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik,<br />
Heft 4, 478-498.<br />
GEIßLER, K. (1990): Der falsche Glanz des goldenen Schlüssels – Zur<br />
Kritik des Schlüsselqualifikationskonzeptes. Manuskript des Vortrages<br />
am 16.03.1990 zum Tag der Beruflichen Bildung in Koblenz.<br />
München.<br />
GREINERT, W.-D. (1998): Das „deutsche System“ der Berufsausbildung.<br />
Tradition, Organisation, FUNKTION. 3., ÜBERARB. AUFL.<br />
BADEN-BADEN: NOMOS.<br />
HERZ, Th. A. (1989): Einstellung zu Beruf und Postmaterialismus unter<br />
Jugendlichen. In: MARKEFKA, M. & NAVE-HERZ, R. (Hrsg.),<br />
Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Bd. 2: Jugendforschung.<br />
Neuwied, 591-606.<br />
33
KUHLEE, D. (2000): Nationale Berufsbildungssysteme im Vergleich – ausgewählte<br />
Beispiele zwischen Staat und Markt. Diplomarbeit am<br />
Institut für Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik der Humboldt-<br />
Universität zu <strong>Berlin</strong>. <strong>Berlin</strong> (Oktober 2000).<br />
LAUR-ERNST. U. (2000): Flexibility and Standardization - no<br />
Contradiction: Innovations in the German Vocational Education and<br />
Training System. In: LAUR-ERNST, U. & KING, J. (Eds.), In Search<br />
of World Class Standrads in Vocational Education and Training. A<br />
US-German Dialogue on Skill Standards in two emerging fields:<br />
Information Technologiy and Environmental and Processing<br />
Technology. Bundesinstitut für Berufsbildung. Bonn<br />
(Sonderveröffentlichung).<br />
LANDSBERG, G. VON & WEIß, R. (Hrsg.): Bildungscontrolling (2. über<br />
arbeitete Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.<br />
LEHMANN, R. H., PEEK, R. u.a. (2000): QuaSUM. Quallitätsuntersuchung<br />
an Schulen zum Unterricht in Mathematik. Ergebnisse einer repräsentativen<br />
Untersuchung im Land Brandenburg. Ministerium für<br />
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Potsdam.<br />
LEMPERT, W. (1995): Das Märchen vom unaufhaltsamen Niedergang des<br />
„Dualen Systems“. In Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik.<br />
Heft 3, 357-372.<br />
MAYER, K. U. (1996): Ausbildungswege und Berufskarrieren. In: BUN-<br />
DESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (Hrsg.): Forschung im<br />
Dienste von Praxis und Politik. Dokumentation der Festveranstaltung<br />
zum 25jährigen Bestehen des Bundesinstituts für Berufsbildung am<br />
7. und 8. September 1995. Bielefeld: Bertelsmann, 113-145.<br />
MERKENS, H. (2001): Berufsbildungsforschung in der Jugendforschung.<br />
In: BUER, J. VAN, KELL, A. & WITTMANN, E. (Hrsg.), Berufsbildungsforschung<br />
in ausgewählten Wissenschaften und multidisziplinären<br />
Forschungsbereichen. Frankfurt a. M.: Lang, 127-153.<br />
MÖNNICH, I. & WITZEL, A. (1994): Arbeitsmarkt und Berufsverläufe<br />
junger Erwachsener. Ein Zwischenergebnis. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung<br />
und Erziehungssoziologie. Heft 2, 262-277.<br />
OECD (2001): Bildungspolitische Analyse - Bildung und berufliche Qualifikationen.<br />
Center for Educational Research and Innovation (CERI).<br />
Paris.<br />
ROLOFF, J. (2000): Die demografische Entwicklung in den Bundesländern<br />
Deutschlands. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.<br />
Wiesbaden. Heft 100.<br />
SEEBER, S. (2000): Stand und Perspektiven von Bildungscontrolling.<br />
In: SEEBER, S., KREKEL, E. M. & BUER, J. VAN (Hrsg.), Bildungscontrolling.<br />
Ansätze und kritische Diskussionen zur Effizienzsteigerung<br />
von Bildungsarbeit. Frankfurt a. M.: Lang, 19-50.<br />
SEEBER, S., KREKEL, E. M. & BUER, J. VAN (Hrsg.): Bildungscontrolling.<br />
Ansätze und kritische Diskussionen zur Effizienzsteigerung von<br />
Bildungsarbeit. Frankfurt a. M.: Lang.<br />
34
SEITZ, H. (2001): Demografischer Wandel und Infrastrukturaufbau in<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg bis 2010/2015: Herausforderungen für eine<br />
strategische Allianz der Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg. Gutachten<br />
erstellt im Auftrag der Vereinigung der Unternehmensverbände in<br />
<strong>Berlin</strong> und Brandenburg e.V. Europa-Universität. Frankfurt/Oder.<br />
STENDER, J. (1997): Berufsverlauf und Weiterbildung junger Fachkräfte.<br />
Bochum: Schallwig<br />
SQUARRA, D. & HÖPPNER, Y. (2001): Modularisierung in MDQM. In:<br />
VAN BUER, BADEL u. a. (20001), Lernschwache und<br />
marktbenachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung.<br />
Abschlussbericht zum Modellversuch „Modulare Duale Qualifizie<br />
rungs Maßnahme (MDQM)“. Studien zur Wirtschaftspädagogik und<br />
Berufsbildungsforschung aus der Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong>.<br />
Band 2.1 (erscheint im Oktober 2001).<br />
WEBER, S. (1998). Zur interkulturellen Kompetenz im Wirtschaftslehreunterricht.<br />
In: WITTMANN, E. & BUER, J. VAN (Hrsg.), WITTMANN,<br />
E. & BUER, J. VAN (Hrsg.) (1998): Schlüsselqualifikationen zwischen<br />
bildungspolitischem Anspruch, wissenschaftlicher Grundlegung<br />
und wissenschaftsadäquater Umsetzung. Studien zur Wirtschafts-<br />
und Erwachsenenpädagogik aus der Humboldt-Universität<br />
zu <strong>Berlin</strong>. Bd. 18. <strong>Berlin</strong>, 49-63.<br />
WEIß, R. (1999): Cost-benefit analysis of vocational and in-company<br />
education and training. In: SEEBER, S. & BUER, J. van (EDS.),<br />
Control of educational processes – economic and educational perspectives.<br />
Studies in business and Adult Education. Vol. 20.2.<br />
Humboldt-University. <strong>Berlin</strong>, 125-138.<br />
WITT, R. (1996): Meta-Wissen für den Umgang mit Fachwissen in einer<br />
wissensförmigen‘ kaufmännischen Berufspraxis. In: BECK, K.,<br />
MÜLLER u. a. (Hrsg.), Berufserziehung im Umbruch. Didaktische<br />
Herausforderungen und Ansätze zu ihrer Bewältigung. Weinheim:<br />
Deutscher Studienverlag.<br />
WITTHAUS, U. (1996): Bildungssystem und Beschäftigungssystem – Konsequenzen<br />
für schulisches Lernen aus den Veränderungen gesellschaftlicher<br />
Arbeit. In: HELSPER, W., KRÜGER, H. & WENZEL, H.<br />
(Hrsg.), Schule und Gesellschaft im Umbruch. Bd. I: Theoretische<br />
und internationale Perspektiven. Weinheim, 405-426.<br />
WITTMANN, E. (2000): Zum Umgang von kaufmännische Auszubildenden<br />
mit kundenkommunikativen Qualifikationsanforderungen. Eine<br />
empirische Untersuchung zum Einfluß betrieblicher Ausbildungsbedingungen<br />
im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/Bankkauffrau.<br />
Dissertation an der Philosophischen Fakultät IV der Humboldt-<br />
Universität <strong>Berlin</strong>. <strong>Berlin</strong>.<br />
WITTMANN, E. & BUER, J. VAN (Hrsg.) (1998): Schlüsselqualifikationen<br />
zwischen bildungspolitischem Anspruch, wissenschaftlicher Grundlegung<br />
und wissenschaftsadäquater Umsetzung. Studien zur Wirtschafts-<br />
und Erwachsenenpädagogik aus der Humboldt-Universität<br />
zu <strong>Berlin</strong>. Bd. 18. <strong>Berlin</strong>.<br />
WOTTAWA, H. & THIERAU, H. (1990): Lehrbuch Evaluation. Bern,<br />
Stuttgart, Toronto.<br />
35
Grußwort<br />
Staatssekretär Dr. F.-W. Dopatka<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales<br />
und Frauen<br />
36<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
der <strong>Berlin</strong>er Senat und die Senatsverwaltung<br />
für Arbeit, Soziales und Frauen freuen sich,<br />
dass diese Tagung heute stattfindet und<br />
dass Sie sich Zeit genommen haben, an dieser<br />
Veranstaltung teilzunehmen.<br />
Ein Blick zurück auf die 90er Jahre erweckt den Eindruck, als hätten die<br />
Bemühungen um die Bewältigung des Ausbildungsplatzmangels die Fragen<br />
der qualitativen und strukturellen Weiterentwicklung der Berufsausbildung<br />
aus dem Blickfeld der Berufsbildungspolitik – bundesweit und in <strong>Berlin</strong> –<br />
verdrängt. Die Meldungen der Geschäftsstatistik der Bundesanstalt für<br />
Arbeit über das quantitative Verhältnis von Ausbildungsstellenangebot und<br />
-nachfrage hatten in der Diskussion über die Berufsausbildung einen dominierenden<br />
Platz eingenommen.<br />
Nun ist durchaus verständlich, dass in der Zeit des akuten Ausbildungsplatzdefizits,<br />
das vielfach auch als Ausdruck der Krise der dualen Berufsausbildung<br />
gedeutet wurde, die Strategien, Konzepte und Maßnahmen zur<br />
Ausweitung des Ausbildungsplatzangebots im Mittelpunkt der Berufsbildungspolitik<br />
stehen. Das war in den frühen 80er Jahren in der Zeit des<br />
„Schülerberges“ im ehemaligen West-<strong>Berlin</strong> der Fall und hat sich in den<br />
90er Jahren im nunmehr vereinten <strong>Berlin</strong> als Folge des wirtschaftsstrukturellen<br />
Wandels und des demographisch bedingten „Hochs“ der Ausbildungsplatznachfrage<br />
wiederholt. Die zeitweilige und situationsabhängige<br />
Dominanz der quantitativen Fragen der Versorgung der Schulabgänger mit<br />
Ausbildungsplätzen bedeutete jedoch nicht, dass die Herausforderungen<br />
zur Gewährleistung der Ausbildungsqualität in den Hintergrund treten.<br />
Im Gegenteil, die Einflussnahme auf hohe Qualitätsstandards in der Berufsausbildung<br />
hat in der <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik einen hohen Stellenwert.<br />
Es hat sich nämlich sehr bald gezeigt, dass die Maßnahmen zur Bewältigung<br />
des Ausbildungsplatzmangels, wie z.B. die Gewinnung von Ausbildungsbetrieben,<br />
sehr eng mit der Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit<br />
der Betriebe und mit der Gewährleistung der Qualitätsstandards in den Ausbildungsstätten<br />
verflochten sind.<br />
Ich möchte an dieser Stelle nicht ausführlich auf die aus meiner Sicht noch<br />
nicht befriedigend beantwortete Frage eingehen, wodurch die Qualität der<br />
Berufsausbildung eigentlich bestimmt wird, welches die verschiedenen<br />
Aspekte und Einflussfaktoren der Qualität sind und wie man sie messen<br />
kann. Dies ist ein Thema, das eine gesonderte Fachtagung rechtfertigen<br />
würde.<br />
Nur vielleicht soviel dazu:<br />
Meiner festen Überzeugung nach ist dies nicht eine Frage des Geldes, sondern<br />
zunächst einmal eine Frage der Information und der Bewältigung von<br />
Informationen, und übrigens auch eine Frage der Zuneigung und der Ver-
antwortung gegenüber den jungen Leuten, um die es ja doch im Wesentliche<br />
geht.<br />
Ich stimme mit Herrn Prof. van Buer vollkommen darüber ein, dass es keine<br />
fertigen Antworten gibt, dass es aber auch keinen Grund gibt, in Kulturpessimismus<br />
zu verfallen, sondern dass es sehr viel mehr Anlass gibt, durch<br />
Vergleiche, durch Beobachtungen und durch empirische Belege zu einer<br />
Weiterentwicklung des Berufsbildungssystem zu kommen – ein Bildungssystem<br />
das ja auch sehr nachgefragt ist.<br />
Für die <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik galt es, eher pragmatisch ausgerichtete<br />
Konzepte zur Verbesserung der Ausbildungsqualität zu verfolgen. In<br />
diesem Sinne wurde Ausbildungsqualität interpretiert als Komplex von Bedingungen<br />
und Mindestanforderungen, die für die Vermittlung und Aneignung<br />
der in den Ausbildungsordnungen enthaltenen Ziele und Inhalte erfüllt<br />
sein müssen und den Erwerb umfassender beruflicher Handlungskompetenz<br />
und eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen.<br />
Zu diesen Bedingungen gehören in erster Linie die fachliche und berufspädagogische<br />
Befähigung der Ausbilderinnen und Ausbilder und die materielltechnische<br />
und sächliche Ausstattung der Ausbildungsstätten. Die Notwendigkeit<br />
hierzu ist in dem Beitrag von Prof. van Buer bereits angeklungen.<br />
Ich selbst bin kein Theoretiker dieses Berufsbildungssystems. Ich habe allerdings<br />
den Vorteil, dass ich schon einmal Lehrlingsverträge unterschrieben<br />
und selbst ausgebildet habe.<br />
Die Förderung der Ausbildungsqualität sollte sich meiner Auffassung nach<br />
auf zwei Schwerpunkte konzentrieren:<br />
Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der Ausbilderinnen und<br />
Ausbilder<br />
Technischer Wandel, veränderte Arbeitsorganisation und höhere Qualitätsanforderungen<br />
in der Arbeitswelt führen zu neuen bzw. modifizierten Zielen<br />
und Inhalten der Berufsausbildung, zu neuen Medien, neuen Methoden der<br />
Vermittlung und Aneignung von beruflichen Kenntnissen und Kompetenzen<br />
und neuen Organisationsformen der Ausbildung und auch zu erweiterten<br />
Anforderungen an die Ausstattung der Ausbildungseinrichtungen. Die verstärkte<br />
Vermittlung und Aneignung fachübergreifender Schlüsselqualifikationen<br />
und überfachlicher Kompetenzen, auf die es unter den neuen Arbeitsbedingungen<br />
besonders ankommt, erfordern beispielsweise moderne pädagogische<br />
Konzepte wie handlungsorientiertes und ganzheitliches Lernen.<br />
Sie sind mit hohen Anforderungen an die fachliche und berufspädagogische<br />
Befähigung des Ausbildungspersonals verbunden. Das gilt auch für die<br />
bewusste Ausschöpfung jener Flexibilitätsspielräume im Ausbildungsprozess<br />
vor Ort, die in den Ausbildungsordnungen im Interesse einer höheren<br />
beruflichen Disponibilität der ausgebildeten Fachkräfte angelegt sind.<br />
Die erfolgreiche Überführung all dieser qualitativ neuen Anforderungen in<br />
die Berufsbildungspraxis bedarf der Vermittlung durch das Ausbildungsper-<br />
37
sonal. Der Erwerb, die Festigung der vorhandenen und die permanente Erweiterung<br />
der fachlichen, fachübergreifenden und berufspädagogischen<br />
Qualifikation der Ausbilderinnen und Ausbilder ist dafür eine unverzichtbare<br />
Voraussetzung. Sie ist deshalb fester Bestandteil der Qualifizierungspolitik<br />
des Senats von <strong>Berlin</strong> und wird seit Bestehen des Landesprogramms zur<br />
Förderung der Berufsausbildung im Land <strong>Berlin</strong> finanziell gefördert. In den<br />
Jahren von 1991 bis 2000 wurden im Rahmen des Förderprogramms des<br />
Senats insgesamt rd. 4.600 Anträge auf Bezuschussung von Maßnahmen<br />
zur Aus- und Weiterbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern in <strong>Berlin</strong>er<br />
Unternehmen bewilligt. Dafür wurden Landesmittel in Höhe von insgesamt<br />
rd. 7 Mio. DM aufgewandt.<br />
Förderung der Verbundausbildung als Hauptweg zur Verbesserung<br />
der Ausbildungsqualität und Ausbildungsfähigkeit<br />
Im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels kam es in <strong>Berlin</strong> zu einem<br />
dramatischen Abbau von Ausbildungsplätzen, von dem besonders die traditionell<br />
stark vertretenen Metall- und Elektroberufe betroffen waren.<br />
Schmerzhaft war dabei, dass es sich bei diesen Berufen um qualitativ hochwertige<br />
Ausbildungsplätze in gut ausgestatteten Ausbildungswerkstätten mit<br />
erfahrenen und qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbildern handelte. Neue<br />
Ausbildungsplätze entstanden dagegen vornehmlich in Klein- und Mittelbetrieben<br />
(KMU) mit z.T. engen Spezialisierungen und i.d.R. geringen Ausbildungserfahrungen,<br />
was sich in sehr vielen Fällen als ein ernstes Ausbildungshemmnis<br />
erwies.<br />
Daraus leitete sich das bildungspolitische Ziel ab,<br />
● die vorhandenen Ausbildungskapazitäten in den traditionellen<br />
Ausbildungsberufen und die dort konzentrierte pädagogische<br />
Erfahrung und Kompetenz für die Berufsausbildung in <strong>Berlin</strong> zu<br />
erhalten und<br />
● die Ausbildungsfähigkeit der KMU zu entwickeln und die geforderte<br />
Ausbildungsqualität sicherzustellen.<br />
Das Instrument, das mit diesem Ziel eingesetzt wurde, war das Instrument<br />
der Ausbildung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und der Ausbildung<br />
im zwischenbetrieblichen Ausbildungsverbund.<br />
Es ist seit 1978 bis heute elementarer Bestandteil des Programms zur Förderung<br />
der betrieblichen Berufsausbildung im Land <strong>Berlin</strong>.<br />
In der Zeit von 1991 bis 2000 wurden insgesamt etwa 2.100 Plätze mit einem<br />
Gesamtbetrag von rd. 22,7 Mio. DM gefördert (darunter 130 Plätze und<br />
Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio. DM im Rahmen der Sonderförderung<br />
der Verbundausbildung in der <strong>Berlin</strong>er Metall- und Elektroindustrie).<br />
Die Förderung der Verbundausbildung hat seit ihrem Bestehen mehrere<br />
markante qualitative Entwicklungsabschnitte erfahren.<br />
Ab Mitte der 90er Jahre wurde es z.B. erforderlich, neue Wege in der Berufsbildungspolitik<br />
zu gehen. Um den Substanzverlust an Ausbildungsplätzen<br />
in den Großbetrieben zu kompensieren, mussten KMU – darunter häufig<br />
junge und neugegründete Unternehmen ohne Ausbildungserfahrung - in<br />
38
größerem Umfang an die betriebliche Berufsausbildung herangeführt werden.<br />
Dies war jedoch bei einem Festhalten an der Beschränkung der<br />
Förderung auf betriebliche Kooperationsmodelle nicht zu leisten. Vielmehr<br />
galt es, KMU auch mit erfahrenen Trägern oder schulischen Einrichtungen<br />
in regionalen und branchenbezogenen Verbünden unter Nutzung unterschiedlicher<br />
innovativer Verbundkonstruktionen zusammenzuführen. Diese<br />
konzeptionelle Neuorientierung wurde 1997 verwirklicht.<br />
Etwa zu gleicher Zeit wurde auch in den Bund-Länder-Sonderprogrammen<br />
zur Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze für unvermittelte Ausbildungsplatzbewerber/-innen<br />
ein Systemwechsel vollzogen. So wurde von<br />
1997 an von der Förderung ausschließlich außerbetrieblicher Ausbildungsplätze<br />
abgegangen und der Maßnahmenkatalog vornehmlich auf Ausbildungsangebote<br />
in wirtschaftsnahen, branchenorientierten sowie regionalen<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong>n ausgerichtet.<br />
In der Folge stieg die Zahl der Ausbildungsplätze in <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n<br />
steil an. In den Jahren von 1997 bis 2000 wurden insgesamt rd. 8.700 zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze in wirtschaftsnahen, branchenbezogenen und<br />
regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n sowie in der Lernortkooperation zwischen<br />
Oberstufenzentren und wirtschaftsnahen Trägern zur Verfügung gestellt.<br />
Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 96 Mio. DM<br />
bereitgestellt.<br />
Die Wirkung dieses Paradigmenwechsels blieb jedoch nicht allein auf den<br />
Entlastungseffekt des <strong>Berlin</strong>er Ausbildungsstellenmarktes beschränkt. Die<br />
Kooperation von Bildungsträgern, Berufsschulen und Betrieben eröffnete<br />
zugleich völlig neue Perspektiven für die Verbesserung der Ausbildungsqualität.<br />
Die Möglichkeit der Übertragung des bei erfahrenen Trägern akkumulierten<br />
berufspädagogischen Wissens und entsprechender Ausbildungserfahrung<br />
erwies sich für viele Betriebe als wertvolle Hilfestellung und<br />
Unterstützung in allen Fragen der Organisation und Durchführung der Berufsausbildung<br />
und eröffnete zahlreichen KMU erst die Möglichkeit, sich an<br />
der Berufsausbildung zu beteiligen.<br />
Ein qualitativ neuer Entwicklungsabschnitt in der Ausprägung und Intensivierung<br />
kooperativer Formen der Berufsausbildung wurde schließlich mit<br />
der Implementierung des <strong>Netzwerk</strong>es <strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
<strong>Berlin</strong> eingeleitet.<br />
Damit wurde ein neuer strategischer Ansatz zur Schaffung von zusätzlichen<br />
betrieblichen Ausbildungsplätzen und für die Entwicklung der Ausbildungsqualität<br />
entsprechend den Anforderungen geschaffen, die von der seit 1997<br />
beständig gestiegenen Zahl modernisierter bzw. völlig neu geschaffener<br />
Ausbildungsberufe ausging.<br />
Inzwischen sind regionale <strong>Ausbildungsverbünde</strong> in allen <strong>Berlin</strong>er Bezirken<br />
etabliert. Leitträger wirken hier als Dienstleister für die Akquisition von Betrieben,<br />
für die Gestaltung von Verbundkonzepten und für die Anpassung<br />
und Veränderung betrieblicher Arbeits- und Organisationsstrukturen, die<br />
sich aus der Einbeziehung eigener Berufsausbildung bzw. aus der Beteili-<br />
39
gung an <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n ergeben. Sie unterstützen die Kooperationsbetriebe<br />
bei der Planung und Organisation der Berufsausbildung.<br />
Dieser Ansatz wird mit Hilfe des <strong>Netzwerk</strong>es mit dem Ziel weiterentwickelt,<br />
durch Erfahrungs- und Informationsaustausch weitere Synergieeffekte u.a.<br />
für die<br />
● Entwicklung, Abstimmung und Koordination von Maßnahmen zur<br />
Installierung zusätzlicher Verbundausbildungsplätze in <strong>Berlin</strong>er<br />
Betrieben,<br />
● Entwicklung von Qualitätsstandards in der Verbundausbildung,<br />
zu erschließen.<br />
Ausblick<br />
Die Ergebnisse bisher zeigen, dass sich die Verbundausbildung in der Doppelfunktion,<br />
zur Erschließung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplatzkapazitäten<br />
und zur permanenten Verbesserung der Ausbildungsqualität beizutragen,<br />
als ein innovatives und effektives Instrument erwiesen hat.<br />
Unter den aktuellen wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen wird die<br />
Stabilisierung und Ausweitung der Verbundausbildung auch künftig ein<br />
Schwerpunkt in der <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik bleiben.<br />
Nach dem IAB-Betriebspanel <strong>Berlin</strong> 2000 verfügen 54 % der Betriebe über<br />
die Ausbildungsberechtigung, aber nur 24 % aller <strong>Berlin</strong>er Unternehmen beteiligen<br />
sich an der Berufsausbildung. Besonders zugespitzt ist dabei die Situation<br />
in den kleineren Unternehmen mit einer Zahl von 1 bis 19 Beschäftigten.<br />
Hier sind es nur 15 % aller Betriebe in dieser Größengruppe, die<br />
selbst ausbilden.<br />
Das bedeutet: Das zur Verbesserung der Versorgungssituation dringend benötigte<br />
Ausbildungspotenzial muss vorwiegend in den KMU erschlossen<br />
werden. Existenzgründer, Betriebe, die zuvor noch nicht ausgebildet haben,<br />
vor allem junge Unternehmen in Wachstumsbranchen müssen systematisch<br />
an die eigene Berufsausbildung herangeführt werden. Dabei besteht die<br />
Schwierigkeit, dass diese Unternehmen oft nicht die komplette Ausbildung<br />
durchführen können, wie sie die jeweiligen Ausbildungsordnungen vorgeben.<br />
Diese Defizite können aber in Kooperation mit anderen Betrieben, mit Leitbetrieben<br />
oder Leitträgern kompensiert werden. Das nutzt den Verbundpartnern,<br />
die so in die Lage versetzt werden, junge Fachkräfte entsprechend ihres konkreten<br />
Bedarfs ausbilden zu können. Es profitieren aber auch die Auszubildenden,<br />
die eine breiter gefächerte moderne Ausbildung erhalten.<br />
Diese Zusammenhänge verdeutlichen: Die Vertiefung und Weiterentwicklung<br />
von Modellen der regionalen bzw. lokalen Ausbildungskooperation ist<br />
weiterhin eine Grundvoraussetzung für die mittelfristige Schaffung eines unter<br />
quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten ausreichenden, von der<br />
Wirtschaft selbst getragenen betrieblichen Ausbildungsplatzangebots.<br />
Sie bestimmt daher auch für die kommenden Jahre die strategische Ausrichtung<br />
der <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik.<br />
In die Überlegungen zur Weiterentwicklung der regionalen Ausbildungsko-<br />
40
operation müssen allerdings neue<br />
Entwicklungen und neue Anforderungen<br />
in der Berufsausbildung<br />
beachtet und einbezogen werden.<br />
Die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“<br />
im Bündnis für Arbeit,<br />
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit<br />
hat inzwischen eine breite Palette<br />
von Reformvorschlägen zur<br />
Modernisierung der Berufsausbildung<br />
erarbeitet und Beschlüsse gefasst,<br />
die auch für die <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik,<br />
vor allem auch<br />
für die Verbesserung der Ausbildungsqualität<br />
orientierenden Charakter<br />
haben.<br />
Wir können davon ausgehen, dass<br />
die Vorschläge zur Flexibilisierung und Differenzierung der Berufsausbildung<br />
Veränderungen bewirken, die auch die Grundrichtung der<br />
Weiterentwicklung der regionalen Kooperation in der beruflichen Aus- und<br />
Weiterbildung beeinflussen werden.<br />
Beispielsweise werden künftig verstärkt neue oder modernisierte, differenziert<br />
und flexibel gestaltete Ausbildungsberufe angeboten, die in der Ausbildung<br />
vor Ort flexibler handhabbar sind und mehr Gestaltungsspielräume für<br />
die Anpassung an den Qualifikationsbedarf der Betriebe an neue technische<br />
Entwicklungen sowie an die Leistungsvoraussetzungen der Auszubildenden<br />
ermöglichen. Dies bietet jungen Unternehmen Möglichkeiten und Chancen<br />
für die eigene Berufsausbildung, ist aber zugleich mit höheren Anforderungen<br />
an die Gestaltung der Ausbildung und an die berufspädagogische Befähigung<br />
der Ausbilderinnen und Ausbilder verbunden.<br />
Dies gilt auch für den Einsatz<br />
● neuer Ordnungskonzepte, die eine Kombinierbarkeit von Wahlpflicht-<br />
und Wahlbausteinen oder die Erweiterung des Ausbildungsspektrums<br />
durch Zusatzqualifikationen vorsehen,<br />
● neuer Formen des Wissens- und Kompetenzerwerbs, die auf eine<br />
größere Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Auszubildenden<br />
hinzielen.<br />
Konsequenzen, die sich daraus für die Weiterentwicklung der regionalen<br />
Ausbildungskooperation ergeben, zeichnen sich bereits in einzelnen regionalen<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong>n ab.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
v. l. n. r. N. Bücker, Prof. Dr. Dr. J. van Buer, Dr. F.-W. Dopatka, R. Rilling<br />
erst vor wenigen Tagen hatten wir in <strong>Berlin</strong> eine Veranstaltung zur Frage der<br />
„Zertifizierung“. Dieses Thema wurde auch bereits im Vortrag von Professor<br />
van Buer angesprochen.<br />
41
Die Entwicklung und die Anwendung modularer Qualifizierungsbausteine in<br />
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, deren Zertifizierung und Dokumentierung<br />
(wie sie in <strong>Berlin</strong> mit dem Qualifizierungspass angestrebt wird)<br />
sowie die Nutzung von Zusatzqualifikationen für die Entwicklung differenzierter,<br />
zwischen den Verbundpartnern abgestimmter Ausbildungskonzepte<br />
und das Angebot der umfassenden Ausbildungsbegleitung für die Kooperationsbetriebe<br />
durch Leitbetriebe/Leitträger werden als innovative Elemente<br />
in die Verbundausbildung eingebracht. Diese Elemente müssen künftig ausgebaut<br />
werden. Sie ermöglichen es, mit den Verbundpartnern – und weiteren<br />
Betrieben des Standortes, die als potenzielle Partner in Frage kommen<br />
– „maßgeschneiderte“, mit dem Qualifikationsbedarf und den Ausbildungsmöglichkeiten<br />
der Kooperationspartner abgestimmte Ausbildungen zu<br />
entwickeln.<br />
Die von den Partnern im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit<br />
entwickelten Zielorientierungen, wie die definitive Ausrichtung der<br />
Berufsausbildung auf die Erlangung von Beschäftigungsfähigkeit, die Verbesserung<br />
der Arbeitsmarktverwertbarkeit und die flexible und differenzierte<br />
Handhabung vor Ort, finden auf diese Weise eine regionalspezifische Umsetzung<br />
und Ausprägung.<br />
Diese neuen Möglichkeiten erweitern die traditionelle Rolle und Funktion<br />
der Leitbetriebe/Leitträger als Hilfestellung gebender Partner der Kooperationsbetriebe<br />
beim Einstieg sowie bei der Planung und Durchführung der<br />
Berufsausbildung.<br />
Es ist abzusehen, dass sich die Leitbetriebe/Leitträger zu leistungsfähigen<br />
Bildungsdienstleistern profilieren werden und sich auch zu regionalen Zentren<br />
für Bildungsinnovationen und -transfer entwickeln können.<br />
Ich sehe das „Verbundmanagement“ und die umfassende Begleitung und<br />
Unterstützung der Kooperationsbetriebe in allen Fragen der beruflichen<br />
Aus- und Weiterbildung durch regionale Kompetenzzentren als Schlüssel<br />
nicht nur für die Schaffung eines Potenzials künftiger Ausbildungsbetriebe<br />
in <strong>Berlin</strong>, sondern auch für die Verbesserung der Ausbildungsqualität an.<br />
Ein sehr interessanter Nebeneffekt ist in diesem Zusammenhang auch der<br />
positive Einfluss, der von der Heranbildung bedarfsgerecht qualifizierter<br />
Fachkräfte auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausgeht. Hier deutet<br />
sich an, welche Potenzen Leitbetriebe/Leitträger als Bildungsdienstleister<br />
für die Standortentwicklung haben können. Diese Potenzen durch die<br />
enge Verzahnung von beruflicher Bildung und <strong>Regionale</strong>ntwicklung zielstrebig<br />
zu erschließen, halte ich im Hinblick auf die Bewältigung des wirtschaftlichen<br />
Strukturwandels in <strong>Berlin</strong> für sehr wichtig. Dabei ist es von Vorteil, auf<br />
regionalen oder branchentypischen Bezügen aufzubauen. Das können z.B.<br />
bestehende Kunden- und Zulieferbeziehungen oder betriebliche Verbünde<br />
innerhalb von Gewerbe- und Technologiezentren sein.<br />
Hiermit bietet sich im Übrigen ein interessantes Themenfeld für den Erfahrungsaustausch<br />
im Rahmen des <strong>Netzwerk</strong>es <strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
<strong>Berlin</strong> an.<br />
Wegen der Bedeutung, die die Verbundausbildung für die Vermittlung von<br />
42
eruflichen Kenntnissen und Kompetenzen in Übereinstimmung mit dem<br />
Qualifikationsbedarf und den Qualifikationsanforderungen sowie für die<br />
Ausnutzung der in den Betriebe vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten<br />
hat, wird die Weiterentwicklung kooperativer Formen der Ausbildung - trotz<br />
aller Sparzwänge – auch künftig ein Schwerpunkt der Förderung der<br />
Berufsausbildung im Land <strong>Berlin</strong> sein.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
vorerst bedanke ich mich für die Einladung<br />
der SPI ServiceGesellschaft und die damit<br />
verbundene Gelegenheit, in Vertretung für<br />
den Referatsleiter des Referats Arbeitsmarkt-<br />
und Berufsbildungspolitik der Senatsverwaltung<br />
für Arbeit, Soziale und Frauen<br />
des Landes <strong>Berlin</strong>, Herrn Schulz-Hofen, einiges<br />
zum Themenfeld der Beruflichen Bildung<br />
vortragen zu dürfen.<br />
Das Thema, dem ich mich heute hier stelle,<br />
lautet: „Welche ausbildungsrelevanten<br />
strukturellen Entwicklungen und Heraus-<br />
Impulsreferat<br />
forderungen lassen sich für den Wirtschaftsraum <strong>Berlin</strong>-Brandenburg<br />
erkennen ?“<br />
Ich möchte Ihnen anhand der bestehenden Ausgangslage, die wir derzeit<br />
auf dem Ausbildungsstellenmarkt vorfinden, die sich daraus ableitenden<br />
Herausforderungen vorstellen. Ich hoffe, dass Sie den einzelnen Folien und<br />
auch dem Zahlenmaterial folgen können.<br />
Ausgangslage ist, dass die Nachfrage nach (betrieblichen) Ausbildungsplätzen<br />
im Wirtschaftraum <strong>Berlin</strong>-Brandenburg das Angebot weiterhin deutlich<br />
übersteigt.<br />
Zwar ist zuletzt die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen für<br />
<strong>Berlin</strong> nach Angaben des Landesarbeitsamtes <strong>Berlin</strong>-Brandenburg für den<br />
Monat Mai 2001 im Vergleich zum Vorjahr erneut (um 1,7 % auf 10.542) gestiegen,<br />
was beweist, dass die Wirtschaft weiterhin bemüht ist, ihrer Verpflichtung<br />
„betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen“, nach zu kommen.<br />
Diese Bemühungen reichen jedoch letztlich allein noch nicht aus.<br />
Die Entwicklung auf der Nachfrageseite stellt sich derzeit wie folgt dar:<br />
Welche ausbildungsrelevanten<br />
Strukturen Entwicklungen und<br />
Herausforderungen lassen sich für<br />
den Wirtschaftsraum <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg erkennen?<br />
Sebastian Fischer<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und<br />
Frauen<br />
Die Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in <strong>Berlin</strong><br />
im Jahr 2001 mit ca. 24.500 Jugendlichen vermutlich einen neuen Spitzenwert<br />
erreichen wird.<br />
Die Zahl der Schulabgänger/innen der allgemeinbildenden Schulen wird<br />
nach der aktualisierten Modellrechnung der SenSchulJugSport ebenfalls<br />
nochmals ansteigen (auf ca. 36.700).<br />
43
Insoweit gibt bereits die demographische Entwicklung auf der Nachfrageseite<br />
Anlass dazu, dass sich alle Beteiligten im Bereich der Beruflichen Bildung<br />
noch stärker als bislang darum bemühen, das Ziel zu erreichen, dass „jeder<br />
Jugendliche, der will und kann“, einen Ausbildungsplatz erhält.<br />
Bei der Entwicklung der Nachfrageseite nach Ausbildungsplätzen im Wirtschaftsraum<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg stellen sich dabei insbesondere für <strong>Berlin</strong><br />
folgende qualitative und strukturelle Besonderheiten dar:<br />
● Der Anteil von sog. „Altnachfragern“ ist unter den gemeldeten<br />
Bewerber/innen um einen Ausbildungsplatz zur Zeit besonders<br />
hoch und steigt in nächster Zeit noch an (auf ca. 10.600 = rd. 50 %<br />
der Gesamtnachfrager),<br />
● die Zahl der aus dem Umland einpendelnden Jugendlichen nimmt<br />
– insbesondere für <strong>Berlin</strong> – weiter zu; für 2001 wird damit gerechnet,<br />
dass sich ca. 3.400 Jugendliche aus dem Umland in <strong>Berlin</strong> um<br />
einen Ausbildungsplatz bewerben werden (rd. jeder 7. Nachfrager<br />
kommt damit aus dem Umland !),<br />
● rd. 15 % aller Schulabgänger/innen verlassen die allgemeinbildende<br />
Schule ohne einen Schulabschluss,<br />
● der Anteil ausländischer Jugendlicher an der Gesamtzahl aller<br />
Schulabgänger/innen (rd. 1 zu 8) ist für <strong>Berlin</strong> im Bundesvergleich<br />
vergleichsweise hoch; hier besteht eine besondere Aufgabe der<br />
Verzahnung von Sprachkenntnissen und (Aus-)Bildung.<br />
Demgegenüber ergeben sich auf der ausbildungsrelevanten Angebotsseite<br />
für den Wirtschaftsraum <strong>Berlin</strong>-Brandenburg die folgenden quantitativen sowie<br />
strukturellen bzw. qualitativen Besonderheiten, die entscheidenden Einfluss<br />
auf die Entwicklung der Situation der beruflichen Bildung haben:<br />
Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze in <strong>Berlin</strong> ist zuletzt stetig gestiegen,<br />
reicht jedoch – wie bereits eingangs erwähnt – immer noch nicht<br />
aus, um allen Jugendlichen einen betrieblichen Ausbildungsplatz anbieten<br />
zu können.<br />
Die Zahl der ausbildenden Betrieben muss noch weiter gesteigert werden !<br />
Von 100 % aller Betriebe in <strong>Berlin</strong> bilden 76 % derzeit nicht aus. Von den<br />
zur Ausbildung berechtigten 54 % Betrieben bilden nur 24 % tatsächlich<br />
aus; 30 % könnten noch ausbilden, wenn sie wollten. 46 % haben keine<br />
Ausbildungsberechtigung.<br />
Dabei ist zu erwähnen, dass mit zunehmender Betriebsgröße der Anteil der<br />
ausbildenden Betriebe in <strong>Berlin</strong> steigt: Bilden immerhin 55 % aller Großbetriebe<br />
(über 100 Arbeitnehmer/innen) aus, so bilden dagegen nur 15 % aller<br />
Kleinstbetriebe (1 bis 4 Arbeitnehmer/innen) aus.<br />
Auf die Auswirkungen dieser Besonderheiten (54 % der Kleinstbetriebe haben<br />
keine Ausbildungsberechtigung etc.) werde ich zu einem späteren Zeitpunkt<br />
im Rahmen der „Ausbildung im Verbund“ nochmals zu sprechen kommen.<br />
Die Region <strong>Berlin</strong>-Brandenburg befindet sich zur Zeit im wirtschaftlichen<br />
Umbruch und strukturellen Wandel.<br />
44
Der Weg <strong>Berlin</strong>s hin zu einer internationalen Metropole setzt sich fort. Stichworte,<br />
die in diesem Zusammenhang stets fallen, sind: Globalisierung, Europäisierung,<br />
Internationalität.<br />
Dienstleistungen, Technologien, Wissenschaftsstandorte werden weiterhin<br />
in verstärktem Maße für die Region gewonnen werden müssen, damit der<br />
Umbruch noch schneller gelingt, als bisher. Die notwendige Ansiedlung von<br />
„modernen Dienstleistungen“ ist hierbei das Schlagwort, das in diesem Zusammenhang<br />
in letzter Zeit – in der Sache treffend – oft verwendet wird.<br />
Der Weg für eine positive wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle<br />
Entwicklung <strong>Berlin</strong>s ist frei, er muss nur genutzt werden.<br />
Die Verzahnungen und Verflechtungen der Stadt <strong>Berlin</strong> zu seinem Umland<br />
sind fließend und werden sich weiter verstärken.<br />
Neben diesen allgemeinen Rahmenbedingungen bestehen derzeit speziell<br />
auf der Angebotsseite für den Ausbildungsstellenmarkt folgende Tendenzen:<br />
● Verschiebungen der Ausbildungszahlen in den einzelnen Kammerbereichen<br />
(beispielsweise Abnahme der Ausbildungsplatzzahlen im<br />
Handwerk aufgrund der Probleme im Baubereich)<br />
Allgemeiner Trend: Hin zu Dienstleistungen, neuen Technologien,<br />
neuen Medien. Hier liegen die zukünftigen Chancen.<br />
● Einerseits wird die Zahl der Schulabgänger/innen für die Zeit nach<br />
2005 langsam zurückgehen (s.o.); demgegenüber werden die<br />
Zahlen der Jahrgänge, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden,<br />
weiter steigen, mit der Folge, dass ein Fachkräftemangel für<br />
kommende Zeiten in bestimmten Bereichen (Beispiel: Maschinenbau,<br />
IT-Medien, hierzu: „Green-card“...) schon heute absehbar ist.<br />
● Durch Qualitätsanforderungen der Wirtschaft wird sich auf der<br />
Angebotsseite die Zahl der Arbeitsplätze für Ungelernte bis 2010<br />
auf die Hälfte reduzieren (lt. IAB-Studie = Institut für Arbeitsmarkt-<br />
und Berufsforschung),<br />
Aus den genannten Rahmenbedingungen/Tendenzen/Gegebenheiten mit<br />
den unterschiedlichsten Facetten der Ausgangslage lassen sich nun die<br />
notwendigen Handlungsspielräume und -notwendigkeiten für den Bereich<br />
der Beruflichen Bildung/Ausbildung ableiten.<br />
Als ganz besondere Herausforderung bedeutet dies, dass alle an der beruflichen<br />
Bildung Beteiligten (Kammern, Verbände, Gewerkschaften, die einzelnen<br />
Betriebe, die Wirtschaft, die Schulen, die Politik) unter den gesetzten<br />
Rahmenbedingungen Ausbildung gestalten müssen.<br />
Dies bedeutet auch: Eine qualitative Ausbildung unter den Vorgaben der<br />
quantitativen Einflussfaktoren (nach Angebot und Nachfrage), d.h. so viel<br />
Ausbildung, aber auch so gute Ausbildung, wie möglich.<br />
Dabei muss sich Ausbildung an den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Region<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg (Verstärkung von Dienstleistungen, Technologien,<br />
...) orientieren.<br />
45<br />
Wer keine<br />
Ausbildung hat,<br />
hat künftig immer<br />
weniger Chancen<br />
auf dem Arbeitsmarkt
Die regionalen<br />
Besonderheiten<br />
müssen als<br />
Chance begriffen<br />
werden<br />
Die Qualität der Ausbildung muss jedem Einzelnen individuelle Wege in der<br />
Berufsbildung ermöglichen. Hier darf es keine sog. „Sackgassen“ geben.<br />
Diese Ansätze bilden die Vorgaben für das Handeln der Politik, damit<br />
Lösungen, Modelle und Strukturen geschaffen werden, damit dem und der<br />
Einzelnen der Weg in eine qualitative Berufsbildung mit Zukunft gewährt<br />
werden kann.<br />
Es gibt dabei keinen sog. „goldenen Weg“, der alle Ansätze zugleich bedient.<br />
Dabei denke ich an die Vorgaben immer komplexer werdender Anforderungen<br />
innerhalb der anerkannten Ausbildungsberufe.<br />
Einzelne, teilweise kleine Einzelschritte und unterschiedliche Gehwege und<br />
Trampelpfade sind hier nötig, damit die Schere zwischen denen, die einen<br />
Ausbildungsplatz haben, und denen, die keinen haben, nicht immer größer<br />
wird.<br />
Damit meine ich Folgendes:<br />
Das, was heute sinnvolle Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf<br />
mit Blick auf spätere Beschäftigung im Beruf bedeutet, bedeutet noch<br />
lange nicht auch morgen Erfolg versprechende Ausbildung mit Beschäftigungssicherung.<br />
Hier ist mehr Beweglichkeit im Handeln und Denken gefragt. D.h.<br />
● Flexibilität in die Ausbildungsordnungen bringen und<br />
● im Betrieb bzw. so betriebsnah wie möglich auszubilden<br />
müssen hier die Prämissen sein.<br />
Eine wesentliche Herausforderung ist es dabei zuallererst – wie bereits<br />
schon eingangs angesprochen –, die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen<br />
mit einem entsprechenden betrieblichen Angebot zu decken.<br />
Ein Vorrang für die betriebliche Berufsausbildung besteht und wird von niemandem<br />
ernsthaft bezweifelt.<br />
Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze in <strong>Berlin</strong>-Brandenburg ist zuletzt<br />
stetig gestiegen, reicht jedoch bei weitem immer noch nicht aus, um allen<br />
Jugendlichen einen betrieblichen Ausbildungsplatz anbieten zu können.<br />
Da wir dieses Ziel in der Beruflichen Bildung trotz aller Bemühungen (Werbung<br />
bei der Wirtschaft und den Betrieben zur Schaffung weiterer Ausbildungsplätze,<br />
„Klinken putzen“ o.ä.) derzeit nicht erreichen, sind die unterschiedlichen<br />
Ansätze der Fördermaßnahmen/-instrumente gefragt:<br />
Dabei hilft nochmals ein Blick zurück:<br />
Ursprünglicher Ansatz für die Zeit ab 1990 war zunächst die Förderung (zusätzlicher)<br />
betrieblicher Ausbildungsplätze im Sinne einer Geld/Prämienförderung<br />
ausbildender Betriebe und die Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze.<br />
46
Eine Überprüfung der Effizienz der<br />
Förderungsinstrumente musste im<br />
Laufe der Zeit jedoch auf klassische<br />
Zielkonflikte stoßen. Sie führten<br />
langfristig nicht zu dem gewünschten<br />
Erfolg:<br />
Bei der Förderung zusätzlicher betrieblicher<br />
Ausbildungsplätze bestand<br />
nach einigen Jahren durchgehend<br />
die Gefahr der Verringerung<br />
der Ausbildungsleistung nicht geförderter<br />
Betriebe. Die Definition der<br />
„Zusätzlichkeit“ enthielt zwangsläufig<br />
Schwächen. Zudem war nicht zu ermitteln,<br />
welche zusätzlichen Ausbildungsplätze<br />
auch ohne Förderung<br />
entstanden wären. Mitnahmeeffekte der geförderten Betriebe waren darüber<br />
hinaus die Folge.<br />
Christian Joseph, SenASF Sebastian Fischer, SenASF<br />
Auf der anderen Seite war bei der Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze<br />
zu erkennen, dass die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze<br />
zwar gewährleistet wird, die Vorteile der Einbindung der Ausbildung<br />
in Betriebsabläufe aber weitgehend verloren gehen. Zugleich waren die<br />
Kosten mit 50.000,- DM bis 60.000,- DM pro Ausbildungsplatz zu hoch.<br />
Beide Instrumente waren deshalb nur für einen begrenzten Zeitraum effizient<br />
einsetzbar. Sie taugten mittelfristig – wie gesagt – nur begrenzt zur Erschließung<br />
neuer Ausbildungskapazitäten.<br />
Zu erkennen war darüber hinaus, dass der unmittelbare Arbeitsmarktbezug<br />
in der geförderten betrieblichen Berufsausbildung sowie in der außerbetrieblichen<br />
Berufsausbildung erheblich eingeschränkt war.<br />
Zwar handelte es sich auch bei der außerbetrieblichen Ausbildung um arbeitsmarktbezogene<br />
vollständige Berufsausbildungen in anerkannten Ausbildungsberufen<br />
mit unterschiedlichem Umfang der betrieblichen Bestandteile.<br />
Eine Übernahme in den Ausbildungsbetrieb erfolgte jedoch in der Regel<br />
auch in der subventionierten betrieblichen Berufsausbildung nicht, denn es<br />
wurden nur zusätzliche Ausbildungsplätze über den Eigenbedarf hinaus gefördert<br />
(andernfalls wurde eine Einschätzung des Ausbildungsbetriebes korrigiert<br />
oder das Subventionsziel verfehlt). In der außerbetrieblichen Berufsausbildung<br />
war ferner eine Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb nicht<br />
möglich.<br />
Seit 1997 gibt es deshalb in <strong>Berlin</strong> im Rahmen der Bund-Länder-Sonderprogramme<br />
keine außerbetriebliche Berufsausbildung mehr.<br />
47
Zudem wurde zuletzt – für <strong>Berlin</strong> im Jahr 2000 – beschlossen, die Förderung<br />
durch Prämien/Geldförderung (siehe Richtlinienförderprogramm für<br />
<strong>Berlin</strong>; Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze mit 3.000 DM ) degressiv<br />
auslaufen zu lassen.<br />
<strong>Berlin</strong> und Brandenburg konzentrieren sich heute in unterschiedlichen<br />
Ausprägungen in ihren Ausbildungsförderprogrammen auf eine<br />
● vollzeitschulische Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen<br />
bzw.<br />
● überwiegend auf die Berufsausbildung in <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n /<br />
Kooperationen.<br />
Als Förderinstrument hat sich dabei – wie bereits Herr StS Dr. Dopatka in<br />
seinem Vortrag ausgeführt hat – insbesondere die Verbundausbildung in ihrer<br />
Doppelfunktion zur Erschließung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungskapazitäten<br />
und zur permanenten Verbesserung der Ausbildungsqualität<br />
bewährt und sich dabei als ein innovatives und effektives Instrument erwiesen.<br />
Mit der Umgestaltung des „Bund-Länder-Sonderprogramm 1997“ in <strong>Berlin</strong><br />
wurde neben der Entwicklung wirtschaftsnaher, branchenbezogener <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
u.a. die Finanzierung der ersten regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
ermöglicht.<br />
<strong>Regionale</strong> Ausbildungsinitiativen bzw. regionale <strong>Ausbildungsverbünde</strong> spielen<br />
eine sehr wichtige Rolle bei der Erschließung betrieblicher Ausbildungsplätze<br />
im Bezirk. Sie nutzen die Chancen der Region.<br />
Sie tragen ferner dazu bei, eine neue Qualität von Arbeitsbeziehungen zwischen<br />
bezirklichen Akteuren (Bezirksamt, ortsansässigen Klein- und Mittelbetrieben,<br />
freien Trägern, Oberstufenzentren und Arbeitsamt) mit dem Ziel<br />
zu entwickeln, zusätzliche Ausbildungsplätze zu akquirieren.<br />
Sie bewirken u.a.:<br />
● Eine kurzfristige Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen,<br />
● mittelfristig das Heranführen von KMU an eigene Berufsausbildung,<br />
● die Vermittlung von Know-How; Organisationserleichterungen in<br />
der Ausbildung; Kosten-Nutzen-Optimierung von alle Beteiligten<br />
durch positive Synergieeffekte,<br />
● eine Qualitätsverbesserungen in der Ausbildung,<br />
● eine Attraktivitätserhöhung zur Ausbildung,<br />
● die Vermittlung von Sattelitenkompetenzen,<br />
● allgemeinen Zugewinn durch Austausch.<br />
In den meisten Fällen schließt ein Ausbildungsträger mit einem Auszubildenden<br />
einen Ausbildungsvertrag ab und führt die Berufsausbildung teilweise<br />
beim Träger und teilweise in einem kooperierenden Betrieb durch. Die Abschlussprüfung<br />
wird vor einem Prüfungsausschuss der Kammern abgelegt.<br />
Mit diesem Ansatz wird einem wesentlichen Ausbildungshemmnis entgegengewirkt:<br />
48
Viele Betriebe können wegen ihres begrenzten Geschäftsfeldes nicht alle<br />
Bestandteile der Ausbildungsordnung eines anerkannten Ausbildungsberufes<br />
abdecken. Durch die Kooperation mit Ausbildungsträgern können die<br />
fehlenden Teile ergänzt und damit unmittelbar zusätzliche Ausbildungsplätze<br />
erschlossen werden.<br />
Viele ausbildungsunerfahrene Betriebe scheuen den Organisationsaufwand,<br />
der mit der erstmaligen betrieblichen Berufsausbildung verbunden ist.<br />
Erfahrene Ausbildungsträger können den Betrieben diesen Aufwand abnehmen<br />
und sie über die Vorstufe der Verbundausbildung an die eigene Berufsausbildung<br />
heranführen.<br />
Während dieser Phase können die Betriebe auch feststellen, dass sich eigene<br />
Berufsausbildung für sie ökonomisch rechnet.<br />
Die Auszubildenden erwirtschaften vom 2. Ausbildungsjahr an – spätestens<br />
aber im 3. Ausbildungsjahr – positive Erträge. Fachkräfte, die ein Betrieb<br />
selbst ausgebildet hat, verfügen nach abgeschlossener Berufsausbildung<br />
über betriebsbezogene Kenntnisse und brauchen nicht eingearbeitet zu<br />
werden. Die Gefahr einer Fehleinschätzung bei der Einstellung von Fachkräften<br />
des externen Arbeitsmarkts entfällt, weil das Profil der selbst ausgebildeten<br />
Fachkräfte bekannt ist.<br />
Es hat sich gezeigt, dass die Erschließung weiterer Ausbildungsverhältnisse<br />
mit ortsansässigen Kleinst- und Kleinbetrieben nur mit einer hochprofessionellen<br />
langfristigen Strategie möglich ist.<br />
Gegenwärtig wird in allen <strong>Berlin</strong>er Bezirken ein umfassender Ansatz der regionalen<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong> durchgeführt. Die regionalen Verbünde werden<br />
in einem <strong>Netzwerk</strong> koordiniert.<br />
Die Bezirke haben darin Leitträger als Dienstleister für die Akquisition von<br />
Betrieben benannt, die die Gestaltung von Verbundkonzepten, die Anpassung<br />
und Veränderung betrieblicher Arbeits- und Organisationsstrukturen<br />
durch Einbeziehung eigener Berufsausbildung bzw. bei der Beteiligung an<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong>n sowie die Erweiterung von Geschäftsfeldern und die<br />
Konzipierung von Dienstleistungsmodulen für die betriebliche Berufsausbildung<br />
vornehmen.<br />
Die regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> haben sich zu einem <strong>Berlin</strong>er <strong>Netzwerk</strong><br />
dabei mit der folgenden Zielsetzung zusammengeschlossen:<br />
● Entwicklung, Abstimmung und Koordination von Marketinginstrumenten<br />
und Maßnahmen,<br />
● Installierung zusätzlicher Verbundausbildungsplätze in <strong>Berlin</strong>er<br />
Betrieben,<br />
● Entwicklung von Qualitätsstandards in der Verbundausbildung,<br />
● Vernetzung von Dienstleistungsangeboten für <strong>Berlin</strong>er Wirtschafts<br />
betriebe,<br />
● Modularisierung und Zertifizierung von Ausbildungsabschnitten,<br />
● Finanzierungsmöglichkeiten von Ausbildungsmaßnahmen,<br />
49
Es ist das Ziel<br />
der regionalen<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong>,Unternehmen<br />
als<br />
Lernorte für die<br />
berufliche<br />
Ausbildung zu<br />
erhalten bzw.<br />
neu zu gewinnen.<br />
Die Stabilisierung<br />
und Ausweitung<br />
der Verbundausbildung<br />
wird<br />
auch künftig einen<br />
Schwerpunkt in der<br />
<strong>Berlin</strong>er Berufsbildungspolitik<br />
bilden<br />
● Informationsaustausch zur Nutzung von Förderungsprogrammen<br />
und -instrumenten,<br />
● Organisation und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen<br />
für Betriebe mit Kammern und Verbänden.<br />
<strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong> bilden einen strategischen Ansatz zur<br />
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in <strong>Berlin</strong>.<br />
Unter Nutzung der konzeptionellen Möglichkeiten der Ausbildung im Verbund<br />
und der möglichen Synergieeffekte durch eine Beteiligung der <strong>Berlin</strong>er<br />
Bezirke kann es gelingen, das Ausbildungsplatzdefizit in <strong>Berlin</strong> zu verringern.<br />
Der Grundsatz der Berufsausbildung im Dualen System steht dabei im Vordergrund.<br />
Durch Organisation von regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n soll die Finanzierung<br />
zusätzlicher Ausbildungsplätze kostengünstig im Verbund mit <strong>Berlin</strong>er<br />
Betrieben organisiert werden. Die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze<br />
erfolgt dabei so betriebsnah wie möglich, Qualitätsverluste in der<br />
Berufsausbildung werden dadurch vermieden.<br />
Weitere Schwerpunkte der Förderung des Senats sind, wie aus dem Bund-<br />
Länder-Sonderprogramm für das Jahr 2001 ersichtlich:<br />
● wirtschaftsnahe und branchenorientierte <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
● Kooperationen (z.B. Lernortkooperation wirtschaftsnaher Träger mit<br />
OSZ für unversorgte Bewerber/innen unterhalb des erweiterten<br />
Hauptschulabschlusses)<br />
● gesonderte Verbundformen (z.B. Verbundausbildung mit der<br />
Bundeswehr)<br />
● vollzeitschulische Ausbildungen mit Kammerprüfung (z.B. 24-monatige<br />
Anschlussausbildung an die einjährige, nicht berufsqualifizierende<br />
Berufsfachschule (OBF); sowie vollschulische Plätze in<br />
Berufsfachschulen).<br />
Im Richtlinienprogramm des Landes <strong>Berlin</strong> wird künftig beispielsweise die<br />
Verbundausbildung von Betrieben mit freien Trägern und Berufsschulen<br />
(Schulischen Einrichtungen) fortgesetzt gefördert.<br />
Hierin ist der Umschwung: Weg von der Prämienförderung, hin zur Verbundausbildung/Förderung<br />
von Kooperationen, zu verzeichnen.<br />
Das daraus sich ableitende Fazit lautet:<br />
Solange sich die Zahl der Nachfrage und die Zahl des Angebot nach bzw.<br />
von betrieblichen Ausbildungsplätzen nicht deckt, werden die soeben genannten<br />
Fördermaßnahmen des Senats fortzusetzen sein.<br />
Sie sind jedoch den realen wirtschaftlichen und regionalen Gegebenheiten<br />
anzupassen, um eine möglichst hohe Wirksamkeit zu entfalten.<br />
Kooperationen, regionale Verbünde bilden hier die auf die Region <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg abgezielte effektivste Förderform.<br />
50
Einerseits müssen in <strong>Berlin</strong>-Brandenburg die Chancen der Region genutzt<br />
werden und junge Unternehmen und Wachstumsbranchen für die Berufsbildung<br />
gewonnen werden.<br />
Zukunftsfähige Berufe müssen in der Region eine Chance haben (Stichwort:<br />
IT/Neue Medien).<br />
Kooperationen mit Betrieben, Leitbetrieben, Trägern helfen hier, immer vor<br />
dem Hintergrund quantitativer und qualitativer Verbesserungen, der Situation<br />
der Berufsbildung.<br />
Allerdings sind bei der Weiterentwicklung der Ausbildungskooperationen in<br />
der Region auch die generellen neuen Entwicklungen und Anforderungen in<br />
der Berufsbildung zu beachten.<br />
Die immer komplexer werdenden Anforderungen der Ausbildungsordnungen<br />
innerhalb des Berufskonzepts dürfen die Schere zwischen denen, die<br />
einen Ausbildungsplatz haben und denen, die keinen haben, nicht weiter<br />
vergrößern.<br />
Ausbildung darf darüber hinaus nicht zum Selbstzweck geraten, sondern<br />
muss – notfalls über Qualifizierung in Teilschritten – auf das eigenverantwortliche<br />
Berufsleben vorbereiten.<br />
Aus diesem Grund ist ein differenzierter Ansatz gefragt, der allen Jugendlichen<br />
den Zugang zur Berufsbildung mit Zukunftsperspektive gewährt.<br />
Es muss heißen:<br />
● Stärkere fordern,<br />
● Schwächere fördern.<br />
Der Senat fördert hierzu im Rahmen des Richtlinienprogramms beispielsweise<br />
Betriebe, die benachteiligte Jugendliche ausbilden, derzeit mit einem<br />
Zuschuss von 75 % der Ausbildungsvergütung (max. 15.000).<br />
Benachteiligte Jugendliche sind dabei solche,<br />
● ohne Schulabschluss (s.o., immerhin 15 % aller Schulabgänger/-<br />
innen in <strong>Berlin</strong>),<br />
● Abbrecher aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm,<br />
● Abbrecher von MDQM Stufe 1 (vollschulischer Lehrgang zur<br />
Vermittlung von berufsvorbereitenden Inhalten im Rahmen von<br />
Ausbildungsmodulen; Modular-Duale-Qualifizierungs-Maßnahme,<br />
dazu später mehr).<br />
Um den/die Einzelne/n – wie Eingangs erwähnt – nicht in eine „Sackgasse“<br />
gehen zu lassen, sind also gestaltungsoffene Ansätze bzw. flexible Bausteine<br />
innerhalb der anerkannten Ausbildungsberufe gefragt.<br />
In vielen Fällen macht es dabei Sinn, die Anforderungen innerhalb des Dualen<br />
Systems an die Wirklichkeit anzupassen. Ansatz ist, nicht allein in fest<br />
gefahrenen Berufsanforderungen, sondern insbesondere als Alternative für<br />
die leistungsschwächeren, in Modulen bzw. Bausteinen, auszubilden, mit<br />
51
Qualifizierungspass<br />
dem Ziel, einen Ausbildungsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf<br />
zu erreichen.<br />
Dabei ist nochmals Folgendes zu beachten:<br />
● Die Anforderungen an die Jugendlichen steigen zunehmend.<br />
● Das Duale Ausbildungssystem mit seinem Ansatz des „Alles oder<br />
Nichts“ muss hier flexibler den Bedürfnissen der Wirklichkeit<br />
entsprechen.<br />
Die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbildung<br />
und Wettbewerbsfähigkeit auf Bundesebene hat aus diesem Grund<br />
mittlerweile ganz wesentliche Reformvorschläge zur Differenzierung und<br />
Flexibilisierung der Berufsausbildung ausgearbeitet, die auch die Richtung<br />
der Weiterentwicklung der Ausbildung in den einzelnen Regionen beeinflussen<br />
werden.<br />
Beispiele sind hier:<br />
● Differenziert und flexibel gestaltete Ausbildungsberufe, die mehr<br />
Gestaltungsspielräume für die Anpassung an den Qualifikationsbedarf<br />
der Betriebe an neue technische Entwicklungen bieten,<br />
● neue Ordnungskonzepte mit Kombinierbarkeit von Wahlpflicht- und<br />
Wahlbausteinen.<br />
In <strong>Berlin</strong> existiert der Schulversuch MDQM (Stufe I und II), in dem berufsvorbereitende<br />
Inhalte in Stufe I bzw. eine Berufsausbildung in Stufe II in Portionen<br />
bzw. Modulen vermittelt werden.<br />
Die Elemente der modularen Qualifizierungsbausteine werden dabei in Zukunft<br />
ausgebaut werden, um auch im Rahmen der innovativen regionalen<br />
Verbundausbildung eine differenzierte und flexible Handhabung regionalspezifisch<br />
vor Ort zu ermöglichen.<br />
Darüber hinaus ist eine Verzahnung von Ausbildung, Qualifizierung und<br />
Weiterbildung im Sinne von Qualifizierungsbausteinen bei der beruflichen<br />
Aus- und Weiterbildung und deren Zertifizierung und Dokumentierung sinnvoll<br />
und bildet eine weitere Herausforderung.<br />
Um beispielsweise die Integration ausländischer Jugendlicher zu erhöhen<br />
und diesen überhaupt den Einstieg in die Ausbildung zu gewährleisten, wird<br />
Sprache als komplementäre Ergänzung zur berufsfachlichen Qualifikation<br />
zu zertifizieren sein.<br />
Ziel ist dabei vorerst die Ausbildung. Wenn dieses Ziel mit einem Schritt<br />
nicht erreicht wird, sind mehrere Zwischenschritte notwendig. D.h. die einzelnen<br />
Schritte der Qualifizierung in Teilschritten sind sinnvoll miteinander<br />
zu verbinden. Diese sind schrittweise zu zertifizieren und zu dokumentieren.<br />
Er hält die einzelnen Schritte der zertifizierten Ausbildungsbausteine in einem<br />
Dokument fest und ermöglicht somit die weitere Teilqualifizierung in<br />
Schritten für den weiteren beruflichen Werdegang des Jugendlichen (Stich-<br />
52
worte: Im Kontext der Berufsvorbereitung, Qualifizierung, Nachqualifizierung<br />
und Weiterbildung).<br />
Im Rahmen der derzeitigen SGB III Novellierung auf Bundesebene werden<br />
darüber hinaus zur Zeit die bundesrechtlichen Gesetzesvorschriften vereinheitlicht,<br />
um die unterschiedlichsten Förder-/Qualifizierungsmaßnahmen –<br />
auch die der Ausbildungsförderung für benachteiligte Jugendliche – abzustimmen.<br />
Ziel bei Maßnahmen ist es weiterhin, den vereinheitlichten Einstieg und<br />
Ausstieg sowie eine Anschlussfähigkeit an die einzelnen Schritte zu<br />
ermöglichen.<br />
Eine weitere Herausforderung ist es, die Lernfortschritte bei Qualifizierungsmaßnahmen<br />
bestimmen zu können. Hierzu wird zu überlegen sein, ob – wie<br />
bei der sog. „TIMM-Studie“ (Vergleichsstudie von Schülerwissen) – ein entsprechender<br />
Ansatz tragfähig sein wird.<br />
Zudem wird sich zukünftig die allgemeinbildende Schule weiter den Betrieben<br />
und der Arbeitswelt öffnen müssen, d.h. so viele und so gute Berufspraktika<br />
den Schüler/innen zu ermöglichen wie möglich, um ihnen bereits<br />
frühzeitig einen Einblick in die Arbeits- und Berufswelt zu verschaffen.<br />
Wie Sie sehen, es gibt im Rahmen der ausbildungsrelevanten und strukturellen<br />
Gegebenheiten derzeit zahlreiche Herausforderungen, denen sich alle<br />
an der Beruflichen Bildung Beteiligten zu stellen haben.<br />
Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen wird dies tun.<br />
Hier hoffen wir auf Ihre Zusammenarbeit.<br />
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !<br />
53
Workshops
Workshop 1<br />
Wo liegt die Zukunft der<br />
Qualitätssicherung in der<br />
Berufsausbildung?<br />
Inputthesen<br />
Dr. Susan Seeber<br />
Humboldt Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
Meine Damen und Herren, ich bin gebeten<br />
worden, zum Einstieg in diesen Workshop,<br />
5 einführende Thesen zu der Fragestellung:<br />
„Wo liegt die Zukunft der Qualitätssicherung<br />
in der Berufsbildung“ aufzustellen.<br />
These 1:<br />
Zur Aktualität des Themas - Zauberwort<br />
oder erfolgversprechendes Konzept?<br />
Qualitätssicherung ist kein neues Thema in<br />
der beruflichen Aus- und Weiterbildung – die<br />
aktuellen Diskussionen dazu verweisen jedoch<br />
auf Umbrüche im Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungssysteme<br />
mit weitreichenden Konsequenzen für das System der beruflichen Ausund<br />
Weiterbildung:<br />
● Veränderungen in den Berufsstrukturen, ein starker Trend zur<br />
„Entberuflichung“ der Ausbildung und zum „homo disponibilis“,<br />
führen zu neuen Mustern in den Bildungs- und Erwerbskarrieren<br />
Jugendlicher und junger Erwachsener.<br />
● Die Berufsausbildung wird zunehmend zur „Vorschule“ der Weiterbildung,<br />
denn das Ende der Berufsausbildung fällt zunehmend mit<br />
dem Beginn der Weiterbildung zusammen.<br />
● Tendenzen der Globalisierung machen Bildung zu einem Wettbewerbsfaktor<br />
für das wirtschaftliche Überleben, wobei noch offen<br />
ist, welches Bildungs- und Qualifikationssystem am besten den<br />
steigenden Leistungs- und Qualitätsanforderungen gerecht wird.<br />
These 2:<br />
Zentrale Entwicklungen in den Systemumwelten beruflicher Aus- und<br />
Weiterbildung.<br />
Kürzungen der Budgets verstärken den Konkurrenzdruck zwischen den Anbietern<br />
beruflicher Aus- und Weiterbildung. Veränderungen in den Finanzierungsstrategien,<br />
insbesondere der öffentlichen Finanzierung von beruflicher<br />
Aus- und Weiterbildung, ersetzen sukzessive eine institutionelle Förderung<br />
durch eine individuenzentrierte Förderung. Öffentliche Mittel werden künftig<br />
über die individuelle Nachfrage auf Bildungsmärkten in private Institutionen<br />
transferiert mit der Konsequenz der Entwicklung eines stärker nachfrageals<br />
angebotsorientierten Marktes.<br />
These 3:<br />
Die Qualitätsdiskussion der 90er Jahre<br />
Verknappung von Ressourcen und gleichzeitig steigende Erwartungen und<br />
Anforderungen an die Ergebnisse von Bildungs- und Qualifizierungsprozessen<br />
ersetzen eine an Inputkriterien orientierte Steuerung öffentlicher Bildungsinvestitionen<br />
durch eine eher outputorientierte Steuerung von Mitteln.<br />
Dies schließt für die Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildung die Verpflichtung<br />
ein, neben den Kosten der Bildungsarbeit auch deren Ergebnisse<br />
56
(Output) und Verwertungsperspektiven<br />
(Outcome) nachzuweisen, und<br />
dies bei Erhöhung der Effizienz.<br />
These 4:<br />
Kritische Bemerkungen zu einschlägigen<br />
Qualitätsansätzen<br />
Qualitätsmanagementsansätze wie<br />
ISO 9000ff., EFQM, regionale Qualitätsgütesiegel<br />
usw. sind eine<br />
„Eintrittskarte“ zur Teilhabe am<br />
Wettbewerb um Bildungsnachfrage<br />
geworden und dienen primär der Sicherung<br />
von Marktanteilen als der<br />
Erhöhung der Qualität der Bildungsarbeit.<br />
Implementiert in der<br />
Hoffnung auf Modernisierung und langfristige Optimierung von Bildung sind<br />
Zweifel erheblich und verbreitet, ob diese Konzepte tatsächlich für mehr Effizienz,<br />
Wirtschaftlichkeit und Erfolg bürgen und die notwendige Qualitätsentwicklung<br />
hinreichend steuern (können). Kundenzufriedenheit als<br />
alleiniges Erfolgskriterium dürfte ein schwacher Indikator für Qualität sein,<br />
vor allem, wenn die marktregulierende Wirkung weitgehend fehlt, der Adressant<br />
„Kunde“ nicht eindeutig definiert und das Konstrukt sowie die Messung<br />
der Zufriedenheit nicht präzise bestimmt sind.<br />
These 5:<br />
Perspektiven der Qualitätssicherung<br />
Dr. Susan Seeber, Prof. Dr. Dr. v. Buer, Wolfgang Krüger<br />
Qualitätsentwicklung und Qualitätssteigerung in der beruflichen Aus- und<br />
Weiterbildung verweisen in drei Richtungen: Anbieter beruflicher Aus- und<br />
Weiterbildung werden sich zusehends mit der Explizierung von Standards –<br />
und dies nicht nur als Unterscheidungsmerkmal von der Konkurrenz – auseinander<br />
setzen müssen. Die legitime Forderung nach erhöhter Transparenz<br />
auf allen Stufen von Bildungsprozessen führt zu einer „Entprivatisierung“<br />
von Unterricht und Ausbildung, zu einer Abkehr von der Selbstzuschreibung<br />
von Leistungen. Gefordert wird eine explizite Rechenschaftspflicht<br />
im Sinne von Qualitätskontrolle durch Nachweis der Effekte sowie<br />
durch eine Professionalisierung der Steuerung und Kontrolle mit Konsequenzen<br />
für die Ausgestaltung des Verhältnisses von externer und interner<br />
Evaluation.<br />
57
Workshop 2<br />
Was muß die allgemeinbildende<br />
Schule leisten und wie muss sie<br />
sich entwickeln, um Jugendliche<br />
auf den Prozess der Ausbildung<br />
vorzubereiten?<br />
Inputthesen<br />
Ulrich Thöne<br />
Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaft<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
58<br />
1.<br />
Der Bildungsauftrag der Berufsschule ist der<br />
Orientierungspunkt für die Frage, welche<br />
Qualifikationen Schülerinnen und Schüler<br />
der allgemeinbildenden Schulen mitbringen<br />
sollen. Dieser Bildungsauftrag ist in der<br />
Rahmenvereinbarung über die Berufsschule<br />
durch Beschluss der KMK vom 15.03.91<br />
beschrieben. Dabei geht es um die Berufsfähigkeit,<br />
die berufliche Flexibilität einschließt<br />
und um die Bereitschaft zur beruflichen Fortund<br />
Weiterbildung, aber auch um die Fähigkeit,<br />
bei der individuellen Lebensgestaltung<br />
und im öffentlichen Leben bezogen auf<br />
die Gesellschaft verantwortungsbewusst zu<br />
handeln.<br />
Alle aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz<br />
gerichtet. Diese wird verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit<br />
des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen<br />
sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich<br />
zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen<br />
von Fach-, Personal- und Sozial-/Demokratiekompetenz.<br />
Die einzelnen berufsbildenden Schulen erwarten kein auf den zu erlernenden<br />
Beruf vorvermitteltes Wissen, sondern die Bereitschaft der Jugendlichen,<br />
Neues lernen zu wollen. Dabei sollten die Grundlagen für die<br />
o. g. Kompetenzen gelegt worden sein.<br />
Erwartungen hinsichtlich der<br />
Fachkompetenz:<br />
● Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit; aber auch Grundlagen in<br />
mindestens einer Fremdsprache (Stichwort/Europäisierung),<br />
● einen Arbeitsauftrag verstehen und analysieren können,<br />
● darstellen, in welchen Schritten ein Problem gelöst werden<br />
kann,<br />
● eine Problemlösung<br />
bewerten und beurteilen.<br />
Personalkompetenz:<br />
● Bereitschaft, sich für den<br />
Lernprozess selbst verantwortlich<br />
zu fühlen,<br />
● Bereitschaft, Probleme<br />
lösen zu wollen.
5.<br />
6.<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Sozial-/Demokratiekompetenz:<br />
● das Beherrschen der elementaren Umgangsformen,<br />
● Bereitschaft mit anderen Schülerinnen und Schülern<br />
zusammenzuarbeiten (Teamfähigkeit),<br />
● Bereitschaft, andere Meinungen zu tolerieren und sich mit<br />
anderen Menschen, rational und verantwortungsbewusst auseinander<br />
zu setzen und zu verständigen,<br />
● Fähigkeit zu sozialer Verantwortung und Solidarität.<br />
Die allgemeinbildende Schule kann sich der Vermittlung der o. g. Kompetenzen<br />
nur dann verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll annehmen,<br />
wenn die entsprechenden Lern- und Arbeitsbedingungen geschaffen<br />
werden.<br />
Zur besseren Verzahnung zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden<br />
Schulen ist ein gezielter pädagogischer Erfahrungsaustausch<br />
wünschenswert.<br />
Der Bildungsauftrag der allgemeinbildenden<br />
Schule lässt sich nicht aus den Anforderungen<br />
der beruflichen Ausbildung<br />
ableiten; denn die Qualifikation der Schülerinnen<br />
und Schüler für eine berufliche<br />
Ausbildung stellt für die Schule nur eine<br />
Aufgabe neben der der sozialen Integration<br />
dar, auch wenn beides im Zeichen<br />
der Entwicklung der Gesamtpersönlich-<br />
Workshop 2<br />
Inputthesen<br />
Prof. Dr. Dr. <strong>Rainer</strong> Lehmann<br />
Humboldt Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
keit in engem Zusammenhang steht. Gestützt wird diese Sichtweise u. a.<br />
durch Vergleiche der Anforderungsprofile von Ausbildungsbetrieben und<br />
den Leistungsprofilen von Schulabgängern (Institut der deutschen Wirtschaft,<br />
1997).<br />
Es erscheint zudem fraglich, ob – wie in den geltenden Grundsätzen zur<br />
beruflichen Ausbildung üblich geworden – der Bildungsauftrag (oder<br />
auch nur der Qualifikationsauftrag) der allgemeinbildenden Schule angemessen<br />
aus einem allgemeinen und damit notwendig inhaltsarmen Begriff<br />
der Handlungskompetenz hergeleitet werden kann. Auch und gerade<br />
in der gängigen Ausdifferenzierung nach Fach-, Personal- und Sozialkompetenz<br />
gilt es dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Verhältnis<br />
von allgemeiner und beruflicher Bildung sehr unterschiedlich bestimmt<br />
ist. Besonders deutlich zeigt sich dies an der Schwierigkeit der<br />
Zuordnung von Methodenkompetenzen.<br />
Den vorläufigen Leitsätzen der Expertengruppe „Bildungs- und Qualifikationsziele<br />
von morgen“ (Materialien des Forum Bildung, 5, 2001) folgend<br />
kann man Lernen als Kernaktivität aller Bildungsinstitutionen, so auch<br />
der allgemeinbildenden Schulen, umschreiben als den Erwerb der folgenden<br />
Kompetenzen:<br />
(1) Intelligentes Wissen,<br />
(2) Anwendungsfähiges Wissen,<br />
(3) Lernkompetenz,<br />
59
4.<br />
5.<br />
60<br />
(4) Methodisch-instrumentelle Schlüsselkompetenzen,<br />
(5) Soziale Kompetenzen,<br />
(6) Wertorientierungen (a.a.O., S.19).<br />
Der enge Bezug all dieser Kompetenzen zur beruflichen Ausbildung –<br />
aber nicht nur zu ihr – dürfte unbeschadet der davon abweichenden Systematisierung<br />
in der Theorie der beruflichen Bildung offensichtlich sein.<br />
Die hier übernommene Klassifikation hat aber den Vorzug, gerade die<br />
Vernetzung von Kompetenzen zu betonen, auf die es vor allem an den<br />
Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen und speziell<br />
auch zwischen verschiedenen Lernumgebungen ankommt.<br />
Zu den methodisch-instrumentellen Schlüsselkompetenzen, deren kumulativer<br />
Erwerb teilweise bereits am Anfang schulischen Lernens steht,<br />
gehören die folgenden Grundqualifikationen:<br />
● die Fähigkeit, deutschsprachige Texte zu erschließen und<br />
selbstgesteuert zu nutzen, also das „Leseverständnis“ in seiner<br />
fundamentalen Bedeutung für jegliches weiterführendes Lernen,<br />
● die Fähigkeit, eigene Erkenntnisse, Überzeugungen und<br />
Wertungen in Wort und Schrift mitzuteilen, also die normgerechte<br />
„Ausdrucksfähigkeit“,<br />
● die Fähigkeit, mathematische Strukturen zu durchschauen und,<br />
darauf aufbauend, zielführende Algorithmen anzuwenden,<br />
● Hörverständnis, Leseverständnis und Ausdrucksfähigkeit in Wort<br />
und Schrift in mindestens einer Fremdsprache, möglichst einer<br />
internationalen Verkehrssprache und<br />
● die Fähigkeit, moderne Kommunikationsmedien effektiv zu<br />
nutzen, nicht zuletzt im Sinne der Effektivierung künftigen<br />
Lernens.<br />
Für die methodisch-instrumentellen Schlüsselqualifikationen ist es charakteristisch,<br />
dass sie hoch automatisiert werden können und müssen,<br />
so dass beispielsweise elementare mathematische Fähigkeiten übergehen<br />
in verlässliche Rechenfertigkeiten.<br />
Im Grunde für alle zentralen Lebensbereiche relevant, weithin jedoch unmittelbar<br />
für die berufliche Ausbildung einschlägig, sind Kompetenzen,<br />
die zugleich als „intelligentes“ und „anwendungsfähiges Wissen“ darstellbar<br />
sind und an den allgemeinbildenden Schulen exemplarisch und überwiegend<br />
im Fachunterricht angeeignet werden sollen. Ihre Entwicklung<br />
erfordert sowohl den vertikalen Transfer (d. h. kumulatives Lernen) als<br />
auch den horizontalen Transfer (d. h. die Anwendung situationsspezifisch<br />
erworbener Fähigkeiten). Dabei handelt es sich vor allem um:<br />
● naturwissenschaftlich-technische Kompetenzen, die in den<br />
Fächern Biologie, Chemie, Physik und in Teilen der Geographie<br />
erworben werden und<br />
● gesellschaftsbezogene Kompetenzen, die vor allem in Fächern<br />
wie Sozialkunde, Arbeitslehre und Geschichte, ggf. auch im<br />
Ethik- und/oder Religionsunterricht thematisch werden.
6.<br />
7.<br />
1.<br />
Dabei ist kritisch anzumerken,<br />
dass der traditionelle Fächerkanon<br />
wesentliche Bereiche, wie<br />
beispielsweise das Recht und<br />
ökonomische Zusammenhänge,<br />
weitgehend ausspart.<br />
Der Erwerb der Lernkompetenz<br />
als einer gleichermaßen für eine<br />
erfolgreiche berufliche Ausbildung<br />
als auch für parallele oder<br />
spätere Lernprozesse maßgeblichen<br />
Fähigkeit vollzieht sich lernprozessbegleitend<br />
durch die habitualisierte<br />
Reflexion der jeweils<br />
eigenen Lernerfolge bzw. ggf.<br />
auch -Misserfolge. Er erfordert<br />
eine „bildungstheoretische Revolution“ (a.a.O., S. 23) und verweist somit<br />
auf die zentrale Aufgabe der Qualitätsentwicklung im allgemeinbildenden<br />
Schulsystem, insbesondere auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität<br />
in Richtung auf intensivere und bewusstere Lernprozesse.<br />
Aus internationalen Vergleichsstudien, aber auch aus regionalen Lernstandserhebungen,<br />
ist bekannt, dass viele Schülerinnen und Schüler<br />
deutscher Schulen in ihren Lernerfolgen deutlich hinter den eigenen<br />
Möglichkeiten zurückbleiben. Belegt ist dies u. a. für das Leseverständnis<br />
(IEA 1991), die Mathematik (IEA 1996 1997: TIMSS; Brandenburg<br />
2000: QuaSUM), die Naturwissenschaften (a.a.O.), das politische Verständnis<br />
(IEA 2001). Zu vermuten ist, dass die für Deutschland typische<br />
Konzentration auf schulorganisatorische Fragen („Systemvergleich“;<br />
„Schulentwicklung“; „Unterrichtsformen“) den Blick auf die konkrete inhaltliche<br />
Verbesserung des Unterrichts eher verstellt als eröffnet hat.<br />
Informationsgesellschaft" bedeutet die<br />
weitgehende, äußerst empfindliche Abhängigkeit<br />
großer Bereiche von Teilen des<br />
öffentlichen, wirtschaftlichen und privaten<br />
Lebens von digitalen/elektronischen Informationen,<br />
● in Datenbanken und als Volldokumente<br />
gespeichert auf Computern<br />
von Firmen, Institutionen und<br />
Privaten,<br />
● verfügbar gemacht über lokale<br />
und welt weite Netze,<br />
● vermittelt über Kabel und Satellit,<br />
Prof. Dr. Dr. <strong>Rainer</strong> Lehmann <strong>Rainer</strong> Holland<br />
Workshop 3<br />
● gefährdet durch technische Störungen, interne und externe<br />
Manipulationen, (Industrie-) Spionage, Terrorismus, aber auch<br />
durch Inkompatibilitäten und die schnelle Alterung von Hard-<br />
und Software.<br />
Welche Anforderungen erwachsen<br />
aus der Informationsgesellschaft<br />
an das Berufsbildungssystem aus<br />
der Sicht der Wirtschaft?<br />
Inputthesen<br />
Prof. Dr. Peter Diepold<br />
Göttingen<br />
61
"Das Berufsbildungssystem" muß<br />
auf den verantwortlichen Umgang<br />
vorbereiten; dies wird für unterschiedliche<br />
Ebenen und in unterschiedliche<br />
Berufsfeldern zu gewichten<br />
und zu konkretisieren sein.<br />
3.<br />
Für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden<br />
haben wir in einem<br />
BLK-Modellversuch an der Humboldt-Universität<br />
die Anforderungen<br />
an "informatische Kompetenz" in<br />
mehreren inhaltlichen Bereichen<br />
aufgeschlüsselt, in drei Dimensionen<br />
beschrieben, die von der technischen<br />
Beherrschung über die<br />
Anwendung in der beruflichen Praxis<br />
bis zu übergreifenden gesellschaftlichen Fragen reichen und in konkrete<br />
Lehr-Lern-Module überführt (vgl. http://www.educat.hu-berlin.de/<br />
mv/baustein.html).<br />
Diese Matrix ließe sich für verschiedene Berufsfelder bezüglich der Inhalte,<br />
der Beispiele und der angestrebten Beherrschung der zu vermittelnden<br />
Qualifikationen adaptieren.<br />
Sie müsste ggf. durch weitere Aspekte erweitert werden, die sich insbesondere<br />
dem Problem der Gefährderung von Daten durch Themen wie<br />
Passwortsicherheit, Virenschutz, Firewall, Verschlüsselung befassen.<br />
Reinhard Selka Prof. Dr. Peter Diepold<br />
4.<br />
5.<br />
62<br />
2.<br />
Bereits vor der insbesondere durch das Internet gekennzeichneten rassanten<br />
Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik<br />
in den 90er Jahren hat der Modellversuch "Wolfsburger Kooperationsmodell<br />
für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau unter besonderer<br />
Berücksichtigung neuer Technologien (WOKI)" die Wichtigkeit von<br />
Schlüsselqualifikationen betont, die 1987 von den kaufmännischen Ausbildungsleitern<br />
führender deutscher Unternehmen konsensual abgestimmt<br />
wurden (vgl. http://www.educat.hu-berlin.de/mv/sqindkfl.html).<br />
Diese übergreifenden Fähigkeiten sind m.E. nicht obsolet, sondern haben<br />
im Zeitalter der Vernetzung und globaler wirtschaftlicher Konkurrenz<br />
eine noch größere Wichigkeit als in den 80er Jahren.<br />
Mit dem Stichwort "Selbstverantwortung" wird auch die Notwendigkeit<br />
zum verantwortlichen Umgang mit dem Netz beschrieben, den wir in einem<br />
Seminar vor einiger Zeit, bezogen auf Schüler und Lehrer, in den<br />
"10 Geboten für einen verantwortlichen Umgang mit dem Netz" beschrieben<br />
haben (vgl. http://www.educat.hu-berlin.de/mv/10gebote.html).
Die „Wirtschaft“ ist Bestandteil des Berufsbildungssystems<br />
in Deutschland – in der dualen<br />
Ausbildung versteht sie sich als wesentlicher<br />
Bestandteil. Nachfolgend formulierte<br />
Workshop 3<br />
Inputthesen<br />
die Wirtschaft Anforderungen sind somit Friedhelm Rennhak<br />
zum großen Teil Forderungen an sich selbst Industrie- u. Handelskammer zu <strong>Berlin</strong><br />
und schon vorhandene bzw. künftige Partner<br />
in diesem System; sie kommen einer Beschreibung<br />
des aktuellen Prozesses und der erwarteten Entwicklung gleich.<br />
Um Tendenzen/Erwartungen/Anforderungen an ein künftiges Berufsbildungssystem<br />
einordnen zu können, muss die Ausgangssituation kurz definiert<br />
werden.<br />
Wir haben in Deutschland mit der dualen Berufsausbildung ein akzeptiertes,<br />
funktionierendes Ausbildungssystem, welches international anerkannt ist<br />
und bis heute jedem Vergleich mit anderen Systemen standhält. Wir sind<br />
somit für jegliche Entwicklung hervorragend positioniert. Das duale Ausbildungssystem<br />
ist die beste Ausgangsbasis für zukünftige Ausbildungsformen.<br />
Nichtsdestotrotz hat auch die duale Berufsausbildung schon heute<br />
erkennbare Schwachstellen, welche – sollten wir sie nicht direkt offensiv angehen<br />
– künftig, insbesondere in einer schnelllebigen Informationsgesellschaft,<br />
gravierend größer werden und unser ganzes Bildungssystem gefährden<br />
könnten. Unser derzeitiges Angebot an beruflichen Qualifizierungen<br />
erreicht nicht alle Jugendlichen und die Zahl der nicht Ausbildungsfähigen<br />
wird von Jahr zu Jahr größer. Die Zahl der jungen Menschen (19 - 29jährig),<br />
die ohne abgeschlossene Berufsausbildung bleiben, ist mit zur Zeit rund<br />
1,3 Mio. zu hoch.<br />
Die von Bildungsexperten schon vor Jahren beschriebene und prognostizierte<br />
Trendwende scheint nun erreicht. Wir entwickeln uns von Lehrstellenknappheit<br />
zum Fachkräftemangel – dieses ist mit Sicherheit in naher<br />
Zukunft die große Herausforderung für Wirtschaft und Bildung. Die vier Phasen<br />
in unserem Bildungssystem:<br />
● Schulausbildung,<br />
● Berufsausbildung,<br />
● Weiter- und Fortbildung sowie<br />
● Neu- und Umqualifizierung für ältere Menschen<br />
müssen besser miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt werden.<br />
Das heißt, Kinder müssen gefördert und gefordert werden. Unter Berücksichtigung<br />
verschiedener Neigungen und Begabungen, aber auch im Hinblick<br />
auf Leistungswillen und -vermögen, müssen sie so gut wie möglich<br />
ausgebildet und gefördert werden. Die unterschiedlichen Schultypen müssen<br />
ihr eigenständiges Profil schärfen. Die Hauptschule muss als Regelschule<br />
wiederhergestellt und gefördert werden; sie ist geeignet auch mehr<br />
praktisch begabten Jugendlichen Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit<br />
zu vermitteln. Die Schule muss auf die Berufsausbildung vorbereiten und<br />
daher praxis- und lebensnah die Inhalte vermitteln, die zur Ausbildungsreife<br />
führen. Die Stärke der Realschule liegt in der Vermittlung einer vertieften,<br />
63
vielseitigen und an der Praxis orientierten<br />
Allgemeinbildung. Auch sie<br />
muss auf die Berufsausbildung vorbereiten.<br />
Gymnasien sollen ihren<br />
besonderen Auftrag erfüllen – zur<br />
Studierfähigkeit führen.<br />
Die duale Ausbildung muss für alle<br />
erschlossen und modernisiert werden.<br />
Unser derzeitiges Angebot an<br />
beruflichen Qualifizierungen muss<br />
erweitert werden; wir brauchen zusätzliche<br />
Angebote für leistungsschwache<br />
und schwierige junge<br />
Menschen. Betriebe befinden sich<br />
künftig in einem Wettbewerb um<br />
Jugendliche, welcher – solange der Zuzug aus dem Ausland, auch aus den<br />
EU-Beitrittsländern, noch nicht geklärt ist – zunehmen wird. Unternehmen<br />
werden etwas bieten müssen, um für die jugendlichen Bewerber (vor allem<br />
die leistungsfähigen) attraktiv zu sein. Höhere Vergütungen werden nicht<br />
reichen. Entscheidend wird sein, ob Jugendliche genügend persönliche<br />
Entwicklung erkennen.<br />
Wahlmöglichkeiten und zusätzliche Qualifikationen können gleichermaßen<br />
für Unternehmen von Nutzen sein und den Jugendlichen Perspektiven bieten.<br />
Ohne attraktive Differenzierungen in den Ausbildungsordnungen wird<br />
man sich künftig wohl nur mit leistungsschwächeren Bewerbern zufriedengeben<br />
müssen. Die Berufspalette muss weiter zunehmen, selbst wenn in<br />
klassischen Bereichen der eine oder andere Beruf zusammengelegt werden<br />
kann.<br />
Auch der IT-Sektor dürfte nicht am Ende seiner Gestaltung sein. So sehr wir<br />
gerade diese Berufe loben, so sehr zeigt sich aber auch, dass wir dort noch<br />
nicht die optimale Berufsstruktur gefunden haben, um sie auch für Anwenderbranchen<br />
attraktiv zu machen.<br />
Die ersten Berufe der neuen Berufsfamilie der Dienstleister sind ein Schritt<br />
in die richtige Richtung. Die Modernisierung der Ausbildung allein wird aber<br />
nicht reichen den Fachkräftemangel zu beheben. Für die zur Zeit 80.000 Jugendlichen<br />
ohne Schulabschluss müssen entsprechende Berufe geschaffen<br />
werden, die sich aus Arbeitsmöglichkeiten ableiten.<br />
Im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit wurde ein Paradigmenwechsel<br />
eingeleitet. Das betrifft die konsequente Qualifizierung der<br />
älteren Arbeitnehmer als Antwort auf zahlenmäßig geringen Nachwuchs und<br />
Alternative zur Frühverrentung. Insbesondere die Wirtschaft kann hierzu<br />
durch die frühzeitige Entwicklung erwachsenengerechter Qualifizierungsbausteine<br />
beitragen. Einen weiteren Paradigmenwechsel stellt das Bekenntnis<br />
dar, Qualifizierung in Tarifverträge konsequenter als bisher einzubauen.<br />
Hier können wir nur hoffen, dass es zu Regeln kommt, welche be-<br />
64
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
darfsgerecht und von Unternehmen aller Größenordnungen realisierbar<br />
sind. Arbeitnehmer müssen hieran beteiligt werden.<br />
Es besteht weiterhin die Gefahr, dass Bildungsexperten bei Lösungen<br />
und Kompromissen nicht ausreichend eingebunden werden. Es geht<br />
darum, darauf zu achten, Fehlentwicklungen aus den 90er Jahren nicht<br />
zu wiederholen.<br />
Für die Kunden (Personalabteilungen,<br />
Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamsprecher)<br />
des „Bildungsprodukts“ „Deutscher<br />
Facharbeiter“ zeigt sich der Wandel<br />
zur Informationsgesellschaft in einer<br />
deutlich gesteigerten Anspruchshaltung<br />
an den „soft skill“-Behafteten, technisch<br />
wandlungsfähigen Generalisten und<br />
schnell hochtrainierbaren Spezialisten.<br />
Workshop 3<br />
Inputthesen<br />
Wolfgang Krüger<br />
Schulleiter Werkberufsschule Siemens AG<br />
Die Lernfelder der modernen Berufsbilder bieten dem Kunden ein breites<br />
Sortiment, aus dem unter bereichsspezifischem Fokus gewählt wird.<br />
Dieses Tätigkeitsbündel prägt die Erwartungshaltung an die Qualität der<br />
Ausbildung und an die Inhalte der Prüfungen.<br />
Für die konkrete Einsatzfähigkeit (Handlungsfähigkeit) ist der Wandel zur<br />
Wissensgesellschaft der entscheidende Schritt. Die zur Informationsrecherche<br />
bereitstehenden Datenmengen (Internet/Intranet/Netz-Bibliotheken)<br />
ermöglichen nur noch dem Erfahrenen eine Entscheidung für die<br />
richtigen Informationen, eine Sichtung aller Daten zu einem beliebigen<br />
Thema ist kaum noch möglich. Damit gibt nur ein von Lerngruppen gestaltetes<br />
Wissensmanagement die Möglichkeit, über den Zeitraum der<br />
gesamten Ausbildung hinweg, auf das erworbene Wissen zurückzugreifen<br />
und dieses zur Problemlösung zu transferieren. Lernplattformen wie<br />
z.B. Exchange 2000 stellen die Hilfsmittel.<br />
Für die Auszubildenden und Schüler ist die Informationsgesellschaft real,<br />
sie wird jedoch häufiger über den Freizeitbereich, über die individuelle<br />
Kommunikation, als über ihre sichtbare Existenz in den Schulen/ bei den<br />
Lehrern/ in den Lehrwerkstätten wahrgenommen. Wo kann der Schüler<br />
sich die Fähigkeit zum Wissensmanagement erwerben? An welcher<br />
Schule werden die soft skills jahrgangsstufenmäßig abgestimmt gelehrt?<br />
Wo arbeiten z.B. alle Lehrer des 8. Schuljahres an einer gemeinsamen<br />
Abschlusspräsentation? Wo wird der Unterricht in Lernepochen<br />
angeboten, wo ist der 45-Minuten-Wechsel der Schnellhefter abgeschafft?<br />
Korreliert der Wandel des Qualitätsbegriffs/ Qualitätsverständnisses von<br />
Bildung mit dem Wandel von der Informations- zur Wissensgesellschaft?<br />
Die Qualität von Bildung muss in den Prüfungen zum Nachweis der Berufsfähigkeit<br />
auch:<br />
● soft skills prüfen,<br />
● Einzel- und Gruppenleistung prüfen,<br />
65
5.<br />
Workshop 4<br />
Sind Ausbildung im Verbund,<br />
regionale Ausbilungsverbünde<br />
und <strong>Netzwerk</strong>e die Konzepte der<br />
Zukunft?<br />
Inputthesen<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
66<br />
● Fähigkeit zur Informationsrecherche/ zum Wissensmanagement<br />
prüfen und<br />
● individuelle Prüfungsleistung zulassen.<br />
Dies bedingt eine Abstimmung der Rahmenpläne von Schule und Betrieb.<br />
Warum z.B. müssen Schule und Betrieb eine Vielzahl von Netzbetriebssystemen<br />
ausbilden und unterrichten? Warum kann es nicht in der<br />
Schule ein Wahlpflichtfach dazu geben? Eine schulische Abschlussprüfung<br />
(der staatlich bereitgestellte „Bildungsträger“ darf dann auch von<br />
der IHK anerkannt prüfen) kann dann auch eine Note im Wahlpflichtfach<br />
ermitteln.<br />
Ist die Zielsetzung von gymnasialer Bildung wirklich schon zu einer Vorbereitung<br />
auf das Berufsausbildungssystem der Informationsgesellschaft<br />
geworden oder doch das Trainingscamp für universitär gestartete Karrieren?<br />
Zumindest wird die Bildung des Gymnasiums in der neuen Berufsschule<br />
nicht fortgesetzt. Der Entwurf zum neuen Schulgesetz für das<br />
Land <strong>Berlin</strong> (März 2001) formuliert: §28: Das Gymnasium vermittelt ...<br />
vertiefte allgemeine Bildung ... und ... eine Schwerpunktbildung ... §31:<br />
Die Berufsschule vermittelt ... die ... erforderlichen fachtheoretischen<br />
Kenntnisse. Gibt es damit doch keine Äquivalenz zwischen der Bildung<br />
des Gymnasiums und der „Kenntnisvermittlung“ der Berufsschule (siehe<br />
Deutscher Bildungsrat 1972).<br />
Meine Damen und Herren,<br />
zum Einstieg in das Workshopthema, würde<br />
ich gerne 5 Thesen aufstellen, um gemeinsam<br />
in die Diskussion einzusteigen, doch<br />
vorab einige Vorbemerkungen:<br />
Berufliches Lernen steht im unmittelbaren<br />
Zusammenhang mit dem Beschäftigungssystem.<br />
Es ist unbestritten, dass jede Berufsausbildung,<br />
für Handwerk und Industrie, für<br />
Handel und Verwaltung sowie für Dienstleistungen<br />
und Sozialbereiche nur dann sinnvoll<br />
und gut ist, wenn die gesellschaftlichen, ökonomischen<br />
und technischen Veränderungen<br />
und Entwicklungen in der Berufsausbildung<br />
im ausreichenden Umfang berücksichtigt werden.<br />
Als Antwort auf den Wandel von der Industriegesellschaft zur Informations-<br />
und Wissensgesellschaft sind daher strukturelle Veränderungen<br />
bei der Konzeption von Ausbildungsordnungen erforderlich.<br />
Ziel muss daher sein,<br />
dynamische und gestaltungsoffene Ausbildungsordnungen und Berufsbilder<br />
zu schaffen, die aus einem verbindlichen Kern von Fachinhalten<br />
und Schlüsselqualifikationen sowie einem differenzierten Angebot von<br />
Wahlmöglichkeiten bestehen.<br />
Das heißt, es bedarf einer stärkeren Ausrichtung der Rahmenlehrpläne,
der Prüfungsinhalte und Strukturen am praktischen Berufsleben.<br />
<strong>Regionale</strong> Besonderheiten sind dabei genau so zu berücksichtigen, wie individuelle<br />
Stärken und Schwächen der Auszubildenden.<br />
Die berufliche Ausbildung muss als Weg in die Arbeitswelt für alle offen sein,<br />
es gibt, durch differenzierte Ausbildungsangebote für Leistungschwächere<br />
und Leistungsstarke diese Chance zu ermöglichen.<br />
Eine Verzahnung der Berufsausbildung mit den Bereichen der Weiterbildung<br />
ist für den Ansatz von lebensbegleitendem Lernen dringend erforderlich.<br />
These 1:<br />
Ausbildung im Verbund ist ein Konzept mit Zukunft.<br />
Wenn die berufliche Ausbildung die Vermittlung eines komplexen Kompetenzbildes<br />
zum Ziel hat, bilden Verbundkonzepte eine qualitativ hochwertige<br />
Alternative zur „klassischen“ Vollausbildung im Betrieb, insbesondere<br />
● für Betriebe, die alleine nicht ausbilden können,<br />
● für Betriebe, die alleine nicht ausbilden wollen und<br />
● für Jugendliche, die eine qualitative und breit angelegte Ausbildung<br />
wünschen.<br />
These 2:<br />
Neue Berufsbilder und -kompetenzen, neues Wissen erfordern neue<br />
Formen der Kooperation und der Verzahnung von Lernorten. Ausbildung<br />
im Verbund hat viele Formen, z. B.<br />
● Auftragsausbildung,<br />
● Ausbildungskonsortium,<br />
● Leitbetrieb mit Partnerbetrieben und<br />
● Ausbildungsverein.<br />
Hinzu kommen Modelle<br />
● freier Träger mit Kooperationsbetrieben und<br />
● Berufsschulen mit Kooperationsbetrieben.<br />
Das Grundkonzept heißt:<br />
„In Kooperation ausbilden“.<br />
These 3:<br />
Ausbildung im Verbund hat viele Vorteile.<br />
Als Vorteil für die Betriebe,<br />
● sichert sie den betrieblichen Nachwuchs auch in kleinen und/oder<br />
hoch spezialisierten Betrieben,<br />
● nutzt sie spezielle Kapazitäten und Kompetenzen beteiligter<br />
Betriebe/Partner und<br />
● ermöglicht eine bessere Verteilung der Ausbildungsaufwendungen.<br />
Für die Auszubildenden,<br />
● ermöglicht die Ausbildung im Verbund eine qualitativ hochwertige<br />
Ausbildung,<br />
67
● das Erleben unterschiedlicher<br />
Lernorte/-welten.<br />
● Sie befördert die Flexibilität<br />
und Mobiltät der Auszubildenden<br />
und<br />
● bietet eine praktische/qualitative<br />
Basis für die Modularisierung<br />
in der Berufsbildung.<br />
Als Vorteil für die Region,<br />
● erhöht sie das Ausbildungsplatzangebot.<br />
These 4:<br />
Ausbildungsnetzwerke bieten ein<br />
flächendeckendes Strukturangebot<br />
für ein differenziertes Ausbildungsangebot entsprechend<br />
● den Bedarfen der Region,<br />
● den Bedarfen der Wirtschaft,<br />
● dem individuellen Leistungs vermögen der Jugendlichen und<br />
● ihren Neigungen und Wünschen.<br />
<strong>Regionale</strong> Kooperationen zwischen Kommunen, Betrieben, Berufsschulen<br />
und Bildungsträgern bilden die Grundlage für Kompetenznetzwerke in der<br />
Region.<br />
Die Kompetenzen der verschiedenen Ausbildungspartner können optimal<br />
genutzt und ihre Angebote aufeinander abgestimmt werden.<br />
These 5:<br />
<strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong> und <strong>Netzwerk</strong>e bieten eine neue<br />
Form der Kooperation in der Ausbildungsmarktpolitik und ermöglichen<br />
den notwendigen Berufsbildungsdialog auch auf lokaler Ebene.<br />
<strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong>, wie beispielsweise das <strong>Berlin</strong>er Modell,<br />
● ermöglichen die Einbeziehung der Bezirke/Kommune als Akteure in<br />
der lokalen Ausbildungsmarktpolitik,<br />
● befördern das Ziel: Ausbildungsmarktpolitik als fachübergreifende<br />
Aufgabe der Kommunalverwaltung zu verankern,<br />
● befördern die institutionelle Kooperation im Bezirk / in der Region<br />
und ermöglichen einen regionalen Berufsbildungsdialog,<br />
● ermöglichen die Organisation bedarfsgerechter Ausbildungsangebote<br />
im Bezirk / in der Region und<br />
● bilden einen innovativen Ausbildungsansatz für die Region.<br />
Meine Damen und Herren, eine 6. These muss ich allerdings noch hinzufügen,<br />
da ich denke, dass sie entscheidend ist für den Erfolg von Kooperationen<br />
und <strong>Netzwerk</strong>en.<br />
68
These 6:<br />
<strong>Netzwerk</strong>e sind keine Geheimnisse<br />
Das Wesen gut funktionierender <strong>Netzwerk</strong>e basiert auf<br />
● einer gemeinsam getragenen Philosophie,<br />
● einem klar definierten Ziel,<br />
● einer „Win-Win“ Situation für alle Beteiligten,<br />
● klaren Regeln über Aufgaben- und Verantwortungsteilung<br />
● und Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen.<br />
Herzlichen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
Meine Damen und Herren,<br />
aus Sicht der Senatsverwaltung für Arbeit,<br />
Soziales und Frauen, lassen sich zu der Fragestellung<br />
des Workshops „Sind Ausbildung<br />
im Verbund, regionale <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
und <strong>Netzwerk</strong>e die Konzepte der Zukunft?“,<br />
5 Thesen in den Vordergrund stellen.<br />
These 1:<br />
Ausbildung im Verbund schafft zusätzliche Ausbildungsplätze!<br />
Durch zunehmende Spezialisierung der Unternehmen bei gleichzeitiger Abnahme<br />
der Fertigungstiefe von industriellen Produkten, ist die gewünschte<br />
Breite und Tiefe der Ausbildung in einem Unternehmen vielfach nicht mehr<br />
gewährleistet. Die Folge ist die Abnahme der Bereitschaft auszubilden und<br />
der Möglichkeiten, in einem Unternehmen eine komplette und umfassende<br />
Berufsausbildung darzustellen.<br />
Durch die kooperative Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen kann dieser<br />
Mangel behoben werden.<br />
These 2:<br />
Ausbildung im Verbund erhöht die Qualität der Ausbildung!<br />
Workshop 4<br />
Redebeitrag<br />
Norbert Bücker<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und<br />
Frauen<br />
Durch Ausbildung im Verbund erhöht sich die Qualität der Ausbildung, da<br />
durch den Einsatz in unterschiedlichen Betrieben nicht nur einmalig betriebsspezifisch<br />
ausgebildet wird. Bereits in einem Betrieb vermittelte Ausbildungsinhalte<br />
werden durch andere Partner anders oder zusätzlich dargestellt,<br />
Lerndefizite werden erkannt und beseitigt. Durch unterschiedliche Anwendungs-<br />
und Einsatzgebiete gelingt es dem Auszubildenden, das Erlernte<br />
anzuwenden, Zusammenhänge zu erkennen und den Transfer zu bilden.<br />
Seine Handlungskompetenz wird erhöht. Durch den Einsatz bei unterschiedlichen<br />
Unternehmen mit verschiedenen Ansprechpartnern besteht<br />
die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben. Als Nebeneffekt wird<br />
dabei die regionale Mobilität erhöht. Durch den Einsatz während der Ausbildungszeit<br />
in verschiedenen Unternehmen und den Umgang mit unterschiedlichen<br />
Partnern erhöht sich die Chance der Vermittelbarkeit nach Abschluss<br />
der Ausbildung, wenn kein Übernahmeangebot der beteiligten Firmen<br />
erfolgt.<br />
69
These 3:<br />
Ausbildung im Verbund zwischen Ausbildungsträgern und<br />
Kooperationsbetrieben hilft kurzzeitig in wirtschaftlichen<br />
Ausnahmesituationen das Ausbildungsplatzproblem abzufedern!<br />
Jugendliche, die ausbildungsfähig und -reif sind, aber auf Grund wirtschaftlicher<br />
Ausnahmesituationen keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten<br />
konnten, wird durch eine Verbundausbildung zwischen Ausbildungsträgern<br />
und Betrieben die Möglichkeit eröffnet, eine betriebsnahe Ausbildung zu<br />
erhalten. Betriebe, die aus strukturellen Gründen keine komplette Berufsausbildung<br />
durchführen können oder wollen, sind in der Lage, Teile einer<br />
Ausbildung durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Bildungsträger<br />
anzubieten. Für den Betrieb unrentable Ausbildungszeiten werden<br />
ausgelagert und zugekauft. Trotzdem sichert der Betrieb sich durch seine<br />
Beteiligung als Kooperationsbetrieb seine zukünftigen Mitarbeiter.<br />
Betriebe, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht bereit sind über Bedarf<br />
auszubilden, erklären sich oftmals bereit, zusätzliche Auszubildende unter<br />
Kostenbeteiligung auszubilden, wenn der unrentable Teil der Ausbildung auf<br />
einen Bildungsträger verlagert wird und dafür keine Zusatzkosten für den<br />
Betrieb entstehen.<br />
Schwächere, noch nicht ganz ausbildungsreife Jugendliche werden durch<br />
die Ausbildungsträger zur Ausbildungsreife gefördert und erhalten die<br />
Chance auf eine betriebsnahe Ausbildung in einem Kooperationsbetrieb.<br />
These 4:<br />
In regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n liegt die Kompetenz zur Lösung<br />
regionaler Probleme.<br />
Impulse für zielgerichtete Ausbildungsangebote, insbesondere im Verbund<br />
zwischen Ausbildungsträgern und regionalen klein- und mittelständischen<br />
Betrieben, helfen bei der Problemlösung.<br />
Durch kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den regionalen<br />
Verbundpartnern werden gemeinsame Strategien und Aktionen für Verbundausbildung<br />
entwickelt und auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse werden<br />
überprüft und reflektiert.<br />
Zur Sicherung der Kompetenz und Handlungsfähigkeit sollten folgende regionale<br />
Verbundpartner an den Problemlösungen beteiligt werden:<br />
Vertreter der jeweiligen Bezirksämter, Wirtschaftsbeiräte und Wirtschaftsförderer,<br />
Jugendämter, Sozialämter, Leitträger und Koordinatoren des Verbundes,<br />
Vertreter der Berufskammern und der regionale Arbeitsämter, kooperierende<br />
Ausbildungsträger und Betriebe.<br />
Die regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> haben 2 Hauptaufgaben:<br />
Durch die in die regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> eingebundenen Akteure<br />
ist die Kompetenz vorhanden, um einerseits für die individuellen Probleme<br />
der in der Region unversorgten Jugendlichen Lösungen zu entwickeln, die<br />
eine isolierte Institution nicht allein lösen kann, andererseits kann zur Verbesserung<br />
der konkreten ausbildungsbezogenen Dienstleistungsangebote<br />
der regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> - insbesondere für klein- und mittel-<br />
70
ständische Unternehmen der Region beigetragen werden (Verbesserung<br />
der Ausbildungsstruktur). Dabei wird diesen Unternehmen bei der Entwicklung<br />
und Einführung der neuen zukunftsorientierten Berufsbilder, z. B. im IT-<br />
Bereich, geholfen.<br />
Durch diese Hilfe kann bisher nicht genutztes Ausbildungspotential in Wirtschaftsunternehmen<br />
und Organisationen entwickelt werden. Dabei werden<br />
auch die noch unterrepräsentierten ausländischen Unternehmen berücksichtigt.<br />
These 5:<br />
<strong>Netzwerk</strong>e helfen intelligente Problemlösungen für erkennbare<br />
Zukunftsprobleme zu entwickeln.<br />
Durch Einbeziehung der regionalen <strong>Ausbildungsverbünde</strong> und darüber hinaus<br />
auch der allgemeinbildenden Schulen gilt es, gemeinsam neue Formen<br />
der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu implementieren, um Jugendliche<br />
bereits frühzeitig auf die künftigen Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt<br />
vorzubereiten, aber auch um den politischen Entscheidungsträgern an<br />
der Realität orientierte Wege und Entscheidungshilfen aufzuzeigen.<br />
Allgemein ist festzustellen, dass einerseits Schulabgänger mit schlechtem<br />
oder ohne Abschluss nur geringe Chancen haben, einen betrieblichen Ausbildungsplatz<br />
zu erhalten, und andererseits der Einstieg in die Arbeitswelt<br />
ohne eine Qualifizierung oder Ausbildung zunehmend schwieriger wird.<br />
Auch Jugendliche mit Sprachdefiziten haben erhebliche Schwierigkeiten bei<br />
der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Viele Jugendliche haben auch keine<br />
reale Vorstellung über die Arbeitswelt und die Erwartungshaltung der Unternehmen.<br />
Zur weitgehenden Vermeidung von Warteschleifen unversorgter Ausbildungsplatzbewerber,<br />
der Vermeidung von Förderketten und Ausbildungsabbrüchen,<br />
erscheint es dringend erforderlich, allgemeine und spezifische<br />
Informationen der Arbeits- und Berufswelt bereits in den beiden<br />
letzten Klassenstufen der allgemeinbildenden Schulen zu vermitteln. Neben<br />
der Informationsvermittlung durch die Berufsberatung der Arbeitsämter ist<br />
es dringend angeraten, die Erwartungshaltung der Unternehmen und die<br />
reale Arbeitswelt durch kompetente Vertreter der Unternehmen vorzustellen.<br />
Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass Unternehmen verschiedener<br />
Gewerke durch spezifisch zusammengestellte Interessengruppen besucht<br />
werden. Im Weiteren ist zu empfehlen, dass für interessierte Jugendliche in<br />
verschiedenen Gewerken bei erfahrenen Ausbildungsträgern angeboten<br />
werden. Hier könnten auch zusätzlich Sprachmodule für Jugendliche mit<br />
Sprachdefiziten angeboten werden, die sich in der Vermittlung an den Erfordernissen<br />
der Arbeitswelt orientieren und die die Jugendlichen in die Lage<br />
versetzen, die angebotenen Lerninhalte zu verstehen und der in einer Ausbildung<br />
notwendigen Kenntnisvermittlung folgen zu können. Die zzt. angebotene<br />
Form der Schülerpraktika ist nicht bedarfsorientiert und lässt keine<br />
Auswahl verschiedener Gewerke zu. Gerade Jugendliche mit Lerndefiziten<br />
wirken oftmals orientierungslos und müssen sich durch das Ausprobieren<br />
verschiedener Tätigkeiten in verschiedenen Gewerken ohne Leistungszwang<br />
orientieren können.<br />
71
Workshop 4<br />
Redebeitrag<br />
Reinhard Selka<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
Meine Damen und Herren,<br />
ich bin von der SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
gebeten worden, einige Erkenntnisse zum<br />
Ansatz der Ausbildung im Verbund aus Sicht<br />
des Bundesinstituts für Berufsbildung vorzutragen.<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
In der Berufsausbildung dominiert augenblicklich<br />
die quantitative Sichtweise: <strong>Ausbildungsverbünde</strong>n wird nachgesagt,<br />
dass sie zu einer Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt beitragen<br />
können. Dabei wird zugleich allgemein festgestellt, dass diese Form der<br />
Ausbildung auch qualitativen Ansprüchen standhält und zudem voll kompatibel<br />
mit dem Dualen System 1 der Berufsausbildung sei.<br />
Es ist nicht bekannt, wie viele Verbünde in den letzten Jahren entstanden<br />
sind. Unter organisatorischen Gesichtspunkten werden meist die vier<br />
Grundtypen von Verbünden genannt 2 . Allerdings ist zu beobachten, dass eine<br />
Vielzahl von Mischformen existieren, die sich eher an regionalen Bedarfslagen<br />
bzw. an länderspezifischer Förderpolitik orientieren.<br />
Interessanter jedoch sind die verschiedenen Formen von Verbünden, die<br />
sich aus der Interessenlage der Beteiligten ergeben. Hiervon sollen einige<br />
qualitativ interessante Ansätze vorgestellt werden 3 :<br />
Einzelbetriebliche Problemlösungen<br />
Personalentwicklung<br />
Innovative Betriebe sind häufig in der paradoxen Situation, dass sie gut<br />
qualifiziertes Personal mit breiter Bildung und Arbeitserfahrung benötigen,<br />
genau dieses jedoch wegen ihrer Spezialisierung weder selbst ausbilden,<br />
noch auf dem Arbeitsmarkt finden können. Verbünde können hier in einer<br />
Reihe von Fällen helfen.<br />
Auslastung von Kapazitäten<br />
Eine unter Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvolle Gruppengröße von Auszubildenden<br />
entspricht nicht unbedingt dem einzelbetrieblichen Nachwuchsbedarf.<br />
Viele Großunternehmen vermarkten daher freie Kapazitäten und<br />
lassen so – zum beiderseitigen Nutzen – kleinere Unternehmen an ihren<br />
Ausbildungsressourcen partizipieren. Vereinzelt sind auch langfristig angelegte<br />
Absprachen zwischen Unternehmen zu beobachten, kostenintensive<br />
Ausbildungsabschnitte gemeinsam zu planen.<br />
Qualitätssicherung in Prozessketten<br />
Die zunehmende Konzentration von Unternehmen auf sog. Kerngeschäfte<br />
erfordert unternehmensübergreifende Prozessketten in der Herstellung von<br />
Produkten oder Dienstleistungen. Die gemeinsame Ausbildung durch solche<br />
Geschäftspartner verstärkt das Zusammenhangsdenken der Auszubildenden<br />
und erhöht damit die Qualität und Wirtschaftlichkeit.<br />
1 Dies stützt sich auf § 22 Absatz 2 BBiG, nach dem Mängel in der Breite des Bildungsangebotes eines<br />
Ausbildungsbetriebes durch ”Ausbildungsmaßnahmen außerhalb” geheilt werden können.<br />
2 siehe Abb. 1<br />
3 siehe Abb. 2<br />
72
Branchenbezogene Lösungen<br />
Nachwuchspflege<br />
In einer Reihe von Wirtschaftsfeldern<br />
dominieren kleinere Unternehmen,<br />
die die benötigten Qualifikationen<br />
durch einzelbetriebliche<br />
Ausbildung nur schwer heranbilden<br />
können. So hat beispielsweise das<br />
private Versicherungsgewerbe –<br />
ohne die Bezeichnung „Verbund“ zu<br />
erwähnen – mit einem nahezu<br />
flächendeckend eingerichteten Bildungswerk<br />
schon vor vielen Jahren<br />
eine Branchenlösung entwickelt.<br />
Die neuerdings in der Ausbildung<br />
vorgesehene Zweisparten- Ausbildung<br />
erfordert zusätzlich die Kooperation zwischen den häufig stark spezialisierten<br />
Agenturen.<br />
Andere Beispiele finden sich in weniger bekannten Ausbildungsberufen, etwa<br />
in der Steine- und Erdenindustrie oder in der Kunststoffverarbeitung.<br />
Qualitätssicherung<br />
Wenngleich die Qualitätssicherung natürlich auch in den eben genannten Beispielen<br />
ein wesentlicher Bestimmungsfaktor ist, gibt es Branchenlösungen für<br />
Verbünde, die sich explizit diesem Ziel verschrieben haben. Hierzu gehören<br />
regionale Branchenverbünde des Güterkraftverkehrs (Speditionskaufleute,<br />
Berufskraftfahrer), aber auch der Mineralölwirtschaft, deren Tankstellen den<br />
Entwicklungsprozess von der kleinen Werkstatt zum Einzelhandelsunternehmen<br />
ohne <strong>Ausbildungsverbünde</strong> kaum leisten können.<br />
Standortbezogene Lösungen<br />
Unternehmensentwicklung<br />
In Gewerbeparks und Technologie- und Gründerzentren sind Verbundlösungen<br />
zu beobachten, die neu gegründeten Unternehmungen nach ihrer<br />
ersten Konsolidierungsphase durch externes Ausbildungsmanagement den<br />
Weg in eine langfristige Personalentwicklung ebnen. Da diese Standorte<br />
häufig Unternehmen mit ähnlichen Qualifikationsanforderungen zusammenführen,<br />
lassen sich hier schon kurz nach Unternehmensgründung erste<br />
Verbundphasen organisieren.<br />
Kundenorientierung<br />
Einige Einkaufszentren haben damit begonnen, die Kundenorientierung ihrer<br />
Mieter auch durch gemeinsame Ausbildung zu fördern. Damit ergänzen<br />
sie die technische und die auf gemeinsame Werbung abgestellte Kundenansprache<br />
um eine qualitative Komponente.<br />
<strong>Regionale</strong> Problemlösungen<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Die Medienbranche (z. B. Standorte Köln oder Nürnberg) oder das Hotelund<br />
Gaststättengewerbe (z.B. Mecklenburg-Vorpommern) verbinden die re-<br />
73
gionale Wirtschaftsförderung mit einem breit angelegten Feld von Aus- und<br />
Weiterbildung. Dabei verbindet sich der Gedanke des Ausbildungsverbundes<br />
mit einem differenzierten Angebot an Aus- und Fortbildung unter<br />
Einschluss vollzeitschulischer Bildungsgänge, abschlussbezogener Fortbildungslehrgänge<br />
sowie ad hoc- Angeboten für spezielle Bedarfslagen.<br />
Jugendförderung<br />
Zu guter Letzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich durch regionale Verbünde<br />
auch Lösungen entwikkeln lassen, durch die Jugendliche eine Ausbildungschance<br />
erhalten, die sie ohne diese Angebote nicht hätten. Dabei<br />
sind glücklicherweise zunehmend Beispiele 4 aufzufinden, die auf nachhaltige<br />
Integration in das Erwerbsleben setzen und sich von dem leider noch<br />
verbreiteten Slogan abwenden, dass irgendeine Ausbildung besser sei, als<br />
gar keine.<br />
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
4 Eine Sammlung von Good-Pactice ist die Dokumentation der Wettbewerbsbeiträge zum<br />
Hermann-Schmidt-Preis 2000: Selka, Reinhard: Förderung von Benachteiligten in der Berufsausbildung.<br />
Bielefeld 2000<br />
74
Präsentation<br />
der Workshop-<br />
Ergebnisse
Workshop 1<br />
Ergebnisse<br />
Rolf-Joachim Heger<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
78<br />
Frage: Wo liegt die Zukunft der Qualitätssicherungen<br />
der Ausbildung?<br />
Bereits jetzt schon von Ergebnissen zu sprechen,<br />
ist natürlich ein wenig voreilig, wurde<br />
doch zunächst im Workshop versucht, Annäherungen<br />
an die Thematik zu formulieren<br />
und die Brisanz und Konsequenz der Fragestellung<br />
konkreter zu fassen. Denn wenn<br />
man sich den Titel dieses Workshops noch<br />
einmal vor Augen hält, diese durchaus zielgerichtete Frage nach der Verortung,<br />
dem “Wo”, der zeitlichen Dimension “Zukunft” und dem Ort “Verbundausbildung”<br />
mit dem Sujet “Qualitätssicherung”, so sind dies alles Begriffe<br />
mit hohem Anforderungs- aber auch Aufforderungscharakter, und es<br />
gilt, diese in Zeiten wie den jetzigen näher zu bestimmen, perspektivisch<br />
auszuloten und eventuell Prognosen und Trends über das bisher Bekannte<br />
hinaus zu formulieren. Eine wahrliche Herkulesarbeit, dies in der zur Verfügung<br />
stehenden Zeit anzugehen. Deshalb im Zeitraffer nur “Annäherungen”<br />
an das Thema.<br />
Annäherung 1: Qualitätssicherung erfordert 3 relevante Aspekte: Zum einen<br />
die notwendige Erhöhung der organisatorischen Flexibilität, d.h. die beteiligten<br />
Institutionen Schule, Betrieb und Bildungsträger müssen Veränderungen<br />
schnell und nachhaltig realisieren können. Der Nachweis einer<br />
Qualität in dem angesprochenen Feld ist zu belegen, sei es über das Preis-<br />
Leistungsverhältnis, die Markt- und Kundenbindung und/oder die verwaltungstechnische<br />
Zuverlässigkeit. Der zweite Aspekt ist die Forderung nach<br />
Erhöhung der didaktischen Flexibilität, also all das, was mit Lernarrangements<br />
zu tun hat, all das, was mit veränderten Anforderungen auf der curricularen<br />
Ebene, sprich: ständig anzupassenden lehr-, lern- und ausbildungsmethodischen<br />
settings gemeint ist und letztlich all das, was mit der<br />
Veralterungsquote aktuellen Wissens und spezieller Produkt- oder Bildungsangebote<br />
zu tun hat. Denn didaktische Flexibilität bedeutet auch die<br />
schnelle Implementierung neuer Bildungsinhalte und -formen. Die oft thematisierte<br />
– und eher defensiv beurteilte – Modernisierung beruflicher Curricula<br />
innerhalb bestehender Ausbildungsberufe wird zunehmend über externe<br />
Anforderungen (z.B. fachunspezifische Qualifikationen, Haltungen<br />
und Einstellungen zum Lernen u.ä.) beschleunigt. Dies leitet zwangsläufig<br />
zum dritten Aspekt über, der sich auf die damit einhergehende und notwendige<br />
Erhöhung der Effektivität und Transparenz bei den Anbietern im Berufsbildungssystem<br />
konzentriert. Dies hat einerseits viel mit Wirtschaftlichkeit<br />
zu tun, aber auch – besonders auf der Strukturebene – mit der Funktionalität<br />
der Verbundausbildung und der daraus resultierenden „neuen“ Konkurrenzsituation<br />
zahlreicher Teilnehmer auf einem zunehmend vernetzteren<br />
Bildungsmarkt.<br />
Annäherung 2: Die Qualitätssicherung im Zusammenhang mit der Verbundausbildung<br />
erfordert kontinuierliche Abstimmungs- und Ausrichtungsprozesse<br />
unter den beteiligten Institutionen. Dies ist durchaus eine „neue“<br />
Qualität, im Gegensatz zum Agieren (und oft nur Reagieren) im Dualen Sys-
tem, wo die Kunst im Zusammenspiel<br />
zweier Systeme liegt, sich nun<br />
aber auf drei und mehr ausweitet,<br />
so dass dies in der Tat anderer Formen<br />
gegenseitiger Kooperationen<br />
bedarf. Verbundausbildung als so<br />
verstandenes Zukunftsmodell heißt<br />
aber auch, über die angesprochene<br />
strukturelle Anforderung in den Kooperationen<br />
mit den Lernorten hinaus<br />
auf mögliche Anfälligkeiten als<br />
Risikoträger abzustellen, wenn Ersatzfunktionen<br />
zwischen den Beteiligten<br />
dominieren; d.h., wenn etwa<br />
Bildungsträger zum ausschließ- Rolf-Joachim Heger<br />
lichen „Ersatz“ für betriebliche Ausbildung<br />
angesehen werden und alleinige<br />
Verantwortung übernehmen müssen für gelungene oder nicht gelungene<br />
Berufseinmündungen.<br />
Annäherung 3: Ein scheinbares „Allheilmittel“ in der Vermittlung zwischen<br />
bisherigen Standards und den qualitätsorientierten neu geforderten flexiblen<br />
Strukturen im Lehr- und Lernangebot liegt in der sogenannten Modularisierung.<br />
Hierbei ist vor allem die Frage nach dem Wie und Was einer Zertifizierung<br />
der Module relevant, denn deren Wertigkeit macht nur Sinn – auch<br />
grenzüberschreitend – wenn das Ergebnis einzelner Bausteine einer objektiv<br />
überprüfbaren Messung standhält und nicht allein die Formulierung, dass<br />
modular ausgebildet wird, bereits dem Siegel der Qualität entspricht. Hierbei<br />
greift die Frage nach der Qualitätssicherung ganz direkt in die Perspektive<br />
der Verbundausbildung ein. Eine Beantwortung auf nationaler wie europäischer<br />
Ebene ist gegenwärtig weder ausdrücklich noch annähernd erfolgt,<br />
trotz zahlloser Modellversuche, Ankündigungen, Umsetzungsversuche. Abschließend<br />
sei auf den Eindruck eines Teilnehmers aus dem Workshop verwiesen:<br />
„Noch immer bewegen wir uns im Zirkelschluss zwischen Qualität<br />
bestimmen, Qualität halten und Qualität steigern. Die Frage bleibt wie?“<br />
Workshop 1 Ergebnis:<br />
1. Qualitätssicherung erfordert,<br />
● Erhöhung organisatorischer Flexibilität,<br />
● Erhöhung der didaktischen Flexibilität,<br />
● und Erhöhung der Effizienz und Transparenz.<br />
2. Qualitätssicherung erfordert ferner kontinuierliche Abstimmung und<br />
Ausrichtung an den Konsequenzen.<br />
3. Verbundausbildung ist ein Zukunftsmodell, mit hohen Anforderungen<br />
im Hinblick auf Kooperation der Lernorte, Modularisierung der Ausbildung<br />
und bezogen auf <strong>Berlin</strong>, finanziell risikoreich für die Träger.<br />
4. Bereits erarbeitete Module aus Modellprojekten müssen der Allgemeinheit<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
5. Qualitätssicherung kostet Geld.<br />
79
Workshop 2<br />
Ergebnisse<br />
Heide Dendl<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Heide Dendl<br />
Frage: Was muß die Allgemeinbildende<br />
Schule leisten um Jugendliche auf den Prozess<br />
der Ausbildung vorzubereiten oder wie<br />
muss Sie sich entwickeln?<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, die Experten<br />
in unserem Workshop haben mit den Inputthesen<br />
ihre Sichtweise zur Fragestellung<br />
deutlich gemacht und gleichzeitig dafür Sorge<br />
getragen, dass genügend „Zündstoff“ für<br />
die Diskussion gelegt wurde. In unserem Workshop bildeten sich 2 Gruppen,<br />
die scheinbar von unterschiedlichen Ausgangspositionen versuchten,<br />
das Thema zu erschließen. Während die eine Gruppe mehr den Ansatz des<br />
Überganges von der Schule in den Beruf (Schultypen etc.) betrachtete,<br />
legte die andere mehr darauf Wert, die Rahmenbedingungen und Partner<br />
des allgemeinbildenden Schulprozesses zu reflektieren. Welche Ergebnisse<br />
wurden nun erreicht? Die vorliegenden Thesen wurden zwar getrennt in<br />
beiden Gruppen erarbeitet, aber dann gemeinsam diskutiert und vereinbart<br />
(Konsens). Darüber hinaus besteht weiterer Diskussionsbedarf.<br />
Als erstes Thesen-Ergebnis wurde folgendes erarbeitet: Die Schule soll<br />
sich zur Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen/Partnern öffnen.<br />
Zur Unterstützung und Weiterentwicklung der allgemeinbildenden Schule ist<br />
es aus Sicht der Teilnehmer erforderlich, andere Institutionen und<br />
Erfahrungen einmünden zu lassen. Das relativ starre und in sich geschlossene<br />
System Schule muss von außen belebende Impulse bekommen. Das<br />
„wirkliche“ Arbeitsleben muss vermittelt werden, z.B. über Entwicklungspartnerschaften<br />
mit der Wirtschaft oder Elternworkshops, die sowohl Lehrer<br />
als auch Schüler fit für die Zukunft machen.<br />
Als zweites Thesen-Ergebnis wurde hervorgehoben: Die Vergleichbarkeit<br />
und Aussagekraft von Zensuren auf Zeugnissen ist zu erhöhen.<br />
Sowohl die unterschiedlichen Schultypen in den einzelnen Bundesländern,<br />
als auch die Unterschiede zwischen den Bundesländern schlechthin, tragen<br />
dazu bei, dass die Zensuren auf Zeugnissen bundesweit sehr unterschiedlich<br />
interpretiert werden. Insbesondere<br />
bei Bewerbungsvorgängen<br />
sind Mitarbeiter von z.B. Personalabteilungen<br />
überfordert, Zeugnisse<br />
zu lesen bzw. Zeugniszensuren von<br />
verschiedenen Schulen zu vergleichen.<br />
Insofern macht hier eine Vergleichbarkeit<br />
bzw. Erhöhung der Aussagekraft<br />
Sinn. Neben der fachlichen<br />
Bewertung sollte zukünftig<br />
auch Bezug auf soziale Kompetenzen<br />
genommen werden, um damit<br />
Zeugnisse (Personen) beurteilungsfähiger<br />
zu machen.<br />
80
Das dritte Thesen-Ergebnis war: Mehr Selbständigkeit der Schulen<br />
bei pädagogischen Entscheidungen unter Sicherung von<br />
Qualitätsstandard in Kernbereichen der schulischen Bildung.<br />
Die noch sehr ausgeprägten starren Vorschriften an den allgemeinbildenden<br />
Schulen sind flexibler zu gestalten. Projektorientierte Unterrichtsphasen<br />
dürfen aufgrund von Zeitschemen nicht be- bzw. verhindert werden. Allgemeinbildende<br />
Schule muss losgelöst von administrativen Zwängen, Schüler<br />
realistisch und zukunftsorientiert auf das berufliche Leben vorbereiten (kurzfristiges<br />
Reagieren auf aktuelle Veränderungen).<br />
Das vierte Thesen-Ergebnis lautet: Der Übergang von allgemeinbildender<br />
zu berufsbildender Schule soll durch frühzeitige Kompetenz- und<br />
Potentialanalyse der Schüler unterstützt werden.<br />
Zur besseren und realistischeren Vorbereitung der Schüler auf die berufliche<br />
Ausbildung macht es Sinn, die individuellen Kompetenzen und Potentiale<br />
zu ermitteln. Damit können sowohl Schüler als auch Berufsberater<br />
bereits im Vorfeld die Berufswünsche besser hinsichtlich der zu erwartenden<br />
Anforderungen abgleichen.<br />
Frage: Welche Anforderungen erwachsen<br />
aus der Informationsgesellschaft an das Berufsbildungssystem<br />
aus Sicht der Wirtschaft?<br />
Nach dem bisher Gehörten muss ich meine<br />
Ausführungen mit einer Binsenweisheit beginnen,<br />
die da lautet: „Alles hängt mit allem zusammen“.<br />
Schule war nämlich auch in unserem<br />
Workshop ein zentrales Thema. Im Grunde<br />
ist das auch nicht verwunderlich, denn für<br />
die Wirtschaft ist es natürlich von großem<br />
Workshop 3<br />
Ergebnisse<br />
<strong>Rainer</strong> Hölmer<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Prof. Dr. Peter Diepold<br />
Göttingen<br />
Interesse, was den Absolventen der allgemeinbildenden Schulen mit auf ihren<br />
Weg gegeben wird und wie sich die Zusammenarbeit mit den Schulen, insbesondere<br />
auch den berufsbildenden Schulen, gestaltet. Das schlägt sich<br />
entsprechend in den Thesen nieder.<br />
These 1:<br />
Der kritische Umgang mit vernetzten Informationen (verfügbar machen,<br />
auswählen, strukturieren, interpretieren etc.) muß von der Grundschule<br />
in allen Schulformen wie auch in der Fort- und Weiterbildung durchgängig<br />
„trainiert“ werden (soft skills, Lebenslanges lernen etc.)<br />
Herr Professor Diepold, sie haben diesbezüglich im Rahmen eines Modellversuchs<br />
quasi schon „vorgearbeitet". Vielleicht stellen Sie das Projekt kurz vor?<br />
Ja gern, wir haben einen Modellversuch für Lehrer an der Humboldt Universität<br />
durchgeführt, über drei Jahre hinweg, dessen Ergebnis eine fächerunabhängige<br />
Matrix von Themen hinsichtlich der informatischen Bildung ist.<br />
Mit informatischer Bildung meinen wir den kritischen Umgang mit Informationen,<br />
die heutzutage im Netz sind, deren Auflistung nach Themen und deren<br />
praktische Nutzung und Umsetzung im Rahmen der Lehrerausbildung<br />
81
in einer Reihe von Modulen, ich glaube es sind etwa 500, in drei Dimensionen.<br />
Unsere Idee war, dass man dies durchaus für einzelne Berufe oder<br />
Schularten weiterentwickeln oder spezifizieren könnte. Die Fähigkeit, mit Informationen<br />
umzugehen, das ist natürlich nichts Neues. Im Unterricht war<br />
es immer wichtig zu reflektieren: Wie ordne ich meine Gedanken, wie drücke<br />
ich mich aus, dass es verständlich ist? Aber doch ist es heutzutage unter<br />
dem Aspekt der Informationsgesellschaft viel wichtiger geworden, wie<br />
wir uns, und das betrifft schon die kleinen Kinder, in dem Informationsmeer<br />
des Internets zurecht finden. Wie kann ich das strukturieren, wie kann ich<br />
das gewichten, wie kann ich die Richtigkeit im Vergleich mit anderen sehen,<br />
wie kann ich das dahinter liegende Interesse deutlich machen, wie kann ich<br />
so etwas für mich selber so verarbeiten? Es geht um das, was heute Herr<br />
Professor van Buer die mehr kognitiven Fähigkeiten nannte. Alles das sind<br />
Fragen, die von der Grundschule an über das gesamte Lebensalter bis in<br />
die Seniorenpädagogik vermittelt und trainiert werden sollten. Unsere Ergebnisse<br />
und Erkenntnisse aus dem Modellprojekt haben wir, zusammen<br />
mit der Medienoffensive an Brandenburger Schulen, nicht nur auf den Server<br />
gelegt, sondern auf eine CD gebracht, von der Sie hier ein Exemplar bekommen<br />
können.<br />
Herr Professor Diepold, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Mit unserer<br />
2. These, die sich auf die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bezieht,<br />
können wir logisch daran anschließen:<br />
These 2:<br />
Diese Fähigkeiten müssen vor allem auch Lehrer/-innen und<br />
Ausbilder/-innen beherrschen und vermitteln (Sicherstellung der<br />
Handlungsfähigkeit).<br />
Die Betonung liegt dabei auf „vermitteln“. Es ist, so denke ich, unbestritten,<br />
dass die Lehrenden das, was sie letztendlich den Jugendlichen und jungen<br />
Erwachsenen vermitteln wollen, dem Grunde nach selbst beherrschen müssen.<br />
Entscheidend aber ist, die Inhalte und Verfahren auch in geeigneter<br />
Weise zu vermitteln und Lernprozesse zur Entwicklung und Förderung der<br />
angestrebten Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Lernenden zu gestalten.<br />
Die 3. These lautet:<br />
Für einzelne Ausbildungsgänge sollten die „informatischen“ Kompetenzen<br />
konkretisiert und in miteinander verknüpfbaren altersspezifischen<br />
Lehr-/Lern- Bausteinen umgesetzt werden.<br />
Dabei geht es im Grunde darum, vor dem Hintergrund der bislang noch etwas<br />
unspezifischen Forderungen die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten<br />
zu konkretisieren und in Form von Lehr-/Lern-Bausteinen auf praktische<br />
zielgruppen- und altersspezifische Inhalte runterzubrechen. Das könnte,<br />
in Anlehnung an den Modellversuch Professor Diepolds und unter Nutzung<br />
der gewonnenen Erkenntnisse, in Form einer Matrix erfolgen, einer<br />
Darstellung, die sowohl das Beziehungsgeflecht, die Bedeutung des Einen<br />
für das Andere, wie die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen übersichtlich<br />
darzustellen vermag.<br />
82
Unsere 4. und letzte These lautet:<br />
Die Wirtschaft braucht verstärkt (informelle) Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen,<br />
die für die Informationsgesellschaft adäquat mit<br />
Sach- und Personalmittel ausgestattet sind. Das gilt insbesondere<br />
auch für die Schulen.<br />
Eine qualitativ hochwertige berufliche Bildung ist heute mehr denn je auf eine<br />
Zusammenarbeit, auf eine Vernetzung der einzelnen Akteure angewiesen.<br />
Die Zusammenarbeit von Wirtschaft mit anderen Akteuren kann, wie<br />
am Beispiel Berufsschule, sehr strukturiert und formalisiert sein, aber auch<br />
informelle Partnerschaften gewinnen zunehmend an Bedeutung. Zur Sicherung<br />
der Bildungsqualität ist bei den einzelnen Partnern eine angemessene<br />
Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln unerlässlich. Das gilt insbesondere<br />
für die Schulen, aber auch für alle andern Bildungseinrichtungen und<br />
natürlich auch für Bildungsprozesse in den Unternehmen, z.B. in betrieblichen<br />
Bildungseinrichtungen.<br />
Frage: Sind Ausbildung im Verbund, regionale<br />
<strong>Ausbildungsverbünde</strong> und <strong>Netzwerk</strong>e<br />
die Konzepte der Zukunft?<br />
Auch für diesen Workshop lässt sich eins<br />
vorwegnehmend sagen: Die Fragestellung,<br />
die es zu bearbeiten galt und an der wir lange<br />
diskutiert haben, hat sich letztendlich als<br />
sehr komplex und vielschichtig erwiesen.<br />
Und schaut man sich die Fragestellung ein-<br />
mal genauer an, eröffnet sich ein ganz weites Spektrum, in welchem jeder<br />
einzelne Frageteil bereits einen eigenständigen Workshop hätte füllen können.<br />
Nichtsdestotrotz konnten – wenn auch ob der Komplexität mit einigen<br />
Mühen – vier Thesen im Rahmen des Workshops formuliert werden.<br />
These 1:<br />
Spezialisierung der Betriebe macht Verbund als Form für die<br />
Ausbildung notwendig.<br />
Die zunehmende Spezialisierung von Betrieben, die wachsende Zahl von<br />
Klein- und Kleinstbetrieben steht in der Berufsausbildung Ausbildungsrahmenplänen<br />
mit eher komplexen und generalisierenden Inhalten gegenüber.<br />
Die Folge ist, in diesen Betrieben kann das komplette Ausbildungsprofil eines<br />
Berufsbildes nicht mehr abgebildet werden, was schlussendlich dazu<br />
führt, dass Ausbildung nicht (mehr) stattfindet. Hier ist der Vorteil, der in der<br />
Ausbildung im Verbund liegt, klar erkannt worden: Durch diese Form der<br />
Ausbildung wird erst die Möglichkeit zur aktiven Partizipation an Ausbildung<br />
und damit zur eigenen Nachwuchsgewinnung geschaffen.<br />
83<br />
Workshop 4<br />
Ergebnisse<br />
Sylvia Runge<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH
These 2:<br />
Verbundausbildung schafft höhere Qualität und zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze.<br />
Zwei Komponenten der Diskussion wurden in dieser einen These<br />
zusammengefasst: Der Qualitätsaspekt, der durch die Verbundausbildung befördert<br />
wird, und der Umstand, dass durch die Verbundausbildung zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze geschaffen werden können.<br />
Gerade in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen das<br />
diesbezügliche Angebot bei Weitem übersteigt, sind Ansätze gefragt, die zur<br />
Ausweitung des Ausbildungsplatzangebotes beitragen. Insbesondere das<br />
<strong>Berlin</strong>er Modell der Umsetzung des Bund-Länder-Sonderprogrammes, in<br />
welchem die Ausbildung im Verbund zwischen Ausbildungsträgern und Betrieben<br />
gefördert wird, hat gezeigt, dass es auf diese Weise möglich ist, zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze zu schaffen, indem bislang ungenutzte Ausbildungspotentiale<br />
nunmehr genutzt werden. Eine Vielzahl von Betrieben,<br />
die bislang noch nicht ausgebildet hatten, haben sich in diesem Rahmen<br />
erstmalig an der Ausbildung selbst aktiv beteiligt. Darüber hinaus wurden<br />
und werden Ausbildungsressourcen in Betrieben gewonnen, in denen nicht<br />
alle notwendigen Teile eines Berufsbildes ausgebildet werden können.<br />
Ist der vorgenannte Aspekt der These dem Grunde nach eher offensichtlich,<br />
so wird der Qualitätsaspekt vermutlich erst auf den zweiten Blick verständlich.<br />
In der Diskussion wurden als Faktoren, die zu einer höheren Qualität in<br />
der Ausbildung beitragen, u. a. aufgeführt:<br />
● die Verzahnung von Praxiskompetenz mit pädagogischdidaktischer<br />
Kompetenz,<br />
● die Erweiterung des Lernhorizontes bedingt durch die unterschiedlichen<br />
Lernorte und die damit verbundenen Anwendungs- und<br />
Einsatzgebiete für das Erlernte, was in der Folge auch eine Erhöhung<br />
der Handlungskompetenz nach sich zieht.<br />
Es wurde festgestellt, dass insbesondere kompetenz- und handlungsorientierte<br />
Ansätze in der Ausbildung von ihrer Bedeutung her verstärkt neben<br />
die Vermittlung fachlicher Inhalte treten müssen.<br />
Die Entstehung von Kompetenzzentren ist dann nur noch ein folgerichtiger<br />
(nächster) Schritt. Und diese Kompetenzzentren können bei sehr unterschiedlichen<br />
Institutionen angesiedelt sein oder sich aus ihnen heraus bilden:<br />
angefangen bei Ausbildungsträgern bzw. Leitbetrieben in der Region,<br />
über bestimmte Betriebe bis hin zu den Oberstufenzentren. Die diesbezüglichen<br />
Entwicklungen und Bestrebungen sind teilweise bereits im Gange. Es<br />
ist davon auszugehen, dass durch die auftretende Konkurrenzsituation die<br />
Qualität in der Ausbildung ebenfalls eine Beförderung erfahren wird.<br />
These 3:<br />
Um Ausbildung im Verbund/<strong>Netzwerk</strong>e zum Erfolg zu führen, ist die<br />
Beteiligung aller Ausbildungspartner und der an Bildungspolitik<br />
interessierten Personen (-gruppen) erforderlich (inkl. der Wirtschaft).<br />
Für die Ausbildung im Verbund gleichermaßen wie für <strong>Netzwerk</strong>e gilt: Von<br />
Erfolg gekrönt sein werden diese nur dann, wenn es gelingt, alle notwendi-<br />
84
gen und kompetenten Partner zu<br />
beteiligen und – mehr noch – zu<br />
einer engagierten Zusammenarbeit<br />
zu bewegen. Von ganz entscheidender<br />
Bedeutung ist die<br />
Einbindung der Wirtschaft in derart<br />
partnerschaftliche Kooperationen,<br />
wie Herr Selka zu Recht unterstrich.<br />
These 4:<br />
<strong>Regionale</strong> <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
schaffen die Chance für einen<br />
lokalen Dialog in der Qualifizierungs-,<br />
Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik,<br />
bedürfen<br />
jedoch des Managements.<br />
Sylvia Runge<br />
Durch die Institution der <strong>Regionale</strong>n <strong>Ausbildungsverbünde</strong> ist eine Plattform<br />
geschaffen worden für den Dialog mit allen Beteiligten in der Qualifizierungs-,<br />
Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik auf regionaler/kommunaler<br />
Ebene, die jedoch aktiv ausgefüllt werden muss. Es gilt, gemeinsam<br />
im Sinne der Region zu handeln und für die vielfältigen, regionalspezifischen<br />
Probleme Lösungen zu suchen, zu erarbeiten und erarbeitete<br />
Konzepte umzusetzen.<br />
Ohne ein hohes Maß an Organisation und ein professionelles Management<br />
wird jedoch weder der Dialog aufrecht zu erhalten sein, noch werden Prozesse<br />
und konzertierte Aktionen auf den Weg zu bringen sein.<br />
85
Abschlußreferat<br />
Wohin die Reise geht?<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
Abschließender<br />
Blick<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Am einfachsten hätte ich es mir machen<br />
können, wenn ich mir schon vor Beginn<br />
dieser Tagung überlegt hätte, was ich Ihnen<br />
als deren Fazit präsentieren wollte.<br />
Dieser sehr üblichen Art bin ich jedoch<br />
nicht gefolgt. Und so hab ich jetzt den<br />
„Schlamassel“. Ich muss versuchen, aus<br />
dem Stehgreif heraus einen abschließenden<br />
und möglichst auch wegweisenden Schlusskommentar zu geben. Ziel<br />
meines Kommentars soll sein, deutlich zu machen, wohin die „Reise geht“<br />
– oder besser: wohin die Reise gehen könnte. Denn mit Verweis auf mein<br />
Eingangsreferat ist zunächst festzustellen, dass die Frage nach der<br />
Beschaffenheit der Zukunft kaum beantwortet werden kann.<br />
So kann ich nur eine gute Antwort auf die Frage nach meiner nächsten Zukunft<br />
geben: Nach meinem Schlusskommentar nehme ich – wenn nichts dazwischen<br />
kommt – die U-Bahn, dann die S-Bahn, dann meine eigenen Füße<br />
und frage zu Hause, ob die mich ins Haus lassen. Viel mehr weiß ich nicht.<br />
So interpretiere ich die Frage, wohin die Reise gehen könnte, als Frage,<br />
wohin sie gehen sollte – und damit als Frage nach Optionen, Wünschbarkeiten<br />
und möglicher Weise gesellschaftlichen Notwendigkeiten.<br />
Vier Fragestellungen will ich im Folgenden nachgehen:<br />
Fragestellung 1: Welche Entwicklungen kommen möglicher Weise in der<br />
nächsten Zeit auf das Berufsbildungssystem in <strong>Berlin</strong> in<br />
der nächsten Zeit zu - auch und gerade in seiner Abstimmung<br />
mit den allgemeinen Schulen?<br />
Fragestellung 2: Was sind die Forderungen von Wirtschaft und Industrie<br />
an die berufliche Bildung für die allernächste Zeit?<br />
Fragestellung 3: Welche Rolle spielt die Verbesserung der inneren<br />
Qualität des Berufsbildungssystems in den nächsten<br />
Jahren?<br />
Fragestellung 4: Welche Anforderungen sind an die Arbeit der verschiedenen<br />
Steuerungsebenen in der beruflichen Bildung<br />
zu stellen?<br />
Zur Fragestellung 1:<br />
Mögliche Entwicklungen im <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungssystem<br />
Für wie stabil man das Bildungs- und Berufsbildungssystem in <strong>Berlin</strong> auch immer<br />
einschätzt, eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Entwicklungen können<br />
im <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungssystem möglicher Weise in der allernächsten<br />
Zukunft erfolgen – dies gerade auch in der Abstimmung mit den allgemeinen<br />
Schulen. Auf drei gehe ich in meinem Abschlusskommentar näher ein:<br />
(a) Zur Veränderung der 11-jährigen Schulpflicht im Schulgesetzentwurf für<br />
<strong>Berlin</strong> vom März 2001: Derzeit ist noch offen, ob die 11-jährige Schulpflicht<br />
mit der Regelung, dass das 11. Schuljahr im Berufsbildungssystem zu absolvieren<br />
sei, auch weiterhin gelten soll. Im neuen Schulgesetzentwurf wird<br />
von einer 10-jährigen Schulpflicht gesprochen, wie sie andere Bundesländer<br />
auch haben. Diese Veränderung trifft nicht die allgemeinen Schulen,<br />
sondern den schulischen Teil des Berufsbildungssystems.<br />
86
Man kann spekulieren, warum diese Änderung gerade zu Zeiten von großen<br />
Haushaltsnöten in <strong>Berlin</strong> eingeführt werden soll; und ohne große Mühe<br />
kommt man auf die Vermutung, dass es vor allem finanztechnische Aspekte<br />
sind – nämlich die Verlagerung der vom Land zu tragenden Kosten oder wie<br />
in Brandenburg von großen Teilen der Kosten auf Bundesmittel.<br />
Neben diesen sicherlich nicht unbedeutenden Gesichtspunkten bleibt für<br />
die im Berufsbildungssystem tätigen Pädagogen jedoch die Frage, welche<br />
Folgen eine solche Änderung für welche Jugendlichen hätte. Zunächst ist<br />
festzuhalten: Für die lernstarken Jugendlichen – für diejenigen, die den Realschulabschluss<br />
bzw. die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife<br />
erwerben (wollen) - hat sie kaum oder nur geringe Konsequenzen; hier<br />
zielt die allgemeine Diskussion auf die Frage nach dem Abitur bereits nach<br />
zwölf Jahren. Aber für die lernschwächeren Jugendlichen, für diejenigen mit<br />
eher geringen kognitiven Ressourcen, eher schwierigem soziobiograpischen<br />
Hintergrund, motivationalen Schwächen etc., vor allem für solche<br />
Jugendlichen mit Verknüpfungen aus Einzelschwächen, führt die Veränderung<br />
der Schulpflicht zu weit reichenden Folgen. Denn zumindest für<br />
die Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss oder den einfachen Hauptschulabschluss<br />
nach Klasse 9 – somit vor allem für diejenigen, die keinen<br />
Ausbildungsplatz erhalten haben – werden nicht mehr wie bisher vollzeitschulische<br />
Angebote in der Berufsförderung bzw. Berufsvorbereitung gemacht<br />
– wie erfolgreich sie in der derzeitigen Form auch immer sein<br />
mögen; statt dessen werden sie in die „Arme“ der Arbeitsämter und deren<br />
Qualifi-zierungsmaßnahmen übergeben. Über diese angemessen zu reden,<br />
wür-den einen eigenen Vortrag erfordern. So sei hier nur der Hinweis auf die<br />
Frage nach dem Erwerb allgemein anerkannter Abschlüsse erlaubt. Insgesamt<br />
ist zu projizieren, dass die Veränderung der Schulpflicht zu einer Verschiebung<br />
zwischen Sozial-, Jugend-, Schul- und Berufsbildungspolitik führen<br />
wird.<br />
(b) Flexibilisierung des Verbleibs in den allgemeinen Schulen und im Berufsbildungssystem:<br />
Im Kontext der Verkürzung der Schulpflicht sei auf einen<br />
weiteren Aspekt aufmerksam gemacht, der bereits im Berufsbildungsbericht<br />
<strong>Berlin</strong> 1999 angesprochen wurde: Warum sind ausgewählte Subgruppen<br />
von Jugendlichen gezwungen, so lange in der allgemeinen Schule<br />
zu bleiben? Gerade die lernschwächeren Jugendlichen haben in nicht unbeträchtlichem<br />
Ausmaß in den scholarisierten Lehrumgebungen des Unterrichts<br />
in diesen Schulen starke Belastungserfahrungen und Erfahrungen<br />
nicht-erfolgreichen Lernens gemacht. Ihre Bewältigungsstrategien sind häufig<br />
solche der Vermeidung, der Bedeutungsverminderung für Lernen in<br />
Schule etc. Eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen – gerade<br />
auch von solchen aus <strong>Berlin</strong> - werfen die Frage auf, warum solche Schüler<br />
und Schülerinnen nicht schon viel früher als i. d. R. nach dem 10. Schuljahr<br />
in andere Lernumgebungen, in andere Settings, überführt werden, die deutlich<br />
geringere Scholarisierungen beinhalten. Damit würden ihnen möglicher<br />
Weise neue Perspektiven eröffnet, wieder Freude und Spaß an Lernen aufzubauen<br />
und an bestimmte Bedingungen formalisierten Lernens herangeführt<br />
zu werden.<br />
87
(c) Berufs- und arbeitsbezogene Inhalte und allgemeine Schulen: In einer<br />
empirischen Untersuchung der Abteilung Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität<br />
zu lernschwachen und marktbenachteiligten Jugendlichen<br />
in der beruflichen Bildung waren sich mehr als 80% der befragten Schulund<br />
Klassenleitungen derjenigen <strong>Berlin</strong>er Oberstufenzentren, in denen<br />
Klassen aus der „Modularen Dualen QualifizierungsMaßnahme (MDQM)“<br />
lernen, einig, dass die allgemeinen Schulen nicht (mehr) angemessen auf<br />
die Anforderungen erfolgreichen Lernens in der beruflichen Bildung vorbereiten.<br />
Die Ergebnisse der internationalen TIMSS/III-Studie können für große<br />
Subgruppen von Absolventen der allgemeinen Schule ebenfalls in dieser<br />
Richtung interpretiert werden. Ob dies an einem Leistungs- „abfall“ der Absolventen<br />
oder an einem Anstieg der Leistungsanforderungen seitens der<br />
Abnehmer, der Wirtschaft und Industrie, oder an beidem liegt, sei dahingestellt.<br />
Allein die Tatsache, dass mindestens acht von zehn Berufsschullehrern<br />
und -lehrerinnen der Meinung sind, die Jugendlichen kämen mit z. T.<br />
gravierenden Mängeln hinsichtlich erfolgreichen Lernens in der beruflichen<br />
Bildung in das Berufsbildungssystem, verweist zumindest auf ein subjektiv,<br />
d. h. bei den abnehmenden Schulen – und übrigens auch Betrieben und Unternehmen<br />
– ,schwer wiegendes Problem. Ich will an dieser Stelle nicht die<br />
Frage nach dem Leistungsstand der Absolventen der allgemeinen Schulen<br />
in Deutschland und besonders in <strong>Berlin</strong> diskutieren; dazu gab es auf dieser<br />
Tagung einen eigenen Workshop.<br />
Statt dessen stelle ich die Frage nach den arbeits- und beruflichen Bezügen<br />
und Inhalten der Curricula in den allgemeinen Schulen. Die Forderung aus<br />
ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, dass wir in hohem<br />
Maße Wirtschaftsbürger und Technikbürger bräuchten, ist unüberhörbar;<br />
die Argumente sind z. T. tief greifend und weit reichend. Lassen Sie es mich<br />
spitz und kantig, auch ein wenig salopp formulieren: Es ist dringendst an der<br />
Zeit, dass die jungen Leute nicht nur die Scheckkarte bedienen können,<br />
sondern dass sie auch verstehen lernen – d. h. nicht zuletzt auch die Hintergründe<br />
begreifen – , was ein Scheck ist, welche Konsequenzen diese<br />
Formen, zunehmend die Formen des on-line-Banking etc., für das Wirtschaftsleben<br />
eines Landes, für den Arbeitsmarkt und das Beschäftigungswesen,<br />
aber auch für die Konstruktion des privaten Lebens haben. Ähnliches<br />
gilt für die technischen Entwicklungen und ihre gesellschaftlichen Folgen;<br />
dies betrifft vor allem den informationstechnischen Bereich und dessen<br />
Produkte zwischen PC-Spielen und Modellierung komplexer Systeme und<br />
Automatisierung von Problemlösungen durch solche Systeme. Auch hier<br />
hat der Workshop auf dieser Tagung sicherlich wichtige Diskussionen gebracht.<br />
Zentral ist, dass die oben angedeuteten Entwicklungen nicht nur eine<br />
Sache für „Experten“ sind, sondern gerade auch für die „Laien“, die<br />
Abnehmer und freiwilligen und/oder unfreiwilligen, bewussten und/oder unbewussten<br />
Verwender. Zugespitzt könnte man sagen: Es kann doch nicht<br />
sein, dass Jugendliche zehn bis dreizehn Jahre lang in einem formalisierten,<br />
scholarisierten Kontext viel über Kultur und Zivilisation und deren geschichtliche<br />
Kontexte lernen – nur kaum etwas über die moderne Arbeitsund<br />
Berufswelt und deren Folgen für die Entwicklung von Gesellschaft.<br />
88
In diesem Kontext stellt sich immer wieder die Frage nach der Einführung<br />
dieser neuen Lerngebiete mittels neuer Fächer. Dies würde dazu führen,<br />
dass die zeitliche und inhaltliche Belastung der Schüler und Schülerinnen,<br />
die in den allgemeinen Schulen im Sekundarstufenbereich I und II zwischen<br />
30 und 35 Unterrichtsstunden und dem zusätzlichen Lernen mittels Hausarbeiten,<br />
Zusatzangeboten an Kursen etc. haben, weiter zunimmt. Dies ist<br />
nicht der probate Weg, denn relativ schnell deutet sich das Ende möglicher<br />
Zusatzbelastungen an – vor allem für die lernschwächeren Schüler und<br />
Schülerinnen. Statt dessen geht es um die „Entrümpelung“ von Curricula<br />
und Lehrinhalten. Für die arbeits- und berufsbezogenen Inhalte als mögliche<br />
curriculare Bereiche und Lehrinhalte geht es darum, sie in die bereits<br />
bestehenden Fächer zu integrieren und damit die Chance zu eröffnen, deren<br />
Verknüpfung mit dem, was unter Allgemeinbildung im Humboldtschen<br />
Sinne verstanden wird, im Sinne kognitiver <strong>Netzwerk</strong>e bei den Schülern und<br />
Schülerinnen aufzubauen.<br />
Insgesamt deutet alles darauf hin, Lernen und individuelle Entwicklung nicht<br />
nur in Fest- und Sonntagsreden als einen lebenslangen Prozess zu verstehen,<br />
sondern die von vielen als Wissensgesellschaft benannte Gesellschaft<br />
auch in ihrer institutionellen Struktur darauf zu verpflichten, die fast skalpellartige<br />
Trennung von „allgemeiner Bildung = allgemeine Schulen“ //„beruflicher<br />
Bildung = Berufsbildungssystem“ // „(berufliche) Weiterbildung = weitestgehend<br />
ungeordneter Angebotsmarkt“ zu überwinden.<br />
Zur Fragestellung 2:<br />
Forderungen von Wirtschaft und Industrie an die berufliche Bildung<br />
Drei Aspekte seien fast im Vorbeiflug angesprochen, davon der erste in ironischer,<br />
aber nicht ausschließlich ironischer Weise:<br />
(a) Forderung nach dem Arbeitnehmer als idealem Menschen: Eigentlich<br />
bräuchte ich diesen Punkt gar nicht ansprechen, er ist fast ein alltägliches<br />
Tagesgespräch im Zusammenhang mit den Problemen im Beschäftigungssystem,<br />
der Frage nach der Um- und Weiterqualifizierung von Arbeitsuchenden<br />
und Arbeitnehmern und -nehmerinnen und nicht zuletzt auch im<br />
Kontext der Debatte um die Entzerrung des debalancierten Verhältnissen<br />
von Angebot an und Nachfrage nach (betrieblichen) Ausbildungsplätzen. In<br />
einem anderen Kontext habe ich einmal die Lautbarungen der einschlägigen<br />
Organisationen und Standesvertreter zusammengetragen und katalogisiert.<br />
Das Ergebnis ist, dass die Anbieter an bezahlter Arbeit gar nicht so viel<br />
von den Nachfragern nach bezahlter Arbeit erwarten – nur, dass sie ideale<br />
Menschen sind: klug, ausgestattet mit komplexem und zielgerichtetem Problemlöseverhalten,<br />
lernfähig und – willlig, hoch motiviert, hoch belastungsfähig,<br />
über hohe soziale Kompetenz verfügend, ausgestattet mit breitem<br />
und tief greifendem Fachwissen, nicht zuletzt auch willig für flexiblen Arbeitseinsatz<br />
und regional mobil. Eigentlich wirklich nicht viel. Doch weg von<br />
dieser durchaus nicht unironischen Zusammenfassung.<br />
(b) Informationelle Grundbildung als Kulturtechnik für alle: Eine wichtige<br />
Forderung wurde auch in dieser Tagung mehr als nur ein Mal deutlich ge-<br />
89
nannt: Auf- und Ausbau der informationellen Grundbildung bei allen Schülern<br />
und Schülerinnen. Informationelle Grundbildung bedeutet, dass der<br />
Beginn des systematischen Lernens in den formalisierten und scholarisierten<br />
Systemen – den Schulen – zeitlich weit vorn liegen muss, nicht erst in<br />
der 5., 6., 7. Klasse, sondern deutlich weiter vorn. Ob dies in der 1. Klasse<br />
sein muss, sei dahingestellt; darüber kann man streiten. Unstrittig ist, dass<br />
die informationelle Grundbildung inzwischen eine weitere unverzichtbare<br />
Kulturtechnik darstellt – gleichberechtigt neben dem Umgehen mit den verschiedenen<br />
Verwendungsformen von Sprache und dem Umgehen mit den<br />
verschiedenen Formen formalisierter Abbildungssysteme zwischen Mathematik<br />
und formalisierten Abbildungen mittels Schemata. Für die weitere<br />
gesellschaftliche Entwicklung im Sinne des Ausbaus demokratischer Alltagskultur<br />
ist es unverzichtbar, dass informationelle Grundbildung kein Selektionskriterium<br />
und damit differenzierendes Machkriterium für die Entwicklung<br />
von Individuen bleibt bzw. wird. Dies gilt übrigens auch für die sog.<br />
althergebrachten Kulturtechniken, z. B. für den Umgang mit der schriftlichen<br />
Verwendungsform von Sprache.<br />
Eine weitere Konsequenz ist auch, dass die informationelle Grundbildung<br />
nicht an die Stelle einer der bisherigen Kulturtechniken treten kann, sie sozusagen<br />
ausmerzen kann. Benötigt wird genau so das routinierte Umgehen<br />
mit Texten, mit Sprache in verschiedenen formalisierten Kontexten, das Umgehen<br />
mit Schemata, mit Zahlen, und das sofort.<br />
Diese Forderung nach dem routinierten Verfügen über diese Kulturtechniken<br />
trifft auch die lernstarken Jugendlichen; es trifft allerdings besonders die<br />
lernschwächeren Jugendlichen. An dieser Stelle stellt sich auch die Frage<br />
danach, wie diesbezüglich mit den Schülern und Schülerinnen nicht-deutscher<br />
Herkunft umgegangen werden sollte; denn diese Jugendlichen sind<br />
nicht nur deutlich in der Gruppe derjenigen überrepräsentiert, die keinen allgemeinen<br />
Abschluss bzw. nur den einfachen Hauptschulabschluss nach<br />
Klasse 9 erwerben. Sie sind auch deutlich unterrepräsentiert bei den Jugendlichen,<br />
die einen betrieblichen Ausbildungsplatz erworben haben, sogar<br />
bei denjenigen, die in der Verbundausbildung mit hoher staatlicher Subvention<br />
ausgebildet werden. Und sie sind in hohem Maße überrepräsentiert<br />
bei denjenigen, die im Berufsbildungssystem nicht erfolgreich ler-nen, abgesehen<br />
davon, dass sie im Bereich der akademischen Berufsaubildung mehr<br />
als deutlich unterrepräsentiert sind.<br />
Die Curricula in der informationellen Grundbildung und in dem schon angesprochenen<br />
Bereich arbeits- und berufsbezogener Lehrinhalte zu verbessern<br />
und sie zu einem qualitätsvollen Bestandteil unterrichtlicher Alltagskultur<br />
zu machen, bedeutet auch, neue Möglichkeiten des Unterrichtens zu<br />
schaffen, multimediales Lernen auch tatsächlich einzuüben und von dort<br />
her neue Zugänge zur Medienwelt zu schaffen. Damit ergeben sich auch<br />
neue Möglichkeiten, Alternativen zu den heimlichen häuslichen „Erziehungs“programmen<br />
am Computer und am Fernsehen zu konstruieren.<br />
(c) Definieren dessen, was die Anbieter an bezahlter Arbeit vom Berufsbildungssystem<br />
verlangen: Dieser Punkt klingt ganz simpel; betrachtet man<br />
90
den Punkt (a) in diesem Abschnitt, wird deutlich, dass dies gar nicht so einfach<br />
ist, vor allem, dass dies nicht mittels solcher Globalforderungen auf<br />
hoher Abstraktionsebene geht. Wirtschaft, Industrie, Gewerbe und Dienstleistung<br />
sowie Industrie sollten, möglichst auf der Basis curricularer und didaktisch-methodischer<br />
Überlegungen und Konzepte, zumindest zweierlei<br />
sagen – zum einen, was sie auf den verschiedenen Ebenen zwischen Berufsbildungsgesetz<br />
und Lehr-Lern-Alltag vom Berufsbildungssystem verlangen,<br />
und zum anderen, was sie bereit sind, zur Realisierung zu investieren.<br />
Dabei sollte ein intensiver Dialog nicht nur auf der Ebene der politischen<br />
Agenten durchgeführt werden, sondern nicht zuletzt auch zwischen<br />
den Unternehmen auf der einen und den beruflichen Schulen und Bildungsträgern<br />
auf der anderen Seite. Dass dies bisher nur partiell so und daher<br />
deutlich verbesserungswürdig ist, zeigen z. B. die empirischen Untersuchungen<br />
zur Lernortkooperation.<br />
Zur Fragestellung 3:<br />
Qualitätssicherung und -steigerung<br />
in der beruflichen Bildung<br />
Qualitätssicherung in der beruflichen<br />
Bildung, vor allem Qualitätssteigerung<br />
und dabei die Steigerung der<br />
„inneren“ Qualität der einzelnen<br />
Lehr- und Ausbildungsangebote, ist<br />
ein ganz zentraler Punkt, an dem<br />
sich auch die Zukunft des deutschen<br />
Berufsbildungssystems entscheiden<br />
wird. Dies habe ich bereits heute<br />
morgen in meinem Eingangsreferat<br />
angesprochen, und dies wurde auch<br />
in dem Workshop deutlich, in dem<br />
ich mitarbeiten durfte.<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong> Prof. Dr. D. h. c. Jürgen van Buer<br />
Welchem Konzept oder Modell man auch immer folgt, ein zentraler Punkt ist<br />
dabei die Entwicklung und Weiterentwicklung, vor allem die zeitstabile Entwicklung<br />
des Personals. Sein Personal qualitativ aufzubauen, es ist ein<br />
langwieriger, ein teurer Weg. Verkürzt gesprochen: Es reicht nicht mehr,<br />
zwei Mal in einem Fünf-Jahres-Rhythmus ein Training anzubieten. Didaktische<br />
und fachliche Kompetenz des Ausbildungspersonals so aufzubauen,<br />
dass sie auf hoher Qualitätsstufe zeitlich stabil und gleichzeitig auch<br />
innovationsfähig bleibt, führt zu zyklischen, engen Weiterbildungssettings.<br />
Ganz im Sinne von weiter reichenden Konzepten des Bildungscontrollings<br />
geht es um mit einander verschränkte Qualitätsentwicklung auf verschiedenen<br />
Ebenen; drei seien hier kurz benannt: (a) Es geht um die Verknüpfung<br />
von Input-, Prozess-, Output und Outcome, somit um eine fast klassische<br />
Evaluations- und Implementierungsfrage: Wie realisiere ich für welche Jugendlichen<br />
effektive Lehr- und Ausbildungsangebote und -umgebungen, so<br />
dass die Ausbildungsziele erreicht werden? Dabei spielt die Entwicklung der<br />
didaktischen und fachlichen Kompetenz des einzelnen Ausbilders und der<br />
einzelnen Ausbilderin eine wichtige Rolle; und diese Entwicklung bezieht<br />
91
sich nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Probleminterpretationen, Einstellungen,<br />
Verhalten und Verhaltensroutinen und nicht zuletzt auch auf das<br />
kommunikative Mikroverhalten in der Lehr-Lern-Situation, somit auf Persönlichkeitsentwicklung.<br />
(b) Solche Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote<br />
sollten selbst wiederum Evaluationen unterworfen werden. (c) Die offene<br />
Frage gerade für Bildungsträger, aber auch für die mit öffentlichen Mitteln finanzierten<br />
beruflichen Schulen, lautet: Wie schafft man es, das Geld für solche<br />
Entwicklungsangebote herbei zu schaffen - und dies für eine regelmäßige<br />
in kurzen Abständen platzierte Weiterbildung? Denn dies wurde in den<br />
Antworten in meinem Workshop ebenfalls schnell sichtbar: Die Ressourcen<br />
dafür, gerade die Ressourcen der Bildungsträger für die Personalentwicklung,<br />
sind ausgesprochen gering. Die Frage, welche Ressourcen das Land<br />
seinen Berufsschullehrern und -lehrerinnen zur Verfügung stellt und was damit<br />
inhaltlich gemacht wird, möchte ich hier nicht stellen. Angedeutet sei<br />
nur: Wo nichts oder wenig ist, kann man auch nichts fordern, z. B. von der<br />
Weiterbildungsaktivität seiner eigenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.<br />
Deutlich sollte aber sein: Weiterbildung ist eine Balance zwischen Investition<br />
der Unternehmung – welcher Rechtsform auch immer – in Weiterbildungsangebote<br />
und der Investition jeden einzelnen Arbeitnehmers und<br />
jeder Arbeitnehmerin in seine bzw. ihre eigene Weiterentwicklung.<br />
Zur Fragestellung 4:<br />
Anforderungen an die Steuerungsebenen im <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungssystem<br />
Dieser Punkt wird in den eher privat gehaltenen Gesprächen immer wieder<br />
sichtbar, unabdingbar davon, mit welcher Person man spricht, die im <strong>Berlin</strong>er<br />
Berufsbildungssystem arbeitet. Fasst man diese Äußerungen ein wenig<br />
ironisch zusammen, scheint es, als arbeiteten Kampfhähne gegeneinander<br />
oder als warteten sie darauf, dass der eine dem anderen etwas Böses tue.<br />
Es ist so, als ob die verschiedenen Steuerungsebenen von der Senatsverwaltung<br />
für Arbeit, Berufliche Bildung, Gesundheit und Frauen bzw. Schule,<br />
Jugend und Sport, über Arbeitgeber und Gewerkschaften, über die Kammern,<br />
über die Arbeitsämter bis hinunter zu den verschiedenen Bildungsträgern<br />
nicht in einem komplexen System verknüpft seien, das letztendlich<br />
primär zwei Dingen dient – der Entwicklung des Individuums im Rahmen<br />
von Ausbildung, Arbeit und Beruf sowie der Entwicklung der Gesellschaft in<br />
und durch Arbeit und Beruf. Dieses Gefühl der Zertrennung statt Verknüpfung<br />
trifft übrigens nicht nur für <strong>Berlin</strong> zu; dies kann man auch in anderen<br />
Bundesländern nachvollziehen.<br />
Angesichts der viel beschworenen Herausforderungen gerade in den nächsten<br />
Jahren wird es mehr denn je notwendig werden, dass sich die handelnden<br />
Personen in diesen unterschiedlichen Steuerungsebenen zusammensetzen<br />
und zu gemeinsamen Konzepten und Umsetzungsmodalitäten<br />
finden. Angesprochen sind nicht zuletzt die Programme in der beruflichen<br />
Bildung für die nächsten zwei bis drei Jahre.<br />
Die Frage, wie man denn konstruktiv und mittels komplexer Problemlösungsmuster<br />
entwickelt, wie man denn Vorstellungen darüber entwickelt, auf<br />
92
welche Weise und wohin sich in den nächsten zwei / drei Jahren bestimmte<br />
bisher weit reichend subventionierte Bereiche der beruflichen Bildung entwickeln<br />
sollten, ist eine, deren Beantwortung nicht nur den top-down-Weg<br />
gehen kann. Es ist eine Frage, die auch über den buttom-up-Weg beantwortet<br />
werden sollte; aber da erzähle ich Ihnen eigentlich nichts Neues.<br />
In einer kurzen Zusammenfassung verweise ich auf zwei Szenarien, die erwartbar<br />
sind:<br />
In dem ersten Szenario wird die Homogenisierung der bisher stark diversifizierten<br />
Struktur des <strong>Berlin</strong>er Berufsbildungssystems erwartet; d. h. es wird<br />
davon ausgegangen, dass die Struktur karger wird, nicht notwendiger Weise<br />
dadurch schlechter. Ein mögliches Indiz dafür ist die Einführung der dreijährigen<br />
Berufsoberschule, die eine Reihe von Ungereimtheiten zwischen<br />
der Berufsfachschule, der Fachoberschule bis hin zur gymnasialen Oberstufe<br />
beseitigen wird. Ein weiteres Indiz könnte die Diskussion um die Neugestaltung<br />
der Stufe der Berufsförderung und Berufsvorbereitung sein.<br />
In dem zweiten Szenario wird eine weitere Diversifizierung der Struktur des<br />
Berufsbildungssystems erwartet. Auch dafür liegen Indizien vor – der Ausbau<br />
unterschiedlicher vollzeitschulischer Bildungsgänge, die Zunahme der<br />
Zahl von Ausbildungsberufen.<br />
Derzeit erscheint das Berufsbildungssystem zwar stabil; vieles spricht jedoch<br />
dafür, dass es eher erschüttert ist. Wenn es nicht unkontrolliert ins<br />
Wanken geraten soll, wird nicht zuletzt auch ein gesellschaftlicher Konsens<br />
über die Beantwortung der Frage benötigt, wohin sich die berufliche Bildung<br />
und deren Institutionalisierung entwickeln soll. Diese Frage zielt auf die<br />
Struktur dieses Systems, auf die Beteiligung der unterschiedlichen gesellschaftlichen<br />
Gruppen an diesem System, auf die curriculare und didaktischmethodische<br />
Ausgestaltung dieses Systems, auf den Umgang mit den<br />
dort erwerbbaren Zertifikaten und besonders auch auf die Finanzierungsmodalitäten<br />
zwischen öffentlich-rechtlicher und privatwirtschaftlicher Form<br />
sowie zwischen Investition des nachfragenden Individuums und öffentlicher<br />
Subvention des Individuums.<br />
Dankeschön, dass Sie es bis hierher ausgehalten haben. Ich wünsche Ihnen,<br />
dass davon keine schwerer wiegenden Schädigungen bleiben.<br />
93
Schlußwort<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Meine Damen und Herren,<br />
ich möchte an dieser Stelle jetzt keine lange<br />
Schlußrede halten, denn ich glaube, der Tag<br />
war sehr erfolgreich, aber auch anstrengend<br />
genug für uns alle.<br />
Mit dem Thema unserer Tagung „Qualität in der Berufsbildung" haben wir<br />
alle Facetten der Berufsbildung berührt und mussten feststellen, dass die<br />
Komplexität des Themas uns fast erschlagen hätte und einzelne Aspekte<br />
und Themen jeweils einer eigenen Veranstaltung bedurft hätten.<br />
Dabei hatten wir doch bewusst bei der Planung unserer Veranstaltung<br />
schon einige, auch spannende Themen wie Modularisierung, Kosten der<br />
Qualitätssicherung, Finanzierung von Ausbildung etc. ausgeklammert.<br />
Ich kann Ihnen nur ankündigen, dass wir die Ergebnisse dieser Tagung dokumentieren<br />
werden und versuchen werden, hier von <strong>Berlin</strong> aus die relevanten<br />
Themen zur Berufsbildungspolitik weiter anzugehen. Hierzu möchte<br />
ich Sie bereits heute einladen.<br />
Meine Damen und Herren,<br />
ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur "Danke", sagen. Dank an die Experten,<br />
Dank aber auch an Sie und Ihre Mitarbeit in den einzelnen Workshops.<br />
Herzlichen Dank!<br />
Eine schöne Heimreise,<br />
und als Norddeutscher sagt man;<br />
„Tschüss!“<br />
94
Experten
Norbert Bücker<br />
Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen des<br />
Landes <strong>Berlin</strong>, Gruppenleiter<br />
Jahrgang: 1943<br />
Arbeitsfelder<br />
- Betriebliche Ausbildung; Schwerpunkt Elektronik, Entwicklung von<br />
Ausbildungsunterlagen und Ausbildungsprojekten<br />
- Leitung der betrieblichen Kenntnisvermittlung<br />
- Leitung des Berufsamtes<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Entwicklung und Umsetzung von Ausbildungsförderprogrammen für<br />
unversorgte Ausbildungsplatzbewerber (Bund-Länder-Sonderprogramme)<br />
- Entwicklung und Förderung von modularen Qualifizierungsmaßnahmen,<br />
vorwiegend für Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (MDQM)<br />
- Förderung und Entwicklung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten<br />
(ÜBS)<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
- Abstimmungsgespräche mit Gremien der beruflichen Bildung<br />
- Beteiligung an Berufsbildungsausschüssen<br />
Prof. Dr. Peter Diepold<br />
Universitäts – Professor i. R.<br />
Jahrgang: 1938<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Hochschuldidaktik,<br />
- neue Technologien und berufliche Qualifizierung,<br />
- Modellversuche,<br />
- Literaturdokumentationssysteme,<br />
- Berufliche Bildung<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
Internet und World Wide Web<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
- Steuerungsgruppe von BLK und KMK „Deutscher Bildungsserver“,<br />
- HRK-Kommission „Neue Medien und Wissenstransfer“,<br />
- Vorstand „Deutsche Initiative für <strong>Netzwerk</strong>-Information<br />
98
Veröffentlichungen u. a.:<br />
- Berufliche Aus- und Weiterbildung: Konvergenzen/Divergenzen,<br />
Nürnberg 1996<br />
- Modellversuch WOKI, <strong>Berlin</strong> 1991<br />
- Lernen an kaufmännischen Arbeitsplätzen, <strong>Berlin</strong> 1997<br />
Sebastian Martin Fischer<br />
Verwaltungsangestellter, jur. Referent im Referat I A Arbeitsmarkt- und<br />
Berufbildungspolitik der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
(SenArbSozFrau) des Landes <strong>Berlin</strong><br />
Jahrgang: 1969<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Bankkaufmann; betriebliche Ausbildung für Bankkaufleute (AEVO)<br />
- Rechtsanwalt (Schwerpunkte: Arbeitsrecht, Öffentliches Recht)<br />
- Persönlicher Referent der Senatorin<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
Grundsatzfragen, -angelegenheiten, Gesetzgebungsverfahren, rechtliche<br />
Begleitung zu Fragen des Arbeitsrechts (insb. BBiG), Arbeits- und Ausbildungsförderungsrechts<br />
(insb. SGB III), Vergaberechts (GWB, VOL/A) im<br />
Referat I A Arbeitsmarkt- Berufbildungspolitik der Senatsverwaltung für Arbeit,<br />
Soziales und Frauen des Landes <strong>Berlin</strong><br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
Auf Arbeitsebene fachliche Begleitung und Vorbereitung des Referats I A,<br />
Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik SenArbSozFrau auf Sitzungen des<br />
Landesausschusses für Berufsbildung (LAB) nebst Unterausschüssen sowie<br />
Einbindung in die fachliche Vorbereitung der Arbeitsausschüsse des<br />
Abgeordnetenhauses sowie der <strong>Berlin</strong>er Regionalkonferenz im Rahmen<br />
des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit, Sonderkommission<br />
„Ausbildungsplatzsituation“<br />
99
Wolfgang Krüger<br />
Schulleiter<br />
Werkberufsschule Siemens AG<br />
Jahrgang: 1948<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Leiter einer privaten Berufsschule, Mitglied der Leitung der Siemens<br />
Professional Education <strong>Berlin</strong><br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Projektleitung: Wissensmanagement in der Fachinformatik<br />
Berufsbildung<br />
Veröffentlichungen u. a.:<br />
- Pädagogisches Handeln, Heft 2/2000 Hrsg. Prof. Eckerle v. A. Krüger/<br />
Stelling:<br />
Lernen in Modulen der Ausbildung in den IT- und Medienberufen mit<br />
Unterstützung einer Internet -Plattform.<br />
Prof. Dr. Dr. <strong>Rainer</strong> Lehmann<br />
Leiter der Abt. Empirische Bildungsforschung und Methodenlehre, Humboldt-<br />
Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
Jahrgang: 1944<br />
Arbeitsfelder:<br />
Pädagogische Diagnostik, Schulleistungsforschung (auch im internationalen<br />
Vergleich), (Aufsatzleistung, Leseverständnis, Mathematik, Politische<br />
Bildung, Grundqualifikationen Erwachsener)<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
Forum Bildung, Expertengruppe „Bildungs- und Qualifikationsziele von<br />
Morgen“<br />
Veröffentlichungen u. a.:<br />
- Lehmann, R .H., Peek, R.,Pieper, I. & von Stritzy, R.: Leseverständnis<br />
und Lesegewohnheiten deutscher Schüler und Schülerinnen. Weinheim<br />
und Basel 1995.<br />
- Baumert, J., Bos, W. , & Lehmann, R. (Hg): Dritte internationale<br />
Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie – Mathematische und<br />
naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn. 2 Bände<br />
Opladen 2000<br />
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. W.: Citizenschip and Education<br />
in Twentyeight Countries, Civic Know-ledge and Engagement at<br />
Age Fourteen. Amsterdam 2001<br />
100
Friedhelm Rennhak<br />
Bereichsleiter gewerblichtechnische Berufsausbildung der IHK zu <strong>Berlin</strong><br />
Jahrgang: 1957<br />
Arbeitsfelder:<br />
- seit 1976 i. d. Berufsausbildung, Erwachsenenbildung, Bw./Ausbild.<br />
Leiter in mittel-ständigen Betrieben/IHK seit 1991<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Akquisition von Ausbildungsplätzen, Ausbildungsberatung (rechtl.),<br />
Prüfungsorganisation, Prüferqualifizierung<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
Fachbeiräte, LAG-Berufsbildung, AK-Ausbildung DIHT<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
Bereichsleiter Ausbildung/Bezirkliche BeschäftigungsBündnisse,<br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Jahrgang: 1952<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Leitender Mitarbeiter sozialer Organisationen, Organisationsberatung<br />
freier gemeinnütziger Träger,<br />
- Beratung von Unternehmen in personalwirtschaftlichen Fragen<br />
- Organisation und Durchführung von Assessmentcenterverfahren<br />
- Dozent in der beruflichen Weiterbildung<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Ausbildung/Bezirkliche Beschäftigungs-Bündnisse<br />
- Koordination und Coaching unternehmensorientierter Beratungsprojekte<br />
- Organisationsberatung, Personalmanagement, Arbeitsrecht,<br />
Management auf Zeit<br />
101
Dr. Susan Seeber<br />
Wissenschaftliche Assistentin, Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
Arbeitsfelder:<br />
- Controlling, Qualitätsmanagement, Schulentwicklung<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Qualitätsmanagement, -Schulentwicklung, -Bildungscontrolling<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
- Qualitätsarbeitskreis berufsbildende Schulen<br />
Veröffentlichungen u.a.:<br />
- Seeber, S. (2000) Stand und Perspektiven von Bildungscontrolling.<br />
In: Seeber, S., van Buer, J. & Krekel, E. M. (Hrsg.), Bildungscontrolling<br />
– Ansätze und kritische Diskussion zur Effizienzsteigerung<br />
von Bildungsarbeit. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, 19-50.<br />
- Seeber, S. (2000). Benchmarking – ein Ansatz zur Steigerung von<br />
Effektivität und Effizienz beruflicher Bildung? In: Bötel, Ch. & Krekel,<br />
E. M. (Hrsg), Bedarfsanalyse, Nutzenbewertung und Benchmarking –<br />
Zentrale Elemente des Bildungscontrolling. Bielefeld: W. Bertelsmann,<br />
125-148<br />
- Seeber, S. (2000). Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in der<br />
beruflichen Bildung – Konsequenzen in der Ausbildung von Wirtschaftspädagogen.<br />
In: Matthäus, S. & Seeber, S. (Hrsg.), Das universitäre<br />
Studium der Wirtschaftspädagogik – Befunde und aktuelle Entwicklungen.<br />
Studien zur Wirtschaftspädagogik und Berufsbildungsforschung<br />
aus der Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong> . Bd. 1, 57-82.<br />
Reinhard Selka<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
Jahrgang: 1943<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Ausbildungsqualifizierung,<br />
- Berufsinformation,<br />
- <strong>Netzwerk</strong>e<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Entwicklung regionaler <strong>Netzwerk</strong>e in den neuen Ländern<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
- div. Beiräte z. B. Strategiekreis Bildungsoffensive, Brandenburg<br />
102
Veröffentlichungen u. a.:<br />
- Ausbilden im Verbund, Bielefeld 1995<br />
- <strong>Regionale</strong> Kooperation für Ausbildungsplätze, Bielefeld 2000<br />
- Ausbilden sichert Zukunft, Bielefeld 1998<br />
Ulrich Thöne<br />
Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften<br />
BERLIN<br />
Jahrgang: 1951<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Bankkaufmann; Lehrer im Oberstufenzentrum Gesundheit<br />
103
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen van Buer<br />
Universitätsprofessor, Humboldt-Universität zu <strong>Berlin</strong><br />
Jahrgang: 1949<br />
Arbeitsfelder:<br />
- Berufsbildungsforschung,<br />
- Lehr-Lern-Forschung,<br />
- Qualitätssicherung<br />
Arbeitsschwerpunkte:<br />
- Modularisierung und Zertifizierung, Qualitätssicherung, benachteiligte<br />
Jugendliche<br />
Mitarbeit Expertengremien:<br />
- Mitglied der Bildungskommission <strong>Berlin</strong> - Brandenburg<br />
Veröffentlichungen u. a. :<br />
- van Buer, J.: Berufliche Bildung und Qualifizierung – Überlegungen zu<br />
einer neuen Lehr-Lern-Kultur als Antwort auf die Herausforderungen<br />
der Zukunft. Wegrzeckiej, M. (Hrsg.): Unowoczesnianie procesu<br />
dydaktiycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku. Kraków/<br />
Wydawnictwo Naukowe APP 1999, 67-102.<br />
- van Buer, J./Kell, A. u.a.: Berichterstattung Berufsbildungsforschung in<br />
der Bundesrepublik Deutschland. Projektendbericht. Humboldt Universität<br />
zu <strong>Berlin</strong>/Universität-GH-Siegen. Ber-lin/Siegen 1999 (erscheint<br />
Herbst 2001 im Lang-Verlage, Frankfurt a. M.).<br />
- van Buer, J.: Prozesscontrolling. In: Seeber, S./Krekel, E. M./ van Buer,<br />
J. (Hrsg): Effektivität und Effizienz beruflicher Bildung – Bildungscontrolling<br />
als Ansatz zur Planung, Steuerung und Optimierung. Frankfurt<br />
(Lang) 2000.<br />
104
105
Teilnehmer
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Arnold, <strong>Rainer</strong> OSZ Elektrotechnik/ Goldbeckweg 8-14, 13599 <strong>Berlin</strong><br />
Energietechnik I Tel.: 030 / 35 49 - 46 13 / - 46 60<br />
Arnold@energie.be.schule.de<br />
Bernhard, Ursula Fachgemeinschaft Bau e.V. Belßstr. 12, 12277 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 030 / 72 38 97 21<br />
info@lehrbauhof.fg-bau.de<br />
Böer, Gisela InBIT gGmbH Lohmühlenstraße 65, 12435 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 5 33 38 – 7 38<br />
Giesela.boer@inbit.de<br />
Boldt, Corinna KirchBauhof gGmbH Falckensteinstr. 49, 10997 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 61 77 62 - 76<br />
c.boldt@kirchbauhof.de<br />
Borchert, Hans-Joachim ABU gGmbH Beilsteiner Str. 118, 12681 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 54 99 60 - 248<br />
borchert@abu-ggmbh.de<br />
Borkenhagen, Nicole Aufzugswerke M. Miraustr. 54, 13509 <strong>Berlin</strong><br />
Schmitt & Sohn GmbH Tel.: 030 / 43 55 14 77<br />
www.schmitt-aufzuege.com<br />
Braun, Petra <strong>Regionale</strong>r Ausbildungs- Storkower Str. 56, 10409 <strong>Berlin</strong><br />
verbund URBAN e.V. Tel.: 030 / 4 28 91 20<br />
URBAN_eV@t-online.de<br />
Bremeyer, Heike Bildungsmarkt Waldenserstr. 2-4, 10551 <strong>Berlin</strong><br />
Waldenser gGmbH Tel.: 030 / 39 73 91- 0<br />
waldenser@bildungsmarkt.de<br />
Bücker, Norbert Senatsverwaltung für Arbeit, Storkower Str. 134, 10407 <strong>Berlin</strong><br />
Soziales und Frauen, I F 4 Tel.: 030 / 90 22 – 25 06<br />
norbert.buecker@senarbsozfrau.<br />
verwalt-berlin.de<br />
Burghof, Christel Kreuzberger Kreis e. V. Prinzenstr. 85, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Cleinow, Detlev Ev. Johannesstift <strong>Berlin</strong>, Schönwalder Allee 26, 13587 <strong>Berlin</strong><br />
Ausbildungsabteilung Tel.: 030 / 3 36 09 – 7 49<br />
Leitbetrieb.Johannesstift@t-online.de<br />
Dendl, Heide SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 68 80 76 - 0<br />
heide.dendl@spisg.de<br />
Diepold, Prof. Dr. Peter Schildweg 20, 37085 Göttingen<br />
Tel.: 05 51/ 5 55 35<br />
Peter@Diepold.de<br />
Döhl, Reinhard Bildungsmarkt Vulkan gGmbH Vulkanstr. 13, 10367 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 57 79 74 - 38<br />
vulkan@bildungsmarkt.de<br />
108
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Dopatka, Senatsverwaltung für Arbeit, Oranienstr. 106, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Dr. Friedrich-Wilhelm Soziales und Frauen, StS Tel.: 030 / 90 28 - 22 00<br />
Dowidat, Kerstin SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 030 / 69 80 76 - 0<br />
kerstin.dowidat@spisg.de<br />
Eichhorst, Anke Gesellschaft für Arbeits- Kieler Str. 53, 24768 Rendsburg<br />
markt- u. Strukturpolitik Tel.: 0 43 31 - 13 19 - 13<br />
a.eichhorst@gefas-uv.de<br />
Fischer, Sebastian Senatsverwaltung für Arbeit, Storkower Straße 134, 10407 <strong>Berlin</strong><br />
Soziales und Frauen, II A 4 Tel.: 030 / 90 22 – 25 12<br />
sebastian.fischer@senarbsozfrau.<br />
verwalt-berlin.de<br />
Gand, Volker OSZ Industrie u. Prinzregentenstr. 60, 10715 <strong>Berlin</strong><br />
Datenverarbeitung Tel.: 030 / 85 75 89 21<br />
Gehrke, Frank ALÜ Ausbildungsverbund Marie-Curie-Str. 2, 21337 Lüneburg<br />
Lüneburg e.V. Tel.: 0 41 31 / 30 30 7 - 20<br />
Gehrke@ausbildungverbund-lueneburg.de<br />
Görgün, Dilhan GÜN Buchführungsservice Lietzenburger Str. 88; 10719 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 88 62 88 31<br />
guen@guencompany.de<br />
Gubi, Reinhard OSZ Farbtechnik und Immenweg 6 – 10, 12169 <strong>Berlin</strong><br />
Raumgestaltung Tel.: 030 / 63 21 - 23 92<br />
Gustke, Marlis ESO Euro Train Alt Blankenburg 1 – 5, 13129 <strong>Berlin</strong><br />
Bildungscenter <strong>Berlin</strong> Tel.: 030 / 4 74 97 50<br />
eurotrain@eso.de<br />
Häger, Klaus-Jürgen Knobelsdorff-Schule, Nonnendammallee 140/143, 13599 <strong>Berlin</strong><br />
OSZ Bautechnik I Tel.: 030 /33 09 06-28 / -32<br />
Hausmann, Manfred inab GmbH Fichtestr. 3, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 80 94 - 3 inab<strong>Berlin</strong>.hausmann@gmx.de<br />
Heger, Rolf-Joachim SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 7, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 57 05 - 0 rolf.joachim.heger@spisg.de<br />
Heringhaus, Heike OSZ Bekleidung und Mode, Filiale Albrechtstr. 27, 10117 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 25 39 15 11<br />
Hoffmann, Bernd OSZ Bürowirtschaft II Fischerstr. 32, 10317 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 52 28 05 00<br />
1713103@schulen.verwalt-berlin.de<br />
Hoffmann, Helmut OSZ Bautechnik II Gustav-Adolf-Str. 66, 13086 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 96 27 47 - 0<br />
109
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Höhl, Mara FORUM Berufsbildung e.V. Charlottenstr. 2, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 25 90 08 - 15<br />
mara.hoehl@forum-berufsbildung.de<br />
Holland, <strong>Rainer</strong> SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 030 / 69 80 76 - 0<br />
rainer.holland@spisg.de<br />
Hölmer, <strong>Rainer</strong> SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 030 / 69 80 76 - 0<br />
rainer.hoelmer@spisg.de<br />
Hübner, Dr. Kreuzberger Kreis e.V. Prinzenstr. 85, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Huschke, Prof. Dr. Thomas Nordberlin Akademie GmbH Wackenbergstr. 68, 13156 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 47 41 14 00<br />
NOABLN@aol.com<br />
Joseph, Christian Senatsverwaltung für Arbeit, Storkower Str. 134, 10407 <strong>Berlin</strong><br />
Soziales und Frauen Tel.: 030 / 90 22 - 25 13<br />
christian.joseph@senarbsozfrau.verwaltberlin.de<br />
Kampet, Sabine Deutsche Gesellschaft Seestraße 64, 13347 <strong>Berlin</strong><br />
für Solarenergie Tel.: 030 / 75 70 23 – 10<br />
LV <strong>Berlin</strong>-Brandenburg e.V. sabine.kampet@dgs-berlin.de<br />
SolarSchule <strong>Berlin</strong><br />
Kappis, Elke ABU Akademie für Berufsförde- Beilsteiner Str. 118, 12681 <strong>Berlin</strong><br />
rung und Umschulung gGmbH Tel.: 030 / 54 99 60 245<br />
kappis@abu-ggmbh.de<br />
Kastens, Petra Bildungsmarkt Waldenserstr. 2-4, 10551 <strong>Berlin</strong><br />
Waldenser gGmbH Tel.: 030 / 39 78 07 - 0<br />
waldenser@bildungsmarkt.de<br />
Kaußmann, Doris STATTBAUHOF gGmbH Markgrafendamm 16/17, 10245 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 2 93 94 – 117<br />
D.Kauszmann@stattbauhof.de<br />
Kayadan, Sevil SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel: 030 / 69 80 76 - 0<br />
sevil.kayadan@spisg.de<br />
Klimesch, Katja Institut für technische Luxemburger Str. 10, 13353 <strong>Berlin</strong><br />
Weiterbildung e.V. Tel.: 030 / 45 48 26 - 33<br />
info@itw-berlin.de<br />
Kolkmann-Weisel, Schildkröte GmbH Wolliner Str. 18, 10435 <strong>Berlin</strong><br />
Reinhold Tel.: 030 / 44 31 94 3 - 0<br />
wolliner@schildkroete-berlin.de<br />
110
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Koß, Hermann Ministerium für Arbeit, Soziales, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam<br />
Gesundheit und Frauen Tel.: 03 31/ 8 66 - 53 90<br />
des Landes Brandenburg<br />
Krüger, Wolfgang Werkberufschule Siemens AG Nonnendammallee, 13629 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 3 86 – 2 56 47<br />
wolfgang.krueger@bln.siemens.de<br />
Laufer, Gudrun STATTBAUHOF gGmbH Markgrafendamm 16, 10245 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 2 93 94 – 1 38<br />
G.Laufer@stattbauhof.de<br />
Lehmann, Humboldt Universität zu <strong>Berlin</strong>, Geschwister-Scholl-Str. 7, 10177 <strong>Berlin</strong><br />
Prof. Dr. <strong>Rainer</strong> H. Abt. Empirische Bildungs- rlehmann@educat.hu-berlin.de<br />
forschung<br />
Löbel, Manfred Handwerkskammer <strong>Berlin</strong> Blücherstraße 68, 10961 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 2 59 03 - 4 61<br />
Mayr, Viktoria OSZ Farbtechnik und Immenweg 6-10, 12169 <strong>Berlin</strong><br />
Raumgestaltung Tel.: 030 / 6321-23 92<br />
Pfaffe, Dr. Andreas Dienstleistung und Genslerstraße 13; 13055 <strong>Berlin</strong><br />
Bildung gGmbH Tel.: 030 / 98 60 09 - 0<br />
andreas.pfaffe@dub-berlin.de<br />
Ploog, Stephan PAETEC Wirtschaftsakademie Bouchéstr. 12, H. - // Aufg. C, 12435 <strong>Berlin</strong><br />
<strong>Berlin</strong> Tel.: 030 / 53 31 24 12<br />
ploog@paetec.de<br />
Polland, Uta AK Medienpädagogik e.V. Gneisenaustraße 109 - 110, 10961 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 2 17 24 - 01 / - 03<br />
Pöpsel, Fritz S-Bahn <strong>Berlin</strong> GmbH Invalidenstr. 19, 10115 <strong>Berlin</strong><br />
FB Personal- u. Sozialwesen Tel.: 030 / 2 97 - 4 39 66<br />
Poneß, Klaus OSZ Konstruktionsbautechnik Lobeckstr. 76, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 61 67 05 -10<br />
poness@osz-konstruktionsbautechnik.de<br />
Pulletz, Werner OSZ Verkehr, Dudenstr. 35-37, 10965 <strong>Berlin</strong><br />
Wohnungswirtschaft, Steuern Tel.: 030 / 78 60 45 - 0<br />
Raddatz, Dr. Elke Institut für technische Luxemburger Str. 10, 13353 <strong>Berlin</strong><br />
Weiterbildung e.V Tel.: 030 / 45 48 26 - 34 / -35<br />
gs@itw-berlin.de<br />
Rennhak, Friedhelm IHK zu <strong>Berlin</strong> Hardenbergstr. 16-18, 10623 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 3 15 10 - 4 60<br />
ren@berlin.ihk.de<br />
Richter ,Jutta Deutsche Bildungs-Akademie Keplerstr. 8-10, 10589 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 34 56 05 54<br />
111
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Riedel, Petra ESO Euro Train <strong>Berlin</strong> Alt Blankenburg 1-5, 13129 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 4 74 97 50<br />
eurotrain@eso.de<br />
Rilling, Raimund SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 57 05 - 0<br />
raimund.rilling@spisg.de<br />
<strong>Rodewald</strong>, <strong>Rainer</strong> SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 80 76 - 0<br />
rainer.rodewald@spisg.de<br />
Runge, Sylvia SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 80 76 - 0<br />
sylvia.runge@spisg.de<br />
Schmidt, Dr. Norbert PAETEC Bouchéstr. 12, H. 1/2 // Aufg. C, 12435 <strong>Berlin</strong><br />
Wirtschaftsakademie <strong>Berlin</strong> Tel.: 030 / 53 31 24 00<br />
n-schmidt@paetec.de<br />
Schönfeld, Thorsten Ev. Johannesstift <strong>Berlin</strong>, Schönwalder Allee 26, 13587 <strong>Berlin</strong><br />
Ausbildungsabteilung<br />
Schonefeld, Hilde Berufsfortbildungswerk GmbH Keithstraße 1-3, 10787 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 21 45 84 18<br />
Schuhmann, <strong>Rainer</strong> Knobelsdorff-Schule, Nonnendammallee 140-143, 13599 <strong>Berlin</strong><br />
OSZ Bautechnik I Tel.: 030 / 33 09 06 - 31<br />
Schulte, Uwe COMHARD GmbH Heinrich-Roller-Str. 15, 10405 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 441 03 11<br />
Schulze, Hannelore Forum Berufsbildung e.V. Charlottenstr. 2, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 2 59 00 8 - 0<br />
forum-berufsbildung@bln.de<br />
Schulze, Hans-Gerd S-Bahn <strong>Berlin</strong> GmbH Adlergestell 143; 12439 <strong>Berlin</strong><br />
Ausbildungsstätte Tel.: 030 / 2 97 - 2 83 78<br />
Schüttauf, Dr. Erna BAFU GmbH Wollenberger Str. 1, 13053 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 98 19 54 - 0<br />
bafu.bln@t-online.de<br />
Seeber, Dr. Susan Humboldt Universität zu <strong>Berlin</strong>, Geschwister-Scholl-Str. 7, H. 10, 10177 <strong>Berlin</strong><br />
Philosophische Fakultät IV Tel.: 030 / 20 93 - 41 70<br />
Susan.Seeber@rc.hu-berlin.de<br />
Seidel, Gabriele GFB Gesellschaft zur Förde- Oberlandstraße 52-65, 12099 <strong>Berlin</strong><br />
rung der Berufsfortbildung e.V. Tel.: 030 / 75 77 42 - 60<br />
Gabriele.Seidel.GFB-e.V@Web.de<br />
112
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Selka, Reinhard Bundesinstitut für Berufsbildung Neues Abgeordnetenhaus,<br />
Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn<br />
Tel.: 0228 - 1 07 - 14 08<br />
selka@bibb.de<br />
Stamm, Birgit Ausbildungsverbund der Hansestraße 19, 38112 Braunschweig<br />
Braunschweig/Wirtschaftsregion Tel.: 05 31 – 31 10 06<br />
Magdeburg e.V. Stamm@abv-bs-sz-gs.de<br />
Stieger, Evelin IHK zu <strong>Berlin</strong> Hardenbergstr. 16-18, 10623 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 3 15 10 - 4 90<br />
stie@berlin.ihk.de<br />
Stöck, Werner KirchBauhof gGmbH Falckensteinstr. 49, 10997 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 61 77 62 - 54<br />
abv@kirchbauhof.de<br />
Stoll, Edith Baufachfrau <strong>Berlin</strong> e.V. Meyerbeerstr. 36/40, 13088 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 92 09 21 76<br />
bff.berlin@t-online.de<br />
Stute, Hans-Eckhard OSZ Kraftfahrzeugtechnik Gierkeplatz 1 u. 3, 10585 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 9 0198 - 6 03<br />
0713102@schulen.verwalt-berlin.de<br />
Sziegoleit, Stefanie Kreuzberger Kreis e.V. Wienerstraße 10, 10999 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 6 10 00 – 9 18<br />
Thöne, Ulrich Gewerkschaft Erziehung Ahornstr. 5, 10787 <strong>Berlin</strong><br />
und Wissenschaften Tel.: 030 / 21 99 93 - 0<br />
vorstand@gew-berlin.de<br />
Topac, Fadime SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 80 76 - 0<br />
fadime.topac@spisg.de<br />
Ulrichs, Arno IHK für Ostfriesland Ringstraße 4; 26721 Emden<br />
und Papenburg Tel.: 0 49 21/ 89 01 - 73<br />
ulrichs@emden.ihk.de<br />
van Buer, Humboldt Universität <strong>Berlin</strong> Geschwister-Scholl-Str. 7, H.10, 10177 <strong>Berlin</strong><br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Philosophische Fakultät IV Tel.: 030 / 20 93 - 41 22 / - 41 71<br />
van.buer@rc.hu-berlin.de<br />
Wachsmuth, Rudolf AEG Signum GmbH Sickingenstr. 71, 10553 <strong>Berlin</strong><br />
Bildungszentrum <strong>Berlin</strong> Tel.: 030 / 3 46 92 - 3 75<br />
rwachsmuth@berlin.aeg-signum.de<br />
Wagner, Walter Kreuzberger Kreis e.V. Prinzenstr. 85, 10969 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 6 16 72 - 275<br />
WagnerW@kreuzbergerkreis.de<br />
113
NAME INSTITUTION ANSCHRIFT/TELEFON/E-MAIL<br />
Weber, Angelika SPI ServiceGesellschaft mbH Boppstr. 10, 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 69 80 76 - 0<br />
angelika.weber@spisg.de<br />
Werner, Annette NILES Aus- und Weiter- Gehringstr. 39, 13088 <strong>Berlin</strong><br />
bildung gGmbH Tel.: 030 / 96 24 82 - 0<br />
info@niles-aw.de<br />
Wiedemann, Ulrich PRAXIS-NAH e.V. Wendenschloßstr. 154-174, H. 28, 12557 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: 030 / 65 49 90 16<br />
praxis-nah@t-online.de<br />
Zielinski, Anne-Katrin Bildungszentrum des Meraner Str. 1, 12681 <strong>Berlin</strong><br />
Einzelhandels Tel.: 030 / 54 37 65 56<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg info@bze-bb.de<br />
114
115
Ablaufplan
Fachtagung „Qualität in der Berufsbildung“ 28. Juni 2001<br />
118<br />
9:30 Uhr<br />
Begrüßung/Eröffnung<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
9:45 Uhr<br />
Ist das Berufsbildungssystem den Anforderungen der Zukunft<br />
gewappnet?<br />
Impulsreferat 1<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
10:15 Uhr<br />
Grußwort<br />
Staatssekretär Dr. F.-W. Dopatka<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
11:00 Uhr<br />
Welche ausbildungsrelevanten strukturellen Entwicklungen und<br />
Herausforderungen lassen sich für den Wirtschaftsraum <strong>Berlin</strong>-<br />
Brandenburg erkennen?<br />
Impulsreferat 2<br />
Sebastian Fischer<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
11:45 Uhr<br />
Zusammenfassung der Botschaften aus den Impulsreferaten und<br />
Transformation auf die folgenden Workshops<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
12:00 Uhr<br />
Mittagspause<br />
ab 13:00Uhr<br />
Workshop 1<br />
Wo liegt die Zukunft der Qualitätssicherung in der Berufsbildung?<br />
Dr. Susan Seeber<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Ablauf
Workshop 2<br />
Was muß die allgemeinbildende Schule leisten und wie<br />
muß sie sich entwickeln, um Jugendliche auf den Prozeß<br />
der Ausbildung vorzubereiten?<br />
Ulrich Thöne<br />
Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaften<br />
Prof. Dr. Dr. <strong>Rainer</strong> H. Lehmann<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
Workshop 3<br />
Welche Anforderungen erwachsen aus der<br />
Informationsgesellschaft an das Berufsbildungssystem aus<br />
Sicht der Wirtschaft?<br />
Prof. Dr. Peter Diepold,<br />
Göttingen<br />
Friedhelm Rennhak<br />
Bereichsleiter gewerblichtechnische Berufe IHK zu <strong>Berlin</strong><br />
Wolfgang Krüger<br />
Schulleiter Werkberufsschule Siemens AG<br />
Workshop 4<br />
Sind Ausbildung im Verbund, regionale <strong>Ausbildungsverbünde</strong><br />
und <strong>Netzwerk</strong>e die Konzepte der Zukunft?<br />
<strong>Rainer</strong> <strong>Rodewald</strong><br />
SPI ServiceGesellschaft mbH<br />
Norbert Bücker<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen<br />
Reinhard Selka<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
15:30 Uhr<br />
Kaffeepause<br />
15:45 Uhr<br />
Plenum<br />
Präsentation der Workshop-Ergebnisse<br />
16:30 Uhr<br />
Schlußreferat<br />
Wohin die Reise geht?<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen van Buer<br />
Humboldt Universität <strong>Berlin</strong><br />
ca. 17:00 Uhr<br />
Ende<br />
119