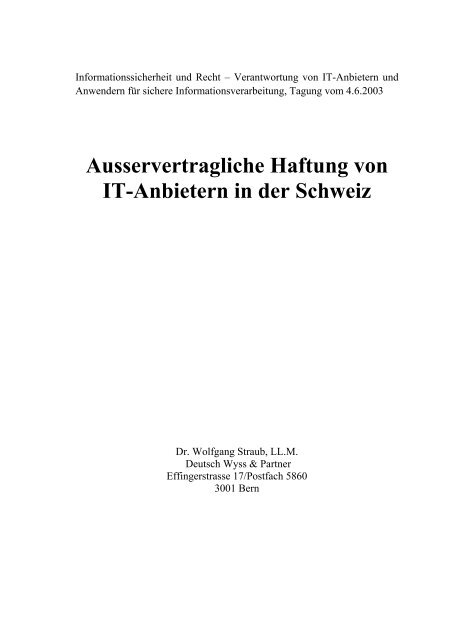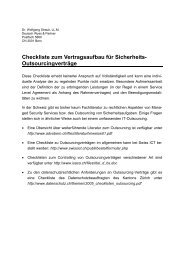Ausservertragliche Haftung von IT-Anbietern in der Schweiz' PDF
Ausservertragliche Haftung von IT-Anbietern in der Schweiz' PDF
Ausservertragliche Haftung von IT-Anbietern in der Schweiz' PDF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalt1 Allgeme<strong>in</strong>es............................................................................................. 42 Unerlaubte Handlung............................................................................ 62.1 Überblick .......................................................................................... 62.2 Schaden ............................................................................................ 72.3 Wi<strong>der</strong>rechtlichkeit............................................................................ 82.4 Verschulden.................................................................................... 102.5 Adäquate Kausalität ....................................................................... 113 Geschäftsherrenhaftung...................................................................... 134 Produktehaftung.................................................................................. 174.1 Überblick über die <strong>Haftung</strong>svoraussetzungen ............................... 174.2 Schaden .......................................................................................... 184.3 Produkt ........................................................................................... 194.4 Fehler 204.5 Hersteller ........................................................................................ 224.6 Kausalität........................................................................................ 244.7 Entlastungsgründe .......................................................................... 254.7.1 Fehlendes Inverkehrbr<strong>in</strong>gen ............................................... 264.7.2 Nachträglich entstandene Produktefehler........................... 264.7.3 Entlastungsbeweis des Teilherstellers ................................ 274.7.4 E<strong>in</strong>haltung zw<strong>in</strong>gen<strong>der</strong> Normen ......................................... 274.7.5 Entwicklungsrisiken............................................................ 274.7.6 Nichtkommerzielle Tätigkeit .............................................. 294.8 Verjährung und Verwirkung .......................................................... 294.9 Produkte<strong>in</strong>formation und Rückruf ................................................. 302
5 Schadensverhütung und Schadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung ................................. 316 Konkurrenz <strong>von</strong> Haftpflichtigen........................................................ 327 <strong>Haftung</strong>sbeschränkungen ................................................................... 328 Ergebnisse............................................................................................. 33H<strong>in</strong>weise auf weiterführende Literatur .................................................. 353
1 Allgeme<strong>in</strong>esDie Frage nach e<strong>in</strong>er <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-Dienstleistern und Herstellern stelltsich erst, wenn e<strong>in</strong> konkreter Schaden vorliegt. Ungenügende Informationssicherheitkann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dazu führen, dass Daten unrichtig verarbeitetbzw. gelöscht werden o<strong>der</strong> Unbefugte Zugriff auf Daten o<strong>der</strong> Prozessehaben. Dies kann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e folgende Konsequenzen haben:• Produktionsausfälle. Diese führen z.B. zu E<strong>in</strong>nahmenverlust,Schadenersatzansprüche <strong>von</strong> Vertragspartnern, weitere <strong>in</strong>direkte Schäden• gefährliche Prozesse geraten ausser Kontrolle. Dadurch entstehenz. B. Körperverletzungen und Sachschäden bei Fehlsteuerung <strong>von</strong> Fertigungsroboterno<strong>der</strong> bei Ausfall <strong>von</strong> Temperatursteuerungen• Imageverluste• Persönlichkeits- und Datenschutzverletzungen durch den ZugriffUnbefugter auf Daten und Informationen.Die wirtschaftlichen Folgen solcher Vorfälle müssen immer entwe<strong>der</strong> vomGeschädigten o<strong>der</strong> <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em o<strong>der</strong> mehreren Schädigern getragen werden.Die Rechtsordnung versucht durch die Regeln <strong>der</strong> vertraglichen und ausservertraglichen<strong>Haftung</strong> e<strong>in</strong>en möglichst gerechten Ausgleich zwischenden Interessen aller Beteiligten zu f<strong>in</strong>den. Man kann sich das VertragsundHaftpflichtrecht wie verschiedene übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> liegende Lochkartenvorstellen. Jede dieser Ebenen führt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihe <strong>von</strong> Situationen zurVerantwortlichkeit des Verursachers, enthält jedoch Löcher für an<strong>der</strong>eKonstellationen. Die ‚Lücken’ s<strong>in</strong>d grundsätzlich ebenso wie <strong>der</strong> abgedeckteBereich auf Entscheidungen des Gesetzgebers zurückzuführen unddaher grundsätzlich nicht als Unvollkommenheiten des Systems zu betrachten.Das nachfolgende Schema gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die typischen <strong>Haftung</strong>sartenbei Störungen <strong>von</strong> Informationssystemen.4
Unerlaubte HandlungGeschädigteAnwen<strong>der</strong>Betreiber/EigenVertragspart-geschä-tümer des <strong>IT</strong>-ner <strong>der</strong> Betrof-digteVerantwortlicheSystemsfenenDritteAngreifer D D D DHersteller und <strong>IT</strong>-DienstleisterD/P/G V/D/P/G D/G D/G/PArbeitnehmerHilfspersonenundD V/D D DGeschäftsleitung,Verwaltungsräteund RevisorenG V/G G GArt des Anspruchs:DGPGVDeliktshaftungGeschäftsherrenhaftungProduktehaftunggesellschaftsrechtliche VerantwortlichkeitVertragDie ausservertragliche <strong>Haftung</strong> ist sowohl <strong>in</strong> jenen Fällen <strong>von</strong> Bedeutung,<strong>in</strong> welchen Schädiger und Geschädigter <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Vertragsverhältniszue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen, als auch <strong>in</strong> jenen, <strong>in</strong> welchen die vertraglichen Ansprücheerloschen s<strong>in</strong>d (z. B. durch Verjährung). Ob die kurzen Verjährungsbestimmungendes Kauf- und Werkvertragsrechts auch für ausservertragliche<strong>Haftung</strong>sarten gelten, ist umstritten. Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz wohl herrschendeMe<strong>in</strong>ung verne<strong>in</strong>t dies jedoch.Es gibt drei Haupttypen ausservertraglicher <strong>Haftung</strong>, welche für Schädendurch <strong>IT</strong>-Produkte <strong>von</strong> Bedeutung s<strong>in</strong>d: die allgeme<strong>in</strong>e ausservertragliche<strong>Haftung</strong> (Art. 41 OR, Deliktshaftung), die ausservertragliche <strong>Haftung</strong> fürdas Verhalten <strong>von</strong> Mitarbeitern (Art. 55 OR, Geschäftsherrenhaftung)und die <strong>Haftung</strong> für fehlerhafte Produkte nach dem Produktehaftungsge-5
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizsetz (PrHG). Daneben bestehen beson<strong>der</strong>e Regelungen für Schäden, welchedurch Eisenbahnen, Atomanlagen etc. verursacht wurden.2 Unerlaubte Handlung2.1 ÜberblickVorliegend wird deshalb zuerst auf die Deliktshaftung e<strong>in</strong>gegangen, weildie an<strong>der</strong>en <strong>Haftung</strong>stypen historisch und logisch bis zu e<strong>in</strong>em gewissenGrad auf ihr aufbauen. Werden Schäden <strong>in</strong> arbeitsteiligen Prozessen durchHilfspersonen wie Mitarbeiter e<strong>in</strong>es <strong>IT</strong>-Dienstleisters o<strong>der</strong> Herstellersverursacht, haftet das betreffende Unternehmen nach den beson<strong>der</strong>enGrundsätzen <strong>der</strong> Geschäftsherrenhaftung dafür (vgl. dazu Kap. 3). SoweitAnsprüche aus Produktehaftungsgesetz bestehen, verdrängen sie die allgeme<strong>in</strong>eDeliktshaftung (vgl. dazu Kap. 4). Diese kann aber <strong>in</strong> folgendenKonstellationen durchaus noch praktische Bedeutung haben:• Ansprüche gegenüber den e<strong>in</strong>en Schaden konkret verursachendennatürlichen Personen (z.B. Hacker, schadensverursachende Mitarbeitere<strong>in</strong>es <strong>IT</strong>-Unternehmens)• Sicherheitsverletzungen, welche im Rahmen <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-Dienstleistungendurch selbständigerwerbende natürliche Personen verursacht wurden.• Sofern Organe e<strong>in</strong>er Gesellschaft (z.B. Direktoren, Verwaltungsräte)im Rahmen <strong>der</strong> Ausübung ihrer Aufgaben e<strong>in</strong>en Schaden verursachen,haftet das Unternehmen für <strong>der</strong>en Handlungen ebenfalls nach Art. 41OR (Zurechnung via Art. 55 ZGB).E<strong>in</strong>e Schadenersatzpflicht nach Art. 41 OR setzt voraus, dass <strong>der</strong> Geschädigtefolgende Voraussetzungen beweisen kann:• Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Schadens• Absichtliche o<strong>der</strong> fahrlässige Verursachung des Schadens (Verschuldendes Schädigers)6
Unerlaubte Handlung• Adäquate Kausalität zwischen schädigen<strong>der</strong> Handlung und Schadense<strong>in</strong>tritt• Wi<strong>der</strong>rechtlichkeit <strong>der</strong> Schadensverursachung2.2 SchadenSchäden im rechtlichen S<strong>in</strong>n setzen stets e<strong>in</strong>e Vermögensverm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungvoraus. Daher führen z.B. Datenchutzverletzungen nicht automatisch zue<strong>in</strong>er <strong>Haftung</strong>. Der Schaden liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Differenz zwischen dem Vermögensstanddes Betroffenen nach <strong>der</strong> Schädigung gegenüber jenem (hypothetischen)Vermögensstand, welcher ohne die schädigende Handlung bestehenwürde (vgl. dazu BGE 127 III 75 E. 4a, 126 III 393, E. 11a). Generellwird unterschieden zwischen:• Tod und Köperverletzung: Diese führen e<strong>in</strong>erseits zu quantifizierbarenSchäden (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Heilungskosten, Arbeitsausfall, Wegfall <strong>der</strong>Unterstützung durch e<strong>in</strong>en Angehörigen), an<strong>der</strong>erseits aber auch zuphysischem und psychischem Leiden. Obwohl dieses nicht <strong>in</strong> Geldmessbar ist, können die Betroffenen dafür Genugtuungsleistungen <strong>in</strong>Geld erhalten, sofern die übrigen Voraussetzungen e<strong>in</strong>er ausservertraglichen<strong>Haftung</strong> gegeben s<strong>in</strong>d (Art. 47 und 49 OR; vgl. zur Abgrenzungzwischen Schaden und immaterieller Unbill BGE 123 IV 147 E. 4b/bb).Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz <strong>in</strong> diesen Fällen zugesprochenen Beträge liegen <strong>in</strong>dessenweit unter denjenigen, welche aus den USA bekannt s<strong>in</strong>d (vgl.dazu die Übersicht über die Rechtsprechung <strong>in</strong> BGE 112 II 131 E. 2/3).• Sachschäden: Diese bestehen im Verlust o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Wertverm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<strong>von</strong> körperlichen Gegenständen. Inwieweit auch Datenverlust e<strong>in</strong>enSachschaden darstellt, ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz bisher noch ungeklärt (vgl.dazu auch Kap. 2.3 und 4.2).• Re<strong>in</strong>e Vermögensschäden: Diese Kategorie umfasst alle übrigenf<strong>in</strong>anziell bezifferbaren Vermögensbee<strong>in</strong>trächtigungen (z. B. entgangenerGew<strong>in</strong>n, Produktivitätsausfall, Schadenersatzpflichten des Geschädigtengegenüber Dritten). Der Schaden kann grundsätzlich auch <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em entgangenen Gew<strong>in</strong>n liegen (z. B. weil die Nachfrage nach7
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweize<strong>in</strong>em bestimmten Produkt aufgrund e<strong>in</strong>es softwarebed<strong>in</strong>gten Produktionsausfallsnicht rechtzeitig befriedigt werden konnte).Diese Unterscheidung ist <strong>von</strong> grosser praktischer Bedeutung, da die Voraussetzungen<strong>der</strong> Ersatzpflicht für die e<strong>in</strong>zelnen Schadensarten unterschiedlichs<strong>in</strong>d (vgl. Kap. 2.3.).Oft führen Schäden zu weiteren Schäden (mittelbaren Schäden), z. B.verursacht e<strong>in</strong> Softwarefehler <strong>in</strong> <strong>der</strong> Steuerung e<strong>in</strong>er Masch<strong>in</strong>e <strong>der</strong>en Überhitzung,was die Zerstörung <strong>der</strong> Masch<strong>in</strong>e selbst sowie e<strong>in</strong>en Brand imbetreffenden Fabrikationsgebäude auslöst, welcher das Warenlager vernichtetund e<strong>in</strong>en Produktionsausfall verursacht. Unmittelbare und mittelbareSchäden werden im Haftpflichtrecht grundsätzlich gleich behandelt(vgl. demgegenüber Art. 208 Abs. 3 OR im Kaufrecht).2.3 Wi<strong>der</strong>rechtlichkeitDie allgeme<strong>in</strong>e Deliktshaftung wird auch als ‚<strong>Haftung</strong> aus unerlaubterHandlung’ bezeichnet. Sie setzt nämlich voraus, dass <strong>der</strong> Schaden durche<strong>in</strong>e rechtswidrige Handlung entstanden ist, d. h. unter Verletzung e<strong>in</strong>errechtlichen Norm.Leben, körperliche Integrität und Eigentum an Sachen s<strong>in</strong>d <strong>von</strong> <strong>der</strong> Rechtsordnungumfassend geschützt, so dass <strong>der</strong>en Verletzung immer wi<strong>der</strong>rechtlichist (Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter). Blosse Vermögensschäden(z. B. Arbeitsausfall, Ansprüche <strong>von</strong> Kunden des Geschädigtenwegen Lieferverzögerung und Imageverluste) s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen nur dann zuersetzen, wenn bei <strong>der</strong> Verursachung e<strong>in</strong>e gesetzliche Bestimmung verletztwurde, welche dem Schutz des Vermögens gegen Schädigungen dieser Artdient (vgl. zur Bedeutung solcher Normen auch BGE 125 III 86, E. 3b und119 II 128 E. 3). Technische Normen (z.B. ISO/BS) s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Vermögensschutznormen.Da solche spezifische Schutznormen selten s<strong>in</strong>d, bestehenfür Vermögensschäden durch <strong>IT</strong>-Produkte und -Dienstleistungen nurselten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.8
Unerlaubte HandlungH<strong>in</strong>gegen ziehen strafrechtlich relevante Angriffe gegen Informationssystemeo<strong>der</strong> <strong>IT</strong>-Infrastruktur e<strong>in</strong>e zivilrechtliche <strong>Haftung</strong> des Angreifersnach sich (z.B. unbefugtes E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Datenverarbeitungsanlagen, Art.143 bis StGB o<strong>der</strong> Störung des Telefonverkehrs, Art. 239 StGB). In diesemZusammenhang könnte die geplante Umsetzung <strong>von</strong> Art 12 Abs. 2 <strong>der</strong> Cybercrime-Conventiondes Europarats, welcher Arbeitgeber bis zu e<strong>in</strong>emgewissen Grad verpflichtet, Computerdelikte ihrer Mitarbeiter zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n,auch zivilrechtliche Auswirkungen haben.Ob das Löschen o<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Daten auf e<strong>in</strong>em Datenträger (z.B.Harddisk) per se e<strong>in</strong>e wi<strong>der</strong>rechtliche Eigentumsverletzung darstellt o<strong>der</strong>ob sie zu blossen Vermögensschäden führt, wird <strong>in</strong>ternational kontroversdiskutiert. Da ungenügende Informationssicherheit oft zu Datenverlust o<strong>der</strong>zur Verfälschung <strong>von</strong> Informationen führt, hat diese Frage erheblichepraktische Bedeutung wurde bisher aber noch kaum gerichtlich entschieden.Bei wie<strong>der</strong>beschreibbaren Medien wird <strong>der</strong> Datenträger durch denLöschvorgang nicht selbst bee<strong>in</strong>trächtigt (Substanzbee<strong>in</strong>trächtigungstheorie).Allerd<strong>in</strong>gs liegt <strong>der</strong> wirtschaftliche und betriebliche Wert meist mehr<strong>in</strong> den Daten als im Speichermedium. Zum<strong>in</strong>dest <strong>der</strong> Verlust <strong>von</strong> lauffähigerSoftware wird daher <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen Diskussion zunehmend alsEigentumsverletzung betrachtet (Funktionsbee<strong>in</strong>trächtigungstheorie).Die Zerstörung <strong>von</strong> Datenträgern und das Unlesbarmachen <strong>von</strong> nur e<strong>in</strong>malbeschreibbaren Medien (z.B. CD-ROM) stellen zwar ohne weiteresSachbeschädigungen dar. Allerd<strong>in</strong>gs fragt sich auch hier, <strong>in</strong>wieweit dieverlorenen Daten bei <strong>der</strong> Berechnung des Sachschadens zu berücksichtigens<strong>in</strong>d. Jedenfalls s<strong>in</strong>d durch Datenverlust verursachte Arbeitsausfälle undMehraufwände grundsätzlich re<strong>in</strong>e Vermögensschäden und somit nur dannzu ersetzen, wenn e<strong>in</strong>e Vermögensschutznorm verletzt wurde.In Zusammenhang mit umfangreichen Datenschäden stellt sich stets dieFrage, <strong>in</strong>wieweit <strong>der</strong> Geschädigte zur Datensicherung verpflichtet gewesenwäre (vgl. dazu Kap. 5).Datenlöschung bzw. -verän<strong>der</strong>ung kann zu Fehlfunktionen e<strong>in</strong>es Informationssystemsführen, welche ihrerseits Sach- und Personenschädenauslösen.9
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizSchliesslich haftet auch, wer e<strong>in</strong>en Schaden <strong>in</strong> ‚sittenwidriger Weise’ absichtlichverursacht (Art. 41 Abs. 2 OR; vgl. dazu auch BGE 124 III 297E. 5e). E<strong>in</strong>e Schädigung kann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dann sittenwidrig se<strong>in</strong>, wennzwischen Schädiger und Geschädigtem e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>es Vertrauensverhältnisbesteht (z. B. aufgrund e<strong>in</strong>e Vertrages). Gibt z. B. <strong>der</strong> Hersteller e<strong>in</strong>es<strong>IT</strong>-Systems wi<strong>der</strong> besseres Wissen e<strong>in</strong>e Zusicherung über dessen sicherheitsrelevanteEigenschaften ab, kann er für dadurch entstandene Vermögensschädenauch noch nach Ablauf <strong>der</strong> Gewährleistungsfristen haften.Bei Schäden, welche <strong>in</strong> Zusammenhang mit dem Unterlassen <strong>von</strong> Sicherheitsmassnahmenentstanden s<strong>in</strong>d, muss differenziert werden:• Wären sie nicht entstanden, wenn die betreffende Leistung gar nicht erbrachtworden wäre, liegt nicht e<strong>in</strong>e Schädigung durch Unterlassen son<strong>der</strong>ndurch aktives Handeln vor (z.B. Schädigungen beim E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>erneuen <strong>IT</strong>-Komponente, weil bei <strong>der</strong> Installation Sicherheitsvorkehrungenunterlassen wurden).• Erfolgte die Schädigung h<strong>in</strong>gegen durch externe Ursachen, stellt sichdie Frage, ob das Unterlassen <strong>der</strong> Sicherheitsvorkehren gegen e<strong>in</strong>e vertraglicheo<strong>der</strong> gesetzliche Garantenstellung verstossen hat (vgl. dazuBGE 115 II 15), z.B. e<strong>in</strong>e Pflicht zum Schutz vor bestimmten AngriffenDritter im Rahmen <strong>von</strong> Managed Security Service Verträgen.2.4 VerschuldenDie Deliktshaftung setzt voraus, dass <strong>der</strong> Schaden schuldhaft, d. h. absichtlicho<strong>der</strong> fahrlässig verursacht wurde. Das Verschulden des Schädigersmuss sowohl nach objektiven als nach personenbezogenen Kriterien beurteiltwerden. Bei Schäden durch Softwarefehler ist etwa zu prüfen, ob sich<strong>der</strong> Verursacher so verhalten hat, wie man es <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em Informatiker mitdem betreffenden Ausbildungsstand erwarten durfte und ob se<strong>in</strong> Verhalten<strong>in</strong> <strong>der</strong> konkreten Situation vorwerfbar war.Letztlich geht es darum, ob <strong>der</strong> Schadensverursacher jenes Mass an Sorgfaltaufgewendet hat, welches <strong>von</strong> ihm objektiv erwartet werden durfte. In10
Unerlaubte Handlungdiesem Zusammenhang ist es wichtig, dokumentieren zu können, ob diebranchenüblichen Standards e<strong>in</strong>gehalten wurden. Dazu kann z.B. gehören:• E<strong>in</strong>halten <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> betreffenden Branche gängigen Sicherheitsstandards(z.B. ISO/IEC 17799 soweit diese <strong>IT</strong>-Hersteller und Dienstleistermitbetreffen).• Massnahmen zur Qualitätssicherung• Produktemonitor<strong>in</strong>g nach Inverkehrbr<strong>in</strong>gen/nachträgliche Produkte<strong>in</strong>formation2.5 Adäquate KausalitätE<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong> besteht nur dann, wenn <strong>der</strong> Schaden e<strong>in</strong>deutig auf e<strong>in</strong> vorwerfbaresVerhalten des Schädigers zurückgeführt werden kann. Nicht je<strong>der</strong>noch so unwahrsche<strong>in</strong>liche Kausalzusammenhang lässt es als gerechtfertigtersche<strong>in</strong>en, alle Personen für e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>getretenen Schaden haften zulassen, welche zu se<strong>in</strong>er Entstehung irgend e<strong>in</strong>en Beitrag geleistet haben.Es ist sozusagen e<strong>in</strong>e qualifizierte (adäquate) Kausalität notwendig. Nach<strong>der</strong> ‚Adäquanzformel‘ des schweizerischen Bundesgerichts ist <strong>der</strong> Kausalzusammenhangdann adäquat, ‚wenn die betreffende Ursache nach demgewöhnlichen Lauf <strong>der</strong> D<strong>in</strong>ge und <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Lebenserfahrung geeignetwar, den e<strong>in</strong>getretenen Erfolg zu bewirken, so dass <strong>der</strong> E<strong>in</strong>tritt des Erfolgesals durch die fragliche Tatsache allgeme<strong>in</strong> begünstigt ersche<strong>in</strong>t‘ (vgl.BGE 123 III 110 E. 3a und 102 II 232 E. 2 mit weiteren H<strong>in</strong>weisen). Allerd<strong>in</strong>gswird diese Formel vom Bundesgericht sehr weit <strong>in</strong>terpretiert, so dasses an <strong>der</strong> Adäquanz nur <strong>in</strong> seltenen Ausnahmefällen fehlen dürfte.Im Bereich <strong>der</strong> Informationssicherheit werden Schäden durch <strong>IT</strong>-Herstellerund -Dienstleister typischerweise dadurch mitverursacht, dass sie schadensverhütendeMassnahmen unterlassen (z.B. Verzicht auf E<strong>in</strong>bau <strong>von</strong>Schutzmechanismen <strong>in</strong> Produkte, Nichte<strong>in</strong>spielen <strong>von</strong> Softwareupdates,unsachgemässe Konfiguration <strong>von</strong> Firewalls). <strong>IT</strong>-Hersteller und -Dienstleister können auch dann zu <strong>Haftung</strong> gezogen werden, wenn <strong>der</strong>Schaden zwar primär durch Zufall o<strong>der</strong> Drittverhalten (z.B. Angriffe <strong>von</strong>11
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizHackern) ausgelöst worden ist, sie aber pflichtwidrig Massnahmen unterlassenhaben, welche den Schadense<strong>in</strong>tritt verhütet hätten.Das Verhalten des Geschädigten o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es Dritten vermag im Normalfallden adäquaten Kausalzusammenhang nicht zu beseitigen (BGE 112 II 141E. 3a). Ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Ursache im Verhältnis zu den an<strong>der</strong>n Gründen <strong>der</strong>Schadensentstehung allerd<strong>in</strong>gs als <strong>von</strong> völlig untergeordneter Bedeutung,gilt <strong>der</strong> adäquate Kausalzusammenhang als unterbrochen und kann daherke<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong> mehr auslösen (vgl. dazu BGE 116 II 519 E. 4b). Obwohlbeispielsweise das Verschulden e<strong>in</strong>es Crackers für e<strong>in</strong>en Schadensehr viel schwerer wiegt als das fahrlässige Offenlassen <strong>von</strong> Sicherheitslückendurch e<strong>in</strong>en <strong>IT</strong>-Dienstleister führt es grundsätzlich nicht zu e<strong>in</strong>erUnterbrechung des Kausalzusammenhangs. H<strong>in</strong>gegen ist dem unterschiedlichgrossen Verschulden im Rahmen <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternen Schadensverteilung zwischenden Verursachern Rechnung zu tragen soweit <strong>der</strong> Angreifer überhaupt<strong>in</strong>s Recht gefasst werden kann (vgl. dazu Kap. 6).12
3 GeschäftsherrenhaftungSchädigungen durch mangelhafte <strong>IT</strong>-Produkte o<strong>der</strong> -Dienstleistungen werdenletztlich meistens durch Mitarbeiter e<strong>in</strong>es Unternehmens verursacht.Für den Geschädigten ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel unzweckmässig, gegen denjenigenArbeitnehmer zu klagen, welcher den Schaden verschuldet hat. E<strong>in</strong>erseitsist es für Aussenstehende mitunter kaum möglich zu eruieren, wer denSchaden verursacht hat. An<strong>der</strong>erseits verfügen Arbeitnehmer oft nicht übergenügend Mittel bzw. eigene Versicherungsdeckung zum Ersatz grosserSchäden.Aufgrund <strong>der</strong> spezifischen Geschäftsherrenhaftung <strong>von</strong> Art. 55 OR kann<strong>der</strong> Geschädigte den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberfirma des Schadensstifters<strong>in</strong>s Recht fassen. E<strong>in</strong> Unternehmen haftet als ‚Geschäftsherr’, fürdas Verhalten se<strong>in</strong>er Arbeitnehmer o<strong>der</strong> sonstigen Hilfspersonen, wennfolgende Voraussetzungen gegeben s<strong>in</strong>d:• Der Schaden muss durch e<strong>in</strong>e Hilfsperson verursacht worden se<strong>in</strong>. Dassetzt nicht zw<strong>in</strong>gend e<strong>in</strong>en gültigen Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmenund dem Schadensverursacher voraus. Massgebend ist, obe<strong>in</strong> Unterordnungsverhältnis zum ‚Geschäftsherrn’ besteht, d. h. obdie Hilfsperson unter Aufsicht steht und Weisungen befolgen musste.Sofern e<strong>in</strong> faktisches Unterordnungsverhältnis besteht, kann die Geschäftsherrenhaftungauch für Freelancer gegeben se<strong>in</strong>. H<strong>in</strong>gegen s<strong>in</strong>dSubakkordanten und Zulieferer grundsätzlich ke<strong>in</strong>e Hilfspersonen.• Die Schadensverursachung muss <strong>in</strong> Ausübung <strong>der</strong> geschäftlichen Verrichtungenstattgefunden haben. Das ist auch dann <strong>der</strong> Fall, wenn <strong>der</strong>Arbeitnehmer sich bei <strong>der</strong> Ausführung <strong>der</strong> Arbeit über Weisungen desGeschäftsherrn h<strong>in</strong>wegsetzte (z. B. Sicherungsmassnahmen unterlässt).H<strong>in</strong>gegen haftet <strong>der</strong> Arbeitgeber grundsätzlich nicht für privat motivierteSabotageakte <strong>der</strong> Arbeitnehmer (z. B. Hack<strong>in</strong>g), auch wenn siebei Gelegenheit <strong>der</strong> Arbeit erfolgen.• Die Schädigung muss wi<strong>der</strong>rechtlich erfolgt se<strong>in</strong> (vgl. dazu Kap. 2.3).• Zwischen schädigen<strong>der</strong> Handlung und Schaden muss e<strong>in</strong> adäquaterKausalzusammenhang bestehen (vgl. Kap. 2.5).13
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizDer ‚Geschäftsherr’ kann sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong> befreien, wenn er beweist,dass er die nötige Sorgfalt <strong>in</strong> folgenden Bereichen walten liess:• Auswahl <strong>der</strong> schadensverursachenden Hilfsperson. Diese musste <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eüber die notwendige berufliche Qualifikation für die betreffendeAufgabe verfügen.• Korrekte und ausreichende Instruktion <strong>der</strong> Hilfsperson. Der Umfang<strong>der</strong> notwendigen Anleitung hängt ebenfalls <strong>von</strong> <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong>betreffenden Person ab.• Ausreichende Überwachung und Kontrolle <strong>der</strong> Hilfsperson. Da <strong>in</strong>grösseren Unternehmen nicht alle Mitarbeiter <strong>von</strong> Verwaltungsrat undDirektion persönlich überwacht werden können, hat die Implementierung<strong>von</strong> Controll<strong>in</strong>g- und Qualitätssicherungsverfahren hier beson<strong>der</strong>eBedeutung.• Schliesslich muss <strong>der</strong> Geschäftsherr beweisen, dass alle objektiv gebotenenMassnahmen zur Vermeidung <strong>von</strong> Schäden <strong>der</strong> betreffenden Artdurch zweckmässige Organisation des Arbeitsprozesses getroffen wurden.Dazu gehört auch das Bereitstellen <strong>der</strong> nötigen personellen Ressourcenfür e<strong>in</strong>e bestimmte Aufgabe und e<strong>in</strong>e realistische Zeitplanung.Softwareentwicklung erfolgt häufig unter extremem Zeitdruck. Führte<strong>in</strong>e unzweckmässiger Projektplanung durch den Geschäftsherrn zuSchäden wegen Übermüdungseffekten, kann <strong>der</strong> Entlastungsbeweisscheitern.Nach <strong>der</strong> Rechtsprechung des Bundesgerichtes muss <strong>der</strong> Geschäftsherr<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e wirksame Qualitätskontrollen <strong>der</strong> <strong>von</strong> ihm hergestelltenProdukte durchführen. Falls dies nicht möglich ist, muss e<strong>in</strong> Herstellungsprozessgewählt werden, welcher Schädigungen mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitausschliesst (vgl. BGE 110 II 456 E. 3a/b). Bei komplexen<strong>IT</strong>-Produkten ist angesichts des Problems <strong>der</strong> praktischen Unvermeidbarkeit<strong>von</strong> Fehlern im S<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Technik entscheidend, wie weitdie Testmassnahmen gehen müssen (vgl. zu Entwicklungsrisiken auchKap. 4.7.5). Der notwendige Umfang <strong>von</strong> Tests hängt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e vomSchädigungspotential des betreffenden Produkts ab. Beson<strong>der</strong>s hoheAnfor<strong>der</strong>ungen gelten z. B. für mediz<strong>in</strong>altechnische Systeme.14
GeschäftsherrenhaftungVere<strong>in</strong>zelte Ausreisser <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Produktionsserie, welcheauch durch sorgfältige Tests nicht erkannt werden konnten, führen nichtzur Geschäftsherrenhaftung des Herstellers. Dies ist aber praktisch nurfür Hardware <strong>von</strong> Bedeutung, da Fehler <strong>in</strong> Standardsoftware grundsätzlichalle Exemplare des betreffenden Releases umfassen. Ausnahmens<strong>in</strong>d immerh<strong>in</strong> für Bee<strong>in</strong>trächtigungen durch Fehler <strong>der</strong> Datenträgerndenkbar.Der Geschäftsherr haftet nur, wenn e<strong>in</strong>e Verletzung se<strong>in</strong>er Sorgfaltspflichtenfür die Entstehung des Schadens tatsächlich kausal war. Allerd<strong>in</strong>gsdürfte nur <strong>in</strong> seltenen Fällen <strong>der</strong> Beweis gel<strong>in</strong>gen, dass <strong>der</strong> Schaden auchbei Aufwendung <strong>der</strong> nötigen Sorgfalt e<strong>in</strong>getreten wäre.Soweit <strong>der</strong> Schaden durch e<strong>in</strong> fehlerhaftes Produkt verursacht wurde,kommt neben <strong>der</strong> Geschäftsherrenhaftung die Anwendung des Produktehaftungsrechts<strong>in</strong> Betracht. In welchem Verhältnis diese beiden <strong>Haftung</strong>sartenzu e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen, ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz noch nicht abschliessend geklärt.Es ist aber da<strong>von</strong> auszugehen, dass die Geschäftsherrenhaftung anwendbarist, wenn die beson<strong>der</strong>en Voraussetzungen des Produktehaftungsrechtsnicht gegeben s<strong>in</strong>d (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e, wenn ke<strong>in</strong> Schaden im S<strong>in</strong>n desProduktehaftungsgesetzes vorliegt). Die Produktehaftung des Geschäftsherrnhat somit vor allem noch Bedeutung für Sachschäden an kommerziellgenutzten Gegenständen (z.B. Beschädigung <strong>von</strong> Produktionsanlagendurch Softwarefehler, Brände).Inwieweit zu den Sorgfaltspflichten des Herstellers auch die Beobachtung<strong>von</strong> bereits <strong>in</strong> Verkehr gebrachten Produkten gehört (Produktemonitor<strong>in</strong>g),bzw. ob er bei erst nachträglich erkennbarer Gefährlichkeit <strong>der</strong> Produktezur Information bzw. zum Rückruf verpflichtet ist, wird <strong>in</strong>ternationalkontrovers diskutiert. Diese Frage ist im <strong>IT</strong>-Bereich vor allem für Sicherheitsprodukterelevant, welche gegen sich verän<strong>der</strong>nde Gefährdungen ke<strong>in</strong>enSchutz mehr bieten.15
4 ProduktehaftungZiel des Produktehaftungsrechts ist primär <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Konsumentenund zufälligerweise geschädigter Dritter (<strong>in</strong>nocent bystan<strong>der</strong>s) vor gefährlichenProdukten. 1985 hat die EU e<strong>in</strong>e Richtl<strong>in</strong>ie zur Vere<strong>in</strong>heitlichung<strong>der</strong> Vorschriften zur <strong>Haftung</strong> für fehlerhafte Produkte (PrHRL) erlassen,welche die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, e<strong>in</strong> <strong>der</strong> Richtl<strong>in</strong>ie entsprechendesProduktehaftungsrecht e<strong>in</strong>zuführen.Unter das EU-Produktehaftungsrecht fallen auch schweizerische Hersteller,wenn <strong>der</strong>en Produkte <strong>in</strong> die EU exportiert werden und dort Schädenverursachen. Umgekehrt können ausländische Hersteller für <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweize<strong>in</strong>getretene Schäden hier <strong>in</strong>s Recht gefasst werden (vgl. zum anwendbarenRecht Art. 135 IPRG und zu Zuständigkeit und Vollstreckbarkeit Art. 5Ziff. 3 LugÜ).In <strong>der</strong> Schweiz hat die PrHRL zwar ke<strong>in</strong>e direkte Geltung. Aus <strong>der</strong> Entstehungsgeschichtedes schweizerischen Produktehaftungsgesetzes (PrHG)ergibt sich aber das Bestreben e<strong>in</strong>er engen Anlehnung an die PrHRL. Dieseist daher bei se<strong>in</strong>er Auslegung mit zu berücksichtigen.Obwohl unsichere Informationssysteme zahlreich s<strong>in</strong>d, gibt es bisher we<strong>der</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz noch <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU Gerichtsentscheide zu Produktehaftung für<strong>IT</strong>-Produkte. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass das Produktehaftungsrechtnicht alle Arten <strong>von</strong> Schäden umfasst: Bei Schäden an privatgenutzten Gegenständen steht das Prozessrisiko meist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zuungünstigen Verhältnis zum erreichbaren Schadenersatz, so dass solcheFälle <strong>in</strong> Europa praktisch nie gerichtlich ausgetragen werden.4.1 Überblick über die <strong>Haftung</strong>svoraussetzungenE<strong>in</strong> Hersteller haftet nach dem PrHG bzw. <strong>der</strong> PrHRL unter folgendenVoraussetzungen:17
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz• Nachweis e<strong>in</strong>es Schadens durch Tod, Körperverletzung o<strong>der</strong> an e<strong>in</strong>emGegenstand, welcher dem Privatgebrauch diente (Art. 1 PrHG/Art. 9PrHRL),• Verursachung durch e<strong>in</strong> fehlerhaftes Produkt (Art. 4 und 5PrHG/Art. 6 PrHRL)• adäquate Kausalität zwischen Schaden und Produktefehler.Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich <strong>der</strong> Hersteller <strong>von</strong> <strong>der</strong> Produktehaftungentlasten (vgl. dazu im e<strong>in</strong>zelnen Kap. 4.7).4.2 SchadenNur Schäden durch Tod, Körperverletzung o<strong>der</strong> an Gegenständen, welchedem Privatgebrauch dienen, s<strong>in</strong>d vom Produktehaftungsrecht erfasst(vgl. zum Umfang <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Schadensarten Kap. 2.2). Schäden ankommerziell nutzbaren Objekten und sonstige Vermögensschäden liegensomit ausserhalb des Anwendungsbereiches des PrHG.Mangelhafte Computerprogramme führen häufig zu Datenverlust und unerwünschterDatenverän<strong>der</strong>ung. Nach <strong>der</strong> hier vertretenen Auffassung fallendiese nicht unter die vom Produktehaftungsrecht erfassten Schäden, daDaten an<strong>der</strong>s als Computerprogramme auch nicht als ‚Produkt’ im S<strong>in</strong>n desPrHG bzw. <strong>der</strong> PrHRL zu qualifizieren s<strong>in</strong>d. Die Frage wird allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>ternationalkontrovers diskutiert.Schäden am fehlerhaften Produkt selbst s<strong>in</strong>d vom Produktehaftungsrechtebenfalls nicht erfasst. Dies kann mitunter zu schwierigen Abgrenzungsfragenzwischen Gesamtprodukt und Produktebestandteilen führen.Das Produktehaftungsrecht hat somit nur für jene <strong>IT</strong>-Produkte o<strong>der</strong> Systemepraktische Bedeutung, welche zu Personenschäden führen können.Das ist bei Computerprogrammen zum Glück relativ selten <strong>der</strong> Fall. Allerd<strong>in</strong>gshaben Computerprogramme zur Temperaturüberwachung bereits zuBränden geführt und Fehler <strong>in</strong> <strong>der</strong> Steuerungssoftware <strong>von</strong> Benz<strong>in</strong>pumpenund Verkehrsampeln schon schwere Verkehrsunfälle verursacht.18
Produktehaftung4.3 ProduktDas Produktehaftungsrecht geht <strong>von</strong> körperlichen Sachen aus. Ob Softwaredarunter fällt, ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz noch teilweise umstritten. Es zeichnetsich jedoch <strong>in</strong>ternational e<strong>in</strong>e klare Tendenz ab, diese Frage zu bejahen,unabhängig da<strong>von</strong>, ob die Software <strong>in</strong> e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es Produkt <strong>in</strong>tegriert o<strong>der</strong>als eigenständiges Gut vermarktet wird. Es spielt auch ke<strong>in</strong>e Rolle, ob e<strong>in</strong>Computerprogramm onl<strong>in</strong>e übertragen o<strong>der</strong> auf e<strong>in</strong>em physischen Datenträgergeliefert wird.Nach <strong>der</strong> hier vertretenen Auffassung besteht ke<strong>in</strong>e Produktehaftung fürre<strong>in</strong>e Daten, (z. B. fehlerhafte Informationen <strong>in</strong> Datenbanken) da dieseke<strong>in</strong>e produktetypische Funktionalität aufweisen und Schäden im S<strong>in</strong>n desProduktehaftungsrechts erst durch die Umsetzung <strong>der</strong> Information entstehen.Die Frage <strong>der</strong> Produktehaftung für Informationen (z. B. fehlerhafteAngaben <strong>in</strong> Bücher, Flugkarten etc.) ist allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>ternational kontrovers.Obwohl die Produktehaftung vor allem auf <strong>in</strong>dustriell gefertigte Gegenständezugeschnitten ist, umfasst sie auch <strong>in</strong>dividuell hergestellte Produkte(z. B. Individualsoftware und <strong>in</strong>tegrierte <strong>IT</strong>-Systeme).H<strong>in</strong>gegen ist das Produktehaftungsrecht nicht auf Dienstleistungen anwendbar.Der Versuch, e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e ausservertragliche Dienstleistungshaftunge<strong>in</strong>zuführen, ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU vorläufig gescheitert. Allerd<strong>in</strong>gs könnensich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei Entwicklungs-, Wartungs- und Outsourc<strong>in</strong>gleistungenschwierige Abgrenzungsfragen zwischen Produkten und Dienstleistungenstellen. Nach <strong>der</strong> hier vertretenen Auffassung ist entscheidend, ob solcheLeistungen direkt e<strong>in</strong> funktionsfähiges Produkt erzeugen (z. B. lauffähigesComputerprogramm, nicht aber e<strong>in</strong> blosses Programmkonzept).Reparatur und Wartung führen bei Computerprogrammen im Gegensatzzu Produkten, welche nur <strong>in</strong> den ursprünglichen Zustand bei Inverkehrbr<strong>in</strong>genzurückversetzt werden, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel zu e<strong>in</strong>em verän<strong>der</strong>tenProdukt. Damit unterliegen solche Leistungen grundsätzlich <strong>der</strong> Produktehaftung.Es ersche<strong>in</strong>t jedoch bei nur e<strong>in</strong>zelne Module erfassenden Än<strong>der</strong>ungennicht unbed<strong>in</strong>gt s<strong>in</strong>nvoll, das modifizierte Programm als völligneues Produkt zu betrachten und damit die Zehnjahresfrist seit Inver-19
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizkehrbr<strong>in</strong>gen für das ganze Programm o<strong>der</strong> gar das ganze <strong>IT</strong>-System erneutauszulösen. H<strong>in</strong>gegen kann das geän<strong>der</strong>te Modul selbst als neues Produktbegriffen werden sofern es eigene produktetypische Gefährdungen mit sichbr<strong>in</strong>gt.Outsourc<strong>in</strong>gunternehmer, Application Service Provi<strong>der</strong> und ähnlicheDienstleister haften grundsätzlich nur für das Zurverfügungstellen <strong>von</strong>selbst hergestellten Programmen als Produktehersteller, nicht aber für Verfügbarkeitsunterbrücheund <strong>der</strong>gleichen. Für Fremdprogramme kann allerd<strong>in</strong>gse<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong> als Importeur o<strong>der</strong> Lieferant bestehen (vgl. dazuKap. 4.5).4.4 FehlerE<strong>in</strong> durch e<strong>in</strong> Produkt verursachter Schaden führt nur dann zu e<strong>in</strong>er <strong>Haftung</strong>des Herstellers, wenn es als fehlerhaft zu qualifizieren ist. Ob ihn e<strong>in</strong>Verschulden an <strong>der</strong> Fehlerhaftigkeit trifft, spielt h<strong>in</strong>gegen ke<strong>in</strong>e Rolle. DerFehlerbegriff des Produktehaftungsrechts ist we<strong>der</strong> mit dem Fehlerbegriff<strong>der</strong> Technik noch mit dem Mangelbegriff des Vertragsrechts identisch.E<strong>in</strong> Produkt ist dann fehlerhaft im S<strong>in</strong>n des Produktehaftungsrechts, wennes berechtigte Sicherheitserwartungen enttäuscht. Dies ist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eanhand folgen<strong>der</strong> Kriterien zu prüfen:• Produktepräsentation (z. B. Werbung, Benutzerhandbücher und grafischeBenutzeroberfläche)• vernünftigerweise zu erwarten<strong>der</strong> Gebrauch• E<strong>in</strong>satzgebiet (z. B. Steuerung <strong>von</strong> Operationsgeräten o<strong>der</strong> blossesSchreibprogramm)• Anwen<strong>der</strong>kreis (z. B. professionelle, technisch versierte Anwen<strong>der</strong>o<strong>der</strong> Laien)• Produktepreis. Allerd<strong>in</strong>gs besteht auch bei günstigen Produkten e<strong>in</strong>Anspruch auf sichere M<strong>in</strong>destfunktionalität.20
ProduktehaftungDie relevanten Sicherheitserwartungen an e<strong>in</strong> Produkt beziehen sich auf dieSchädigungsgefahr und nicht auf dessen technische Eigenschaften. Die Benutzerbrauchen sich grundsätzlich ke<strong>in</strong>e konkreten Vorstellungen über die<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Produkt enthaltenen Sicherheitsmechanismen zu machen, son<strong>der</strong>nsie dürfen da<strong>von</strong> ausgehen, dass es bei richtiger Anwendung ke<strong>in</strong>e Schädenan Leib und Leben o<strong>der</strong> privaten Gegenständen verursacht. Sicherheit bestehtnach <strong>der</strong> hier vertretenen Auffassung immer nur im H<strong>in</strong>blick aufe<strong>in</strong>en bestimmten Gebrauch, so dass die Sicherheitserwartungen die zu erwartendeBandbreite sicheren Gebrauchs umfassen.Diese Bandbreite des sicheren Gebrauchs muss neben dem Normalgebrauchauch vorhersehbare Fehlgebrauchsarten umfassen. Für <strong>IT</strong>-Produkteist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e an die Möglichkeit <strong>von</strong> Fehlmanipulationen durchfalsche o<strong>der</strong> zufällige E<strong>in</strong>gaben zu denken, h<strong>in</strong>gegen wohl nicht an Programmän<strong>der</strong>ungenseitens des Benutzers. Wenn damit gerechnet werdenmuss, dass durch Fehle<strong>in</strong>gaben produktehaftungsrelevante Schäden entstehenkönnten, s<strong>in</strong>d zum<strong>in</strong>dest geeignete Rückfragen via Bildschirm e<strong>in</strong>zubauen.Unter Umständen muss e<strong>in</strong> Produkt auch Sicherheit gegenüber äusserenE<strong>in</strong>flüssen bieten (z. B. ke<strong>in</strong>e unnötige Gefährlichkeit im Fall <strong>von</strong>‚Systemabstürzen’). E<strong>in</strong>zelne <strong>IT</strong>-Produkte wie Firewalls und Antivirenprogrammedienen ausschliesslich <strong>der</strong> Sicherheit und sollen Schutz vor gängigenAngriffstechniken garantieren. Betriebssysteme o<strong>der</strong> Programme, welcheZugang zum Internet verschaffen, erfüllen zwar primär e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>enZweck, stellen aber neuralgische Punkte <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Sicherheitsarchitekturdar und können daher ebenfalls beson<strong>der</strong>e Schutzerwartungenwecken. Für sicherheitsrelevante Produkte muss die Bandbreite <strong>der</strong> zu erwartendenStörungen ermittelt werden, welche vom Produkt kompensiertwerden soll.Das Produktehaftungsrecht stellt nicht auf die E<strong>in</strong>haltung technischerNormen son<strong>der</strong>n auf die Enttäuschung berechtigter Sicherheitserwartungenab. Immerh<strong>in</strong> kann die Verletzung e<strong>in</strong>schlägiger Sicherheitsnormen e<strong>in</strong> Indizfür die Fehlerhaftigkeit des Produkts bilden.21
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizDie Fehlerfreiheit e<strong>in</strong>es Produkts kann grundsätzlich nicht an später <strong>in</strong>Verkehr gebrachten Produkten gemessen werden (Art. 4 Abs. 2 PrHG). BeiSerienprodukten, welche über längere Zeit h<strong>in</strong>weg hergestellt werden, istauf die Sicherheitserwartungen bei Inverkehrbr<strong>in</strong>gen des konkret schadensstiftendenExemplars abzustellen.4.5 HerstellerNach dem PrHG haften folgende Personengruppen für die Schäden durchdie Fehlerhaftigkeit <strong>der</strong> <strong>von</strong> ihnen <strong>in</strong> Verkehr gebrachten Produkte:• Hersteller des Endprodukts• Hersteller fehlerhafter Produktebestandteile• ‚Quasihersteller’ wie Zwischenhändler und Lizenzgeber, welche denAnsche<strong>in</strong> erwecken, das Produkt selbst hergestellt zu haben.• Importeure• subsidiär Lieferanten<strong>IT</strong>-Produkte durchlaufen meist Herstellungsschritte auf verschiedenenMarktstufen. Z. B. besteht e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegriertes <strong>IT</strong>-System aus Hard- und Softwarekomponentene<strong>in</strong>er Vielzahl <strong>von</strong> Herstellern. Im S<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er immerbreiter werdenden ‚<strong>Haftung</strong>skaskade’ haftet je<strong>der</strong> Beteiligte für die Fehlerhaftigkeitse<strong>in</strong>er eigenen Leistung und <strong>der</strong>jenigen se<strong>in</strong>er ‚Vorhersteller‘,nicht aber für <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong> ‚Nachhersteller‘. Als ‚Hersteller’ werden vomProduktehaftungsrecht praktisch alle Beteiligten erfasst, welche Verantwortungfür die Qualität e<strong>in</strong>es Produktes o<strong>der</strong> für dessen Inverkehrbr<strong>in</strong>genwahrnehmen können.Voraussetzung für e<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong> als Teilhersteller ist stets, dass e<strong>in</strong> Arbeitsergebnismit eigener produktetypischer Schädigungsgefahr geschaffenwird (z. B. lauffähiges Unterprogramm, nicht aber blosse Mitarbeit,etwa durch Entwurf <strong>der</strong> Programmstruktur).22
ProduktehaftungWenn Lieferanten bzw. Assembler <strong>in</strong>tegrierte <strong>IT</strong>-Systeme aus Standardkomponentenzusammenstellen und <strong>in</strong>stallieren, fragt sich, ob sie als Gesamtprodukteherstellerhaften. E<strong>in</strong> Produkt im S<strong>in</strong>n des Produktehaftungsrechtsist mehr als die Summe se<strong>in</strong>er Bestandteile. Nach <strong>der</strong> hier vertretenenAuffassung ist entscheidend, ob <strong>der</strong> Assembler selbst produktetypischeRisiken schafft, etwa durch Auswahl <strong>von</strong> Komponenten, Installation undKonfiguration.Die rechtliche E<strong>in</strong>ordnung <strong>von</strong> Freelancern, welche fehlerhafte Bestandteileentwickeln, hängt da<strong>von</strong> ab, <strong>in</strong>wieweit sie <strong>in</strong> die Arbeitsorganisationdes Gesamtprodukteherstellers e<strong>in</strong>gebunden s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e, ob sie faktischan se<strong>in</strong>e Weisungen gebunden s<strong>in</strong>d. Sie s<strong>in</strong>d nur dann als Teilherstellerzu betrachten, wenn dies nicht <strong>der</strong> Fall ist.Für die Geschädigten ist es unter Umständen schwierig, Ansprüche gegenüberHerstellern durchzusetzen, welche ihren Sitz im Ausland haben (vgl.für die Mitgliedstaaten des EWR immerh<strong>in</strong> Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Die EU-Produktehaftungsrichtl<strong>in</strong>ie sieht für Produkte, welche ausserhalb <strong>der</strong> EUbzw. des EWR-Raums hergestellt wurden daher e<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong> des Importeursvor. E<strong>in</strong>e analoge <strong>Haftung</strong> kennt das schweizerische PrHG für Produkte,welche nicht aus <strong>der</strong> Schweiz o<strong>der</strong> Liechtenste<strong>in</strong> stammen (Art. 2Abs. 1 lit. c PrHG). Da Produktehaftungsansprüche gegenüber den Geschädigtennicht ausgeschlossen werden können, ist es für Importeure entsprechen<strong>der</strong>Produkte wichtig, dass ihnen <strong>der</strong> Hersteller vertraglich zusichert,im <strong>Haftung</strong>sfall Ersatz zu leisten (Freistellung <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong>).Schadenersatzansprüche stossen auch dann auf praktische Schwierigkeiten,wenn <strong>der</strong> Geschädigte nicht feststellen kann, wer das Produkt hergestelltbzw. importiert hat. Für diesen Fall sieht das Produktehaftungsrecht vor,dass auf den Lieferanten zurückgegriffen werden kann (Art. 2 Abs. 2 und3 PrHG). Dieser kann sich allerd<strong>in</strong>gs durch die Bekanntgabe des Herstellersbzw. se<strong>in</strong>es Lieferanten <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong> befreien.Computerprogramme werden mitunter via Internet direkt vertrieben. Dieeigentliche Importhandlung wird zwar durch den Erwerber ausgelöst, welcherdas Programm auf dem fremden Server abruft und damit sozusagen23
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizselbst e<strong>in</strong>führt. Der Onl<strong>in</strong>e-Anbieter kann jedoch als Importeur haften,wenn <strong>der</strong> E<strong>in</strong>speisungsort im Ausland liegt.Lizenzgeber, OEM-Partner etc. unterliegen dann <strong>der</strong> Produktehaftung,wenn sie den E<strong>in</strong>druck erwecken, die Produkte selbst hergestellt zu habenbzw. die <strong>in</strong>haltliche Verantwortlichkeit dafür zu tragen (<strong>Haftung</strong> als Quasiherstellernach Art. 2 Abs. 1 lit. b PrHG).Für jeden Hersteller gilt die Weitergabe an die nächste Marktstufe als Zeitpunktdes Inverkehrbr<strong>in</strong>gens. Insbeson<strong>der</strong>e Sicherheitsprodukte, welcheim Zeitpunkt des Inverkehrbr<strong>in</strong>gens durch e<strong>in</strong>en (Teil-)hersteller fehlerfreiwaren, können bei <strong>der</strong> Weiterveräusserung durch den Gesamtherstellero<strong>der</strong> Importeur unter Umständen fehlerhaft se<strong>in</strong>, weil <strong>in</strong>zwischen neue Angriffstechnikenaufgekommen s<strong>in</strong>d, gegen welche es wirkungslos ist.4.6 KausalitätSchäden s<strong>in</strong>d nur dann produktehaftungsrechtlich relevant, wenn ihre Verursachunge<strong>in</strong>em fehlerhaften Produkt adäquat kausal zugeordnet werdenkann (vgl. dazu Kap. 2.5).Bei <strong>IT</strong>-Systemen mit Hard- und Softwarekomponenten verschiedener Herstellerund Lieferanten ist oft schwer festzustellen, welches Element nichtkorrekt funktionierte und wer daher als Hersteller <strong>in</strong>s Recht gefasst werdenkönnte. Beson<strong>der</strong>e Beweisschwierigkeiten br<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e nicht reproduzierbareFehler mit sich. Gel<strong>in</strong>gt es dem Geschädigten nicht, dasGericht da<strong>von</strong> zu überzeugen, dass <strong>der</strong> Schaden durch e<strong>in</strong>en Fehler <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em bestimmten Produkt entstanden ist, muss er ihn selbst tragen.Die Adäquanz <strong>der</strong> Schadensverursachung kann auch dann problematischse<strong>in</strong>, wenn e<strong>in</strong> <strong>IT</strong>-System e<strong>in</strong>e falsche Information generiert (z.B. unrichtigeBerechnung mediz<strong>in</strong>ischer Analysedaten), aber erst <strong>der</strong>en unkritischeUmsetzung durch e<strong>in</strong>e Person zu e<strong>in</strong>em Schaden führt. Ob die Erzeugunggefährlicher Fehl<strong>in</strong>formationen überhaupt e<strong>in</strong>en Produktefehler darstellenkann, wird allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>ternational kontrovers diskutiert.24
ProduktehaftungBei wirkungslosen Sicherheitsprodukten (z. B. Firewalls, Virenschutzprogramme),welche e<strong>in</strong>en Schaden hätten verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n sollen, ist zunächstzu prüfen, ob überhaupt berechtigte Sicherheitserwartungen h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Resistenz gegenüber den betreffenden Störungen bzw. Angriffen bestehen.Die Schädigung ist kausal, wenn sich belegen lässt, dass <strong>der</strong> Schadennicht e<strong>in</strong>getreten wäre, wenn bei Kenntnis <strong>der</strong> Wirkungslosigkeit desbetreffenden Produkts e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es, wirkungsvolles e<strong>in</strong>gesetzt worden wäreo<strong>der</strong> <strong>der</strong> Geschädigte sich an<strong>der</strong>s verhalten hätte.4.7 EntlastungsgründeSowohl das PrHG als auch die PrHRL enthalten e<strong>in</strong>e abschliessende Aufzählung<strong>von</strong> sechs Entlastungsgründen. Teilweise handelt es sich um echteAusnahmen <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong>, teilweise um Konstellationen, <strong>in</strong> welchen imGrunde die <strong>Haftung</strong>svoraussetzungen fehlen (durch <strong>der</strong>en E<strong>in</strong>ordnung unterdie Entlastungsgründe soll die Beweislast aber dem Hersteller auferlegtwerden):• Der Hersteller hat das fehlerhafte Produkte nicht selbst <strong>in</strong> Verkehr gebracht.• Der Produktefehler ist erst nach dem Inverkehrbr<strong>in</strong>gen entstanden.• Der Hersteller e<strong>in</strong>es Teilprodukts haftet nicht, wenn <strong>der</strong> Fehler aufAnweisungen des Gesamtprodukteherstellers o<strong>der</strong> Eigenschaften desEndproduktes zurückzuführen ist.• Der Fehler beruht auf <strong>der</strong> E<strong>in</strong>haltung zw<strong>in</strong>gen<strong>der</strong> rechtlicher Normen.• Der Fehler war nach dem Stand <strong>der</strong> Wissenschaft und Technik im Zeitpunktdes Inverkehrbr<strong>in</strong>gens nicht erkennbar.• Das Produkte wurde nicht im Rahmen e<strong>in</strong>er kommerziellen Tätigkeithergestellt bzw. vertrieben.25
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz4.7.1 Fehlendes Inverkehrbr<strong>in</strong>genNach <strong>der</strong> gängigen Def<strong>in</strong>ition gilt e<strong>in</strong> Produkt als <strong>in</strong> Verkehr gebracht, sobald<strong>der</strong> Hersteller es willentlich aus se<strong>in</strong>em Herrschaftsbereich entlassenhat (Werktorpr<strong>in</strong>zip). Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es dabe<strong>in</strong>icht an, so dass auch bloss befristet lizenzierte Software als <strong>in</strong> Verkehrgebracht gilt. Entscheidend ist, dass das Produkt dem Erwerber zugänglichgemacht wurde. Computerprogramme dürften onl<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Verkehr gebrachtse<strong>in</strong>, sobald sie <strong>von</strong> den Benutzern ordnungsgemäss heruntergeladen werdenkönnen.Selbst hergestellte Produkte, welche bei <strong>der</strong> Erbr<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong>er Dienstleistungverwendet werden, gelten auch als <strong>in</strong> Verkehr gebracht (vgl. dazu denEntscheid des EuGH vom 10.5.2001 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rechtssache C-203/99, Veedfald/ArhusAmtskommune, Slg. 2001 I 3569).Raubkopien lösen ke<strong>in</strong>e Produktehaftung des Orig<strong>in</strong>alherstellers aus, dasie nicht vom Hersteller <strong>in</strong> Verkehr gebracht wurden. H<strong>in</strong>gegen stellt dieÜbernutzung grundsätzlich nur e<strong>in</strong> vertragsrechtliches Problem zwischenHersteller und Lizenznehmer dar. Allerd<strong>in</strong>gs können sich bei <strong>der</strong> unerlaubtenHerstellung zusätzlicher Programmkopien schwierige Abgrenzungsfragenstellen.4.7.2 Nachträglich entstandene ProduktefehlerUrsprünglich korrekt funktionierende <strong>IT</strong>-Produkte können im Lauf <strong>der</strong> Zeitfehlerhaft werden (z. B. durch Alterung <strong>von</strong> Datenträgern). Dies führt allerd<strong>in</strong>gsnicht <strong>in</strong> jedem Fall zu e<strong>in</strong>er Entlastung des Herstellers: Fehlte esim Zeitpunkt des Inverkehrbr<strong>in</strong>gens an <strong>der</strong> Sicherheit für die zu erwartendeGebrauchsdauer, war <strong>der</strong> Fehler bereits latent vorhanden.<strong>IT</strong>-Sicherheitsprodukte wie Firewalls und Antivirenprogramme werdennicht dadurch fehlerhaft, dass nach ihrem Inverkehrbr<strong>in</strong>gen neuartige Angriffstechnikenauftauchen (vgl. zur Produktebeobachtung allerd<strong>in</strong>gsKap. 3). Waren bestimmte Angriffsmethoden h<strong>in</strong>gegen damals bereits bekannto<strong>der</strong> naheliegend, ist zu prüfen, ob die Nutzer damit rechnen durften,dass das Produkt Sicherheit dagegen biete.26
Produktehaftung4.7.3 Entlastungsbeweis des TeilherstellersDas Gefahrenpotential bestimmter Teilprodukten entsteht erst <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dungmit an<strong>der</strong>en Elementen bzw. dem Gesamtprodukt. Sicherheit <strong>von</strong> Informationssystemenist <strong>in</strong> gewissen Bereichen nur durch e<strong>in</strong>e kohärente <strong>IT</strong>-Sicherheitsarchitektur zu erreichen. Wenn e<strong>in</strong>e Komponente <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten<strong>IT</strong>-Umgebung nicht sicher funktioniert, kann dies darauf zurückzuführense<strong>in</strong>, dass sie nicht den typischerweise an solche Teilprodukte gestelltenAnfor<strong>der</strong>ungen entspricht. Es kann aber auch se<strong>in</strong>, dass ihre Auswahlo<strong>der</strong> Integration <strong>in</strong> das Gesamtprodukt nicht fachgerecht erfolgt ist.Im letzteren Fall wird <strong>der</strong> Teilhersteller entlastet, da die Auswahl geeigneterKomponenten und <strong>der</strong>en Integration <strong>in</strong> den Verantwortungsbereich desGesamtherstellers fällt.Der Teilhersteller haftet auch dann nicht, wenn <strong>der</strong> Fehler auf Vorgabendes Gesamtherstellers beruht. Diese können sowohl die Spezifikationendes Teilprodukts als auch unrichtige Angaben über den Verwendungszweckbetreffen. Der Teilhersteller wird allerd<strong>in</strong>gs wohl nur entlastet, wenner die Fehlerhaftigkeit <strong>der</strong> Anleitung we<strong>der</strong> erkannt hat noch hätte erkennenmüssen.4.7.4 E<strong>in</strong>haltung zw<strong>in</strong>gen<strong>der</strong> NormenDer Hersteller haftet nicht für Fehler, welche durch die E<strong>in</strong>haltung verb<strong>in</strong>dlicher,hoheitlich erlassener Vorschriften (nicht aber privater Standardswie ISO-Normen!) verursacht wurden. E<strong>in</strong>e Befreiung <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong>setzt allerd<strong>in</strong>gs voraus, dass ke<strong>in</strong>e Konstruktionsvariante möglich ist,welche sowohl <strong>der</strong> Norm entspricht als auch den Fehler vermeidet. DieserEntlastungsgrund hat daher nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen praktische Bedeutung.4.7.5 EntwicklungsrisikenComputerprogramme bestehen oft aus Hun<strong>der</strong>ttausenden o<strong>der</strong> gar Millionen<strong>von</strong> Zeilen mit e<strong>in</strong>zelnen Befehlen, Hardwarechips aus Millionenelektrischer Schalter. Statistische Untersuchungen gehen da<strong>von</strong> aus, dassungefähr jede 66. Programmzeile e<strong>in</strong>en technischen Fehler enthält. Da<strong>von</strong>27
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizwird durchschnittlich etwa die Hälfte beim Testen noch entdeckt. Innerhalbe<strong>in</strong>es grösseren Computerprogramms ist zudem die Anzahl möglicher Verknüpfungenbeim Programmablauf vom menschlichen Vorstellungsvermögennicht mehr fassbar. Ähnliches gilt für Hardware. Beträgt beispielsweisedie Ausfallwahrsche<strong>in</strong>lichkeit pro Transistor 1:1'000'000 pro Stunde, istda<strong>von</strong> auszugehen, dass <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Mikroprozessors mit 10 Mio.Transistoren durchschnittlich ca. 10 Transistoren pro Stunde ausfallen. Abe<strong>in</strong>er gewissen Komplexität ist bei <strong>IT</strong>-Produkten e<strong>in</strong>e Fehlerhaftigkeit imS<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Informatik somit unvermeidbar. Daraus resultiert e<strong>in</strong>e erhöhte Gefahr<strong>von</strong> produktehaftungsrechtlich relevanten Fehlfunktionen. Währenddemdie völlige Elim<strong>in</strong>ation aller Fehler statistisch gesehen praktisch ausgeschlossenist, wäre je<strong>der</strong> dieser Fehler e<strong>in</strong>zeln ohne weiteres erkennbarund damit auch vermeidbar gewesen.E<strong>in</strong>e <strong>Haftung</strong>sbefreiung ist nur dann möglich, wenn <strong>der</strong> Produktefehler imZeitpunkt des Inverkehrbr<strong>in</strong>gens we<strong>der</strong> nach dem Stand <strong>der</strong> Wissenschaftnoch nach demjenigen <strong>der</strong> Technik hätte erkannt werden können. Bei solchenFehlern handelt sich sog. Entwicklungsrisiken. (Vgl. dazu auch denEntscheid des EuGH vom 29. Mai 1997 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rechtssache C-300/95Kommission gegen Grossbritannien und Nordirland, Slg. 1997 I 2649, <strong>der</strong>festhält, dass <strong>der</strong> Hersteller beweisen muss, dass <strong>der</strong> Fehler nach dem objektivhöchsten, publizierten Stand <strong>der</strong> Wissenschaft und Technik nicht erkanntwerden konnte). Der Hersteller haftet daher immer, wenn die Entdeckungdes konkret schadensverursachenden Mangels möglich gewesenwäre. Er kann somit ke<strong>in</strong>e generelle Entlastung aus <strong>der</strong> Tatsache ableiten,dass komplexe <strong>IT</strong>-Produkte nie fehlerfrei im S<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Technik s<strong>in</strong>d. Entwicklungsrisikenkönnten immerh<strong>in</strong> für Sicherheitsprodukte <strong>von</strong> praktischerBedeutung se<strong>in</strong>, welche sich gegenüber neuen und nicht ohne weiteresnahe liegenden Angriffstechniken als unwirksam erweisen (z. B. Antivirenprogramme).Die Problematik <strong>der</strong> statistischen Unvermeidbarkeit <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-Fehlern ist<strong>in</strong> <strong>der</strong> Informatik allgeme<strong>in</strong> bekannt und kann unter Umständen die Erwartungenan die Bandbreite sicherer Anwendungen bee<strong>in</strong>flussen. DieVerwendung <strong>der</strong> Produkte im Rahmen des Haupte<strong>in</strong>satzzwecks muss aber<strong>in</strong> jedem Fall sicher se<strong>in</strong>. Beispielsweise stellen Softwarefehler <strong>in</strong> chirurgi-28
Produktehaftungschen Operationsgeräten, welche zu e<strong>in</strong>em Schädigungsrisiko für die Patientenführen, generell Fehler im S<strong>in</strong>n des Produktehaftungsrechts dar.4.7.6 Nichtkommerzielle TätigkeitWährenddem <strong>der</strong> private Import überhaupt nicht unter das Produktehaftungsrechtfällt, ist für die private Herstellung und den privaten Vertriebnur dann e<strong>in</strong>e Entlastung möglich, wenn sie ke<strong>in</strong>en wirtschaftlichen Zweckverfolgen.Die kommerzielle ‚Gratisbeigabe’ <strong>von</strong> Software zu an<strong>der</strong>en Produktenfällt ohne weiteres unter das Produktehaftungsrecht, da sie Teil <strong>der</strong> Gegenleistungfür e<strong>in</strong> Gesamtentgelt ist und somit eigentlich gar nicht gratis erfolgt.Heikel ist die E<strong>in</strong>ordnung <strong>von</strong> Open Source Software (z.B. Programmeund Programmbibliotheken, welche unter <strong>der</strong> GNU General Public Licensestehen). Hier ist zwischen verschiedenen Konstellationen zu differenzieren:Unter das Produktehaftungsrecht fallen grundsätzlich <strong>der</strong> kommerzielleVertrieb <strong>von</strong> Datenträgern mit an sich freier Software sowie die Entwicklung<strong>von</strong> Gratissoftware im Rahmen e<strong>in</strong>es Geschäftsmodells, welches daraufabzielt, softwarebezogene Dienstleistungen zu verkaufen. H<strong>in</strong>gegen istdie re<strong>in</strong> private Arbeit für Open Source Projekte <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Haftung</strong> ausgenommen.4.8 Verjährung und VerwirkungAnsprüche aus Produktehaftungsrecht müssen <strong>in</strong>nert drei Jahren nachE<strong>in</strong>tritt des Schadens, spätestens jedoch <strong>in</strong>nert zehn Jahren seit dem Inverkehrbr<strong>in</strong>gendes Produkts geltend gemacht werden (Art. 9 und 10PrHG).29
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz4.9 Produkte<strong>in</strong>formation und RückrufProdukterisiken lassen sich bis zu e<strong>in</strong>em gewissen Grad durch geeigneteInformation (Bedienungsanleitung, Warnh<strong>in</strong>weise auf dem Produkt etc.)vermeiden. Vollständige Information über Restrisiken verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t die Entstehungungerechtfertigter Sicherheitserwartungen (vgl. dazu auchKap. 4.4). H<strong>in</strong>gegen s<strong>in</strong>d pauschale H<strong>in</strong>weise auf die softwaretypischeFehler<strong>in</strong>härenz nicht relevant, da sie den Benutzern ke<strong>in</strong>e Anhaltspunktefür e<strong>in</strong> risikogerechtes Verhalten liefern.Obwohl we<strong>der</strong> das PrHG noch die PrHRL den Rückruf <strong>von</strong> Produkten nach<strong>der</strong>en Inverkehrbr<strong>in</strong>gen regeln, kann sich für den Hersteller nachträglicheProdukte<strong>in</strong>formation o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Produkterückruf aus verschiedenenGründen aufdrängen:• Solche Massnahmen dienen zunächst e<strong>in</strong>mal <strong>der</strong> Vermeidung <strong>von</strong>Schädigungen und damit <strong>von</strong> <strong>Haftung</strong>sansprüchen und Imageverlusten.Der Hersteller kann sich allerd<strong>in</strong>gs durch Rückruf bzw. Austausch fehlerhafterProdukte nur gegenüber den <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er solchen Aktion konkretErreichten <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Schadenersatzpflicht befreien.• Falls das Produkt Leib und Leben <strong>von</strong> Personen gefährdet (z. B. fehlerhaftemediz<strong>in</strong>ische Geräte), kann die Untätigkeit des Herstellers zu e<strong>in</strong>erstrafrechtlichen Verantwortlichkeit führen (vgl. dazu BGE 121 IV 15E. 3a).• Erkennt <strong>der</strong> Hersteller nachträglich die Gefährlichkeit se<strong>in</strong>es Produkts,könnte sich auch im schweizerischen Recht e<strong>in</strong>e Informations- o<strong>der</strong>Rückrufpflicht aus nachvertraglichen Nebenpflichten o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong>Geschäftsherrenhaftung <strong>von</strong> Art. 55 OR ergeben.• Versicherungspolicen sehen regelmässig Schadensverh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspflichtenvor, bei <strong>der</strong>en Nichtbefolgung die Versicherungsansprüche erlöschen.• Die EU-Produktesicherheitsrichtl<strong>in</strong>ie 2001/95/EG verpflichtet denHersteller zur Beobachtung und eventuell zum Rückruf <strong>von</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU <strong>in</strong>Verkehr gebrachten gefährlichen Produkten (vgl. Art. 5 Abs. 1 PrSRL).30
Produktehaftung5 Schadensverhütung und Schadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungS<strong>in</strong>d die Benutzer über Sicherheitslücken e<strong>in</strong>es Informationssystems <strong>in</strong>formiert,so haben sie sich nach den Grundsätzen <strong>der</strong> Schadensverhütungund <strong>der</strong> Schadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung zu verhalten und müssen es anpassen, soweitsonst mit <strong>der</strong> Verursachung <strong>von</strong> Schäden zu rechnen ist. An<strong>der</strong>nfalls kanndie Schadenersatzpflicht wegen Selbstverschulden herabgesetzt o<strong>der</strong> aufgehobenwerden (Art. 44 OR).Wenn das Selbstverschulden die Bedeutung <strong>der</strong> sonstigen Schadensursachenverblassen lässt, kann es ausnahmsweise sogar <strong>der</strong>en adäquatenKausalzusammenhang unterbrechen, so dass die Schadenersatzpflichtpr<strong>in</strong>zipiell entfällt (vgl. dazu Kap. 2.5).E<strong>in</strong> hohes Mass an Informationssicherheit kann nur durch Zusammenwirken<strong>von</strong> <strong>IT</strong>-Herstellern/Dienstleister und Anwen<strong>der</strong> erreicht werden.Vernachlässigt <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> diejenigen Sicherheitsmassnahmen, welche<strong>von</strong> ihm objektiv erwartet werden können, muss er e<strong>in</strong>e Kürzung bzw. imExtremfall sogar den Wegfall se<strong>in</strong>er Schadenersatzansprüche <strong>in</strong> Kauf nehmen.Soweit das Löschen bzw. Verän<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Daten überhaupt zu e<strong>in</strong>er ausservertraglichen<strong>Haftung</strong> führt (vgl. dazu Kap. 2.3), stellt sich die Frage,<strong>in</strong>wieweit Datensicherung zu den Schadensverhütungspflichten <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong>gehört. Währenddem zum<strong>in</strong>dest bei Unternehmen das Vorhandense<strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Datensicherung heute generell vorausgesetzt werden kann, lässtsich die vorauszusetzende Häufigkeit und Art kaum generell bestimmen(z.B. bloss tägliche Bandsicherung <strong>von</strong> Daten o<strong>der</strong> zeitnahe Spiegelunglaufen<strong>der</strong> Systeme).Die Schadenshöhe bei <strong>IT</strong>-Ausfällen hängt oft <strong>in</strong> erheblichem Mass da<strong>von</strong>ab, ob <strong>der</strong> Betroffene auf e<strong>in</strong>e entsprechende Situation vorbereitet war o<strong>der</strong>nicht (z.B. ob organisatorische und technische Vorkehren zu e<strong>in</strong>em Wie<strong>der</strong>anlauf<strong>der</strong> Produktion getroffen wurden). In welchem Mass e<strong>in</strong> DisasterRecovery Plann<strong>in</strong>g heute allgeme<strong>in</strong> vorausgesetzt werden kann, hängtebenfalls <strong>von</strong> Art und Grösse des Unternehmens ab. Es handelt sich dabeisozusagen um präventive Schadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspflichten.31
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizUm zu belegen, dass alle sich aufdrängenden Schadensverhütungs- undSchadensm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsmassnahmen getroffen wurden, bzw. dass ke<strong>in</strong>Selbstverschulden vorliegt, kann für den Betreiber e<strong>in</strong>es Informationssystems<strong>der</strong> Nachweis e<strong>in</strong>es aktuellen Sicherheitskonzepts und die periodischeÜberprüfung se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>haltung wichtig se<strong>in</strong>.6 Konkurrenz <strong>von</strong> HaftpflichtigenHaben mehrere Personen an Konzeption, Produktion, Installation, Verkaufund Wartung e<strong>in</strong>es fehlerhaften <strong>IT</strong>-Systems o<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Erbr<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong>erschädigenden <strong>IT</strong>-Dienstleistung mitgewirkt, ist zu prüfen, wer welche Verantwortungan <strong>der</strong> Schadensentstehung trägt. Gegenüber dem Geschädigtenhaften alle Verursacher geme<strong>in</strong>sam (solidarisch). E<strong>in</strong> allfälliges Selbstverschuldendes Geschädigten kann jedoch zu e<strong>in</strong>er Reduktion des Gesamtbetragesführen. Je<strong>der</strong> Schadensverursacher kann sich jedoch auf allfälligeeigene Entlastungsgründe und auf die für ihn geltenden Verjährungsfristenberufen (Art. 144 ff. OR).Bei <strong>der</strong> Bestimmung <strong>der</strong> Höhe <strong>von</strong> Regressansprüchen gegenüber Mitverursachernhat <strong>der</strong> Richter letztlich Wertungen über den Grad <strong>der</strong> Verantwortung<strong>der</strong> beteiligten <strong>IT</strong>-Herstellern und -Dienstleistern vorzunehmen(vgl. dazu aber auch Art. 51 OR).7 <strong>Haftung</strong>sbeschränkungen<strong>Ausservertragliche</strong> Ansprüche unterliegen grundsätzlich <strong>der</strong> Vertragsfreiheitso dass <strong>der</strong> potentiell Geschädigten zum voraus auf sie verzichtenkann. Allerd<strong>in</strong>gs gilt es dabei verschiedene E<strong>in</strong>schränkungen zu beachten:• E<strong>in</strong> zum voraus getroffener <strong>Haftung</strong>sausschluss für rechtswidrige Absichto<strong>der</strong> grobe Fahrlässigkeit ist nichtig (Art. 100 OR). H<strong>in</strong>gegenkann die <strong>Haftung</strong> für Hilfspersonen vollständig wegbedungen werden(Art. 101 Abs. 2 OR). In Ausnahmefällen kann aber e<strong>in</strong> schwerwiegendesVerschulden des Geschäftsherrn h<strong>in</strong>sichtlich Auswahl, Instruktionund Überwachung <strong>der</strong> Hilfsperson zu e<strong>in</strong>er <strong>Haftung</strong> aus unerlaubterHandlung führen.32
Produktehaftung• Auch e<strong>in</strong> zum voraus erklärter Verzicht auf <strong>Haftung</strong> für leichtesVerschulden kann nach Ermessen des Richters als nichtig betrachtetwerden, wenn die Verantwortlichkeit aus dem Betrieb e<strong>in</strong>es ‚obrigkeitlichkonzessionierten Gewerbes’ folgt (Art. 100 Abs. 2 OR). Im <strong>IT</strong>-Bereich können <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Telekommunikationsleistungen auf obrigkeitlicheKonzessionen basieren.• In Ausnahmefällen kann e<strong>in</strong> <strong>Haftung</strong>sverzicht als sittenwidrig ersche<strong>in</strong>enund aus diesem Grund ebenfalls als nichtig betrachtet werden. Nach<strong>der</strong> wohl herrschenden Lehre kann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e das Ausnützen e<strong>in</strong>erMonopolstellung zur Durchsetzung <strong>von</strong> <strong>Haftung</strong>sfreizeichnungen unzulässigse<strong>in</strong>. Allerd<strong>in</strong>gs gibt es bisher noch kaum Gerichtsentscheidezu dieser Frage.• E<strong>in</strong>e Beschränkung <strong>von</strong> Ansprüchen aus dem Produktehaftungsgesetzist nichtig (Art. 8 PrHG).Nach Schadense<strong>in</strong>tritt kann <strong>der</strong> Geschädigte <strong>in</strong> jedem Fall auf die Geltendmachungse<strong>in</strong>er <strong>Haftung</strong>sansprüchen verzichten.Indirekt kann die Durchsetzung <strong>von</strong> <strong>Haftung</strong>sansprüchen auch über vertraglicheRegeln zur Beweislastverteilung und Schadensberechnung bee<strong>in</strong>flusstwerden.Umfassen generelle <strong>Haftung</strong>sausschlüsse (Freizeichnungsklauseln) <strong>in</strong><strong>IT</strong>-Verträgen auch ausservertragliche Ansprüche? Dies ist letztlich durchAuslegung des konkreten Vertrages zu ermitteln. Im Zweifel ist wohl da<strong>von</strong>auszugehen, dass ausservertragliche Ansprüche – soweit gesetzlichüberhaupt zulässig – <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em <strong>Haftung</strong>sausschluss mit umfasst werden(vgl. dazu BGE 107 II 161, E. 8, offen gelassen allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> BGE111 II 471).8 ErgebnisseBisher gibt es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz ke<strong>in</strong>e Gerichtsentscheidungen zur ausservertraglichen<strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> Zusammenhang mit ungenügen<strong>der</strong>Sicherheit ihrer Produkte und Dienstleistungen. Trotzdem gibt es Konstel-33
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizlationen, <strong>in</strong> welchen solche Ansprüche praktische Bedeutung erlangen können.Zu denken ist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e an Sach- und Personenschäden durchFehlfunktion <strong>von</strong> softwaregesteuerten Geräten und Anlagen. Bisher ungeklärtist h<strong>in</strong>gegen die Frage, <strong>in</strong> welchem Mass Datenverlust zu ausservertraglichenAnsprüchen führt (Verletzung eigentumsähnlicher Rechte o<strong>der</strong>blosse Vermögensschäden?).<strong>Ausservertragliche</strong> Ansprüche s<strong>in</strong>d vor allem relevant, wenn zwischen <strong>IT</strong>-Anbieter und Geschädigtem ke<strong>in</strong> Vertragsverhältnis bestehet o<strong>der</strong> vertraglicheAnsprüche durch Verzicht, Verjährung o<strong>der</strong> Verwirkung untergegangens<strong>in</strong>d. Zudem s<strong>in</strong>d vertragliche <strong>Haftung</strong>sbeschränkungen gegenüberausservertraglichen Ansprüchen nur <strong>in</strong>nerhalb gewisser Grenzen möglich(z.B. ke<strong>in</strong> Ausschluss <strong>von</strong> Produktehaftungsansprüchen).Die <strong>in</strong>formatiktypische Unvermeidbarkeit <strong>von</strong> Fehlern <strong>in</strong> S<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Technikführt nicht zu e<strong>in</strong>er Befreiung des Herstellers <strong>von</strong> <strong>der</strong> Produktehaftung.Wenn fehlerhafte <strong>IT</strong>-Produkte zu Personenschäden führen, wird die <strong>Haftung</strong>aus unerlaubter Handlung/Geschäftsherrenhaftung daher weitgehenddurch das Produktehaftungsrecht verdrängt. Es ist allerd<strong>in</strong>gs denkbar,dass aus den generellen Sorgfaltspflichten <strong>von</strong> Art. 55 OR <strong>in</strong> Zukunft auch<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz e<strong>in</strong>e Pflicht zur Beobachtung und zum Rückruf bereits <strong>in</strong>Verkehr gebrachter Produkte, welche sich nachträglich als gefährlich erweisen,abgeleitet werden könnte.Bisher ungeklärt ist die Frage, ob Informationssysteme, welche falscheInformationen generieren (z.B. unrichtige mediz<strong>in</strong>ische Daten) unter dieProduktehaftung fallen. Bei spezifischen <strong>IT</strong>-Sicherheitsprodukten wie Firewallsmuss im E<strong>in</strong>zelfall geprüft werden, gegenüber welchen Angriffstechniken<strong>von</strong> ihnen Sicherheit erwartet werden darf und <strong>in</strong>wieweit sieLücken <strong>in</strong> den übrigen Teilen <strong>der</strong> Sicherheitsarchitektur e<strong>in</strong>es Informationssystemskompensieren müssen.34
ProduktehaftungH<strong>in</strong>weise auf weiterführende LiteraturSCHWEIZBREHM ROLAND, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Kommentar zuArt. 41-61 OR, <strong>in</strong>: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, TeilbandVI/1/3/1, Bern 1998; BÜHLER ROLAND, Produktehaftung für Software, <strong>in</strong>: Software-Schutz Software-<strong>Haftung</strong>, Zürich 1992, S. 92 ff., und <strong>der</strong>s., Def<strong>in</strong>ition des Produktfehlersim Produktehaftpflichtgesetz, AJP 1993, S. 1425 ff.; DESCHENAUXHENRI/TERCIER PIERRE, La responsabilité civile, 2. A., Bern 1982; FELLMANNWALTER, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz, <strong>in</strong>: Kommentar zum schweizerischenPrivatrecht, Obligationenrecht I, 2. A., Basel/Frankfurt a. M. 1996; FELLMANNWALTER/VON BÜREN-VON MOOS GABRIELLE, Grundriss <strong>der</strong> Produkte-Haftpflicht,Bern 1993; HESS HANS-JOACHIM, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz, 2. A.,Bern 1996; HILTY RETO M., Produktehaftpflicht und Lizenzverträge, JKR 2000,S. 74 ff.; HOLLIGER-HAGMANN EUGÉNIE, Management <strong>der</strong> Produkthaftpflicht, Zürich2001; OFTINGER KARL/STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I,5. A., Zürich 1995, Band II/1, 4. A., Zürich 1987; HONSELL HEINRICH, SchweizerischesHaftpflichtrecht, 2. A., Zürich 1996; KELLER ALFRED, Haftpflicht im Privatrecht,Band I, 6. A., Bern 2001, Band II, 2. A. 1998; MORSCHER LUKAS, Software-Überlassungnach Schweizer Recht; Urheberrecht, Gewährleistungspflichten, Produkthaftung,CR 1999, S. 262; ROBERTO V<strong>IT</strong>O, Produktehaftpflicht und Software, JKR 2000,S. 56 ff.; <strong>der</strong>s., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002; STOESSEL GERHARD,<strong>Haftung</strong> des Lizenzgebers nach Produktehaftpflichtrecht, SVZ 1999, S. 70 ff.;SCHNYDER ANTON K., Art. 51-59 OR, <strong>in</strong>: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,Obligationenrecht I, 2. A., Basel/Frankfurt a. M. 1996; STRAUB WOLFGANG,Produktehaftung für Informationstechnologiefehler, Zürich 2002; WEBER ROLF H., Informatikund Jahr 2000, Risiken und Vorsorgemöglichkeiten aus rechtlicher Sicht, Zürich1998EUROPÄISCHE UNIONBARTSCH MICHAEL, Computerviren und Produkthaftung, CR 2000, S. 721 ff.; BAUERAXEL, Produkthaftung für Software nach geltendem und künftigem deutschen Recht,PHI 1992, S. 38 ff. und 98 ff.; CAHN ANDREAS, Produkthaftung für verkörperte geistigeLeistungen, NJW 1996, S. 2899 ff., <strong>der</strong>s.; Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,Band 5, 3. A., München 1997; GÜNTHER ANDREAS, Produkthaftung für Informationsgüter;Verlagserzeugnisse, Software und Multimedia im deutschen und USamerikanischenProdukthaftungsrecht, Köln 2001, zugl. Diss. München 2000;HEYMANN THOMAS, <strong>Haftung</strong> des Softwareimporteurs, CR 1990, S. 176 ff.; HOERENTHOMAS, Produkthaftung für Software – zugleich e<strong>in</strong>e kritische Erwi<strong>der</strong>ung auf Bauer,35
<strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> <strong>von</strong> <strong>IT</strong>-<strong>Anbietern</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> SchweizPHI 1989, S. 138 ff.; KARDASIADOU ZOI, Die Produkthaftung für fehlerhafte mediz<strong>in</strong>ischeExpertensysteme, Baden-Baden 1998; KORT MICHAEL, Produkteigenschaft mediz<strong>in</strong>ischerSoftware, E<strong>in</strong>ordnung im deutschen und US-amerikanischen Produkthaftungsrecht,CR 1990, S. 171 ff.; KULLMANN HANS JOSEF/PFISTER BERNHARD, Produzentenhaftung,Loseblattsammlung, Berl<strong>in</strong> 1980 ff.; KURBOS RAINER, Computerausfall –wer zahlt? Wien/Frankfurt 1999; LEHMANN MICHAEL, Produzenten- und Produkthaftungfür Soft- und Hardware, <strong>in</strong>: Michael Lehmann (Hrsg.), Rechtsschutz und Verwertung<strong>von</strong> Computerprogrammen, 2. A., Köln 1993, S. 999 ff.; <strong>der</strong>s., Produkt- und Produzentenhaftungfür Software, NJW 1992, S. 1721 ff.; LLOYD IAN J., InformationTechnology Law, 3. A., London/Ed<strong>in</strong>burgh/Dubl<strong>in</strong> 2000; MEIER KLAUS/ANDREASWEHLAU, Produzentenhaftung des Softwareherstellers, § 823 Abs. 1 BGB und das Produkthaftungsgesetz,CR 1990, S. 95 ff.; MUSULAS GIORGOS, Die <strong>Haftung</strong> des Softwareherstellersim H<strong>in</strong>blick auf das ProdHaftG, Diss. Berl<strong>in</strong> 1990; OECHSLER JÜRGEN,Produktehaftungsgesetz, <strong>in</strong>: J. <strong>von</strong> Staud<strong>in</strong>gers Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuchmit E<strong>in</strong>führungsgesetzen und Nebengesetzen, 13. Bearbeitung, Berl<strong>in</strong> 1998;ROLLAND WALTER, Produkthaftungsrecht, Kommentar, Köln 1990; SCHMIDT-SALZERJOACHIM, Kommentar EG-Richtl<strong>in</strong>ie Produkthaftung, Band 1, 2. A., Heidelberg 1988;SPINDLER GERALD, <strong>Haftung</strong>srecht, <strong>in</strong>: Thomas Hoeren/Ulrich Sieber (Hrsg.), Handbuchdes Multimediarechts (Loseblatt), München 1999, Teil 29; TASCHNER HANSCLAUDIUS/FRIETSCH EDWIN, Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtl<strong>in</strong>ie,2. A., München 1990; TAEGER JÜRGEN, <strong>Ausservertragliche</strong> <strong>Haftung</strong> für fehlerhafteComputerprogramme, Tüb<strong>in</strong>gen 1995; <strong>der</strong>s., Produkt- und Produzentenhaftung beiSchäden durch fehlerhafte Computerprogramme, CR 1996, S. 257 ff.; THÖMEL JENS-ARNE, Datenbankverträge: Rechtsnatur und <strong>Haftung</strong> für fehlerhafte Information, Frankfurta. M. 2002, zugl. Diss Frankfurt a. M. 2001; VON WESTPHALEN FRIEDRICH, ProdukthaftungshandbuchBand 2, 2. A., München 1999.36