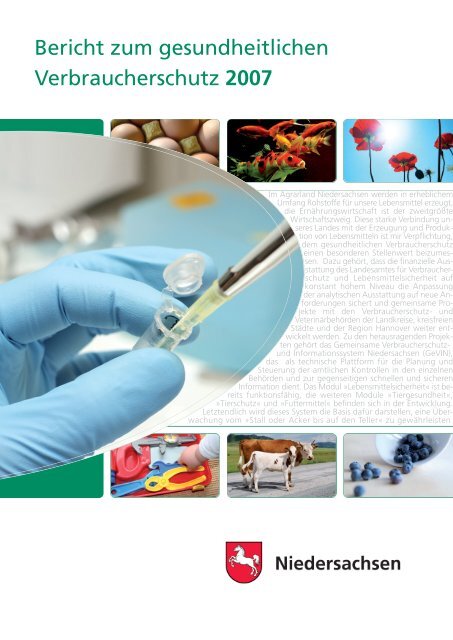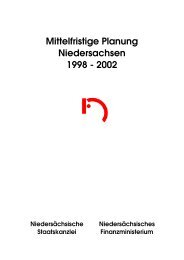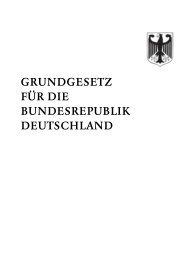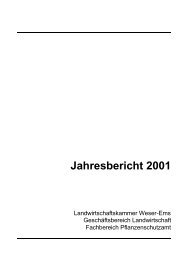3. Verbraucherschutz und Tiergesundheit - Niedersachsen
3. Verbraucherschutz und Tiergesundheit - Niedersachsen
3. Verbraucherschutz und Tiergesundheit - Niedersachsen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bericht zum ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> 2007<br />
Im Agrarland <strong>Niedersachsen</strong> werden in erheblichem<br />
Umfang Rohstoffe für unsere Lebensmittel erzeugt,<br />
die Ernährungswirtschaft ist der zweitgrößte<br />
Wirtschaftszweig. Diese starke Verbindung unseres<br />
Landes mit der Erzeugung <strong>und</strong> Produktion<br />
von Lebensmitteln ist mir Verpflichtung,<br />
dem ges<strong>und</strong>heitlichen Verbrau cher schutz<br />
einen besonderen Stellenwert beizumessen.<br />
Dazu gehört, dass die finanzielle Ausstattung<br />
des Landesamtes für Ver braucherschutz<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit auf<br />
konstant hohem Niveau die Anpassung<br />
der analytischen Ausstattung auf neue Anforderungen<br />
sichert <strong>und</strong> gemeinsame Projekte<br />
mit den <strong>Verbraucherschutz</strong>- <strong>und</strong><br />
Veterinärbehörden der Landkreise, kreisfreien<br />
Städte <strong>und</strong> der Region Hannover weiter entwickelt<br />
werden. Zu den herausragenden Projekten<br />
gehört das Gemeinsame Ver braucherschutz<strong>und</strong><br />
Informationssystem <strong>Niedersachsen</strong> (GeVIN),<br />
das als technische Plattform für die Planung <strong>und</strong><br />
Steuerung der amtlichen Kontrollen in den einzelnen<br />
Behörden <strong>und</strong> zur gegenseitigen schnellen <strong>und</strong> sicheren<br />
Information dient. Das Modul »Lebensmittelsicherheit« ist bereits<br />
funktionsfähig, die weiteren Module »Tierges<strong>und</strong>heit«,<br />
»Tierschutz« <strong>und</strong> »Futtermittel« befinden sich in der Entwicklung.<br />
Letztendlich wird dieses System die Basis dafür darstellen, eine Überwachung<br />
vom »Stall oder Acker bis auf den Teller« zu gewährleisten
Liebe Leserinnen<br />
<strong>und</strong> Leser!<br />
Mit dem ersten Bericht zum ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
in <strong>Niedersachsen</strong> wird ein schon in den vergangenen Jahren entwickelter<br />
Ansatz zu einer umfassenden Information der Bürger innen<br />
<strong>und</strong> Bürger über alle Themenbereiche des ges<strong>und</strong>heitlich en<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>es weiterentwickelt. Dieses Dokument wurde<br />
von den für die Durchführung amtlicher Kontrollen vor Ort zu -<br />
ständigen kommunalen Veterinär- <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> ämtern<br />
<strong>und</strong> dem Landesamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Le bens mittel si -<br />
cherheit (LAVES) in Zusammenarbeit mit dem Mi nis te rium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft, <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landes ent wicklung<br />
erstellt.<br />
Mit diesem Bericht möchten wir Transparenz über die Tätig kei -<br />
ten der niedersächsischen Behörden auf dem Gebiet der Lebensmittel-<br />
<strong>und</strong> Futtermittelsicherheit herstellen. Zudem sollen die Informationen<br />
Ihnen als Verbraucherinnen <strong>und</strong> Verbraucher da bei<br />
helfen, eine bewusste <strong>und</strong> selbstbestimmte Auswahl aus dem<br />
vielfältigen Lebensmittelangebot zu treffen.<br />
Der Bericht enthält eine Auswahl der in den Behörden verfügbar<br />
en Informationen. Wer zu den dargestellten Themen weitergehende<br />
Informationen wünscht, sollte in dem Bericht den Hin -<br />
weisen auf die Internetseiten des LAVES mit den ausführlichen<br />
Daten zu den Themen folgen.<br />
Der Bericht zum ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> in Nieder -<br />
sachsen soll sich an den Wünschen <strong>und</strong> Informationsbe dürfnis sen<br />
seiner Leserinnen <strong>und</strong> Leser weiterentwickeln.<br />
Auf Ihre Anregungen <strong>und</strong> Vorschläge sind wir sehr gespannt.<br />
Minister Hans-Heinrich Ehlen<br />
Niedersächsisches Ministerium für<br />
Ernährung, Landwirtschaft, Ver -<br />
braucher schutz <strong>und</strong> Landesent -<br />
wick lung<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Präsident des Niedersächsischen<br />
Landesamtes für Verbraucher -<br />
schutz <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
Klaus Wiswe<br />
Vorsitzender des Nieder sächsi -<br />
schen Landkreistages, Landrat<br />
des Land kreises Celle<br />
Ulrich Mädge<br />
Präsident des Niedersächsischen<br />
Städtetages, Oberbürgermeister<br />
der Hansestadt Lüneburg<br />
Vorwort<br />
Vorwort
2<br />
1. Einführung 10<br />
1.1 Der ges<strong>und</strong>heitliche <strong>Verbraucherschutz</strong> in <strong>Niedersachsen</strong> 10<br />
1.2 Das Landesamt 12<br />
1.3 Kommunale Veterinärbehörden sorgen für verlässlichen<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> vor Ort 13<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation 14<br />
2.1 Übersicht 14<br />
2.2 Das LAVES 15<br />
2.3 Was macht eine kommunale <strong>Verbraucherschutz</strong>behörde? 19<br />
2.4 Neue Wege geht das Land – Qualitätsmanagement in der<br />
öffentlichen Verwaltung 21<br />
2.5 Gemeinsames <strong>Verbraucherschutz</strong>informationssystem<br />
<strong>Niedersachsen</strong> (GeViN) 24
<strong>3.</strong> Ausgewählte Ergebnisse im <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>und</strong> in der Tierges<strong>und</strong>heit 26<br />
<strong>3.</strong>1 Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung 26<br />
Fleisch- <strong>und</strong> Fleischerzeugnisse 26<br />
Kochpökelerzeugnisse vom Geflügel 26<br />
Kochschinken <strong>und</strong> ähnliche Kochpökel-Erzeugnisse – was erwartet der Verbraucher<br />
<strong>und</strong> was bekommt er tatsächlich? 27<br />
Separatorenfleisch – wie sieht es mit der Kennzeichnung aus? 28<br />
Unerlaubte Wasserzusätze in Geflügelfleischerzeugnissen 29<br />
Konserven aus handwerklicher Herstellung: Kesselkonserve oder Vollkonserve? 30<br />
Untersuchung von Wurst <strong>und</strong> Fleischerzeugnissen auf Fremdeiweiß <strong>und</strong> Allergene 31<br />
Sarkosporidien in Thüringer Mett als Auslöser einer Gruppenerkrankung 32<br />
Hygienesituation bei der Fleischgewinnung 34<br />
Negative Vorgänge im Fleischhandel 35<br />
Zusammenarbeit mit dem Fleischerverband <strong>Niedersachsen</strong>-Bremen<br />
bei der Zulassung von Betrieben 36<br />
Betriebe im EG-Zulassungsverfahren 37<br />
Fische <strong>und</strong> Meerestiere 38<br />
Perfluorierte Tenside (PFT) in Fischen 38<br />
PSP-Toxine in Muschelkonserven 39<br />
»Fisch-Döner«, »Kaviarcreme«, »Tintenfischringe«: Fallberichte zur<br />
Verbrauchertäuschung <strong>und</strong> zur Beurteilung unbekannter Risiken 40<br />
Matjes – ein Genuß für Schwangere? 42<br />
Angebrochene Thunfischdosen – ein Risiko? 43<br />
Milch <strong>und</strong> Milcherzeugnisse 44<br />
Ist bei Milch, Milcherzeugnissen, Butter <strong>und</strong> Käse »Alles in Butter«? 44<br />
Milch im Fokus der Lebensmittelüberwachung 48<br />
Eier 50<br />
Eier auf neuen Wegen 50<br />
3
4<br />
Getreideerzeugnisse 52<br />
Frisch auf den Tisch? Untersuchungen zur mikrobiologischen Qualität frischer Teigwaren 52<br />
Morphin in Mohnsamen <strong>und</strong> Mohngebäck 54<br />
Mikrobiologischer Status von Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung 56<br />
Würzmittel 58<br />
Untersuchung auf Zusatzstoffe mit allergenem Potential, Kontaminanten, Mykotoxine,<br />
nicht zugelassene Farbstoffe <strong>und</strong> gentechnisch veränderte Organismen 58<br />
Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstriche 60<br />
Erzeugnisse von Direktvermarktern 60<br />
Prüfung von Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstrichen auf Trägerstoffe <strong>und</strong> Lactone als<br />
Nachweis für eine Aromatisierung 62<br />
Honig 63<br />
Heidehonig, ein Erzeugnis von regionaler Bedeutung 63<br />
Süßwaren, Desserts 64<br />
Speiseeis aus Eisdielen 64<br />
Vitaminzusätze bei Bonbons <strong>und</strong> Weingummi 66<br />
Nahrungsergänzungsmittel 67<br />
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 67<br />
Getränke/Wasser 68<br />
Wie hygienisch sind Watercooler? 69<br />
Untersuchung von weißem Rum aus Anbruchflaschen in Gaststätten 70<br />
Konservierungsstoffe in alkoholfreien Getränken – Trends, Abbau <strong>und</strong> Verstöße 71<br />
Tees mit Zusatznutzen 73
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>3.</strong>2 Spezielle Untersuchungen 74<br />
Pestizide 74<br />
Pestizidergebnisse in Strauchbeerenobst 74<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände <strong>und</strong> Rückstände an Schwermetallen in Kulturpilzen 76<br />
Dioxine 78<br />
Verhältnis von Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB in verschiedenen Lebensmitteln 78<br />
Mykotoxine 80<br />
Neue Untersuchungen zu Schimmelpilzgiften (Mykotoxine) 80<br />
Reaktionsprodukte 83<br />
Trans-Fettsäuren in pflanzlichen Lebensmitteln 83<br />
Gentechnische Veränderungen 85<br />
Gentechnisch veränderte Organismen <strong>und</strong> ihre Produkte in Lebensmitteln: Verbreitung<br />
in sojahaltigen Lebensmitteln 85<br />
Weitere spezielle Untersuchungen 86<br />
Niedersächsische Erzeuger erfolgreich bei der Reduzierung von Cumarin in Lebensmitteln 86<br />
<strong>3.</strong>3 Bedarfsgegenstände <strong>und</strong> Kosmetika 88<br />
Bedarfsgegenstände 88<br />
Chrom(VI) in Lederhandschuhen 88<br />
Sind Spielwaren aus China schlechter als andere? 89<br />
Bleihaltiger Schmuck für Kinder 90<br />
Kosmetika 91<br />
Diethylenglykol (DEG) in Zahncreme 91<br />
<strong>3.</strong>4 Futtermittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung 92<br />
Melamin – kein Problem für Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel in <strong>Niedersachsen</strong> 92<br />
Kokzidiostatika in Futtermitteln für Nichtzieltierarten – Forderung nach<br />
einheitlichen Bewertungsmaßstäben 94<br />
5
6<br />
<strong>3.</strong>5 Tierges<strong>und</strong>heit 96<br />
Oleander, eine schöne, aber gefährliche Pflanze! – Oleander-Vergiftung beim Bison 96<br />
Tierseuchen <strong>und</strong> Tierkrankheiten 98<br />
Entwicklung der Blauzungenkrankheit in <strong>Niedersachsen</strong> 98<br />
Tierseuchenübungen in <strong>Niedersachsen</strong> – erste Übung im Mobilen Bekämpfungszentrum (MBZ) 100<br />
Zunehmende Bedeutung der molekularbiologischen Diagnostik am Beispiel der<br />
Koi-Herpesvirus-PCR 102<br />
Vektoren-Tierseuchen auf dem Vormarsch? Ausbrüche von Infektiöser Anämie<br />
der Einhufer in Deutschland 104<br />
Die Welt zu Gast in Oldenburg – ein internationaler Geflügelpest-Workshop 105<br />
Die Entwicklung der Fischbestände in der Oberweser vor dem Hintergr<strong>und</strong> der<br />
Belastungen mit Kaliendlaugen 106<br />
B<strong>und</strong>esweites Bienenmonitoring liefert Erkenntnisse zu den Ursachen von<br />
Bienenvölkerverlusten 108<br />
Zoonosen 109<br />
Umsetzung der Zoonosenverordnung <strong>und</strong> Zoonosenbekämpfung in der Primärproduktion<br />
zur Verbesserung des ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong>es 109<br />
Resistenzprüfungen im Mikrodilutionsverfahren – Ergebnisse <strong>und</strong> Resistenzentwicklung 2007 112<br />
Tularämie – eine vergessene Zoonose 118<br />
Salmonellenerkrankungen in Krankenhäusern 119<br />
Tierschutz 120<br />
Ist der Betrieb von Angelteichen mit dem Tierschutz zu vereinbaren? 120<br />
Zur Verwendung von Elektroreizgeräten beim H<strong>und</strong> 122<br />
Schadstoffunfall in der Nordsee – Umgang mit verölten Seevögeln 124<br />
Pilotprojekt zur Broilerhaltung ist abgeschlossen – erste Empfehlung zur Erhaltung der<br />
Fußballenges<strong>und</strong>heit von Masthühnern vorgelegt 126<br />
Tierversuche 127
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>3.</strong>6 Weitere Themen 128<br />
Forschungsprojekte <strong>und</strong> -kooperationen im Bereich ges<strong>und</strong>heitlicher<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> in <strong>Niedersachsen</strong> 128<br />
Forschungsprojekt des B<strong>und</strong>esministeriums/B<strong>und</strong>esinstitutes für Risikobewertung<br />
im LAVES Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse Cuxhaven abgeschlossen 130<br />
Tätigkeiten eines Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsamtes bei Lebensmittel-<br />
<strong>und</strong> Tierexporten in Drittländer 132<br />
Alle Jahre wieder: Lebensmittelüberwachung auf Weihnachtsmärkten 133<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> Tätigkeiten im<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> 134<br />
4.1 Lebensmitteluntersuchung 134<br />
Fische <strong>und</strong> Meerestiere 135<br />
Eier 138<br />
Fette <strong>und</strong> Öle 138<br />
Suppen <strong>und</strong> Soßen 139<br />
Mayonnaisen <strong>und</strong> emulgierte Soßen 139<br />
Getreide <strong>und</strong> Getreideerzeugnisse 140<br />
Nüsse <strong>und</strong> Ölsamen 144<br />
Obsterzeugnisse 145<br />
Honig, Imkereierzeugnisse <strong>und</strong> süße Brotaufstriche 146<br />
Fertiggerichte, zubereitete Speisen 148<br />
Nahrungsergänzungsmittel 149<br />
Säuglingsnahrung 150<br />
Getränke/Wasser 151<br />
7
8<br />
4.2 Spezielle Untersuchungen 155<br />
Pestizide 155<br />
Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB 157<br />
Gentechnische Veränderungen 157<br />
Sonstige 159<br />
Tierartbestimmung 159<br />
Lebensmittelbestrahlung 160<br />
Authentizitätsanalyse 161<br />
Mikrobiologische Untersuchungen 163<br />
4.3 Marktüberwachung 166<br />
Vieh <strong>und</strong> Fleisch 166<br />
Geflügel 166<br />
Eier 167<br />
Obst, Gemüse <strong>und</strong> Kartoffeln 168<br />
Medienüberwachung 168<br />
4.4 Lebensmittelüberwachung 169<br />
EU-Zulassungen 169<br />
Genehmigungen, Anerkennungen <strong>und</strong> amtliche Beobachtungen 169<br />
Schnellwarnsystem 170<br />
4.5 Tierarzneimittelüberwachung 170
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
4.6 Bedarfsgegenstände <strong>und</strong> Kosmetika 171<br />
Bedarfsgegenstände 171<br />
Kosmetika 172<br />
4.7 Futtermittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung 173<br />
Aufgaben der Futtermittelüberwachung 173<br />
Aufgaben der Futtermitteluntersuchung 174<br />
Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB 179<br />
Gentechnische Veränderungen 179<br />
4.8 Tierges<strong>und</strong>heit 180<br />
Überwachung, Tierschutz <strong>und</strong> Tierseuchenbekämpfung 180<br />
Tierseuchen <strong>und</strong> Tierkrankheiten 183<br />
Zoonosen 200<br />
Hygieneproben – Betriebshygiene 201<br />
Bakteriologische Fleischuntersuchung 207<br />
Rückstandsuntersuchung 207<br />
5. Fotoverzeichnis 210<br />
6. Adressen 214<br />
9
10<br />
1. Einführung<br />
1.1 Der ges<strong>und</strong>heitliche <strong>Verbraucherschutz</strong> in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Im Agrarland <strong>Niedersachsen</strong> werden in erheblichem Umfang Roh -<br />
stoffe für unsere Lebensmittel erzeugt, die Ernährungswirtschaft<br />
ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig. Diese starke Verbindung<br />
unseres Landes mit der Erzeugung <strong>und</strong> Produktion von Lebens -<br />
mit teln ist mir Verpflichtung, dem ges<strong>und</strong>heitlichen Verbraucher -<br />
schutz einen besonderen Stellenwert beizumessen.<br />
Dazu gehört, dass die finanzielle Ausstattung des Landesamtes<br />
für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit auf konstant<br />
hohem Niveau die Anpassung der analytischen Ausstattung auf<br />
neue Anforderungen sichert <strong>und</strong> gemeinsame Projekte mit den<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>- <strong>und</strong> Veterinärbehörden der Landkreise, kreisfreien<br />
Städte <strong>und</strong> der Region Hannover weiter entwickelt werden.<br />
Zu den herausragenden Projekten gehört das Gemeinsame Ver -<br />
braucherschutz- <strong>und</strong> Informationssystem <strong>Niedersachsen</strong> (GeVIN),<br />
das als technische Plattform für die Planung <strong>und</strong> Steuerung der<br />
amtlichen Kontrollen in den einzelnen Behörden <strong>und</strong> zur gegenseitigen<br />
schnellen <strong>und</strong> sicheren Information dient. Das Modul<br />
»Lebensmittelsicherheit« ist bereits funktionsfähig, die weiteren<br />
Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird im folgenden Text<br />
nur die männliche Form verwendet. Dies schließt die weibliche Form<br />
mit ein.<br />
Module »Tierges<strong>und</strong>heit«, »Tierschutz« <strong>und</strong> »Futtermittel« be -<br />
finden sich in der Entwicklung. Letztendlich wird dieses System<br />
die Basis dafür darstellen, eine Überwachung vom »Stall oder<br />
Acker bis auf den Teller« zu gewährleisten.<br />
Die Einführung eines gemeinsamen Qualitätsmanagementsystems<br />
für alle am ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> beteiligten Be -<br />
hörden in <strong>Niedersachsen</strong> ist das zweite große gemeinsame Pro -<br />
jekt, das in den zurückliegenden zwei Jahren so weit entwickelt<br />
werden konnte, dass fast alle Behörden ein erstes Audit absolviert<br />
haben.<br />
Damit konnten wichtige Gr<strong>und</strong>lagen für einen einheitlichen <strong>und</strong><br />
wirkungsvollen ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> in den zu -<br />
stän digen Behörden gelegt werden.<br />
Aber auch diese Maßnahmen werden nicht garantieren, dass<br />
künftig keine »Lebensmittelskandale« die Öffentlichkeit erschüttern.<br />
Da das Agrarland <strong>Niedersachsen</strong> eine starke Verbindung mit der Er zeu-<br />
gung <strong>und</strong> Produktion von Lebensmitteln hat, ist dem ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Ver braucherschutz ein besonderer Stellenwert beizumessen
Zum einen kann kein Überwachungssystem kriminelle Machen -<br />
schaften zu 100% verhindern: ein gutes System sollte mögliche<br />
Betrüger aber abschrecken. Abschreckend wirkt eine hohe Auf -<br />
klä rungsrate <strong>und</strong> anschließende Bestrafung der Verant wortlichen.<br />
Gemessen an diesen Kriterien sind die <strong>Verbraucherschutz</strong>- <strong>und</strong><br />
Veterinärbehörden außerordentlich erfolgreich.<br />
Die sorgfältige Aufklärung des Sachverhaltes <strong>und</strong> die Veran las -<br />
sung angemessener Maßnahmen führt in den meisten Fällen am<br />
schnellsten <strong>und</strong> nachhaltig zu einer Verbesserung der Lebensmittelsicherheit.<br />
Die redlichen <strong>und</strong> verantwortungsbewussten Lebensmittelunternehmer<br />
arbeiten mit dem Ziel, uns mit sicheren Lebensmitteln<br />
zu versorgen.<br />
Unsere demokratische Gesellschaft wird von mündigen Bürgern<br />
getragen. Bürger können sich als Verbrau cher nur mündig – also<br />
selbstbestimmt – verhalten, wenn sie über die entscheidungsrelevanten<br />
Informationen verfügen. Es ist nicht einzusehen, dass<br />
In for mationen über die Lebensmittelsicherheit ausschließlich von<br />
den Behörden an die Verbraucher vermittelt werden. Ich wünsche<br />
mir, dass Lebensmittelunternehmer sich entscheiden, künf tig dem<br />
Aspekt Lebensmittelsicherheit in der Kommunikation mit den Verbrauchern<br />
größeren Raum zu bieten.<br />
Lebensmittelsicherheit ist ein wissenschaftsbasiertes Themen feld.<br />
Für die Verbraucher ist es schwierig, die öffentlichen Diskus sio nen<br />
der Wissenschaftler zur Risikoein schät z ung zu verfolgen <strong>und</strong> für<br />
sich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Oft ist Ver un si -<br />
cherung die Folge.<br />
1. Einführung<br />
1. Einführung<br />
Ich denke, hier sind die Behörden des ges<strong>und</strong>heitlichen Ver brau -<br />
cherschutzes gefordert, die Verbraucher durch eine intensive In -<br />
formationspolitik zu unterstützen. Unsere Behörden sind neutrale<br />
Einrichtungen, die darauf verpflichtet sind, die Wirtschaft nicht<br />
mehr einzuschränken als zum Ges<strong>und</strong>heits schutz <strong>und</strong> zum Täu -<br />
schungsschutz erforderlich ist, aber die not wendigen Einschrän -<br />
kungen zum Erreichen der beiden Ziele auch konsequent durchsetzen.<br />
Ich wünsche mir, dass dieser Bericht zum ges<strong>und</strong>heitlichen Ver -<br />
braucherschutz in <strong>Niedersachsen</strong> dazu beiträgt, das Vertrauen<br />
der Verbraucher in die Sicherheit unserer Lebensmittel zu festigen.<br />
Ehlen, H. (Minister für Ernährung, Landwirtschaft, <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
<strong>und</strong> Landesentwicklung)<br />
11
12<br />
1.2 Das Landesamt<br />
Mit der Gründung des Landesamtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Le bensmittelsicherheit im Jahr 2001 wurde schon frühzeitig der<br />
auch in der EU-Gesetzgebung verankerte Ansatz einer prozess<strong>und</strong><br />
produktionsstufenübergreifenden Risikoanalyse <strong>und</strong> -be wertung<br />
für alle Angelegenheiten des ges<strong>und</strong>heitlichen Verbrau cher -<br />
schutzes in <strong>Niedersachsen</strong> umgesetzt. Risikobewertung <strong>und</strong> Ri -<br />
sikokommunikation sind deshalb die Aufgabenschwerpunkte des<br />
Landesamtes.<br />
Die Untersuchungsergebnisse für die amtlich entnommenen Pro -<br />
ben zeigen z. B. auf, ob ein Lebensmittel im Hinblick auf seine<br />
Zusammensetzung, die Hygieneindikatoren, die Rückstands- oder<br />
Kontaminantengehalte den rechtlichen Anforderungen entspricht.<br />
Bei festgestellten Abweichungen wird geprüft, ob mit der Ab wei -<br />
chung von der rechtlichen Norm eine Gefahr für die Verbraucher<br />
verb<strong>und</strong>en ist, in welchem Ausmaß die Gefahr tatsächlich eintreten<br />
kann <strong>und</strong> welcher Schaden durch die Gefahr entsteht. Die<br />
Antworten auf diese Fragen werden in der Risikobewertung zu -<br />
sam mengeführt. Aus der Risikobewertung leiten die kommunalen<br />
Überwachungsbehörden die notwendigen Maßnahmen zum<br />
Abstellen der Gefahr ab <strong>und</strong> setzen diese in den Betrieben vor<br />
Ort durch.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> misst der Tierseuchenprophylaxe <strong>und</strong> Tierseu chenbekämpfung<br />
wegen seiner großen Bestände an landwirtschaftlichen<br />
Nutztieren hohe Bedeutung zu. Deshalb wurde die »Task-<br />
Force Veterinärwesen« im Landesamt eingerichtet, die Schu lungs-<br />
Bei Abweichungen in den Untersuchungsergebnissen der amtlich<br />
entnommenen Proben wird geprüft, ob mit der Abweichung eine<br />
Gefährdung des Verbrauchers verb<strong>und</strong>en ist<br />
<strong>und</strong> Fortbildungsmaßnahmen organisiert <strong>und</strong> die Durchführung<br />
vorbeugender Maßnahmen <strong>und</strong> im akuten Seuchenfall auch die<br />
Bekämp fungsmaßnahmen in den Landkreisen <strong>und</strong> kreisfreien<br />
Städten <strong>und</strong> der Region Hannover unterstützt. Die Task-Force<br />
Veterinärwesen betreut auch das Mobile Tierseuchen bekämp -<br />
fungszentrum der B<strong>und</strong>esländer, das in Barme stationiert ist.<br />
Als wissenschaftlich geprägte Einrichtung steht das Landesamt<br />
allen kommunalen Behörden <strong>und</strong> dem Ministerium für Ernäh rung,<br />
Landwirtschaft, <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung in beratender<br />
Funktion zur Verfügung.<br />
Eine wichtige Aufgabe des Landesamtes ist die Information der<br />
Öffentlichkeit in Form von Pressemitteilungen zu aktuellen Fra ge -<br />
stellungen oder mit umfassenden Berichten über die Ergeb nis se<br />
der amtlichen Kontrollen r<strong>und</strong> um die Themen Lebensmittel- <strong>und</strong><br />
Futtermittelsicherheit, Tierges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Tierschutz im Inter net.<br />
Fachspezifische Symposien <strong>und</strong> wissenschaftliche Publikationen<br />
sichern den Austausch mit der Fachöffentlichkeit. Mit einer um -<br />
fangreichen Vortragstätigkeit wird das Angebot der Öffentlich -<br />
keitsarbeit des Landesamtes abger<strong>und</strong>et.<br />
Dr. Haunhorst, E. (Präsident des LAVES)
1.3 Kommunale Veterinärbehörden sorgen für verlässlichen ges<strong>und</strong>heit-<br />
lichen <strong>Verbraucherschutz</strong> vor Ort<br />
Um Verbraucher effektiv vor Gefahren zu schützen, sind die Auf -<br />
gaben der Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> der Veterinärbe hör den<br />
in <strong>Niedersachsen</strong> schon 1978 auf die kom munale Ebene übertragen<br />
worden. Für die Verbraucher sicher heit vor Ort sind daher<br />
heute die Landkreise, die kreisfreien Städte <strong>und</strong> die Region Hannover<br />
zuständig. In einigen Regionen des Landes werden zu ei -<br />
ner effizienten Aufgabenwahrnehmung die Mög lich keiten der<br />
kommunalen Zusammenarbeit genutzt, so dass zurzeit in Nie der -<br />
sachsen 42 kommunale Veterinär- <strong>und</strong> Verbrau cher schutz be hör -<br />
den bestehen.<br />
Diese Ortsnähe der kommunalen Ver braucherschutzbehörden ist<br />
ihre große Stärke: Die genaue Kennt nis der örtlichen Gegeben -<br />
heit en <strong>und</strong> die Besonderheiten der je weiligen Betriebe sowohl bei<br />
der Lebensmittelerzeugung (etwa in Schlachthöfen) als auch bei<br />
der Weiterverarbeitung <strong>und</strong> Zu be reitung von Lebensmitteln (et -<br />
wa in Bäckereien <strong>und</strong> Gaststätten) ermöglichen den Behörden eine<br />
effiziente Überwachung der Ein haltung der vielfältigen Vor -<br />
schriften zum ges<strong>und</strong>heitlichen Ver braucherschutz.<br />
Gerade in einem landwirtschaftlich geprägten Land wie Nieder -<br />
sachsen mit intensiver Tierhaltung <strong>und</strong> Lebens mittelproduktion<br />
ist eine räumlich nah beim Produzenten gelegene Überwa chungs<strong>und</strong><br />
Kontrollbehörde unverzichtbar. Die kommunalen Behörden<br />
verstehen sich dabei nicht nur als Kon trolleure, sondern sind vor<br />
Ort in den Betrieben oftmals auch be ratend tätig <strong>und</strong> leisten täglich<br />
– oft unbemerkt im Hintergr<strong>und</strong> – Überzeugungsarbeit für<br />
den <strong>Verbraucherschutz</strong>. Diese Ortsnä he macht die Verbraucher -<br />
schutzbehörden auch zur Anlaufstelle für Verbraucher, die be -<br />
für chten, verdorbene Lebensmittel genossen zu haben oder die<br />
um Überprüfung von eventuellen Hygiene män geln in einem le -<br />
bensmittelverarbeitenden Betrieb bitten. Auf re lativ überschaubarem<br />
Weg finden Bürger ihre jeweilige Kommunalbehörde mit<br />
kompetenten Ansprechpart nern im <strong>Verbraucherschutz</strong>, die im<br />
Bedarfsfall auch rasch vor Ort sind. Dies ermöglicht bei Gefah -<br />
ren für Verbraucher eine schnelle <strong>und</strong> effektive Reaktion, etwa<br />
durch Beschlagnahmungen oder Ver kaufs verbote.<br />
* Weitere Informationen erhalten Sie im Internetangebot Ihrer<br />
jeweils zuständigen kommunalen Veterinärbehörde. Ein Adressen<br />
verzeichnis aller kommunalen Veterinärbehörden ist hinten<br />
in diesem <strong>Verbraucherschutz</strong>bericht abgedruckt.<br />
Eine räumlich nah beim Produzenten gelegene Überwachungs- <strong>und</strong><br />
Kontrollbehörde ist besonders in einem Land mit intensiver Tier hal -<br />
tung <strong>und</strong> Lebensmittelproduktion unverzichtbar<br />
1. Einführung<br />
1. Einführung<br />
Die große Be deu tung des ortsnahen <strong>Verbraucherschutz</strong>es in Nie -<br />
dersachsen lässt sich auch daran messen, dass bei den kommunalen<br />
Veterinärbe hör den derzeit ca. 1.650 Mitarbeiter beschäftigt<br />
sind, die sich täglich für den Verbrau cher schutz der Bürger<br />
vor Ort einsetzen.*<br />
Dr. Meyer, H. (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied – NLT)<br />
13
14<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2.1 Übersicht<br />
Die Lebensmittel- <strong>und</strong> Veterinärüberwachung ist in Deutschland<br />
Aufgabe der einzelnen B<strong>und</strong>esländer. <strong>Niedersachsen</strong> verfügt seit<br />
2005 über eine zweistufige Struktur. Die Fachaufsicht <strong>und</strong> damit<br />
die Steuerung der Aufgaben der Lebensmittel- <strong>und</strong> Veterinär überwachung<br />
liegt beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft, Verbraucher schutz <strong>und</strong> Landesentwicklung (ML).<br />
Dem ML unterstehen zum Einen das Niedersächsische Lan desamt<br />
für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES) <strong>und</strong><br />
zum Anderen die 42 kommunalen Ämter für Veterinär we sen,<br />
Ver braucherschutz <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachung.<br />
Die kommunalen Überwachungsbehörden überprüfen die für Pro -<br />
duktion <strong>und</strong> Handel verantwortlichen Betriebe im Bereich Lebensmittel,<br />
Kosmetika <strong>und</strong> Bedarfsgegenstände vor Ort, dokumentieren<br />
Ergebnisse <strong>und</strong> entnehmen Proben. Werden Mängel festgestellt,<br />
ergreifen sie entsprechende Maßnahmen <strong>und</strong> leiten ge gebenenfalls<br />
Sanktionen ein.<br />
Das LAVES untersucht <strong>und</strong> beurteilt die von den kommunalen<br />
Le bensmittel- <strong>und</strong> Veterinärbehörden entnommenen Proben in<br />
Abbildung 2.1: Organisation des ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong>es in <strong>Niedersachsen</strong><br />
den zum LAVES gehörenden acht Instituten. Darüber hinaus steht<br />
es den kommunalen Überwachungsbehörden beratend zur Ver -<br />
fügung, arbeitet Konzepte aus <strong>und</strong> koordiniert Projekte.<br />
Das LAVES ist außerdem die zuständige Behörde für die Ertei lung,<br />
das Aussetzen <strong>und</strong> den Entzug von EU-Zulassungen für Be trie be,<br />
die Lebensmittel tierischer Herkunft in den Verkehr bringen wol len,<br />
sowie für die Zulassung <strong>und</strong> Überwachung von Verarbei tungs be -<br />
trieben von nicht zum Verzehr geeigneten tierischen Nebenpro -<br />
dukten.<br />
Im Bereich Futtermittelüberwachung, landwirtschaftliche Markt -<br />
überwachung <strong>und</strong> Tierarzneimittelüberwachung liegt die Auf gabe<br />
der Kontrolle <strong>und</strong> des Vollzugs direkt beim LAVES.<br />
In Krisenfällen übernimmt das Landesamt wesentliche Aufga ben<br />
des Risiko managements.<br />
Horstmann, I.; Dr. Rolfe, B. (Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit)
2.2 Das LAVES<br />
»Die Äpfel riechen nach Chemie«, »Nach Verzehr des Geflügel -<br />
salates wurde mir schlecht« – beim Niedersächsischen Landes amt<br />
für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES) gehen<br />
Proben ein, die Verbraucher bei den kom munalen Veterinär be hörden<br />
abgeben. Diese sogenannten »Be schwerdeproben« machen<br />
jedoch nur einen kleinen Teil der Auf gaben <strong>und</strong> Unter su chungen<br />
im LAVES aus.<br />
Das LAVES ist in <strong>Niedersachsen</strong> die zentrale wissenschaftliche Behörde<br />
für alle Themen des ges<strong>und</strong>heitlichen Verbraucher schutz es.<br />
Auslöser für die Gründung im Jahr 2001 waren Krisen wie BSE.<br />
Sie veranlassten die niedersächsische Landesregierung eine un -<br />
ab hängige Instanz für die Risikobewertung zu schaffen. Dem Landesamt<br />
gehören niedersachsenweit acht Institute <strong>und</strong> fünf Ab -<br />
teilungen an, denen Fachdezernate zugeordnet sind. An der Spitze<br />
des LAVES steht der Präsident. Die r<strong>und</strong> 870 Beschäftigten sind<br />
an den Standorten Oldenburg, Hannover, Lüneburg, Stade, Celle,<br />
Braunschweig <strong>und</strong> Cuxhaven im Einsatz. Sitz der Zentrale ist Oldenburg.<br />
Die Untersuchung sogenannter »Beschwerdeproben«, die vom Ver -<br />
braucher abgegeben werden, stellt nur einen kleinen Teil der Auf -<br />
gaben <strong>und</strong> Untersuchungen des LAVES dar<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
Ges<strong>und</strong>heitsrisiken für Verbraucher frühzeitig zu ermitteln <strong>und</strong><br />
wirksam zu minimieren – mit zuverlässigen Kontrollen <strong>und</strong> Analysemethoden<br />
wird in den verschiedenen In stituten <strong>und</strong> Abtei lun -<br />
gen an diesem Ziel gearbeitet. Die Gr<strong>und</strong> lage der Arbeit bilden<br />
nationale <strong>und</strong> internationale gesetzliche Vorgaben.<br />
Die Aufgaben der Abteilungen <strong>und</strong> Institute im Über blick:<br />
In der Abteilung Lebensmittelsicherheit unterstützt <strong>und</strong> be -<br />
rät das Fachdezernat Lebensmittelüberwachung die zuständigen<br />
kommunalen Behörden in allen Fragen der Überwachung<br />
von Lebensmitteln tierischer <strong>und</strong> nichttierischer Herkunft. Wei tere<br />
Aufgaben sind die Zulassung von Betrieben für die Verarbei tung<br />
von Lebensmitteln tierischer Herkunft nach EU-rechtlichen Vor -<br />
gaben sowie die Anerkennung von Mineralwasserbrunnen. Das<br />
Fachdezernat Lebensmittelkontrolldienst wurde eingerichtet,<br />
um die kommunalen Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
bei der Durchführung <strong>und</strong> Umsetzung der umfang -<br />
reichen rechtlichen Bestimmungen fachlich zu beraten <strong>und</strong> zu<br />
un terstützen. Neben tierischen <strong>und</strong> pflanzlichen Lebensmitteln<br />
15
16<br />
umfasst das auch Bereiche wie Kosmetika, Bedarfsgegen stän de,<br />
gentechnisch veränderte Lebensmittel, Rückstände von Pflan zen -<br />
schutzmitteln oder Kontamination mit Schadstoffen. Die Tier arzneimittelüberwachung<br />
<strong>und</strong> der Rückstandskontrolldienst in -<br />
spi zie ren tierärztliche Hausapotheken darauf, ob die arzneimittelrecht<br />
lichen <strong>und</strong> betäubungsmittelrechtlichen Bestimmungen so -<br />
wie die einschlägigen Vorschriften des Heilmittelwerbegesetzes<br />
eingehalten werden. Eine zentrale Aufgabe des Rückstands kon -<br />
trolldienstes ist die Mitwirkung bei der Erstellung <strong>und</strong> Um setzung<br />
des Nationalen Rückstandskontrollplans.<br />
Tierges<strong>und</strong>heit ist ein weiterer Themenschwerpunkt des LAVES<br />
<strong>und</strong> umfasst die Fachdezernate Tierseuchenbekämpfung <strong>und</strong><br />
Be seitigung tierischer Nebenprodukte, Task-Force Veterinär -<br />
wesen, Tierschutzdienst <strong>und</strong> Binnenfischerei. Essentielle Aufgaben<br />
sind die Prävention <strong>und</strong> die Bekämpfung von Tierseu chen<br />
<strong>und</strong> Schädlingen, die Überwachung von Ausstellungen <strong>und</strong> Märk -<br />
ten mit Tieren, die Zulassung von Verarbeitungsbetrieben von<br />
nicht zum Verzehr geeigneten tierischen Nebenprodukten <strong>und</strong><br />
Aquakulturbetrieben sowie die Genehmigung für das Arbeiten<br />
mit Krankheitserregern in Laboren. Die Dezernate Tierseuchen -<br />
be kämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie Task-<br />
Force Veterinärwesen arbeiten beratend <strong>und</strong> unterstützend für<br />
die kommunalen Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüber wachungs be -<br />
hör den <strong>und</strong> bieten Schulungen für die Anwendung der zentralen<br />
Tierdatenbank HI-Tier <strong>und</strong> der europäischen Datenbank<br />
TRACES (Programm für den Handel mit Tieren, tierischen Er zeugnissen<br />
<strong>und</strong> TSN) an. Der Tierschutzdienst unterstützt die Veteri -<br />
när behörden bei der Durchführung <strong>und</strong> Umsetzung tierschutz-<br />
Die Prävention <strong>und</strong> die Bekämpfung von Tierseuchen ist einer der Auf -<br />
gabenbereiche, der unter den Themenschwerpunkt »Tier ge s<strong>und</strong> heit«<br />
fällt<br />
recht licher Bestimmungen, erstellt Gutachten <strong>und</strong> arbeitet mit<br />
Tier schutzorganisationen zusammen. Der Bereich Binnenfischerei<br />
<strong>und</strong> fischereik<strong>und</strong>licher Dienst war bis Dezember 2007 beim In -<br />
sti tut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse Cuxhaven angesiedelt.<br />
Das Fachdezernat mit Sitz in Hannover kümmert sich um die Belan<br />
ge der Binnen fi sch e rei mit dem Ziel, standorttypische, artenreiche<br />
<strong>und</strong> ausgewoge ne Fischbestände zu erhalten <strong>und</strong> aufzubauen.<br />
Um Tierseuchen schnell <strong>und</strong> wirksam bekämpfen zu können,<br />
wur de Ende 2006 vom LAVES im Auftrag der B<strong>und</strong>esländer das<br />
Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) eingerichtet. Durch sei ne<br />
Containerbauweise ist es im gesamten B<strong>und</strong>esgebiet einsetz bar.<br />
Ne ben der Krisenbewältigung ist es auch für praxisnahe Fort bil -<br />
dung en <strong>und</strong> Übungen geeignet.<br />
Die Aufgaben der Abteilung Futtermittelsicherheit, Markt -<br />
überwachung reichen von der Inspektion der Betriebe über die<br />
Probenahme bis hin zum Vollzug <strong>und</strong> der Beratung. Das De zernat<br />
Futtermittelüberwachung kontrolliert auf allen Ebenen der<br />
Futtermittelherstellung <strong>und</strong> des Handels bis hin zu den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben. Neben der Registrierung <strong>und</strong> Zulassung<br />
von Betrieben gehören Buchprüfung, Beratung <strong>und</strong> insbesondere<br />
Probenahmen zu den Aufgaben. Die Proben werden im LAVESeigenen<br />
Futtermittelinstitut Stade analysiert. Die Markt über wachung<br />
kontrolliert die Einhaltung von rechtlichen Vorgaben in<br />
Bezug auf EU-einheitliche Qualitätsnormen <strong>und</strong> Handelsklassen.<br />
Geprüft werden Kennzeichnungen bei Eiern, Obst, Gemüse <strong>und</strong><br />
Fleisch, die Einhaltung von Mindestbedingungen bei bestimmten<br />
Haltungsformen in der Geflügelmast <strong>und</strong> die Zulassung von Be -
trie ben. Zur Marktüberwachung gehört auch die Medien auf sicht,<br />
in der das LAVES im Wesentlichen die Einhaltung der Impressumspflichten<br />
prüft. Das Fachdezernat Ökologischer Landbau ist<br />
die Kontrollbehörde für den ökologischen Land bau in Nieder sachs<br />
en. Es überwacht die in <strong>Niedersachsen</strong> zugelassenen privaten<br />
Kon trollstellen, die mindestens einmal jährlich die Ökoland be triebe<br />
kontrollieren.<br />
Das LAVES ist außerdem für das Land <strong>Niedersachsen</strong> Kontakt -<br />
stelle für das EU-Schnellwarnsystem für Futtermittel <strong>und</strong> Lebens -<br />
mittel. Eingehende Meldungen werden sondiert <strong>und</strong> den zuständigen<br />
Behörden zugeleitet, ausgehende Meldungen über das<br />
B<strong>und</strong>esamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit der<br />
Europäischen Kommission zugeleitet<br />
Der Abteilung Zentrale Aufgaben gehören fünf Dezernate an.<br />
In den Dezernaten Personal, Organisation, Haushalt, Liegen schaften,<br />
Innerer Dienst <strong>und</strong> Recht werden die klassischen Dienst leis -<br />
tungen der inneren Verwaltung erbracht. Das LAVES wird im<br />
Rah men neuer Steuerungsinstrumente – Controlling, Kosten<strong>und</strong><br />
Leistungsrechnung – geführt.<br />
Im LAVES sind die ehemaligen staatlichen Untersuchungsämter<br />
für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände <strong>und</strong> Veterinär diagnos tik<br />
sowie das Institut für Bienenk<strong>und</strong>e in der Abteilung Unter su -<br />
chungseinrichtungen zusammengefasst worden. Ein hoher An -<br />
teil der Untersuchungen wird in den Veterinärinstituten durch geführt.<br />
Dazu kommen die Bereiche Lebensmittel, kosmetische Mittel<br />
<strong>und</strong> Bedarfsgegenstände (Gegenstände des alltäglichen Le -<br />
bens, wie Geschirr, Verpackungen oder Spielzeug), sowie Fut termittel.<br />
Die Kontrolle der lebensmittelproduzierenden Betriebe erfolgt<br />
in <strong>Niedersachsen</strong> durch die 42 kommunalen Lebensmittel über -<br />
wa chungsbehörden. Sie entnehmen im Be darfsfall Proben, die in<br />
den Lebensmittelinstituten Oldenburg <strong>und</strong> Braunschweig<br />
(LI OL <strong>und</strong> LI BS) analysiert <strong>und</strong> bewertet werden. Im Olden burger<br />
Lebensmittelinstitut werden vorwiegend Fleisch, Wurst waren,<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
Obst, Gemüse, Säuglingsnahrung <strong>und</strong> Süßwaren untersucht;<br />
ei nen besonderen Schwerpunkt bilden hier der Nachweis von<br />
Pflanzen schutzmittelrückständen sowie die Dioxin-Analytik. Das<br />
Braun schweiger Institut ist auf die Untersuchung gentechnisch<br />
veränderter Organismen sowie Schimmelpilzgifte in Lebens mitteln<br />
spezialisiert <strong>und</strong> prüft darüber hinaus Milch, Milcher zeug nisse,<br />
Eier, Getreide, Backwaren, Fette, Getränke <strong>und</strong> Fertiggerichte.<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> fängt auf dem Feld an. Das Futtermittel in -<br />
stitut Stade (FI STD) überprüft, ob die für Nutztiere angebauten<br />
Futtermittel unbedenklich sind. Untersucht wird auf die Ein -<br />
hal tung gesetzlicher Grenzwerte, schädliche Stoffe <strong>und</strong> die hy gi enische<br />
Qualität. Parameter sind unter anderem Stoffe wie Schwermetalle,<br />
Pestizide, Antibiotika <strong>und</strong> unzulässige Pharmaka sowie<br />
gefährliche Bakterien <strong>und</strong> Schimmelpilzgifte.<br />
Aufgabe der Veterinärinstitute Oldenburg <strong>und</strong> Hannover<br />
(VI OL <strong>und</strong> VI H) ist es, das Vorkommen von Tierseuchen <strong>und</strong><br />
-krankheiten frühzeitig zu erkennen. Schwerpunkt der Arbeit ist<br />
dabei die Untersuchung von Blut- <strong>und</strong> Milchproben oder von veren<br />
deten Tieren auf Viren oder Bakterien. Weitere Aufgaben sind<br />
Hygieneuntersuchungen von Schlacht- <strong>und</strong> Zerlegebetrieben, Molkereien<br />
<strong>und</strong> eiverarbeitenden Betrieben, Analysen auf Rück stän -<br />
de von Tierarzneimitteln, verbotenen oder nicht zugelassenen<br />
Stof fen. Das VI H ist ferner schwerpunktmäßig zuständig für Untersuchungen<br />
zur Erkennung von Krankheitserregern <strong>und</strong> Krankheiten<br />
bei Wildtieren. Das VI OL verfügt über besondere Kom -<br />
petenzen für Viruserkrankungen des Geflügels. Die Veteri när in -<br />
stitute befassen sich außerdem mit tierschutzrechtlichen Frage -<br />
stellungen.<br />
Im Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse Cuxhaven<br />
(IFF CUX) werden sämtliche chemischen, parasitologischen <strong>und</strong><br />
molekularbiologischen Analysen bei Fischen <strong>und</strong> Fischwaren aus<br />
ganz <strong>Niedersachsen</strong>, Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven durchgeführt. Das<br />
Institut untersucht zudem erkrankte Seefische <strong>und</strong> Meeres säu ger<br />
wie Wale, Robben <strong>und</strong> Seekühe <strong>und</strong> überwacht niedersachsenweit<br />
die Umweltradioaktivität in Fischereiprodukten. Das IFF CUX<br />
ist Teil des »Fischkompetenzzentrums Nord«.<br />
17
18<br />
Das Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG) un -<br />
tersucht Gegenstände des alltäglichen Lebens, die mit dem Men -<br />
schen direkt oder indirekt, z. B. durch Kontakt mit Lebens mitteln,<br />
in Berührung kommen. Dazu gehören u. a. Geschirr, Spielwaren,<br />
Körperpflegemittel, Kosmetika <strong>und</strong> Verpackungen. Das Unter -<br />
suchungsspektrum ist sehr breit: Textilien werden beispielsweise<br />
auf krebserzeugende, allergieauslösende oder verbotene Stoffe<br />
untersucht; Spielzeug wird darauf hin geprüft, ob es von Kin dern<br />
verschluckt werden kann oder ges<strong>und</strong>heitsschädliche Stoffe wie<br />
Weichmacher, chemische Stoffe oder Schermetalle enthält. Eine<br />
weitere Aufgabe ist die Überwachung von Wasch- <strong>und</strong> Reini -<br />
gungs mitteln für <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Schleswig-Holstein. Die<br />
europäische Gesetzgebung sieht eine Kennzeichnungspflicht für<br />
bestimmte Inhaltsstoffe vor. Das IfB LG kontrolliert, ob wichtige<br />
Produktangaben wie z. B. eingesetzte Duftstoffe mit allergenem<br />
Potential enthalten sind.<br />
Das Institut für Bienenk<strong>und</strong>e Celle (IB CE) ist das Kompe tenzzentrum<br />
für alle Belange der Bienenhaltung sowie angrenzende<br />
Bereiche. Im Institut werden Honige aus dem In- <strong>und</strong> Ausland<br />
auf Reife, Reinheit, Rückstände, Wärme- <strong>und</strong> Lagerschäden <strong>und</strong><br />
korrekte Kennzeichnung hin untersucht. Neben der Diagnostik<br />
von Bienenkrankheiten gehört auch die Zucht leistungsstarker<br />
Königinnen zu den Aufgaben des Institutes, das außerdem um -<br />
fangreich bei der Beratung von Imkern mitwirkt. Das IB CE veranstaltet<br />
regelmäßig Seminare <strong>und</strong> Fortbildungen <strong>und</strong> bildet auch<br />
aus: B<strong>und</strong>esweit ist es die einzige Berufsschule für die Ausbil dung<br />
zum Berufsimker.<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> braucht eine gute Aufklärungsarbeit. Die<br />
Stabsstelle Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit bereitet Fach -<br />
informationen <strong>und</strong> Broschüren für Verbraucher <strong>und</strong> Medien ver-<br />
U. a. sind Fachinformationen <strong>und</strong> Broschüren für Verbraucher <strong>und</strong> Medien<br />
ein wichtiges Bindeglied in der Aufklärungsarbeit des LAVES<br />
ständlich auf <strong>und</strong> schafft so noch mehr Transparenz <strong>und</strong> Sicher -<br />
heit. Medien sind in der Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeit<br />
ein wichtiges Bindeglied. Die Vorbereitung von Pressege sprä chen<br />
<strong>und</strong> Interviews, das Verfassen von Pressemeldungen <strong>und</strong> die Or -<br />
ganisation von Pressekonferenzen gehören zum Tagesgeschäft<br />
der Stabsstelle. Wesentlicher Teil der Arbeit ist die Krisen kom munikation,<br />
die in enger Zusammenarbeit mit dem entsprechenden<br />
Dezernat erfolgt. Weitere Aufgaben sind die Koordinierung <strong>und</strong><br />
Aktualisierung des Internetauftritts, die Teilnahme an Messen, die<br />
Mitarbeit an Symposien sowie die Erstellung des Verbraucher -<br />
schutz berichtes.<br />
Eine wichtige Neuerung für das Jahr 2007 war die erfolgreiche<br />
Einführung des Qualitätsmanagement-Systems EQUINO. Seit De -<br />
zember 2007 ist das LAVES nach der internationalen Norm DIN<br />
ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Stabsstelle Qualitätsmanage -<br />
ment ist ebenso wie die Stabsstelle Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeits -<br />
arbeit direkt dem Präsidenten unterstellt.<br />
Als beratendes Gremium steht dem LAVES der Beirat zur Seite.<br />
20 Vertreter aus der Verbraucherschaft (Ver braucherzentrale,<br />
Landfrauenverband, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, BUND,<br />
NABU, Tierschutzbeirat), der Wirtschaft (Lan desverband Einzel handel,<br />
Institut der Niedersächsischen Wirt schaft, Genossen schafts -<br />
verband etc.) <strong>und</strong> der Wissenschaft (Tech nische Universität Braunschweig,<br />
Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, Georg-Au gust-<br />
Universität Göttingen etc.) wirken bei der Entwicklung der Auf -<br />
gaben des LAVES beratend mit.<br />
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Abteilungen <strong>und</strong><br />
Instituten sind im Internet unter www.laves.niedersachsen.de<br />
zu finden.<br />
Horstmann, I. (Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit)
2.3 Was macht eine kommunale <strong>Verbraucherschutz</strong>behörde?<br />
Die kommunalen <strong>Verbraucherschutz</strong>behörden sind mit den Aufgaben<br />
der Lebensmittel- <strong>und</strong> Bedarfsgegenständeüberwachung<br />
vor Ort betraut. Dabei wird überprüft, ob die vielfältigen europa<strong>und</strong><br />
b<strong>und</strong>esrechtlichen Vorschriften zum Umgang mit Lebens -<br />
mit teln <strong>und</strong> Bedarfsgegenständen (etwa kosmetische Produkte,<br />
Wasch- <strong>und</strong> Pflegemittel) eingehalten werden. Ziel ist es, Käu fer<br />
<strong>und</strong> Konsumenten vor akuten Ges<strong>und</strong>heitsgefahren, vor langfris -<br />
tigen Ges<strong>und</strong>heitsgefährdungen <strong>und</strong> vor Irreführung <strong>und</strong> Täu -<br />
schung zu schützen.<br />
Um diese Ziele des ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong>es zu er -<br />
reichen, werden gr<strong>und</strong>sätzlich alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe<br />
regelmäßig <strong>und</strong> unangemeldet überprüft. Die Häufigkeit<br />
richtet sich dabei u. a. nach der Art der Betriebe sowie nach vorher<br />
festgelegten Probenplänen. Auch Verbraucherbeschwerden<br />
wird durch eine Betriebsinspektion nachgegangen. In einigen besonders<br />
sensiblen Betrieben (wie etwa Schlachthöfen) sind Mit -<br />
arbeiter der kommunalen Veterinärbehörden sogar ständig vor<br />
Ort. Bei der Überwachung eines Betriebes erfolgt gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
immer eine Kontrolle der Hygienebedingungen im Betrieb, d. h.<br />
Alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe werden geprüft. In sensiblen<br />
Betrieben, wie z. B. Schlachthöfen, sind Mitarbeiter der kommunalen<br />
Veterinärbehörde ständig vor Ort<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
die Arbeitsräume, Arbeitsgeräte <strong>und</strong> Arbeitsflächen sowie die<br />
Hygienemaßnahmen für das Personal werden überprüft. Zu ei -<br />
ner Betriebskontrolle gehört beispielsweise auch die Überprü fung<br />
der betrieblichen Bekämpfung von Schadnagern wie Ratten oder<br />
Mäusen. Bei Lebensmittelproduktionsbetrieben werden im Rah -<br />
men eines Betriebsbesuches nicht nur von den verarbeiteten Lebensmitteln,<br />
sondern auch von den Oberflächen Hygiene proben<br />
genommen, die im Labor auf Verunreinigungen durch Keime <strong>und</strong><br />
auf andere Ges<strong>und</strong>heitsgefahren überprüft werden. Ferner werden<br />
die dem <strong>Verbraucherschutz</strong> dienenden Maßnahmen der so -<br />
genannten betrieblichen Eigenüberwachung kontrolliert, d. h., es<br />
wird beispielsweise festgestellt, ob die Aufzeichnungspflichten<br />
etwa zur Dokumentation der Temperatur der Kühlschränke oder<br />
zur regelmäßigen Reinigung von Getränkezapfanlagen eingehalten<br />
wurden.<br />
19
20<br />
Auch andere Aufgaben der kommunalen Veterinär- <strong>und</strong> Verbrau -<br />
cherschutzbehörden dienen dem <strong>Verbraucherschutz</strong>. Wichtige<br />
behördliche Tätigkeiten in einem viehreichen B<strong>und</strong>esland wie Nie -<br />
dersachsen sind dabei die Schlachttier- <strong>und</strong> Fleischunter su chung<br />
<strong>und</strong> die Geflügelfleischuntersuchung, die am Beginn der Kette<br />
der Lebensmittelproduktion stehen. Neben der klassischen Kon -<br />
trolle der Schlachttiere im Hinblick auf ges<strong>und</strong>heitsgefährdende<br />
Erkrankungen ist auch die sogenannte Rückstands untersu chung<br />
ein wesentlicher Aufgabenbereich des vorbeugenden Verbrau -<br />
cherschutzes. Sie umfasst die Probenahmen am lebenden Tier im<br />
Erzeugerbetrieb <strong>und</strong> am Fleisch für eine chemische Unter suchung<br />
auf Arzneimittelrückstände <strong>und</strong> andere verbotene <strong>und</strong> möglicherweise<br />
ges<strong>und</strong>heitsgefährdende Stoffe. Auch andere Aufgaben<br />
der kommunalen Veterinärämter wie etwa die Organisation der<br />
Tierseuchenbekämpfung hängen eng mit dem Verbraucher schutz<br />
zusammen. Beispielsweise sind manche Tierseuchen auf den Men -<br />
schen übertragbar, so dass Tierseuchenvorbeugung <strong>und</strong> -be kämpfung<br />
immer auch prophylaktischen <strong>Verbraucherschutz</strong> bedeuten.<br />
Die Rückstandsuntersuchung umfasst auch die Probenahmen am<br />
lebenden Tier im Erzeugerbetrieb <strong>und</strong> am Fleisch für eine chemische<br />
Untersuchung auf z. B. Arzneimittelrückstände<br />
Bei ihren vielfältigen Aufgaben arbeiten die kommunalen Be hör -<br />
den eng mit anderen staatlichen Stellen im Bereich des Ver brau -<br />
cherschutzes zusammen. Die entnommenen Proben werden<br />
zu meist nicht von kommunalen Mitarbeitern, sondern in den Untersuchungsstellen<br />
<strong>und</strong> Laboren des Niedersächsischen Landes -<br />
amtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit analysiert.<br />
Von dort werden die Ergebnisse den Behörden vor Ort mitgeteilt,<br />
die dann in enger Abstimmung mit den Analytikern über<br />
die zu treffenden Maßnahmen entscheiden. Bei absichtlichen oder<br />
wiederholten Verstößen informieren die kommunalen Behörden<br />
die zuständige Staatsanwaltschaft, wenn strafrechtlich relevantes<br />
Verhalten vorliegt. Durch diese enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen<br />
Spezial- <strong>und</strong> Fachbehörden wird ein umfassender Schutz<br />
der Verbraucher vor Ort <strong>und</strong> im gesamten Land <strong>Niedersachsen</strong><br />
sichergestellt.<br />
Dr. Schwind, J. (NLT)
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2.4 Neue Wege geht das Land – Qualitätsmanagement in der öffentlichen<br />
Verwaltung<br />
EQUINO – Einheitliches Qualitätsmanagement in niedersächsischen<br />
Organisationen des ges<strong>und</strong>heitlichen Ver brau -<br />
cherschutzes<br />
Neue Anforderungen an die Mitgliedsstaaten der Europäischen<br />
Union <strong>und</strong> ihre Verwaltungen erfordern neue Wege in der öf fentlichen<br />
Verwaltung. Mit der VO (EG) Nr. 882/2004 über amtliche<br />
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- <strong>und</strong><br />
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tierge s<strong>und</strong> heit<br />
<strong>und</strong> Tierschutz 1 werden einheitliche Verfahrensweisen bei der<br />
Durchführung der amtlichen Kontrollen gefordert. Dabei sind die<br />
Kontrollen einheitlich <strong>und</strong> auf konstant hohem Niveau anhand<br />
dokumentierter Verfahren durchzuführen. Die in der VO aufgestellten<br />
Gr<strong>und</strong>sätze orientieren sich dabei an internationalen Stan -<br />
dards zum Qualitätsmanagement, ohne konkret auf eine Norm<br />
Bezug zu nehmen. Ergänzend hierzu verpflichtet auf nationaler<br />
Ebene die AVV Rüb 2 die zuständigen Behörden zur Verbesse rung<br />
der Transparenz <strong>und</strong> Nachvollziehbarkeit zur Einrichtung von Qualitätsmanagementsystemen.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wurde im Land <strong>Niedersachsen</strong> die Not -<br />
wendigkeit gesehen, ein an den internationalen Normen orientiertes<br />
Qualitätsmanagementsystem (QMS) im Bereich der amtlichen<br />
Überwachung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln,<br />
Bedarfsgegenständen, Futtermitteln, Tierarzneimitteln, sowie in<br />
den Bereichen Fleischhygiene, Tierges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Tierschutz zu<br />
etablieren.<br />
Logo des Qualitätsmanagementsystems EQUINO<br />
1 Abl. L 191 vom 28.05.2004, S. 1-52<br />
2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Gr<strong>und</strong>sätze zur Durch -<br />
führung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher,<br />
weinrechtlicher <strong>und</strong> tabakrechtlicher Vorschriften vom<br />
21.12.2004 (GMBl. Nr. 58, S. 1169), zuletzt geändert am 15.0<strong>3.</strong>2007<br />
(GMBl. Nr. 17 S. 351)<br />
Der niedersächsische Weg<br />
Im Frühjahr 2005 wurde das Projekt »Einführung eines einheitlichen<br />
Qualitätsmanagementsystems auf allen Verwaltungs ebe -<br />
nen im ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong>« – EQUINO – auf<br />
Ba sis der internationalen Norm ISO 9001 beschlossen. Projekt -<br />
teil nehmer waren das Niedersächsische Ministerium für Ernäh rung,<br />
Landwirtschaft,<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung (ML),<br />
das Niedersächsische Landesamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Le -<br />
bens mittelsicherheit (LAVES) <strong>und</strong> die kommunalen Veterinär- <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachungsbehörden der Landkreise <strong>und</strong> kreisfreien<br />
Städte.<br />
Zur Koordination, dauerhaften Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Weiter -<br />
ent wicklung des Qualitätsmanagementsystems EQUINO wurde<br />
Frau Dr. Dorit Stehr zur Beauftragten für das Qualitäts manage -<br />
ment im Aufgabenbereich <strong>Verbraucherschutz</strong>, Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Tierschutz durch das ML ernannt.<br />
Q-Zirkel-Mitglieder beim Projektstart<br />
21
22<br />
Das Projekt war von Anfang an dergestalt konzipiert, dass alle betroffenen<br />
Behörden aktiv in den Entwicklungsprozess des QMS<br />
eingeb<strong>und</strong>en waren. Hierdurch sollte, neben der höheren Akzeptanz<br />
auf allen Ebenen, insbesondere auch ein an der Praxis ori -<br />
entiertes System aufgebaut werden.<br />
Während der 1½-jährigen Projektlaufzeit wurden Schulungen von<br />
Multiplikatoren aus allen beteiligten Behörden durch das Land<br />
<strong>Niedersachsen</strong> finanziert.<br />
In dieser Zeit wurde in zehn Arbeitsgruppen, sogenannten Qua litäts<br />
zir keln, die erforderliche Gr<strong>und</strong>dokumentation erarbeitet. Im<br />
Ergebnis stand ein zertifizierungsfähiges Qualitätsmanage ment -<br />
system nach DIN ISO 9001.<br />
Das Projekt endete mit der feierlichen Unterzeichnung des einheitlichen<br />
Managementhandbuches am 22. Juni 2007 durch den<br />
Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke für die Landesbehörden sowie<br />
Wolfgang Kix (Niedersächsischer Landkreistag) <strong>und</strong> Klaus Bothe<br />
(Niedersächsischer Städtetag).<br />
Der prozessorientierte Ansatz von EQUINO<br />
In Umsetzung der DIN ISO 9000ff. mit ihrem prozessorientierten<br />
Ansatz ist EQUINO ebenfalls konsequent prozessorientiert aufgebaut<br />
(siehe Abbildung 2.2). Innerhalb dieser Gr<strong>und</strong>prozesse werden<br />
gleiche Prozesse wie z. B. der allgemeine Ablauf von Kon trollen,<br />
Probenahmen, Risikoanalysen oder Verwaltungsverfahren, un -<br />
abhängig davon in welchem Aufgaben- oder Fachgebiet sie an -<br />
fallen, nur einmal beschrieben. Eine solche Prozessbe schreibung<br />
wird ergänzt durch Managementtabellen, die beispielsweise mitgeltende<br />
Unterlagen wie Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen zu einzelnen<br />
Sachgebieten auflisten oder Aussagen zu vorgeschriebenen Kon -<br />
trollfrequenzen treffen. Soweit erforderlich werden die Pro zess -<br />
beschreibungen im Weiteren fach- <strong>und</strong> arbeitsplatzbezogen durch<br />
Arbeitsanweisungen, Formblätter <strong>und</strong> Checklisten konkretisiert.<br />
Bei der M-Dokumentation gilt immer die Maxime: So viel wie nötig,<br />
so wenig wie möglich!<br />
Wo stehen wir?<br />
Neben der Beendigung des Einführungsprojektes mit der Unter -<br />
zeichung des einheitlichen Managementhandbuches stand das<br />
Jahr 2007 insbesondere im Fokus der Umsetzung des QMS in<br />
den einzelnen beteiligten Behörden. Die Umsetzung stellt noch<br />
einmal eine besondere Herausforderung dar, da das einheitliche<br />
QMS »EQUINO« auf die jeweiligen Verhältnisse in den beteiligten<br />
Behörden angepasst werden muss.<br />
Zu den Behörden, die das QMS EQUINO bereits erfolgreich um -<br />
gesetzt haben, gehört das Niedersächsische Landesamt für Ver -<br />
braucherschutz <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES). Das LAVES<br />
hat als erste Behörde in <strong>Niedersachsen</strong> im ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
sein QMS nach ISO DIN 9001 zertifizieren lassen.<br />
Die Zertifizierung ist im niedersächsischen System nicht zwingend<br />
vorgesehen. Da es aber gr<strong>und</strong>sätzlich als zertifizierungsfähiges<br />
QMS entwickelt wurde, kann jede beteiligte Behörde die Ent -<br />
scheidung treffen, sich zertifizieren zu lassen.<br />
Streben weitere Behörden in <strong>Niedersachsen</strong> eine Zertifizierung<br />
ihres QMS an, besteht die Möglichkeit, in Zukunft auch zu ei ner<br />
landesweiten Verb<strong>und</strong>zertifizierung zu kommen.<br />
Nagel, J.-P. (LAVES - Stabsstelle QM)
Abbildung 2.2: Gr<strong>und</strong>prozessstruktur von EQUINO<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
23
24<br />
2.5 Gemeinsames <strong>Verbraucherschutz</strong>informationssystem <strong>Niedersachsen</strong><br />
(GeViN)<br />
Mit dem Aufbau des Gemeinsamen <strong>Verbraucherschutz</strong> informa -<br />
tions systems <strong>Niedersachsen</strong> (GeViN) wird das Ziel verfolgt, eine<br />
ein heitliche Plattform für alle im Krisenfall sowie zu Berichts zwecken<br />
erforderlichen Daten aufzubauen. Zu diesem Zweck hat das<br />
Niedersächsische Ministerium für Ernäh rung, Landwirtschaft, Ver -<br />
braucherschutz <strong>und</strong> Landesentwicklung (ML) mit dem Nieder sächs<br />
i schen Landkreistag (NLT) <strong>und</strong> dem Niedersächsischen Städte -<br />
tag (NST) einen Rahmenvertrag geschlossen, der die Vorgehens -<br />
weisen r<strong>und</strong> um GeViN wie z. B. die Umstellung der Kom mu nen<br />
auf die erforderliche Software, die Schulung der Anwender <strong>und</strong><br />
die Weiterentwicklung des Systems regelt. Entscheidungen r<strong>und</strong><br />
um GeViN werden vom Lenkungsausschuss getroffen, dem ne -<br />
ben Vertretern des ML, des LAVES, des NLT <strong>und</strong> des NST auch<br />
Vertreter der Facharbeitsgruppen angehören. So wird sichergestellt,<br />
dass alle Interessen im ges<strong>und</strong>heitlichen Verbraucher schutz<br />
vertreten sind <strong>und</strong> auch die Fachleute ihren Beitrag leisten können.<br />
Bei GeViN handelt es sich um eine hochkomplexe Datenbank,<br />
welche die b<strong>und</strong>eseinheitliche Fachsoftware BALVI iP nutzt. Die -<br />
se Datenbank steht, zentral auf einem IT-System bestehend aus<br />
Datenbankservern, Terminalservern, Fileservern <strong>und</strong> einem ftp-<br />
Server zur Verfügung <strong>und</strong> ist allen in <strong>Niedersachsen</strong> mit Auf ga ben<br />
im ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> betrauten Stellen zugänglich.<br />
So arbeiten die kommunalen Veterinärämter auf der gleichen<br />
Datenbank wie das LAVES <strong>und</strong> das Ministerium, was im Krisen -<br />
fall den Vorteil hat, dass auf Knopfdruck jeder zuständigen Stelle<br />
die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.<br />
Die erforderliche Rechenleistung wird vom IZN zur Verfügung gestellt.<br />
Alle Vorgänge r<strong>und</strong> um den Betrieb des Systems wie z. B.<br />
die Verbesserung der technischen Ausstattung <strong>und</strong> die Erstel lung<br />
der jährlichen Abrechnungen werden vom LAVES in Abstim mung<br />
mit dem Lenkungsausschuss gesteuert.<br />
Derzeitig befindet sich dieses System noch im Aufbau. In den Jah -<br />
ren 2006 <strong>und</strong> 2007 erhielten alle kommunalen Veterinärämter die<br />
erforderliche Fachsoftware mit dem Betriebsregister <strong>und</strong> den Fachmodulen<br />
Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> Tierseuchenbe kämp fung.<br />
Im nächsten Jahr sollen weitere Fachmodule hinzukommen. Das<br />
LAVES betreibt ebenfalls das Betriebsregister <strong>und</strong> das Fach mo dul<br />
Lebensmittelüberwachung, hier kommen noch weitere Fach mo -<br />
dule für die Erledigung der dortigen Aufgaben zum Einsatz.<br />
Der Übergang auf die Fachsoftware BALVI iP wurde den meisten<br />
Kommunen dadurch erleichtert, dass dort bereits die Vorgäng er -<br />
software HAMLET (für die Lebensmittelüberwachung) bzw. DAVID<br />
(für die Tierseuchenbekämpfung) zum Einsatz kam. Dies gewährleistete<br />
einen fließenden Übergang zum neuen System ohne Vernachlässigung<br />
des <strong>Verbraucherschutz</strong>es in der Umstellungs phase.<br />
In der letzten Ausbaustufe soll die Datenbank für die Erledi gung<br />
aller Überwachungstätigkeiten im ges<strong>und</strong>heitlichen Verbraucher -<br />
schutz eingesetzt werden. Damit werden die Bereiche Lebensmittelüberwachung,<br />
Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel kontrol le,<br />
Tierschutz, Handelsklassenkontrolle usw. in einem einheitlichen<br />
System bearbeitet werden können.<br />
Die hochkomplexe Datenbank GeViN ist allen in <strong>Niedersachsen</strong> mit<br />
Aufgaben im ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong> betrauten Stellen<br />
zugänglich
Unterstützt wird die Arbeit der Überwachungsbehörden dabei<br />
durch Schnittstellen dieser Datenbank z. B. zum zentralen Re gister<br />
HIT sowie zu TSN, auch hier wiederum mit dem Ziel, jederzeit<br />
aktuelle Daten zur Verfügung zu haben <strong>und</strong> die Melde pflich ten<br />
gegenüber dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> der EU zu erfüllen. Weitere Schnitt -<br />
stellen, z. B. zum Laborinformations- <strong>und</strong> Managementsystem<br />
der Institute des LAVES sowie zum Gewerberegister, befinden sich<br />
in Vorbereitung. Gerade hier liegt ein großer Vorteil dieses Sys -<br />
tems insbesondere im Krisenfall. Nur durch derartige Schnitt stellen<br />
kann sichergestellt werden, dass jederzeit »auf Knopfdruck«<br />
die aktuellsten Daten für die Bewältigung einer Krise genutzt<br />
werden <strong>und</strong> dadurch die Einleitung der erforderlichen Maß nah -<br />
men so schnell wie nur möglich erfolgen kann.<br />
Abger<strong>und</strong>et wird die Nutzbarkeit durch die ebenfalls enthaltenen<br />
Funktionalitäten der Dokumentenverwaltung, Terminverwal tung,<br />
Probenplanung etc. zur effektiven Steuerung der Überwachungstätigkeiten<br />
in den überwachenden Behörden.<br />
Neben dem üblichen Zugang über das Landesnetz, ist der Zugriff auf<br />
das System auch über einen VPN-Zugang möglich<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
Der Zugang zum System ist, in Ergänzung zum üblichen Zu gang<br />
über das Landesnetz, auch über einen VPN-Zugang möglich. Dies<br />
soll in Zukunft genutzt werden, um die Arbeit der Kontrolleure<br />
vor Ort zu vereinfachen. Es befinden sich in diesem Jahr diverse<br />
Möglichkeiten für eine mobile Nutzung <strong>und</strong> Erfassung der Daten<br />
in der Prüfung. Dadurch stünden jedem Kontrolleur vor Ort die<br />
aktuellen Daten für eine Kontrolle zur Verfügung. Weiterhin können<br />
z. B. Probenahmeprotokolle online ausgefüllt werden. Dies<br />
sollte zu einer weiteren Verbesserung im ges<strong>und</strong>heitlichen Ver -<br />
braucherschutz führen.<br />
In der gleichen Art <strong>und</strong> Weise werden ständig neue Techno lo gien<br />
auf ihre Nutzbarkeit für den ges<strong>und</strong>heitlichen Verbraucher schutz<br />
getestet, mit dem Ziel der stetigen Verbesserung für den Verbraucher.<br />
Mit GeViN wurde die Basis für die Nutzung dieser Tech no -<br />
logien geschaffen.<br />
Dr. Luger, A. (LAVES, Abteilung 2)<br />
25
26<br />
<strong>3.</strong> Ausgewählte Ergebnisse im Verbrau cherschutz<br />
<strong>und</strong> in der Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong>1 Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung<br />
Fleisch <strong>und</strong> Fleischerzeugnisse<br />
Kochpökelerzeugnisse vom Geflügel<br />
Bei der Herstellung von Fleisch- <strong>und</strong> Geflügelfleischer zeugnis sen<br />
zeigen manche Unternehmen hohe Innovationsfreudigkeit, setzen<br />
neuere Technologien ein <strong>und</strong> entwickeln »patentierte Verfah ren«,<br />
die zu einer großen Produktvielfalt führen. Neuartige Produkte,<br />
so genannte »Aliuds«, können den Markt durchaus bereichern,<br />
zumal wenn es sich dabei um Erzeugnisse aus hochwertigem Aus -<br />
gangsmaterial, z. B. ganzen Geflügelbrustfilets, Schinken oder<br />
großen Schinkenteilen handelt. Allerdings können <strong>und</strong> dürfen<br />
auch Teilstücke mit geringerem Wert verarbeitet werden, was<br />
dem Endprodukt kaum oder nur mit großer Fachkenntnis anzumerken<br />
ist. Dadurch kommt der korrekten Kennzeichnung eine<br />
immer höhere Bedeutung zum Schutz des Verbrauchers zu. Zwar<br />
geben die »Leitsätze für Fleisch <strong>und</strong> Fleischerzeugnisse« des Deu t -<br />
schen Lebensmittelbuches maßgebliche Orientierung, be handeln<br />
aber nicht immer besondere Einzelfälle. Somit bleibt Spielraum<br />
für differente Interpretationen von Seiten der Unternehmen einerseits,<br />
die gern traditionelle Bezeichnungen bewahren, <strong>und</strong> der<br />
amtlichen Überwachung andererseits, die zum Schutz des Ver -<br />
brauchers differenzierte Verkehrsbezeichnungen einfordert. Ge -<br />
richtliche Klärungen haben dabei manchmal den Charakter eines<br />
Musterprozesses. Ein aktuelles Verfahren vor dem Oberverwal -<br />
tungsgericht Lüneburg ist Gegenstand derartiger Auseinander -<br />
setzungen <strong>und</strong> hat hohe allgemeine Bedeutung.<br />
Unabhängig von unterschiedlichen Zuständigkeiten bei der amtlichen<br />
Überwachung zeigt sich in diesem Verfahren: Neben der<br />
analytischen Untersuchung des Endproduktes im Labor müssen<br />
die Behörden »vor Ort« die Hygiene sowie auch die Wertigkeit<br />
der verwendeten Ausgangsmaterialien fest im Blick haben. Ei ner<br />
hervorragenden Zusammenarbeit von LAVES <strong>und</strong> kommuna ler<br />
Veterinärbehörde dürfte bei dem genannten Gerichtsver fah ren<br />
der Erfolg in erster Instanz zu verdanken sein.<br />
Wie auch immer der oben genannte Einzelfall in der Berufung<br />
entschieden wird, der Verbraucher seinerseits tut gut daran, sich<br />
anhand der Zutatenliste umfassend über die Zusammensetzung<br />
der Produkte zu informieren <strong>und</strong> deren Verkehrsbezeichnung kritisch<br />
zu beurteilen.
Unter der Bezeichnung »Kochschinken«, meist durch hervorhebende<br />
Hinweise wie »Delikatess« oder »Spitzenqualität« ergänzt,<br />
werden die unterschiedlichsten Erzeugnisse angeboten.<br />
Während viele handwerklich orientierte Betriebe noch auf traditionelle<br />
Weise ganze Schinken zu Kochschinken verarbeiten (vgl.<br />
Bild unten), setzen die meisten industriellen Hersteller auf Rati o -<br />
na li sierung <strong>und</strong> Standardisierung. Teilstücke des Schinkens werden<br />
nach dem Spritzpökeln mechanisch vorbehandelt, in meterlange<br />
Kunstdärme abgefüllt <strong>und</strong> erhitzt. Auf diese Weise wird ein<br />
im mer gleich bleibendes Kaliber garantiert <strong>und</strong> der Verschnitt mi -<br />
ni miert. Je nach Größe der verarbeiteten Schinkenstücke erin nert<br />
das Schnittbild an gewachsenen Kochschinken, an Formfleisch<br />
oder zuweilen eher an Bierschinken.<br />
Wer im Restaurant ein Gericht bestellt, das laut Speisekarte »Koch -<br />
schinken« enthält (z. B. Schinken-Pizza), erhält manchmal Form -<br />
fleisch-Schinken (aus kleineren Fleischstücken zusammengefügte<br />
Erzeugnisse). Oftmals werden jedoch minderwertige Ersatzproduk<br />
te, die mit Schinken nichts mehr gemein haben <strong>und</strong> z. T. nur<br />
noch zu 51 bis 70% aus Fleisch, dafür aus viel Wasser, Stärke,<br />
Pflanzeneiweiß <strong>und</strong> Geschmacksverstärkern bestehen, in Gerichten<br />
verarbeitet. Als »Schinken« bezeichnet dürfen derartige Imitate<br />
rechtmäßig überhaupt nicht in den Verkehr gelangen (siehe<br />
Bild rechts).<br />
Auch äußerlich unverdächtig erscheinende Schinken können verfälscht<br />
sein. Eine Streckung durch Fremdwasser ist keine Selten -<br />
heit. Auch die Injektion von Eiweißpulvern (z. B. hydrolysierte Gelatine),<br />
proteinhaltigen Emulsionen <strong>und</strong> sogar Separatoren fleisch<br />
wurden bereits festgestellt. Kochschinken <strong>und</strong> Schinkenerzeug -<br />
nisse wurden im Berichtsjahr mit einer breiten Methodenpalette<br />
untersucht. In Zweifelsfällen ist die Analyse durch Kontrollen des<br />
Prozesses im Herstellungsbetrieb zu ergänzen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Kochschinken <strong>und</strong> ähnliche Kochpökel-Erzeugnisse – was erwartet der Verbraucher, <strong>und</strong> was bekommt<br />
er tatsächlich?<br />
Traditioneller Kochschinken<br />
Die Untersuchung von 130 Proben Kochschinken <strong>und</strong> Schinken -<br />
er zeugnissen führte zu zahlreichen Beanstandungen. Insgesamt<br />
wurden 89 (68,5%) der Proben beanstandet, davon 47 aufgr<strong>und</strong><br />
der geweblichen Zusammensetzung. Es handelte sich meist um<br />
kleinstückig zusammengefügte Erzeugnisse, die einen z. T. be -<br />
reits grobsinnlich wahrnehmbaren Anteil an brätartiger Sub stanz<br />
aufwiesen. Der überhöhte Brätgehalt wurde jeweils durch die his -<br />
tologische Untersuchung bestätigt. 32 Proben mussten wegen<br />
Unterschreitung des Eiweißgehaltes bzw. entsprechend überhöhter<br />
Fremdwassergehalte beanstandet werden.<br />
Die höchsten Beanstandungsquoten ergaben sich bei lose in Gas -<br />
tronomiebetrieben entnommenen Proben, die in den Speise kar -<br />
ten als »Kochschinken« oder »Vorderschinken« bezeichnet wa ren.<br />
Hier wurden ausnahmslos alle Proben als irreführend bezeichnet<br />
beanstandet.<br />
Dr. Orellana, A. (LI OL)<br />
Schinkenimitat<br />
27
28<br />
Separatorenfleisch – wie sieht es mit der Kennzeichnung aus?<br />
»Separatorenfleisch« ist nach gesetzlicher Definition Fleisch, das<br />
unter Veränderung oder Auflösung der Muskelfaserstruktur maschi<br />
nell von Fleisch tragenden Knochen oder Geflügel schlacht -<br />
körpern abgelöst wird (siehe Bilder unten).<br />
Es darf nur unter der Bezeichnung »Separatorenfleisch« (im englischsprachigen<br />
Raum »MSM« – mechanically separated meat)<br />
in den Verkehr gebracht werden. Die Bezeichnung »Fleisch« ist<br />
für Separatorenfleisch nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht<br />
zulässig.<br />
Separatorenfleisch darf in zahlreichen Fleischerzeugnissen verarbeitet<br />
werden, insbesondere in hitzebehandelten Produkten wie<br />
z. B. Brühwurst. Der Zusatz von Separatorenfleisch muss jedoch<br />
für den Verbraucher ersichtlich kenntlich gemacht werden, z. B.<br />
im Verzeichnis der Zutaten. Besteht der Anteil an Fleischzutaten<br />
überwiegend oder ausschließlich aus Separatorenfleisch, muss ei -<br />
ne andere Verkehrsbezeichnung gewählt werden, um den Un ter -<br />
schied zu herkömmlichen Produkten ausreichend zu verdeutlichen.<br />
Die Beimengung von Separatorenfleisch im fertigen Erzeugnis<br />
durch Laboranalysen nachzuweisen, ist problematisch, da so -<br />
wohl Calciumgehalt als auch Knochengehalt je nach Qualität<br />
stark schwan ken.<br />
Trotzdem wurde die Verarbeitung von Separatorenfleisch ohne<br />
entsprechende Kenntlichmachung in verschiedenen Produkten<br />
wie Brühwurst, Döner Kebab, Frikadellen <strong>und</strong> sogar Koch schin -<br />
Geflügel- Separatorenfleisch<br />
ken-Imitaten festgestellt. Obwohl meist preiswerte Produkte durch<br />
einen erhöhten Anteil an Knochenpartikeln auffielen, ergaben sich<br />
auch bei einigen Erzeugnissen namhafter Hersteller Beanstan dungen.<br />
Die Ursache der fehlenden Angabe von Separatorenfleisch liegt<br />
u. a. auch darin, dass oftmals Rohmaterialien unter falscher Be -<br />
zeichnung in den Verkehr gebracht werden. Es wurden mehrere<br />
Proben rohes, zerkleinertes Fleisch zur Verarbeitung mit den<br />
Bezeichnungen »3 mm Fleisch«, »Baaderfleisch« <strong>und</strong> »Verar bei -<br />
tungsfleisch« von Schwein <strong>und</strong> Geflügel zur Untersuchung eingereicht,<br />
bei denen auf Gr<strong>und</strong> des erhöhten Gehaltes an Calcium<br />
<strong>und</strong> Knochenpartikeln die Diagnose »Separatorenfleisch« ge -<br />
stel lt wurde.<br />
Nur durch eine konsequente Kontrolle der Hersteller von Sepa -<br />
ra torenfleisch kann erreicht werden, dass die Fleischrohstoffe<br />
mit der korrekten Bezeichnung gehandelt werden.<br />
Denn jeder Verbraucher soll die Entscheidung selber treffen können,<br />
ob er Produkte mit Separatorenfleisch kaufen möchte oder<br />
nicht, <strong>und</strong> dies ist nur bei zuverlässiger Kennzeichnung möglich.<br />
Dr. Orellana, A. (LI OL)<br />
Ausgangsmaterial für Hühner- Separatorenfleisch
Unerlaubte Wasserzusätze in Geflügelfleischerzeugnissen<br />
Seit Jahren befinden sich im Handel küchenfertig zubereitete Tief -<br />
kühlprodukte, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Dabei<br />
handelt es sich um flüssig gewürzte Geflügelprodukte wie »Hähnchen-<br />
bzw. Putenbrustfilets mit 8% Flüssigwürzung« oder »Hähnchen-<br />
bzw. Putenschnitzel mit 8% Flüssigwürzung«. Laut Deklaration<br />
auf der Verpackung bestehen diese Erzeugnisse aus 92%<br />
Fleisch <strong>und</strong> 8% Flüssigwürzung.<br />
Geflügelbrustfleisch ist ein von Natur aus eher trockenes Fleisch.<br />
Um dem Wunsch von Verbrauchern nach saftigerem Fleisch entgegenzukommen<br />
<strong>und</strong> um eine gleichmäßigere Verteilung der<br />
Wür zung im Produkt zu erreichen, ging die Industrie dazu über,<br />
Flüssigwürzung in die Brustfilets einzuarbeiten. Flüssigwürzung<br />
besteht aus Wasser <strong>und</strong> geschmackgebenden Stoffen wie Salz,<br />
Würze <strong>und</strong> Zuckerstoffen (z. B. Glucose <strong>und</strong> Lactose).<br />
Der Anteil an Flüssigwürzung ist bei rohen Erzeugnissen analytisch<br />
leicht zu bestimmen. Aus den Ergebnissen der chemischen<br />
Untersuchung lässt sich der Anteil an eingesetztem Fleisch er -<br />
rechnen. Dieser Berechnung liegt die Tatsache zugr<strong>und</strong>e, dass<br />
zwischen dem Wasser- <strong>und</strong> Eiweißgehalt im Fleisch ein enger Zu -<br />
sammenhang besteht, d. h. das Verhältnis von (fleischeigenem)<br />
Wasser <strong>und</strong> Eiweiß ist relativ konstant. Aus dem analysierten Ei -<br />
weißgehalt kann über diese Beziehung nach Hinzurechnen von<br />
Fett <strong>und</strong> Mineralstoffen der Anteil an Fleisch berechnet werden.<br />
Bei einer Vielzahl von auf ihren Fleischanteil untersuchten Pro -<br />
dukten wurde festgestellt, dass weniger Fleisch verarbeitet wur -<br />
de als auf der Verpackung angegeben war; häufig ergaben sich<br />
Abweichungen von über 10% des deklarierten Gehaltes.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Aufgr<strong>und</strong> zahlreicher Beanstandungen in den letzten Jahren wurden<br />
im Berichtsjahr Herstellerbetriebe gezielt kontrolliert <strong>und</strong> di -<br />
verse Verdachtsproben zur Untersuchung eingereicht. Die Ana ly -<br />
senergebnisse bestätigten auch in diesen Fällen die Vorbe f<strong>und</strong>e.<br />
Seitens der Lebensmittelüberwachungsbehörden wurden daraufhin<br />
Verfahren eingeleitet.<br />
Leskow, C. (LI OL)<br />
29
30<br />
Konserven aus handwerklicher Herstellung: Kesselkonserve oder Vollkonserve?<br />
Bei vielen Wurst- <strong>und</strong> Fleischkonserven aus handwerklicher Her -<br />
stellung handelt es sich um sogenannte »Kesselkonserven«, da<br />
sie zur Haltbarmachung lediglich im Kessel erhitzt werden <strong>und</strong><br />
so die Sporen mesophiler Bacillus-Arten nicht immer abgetötet<br />
werden. Im Gegensatz zur industriell hergestellten <strong>und</strong> ungekühlt<br />
lagerfähigen Vollkonserve müssen Kesselkonserven bei max. 10 °C<br />
gekühlt aufbewahrt werden <strong>und</strong> sind dann ca. ein Jahr haltbar.<br />
Zur Ermittlung der mikrobiellen Beschaffenheit von Wurst- <strong>und</strong><br />
Fleischkonserven aus dem Handwerk werden die Proben bei 37 °C<br />
sieben Tage lang bebrütet <strong>und</strong> anschließend sensorisch, mikrobiologisch<br />
<strong>und</strong> gegebenenfalls mikroskopisch untersucht. Ist nach<br />
der Be brü tung Keimwachstum festzustellen, handelt es sich um<br />
eine kühlpflichtige Kesselkonserve. In diesen Fällen wird der fehlende<br />
Kühlhinweis bzw. die zu lange Haltbarkeitsfrist beanstandet.<br />
Ergebnis einer Probenziehungs-Sonderaktion bei Direkt -<br />
vermarktern (Wurstwaren sowie Konserven)<br />
In einigen Landkreisen hat die Wurstwaren-Herstellung in Di rekt -<br />
vermarkterbetrieben eine relativ große Bedeutung. Es gab in der<br />
Vergangenheit mehrfach Probenbeanstandungen bei Dosenwurstwaren,<br />
wobei die Mindesthaltbarkeitsdatums-Angaben (MHD)<br />
nicht er reicht worden sind bzw. eine Beurteilung von angeblichen<br />
Dau erkonserven als Kessel kon serve erfolgte.<br />
Daraufhin wurden mit Schwerpunkt in einem Landkreis bei 35<br />
Direktvermarktern 77 Proben diverser Wurstwaren gezogen. Die<br />
Ergebnisse sind in Tabelle <strong>3.</strong>1 zusammengestellt.<br />
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, lag die Beanstandungsquote<br />
der Dosenware bei 42%, hauptsächlich wurden Kennzeichnung<br />
<strong>und</strong> Mi krobiologie/Haltbarkeit beanstandet. Daraus war zu folgern,<br />
dass die Kennt nisse bezüglich Herstellung <strong>und</strong> Kennzeich nung von<br />
Dosen wa ren bei Direktvermarktern verbesserungswürdig sind. Hinsichtlich<br />
der Haltbarkeit konnte vor Ort ermittelt wer den, dass die<br />
Kon ser ven kochung in der Regel im Kochkessel bei Siedetem pe ratur<br />
erfolg te. Diese als Dauerkonserven gekennzeichneten Dosen<br />
wurden jedoch als Kesselkonserve mit Kühlpflicht beurteilt, unter<br />
an de rem, da es nicht zu einer sicheren Abtötung von unter Umstän<br />
den ges<strong>und</strong>heitsgefährdenden Sporen gekommen war.<br />
Als Korrekturmaßnahmen wurden ausführliche Belehrungen der<br />
Hersteller neben den notwendigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen<br />
durchgeführt. Der Erfolg der Belehrungen wird durch<br />
Nachproben 2008 überprüft.<br />
Müller, U. (Landkreis Göttingen); Dr. Orellana, A. (LI OL)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>1: Übersicht über die bei Direktvermarktern gezogenen Wurst-Konserven <strong>und</strong> sonstigen Wurstwaren<br />
Art Anzahl der Proben ohne Beanstandung noch kein Ergebnis Kennzeichnungsmängel<br />
Dosenwurst<br />
Mettwurst<br />
sonstige Wurstwaren<br />
Summe<br />
43<br />
26<br />
8<br />
77<br />
20<br />
24<br />
7<br />
51<br />
5<br />
–<br />
–<br />
5<br />
12<br />
2<br />
–<br />
14<br />
andere Mängel<br />
3x zu hoher Keimgehalt<br />
2x keine Vollkonserve,<br />
sondern Kesselware<br />
1x Zusammensetzung<br />
–<br />
1x Fleischanteil zu wenig<br />
7
Was ist Fremdeiweiß?<br />
Unter Fremdeiweiß versteht man tierische oder pflanzliche Pro -<br />
teine, welche Wurst <strong>und</strong> Fleischerzeugnissen zugesetzt werden.<br />
Es dürfen bei loser Ware nur bestimmte Mengen dieser Stoffe<br />
zugesetzt werden.<br />
Fremdeiweiße können sein:<br />
Milcheiweiße<br />
Blutplasma (Rinder- bzw. Schweinealbumin)<br />
Ei<br />
Sojaprotein<br />
Klebereiweiße aus Getreide/Weizenprotein (Gluten)<br />
Häufig werden Fremdeiweiße jedoch nicht direkt als Zutat eingesetzt,<br />
sondern finden sich als Trägermaterial in Gewürzen <strong>und</strong><br />
Hilfsmitteln.<br />
Die genannten Fremdeiweiße sind bis auf das Blutplasma gleichzeitig<br />
Allergene. Für diese Stoffe gilt in verpackten Lebens mitteln:<br />
Sie müssen auch deklariert sein, wenn sie die Zutat einer Zutat<br />
sind.<br />
Wenig Beanstandungen<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> werden im Lebensmittelinstitut Braun schweig<br />
Wurst <strong>und</strong> Fleischerzeugnisse auf Fremdeiweiß sowie eine weitere<br />
Vielzahl von Lebensmitteln auf Allergene untersucht.<br />
Die Beanstandungsquote beträgt bei den Fremdeiweißen 3,9%.<br />
Auffällig sind hier vor allem Dönerprodukte. Von den 28 Bean -<br />
standungen bei Sojaeiweißzusatz (siehe Tabelle <strong>3.</strong>2) handelt es<br />
sich in 23 Fällen um Dönerprodukte. Ähnlich sieht es bei Gluten<br />
aus, hier sind es 16 von 21 Beanstandungen.<br />
Finden sich nur Spuren eines Fremdeiweißes in den Lebens mit -<br />
teln, kann es sich um Kontaminationen handeln. Findet sich zum<br />
Beispiel in einem Lebensmittel Dextrose, kann es zu Kontamina -<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Untersuchung von Wurst <strong>und</strong> Fleischerzeugnissen auf Fremdeiweiß <strong>und</strong> Allergene<br />
tionen mit Gluten kommen, was bei einem bestimmten Per so nenkreis<br />
zu Unverträglichkeiten führt. Bei Laktose als Zutat fin den sich<br />
in einigen Fällen Kasein oder Laktoglobulin. Diese Kon tamina tionen<br />
sind nicht deklarationspflichtig. Hersteller geben aber oft Hinweise<br />
auf die Kontaminationen, z. B. »Kann Spuren von … enthalten«,<br />
oder »in unserem Betrieb wird auch … verarbeitet.<br />
Bei losen Fleisch- <strong>und</strong> Wursterzeugnissen muss in einer Vielzahl<br />
von Fällen der Zusatz der genannten Fremdeiweiße gekennzeichnet<br />
sein.<br />
Für Allergene in lose verkauften Lebensmitteln gibt es noch<br />
kei ne Kennzeichnungspflicht.<br />
Allergiker <strong>und</strong> Personen mit Unverträglichkeitsreaktionen müssen<br />
zwar immer noch mit Kontaminationen in Lebensmitteln rechnen,<br />
jedoch wurden im vergangenen Jahr nur wenige Spurenverun -<br />
reinigungen (Tabelle <strong>3.</strong>2) gef<strong>und</strong>en.<br />
Dr. Ohrt, G. (LI BS)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>2: Darstellung von Untersuchungsergebnissen<br />
ausgewählter Parameter<br />
Untersuchungsparameter<br />
Kasein<br />
Laktoglobulin<br />
Ei<br />
Soja<br />
Gluten<br />
Anzahl der Un -<br />
tersuchungen<br />
571<br />
528<br />
582<br />
534<br />
614<br />
Positive Befun -<br />
de in Spuren<br />
7<br />
2<br />
2<br />
12<br />
12<br />
Beanstandungen<br />
1<br />
1<br />
0<br />
28<br />
21<br />
31
32<br />
Sarkosporidien in Thüringer Mett als Auslöser einer Gruppenerkrankung<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Mitteilung einer Arztpraxis über mehrere an Durchfall<br />
<strong>und</strong> Erbrechen erkrankte Patienten nach Genuss von Thü rin -<br />
ger Mett aus einem bestimmten Betrieb, wurden die Ermittlun -<br />
gen von der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde in<br />
Zusammenarbeit mit dem Ges<strong>und</strong>heitsamt vor Ort aufgenommen.<br />
Die insgesamt 28 gemeldeten Erkrankungsfälle (Durchfall,<br />
Erbrechen, Bauchschmerzen) stammten aus drei voneinander unabhängigen<br />
Gruppen. Zwei Gruppen reichten zu ihrer Beschwer -<br />
de eine Restmenge des Thüringer Metts ein.<br />
Betriebskontrolle <strong>und</strong> Probenahme<br />
In dem Herstellerbetrieb wurden die Betriebsabläufe hinsichtlich<br />
der Herstellung des Thüringer Metts überprüft. Weiterhin wurden<br />
die hierfür genutzten Maschinen <strong>und</strong> Geräte einer optischen <strong>und</strong><br />
mikrobiologischen Untersuchung unterzogen, die keine Hin weise<br />
auf Hygienemängel in dem Betrieb ergab. Außerdem wurden ver -<br />
schiedene amtliche Proben entnommen.<br />
Untersuchungen <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
Lebensmittelproben<br />
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchungen der Lebens -<br />
mittelproben wurden keine Krankheitserreger nachgewiesen. Im<br />
Rahmen der histologischen Untersuchungen wurden in einer Probe<br />
Thüringer Mett (Beschwerdeprobe) ein hochgradiger, in ei ner<br />
anderen Probe Thüringer Mett (aus dem Herstellerbetrieb) ein geringgradiger<br />
Gehalt an Sarkosporidien nachgewiesen.<br />
In mehreren Proben Thüringer Mett wurden Sarkosporidien nachgewiesen<br />
Stuhlproben<br />
Im Niedersächsischen Landesges<strong>und</strong>heitsamt (NLGA) wurden im<br />
Rahmen des Krankheitsgeschehens Stuhlproben von Mitar bei tern<br />
des Herstellungsbetriebes sowie von erkrankten Personen virologisch,<br />
mikrobiologisch <strong>und</strong> parasitologisch untersucht. Diese Untersuchungen<br />
ergaben ein negatives Ergebnis.<br />
Sarkosporidien<br />
Die Sarkosporidien gehören zu den zystenbildenden Kokzidien,<br />
deren Zyklus einen Endwirt (mit sexuellem Zyklus = Gamo go nie)<br />
<strong>und</strong> einen Zwischenwirt (mit asexuellem Zyklus = Schizogonie)<br />
umfasst. Der Mensch als Endwirt kann über rohes oder ungenügend<br />
erhitztes Rind- oder Schweinefleisch Gewebezysten aufnehmen.<br />
In Abbildung <strong>3.</strong>1 ist der Entwicklungszyklus von Sar cocystis<br />
sui-hominis dargestellt.<br />
Drei bis sechs St<strong>und</strong>en, längstens 36 St<strong>und</strong>en nach Verzehr von<br />
kontaminierten Lebensmitteln, können beim Menschen folgende<br />
Symptome auftreten: Bauchschmerzen, leichtes Fieber, Übel keit,<br />
Erbrechen, Durchfall. Die Symptome halten nur wenige Tage an.<br />
Nach etwa fünf bis zwölf Tagen werden Sporozysten mit dem<br />
Stuhl wieder ausgeschieden. Die Sporozysten sind wiederum für<br />
den Zwischenwirt (Schwein, Rind) infektiös, nicht aber für den<br />
Menschen.<br />
Fleischhygienerechtliche Beurteilung<br />
Die fleischhygienerechtliche Beurteilung (Schlachttier- <strong>und</strong> Fleischuntersuchung)<br />
erfolgt nach Verordnung der (EG) Nr. 854/2004.<br />
Auf gr<strong>und</strong> dieser Rechtsgr<strong>und</strong>lage ist Fleisch für genussuntauglich<br />
zu erklären, wenn es Parasitenbefall aufweist. Dies bedeutet, dass<br />
sarkosporidienbelastetes Fleisch als untauglich zu beurteilen ist.<br />
Für die Umsetzung in die Praxis zum Nachweis einer Sarkospo ri -<br />
diose fehlen jedoch weitgehend adäquate Untersuchungen.
Der Befall mit Sarkosporidien verläuft bei Schweinen <strong>und</strong> Rin dern<br />
im Allgemeinen symptomlos <strong>und</strong> ist in der vorgeschriebenen Lebenduntersuchung<br />
vor Schlachtbeginn nicht erkennbar. Für die<br />
Fleischuntersuchung existieren keine ausdrücklichen Hinweise<br />
oder spezifische Vorgaben, um die Sarkozysten zu erkennen. We -<br />
der im EU-Recht noch im nationalen Recht sind gezielte Unter -<br />
suchungen zum Nachweis dieser Protozoen vorgeschrieben. Die<br />
Muskelzysten des Parasiten sind nur nach Anschnitt erkennbar.<br />
Erst bei deutlichen Veränderungen des Gewebes durch zahlreiche<br />
Zysten kann das Fleisch in der Fleischuntersuchung als untauglich<br />
erkannt <strong>und</strong> beurteilt werden.<br />
Auf der Ebene der Fleischgewinnung können aufgr<strong>und</strong> dessen<br />
nur Tierkörper mit hoher Befallsrate eliminiert werden. Eine ef -<br />
fektive gezielte Verminderung des Risikos einer Erkrankung durch<br />
Sarkosporidien auf dieser Ebene wäre nur durch zusätzliche Un -<br />
tersuchungen erreichbar.<br />
Lebensmittelrechtliche Beurteilung<br />
Aufgr<strong>und</strong> des Vorhandenseins von Sarkosporidien in den beiden<br />
Proben Thüringer Mett wurden diese nach Art. 14 Abs. 1 in Verbindung<br />
mit Abs. 2 Buchstabe a der VO (EG) Nr. 178/2002 als<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädlich beurteilt.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>1: Entwicklungszyklus von Sarcocystis sui-hominis<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Zusammenfassung<br />
Der beschriebene Fallbericht zeigt, dass trotz intensiver Hygienemaßnahmen<br />
<strong>und</strong> Kontrollen beim Verzehr von rohem Fleisch ein<br />
Restrisiko für die Verbraucher verbleibt. Dies ist nur schwer in den<br />
Griff zu bekommen, da ein Befall mit Sarkosporidien weder durch<br />
gute Schlachthygiene noch durch Kontrollen der Tiere gänzlich<br />
ausgeschlossen werden kann. Nur eine Erhitzung auf 65-70 °C<br />
für zehn Minuten oder das Tiefgefrieren (-20 °C) für drei Tage<br />
führt zu einer Abtötung der Parasiten. Die abtötende Wirkung<br />
der Pökelung ist noch nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich.<br />
Wer eine Infektion sicher vermeiden möchte, sollte auf den Ver -<br />
zehr von rohem Schweine- oder Rindfleisch verzichten.<br />
Dr. Böhmler, G. (LI BS); Dr. Brügmann, M.; Dr. Djuren, M. (VI OL);<br />
Höxter, K. (LK Goslar); Dr. Monazahian, M. (NLGA)<br />
Literatur:<br />
Böhmler, G.; Brügmann, M.; Djuren, M.; Höxter, K.; Monazahian, M.<br />
(2008): Sarcosporidien in Thüringer Mett als Auslöser einer lebensmittelassoziierten<br />
Gruppenerkrankung; eine bisher unterschätze Gefahr?,<br />
Journal für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, 3, 4-10<br />
33
34<br />
Hygienesituation bei der Fleischgewinnung<br />
Hygienisches Arbeiten ist eine unverzichtbare Voraussetzung für<br />
das Herstellen sicherer Lebensmittel. Die amtliche Lebensmittel -<br />
überwachung kontrolliert regelmäßig die Einhaltung der Hygieneanforderungen<br />
in Betrieben, die Lebensmittel herstellen <strong>und</strong> in<br />
den Verkehr bringen. Im Rahmen der Betriebskontrollen werden<br />
z. B. die Sauberkeit der Betriebsräume, die ordnungsgemäße<br />
Durchführung von Reinigungs- <strong>und</strong> Desinfektionsmaßnahmen,<br />
die Qualifikation <strong>und</strong> das Hygieneverhalten des Personals beim<br />
Umgang mit Lebensmitteln <strong>und</strong> die Durchführung vorgeschriebener<br />
Eigenkontrollen geprüft.<br />
Zur Beurteilung der Hygienesituation werden Tupferproben von<br />
Oberflächen <strong>und</strong> Geräten entnommen, sowie auch Proben der<br />
dort hergestellten Produkte. Im Jahr 2007 entnahmen die Lebensmittelüberwachungsbehörden<br />
im Rahmen von Betriebs kon trollen<br />
4.162 amtliche Tupfer- <strong>und</strong> Produktproben in Schlachthöfen, Zerlegebetrieben<br />
<strong>und</strong> Fleischereien. Diese Oberflächen- <strong>und</strong> Pro duktproben<br />
wurden im Veterinärinstitut bakteriologisch untersucht.<br />
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass die Be triebe, die ein<br />
gut funktionierendes Hygienekonzept haben <strong>und</strong> dies auch konsequent<br />
anwenden, die besten Resultate erzielten. So ergaben<br />
57% der durchgeführten Betriebsüberprüfungen kei ne oder nur<br />
geringe Mängel, 43% jedoch deutliche oder gar schwerwiegen de<br />
Mängel bei der Durchführung von Reini gungs- <strong>und</strong> Desinfekti onsmaßnahmen.<br />
Bei diesen Betrieben sind in der Regel eine Fehler -<br />
analyse <strong>und</strong> Verbesserungen im Reinigungs kon zept erforderlich.<br />
Die Untersuchungsergebnisse der Schlachtkörper von Rind <strong>und</strong><br />
Schwein fielen ähnlich aus wie im Vorjahr: Der Oberflächen keimgehalt<br />
lag bei 57% (60% im Vorjahr) der untersuchten Schlachtkörper<br />
in der vom EU-Recht als befriedigend bezeichneten Gren ze.<br />
Sal mo nellen wurden bei 384 untersuchten Schlachtkör per häl f ten<br />
in drei Fällen nachgewiesen. Für verkaufsfertige Fleischstücke,<br />
Ge flügel schlachtkörper <strong>und</strong> zerlegtes Fleisch wie z. B. Schnitzel,<br />
Braten fleisch, Rumpsteak <strong>und</strong> Geflügelfleisch gibt das EU-Recht<br />
keine Höchstkeimzahlen vor. Untersuchungsergebnisse dieser<br />
Produk te lassen jedoch ebenso Rückschlüsse auf den Hygiene zustand<br />
des Produktes, die Einhaltung von Hygienebestimmungen<br />
während des Herstellungsprozesses <strong>und</strong> den Hygienezustand des<br />
ein gesetzten Ausgangsmaterials zu. 957 amtliche Proben wurden<br />
untersucht, um Hygienemängel im Herstellungsprozess zu<br />
entdecken <strong>und</strong> daraus erfolgende Verbesserungen zu erzielen.<br />
Hygienisch besonders sensible Produkte sind Fleischzu berei tun gen<br />
(beispielsweise Thüringer Mett) <strong>und</strong> Hackfleisch. Insbesondere bei<br />
diesen Produkten ist es wichtig, dass das Ausgangsmaterial von<br />
besonders guter hygienischer Beschaffenheit ist. Nachteilig ist die<br />
Verwendung von kleinen Fleischabschnitten, die schon häufig<br />
aus der Kühlung <strong>und</strong> in die Hand genommen wurden, bevor sie<br />
zu Hackfleisch verarbeitet werden. Große Stücke, die wenig be -<br />
arbeitet <strong>und</strong> permanent gekühlt wurden, sind deutlich besser ge -<br />
eignet. Als hygienisch einwandfrei erwiesen sich nur 31% (40 von<br />
130) der untersuchten Hackfleischproben <strong>und</strong> 77% (79 von 102)<br />
der untersuchten Fleischerzeugnisse.<br />
Es ist besonders bei hygienisch sensiblen Produkten wie z. B. Hack -<br />
fleisch wichtig, dass das Ausgangsmaterial von einwandfreier Be -<br />
schaffenheit ist
Negative Vorgänge im Fleischhandel<br />
– Fallbeispiel aus dem Landkreis Hildesheim –<br />
»Gammelwurst in Bodenburg«<br />
... so lautete die Überschrift eines der zahlreich zu diesem<br />
Vorgang erschienenen regionalen <strong>und</strong> überregionalen<br />
Presseartikels im letzten Sommer.<br />
Auch der Landkreis Hildesheim hatte seinen »Fleischskandal«.<br />
Was war geschehen?:<br />
Im Juli 2007 erfolgte in einem hier ansässigen Fleischhandels be -<br />
trieb, der sich zuvor im Insolvenzverfahren bef<strong>und</strong>en hatte, eine<br />
– wie üblich – unangekündigte Überprüfung durch eine Amts -<br />
tier ärztin <strong>und</strong> einen Lebensmittelkontrolleur. Neben lebensmit telhygienerechtlichen<br />
Mängeln im Betrieb, nicht vorhandenen Belehrungsnachweisen<br />
für Beschäftigte etc. wurden im Ausliefe rungskühllager<br />
insgesamt ca. 1 Tonne auffällige Fleisch- <strong>und</strong> Wurst wa -<br />
ren vorgef<strong>und</strong>en. Im Detail handelte es sich hier um Waren mit<br />
abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten, aber auch um augenscheinlich<br />
sensorisch veränderte Erzeugnisse, die zum Teil schmierige<br />
Auflagerungen aufwiesen. Bei etlichen Lebensmitteln war<br />
aufgr<strong>und</strong> vollständig fehlender Kennzeichnung der Ware jegliche<br />
Rückverfolgbarkeit, d. h. eine Zuordnung der Ware zu Liefer schei -<br />
nen, ausgeschlossen.<br />
Zur Untersuchung wurden Proben an das LAVES, Lebensmit tel -<br />
institut Oldenburg (LI OL), eingesandt. Zusammen mit der Poli zei<br />
<strong>und</strong> unter Zuhilfenahme der Technischen Ermittlungsgruppe Um -<br />
welt (TEGU) der Polizeidirektion Göttingen wurde schließlich der<br />
sichergestellte Warenbestand zur Beweissicherung auch mittels<br />
Fotodokumentation vollständig erfasst <strong>und</strong> versiegelt, bevor er<br />
später unter Zustimmung des Verantwortlichen einer ordnungsgemäßen<br />
Entsorgung zugeführt wurde.<br />
Im Zuge der Ermittlungen schlossen sich im Landkreis Hildes heim<br />
Verdachtsprobenahmen in 22 belieferten Betrieben, hauptsächlich<br />
Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, an. Parallel wurden<br />
die zuständigen Behörden der insgesamt 71 mit den betreffenden<br />
Artikeln belieferten Betriebe sowie die der Hersteller informiert,<br />
da der Gewerbetreibende äußerte, die Lebensmittel seien ihm ja<br />
u. U. bereits verdorben geliefert worden. Insgesamt zeigte sich<br />
der Gewerbetreibende kooperativ <strong>und</strong> stellte Lieferunterlagen zur<br />
Verfügung. Die Ermittlungen wurden jedoch u. a. dadurch er -<br />
schwert, dass die Ware in den Lieferunterlagen im Vergleich zu<br />
den Rechnungen bzw. den vorgef<strong>und</strong>enen Artikeln z. T. voneinander<br />
abweichende Verkehrsbezeichnungen aufwies.<br />
Durch das LI OL erfolgte dann eine Vorabmitteilung, dass alle im<br />
Gewerbebetrieb gezogenen Proben sensorisch beanstandet werden<br />
<strong>und</strong> voraussichtlich als »nicht zum Verzehr geeignet« beurteilt<br />
würden. Später wurde mitgeteilt, dass ebenfalls einige der<br />
Verdachtsproben in belieferten Betrieben nicht verzehrsfähig wa -<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
ren. Eine Ges<strong>und</strong>heitsgefahr wurde allerdings in keiner der Pro -<br />
ben nachgewiesen. Abschließend wurden alle im Betrieb gezogenen<br />
Proben <strong>und</strong> die meisten der Verfolgsproben in den belieferten<br />
Betrieben als nach der EG-Lebensmittelbasisverordnung<br />
für den Verzehr ungeeignet, nicht sicher <strong>und</strong> nicht verkehrsfähig<br />
beurteilt. Das reguläre Tagesgeschäft war in der Zeit der Ermitt -<br />
lungen natürlich erheblich beeinträchtigt, da sich der Kreis der<br />
Ansprechpartner schnell auf Vorgesetzte im Hause, Bericht er -<br />
stat tung an ML, vorbereitende Pressearbeit, Kommunikation mit<br />
Polizei, LI OL <strong>und</strong> anderen betroffenen Landkreisen etc. erweitert<br />
hat te. Die personelle Unterstützung durch die TEGU wurde von<br />
hier erneut sehr begrüßt, da die Maßnahmen zur Beweis siche rung<br />
zum einen sehr zeitintensiv <strong>und</strong> mit dem vorhandenen Personal<br />
nicht ohne starke Einschränkung des weiteren Tagesgeschäftes<br />
möglich gewesen wären <strong>und</strong> zum anderen gerade außerordentlich<br />
wichtig für eine f<strong>und</strong>ierte Ahndung der Verstöße sind.<br />
Im Gefolge der ordnungsbehördlichen Maßnahmen nahm die<br />
Staatsanwaltschaft ergänzende Ermittlungen auf.<br />
Der Lebensmittelunternehmer hat nicht bestritten, dass Mängel<br />
vorgelegen haben, er sieht aber die Verantwortung eher bei seinen<br />
damals zuständigen Mitarbeitern. Die weitere Prüfung auf<br />
Vorsatz oder Fahrlässigkeit obliegt nun der Staatsanwaltschaft.<br />
Der in Rede stehende Betrieb hat zwischenzeitlich das Gewerbe<br />
abgemeldet.<br />
Dr.Schulz, I. (Landkreis Hildesheim)<br />
35
36<br />
Zusammenarbeit mit dem Fleischerverband <strong>Niedersachsen</strong>-Bremen bei der Zulassung von Betrieben<br />
Durch das seit dem 1. Januar 2006 anzuwendende neue EU-<br />
Lebens mittelhygienerecht müssen nun – mit einer Über gangs -<br />
frist bis zum Ende des Jahres 2009 – u. a. auch handwerkliche<br />
Fleischbetriebe zugelassen werden, die bislang aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
geringen Produktionsmenge nicht zulassungspflichtig waren. Um<br />
im Rahmen eines gemeinsamen Projektes eine optimale fachliche<br />
Beratung für die Durchführung des Zulassungsverfahrens anbieten<br />
zu können, hat das LAVES als die für die Betriebszu lassungen<br />
zuständige Behörde in <strong>Niedersachsen</strong> mit dem Fleischerverband<br />
<strong>Niedersachsen</strong>-Bremen Kontakt aufgenommen.<br />
Das LAVES stellte die Anforderungen <strong>und</strong> Voraussetzungen für<br />
die Erteilung einer Zulassung vor. Der Fleischerverband präsentierte<br />
sein Konzept zur Hygienepraxis, Eigenkontrolle <strong>und</strong> Doku -<br />
mentation in fleischhandwerklichen Betrieben. Auf dieser Basis<br />
wurden gemeinsame Betriebsbegehungen unter Einbeziehung<br />
der für die laufende Überwachung zuständigen kommunalen<br />
Behörden in Fleischbetrieben durchgeführt <strong>und</strong> das Zulas sungs -<br />
verfahren exemplarisch durchgespielt.<br />
Mittlerweile wurde bei 27 Fleischbetrieben so verfahren. Zwölf<br />
dieser Betriebe haben die Zulassung erhalten. Bei weiteren fünf<br />
Betrieben wurde zunächst eine Beratung vor Ort durchgeführt,<br />
um den Betriebsinhabern die noch zu ergreifenden Maßnah men<br />
zu erläutern. Die restlichen Betriebe werden im Laufe der nächsten<br />
Wochen <strong>und</strong> Monate intensiv auf die Zulassung vorbereitet.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen dem Fleischerverband, den zu zulassenden<br />
Betrieben, den kommunalen Überwachungsbehörden<br />
<strong>und</strong> dem LAVES wird stetig fortentwickelt, um die einheitliche<br />
Umsetzung der hygienerechtlichen Vorgaben innerhalb Nieder -<br />
Die Zusammenarbeit zwischen dem Fleischerverband, den zu zu lassen<br />
den Betrieben, den kommunalen Überwachungsbehörden <strong>und</strong><br />
dem LAVES wird stetig fortentwickelt<br />
sachsens zu gewährleisten <strong>und</strong> die rechtzeitige Zulassung der betreffenden<br />
Betriebe vor Ablauf der o. g. Übergangsfrist zu erreichen.<br />
Hierzu ist es unabdingbar, dass sich alle betroffenen Le bensmittelunternehmer<br />
der bestehenden Zulassungspflicht für ihre Betriebe<br />
bewusst sind <strong>und</strong> rechtzeitig einen Antrag auf Zulassung<br />
stellen.<br />
Dr. Bisping, M.; Dr. Senning, G.; Haring, S. (Dez. 21)
Betriebe im EG-Zulassungsverfahren<br />
Der <strong>Verbraucherschutz</strong> besitzt einen hohen Stellenwert. Er ist<br />
da von gekennzeichnet, dass insbesondere von EU-Vorschriften<br />
hohe Anforderungen an Produkte <strong>und</strong> Betriebe gestellt werden.<br />
Da seit dem 1. Januar 2006 eine neue EU-Hygienegesetz gebung<br />
gilt, die auch in deutsches Recht umgesetzt wurde, kommen auf<br />
bisher nicht zulassungspflichtige Betriebe, die Lebensmittel tierischen<br />
Ursprungs produzieren, verarbeiten <strong>und</strong> vertreiben be -<br />
son dere Anforderungen zu. Diese Betriebe müssen spätestens<br />
bis zum 31. Dezember 2009 zugelassen sein. Bisher war nur eine<br />
Regis trierung bei der Lebensmittelüberwachungsbehörde vorgeschrie<br />
ben, die natürlich auch regelmäßige, risikoorientierte Kontrollen<br />
<strong>und</strong> Probenahmen nach sich zog.<br />
Im Zulassungsverfahren der handwerklichen Betriebe zählt zu<br />
den Aufgaben der kommunalen Überwachungsbehörde insbesondere<br />
die Beratung <strong>und</strong> Unterstützung im Hinblick auf dieses<br />
Verfahren.<br />
Alle in Frage kommenden Betriebe wurden im Zusammenhang<br />
mit der anstehenden Zulassung aufgesucht, es wurde eine Be -<br />
triebs kontrolle durch den beamteten Tierarzt <strong>und</strong> einen Lebens -<br />
mittelkontrolleur durchgeführt <strong>und</strong> der Betriebsleiter wurde in<br />
der erforderlichen Dokumentation unterwiesen. Notwendige An -<br />
tragsunterlagen wurden zu diesem Termin ausgehändigt.<br />
Zum Eintritt in das Zulassungsverfahren ist ein umfassender Be -<br />
triebsdurchgang von der reinen zur unreinen Seite erforderlich,<br />
in den alle Räumlichkeiten inklusive Personalräume einbezogen<br />
werden müssen.<br />
Nach dieser umfangreichen Inspektion wird der Betriebsleiter auf<br />
Mängel hingewiesen.<br />
Nach dem Durchgang folgt eine Sichtung der betriebsspezifischen<br />
Eigenkontrollen.<br />
Eine Abschlussbesprechung über Unregelmäßigkeiten <strong>und</strong> Mängel,<br />
die abzustellen sind, erfolgt nach jeder Überprüfung von Betrieben,<br />
so auch bei der Zulassungsvorbereitung. Dem Betrieb wird<br />
die Einschätzung der Überwachung mitgeteilt.<br />
Die Behörde erstellt nach dem Ergebnis dieser ersten Über prüf -<br />
ung eine Prioritätenliste <strong>und</strong> empfiehlt den Gewerbe treiben den,<br />
die es schaffen können, frühzeitig in das Zulassungsverfahren<br />
einzusteigen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Im Landkreis Harburg gibt es 29 dieser zulassungspflichtigen Be -<br />
triebe, die während des Verfahrens durchschnittlich dreimal be -<br />
sucht werden, dies mit einem Zeitaufwand ca. drei St<strong>und</strong>en (sechs<br />
Ar beitsst<strong>und</strong>en der zwei Mitarbeiter), so dass sich ein Gesamt -<br />
auf wand von ca. 500 St<strong>und</strong>en ergibt.<br />
Für die anderen Betriebe besteht die Tätigkeit der Überwach ungsbehörde<br />
weiterhin in der Beratung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
bei Neu- <strong>und</strong> Umbaumaßnahmen<br />
bei der Umsetzung von Hygieneanforderungen an Betriebs abläufe<br />
bei der Umsetzung der notwendigen Eigenkontrollen <strong>und</strong> Do -<br />
kumenta tion<br />
Dr. Krüger, A. (Landkreis Harburg)<br />
37
38<br />
Fische <strong>und</strong> Meerestiere<br />
Perfluorierte Tenside (PFT) in Fischen<br />
PFT sind Verbindungen, die in vielen industriellen Produkten zu<br />
finden sind. Als Stoffe, welche die Oberflächenspannung herabsetzen,<br />
sind sie z. B. in Teflonbeschichtungen von Bratpfannen<br />
sowie in der Imprägnierung von Textilien zu finden. PFT sind für<br />
Mensch <strong>und</strong> Tier toxisch. Darüber hinaus sind PFT bioakkumulierend,<br />
d.h. sie reichern sich im Körper an <strong>und</strong> werden dort nur<br />
sehr langsam abgebaut. PFT sind weltweit verbreitet <strong>und</strong> wurden<br />
sogar schon in Leberproben von Eisbären nachgewiesen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> zahlreicher Meldungen aus Nordrhein-Westfalen über<br />
sehr hohe Belastungen von Fischen mit perfluorierten Tensiden<br />
wurden auch in <strong>Niedersachsen</strong> Messungen dieser Art durch geführt.<br />
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 98 Proben aus Nieder sachsen<br />
mit Hilfe der LC-MS/MS-Technik auf Verbindungen dieser Substanzgruppe<br />
untersucht. Während 62 dieser Proben aus Flüssen<br />
stammten, wurden 36 weitere Proben niedersächsi schen Aqua -<br />
kulturen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes<br />
entnommen.<br />
Während in den Fischproben aus niedersächsischen Aquakul tu -<br />
ren durchweg keine Rückstände von perfluorierten Tensiden nachweisbar<br />
waren, enthielten 45 Proben aus niedersächsischen Flüssen<br />
teilweise erhebliche Mengen der Verbindung Perfluoroctan -<br />
sulfonsäure (PFOS). Seitens des B<strong>und</strong>esinstitutes für Risiko bewer -<br />
tung (BfR) werden PFOS-Konzentrationen von bis zu 20 µg/kg<br />
als tolerabel eingestuft. In 20 der untersuchten Proben wurde<br />
allerdings dieser Wert überschritten. Der Maximalwert von 127<br />
µg/kg PFOS wurde in einer Brasse aus der Elbe nachgewiesen.<br />
Die PFT-Problematik bedarf – nicht nur in Bezug auf Fische – in<br />
den kommenden Jahren einer Aufarbeitung.<br />
Dr. Effkemann, S. (IFF CUX)<br />
In einer Brasse aus der Elbe wurde der Maximalwert von 127 µg/kg<br />
PFOS nachgewiesen
PSP-Toxine in Muschelkonserven<br />
Im Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse wurden im Jahr<br />
2007 insgesamt 251 Teilproben Muscheln <strong>und</strong> Muschelkon ser -<br />
ven auf PSP-Toxine un tersucht. Dabei wurden in insgesamt neun<br />
Konserven spanischer Pfahl muscheln bis zu 1.900 µg/kg (STXdiHCL<br />
Equivalente) Nerven gifte aus der Gruppe der PSP-(Paraly -<br />
tic Shellfish Poisoning) To xi ne nachgewiesen. Diese Toxine sind<br />
immer wieder ursächlich für zahlreiche Vergiftungsfälle im Zu -<br />
sammenhang mit dem Verzehr von Muscheln. Der Grenzwert für<br />
diese Verbindungsklasse liegt bei 800 µg/kg (STX-diHCL Equi va -<br />
lente). Nach einer europaweiten Schnellwarnung wurden die ausschließlich<br />
in Deutschland vertrie benen Muscheln aus dem Ver -<br />
kehr gezogen.<br />
PSP-Toxine werden unter geeigneten Bedingungen durch be stim mte<br />
Algenarten (z. B. Gonyaulax tamarensis) produziert. Unter günstigen<br />
Bedingungen können sich diese explosionsartig vermehren<br />
<strong>und</strong> zu regelrechten Algenblüten führen. Ausgewachse ne Mies -<br />
muscheln (Mytilus edulis) filtrieren bis zu drei Liter Meerwas ser<br />
pro St<strong>und</strong>e. Bei diesem Prozess reichern sich die Toxine in der<br />
Muschel stark an <strong>und</strong> können nach deren Verzehr dem Men schen<br />
sehr gefährlich werden, da sie stark lähmend wirken. Bei einfachen<br />
Vergiftungen tritt lediglich ein Kribbeln in den Extremitä -<br />
ten auf; hochgradige Vergiftungen enden nicht selten tödlich.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> müssen Muscheln vor dem Inverkehrbringen<br />
auf die Anwesenheit dieser Substanzen untersucht werden. Lei -<br />
der werden in einigen Ländern immer noch Tierversuche zu diesem<br />
Zweck eingesetzt. Oft kommt es dabei zu falschen Ergebnissen.<br />
Aus diesen Gründen werden in Deutschland für diese <strong>und</strong><br />
verwandte Fragestellungen nahezu ausschließlich chemisch-analytische<br />
Verfahren eingesetzt.<br />
Dr. Effkemann, S. (IFF CUX)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
39
40<br />
»Fisch-Döner«, »Kaviarcreme«, »Tintenfischringe«: Fallberichte zur Verbrauchertäuschung <strong>und</strong> zur<br />
Beurteilung unbekannter Risiken<br />
Innovation in der Herstellung von Fischereierzeugnissen<br />
In der Herstellung von Fischerzeugnissen ist gegenwärtig ein In -<br />
novationstrend zu beobachten, bei dem die amtliche Unter s u -<br />
chung im Hinblick auf Verbrauchertäuschung <strong>und</strong> Verbraucher -<br />
in formation zunehmend gefordert ist. Darüber hinaus sind bei<br />
der Abschätzung möglicher Risiken für den Verbraucher weitere,<br />
über die Spezifika bei Fischereierzeugnissen hinausgehende<br />
Gefahren für die Lebensmittelsicherheit zu erkennen <strong>und</strong> zu be -<br />
werten. Dies erfordert nicht nur einen aktuellen Informati ons -<br />
stand zu Trends der Fischverarbeitung vor dem Hintergr<strong>und</strong> des<br />
weltweiten Fischmarktes, sondern auch die analytische Kompe -<br />
tenz, gegebenenfalls mit Hilfe verstärkter Zusammenarbeit der<br />
Untersuch ungseinrichtungen.<br />
Folgende Beispiele von Fischerzeugnissen sollen die Problematik<br />
veranschaulichen:<br />
»Fisch-Döner«<br />
Ein als Fisch-Döner bezeichnetes Fischerzeugnis wurde in einem<br />
EU-zugelassenen Betrieb hergestellt <strong>und</strong> innergemeinschaftlich<br />
nach Deutschland verbracht. In einem Landkreis <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
ist das Erzeugnis bei einem Fischhändler auffällig geworden. Dem<br />
Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse des LAVES wurde ein<br />
Fisch-Döner, ganz mit Stab<br />
kegelartiger, backteigfarbener, ca. 8 kg schwerer Förmling in der<br />
Form eines Drehspießes vorgestellt. Er bestand aus feinzerkleinertem<br />
musigen Material mit grauweißlichen, bläulich schimmernden,<br />
erbsengroßen, sehr festen Gewebestücken (siehe Bild unten<br />
links). Laut Zuta tenliste waren neben Tintenfisch (Mollusken), Panier<br />
mehl, Palm fett, Zellulosepulver, Stärke, Kräuter- <strong>und</strong> Gewürzmi<br />
schun gen, Stabilisatoren Dextrose, Antioxidantien, Konser vie -<br />
rungsstoffe <strong>und</strong> Geschmacksverstärker enthalten. Das als Fisch -<br />
erzeugnis aufgemachte, aber nicht leitsatzkonforme Produkt enthielt<br />
auf 5 kg Erzeugnis lediglich 270 g (5,3%) zerkleinertes Molluskenfleisch<br />
(siehe Bild unten rechts). Der nach dem Auftauen<br />
musige back teigähnliche Haupt anteil des Erzeugnisses ließ sich<br />
sehr leicht von den wenigen stückigen Anteilen mit Wasser trennen.<br />
Optisch äh nelte das Produkt ausschließlich einer faden Teigware,<br />
dennoch zeigte der relativ hohe Gehalt an freiem Stick -<br />
stoff den ungenügenden Fri schezustand der im Spieß enthalte-<br />
Fisch-Döner: präparativ gewonnener Anteil von Molluskenfleisch
nen Fisch ereier zeug nisse. Au ßerdem wurde vom Koopera tions -<br />
partner LUA Bremen Listeria monocytogenes qualitativ nachgewiesen.<br />
Das Erzeugnis wurde als nicht verkehrs- <strong>und</strong> verzehrsfähig<br />
beurteilt <strong>und</strong> beanstandet.<br />
»Panierte Tintenfischringe«<br />
Bei einem als Tintenfischringe bezeichneten Produkt konnten<br />
mittels der Isolelektrischen Fokussierung zur Fischarten diffe ren -<br />
zierung Tintenfischeiweiße nicht eindeutig nachgewiesen werden.<br />
Außerdem wurde die nicht zulässige Verwendung von Polyphos -<br />
phaten nachgewiesen. Das Produkt wurde wegen Verstoßes ge -<br />
gen die Verwendung nicht zugelassener Zusatzstoffe beanstandet.<br />
Die Verbrauchertäuschung war auffällig <strong>und</strong> die Herstel lung<br />
schnitt- <strong>und</strong> formfähiger Erzeugnisse – möglicherweise aus Tin -<br />
ten fischfarce – unter Verwendung wasserbindender Polyphos phate<br />
ist zudem mit anderen Risiken verb<strong>und</strong>en als die Herstellung<br />
originärer Tintenfischringe im Panademantel.<br />
»Kaviarcreme«<br />
Das organoleptisch unauffällige, als Kaviarcreme bezeichnete Er -<br />
zeugnis, hergestellt bei einem EU-zugelassenen Feinkost herstel ler<br />
in Deutschland, wurde wegen Verbrauchertäuschung in Be zug<br />
auf die Verwendung von Kaviar beanstandet. Die vergleichen de<br />
Prüfung der aus der Kaviarcreme isolierten Partikel mit der si chergestellten<br />
Rohware zeigte, dass es sich bei den Parti keln nicht um<br />
Rogen verschiedener Störarten (Echter Kaviar oder Kaviar) handelte.<br />
Auch die als Kabeljau-Rogen verwendete Roh ware konnte<br />
als verwendeter Ausgangsstoff für die Kaviar creme ausgeschlossen<br />
werden (siehe Bild oben rechts). Der Charakter der verwendeten,<br />
weder wasser-, alkohol- noch fettlöslichen Par tikel war<br />
nicht festzustellen.<br />
Herausforderung an die Überwachungsbehörden<br />
In allen drei geschilderten Fällen erfolgte die Herstellung in EUzugelassenen<br />
Betrieben. Die Innovation in der Fischverarbeitung<br />
stellt die Vor-Ort-Behörden vor neue Herausforderungen. Han delt<br />
es sich außerdem um einen Hersteller in einem anderen EU-Mitgliedsstaat,<br />
ist die fachliche Verständigung zwischen den zu stän -<br />
digen Behörden für Herstellung <strong>und</strong> Handel hinsichtlich Tech nologie,<br />
Rohwaren, Überprüfung der Eigenkontrollen <strong>und</strong> lebensmittelrechtlicher<br />
Bewertung besonders wichtig. Ins be sondere beim<br />
Beispiel des Fisch-Döners wurde die Prüfung des rechtmäßigen<br />
Herstellens <strong>und</strong> innergemeinschaftlichen Verbrin gens dringend<br />
empfohlen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Rogen verschiedener Fischarten im Vergleich zu Partikeln aus Kaviarcreme<br />
Anhand der o. g. Beispiele zeigte sich, dass vorrangig das Vor gehen<br />
gegen Verbrauchertäuschung oder gegen den unerlaubten<br />
Zu satz von Zusatzstoffen die einzigen Instrumente sind, den Verbrau<br />
cher vor derzeit aufgr<strong>und</strong> der wenigen vorliegenden Hin wei -<br />
se zur Zusammensetzung <strong>und</strong> Herstellung des Produktes nicht<br />
ab schätzbaren Risiken zu schützen.<br />
Dr. Bartelt, E; Dr. Etzel, V. (IFF CUX)<br />
41
42<br />
Matjes – ein Genuß für Schwangere?<br />
Immer wieder liest man in Ratgebern für Schwangere, dass in der<br />
Schwangerschaft auf bestimmte Fischereierzeugnisse u. a. auf<br />
Matjes verzichtet werden soll. Als Gr<strong>und</strong> hierfür ist die regelmäßige<br />
Belastung mit Listeria monocytogenes genannt.<br />
Listeria monocytogenes kann bei Schwangeren Infektionen verursachen,<br />
die das Ungeborene gefährden. Diese Empfehlungen<br />
spiegeln auch niedersächsische Ergebnisse der letzten Jahre wi -<br />
der, in denen immer wieder Listeria monocytogenes in Matjes<br />
<strong>und</strong> Matjesartigen nachgewiesen wurden. In der Zeitschrift »Mat -<br />
jes-News 01/07« wurde Matjes aufgr<strong>und</strong> seiner wertvollen In -<br />
haltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren explizit für Schwangere <strong>und</strong><br />
junge Mütter empfohlen. Die nicht zu bestreitende Belastung mit<br />
Listeria monocytogenes wurde in dem Artikel nicht thematisiert.<br />
Dieser Artikel wurde zum Anlaß genommen, die derzeitige Si tu -<br />
ation Matjes – Listeria monocytogenes – Belastung zu überprüfen.<br />
Neben 47 Matjesartigen kamen 17 echte Matjes zur Untersu -<br />
chung. Als »echter Matjes« wird leicht gesalzener <strong>und</strong> gereifter<br />
Hering ohne äußerlich erkennbaren Ansatz von Milch <strong>und</strong> Ro gen<br />
bezeichnet.<br />
Das Fleisch von frisch gefangenem Seefisch ist keimfrei, zur Verunreinigung<br />
mit Keimen u. a. mit Listerien kann es während der<br />
Verarbeitung kommen.<br />
Bei allen 17 »echten Matjes« Proben wurde durchgängig in keiner<br />
Probe Listeria monocytogenes nachgewiesen.<br />
Die Anzahl der untersuchten Proben ist jedoch nicht so repräsentativ,<br />
dass Schwangeren der Verzehr empfohlen werden kann. Da<br />
es sich um eine »Momentaufnahme« handelt, sollte man nach<br />
wie vor Vorsicht walten lassen <strong>und</strong> in der Schwangerschaft auf<br />
dieses Lebensmittel verzichten.<br />
Berges, M.; Dr. Lindena, U. (LUA Bremen, Außenst. Brhv.)<br />
Bei frisch gefangenem Seefisch ist das Fleisch keimfrei. Zu Verun rei ni -<br />
gun gen mit Keimen kommt es meist erst während der Verarbeitung
Angebrochene Thunfischdosen – ein Risiko?<br />
Thunfisch in Dosen in Öl oder Lake wird während der Herstel lung<br />
in Dosen sterilisiert, so dass bei deren Öffnung ein praktisch steriles<br />
Produkt vorliegt. Dennoch werden häufig bei Thunfisch aus<br />
angebrochenen Dosen hohe Keimzahlen gef<strong>und</strong>en. Wie kommt<br />
es dazu?<br />
Thunfischmuskulatur in Öl oder Lake aus Dosen ist eine beliebte<br />
Zutat zu Salaten <strong>und</strong> auch als Pizza-Auflage. In der Gastro no mie<br />
werden deswegen oft große Packungseinheiten, das heißt z. B.<br />
Dosen mit 1.400 g Inhalt verwendet. Unhygienische Entnahme<br />
führt in Verbindung mit zu langer <strong>und</strong>/oder unsachgemäßer La -<br />
gerung des Anbruchs zu hohen Keimbelastungen. Insbesondere<br />
wenn sich bestimmte Keime wie Enterobacteriaceen oder Laktobazillen<br />
vermehren, kann es zur Bildung von Histamin <strong>und</strong> somit<br />
zu ernsthaften Lebensmittelvergiftungen kommen. Wie Unter suchungen<br />
aus dem Jahr 2005 belegen, sind hohe Keimzahlen notwendige,<br />
jedoch nicht hinreichende Bedingung für hohe Hista -<br />
mingehalte.<br />
Bereits in den Jahren 2005 <strong>und</strong> 2006 wurde Thunfisch aus geöffneten<br />
Behältnissen beprobt. Aufgr<strong>und</strong> der gleichbleibend ho hen<br />
Beanstandungsquoten in den letzten Jahren wurde dieses Pro -<br />
gramm im Jahr 2007 fortgeführt.<br />
Es wurden 2007 insgesamt 38 Thunfischproben aus geöffneten<br />
Behältnissen aus Bremen <strong>und</strong> <strong>Niedersachsen</strong> organoleptisch <strong>und</strong><br />
bakteriologisch untersucht. Bei sechs Erzeugnissen wurden bereits<br />
bei der Organoleptik (Aussehen, Geruch, Geschmack) verdorbenheits<br />
bedingte Mängel wie faulig, sauer, hefig, gärig sowie we niger<br />
gravierende Mängel wie alt, dumpf, muffig festgestellt. Bei<br />
allen sechs Proben korrelierte auch die Organoleptik mit dem<br />
Nachweis hoher bis sehr hoher Keimzahlen.<br />
13 Produkte waren im Aussehen <strong>und</strong> im Geruch nicht offensichtlich<br />
verdorben, wiesen jedoch so hohe Keimzahlen auf, dass es<br />
zu einer Beanstandung kam. Insgesamt wurden somit 19 von<br />
38 Thunfischproben (50%) aus geöffneten Behältnissen beanstandet.<br />
Bei den Keimen, die zum Verderb der vorliegenden Proben führten,<br />
handelte es sich durchgängig um Pseudomonaden <strong>und</strong> En -<br />
terobacteriaceen. Vereinzelt wurden auch erhöhte Gehalte von<br />
Hefen <strong>und</strong> Laktobazillen gef<strong>und</strong>en.<br />
Die Beanstandungsquote liegt somit nicht nur im Bereich des Vorjahrs,<br />
sondern ist sogar noch gestiegen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Geöffnete Thunfischdosen sollten höchstens zwei Tage abgedeckt im<br />
Kühlschrank aufbewahrt werden<br />
Um hohe Keimbelastungen bei geöffneten Dosen Thunfisch zu<br />
vermeiden, wird empfohlen:<br />
Thunfisch mit sauberen Gerätschaften entnehmen<br />
kleine Packungseinheiten verwenden<br />
geöffnete Behältnisse im Kühlschrank lagern<br />
geöffnete Dosen höchstens zwei Tage abgedeckt im Kühl -<br />
schrank aufbewahren<br />
Dr. Lindena, U.; Berges, M. (LUA Bremen, Außenst. Brhv.)<br />
43
44<br />
Milch <strong>und</strong> Milcherzeugnisse<br />
Ist bei Milch, Milcherzeugnissen, Butter <strong>und</strong> Käse »Alles in Butter«?<br />
Diese Frage wurde vom Lebensmittelinstitut Braunschweig im Jahr<br />
2007 bei 1.855 Proben beantwortet. Dabei wurden 493 (27%)<br />
Proben beanstandet (siehe Abbildung <strong>3.</strong>2). Eine Übersicht über<br />
die Art der Beanstandungen ist Tabelle <strong>3.</strong>3 zu entnehmen. Zur<br />
Unter suchung <strong>und</strong> Beurteilung von Speiseeis wird auf den diesbezüg<br />
lichen Bericht in Kapitel 3 verwiesen.<br />
Um neben der statistischen Auswertung einen Einblick in die Praxis<br />
der Untersuchung <strong>und</strong> Beurteilung zu geben, werden exemplarisch<br />
an dieser Stelle einige Schwerpunktthemen aus 2007<br />
vorgestellt:<br />
Abbildung <strong>3.</strong>2: Gesamtprobenzahl/Anzahl der Beanstandungen<br />
Funktionelle Zutaten <strong>und</strong> Nährwertkennzeichnung bei<br />
Milcherzeugnissen – Trends<br />
Der Markt mit Milcherzeugnissen, die spezielle Lebensmittel zu -<br />
taten enthalten, wächst rasant.<br />
Sehr beliebt sind Joghurterzeugnisse mit probiotischen Bakte ri -<br />
enkulturen, die mit positiven Wirkungen für den Darm <strong>und</strong> das<br />
Verdauungssystem beworben werden. Während diese Wirkun gen<br />
durch wissenschaftliche Studien weitgehend als belegt angesehen<br />
werden können, warten manche Hersteller in jüngster Zeit<br />
mit Werbeaussagen auf, deren Wirkungen nach hiesiger Ansicht<br />
umstritten sind.<br />
Joghurterzeugnisse mit probiotischen Bakterienkulturen sind beim<br />
Verbraucher sehr beliebt
Tabelle <strong>3.</strong>3: Art der Beanstandungen<br />
Beanstandungsgründe<br />
Anzahl der Proben<br />
Anzahl<br />
Beanstandungen*<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädlich/<br />
-gefährdend<br />
nicht zum Verzehr<br />
geeignet<br />
wertgemindert<br />
irreführende Angaben<br />
fehlende Kenntlichma -<br />
chung von Zusatzstoffen<br />
fehlende oder mangelhafte<br />
Kennzeichnung<br />
Hinweis auf Hygiene -<br />
mängel im Betrieb<br />
Sonstige<br />
Milch<br />
241<br />
27<br />
0<br />
10<br />
0<br />
0<br />
0<br />
11<br />
2<br />
4<br />
Milcherzeugnisse<br />
796<br />
262<br />
0<br />
60<br />
1<br />
34<br />
7<br />
63<br />
91<br />
*Mehrfachnennungen je Probe sind möglich<br />
6<br />
Butter Käse<br />
69<br />
9<br />
0<br />
1<br />
4<br />
0<br />
0<br />
4<br />
0<br />
0<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
749<br />
195<br />
0<br />
4<br />
8<br />
45<br />
17<br />
102<br />
8<br />
11<br />
Beispielhaft seien hier zwei Produktwerbungen aus dem<br />
Jahr 2007 aufgeführt:<br />
Für ein Joghurtgetränk wurde mit der Aussage »Hilft weniger zu<br />
essen« geworben. Laut Herstellerangaben soll ein regelmäßiger<br />
(täglicher) Konsum des Erzeugnisses über drei Wochen den Ap -<br />
petit zügeln. Verwiesen wird auf wissenschaftliche Studien, die<br />
auf der Homepage des Herstellers im Internet abrufbar sind. Be -<br />
wirkt werden soll die Wirkung durch eine neuartige Kombi na ti -<br />
on von Palm- <strong>und</strong> Haferöl, die zu 2% im Joghurt enthalten ist.<br />
Der Inhalt der vorliegenden Studien nährte den Zweifel an dem<br />
angeblichen Nachweis der behaupteten Wirkaussagen. Die Be -<br />
hauptung wurde daher als wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert<br />
beanstandet.<br />
Als W<strong>und</strong>erwaffe werden auch konjugierte Linolsäuren (CLA =<br />
Conjugated Linoleic Acid) beworben. »CLA kann die Funktion<br />
eines Fat Managers übernehmen.«… »Der regelmäßige Verzehr<br />
kann einen Beitrag zum Abbau von Körperfett leisten.«<br />
Mit solchen <strong>und</strong> ähnlichen Versprechungen soll der Absatz an<br />
Milcherzeugnissen gesteigert werden. CLA sind Abkömmlinge<br />
der essentiellen Fettsäuren, deren Doppelbindung in cis- <strong>und</strong>/oder<br />
trans-Stellung konjugiert sind. Sie entstehen im Pansen von Wie -<br />
derkäuern <strong>und</strong> sind folglich in Milch <strong>und</strong> Milchprodukten <strong>und</strong> im<br />
Fleisch von Wiederkäuern enthalten. Nach den Ergebnissen in<br />
Tierversuchen sowie an Zellkulturen reduziert eine Zugabe von<br />
CLA die Fettmasse <strong>und</strong> erhöht die Magermasse. Beim Men schen<br />
hingegen ist ein Nutzen bislang nicht eindeutig nachgewiesen,<br />
negative Wirkungen wie beispielsweise ein Absenken des HDL-<br />
Cholesterols sind nicht auszuschließen. Die Wirkaussagen wurden<br />
daher ebenfalls als wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert<br />
beanstandet.<br />
45
46<br />
Tabelle <strong>3.</strong>4: Übersicht über Probenspektrum <strong>und</strong><br />
Beanstandungen<br />
Lebensmittel gesamt<br />
Anzahl<br />
Schafskäse, gesamt<br />
Schafskäse, griechisch (ohne Feta)<br />
Schafskäse, französisch<br />
Schafskäse, spanisch<br />
Ziegenkäse<br />
Büffelmozzarella<br />
Salate mit Käse<br />
Gefülltes Gemüse<br />
Fertiggerichte<br />
143<br />
* auf Gr<strong>und</strong> der geringen Probenzahl keine Aussage<br />
27<br />
50<br />
6<br />
84<br />
6<br />
7<br />
12<br />
15<br />
beanstandet<br />
Anzahl (%)<br />
12 (8,4%)<br />
1 (3,7%)<br />
0<br />
1 (–*)<br />
2 (2,4%)<br />
0 (–*)<br />
2 (–*)<br />
2 (–*)<br />
5 (–*)<br />
Zunehmend wird bei Milcherzeugnissen der geringe Fettgehalt<br />
von Produkten in der Aufmachung in den Vordergr<strong>und</strong> gestellt.<br />
»0% Fett«, »0,1% Fett«, »nur 0,5% Fett« prangt in großen Let -<br />
tern auf den Schauseiten der Verpackungen, oft begleitet von<br />
stilisierten schlanken Figuren, die dem Verbraucher suggerieren,<br />
dass er ein Erzeugnis ersteht, das gut für die schlanke Linie ist.<br />
Dass diese Erzeugnisse aber beileibe nicht so kalorienarm sind,<br />
wie der erste Blick vermuten lässt, zeigt ein näheres Studium der<br />
Nährwerttabelle, meist verschämt auf der Rückseite der Verpack<br />
ungen. Oft handelt es sich um ein kräftig gesüßtes Erzeugnis<br />
mit beträchtlichem Kaloriengehalt. Da in der EG das Leitbild des<br />
ver ständigen <strong>und</strong> aufmerksamen Verbrauchers vorherrscht, ist<br />
die se Art der Aufmachung im Normalfall nicht zu beanstanden,<br />
denn die Aussagen bezüglich des Fettgehaltes sind meist zutreffend<br />
<strong>und</strong> eine Nährwertkennzeichnung ist in aller Regel angegeben.<br />
Dem flüchtigen Verbraucher dürfte trotzdem oft nicht klar<br />
sein, dass er mit solchen Produkten eher wenig für seine schlan ke<br />
Linie tun kann.<br />
Tierartbestimmung in Käse oder »Macht das Tier für un -<br />
seren Schafskäse Muhhh?« – Die Untersuchungen<br />
Von Geschmack <strong>und</strong> Aussehen lassen sich Schafs- <strong>und</strong> Ziegen -<br />
käse nicht sicher von Kuhmilchprodukten unterscheiden. Die Sortenvielfalt<br />
ist zudem groß. Jedoch kann man mit einer Protein -<br />
analyse Kuhmilchproteine von Schaf- <strong>und</strong> Ziegenmilchproteinen<br />
unterscheiden.<br />
Im Lebensmittelinstitut Braunschweig werden Milch, Milcher zeug -<br />
nisse <strong>und</strong> Käse auf die Tierart der verwendeten Milch untersucht.<br />
Von den 370 verschiedenen Proben waren 35 zu beanstanden.<br />
Es handelte sich im Gegensatz zu den letzten Jahren fast nur um<br />
lose Proben. Eine Aufstellung der wichtigsten Produkte ist in Ta -<br />
belle <strong>3.</strong>4 dargestellt.
Feta – der geschützte Käse<br />
Lange Zeit war es in Europa üblich, dass ein »Feta« aus Schaf -<br />
milch bestehen konnte, aber noch lange nicht musste. Salz lakenkäse<br />
aus Kuhmilch wurde unter anderem vor allem in Deutsch -<br />
land <strong>und</strong> Dänemark hergestellt <strong>und</strong> unter diesem Namen vermarktet.<br />
Doch die EU entschied, dass dieser Käse schützenswert<br />
ist.<br />
Das Produkt<br />
Bei Feta handelt es sich um einen Weichkäse, welcher aus reiner<br />
Schafmilch oder aus Schafmilch mit einem Zusatz von Ziegen milch<br />
hergestellt wird. Nach dem Pasteurisieren der Kesselmilch wird<br />
diese mit Starterkulturen versetzt <strong>und</strong> so zur Gerinnung gebracht.<br />
Der anschließend nur leicht gepresste, geformte <strong>und</strong> geschnittene<br />
Bruch wird dann in ein Salzbad verbracht, um darin für ca.<br />
einen Monat zu reifen (aus: Handbuch der Käse. Eine Enzyklo pä -<br />
die.; Volkswirtschaftlicher Verlag Kempten, 1974). Der Käsekör per<br />
bleibt auf diese Weise rindenlos <strong>und</strong> wird am Ende der Reifung<br />
zu dem, was der Verbraucher an ihm schätzt – ein weicher, gut<br />
durchfeuchteter <strong>und</strong> stark salzhaltiger weißer Käse mit vielseitigen<br />
Einsatzmöglichkeiten in der kalten <strong>und</strong> warmen Küche.<br />
Schaf oder nicht Schaf<br />
Wer vor dem 15. Oktober 2007 einen Feta erstehen wollte, mus ste<br />
genau hinsehen, damit er keinen Weichkäse aus Kuhmilch<br />
nach Hause trug. Hersteller konnten bis zu diesem Zeitpunkt<br />
auch einen Salzlakenkäse aus Kuhmilch als Feta in den Verkehr<br />
bringen. Doch damit ist jetzt Schluss.<br />
Das Urteil<br />
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1829/2002 vom 14. Oktober 2002<br />
hat die Kommission die Bezeichnung »Feta« als geschützte Ur -<br />
sprungs bezeichnung zu Gunsten Griechenlands aufgenommen.<br />
Die Über gangsfrist von fünf Jahren, die den Herstellern anderer<br />
EU-Län der eingeräumt wurde, ist nun verstrichen, so dass ab dem<br />
15. Oktober 2007 die weiße Scheibe aus Schafmilch (gegebenenfalls<br />
mit Zusatz von Ziegenmilch) nur noch mit der Bezeichnung<br />
»Feta« versehen werden darf, wenn sie auf dem griechischen Festland<br />
sowie der Insel Lesbos hergestellt wurde.<br />
Die Untersuchungen<br />
Immer wenn eine Frist verstreicht, gilt es für die amtliche Lebens -<br />
mittelüberwachung zu prüfen, ob sich die Hersteller auch an diese<br />
rechtlichen Vorgaben halten. So hat das Lebensmittelinstitut<br />
Braunschweig im Jahre 2007 insgesamt 62 Proben, die unter der<br />
Bezeichnung »Feta« in den Verkehr gebracht wurden, auf die<br />
Tierart der eingesetzten Milch untersucht. Die Proben wurden zumeist<br />
aus dem Einzelhandel entnommen, sowohl in abgepackter<br />
als auch in loser Form. Wertet man die Ergebnisse aus, zeigt sich<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
bei verpackter Ware Erfreuliches. Die meisten Hersteller änderten<br />
pünktlich mit Fristablauf die Kennzeichnung. So entstanden eine<br />
Reihe »neuer« Produkte auf dem Markt. Aus Feta aus Kuhmilch<br />
wurde nun Hirtenkäse, Weißkäse oder Balkankäse. Der Phan ta -<br />
sie der Hersteller ist hier kaum eine Grenze gesetzt, solange der<br />
Verbraucher anhand der auf der Packung angegebenen Ver kehrsbezeichnung<br />
entnehmen kann, welches Produkt er kauft.<br />
Bei den Anbietern loser Ware <strong>und</strong> in Speisegaststätten sieht das<br />
Bild etwas anders aus. Hier zeigt sich, dass in Speisekarten noch<br />
häufig »Feta« deklariert wird, tatsächlich aber Kuhmilchkäse zur<br />
Verwendung kommt. Auch lose Ware vom Stand ist noch nicht<br />
immer rechtskonform ausgezeichnet. Hier zeigt sich weiterer<br />
Handlungsbedarf an.<br />
Das Résumé<br />
Für das Jahr 2008 sind fortlaufend weitere Untersuchungen ge -<br />
plant. Die verstärkte Überprüfung der Angebote an Salz laken käse<br />
<strong>und</strong> die vor Ort vorgenommene Deklaration der Produkte in<br />
Speisekarten von Restaurants, Schnellrestaurants, Bringdiensten<br />
etc. wird dabei im gesamten Jahr einen Schwerpunkt bilden.<br />
Untersuchungen, ob es sich bei lose angebotenem Feta, der aus<br />
Schafmilch hergestellt wurde, auch tatsächlich um ein Produkt<br />
aus Griechenland handelt, sollen mittelfristig im LAVES erfolgen.<br />
Burmeister, A.; Dr. Keck, S.; Nickel, S.; Dr. Ohrt, G. (LI BS)<br />
47
48<br />
Milch im Fokus der Lebensmittelüberwachung<br />
Fallbeispiel Landkreis Ammerland<br />
Die Überwachung der Produktion von Trinkmilch <strong>und</strong> Milch er -<br />
zeugnissen umfasst die Kontrolle von den Milcherzeugern über<br />
die Molkereien bis hin zur Abgabe an den Verbraucher. Als ein<br />
Schwer punkt der Milchverarbeitung in <strong>Niedersachsen</strong> kristallisierte<br />
sich in den letzten Jahren immer mehr der Landkreis Ammer -<br />
land he raus. Nach Jahren der Konzentrierung <strong>und</strong> Speziali sie rung<br />
wie in kaum einem anderen Lebensmittelbereich sind die typischen<br />
Dorf molkereien weitgehend von der Bildfläche verschw<strong>und</strong>en. Die<br />
beiden Molkereien des Ammerlandes, die Molkerei Ammerland<br />
in Dringenburg <strong>und</strong> die Molkerei Nordmilch in Edewecht, gehören<br />
mittlerweile zu den größten Milchverarbeitern b<strong>und</strong>esweit.<br />
In beiden Betrieben zusammen werden annähernd 2 Milliarden<br />
Liter Milch jährlich vor allem zu Schnittkäse <strong>und</strong> Butter verarbeitet.<br />
Dies entspricht einem Anteil von ca. 40% der in ganz Nie -<br />
der sachsen erzeugten Milch. Die beiden sehr stark exportorientierten<br />
Milchwerke bilden somit einen Schwerpunkt in der Le -<br />
bensmittelüberwachung des Ammerlandes.<br />
Lange Tradition hat in Molkereien die Kontrolle der angelieferten<br />
Milch durch Eigenuntersuchungen. Dem Anspruch der Vorreiterrolle<br />
der Eigenkontrollen in der gesamten Lebensmittelbranche<br />
wird die Milchwirtschaft durchaus gerecht. Von »Lebens mittel -<br />
skandalen« blieb sie weitgehend verschont.<br />
Ausgehend von zunächst einfachen Untersuchungen wie dem<br />
Säuregrad der Milch als Qualitätskriterium, werden seit annähernd<br />
50 Jahren in den Molkereien neben den Qualitätspa ra metern<br />
Fett <strong>und</strong> Eiweißgehalt der Anlieferungsmilch, auch hygienische<br />
Standards gesetzt. Dazu zählen neben der Untersuchung auf<br />
Hemmstoffe, wie an Kühe verabreichte Antibiotika, insbesondere<br />
auch die Keimzahl als Maß für die Hygiene im milcherzeugen den<br />
Betrieb sowie die Zellzahl als Kriterium für die Euterge s<strong>und</strong> heit<br />
der Kühe. Falls ein Landwirt entsprechende Kriterien nicht einhält,<br />
kann dies zu einem Milchanlieferungsverbot führen. Zu dem kann<br />
die Nichtbefolgung der Hygienevorschriften bei der Erzeugung<br />
von Rohmilch je nach Schwere nach Bußgeld- oder Straf vor schrif-<br />
Einer der Bereiche die in Molkereien überprüft werden, ist ob die An -<br />
forderungen an die Hygiene im Betrieb <strong>und</strong> an das Personal erfüllt<br />
werden<br />
ten geahndet werden. Dass es dazu im Normalfall nicht kommt,<br />
wird nicht zuletzt auch durch die Möglichkeit der erheblichen<br />
Kürzung des Milchauszahlungspreise nach der Milch-Güte verordnung<br />
bewirkt.<br />
Ausgehend von den Eigenkontrollen der Anlieferungsmilch führen<br />
die Molkereien auch intern seit langen Jahren Qualitäts kon -<br />
trollen in der Produktion durch. Anfangs beschränkten sich die -<br />
se im Wesentlichen auf die Kontrolle des verkaufsfertigen Er zeu gnisses.<br />
Später, bevor sich der Gesetzgeber des Themas angenommen<br />
hat, wurden produktionsbegleitende Kontrollen in Abstim -<br />
mung mit dem Veterinäramt durchgeführt.<br />
Sinn der heute nach EG-Recht verpflichtend eingeführten Eigenkontrollen<br />
ist die Erkennung möglicher Qualitäts- oder Hygiene -<br />
mängel bereits in ihrer Entstehung, so dass die Produktion durch<br />
Eingriffe in den Prozess rechtzeitig auf die »sichere Seite« ge lenkt<br />
werden kann.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hohen Dichte dokumentierter Eigenkontrollen liegt<br />
der Schwerpunkt der amtlichen Überwachung auf der Kontrolle<br />
der durchgeführten Eigenkontrollmaßnahmen der Molkerei. Dies<br />
erfordert Einsicht in die Produktionsprozesse, die Kontrolle der
Messungen an den Prozesslenkungsstellen <strong>und</strong> die Bewertung<br />
der vom Betrieb festgelegten Kontrollmaßnahmen im Hinblick<br />
auf die ges<strong>und</strong>heitliche Sicherheit der Produkte für den Konsu -<br />
menten.<br />
Die Kontrollhäufigkeit in den Betrieben richtet sich nach den<br />
Ergebnissen einer Risikobeurteilung. Für die Bewertung werden<br />
verschiedene Faktoren herangezogen: Handelt es sich um leicht<br />
verderbliche <strong>und</strong> anfällige Produkte, wie verlässlich ist das Unter -<br />
nehmen bisher gewesen, gab es in der Vergangenheit wiederholt<br />
Beanstandungen, hat der Betrieb ein funktionierendes Ei -<br />
genkontrollkonzept?<br />
Die Betriebsinspektionen beziehen sich dabei auf folgende Be -<br />
reiche:<br />
Prüfung eines von dem Betrieb vorzulegenden Konzeptes, in<br />
dem die möglichen Ges<strong>und</strong>heitsgefährdungen analysiert werden<br />
Überprüfen der sogenannten kritischen Punkte, wie z. B. das<br />
Erhitzen der Milch zum Abtöten der krankheitserregenden<br />
Keime oder das Kühlen der Produkte<br />
Anforderungen an die Hygiene im Betrieb <strong>und</strong> an das Personal<br />
Anforderungen mikrobiologischer <strong>und</strong> chemischer Art an das<br />
Produkt <strong>und</strong> an das mit dem Produkt in Berührung kommende<br />
Wasser<br />
Reinigung des Umfeldes <strong>und</strong> der milchberührenden Anlagen<br />
Schädlingsbekämpfung, die auch präventiv zu erfolgen hat<br />
Nachweise über die Rückstandsuntersuchungen wie z. B. auf<br />
Antibiotika, Pestizide oder Stoffe mit pharmakologischer Wir -<br />
kung<br />
Ordnungsgemäße Kennzeichnung sowie die Rückverfolgung<br />
der Produkte<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Um die Ergebnisse der Selbstkontrolle zu überprüfen, werden so -<br />
wohl vom Betrieb als auch von der amtlichen Überwachung des<br />
Ve te rinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsamtes Proben von Vorprodukten<br />
<strong>und</strong> Fertigprodukten entnommen <strong>und</strong> amtlich untersucht.<br />
Schwerpunkt bildet die mikrobiologische Untersuchung auf<br />
die Risikokeime Salmonella <strong>und</strong> Listeria <strong>und</strong> zwar nicht nur vom<br />
Produkt direkt, sondern auch von den Vorprodukten, um Schwachpunkte<br />
bereits im Produktionsprozess zu erkennen.<br />
Bei den monatlich im Jahr 2007 durch den Landkreis Ammer land<br />
durchgeführten Betriebsinspektionen wurden keine schwerwiegenden<br />
Mängel festgestellt. Bestätigt wird dieses gute Ergebnis<br />
durch zahlreichen Proben, die die Kontrolleure dabei entnommen<br />
haben. Die insgesamt 220 amtlichen Hygieneproben, die im Ve -<br />
te rinärinstitut Hannover untersucht wurden, blie ben genauso unbeanstandet<br />
wie die 63 amtlichen Lebens mittel proben, die im<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig begutachtet wurden.<br />
Roth, W. (Landkreis Ammerland)<br />
49
50<br />
Eier<br />
Eier auf neuen Wegen<br />
Die Marktordnungen gehören zu den agrarpolitischen Instru men -<br />
ten der Europäischen Union im Bereich der Landwirtschaft. Sie<br />
wirken unmittelbar auf Erzeugung <strong>und</strong> Vermarktung bis hin zum<br />
Verbraucher. Novellierungen sollen die Normen an die aktuellen<br />
Bedürfnisse <strong>und</strong> Entwicklungen der Wirtschaft <strong>und</strong> des Ver brau -<br />
cherschutzes anpassen.<br />
Die Vermarktungsnorm für Eier ist nach langen Verhandlungen<br />
im Jahr 2007 auf eine neue Basis gestellt worden. Künftig gelten<br />
die Regeln der EU-Ratsverordnung 1028/2006 <strong>und</strong> die dazugehörende<br />
Durchführungsverordnung der Kommission 557/2007.<br />
Gegenüber den bisherigen Regelungen sind einige Verän derun -<br />
gen auffällig:<br />
Eier mussten bisher innerhalb festgesetzter Fristen für jede Ver -<br />
marktungsstufe vom Verbraucher gegebenenfalls über Sam melstellen<br />
an registrierte Packstellen geliefert werden. Spätestens<br />
am sechsten Tag waren die Eier zu kennzeichnen, zu sortieren<br />
<strong>und</strong> zu verpacken. Die neue Regelung sieht nun eine General -<br />
frist von zehn Tagen nach dem Legen vor, innerhalb derer die<br />
Kennzeichnung, Sortierung nach Größenklassen <strong>und</strong> Güte sowie<br />
das Verpacken zu erfolgen hat. Am Mindesthaltbarkeitsdatum<br />
von 28 Tagen nach dem Le getag hat sich nichts geändert.<br />
Damit einhergehend ist auch der bisher strikt reglementierte Vermarktungsweg<br />
der Eier vom Erzeuger über gegebenenfalls eine<br />
Sammelstelle an eine Packstelle nicht mehr festgelegt. Nun mehr<br />
ist innerhalb der genannten 10-Tagesfrist eine Weitergabe über<br />
mehrere Zwischenhandelsstufen möglich. Buchführungs pflich ten<br />
sollen die Rückverfolgbarkeit der Eier dennoch gewährleisten.<br />
Eine Vereinfachung erfuhr dabei die Tätigkeit der Sammel stellen.<br />
Diese sind künftig für ihre Tätigkeit, das Sammeln unsortierter<br />
Rohware, nicht mehr anzeigepflichtig. Zusammen mit den liberalisierten<br />
Vermarktungswegen führt dies bereits jetzt erkennbar<br />
zu Mehraufwand bei den Kontrollen hinsichtlich der Sicherung<br />
der Nämlichkeit der Ware »Ei« – dem <strong>Verbraucherschutz</strong> ist hier<br />
gegenüber den Wirtschaftsbeteiligten ein Nachteil erwachsen.
Eine weitere Deregulierung im Kontrollverfahren hat demge genüber<br />
für alle Beteiligten Nachteile: Wo der bisherige Rechtsrah -<br />
men eindeutige Grenzen <strong>und</strong> Verpflichtungen der Kontroll behörde<br />
bei der Beanstandung von Eiern festlegte, verzichtet die neue<br />
Verordnung auf diese Festlegung. Der dadurch entstehenden<br />
Rechtsunsicherheit zu Lasten der Wirtschaft wie der Kontroll be -<br />
hörden wird deutschlandweit nach einer entsprechenden länderübergreifenden<br />
Absprache durch national-staatliche Anwen dung<br />
der alten Kontrollvorgaben entgegengewirkt.<br />
Einer Veränderung unterliegt auch die bisher in den Vermark tungsnormen<br />
abschließend geregelte Zulassung von Packstellen. Die se<br />
wurde aufgespalten in eine marktrechtliche Zulassung <strong>und</strong> eine<br />
hygienerechtliche Zulassung. Das Verfahren wird dadurch deutlich<br />
umfangreicher <strong>und</strong> verursacht höhere Verwaltungskosten.<br />
Die Liste der Änderungen ließe sich fortsetzen. Der Gr<strong>und</strong> ge danke<br />
der Novellierung, durch entsprechende »Vereinfachung« einer<br />
Vermarktungsnorm dem gr<strong>und</strong>sätzlich wünschenswerten Ziel des<br />
Vorschriftenabbaus näher zu kommen, hat allerdings im Ergeb nis<br />
zu einem Mehrbedarf an Rechtsauslegung geführt. Entsprechend<br />
bemüht sich das B<strong>und</strong>ministerium für Ernährung, Landwirt schaft<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong>, b<strong>und</strong>eseinheitliche Auslegungen gemeinsam<br />
mit den für die Überwachung zuständigen Ländern zu formulieren.<br />
<strong>Niedersachsen</strong> hat daran wegen der außerordentlich -<br />
en Bedeutung seiner Eiererzeugung ein besonderes Interesse.<br />
Schließlich ist <strong>Niedersachsen</strong> im B<strong>und</strong>esgebiet der größte »Ex -<br />
por teur«. Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung wie auch<br />
das LAVES mit seinem für die Überwachung zuständigen Dezer -<br />
nat Markt überwachung engagieren sich daher hier in besonderer<br />
Weise.<br />
Nach der Reform ist vor der Reform ... In kaum einem anderen<br />
Ressort werden weitere Diskussionen <strong>und</strong> Entwicklungen so in -<br />
tensiv geführt wie im Agrarbereich, was mit Blick auf den sehr<br />
hohen Anteil am Gesamtetat der EU auch nicht verw<strong>und</strong>ern<br />
kann. Tatsächlich wird die gerade novellierte Vermarktungs norm<br />
für Eier ab dem 1. Juli 2008 schon wieder auf eine neue Rechts -<br />
gr<strong>und</strong>lage gestellt. Diesmal ist der Ansatz ein umfassender: Der<br />
Agrarministerrat hat unter deutscher Präsidentschaft eine Ge -<br />
meinsame Marktordnung (GMO) für alle Erzeugnisse aufgelegt,<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
die einer Regulierung durch Gemeinschaftsrecht unterliegen. Die -<br />
se im Herbst 2007 verabschiedete GMO ersetzt künftig alle bisherigen<br />
Ratsverordnungen. Sie führt dazu, dass alle Kommis si ons -<br />
verordnungen, die die Gr<strong>und</strong>sätze der Ratsverordnungen in ge -<br />
naue Definitionen <strong>und</strong> Regeln umsetzen müssen, neu zu fassen<br />
sind. Ab Juli 2008 könnte daher bereits wieder eine neue Ver ordnung<br />
über die Vermarktungsnormen für Eier gelten.<br />
Die wiederholte Neuordnung der Rechtsgr<strong>und</strong>lagen für die Marktüberwachung<br />
führt zu Schwierigkeiten bei der Sanktion von Verstößen<br />
gegen die Vermarktungsnormen, da nationale Umsetz -<br />
ungsverordnungen noch ausstehen. Die Ahndung festgestellter<br />
Rechtsverstöße ist dadurch erschwert.<br />
Dr. Aue, B.; Mörler, T. (Dez. 43)<br />
51
52<br />
Getreideerzeugnisse<br />
Frisch auf den Tisch? Untersuchungen zur mikrobiologischen Qualität frischer Teigwaren<br />
Frisch soll es sein. Das gilt auch für Pasta. Das Angebot frischer,<br />
kühlpflichtiger Nudeln im Einzelhandel ist in den letzten Jahren<br />
gestiegen. Einige Restaurants stellen Nudeln auch selbst her. Das<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig wollte deshalb wissen, wie es<br />
um den hygienischen Status derartiger Erzeugnisse bestellt ist.<br />
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 22 Proben eingesandt, wobei<br />
es sich um Nudeln mit <strong>und</strong> ohne Füllung handelte. Neun Pro ben<br />
wurden direkt aus Herstellerbetrieben, fünf Proben aus Restau -<br />
rants <strong>und</strong> acht Proben aus dem Einzelhandel entnommen. Eine<br />
Zusammenfassung der Beurteilungen ist in Tabelle <strong>3.</strong>5 ersichtlich.<br />
Die mikrobiologische Untersuchung umfasste einerseits Hy gi e neparameter<br />
wie die Gesamtkeimzahl, Schimmelpilze, Hefen, Ba -<br />
cil lus cereus, Enterobacteriaceae, E. coli oder koagulasepositive<br />
Staphylokokken, andererseits auch pathogene Mikro organis men<br />
wie Salmonellen oder Listeria monocytogenes. Weiterhin wurde<br />
die Lagertemperatur der Teigwaren im Restaurant bzw. Einzel handel<br />
überprüft.<br />
Als positives Ergebnis konnte verzeichnet werden, dass in keiner<br />
Probe Salmonellen oder Listeria monocytogenes vorhanden waren.<br />
Zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung wurden die Richt- <strong>und</strong><br />
Warnwerte der Deutschen Gesellschaft für Hygiene <strong>und</strong> Mikro -<br />
biologie (DGHM) für feuchte, verpackte bzw. für offen angebotene<br />
Teigwaren herangezogen.<br />
Gemäß DGHM zeigt eine Überschreitung des Richtwertes im Rahmen<br />
der Betriebsüberwachung Schwachstellen im Herstellungs -<br />
prozess <strong>und</strong> die Notwendigkeit an, die Wirksamkeit der vorbeugenden<br />
Maßnahmen zu überprüfen <strong>und</strong> Maßnahmen zur Ver -<br />
besserung der Hygiene einzuleiten. Gemäß DGHM geben Warnwerte<br />
Mikroorganismengehalte an, deren Überschreitung einen<br />
Hinweis darauf geben, dass die Prinzipien einer guten Herstel lungspraxis<br />
verletzt wurden <strong>und</strong> zudem eine Ges<strong>und</strong>heitsgefährdung<br />
des Verbrauchers nicht auszuschließen ist.<br />
Insgesamt wurde bei neun Proben eine Richtwert überschreitung<br />
für einen oder mehrere Hygieneparameter festgestellt. Bei einer<br />
Probe »Spaghetti« aus einem Herstellerbetrieb war der Warn wert<br />
für koagulasepositive Staphylokokken überschritten.<br />
Mikrobiologische Untersuchungen wurden an frischen Nudeln, mit<br />
<strong>und</strong> ohne Füllung, durchgeführt
Tabelle <strong>3.</strong>5: Zusammenfassung der Beurteilungen zur<br />
Untersuchung von frischen Nudeln<br />
Entnahmeort Anzahl der<br />
Proben<br />
Hersteller<br />
Einzelhandel<br />
Restaurants<br />
Summe<br />
9<br />
8<br />
5<br />
22<br />
Bemängelung Beanstandung<br />
Eine Probe wurde bei zu hohen Temperaturen aufbewahrt. Da<br />
es sich bei frischen Nudeln um leicht verderbliche Lebensmittel<br />
handelt, sollten diese bei max. 7°C gelagert werden, um die<br />
Keim vermehrung zu hemmen.<br />
Bei einer Bemängelung/Beanstandung wurde auf § 3 Satz 1 Le -<br />
bensmittelhygieneverordnung (LMHV) hingewiesen bzw. da nach<br />
beanstandet. Demnach dürfen Lebensmittel nur so hergestellt,<br />
behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung<br />
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer<br />
nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.<br />
Insgesamt ist festzustellen, dass der hygienische Status der frischen<br />
Nudeln bei der Mehrzahl der untersuchten Proben zwar<br />
auffällig war, eine ges<strong>und</strong>heitliche Beeinträchtigung der Ver braucher<br />
jedoch nicht zu erwarten ist, da zum einen keine Krank heitserreger<br />
nachgewiesen wurden <strong>und</strong> zum anderen die Teigwaren<br />
vor dem Verzehr noch einmal gekocht werden. Dies führt zu ei -<br />
ner Abtötung der enthaltenen Mikroorganismen.<br />
6<br />
2<br />
1<br />
9<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
1<br />
0<br />
0<br />
1<br />
Die Ergebnisse stellen jedoch Hinweise auf Hygienemängel dar.<br />
Interessant hierbei ist, dass schon in den Herstellerbetrieben er -<br />
höhte Keimgehalte nachgewiesen wurden. Von den insgesamt<br />
zehn auffälligen Proben stammten sieben aus Hersteller betrie -<br />
ben. Bei einer Probe aus einem Restaurant sowie bei zwei Pro -<br />
ben aus dem Einzelhandel wurden Richtwertüberschreitungen<br />
festgestellt.<br />
Trotz der relativ geringen Probenzahl ist ein Trend feststellbar, der<br />
darauf hinweist, dass offenbar schon im Bereich der Her stellung<br />
von frischen feuchten Teigwaren Hygienemängel vorliegen. Die<br />
zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden werden durch<br />
entsprechende Maßnahmen, wie beispielsweise Betriebs kon trollen,<br />
den Ursachen auf den Gr<strong>und</strong> gehen.<br />
Die ermittelten Ergebnisse nimmt das Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
zum Anlass, derartige Erzeugnisse zukünftig vermehrt<br />
mikrobiologisch zu untersuchen.<br />
Dr. Böhmler, G. (LI BS)<br />
53
54<br />
Morphin in Mohnsamen <strong>und</strong> Mohngebäck<br />
Bei 45% der untersuchten Mohnproben aus dem Einzel handel<br />
sowie bei 77% der untersuchten Mohnsamen für Bäckereien<br />
wur den Morphingehalte über dem vorläufigen Richt wert des B<strong>und</strong>esinstitutes<br />
für Risikobewertung (BfR) festgestellt. Gegenüber<br />
den Vorjahren fallen die Morphingehalte der Proben jedoch insgesamt<br />
schon erheblich niedriger aus.<br />
Untersuchungen zeigten, dass Mohnsamen höhere Gehalte an<br />
Morphin aufweisen können. Nach den bisherigen Erkennt nissen<br />
scheint der Morphingehalt in Speisemohn vor allem von der<br />
Mohn sorte <strong>und</strong> dem jeweiligen Ernteverfahren abhängig zu sein.<br />
Durch entsprechende Verarbeitungsschritte im weiterverarbeitenden<br />
Betrieb wie Waschen, Mahlen oder Erhitzen kann zusätzlich<br />
eine deutliche Senkung des Morphingehaltes auf unbedenkliche<br />
Anteile erzielt werden.<br />
Bei den untersuchten Mohnmassen <strong>und</strong> Mohngebäcken wurden<br />
daher bis auf zwei Fälle überwiegend keine oder nur geringe, unbedenkliche<br />
Morphingehalte festgestellt.<br />
Mohnsamen für Speisezwecke sind die reifen Samen von Papa ver<br />
somniferum L. (Schlafmohn). Sie dienen in Deutschland hauptsächlich<br />
zur Herstellung von mohnhaltigen Backwaren. Die Samen<br />
von Blau-, Grau oder Weißmohn werden z. B. zum Bestreuen der<br />
Gebäckoberfläche von Brot, Brötchen oder Knabbergebäck verwendet.<br />
In gemahlener Form werden sie für die Herstellung von<br />
Mohnmassen zum Füllen von Mohnkuchen, Mohnstollen usw.<br />
eingesetzt. Nach allgemeiner Verkehrsauffassung enthalten Mohnfüllungen<br />
mindestens 20% Mohnsamen mit handelsüblichem<br />
Feuchtigkeitsgehalt.<br />
Das BfR hat eine ges<strong>und</strong>heitliche Bewertung des Morphin ge hal -<br />
tes in Mohnsamen vorgenommen (Stand 27. Dezember 2005).<br />
In dieser Bewertung wird eine vorläufige maximale tägliche Auf -<br />
nahmemenge von 6,3 µg Morphin/kg Körpergewicht/Tag angegeben.<br />
Für einen Erwachsenen mit einem Körpergewicht von<br />
60 kg errechnet sich daraus eine vorläufige maximale tägliche<br />
Aufnahmemenge von 0,38 mg Morphin. Hieraus wurde ein vorläufiger<br />
Richtwert von 4 mg/kg Mohnsaat abgeleitet (weitere Informationen<br />
hierzu siehe unter www.bfr.b<strong>und</strong>.de).<br />
Im Lebensmittelinstitut Braunschweig wurden verschiedene Pro -<br />
ben Speisemohn, Mohnmassen zum Füllen von Mohnkuchen so -<br />
wie Mohngebäcke auf den Gehalt an Morphin untersucht.<br />
Von elf untersuchten Proben abgepackter Mohn aus dem Ein zel -<br />
handel wiesen fünf Proben Morphingehalte über dem vorläufigen<br />
BfR-Richtwert von 4 mg/kg auf. Die Gehalte lagen zwischen 4,2<br />
<strong>und</strong> 17,3 mg/kg.<br />
Entsprechende Verarbeitungs- <strong>und</strong> Verzehrshinweise waren auf<br />
keiner Packung vorhanden.<br />
Untersucht wurden auch 13 lose Proben Mohnsamen für Bäck -<br />
ereien sowie zwei Proben Mohnmassen aus verarbeitetem, ge -<br />
mah lenem Mohn. Nur drei Proben Mohnsamen wiesen Mor phin -<br />
ge halte unter 4 mg/kg auf. Bei allen anderen wurden Morphin -<br />
gehalte zwischen 4,3 <strong>und</strong> 22,6 mg/kg festgestellt.
In den beiden Mohnmassen war Morphin dagegen nicht nachweisbar<br />
bzw. nur in sehr geringer Menge (0,8 mg/kg) vorhanden.<br />
Dies zeigt, dass Verarbeitungsprozesse den Morphingehalt<br />
deutlich senken können.<br />
Lediglich eine Probe loser Mohn mit einem Morphingehalt von<br />
20,68 mg/kg enthielt in den Lieferpapieren den Hinweis »nur<br />
zur Weiterverarbeitung für Backwaren vorgesehen«.<br />
Es wurden 32 Proben von mohnhaltigen feinen Backwaren auf<br />
ihren Gehalt an Morphin untersucht.<br />
Dabei handelte es sich überwiegend um Mohnkuchen <strong>und</strong> Mohnstreuselkuchen,<br />
wobei 20 lose Proben aus handwerklicher Pro -<br />
duktion <strong>und</strong> zwölf Proben in Fertigpackungen aus dem Han del<br />
eingeliefert wurden.<br />
Bei neun Proben wurden keine Morphingehalte <strong>und</strong> bei drei Proben<br />
nur Gehalte in Spuren festgestellt.<br />
18 Proben enthielten Morphin im Bereich von 0,1 bis 1,0 mg/kg<br />
Gebäck.<br />
Zwei Proben wiesen einen sehr hohen Morphingehalt von 4,2<br />
bzw. 23,9 mg/kg Gebäck auf <strong>und</strong> wurden daher als nicht sicheres<br />
Lebensmittel beurteilt.<br />
Weiß, H.; Scharf, D. (LI BS)<br />
Abbildung <strong>3.</strong>3: Morphin in Speisemohn<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Überwiegend wurden keine oder nur geringe unbedenkliche Mor -<br />
phin gehalte in den untersuchten Mohnmassen <strong>und</strong> Mohngebäcken<br />
festgestellt<br />
Abbildung <strong>3.</strong>4: Morphin in Mohngebäck<br />
55
56<br />
Mikrobiologischer Status von Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung<br />
Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung wie z. B. Produkte mit<br />
Obstbelag sowie Krem- oder Sahnefüllungen sind in mikrobiologischer<br />
Hinsicht leicht verderblich. Hierbei spielt auch die Tem peraturführung<br />
während der Lagerung im Betrieb eine große Rolle.<br />
In den letzen Jahren waren bei den mikrobiologischen Untersu -<br />
chungen hohe Bemängelungs- bzw. Beanstandungsquoten zu<br />
beobachten (siehe Tabelle <strong>3.</strong>6). Deshalb wurden im Berichtsjahr<br />
schwer punktmäßig feine Backwaren in das Untersuchungspro -<br />
gramm des Lebensmittelinstitutes Braunschweig aufgenommen.<br />
Von den insgesamt 300 feinen Backwaren waren 135 (45%) der<br />
Proben mikrobiologisch auffällig, die Lagertemperatur war in 61<br />
(20%) der Fälle unzureichend.<br />
Für die rechtliche Beurteilung wurden die von der Deutschen Ge -<br />
sellschaft für Hygiene <strong>und</strong> Mikrobiologie (DGHM) veröffentlichten<br />
Richt- <strong>und</strong> Warnwerte zugr<strong>und</strong>e gelegt. In 96 der untersuchten<br />
Proben lagen die nachgewiesenen Keimgehalte über den<br />
Richtwerten der DGHM <strong>und</strong> wurden bemängelt. In den meisten<br />
Fällen wurden die Richtwerte für die Gesamtkeimzahl, Entero -<br />
bacteriaceae <strong>und</strong>/oder Hefen überschritten. Einige Proben wiesen<br />
auffällige Gehalte an Pseudomonaden auf. Richtwerte geben<br />
eine Orientierung, welches produktspezifische Mikroorganis menspektrum<br />
zu erwarten <strong>und</strong> welche Mikroorganismengehalte in<br />
den jeweiligen Lebensmitteln bei Einhaltung einer guten Hy gi e -<br />
nepraxis akzeptabel sind.<br />
Aufgr<strong>und</strong> mikrobiologischer Verunreinigungen wurden 39 Pro -<br />
ben beanstandet. Drei Proben wurden als ges<strong>und</strong>heitsschädlich<br />
gemäß Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Buchstabe a der<br />
VO (EG) Nr. 178/2002 <strong>und</strong> § 5 Abs. 1 LFGB beanstandet. In diesen<br />
drei Proben wurde Salmonella Enteriditis nachgewiesen. Bei<br />
zwei dieser Proben handelte es sich um Tiramisu, welches aufgr<strong>und</strong><br />
von Erkrankungsfällen zur Untersuchung eingesandt wur -<br />
de. Eines der Tiramisus wurde unter Verwendung von Rohei hergestellt.<br />
Ob das Tiramisu durch die Eier mit Salmonellen kontaminiert<br />
wurde, ist jedoch nicht bekannt. Die dritte Probe, in der<br />
Salmonella Enteriditis nachgewiesen wurde, war eine Manda ri -<br />
nen-Schmand-Schnitte.<br />
In drei Fällen wiesen die beanstandeten Proben zudem sensorische<br />
Abweichungen auf. Davon wurden zwei Proben als zum Ver -<br />
zehr nicht geeignet beurteilt <strong>und</strong> nach Art. 14 Abs. 1 in Verbin -<br />
dung mit Abs. 2 Buchstabe b VO (EG) Nr. 178/2002 beanstandet.<br />
Eine Backware war wertgemindert im Sinne von § 11 Abs.<br />
2 Nr. 2 b LFGB.<br />
33 Proben wurden gemäß Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004<br />
bzw. seit Inkrafttreten der neuen Lebensmittelhygiene verord nung<br />
nach § 3 Abs. 1 LMHV beanstandet. In den meisten Fällen wurden<br />
der Richtwert für die Gesamtkeimzahl <strong>und</strong>/oder der Warn -<br />
wert für Enterobacteriaceae deutlich überschritten. Warnwerte<br />
geben gemäß DGHM Mikroorganismengehalte an, deren Über -<br />
schreitung einen Hinweis darauf gibt, dass die Prinzipien einer<br />
guten Herstellungspraxis verletzt wurden <strong>und</strong> zudem eine Ge -<br />
s<strong>und</strong>heitsgefährdung des Verbrauchers nicht auszuschließen ist.<br />
Zu den Enterobacteriaceae gehört auch Escherichia coli (E. coli).<br />
E. coli gilt als Indikatororganismus für fäkale Verunreinigun gen,<br />
kann aber auch als Krankheitserreger eine Rolle spielen, da en -<br />
te ro hämorrhagische E. coli ein Spektrum verschiedener Erkran -<br />
kungen verursachen können. In zwei Proben wurden auffällige<br />
Gehalte an Bacillus cereus nachgewiesen.
Feine Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung zählen zu den<br />
leicht verderblichen Lebensmitteln. Die Verkehrsfähigkeit dieser<br />
Produkte kann nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen er -<br />
halten werden, da hierdurch eine unerwünschte Vermehrung<br />
von Mikroorganismen in Grenzen gehalten wird. Nach der DIN<br />
10508 »Temperaturen für Lebensmittel« sollten Backwaren mit<br />
nicht durcherhitzten Auflagen oder Füllungen bei höchstens +7°C<br />
gelagert werden.<br />
Es wurden 24 Proben aufgr<strong>und</strong> fehlender Kühllagerung gemäß<br />
Art. 4 Abs. 3 Buchstabe d VO (EG) Nr. 852/2004 bzw. § 3 Abs.<br />
1 LMHV beanstandet. Davon wiesen zwei Proben hygienische<br />
Mängel auf. In fünf Fällen wurde aufgr<strong>und</strong> der hohen Keimge -<br />
halte eine zusätzliche Beanstandung ausgesprochen.<br />
Bei 35 Proben wurde ein Hinweis auf unzureichende Kühlung<br />
gegeben. Diese Proben wurden zwar gekühlt, jedoch über den<br />
empfohlenen 7 °C gelagert. In 20 dieser Proben wurden erhöhte<br />
Keimgehalte nachgewiesen.<br />
Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die mikrobiologische Be -<br />
schaf fenheit feiner Backwaren sowie deren Lagertemperatur<br />
weiterhin unzureichend sind. Insbesondere der Nachweis von<br />
Salmonellen in drei Proben zeigt, dass es sich um eine Waren -<br />
gruppe handelt, die eine potenzielle Ges<strong>und</strong>heitsgefahr darstellen<br />
kann, da die Erzeugnisse vor dem Verzehr keinem Erhitzungs -<br />
schritt unterzogen werden. Im Jahr 2008 ist die Ermittlung des<br />
mikrobiologischen Status von Backwaren mit nicht durcherhitzter<br />
Fül lung in das B<strong>und</strong>esweite Überwachungsprogramm (BÜP)<br />
aufgenommen worden. Das Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
hat für dieses Programm die Federführung <strong>und</strong> wird sich in erheblichem<br />
Maße daran beteiligen. Durch diese b<strong>und</strong>esweit angelegte<br />
Un ter suchung wird eine große Anzahl an Daten erhoben, die<br />
es er möglichen, ein Lagebild zu erstellen <strong>und</strong> entsprechende Maßnah<br />
men einzuleiten.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Dr. Seide, K. (LI BS)<br />
Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung, z. B. einer Krem- oder<br />
Sahnefüllung, sind in mikrobiologischer Hinsicht leicht verderblich<br />
Tabelle <strong>3.</strong>6: Mikrobiologischer Status von Backwaren mit<br />
nicht durchgebackener Füllung<br />
Jahr<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
119<br />
270<br />
300<br />
Nicht zu be -<br />
an standen<br />
66,3%<br />
56,2%<br />
55,0%<br />
Bemängelungen<br />
30,3%<br />
28,9%<br />
32,0%<br />
Beanstandungen<br />
3,4%<br />
14,9%<br />
13,0%<br />
57
58<br />
Würzmittel<br />
Untersuchung auf Zusatzstoffe mit allergenem Potential, Kontaminanten, Mykotoxine, nicht<br />
zugelassene Farbstoffe <strong>und</strong> gentechnisch veränderte Organismen<br />
Bei der Zubereitung von Speisen kommt den Gewürzen eine zentrale<br />
Bedeutung zu, da sie wegen ihres Gehaltes an natürlich en,<br />
aromaaktiven Inhaltsstoffen als geruch-, geschmack- oder farbgebende<br />
Zutaten für viele Gerichte unverzichtbar sind. Die Pro -<br />
duktgruppe der Würzmittel umfasst eine Vielzahl von Erzeug nissen<br />
mit ebenfalls würzendem Charakter. Typische Vertreter sind<br />
neben Gewürzzubereitungen <strong>und</strong> Gewürzsalzen unter anderem<br />
Würzsoßen wie Tomatenketchup, Speisewürzen wie Sojasoße,<br />
Essig, Senf <strong>und</strong> Meerrettichzubereitungen.<br />
Viele Gewürze, die aus tropischen Anbauländern stammen, zeigen<br />
sich gegenüber einer unerwünschten Vermehrung von Bak terien<br />
<strong>und</strong> Schimmelpilzen vergleichsweise anfällig. Sind die Wachstumsbedingungen<br />
für bestimmte Mikroorganismen günstig, können<br />
Schimmelpilzgifte wie Aflatoxine oder Ochratoxin A gebildet<br />
werden. Während für Aflatoxine Höchstmengen für Gewürze<br />
existieren, die unter anderem die Summe der Varianten B1, B2,<br />
G1 <strong>und</strong> G2 auf 10 µg/kg beschränken, ist für Ochratoxin A bisher<br />
keine entsprechende Regelung getroffen worden.<br />
Zur Verringerung der Keimzahl ist eine Bestrahlung zulässig, muss<br />
aber kenntlich gemacht werden.<br />
In der Vergangenheit war immer wieder festzustellen, dass Ge -<br />
würze <strong>und</strong> Würzmittel mit nicht zugelassenen Farbstoffen versetzt<br />
worden waren. Zum Untersuchungsumfang gehörten da her<br />
insbesondere die zu dieser Gruppe zählenden Sudan farbstoffe.<br />
Überreife Weintrauben <strong>und</strong> getrocknete Weinbeeren können<br />
eben falls Ochratoxin A enthalten. Ein weiterer Untersuchungs -<br />
schwerpunkt war deshalb die Bestimmung des Gehaltes in Ace -<br />
to Balsamico (Balsamicoessig), der üblicherweise unter Verwen -<br />
dung von eingedicktem Traubenmost hergestellt wird.<br />
Bei der Herstellung von Hydrolysatwürzen wie Sojasaoße kann<br />
unter Hitze- <strong>und</strong> Säureeinwirkung aus natürlichen Inhalts stoffen<br />
3-Chlor-1,2-propandiol (3-MCPD) gebildet werden. Die Subs tanz<br />
steht im Verdacht, krebserregend zu sein, weshalb der Gehalt<br />
in Sojasoßen 50 µg/kg (bezogen auf die Trockenmasse) nicht<br />
übersteigen darf.<br />
Schwefeldioxid <strong>und</strong> die als Sulfite bezeichneten Salze der schwefligen<br />
Säure werden Lebensmitteln üblicherweise zum Zweck der<br />
Farberhaltung zugesetzt. Da diese Stoffe bei empfindlichen Per -<br />
sonen Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können, muss eine<br />
Verwendung nach den Regeln der so genannten Allergenkenn -<br />
zeichnung in für die Konsumenten eindeutiger Weise gekennzeichnet<br />
sein.<br />
Ebenfalls kennzeichnungspflichtig ist die Anwesenheit gentechnisch<br />
veränderter Organismen in einem Lebensmittel. So kann<br />
Senf beispielsweise durch gentechnisch veränderte Rapssaat verunreinigt<br />
sein.<br />
In Tabelle <strong>3.</strong>7 sind die Ergebnisse aus den Untersuchungs schwer -<br />
punkten zusammenfassend dargestellt.<br />
Dr. Hausch, M.; Weiß, H. (LI BS)
Tabelle <strong>3.</strong>7: Gewürze <strong>und</strong> Würzmittel (ausgewählte Untersuchungen)<br />
Warenbezeichnung Untersuchungsschwerpunkte<br />
Gewürze,<br />
Gewürzzubereitungen,<br />
Gewürzsalze,<br />
Würzmischungen<br />
Sojawürzen<br />
Würzsoßen,<br />
Meerrettichzubereitungen<br />
Senf<br />
Essig, Essigessenz,<br />
Aceto Balsamico<br />
Keimstatus<br />
Aflatoxine<br />
Ochratoxin A<br />
Behandlung mit ionisierenden<br />
Strahlen<br />
Schwefeldioxid<br />
nicht zugelassene<br />
Farbstoffe<br />
3-MCPD<br />
Schwefeldioxid<br />
nicht zugelassene<br />
Farbstoffe<br />
Schwefeldioxid<br />
gentechnisch veränderte<br />
Organismen<br />
Schwefeldioxid<br />
Ochratoxin A<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Anzahl der<br />
Untersuchungen<br />
58<br />
63<br />
61<br />
63<br />
32<br />
25<br />
26<br />
27<br />
29<br />
14<br />
10<br />
60<br />
26<br />
Beanstandungen<br />
1x gemahlener Ingwer (Warnwert für Bacillus<br />
cereus überschritten)<br />
1x gemahlene Guaranasamen (hohe Keim- <strong>und</strong><br />
Schimmelpilzgehalte)<br />
keine (Gehalte von nicht nachweisbar bis<br />
4,01 µg/kg Summenwert)<br />
keine (Gehalte von nicht nachweisbar bis<br />
70,8 µg/kg)<br />
1x Würzmischung (Bestrahlung nicht deklariert)<br />
2x Suppengewürz (Zusatz nicht deklariert)<br />
keine<br />
keine (Gehalte von 5,71 bis 21,0 µg/kg)<br />
keine<br />
keine<br />
1x Senf (Zusatz nicht deklariert)<br />
keine<br />
4x Aceto Balsamico (Zusatz nicht oder unzurechend<br />
deklariert, fehlende Allergen kennzeichnung)<br />
keine (Gehalte von nicht nachweisbar bis Spuren)<br />
59
60<br />
Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstriche<br />
Erzeugnisse von Direktvermarktern<br />
Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstriche von Direktvermarktern sind bei<br />
Verbrauchern sehr beliebt, fallen aber nach wie vor durch eine<br />
Vielzahl von Beanstandungen auf.<br />
Häufig wird von den Herstellern nicht berücksichtigt, dass auch<br />
ihre oft nur in kleinen Mengen hergestellten Produkte die einschlägigen<br />
Rechtsvorschriften einhalten müssen.<br />
So sind für Konfitüren <strong>und</strong> Gelees die Vorschriften der Konfi tü -<br />
renverordnung maßgebend. Danach werden Konfitüre extra <strong>und</strong><br />
Konfitüre sowie Gelee extra <strong>und</strong> Gelee je nach Fruchtgehalt un -<br />
terschieden. Als Zutaten dürfen nur bestimmte Lebensmittel so -<br />
wie die in der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung aufgeführten<br />
Zusatzstoffe verwendet werden. Die lösliche Trockenmasse dieser<br />
Erzeugnisse beträgt mindestens 60%. Eine Konservierung<br />
ist nur bei brennwertverminderten oder zuckerfreien Konfitüren<br />
zulässig.<br />
Fruchtaufstriche entsprechen in ihrer Gesamtaufmachung zwar<br />
einer Konfitüre bzw. einem Gelee, da sie jedoch als Fruchtauf -<br />
strich bezeichnet sind, finden die Vorschriften der Konfitüren verordnung<br />
keine Anwendung. Eine Konservierung ist gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
erlaubt, ein Mindestgehalt für den Gesamtzucker <strong>und</strong> die<br />
verwendeten Früchte ist nicht festgelegt.<br />
Die meisten Fruchtaufstriche weisen deutlich niedrigere Gesamt -<br />
zuckergehalte auf als Konfitüren <strong>und</strong> Gelees. Sie werden daher<br />
von den Verbrauchern bevorzugt, die Wert auf eine kalorienbewusste<br />
Ernährung legen.<br />
Alle Konfitüren <strong>und</strong> 88% der untersuchten Fruchtaufstriche mussten,<br />
vorrangig wegen fehlerhafter Kennzeichnung, beanstandet werden<br />
Viele Direktvermarkter sind bereits schon vor Jahren dazu übergegangen,<br />
ihre Produkte verstärkt als Fruchtaufstriche anzubieten,<br />
um die Regelungen der Konfitürenverordnung zu umgehen<br />
<strong>und</strong> den veränderten Ernährungsgewohnheiten des Ver brau chers<br />
Rechnung zu tragen. So bieten sie Erzeugnisse mit höheren Frucht -<br />
gehalten aber weniger Zucker an.<br />
Die Mehrzahl der untersuchten Proben stammte aus Hofläden,<br />
einige auch von örtlichen Märkten.<br />
Von insgesamt 40 Proben, darunter 14 Konfitüren <strong>und</strong> 26 Frucht -<br />
aufstriche, entsprachen lediglich drei den lebensmittelrechtlichen<br />
Vorschriften.
Alle Konfitüren sowie 88% der Fruchtaufstriche mussten beanstandet<br />
werden. Vorrangig handelte es sich um fehlerhafte Kennzeichnungen.<br />
Dazu zählten fehlende Mengenangaben der Früchte,<br />
unkorrekte Zutatenverzeichnisse, fehlende Losangaben sowie<br />
unvollständige Mindesthaltbarkeitsdaten. In drei Konfitüren wur -<br />
de eine für Konfitüren nicht zugelassene Konservierung mit Sor -<br />
binsäure festgestellt. Bei drei Fruchtaufstrichen fehlte die zugesetzte<br />
Sorbinsäure im Zutatenverzeichnis. Auch das Säuerungsmit -<br />
tel Citronensäure oder die Zutaten des Gelierzuckers waren bei<br />
einigen Proben nicht angegeben.<br />
In fünf Konfitüren wurde die vorgeschriebene lösliche Trocken -<br />
masse von 60% nicht erreicht.<br />
Einige Proben wiesen als Verkehrsbezeichnung lediglich die Frucht -<br />
sorte oder eine Fantasiebezeichnung wie »Winterzauber« oder<br />
»Kirsch-Gewürz« auf. Dies ist nicht ausreichend.<br />
Auffällig war auch ein Glas »Aprikosenfruchtaufstrich« mit deu tlich<br />
weniger Inhalt als deklariert <strong>und</strong> der Hauptzutat »Liebe«.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>8: Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstriche<br />
Anbieter<br />
überregionale<br />
Herstel -<br />
ler<br />
Direktvermarkter<br />
Produkt<br />
Konfitüren,<br />
Gelees<br />
Fruchtaufstriche<br />
Konfitüren,<br />
Gelees<br />
Fruchtaufstriche<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
122<br />
66<br />
14<br />
26<br />
Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
39 (32%)<br />
20 (30%)<br />
14 (100%)<br />
23 (88%)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Ein Löwenzahnblütengelee entsprach weder einem Frucht auf -<br />
strich noch einem Gelee im Sinne der Konfitürenverordnung.<br />
Löwenzahnblüten sind keine Früchte <strong>und</strong> können somit auch<br />
nicht zur Herstellung eines Fruchtaufstrichs oder eines Frucht gelees<br />
eingesetzt werden.<br />
Ein derartiges Erzeugnis darf nur als »Brotaufstrich« bezeichnet<br />
werden.<br />
In der nachfolgenden Tabelle werden Konfitüren <strong>und</strong> Frucht auf -<br />
striche von überregionalen Herstellern den Erzeugnissen von Di -<br />
rektvermarktern gegenüber gestellt.<br />
Weiß, H. (LI BS)<br />
61
62<br />
Prüfung von Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstrichen auf Trägerstoffe <strong>und</strong> Lactone als Nachweis<br />
für eine Aromatisierung<br />
Für Konfitüren <strong>und</strong> Gelees, die den Vorschriften der Konfitü ren -<br />
verordnung unterliegen, ist eine Aromatisierung nicht zugelassen.<br />
Fruchtaufstrichen dürfen dagegen Aromen zugesetzt werden.<br />
Dies erfordert allerdings eine Aufführung im Zutatenverzeich nis.<br />
Der Nachweis einer Aromatisierung kann z. B. über die Bestim -<br />
mung von Trägerstoffen <strong>und</strong> geschmacksbeeinflussenden Stof fen<br />
vorgenommen werden, die in der Aromenverordnung für Aro men<br />
zugelassen wurden. Dazu zählen u. a. die Trägerstoffe Benzyl al -<br />
kohol, Glycerintriacetat <strong>und</strong> Triethylcitrat sowie die geschmacksbeeinflussenden<br />
Stoffe Maltol <strong>und</strong> Ethylmaltol.<br />
35 verschiedene Konfitüren <strong>und</strong> Fruchtaufstriche wurden untersucht,<br />
darunter elf Himbeerkonfitüren <strong>und</strong> zehn Himbeerfrucht -<br />
aufstriche.<br />
In allen Proben waren die Stoffe Benzylalkohol, Triethylcitrat, Mal -<br />
tol <strong>und</strong> Ethylmaltol nicht nachweisbar.<br />
Glycerintriacetat wurde in 13 Proben festgestellt. Die Gehalte<br />
lagen zwischen 1,9 mg/kg <strong>und</strong> 7,4 mg/kg. Betroffen waren vor<br />
allem Konfitüren der Fruchtsorte Himbeere. Aber auch in einer<br />
Erdbeerkonfitüre, einer Ananaskonfitüre sowie in vier Zwei- <strong>und</strong><br />
Mehrfruchterzeugnissen konnte Glycerintriacetat nachgewiesen<br />
werden. Glycerintriacetat kommt nach Literaturrecherchen 1 in<br />
Früchten natürlicherweise nicht vor.<br />
Es wurde empfohlen, am jeweiligen Ort der Herstellung zu prüfen,<br />
ob während der Produktion eine Kontamination mit aromatisierten<br />
Erzeugnissen stattgef<strong>und</strong>en haben könnte. Da Gly ce rin -<br />
1 Literatur: Volatile Compo<strong>und</strong>s in Food. 7. Auflage 1996, TNO<br />
Nutrition and Food Research Institute, Zeist, Niederlande<br />
triacetat ausschließlich in Glasware nachgewiesen wurde, vermutete<br />
ein Hersteller die Ursache des Glycerintriacetatgehaltes in<br />
einem Übergang des Stoffes aus den verwendeten Deckeln. Der<br />
Hersteller wird dies weiter verfolgen.<br />
Bestimmte Aromastoffe, wie beispielsweise die so genannten Lactone,<br />
können in zwei chemisch identischen, physikalisch aber<br />
spiegelbildlich gebauten Formen auftreten. Ist ein Aromastoff<br />
natürlicher Herkunft, überwiegt meist eine der beiden Formen.<br />
In naturidentischen bzw. synthetischen Aromen liegen dagegen<br />
beide Formen üblicherweise zu gleichen Anteilen vor.<br />
In zwei der Himbeerkonfitüren, in denen das als Trägerstoff einsetzbare<br />
Glycerintriacetat enthalten war, wurde auch die aromaaktive<br />
Substanz γ-Decalacton nachgewiesen. Von den beiden<br />
möglichen Formen waren etwa gleiche Mengen vorhanden. Dies<br />
erhärtete die Vermutung, dass den Produkten ein synthetisches<br />
Aroma zugesetzt worden war<br />
Weiß, H.; Dr. Hausch, M. (LI BS)
Honig<br />
Heidehonig, ein Erzeugnis von regionaler Bedeutung<br />
Heidehonig ist eine herbwürzige Spezialität, die in Deutschland<br />
hauptsächlich in der Lüneburger Heide geerntet wird.<br />
Das Gebiet der Lüneburger Heide erstreckt sich zwischen Aller <strong>und</strong><br />
Elbe <strong>und</strong> ist die größte geschlossene Heidelandschaft Deutsch -<br />
lands. Sie ist ein Teil der Niedersächsischen Geest, einer ab wechslungsreichen<br />
Landschaft mit feuchten Niederungen <strong>und</strong> sandigen<br />
Siedlungsinseln.<br />
Entstanden ist diese Heidelandschaft als Folge menschlichen Eingriffs<br />
in die Natur. Übermäßiger Holzeinschlag, Überweidung <strong>und</strong><br />
das Abtragen ganzer Bodenschichten ließen die Landschaft im -<br />
mer mehr veröden. Das typische Bild der Heide ist daher geprägt<br />
durch Grasflächen mit Wacholderbüschen, Ginster <strong>und</strong> Birken -<br />
bäumchen.<br />
Die Trachtpflanze für Heidehonig kann sowohl Besenheide (Cal -<br />
luna vulgaris) als auch Glockenheide (Erica spec.) sein. In der Lüneburger<br />
Heide ist jedoch, wie in ganz Mittel- <strong>und</strong> Nordeuropa,<br />
die Besenheide die häufigere Trachtpflanze, Erica-Arten sind nur<br />
vereinzelt vorhanden. Bei einem deutschen Heidehonig ist somit<br />
ein Erzeugnis aus der Besenheide zu erwarten. Schwerpunkt der<br />
Anforderung durch das Lebensmittelinstitut Braunschweig war<br />
da her die gezielte Probenahme bei in der Lüneburger Heide an -<br />
sässigen Imkern.<br />
Der Honig der Besenheide hat ein würziges, herbes, mitunter säuerliches<br />
Aroma. Seine Farbe variiert von rötlichbraun <strong>und</strong> bern -<br />
steinfarben bis hin zu beige. Bedingt durch einen hohen Anteil<br />
kolloidaler Bestandteile wie Proteine, Glucoproteine <strong>und</strong> Muco -<br />
polysaccharide besitzt er eine charakteristische geleeartige Kon -<br />
sistenz. Ein solcher Honig ist nur nach einer besonderen Behandlung,<br />
dem sogenannten »Stippen« schonend zu schleudern. Dabei<br />
geht durch mehrmaliges Eindrücken <strong>und</strong> Herausziehen von<br />
Metallstiften in den einzelnen Wabenzellen der Honig kurzfristig<br />
vom Gel- in den flüssigen Sol-Zustand über. Später kehrt der Honig<br />
dann in den Gel-Zustand zurück. Dieses reversible Verhalten<br />
wird als »Thixotropie« bezeichnet <strong>und</strong> dient als Kriterium zur<br />
Differenzierung von Besenheide- <strong>und</strong> Erica-Honigen.<br />
Heidehonig wird, bedingt durch diese Eigenschaft, häufig auch<br />
ungeschleudert in Form einer gefüllten Honigwabe (Scheiben -<br />
honig) oder als Presshonig angeboten.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Die Ergänzung der Bezeichnung Honig durch die Angabe der<br />
Trachtquelle ist gemäß Honigverordnung dann möglich, wenn<br />
der Honig vollständig oder überwiegend den genannten Blüten<br />
oder Pflanzen entstammt <strong>und</strong> die entsprechenden organoleptischen,<br />
physikalisch-chemischen <strong>und</strong> mikroskopischen Merkmale<br />
aufweist.<br />
Charakteristische Eigenschaften für Besenheidehonig sind eine<br />
für Blütenhonige ungewöhnlich hohe elektrische Leitfähigkeit,<br />
ein erhöhter Wassergehalt sowie das thixotrope Verhalten. Über<br />
diese Parameter hinaus wurden der HMF-Gehalt sowie die Di a stase-<br />
<strong>und</strong> Saccharaseaktivität als Maßstab für eine Wärme schä di -<br />
gung untersucht. Ergänzend wurden Präparate der Honige mi -<br />
kroskopiert.<br />
Bei zehn von den 19 zur Untersuchung eingereichten Proben musste<br />
eine Beanstandung ausgesprochen werden.<br />
Vier der als Heidehonig bezeichneten Honige wiesen kein thixotropes<br />
Verhalten auf, darunter ein Honig mit der Auslobung »aus<br />
Besenheide«, sowie ein Erzeugnis mit dem Hinweis »aus der Lü -<br />
neburger Heide«. Die Leitfähigkeit des letzteren Erzeugnisses<br />
entsprach ebenfalls nicht den Anforderungen. Wegen eines er -<br />
höhten HMF-Gehaltes mussten zwei Heidehonige beanstandet<br />
werden. Ein Honig fiel im Rahmen der Untersuchung durch einen<br />
sehr hohen Anteil unlöslicher Partikel auf. Der zulässige Höchst -<br />
gehalt an wasserunlöslichen Stoffen für Presshonige wurde überschritten.<br />
Weitere Beanstandungsgründe betrafen Kennzeichnungs män gel<br />
wie z. B. die fehlende oder mangelhafte Angabe des Mindest -<br />
haltbarkeitsdatums oder des Herkunftslandes.<br />
Dr. Bronner, M. (LI BS)<br />
63
64<br />
Süßwaren, Desserts<br />
Speiseeis aus Eisdielen<br />
An heißen Tagen ist es der Renner: Speiseeis aus Eisdielen. Aber<br />
auch wenn die Sonne nicht ganz so brennt, erfreut es sich großer<br />
Beliebtheit bei kleinen <strong>und</strong> großen Verbrauchern, die aus einem<br />
umfangreichen Sortiment wählen können. Einige lose ab -<br />
gegebene Speiseeissorten wurden im Jahr 2007 genauer unter<br />
die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass die gesetzlichen<br />
Regelungen nicht immer eingehalten wurden.<br />
ACE-Eis: Vitaminauslobung verboten<br />
Die Anreicherung von Lebensmitteln mit Vitaminen macht auch<br />
vor dem Speiseeissektor nicht halt. So ist inzwischen ein so ge -<br />
nanntes »ACE-Eis« auf dem Markt, das – wie die Verkehrs be zeichnung<br />
sagt – die Vitamine A, C <strong>und</strong> E enthalten soll. Fünf dieser<br />
Proben wurden im Sommer 2007 zur Untersuchung eingereicht,<br />
alle fünf Proben waren nicht verkehrsfähig.<br />
Einer der Gründe dafür ist, dass Lebensmittel mit Vitaminzu sätzen<br />
nur in Fertigpackungen in den Verkehr gebracht werden dürfen.<br />
Darüber hinaus erwartet der Verbraucher natürlich nennenswerte<br />
Gehalte an den genannten Vitaminen. Diese Erwartung wur -<br />
de enttäuscht. So war in drei Proben gar kein Vitamin C enthalten,<br />
die beiden anderen Proben wiesen nur geringe Mengen an<br />
Vitamin C auf. Vitamin E war in einer Probe ebenfalls nicht nachweisbar,<br />
in drei Proben lag der Gehalt niedrig. Lediglich eine Pro -<br />
be enthielt eine signifikante Menge an Vitamin E in 100 g. Die<br />
Vitamin A-Gehalte wurden nicht überprüft.<br />
Stracciatella-Eis <strong>und</strong> After Eight-Eis: tatsächlich mit<br />
Schokostückchen?<br />
Bei Stracciatella-Eis handelt es sich um Milchspeiseeis mit Scho -<br />
kostückchen – so denkt man, <strong>und</strong> so sieht es ja auch aus. Tat -<br />
sächlich wird sehr häufig anstelle von Schokolade kakaohaltige<br />
Fettglasur verwendet. Das ist erlaubt, solange diese Ab weich ung<br />
kenntlich gemacht wird.<br />
Bei Untersuchungen von lose abgegegeben Speiseeissorten wurde<br />
festgestellt, dass gesetzliche Regelungen nicht immer eingehalten<br />
wurden<br />
Im Berichtszeitraum wurden 27 Proben Stracciatella-Eis <strong>und</strong> After<br />
Eight-Eis bzw. Pfefferminz-Eis untersucht. Zwölf Proben mussten<br />
wegen fehlender Kenntlichmachung der kakaohaltigen Fettgla sur<br />
beanstandet werden. Nur eine Probe enthielt tatsächlich Schokoladenstückchen.<br />
Fruchtgehalt in Zitroneneis<br />
Nach den Leitsätzen für Speiseeis <strong>und</strong> Speiseeishalberzeugnisse<br />
weist Zitroneneis einen Fruchtgehalt von mindestens 10% auf.<br />
Von 21 untersuchten losen Proben entsprachen nur elf dieser Vor -<br />
gabe. Zehn Proben mussten aufgr<strong>und</strong> eines zu niedrigen Frucht -<br />
anteils beanstandet werden, der analytisch anhand der Parame -<br />
ter Kalium <strong>und</strong> D-Iso-Citronensäure ermittelt wurde.<br />
Farbstoffdeklaration<br />
Fruchteis weist häufig eine intensive Farbe auf, die durch den<br />
Fruchtanteil <strong>und</strong>/oder durch synthetische Farbstoffe hervorgerufen<br />
wird. Bei solchen Farbstoffen handelt es sich um Zusatz stof -<br />
fe, die bei loser Abgabe kenntlich gemacht werden müssen.
2007 wurden 26 farbige lose Speiseeisproben untersucht, bei<br />
de nen keine Farbstoffe angegeben waren. Bei neun Proben wurden<br />
wir fündig: Sie enthielten synthetische Farbstoffe <strong>und</strong> wurden<br />
wegen der fehlenden Kenntlichmachung beanstandet.<br />
Silber in Speiseeis<br />
Im Jahr 2007 wurden im Lebensmittelinstitut Braunschweig lose<br />
Eisproben auf Silber untersucht. Silber <strong>und</strong> seine Verbindungen<br />
besitzen antimikrobielle Wirkung.<br />
Zwar ist es gemäß den Vorschriften der Zusatzstoff-Zulassungs -<br />
verordnung (ZZulV) verboten, Silberverbindungen als Zusatz stoffe<br />
bei der Herstellung von Speiseeis zu verwenden, jedoch wird<br />
Speiseeis nach den Leitsätzen für Speiseeis <strong>und</strong> Speiseeis halber -<br />
zeug nisse auch unter Verwendung von Trinkwasser hergestellt.<br />
Trinkwasser darf gr<strong>und</strong>sätzlich nicht durch Silber <strong>und</strong> seine Ver -<br />
bindungen aufbereitet werden. Nur im Ausnahmefall darf es als<br />
Zusatz zu Trinkwasser zum Zwecke der Konservierung verwendet<br />
werden. Diese Ausnahme gilt jedoch nur für den nicht systematischen<br />
Gebrauch <strong>und</strong> mit einer Höchstmenge von 0,08 mg/l<br />
(§ 6a in Verbindung mit Anlage 6a Spalte 2 ZZulV).<br />
Im Allgemeinen ist somit davon auszugehen, dass ein Hersteller<br />
von Speiseeis das für die Herstellung benötigte Trinkwasser der<br />
öffentlichen Trinkwasserversorgung entnimmt. Dieses ist bereits<br />
aufbereitet (ohne Silber), eine ergänzende Desinfektion des Trinkwassers<br />
ist daher nicht erforderlich <strong>und</strong> auch nicht zulässig.<br />
Bekannt ist, dass zur Reinigung von Lebensmittelbedarfs gegen -<br />
ständen u. a. auch silberhaltige Desinfektionsmittel (wie beispielsweise<br />
Micropur) verwendet werden. Wird bei der Abgabe des<br />
Eises an den Verbraucher ein Eisportionierer benutzt, der gegebenenfalls<br />
mit Hilfe von derartigem silberhaltigen Desinfekti ons -<br />
mittel gereinigt wird, muss sichergestellt sein, dass keine Be standteile<br />
dieses Desinfektionsmittels auf das Lebensmittel übergehen.<br />
Ein gründliches Abspülen mit unbelastetem Trinkwasser ist da her<br />
unerlässlich.<br />
Insgesamt wurden 35 Eisproben auf Silber untersucht. Bei vier Eisproben<br />
wurden Silbergehalte von 0,011 - 0,017 mg/kg er mit telt.<br />
In diesen Fällen wurden Mitteilungen an die jeweiligen Über wa -<br />
chungsbehörden ausgesprochen mit dem Hinweis, eine Prüf ung<br />
vor Ort vorzunehmen. In drei Eisproben wurden Silbergehalte von<br />
0,172 mg/kg, 0,694 mg/kg sowie 0,781 mg/kg festgestellt. Sil -<br />
ber in derartigen Größenordnungen wurde als nicht zugelassener<br />
Zusatzstoff im Sinne von § 6 (1) LFGB beurteilt <strong>und</strong> beanstandet.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Spezielle Beprobung von Speiseeisherstellern im Land kreis<br />
Göttingen<br />
Im Zuständigkeitsbereich des Veterinär- <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> -<br />
amtes des Landkreises Göttingen gab es in den zurückliegenden<br />
Jahren eine Häufung von Keimbelastungen in Speiseeis aus Eis -<br />
dielen. Hierbei handelte es sich vorwiegend um coliforme Keime<br />
(Fäkalkeime).<br />
Dies wurde zum Anlass genommen, um im Berichtszeitraum ge -<br />
zielte Beprobungen durchzuführen. Dazu wurden Betriebe ausgewählt,<br />
die in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen<br />
waren.<br />
Insgesamt wurden 17 Milcheisproben inklusive Nachproben un -<br />
tersucht. Fünf Proben mussten aufgr<strong>und</strong> ihres Gehaltes an coliformen<br />
Keimen beanstandet werden. In einem Fall wurde auch<br />
die Nachprobe wegen überhöhter Keimbelastung (E. coli) beanstandet.<br />
Zusätzlich wurden in Zusammenarbeit mit dem Ges<strong>und</strong>heitsamt<br />
Göttingen <strong>und</strong> einem beliehenen Unternehmen zwei Wasserproben<br />
bei einem Speiseeishersteller entnommen, der in der Ver gan -<br />
genheit häufig durch Beanstandungen aufgefallen war. In der ers -<br />
ten Wasserprobe wurde eine geringe E. coli-Belastung festgestellt.<br />
Die kurz darauf gezogene zweite Wasserprobe aus der Trink wasserleitung<br />
in der Eisherstellung wurde nicht beanstandet.<br />
Die dargestellte Problematik verdeutlicht, dass dieses Thema wei -<br />
terhin - <strong>und</strong> nicht nur im Landkreis Göttingen - besondere Auf -<br />
merksamkeit verdient.<br />
Die Ergebnisse aller mikrobiologischen Untersuchungen von Spei -<br />
seeisproben aus <strong>Niedersachsen</strong> sind in Kapitel 4 Tabelle 4.49 un ter<br />
»Mi krobiologische Untersuchungen« aufgeführt.<br />
Dr. Nutt, S. (LI OL); Geßener, C. (LI BS); Krause, K. (LK Göttingen)<br />
65
66<br />
Vitaminzusätze bei Bonbons <strong>und</strong> Weingummis<br />
Sie sind beliebt bei Alt <strong>und</strong> Jung, <strong>und</strong> das nicht nur zur Karne -<br />
vals zeit: Hart- <strong>und</strong> Weichkaramellen <strong>und</strong> Weingummis in den<br />
verschiedensten Farben, Formen <strong>und</strong> Geschmacksrichtungen sind<br />
in den Supermärkten in reicher Auswahl zu finden. Und ganz besonders<br />
gern greift man zu, wenn sie auch noch einen »ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Zusatznutzen« versprechen, wie die Vitaminisierung<br />
von Lebensmitteln im Fachjargon auch genannt wird.<br />
Im Jahr 2007 wurden verschiedenste Süßwaren mit einem ausgelobten<br />
Vitaminzusatz auf ihren tatsächlichen Vitamingehalt<br />
überprüft. Untersucht wurde auf die wasserlöslichen Vitamine<br />
B1, B2, B6, C <strong>und</strong> Niacin sowie das fettlösliche Vitamin E. Eine<br />
Zusammenfassung der Ergebnisse ist in den Tabellen <strong>3.</strong>9 <strong>und</strong> <strong>3.</strong>10<br />
dargestellt.<br />
Beanstandet wurden Proben, die einen um mehr als 20% geringeren<br />
Vitamingehalt aufwiesen, als auf den Verpackungen an -<br />
gegeben war (Toleranz bei Vitamin E: 30%), sowie Proben, die<br />
annähernd das Doppelte oder mehr von den deklarierten Werten<br />
enthielten.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>9: Anzahl der untersuchten <strong>und</strong> der beanstandeten<br />
Proben, differenziert nach Vitaminunter-<br />
<strong>und</strong> -überdosierungen<br />
Vitamin Anzahl der<br />
Proben<br />
Vitamin B1<br />
Vitamin B2<br />
Vitamin B6<br />
Niacin<br />
Vitamin C<br />
Vitamin E<br />
11<br />
12<br />
27<br />
20<br />
47<br />
12<br />
Vitamingehalte<br />
zu niedrig<br />
–<br />
5<br />
–<br />
1<br />
–<br />
1<br />
Vitamingehalte<br />
zu hoch<br />
–<br />
–<br />
6<br />
3<br />
3<br />
1<br />
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Hersteller in der Regel die<br />
Mengen an Vitaminen zusetzen, die sie auch ausloben, ja dass<br />
sie sogar eher zu viel zudosieren.<br />
Über Sinn <strong>und</strong> Unsinn von Vitaminzusätzen bei Süßwaren mag<br />
sich der Leser seine eigene Meinung bilden.<br />
Zum Vergleich sind die in den Produkten deklarierten <strong>und</strong> er mittelten<br />
Gehalte je 100 g Süßware sowie die empfohlenen Tages -<br />
dosen der einzelnen Vitamine für Erwachsene mit aufgeführt. Fakt<br />
ist, dass laut Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für<br />
Ernährung der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung mehr als<br />
ausreichend mit den meisten Vitaminen versorgt ist. Eine Aus nahme<br />
bildet u. a. das Vitamin E, dessen Referenzwert bei einigen<br />
Altersgruppen im Durchschnitt nicht erreicht wird. Jeder mag<br />
selbst entscheiden, ob er dieses Defizit anstatt durch eine an<br />
Pflanzenölen reiche Mischkost durch Süßwaren decken möchte.<br />
Dr. Nutt S. (LI OL)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>10: Vergleich der deklarierten <strong>und</strong> der tatsächlich<br />
enthaltenen Mengen <strong>und</strong> die empfohlene Tagesdosis für<br />
Erwachsene<br />
Vitamin deklarierte<br />
Mengen<br />
[mg/100 g]<br />
Vitamin B1<br />
Vitamin B2<br />
Vitamin B6<br />
Niacin<br />
Vitamin C<br />
Vitamin E<br />
0,2 – 5,8<br />
0,4 – 7,1<br />
0,4 – 6,5<br />
9 – 70<br />
15 – 958<br />
10 – 45<br />
analysierte<br />
Mengen<br />
[mg/100 g]<br />
0,3 – 6,5<br />
0,1 – 7,3<br />
0,6 – 10,2<br />
8 – 95<br />
15 – 895<br />
10 – 76<br />
empfohlene<br />
Tagesdosis<br />
1,4 mg<br />
1,6 mg<br />
2,0 mg<br />
18 mg<br />
60 mg<br />
10 mg
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Nahrungsergänzungsmittel (NEM)<br />
Entwicklungen im Nahrungsergänzungsmittelbereich<br />
Vor einigen Jahren setzten sich so genannte NEM in erster Linie<br />
aus Vitaminen <strong>und</strong> Mineralstoffen, später dann auch aus Spu renelementen<br />
zusammen, bekannt als Brausetabletten aber vereinzelt<br />
auch in Form von Kapseln. Diese Präparate haben nach wie<br />
vor ihre Bedeutung <strong>und</strong> einen hohen Stellenwert, treten aber zunehmend<br />
in den Hintergr<strong>und</strong>. Heute nimmt der Anteil an NEM<br />
mit sonstigen Stoffen rasant zu <strong>und</strong> beherrscht den Markt. Die<br />
Ursache für diese Entwicklung findet sich in erster Linie in der<br />
Nahrungsergänzungsmittel-Richtlinie wieder, nach der seit 2002<br />
auch eine legalrechtliche Definition für NEM enthalten ist, in der<br />
neben den Nährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe <strong>und</strong> Spuren ele -<br />
mente) auch sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder phy -<br />
siologischer Wirkung als Zutaten für NEM mit aufgenommen worden<br />
sind. Dies war der Startschuss für die Entwicklung <strong>und</strong> Ver -<br />
marktung neuer NEM, die aus Pflanzen- oder Kräuterextrakten<br />
bestehen. Mittlerweile handelt es sich um Zutaten/Extrakte, die<br />
ursprünglich in der traditionellen Medizin (China, Indien, Süd a -<br />
merika, Afrika) eingesetzt werden, jedoch in Europa als NEM <strong>und</strong><br />
damit als Lebensmittel im Sinne der Basisverordnung in den Ver -<br />
kehr gebracht werden. Ein Großteil dieser Zutaten wird als Funktionsarzneimittel<br />
eingestuft, soweit eine pharmakologische Wir -<br />
kung zu erwarten ist. Zumindest handelt es sich bei den überwiegenden<br />
Stoffen um neuartige Lebensmittel, die von dem Her steller<br />
bzw. Inverkehrbringer bei der Europäischen Kommission an -<br />
gezeigt <strong>und</strong> ein EU-Zulassungsverfahren im Sinne der VO (EG)<br />
Nr. 258/1997 durchlaufen müssen.<br />
Beurteilung der ges<strong>und</strong>heitlichen Unbedenklichkeit<br />
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es dringend geboten, dass NEM<br />
– insbesondere bei der Verwendung von komplexen Extrakten aus<br />
pflanzlichem oder tierischem Material - bezüglich der verwendeten<br />
Rohstoffe, der Herstellungsverfahren <strong>und</strong> der relevanten isolierten<br />
bzw. angereicherten Inhaltsstoffe hinreichend gut charakterisiert<br />
sind. NEM sind nicht zur Therapie von Erkrankungen be -<br />
stimmt <strong>und</strong> müssen auch bei längerfristigem Verzehr sicher sein.<br />
Anders als bei Arzneimitteln ist bei NEM weder eine fachliche<br />
Beratung oder begleitende Überprüfung der Verträglichkeit vorgesehen,<br />
noch werden in der Kennzeichnung der Erzeugnisse<br />
Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen an den Verbraucher wei -<br />
tergegeben. Häufig sind jedoch Wirkungen <strong>und</strong> Wirkmecha nis -<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
men der in NEM verwendeten Stoffe nicht angemessen untersucht<br />
<strong>und</strong> zuverlässige Daten zu Aufnahmemengen von relevanten<br />
Inhaltsstoffen <strong>und</strong> deren Bioverfügbarkeit sind teilweise kaum<br />
vorhanden.<br />
Die Europäische Kommission hat die Dringlichkeit erkannt <strong>und</strong><br />
kürzlich eine Übersicht bezüglich der Sicherheitsbewertung von<br />
Pflanzen <strong>und</strong> pflanzlichen Inhaltsstoffen als Entwurf veröffentlicht<br />
mit dem Hintergr<strong>und</strong>, deren Verwendung in NEM zu harmonisieren.<br />
Am 17. Dezember 2007 hat die EFSA unter dem Titel<br />
»Safety assessment of botanicals and botanical preparations for<br />
the use as food supplements« zur öffentlichen Konsultation aufgerufen<br />
(http://www.efsa.europa.eu).<br />
Beispiele von Beanstandungen des Jahres 2007<br />
Als Funktionsarzneimittel wurden als NEM ausgelobte Produkte<br />
beurteilt, die Artischockenblätterextrakt, Weihrauchextrakt, Zimt<br />
bzw. Zimtextrakt in Kapseln oder Tabletten zur Blutzucker sen kung<br />
oder aber Sägepalmenextrakt enthielten.<br />
Als neuartige Lebensmittelzutaten wurden Hoodia-Extrakte, der<br />
Raupenpilz (Cordicep sinensis), Perillaöl <strong>und</strong> die in der Ayurve di -<br />
schen Medizin verwendeten Pflanzen Tinospora cordifolia <strong>und</strong><br />
Woodfordia fruticosa eingestuft.<br />
Beispiele beanstandeter krankheitsbezogener Werbeaussagen<br />
sind: »Schmerzen, beispielsweise durch Verstauchungen oder<br />
Hexenschuss, Rheuma <strong>und</strong> auch Menstruationsbeschwerden,<br />
sollen gelindert werden«; »wirkt krampflösend, schmerzstillend<br />
<strong>und</strong> antibakteriell«; »schützt gegen Strahlenbelastung (z. B. Che -<br />
motherapie)«.<br />
67
68<br />
Langkettige Omega-3-Fettsäuren in Form von EPA <strong>und</strong> DHA aus<br />
Fischöl wurden bisher als Cholesterin senkend ausgelobt. Nach<br />
Auswertung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur zeigte<br />
sich, dass sie jedoch nur erhöhte Triglyceride senken, nicht aber<br />
Cholesterin. Entsprechende Auslobungen wurden daher beanstan<br />
det.<br />
Im vergangenen Jahr wurden 35 gemäß §5 NemV beim B<strong>und</strong>esamt<br />
für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (BVL) neu<br />
angezeigte NEM eingeliefert, untersucht <strong>und</strong> bewertet. Von diesen<br />
35 Proben mussten 28 beanstandet werden.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>11: Beanstandungen von NEM<br />
Beanstandungen<br />
Gr<strong>und</strong>/Rechtsgr<strong>und</strong>lage<br />
irreführende Angaben<br />
krankheitsbezogene Angaben<br />
Kennzeichnungsverstöße<br />
nicht zugelassene Zusatzstoffe<br />
Kenntlichmachung von Zusatzstoffen<br />
keine Lebensmittel i. S. VO (EG) Nr. 178/2002<br />
neuartige Lebensmittel i. S. VO (EG) Nr. 258/97<br />
Anzahl<br />
73<br />
6<br />
54<br />
67<br />
3<br />
19<br />
6<br />
BVerwG-Urteil Leipzig Juli 2007<br />
In den letzten Jahren wurde eine zum Teil erbittert geführte Auseinandersetzung<br />
um die Auslegung des Begriffs »Zusatzstoff«<br />
im deutschen <strong>und</strong> europäischen Lebensmittelrecht geführt. Auslöser<br />
ist nicht zuletzt die Nahrungsergänzungsmittel-Richtlinie,<br />
mit der als mögliche Zutaten für NEM neben den Nährstoffen<br />
»sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer<br />
Wirkung« eingeführt wurden.<br />
Aus Pflanzen gewonnene Extrakte mit Inhaltsstoffen, die gegenüber<br />
der ursprünglichen Zusammensetzung in angereicherter oder<br />
isolierter Form vorliegen, wurden hier in der Vergangenheit als<br />
nicht zugelassene Zusatzstoffe eingestuft. Nach dem Urteil des<br />
B<strong>und</strong>esverwaltungsgerichts Leipzig muss diese Einstufung neu<br />
diskutiert werden.<br />
Dr. Täubert, Th.; Dr. Schmidt, E.; Maslo, R.; Dr. Held, R. (LI BS)
Getränke/Wasser<br />
Wie hygienisch sind Watercooler?<br />
Seit einigen Jahren erfreuen sich Wasserspender, auch »Water -<br />
cooler« genannt, zunehmender Beliebtheit. Inzwischen findet<br />
man sie fast überall, in Kaufhäusern, Banken, Apotheken <strong>und</strong><br />
Baumärkten. Sie sind als kostenloser <strong>und</strong> bequemer Service für<br />
den Verbraucher gedacht, denn sie bieten die praktische Mög -<br />
lichkeit, den Durst unterwegs schnell, sozusagen im Vorbei ge hen,<br />
zu löschen. Doch wie sieht es mit dem hygienischen Status des<br />
entnommenen Wassers aus?<br />
Watercooler sind freistehende Geräte, die über eine aufgesetzte<br />
Flasche als Wasserreservoir mit zumeist Quell- <strong>und</strong> Tafelwas -<br />
ser verfügen. Am Lebensmittelinstitut Braunschweig wurden im<br />
Jahr 2007 insgesamt 19 Proben aus diesem Marktsegment un -<br />
tersucht. Zur rechtlichen Beurteilung wurde die Mineral- <strong>und</strong> Tafelwasserverordnung<br />
(MTV) herangezogen. In mehr als 45% der<br />
Fälle (neunmal) wurden erhöhte Gesamtkeimzahlen (GKZ) festgestellt.<br />
In drei Proben waren zusätzlich Coliforme Keime nachweisbar.<br />
Erhöhte Gesamtkeimgehalte allein stellen aus fachlicher Sicht<br />
noch keine direkte ges<strong>und</strong>heitliche Gefahr für den Konsu men -<br />
ten dar. Vielmehr sind sie ein Hinweis auf allgemeine Hygiene -<br />
mängel <strong>und</strong> zeigen eine allgemeine Verschlechterung der Qua -<br />
lität des abgegebenen Wassers an. Hinzu kommt, dass gemäß<br />
MTV die GKZ innerhalb von zwölf St<strong>und</strong>en nach Abfüllung zu untersuchen<br />
ist, dies ist in der Regel bei Watercoolern mit einem<br />
Wasserreservoir nicht möglich. Bei der Beurteilung muss zusätzlich<br />
berücksichtigt werden, dass in anderen Produkten z. T. deutlich<br />
höhere Keimzahlen toleriert werden. Da es sich bei den er -<br />
mittelten GKZ nur um geringfügige Überschreitungen handelte,<br />
wurde aus den genannten Gründen auf eine Beanstandung verzichtet<br />
<strong>und</strong> lediglich auf den Mangel hingewiesen. Anders verhält<br />
es sich bei der Beurteilung von Coliformen Keimen. Sie stellen<br />
Schmutzindikatoren dar. Ihr Nachweis deutet auf Mängel in<br />
der Aufbereitung, in den Behältnissen bzw. dem Gerät hin. Sie<br />
sind in hygienisch einwandfreiem Wasser aus Watercoolern in<br />
250 ml nicht nachweisbar. Diese Proben mit positivem Bef<strong>und</strong><br />
wurden entsprechend beanstandet.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Die German Bottled Watercooler Association (GBWA) hat Leitli -<br />
ni en zur Guten Hygiene-Praxis für Watercooler-Unternehmen verfasst<br />
<strong>und</strong> damit ein Instrument zur Standardisierung bezüglich<br />
der Hygieneanforderungen geschaffen. Berücksichtigung finden<br />
nicht nur der gesamte Herstellungsprozess einschließlich Desin -<br />
fektion <strong>und</strong> Reinigung der Behältnisse <strong>und</strong> Abfüllanlagen, sondern<br />
auch Angaben zur Standortwahl sowie zur Wartung, Rei -<br />
nigung <strong>und</strong> Desinfektion von bereits aufgestellten <strong>und</strong> in Betrieb<br />
befindlichen Watercoolern. Auf die mikrobiologischen Kriterien<br />
der MTV wird ausdrücklich Bezug genommen. In den Leitlinien<br />
ist die Standzeit der Behälter bisher jedoch nicht geregelt. Ent -<br />
schei dend für eine einwandfreie Beschaffenheit ist ein verantwortungsvoller<br />
Umgang hinsichtlich Reinigung, Desinfektion, War -<br />
tung <strong>und</strong> Inspektion der Wasserspender sowie der Standort be -<br />
din gungen von Seiten der Hersteller sowie des Personals der aufstellenden<br />
Einrichtung (z. B. Kaufhaus). Und auch der Konsu ment<br />
selbst kann durch sein Verhalten zur einwandfreien Hygiene beitragen.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der Untersuchungsergebnisse werden am Lebens mittelinstitut<br />
Braunschweig auch zukünftig Wässer aus Water coolern<br />
untersucht werden.<br />
Dr. Schmidt, A.; Dr. de Wreede, I. (LI BS)<br />
69
70<br />
Untersuchung von weißem Rum aus Anbruchflaschen in Gaststätten<br />
Niedersächsische Gastwirte sind ehrlich<br />
Vergleichende Untersuchungen von original verschlossenen Flaschen<br />
<strong>und</strong> Anbruchflaschen von weißem Rum der gleichen Marke<br />
aus Gaststätten haben keinen Verdacht im Hinblick auf eine mögliche<br />
Täuschung des Verbrauchers ergeben.<br />
Der Authentizitätsnachweis erfolgte über den Gehalt an Anio nen.<br />
Das Anionenspektrum der Erzeugnisse verrät die Herkunft der<br />
Getränke. Das Rumdestillat ist zunächst völlig frei von Mineral -<br />
stoffen. Beim Fertigstellen wird das hochprozentige Destillat mit<br />
(teil)entmineralisiertem Wasser auf Trinkstärke herabgesetzt. Die -<br />
ses (teil)entmineralisierte Wasser wird charakterisiert durch das<br />
verwendete Wasser <strong>und</strong> die Art der Aufbereitung (bzw. auch die<br />
Ansprüche des Herstellers an die Wasseraufbereitung).<br />
Untersucht wurden insgesamt 22 Anbruchflaschen weißen Rums,<br />
die in 17 Landkreisen entnommen wurden.<br />
Anlass für die Probenanforderung waren die Untersuchungen ei -<br />
nes weißen Rums <strong>und</strong> eines Weinbrandes aus einer Gaststätte im<br />
März 2007. Bei diesen begründeten Untersuchungen stellte sich<br />
heraus, dass der Inhalt nicht der Bezeichnung entsprach. Es handelte<br />
sich, wie sich auch an den zu niedrigen Alkoholgehalten<br />
zeigte, nicht um die allseits bekannten Markenspirituosen. Der<br />
weiße Rum enthielt deutlich mehr Chlorid, Nitrat <strong>und</strong> Sulfat als<br />
andere Proben dieser Marke.<br />
Das staatsanwaltliche Verfahren gegen die Gaststätte ist z. Z.<br />
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.<br />
Borck-Strohbusch, C.; Zehmer, H.; Fischer, M. (LI BS)<br />
Vergleichende Untersuchungen von original verschlossenen Flasch en<br />
<strong>und</strong> An bruchflaschen von weißem Rum der gleichen Marke haben keinen<br />
Ver dacht im Hinblick auf eine mög liche Täuschung des Verbrauchers<br />
erge ben
Getränke wandeln sich von Durstlöschern zu multifunktionalen<br />
Lebensmitteln. Das moderne Getränk soll zusätzlich ges<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
im Geschmack ansprechend sein, den Organismus nicht belasten<br />
<strong>und</strong> einen geringen Brennwert aufweisen. Natürlichkeit <strong>und</strong><br />
M<strong>und</strong> gefühl sind die neuen Schlagworte. Im Trend liegen Erfri -<br />
schungsgetränke, die aus Mineralwasser mit Zusatz von Aro men<br />
hergestellt werden. Sie werden überwiegend in farblosen PET-<br />
Flaschen angeboten <strong>und</strong> unterstreichen dadurch den »leichten«<br />
Charakter. Da der Konsument ein süß schmeckendes Erzeugnis<br />
bevorzugt, wird diesen Getränken eine geringe Menge an Zucker<br />
zugesetzt. Der Zuckerzusatz ist dabei so begrenzt, dass eine Werbung<br />
mit »kalorienarm« zulässig bleibt. Der Vorteil gegenüber<br />
dem Zusatz von künstlichen Süßstoffen liegt darin, dass diese<br />
Er zeugnisse durch den Zuckerzusatz beim Trinken ein besseres<br />
M<strong>und</strong>gefühl aufweisen. Allerdings sind diese Getränke, bedingt<br />
durch ihre Zusammensetzung, in mikrobiologischer Hinsicht in -<br />
stabil, sodass sie konserviert werden müssen. Obwohl der Trend<br />
zur »Natürlichkeit« weiterhin gegeben ist, erobern diese mit Kon -<br />
servierungsstoffen versetzten Getränke zunehmend den Markt.<br />
Den alkoholfreien Erfrischungsgetränken dürfen nach den Vor -<br />
schriften der Zusatzstoffzulassungsverordnung die Konser vie rungsstoffe<br />
Benzoe- <strong>und</strong> Sorbinsäure <strong>und</strong> die entsprechenden Salze<br />
bis zu festgelegten Höchstmengen zugesetzt werden. Auf den<br />
Fertigpackungen müssen sie im Zutatenverzeichnis mit dem Klassennamen<br />
Konservierungsstoff gefolgt von dem Namen oder der<br />
entsprechenden E-Nummer gekennzeichnet werden.<br />
In Studien konnte inzwischen zweifelsfrei nachgewiesen werden,<br />
dass Benzol in alkoholfreien Erfrischungsgetränken aus dem Kon -<br />
servierungsstoff Benzoesäure <strong>und</strong> Ascorbinsäure gebildet werden<br />
kann. Ascorbinsäure wird als Antioxidationsmittel zugesetzt oder<br />
ist als natürliches Vitamin C vorhanden. Der in diesen Geträn ken<br />
übliche pH-Wert von ca. 3,5 begünstigt diese Bildung. Benzol<br />
wirkt krebserregend <strong>und</strong> keimzellschädigend, deshalb sollte im<br />
Sinne des vorbeugenden <strong>Verbraucherschutz</strong>es der Benzolgehalt<br />
in Lebensmitteln nach Möglichkeit minimiert oder besser nicht<br />
mehr nachweisbar sein. Für Trinkwasser besteht ein Grenzwert<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Konservierungsstoffe in alkoholfreien Getränken – Trends, Abbau <strong>und</strong> Verstöße<br />
von 1 µg/L. Im Rahmen eines b<strong>und</strong>esweiten Überwachungs pro -<br />
grammes wurde der Benzolgehalt in alkoholfreien Getränken ermittelt.<br />
In der Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse der Proben<br />
dargestellt, die sowohl Benzoesäure als auch Ascorbinsäure<br />
enthielten. In Getränken, in denen einer dieser Stoffe oder bei de<br />
nicht nachweisbar waren, war Benzol ebenfalls in keinem Fall<br />
quantifizierbar.<br />
Die Industrie hat inzwischen reagiert <strong>und</strong> bei vielen Produkten die<br />
Verwendung von Benzoesäure durch eine Änderung der Tech nologie<br />
minimiert, wie z. B. eine aseptische Abfüllung, bei der keine<br />
Konservierungsstoffe mehr notwendig sind, oder durch Aus -<br />
tausch mit Sorbinsäure. Durch diese Umstellungen hat sich allerdings<br />
der Anteil der Proben, die als mikrobiologisch verdorben<br />
beurteilt wurden, erhöht. Mehrere Erzeugnisse waren durch watteähnliche<br />
weißliche Schimmelpilzmycele auffällig. Diese Geträn -<br />
ke wiesen zusätzlich einen lösemittelartigen Fremdgeruch auf.<br />
Es handelt sich hier um einen mikrobiologisch bedingten Abbau<br />
des Konservierungsstoffes Sorbinsäure, wobei 1,3-Pentadien ge -<br />
bildet wird.<br />
71
72<br />
Bei Getränken aus dem EU-Ausland <strong>und</strong> aus Osteuropa sind wei -<br />
terhin wie in den Vorjahren Verstöße gegen zusatzstoffrechtliche<br />
Regelungen festgestellt worden. Diese Getränke werden meist<br />
sehr kostengünstig <strong>und</strong> in großen Gebinden angeboten. Sie sind<br />
intensiv gefärbt, mit künstlichem Süßstoff <strong>und</strong> Aroma versetzt<br />
<strong>und</strong> größtenteils konserviert. Dieses Marktsegment wurde ebenfalls<br />
im Rahmen eines b<strong>und</strong>esweiten Überwachungsprogrammes<br />
untersucht. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 31 alkoholfreie<br />
Getränke aufgr<strong>und</strong> einer fehlenden Kenntlichmachung bzw.<br />
Kennzeichnung eines Zusatzstoffes beanstandet. In drei Fällen<br />
wurde eine Höchstmengenüberschreitung festgestellt. Neun Be -<br />
anstandungen bezogen sich auf eine fehlende Angabe eines verwendeten<br />
Konservierungsstoffes.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>12: Benzolgehalte in Getränken, die Benzoesäure <strong>und</strong> Ascorbinsäure enthalten<br />
Gehalt an Benzol<br />
in µg/L<br />
< Nachweisgrenze<br />
0,19 µg/L<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Überwachung ständig än -<br />
dern den Anforderungen stellen muss. Aufgr<strong>und</strong> neuer Erkennt -<br />
nisse aus der Forschung <strong>und</strong> der Entwicklung neuer »moderner«<br />
Getränke, ändert sich die Zusammensetzung der Erzeugnisse stetig.<br />
Zusätzlich werden durch eine Globalisierung des Handels immer<br />
wieder neue Erzeugnisse importiert. Die Überprüfung der<br />
Gehalte an Konservierungsstoffen, anderen Zusatzstoffen <strong>und</strong><br />
deren Kennzeichnung bzw. Kenntlichmachung bei alkoholfrei en<br />
Erfrischungsgetränken wird auch zukünftig bei den verschiedenen<br />
Getränkearten einen Schwerpunkt darstellen.<br />
Dr. de Wreede, I. (LI BS)<br />
0,19 - 5 µg/L 5 - 10 µg/L 10 - 15 µg/L > 15 µg/L<br />
Anzahl der Proben 3<br />
7 3 4 3
Tees mit Zusatznutzen<br />
Immer mehr in Mode kommen Teemischungen, die Zutaten enthalten,<br />
die auch als Arzneimittel-Tees zugelassen sind.<br />
Durch entsprechende Werbung, Abbildungen <strong>und</strong> dem »Halb -<br />
wissen« der Verbraucher sollen den Erzeugnissen offensichtlich<br />
positive Wirkungen, die von den echten Arzneitees aus der Apotheke<br />
bekannt sind, auch auf diese Teemischungen übertragen<br />
werden.<br />
So sind die Zutaten Ginkgo, Ginseng, Johanniskraut, Mistel kraut,<br />
Frauenmantelkraut, Erdrauchkraut usw. auch als zugelassene<br />
Arzneimittel auf dem Markt.<br />
Als Zutaten zu Tees <strong>und</strong> teeähnlichen Erzeugnissen werden sie<br />
meist in geringen Mengen Tees <strong>und</strong> teeähnlichen Erzeugnissen<br />
zugesetzt. Die Hersteller behaupten häufig, die Zutaten zur ge -<br />
schmacklichen Abr<strong>und</strong>ung zuzusetzen. Dies ist oft wenig glaubhaft,<br />
da diese geringen Mengen, neben einer häufig kräftigen<br />
Aromatisierung, meist nicht mehr geschmacklich wahrnehmbar<br />
sind. Zudem gibt es für diesen Zweck andere unbedenklichere<br />
Zutaten.<br />
Die Werbung ist häufig diffus in Richtung »Wellness, ayurvedisches<br />
altindisches Wissen vom ges<strong>und</strong>en Leben« <strong>und</strong> ähnlichen<br />
Andeutungen. Direkte Angaben zu konkreten ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Wirkungen werden vermieden, da bei Lebensmitteln ges<strong>und</strong>heitsbezogene<br />
Werbung verboten ist. Diese ist den Arznei mitteln<br />
vorbehalten <strong>und</strong> muss im Zulas sungs verfahren bewiesen werden.<br />
Auf ihrer 89. Sitzung haben die Fachleute des Arbeitskreises<br />
Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder <strong>und</strong> des<br />
BVL (= ALS) im März 2007 beschlossen, dass Zutaten, die im<br />
Endprodukt keine pharmakologische Wirkung ausüben, als Le -<br />
bensmittelzutaten zu beurteilen sind. Üben diese Zutaten eine<br />
arzneiliche Wirkung bei vorhersehbaren Gebrauch aus, so sind<br />
die Erzeugnisse nicht als Lebensmittel verkehrsfähig.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Zudem ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob diese Zutaten überwiegend<br />
wegen ihres Nähr-, Geruchs- oder Geschmackswertes<br />
oder als Genussmittel in Lebensmitteln verwendet werden bzw.<br />
ob es sich um eine charakteristische Lebensmittelzutat handelt.<br />
Auch die Kennzeichnung derartiger Produkte ist umstritten. Ei -<br />
ne Hervorhebung der pharmazeutisch wirksamen Zutaten außerhalb<br />
der Zutatenliste wird abgelehnt, da dies als verdeckter Hin -<br />
weis auf die Arzneimitteleigenschaft gewertet wird.<br />
Dr. Gabel, B. (LUA Bremen)<br />
Viele Teemischungen enthalten geringe Mengen an Zutaten, die auch<br />
als zugelassene Arzneimittel auf dem Markt sind, wie z. B Ginkgo,<br />
Ginseng, Johanniskraut <strong>und</strong> Mistelkraut<br />
73
74<br />
<strong>3.</strong>2 Spezielle Untersuchungen<br />
Pestizide<br />
Pestizidergebnisse in Strauchbeerenobst<br />
Im Sommer 2007 wurden insgesamt 89 Proben Strauch beeren -<br />
obst auf Pestizidrückstände untersucht. Es handelte sich um 40<br />
Proben Blaubeeren, auch Heidelbeeren genannt, 25 Proben Jo -<br />
hannisbeeren, davon 22 mal rote <strong>und</strong> dreimal schwarze, 13 Proben<br />
Himbeeren, zehn Proben Stachelbeeren <strong>und</strong> eine Brombeerprobe.<br />
Bis auf eine Probe – die ihren Ursprung in den Nieder landen<br />
hatte – stammten sämtliche Proben aus Deutschland.<br />
In 24 Blaubeerproben konnten keine Rückstände an Pestiziden<br />
identifiziert werden. Weiterhin wurden in fünf Proben Johannis -<br />
beeren <strong>und</strong> einer Stachelbeerprobe keine Rückstände nachgewiesen<br />
(siehe Abbildung <strong>3.</strong>5).<br />
In vier Proben wurden Rückstände über der Höchstmenge analysiert,<br />
es handelte sich um eine Blaubeerprobe <strong>und</strong> vier Johan nisbeerproben.<br />
Es wurde jedoch lediglich eine Probe rote Jo han nisbeeren<br />
aufgr<strong>und</strong> einer Höchstmengenüberschreitung beanstandet,<br />
Abbildung <strong>3.</strong>5: Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
die Gehalte in den übrigen drei Proben lagen noch im Streu be -<br />
reich der Messunsicherheit.<br />
In vier Proben wurden Wirkstoffe gef<strong>und</strong>en, die für die jeweilige<br />
Kultur in Deutschland nicht zugelassen sind. Das zuständige<br />
Pflanzenschutzamt hat die Sachverhalte geprüft. Ein Fall wurde<br />
zuständigkeitshalber an Nordrhein-Westfalen abgegeben <strong>und</strong> in<br />
drei Fällen wur de die Anhörung eingeleitet.<br />
In über der Hälfte der Proben konnten Mehrfachrückstände nachgewiesen<br />
werden. Am häufigsten wurden drei Wirkstoffe in ei -<br />
ner Probe bestimmt (siehe Abbildung <strong>3.</strong>6). In verschiedenen Ar -<br />
beitsgruppen auf nationaler <strong>und</strong> internationaler Ebene wird an<br />
Konzepten zur toxikologischen Bewertung von Mehrfach rück ständen<br />
gearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem LAVES beschäftigt<br />
sich auch eine Doktorandin der Tierärztlichen Hochschule in Hannover<br />
mit diesem Thema.
Insgesamt wurden in den Beerenobstproben 18 verschiedene<br />
Wirk stoffe bestimmt. In etwa jeder zweiten Probe konnten die<br />
Fungizide (sie wirken gegen Schimmelpilze) Cyprodinil <strong>und</strong> Flu -<br />
dioxonil nachgewiesen werden (siehe Abbildung <strong>3.</strong>7).<br />
Abbildung <strong>3.</strong>6: Anzahl der Wirkstoffe je Probe in Beerenobst<br />
Abbildung <strong>3.</strong>8: Ausschöpfung der Höchstmenge für die nachgewiesenen<br />
Gehalte<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Betrachtet man die gef<strong>und</strong>enen Gehalte <strong>und</strong> die festgesetzten<br />
Höchstmengen der entsprechenden Wirkstoffe, ist festzustellen,<br />
dass die Höchstmengen bei etwa zwei Drittel der Proben lediglich<br />
zu unter 10% ausgeschöpft wurden. Nur in wenigen Fäl len<br />
werden die Höchstmengen bei den gef<strong>und</strong>enen Gehalten zu<br />
über 50% ausgeschöpft (siehe Abbildung <strong>3.</strong>8).<br />
Bei einem Vergleich mit den Rückstandsdaten aus 2005 <strong>und</strong> 2006<br />
sind in Blaubeeren auch 2007 wieder wenige Rückstände nachweisbar.<br />
Ingesamt bestätigen die Ergebnisse der Untersuchun gen<br />
aus 2007 die Rückstandssituation der Jahre 2005 <strong>und</strong> 2006.<br />
Dr. Rolfe, B. (LI OL)<br />
Abbildung <strong>3.</strong>7: Nachgewiesene Wirkstoffe in Beerenobst<br />
75
76<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände <strong>und</strong> Rückstände an Schwermetallen in Zuchtpilzen<br />
In diesem Jahr wurden im Lebensmittelinstitut Oldenburg 53 Proben<br />
Pilze auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Über -<br />
wiegend handelte es sich um Champignons (41 Proben); sie<br />
stam mten zu 87% aus Deutschland, die übrigen Champignons<br />
stammten aus Polen (fünf Proben), Thailand (eine Probe) <strong>und</strong> den<br />
Nie derlanden (eine Probe). Weiterhin wurden Austernseitlinge,<br />
Shiita ke pilze, Shinejipilze <strong>und</strong> Kräuterseitlinge – sämtliche mit<br />
Her kunft Deutschland – untersucht.<br />
In 28 Proben konnten keine Rückstände an Pestiziden nachgewiesen<br />
werden. Rückstände über der Höchstmenge wurden in<br />
fünf Champignonproben festgestellt (siehe Tabelle <strong>3.</strong>13). Vier<br />
davon – zwei aus Polen <strong>und</strong> zwei aus Deutschland – lagen noch<br />
Tabelle <strong>3.</strong>13: Zusammenfassung der Untersuchung auf<br />
Pflanzenschutzmittel in Pilzen<br />
ohne nachweisbare<br />
Rückstände<br />
mit Rückständen<br />
> HM<br />
mit Rückständen<br />
< HM (ohne Be -<br />
anstandung, da<br />
noch innerhalb<br />
der Messun -<br />
sicher heit)<br />
mit Rückständen<br />
< HM<br />
mit Wirkstoffen,<br />
die für Pilze in D<br />
nicht zugelassen<br />
sind<br />
Summe<br />
Champignons Shiitakepilze Sonstige<br />
21<br />
15<br />
4<br />
1<br />
2<br />
41<br />
3<br />
3<br />
0<br />
0<br />
2<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0<br />
1<br />
6<br />
im Streubereich der Messunsicherheit <strong>und</strong> wurden daher nicht<br />
beanstandet. Lediglich eine Champignonprobe aus Deutschland<br />
wurde aufgr<strong>und</strong> einer Höchstmengenüberschreitung beanstandet.<br />
Maximal konnten fünf Wirkstoffe in einer Probe nachgewiesen<br />
werden (siehe Abbildung <strong>3.</strong>9). Am häufigsten wurden lediglich<br />
ein oder zwei Wirkstoffe identifiziert.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>9: Anzahl der Wirkstoffe in den Proben
Abbildung <strong>3.</strong>10: Nachgewiesene Wirkstoffe in Pilzen<br />
Insgesamt wurden zwölf verschiedene Wirkstoffe gef<strong>und</strong>en. Chlormequat<br />
<strong>und</strong> Mepiquat wurden am häufigsten nachgewiesen<br />
(siehe Abbildung <strong>3.</strong>10).<br />
In Deutschland dürfen diese beiden Wirkstoffe für die Pilzzucht<br />
nicht eingesetzt werden. Sie werden üblicherweise als Wachs -<br />
tumsregulatoren insbesondere im Getreideanbau eingesetzt, um<br />
die Halme kurz zu halten. Zwei Shiitakepilzproben, eine Cham -<br />
pignonprobe <strong>und</strong> eine Probe Austernseitlinge wurden aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> beanstandet. Das zuständige Pflanzenschutzamt wur -<br />
de gebeten, die Sachverhalte zu prüfen. Da im Pilzanbau auch<br />
Stroh als Substrat verwendet wird, könnte ein Eintrag darüber<br />
erfolgt sein.<br />
Bei einer weiteren Champignonprobe wurden die Wirkstoffe Oxamyl<br />
<strong>und</strong> Prochloraz nachgewiesen, die in der Champignon zucht<br />
in Deutschland ebenfalls nicht zugelassen sind. Nach Auskunft<br />
des Pflanzenschutzamtes ist jedoch davon auszugehen, dass es<br />
sich hier ebenfalls um einen Stoffübergang aus dem Substrat<br />
(Substrat besteht aus Stroh, Mist, Gips, Wasser) <strong>und</strong> nicht um<br />
eine unzulässige Anwendung handelt.<br />
Ökotest (Ausgabe 10/2006) kam in seinem Test zu einem ähnlichen<br />
Ergebnis.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Bei der Untersuchung auf Blei <strong>und</strong> Cadmium wurden überwiegend<br />
Gehalte weit unterhalb der dafür festgesetzten Höchst men -<br />
gen analysiert. Lediglich in vier Proben wurden erhöhte Gehalte<br />
an Cadmium festgestellt. Es handelte sich um eine Probe Aus -<br />
ternseitlinge, eine Probe Steinpilze <strong>und</strong> eine Probe Shiitakepilze,<br />
die Cadmiumgehalte zwischen 0,12 <strong>und</strong> 0,16 mg/kg aufwiesen.<br />
Diese Gehalte lagen noch unterhalb der zulässigen Höchstmen -<br />
ge von 0,20 mg/kg. In einer Probe Shiitakepilze wurde jedoch<br />
ein Cadmiumgehalt von 0,28 mg/kg nachgewiesen. Die Probe<br />
wurde aufgr<strong>und</strong> der Höchstmengenüberschreitung beanstandet.<br />
Dr. Rolfe, B. (LI OL)<br />
77
78<br />
Dioxine<br />
Verhältnis von Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB in verschiedenen Lebensmitteln<br />
Dioxine entstehen als unerwünschte Nebenprodukte bei thermischen<br />
<strong>und</strong> industriellen Prozessen <strong>und</strong> sind ubiquitär in der Umwelt<br />
vorhanden. Unter dem Begriff Dioxine werden die Poly chlo -<br />
rierten Dibenzodioxine (PCDD, 75 Kongenere) <strong>und</strong> Polychlo rier -<br />
ten Dibenzofurane (PCDF, 135 Kongenere) zusammengefasst, sie<br />
kommen immer in Stoffgemischen vor, wobei sich die Wirkungsintensitäten<br />
der einzelnen PCDD/F-Kongenere stark unterscheiden.<br />
Die 2,3,7,8-chlorsubstituierten PCD/F sind toxikologisch besonders<br />
bedeutsam, die höchste Toxizität besitzt das auch als<br />
»Seveso-Gift« bekannt gewordene 2,3,7,8-TCDD. Zur Abschät -<br />
zung des toxikologischen PCDD/F-Gesamtpotentials wurden für<br />
die 2,3,7,8-substituierten PCDD/F Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF)<br />
in Relation zum 2,3,7,8-TCDD festgelegt: die analytisch ermit telten<br />
Gehalte der PCDD/F-Kongenere werden mit den dazugehörigen<br />
TEFs multipliziert <strong>und</strong> zu den Dioxin-Toxizitäts äquivalen ten<br />
(WHO-PCDD/F-TEQ) einer Matrix aufaddiert.<br />
Polychlorierte Biphenyle (PCB) wurden aufgr<strong>und</strong> ihrer technologischen<br />
Eigenschaften (nicht leitend, nicht brennbar) weltweit<br />
in großen Mengen hergestellt <strong>und</strong> z. B. in Kondensatoren <strong>und</strong><br />
Transformatoren eingesetzt. Bei den PCB werden 209 Konge nere<br />
unterschieden, einige dieser Kongenere können aufgr<strong>und</strong> ih -<br />
res Molekülaufbaues eine den Dioxinen ähnliche räumliche Struktur<br />
annehmen <strong>und</strong> zeigen ein vergleichbares Wirkprofil. Zwölf<br />
Kongeneren dieser sogenannten dioxinähnlichen PCB (dl-PCB)<br />
wurden von der WHO ebenfalls TEFs in Relation zum 2,3,7,8-<br />
TCDD zugeordnet (WHO-PCB-TEQ).<br />
Die Dioxin-Toxizitätsäquivalente (WHO-PCDD/F-TEQ) <strong>und</strong> die dl-<br />
PCB-Toxizitätsäquivalente (WHO-PCB-TEQ) werden zusammenaddiert<br />
zum Summenparameter der WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (Gesamt-TEQ).<br />
Aufgr<strong>und</strong> ihrer guten Fettlöslichkeit <strong>und</strong> Langlebigkeit reichern<br />
sich Dioxine <strong>und</strong> PCB im Fettgewebe von Tier <strong>und</strong> Mensch <strong>und</strong><br />
damit in der Nahrungskette an. Die Exposition des Menschen erfolgt<br />
zu ca. 95% über Lebensmittel, wobei der Hauptanteil von<br />
ca. 90% aus Lebensmitteln tierischer Herkunft stammt. Be deu -<br />
tende Quellen für Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB sind folgende Lebens mit -<br />
tel <strong>und</strong> deren Verarbeitungsprodukte: Milch, Fleisch, Fisch <strong>und</strong><br />
Eier.<br />
Von der SCF (Scientific Committee on Food) wurde 2001 eine tolerierbare<br />
wöchentliche Aufnahmemenge (TWI) von 14 pg WHO-<br />
PCDD/F-PCB-TEQ pro kg Körpergewicht für die Summe aus Di -<br />
oxinen <strong>und</strong> dl-PCB festgelegt. Trotz der Erfolge der Maßnah men<br />
zur Minimierung der PCDD/F- <strong>und</strong> PCB-Emissionen, die dazu führten,<br />
dass die Belastung seit Mitte der achtziger Jahre um mehr<br />
als die Hälfte zurückging, ergeben Expositionseinschätzungen,<br />
dass ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung noch Mengen an<br />
Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB zu sich nimmt, die über dem TWI liegen. Zusätzlich<br />
zu den auf EU-Ebene seit 2002 festgesetzten Höchst ge -<br />
halten <strong>und</strong> Auslösewerten für Dioxine gelten ab November 2006<br />
auch Höchstgehalte für die Summe aus Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB <strong>und</strong><br />
getrennte Auslösewerte für Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB. Die Einbezie hung<br />
der dl-PCB in die Höchstgehaltsregelung macht es notwendig,<br />
die dl-PCB-Belastung der Lebensmittel zu überprüfen <strong>und</strong> die<br />
Bedeutung dieser Verbindungsklasse für den Summenwert aus<br />
Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB zu ermitteln.<br />
Im Jahr 2007 wurden 184 Lebensmittel- <strong>und</strong> zusätzlich 29 Frau -<br />
enmilchproben auf Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB untersucht. Das prozentuale<br />
Verhältnis der Toxizitätsäquivalente der Dioxine zu denen<br />
der dl-PCB in diesen Matrices ist in Abbildung <strong>3.</strong>11 dargestellt.<br />
Gr<strong>und</strong> sätzlich lagen die Beiträge der Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB zum<br />
Ge samt-TEQ in den untersuchten Lebensmitteln in der gleichen<br />
Größenordnung, wobei der Beitrag der dl-PCB bei der Mehr zahl<br />
der Lebensmittel überwog. In Einzelfällen trug der dl-PCB-Anteil<br />
sogar beträchtlich zur Erhöhung des Gesamt-TEQ bei.
Abbildung <strong>3.</strong>11: Prozentuales Verhältnis von Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB in<br />
verschiedenen Lebensmitteln<br />
Bei den Rohmilch- <strong>und</strong> Rindfleischproben wurde im Mittel ein Anteil<br />
der dl-PCB am Gesamt-TEQ von 68% bzw. 67% mit Schwan -<br />
kungsbreiten von 20 - 25% festgestellt. Die Ergebnisse aller Rohmilchproben<br />
lagen deutlich unterhalb der Höchstgehalte <strong>und</strong><br />
Auslösewerte. Bei den Rindfleischproben gab es ebenfalls keine<br />
Überschreitungen der Höchstgehalte, allerdings wurde der vergleichsweise<br />
niedrig festgelegte Auslösewert für dl-PCB für Rind -<br />
fleisch in fünf von 26 Proben überschritten.<br />
Bei Eiern lag der mittlere Anteil der dl-PCB am Gesamt-TEQ bei<br />
49%, die dl-PCB-Anteile schwankten aber mit 18 bis 78% sehr<br />
stark. Dies ist vermutlich auf den Einfluss unterschiedlicher Hal -<br />
tungsformen der Legehennen zurückzuführen. Bei einer Probe<br />
aus Freilandhaltung wurde der Höchstgehalt für die Summe aus<br />
PCDD/F <strong>und</strong> dl-PCB überschritten, bei einer weiteren Probe aus<br />
Freilandhaltung <strong>und</strong> einer Probe aus Käfighaltung wurde der Auslösewert<br />
für dl-PCB überschritten.<br />
Die untersuchten Fische <strong>und</strong> Muscheln zeigten erwartungsgemäß<br />
mit 61% ebenfalls höhere Anteile von dl-PCB zum Gesamt-TEQ,<br />
bei Lachsölkapseln wurde ein Anteil von 92% ermittelt. Auf gr<strong>und</strong><br />
geringer Probenzahlen können diese Ergebnisse allerdings nicht<br />
als repräsentativ angesehen werden. Höchstgehalts- oder Aus lö -<br />
sewertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Nur bei den Wildschweinfleischproben überwog der Anteil der<br />
Dioxine mit 60% zum Gesamt-TEQ gegenüber dem Anteil der<br />
dl-PCB. Für Wildschweinfleisch wurden bislang keine Höchst ge -<br />
halte <strong>und</strong> Auslösewerte festgelegt.<br />
Obwohl für die Emissionen von Dioxinen <strong>und</strong> dl-PCB unterschiedliche<br />
Quellen verantwortlich sind, zeigte sich in den einzelnen Lebensmittelgruppen<br />
bis auf wenige Ausnahmen ein verhältnismäßig<br />
konstantes Verhältnis der beiden Stoffgruppen. Dieses Ergebnis<br />
lässt darauf schließen, dass die Kontamination der Lebens -<br />
mittel mit diesen Umweltkontaminanten auf der vorhandenen<br />
Hintergr<strong>und</strong>belastung basiert, Einträge durch spezielle Konta mi -<br />
nationsfälle oder regionale Einflüsse spielen eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
Frauenmilch besitzt eine wichtige Funktion als Bioindikator: sie<br />
liefert Informationen hinsichtlich der internen Belastung des Menschen<br />
als dem Endglied der Nahrungskette mit persistenten Umweltschadstoffen.<br />
Untersuchungen seit Mitte der achtziger Jah -<br />
re belegen, dass die Belastung der Frauenmilch mit PCDD/F auf<br />
weniger als ein Drittel zurückgegangen ist. Bei der Frauenmilch<br />
schwankte der Anteil der dl-PCB am Gesamt-TEQ – mit einer Ausnahme<br />
– in einem relativ engen Bereich zwischen 41% bis 62%<br />
mit einem Mittelwert von 52%. Die relativ geringe Schwankungs -<br />
breite lässt sich durch die überregionale Versorgung mit Lebensmitteln<br />
erklären, die eine vergleichbare Gr<strong>und</strong>belastung durch<br />
Lebensmittel bewirkt.<br />
Dr. Bruns-Weller, E.; Dr. Knoll, A. (LI OL)<br />
79
80<br />
Mykotoxine<br />
Neue Untersuchungen zu Schimmelpilzgiften (Mykotoxinen)<br />
Seit fast 50 Jahren ist bekannt, dass Schimmelpilzgifte zu Erkrankungen<br />
bei Mensch <strong>und</strong> Tier führen. Anfänglich wurden Lebensmittel<br />
nur auf Aflatoxin B1 geprüft, das zu den am stärksten wirksamen<br />
krebserregenden Stoffen gehört. In den folgenden Jahren<br />
wurden weitere Mykotoxine identifiziert <strong>und</strong> als krebserregend,<br />
leberschädigend oder nierentoxisch eingestuft. Im Lebensmit tel -<br />
institut Braunschweig wurde im Laufe des Jahres 2007 auf zwölf<br />
Mykotoxine bzw. Mykotoxingruppen geprüft, wofür 2.500 Un -<br />
tersuchungen durchgeführt wurden. In zwei Drittel der Proben<br />
waren keine Mykotoxine nachweisbar. Die Tabelle <strong>3.</strong>14 enthält<br />
eine Zusammenstellung der Proben, die auf Mykotoxine mit<br />
Höchst mengenregelungen geprüft wurden.<br />
In nur 1% der untersuchten Proben waren Höchstmengen über -<br />
schreitungen feststellbar. Der höchste nachgewiesene Wert für<br />
die Summe der Aflatoxine war 87,3 µg/kg in gerösteten Erd nüs -<br />
sen. Aber auch in Pistazien, Haselnüssen, Datteln <strong>und</strong> Feigen wa -<br />
ren deutliche Überschreitungen messbar. Fumonisine <strong>und</strong> Zea rale<br />
non traten hauptsächlich in Maismehl, Maisgries, Tortillachips<br />
<strong>und</strong> glutenfreien Teigwaren auf. Der höchste Gehalt an Fumo ni -<br />
sin B1 <strong>und</strong> B2 wurde in einer Probe Polenta-Maisgries mit <strong>3.</strong>204<br />
µg/kg gemessen. Zearalenongehalte über der Höchstmenge waren<br />
hauptsächlich in Tortillachips zu finden. Die Gehalte lagen je -<br />
doch innerhalb der analytischen Streubreite <strong>und</strong> die Proben wurden<br />
nicht beanstandet.<br />
Nicht alle Schimmelpilze produzieren Gifte. Werden aber Gifte gebildet,<br />
so sind sie oft hochtoxisch. Die Toxizität (Giftigkeit) eines<br />
Stoffes wird durch den LD50-Wert beschrieben. Die LD50 (Leta le<br />
Dosis) beschreibt die Menge des Stoffes, die, oral verabreicht, da -<br />
zu führt, dass 50% der Versuchstiere sterben.<br />
Wie aus Tabelle <strong>3.</strong>15 hervorgeht, liegen die LD50–Werte von Moniliformin<br />
<strong>und</strong> auch einiger Alternaria-Toxine durchaus im Be -<br />
reich der Toxine, die eine hohe akute Toxizität aufweisen wie z. B.<br />
das Ochratoxin A. Für diese Toxine existieren noch keine für Le -<br />
bens mittel zulässigen Höchstgehalte. Um zu prüfen, ob es notwen<br />
dig ist, solche Höchstgehalte festzusetzen <strong>und</strong> in welcher Höhe,<br />
ist eine breite Datenbasis erforderlich. Das Lebensmittel institut<br />
Braunschweig liefert mit seinen Untersuchungen Ergeb nisse,<br />
die über das zuständige Ministerium an die Kommission der Eu -<br />
ropäischen Gemeinschaft weitergereicht werden. Nach einer Be -<br />
wertung der Ergebnisse, auch aus anderen Ländern, durch den<br />
wissenschaftlichen Ausschuss kann dann über die Festsetzung<br />
von Höchstgehalten diskutiert werden.<br />
In Tabelle <strong>3.</strong>16 sind die Probenzahlen zu Untersuchungen von Mykotoxinen<br />
ohne Höchstmengenregelungen zusammengestellt.<br />
Während für T2-Toxin <strong>und</strong> HT-2-Toxin bereits über einen Sum -<br />
men höchstwert diskutiert wird, fehlen für die toxikologische Beurteilung<br />
der anderen Toxine noch eine ausreichende Anzahl<br />
Daten.<br />
Die schon seit Jahren im Lebensmittelinstitut Braunschweig routinemäßig<br />
durchgeführte Analytik wurde im Jahr 2007 um zwei<br />
Methoden erweitert. Die eine Methode ermöglicht die Bestim -<br />
mung von Moniliformin mittels HPLC-DAD, die zweite Methode<br />
dient zur Bestimmung von fünf Alternaria-Toxinen mittels LC-<br />
MS/MS.<br />
Zur Bestimmung der Alternaria-Toxine wurden 92 Lebensmittel<br />
auf Alternariol (AOH), Alternariolmethylether (AME), Altenuen<br />
(ALT), Tenuazonsäure (TEA) <strong>und</strong> Tentoxin (TEN) untersucht. In<br />
Apfelsaft <strong>und</strong> Kartoffelpüree waren keine Alternaria-Toxine über<br />
der Bestimmungsgrenze von 5 µ/kg bzw. 25 µg/kg nachweisbar.<br />
In Tomatensaft, Gemüsesaft, passierten Tomaten <strong>und</strong> getrockneten<br />
Paprika lag die Bestimmungsgrenze bei 10 µg/kg. In den Proben<br />
wurde nur Tenuazonsäure in bestimmbaren Mengen nachgewiesen.<br />
Die gef<strong>und</strong>enen Werte sind in Ab bil dung <strong>3.</strong>12 zu sam -<br />
mengestellt. Während die Gehalte im Traubensaft gerade über<br />
der Bestimmungsgrenze von 5 µg/kg liegen, sind in ca. 50%
Tabelle <strong>3.</strong>14: Untersuchungen auf Mykotoxine, Anzahl der Proben (inklusive Monitoring- <strong>und</strong> BUEB-Proben) über der<br />
jeweiligen Höchstmenge im Vergleich zur Anzahl aller untersuchten Proben (fettgedruckt)<br />
Probenart Aflatoxin B1 Ochratoxin A<br />
Getreide<br />
Getreideprodukte<br />
Brote, Kleingebäck<br />
Feine Backwaren<br />
Teigwaren<br />
Hülsenfrüchte, Öl -<br />
samen, Schalenobst<br />
Haselnusspaste<br />
Gemüseerzeugnisse<br />
Obstprodukte<br />
Fruchtsäfte,<br />
Nektare, u. a.<br />
Wein<br />
Biere<br />
süße Brotaufstriche<br />
Süßwaren<br />
Diätetische<br />
Lebensmittel<br />
Würzmittel<br />
Gewürze<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7<br />
1<br />
0<br />
3<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
54<br />
41<br />
2<br />
8<br />
194<br />
2<br />
16<br />
24<br />
19<br />
29<br />
2<br />
6<br />
70<br />
1<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
52<br />
108<br />
Tabelle <strong>3.</strong>15: LD50 –Werte einiger Mykotoxine<br />
Mykotoxin<br />
Aflatoxin B1<br />
Ochratoxin A<br />
T-2-Toxin<br />
HT-2-Toxin<br />
Deoxynivalenol<br />
Moniliformin<br />
Alternaria-Toxine, z. B. Tenuazonsäure<br />
45<br />
9<br />
20<br />
79<br />
39<br />
29<br />
46<br />
59<br />
5<br />
32<br />
68<br />
LD50 (mg/kg<br />
Körpergewicht)<br />
Patulin<br />
7,2 Ratte<br />
9,5 neugeborene Maus<br />
2-20 je nach Tierart<br />
3 Maus<br />
9 Maus<br />
50 weibliche Maus<br />
20 Maus<br />
50-400 Maus<br />
115 weibliche Maus<br />
162 männliche Maus<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
3 76<br />
Deoxynivalenol<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
33<br />
141<br />
19<br />
43<br />
5<br />
Zearalenon<br />
1<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
83<br />
44<br />
21<br />
44<br />
18<br />
16<br />
Fumonisine<br />
0<br />
3<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
2<br />
17<br />
51<br />
1<br />
15<br />
43<br />
17<br />
52<br />
81
82<br />
Abbildung <strong>3.</strong>12: Tenuazonsäure-Gehalte in einigen Lebensmitteln<br />
* nn = nicht nachweisbar, NG = Nachweisgrenze<br />
Getreide<br />
Getreideprodukte<br />
Brote, Kleingebäck<br />
Feine Backwaren<br />
Teigwaren<br />
Diätetische<br />
Lebensmittel<br />
Kartoffelprodukte<br />
Gemüseerzeugnisse<br />
Fruchtsäfte<br />
1<br />
10<br />
2<br />
0<br />
0<br />
33<br />
141<br />
19<br />
42<br />
5<br />
0<br />
14<br />
4<br />
0<br />
0<br />
33<br />
141<br />
19<br />
42<br />
5<br />
der Erzeugnisse aus Tomaten die Gehalte um 100 µg/kg <strong>und</strong> hö -<br />
her. Der höchste Wert an TEA wurde in geschälten Tomaten mit<br />
239 µg/kg ermittelt.<br />
Moniliformin wurde in 16 Proben untersucht. In Getreidemeh len<br />
(fünf Proben) waren keine Gehalte über der Nachweisgrenze<br />
von 4 µg/kg oder nur Spuren (Bestimmungsgrenze 11 µg/kg)<br />
nachweisbar. Deutliche Mengen waren in einer Probe Maismehl<br />
(52 µg/kg) <strong>und</strong> in Popcornmais mit bis zu 50 µg/kg nachweisbar.<br />
Dr. Reinhold, L. (LI BS)<br />
Tabelle <strong>3.</strong>16: Untersuchungen auf Mykotoxine, für die keine Höchstgehalte festgesetzt sind – Anzahl der Proben<br />
(inklusive Monitoring- <strong>und</strong> BUEB-Proben) mit nachweisbaren Gehalten im Vergleich zur Anzahl aller untersuchten<br />
Proben (fettgedruckt)<br />
Probenart T-2-Toxin HT-2-Toxin<br />
Ergotalkaloide<br />
1<br />
25<br />
1<br />
1<br />
73<br />
2<br />
Citrinin<br />
20<br />
9<br />
24<br />
27<br />
Moniliformin<br />
1<br />
2<br />
9<br />
7<br />
Alternaria-Toxine<br />
0<br />
13<br />
7<br />
17<br />
15<br />
47
Reaktionsprodukte<br />
Trans-Fettsäuren in pflanzlichen Lebensmitteln<br />
»Unges<strong>und</strong>e Bäckerei – Riskante Knabberei – gefäßschädigende<br />
Transfette – New York sagt Fritten den Kampf an ...«<br />
Aktuelle Schlagzeilen aus den Printmedien belegen zu Recht das<br />
öffentliche Interesse an trans-Fettsäuren (trans fatty acids, TFA)<br />
in pflanzlichen Lebensmitteln.<br />
Eine US-amerikanische Langzeitstudie hat bestätigt, dass eine<br />
reich liche Zufuhr von trans-Fettsäuren mit der Nahrung maßgeblich<br />
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.<br />
Natürlicherweise kommen trans-Fettsäuren in tierischen Fetten<br />
von Wiederkäuern vor <strong>und</strong> gelangen über deren Fleisch <strong>und</strong><br />
Milchprodukte in die menschliche Nahrungskette. Diese TFA-Gehalte<br />
liegen in einer Größenordnung von ca. 5 g/100 g, bezogen<br />
auf den Fettanteil des Lebensmittels.<br />
Im Blickpunkt des Interesses stehen in den neueren Veröffent li -<br />
chungen die durch industrielle Prozesse wie z. B. die Fetthär tung<br />
(Hydrogenierung) erzeugten TFA-Gehalte in pflanzlichen Fetten<br />
<strong>und</strong> Ölen sowie den damit hergestellten Lebensmitteln. Die Hy -<br />
dro genierung verbessert die thermische <strong>und</strong> oxidative Stabilität<br />
der Produkte. Dadurch wird eine längere Haltbarkeit <strong>und</strong> teilwei -<br />
se auch ein besserer Geschmack von Backwaren <strong>und</strong> Süßigkei -<br />
ten erreicht. Erhöhte TFA-Gehalte wurden in Margarinen, Snacks<br />
(Chips, Mikrowellen-Popcorn, Croutons), Fast-Food-Produkten<br />
<strong>und</strong> Backwaren (Waffeln, Keksen, Blätterteiggebäck) festgestellt.<br />
Ernährungsempfehlungen der DGE <strong>und</strong> des BfR<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte die Aufnahme an TFA so niedrig wie möglich<br />
sein. Ein Anteil von weniger als 1% der Nahrungs energie ist<br />
anzustreben (Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), so wie<br />
die entsprechenden Fachgremien der Schweiz <strong>und</strong> Öster reichs:<br />
DACH, 2000).<br />
In einer Stellungnahme des B<strong>und</strong>esinstitutes für Risikobewertung<br />
(BfR) vom 30. Januar 2006 wird mitgeteilt, dass trans-Fettsäu ren<br />
ebenso wie gesättigte Fettsäuren aus ernährungsphysiologischer<br />
Sicht zu den unerwünschten Bestandteilen unserer Nahrung ge -<br />
hören, da sie den Gehalt an LDL-Cholesterin im Blut <strong>und</strong> damit<br />
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Ungünstige Blutfettwerte <strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene erhöhte Ri -<br />
siko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten durch eine Einschränkung<br />
des Gesamtfettverzehrs <strong>und</strong> eine Verbesserung der Fett -<br />
qualität beeinflusst werden. Bei der Lebensmittelauswahl ist bei<br />
tierischen Fetten, Fast-Food-Produkten <strong>und</strong> süßen Backwaren Zurückhaltung<br />
angebracht. Bei der Zubereitung von Speisen sollten<br />
natürliche pflanzliche Fette <strong>und</strong> Öle bevorzugt werden.<br />
Gesetzliche Regelungen<br />
Die dänischen Behörden legten im Jahr 2003 für Öle sowie für<br />
verarbeitete Lebensmittel, die Fette <strong>und</strong> Öle als Zutaten enthalten,<br />
einen Grenzwert fest: maximal 2% trans-Fettsäuren bezogen<br />
auf den Gesamtfettgehalt. Von dieser Regelung sind natürlich<br />
vorkommende trans-Fettsäuren in tierischen Fetten ausgenommen.<br />
Gesetzliche Grenzwerte für trans-Fettsäuren existieren in der Eu -<br />
ropäischen Union für verschiedene Olivenölkategorien (Summe<br />
der trans-Fettsäuren < 0,05-0,4 g/100 g) <strong>und</strong> Säuglings nahrung<br />
(< 4 g/100 g Fett).<br />
In der 2007 veröffentlichten europaweit geltenden Health Claims-<br />
Verordnung werden Regelungen für nährwert- <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogene<br />
Angaben getroffen.<br />
Wenn ein Erzeugnis als »arm an gesättigten Fettsäuren« ausgelobt<br />
wird, darf die Summe der gesättigten Fettsäuren <strong>und</strong> der<br />
trans-Fettsäuren bei einem festen Lebensmittel 1,5 g/100 g bzw.<br />
0,75 g/100 ml bei flüssigen Lebensmitteln betragen.<br />
83
84<br />
In beiden Fällen dürfen die gesättigten Fettsäuren <strong>und</strong> die trans-<br />
Fettsäuren insgesamt nicht mehr als 10% des Brennwertes liefern.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>17: TFA-Gehalte in pflanzlichen Lebensmitteln<br />
Warengruppe TFA-Gehalte<br />
[g/100g]*<br />
pflanzliche Fette<br />
pflanzliche Öle<br />
Margarinen,<br />
Brotaufstriche<br />
Fettglasuren<br />
Backfettmischungen<br />
Frittierfette <strong>und</strong><br />
-öle<br />
Pflanzencremes<br />
(Bratfettmischungen)<br />
Mayonnaiseerzeugnisse,<br />
emulgierte<br />
Soßen<br />
Fettgebäck,<br />
Blätterteiggebäck<br />
Pommes Frites<br />
Kartoffelchips<br />
Nuss-Nougat-<br />
Creme<br />
Diabetiker-<br />
Eis creme (aus<br />
Pflanzenfett)<br />
0,3 - 37,3<br />
0,1 - 2,2<br />
0,2 - 13,5<br />
0,1 - 43,4<br />
1,1 - 10,4<br />
0,2 - 40,5<br />
0,1 - 0,8<br />
0,1 - 0,4<br />
0,9 - 1,5<br />
0,5 - 32,5<br />
0,6 - 5,5<br />
0,2 - 0,9<br />
13,7<br />
0,6<br />
Anzahl Proben<br />
mit TFA-<br />
Gehalten < 2<br />
[g/100g]*<br />
6<br />
199<br />
* bezogen auf den Fettanteil des Lebensmittels<br />
41<br />
9<br />
2<br />
69<br />
13<br />
4<br />
2<br />
4<br />
2<br />
10<br />
–<br />
1<br />
Anzahl Proben<br />
mit TFA-<br />
Gehalten > 2<br />
[g/100g]*<br />
1<br />
1<br />
20<br />
9<br />
2<br />
73<br />
–<br />
–<br />
–<br />
35<br />
2<br />
–<br />
1<br />
–<br />
Bei der Auslobung »frei von gesättigten Fettsäuren« darf die<br />
Sum me der gesättigten Fettsäuren <strong>und</strong> der trans-Fettsäuren<br />
0,1 g/100 g bzw. 100 ml nicht überschreiten.<br />
Für verpackte Lebensmittel ist in Deutschland bei Verwendung<br />
von gehärteten Fetten <strong>und</strong> Ölen eine Kennzeichnung im Rah men<br />
der Zutatenliste durch den Hinweis »gehärtet« vorgeschrieben.<br />
Ein gesetzlicher Grenzwert existiert jedoch nicht.<br />
Bei nicht verpackten Lebensmitteln, z. B. losen Backwaren oder<br />
frittierten Fast-Food-Erzeugnissen, kann sich der Verbraucher nur<br />
unzureichend über die ernährungsphysiologische Qualität der verwendeten<br />
Fettzutaten informieren.<br />
Untersuchungsergebnisse<br />
Um den TFA-Gehalt verschiedener pflanzlicher Lebensmittel zu<br />
ermitteln, wurden im Lebensmittelinstitut Braunschweig im Jahr<br />
2007 insgesamt 506 Proben untersucht. Tabelle <strong>3.</strong>17 enthält ei -<br />
ne Zusammenstellung der erzielten Ergebnisse.<br />
Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich ablesen, dass insbesondere<br />
über die verwendeten Frittierfette <strong>und</strong> -öle ein Ein -<br />
trag von trans-Fettsäuren in die Nahrungskette erfolgt. Von ei -<br />
nigen Warengruppen sind die untersuchten Probenzahlen zu gering,<br />
um eine ausreichende Marktübersicht gewinnen zu können.<br />
Ausblick<br />
Zurzeit ist eine Abschätzung der TFA-Zufuhr in Europa aufgr<strong>und</strong><br />
des Fehlens aktualisierter TFA-Daten schwierig.<br />
Für das Jahr 2008 wurde vom B<strong>und</strong>esamt für Verbraucher schutz<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (BVL) ein spezielles Untersu chungs -<br />
programm (BÜP) veranlasst, in dem die besonders betroffenen<br />
Warengruppen z. B. Zieh- <strong>und</strong> Kremmargarinen, Blätterteig ge -<br />
bäcke, Backwaren aus Waffelmasse <strong>und</strong> fettreiche süße Brot aufstriche<br />
in den einzelnen B<strong>und</strong>esländern auf ihre TFA-Gehalte untersucht<br />
werden, um Rückschlüsse für eventuell erforderliche gesetzliche<br />
Maßnahmen gewinnen zu können. Das Lebens mittel -<br />
institut Braunschweig wird sich an diesem Programm beteiligen<br />
<strong>und</strong> darüber hinaus weitere Untersuchungen durchführen.<br />
Skerbs, C. (LI BS)
Gentechnische Veränderungen<br />
Gentechnisch veränderte Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel werden nach<br />
wie vor von den Verbrauchern kritisch beurteilt.<br />
Nach den gesetzlichen Vorgaben der VO (EG) Nr. 1829/2003 muss<br />
ein Produkt gekennzeichnet werden, das aus einem in der EU<br />
zur Vermarktung zugelassenen gentechnisch veränderten Orga -<br />
nismus (GVO) hergestellt wurde, aus diesem besteht oder gentechnisch<br />
veränderte (gv) Bestandteile enthält. Eine Ausnahme<br />
von dieser Kennzeichnungspflicht besteht nur, wenn der Gehalt<br />
der gv Be standteile unterhalb des Schwellenwertes liegt, <strong>und</strong> der<br />
Unter nehmer darlegen kann, dass die Bestandteile zufällig oder<br />
aufgr<strong>und</strong> technischer Unvermeidbarkeit in das Produkt gelangt<br />
sind. Die ser Schwellenwert lag bis zum Jahr 2003 bei 1% (nach VO<br />
(EG) Nr. 1139/98). Mit in Kraft treten der VO (EG) Nr. 1829/2003<br />
wurde der Schwellenwert auf 0,9% herabgesetzt.<br />
Seit Jahren ist die Entwicklung zu beobachten, dass Gehalte von<br />
GVO in Lebensmitteln oberhalb des gesetzlichen Schwellen wer -<br />
tes nur einen relativ geringen Prozentsatz der analysierten Pro -<br />
ben ausmachen, im Gegensatz dazu aber ein deutliches Mehr<br />
an GVO-Gehalten unterhalb des Schwellenwertes nachgewiesen<br />
wird. Insbesondere bei sojahaltigen Lebensmitteln ist dieser Trend<br />
zu beobachten.<br />
Die Untersuchung auf die gentechnisch veränderte Sojabohnenlinie<br />
Ro<strong>und</strong>up Ready ist von hohem Interesse, da Soja sehr häufig<br />
als Bestandteil in Lebens- <strong>und</strong> Futtermitteln verwendet wird.<br />
Es wird geschätzt, dass Soja Bestandteil von 20-30.000 Le bens -<br />
mitteln ist (Quelle: www.transgen.de).<br />
In der letzten Dekade nahm die Fläche an mit gentechnisch veränderten<br />
Sojabohnen bepflanzter Ackerfläche weltweit kontinuierlich<br />
zu. Im Jahr 2007 waren 64% (Quelle: www.transgen.de)<br />
der weltweit angebauten Sojabohnen gentechnisch verändert.<br />
Diese Tatsache spiegelt sich in dem kontinuierlich hohen Prozentsatz<br />
sojahaltiger Lebensmittel wider, die Gehalte an gentechnisch<br />
veränderter Soja aufweisen.<br />
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch im Jahr 2007 folgende<br />
Lebensmittelgruppen bezüglich des Vorhandenseins von<br />
Material der gv-Sojabohne auffällig: Tofu, Sojadrinks, vegetarische<br />
Gerichte mit Soja als Fleischersatz, hypoallergene Säug lingsnahrung,<br />
Produkte zur Gewichtsreduktion, Fitnessriegel, sojahaltige<br />
Trocken- bzw. Fertigsuppen, sojahaltiges Knabberzeug,<br />
Frühstückscerealien. Auch in Schokolade oder Nussnougat cremes,<br />
in denen Soja als Emulgator Verwendung findet, wurden in den<br />
vergangenen Jahren Bestandteile aus der GVO-Sojabohnenlinie<br />
nachgewiesen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Gentechnisch veränderte Organismen <strong>und</strong> ihre Produkte in Lebensmitteln: Verbreitung in sojahaltigen<br />
Lebensmitteln<br />
In Abbildung <strong>3.</strong>13 ist der Anteil der gv-Soja enthaltenden Le bensmittelproben<br />
in Bezug auf den Schwellenwert dargestellt.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>13: Prozentualer Anteil der RR-Soja enthaltenden in den<br />
am Lebensmittelinstitut Braunschweig auf Soja untersuchten Lebens -<br />
mitteln in den Jahren 2000 bis 2007<br />
Deutlich tritt der hohe Anteil an Lebensmitteln hervor, in denen<br />
gv-Bestandteile unterhalb des Schwellenwertes nachgewiesen wurden.<br />
Über das langjährige Mittel hat sich gezeigt, dass r<strong>und</strong> 20%<br />
der hier untersuchten Lebensmittel messbare gv-Bestandeile un -<br />
terhalb des Schwellenwertes enthielten. Keine dieser Proben war<br />
bezüglich ihres GVO-Gehaltes gekennzeichnet.<br />
Durch die Überwachungsbehörden wird in solchen Fällen überprüft,<br />
ob es sich um zufällige oder technisch unvermeidbare Kontaminationen<br />
mit GVO-Material handelt. Doch auch wenn die<br />
Industrie weiterhin Anstrengungen unternimmt, die Verwen dung<br />
von GVO-haltigem Material zu vermeiden, sind die GVO-Pro dukte<br />
bei dem Verbraucher angekommen.<br />
Es bleibt somit die notwendige Aufgabe der amtlichen Über wa -<br />
chung, die korrekte Kennzeichnung von Lebensmitteln, aber auch<br />
von Futtermitteln <strong>und</strong> Saatgut zu überprüfen.<br />
Dr. Eichner, Ch.; Naumann, H.; Dr. Gebhard, F. (LI BS)<br />
Eine ausführliche Darstellung der gesamten molekularbiologischen<br />
Untersuchungser geb nisse findet sich<br />
in Kapitel 4.<br />
85
86<br />
Weitere spezielle Untersuchungen<br />
Niedersächsische Erzeuger erfolgreich bei der Reduzierung von Cumarin in Lebensmitteln<br />
Nachdem im Jahr 2006 verschiedene zimthaltige Lebensmittel<br />
auf gr<strong>und</strong> von erhöhten Cumaringehalten vom Markt genommen<br />
werden mussten, enthielten derartige Lebensmittel 2007 im Vergleich<br />
zum Vorjahr deutlich weniger Cumarin.<br />
In den Untersuchungsinstituten des LAVES <strong>und</strong> beim Koope ra -<br />
tionspartner, dem Landesuntersuchungsamt Bremen, wurden im<br />
Jahr 2007 zahlreiche Lebensmittelproben auf deren Cumaringe -<br />
halte untersucht. Nur in wenigen Fällen mussten Beanstan dun gen<br />
ausgesprochen werden. Diese erfreuliche Entwicklung ist ein Zei -<br />
chen für die effektive Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur<br />
Cumarinreduzierung in den lebensmittelproduzierenden Betrie -<br />
ben nach den intensiven Kontrollen der Überwachungsbehörden.<br />
Im Regelfall konnte z. B. durch Rezepturumstellungen oder veränderte<br />
Rohwareneinsätze bei der Lebensmittelproduktion eine<br />
Reduzierung der Cumaringehalte erzielt werden.<br />
Zimt ist eine wichtige Zutat bei der Herstellung u. a. für Lebku -<br />
chen, Spekulatius, Zimtsterne <strong>und</strong> Teeerzeugnisse. Das traditio nelle<br />
Gewürz ist aus der Weihnachtsbäckerei nicht wegzuden ken, da<br />
es den Gebäcken ein besonderes, charakteristisches Aro ma verleiht.<br />
Aber auch andere Lebensmittel wie bestimmte Früh stückscerealien,<br />
Glühwein, Punsch oder »Milchreis mit Zimt« wer den<br />
mit Zimt gewürzt<br />
Einige Zimtsorten enthalten den in der Pflanzenwelt weit verbreiteten<br />
natürlichen Aromastoff Cumarin in beachtlichen Konzen -<br />
trationen. Besonders hoch belastet ist der Cassia-Zimt, der meist<br />
aus China <strong>und</strong> Indonesien stammt. Der unbelastete Ceylon-Zimt<br />
ist im Handel seltener zu finden, meist in Reformhäusern <strong>und</strong> Bioläden.<br />
Toxikologische Untersuchungen <strong>und</strong> Bewertungen der Europäischen<br />
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) <strong>und</strong> des<br />
deutschen B<strong>und</strong>esinstitutes für Risikobewertung (BfR) haben ergeben,<br />
dass bei übermäßiger Aufnahme von Cumarin eine leber-<br />
0,3 g 1,0 g<br />
Kinder sollten die täglich duldbare Höchstmenge von 0,3 g Zimt (links)<br />
nicht überschreiten, Erwachsene sollten pro Tag nicht mehr als 1,0 g<br />
Zimt (rechts) verzehren
Tabelle <strong>3.</strong>18: Anzahl der Cumarinuntersuchungen in verschiedenen<br />
Lebensmitteln<br />
Lebensmittel Anzahl der Un -<br />
tersuchungen<br />
Frühstückscerealien<br />
Feine Backwaren wie Spekulatius,<br />
Lebkuchen, Zimtsterne usw.<br />
Kinderpunsch<br />
Glühwein, Fruchtglühwein u. ä.<br />
Spirituosen<br />
Honig, Konfitüren<br />
Zimt<br />
Zimtkapseln<br />
Milchprodukte, Speiseeis<br />
Tees mit hohem Zimtanteil<br />
Süßwaren wie Fruchtschnitten,<br />
Zimtmandeln, Zimtpastillen<br />
Puddinge, Desserts<br />
Säuglings- <strong>und</strong> Kleinkindernahrung<br />
wie Getreidebreipulver <strong>und</strong> Kekse<br />
26<br />
142<br />
30<br />
80<br />
22<br />
7<br />
57<br />
14<br />
8<br />
10<br />
18<br />
18<br />
4<br />
davon<br />
beanstandet<br />
Links zum Thema:<br />
http://www.laves.niedersachsen.de/master/C27974673_N15510554_L20_D0_I826 (Stand: 11.02.2007)<br />
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-178620753824_1178620762318.htm (Stand: 11.02.2007)<br />
http://www.bfr.b<strong>und</strong>.de/cd/432 (Stand: 11.02.2007)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
2<br />
9<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
1<br />
0<br />
schädigende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Auf -<br />
gr<strong>und</strong> der aktuell festgestellten geringeren Cumaringehalte in<br />
zimthaltigen Lebensmitteln kann im Vergleich zum Vorjahr von<br />
Verzehrempfehlungen bei einzelnen Lebensmitteln abgesehen<br />
werden.<br />
Diese neuen Erkenntnisse fließen zurzeit in die Änderung des Aro -<br />
menrechts bei der Europäischen Union ein. Deutschland hat die<br />
Diskussion zum Anlass genommen, um Vorschläge für einheitliche<br />
Cumarin-Höchstmengen in bestimmten Lebensmittel gruppen<br />
in Europa zu unterbreiten.<br />
Das BfR schlägt als Höchstmenge für Cumarin in Zimt 1.800 mg/kg<br />
vor. Soll diese Höchstmenge unterschritten <strong>und</strong> die täglich duldbare<br />
Höchstmenge eingehalten werden, so sollen Er wachsene<br />
nicht mehr als 1 g Zimt <strong>und</strong> Kinder nur 0,3 g Zimt täglich verzehren<br />
(siehe Bild).<br />
Dr. Wald, B. (LI BS); Dr. Morales, G. (LI OL); Lay, J. (Dez. 21);<br />
Dr. Gabel, B. (LUA Bremen)<br />
87
88<br />
<strong>3.</strong>3 Bedarfsgegenstände <strong>und</strong> Kosmetika<br />
Bedarfsgegenstände<br />
Chrom(VI) in Lederhandschuhen<br />
Lederarbeitshandschuhe wurden aufgr<strong>und</strong> eines deutlich erhöhten<br />
Chromatgehaltes als ges<strong>und</strong>heitsschädlich beanstandet. Das<br />
Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG) hat im Jahr 2007<br />
insgesamt 60 Lederbedarfsgegen stände wie Schuhe, Sandalen,<br />
Jacken, Lederarmbänder, Lederschmuck <strong>und</strong> Lederhandschuhe<br />
auf allergieauslösendes Chrom(VI) un ter sucht. 51 Proben gaben<br />
keinen Anlass zur Beanstandung. Bei neun Proben wurde der tolerierbare<br />
Wert von 3 mg/kg Chrom(VI) über schritten. Die höchs -<br />
ten ermittelten Gehalte waren 91,2 mg/kg bei Arbeits hand schu -<br />
hen <strong>und</strong> 18,9 mg/kg bei Kindersandalen. Ge genüber den Schwerpunkt<br />
untersuchungen im Jahr 2005 hat sich die Zahl der beanstandeten<br />
Proben prozentual verringert. Wie sich an den aktu el -<br />
len Ergebnissen aus dem Jahr 2007 zeigt, sind deutliche Über -<br />
schreitungen an Chrom(VI) in Ledererzeugnissen aber immer noch<br />
festzustellen. Die Chrom(VI) Problematik ist im Jahr 2007 Anlass<br />
verschiedener Expertengespräche unter Teil nah me von Indus trie,<br />
Handel <strong>und</strong> Behörden gewesen, mit dem Ziel, überhöhte Chrom(VI)<br />
Gehalte in Ledererzeugnissen zukünftig zu vermeiden.<br />
Ergänzende Fachinformation zu Chrom(VI)<br />
Die zur Lederherstellung verwendeten Tierhäute <strong>und</strong> Felle enthalten<br />
Kollagene (Faserproteine). Die Chromgerbung hat die Auf -<br />
gabe, durch Vernetzung der Carboxygruppen des Kollagens eine<br />
thermische <strong>und</strong> mechanische Stabilität des Leders zu erreichen.<br />
Die Ledergerbung wird weltweit vorwiegend mit Chrom(III) Sal -<br />
zen durchgeführt. Aufgr<strong>und</strong> von chemischen Prozessen (Redox -<br />
reaktion) kann es aber auch hier zur Bildung von Chrom(VI) kommen.<br />
Auslöser können z. B. alkalische Stoffe (Kleber, Hilfsstof fe)<br />
sein. Darüber hinaus kann das Leder altern. Dabei tragen Feuchtigkeit<br />
<strong>und</strong> UV-Strahlung zu einer weiteren Chrom(VI) Bildung<br />
bei. Für den analytischen Nachweis von Chrom(VI) wurde eine<br />
DIN bzw. Europäische Norm erarbeitet. Neben seiner sensibilisierenden<br />
Wirkung werden bestimmte Chrom(VI) Verbindungen auch<br />
als cancerogen <strong>und</strong> toxisch beschrieben. Untersuchungen ha -<br />
ben gezeigt, dass sich Chrom(VI) unter Einwirkung von Schweiß<br />
(Schweiß-Simulanz-Lösung) aus dem Leder herauslösen kann. Bei<br />
solchen Ledererzeugnissen sollte ein länger andauernder Haut -<br />
kontakt vermieden werden.<br />
Punkert, M. (IfB LG)
Sind Spielwaren aus China schlechter als andere?<br />
In den vergangenen Monaten wurden wiederholt verschiedenartigste<br />
Spielwarensortimente wegen ges<strong>und</strong>heitsgefährdender<br />
Farbe oder anderer Ges<strong>und</strong>heitsrisiken in großer Anzahl aus dem<br />
Handel gezogen. Allein der US-Konzern Mattel rief im August<br />
2007 weltweit über 20 Millionen Kinderspielwaren zurück. Die -<br />
ses in China produzierte Spielzeug enthielt bleihaltige Farbe, die<br />
bei Kindern zu Ges<strong>und</strong>heitsschäden führen kann.<br />
Doch wie kann man erkennen, ob ein Produkt aus China kommt<br />
oder nicht? Bei vielen Produkten ist das Herkunftsland nicht zu<br />
erkennen, wenn diese in einem Land der EU in den Verkehr ge -<br />
bracht worden sind. Die Zweite Verordnung zum Geräte- <strong>und</strong><br />
Pro duktsicherheitsgesetz (Verordnung über die Sicherheit von<br />
Spielzeug – 2. GPSGV) verlangt die Angabe eines innerhalb der<br />
EU ansässigen Verantwortlichen, der auf den Erzeugnissen zu<br />
kennzeichnen ist. Eine zusätzliche verbindliche Angabe des Her -<br />
stellungslandes ist für den europäischen Markt – im Gegensatz<br />
zu großen Industrieländern wie Japan, Australien, China oder den<br />
USA – nicht vorgesehen. Somit war eine eindeutige Zuordnung<br />
nur bei den Spielzeugproben möglich, bei denen China als Her -<br />
stellungsland z. B. durch Kennzeichnung »Made in China« zu<br />
identifizieren war.<br />
Insgesamt wurden im Jahre 2007 im Institut für Bedarfsgegen -<br />
stände 251 Spielwaren auf sich im Magen herauslösendes Blei<br />
untersucht. Da Spielwaren oft mehrere verschiedenfarbige La -<br />
ckierungen aufweisen, wurden insgesamt 2.496 Unter suchun -<br />
gen auf Blei durchgeführt. Bei zwölf Proben (4,8%) wurde ein<br />
zu hoher Bleigehalt festgestellt, von diesen waren zwei Proben<br />
mit »Made in China« gekennzeichnet. Die anderen zehn Pro ben<br />
waren keinem Herstellungsland zuzuordnen. Aus dem gesamten<br />
Pool von 251 Spielwaren konnte bei 59 Produkten China als Herstellungsland<br />
identifiziert werden. Vergleicht man nun die Ge -<br />
samt menge der Bleibeanstandungen aus allen Untersuchungen<br />
von 4,8% mit den Beanstandungen der nachweislich aus China<br />
stammenden Proben von 3,4%, zeigt sich ein vergleichbares Bild.<br />
Bei Spielzeug aus Kunststoff haben sich die Fallzahlen in Hinblick<br />
auf Nachweis verbotener Weichmacher (Phthalsäureester) im Jahr<br />
2007 erhöht. Dabei ist zu beachten, dass eine neue Regelung für<br />
Phthalsäureester seit dem 16. Januar 2007 existiert. Es ist davon<br />
aus zugehen, dass es sich bei einem Großteil der beanstandeten<br />
Spielwaren um Restposten aus den vorhergehenden Jahren handelt.<br />
Diese waren zum Zeitpunkt der Herstellung nicht zu beanstanden.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Wegen ges<strong>und</strong>heitsgefährdender Farbe oder anderer Ges<strong>und</strong>heits ri -<br />
siken wurden in China produzierte Spielwaren in großer Anzahl aus<br />
dem Handel gezogen<br />
Von insgesamt 275 eingegangenen Proben Spielzeug aus Kunststoff<br />
waren 88 Produkte aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt. Der<br />
Anteil an Proben chinesischer Herkunft betrug 31, da von waren<br />
in 15 Proben Phthalsäureester nicht nachweisbar; 16 Proben wurden<br />
aufgr<strong>und</strong> der Verwendung verbotener Phthal säu reester be -<br />
anstandet. Eine entsprechende Anzahl an Beanstan dun gen aufgr<strong>und</strong><br />
stofflicher Eigenschaften hat sich bei Spielwaren, bei de nen<br />
die Herkunft nicht zuzuordnen war, ergeben.<br />
Eichhoff, S.; Lobsien, M. (IfB LG)<br />
89
90<br />
Bleihaltiger Schmuck für Kinder<br />
In den USA starb 2004 ein Kind an einer Bleivergiftung, nachdem<br />
es ein Schmuckstück verschluckt hatte, das extra für Kinder hergestellt<br />
worden war. Da zu befürchten ist, dass bleihaltiger Kin -<br />
derschmuck auch in Europa in den Verkehr gebracht wird, wur -<br />
de im Jahr 2007 am LAVES Institut für Bedarfsgegenstände in Lü -<br />
neburg (IfB LG) Modeschmuck, der vor allem für Kinder <strong>und</strong> Ju -<br />
gend li che bestimmt war, auf Bleigehalt <strong>und</strong> die entsprechende<br />
Bioverfüg bar keit hin untersucht. Dabei wurde deutlich, dass auch<br />
in Deutsch land nicht unwesentliche Mengen an bleihaltigem<br />
Schmuck in den Verkehr gebracht werden.<br />
Ganz allgemein ist zu beobachten, dass vor allem Kinder Teile von<br />
Ketten in den M<strong>und</strong> nehmen <strong>und</strong> daran lutschen. Weiterhin kann<br />
nicht ausgeschlossen werden, dass Schmuck in Einzelteile zerlegt<br />
<strong>und</strong> dann von kleinen Kindern verschluckt werden kann. Im Zu -<br />
sammenhang mit besagtem Todesfall hat die US-Regierung im<br />
Jahr 2005 Vorschriften in Bezug auf den Bleigehalt <strong>und</strong> die Bio -<br />
verfügbarkeit von Blei in Kinderschmuck erlassen. Seitdem muss -<br />
ten mehrere Millionen Schmuckstücke vom amerikanischen Markt<br />
zurückgerufen werden. In Europa existieren zum gegenwärtigem<br />
Zeitpunkt keine Vorschriften in Bezug auf Bleigehalt <strong>und</strong> Bio verfügbarkeit<br />
in Kinderschmuck. Zur Orientierung wurden daher die<br />
in den USA geltenden Grenzwerte herangezogen.<br />
Die Untersuchungen am LAVES ergaben bei 17 von 47 (36%) Pro -<br />
ben einen Bleigehalt von mehr als 0,06% <strong>und</strong> bei 16 (34%) Proben<br />
eine Bioverfügbarkeit von mehr als 175 µg Blei/Gegenstand.<br />
Eine hier zu findende geringe Überschreitung der amerikanischen<br />
Grenzwerte bedeutet allerdings noch keine akute Ges<strong>und</strong>heits -<br />
gefährdung, dennoch wären diese Proben in Hinblick auf den<br />
vorbeugenden <strong>Verbraucherschutz</strong> in den USA nicht verkehrsfähig<br />
gewesen. Einige der in Lüneburg untersuchten Proben zeigten<br />
allerdings Werte für den Bleigehalt von 12,9% (Glie der einer<br />
Halskette) bis zu 37% (Verschluss einer Kette) <strong>und</strong> Bio verfüg bar -<br />
keiten von bis zu 4606 µg (Anhänger einer Kette)! Bei der Un ter -<br />
suchung einer Holzperlenkette wurde für den Metall verschluss<br />
ebenfalls eine erhöhte Bleiabgabe ermittelt. Eine Ge s<strong>und</strong>heits -<br />
ge fährdung ist trotzdem auch bei hohen Über schrei tun gen nicht<br />
zwangsläufig gegeben, sondern hängt von vielen Fak toren wie<br />
etwa Alter, Gewicht, Ernährungszustand <strong>und</strong> Agilität ab. Eine eu -<br />
ropaweite Regelung wäre daher im Sinne des vorbeu genden <strong>Verbraucherschutz</strong>es<br />
hilfreich.<br />
Insbesondere Verschlüsse von Ketten <strong>und</strong> Armbändern verfügten<br />
über hohe Bioverfügbarkeit von Blei. Dies ist dadurch zu er -<br />
klären, dass zu ihrer Herstellung oftmals bleihaltiges Lot verwendet<br />
wird. Dies zeigt aber auch, dass nicht nur Schmuck aus Me -<br />
tall zu einem ges<strong>und</strong>heitlichen Risiko werden kann, sondern auch<br />
Schmuck, der größtenteils aus anderen Materialien be steht. Da -<br />
bei wäre es durchaus möglich, Verschlüsse ohne Verwen dung von<br />
bleihaltigem Lot herzustellen. Diese stehen jedoch aufgr<strong>und</strong> der<br />
höheren Material- <strong>und</strong> Verarbeitungskosten der üblichen Preis -<br />
gestaltung von Modeschmuck entgegen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der möglichen Ges<strong>und</strong>heitsgefährdung durch Blei in<br />
Kinderschmuck werden im LAVES Untersuchungen dieser Art<br />
auch im nächsten Jahr eine wichtige Rolle spielen.<br />
Fachinformationen zu Blei<br />
Blei wird aufgr<strong>und</strong> seiner physikalischen Eigenschaften (hohes Gewicht,<br />
leicht zu verarbeiten), sowie seines geringen Beschaffungspreises<br />
vermehrt in billigem Schmuck als »Trägermaterial« oder<br />
»Gr<strong>und</strong>gerüst« eingesetzt. Um die stumpfe, graue Färbung des<br />
Bleis zu überdecken, werden die Schmuckstücke nach ihrer Form -<br />
gebung mit anderen Edelmetallen überzogen (galvanisiert). Je<br />
nach Qualität <strong>und</strong> Dicke des Überzugs können jedoch erhebliche<br />
Bleimengen, z. B. beim Verschlucken, durch die Magensäu re<br />
herausgelöst werden.<br />
Schmidt, O. (IfB LG)
Kosmetika<br />
Diethylenglykol (DEG) in Zahncreme<br />
Im Sommer 2007 warnten US-amerikanische Behörden vor Zahncremes,<br />
darunter nachgeahmte Markenzahncremes chinesischer<br />
Herkunft, in denen DEG festgestellt wurde. Kurze Zeit später<br />
wur den auch in einigen EU-Ländern (z. B. Spanien, Italien) Zahncremes<br />
mit DEG-Gehalten bis zu 9% entdeckt.<br />
Im Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg wurden daraufhin<br />
Zahncremes, die insbesondere in Sonderpostenmärkten entnommen<br />
wurden, hinsichtlich der Verwendung von DEG als Feucht -<br />
hal temittel untersucht. In keiner der 38 zur Untersuchung eingegangenen<br />
Proben konnte DEG nachgewiesen werden. In den<br />
Erzeugnissen waren die üblicherweise in Zahncremes eingesetzten<br />
<strong>und</strong> als ges<strong>und</strong>heitlich unbedenklich geltenden Feucht haltemittel<br />
wie Glycerin, Dipropylenglykol oder Sorbitol enthalten.<br />
Der Einsatz des im Vergleich zu den gängigen Feuchthalte mit teln<br />
preiswerteren DEGs in kosmetischen Mitteln ist in der EU nicht<br />
ausdrücklich verboten. Aufgr<strong>und</strong> der oralen Toxizität des Stof fes<br />
darf er in Zahncremes jedoch nur in so geringen Mengen vorhanden<br />
sein, dass von den Produkten bei bestimmungsgemäßem<br />
<strong>und</strong> vorauszusehendem Gebrauch kein ges<strong>und</strong>heitliches<br />
Risiko ausgeht.<br />
Nach einer Risikobewertung des B<strong>und</strong>esinstitutes für Risikobe wer -<br />
tung (BfR) ist für einen erwachsenen Verbraucher unter normalen<br />
Bedingungen von den in der EU auf getauchten DEG-haltigen<br />
Zahncremes kein erhöhtes Risiko zu er warten. Bei der Verwen dung<br />
durch Kleinkinder kann aufgr<strong>und</strong> des geringeren Körpergewichtes<br />
<strong>und</strong> des Verschluckens größerer Mengen an Zahnpasta unter bestimmten<br />
Umständen ein er höhtes Ges<strong>und</strong>heitsrisiko jedoch nicht<br />
ausgeschlossen werden.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Fachinformation zu Diethylenglykol (DEG) in Zahncreme<br />
DEG ist eine farblose, ölige, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem<br />
Geschmack. Die Substanz wird u. a. als Feuchthalte-, Trocknungs-<br />
<strong>und</strong> technisches Lösemittel verwendet <strong>und</strong> ist ferner in<br />
Gefrierschutzmitteln enthalten. DEG ist ges<strong>und</strong>heitsschädlich beim<br />
Verschlucken, was weltweit in den Jahren 1937 bis 1998 in da -<br />
maliger Unkenntnis der oralen Toxizität zu akuten Vergiftungen<br />
mit zahlreichen Todesfällen durch orale Arzneimittel führte. En -<br />
de der 80er Jahre stand DEG aufgr<strong>und</strong> seines verbotenen Ein -<br />
satzes vor allem in österreichischen Weinen in der Diskussion.<br />
Dort wurde es eingesetzt, um eine bessere Qualität vorzutäuschen.<br />
Weßels, B. (IfB LG)<br />
91
92<br />
<strong>3.</strong>4 Futtermittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung<br />
Melamin – kein Problem für Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Im Jahr 2007 geriet mit Melamin ein Stoff in den Fokus der Öf -<br />
fentlichkeit <strong>und</strong> Überwachungsbehörden, der für den Tod durch<br />
Nierenversagen von H<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Katzen vor allem in den USA,<br />
Kanada <strong>und</strong> Südafrika verantwortlich gemacht wurde. Es wird<br />
davon ausgegangen, dass Melamin in einzelnen Chargen von<br />
Weizengluten, Maiskleber <strong>und</strong> Reisproteinkonzentrat aus China<br />
enthalten war, welche als Rohstoffe für die Produktion von Heimtierfutter<br />
Anwendung finden. Melamin ist ein farbloses kristallines<br />
Pulver, welches sich durch einen hohen Stickstoffanteil im<br />
Molekül auszeichnet (etwa 66% Stickstoff). Durch den Zusatz<br />
von Melamin wird offensichtlich ein erhöhter Stickstoffgehalt in<br />
minderwertigen Futtermitteln erreicht. Das führt zur Vortäu schung<br />
eines höheren Proteingehaltes, da der Proteingehalt nach den gängigen<br />
Standardmethoden (Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl)<br />
über den Stickstoffgehalt ermittelt wird.<br />
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Melamin in Futter- <strong>und</strong><br />
Lebensmitteln aus niedersächsischer Verarbeitung im Jahr 2007<br />
kein Problem darstellte. Insgesamt wurden im Futtermittel insti tut<br />
Stade (FI STD) 96 Futter- <strong>und</strong> Lebensmittel aus <strong>Niedersachsen</strong><br />
<strong>und</strong> vier weiteren B<strong>und</strong>esländern (Schleswig-Holstein, Hessen,<br />
Mecklen burg-Vorpommern <strong>und</strong> Rheinland-Pfalz) untersucht. Nahezu<br />
60% der Proben kamen aus <strong>Niedersachsen</strong>. Tabelle <strong>3.</strong>19<br />
stellt den Un tersuchungsumfang dar.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>19: Untersuchungsumfang auf Melamin am<br />
Futtermittelinstitut Stade im Jahr 2007<br />
Probenart Anzahl Ergebnis<br />
Allein- <strong>und</strong> Ergänzungsfutter für<br />
Heimtiere<br />
Einzelfuttermittel (z. B. Maiskleber,<br />
Sojabohnenprotein)<br />
andere Futtermittel (z. B. Alleinfutter,<br />
Ergänzungsfutter, Vormischungen)<br />
Lebensmittel (z. B. Tofu, Sojadrinks)<br />
Summe<br />
41<br />
17<br />
21<br />
17<br />
96<br />
39 negativ,<br />
2 positiv<br />
17 negativ<br />
19 negativ,<br />
2 positiv<br />
17 negativ<br />
92 negativ,<br />
4 positiv
Den Hauptteil der Proben umfassten Allein- <strong>und</strong> Ergänzungs futter<br />
für Heimtiere (43%) was in der Historie der Ereignisse be gründet<br />
liegt. Mitte März wurde erstmalig im Europäischen Schnell -<br />
warnsystem für Lebensmittel <strong>und</strong> Futtermittel mitgeteilt, dass in<br />
den USA <strong>und</strong> später weltweit Katzenfutter zurückgerufen wurde.<br />
Rätselhafte Todesfälle von Katzen <strong>und</strong> H<strong>und</strong>en führten zur Analyse<br />
der verdächtigen Futtermittel, in denen Melamin gef<strong>und</strong>en<br />
wurde.<br />
Das war Anfang Mai für das Futtermittelinstitut Stade Anlass zur<br />
Etablierung einer von der US-Überwachungsbehörde (FDA) entwickelten<br />
Methode zur Bestimmung von Melamin <strong>und</strong> seinen Hy -<br />
drolyseprodukten Ammelin, Ammelid <strong>und</strong> Cyanursäure. Die Analyse<br />
erfolgt nach Derivatisierung <strong>und</strong> gaschromatografischer Trennung<br />
mit Hilfe eines massenselektiven Detektors.<br />
Seit Mitte Mai wurden dann eine Reihe von Alleinfuttermitteln<br />
für Heimtiere, Ausgangserzeugnisse zu deren Produktion <strong>und</strong><br />
auch relevante Lebensmittel auf Melamin untersucht. Erfreu liches<br />
Ergebnis war, dass alle Lebensmittel <strong>und</strong> auch Einzelfutter mittel<br />
sowie der überwiegende Teil der Mischfutter frei von Melamin<br />
waren. In zwei Alleinfuttermitteln für H<strong>und</strong>e <strong>und</strong> zwei Angel kö -<br />
dern wa ren die Bef<strong>und</strong>e positiv. Das aus Südafrika importierte<br />
<strong>und</strong> sich noch im Verkehr befindliche belastete H<strong>und</strong>efutter wur -<br />
de unverzüglich zurückgerufen <strong>und</strong> schadlos vernichtet.<br />
Dr. Zierenberg, B.; Dr. Hashem, A. (FI STD)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
93
94<br />
Kokzidiostatika in Futtermitteln für Nichtzieltierarten – Forderung nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben<br />
Etwa jede sechste Futtermittelprobe, die im Futtermittelinstitut<br />
Stade (FI STD) im Jahr 2007 analysiert wurde, war auf Ver schleppungen<br />
von pharmakologisch wirksamen Substanzen zu untersuchen.<br />
Die größte Rolle spielten dabei Kokzidiostatika, die als<br />
Futtermittel zu satz stoff vor allem bei Geflügel präventiv gegen<br />
Kokzidiose eingesetzt werden.<br />
Insgesamt wurden im Jahr 2007 im Futtermittelinstitut Stade 525<br />
Proben auf Verschleppungen von Kokzidiostatika untersucht. Beim<br />
überwiegenden Teil der Proben handelte es sich um Alleinfutter<br />
(davon über 55% für Schweine <strong>und</strong> etwa 25% für Geflügel). Bei<br />
einer Nachweisgrenze von 0,06 mg/kg wurden 2007 in über 80%<br />
der untersuchten Futtermittelproben keine Kokzidiostatika nachgewiesen.<br />
Die Tabelle <strong>3.</strong>20 zeigt eine Zusammenfassung.<br />
Alleinfutter<br />
Ergänzungsfutter<br />
Mineralfutter<br />
Vormischungen<br />
Einzelfutter + Sonstige<br />
Summe<br />
311 (59,2%)<br />
158 (30,1%)<br />
25 (4,8%)<br />
15 (2,8%)<br />
16 (3,0%)<br />
525<br />
233 (74,9%)<br />
106 (67,1%)<br />
25 (100%)<br />
7 (46,7%)<br />
11 (68,8%)<br />
382 (72,8%)<br />
In Ermangelung von Aktions- bzw. Höchstwerten von Kok zidio -<br />
statika in Futtermitteln für Nichtzieltierarten (Tierart, für die dieser<br />
Zusatzstoff nicht zugelassen ist) gilt die »Null tole ranz«, die<br />
insbesondere vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer immer empfindli ch e ren<br />
Messtechnik kaum praktikabel <strong>und</strong> sinnvoll ist. Zudem weichen<br />
die Vorgehensweisen in der Analytik in den verschiede nen Bun -<br />
desländern sehr stark voneinander ab. Daher ist es uner lässlich,<br />
in Zukunft einheitliche Aktionswerte oder Höchstwerte festzulegen.<br />
Dies muss durch Fachgremien der EU <strong>und</strong> der Mit glieds -<br />
staaten erfolgen. Ende 2007 wurde in der Sitzung des »Stän di -<br />
gen Ausschusses für die Lebensmittelkette <strong>und</strong> die Tierge s<strong>und</strong> -<br />
heit, Gruppe Tierernährung« über die Einführung von Rück standshöchstgehalten<br />
von Narasin <strong>und</strong> Monensin in Futtermitteln von<br />
Nichtzieltierarten diskutiert. Die diskutierten Werte liegen zwischen<br />
Tabelle <strong>3.</strong>20: Aufstellung der untersuchten Futtermittel <strong>und</strong> Anteil der Verschleppung von Kokzidiostatika<br />
Anzahl Proben Kokzidiostatika n.n. Hemmstoff positiv<br />
nicht qualifizierbar<br />
3 (1,0%)<br />
27 (17,1%)<br />
0 (0%)<br />
7 (46,7%)<br />
3 (18,7%)<br />
40 (7,6%)<br />
Kokzidiostatika positiv<br />
75 (24,1%)<br />
25 (15,8%)<br />
0 (0%)<br />
1 (6,6%)<br />
2 (12,5%)<br />
103 (19,6%)
1,0 <strong>und</strong> 4,0 mg/kg. Dies ist zumeist bei Weitem höher, als die im<br />
Jahre 2007 im Futtermittelinstitut Stade ermittelten Gehalte. In<br />
85% der mit Kokzidiostatika belasteten Futtermittel wurde ein<br />
Gehalt von 1,0 mg/kg nicht überschritten.<br />
Kokzidiostatika in Endmastfutter für Geflügel<br />
Beispielhaft, da überdurchschnittlich oft mit Kokzidiostatika be -<br />
lastet, wird in der Folge auf Endmastfutter für Masttruthühner<br />
<strong>und</strong> Masthähnchen eingegangen. Insgesamt wurden 33 derartige<br />
Proben untersucht. Davon enthielten über 60% Kokzidio sta -<br />
tika. In der Hälfte der Proben wurden Verschleppungen von zwei<br />
bis vier Kokzidiostatika gleichzeitig ermittelt. In der Abbildung<br />
<strong>3.</strong>13 sind die gef<strong>und</strong>enen Gehalte detaillierter aufgeführt.<br />
Berücksichtigt man die momentan diskutierten Höchstgehalte<br />
wären lediglich zwei Futtermittel der beschriebenen Mast end futter<br />
auffällig geworden.<br />
Dr. Zierenberg, B. (FI STD)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Abbildung <strong>3.</strong>13: Gehalte verschiedener Kokzidiostatika in Endmast -<br />
futter für Geflügel<br />
95
96<br />
<strong>3.</strong>5 Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Oleander eine schöne, aber gefährliche Pflanze! – Oleander-Vergiftung beim Bison<br />
In einer niedersächsischen Bison-Hobbyhaltung verendeten ein<br />
Bisonbulle <strong>und</strong> eine Bisonkuh wenige St<strong>und</strong>en nachdem sie ein<br />
gestörtes Allgemeinbefinden mit Taumeln, Stolpern, Inkoordi nation,<br />
hochfrequenter Atmung <strong>und</strong> Koliksymptomen gezeigt hatten.<br />
Ein Bisonkalb, welches auf derselben Weide gehalten wur -<br />
de, war <strong>und</strong> blieb klinisch unauffällig.<br />
Vorberichtlich gaben die Besitzer an, dass der Nachbar Garten -<br />
abfälle auf der Weide entsorgt hätte, die Reste von Oleander-<br />
Sträuchern enthielten. Die Aufnahme der Gartenabfälle erfolgte<br />
sehr wahrscheinlich nur von den beiden Elterntieren.<br />
Vorbereitung des Bisonbullen zur Sektion<br />
Bei der Sektion des Bisonbullen <strong>und</strong> der Bisonkuh im Veterinär -<br />
institut Oldenburg wurden zahlreiche Blutungen in der Unter haut<br />
des Brustkorbes, in der Magenschleimhaut <strong>und</strong> der Pansen wand<br />
sowie in der linken Herzkammer festgestellt. Nach Öffnung der<br />
Vormägen konnten erst nach akribischer Suche bei beiden Tie -<br />
ren einzelne Fragmente von Oleanderblättern entdeckt werden.<br />
Suche nach Oleanderblättern<br />
Da die Blattunterseite von Oleander charakteristische Krypten aufweist<br />
<strong>und</strong> diese bei der histologischen Untersuchung deutlich zu<br />
erkennen sind, wurden auch die stark zerkleinerten Blattrudi mente<br />
durch die mikroskopische Untersuchung als Oleanderblätter<br />
identifiziert.<br />
Oleanderblatt-Rudimente aus dem Pansen
Typische Krypten der Blattunterseite Native Oleanderblätter<br />
Oleander (Nerium oleander) gehört zu der Familie der H<strong>und</strong>s giftgewächse<br />
<strong>und</strong> kommt ursprünglich im gesamten Mittel meer raum<br />
vor, ist aber mittlerweile weltweit verbreitet <strong>und</strong> wächst als bis<br />
zu 5 m hoher Strauch oder Baum mit lanzettförmigen, le derartigen<br />
immergrünen Blättern. Die Blüten sind weiß oder ro sa, die<br />
Blütezeit liegt zwischen Juli <strong>und</strong> Oktober.<br />
Oleander wird im frischen Zustand aufgr<strong>und</strong> seines sehr bitteren<br />
Geschmacks meist nicht aufgenommen, es sei denn die Tiere haben<br />
über längere Zeit gehungert. Häufiger wird Oleander als Kontamination<br />
des Futters in Form getrockneter Oleanderblätter (z. B.<br />
aus Gartenabfällen) aufgenommen. Die Blätter der Pflanze enthalten<br />
mindestens 1,5% Glykoside, das Hauptglykosid ist Olean -<br />
drin (L-Oleandrosid des 10-Acetylgitoxigenin). Oleandrin ist ne ben<br />
den in geringen Mengen vorkommenden Odorosiden verantwortlich<br />
für die Herzwirksamkeit der Pflanze, vergleichbar den Digi -<br />
talisglykosiden.<br />
Die Vergiftungserscheinungen bestehen nach oraler Aufnahme<br />
von Oleandrin in einer Verlangsamung oder auch Erhöhung der<br />
Frequenz des Herzschlages, Erregungsleitungsstörungen am Herzen<br />
bis hin zum Kammerflimmern <strong>und</strong> Herzstillstand. Zusätzlich<br />
können lokale Reizungen der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes,<br />
Speicheln, Diarrhoe, Erbrechen, Atemnot, Zittern, Schwäche<br />
<strong>und</strong> Unruhe beobachtet werden. Als zentralnervöse Erscheinung<br />
besteht häufig zunächst eine Erregung, die dann in eine Läh mung<br />
übergehen kann.<br />
Da es sich bei Oleander um eine hochtoxische Pflanze handelt,<br />
genügt für eine fulminant verlaufende Intoxikation die Aufnah -<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Blutungen im Herzmuskel<br />
me einer geringen Blattmenge. Die tödliche Dosis wird beim Rind<br />
mit 10 bis 20 Oleanderblättern angegeben. Auch beim Bison ist<br />
daher im Analogieschluss zum Rind sehr wahrscheinlich eine<br />
ähnlich geringe Menge an Oleanderblättern letal.<br />
Im vorliegenden Fall wurde Oleandrin in den Blattfragmenten (mittels<br />
HPLC) aus dem Vormagen nachgewiesen. Zusätzlich erfolgte<br />
der Nachweis eines Metaboliten von Oleandrin im Blut. Damit<br />
wurde die Todesursache zweifelsfrei geklärt.<br />
Dr. Brügmann, M.; Niemann, U. (VI OL)<br />
97
98<br />
Tierseuchen <strong>und</strong> Tierkrankheiten<br />
Entwicklung der Blauzungenkrankheit in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Die Blauzungenkrankheit ist im August 2006 erstmalig in Deutsch -<br />
land festgestellt worden. Überwiegend war das Bun des land Nordrhein-Westfalen<br />
(NRW) mit 945 Betrie ben betroffen. In Nieder sachsen<br />
wurde zwischen Anfang November 2006 <strong>und</strong> Ende Fe bruar<br />
2007 auf 21 Betrieben die Blauzungenkrankheit nachgewie sen.<br />
Im Frühjahr <strong>und</strong> im Sommer 2007 wurden so wohl im Gefähr -<br />
dungs gebiet als auch in der 150-km-Zone Moni toring untersu -<br />
chun gen in Rinderbeständen durchgeführt, die alle negative Er -<br />
gebnisse hatten.<br />
Erst am 1<strong>3.</strong> August 2007 wurde die Blauzungenkrankheit auf ei -<br />
nem Betrieb in Grenznähe zu Nordrhein-Westfalen (NRW) erneut<br />
nachgewiesen. In NRW waren bis dahin schon ca. 250 Ausbrüche<br />
registriert worden.<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> nahm die Zahl der gemeldeten Ausbrüche pro<br />
Woche bis Mitte Oktober stetig zu. Seit Mitte Oktober ist ein<br />
Rück gang in den Meldungen von Neuinfektionen zu verzeich-<br />
nen. Ins gesamt waren zwischen dem 1<strong>3.</strong> August <strong>und</strong> 31. De zember<br />
2007 2.935 Betriebe in <strong>Niedersachsen</strong> von der Blauzungen -<br />
krankheit betroffen. Deutschlandweit waren es zwischen dem<br />
6. Juni <strong>und</strong> dem 31. Dezember 2007 20.259 Ausbrüche, die sich<br />
annähernd jeweils zur Hälfte auf Rinder- <strong>und</strong> Schafbe stän de verteilten.<br />
Der überwiegende Anteil festgestellter Neuinfektio nen<br />
(92,2%) 2007 ging sowohl in <strong>Niedersachsen</strong> als auch deutschlandweit<br />
einher mit deutlichen klinischen Symptomen der Blau -<br />
zungenkrankheit. Die restlichen Infektionen wurden meist im Rahmen<br />
von Untersuchungen für das Verbringen von Tieren festgestellt.<br />
Auch wenn Vergleichszahlen fehlen, ist anzunehmen, dass<br />
der Anteil infizierter Tiere innerhalb einer Herde <strong>und</strong> auch das<br />
Verhältnis an der Krankheit verendeter Tiere zu erkrankten Tie -<br />
ren dieses Jahr höher als im letzten Jahr ist. In einzelnen Betrie -<br />
ben, in denen klinische Erscheinungen auftraten, wurden Gesamtbestandsuntersuchungen<br />
durchgeführt. Es zeigte sich, dass bis<br />
zu 50% der untersuchten Tiere infiziert waren. Neben den typischen<br />
klinischen Erscheinungen wurde ein erheblicher Einbruch<br />
Die Ausbrüche der Blauzungenkrankheit verteilten sich annähernd<br />
jeweils zur Hälfte auf Rinder- <strong>und</strong> Schafbestände
der Milchleistung festgestellt. Es ist noch unklar, inwieweit es zu<br />
einer diaplazentaren Übertragung des Virus <strong>und</strong> damit zu einer<br />
intrauterinen Infektion von Kälbern kommen konnte.<br />
Die bisherigen Bekämpfungsmaßnahmen dienten vor allem da zu,<br />
eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Zwar wurden<br />
die meisten Neuinfektionen im bereits bestehenden Gefähr dungsgebiet<br />
(20-km-Zone) bzw. in den relativ dicht angrenzenden Gebieten<br />
nachgewiesen. Jedoch kam es zu Neuinfektionen am Rande<br />
der 150-km-Zone. Insgesamt war eine stetige Ausweitung des<br />
Gebietes, in dem das Blauzungenvirus nachweislich zirkulierte, insbesondere<br />
in den Monaten September <strong>und</strong> Oktober 2007 festzustellen.<br />
Dieses wird vor allem auf eine Weiterverbreitung des<br />
Virus durch den Vektor zurückgeführt. Seit Anfang November ist<br />
ganz <strong>Niedersachsen</strong> bis auf einen schmalen Streifen im Land kreis<br />
Goslar als 20 km-Zone ausgewiesen.<br />
In der EU ist man bestrebt, die Zulassung eines wirksamen Impf -<br />
stoffes gegen das Blauzungenvirus zu fördern. So gehen für 2008<br />
die Hoffnungen dahin, empfängliche Tiere durch eine Impfung<br />
besser schützen zu können.<br />
Die Aktivitäten der Veterinärämter bei der Bekämpfung der Blau -<br />
zungenkrankheit sind gesetzlich festgelegt <strong>und</strong> ergeben sich aus<br />
der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit. Nach<br />
der Seuchenfeststellung durch den Amtstierarzt leitet die Behör -<br />
de notwendige Maßnahmen ein, macht den Seuchenausbruch<br />
öffentlich bekannt <strong>und</strong> informiert alle betroffenen Fachkreise.<br />
Außerdem ist die Behörde dazu verpflichtet, innerhalb von 24<br />
St<strong>und</strong>en über das Tierseuchennachrichtensystem eine Meldung<br />
über das B<strong>und</strong>esministerium für Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> (BMELV) an die EU-Kommission abzugeben.<br />
Für Tiere, die deutliche klinische Symptome haben <strong>und</strong> bei de -<br />
nen die Erkrankung auch nachgewiesen wurde, wird eine Tö -<br />
tungsanordnung ausgesprochen, um zum einen eine Seuchen -<br />
verschleppung zu verhindern <strong>und</strong> zum anderen den hochgradig<br />
kranken Tieren weiteres Leiden zu ersparen. Für diese Tiere er -<br />
hält der Tierhalter eine Entschädigung durch die Tierseu chen kas se.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Um den Seuchenausbruchsbestand wird ein 20 km großer Ra -<br />
dius gezogen, der sich an örtlichen Gegebenheiten orientiert, in<br />
dem für alle empfänglichen Tiere die behördliche Beobachtung<br />
angeordnet wird. Soweit jahreszeitlich erforderlich, wird die Be -<br />
handlung der empfänglichen Tiere mit Insektiziden angeordnet.<br />
Weiterhin wird eine 150 km große Überwachungszone eingerichtet.<br />
Die Ein rich tung dieser 20 <strong>und</strong> 150 km-Zone hat beträchtliche<br />
Auswir kun gen auf den Viehverkehr. Innerhalb der jeweiligen<br />
Zone bestehen kei ne Einschränkungen, in den übrigen Fällen<br />
dürfen Zucht- <strong>und</strong> Nutztiere sowie Schlachttiere nur mit Ge nehmigung<br />
des Ve te ri näramtes verbracht werden. Seit dem 1. November<br />
2007 ist die EG-Verordnung 1266/2007 in Kraft, mit der es<br />
erhebliche Er leich terungen für den Tierverkehr gibt. Hinsichtlich<br />
Verbringungs be schränkungen gibt es seit dem keine Unter tei lung<br />
in 20 km, 150 km <strong>und</strong> freies Gebiet mehr, sondern die 20 km<strong>und</strong><br />
150 km-Zone bilden ein Gebiet, in dem klinisch ges<strong>und</strong>e<br />
Tiere frei ge han delt werden dürfen. Lediglich beim Verbringen<br />
aus diesem Ge biet heraus sind gewisse Auflagen, wie z. B. die<br />
Untersu chungs pflicht, zu berücksichtigen.<br />
Dr. Schmedt auf der Günne, H. (Dez. 32); Dr. Bötcher, L. (VI OL);<br />
Krüger, A. (Landkreis Harburg)<br />
99
100<br />
Tierseuchenübungen in <strong>Niedersachsen</strong> – erste Übung im Mobilen Bekämpfungszentrum (MBZ)<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> werden von der Task-Force Veterinärwesen des<br />
LAVES in jedem Jahr Tierseuchenübungen für die kommunalen<br />
Veterinärbehörden organisiert. Bei der Übung 2007 stand die Bekämpfung<br />
der Klassischen Schweinepest (KSP) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Für alle Veterinärämter wurde zu Beginn der Übung das folgende<br />
Szenario vorgegeben: Nach einem Ausbruch der KSP in ei nem<br />
Bestand in der Gemeinde X im Landkreis Y am 10. September<br />
2007 kam es in den Folgetagen zu weiteren vier Ausbrüchen in -<br />
nerhalb des bereits eingerichteten Beobachtungs gebietes. Auf -<br />
gr<strong>und</strong> weiterer Ausbreitungstendenz der Seuche <strong>und</strong> drohender<br />
Handelsrestriktionen durch die EU wurde die Impfung als Be kämpfungsstrategie<br />
geprobt.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>14: TSN-Musterprojekt<br />
Die Übung in <strong>Niedersachsen</strong> hatte vor allem die folgenden Ziele:<br />
Auseinandersetzung mit dem Thema Impfung bei Klassischer<br />
Schweinepest<br />
Anwendung des Tierseuchen-Nachrichten-Programms (TSN)<br />
insbesondere im Hinblick auf das Zusammenfügen von Re -<br />
striktionsgebieten<br />
Anwendung des Tierseuchenbekämpfungshandbuches (TSBH)<br />
Organisation des Mobilen Bekämpfungszentrums (MBZ)<br />
Organisation des gemeinsamen Tierseuchenbekämpfungs zentrums<br />
praktischer Test der Arbeit im <strong>und</strong> mit dem MBZ<br />
Einbeziehung der praktizierenden Tierärzte <strong>und</strong> des landwirtschaftlichen<br />
Fachpersonals in die Übung<br />
� Ausbruchbetrieb<br />
O Betriebe<br />
1 km Radius um Ausbruchbetrieb<br />
2 km Radius um Ausbruchbetrieb<br />
Zusammengesetzter 3 km Sperrbezirk<br />
Zusammengesetztes 10 km Beobachtungsgebiet
Die landesweite Übung fand in drei Teilen statt. Am 19. Sep tember<br />
2007 wurde die Übung in den Landkreisen <strong>und</strong> kreisfreien<br />
Städten im westlichen <strong>Niedersachsen</strong> durchgeführt. Teil 2 der<br />
Übung fand am 26. September 2007 mit den Landkreisen <strong>und</strong><br />
kreisfrei en Städten des süd-östlichen <strong>Niedersachsen</strong> statt. Am<br />
20. <strong>und</strong> 21. September 2007 übte das gemeinsame Tierseuchenbe<br />
kämp fungszentrum der Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Ro -<br />
tenburg/ Wümme <strong>und</strong> Stade im MBZ der Länder der B<strong>und</strong>es re -<br />
publik Deutschland. Dabei wurden durch das LAVES praktizierende<br />
Tierärzte <strong>und</strong> durch den Landkreis Rotenburg landwirtschaftliches<br />
Fachpersonal in die Übung einbezogen, wodurch es erstmalig<br />
eine groß angelegte Tierseuchenübung der Veterinär be hör -<br />
den mit der Tierärzteschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft in Nieder sach sen<br />
gab. Zehn Impfteams, bestehend aus je einem praktizierenden<br />
Tier arzt, einem Berufsschüler (Fachrichtung Landwirtschaft) <strong>und</strong><br />
ei nem Verwaltungsmitarbeiter, haben insgesamt 20 Betriebe, die<br />
Schweine halten, aufgesucht. Zuvor fand im MBZ das sogenan nte<br />
Briefing, die allgemeine Einweisung der Impfteams, sowie die Ausrüstung<br />
der Teams mit Schutzkleidung, Schreibmaterial etc. statt.<br />
Auf den Betrieben vor Ort wurde das Hygiene proce de re geübt,<br />
der Bestand an zootechnischen Hilfsmitteln festgestellt <strong>und</strong> der<br />
Zeitaufwand für Impfung <strong>und</strong> Kennzeichnung der Schwei ne er -<br />
mittelt. An beiden Tagen fanden Lagebesprechungen, am zweiten<br />
Tag fand eine Pressekonferenz statt.<br />
Als Ergebnis der gemeinsamen Übung im MBZ ist festzustellen,<br />
dass das MBZ für Einsätze »vor Ort« gut geeignet ist. Die Ein -<br />
beziehung der Praktiker wurde von allen Seiten begrüßt.<br />
Die Arbeitsergebnisse aus allen Tierseuchenübungen 2007 wurden<br />
von der Task-Force Veterinärwesen anhand eines Bewer tungsschemas<br />
ausgewertet <strong>und</strong> den kommunalen Veterinärbehörden<br />
wurde das jeweilige Ergebnis mitgeteilt.<br />
Das TSBH war eine wertvolle Hilfe, einige Dokumente müssen je -<br />
doch überarbeitet werden. Hier sind alle Nutzer des TSBH gleicher<br />
maßen gefordert. Eine Besetzung der Impfteams mit drei Per -<br />
sonen ist, abweichend von den Vorgaben des TSBH, das vier Per -<br />
sonen vorsieht, ausreichend aber auch notwendig. Als beson ders<br />
problematisch stellten sich die sehr zeitaufwändige Kenn zeich -<br />
nung der geimpften Tiere sowie der Verbleib des Fleisches ge -<br />
imp fter Tiere dar. Wenn auch die – innerstaatliche – Vermark tung<br />
des Fleisches gr<strong>und</strong>sätzlich möglich ist, so dürfte sich in der Re -<br />
alität kein Abnehmer finden. Hier erscheint eine Änderung der<br />
Rechtsvorschriften dringend erforderlich.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Erste Übung im Mobilen Bekämpfungszentrum (MBZ)<br />
Es bleibt festzuhalten, dass das Niveau der Übungsergebnisse in<br />
den letzten Jahren deutlich gestiegen ist <strong>und</strong> fast alle kommunalen<br />
Veterinärbehörden die Ziele der Übung erreicht haben.<br />
Dies ist u. a. eine Folge der konsequenten Schulungsmaß nah men<br />
<strong>und</strong> spricht für einen guten Stand der Vorbereitungen in den niedersächsischen<br />
Veterinärämtern auf einen Tierseuchenkrisenfall.<br />
Die praktische Übung im MBZ kann allen Landkreisen nur empfohlen<br />
werden.<br />
Dez. 32 des LAVES; Landkreise Osterholz, Rotenburg, Stade,<br />
Grafschaft Bentheim, Harburg<br />
101
102<br />
Zunehmende Bedeutung der molekularbiologischen Diagnostik am Beispiel der Koi-Herpesvirus-PCR<br />
Ende der neunziger Jahre wurde bei Koi- <strong>und</strong> Speisekarpfen<br />
zu nächst in Israel <strong>und</strong> seit 2002 auch in Deutschland eine neue<br />
Krank heit beobachtet. Als Ursache wurde ein Herpesvirus er kan nt,<br />
das sich in betroffenen Fischbeständen seuchenhaft ausbreitete.<br />
Die Verluste können bis zu 100% betragen. Aufgr<strong>und</strong> der Tat -<br />
sache, dass die Infektion unerkannt (latent) verlaufen kann <strong>und</strong><br />
durch den kaum kontrollierbaren internationalen Handel mit Koikarpfen<br />
breitete sich die Krankheit sehr schnell in vielen Län dern<br />
aus <strong>und</strong> kommt nun fast weltweit vor.<br />
Der Erreger wird gegenwärtig als »Koi-Herpesvirus« (KHV) be -<br />
zeichnet. Das Virus ist nach derzeitigem Kenntnisstand für Men -<br />
schen ungefährlich.<br />
Zur Seuchensituation<br />
Während im Jahr 2006 noch 82 KHV-Nachweise in Nieder sach -<br />
sen registriert wurden, ging diese Zahl für das Jahr 2007 auf insgesamt<br />
34 Fälle zurück. Dieser gravierende Rückgang scheint je -<br />
doch in erster Linie die Folge geringerer Wassertemperaturen im<br />
Sommer 2007 im Vergleich zu 2006 zu sein. Es besteht daher<br />
kein Gr<strong>und</strong> zur Entwarnung, zumal zu vermuten ist, dass es in<br />
Bezug auf die tatsächlichen Fälle eine große Dunkelziffer gibt.<br />
Ges<strong>und</strong>e Koikarpfen<br />
Das Veterinärinstitut Hannover ist für die labordiagnostische Un tersuchung<br />
auf KHV zuständig. Die KHV-Nachweise erfolgten im<br />
Berichtsjahr mehrheitlich im Zuge von Einsendungen der Ab tei -<br />
lung Fischkrankheiten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.<br />
Bei positiven Bef<strong>und</strong>en werden die zuständigen kommunalen<br />
Veterinärbehörden <strong>und</strong> die Task-Force Veterinärwesen, Fachbereich<br />
Fischseuchenbekämpfung, zwecks etwaiger Bekämp fungsmaßnahmen<br />
<strong>und</strong> epidemiologischer Nachforschungen in Kennt -<br />
nis gesetzt.<br />
Sowohl Zierfischhändler als auch Gartenteichbesitzer waren im<br />
Berichtszeitraum von der Seuche betroffen. Es gab auch Nach -<br />
weise beim Goldfisch. Neue Erkenntnisse belegen, dass der KHV-<br />
Erreger nicht nur in Goldfischen, sondern auch u. a. Karau schen,<br />
Graskarpfen, Marmorkarpfen, Silberkarpfen, Schleien, Welsen<br />
<strong>und</strong> Stören vorkommen kann, ohne Symptome hervorzurufen.<br />
Diese zwar klinisch ges<strong>und</strong>en Fische sind unter Umständen in der<br />
Lage das Virus auszuscheiden. Über das natürliche Erreger reser -<br />
voir ist bis dato jedoch noch wenig bekannt.<br />
Zu Beginn des Frühjahrs gab es einen Nachweis des KHV-Erre gers<br />
in einem geimpften Bestand. Die Tiere wurden im Herkunfts dritt -<br />
land mit einer dort zugelassenen Vakzine gegen das KHV ge impft.<br />
Zum Zeitpunkt des Nachweises konnte diagnostisch nicht zwischen<br />
Feld- <strong>und</strong> Impfvirus differenziert werden. Das Nationale<br />
Referenzlabor für Fischkrankheiten bestätigte das Ergebnis des<br />
Veterinärinstitutes Hannover <strong>und</strong> die von der zuständigen Be hör -<br />
de eingeleiteten Sperrmaßnahmen wurden aufrechterhalten.
Am KHV erkrankter Koikarpfen<br />
Tierseuchenrechtliche Reglementierung<br />
Seit 2005 besteht für die KHV-Infektion eine Anzeigepflicht, je -<br />
doch keine Bekämpfungspflicht. Falls die zuständige Behörde ei -<br />
ne staatliche Bekämpfung jedoch für erforderlich erachtet, kann<br />
dies jederzeit auf Basis des Tierseuchengesetzes geschehen.<br />
Die EU-Kommission hat im Jahr 2006 eine neue Aquakultur richtlinie<br />
(2006/88/EG) erlassen, die bis Mai 2008 in nationales Recht<br />
umzusetzen ist. Erstmalig wird mit dieser Richtlinie die KHV-In -<br />
fektion auf EU-Ebene reglementiert. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> bedarf<br />
es sicherer Diagnoseverfahren, da insbesondere in Bezug auf<br />
Einfuhren von Zierkarpfen aus Drittländern <strong>und</strong> Untersuchun gen<br />
in möglicherweise latent infizierten Fischbeständen eine größtmögliche<br />
Diagnosesicherheit gewährleistet sein muss.<br />
Die Stellung der molekularbiologischen Diagnostik<br />
Infektionserreger sollten möglichst schnell nachgewiesen werden,<br />
um umgehend gezielte Maßnahmen einleiten zu können. Die -<br />
ser Kernsatz gilt für Mensch <strong>und</strong> Tier. In der Veterinärmedizin ist<br />
man zudem häufig mit Krankheitserregern konfrontiert, die sich<br />
rasant ausbreiten. Um die Ausbreitung zu verhindern, ist neben<br />
der Tierseuchenbekämpfung vor Ort eine schnelle <strong>und</strong> präzise<br />
Labordiagnostik Voraussetzung. Im Falle der Tierseuchenerreger<br />
handelt es sich oftmals um Viren. Bei der Diagnostik der Viren<br />
werden zwei Wege beschritten: In der Serologie werden erregerspezifische<br />
Antikörper nachgewiesen, die nach einer Infektion des<br />
Tieres im Verlauf der Immunantwort gebildet werden. Hierbei<br />
han delt es sich um einen indirekten Erregernachweis. Beim di rekten<br />
Erregernachweis ist die klassische Methode die Vermehrung<br />
der Viren in Zellkulturen. Diese Methode besitzt zwar eine hohe<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Sensitivität, benötigt jedoch viel Zeit <strong>und</strong> ist für die Untersu chung<br />
großer Probenmengen nur begrenzt einsetzbar. Andere Metho -<br />
den beruhen auf dem Nachweis von bestimmten Strukturen des<br />
Erregers. Durch diese so genannten Antigennachweise werden<br />
aber geringe Mengen des Erregers oft nicht erkannt. Zudem sind<br />
sie manchmal auch ungenau.<br />
Seit einigen Jahren wird daher insbesondere zur Diagnostik vi -<br />
raler Krankheitserreger immer öfter eine molekularbiologische<br />
Methode – die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) – eingesetzt.<br />
Mit der PCR können definierte Abschnitte der Erbsubstanz ei nes<br />
Krankheitserregers vervielfältigt werden. Diese Methode ist erregerspezifisch,<br />
weist eine sehr hohe Nachweisempfindlichkeit auf,<br />
ist vergleichsweise schnell durchführbar <strong>und</strong> lässt sich zudem automatisieren.<br />
Die schnelle Durchführung <strong>und</strong> Automation führen<br />
auch zur Reduktion der Kosten. In Kombination mit weiteren<br />
Techniken wie beispielsweise dem Einsatz von DNA-Sonden oder<br />
der Sequenzierung von Nukleinsäuren, also der Bestimmung von<br />
Abschnitten des Erbgutes der Krankheitserreger, kann diese Methode<br />
noch ergänzt <strong>und</strong> verbessert werden. Daher gewinnt sie<br />
gerade in der Tierseuchendiagnostik zunehmend an Bedeutung<br />
<strong>und</strong> wird oft zusätzlich zu den anderen Nachweismethoden eingesetzt.<br />
Im Falle des KHV besteht die besondere Situation, dass das Vi rus<br />
häufig in der Zellkultur nur schlecht oder gar nicht angezüchtet<br />
werden kann <strong>und</strong> andere Nachweismethoden nicht ausreichend<br />
validiert sind. Die PCR ist daher zum Erregernachweis die Me thode<br />
der Wahl. Im VI Hannover des LAVES wird in Zusammen ar -<br />
beit mit der Abteilung Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hoch -<br />
schule Hannover im Rahmen eines Forschungsprojektes intensiv<br />
an einer weiteren Optimierung der KHV-PCR gearbeitet.<br />
PD Dr. Runge, M. (VI H); Kleingeld, D. W. (Dez. 32)<br />
103
104<br />
Vektoren-Tierseuchen auf dem Vormarsch? Ausbrüche von Infektiöser Anämie der Einhufer in<br />
Deutschland<br />
In den vergangenen Jahren kam es sporadisch zu Einzelaus brüchen<br />
dieser Tierseuche. Blutsaugende Insekten sind als so genannte<br />
Vektoren maßgeblich an der Übertragung der Infektiösen Anä -<br />
mie beteiligt. Das milde Klima der vergangenen Winter trug zum<br />
längeren Über leben der Insekten bei, <strong>und</strong> der Anstieg der ge meldeten<br />
Fälle 2006 ließ zunächst eine Verschärfung der Seuchen -<br />
si tuation, die glück licherweise so jedoch nicht eintrat, befürchten.<br />
Bei der Infektiösen Anämie der Einhufer (EIA) handelt es sich um<br />
eine akut bis chronisch zum Teil unscheinbar verlaufende Virus -<br />
erkrankung der Pferde, Ponys, Esel, Maultiere <strong>und</strong> Maulesel. Die<br />
Krankheit ist weltweit verbreitet <strong>und</strong> tritt regional gehäuft in Nord<strong>und</strong><br />
Südamerika, Afrika, Asien, Australien, Süd- <strong>und</strong> Osteuropa<br />
auf. In Nord- <strong>und</strong> Mitteleuropa kommt sie nur sporadisch vor. Das<br />
Virus ist in Deutschland nicht heimisch, es treten aber im mer wieder<br />
vereinzelt EIA-Ausbrüche auf Gr<strong>und</strong> der Einfuhr von infizierten<br />
Pferden aus Seuchengebieten auf.<br />
Die EIA ist eine gemäß dem Tierseuchengesetz anzeigepflichtige<br />
Tierseuche <strong>und</strong> wird durch ein Lentivirus der Familie der Retro viri<br />
dae hervorgerufen. Dieses Virus ist zwar mit dem menschlichen<br />
AIDS-Erreger HIV1 entfernt verwandt, aber für den Menschen ungefährlich.<br />
Als Besonderheit des EIA-Virus ist die nicht konstante<br />
Erregerstruktur zu nennen. Diese Eigenschaft, die beispielsweise<br />
auch bei Grippeviren bekannt ist <strong>und</strong> als »antigenic drift« bezeich-<br />
Tabelle <strong>3.</strong>21: Neuausbrüche 1993 bis 2007<br />
Jahr Anzahl<br />
1993<br />
1998<br />
1999<br />
2002<br />
2006<br />
2007<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
7<br />
2<br />
net wird, führt dazu, dass das infizierte Tier den Erreger durch Antikörper<br />
nicht zerstören kann, da immer neue Varianten des Vi rus<br />
entstehen. Hieraus resultieren die typischen Krankheitsschübe <strong>und</strong><br />
die Tatsache, dass ein infiziertes Tier lebenslang Antikörper- <strong>und</strong><br />
Virusträger ist.<br />
Die klinisch chronische bzw. klassische Verlaufsform zeichnet sich<br />
durch immer wiederkehrende Fieber- <strong>und</strong> Krankheitsschübe aus.<br />
Blutungen sind in den untersten Schichten der Schleimhäute zu<br />
beobachten. Die Tiere zeigen Konditionsverlust, Abgeschlagen -<br />
heit, Appetitlosigkeit <strong>und</strong> Abmagerung. Durch die Infektion wird<br />
eine Blutarmut (Anämie) hervorgerufen, die für die Erkrankung<br />
namensgebend war. Die Blutarmut ist auf die Zerstörung der<br />
roten Blutkörperchen zurückzuführen. Die antiviralen Antikör per<br />
bilden mit Bestandteilen der Virusoberfläche, die sich an die ro ten<br />
Blutkörperchen geb<strong>und</strong>en haben, einen Virus-Antikörper-Kom -<br />
plex. Hierdurch wird die körpereigene Infektionsabwehr aktiviert,<br />
die die roten Blutkörperchen auflöst. Die Krankheit endet meist<br />
tödlich.<br />
Die Übertragung des Erregers erfolgt unter natürlichen Bedin -<br />
gungen durch blutsaugende Insekten. Hierzu zählen Bremsen<br />
<strong>und</strong> Wadenstecher. Das Virus ist an den M<strong>und</strong>werkzeugen dieser<br />
Arthropoden 30 Minuten infektiös. Infizierte Tiere stellen das<br />
Virusreservoir dar. Entsprechend den Schwärmperioden der Blut -<br />
sauger ist eine Häufung der Krankheitsfälle im Spätsommer <strong>und</strong><br />
Herbst zu beobachten.<br />
Labordiagnostische Untersuchungen auf EIA werden im Veteri när -<br />
institut Hannover in landesweiter Zuständigkeit durch geführt. Dort<br />
wird in der Diagnostik neben dem ELISA-Test vor allem der zu gelassene,<br />
internationale Goldstandard, der Agargel präzipitations-<br />
(Immunodiffusions-)Test, der Coggins-Test, angewandt.<br />
Dr. Nagel-Kohl, U.; Dr. Probst, D.; Dr. Keller, B. (VI H)
Die Welt zu Gast in Oldenburg – ein internationaler Geflügelpest-Workshop<br />
Im Mai 2007 haben sich 60 Geflügelpestspezialisten aus den Ländern<br />
Ägypten, Kambodscha, Laos, Marokko, Myanmar, Nigeria,<br />
Rumänien <strong>und</strong> der Türkei am Veterinärinstitut Oldenburg zu ei -<br />
nem Geflügelpest-Workshop getroffen. Der Workshop fand an<br />
drei verschiedenen Terminen über jeweils drei Tage statt <strong>und</strong> wur -<br />
de im Rahmen des Programms »Better Training for safer food«<br />
der Europäischen Union durchgeführt. Ziel der Veranstaltung <strong>und</strong><br />
des Programms war es, die Bekämpfung der Hochpathogen Aviären<br />
Influenza (HAI) zu verbessern <strong>und</strong> unter den Ländern abzustimmen.<br />
Schwerpunkt der Trainingsveranstaltung am Veterinärinstitut Ol -<br />
denburg waren vor allem die labordiagnostischen Verfahren. In<br />
Kleingruppen wurden in Theorie <strong>und</strong> Praxis die Pathologie, die<br />
serologische Diagnostik, die molekularbiologischen Nachweis verfahren<br />
<strong>und</strong> die klassische Virologie der HAI behandelt.<br />
Neben dem offiziellen Programm kam es in zahlreichen Gesprä -<br />
chen <strong>und</strong> Diskussionen zu einem regen Gedankenaustausch. Da -<br />
bei wurde deutlich, dass sowohl die Bedeutung als auch der Stellenwert<br />
der HAI in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich<br />
ist. Ebenso wurde deutlich, dass die technischen <strong>und</strong> finanziellen<br />
Voraussetzungen für die Bekämpfung der HAI in den einzelnen<br />
Teil nehmerländern sehr verschieden sind. Diese Punkte er schweren<br />
in ei nigen Ländern ein einheitliches <strong>und</strong> gemeinsames Vor -<br />
gehen im Kampf gegen die Geflügelpest.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
An dem Geflügelpest-Workshop im Veterinärinstitut Oldenburg ha ben<br />
60 Geflügelpestspezialisten aus diversen Ländern teilgenommen<br />
Insgesamt hat der Workshop die internationale Geflügelpest be -<br />
kämpfung ein gutes Stück nach vorne gebracht <strong>und</strong> die kontinentübergreifende<br />
Zusammenarbeit verbessert.<br />
Dr. Moss, A. (VI OL)<br />
105
106<br />
Die Entwicklung der Fischbestände in der Oberweser vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Belastungen mit<br />
Kaliendlaugen<br />
In den 70er <strong>und</strong> 80er Jahren wurden in <strong>Niedersachsen</strong> im Zu sammenhang<br />
mit den Beweissicherungsverfahren der Kernkraft werke<br />
Würgassen <strong>und</strong> Grohnde an der Oberweser fischereiliche Untersuchungen<br />
durchgeführt. Es handelte sich dabei hauptsächlich<br />
um Elektrobefischungen <strong>und</strong> begleitende Untersuchungen an den<br />
gefangenen Fischen. Von 1993 bis 1997 wurden die Unter su chungen<br />
in ähnlichem Umfang im Rahmen eines Forschungs- <strong>und</strong> Ent -<br />
wicklungsvorhabens zur Salzbelastung von Werra <strong>und</strong> Weser fortgesetzt<br />
<strong>und</strong> auf Werra <strong>und</strong> Mittelweser ausgedehnt. Seit 1998<br />
führt das Land <strong>Niedersachsen</strong> als Folgeuntersuchung dieses Projektes<br />
jährliche Elektrobefischungen der Oberweser <strong>und</strong> der un -<br />
teren (niedersächsischen) Werra durch. Dabei sollen weiterhin die<br />
Auswirkungen der Belastung mit Kaliendlaugen auf die Entwicklung<br />
der Fischbestände erfasst werden.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>15: Jahresmittel der Chloridgehalte der Werra bei der<br />
Messstelle Gerstungen aus den Jahren 1980 bis 2006<br />
In Abbildung <strong>3.</strong>15 sind die mittleren jährlichen Belastungen mit<br />
Kaliendlaugen <strong>und</strong> die dazugehörigen Extrema bei Gerstungen<br />
seit 1980 als Chloridkonzentrationen (berechnet aus Tageswer -<br />
ten) dargestellt. Demnach waren die hohen Belastungen der 80er<br />
Jahre (Ø r<strong>und</strong> 8.800 mg/l) mit großen Schwankungen verb<strong>und</strong>en.<br />
Seit Anfang der 90er Jahre lagen deutlich reduzierte Einleitun gen<br />
vor (Ø r<strong>und</strong> <strong>3.</strong>000 mg/l), die aber weiterhin mit hohen Schwan -<br />
kun gen behaftet waren. Seit 2000 findet durch eine an die Was -<br />
ser führung angepasste Einleitung eine weitere Reduzierung der<br />
Ka liendlaugeneinleitung statt (Ø r<strong>und</strong> 2.000 mg/l) mit einer we -<br />
sent lichen Verringerung der Schwankungsbreite.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>16: Erkrankungsmerkmale von Fischen der Oberweser
Entsprechend den zunehmenden Verbesserungen hinsichtlich der<br />
Kaliendlaugenbelastung der drei charakterisierten Belastungs zei -<br />
träume wurden bei den Fischbeständen von Werra <strong>und</strong> Ober we -<br />
ser folgende Entwicklungen festgestellt:<br />
Zunahme von Ab<strong>und</strong>anz <strong>und</strong> Biomasse (Anzahl Fische bzw.<br />
Fischgewicht im Elektrofang auf definierter Uferstrecke)<br />
Zunahme der Fischartenzahl in der unteren Werra von 12 Ar -<br />
ten (1997/98) auf 25 Arten (1999-2007), in der Oberweser von<br />
24 Arten (1993-99) auf 33 Arten (2000-2007)<br />
Zunahme des Jungfischanteils führt zur Verbesserung der Al -<br />
tersstruktur bei den meisten Arten<br />
positive Bestandsentwicklung einiger empfindlicher Arten (Barbe,<br />
Mühlkoppe, Gründling, Aland)<br />
Verschlechterung des Ernährungszustandes von «sehr gut er -<br />
nährt« auf «durchschnittlich ernährt«; – zurückzuführen auf<br />
Abnahme der Häufigkeit des salzangepassten Hauptfisch nährtieres<br />
Tigerflohkrebs (Gammarus tigrinus)<br />
Rückgang der Erkrankungsrate <strong>und</strong> Veränderung der Häufig -<br />
keiten der erfassten Krankheitsmerkmale. Die für höhere Ka -<br />
liendlaugenkonzentrationen typische «nekrotische Verän de -<br />
rung« nimmt mit Verringerung der Salzkonzentration <strong>und</strong> deren<br />
Schwankungsbreite in ihrer Häufigkeit ab, z. T. zu Guns -<br />
ten des weniger gravierenden Merkmals «Flossenschädigung«.<br />
In Abbildung <strong>3.</strong>16 ist für den Oberweserbereich der Rückgang<br />
der Gesamtzahl der erfassten Krankheitsmerkmale <strong>und</strong> die Häu -<br />
fig keitsentwicklung der Merkmale «nekrotische Veränderung«<br />
(Nekrose) <strong>und</strong>«Flossenschädigung« (Flossen) in den unterschiedlichen<br />
Belastungszeiträumen mit Kaliendlaugen dargestellt.<br />
Das Bild oben rechts zeigt eine stark geschädigte Plötze mit<br />
lateraler Nekrose.<br />
Es ist geplant, die Untersuchungen zur Fischbestands entwick lung<br />
in Werra <strong>und</strong> Oberweser im Jahr 2008 <strong>und</strong> in den Folge jahren<br />
fortzusetzen.<br />
Matthes, U. (Dez. 34)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Laterale Schädigung einer Plötze (Rutilus rutilus)<br />
107
108<br />
B<strong>und</strong>esweites Bienenmonitoring liefert Erkenntnisse zu den Ursachen von Bienenvölkerverlusten<br />
Ziel des 2004 gestarteten Bienenmonitoring-Projektes ist es, Ur -<br />
sa chenforschung im Hinblick auf das immer wieder zu beobachtende<br />
Bienensterben zu betreiben <strong>und</strong> gesicherte Erkenntnisse<br />
über die auslösenden Faktoren zu sammeln. Die Anzahl der am<br />
b<strong>und</strong>esweit durchgeführten Bienenmonitoring beteiligten Imkerbetriebe<br />
hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 120 kaum verän -<br />
dert. Erhoben werden Daten zu den Standorten, der Überwin terung<br />
sowie Entwicklung der Bienenvölker. Bienenproben werden<br />
auf Krankheitskeime <strong>und</strong> Parasiten untersucht. Unter su chun gen<br />
von Honig- <strong>und</strong> Pollenproben liefern Daten über das Nah rungs -<br />
angebot sowie mögliche Rückstände von Pflanzenschutz mitteln.<br />
Die Winterverluste 2006/2007 auf der Basis von über 7.000 von<br />
den Monitoring-Imkern bewirtschafteten Bienenvölkern waren<br />
mit 8,9% etwas niedriger als im Vorjahr. Die darüber hinaus in<br />
Umfragen ermittelten durchschnittlichen Auswinterungsverluste<br />
lagen bei ca. 14%. Der warme Winter 2006/2007 <strong>und</strong> ein au -<br />
ßergewöhnlich früher Saisonbeginn haben die Überwinterung<br />
positiv beeinflusst. Der Saisonverlauf <strong>und</strong> die Honigerträge wurden<br />
allgemein als zufrieden stellend bis gut beschrieben. Bei den<br />
Untersuchungen auf Bienenkrankheiten blieb der Anteil positiver<br />
Proben für Bienenviren (ABPV, DWV, SBV) <strong>und</strong> Nosema weitgehend<br />
unverändert, allerdings gab es regionale Verschiebungen<br />
für das Vorkommen bestimmter Erreger. Virus- <strong>und</strong> Nosemaer -<br />
krankungen sowie insbesondere erhöhter Varroabefall hatten<br />
negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Bienenvölker<br />
während des Winters 2006/2007. Der starke Befall mit Varroa -<br />
milben war 2007 deutlich höher als in den Vorjahren. Das Insti -<br />
tut für Bienenk<strong>und</strong>e Celle hat bereits im Sommer auf diese be -<br />
drohliche Situation hingewiesen. Trotz allem muss nach ersten<br />
Umfragen im kommenden Winter mit erhöhten Verlusten an Bienenvölkern<br />
gerechnet werden. Basierend auf den Daten aus dem<br />
deutschlandweiten Bienenmonitoring sowie anderen langjährigen<br />
Untersuchungen wird seitens der Bieneninstitute mit Verlusten<br />
von etwa 25 bis 30% gerechnet.<br />
Dr. von der Ohe, W. (IB CE); Dr. Rosenkranz, P. (Universität Hohenheim)
Zoonosen<br />
Einleitung zu Bekämpfungsstrategien<br />
Die Bekämpfung von Zoonosen <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en der Schutz<br />
des Verbrauchers vor besonderen Gefahren ist ein wichtiges Ziel<br />
in der Europäischen Gemeinschaft.<br />
Zoonosen sind Infektionskrankheiten bzw. deren auslösende Er -<br />
reger, die direkt oder indirekt zwischen Tieren <strong>und</strong> Menschen übertragen<br />
werden können. Eine Übertragung erfolgt entweder di -<br />
rekt durch infizierte Tiere oder über Lebensmittel.<br />
Nach Statistiken des Robert-Koch-Institutes aus dem Jahr 2007<br />
über meldepflichtige Infektionskrankheiten ist bei Salmonellen,<br />
sehr bedeutsamen <strong>und</strong> den vielleicht bekanntesten Zoono seer -<br />
regern, mit 55.155 Erkrankungsausbrüchen wieder ein leichter<br />
Anstieg gegenüber 2006 zu verzeichnen. Allerdings lag die An -<br />
zahl gemeldeter Ausbrüche bei Norovirusinfektionen mit 198.992,<br />
Rotavirusinfektion mit 59.165 <strong>und</strong> Campylobacter-Enteritis-Infektionen<br />
mit 65.785 noch darüber, wobei vor allem bei Norovi rusinfektionen<br />
eine bedeutsame Zunahme um 75.639 gegenüber<br />
2006 zu sehen war. Trotz einiger bekannt gewordener überregionaler<br />
Ausbrüche mit weniger bekannten Salmonellentypen,<br />
hier S. Panama, ist S. Enteritidis (Roheispeisen) nach wie vor der<br />
beim Menschen dominierende Serotyp gefolgt von S. Typhi murium<br />
(schweinefleischassoziiert). So kann man nach einem Rück -<br />
gang der Salmonelleninfektionen in den früheren Jahren offensichtlich<br />
eine Stagnation auf hohem Niveau erkennen. Trotz deutlicher<br />
Zunahme anderer Darmerkrankungen (Norovirus, Cam pylobacter,<br />
Rotavirus) geht von Salmonellen nach wie vor ein ho hes<br />
Risiko aus. Salmonellen haben zudem ein besonderes zoonotisches<br />
Potential, da sie relativ widerstandsfähig gegenüber Bekämp fungs -<br />
maßnahmen sind <strong>und</strong> sich auch in unserer Umwelt vermehren<br />
können.<br />
Ein Abbau von Handelshemmnissen sowie ein umfangreicher Handelsverkehr<br />
der Waren tragen auch zu einer schnellen Verbrei -<br />
tung von Gefahren wie den Zoonosen bei. Einzelne bedeutsame<br />
Zoonosen wie z. B. die Brucellose konnten durch wirkungsvolle<br />
Bekämpfungsmaßnahmen in vielen Staaten bereits deutlich zu -<br />
rückgedrängt werden. Andere Zoonosen wie z. B. Salmonellen<strong>und</strong><br />
Campylobacter-Infektionen sind auch häufig mit latenten<br />
Erkrankungsverläufen – also ohne sichtbare Krankheitszeichen<br />
– verb<strong>und</strong>en. Diese Erreger können über die Produktionskette<br />
von Lebensmitteln zum Verbraucher gelangen. Da bei den ge -<br />
nannten Erregern ein vollständiges Auslöschen fraglich ist, sind<br />
die Bekämpfungsmaßnahmen auf die Reduktion des Erregers<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Umsetzung der Zoonosenverordnung <strong>und</strong> Zoonosenbekämpfung in der Primärproduktion zur Ver -<br />
besserung des ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>Verbraucherschutz</strong>es<br />
ausgerichtet, um das Risiko der Übertragung <strong>und</strong> Entstehung von<br />
Infektionskrankheiten zu verringern. Ziele zur Reduktion der Sal -<br />
monellenbelastung sind in entsprechenden Richtlinien <strong>und</strong> EG-<br />
Verordnungen benannt <strong>und</strong> werden durch nationale Ausfüh rungsbestimmungen<br />
(hier vor allem Änderung der Hühner-Salmo nel -<br />
len-Verordnung (Bgbl I 2001 Nr. 16, S. 543 vom 20. April 2001)<br />
entsprechend der jeweiligen Situation in den einzelnen Ländern<br />
angepasst. So muss in Kenntnis der jetzigen Infektionsrate die<br />
Salmonellenbelastung in Legehennenherden innerhalb von zwei<br />
Jahren durch nationale Überwachungsprogramme pauschal um<br />
30% auf maximal 17% gesenkt werden. Die derzeitige Bekämp -<br />
fung ist insbesondere auf S. Enteritidis <strong>und</strong> S. Typhimurium ausgerichtet,<br />
kann aber auch auf andere Serotypen ausgeweitet werden,<br />
wenn eine besondere ges<strong>und</strong>heitliche Relevanz für den Menschen<br />
angenommen wird. EG-Verordnungen betreffen aber nicht<br />
nur die Primärproduktion, die sogenannte grüne Seite. Die bei<br />
der Lebensmittelgewinnung <strong>und</strong> Verarbeitung des Fleisches geltende<br />
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Krite<br />
rien für die Lebensmittelproduktion setzt Grenzen bei der Belastung<br />
von Lebensmitteln auch mit Zoonoseerregern. Mit der<br />
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 werden die mikrobiologischen Krite<br />
rien für bestimmte Mikroorganismen sowie die Durchfüh rungsbestimmungen<br />
festgelegt, die von den Lebensmittel unterneh mern<br />
bei der Durchführung allgemeiner <strong>und</strong> spezifischer Hygiene maßnahmen<br />
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 einzuhalten<br />
sind. Die zuständige Behörde überprüft die Einhaltung<br />
der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Bestim mun gen<br />
<strong>und</strong> Kriterien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004, unbeschadet<br />
ihres Rechts, weitere Probenahmen <strong>und</strong> Untersuchun gen<br />
im Rahmen von Prozesskontrollen in Fällen, in denen der Ver dacht<br />
besteht, dass Lebensmittel nicht unbedenklich sind, oder im Zu -<br />
sammenhang mit einer Risikoanalyse durchzuführen, um andere<br />
Mikroorganismen, deren Toxine oder Metaboliten nachzuweisen<br />
<strong>und</strong> zu messen. Allerdings sind einige wichtige Erreger (Cam -<br />
py lo bacter, Viren) wegen fehlender Standards noch nicht berück -<br />
sichtigt.<br />
109
110<br />
Die Bekämpfung einzelner Salmonellen-Typen hat wahrscheinlich<br />
auch parallele Effekte auf das Auftreten anderer Serovare bzw.<br />
Erreger. Durch Verringerung der Salmonellenbelastung insgesamt<br />
kann eine Reduzierung des Risikos von Salmonellenausbrüchen<br />
erreicht werden.<br />
Das EU-Monitoring belegt, dass Deutschland mit einer vergleichsweise<br />
hohen Salmonellenbelastung der Betriebe im EG-weiten<br />
Vergleich einen mittleren Platz einnimmt. Die geringe Salmo nel -<br />
lennachweisrate in skandinavischen Ländern <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
dort zeigen, dass durch intensive Bekämpfungsmaßnahmen Verbesserungen<br />
erreicht werden können.<br />
Im Jahr 2007 startete das Bekämpfungsprogramm im Zucht ge -<br />
flügelbereich, wo die Ausgangssituation durch niedrige Salmo -<br />
nelleninfektionsraten günstig war. Eine Senkung der Prävalenz<br />
soll neben der Verbesserung der Betriebshygiene kontinuierlich<br />
durch Impfung von Jungtieren <strong>und</strong> Schlachtung oder Tötung in -<br />
fizierter Herden erreicht werden. Das Bekämpfungsprogramm<br />
für Legehennen startet 2008 nach dem gleichen Prinzip. Diese<br />
Maßnahmen sowie eingeschränkte Vermarktungs möglich kei ten<br />
von Eiern <strong>und</strong> Tieren aus infizierten Betrieben üben vermehrt<br />
Druck auf die Erzeuger aus. Ein Einsatz von Antibiotika bei der<br />
Salmonellenbekämpfung ist bis auf wenige Ausnahmen stark eingeschränkt<br />
(erkrankte Tiere, wertvolle Zuchtbestände, Einsatz amtlich<br />
überwacht). Bekämpfungsprogramme gegen Salmonellen<br />
bei Masthähnchen, Puten <strong>und</strong> Mastschweinen werden folgen.<br />
Niedrige Nachweisraten von Salmonellen in Zuchtgeflügel beständen<br />
in den letzten Jahren bestätigen, dass durch konsequente<br />
Umsetzung seit langem bekannter Vorgaben zur Betriebshy gie -<br />
ne <strong>und</strong> Einsatz von Impfstoffen trotz nicht immer vermeidbarer<br />
Erregerkontakte eine Infektion <strong>und</strong> Ausbreitung von Salmonel -<br />
len im Bestand verhindert werden kann.<br />
Für den Zuchtbetrieb ergeben sich nach einem Salmonellennachweis<br />
dramatische Folgen. Durch Tötung ganzer Herden ist die<br />
Zucht basis bedroht. Lieferausfälle <strong>und</strong> eingeschränkte Möglich -<br />
keiten der Verwertung bzw. Schlachtung von Tieren aus infekti -<br />
onsverdächtigen Herden stellen für den Betrieb weitere folgenreiche<br />
Einschränkungen dar, so dass insgesamt erhebliche Betriebsver<br />
luste entstehen.<br />
Durch gesetzlich vorgeschriebene, regelmäßige Untersuchun gen<br />
(Eigenkontrollen, amtliche Kontrolluntersuchungen, Monitoring)<br />
nach standardisierten Untersuchungsbedingungen wird der Fort -<br />
schritt bei der Senkung der Salmonellenbelastung in den Tierbe -<br />
ständen überwacht <strong>und</strong> der Erfolg der Maßnahmen dokumentiert.<br />
Salmonellen-Belastung bei Puten <strong>und</strong> Schlachtschweinen<br />
– Erkenntnisse eines EU-weiten Salmonellenmonitorings<br />
2006 <strong>und</strong> 2007 wurden EU-weit Untersuchungen zur Salmo nellen<br />
belastung bei Puten <strong>und</strong> Schlachtschweinen durchgeführt <strong>und</strong><br />
abgeschlossen. Die niedersächsischen Ergebnisse des EU-Sal mo -<br />
nellen-Monitorings 2006/2007 sind in Tabelle <strong>3.</strong>22 <strong>und</strong> <strong>3.</strong>23 zu -<br />
sammengefasst dargestellt.<br />
Tabelle <strong>3.</strong>22: EU-Salmonellenmonitoring 2006 <strong>und</strong> 2007,<br />
Salmonellennachweise bei Puten <strong>und</strong> Schlachtschweinen<br />
in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Proben<br />
Salmonellen<br />
positiv<br />
Betriebe<br />
Salmonellen<br />
positiv<br />
Erregernachweis Antikörpernachweis<br />
Puten Schweine Schweine<br />
n % n % n %<br />
720<br />
776<br />
532<br />
61<br />
144<br />
20<br />
8,5<br />
13,9<br />
162<br />
20,9<br />
117<br />
33,3
Tabelle <strong>3.</strong>23: Nachgewiesene Salmonellentypen bei Puten<br />
<strong>und</strong> Schweinen in <strong>Niedersachsen</strong> im Rahmen des EU-Mo -<br />
ni toring 2006 <strong>und</strong> 2007<br />
Salmonellen-Typen bei Puten bei Schweinen<br />
S. Typhimurium<br />
S. Enteritidis<br />
S. Gruppe B, monophasisch<br />
S. Paratyphi B<br />
S. 4,12:D:- (monophasisch)<br />
S. Agona<br />
S. Anatum<br />
S. Brandenburg<br />
S. Brenderup<br />
S. Derby<br />
S. Goldcoast<br />
S. Hadar<br />
S. Infantis<br />
S. Kottbus<br />
S. Livingstone<br />
S. London<br />
S. Saint-Paul<br />
S. Gr. I Rauhform<br />
Summe<br />
Sowohl bei Puten als auch bei Schweinen kann von einer deutlichen<br />
Salmonellenbelastung der Herden ausgegangen werden<br />
(Puten mit 8,5% <strong>und</strong> Schlachtschweine mit 20,9% Nachwei sen).<br />
Untersuchungen der Puten-Zuchtherden in <strong>Niedersachsen</strong> (An -<br />
zahl untersuchter Herden, n = 10) wie auch b<strong>und</strong>esweit (n = 98)<br />
ergaben keine Salmonellennachweise. Die niedersächsischen Un -<br />
tersuchungsergebnisse decken sich im Wesentlichen mit den bun -<br />
desweiten Erkenntnissen. Hier waren 10,5% der Mastherden (n<br />
= 295) <strong>und</strong> 7,3% der Proben (Anzahl untersuchter Proben, n =<br />
1.475) positiv. Die Häufigkeitsverteilung der isolierten Salmo nel -<br />
len-Serovare entspricht ebenfalls dem in <strong>Niedersachsen</strong> festgestellten<br />
Verteilungsmuster.<br />
12<br />
2<br />
7<br />
1<br />
10<br />
7<br />
5<br />
1<br />
12<br />
4<br />
61<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
84<br />
1<br />
40<br />
1<br />
1<br />
4<br />
1<br />
16<br />
1<br />
1<br />
1<br />
10<br />
162<br />
Der Anteil von 33,2% positiver Proben mit Nachweis von Anti -<br />
körpern an geschlachteten Schweinen bestätigt, dass ein hoher<br />
Anteil der Tiere Kontakt mit Salmonellen hatte <strong>und</strong> nach überstandener<br />
Infektion Antikörper gebildet hat. B<strong>und</strong>esweit lag dieser<br />
Anteil bei 27,7% (n = 2.400). Nach vormals freiwilligem Salmonellenmonitoring,<br />
durchgeführt im Rahmen eines sogenannten<br />
QS-Programms zur Qualitätssicherung der Schweinefleisch erz<br />
eugung, besteht nun durch eine neue Schweine-Salmonellen-<br />
Verordnung für den Tierhalter die Verpflichtung zur Ermittlung<br />
des Salmonellenstatus seines Bestandes. Bei deutlicher Belas tung<br />
mit Salmonellen (Einstufung als sog. Kategorie-III-Betrieb) müssen<br />
nun Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen werden.<br />
Neben bereits in früheren Jahren ebenfalls festgestellten deutlichen<br />
Salmonellenbelastungen in legehennenhaltenden <strong>und</strong> in<br />
Broiler-Betrieben zeigen die Ergebnisse aber auch, dass es deutliche<br />
tier artbezogene Unterschiede der Verteilung von Salmo nellentypen<br />
gibt. Während Salmonella Typhimurium <strong>und</strong> eine mo nophasische<br />
Variante von Gruppe-B-Salmonellen bei Schlacht schwei -<br />
nen do minieren, gibt es bei den Puten eine breitere Verteilung<br />
verschie dener Typen mit Häufungen von S. Saintpaul, S. Agona,<br />
S. Hadar <strong>und</strong> S. Infantis (siehe Tabelle <strong>3.</strong>23). Dieses ist bei der der<br />
Be kämp fung zu berücksichtigen (Impfungen).<br />
Das EU-Salmonellenmonitoring bei Legehennen ergab einen dominierenden<br />
Anteil von über 80% an S.-Enteritidis-Isolaten, bei<br />
den Broilern hingegen ein breit gefächertes Bild mit den häufigsten<br />
Typen S. Paratyphi B (19,5%) <strong>und</strong> S. 4,12:D:- (monophasisch)<br />
(18,8%).<br />
Dr. Klarmann, D.; Dr. Schleuter G.; Dr. Schöttker-Wegner, H.-H. (VI OL);<br />
Dr. Kurlbaum, S. (Dez. 31)<br />
111
112<br />
Resistenzprüfungen im Mikrodilutionsverfahren – Ergebnisse <strong>und</strong> Resistenzentwicklung 2007<br />
Neben dem Hinweis für Therapieempfehlungen ist die Ermit tlung<br />
der Resistenzlage von bedeutsamen Zoonose- <strong>und</strong> anderen In fektionserregern<br />
mittlerweile auch aus Gründen des Verbraucher -<br />
schutzes von besonderem Interesse. Verschiedene Infektions er reger<br />
können genetisch fixierte Resistenzeigenschaften austauschen<br />
<strong>und</strong> den Einsatz neu entwickelter Antibiotika bei der Bekämp fung<br />
von Infektionskrankheiten von Mensch <strong>und</strong> Tier unwirksam machen.<br />
Eine fortwährende Dokumentation der generellen Resis tenzen<br />
wird nach der EG-Zoonoserichtlinie (2003/99/EG vom 17. November<br />
2003) gefordert. Die Erfassung der Resistenzen in den<br />
Mitgliedsstaaten mittels standardisierter Technik soll das rechtzeitige<br />
Erkennen entsprechender Gefahren ermöglichen.<br />
Neuere Untersuchungstechniken wie der Mikrodilutionstest (MDT)<br />
zur Erfassung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) werden<br />
wegen besserer Standardisierbarkeit <strong>und</strong> Vergleichbarkeit der Resistenzdaten<br />
empfohlen. Umfangreiche Testkontrollen sind hierbei<br />
unbedingte Vorrausetzung. So wurden im Jahr 2007 von 843<br />
durchgeführten Resistenzprüfungen allein 113 Tests als ständige<br />
Versuchskontrollen mitgeführt <strong>und</strong> 174 Tests zur Bestätigung der<br />
Vergleichbarkeit von Ergebnissen in Ringversuchen durchgeführt.<br />
Damit konnte aber auch gezeigt werden, dass das derzeit nur in<br />
der Untersuchungsroutine des Veterinärinstitutes Oldenburg eingesetzte<br />
Untersuchungsverfahren den Anforderungen genügte.<br />
Im Folgenden aufgeführte Ergebnisse beziehen sich daher auch<br />
nur auf diese Auswertungen.<br />
Aus den Tabellen <strong>3.</strong>24 <strong>und</strong> <strong>3.</strong>25 ist ersichtlich, dass die Anzahl<br />
der in den Jahren 2005 bis 2007 durchgeführten Resistenz prü -<br />
fungen deutlich angestiegen ist.<br />
Ein erheblicher Anteil der Prüfungen wurde an Salmonellen durchgeführt,<br />
die im Rahmen des EU-Salmonellenmonitoring (Lege -<br />
hühner, Broiler <strong>und</strong> Pute) isoliert wurden <strong>und</strong> an im Rahmen von<br />
Schlachtung <strong>und</strong> Hygieneuntersuchungen isolierten Salmo nel len.<br />
Insgesamt wurde die Resistenz 2007 bei 421 Salmonellen geprüft.<br />
In Tabelle <strong>3.</strong>26 ist die Verteilung der MHK-Werte (µg/ml) aller Salmo<br />
nellenisolate bei den wichtigsten geprüften Antibio tikagrup -<br />
pen widergegeben. Der MHK-50-Wert gibt die Konzentration ei -<br />
nes Antibiotikums an, das 50% der isolierten Bakterienstämme<br />
hemmt, der MHK-90-Wert entsprechend die Konzentration, welche<br />
90% der Isolate im Wachstum hemmt. Mit * <strong>und</strong> ** ge kennzeichnet<br />
sind die Felder der Antibiotika, bei denen ein hoher Anteil<br />
der isolierten Salmonellenstämme (bis zu 50% bei MHK-50<br />
oder bis zu 10% bei MHK-90) nicht mehr in einem wirksamen<br />
MHK-Wertebereich liegt <strong>und</strong> damit als resistent gilt. Mit Mar -<br />
kie rungen (#) versehene Einträge in Tabelle <strong>3.</strong>26 weisen auf ab -<br />
wei chende Einstufungen zwischen DIN <strong>und</strong> CLSI bei der Resis -<br />
tenz be urteilung hin. Auch erschweren unterschiedliche Testkonzen<br />
trationen nach DIN <strong>und</strong> CLSI bei den Antibiotika kombina ti -<br />
onen Amoxycillin/Clavulansäure <strong>und</strong> Trimethoprim/Sulfonamid<br />
(Cotri moxazol) den Vergleich von Resistenzangaben.<br />
Von einer guten generellen Wirksamkeit ist nur bei wenigen Antibiotika<br />
auszugehen, deren MHK-90-Wert nicht als resistent eingestuft<br />
wird. Falls nur der MHK-50-Wert als sensibel eingeordnet<br />
wird, bedarf es in jedem Fall einer intensiven Prüfung vor Ein -<br />
satz. Des Weiteren ist der Einsatz gr<strong>und</strong>sätzlich von der Zulas -<br />
sungssituation eines Antibiotikums für die jeweilige Tierart <strong>und</strong>
Tabelle <strong>3.</strong>24: Anzahl Resistenzprüfungen 2005 bis 2007<br />
(Teil 1)<br />
Infektionserreger Salmonellen 2005<br />
Salmonella Adelaide<br />
Salmonella Agona<br />
Salmonella Anatum<br />
Salmonella Blockley<br />
Salmonella Bovismorbificans<br />
Salmonella Braenderup<br />
Salmonella Brandenburg<br />
Salmonella der Gruppe B 4,12:-:-<br />
Salmonella der Gruppe B 4,12:d:- monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe B 4,12:i:- monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe B 4,5:i:- monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe B 4,5,12:i:monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe C1 6,7:k:monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe C2 6,8:r:- monophasisch<br />
Salmonella der Gruppe E1 3,10:-:-<br />
Salmonella der Gruppe E1 3,10:-:1,6<br />
monophasisch<br />
Salmonella Derby<br />
Salmonella Dublin<br />
S. Enteritidis<br />
S. Gallinarum<br />
S. Goldcoast<br />
S. Gruppe B<br />
S. Gruppe C<br />
158<br />
26<br />
20<br />
2006<br />
10<br />
14<br />
3<br />
47<br />
10<br />
1<br />
2<br />
16<br />
37<br />
13<br />
3<br />
1<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
2007<br />
1<br />
1<br />
1<br />
3<br />
1<br />
4<br />
1<br />
6<br />
10<br />
10<br />
44<br />
2<br />
1<br />
21<br />
29<br />
64<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Tabelle <strong>3.</strong>24: Anzahl Resistenzprüfungen 2005 bis 2007<br />
(Teil 2)<br />
Infektionserreger Salmonellen 2005<br />
S. Gruppe D<br />
S. Gruppe D1<br />
S. Gruppe E<br />
Salmonella Hadar<br />
Salmonella Heidelberg<br />
Salmonella Indiana<br />
Salmonella Infantis<br />
Salmonella Kiambu<br />
Salmonella Kottbus<br />
Salmonella Lexington<br />
Salmonella Livingstone<br />
Salmonella London<br />
Salmonella Mbandaka<br />
Salmonella Montevideo<br />
Salmonella Ohio<br />
Salmonella Paratyphi B<br />
Salmonella Rissen<br />
Salmonella Saintpaul<br />
Salmonella Subspec. I Rauhform<br />
Salmonella Subspec. III b<br />
Salmonella Thompson<br />
Salmonella Typhimurium<br />
Salmonella Typhimurium var. cop.<br />
Salmonella Virchow<br />
S. species (andere Gruppen)<br />
Summe (Teil 1 <strong>und</strong> Teil 2)<br />
21<br />
6<br />
38<br />
15<br />
284<br />
2006<br />
1<br />
5<br />
4<br />
2<br />
8<br />
23<br />
4<br />
4<br />
6<br />
1<br />
10<br />
1<br />
26<br />
4<br />
7<br />
2<br />
63<br />
10<br />
6<br />
1<br />
345<br />
2007<br />
14<br />
3<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
15<br />
19<br />
2<br />
2<br />
87<br />
51<br />
1<br />
421<br />
113
114<br />
Indikation abhängig. Umwidmungen sind nur begrenzt möglich.<br />
Für Geflügelzuchtbestände besteht bei der Salmonellen bekämpfung<br />
ein Anwendungsverbot für Antibiotika bei der Sanierung<br />
(VO (EG) Nr. 1091/2005). Beim Geflügel ist zudem nur ein be grenztes<br />
Spektrum an Antibiotika zugelassen. Von den zugelassenen<br />
Antibiotika wäre lediglich beim Amoxicillin, Ampicillin, Chlorte -<br />
tracyclin, Danofloxacin, Difloxacin, Enrofloxacin, Oxytetracyclin,<br />
Tetracyclin <strong>und</strong> Trimethoprim-Sulfamethoxazol eine Wirksam keit<br />
gegenüber Salmonellen zu erwarten. Antibiotika wie z. B. Ben -<br />
zylpenicillin, Erythromycin, Lincomycin Spectinomycin in Kom bi -<br />
nation, Neomycin, Phenoxymethylpenicillin-Kalium, Spectino my cin,<br />
Sulfadimethoxin, Sulfadimidin, Sulfaquinoxalin, Tiamulin, Til mi cosin<br />
<strong>und</strong> Tylosin verfügen generell über keine oder nicht therapeutisch<br />
nutzbare Wirksamkeit gegenüber Salmonellen. Einige Wirk -<br />
stoffe dürfen bei Tieren nicht angewendet werden, deren Eier<br />
für den menschlichen Verzehr gewonnen werden, da kein MRL<br />
(Rückstandsgrenzwert oder Wartezeiten) für Eier existiert.<br />
Demzufolge ergibt sich aus Tabelle <strong>3.</strong>24 lediglich für Gyrase hemmer,<br />
hier stellvertretend Enrofloxacin getestet, eine gute Resis -<br />
tenzsituation. In Einzelfällen werden aber auch hier verminderte<br />
Empfindlichkeiten oder Resistenzen beobachtet (6% bzw. 2,15%).<br />
Festgestellt wurde dieses u. a. bei Salmonella Saint Paul, einem<br />
häufig bei Puten nachgewiesenen Salmonellentypen. Die Resis -<br />
tenzsituation bei Ampicillin, Tetracyclin, Florfenicol <strong>und</strong> der Tri me -<br />
thoprim-Sulfonamid-Kombination war insgesamt geprägt durch<br />
hohe Resistenzraten zwischen 48,6% <strong>und</strong> 53,6%.<br />
Auffallend hohe Resistenzraten wurden bei S. Saint Paul <strong>und</strong><br />
nicht näher zu typisierenden Rauhformen festgestellt, hier wa ren<br />
auch bemerkenswert hohe Resistenzraten gegenüber Gy rase hemmern<br />
zu erkennen. Bei Salmonella typhimurium <strong>und</strong> einzelnen<br />
Typen der Gruppe B (4,5,12:i:-, 4,12:i:-, 4,5:i:-) sind zudem Mehrfachresistenzen<br />
gegen Ampicillin, Tetracyclin, der Trimethoprim-<br />
Sulfonamid-Kombination <strong>und</strong> Florfenicol ausgeprägt mit einer<br />
Resistenzquote zwischen 68% <strong>und</strong> 100%. S. Enteritidis, häufiger<br />
Salmonellentyp beim Menschen <strong>und</strong> bei Legehühnern, zeig-<br />
Tabelle <strong>3.</strong>25: Anzahl Resistenzprüfungen 2005 bis 2007<br />
(Teil 1)<br />
Übrige Infektionserreger 2005<br />
Acinetobacter spec.<br />
Actinobacillus pleuropneumoniae<br />
Arcanobacterium pyogenes<br />
Bordetella bronchiseptica<br />
Burkholderia cepacia<br />
Clostridium perfringens<br />
Corynebacterium pseudotuberculosis<br />
Enterococcus faecalis<br />
Enterococcus species<br />
Enterobacter sakazakii<br />
Erysipelothrix rhusiopathiae<br />
E. coli<br />
Gallibacterium anatis<br />
Mannheimia haemolytica<br />
Mannheimia varigena<br />
Morganella morganii<br />
Pasteurella multocida<br />
Pasteurella species<br />
Proteus mirabilis<br />
Serratia plymuthica<br />
4<br />
1<br />
4<br />
27<br />
4<br />
6<br />
2006<br />
4<br />
1<br />
1<br />
39<br />
1<br />
4<br />
8<br />
1<br />
2<br />
2007<br />
1<br />
7<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
62<br />
1<br />
4<br />
1<br />
1<br />
10<br />
8<br />
1
Tabelle <strong>3.</strong>25: Anzahl Resistenzprüfungen 2005 bis 2007<br />
(Teil 2)<br />
Übrige Infektionserreger 2005<br />
Staphylococcus aureus<br />
Staphylococcus carnosus<br />
Staphylococcus equorum<br />
Staphylococcus haemolyticus<br />
Staphylococcus intermedius<br />
Staphylococcus xylosus<br />
Streptococcus bovis<br />
Streptococcus canis<br />
Streptococcus dysgalactiae ssp. dysgalactiae<br />
Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis<br />
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus<br />
Streptococcus Gruppe C<br />
Streptococcus Gruppe G<br />
Streptococcus species<br />
Streptococcus suis<br />
Streptococcus uberis<br />
Vibrio parahaemolyticus<br />
Yersinia pseudotuberculosis<br />
Summe (Teil 1 <strong>und</strong> Teil 2)<br />
13<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
118<br />
2006<br />
4<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
4<br />
1<br />
1<br />
76<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
2007<br />
5<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
5<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
3<br />
126<br />
te vereinzelt Resistenzen bei Ampicillin, Tetracyclin <strong>und</strong> Trime thoprim-Sulfonamid-Kombination.<br />
S. Dublin hingegen, ein häufig<br />
bei Rindern nachgewiesener Salmonellentyp, zeigte keine auffälligen<br />
Resistenzen.<br />
Besondere Aufmerksamkeit wird übertragbaren Resistenzeigen -<br />
schaften zuteil, weil sie bei Mikroorganismen genetisch verankert<br />
sind <strong>und</strong> auch zwischen einzelnen Bakterienarten übertragen<br />
werden können. Als Beispiel solcher in letzter Zeit häufiger<br />
diskutierter Gefahren sind bei grampositiven Staphylokokken häufigere<br />
Nachweise von MRSA <strong>und</strong> bei gramnegativen Entero bak -<br />
terien der Nachweis von ESBL.<br />
Definitionen<br />
ESBL (Extended Spectrum β-Lactamasen) tragende Bakterien, vor<br />
allem E. coli <strong>und</strong> Klebsiellen als gramnegative Enterobakterien,<br />
sind resistent gegen ein großes Spektrum der für die Therapie<br />
bedeutsamen Beta-Lactam-Antibiotika (Penicilline, Cephalo spo -<br />
rine (Generation 1–4), Monobactame). Durch eine Punktmu ta ti -<br />
on entstandene ESBL-Gene befinden sich auf Plasmiden, die von<br />
Bakterium zu Bakterium weitergegeben werden können. Die antibiotikainaktivierenden<br />
Enzyme vom Typ ESBL können durch zusätzliche<br />
Gabe von β-Lactamase-Inhibitoren wie Clavulansäure,<br />
Sulbactam oder Tazobactam gehemmt werden.<br />
115
116<br />
MRSA ist die Abkürzung für Methicillinresistenter Staphylo coccus<br />
aureus <strong>und</strong> bezeichnet Antibiotikaresistenz von Staphylococcus<br />
aureus-Stämmen gegen Methicillin, wie Penicillin ein Beta-Lac tam-<br />
Antibiotikum. Die nachgewiesene Resistenz umfasst alle Beta-Lac -<br />
tam-Antibiotika, einer großen <strong>und</strong> sehr wichtigen Gruppe der für<br />
die Therapie von Staphylokokkeninfektionen eingesetzten Anti -<br />
biotika. Die Resistenzeigenschaft ist auf einer innerhalb der Sta -<br />
phylokokken übertragbaren Genkassette lokalisiert. In letzter Zeit<br />
wurden häufiger Stämme mit gleichartigen Eigenschaften <strong>und</strong><br />
Mehrfachresistenzen, sogenannter Multiresistenz beispielsweise<br />
gegen Tetracycline, Aminoglykoside <strong>und</strong> Makrolide, bei Mensch<br />
<strong>und</strong> Tier nachgewiesen. Eine Übertragung des Erregers zwischen<br />
Mensch <strong>und</strong> Tier wurde in Einzelfällen nachgewiesen.<br />
So beginnen 2007 b<strong>und</strong>esweit mit niedersächsischer Beteiligung<br />
verschiedene Projekte zum Nachweis der Verbreitung von MRSA<br />
in Schweinebeständen <strong>und</strong> bei Schlachttieren, um die Verbreitung<br />
zu klären <strong>und</strong> ein mögliches Risiko der Übertra gung auf den Men -<br />
schen besser abschätzen zu können. Hierzu werden besondere<br />
Nachweisverfahren (Anreicherung mit Subkultur auf festen Se lektivnährböden,<br />
molekularbiologische Charakteri sie rung der Stäm -<br />
me) eingesetzt. Für die Routinediagnostik wurde der Nachweis<br />
dieser Resistenzmechanismen 2007 etabliert. Im Zusammen hang<br />
mit dem Nachweis von Infektionserregern bei Tieren (Staph. aureus<br />
<strong>und</strong> E. coli) konnten ESBL <strong>und</strong> MRSA bislang noch nicht<br />
nachgewiesen werden. Penicillinresistenz wur de bei 7 von 13<br />
geprüften Staph. aureus-Stämmen nachgewiesen. Ansonsten<br />
wurde bei sieben Arcanobacterium pyogenes keine <strong>und</strong> bei 16<br />
Streptokokkenstämmen lediglich in einem Fall eine Penicillin re -<br />
sistenz ermittelt. Problematischer ist die Situation bei Entero kokken-Stämmen,<br />
die aber 2007 lediglich im Zusammen hang mit<br />
Ringversuchen auf Resistenzeigenschaften hin geprüft wurden.<br />
Pasteurella- <strong>und</strong> Mannheimia-Stämme (n = 24) zeigten bei den<br />
ß-Laktam-Antibiotika Penicillin <strong>und</strong> Ampicillin, sowie bei Tilmi cosin<br />
Resistenzraten von 0% bis 30%, bei Cephalosporinen <strong>und</strong> der<br />
Antibiotikakombination Amoxycillin/Clavulansäure hingegen kei -<br />
ne Resistenzen. Bei den Makrolidantibiotika Erythromycin <strong>und</strong><br />
Clindamycin bestand bei allen getesteten Stämmen wie schon im<br />
Jahr 2006 Resistenz. Gute Empfindlichkeiten waren auch bei neueren<br />
Präparaten zur Behandlung von Atemwegsinfektionen (Ce -<br />
phalosporine neuerer Generation, Enrofloxacin <strong>und</strong> Florfenicol)<br />
zu verzeichnen.<br />
Dr. Klarmann, D. (VI OL)
Tabelle <strong>3.</strong>26: MHK-Werte der isolierten Salmonellen (2007: n = 427; 2006: n = 345; 2005: n = 284)<br />
Antibiotikum MHK 50%<br />
MHK 90%<br />
Amoxycillin/Clavulansäure<br />
Ampicillin<br />
Apramycin<br />
Cephalotin<br />
Cefquinom<br />
Ceftiofur<br />
Colistin<br />
Enrofloxacin<br />
Florfenicol<br />
Gentamicin<br />
Neomycin<br />
Spectinomycin<br />
Tetracyclin<br />
Trimethoprim/Sulfamethoxazol (SI)<br />
* intermediärer Bereich<br />
** Resistenz (Therapie nicht mehr sinnvoll)<br />
2/1<br />
1<br />
8<br />
4<br />
1<br />
1<br />
0,5<br />
0,0625<br />
4<br />
2 (#)<br />
8<br />
128 **<br />
2 (#)<br />
4/76 **<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
2005 2006 2007 2005<br />
2/1<br />
1<br />
8<br />
4<br />
1<br />
1<br />
0,5<br />
0,0625<br />
4<br />
2 (#)<br />
8<br />
64 *<br />
2 (#)<br />
> 4/76 **<br />
2/1<br />
2<br />
8<br />
4<br />
1<br />
1<br />
0,5<br />
0,0625<br />
8 *<br />
2 (#)<br />
8<br />
64 *<br />
8 **<br />
1/19 **<br />
8/4 (#)<br />
> 32 **<br />
8<br />
4<br />
1<br />
1<br />
2 *<br />
0,125<br />
8 *<br />
2 (#)<br />
8<br />
> 128 **<br />
> 16 **<br />
> 4/76 **<br />
2006 2007<br />
16/8 *<br />
> 32 **<br />
8<br />
16 *<br />
1<br />
1<br />
1 *<br />
0,5<br />
> 8 **<br />
2 (#)<br />
8<br />
> 128 **<br />
> 16 **<br />
> 4/76 **<br />
16/8 *<br />
> 32 **<br />
8<br />
16 *<br />
1<br />
1<br />
1 *<br />
0,125<br />
>8 **<br />
2 (#)<br />
8<br />
> 128 **<br />
> 16 **<br />
> 4/76 **<br />
117
118<br />
Tularämie – eine vergessene Zoonose<br />
Nach einer Treibjagd in Hessen kam es Ende des Jahres 2005 bei<br />
zehn Teilnehmern zu den gleichen Krankheitssymptomen: hohes<br />
Fieber, Schüttelfrost, Lymphknotenschwellungen sowie Kopf- <strong>und</strong><br />
Gliederschmerzen. Alle Erkrankten hatten sich am Abbalgen <strong>und</strong><br />
Ausweiden von Hasen beteiligt. Zwei der Jagdausübenden zo gen<br />
sich Schnittverletzungen zu. Bei diesen beiden Per sonen wurden<br />
zu den beschriebenen Symptomen zusätzlich noch geschwürige<br />
Ver änderungen im Bereich der verletzten Haut fest gestellt. Neun<br />
der zehn Jäger waren an Tularämie erkrankt, einer vom Tier auf<br />
den Mensch übertragbaren Infektionskrankheit (Zo onose).<br />
Der Erreger der Tularämie, das Bakterium Francisella tularensis,<br />
ist schon seit annähernd 100 Jahren bekannt <strong>und</strong> wurde erstmals<br />
in Kalifornien isoliert. In Europa wurde die Tularämie Anfang der<br />
dreißiger Jahre in Schweden, Russland <strong>und</strong> in Deutschland be -<br />
schrie ben. In Deutschland kam es vor allem in den 50er <strong>und</strong> 60er<br />
Jahren häufiger zu Erkrankungen beim Menschen. Nach Jahr zehnten,<br />
in denen diese Erkrankungen kaum festgestellt wur den, wur -<br />
de die Zoonose in den letzten Jahren wieder vermehrt nachgewiesen.<br />
Francisella tularensis ist ein hoch ansteckendes Bakterium. Be sonders<br />
hervorzuheben ist die Kälteresistenz des Erregers, durch die<br />
in tiefgekühltem Wildbret, Kadavern <strong>und</strong> (Oberflächen-) Wasser<br />
seine Ansteckungsfähigkeit für Monate erhalten bleibt. Bereits<br />
eine geringe Anzahl der Bakterien reichen aus, um beispielswei -<br />
se durch Einatmen erregerhaltigen Staubes oder winziger, bakterienhaltiger<br />
Tröpfchen eine Erkrankung auszulösen. So wurde<br />
beispielsweise über Infektionen in Schweden mit ca. 600 Ein -<br />
zelerkrankungen berichtet, die durch Inhalation von kontaminiertem<br />
Staub beim Umsetzen von Heu hervorgerufen wurden.<br />
Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nach gegenwärtigem<br />
Wissensstand jedoch nicht möglich.<br />
Francisellen sind nicht wirtsspezifisch <strong>und</strong> konnten bereits in mehr<br />
als 70 Wirbeltieren <strong>und</strong> Vogelarten nachgewiesen werden. Das<br />
Wirtsspektrum erfasst dabei vor allem Hasen, Kaninchen <strong>und</strong> auch<br />
einheimische Nager (Ratte, Bisam, Eichhörnchen, Biber, Hamster),<br />
ebenso Fuchs, Wiesel, Frettchen, Rehwild, landwirtschaftliche<br />
Nutz tiere <strong>und</strong> nicht zuletzt – wenn auch selten – H<strong>und</strong> <strong>und</strong> Katze.<br />
Weiterhin wurden auch zahlreiche Wildvogelarten, unter anderem<br />
Rebhühner <strong>und</strong> Fasane sowie der aus Nordskandinavien stammende<br />
<strong>und</strong> in Deutschland im Rahmen des Vogelzuges auftretende<br />
Seidenschwanz als Träger <strong>und</strong> Ausscheider des Erregers identifiziert.<br />
Als Erregerreservoire gelten insbesondere blutsaugende<br />
In sekten wie Stechmücken, Zecken <strong>und</strong> Flöhe sowie im Wasser<br />
lebende Einzeller (Protozoen).<br />
Über die gegenwärtige Verbreitung von Francisella tularensis ist<br />
nichts bekannt. Daher wurde im Veterinärinstitut Hannover in<br />
Zusammenarbeit mit dem Institut für Wildtierforschung an der<br />
Tierärztlichen Hochschule Hannover <strong>und</strong> dem Friedrich-Loeffler-<br />
Institut in Jena im Rahmen eines Monitorings eine Untersu chung<br />
an der Hasenpopulation <strong>Niedersachsen</strong>s begonnen, um Erkenntnisse<br />
über das Vorkommen <strong>und</strong> die derzeitige Verbreitung des<br />
Tularämie-Erregers zu gewinnen.<br />
Im Berichtsjahr wurden annähernd 900 Hasen unter anderem<br />
auf Francisella tularensis untersucht. Bei einem Tier konnte der<br />
Erreger nachgewiesen werden. Das Monitoring ist für einen Zeitraum<br />
von etwa drei Jahren vorgesehen, in dem nach Mög lich -<br />
keit alle Landkreise <strong>Niedersachsen</strong>s in die Untersuchung einbezogen<br />
werden sollen.<br />
Dr. von Keyserlingk, M.; Dr. Braune, S.; PD Dr. Runge, M. (VI H)
Salmonellenerkrankungen in Krankenhäusern<br />
Im Berichtsjahr traten in zwei niedersächsischen Kranken häu sern<br />
gehäuft Salmonellose-Erkrankungen auf. In beiden Fällen wurden<br />
die Infektionen durch Salmonella Enteritidis verursacht. Salmo nellen<br />
gehören neben Campylobacter zu den wichtigsten bakteri el len<br />
Zoonoseerregern. Das Auftreten von Erkrankungsfällen in Kran -<br />
kenhäusern ist besonders problematisch, da das Immunsystem der<br />
Erkrankten meist durch Primärerkrankungen schon geschwächt<br />
ist.<br />
Krankenhaus A<br />
In einem Zeitraum von 20 Kalenderwochen erkrankten 28 Pati -<br />
enten an einer Salmonellose. Bei 19 Patienten traten die ersten<br />
Durchfallsymptome nach mehr als 48 St<strong>und</strong>en nach der stationären<br />
Aufnahme ein, weshalb davon ausgegangen wurde, dass die<br />
Infektion im Krankenhaus erfolgte. Parallel zu diesen Erkran kungsfällen<br />
gab es anfänglich auch Erkrankungen in einer Kinder tagesstätte<br />
des Krankenhauses, die ebenfalls mit Essen aus der Kran -<br />
kenhausküche beliefert wurde. Durch Untersuchungen von Stuhl -<br />
proben des Küchenpersonals wurden fünf Ausscheider identifiziert.<br />
Im Rahmen dieses Ausbruches wurden 178 Rückstell pro ben<br />
auf Salmonellen untersucht. Dabei wurden in vier Proben Salmo -<br />
nellen nachgewiesen. In allen vier Fällen handelte es sich um Sal -<br />
monella Enteriditis Phagentyp 8. Die betroffenen Lebensmittel<br />
waren Kartoffelsuppe, Rote Grütze, Vanillesoße <strong>und</strong> Käse. Die<br />
Heterogenität der Lebensmittel erlaubte keinen Rückschluss auf<br />
ein bestimmtes Lebensmittel als ursächliche Kontaminations quelle.<br />
Im Verlauf des Jahres erkrankte ein weiterer Patient an Salmo nellose.<br />
Hierbei handelte es sich jedoch um einen Einzelfall, es war<br />
auch nicht auszuschließen, dass der Patient schon vor der stationären<br />
Aufnahme infiziert war. In diesem Zusammenhang wurden<br />
zehn Rückstellproben untersucht. In keiner der Proben wurden<br />
Salmonellen nachgewiesen.<br />
Nach anfänglichen Klärungsversuchen auf Ortsebene (Ges<strong>und</strong> -<br />
heits amt, Veterinäramt) wurden als Landesbehörden das Nie der -<br />
sächsisches Landesges<strong>und</strong>heitsamt (NLGA) <strong>und</strong> das LAVES so wie<br />
die B<strong>und</strong>esbehörden Robert Koch Institut (RKI) <strong>und</strong> B<strong>und</strong>es insti -<br />
tut für Risikobewertung (BfR) mit einbezogen.<br />
.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden Erkenntnisse wurde angenommen,<br />
dass die ersten Erkrankungsfälle auf eine gleichartige Infekti onsquelle<br />
zurückgehen.<br />
Da nicht auszuschließen ist, dass anfangs infizierte Küchen mit ar -<br />
beiter Salmonellen über einen längeren Zeitraum ausgeschieden<br />
<strong>und</strong> so zu weiteren Kontaminationen der Lebensmittel beigetragen<br />
haben, werden die späteren Erkrankungsfälle auf diesen epidemiologischen<br />
Mechanismus zurückgeführt.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Krankenhaus B<br />
Innerhalb einer Woche erkrankten fünf Personen an Salmonel -<br />
lose. Zunächst erkrankten zwei Mitarbeiterinnen, von denen ei -<br />
ne sowohl in der Küche als auch auf den Stationen tätig war. In<br />
den darauf folgenden Tagen erkrankten drei weitere Personen.<br />
Daraufhin wurde die mikrobiologische Untersuchung aller verfügbaren<br />
Rückstellproben veranlasst.<br />
Insgesamt wurden 334 Proben auf Salmonellen untersucht, da -<br />
runter waren zehn Tupferproben. Die Proben wurden zunächst<br />
molekularbiologisch untersucht. Durch diese Untersuchungs me -<br />
thode war eine zeitnahe Ergebnismitteilung für große Proben zahlen<br />
möglich. Im molekularbiologischen Screening positive Pro ben<br />
wurden zusätzlich kulturell untersucht. In 17 Proben wurden Sal -<br />
monellen nachgewiesen. In allen 17 Fällen konnte Salmonella<br />
Enteritidis Phagentyp 4 isoliert werden. Auffällig war, dass es sich<br />
bei den positiven Proben in elf Fällen um Suppen oder Soßen<br />
handelte. Viermal wurden Salmonellen in Gemüse <strong>und</strong> zweimal<br />
in Pudding nachgewiesen.<br />
Das Krankenhaus wird größtenteils mit zubereiteten Lebens mit -<br />
teln beliefert, die vor Ort nur noch erhitzt werden. Nur wenige<br />
Lebensmittel werden in der Krankenhausküche zubereitet. Die<br />
ursprüngliche Infektionsquelle konnte nicht identifiziert werden.<br />
Es ist auch in diesem Fall nicht auszuschließen, dass die Infekti -<br />
on über eine oder beide Mitarbeiterinnen, die Salmonellen ausschieden,<br />
weitergegeben wurde.<br />
Dr. Seide, K. (LI BS)<br />
119
120<br />
Tierschutz<br />
Ist der Betrieb von Angelteichen mit dem Tierschutz zu vereinbaren?<br />
Das Angeln von Fischen als Freizeitbeschäftigung wird häufig un -<br />
ter dem Aspekt des Tierschutzes thematisiert <strong>und</strong> kritisiert (»An -<br />
gelsport«). Das Fangen von Fischen mit der Handangel ist aus<br />
Sicht des Tierschutzes vertretbar, wenn es auf den Nahrungs ge -<br />
winn abzielt oder wenn ein Angeln im Rahmen von fischereilich<br />
vertretbaren Hegemaßnahmen erforderlich erscheint. Es stellt sich<br />
die Frage, ob der Betrieb von Angelteichen mit den Gr<strong>und</strong>sät zen<br />
des Tierschutzes vereinbar ist.<br />
Merkblatt zum tierschutzgerechten Betrieb von Angel-<br />
tei chen in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirt schaft,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung (ML) hat vor dem<br />
Hinter gr<strong>und</strong> der genannten Problematik bereits im Jahr 1997 ein<br />
Merk blatt zum tierschutzgerechten Betrieb von Angelteichen in<br />
Nie dersachsen erstellt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> aktueller Rechtsverfahren sowie einer Anfrage der<br />
Rechtsvertretung eines Angelteichbetreibers an das ML <strong>und</strong> in<br />
Verbindung mit neuen Er kenntnissen zur Tierschutzrelevanz des<br />
Angelns, erschien eine Aktualisierung des Merkblattes mit Emp -<br />
fehlungen <strong>und</strong> Hinwei sen zum Betrieb von Angelteichen erforderlich.<br />
Der neu ausgearbeitete Leitfaden soll dem Tierhalter <strong>und</strong> dem<br />
Angler als Vorgabe für die gute fachliche Angelteichpraxis <strong>und</strong><br />
dem Amtstierarzt als Handhabe zur tierschutzrechtlichen Über -<br />
wachung der Angelteichanlagen dienen.<br />
Tierschutzgerechter Betrieb von Angelteichanlagen<br />
In <strong>Niedersachsen</strong> gibt es Gewässer oder Anlagen zur Fischhal -<br />
tung, die als so genannte »Angelteiche« gewerbsmäßig betrieben<br />
werden, indem hier Fische gegen Entgelt geangelt werden<br />
Der neu ausgearbeitete Leitfaden soll dem Tierhalter <strong>und</strong> dem Angler<br />
als Vorgabe für die gute fachliche Angelteichpraxis <strong>und</strong> dem Amts tier -<br />
arzt als Handhabe zur tierschutzrechtlichen Über wachung der Angel -<br />
teichanlagen dienen
können. Diese Fische, die entweder aus eigener Produktion stammen<br />
oder zugekauft werden, werden vom Betreiber häufig be -<br />
reits als fertige Speisefische in die Angelteiche eingesetzt. Das<br />
Angeln in derartigen Angelteichen wird häufig kritisiert, da die<br />
Fische offensichtlich nur zum Zwecke des späteren Wieder herausangelns<br />
eingesetzt werden.<br />
Aktuelle Untersuchungsergebnisse belegen allerdings, dass das<br />
Fangen von Fischen mit der Handangel, auch im Vergleich zu an -<br />
deren Fischfangmethoden, unter Einhaltung bestimmter Vorga -<br />
ben mit dem Tierschutz durchaus vereinbar ist.<br />
Eine wichtige Forderung ist, dass die Fische nicht im Beisein der<br />
Angler in die Angelteichgewässer eingesetzt werden dürfen. Ferner<br />
ist nach Zukauf von Fischen zum Angelteichbesatz eine War -<br />
tezeit nach erfolgtem Transport erforderlich, während der die an -<br />
gelieferten Fische nicht abgeangelt werden sollen.<br />
In dem Merkblatt mit Hinweisen <strong>und</strong> Empfehlungen zum Be trieb<br />
von Angelteichen in <strong>Niedersachsen</strong> wird auch auf das waidgerechte<br />
Angeln eingegangen. So sind zum Beispiel Setzkescher<br />
zur Lebendfischhälterung der gefangenen Fische nicht zu verwen<br />
den, da es für die Verwendung solcher Setzkescher keinen<br />
rechtfertigenden vernünftigen Gr<strong>und</strong> gibt. Die Fische sind sofort<br />
nach dem Fang tierschutzgerecht zu töten <strong>und</strong> gekühlt aufzubewahren.<br />
Die Fische sind nach dem Anbiss schonend anzulanden<br />
(Drill). Mit Hilfe von Unterfangkeschern werden die geangelten<br />
Fische aus dem Wasser gehoben <strong>und</strong> vor dem Abhaken<br />
mittels Kopf schlag tierschutzgerecht betäubt. Spätestens nach<br />
dem Abha ken sollen die Fische, z. B. mittels Herzstich, getötet<br />
werden.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Eine fachk<strong>und</strong>ige Aufsicht am Angelteich <strong>und</strong> der Aushang ei -<br />
ner Angelordnung sind jederzeit sicherzustellen.<br />
In dem Merkblatt mit Hinweisen <strong>und</strong> Empfehlungen zum<br />
Betrieb von Angelteichen wird unterschieden zwischen:<br />
Gewässern, die der Hegepflicht nach § 40 des Nieder säch si -<br />
schen Fischereigesetzes unterliegen<br />
Angelteichen, die in Verbindung mit Fischzuchtanlagen be -<br />
trieben werden, <strong>und</strong><br />
sonstigen Angelteichen<br />
Das Merkblatt wurde im Auftrag des Ministeriums unter Feder -<br />
führung des LAVES <strong>und</strong> unter Beteili gung des niedersächsischen<br />
Tierschutzbeirates, der Landwirtschafts kammer <strong>Niedersachsen</strong>,<br />
der niedersächsischen Sportfischer ver bände sowie des Landes -<br />
fischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong> e. V. erstellt. Der Volltext des<br />
Merkblattes steht auf der Homepage des LAVES zum Download<br />
zur Verfügung.<br />
Kleingeld, D. W. (Dez. 32)<br />
121
122<br />
Zur Verwendung von Elektroreizgeräten beim H<strong>und</strong><br />
Der Einsatz von Elektroreizgeräten im Rahmen der H<strong>und</strong>eaus -<br />
bil dung ist tierschutzrechtlich verboten. Aber auch in Nieder sachsen<br />
kommen Elektroreizgeräte zur Anwendung. Bei Kenntnis nahme<br />
durch die zuständigen kommunalen Veterinärbehörden ha -<br />
ben diese den Einzelfall u. a. im Hinblick auf die Einleitung von<br />
Ord nungs widrigkeiten- oder Strafverfahren zu prüfen. Zur Be ant -<br />
wor tung der Frage, ob die Verwendung dieser Geräte unter be -<br />
stim mten Voraussetzungen aus tierschutzfachlicher Sicht vertretbar<br />
ist, bedarf es wissenschaftlich belegbarer Fakten.<br />
Was sind Elektroreizgeräte?<br />
Elektroreizgeräte, u. a. auch als Telereiz-, Teletakt-, Stromim pulsgeräte<br />
oder Erziehungshalsbänder bezeichnet, bestehen im All -<br />
gemeinen aus einem tragbaren Sender <strong>und</strong> einem mit Elek tro den<br />
ausgestatteten H<strong>und</strong>ehalsband (Empfänger), durch das funkgesteuert,<br />
elektrische Reize auf das Tier übertragen werden können.<br />
Die Impulse können manuell, aber auch durch bestimmte<br />
Verhaltensweisen des H<strong>und</strong>es ausgelöst werden. In dem Zusammenhang<br />
sind auch elektronische Arealbegrenzer, sogenannte<br />
unsichtbare Zäune, zu erwähnen, die nach ähnlichem Prinzip<br />
funk tionieren. Bei diesen Zäunen wird das den elektrischen Strafreiz<br />
auslösende Signal durch das Überschreiten einer bestimmten<br />
Distanz zu einem ober- oder unterhalb der Erde befindlichen Antennendraht<br />
ausgelöst.<br />
Tierschutzrelevante Aspekte<br />
Befürworter des Einsatzes von Elektroreizgeräten argumentieren,<br />
dass mit Hilfe dieser Geräte unerwünschte Verhaltensweisen unterb<strong>und</strong>en<br />
werden können <strong>und</strong> stärker belastende Maßnahmen<br />
somit nicht ergriffen werden müssen.<br />
Training eines H<strong>und</strong>es ohne Elektroreizgerät<br />
Anwender der Geräte müssten jedoch über ein hohes Maß an<br />
lernbiologischem <strong>und</strong> ethologischem Wissen verfügen. Über dies<br />
wären spezielle Kenntnisse zur Elektrophysiologie <strong>und</strong> Geräte -<br />
technik erforderlich. Eine Arbeitsgruppe des Tierschutzzentrums<br />
der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat eine Sach k<strong>und</strong>eschulung<br />
mit entsprechenden Inhalten entwickelt. Insbeson dere<br />
die praktischen Qualitäten des Anwenders, d. h. Erfahrung <strong>und</strong><br />
die Fähigkeit einer zeitlich <strong>und</strong> situativ korrekten Einwirkung,<br />
sind von großer Bedeutung.<br />
Die unsachgemäße Anwendung beinhaltet ein hohes Risiko er -<br />
heblicher Stresserscheinungen, körperlicher Schädigungen, Ver -<br />
haltensstörungen <strong>und</strong> Folgeschäden für den H<strong>und</strong>. Durch ein<br />
fehlerhaftes Timing des Anwenders entstehende Fehlverknüp -<br />
fungen können außerdem zu Reaktionen des H<strong>und</strong>es führen, die<br />
zu einer Gefahr für Unbeteiligte werden können.
Zu berücksichtigen <strong>und</strong> nicht beeinflussbar ist, dass der Grad der<br />
Schmerzempfindung, die der elektrische Reiz auslösen kann, von<br />
verschiedenen Variablen abhängt sowie von Tier zu Tier <strong>und</strong> je<br />
nach Situation sehr individuell ist.<br />
Rechtslage<br />
Nach § 3 Nr. 11 des Tierschutzgesetzes (TierSchG) ist es verboten,<br />
ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das<br />
artgemäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine Bewe gung,<br />
erheblich einschränkt oder es zur Bewegung zwingt <strong>und</strong> dem<br />
Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schä den<br />
zufügt, soweit dies nicht nach b<strong>und</strong>es- oder landesrechtlichen<br />
Vorschriften zulässig ist.<br />
Strittig war seit dem Inkrafttreten der Norm, ob dieser Vorschrift<br />
ein generelles Verbot der Verwendung von Elektroreizgeräten entnommen<br />
werden kann.<br />
Das B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht (BVerwG) Leipzig hat mit Urteil<br />
vom 2<strong>3.</strong> Februar 2006 entschieden, dass der Ein satz von Elek troreizgeräten<br />
für Zwecke der H<strong>und</strong>eausbildung gemäß § 3 Nr. 11<br />
TierSchG verboten ist. Dabei komme es nicht auf die kon krete<br />
Ver wendung des Gerätes im Einzelfall, sondern darauf an, ob es<br />
von seiner Bauart <strong>und</strong> Funktionsweise her geeignet ist, dem Tier<br />
nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen.<br />
Durch dieses höchstrichterliche Urteil wurde entschieden, dass<br />
§ 3 Nr. 11 TierSchG den Einsatz solcher Geräte generell verbietet.<br />
Anzumerken ist, dass Vertrieb <strong>und</strong> Erwerb dieser Geräte hingegen<br />
nicht verboten sind.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Fazit – Ausblick<br />
Die nach § 3 Nr. 11 TierSchG mögliche Ausnahmen vom generellen<br />
Verbot durch b<strong>und</strong>es- oder landesrechtliche Vorschriften<br />
wurden bisher nicht normiert. Infolge des Urteils des BVerwG<br />
wurde der Ruf verschiedener Interessengruppen laut, von der<br />
Verordnungsermächtigung nach § 2a Abs. 1a TierSchG Gebrauch<br />
zu machen <strong>und</strong> eine Rechtsnorm für die Anwendung von Elek -<br />
tro reizgeräten zu schaffen. Das B<strong>und</strong>esministerium für Ernäh rung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> hat daraufhin tierschutzfachliche<br />
Fragen zum Einsatz der Geräte mit einer Gruppe von<br />
Sachverständigen erörtert. Ob <strong>und</strong> in welchen Fällen der Ein satz<br />
erforderlich sein kann <strong>und</strong> welche Anforderungen bei der Aus -<br />
bil dung <strong>und</strong> Erziehung getroffen werden müssten, ist noch zu<br />
entscheiden.<br />
Das Ziel, einen gehorsamen <strong>und</strong> sozialsicheren H<strong>und</strong> zu erziehen,<br />
darf nur durch die mildeste Methode <strong>und</strong> auf verhaltensbiologischen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen erreicht werden. Die Arbeit mit positiven Ver -<br />
stärkern ist generell zu bevorzugen.<br />
Das Dezernat Tierschutzdienst des LAVES hat im Zuge von Ord -<br />
nungswidrigkeiten- oder Strafverfahren auf Anfrage von Staats -<br />
anwaltschaften, tierschutzfachliche Stellungnahmen zur Anwendung<br />
<strong>und</strong> über die möglichen Folgen des Einsatzes von Elektro -<br />
reizgeräten verfasst. Beratend wurde das Dezernat insbesondere<br />
zur Auslegung gerichtlicher Urteile <strong>und</strong> der rechtlichen Bewertung<br />
sowie Einschätzung von Arealbegrenzern tätig.<br />
Dr. Welzel, A. (Dez. 33)<br />
123
124<br />
Schadstoffunfall in der Nordsee – Umgang mit verölten Seevögeln<br />
Das am 6. November 2007 leckgeschlagene Containerschiff<br />
«Dun can Island« (178 m Länge) war auf dem Weg von Ant wer -<br />
pen nach Hamburg. Bei schwerem Seegang verlor der Bana nen -<br />
frachter in Höhe der niederländischen Insel Terschelling zehn Container.<br />
Dabei wurde einer der Tanks des Schiffes beschädigt, so<br />
dass vor den ostfriesischen Inseln bis zum zugewiesenen Not -<br />
liegeplatz Cuxhaven insgesamt ca. 90 Tonnen leichtes Schweröl<br />
durch ein fußballgroßes Loch oberhalb der Wasserlinie austraten.<br />
Nach Übernahme der Gesamteinsatzleitung durch das Havarie -<br />
kommando, einer Einrichtung des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Küsten län der<br />
zur Gewährleistung eines gemeinsamen Unfallmanagements auf<br />
Nord- <strong>und</strong> Ostsee, wurde das LAVES von dort über die Lage <strong>und</strong><br />
mögliche Auswirkungen für die Umwelt informiert. Am 7. No vember<br />
2007 wurden erste verölte Seevögel auf den ostfriesischen<br />
Inseln gemeldet.<br />
Da das LAVES im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung (ML) <strong>und</strong><br />
in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt<br />
<strong>und</strong> Klimaschutz (MU) eine Notfallplanung zum Umgang mit<br />
kon taminierten Wild tieren erarbeitet, erfolgte die Koordinie rung<br />
aller diesbezügli chen Maßnahmen der Küstenlandkreise <strong>und</strong> kreisfrei<br />
en Städte, des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasser -<br />
wirt schaft, Küsten- <strong>und</strong> Naturschutz (NLWKN) <strong>und</strong> der Nationalpark<br />
verwal tung <strong>und</strong> der Vogelpflege sta tion Norddeich in enger<br />
Abstimmung mit den zuständigen Mi nisterien durch die Dezer -<br />
nate Task-Force Ve terinärwesen <strong>und</strong> Tierschutz. Notwendige Abstim<br />
mungen mit international operierenden Tierschutzorgani sa -<br />
tio nen sowie Ab stimmungs- <strong>und</strong> Berichtspflichten gegenüber dem<br />
Ha varie kom mando waren weitere Schwerpunkte der Einsatzlei -<br />
tung.<br />
Alle Beteiligten verständigten sich anlässlich einer ersten Be spre -<br />
chung in Norddeich auf folgendes Vorgehen:<br />
Festlegung von Sammelstellen auf den Inseln <strong>und</strong> am Fest land<br />
Benennung von Koordinatoren für das Sammeln lebender <strong>und</strong><br />
toter Vögel<br />
sachk<strong>und</strong>ige Personen für die Euthanasie nicht rehabilitationsfähiger<br />
Vögel<br />
Aufbau der Betriebsbereitschaft der Vogelpflegestation in Nord -<br />
deich<br />
Dokumentation aller Maßnahmen incl. der Erfassung von Art<br />
<strong>und</strong> Anzahl kontaminierter Vögel<br />
Zu diesem Zeitpunkt lag aufgr<strong>und</strong> ungünstiger Witterungsbe din -<br />
gungen kein aussagekräftiges Lagebild vor. Es musste jedoch davon<br />
ausgegangen werden, dass eine Vielzahl von kontaminierten<br />
Vögeln in den nächsten Tagen die Inseln <strong>und</strong> das Festland erreichen<br />
würde.<br />
Temperaturmessung bei der Eingangsuntersuchung einer verölt eingelieferten<br />
Trauerente
In den folgenden Tagen wurden tote Vögel von den Helfern eingesammelt,<br />
Ölproben für die Beweissicherung im Entschädi gungsverfahren<br />
entnommen, Anzahl <strong>und</strong> Vogelart der Todf<strong>und</strong>e registriert<br />
<strong>und</strong> die Tierkörper der Entsorgung zugeführt. Lebende<br />
kontaminierte Vögel wurden – sofern möglich – eingesammelt<br />
<strong>und</strong> je nach Umständen <strong>und</strong> Untersuchungsbef<strong>und</strong> der Vogel -<br />
pflegestation übergeben oder euthanasiert.<br />
Insgesamt wurden 89 Seevögel, vor allem Trauerenten, Tor dal ken<br />
<strong>und</strong> Trottellummen, von der Vogelpflegestation in Norddeich aufgenommen.<br />
Nach einer umfassenden Eingangsuntersuchung<br />
durch die Stationstierärztin erfolgte die Stabilisierung der Vögel<br />
durch Ruhe, Wärme, <strong>und</strong> soweit erforderlich, Elektrolytgaben.<br />
Die anschließende Waschung der Vögel lag in den Händen der<br />
Stations-Tierpfleger unter Einbindung spezialisierter Fachkräfte<br />
einer auf diesem Gebiet international tätigen Tierschutz organi sa -<br />
tion. Parallel zur Erstversorgung der Tiere wurde mit viel Elan <strong>und</strong><br />
Engagement die Station für die Rehabilitation der Vögel weiter<br />
aufgerüstet: u. a. mit zusätzlichen Netzböden für die Unterbrin -<br />
gung der Seevögel sowie beheizbaren Innen- <strong>und</strong> Außenpools,<br />
um die gewaschenen Tiere so schnell wie möglich wieder auf das<br />
Wasser zu lassen. Insgesamt stellt die Pflege dieser extrem an das<br />
Leben auf offener See angepassten Vogelarten sehr hohe Anforderungen<br />
an die Sachk<strong>und</strong>e der betreuenden Personen <strong>und</strong> die<br />
Ausstattung der Station. Die umfassende Dokumentation der<br />
Pflege- <strong>und</strong> Behandlungsmaßnahmen für jeden aufgenommenen<br />
Vogel erfolgte in enger Abstimmung mit der zuständigen<br />
Veterinärbehörde.<br />
Alle in der Station verendeten oder euthanasierten Vögel wurden<br />
zur Untersuchung der Todesursache an die Stiftung Tierärzt liche<br />
Hochschule Hannover, Klinik für Zier- <strong>und</strong> Wildvögel, sowie das<br />
Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES eingesandt. Eine Evaluie -<br />
rung der Vogelpflege einschließlich Beurteilung der Untersu chungs -<br />
ergebnisse steht noch aus.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Von den beteiligten Veterinärbehörden der Küstenlandkreise <strong>und</strong><br />
kreisfreien Städte, der Nationalparkverwaltung, dem NLWKN <strong>und</strong><br />
der Vogelpflegestation wurden sachk<strong>und</strong>ige, freiwilliger Helfer<br />
(Wattenjagdaufseher, Zivildienstleistende, Mitarbeiter von Städ -<br />
ten <strong>und</strong> Gemeinden, Personen des Natur- <strong>und</strong> Tierschutzes etc.)<br />
eingesetzt bzw. eingeb<strong>und</strong>en. Alle Beteiligten haben durch das<br />
schnelle <strong>und</strong> umsichtige Handeln zur Bewältigung der Schadenslage<br />
beigetragen.<br />
Dr. Petermann, S. (Dez. 33); Huesmann, J. (Dez. 32)<br />
Tordalken <strong>und</strong> Trottellummen auf eingehängtem Netzboden nach<br />
ersten Schwimmversuchen im Außenpool<br />
125
126<br />
Pilotprojekt zur Broilerhaltung abgeschlossen – erste Empfehlungen zur Erhaltung der Fußballen ge -<br />
s<strong>und</strong>heit von Masthühnern vorgelegt<br />
Schon vor der Verabschiedung der neuen EU-Richtlinie zur Broi -<br />
ler haltung (Richtlinie 2007/43/EG des Rates vom 28. Juni 2007)<br />
wurde zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für Ernäh -<br />
rung, Landwirtschaft, <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesent wick lung<br />
sowie der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband<br />
e.V. (NGW), ein Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der sogenannten<br />
»Hähnchenvereinbarung« auf den Weg gebracht. Hierfür<br />
wurden insgesamt drei Jahre lang unter Federführung des Tier -<br />
schutzdienstes in Zusammenarbeit mit den kommunalen Veteri -<br />
närbehörden, der Landwirtschaftskammer <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong><br />
der NGW auf vier niedersächsischen Schlachthöfen Daten zur<br />
Fußballenges<strong>und</strong>heit von Broilern erfasst sowie parallel dazu in<br />
insgesamt 39 Mastbetrieben managementspezifische Erhebun -<br />
gen durchgeführt.<br />
Schwedische Untersuchungen haben schon in den 90er Jah ren<br />
gezeigt, dass nicht in erster Linie die Besatzdichte, sondern vielmehr<br />
die Ausstattung der Betriebe, das Management <strong>und</strong> die<br />
jahreszeitbedingten Klimaverhältnisse Einfluss auf die Ges<strong>und</strong> heit<br />
der Broiler haben. Als Indikator für die Beurteilung der Tierhal -<br />
tung wird in diesem Zusammenhang die Fußballenges<strong>und</strong>heit ge -<br />
nutzt, die eng mit dem Stallklima, insbesondere der Steuerung<br />
von Lüftung <strong>und</strong> Heizung, sowie der Einstreuqualität korreliert.<br />
Neben einer Bestandsaufnahme zur Fußballenges<strong>und</strong>heit wurden<br />
im Rahmen des Pilotprojektes auch Ursachen für die Verände rungen<br />
an den Sohlenballen ermittelt, um gezielt Maßnahmen zur<br />
Erhaltung einer »guten« Fußballenges<strong>und</strong>heit ergreifen zu können.<br />
Hauptrisikofaktor für Veränderungen an den Fußballen stellt<br />
nach Literaturangaben <strong>und</strong> Praxiserfahrungen feuchte Einstreu<br />
dar. Ammoniak wird vermehrt freigesetzt <strong>und</strong> führt aufgr<strong>und</strong><br />
seiner ätzenden Wirkung an der aufgeweichten Sohlenhaut zu<br />
mehr oder weniger starken Schäden. Gemeinsam mit den kommunalen<br />
Veterinärbehörden, der Landwirtschaftskammer Nie dersachsen<br />
<strong>und</strong> der NGW wurden daher Empfehlungen zur Erhal -<br />
tung der Fußballenges<strong>und</strong>heit erarbeitet <strong>und</strong> verabschiedet. Die se<br />
Empfehlungen zielen insbesondere auf Maßnahmen zur Trockenhaltung<br />
der Einstreu ab.<br />
Vor der Einstallung der Küken muss z. B. nicht nur der Stallin nenraum,<br />
sondern auch der Stallboden zur Vermeidung von Kon denswasserbildung<br />
ausreichend aufgeheizt werden (Bodentem pera -<br />
tur ca. 28 °C). Es darf nur Einstreumaterial bester Qualität verwendet<br />
werden. Während früher die Auffassung vertreten wurde,<br />
zu Beginn des Mastdurchgangs möglichst viel einzustreuen, zeigen<br />
neuere Erfahrungen <strong>und</strong> Untersuchungen, dass eine dünne<br />
Schicht von nur wenigen Zentimetern von den Broilern leichter<br />
durchgearbeitet wird. Das Einstreumaterial wird dadurch besser<br />
belüftet <strong>und</strong> bleibt deutlich trockener als eine stärkere Schicht
Einstreu. Wird Stroh eingesetzt, muss es möglichst kurz gehäckselt<br />
sein (Halmlänge 3 bis 5 cm), um ein hohes Bindungs vermö -<br />
gen für Feuchtigkeit zu garantieren. Ob sich neue Einstreu materi -<br />
alien wie z. B. Maissilage bewähren werden, bleibt abzuwarten.<br />
Insgesamt haben die Auswertungen gezeigt, dass es schon jetzt<br />
Betriebe gibt, die durchweg Masthühner mit einer guten Fuß -<br />
ballenges<strong>und</strong>heit der Schlachtung zuführen. Es gibt aber auch<br />
Betriebe, die ein deutliches Verbesserungspotential aufweisen.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der anstehenden Umsetzung der neuen<br />
EU-Richtlinie zur Broilerhaltung in nationales Recht haben die<br />
Empfehlungen zur Erhaltung der Fußballenges<strong>und</strong>heit noch an<br />
Bedeutung gewonnen, da die Richtlinie vorschreibt, dass die<br />
Mitgliedsstaaten zukünftig die Erarbeitung von Leitlinien für die<br />
gute betriebliche Praxis fördern müssen.<br />
Dr. Petermann, S. (Dez. 33)<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Tierversuche<br />
Im Jahre 2007 wurden von der Genehmigungsbehörde für Tier -<br />
versuche dem Dezernat Tierschutzdienst des LAVES über 1.300<br />
Bescheide erstellt. Die Zahl der Neuanträge genehmigungs pflichtiger<br />
Tierversuche stieg um 17% auf 308. Die Bearbei tungs dauer<br />
für einen Antrag lag bei durchschnittlich 42 Tagen <strong>und</strong> somit<br />
deutlich unter der im Tierschutzgesetz vorgeschriebenen Höchstdauer<br />
von 3 Monaten.<br />
Vom LAVES wurden 248 anzeigepflichtige Tierversuche zur Kenntnis<br />
genommen sowie in 449 Fällen Änderungen bereits genehmigter<br />
bzw. angezeigter Vorhaben bearbeitet. Die Behörde er -<br />
teilte 201 Ausnahmegenehmigungen an qualifizierte Personen<br />
für die Mitarbeit in einem Vorhaben <strong>und</strong> 98 Einfuhrgeneh migungen<br />
für Versuchstiere aus Drittländern.<br />
In stark zunehmendem Maße wurden Beratungen von Antrag -<br />
stellern, Tierschutzbeauftragten, kommunalen Veterinär behör den<br />
<strong>und</strong> Tierschutzorganisationen nachgefragt.<br />
Auf Anregung der Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderarbeits -<br />
ge meinschaft <strong>Verbraucherschutz</strong> (LAV) wurde im April 2007 der<br />
»Arbeitskreis der Genehmigungsbehörden für Tierversuche« gegründet.<br />
Zweimal jährlich stattfindende Treffen sowie ein neu<br />
eingerichtetes »E-Mail-Forum« für den Informationsaustausch<br />
zwischen den Genehmigungsbehörden tragen zu einem bun desweit<br />
einheitlichen Vollzug bei der Genehmigung von Tierver su -<br />
chen bei.<br />
Dr. Suhr, I. (Dez. 33)<br />
127
128<br />
<strong>3.</strong>6 Weitere Themen<br />
Forschungsprojekte <strong>und</strong> -kooperationen im Bereich ges<strong>und</strong>heitlicher <strong>Verbraucherschutz</strong> in<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Die amtlichen Untersuchungen an Lebensmitteln, Futtermitteln,<br />
Bedarfsgegenständen <strong>und</strong> diagnostischen Proben von landwirtschaftlichen<br />
Nutztieren <strong>und</strong> Haustieren in <strong>Niedersachsen</strong> werden<br />
insgesamt im Landesamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmit -<br />
tel sicherheit (LAVES) durchgeführt. Dort arbeiten Wissen schaft -<br />
ler, die – oft in Zusammenarbeit mit universitären Ein rich tungen<br />
– Forschungsprojekte durchführen, um Untersuchungs me tho den<br />
weiterzuentwickeln oder fachliche Fragestellungen zu klären. In<br />
Zusammenarbeit mit den kommunalen Überwachungs behör den<br />
werden zum Beispiel präventive Untersuchungen durch geführt,<br />
um Risiken für die Verbraucher oder Tierbestände im Sinne der<br />
Frühbeobachtung rechtzeitig erkennen zu können.<br />
Projekte<br />
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 63 Projekte auf Gebieten der angewandten<br />
Forschung durchgeführt, die im Wesentlichen drei<br />
Bereichen zuzuordnen waren:<br />
Entwicklung von Methoden<br />
zur Rückstandsanalytik, zu molekularbiologischen Nach weisverfahren,<br />
zur alternativen Beseitigung von Tierkörpern im<br />
Tierseuchenkrisenfall, zur Herkunftsbestimmung von Lebensmittel<br />
(Authentizität) <strong>und</strong> zur »wirkungsbezogenen Analytik«<br />
Landesweite Untersuchungsprogramme<br />
zum Vorkommen von Krankheitserregern bzw. Krank hei ten<br />
bei Tieren, die auf den Menschen übertragen werden können:<br />
Salmonellen <strong>und</strong> Campylobacter in Geflügel, Noro vi ren<br />
<strong>und</strong> Vibrionen in Meeresfrüchten, Q-Fieber bei Schafen, Tularämie<br />
bei Wildtieren, Toxoplasmen bei Schweinen <strong>und</strong> Geflügel,<br />
Rinderbandwurm, Trichinen in Schlachtkörpern, multi<br />
resistente Staphylococcus aureus-Stämme<br />
zum Nachweis <strong>und</strong> zur toxikologischen Bewertung von Mehrfach-Rückständen<br />
von Pflanzenschutzmitteln<br />
Resistenzen von Bakterien gegenüber Antibiotika<br />
Resistenzen von Ratten gegenüber Rodentiziden<br />
Belastung von Lebensmitteln mit Schwermetallen, Dioxinen<br />
<strong>und</strong> Antibiotika-Rückständen<br />
Untersuchungen zu Qualitätsparametern bei Honig <strong>und</strong> zur<br />
Amerikanischen Faulbrut (Bienensterben)<br />
Aufbau von Datenbanken zu verbraucherschutzrelevanten Un -<br />
tersuchungsparametern<br />
Diese Forschungsprojekte dienen der Weiterentwicklung des <strong>Verbraucherschutz</strong>es<br />
<strong>und</strong> der Verbesserung der Tierges<strong>und</strong>heit. Über<br />
einige Projekte wird in diesem Kapitel an anderer Stelle berichtet.<br />
Eine ausführliche Aufstellung der Projekte <strong>und</strong> daraus hervorgegangener<br />
Publikationen ist dem <strong>Verbraucherschutz</strong>be richt 2007<br />
im Internet unter www.laves.nie der sach sen.de zu entnehmen<br />
Kooperationen<br />
Kooperationspartner für die Forschungsprojekte in den verschie -<br />
denen Bereichen ist die Tierärztliche Hochschule Hannover, die<br />
Tech nische Universität Braunschweig, die Georg-August-Univer -<br />
sität Göttingen, das Alfred-Wegener-Institut <strong>und</strong> B<strong>und</strong>es behör den,
wie das Friedrich-Loeffler-Institut, das B<strong>und</strong>esamt für Risikobe -<br />
wer tung oder die Biologische B<strong>und</strong>esanstalt für Land- <strong>und</strong> Forst -<br />
wirt schaft sowie auch staatliche Untersuchungseinrichtungen an -<br />
derer Län der. Daneben wirkt das LAVES in Forschungsnetz wer ken<br />
wie den Forschungsverbünden der Förderinitiative Zoonosen der<br />
Bun des regierung mit.<br />
Eine spezielle Kooperation besteht zurzeit zwischen dem Nie der -<br />
sächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Ver braucherschutz<br />
<strong>und</strong> Landesentwicklung (ML) <strong>und</strong> der Veterinär medi -<br />
zini schen Fakultät der Universität Leipzig.<br />
Dabei geht es um die Entwicklung von Verfahren zur farbli chen<br />
Markierung von Nebenprodukten der Schlachtung (sogenanntes<br />
Kategorie 3-Material). Dieses Material stammt zwar von als für<br />
den menschlichen Verzehr tauglich beurteilten geschlachteten<br />
Tieren, es darf aber nicht zu Lebensmittelzwecken, sondern nur<br />
z. B. zur Herstellung von Heimtiernahrung verwendet werden. Da<br />
in der näheren Vergangenheit mehrfach kriminelle Fehllei tun gen<br />
solchen Materials in die Lebensmittelverarbeitung vorgekommen<br />
sind <strong>und</strong> die Überwachung anhand von Betriebs- <strong>und</strong> Trans portdokumentationen<br />
nicht hinreichend sicher erscheint, wird von<br />
deutscher Seite die direkte optische Unterscheidbarkeit des be -<br />
treffenden Materials von Lebensmittelrohstoffen als Mittel der<br />
Wahl angesehen, um zukünftig Fehlleitungen zu verhindern.<br />
Für eine solche Materialmarkierung hat die Universität Leipzig einen<br />
Projektplan entwickelt <strong>und</strong> führt zurzeit mit Unter stüt zung<br />
durch das ML ein entsprechendes Forschungsvorhaben mit folgender<br />
differenzierter Zielrichtung durch:<br />
Zum einen soll die farbliche Erkennbarkeit des Materials vom An -<br />
fallsort bis zum Verarbeitungsbetrieb gesichert werden. Zum an -<br />
deren soll der verwendete Marker im Verarbeitungsprozess sei -<br />
ne färbende Wirkung verlieren, gleichwohl aber im Endprodukt<br />
mit einer einfachen physikalischen Methode erkennbar bleiben.<br />
Auf diese Weise können Fehlkanalisierungen weitestgehend verhindert<br />
werden. Sollte trotzdem eine illegale Verwendung in ei -<br />
nem Lebensmittel erfolgen, wäre dies durch die Untersu chung<br />
der betreffenden Produkte nachweisbar.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Meeresfrüchte wurden im Rahmen eines landesweiten Untersuchungs -<br />
programmes auf das Vorkommen von Noroviren <strong>und</strong> Vibri onen unter-<br />
sucht<br />
Um die Eignung eines solchen Verfahrens den anderen Mitgliedsstaaten<br />
<strong>und</strong> der Europäischen Kommission als schlüssigen Weg<br />
darzustellen, der die legale Verwendung des betreffenden Ma -<br />
terials weiterhin ermöglicht, gleichzeitig aber illegales Handeln<br />
unterbindet, soll das Verfahren im Juni 2008 in der Vertretung<br />
des Landes <strong>Niedersachsen</strong> in Brüssel präsentiert werden.<br />
129
130<br />
Forschungsprojekt des B<strong>und</strong>esumweltministeriums/B<strong>und</strong>esinstitutes für Risikobewertung im LAVES<br />
Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse Cuxhaven abgeschlossen<br />
Gemäß § 13 Absatz 5 des Lebensmittel- <strong>und</strong> Futtermittelgesetzbuches<br />
ist das B<strong>und</strong>esministerium für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong><br />
Reaktorsicherheit federführend zu ständig für die Verhütung von<br />
Gefährdungen der Verbraucher, die von Lebensmitteln ausgehen,<br />
welche einer Einwirkung durch Verunreinigungen der Luft, des<br />
Wassers oder des Bodens (sogenannter Umweltkontaminanten)<br />
ausgesetzt waren. Im Bereich der Lebensmittel gehören Fische<br />
bzw. Fischerei erzeugnisse zu den Lebensmitteln mit einem er höhten<br />
Konta mi nationsrisiko durch Quecksilber (Hg). Seit den unter<br />
dem Begriff »Minamata-Katastrophe« eingetretenen Ereignis sen<br />
in Japan sind weltweit tausende von Studien <strong>und</strong> Untersuchun -<br />
gen zu dieser Problematik erarbeitet worden. Bei deren großer<br />
Mehrzahl be schränken sich die Ergebnisse auf das unspeziierte<br />
Gesamt-Hg.<br />
Die genaue Ermittlung der Quecksilbergehalte von Fischen ist ein<br />
wichtiges Instrument sowohl bei der Überwachung der Um welt<br />
als auch von Lebensmitteln. Zurzeit setzt das Gemein schafts recht<br />
in VO (EG) Nr. 1881/2006 Höchstgehalte für potenziell toxische<br />
Schwermetalle einschließlich Quecksilber in Fischerei er zeug nis sen<br />
ausschließlich über die Gesamtgehalte der einzelnen Elemente<br />
fest. Die genaue Kenntnis der Art ihrer chemischen Bin dung (die<br />
sogenannte »Speziation«) im Gesamtmolekül wird je doch zu nehmend<br />
als wichtiges Kriterium für eine objektive Be wertung po -<br />
tenziell toxischer Elemente anerkannt. Unter den in Umwelt pro -<br />
ben vorkommenden Hg-Verbindungen überragt das »Methyl -<br />
quecksilber« alle übrigen an Giftigkeit (das National Re search<br />
Council (NRC) der USA hat 2000 einen provisional tolerable weekly<br />
intake (PTWI) von 0,7 µg/kg Körpergewicht festgesetzt).<br />
Ein gewichtiges Problem besteht allerdings darin, dass die Datenlage<br />
an speziierten, den Anteil an Methyl-Hg berücksichtigenden<br />
Untersuchungsergebnissen von Fischen deutlich weniger umfangreich<br />
ist, als die für Gesamt-Hg. Um den Forderungen der EU (EFSA,<br />
18. März 2004) nach Einführung der Hg-Speziesanalytik ge recht<br />
zu werden, haben das B<strong>und</strong>esumweltministerium <strong>und</strong> das Bun -<br />
desinstitut für Risikobewertung das Institut für Fische <strong>und</strong> Fisch -<br />
ereierzeugnisse Cux haven (IFF CUX) mit der Entwick lung einer<br />
routinefähigen Methode beauftragt. Das IFF Cux ha ven ist das<br />
Schwer punkt institut für Fische <strong>und</strong> Fischereier zeug nisse in Nie -<br />
dersachsen <strong>und</strong> durch seine Expertise in der anorganischen <strong>und</strong><br />
organischen Ana lytik von Fischereierzeugnissen b<strong>und</strong>esweit an -<br />
erkannt.<br />
Abbildung <strong>3.</strong>17: Methylquecksilber (Me-Hg + ) <strong>und</strong> Anorganisches Queck silber (Hg2+ ) in<br />
ausgewählten Fischarten (Mittelwerte)
Als am besten geeignetes Untersuchungsverfahren für die Spe -<br />
zies-Analytik von Hg in Fischen <strong>und</strong> Fischereierzeugnissen hat<br />
sich eine Kopplung der Gaschromatographie mit der Kaltdampf-<br />
Atomfluoreszenz (GC-CVAFS) herausgestellt. In der jetzt in Cuxhaven<br />
entwickelten Version ist diese Methode robust, mengenmäßig<br />
leistungsfähig, vergleichsweise kostengünstig <strong>und</strong> bei entsprechender<br />
Ausstattung leicht von anderen Anwendern zu übernehmen.<br />
Nach erfolgreicher Entwicklungsarbeit hat das Cuxhavener In -<br />
stitut mittels dieser Methode in den vergangenen zwei Jahren<br />
an die tausend Proben aus der gesamten Palette mariner bzw.<br />
aquatischer Organismen, die bei der menschlichen Ernährung<br />
eine Rolle spielen, untersucht. Somit stehen nunmehr neben den<br />
durch die klassische Methode »Gesamt-Hg« gewonnenen Da -<br />
ten auch die durch Speziesanalytik ermöglichten zusätzlichen<br />
Para meter »Methylquecksilber« <strong>und</strong> »Anorganisches Queck sil -<br />
ber« in großer Zahl zur Verfügung.<br />
Verbesserter <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Bei bisherigen Überwachungsmaßnahmen wurde – gestützt durch<br />
die derzeit geltenden rechtlichen Bestimmungen der VO (EG)<br />
Nr. 1881/2006 – Quecksilber in Lebensmitteln ausschließlich über<br />
den Parameter Gesamt-Hg bewertet. Diesem Vorgehen lag die<br />
Annahme zugr<strong>und</strong>e, dass ein Anteil von ca. 90% als Methyl-Hg<br />
vorliegt. Die Erkenntnisse aus der aktuellen Cuxhavener Erhe bung<br />
haben dies im Wesentlichen bestätigt, daneben aber gezeigt, dass<br />
in manchen Arten der Methyl-Hg-Anteil nahezu 100% betragen<br />
kann. Daneben können einzelne Arten oder Individuen aber auch<br />
Anteile von < 50% aufweisen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Bei mehreren kontaminationsträchtigen <strong>und</strong> dabei z. T. hochpreisigen<br />
Arten wie bestimmten Thunfischarten, Haien, Heilbutt,<br />
Schwertfisch, Buttermakrele u. a. ist die Bewertung nach erfolgter<br />
Speziesanalytik vorzuziehen, da bei Proben dieser Arten die<br />
Hg-Spezies-Anteile erhebliche Streubreiten aufweisen <strong>und</strong> au -<br />
ßerdem Abhängigkeiten von der Gesamt-Belastungshöhe gegeben<br />
sind. Das Ziel eines effektiven <strong>Verbraucherschutz</strong>es einerseits<br />
<strong>und</strong> der Vermeidung ungerechtfertigter Beanstandungen andererseits<br />
kann somit nur durch Einbeziehung der Spezies-Ana lytik<br />
erreicht werden.<br />
Kruse, R. (IFF CUX)<br />
131
132<br />
Tätigkeiten des Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsamtes bei Lebensmittel- <strong>und</strong> Tierexporten<br />
in Drittländer<br />
Die Abfertigung von Exporten von Lebensmitteln <strong>und</strong> Tieren ist<br />
für die Tierärzte der Veterinärämter in exportintensiven Land krei -<br />
sen eine verantwortungsvolle Aufgabe, die im Tagesgeschäft ei -<br />
nen breiten Raum beansprucht. Da Ges<strong>und</strong>heitsatteste der Ve terinärämter<br />
einer notariellen Beurk<strong>und</strong>ung der jeweiligen Export -<br />
sendung gleichzusetzen sind, können die Konsequenzen bei Fehlern<br />
für den jeweiligen Tierarzt, aber auch für den Exportbe trieb,<br />
sehr schwerwiegend sein.<br />
Mit den amtlichen Exportzertifikaten von Lebensmitteln bestätigt<br />
der amtliche Tierarzt deren hygienische Qualität, verb<strong>und</strong>en<br />
mit der Zusicherung der ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>und</strong> tierseuchenrechtlichen<br />
Unbedenklichkeit des Lebensmittels. Voraussetzung für<br />
eine verantwortbare Ausstellung der Atteste ist daher immer die<br />
genaue Kenntnis der Rohstoffherkunft <strong>und</strong> -qualität sowie fallbezogen<br />
der Schlachthygiene oder bei verarbeiteten Lebens mit -<br />
teln wie Käse oder Fleischerzeugnissen die Hygiene des gesamten<br />
Produktionsprozesses.<br />
Je nach Anforderungen des Importlandes des Lebensmittels hat<br />
der Tierarzt auch Untersuchungsergebnisse der Lebensmittel zu<br />
prüfen, die in den meisten Fällen auf Eigenkontrollen der Fir men<br />
beruhen, deren Aussagekraft jedoch stichprobenartig durch amtliche<br />
Vergleichsuntersuchungen verifiziert sein müssen. Vor der<br />
Verladung muss darüber hinaus jede Exportsendung auf Identi -<br />
tät mit der im Attest beschriebenen Ware kontrolliert werden.<br />
Soweit die Ware einer Untersuchung zugänglich ist, ist sie gegebenenfalls<br />
auch hinsichtlich der Identität zu untersuchen. Bei<br />
Waren, deren Untersuchung ohne Zerstörung der Verpackung<br />
nicht möglich ist, wie z. B. verpackte Fleischwaren oder Milch -<br />
er zeugnisse, muss sich die Kontrolle auf eine visuelle Unter su -<br />
chung der Verpackung beschränken. Sicherheit bei der Attes tie -<br />
rung solcher Waren kann der Tierarzt in diesen Fällen nur über<br />
genaue Kenntnis <strong>und</strong> Überwachung der Produktion sowie die<br />
produktionsbezogene Dokumentation des Betriebes erlangen.<br />
Besonders hohe Anforderungen an die Kontrolle der Produk ti on<br />
erfordern Exporte in die Vereinigten Staaten von Amerika. In<br />
Landkreisen wie dem Ammerland, in dem zwei von insgesamt<br />
fünf in Deutschland zugelassenen US-Exportbetrieben für Fleischerzeugnisse<br />
arbeiten, nehmen die Kontrollen <strong>und</strong> deren Doku -<br />
men tation für den US-Export weiten Raum im Tagesgeschäft des<br />
Veterinäramtes ein.<br />
Bei der Zertifizierung von Tierexporten steht die Kontrolle der<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>und</strong> tierseuchenrechtlichen Voraussetzungen<br />
des Importlandes sowie tierschutzrechtliche Kontrollen der Ver -<br />
ladung <strong>und</strong> des Transportes im Vordergr<strong>und</strong>. Die Tierärzte des<br />
Veterinäramtes haben sich vor jedem Transport zu vergewissern,<br />
dass die Tiere ges<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Anforderungen eines manchmal<br />
langen Transportes gewachsen sind sowie den tierseuchenrechtlichen<br />
Anforderungen des Importlandes genügen. Darüber hinaus<br />
muss der Tierarzt sicherstellen, dass die Tiere schonend in<br />
für sie geeignete Behälter oder Fahrzeuge verladen werden. Dies<br />
erfordert die Anwesenheit während des gesamten Verladevor -<br />
ganges.<br />
Insgesamt erfordert die Abfertigung von Tier- <strong>und</strong> Lebensmit tel -<br />
exporten von den Tierärzten der Veterinärämter große Sorgfalt,<br />
Kenntnis der unterschiedlichen <strong>und</strong> häufig wechselnden Anfor -<br />
derungen der Importländer <strong>und</strong> ... viel Zeit.<br />
Landkreis Ammerland
Alle Jahre wieder: Lebensmittelüberwachung auf Weihnachtsmärkten<br />
Vor mehr als 25 Jahren haben nur wenige Verkaufsstände mit<br />
Süßigkeiten <strong>und</strong> Glühwein den Weihnachtsmarkt an der Stadt -<br />
kirche in der Altstadt von Celle gebildet. Im Laufe der Jahre entwickelte<br />
er sich mehr <strong>und</strong> mehr zu dem überregional bekannten<br />
»Celler Weihnachtmarkt«, der heute einen großen Teil der Alt -<br />
stadt von Celle einnimmt <strong>und</strong> als Publikumsmagnet viele tau send<br />
Menschen aus nah <strong>und</strong> fern anzieht.<br />
Die Lebensmittelkontrolleure des Amtes für Veterinärangele genheiten<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> des Landkreises Celle haben die<br />
Weihnachtsmärkte der letzten Jahre planmäßig überwacht <strong>und</strong><br />
dabei neben der Frage der ges<strong>und</strong>heitlichen Unbedenklichkeit<br />
der Lebensmittel auch die Hygiene <strong>und</strong> den Täuschungsschutz<br />
im Visier gehabt. In den letzten Jahren führten von ungeeigneten<br />
Ausschankgefäßen ausgehende Schwermetallgehalte in heißen<br />
Getränken wie Glühwein <strong>und</strong> Punsch zu Beanstandungen.<br />
Diese konnten im Laufe der Jahre beseitigt werden <strong>und</strong> waren<br />
im Jahr 2007 schon kein Thema mehr.<br />
Bereits bevor der Weihnachtsmarkt Ende November 2007 in der<br />
Celler Altstadt für die Besucher die Tore öffnete, überprüften die<br />
Lebensmittelkontrolleure des Landkreises insbesondere die Buden<br />
<strong>und</strong> Stände, in denen Glühwein, Bratwurst, Schmalzkuchen, Ho -<br />
nig oder andere Lebensmittel angeboten wurden. Bei den Kon -<br />
trollen am Abnahmetag <strong>und</strong> während des Weihnachtsmarktes<br />
wurden schwerpunktmäßig die Hygiene, Kennzeichnung sowie<br />
Hygieneschulung der Mitarbeiter überprüft.<br />
Bei den insgesamt 43 Kontrollen wurden lediglich vier Fälle mit<br />
erheblichen Verstößen gegen die <strong>Verbraucherschutz</strong>vorschriften<br />
festgestellt (siehe auch Abbildung <strong>3.</strong>18). Als Folge dessen wurden<br />
drei Standinhaber schriftlich aufgefordert, die Mängel zu beseitigen.<br />
In einem weiteren Fall wurde wegen fortgesetzt fehlender<br />
Kennzeichnung der Verkauf eines Lebensmittels untersagt <strong>und</strong><br />
zusätzlich ein Bußgeldverfahren eingeleitet. In 18 Fällen wurden<br />
keine Verstöße festgestellt. Die Lebensmittelunternehmer in den<br />
verbleibenden 21 Fällen mit geringfügigen Abweichungen wurden<br />
mit dem Betriebsbesichtigungsprotokoll informiert <strong>und</strong> damit<br />
motiviert, den ihnen obliegenden Unternehmerpflichten künftig<br />
vollständig nachzukommen.<br />
Um die Lebensmittelqualität zu überprüfen, wurden darüber hi -<br />
naus 15 Lebensmittelproben genommen <strong>und</strong> im Institut des Niedersächsischen<br />
Landesamtes für Ver braucherschutz <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
auf Zusammensetzung <strong>und</strong> Wahrheitsgehalt der<br />
Angaben geprüft. Zudem wurden für die Überwachung der Sauberkeit<br />
der vor Ort gespülten Trinkbecher insgesamt 14 Proben<br />
genommen <strong>und</strong> einer bakteriologischen Laboruntersuchung unterzogen.<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>3.</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Die Ergebnisse der Analysen von Glühwein, Punsch <strong>und</strong> anderen<br />
alkoholischen Getränken zeigten nicht nur gute Qualitäten.<br />
In drei von acht Fällen wurde der gesetzliche Mindestalkohol ge -<br />
halt unterschritten. Als Ursache dafür wurde ein zu schnelles<br />
Verdampfen des Alkohols aufgr<strong>und</strong> einer wenig geeigneten Ausschanktechnik<br />
ermittelt. Die betroffenen Lebensmittelunter neh -<br />
mer wurden wegen der Verstöße belehrt <strong>und</strong> hinsichtlich der Ausschanktechnik<br />
beraten.<br />
Die Laboruntersuchungen bewiesen darüber hinaus, dass die<br />
für den Ausschank der alkoholischen Heißgetränke verwendeten<br />
Trinkbecher durchweg hygienisch bedenkenlos verwendbar<br />
waren.<br />
»Die Besucher des Weihnachtsmarktes (2007) in der Celler Alt -<br />
stadt haben eine ordentliche Hygiene vorgef<strong>und</strong>en, so das Er -<br />
gebnis der Kontrollen. Die Lebensmittelqualität jedoch war nur<br />
zufrieden stellend«. Dieses Fazit zog der Leiter des Amtes für<br />
Veterinärangelegenheiten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong> des Landkrei -<br />
ses Celle, Dr. Heiko Wessel, anlässlich der ausgewerteten Kon -<br />
trollen <strong>und</strong> entnommenen Lebensmittelproben.<br />
Prinz, D.; Dr. Wessel, H. (Landkreis Celle)<br />
Abbildung <strong>3.</strong>18: Weihnachtsmarkt Celle-Altstadt 2007 – Kontrollen<br />
<strong>und</strong> Ergebnisse<br />
133
134<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> Tätigkeiten<br />
im Verbrau cher schutz<br />
In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der im Jahr 2007 durchgeführten<br />
Untersuchungen aufgeführt, die in Kapitel 3 noch nicht<br />
genannt wurden. Die Ergebnisse der Untersuchungs schwer punkte<br />
sind in zusammengefasster Form genannt. Für wissenschaftliche<br />
Arbeiten stehen einzelne <strong>und</strong> detaillierte Untersuchungsdaten im<br />
LAVES zur Verfügung.<br />
Tabelle 4.1: Berichterstattung zur amtlichen Lebensmittelüberwachung (gemäß Artikel 14 Abs. (2) der Richtlinie des<br />
Rates 89/397/EWG) in <strong>Niedersachsen</strong> im Jahr 2007<br />
Kontrolle vor Ort, Anzahl <strong>und</strong> Art der festgestellten Verstöße (*)<br />
Zahl der Betriebe<br />
Zahl der kontrollierten<br />
Betriebe<br />
Zahl der<br />
Kontrollbesuche<br />
Zahl der Betriebe<br />
mit Verstößen*<br />
Art der Verstöße*<br />
Hygiene (HACCP,<br />
Ausbildung)<br />
Hygiene<br />
allgemein<br />
Zusammensetzung<br />
(nicht mi -<br />
kro biologisch)<br />
Kennzeichnung<br />
<strong>und</strong> Aufmachung<br />
andere Verstöße<br />
Erzeuger<br />
(Urproduktion)<br />
14.561<br />
854<br />
1.014<br />
52<br />
10<br />
40<br />
1<br />
14<br />
4<br />
Hersteller <strong>und</strong><br />
Abpacker<br />
1.728<br />
861<br />
4.020<br />
168<br />
48<br />
151<br />
3<br />
25<br />
20<br />
Vertriebsunternehmer<br />
<strong>und</strong><br />
Transporteure<br />
1.822<br />
571<br />
1.188<br />
64<br />
21<br />
43<br />
2<br />
24<br />
9<br />
Einzelhändler<br />
(Einzelhandel)<br />
32.733<br />
15.330<br />
2<strong>3.</strong>282<br />
1.880<br />
486<br />
1.449<br />
15<br />
645<br />
80<br />
Dienstleistungs<br />
-<br />
betriebe<br />
4<strong>3.</strong>056<br />
20.486<br />
28.645<br />
4.283<br />
1.447<br />
<strong>3.</strong>724<br />
45<br />
802<br />
187<br />
Hersteller, die<br />
im wesentlichen<br />
auf der<br />
Einzelhandelsstufe<br />
verkaufen<br />
* Nur diejenigen Verstöße, die zu formellen Maßnahmen der zuständigen Behörden im Sinne der Leitlinien geführt haben<br />
5.568<br />
<strong>3.</strong>332<br />
5.461<br />
719<br />
246<br />
600<br />
24<br />
159<br />
43<br />
Summe<br />
99.468<br />
41.434<br />
6<strong>3.</strong>610<br />
7.166<br />
2.258<br />
6.007<br />
90<br />
1.669<br />
343
4.1 Lebensmitteluntersuchung<br />
Fische <strong>und</strong> Meerestiere<br />
Mikrobiologie<br />
Räucherlachs<br />
Graved Lachs<br />
91<br />
29<br />
Für den Nachweis von lebensmittelassoziierten Viren (Norovirus<br />
<strong>und</strong> Rotavirus) in Miesmuscheln, Austern, Garnelen, Shrimps,<br />
Nord seekrabben, Meeresfrüchtesalaten <strong>und</strong> Flusskrebsen im Rah -<br />
men der Planproben <strong>und</strong> auch als wissenschaftliche Unter su -<br />
chungen wurden zwei molekularbiologische Methoden angewendet:<br />
die Nested RT-PCR <strong>und</strong> die Real Time RT-PCR. Ferner erfolgte<br />
die Validierung dieser Nachweismethoden für weitere lebensmittelhygienisch<br />
relevante Virusarten.<br />
Im Jahr 2007 wurden in insgesamt 235 untersuchten Proben<br />
kei ne Viren nachgewiesen.<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.2: Mikrobiologische Untersuchungen an Räucherlachs <strong>und</strong> Graved Lachs<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
Untersuchung auf Listeria monocytogenes<br />
positiv
136<br />
Parasiten<br />
Durch unzureichende Verarbeitungstechniken <strong>und</strong> Untersu chun gen<br />
im Rahmen von betrieblichen Eigenkontrollen können vermehrt<br />
Nematodenlarven auftreten. Diese sind nach VO (EG) 178/2002<br />
zu beurteilen.<br />
Schwermetalle<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Entscheidung der Kommission vom 21. März 2006<br />
über »Sondervorschriften für die Einfuhr von zum Verzehr be -<br />
stim m ten Fischereierzeugnissen aus Indonesien« werden alle Fischer<br />
ei erzeugnisse aus Indonesien im Rahmen der Einfuhrkontrollen<br />
der Grenzkontrollstelle Bremerhaven auf Schwermetalle untersucht.<br />
Diese sind nach VO (EG) 1881/2006 zu beurteilen.<br />
Untersuchungen von Muscheln <strong>und</strong> Muschelerzeugnissen auf<br />
Schwermetalle. Diese sind nach VO (EG) 1881/2006 zu beurteilen.<br />
Tabelle 4.4: Ergebnisse der Untersuchungen zu Ne mato -<br />
den vorkommen in Fischen <strong>und</strong> Fischereierzeugnissen<br />
Probenart Anzahl der<br />
Proben<br />
Seelachs<br />
Wildlachs<br />
Fischereierzeugnisse<br />
19<br />
246<br />
150<br />
Anzahl der Proben<br />
mit vermehrtem<br />
Nematodenanteil<br />
keine<br />
Tabelle 4.5: Schwermetalle in Fischereierzeugnissen aus<br />
Indonesien<br />
Probenart Anzahl der<br />
Proben<br />
Garnelen<br />
Thunfisch<br />
sonstige<br />
Summe<br />
101<br />
20<br />
10<br />
131<br />
68<br />
12<br />
Anzahl der<br />
Höchstmengenüberschreitungen<br />
keine<br />
keine<br />
keine<br />
keine<br />
Tabelle 4.6: Schwermetalle in Muschelerzeugnissen<br />
Probenart Anzahl der<br />
Proben<br />
Muscheln, frisch oder<br />
TK<br />
Muschelkonserven<br />
Summe<br />
7<br />
25<br />
32<br />
Anzahl der<br />
Höchstmengenüberschreitungen<br />
keine<br />
keine<br />
keine
Benzo(a)pyren<br />
Durch Vorbelastung des Ölanteils oder durch Räuchern des Fischanteils<br />
können erhöhte BaP-Konzentrationen auftreten. Diese<br />
sind nach VO (EG) 1881/2006 unter Einbeziehung der VO (EG)<br />
466/2001 zu beurteilen.<br />
Fischartendifferenzierung<br />
In 2007 wurden 30 Proben Frischfisch oder tiefgekühlter Fisch<br />
zur Fischartenbestimmung mittels Isolelektrischer Fokussierung<br />
eingesandt. In vier Fällen konnte die deklarierte Fischart nicht bestä<br />
tigt werden <strong>und</strong> führte zur Beanstandung. Betroffen war in<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.7: Benzo(a)pyren (BaP) in ölhaltigen geräucherten<br />
Fisch-Dauerkonserven<br />
Probenart Anzahl der<br />
Proben<br />
Sprotten<br />
sonstige<br />
Summe<br />
Tabelle 4.8: Fischartendifferenzierung mittels Isolelektrischer Fokussierung<br />
Fischart Anzahl je untersuchter<br />
Deklaration<br />
Viktoriabarschfilet<br />
Heilbuttfilet<br />
Meeresfrüchtesalat<br />
Rotzunge<br />
Tintenfischringe<br />
Rotbarschfilet<br />
Seelachsfilet<br />
Tilapia<br />
Schollenfilet<br />
Seezungenfilet<br />
Hokifilet<br />
Tintenfischtuben<br />
Kalmar<br />
Kabeljaufilet<br />
Plattfischfilet<br />
Schellfischfilet<br />
Summe<br />
Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse Cuxhaven<br />
1<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
4<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
30<br />
26<br />
14<br />
40<br />
Anzahl der BaP-<br />
Höchstmengenüberschreitungen<br />
diesen Fällen jeweils eine Probe Viktoriabarschfilet, Rotbarsch fi -<br />
let, Seelachsfilet <strong>und</strong> Seezungenfilet. In sieben weiteren Fällen war<br />
die Be stätigung fraglich.<br />
bestätigt nicht bestätigt<br />
(beanstandet)<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
1<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
19<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4<br />
fraglich<br />
1<br />
2<br />
4<br />
7<br />
11<br />
3<br />
14<br />
137
138<br />
Eier<br />
Tabelle 4.9: Eier <strong>und</strong> Eiprodukte<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
frische Eier<br />
bunte Eier/gekochte Eier<br />
Flüssigeiprodukte<br />
Summe<br />
Fette <strong>und</strong> Öle<br />
Tabelle 4.10: Fette <strong>und</strong> Öle<br />
140<br />
30<br />
27<br />
197<br />
20<br />
3<br />
0<br />
23 (12%)<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
tierische Fette <strong>und</strong> Öle<br />
pflanzliche Fette <strong>und</strong> Öle<br />
davon<br />
Margarine, Brotaufstriche,<br />
Fettmischungen zum Backen<br />
<strong>und</strong> Braten, Fettglasuren<br />
davon<br />
Frittierfette <strong>und</strong> Frittieröle,<br />
ungebraucht<br />
Frittierfette <strong>und</strong> Frittieröle,<br />
gebraucht<br />
13<br />
218<br />
98<br />
91<br />
114<br />
–<br />
13<br />
4<br />
9<br />
2<br />
1<br />
1<br />
–<br />
30<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
1 Probe: ges<strong>und</strong>heitsschädlich (Salmonellen)<br />
4 Proben: wertgemindert/alt<br />
1 Probe Wachteleier: irreführende ges<strong>und</strong>heitsbezogene<br />
Werbung<br />
14 Proben: Kennzeichnungsmängel<br />
2 Proben: Mindesthaltbarkeitsdatum irreführend, da zu<br />
lang bemessen<br />
1 Probe: Hinweis auf Naturfarben nicht zutreffend, daher<br />
irreführend<br />
Bemerkungen<br />
U: Untersuchungsziele<br />
B: Beurteilungen<br />
U: Identität, trans-Fettsäuren (TFA)<br />
U: Kontaminanten (PAK, Phthalate, halogenierte<br />
Lösungsmittel, Sudanfarbstoff), TFA, Identität,<br />
Nährwertkennzeichnung<br />
B: Höchstmengenüberschreitung (PAK)<br />
B: Kennzeichnungsmängel<br />
U: Konservierungsstoffe, TFA, Nährwertkennzeichnung<br />
B: nicht zum Verzehr geeignet<br />
B: Kennzeichnungsmängel<br />
U: trans-Fettsäuren<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
U: Polare Anteile, polymere Triglyceride, trans-Fettsäuren<br />
B: nicht zum Verzehr geeignet<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig
Suppen <strong>und</strong> Soßen<br />
Tabelle 4.11: Suppen <strong>und</strong> Soßen<br />
Art der Proben Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Suppen aus asiatischen<br />
Gaststätten<br />
Rahmsuppen aus der<br />
Gastronomie<br />
Instantsuppen osteuropäischer<br />
Hersteller<br />
Beschwerde/Verdachtsproben<br />
sonstige Proben<br />
Summe<br />
Mayonnaisen <strong>und</strong> emulgierte Soßen<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
60<br />
8<br />
26<br />
8<br />
138<br />
240<br />
Tabelle 4.12: Mayonnaisen <strong>und</strong> emulgierte Soßen<br />
22<br />
0<br />
4<br />
3<br />
61<br />
90 (37,5%)<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Mayonnaise/Remoulade<br />
aus Gaststätten <strong>und</strong><br />
Imbissbetrieben<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Untersuchungsgr<strong>und</strong> Beurteilung/<br />
Bemerkung<br />
Glutaminsäure Kenntlich -<br />
machung <strong>und</strong> Höchstmen -<br />
geneinhaltung<br />
Milchfettgehalt<br />
gentechnisch veränderte<br />
Anteile von Reis/Soja<br />
abweichender Geruch/Ge -<br />
schmack Fremdkörper<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
die Kenntlichmachung von<br />
Geschmacksverstärkern<br />
bleibt weiterhin ein Pro -<br />
blem; Höchstmengenüber -<br />
schreitung in sechs Proben<br />
der nach allgemeiner<br />
Verkehrsauffassung übliche<br />
Mindestgehalt an Milchfett<br />
lag in allen untersuchten<br />
Proben vor<br />
Nachweis von gentechnisch<br />
verändertem Soja in vier<br />
Proben, davon Gehalte<br />
über 0,9% in einer Probe<br />
zwei Sahnesoßen waren<br />
verdorben, scharfkantiger<br />
Metallsplitter in einem<br />
Fertiggericht<br />
diverse Kennzeichnungs -<br />
mängel (Fehlende QUID-<br />
Angaben, fehlende Füll-<br />
mengenangabe, unvollständiges<br />
Zutatenverzeichnis etc.)<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
27 12 (44%) 5 Proben: Zusatzstoffe (Konservierungsstoffe <strong>und</strong> oder<br />
Süßstoffe nicht kenntlich;<br />
3 Proben irreführend, da Qualitätsanforderungen an<br />
Mayonnaise nicht erfüllt;<br />
3 Proben: mikrobiologische Bemängelung wegen<br />
Hefen/Milchsäurebakterien;<br />
1 Probe: Lagertemperatur zu hoch<br />
139
140<br />
Getreide <strong>und</strong> Getreideerzeugnisse<br />
Tabelle 4.13: Getreide<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Weizen<br />
Roggen<br />
Mais (für Popcorn)<br />
Reis<br />
Amaranth, Buchweizen,<br />
Hirse, Quinoa, Hafer, Gerste<br />
Summe<br />
63<br />
17<br />
11<br />
92<br />
20<br />
203<br />
3 (5%)<br />
2 (12%)<br />
0<br />
17 (18%)<br />
0<br />
22 (11%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
Tabelle 4.14: Getreideprodukte, Backvormischungen, Massen <strong>und</strong> Teige für Backwaren<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Mehle aller Art<br />
Maisgrieß, Polenta<br />
Roggenschrot<br />
Frühstückscerealien<br />
Haferflocken<br />
Müsli<br />
Brotbackmischungen<br />
Backmischungen für Kuchen<br />
139<br />
24<br />
6<br />
45<br />
36<br />
53<br />
49<br />
30<br />
17 (7%)<br />
5 (21%)<br />
2 (33%)<br />
9 (20%)<br />
1 (3%)<br />
8 (15%)<br />
2 (4%)<br />
4 (13%)<br />
Überschreitung der Höchstmenge für Ochratoxin A; falsche<br />
Verkehrsbezeichnung Dinkelreis; Kennzeichnungsmangel<br />
lebende Raupen; Bio mit Pestizidgehalt<br />
nicht zugelassene Reislinie; fehlerhafte Brennwertberechung;<br />
diverse Kennzeichnungsmängel<br />
527<br />
81<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
9x falsche Typenangabe<br />
1x Gespinste<br />
1x Untergewicht<br />
6x Kennzeichnungsmängel<br />
2x Höchstmenge Fumonisine überschritten<br />
2x Schädlingsbefall<br />
1x fehlende Losangabe<br />
1x Überschreitung der Höchstmenge für Ochratoxin A<br />
1x Gespinste <strong>und</strong> Käferbefall<br />
5x falsch bezeichnete Zutat (Eisen)<br />
2x zu geringer Folsäuregehalt<br />
1x Cumaringehalt zu hoch<br />
1x irreführende Fettangabe<br />
1x unzutreffender Fett- <strong>und</strong> Zinkgehalt<br />
3x abweichende Sensorik<br />
1x falscher Eiweißgehalt<br />
1x zu geringer Fruchtgehalt<br />
2x Schädlingsbefall<br />
1x falsche Brennwertangabe<br />
4x Kennzeichnungsmängel
Tabelle 4.15: Brote <strong>und</strong> Kleingebäck<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
Gefahr für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
nicht zum Verzehr geeignet, nicht<br />
sicher<br />
wertgemindert<br />
irreführende Angaben<br />
Zusatzstoffverwendung<br />
Kennzeichnung<br />
Losangabe<br />
Nährwertangabe<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
2<br />
10<br />
6<br />
22<br />
6<br />
59<br />
13<br />
4<br />
490<br />
90<br />
1x Brötchen mit einem Steinchen<br />
1x Dinkel-Kürbisbrot mit einem Glassplitter<br />
6x Befall mit Mehlmotten <strong>und</strong> Gespinsten,<br />
1x nicht näher identifizierbarer Fremdkörper<br />
1x ein Kotstückchen (Maus)<br />
2x abweichende Sensorik<br />
kakaohaltige Fettglasur statt Schokolade, Fremdfett in Buttertoast,<br />
2x verbrannte Kruste bei Graubrot, Brotfehler (große Hohlräume) bei einem<br />
Bauernbrot, parfümig-seifiger Geschmack bei einem Toastbrot<br />
12x Schimmelbefall bei oder vor Erreichen des MHD<br />
4x wertgebende Anteile wie Butter, Buttermilch, Sahne zu niedrig oder nicht<br />
vorhanden<br />
2x deutliches Untergewicht<br />
3x falsche Nährwertangaben (Fett, Ballaststoffe)<br />
1x Angabe »ohne Konservierungsstoffe« obwohl Sorbinsäure vorhanden war<br />
4x Verwendung von Konservierungsstoffen (Propion- <strong>und</strong> Sorbinsäure,<br />
Schwefeldioxid in Früchtebrot) ohne Kenntlichmachung<br />
1x Überschreitung der zulässigen Höchstmenge für Sorbinsäure<br />
1x unzulässige Farbstoffverwendung<br />
vollständig fehlende Kennzeichnung, fehlende Zutaten, fehlendes MHD, fehlende<br />
Quid-Angabe, fehlender Hersteller u.a.<br />
fehlende Losangabe<br />
fehlende oder schlecht lesbare Angaben, falsche Reihenfolge<br />
141
142<br />
Tabelle 4.16: Feine Backwaren<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Baumkuchen<br />
Baumkuchenspitzen<br />
Backwaren aus Biskuit -<br />
masse, Wiener Masse,<br />
Rührmasse <strong>und</strong> Sandmasse<br />
(wie Tortenböden, Tiramisu,<br />
Zitronenkuchen, Sand -<br />
kuchen, Marmorkuchen)<br />
Backwaren aus Ölsamenmasse<br />
(wie Makronen,<br />
Florentiner, Mandel -<br />
hörnchen, Nussecke)<br />
Backwaren mit Nougatbzw.<br />
Nougatkremanteil<br />
Blätterteiggebäck (z. B.<br />
Schweineohren, Baklava)<br />
Croissants<br />
Pl<strong>und</strong>ergebäck<br />
Stollen<br />
Maisfladen<br />
Tortilla Chips<br />
Taco Shells<br />
Feine Backwaren aus Teigen<br />
<strong>und</strong> Massen<br />
(wie Erdbeerkuchen,<br />
Donauwelle, Schwarzwälder<br />
Kirschtorte, Frankfurter<br />
Kranz)<br />
Backwaren für Diabetiker<br />
20<br />
282<br />
114<br />
35<br />
103<br />
60<br />
32<br />
225<br />
108<br />
6 (30%)<br />
86 (30%)<br />
30 (26%)<br />
23 (66%)<br />
22 (21%)<br />
27 (45%)<br />
7 (22%)<br />
121 (54%)<br />
29 (27%)<br />
1.725<br />
531<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
2x irreführende Angaben (QUID-Angabe unzutreffend,<br />
mehrere Zutatenverzeichnisse)<br />
8x Kennzeichnungsmängel (LMKV, LKV, FPackV)<br />
6x als nicht zum Verzehr geeignet (Schimmel, Lösemittelgeruch,<br />
Metallspäne)<br />
16x aufgr<strong>und</strong> mikrobiologischer Kriterien*<br />
2x als irreführend bezeichnet<br />
10x Fettglasur <strong>und</strong> 10x Farbstoff nicht kenntlich gemacht<br />
47x Kennzeichnungsmängel<br />
1x als nicht zum Verzehr geeignet<br />
5x als irreführend bezeichnet<br />
12x Fettglasur, 5x Persipan <strong>und</strong> 1x Farbstoff nicht kenntlich<br />
gemacht<br />
6x Kennzeichnungsmängel<br />
16x als irreführend bezeichnet<br />
12x Fettglasur nicht kenntlich gemacht<br />
3x Kennzeichnungsmängel<br />
* zum mikrobiologischen Status von Feinen Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung siehe auch Kapitel 3<br />
4x irreführende Angaben (Füllung keine Schokolade, irreführende<br />
Bezeichnungen, mehrere Zutatenverzeichnisse)<br />
8x kakaohaltige Fettglasur, 4x Farbstoffe, 3x Persipan<br />
nicht kenntlich gemacht<br />
1x wertgemindert (zu geringer Fettanteil)<br />
7x Kennzeichnungsmängel (LMKV, LKV, FPackV)<br />
26x fehlende/fehlerhafte Angaben nach LMKV (häufig:<br />
fehlende QUID-Angabe von Butter, Zutaten zusammengesetzter<br />
Zutaten wie Citronat, Orangeat, Marzipan/<br />
Persipan nicht aufgeführt)<br />
30x weitere Kennzeichnungsmängel (LKV, FPackV)<br />
3x Höchstmenge Fumonisine erreicht/überschritten<br />
2x GVO-Mais nicht gekennzeichnet<br />
1x abweichender Geschmack<br />
1x Mindergewicht<br />
1x Nährwertkennzeichnung unvollständig<br />
5x weitere Kennzeichnungsmängel (LMKV, LKV, FPackV)<br />
101x aufgr<strong>und</strong> mikrobiologischer Kriterien, Lagertemperatur*<br />
8x wertgemindert (z. B. keine Butterkrem bei Frankfurter<br />
Kranz, kein Alkoholgehalt bei Schwarzwälder Kirschtorte)<br />
18x Farbstoffe, 9x kakaohaltige Fettglasur bzw. Konsum -<br />
streusel, 1x Persipan nicht kenntlich gemacht<br />
1x Kennzeichnungsmängel (LMKV)<br />
1x unzulässiger Saccharose-Zusatz<br />
9x fehlende oder unzureichende Diät-Angaben<br />
10x fehlende Kenntlichmachung des Süssungsmittels<br />
3x unzutreffende Nährwertangaben<br />
18x Kennzeichnungsmängel
Tabelle 4.17: Teigwaren<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
irreführende Angaben<br />
Kennzeichnungsmängel nach<br />
LebensmittelkennzeichnungsVO<br />
Kennzeichnungsmängel nach<br />
LoskennzeichnungsVO<br />
Nährwert-<br />
Kennzeichnungsverordnung<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
7<br />
21<br />
4<br />
3<br />
318<br />
30<br />
Ein als Eiernudel bezeichnetes Erzeugnis wies keinerlei Eianteil auf <strong>und</strong> bei<br />
fünf Proben Eierteigwaren wurden deutlich niedrigere Eigehalte, als im Zu -<br />
tatenverzeichnis deklariert, festgestellt. Bei einer Vollkorn-Teigware wurde<br />
ein deutlich zu niedriger Ballaststoffgehalt festgestellt.<br />
Bei drei Proben fehlte die Angabe des Herstellers oder der Anschrift, bei<br />
sechs Proben war das Zutatenverzeichnis unzureichend oder unvollständig,<br />
eine unzureichende Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums wurde bei 14<br />
Teigwaren festgestellt. Bei einer Probe fehlte die Quidangabe, die Anfor -<br />
derung an das Sichtfeld war bei drei Proben nicht erfüllt.<br />
nicht, bzw. schwer lesbare Angaben<br />
unzureichende <strong>und</strong> fehlende Angaben<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
143
144<br />
Nüsse <strong>und</strong> Ölsamen<br />
Tabelle 4.18: Nüsse <strong>und</strong> Ölsamen<br />
Produktgruppe Untersuchungsschwerpunkte Anzahl der<br />
Proben<br />
Schalenfrüchte (wie<br />
Cashewnüsse, Erdnüsse,<br />
Macadamianüsse,Mandeln,<br />
Haselnüsse, Pistazien,<br />
Walnüsse)<br />
süße Aprikosenkerne<br />
frische Maronen<br />
Sesamsaat,<br />
Sesampaste (Tahin)<br />
weitere Ölsamen (Lein sa -<br />
men, Sonnenblumenkerne,<br />
Kürbiskerne, Melonen -<br />
kerne)<br />
Mohnsamen siehe Kapitel 3<br />
Nuss-Fruchtmischungen<br />
Importkontrollen aufgr<strong>und</strong><br />
von Sondervorschriften<br />
sonstige Erzeugnisse<br />
wie z. B. Kokoserzeugnisse,<br />
gekochte Maronen<br />
Summe<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine,<br />
Ochratoxin A),<br />
bromhaltige Begasungsmittel,<br />
Schwermetalle,<br />
Isotopenanalyse (Herkunftsnachweis bei<br />
Pistazien),<br />
polycyclische aromatische Kohlenwasser -<br />
stoffe PAK (bei Macadamianüssen)<br />
Blausäure<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine,<br />
Ochratoxin A),<br />
bromhaltige Begasungsmittel,<br />
Schwermetalle<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine,<br />
Ochratoxin A),<br />
Salmonellen<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine,<br />
Ochratoxin A),<br />
Schwermetalle<br />
Zusatzstoffe wie Schwefeldioxid,<br />
Farbstoffe<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine)<br />
je nach Produkt Zusatzstoffe <strong>und</strong>/oder<br />
Mykotoxine<br />
(Aflatoxine,Ochratoxin A),<br />
Keimstatus<br />
166<br />
8<br />
15<br />
28<br />
29<br />
13<br />
6<br />
44<br />
309<br />
Beanstandungen/<br />
Bemängelung<br />
25 (15%)<br />
0 (0%)<br />
10 (67%)<br />
10 (36%)<br />
8 (28%)<br />
8 (62%)<br />
2 (33%)<br />
6 (14%)<br />
67 (22%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
3x Aflatoxin-Höchstmengenüberschreitungen<br />
bei Haselnüssen, Pistazien <strong>und</strong> Erdnüssen<br />
1x Höchstmengenüberschreitung bromhaltiger<br />
Begasungsmittel bei Pistazien<br />
8x wertgemindert durch sensorische<br />
Mängel<br />
1x irreführende Bezeichnung: Haselnüsse<br />
statt Erdnüsse<br />
1x Walnüsse aufgr<strong>und</strong> eines hohen Anteils<br />
an kleinen Nüssen<br />
2x irreführende Herkunftsangaben bei<br />
Pistazien<br />
10x Kennzeichnungsmängel<br />
2x Höchstmengenüberschreitung bromhaltiger<br />
Begasungsmittel<br />
7x verdorben durch lebende Maden <strong>und</strong><br />
hohen Anteil an verdorbenen Maronen<br />
3x wertgemindert (Gehalt an unbrauchbar<br />
en Maronen über der Toleranz)<br />
3x ges<strong>und</strong>heitsschädlich durch Salmonellen<br />
bei Sesamsaat<br />
1x wertgemindert durch sensorische<br />
Mängel<br />
6x Kennzeichnungsmängel<br />
2x Melonenkerne mit fehlender Zutat<br />
Kochsalz <strong>und</strong> Citronensäure<br />
2x Sonnenblumenkerne verdorben, ungenießbar<br />
ranzig, medizinisch-phenolisch<br />
(2,4-Dichlorphenol nachweisbar)<br />
1x wertgemindert durch sensorische<br />
Mängel<br />
3x Kennzeichnungsmängel<br />
4x irreführende Gehaltsangaben zu Zutaten<br />
1x irreführende Angabe zum Vitamin C-<br />
Gehalt<br />
3x Kennzeichnungsmängel<br />
Zurückweisungen von Partien aufgr<strong>und</strong><br />
hoher Aflatoxingehalte:<br />
1x Haselnüsse aus der Türkei<br />
1x Pistazien aus der Türkei<br />
1x verdorbene Kokosnuss (alt, faulig)<br />
3x gekochte, verzehrfertige Maronen mit<br />
Kennzeichnungsmängeln<br />
2x Hygienemängel bei Kokoserzeugnissen<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig
Obsterzeugnisse<br />
Tabelle 4.19: Obsterzeugnisse<br />
Produktgruppe Untersuchungsschwerpunkte Anzahl der<br />
Proben<br />
Obstkonserven<br />
zubereitetes<br />
frisches Obst<br />
getrocknete Feigen<br />
getrocknete Datteln<br />
sonstiges<br />
Trockenobst<br />
wie Aprikosen,<br />
Pflaumen,<br />
Sultaninen<br />
Orangeat, Zitronat<br />
sonstige Obsterzeugnisse<br />
(Fruchtaufstriche <strong>und</strong> Kon -<br />
fitüren siehe Kapitel 3)<br />
Summe<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Zusatz von Aromastoffen,<br />
Zuckerkonzentrationsstufe,<br />
Eisen,<br />
Zinn<br />
Lagerung an der Verkaufsstelle,<br />
Sensorik,<br />
Keimstatus<br />
Schädlings- <strong>und</strong> Schimmelbefall,<br />
Mykotoxine (Aflatoxine, Ochratoxin A)<br />
Schädlings- <strong>und</strong> Schimmelbefall,<br />
Mykotoxine (Aflatoxine, Ochratoxin A)<br />
Schädlings- <strong>und</strong> Schimmelbefall,<br />
Mykotoxine (Aflatoxine, Ochratoxin A)<br />
Schwefeldioxid/Sulfite,<br />
Konservierungsstoffe<br />
Schwefeldioxid/Sulfite,<br />
Konservierungsstoffe<br />
Zusatzstoffe<br />
106<br />
26<br />
24<br />
19<br />
86<br />
18<br />
35<br />
314<br />
Beanstandungen/<br />
Bemängelung<br />
18 (17%)<br />
10 (38%)<br />
16 (67%)<br />
11 (58%)<br />
20 (23%)<br />
4 (22%)<br />
9 (26%)<br />
88 (28%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
4x wertgemindert durch sensorische Mängel<br />
14x Kennzeichnungsmängel (darunter 2x<br />
nicht deklarierte Aromastoffe)<br />
1x zu geringes Abtropfgewicht<br />
3x keine Kühllagerung<br />
2x überhöhte Gesamtkeimzahl<br />
1x Lysteria monocytogenes<br />
6x Kennzeichnungsmängel<br />
1x ekelerregend durch lebende Milben<br />
3x wertgemindert durch Schimmel oder<br />
sensorische Mängel<br />
4x Höchstmengen für Mykotoxine überschritten<br />
(3x Aflatoxine, 1x Ochratoxin A)<br />
13x Kennzeichnungsmängel<br />
6x wertgemindert durch Schädlingsbefall<br />
oder Schimmel<br />
1x Höchstmenge für Aflatoxin überschritten<br />
7x Kennzeichnungsmängel<br />
1x Untergewicht<br />
4x wertgemindert durch sensorische<br />
Mängel<br />
14x Kennzeichnungsmängel (darunter 2x<br />
nicht deklarierte Schwefelung, 3x fehlende<br />
Allergenkennzeichnung für Schwefeldioxid/Sulfit)<br />
3x Untergewicht<br />
4x Kennzeichnungsmängel<br />
2x Höchstmenge für Schwefeldioxid überschritten<br />
8x Kennzeichnungsmängel (darunter 1x<br />
nicht deklarierte Schwefelung)<br />
1x Untergewicht<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
145
146<br />
Honig, Imkereierzeugnisse <strong>und</strong> süße Brotaufstriche<br />
Tabelle 4.20: Honig<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
unzureichende Beschaffenheit nach<br />
HonigVO<br />
ungerechtfertigte Trachtangabe<br />
fehlende oder unzureichende<br />
Herkunftsangabe<br />
irreführende Angaben<br />
Kennzeichnungsmängel nach<br />
LebensmittelkennzeichnungsVO<br />
Kennzeichnungsmängel nach<br />
LoskennzeichnungsVO<br />
14<br />
13<br />
33<br />
26<br />
60<br />
8<br />
301<br />
98<br />
Bei einem als »Honig mit Wabe« bezeichneten Erzeugnis handelte es sich<br />
nicht um einen Honig. Der zulässige HMF-Gehalt wurde bei sieben Ho ni -<br />
gen überschritten. Verunreinigung mit Stärke, Hefen oder Fremdpartikeln<br />
führten bei drei Erzeugnissen zu einer Beanstandung. Bei vier Honigen<br />
wur de eine Verfälschung mit C4-Zucker festgestellt.<br />
Sieben Honige erfüllten nicht die Qualitätsanforderung für »kalt geschleudert«<br />
der Leitsätze für Honig.<br />
Aussagen wie »Ohne Wärmeschädigung«, »Naturprodukt«, »Ausgereift«,<br />
»Rein <strong>und</strong> Natürlich«, »Naturbelassen« wurden als Werbung mit<br />
Selbstverständlichkeit beurteilt.<br />
Eine fehlende bzw. unzureichende Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums<br />
wurde bei 42 Honigen beanstandet. Die Anforderung an das Sichtfeld war<br />
bei 30 Honigen nicht erfüllt.<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig
Tabelle 4.22: Süße Brotaufstriche<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Erdnusscreme<br />
Zuckerrübensirup<br />
Nuss-Nougat-Creme<br />
andere wie z. B. Heller<br />
Sirup, Süßmolkencreme,<br />
Streifencreme<br />
Summe<br />
Honiguntersuchungen im Institut für Bienen -<br />
k<strong>und</strong>e Celle<br />
Insgesamt wurden 1.821 Proben chemisch-physikalisch <strong>und</strong>/ oder<br />
mikroskopisch untersucht. Die Zahl gliederte sich in 328 For schungsproben,<br />
637 Orientierungsproben, 425 Marktkontrollen sowie<br />
diverse andere Fragestellungen, die nicht im Rahmen der amtlichen<br />
Lebensmittelüberwachung durchgeführt wurden.<br />
Tabelle 4.21: Rückstandsuntersuchungen pharmakologisch<br />
wirksamer Stoffe in Honig<br />
Untersuchung auf Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Nitrofuran<br />
Tetracycline<br />
Sulfonamide<br />
Streptomycin<br />
Chloramphenicol<br />
andere Rückstände<br />
26<br />
37<br />
37<br />
42<br />
37<br />
9<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
8<br />
13<br />
35<br />
24<br />
80<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
2<br />
8<br />
11 (14%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Kennzeichnungsmängel nach LebensmittelkennzeichnungsVO<br />
Kennzeichnungsmängel nach LebensmittelkennzeichnungsVO<br />
Kennzeichnungsmängel nach Lebensmittelkennzeichnungs<strong>und</strong><br />
NährwertkennzeichnungsVO<br />
147
148<br />
Fertiggerichte, zubereitete Speisen<br />
Tabelle 4.23: Fertiggerichte <strong>und</strong> zubereitete Speisen<br />
Art der Proben Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Fertigpackungen mit<br />
Nährwertangaben<br />
Pizzen, Baguette,<br />
Blätterteigrollen mit<br />
Schafskäse/Feta<br />
Fertiggerichte/zubereitete<br />
Menüs mit Reis oder<br />
Fleischersatz auf Sojabasis<br />
Frühlingsrollen <strong>und</strong> andere<br />
zubereitete Speisen aus asiatischen<br />
Gaststätten<br />
gekochter Reis/gekochte<br />
Nudeln aus Gaststätten<br />
Beschwerde-/Verdachts-/<br />
Verfolgsproben<br />
sonstige Proben<br />
Summe<br />
109<br />
18<br />
45<br />
35<br />
41<br />
21<br />
474<br />
743<br />
11<br />
7<br />
2<br />
22<br />
24<br />
6<br />
72<br />
144 (19%)<br />
Untersuchungsgr<strong>und</strong> Beurteilung/<br />
Bemerkung<br />
Überprüfung der Nähr wert -<br />
angaben (Hauptnährstoffe,<br />
Vitamine, Mineralstoffe)<br />
Tierart<br />
Gentechnisch veränderte<br />
Anteile an Reis oder Soja<br />
Glutamat: Kenntlich mach -<br />
ung, Einhaltung von<br />
Höchst mengen<br />
mikrobilogischer Status,<br />
Hygienemängel<br />
Relativ häufige Abweichung<br />
von deklarierten <strong>und</strong> festgestellten<br />
Nährstoffgehalten.<br />
In den Beanstandungsfällen<br />
lag kein Schafskäse vor. Auch<br />
Feta-Käse muss nach der<br />
VO(EG) 1829/2002 vom 14.<br />
Oktober 2002 aus Schafsoder<br />
Ziegenkäse bestehen.<br />
In zwei Fällen Nachweis von<br />
gentechnisch verändertem<br />
Soja. Die Gehalte lagen un -<br />
ter 0,9% GVO-Reis wur de in<br />
keiner Probe nachgewiesen.<br />
Die Kenntlichmachung von<br />
Geschmacksverstärkern bleibt<br />
weiterhin ein Problem; Höchst -<br />
mengenüberschreitung in vier<br />
Proben.<br />
Einzelheiten siehe unter<br />
Tabelle 4.51<br />
Diverse Kennzeichnungsmän -<br />
gel: fehlende QUID-Angaben,<br />
unvollständige Zutatenver -<br />
zeichnisse, nicht rechtskonforme<br />
Verkehrsbezeichnung<br />
von Zutaten, fehlendes oder<br />
unleserliches MHD, fehlen de<br />
Loskennzeichnung etc.<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig
Nahrungsergänzungsmittel<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.24: Sportlernahrung, EbD, Diät-Lebensmittel in Kapsel-/Tablettenform<br />
Lebensmittel Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Sportlernahrung<br />
kalorienarme Ernährung<br />
bilanzierte Diäten (vollst.<br />
<strong>und</strong> ergänz.)<br />
Diät-LM in Kapsel-/<br />
Tablettenform<br />
Summe<br />
43<br />
18<br />
5<br />
9<br />
75<br />
9<br />
6<br />
3<br />
7<br />
25 (33%)<br />
Beurteilung/<br />
Bemerkung<br />
Fehlende Kenntlichmachung von Zusatzstoffen,<br />
Verwendung von nicht zugel. Zusatzstoffen,<br />
Gen-Soja nachgewiesen,<br />
Irreführende Angaben von Nährstoffgehalten bzw. zu<br />
Inhaltsstoffen,<br />
Fehlende bzw. unzureichende Kennzeichnung i.S. der Diät<br />
V sowie LMKV<br />
Anforderungen der DiätV nicht erfüllt,<br />
Irreführende Angaben von Nährstoffgehalten,<br />
Gen-Soja nachgewiesen,<br />
Fehlerhafte Kennzeichnung,<br />
Fehlende Kenntlichmachung von Zusatzstoffen,<br />
Verwendung neuartiger Lebensmittel,<br />
Angabe wissenschafftlich nicht gesicherter Aussagen<br />
Wissenschaftlich nicht gesicherte Angaben,<br />
krankheitsbezogene Angaben,<br />
Anschein eines Arzneimittels,<br />
unzulässige Verwendung von Zusatzstoffen,<br />
fehlerhafte Kennzeichnung,<br />
Artischockenblätter kein Lebensmittel<br />
Diäteignung nicht gegeben,<br />
Zimtextrakt-haltige Präparate keine Lebensmittel<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
149
150<br />
Säuglingsnahrung<br />
Tabelle 4.25: Aufstellung der Proben Säuglings- <strong>und</strong> Kleinkindernahrung, die zu Beanstandungen führten<br />
Anzahl der<br />
Beanstandungen wegen<br />
nicht der Diätverordnung<br />
entsprechender<br />
Zusammensetzung<br />
unzutreffender<br />
Nährwertangaben<br />
unzulässiger Angaben nach<br />
Diätverordnung<br />
irreführender Angaben<br />
Werbung mit<br />
Selbstverständlichkeiten<br />
nicht gerechtfertigter An -<br />
gabe »natriumreduziert«,<br />
»salzreduziert«<br />
nicht gerechtfertigter An -<br />
gabe »ohne Kristallzucker«<br />
fehlerhafter Kennzeichnung<br />
nach Diätverordnung<br />
fehlerhafter Kennzeichnung<br />
nach Lebensmittelkenn -<br />
zeichnungsVO<br />
fehlerhafter Kennzeichnung<br />
nach Nährwertkennzeich -<br />
nungsVO<br />
fehlender<br />
Loskennzeichnung<br />
Summe<br />
gesamt,<br />
davon<br />
8<br />
54<br />
3<br />
8<br />
6<br />
18<br />
14<br />
17<br />
12<br />
70<br />
1<br />
211<br />
Säuglingsanfangsnahrung<br />
1<br />
11<br />
3<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
1<br />
2<br />
2<br />
–<br />
20<br />
Folgenahrung<br />
für<br />
Säuglinge<br />
2<br />
11<br />
–<br />
–<br />
1<br />
–<br />
14<br />
14<br />
3<br />
26<br />
–<br />
71<br />
Getreidebeikost<br />
2<br />
10<br />
–<br />
–<br />
3<br />
–<br />
–<br />
–<br />
1<br />
14<br />
–<br />
30<br />
Komplettmahlzeiten<br />
1<br />
9<br />
–<br />
2<br />
–<br />
17<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
6<br />
–<br />
35<br />
Beikost auf<br />
Obst-/Gemüsebasis<br />
2<br />
7<br />
–<br />
4<br />
–<br />
1<br />
–<br />
–<br />
3<br />
15<br />
–<br />
32<br />
Teeerzeugnisse<br />
–<br />
3<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
2<br />
2<br />
–<br />
1<br />
8<br />
Andere<br />
Säuglings-/<br />
Kleinkindernahrung<br />
–<br />
3<br />
–<br />
2<br />
2<br />
–<br />
–<br />
–<br />
1<br />
7<br />
–<br />
15<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg
Getränke/Wasser<br />
Tabelle 4.26: Fruchtsäfte, Fruchtnektare einschließlich Diätnektare<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
verdorben, nicht sicher<br />
wertgemindert<br />
Zusatzstoffverwendung<br />
Authentizität<br />
irreführende Angaben<br />
Kennzeichnungsmängel<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
3<br />
14<br />
14<br />
4<br />
48<br />
88<br />
611<br />
120 (20%)<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
verdorben, nicht sicher<br />
wertgemindert<br />
Zusatzstoffverwendung<br />
irreführende Angaben<br />
Kennzeichnungsmängel<br />
13<br />
10<br />
31<br />
75<br />
180<br />
1 Probe: erhöhter Patulingehalt; 2 Proben: Pilzmycel<br />
3 Proben: gegoren, erhöhter Gehalt an Milchsäure, Gluconsäure<br />
3 Proben: Hitzeschädigung, erhöhter HMF-Gehalt sensorisch abweichend<br />
8 Proben: zu wenig Vitamin C<br />
4 Proben: Nachweis eines nicht zugelassenen Konservierungsstoffes<br />
1 Probe: eines Farbstoffes;<br />
8 Proben: fehlende Kennzeichnung Antioxidationsmittel Ascorbinsäure<br />
Nachweis von Zitrussaft in einem Maracujanektar, Apfelsaftzusatz in einem<br />
Granatapfelsaft, Wasserzusatz in einem Sandornsaft, Fremdfruchtzusatz in<br />
einem Erdbeernektar<br />
unzutreffende Frucht-, Vitamin-, Natrium-, Eisengehalte; unzutreffende<br />
Angaben: »zuckerfrei«, »für Diabetiker geeignet«, Werbungen mit<br />
Selbstverständlichkeiten<br />
fehlende <strong>und</strong> unzureichende Nährwertkennzeichnung; fehlende <strong>und</strong> un zureichende<br />
Fruchtgehaltsangaben; fehlende Angaben von Klassennamen <strong>und</strong><br />
Zutatenmengen, unvollständiges Zutatenverzeichnis, sonstige Kenn zeich -<br />
nungs mängel<br />
Tabelle 4.27: alkoholfreie Erfrischungsgetränke, wie Fruchtsaftgetränke, Limonaden, Brausen, Fruchtsaftschorlen,<br />
Energydrinks, Eisteegetränke u.v.m. einschließlich der diätetischen Getränke<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
708<br />
222 (31%)<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
6 Proben: mikrobiell verdorben, Fehlaroma durch mikrobiell bedingten<br />
Abbau von Sor binsäure; deutliche Fremdnoten, gärig, Fremdkörper, muffiger<br />
Geruch<br />
terpeniger Geruch <strong>und</strong> Geschmack; erhöhter Alkohol-, Milchsäuregehalt;<br />
zu geringer Koffeingehalt in Colagetränken; fehlendes Punschgewürz in<br />
Punschgetränken; zu geringer Vitamin C-Gehalt<br />
3 Proben: Höchstmengenüberschreitungen von Süßstoffgehalten; fehlende<br />
Kennzeichnung von Süßstoffen, Farbstoffen, Konservierungsstoffen <strong>und</strong><br />
des Antioxidationsmittels Ascorbinsäure<br />
irreführende Verkehrsbezeichnungen, Fruchtabbildungen, Fruchtgehaltsan -<br />
gaben, Hinweise auf Energie, Angabe zuckerfrei, Tauringehalte, Natrium -<br />
gehalte, Vitamin C-Gehalte <strong>und</strong> Geschmacksangaben<br />
31 Proben: Fehlende <strong>und</strong> unzureichende Nährwertkennzeichnung;<br />
20 Proben: fehlende Angaben von Zutatenmengen; unzureichendes Zu ta ten -<br />
ver zeichnis; fehlende deutsche Kennzeichnung; unzureichende Diät kenn -<br />
zeich nung; sonstige Kennzeichnungsmängel<br />
151
152<br />
Tabelle 4.28: Wein, Perlwein, Schaumwein, Federweißer<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
sensorisch fehlerhaft<br />
unzulässige önologische Verfahren<br />
mangelnde Identität<br />
irreführende <strong>und</strong> unzutreffende<br />
Angaben/Aufmachung<br />
nicht vorschriftsmäßige/<br />
fehlende Angaben<br />
32<br />
4<br />
18<br />
16<br />
102<br />
590<br />
153 (26%)<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
7x oxidativ (überlagert), 15x untypische Alterungsnote <strong>und</strong> oxidativ, 3x<br />
untypische Alterungsnote, 2x essigstichig, 3x Korkgeschmack, 1x trüb, 1x<br />
Kohlensäure zu gering <strong>und</strong> oxidativ<br />
3x Natriumgehalt zu hoch <strong>und</strong>/oder Calciumgehalt zu niedrig (Einfuhr -<br />
untersuchung), 1x Grenzwert für Sorbinsäure überschritten, 1x Zusatz von<br />
Versanddosage (aromatischer Qualitätsschaumwein)<br />
8x mit Prüfanalyse nicht identisch (deutsche Qualitätsweine), 10x mit<br />
Einfuhranalyse nicht identisch (Einfuhruntersuchung)<br />
7x Alkoholgehaltsangabe, 2x falsches Herkunftsland, 1x Rotspon ohne<br />
Holzfasslagerung, 2x Pseudo-Anbaugebiete, 2x verwechselbar mit<br />
Flaschenimport, 1x unterschiedliche Rebsortenangabe, 1x fehlende<br />
Verkehrsbezeichnung<br />
6/40x Allergenkennzeichnung fehlt/nicht korrekt, 20x andere fehlende<br />
Pflichtangaben, 3x unzulässige Rebsorten- <strong>und</strong> Jahrgangsangabe,<br />
Angabe »mit zugesetzter Kohlensäure« unzureichend, Hinweis auf<br />
Medaille unzulässig, Loskennzeichnung fehlt/nicht korrekt, u. a.<br />
Tabelle 4.29: Likörwein, Erzeugnisse aus Wein (aromatisierter Wein, aromatisierte weinhaltige Getränke (Glühwein,<br />
Sangria) <strong>und</strong> aromatisierte weinhaltige Cocktails), weinhaltige Getränke, alkoholfreier <strong>und</strong> alkoholreduzierter Wein<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
alle Erzeugnisse außer<br />
nachstehende<br />
Glühwein/Punsch (lose, vom<br />
Weihnachtsmarkt)<br />
Summe<br />
16<br />
15<br />
31 (19%)<br />
3x Alkoholangabe falsch, 3x unzutreffende Bezeichnung, 2x verständliche<br />
deutsche Verkehrsbezeichnung fehlt, 1x Aufmachung verwechselbar mit<br />
Asti Spumante, 1x Herstellungsangabe irreführend, 1x Sangria als Glühwein<br />
ausgelobt, 6x Anschrift des Inverkehrbringers fehlt, diverse andere Kenn -<br />
zeichnungsmängel (Los/Allergenkennzeichnung fehlt bzw. unzureichend<br />
u. a.)<br />
10x Mindestalkoholgehalt unterschritten, 2x Kupfergehalt zu hoch, 2x ausgelobter<br />
Alkoholgehalt unterschritten, 2x Verkehrsbezeichnung fehlt, 2x<br />
Fruchtglühwein als Glühwein bezeichnet
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.30: Fruchtwein, Fruchtperlwein, Erzeugnisse aus Fruchtwein (Frucht-Glühwein, Fruchtwein-Bowle,<br />
Fruchtwein-Cocktail u. a.)<br />
Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
alle Erzeugnisse 20 (29%) 4x wertgemindert, 2x Alkoholangabe falsch, 5x Verkehrsbezeichnung<br />
nicht rechtskonform, 1x Farbstoff nicht kenntlich gemacht, 1x Angabe<br />
»Natur produkt« irreführend, fehlende/unzureichende Angaben (z. B. An -<br />
schrift des Inverkehrbringers, Los- <strong>und</strong> Allergenkennzeichnung)<br />
Tabelle 4.31: Bier, bierähnliche Getränke einschließlich Diätbier<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
Bier in Fertigpackungen<br />
(Schankbier, Vollbier,<br />
Starkbier, Diätbier)<br />
alkoholfreies Bier/<br />
Malztrunk<br />
Biermischgetränke<br />
loses Bier aus der<br />
Gastronomie<br />
Summe<br />
210<br />
26<br />
55<br />
37<br />
328<br />
75<br />
3<br />
12<br />
3<br />
93 (28%)<br />
Beurteilung/Bewertung<br />
1 Probe: Geruch nach Schimmel; 4 Proben: zu geringe<br />
Stammwürze; 2 Proben: unzulässige Zutaten; 2 Proben:<br />
mit ges<strong>und</strong>heitsbezogener Werbung; 4 Proben: irreführende<br />
Angaben; allgemeine Kennzeichnungsmängel<br />
2 Proben: nicht zum Verzehr geeignet (Geruch nach<br />
Chlor); 1 Probe: zu geringe Stammwürze<br />
3 Proben: nicht zum Verzehr geeignet (Bombage); 2 Pro -<br />
ben: irreführende Angaben; je 1 Probe: fehlende Angabe<br />
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, fehlende Nähr wert -<br />
kennzeichnung; allgemeine Kenn zeichnungsmängel<br />
3 Proben: Hygienemängel (erhöhte Keimzahlen, Hefen)<br />
153
154<br />
Tabelle 4.32: Spirituosen<br />
Gesamtanzahl der untersuchten Proben<br />
davon beanstandet<br />
wertgemindert<br />
Höchstmengenüberschreitung<br />
irreführende <strong>und</strong> unzutreffende<br />
Angaben<br />
fehlende Angaben<br />
2<br />
1<br />
45<br />
52<br />
387<br />
65 (17%)<br />
Beanstandungsgr<strong>und</strong> Beanstandungen/Bemängelungen Beurteilung/Bemerkung<br />
Mineral-, Quell- <strong>und</strong><br />
Tafelwasser, abgefülltes<br />
Trinkwasser<br />
loses Wasser aus Spendern<br />
(Water-Cooler <strong>und</strong> leitungsgeb<strong>und</strong>ene<br />
Systeme)<br />
Wasser für<br />
Lebensmittelbetriebe<br />
Summe<br />
291<br />
40<br />
14<br />
345<br />
90<br />
7<br />
10<br />
mit Fremdpartikeln verunreinigt <strong>und</strong> Alkoholgehalt zu gering<br />
Methanolgehalt zu hoch<br />
2x in Getränkekarte genannte Markenspirituose durch andere Spirituose<br />
ersetzt, 19x falsche Alkoholangabe, 6x irreführende Aufmachung, 19x<br />
falsche oder nicht rechtskonforme Verkehrsbezeichnungen<br />
2x Anschrift, 1x Alkoholgehalt, 3x Farbstoffe, 1x Glycyrhizin, 1x Allergen-<br />
Kennzeichnung Schwefeldioxid, 17x Los-Kennzeichnung, 3x Füllmenge,<br />
sonstige Kennzeichnungsmängel<br />
Tabelle 4.33: Mineral-, Quell- <strong>und</strong> Tafelwasser abgefülltes Trinkwasser, Wasser für Lebensmittelbetriebe<br />
Warenbezeichnung Anzahl der Proben Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
107 (31%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
1 Probe: Reste von Spüllauge; 9 Proben: nicht zum Verzehr<br />
geeignet (Fremdkörper, Fremdgeruch, Lösungsmittelrück -<br />
stände); 5 Proben: Wertminderung (Trübungen); 7 Proben:<br />
Höchstmengenüberschreitungen (Arsen, Selen, Barium,<br />
Mangan, Bromat); 5 Proben: Ozonisierungsverfahren nachgewiesen;<br />
14 Proben: fehlende oder fehlerhafte Quellan -<br />
gaben; 39 Proben: von der Kennzeichnung abweichende<br />
Mineralisierung; 9 Proben: irreführende Angaben; allgemeine<br />
Kennzeichnungsmängel<br />
Hygienemängel (Coliforme Keime, erhöhte Keimzahl)<br />
1 Probe: E. coli (Fäkalindikator), 9 Proben: Hygienemängel<br />
(Coliforme Keime, erhöhte Keimzahl, Enterokokken)<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig
4.2 Spezielle Untersuchungen<br />
Pestizide<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.34: Ergebnisse der Schwerpunktuntersuchungen von Obst <strong>und</strong> Gemüse auf Pestizide (Teil 1)<br />
Lebensmittel<br />
Erdbeeren<br />
Strauchbeeren<br />
Trauben<br />
Äpfel<br />
Birne<br />
Pflaumen<br />
Kirschen<br />
anderes Steinobst<br />
Clementine<br />
andere Zitrusfrüchte<br />
Rhabarber<br />
Ananas<br />
Banane<br />
Kiwi<br />
Kaki/Sharon<br />
Physalis<br />
Karambole<br />
Avocado<br />
Andere exotische<br />
Früchte<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
* Anzahl der Pestizide pro Probe<br />
153<br />
89<br />
139<br />
117<br />
19<br />
124<br />
48<br />
78<br />
100<br />
73<br />
28<br />
21<br />
33<br />
48<br />
21<br />
19<br />
15<br />
21<br />
8<br />
ohne Pestizidbef<strong>und</strong><br />
5 (3%)<br />
30 (34%)<br />
20 (14%)<br />
12 (10%)<br />
7 (37%)<br />
48 (39%)<br />
14 (29%)<br />
19 (24%)<br />
11 (11%)<br />
25 (34%)<br />
28 (100%)<br />
2 (10%)<br />
2 (6%)<br />
16 (33%)<br />
13 (62%)<br />
14 (74%)<br />
4 (27%)<br />
17 (81%)<br />
7 (88%)<br />
mit Pestizidbef<strong>und</strong><br />
148 (97%)<br />
59 (66%)<br />
119 (86%)<br />
105 (90%)<br />
12 (63%)<br />
76 (61%)<br />
34 (71%)<br />
59 (76%)<br />
89 (89%)<br />
48 (66%)<br />
–<br />
19 (90%)<br />
31 (94%)<br />
32 (67%)<br />
8 (38%)<br />
5 (26%)<br />
11 (73%)<br />
4 (19%)<br />
1 (13%)<br />
davon<br />
mit Mehrfachrück<br />
ständen<br />
17 (11%) 2-8 *<br />
49 (55%) 2-6 *<br />
37 (27%) 2-9 *<br />
93 (79%) 2-7 *<br />
5 (26%) 2-7 *<br />
27 (22%) 2-5 *<br />
24 (50%) 2-6 *<br />
37 (47%) 2-5 *<br />
88 (88%) 2-8 *<br />
44 (60%) 2-7 *<br />
–<br />
18 (86%) 2-4 *<br />
25 (76%) 2-4 *<br />
10 (21%) 2-3 *<br />
–<br />
–<br />
3 (20%) 2-4 *<br />
–<br />
1 (13%) 8 *<br />
mit Höchstmengen -<br />
überschreitungen<br />
1 (1%)<br />
4 (4%)<br />
5 (4%)<br />
–<br />
–<br />
3 (2%)<br />
–<br />
5 (6%)<br />
6 (6%)<br />
5 (7%)<br />
–<br />
–<br />
–<br />
2 (4%)<br />
2 (10%)<br />
–<br />
1 (7%)<br />
–<br />
1 (13%)<br />
155
156<br />
Tabelle 4.34: Ergebnisse der Schwerpunktuntersuchungen von Obst <strong>und</strong> Gemüse auf Pestizide (Teil 2)<br />
Lebensmittel<br />
Kartoffeln<br />
Spargel<br />
anderes Sprossgemüse<br />
Möhren<br />
Radieschen<br />
Tomate<br />
Paprika<br />
Melonen<br />
anderes Fruchtgemüse<br />
Grünkohl<br />
Rosenkohl<br />
Chinakohl<br />
anderes Kohlgemüse<br />
Eisbergsalat<br />
Kopfsalat<br />
Feldsalat<br />
Rucola<br />
andere Salate<br />
weiteres Gemüse<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
* Anzahl der Pestizide pro Probe<br />
73<br />
125<br />
18<br />
86<br />
36<br />
26<br />
71<br />
87<br />
22<br />
48<br />
44<br />
22<br />
20<br />
31<br />
18<br />
24<br />
16<br />
16<br />
21<br />
ohne Pestizidbef<strong>und</strong><br />
60 (82%)<br />
119 (95%)<br />
18 (100%)<br />
37 (43%)<br />
23 (64%)<br />
6 (23%)<br />
30 (42%)<br />
21 (24%)<br />
13 (59%)<br />
30 (62%)<br />
8 (18%)<br />
16 (73%)<br />
7 (35%)<br />
15 (48%)<br />
4 (22%)<br />
5 (21%)<br />
2 (13%)<br />
10 (63%)<br />
10 (48%)<br />
mit Pestizidbef<strong>und</strong><br />
13 (18%)<br />
6 (5%)<br />
–<br />
49 (57%)<br />
13 (36%)<br />
20 (77%)<br />
41 (58%)<br />
66 (76%)<br />
9 (41%)<br />
18 (38%)<br />
36 (82%)<br />
6 (27%)<br />
13 (65%)<br />
16 (52%)<br />
14 (78%)<br />
19 (79%)<br />
14 (87%)<br />
6 (37%)<br />
11 (52%)<br />
davon<br />
mit Mehrfachrückständen<br />
–<br />
–<br />
–<br />
28 (33%) 2-5 *<br />
3 (8%) 2-4 *<br />
10 (38%) 2-5 *<br />
24 (34%) 2-6 *<br />
36 (41%) 2-6 *<br />
5 (23%) 2-3 *<br />
9 (19%) 2-5 *<br />
20 (45%) 2-5 *<br />
2 (9%) 2-6 *<br />
7 (35%) 2-6 *<br />
13 (42%) 2-9 *<br />
11 (61%) 2-8 *<br />
10 (42%) 2-5 *<br />
11 (69%) 2-7 *<br />
5 (31%) 2-4 *<br />
6 (29%) 2-6 *<br />
mit Höchstmengen -<br />
überschreitungen<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
–<br />
–<br />
–<br />
2 (2%)<br />
2 (6%)<br />
–<br />
1 (1%)<br />
11 (13%)<br />
–<br />
6 (13%)<br />
–<br />
2 (9%)<br />
1 (5%)<br />
1 (3%)<br />
1 (6%)<br />
3 (13%)<br />
6 (38%)<br />
1 (6%)<br />
2 (10%)
Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.35: Übersicht über Ergebnisse von Untersuchungen auf Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB in Lebensmitteln<br />
Lebensmittelgruppe<br />
Frauenmilch<br />
Rohmilch<br />
Milchhygiene<br />
Hofsammelmilch<br />
SAD<br />
Rindfleisch<br />
Eier NRKP<br />
Lachsölkapseln<br />
Fische*<br />
Wildschwein<br />
Miesmuscheln*<br />
Grünkohl*<br />
Probenzahl<br />
30<br />
66<br />
14<br />
26<br />
39<br />
6<br />
16<br />
12<br />
5<br />
28<br />
Dioxine<br />
[pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett]<br />
Mittelwert<br />
6,95<br />
0,35<br />
0,36<br />
0,44<br />
0,37<br />
0,09<br />
0,37<br />
0,86<br />
0,33<br />
0,10<br />
Median<br />
6,47<br />
0,36<br />
0,33<br />
0,42<br />
0,20<br />
–<br />
0,26<br />
0,72<br />
–<br />
0,08<br />
Minimum<br />
2,31<br />
0,17<br />
0,22<br />
0,06<br />
0,08<br />
0,06<br />
0,03<br />
0,28<br />
0,17<br />
0,03<br />
Maximum<br />
13,09<br />
0,57<br />
0,63<br />
0,91<br />
2,56<br />
0,11<br />
1,39<br />
2,24<br />
0,54<br />
0,41<br />
* abweichende Angaben in pg WHO-TEQ/g Frischgewicht<br />
Gentechnische Veränderungen<br />
Probenzahl<br />
29<br />
66<br />
14<br />
26<br />
39<br />
6<br />
16<br />
12<br />
5<br />
dioxinähnliche PCB (dl-PCB)<br />
[pg WHO-PCB-TEQ/g Fett]<br />
Mittelwert<br />
7,63<br />
0,74<br />
0,83<br />
0,96<br />
0,54<br />
1,27<br />
0,53<br />
0,55<br />
0,55<br />
Median<br />
7,35<br />
0,73<br />
0,78<br />
0,78<br />
0,18<br />
–<br />
0,33<br />
0,49<br />
–<br />
Minimum<br />
3,01<br />
0,38<br />
0,53<br />
0,12<br />
0,04<br />
0,47<br />
0,03<br />
0,22<br />
0,15<br />
Maximum<br />
17,77<br />
1,86<br />
1,32<br />
2,13<br />
6,44<br />
2,06<br />
1,87<br />
1,48<br />
1,00<br />
Summe Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB<br />
[pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett]<br />
Probenzahl<br />
29<br />
66<br />
14<br />
26<br />
39<br />
6<br />
16<br />
12<br />
5<br />
Mittelwert<br />
14,56<br />
1,09<br />
1,19<br />
1,40<br />
0,90<br />
1,36<br />
0,91<br />
1,40<br />
0,88<br />
Median<br />
14,57<br />
1,05<br />
1,10<br />
1,15<br />
0,39<br />
–<br />
0,67<br />
1,19<br />
–<br />
Minimum<br />
5,43<br />
0,58<br />
0,82<br />
0,18<br />
0,12<br />
0,53<br />
0,06<br />
0,50<br />
0,32<br />
Maximum<br />
28,66<br />
2,24<br />
1,88<br />
2,78<br />
9,00<br />
2,15<br />
3,26<br />
3,72<br />
1,54<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
Tabelle 4.36: GVO-Linien, auf die Lebens- <strong>und</strong> Futtermittel im LAVES im Jahr 2007 standardmäßig untersucht worden sind<br />
Pflanzengattung GVO-Linie<br />
Soja<br />
Mais<br />
Raps<br />
Papaya<br />
Reis<br />
Kartoffel<br />
Zuckerrübe<br />
Ro<strong>und</strong>up Ready<br />
GA 21, MIR 604, MON 810, Bt176, T25, Herculex TC1507, Linie 59122, NK603, Bt11, Bt10, Star Link, Mon863<br />
Falcon GS 40/90, Topas 19/2, Liberator pHoe6/Ac, GT73, MS1/RF1, MS1/RF2, MS8/RF3, Laurat, Trierucin<br />
55-1, 63-1<br />
LL62, LL601, Bt63-Reis<br />
EH-92-527-1<br />
H7-1<br />
157
158<br />
Tabelle 4.37: Ergebnisse der molekularbiologischen Untersuchungen des Jahres 2007 auf gentechnisch veränderte<br />
Organismen (GVO) in Lebensmitteln <strong>und</strong> Saatgut im Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Untersuchungen<br />
auf Bestandteile<br />
von GVO-Linien<br />
Lebensmittel<br />
Soja<br />
Mais<br />
Raps<br />
Papaya<br />
Kartoffel<br />
Reis**<br />
Summe<br />
Saatgut***<br />
Raps<br />
Mais<br />
Summe<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
Anzahl der<br />
Untersuchungen*<br />
264<br />
220<br />
Untersuchungen von Lebensmittelproben für das Land Bremen<br />
Soja<br />
Mais<br />
Raps<br />
Reis**<br />
Summe<br />
650<br />
144<br />
44<br />
17<br />
26<br />
23<br />
267<br />
817<br />
69<br />
75<br />
144<br />
22<br />
12<br />
1<br />
12<br />
47<br />
Positive Bef<strong>und</strong>e<br />
>0,9% (Anteil an<br />
der Anzahl der<br />
Untersuchungen)<br />
6 (2,3%)<br />
2 (0,9%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
keine positiven Bef<strong>und</strong>e<br />
0<br />
0<br />
0<br />
keine positiven Bef<strong>und</strong>e<br />
Positive Bef<strong>und</strong>e<br />
0,9%/
Sonstige<br />
Tierartbestimmung<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.38: Untersuchung von Lebensmitteln auf die Verarbeitung der angegebenen Tierart (ohne Milch,<br />
Milcherzeugnisse <strong>und</strong> Käse)<br />
Lebensmittel Gesamtuntersuchungen Molekularbiologische<br />
Untersuchungen<br />
Gesamtanzahl der<br />
Lebensmittel*<br />
Rind<br />
Schwein<br />
Huhn<br />
Pute<br />
Hirsch<br />
Reh<br />
Pferd<br />
Schaf<br />
578 *<br />
532<br />
534<br />
539<br />
539<br />
* beinhaltet weitere nicht in der Tabelle genannte Tierarten<br />
30<br />
17<br />
10<br />
17<br />
91 *<br />
25<br />
24<br />
23<br />
23<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
Soll-Tierart gef<strong>und</strong>en Beanstandungen/<br />
Bemängelungen<br />
570 *<br />
160<br />
276<br />
45<br />
53<br />
25<br />
11<br />
9<br />
10<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
8<br />
1<br />
1<br />
0<br />
3<br />
1<br />
0<br />
1<br />
1<br />
159
160<br />
Lebensmittelbestrahlung<br />
Tabelle 4.39: Lebensmittelbestrahlung<br />
Untersuchte<br />
Lebensmittelwarengruppe<br />
Eier <strong>und</strong> Eiprodukte<br />
Geflügel<br />
Fleischerzeugnisse<br />
Hülsenfrüchte, Öl -<br />
samen, Schalenobst<br />
Gemüse, frisch<br />
Gemüse, getrocknet<br />
u. a. Gemüse -<br />
erzeugnisse<br />
Pilze, frisch<br />
Pilze, getrocknet u.<br />
a. Pilzerzeugnisse<br />
Obst, frisch<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Würzmittel<br />
Kräuter, Gewürze<br />
getrocknet<br />
Summe der<br />
untersuchten<br />
Proben<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
15<br />
5<br />
6<br />
1<br />
14<br />
52<br />
nicht bestrahlt<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
15<br />
5<br />
6<br />
1<br />
13<br />
52<br />
ordnungsgemäß<br />
gekennzeichnet<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Anzahl der Proben mit dem Ergebnis<br />
Lebensmittel<br />
bestrahlt (nach § 1 LMBestrV zulässig)<br />
nicht ordnungsgemäß<br />
gekennzeichnet<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
1<br />
–<br />
bestrahlt<br />
(Zulässigkeit der<br />
Bestrahlung<br />
nicht geklärt)<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
bestrahlt<br />
(Bestrahlung<br />
nicht zulässig)<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–
Authentizitätsanalyse<br />
Im Jahr 2007 wurden über 500 Proben mit Hilfe der Analyse der<br />
stabilen Isotope untersucht. Die folgenden Tabellen geben Aus -<br />
kunft über die Anzahl an Proben <strong>und</strong> über die jeweilige Ziel richtung<br />
der Untersuchungen.<br />
Tabelle 4.40: Unterscheidung biologisch <strong>und</strong> konventionell<br />
erzeugter Lebensmittel<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Milch<br />
Käse<br />
Tabelle 4.41: Herkunftsanalyse <strong>und</strong> Unterscheidung biologisch<br />
<strong>und</strong> konventionell erzeugter Lebensmittel<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Fleisch <strong>und</strong> Fleischerzeugnisse<br />
Fische <strong>und</strong> Fischzuschnitte<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
7<br />
15<br />
13<br />
15<br />
Tabelle 4.42: Unterscheidung von »echtem« Vanillearoma<br />
gegenüber naturidentischem oder künstlichem<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Getreideprodukte, Backvormischungen etc.<br />
Feine Backwaren<br />
Puddinge, Kremspeisen, süße Soßen<br />
Sojadrinks etc.<br />
Apfelmus Vanille<br />
Vanille-Zucker<br />
Speiseeis <strong>und</strong> -vorprodukte<br />
Tee<br />
Säuglings- <strong>und</strong> Kleinkindernahrung (Brei)<br />
Vanille-Gewürze<br />
Vanille-Aromen<br />
Verarbeitungshilfsmittel<br />
Tabelle 4.43: Unterscheidung von Freiland- <strong>und</strong> Treibhaus -<br />
anbau<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Erdbeeren<br />
Gemüsepaprika<br />
3<br />
2<br />
46<br />
7<br />
1<br />
1<br />
39<br />
14<br />
2<br />
7<br />
4<br />
2<br />
21<br />
10<br />
161
162<br />
Tabelle 4.44: Unterscheidung von Saft <strong>und</strong> rückverdünntem<br />
Saft<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Rote Beete-Saft<br />
Säuglings- <strong>und</strong> Kleinkindernahrung (Saft)<br />
Tabelle 4.45: Untersuchung der Echtheit<br />
Lebensmittel Anzahl<br />
Ahorn-Sirup 13<br />
Tabelle 4.46: Verschiedenes<br />
Technische Untersuchungen, Laborvergleichsuntersuchungen<br />
Anzahl<br />
verschiedene Matrices 42<br />
1<br />
10<br />
Tabelle 4.47: Wasser<br />
Matrix Anzahl<br />
Regenwasser, gesammelt durch den DWD<br />
Oldenburg<br />
Zisternenwasser, LI Oldenburg<br />
Tabelle 4.48: Herkunftsanalyse<br />
Lebensmittel/Matrix Anzahl<br />
Pistazien<br />
Spargel<br />
Pfifferlinge<br />
Pferdehaare<br />
Honig<br />
12<br />
12<br />
31<br />
45<br />
11<br />
2<br />
120<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg
Mikrobiologische Untersuchungen<br />
Tabelle 4.49: Mikrobiologische Untersuchungen von Speiseeis<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Matrix Anzahl der Proben Proben mit Überschreitung mikrobiologischer<br />
Kriterien (Anzahl/Prozent)*<br />
Speiseeis<br />
Summe<br />
1.009<br />
1.009<br />
Coliforme/Enterobacteriaceae:<br />
330 (33%)<br />
Coliforme/Enterobacteriaceae <strong>und</strong> Gesamtkeimzahl:<br />
62 (6%)<br />
Gesamtkeimzahl:<br />
47 (5%)<br />
koagulasepositive Staphylokokken:<br />
61 (6%)<br />
E. coli:<br />
9 (1%)<br />
Listeria monocytogenes:<br />
2 (0,2%)<br />
Salmonella spp.:<br />
* Mehrfachnennungen sind möglich, wenn in einer Probe mehrere Parameter überschritten wurden<br />
0<br />
511 (51%)<br />
Beurteilung/Bemerkung<br />
Die Beurteilung wurde bis<br />
zum 07. August 2007 nach<br />
Milch verordnung <strong>und</strong> VO<br />
(EG) Nr. 2073/2005 durchgeführt.<br />
Nach Inkrafttreten der Verordnung<br />
zur Durchführung von<br />
Vorschriften des gemein schaftlichen<br />
Lebensmittelhygiene -<br />
rechtes am 08. August 2007<br />
<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Aufhebung der Milchverordnung<br />
erfolgte eine Beurtei -<br />
lung ge mäß mikrobiologischer<br />
Krite rien nach DGHM<br />
so wie nach Le bensmittel -<br />
hygienever ord nung <strong>und</strong><br />
VO (EG) Nr. 2073/2005.<br />
Lebensmittelinstitute Braunschweig <strong>und</strong> Oldenburg<br />
163
164<br />
Tabelle 4.50: Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung von flüssiger <strong>und</strong> aufgeschlagener Sahne zur Überprü -<br />
fung der Sahnespender, bewertet entsprechend den mikrobiologischen Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Hy -<br />
giene <strong>und</strong> Mikrobiologie (DGHM) <strong>und</strong> der LMHV<br />
Matrix Anzahl der<br />
Proben<br />
Sahne,<br />
flüssig<br />
Sahne,<br />
aufgeschlagen<br />
104<br />
114<br />
Mikrobiologische Parameter<br />
Gesamtkeimzahl<br />
Enterobacteriaceae<br />
Escherichia coli<br />
Salmonellen<br />
Koagulase-positive Staphylokokken<br />
Pseudomonaden<br />
Listeria monocytogenes<br />
Gesamtkeimzahl<br />
Enterobacteriaceae<br />
Escherichia coli<br />
Salmonellen<br />
Koagulase-positive Staphylokokken<br />
Pseudomonaden<br />
Listeria monocytogenes<br />
Überschreitungen des DGHM-<br />
Richtwertes*<br />
Anzahl Anzahl<br />
2 (2%)<br />
3 (3%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5 (5%)<br />
0<br />
62 (54%)<br />
10 (9%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
94 (82%)<br />
* Mehrfachnennungen sind möglich, wenn in einer Probe mehrere Parameter überschritten wurden<br />
0<br />
Überschreitungen des DGHM-<br />
Warnwertes*<br />
kein Warnwert<br />
definiert<br />
kein Warnwert<br />
definiert<br />
kein Warnwert<br />
definiert<br />
kein Warnwert<br />
definiert<br />
0<br />
1 (1%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
11 (10%)<br />
4 (4%)<br />
0<br />
0<br />
0
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tabelle 4.51: Ergebnisse der Untersuchungen (Mikrobiologie, Lagertemperatur) von vorgekochten Nudeln sowie vorgekochtem<br />
Reis aus Gaststätten<br />
Matrix Anzahl der<br />
Proben<br />
Vorgekochte Nudeln<br />
Vorgekochter Reis<br />
Summe<br />
19<br />
22<br />
41<br />
Beurteilung<br />
Überprüfte<br />
Parameter**<br />
Gesamtkeimzahl<br />
Enterobacteriaceae<br />
Hefen<br />
Lagertemperatur im<br />
Betrieb<br />
Gesamtkeimzahl<br />
Enterobacteriaceae<br />
Hefen<br />
Lagertemperatur im<br />
Betrieb<br />
Hygienemängel*<br />
(Hinweis gemäß<br />
§ 3 Satz 1 LMHV<br />
bzw. Art. 4 Abs. 2<br />
VO (EG) Nr.<br />
852/2004)<br />
Anzahl<br />
4 (21%)<br />
4 (21%)<br />
3 (16%)<br />
3 (16%)<br />
1 (5%)<br />
2 (9%)<br />
Hygienemängel*<br />
(Beanstandung ge -<br />
mäß § 3 Satz 1<br />
LMHV bzw. Art. 4<br />
Abs. 2 VO (EG) Nr.<br />
852/2004)<br />
Anzahl Anzahl<br />
Nicht zum Verzehr<br />
geeignet* (Beanstan -<br />
dungen gemäß Art.<br />
14 Abs. 2 Nr. b in<br />
Verb. mit Abs. 5 VO<br />
(EG) Nr. 178/2002)<br />
* Mehrfachnennungen sind möglich, wenn in einer Probe mehrere Parameter überschritten wurden<br />
** Salmonellen, Escherichia coli, koagulasepositive Staphylokokken, Bacillus cereus <strong>und</strong> Schimmelpilze wurden in keiner der untersuchten<br />
Proben nachgewiesen<br />
0<br />
0<br />
17 (14%)<br />
4 (21%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1 (5%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5 (12%)<br />
1 (5%)<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1 (5%)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2 (5%)<br />
165
166<br />
4.3 Marktüberwachung<br />
Vieh <strong>und</strong> Fleisch<br />
Tabelle 4.52: Betriebsarten im Fachbereich Vieh <strong>und</strong><br />
Fleisch<br />
Betriebsart Anzahl in 2007<br />
Schlachtbetriebe insgesamt<br />
davon EU-zugelassen<br />
Zerlegebetriebe<br />
Viehhandelsbetriebe<br />
999<br />
69<br />
148<br />
857<br />
Tabelle 4.53: Amtliche Preisnotierung für Rindfleisch <strong>und</strong><br />
Schweinehälften in <strong>Niedersachsen</strong><br />
meldepflichtige<br />
Betriebe<br />
Schlachtungen in<br />
Stück<br />
Geflügel<br />
2006<br />
2007<br />
Schweine Rinder Schweine Rinder<br />
30<br />
14.491.312<br />
15<br />
405.682<br />
28<br />
15.414.142<br />
Tabelle 4.55: Betriebsarten im Fachbereich Geflügel<br />
Betriebsart Anzahl in 2007<br />
Geflügelschlachtbetriebe<br />
Geflügel- <strong>und</strong> Zerlegebetriebe<br />
sonstige Betriebe (Großhandel, Verteilerzentren,<br />
Kühlhäuser)<br />
29<br />
32<br />
134<br />
15<br />
375.187<br />
Abteilung 4 Marktüberwachung<br />
Tabelle 4.54: Prüfungen <strong>und</strong> eingeleitete Verfahren bei<br />
Beanstandungen in 2007<br />
Anzahl<br />
Durchgeführte Prüfungen insgesamt 1.023<br />
Hinweise/Abmahnungen<br />
eingeleitete OWi-Verfahren<br />
davon wurden abgeschlossen mit<br />
Verwarnungen<br />
davon mit Verwarngeld<br />
Bußgeldbescheide<br />
Einstellung des Verfahrens<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft<br />
160<br />
13<br />
Abteilung 4 Marktüberwachung<br />
3<br />
3<br />
3<br />
4<br />
1
Eier<br />
Tabelle 4.56: Betriebsarten im Fachbereich Eier<br />
Betriebsart Anzahl in 2007 Änderungs- <strong>und</strong><br />
Registrierungsanträge<br />
Erzeuger<br />
Packstellen<br />
Sammelstellen<br />
830<br />
374<br />
14<br />
Tabelle 4.57: Prüfungsaufträge in 2007<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
569<br />
Prüfaufträge Anzahl Beanstandungsquote<br />
Buchführung<br />
Tätigkeiten/Pflichten<br />
Gewichts- <strong>und</strong><br />
Qualitätskontrolle<br />
Haltungsangaben<br />
Kennzeichnung<br />
Beratung<br />
Legehennenbetriebsregister<br />
Registrierung Erzeuger<br />
Zulassung Packstellen<br />
Eintragung<br />
Sammelstellen<br />
Sonstiges<br />
Prüfungsverweigerung<br />
677<br />
101<br />
299<br />
271<br />
558<br />
29<br />
168<br />
46<br />
30<br />
3<br />
18<br />
0<br />
38<br />
Abteilung 4 Marktüberwachung<br />
2<br />
21,7%<br />
6,9%<br />
4,7%<br />
17,0%<br />
20,1%<br />
6,9%<br />
29,8%<br />
34,8%<br />
46,7%<br />
33,3%<br />
33,3%<br />
–<br />
Tabelle 4.58: Eingeleitete Verfahren bei Beanstandungen<br />
Anzahl<br />
Eingeleitet Verfahren 134<br />
abgeschlossene Verfahren<br />
davon durch<br />
Verwarnung mit Verwarngeld<br />
Bußgeldbescheide<br />
Einstellung des Verfahrens<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft<br />
Abgabe an andere B<strong>und</strong>esländer/EU-Staaten<br />
117<br />
77<br />
27<br />
2<br />
2<br />
9<br />
167
168<br />
Obst, Gemüse <strong>und</strong> Kartoffeln<br />
Tabelle 4.59: Prüfungen in 2007<br />
Betriebsart Anzahl der Betriebe Prüfungen in 2007 Geprüfte Partien Beanstandete Partien<br />
Erzeuger/Selbstvermarkter<br />
Sortier-, Pack-, Lagerbetriebe<br />
Großhandel<br />
Erzeugerorganisationen<br />
Handelsagenturen<br />
Verteilerzentren des<br />
Lebensmitteleinzelhandels<br />
Summe<br />
256<br />
83<br />
175<br />
21<br />
3<br />
23<br />
561<br />
Tabelle 4.60: Eingeleitete Verfahren bei Beanstandungen<br />
in 2007<br />
OWi-Verfahren 40<br />
Verwarnung mit Verwarngeld<br />
Anhörungen<br />
Bußgeldbescheide<br />
Einstellung des Verfahrens<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft<br />
Vermarktungsverbote<br />
Medienüberwachung<br />
Tabelle 4.61: Umfang der Medienüberwachung<br />
Überwachung Anzahl der Hinweise<br />
Telemediengesetz/R<strong>und</strong>funkstaatsvertrag<br />
Pressegesetz<br />
Anzahl<br />
35<br />
Abteilung 4 Marktüberwachung<br />
39<br />
Abteilung 4 Marktüberwachung<br />
8<br />
6<br />
0<br />
0<br />
23<br />
7<br />
311<br />
200<br />
397<br />
61<br />
3<br />
95<br />
1.067<br />
892<br />
914<br />
2.885<br />
265<br />
4<br />
978<br />
5.938<br />
56<br />
26<br />
216<br />
20<br />
0<br />
33<br />
351
4.4 Lebensmittelüberwachung<br />
EU-Zulassungen<br />
Tabelle 4.62: EU-Zulassungen<br />
Betriebsart Anzahl der<br />
Betriebe<br />
Fleischbetriebe<br />
Eiproduktbetriebe<br />
Milchbetriebe<br />
Fischbetriebe<br />
Summe<br />
679<br />
48<br />
83<br />
83<br />
893<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Neuzulassungen<br />
61<br />
Abteilung 2 Lebensmittelsicherheit<br />
Tabelle 4.63: Amtliche anerkannte Mineralbrunnen<br />
Anzahl Mineralwasserbrunnen<br />
Amtliche Anerken -<br />
nungen 2007<br />
1<br />
3<br />
4<br />
69<br />
Genehmigungen, Anerkennungen <strong>und</strong> amtliche Beobachtungen<br />
Nutzungsgenehmigungen<br />
2007<br />
56 2<br />
3<br />
Tabelle 4.64: Genehmigungen zur Herstellung von diätetischen<br />
Lebensmitteln nach § 11 Diätverordnung<br />
Anzahl Genehmigungen Genehmigungen 2007<br />
12 1<br />
Tabelle 4.65: Amtliche Beobachtung von Ausnahme geneh -<br />
migungen nach § 68 LFGB<br />
Anzahl der Betriebe, die einer amtlichen Beobachtung gemäß<br />
§ 68 LFGB durch das LAVES unterliegen<br />
Tabelle 4.66: Sonstige Genehmigungen <strong>und</strong> amtliche<br />
Anerkennungen<br />
Anzahl Genehmigungen/Anerkennungen Neuzulassungen<br />
12<br />
1* 0<br />
* Ausnahmegenehmigung nach dem vorliegendem Bier gesetz<br />
Abteilung 2 Lebensmittelsicherheit<br />
169
170<br />
Schnellwarnsystem<br />
Der Auswertung sind 5.761 Meldungen zugr<strong>und</strong>e gelegt (Stand<br />
12. Februar 2008). Davon betrafen 228 Meldungen Nieder sach -<br />
sen, was einem Anteil von etwa 4% entspricht. Die Anzahl der<br />
Meldungen, die <strong>Niedersachsen</strong> betreffen, ist damit im Jahr 2007<br />
um ca. 30 Meldungen angestiegen (2006: 197 Meldungen).<br />
4.5 Tierarzneimittelüberwachung<br />
Tabelle 4.68: Tierarzneimittelüberwachung 2007<br />
Aufgaben gemäß Arzneimittelgesetz (AMG) Anzahl<br />
zu überwachende tierärztliche Hausapotheken<br />
durchgeführte Inspektionen tierärztlicher Hausapotheken<br />
eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Ahndung von Beanstandungen in tierärztlichen Hausapotheken mit<br />
folgendem Abschluss<br />
Verwarnung<br />
Bußgeld<br />
Einstellung<br />
Bescheinigungen über die Einrichtung <strong>und</strong> den Betrieb tierärztlicher Hausapotheken gem. § 47 (1a) AMG<br />
Entgegennahme von Anzeigen klinischer Prüfungen gem. § 67 i. V. m. § 59 AMG<br />
Entgegennahme von Anzeigen über das Verbringen von Tierarzneimitteln aus EU-Mitgliedstaaten gem. § 73 (3) AMG<br />
Tabelle 4.67: Übersicht über die Meldungen, die in 2007<br />
die Lebensmittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> betrafen<br />
Art der Meldung Anzahl<br />
Warnmeldungen<br />
Informationsmeldungen<br />
Nachrichten<br />
RAPEX-Meldungen<br />
Summe<br />
1.436<br />
302<br />
48<br />
7<br />
40<br />
1<br />
151<br />
38<br />
60<br />
169<br />
40<br />
Abteilung 2 Lebensmittelsicherheit<br />
1<br />
18<br />
228<br />
Abteilung 2 Lebensmittelsicherheit
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4.6 Bedarfsgegenstände <strong>und</strong> Kosmetika<br />
Bedarfsgegenstände<br />
Tabelle 4.69: Ergebnisse der Untersuchung von Bedarfsgegenständen<br />
Zahl der untersuchten Proben<br />
Zahl der beanstandeten Proben<br />
Prozentsatz der beanstandeten Proben<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädlich (mikrobiologische Verun reinigungen)<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädlich (andere Ursachen)<br />
ges<strong>und</strong>heitsgefährdend aufgr<strong>und</strong> von<br />
Verwechslungsgefahr<br />
Übergang von Stoffen auf Lebensmittel<br />
unappetitliche <strong>und</strong> ekelerregende Beschaffenheit<br />
Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, stoffliche<br />
Beschaffenheit<br />
Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, Kennzeich -<br />
nung, Aufmachung (Lebensmittelbedarfsgegenstände)<br />
Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, stoffliche<br />
Beschaffenheit<br />
Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften,<br />
Kennzeichnung, Aufmachung (Sonstiges)<br />
Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen, stoffliche<br />
Beschaffenheit, freiwillige Vereinbarungen<br />
Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen,<br />
Kennzeichnung, Aufmachung, freiwillige<br />
Vereinbarungen<br />
Irreführende Bezeichnung, Aufmachung von<br />
Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt<br />
Normabweichung<br />
300<br />
310<br />
320<br />
330<br />
340<br />
350<br />
360<br />
370<br />
380<br />
390<br />
400<br />
410<br />
Bedarfsgegenstände<br />
mit Körperkontakt<br />
394<br />
14<br />
3,6<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
7<br />
1<br />
0<br />
1<br />
0<br />
Bedarfsgegen<br />
stände<br />
zur Rei nigung<br />
<strong>und</strong><br />
Pfle ge, Haus -<br />
haltschemikalien<br />
406<br />
22<br />
5,4<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
22<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Spielwaren<br />
<strong>und</strong> Scherzartikel<br />
599<br />
63<br />
10,5<br />
Institut für Bedarfsgegenstände<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
53<br />
33<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Bedarfsgegenstände<br />
mit Lebensmittelkontakt<br />
1.882<br />
90<br />
4,8<br />
1<br />
2<br />
1<br />
10<br />
3<br />
2<br />
52<br />
1<br />
2<br />
3<br />
0<br />
17<br />
Summe<br />
<strong>3.</strong>281<br />
189<br />
5,9<br />
2<br />
4<br />
1<br />
10<br />
3<br />
2<br />
52<br />
61<br />
58<br />
3<br />
1<br />
17<br />
171
172<br />
Kosmetika<br />
Tabelle 4.70: Ergebnisse der Untersuchungen von kosmetischen Mitteln<br />
Zahl der untersuchten<br />
Proben<br />
Zahl der beanstandeten<br />
Proben<br />
Prozentsatz der beanstandeten<br />
Proben<br />
ges<strong>und</strong>heitsschädlich<br />
irreführend<br />
Verstöße gegen Kenn -<br />
zeichnungsvorschriften<br />
(Chargen-Nr., Hersteller,<br />
MHD, Verwendungs -<br />
zweck, Liste der Be -<br />
stand teile)<br />
Verstöße gegen Kenn -<br />
zeichungsvorschriften<br />
(Warnhinweise, An -<br />
wendungsbedingungen,<br />
Deklaration von<br />
Stoffen)<br />
Verwendung verschreibungspflichtiger<br />
oder<br />
verbotener Stoffe<br />
Verstöße gegen sonstige<br />
Kennzeichnungsvor -<br />
schrift en oder Hilfs -<br />
normen<br />
Verstöße gegen sonstige<br />
Rechtsvorschriften oder<br />
Hilfsnormen, stoffl. Be -<br />
schaffenheit<br />
Verstöße gegen Vor -<br />
schrif t en zur Bereithal -<br />
tung von Unterlagen<br />
ges<strong>und</strong>heitsgefährdend<br />
aufgr<strong>und</strong> Verwechslungs -<br />
gefahr mit Lebensmit -<br />
teln<br />
Normabweichung<br />
50<br />
51<br />
52<br />
53<br />
54<br />
55<br />
56<br />
57<br />
58<br />
Mittel zur<br />
Hautreinigung<br />
163<br />
24<br />
14,7<br />
2<br />
2<br />
20<br />
0<br />
8<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Mittel zur<br />
Hautpflege<br />
275<br />
27<br />
9,8<br />
0<br />
13<br />
16<br />
0<br />
12<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Mittel zur<br />
Be einflus -<br />
sung des<br />
Aussehens<br />
162<br />
20<br />
12,3<br />
0<br />
1<br />
17<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Mittel zur<br />
Haarbehandlung<br />
346<br />
27<br />
7,8<br />
0<br />
11<br />
22<br />
0<br />
4<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Mittel zur<br />
Nagelkosmetik<br />
42<br />
2<br />
4,8<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Reinigungs-<br />
u.<br />
Pflege mittel<br />
für<br />
M<strong>und</strong> u.<br />
Zähne<br />
178<br />
5<br />
2,8<br />
0<br />
2<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Mittel zur<br />
Beeinflussung<br />
des<br />
Ge ruchs/<br />
Vermittlung<br />
v. Ge -<br />
ruchs eindrücken<br />
178<br />
14<br />
7,9<br />
0<br />
2<br />
13<br />
1<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Kosmetische<br />
Mittel<br />
Summe<br />
1.344<br />
119<br />
8,9<br />
2<br />
31<br />
91<br />
4<br />
27<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Tätowiermittel<br />
Summe<br />
43<br />
2<br />
4,7<br />
Institut für Bedarfsgegenstände<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4.7 Futtermittelüberwachung <strong>und</strong> -untersuchung<br />
Aufgaben der Futtermittelüberwachung<br />
Tabelle 4.71: Anzahl der anerkannten/zugelassenen/<br />
registrierten Futtermittelunternehmen<br />
Jahr<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
gewerbliche Hersteller<br />
landwirtschaftliche Betriebe<br />
Anzahl anerkannte/<br />
zugelassene<br />
140<br />
141<br />
12<br />
Anzahl registrierte<br />
39<br />
123<br />
169<br />
5<strong>3.</strong>500<br />
5<strong>3.</strong>500<br />
Tabelle 4.72: Zulassungen <strong>und</strong> Registrierungen zur Verarbeitung von Fischmehl/Ergänzungsfuttermitteln mit Fischmehl<br />
u. a., Stand 31. Dezember 2007<br />
Zulassung (Verarbeitung<br />
Fischmehl/Futtermittel > 50%<br />
Rohprotein mit Fischmehl u. a.)<br />
Registrierung (Verarbeitung<br />
Futtermittel < 50% Rohprotein<br />
mit Fischmehl u. a.) <strong>und</strong><br />
Gestattung<br />
entfällt<br />
Tabelle 4.73: Inspektionen, Buchprüfungen <strong>und</strong> Orte der Kontrolle 2004 bis 2007<br />
150<br />
Gestattungen für Betriebe, die<br />
auch Wiederkäuer halten<br />
Anzahl im Jahr 2004 2005 2006 2007<br />
aufgesuchte Orte der Kontrolle<br />
Betriebsprüfungen<br />
Buchprüfungen/Rückverfolgbarkeit<br />
1.227<br />
1.401<br />
376<br />
Tabelle 4.74: Anzahl <strong>und</strong> Verteilung der Futtermittel -<br />
proben 2007 auf die Orte der Entnahme<br />
Hersteller/Lager Einzelfuttermittel<br />
Hersteller<br />
Vormischungen/Zusatzstoffe<br />
Hersteller Mischfuttermittel<br />
(gewerblich)<br />
Handelsbetriebe<br />
Tierhalter einschließlich Selbstmischer<br />
Importproben<br />
Dez. 41 Futtermittelüberwachung<br />
Anzahl der entnommenen Proben<br />
150<br />
90<br />
975<br />
420<br />
270<br />
320<br />
1.170<br />
1.530<br />
135 (davon<br />
113 bei gewerblichen<br />
Herstel lern/ Händlern)<br />
1.767<br />
1.462<br />
628 (davon<br />
70 bei gewerblichen<br />
Herstel lern/Händlern)<br />
entfällt<br />
281<br />
1.670<br />
1.575<br />
697 (davon<br />
98 bei gewerblichen<br />
Herstel lern/Händlern)<br />
173
174<br />
Aufgaben der Futtermitteluntersuchung<br />
Tabelle 4.75: Übersicht über Art <strong>und</strong> Umfang von Futtermitteluntersuchungen (Teil 1)<br />
Elemente<br />
Arsen<br />
Blei<br />
Cadmium<br />
Calcium<br />
Chrom<br />
Eisen<br />
Kalium<br />
Kobalt<br />
Kupfer<br />
Magnesium<br />
Mangan<br />
Molybdän<br />
Natrium<br />
Nickel<br />
Phosphor<br />
Quecksilber<br />
Selen<br />
Zink<br />
Alleinfuttermittel<br />
71<br />
162<br />
157<br />
54<br />
1<br />
16<br />
2<br />
4<br />
205<br />
2<br />
19<br />
1<br />
17<br />
1<br />
43<br />
80<br />
138<br />
184<br />
Einzelfutter<br />
mittel<br />
391<br />
513<br />
511<br />
7<br />
4<br />
1<br />
2<br />
13<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
398<br />
4<br />
8<br />
Ergänzungsfuttermittel<br />
31<br />
93<br />
89<br />
35<br />
15<br />
95<br />
9<br />
8<br />
14<br />
29<br />
26<br />
61<br />
49<br />
Mineralfutter<br />
18<br />
34<br />
30<br />
15<br />
2<br />
12<br />
8<br />
37<br />
13<br />
11<br />
11<br />
2<br />
14<br />
13<br />
29<br />
26<br />
Sonstige Vormischung<br />
1<br />
15<br />
20<br />
20<br />
1<br />
6<br />
1<br />
15<br />
6<br />
1<br />
14<br />
11<br />
11<br />
Zusatzstoffe<br />
13<br />
11<br />
11<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
10<br />
2<br />
Summe<br />
der<br />
Aufträge<br />
539<br />
834<br />
818<br />
112<br />
9<br />
52<br />
2<br />
15<br />
367<br />
25<br />
47<br />
1<br />
46<br />
9<br />
88<br />
541<br />
243<br />
280<br />
Summe<br />
der Einzel -<br />
parameter<br />
539<br />
834<br />
818<br />
112<br />
9<br />
52<br />
2<br />
15<br />
367<br />
25<br />
47<br />
1<br />
46<br />
9<br />
88<br />
541<br />
243<br />
280
Tabelle 4.75: Übersicht über Art <strong>und</strong> Umfang von Futtermitteluntersuchungen (Teil 2)<br />
Mykotoxine<br />
Aflatoxin B1<br />
DON<br />
Fumonisine<br />
Ochratoxin<br />
Zearalenon<br />
HT2/T2-Toxin<br />
CKW<br />
PCB<br />
Dioxine<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
GVO<br />
PAK<br />
Ethylenglycol<br />
Alleinfuttermittel<br />
238<br />
192<br />
132<br />
238<br />
239<br />
83<br />
108<br />
134<br />
37<br />
8<br />
14<br />
pharmakologisch wirksame Substanzen<br />
Deklarationskontrolle<br />
Flavophospholipol<br />
Lasalocid<br />
Maduramycin<br />
Monensin<br />
Narasin<br />
Nicarbazin<br />
Saliomycin<br />
Rückstandskontrolle<br />
Pharmakologisch wirksame<br />
Substanzen<br />
Chloramphenicol<br />
11<br />
2<br />
17<br />
7<br />
5<br />
7<br />
311<br />
19<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Einzelfuttermittel<br />
271<br />
206<br />
168<br />
271<br />
272<br />
126<br />
456<br />
475<br />
112<br />
201<br />
26<br />
2<br />
2<br />
16<br />
5<br />
Ergänzungsfuttermittel<br />
102<br />
70<br />
76<br />
102<br />
103<br />
38<br />
108<br />
121<br />
26<br />
2<br />
9<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
158<br />
7<br />
Mineralfutter<br />
0<br />
5<br />
5<br />
1<br />
25<br />
Sonstige Vormischung<br />
3<br />
1<br />
3<br />
3<br />
3<br />
1<br />
2<br />
6<br />
5<br />
1<br />
0<br />
9<br />
12<br />
5<br />
1<br />
4<br />
1<br />
1<br />
15<br />
Zusatzstoffe<br />
1<br />
0<br />
1<br />
1<br />
16<br />
19<br />
30<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Summe<br />
der Auf -<br />
träge<br />
615<br />
469<br />
379<br />
615<br />
618<br />
248<br />
704<br />
772<br />
216<br />
203<br />
43<br />
2<br />
16<br />
2<br />
15<br />
2<br />
19<br />
12<br />
7<br />
9<br />
525<br />
31<br />
Summe<br />
der Einzel -<br />
parameter<br />
615<br />
469<br />
758<br />
615<br />
618<br />
496<br />
11.968<br />
5.404<br />
<strong>3.</strong>672<br />
9.744<br />
55<br />
2<br />
16<br />
2<br />
15<br />
2<br />
19<br />
12<br />
7<br />
9<br />
10.500<br />
31<br />
175
176<br />
Tabelle 4.75: Übersicht über Art <strong>und</strong> Umfang von Futtermitteluntersuchungen (Teil 3)<br />
wertgebende Bestandteile<br />
Asche säureunlöslich<br />
ELOS<br />
Lactose<br />
Rohasche<br />
Rohasche mineralisch<br />
Rohfaser<br />
Rohfett A<br />
Rohfett B<br />
Rohprotein<br />
Stärke<br />
Trockenmasse<br />
Zucker<br />
Zucker gesamt<br />
Energie Geflügel<br />
Energie Rind<br />
Energie Schwein<br />
Alleinfuttermittel<br />
8<br />
1<br />
29<br />
278<br />
277<br />
240<br />
68<br />
350<br />
237<br />
675<br />
30<br />
231<br />
48<br />
1<br />
215<br />
Einzelfuttermittel<br />
31<br />
9<br />
41<br />
2<br />
19<br />
49<br />
2<br />
909<br />
7<br />
Ergänzungsfuttermittel<br />
7<br />
48<br />
4<br />
149<br />
158<br />
69<br />
61<br />
182<br />
21<br />
409<br />
4<br />
19<br />
12<br />
48<br />
15<br />
Mineralfutter<br />
3<br />
2<br />
67<br />
Sonstige Vormischung<br />
69<br />
15<br />
43<br />
Zusatzstoffe<br />
1<br />
1<br />
1<br />
55<br />
Summe<br />
der Auf -<br />
träge<br />
49<br />
49<br />
33<br />
437<br />
2<br />
476<br />
311<br />
149<br />
582<br />
260<br />
2.227<br />
34<br />
257<br />
60<br />
49<br />
230<br />
Summe<br />
der Einzelparameter<br />
49<br />
49<br />
33<br />
437<br />
2<br />
476<br />
311<br />
149<br />
582<br />
260<br />
2.227<br />
34<br />
257<br />
60<br />
49<br />
230
Tabelle 4.75: Übersicht über Art <strong>und</strong> Umfang von Futtermitteluntersuchungen (Teil 4)<br />
Mikroskopie<br />
botanische Reinheit<br />
Ambrosia<br />
Jakobskraut<br />
Mutterkorn<br />
tierische Bestandteile<br />
Verpackungsmaterial<br />
Zusammensetzung<br />
sonstige<br />
Aminosäuren<br />
Antioxidantien<br />
Chlorid<br />
Fluor<br />
Harnstoff<br />
Nitrit<br />
pH-Wert<br />
Phytase<br />
Melamin<br />
Vitamin A1<br />
Vitamin D<br />
Vitamin E<br />
Methanol<br />
Alleinfuttermittel<br />
3<br />
1<br />
25<br />
178<br />
2<br />
55<br />
97<br />
16<br />
33<br />
1<br />
1<br />
5<br />
29<br />
101<br />
61<br />
86<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Einzelfuttermittel<br />
355<br />
3<br />
1<br />
23<br />
430<br />
7<br />
1<br />
2<br />
12<br />
2<br />
2<br />
2<br />
12<br />
1<br />
Ergänzungsfuttermittel<br />
1<br />
1<br />
6<br />
139<br />
48<br />
23<br />
8<br />
1<br />
7<br />
15<br />
1<br />
1<br />
26<br />
63<br />
27<br />
41<br />
Mineralfutter<br />
13<br />
10<br />
4<br />
2<br />
30<br />
20<br />
24<br />
Sonstige Vormischung<br />
12<br />
4<br />
9<br />
3<br />
27<br />
1<br />
1<br />
4<br />
1<br />
1<br />
18<br />
18<br />
11<br />
Zusatzstoffe<br />
1<br />
1<br />
Summe<br />
der Auf -<br />
träge<br />
359<br />
4<br />
2<br />
54<br />
772<br />
9<br />
109<br />
130<br />
27<br />
1<br />
69<br />
17<br />
3<br />
8<br />
9<br />
96<br />
212<br />
126<br />
162<br />
1<br />
Summe<br />
der Einzelparameter<br />
359<br />
4<br />
2<br />
54<br />
772<br />
9<br />
109<br />
520<br />
54<br />
1<br />
69<br />
17<br />
3<br />
8<br />
9<br />
384<br />
212<br />
126<br />
162<br />
1<br />
177
178<br />
Tabelle 4.75: Übersicht über Art <strong>und</strong> Umfang von Futtermitteluntersuchungen (Teil 5)<br />
Alleinfuttermittel<br />
Futtermittelhygiene/Mikrobiologie<br />
Bakterien<br />
Clostridien, qualitativ<br />
Clostridien, quantitativ<br />
Coliforme Keime<br />
E. coli<br />
Enterobacteriaceen<br />
Gesamtkeimzahl<br />
Hefen<br />
Keimgehalt (allgemein)<br />
Listerien<br />
Probiotika<br />
Pseudomonaden<br />
Salmonellen<br />
Schimmelpilze<br />
Sensorik<br />
Staphylokokken<br />
Aujetzki<br />
Summe (Teil 1-5)<br />
44<br />
1<br />
44<br />
44<br />
48<br />
3<br />
61<br />
44<br />
65<br />
6.695<br />
Einzelfuttermittel<br />
97<br />
5<br />
4<br />
20<br />
15<br />
113<br />
113<br />
116<br />
1<br />
185<br />
98<br />
186<br />
1<br />
7.348<br />
Ergänzungsfuttermittel<br />
49<br />
1<br />
49<br />
48<br />
49<br />
4<br />
61<br />
49<br />
62<br />
<strong>3.</strong>468<br />
Mineralfutter<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
493<br />
Sonstige Vormischung<br />
15<br />
148<br />
2<br />
302<br />
423<br />
9<br />
19<br />
18<br />
20<br />
2<br />
3<br />
477<br />
17<br />
48<br />
2<br />
1.658<br />
1<br />
268<br />
Zusatzstoffe<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
203<br />
Summe<br />
der Auf -<br />
träge<br />
208<br />
153<br />
6<br />
2<br />
302<br />
443<br />
24<br />
228<br />
226<br />
236<br />
12<br />
3<br />
787<br />
211<br />
364<br />
2<br />
1<br />
20.133<br />
Summe<br />
der Einzel -<br />
parameter<br />
208<br />
153<br />
6<br />
2<br />
302<br />
443<br />
24<br />
228<br />
226<br />
236<br />
12<br />
3<br />
787<br />
211<br />
364<br />
2<br />
1<br />
60.333<br />
Futtermittelinstitut Stade
Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB<br />
Tabelle 4.76: Übersicht über Ergebnisse von Untersuchungen auf Dioxine <strong>und</strong> dioxinähnliche PCB in Futtermitteln<br />
Anzahl im Jahr Probenzahl<br />
Dioxine<br />
[ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg Futtermittel<br />
(12% Feuchte)]<br />
dioxinähnliche PCB (dl-PCB)<br />
[ng WHO-PCB-TEQ/kg Futtermittel<br />
(12% Feuchte)]<br />
Summe Dioxine <strong>und</strong> dl-PCB<br />
[ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg Futtermittel<br />
(12% Feuchte)]<br />
184<br />
Gentechnische Veränderungen<br />
70<br />
70<br />
Mittelwert<br />
0,23<br />
0,28<br />
0,39<br />
Median<br />
0,04<br />
0,01<br />
0,05<br />
Minimum<br />
0,03<br />
0,9%<br />
(Anteil an der<br />
Anzahl der<br />
Untersuchungen)<br />
Positive Bef<strong>und</strong>e<br />
0,9%/
180<br />
4.8 Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Überwachung, Tierschutz <strong>und</strong> Tierseuchenbekämpfung<br />
Tabelle 4.78: Zulassungen <strong>und</strong> Genehmigungen in der Tierseuchenbekämpfung<br />
Anlass Tierart<br />
Anzahl Veranstaltungen/Zu -<br />
las sungen/Genehmigungen<br />
§ 4 VVVO; anzeigepflichtige<br />
Veranstaltungen<br />
Zwischensumme<br />
EG-Zulassungen (neu oder<br />
aktualisiert)<br />
Zwischensumme<br />
Gesamtsumme<br />
Gem. Veranstaltungen<br />
Geflügel<br />
Kaninchen<br />
Pferde<br />
Rinder<br />
Schafe/Ziegen<br />
Schweine<br />
Tauben<br />
Sonstige<br />
Affenhaltung<br />
Pferdebesamungsstation<br />
Schweinebesamungsstation<br />
Rindersamendepots<br />
Fischhaltung<br />
vermehrungsfähige<br />
Tierseuchenerreger<br />
56<br />
67<br />
5<br />
538<br />
113<br />
15<br />
9<br />
13<br />
8<br />
824<br />
1<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
4<br />
14<br />
838<br />
Anzahl Bescheide<br />
22<br />
65<br />
5<br />
68<br />
19<br />
6<br />
2<br />
13<br />
7<br />
207<br />
1<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
4<br />
14<br />
221
Tabelle 4.79: Schädlingsbekämpfung – Zoodiagnostik<br />
Ges<strong>und</strong>heitsämter<br />
Veterinärämter, Lebensmittelüberwachung<br />
andere Ämter, Öffentl.<br />
Einrichtungen<br />
LAVES intern<br />
(Mitarbeiter, Institute)<br />
Firmen<br />
(Schädlingsbekämpfer)<br />
Privatpersonen<br />
Summe<br />
Anzahl<br />
Einsendungen<br />
206<br />
6<br />
2<br />
50<br />
340<br />
26<br />
630<br />
Vergleich zum<br />
Vorjahr<br />
-19<br />
-4<br />
±0<br />
-4<br />
+47<br />
-3<br />
+16<br />
Tabelle 4.80: Schädlingsbekämpfung – Beratungen<br />
Anfragesteller Behörden aus<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Anzahl 713 158<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Behörden aus<br />
den anderen<br />
B<strong>und</strong>esländern,<br />
Österreich <strong>und</strong><br />
der Schweiz<br />
Privatpersonen<br />
491<br />
Schädlingsbekämpfungsfirmen<br />
221<br />
LAVES-intern<br />
Tabelle 4.81: Schädlingsbekämpfung – Kontrollen großräumiger Rattenbekämpfungsmaßnahmen (jeweils 1-2<br />
Wochen/Kontrolle)<br />
Kurorte/<br />
Luftkurorte<br />
Beanstandungen<br />
Anzahl 44 14<br />
durchgeführte<br />
Nachkontrollen<br />
5<br />
anstehende<br />
Nachkontrollen<br />
8<br />
152<br />
anstehende<br />
Hauptkontrollen<br />
8<br />
Summe<br />
1.735<br />
Summe<br />
61<br />
181
182<br />
Tabelle 4.82: Fischseuchenbekämpfung – Beratung <strong>und</strong><br />
Kontrollen<br />
Fischseuchenbekämpfung<br />
telefonische <strong>und</strong> schriftliche Beratung<br />
behördliche Stellungnahmen <strong>und</strong> Vermerke<br />
Betriebsbesuche/vor Ort Beratung <strong>und</strong><br />
Probenahme<br />
klinische Untersuchungen<br />
Workshop Fischseuchenbekämpfung<br />
Tierschutz bei Fischen<br />
telefonische <strong>und</strong> schriftliche Beratung<br />
behördliche Stellungnahmen <strong>und</strong> Vermerke<br />
Betriebsbesuche/vor Ort Beratung<br />
Überprüfung des Ges<strong>und</strong>heitsstatus von<br />
Fischen<br />
Wasseruntersuchungen<br />
Sachk<strong>und</strong>elehrgang Zierfische<br />
Fischsterben in öffentlichen Gewässern<br />
telefonische <strong>und</strong> schriftliche Beratung<br />
behördliche Stellungnahmen <strong>und</strong> Vermerke<br />
Probenahme <strong>und</strong> Untersuchung<br />
Anzahl<br />
213<br />
41<br />
35<br />
28<br />
2<br />
78<br />
21<br />
17<br />
17<br />
14<br />
2<br />
6<br />
3<br />
3<br />
Anzahl<br />
Teil nehmer<br />
156<br />
16<br />
43<br />
Tabelle 4.83: Tierschutz – Beratungen nach Tierarten <strong>und</strong><br />
Sachgebieten<br />
Tiergruppen Anzahl der Anfragen<br />
Nutztiere<br />
Vögel<br />
Fische<br />
Wildtiere<br />
Haus- <strong>und</strong> Heimtiere<br />
Wirbellose<br />
Zoo- <strong>und</strong> Zirkustiere<br />
Spezielle Sachgebiete (Transporte, Schlachtung,<br />
§11-Erlaubnisse usw.)<br />
Tierschutz allgemein<br />
Summe<br />
991<br />
79<br />
20<br />
65<br />
216<br />
11<br />
138<br />
930<br />
31<br />
2.481
Tabelle 4.84: Tierschutz – Beratung, Herkunft der Anfragen<br />
Empfänger Anteil<br />
Kommunale Veterinärbehörden in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung<br />
Veterinärbehörden anderer B<strong>und</strong>esländer, BMVEL,<br />
Ausland<br />
sonstige Nds. Behörden/Institutionen<br />
Wissenschaftliche Einrichtungen (Universitäten,<br />
Fachhochschulen, Institute einschl.<br />
Tierversuchseinrichtungen)<br />
Verbände (Tierschutzorganisationen, Landvolk,<br />
Geflügelwirtschaftsverband etc.)<br />
Parteien, Medien<br />
Firmen, Landwirte, Privatpersonen<br />
38%<br />
12%<br />
8%<br />
8%<br />
14%<br />
7%<br />
2%<br />
11%<br />
Tierseuchen <strong>und</strong> Tierkrankheiten<br />
TSE<br />
Tabelle 4.86: TSE-Untersuchungen von Rindern <strong>und</strong> kleinen<br />
Wiederkäuern<br />
Kategorie Anzahl<br />
Ges<strong>und</strong>schlachtung<br />
Monitoring<br />
Getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung<br />
Summe<br />
verendet<br />
not-/krankgeschlachtet<br />
Tiere mit klinischen Erschei -<br />
nungen vor der Schlachtung<br />
Tabelle 4.87: Bestätigte TSE-Fälle 2007<br />
Monat Landkreis<br />
(Geburt)<br />
April<br />
Juni<br />
Summe<br />
LER<br />
WAF<br />
157.383<br />
38.348<br />
2.830<br />
17<br />
21<br />
198.599<br />
Kategorie Tierart Geburtsdatum/<br />
Alter<br />
Normalschlachtung<br />
verendet<br />
2<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Rind<br />
Rind<br />
28.12.1999<br />
01.08.1999<br />
Tabelle 4.85: Tierversuche, Anzahl der Verwaltungs ver -<br />
fahren<br />
Art des Verfahrens Anzahl<br />
Genehmigung Tierversuch<br />
Änderungen von genehmigungspfl. Tierversuchen<br />
Anzeigepflichtige Vorhaben<br />
Änderungen bei anzeigepflichtigen Vorhaben<br />
Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Abs. 1<br />
Satz 4 TierSchG<br />
Einfuhrgenehmigungen<br />
Summe<br />
308<br />
412<br />
248<br />
37<br />
201<br />
98<br />
1.304<br />
Abteilung 3 Tierges<strong>und</strong>heit<br />
183
184<br />
Tabelle 4.88: TSE -Untersuchungen von kleineren Wieder -<br />
käuern/CWD-Monitoring 2007<br />
Tierart<br />
Schaf<br />
Ziege<br />
Rotwild<br />
Summe<br />
Kategorie<br />
Ges<strong>und</strong>schlachtung<br />
verendet<br />
not-/krankgeschlachtet<br />
Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der<br />
Schlachtung<br />
getötete Tiere im Rahmen der TSE-<br />
Ausmerzung<br />
Ges<strong>und</strong>schlachtung<br />
verendet<br />
not-/krankgeschlachtet<br />
Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der<br />
Schlachtung<br />
Tötung<br />
Anzahl<br />
2.039<br />
1.292<br />
2<br />
42<br />
147<br />
41<br />
<strong>3.</strong>563<br />
Tabelle 4.89: Pathomorphologische Untersuchungen mit<br />
Tierschutzrelevanz<br />
Tierart<br />
Rind<br />
Schaf<br />
Schwein<br />
H<strong>und</strong><br />
Katze<br />
Pferd<br />
Reptilien<br />
Pute<br />
Wildgeflügel<br />
Ziervögel<br />
Igel<br />
Marder<br />
Summe<br />
Anzahl der eingesandten Fälle<br />
mit Tierschutzrelevanz; Nachweis -<br />
methode: Makroskopie <strong>und</strong> Histo<br />
logie<br />
11<br />
5<br />
7<br />
5<br />
1<br />
2<br />
3<br />
7<br />
88<br />
2<br />
1<br />
1<br />
133
Anzeigepflichtige Tierseuchen<br />
Tabelle 4.90: Untersuchungen zu anzeigepflichtigen Tierseuchen (Teil 1)<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode Untersuchungen insgesamt davon positiv<br />
Aujeszkysche Krankheit<br />
(Pseudowut)<br />
Aviäre Influenza<br />
(Geflügelpest)<br />
Beschälseuche der Pferde<br />
Blauzungenkrankheit<br />
Bovines Herpesvirus 1<br />
(BHV1), Infektiöse Bovine<br />
Rhinotracheitis (IBR)<br />
Bovine Virusdiarrhoe/<br />
Mucosal Disease (BVD/MD)<br />
Amerikanische Faulbrut der<br />
Bienen<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Antikörper<br />
Virus<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Bakterien<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
gb-ELISA<br />
ge-ELISA<br />
ELISA<br />
SNT<br />
Eikultur<br />
PCR<br />
ELISA<br />
HAH<br />
KBR<br />
PCR<br />
ELISA<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
ELISA<br />
SNT<br />
Antigen-Elisa<br />
PCR<br />
Zellkultur<br />
Immunfluoreszenz<br />
ELISA<br />
SNT<br />
Kultur, Brutwaben<br />
Kultur, Futterkranzproben<br />
1.505<br />
270<br />
6.989<br />
9.358<br />
5.833<br />
1<br />
155<br />
,<br />
7.524<br />
1.364<br />
8.350<br />
50<br />
74.023<br />
91.875<br />
167<br />
170<br />
530.628<br />
10<br />
97.185<br />
577<br />
645<br />
338<br />
2.814<br />
7<br />
82<br />
<strong>3.</strong>651<br />
0<br />
0<br />
102<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2<br />
25<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5.967<br />
5.135<br />
3<br />
0<br />
25.397<br />
0<br />
1.285<br />
108<br />
134<br />
20<br />
466<br />
5<br />
40<br />
282<br />
Impfantikörper<br />
keine H5N1<br />
**<br />
**<br />
*<br />
*<br />
185
186<br />
Tabelle 4.90: Untersuchungen zu anzeigepflichtigen Tierseuchen (Teil 2)<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode Untersuchungen insgesamt davon positiv<br />
Brucellose<br />
Enzootische Rinderleukose<br />
Infektiöse Anämie der Einhufer<br />
Klassische Schweinepest<br />
(Hausschwein)<br />
Klassische Schweinepest<br />
(Wildschwein)<br />
Koi-Herpesvirus<br />
Newcastle Disease<br />
(Atypische Geflügelpest)<br />
Psittakose<br />
(Papageienkrankheit)<br />
Erreger<br />
Antikörper<br />
Antikörper<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
DNA<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Bakterien/DNA<br />
Kultur<br />
PCR<br />
Rose-Bengal-Test<br />
KBR<br />
ELISA<br />
Langsamagglutination<br />
ELISA<br />
IDT<br />
Agarimmunodiffusion<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
PCR<br />
ELISA<br />
SNT<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
ELISA<br />
PCR<br />
ELISA<br />
PCR<br />
Eikultur<br />
HAH<br />
PCR<br />
HAH<br />
Ag-Elisa<br />
PCR<br />
384<br />
902<br />
4.991<br />
8.492<br />
8.426<br />
6<strong>3.</strong>818<br />
9.082<br />
64.505<br />
79<br />
1.566<br />
303<br />
1.745<br />
2.902<br />
8<br />
40<br />
173<br />
9<br />
2.216<br />
2.155<br />
321<br />
33<br />
66<br />
60<br />
878<br />
326<br />
41<br />
0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
60<br />
0<br />
0<br />
0<br />
670<br />
8<br />
20<br />
(Hase)<br />
**
Tabelle 4.90: Untersuchungen zu anzeigepflichtigen Tierseuchen (Teil 3)<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode Untersuchungen insgesamt davon positiv<br />
Rauschbrand<br />
Rotz<br />
Salmonellen beim<br />
Zuchtgeflügel (S. Typhimu -<br />
rium, S. Enterititdis)<br />
Salmonellose des Rindes<br />
Tollwut<br />
Trichomonadenseuche des<br />
Rindes<br />
Tuberkulose des Rindes<br />
Tularämie<br />
Vibrionenseuche des Rindes<br />
Virale Hämorrhagische<br />
Septikämie (VHS) der<br />
Forellen<br />
Infektiöse Hämatopoetische<br />
Nekrose (IHN) der Forellen<br />
Erreger<br />
Antikörper<br />
Bakterien<br />
Bakterien<br />
Virus/Antigen<br />
Erreger<br />
Erreger<br />
Erreger<br />
Erreger<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Kultur<br />
KBR<br />
Kultur<br />
Kultur<br />
PCR<br />
IFT<br />
Zellkultur<br />
Kultur<br />
ZN<br />
PCR<br />
Kultur<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
ELISA<br />
PCR<br />
Zellkultur<br />
* Endergebnisse<br />
** Mehrfachnennungen, positive Ergebnisse wurden z. T. mit verschiedenen Testsystemen bestätigt<br />
*** VHS/IHN/IPN werden parallel, auf den gleichen Zelllinien untersucht<br />
IFT<br />
ELISA<br />
PCR<br />
57<br />
45<br />
2.214<br />
4.388<br />
2<br />
1.627<br />
136<br />
262<br />
13<br />
898<br />
312<br />
215<br />
8<br />
10<br />
14<br />
215<br />
8<br />
10<br />
10<br />
8<br />
0<br />
35<br />
247<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2<br />
1<br />
0<br />
8<br />
8<br />
8<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
0<br />
**<br />
(Hase)<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
187
188<br />
Meldepflichtige Tierseuchen<br />
Tabelle 4.91: Untersuchungen zu meldepflichtigen Tierkrankheiten<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode Untersuchungen insgesamt davon positiv<br />
Campylobacteriose (thermophile<br />
Campylobacter)<br />
Caprine Arthritis/Encephalitis<br />
(CAE) <strong>und</strong> Maedi/Visna<br />
Chlamydiose (außer<br />
Psittakose)<br />
Echinokokkose<br />
EHEC/O157<br />
Equine virale Arteriitis (EVA)<br />
Infektiöse Pankreasnekrose<br />
der Forellen <strong>und</strong><br />
Forellenartigen (IPN)<br />
Leptospirose<br />
Listeriose<br />
Paratuberkulose<br />
Q-Fieber<br />
Salmonellose<br />
Tuberkulose<br />
DNA<br />
Antikörper<br />
Erreger/Antigen<br />
Antikörper<br />
Erreger<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Antikörper<br />
Erreger<br />
Erreger<br />
Antikörper<br />
Erreger<br />
Antikörper<br />
Erreger<br />
Bakterien<br />
Kultur<br />
* Mehrfachnennungen, positive Ergebnisse wurden z. T. mit verschiedenen Testsystemen bestätigt<br />
** Bestätigungstest für Zellkultur<br />
PCR<br />
ELISA<br />
AG-Elisa<br />
PCR<br />
ELISA<br />
Mikroskopie<br />
PCR<br />
SNT<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
ELISA<br />
MAR<br />
Kultur<br />
PCR<br />
ZN<br />
PCR<br />
Kultur<br />
ELISA<br />
PCR<br />
ELISA<br />
PCR<br />
Kultur<br />
ZN<br />
PCR<br />
222<br />
623<br />
155<br />
244<br />
201<br />
81<br />
763<br />
53<br />
22<br />
215<br />
4<br />
3<br />
1.274<br />
89<br />
526<br />
72<br />
1.245<br />
1.335<br />
21.900<br />
114<br />
579<br />
2.456<br />
<strong>3.</strong>542<br />
16<br />
8<br />
87<br />
345<br />
21<br />
2<br />
31<br />
20<br />
27<br />
3<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
12<br />
20<br />
168<br />
18<br />
122<br />
109<br />
217<br />
16<br />
11<br />
326<br />
88<br />
4<br />
6<br />
*<br />
*<br />
*<br />
**<br />
**<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*
Sonstige Tierkrankheiten<br />
Tabelle 4.92: Untersuchungen zu sonstigen Tierkrankheiten – Nachweise von Viren <strong>und</strong> speziellen anderen Krankheits -<br />
erregern<br />
Erkrankung/Erreger Nachweis von Nachweismethode 1) Untersuchungen insgesamt davon positiv<br />
Border Disease<br />
Bovine Respiratory Syncytial<br />
Virus<br />
Calicivirus, Rabbit<br />
Hemorrhagic Disease (RHD)<br />
Hauskaninchen<br />
European Brown Hare<br />
Syndrom (EBHS) Feldhase<br />
Chlamydien<br />
Circovirus (PCV 2)<br />
Clostridien<br />
Coronavirus<br />
Q-Fieber<br />
Fischkrankheiten viraler Ge -<br />
nese (ohne VHS/IHN/IPN/KHV)<br />
Parainfluenza-3-Virus<br />
Equines-Herpes-1-Virus<br />
Neospora caninum<br />
Porcine Reproductive and<br />
Respiratory Syndrome (PRRS)<br />
Rotavirus<br />
Staupe<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
Erreger/Antigen<br />
Antikörper<br />
Virus<br />
Virus/Antigen<br />
Erreger<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
Antigen<br />
Antikörper<br />
Antikörper<br />
Virus/Antigen<br />
Virus/Antigen<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
IFT<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
Zellkultur<br />
HA<br />
AG-Elisa<br />
PCR<br />
Ak-Elisa<br />
PCR<br />
PCR<br />
ELISA<br />
PCR<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
Zellkultur<br />
IFT<br />
Zellkultur<br />
PCR<br />
ELISA<br />
ELISA<br />
Latextest<br />
ELISA<br />
IFT<br />
Veterinärinstitute Oldenburg <strong>und</strong> Hannover<br />
23<br />
20<br />
11<br />
22<br />
63<br />
117<br />
93<br />
30<br />
81<br />
23<br />
83<br />
126<br />
226<br />
28<br />
39<br />
28<br />
1<br />
1<br />
70<br />
429<br />
109<br />
10<br />
126<br />
48<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
29<br />
8<br />
0<br />
1<br />
20<br />
15<br />
8<br />
2<br />
0<br />
2<br />
0<br />
1<br />
1<br />
0<br />
3<br />
96<br />
60<br />
1<br />
27<br />
11<br />
white bream<br />
virus<br />
189
190<br />
Tabelle 4.93: Nachweis weiterer bakterieller bzw. mykologischer Infektionserreger bei Tierkrankheiten (Teil 1)<br />
Nachweis von<br />
Infektionserregern<br />
kein Nachweis von<br />
Infektionserregern<br />
Actinobac. pleuropneumoniae<br />
Aeromonas sobria<br />
Arcanobacterium pyogenes<br />
Aspergillus spec.<br />
Arcobacter cryaerophilus<br />
Bacillus licheniformis<br />
Bordetella bronchiseptica<br />
Clostridium clostridiiforme<br />
Clostridium perfringens<br />
Clostridium septicum<br />
Enterococcus faecalis<br />
Erysipelothrix rhusiopathiae<br />
Escherichia coli<br />
E. coli (O78:K80)<br />
E. coli (O8:K87)<br />
Gallibacterium anatis<br />
Haemophilus parasuis<br />
Rind Schwein Pferd Schaf,<br />
Ziege<br />
89<br />
15<br />
8<br />
10<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
2<br />
26<br />
6<br />
6<br />
1<br />
26<br />
39<br />
1<br />
4<br />
1<br />
2<br />
1<br />
3<br />
1<br />
7<br />
1<br />
5<br />
13<br />
2<br />
H<strong>und</strong>,<br />
Katze,<br />
Heimtiere<br />
14<br />
17<br />
2<br />
1<br />
5<br />
Zootiere,<br />
Wild (Rehe,<br />
u. a.), sonstige<br />
Tiere<br />
6<br />
8<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
Hausgeflügel<br />
2<br />
33<br />
1<br />
Zier-,<br />
Wildvögel<br />
4<br />
16<br />
1<br />
2<br />
1<br />
weitere<br />
Tierarten<br />
0<br />
0
Tabelle 4.93: Nachweis weiterer bakterieller bzw. mykologischer Infektionserreger bei Tierkrankheiten (Teil 2)<br />
Mannheimia haemolytica<br />
Mannheimia varigena<br />
Morganella morganii<br />
Pasteurella multocida<br />
Proteus mirabilis<br />
Salmonella<br />
Staphylococcus aureus<br />
Staphylococcus intermedius<br />
Staphylokokken (koag.<br />
positiv)<br />
Staphylokokken (koag.<br />
negativ)<br />
Streptococcus bovis<br />
Streptococcus canis<br />
Streptococcus dysgalactiae<br />
Streptococcus equi ssp.<br />
zooepidemicus<br />
Streptococcus spec.<br />
Streptococcus suis<br />
Streptococcus uberis<br />
Vibrio metschnikovii<br />
Yersinia pseudotuberculosis<br />
Rind Schwein Pferd Schaf,<br />
Ziege<br />
4<br />
1<br />
1<br />
6<br />
1<br />
11<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
7<br />
1<br />
2<br />
1<br />
6<br />
3<br />
1<br />
4<br />
H<strong>und</strong>,<br />
Katze,<br />
Heimtiere<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
Zootiere,<br />
Wild (Rehe,<br />
u. a.), sonstige<br />
Tiere<br />
1<br />
1<br />
Hausgeflügel<br />
1<br />
Zier-,<br />
Wildvögel<br />
weitere<br />
Tierarten<br />
191
192<br />
Tabelle 4.94: Nachweis von Darminfektionen (Bakterien, Hefen) bei Jungtieren<br />
Parasitennachweise<br />
Enteritiserreger nachweisbar<br />
davon Candida glabrata<br />
Clostridium perfringens<br />
davon Typ A<br />
davon Typ D<br />
Escherichia coli<br />
davon hämolysierende E.<br />
coli<br />
E. coli (O78:K80)<br />
E. coli (O8:K87)<br />
Salmonella Lexington<br />
Salmonella Subspez. IIIb<br />
Salmonellenanreicherung<br />
negativ<br />
Keine Enteritiserreger<br />
nachweisbar<br />
Virus-ELISA (n = 118)<br />
Rota-Virus<br />
Corona-Virus<br />
Rind Schwein Pferd Schaf,<br />
Ziege<br />
52<br />
9<br />
41<br />
16<br />
7<br />
129<br />
87<br />
26<br />
2<br />
5<br />
4<br />
1<br />
1<br />
16<br />
11<br />
3<br />
6<br />
6<br />
2<br />
2<br />
4<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
11<br />
8<br />
H<strong>und</strong>,<br />
Katze,<br />
Heimtiere<br />
1<br />
1<br />
5<br />
4<br />
Zootiere,<br />
Wild (Rehe,<br />
u. a.), sonstige<br />
Tiere<br />
3<br />
2<br />
1<br />
3<br />
Hausgeflügel<br />
5<br />
4<br />
3<br />
8<br />
3<br />
Zier-,<br />
Wildvögel<br />
1<br />
1<br />
10<br />
9<br />
weitere<br />
Tierarten<br />
4<br />
4
Tabelle 4.95: Nachweis von Parasiten<br />
Parasitenbefall<br />
Kryptosporidien<br />
kein Nachweis<br />
Parasiten (Flotation)<br />
Proben mit Nachweis<br />
davon Kokzidien<br />
Magen-Darm-Strongyliden<br />
Spulwurm<br />
kein Nachweis<br />
Sedimentation (Band-, Saugwurmnachweise)<br />
Fasciola hepatica<br />
sonst.<br />
Trematodennachweis<br />
kein Nachweis<br />
Migration (Lungenwurmnachweis)<br />
Dictyocaulus<br />
kein Nachweis<br />
Ektoparasitennachweis<br />
kein Nachweis<br />
Rind Schwein Pferd Schaf,<br />
Ziege<br />
53<br />
115<br />
20<br />
17<br />
140<br />
1<br />
1<br />
24<br />
1<br />
7<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
0<br />
3<br />
1<br />
1<br />
3<br />
1<br />
4<br />
3<br />
23<br />
15<br />
26<br />
1<br />
6<br />
7<br />
1<br />
H<strong>und</strong>,<br />
Katze,<br />
Heimtiere<br />
8<br />
8<br />
1<br />
11<br />
Zootiere,<br />
Wild (Rehe,<br />
u. a.), sonstige<br />
Tiere<br />
6<br />
3<br />
5<br />
11<br />
1<br />
Hausgeflügel<br />
1<br />
13<br />
6<br />
8<br />
2<br />
5<br />
Zier-,<br />
Wildvögel<br />
7<br />
2<br />
6<br />
4<br />
weitere<br />
Tierarten<br />
13 4<br />
Veterinärinstitut Oldenburg<br />
193
194<br />
Tabelle 4.96: Pathomorphologische Untersuchungen auf Krankheits- oder Todesursache<br />
Broiler<br />
Fuchs<br />
Hamster<br />
Hase<br />
Hausgeflügel<br />
Hauskaninchen<br />
Hausnager<br />
Hausschwein<br />
Hausziege<br />
Hirsch<br />
H<strong>und</strong><br />
Känguru<br />
Katze<br />
Meerschweinchen<br />
Pferd<br />
Reh<br />
Reptilien<br />
Rind<br />
Rinderfetus<br />
Schaf<br />
Schaflamm<br />
Sittich<br />
Wildgeflügel<br />
Wildtier<br />
Ziervögel<br />
Papagei<br />
Zootier<br />
Zoovogel<br />
Summe<br />
11<br />
1<br />
28<br />
1<br />
20<br />
2<br />
3<br />
2<br />
1<br />
26<br />
43<br />
4<br />
1<br />
4<br />
6<br />
1<br />
1<br />
155<br />
1<br />
5<br />
6<br />
15<br />
1<br />
2<br />
11<br />
2<br />
1<br />
44<br />
3<br />
23<br />
5<br />
1<br />
4<br />
10<br />
1<br />
2<br />
49<br />
2<br />
2<br />
24<br />
1<br />
3<br />
3<br />
1<br />
2<br />
20<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
13<br />
1<br />
78<br />
7<br />
9<br />
2<br />
18<br />
2<br />
4<br />
3<br />
1<br />
45<br />
6<br />
3<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
108<br />
5<br />
5<br />
10<br />
1<br />
2<br />
1<br />
4<br />
11<br />
4<br />
5<br />
20<br />
1<br />
20<br />
4<br />
3<br />
10<br />
1<br />
3<br />
6<br />
2<br />
1<br />
33<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
7<br />
1<br />
2<br />
99<br />
17<br />
1<br />
2<br />
24<br />
8<br />
1<br />
9<br />
1<br />
3<br />
22<br />
4<br />
25<br />
2<br />
7<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
132<br />
1<br />
1<br />
1<br />
21<br />
20<br />
2<br />
7<br />
1<br />
1<br />
5<br />
1<br />
1<br />
4<br />
15<br />
13<br />
9<br />
9<br />
1<br />
4<br />
117<br />
Bakteri-<br />
ämie/<br />
Sepsis<br />
Virusin-<br />
fektion<br />
Pneumo-<br />
nie<br />
Enteritis Arthritis Enzepha -<br />
litis<br />
nicht ent-<br />
zündliche<br />
Organver-<br />
änderun-<br />
gen<br />
Tierart entzünd-<br />
licheOr- ganver-<br />
änderun- gen<br />
Parasi-<br />
tosen<br />
Entero-<br />
toxämie<br />
fokale<br />
bak teri -<br />
elle In -<br />
fektion
Tabelle 4.97: Pathomorphologische Untersuchungen auf Krankheits- oder Todesursache (Teil 1)<br />
Tierart<br />
Brieftaube<br />
Eichhörnchen<br />
Fledermaus<br />
Fuchs<br />
Hase<br />
Hausgeflügel<br />
Hauskaninchen<br />
Hausnager<br />
Hausschwein<br />
Hirsch<br />
H<strong>und</strong><br />
Igel<br />
Iltis<br />
Känguru<br />
Katze<br />
Lama<br />
Marder<br />
infektiöser<br />
Abort<br />
nichtinfektiöser<br />
Abort<br />
3<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Tumor Trauma Missbildung<br />
1<br />
3<br />
9<br />
3<br />
5<br />
2<br />
1<br />
10<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
Tier -<br />
schutz -<br />
relevanz<br />
7<br />
7<br />
5<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Intoxika -<br />
tio nen<br />
1<br />
5<br />
1<br />
AnzeigeMelde- ohne<br />
pflichtigepflichtige Bef<strong>und</strong><br />
TierTierkrank - krank<br />
heiten heiten<br />
15<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
33<br />
1<br />
30<br />
9<br />
3<br />
4<br />
2<br />
6<br />
Tollwut<br />
negativ<br />
2<br />
14<br />
3<br />
1<br />
AIV<br />
negativ<br />
1<br />
154<br />
195
196<br />
Tabelle 4.97: Pathomorphologische Untersuchungen auf Krankheits- oder Todesursache (Teil 2)<br />
Tierart<br />
Pferd<br />
Pferdefetus<br />
Reptilien<br />
Rind<br />
Rinderfetus<br />
Schaf<br />
Schaffetus<br />
Schaflamm<br />
Schweinefetus<br />
Sittich<br />
Wildgeflügel<br />
Ziegenfetus<br />
Ziervögel<br />
Papagei<br />
Zootier<br />
Zoovogel<br />
Summe (Teil 1-2)<br />
infektiöser<br />
Abort<br />
1<br />
1<br />
28<br />
1<br />
2<br />
33<br />
nichtinfektiöser<br />
Abort<br />
4<br />
4<br />
43<br />
2<br />
2<br />
4<br />
2<br />
64<br />
Tumor Trauma Missbildung<br />
5<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
27<br />
5<br />
5<br />
12<br />
3<br />
1<br />
2<br />
2<br />
57<br />
3<br />
5<br />
Tierschutzrelevanz<br />
1<br />
3<br />
9<br />
5<br />
87<br />
2<br />
129<br />
Intoxi-<br />
katio nen<br />
3<br />
1<br />
1<br />
64<br />
1<br />
77<br />
AnzeigepflichtigeTierkrankheiten<br />
13<br />
6<br />
1<br />
4<br />
1<br />
25<br />
Melde- ohne<br />
pflichtige Bef<strong>und</strong><br />
Tierkrankheiten<br />
10<br />
5<br />
2<br />
1<br />
36<br />
2<br />
40<br />
8<br />
4<br />
4<br />
3<br />
1<br />
Tollwut<br />
negativ<br />
154 20<br />
AIV<br />
negativ<br />
Vielfach sind hier Mehrfachnennungen impliziert, da bei einer Sektion eines Tieres häufig unterschiedliche Bef<strong>und</strong>e bzw. Diagnosen festgestellt<br />
werden<br />
Veterinärinstitut Oldenburg <strong>und</strong> Futtermittelinstitut Stade<br />
13<br />
153<br />
321
Tabelle 4.98: Nachweis obligat fischpathogener Bakterien<br />
Fischgruppe Nutzfische Zierfische Wasser Summe<br />
Einsendungen<br />
Bakteriengattungen/-arten<br />
Aeromonas salmonicida<br />
Edwardsiella sp.<br />
Flavobakterium sp./ Flexibacter sp.<br />
Mykobakterien<br />
Streptococcus iniae<br />
Vibrio anguillarum<br />
Yersinia ruckeri<br />
Tabelle 4.99: Nachweis fakultativ fischpathogener Bakterien <strong>und</strong> Mykosen<br />
115<br />
7<br />
1<br />
2<br />
–<br />
–<br />
–<br />
8<br />
Fischgruppe Nutzfische Zierfische Wasser Summe<br />
Einsendungen<br />
Bakteriengattungen/-arten<br />
bewegliche Aeromonaden<br />
Aeromonas hydrophila<br />
Aeromonas sobria<br />
Acinetobacter<br />
Citrobacter fre<strong>und</strong>ii<br />
Cytophaga sp.<br />
Pseudomonas sp.<br />
Vibrio sp.<br />
weitere Bakteriengattungen<br />
Saprolegnia<br />
weitere Mykosen<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
115<br />
14<br />
18<br />
25<br />
3<br />
2<br />
2<br />
34<br />
4<br />
3<br />
8<br />
17<br />
334<br />
1<br />
2<br />
10<br />
5<br />
1<br />
2<br />
2<br />
334<br />
32<br />
93<br />
165<br />
14<br />
12<br />
24<br />
169<br />
14<br />
11<br />
16<br />
18<br />
51<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
51<br />
1<br />
16<br />
12<br />
–<br />
–<br />
2<br />
12<br />
–<br />
3<br />
–<br />
–<br />
500<br />
8<br />
3<br />
12<br />
5<br />
1<br />
2<br />
10<br />
500<br />
47<br />
127<br />
202<br />
17<br />
14<br />
26<br />
215<br />
18<br />
17<br />
24<br />
35<br />
197
198<br />
Tabelle 4.100: Virologische <strong>und</strong> molekularbiologische<br />
Untersuchungen von Fischproben (Teil 1)<br />
Fischart/Untersuchungsanlass Einsendungen<br />
(Einzelproben/<br />
Pools)<br />
VHS/IHN<br />
Regenbogenforelle<br />
Bachforelle<br />
Saibling<br />
Seesaibling<br />
Lachs<br />
Steinbutt<br />
Hecht<br />
Quappe<br />
Rotauge<br />
Fischfutter<br />
Summe<br />
Koikarpfen<br />
Goldfisch<br />
Karpfen (Nutzfische)<br />
Graskarpfen<br />
Zierkarpfen<br />
Schleie<br />
Unbekannt<br />
Summe<br />
196<br />
4<br />
4<br />
3<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
215<br />
Positiv<br />
8x VHS<br />
4x IPN<br />
1x IHN<br />
KHV (Einsendungen aus <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> anderen B<strong>und</strong>esländern)<br />
284<br />
16<br />
14<br />
1<br />
3<br />
1<br />
2<br />
321<br />
58<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Tabelle 4.100: Virologische <strong>und</strong> molekularbiologische<br />
Untersuchungen von Fischproben (Teil 2)<br />
Fischart/Untersuchungsanlass Einsendungen<br />
(Einzelproben/<br />
Pools)<br />
SVC<br />
Karpfen<br />
Spiegelkarpfen<br />
Koi<br />
Schleierschwanz<br />
Giebelfisch<br />
Dornauge<br />
Schleie/Barsch/Karpfen<br />
Summe Untersuchungen auf SVC<br />
Sonstige Krankheiten viraler Genese<br />
Aal<br />
Tilapia<br />
Wolfbarsch<br />
Summe<br />
Untersuchungen Gesamtsumme<br />
6<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
14<br />
10<br />
1<br />
1<br />
12<br />
562<br />
Positiv<br />
1x White<br />
Bream Virus<br />
1x White<br />
Bream Virus<br />
2x Picornavirus
Wildtierkrankheiten<br />
Tabelle 4.101: Diagnosen von Wild<br />
Vollsektionen 357<br />
Diagnosen<br />
Trauma<br />
bakterielle Infektionen<br />
Parasitose<br />
Yersiniose/Pasteurellose<br />
EBHS/RHD<br />
Enzephalitis<br />
Staupe<br />
Andere<br />
Summe*<br />
Hase/<br />
Kaninchen<br />
11<br />
45<br />
29<br />
20<br />
39<br />
1<br />
29<br />
128<br />
Tabelle 4.102: Diagnosen von Wild<br />
Tierart Teilsektionen<br />
Hase<br />
Bisam<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Reh Wildschwein<br />
7<br />
16<br />
8<br />
9<br />
11<br />
33<br />
16<br />
7<br />
2<br />
6<br />
24<br />
Fuchs Marder Wildvögel Wassergeflügel<br />
7<br />
10<br />
4<br />
2<br />
5<br />
19<br />
1<br />
1<br />
6<br />
1<br />
9<br />
11<br />
25<br />
7<br />
14<br />
2<br />
9<br />
27<br />
10<br />
16<br />
3<br />
16<br />
41<br />
Fledermaus<br />
48<br />
48<br />
Andere<br />
* Abweichungen hinsichtlich der Übereinstimmung von Einsendungen <strong>und</strong> Diagnosen können auf Gr<strong>und</strong> von Mehrfachdiagnosen je Tier zu stan-<br />
de kommen<br />
413<br />
763<br />
Im Rahmen des Projektes Zoonoseerreger beim Hasen<br />
Im Rahmen des Projektes Zoonoseereger beim Bisam<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
6<br />
12<br />
Veterinärinstitut Hannover<br />
199
200<br />
Zoonosen<br />
Tabelle 4.103: Salmonellose der Rinder<br />
Land/Region<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Deutschland<br />
Neuausbrüche während der Jahre 2003 bis 2007 (Zahl der Gehöfte, Auszüge aus dem Tierseuchenbericht des<br />
BMVEL)<br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
79<br />
214<br />
47<br />
138<br />
Tabelle 4.104: Nachweis von Salmonellen im Rahmen der bakteriologischen Untersuchung <strong>und</strong> von<br />
Hygieneuntersuchungen aus Schlacht- <strong>und</strong> Fleischproben, sowie Eiern, Milch <strong>und</strong> Hygienetupfern<br />
Matrix<br />
bakteriolog. Fleischuntersuchung Rind<br />
bakteriologische Fleischuntersuchung Schwein<br />
Schlachtkörper* Rind<br />
Schlachtkörper** Schwein<br />
Schlachtkörper* Schaf, Ziege, Pferd<br />
Hackfleisch*<br />
Separatorenfleisch*<br />
Fleischzubereitungen*<br />
Fleischerzeugnisse*<br />
Schlachtkörper* Masthähnchen (Broiler)<br />
Schlachtkörper* sonstiges Geflügel<br />
zerlegtes Fleisch<br />
zerlegtes Geflügelfleisch<br />
* Definitionen nach VO EC 853/2004 Anhang I 1. Fleisch<br />
** Definition nach VO EC 853/2004 Anhang I 7. Verarbeitungserzeugnisse<br />
untersucht davon positiv davon positiv<br />
S. Typhimurium<br />
863<br />
103<br />
57<br />
319<br />
8<br />
130<br />
50<br />
102<br />
115<br />
97<br />
74<br />
473<br />
249<br />
15<br />
97<br />
4<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
4<br />
10<br />
42<br />
7<br />
36<br />
17<br />
16<br />
95<br />
3<br />
2<br />
9<br />
21<br />
91<br />
davon positiv<br />
S. Enteritidis<br />
34<br />
3
Hygieneproben – Betriebshygiene<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Fleisch, Geflügelfleisch, Hackfleisch Fleischzubereitungen<br />
Tabelle 4.105: Beurteilung der Betriebe: Kontrolle der Reinigung <strong>und</strong> Desinfektion<br />
Betriebe ohne Mängel mit geringen<br />
Mängeln<br />
EU-Betriebe<br />
registrierte Betriebe<br />
Summe<br />
45<br />
40<br />
85<br />
60<br />
76<br />
136<br />
mit deutlichen<br />
Mängel<br />
Tabelle 4.106: Beurteilung der Betriebe – Kontrolle der Reinigung <strong>und</strong> Desinfektion<br />
48<br />
47<br />
95<br />
mit schwerwiegenden<br />
Mängel<br />
Betriebe Anzahl untersuchter Tupfer Gesamtkeimzahl über Richtwert<br />
EU-Betriebe<br />
registrierte Betriebe<br />
Summe<br />
2.570<br />
1.556<br />
4.126<br />
17<br />
54<br />
71<br />
718<br />
634<br />
1.352<br />
Anzahl Betriebe<br />
126 mit 170 Kontrollen<br />
211 mit 217 Kontrollen<br />
337 mit 387 Kontrollen<br />
201
202<br />
Tabelle 4.107: Amtliche Kontrolle betrieblicher Eigenkontrollen nach VO EU 2073/2005<br />
Material<br />
Schlachtkörper<br />
Schwein<br />
Schlachtkörper<br />
Rind<br />
Schlachtkörper<br />
Pferd, Schaf<br />
Summe<br />
* m: unterer Grenzwert<br />
M: oberer Grenzwert<br />
Tabelle 4.108: Amtliche Kontrolle betrieblicher Eigenkontrollen nach VO EU 2073/2005<br />
Material Anzahl der<br />
Proben<br />
Hackfleisch<br />
Separatorenfleisch<br />
Fleischzubereitungen<br />
Summe<br />
* m: unterer Grenzwert<br />
M: oberer Grenzwert<br />
Anzahl der<br />
Proben<br />
130<br />
50<br />
102<br />
282<br />
319<br />
57<br />
8<br />
384<br />
zwischen m <strong>und</strong> M* über M*<br />
Gesamtkeimzahl<br />
56<br />
14<br />
entfällt<br />
Gesamtkeimzahl<br />
60<br />
17<br />
5<br />
E. coli Gesamtkeimzahl<br />
28<br />
11<br />
20<br />
Enterobacteriaceae<br />
12<br />
34<br />
8<br />
entfällt<br />
7<br />
0<br />
Probenanzahl<br />
zwischen m <strong>und</strong> M* über M*<br />
Gesamtkeimzahl Enterobacteriaceae<br />
E. coli<br />
23<br />
24<br />
3<br />
14<br />
5<br />
0<br />
Salmonellen<br />
1<br />
4<br />
10<br />
12<br />
0<br />
List. monocytogenes<br />
37<br />
2<br />
36<br />
Salmonellen<br />
3<br />
0<br />
0<br />
VTEC<br />
0<br />
entfällt<br />
entfällt
Tabelle 4.109: Amtliche Kontrollen der Verlässlichkeit bereits durchgeführter betrieblicher Eigenkontrollen nach VO EU<br />
882/2004, Art. 3<br />
Material Anzahl der Proben<br />
Zerlegeteile Schwein<br />
Zerlegeteile Rind<br />
Zerlegeteile Schaf<br />
Organe<br />
Fleischerzeugnisse<br />
Schlachtblut<br />
Schlachtkörper<br />
Hähnchen<br />
Schlachtkörper Pute<br />
Schlachtköper<br />
Ente/Gans<br />
Zerlegeteile Hähnchen<br />
Zerlegeteile Pute<br />
Geflügelfleisch sonstiges<br />
Summe<br />
406<br />
59<br />
8<br />
40<br />
18<br />
6<br />
97<br />
54<br />
20<br />
68<br />
160<br />
21<br />
957<br />
Gesamtkeimzahl Enterobacteriaceae Salmonellen List. monocytogenes<br />
entfällt<br />
228<br />
Tabelle 4.110: Spezielle Programme Zoonoseerreger<br />
34<br />
1<br />
4<br />
1<br />
23<br />
24<br />
3<br />
22<br />
78<br />
1<br />
129<br />
26<br />
1<br />
4<br />
5<br />
21<br />
30<br />
0<br />
5<br />
42<br />
1<br />
über Richtwert<br />
Material Parameter Anzahl der Proben davon positiv C. jejuni<br />
Masthähnchen-Blinddarm Campylobacter<br />
Schlachtkörper Campylobacter<br />
Masthähnchen<br />
Schlachtkörper Schwein, Salmonellen<br />
Lymphknoten<br />
Fleischerzeugnisse Salmonellen<br />
Fleischerzeugnisse List. monocytogenes<br />
Fleischerzeugnisse E.coli O157<br />
Tupfer MRSA<br />
Summe<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
332<br />
35<br />
598<br />
115<br />
108<br />
12<br />
390<br />
1.590<br />
209<br />
23<br />
142<br />
0<br />
12<br />
0<br />
noch nicht abgeschlossen<br />
Veterinärinstitut Oldenburg<br />
35<br />
1<br />
42<br />
7<br />
0<br />
6<br />
11<br />
0<br />
127<br />
16<br />
C. coli<br />
12<br />
82<br />
7<br />
203
204<br />
Milch <strong>und</strong> Milcherzeugnisse<br />
Tabelle 4.111: Vorzugsmilch, Rohmilch <strong>und</strong> daraus hergestellte Produkte<br />
Produkt Anzahl der Proben Parameter auffällig* Code 30* Code 50* Abweichungen gesamt<br />
Vorzugsmilch<br />
Einzelgemelk<br />
Abweichungen<br />
Sammelmilch (Tank)<br />
Rohmilch<br />
Rohmilchkäse Kuh<br />
Rohmilchkäse Schaf<br />
Rohmilchkäse Ziege<br />
Summe<br />
* Erläuterungen siehe Seite 207<br />
196<br />
16<br />
3<br />
103<br />
21<br />
10<br />
22<br />
371<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
E. coli<br />
Pseudomonaden<br />
Staphylokokken quantitativ<br />
Staphylokokken qualitativ<br />
Listerien qualitativ<br />
L. monocytogenes qualitativ<br />
Somatische Zellzahl<br />
Campylobacter PCR<br />
–<br />
–<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
Phosphatase<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
E. coli<br />
Hefen<br />
Enterobacteriaceae<br />
Coliforme Keime<br />
E. coli<br />
Hefen<br />
–<br />
5<br />
22<br />
25<br />
5<br />
1<br />
3<br />
10<br />
15<br />
–<br />
–<br />
1<br />
–<br />
–<br />
1<br />
18<br />
18<br />
5<br />
1<br />
1<br />
–<br />
2<br />
6<br />
–<br />
–<br />
5<br />
–<br />
8<br />
26<br />
12<br />
–<br />
–<br />
11<br />
–<br />
5<br />
10<br />
31<br />
–<br />
–<br />
–<br />
13<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
5<br />
–<br />
–<br />
6<br />
5<br />
–<br />
–<br />
13<br />
48<br />
37<br />
5<br />
1<br />
14<br />
10<br />
20<br />
10<br />
31<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
14<br />
18<br />
18<br />
5<br />
1<br />
1<br />
5<br />
2<br />
6<br />
6<br />
5<br />
5<br />
0
Tabelle 4.112: Pasteurisierte Milch <strong>und</strong> daraus hergestellte Produkte<br />
Produkt Anzahl der Proben Parameter auffällig* Code 30* Code 50* Abweichungen gesamt<br />
Milch pasteurisiert<br />
Milch/Produkte UHT<br />
Käse <strong>und</strong> Vorprodukte Käse<br />
Butter<br />
Trockenprodukte<br />
Milchprodukte sonstige<br />
Milchmixgetränke<br />
Ziegen- <strong>und</strong> Schafkäse<br />
Eis<br />
Summe<br />
* Erläuterungen siehe Seite 207<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
352<br />
35<br />
173<br />
37<br />
216<br />
571<br />
19<br />
29<br />
105<br />
1.537<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
Pseudomonaden<br />
Bacillus cereus<br />
Peroxidase<br />
–<br />
Hefen<br />
Schimmelpilze<br />
Sensorik<br />
Bacillus cereus<br />
Schimmelpilze<br />
Staphylokokken quantitativ<br />
Staphylokokken qualitativ<br />
GKZ<br />
Pseudomonaden<br />
Hefen<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
Pseudomonaden<br />
Hefen<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
Staphylokokken quantitativ<br />
10<br />
11<br />
15<br />
5<br />
5<br />
5<br />
–<br />
8<br />
7<br />
9<br />
10<br />
5<br />
8<br />
13<br />
3<br />
3<br />
12<br />
–<br />
–<br />
1<br />
10<br />
1<br />
1<br />
1<br />
8<br />
7<br />
15<br />
9<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
1<br />
1<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
17<br />
26<br />
24<br />
5<br />
5<br />
5<br />
0<br />
8<br />
7<br />
9<br />
10<br />
5<br />
8<br />
13<br />
3<br />
3<br />
12<br />
1<br />
1<br />
1<br />
10<br />
1<br />
1<br />
1<br />
8<br />
205
206<br />
Tabelle 4.113: Tupferproben <strong>und</strong> Spülproben aus dem Herstellungsbereich von Milch <strong>und</strong> Milchprodukten<br />
Produkt Anzahl der Proben Parameter auffällig* Code 30* Code 50* Abweichungen gesamt<br />
Spülproben<br />
Tupferproben<br />
Summe<br />
Eier <strong>und</strong> Eiprodukte<br />
24<br />
195<br />
219<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
coliforme Keime<br />
Schimmelpilze<br />
Tabelle 4.114: Unpasteurisiertes Vollei, erhitzte Eiprodukte, Hühnereier<br />
Produkt Anzahl der Proben Parameter auffällig* Code 30* Code 50* Abweichungen gesamt<br />
Vollei nicht pasteurisiert<br />
Eiprodukte past., sterilisiert<br />
Eier Salmonellen-Monitoring<br />
Bruteier<br />
Summe<br />
* Erläuterungen siehe Seite 207<br />
87<br />
27<br />
1.668<br />
(Summe aus 834 Eischalen<br />
plus 834 Eidotter)<br />
2<br />
1.784<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
Staphylokokken quantitativ<br />
Salmonellen<br />
GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
Salmonellen<br />
–<br />
5<br />
8<br />
32<br />
4<br />
4<br />
1<br />
23<br />
28<br />
3<br />
51<br />
1<br />
1<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
30<br />
–<br />
5<br />
8<br />
32<br />
4<br />
4<br />
1<br />
23<br />
28<br />
3<br />
51<br />
1<br />
1<br />
30<br />
0
Tabelle 4.115: Tupferproben aus dem Herstellungsbereich von Eiern <strong>und</strong> Eiprodukten<br />
Produkt Anzahl der Proben Parameter auffällig* Code 30* Code 50* Abweichungen gesamt<br />
Tupferproben 175 GKZ<br />
Enterobacteriaceae<br />
* Erläuterungen:<br />
1 Parameter auffällig: Auflistung nur der Parameter eines Prüfumfanges, bei denen Abweichungen festgestellt wurden, d. h. Ergebnisse, die<br />
unter die Nachweisgrenze fielen <strong>und</strong>/oder keinen Anlass zur Beanstandung gaben, wurden hier nicht erfasst<br />
GKZ = aerobe mesophile Gesamtkeimzahl<br />
2 Bewertungscodes:<br />
Code 30 = Standard nicht erfüllt (Feststellung der Abweichung von Untersuchungsergebnissen aufgr<strong>und</strong> fachlicher Vorgaben)<br />
Code 50 = Standard nicht erfüllt (Feststellung der Abweichung von Untersuchungsergebnissen aufgr<strong>und</strong> rechtlicher Vorgaben)<br />
Bakteriologische Fleischuntersuchung<br />
Tabelle 4.116: Bakteriologische Fleischuntersuchungen inklusive Hemmstofftests<br />
Tierart Probenzahl Nachweise potentieller<br />
Krankheitserreger<br />
Rind<br />
Kalb<br />
Schwein<br />
Rückstandsuntersuchung<br />
Tabelle 4.117: Hemmstofftest<br />
Planproben<br />
Verdachtsproben<br />
Rind<br />
Kalb<br />
850<br />
13<br />
103<br />
Schwein<br />
Summe<br />
Kalb<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
67<br />
551 21<br />
8<br />
Nachweise von<br />
Zoonoseerregern<br />
–<br />
–<br />
67<br />
Veterinärinstitut Hannover<br />
positiver Hemmstofftest<br />
Untersuchungsanlass Tierart Anzahl der Proben positive Nachweise<br />
1.036<br />
1.634<br />
40.941<br />
4<strong>3.</strong>676<br />
45<br />
4<br />
11<br />
106<br />
121<br />
10<br />
18<br />
–<br />
–<br />
Veterinärinstitut Oldenburg<br />
8<br />
207
208<br />
Tabelle 4.118: Rückstandsuntersuchungen in den Veterinärinstituten des Landes <strong>Niedersachsen</strong>, Auflistung nach Tierart<br />
<strong>und</strong> Analyten (Teil 1)<br />
Gruppe A – Stoffe mit anaboler Wirkung <strong>und</strong> nicht zugelassene Stoffe<br />
Untersuchte<br />
Parameter<br />
A1 Stilbene<br />
A2 Thyreostatika<br />
A3 Synth. Androgene<br />
A3 Synth. Gestagene<br />
A3 Synth. Östrogene<br />
A3 Natürl. Hormone<br />
A4 Resorcylsäure-Lactone<br />
A5 ß-Agonisten<br />
A5 Ractopamin<br />
A6 Chloramphenicol<br />
A6 Nitroimidazole<br />
A6 Nitrofurane<br />
A6 Phenylbutazon<br />
Anzahl der Untersuchungen<br />
430<br />
434<br />
691<br />
160<br />
592<br />
176<br />
636<br />
871<br />
379<br />
2.374<br />
1.765<br />
659<br />
949<br />
Rinder/Kälber<br />
141<br />
98<br />
396<br />
35<br />
309<br />
176<br />
163<br />
286<br />
102<br />
706<br />
41<br />
8<br />
550<br />
Schweine Geflügel<br />
194<br />
237<br />
176<br />
125<br />
160<br />
346<br />
257<br />
277<br />
523<br />
811<br />
204<br />
397<br />
94<br />
98<br />
118<br />
0<br />
122<br />
124<br />
281<br />
857<br />
853<br />
376<br />
Milch Eier<br />
45<br />
254<br />
16<br />
58<br />
51<br />
Sonstige<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
3<br />
2<br />
18<br />
2<br />
20<br />
2
Tabelle 4.118: Rückstandsuntersuchungen in den Veterinärinstituten des Landes <strong>Niedersachsen</strong>, Auflistung<br />
nach Tierart <strong>und</strong> Analyten (Teil 2)<br />
Gruppe B – Tierarzneimittel <strong>und</strong> Kontaminanten<br />
Untersuchte<br />
Parameter<br />
Anzahl der Unter<br />
suchungen<br />
B1 Stoffe – mit antibakterieller Wirkung<br />
B1 Sulfonamide<br />
B1 Tetracycline<br />
B1 Chinolone<br />
B1 Aminoglycoside<br />
B1 Penicilline<br />
B1 Makrolide<br />
B2a Anthelminthika(Avermektine)<br />
B2a Anthelminthika(Imidazole)<br />
B2b Kokzidiostatika<br />
B2c Carbamate/<br />
Pyrethroide<br />
B2d Sedativa<br />
B2e NSAID<br />
(Profene)<br />
B2f Synth. Kortikosteroide<br />
B2f Sonstige<br />
Stoffe mit<br />
pharmakologischerWirkung<br />
853<br />
1.806<br />
1.167<br />
205<br />
B3 – andere Stoffe <strong>und</strong> Kontaminanten<br />
B3a Pestizide/PCB<br />
B3 Dioxine<br />
B3b Organ. Phosphorverb.<br />
B3c Chemische<br />
Elemente<br />
B3d Mykotoxine<br />
B3f Andere Kontaminanten<br />
Niedersächsisches<br />
Kälbermonitoring<br />
Summe<br />
4<br />
538<br />
576<br />
148<br />
669<br />
210<br />
468<br />
579<br />
164<br />
6<br />
527<br />
38<br />
78<br />
621<br />
20<br />
90<br />
171<br />
19.054<br />
Rinder/Kälber Schweine Geflügel Milch Eier Sonstige<br />
152<br />
338<br />
182<br />
118<br />
4<br />
8<br />
133<br />
17<br />
92<br />
74<br />
77<br />
77<br />
51<br />
15<br />
Veterinärinstitut Oldenburg <strong>und</strong> Hannover<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
661<br />
846<br />
636<br />
68<br />
358<br />
185<br />
89<br />
107<br />
94<br />
468<br />
201<br />
87<br />
376<br />
49<br />
224<br />
12<br />
312<br />
302<br />
2<br />
156<br />
41<br />
366<br />
39<br />
46<br />
53<br />
54<br />
254<br />
3<br />
254<br />
254<br />
12<br />
12<br />
20<br />
32<br />
43<br />
102<br />
41<br />
38<br />
25<br />
20<br />
28<br />
24<br />
1<br />
17<br />
16<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
6<br />
6<br />
2<br />
306<br />
70<br />
209
210<br />
5. Fotoverzeichnis<br />
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
Titel<br />
Vorwort<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einführung<br />
2. Struktur, Aufgaben, Kommunikation<br />
Labortätigkeit (großes Bild)<br />
Eier<br />
Koikarpfen<br />
Mohnblumen<br />
Kinderspielzeug<br />
Kuh mit Kalb<br />
Heidelbeeren<br />
Minister Hans-Heinrich Ehlen<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Klaus Wiswe<br />
Ulrich Mädge<br />
Eierschalen<br />
Labormaterial<br />
Gläser mit Saft<br />
Spritze<br />
Glas mit Milch<br />
Wappen von <strong>Niedersachsen</strong><br />
Reagenzgläser<br />
Presse-Info<br />
Kühe<br />
Fleischverarbeitung<br />
Apfel<br />
LAVES-Zentrale<br />
Wildgänse<br />
Feldarbeit<br />
Zeitungen<br />
Schlachthof<br />
Laborbild<br />
Hühner auf einer Scharrmatte<br />
Pillen<br />
EQUINO-Logo<br />
Q-Zirkel Mitglieder<br />
Ordner Qualitätsmanagement<br />
Akten<br />
Computertastatur mit Maus <strong>und</strong> Glas<br />
Netzwerkstecker<br />
Serverprotokoll<br />
© Digital_Zombie / Fotolia.de<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© D.A. Fischer / photocase.com<br />
© daniel.schoenen / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© Dmitry Pichugin / Fotolia.de<br />
© goldkatze / photocase.com<br />
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Landesentwicklung<br />
Niedersächsisches Landsamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Lebensmittelsicherheit (LAVES)<br />
Niedersächsischer Landkreistag<br />
Niedersächsischer Städtetag<br />
© emma75 / photocase.com<br />
© Vasiliy Koval / Fotolia.de<br />
© meon / photocase.com<br />
© ExQuisine / Fotolia.de<br />
© Thomas Martin Pieruschek / photocase.com<br />
Land <strong>Niedersachsen</strong><br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
MW Grafik-Design<br />
LAVES – Futtermittelüberwachung<br />
LAVES – Lebensmittelüberwachung<br />
© sveni_com / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© dioxin / photocase.com<br />
© Jan Ortgies / photocase.com<br />
© mal / photocase.com<br />
© Sanjarok / photocase.com<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
© öde_inge / photocase.com<br />
LAVES – Qualitätsmanagement<br />
LAVES – Qualitätsmanagement<br />
LAVES – Qualitätsmanagement<br />
MW Grafik-Design<br />
© Julia Nimbus / photocase.com<br />
MW Grafik-Design<br />
© Benedikt Deicke / photocase.com
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
<strong>3.</strong> Ausgewählte Ergebnisse im <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> in der Tierges<strong>und</strong>heit im Jahr 2007<br />
traditioneller Kochschinken<br />
Schinkenimitat<br />
Geflügel-Separatorenfleisch<br />
Ausgangsmaterial für Hühner-Separatorenfleisch<br />
marinierte Hühnerbrustfilets<br />
Puten<br />
Laborröhrchen<br />
Mettbrötchen<br />
Hackbällchen<br />
Lebensmittelkontrolle Fleisch<br />
Temperaturmessung bei Fleisch<br />
Probenahme von einer Oberfläche<br />
Brasse<br />
Muscheln in Öl<br />
Muscheln<br />
Fisch-Döner, ganz mit Stab<br />
präparativ gewonnener Molluskenfleischanteil<br />
Rogen im Vergleich mit Kaviarcreme-Partikeln<br />
Tintenfisch<br />
Matjesbrötchen<br />
frisch gefangene Heringe<br />
Thunfischdose<br />
Thunfische<br />
Joghurt<br />
Milchkanne<br />
Feta<br />
Milch<br />
Kühe<br />
Eier<br />
Henne<br />
Tortellini<br />
frische Spaghetti<br />
Mohnblumen<br />
Mohngebäck<br />
Torte mit Obstbelag<br />
Stück Sahnetorte<br />
Essige<br />
Pflaumenkonfitüre<br />
Erdberen<br />
Himbeeren<br />
Holzbank in der Lüneburger Heide<br />
Speiseeis<br />
Artischocke<br />
Vitamin-C Kapseln<br />
5. Fotoverzeichnis<br />
5. Fotoverzeichnis<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
© Elena Moiseeva / Fotolia.de<br />
© Helgi / photocase.com<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© Rudolf Schmidt / Fotolia.de<br />
Landkreis Harburg<br />
Landkreis Harburg<br />
Landkreis Harburg<br />
© Peter Jobst / Fotolia.de<br />
© Francis Lempérière / Fotolia.de<br />
© judigrafie / photocase.com<br />
LAVES – Institut für Fische u. Fischereierzeugnisse Cuxhaven<br />
LAVES – Institut für Fische u. Fischereierzeugnisse Cuxhaven<br />
LAVES – Institut für Fische u. Fischereierzeugnisse Cuxhaven<br />
© V.RUMI / Fotolia.de<br />
© LiliConCarne / photocase.com<br />
© diemedialisten / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© iofoto / Fotolia.de<br />
© Simone van den Berg / Fotolia.de<br />
© jamail99 / photocase.com<br />
© vandalay / photocase.com<br />
© Dušan Zidar / Fotolia.de<br />
© ne_fall_photos / Fotolia.de<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© krockenmitte / photocase.com<br />
© Maria.P. / Fotolia.de<br />
© paule.p / photocase.com<br />
© daniel.schoenen / photocase.com<br />
© digi-eye / photocase.com<br />
© Julianna Tilton / Fotolia.de<br />
© Svenja98 / Fotolia.de<br />
© ilumus photography / Fotolia.de<br />
© Monika Adamczyk / Fotolia.de<br />
© emma75 / photocase.com<br />
© emma75 / photocase.com<br />
© rokit_de / photocase.com<br />
© Mario / Fotolia.de<br />
© gusperus / photocase.com<br />
© heytommy / photocase.com<br />
211
212<br />
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
Wasser<br />
Caipirinha<br />
Bar<br />
Flasche mit Strohhalmen<br />
Getränkedosen<br />
Tasse mit Teebeutel<br />
Heidelbeeren<br />
Pilze<br />
Labormaterial<br />
Apfelringe<br />
Öle<br />
Zimtstange<br />
täglich duldbare Zimt-Höchstmengen<br />
Frühstückscerealien<br />
Lederhandschuhe<br />
Kinderspielzeug<br />
Zahnbürstenkopf mit Zahncreme<br />
Zahncreme<br />
junge Katze<br />
Tierfutter<br />
Schweine am Futtertrog<br />
Bisonbulle vor der Sektion<br />
Suche nach Oleanderblättern<br />
Oleanderblatt-Rudimente aus dem Pansen<br />
typische Krypten der Blattunterseite<br />
native Oleanderblätter<br />
Blutungen im Herzmuskel<br />
Schaf<br />
Kühe<br />
Labormaterial<br />
erste Übung im MBZ<br />
ges<strong>und</strong>e Koikarpfen<br />
am KHV erkrankter Koikarpfen<br />
Geflügelpest-Workshop-Teilnehmer<br />
Labormaterial<br />
laterale Schädigung einer Plötze<br />
Weser<br />
Biene<br />
Ferkel<br />
Reagenzgläser<br />
Labormaterial<br />
Kantinen-Essen<br />
Angelhaken <strong>und</strong> Blinker<br />
Angelteichanlage<br />
angeln im Sonnenuntergang<br />
Training eines H<strong>und</strong>es<br />
Jack Russel Terrier<br />
Temperaturmessung einer verölten Trauerente<br />
eingehängter Netzboden im Außenpool<br />
Möwen an der Nordsee<br />
Kontrolle der Fußballenges<strong>und</strong>heit<br />
Versuchstier Maus<br />
Meeresfrüchte<br />
Petrischalen<br />
Haifisch<br />
zubereitete Forelle<br />
Kontrolle von einem Lebensmittelexport<br />
© NormanBates / photocase.com<br />
© sanschein / photocase.com<br />
© .marqs / photocase.com<br />
© complize / photocase.com<br />
© ploum1 / Fotolia.de<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© goldkatze / photocase.com<br />
© thesweetg / photocase.com<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
LUA Bremen<br />
LUA Bremen<br />
© xtra06 / photocase.com<br />
MW Grafik-Design<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© NormanBates / photocase.com<br />
© complize / photocase.com<br />
© JaneDoe87 / photocase.com<br />
© Twilight_Art_Pictures / Fotolia.de<br />
© LEGOS / Fotolia.de<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
© D.A. Fischer / photocase.com<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
LAVES – Binnenfischerei <strong>und</strong> fischereik<strong>und</strong>licher Dienst<br />
© Mischmasch / photocase.com<br />
© Christian Sest / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© iofoto / Fotolia.de<br />
© Digital_Zombie / Fotolia.de<br />
© Gestaltbar / photocase.com<br />
© AndreasF. / photocase.com<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
© Arnsn / photocase.com<br />
Dr. Tanja Rusch<br />
© jack-24 / photocase.com<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
© Goulden / photocase.com<br />
LAVES – Tierschutzdienst<br />
© Dragon30 / photocase.com<br />
© pb / photocase.com<br />
© SaraStock / Fotolia.de<br />
© subwaytree / photocase.com<br />
© evgenyb / Fotolia.de<br />
Landkreis Ammerland
Kapitel Fotobeschriftung Bildrechte<br />
4. Untersuchungsdaten <strong>und</strong> Tätigkeiten im <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
5. Fotoverzeichnis<br />
6. Adressen<br />
zubereitete Muscheln<br />
Brötchen<br />
Nudeln mit Tomate<br />
Honig<br />
Honigwabe<br />
Blisterverpackung<br />
Weinflaschen<br />
Weintrauben<br />
Kartoffel auf dem Feld<br />
Pferd<br />
Paprika<br />
grüner Spargel<br />
Speiseeis<br />
zubereiteter Reis<br />
Ei<br />
verschiedene Obstsorten<br />
Carpaccio mit Balsamico <strong>und</strong> Basilikum<br />
Ähre<br />
Futtermittel<br />
Ratte<br />
Koikarpfen<br />
Kuh<br />
Rotwild<br />
Gans<br />
Tiger im Käfig<br />
Lama<br />
Reptil<br />
Hase<br />
Laboruntersuchung<br />
Kuh mit Kalb<br />
Fotofilm<br />
Kamera<br />
Ausschnitt Stadtplan Oldenburg<br />
Bienenstock<br />
© Olga Lyubkina / Fotolia.de<br />
© digi-eye / photocase.com<br />
© i make design / photocase.com<br />
© joanna wnuk / Fotolia.de<br />
© royalmg / photocase.com<br />
© Marnai / photocase.com<br />
© unpict / Fotolia.de<br />
MW Grafik-Design<br />
© tina_ki / photocase.com<br />
© Andreas Kreuzeder / photocase.com<br />
© Kasoga / Fotolia.de<br />
© tbaab / photocase.com<br />
© Brebca / Fotolia.de<br />
© Brebca / Fotolia.de<br />
© denkerhaus / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© Christian Jung / Fotolia.de<br />
© keg11 / photocase.com<br />
© Allyson Ricketts / Fotolia.de<br />
© Michael Eaton / Fotolia.de<br />
LAVES – Task-Force Veterinärwesen<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© lea_kl / photocase.com<br />
LAVES – Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
© kallejipp / photocase.com<br />
© daniel.schoenen / photocase.com<br />
© klammerfranz / photocase.com<br />
© prokop / photocase.com<br />
LAVES – Veterinärinstitut Oldenburg<br />
© Dmitry Pichugin / Fotolia.de<br />
© Markus Imorde / photocase.com<br />
MW Grafik-Design<br />
© Ewe Degiampietro / Fotolia.de<br />
© alphoxic / photocase.com<br />
5. Fotoverzeichnis<br />
5. Fotoverzeichnis<br />
213
214<br />
6. Adressen<br />
Adressen des LAVES<br />
Stabsstelle Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 570 26 - 180<br />
Telefax (04 41) 570 26 - 179<br />
E-Mail pressestelle@laves.niedersachsen.de<br />
Stabsstelle Qualitätsmanagement<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (0 41 31) 15 - 11 00<br />
Telefax (0 41 31) 15 - 11 28<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Abteilung 1: Zentrale Aufgaben<br />
Dez. 11: Personal, Organisation, Haushalt, Liegenschaften,<br />
Innerer Dienst<br />
Dez. 12: IuK-Technik, Betriebswirtschaftliche Steuerungs instru<br />
mente, Datenmanagement<br />
Dez. 13: Recht<br />
Dez. 14: Fachbezogene Ausbildungs- <strong>und</strong> Prüfungsan -<br />
gele gen heiten<br />
Dez. 15: Technische Sachverständige<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 5 70 26 - 0<br />
Telefax (04 41) 5 70 26 - 179<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Abteilung 2: Lebensmittelsicherheit<br />
Dez. 21: Lebensmittelüberwachung<br />
Dez. 22: Lebensmittelkontrolldienst<br />
Dez. 23: Tierarzneimittelüberwachung, Rückstandskontrolldienst<br />
Dez. 24: Koordinierungsstelle Sichere Lebensmittel<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 5 70 26 - 0<br />
Telefax (04 41) 5 70 26 - 179<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Abteilung 3: Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Dez. 31: Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte<br />
Dez. 32: Task-Force Veterinärwesen<br />
Dez. 33: Tierschutzdienst<br />
Dez. 34: Binnenfischerei <strong>und</strong> fischereik<strong>und</strong>licher Dienst<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 5 70 26 - 0<br />
Telefax (04 41) 5 70 26 - 179<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de
Abteilung 4: Futtermittelsicherheit, Marktüberwachung<br />
Dez. 41: Futtermittelüberwachung<br />
Dez. 42: Ökologischer Landbau<br />
Dez. 43: Marktüberwachung<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 5 70 26 - 0<br />
Telefax (04 41) 5 70 26 - 179<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Abteilung 5: Untersuchungseinrichtungen<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 5 70 26 - 0<br />
Telefax (04 41) 5 70 26 - 179<br />
E-Mail poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Lebensmittelinstitut Oldenburg<br />
Martin-Niemöller-Str. 2<br />
26133 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 99 85 - 0<br />
Telefax (04 41) 99 85 - 121<br />
E-Mail poststelle.li-ol@laves.niedersachsen.de<br />
Lebensmittelinstitut Braunschweig<br />
Dresdenstr. 2 <strong>und</strong> 6<br />
38124 Braunschweig<br />
Telefon (05 31) 68 04 - 0<br />
Telefax (05 31) 68 04 - 101<br />
E-Mail poststelle.li-bs@laves.niedersachsen.de<br />
Veterinärinstitut Oldenburg<br />
Philosophenweg 38<br />
26121 Oldenburg<br />
Telefon (04 41) 97 13 - 0<br />
Telefax (04 41) 97 13 - 814<br />
E-Mail poststelle.vi-ol@laves.niedersachsen.de<br />
Veterinärinstitut Hannover<br />
Eintrachtweg 17<br />
30173 Hannover<br />
Telefon (05 11) 2 88 97 - 0<br />
Telefax (05 11) 2 88 97 - 299<br />
E-Mail poststelle.vi-h@laves.niedersachsen.de<br />
6. Adressen<br />
6. Adressen<br />
215
216<br />
Institut für Fische <strong>und</strong> Fischereierzeugnisse<br />
Cuxhaven<br />
Schleusenstr. 1<br />
27472 Cuxhaven<br />
Telefon (0 47 21) 69 89 - 0<br />
Telefax (0 47 21) 69 89 - 16<br />
E-Mail poststelle.iff-cux@laves.niedersachsen.de<br />
Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg<br />
Am Alten Eisenwerk 2A<br />
21339 Lüneburg<br />
Telefon (0 41 31) 15 - 10 00<br />
Telefax (0 41 31) 15 - 10 03<br />
E-Mail poststelle.ifb-lg@laves.niedersachsen.de<br />
Futtermittelinstitut Stade<br />
Heckenweg 6<br />
21680 Stade<br />
Telefon (0 41 41) 9 33 - 6<br />
Telefax (0 41 41) 9 33 - 777<br />
E-Mail poststelle.fi-stade@laves.niedersachsen.de<br />
Institut für Bienenk<strong>und</strong>e Celle<br />
Herzogin-Eleonore-Allee 5<br />
29221 Celle<br />
Telefon (0 51 41) 9 05 03 - 40<br />
Telefax (0 51 41) 9 05 03 - 44<br />
E-Mail poststelle.ib-ce@laves.niedersachsen.de
Adressen der kommunalen Veterinär- <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong>behörden<br />
Landkreis Ammerland<br />
39 Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsamt<br />
Wilhelm-Geiler-Straße 9<br />
26655 Westerstede<br />
Landkreis Aurich<br />
Amt für Veterinärwesen- <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Fischteichweg 7-13<br />
26603 Aurich<br />
Stadt Braunschweig<br />
Ordnungsamt<br />
Veterinärwesen <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Altewiekring 60 A<br />
38102 Braunschweig<br />
Amt für Veterinärangelegenheiten<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Trift 29<br />
29221 Celle<br />
Landkreis Celle<br />
Landkreis Cloppenburg<br />
Amt für Veterinärwesen- <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Eschstraße 29<br />
49661 Cloppenburg<br />
Landkreis Cuxhaven<br />
Veterinäramt<br />
Vincent-Lübeck-Straße 2<br />
27474 Cuxhaven<br />
Stadt Delmenhorst<br />
Fachdienst 32 <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
öffentliche Sicherheit<br />
City Center<br />
Lange Straße 1 A<br />
27749 Delmenhorst<br />
Landkreis Diepholz<br />
Fachdienst für Veterinärwesen<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Grafenstraße 3<br />
49356 Diepholz<br />
Stadt Emden<br />
Fachdienst Veterinärwesen,<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Ringstraße 18<br />
26721 Emden<br />
Landkreis Emsland<br />
Fachbereich für Veterinärwesen<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Ordeniederung 1<br />
49716 Meppen<br />
6. Adressen<br />
6. Adressen<br />
217
218<br />
Landkreis Gifhorn<br />
Amt für Veterinärwesen<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelüberwachung<br />
Schlossplatz 1<br />
38518 Gifhorn<br />
Landkreis Goslar<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>- <strong>und</strong> Veterinäramt<br />
Klubgartenstraße 11<br />
38640 Goslar<br />
Landkreis Göttingen<br />
Veterinäramt für den Landkreis<br />
<strong>und</strong> die Stadt Göttingen<br />
Walkemühlenweg 8<br />
37083 Göttingen<br />
Landkreis Grafschaft Bentheim<br />
Abteilung für Veterinärwesen <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Ootmarsumer Weg 11<br />
48527 Nordhorn<br />
Landkreis Hameln-Pyrmont<br />
Fachdienst Veterinärwesen <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Süntelstraße 9<br />
31785 Hameln<br />
Landeshauptstadt Hannover<br />
Fachbereich Recht <strong>und</strong> Ordnung<br />
Gewerbe- <strong>und</strong> Veterinärangelegenheiten<br />
Vordere Schöneworth 14<br />
30167 Hannover<br />
Region Hannover<br />
Fachdienst für <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
<strong>und</strong> Veterinärwesen<br />
Hildesheimer Straße 20<br />
30169 Hannover<br />
Landkreis Harburg<br />
Veterinäramt<br />
Von-Somnitz-Ring 13<br />
21423 Winsen/Luhe<br />
Landkreis Helmstedt<br />
Veterinär- <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong>amt<br />
Charlotte-von-Veltheim-Weg 5<br />
38350 Helmstedt<br />
Landkreis Hildesheim<br />
Fachdienst 203 Veterinärwesen <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Bischof-Janssen-Straße 31<br />
31134 Hildesheim
Landkreis Holzminden<br />
Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsamt<br />
Bgm.-Schrader-Straße 24<br />
37603 Holzminden<br />
Zweckverband Veterinäramt JadeWeser<br />
Veterinäramt<br />
Olympiastraße 1<br />
Gebäude 6A<br />
TCN-Gelände/Zufahrt Tor 1<br />
26419 Schortens<br />
Landkreis Leer<br />
Amt für Veterinärwesen <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Friesenstraße 30<br />
26789 Leer<br />
Landkreis Lüchow-Dannenberg<br />
Fachdienst 39<br />
Veterinärwesen <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Königsberger Straße 10<br />
29439 Lüchow<br />
Landkreis Lüneburg<br />
Fachdienst Veterinär-, Lebensmittel-<br />
<strong>und</strong> Gewerbeüberwachung<br />
Auf dem Michaelis-Kloster 4<br />
21335 Lüneburg<br />
Landkreis Nienburg<br />
Veterinäramt<br />
Kreishaus am Schlossplatz<br />
31582 Nienburg/Weser<br />
Landkreis Northeim<br />
Fachdienst Ges<strong>und</strong>heitlicher<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>/Veterinärdienste<br />
Medenheimer Straße 6/8<br />
37154 Northeim<br />
Landkreis Oldenburg<br />
39 Veterinäramt<br />
Delmenhorster Straße 6<br />
27793 Delmenhorst<br />
Stadt Oldenburg<br />
Amt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Veterinärwesen<br />
Rohdenweg 65<br />
26135 Oldenburg<br />
Landkreis Osnabrück<br />
Veterinärdienst für den Landkreis<br />
<strong>und</strong> die Stadt Osnabrück<br />
Am Schölerberg 1<br />
49082 Osnabrück<br />
Landkreis Osterholz<br />
Veterinäramt<br />
Osterholzer Straße 23<br />
27711 Osterholz-Scharmbeck<br />
6. Adressen<br />
6. Adressen<br />
219
220<br />
Landkreis Osterode am Harz<br />
Amt für Veterinärwesen<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Katzensteiner Straße 137<br />
37520 Osterode am Harz<br />
Landkreis Peine<br />
Fachdienst Veterinärwesen<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelüberwachung<br />
Hopfenstraße 4<br />
31224 Peine<br />
Landkreis Rotenburg<br />
Veterinäramt<br />
Hopfengarten 2<br />
27356 Rotenburg/Wümme<br />
Landkreis Schaumburg<br />
Amt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Veterinärwesen<br />
Bahnhofstraße 25<br />
31675 Bückeburg<br />
Landkreis Soltau-Fallingbostel<br />
Veterinärwesen <strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Quintusstraße 1<br />
29683 Bad Fallingbostel<br />
Landkreis Stade<br />
Veterinäramt<br />
Große Schmiedestraße 1-3<br />
21682 Stade<br />
Landkreis Uelzen<br />
Amt 39 – Veterinäramt<br />
Auf dem Rahlande 15<br />
29525 Uelzen<br />
Landkreis Vechta<br />
Amt für Veterinärwesen <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung<br />
Ravensberger Straße 20<br />
49377 Vechta<br />
Landkreis Verden<br />
Fachdienst Veterinärdienst <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Lindhooper Straße 67<br />
27283 Verden/Aller<br />
Landkreis Wolfenbüttel/Stadt Salzgitter<br />
Veterinäramt für den Landkreis Wolfenbüttel <strong>und</strong> die<br />
Stadt Salzgitter<br />
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8<br />
38300 Wolfenbüttel<br />
Stadt Wolfsburg<br />
Veterinäramt<br />
Dieselstraße 18 a<br />
38446 Wolfsburg
7. Anhang<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
7. 1 Verzeichnis der Mitwirkung in Gremien………………………………………..…… 1<br />
7. 2 Verzeichnis der wissenschaftlichen Vorträge <strong>und</strong> Veröffentlichungen………. 7<br />
7. 3 Verzeichnis der Ringversuche <strong>und</strong> Laborvergleichsuntersuchungen….……. 26<br />
7. 4 Sachverständige………………………………………………………………….…….. 38<br />
7. 5 Forschungsaufgaben…………………………………………………………….……. 39<br />
7. 6 Personalstärke des LAVES (Stand 31. Dezember 2007)………………….……... 42<br />
7. 7 Ausbildungsverhältnisse <strong>und</strong> Praktikumsangebote im LAVES………….……. 43<br />
7. 8 Organisationsplan des LAVES………………………………………………….……. 44<br />
7. 1 Verzeichnis der Mitwirkung in Gremien<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Allergene" Schulze, M. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Analytik von Delta-9-THC in Hanf enthaltenden<br />
Lebensmitteln"<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Chemische u. physikal. Untersuchungsverfahren für<br />
Milch <strong>und</strong> Milchprodukte<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Entwicklung von Methoden zum Nachweis von<br />
Lebensmitteln, bei deren Herstellung gentechnische Verfahren eingesetzt worden<br />
sind"<br />
Reinhold, L. (LI BS)<br />
Keck, S. (LI BS)<br />
Schulze, M. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Molekularbiologische Methoden - Mikrobiologie" Schulze, M. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Mykotoxine" Reinhold, L. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Süßungsmittel" de Wreede, I. (LI BS); Nuyken-<br />
Hamelmann, C. (LI OL)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Tierartendifferenzierung -Fleisch" Ohrt, G. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Unterarbeitsgruppe Furananalytik Reinhold, L. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Backwaren" Wald, B. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Kosmetische Mittel" Behm, F. (IfB LG)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Tierarzneimittelrückstände" Schnarr, K. (VI H)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Vitaminanalytik" Täubert, T. (LI BS)<br />
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe "Wirkungsbezogene Analytik" Böhmler, G. (LI BS)<br />
Aalkommission des Deutschen Fischerei-Verbandes e.V. Meyer, L. (Dez. 34)<br />
Ad hoc-Arbeitsgruppe Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Eichhoff, S. (IfBLG)<br />
ADV-Arbeitsgruppe B<strong>und</strong>/Länder Franke, K. (Dez. 12)<br />
ADV-Arbeitsgruppe Veterinärwesen <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit der B<strong>und</strong>esländer Luger, A. (Dez. 22)<br />
AG "Aggreement on the Conservation of Small Cetaceens of the Baltic and North<br />
Sea (ASCOBANS)"<br />
Stede, M. (IFF CUX)<br />
AG "Ausführungshinweise Fischhygiene" Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
AG "European Feed Microbiologie Organisation (EFMO)" Schlägel, E. (FI STD)<br />
GDCh-AG "Fruchtsäfte u. fruchtsafthaltige Getränke" de Wreede, I. (LI BS)<br />
AG "Listeria monocytogenes" des Codex Committee on Food Hygiene Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
AG "Tierschutz verölte Vögel" Stede, M. (IFF CUX)<br />
AG der Bieneninstitute von der Ohe, W.; Janke, M.;<br />
1
AG Projektentwicklung Länderübergreifendes Meldeverfahren von<br />
Grenzwertüberschreitungen b.d. Rohmilchkontrolle<br />
AG PSM-Rückstandsanalytik in der länderübergreifenden norddeutsch.<br />
Kooperation<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Palla, H. (Dez. 21); Schmedt<br />
auf der Günne, H. (Dez. 31);<br />
Ramdohr, S. (IFF CUX)<br />
Suckrau, I.; Richter, A. (LI OL)<br />
AG Stabilisotopenanalytik der Lebensmittelchemischen Gesellschaft i.d. GDCh Meylahn, K. (LI OL)<br />
AG Tierarzneimittel der Länderarbeitsgemeinschaft ges<strong>und</strong>heitlicher<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
AG Trilateral Seal Expert Group Stede, M. (IFF CUX)<br />
AGTT Arbeitsgruppe QM Stehr, D. (Dez. QM)<br />
AK "Fischereiliche Gewässerzustandsüberwachung Mosch, E. (Dez. 34)<br />
AK Bewirtschaftungsplan-Aal Diekmann, M. (Dez. 34)<br />
AK Organik der Fachgr. Umwelt- <strong>und</strong> Spurenanalytik <strong>und</strong> AG<br />
Pflanzenschutzmittel der Projekt-AG LC/MS<br />
Suckrau, I. (LI OL)<br />
AKS-Fachausschuss "Diagnostik" Thoms, B. (VI H/LI BS)<br />
ALS ad-hoc AG "Bedarfsgegenstände" Punkert, M. (IfB LG)<br />
ALS Arbeitsgruppe "Diätetische Lebensmittel, Ernährung <strong>und</strong><br />
Abgrenzungsfragen"<br />
Täubert, T.; Maslo, R. (LI BS)<br />
ALS Arbeitsgruppe "Kosmetische Mittel" Weßels, B. (IfB LG)<br />
ALS UnterAG "Risikoorientierte Probenahme" der AG Kosmet. Mittel Behm, F. (IfB LG)<br />
ALS-Arbeitsgruppe "Überwachung gentechnisch veränderter Lebensmittel" Schulze, M. (LI BS)<br />
ALS-Arbeitsgruppe "Wein <strong>und</strong> Spirituosen" Borck-Strohbusch, C. (LI BS)<br />
ALTS-Arbeitsgruppe "Lebensmittelrechtl. Bewertung von Viren in Lebensmitteln" Mauermann, U. (LI OL)<br />
ALTS-Arbeitsgruppe "Validierung mikrobiolog. Untersuchungsverfahren" Mauermann, U. (LI OL)<br />
Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V. von der Ohe, W.; Janke, M.;<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Arbeitsgemeinschaft Futtermittel Ady, G. (FI STD)<br />
Arbeitsgruppe "Analytik von 3-MCPD-Fettsäureestern" Reinhold, L. (LI BS)<br />
Arbeitsgruppe "Ausführungshinweise Muschelhygiene" Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
Arbeitsgruppe "Fortentwicklung des<br />
B<strong>und</strong>estierseuchenbekämpfungshandbuches"<br />
Arbeitsgruppe "Junghühnerhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen<br />
Vereinbarung"<br />
Thalmann, G. (VI OL); Gerdes,<br />
U. (Dez. 32)<br />
Petermann, S.; Maiworm, K.<br />
(Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe "Kontaminanten in Lebensmitteln" Kombal, R. (LI OL)<br />
Arbeitsgruppe "Kontaminanten in Lebensmitteln, Bereich Dioxine u. PCBs" Bruns-Weller, E. (LI OL)<br />
Arbeitsgruppe "Moschusentenhaltung, Weiterentwicklung der<br />
Mindestanforderungen"<br />
Petermann, S.; Maiworm, K.<br />
(Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe "Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)" Hänsel, A. (Dez. 23)<br />
Arbeitsgruppe "Normabweichungen bei Kochschinken" Orellana, A. (LI OL)<br />
Arbeitsgruppe "Pekingentenhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen<br />
Vereinbarung"<br />
Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe "Putenhaltung, Weiterentwicklung der freiwilligen Vereinbarung" Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe "Salzbelastung der Fliessgewässer" Matthes, U. (Dez. 34)<br />
Arbeitsgruppe "Schnabelkürzen bei Nutzgeflügel" Petermann, S.; Maiworm, K.<br />
2
(Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe "Tierarzneimittelrückstände in Lebensmitteln" Christof, O. (VI OL)<br />
Arbeitsgruppe "Tierseuchenbekämpfungshandbuch <strong>Niedersachsen</strong>-NRW" Thalmann, G.; Nöcker, A. (VI<br />
OL); Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe "Tierseuchendiagnostik der Nds. Untersuchungseinrichtungen" Thalmann, G.; Klarmann, D. ;<br />
Bötcher, L.; Schöttker-Wegner,<br />
H. (VI OL); Gerdes, U. (Dez.<br />
32)<br />
Arbeitsgruppe Bienenschutz von der Ohe, W.; Jahnke, M.<br />
(IB CE)<br />
Arbeitsgruppe für das Lebensmittelmonitoring "Natürliche Toxine" Reinhold, L. (LI BS)<br />
Arbeitsgruppe Geflügeltötung Diekmann, J. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe Handbuch Kontrolle Nutztierhaltungen Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe Handbuch Tiertransporte Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitsgruppe Nitrosaminanalytik Reinhold, L. (LI BS); Eichhoff,<br />
S. (IfB LG)<br />
Arbeitsgruppe Zierfischkrankheiten der European Association of Fish Pathologists Kleingeld, D. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe zum Einsatz Landwirtschaftlichen Fachpersonals im<br />
Tierseuchenkrisenfall<br />
Jeske, C. (Dez. 32)<br />
Arbeitsgruppe zum Einsatz Tierärztlichen Fachpersonals im Tierseuchenkrisenfall Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis "Futtermittelmikrobiologie" des VDLUFA Schlägel, E. (FI STD)<br />
Arbeitskreis der Genehmigungsbehörden von Tierversuchen Suhr, I.; Kogelheide, B.; Welzel,<br />
A.; Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Arbeitskreis der Niedersächsischen Tierseuchendiagnostik-Institute Gerdes, U.; Diekmann, J.;<br />
Mahnken, M.; Schmedt<br />
a.d.Günne, H.; Schwochow, K.<br />
(Dez. 32)<br />
Arbeitskreis lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder <strong>und</strong> d. BVL Block, I. (LI OL)<br />
Arbeitskreis Medizinische Arachno-Entomologie Freise, J. (Dez. 32)<br />
Arbeitskreis Messtechnik <strong>und</strong> EDV im Bereich der Marktüberwachung Vollmers, D. (Dez. 43)<br />
Arbeitskreis Nord der QM-Beauftragten Gräfe, A. (VI OL); Ballin, U. (IFF<br />
CUX); Keck, S. (LI BS); Braune,<br />
S.; Schnarr, K. (VI H);<br />
Behm, F.; Eichhoff, S.; Schnug-<br />
Reuter, B. (IfB LG);Buntrock-<br />
Taux, E.; Leskow, C.; Suckrau,<br />
I. (LI OL); Janke, M. (IB CE)<br />
Arbeitskreis Qualitätskontrolle Obst, Gemüse <strong>und</strong> Speisekartoffeln Aue, B.; Leymers, H. (Dez. 43)<br />
Arbeitskreis Speisekartoffeln Hahnkemeyer, E. (Dez. 43)<br />
Arbeitskreis Vorratsschutz Freise, J.; Oltmann, B. (Dez.<br />
32)<br />
Arbeitskreis Wirbeltiere Freise, J.; Oltmann, B. (Dez.<br />
32)<br />
Ausschuss Lebensmittel-Monitoring Meylahn, K.; Kombal, R.;<br />
Richter, A. (LI OL)<br />
AVID-Arbeitsgruppe "Molekularbiologische Methoden in der<br />
Tierseuchendiagnostik"<br />
Runge, M. (VI H)<br />
Beirat Rahmenvereinbarung Schlachtvieh Aue, B.; Grauer, A. (Dez. 43)<br />
3
BfR-Arbeitskreis Gummi Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
BfR-Kommission für Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe u.<br />
Verarbeitungshilfsstoffe<br />
Maslo, R. (LI BS)<br />
B<strong>und</strong>/Länder-AG "Q-Fieber" Runge, M. (VI H)<br />
B<strong>und</strong>/Länder-AG "Rückverfolgbarkeit mit Hilfe der stabilen Isotopentechnik" Wolf, E.; Meylahn, K. (LI OL)<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgruppe BALVI IP Tierseuchen Schumacher, T. (Dez. 24)<br />
B<strong>und</strong>-Länder-Arbeitsgruppe "Aal" Meyer, L.; Diekmann, M. (Dez.<br />
34)<br />
CEN Working group - Monitoring of Genetically Modified Organismus von der Ohe, W. (IB CE)<br />
CEN-AG zur Standardisierung von Methoden zum Nachweis von potentiell<br />
pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln<br />
Schulze, M. (LI BS)<br />
Codex Committee Food Hygiene Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
DGK-Arbeitsgruppe "Mikrobiologie" Wessels, B. (IfB LG)<br />
Diagnostic Team <strong>und</strong> Ruminant Team Runge, M. (VI H)<br />
DIB Beirat für Honigfragen von der Ohe, W. (IB CE)<br />
DIN Arbeitsausschuss "Acrylamid in Wasser" Reinhold, L. (LI BS)<br />
DIN Arbeitsausschuss "Biotoxine" Reinhold, L. (LI BS)<br />
DIN Arbeitsausschuss "Honiguntersuchung" von der Ohe, W. (IB CE)<br />
DIN Arbeitsausschuss "Lebensmittelsicherheits-Managementsysteme" Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
DIN Arbeitsausschuss "Mikrobiologische Untersuchungen von Lebensmitteln<br />
einschl. Schnellverfahren"<br />
Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
DIN Arbeitsausschuss Pestizide Suckrau, I. (LI OL)<br />
DIN Normenausschuss Lebensmittel <strong>und</strong> landwirtschaftliche Produkte (NAL),<br />
Arbeitsausschuss Gewürze <strong>und</strong> würzende Zutaten<br />
DIN/DGF-Gemeinschaftsausschuss für die Analytik von Fetten, Ölen,<br />
Fettprodukten verwandten Stoffen <strong>und</strong> Rohstoffen<br />
Weiß, H. (LI BS)<br />
Keck, S. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Automatische Melkverfahren" Scheele, W. (Dez. 15)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Bestrahlte Lebensmittel" Pfordt, J. (LI OL)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Chemisch technologische Prüfverfahren für Papier,<br />
Pappe, Faserstoffe u. Chemiezellstoff"<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Nachweismethoden für Lebensmittel, bei deren<br />
Herstellung gentechnische Verfahren eingesetzt wurden"<br />
Punkert, M. (IfB LG)<br />
Schulze, M. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Prozesskontaminanten" Pfordt, J. (LI OL)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Prüfung von Textilien - Obleuteausschuss" Punkert, M. (IfB LG)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Süßungsmittel" de Wreede, I. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss "Vitamine" Täubert, T. (LI BS)<br />
DIN-Arbeitsausschuss Artikel für Säuglinge <strong>und</strong> Kleinkinder Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
DIN-Arbeitsausschuss Bedarfsgegenstände aus Kunststoff in Kontakt mit<br />
Lebensmitteln<br />
Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
DIN-Arbeitsausschuss Textilchem. Prüfungen <strong>und</strong> Fasertrennungen Punkert, M. (IfB LG)<br />
DIN-Arbeitskreis Werkstoffe in Kontakt mit Lebensmitteln Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
DIN-Gemeinschaftsarbeitskreis "NPF/NAB Speichel- <strong>und</strong> Schweißechtheit" Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
DIN-Normenausschuss "Hygieneschleuse" Velleuer, R. (Dez. 22);<br />
Schumacher, T. (Dez. 24)<br />
4
DIN-Normenausschuss "Lebensmittel u.<br />
landwirtschaftliche Produkte - Arbeitskreis Rückverfolgbarkeit in der<br />
Lebensmittelkette"<br />
DIN-Normenausschuss "Lebensmittelhygiene- Lüftungseinrichtungen für<br />
Lebensmittelverkaufsstätten"<br />
DIN-Unterarbeitsausschuss Polymerase-Kettenreaktion zum Nachweis von<br />
Mikroorganismen in Lebensmitteln<br />
DIN-Unterausschuss Sicherheit von Spielzeug - organisch-chemische<br />
Verbindungen<br />
Diskursprojekt Tierversuche in der Forschung - Weiterentwicklung des<br />
Großgruppenprojekts f.d. Diskurs an Schulen<br />
Velleuer, R. (Dez. 22)<br />
Könneke, K. (Dez. 15)<br />
Schulze, M. (LI BS)<br />
Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
Welzel, A. (Dez. 33)<br />
DVG-Arbeitsgruppe Resistenzen Klarmann, D. (VI OL)<br />
eAkte Kernteam Knorr, G. (Dez. 12)<br />
EU Kommissionsgremium "Sachverständigenausschuss Agrarkontaminanten" Reinhold, L. (LI BS)<br />
EU-Beratungsgremium "Zusatzstoffe" Maslo, R. (LI BS)<br />
EURBEE von der Ohe, W.; Janke, M.;<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Expertenfachgruppe "Fütterungsarzneimittel" der ZLG Schnarr, K. (VI H)<br />
Expertenfachgruppe "Tierarzneimittel" der ZLG Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Expertenfachgruppe "Tierimpfstoffe" der ZLG Lehmann, I.; Anduleit, M. (Dez.<br />
23); Thalmann, G. (VI OL)<br />
Expertengruppe "Toxische Reaktionsprodukte" Pfordt, J. (LI OL)<br />
Expertengruppe Pestizid Rückstandsanalytik (EPRA) Suckrau, I. (LI OL)<br />
Expertenkomitee "Umwelt- <strong>und</strong> Industriekontaminanten in Lebensmitteln" Pfordt, J. (LI OL)<br />
Expertenkomitee-Arbeitsgruppe "Persistent Organic Pollutants" Knoll, A.; Bruns-Weller, E. (LI<br />
OL)<br />
Experten-Kommission für Bedarfsgegenstände Punkert, M. (IfB LG)<br />
Fachausschuss "Aquatische Genetische Ressourcen" Arzbach, H. (Dez. 34)<br />
Fachausschuss Rodentizidresistenz Freise, J. (Dez. 32)<br />
Fachbeirat "Tiefkühlfisch" der Stiftung Warentest Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
Fachberirat Wirbeltiere Freise, J. (Dez. 32)<br />
Fachgruppe Futtermittelanalytik des VDLUFA Rasenack, U.; Zierenberg, B.;<br />
Warnecke, H.; Schlägel, E. (FI<br />
STD)<br />
Fischges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Fischseuchenbekämpfungsdienste der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland<br />
Kleingeld, D. (Dez. 32)<br />
Forum Waschen für die Zukunft Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
GDCh-AG "Bedarfsgegenstände" Punkert, M. (IfB LG)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe "Aromastoffe" Hausch, M. (LI BS)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe "Biochemische <strong>und</strong> molekularbiologische Analytik" Schulze, M. (LI BS)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe "Kosmetische Mittel" Behm, F. (IfB LG)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe "Lebensmittel auf Getreidebasis" Wald, B. (LI BS)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe "Pharmakologisch wirksame Stoffe" Christof, O. (VI OL); Schnarr, K.<br />
(VI H)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe Fisch Ballin, U. (IFF CUX)<br />
5
GDCh-Arbeitsgruppe Fleischwaren Rieckhoff, D. (LI OL)<br />
GDCh-Arbeitsgruppe Pestizide Suckrau, I. (LI OL)<br />
GDCh-Fachgruppe Waschmittelchemie "Hauptausschuss Detergentien" Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
GDCh-Fachgruppe Waschmittelchemie Vorstand Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
Gemeins. Projektgruppe von LAGV "Risikobeurteilung bei der Überwachung von<br />
Lebensmittelbetrieben"<br />
Gemeinsamer Arbeitskreis "Umweltradioaktivität" der Radioaktivitätsmessstellen<br />
des Landes <strong>Niedersachsen</strong><br />
Velleuer, R. (Dez. 22)<br />
Ballin, U. (IFF CUX);<br />
Weiszenburger, W. (LI BS);<br />
Nordmeyer, K. (LI OL); Runge,<br />
M.; v.Keyserlingk, I. (VI H)<br />
GeVin-Arbeitsgruppe Tierschutz Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Honig-Analytik-Workshop von der Ohe, W.; von der Ohe,<br />
K.; Janke, M. (IB CE)<br />
Informations- <strong>und</strong> Dialogforum "Tierversuche in der Forschung" Welzel, A. (Dez. 33)<br />
International Commission of Plant and Bee Relationship Bee Protection Group von der Ohe, W.; Janke, M. (IB<br />
CE)<br />
International Honey-Commission von der Ohe, W. Janke,<br />
M. (IB CE)<br />
Internationale Arbeitsgemeinschaft Futtermittelmikroskopie (IAG) Warnecke, H. (FI STD)<br />
INvitRA Ring Test Group on the In-vitro Bee larvae Rearing Janke, M. (IB CE)<br />
ISO WG "Food Safety Management Systems" Bartelt, E. (IFF CUX)<br />
Kommission zur Bewertung der gem. § 18 Infektionsgesetz geprüften<br />
Entwesungs-mittel u. -verfahren sowie der Wirksamkeit v. Mitteln u. Verfahren<br />
gegen Hygieneschädlinge<br />
Freise, J. (Dez. 32)<br />
Länderübergreifende Arbeitsgruppe Tierseuchen Thalmann, G. (VI OL); Thoms,<br />
B. (VI H/LI BS)<br />
Länderübergreifende Expertengruppe Fischfauna Weser Lecour, C. (Dez. 34)<br />
Landesfachgruppe Oberflächengewässer zur Umsetzung der EG-WRRL Meyer, L.; Mosch, E. (Dez. 34)<br />
Landesfachgruppe Übergangsgewässer <strong>und</strong> Küste zur Umsetzung der EG-WRRL Meyer, L. (Dez. 34)<br />
Landesmarktverband der nieders. Fleischwirtschaft Aue, B.; Grauer, A. (Dez. 43)<br />
LAV-Projektgruppe QM Stehr, D. (Dez. QM)<br />
Lebensmittel-Monitoring, Ausschuss Monitoring Kombal, R. (LI OL)<br />
Lebensmittelmonitoring-Expertengruppe "Pflanzenschutz- <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfungsmittel,<br />
Biozide"<br />
Richter, A. (LI OL)<br />
Materialien im Kontakt mit Lebensmitteln Eichhoff, S. (IfB LG)<br />
Nationale Arbeitsgruppe zur MRSA-Problematik in der Tierhaltung Schleuter, G. (VI OL)<br />
Nds. Arbeitsgruppe "BALVI IP Tierseuchen Schumacher, T. (Dez. 24);<br />
Bäker, L. (Dez. 31)<br />
Orale Anwendung von Tierarzneimitteln im Nutztierbereich Kleiminger, E. (Dez. 23)<br />
Pollen-Workshop von der Ohe, K. (IB CE)<br />
Projektbegleitendes Gremium zur Studie zur Überprüfung der Überwachung der<br />
Vermarktungsnormen<br />
Aue, B. (Dez. 43)<br />
Projektgruppe "Ausführungshinweise zur TierNebV <strong>und</strong> zum TierNebG" Scheele, W. (Dez. 15)<br />
Projektgruppe "Programmierung einer Fachsoftware f.d. Futtermittelbereich" Diers, F. (Dez. 41)<br />
Projektgruppe LC-MS/MS d. Fachgr. 6 des VDLUFA, Unterprojektgr.<br />
Kokzidiostatika<br />
Zierenberg, B. (FI STD)<br />
6
Projektgruppe LC-MS/MS d. Fachgr. 6 des VDLUFA, Unterprojektgr. Mykotoxine Hashem, A. (FI STD)<br />
Prüfungsausschuss für Biologielaboranten/innen Nagel-Kohl, U. (VI H)<br />
Prüfungsausschuss für die Prüfung der Lebensmittelkontrolleure Stehr, D. (Dez. QM)<br />
Prüfungsausschuss für Tierwirte/Tierwirtinnen Fachrichtung Imkerei von der Ohe, W.; Boecking, O.;<br />
Lembke, S.; Schell, H.;<br />
Schönberger, H. (IB CE)<br />
QM Futtermittelkontrolle B<strong>und</strong> Böming, J. (Dez. 419<br />
Ressortübergreifende Planungsgruppe zur Erstellung integrierter<br />
Bewirtschaftungs-läne für die Ästuare Elbe, Weser <strong>und</strong> Ems<br />
Sachverständigengruppe Campylobactermonitoring u. Salmonellenmonitoring<br />
Geflügel<br />
Meyer, L. (Dez. 34)<br />
Seybold, C. (VI OL)<br />
Sachverständigengruppe MRSA im Tier <strong>und</strong> in Lebensmitteln tierischer Herkunft Schleuter, G. (VI OL)<br />
Sachverständigengruppe Prävalenzstudie Salmonellen Schlachtschweine Schleuter, G. (VI OL)<br />
Sachverständigenrat für Labor-akkreditierung Täubert, T. (LI BS); Thoms, B.<br />
(VI H/LI BS)<br />
Scientific Board der Apidologie von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Tierseuchenbekämpfungshandbuch Diekmann, J.;Dörrie, H.; Freise,<br />
J.; Gerdes, U.; Grothusmann,<br />
M.; Jeske, C.; Kleingeld, D.;<br />
Mahnken, M.; Schmedt<br />
a.d.Günne, H.; Tapper, S.;<br />
Kurlbaum, S.; Bäker, L. (Dez.<br />
32/31)<br />
UAG-Referenz-Messprogramm im Rahmen der B<strong>und</strong>/Länder-Arbeitsgruppe<br />
Dioxine<br />
Knoll, A.; Bruns-Weller, E. (LI<br />
OL)<br />
Unterarbeitsgruppe Balvi Tierschutzmodul Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Unterarbeitsgruppe Datenkataloge/ Futtermittelstatistik Diers, F.; Kay, C. (Dez. 41)<br />
VDI/DIN Fachbeirat "GVO-Monitoring" von der Ohe, W. (IB CE)<br />
Wildbretthygiene der Deutschen<br />
Jagdschutz-Verbandes, Bonn<br />
Treu, H. (Dez. 14/31)<br />
7. 2 Verzeichnis der wissenschaftlichen Vorträge <strong>und</strong> Veröffentlichungen<br />
Ady, G. (FI STD) Posterpräsentation auf der 1. Jahrestagung der LAVES-Institute: Umstrukturierung<br />
einer Untersuchungseinrichtung – Veterinäruntersuchungsamt → Futtermittelinstitut (FI<br />
STD)<br />
Ady, G. (FI STD); Haunhorst, E. (P);<br />
Schütte, R. (AL 4)<br />
Futtermittelkontrolle in der Praxis, FeedMagazine, Kraftfutter, 7-8 2007, S. 16-20<br />
Arzbach, H.-H. (IfF CUX) Vorträge: Biologie, Ökologie <strong>und</strong> Verhalten der Flusskrebse / Krebsarten: Herkunft,<br />
Verbreitung <strong>und</strong> artenspezielle Aspekte, Flusskrebslehrgang der LWK <strong>Niedersachsen</strong><br />
Echem, 2<strong>3.</strong>11.2007.<br />
Aue, Dr., B. (Dez. 43) Vortrag: Freilandhaltung von Legehennen – Zur Gestaltung <strong>und</strong> Nutzung des<br />
Auslaufes als Voraussetzung für die Vermarktung von Freilandware, 2<strong>3.</strong>0<strong>3.</strong>2007, 6.<br />
Niedersächsisches Tierschutzsymposium, Staatliches Museum für Natur <strong>und</strong> Mensch,<br />
Oldenburg<br />
Veröffentlichung: gleichlautend wie vorstehend im Symposiumsband, Hrsg.:<br />
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> <strong>Verbraucherschutz</strong>, Laves, 09/2007, Hannover <strong>und</strong> Wardenburg<br />
7
Ballin, U. (IfF CUX) Vorträge: Zur Gefahrenanalyse von begrenzt haltbaren Heringserzeugnissen /<br />
Fischereierzeugnisse- Fang <strong>und</strong> Verarbeitung- eine Übersicht / Technologie von<br />
Marinaden, Anchosen <strong>und</strong> gesalzenen Fischereierzeugnissen, Anorganische<br />
Schadstoffe in Fischereierzeugnissen: aktueller Stand <strong>und</strong> Bewertung, Seminar des<br />
Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven „Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11.-07.11.2007 <strong>und</strong> Seminar des<br />
Fischkompetenzzentrums Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Bremen<br />
„Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der<br />
amtlichen Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 07.11. – 09.11.2007.<br />
Bartelt, E. (IfF CUX) Vortrag: Aquakulturen in <strong>Niedersachsen</strong>: Hygienebeprobungen zur Überwachung der<br />
Betriebshygiene in Aquakulturbetrieben <strong>Niedersachsen</strong>s im Zuge von EU-<br />
Zulassungen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong><br />
<strong>und</strong> Bremen „Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für<br />
Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> der<br />
Grenzkontrollstellen, Cuxhaven, Bremerhaven, 07.11.-09.11.2007 / Seminar des<br />
Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven „Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11. – 07.11.2007.<br />
Vortrag: Risiken durch Fischereierzeugnisse; Seminar des Fischkompetenzzentrums<br />
Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Bremen „Risikoorientierte Überwachung von<br />
Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung<br />
<strong>und</strong> der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven, Bremerhaven, 07.11.-09.11.2007; Seminar<br />
des Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven „Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11. – 07.11.2007.<br />
Vortrag: Ges<strong>und</strong>heitlicher <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Risiken beim Verzehr von<br />
Fischereierzeugnissen: FH Osnabrück, 31.5.2007.<br />
Vortrag: „Fisch als Lebensmittel – die amtliche Untersuchung von<br />
Fischereierzeugnissen“<br />
Umwelttag des DHB Cuxhaven „Fisch <strong>und</strong> Umwelt“ , Kreishaus Cuxhaven, 17.10.<br />
2007.<br />
Vortrag: „Die amtliche Untersuchung von Fischereierzeugnissen“ 2. Braunschweiger<br />
QI-Tage: angeMESSEN ! Thema 2007: Lebensmittel S I C H E R H E I T PTB<br />
Braunschweig, 17.9.- 18.9.2007.<br />
Vortrag: Der “Muschelwächter“: Qualitätsgemeinschaft „Fisch“, Meeting 14.11.2007,<br />
Bremerhaven.<br />
Veröffentlichung: Enumeration of Campylobacter spp. on the surface and within<br />
chicken breast fillets. J. Appl. Microbiol. 102/2 (2007): 313-318.<br />
Bartelt, E.; Effkemann, S.; Kruse, R.<br />
(IfF CUX) (Mitautoren)<br />
Bartelt, E.; Etzel, V.; Ramdohr, S.;<br />
Jark, U. (IfF CUX)<br />
Becker, D. (HU Hamburg); Runge, M.<br />
(VI H); Pelz, H-J. (BBA)<br />
Boecking, O. (IB CE)<br />
Veröffentlichung: Globale Destillation II, Anreicherung von „persistenten,<br />
bioakkumulierenden, toxischen Substanzen“ <strong>und</strong> von „sehr persistenten, sehr<br />
bioakkumulierenden Substanzen“ in Heringen aus dem Nordatlantik, der Nordsee <strong>und</strong><br />
der Ostsee, J. f. <strong>Verbraucherschutz</strong> u. Lebensmittelsicherheit 3 (1), 82-94 (2007).<br />
Poster: Forschungsprojekt „Aquakulturen in <strong>Niedersachsen</strong>“, Untersuchungen zur<br />
Hygiene der Schlachtung <strong>und</strong> Verarbeitung in niedersächsischen Aquakulturbetrieben<br />
(Aquakulturprojekt III); LAVES-Jahrestagung Braunschweig 8.5.- 9.5.2007.<br />
Vortrag: Methodisch-technische Probleme bei der molekularbiologischen<br />
Resistenzanalyse, Jahrestagung des Fachausschusses Rodentizidresistenz,<br />
Wardenburg, 19.-20. November 2007.<br />
Veröffentlichung: Cerana: Ursprungswirt der Varroamilbe. Deutsches Bienenjournal<br />
18(10) 2007: 9.<br />
Vortrag: Bestäubung <strong>und</strong> Bestäubungsmanagement; KIV Stade<br />
Vortrag: Imkerliche Betriebsweisen „Celler-Rotationsverfahren“; KIV Bernkastel-Wittlich<br />
Vortrag: Die Varroose eine existenziell bedrohliche Parasitose für die deutsche Imkerei<br />
– es gibt Auswege aus der Bedrohung für die Praxis; DVG-Tagung, FG Parasitologie<br />
<strong>und</strong> parasitäre Krankheiten; Celle<br />
Vortrag: Der Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida) <strong>und</strong> die Tropilaelaps-Milbe<br />
(Tropilaelaps clareae) sind in der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen<br />
gelistet – sie sind bislang in Deutschland nicht nachgewiesen; DVG-Tagung, FG<br />
Parasitologie <strong>und</strong> parasitäre Krankheiten; Celle<br />
8
Vortrag: Begleitende Analyse einer Paarungssaison auf der Gebirgsbelegstelle<br />
„Torfhaus“ im Harz; Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung<br />
e.V.; 27.0<strong>3.</strong>07 Veitshöchheim<br />
Boecking, O. (IB CE); Traynor, K. Veröffentlichung: Varroa Biology and Methods of Control. Part 1. American Bee<br />
Journal 148(10) 2007: 873-878; Part II. American Bee Journal 148(11) 2007: 955-961;<br />
Part III. Soft chemical methods. American Bee Journal 148(12) 2007: 1059-1064.<br />
Boecking, O.; Kubersky, U. (IB CE)<br />
Böhmler G. (LI BS)<br />
Veröffentlichung: Schlussbericht: Entwicklung eines Rückstands-Kontrollsystems im<br />
Bereich Honig aus ökologischer Bienenhaltung. 2007 http://orgprints.org/10384/<br />
Veröffentlichung: Leitfaden: Entwicklung eines Rückstands-Kontrollsystems im Bereich<br />
Honig aus ökologischer Bienenhaltung. 2007 http://orgprints.org/10384/<br />
Boecking O. & Kubersky U.: Varroazide – Rückstandsverhalten von organischen<br />
Säuren; 1.Jahrestagung LAVES; 09.05.07 Braunschweig<br />
Vortrag: Bestäubung von Heidelbeeren; Heidelbeersprechtag 2007 in Langförden<br />
„Wirkungsbezogene Analytik in der Lebensmitteluntersuchung“, Vortrag im Rahmen<br />
der 1. Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
Poster: Zhang H., Zühlke S., Günther K., Böhmler G. Spiteller M.: „Occurence and<br />
degradation of chiral nonylphenol isomers“, Symposium EnTox 2007, 10.-11.05.2007,<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Poster: G. Böhmler <strong>und</strong> I. Thiem: „Effect-directed analysis in food control – First Step:<br />
Establishment of appropriate biological test systems“, SETAC Europe 17 th Annual<br />
Meeting, 20.-24.05.2007, Porto, Portugal<br />
„Bedeutung der wirkungsbezogenen Analytik in der Lebensmittelüberwachung“,<br />
Vortrag im Rahmen der ad-hoc AG „Wirkungsbezogene Analytik in der HPTLC“,<br />
Saarbrücken, 25.07.2007<br />
„Wirkungsbezogene Analytik in der Lebensmitteluntersuchung“, Vortrag im Rahmen der<br />
48. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der DVG, Garmisch-<br />
Partenkirchen, 25.09.- 28.09.2007<br />
„Bedeutung der wirkungsbezogenen Analytik in der Lebensmittelüberwachung“, Vortrag<br />
im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung für Sachverständige der<br />
Lebensmitteluntersuchung der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Thüringen,<br />
Meißen, 08.11.2007<br />
„Vor-Ringversuch: Mikro-EROD-Assay zum Nachweis von Dioxinen <strong>und</strong><br />
dioxinähnlichen Substanzen“, Vortrag im Rahmen der <strong>3.</strong> Sitzung der § 64-LFGB-AG<br />
„Wirkungsbezogene Analytik, Berlin, 11.12.2007<br />
Bötcher, L. (VI OL) Vortrag: Erfahrungen mit einer weitgehenden Automatisierung in der<br />
Tierseuchendiagnostik vom Stall bis zum Veterinäramt, LAVES-Jahrestagung,<br />
Braunschweig, 8.5.2007<br />
Bötcher, L.; Schöttker-Wegner, H.-H.<br />
(VI OL)<br />
Bötcher, L.; Schöttker-Wegner, H.-H.;<br />
Knorr, G. (VI OL)<br />
Bötcher, L.; Schöttker-Wegner, H.-H.;<br />
Moss, A.; Krah, B. (VI OL)<br />
Vortrag: Dichtung oder Wahrheit? – Anmerkungen zur MAP-Serologie. Jüngste<br />
Ergebnisse von Vergleichsuntersuchungen. AVID-Workshop–Paratuberkulose, Kassel,<br />
14.5.2007<br />
Vortrag: Automatisierung in der Tierseuchendiagnostik vom Stall bis zum Veterinäramt;<br />
DVG-Kongress, Berlin, 12.–14.4.2007<br />
Vortrag: Bluetongue, eine neue Tierseuche in Deutschland. LAVES-Jahrestagung,<br />
Braunschweig, 8.5.2007<br />
Brix, A. (VI H) Dissertation: Untersuchung zu minimalen Hemmkonzentrationen von antimikrobiellen<br />
Wirkstoffen gegenüber bovinen Mastitiserregern. Stiftung TiHo Hannover.<br />
Brix, A. (VI H); Hoedemaker, M.; Klein,<br />
G.<br />
Poster: Differenzierung <strong>und</strong> epidemiologische Untersuchung zu minimalen<br />
Hemmstoffkonzentrationen von Enterokokken, isoliert aus Milch boviner<br />
Mastitisinfektionen. 48. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der<br />
DVG, Garmisch-Partenkirchen, 25.09 - 28.09 2007.<br />
Bronner, M.; Eichhorn, S. (LI BS) Untersuchung von Honig im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung;<br />
Posterbeitrag zur 1. Jahrestagung der Institute des LAVES in Braunschweig, 08.-<br />
09.05.2007<br />
Brügmann, M. (VI OL) Poster: „Fallbericht aus der Pathologie: Tod eines Norwegers“, Posterdemonstration<br />
des Arbeitskreises „Diagnostische Veterinärpathologie“ in Erbenhausen am 31.05–<br />
02.06.2007 <strong>und</strong> auf der Jahrestagung der LAVES-Institute in Braunschweig am<br />
9
08.05.2007<br />
Poster: „Oleanderintoxikation beim Bison”, Posterdemonstration des Arbeitskreises<br />
„Diagnostische Veterinärpathologie“ in Erbenhausen am 31.05–02.06.2007<br />
Vortrag: „Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der pathomorphologischen Untersuchung bei<br />
Atemwegserkrankungen des Schweins”, BpT-Kongress in Bremen am 1<strong>3.</strong>10.2007,<br />
Vortragsband: ISBN 978-3-937266-17-6, S. 91–109<br />
Vortrag: „Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der pathomorphologischen Untersuchung beim<br />
Schwein”, Tagung für Schweinepraktiker: „Schwein gehabt“ auf Schloss Seggau –<br />
Leibnitz, Österreich am 17.10.2007<br />
Brügmann, M. (VI OL) (Mitautor) Artikel: „Porcine circovirus type 2-associated cerebellar vasculitis in postweaning<br />
multisystemic wasting syndrome (PMWS)-affected pigs”, Seeliger et al. Vet. Pathol. 44:<br />
621–634, 2007<br />
Artikel: „Eradication of ovine pulmonary adenocarcinoma by motherless rearing of<br />
lambs” Voigt et al., Vet. Rec., 161:129-132, 2007<br />
Artikel: „PCR examination of bronchoalveolar lavage samples is a useful tool in preclinical<br />
diagnosis of ovine pulmonary adenocarcinoma (Jaagsiekte)”, Voigt et al., Res.<br />
Vet. Sci., 83:419–427, 2007<br />
de Wreede, I. (LI BS) „Untersuchungen von Fruchtsäften, alkoholfreien Getränken <strong>und</strong> Bier mit Hilfe der<br />
Infrarotspektroskopie“<br />
Posterpräsentation im Rahmen der 1. Jahrestagung des LAVES am 8. <strong>und</strong> 9. 5. 2007<br />
in Braunschweig<br />
Dekker, C., Hedemann, M., Klarmann,<br />
D. (VI OL)<br />
Poster: „Salmonellennachweis bei Zuchtgeflügel im Rahmen der amtlichen Kontrolle<br />
der Eigenkontrolle im Methodenvergleich – Eine Gegenüberstellung von MSRV <strong>und</strong><br />
MKTTn im VI-Oldenburg.“ AVID-Jahrestagung, Kloster Banz, 24.–26. Oktober 2007<br />
Diekmann, J. (Dez. 32) Vortrag: Praxisrelevante Methoden zur Tötung <strong>und</strong> Beseitigung von Geflügel, AKNZ-<br />
Seminar „Fallstudie Tierseuchen – Aviäre Influenza“, 01.02.2007, Ahrweiler<br />
Vortrag: Zusammenarbeit THW - Mobiles Bekämpfungszentrum, THW-Geschäftsstelle<br />
Verden, 26.01.2007<br />
Vortrag: Möglichkeiten eines Mobilen Bekämpfungszentrums, AKNZ-Seminar<br />
„Fallstudie Tierseuchen“, 06.02.2007, Ahrweiler<br />
eLearning-Video: „Biosicherheit beim Betreten <strong>und</strong> Verlassen eines Gehöftes“; E-<br />
Learning-Projekt Ehlers, TiHo, Pannwitz, LK Anklam, Diekmann, LAVES; 07.02.2007,<br />
Hannover<br />
eLearning-Video: „Mobiles Bekämpfungszentrum“; E-Learning-Projekt Ehlers, TiHo;<br />
04.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Public relations in case of crisis, Twinning Project LT 2003/IB/AG/02,<br />
20.04.2007, Vilnius, Litauen<br />
Vortrag: Actions on suspicion of a notifiable animal disease, Twinning Project BA05 IB<br />
AG 01, 18.06.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Task-Force Veterinary Affairs, Twinning Project BA05 IB AG 01, 18.06.2007,<br />
Oldenburg<br />
Vortrag: MEC-Training in Lower Saxony, Twinning Project BA05 IB AG 01, 18.06.2007,<br />
Oldenburg<br />
Vortrag: Tötung von Tieren im Seuchenfall, Veranstaltung des Staatssekretärs mit den<br />
Landräten <strong>Niedersachsen</strong>s, 22.06.2007, Barme<br />
Vortrag: MBZ, Gemeinderat Dörverden, 1<strong>3.</strong>08.2007, Barme<br />
Vortrag: Tierschutzgerechte Tötung von Geflügelbeständen, Tierschutztagung,<br />
1<strong>3.</strong>09.2007, Hannover<br />
Vortrag: Schweinehaltungshygieneverordnung – Untersuchungen nach § 8,<br />
Kreisstellenversammlung Tierärztekammer, 31.10.2007, Wildeshausen<br />
Diekmann, J.; Dörrie, H-G.; Freise, J.;<br />
Gerdes, U.; Grothusmann, M.;<br />
Huesmann, J.; Jeske, C.; Kleingeld,<br />
D.W.; Mahnken, M.; Tapper, S. (Dez.<br />
32)<br />
Veröffentlichung: Bericht zur Tierseuchenübung 2007, Oldenburg, Dezember 2007<br />
Veröffentlichung: Jahresbericht 2007 der Task-Force Veterinärwesen des LAVES,<br />
Oldenburg, Juni 2008<br />
Diekmann, M. (IfF CUX) Vortrag: Aalmanagementpläne für die Flussgebietseinheiten Ems <strong>und</strong> Weser, 1.<br />
Treffen der an der Erstellung der Aal-Bewirtschaftungspläne für die Flussgebiete Ems<br />
<strong>und</strong> Weser beteiligten B<strong>und</strong>esländer, Hannover, 9.9.07.<br />
10
Diekmann, M. (IfF CUX) (Mitautor) Veröffentlichung: Lake depth and geographical position modify lake fish assemblages<br />
of the European ‘Central Plains’ ecoregion, Freshwater Biology 52, 2285–2297 (2007).<br />
Diers, F. (Dez. 41) Seminar: Buchprüfung in der Futtermittelkontrolle, 21.0<strong>3.</strong>2007, Sachk<strong>und</strong>elehrgang<br />
Futtermittelkontrolleurverordnung, Burg Warberg<br />
Vortrag: „Amtliche Futtermittelüberwachung“, 11.07.2007, Wahlpflichtveranstaltung zur<br />
Tierernährung, Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
Dildei, C. (VI H) Vortrag: Laboratories for investigations of milk and dairy products -Categories and<br />
functions. EU-Twinning Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and<br />
surveillance and control of milk collection and processing, Activity 4.1: Milk, Analysis<br />
and assessment; Presentation of the framework of surveillance and control,<br />
Riga/Lettland, Mai 2007.<br />
Vortrag: Guidelines according to requirements of reg. (EC) 2073/2005 and examples<br />
for specific properties incl. interpretation and assessment of results. EU-Twinning<br />
Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and surveillance and control of milk<br />
collection and processing. Activity 4.2 Elaboration of improvements and innovations.<br />
Riga/Lettland, Oktober 2007.<br />
Vortrag: Sampling plan and categories of samples for surveillance and control of<br />
dairies. EU-Twinning Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and<br />
surveillance and control of milk collection and processing. Activity 4.2 Elaboration of<br />
improvements and innovations. Riga/Lettland, Oktober 2007.<br />
Vortrag: Organization structure of laboratories for investigations of milk and dairy<br />
products in Lower Saxony. EU-Twinning Project, Latvia , Component 4: Quality of raw<br />
milk and surveillance and control of milk collection and processing. Activity 4.2<br />
Elaboration of improvements and innovations. Riga/Lettland, Oktober 2007.<br />
Vortrag: Basics for interpretation of Reg. (2073/2005 and other microbiological<br />
guidelines as base of inspector´s decision. EU-Twinning Project, Latvia, Component 4:<br />
Quality of raw milk and surveillance and control of milk collection and processing.<br />
Activity 4.3 Training in surveillance and control of milk products and control of raw milk<br />
quality. Riga/Lettland, November 2007.<br />
Vortrag: Sampling on the dairy level: Swabs, milk and milk products. EU-Twinning<br />
Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and surveillance and control of milk<br />
collection and processing. Activity 4.3 Training in surveillance and control of milk<br />
products and control of raw milk quality. Riga/Lettland, November 2007.<br />
Vortrag: Interpretation of microbiological results: Milk and milk products. EU-Twinning<br />
Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and surveillance and control of milk<br />
collection and processing. Activity 4.3 Training in surveillance and control of milk<br />
products and control of raw milk quality. Riga/Lettland, November 2007.<br />
Vortrag: Handling plan for preventive measures after determination of Verotoxin and/or<br />
Verotoxin producing E. coli (VTEC) in raw milk and raw milk products. EU-Twinning<br />
Project, Latvia, Component 4: Quality of raw milk and surveillance and control of milk<br />
collection and processing. Activity 4.3 Training in surveillance and control of milk<br />
products and control of raw milk quality. Riga/Lettland, November 2007.<br />
Dildei, C., H. Kirchhoff (VIH/LI OL) Vortrag: Zum dreistufigen Bezeichnungsschema zur Beurteilung von Döner Kebap <strong>und</strong><br />
dönerähnlichen Erzeugnissen: Kriterien zum Beurteilungsmerkmal „Grad der<br />
Leitsatzkonformität“ als Maßstab zur Abgrenzung der Produktgruppen „ALIUD“ <strong>und</strong><br />
„nach Döner Kebap Art“. 60. Arbeitstagung des Arbeitskreises der auf dem Gebiet der<br />
Lebensmittelhygiene <strong>und</strong> der vom Tier stammenden Lebensmittel tätigen<br />
Sachverständigen (ALTS), Berlin, Juni 2007.<br />
Dildei, C., Kirchhoff, H. (VI OL, LI OL) Vortrag: Zum dreistufigen Bezeichnungsschema zur Beurteilung von Döner Kebap <strong>und</strong><br />
dönerähnlichen Erzeugnissen: Kriterien zum Beurteilungsmerkmal „Grad der<br />
Leitsatzkonformität“ als Maßstab zur Abgrenzung der Produktgruppen „ALIUD“ <strong>und</strong><br />
„nach Döner Kebap Art“ / 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11.-1<strong>3.</strong>06.07 in Berlin<br />
Dildei, C., S. Nickel, H. Kirchhoff, A.<br />
Orellana (VI H, LI BS, LI OL)<br />
Dildei, C.; Dolzinski, B. ; Runge, M. (VI<br />
H)<br />
Veröffentlichung: Eine Statuserhebung zur Beschaffenheit von Hähnchen-Döner<br />
Kebap -Untersuchungen zur präparativ-gravimetrischen <strong>und</strong> chemisch-analytischen<br />
Beschaffenheit von Hähnchen-Döner Kebap. Fleischwirtschaft, Dezember 2007, S.<br />
111-114.<br />
Vortrag: Qualitäts- <strong>und</strong> Hygienemanagement am Beispiel eines Kooperationsprojektes<br />
zwischen LAVES, Kommunalen Veterinärbehörden <strong>und</strong> Herstellerbetrieben:<br />
Handlungsschema für die Vorgehensweise im Erzeugerbetrieb beim Nachweis von<br />
11
pathogenen Keimen in rohen Lebensmitteln; Vorstellung des niedersächsischen<br />
Maßnahmenplans zur Vorgehensweise beim Nachweis von Verotoxin bzw. VTEC in<br />
Vorzugsmilch. 26. Internationaler Veterinärkongress des BbT, Bad Staffelstein, April<br />
2007<br />
Veröffentlichung in: BbT Kongress-Band 26. Internationaler Veterinärkongress, 2007.<br />
Vortrag: Präventiver <strong>Verbraucherschutz</strong> im Herstellerbetrieb -Vorstellung eines<br />
Handlungsschemas als Sofortmaßnahme beim Nachweis von Verotoxin bzw. VTEC in<br />
Vorzugsmilch; Beispiel für ein Kooperationsprojekt zwischen LAVES, Kommunalen<br />
Veterinärbehörden <strong>und</strong> Vorzugsmilchbetrieben. 1. Jahrestagung der Institute des<br />
LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Veröffentlichung: Präventiver <strong>Verbraucherschutz</strong> im Herstellerbetrieb am Beispiel<br />
Vorzugsmilch - Vorstellung eines Handlungsschemas als Sofortmaßnahme beim<br />
Nachweis von Verotoxin bzw. VTEC in Vorzugsmilch als Beispiel für ein<br />
Kooperationsprojekt zwischen LAVES, Kommunalen Veterinärbehörden <strong>und</strong><br />
Vorzugsmilchbetrieben. Amtstierärztlicher Dienst <strong>und</strong> Lebensmittelkontrolle, 14.<br />
Jahrgang, II. Quartal 2007, S. 81-8<strong>3.</strong><br />
Dörrie, H.-G. (Dez. 32) Vortrag: Wildbrethygiene Was kommt auf uns Jäger zu? Damwildhegegemeinschaft<br />
Delme-Hunte-Klosterbach, Harpstedt,01.0<strong>3.</strong>2007<br />
Vortrag: Wildbrethygiene / Wildbretbehandlung, Was kommt auf uns Jäger zu?<br />
Hegering Friesische Wehde-Süd, Varel, 14.0<strong>3.</strong>2007<br />
Vortrag: Neues zum Hygienerecht,<br />
Nds. Landesforsten, Gebiet-Nord, Sellhorn, 12.04.2007<br />
Vortrag: Wildbrethygiene / Wildbretbehandlung, Neue Vorgaben für Jäger?<br />
Jägerschaft Aschendorf-Hümmling, Heede, 19.04.2007<br />
Veröffentlichung: Neue Regelungen zur Wildbrethygiene, Beitrag zum<br />
Landesjagdbericht 2006, April 2007<br />
Vortrag: Aktuelle Wildbrethygienevorschriften <strong>und</strong> deren praktische Umsetzung<br />
Nds. Landesforsten, Münchehof, 05.06.2007<br />
Vortrag: Aktuelle Wildbrethygienevorschriften <strong>und</strong> deren praktische Umsetzung<br />
NFA Ankum, Ankum, 31.08.2007<br />
Vortrag: Aktuelle Wildbrethygienevorschriften<br />
Betriebsleitung Niedersächsische Landesforsten, Braunschweig, 05.09.2007<br />
Vortrag: Die neuen Wildbrethygienevorschriften, Was bringen die neuen Regelungen<br />
für die Jäger? Hegeringe Abbehausen, Butenland, Nordenham,<br />
Stollhamm, 24.09.2007<br />
Effkemann, S. (IfF CUX) Vorträge: Neue Strategien für den Antibiotikanachweis in Fischereierzegnissen / Zur<br />
Analytik von marinen Biotoxinen, Seminar des Fischkompetenzzentrums Nord der<br />
Länder <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Bremen „Risikoorientierte Überwachung von<br />
Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der amtlichen Lebensmittelüberwachung<br />
<strong>und</strong> der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven, Bremerhaven, 07.11.-09.11.2007 / Seminar<br />
des Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven „Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11.-07.11.2007.<br />
Vorträge: Forschungsprojekt „Globale Destillation“ / Marine Biotoxine, LAVES-<br />
Jahrestagung Braunschweig, 8.5.-9.5.2007.<br />
Vortrag: Simultanbestimmung von Triphenylmethanfarbstoffen in Fischen mittels LC-<br />
MS/MS, Tagung beim B<strong>und</strong>esamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
(BVL), 10. Mai 2007, Berlin.<br />
Veröffentlichung: Analytische Bestimmung <strong>und</strong> Beurteilung des Farbstoffgehaltes in<br />
„Seelachsschnitzeln (Lachsersatz) in Öl“, J. f. <strong>Verbraucherschutz</strong> u.<br />
Lebensmittelsicherheit 2 (4), 499 (2007).<br />
Effkemann, S.; Bartelt, E. (IfF CUX) Vortrag: Analytische Bestimmung <strong>und</strong> Beurteilung des Farbstoffgehaltes in<br />
„Seelachsschnitzeln (Lachsersatz) in Öl“ . 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11. – 1<strong>3.</strong><br />
Juni 2007 in Berlin.<br />
Eichhoff, S. (IfB LG) Vortrag: Aktive Verpackungen, 1. Jahrestagung der Institute des Nds. Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES), Braunschweig 8.-9.5. 2007<br />
Etzel, V. (IfF CUX) Vorträge: Nematodenlarven in Fischereierzeugnissen, insbesondere in Wildlachs,<br />
aktueller Sachstand / Fischartendemonstration, Vermarktung <strong>und</strong> industrielle<br />
Fischverarbeitung / Zur Kennzeichnung von Erzeugnissen aus Surimi, Seminar des<br />
Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven „Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für<br />
Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11.- 07.11.2007.<br />
12
Etzel, V.; Ramdohr, S. (IfF CUX) ,<br />
Jark, U. (Dez. 21)<br />
Etzel, V.; Ramdohr, S.; Bartelt, E. (IfF<br />
CUX), Boiselle, C. (LMTVet BHV),<br />
Freise, J. F.; Oltmann, B.; Röhrs, S;<br />
Saathoff, M.; Stelling, K.; Stoltenberg,<br />
J. (Dez. 32)<br />
Vortrag: Parasiten in Seefischen, 2. Fortbildungsveranstaltung der<br />
„Länderarbeitsgemeinschaft ges<strong>und</strong>heitlicher <strong>Verbraucherschutz</strong>“ ( LAGV ), AG: Ein-,<br />
Aus- <strong>und</strong> Durchfuhr ( EAD ), für das Personal der Grenzkontrollstellen am 06./07.<br />
November 2007 in Bremen.<br />
Vortrag: Nematoden beim Wildlachs – aktueller Stand, Seminar des<br />
Fischkompetenzzentrums Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Bremen<br />
„Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der<br />
amtlichen Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 07.11.-09.11.2007.<br />
Vortrag: Nematoden beim Wildlachs – aktueller Stand, XI. Fortbildungsveranstaltung<br />
für die Fischindustrie, Groß- <strong>und</strong> Einzelhandel, 12.11.2007 in HH – Altona<br />
Vortrag : Fischstäbchen ist nicht gleich Fischstäbchen: Nematoden in Fischstäbchen<br />
aus Fischmus, 60. Arbeitstagung des ALTS, Berlin, 11.-1<strong>3.</strong>06.2007<br />
Vortrag: Vorschlag zum Nachweis <strong>und</strong> zur Beurteilung von Nematodenlarven in<br />
Wildlachs vor dem Hintergr<strong>und</strong> des geltenden EU - Rechts, 60. Arbeitstagung des<br />
ALTS, Berlin, 11.06.-1<strong>3.</strong>06.2007<br />
Veröffentlichung: 2005, ein Jahr der Hantaviren – Quo vadis? Der Hygieneinspektor.9,<br />
Juni 2006: 61-68.<br />
Veröffentlichung: Bekämpfungsprobleme bei der Roten Vogelmilbe. Der praktische<br />
Schädlingsbekämpfer 7 / 2007: 11-1<strong>3.</strong><br />
Veröffentlichung: Die Ratte als Überträger von Krankheitserregern. In: Walter<br />
Bodenschatz: Handbuch für Schädlingsbekämpfer, Behrs’s Verlag.<br />
Loseblattsammlung.<br />
Veröffentlichung: Die Reproduktionsraten der Wanderratte. In: Walter Bodenschatz:<br />
Handbuch für Schädlingsbekämpfer, Behrs’s Verlag. Loseblattsammlung.<br />
Veröffentlichung: Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Amtstierärztlicher Dienst <strong>und</strong> Lebensmittelkontrolle 2007 / IV: 277-279.<br />
Veröffentlichung: Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
Pest Control News 37, Oktober 2007: 16-17.<br />
Veröffentlichung: Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong>. In:<br />
Walter Bodenschatz: Handbuch für Schädlingsbekämpfer, Behrs’s Verlag.<br />
Loseblattsammlung.<br />
Veröffentlichung: Leitfaden zur großräumigen Rattenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong>. 2.<br />
Auflage. Eigenverlag LAVES: 28 pp.<br />
Veröffentlichung: Maßnahmen zur Bekämpfung aktueller Tierseuchen <strong>und</strong> Aufgaben<br />
der Schädlingsbekämpfung. Tagungsband, Grünauer Tagung, Dresden, 14.04.2007.<br />
Veröffentlichung: Masthähnchen oft mit Salmonellen infiziert. Der praktische<br />
Schädlingsbekämpfer 2 / 2007: 6.<br />
Veröffentlichung: Rattenbekämpfung im Fischereihafen Cuxhaven – erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit von Behörden <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfern. Tagungsband des 2.<br />
Niedersächsischen Schädlingsbekämpfungssymposiums, Vechta, 24.10.2007.<br />
Eigenverlag LAVES.<br />
Veröffentlichung: Schaben im Schweinestall sind ein Problem. LZ Rheinland, Ausgabe<br />
42, 18. Oktober 2007: 27-30.<br />
Veröffentlichung: Tierseuchenrechtliche Aspekte der Bekämpfung der durch<br />
Certatopogonidae übertragenen Blauzungenkrankheit, einer anzeigepflichtigen<br />
Tierseuche. Tagungsband des Treffens des AK der Deutschen Gesellschaft für<br />
medizinische Entomologie <strong>und</strong> Acarologie, Bochum, 12.10.2007.<br />
Veröffentlichung: Vogelmilbe kann schnell zur Gefahr werden. LZ Rheinland, Ausgabe<br />
41, 11. Oktober 2007: 34-36.<br />
Veröffentlichungen: Hantaviren in Deutschland – das Jahr 2007. Tagungsband des<br />
Treffens des Arbeitskreises Wirbeltiere der Deutschen phytomedizinischen<br />
Gesellschaft in Oldenburg, 20.-12.11.2007.<br />
Vortrag: Ansatzpunkte für die Etablierung eines Resistenzmonitoringsystems für<br />
Ratten in <strong>Niedersachsen</strong>. Jahreswechselsymposium in Stade, 05.01.2007<br />
Vortrag: Ansatzpunkte für die Etablierung eines Resistenzmonitoringsystems für<br />
Ratten in <strong>Niedersachsen</strong> – Ergebnisse des ersten Jahres. Fachgespräch<br />
Rodentizidresistenz im LAVES, Oldenburg, 20.11.2007.<br />
Vortrag: Auswahl Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen zur Schädlingsbekämpfung.<br />
Fortbildungsveranstaltung für Deponiemitarbeiter zum Thema „Schädlinge <strong>und</strong><br />
Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg, 05.07.2007.<br />
13
Vortrag: Befallserkennung <strong>und</strong> Bekämpfung von (Bett-) Wanzen.<br />
Fortbildungsveranstaltung für Servicekräfte <strong>und</strong> Krankenpfleger, Timmendorf,<br />
30.10.2007.<br />
Vortrag: Befallserkennung <strong>und</strong> Bekämpfung von Teppichkäfern.<br />
Fortbildungsveranstaltung für Servicekräfte <strong>und</strong> Krankenpfleger, Timmendorf,<br />
30.10.2007.<br />
Vortrag: Großräumiger Schabenbefall im Bereich Damme: ein Fallbeispiel.<br />
Fortbildungsveranstaltung für Deponiemitarbeiter zum Thema „Schädlinge <strong>und</strong><br />
Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg, 05.07.2007.<br />
Vortrag: Hantaviren in Deutschland - das Jahr 2007. Treffen des Arbeitskreises<br />
Wirbeltiere der Deutschen phytomedizinischen Gesellschaft in Oldenburg, 20.-<br />
22.11.2007.<br />
Vortrag: Maßnahmen zur Bekämpfung aktueller Tierseuchen <strong>und</strong> Aufgaben der<br />
Schädlingsbekämpfung. Grünauer Tagung, Dresden, 14.04.2007.<br />
Vortrag: Ratten – Vorkommen <strong>und</strong> Bedeutung. Bürgerinformationsveranstaltung, SG<br />
Rosche, 09.10.2007.<br />
Vortrag: Ratten <strong>und</strong> Mäuse. Fortbildungsveranstaltung für Deponiemitarbeiter zum<br />
Thema „Schädlinge <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg, 05.07.2007.<br />
Vortrag: Rattenbekämpfung im Fischereihafen Cuxhaven – erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit von Behörden <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfern. 2. Niedersächsisches<br />
Schädlingsbekämpfungssymposium, Vechta, 24.10.2007.<br />
Vortrag: Sach- <strong>und</strong> Fachgerechte (großräumige) Rattenbekämpfung nach TRNS.<br />
Technikerschulung des Landesverbandes Nord, Bad Bramstedt, 11.05.2007.<br />
Vortrag: Schaben als Ges<strong>und</strong>heitsschädlinge. Fortbildungsveranstaltung für<br />
Deponiemitarbeiter zum Thema „Schädlinge <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg,<br />
05.07.2007.<br />
Vortrag: Schaben <strong>und</strong> Ratten als Vektoren - Erkennung <strong>und</strong> Bekämpfung eines<br />
Befalls. Fortbildungsveranstaltung für Servicekräfte <strong>und</strong> Krankenpfleger, Timmendorf,<br />
30.10.2007.<br />
Vortrag: Schabenbekämpfung in einer Müllverbrennungsanlage.<br />
Fortbildungsveranstaltung für Deponiemitarbeiter zum Thema „Schädlinge <strong>und</strong><br />
Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg, 05.07.2007.<br />
Vortrag: Schädlingsbekämpfung als Arbeitsschutz. Fortbildungsveranstaltung für<br />
Deponiemitarbeiter zum Thema „Schädlinge <strong>und</strong> Schädlingsbekämpfung“, Oldenburg,<br />
05.07.2007.<br />
Vortrag: Tierseuchenrechtliche Aspekte der Bekämpfung der durch Certatopogonidae<br />
übertragenen Blauzungenkrankheit, einer anzeigepflichtigen Tierseuche. Treffen des<br />
AK der Deutschen Gesellschaft für medizinische Entomologie <strong>und</strong> Acariologie,<br />
Bochum, 12.10.2007.<br />
Vortrag: Vektorbekämpfung <strong>und</strong> Prophylaxemaßnahmen (BTD). Treffen der amtlichen<br />
Veterinäre <strong>und</strong> Vertreter der LWK Rheinland-Pfalz. Münchweiler a.d. Alsenz,<br />
30.05.2007.<br />
Vortrag: Was sind Schädlinge? Was macht man gegen Schädlinge? Kindergarten am<br />
Gartenweg, Sandkrug, 19.10.2007.<br />
Ganter, M.; Runge, M. (VI H) Veröffentlichung: Untersuchung zum Q-Fieber im Rahmen der Zoonoseinitiative der<br />
B<strong>und</strong>esregierung. 2007. DGfZ-Schriftenreihe, 47, 328-335.<br />
Vortrag: Untersuchung zum Q-Fieber im Rahmen der Zoonoseinitiative der<br />
B<strong>und</strong>esregierung. Symposium „Perspektiven der Schaf- <strong>und</strong> Ziegenhaltung in<br />
Mitteleuropa“, Iden, 4.-6.10.2007.<br />
Gässler, N.; Paul, H.; Runge, M. (VI H) Veröffentlichung: Schneller Nachweis von Harnwegsinfektionen – Bewertung der<br />
Durchflusszytometrie. 2007. Nieren- <strong>und</strong> Hochdruckkrankheiten 6, 225-230.<br />
Gerdes, U. (Dez. 32)<br />
Vortrag: Praktische Erfahrung der Tötung von Geflügel im Tierseuchenfall, Sitzung<br />
einer AG der SCOFCA, Brüssel, 2<strong>3.</strong>01.2007<br />
Vortrag: Tierseuchenprophylaxe in Schulbauernhöfen, B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft der<br />
Schul- <strong>und</strong> Lernbauernhöfe, Altenkirchen, 10.02.2007<br />
Vortrag: Aktuelle Lage der Schweinepest, Vortrag im Rahmen der<br />
Fortbildungsveranstaltung für praktizierende Tierärzte im MBZ in Zusammenarbeit mit<br />
der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> dem Nds. ML, Barme, 14.04.2007<br />
Vortrag: Tierseuchenkrisenmanagement in <strong>Niedersachsen</strong>, Seminar zur Ausbildung<br />
der Veterinärreferendare, Verden, 10.04.2007<br />
Vortrag: Lower Saxony Federal State office of Consumer protection and Food safety,<br />
14
Struktur <strong>und</strong> Aufgaben des LAVES, Besuch einer Delegation aus Thailand beim<br />
Niedersächsischen Landesamt für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit,<br />
07.05.2007<br />
Vortrag: Das Mobile Bekämpfungszentrum als Baustein im<br />
Tierseuchenkrisenmanagement, in Zusammenarbeit mit der Tierärztekammer<br />
Sachsen, Barme, 18.06.2007<br />
Vortrag: Berufsbild Tierarzt – Tierärztin, Workshop Gymnasium Eversten, Oldenburg,<br />
1<strong>3.</strong>07.2007<br />
Vortrag: Das Mobile Bekämpfungszentrum als Baustein im<br />
Tierseuchenkrisenmanagement, Tierseuchenübung im MBZ 2007, Barme, 30.10.2007<br />
Vortrag: Das Mobile Bekämpfungszentrum als Baustein im<br />
Tierseuchenkrisenmanagement, Veranstaltung der Amtstierärzte des Landes<br />
Thüringen, Barme, 30.10.2007<br />
Vortrag: Konzept der geografischen Kompartimentierung, Expertenschulung, Bad<br />
Breisig, 18.10.2007<br />
Vortrag: Tierseuchenkrisenmanagement in <strong>Niedersachsen</strong>, Universität Göttingen,<br />
29.10.2007<br />
Vortrag: Tierseuchenkrisenmanagement <strong>und</strong> Bekämpfung der Blauzungenkrankheit in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, Landwirtschaftlicher Verein Landkreis Oldenburg, Stenum, 1<strong>3.</strong>11.2007<br />
Vortrag: Struktur der Veterinärverwaltung <strong>und</strong> Tierseuchenkrisenmanagement in<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, Berufsbildende Schulen II in Oldenburg, 02.10.2007<br />
Vortrag: Kompartimentierung, Dienstbesprechung des LAVES mit den kommunalen<br />
Veterinärbehörden, Oldenburg, 21.11.2007<br />
Vortrag: Tierseuchenprophylaxe in Schul- <strong>und</strong> Lernbauernhöfen,<br />
Landesarbeitsgemeinschaft der Lernbauernhöfe <strong>Niedersachsen</strong>, Lüneburg,<br />
28.11.2007<br />
Vortrag: Auftreten, Klinik <strong>und</strong> Verbreitung der Blauzungenkrankheit in Deutschland,<br />
Fleischausschuss des Niedersächsischen Landvolks, Verden, 17.12.2007<br />
Veröffentlichung. Berufsbild Amtstierarzt, Amtstierärztliche Aufgaben in der<br />
Tierseuchenbekämpfung <strong>und</strong> Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Parey Verlag,<br />
Stuttgart, 2007<br />
Geßener, C.; Nickel, S. (LI BS) „Nitrat in Hart- <strong>und</strong> Schnittkäse; Untersuchung zur Ermittlung eines unteren<br />
Richtwertes“; Vortrag im Rahmen der Jahrestagung des LAVES, Braunschweig,<br />
08.05.2007<br />
Hänsel, A. (Dez. 23) Vortrag: Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes in <strong>Niedersachsen</strong> i.R.<br />
der Ausbildung von Praktikanten am 05.11.2007<br />
Hashem, A. (FI STD), Korte,E. Posterpräsentation 29th Mycotoxin-Workshop, Fellbach: New fast alternative Clean-up<br />
Method for Deoxynivalenol from Feed<br />
Posterpräsentation XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and<br />
Phycotoxins, Istanbul: New fast alternative Clean-up Method for Deoxynivalenol from<br />
Feed<br />
Heemken, O. (VI OL) Vortrag: Androgene Steroidhormone – natürliches Vorkommen oder illegale<br />
Verabreichung, NRL-Fachtagung „Aktuelle Informationen zur Rückstandsanalytik –<br />
Tierarzneimittel, hormonell wirksame Stoffe, Farbstoffe“, Berlin, Mai 2007<br />
Vortrag: Nachweis von beta-Agonisten mittels LC-MS/MS nach Anreicherung auf<br />
Molecularly Imprinted Polymer Säulen, Sigma-Aldrich Seminar „Probenvorbereitung –<br />
ein entscheidender Schritt in der Analytik“, Hamburg, April 2007<br />
Vortrag: Nachweis von beta-Agonisten mittels LC-MS/MS nach Anreicherung auf<br />
Molecularly Imprinted Polymer Säulen, Seminar der AG „Organische<br />
Rückstandsanalytik“, FI Stade, Juli 2007<br />
Held, R. (LI BS) „Vortragsfolge zur Health Claim Verordnung – Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Angaben“,<br />
Vortrag im Rahmen der 1. Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen<br />
Landesamtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig,<br />
09.05.2007<br />
Heyne, S. (Dez. 41) Vortrag : „Sachstand CC - Kontrollen 2007“, 21.11.07, vor Landkreisvertretern im<br />
LAVES-Zentrale Oldenburg<br />
Vortrag: Praktische Futtermittelüberwachung an der Schnittstelle zur<br />
Lebensmittelüberwachung, 25.09.2007, Lebensmittelchemische Gesellschaft<br />
Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Regionalverband Nord<br />
15
Hopkins, S.; Schöbel, S.; Baumann,<br />
S.; von Keyserlingk, I.; Steinhagen, D.;<br />
Runge, M. (VI H)<br />
Poster: Evaluation of new real-time PCR for the detection of Koi herpesvirus.<br />
1. Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Huesmann, J. (Dez. 32) Vorträge: Notfallplanung kontaminierte Wildtiere; Planungsstand<br />
Veterinärbehörden der Küstenlandkreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte am 14.02,2007,<br />
15.02.2007 <strong>und</strong> 01.0<strong>3.</strong>2007<br />
Tier- <strong>und</strong> Naturschutzverbände am 0<strong>3.</strong>05.2007<br />
Janke, M. (IB CE) Vortrag: Bienenvergiftungen – Wechselwirkungen von Pflanzenschutzmitteln <strong>und</strong><br />
anderen Faktoren; 1.Jahrestagung LAVES; 09.05.07 Braunschweig<br />
Janke, M. et al. (IB CE) Vortrag: Honigqualitätsparameter Bedeutung sowie deren Bestimmung mittels<br />
Infrarotspektroskopie; DLG Fachtagung Honig, 07.0<strong>3.</strong>07 Bremen<br />
Juilfs, H. (Dez. 43) Schulung / Vortrag: Schlachtkörperklassifizierung, 27.02.-01.0<strong>3.</strong>2007, 0<strong>3.</strong>-05.07.2007,<br />
05.-08.11.2007, Ausbildung von Sachverständigen für die Einreihung von<br />
Schlachtkörpern in Handelsklassen, mit LWK <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> BFEL Kulmbach,<br />
wechselnde Orte<br />
Kämmereit, M. (IfF CUX) Vortrag: Zum Sachstand der Aalschutzverordnung, Arbeitsgemeinschaft der<br />
Weserfischereigenossenschaften, Achim, 1<strong>3.</strong>6.2007.<br />
Vortrag: Flusskrebse in der Gesetzgebung – Fischerei- <strong>und</strong> Naturschutzrecht,<br />
Flusskrebslehrgang der LWK <strong>Niedersachsen</strong>, Echem, 2<strong>3.</strong>11.2007.<br />
Kämmereit, M. (IfF CUX) (Mitautor) Veröffentlichung: Triphenylzinn-Biota-Monitoring in Gewässern <strong>Niedersachsen</strong>s. –<br />
Vom Wasser 105 (1), 20-24 (2007).<br />
Keller, B.; Rickling, S.; Schmerse, A.;<br />
Moser, P.; Braune, S.; Albrecht, I.;<br />
Dolle, K.; Runge, M.; Baumann, S.;<br />
Schöbel, S.; von Keyserlingk, I. (VI H);<br />
D.W. Kleingeld (Dez. 32, FB<br />
Fischseuchenbekämpfung LAVES)<br />
Keller, B.; Schmerse, A.;<br />
Wickenhäuser, S.;Moser, P. (VI H)<br />
Poster: Fischseuchenbekämpfung in <strong>Niedersachsen</strong>. 1. Jahrestagung der Institute des<br />
LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Poster: Tollwutuntersuchungen in <strong>Niedersachsen</strong>.<br />
1. Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Kirchhoff, H. (LI OL) Vortrag: Leitlinien – Überlegungen zur rechtlichen Relevanz von in Leitlinien<br />
enthaltenen Vorschriften / 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11.-1<strong>3.</strong>06.07 in Berlin<br />
Kirchhoff, H. , Ziegelmann, B. (LI OL) Vortrag: Geflügelfleisch mit Flüssigwürzung – Verbrauchererwartung <strong>und</strong><br />
Herstellungspraxis, 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11.-1<strong>3.</strong>06.07 in Berlin<br />
Vortrag: Geflügelfleisch mit Flüssigwürzung – Verbrauchererwartung <strong>und</strong><br />
Herstellungspraxis, 1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 09.05.07 in Braunschweig<br />
Klarmann, D. (VI OL) Vortrag: „Entwicklung des Infektionsstatus ausgewählter rinderhaltender Betriebe im<br />
Rahmen des Niedersächsischen Sanierungsverfahrens zur Bekämpfung der<br />
Paratuberkulose“, 6. Stendaler Symposium zur BHV1, BVD- <strong>und</strong><br />
Paratuberkulosebekämpfung, 07.–09.März.2007, Stendal<br />
Vortrag: „Erfahrungen mit einem geänderten Verfahren zum Nachweis von<br />
Salmonellen in Geflügelzuchtbeständen – Umsetzung der VO EG 2160/2003 zur<br />
Salmonellenbekämpfung.“ 31. Januar 2007, Cloppenburg<br />
Vortrag: „Ergebnisse der Resistenzsituation von Salmonellen, isoliert im Rahmen der<br />
Diagnostik <strong>und</strong> des EU-Salmonellenmonitoring, Strategie zur Vermeidung von<br />
Resistenzen <strong>und</strong> Bekämpfung von Salmonellen in Geflügelbeständen“<br />
Vortrag: „Neueste Erkenntnisse nach einem Paratuberkuloseworkshop des AVID zur<br />
Diagnostik, Situation der Sanierung von Rinderbeständen“<br />
Vortrag: „Resistenzen von Salmonella-Isolaten aus Nord-West-Deutschland“, 1.<br />
LAVES-Jahrestagung, 08.–09. Mai 2007, Braunschweig<br />
Vortrag: Nachweis von Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis, Ergebnisse eines<br />
Ringversuchs 2005 – Auswertung einer Umfrage <strong>und</strong> Vorschlag für eine<br />
Harmonisierung“ , AVID-Workshop Harmonisierung der Paratuberkulosediagnostik,<br />
14.–15. Juni.2007, Kassel<br />
Klarmann, D.; Schöttker-Wegner, H.-<br />
H.; Brügmann, M. (VI OL)<br />
Vortrag: „Einsendung von Probematerialien“, Informationsveranstaltung für<br />
Amtstierärzte, 26. Juni 2007, Oldenburg<br />
16
Kleiminger, E. (Dez. 23) Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Nationaler<br />
Rückstandskontrollplan (Umsetzung in <strong>Niedersachsen</strong>) i. Rahmen der<br />
Praktikantenausbildung im LAVES am 31.1.2007 in Oldenburg<br />
Vortrag: Tierarzneimittelrecht, Fütterungsarzneimittel – Arzneimittelrechtliche<br />
Vorschriften für die Anwendung von Tierarzneimitteln <strong>und</strong> Fütterungsarzneimitteln bei<br />
Nutztieren i. R. des Sachk<strong>und</strong>elehrganges für Futtermittelprüfer auf der Burg Warberg<br />
am 2<strong>3.</strong>2.2007<br />
Vorträge: Tierarzneimittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>,<br />
Tierarzneimittelüberwachung im kleinen Grenzverkehr,<br />
Organisation der Rückstandsüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> gem.<br />
Rückstandskontrollplan (NRKP); Fortbildungsreihe „Lebensmittel u. Arzneien“ des<br />
Bildungsinstitutes der Polizei am 06.0<strong>3.</strong>2007 in Wennigsen<br />
Vortrag: Tierärztliche Hausapothekenverordnung <strong>und</strong> Tierimpfstoff – Verordnung,<br />
Kreisstelle Emden der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong> am 06.0<strong>3.</strong>2007 in Emden<br />
Vortrag: Control of veterinary medicinal products in Lower Syxony and National<br />
Residue Control Plan (NRKP) i. R. des Twinning Bosnien – Internship am 9.<strong>3.</strong>2007 in<br />
Oldenburg<br />
Vortrag: Tierärztliche Hausapothekenverordnung <strong>und</strong> Tierimpfstoff – Verordnung –<br />
aktuelle Änderungen, Kreisstelle Cloppenburg der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong> am<br />
12.04.2007 in Vordersten Thüle<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung <strong>und</strong> Rückstandskontrolle in <strong>Niedersachsen</strong> i. R.<br />
der Ausbildung der Veterinärreferendare in <strong>Niedersachsen</strong> am 15.5.2007 in Hannover<br />
Vorträge am 6. <strong>und</strong> 7. Juli 2007 i. R. des Projektes „Beraten – Bewerten – Beurteilen“<br />
der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>:<br />
Tierärztliche Hausapothekenüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong> – Verfahrensweise <strong>und</strong><br />
Erfahrungen<br />
„Umwidmung“ – Rechtliche Vorgaben <strong>und</strong> Forderungen an die praktische<br />
Vorgehensweise<br />
Versuch der Synopse der besonders bedeutsamen Bestimmungen <strong>und</strong><br />
Rechtsinterpretationen des Arzneimittelrechts<br />
Vortrag: Tierarzneimittelüberwachung – Erfahrungsbericht <strong>und</strong> aktuelle Änderungen im<br />
Arzneimittelrecht mit praktischen Hinweisen zur Einhaltung der Vorschriften bei<br />
Anwendung <strong>und</strong> Abgabe von Arzneimitteln i. R. der 6. zentrale ITBS-Fortbildung am<br />
19.9.2007 in Verden<br />
Vortrag: Die neue Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung i. R. der Jahrestagung<br />
der pharmazeutischen <strong>und</strong> veterinärmedizinischen Überwachungsbeamten am<br />
11.10.2007 in Ulm<br />
Veröffentlichung: Wurmkur nur vom Tierarzt, Cavallo, Januar 2007<br />
Veröffentlichung: Dokumentationspflicht ist geblieben, Land & Forst; Nr. 33/2007<br />
Kleiminger, E. (Dez. 23) <strong>und</strong> Jäger,<br />
Cornelie (SES Baden-Württemberg)<br />
Kleiminger, E., Lehmann, I., Praß, U.,<br />
Zeit, S., (Dez. 23)<br />
Erfahrungen aus der arzneimittelrechtlichen Kontrollpraxis – Beispiele aus<br />
<strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Baden-Württemberg, R<strong>und</strong>schau für Fleischhygiene <strong>und</strong><br />
Lebensmittelüberwachung, 8/2007<br />
Unangemeldete Hausapothekenkontrolle – Erfahrungen aus der Überwachung,<br />
Mitteilungsblatt des B<strong>und</strong>esverbandes praktizierender Tierärzte/Landesverband<br />
<strong>Niedersachsen</strong>/Bremen e. V. <strong>3.</strong> Quartal 2007.<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32) Vorlesung Aquakultur I: Krankheiten <strong>und</strong> Hygiene in der Fischhaltung, Institut für<br />
Tierzucht <strong>und</strong> Haustiergenetik, Universität Göttingen, 17.-18.01.2007, Göttingen<br />
Vortrag: Erfassung <strong>und</strong> Risikoanalyse von niedersächsischen Aquakulturbetrieben vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> der Fischseuchengesetzgebung; Institutskolloquium des Instituts für<br />
Tierzucht <strong>und</strong> Haustiergenetik der Georg-August-Universität Göttingen, 17.01.2007,<br />
Göttingen<br />
Vortrag: Die wichtigsten Erkrankungen heimischer Fische / Aal-Herpesvirus, eine<br />
Gefahr für Wildaalbestände, Weiterbildungsveranstaltung der BVO-Emden,<br />
27.01.2007, Emden<br />
Vortrag: Aspekte der staatlichen Fischseuchenbekämpfung <strong>und</strong> des Tierschutzes bei<br />
Fischen, Lehrgang „Ordnungsgemäße Fischhaltung“, Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong>, 2<strong>3.</strong>-24.02.2007, Echem<br />
Vortrag: Aktuelles aus der Fischseuchenbekämpfung; Jahresüberblick 2006,<br />
Jahreshauptversammlung des Landesfischereiverbandes <strong>Niedersachsen</strong>, 27.02.2007,<br />
Verden<br />
Vortrag: Tierschutzfachliche Beurteilung der Haltung von Zierfischen in Diskotheken,<br />
17
DVG-Tierschutztagung, 08.0<strong>3.</strong>2007, Nürtingen<br />
Vortrag: Hinweise <strong>und</strong> Empfehlungen zum Betrieb von Angelteichen,<br />
Jahreshauptversammlung der nordrhein-westfälischen Fischzüchter, 18.0<strong>3.</strong>2007,<br />
Waltrop<br />
Vortrag: Fragen des Tierschutzes beim Elektrofischfang, Elektrofischerlehrgang 2007<br />
(IfF Cuxhaven, Abt. Binnenfischerei), 19.04.2007, Echem<br />
Vortrag: Probenahme in Fischhaltungsbetrieben, Workshop „Der Fisch als Patient“,<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 21.04.2007, Hannover<br />
Vortrag: Konditionierung von Fischen, Workshop „Der Fisch als Patient“, Stiftung<br />
Tierärztliche Hochschule Hannover, 22.04.2007, Hannover<br />
Vorlesung: Anforderungen an die Produktion ges<strong>und</strong>er Speisefische, Fachhochschule<br />
Osnabrück, 26.04.2007, Osnabrück<br />
Vortrag: Umsetzung der Aquakulturrichtlinie 206/88/EG in Bezug auf die Koi-<br />
Herpesvirus-Infektion <strong>und</strong> den Zoofachhandel, Treffen der EAFP Arbeitsgruppe<br />
Zierfischkrankheiten, 28.04.2007, Melle<br />
Vortrag: Zur Problematik transgener Zebrabärblinge, Treffen der EAFP Arbeitsgruppe<br />
Zierfischkrankheiten, 28.04.2007, Melle<br />
Vortrag: Umsetzung der Aquakulturrichtlinie 206/88/EG in Bezug auf die Koi-<br />
Herpesvirus-Infektion <strong>und</strong> den Zoofachhandel, Treffen der EAFP Arbeitsgruppe<br />
Zierfischkrankheiten, 28.04.2007, Melle<br />
Vortrag: Die wichtigsten Krankheiten der einheimischen Süßwasserfische,<br />
Fischseuchenbekämpfung aus Sicht der behördlichen Praxis; Gewässerwartelehrgang,<br />
09.05.2007 <strong>und</strong> 06.09.2007, Bad Salzdetfurth<br />
Vorträge: Fischseuchen, rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen, Fischartenk<strong>und</strong>e Gartenteichfische;<br />
Sachk<strong>und</strong>elehrgang Zierfische, 11.-1<strong>3.</strong>05.2007 <strong>und</strong> 02.-04.11.2007, Echem<br />
Vortrag: Zur KHV-Problematik, Treffen der Fischges<strong>und</strong>heitsdienste der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, 16.05.2007, Weiden-Almesbach<br />
Vortrag: Fischseuchenbekämpfung in der behördlichen Praxis, Fachseminar,<br />
05.06.2007, Hannover<br />
Vortrag: Fischseuchenbekämpfung <strong>und</strong> Fischges<strong>und</strong>heitsfürsorge,<br />
Berufsschulunterricht Justus von Liebig-Schule, 08.06.2007, Hannover<br />
Vortrag: Aalerkrankungen, Jahrestagung der ARGE der Fischereigenossenschaften an<br />
der Weser, Achim, 1<strong>3.</strong>06.2007<br />
Vortrag: Fish epizootics control in Lower Saxony, Twinning Project BA 05 IB AG 01,<br />
12.06.2007, Oldenburg<br />
Veröffentlichung: Hinweise <strong>und</strong> Empfehlungen zur Desinfektion in der Fischzucht, Koi<br />
Kurier 52, S. 65-67<br />
Vortrag: Epidemiologie der Fischseuchen, 7. Lehrgang zur Vorbereitung auf die<br />
Anstellungsprüfung für die Laufbahn des höheren Veterinärdienstes, 26.09.2007,<br />
München<br />
Veröffentlichung: Tierschutzfachliche Beurteilung der Haltung von Zierfischen in<br />
Diskotheken (2007), Tagungsband der DVG-Fachgruppe „Tierschutz“, Nürtingen 8. –<br />
9. März 2007, S. 95 – 101<br />
Vortrag: Aquakulturrichtlinie 2006/88/EG – Sachstandsbericht <strong>und</strong> Umsetzung,<br />
01.10.2007, Wietzendorf<br />
Vortrag: Fischkrankheiten <strong>und</strong> Fischseuchen, Fortbildungstagung für Gewässerwarte,<br />
Sportfischerverband im Landesfischereiverband Weser-Ems, 10.11.2007, Bad<br />
Zwischenahn<br />
Vortrag: Tierschutzfachliche Beurteilung der Haltung von Zierfischen in Diskotheken,<br />
EAFP-Arbeitsgruppe Zierfische, 17.11.2007, Starnberg<br />
Vortrag: Über die KHV-Situation in Deutschland - Einführung, 17.11.2007, Starnberg<br />
Vortrag: Krebsseuchenproblematik: Entwicklung, Schutzmaßnahmen <strong>und</strong><br />
Bekämpfung, Lehrgang Flusskrebse, 2<strong>3.</strong>11.2007, Echem<br />
Veröffentlichung: Fischseuchen im b<strong>und</strong>eseinheitlichen Tierseuchenbekämpfungshandbuch<br />
(2007), Tagungsband (CD) der XI. Gemeinschaftstagung der Deutschen,<br />
der Österreichischen <strong>und</strong> der Schweizer Sektion der European Association of Fish<br />
Pathologists (EAFP), 11. – 1<strong>3.</strong> Oktober 2006, Murten Schweiz, S. 38 - 44<br />
Kombal, R. (LI OL) Vortrag: Perfluorierte organische Tenside (PFT) – Methode <strong>und</strong> Ergebnisse,<br />
1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 09.05.07 in Braunschweig<br />
Kruse, R. (IfF CUX) Vorträge: Bestimmung <strong>und</strong> Bewertung organischer Schadstoffe in<br />
Fischereierzeugnissen / Phosphatanwendung bei Fischereierzeugnissen /<br />
Kohlenmonoxidbehandlung von Fischereierzeugnissen, Seminar des<br />
18
Kruse, R.; Grabow, A.; Bartelt, E. (IfF<br />
CUX)<br />
Fischkompetenzzentrums Nord der Länder <strong>Niedersachsen</strong> <strong>und</strong> Bremen<br />
„Risikoorientierte Überwachung von Fischereierzeugnissen“ für Sachverständige der<br />
amtlichen Lebensmittelüberwachung <strong>und</strong> der Grenzkontrollstellen, Cuxhaven,<br />
Bremerhaven, 07.11.-09.11.2007.<br />
Vorträge: Organische Schadstoffe <strong>und</strong> Rückstände / Verbrauchertäuschung durch den<br />
Einsatz von CO <strong>und</strong> Polyphosphat, Seminar des Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven<br />
„Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11.-07.11.2007.<br />
Vortrag: Speziierungsanalytik von Hg in Fischen, LAVES-Jahrestagung Braunschweig,<br />
8.5.-9.5.2007.<br />
Poster: Automated multiple Determination of Hg-Species in Marine Biota by GC-<br />
CVAFS after TMAH Digestion and Solvent Stripping, 11 th Workshop on Progress in<br />
Analytical Methodologies for Trace Metal Speciation, Universität Münster, 04.10.-<br />
07.10.2007.<br />
Vortrag: Determination of Hg-Species in Commercial Fish by GC-CVAFS after TMAH<br />
Digestion and Solvent Stripping, Jahrestagung der WEFTA (West European Fish<br />
Technologists Association), 24.10.-27.10.2007, Lissabon<br />
Kubersky, U.; Boecking O. (IB CE) Veröffentlichung: Viele Bienen, reiche Ernte. Deutsches Bienenjournal 15(9) 2007: 38-<br />
39.<br />
Veröffentlichung: Beigeschmack unerwünscht. Deutsches Bienenjournal 15(7) 2007:<br />
16-17.<br />
Vortrag: Bestäubung von Heidelbeeren; Heidelbeersprechtag 2007 in Schwarmstedt<br />
Vortrag: Untersuchungen zu praktischen Fragen der Bestäubung im Kulturheidelbeer-<br />
<strong>und</strong> Erdbeeranbau; Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung<br />
e.V.; 28.0<strong>3.</strong>07 Veitshöchheim<br />
Lecour, C. (IfF CUX) Vortrag: Aktuelles Anforderungsprofil des neuen Fischpasses Marklendorf,<br />
Fortbildungsveranstaltung des Ingenieurverbandes der Wasser- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung, Schwarmstedt, 24.04.2007.<br />
Lecour, C. (IfF CUX) (Mitautorin) Veröffentlichung : Funktionskontrollen von Fischaufstiegsanlagen – Notwendigkeit <strong>und</strong><br />
Methodik. – Wasser <strong>und</strong> Abfall, 5, 41-45 (2007).<br />
Veröffentlichung: Ermittlung überregionaler Vorranggewässer im Hinblick auf die<br />
Herstellung der Durchgängigkeit für Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäuler im Bereich der FGG Elbe<br />
sowie Erarbeitung einer Entscheidungshilfe für die Priorisierung von Maßnahmen,<br />
Abschlussbericht der ad-hoc-Arbeitsgruppe „Durchgängigkeit/Fische“ der ARGE<br />
Elbe/FGG Elbe, 28.08.2007, 52 pp.<br />
Lehmann, I. (Dez. 23) Vortrag: Kontrolle tierärztlicher Hausapotheken, Veranstaltung der Kreisstelle Stadt<br />
Hannover der Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, 21.11.2007<br />
Mahnken, M. (Dez. 32) Vortrag: Crisis management in disease eradication in Lower Saxony, Twinning Project<br />
BA05 IB AG 01, 31.02.2007, MBZ Barme<br />
Vortrag: KSP-Frühwarnsystem, Monitoring, Untersuchungen nach § 8<br />
Schweinehaltungshygieneverordnung, Fortbildungsveranstaltung<br />
Schweinepestbekämpfung <strong>und</strong> Einsatz von praktizierenden Tierärzten im<br />
Tierseuchenkrisenfall im MBZ, 14.04.2007, MBZ Barme<br />
Vortrag: Planning and implementation of monitoring and surveillance programmes<br />
in Lower Saxony, Twinning Project BA05 IB AG 01, 18.06.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Crisis management in disease eradication in Lower Saxony, Twinning Project<br />
BA05 IB AG 01, 18.06.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Planning and implementation of monitoring and surveillance programmes in<br />
Lower Saxony, Twinning Project BA05 IB AG 01, 24.07.2007, Bosnien<br />
Vortrag: Task-Force Veterinary Affairs, Twinning Project BA05 IB AG 01, 25.07.2007,<br />
Bosnien<br />
Vortrag: Crisis management in disease eradication in Lower Saxony, Twinning Project<br />
BA05 IB AG 01, 26.07.2007, Bosnien<br />
Vortrag: MBZ, MdB Stünker <strong>und</strong> Mitglieder der SPD Dörverden, 20.08.2007, MBZ<br />
Barme<br />
Vortrag: MBZ, Mitglieder der B<strong>und</strong>esanstalt THW Bonn, 18.10.2007, MBZ Barme<br />
Maslo, R. (LI BS) „Vortragsfolge zur Health Claim Verordnung - Nährwertprofile“, Vortrag im Rahmen der<br />
1. Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
19
“Neuartige/ funktionelle Lebensmittel: bestehende Regelungen <strong>und</strong> Vorgehensweisen<br />
bei der Sicherheitsbewertung” Vortrag im Kurs “Lebensmittelsicherheit/<br />
Lebensmitteltoxikologie” im Rahmen der Weiterbildung “Fachtoxikologe/<br />
Fachtoxikologin” DGPT (Deutsche Gesellschaft für Experimentelle <strong>und</strong> Klinische<br />
Pharmakologie <strong>und</strong> Toxikologie), Kaiserslautern, 16.10.2007<br />
Matthes, U. (IfF CUX) Vorträge: Die hydrologische Situation der Oberweser im Jahr 2006 / Ergebnisse der<br />
Elektrobefischungen von Werra <strong>und</strong> Oberweser im Jahr 2006, Gremium zur<br />
Festlegung von Fischbesatzquoten (Entschädigungszahlungen Kernkraftwerke<br />
Grohnde <strong>und</strong> Würgassen), 07.0<strong>3.</strong>2007.<br />
Vortrag: Entwicklung der Fischbestände in Werra <strong>und</strong> Oberweser vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der Belastung mit Kaliendlaugen, Kali <strong>und</strong> Salz (2007).<br />
Mauermann, U. (LI OL) Vortrag: Zoonoseerreger in Lebensmitteln - Vorkommen in 2006 <strong>und</strong> rechtliche<br />
Würdigung der Ergebnisse vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Möglichkeiten von<br />
Basisverordnung <strong>und</strong> Hygienepaket, 1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 09.05.07<br />
in Braunschweig<br />
Meyer, L. (IfF CUX) Vortrag: Fischmonitoring, Wasserverbandstagung e.V., 31.05.2007.<br />
Vortrag: Fischmonitoring, Refernzen <strong>und</strong> Bewertung, 4. Sitzung der erweiterten<br />
WRRL-Fachgruppe Oberflächengewässer beim MU, 16.0<strong>3.</strong>2007<br />
Meyer, L. (IfF CUX) (Mitautor) Veröffentlichung: Gute fachliche Praxis fischereilicher Besatzmaßnahmen. –<br />
Schriftenreihe des Verbandes Deuter Fischereiverwaltungsbeamter <strong>und</strong><br />
Fischereiwissenschaftler e.V., Heft 14, 151 (2007).<br />
Veröffentlichung: Einige Ausführungen zur guten fachlichen Praxis fischereilicher<br />
Besatzmaßnahmen. – Fischer & Teichwirt, 12, 449-451 (2007).<br />
Meylahn, K. (LI OL) Vortrag: Stabilisotopenanalytik in der Lebensmittelkontrolle, Lebensmittelchemisches<br />
Seminar der Universität Dresden<br />
Vortrag: Stabile Isotope in der Lebensmittelkontrolle, 1. Jahrestagung der LAVES-<br />
Institute am 09.05.07 in Braunschweig<br />
Meylahn, K., Wolf, E. (LI OL);<br />
Ohe, W. von der (IB CE)<br />
Vortrag: Herkunftsanalyse mit Hilfe der stabilen Isotope d 2 H <strong>und</strong> d 18 O im Wasser des<br />
Honigs, Arbeitstagung 2007 des Regionalverbands Nord der Lebensmittelchemischen<br />
Gesellschaft, Fachgruppe in der GDCh:<br />
Morales, G. (LI OL) Vortrag: Nährwertbezogene Angaben – Anhang der Verordnung 1924/2006 (Health-<br />
Claims-Verordnung), 1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 9.05.07 in<br />
Braunschweig<br />
Vortrag: „Was ist in unserem Essen drin?“ <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
in <strong>Niedersachsen</strong>; Bürger-Informationsveranstaltung am 16.0<strong>3.</strong>07 in<br />
Ihlowerfehn<br />
Mörler, T. (Dez.43) Vortrag: Vermarktungsnormen für Eier, 05.02.2007, Verband alternativer<br />
Legehennenhalter, Laar<br />
Mosch, E. (IfF CUX) Vortrag: Fischmonitoring, Landessportfischerverband <strong>Niedersachsen</strong>, Tagung der<br />
Fischereivertreter der Gebietskooperationen, Neustadt, 05.05.2007<br />
Moss, A. (VI OL) Vortrag: AVID-Jahrestagung, Kloster Banz, 24. Oktober 2007: Dem Erreger aufs Gen<br />
geschaut – Neue Wege in der bakteriellen Diagnostik!<br />
Vortrag: Better Training for Safer Food, Internationaler AIV-Workshop in Oldenburg,<br />
10., 15. <strong>und</strong> 24 Mai 2007: Molekularbiologische AIV-Diagnostik<br />
Vortrag: Informationsveranstaltung für Amtstierärzte, 26. Juni 2007: Bluetongue<br />
Disease<br />
Vortrag: LAVES-Jahrestagung in Braunschweig, 08. Mai 2007: Dem Erreger aufs Gen<br />
geschaut – Neue Wege in der bakteriellen Diagnostik!<br />
Nagel-Kohl, U.; Probst, D.; Schubach,<br />
K. (VI H)<br />
Poster: Untersuchungen von Blut- <strong>und</strong> Fleischsaftproben auf Antikörper KSPV. 1.<br />
Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Poster: Fleischsaftuntersuchungen zum Vorkommen von Trichinella spiralis beim<br />
Schwarzwild. 1. Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Nutt, S. (LI OL) Vortrag: Krankheitsrisiko - reduzierende Angaben nach Health-Claims-Verordnung; 1.<br />
Jahrestagung der LAVES-Institute am 9.05.07 in Braunschweig<br />
20
Nuyken-Hamelmann, C. (LI OL) Vortrag : Echte Vanille oder Vanillin; 1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 9.05.07<br />
in Braunschweig<br />
Ohe, K. von der (IB CE) Vortrag: Das Pollenspektrum polnischer Honige; 1.Jahrestagung LAVES; 08.05.07<br />
Braunschweig<br />
Ohe, W. von der (IB CE) Veröffentlichung: Verluste: Sind auch unsere Bienen davon gefährdet? Deutsches<br />
Bienen-Journal 05/2007: 221<br />
Veröffentlichung: Honigkristallisation. Letzeburger Bienen-Zeitung 118 06/2007: 146-<br />
147<br />
Veröffentlichung: Invertaseaktivität, ein Qualitätsmerkmal für Honig. Letzeburger<br />
Bienen-Zeitung 118 06/2007: 148-149<br />
Veröffentlichung: Reife, Naturbelassenheit <strong>und</strong> Unverfälschtheit von Honig.<br />
Letzeburger Bienen-Zeitung 118 06/2007: 150-151<br />
Veröffentlichung: Honigfehler – <strong>und</strong> wie sie sich vermeiden lassen. Deutsches Bienen-<br />
Journal 08/2007: 354-355<br />
Veröffentlichung: Auf Varroen <strong>und</strong> Futterversorgung achten! Die neue Bienenzucht<br />
08/2007: 254<br />
Veröffentlichung: Stress factors – interaction of plant protection products and other<br />
factors. 40th Apimondia International Apicultural Congress,Melbourne 09. – 14th<br />
September 2007, Abstracts S. 104<br />
Veröffentlichung: Honey: Authenticity of botanical and geographical origin. 40th<br />
Apimondia International Apicultural Congress,Melbourne 09. – 14th September 2007,<br />
Abstracts S. 86<br />
Veröffentlichung: Farbe des Honigs. Letzeburger Bienen-Zeitung 118 11/2007: 272-<br />
275<br />
Veröffentlichung: Pollen – ein wichtiger Bestandteil der Bienenernährung. Letzeburger<br />
Bienen-Zeitung 118 11/2007: 276-280<br />
Vortrag: Pflanzenschutzmittel <strong>und</strong> Bienenschutz; Jahrestagung des DBIB; 14.01.07<br />
Soltau<br />
Vortrag: Honigqualität – von der Blüte auf den Frühstückstisch; 04.02.2007<br />
Gelnhausen<br />
Vortrag: Pflanzenschutzmittel <strong>und</strong> Bienenschutz; Vortragstagung des Baumschul-<br />
Beratungsringes Weser-Ems; 08.02.07 Bad Zwischenahn<br />
Vortrag: Honig Kristallisation; DLG Fachtagung Honig, 07.0<strong>3.</strong>07 Bremen<br />
Vortrag: Untersuchungen zur Enzymaktivität von Robinienhonigen; Tagung der<br />
Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V.; 28.0<strong>3.</strong>07 Veitshöchheim<br />
Vortrag: Amerikanische Faulbrut – Bekämpfungsstrategie in <strong>Niedersachsen</strong>;<br />
1.Jahrestagung LAVES; 08.05.07 Braunschweig<br />
Vortrag: Stress factors – interactions of plant protection products and other factors;<br />
40th Apimondia Congress; 11.09.07 Melbourne<br />
Vortrag: Honey – Authenticity of botanical and geographical origin; 40th Apimondia<br />
Congress; 11.09.07 Melbourne<br />
Vortrag: Pollenmonitoring mit dem „biologischen Sammler“ Bienenvolk; NABU<br />
Workshop „Bienen <strong>und</strong> GVO“; 30.11.07 Berlin<br />
Ohe, W. von der (IB CE); Pohl, F. Veröffentlichung: Diagnose von Bienenkrankheiten. Deutsches Bienen-Journal<br />
01/2007: 12-14<br />
Veröffentlichung: Durchfall erkennen, heilen <strong>und</strong> verhindern. Deutsches Bienen-<br />
Journal 02/2007: 60-62<br />
Veröffentlichung: Ges<strong>und</strong>heitsgefahren für Bienen im Frühjahr. Deutsches Bienen-<br />
Journal 04/2007: 156-157<br />
Veröffentlichung: Verstopfung – die Maikrankheit. Deutsches Bienen-Journal 05/2007:<br />
210<br />
Veröffentlichung: Kalkbrut: meist harmlos, aber erblich. Deutsches Bienen-Journal<br />
06/2007: 254-255<br />
Veröffentlichung: Varroa – Symptome richtig deuten. Deutsches Bienen-Journal<br />
07/2007: 202-303<br />
Veröffentlichung: Amerikanische Faulbrut – wie gefährlich ist sie? Deutsches Bienen-<br />
Journal 08/2007: 350-351<br />
Veröffentlichung: Amerikanische Faulbrut – rechtzeitig reagieren. Deutsches Bienen-<br />
Journal 09/2007: 398-400<br />
Veröffentlichung: Sackbrut – für starke Völker kein Problem. Deutsches Bienen-Journal<br />
21
Ohe, W. von der; Janke, M.; Ohe, K.<br />
von der (IB CE)<br />
10/2007: 446-447<br />
Veröffentlichung: Wachsmotte – Fre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Feind in einem. Deutsches Bienen-<br />
Journal 11/2007: 500<br />
Veröffentlichung: Milben in den Atemwegen. Deutsches Bienen-Journal 12/2007: 542-<br />
543<br />
Veröffentlichung: Sortendeklaration bei Honig. ADIZ/db/IF 41 04/2007: 25-27<br />
Orellana, A. , Kirchhoff, H. (LI OL) Vortrag: Kenntlichmachung der abweichenden Beschaffenheit von Zutaten auf<br />
Speisekarten, 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11.-1<strong>3.</strong>06.07 in Berlin<br />
Vortrag: Kennzeichnung von ausschließlich oder überwiegend aus Separatorenfleisch<br />
hergestellten Fleischerzeugnissen, 60. Arbeitstagung des ALTS vom 11.-1<strong>3.</strong>06.07 in<br />
Berlin<br />
Pfordt, J. (LI OL) Vortrag: Globale Destillation, 1. Jahrestagung der LAVES-Institute am 09.05.07 in<br />
Braunschweig<br />
Probst, D.; Nagel-Kohl, U.; Moser, P.<br />
(VI H)<br />
Punkert, M. (IfB LG)<br />
Poster: Weltweite Zusammenarbeit bei der Diagnostik der Leptospirose.<br />
1. Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Poster: Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Textilien <strong>und</strong> Leder auf<br />
biozide/antimikrobielle Substanzen, 36. Deutscher Lebensmittelchemikertag Nürnberg<br />
10.-12.9.2007<br />
Poster: Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Textilien <strong>und</strong> Leder auf<br />
biozide/antimikrobielle Substanzen, 1. Jahrestagung der Institute des Nds.<br />
Landesamtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> (LAVES), Braunschweig 8.-9.5. 2007<br />
L. W. Kroh (Hrsg.) Analytik von Bedarfsgegenständen, Kap. 5: Holz <strong>und</strong> Kork für den<br />
Lebensmittelkontakt, Behr´s Verlag Hamburg 2007<br />
L.W. Kroh (Hrsg.) Analytik von Bedarfsgegenständen, Kap. 4: Brauer B., Punkert M. :<br />
Bedarfsgegenstände aus Papier, Karton <strong>und</strong> Pappe, Behr´s Verlag Hamburg 2007<br />
L.W. Kroh (Hrsg.) Analytik von Bedarfsgegenständen, Kap. 3: Haffke, H., Punkert, M. :<br />
Leder <strong>und</strong> Textilien, Behr´s Verlag, Hamburg 2007<br />
Expertengespräch Chrom (VI) in Leder, Prüf <strong>und</strong> Forschungsinstitut Pirmasens 15.Mai<br />
2007: Experten aus Wissenschaft, Behörden, Überwachung, private Prüflaboratorien,<br />
Industrie <strong>und</strong> Handel, Medizin <strong>und</strong> Rechtswesen, Darstellung der Untersuchung <strong>und</strong><br />
Beurteilung von Leder-Bedarfsgegenständen auf Chrom (VI).<br />
Expertengespräch Chrom VI in Leder, Stiftung Warentest 12.10.2007, Vortrag „ Cr(VI)<br />
in Leder- Darstellung der Untersuchungsergebnisse für <strong>Niedersachsen</strong> unter<br />
Einbeziehung der Untersuchungsmethode“<br />
Ramdohr, S. (IfF CUX) (Mitautor) Vortrag: Under-yearling and yearling southern elephant seal (Mirounga leonina)<br />
movements at Marion Island: bathymetric relationships. 17 th Biennal Conference on the<br />
Biology of Marine mammals, 29.11-<strong>3.</strong>12.2007 Kapstadt, Südafrika<br />
Ramdohr, S.; Stede, M.; Effkemann,<br />
S.; Bartelt, E.; Etzel, V. (IfF CUX)<br />
(Mitautoren)<br />
Vortrag: Projekt MYTIFIT - Untersuchungen zur Zucht- <strong>und</strong> Verzehrfähigkeit von<br />
Miesmuscheln (Mytilus edulis) aus Offshore WindParks. 48. DVG Arbeitstagung des<br />
Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene, Garmisch-Partenkirchen, 25.09.-28.09.2007<br />
Reinhold, L.: Bartels, I. (LI BS) „Bestimmung von Alternaria-Toxinen in Lebensmitteln“, LaborPraxis, 10/2007, 62-64<br />
Rohrdanz, A (IfB LG) Vortrag: Neue rechtliche Regelungen für Wasch- <strong>und</strong> Reinigungsmittel,<br />
mehr Schutz für den Verbraucher ?<br />
Tagung des Regionalverbandes der GDCh Nord, 22.<strong>3.</strong>2007 Hannover<br />
Vortrag: Global Harmonisiertes System (GHS) zur Einstufung <strong>und</strong> Kennzeichnung von<br />
Stoffen <strong>und</strong> Gemischen<br />
Workshop „Forum Waschen“ 26./27. 9.2007<br />
Runge, M. (VI H) Vortrag: Q-Fieber: Renaissance einer Zoonose? 1. Jahrestagung der Institute des<br />
LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Vortrag: Q fever outbreak within the district of Holzminden – risk assessment and<br />
control measures. Vortrag im Rahmen eines Twinning-Programms mit Bosnien,<br />
Hannover, 29.06.2007.<br />
Vortrag: Zecken – Biologie, Verbreitung <strong>und</strong> ihre Rolle als Überträger von Krankheiten.<br />
Fachtagung „Borreliose <strong>und</strong> FSME – eine Herausforderung für den Arbeits- <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitsschutz“, Hannover, 5.09.2007.<br />
Vortrag: Detection of thermophilic Campylobacter spp. in broilers – comparison of<br />
22
Ruoff, K.; Ohe, K. von der; Ohe, W.<br />
von der (IB CE) u.a.<br />
culture techniques and PCR. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de<br />
Cienzias Biológicas y Agropecuarias. 18.09.2007.<br />
Vortrag: Lungenseuche. Im Rahmen des Kurses „Tropenveterinärmedizin II“. Institut<br />
für Parasitologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche Hochschule<br />
Hannover, Sommerstudienhalbjahr 2007.<br />
Vorlesung: Brucellen, Chlamydien, Mykoplasmen. Im Rahmen der Wahlpflicht-<br />
Vorlesung „Spezielle Bakteriologie“. Institut für Mikrobiologie, Zentrum für<br />
Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Winterstudienhalbjahr<br />
2007/08.<br />
Vorlesung: Methoden der molekularen Infektionsbiologie. Im Rahmen der<br />
Ringvorlesung „Allgemeine Medizinische Mikrobiologie“. Institut für Mikrobiologie,<br />
Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Winterstudienhalbjahr 2006/07.<br />
Vorlesung: Molekularbiologie für VMTA-SchülerInnen. VMTA-Schule, Stiftung<br />
Tierärztliche Hochschule Hannover, Winterstudienhalbjahr 2007/08<br />
Veröffentlichung: Authentication of the botanical origin of honey using profiles of<br />
classical measurands and discriminant analysis.Apidologie, 38 2007, 411-504<br />
Schlägel, E. (FI STD) Vortrag auf der 1. Jahrestagung der LAVES-Institute: Hygienische Beschaffentheit von<br />
Kauspielzeug<br />
Schleuter, G.(VI OL) Vortrag: Control of cleaning and disinfection – Sampling methodology to be applied to<br />
evaluate quality of surface cleaning, Riga, Februar 2007, Schulung der Inspektoren der<br />
Überwachungsbehörden<br />
Vortrag: Equipment for Sampling carcasses, minced meat, MSM, meat preparations,<br />
Riga, Februar 2007, Schulung der Inspektoren der Überwachungsbehörden<br />
Vortrag: Microbiological Conditions in Food of Meat Origin, Riga, Februar 2007,<br />
Schulung der Inspektoren der Überwachungsbehörden<br />
Schmedt auf der Günne, H. (Dez. 32) Vortrag: Möglichkeiten eines Mobilen Bekämpfungszentrums, AKNZ-Seminar<br />
„Fallstudie Tierseuchen – Aviäre Influenza“, 15.02.2007, Ahrweiler<br />
Vortrag: Aufbau, Ausstattung <strong>und</strong> Einsatz eines Mobilen Bekämpfungszentrums,<br />
Fortbildungsveranstaltung Schweinepestbekämpfung <strong>und</strong> Einsatz von praktizierenden<br />
Tierärzten im Tierseuchenkrisenfall, 14.04.2007, Barme<br />
Vortrag: Blauzungenkrankheit in <strong>Niedersachsen</strong>, Treffen der Vertreter der<br />
Veterinärbehörden aus den Niederlanden <strong>und</strong> Deutschland, 10.05.2007, Barme<br />
Vortrag: Methods for the culling of poultry, EU workshop zur Aviären Influenza,<br />
25.05.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Aufbau, Ausstattung <strong>und</strong> Einsatz eines Mobilen Bekämpfungszentrums,<br />
Fortbildungsveranstaltung der Landestierärztekammer Sachsen, 18.06.2007, Barme<br />
Vortrag: Möglichkeiten eines Mobilen Bekämpfungszentrums, AKNZ-Seminar<br />
„Fallstudie Tierseuchen – Expertenschulung“, 18.10.2007, Ahrweiler<br />
Vortrag: Das deutsche mobile Seuchenbekämpfungszentrum, Public Health Pool,<br />
08.11.2007, Wien<br />
Vortrag: Blauzungenkrankheit in <strong>Niedersachsen</strong>, Arbeitskreis Wirbeltiere der<br />
Deutschen Gesellschaft für Phytomedizin, 21.11.2007, Oldenburg<br />
Vortrag: Aktuelles Blauzungengeschehen 2007, Veterinärtagung der Masterrind<br />
GmbH, 06.12.2007, Verden<br />
Veröffentlichung: Tierseuchenrechtliche Aspekte der Bekämpfung der durch<br />
Certatopogonidae übertragenen Blauzungenkrankheit, einer anzeigepflichtigen<br />
Tierseuche. Tagungsband des Treffens des AK der Deutschen Gesellschaft für<br />
medizinische Entomologie <strong>und</strong> Acariologie, Bochum, 12.10.2007.<br />
Schnarr, K.; Schwarze, D. (VI H) Vortrag: Anforderung an die Probeneinsendung aus Sicht der Veterinärinstitute.<br />
Gemeinsame Dienstbesprechung des ML <strong>und</strong> des LAVES mit den kommunalen<br />
Veterinär- <strong>und</strong> Lebensmittelüberwachungsbehörden zum Thema „Tierarzneimittel- <strong>und</strong><br />
Rückstandsüberwachung, Oldenburg, 15.02.2007<br />
Schöttker-Wegner, H.-H.; Bötcher, L.;<br />
Moss, A. (VI OL)<br />
Anmerkungen zur BVD-Diagnostik. Vortrag 6. Stendaler Symposium zur BHV1-, BVD-<br />
<strong>und</strong> Paratuberkulose-Bekämpfung, Stendal 7.–9.<strong>3.</strong>2007<br />
Schulze, M. (LI BS/VI H) “Genetically modified organisms and their products – Examole:Official surveillance in<br />
the Federal State Lower Saxony”, Tallinn, 10.01.2007<br />
“Genetically modified organisms – European legislation and surveillance”, Tekirdag,<br />
17.04.2007<br />
23
“Genetically modified organisms – European legislation and surveillance”, Anakra,<br />
20.04.2007<br />
Legal framework for food and feed surveillance for GMO in the European Union,<br />
Sampling procedures – GMO in / as food Amtliche Lebensmittelüberwachung:<br />
Interpretation and Konsequenzen von GM positiven Ergebnissen<br />
Genetically modified organisms – European legislation and surveillance, Tallinn,<br />
17.5.2007<br />
“Overview results Twininng project component 5 Surveillance of GMO and their<br />
products in food, feed and seed, part 1, Final meeting Tallinn 27.6.2007<br />
Schulze, M. (VI OL) Vortrag: „Möglichkeiten zur Typisierung von Mycobacterium avium subsp.<br />
paratuberculosis.“, LAVES-Jahrestagung in Braunschweig, 08. Mai 2007<br />
Schulze, M.; Moss, A.; Klarmann, D.<br />
(VI OL)<br />
Poster: „Möglichkeiten der Stammdifferenzierung von Mycobacterium avium subsp.<br />
paratuberculosis (Map).“ AVID-Jahrestagung, Kloster Banz, 24.–26. Oktober 2007<br />
Vortrag: „Untersuchungen zur Stammdifferenzierung von Myobacterium avium subsp.<br />
paratuberculosis (Map).“ 6. Stendaler Symposium zur BHV1-, BVD- <strong>und</strong><br />
Paratuberkulose-Bekämpfung, Stendal 07.–09. März 2007<br />
Schütte, Dr., R. (Dez. 41) Vortrag: Amtliche Futtermittelüberwachung in <strong>Niedersachsen</strong>/Bremen 2007,<br />
20.0<strong>3.</strong>2007, DVT Regionalgruppe Nord e.V., Großenkneten<br />
Vortrag: Das Futtermittelrecht, 2<strong>3.</strong>0<strong>3.</strong>2007, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik,<br />
Quakenbrück<br />
Vortrag: Futtermittelsicherheit in <strong>Niedersachsen</strong>/Bremen, 19.04.2007 vor<br />
Agrardiplomaten, LAVES-Zentrale Oldenburg<br />
Vortrag: State of Lower Saxony, State Inspection – Feed, Fruits and Vegetables ,<br />
08.05.07 für Besucher aus Thailand, LAVES-Zentrale Oldenburg<br />
Veröffentlichung: Futtermittelkontrolle in der Praxis, Feed Magazine / Kraftfutter 7-8/07,<br />
Hrsg.: Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt/M.<br />
Schwarze, D.; Schnarr, K.; Johannes,<br />
B. (VI H)<br />
Schwarzlose, I.; Jeske, C.; Gerdes, U.<br />
(TF); Behr, K.-P.; Gerlach, G.-F.;<br />
Runge, M. (VI H); Thalmann, G.;<br />
Nöckler, A.; Klarmann, D. (VI OL);<br />
Neumann, U.; Hartung, J.; Seedorf, J.<br />
Vortrag: Rückstände antimikrobiell wirksamer Stoffe in Fleisch – Screening <strong>und</strong><br />
Bestätigung. 1. Jahrestagung der Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007<br />
Vortrag: Darstellung der Kompostierung von Geflügeltierkörpern als alternative<br />
Beseitigungsmöglichkeit im Tierseuchenkrisenfall. 1. Jahrestagung der Institute des<br />
LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Vortrag: Kompostierung von Geflügeltierkörpern als alternative<br />
Beseitigungsmöglichkeit vor Ort im Tierseuchenkrisenfall. Fortbildungsveranstaltung<br />
„Aktuelle Probleme des Tierschutzes", Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
14.09.2007.<br />
Seide, K. (LI BS) Poster: „Mikrobiologischer Status von Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung“,<br />
Jahrestagung des Niedersächsischen Landesamtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Lebensmittelsicherheit, Braunschweig 09.05.2007<br />
Skerbs, C. (LI BS) Käseimitate – nicht zugelassene Pflanzenfette in Käse – Poster Präsentation auf der<br />
1. Jahrestagung des LAVES am 08.05.2007 in Braunschweig<br />
Stede, M. (IfF CUX) Vorträge: Ichthyology and veterinary quality assessment / GHP and HACCP regarding<br />
fishery products. Danzig, Twinning-Projekt PL 2007, 05.-07.0<strong>3.</strong>2007.<br />
Vorträge: Hygiene requirements of fisheries unloading places / Quality assessment of<br />
fishery products according to Regulation 2406/96. Twinning-Projekt LV Liepaja <strong>und</strong><br />
Riga (Feb. 2007).<br />
Vorträge: Anwendbarkeit des Art. 8 der VO 178/2002 / Sichtbare Hinweise auf den<br />
Verderb von Fischereierzeugnissen, Seminar des Instituts für Fischk<strong>und</strong>e Cuxhaven<br />
„Fische <strong>und</strong> Fischwaren“ für Lebensmittelkontrolleure, Cuxhaven, 05.11.-07.11.2007.<br />
Vortrag: EU-Programm: Better Training for safer Food: Airport Border Inspection Posts<br />
(Wien, 18.-21-09. 2007): Ichthyology.<br />
Stede, M. (IfF CUX) (Mitautor) Veröffentlichung: Aerial Surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2007:<br />
Population age-composition returning to a stable age-structure?, Wadden Sea<br />
Newsletters, Heft 1 (2007) S. 26-27.<br />
Veröffentlichung: An effective survey design for harbour seals in the Wadden Sea:<br />
tuning Trilateral Seal Agreement and EU-Habitat Directive requirements. Report to the<br />
TWG, Meeting April 2007, Delfzijl, The Netherlands.<br />
Suckrau, I. (LI OL) Vorträge: Pestizide: Vorkommen, rechtliche Regelungen, Probenahme;<br />
TA-Projekt mit Polen in Warschau;<br />
Kurzzeitexpertin zur Schulung der polnischen Lebensmittelkontrolleure am<br />
24
28.02/1.0<strong>3.</strong>/21.0<strong>3.</strong>/22.0<strong>3.</strong>/28.06.07<br />
Vortrag : GC-ToF-MS : Anwendung in der Pestizidanalytik; 1. Jahrestagung der<br />
LAVES-Institute am 9.05.07 in Braunschweig<br />
Vortrag: Automatisierung in der Pestizidanalytik;<br />
Gerstel K<strong>und</strong>enseminar zum 40 jährigen Firmenjubiläum am 10.10.07 in Mülheim<br />
(Ruhr)<br />
Täubert, Th (LI BS) „Vortragsfolge zur Health Claim Verordnung - Übergangsfristen“, Vortrag im Rahmen<br />
der 1. Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
Thalmann, G. (VI OL) Vortrag: „Einsatz von Impfstoffen bei der Bekämpfung der Salmonellosen in Hühner-<br />
<strong>und</strong> Schweinebeständen“ – Vortragsveranstaltung der EFG 16 „Tierimpfstoffe“ im BfR<br />
Berlin, 20.06.2007<br />
Vortrag: „Highly Pathogenic Avian Influenza-Situation and Diagnostic Procedure“, EU-<br />
Workshops „Better Training for Safer Food“, Mai 2007<br />
Thielke, S. (LI BS) Poster: “Mikrobiologischer Status von vorgekochtem Reis <strong>und</strong> Nudeln”, Jahrestagung<br />
der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für <strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong><br />
Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
Thiem, I. (LI BS) „Einsatz biologischer Testsysteme in der Lebensmittelanalytik“, Vortrag im Rahmen<br />
der 1. Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
Poster: G. Böhmler <strong>und</strong> I. Thiem: „Effect-directed analysis in food control – First Step:<br />
Establishment of appropriate biological test systems“, SETAC Europe 17 th Annual<br />
Meeting, 20.-24.05.2007, Porto, Portugal<br />
„Vor-Ringversuch: Mikro-EROD-Assay zum Nachweis von Dioxinen <strong>und</strong><br />
dioxinähnlichen Substanzen“, Vortrag im Rahmen der <strong>3.</strong> Sitzung der § 64-LFGB-AG<br />
„Wirkungsbezogene Analytik, Berlin, 11.12.2007<br />
Thoms, B. (V IH) Vortrag: Der Weg zur Akkreditierung von Laboratorien nach ISO/IEC 17025. Im<br />
Rahmen eines Twinning-Programms mit Bosnien, Hannover, 24.02.2007<br />
Vortrag: Das Tätigkeitsfeld von Chemielaboranten in einem Lebensmittelinstitut.<br />
Vortrag für Schüler der Justus-von-Liebig Schule, Braunschweig, 15.5.2007<br />
Vortrag: Consumer Protection in Lower Saxony. Vorträge im Rahmen des Besuchs<br />
von Delegationen aus Schwellenländern, Kooperation mit der PTB Braunschweig,<br />
2<strong>3.</strong><strong>3.</strong>2007, 1<strong>3.</strong>5.2007, 15.10.2007.<br />
Vortrag: Einbindung der Veterinärinstitute im Krisenfall. Im Rahmen eines Twinning-<br />
Programms mit Bosnien, Hannover , 29.06.2007.<br />
Vortrag: Evaluation of laboratory infrastructure and accreditation possibilities. Im<br />
Rahmen eines Twininning-Projekts 11.-14.11.2007, Bosnien.<br />
von Keyserlingk, M. (VI H) Veröffentlichungen: Diverse zu Wildkrankheiten in jagdlichen Fachzeitschriften<br />
Vortrag: Das Fuchsbandwurmmonitoring in <strong>Niedersachsen</strong>. 1. Jahrestagung der<br />
Institute des LAVES, Braunschweig, 8.-9.05.2007.<br />
Wald, B. (LI BS) „Cumarin in Zimt <strong>und</strong> Zimthaltigen Lebensmitteln“ ,Vortrag im Rahmen der 1.<br />
Jahrestagung der Institute des Niedersächsischen Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 09.05.2007<br />
„Lebensmittelkennzeichnung bei Backwaren“ Vortrag bei der Bäko Mitte eG Göttingen-<br />
Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, 12.06.2007<br />
Wedekind, M.; von Keyserlingk, M.<br />
(VI H); Grauer, A.; Voigt, U.; Melzer,<br />
F.; Pohlmeyer, K.; Runge, M. (VI H)<br />
Poster: Untersuchungen zur Verbreitung von Francisella tularensis <strong>und</strong> Brucellen in<br />
niedersächsischen Hasen- <strong>und</strong> Kaninchenpopulationen – erste Ergebnisse, Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Fortbildungstagung des Arbeitskreises für veterinärmedizinische<br />
Infektionsdiagnostik (AVID) der DVG, Kloster Banz, 24.-26.10.2007.<br />
Weiß, H.; Hausch, M. (LI BS) „Gewürze, ausgewählte Untersuchungsergebnisse der Jahre 2003 bis 2006“<br />
Posterpräsentation im Rahmen der 1. Jahrestagung des LAVES, 08./09.05.2007 in<br />
Braunschweig<br />
Weßels, B. (IfB LG) Vortrag: Allergene Duftstoffe in kosmetischen Mitteln sowie Wasch- <strong>und</strong><br />
Reinigungsmitteln, 1. Jahrestagung der Institute des Nds. Landesamtes für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong> <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES), Braunschweig 8.-9.5. 2007<br />
Wiecking, H.; Leymers, H.;<br />
Hahnkemeyer, E.; Schammler, H.<br />
Schulung (u. Erfahrungstausch) der LMK der Kommunen „Handelsklassenkontrolle im<br />
LEH für frisches Obst <strong>und</strong> Gemüse“, 17.04.2007 (OL), 19.04.2007 (H), Fortbildung<br />
25
(Dez. 43) LMK der Kommunen / operative Beratung, LAVES-Zentrale, Behördenhaus Hannover<br />
Zeit, S. (Dez. 23) Vortrag: Tierärztliche Hausapothekenverordnung <strong>und</strong> Tierimpfstoffverordnung (aktuelle<br />
Änderungen der rechtlichen Vorgaben) Veranstaltung der Kreisstelle Stade der<br />
Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Düdenbüttel, 09.05.2007.<br />
Vortrag: Apothekenkontrollen im Rückblick, Veranstaltung der Kreisstelle Lüneburg der<br />
Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Brietlingen, 07.11.2007<br />
Vortrag: Apothekenkontrollen im Rückblick, Veranstaltung der Kreisstelle Uelzen der<br />
Tierärztekammer <strong>Niedersachsen</strong>, Uelzen, 05.12.2007<br />
Zierenberg, B. (FI STD) Vortrag auf der 1. Jahrestagung der LAVES-Institute: Rückstandsanalytik von<br />
pharmakologisch wirksamen Substanzen (PWS) am Futtermittelinstitut Stade<br />
7. 3 Verzeichnis der Ringversuche <strong>und</strong> Laborvergleichsuntersuchungen<br />
Im Verzeichnis der Ringversuche ist der Veranstalter im Feld (Ver.) wie folgt gekennzeichnet:<br />
Nr. im Feld<br />
(Ver.)<br />
Veranstalter<br />
1 AG nach § 35 LMBG „Fleisch“<br />
2 Bayerisches Landesamt für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
3 B<strong>und</strong>esinstitut für Risikobewertung<br />
4 B<strong>und</strong>esamt für Strahlenschutz<br />
5 B<strong>und</strong>esanstalt für Milchforschung<br />
6 B<strong>und</strong>esforschungsanstalt für Ernährung <strong>und</strong> Lebensmittel<br />
7 BVL<br />
8 BVL § 35 AG „Lebensmittelallergene“<br />
9 BVL Analysenausschuss<br />
10 CVUA Münster<br />
11 Friedrich-Löffler-Institut, B<strong>und</strong>esforschungsinstitut für Tierges<strong>und</strong>heit (FLI), Nationales<br />
Referenzlabor für KSP<br />
12 Friedrich-Löffler-Institut, B<strong>und</strong>esforschungsinstitut für Tierges<strong>und</strong>heit (FLI), Institut für neue <strong>und</strong><br />
neuartige Tierseuchenerreger, Institut f. Biotechn. Diagnostik der GBD Berlin; Charité-<br />
Universitätamedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Institut f. Infektionsmedizin der FU Berlin<br />
13 DACH<br />
14 Deutsche Gesellschaft für Fettforschung (DGF)<br />
15 DIN<br />
16 DIN/VdC<br />
17 Europäische Kommission/University of Almeria<br />
18 FAPAS<br />
19 FEPAS<br />
20 Food and Consumer Product Safety Authority (voedsel en waren, Niederlande)<br />
21 GDCh Arbeitsgruppe „Pestizide“<br />
22 Health Protection Agency<br />
23 Hüfner<br />
24 IB Celle (für Honiganalytik-Workshop)<br />
25 IB Celle (für Pollen-Workshop)<br />
26 Institut für Laborkontrolle (Lab-control)<br />
27 Institut für Veterinär-Anatomie, - Histologie <strong>und</strong> Embryologie, Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
28 Institute for Interlaboratory Studies, 3301 CE Dordrecht, Netherlands (iis)<br />
29 International Atomic Energy Agency (IAEA)<br />
30 International Leptospiroris MAT Proficiency Tesing Schme, Dr. Chappel<br />
31 Keuringsdienst van Waren, CHEK proficiency study<br />
32 Leitstelle Trinkwasserringversuch NRW (Lögd)<br />
33 NLGA-Außenstelle Aurich<br />
34 LVU Lippold<br />
35 Milchwirtschaftliche Untersuchungs- <strong>und</strong> Versuchsanstalt Kempten (MUVA)<br />
36 Oxoid, QM: Quality in microbiology scheme<br />
26
37 Pflanzendirektorat des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong> Fischerei, Dänemark<br />
38 Q-Bioanalytik GmbH<br />
39 SUERC (Scottish Universities Environmental Research Centre)<br />
40 USDA GIPSA Proficiency Program<br />
41 Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs– <strong>und</strong> Forschungsanstalten (VDLUFA)<br />
42 Veterinary Laboratory Quality Assessment / United Kingdom<br />
43 VI Oldenburg<br />
44 RIKILT Wageningen (NL)<br />
45 CVUA Ostwestfalen-Lippe<br />
46 CEN (Comité Européen de Normalisation)<br />
47 Defence Science and Technology Laboratory; UK<br />
48 Europäisches Referenzlabor (CRL): Universitiy of Almeria/Spanien<br />
49 Europäisches Referenzlabor (CRL): CVUA Stuttgart<br />
50 B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e<br />
51 SUERC<br />
52 Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet)<br />
53 INSTAND e.V., Institut für Standardisierung <strong>und</strong> Dokumentation im medizinischen Laboratorium<br />
54 BVL, Berlin, DVG-Arbeitsgruppe Resistenzen<br />
55 BfR, Berlin, NRL Salmonellen<br />
56 Friedrich-Löffler-Institut, B<strong>und</strong>esforschungsinstitut für Tierges<strong>und</strong>heit (FLI), Nationales<br />
Referenzlabor Paratuberkulose<br />
57 Institut für Parasitologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
(Laborvergleichsuntersuchung)<br />
58 Fachgruppe Pathologie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG)<br />
59 FLI Wusterhausen<br />
60 FLI Insel Riems<br />
61 BVL § 64 LFGB, AG Kosmetische Mittel<br />
62 GDCh AG Kosmetische Mittel<br />
63 National Serology Reference Laboratory Australia, Dr. R. Chappel<br />
64 Deutsches Referenzbüro für Lebensmittelringversuche <strong>und</strong> Referenzmaterialien (DRRR)<br />
65 DLA<br />
66 Kanton Aargau Amt für <strong>Verbraucherschutz</strong>, Schweiz<br />
67 FAPAS-GeMMA<br />
68 International Seed Testing Association (ISTA)<br />
69 CRL for Cereals & Feeding Stuff, National Food Institute/Denmark<br />
70 CRL for Food of Animal Origin and Commodities with High Fat Content, CVUA Freiburg<br />
71 Dienstleistung Lebensmittel-Analytik GbR (DLA<br />
72 QMS Microbiology Profiency Testing Scheme<br />
LGC; QM and Aquacheck<br />
73 BVL / PTB<br />
(Pilot Study CAP P90)<br />
74 NRL (BVL) für Tierarzneimittelrückstände<br />
75 RIKILT (NL) Institute of Food Safety<br />
76 Fachgruppe „Pathologie“ der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG)<br />
77 NRL (BVL) für Lebensmittel-Monitoring<br />
78 Friedrich-Loefffler-Institut (FLI), Nationale Referenzlabore für IHN, VHS, ISA <strong>und</strong> KHV-Infektion<br />
79 FLI Jena<br />
80 FLI Riems, Referenzlabor für MKS<br />
81 Hüfner<br />
82 BfR, Berlin, NRL Resistenzen<br />
83 Uni-Leipzig<br />
84 EFMO (European Feed Microbiology Organisation)<br />
85 Agroscope Liebefeld-Posieux Researchstation (CH)<br />
86 CVUA Freiburg<br />
87 CVUA Stuttgart<br />
88 Allgemeine Gold- <strong>und</strong> Silberscheideanstalt AG<br />
89 LVU Münster<br />
90 LVU Herbolzheim<br />
27
7.<strong>3.</strong>1 LAVES - LI Braunschweig<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Apfelsaft 18 Patulin LC-MS/MS<br />
Aprikosenpulpe 20 Schwefeldioxid Titrimetrie nach Reith-Willems<br />
Babynahrung 18 Aflatoxine HPLC<br />
Backware 15 Trockenmasse, Asche, Ballaststoffe, Stärke, Anteil<br />
Vollkornmehl<br />
Gravimetrie, Polarimetrie, Berechnung<br />
Backware 34 Wasser, Asche, Rohprotein, Fett, Butterfett, Stärke, Gravimetrie, Kjeldahl, Weibull-Stoldt,<br />
Cholesterin, Fructose<br />
Tiritmetrie, GC, Polarimetrie, Enzymatik<br />
Bier Pils 34 Alkohol, wirklicher Extrakt, rel. Dichte, Stammwürze,<br />
scheinbarer Extrakt, pH-Wert, Gesamtsäure pH 8,1,<br />
Gesamtsäure pH 7,0<br />
Bier 36 Keimzahl, Hefen, Schimmelpilze, Milchsäurebakterien,<br />
E. coli<br />
pyknometrisch, Destillation, ,<br />
Biegeschwinger, Titrimetrie<br />
Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Bier 7 Ochratoxin A, Deoxynivalenol HPLC-FLD, LC-MS/MS<br />
Blumenkohl 9 As, Pb, Cd, Cu, Se, Th, Zn ICP-MS Hydrid-AAS<br />
Blumenkohl 9 Nitrat, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Selen, Thallium Photometrie / ICP-MS<br />
Brühwurst 9 Casein als Fremdeiweiß ELISA<br />
Brühwurst 34 Tierartbestimmung, Bestimmung von Fremdeiweiß Serologische, nicht-serologische <strong>und</strong><br />
mikrobiologische Analytik<br />
Brühwurst 34 ZNS-Material/Separatorenfleisch Serologische Analytik, Western Blot<br />
Brühwurst 34 Blei, Cadmium, Quecksilber ICP-MS, Kaltdampf-AAS<br />
Butter 35 Wasser, pH-Wert, fettfreie Trockenmasse Gravimetrie, Potentiometrie<br />
Chilli-Pulver 65 Ochratoxin A HPLC<br />
Chilli-Pulver 18 Nicht zugelassene Farbstoffe HPLC-DAD<br />
Chinesisches<br />
Essen (Reis)<br />
49 Glutaminsäure Enzymatik<br />
Diätetisches<br />
Lebensmittel<br />
33 Saccharin, Cyclamat, Benzoesäure, Sorbinsäure HPLC-DAD<br />
DNA 9 Bestimmung gentechnisch veränderten Materials Qualitative/quantitative<br />
molekularbiologische Analytik<br />
Dry cake mix 18 Erdnussprotein DGD, ELISA<br />
Ei 7 organische Kontaminanten GC-MSD<br />
Energy Drink 34 pH-Wert, Taurin, Coffein, Inosit, Glucuronolacton, Potentiometrie, Aminosäureanalysator,<br />
Saccharose, Glucose<br />
HPLC- DAD, HPLC- RI<br />
Feinkostsalat 18, 31 Benzoesäure, Sorbinsäure Photometrie, HPLC<br />
Feta-Käse 7 Aflatoxin M1 HPLC<br />
Fischöl- 14 Buttersäure, FSV, Stigmastadien, Polymere<br />
GC-FID, Säulenchromatografie, HPLCmischung<br />
Triglyceride<br />
DAD, HPLC-RI<br />
Fleisch- 66 Tierartbestimmung in Wurstwaren quantitative molekularbiologische<br />
erzeugnis<br />
Analytik<br />
Fleisch-<br />
9 Allergennachweis in Wurstwaren qualtitative molekularbiologische<br />
erzeugnis<br />
Analytik<br />
Frittierfett 14 Polare Anteile, Säurezahl, Polymere Triglyceride Säulenchromatographie, Gravimetrie,<br />
HPLC-RI<br />
Frühstücks- 18 Vitamin B2, Folsäure HPLC-FD, mikrobiologisches<br />
cerealien<br />
Prüfsystem<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Deoxynivalenol LC-MS/MS<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Acrylamid GC-MSD<br />
Fruchtsaft 18 Vitamin C HPLC-FD bzw. HPLC-DAD<br />
Futtermittel 67 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Gewürz<br />
(Paprikapulver)<br />
65 Sudanfarbstoffe HPLC-DAD<br />
Hafer 18 T-2-Toxin, HT-2-Toxin LC-MS/MS<br />
Hafermehl 36 Cl. perfringens, Clostridium spp. Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
28
Hafermehl 36 Aerobe mesophile Keime, E. coli, Coliforme Keime,<br />
Enterobacteriaceae<br />
Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Haselnuss 18 Haselnussprotein in Schokolade ELISA<br />
Honig 34 Glucose, Fructose, freie Säuren, HMF, Leitfähigkeit, HPLC, Titration, Konduktometrie,<br />
pH-Wert, Wasser, Prolin, Diastase<br />
Refraktometrie, Photometrie<br />
Honig 18 Chloramphenicol LC-MS/MS<br />
Honig 18 Nitrofuranmetaboliten: AOZ, AMOZ, SEM, AHD LC-MS/MS<br />
Kakaoerzeugnis 34 Fett, Butterfett, Theobromin/Coffein, Wasser Weibull-Stoldt, GC, HPLC, Gravimetrie<br />
Keksmix 18 Ei-Eiweiß ELISA<br />
Kindermilchbrei 34 Vitamine B1, B2, C, A, E HPLC-FD, HPLC-FD, HPLC-FD, HPLC-<br />
DAD, HPLC-DAD<br />
Kindernahrung 34 Na, Mg, Fe, K, Ca Flammen–AAS<br />
Knäckebrot 18 Acrylamid GC-MSD<br />
Kokosnussölmischung<br />
14 Säurezahl, Buttersäure, FSV Titrimetrie, GC-FID<br />
Kurkuma 18 Nicht zugelassene Farbstoffe HPLC-DAD<br />
Lachssalat 31 Acesulfam-K, Saccharin, Aspartam, Benzoesäure,<br />
Sorbinsäure<br />
HPLC<br />
Limonade 34 pH-Wert, Aspartam, künstliche Farbstoffe, Cyclamat, Potentiometrie, HPLC-DAD, PC<br />
kalorien-<br />
Saccharin, Acesulfam-K, Diketopiperazin,<br />
reduziert<br />
Aspartylphenylalanin, Gesamtsäure pH 8,1<br />
Limonade 20 Fruktose, Glukose, Saccharose, Lactose Enzymatik<br />
Magermilch- 36 Genus Listeria, L. monocytogenes Quantitative <strong>und</strong> qualitative<br />
pulver<br />
mikrobiologische Methoden<br />
Magermilchpulver<br />
36 Campylobacter Qualitative mikrobiologische Methode<br />
Magermilchpulver<br />
36 Milchsäurebakterien Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Maismehle 40 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Mandeln 18 Aflatoxine HPLC<br />
Mayonnaise 34 Wasser, Fett, Benzoesäure, Sorbinsäure, Saccharin,<br />
Eigelbgehalt, Cholesterin<br />
Gravimetrie, HPLC, GC<br />
Mehl 34 Asche, Wasser, Stärke, Rohprotein, Type Veraschung, Gravimetrie, Polarimetrie,<br />
Kjeldahl, Berechnet<br />
Mehl verbacken 67 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Milch 35 Fett, Trockenmasse, Gefrierpunkt, Laktose, Protein, Röse-Gottlieb, Gravimetrie, Kryoskopie,<br />
Calcium<br />
Enzymatik, Kjehldahl, AAS<br />
Milch 35 E. coli Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Milch 23 Gesamtkeimzahl Quantitative mikrobiologische Methode<br />
Milch 64 E. coli, Gesamtkeimzahl Quantitative mikrobiologische Methode<br />
Milchbrot 31 Milchfett, Chlorid GC-FID, potentiometrische Titration<br />
Milchpulver 3 Listerien (qual. <strong>und</strong> quant.), Salmonellen Quantitative <strong>und</strong> qualitative<br />
mikrobiologische Methoden<br />
Nahrungsergänzungsmittel,<br />
flüssig<br />
18 Vitamin B1, Vitamin B2 HPLC-FD<br />
Olivenöl 18 Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen,<br />
Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren),<br />
Benzo(g,h,i)perylen<br />
GC-MSD<br />
Olivenöl- 14 Säurezahl, FSV, K-Werte, Stigmastadien Titrimetrie, GC-FID, Fotometrie, Säulenmischungchromatografie,<br />
HPLC-DAD<br />
Rahm 35 Fett, Trockenmasse, Protein Gravimetrie, Kjeldahl<br />
Reis 67 qualitative Bestimmung des Anteils gentechnisch qualitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Saatgut 68 quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Roggenbrot 31 Chlorid, Propionsäure, Sorbinsäure Potentiometrie, GC, HPLC<br />
29
Säuglingsanfangsnahrung<br />
18 Vitamin A, Vitamin C HPLC-DAD, HPLC-FD<br />
Säuglingsnahrung<br />
18 Furan GC-MSD<br />
Säuglingsanfangsnahrung<br />
auf Sojabasis<br />
18 Casein ELISA<br />
Säuglingsanfangsnahrung<br />
auf Sojabasis<br />
18 ß-Lactoglobulin ELISA<br />
Schmelzkäse 35 Fett, Trockenmasse, Protein, Lactose, Kochsalz, Gravimetrie, Kjeldahl, Enzymatik,<br />
pH-Wert, Nitrat, Citronensäure<br />
Potentiometrie, Photometrie<br />
Schokoladenkuchen<br />
18 Sorbinsäure, Theobromin HPLC-UV, HPLC-UV<br />
Soft-Drink 18 Brix, pH-Wert, Citronensäure, Saccharin, Sorbinsäure Potentiomerie, Enzymatik, HPLC-DAD<br />
Sojamehle 40 Quantitative Bestimmung des Anteils gentechnisch Quantitative molekularbiologische<br />
veränderten Materials<br />
Analytik<br />
Sonnenblumenöl<br />
18 Phthalate GC-MSD<br />
Speiseöl 34 Tocopherolverteilung, Gesamttocopherole, Säurezahl, HPLC-Fluoreszenzdetektion, Titrimetrie,<br />
Peroxidzahl, FSV<br />
GC-FID<br />
Speisesenf 34 Speisesenf Gravimetrie, Weibull-Stoldt,<br />
Potentiometrie, Enzymatik, Destillation<br />
<strong>und</strong> Photometrie<br />
Spirituosen 34 Relative Dichte 20 °C/20 °C, Alkohol in % vol.,<br />
Gärungsbegleitstoffe (Ester, Aldehyde, höhere<br />
Alkohole, Methanol)<br />
Pyknometrie, Gaschromatographie<br />
Teigware 34 Wasser, Fett, Rohprotein, Asche, Kochsalz,<br />
Gravimetrie, Weibull-Stoldt, Kjeldahl,<br />
Cholesterin, Eigehalt<br />
Potentiometrie, GC, Berechnung<br />
Traubensaft 34 Relative Dichte 20 0 /20°, pH-Wert, Gesamtsäure pH Biegeschwinger, Potentiometrie,<br />
8,1, Glucose, Fruktose, L-Äpfelsäure, Asche, Enzymatik, Gravimetrie, Photometrie,<br />
Phosphat, Kalium, Calcium, Magnesium<br />
AAS,<br />
Trinkwasser 33 Aluminium, Ammonium, Eisen, Kupfer, pH-Wert, Konduktometrie, Photometrie,<br />
Leitfähigkeit, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit, Ionenchromatographie, Titrimetrie,<br />
Färbung, Trübung, TOC<br />
Trübungsmessgerät, ICP-MS<br />
Trinkwasser 33 Coliforme Bakterien, E. coli, Koloniezahl, Intestinale<br />
Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa<br />
Quantitative mikrobiologische Methoden<br />
Trocken-Feigen 18 Aflatoxine HPLC<br />
Thunfisch 9 Cadmium, Kupfer, Quecksilber, Blei, Zink, Arsen,<br />
Selen<br />
ICP-M, Kaltdampf-AAS<br />
Wasserprobe 5 Gamma-Radionuklide<br />
Gammaspektrometrie<br />
1 Modellwasser Am-241<br />
alphanuklidspezifischer Nachweis<br />
Sr-90<br />
beta-low-level-Messung<br />
Wasserprobe 5 Gamma-Radionuklide<br />
Gammaspektrometrie<br />
2 Reales<br />
Am-241<br />
alphanuklidspezifischer Nachweis<br />
Wasser<br />
Sr-90<br />
beta-low-level-Messung<br />
Wein 34 Relative Dichte 20 °C/20 °C, Gesamtalkohol, Pyknometrie, potent. Titrimetrie,<br />
vorhandener Alkohol, Gesamtextrakt, vergärbarer Photometrie, Enzymatik, Gravimetrie,<br />
Zucker, Glucose, Fructose, Gesamtsäure, Weinsäure, HPLC, AAS, Gaschromatographie, LC-<br />
Gesamte Äpfelsäure, L-Äpfelsäure, D-Äpfelsäure,<br />
Gesamte Milchsäure, L-Milchsäure, D-Milchsäure,<br />
Flüchtige Säure, Citronensäure, freie schweflige Säure,<br />
gesamte schweflige Säure, Glycerin, L-Äpfelsäure, D-<br />
Äpfelsäure, L-Milchsäure, D-Milchsäure, Shikimisäure,<br />
Sorbinsäure, Benzoesäure, Salizylsäure, Asche,<br />
Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Chlorid,<br />
Phosphat, Sulfat als Kaliumsulfat, Methanol,<br />
Fumarsäure, 3-Methoxypropandiol, Cyclische<br />
Diglyceride<br />
MS/MS<br />
Wein 34 Methoxypropandiol, Cyclische Diglyceride GC-MSD<br />
Zimtpulver 65 Ätherisches Öl, Cumarin Destillation, HPLC-DAD<br />
30
7.<strong>3.</strong>2 LAVES - LI Oldenburg<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Brühwurst 34 Rohprotein, Wasser, Asche, Fett, Hydroxyprolin, Kjeldahl, Gravimetrie, Photometrie,<br />
Gesamtphosphat, Kochsalz, Stärke<br />
Weibull-Stoldt, Potentiometrie, Titration<br />
Brühwurst 34 Citrat, Lactat, Glutaminsäure, NPN, säurelöslicher<br />
Phosphor, Pökelstoffe, Kollagenabbauprodukte,<br />
Farbstoffe<br />
Enzymatik, Kjeldahl, Photometrie, DC<br />
Fleisch 19 Nitrit, Nitrat Fließinjektionsanalyse, Photometrie<br />
Brühwurst 34 Fett Caviezel<br />
Speiseöl 34 Säurezahl, Peroxidzahl Titration<br />
Reis 19 Bacillus cereus Mikrobiologische Untersuchung<br />
Geflügelfleisch 19 Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria<br />
monocytogenes, aerobe Gesamtkeimzahl<br />
Mikrobiologische Untersuchung<br />
Rindfleisch 19 Pseudomonas spp., coliforme Keime, E. coli,<br />
Enterokokken, Listeria monocytogenes, Hefen,<br />
Schimmelpilze, Enterobacteriaceen,<br />
Milchsäurebakterien, Clostridium perfringens<br />
Mikrobiologische Untersuchung<br />
Milchpulver 19 Yersinia enterocolitica Mikrobiologische Untersuchung<br />
Hafermehl, 36 Enterobacter sakazakii, Staphylokokken, Bacillus Mikrobiologische Untersuchung<br />
Milchpulver<br />
cereus<br />
Fleisch 36 aerobe Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceen,<br />
coliforme Keime, E.coli, Salmonella spp.<br />
Mikrobiologische Untersuchung<br />
Lyophylisat<br />
einer Kultur<br />
36 pathogenes Isolat Mikrobiologische Untersuchung<br />
Milch 23 aerobe Gesamtkeimzahl Mikrobiologische Untersuchung<br />
Fisch 19 Vibrio parahaemolyticus Mikrobiologische Untersuchung<br />
Frühstückscerealien<br />
18 Acrylamid GC/MS<br />
Säuglingsnahrung<br />
18 Furan GC/MS<br />
Gewürze 39 Behandlung mit ionisierenden Strahlen Photostimulierte Lumineszenz (PSL)<br />
Rapsöl 70 Bifenthrin, Chlorpyrifos-methyl, Deltamethrin, Dieldrin,<br />
Fenvalerat, Lindan, cis-Heptachlorepoxid, Methacrifos,<br />
Parathion, Pirimiphos-methyl, Quintozen, Resmethrin<br />
GC<br />
Kohl 19 Nitrat HPLC<br />
Weizen 49 & Azoxystrobin, Carbendazim, Deltamethrin, Diazinon, GC, HPLC<br />
69 Pirimiphos-methyl, Propiconazole, Chlormequat,<br />
MCPA, Mecoprop<br />
Gemüsesaft 34 Nitrat HPLC<br />
Birne 48 Acetamiprid, Carbaryl, Diazinon, Dimethoat, Imazalil,<br />
Imidacloprid, Iprodion, Omethoat, Oxydemeton-methyl,<br />
Pyrimethanil, Tetraconazol<br />
GC, HPLC<br />
Erdbeere 48 Bupirimat, Cyprodinil, Diazinon, Endosulfan-alpha,<br />
Endosulfan-beta, Fenhexamid, Fenitrothion,<br />
Fludioxonil, Hexythiazox, Iprodion, Myclobutanil,<br />
Oxamyl, Penconazol, Procymidon, Pyrimethanil,<br />
Quinoxyfen, Tebuconazol, Tolylfluanid, Triadimenol<br />
GC, HPLC<br />
Gemüsepürree 18 Pb, Cd, Sn GF AAS<br />
Thunfisch,<br />
gefriergetrockn.<br />
7 As, Cd, Cu, Pb, Se, Zn, Hg ICP-MS, Hydridtechnik<br />
Fleisch 18 Ca, Zn, P ICP-MS, FL AAS<br />
Softdrink 18 Sb, Cr, Cu, Cd, ges. As, Zn ICP-MS<br />
Milchpulver 18 Al, ges. As, Cd, Pb, ges. Hg ICP-MS, Hydridtechnik<br />
Molkereiprodukt<br />
18 Fe, Mg, Mn, Se ICP-MS<br />
Waldpilze 7 As, Pb, Cd, Cu, Se, Tl, Zn, Hg ICP-MS, Hydridtechnik<br />
Separatorenfleisch<br />
34 Ca ICP-MS<br />
Getränke/ 10 Cyclamat HPLC<br />
31
Konfitüre<br />
Breakfast<br />
Cereals<br />
18 Niacin, Vitamin B2, B6 HPLC<br />
Baby Food<br />
Powdered<br />
18 Vitamin A, C, E HPLC<br />
Getrockneter<br />
Aprikosenbrei<br />
18 SO2 Reith-Willems<br />
Baby Food<br />
Formula<br />
18 Fett, Fettsäure-Verteilung, Trans-Fettsäuren Büchi-Caviezel, GC<br />
Grape Juice 18 pH-Wert, Citronensäure, Glucose, Fructose,<br />
Saccharose<br />
Potentiometrie, Enzymatik<br />
Chili-Paste 18 Sudan-Farbstoffe HPLC<br />
Salat (Feinkost) 31 Konservierungsstoffe HPLC<br />
Butter-Biscuit 31 Fett, Butterfett, Kochsalz GC, Titration<br />
Biscuit 31 Fettsäure-Verteilung (cis/trans) GC<br />
Sauerkraut 34 Ascorbinsäure, Gesamtsäure, pH-Wert, Milchsäure, HPLC, Potentiometrie, Titration,<br />
Kochsalz<br />
Enzymatik<br />
Gemüsesaft 34 Dichte, Nitrat, Fructose, Citronensäure, Gesamtsäure, HPLC, Enzymatik, Potentiometrie,<br />
Kochsalz, pH-Wert<br />
Titration,<br />
Tomatensaft 34 pH-Wert, Gesamtsäure, lösliche Trockenmasse,<br />
relative Dichte, Citronensäure, Glucose, Fructose,<br />
Chlorid<br />
HPLC, Titration, Potentiometrie,<br />
Enzymatik, Potentiometrie<br />
Speisefett 34 Fettsäureverteilung, Tocopherolverteilung GC, HPLC<br />
kalorien- 34 pH-Wert, Saccharin, Cyclamat, Acesulfam-K, Potentiometrie, HPLC<br />
reduzierte<br />
Getränke<br />
Aspartam, künstliche Farbstoffe<br />
Milchbreipulver 34 Wasser, Fett, Butterfett, Lactose, Glucose, Fructose, Karl-Fischer-Titration, Büchi-Caviezel,<br />
Saccharose, Asche<br />
GC, Enzymatik, Gravimetrie<br />
Vitamine in<br />
Kindernahrungsmittel<br />
34 Vitamin A, B1, B2, C, E, HPLC<br />
Kindernahrung<br />
auf Milchbasis<br />
(Pulver)<br />
35 Saccharose, Fructose, Glucose, Vitamin C + E Enzymatik, HPLC<br />
Zimt 71 Cumarin, etherische Öle HPLC, Destillation<br />
Dorschleberöl 18 PCDD/F <strong>und</strong> dl-PCB GC/MS<br />
Lachsfilet 52 PCDD/F <strong>und</strong> dl-PCB GC/MS<br />
Hähnchenfleisch<br />
52 PCDD/F <strong>und</strong> dl-PCB GC/MS<br />
Butter 52 PCDD/F <strong>und</strong> dl-PCB GC/MS<br />
Pflanzliches Öl 18 CLKW <strong>und</strong> PCB GC/ECD<br />
7.<strong>3.</strong>3 LAVES - IFF Cuxhaven<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Mayonnaise 34 Salz, Fett, Titration, Gravimetrie<br />
Modell-Wasser 4 Gamma-Radionuklide, Strontium-90 Gammaspektrometrie, beta-low-level-<br />
Messung<br />
Reales Wasser 4 Gamma-Radionuklide, Strontium-90 Gammaspektrometrie, beta-low-level-<br />
Messung<br />
Schwertfisch 25 Schwermetalle Z-GFAAS/ FIMS<br />
Thunfisch 11/25 Schwermetalle Z-GFAAS/ FIMS<br />
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
32
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
Lyophilisat 22 E. Coli, Salmonellen Qualitativ/MPN<br />
Lyophilisat 22 Norovirus/Hepatitis A PCR/Qualitativ<br />
Thunfisch 31 Biogene Amine LC-Fluoreszenz<br />
Forelle 7 Triphenylmethanfarbstoffe (Malachitgrün) LC-MS/MS<br />
Muscheln 7 DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)-Toxine LC-MS/MS<br />
Muscheln 7 PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) LC-Fluoreszenz<br />
7.<strong>3.</strong>4 LAVES - VI Hannover<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Blutseren 63 Leptospirose-Antikörper Mikroagglutinationstest (MAT)<br />
Blutseren 60 MKS-Antikörper ELISA<br />
Blutseren 59 Antikörper gegen Enzootische Leukose der Rinder ELISA<br />
Eipulver 26 Nachweis von Enterobacteriaceae quantitativ; E. coli<br />
quantitativ; Hefen quantitativ<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Fleischproben 3 Detektion <strong>und</strong> Isolierung von VTEC/STEC aus Mikrobiologische Methoden, ELISA,<br />
Hackfleisch<br />
Kolonie-Immunoblot, PCR<br />
Haut<br />
(Bachforelle),<br />
Haut<br />
(Bachforelle),<br />
Niere<br />
(Regenbogenfor<br />
elle)<br />
Hirntupfer<br />
(Ferkel),<br />
Kot (Kuh),<br />
Hirntupfer<br />
(Schaf)<br />
42<br />
Nachweis bakterieller Krankheitserreger bei<br />
Kaltwasserfischen<br />
(Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida,<br />
Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri)<br />
42 Nachweis primär pathogener Keime<br />
(Streptococcus suis Type 2, Salmonella Thompson,<br />
Arcanobacterium pyogenes)<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Kakaopulver 72 Nachweis von Salmonella spp. qualitativ Mikrobiologische Methoden<br />
Kot (Huhn) 42 Nachweis primär pathogener Keime<br />
(Salmonella gallinarum var pullorum)<br />
PCR<br />
Kot (Huhn), 42 Nachweis primär pathogener Keime<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Labmagen<br />
(Salmonella gallinarum var pullorum, Clostridium<br />
(Schaf),<br />
Leber (Forelle)<br />
sordellii, Yersinia ruckeri)<br />
Lebensmittel 72 Nachweis eines unbekannten pathogenen<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Lyophillisat<br />
Organismuses<br />
Magermilch- 36 Campylobacter spp. Real-time PCR nach<br />
pulver<br />
Anreicherungskultur<br />
Milch<br />
(Lyophilisat)<br />
73 Rückstände von Chloramphenicol LC-MS/MS<br />
Milch<br />
74 Rückstände von Antibiotika<br />
LC-MS/MS<br />
(Lyophilisat)<br />
(Chinolone <strong>und</strong> Tetracycline)<br />
Milch (Kuh), 42 Nachweis primär pathogener Keime<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Kot (Schaf),<br />
(Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, Salmonella<br />
Leber<br />
(Eintagsküken)<br />
Infantis, Enterococcus faecalis)<br />
Milch (Kuh), 42 Nachweis primär pathogener Keime<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Leber (Schwein), (Corynebacterium bovis, Streptococcus dysgalactiae<br />
Lunge<br />
(Eintagsküken)<br />
equisimilis, Aspergillus fumigatus)<br />
Modellwasser<br />
Muskelproben 3<br />
4 Gamma-Nuklide Gamma-Spektroskopie<br />
Nachweis von Trichinella-Muskellarven Magnetrührverfahren<br />
33
Muskulatur <strong>und</strong><br />
Niere<br />
Nierentupfer<br />
(Lachsartige),<br />
Haut<br />
(Regenbogenforelle),<br />
Nierentupfer<br />
(Regenbogenforelle)<br />
Nierentupfer<br />
(Regenbogenforelle),<br />
Haut<br />
(Regenbogenforelle)<br />
Haut<br />
(Regenbogenforelle<br />
75 Rückstände von Penicillinen LC-MS/MS<br />
42<br />
Nachweis bakterieller Krankheits-erreger bei<br />
Kaltwasserfischen<br />
(Renibacterium salmoninarum, Pseudomonas<br />
fluorescens, Hafnia alveii)<br />
42 Nachweis bakterieller Krankheits-erreger bei<br />
Kaltwasserfischen<br />
(Hafnia alvei, Flavobacterium indologenes, Shewanella<br />
putrefaciens)<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Putenkot 55 Nachweis von Salmonellen ISO 6579:2002, modifiziert nach<br />
Empfehlungen des CRL-Salmonella<br />
Bilthoven<br />
Realwasser 4 Gamma-Nuklide Gamma-Spektroskopie<br />
Schokolade 72 Nachweis von Salmonella spp. qualitativ Mikrobiologische Methoden<br />
Schweineblutproben<br />
11 KSP-Genom Real-time RT-PCR<br />
Schweineblutproben,<br />
lyophilisiert<br />
11 KSP-Antikörper Antikörper-ELISA<br />
Schweineblutproben,<br />
lyophilisiert<br />
Stammhirnhomogenate<br />
Rind<br />
Stammhirnhomogenate<br />
Schaf<br />
11 KSP-Virus<br />
KSP-Antigen<br />
KSP-Antikörper<br />
12 BSE- Antigen AG-ELISA<br />
12 Scrapie- Antigen AG-ELISA<br />
Virusanzüchtung in der Zellkultur mit<br />
anschließender Immunfärbung,<br />
Neutralisationstest (NPLA)<br />
Trockenmilch 72 Nachweis von Listeria spp. qualitative u. quantitativ;<br />
Listeria monocytogenes qualitative u. quantitativ;<br />
aerober mesophiler Gesamtkeimzahl quantitativ; E. coli<br />
quantitativ; coliforme Keime quantitativ;<br />
Enterobacteriaceae quantitativ; koagulasepositive<br />
Staphylokokken quantitativ; Bacillus cereus quantitativ;<br />
Hefen; Schimmelpilze; Salmonella spp. qualitative;<br />
Campylobacter spp. qualitative; Pseudomonas spp.<br />
quantitativ<br />
Mikrobiologische Methoden<br />
Vollei<br />
(Lyophilisat)<br />
74 Rückstände von Nitroimidazolen LC-MS/MS<br />
Vollei 75 Rückstände von Chinolonen LC-MS/MS; HPLC-DAD/FLD<br />
Waldpilze<br />
(Lyophilisat)<br />
77 Elemente Atomspektroskopie<br />
Zellkulturüberstände<br />
78 Nachweis von KHV Real-time PCR<br />
Zellkulturüberstande<br />
7.<strong>3.</strong>5 LAVES - VI Oldenburg<br />
60 Erreger anzeigepflichtiger Fischseuchen<br />
(VHS/IHN/KHV),<br />
fakultativ IPN/SVC<br />
Virusanzüchtung auf verschiedenen<br />
Zelllinien, anschließend direkte <strong>und</strong><br />
indirekte Immunfärbung, AG-ELISA,<br />
Titration<br />
34
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
ZNS in<br />
Brühwürsten<br />
Chloramphenicol<br />
in Milch<br />
lyophilisierte<br />
Schweine-Seren<br />
83<br />
11<br />
Qualifizierung <strong>und</strong> gg. Quantifizierung von ZNS Material<br />
in Brühwürsten (Uni-Leipzig)<br />
Qualifizierung <strong>und</strong> gg. Quantifizierung von<br />
Chloramphenicol in Milch<br />
GC-MS<br />
GC-MS <strong>und</strong> Screening<br />
11 ESP-Antikörpernachweis, ESP-Antigennachweis ELISA, PCR, Virusisolierung<br />
Hirnpräparationen<br />
von Rindern 12 Nachweis anormales Prionprotein (PrPSC )<br />
HerdChek® Bovine Spongiforme<br />
Enzephalopathie (BSE) Antigen-<br />
Testkit, EIA, Firma IDEXX<br />
HerdChek® BSE-Scrapie Antigen-<br />
Testkit, EIA, Firma IDEXX<br />
Hirnpräparationen<br />
von Schafen 12 Nachweis anormales Prionprotein (PrPSC )<br />
Fleisch 19 Escherichia coli Kultureller Nachweis<br />
Kultur mit Voranreicherung gemäß<br />
Fleisch 19 Salmonellen<br />
AVVFLH; biochem. u serolog.<br />
Differenzierung<br />
Lyophil. Fleisch 19 Thermophile Campylobacter ISO 10727-1<br />
Lyophil. Fleisch 19 Listeria monocytogenes Zählung ISO 11290-2<br />
Lyophil. Fleisch 19 Gesamtkeimzahl, Anzahl Enterobacteriaceae DIN ISO 10161, DIN ISO 10164<br />
Lyophil. Fleisch 19 E.coli O157 FSIS, USDA MLG 5.03<br />
Lyophil. Fleisch 19 E. coli Keimzählung ISO 16649-2<br />
Sulfonamide in<br />
Niere<br />
19<br />
Qualifizierung <strong>und</strong> gg. Quantifizierung von Sulfonamiden<br />
in Niere<br />
LCMSMS<br />
Tetracycline in<br />
Muskel<br />
19<br />
Qualifizierung <strong>und</strong> gg. Quantifizierung von Tetracyclinen<br />
in Muskel<br />
LCMSMS<br />
Lyophil. Fleisch 36 Salmonellen in 25g ISO 6579<br />
Milchpulver 36 Clostridien<br />
Kultur mit Voranreicherung gemäß<br />
AVVFLH; biochem. Differenzierung<br />
Chloramphenicol<br />
in Muskel)<br />
52<br />
Qualifizierung <strong>und</strong> gg. Quantifizierung von<br />
Chloramphenicol in Muskel<br />
GC-MS <strong>und</strong> Screnning<br />
Bakterienstämme,<br />
lyophilisiert<br />
Bakterien-<br />
53 Identifizierung, Resistenzbestimmung<br />
Mikrobiologische Techniken (Kultur,<br />
Biochemie, Molekularbiologie,<br />
Mikroskopie, u.a. anerkannte<br />
Verfahren)<br />
stämme,<br />
lyophilisiert<br />
53 Identifizierung von Bakterienstämmen Sequenzierung<br />
Objektträger,<br />
fixiert mit Organausstrichen<br />
53<br />
Identifizierung von säurefesten Stäbchen<br />
(Mykobakterien)<br />
Mikroskopischer Nachweis nach Ziehl-<br />
Neelsen-Färbung<br />
unbekanntes<br />
Lyophilisat<br />
53 Bakteriangenom-Nachweis Salmonella enterica PCR<br />
unbekanntes<br />
Lyophilisat<br />
Bakterien-<br />
53 Bakteriangenom-Nachweis EHEC (stx 1 <strong>und</strong> stx 2) PCR<br />
stämme,<br />
lyophilisiert,<br />
Mikrotiterplatten<br />
versch.<br />
Antibiotika in unterschiedlichen<br />
Konzentrationen<br />
54<br />
Resistenzprüfung von 6 Stämmen (Feldstämme von<br />
Past. mult., Salmonella spec., Strept. suis,<br />
Referenzstämme von St. aureus, E. coli, Klebs.<br />
pneumoniae), Resistenzbestimmung mit jeweils 24<br />
versch. Antibiotika auf jeweils 3 MT-Platten<br />
Resistenzprüfung <strong>und</strong> Bewertung<br />
nach NCCLS M31-A2 (2002) im<br />
Mikrodilutionsverfahren, Angabe der<br />
MHK-Werte<br />
angereicherte<br />
Putenkotproben<br />
angereicherte<br />
Tabletten mit<br />
55 Salmonella spp. PCR<br />
sublethal<br />
geschädigten<br />
Salmonellaenteritidis-Zellen<br />
55 Salmonella spp. PCR<br />
35
Lyophil. Fleisch 55 Salmonellen in 25g ISO 6579<br />
Vor- <strong>und</strong> Hauptanreicherung,<br />
serologische <strong>und</strong> biochemische<br />
Putenkot 55 Nachweis von Salmonellen, 19 Proben<br />
Differenzierung, Verfahren „MSRV“<br />
nach EU-Referenzlabor, Salmonellen-<br />
Prävalenzstudie<br />
Rinderkot 56<br />
Nachweis von Mycobacterium avium ssp.<br />
paratuberculosis (MAP), 15 Proben<br />
Kultureller <strong>und</strong> molekularbiologischer<br />
Erregernachweis<br />
Milch 59 Leukose-Antikörpernachweis ELISA<br />
HE-<br />
Schnittpräparate 76<br />
Nachweis bzw. Feststellung pathologischer oder<br />
physiologischer Veränderungen (Hyperplasie, Dysplasie,<br />
Tumor, Entzündung u.a.)<br />
Lichtmikroskopie<br />
Lymphknoten 79 Bakteriangenom-Nachweis Tuberkulose PCR<br />
Serum 80 MKS-Antikörpernachweis ELISA<br />
tiefgefrorene<br />
Milch<br />
81 Gesamtkeimzahl DIN ISO 10161<br />
Resistenzprüfung <strong>und</strong> Bewertung<br />
Salmonellenstämme<br />
82<br />
Resistenzbestimmung von 9 Stämmen mit jeweils 32<br />
versch. Antibiotika, einschl. ESBL<br />
nach NCCLS M31-A2 (2002) im<br />
Mikrodilutionsverfahren, Angabe der<br />
MHK-Werte<br />
Testblättchen 43 Hemmstoffe<br />
Dreiplatten-Hemmstofftest gemäß<br />
AVVFLH<br />
7.<strong>3.</strong>6 LAVES - FI Stade<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Hafermehl 36 Hefen <strong>und</strong> Schimmelpilze (Keimzählung) VDLUFA 28.1.2<br />
Hafermehl 36 Listeria species <strong>und</strong> Listeria monocytogenes § 64 LFGB<br />
Hafermehl 36 Qualitativer Nachweis von Salmonella ssp. § 64 LFGB<br />
Futtermittel- 41 Pediococcus acidilactici (Probiotikum) VDLUFA 28.2.5 <strong>und</strong> parallel<br />
Zusatzstoff<br />
CEN-Methode<br />
Futtermittel- 41 Saccharomyces cerevisiae (Probiotikum) VDLUFA 28.2.6 <strong>und</strong> parallel<br />
Zusatzstoff<br />
CEN-Methode<br />
Getreideschrot 84 produkttypische <strong>und</strong> verderbanzeigende Bakterien,<br />
Schimmelpilze <strong>und</strong> Hefen<br />
VDLUFA 28.1.2<br />
Schweinefutter 84 produkttypische <strong>und</strong> verderbanzeigende Bakterien, VDLUFA 28.1.2<br />
(Mehl)<br />
Schimmelpilze <strong>und</strong> Hefen<br />
Brotpellets 84 produkttypische <strong>und</strong> verderbanzeigende Bakterien,<br />
Schimmelpilze <strong>und</strong> Hefen<br />
VDLUFA 28.1.2<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Phytase VDLUFA 27.1.2<br />
Mineralfutter 41 Phytase VDLUFA 27.1.2<br />
Mineralfutter 41 Bacillus licheniformis <strong>und</strong> Bacillus subtilis<br />
(Probiotikum)<br />
VDLUFA 28.2.2<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Enterococcus faecium (Probiotikum) VDLUFA 28.2.3<br />
Schweinefutter 41 Bacillus licheniformis <strong>und</strong> Bacillus subtilis<br />
(Probiotikum)<br />
VDLUFA 28.2.2<br />
Milcheiweiß 36 Qualitativer Nachweis von Salmonella ssp. gem. Rindersalmonellose-VO<br />
Simulierter 11 Qualitativer Nachweis von Taylorella equigenitalis kulturelle , biochemische <strong>und</strong><br />
Klitoristupfer<br />
Bestimmung der Streptomycin-Resistenz<br />
serologische Differenzierung<br />
Ergänzungsfutter<br />
für Rinder<br />
37 tierische Bestandteile mikroskopisch<br />
Ergänzungsfutter<br />
für Rinder<br />
37 tierische Bestandteile mikroskopisch<br />
Ergänzungsfutter<br />
für Rinder<br />
37 tierische Bestandteile mikroskopisch<br />
Legehennenfutter<br />
85 Zusammensetzung mikroskopisch<br />
Schweinefutter 85 Zusammensetzung mikroskopisch<br />
36
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Feuchte, Rohasche gravimetrisch<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Rohprotein Kjeldahl<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Gesamtfett Extraktionsmethode<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Rohfaser Weender-Verfahren<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Stärke polarimetrisch<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Zucker, Lactose LUFF-Schoorl<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Schwermetalle (Cd, Pb) AAS<br />
Ferkelaufzuchtfutter<br />
41 Vitamin A, Vitamin E HPLC<br />
Ferkelaufzucht- 41 Aminosäuren (Lys, Met, Thr, Leu, Ile, Tyr, Phe, His, Aminosäurenanalysator<br />
futter<br />
Arg, Ser, Asn, Glu, Ala, Val, Pro, Gly)<br />
Milchleistungsfutter<br />
41 Feuchte, Rohasche, ELOS gravimetrisch<br />
Milchleistungsfutter<br />
41 Rohprotein Kjeldahl<br />
Milchleistungsfutter<br />
41 Gesamtfett Extraktionsmethode<br />
Milchleistungsfutter<br />
41 Rohfaser Weender-Verfahren<br />
Mineralfutter für<br />
Zuchtsauen<br />
41 Feuchte, Rohasche gravimetrisch<br />
Mineralfutter für<br />
Zuchtsauen<br />
41 Chlorid Titration<br />
Mineralfutter für<br />
Zuchtsauen<br />
41 Vitamine (A, D3, E) HPLC<br />
Mineralfutter für<br />
Zuchtsauen<br />
41 Aminosäuren (Lys, Met, Thr) Aminosäurenanalysator<br />
Grassilage 41 Feuchte gravimetrisch<br />
Grassilage 41 Rohfaser Weender-Verfahren<br />
Grassilage 41 Schwermetalle (As, Cd, Pb, Hg) AAS<br />
Grassilage 41 Fluor, Fluor HCl Ionensensitive Elektrode<br />
Grassilage 41 CKW GC<br />
Wasser 52 Chloramphenicol Festphasenextraktion, GC-MS<br />
Rinderfutter 44 CKW’s, PCB’s GC<br />
Kükenfutter 44 CKW’s, PCB’s GC<br />
Schweinefutter 44 CKW’s, PCB’s GC<br />
Fischmehl 44 CKW’s, PCB’s GC<br />
Ölproben 44 CKW’s, PCB’s GC<br />
7.<strong>3.</strong>7 LAVES - IB Celle<br />
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Honig 24 Wasser, elektr. Leitfähigkeit, Invertase, Diastase, freie<br />
Säure, Zucker- + Pollenspektrum<br />
Honig 25 Pollenspektrum Mikroskopie<br />
Futterproben 86 CFU Paenibacillus larvae Bakteriologie<br />
7.<strong>3.</strong>8 LAVES - IfB Lüneburg<br />
Refraktometrie, Konduktometrie,<br />
Titration, Photometrie, HPLC,<br />
Mikroskopie<br />
37
Matrix Ver. Parameter Methodik<br />
Creme 90 Panthenol, Triclosan, bromierte Konservierungsstoffe<br />
Bronidox, Bronopol <strong>und</strong> Methyl-dibromoglutaronitril<br />
HPLC-DAD, HPLC-ECD, LC-MSD<br />
Futtermittel 41 Ca, Na, P, Fe, Cu, Mn, Se, As, Cd, Pb, Hg ICP-MS, Hg-Analysator<br />
Kunstlederpulver<br />
15 4-Amino-benzol HPLC, CE, GC-MSD, LC-MSD<br />
Kunststoff 28 Weichmacher Phthalate GC/GCMSD<br />
Kunststofffolien 87 Geruch, Geschmack Sensorik<br />
Milch 23 Gesamtkeimzahl Plattenguss- <strong>und</strong> Spatelverfahren<br />
Metall (Ohrringe, 88<br />
Ohrstecker)<br />
Oberflächenbestimmung Berechnung<br />
Shampoo 61 Antischuppenwirkstoffe:<br />
zinc Pyrithione, Piroctone Olamine, Climbazole<br />
HPLC-DAD<br />
Sonnenmilch 89 UV-Filer, Methyldibromo-glutaronitrile HPLC-DAD, LC-MSD<br />
Textilien 15 Metalle ICP, AAS<br />
Vollei 26 Gesamtkeimzahl, Enterobacteriaceen, Hefen, E.coli Plattenguss- <strong>und</strong> Spatelverfahren<br />
7. 4 Sachverständige<br />
Amtsgericht Cloppenburg, Ladung als Sachverständiger zur<br />
Hauptverhandlung in einer Bußgeldsache wegen Verarbeitung nicht zum<br />
Verzehr geeigneter Fleischrohstoffe zu Frikadellen<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF) -Projekt „Marine<br />
Aquakultur Technologie“<br />
GMP-Inspektion bei der Fa. Bio Protect Research GmbH Cuxhaven -Bericht<br />
vom 25.01.2007<br />
Kirchhoff, H. (LI OL)<br />
Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Thalmann, G. (VI OL)<br />
GMP-Inspektion bei der WdT, Serumwerk Memsen -Bericht vom 12.01.2007 Thalmann, G. (VI OL)<br />
GMP-Inspektion im Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH -Bericht vom<br />
10.01.2007<br />
Thalmann, G. (VI OL)<br />
Sachverständiger vor Amtsgericht Cloppenburg 27.0<strong>3.</strong>2007 Christof, O. (VI OL)<br />
Sachverständiger vor Amtsgericht Dannenberg 0<strong>3.</strong>07.2007 Christof, O. (VI OL)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Franzky, A. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Kleingeld, D.W. (Dez. 32)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Maiworm, K. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Petermann, S. (Dez. 33)<br />
Tierschutzfachliche Rechtsgutachten in Gerichtsverfahren Welzel, A. (Dez. 33)<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der DLG-Qualitätsprüfung für<br />
Fleischerzeugnisse<br />
Gutachterliche Tätigkeiten im Rahmen tierschutzrelevanter<br />
Tatbestände (Amtsgericht H <strong>und</strong> BS sowie Landgericht H)<br />
Schlägel, E. (FI STD)<br />
von Keyserlingk, M. (VI H)<br />
38
7. 5 Forschungsaufgaben<br />
Aufgabe Auftraggeber Verantwortliche Wissenschaftler<br />
Evaluierung einer real-time PCR<br />
zum qualitativen <strong>und</strong> quantitativen<br />
Nachweis des Koi-Herpesvirus<br />
Prävalenz von Coxiella burnetii in<br />
Schafhaltungen in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Campylobacter-Monitoring bei<br />
Masthähnchen<br />
Salmonellen-Prävalenzstudie in<br />
Puten<br />
Wirksamkeit der<br />
Putenkompostierung unter<br />
Seuchenbedingungen in<br />
<strong>Niedersachsen</strong><br />
Untersuchungen zur Verbreitung<br />
von Francisella tularensis <strong>und</strong><br />
Brucellen in niedersächsischen<br />
Hasenpopulationen<br />
Rodentizidresistenz bei<br />
Wanderratten in <strong>Niedersachsen</strong><br />
Untersuchungen zum Vorkommen<br />
von Zoonoseerregern in der<br />
Bisampopulation <strong>Niedersachsen</strong>s<br />
Niedersächsisches Ministerium für<br />
den ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Niedersächsisches Ministerium für<br />
den ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>; Klinik für kleine<br />
Klauentiere, Stiftung Tierärztliche<br />
Hochschule Hannover, Schafs- <strong>und</strong><br />
Ziegenges<strong>und</strong>heitsdienst;<br />
Zentrales Institut des<br />
Sanitätsdienstes der B<strong>und</strong>eswehr<br />
Kiel (Bw)<br />
B<strong>und</strong>esministerium für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>, Ernährung <strong>und</strong><br />
Landwirtschaft<br />
B<strong>und</strong>esministerium für<br />
<strong>Verbraucherschutz</strong>, Ernährung <strong>und</strong><br />
Landwirtschaft<br />
Niedersächsisches Ministerium für<br />
den ländlichen Raum, Ernährung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
<strong>Verbraucherschutz</strong><br />
Niedersächsische<br />
Landesjägerschaft<br />
LAVES<br />
LAVES<br />
Runge, M. (VI H); Steinhagen, D.<br />
(Abteilung Fischkrankheiten, TiHo<br />
Hannover)<br />
Runge, M.; v. Keyserlingk, M. (VI<br />
H); Ganter, M. (Klinik für kleine<br />
Klauentiere, TiHo Hannover);<br />
Binder, A. (Bw)<br />
Braune, S.; Runge, M. (VI H);<br />
Schleuter, G.; Hohmann, M. (VI<br />
OL), Ellerbroek (BfR)<br />
Braune, S. (VI H); Klarmann, D. (VI<br />
OL); Helmuth, R.; Käsbohrer, A.<br />
(BfR)<br />
Schwarzlose, I.; Jeske, C.; Gerdes, U.<br />
(Dez. 32); Gerlach, G-F. (Institut für<br />
Mikrobiologie, TiHo Hannover);<br />
Neumann (Klinik für Geflügel, TiHo<br />
Hannover), Runge, M. (VI H);<br />
Thalmann, G. (VI OL); Behr, K.-P.<br />
(AniCon Labor GmbH,<br />
Hoeltinghausen); Hartung, J. (Inst. f.<br />
Tierhygiene, Tierschutz <strong>und</strong><br />
Nutztierethologie, TiHo Hannover)<br />
v. Keyserlingk, M.; Runge, M.;<br />
Braune, S. (VI H); Pohlmeyer, K.<br />
(Institut für Wildtierforschung, TiHo<br />
Hannover); Neubauer, H. (Institut<br />
für bakterielle Infektionen <strong>und</strong><br />
Zoonosen, FLI, Jena)<br />
Runge, M. (V I H); Pelz, J.<br />
(Biologische B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Institut<br />
für Nematologie <strong>und</strong>d<br />
Wirbeltierk<strong>und</strong>e, Münster); Plenge-<br />
Bönig, A.; Becker, D.<br />
(Hygieneinstitut Hamburg)<br />
v. Keyserlingk, M.; Braune, S.;<br />
Runge, M. (VI H); Eiler, T.<br />
(Landwirtschaftskammer<br />
<strong>Niedersachsen</strong>); Ulrich, R. (FLI,<br />
Riems)<br />
Fortsetzung <strong>und</strong> Beendigung des BfR / BMU Kruse, R. (IfF CUX)<br />
39
Forschungsauftrages „Exposition<br />
mit Methylquecksilber durch<br />
Fischverzehr“<br />
Schwermetalluntersuchungen an<br />
Fischen <strong>und</strong> Flusswasser aus<br />
ausgewählten Gewässern im Harz<br />
<strong>und</strong> Harzvorland<br />
Nematoden in Wildlachs,<br />
Beurteilung <strong>und</strong> Bewertung<br />
„MytiFit“ : Eignung des<br />
Seegebietes am geplanten<br />
Offshore-Windpark „Nordergründe“<br />
für die Zucht von Miesmuscheln“;<br />
Projektteil ‚Bestimmung von<br />
lebensmittelhygienisch relevanten<br />
Parametern <strong>und</strong> Mikroparasiten’<br />
Statuserhebung zur mikrobiellen<br />
<strong>und</strong> Virusbelastung von<br />
Miesmuscheln <strong>und</strong> Austern aus<br />
dem Beifang im Rahmen des<br />
Muschelmonitorings<br />
Antibiotika-Rückstände in<br />
Fischereierzeugnissen aus<br />
Aquakulturen (Promotionsarbeit)<br />
Aquakulturprojekt III: „Aquakulturen<br />
in <strong>Niedersachsen</strong>“:<br />
Untersuchungen zur Hygiene der<br />
Schlachtung <strong>und</strong> Verarbeitung in<br />
niedersächsischen<br />
Aquakulturbetrieben<br />
(Promotionsarbeit)<br />
„Globale Destillation: Belastuung<br />
von Heringen in arktischen<br />
Gewässern, Barentsee, Nordsee<br />
<strong>und</strong> Ostsee mit PBT- <strong>und</strong> vPvB-<br />
Substanzen“; Nachweis relevanter<br />
PBT bzw. vPvB-Substanzen in<br />
ausgewählten Fischen<br />
Entwicklung eines Verfahrens zur<br />
Bestimmung von Perfluorierten<br />
Tensiden in Fischen<br />
„MytiFit“ : Eignung des<br />
Seegebietes am geplanten<br />
Offshore-Windpark „Nordergründe“<br />
für die Zucht von Miesmuscheln“;<br />
Projektteil ‚Bestimmung von<br />
lebensmittelhygienisch relevanten<br />
Parametern <strong>und</strong> Mikroparasiten’<br />
Statuserhebung zur mikrobiellen<br />
<strong>und</strong> Virusbelastung von<br />
Miesmuscheln <strong>und</strong> Austern aus<br />
dem Beifang im Rahmen des<br />
Muschelmonitorings<br />
LAVES Arzbach, H.-H.; Ballin, U. (IfF Cux),<br />
Rohrdanz, A. (IfB LG)<br />
Laves Etzel, V., (IfF CUX), Berges, M.,<br />
(LUA Bremen), Boiselle, C. (LMT-<br />
Vet Brhv)<br />
AWI Bremerhaven, LAVES Ramdohr, S.; Stede, M.;<br />
Effkemann, S.; Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
LAVES Bartelt, E.; Ramdohr, S.;<br />
Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
LAVES Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
LAVES Bartelt, E.; Ramdohr, S.; Etzel, V.<br />
(IfF CUX)<br />
BVL Effkemann, S.; Kruse, R. (IfF<br />
CUX), in Kooperation mit LI OL <strong>und</strong><br />
dem LALF M.-V.<br />
BVL Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
AWI Bremerhaven, LAVES Stede, M.; Ramdohr, S.;<br />
Effkemann, S.; Bartelt, E. (IfF CUX)<br />
LAVES Bartelt, E.; Ramdohr, S.;<br />
Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
40
Nematoden in Wildlachs,<br />
Beurteilung <strong>und</strong> Bewertung<br />
Untersuchung zur<br />
Rückstandssituation von Antibiotika<br />
in Fischen<br />
aus Aquakulturen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsstatus bei<br />
Meeressäugern der<br />
niedersächsischen Küste<br />
Invertaseaktivität von<br />
Robinienhonigen<br />
Optimierung der<br />
Honiguntersuchung im Rahmen<br />
von Qualitätssicherung <strong>und</strong> –<br />
kontrolle<br />
Radioaktive Belastung von<br />
Honigen<br />
Pyrrolizidine im Honig<br />
Pollenanalyse: Strukturanalyse,<br />
Bildverarbeitung <strong>und</strong> Datenbank<br />
Charakterisierung von<br />
Heidelbeerhonig<br />
Messpunktmonitoring -<br />
Paenibacillus-larvae-Sporen in<br />
Futterkranzproben<br />
Bienenmonitoring<br />
Erschließung <strong>und</strong> Management<br />
adäquater Bestäuber im Erdbeer-<br />
<strong>und</strong> Kulturheidelbeeranbau<br />
Laves Etzel, V., (IfF CUX), Berges, M.,<br />
(LUA Bremen), Boiselle, C. (LMT-<br />
Vet Brhv)<br />
LAVES Effkemann, S. (IfF CUX)<br />
Laves Stede, M. (IfF CUX)<br />
ML Janke, M. (IB CE)<br />
EU <strong>und</strong> ML (797/2004) Janke, M.; Ohe, W. von der (IB CE)<br />
ML Ohe, W. von der (IB CE)<br />
Uni Braunschweig, DFG, ML Ohe, W. von der (IB CE)<br />
ML Ohe, W. von der (IB CE)<br />
ML Ohe, W. von der (IB CE)<br />
ML Ohe, W. von der (IB CE)<br />
BMELV, ML, IVA, DIB, DBIB Ohe, W. von der (IB CE)<br />
BLE Boecking, O. (IB CE)<br />
41
7. 6 Personalstärke des LAVES (Stand 31. Dezember 2007)<br />
insgesamt<br />
Zentrale<br />
(Abteilungen<br />
1 bis 4<br />
+ Leitung)<br />
LI<br />
Oldenburg<br />
LI<br />
Braunschweig<br />
VI<br />
Oldenburg<br />
davon<br />
VI<br />
Hannover<br />
IFF<br />
Cuxhaven<br />
IfB<br />
Lüneburg<br />
FI Stade IB Celle<br />
Personal-Kopfzahlen,<br />
Stand 31.12.2007 (ohne<br />
Auszubildende pp.)<br />
Auszubildende, Referendare,<br />
Praktikanten Lebens-<br />
808 184 115 148 133 61 34 49 60 24<br />
mittelchemie<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.) unterteilt<br />
nach Beschäftigungsumfang<br />
80 22 9 16 9 1 8 7 0 8<br />
- vollzeitbeschäftigt 460 125 53 81 69 48 27 24 22 11<br />
- teilzeitbeschäftigt 312 49 57 57 59 11 7 24 35 13<br />
- beurlaubt<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.) unterteilt<br />
nach Geschlecht<br />
36 10 5 10 5 2 0 1 3 0<br />
- weiblich 555 95 94 119 89 38 21 39 51 9<br />
- männlich<br />
Personal (ohne Auszubildende<br />
pp.) unterteilt<br />
nach Qualifikationen<br />
253 81 22 38 37 19 15 13 13 15<br />
o Tierärzte, Lebensmittelchemiker<br />
u. and. 190 52 32 38 18 14 13 9 9 5<br />
Universitätsabschlüsse<br />
o Laboranten 90 0 17 9 26 8 4 18 8 0<br />
o MTA, CTA, BTA, VMTA 209 0 42 68 35 22 6 13 20 3<br />
o Laborhilfskräfte<br />
o Ingenieure (FH), Fach-<br />
55 0 10 11 14 2 3 3 11 1<br />
richtungen Agrar,<br />
Lebensmitteltechnologie 52 43 0 5 2 0 1 0 1 0<br />
u.a.<br />
o Verwaltungskräfte 143 73 13 10 17 9 5 7 4 5<br />
o Sonstige 69 6 3 15 13 4 4 3 11 10<br />
42
7. 7 Ausbildungsverhältnisse <strong>und</strong> Praktikumsangebote im LAVES<br />
Bezeichnung der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
Anzahl der<br />
Auszubildenden/<br />
Praktikanten<br />
Dauer der Ausbildung/<br />
des Praktikums<br />
Voraussetzung für<br />
die Ausbildung/<br />
das Praktikum<br />
Berufliche Ausbildung im LAVES<br />
ChemielaborantIn 25 3,5 Jahre<br />
(kann auf 3 Jahre verkürzt werden)<br />
Realschulabschluss oder Abitur<br />
BiologielaborantIn 10 3,5 Jahre<br />
(kann auf 3 Jahre verkürzt werden)<br />
Realschulabschluss oder Abitur<br />
TierwirtIn, Fachbereich<br />
Bienenhaltung<br />
8 3 Jahre Hauptschulabschluss<br />
Praktika im Rahmen einer beruflichen Ausbildung<br />
Lebensmittelkontroll-<br />
3 10 Wochen im Rahmen ihrer 2-jährigen Begonnene Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur<br />
assistentanwärterIn<br />
Ausbildung<br />
Medizinisch-technische AssistentIn 4 zwei, fünf oder sechs Wochen im Rahmen ihrer Realschulabschluss, erweiterter Hauptschulabschluss, abgeschlossene<br />
Ausbildung<br />
Berufsausbildung nach Hauptschulabschluss<br />
Veterinärmedizinisch-technische<br />
6 zwei Monate bzw. fünf Monate im Rahmen ihrer Realschulabschluss, erweiterter Hauptschulabschluss, abgeschlossene<br />
AssistentIn<br />
Ausbildung<br />
Berufsausbildung nach Hauptschulabschluss<br />
Ausbildungen /Pflichtpraktika (die insgesamt im LAVES absolviert werden) im Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium,<br />
VeterinärreferendarIn 17 durchschnittlich jeweils sieben Monate im Anforderung gemäß Ausbildungs- <strong>und</strong> Prüfungsverordnung für die<br />
Rahmen ihrer Ausbildung<br />
Laufbahn des höheren Veterinärdienstes des Landes <strong>Niedersachsen</strong><br />
LebensmittelchemikerIn 33 1 Jahr nach Abschluss des Hochschulstudiums 1. Staatsexamen im Fach Lebensmittelchemie<br />
Praktika im Rahmen eines Hochschulstudiums<br />
Studierende der Veterinärmedizin 9 2 Wochen im Rahmen ihrer Ausbildung Studium der Tiermedizin nach Abschluss des 9. Fachsemesters gemäß<br />
Approbationsordnung für Tierärzte<br />
Studierende u. Referendare der<br />
6 mehrere Wochen im Rahmen des Studiums o.<br />
Rechtswissenschaften sowie<br />
Studierende der Fachhochschulstudiengänge<br />
„Verwaltung“<br />
Sonstige Ausbildungen/Praktika<br />
eines anschließenden Referendariats<br />
Ausbildung / Betreuung im Rahmen<br />
einer Promotion<br />
DoktorandIn<br />
6 bis zur Promotion abgeschlossenes Studium der Tiermedizin<br />
Schulpraktika<br />
59 2-3 Wochen im Rahmen der Schulausbildung Schüler an Allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen, Techniker-,<br />
SchülerInnen<br />
Chemieschulen sowie sonstige Fachschulen<br />
Sonstige Praktika 10 u.a. Studierende der Ökotrophologie, berufliche Wiedereingliederung,<br />
fachliche Weiterbildung<br />
43
MTA-01-002-LV_Vers. 2.0<br />
7.8 Organisationsplan des LAVES<br />
Frauenbeauftragte<br />
LAVES-Zentrale<br />
Dr. Martina Mahnken<br />
Abteilung 1<br />
Zentrale Aufgaben<br />
Konrad Scholz<br />
11 Personal, Organisation,<br />
Haushalt, Liegenschaften,<br />
Innerer Dienst<br />
Anja Völker<br />
12 IuK-Technik, Betriebswirtschaftl.Steuerungsinstrumente,Datenmanagement<br />
Uwe Bollerslev<br />
13 Recht<br />
Franz-Christian Falck<br />
14 Fachbezogene<br />
Ausbildungs- <strong>und</strong><br />
Prüfungsangelegenheiten<br />
Dr. Heini Treu<br />
15 Technische<br />
Sachverständige<br />
Rainer Thomes<br />
(m.d.W.d.G.b.)<br />
01 Presse- <strong>und</strong><br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Hiltrud Schrandt<br />
QM Qualitätsmanagement<br />
Dr. Dorit Stehr<br />
Abteilung 2<br />
Lebensmittelsicherheit<br />
Dr. Reinhard Velleuer<br />
21 Lebensmittelüberwachung<br />
Dr. Uwe Jark<br />
22 Lebensmittelkontrolldienst<br />
Dr. Reinhard Velleuer<br />
23 Tierarzneimittelüberwachung,<br />
Rückstandskontrolldienst<br />
Dr. Elke Kleiminger<br />
24 Koordinierungsstelle<br />
Sichere Lebensmittel<br />
Dr. Torsten Schumacher<br />
Präsident<br />
Dr. Eberhard Haunhorst<br />
Vizepräsident<br />
Konrad Scholz<br />
Abteilung 3<br />
Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Dr. Ursula Gerdes<br />
32 Task-Force<br />
Veterinärwesen<br />
Dr. Ursula Gerdes<br />
33 Tierschutzdienst<br />
Dr. Sabine Petermann<br />
Niedersächsisches Landesamt für <strong>Verbraucherschutz</strong><br />
<strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit (LAVES)<br />
Postfach 39 49<br />
26029 Oldenburg<br />
Telefon: 0441/57026-0 / Telefax: 0441/57026-179<br />
E-Mail: Poststelle@laves.niedersachsen.de<br />
Internet: www.laves.niedersachsen.de<br />
31 Tierseuchenbekämpfung,<br />
Beseitigung tierischer<br />
Nebenprodukte<br />
Dr. Martina Mahnken<br />
34 Binnenfischerei <strong>und</strong><br />
fischereik<strong>und</strong>licher Dienst<br />
Michael Kämmereit<br />
Beauftragte des ML<br />
für den Tierschutz<br />
Dr. Sabine Petermann<br />
Abteilung 4<br />
Futtermittelsicherheit,<br />
Marktüberwachung<br />
Dr. Reinhold Schütte<br />
41 Futtermittelüberwachung<br />
Dr. Reinhold Schütte<br />
42 Ökologischer Landbau<br />
Diethelm Rohrdanz<br />
43 Marktüberwachung<br />
Dr. Bernhard Aue<br />
Beauftragte des ML für<br />
das Qualitätsmanagement<br />
Dr. Dorit Stehr<br />
Beirat<br />
Abteilung 5<br />
Untersuchungseinrichtungen<br />
Dr. Michael Kühne<br />
51 Lebensmittelinstitut<br />
Oldenburg<br />
Dr. Thomas Heberer<br />
52 Lebensmittelinstitut<br />
Braunschweig<br />
Dr. Brigitte Thoms<br />
(zugleich Leiterin VI H)<br />
53 Veterinärinstitut Oldenburg<br />
Prof. Dr. Günter Thalmann<br />
54 Veterinärinstitut Hannover<br />
Dr. Brigitte Thoms<br />
(zugleich Leiterin LI BS)<br />
55 Institut für Fische <strong>und</strong><br />
Fischereierzeugnisse<br />
Cuxhaven<br />
Dr. Edda Bartelt<br />
56 Institut für Bedarfsgegenstände<br />
Lüneburg<br />
Dr. Astrid Rohrdanz<br />
57 Futtermittelinstitut Stade<br />
Dr. Gerhard Ady<br />
58 Institut für Bienenk<strong>und</strong>e<br />
Celle<br />
Dr. Werner von der Ohe