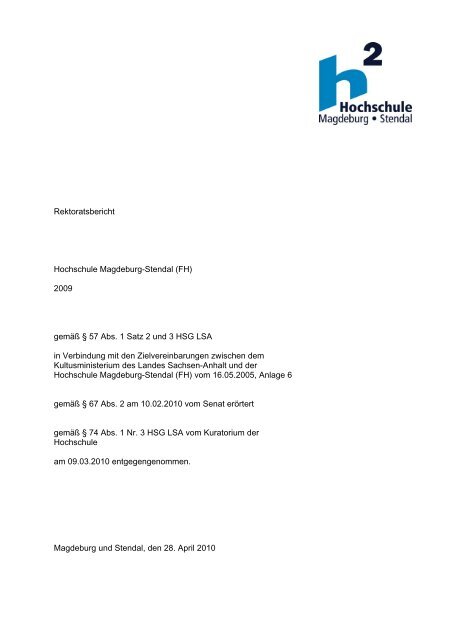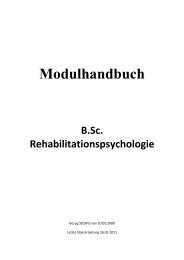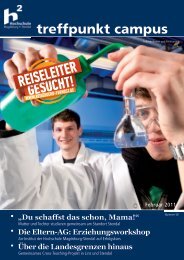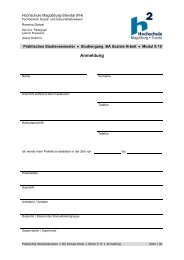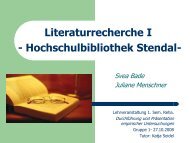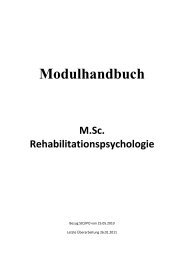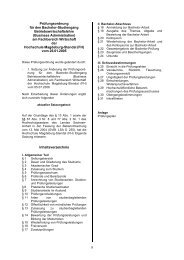Rektoratsbericht 2009 - Hochschule Magdeburg-Stendal
Rektoratsbericht 2009 - Hochschule Magdeburg-Stendal
Rektoratsbericht 2009 - Hochschule Magdeburg-Stendal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Rektoratsbericht</strong><br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
<strong>2009</strong><br />
gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 HSG LSA<br />
in Verbindung mit den Zielvereinbarungen zwischen dem<br />
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt und der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 16.05.2005, Anlage 6<br />
gemäß § 67 Abs. 2 am 10.02.2010 vom Senat erörtert<br />
gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 3 HSG LSA vom Kuratorium der<br />
<strong>Hochschule</strong><br />
am 09.03.2010 entgegengenommen.<br />
<strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong>, den 28. April 2010
Seite 2
Inhalt<br />
1 Strukturentwicklung ................................................................................................ 7<br />
2 Lehre, Studium, Weiterbildung............................................................................. 10<br />
2.1 Ausbildungskapazität und Struktur des Lehrangebots ............................................ 10<br />
2.1.1 Nachfrage nach Studienplätzen............................................................................... 10<br />
2.1.2 Nachfrage nach Studienplätzen im Detail................................................................ 11<br />
2.1.2.1 Erfüllung der Zielzahlen für Bachelorstudiengänge ................................................. 11<br />
2.1.2.2 Nachfrage nach Studienplätzen in Masterstudiengängen ....................................... 11<br />
2.1.2.3 Weiterbildungsstudiengänge ................................................................................... 11<br />
2.1.3 Erfüllung der Zielzahl 3.500 Studierende an der <strong>Hochschule</strong>.................................. 11<br />
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Absolventinnen und Absolventen.................................... 12<br />
2.1.5 Kapazitätsberechnung ............................................................................................. 13<br />
2.1.6 Steuerung der Kapazitäten ...................................................................................... 13<br />
2.2 Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master) .................................................. 14<br />
2.2.1 BA-Studiengänge..................................................................................................... 14<br />
2.2.2 MA-Studiengänge .................................................................................................... 15<br />
2.2.3 Akzeptanz der Abschlüsse ...................................................................................... 17<br />
2.3 Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden,<br />
Absolventenquote .................................................................................................... 18<br />
2.3.1 Auswahl von Studienbewerbern .............................................................................. 18<br />
2.3.2 Betreuung der Studierenden.................................................................................... 18<br />
2.3.3 Absolventinnen- und Absolventenquote .................................................................. 19<br />
2.4 Weiterbildung........................................................................................................... 19<br />
2.4.1 Entwicklung der Weiterbildung an der <strong>Hochschule</strong> ................................................. 19<br />
2.4.1.1 Strukturelle Entwicklung an der <strong>Hochschule</strong> ........................................................... 19<br />
2.4.1.2 Weiterbildungsangebote, Teilnehmerzahlen und Gebühreneinnahmen.................. 21<br />
2.4.2 Selbstverständnis, Wirkung und Arbeitsbereiche des Zentrums für<br />
Weiterbildung........................................................................................................... 22<br />
2.4.3 Entwicklung der einzelnen Arbeitsbereiche am Zentrum für Weiterbildung............. 22<br />
2.4.3.1 Sprachen und Kommunikation................................................................................. 22<br />
2.4.3.2 Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften ................................................................. 23<br />
2.4.3.3 Studium Generale.................................................................................................... 23<br />
2.4.3.4 Mitarbeiterweiterbildung........................................................................................... 23<br />
3 Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer,<br />
Regionalbezug ....................................................................................................... 25<br />
3.1 Drittmittelaufkommen im Bereich Forschung und Entwicklung................................ 25<br />
3.2 Innovation/Wissens- und Technologietransfer und Existenzgründung –<br />
Entwicklung der Strukturen des Technologietransfers ............................................ 25<br />
3.2.1 KAT – Konsequente Fortführung des Ausbaus von leistungsfähigen<br />
ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzfeldern/Industrielaboren an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ..................................................................... 25<br />
3.2.2 Kabelnetzlabor – Institut für Elektrotechnik ............................................................. 27<br />
3.2.3 Schutzrechtsarbeit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Jahr <strong>2009</strong>........... 27<br />
3.2.4 Entwicklung von Existenzgründungsvorhaben <strong>2009</strong> ............................................... 28<br />
3.2.5 Entwicklung von Strukturen im Technologietransfer................................................ 29<br />
4 Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung.................................. 34<br />
4.1 Qualitätsbestimmung und -entwicklung in Studium, Lehre und Forschung............. 34<br />
4.2 Akkreditierung.......................................................................................................... 37<br />
4.3 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren ........................................ 37<br />
Seite 3
5 Internationalisierung ............................................................................................. 39<br />
5.1. Einleitung ................................................................................................................. 39<br />
5.2 Auslandsstudium und EU-Programme .................................................................... 40<br />
5.3. Projektbezogene Kooperationen - Dozentenaustausch .......................................... 41<br />
5.4 Ausländerstudium .................................................................................................... 41<br />
5.5 Mitteleinwerbung...................................................................................................... 43<br />
5.6 German-Jordanian-University (GJU) ....................................................................... 43<br />
6 Tätigkeitsbericht im Rahmen der Zielsetzungen Chancengleichheit<br />
und Familiengerechtigkeit .................................................................................... 45<br />
6.1 Schwerpunktsetzung ............................................................................................... 45<br />
6.2 Statistik .................................................................................................................... 45<br />
6.3 Fördermaßnahmen .................................................................................................. 45<br />
6.4 Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie ......................................................... 46<br />
6.4.1 Kinderbetreuung ...................................................................................................... 46<br />
6.4.2 Audit Familiengerechte <strong>Hochschule</strong> ........................................................................ 46<br />
6.4.3 Hochschulübergreifende Koordination..................................................................... 47<br />
7 Hochschulmarketing ............................................................................................. 48<br />
7.1 Hochschulübergreifendes Marketing – Beteiligung am Landesmarketing............... 48<br />
7.2 Hochschulspezifisches Marketing............................................................................ 49<br />
7.3 Erste Ergebnisse ..................................................................................................... 51<br />
8 Verhältnis Staat und <strong>Hochschule</strong> – Flexibilität und<br />
Eigenverantwortung .............................................................................................. 52<br />
8.1 Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt .................................................................. 52<br />
8.2 Stärkung interner Selbststeuerung .......................................................................... 52<br />
8.2.1 Stand der hochschulinternen, leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM)............. 53<br />
8.2.2 Entwicklungsstand des Controllings/Kosten- und Leistungsrechnung .................... 54<br />
8.2.2.1 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).................................................................... 54<br />
8.2.2.2 Operatives Controlling ............................................................................................. 55<br />
8.2.2.2.1 Kennzahlensystem/Balanced Scorecard ................................................................. 55<br />
8.2.2.2.2 Zur Messung der Abbrecherquote: Verbleibsquoten nach Studiengang ................. 55<br />
8.2.2.2.3 Interne Planungsmodelle ......................................................................................... 57<br />
8.2.2.2.4 Sonstige operative Arbeiten im Controllingbereich.................................................. 59<br />
8.2.3 Leistungsmessung und Leistungserfassung im Rahmen des akademischen<br />
Controllings.............................................................................................................. 60<br />
8.2.3.1 Kontrolle der Deputate............................................................................................. 60<br />
8.2.3.2 Quantitative Leistungserfassung ............................................................................. 60<br />
8.2.3.3 Qualitative Leistungsbewertung, interne Evaluation und Qualitätssicherung .......... 62<br />
8.2.3.4 Benchmarking.......................................................................................................... 65<br />
8.2.4 Strategisches Controlling......................................................................................... 66<br />
8.2.5 Schaffung eines Data-Warehouse-gestützten zentralen<br />
Informationssystems................................................................................................ 67<br />
8.2.6 Regelungspflichten .................................................................................................. 67<br />
8.3 Flexible Ressourcenbewirtschaftung ....................................................................... 67<br />
8.3.1 W-Besoldung ........................................................................................................... 67<br />
8.3.2 Ausblick auf den Wirtschaftsplan 2010/11 sowie zur mittelfristigen<br />
Finanzplanung 2012 bis 2014.................................................................................. 68<br />
8.3.2.1 Entwicklung der Rücklage ....................................................................................... 68<br />
8.3.2.2 Finanzielle Situation................................................................................................. 68<br />
8.3.2.3 Titelgruppe 96.......................................................................................................... 68<br />
8.3.2.4 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren ........................................ 68<br />
Seite 4
8.4 Hochschulbau, Flächenmanagement, Bauunterhalt und Liegenschaften ............... 69<br />
8.4.1 Sachstand zur Einführung des Facility Managements und interner<br />
Flächenmanagementmodelle zur wirtschaftlichen Flächennutzung ........................ 69<br />
8.4.2 Sachstand zu den Großen Baumaßnahmen ........................................................... 69<br />
8.4.2.1 Sanierung Haus 1 der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong> ............................ 69<br />
8.4.2.2 Neubau der Mensa der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong>........................... 69<br />
8.4.3 Sachstand zu den Kleinen Baumaßnahmen ........................................................... 70<br />
8.4.3.1 Kleine Baumaßnahmen im Zuge der Hochschulstrukturreform............................... 70<br />
8.4.3.2 Weitere Kleine Baumaßnahmen.............................................................................. 70<br />
8.4.4 Sachstand zum Bauunterhalt................................................................................... 70<br />
8.4.5 Entwicklungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung......................................... 71<br />
8.5 Informations- und Kommunikationstechnologien..................................................... 71<br />
Anhang zum <strong>Rektoratsbericht</strong> <strong>2009</strong> ....................................................................................... 75<br />
Anhang 1: Struktur- und Leistungsdaten der <strong>Hochschule</strong>.......................................................... 75<br />
Anhang 2: Firmenkontaktmesse................................................................................................. 77<br />
Anhang 3: Career Center ........................................................................................................... 78<br />
Anhang 4: Fragebogen SQM (Ausschnitt) ................................................................................. 80<br />
Anhang 5: Internationalität (Ein Beispiel) ................................................................................... 82<br />
Anhang 6: Fragebogen Studienabbruch .................................................................................... 83<br />
Anhang 7: Scouts....................................................................................................................... 86<br />
Anhang 8: Zweitschönster Campus Deutschlands..................................................................... 89<br />
Anhang 9: Chancen der Studierendenwerbung ......................................................................... 90<br />
Anhang 10: Spatenstich Mensa ................................................................................................. 91<br />
Seite 5
Seite 6
1 Strukturentwicklung<br />
Im Jahre <strong>2009</strong> hat sich die <strong>Hochschule</strong> enorm weiterentwickelt. Grundlage hierfür war sicherlich<br />
die Tatsache, dass die belastenden Auswirkungen der Hochschulstrukturreform von 2004 weitgehend<br />
überwunden sind. So konnte sich die <strong>Hochschule</strong> wieder verstärkt auf ihre Kernaufgaben<br />
konzentrieren. Und dies war in der Lehre die Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses<br />
und in der Forschung ein enormer Aufwuchs der Drittmittel.<br />
Auch wenn es z. B. im Fachbereich Bauwesen noch einige Doppelbesetzungen gibt, die aus<br />
der Übersiedlung der Bauingenieure der <strong>Hochschule</strong> Anhalt (FH) als Ergebnis der Hochschulstrukturreform<br />
resultieren, hat sich der Fachbereich doch insgesamt konsolidiert. Durch<br />
Unterstützung der gesamten <strong>Hochschule</strong> konnten im personellen Bereich Lücken geschlossen<br />
und neue Berufungen auf den Weg gebracht werden. Im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen,<br />
der große personelle Überhänge zu bewältigen hatte, konnten diese zwar noch<br />
nicht vollständig abgebaut werden, aber durch interne Umstrukturierungen und durch Altersabgänge<br />
hat sich die Situation deutlich entspannt, so dass auch in diesem Fachbereich die<br />
notwendige Besetzung von so genannten Eckprofessuren in Angriff genommen und teilweise<br />
schon vollzogen werden konnte. Für die beiden genannten Fachbereiche ist dies entlastend<br />
und stellt eine erfreuliche Entwicklung dar. Für die <strong>Hochschule</strong> insgesamt bedeutet dies, dass<br />
die aufgrund der personellen Verwerfungen notwendig gewordenen Verschiebungen in der Personalstruktur<br />
zwischen den Fachbereichen weitgehend korrigiert werden konnten und die<br />
Personalentwicklung in der <strong>Hochschule</strong> insgesamt zunehmend strukturgerecht verläuft.<br />
Weiterhin keine Berücksichtigung fanden bisher die Forderungen der <strong>Hochschule</strong>, die finanzielle<br />
Benachteiligung, die aufgrund der Verstetigung des im Jahre 2002 aus anderen Gründen<br />
abgesenkten Haushaltsansatzes entstanden ist, auszugleichen. Obwohl die <strong>Hochschule</strong> in den<br />
vergangenen Jahren durch interne Haushaltssperren und andere Sparmaßnahmen einen großen<br />
Eigenbeitrag zum Ausgleich dieser Finanzlücke geleistet hat, bleibt aktuell noch ein Defizit<br />
von ca. 600T€/Jahr, das für den neuen Budgetzeitraum (ab 2011) zusätzlich angemeldet wurde.<br />
Das Ministerium hat die Aufnahme dieser zusätzlichen Mittel in den Wirtschaftsplan zwar nicht<br />
akzeptiert, aber eine Neuberechnung im Rahmen des Vollzugs in Aussicht gestellt.<br />
In Erfüllung der Koalitionsvereinbarung von 2005 hat die <strong>Hochschule</strong> darüber hinaus – und dies<br />
hat ebenfalls Auswirkungen auf die Personalstruktur – am Standort <strong>Stendal</strong> den Studiengang<br />
„Bildung Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von Kindertageseinrichtungen“ eingerichtet.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> ist dabei, da hierfür weder zusätzliche Stellen noch zusätzliche<br />
Finanzmittel zur Verfügung standen, in Vorleistung getreten. Allerdings gibt es seitens des Kultusministeriums<br />
die Zusage, dass bei dem Abschluss der nächsten Zielvereinbarungen die<br />
notwendigen Mittel eingeplant und die zusätzlichen Stellen bereitgestellt werden, so dass die für<br />
diesen Studiengang „ausgeliehenen“ Stellen wieder zurückgeführt werden können. Die zusätzlich<br />
benötigten Mittel für Personal- und Sachausgaben in Höhe von 220T€/Jahr sind für den<br />
neuen Budgetzeitraum gegenüber dem Ministerium geltend gemacht worden. Die Berücksichtigung<br />
ist ebenfalls im Rahmen des Vollzugs in Aussicht gestellt worden.<br />
Bundesweit hat die Diskussion um den Bologna-Prozess im abgelaufenen Jahr zugenommen<br />
und dabei teilweise Züge angenommen, die nicht selten geprägt waren von unsachlichen bzw.<br />
populistischen Argumenten und damit Verantwortungslosigkeit gegenüber den Studierenden,<br />
da dies – einen Weg zurück kann es nicht geben – nur zu weiterer Verunsicherung führt. Dabei<br />
ist gerade mit Blick auf die Studierendenschaft ein hohes Maß an Sensibilität, Dialogbereitschaft<br />
und Unterstützung notwendig, um die – teilweise sicherlich nicht einfachen – Konsequenzen<br />
und Belastungen des Bologna-Prozesses bei der Umsetzung zu bewältigen. So kam der<br />
Bildungsstreik im Herbst letzten Jahres nicht überraschend, obwohl hier sicherlich noch einige<br />
andere Beweggründe eine Rolle spielten.<br />
Seite 7
Von all diesem blieb die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) verschont, um nicht zu sagen:<br />
unberührt. Dies auf mangelndes Problembewusstsein bzw. Engagement der Studierenden zurückzuführen,<br />
geht sicherlich an der Sache vorbei, was Gespräche mit der Studierendenschaft<br />
unterstreichen. Vielmehr ist es der <strong>Hochschule</strong> wohl offensichtlich gelungen, diesen schwierigen<br />
Prozess nicht nur frühzeitig, sondern auch verantwortungsbewusst und weitsichtig<br />
anzugehen. Als richtig erweist sich dabei aus heutiger Sicht noch einmal, dass die <strong>Hochschule</strong><br />
die Umstellung auf die neuen Studienformen zum Wintersemester 2005/06 – auch gegen einige<br />
interne Widerstände – in allen Studienprogrammen vollzogen hat. Notwendige Korrekturen –<br />
insbesondere an den Curricula – wurden kontinuierlich im Prozess der Umsetzung vorgenommen.<br />
So veranlassten die in der Öffentlichkeit heftig diskutierten ersten Meldungen über erhöhte<br />
Abbrecherquoten1, die einer HIS-Studie zu Grunde lagen, auch unsere <strong>Hochschule</strong>, die Fächerdichte<br />
in einigen Studiengängen noch einmal zu überprüfen und z. B. auch vermehrt<br />
Brückenkurse bzw. Tutorien einzurichten. Im Ergebnis führte dies zu einer Reihe von Änderungssatzungen<br />
und in der Konsequenz zur Senkung von Abbrecherquoten in besonders<br />
auffälligen Bereichen. Dass die Fachhochschulen sich insgesamt mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses<br />
aufgrund ihrer Fächerstruktur bzw. den Lehr- und Lernformen leichter tun als<br />
der universitäre Sektor, soll an dieser Stelle – ohne dies zu vertiefen – nicht unerwähnt bleiben.<br />
Sehr erfolgreich betätigte sich die <strong>Hochschule</strong> im Jahr <strong>2009</strong> auch bei der Drittmitteleinwerbung.<br />
So wurde nicht nur das Bildungsexportprojekt „German-Jordanian-University (GJU)“, bei dem<br />
die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) die federführende <strong>Hochschule</strong> auf deutscher Seite ist,<br />
vom DAAD für vier Jahre mit einem Fördervolumen von über 3 Millionen Euro verlängert. Auch<br />
in einem anderen, sehr prestigeträchtigen Förderprogramm der Bundesregierung, nämlich der<br />
Formatinitiative, erhielt die <strong>Hochschule</strong> einen Zuschlag. Für einen Förderzeitraum von zwei Jahren<br />
beträgt das Fördervolumen ca. 1,8 Millionen Euro. So kann die <strong>Hochschule</strong> inzwischen mit<br />
Recht sagen, zu den forschungsstarken Fachhochschulen in der Republik zu gehören. Besonders<br />
erfreulich ist dabei, dass ein Großteil des Fördervolumens in so genannten peer-reviewed-<br />
Projekten eingeworben wurde. Dies ist insbesondere wichtig im Hinblick auf eine Mitgliedschaft<br />
in der European University Association (EUA), die die <strong>Hochschule</strong> anstrebt. Denn die Aufnahmekriterien<br />
sind nach dem Grundsatzbeschluss der EUA, Fachhochschulen unter bestimmten<br />
Voraussetzungen die Vollmitgliedschaft zu ermöglich, sehr eng, weshalb erst ca. 10 Aufnahmeanträge<br />
von Fachhochschulen positiv beschieden wurden. Insofern unterstreicht die Aussicht<br />
auf eine Mitgliedschaft in der EUA allein schon die Position, die die <strong>Hochschule</strong> inzwischen im<br />
Konzert der Fachhochschulen bundesweit einnimmt.<br />
Dies wirft natürlich auch Fragen auf im Hinblick auf die Qualifizierung des wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses bzw. die Fördermöglichkeiten von Fachhochschulabsolventen/-innen in diesem<br />
Kontext. Zwar ist die Zahl der abgeschlossenen Promotionen von Fachhochschulabsolventen/innen<br />
nach einer Studie der HRK insgesamt gestiegen, aber noch immer liegen die Anforderungen<br />
für Fachhochschulabsolventen/-innen im Vergleich zu den Universitätsabsolventen/-innen<br />
deutlich höher, das heißt, vor Einstieg in ein Promotionsverfahren müssen sich z. B. vielfach<br />
auch Absolventen/-innen von Masterstudiengängen an Fachhochschulen – trotz formaler<br />
Gleichstellung – so genannten Eignungsfeststellungsprüfungen unterziehen.<br />
Auf der anderen Seite gibt es auch von unserer <strong>Hochschule</strong> sehr intensive Forschungskooperationen<br />
mit Universitäten, in deren Rahmen auch Fachhochschulabsolventen/-innen beabsichtigen<br />
zu promovieren. Inwieweit diese Forschungsverbünde Berücksichtigung finden im<br />
Rahmen der von der Bundesregierung ins Auge gefassten Förderung von ausgewählten kooperativen<br />
Forschungs- und Graduiertenkollegs, kann hier noch nicht beantwortet werden. Die<br />
diesbezügliche Ausschreibung und die Begutachtung der eingereichten Anträge, die mit Sicherheit<br />
auch von unserer <strong>Hochschule</strong> kommen, könnten noch im laufenden Jahr erfolgen.<br />
In diesem Kontext zu nennen sind auch Bemühungen, die Kooperation zwischen der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) und der benachbarten Otto-von-Guericke-Universität zu intensivie-<br />
1 Genauer müsste man in vorliegendem Fall von Schwundquote sprechen. Vgl. hierzu Kapitel 8.2.2.2.2.<br />
Seite 8
en. Dies bezieht sich einmal auf die kooperativen Promotionsverfahren, wobei die bisherigen<br />
Verfahren eher singulär waren, die Hürden für Fachhochschulabsolvent/innen vergleichsweise<br />
hoch und die betreuenden Fachhochschulprofessor/innen nicht in die Begutachtungen und Prüfungen<br />
einbezogen waren. Es zielt aber auch auf eine engere Verzahnung ausgewählter<br />
Studienprogramme beider Einrichtungen und gemeinsame Forschungsaktivitäten. Die einmal<br />
im Semester geplanten gemeinsamen Sitzungen der Rektorate sollen diesen Prozess vorbereiten<br />
und begleiten.<br />
Seite 9
2 Lehre, Studium, Weiterbildung<br />
2.1 Ausbildungskapazität und Struktur des Lehrangebots<br />
2.1.1 Nachfrage nach Studienplätzen<br />
Die Zahl der Bewerbungen für das Wintersemester <strong>2009</strong>/10 lag mit 6.099 nahezu auf dem Niveau<br />
des Vorjahres. Der Rückgang beträgt etwa 1,7 %. Dieser Rückgang muss angesichts der<br />
demografischen Entwicklung interpretiert werden, denn <strong>2009</strong> verließen im Vergleich zum Vorjahr<br />
allein in Sachsen-Anhalt etwa 21 % weniger Schulabgänger mit einer Hochschulzugangsberechtigung<br />
die Schulen. Diese Entwicklung lässt sich im Großen und Ganzen auf alle neuen<br />
Länder übertragen. Bedenkt man zusätzlich, dass die <strong>Hochschule</strong>n in den letzten Jahren noch<br />
vom doppelten Abiturjahrgang (2007) im Lande profitiert haben, so erscheint der geringe Rückgang<br />
in einem anderen Licht.<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Anfängerinnen und Anfänger sowie Bewerberinnen und Bewerber<br />
3372<br />
959<br />
3424<br />
10 0 9<br />
Bewerber<br />
Anfänger<br />
3891<br />
12 9 7<br />
3818<br />
12 7 3<br />
4569<br />
15 8 2<br />
5335<br />
16 9 9<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong> WS<br />
09/10<br />
5220<br />
Abb. 1: Bewerberinnen und Bewerber sowie Neu-Immatrikulierte<br />
Beim Vergleich der Zahl der Studienanfänger im WS <strong>2009</strong>/10 mit den Vorjahren muss berücksichtigt<br />
werden, dass in einigen Studiengängen der <strong>Hochschule</strong> auch zum Sommersemester<br />
immatrikuliert wird, so dass schon heute zu sehen ist, dass auch im akademischen Jahr 2010<br />
eine Zahl zwischen 1.700 und 1.800 erreicht wird. Die <strong>Hochschule</strong> gewinnt, was auch in der<br />
Analyse der Bewerberzahlen zum Ausdruck kommt, an überregionaler Ausstrahlungskraft. Zum<br />
Wintersemester <strong>2009</strong>/102 kamen etwa 37 % der Bewerberinnen und Bewerber aus Sachsen-<br />
Anhalt, etwa 25 % aus den übrigen neuen Bundesländern, über 3 % aus Berlin und über 34 %<br />
aus den westdeutschen Bundesländern.<br />
2 Diese Prozentsätze beziehen sich nur auf die Bachelor-Studiengänge, die im Rahmen des Hochschulpakts<br />
2020 eine herausgehobene Rolle spielen.<br />
Seite 10<br />
2055<br />
4811<br />
12 3 8<br />
5510<br />
14 3 4<br />
6308<br />
16 17<br />
6590<br />
17 9 5<br />
6099<br />
15 2 3
2.1.2 Nachfrage nach Studienplätzen im Detail<br />
2.1.2.1 Erfüllung der Zielzahlen für Bachelorstudiengänge<br />
Die Vorgaben des Landes im Kalenderjahr <strong>2009</strong>, mindestens 1.053 Bewerberinnen und Bewerber<br />
in die Bachelorstudiengänge (1. Fachsemester) zu immatrikulieren, wurden mit einer Zahl<br />
von 1.512 genauso übertroffen wie die Zielzahl gemäß Hochschulpakt 2020 in Höhe von 1.078<br />
Studienanfängerinnen und Anfängern im 1. Hochschulsemester mit 1.267.<br />
Gegenüber 2008 stieg die Zahl der Neuimmatrikulierten in den Bachelorstudiengängen nochmals<br />
um 7,3 % (1. HS um 4,9 %). Da in diesem Jahr nur etwa 84 % der Studienanfänger ins 1.<br />
Hochschulsemester (Vorjahr 86 %) immatrikuliert wurden, manifestiert sich der Aufbau der<br />
Überlast der <strong>Hochschule</strong> weiter.<br />
Auch hinsichtlich der regionalen Herkunft der Studienanfängerinnen und -anfänger in den Bachelorstudiengängen<br />
kann die <strong>Hochschule</strong> eine zunehmende überregionale Attraktivität<br />
nachweisen:<br />
Kamen im Wintersemester 2008/09 etwa 11,9 % der Studienanfängerinnen und -anfänger aus<br />
den westdeutschen Bundesländern und 2,2 % aus Berlin, so stieg der Prozentsatz für die Herkunft<br />
aus den alten Ländern auf 16,3 % und für Berlin auf 2,8 %. Bezogen auf alle Studiengänge<br />
liegt der Prozentsatz für diejenigen, die aus dem Westen bzw. Berlin kommen, im<br />
Wintersemester <strong>2009</strong>/10 bei über 21 %.<br />
2.1.2.2 Nachfrage nach Studienplätzen in Masterstudiengängen<br />
Die Akzeptanz der Masterstudiengänge entwickelt sich ebenso freundlich. <strong>2009</strong> fingen 187 Absolventen/-innen<br />
in einem Masterstudiengang an, die Zahl liegt 17,5 % über der des Jahres<br />
2008.<br />
2.1.2.3 Weiterbildungsstudiengänge<br />
Auch das Interesse am Weiterbildungsangebot der <strong>Hochschule</strong> erfreut sich steigenden Interesses.<br />
Die Zahl der Neuimmatrikulierten stieg <strong>2009</strong> gegenüber dem Vorjahr um fast 14 % auf 189.<br />
2.1.3 Erfüllung der Zielzahl 3.500 Studierende an der <strong>Hochschule</strong><br />
Aufgrund der hohen Zulassungszahlen kann es nicht verwundern, dass sich die Zahl der Studierenden<br />
weit über der „Ausbildungskapazität“ hält. Im Wintersemester <strong>2009</strong>/10 zählt die<br />
<strong>Hochschule</strong> bei einer Ausbildungskapazität von 3.500 Studienplätzen 6.365 Studierende (6.411<br />
im WS 2008/09).<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
3512<br />
3877<br />
4307<br />
4525<br />
Zahl der Studierenden<br />
5035<br />
5649<br />
6443<br />
6213 6206 6209 6130<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong> WS<br />
09/10<br />
Durchschnitt akadem. Jahr<br />
Abb. 2: Entwicklung der Zahl der Studierenden an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
6365<br />
Seite 11
Bezogen auf die Ausbildungskapazität stellt dies in etwa eine Gesamtlast von 170 % dar. Der<br />
Beitrag der einzelnen Fachbereiche ist, wie folgende Abbildung zeigt, sehr unterschiedlich: Insbesondere<br />
die Fachbereiche Bauwesen und Wirtschaft tragen dazu bei, dass die <strong>Hochschule</strong><br />
ihren Beitrag an Studierenden im Land Sachsen-Anhalt (Diskussion um die 51.000 Studierenden<br />
im Land) halten kann.<br />
400%<br />
350%<br />
300%<br />
250%<br />
200%<br />
150%<br />
100%<br />
50%<br />
0%<br />
HS ges. FB IWID FB BW FB SGW FB WKW FB KuM FB Wirt FB AHW<br />
Abb. 3: Gesamtlast einzelner Fachbereiche3<br />
Dahinter verbirgt sich ein für die <strong>Hochschule</strong> nicht lösbares Steuerungsproblem. In Studiengängen,<br />
die zulassungsbeschränkt sind, bestehen gemäß Kapazitätsrecht kaum Möglichkeiten<br />
der Variation von Zulassungszahlen. In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung ergibt<br />
sich die Gefahr, dass die Zulassungszahlen möglicherweise weit oberhalb der berechneten Kapazität<br />
liegen. An dieser Stelle wird überdeutlich, dass die von den <strong>Hochschule</strong>n erwarteten<br />
Zulassungs- und Bestandszahlen inkompatibel sind. Nur wenn Fachbereiche die Kapazitätsbeschränkungen<br />
aufheben, kann es der <strong>Hochschule</strong> gelingen, die geforderten Bestandszahlen<br />
zu erreichen.<br />
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Absolventinnen und Absolventen<br />
Deutlich spürbar ist nach wie vor die große Belastung der Lehrenden aufgrund der Tatsache,<br />
dass seit letztem Jahr Diplomstudierende ihre Abschlussarbeiten zeitgleich mit den ersten Bachelorabsolventen/-innen<br />
anfertigen. So stieg die Zahl der Absolventen/-innen in diesem Jahr<br />
auf einen neuen Rekord in Höhe von 1.369.<br />
3 IWID: Ingenieurwissenschaften und Industriedesign; BW: Bauwesen; SGW: Sozial- und Gesundheitswesen;<br />
WKW: Wasser- und Kreislaufwirtschaft; KuM: Kommunikation und Medien; Wirt: Wirtschaftswissenschaften;<br />
AHW: Angewandte Humanwissenschaften<br />
Seite 12
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
448<br />
567<br />
600<br />
568<br />
Zahl der Absolventen<br />
665<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Abb. 4: Entwicklung der Zahl der Absolventen/-innen<br />
2.1.5 Kapazitätsberechnung<br />
Die Kapazitätsberechnung für die Aufnahmekapazitäten an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) folgt den Vorgaben des Kultusministeriums und sorgt für eine den Personalkapazitäten<br />
entsprechende Zuordnung von Studienanfängern in die Fachbereiche und deren Studiengänge.<br />
Der Wegfall der CNWs als gesetzliche Vorgabe und deren Ersetzung durch die quantitativen<br />
Studienpläne der jeweiligen Curricula erfordern eine ganz neue strategische Steuerung seitens<br />
der <strong>Hochschule</strong>. Die Aufnahmekapazität in grundständige BA-Studiengänge ist dabei einer der<br />
wichtigsten Parameter. Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erfüllte die Zahl der Studienanfänger<br />
in grundständigen Angeboten in den Jahren 2006, 2007 und 2008 deutlich über die<br />
angesetzten 1053 Studienplätze hinaus.4 Allein in den grundständigen Studiengängen wurden<br />
2008 insgesamt 1.356 Bewerberinnen und Bewerber sowie <strong>2009</strong> 1.512 Bewerberinnen und<br />
Bewerber immatrikuliert, wodurch die mit dem Ministerium vereinbarte Kapazität um 30 % bzw.<br />
fast 50 % überschritten worden ist.<br />
Bezüglich der Fächergruppen gemäß den Vorgaben der Zielvereinbarungen ist und bleibt die<br />
Ausbildung gewährleistet.<br />
2.1.6 Steuerung der Kapazitäten<br />
Mit Umstellung auf das neue System gestaffelter Studiengänge nach dem Bachelor-/Master-<br />
Konzept, stand die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vor der Aufgabe, das vorhandene<br />
Lehrdeputat ausgewogen auf Studiengänge mit stark unterschiedlicher Betreuungsintensität zu<br />
verteilen. Ein besonderes Problem stellten dabei die zusätzlich aufzubauenden betreuungsintensiven<br />
Masterstudiengänge dar, für die an Fachhochschulen hochschulpolitisch keine<br />
zusätzlichen Stellen bereitgestellt werden.<br />
Um den Umgang mit den knappen Ressourcen so effizient wie möglich zu gestalten, hat die<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ein „internes Kapazitätsmodell“5 entwickelt, mit dem eine<br />
Planung der Lehrkapazitäten innerhalb und der Dienstleistungen zwischen den Fachbereichen<br />
möglich ist. An dem über ein Jahr andauernden Projekt, das vom Kapazitätsbeauftragten und<br />
4 Vgl. Aufnahmekapazitäten der staatlichen <strong>Hochschule</strong>n im Studienjahr <strong>2009</strong>/10, Kultusministerium des Landes<br />
Sachsen-Anhalt<br />
5 Vgl. hierzu Seite 58<br />
795<br />
774<br />
907<br />
1122<br />
1369<br />
Seite 13
der Controllerin der <strong>Hochschule</strong> geleitet wurde, haben sich alle Fachbereiche sehr konstruktiv<br />
beteiligt. Mit dem entstandenen Modell können Fachbereiche und Hochschulleitung die Zuordnung<br />
der Lehrkapazitäten zu Studiengängen planen, Veränderungen simulieren und<br />
Fehlentwicklungen vermeiden bzw. korrigieren. Die Dienstleistungen zwischen den Fachbereichen<br />
können quantitativ erfasst und in Zielvereinbarungen vertraglich geregelt werden.<br />
Das Modell schafft eine bisher nicht bekannte Transparenz und ist zu einem wichtigen Steuerungsinstrument<br />
in der <strong>Hochschule</strong> herangereift.<br />
Die gegenwärtige Ausbildungsstruktur ist geprägt durch ein bereits mehrjährig laufendes, umfangreiches<br />
Bachelor-Programm und ein inzwischen vollständig angelaufenes Master-<br />
Programm. Zu jedem Bachelor gibt es konsekutive Master-Angebote.<br />
Die Masterprogramme der <strong>Hochschule</strong> sind inzwischen zunehmend interdisziplinär. Diese Studiengänge<br />
werden für Studierende der beteiligten Disziplinen geöffnet, so dass Interdisziplinarität<br />
als entscheidendes Kriterium nicht nur von den Lehrenden, sondern auch von den<br />
Studierenden gelebt wird, was immer mehr zum essentiellen Kriterium beruflicher Praxis wird.<br />
Diese Masterprogramme vor allem lassen abgesicherte Aussagen über die überregionale Attraktivität<br />
der <strong>Hochschule</strong> zu.<br />
Als Herausforderungen für die Verwaltung bei der Umstellung auf die gestuften Studiengänge<br />
stellt sich inzwischen nicht mehr die komplette Neuerstellung aller Studiendokumente für die<br />
neuen Studiengänge dar, sondern die Erarbeitung der Änderungssatzungen, die zumindest für<br />
alle Bachelor in mindestens erster Fassung vorliegen. Zumeist sind die das Ergebnis von Programmakkreditierung.<br />
So wurden <strong>2009</strong> 15 Änderungssatzungen von Studien- und Prüfungsordnungen<br />
beschlossen und veröffentlicht (darunter Änderungssatzungen der Muster-SPO für<br />
Bachelorstudiengänge und der Muster-SPO für Masterstudiengänge). Weiterhin wurden drei<br />
Studien- und Prüfungsordnungen für neue Studiengänge in den Gremien der <strong>Hochschule</strong> beschlossen.<br />
Das ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) erfordert die Erarbeitung des<br />
Diploma Supplements für alle Studiengänge, die auch für die neuen Studiengänge vollständig<br />
vorliegen und zusammen mit Zeugnissen und Abschlussurkunden an die Absolventen/-innen<br />
ausgereicht werden.<br />
2.2 Neuorganisation des Studiums (Bachelor/Master)<br />
2.2.1 BA-Studiengänge<br />
Entsprechend der Zielvereinbarung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit dem Kultusministerium<br />
laufen 23 der 24 benannten grundständigen BA-Studiengänge.<br />
<strong>2009</strong> wurde die Schließung des Studiengangs B.A. „Interkulturelle Wirtschaftskommunikation“<br />
von den Gremien der <strong>Hochschule</strong> beschlossen und dem Kultusministerium angezeigt, was seinerseits<br />
die Schließung genehmigte. Die Gründe lagen in inhaltlichen Unsicherheiten sowie der<br />
Schwierigkeit, den Studiengang langfristig personell adäquat zu untersetzen.<br />
Diese eine Schließung wird aber mehr als ausgeglichen durch weitere zusätzliche Bachelorstudiengänge,<br />
die die <strong>Hochschule</strong> zusätzlich zur Zielvereinbarung anbietet:<br />
• B.A. „Soziale Dienste in der Justiz“ am FB SGW (seit WS 2008/09) gefördert durch die<br />
Staatskanzlei (PSC)<br />
• B.A. „Angewandtes Innovationsmangement für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ (seit<br />
WS08|09) als berufsbegleitendes Fernstudium, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft<br />
• Beteiligung am B.A. „Berufsbildung“, berufliche Fachrichtung „Bautechnik“ (seit WS<br />
2008/09), mit der Otto-von-Guericke-Universität <strong>Magdeburg</strong><br />
• B.Eng. Dualer BA „Bauingenieurwesen“, 9 Semester<br />
Seite 14
• B.A. „Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von Kindertageseinrichtungen“<br />
am FB AHW (seit SoS <strong>2009</strong>)<br />
Der zuletzt genannte Bachelor ist <strong>2009</strong> erstmalig mit 31 Studierenden gestartet. In Ausführung<br />
der Koalitionsvereinbarung wurde die <strong>Hochschule</strong> durch das Kultusministerium aufgefordert,<br />
diesen BA-Studiengang einzurichten. Der Studiengang ist nach §9 HSG LSA genehmigt und bis<br />
zum 30.4.2014 akkreditiert.<br />
Somit liefen <strong>2009</strong> die folgenden 27 Bachelorstudiengänge an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH):<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.A.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Sc.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
B.Eng.<br />
Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Dualer Studiengang Betriebwirtschaftslehre<br />
Betriebswirtschaftlehre<br />
Fachdolmetschen<br />
Fachkommunikation (ehemals Fachübersetzen)<br />
Gebärdensprachdolmetschen<br />
Gesundheitsförderung und -management<br />
Industrial Design<br />
Journalistik/Medienmanagement<br />
Soziale Arbeit<br />
Soziale Dienste in der Justiz<br />
Angewandtes Innovationsmangement für kleine und mittlere<br />
Unternehmen (KMU), berufsbegleitendes Teilzeitstudium<br />
Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung<br />
von Kindertageseinrichtungen<br />
Angewandte Gesundheitswissenschaften (berufsbegleitendes<br />
Fernstudium)<br />
Rehabilitationspsychologie<br />
Sicherheit und Gefahrenabwehr<br />
Statistik<br />
Betriebswirtschaftslehre (Fernstudium)<br />
Betriebswirtschaftslehre/Sozialversicherungsmanagement<br />
(Fernstudium)<br />
Bauingenieurwesen<br />
Dualer Studiengang Bauingenieurwesen<br />
Elektrotechnik<br />
Mechatronische Systemtechnik (Systems Engineering)<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Maschinenbau<br />
Wasserwirtschaft<br />
Wirtschaftsingenieurwesen<br />
2.2.2 MA-Studiengänge<br />
Das in der Zielvereinbarung festgeschriebene Angebot an 21 MA-Studiengängen läuft an der<br />
<strong>Hochschule</strong> fast vollständig. Manche der MA-Studiengänge erfuhren eine deutlichere Profilierung<br />
als bei der Formulierung der Zielvereinbarungen absehbar war. Zu nennen seien hier der<br />
MA Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft (ehemals MA Soziale Arbeit) oder der MA<br />
Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung (ehemals MA Gesundheitsförderung und -<br />
management) aber auch der MA Risikomanagement, der an die Stelle eines geplanten MA Betriebswirtschaftslehre<br />
tritt.<br />
Seite 15
Der MA Medienmanagement wird unter dem Titel „Media Creative Producing“ angeboten werden.<br />
Seine Einführung hat sich durch andere curriculare Projekte im Fachbereich etwas<br />
verzögert. Es ist vorgesehen, die Zulassungsunterlagen im Mai des Sommersemesters 2010<br />
den Hochschulgremien vorzulegen und danach bei der Agentur ACQUIN die Akkreditierung zu<br />
beantragen. Der Start des MA-Studiengangs MCP ist für den Beginn des Sommersemesters<br />
2011 geplant.<br />
Für den weiterbildenden MA „European Perspectives on Social Inclusion“ wurde vom Fachbereich<br />
SGW die Schließung beantragt, da die Nachfrage dauerhaft stagnierte und trotz<br />
engagierter Werbung nicht zu steigern war. Zu den Gründen gehört sicher die im Rahmen der<br />
Hochschulstrukturreform beschlossene Schließung des ehemaligen Diplomstudiengangs „Heilpädagogik“<br />
und seine Nicht-Fortführung als BA. Der Senat folgte der Argumentation und<br />
beschloss in seiner Dezembersitzung mit Bedauern die Schließung des MA. Die Genehmigung<br />
des Kultusministeriums steht noch aus.<br />
Ergänzend zu den Zielvereinbarungen wurden vor allem weiterbildende MA-Studiengänge etabliert.<br />
Somit werden derzeit insgesamt 21 MA-Studiengänge inkl. 6 weiterbildender Studiengänge<br />
angeboten:<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.Sc<br />
M.Sc.<br />
M.Sc.<br />
M.Sc.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.Eng.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
M.A.<br />
Interaction Design<br />
Sozial- und Gesundheitsjournalismus<br />
(ZV: Journalismus)<br />
Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft<br />
(ZV: Soziale Arbeit)<br />
Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung<br />
(ZV: Gesundheitsförderung und Management)<br />
Engineering Design<br />
Risikomanagement (ZV: Betriebswirtschaftslehre)<br />
Ingenieurökologie<br />
Sicherheit und Gefahrenabwehr<br />
Rehabilitationspsychologie<br />
Maschinenbau<br />
Funkidentifikation/Nahbereichsfunktechnik<br />
Energieeffizientes Bauen (ZV: Hochbau)<br />
Tief- und Verkehrsbau (ZV: Tiefbau)<br />
Regenerative und Rationelle Gebäudeenergiesysteme<br />
(ZV: Regenerative Energien)<br />
Wasserwirtschaft<br />
Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von<br />
Kindern, Jugendlichen und Familien (weiterbildend)<br />
Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis<br />
(weiterbildend)<br />
Innovatives Management (mit Weiterbildungsanteil)<br />
Gesundheitsförderung und -management in Europa<br />
(EUMAPH), weiterbildend<br />
Management im Gesundheitswesen (weiterbildend)<br />
European Master in Sign Language Interpreting (weiterbildend<br />
und trinational)<br />
Der folgende MA-Studiengang ist bereits <strong>2009</strong> genehmigt worden:<br />
M.A.<br />
Seite 16<br />
Interdisziplinäre Therapie psychiatrischer Störungen auf<br />
psychodynamischer Grundlage (weiterbildend)
Abgesehen vom geplanten MA „Media Creative Producing“, der erst 2010 startet, erfüllt die<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) alle in der Zielvereinbarung genannten Verpflichtungen<br />
zur BA-/MA-Struktur und geht durch die zusätzlichen Angebote sogar weit darüber hinaus.<br />
Neben derzeit dezidiert berufsbegleitend angelegten Studiengängen gibt es weitere, vor allem<br />
MA-Studiengänge, die individuell eine Berufstätigkeit ermöglichen, weil sie Teilzeitoptionen<br />
nicht nur wegen einer speziellen sozialen Situation ermöglichen, sondern explizit wegen paralleler<br />
Berufstätigkeit. Diese individuelle Teilzeit-Option ist in der Musterordnung für alle Masterstudiengänge<br />
verankert.<br />
2.2.3 Akzeptanz der Abschlüsse<br />
Die ersten Absolventenjahrgänge haben die <strong>Hochschule</strong> verlassen und die Akzeptanz der neuen<br />
Abschlüsse in Institutionen und Firmen scheint hoch zu sein. Allerdings ist es noch zu früh,<br />
statistisch belastbare Aussagen zu benennen, da eine systematische Absolventenbefragung<br />
erst für 2010 geplant ist.<br />
Schwierigkeiten gibt es beim Übergang unserer Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen an<br />
Masterstudiengänge der Universitäten, wenn dort die Kapazitäten durch eigene Studierende<br />
nachgefragt werden. Konkret wurde <strong>2009</strong> Absolventinnen des BA Rehabilitationspsychologie<br />
der Zugang zum Master Psychologie an der Otto-von-Guericke-Universität-<strong>Magdeburg</strong> verwehrt.<br />
Deshalb ist aktuell mit der Otto-von-Guericke-Universität-<strong>Magdeburg</strong> für Anfang 2010 verabredet<br />
worden, dass sich die Studiendekane/-innen von inhaltlich ähnlichen Fachbereichen<br />
abstimmen und den jeweiligen Wechsel zwischen Bachelor und Master in beide Richtungen<br />
konkretisieren. Im Ergebnis sollen detaillierte Zulassungsvoraussetzungen für die Master zu<br />
mehr Transparenz für alle Studierenden führen. Eine allgemeine Regelung des wechselseitigen<br />
Übergangs in die Masterstudiengänge ist Teil der in der Diskussion befindlichen Kooperationsvereinbarung<br />
zwischen den zwei <strong>Magdeburg</strong>er <strong>Hochschule</strong>n.<br />
Schwierigkeiten gibt es trotz der neuesten Änderungen in den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz<br />
mit der unterschiedlich langen Dauer von Bachelorstudiengängen, wenn die Master<br />
als Zulassungsvoraussetzung z. B. mindestens 210 Credits fordern. Derzeit geht die <strong>Hochschule</strong><br />
mit dem Problem sehr pragmatisch um. Die dreisemestrigen Master sehen einen Passus vor,<br />
der es sechssemestrigen Bachelor-Absolventen/-innen ermöglicht, zusätzliche 30 Credits vor<br />
Beginn des Masterstudiums zu erwerben. Damit gehen wir als „aufnehmende“ <strong>Hochschule</strong> in<br />
die Offensive. Den Fachbereichen, die sechssemestrige Bachelor anbieten, wird empfohlen, in<br />
Einzelfällen den Bachelor-Studierenden die Möglichkeit einzuräumen, durch zusätzliche Leistungen<br />
die fehlenden 30 Credits zu erwerben. Allerdings ist das problematisch, da dieser<br />
Mehraufwand erstens nicht durch unsere Kapazität gedeckt ist und zweitens ein planmäßiges<br />
Überschreiten der Regelstudienzeit bedeutet.<br />
Andererseits hat <strong>2009</strong>, schon vor den Studierendenprotesten, die Diskussion im Bereich Design<br />
und Medien begonnen, sechssemestrige Bachelor auf eine siebensemestrige Studienstruktur<br />
umzustellen.<br />
Besonders erfolgreich war die <strong>Hochschule</strong> in der Anerkennung der Qualifikation ihrer Absolventen/-innen<br />
des Masterstudiengangs "Rehabilitationspsychologie". Diese erfüllen in Absprache<br />
mit den Ministerien (MK und MS) des Landes Sachsen-Anhalt die Zugangsvoraussetzungen<br />
nach § 5 (2) Ziff. 1a PsychThG und sind somit für eine entsprechende weiterführende Ausbildung<br />
zum Psychologischen Psychotherapeuten qualifiziert.<br />
Ferner stellen die Abschlüsse im Bachelor-Studiengang "Rehabilitationspsychologie" bzw. im<br />
von ihm abgelösten Diplom-Studiengang "Rehabilitationspsychologie", die ebenfalls an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erworben werden bzw. wurden, eine Zugangsvoraussetzung<br />
zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten dar.<br />
Seite 17
2.3 Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung der Studierenden, Absolventenquote<br />
2.3.1 Auswahl von Studienbewerbern<br />
Trotz der mit dem reformierten Hochschulzulassungsgesetz möglich gewordenen Auswahl der<br />
Studierenden hat die <strong>Hochschule</strong> im WS <strong>2009</strong>/10 lediglich in 3 der 8 NC-Studiengänge eine<br />
Auswahl durchgeführt. Es handelt sich um Gebärdensprachdolmetschen, Journalistik/Medienmanagement<br />
und Rehabilitationspsychologie.<br />
Hier werden neben der Abiturnote ein fachspezifischer Studierfähigkeitstest, studiengangspezifische<br />
Berufsausbildung bzw. -tätigkeit und Auslandserfahrungen als weitere Kriterien für die<br />
Auswahl herangezogen.<br />
In allen anderen NC-Studiengängen wurden die Plätze nur nach Abiturnote und Wartesemestern<br />
vergeben, da die Wirkung der aufwendigen Auswahlverfahren durch das gleichzeitig<br />
geringe Annahmeverhalten konterkariert wurde. Die Annahmequote war so gering, dass am<br />
Ende für die zu vergebenden 60 % der Plätze Zulassungen für den gesamten in Frage kommenden<br />
Bewerberkreis erteilt wurden, der seinerseits aber nur durch die Abiturnote bestimmt<br />
war.<br />
Wie schon im Jahr 2006 wurde auch im Jahr 2008 eine Befragung der „abgesprungenen“ Bewerber<br />
durchgeführt, die <strong>2009</strong> als Basis für die Betreuung und Information der Bewerber und<br />
Bewerberinnen herangezogen wurde.<br />
2.3.2 Betreuung der Studierenden<br />
Die <strong>Hochschule</strong> schenkt der Betreuung der Studierenden – auch schon vor den Studierendenprotesten<br />
<strong>2009</strong> – besondere Aufmerksamkeit.<br />
Das seit 2006 laufende Tutorienprogramm (finanziert aus den Langzeitstudiengebühren) wurde<br />
<strong>2009</strong> weiter ausgebaut. Es konzentriert sich vornehmlich auf die Bachelorstudierenden, denen<br />
zusätzliche Lehrsituationen in vor allem kleinen Gruppen angeboten werden können. Die Evaluationen<br />
der Tutorien sprechen eine deutliche Sprache: die Studierenden sind überwiegend<br />
geradezu begeistert.<br />
In <strong>2009</strong> wurden 54 Tutorien im Umfang von 62.000 Euro finanziert.<br />
Darüber hinaus wurden in einigen Schwerpunktfächern mit geringen Verbleibsquoten Brückenkurse<br />
vorwiegend im Bereich der Mathematik angeboten. Die Rückmeldungen dazu ermutigen<br />
uns, diese Kurse auch 2010 auf andere Fachbereiche auszudehnen.<br />
Aber Betreuung von Studierenden heißt eben auch Spitzenförderung. Dazu hat die <strong>Hochschule</strong><br />
seit 2006 das Instrument der Meisterklassen eingeführt, das ebenfalls aus Langzeitstudiengebühren<br />
finanziert wird. Dort werden besonders leistungsbereite und leistungsfähige<br />
Bachelorstudierende aufgenommen und durch einen „Meister“ oder „Meisterin“ betreut und in<br />
speziellen Projekten unter besonders guten Rahmenbedingungen gefördert.<br />
<strong>2009</strong> liefen 3 Meisterklassen im Bereich Rehabilitationspsychologie, Medien und Industriedesign,<br />
die mit insgesamt 15.000 Euro gefördert wurden. Während das Thema der Meisterklasse<br />
der Rehabilitationspsychologie "Kontrolliert randomisierte Studie zur Evidenzabsicherung der so<br />
genannten Lernpyramide" war, beschäftigte sich die Industriedesign-Meisterklasse mit dem<br />
Thema "Design for Innovative Communities", das im Februar 2010 in Lugano auf einem internationalen<br />
Symposium vorgestellt wurde.<br />
Um den Studierenden den Start in das Studium weiter zu erleichtern, soll 2010 mit dem Aufbau<br />
eines studentischen Mentorenprogramms6 angefangen werden. Empirische Studien7 zeigen,<br />
6 Siehe hierzu S. 50<br />
Seite 18
dass die Studienbewerber und -bewerberinnen befürchten, dass die in ihrer Schulzeit erworbene<br />
Vorbereitung auf das Studium nicht ausreichen könnte. Tutorate und Mentoren sollen<br />
tatsächliche oder gefühlte Defizite beim Übergang von Schule zu <strong>Hochschule</strong> ausgleichen.8 Die<br />
<strong>Hochschule</strong> verbindet damit die Hoffnung, zum einen noch attraktiver im Wettbewerb um Studierende<br />
zu werden und zum anderen die Schwund-/Abbrecherquote noch weiter senken zu<br />
können.<br />
2.3.3 Absolventinnen- und Absolventenquote<br />
Wie schon im letzten <strong>Rektoratsbericht</strong> ausgeführt, erhebt die <strong>Hochschule</strong> eine Reihe von Kennzahlen<br />
zum erfolgreichen bzw. nicht erfolgreichen Abschluss des Studiums. Die Analysen<br />
dieser Zahlen, für die es auch keine Vergleichszahlen anderer <strong>Hochschule</strong>n gibt, sind augenblicklich<br />
noch dadurch erschwert, dass die Zahl der Absolventenjahrgänge nach der Umstellung<br />
auf das gestufte System noch gering ist. Die Interpretation der vorliegenden Daten ist nur mit<br />
äußerster Vorsicht möglich, da die Höhe der Abbrecherquoten teilweise nicht von der <strong>Hochschule</strong><br />
allein beeinflussbar ist9 oder z.B. auch von der Nachfrage nach Studienplätzen abhängt.<br />
So scheinen stark nachgefragte Studiengänge mit beschränkten Zugangsmöglichkeiten geringere<br />
Abbrecherquoten als weniger nachgefragte nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge<br />
aufzuweisen. Insofern ist, wie dieses Beispiel zeigt, die Auswahl der Maßnahmen zur Erhöhung<br />
der Quote des erfolgreichen Abschlusses ohne detaillierte Analyse nicht möglich. Im vorliegenden<br />
Fall würden z.B. auch weitere Marketingaktivitäten eine tendenzielle Erhöhung der<br />
Absolventenquote mit sich bringen, was allerdings angesichts der demografischen Entwicklung<br />
in Ostdeutschland allerdings nicht einfach werden dürfte. Die weiteren Überlegungen sind dem<br />
Kapitel „Zur Messung der Abbrecherquote: Verbleibsquoten nach Studiengang“10 zu entnehmen.<br />
2.4 Weiterbildung<br />
2.4.1 Entwicklung der Weiterbildung an der <strong>Hochschule</strong><br />
2.4.1.1 Strukturelle Entwicklung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>2009</strong> wurden Strukturen und Prozesse zur Organisation und Umsetzung aller Weiterbildungsaktivitäten<br />
an der <strong>Hochschule</strong> gefestigt und geschaffen. Seit Juni <strong>2009</strong> ist die<br />
Weiterbildungsordnung der <strong>Hochschule</strong>, die durch den Senat beschlossen wurde, in Kraft. Die<br />
vorliegende Ordnung regelt die Ziele, Inhalte, Organisationsformen sowie Durchführung aller<br />
Weiterbildungsangebote der <strong>Hochschule</strong>. Die <strong>Hochschule</strong> sieht es darin als ihre Aufgabe<br />
• wissenschaftliche und forschungsbezogene<br />
• berufsbezogene<br />
• persönlichkeitsbildende und allgemeine Weiterbildungsangebote auf Hochschulniveau<br />
zu fördern und zu etablieren.<br />
7 Nur zwei Fünftel der deutschen Studienanfänger fühlen sich durch die Schule gut oder sehr gut auf das Studium<br />
vorbereitet. Schlecht oder unzureichend vorbereitet fühlt sich knapp ein Drittel. Heine, Ch. u.v.a.: Studienanfänger<br />
im Wintersemester 2007/08; in: HIS: Forum <strong>Hochschule</strong> 16/2008, S. 2 (http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-<br />
200816.pdf)<br />
8 Nur 30 % aller befragten Studienanfänger sagen, dass es hilfreiche Kurse zur Auffrischung oder Ergänzung des<br />
Wissens gibt. Vgl. hierzu Heine, Ch. u.v.a.: Studienanfänger im Wintersemester 2007/08; in: HIS: Forum <strong>Hochschule</strong><br />
16/2008, (http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-200816.pdf)<br />
9 Vgl. Ulrich Heublein/Christopher Hutzsch/Jochen Schreiber/Dieter Sommer/Georg Besuch: Ursachen des Studienabbruchs<br />
in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen, in HIS: Projektbericht Dezember <strong>2009</strong><br />
www.his.de/pdf/21/studienabbruch_ursachen.pdf<br />
10 Vgl. zu detaillierten Ausführungen auch das Kapitel „Zur Messung der Abbrecherquote: Verbleibsquoten nach<br />
Studiengang“ auf Seite 55<br />
Seite 19
Neben der Weiterbildungsordnung wurden auch Prozessmodelle und Leitfäden in der Kommission<br />
für Weiterbildung und durch den Senat bestätigt. In ihnen werden sämtliche<br />
Weiterbildungsaktivitäten von der Idee bis zur Umsetzung in Abläufen und Zuständigkeiten geregelt.<br />
Seit Oktober <strong>2009</strong> tagt die Kommission für Weiterbildung. Durch den Austausch in der Kommission<br />
für Weiterbildung werden die Zusammenarbeit aller Fachbereiche sowie die nachhaltige<br />
und interdisziplinäre Gestaltung von Weiterbildungsangeboten an der <strong>Hochschule</strong> gefördert mit<br />
dem Ziel, über das bisherige Angebot hinaus weitere weiterbildende Studiengänge, -<br />
programme und -angebote zu etablieren.<br />
Die Kommission für Weiterbildung hat folgende Aufgaben:<br />
• Aufbau, Umsetzung und Förderung der Weiterbildung der <strong>Hochschule</strong><br />
• Profilbildung der <strong>Hochschule</strong> auf dem Gebiet der Weiterbildung unter Einbeziehung regionaler,<br />
überregionaler und internationaler Entwicklungen<br />
• Förderung der interdisziplinären Kooperation und Vernetzung zwischen den durchführenden<br />
Institutionen in der Angebotsplanung und -durchführung<br />
• Prüfung und Weiterentwicklung von Prozessmodellen, Leitfäden, Musterdokumenten für<br />
Weiterbildungsangebote<br />
• Prüfung und Beratung der Kostensätze für Leistungen der <strong>Hochschule</strong> aller Weiterbildungsangebote<br />
• Genehmigung von weiterbildenden Studienangeboten mit Vergabe von Credits<br />
• Empfehlung der SPO und der Gebührensatzung an den Senat<br />
• Entwicklung und Prüfung der Evaluationsinstrumente<br />
Neben der Kommission für Weiterbildung ist eine weitere Struktureinheit zu benennen, die seit<br />
<strong>2009</strong> in regelmäßigen Abständen tagt. Der ‚Inner Circle‘ (Arbeitstitel) ist ein monatlich stattfindender<br />
Arbeitskreis zwischen dem Prorektorat für Studium und Lehre, den Rektoratsbeauftragten<br />
für Weiterbildung, dem Zentrum für Weiterbildung sowie Vertretern der Verwaltung,<br />
speziell dem Dezernat für Akademische und Studentische Angelegenheiten. Hier werden inhaltliche<br />
und strategische Entscheidungen, die die Weiterbildung an der <strong>Hochschule</strong> betreffen,<br />
besprochen. Zur Arbeit im Inner Circle gehörten <strong>2009</strong> u. a. Entwicklungen, Empfehlungen und<br />
Entscheidungen zu allgemein gültigen Finanzierungsmodellen von Weiterbildungsangeboten<br />
und die Erstellung von Dokumenten (Letter of Intent und Kooperationsverträge), die als jeweilige<br />
Muster analog zu den Prozessmodellen erstellt wurden. Darüber hinaus wird eine Lösung für<br />
das Problem gesucht, welches sich bei der Akkreditierung der Weiterbildungsstudiengänge ergibt.<br />
Die Forderung der Akkreditierungsagenturen, hauptamtliches Personal in diesen Studiengängen<br />
einzusetzen, kann aufgrund der Gesetzeslage in Sachsen-Anhalt nicht erfüllt werden,<br />
da auch hauptamtlich Lehrende nur in Nebentätigkeit in diesen Studiengängen unterrichten<br />
können. Zur Lösung dieses Problems sollen Gespräche mit dem Kultusministerium erfolgen.<br />
In mehreren Workshops und Tagungen konnte über die Entwicklung der <strong>Hochschule</strong> im Rahmen<br />
der Weiterbildung berichtet werden. Der Austausch mit anderen <strong>Hochschule</strong>n im In- und<br />
Ausland wird intensiv gepflegt und Anregungen eingeholt. <strong>2009</strong> erfolgte u. a. an folgenden Konferenzen,<br />
Tagungen und Workshops eine Teilnahme:<br />
• Erfolgreiche Modelle der Vernetzung und Kooperation von Einrichtungen für Weiterbildung<br />
an <strong>Hochschule</strong>n, Basel, 7. – 8. Mai <strong>2009</strong><br />
• Geschäftsmodelle in der Weiterbildung, 26. Juni <strong>2009</strong> <strong>Magdeburg</strong><br />
• Durchlässigkeit und Anrechnung im Hochschulalltag - Dem lebenslangen Lernen Türen öffnen.<br />
17. Juni <strong>2009</strong>, Brandenburg<br />
• Zukunftsfaktor Weiterbildung – Kluge Konzepte aus der <strong>Hochschule</strong>, 23.09.<strong>2009</strong> <strong>Magdeburg</strong><br />
• Norddeutsche Konferenz für wissenschaftliche Weiterbildung, 14.9.<strong>2009</strong>, Kiel<br />
• Gleichwertig aber andersartig – Zur Rolle der Fachhochschulen: Lehre, Forschung, Weiterbildung;<br />
16. – 17.11.<strong>2009</strong>, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, Stuttgart<br />
Seite 20
• Ars-legendi-Preis in den Geisteswissenschaften, 2.10.<strong>2009</strong>, HRK und Stifterverband für die<br />
dt. Wissenschaft, Heidelberg<br />
• Exploring the Difference: Integrating lifelong Learning into Universities’ Missions, 19.10.<strong>2009</strong>,<br />
DAAD, Berlin<br />
• Lenkungsausschuss Wissenstransferzentren in Sachsen-Anhalt, Ministerium für Wirtschaft<br />
und Arbeit 19.11.<strong>2009</strong><br />
2.4.1.2 Weiterbildungsangebote, Teilnehmerzahlen und Gebühreneinnahmen<br />
<strong>2009</strong> wurden Teilnehmer in 12 weiterbildenden Studiengängen, 13 weiterbildenden Studienprogrammen<br />
und in mehr als 120 weiterbildenden Studienangeboten immatrikuliert. Die<br />
Entwicklung der Teilnehmerzahlen allein in den weiterbildenden Studiengängen der <strong>Hochschule</strong><br />
ist <strong>2009</strong> leicht ansteigend einzuschätzen. Gegenüber den Teilnehmerzahlen im WS 2008/09<br />
sind im WS <strong>2009</strong>/10 ca. 14 % mehr Teilnehmer in den weiterbildenden Studiengängen in den<br />
Fachbereichen zu verzeichnen.<br />
Fachbereich SoS 2008 WS 2008/09 SoS <strong>2009</strong> WS <strong>2009</strong>/10<br />
IWID 57 47 37 26<br />
SGW 207 213 232 235<br />
KuM 7 6 7<br />
Wirtschaft 585 556 666 654<br />
AHW 31 27<br />
Summe 849 817 972 959<br />
Tab.1: Entwicklung der Teilnehmerzahlen in weiterbildenden Studiengängen <strong>2009</strong><br />
Erfreulich ist, dass sich die <strong>Hochschule</strong> <strong>2009</strong> an einer Ausschreibung des Kultusministeriums<br />
Sachsen-Anhalt zur Förderung von online-gestützten Weiterbildungsmasterstudiengängen an<br />
den <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt beteiligte. Zum einen wurde in Kooperation der Institute<br />
Industrial Design und Medien der <strong>Hochschule</strong> der Master „Cross Media“ als Projekt eingereicht.<br />
Zum anderen beteiligte sich die <strong>Hochschule</strong>, speziell das Institut Medien, in Partnerschaft mit<br />
der <strong>Hochschule</strong> Merseburg und der <strong>Hochschule</strong> für Kunst und Design Halle mit dem Projekt<br />
„Online Radio. Aufbau einer online-gestützten Weiterbildung für hoch qualifizierte Fachkräfte mit<br />
innovativen Ansätzen zur Digitalisierung der Radiobranche in Sachsen-Anhalt“ an der Ausschreibung.<br />
Nach mehrmonatigem Auswahlverfahren erhielten beide Projekte der <strong>Hochschule</strong><br />
einen positiven Förderbescheid.<br />
Dabei kommt dem Master „Cross Media“ als Modellprojekt für unsere <strong>Hochschule</strong> ab 2010 eine<br />
besondere Bedeutung zu: Immer stärker finden individuelle Bildungsverläufe und informell erworbene<br />
Kompetenzen Einzelner Einzug in neue flexible Lern- und Bildungsstrukturen. Der<br />
Master „Cross Media“ orientiert sich zielgruppenspezifisch im besonderen Maße an diesem Anspruch.<br />
Neue Wege des Hochschulzugangs und der Anrechnung beruflicher Kompetenzen<br />
werden durch das Zentrum für Weiterbildung begleitet, erprobt und fließen als Erfahrungswerte<br />
in die Umsetzung neuer weiterbildender Masterprogramme zurück.<br />
Die Darstellung der Entwicklung der Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungsmaßnahmen baut<br />
auf der entsprechenden Statistik des <strong>Rektoratsbericht</strong>s von 2008 auf.<br />
FB/ZE 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
BW 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3470,00 €<br />
IWID 19.833,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Wirtschaft 148.681,00 € 249.600,00 € 255.000,00 € 243.315,00 € 316.601,24 €<br />
AHW 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
KuM 12.850,00 € 21.138,00 € 12.000,00 € 28.510,00 € 42.840,00 €<br />
SGW 318.833,00 € 244.426,00 € 256.000,00 € 315.197,00 € 356.752,72 €<br />
WKW 0,00 € 25.484,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Zentrum f. WB - - 0,00 € 0,00 € 33.716,00 €<br />
Transferzent- - - - 0,00 € 7.000,00 €<br />
Seite 21
um<br />
Gesamt 500.197,00 € 541.048,00 € 523.000,00 € 587.022,00 € 760.379,96€<br />
Tab. 2: Entwicklung der Gebühreneinnahmen aus Weiterbildungsmaßnahmen 2005 – <strong>2009</strong><br />
2.4.2 Selbstverständnis, Wirkung und Arbeitsbereiche des Zentrums für Weiterbildung<br />
Das Zentrum für Weiterbildung ist eine zentrale Einrichtung der <strong>Hochschule</strong> und erfüllt die<br />
Funktion als Kompetenz- und Servicezentrum für die Hochschulleitung, die Fachbereiche, die<br />
Gremien, die weiteren zentralen Einrichtungen und die Verwaltung.<br />
Auf der Basis bildungswissenschaftlicher Fachkompetenz koordiniert das Zentrum für Weiterbildung<br />
entsprechend der im Juni <strong>2009</strong> durch den Senat beschlossenen Weiterbildungsordnung<br />
das Weiterbildungsangebot der gesamten <strong>Hochschule</strong> in Zusammenarbeit mit der Kommission<br />
für Weiterbildung, die unter der Leitung der Rektoratsbeauftragten für Weiterbildung seit dem<br />
WS <strong>2009</strong>/10 als eine vom Senat gewählte Kommission ihre Arbeit aufnahm.<br />
Das Zentrum für Weiterbildung ist bereits an der Umsetzung an den Fachbereichen vorhandener<br />
sowie an der Konzeptionierung, Planung und Durchführung neuer Weiterbildungsmaßnahmen<br />
hochschulübergreifend beteiligt. Dabei orientieren sich die Aktivitäten in der Ausrichtung<br />
und Umsetzung neuer Weiterbildungsmaßnahmen auf Konzepte des Lebenslangen Lernens.<br />
<strong>2009</strong> ist eine enge Zusammenarbeit des Zentrums für Weiterbildung vorwiegend mit dem Institut<br />
Kommunikation, den Fachbereichen Wirtschaft und Ingenieurwissenschaft/Industrial Design<br />
gelungen, die sich bereits sehr intensiv gestaltet. Andere Fachbereiche dagegen haben traditionell<br />
ihre Weiterbildungen eher am Fachbereich selbst oder an AN-Instituten angesiedelt. Das<br />
Zentrum für Weiterbildung wird intensiv daran arbeiten, attraktive Bedingungen zu schaffen,<br />
damit weitere Fachbereiche dessen Service- und Dienstleistungen intensiver nutzen.<br />
Die Arbeitsbereiche des Zentrums für Weiterbildung können derzeit wie folgt charakterisiert<br />
werden:<br />
• Sprachen und Kommunikation<br />
• Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften<br />
• Studium Generale<br />
• Mitarbeiterweiterbildung<br />
…<br />
2.4.3 Entwicklung der einzelnen Arbeitsbereiche am Zentrum für Weiterbildung<br />
2.4.3.1 Sprachen und Kommunikation<br />
Die Etablierung dieses Bereichs geht auf die Initiative des Instituts Kommunikation zurück, die<br />
Organisation und Durchführung von weiterbildenden Studienangeboten sowie Studienprogrammen<br />
an das Zentrum für Weiterbildung zu übertragen.<br />
Seit dem Januar <strong>2009</strong> ist das deutschlandweit einmalig angebotene weiterbildende Studienangebot<br />
„Simultandolmetschen in Gerichten und Behörden“ sowie das weiterbildende Studienprogramm<br />
„Dolmetschen und Übersetzen in Gerichten und Behörden“ unter fachlicher Leitung<br />
des Instituts Kommunikation mit der Durchführung im Zentrum für Weiterbildung verankert.<br />
Über Gebühreneinnahmen aus diesen Angeboten konnte seit September <strong>2009</strong> eine halbe Mitarbeiterstelle<br />
am Zentrum für Weiterbildung etabliert werden, die ab 2010 in eine ganze Stelle<br />
münden wird und durch aktuelle Entwicklungen vorangetrieben, mit dem Aufbau und Ausbau<br />
eines Bereichs „Sprachen und Kommunikation“ im Zentrum für Weiterbildung beauftragt ist.<br />
Weitere und neue Programmplanungen sind für 2010 bereits abgeschlossen, die grundsätzlich<br />
auf der Zusammenarbeit zwischen dem Institut Kommunikation und dem Zentrum für Weiterbildung<br />
fußen. Im Jahr <strong>2009</strong> (Stand 03.12.<strong>2009</strong>) wurden durch den Bereich Sprachen und<br />
Kommunikation im Zentrum für Weiterbildung 40 Studierende weitergebildet und Einnahmen in<br />
Höhe von 33.716 € erzielt.<br />
Seite 22
2.4.3.2 Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften<br />
Der Bereich Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften wird durch das Transferzentrum der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), insbesondere der darin vorgesehenen Kontaktstelle für<br />
wissenschaftliche Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte in kleinen und mittleren Unternehmen,<br />
übernommen, welche im Rahmen des operationellen Programms aus Mitteln des<br />
Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Die Aufgabengebiete<br />
dieses Bereichs sind:<br />
• Gestaltung und Bereitstellung von nachfrageorientierten Weiterbildungsprogrammen für<br />
kleine und mittlere Unternehmen sowie Programmkoordination<br />
• Ansprechpartner für Wirtschaftsunternehmen zu Fragen der Weiterbildung<br />
• Beratung zur Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten in Sachsen-Anhalt<br />
Mehrere Weiterbildungsmaßnahmen wurden <strong>2009</strong> durch die Kontaktstelle in diesem Bereich<br />
konzeptioniert, wie z. B. im weiterbildenden Studienangebot „Vertrieb für Ingenieure und technische<br />
Berufe“, welches mit 16 Teilnehmern aus sachsen-anhaltischen Unternehmen erfolgreich<br />
durchgeführt wurde. Weitere Kurse wurden im Rahmen des Studium Generale angeboten und<br />
unter der Kursbetreuung das Transferzentrums organisiert und durchgeführt. Insgesamt wurden<br />
232 Teilnehmer in 18 Kursen weitergebildet. Da das Transferzentrum neben der Kontaktstelle<br />
auch durch das Career Center an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) repräsentiert wird,<br />
sind Weiterbildungsinhalte zum Thema Berufsorientierung und -findung für Studierende eingebracht<br />
worden.<br />
2.4.3.3 Studium Generale<br />
Das Studium Generale, welches auf eine auf die <strong>Hochschule</strong> zugeschnittene und daher definitorisch<br />
eigens ausgerichtete, spezielle inhaltliche Konzeption fußt, wurde <strong>2009</strong> weiter verfolgt<br />
und quantitativ ausgebaut. Erfolgreich war die Zusammenarbeit des Zentrums für Weiterbildung<br />
mit dem Transferzentrum und dem Weiterbildungsverantwortlichen am Standort <strong>Stendal</strong> in der<br />
Organisation und Durchführung des Studium Generale. Seit der Implementierung und Durchführung<br />
des Studium Generale an der <strong>Hochschule</strong> (WS 2008/09) werden seit dem WS <strong>2009</strong>/10<br />
Kurse entsprechend der vorliegenden Konzeption am Standort <strong>Stendal</strong> angeboten.<br />
Semester Angebotene Kurse Teilnehmerzahlen<br />
Wintersemester 2008/<strong>2009</strong> 19 219<br />
Sommersemester <strong>2009</strong> 34 263<br />
Wintersemester <strong>2009</strong>/2010 67<br />
502<br />
(Stand 3.12.<strong>2009</strong>)<br />
(MD: 39 und SDL: 28) (MD: 310 und SDL: 192)<br />
Tab. 3: Kurse und Teilnehmerzahlen im Studium Generale<br />
Im Jahr <strong>2009</strong> wurden im Studium Generale insgesamt 120 Kurse erfolgreich durchgeführt und<br />
darin 984 Teilnehmer weitergebildet.<br />
Gebühren werden im Studium Generale erst ab WS <strong>2009</strong>/10 erhoben, die durch eine seit Juni<br />
<strong>2009</strong> speziell in Kraft getretene Gebührenordnung geregelt werden.<br />
2.4.3.4 Mitarbeiterweiterbildung<br />
Die 2007 begonnenen Englischkurse für Mitarbeiter der <strong>Hochschule</strong>, die im Rahmen der Internationalisierungsstrategie<br />
der <strong>Hochschule</strong> angeboten und finanziert werden, wurden <strong>2009</strong><br />
fortgeführt.<br />
An den Standorten <strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong> fanden Englischkurse für Mitarbeiter statt, die als<br />
Advanced Beginners, Intermediate- und Upper-Intermediate-Course angeboten worden sind. Im<br />
Wintersemester 2008/09 nahmen insgesamt 42 Mitarbeiter beider Standorte an den Kursen teil.<br />
Im Wintersemester <strong>2009</strong>/10 sind derzeit insgesamt 30 Mitarbeiter am Refresher und am Business-English-Course<br />
eingeschrieben. Der Grund für den leichten Rückgang der Teilnehmerzahlen<br />
ist vermutlich durch den Wunsch nach weiterführenden Angeboten gekennzeichnet.<br />
Denn neben den Englischkursen gab es für die Mitarbeiter seit WS 2008/09 auch die Möglich-<br />
Seite 23
keit, mit der Implementierung des Studium Generale in die <strong>Hochschule</strong>, an diesen Kursen teilzunehmen.<br />
Das Angebot wurde von den Mitarbeitern im WS 2008/09 noch zögerlich<br />
wahrgenommen (3 Mitarbeiter). Im WS <strong>2009</strong>/10 ist ein Anstieg der Teilnahme von Mitarbeitern<br />
im Studium Generale, vor allem in den Schwerpunkten Kommunikation, soziale Kompetenz und<br />
Fremdsprachen, zu verzeichnen. Das Zentrum für Weiterbildung bündelt seit dem SoS <strong>2009</strong><br />
kontinuierlich die Anfragen der Mitarbeiter zu inhaltlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen<br />
der Umsetzung von internem Weiterbildungsbedarf. Es wurde <strong>2009</strong> eine Befragung<br />
unter Mitarbeitern durchgeführt, um die Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildung überhaupt<br />
bzw. konkrete Bedarfe der Mitarbeiter zu erheben, die in einem speziellen Programm ab SoS<br />
2010 münden und angeboten werden. Dabei wird das Zentrum für Weiterbildung für die gesamte<br />
<strong>Hochschule</strong> als Koordinierungs- und Organisationseinheit für die Umsetzung der<br />
Mitarbeiterweiterbildung fungieren.<br />
Seite 24
3 Forschung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer,<br />
Regionalbezug<br />
3.1 Drittmittelaufkommen im Bereich Forschung und Entwicklung<br />
Die Auflistung der Drittmittel für Forschung ist aus folgender Darstellung zu entnehmen:<br />
Entwicklung der Drittmittelaufkommen F & E<br />
gelistet nach Fachbereichen bzw. Instituten in den Jahren 2004 – <strong>2009</strong><br />
FB 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Bauwesen 0,00 € 0,00 € 18.248,00 € 11.150,00 € 4.500,00 € 136.935,00 €<br />
Chemie/Pharma. 255.805,44 € 271.342,25 € 183.307,40 € 66.895,41 € 2.000,00 € 0,00 €<br />
Maschinenbau 638.298,12 € 632.269,94 € 574.709,69 € 392.252,07 € 1.049.900,00 € 1.196.719,65 €<br />
Elektrotechnik 214.818,58 € 97.696,93 € 99.910,76 € 40.478,99 € 110.297,85 € 487.308,00 €<br />
Industriedesign 35.851,06 € 63.377,04 € 53.000,00 € 41.870,00 € 33.150,00 € 103.530,00 €<br />
KuM 0,00 € 1.500,00 € 19.160,00 € 0,00 € 63.333,33 € 91.666,67 €<br />
SGW 717.817,82 € 1.060.453,56 € 921.899,69 € 588.880,54 € 489.850,07 € 261.598,63 €<br />
Wirtschaft 243.443,82 € 379.946,66 € 429.820,19 € 388.137,89 € 261.008,00 € 253.860,00 €<br />
AHW 21.001,41 € 29.416,51 € 49.584,39 € 21.206,15 € 34.000,00 € 70.000,00 €<br />
WuK 627.553,49 € 707.146,92 € 615.248,33 € 418.255,68 € 316.210,17 € 308.291,89 €<br />
Gesamt 2.754.589,74 € 3.243.176,81 € 2.964.888,45 € 1.733.128,60 € 2.364.149,42 € 2.909.909,84 €<br />
Tab. 4: Drittmittelaufkommen (Forschung)<br />
Das aufgelistete Drittmittelaufkommen in den einzelnen Fachbereichen ist u. a. ein Indikator für<br />
die Vielfalt der Forschungsaktivitäten in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen der<br />
<strong>Hochschule</strong>. Grundsätzlich ist bei der Interpretation der unterschiedlichen Drittmittelaufkommen<br />
in den Fachbereichen die Tatsache zu berücksichtigen, dass gerade hier in Sachsen-Anhalt,<br />
aufgrund der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur, im Rahmen des Technologie- und Wissenstransfers<br />
ein hohes Maß an Beratungs- und Unterstützungsleistung für die Partner der Region, ohne<br />
formelle Projektdefinition, erfolgt und somit eine große Anzahl von Transferaktivitäten keinen<br />
Einfluss auf die Entwicklung des Drittmittelaufkommens hat.<br />
3.2 Innovation-/Wissens- und Technologietransfer und Existenzgründung<br />
– Entwicklung der Strukturen des Technologietransfers<br />
3.2.1 KAT – Konsequente Fortführung des Ausbaus von leistungsfähigen ingenieurwissenschaftlichen<br />
Kompetenzfeldern/Industrielaboren an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
An der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) werden durch die KAT-Initiative im Umfeld des<br />
Kompetenzzentrums Ingenieurwissenschaften/Nachwachsende Rohstoffe vier äußerst innovative<br />
Forschungsfelder/Industrielabore ausgebaut. Dies sind:<br />
• Innovative Biowerkstoffe (stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe)<br />
• Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)<br />
• Innovative Fertigungsverfahren (IFV)<br />
• Funktionsoptimierter Leichtbau (FOL)<br />
Diese Forschungsfelder konnten sich im Berichtszeitraum, dank der KAT-Förderung im Sinne<br />
einer Anschubfinanzierung, überproportional entwickeln. Wesentliche Entwicklungspotentiale<br />
sind:<br />
• Innovative, Anwendungs- und Markt relevante F&E- Inhalte mit großem Transferpotential<br />
Seite 25
• Aufbau und Etablierung von umfangreichen bzw. grundsätzlich repräsentativen Partnernetzwerken<br />
mit besonderem Focus auf die erweiterte Region<br />
• Aufbau interdisziplinärer Teams in und zwischen den oben genannten Kompetenzfeldern<br />
Durch die forschungsstrategische Schwerpunktsetzung (MK, MW) auf die an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) besonders leistungsfähigen, regional integrierten Ingenieurdisziplinen<br />
konnten insbesondere positive Effekte hinsichtlich des Drittmittelaufkommens in EU- und<br />
BMBF-Programmen, im prosperierenden Aufbau von Partnernetzwerken und außergewöhnlichen<br />
Anlageninvestitionen der Industrie an der <strong>Hochschule</strong> erzielt werden. Dies wird im Folgenden<br />
exemplarisch an einigen Beispielen der einzelnen Forschungsfelder verdeutlicht.<br />
Neben erfolgreichen Projekten zur Einführung von Biowerkstoffen in die Spritzgusstechnologie<br />
zur Herstellung technischer Funktionsbauteile ist die Beteiligung als Forschungspartner im EU-<br />
Projekt „HEELLESS“ ein Hinweis auf die verstärkte Nachfrage und Wahrnehmung der entwickelten<br />
Kompetenzen auch im europäischen Forschungsraum. Inzwischen sind zwei weitere<br />
Akquisitionen im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU (Industry-Academia Partnerships and<br />
Pathways IAPP), deren Ziel der Technologietransfer zwischen KMU und Forschungseinrichtungen<br />
über Personen ist, in Vorbereitung.<br />
Das vom Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau etablierte Partnernetzwerk (Wachstumskern<br />
Alfa Haldensleben) und diverse Projekte mit und für Unternehmen der Region sind bei<br />
zusätzlicher Berücksichtigung der konzipierten Weiterbildungsmaßnahmen (Personalentwicklung<br />
für Composite, PeCom und Denken in Compositen, DiCom) für regionale Unternehmen im<br />
Bereich der Compositefertigung als besondere zusätzliche Leistungen zu erwähnen.<br />
Im Rahmen eines gemeinsamen Akquisitionsvorhabens wurde durch die verantwortlichen Wissenschaftler<br />
der oben genannten Forschungsbereiche ein ForMaT-Projekt zum Thema „Entwicklung<br />
von Mikrowellenverfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Faser-Kunststoffverbunden“<br />
erfolgreich akquiriert. Hierbei handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsprojekt<br />
an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH). Gefördert wird es mit über 1,7 Mio. Euro<br />
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des ForMaT-Programms.<br />
In den nächsten zwei Jahren übernimmt ein Team von zehn Mitarbeitern die vorgesehenen<br />
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Dabei werden die Kompetenzen des Instituts für Elektrotechnik,<br />
Schwerpunkt Zerstörungsfreie Prüfung, des Instituts für Maschinenbau, Schwerpunkt<br />
Leichtbau und des Kompetenzzentrums Ingenieurwissenschaften/Nachwachsende<br />
Rohstoffe in einem interdisziplinären Forschungsteam gebündelt. Die in den KAT-Industrielaboren<br />
„Funktionsoptimierter Leichtbau“ und „Biowerkstoffe“ gemeinsam bearbeiteten F&E-Themen<br />
zu Compositematerialien (Glasfaser- und Naturfaserverbundwerkstoffe) liefern die erforderliche<br />
werkstoffliche Kompetenz für das interdisziplinäre Projekt zur Zerstörungsfreien Prüfung.<br />
Das Team des Industrielabors Innovative Fertigungsverfahren pflegt besonders enge F&E-<br />
Kooperationen mit regionalen Unternehmen des Sondermaschinenbaus (Cluster Sondermaschinen-<br />
und Anlagenbau, SMAB). Durch Mitgliedsunternehmen des Clusters wurden dem an<br />
der <strong>Hochschule</strong> eingerichteten Industrielabor Maschinen und Anlagen im Wert von ca. 2 Mio. €<br />
zur Erprobung und Weiterentwicklung überlassen.<br />
Die etablierte wissenschaftliche Kompetenz zur Entwicklung von „Zukunftstechnologien in der<br />
Präzisionsbearbeitung“ eröffnet neben der breiten Nachfrage im Maschinen- und Fahrzeugbau<br />
signifikante Zukunftspotentiale im Bereich der Erzeugung medizintechnischer Produkte und der<br />
Produkte selbst. In diesen Bereichen könnte die Anwendung der verfügbaren Verfahren zur<br />
Präzisionsbearbeitung zur Herstellung von Implantaten genutzt werden, die nicht nach einer befristeten<br />
Nutzungsdauer, wie heute üblich, ersetzt werden müssen, sondern die Lebensdauer<br />
des Trägers überschreiten. Neben dem Cluster aus Unternehmen des Sondermaschinenbaus<br />
entstand im Berichtszeitraum auch ein Netzwerk für medizintechnische Entwicklungen und Anwendungen.<br />
Seite 26
3.2.2 Kabelnetzlabor – Institut für Elektrotechnik<br />
Im Herbst 2008 wurde der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ein umfangreiches Kabelnetzlabor<br />
von der Firma Nokia Siemens Networks (NSN) in München gespendet und in einer<br />
spektakulären Aktion mit einem historischen Dampfzug nach <strong>Magdeburg</strong> transportiert. Das Labor<br />
umfasst Einrichtungen und Geräte mit einem Gesamtgewicht von etwa 14 t, die in zwei<br />
dicht bepackten Containern von je 7 m Länge untergebracht wurden. Im Frühjahr <strong>2009</strong> wurde<br />
von der Hochschulleitung ein passender Laborraum mit zirka 120 m² Fläche zur Verfügung gestellt.<br />
Dieses in der Hochschullandschaft einzigartige Labor wird es erlauben, ein komplettes Kabelnetz<br />
konzentriert in einem Raum nachzubilden. Damit können die Signalübertragung in<br />
Kabelnetzen und das Verhalten dieser Netze unter verschiedenen Lastsituationen praxisnah<br />
untersucht werden. Solche Untersuchungen sind nicht nur für die Lehre interessant, sie haben<br />
auch eine große praktische Bedeutung, denn Kabelnetze haben sich in den letzten zehn Jahren<br />
von einfachen Verteilnetzen für Ton- und Fernsehrundfunksignale zu vollwertigen Telekommunikationsnetzen<br />
entwickelt, d. h. sie erlauben heute auch die Übertragung von Telefon- und<br />
Datendiensten. Wegen ihrer Breitbandigkeit sind sie herkömmlichen Telefonnetzen hinsichtlich<br />
der übertragbaren Datenraten deutlich überlegen. Allein in Deutschland verfügen die Kabelnetzbetreiber<br />
über mehr als 20 Millionen Anschlüsse. Sie stehen in den Ballungsgebieten in<br />
unmittelbarer Konkurrenz zur Deutschen Telekom AG und stellen einen bedeutenden Faktor im<br />
politisch gewollten Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt dar.<br />
Diese Situation wurde durch den Einsatz moderner Übertragungstechniken ermöglicht, die noch<br />
ständig weiter entwickelt werden, um dem durch das Wachstum des Internets verursachten stetig<br />
steigenden Bedarf an Datenübertragungskapazität gerecht werden zu können.<br />
Eine umfassende Erprobung und Untersuchung neuer Übertragungstechniken ist allerdings in<br />
aktiv genutzten Netzen kaum möglich, weil die Verfügbarkeit und Qualität der übertragenen<br />
Dienste höchste Priorität genießen. Dafür werden realistische Netznachbildungen benötigt, wie<br />
das nun im Aufbau befindliche Kabelnetzlabor. Den damit verbundenen Aufwand können sich<br />
jedoch nur wenige Hersteller oder Netzbetreiber leisten. Die Sachspende hat daher große Aufmerksamkeit<br />
in der Fachwelt erregt und hohe Erwartungen geweckt. Die große Bedeutung, die<br />
dieses von der <strong>Hochschule</strong> als neutrale Instanz betriebene Labor zukünftig für die Kabelnetzbranche<br />
haben könnte, wird schon aus der Vielzahl namhafter Spenden von Netzbetreibern und<br />
Herstellern ersichtlich, mit denen der kostspielige Transport finanziert werden konnte.<br />
3.2.3 Schutzrechtsarbeit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Jahr <strong>2009</strong><br />
Von der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wurden der ESA Patentverwertungsagentur<br />
Sachsen-Anhalt GmbH (ESA PVA) als zentralem Dienstleister der SAFE im Jahr <strong>2009</strong> acht Erfindungsmeldungen<br />
zur Prüfung und Bewertung vorgelegt. Zwei Prüfungen sind noch nicht<br />
abgeschlossen.<br />
Die Erfindung „Planare Antenne auf elektrisch leitender Grundfläche mit weichmagnetischer Antennenstruktur<br />
- DE 10 <strong>2009</strong> 023 745 (unter Nutzung der inneren Priorität DE 10 2008 045 605)<br />
ist angemeldet. Im Rahmen der Verwertung wurde zur tiefergehenden inhaltlich technologischen<br />
Prüfung und zum Austausch von Informationen sowohl mit einem regionalen als auch mit<br />
einem überregionalen Unternehmen ein Non-Disclosure-Agreement abgeschlossen.<br />
Für die Erfindung „Gestengesteuertes MIDI-Instrument“ laufen nach erfolgter Patentanmeldung<br />
(DE 10 2008 020 340) und Internationalisierung derzeit Bemühungen einer internationalen Verwertung<br />
in den USA.<br />
Die Verwertungsanstrengungen für die Erfindung „Schotstopper für Segelboote“ (DE 10 2007<br />
058 466) werden fortgesetzt. Gegenwärtig wird auf der Grundlage eines Non-Disclosure-<br />
Agreements der Inhalt der Patentanmeldung auf Eignung durch einen Patentfond geprüft.<br />
Für das „Verfahren zum Betrieb einer Kläranlage“ (DE 10 2007 034 133) konnte auf der Grundlage<br />
der Patentanmeldung ein Förderprojekt eingeworben werden. Ziel ist es, in Zusammenarbeit<br />
mit einem Industriepartner bis Sommer 2010 den praktischen Nachweis der<br />
Wirtschaftlichkeit der Erfindung zu erbringen und eine Regelungskomponente einschließlich<br />
Seite 27
Software zu entwickeln. Bei positivem Ausgang ist das Partner-Unternehmen an einer Lizenznahme<br />
interessiert.<br />
Die Verwertung der 2007 zum Patent angemeldeten Erfindungen „Einrichtung zur laserbasierten<br />
Werkstückmessung an Drehmaschinen“ (DE 10 2007 061 887, innere Priorität von<br />
DE 10 2007 008 014) und „Einrichtung zur laserbasierten Vermessung von Werkstücken, Baugruppen<br />
und Werkzeugen“ (DE 10 2007 061 886) wird im Paket angestrebt. Eine erste<br />
Patenterteilung unterstützt die Verwertungsbemühungen.<br />
Für den Erfindungskomplex „Kompressionswärmepumpen“ mit drei separaten Erfindungsmeldungen<br />
konnte in Zusammenarbeit mit der SAFE und ESA PVA auch hier eine geförderte<br />
Finanzierung der Patentanmeldungen erreicht werden. Der Antrag auf deutsche Patenterteilung<br />
wurde am 21.12.<strong>2009</strong> beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt. Die Verwertungsverhandlungen<br />
im Sinne einer Kooperation zwischen einem regionalen Unternehmen und<br />
der <strong>Hochschule</strong> schließen sich unmittelbar an.<br />
Für die Erfindung „Miniaturreibschweißspindel“ aus dem Jahr 2008 wurde nach intensiver Arbeit<br />
mit dem Haupterfinder nunmehr am 22.12.<strong>2009</strong> eine Patentanmeldung vorgenommen.<br />
Dagegen wurde die Verwertungsbetreuung für die Anmeldung „Verfahren zur Wandstärkenmessung“<br />
(DE 10 2006 034 458) in Auswertung des zweiten Prüfbescheides des DPMA, der<br />
Vermarktungsaktivitäten und den geführten Erfindergesprächen beendet.<br />
Zusammengefasst lässt sich folgende Statistik der Schutzrechtsbetreuung der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) für das Jahr <strong>2009</strong> aufstellen:<br />
Erfindungsmeldungen: 8 Plan: 4<br />
prioritätsbegründende Patentanmeldungen (DE): 4 Plan: 2<br />
Nachanmeldungen (PCT, EP, DE): 2<br />
Die Schutzrechtsarbeit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erfolgte in Zusammenarbeit<br />
des Prorektorats für Angewandte Forschung, Entwicklung und Technologietransfer und des<br />
Technologie- und Wissenstransferzentrums mit der ESA PVA.<br />
3.2.4 Entwicklung von Existenzgründungsvorhaben <strong>2009</strong><br />
Als zentrale Kontakt-, Beratungs- und Qualifizierungsstelle für Existenzgründer an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) fungiert das Team des Businessplanwettbewerbs Sachsen-<br />
Anhalt des Fachbereichs Wirtschaft am Standort <strong>Stendal</strong>. Das wissenschaftliche Team erfasst,<br />
betreut und qualifiziert seit 2005 im Rahmen einer Initiative des Ministeriums für Wirtschaft und<br />
Arbeit Existenzgründer aus dem Land Sachsen-Anhalt. Die angebotenen Leistungen richten<br />
sich dabei sowohl am Gründungsprozess als auch am individuellen Qualifizierungsbedarf der<br />
Gründer und Gründerinnen aus. Um das Leistungspotential hinsichtlich der Qualität und Effektivität<br />
der Gründungsförderung nachhaltig zu optimieren, kooperiert das Team seit 2008 mit dem<br />
Business Angels Netzwerk Sachsen-Anhalt.<br />
Gemeinsam wurden im Jahr <strong>2009</strong> 109 Gründer/-innen bei ihren insgesamt 65 Vorhaben durch<br />
die Mitarbeiter der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) begleitet und gefördert. Die Bandbreite<br />
der Teilnehmenden reichte von Interessierten mit ernsthaften Gründungsabsichten bis hin zu<br />
bereits im Gründungsprozess fortgeschrittenen Gründern bzw. Jungunternehmern. Zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt wurden <strong>2009</strong> bereits 17 Gründungen realisiert. Der Evaluationsprozess<br />
zu Gründungsgeschehen im Jahr <strong>2009</strong> ist bislang noch nicht abgeschlossen. Konkrete Daten<br />
werden in Kürze verfügbar sein.<br />
Um das Gründungsklima für Studierende, Absolventen/-innen, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen<br />
und Professoren/-innen fortwährend zu verbessern sowie Gründungsprozesse zu beschleunigen<br />
und zu sichern, wurden im Berichtszeitraum verschiedenste Maßnahmen<br />
angeboten. Dies waren unter anderem Workshops und Seminare zum Thema Gründung, Gründer-Coachings<br />
sowie weitere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die Veranstaltung von<br />
Diskussionsrunden am Standort <strong>Magdeburg</strong> sowie die Beteiligung an Messen.<br />
Seite 28
Die durchgeführten Aktivitäten dienen der Sensibilisierung, der Motivierung und der Qualifizierung<br />
von potentiellen Existenzgründern aus der Region sowie von Studierenden und<br />
Absolventen/-innen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH).<br />
Beiträge zur weiteren Stärkung der Gründerdynamik leisteten im letzten Jahr auch wieder zahlreiche<br />
Kooperationen im ego-Netzwerk des Landes Sachsen-Anhalt sowie durch das<br />
Businessplan Team geworbene Sponsoren, die den Gründern auch finanzielle Anerkennung<br />
zukommen ließen.<br />
3.2.5 Entwicklung von Strukturen im Technologietransfer<br />
An der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wurde in den vergangenen Jahren ein weitestgehend<br />
umfassendes Transferkonzept realisiert. Ausgangspunkt hierfür war der konzeptionelle<br />
Ansatz eines erweiterten Transferbegriffes, unter dem jeglicher Output einer Einrichtung des<br />
Wissenschaftssystems subsumiert wird. Hieraus resultiert ein maximiertes Spektrum an<br />
Transfer- und Serviceleistungen durch die <strong>Hochschule</strong> in die Wirtschaft und Gesellschaft<br />
mit primärem Focus auf die Region.<br />
Die durch das Prorektorat für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer (Prorektorat I)<br />
gemeinsam mit dem Technologie- und Wissenstransferzentrum der <strong>Hochschule</strong> (TWZ) realisierte<br />
Transferinfrastruktur beinhaltet als „Schnittstelle zwischen <strong>Hochschule</strong> und<br />
Wirtschaft/Gesellschaft“ alle aktuell verfügbaren Transfereinrichtungen und Transferdienste.<br />
Eine grafische Darstellung ist im Anhang beigefügt.<br />
Im Rahmen der Realisierung wurden in der FEZM GmbH (Forschungs- und Entwicklungszentrum<br />
<strong>Magdeburg</strong>), einem IGZ (Innovations- und Gründerzentrum), das durch Prorektorat und<br />
TWZ seit dem 1.1.<strong>2009</strong> im „Ehrenamt“ betrieben wird, auf einer Fläche von zirka 500 m 2 alle für<br />
den Transfer erforderlichen Einrichtungen und Dienste realisiert.<br />
Der aktuelle Ausbaustand dieses Transfer-Service-Bereiches im „IGZ der <strong>Hochschule</strong>“,<br />
dessen Leistungen für alle externen Partner der Region verfügbar sind, stellt eine nachhaltig<br />
belastbare Transferinfrastruktur dar. Aktuell und mittelfristig werden alle Transferdienste und<br />
entsprechenden Einrichtungen zunehmend unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Effizienz<br />
nachhaltig stabilisiert.<br />
In dieser Konstellation bietet die FEZM GmbH die Infrastruktur für die Vermittlung und Durchführung<br />
bedarfsorientierter, d. h. nachgefragter Dienste in bzw. für die Wirtschaft/Gesellschaft.<br />
Die FEZM GmbH fungiert als Innovations- und Gründerzentrum unter dem besonderen<br />
Aspekt der unmittelbaren Kooperation mit der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in<br />
allen Diensten sowie der Vermarktung von Transferleistungen der <strong>Hochschule</strong>. Hierbei<br />
führt das Technologie- und Wissenstransferzentrum (TWZ) die zentral koordinierende Funktion<br />
aller Einrichtungen und Dienste an der Schnittstelle zwischen <strong>Hochschule</strong> und Wirtschaft/Gesellschaft<br />
aus.<br />
Das TWZ ist eine zentrale Einrichtung der <strong>Hochschule</strong>. Es fungiert in vielen Fällen als erste Anlaufstelle<br />
für externe Partner an der Schnittstelle zwischen <strong>Hochschule</strong> und<br />
Wirtschaft/Gesellschaft. Es ist Kontakt- und Koordinierungszentrum für einen zielgerichteten<br />
Zugang zu den wissenschaftlichen Ressourcen und Serviceleistungen der <strong>Hochschule</strong>.<br />
Aufgabenbereiche und Dienstleistungsspektrum des TWZ in der zentral koordinierenden<br />
Funktion im FEZ, an der Schnittstelle zwischen <strong>Hochschule</strong> und externen Partnern<br />
Die verschiedenen Dienstleistungen und Einrichtungen sind in der Grafik dargestellt:<br />
Seite 29
Abb. 5: Aufgabenbereiche und Dienstleistungsspektrum des TWZ<br />
Technologie- und Wissenstransfer (TWZ; Einrichtung)<br />
Das TWZ ist Ansprechpartner für die Unternehmen und Schaltstelle zu den einzelnen Fachbereichen<br />
bzw. hochschulinternen Experten. Hier werden alle Anfragen bezüglich Forschung,<br />
Förderung, Transfer, Innovation, Personal, Ausschreibungen, Patente, Anpassungsqualifizierung<br />
für KMU etc. erfasst und im Kontext der Leistungen der Gesamttransfer Infrastruktur<br />
bearbeitet.<br />
Ein wichtiges Ziel ist dabei der Aufbau von Vertrauenspartnerschaften zwischen <strong>Hochschule</strong><br />
und Wirtschaft/Gesellschaft (Responsible Partnering nach der Definition im europäischen Wissenschaftsraum,<br />
Empfehlung an die EUA).<br />
Personaltransfer und Personalaustausch (Career Center; Einrichtung)<br />
Das Career Center11 wurde 2004 in Kooperation mit der TÜV-Akademie als Modellprojekt, gefördert<br />
durch das Wirtschaftsministerium, im FEZM eingerichtet. Das Ziel der Arbeit war es, die<br />
hohe Abwanderung von jungen Hochschulabsolventen/-innen aus Sachsen-Anhalt zu reduzieren.<br />
Als konsequente Reaktion auf die erfolgreiche Arbeit im Career Bereich hat das<br />
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit inzwischen ein landesweites Netzwerk von 7 Career Centern<br />
an allen <strong>Hochschule</strong>n und Universitäten aufgebaut. Die Koordinierung dieses Netzwerkes<br />
erfolgt durch ein Projektteam des MW, das ebenfalls im FEZ untergebracht ist.<br />
11 Vgl. hierzu auch den Anhang 2 auf Seite 78<br />
Seite 30
Die Antragstellung für die Projekte im FEZ, wie auch der Entwurf der Antragsunterlagen für das<br />
Netzwerk erfolgte durch das TWZ. In der aktuellen Betriebsphase hat das TWZ die administrative<br />
Koordination der Projekte im FEZ übernommen.<br />
Forschung und Entwicklung (Dienstleistung)<br />
Das TWZ unterstützt und begleitet diverse Großprojekte in der Projektentwicklung, der Antragstellung<br />
und führt das administrative Management durch. Dies bietet den Vorteil, dass alle<br />
administrativen Projektinformationen an einer kompetenten zentralen Stelle bearbeitet werden,<br />
die auch schon in der Phase der Antragstellung federführend involviert war und mit den Inhalten<br />
und Anforderungen des Auftraggebers bestens vertraut ist. Weiterhin werden Unterstützungsleistungen<br />
bei der Personaleinstellung, Investitionsplanung, Berichterstattung etc. erbracht.<br />
Aktuelle Projekte, die diesen Service in Anspruch nehmen, sind „Industrielabore“, „KAT“,<br />
„Transferzentrum“, „Landesstelle zur Koordinierung von Landesinitiativen des Ministeriums für<br />
Wirtschaft und Arbeit“ und „Schutzrechtssicherung durch PVA“.<br />
Wissenschaftliche Weiterbildung als Anpassungsqualifizierung in KMU (Einrichtung)<br />
Hierzu wurde durch das MW ebenfalls ein landesweites Netzwerk der sieben <strong>Hochschule</strong>n und<br />
Universitäten aufgebaut. Das Koordinationsteam arbeitet im FEZ.<br />
Die Anpassungsqualifizierung gerade für KMU in Sachsen-Anhalt ist von sehr großer Bedeutung.<br />
Nicht der akademische Abschluss, sondern die Weiterentwicklung der einzelnen<br />
Mitarbeiter in den Unternehmen ist das avisierte Ziel. Das TWZ leistet Unterstützung bei der<br />
Bedarfsanalyse, der Entwicklung und Vermarktung von wirtschaftlich durchzuführenden Weiterbildungsangeboten<br />
für die Unternehmen der Region. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit<br />
mit dem Zentrum für Weiterbildung der <strong>Hochschule</strong>.<br />
Patentverwertungsagentur Sachsen-Anhalt (PVA, Einrichtung, Mieter im FEZ)<br />
Das lokale Projektmanagement für die <strong>Hochschule</strong> als Partner im Netzwerk der SAFE erfolgt<br />
durch das TWZ. Das TWZ leistet Unterstützung bei der Sensibilisierung des Wissenschaftlers<br />
für die Verwertung seiner Ergebnisse.<br />
In diesem Zusammenhang erfolgt die Vorbereitung der rechtlichen Schritte für die Inanspruchnahme<br />
der Erfindung und die Kontaktherstellung zur PVA im FEZ.<br />
Des Weiteren erfolgt die Organisation von Schulungsveranstaltungen über das TWZ.<br />
Operationeller Betrieb der FEZM GmbH (Dienstleistung, Gründerunterstützung)<br />
Am 01.01.<strong>2009</strong> wurde die Geschäftsführung der FEZM GmbH durch den Prorektor für Forschung,<br />
Entwicklung und Technologietransfer und die Steuerung und Überwachung des<br />
Betriebes im Kontext der vor-Ort-Präsenz durch die Leiterin des TWZ übernommen. Das TWZ<br />
ist der zentrale Ansprechpunkt für alle Projektteams, Institutionen und eingemieteten Firmen.<br />
Im Erdgeschoss der FEZM GmbH wurde der Ausbau der Serviceeinrichtungen der <strong>Hochschule</strong><br />
weiter forciert. Die FEZM GmbH erfüllt somit einerseits die Funktion eines IGZ (junge kooperierende<br />
Firmen in wissenschaftlicher und räumlicher Hochschulnähe) und andererseits beinhaltet<br />
sie die „Schnittstelle zwischen <strong>Hochschule</strong> und Wirtschaft/Gesellschaft“.<br />
Da sich ein stabiler Betrieb im Sinne eines IGZ nicht ausschließlich durch die Mieteinnahmen<br />
realisieren lässt, wird in zunehmendem Maße die Vermarktung von Leistungen der <strong>Hochschule</strong><br />
aufgebaut und professionalisiert. Dem TWZ obliegen somit die Mittlerfunktion in der FEZM und<br />
die Koordination des Transfers zwischen <strong>Hochschule</strong> und Wirtschaft/Gesellschaft. Außerdem<br />
unterstützt das TWZ bei der administrativen Bewirtschaftung der FEZM.<br />
Information und Kommunikation (Dienstleistung)<br />
Das TWZ organisiert und unterstützt Kommissionen und Veranstaltungen. Es vertritt die <strong>Hochschule</strong><br />
im Arbeitskreis „Messen“ der <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland.<br />
Des Weiteren erfolgt die Informationsübermittlung in die <strong>Hochschule</strong> sowie zwischen <strong>Hochschule</strong><br />
und externen Partnern bzw. Behörden. Dies betrifft Informationen über Preisausschreibungen,<br />
Fördermöglichkeiten und Forschungsinformationen etc. sowie Berichterstattungen aus<br />
der <strong>Hochschule</strong> an Ministerien, Wirtschaft und Gesellschaft. Auch die Erfassung der Forschungsdrittmittel<br />
der <strong>Hochschule</strong> wird im TWZ kontinuierlich durchgeführt.<br />
Seite 31
Messen und Veranstaltungen (Dienstleistung)<br />
Die Planung, Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von Messeauftritten in forschungsrelevanten<br />
Bereichen erfolgt über das TWZ.<br />
Auf dem Gemeinschaftsstand „Forschung für die Zukunft“ stellen <strong>Hochschule</strong>n und Universitäten<br />
aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ihre Forschungsergebnisse vor. Außerdem<br />
erfolgt über das TWZ die Organisation von Veranstaltungen, wie z. B. der Forschungsmarkt12<br />
oder auch Sonderausstellungen, wie der Beitrag der <strong>Hochschule</strong> zum Sachsen-Anhalt-Tag oder<br />
ähnliche Veranstaltungen.<br />
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses über das „Studentenbüro für angewandte<br />
fachübergreifende Forschung“ (STAFF; virtuelle Einrichtung)<br />
Die Verzahnung von Forschung und Lehre durch die Qualifizierung von Studenten und Wissenschaftlichen<br />
Hilfskräften in praxisbezogenen, forschungs- und anwendungsrelevanten Tätigkeiten,<br />
ergänzend zum Studium, wurde über die Teams der genannten Projekte realisiert und<br />
wird weiterhin intensiviert werden, um ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen und<br />
die besten Voraussetzungen für den Personaltransfer zu schaffen.<br />
Neben der Qualifizierung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erhalten die Studierenden<br />
konkrete Unterstützung bei Bewerbungen nach dem Studium. Dies wird vor allem deshalb<br />
realisierbar, da über das TWZ vielfältige Partnerkontakte in Wirtschaft und Gesellschaft bestehen,<br />
die aus gemeinsamen Aktivitäten der Bereiche F&E, Beratung, Anpassungsqualifizierung,<br />
Messen etc. entstanden sind und meist auf der Ebene der Firmenleitung bestehen. Derartige<br />
Kontakte beruhen auf Vertrauenspartnerschaften und ermöglichen einen belastbaren Einblick in<br />
das Partnerunternehmen.<br />
Steinbeis Transferzentrum (STZ; Einrichtung)<br />
Das STZ „Projektmanagement“ bietet eine Dienstleistung für alle an der <strong>Hochschule</strong> tätigen<br />
Professorinnen und Professoren an. Es stellt eine ideale Ergänzung zur hochschulinternen Projektbewirtschaftung<br />
dar.<br />
Das STZ bietet die Chance, Projekte ohne die Restriktionen der Landeshaushaltsordnung<br />
durchzuführen. Dies beinhaltet den Vorteil, dass die Finanzmittel nach den primären Erfordernissen<br />
des Projektes und nicht unter externen formalen Restriktionen zu verausgaben sind.<br />
Im STZ werden grundsätzlich Projekte mit der Industrie bewirtschaftet.<br />
Derzeit werden im STZ 15 Professoren (Projektleiter) betreut, wobei das STZ Vertragsgestaltung,<br />
Rechnungslegung und Controlling übernimmt.<br />
Die Vorteile der Bewirtschaftung durch das STZ sind:<br />
• Freier bedarfsorientierter Mitteleinsatz durch den Projektleiter, da die Unabhängigkeit von<br />
Restriktionen der Landeshaushaltsordnung gegeben ist<br />
• Der Wissenschaftler hat „den Rücken frei“ für seine fachbezogene Tätigkeit<br />
• Vertragserstellung und -prüfung, Rechnungsstellung, Personaleinstellung erfolgt formell<br />
über das STZ als Dienstleistung<br />
• Ziele der leistungsorientierten W-Besoldung lassen sich unmittelbar umsetzen<br />
Förderung von Existenzgründern (Dienstleistung)<br />
Hier erfolgt einerseits die Vermittlung von Existenzgründungswilligen zum Expertenteam des<br />
Businessplanwettbewerbes der <strong>Hochschule</strong> nach <strong>Stendal</strong>, zum anderen werden Beratungstermine<br />
im FEZ nach Vereinbarung angeboten.<br />
Bei Bedarf werden Schulungen zum Thema „Existenzgründung“ organisiert oder auch als Wahlfach<br />
an der <strong>Hochschule</strong> angeboten.<br />
Mediendesign für KMU (Dienstleistung)<br />
Das Ziel ist die Low-cost-Unterstützung für KMU der Region bei der Realisierung ihrer Kommunikation<br />
im Rahmen von Marketingmaßnahmen. Die Umsetzung geschieht unter Einbeziehung<br />
12 Vgl. hierzu den Bericht aus Treffpunkt Campus im Anhang auf Seite 77<br />
Seite 32
von wissenschaftlichen Hilfskräften aus Design- und IT-Bereichen bei begleitender Förderung<br />
des wissenschaftlichen Nachwuchses.<br />
Seite 33
4 Qualitätsorientierung in Studium, Lehre und Forschung<br />
4.1 Qualitätsbestimmung und -entwicklung in Studium, Lehre und Forschung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> hat sich immer zu einem Anspruch hoher Qualität in allen Bereichen bekannt.<br />
Qualität entsteht durch das Handeln von Menschen, und so entscheidet das Handeln der Mitarbeiter<br />
und Mitarbeiterinnen, der Studierenden und der Lehrenden über den Grad der Qualität,<br />
deshalb stehen die Menschen und nicht Strukturen im Mittelpunkt aller Qualitätsoffensiven:<br />
• Neue Kollegen/-innen werden intensiv mit Prozessen und Strukturen der <strong>Hochschule</strong> vertraut<br />
gemacht und mit einem Vademecum der <strong>Hochschule</strong> begrüßt. <strong>2009</strong> wurden zum dritten Mal<br />
Neuberufene an der <strong>Hochschule</strong> zu einer Einführungsveranstaltung „Welcome on Board“<br />
eingeladen, um die Fachexperten/-innen auch in Hochschulstrukturen einzuweihen. Diese<br />
Veranstaltung löst regelmäßig euphorische Begeisterung aus;<br />
• Neue Mitarbeiter/-innen werden hochschulweit mit ihrem Aufgabenprofil und einigen biografischen<br />
Daten vorgestellt;<br />
• Die Aufgabenbereiche einzelner Funktionsträger in der akademischen Selbstverwaltung<br />
wurden dezidiert festgeschrieben (Studiendekane, Studienfachberater);<br />
• <strong>2009</strong> geplant und Anfang 2010 durchgeführt werden strategische Veranstaltungen mit Dekanen/-innen.<br />
Diese „speed-up“-Veranstaltungen sind ganztägig konzipiert und beziehen alle<br />
Bereiche der <strong>Hochschule</strong> mit ein. Der bisher angemeldete Zuspruch ist sehr hoch;<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) arbeitet seit 9.11.2005 mit einer Evaluationsordnung,<br />
die folgende Ziele verfolgt:<br />
• Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung durch kontinuierliche Reflektion der Lehre und<br />
das Herausarbeiten der Stärken und Schwächen der betrachteten Lehrveranstaltungen,<br />
• Schaffung einer Grundlage für einen konstruktiven Dialog in der <strong>Hochschule</strong> sowie für konkrete<br />
Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Lehrangebotes in den Studiengängen im<br />
Interesse der Profilbildung der Fachbereiche,<br />
• Sicherung der Qualität und Effektivität der Forschungsaktivitäten an der <strong>Hochschule</strong>,<br />
• Strategische Konzeption und Umsetzung eines nachhaltigen Forschungsmanagements.<br />
Zu den Elementen der Evaluation gehören:<br />
• die studentische Lehrevaluation,<br />
• die interne und externe Evaluation,<br />
• die Evaluation der Forschung.<br />
Besondere Aufmerksamkeit wird der studentischen Lehrevaluation gewidmet. Die seit 2008<br />
eingesetzten Evaluationsbögen nach HILVE-II werden erfolgreich jedes Semester eingesetzt.<br />
Das genaue Procedere zum Umgang mit den Ergebnissen ist inzwischen hochschulweit bekannt.<br />
Im Winter und Sommer <strong>2009</strong> wurden insgesamt 1.200 Lehrveranstaltungen evaluiert, für die<br />
mehr als 20.000 Bögen ausgewertet wurden, was mehr als einer Verdopplung gegenüber 2008<br />
entspricht.<br />
Um die Kommunikation über die Ergebnisse und die Motivation für die Lehrevaluation zu befördern,<br />
informiert die Prorektorin für Studium und Lehre jedes Semester die Studierenden und die<br />
Lehrenden. Dabei wird besonders auf die Bedeutung der individuellen Auswertung der Lehrenden<br />
mit den Studierenden hingewiesen.<br />
<strong>2009</strong> wurden die Dekanate in einer Zusammenfassung über die individuellen Ergebnisse und<br />
das kumulierte Ergebnis des Fachbereichs informiert. In der Folge gab es Einzelgespräche mit<br />
einzelnen Lehrenden. Derzeit widmet sich eine Arbeitsgruppe dem Thema, welche weiteren Daten<br />
als Zusammenfassung relevant wären und wie diese zu ermitteln sind.<br />
Seite 34
Parallel dazu wird im Zentrum für Weiterbildung aktiv an einem Konzept zur Hochschuldidaktik<br />
gearbeitet. In diesem Zusammenhang bleibt immer noch die Forderung der <strong>Hochschule</strong> im<br />
Raum stehen, hochschulübergreifend ein landesweites Zentrum für Hochschuldidaktik, vom MK<br />
oder dem WZW koordiniert, zu gründen.<br />
Das Leitbild, in dem der Qualitätsgedanke mit hoher Priorität festgeschrieben ist, wurde <strong>2009</strong> in<br />
einer großen Arbeitsgruppe der <strong>Hochschule</strong> komplett neu überarbeitet und wird voraussichtlich<br />
im Januar 2010 nach hochschulöffentlicher Diskussion im Senat beschlossen werden.<br />
Ein weiteres – in den zurückliegenden Jahren das wichtigste – Element der Qualitätssicherung<br />
war die Programmakkreditierung. Die erfolgreich durchgeführten Programmakkreditierungen,<br />
die externe Begutachtung des jeweiligen Curriculums und der hochschulischen Rahmenbedingungen<br />
gaben immer wieder positive und gute Impulse für die Verbesserung der<br />
Studienstruktur, die zumeist in den folgenden Änderungssatzungen ihren Niederschlag fanden.<br />
Die Akkreditierungsberichte sind zum überwiegenden Teil sehr positiv und in Teilen sogar euphorisch<br />
und bezeugen ein hohes Qualitätsniveau der an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) eingerichteten Studiengänge.<br />
Für das Qualitätsempfinden der Studierenden ist sicher zu einem großen Teil die Qualität der<br />
Lehre an einer <strong>Hochschule</strong> entscheidend. Darüber hinaus sind die Studierenden aber in eine<br />
Vielzahl weiterer Prozesse an der <strong>Hochschule</strong> involviert. Die Qualität der Service- und Beratungseinrichtungen<br />
sowie der Ausstattung der <strong>Hochschule</strong> hinsichtlich der Bibliothek (z. B.<br />
Verfügbarkeit von Fachliteratur oder Öffnungszeiten), der Labore, der PC-Pools etc. wirken sich<br />
ebenfalls auf die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrer <strong>Hochschule</strong> aus. Zufriedene Studierende<br />
sind überdies ein Marketingargument.13<br />
Auch wenn schon über 44 % der Studierenden die Frage, ob Sie „sehr gerne“ an der <strong>Hochschule</strong><br />
studieren, mit ja beantworten14, bedarf es weiterer Analysen der diesbezüglichen Schwächen<br />
und Stärken der <strong>Hochschule</strong>. Aus diesem Grunde ist eine Zusammenarbeit mit der HIS GmbH<br />
vereinbart worden, die Stärken und Schwächen auf Grundlage der Auswertungen der Ergebnisse<br />
des Studienqualitätsmonitors genauer zu analysieren.<br />
Ausgangspunkt für die Analysen sind die Ergebnisse des von HIS durchgeführten Studienqualitätsmonitors<br />
(SQM)15, an dem sich die <strong>Hochschule</strong> bereits seit drei Jahren beteiligt. Dabei<br />
handelt es sich um eine umfassende und bundesweit repräsentative Online-Erhebung der Studierendensicht<br />
auf Qualität, die es den teilnehmenden <strong>Hochschule</strong>n ermöglicht, die Qualitätsbewertungen<br />
der Studierenden direkt mit landes- oder bundesweiten Referenzwerten zu<br />
vergleichen. Im ersten Schritt ist auf Basis der SQM-Daten eine Stärken-/ Schwächenanalyse<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erstellt worden. Im weiteren Projektverlauf geht es<br />
darum, die festgestellten Schwächen vertiefend zu analysieren. Dabei werden auch die Ergebnisse<br />
einbezogen, die aus anderen Erhebungen an der <strong>Hochschule</strong> bereits vorliegen. Hierbei<br />
handelt es sich insbesondere um<br />
• regelmäßige studentische Lehrveranstaltungsevaluationen auf der Basis der Evaluationsordnung<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 09.11.2005 (Prorektorat für Studium<br />
und Lehre),<br />
• Befragungen von Studierenden, die ihren Studienplatz an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) nicht angetreten haben (Immatrikulationsamt),<br />
• Befragungen von Studienabbrechern und<br />
• Befragungen von Studienanfängern (Prorektorat für Studium und Lehre, z.T. auch eigene<br />
Initiativen in den Fachbereichen).<br />
13 Vgl. Hierzu auch Kapitel 8.2.3.3 auf Seite 62<br />
14 Auf die Frage, ob sie Alles in allem sehr gerne an Ihrer Fachhochschule studieren, antworten bundesweit 35,3%<br />
mit Ja, an den ostdeutschen Fachhochschulen bejahen diese Frage 41%, an unserer <strong>Hochschule</strong> sind dies<br />
44,1% der Befragten.<br />
15 Vgl. www.his.de/abt2/ab21/sqm<br />
Seite 35
Die weiteren vereinbarten Arbeitsschritte sind:<br />
• Erstellung eines Stärken-Schwächen-Profils auf Basis der Daten des SQM und Präsentation<br />
im Senat der <strong>Hochschule</strong> im Vergleich zu den Fachhochschulen in Ostdeutschland und den<br />
Fachhochschulen insgesamt (wettbewerblicher Aspekt)<br />
• Unterstützung der <strong>Hochschule</strong> bei der weitergehenden Analyse der Ursachen und Hintergründe<br />
für identifizierte Schwächen sowohl in inhaltlicher Hinsicht (Aufstellung begründeter<br />
Wirkungsannahmen über die Ursachen von Qualitätsbeurteilungen und Überprüfung dieser<br />
Annahmen anhand des an der <strong>Hochschule</strong> verfügbaren empirischen Datenmaterials) als<br />
auch bezogen auf die methodische Vorgehensweise (z. B. Konzipierung weiterer Erhebungen,<br />
falls erforderlich)<br />
• Ausarbeitung von Empfehlungen für die weitere Entwicklung des Qualitätsmanagements an<br />
der <strong>Hochschule</strong> (z. B. relevante Kennzahlen, Art und Turnus ihrer Erhebung, Verortung der<br />
Zusammenführung und Auswertung, Ableitung von Veränderungsnotwendigkeiten und<br />
Durchsetzung von Konsequenzen)<br />
Nach diesen Vorarbeiten wird über die weitere institutionelle und personelle Verankerung der<br />
Qualitätssicherung entschieden.<br />
Seit 2007 begleitet die Hochschulleitung die Arbeit von Berufungskommissionen intensiv. Sie<br />
führte ein auf allen Stufen des Berufungsprozesses stattfindendes Controlling ein, das eine frühe<br />
Rückkopplung mit den Berufungskommissionen ermöglicht.<br />
Vergleicht man die konzeptionelle Vorgehensweise, die Aspekte und Kriterien der Qualitätssicherung<br />
im Rahmen der Exzellenzoffensive an den Universitäten der Bundesrepublik<br />
Deutschland mit einem zielführenden Qualitätsmanagementkonzept im Bereich der angewandten<br />
und transferorientierten Forschung an Fachhochschulen, so zeigt sich deutlich, dass<br />
grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen zur Anwendung kommen müssen. In diesem<br />
Kontext kann ohne weitere Erläuterung darauf verwiesen werden, dass das Kriterium der Bedeutung<br />
der Forschung für kleine und mittlere Unternehmen der Wirtschaft in der<br />
Exzellenzoffensive den niedrigsten Stellenwert besitzt. Im Bereich der angewandten Forschung<br />
an Fachhochschulen ist dies das Kriterium mit dem höchsten Stellenwert.<br />
Die Qualitätssicherung im Bereich der angewandten und transferorientierten Forschung an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) erfolgt begleitend in den verschiedenen Phasen einer<br />
Projektinitiative. Dies sind die Projektplanung, die Projektentwicklung, die Projektdurchführung<br />
sowie die Evaluation der Projektergebnisse nach Abschluss des Projektes.<br />
In der überwiegenden Mehrzahl der Projekte erfolgt eine externe Evaluation und Bewertung der<br />
Relevanz der Anwendung in den Phasen der Beantragung und der Bewertung des formulierten<br />
Projektkonzeptes. Dies geschieht einerseits durch externe Gutachter und andererseits durch<br />
die Partner aus der Wirtschaft/Gesellschaft. In dieser Phase werden Bedarf, Anwendungsrelevanz,<br />
Marktpotential, Entwicklungs- und Realisierungsrisiko bis hin zur ersten rudimentären<br />
Abschätzung des erforderlichen Zeitrahmens für die avisierte Umsetzung der Ergebnisse abgeschätzt<br />
und bewertet.<br />
Die anschließende Durchführung des Projektes ist bei anwendungs- und transferorientierten<br />
Projekten durch die enge Kooperation, zumindest auf der Ebene der Beratung und des Monitorings,<br />
mit den externen Partnern bzw. Auftraggebern charakterisiert. Hierbei werden Gesamt-<br />
und Teillösungen im Hinblick auf Effektivität, Stabilität (Verfügbarkeit) und Wirtschaftlichkeit bewertet<br />
und die Weiterentwicklung abhängig vom Ergebnis dieser Bewertung forciert oder<br />
modifiziert.<br />
Letztendlich „evaluiert der Markt“ ggf. in Verbindung mit der Arbeit der Patentverwertungsagentur<br />
(PVA). Das Erreichen des Projektzieles ist durch eine Innovation oder einen innovativen<br />
Seite 36
Upgrade charakterisiert. Die Innovation selbst bzw. die Wirkung des Upgrade werden durch die<br />
Reaktion des Marktes definiert und evaluiert.<br />
4.2 Akkreditierung<br />
Zum Stand der Akkreditierung kann für das Jahr <strong>2009</strong> folgendes berichtet werden:<br />
BA-Studiengänge<br />
20 BA-Studiengänge haben sich bereits einer Akkreditierung unterzogen und diese erfolgreich<br />
bestanden. Von den 24 in der Zielvereinbarung genannten Studiengängen sind somit 83 % erfolgreich<br />
akkreditiert. Für den fehlenden BA-Studiengang „Journalismus/Medienmanagement“<br />
fand die Vor-Ort-Begutachtung am 18.12.<strong>2009</strong> statt. Für die noch ausstehenden Studiengänge<br />
aus dem Fachbereich Wirtschaft erfolgt die Einreichung der Akkreditierungsunterlagen zum<br />
31.1.2010, so dass auch deren Akkreditierung noch im Zeitrahmen der Zielvereinbarung erfolgen<br />
wird.<br />
MA-Studiengänge<br />
13 Masterstudiengänge sind bereits erfolgreich akkreditiert. Für die Berechnung der Quote<br />
reicht hier der Bezug zu den 19 MA-Studiengängen der Zielvereinbarung nicht aus, denn der<br />
Umstand der versetzten Einführung der MA-Studiengänge erfordert eine differenzierte Betrachtung.<br />
Im MA-Studiengang „Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen<br />
und Familien“ und im MA „Sozial- und Gesundheitsjournalismus“ hat die Vor-Ort-<br />
Begehung bereits <strong>2009</strong> stattgefunden, und es gab sehr positives mündliches Feedback, so<br />
dass wir baldigst mit einer Akkreditierung rechnen. Zwei weitere MA-Studiengänge aus dem<br />
Fachbereich SGW sind bereits im Sommer der Akkreditierung unterzogen worden. Allerdings<br />
gab es aufgrund inhaltlicher Differenzen, die inzwischen beigelegt sind, zeitliche Verzögerungen.<br />
Aber auch hier rechnen wir Anfang 2010 mit einem positiven Akkreditierungsbescheid.<br />
Somit lässt sich optimistisch feststellen, dass 15 MA-Studiengänge akkreditiert sind.<br />
Wenn die weiteren Studiengänge aus dem FB Wirtschaft ihre Akkreditierungsunterlagen zum<br />
31.1.2010 bei der bereits unter Vertrag stehenden Agentur einreichen, erfüllt die <strong>Hochschule</strong><br />
ihre Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung.<br />
4.3 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren<br />
Die Langzeitstudiengebühren wurden ausschließlich zur Verbesserung der Lehre und Erhöhung<br />
der Qualität des Studienangebotes genutzt. Im Haushaltsjahr <strong>2009</strong> wurden per 30. November<br />
insgesamt rd. 300.000 EURO durch Erhebung von Langzeitstudiengebühren eingenommen. Es<br />
zeigt sich, dass die Einnahmen rückläufig sind. Durch Gewährung von Ratenzahlungen wurden<br />
Härtefälle ausgeglichen. Dadurch werden die Einnahmen teilweise erst im Folgejahr realisiert.<br />
<strong>2009</strong> wurden fünf Maßnahmen finanziert, die unterschiedlichen Studierendeninteressen entgegenkommen.<br />
Zum einen wurden die erweiterten Öffnungszeiten der Bibliotheken an beiden<br />
Standorten erhalten, um (jenseits vom Lehrveranstaltungsbetrieb tagsüber) auch in die Abendstunden<br />
hinein eine Inanspruchnahme der Bibliotheksdienstleistungen zu ermöglichen.<br />
Das zentrale Tutorienprogramm der <strong>Hochschule</strong> erweitert zum einen das Studienangebot, in<br />
dem es über das Curriculum hinaus relevante Tutorien anbietet, zum anderen vertieft es durch<br />
Begleitung curricularer Veranstaltungen den Durchdringungsgrad des Fachgegenstands. Besonders<br />
diese zweite Variante der Tutorien trägt maßgeblich zur Qualitätsverbesserung in der<br />
Lehre bei.<br />
Für eine weitaus kleinere Gruppe von Studierenden relevant, aber nicht weniger wichtig, ist die<br />
Exczellenzförderung herausragender und in besonderer Weise leistungsfähiger Studierender in<br />
sogenannten Meisterklassen.<br />
Seite 37
Das Programm des Studium Generale (siehe auch Weiterbildung) wurde <strong>2009</strong> erfolgreich deutlich<br />
ausgeweitet. Es dient den Studierenden zur Erweiterung ihrer Schlüsselkompetenzen.<br />
Außerdem wurde eine Servicestelle im Dezernat Studentische Angelegenheiten finanziert.<br />
Seite 38
5 Internationalisierung<br />
5.1. Einleitung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat sich in den letzten Jahren immer stärker eine internationale<br />
Ausrichtung gegeben. Über die Jahre hinweg ist ein internationaler Baustein zum<br />
anderen gekommen, so dass sich die Anzahl der Outgoings und Incomings der internationalen<br />
Studiengänge und Projekte heute mehr als sehen lassen kann. Die internationale Strategie der<br />
<strong>Hochschule</strong> wird Schritt für Schritt mit Leben gefüllt.<br />
<strong>2009</strong> haben die Beteiligten einiges erreicht (das ZAH, die Prorektorin, die Internationalisierungsbeauftragte,<br />
die Kommission für Internationales, die Internationalisierungsbeauftragten in<br />
den Fachbereichen/Studiengängen, nicht zuletzt aber auch viele ohne Amt, an Internationalem<br />
Interessierte bzw. Internationalität lebende Mitarbeiter in Lehre und Verwaltung):<br />
Auf Antrag des ZAH stellte der DAAD Mittel für ein Inhouse Training „International Conferences,<br />
visits and events“ bereit. An dem Sprachkurs, der von einem erfahrenen Dozenten der Londoner<br />
Sprachenschule „The London School of English“ durchgeführt wurde, konnten 11<br />
Hochschullehrer teilnehmen. Das Seminar wurde außerordentlich positiv bewertet und war eine<br />
willkommene Unterstützung des Internationalisierungsprozess.<br />
Alle Aufgaben und Aufgabenfelder der an der HS im Bereich Internationales Tätigen wurden auf<br />
den Prüfstand gestellt und abgeglichen. Die Kompetenzen wurden teilweise neu geordnet und<br />
Doppelarbeit vermieden.<br />
Alle Incomings wurden (neben dem unten aufgeführten bewährten Einführungsprogramm des<br />
ZAH) zu Beginn des Wintersemesters sowohl mit studentischen als auch erwachsenen Paten<br />
(außerhalb der <strong>Hochschule</strong>) versehen; die deutschen Studentenpaten begannen nach Zulassung<br />
der Incomings mit einem Brief-/Mailverkehr und nahmen den persönlichen Kontakt auf,<br />
sobald die Incomings in <strong>Magdeburg</strong> waren. Von gemeinsamen Kochabenden über gemischtnationale<br />
Arbeitsgruppen bis hin zu Bachelorarbeiten, deren Thema sich aus den Kontakten<br />
ergibt, ist alles möglich. Die erwachsenen Paten aus allen Bereichen der <strong>Magdeburg</strong>er Gesellschaft<br />
nahmen und nehmen die Incomings an ihren jeweiligen Arbeitsplatz mit und zeigen ihnen<br />
deutsches Leben jenseits des Campus.<br />
Die Kooperation mit der German Jordanian University (GJU) wurde und internationale Studiengänge<br />
in Kooperation mit der GJU werden begleitet, evtl. neu entwickelt bzw. diese Entwicklung<br />
wird unterstützt. Die GJU-Studierenden werden in allen studentischen und internationalen Aktivitäten<br />
mit eingebunden.<br />
Ein E-Mail-Verteiler und ein internationaler Kalender informieren alle international Tätigen über<br />
geplante Aktivitäten, Seminarangebote, Arbeitsschritte etc. Ein Jour Fixe bringt alle im Bereich<br />
Internationales tätigen studentischen Hilfskräfte aus den verschiedenen Fachbereichen bzw. die<br />
Hilfskräfte der Rektoratsbeauftragten zweiwöchentlich zusammen.<br />
Ein elektronischer Kalender „Internationales“ ist installiert worden und wird nach und nach zugänglich<br />
gemacht.<br />
Der Internetauftritt des Bereiches Internationales wurde analysiert und neu strukturiert. Alle Beteiligten<br />
lieferten kurze Texte (mindestens in Deutsch und Englisch) zu.<br />
Die Internationalisierung ist Bestandteil des neuen Leitbildes der <strong>Hochschule</strong>.<br />
Die festen Stellen des International Office werden nicht länger regional (Standort <strong>Magdeburg</strong>/<strong>Stendal</strong>),<br />
sondern nach Sachgebieten so organisiert, dass sich die Zusammenarbeit<br />
möglichst vernünftig ergänzt. Um den Anforderungen an die Tätigkeiten im Bereich Internationales<br />
noch besser gerecht zu werden, werden weitere arbeitsorganisatorische Veränderungen<br />
vorgenommen (Konzentration von Aufgaben in einer Hand, die standortübergreifend wahrgenommen<br />
werden).<br />
Für alle Incomings wurde eine Broschüre erstellt, die bei der Zusage für den Studienplatz mitgeschickt<br />
wird. Ein Teil ist für die ganze <strong>Hochschule</strong> und je ein Teil für die Fachbereiche bzw.<br />
Studiengänge gedacht. Neben den Materialien des ZAH (siehe unten) wurde diese Broschüre<br />
von Studierenden verschiedener Fachbereiche mit Hilfe der Pressestelle erstellt (Zielgruppe für<br />
Zielgruppe).<br />
Seite 39
Eine Late-Summer-School, die Sprachkurse mit landeskundlichen und politischen Seminaren<br />
sowie mit Projektarbeit koppelte, brachte Incomings mit deutschen Erstsemestern in Kontakt.<br />
5.2 Auslandsstudium und EU-Programme<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hält für ihre Studierenden eine große Anzahl von Studienplätzen<br />
im Rahmen von Austauschprogrammen mit Partneruniversitäten, insbesondere in<br />
der Europäischen Union sowie in den USA, bereit.<br />
Eine herausgehobene Rolle bei der Auslandsmobilität spielt das Erasmus Programm.<br />
Es bestehen derzeit 110 bilaterale Vereinbarungen mit <strong>Hochschule</strong>n in EU-Ländern.<br />
Die wichtigsten Kooperationsländer sind:<br />
1. Spanien<br />
2. Frankreich<br />
3. Schweden<br />
4. Belgien, Dänemark, Italien, United Kingdom (mit jeweils 6 Verträgen)<br />
Insgesamt stehen an den Erasmus-Partnerhochschulen 253 Austauschplätze für Studierende<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) zur Verfügung.<br />
Im akademischen Jahr 2008/09 konnten 52 Studierende, davon 5 am Standort <strong>Stendal</strong>, ein<br />
Auslandsstudium im Rahmen des Erasmus-Programms absolvieren.<br />
Damit wurde der 2006/07 einsetzende Abwärtstrend bei der Anzahl der Erasmus-Outgoings<br />
gebremst.<br />
Einen Spitzenplatz unter allen <strong>Hochschule</strong>n des Landes Sachsen-Anhalt nimmt die <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) seit Mitte der 90er Jahre und weiterhin auch im Berichtszeitraum bei<br />
den Auslandspraktika in EU-Ländern ein: 63 Studenten, davon 10 am Standort <strong>Stendal</strong>, konnten<br />
allein im SoS <strong>2009</strong> durch das Erasmus-Programm (früher Leonardo-Programm) gefördert<br />
werden.<br />
Erasmus-Praktika SoS <strong>2009</strong><br />
Anzahl der Praktika<br />
<strong>Hochschule</strong> Burg Giebichenstein 7<br />
HS Anhalt 4<br />
HS Harz 29<br />
HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) 63<br />
HS Merseburg 5<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 15<br />
Otto-von-Guericke Universität <strong>Magdeburg</strong> 38<br />
GESAMT 161<br />
Tab. 5: Zahl der Erasmuspraktika<br />
Quelle: Leonardo Büro, <strong>Magdeburg</strong><br />
Das ZAH unterstützt die Auslandsmobilität der Studierenden durch das Angebot einer regelmäßigen<br />
Auslandsstudienberatung. Dabei geht es um die Bereitstellung von Informationen zu:<br />
• Bewerbungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren für die Teilnahme an Austauschprogrammen<br />
oder für eine Bewerbung als Free Mover<br />
• Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten<br />
• Informationen zur sprachlichen Vorbereitung<br />
• Informationen für die eigenständige Praktikumsplatzsuche<br />
• Informationen zu Formalitäten, wie Krankenversicherung und Visabeantragung<br />
Seite 40
Dank der besseren personellen Besetzung im ZAH konnte die Qualität des Erasmus-<br />
Programmmanagements nachweislich optimiert und die Beratungsangebote für Studierende<br />
ausgeweitet werden.<br />
Ausblick: Die sehr unterschiedliche Partizipationsrate der einzelnen Studiengänge am Erasmus-<br />
Programm (Auslandsstudium) macht deutlich, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, damit<br />
auch Studierende aus wenig auslandsmobilen Studienrichtungen, wie die Ingenieurwissenschaften<br />
oder an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) auch die BWL sowie die technische<br />
Betriebswirtschaft stärker am Programm partizipieren. Das ZAH wird die Informationsmaßnahmen<br />
ausbauen und Werbematerial erstellen. Zu einer Mobilitätssteigerung können auch eine<br />
stärkere curriculare Verankerung von Auslandsstudienabschnitten, umfassende Information interessierter<br />
Studenten über die Modalitäten der Anerkennung von im Ausland erbrachten<br />
Studienleistungen, eine gute fremdsprachliche Vorbereitung der Studierenden und die Internationalisierung<br />
der Curricula sowie die konsequente Anwendung von ECTS beitragen.<br />
5.3. Projektbezogene Kooperationen - Dozentenaustausch<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat mit zahlreichen <strong>Hochschule</strong>n weltweit Kooperationsvereinbarungen<br />
abgeschlossen. Diese Vereinbarungen werden überwiegend für den<br />
Austausch von Studierenden genutzt.<br />
<strong>2009</strong> wurden die folgenden Kooperationsabkommen neu abgeschlossen:<br />
• Quingdao Technical University China<br />
• Nanjing Institute of Technology China<br />
• Staatliche Technische Universität Perm Russland<br />
• Lenoir-Rhyne University USA<br />
Mit einer kleineren Zahl von Erasmus-Partner-Universitäten findet auch ein Austausch von Lehrenden<br />
statt. 2008/09 waren 10 Lehrende der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), davon zwei<br />
des Standorts <strong>Stendal</strong>, als Erasmus-Gastdozenten für Kurzdozenturen an europäischen Partnerhochschulen.<br />
Eine projektbasierte Zusammenarbeit erfolgt nur mit wenigen Partneruniversitäten, insbesondere<br />
mit Universitäten in Peru, Jordanien, den USA und Kuba sowie mit britischen, französischen,<br />
lettischen und finnischen Universitäten, im Rahmen von u. a. aus EU-Mitteln geförderten Curriculumentwicklungsprojekten.<br />
5.4 Ausländerstudium<br />
Im Berichtszeitraum ist der Anteil der ausländischen Studierenden von 342 im WS 2008/09 auf<br />
270, davon 41 in <strong>Stendal</strong>, im WS <strong>2009</strong>/10 zurückgegangen.<br />
Bundesweit liegt der Anteil der ausländischen Studierenden bei etwas mehr als 12 %. An der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) sind es derzeit knapp 5 %.<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH)<br />
Tab. 6: Ausländische Studierende<br />
Quelle MK des LSA, Ref. 41<br />
Wintersemester<br />
Studierende ins-<br />
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09<br />
gesamt<br />
Ausländische<br />
6.575 6.350 6.433 6.467 6.490<br />
Studierende<br />
Anteil Ausländer<br />
405 393 414 376 342<br />
in % 6% 6% 6% 6% 5%<br />
Seite 41
Unter den derzeit 270 ausländischen Studierenden sind 77 Austauschstudierende des Standortes<br />
<strong>Magdeburg</strong> und 5 des Standortes <strong>Stendal</strong>. Diese stellen einen im Vergleich mit anderen<br />
<strong>Hochschule</strong>n sehr hohen Anteil der ausländischen Studierenden. Die Entsendeländer, insgesamt<br />
16, waren, neben den EU-Ländern, Russland, China, die USA, Jordanien, Peru, Chile und<br />
Südafrika.<br />
Das ZAH der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) bietet eine Reihe von zielgruppenspezifischen<br />
Serviceleistungen, die sich insbesondere an Austauschstudierende wenden. Diese<br />
sind im Einzelnen:<br />
• Erstkontakt für jegliche Fragen und in Notfällen<br />
• Studieneinführende Maßnahmen (Orientierungswoche) auf zentraler Ebene durch das Zentrum<br />
für Auslandsbeziehungen<br />
• Vermittlung von Wohnraum<br />
• Information und Beratung zum Studium und Leben in <strong>Magdeburg</strong> und <strong>Stendal</strong> vor Einreise<br />
sowie studienbegleitend (die Studienfachberatung erfolgt durch Vertreter der jeweiligen Studiengänge)<br />
• Vermittlung von Ansprechpartnern<br />
• Koordination der Erstellung der Transcripts of Record (Notenabschriften)<br />
• Beratung in ausländerrechtlichen Angelegenheiten<br />
• Beratung zu den Deutsch-als-Fremdsprache-Angeboten<br />
• Durchführung von deutschlandkundigen Exkursionen<br />
• Einwerbung, Planung und Vergabe der Stipendien sowie Administration der Stipendienprogramme<br />
• Vermittlung bei Problemen mit hochschulinternen und -externen Stellen<br />
Im Berichtszeitraum haben rund 250 Studenten an der Orientierungswoche und den landeskundlichen<br />
Exkursionen teilgenommen.<br />
Dank der besseren personellen Ausstattung des ZAH konnten auch im Bereich des Ausländerstudiums<br />
zahlreiche Verbesserungen erreicht werden. Diese betreffen insbesondere:<br />
• Erweiterung des Online-Informationsangebotes<br />
• englischsprachige Informationen für Austausch- und Vollstudierende im Internet<br />
• Erstellung von Werbe-/Informationsmaterial und Versand an Partnerhochschulen<br />
• Verbesserung der Wohnraumvermittlung<br />
• Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten<br />
• Organisation und Administration einer Sommerschule für ausländische Studierende16<br />
Ausblick: Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität für ausländische Studieninteressenten<br />
und Studierende sind notwendig. Dies sind u. a.:<br />
• Gezielte Rekrutierung von ausländischen (Voll-) Studierenden, z. B. durch Messebesuche<br />
• Zielgruppenorientierter Internetauftritt der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
• Bereitstellung von ECTS-Information-Packages<br />
• Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots<br />
• Aufbau einer hochschulinternen zielgruppenspezifischen Beratung/Informationsvermittlung<br />
zu Anerkennungs- und Zulassungsfragen<br />
• Erweiterung des gedruckten Informationsangebotes<br />
• Verbesserung des Verfahrens zur Transcripterstellung, Erleichterung des Verfahrens für<br />
Studierende<br />
• Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (fachbezogene Tutorien/Veranstaltungen)<br />
16 Vgl. hierzu den Bericht aus Treffpunkt Campus im Anhang auf Seite 82<br />
Seite 42
• Erweiterung des Internetangebots um Online-Anmeldeverfahren für Austauschstudierende<br />
• Ausbau eines Buddy-Systems (jedem interessierten ausländischen steht ein deutscher Studierender<br />
als Kontakt zur Verfügung)<br />
5.5 Mitteleinwerbung<br />
Ein Aufgabenbereich des ZAH ist die Einwerbung von Drittmitteln, z. B. des DAAD zur Durchführung<br />
von internationalen Aktivitäten.<br />
Dies geschieht zum einen durch eigene Drittmittelprojekte, zum anderen durch Beratungsangebote<br />
für potentielle Antragsteller aus den Fachbereichen.<br />
Für das Haushaltsjahr <strong>2009</strong> wurden ZAH-seitig neben den Stipendien für Studierende die folgenden<br />
Mittel eingeworben und administriert:<br />
Erasmus 2008/09: 80.247,00 EUR<br />
Stibet <strong>2009</strong>: 12.730,00 EUR<br />
Mittel des Kultusministeriums: 11.320,00 EUR<br />
Die Fachbereiche haben (2008, die Daten aus dem Jahr <strong>2009</strong> sind noch nicht verfügbar)<br />
31.379 EUR an DAAD-Drittmitteln eingeworben.<br />
5.6 German-Jordanian-University (GJU)<br />
Das mit Mitteln des BMBF, des DAAD und des Landes Sachsen-Anhalt geförderte Projekt<br />
„German-Jordanian-University (GJU)“ ist das gegenwärtig bedeutsamste und – vom Fördervolumen<br />
– größte Bildungsexportprojekt der Bundesrepublik. Im fünften Jahr ihres Bestehens hat<br />
die Universität in Amman inzwischen fast 2.000 Studierende, die sich auf folgende Fakultäten<br />
verteilen:<br />
1. School of Technological Sciences<br />
2. School of Natural Applied Sciences<br />
3. School of Applied Medical Sciences<br />
4. School of Informatics and Computing<br />
5. School of Architecture and Design<br />
6. Talal Abu Ghazaleh College of Business<br />
7. School of Languages<br />
Die grundlegende Idee für das GJU-Projekt kam aus Kreisen der Wirtschaft in Jordanien. Obwohl<br />
diese finanziell im jordanischen Universitätsbereich involviert ist, fällt doch eine mangelnde<br />
Praxisausrichtung in der jordanischen Hochschulbildung auf. Diese Tatsache hat u. a. zur Folge,<br />
dass die Kenntnisse vieler Absolventen, insbesondere der Ingenieursstudiengänge, nicht<br />
den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. Aus der Erkenntnis dieser defizitären Situation<br />
des jordanischen Hochschulsystems begründete sich die ursprüngliche Idee zur<br />
Gründung der German-Jordanian-University – einer öffentlichen jordanischen Universität nach<br />
dem Modell der deutschen Fachhochschulen.<br />
Die grundsätzlichen Leitlinien der Universität lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
- eine praktisch orientierte Ausbildung, die sich klar vom angelsächsisch geprägten Modell<br />
anderer jordanischer Universitäten abhebt und sich streng nach den Anforderungen<br />
der Industrie und des Arbeitsmarktes richtet<br />
Seite 43
- eine fünfjährige Ausbildung17 mit Bachelor-Abschluss, in der ein einjähriger Aufenthalt<br />
in Form von Praktikum und Studium in Deutschland inbegriffen ist sowie eine Reihe weiterführender<br />
Master-Programme nebst verschiedener Weiterbildungsangebote<br />
- eine enge Zusammenarbeit mit der jordanischen und deutschen Wirtschaft<br />
- eine Studentenschaft von max. 5.000 eingeschriebenen Studierenden<br />
- englisch als hauptsächliche Lehr- und Lernsprache sowie Deutsch als Pflichtkurs auf<br />
mittlerer bis fortgeschrittener Niveaustufe<br />
- einen gemischten Lehrkörper aus deutschen und jordanischen Lehrenden<br />
Die Rolle der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) in diesem Projekt lässt sich einmal in der<br />
Projektverwaltung festmachen. Darüber hinaus koordiniert das Projektbüro an der <strong>Hochschule</strong><br />
das Konsortium der an dem Projekt beteiligten ca. 60 Fachhochschulen in Deutschland und ist<br />
auch selbst inhaltlich direkt involviert, z. B. in den Bereichen Wasserwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen<br />
und Erneuerbare Energien.<br />
Die Tatsache, dass alle Studierenden der GJU ein komplettes akademisches Jahr in Deutschland<br />
verbringen, davon die ersten sechs Monate an einer deutschen Fachhochschule studieren,<br />
um dann in der zweiten Hälfte ihres Aufenthaltes ein Praktikum zu absolvieren, stellte eine besondere<br />
Herausforderung dar. Denn nachdem die beiden ersten Gruppen von jordanischen<br />
Studierenden im Herbst 2008 und im März <strong>2009</strong> jeweils nur 45 bzw. 40 Studierende umfassten,<br />
kamen zum Wintersemester <strong>2009</strong>/10 mehr als 140 Studierende. Die entsprechenden Zahlen<br />
werden in den kommenden Jahren analog der wachsenden Studienanfängerzahlen noch steigen.<br />
Die Vermittlung von Praktika in diesen Größenordnungen stellt das Projektbüro vor große<br />
Anforderungen, die nur durch die praktizierte enge Zusammenarbeit mit dem DIHK und der<br />
BDA – um nur die wichtigsten Partner zu nennen – sowie vielen anderen Institutionen und Unternehmen<br />
bewältigt werden können. Darüber hinaus nimmt die <strong>Hochschule</strong> in den oben<br />
genannten Studienbereichen jeweils zum Winter- bzw. Sommersemester sechs bis acht jordanische<br />
Studierende auf.<br />
Das Projekt wurde zu Beginn letzten Jahres für vier weitere Jahre mit einem Fördervolumen<br />
von etwas über 3 Millionen Euro verlängert. Unabhängig von der Tatsache, dass diese Fördermittel<br />
eingehen in die Drittmittelbilanz der <strong>Hochschule</strong>, stärkt dieses Projekt das Bild der<br />
<strong>Hochschule</strong>18 in der Außenwirkung und weist ihr eine besondere Rolle im Rahmen der Internationalisierungsbemühungen<br />
der Fachhochschulen und der Fachhochschulphilosophie zu.<br />
17 Diese fünfjährige Dauer setzt sich aus dem vierjährigen Bachelorstudium in Jordanien und einem einjährigen<br />
Aufenthalt in Deutschland zusammen. Während des Aufenthaltes studieren die ausländischen Gäste ein Semester<br />
an einer <strong>Hochschule</strong> und absolvieren im 2. Halbjahr ein Praktikum.<br />
18 Vgl. hierzu den Bericht aus treffpunkt campus im Anhang auf Seite 82<br />
Seite 44
6 Tätigkeitsbericht im Rahmen der Zielsetzungen Chancengleichheit<br />
und Familiengerechtigkeit<br />
6.1 Schwerpunktsetzung<br />
<strong>2009</strong> hat die <strong>Hochschule</strong> einen Schwerpunkt auf die Erfüllung der Zielsetzung in diesem Bereich<br />
gelegt und die Arbeit daran intensiviert. Zwar hatte die <strong>Hochschule</strong> die in sie gesetzten<br />
Erwartungen nie aus den Augen verloren, doch bei der Zwischenevaluation der Zielvereinbarungen<br />
feststellen müssen, dass sie die restliche Laufzeit zu einer vertieften Abarbeitung nutzen<br />
sollte.<br />
6.2 Statistik<br />
Ein zentrales Element der Gleichstellungspolitik ist die Herstellung der gleichberechtigten und<br />
zahlenmäßigen Partizipation von Frauen und Männern an höherwertigen Positionen.<br />
Das Rektorat und die Dekanate weisen aktuell einen Frauenanteil von 21,4 % und der Akademische<br />
Senat von 34,8 % aus. Auf der professoralen Ebene liegt zurzeit der Frauenanteil bei<br />
20,7 % und befindet sich somit über dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt und dem Bund19.<br />
Eine Voraussetzung für eine zukünftig paritätische Geschlechterverteilung ist die Förderung des<br />
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Anteil der weiblichen Studierenden liegt im<br />
Sommersemester <strong>2009</strong> bei 52,3 % (WS 2006/07: 52,5 %; WS 2007/08: 52,2 %) und befindet<br />
sich damit über dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt und dem Bund20. Es ist jedoch zu beachten,<br />
dass die Geschlechterverteilung innerhalb der Fachbereiche sehr unterschiedlich ist.<br />
Die Fachbereiche mit einer naturwissenschaftlichen bzw. technischen Ausrichtung21 weisen nur<br />
einen Frauenanteil von 22,9 % auf und liegen damit unter dem Bundesdurchschnitt22. Die anderen<br />
Fachbereiche23 weisen einen Frauenanteil von 72,3 % aus.<br />
Es werden zurzeit folgende Fördermaßnahmen durchgeführt, um auf diese noch bestehenden<br />
Ungleichverhältnisse Einfluss zu nehmen.<br />
6.3 Fördermaßnahmen<br />
Frauen, die eine Fachhochschulprofessur in Sachsen-Anhalt anstreben, jedoch die Berufungsvoraussetzungen<br />
gemäß § 35 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA<br />
vom 05.05.2004) noch nicht vollständig erfüllen, sollen im Rahmen des Förderprogramms ‚Professorin<br />
werden‘ unterstützt werden, ihre akademische und praktische Qualifikation so zu<br />
vervollständigen, dass die Berufung auf eine Professur möglich wird. Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) hat zum 1. Mai 2007 Stipendien vergeben und fördert zurzeit 7<br />
Stipendiatinnen.<br />
Zur Erhöhung des Frauenanteils von Studierenden in den technischen und naturwissenschaftlichen<br />
Studienrichtungen werden seit 1997 jährlich spezielle Informationstage für Schülerinnen<br />
der gymnasialen Oberstufe durchgeführt. Dieses Jahr haben die Institute Maschinenbau und<br />
Elektrotechnik sowie der Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft in den Herbstferien je ein<br />
1-Tagesprogramm angeboten, um außerhalb des Schulalltags Interesse für Technik zu vermit-<br />
19 2008 lag der Frauenanteil auf der professoralen Ebene an allen Fachhochschulen in Sachsen-Anhalt bei 19,5 %<br />
und bundesweit bei 17,1 % (vgl. Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Personal an <strong>Hochschule</strong>n. Vorläufige<br />
Ergebnisse. Arbeitsunterlage. Wiesbaden. 2008. S. 80 und 172).<br />
20 Im Wintersemester 2008/09 lag der Anteil der weiblichen Studierenden Anhalt an den Fachhochschulen im Land<br />
Sachsen- bei 46,7 % und bundesweit bei 38,05 % (vgl. Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Studierende<br />
an <strong>Hochschule</strong>n. Wintersemester 2008/<strong>2009</strong>. Vorbericht - Fachserie 11 Reihe 4.1.Wiesbaden. <strong>2009</strong>. S. 6).<br />
21 Dazu zählen die Fachbereich: Ingenieurwissenschaften und Industriedesign, Wasser- und Kreislaufwirtschaft<br />
sowie Bauwesen.<br />
22 Im Wintersemester 2008/09 lag der Anteil der weiblichen Studierenden in den Fächergruppen bzw. Studienbereich<br />
Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften bei 29 % (vgl. Statistisches Bundesamt: Bildung und<br />
Kultur. Studierende an <strong>Hochschule</strong>n. Wintersemester 2008/<strong>2009</strong>. Vorbericht - Fachserie 11 Reihe<br />
4.1.Wiesbaden. <strong>2009</strong>. S. 21.)<br />
23 Dazu gehören die Fachbereiche: Angewandte Humanwissenschaften, Wirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen<br />
sowie Kommunikation und Medien.<br />
Seite 45
teln. Der Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign hat im Rahmen eines Kooperationsvertrags<br />
mit der Deutschen Angestellten Akademie insgesamt 7 Praktikantinnen über<br />
zum Teil mehrmonatige Laufzeit intensiv betreut, drei dieser Praktikantinnen haben die Eignungsprüfung<br />
bestanden und werden zum Sommersemester das Studium aufnehmen.<br />
Außerdem können seit 2002 im April jeden Jahres im Rahmen des Girls’Day Schülerinnen und<br />
Töchter von Hochschulangehörigen die Institute Maschinenbau und Elektrotechnik sowie den<br />
Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft besuchen und kennenlernen.<br />
Mit Einführung der Leistungsorientierten Mittelvergabe im Jahre 2007 ist an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) der Frauenanteil an Studierenden und wissenschaftlichem Personal<br />
ein Kriterium bei der Budgetverteilung an die Fachbereiche.<br />
6.4 Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie<br />
Zwar ist die Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie keine Frauenaufgabe per se, doch auf<br />
Grund der gegenwärtigen Rollenverteilung haben immer noch hauptsächlich Frauen diese Vereinbarkeitsfragen<br />
zu lösen. Deshalb ist es für die Realisierung der gleichberechtigten<br />
Partizipation im Hochschulbereich unabdingbar, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,<br />
die eine Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie ermöglichen.<br />
6.4.1 Kinderbetreuung<br />
Ein wesentlicher Aspekt für die Gestaltung einer familiengerechten <strong>Hochschule</strong> ist die Sicherstellung<br />
einer flankierenden Kinderbetreuung, insbesondere für betreuungsunsichere Zeiten,<br />
wie in den Abendstunden bzw. für Wochenendveranstaltungen. Hier kann die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH) bereits auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Vor 12 Jahren entstand<br />
auf Initiative von Studierenden mit Unterstützung von Dr. Mingerzahn am Hochschulstandort<br />
<strong>Magdeburg</strong> das KiZi (Kinderzimmer). Im Jahr 2008 konnte auch am Hochschulstandort <strong>Stendal</strong><br />
das FaZi (Familienzimmer) eröffnet werden, nachdem im Wintersemester 2007/08 die bestehenden<br />
Bedarfe in einem Studienprojekt von Prof. Hungerland ermittelt wurden.<br />
Die Betreuungsaufgaben werden von Studierenden der Fachbereiche Sozial- und Gesundheitswesen<br />
bzw. Angewandte Humanwissenschaften übernommen und ermöglichen das<br />
kostenlose flankierende Betreuungsangebot. Die kostenneutrale Kinderbetreuung unterstützt<br />
somit Studierende und Beschäftigte bei der Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familienaufgaben.<br />
Die relativ starre Organisation der Bachelor- und Masterstudiengänge erschweren<br />
jedoch die stetige Sicherstellung der flankierenden Betreuungsangebote der Studierenden. Das<br />
und die bestehenden zusätzlichen Fahrtwege schränken auch die Nutzung der flankierenden<br />
Kinderbetreuungsangebote des KiZi und FaZi ein. Die Arbeitsgruppe ‚Hochschul-Kita‘ untersucht<br />
zurzeit Möglichkeiten für die Errichtung einer Hochschul-Kita am Hochschulstandort<br />
<strong>Magdeburg</strong>.<br />
Neben der flankierenden Kinderbetreuung besteht seit diesem Jahr am Hochschulstandort<br />
<strong>Magdeburg</strong> auch ein öffentlich zugänglicher Kinderspielplatz. Dieser wurde auf Initiative von Dr.<br />
Mingerzahn und dem KiZi-Projektteam errichtet und am 07.07.<strong>2009</strong> von Rektor Prof. Geiger<br />
und der Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit und Soziales, Prof. Dienel, feierlich eröffnet.<br />
6.4.2 Audit Familiengerechte <strong>Hochschule</strong><br />
Wie die o. g. Ausführungen darlegen, kann die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) schon auf<br />
punktuelle Maßnahmen für eine familiengerechte Ausrichtung der <strong>Hochschule</strong> verweisen. Jedoch<br />
wurde dieses Thema bisher nicht als Querschnittsaufgabe wahrgenommen und<br />
umgesetzt. Für eine nachhaltige und systematische familiengerechte Ausgestaltung der <strong>Hochschule</strong><br />
empfiehlt es sich, das inzwischen bundesweit anerkannte Audit familiengerechte<br />
<strong>Hochschule</strong> der berufundfamilie gGmbH (buf), eine Initiative der gemeinnützigen Hertie-<br />
Stiftung, durchzuführen. Dieses Verfahren berücksichtigt sowohl die Rahmenbedingungen für<br />
Studium und wissenschaftliche Karriere als auch für die Beschäftigten im Verwaltungsbereich.<br />
Bereits seit 2007 hat die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) Interesse am Auditierungsprozess<br />
der berufundfamilie gGmbH gezeigt. Im letzten Jahr hätten die Auditkosten i.H.v. 11.000<br />
Seite 46
EUR zzgl. MwSt ausschließlich von der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) finanziert werden<br />
müssen, weswegen 2008 von der Teilnahme am Audit Abstand genommen wurde. In diesem<br />
Jahr werden 70 % der Kosten vom Land Sachsen-Anhalt im Rahmen der De-minimis-Beihilfe<br />
gefördert.<br />
Seit August <strong>2009</strong> ist die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) für den Auditierungsprozess angemeldet.<br />
Bis Ende September <strong>2009</strong> erfolgte eine Bestandsaufnahme der bereits bestehenden<br />
familienfreundlichen Strukturen. Im Oktober und November <strong>2009</strong> fand der Strategie- und Auditierungsworkshop<br />
statt. Eine repräsentative Gruppe der Hochschulmitglieder entwickelte<br />
zusammen mit der Hochschulleitung konkrete weiterführende Maßnahmen für die Verwirklichung<br />
einer familiengerechten <strong>Hochschule</strong>. Die von der Hochschulleitung unterzeichnete<br />
Zielvereinbarung soll spätestens Anfang Januar 2010 bei der berufundfamilie gGmbH eingereicht<br />
werden. Nach einer positiven Prüfung des bisherigen Auditierungsprozesses wird der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) Anfang 2010 das Zertifikat ‚Familiengerechte <strong>Hochschule</strong>‘<br />
verliehen.<br />
6.4.3 Hochschulübergreifende Koordination<br />
Die Arbeitsgruppe Frauen, die sich aus den Gleichstellungsbeauftragten und interessierten Mitarbeitern/-innen<br />
und Studierenden zusammensetzt, trifft sich mindestens zweimal im Semester,<br />
um über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren und ggf. Arbeitsvorlagen für die Hochschulleitung<br />
bzw. den Akademischen Senat zu erarbeiten. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an<br />
den Sitzungen des Akademischen Senats teil.<br />
Im August <strong>2009</strong> wurde eine wissenschaftliche Koordinatorin für gleichstellungspolitische und<br />
familienfreundliche Maßnahmen (für ein Jahr befristet) eingestellt. Neben der Begleitung und<br />
Unterstützung gleichstellungspolitischer und familienorientierter Projekte an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wird auch das landesweite Arbeitsprojekt zur Förderung der Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern in der Wissenschaft, an dem sich alle <strong>Hochschule</strong>n des<br />
Landes Sachsen-Anhalts beteiligen und die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) die koordinierende<br />
Funktion übernimmt, forciert.<br />
Nach der erfolgreichen Auditierung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wird zurzeit eine<br />
Fachtagung am Hochschulstandort <strong>Stendal</strong> konzipiert, die an den Input-Workshop im November<br />
2007 zum Thema Gestaltung Familienfreundlicher <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt<br />
anschließen wird. Die Tagung, die im April 2010 stattfindet, wird ein Forum bieten, sich über die<br />
konkreten Chancen und Möglichkeiten des Audits Familiengerechte <strong>Hochschule</strong> der berufundfamilie<br />
gGmbH zu informieren und auszutauschen sowie die Bedingungen für die Entwicklung<br />
zu einer familiengerechten <strong>Hochschule</strong> zu diskutieren.<br />
Weiterhin werden zurzeit mit den anderen <strong>Hochschule</strong>n die Inhalte für das gemeinsame Arbeitsprojekt<br />
abgestimmt, um dann im nächsten Jahr die konkrete Projektkonzeption zu<br />
entwickeln und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen vorzubereiten.<br />
Seite 47
7 Hochschulmarketing<br />
7.1 Hochschulübergreifendes Marketing – Beteiligung am Landesmarketing<br />
Auch <strong>2009</strong> beteiligte sich die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) intensiv an beiden hochschulübergreifenden<br />
Kampagnen, die zum einen aus der Vereinbarung zur Umsetzung des<br />
Hochschulpakts 2020 im Land Sachsen-Anhalt – „Attraktivität und Marketing der Studienbedingungen“,<br />
zum anderen an der Kampagne „Studieren in Fernost“ unter Federführung von Scholz<br />
& Friends (Berlin) für die neuen Länder entwickelten Strategie bestehen.<br />
Kampagne „Attraktivität und Marketing der Studienbedingungen“<br />
Die erste hat zum Ziel, die Attraktivität der <strong>Hochschule</strong>n für westdeutsche Studierwillige zu vermarkten.<br />
Gleichzeitig soll die Attraktivität durch Best-practice-Beispiele erhöht werden. Diese<br />
sollen durch die Entwicklung in hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen allen <strong>Hochschule</strong>n<br />
zugutekommen. Die Themen dieser Arbeitsgruppen lauten:<br />
• „Vom ersten Kontakt bis zur Einschreibung“<br />
• „Fachliche Betreuung während des Studiums“<br />
• „Leben in der Stadt (Stadt/<strong>Hochschule</strong>)“<br />
• „Hochschulmarketing im Internet-Content und Werkzeuge“ sowie<br />
• „Karriereservice“<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) hat die Leitung der Arbeitsgruppe „Karriereservice“<br />
übernommen. Noch in den Sitzungen des Jahres 2008 wurde beschlossen, dass <strong>2009</strong> eine<br />
Weiterbildung hinsichtlich der Serviceorientierung initiiert werden sollte. Diese fand in einem<br />
zweitägigen Workshop für die Teilnehmer der <strong>Hochschule</strong>n statt. Der Workshop wurde vom<br />
Projektteam „Servicequalität Sachsen-Anhalt“ an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im<br />
März und Mai <strong>2009</strong> veranstaltet. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, sich zertifizieren lassen<br />
zu können und dürfen nun den Titel „Qualitäts-Coach“ tragen.<br />
Kampagne „Studieren in Fernost“<br />
Aus der Vielzahl der Aktivitäten werden im Folgenden nur einige exemplarisch dargestellt:<br />
Selbstverständlich hat sich die <strong>Hochschule</strong> am Wettbewerb der Hochschulinitiative Neue Bundesländer<br />
2008/09 – „Schneller ins Studium“ im März <strong>2009</strong> mit einem eigenen Beitrag beteiligt.<br />
Große Teile davon sind, obwohl die <strong>Hochschule</strong> leider nicht zu den Gewinnern zählte, dennoch<br />
umgesetzt worden.<br />
Um die Kampagne möglichst vielen Mitgliedern der <strong>Hochschule</strong> nahezubringen, lud das Rektorat<br />
Herrn Dr. Biggeleben (Scholz & Friends) zu einer Präsentation in die <strong>Hochschule</strong> ein. Diese<br />
fand im Mai <strong>2009</strong> im AudiMax unter großer Beteiligung statt.24 Die sich anschließenden Diskussion<br />
trugen dazu bei, die Notwendigkeit eigener Anstrengungen in den verschiedensten<br />
Bereichen zu verankern.<br />
Drei Campus-Spezialistinnen betreuen kontinuierlich und mit viel Einsatz den Auftritt der<br />
<strong>Hochschule</strong> in schuelerVZ. Durch Anbindung an sowie regelmäßige Rückkopplungen zur Pressestelle<br />
können Maßnahmen konzertiert umgesetzt werden.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> hat am Workshop in Berlin am 3.11.<strong>2009</strong> teilgenommen (Prorektor, Studienberatung,<br />
Pressesprecher) und dort auch zu einer ersten Auswertung der Ergebnisse referiert.<br />
Ebenso waren zahlreiche Mitglieder der <strong>Hochschule</strong> am Workshop in <strong>Magdeburg</strong> am<br />
18.12.<strong>2009</strong> vertreten, als sich die Thematik insbesondere um die neuen Kommunikationsformen<br />
unter WEB 2.0 drehte. Hierbei wurden die Aktivitäten der <strong>Hochschule</strong> wegen ihrer<br />
diesbezüglichen Aktivitäten besonders herausgehoben.<br />
24 Vgl. hierzu: „Studieren in Fernost“, in: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH): Treffpunkt Campus, Nr. 48, Mai<br />
<strong>2009</strong>, S. 14f.<br />
Seite 48
Die Vorbereitung des Wettbewerbsbeitrages für 2010 (Campus Day) gemeinsam mit der Ottovon-Guericke-Universität<br />
und Partnern aus der Stadt läuft seit November.<br />
Eine Unterstützung der von der Hochschulinitiative für 2010 geplanten „Nachwuchs-<br />
Journalisten-Rallye“ wurde aufwändig vorbereitet.<br />
7.2 Hochschulspezifisches Marketing<br />
Die folgenden Ausführungen fußen auf dem Beitrag „Grundlagen des Hochschulmarketings und<br />
Konzept für die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)“25, welcher 25 Seiten umfasst. Dieser<br />
wurde im April im Rahmen der Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpakts 2020 im Land<br />
Sachsen-Anhalt – „Attraktivität und Marketing der Studienbedingungen“ im Kultusministerium<br />
präsentiert und im Mai <strong>2009</strong> im Senat der <strong>Hochschule</strong> vorgestellt. Insofern werden im Folgenden<br />
nur darüber hinausgehende Planungen, Umsetzungen etc. beschrieben:<br />
• Erste Anlaufstelle für Fragen ist die Studienberatung. Sie hat die wichtigste Aufgabe, da<br />
sie für diejenigen Bewerberinnen und Bewerber meist den ersten persönlichen Kontakt mit<br />
der <strong>Hochschule</strong> herstellt. 2980 Kontakte per Mail, 1180 Kontakte im Rahmen eines Beratungsgespräches<br />
vor Ort dokumentieren dies. Zahlreiche Messebesuche fordern die<br />
Mitarbeiterinnen zusätzlich.26<br />
• Ausbau der Testimonials bei www.Studieren-im-Gruenen.de; Erweiterung ist geplant; auch<br />
und gerade in Hinsicht auf dialogische Kommunikation: Kommentarfunktion, Weiterleiten<br />
etc.<br />
• Zur Kinderuni in <strong>Stendal</strong>27 kommt seit WS <strong>2009</strong>/10 der Junior-Campus (Alter 6 bis 14)28<br />
• Die <strong>Hochschule</strong> hat die Marketing-Chance <strong>2009</strong> des Marketing Clubs <strong>Magdeburg</strong>29 für<br />
www.studieren-im-gruenen.de gewonnen.<br />
• Am 6.11.<strong>2009</strong> erschien in der französischen Tageszeitung „Le Monde“ ein Artikel über<br />
die <strong>Hochschule</strong>. Darin wird über die hervorragenden Studienbedingungen berichtet, die sich<br />
den Studierenden in <strong>Magdeburg</strong> bieten. Grund für den Besuch waren lt. Redakteurin die besonderen<br />
Maßnahmen der <strong>Hochschule</strong>, durch Werbung Studierende aus dem Westen zu<br />
gewinnen.30<br />
• Zweitschönster Campus Deutschlands: Für die Studierenden der <strong>Hochschule</strong> ist er klar<br />
die Nummer 1 – der grüne Campus. Für die Jury der Zeitschrift Unicum liegt die <strong>Hochschule</strong><br />
bei der Wahl zum schönsten Campus Deutschlands auf einem sensationellen zweiten<br />
Platz.31<br />
• Hello World! Webseiten der <strong>Hochschule</strong> nun mit reichlich Inhalt in englischer Sprache.<br />
• Bewerbertage nun auch in <strong>Stendal</strong> erfolgreich gestartet: Wie im Jahr 2008 begonnen,<br />
wurden auch in diesem Jahr Bewerber/-innen eingeladen, um Campus und Stadt vor Studienbeginn<br />
kennenzulernen. Mit dabei die neuen Scouts der Fachbereiche. Sie helfen bei<br />
der ersten Orientierung in Stadt und <strong>Hochschule</strong>. Etwa 400 Besucherinnen und Besucher<br />
nutzten die Chance, nach <strong>Stendal</strong> bzw. <strong>Magdeburg</strong> zu fahren. Tage der offenen Tür wurden<br />
erstmals genutzt, um Statements von Besuchern einzufangen. Die Filme sind in den Webauftritt<br />
eingebunden und waren in der Bewerberzeit auf der Startseite verlinkt.<br />
mms://streamsrv.zki.hs-magdeburg.de/ZKI/ToT_1.wmv und mms://streamsrv.zki.hsmagdeburg.de/ZKI/ToT_2.wmv<br />
• Bilder von Ereignissen mit öffentlicher Wirkung werden durch die Pressestelle auch im<br />
web 2.0 verbreitet: Profil der <strong>Hochschule</strong> auf flickr: www.flickr.com/photos/studieren-imgruenen/<br />
25 Vgl. www.hs-magdeburg.de/hochschule/leitung/prorentw/kommision/Marketing-Konzept%20<strong>2009</strong>.pdf<br />
26 Vgl. hierzu den Beitrag aus Treffpunkt Campus im Anhang auf Seite 90<br />
27 Vgl. www.kinderuni-stendal.de/<br />
28 Vgl. www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtung/ver-alu/veranst/<br />
29 Vgl. www.hs-magdeburg.de/aktuelles/archiv/<br />
30 Vgl. www.hs-magdeburg.de/artikel.pdf<br />
31 Siehe www.unicum.de/evo/16595_1_2 oder bzw. den Beitrag aus Treffpunkt Campus, im Anhang auf Seite 89<br />
Seite 49
• Mehr im web 2.0:<br />
Noch im Aufbau:<br />
www.facebook.com/pages/<strong>Magdeburg</strong>-Germany/<strong>Hochschule</strong>-<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong>-<br />
FH/52583930298 155 s. g. Follower auf Twitter<br />
http://twitter.com/hs_magdeburg<br />
Diverse Filme mit Studierenden auf Youtube:<br />
www.youtube.com/user/<strong>Hochschule</strong><strong>Magdeburg</strong><br />
• Treffpunkt campus: Sechs Ausgaben pro Jahr, seit Nr. 50 (Okt. <strong>2009</strong>) durchgehend vierfarbig,<br />
was die Attraktivität wesentlich verbessert; außerdem wird der Abonnentenstamm<br />
durch Absolventen/-innen erweitert.32<br />
• Campusseiten:<br />
Volksstimme: Seit Sept. 2008 fast durchgehend wöchentlich33 mit Zuarbeiten (Text und<br />
Bild) durch Pressestelle<br />
Mitteldeutsche Zeitung: erscheint wöchentlich; seit Herbst Zuarbeiten (Text und Bild) sowie<br />
Themenvorrecherche durch die Pressestelle<br />
• Schaltung von Anzeigen: z. B. im Hessischen Studienführer (Verteilung durch Kultusministerium<br />
Hessen) und in westdeutschen Stadt- und Kulturmagazinen, um für studieren-imgruenen.de<br />
zu werben. Diese Werbung und die Banner auf Webseiten (studieren.de u. a.)<br />
greift: Monatlich bis zu 3.000 zusätzliche Besucher auf der „Landing Page“ für Studieninteressierte<br />
• Weiterarbeit an der Flyerserie zu den Studienangeboten (BA ist komplett, MA überwiegend<br />
fertig)<br />
Um die Attraktivität der <strong>Hochschule</strong> weiter zu erhöhen, wurden im letzten Jahr einige Maßnahmen<br />
umgesetzt bzw. zur Umsetzung für 2010 in Angriff genommen.<br />
Hochschulscouts haben Arbeit aufgenommen<br />
Um nicht nur für Studierende der näheren Umgebung, sondern auch für junge Menschen aus<br />
den westdeutschen Bundesländern attraktiver zu werden, hat die <strong>Hochschule</strong> im letzten Jahr<br />
erfahrene Studierende beauftragt, als sogenannte Hochschulscouts34 tätig zu werden. Ein Studium<br />
fern vom Elternhaus bedeute, dass die jungen Leute zum ersten Mal mit der<br />
Verantwortung für einen eigenen Hausstand in einer für sie unbekannten Umgebung konfrontiert<br />
sind.35 Gerade bei Fragen hierzu stehen die Hochschulscouts hilfreich zur Seite.<br />
Seit Juni <strong>2009</strong> gibt es etwa 18 Hochschulscouts aus allen Fachbereichen für fast alle Bachelorstudiengänge.<br />
Sie haben die Aufgabe, in der Bewerbungsphase und nach der<br />
Immatrikulation hilfreich zur Seite zu stehen. Eine erste Evaluation zeigt, dass dieser Service<br />
der <strong>Hochschule</strong> angenommen wird und die Attraktivität der <strong>Hochschule</strong> tatsächlich erhöht.<br />
Mentorenprogramm in Planung<br />
Das Mentorenprogramm36 soll sich an die Tätigkeit der Hochschulscouts anschließen. Hierbei<br />
stehen weniger Fragen zum neuen Umfeld des Studienortes im Vordergrund, sondern Probleme<br />
fachlicher Art. Oft zweifeln junge Menschen daran, dass ihre eigene schulische Ausbildung<br />
als notwendige Vorbereitung für ein Studium37 ausreicht. Unter Einbindung des Studentenrats<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) wurden erste Kontakte zum Verein „Unimentor<br />
32 Siehe www.hs-magdeburg.de/aktuelles/hszeitung/<br />
33 Siehe www.volksstimme.de/vsm/sonderthemen/campus/<br />
34 Siehe www.hochschulscout.de/<br />
35 Möglicherweise ist dies einer der Gründe, dass für immerhin 2/3 der Studienanfänger die Nähe zum Heimatort<br />
entscheidend ist. Vgl. Heine, Ch. u.v.a.: Studienanfänger im Wintersemester 2007/08; in: HIS: Forum <strong>Hochschule</strong><br />
16/2008, S. 200f<br />
36 Vgl. hierzu auch das Kapitel 2.3.2 Betreuung der Studierenden<br />
37 Nur zwei Fünftel der deutschen Studienanfänger fühlen sich durch die Schule gut oder sehr gut auf das Studium<br />
vorbereitet. Schlecht oder unzureichend vorbereitet fühlt sich knapp ein Drittel. Heine, Ch. u.v.a.: Studienanfänger<br />
im Wintersemester 2007/08; in: HIS: Forum <strong>Hochschule</strong> 16/2008, S. 2 (http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-<br />
200816.pdf)<br />
Seite 50
e.V.“38 in <strong>Magdeburg</strong> geknüpft, um von deren Erfahrungen zu profitieren. 2010 wird dieses<br />
Programm mit den Fachbereichen diskutiert und abgestimmt werden, damit bereits existierende<br />
Programme an einzelnen Fachbereichen implementiert werden können. Sobald dieses geschehen<br />
ist, kann die Maßnahme als hochschulweite Unterstützung nach außen kommuniziert<br />
werden.<br />
Regionalbüro in Salzwedel<br />
Um die regionale Zusammenarbeit bezüglich des Wissens- und Technologietransfers, in der<br />
Weiterbildung, aber auch hinsichtlich der Information für Studienbewerberinnen und -bewerber<br />
zu verbessern, wurde <strong>2009</strong> ein Regionalbüro im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) in<br />
Salzwedel eröffnet. Mit Unterstützung der IGZ und des Altmarkkreises Salzwedel betreibt die<br />
<strong>Hochschule</strong> eine Anlaufstelle für alle Interessierten und kommt so dem Auftrag nach, die <strong>Hochschule</strong>inrichtung<br />
für den Norden Sachsen-Anhalts zu sein. Im abgelaufenen Jahr war diese<br />
Anlaufstelle einmal in der Woche durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter besetzt. Die <strong>Hochschule</strong><br />
strebt hiermit auch an, ihre Bekanntheit in den angrenzenden Bereichen Niedersachsens<br />
zu erhöhen.<br />
Zusätzlich ist die Vorbereitung des Wissenschaftssommers 2010 in <strong>Magdeburg</strong> (5. bis 11. Juni)<br />
inkl. der Langen Nacht der Wissenschaft angelaufen. Diese Veranstaltung findet jährlich in<br />
wechselnden deutschen Städten statt.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> ist natürlich in die Otto-Kampagne der Stadt <strong>Magdeburg</strong>, Wissenschaft und<br />
<strong>Hochschule</strong>n, eingebunden.<br />
7.3 Erste Ergebnisse<br />
Die bereits realisierten Maßnahmen haben mittlerweile wohl schon erste Wirkungen gezeigt.<br />
Bedenkt man, dass beim Vergleich der Zahlen der Neuimmatrikulierten nicht vergessen werden<br />
darf, dass sich in den letzten Jahren der doppelte Abiturjahrgang in Sachsen-Anhalt noch in den<br />
Zahlen niedergeschlagen hat, so ist die jüngste Entwicklung sehr positiv zu sehen, da die Zahl<br />
der Studienanfänger nochmals gestiegen ist.<br />
Die Filme auf Youtube wurden bislang insgesamt etwa 4.000 Mal angesehen, der Beitrag des<br />
Studierenden Felix allein rund 1.600 Mal, die Immatrikulationsfeier auf flickr 1.700 Mal und der<br />
Internetauftritt „studieren-im-grünen.de“ hatte 40.000 Besucher.<br />
Zum Wintersemester <strong>2009</strong>/1039 kamen über 37 % der Bewerberinnen und Bewerber aus den<br />
westdeutschen Bundesländern und Berlin.<br />
Im Wintersemester 2008/09 wurde noch ein Anteil an den Studienanfängerinnen und -<br />
anfängern von 11,9 % aus den westdeutschen Bundesländern und 2,2 % aus Berlin verzeichnet.<br />
Zum Wintersemester <strong>2009</strong>/10 stieg der Prozentsatz für die Herkunft aus den alten Ländern<br />
auf 16,3 % und für Berlin auf 2,8 %. Bezogen auf alle Studiengänge liegt der Prozentsatz für<br />
diejenigen, die aus dem Westen bzw. Berlin kommen, im Wintersemester <strong>2009</strong>/10 bei über 21<br />
%.<br />
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die überregionale Bekanntheit der <strong>Hochschule</strong> weiter<br />
gestiegen ist und die umgesetzten und geplanten Maßnahmen (Hochschulscouts und<br />
Mentorenprogramm) dazu führen sollten, dass ein noch höherer Prozentsatz der Bewerberinnen<br />
und Bewerber sich entschließt, dann auch tatsächlich an der <strong>Hochschule</strong> zu studieren.<br />
Insofern sieht sich die <strong>Hochschule</strong> für die Auswirkungen des demografischen Wandels in den<br />
Neuen Bundesländern gut vorbereitet.<br />
38 www.unimentor.de/<br />
39 Diese Prozentsätze beziehen sich nur auf die Bachelor-Studiengänge, die im Rahmen des Hochschulpakts<br />
2020 eine herausgehobene Rolle spielen.<br />
Seite 51
8 Verhältnis Staat und <strong>Hochschule</strong> – Flexibilität und Eigenverantwortung<br />
8.1 Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt<br />
Die Zusammenarbeit im WZW war auch <strong>2009</strong> intensiv. Mitglieder der <strong>Hochschule</strong> waren bei einer<br />
Vielzahl der Workshops40 vertreten, wovon beispielhaft der Evaluierungsworkshop<br />
„Attraktivität der Studienbedingungen und Hochschulmarketing“, der Expertenworkshop "Transparenz<br />
und Information – Effizienz der Berichterstattung gegenüber der Landesregierung und<br />
dem Parlament" oder das Kolloquium "Strategien der Qualitätssicherung der Forschung" genannt<br />
seien. In der „Lenkungsgruppe Demografischer Wandel im Land Sachsen-Anhalt“ ist die<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) mit Prof. Dr. Jürgen Wolf vertreten.<br />
8.2 Stärkung interner Selbststeuerung<br />
Im Folgenden werden die Weiterentwicklungen der Instrumente der Selbststeuerung <strong>2009</strong> dargestellt.<br />
Gemäß der Zielvereinbarung vom 16.12.05, A 8.2., Satz 3 „Die <strong>Hochschule</strong> etabliert<br />
[…] interne Evaluation und Qualitätssicherung […]“ werden auch qualitative Verfahren der Leistungsbewertung<br />
beschrieben, und es wird in einem Abschnitt auf das ‚Strategische Controlling’<br />
eingegangen. Hervorzuheben ist, dass die Umstellung von Diplomstudiengängen auf das gestufte<br />
System in den Ansätzen der Selbststeuerung nach wie vor große Probleme aufwirft. Zum<br />
einen sind die Daten im Rahmen der Zeitreihenanalyse (z. B. durchschnittliche Studiendauer)<br />
nicht mehr vergleichbar, zum anderen gibt es noch recht wenig zuverlässige Vergleichszahlen<br />
für das Benchmarking. Der anfängliche Aufwand bei der Analyse der neuen Daten sollte nicht<br />
unterschätzt werden.<br />
Bei der Schaffung von Anreizmechanismen für Leistungsverbesserungen innerhalb der <strong>Hochschule</strong><br />
hat die Leistungsorientierte Mittelverteilung an die Fachbereiche für die <strong>Hochschule</strong> eine<br />
zentrale Bedeutung. Deren Auswirkungen werden von der <strong>Hochschule</strong> erst einmal abgewartet.<br />
Darüber hinaus finden regelmäßige Sitzungen der Hochschulleitung mit den Dekanen statt und<br />
bei wichtigen, die Fachbereiche betreffenden strategischen Fragen, auch Klausurtagungen der<br />
Hochschulleitung mit den Fachbereichen. Außerdem gibt es seit dem letzten Jahr für wichtige –<br />
die Strategie der <strong>Hochschule</strong> determinierende – Themen die Position des Rektoratsbeauftragten.<br />
Diese Positionen nehmen Professorinnen oder Professoren ein, die sich längerfristig einem<br />
zentralen Thema der <strong>Hochschule</strong> widmen41. Insofern wurde auch <strong>2009</strong> von Zielvereinbarungen<br />
der Hochschulleitung mit den Fachbereichen abgesehen und haben an der <strong>Hochschule</strong> keine<br />
hervorgehobene Bedeutung, weshalb im nachfolgenden Teil auf einen gesonderten Abschnitt<br />
‚hochschulinterne Zielvereinbarungen’ verzichtet wird. Selbstverständlich ist, dass die Fachbereiche<br />
z. B. monatlich über die monetären (Stand der verfügbaren Haushaltsmittel) und<br />
nichtmonetären (Balanced Scorecard) Daten informiert werden. Bei Abweichungen der Ist- von<br />
den Plangrößen finden Gespräche mit der Hochschulleitung statt.<br />
An dieser Stelle sei auch noch einmal auf den Mitte letzten Jahres erschienenen umfassenden<br />
„Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der<br />
HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)“ gemäß den Zielvereinbarungen hingewiesen, da im Folgenden<br />
häufiger auf diesen Text Bezug genommen wird. Betont werden muss, dass die kontinuierliche<br />
Pflege und regelmäßige Anwendung der Instrumente sowie die Auswertung der mit ihnen erhobenen<br />
Daten mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist.<br />
40 Vgl. hierzu die Übersicht zu den Veranstaltungen des WZW <strong>2009</strong>: http://www.burg-halle.de/5504.0.html<br />
41 Diese Beauftragten sollen das jeweilige Thema in Verbindung mit der Hochschulleitung und entsprechenden<br />
Senatskommissionen über einen längeren Zeitraum begleiten. Die Vorteile liegen in einer Diffundierung von<br />
Wissen in der <strong>Hochschule</strong> und der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den in der Verwaltung und in<br />
Lehre und Forschung Tätigen.<br />
Seite 52
8.2.1 Stand der hochschulinternen, leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM)<br />
Das hochschulweite Mittelverteilungsmodell ist in früheren Berichten schon mehrmals ausführlich<br />
dargestellt worden42, weshalb an dieser Stelle nur über Änderungen des Modells berichtet<br />
wird. Diese betrafen die Kennzahl Absolventenquote: Für die Mittelverteilung im Jahr <strong>2009</strong><br />
musste die Berechnungsweise dieser Kennzahl modifiziert werden, da 2008 neben den Diplomabsolventen/-innen<br />
erstmalig ‚Bachelors’ in größerem Umfang ihr Studium beendeten, deren<br />
Regelstudienzeit sich von der der ’Diplomanden’ unterscheidet. Wir berechneten deshalb für die<br />
Mittelverteilung <strong>2009</strong> erstmalig getrennte Absolventenquoten für die Absolventen/-innen‚ Diplom’,<br />
‚Bachelor43’ und auch ‚Master’. Für die Berechnung der Absolventenquoten für Diplom-<br />
Studiengänge wurde die Zahl der Diplom-Absolventen/-innen eines akademischen Jahres durch<br />
den Durchschnitt der Anfängerzahlen drei, vier und fünf Jahre vorher geteilt, für die 6semestrigen<br />
Bachelor-Studiengänge wurden die Absolventen/-innen des Jahres 2006 in Beziehung<br />
gesetzt zu dem Durchschnitt der Anfänger der akademischen Jahre 2004 – 200644. Die<br />
Berechnung der Master-Absolventenquoten erfolgte in analoger Weise, allerdings wurden hierbei<br />
als Anfängerzeitraum die Jahre 2006 – 200745 gewählt. Danach wurden die getrennt<br />
berechneten Absolventenquoten gewichtet mit dem Anteil der Absolventen/-innen einer Abschlussart<br />
an der Gesamtheit aller Abschlüsse. So erhielt zum Beispiel die Absolventenquote<br />
Diplom für die <strong>Hochschule</strong> insgesamt das Gewicht 0,72, da der Anteil von Diplom-Absolventen/innen<br />
an der Gesamtheit der Abschlüsse 72 % betrug. In einem abschließenden Schritt wurden<br />
die getrennt berechneten und gewichteten Absolventenquoten addiert zu einer einheitlichen<br />
Absolventenquote hochschulweit und je Fachbereich. Die prozentualen Anteile der fachbereichsbezogenen<br />
Absolventenquoten an einer Größe, welche die aufaddierten<br />
Absolventenquoten aller Fachbereiche darstellt, bilden die Grundlage für die Mittelverteilung an<br />
die Fachbereiche für diesen Indikator.<br />
Das mit den dargestellten Änderungen versehene Modell wird 2010 zum vierten Mal für die interne<br />
Mittelverteilung an die Fachbereiche verwendet, wobei – bis auf die Investitionsmittel und<br />
kleinere Beträge – alle den Fachbereichen zur Verfügung gestellten Mittel über dieses Modell<br />
verteilt werden. Dazu ist der Prozess der Datenerhebung <strong>2009</strong> angelaufen, damit die Mittel<br />
2010 zügig verteilt werden können.<br />
Weitere Korrekturen oder Ergänzungen an dem bisherigen Modell wurden bislang nicht vorgenommen.<br />
Der Grund hierfür liegt darin, Auswirkungen des Modells vergleichen zu können. Nach<br />
dem bisherigen Stand lassen sich zu den durch das Modell beabsichtigten und eingetretenen<br />
Steuerungseffekten in Anbetracht der noch relativ kurzen Laufzeit des Modells erst einige vorläufige<br />
Ergebnisse benennen. Zunächst lässt sich festhalten, dass das Modell in den meisten<br />
Fachbereichen mit Zufriedenheit aufgenommen wurde. Diese Beobachtung deckt sich mit der<br />
Einschätzung von Jaeger46, dass Verfahren formelgebundener Mittelzuweisung sich in der Regel<br />
als geeignet erweisen, Transparenz beim Budgetierungsgeschehen sowie hinsichtlich der<br />
42 Z. B. im „Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der HS<br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)“ vom 30.06.2008<br />
43 Bei den ‚Bachelors’ hatten wir als ein zusätzliches Problem, dass es neben Bachelor-Studiengängen mit 6semestriger<br />
Regelstudienzeit solche mit 7-semestriger Regelstudienzeit gibt, die 2008 noch nicht mit ihrem Studium<br />
fertig werden konnten. Daher wurden die Anfängerzahlen für das akademischen Jahres 2006 ohne die<br />
Anfänger der 7-semestrigen Studiengänge berechnet.<br />
44 Das gilt allerdings nur für die Fachbereiche, wo es schon Anfänger in den Jahren 2004 und 2005 gegeben hat,<br />
was für die Fachbereiche Bauwesen und Kommunikation/Medien der Fall ist. Für die Fachbereiche Ingenieurwissenschaften/Industriedesign<br />
und Wirtschaft bestand der Anfängerzeitraum aus den Jahren 2005 und 2006,<br />
da es in diesen Fachbereichen ab 2005 Bachelor-Studenten gab, für Sozial- und Gesundheitswesen und Angewandte<br />
Humanwissenschaften bestand der Anfängerzeitraum nur aus dem Jahre 2006. Der Fachbereich<br />
Wasser- und Kreislaufwirtschaft schließlich verfügt ausschließlich über Studiengänge mit 7-semestriger Regelstudienzeit,<br />
deren Anfänger aber, wie erwähnt, nicht berücksichtigt wurden.<br />
45 Das gilt auch hierbei wieder mit der Einschränkung, sofern dieses möglich war, vgl. die Ausführung in der vorherigen<br />
Fußnote.<br />
46 Jaeger, M. (2006): Leistungsorientierte Budgetierung: Analyse der Umsetzung an ausgewählten Universitäten.<br />
HIS-Kurzinformation A 1. Hannover: Hochschul-Informations-System-GmbH.<br />
Seite 53
erbrachten Leistungen herzustellen. Daneben konnte beobachtet werden, dass in den Fachbereichen<br />
ein lebhafter Diskussionsprozess über die Leistungen der <strong>Hochschule</strong> in Gang gesetzt<br />
worden ist; dort überlegt wird, welche Indikatoren der Leistungssteigerung Priorität haben, und<br />
einige Fachbereiche damit begonnen haben, eigene, fachbereichsinterne Modelle leistungsbezogener<br />
Budgetierung zu entwickeln und mittlerweile einsetzen.<br />
8.2.2 Entwicklungsstand des Controllings/Kosten- und Leistungsrechnung<br />
Das Jahr <strong>2009</strong> wurde genutzt, um die bestehenden Steuerungselemente lt. „Bericht über die<br />
konzeptionelle Anlage und die Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der HS <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
(FH)“ vom 30.06.2008 kontinuierlich zu verfeinern und anzuwenden.<br />
8.2.2.1 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)<br />
Die KLR wird an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)47 als kontinuierlicher Prozess durch<br />
das Controlling verantwortlich ausgeführt.<br />
Bereits zum Jahresende 2008 wurden völlig neue Anforderungen an die KLR als Vollkostenrechnung<br />
bekannt.<br />
Für den „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in Forschung, Entwicklung und Innovation“<br />
sowie für die Abrechnung der EU-Projekte wird von der EU eine Trennungsrechnung in<br />
wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Tätigkeiten auf Vollkostenbasis gefordert. Damit war klar,<br />
dass die bestehende Konzeption der KLR zu überarbeiten und den neuen Erfordernissen anzupassen<br />
ist.<br />
Es muss eine Konzeption gefunden werden, die drei Zielrichtungen erfüllt:<br />
• Trennung von wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit im Rahmen der EU-<br />
Forderungen<br />
• Ermittlung von Gemeinkostensätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung zur Besteuerung<br />
bestimmter DRM-Projekte<br />
• Datenbereitstellung für die interne Steuerung und für ein Benchmarking mit anderen <strong>Hochschule</strong>n<br />
Die Fachhochschulen des Landes Sachsen-Anhalt initiierten eine gemeinsame Arbeitsgruppe<br />
zur Entwicklung eines Kalkulationsschemas für die Planung der entsprechenden Projekte und<br />
zur Erarbeitung einer Vollkosten-/Trennungsrechnung zur Abrechnung bzw. Nachkalkulation<br />
dieser DRM-Projekte. Dieser Arbeitsgruppe haben sich im Verlauf des Jahres <strong>2009</strong> die Universitäten<br />
des Landes Sachsen-Anhalt angeschlossen.<br />
Die Arbeitsgruppe hat am 31.01.<strong>2009</strong> ihre Arbeit aufgenommen und hat sich sowohl mit der betreuenden<br />
Softwarefirma HIS GmbH als auch mit einer Wirtschaftsprüfergesellschaft zu diesem<br />
Thema beraten.<br />
Die Arbeitsgruppe hat zunächst versucht, ein eigenes Kalkulationsmodell zu erstellen. Dazu<br />
wurde auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern initiiert.<br />
Es zeigte sich, dass für die Entwicklung einer buchhalterisch und gesetzlich einwandfreien Methode<br />
zur Trennungsrechnung in wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Tätigkeit eine<br />
beraterische und prüferische Unterstützung durch eine auf dem Gebiet der Hochschulkostenrechnung<br />
kompetente Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zwingend notwendig war.<br />
Die <strong>Hochschule</strong>n haben demzufolge eine Leistungsbeschreibung zur Realisierung einer Trennungsrechnung<br />
in wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Tätigkeit lt. EU-Gemeinschaftsrahmen<br />
erstellt und Angebote von namhaften Wirtschaftsprüfungsunternehmen eingeholt. Aufgrund der<br />
im Land geltenden Regelungen zur Vergabe von Beraterverträgen konnte der Zuschlag zur<br />
Vergabe der Leistung an die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erst nach Freigabe<br />
durch die Staatssekretärskonferenz Mitte Oktober <strong>2009</strong> erfolgen.<br />
Seit November <strong>2009</strong> arbeiten die Haushälter und Controller aller <strong>Hochschule</strong>n im Land Sachsen-Anhalt<br />
gemeinsam mit der KPMG an dieser Trennungsrechnung. Der Prozess beinhaltet<br />
47 Vgl. <strong>Rektoratsbericht</strong> 2007 und Bericht über die Anlage und Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 30.06.2008<br />
Seite 54
zunächst die Erarbeitung eines Kalkulationsschemas, welches den Professoren erlaubt, die<br />
entsprechenden Projekte mit direkten und indirekten Kosten korrekt zu planen.<br />
In einem weiteren Arbeitsschritt soll die Konzeption der Trennungsrechnung erstellt werden, die<br />
mit dem Kalkulationsschema konform ist und die eine entsprechende Nachkalkulation/Abrechnung<br />
der Projekte gewährleistet. Die Umsetzung der Trennungsrechnung in den<br />
einzelnen <strong>Hochschule</strong>n wird abschließend von der KPMG geprüft und bescheinigt.<br />
Geplant war, das Jahr 2008 nach dieser neuen Konzeption in der KLR darzustellen. Dies konnte<br />
aufgrund der zeitlichen Verzögerung im Vergabeprozess der Leistung an die<br />
Wirtschaftsprüfer nicht gewährleistet werden. Deshalb wurde zwischenzeitlich die KLR 2008<br />
noch nach alter Konzeption erstellt, um die Ergebnisse für die Abrechnungen der steuerpflichtigen<br />
Projekte im Jahr 2008 einsetzen zu können.<br />
Die Nutzung der Ergebnisse der KLR im Rahmen der Lehre ist auch für 2008 nur eingeschränkt<br />
möglich. Der Umstellungsprozess von Diplomstudiengängen auf Bachelor- und Master-<br />
Studiengänge ist noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der Vollkostenrechnung der KLR werden<br />
– wie in den vorhergehenden Jahren – die Gesamtkosten über alle zu bedienenden<br />
Studiengänge verteilt. Das hat zur Folge, dass auf keinem der bestehenden Studiengänge die<br />
Kosten für eine Vollbesetzung ausgewiesen werden. Dies erschwert die Bewertung und eine<br />
Trendanalyse. Erst mit dem kompletten Umstieg auf Bachelor-Studiengänge und der Etablierung<br />
aller geplanten Master-Studiengänge werden belastbare Ergebnisse vorliegen.<br />
8.2.2.2 Operatives Controlling<br />
8.2.2.2.1 Kennzahlensystem/Balanced Scorecard<br />
Im Jahr <strong>2009</strong> wurden, wie auch schon 2008, die Daten zu dem zwischen den <strong>Hochschule</strong>n des<br />
Landes abgestimmten Kennzahlenkatalog48 erhoben. Die Balanced Scorecard ist ein fester Bestandteil<br />
im internen Berichtswesen der <strong>Hochschule</strong> geworden.<br />
Leider ist es im Jahr <strong>2009</strong> noch nicht gelungen, den Kennzahlenbereich „internationale Beziehungen“<br />
darzustellen. Hier gibt es immer noch für einige Daten die Erfassungsmodalitäten<br />
(Organisation zentrale oder dezentrale Erfassung) zu klären.<br />
Die Dekane der Fachbereiche erhielten darüber hinaus auch <strong>2009</strong> Zeitreihen mit der Entwicklung<br />
einzelner Studiengänge hinsichtlich der Studierenden, Anfänger und Bewerber,<br />
Absolventen/-innen und Studierdauer.<br />
Die erhobenen Kennziffern werden sowohl teilweise für die leistungsorientierte Mittelverteilung<br />
als auch für die Steuerung von Planabweichungen einzelner Fachbereiche (z. B. Anfängerzahlen,<br />
Verbleibsquoten etc.) genutzt, indem die problematischen Kennziffern tiefer analysiert und<br />
Maßnahmen zur Gegensteuerung gesucht werden.<br />
8.2.2.2.2 Zur Messung der Abbrecherquote: Verbleibsquoten nach Studiengang<br />
Das Thema Studienabbruch ist zu einem sehr aktuellen Thema an deutschen <strong>Hochschule</strong>n geworden.<br />
Für Leitner49 wird das Thema Studienabbruch gar zu einem Leistungsindikator für<br />
<strong>Hochschule</strong>n. Die <strong>Hochschule</strong> hat deshalb erhebliche Anstrengungen unternommen, intern eine<br />
brauchbare Kennzahl Abbrecherquote für die neuen Studiengänge zu definieren.<br />
Um an dieser Stelle die damit verbundenen Probleme anzudeuten: in Anlehnung an die Definition<br />
der derzeit in der Presse und Öffentlichkeit am häufigsten zitierten Studie zum Thema<br />
Studienabbruch von der HIS GmbH50 können unter Studienabbrechern Studierende verstanden<br />
werden, die zwar durch Immatrikulation ein Erststudium an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong><br />
48 Vgl. Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 30.06.2008<br />
49 Leitner, O. (<strong>2009</strong>): Kostspielige Universitäten – preiswerte Fachhochschulen? Redemanuskript der 5. Controller-<br />
Tagung vom 23. – 24. Sept. <strong>2009</strong> in Görlitz<br />
50 Heublein, U., Schmelzer, R., Sommer, D. & Wank, J. (2008): Die Entwicklung der Schwund- und Studienabbruchquoten<br />
an den deutschen <strong>Hochschule</strong>n. HIS:Projektbericht, Hannover<br />
Seite 55
(FH) aufgenommen haben, dann aber die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) endgültig ohne<br />
(erstes) Abschlussexamen verlassen.<br />
Keine Studienabbrecher aus der Sichtweise der <strong>Hochschule</strong> wären:<br />
1. Studierende, die innerhalb der <strong>Hochschule</strong> einen Studiengangs- oder Fachwechsel vollziehen51,<br />
2. erfolglose Bachelor-Studierende in einem Bachelor-Zweitstudium und<br />
3. Master-Studenten, die ihr Studium aufgeben.<br />
Hochschulwechsler, die die <strong>Hochschule</strong> verlassen, um ihr Studium an einer anderen <strong>Hochschule</strong><br />
fortzusetzen oder ein neues Studium an einer anderen <strong>Hochschule</strong> zu beginnen, könnten<br />
aber sehr wohl als Studienabbrecher aus der Perspektive unserer <strong>Hochschule</strong> betrachtet werden.<br />
Ein weiteres Problem stellt die Behandlung von Wechslern dar, die von einer anderen<br />
<strong>Hochschule</strong> zu unserer <strong>Hochschule</strong> gewechselt haben.<br />
Ebenso müsste bei der Berechnung fachbereichs- oder gar studiengangsbezogener Studienabbruchquoten<br />
auf Ebene einer <strong>Hochschule</strong> die Behandlung von Studiengangs- (oder<br />
Fachbereichs-) Wechslern geklärt werden.<br />
Zur Berechnung von Studienabbruchquoten sollte ein Bezug von Studienabbrecherzahlen und<br />
Studienanfängerjahrgängen hergestellt werden52. Methodisch am genauesten wäre dazu die<br />
Berechnung ‚empirischer’ Studienabbruchsquoten mit Hilfe einer Studierenden-Datei, die alle<br />
Studierenden im Sinne der oben genannten Definition, detailliert hinsichtlich Semester des Beginns<br />
des Erststudiums und Veränderungen im Status (z. B. Studienabschluss, Studienabbruch,<br />
Studienfachwechsel) usf., erfasst. Damit könnten Aussagen in der Art, im Semester X eines bestimmten<br />
Studiengangs haben ‚so und so viel’ Prozent von dem Anfängerjahrgang Y ihr<br />
Studium abgebrochen, gemacht werden. Geklärt werden müssten dazu aber die oben angedeuteten<br />
konzeptionellen Probleme in der Behandlung von ‚Wechslern’. Wegen des hohen<br />
methodischen Aufwands derartiger Studienverlaufsstatistiken und auch der noch nicht gelösten<br />
Probleme in der Einordnung von Wechslern wurde von uns ein anderer, pragmatischer Weg<br />
beschritten: Es wurden Verbleibsquoten je Bachelor-Studiengang berechnet. Bei dieser Berechnungsweise<br />
werden die Anfängerzahlen im 1. FS für einen bestimmten Bachelor-<br />
Studiengang und aus einem bestimmten Ausgangssemester, z. B. aus dem WS 2005/06 (erstmalige<br />
Immatrikulation im BA), in ihrer absoluten Entwicklung in den folgenden Semestern (um<br />
im Beispiel zu bleiben, wäre dies das SoS 2006, WS 2006/07 usw.) verfolgt und die prozentualen<br />
Anteile der jeweiligen absoluten Zahlen in den Folgesemestern an den betreffenden<br />
Anfängerzahlen als Maße für den ‚Verbleib’ berechnet. Es folgt dazu ein Beispiel anhand des<br />
Verbleibsquotendiagramms für den Bachelor-Studiengang Rehabilitationspsychologie des<br />
Fachbereiches Angewandte Humanwissenschaften.<br />
51 Aus der Sicht des betreffenden Studienganges oder -faches könnte es sich hingegen um Abbrecher handeln<br />
52 Vgl. Heublein et al. (2008), S. 7<br />
Seite 56
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
100%<br />
Verbleibsquoten im Bachelor-Studiengang Rehabilitationspsychologie (innerhalb der RSZ)<br />
100%<br />
95,2%<br />
93,2% 92,8%<br />
89,7%<br />
92,9%<br />
87,9% 87,4%<br />
90,5%<br />
88,8%<br />
86,4%<br />
85,7%<br />
84,1%<br />
83,3% 83,2%<br />
1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />
Semester<br />
Abb. 6: Verbleibsquoten im Bachelor-Studiengang Rehabilitationspsychologie<br />
WS 05/06 (84 Anf.)<br />
WS 06/07 (107 Anf.)<br />
WS 07/08 (103 Anf.)<br />
WS 08/09 (83 Anf.)<br />
Im Wintersemester 2005/06 haben 84 Studierende mit dem Bachelor-Studium Rehabilitationspsychologie<br />
an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) begonnen. Im Folgesemester (SoS<br />
2006) befanden sich 80 Studierende im 2. Semester (Verbleibsquote = 95,2 %), im WS 2006/07<br />
waren es 78 (Verbleibsquote = 92,9 %) usw. Im Wintersemester 2006/07 begannen 107 Studierende,<br />
im darauf folgenden Sommersemester befanden sich 96 Studierende im 2. Semester (=<br />
89,7 %) usw.<br />
Diese Verbleibsquoten wurden <strong>2009</strong> für alle Bachelor-Studiengänge berechnet und den Dekanen<br />
der Fachbereiche zur Verfügung gestellt. Es fanden intensive Diskussionen über<br />
unterschiedliche Entwicklungen in den Studiengängen statt, und es wurden bereits Gegenmaßnahmen<br />
in den Studiengängen eingeleitet, deren Verbleibsquoten tendenziell am stärksten<br />
sanken. Es ist bis auf Weiteres geplant, die Verbleibsquoten zweimal jährlich periodisch neu zu<br />
berechnen und den Dekanaten zur Verfügung zu stellen.<br />
Darüber hinaus ermittelt die <strong>Hochschule</strong> Schwundfaktoren für Bachelor-Studiengänge. Das geschah<br />
<strong>2009</strong> erstmalig nach Abschluss des Wintersemesters 2008/09, da in vielen Bachelor-<br />
Studiengängen erstmalig ein Zyklus in diesem Semester abgeschlossen wurde. Diese<br />
Schwundfaktoren dienen zugleich als Faktor in der Kapazitätsberechnung zur Ermittlung der<br />
Aufnahmequalität.<br />
8.2.2.2.3 Interne Planungsmodelle<br />
Die erarbeiteten internen Planungsmodelle53<br />
• Kapazitätsmodell<br />
• Flächenmodell<br />
• Ermittlung des Vergaberahmens zur W-Besoldung<br />
wurden im Jahr <strong>2009</strong> kontinuierlich aktualisiert und genutzt bzw. weiter aufgebaut.<br />
53 Vgl. Bericht über die konzeptionelle Anlage und Nutzung der Elemente der Selbststeuerung an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) vom 30.06.2008<br />
Seite 57
Kapazitätsmodell:<br />
Das interne Kapazitätsmodell wurde bereits in vorhergehenden Berichten 12 ausführlich beschrieben.<br />
Zu Beginn des Jahres <strong>2009</strong> ist das Gesamtmodell der <strong>Hochschule</strong> in einer Dekaneklausurtagung<br />
den Dekanen vorgestellt worden.<br />
Das Kapazitätsmodell war nun so weit fortgeschritten, dass daraus eine Dienstleistungsverflechtungsmatrix<br />
entstanden ist, die die langfristigen Dienstleistungen zwischen den<br />
Fachbereichen abbildet und diese stellenwirksam darstellt.<br />
Auf dieser Grundlage wurden Dienstleistungsverträge zwischen den Fachbereichen erstellt, die<br />
im Anschluss an diese Dekaneklausurtagung von den Dekanen zu prüfen, eventuell zu korrigieren<br />
und zu unterzeichnen waren. Dieser Prozess konnte – bis auf einige Ausnahmen –<strong>2009</strong><br />
abgeschlossen werden.<br />
Trotzdem bleibt das Kapazitätsmodell weiterhin ein dynamisches Modell und wird immer wieder<br />
eingesetzt, wenn es um die Auswirkungen von Änderungen in den quantifizierten Studienplänen<br />
geht.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> stellt damit immer wieder sicher, dass die vom Land übergebenen Kapazitäten<br />
eingehalten und effektiv genutzt werden.<br />
Zum anderen werden die Ergebnisse des Kapazitätsmodells im Flächenmodell der <strong>Hochschule</strong><br />
genutzt. Siehe dazu die Ausführungen zum Flächenmodell.<br />
Flächenmodell<br />
Die Arbeiten zum Flächenmodell sind <strong>2009</strong> weitgehend abgeschlossen worden. Die <strong>Hochschule</strong><br />
ist damit in der Lage, den tatsächlichen Gesamtflächenbedarf zu berechnen und den<br />
Flächenbedarf der Fachbereiche als Plangröße zu steuern.<br />
Das Modell ist eng gekoppelt an das aktuelle Kapazitätsmodell, in dem die Planung der Lehrangebote<br />
(STG) unter Beachtung der Zielgrößen für die <strong>Hochschule</strong> mit 3.500 Studienplätzen<br />
und 162 WHP-Stellen erfolgt. Die Flächenbedarfe der Fachbereiche werden im Flächenmodell<br />
getrennt erhoben für die Bereiche:<br />
• Flächen der Lehre<br />
• Büroflächen<br />
• Labore und<br />
• Lager/Archiv<br />
Für die Ermittlung der Flächen der Lehre wurde in gemeinsamen Arbeitstreffen mit den Fachbereichen<br />
jede Lehrveranstaltung einzeln betrachtet und eine Gruppengröße je Lehrveranstaltung<br />
festgelegt, aus der die Raumgröße als kleinste Einheit für die Flächenberechnung Lehre und<br />
die notwendige Anzahl an Veranstaltungen, d. h. ob die betreffende Lehrveranstaltung einmal,<br />
zweimal oder mehrmals durchgeführt wird, abgeleitet wurden. Von diesen Flächen wurden die<br />
Laborveranstaltungen abgezogen. Sämtliche auf diese Weise berechneten Flächen je Lehrveranstaltung<br />
wurden danach addiert für die Berechnung eines Flächenbedarfs Lehre je<br />
Fachbereich und für die <strong>Hochschule</strong> insgesamt. Die Flächenbedarfe für die anderen Bereiche<br />
wurden auf der Grundlage der Vorgaben aus der Strukturreform – Stellenplan und Büroflächen<br />
je Mitarbeiter (Pro-Kopf-Flächenansatz 9 bzw. 18 m 2 ) – und zu Laborflächenanteilen in einzelnen<br />
Fächergruppen gebildet und anschließend ebenfalls jeweils aufsummiert nach Fachbereich<br />
und hochschulweit. Aus der Addition der Summen für alle Bereiche entsteht der Flächenbedarf<br />
je Fachbereich und für die <strong>Hochschule</strong> als Ganzes.<br />
Durch die Kopplung an das Kapazitätsmodell führen künftige Veränderungen im Kapazitätsmodell<br />
entsprechend zu einer Aktualisierung der Flächenbedarfe. Nach unserem Kenntnisstand ist<br />
die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) die einzige <strong>Hochschule</strong> in Sachsen-Anhalt mit dieser<br />
‚Zusammenfügung’ des Flächenmodells an das Kapazitätsmodell und kann dadurch sowohl ih-<br />
Seite 58
en Flächenbedarf exakt bestimmen als auch einen tatsächlichen Soll-Ist-Vergleich für Flächen<br />
berechnen, der jede Lehrveranstaltung berücksichtigt.<br />
Der Flächenbedarf für den Standort <strong>Stendal</strong> wurde auf der Grundlage des Modells geplant und<br />
mit dem Kultusministerium abgestimmt. Der Flächenbedarf ist mit Abschluss der jetzigen großen<br />
Baumaßnahme (Sanierung Haus 1) abgedeckt, und es entsteht somit am Standort <strong>Stendal</strong><br />
kein Flächenüberhang.<br />
Die Ergebnisse des Flächenmodells werden 2010 der Hochschulleitung zur weiteren Abstimmung<br />
vorgelegt werden. Es wird für jeden Fachbereich ein Flächen-Soll festgelegt, das<br />
anschließend mit den Dekanen der Fachbereiche diskutiert wird54. Für die weitere Zukunft ist<br />
auch daran gedacht, im Rahmen der Leistungsorientierten Mittelverteilung ein Bonus-Malus-<br />
System für Flächen einzuführen. Damit soll erreicht werden, dass die Fachbereiche zukünftig<br />
effizienter mit der Ressource Fläche umgehen, schrittweise der Flächenüberhang abgebaut und<br />
Forschungsverfügungsfläche aufgebaut wird.<br />
Vergaberahmen W-Besoldung:<br />
Die Arbeit mit diesem Modell obliegt dem Personaldezernat und dem Prorektor für <strong>Hochschule</strong>ntwicklung<br />
und -marketing. Das Personaldezernat sorgt für die ständige Aktualität der Daten.<br />
Wie bereits im letzten <strong>Rektoratsbericht</strong> geschrieben wurde, hat die geltende W-Besoldung die<br />
Erwartungen nur zum Teil erfüllt: Die Attraktivität des Professorenamtes wurde nicht gerade gestärkt.<br />
Dies ließ sich auch <strong>2009</strong> am schleppenden Verlauf zahlreicher Berufungsverfahren<br />
ablesen. Weder das W2-Grundgehalt, noch das W3-Grundgehalt sind mit der freien Wirtschaft<br />
wettbewerbsfähig, noch bietet der schmale Vergaberahmen die Möglichkeit einer relevanten<br />
Leistungszulage. Außerdem ist eine Schieflage zu anderen Positionen des öffentlichen Dienstes<br />
zu erkennen. Wettbewerbsfähige <strong>Hochschule</strong>n müssen auch finanziell so ausgestattet sein,<br />
dass sie konkurrenzfähig sind. Eine Abschaffung des Besoldungsdurchschnitts allein wird nur<br />
die Berechnung und Planung des Vergaberahmens unnötig machen. Höhere Zahlungen werden<br />
deshalb nicht möglich, da die Budgets der <strong>Hochschule</strong>n zu knapp bemessen sind.<br />
<strong>2009</strong> wurde mit der Evaluation der ersten Zielvereinbarungen begonnen. Dieser Prozess wird<br />
durch den Aufbau der Leistungserfassung und Leistungsmessung (vgl. A 8.2.3.2) unterstützt.<br />
8.2.2.2.4 Sonstige operative Arbeiten im Controllingbereich<br />
Neben den an dieser Stelle bereits in den letzten <strong>Rektoratsbericht</strong>en genannten operativen sowie<br />
kontinuierlich auftretenden Aufgaben ergaben sich für das Controlling <strong>2009</strong> folgende<br />
Aktivitäten:<br />
• Teilnahme an zahlreichen Beratungen der Controller Sachsen-Anhalts zur Trennungsrechnung/Vollkostenrechnung<br />
für den „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in<br />
Forschung, Entwicklung und Innovation“. Siehe auch Punkt A 8.2.2.1 KLR.<br />
• Gestaltung und Koordination (gemeinsam mit dem Haushaltsdezernenten ) der Beantragung<br />
des Beratervertrages mit den Wirtschaftsprüfern zur o. g. Trennungsrechnung für alle <strong>Hochschule</strong>n<br />
des Landes Sachsen-Anhalt beim MK<br />
• Erstellung von Ad-hoc-Auswertungen und Analysen zur Unterstützung der Hochschulleitung<br />
bei verschiedenen Fragestellungen (Landtagsanfragen, Planung von Baumaßnahmen am<br />
Standort <strong>Stendal</strong>, Entwicklung der Bewerberzahlen nach Region für den Standort <strong>Stendal</strong>)<br />
• Teilnahme an der 5. Controller-Tagung in Görlitz zur weiteren Qualifizierung, zum fachlichen<br />
Austausch und zur hochschulübergreifenden Vernetzung der Controller<br />
54 Dieser Flächenanteil geht in die Bewirtschaftungskosten je Fachbereich und damit auch in die Berechnung der<br />
Kosten je Student für jeden Fachbereich ein.<br />
Seite 59
8.2.3 Leistungsmessung und Leistungserfassung im Rahmen des akademischen<br />
Controllings<br />
<strong>Hochschule</strong>n haben heute mehr Erfolgsverantwortung. Dazu tritt eine individuelle Leistungsverantwortung<br />
jedes einzelnen Fachbereichs (Leistungsorientierte Mittelvergabe ,LOM’) und<br />
innerhalb jedes Fachbereiches eines jeden Professors im Rahmen der W-Besoldung. Leistungsmessung<br />
und Leistungserfassung zum Nachweis der Leistungserbringung geraten damit<br />
in das Blickfeld der <strong>Hochschule</strong>n. Leistungen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) waren<br />
in den vorangegangen Teilen bereits implizit Thema: <strong>2009</strong> neu eingerichtete Master-<br />
Studiengänge oder neue berufsbegleitende Studiengänge im Sinne Lebenslangen Lernens stellen<br />
z. B. Leistungen der <strong>Hochschule</strong>n dar. Die Erfassung derartiger Leistungen für die<br />
<strong>Hochschule</strong> als Ganzes verweist noch auf einen anderen Grund, weshalb Leistungsmessung<br />
für <strong>Hochschule</strong>n immer wichtiger wird. <strong>Hochschule</strong>n sind heute autonomer als früher: nicht nur<br />
in der Bewirtschaftung der ihnen zugewiesenen Mittel, sondern vor allem auch in der Gestaltung<br />
ihres Profils. Leistungsmessung kann dazu einen Beitrag liefern, indem sie Transparenz<br />
herstellt, welche Leistungen einer <strong>Hochschule</strong> wo in welchem Maße erbracht werden, und dadurch<br />
hilft, das eigene Profil zu schärfen. Die Leistungserfassung kann durch Benchmarking-<br />
Vergleiche unterstützt werden mit dem Ziel, ein Stärken-Schwächen-Profil der <strong>Hochschule</strong> zu<br />
erstellen. Erkannte Stärken der <strong>Hochschule</strong> können dann wiederum für das Hochschulmarketing<br />
der <strong>Hochschule</strong> genutzt werden.<br />
8.2.3.1 Kontrolle der Deputate<br />
Die Kontrollen der Deputatserfüllung wurden auch <strong>2009</strong> auf Fachbereichsebene und für jeden<br />
Professor und für jede Lehrkraft mit besonderen Aufgaben durchgeführt. Dabei werden die anrechenbaren<br />
Semesterwochenstunden laut Deputatsnachweisen der Lehrenden mit dem Soll-<br />
Deputat, abzüglich der Deputatsermäßigungen, verglichen.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> hat intern eine Richtlinie zur Deputatsreduktion erlassen mit dem Ziel, dadurch<br />
das Leistungsprofil der <strong>Hochschule</strong> (primär durch wissenschaftliches Arbeiten) zu fördern.<br />
Grundsätzlich stehen laut LVVO § 6 7 % des Gesamtlehrdeputats für Lehrermäßigungen zur<br />
Verfügung. In der Vergangenheit wurden Deputatsreduktionen primär für Tätigkeiten im Rahmen<br />
der akademischen Selbstverwaltung, vorgeschlagen durch den Fachbereich, durch den<br />
Rektor genehmigt. Um das von außen wahrnehmbare Profil der <strong>Hochschule</strong> zu stärken, wurde<br />
eine neue zielorientierte Vergabe von Deputatsreduktionen im Rahmen eines modifizierten Vergabekonzeptes<br />
erarbeitet. Der Schwerpunkt der Förderung des Leistungsverhaltens durch<br />
Deputatsreduktion liegt zukünftig im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens. Dazu wurde ein<br />
angemessenes Stundenbudget geschaffen, das zentral durch die Hochschulleitung verwaltet<br />
wird und dessen Höhe höchstens 5 % des gesamten Lehrdeputats der <strong>Hochschule</strong> beträgt. Die<br />
Deputatsermäßigungen für Verwaltungstätigkeiten sollen entsprechend reduziert werden und<br />
zukünftig maximal 2 % des Gesamtlehrdeputats betragen. Die Dekane der Fachbereiche erhielten<br />
<strong>2009</strong> eine tabellarische Übersicht nach Fachbereichen über die Lehrverminderungen für<br />
administrative Tätigkeiten, die in der Dekanerunde diskutiert wurde.<br />
In Zusammenarbeit mit dem ZKI55 sollen die Deputatsnachweise spätestens ab SoS 2010 automatisch<br />
aus LSF56 heraus generiert werden. Das setzt voraus, dass zukünftig alle<br />
Lehrveranstaltungen in LSF eingegeben werden.<br />
8.2.3.2 Quantitative Leistungserfassung<br />
Die Leistungserfassung an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) geschah auch <strong>2009</strong> wieder<br />
zweckbezogen für die Bereiche:<br />
55 Das ZKI ist ein Dienstleistungszentrum für Lehrende und Lernende in den Bereichen Informations- und Kommunikationssysteme<br />
sowie multimediale Anwendungen an beiden Standorten.<br />
56 Das Modul LSF ist eine Webanwendung für Lehre, Studium und Forschung. Es bietet Funktionen für die Erfassung<br />
und Präsentation von Lehrveranstaltungen und den damit verbundenen Ressourcen, wie Personen und<br />
Räume.<br />
Seite 60
1. Kennzahlensystem und Balanced Scorecard<br />
2. Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM)<br />
3. Kriterien für die W-Besoldung<br />
Prinzipiell hat sich die <strong>Hochschule</strong> bei der Definition von Leistungsgruppen an dem landeseigenen<br />
Aufgabenkatalog des § 3 des Landeshochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt<br />
orientiert, der die Aufgaben für die <strong>Hochschule</strong>n des Landes benennt. Entsprechend unterscheidet<br />
die <strong>Hochschule</strong> die Leistungsbereiche Studium und Lehre, Forschung, Weiterbildung,<br />
gesellschaftspolitische Aufgaben, wie Gleichstellung von Männern und Frauen, außenwirksame<br />
Leistungen, Internationalisierung und Qualitätssicherung.<br />
Die Leistungsmessung erfolgt über geeignete Indikatoren. Ein derartiges Indikatorensystem<br />
sollte folgenden Anforderungen genügen:<br />
• wenige, aber dafür treffende Indikatoren<br />
• möglichst vollständige Messung der betreffenden Leistung bzw. Leistungsbereich<br />
• Vermeidung redundanter Indikatoren<br />
• rechtzeitige und periodengerechte Verfügbarkeit der notwendigen Informationen<br />
• leichte Erhebbarkeit unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit<br />
• Gewährleistung des Datenschutzes<br />
Darüber hinaus sollten Indikatoren Zeitvergleiche über mehrere Perioden und Vergleiche von<br />
<strong>Hochschule</strong>n oder Fachbereichen, sog. Benchmarking, und Soll-Ist-Vergleiche ermöglichen und<br />
damit als Steuerungsgrößen geeignet sein.<br />
Wichtig ist auch die Bereitschaft der Befragten zur aktiven Mitarbeit, die in Anlehnung an Brüggemeier57<br />
umso höher sein wird, je besser es gelingt, die Chancen von Leistungsmessungen<br />
zu kommunizieren, wie z. B. Transparenz herzustellen, welche Leistungen einer <strong>Hochschule</strong> wo<br />
und in welchem Maße erbracht werden, denn: „Ohne Leistungstransparenz lässt sich aber das<br />
eigene Profil nicht bestimmen; von einem Leistungs- und Profilvergleich mit anderen <strong>Hochschule</strong>n<br />
ganz zu schweigen.“58<br />
Im Sinne einer einfachen Erhebung der Leistungsdaten wurden diese für die oben genannten<br />
Zwecke – soweit möglich – der hochschulinternen Statistik entnommen und anschließend<br />
zweckgerichtet aufbereitetet.<br />
In den Fällen, wo dieses Vorgehen nicht möglich war – das betraf <strong>2009</strong> wiederum die außenwirksamen<br />
Leistungen und das ‚Forschungsziel’ Anzahl der Veröffentlichungen – wurden die<br />
Daten mit einem für diesen Zweck entwickelten Erfassungsbogen erhoben.<br />
Für <strong>2009</strong> war geplant, die außenwirksamen Leistungen und Anzahl der Veröffentlichungen online,<br />
dezentral und möglichst tagesaktuell in einem neu zu schaffenden Modul ‚Außenwirksame<br />
Leistungen’ der HIS-Software LSF zu erfassen. Diese angedachte Lösung schied nach Anfrage<br />
bei der HIS aus Kostengründen aus, da dazu eine beträchtliche Erweiterung und Überarbeitung<br />
von LSF notwendig gewesen wäre. Im Moment arbeitet die <strong>Hochschule</strong> an einer Eigenlösung,<br />
bei der die Online-Eingabeformulare in der Skriptsprache PHP programmiert werden und die<br />
Eingaben in einer MySQL-Datenbank gespeichert werden.<br />
Zu 1: Kennzahlensystem/Balanced Scorecard und<br />
57 Brüggemeier, M. (2000): Leistungserfassung und Leistungsmessung in <strong>Hochschule</strong>n. In: Norddeutsche Fachtagung<br />
zum New-Public-Management: Leistungserfassung und Leistungsmessung in öffentlichen Verwaltungen.<br />
Wiesbaden: Gabler, S. 221-250<br />
58 a. a. O., S. 224<br />
Seite 61
zu 2: Leistungsorientierte Mittelverteilung:<br />
Diese beiden Instrumente wurden bereits unter anderen Punkten ausführlich dargestellt, weshalb<br />
hier nicht weiter darauf eingegangen wird.<br />
Zu 3: W-Besoldung<br />
Für die Beurteilung der Leistungen und der Erfüllung der Zielvereinbarungen im Rahmen der W-<br />
Besoldung wurden der Hochschulleitung <strong>2009</strong> die Ergebnisse von zwei Leistungsarten aus dem<br />
Bereich Lehre zur Verfügung gestellt: die Ergebnisse der jährlichen Lehr-Evaluation und die Erfüllung<br />
der Lehrdeputate. Zur Lehrevaluation ist an dieser Stelle noch zu sagen, dass dabei das<br />
zentrale Ergebnis der Lehrevaluation jeweils mit dem entsprechenden Fachbereichs-Mittelwert<br />
verglichen wird und dass die Trend-Entwicklung über die Zeit verfolgt wird. Erwähnt werden<br />
muss auch noch, dass es sich bei der Lehrevaluation bereits um ein qualitatives Leistungsbewertungsverfahren<br />
handelt (siehe folgenden Abschnitt).<br />
Grundsätzlich soll sich der Leistungsanteil im Rahmen der W-Besoldung an den vier folgenden<br />
Kategorien orientieren:<br />
• Lehre und Prüfungen<br />
• Forschung, Entwicklung und andere wissenschaftliche Leistungen<br />
• Selbstverwaltung<br />
• sonstige Leistungen<br />
Die außenwirksamen Leistungen und Anzahl der Veröffentlichungen, die für die leistungsorientierte<br />
Mittelverteilung erhoben wurden, können unter Umständen auch für die Kategorie<br />
Forschung, Entwicklung und andere wissenschaftliche Leistungen im Rahmen der W-<br />
Besoldung genutzt werden. Dadurch werden Doppelerhebungen und damit zusätzlicher Erhebungsaufwand<br />
vermieden. Die Einheit, auf welche die Leistungen sich beziehen, sind dabei<br />
dann eben die Professoren, die der W-Besoldung unterliegen, und nicht die Fachbereiche.<br />
8.2.3.3 Qualitative Leistungsbewertung, interne Evaluation und Qualitätssicherung<br />
Das Qualitätsmanagement der <strong>Hochschule</strong> ist <strong>2009</strong> beträchtlich weiterentwickelt worden. Mittlerweile<br />
werden mehrere Verfahren eingesetzt, die sich überwiegend an dem durch das New<br />
Public Management etablierten Paradigma der Kundenorientierung ausrichten. Entsprechend<br />
ist die Studierendenzufriedenheit ein zentraler Maßstab der Qualitätsbeurteilung, wobei von einer<br />
subjektiven Sichtweise der Qualitätsbewertung durch die Betroffenen ausgegangen wird. An<br />
angewendeten Verfahren zu nennen sind:<br />
1. Regelmäßige studentische Lehrveranstaltungsevaluationen auf der Basis der Evalua-<br />
tionsordnung der <strong>Hochschule</strong> vom 9.11.2005 (siehe 4.1)<br />
2. die Beteiligung am Studienqualitätsmonitor (SQM) der HIS GmbH<br />
3. Befragungen von Studienabbrechern und Analysen institutioneller Aspekte des Studienabbruchs<br />
Zu 1. Studentische Lehrevaluation<br />
Da die Lehrevaluation bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt wurde, wird hier darauf<br />
nicht weiter eingegangen.<br />
Zu 2. Beteiligung am Studienqualitätsmonitor der HIS GmbH<br />
Die <strong>Hochschule</strong> nahm – wie schon unter 4.1 beschrieben – auch <strong>2009</strong> wieder am Studienqualitätsmonitor59<br />
der HIS GmbH teil. Dieser wird im jährlichen Rhythmus als Online-Befragung von<br />
Studierenden durch die HIS Hochschul-Informations-System GmbH und die AG Hochschulforschung<br />
der Universität Konstanz durchgeführt. Der Fragebogen zum Studienqualitätsmonitor<br />
59 Bargel, T., Müßig-Trapp, P. & Willige, J. (2008): Studienqualitätsmonitor 2007. Studienqualität und Studiengebühren.<br />
HIS: Forum <strong>Hochschule</strong>, Hannover<br />
Seite 62
enthält – thematisch gegliedert nach relevanten studienqualitätsbezogenen Bereichen – jeweils<br />
mehrere Fragen zu den Merkmalen<br />
• der Betreuungssituation<br />
• dem Lehrangebot<br />
dem Studienverlauf<br />
• der Ausstattung und<br />
• der Beratungs- und Serviceeinrichtungen<br />
Die befragten Studierenden werden in den genannten Bereichen aufgefordert, aus ihrer eigenen<br />
Perspektive eine Bewertung vieler einzelner Merkmale vorzunehmen oder anzugeben, was<br />
ihnen wichtig ist, wie zufrieden sie mit bestimmten Angeboten der <strong>Hochschule</strong> sind usf. (sog.<br />
multiattributive Qualitätsmessung).<br />
Die <strong>Hochschule</strong> erhält über die an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) befragten Studierenden<br />
von HIS eine Randauszählung über alle Fragen mit den Antwortverteilungen und<br />
Mittelwerten für die Befragten insgesamt sowie getrennt nach Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften<br />
und darüber hinaus die Verteilungen und Mittelwerte für FH Insgesamt und FH Ost<br />
sowie den anonymisierten Datensatz der an der <strong>Hochschule</strong> Befragten. Auf der Grundlage des<br />
multiattributiven Messansatzes und der Benchmarking-Werte entsteht ein differenziertes Bild,<br />
und es lässt sich erkennen, wo die <strong>Hochschule</strong> Qualitätsschwächen, aber auch Stärken hat.<br />
Zu 3. Befragung von Studienabbrechern<br />
Das Thema Studienabbruch ist ein hoch aktuelles Thema an deutschen <strong>Hochschule</strong>n geworden.<br />
Die <strong>Hochschule</strong>n in den neuen Bundesländern stehen in Anbetracht der demografischen<br />
Entwicklung in Ostdeutschland in den nächsten Jahren zudem vor der Herausforderung, ihre<br />
Ziel-Studierendenzahlen zu halten und dürften insofern ein zusätzliches Interesse daran haben,<br />
ihre Studienabbruchzahlen niedrig zu halten.<br />
An dieser Stelle geht es um die Strategien der <strong>Hochschule</strong>, Studienabbrüche zu reduzieren.<br />
Dazu beabsichtigt die <strong>Hochschule</strong> die Einführung eines Mentoren-Systems. Außerdem wurde<br />
<strong>2009</strong> begonnen, die Gründe von Studienabbrüchen zu analysieren, um auf dieser Grundlage<br />
gezielt Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Dabei greift sie Gedanken auf, die Schröder-<br />
Gronostay60 bereits 1999 geäußert hatte, als sie darauf hinwies, dass aus institutioneller Sicht<br />
für <strong>Hochschule</strong>n immer wichtiger wird zu wissen, ob sie Studienabbrüche verhindern können<br />
und welche Maßnahmen sie ggf. dazu ergreifen müssen, bzw. dass im Zuge der Profilbildung<br />
der <strong>Hochschule</strong>n verstärkt die einzelne Institution in das Blickfeld der Studienabbruchforschung<br />
gerät. Auf dieser institutionellen Ebene geraten hochschulseitige Ressourcen, wie die Betreuungssituation,<br />
das Lehrangebot, die Ausstattung, Beratungs- und Serviceeinrichtungen, ins<br />
Blickfeld. Es handelt sich dabei um die oben genannten Merkmale der Studienqualität.<br />
Wie oben bereits geschrieben, nimmt die <strong>Hochschule</strong> regelmäßig am Studienqualitätsmonitor61<br />
der HIS GmbH teil und erhält in diesem Rahmen von der HIS einen anonymisierten Datensatz<br />
mit den Angaben der an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) befragten Studierenden<br />
(n=225 für 2008). Da der Fragebogen zum Studienqualitätsmonitor neben Fragen zu den genannten<br />
studienqualitätsbezogenen Bereichen auch eine Frage zum Studienabbruch bzw. zu<br />
der Absicht dazu enthält, lassen sich bivariate Korrelationen zwischen den Antwortverteilungen<br />
von Merkmalen der Studienqualität und dem Studienabbruch berechnen und damit institutionelle<br />
Aspekte des Studienabbruchs ausmachen. In der Tabelle auf der folgenden Seite sind alle<br />
sehr signifikanten Korrelationen (Perasons r) der Produkt-Moment-Korrelationsanalysen zwischen<br />
Merkmalen der Studienqualität und der Absicht zum Studienabbruch aufgelistet:<br />
60 Schröder-Gronostay, M. (1999):Studienabbruch – Zusammenfassung des Forschungsstandes. In: Schröder-<br />
Gronostay, M. & Daniel, H.-D.: Studienerfolg und Studienabbruch. Luchterhand, Neuwied, Kriftel, S. 209-240<br />
61 Bargel, T., Müßig-Trapp, P. & Willige, J. (2008): Studienqualitätsmonitor 2007. Studienqualität und Studiengebühren.<br />
HIS: Forum <strong>Hochschule</strong>, Hannover<br />
Seite 63
Bereich/Merkmal<br />
Betreuungssituation<br />
r N<br />
Beurteilung der Erreichbarkeit der Lehrenden in Sprechstunden -.284 130<br />
Beurteilung der Rückmeldung zu Hausarbeiten, Klausuren, Übungen -.255 141<br />
Zufriedenheit mit Beratungsgesprächen außerhalb von Sprechstunden<br />
in Bezug auf die Qualität der Beratung hinsichtlich der Vermittlung der<br />
thematisierten Sachverhalte<br />
Lehrangebot<br />
-.294 85<br />
Beurteilung der Nutzung audiovisueller Medien bzw. Multimediaprogramme<br />
in Lehrveranstaltungen<br />
-.255 141<br />
Wichtigkeit des Praxisbezuges der Lehrveranstaltungen<br />
Studienverlauf<br />
-.263 142<br />
Absicht, das Studienfach zu wechseln .338 142<br />
Tab. 7: Relevante Motive des Studienabbruchs<br />
Hochsignifikante Korrelationen (p < 0.01) zwischen Merkmalen der Studienqualität nach Bereichen und<br />
der Absicht, das Studium an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) abzubrechen<br />
Zur Erläuterung der Tabelle: Je besser die Erreichbarkeit der Lehrenden in Sprechstunden beurteilt<br />
wird, desto schwächer ist die Absicht, das Studium abzubrechen (negativer<br />
Zusammenhang); ebenso: je besser die Rückmeldung zu Hausarbeiten, Klausuren und Übungen<br />
beurteilt wird und je zufriedener Studierende mit informellen Beratungsgesprächen in<br />
Bezug auf die Qualität der Beratung hinsichtlich der Vermittlung der thematisierten Sachverhalte<br />
sind, desto schwächer ist ebenfalls jeweils die Absicht zum Studienabbruch (negativer<br />
Zusammenhang). Im Hinblick auf den Bereich Lehrangebot gilt, je besser die Nutzung audiovisueller<br />
Medien bzw. Multimediaprogramme beurteilt und je wichtiger der Praxisbezug von<br />
Lehrveranstaltungen eingeschätzt wird, desto weniger ausgeprägt ist wiederum jeweils die Absicht<br />
zum Studienabbruch. Erwartungsgemäß positiv ist hingegen der Zusammenhang<br />
zwischen den Absichten, das Studienfach zu wechseln und dem Studienabbruch.<br />
Merkmale der Studienqualität haben danach einen Einfluss auf die Entscheidung, ein Studium<br />
abzubrechen. Schröder-Gronostay, die den Forschungsstand zum Thema Studienabbruch zusammenfasst,<br />
kommt hinsichtlich institutioneller Variablen zu dem Ergebnis, „dass eine<br />
unüberschaubare Organisationsstruktur, mangelnde didaktische Fähigkeiten der Hochschullehrer/-innen,<br />
eine schlechte Prüfungsorganisation […] relevant zu sein scheinen“62. Die<br />
vorliegenden Ergebnisse passen zu dieser Schlussfolgerung: Studierende unserer <strong>Hochschule</strong><br />
wollen ihre Lehrenden in den Sprechstunden erreichen und erwarten Rückmeldungen zu ihrem<br />
Leistungsstand. Bei den Beratungsgesprächen scheinen die informellen Kontakte und Gespräche<br />
mit dem Lehrpersonal wichtig zu sein – ein Ergebnis, das man möglicherweise in Analogie<br />
zu der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg et al.63 interpretieren kann, die zwischen Faktoren<br />
unterscheiden, die (1) unzufrieden machen und (2) zufrieden stellen. Qualitativ gute Beratungsgespräche<br />
innerhalb der Sprechstunden würden demnach eher als etwas Selbstverständliches<br />
erlebt, während qualitativ gute Beratungsgespräche, die sich lose und ungeplant ergeben haben,<br />
zu hoher Zufriedenheit bei Studierenden führen und insgesamt zu der Auswirkung, dass<br />
die Studienabbruchquote sinkt, obwohl der genaue Mechanismus hier noch nicht ganz klar ist.<br />
Der Praxisbezug von Lehrveranstaltungen ist für Studierende wichtig: wenn dieser fehlt, stellt er<br />
eine potentielle Quelle von Studienabbrüchen dar. Intuitiv gut nachvollziehbar ist der Zusammenhang<br />
zwischen der Absicht, das Studienfach zu wechseln und dem Studienabbruch.<br />
Die vorgenommene Analyse liefert einige interessante Hypothesen zu Motiven des Studienabbruches<br />
und ist in der Hochschulleitung intensiv diskutiert worden. Da die institutionellen Effekte<br />
aber möglicherweise von anderen Faktoren, wie persönliche Gründe, überlagert werden, ist an<br />
der <strong>Hochschule</strong> für eine weitergehende Analyse ein ‚Abbrecher’-Fragebogen64 entwickelt worden,<br />
der über institutionelle Einflussgrößen hinaus weitere Motive des Studienabbruchs abfragt<br />
62 Schröder-Gronostay, M. (1999), S. 226<br />
63 Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. (1967): The motivation to work (2nd ed.). New York: Wiley<br />
64 Vgl. hierzu den Anhang auf Seite 83<br />
Seite 64
und von dem wir uns konkrete Anhaltspunkte für gezielte Maßnahmen versprechen. Außerdem<br />
werden mit diesem Fragebogen die Motive bei einem tatsächlichen Studienabbruch erfasst.<br />
Die Vorgehensweise zur Systematisierung der verschiedenen Ansätze zum Qualitätsmanagement<br />
war unter 4.1 Thema. Hier soll noch einmal betont werden, dass ein nachhaltiges<br />
Qualitätsmanagement eine Ergänzung zum quantitativen Indikatorensystem darstellen soll und<br />
gewährleisten muss, dass Leistungssteigerungen bei quantitativen Indikatoren nicht zu einer<br />
Absenkung qualitativer Standards führen.<br />
8.2.3.4 Benchmarking<br />
Der Begriff Benchmarking ist an verschiedenen Stellen dieses Teils (z. B. A 8.2.3.2 – quantitative<br />
Leistungserfassung oder A 8.2.3.3 – Beteiligung Studienqualitätsmonitor) schon genannt<br />
worden. Allgemein meint es im Hochschulbereich (1) den internen Vergleich der Leistungen<br />
oder Prozesse der Fachbereiche einer <strong>Hochschule</strong>, eventuell auch der Leistungen ihres Personals<br />
oder (2) den Vergleich der Leistungen oder Prozesse von <strong>Hochschule</strong>n bzw. von<br />
Fachbereichen unterschiedlicher <strong>Hochschule</strong>n (z. B. hinsichtlich der Studiendauer ihrer Erstabsolventen/-innen,<br />
des Anteils ausländischer Studierender, ihres Frauenanteils beim<br />
wissenschaftlichen Hauptpersonal usw.) mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dabei<br />
erfolgt eine Orientierung an Bestwerten („Benchmarks“) mit der Absicht von Best-Practice-<br />
Lösungen zu lernen und damit die eigene Position zu verbessern. Leistungsvergleiche über<br />
mehrere Dimensionen ermöglichen ein Stärken-Schwächen-Profil der eigenen Einrichtung.<br />
Zu 1.<br />
Die Leitungsorientierte Mittelverteilung an die Fachbereiche enthält potentiell ein Benchmarking<br />
zwischen den Fachbereichen, denn die Zuweisung finanzieller Mittel erfolgt auf der Basis der<br />
Werte von Leistungsindikatoren (Absolventenquote, eingeworbene Drittmittel, Forschungsleistungen<br />
usw.), wobei je Indikator jenen Fachbereichen mehr Mittel zugewiesen werden, die im<br />
Vergleich zu anderen Fachbereichen in diesem Leistungsbereich besser abschneiden. Um der<br />
Gefahr zu begegnen, hierbei ‚Äpfel mit Birnen’ zu vergleichen, wurden die Kennzahlen für Ausländeranteile<br />
bzw. Ausländerabsolventen/-innen und für die Gleichstellung von Männern und<br />
Frauen an Landesdurchschnitten relativiert. Dies wurde auch <strong>2009</strong> beibehalten.<br />
Zu 2:<br />
Hinsichtlich des Vergleichs der <strong>Hochschule</strong> mit anderen <strong>Hochschule</strong>n lässt sich berichten, dass<br />
die <strong>Hochschule</strong> fortlaufend Vergleiche ihrer Leistungen und die ihrer Fachbereiche mit anderen<br />
<strong>Hochschule</strong>n durchführt. So ist im Rahmen der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements<br />
(siehe 8.2.3.3) die Erstellung eines Stärken-Schwächen-Profils der Studienqualität aus der Sicht<br />
der Studierenden geplant. Die folgende Abbildung auf der nächsten Seite zeigt davon vorab bereits<br />
einen Ausschnitt:<br />
Seite 65
Mittelwerte einer Skala von überhaupt nicht zufrieden (1) bis sehr zufrieden (5)<br />
4,8<br />
4,4<br />
3,6<br />
3,2<br />
2,8<br />
2,4<br />
Verfügbarkeit von EDV-Arbeitsplätzen<br />
4<br />
Ausstattung: Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung in Ihrem Studiengang?<br />
4,2 4,2 4,2 4,2<br />
3,8<br />
Öffnungszeiten der EDV-Räume bzw. Computer-Pools<br />
3,9<br />
Technische Ausstattung der Veranstaltungsräume<br />
4<br />
4<br />
4,3<br />
4,1<br />
4,5<br />
3,7 3,7 3,7<br />
3,6<br />
Ausstattung der Labore<br />
Zugänge zum W-Lan<br />
HS MD-SDL<br />
FH Ost<br />
FH insg.<br />
Abb. 7: Ausstattungsmerkmale der Studienqualität an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) im Vergleich zu<br />
FH Ost und FH insgesamt<br />
Daneben führt die <strong>Hochschule</strong> Leistungsvergleiche in ausgewählten Bereichen durch mit Daten<br />
der Hochschulstatistik, die der Publikation ‚Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen’<br />
des Statistischen Bundesamtes entnommen werden. Diese Publikation erscheint einmal jährlich<br />
Ende Dezember bis Januar. Es finden Vergleiche für diese Merkmale statt:<br />
• Fachstudiendauer<br />
• Frauenanteile Studierender bzw. Frauenanteile<br />
• Anteile ausländischer Studierender und ausländischer Absolventen/-innen<br />
• Betreuungsrelationen<br />
• Erstausbildungsquote<br />
• laufende Finanzausstattung je Studierenden und je Professor sowie für ein Studium<br />
• Drittmittel je Professor<br />
Die Ergebnisse der Hochschulstatistik werden den Dekanen teilweise in der Balanced Scorecard<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Daneben werden die Ergebnisse des CHE-Hochschul-Rankings verwendet. Insgesamt gibt es<br />
aber wegen der neuen gestuften Studiengänge bislang noch recht wenig verlässliche Vergleichszahlen,<br />
was sich möglicherweise mit Erscheinen der neuesten Ausgabe der<br />
nichtmonetären Kennzahlen ändern wird, deren Veröffentlichungstermin sich mit der Fertigstellung<br />
dieses Berichts überschneidet.<br />
8.2.4 Strategisches Controlling<br />
Mit der Neubesetzung der Stelle für das akademische Controlling im vorletzten Jahr wurde die<br />
<strong>Hochschule</strong> auch in diesem Bereich tätig. Vor besonderen Herausforderungen ist die <strong>Hochschule</strong><br />
natürlich durch den demografischen Wandel in den neuen Ländern gestellt. Das<br />
Controlling hat dazu <strong>2009</strong> erste Trendprognosen erstellt, wie sich die Studierendenzahlen in<br />
einzelnen Studiengängen in den nächsten Jahren entwickeln werden und diese Analysen der<br />
Hochschulleitung zur Verfügung gestellt.<br />
Seite 66
Eine weitere Methode des strategischen Controllings ist die im Zusammenhang mit dem Thema<br />
Benchmarking schon genannte Stärken-Schwächen-Analyse, bei der es um das Erkennen der<br />
gegenwärtigen Position der <strong>Hochschule</strong> und daraus ableitbarer strategischer Zukunftsoptionen<br />
geht. Außerdem kann durch dieses Verfahren ein Beitrag zur Profilbestimmung der autonomer<br />
werdenden <strong>Hochschule</strong>n geliefert werden. Ein beträchtlicher Teil der Arbeit <strong>2009</strong> bestand dazu<br />
aber noch in der Recherche und Dokumentation neuester Entwicklungen in der Hochschulpolitik<br />
sowie der Beschaffung des notwendigen Informations- und Datenmaterials (siehe auch den<br />
nächsten Punkt).<br />
8.2.5 Schaffung eines Data Warehouse-gestützten zentralen Informationssystems<br />
Um ihre Informationsfunktion für Managemententscheidungen noch effizienter erfüllen zu können,<br />
engagiert sich das Controlling der <strong>Hochschule</strong> weiterhin für die Einführung eines Data<br />
Warehouses an der <strong>Hochschule</strong>. Dabei wurde zunächst die Einführung von SuperX beabsichtigt,<br />
das speziell für <strong>Hochschule</strong>n entwickelt wurde. Da sich aktuell eine bedeutsame<br />
Weiterentwicklung von SuperX im Rahmen von HISINONE vollzieht, die die <strong>Hochschule</strong> abwarten<br />
will, und sich außerdem herausgestellt hat, dass Abfragen an das SuperX-Data Warehouse<br />
relativ kompliziert sind, sondierte die <strong>Hochschule</strong> <strong>2009</strong> Alternativen zu SuperX. Dazu fanden u.<br />
a. eine Online-Präsentation von IBM Cognos an der <strong>Hochschule</strong> und ein Erfahrungsaustausch<br />
mit der Universität Osnabrück sowie zahlreiche Gespräche, u. a. mit Vertretern von HIS, statt.<br />
Im Prinzip bestärkten diese Aktivitäten unsere Absicht, ein Data Warehouse einzuführen. Andererseits<br />
wird dieses Projekt ein langjähriger Prozess und ohne zusätzliches Personal nicht zu<br />
bewältigen sein. In der Zwischenzeit soll mit der Sammlung stichtagsbezogener Dateien für das<br />
Data Warehouse begonnen worden.<br />
8.2.6 Regelungspflichten<br />
Neben der Überarbeitung einer Vielzahl von Prüfungs- und Studienordnung stand <strong>2009</strong> die Anpassung<br />
der Ordnung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) für die Vergabe von<br />
Leistungsbezügen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen gemäß § 8 HLeistBVO LSA vom<br />
08.02.2006 im Vordergrund. Diese Ordnung, die der Senat im Januar 2005 kurz nach dem<br />
Wechsel der C- in die W-Besoldung beschlossen hatte, erwies sich insbesondere aufgrund der<br />
mangelnden Erfahrung mit der neuen Besoldungsart als in einigen Punkten als zu realitätsfern.<br />
Insofern wurde die Ordnung <strong>2009</strong> überarbeitet, den neuen Gegebenheiten und Erfahrungen<br />
angepasst und am 16.09.<strong>2009</strong> vom Senat beschlossen. Im Anschluss wurde sie zur Genehmigung<br />
an das Kultus- und Finanzministerium gesandt.<br />
8.3 Flexible Ressourcenbewirtschaftung<br />
8.3.1 W-Besoldung<br />
Wie schon in den früheren Berichten betont, soll auch an dieser Stelle – bei allen möglichen<br />
Vorzügen dieser Besoldungsart – auf den drastisch steigenden administrativen Aufwand hingewiesen<br />
werden. Hierbei spielen unterschiedliche Gesichtspunkte eine Rolle. Zum einen kann es<br />
zu Verzögerungen beim Dienstantritt kommen, da sich die Verhandlungen über die Berufungszulagen<br />
in die Länge ziehen. Kommt keine Einigung zustande, sind aufwändige Gespräche mit<br />
dem jeweiligen Fachbereich vonnöten, um deutlich zu machen, dass die Hochschulleitung in<br />
diesem Verfahren eine neutrale Position bezieht und die sorgsame Auswahl der Berufungskommission,<br />
des Fachbereichs und des Senats nicht eigenmächtig außer Kraft setzt. Nachteilig<br />
wird sich hierbei der Wegfall der Anschubfinanzierung erweisen. Angesichts eines inflationsbedingt<br />
reduzierten Haushaltsbudgets ist schon jetzt an der Wettbewerbsfähigkeit der <strong>Hochschule</strong><br />
bzw. der <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt zu zweifeln. Die angelaufene Evaluation der jeweiligen<br />
Zielvereinbarungen erweist sich als sehr zeit- und personalaufwändig, da unterschiedlichste<br />
Ebenen in dieses Verfahren eingebunden werden müssen. Auch an dieser Stelle zeigt<br />
sich deutlich die Gefahr für die <strong>Hochschule</strong>n, dass ihnen neue (und umfangreiche) Aufgaben<br />
übertragen werden, ohne die entsprechende Ausstattung zur Verfügung zu stellen.<br />
Seite 67
8.3.2 Ausblick auf den Wirtschaftsplan 2010/11 sowie zur mittelfristigen Finanzplanung<br />
2012 bis 2014<br />
8.3.2.1 Entwicklung der Rücklage<br />
Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2010/11 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis<br />
2014 wurde durch die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) eine Rücklage aus nicht verbrauchten<br />
Budgetmitteln der Vorjahre in Höhe von 894.400 EURO verplant. Aus der ehemals<br />
gebildeten Rücklage zum Jahresende 2007 in Höhe von 2.248.300 EURO wurden in den Haushaltsjahren<br />
2008 und <strong>2009</strong> insgesamt 1.353.900 EURO entnommen. Die noch vorhandenen<br />
894.400 Euro sind zur Abfederung des Haushaltsjahres 2010 vorgesehen. Danach ist die Rücklage<br />
aufgebraucht.<br />
8.3.2.2 Finanzielle Situation<br />
Wie bereits in <strong>Rektoratsbericht</strong>en der Jahre 2007 und 2008 ausgeführt, fehlen der <strong>Hochschule</strong><br />
durch die hohe Absenkung des Budgets 2003 um rd. 1.100.000 EURO nachhaltig Mittel für eine<br />
stabile Weiterführung des Lehr- und Forschungsbetriebes ab 2011.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2006 wurde ein teilweiser Ausgleich (zulasten der anderen Fachhochschulen)<br />
in Höhe von 500.000 EURO vorgenommen.<br />
Durch die noch vorhandene Rücklage konnte die <strong>Hochschule</strong> so die Wirtschaftpläne für die<br />
Jahre bis 2010 ausgleichen.<br />
Bei der Anmeldung des Wirtschaftsplanes 2010/11 wurde der noch ausstehende Ausgleichbetrag<br />
in Höhe von 600.000 EURO zuschusserhöhend geltend gemacht. Weiterhin hat die<br />
<strong>Hochschule</strong> im WPL zusätzlich 220.000 EURO zur Finanzierung des vom Ministerium gewünschten<br />
Studienganges „Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von<br />
Kindertageseinrichtungen“ veranschlagt.<br />
Beide Beträge sind vom Kultusministerium in den Entwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre<br />
2010 und 2011 nicht übernommen worden. Dadurch und aufgrund der Tatsachen,<br />
dass die Rücklage 2010 aufgebraucht sein wird, ist der Haushalt der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<br />
<strong>Stendal</strong> (FH) ab 2011 in entsprechender Höhe nicht gedeckt. Unter der Voraussetzung der Planung<br />
eines weitestgehend ausfinanzierten Stellenplanes, der Verpflichtung zur Finanzierung<br />
der Stellen in der TGr. 96 sowie aufgrund der Tatsache, dass die Rücklage zur Ausfinanzierung<br />
der Stellen genutzt werden musste, ist ein Ausgleich des Wirtschaftsplanes ab 2011 nicht mehr<br />
möglich.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) geht jetzt davon aus, dass das Kultusministerium von<br />
folgender Regelung lt. Vorwort zum Einzelplan 06 „Soweit sich im Rahmen der Verhandlungen<br />
unterhalb der Gesamtbudgets der <strong>Hochschule</strong>n Veränderungen der Zuschüsse an die einzelne<br />
<strong>Hochschule</strong> ab 2011 ergeben, werden die erforderlichen haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen<br />
im Verwaltungsverfahren nach §§ 37, 38 LHO geschaffen.“ Gebrauch gemacht wird, da<br />
sich sonst die Schlechterstellung der <strong>Hochschule</strong> auch in den Folgejahren fortsetzen würde.<br />
Ohne Umschichtungen des Haushaltes 2011 wird sich diese kritische Situation im Finanzplanungszeitraum<br />
2012 bis 2014 weiter zuspitzen und in den Folgejahren potenzieren.<br />
8.3.2.3 Titelgruppe 96<br />
Seit 2007 bewirtschaftet die <strong>Hochschule</strong> eine (kostenneutrale) Titelgruppe TGr. 96, um strukturbedingte<br />
Verwerfungen ausgleichen zu können. Die Finanzierung dieser Verwerfungen gehen<br />
zu Lasten des Hochschulbudgets. Von ursprünglich 10 Stellen wurden seit 2007 zwei Stellen<br />
abgebaut.<br />
8.3.2.4 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2009</strong> wurden per 30. November insgesamt rd. 300.000 EURO durch Erhebung<br />
von Langzeitstudiengebühren eingenommen. Es zeigt sich, dass die Einnahmen<br />
rückläufig sind. Durch Gewährung von Ratenzahlungen wurden Härtefälle ausgeglichen. Dadurch<br />
werden die Einnahmen teilweise erst im Folgejahr realisiert.<br />
Seite 68
Die Einnahmen aus Langzeitstudiengebühren wurden nicht nur zur Aufstockung des Budgets<br />
eingesetzt, sondern insbesondere für folgende Programme:<br />
• Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek an beiden Standorten<br />
• Bildung von Meisterklassen<br />
• Organisation eines Tutorenprogramms<br />
• Organisation eines „studium generale“<br />
Dadurch sind insgesamt rd. 289.000 EURO zur Verbesserung der Lehr- und Studienbedingungen<br />
eingesetzt worden.<br />
Das „studium generale“ wurde ab <strong>2009</strong> weiter ausgebaut, weshalb dafür erheblich höhere Mittel<br />
als in den Vorjahren zur Verfügung gestellt wurden.<br />
8.4 Hochschulbau, Flächenmanagement, Bauunterhalt und Liegenschaften<br />
8.4.1 Sachstand zur Einführung des Facility Managements und interner Flächenmanagementmodelle<br />
zur wirtschaftlichen Flächennutzung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> führt seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit der Otto-von-Guericke-Universität ein<br />
komplexes Facility Managementsystem ein. Die aufwendige grafische und numerische Datenerhebung<br />
und die Anpassung der Software an die Bedürfnisse der <strong>Hochschule</strong>n und<br />
Universitäten führen zu einem langwierigen Einführungsprozess, der zurzeit noch anhält und<br />
das Dezernat IV auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.<br />
Das Flächen- und Raummanagement der <strong>Hochschule</strong> wird über dieses CAFM-System betrieben.<br />
Im Jahr <strong>2009</strong> wurden das Störungs- und Wartungsmanagement in das CAFM-System<br />
integriert. Über das Störungsmanagement werden derzeit die Aufträge an die Techniker und<br />
Hausmeister generiert. Es soll für alle Mitarbeiter die Möglichkeit geschaffen werden, über ein<br />
WEB-Portal Störungsmeldungen abzusetzen und den Bearbeitungsstand zu verfolgen. Die grafischen<br />
und numerischen Flächendaten sollen über das WEB-Portal allen Mitarbeitern<br />
zugänglich gemacht werden. Derzeit wird die Schnittstelle durch die beauftragte Firma programmiert,<br />
so dass mit der Einführung im Jahr 2010 zu rechnen ist. Das Wartungsmanagement<br />
befindet sich in der Testphase.<br />
Auf der Basis der Kapazitätsberechnungen der <strong>Hochschule</strong> wurde das Flächenmodell erarbeitet.<br />
Die Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2010 der Hochschulleitung und den<br />
Fachbereichen vorgestellt. Detaillierte Aussagen zum Flächenmanagement finden Sie im Kapitel<br />
„Interne Planungsmodelle“, siehe 8.2.2.2.3.<br />
8.4.2 Sachstand zu den Großen Baumaßnahmen<br />
8.4.2.1 Sanierung Haus 1 der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong><br />
Im Rahmen des Konjunkturprogramms II stehen für die Sanierung des Gebäudes 1 in <strong>Stendal</strong><br />
3,591 Mio € zur Verfügung.<br />
Die Planung erfolgte im Jahr <strong>2009</strong> und der Baubeginn war im November dieses Jahres. Die<br />
Fertigstellung ist im Dezember 2010 geplant.<br />
8.4.2.2 Neubau der Mensa der Tauentzienkaserne am Standort <strong>Stendal</strong><br />
Der Neubau der Mensa erfolgt im Rahmen des Konjunkturpakets II. Bauherr und späterer Eigentümer<br />
ist das Studentenwerk <strong>Magdeburg</strong>. Zur reibungslosen Integration des Gebäudes in<br />
die Liegenschaft wird das Bauvorhaben von der <strong>Hochschule</strong> begleitet. Die Fertigstellung der<br />
Mensa ist für Oktober 2010 geplant.65<br />
65 Siehe hierzu den Beitrag aus Treffpunkt Campus im Anhang auf Seite 91<br />
Seite 69
Unabhängig von den o. g. Baumaßnahmen strebt die <strong>Hochschule</strong> nach wie vor die unentgeltliche<br />
Übertragung der Grundstücke in das Körperschaftsvermögen im Sinne des § 108 Abs. 3<br />
HSG-LSA an.<br />
8.4.3 Sachstand zu den Kleinen Baumaßnahmen<br />
8.4.3.1 Kleine Baumaßnahmen im Zuge der Hochschulstrukturreform<br />
Im Zuge der Hochschulstrukturreform sind an der <strong>Hochschule</strong> vier Kleine Baumaßnahmen notwendig.<br />
Die Maßnahmen „Umzug der Geotechniklabore von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die<br />
Laborhalle 1“ mit Baukosten von rund 275 T€ und „Umzug des Wasserbaulabors von der <strong>Hochschule</strong><br />
Anhalt in die Laborhalle 3“ mit Baukosten von rund 385 T€ sind zur Nutzung für die<br />
Lehre übergeben worden.<br />
Die Maßnahme „Umzug Großversuchstechnik von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 1“<br />
ist im Jahr 2008 begonnen worden, nachdem die Finanzierung geklärt war. Durch Verzögerungen<br />
in der Bauausführung ist die Übergabe an den Fachbereich erst Anfang 2010 möglich.<br />
Die Maßnahme „Umzug der Straßenbaulabore von der <strong>Hochschule</strong> Anhalt in die Laborhalle 1“<br />
ist vom Kultusministerium genehmigt worden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 350<br />
T€. Zur weiteren Verfahrensweise ist im Jahr 2010 grundsätzlich zu entscheiden.<br />
8.4.3.2 Weitere Kleine Baumaßnahmen<br />
Im Jahr <strong>2009</strong> wurden folgende kleine Baumaßnahmen begonnen:<br />
• Errichtung Kabelnetzlabor<br />
• Sanierung und Vernetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen aller Gebäude<br />
Weitere Neubeginne waren durch die Haushaltssperre nicht möglich.<br />
Die Finanzierung der Maßnahmen „Sanierung und Vernetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen“<br />
und „Einbau einer Solarthermieanlage für die Mensa“ werden aus dem Konjunkturpaket<br />
II finanziert. Die 2. Maßnahme beginnt im Jahr 2010.<br />
Die nachfolgend aufgeführten Kleinen Baumaßnahmen sind vom Kultusministerium genehmigt<br />
worden und werden in Abhängigkeit der Finanzierung in den Folgejahren realisiert:<br />
• Umzug der Straßenbaulabore von der HS Anhalt in die Laborhalle 1<br />
• Wegebau zu den Laborhallen<br />
• Erweiterung der Lüftungsanlage der Versuchskläranlage in Gerwisch<br />
• Brandschutztechnische Ertüchtigung der Mensa<br />
• Einbau einer zentralen USV im ZKI <strong>Stendal</strong><br />
• Gestaltung der Außenanlagen in <strong>Stendal</strong><br />
Die Maßnahmen „Neubau von Sportflächen am Campus Herrenkrug“, „Anschluss eines Cone-<br />
Calorimeters in der Laborhalle 1“ und „Errichtung eines Kinderspielplatzes“ wurden im Jahr<br />
<strong>2009</strong> abgeschlossen.<br />
8.4.4 Sachstand zum Bauunterhalt<br />
Im Rahmen des Bauunterhaltes wurden im Haushaltsjahr <strong>2009</strong> rund 342 T€ verbaut. Die<br />
Schwerpunkte lagen in der Instandsetzung baulicher und betriebstechnischer Anlagen. Als aufwendigste<br />
Maßnahmen sind hier die Instandsetzung des Absorbtionswärmetauschers der<br />
Lüftungsanlage des Audimax und die Klimatisierung der Netzwerkknoten im Haus 1 zu nennen.<br />
Insgesamt muss festgestellt werden, dass nach 10jährigem Betrieb der <strong>Hochschule</strong> am Campus<br />
Herrenkrug der Unterhaltungsaufwand an den technischen und baulichen Einrichtungen<br />
erheblich steigt und das Bauunterhaltsbudget diesem Umstand angepasst werden muss.<br />
Seite 70
8.4.5 Entwicklungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung<br />
Die <strong>Hochschule</strong> benötigte im Jahr <strong>2009</strong> rund 2,4 Mio € Bewirtschaftungskosten. Die Steigerung<br />
gegenüber den Vorjahren ist dem weiteren Ausbau der Liegenschaft in <strong>Stendal</strong> und den Energiepreiserhöhungen<br />
geschuldet. Der Kostenschwerpunkt liegt dabei auf den Energiekosten,<br />
gefolgt von den Wartungskosten.<br />
Um die Kostenschwerpunkte zu untersuchen und Einsparpotentiale zu ermitteln, wurde Anfang<br />
2007 mit der Firma Siemens Building Technologies eine Grobanalyse zur Energieeinsparung<br />
durch bau- und betriebstechnische Veränderungen durchgeführt. Im Ergebnis dieser Analyse<br />
ergeben sich hauptsächlich Einsparpotentiale durch die Motivation der Mitarbeiter/-innen. Die<br />
zukünftige strategische Ausrichtung des Energiemanagements muss sich demzufolge auf den<br />
täglichen Umgang mit Energie konzentrieren.<br />
8.5 Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Schwerpunkte der Aktivitäten <strong>2009</strong> bildeten die Planung des Neu- und Ausbaus der Netze und<br />
die Sicherung der Qualität der IuK-Dienste. In den letzten zwei Jahren ist ein kontinuierliches<br />
Anwachsen von IT-Diensten zu verzeichnen, die immer mehr an strategischer Bedeutung gewinnen.<br />
Leider kann nicht in gleichem Verhältnis die Personalstruktur erweitert werden. Es<br />
müssen Strategien entwickelt werden, IT-Dienste weiter zu automatisieren und zu stabilisieren.<br />
Dies ist arbeitsintensiv, geht mit umfangreichen Recherchen sowie Planungen einher und kann<br />
nur langfristig effizient gelöst werden.<br />
Die Relevanz von IT für alle Bereiche der <strong>Hochschule</strong> ist beträchtlich. Wünschenswert für die<br />
Unterstützung zentraler IT wäre ein geeignetes Leitungsgremium/Lenkungsausschuss mit umfassenden<br />
Entscheidungskompetenzen hinsichtlich Entwicklung und Koordinierung aller IuK-<br />
Aufgaben der <strong>Hochschule</strong>.<br />
Im Berichtszeitraum wurde das IT-Servicemanagement in den Routinebetrieb übernommen und<br />
vervollständigt. Der Dienstleistungskatalog des ZKI wurde fortgeschrieben und detaillierte Informationen<br />
zu den Dienstleistungen ergänzt. Das Wartungs- und Fehlermeldetool wurde<br />
ergänzt.<br />
Recherchen zu Varianten der Stabilisierung des IT-Betriebes und der Steigerung der Ausfallsicherheit<br />
von IT-Systemen wurden durchgeführt. Ziel ist die Verfügbarkeit der IT-Systeme von<br />
bis zu 99,9 % per anno. Als einziger Weg wird die Virtualisierung von IT-Systemen gesehen.<br />
Um das Thema für die <strong>Hochschule</strong> zu konkretisieren, gab es im dritten Quartal <strong>2009</strong> einen halbtägigen<br />
Workshop mit verantwortlichen Administratoren des ZKI und einer fachkompetenten<br />
Firma. Der Weg soll weiter beschritten werden und 2010 Strategien der Umsetzung entwickelt<br />
werden.<br />
In der Bibliothek wurden <strong>2009</strong> sowohl die Recherche-Arbeitsplätze im Nutzerbereich als auch<br />
die Mitarbeiter-Arbeitsplätze erneuert. Jetzt stehen 35 Thin Client-Arbeitsplätze (Igel) für die<br />
Nutzer/-innen und 16 leistungsfähige PC-Arbeitsplätze sowie ein ausfallsicherer Server für die<br />
Mitarbeiter/-innen zur Verfügung.<br />
Auch die Stabsstellen bzw. Projekte der <strong>Hochschule</strong>, wie das International Office, das Sportzentrum,<br />
das Weiterbildungszentrum sowie das Projekt German-Jordanian University werden<br />
vom ZKI betreut. Dazu gehören Hardwarebeschaffung und -einrichtung sowie Betreuung bei<br />
Hard- und Softwareproblemen. Für alle Nutzer/-innen in den Stabsstellen/Projekten wurde ein<br />
zentraler Speicherbereich für die Datenablage bereitgestellt, der täglich über das zentrale Backup-System<br />
der <strong>Hochschule</strong> gesichert wird.<br />
Der Einsatz von Thin-Clients (Igel) und Applikationsservern in der Zentralverwaltung läuft im<br />
Dezernat IV seit März <strong>2009</strong> im produktiven Betrieb, weitere Anwendungen befinden sich in der<br />
Testphase, so dass der Einsatz in absehbarer Zeit auf weitere Dezernate ausgedehnt werden<br />
kann.<br />
Seite 71
Die Umstellung der elearning-Plattform „webct“ auf „moodle“ war problematischer als angenommen,<br />
da die beauftragte Firma bis ins 1. Quartal <strong>2009</strong> nicht die umgestellten Kurse liefern<br />
konnte.<br />
Inzwischen ist „moodle“ im produktiven Einsatz und ab Sommersemester <strong>2009</strong> alleinige zentrale<br />
Lernplattform der <strong>Hochschule</strong>. Es werden 241 Kurse innerhalb der verschiedenen<br />
Fachbereiche angeboten, mehrheitlich aus dem Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen<br />
und dem Institut Fachkommunikation.<br />
Es werden jetzt alle vom ZKI betreuten WWW-Server der <strong>Hochschule</strong> auf virtueller Hardware<br />
betrieben. Damit kann gewährleistet werden, dass bei einem Hardware-Ausfall der entsprechende<br />
WWW-Server schnell wieder gestartet werden kann. Letzter übernommener Server war<br />
der zentrale WWW-Server der <strong>Hochschule</strong>, da hier umfassendere Arbeiten zur Anpassung an<br />
den neuen Softwarestand notwendig waren.<br />
Neben den Arbeiten an der IT-Sicherheits-Rahmenrichtlinie befasste sich die operative Arbeitsgruppe<br />
IT-Sicherheit mit Maßnahmen zur Absicherung außenwirksamer dezentraler Server. Als<br />
erster Erfolg dieser Maßnahmen kann gewertet werden, dass es im laufenden Jahr keine Sicherheitsvorfälle<br />
in diesem Bereich gab.<br />
Der Projektantrag „campus2go“ wurde genehmigt. Wesentliche Inhalte sind die Verstetigung<br />
von Online-Services und der nutzerbezogene Zugriff auf Ressourcen der <strong>Hochschule</strong> mit (fast)<br />
allen mobilen IT-Systemen (z. B. iPhone) von jedem Ort. Damit ist die Einführung eines Studienportals<br />
verbunden. Durch Verzögerungen im Begutachtungsverfahren konnte hier erst im<br />
Oktober mit einer von zwei beantragten Stellen gestartet werden. Es gibt leider zu wenig Bewerber/-innen<br />
im IT-Bereich. Nach einer zweiten Ausschreibung konnte die zweite Stelle im<br />
November besetzt werden.<br />
Es gab in der Vergangenheit mehrfach Anläufe, ein Groupware System einzuführen, welches<br />
die Zusammenarbeit in einer Gruppe über zeitliche und/oder räumliche Distanz hinweg unterstützt.<br />
Der Umfang der Groupware-Applikationen ist unterschiedlich. Bei vielen sind<br />
Projektmanagement, Kalenderfunktion, WiKi, Notizbuchfunktion, Adressverwaltung oder auch<br />
E-Mail enthalten. Erneute Recherchen und Vergleiche ergaben das Opensource Tool „egruopware“<br />
als mögliche Lösung. Der Testbetrieb im ZKI und an der GJU wurde aufgenommen.<br />
Die Nachnutzung für andere Bereiche der <strong>Hochschule</strong> wird nach erfolgreicher Testphase angeboten.<br />
Weitere groupware-Systeme werden nicht zentral unterstützt.<br />
Gemeinsam mit dem Dezernat I, Herrn Soding, wurde viel Arbeit in die Ausschreibung von zentralen<br />
Druck-/Kopiersystemen investiert. Schwierig gestaltet sich noch immer die Ausschreibung<br />
der Druck-Kopier-Systeme, die auch von Studierenden genutzt werden können. Es wird eine<br />
Nutzung ohne die Autorisierung via Chipkarte angestrebt, da sich das Chipkartenverfahren als<br />
unwirtschaftlich und schlecht zu handhaben erwies. Verfahren ohne Chipkarte sind in der deutschen<br />
Hochschullandschaft noch nicht marktüblich, so dass es kaum Anbieter gibt.<br />
Die <strong>Hochschule</strong> setzt seit vielen Jahren die Software EvaSys für die Lehrevaluationen ein. Das<br />
Erscheinen der Version 4.0 im Juni machte es nötig, die veraltete Technik zu ersetzen und das<br />
Betriebssystem zu updaten.<br />
Nachdem es zu Beginn des Jahres durch die verstärkte Nutzung des Online-<br />
Studierendenservices zu Stabilitäts- und Bandbreitenproblemen des VPN-Zugangs kam, wurde<br />
ein neues VPN-Gateway zum Hochschulnetz beschafft und installiert. Der VPN-Zugang besitzt<br />
nun ausreichend Kapazität, um auch Spitzenbelastungen während der Einschreibe- und Rückmeldezeiträume<br />
abzufangen. Das neue Gateway unterstützt jetzt auch 64-Bit-Betriebssysteme.<br />
Im kommenden Jahr soll dann, nach einer geplanten Hardwareerweiterung, die Hochverfügbarkeit<br />
für den VPN-Zugang erreicht werden.<br />
Seite 72
Das Datennetz der <strong>Hochschule</strong> ist mittlerweile für die interne und externe Kommunikation, den<br />
Austausch von Daten, das Recherchieren zur Informationsgewinnung und die Geschäftsabläufe<br />
innerhalb der <strong>Hochschule</strong> unverzichtbar geworden. Die Anforderungen hinsichtlich Stabilität,<br />
Verfügbarkeit, garantierter Dienstgüte und Leistungsfähigkeit sind gewachsen. Deshalb ist eine<br />
Modernisierung dringend notwendig. Das ZKI trägt dem mit dem Projekt zur Erneuerung des<br />
Datennetzes der <strong>Hochschule</strong> Rechnung. Es soll eine leistungsfähige Infrastruktur geschaffen<br />
werden, die eine Vermittlung von Diensten in hoher Qualität, eine möglichst breitbandige Vernetzung<br />
und einen sicheren Betrieb hinsichtlich Datensicherheit und Betriebssicherheit<br />
gewährleistet. Im Rahmen des Projektes wird bei der Realisierung besonderes Augenmerk gelegt<br />
auf:<br />
• die Ausfallsicherheit wichtiger zentraler Komponenten<br />
• Automatismen für eine hohe Verfügbarkeit des Netzes<br />
• Funktionen zur Gewährleistung des sicheren Betriebes<br />
• zukunftssichere Komponenten, um neuen Anforderungen gerecht zu werden<br />
• Management-Funktionen, die schnelle, sichere und aussagekräftige Informationen über den<br />
Zustand des Netzes liefern<br />
Vor dem Hintergrund einer redundanten WLAN-Netzstruktur hinsichtlich Hard- und Software<br />
wurden alle Hochschulgebäude auf dem <strong>Stendal</strong>er Campus mit Accesspoints ausgerüstet, die<br />
denen in <strong>Magdeburg</strong> entsprechen. Aufgrund dieser durchgehend homogenen Netzarchitektur<br />
ist ein umfassendes Management der Accesspoints von <strong>Magdeburg</strong> aus möglich. Die vollständige<br />
Abdeckung der Innenbereiche und der Campusaußenflächen auch am Standort <strong>Stendal</strong><br />
wird nun gewährleistet.<br />
Am Standort <strong>Stendal</strong> mussten durch die ausführende Firma Nachbesserungs- und Ergänzungsarbeiten<br />
an der Medientechnik des Audimax und der Seminarräume durchgeführt<br />
werden. Die Seminarräume im Haus 1 wurden mit Medientischen analog denen des Hauses 3<br />
ausgestattet.<br />
Auch im Jahr <strong>2009</strong> wurden im ZIM zahlreiche Produktionen für die Lehre und Präsentation der<br />
<strong>Hochschule</strong> realisiert. Exemplarisch seien hier der Auftritt auf der AERO <strong>2009</strong> und die Produktionen<br />
zum Thema Reibschweißen genannt. Einen großen Raum nimmt weiterhin die Betreuung<br />
der Medientechnik im Audimax und in den Hörsälen ein.<br />
Zur Erneuerung bzw. Ausstattung zentraler Seminarräume und Hörsäle mit Medientechnik wurde<br />
ein Antrag auf finanzielle Mittel aus dem Konjunkturpaket gestellt. Die Mittel stehen jetzt zur<br />
Verfügung und die Umsetzung wird vorbereitet (Realisierung Sommer 2010).<br />
Das vom ZIM genutzte digitale Videoarchiv wurde technisch erweitert und steht jetzt auch<br />
hochschulweit zur Verfügung. Die Gebärdensprachler nutzen diese Dienstleistung bereits intensiv<br />
und im Fachbereich Kommunikation und Medien laufen erste Vorbereitungen dazu.<br />
Immer umfangreicher wird die medientechnische Beratung von Studierenden und Lehrenden,<br />
da die Vielfalt von technischen „Standards“ und deren Anwendungsmöglichkeiten kaum noch zu<br />
überblicken sind.<br />
Es wird an einer Änderung der Bild- und Tonregie für das Videostudio gearbeitet. Damit soll die<br />
Nutzungsmöglichkeit durch die Studierenden des Fachbereichs Kommunikation und Medien<br />
verbessert werden.<br />
Insgesamt haben wir aber den Eindruck, dass die Möglichkeiten zur Unterstützung beim Einsatz<br />
neuer Medien in der Lehre noch nicht von allen Lehrenden genutzt werden.<br />
Seite 73
Das ZKI ist aktives Mitglied im Verein der RZ-Leiter Deutschlands und ZIM-aktives Mitglied in<br />
der AMH (Arbeitskreis Medienzentren an <strong>Hochschule</strong>n).<br />
Seite 74
Anhang zum <strong>Rektoratsbericht</strong> <strong>2009</strong><br />
Anhang 1: Struktur- und Leistungsdaten der <strong>Hochschule</strong><br />
Personal, Budget und Flächen<br />
Personal (Plan)<br />
Insgesamt 1) 322<br />
Davon : WHP incl. Stelle des Rektors 163<br />
Nichtwissenschaftliches Personal 159<br />
Finanzen (ohne Drittmittel)<br />
Budgetzuweisung <strong>2009</strong> 1) 22.796.708,54<br />
Ausgaben 24.228.594,43<br />
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 878.900<br />
Eigene Einnahmen und Abbau Ausgabenrest 714.529,51<br />
Flächen: (Plan) 33.326<br />
Davon Anreizfläche 1.770<br />
1) Incl. eine Stelle für Personalratsvorsitzende<br />
2) Incl. Zuweisung doppelter Abiturjahrgang, Anschubfinanzierung Professorenbesoldung abzüglich des Konsolidierungsbeitrags<br />
Verteilung der Ausbildungskapazität und Struktur:<br />
Planzahlen: 3.500 Studienplätze<br />
Angewandte Humanwissenschaften 490<br />
Bauwesen 410<br />
Ingenieurwissenschaften und Industriedesign 900<br />
Kommunikation und Medien 450<br />
Sozial- und Gesundheitswesen 570<br />
Wasser- und Kreislaufwirtschaft 360<br />
Wirtschaft 320<br />
Seite 75
Leistungsübersicht:<br />
1. Bewerber Bewerbungen WS 09/10: 6.099<br />
2. Studienanfänger Studienanfänger WS 09/10: 1.523<br />
Studienanfänger Ba-Studiengänge 1. FS <strong>2009</strong><br />
(SoS09 und WS 09/10):<br />
1.512<br />
Studienanfänger Ba-Studiengänge 1. HS <strong>2009</strong><br />
(SoS 09 und WS 09/10):<br />
1.267<br />
3. Studierende<br />
Ausbildungskapazität: 3.500<br />
Studierende WS 09/10: 6.365<br />
4. Absolventen<br />
Insgesamt: 1.369<br />
(akad. Jahr <strong>2009</strong> = Bachelor-Absolventen: 520<br />
WS 08/09 u. SS 09) Master-Absolventen: 37<br />
5. Einführung der ge- Studierende in Bachelor-Studiengängen: 4.842<br />
stuft. Studiengänge Studierende in Master-Studiengängen: 435<br />
Bachelor-Studiengänge: 27<br />
Master-Studiengänge (ohne weiterbildende): 16<br />
6. Weiterbildung/<br />
Lebenslg. Lernen<br />
Weiterbildungs-Studiengänge 12<br />
Teilnehmer WB-Studiengänge WS 09/10: 401<br />
7. Internationaliät Ausländische Studierende WS 09/10: 270<br />
Erasmus-Studierende Outgoing <strong>2009</strong>: 52<br />
8. Gleichstellung Weibliche Studierende WS 09/10: 3.212<br />
Seite 76
Anhang 2: Firmenkontaktmesse<br />
Seite 77
Anhang 3: Career Center<br />
Personaltransfer<br />
Die Organisation des Personaltransfers zwischen <strong>Hochschule</strong> und Wirtschaft erfolgt an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) über das Career Center.<br />
Das Career Center an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) organisiert die Vermittlung der<br />
Studierenden in Praktika oder Festeinstellungen in Wirtschaftsunternehmen, soziale Einrichtungen<br />
und Institutionen. Darüber hinaus werden die Studierenden individuell hinsichtlich Bewerbungsstrategien<br />
und Karriereplanung unterstützt und durch zusätzliche Weiterbildungsangebote<br />
in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung auf das Berufsleben vorbereitet.<br />
Das Leistungsangebot für Arbeitgeber:<br />
• Vermittlung von Studierenden und Hochschulabsolventen/-innen<br />
• Beratung und Hilfe bei der Personalsuche und -auswahl<br />
• Organisation von Firmenkontaktmessen und Exkursionen, bei denen sich Studierende und<br />
potentielle Arbeitgeber frühzeitig kennen lernen<br />
• Unterstützung bei der Planung, Gestaltung und Durchführung von Weiterbildungsaktivitäten<br />
• Persönliche Beratung und individuelle Betreuung<br />
• Frühzeitiger Kontakt zu akademischen Nachwuchskräften<br />
• Unkomplizierte Nutzung des Online Portals „Nachwuchsmarkt.de“<br />
Leistungsangebot für Studierende und Absolventen/-innen:<br />
• Vermittlung von Festanstellungen, Praktika, Abschlussthemen, qualifizierte Nebentätigkeiten<br />
und Hiwi-Stellen<br />
• persönliche Beratung und individuelle Betreuung<br />
• Verbesserung sozialer Kompetenzen durch Weiterbildungsangebote<br />
• Frühzeitige und direkte Kontaktaufnahme zu potentiellen Arbeitgebern<br />
• Aktuelle Informationen rund um das Thema Berufsvorbereitung und Berufseinstieg<br />
• Kostenlose Nutzung des Online Portals „Nachwuchsmarkt.de“<br />
Das Career Center besitzt ein weit verzweigtes Netzwerk an Unternehmenskontakten.<br />
Das primäre Ziel des Career Center ist es, akademisch ausgebildete junge Menschen im Land<br />
Sachsen-Anhalt zu halten, diese in Unternehmen im Land zu integrieren und somit dem Trend<br />
der Abwanderung von Fach- und Führungskräften entgegenzuwirken.<br />
Der Focus liegt hierbei auf der frühzeitigen Bindung der Studierenden an die hiesigen Unternehmen<br />
und dem Aufbau von partnerschaftlichen Beziehungen. Die Absolventen/-innen werden<br />
speziell auf die Stellengesuche regionaler Unternehmen vermittelt und gezielt bei der Suche<br />
nach einem Arbeitsplatz in der Region unterstützt.<br />
Jährlich lädt das Career Center zur Firmenkontaktmesse „Studierende treffen Wirtschaft“ ein.<br />
<strong>2009</strong> wurde diese im Rahmen des Forschungs- und Nachwuchsmarktes in enger Zusammenarbeit<br />
mit dem TWZ der <strong>Hochschule</strong> organisiert und durchgeführt.<br />
Auch im Zuge der Wirtschaftskrise gelang dem Career Center eine professionelle Veranstaltung.<br />
Durch langfristige partnerschaftliche Beziehungen mit potentiellen Arbeitgebern der<br />
Region weiß man die Potentiale einer solchen Veranstaltung zu schätzen und auch in Krisenzeiten<br />
zu nutzen.<br />
Im Berichtszeitraum stellten sich 36 Aussteller den Studierenden als potentielle Arbeitgeber vor.<br />
Das Career Center an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH) ist seit 2008 Teil des „Transferzentrum<br />
Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung für KMU im Land<br />
Seite 78
Sachsen-Anhalt“, welches an weiteren sechs <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt entstanden ist.<br />
Finanziert wird es aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen-<br />
Anhalt. Das Verbundprojekt der sieben staatlichen <strong>Hochschule</strong>n in Sachsen-Anhalt verfolgt das<br />
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in Sachsen-Anhalt einerseits<br />
durch den Career Service, andererseits durch bedarfsgerechte wissenschaftliche Weiterbildung<br />
von Fach- und Führungskräften in den Unternehmen zu stärken.<br />
Über das Verbundprojekt können die Vermittlungs-, Beratungs- und Weiterbildungsleistungen<br />
stärker an den Bedarf der Unternehmen ausgerichtet und flächendeckend angeboten werden.<br />
Die sieben <strong>Hochschule</strong>inrichtungen nutzen seit September <strong>2009</strong> das Online Portal „Nachwuchsmarkt<br />
Sachsen-Anhalt“ für die landesweite Vermittlung der Studierenden und<br />
Absolventen/-innen. Betreiber des Online Portals ist die <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
und federführend in der weiteren Entwicklung und Anpassung der Gegebenheiten in der Vermittlungsarbeit.<br />
Im Berichtszeitraum wurden vom Career Center betreut:<br />
• 1886 Studierende bzw. Absolventen/-innen<br />
• 842 Arbeitgeber, davon 411 Arbeitgeber aus Sachsen-Anhalt, 392 Arbeitgeber bundesweit<br />
und 39 Arbeitgeber weltweit<br />
• 970 (297) Stellenangebote, davon 625 (136) Festanstellungen, 282 (112) Praktikantenstellen<br />
• 63 (49) qualifizierte Nebentätigkeiten, wurden akquiriert und den Stellensuchenden zur Verfügung<br />
gestellt. Die Klammerwerte beziehen sich auf Sachsen-Anhalt<br />
• 212 Vermittlungen wurden getätigt, davon: 77 Festanstellungen, 57 Abschlussarbeiten inkl.<br />
Praktikum, 40 Praktika und 38 Nebenjob/Freiberufliche Tätigkeiten.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Job<br />
Abschlusspraktika<br />
Praktika<br />
Nebentätigkeiten<br />
Im Rahmen des Studium Generale wurden Seminare zum Thema „Berufsvorbereitung und<br />
-einstieg“ organisiert und angeboten. Zum Angebot zählen beispielsweise:<br />
• Personalauswahl aus Sicht eines Arbeitgebers<br />
• Gesprächsrhetorik<br />
• Interkulturelle Kommunikation am Arbeitsplatz<br />
• Berufliche Zielfindung und Karrierestrategien<br />
• Kommunikation im Management: Gesprächsführung, Moderation, Verhandlung<br />
Seite 79
Anhang 4: Fragebogen SQM (Ausschnitt)<br />
Seite 80
Seite 81
Anhang 5: Internationalität (Ein Beispiel)<br />
Seite 82
Anhang 6: Fragebogen Studienabbruch<br />
Seite 83
Seite 84
Seite 85
Anhang 7: Scouts<br />
Seite 86
Seite 87
Seite 88
Anhang 8: Zweitschönster Campus Deutschlands<br />
Seite 89
Anhang 9: Chancen der Studierendenwerbung<br />
Seite 90
Anhang 10: Spatenstich Mensa<br />
Seite 91
Seite 92