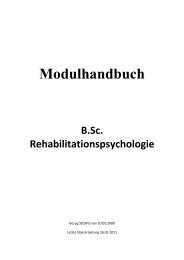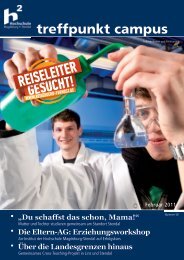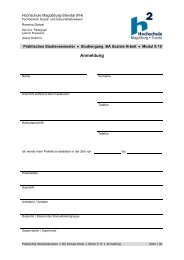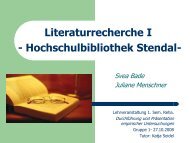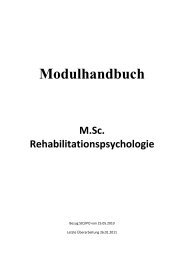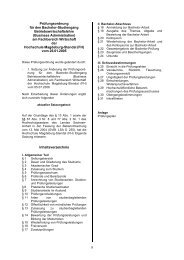Hochschule Magdeburg-Stendal
Hochschule Magdeburg-Stendal
Hochschule Magdeburg-Stendal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studienführer<br />
Bachelorstudiengang<br />
Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Sommersemester 2009<br />
Jahrgänge 2, 3 und 4<br />
April 2009 – September 2009
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
2
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis.............................................................................................................................................3<br />
Begrüßung.........................................................................................................................................................5<br />
Studiengangsteam.............................................................................................................................................5<br />
Lehrende ...........................................................................................................................................................6<br />
Vorlesungsplan für das Semester 2.................................................................................................................8<br />
Vorlesungsplan für das Semester 4...............................................................................................................10<br />
Vorlesungsplan für das Semester 6...............................................................................................................12<br />
Modulkatalog für das Semester 2 .................................................................................................................14<br />
Modulkatalog für das Semester 4 .................................................................................................................33<br />
Modulkatalog für das Semester 6 .................................................................................................................53<br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“ für die Jahrgänge 2 und 3.................90<br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“ für den Jahrgang 4 (und folgende) ..96<br />
Verwaltung / zentrale Einrichtungen .........................................................................................................102<br />
Notizen...........................................................................................................................................................106<br />
Terminplan für das Sommersemester 2009 ...............................................................................................108<br />
Kalender 2009...............................................................................................................................................108<br />
3
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Impressum:<br />
Herausgeber: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Redaktion: Hertha Schnurrer, Franziska Blisse<br />
Layout: Hertha Schnurrer, Franziska Blisse, Thomas Pape<br />
Redaktionsschluss: 30. März 2009<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Standort <strong>Stendal</strong><br />
Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften<br />
Osterburger Str. 25, 39576 <strong>Stendal</strong><br />
http://www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-ahumanw/<br />
4
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Begrüßung<br />
Liebe Studierende,<br />
ein herzliches Willkommen zum neuen Semester. In diesem Studienführer finden Sie<br />
• Angaben zum Studiengangsteam und den Lehrenden<br />
• die Vorlesungspläne des Sommersemesters 2009 für das 2., 4. und 6. Semester<br />
• die Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen der jeweiligen Semester<br />
• den Katalog der Wahlveranstaltungen<br />
• die Regelstudienpläne über alle 6 Semester hinweg gemäß der alten und neuen Studien- und<br />
Prüfungsordnung<br />
• wichtige Adressen und Ansprechpartner/innen an der <strong>Hochschule</strong><br />
• Terminplan für das Sommersemester 2009<br />
• Kalender 2009<br />
Wir wünschen Ihnen (weiterhin) viel Erfolg, Motivation und Freude während Ihres Studiums. Gerne stehen<br />
wir Ihnen für Ihre Anliegen und Fragen zur Verfügung.<br />
Ihr Studiengangsteam<br />
Studiengangsteam<br />
Studiengangsbeauftragte Prof. Dr. Beatrice Hungerland, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Kindheitswissenschaften Haus 3, Raum 2.14, Tel.: (03931) 2187-4883<br />
Email: beatrice.hungerland@hs-magdeburg.de<br />
Stellvertretung und Prof. Dr. Raimund Geene, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Praxiskontakte Haus 3, Raum 2.13, Tel.: (03931) 2187-4866,<br />
Kindl. Entwicklung u. Gesundheit Email: raimund.geene@hs-magdeburg.de<br />
Kindliche Entwicklung, Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Bildung und Sozialisation Haus 3, Raum 2.08, Tel: (03931) 2187-4884<br />
Email: joachim.broecher@hs-magdeburg.de<br />
Kindheit und Differenz Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers, Büro: Osterburger Str. 25<br />
(Diversity Studies) Haus 3, Raum 2.07, Tel: (03931) 2187- 4888<br />
Email: maureen-maisha.eggers@hs-magdeburg.de<br />
Förderung regionale Doreen Beer, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Beziehungen (WiMi) Haus 3, Raum 2.06, Tel.: (03931) 2187-4886<br />
Email: doreen.beer@hs-magdeburg.de<br />
Förderung internationale Mareike Fiedler, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Beziehungen (WiMi) Haus 3, Raum 2.06, Tel.: (03931) 2187-4887<br />
Email: mareike.fiedler@hs-magdeburg.de<br />
Studiengangskoordination (WiMi) Hertha Schnurrer, Büro: Osterburger Str. 25<br />
Haus 3, Raum 2.15, Tel.: (03931) 2187-4801<br />
Email: hertha.schnurrer@hs-magdeburg.de<br />
Postadresse:<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften<br />
Osterburger Str. 25, 39576 <strong>Stendal</strong>,<br />
Tel.: 03931 21 87 – 0, Fax: 03931 2187-4870,<br />
http://www.hs-magdeburg.de bzw. www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-ahumanw/<br />
Aktuelle Infos unter www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-ahumanw/studiengaenge/kiwi<br />
5
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Lehrende<br />
Hochschulstandort <strong>Stendal</strong> FB AHW u. Wirtschaft, Osterburger Str. 25, Haus 2 oder 3<br />
Telefon: (03931) 2187-<br />
Doreen Beer Hs 3, R. 2.06, Tel.: 4886, doreen.beer@hs-magdeburg.de<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sprechzeit: Di 16-18 Uhr u. nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher Hs 3, R. 2.08 , Tel.: 4884, joachim.broecher@hs-magdeburg.de<br />
Kindl. Entwicklung, Bildung, Sozialisation Sprechzeit: Di 12-13 Uhr u. nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers Hs 3, R. 2.07, Tel.: 4888<br />
Kindheit und Differenz maureen-maisha.eggers@hs-magdeburg.de<br />
(Diversity Studies) Sprechzeit nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. Raimund Geene Hs 3, R. 2.13, Tel.: 4866, raimund.geene@hs-magdeburg.de<br />
Kindliche Entwicklung u. Gesundheit Sprechzeit: Di 12-13 Uhr u. nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland Hs 3, R. 2.14, Tel.: 4883<br />
Kindheitswissenschaften beatrice.hungerland@hs-magdeburg.de<br />
Sprechzeit: Mi 10-12 Uhr u. nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. habil. Wolfgang Maiers Hs 2, R. 1.09, Tel.: 4837, wolfgang.maiers@hs-magdeburg.de<br />
Allgemeine Psychologie Sprechzeit: Mi 9-10 Uhr, Do 9-10 u. 14-15, Fr. n. Vereinbarung<br />
Prof. Dr. Christian Meisel Breite Str. 63, Raum 4102, Tel.: 4816<br />
Ökonomie kleiner und mittelständ. christian.meisel@hs-magdeburg.de<br />
Unternehmen u. Existenzgründung<br />
Prof. Dr. Günter Mey Hs 3, R. 0.20, Tel.: N.N., guenter.mey@hs-magdeburg.de<br />
Entwicklungspsychologie Sprechzeit nach Vereinbarung<br />
Dr. Helene Kneip Hs 3, R. 0.15, Tel.: 4896, helene.kneip@hs-magdeburg.de<br />
Vertr.-Prof. Sprechzeit nach Vereinbarung<br />
Sozialversicherungsmanagement<br />
Prof. Dr. Michael Kraus Hs 2, R. 1.01, Tel.: 4835, michael.kraus@hs-magdeburg.de<br />
Forschungs- u. Dokumentationsmeth. Sprechzeit: Mi 13:30-14:30 Uhr u. nach Vereinbarung<br />
Prof. Dr. Christel Salewski Hs 3, R. 1.17, Tel.: 4820, christel.salewski@hs-magdeburg.de<br />
Persönlichkeitspsychologie Sprechzeit: Mi 14-15 Uhr<br />
Hertha Schnurrer Hs 3, R. 2.15, Tel.: 4801<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin hertha.schnurrer@hs-magdeburg.de<br />
Prof. Dr. Burkhard von Hs. 2, Raum 0.01, Tel.: 4848<br />
Velsen-Zerweck burkhard.von-velsen@hs-magdeburg.de<br />
Dienstleistungswirtschaft u.<br />
Management<br />
Prof. Dr. Nicola Wolf-Kühn Hs 3, R. 1.04, Tel.: 4869<br />
Sozialmedizin nicola.wolf@hs-magdeburg.de<br />
Angret Zierenberg Hs 2, R. 1.02, Tel.: 4843<br />
LfbA – Lehrbereich Englisch/ angret.zierenberg@hs-magdeburg.de<br />
Koordination Sprachangebote<br />
6
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Hochschulstandort <strong>Magdeburg</strong> FB SGW, Breitscheidstr. 2, Haus 1,<br />
Tel.: (0391) 886-<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Braun Raum 2.42, Tel.: 4313<br />
Sozialpädagogik/Erziehungswissenschaft karl-heinz.braun@hs-magdeburg.de<br />
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann Raum 0.31, Tel.: 4310<br />
Sozialpsychologie wolfgang.heckmann@hs-magdeburg.de<br />
Dr. Arnd Hofmeister Raum 4.11.2, Tel.: 4691<br />
Vertr.-Prof. f. arnd.hofmeister@hs-magdeburg.de<br />
Europ. Politik u. Gesundheit<br />
Prof. Dr. sc. mus. Susanne Metzner Raum 1.06 (Multikomplex), Tel.: 4717<br />
Musiktherapie susanne.metzner@hs-magdeburg.de<br />
Frauke Mingerzahn Raum 0.37 b, Tel.: 4303<br />
LfbA (Heilpädagogin/Sozialpädagogin) claudia.nicolaus@hs-magdeburg.de<br />
Claudia Nicolaus Raum 0.70, Tel.: 4318<br />
LfbA (Heilpädagogin/Sozialpädagogin) claudia.nicolaus@hs-magdeburg.de<br />
Externe Lehrende<br />
Brock, Ines inesbrock@hotmail.com<br />
Friele Boris (Dr.) boris@friele.de<br />
Janert, Josefine josefine.janert@web.de<br />
Kaindl, Christina ckaindl@zedat.fu-berlin.de<br />
Leitner, Barbara leitnerbar@aol.com<br />
Lohss, Astrid lohss@web.de<br />
Poerschke, Gerd gerd.poerschke@freenet.de<br />
Seidel, Katja katja.seidel@gast.hs-magdeburg.de<br />
Spier, Sven spier@contec.de<br />
Andre Strahl andre.strahl@t-online.de<br />
Mirco Vogel mcbird@web.de<br />
7
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Vorlesungsplan für das Semester 2<br />
2. SEMESTER – SoSe 2009<br />
08.00<br />
–<br />
10.00<br />
10.00<br />
–<br />
12.00<br />
12.00<br />
–<br />
14.00<br />
14.00<br />
–<br />
16.00<br />
16.00<br />
–<br />
18.00<br />
18.00<br />
–<br />
20.00<br />
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH<br />
-Tutorium: Theorie und Praxis der<br />
Sozialpädagogik-Prof. Geene,<br />
(W’Pfl.), Lubke., Gr. 1, R. 0.20<br />
-Kinder u. Kindheit im gesellschaftl.<br />
Kontext, (Pfl.), HUNGERLAND,<br />
Gr. 1, R. 2.17<br />
-Fachenglisch II, (W.), LÜHE,<br />
R. 1.02<br />
-Kinder u. Kindheit im gesellschaftl.<br />
Kontext, (Pfl.), HUNGERLAND,<br />
Gr. 2, R. 2.17<br />
-Bildungs- u. Erziehungsprozesse II:<br />
Theorie und Praxis der<br />
Sozialpädagogik, (W’Pfl.), GEENE,<br />
R. 0.22<br />
-Kinderleben u. Umwelt:<br />
Frühförderung und frühe Hilfen,<br />
(W’Pfl.), GEENE u. WOLF-KÜHN,<br />
R. 4.001<br />
-Jean-Monnet-Modul: Unser Europa<br />
sozial?, (W.), HOFMEISTER, R. 1.11<br />
-Tutorium: Einf. in soziologische<br />
Theorien…-Prof. Hungerland, (W.),<br />
N.N., R. 1.03<br />
-Kinderleben u. Umwelt: Arbeitende<br />
Kinder, (W’Pfl.), HUNGERLAND,<br />
R. 2.16<br />
-Schwedisch Konversation, (W.),<br />
JANERT, R. 0.09<br />
-Vor- u. Nachbereitung der Genf-<br />
Exkursion, (W.), HUNGERLAND,<br />
14-tgl., R. 2.16, Start 06.04.<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
-Lehrforschungsprojekt - Bildungs- u.<br />
Erziehungsprozesse II: Individuelle<br />
Förderung aus sonderpäd. Sicht,<br />
(W’Pfl.), BROECHER, R. 2.16<br />
-Einführung in soziologische Theorien<br />
der Sozialisation und der Kindheit,<br />
(Pfl.), HUNGERLAND,<br />
Gr. 1, R. 2.16<br />
-Vorbereitung Praktikum, (W’Pfl.),<br />
GEENE, 14-tgl. für Gr. 2 bzw. Gr. 3,<br />
R. 0.20<br />
-Vertiefung Allg. Psychologie,<br />
(W`Pfl.), MAIERS, Gr. 1, R. 0.03<br />
(gemeinsam mit Rehas)<br />
-‘We don’t need no education…’ –<br />
Zum Verhältnis von Lernen und<br />
schulischen Lernbedingungen II, (W.),<br />
BEER, R. 1.02<br />
-Tutorium: Vertiefung der päd.<br />
Module auf E-Learning-Basis-Prof.<br />
Broecher (W.), LEMME<br />
-Tutorium: Kinder u. Kindheit im<br />
gesellschaftl. Kontext-Prof.<br />
Hungerland, (W.), N.N. R. 2.16<br />
-Kinderleben u. Religion, (W’Pfl.),<br />
VOGEL, R. 1.20<br />
-Bildungs- u. Erziehungsprozesse II:<br />
Produktiv Umgehen mit Lern- und<br />
Verhaltensproblemen, (W’Pfl.),<br />
BROECHER, R. 2.17<br />
-Einführung in die<br />
Persönlichkeitspsychologie, (W’Pfl.),<br />
SALEWSKI, R. 1.22, Start 15.04.<br />
-Einführung in soziologische Theorien<br />
der Sozialisation und der Kindheit,<br />
(Pfl.), HUNGERLAND,<br />
Gr. 2, R. 2.16<br />
-Kinderleben u. Umwelt: Begleitung<br />
und Evaluation der Kinder-Uni (zzgl.<br />
25.05., 09.05., 30.05., 20.06), (W’Pfl.)<br />
GEENE, R. 3.01 (Winkelmann)<br />
GREMIENZEIT<br />
GREMIENZEIT<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 1, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v. 18-<br />
20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 2, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v. 18-<br />
20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
8
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
2. Semester – SOSE 2009<br />
08.00 –<br />
10.00<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
12.00 –<br />
14.00<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG<br />
-Tutorium: Theorie und Praxis der<br />
Sozialpädagogik-Prof. Geene,<br />
(W’Pfl.), Lubke, Gr. 2, R. 0.20<br />
WAHL WAHL<br />
-Children’s Literature-Great Britain,<br />
(W.), ZIERENBERG, Gr. 1, R. 0.02<br />
-Vertiefung<br />
Entwicklungspsychologie, (Pfl.),<br />
MEY, Gr. 1, R. 0.22<br />
-Bildungs- u. Erziehungsprozesse II:<br />
Ansätze der Frühpädagogik in D., I.<br />
u. den USA, (W’Pfl.), BROECHER,<br />
R. 2.16<br />
-Children’s Literature-Great Britain,<br />
(W.), ZIERENBERG, Gr. 2, R. 0.02<br />
-Vertiefung<br />
Entwicklungspsychologie, (Pfl.),<br />
MEY, Gr. 2, R. 0.22<br />
-Lehrforschungsprojekt - Bildungs- u.<br />
Erziehungsprozesse II: Ansätze der<br />
Frühpädagogik in D., I. u. den USA,<br />
(W’Pfl.), BROECHER,<br />
R. 2.08 (PC-Pool)<br />
-Einführung in die Sozialpsychologie,<br />
(W’Pfl.), HECKMANN, R. 0.02<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
WAHL WAHL<br />
-Vorbereitung Praktikum, (Pfl.),<br />
EGGERS, für Gr. 1, 15./16.05, Fr 10-<br />
18 Uhr u. Sa 11-17 Uhr, R. 1.22<br />
-Vertiefung Allg. Psychologie,<br />
(W`Pfl.), MESSING, Gr. 2,<br />
08./09.05. u. 19./20.06., Fr 14-19 Uhr<br />
u. Sa 09-16 Uhr, R. 2.01 (08./09.05)<br />
u. R. 1.20 (19./20.06)<br />
(gemeinsam mit Rehas)<br />
WAHL<br />
-Vertiefung Allg. Psychologie,<br />
(W`Pfl.), KAINDL, Gr. 3, 05./06.06.<br />
u. 19./20.06., Fr 16-20 Uhr u. Sa 10-<br />
18 Uhr, R. 0.02 (05./06.05.) u.<br />
R. 1.22 (19./20.06.)<br />
(gemeinsam mit Rehas)<br />
WAHL WAHL<br />
WAHL WAHL<br />
Wahlangebote in Form von Wochenendangeboten<br />
- „Musiktherapeutische Selbsterfahrung“ (W.) mit Prof. Dr. Susanne METZNER (FB SGW). Workshop<br />
am 03./04. Juli UND 17./18. Juli. Zeit: Fr. von 12-19 Uhr und Sa. von 09-13 Uhr. Ort:<br />
<strong>Magdeburg</strong>/Herrenkrug, Haus 1 (FB SGW), Raum 2.69<br />
- „Geburt und Übergang Elternschaft“ (W.) mit Ines Brock. Freitags 4-stündig von 10-14 Uhr (24. April,<br />
08. Mai, 12. Juni (weitere Termine werden direkt mit den TeilnehmerInnen vereinbart)), R. N.N.<br />
Einschreibung in die Fremdsprachenkurse mit Ausnahme der KiWi-spezifischen Englischangebote erfolgt ab<br />
31.03. ausschließlich Online.<br />
9
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Vorlesungsplan für das Semester 4<br />
4. SEMESTER – SoSe 2009<br />
08.00 –<br />
10.00<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
12.00 –<br />
14.00<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
18.00 –<br />
20.00<br />
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH<br />
-Fachenglisch IV, (W.), LÜHE,<br />
R. 1.03<br />
-Kindheitswissenschaftliche<br />
Reflexionen II: … (Pfl.),<br />
BROECHER u. SCHNURRER,<br />
14-tgl. 4-std. f. Gr. 1 bzw. Gr. 2<br />
Start: 06.04. f. Gr. 1 (10-12 Uhr) u.<br />
Gr. 2 (12-14 Uhr), R. 4.001/4.005<br />
s.o.<br />
-Kinderleben u. Umwelt:<br />
Frühförderung und frühe Hilfen,<br />
(W’Pfl.), GEENE u. WOLF-KÜHN,<br />
R. 4.001<br />
-Jean-Monnet-Modul: Unser Europa<br />
sozial?, (W.), HOFMEISTER,<br />
R. 1.11<br />
-Kinderleben u. Umwelt: Arbeitende<br />
Kinder, (W’Pfl.), HUNGERLAND,<br />
R. 2.16<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Kindheit d.<br />
Zukunft – Gesundheitsförderung,<br />
(W’Pfl.), GEENE, R. 1.19<br />
-Tutorium: Kinder- u.<br />
Jugendbeteiligung - Prof. Geene,<br />
(W.), N.N., R. 0.20<br />
-Schwedisch Konversation, (W.),<br />
JANERT, R. 0.09<br />
-Vor- u. Nachbereitung der Genf-<br />
Exkursion, (W.), HUNGERLAND,<br />
14-tgl., R. 2.16, Start 06.04.<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
-Sexualität im Kindes- u. Jugendalter<br />
(Pfl.), EGGERS, Gr. 1, R. 3.02<br />
(Winkelmann)<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: (W’Pfl.):<br />
(i) Junge Mütter u. Kinder,<br />
HUNGERLAND, R. 1.02<br />
(ii) Familienfreundliche Hovhschule-<br />
Familienzimmer, HUNGERLAND,<br />
R. 1.02<br />
(iii) Kinder- u. Jugendbeteiligung,<br />
GEENE, R. 0.21<br />
-Sexualität im Kindes- u. Jugendalter<br />
(Pfl.), EGGERS, Gr. 2, R. 3.02<br />
(Winkelmann)<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Schule d. Zukunft,<br />
(W’Pfl.), BEER, R. 1.02<br />
-Einführung in SPSS, (W.),<br />
STRAHL, R. 2.12 (PC-Pool)<br />
-Vertiefung - Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
14.04, 21.04., 28.04., 05.05 + 1 WE,<br />
R. 0.22<br />
-Problematiken…: Devianz und<br />
Delinquenz, (W’Pfl.), FRIELE,<br />
R. 0.04<br />
-‘We don’t need no education…’ –<br />
Zum Verhältnis von Lernen und<br />
schulischen Lernbedingungen II,<br />
(W.), BEER, R. 1.02<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Informationskompetenzen,<br />
(W’Pfl.), EGGERS,<br />
R. 2.03 (PC-Pool)<br />
-Unternehmerisches Handeln u.<br />
Existenzgründung, (W.), MEISEL,<br />
R. 4.001<br />
-Familientherapie und Systemische<br />
Therapie:…, (W.), FRIELE, R. 0.02<br />
-Tutorium: Vertiefung der päd.<br />
Module auf E-Learning-Basis-Prof.<br />
Broecher (W.), LEMME<br />
-Kinderleben u. Religion, (W’Pfl.),<br />
VOGEL, R. 1.20<br />
-Praxisrefl. u. aktuelle<br />
Entwickl.…:(W’Pfl.)<br />
Einf. in die. Diversity Studies…<br />
(W’Pfl.), EGGERS, 14-tgl. 4-std.,<br />
Start: 08.04., R. 2.01<br />
-Planung u. Diskussion v.<br />
qualitativen Forschungsarbeiten…,<br />
(W.), 14-tägl. 4-std., MEY, Start:<br />
08.04, R. 1.08<br />
s.o.<br />
-Kinderleben u. Umwelt: Begleitung<br />
und Evaluation der Kinder-Uni (zzgl.<br />
25.05., 09.05., 30.05., 20.06),<br />
(W’Pfl.) GEENE, R. 3.01<br />
(Winkelmann)<br />
-Children's Literature-Western und<br />
Southern Europe, (W.),<br />
ZIERENBERG, R. 0.22<br />
GREMIENZEIT<br />
GREMIENZEIT<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 1, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v.<br />
18-20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 2, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v.<br />
18-20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
10
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
4. SEMESTER – SoSe 2009<br />
08.00 –<br />
10.00<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
12.00 –<br />
14.00<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
18.00-<br />
20.00<br />
DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG<br />
-Einführung in die Methoden der empirischen<br />
Sozialforschung, (Pfl.), KRAUS, R. 1.08<br />
WAHL WAHL<br />
-Kinderleben und Architektur…, (W’Pfl.), LOHSS,<br />
14-tgl. 4-std., R. 2.01, Start 02.04.<br />
-Kinderleben und Spiel, (W’Pfl.), NICOLAUS,<br />
14-tgl. 4-std., R. 2.01, Start 09.04.<br />
-Children’s Literature-Great Britain, (W.),<br />
ZIERENBERG, R. 0.02<br />
-Kinderleben und Architektur…, (W’Pfl.), LOHSS,<br />
14-tgl. 4-std., R. 2.01, Start 02.04.<br />
-Kinderleben und Spiel, (W’Pfl.), NICOLAUS,<br />
14-tgl. 4-std., R. 2.01, Start 09.04.<br />
-Problematiken…: Erfahren von Gewalt, (W’Pfl.),<br />
EGGERS, R. 2.16<br />
-Children's Literature-Russia and Scandinavia, (W.),<br />
ZIERENBERG, R. 1.20<br />
-Grundlagen der Ökonomie des Bildungs- und<br />
Gesundheitswesens, (Pfl.), KNEIP, Gr. 1., R. 0.21<br />
-Problematiken…: Drogen/Sucht/Suchtprävention,<br />
(W’Pfl.), HECKMANN, R. 1.03<br />
-Grundlagen der Ökonomie des Bildungs- und<br />
Gesundheitswesens, (Pfl.), KNEIP, Gr. 2, R. 0.21<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
Wahlangebote in Form von Wochenendangeboten<br />
WAHL<br />
WAHL<br />
WAHL WAHL<br />
WAHL WAHL<br />
WAHL WAHL<br />
- „Ästhetische Bildung und ästhetische Erfahrung in der Praxis“ - Fortsetzungsseminar für Sem. 4 und 6,<br />
(W.), mit Prof. Dr. J. BROECHER, Termine: Fr., den 24.04 (R. 0.22), Sa., den 09.05 (R. 0.21) und Fr. u.<br />
Sa. 05.-06. 06 (R. 0.21) jeweils von 10-16 Uhr<br />
- „Musiktherapeutische Selbsterfahrung“ (W.) mit Prof. Dr. Susanne METZNER (FB SGW). Workshop<br />
am 03./04. Juli. UND 17./18. Juli. Zeit: Fr. von 14-20:30 Uhr und Sa. von 10-14 Uhr. Ort:<br />
<strong>Magdeburg</strong>/Herrenkrug, Haus 1 (FB SGW), Raum 2.69<br />
- „Lektürekurs Bourdieu: Männliche Herrschaft - als paradigmatische Form der symbolischen Gewalt“<br />
(W.) mit Prof. Dr. Maisha EGGERS. Block am 12./13. Juni (R. 2.16) + 10./11. Juli (R. 2.16), Fr 10-16<br />
Uhr u. Sa 11-17 Uhr<br />
- „Lebendige und authentische Beziehungen gestalten – Gewaltfreie Kommunikation im beruflichen und<br />
persönlichen Alltag“, (W.), mit Barbara Leitner am 08/09.05 (R. 2.16) und 26./27.06. (R. 0.09 und 0.22)<br />
jeweils von 10-18 Uhr<br />
- „Geburt und Übergang Elternschaft“ (W.) mit Ines Brock. Freitags 4-stündig von 10-14 Uhr (24. April,<br />
08. Mai, 12. Juni (weitere Termine werden direkt mit den TeilnehmerInnen vereinbart)), R. N.N.<br />
Einschreibung in die Fremdsprachenkurse mit Ausnahme der KiWi-spezifischen Englischangebote erfolgt ab<br />
31.03. ausschließlich Online.<br />
11
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Vorlesungsplan für das Semester 6<br />
6. SEMESTER – SoSe 2009<br />
08.00 –<br />
10.00<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
12.00 –<br />
14.00<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
18.00 –<br />
20.00<br />
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH<br />
-Forschungsmethoden III: Methoden<br />
der Evaluation (Pfl.),<br />
HOFMEISTER, Gr. 1, R. 1.11<br />
-Forschungsmethoden III: Methoden<br />
der Evaluation (Pfl.),<br />
HOFMEISTER, Gr. 2, R. 1.11<br />
-Kinderleben u. Umwelt:<br />
Frühförderung und frühe Hilfen,<br />
(W’Pfl.), GEENE u. WOLF-KÜHN,<br />
R. 4.001<br />
-Jean-Monnet-Modul: Unser Europa<br />
sozial?, (W.), HOFMEISTER,<br />
R. 1.11<br />
-Kinderleben u. Umwelt: Arbeitende<br />
Kinder, (W’Pfl.), HUNGERLAND,<br />
R. 2.16<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Kindheit der<br />
Zukunft – Gesundheitsförderung,<br />
(W’Pfl.), GEENE, R. 1.19<br />
-Tutorium: Kinder- u.<br />
Jugendbeteiligung - Prof. Geene,<br />
(W.), N.N., R. 0.20<br />
-Schwedisch Konversation, (W.),<br />
JANERT, R. 0.09<br />
-Vor- u. Nachbereitung der Genf-<br />
Exkursion, (W.), HUNGERLAND,<br />
14-tgl., R. 2.16, Start 06.04.<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
-Management II: Strategisches<br />
Management, (Pfl.),<br />
v. VELSEN-ZERWECK, R. 0.02<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle Entwicklungen…:<br />
(W’Pfl.):<br />
(i) Familie der Zukunft - Junge Mütter u.<br />
Kinder, HUNGERLAND, R. 1.02<br />
(ii) Familie der Zukunft – Familienfreundl. HS-<br />
Familienzimmer, HUNGERLAND, R. 1.02<br />
(iii) Kindheit der Zukunft – Kinder- u.<br />
Jugendbeteiligung, GEENE, R. 0.21<br />
(iv) Kindheit der Zukunft: Frühe Hilfen und<br />
Schreibabyarbeit, PÖRSCHKE, R. 0.09<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Schule der<br />
Zukunft, (W’Pfl.), BEER, R. 1.02<br />
-Einführung in SPSS, (W.),<br />
STRAHL, R. 2.12 (PC-Pool)<br />
-Vertiefung - Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
14.04, 21.04., 28.04., 05.05 + 1 WE,<br />
R. XXX<br />
-Begleitveranstaltung zur BA-Arbeit,<br />
(Pfl.),<br />
BROECHER, R. 0.21<br />
EGGERS, R. 0.07<br />
GEENE, R. 1.19<br />
HUNGERLAND, R. 1.20<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…: Kindheit der<br />
Zukunft - Informationskompetenzen,<br />
(W’Pfl.), EGGERS,<br />
R. 2.03 (PC-Pool)<br />
-Unternehmerisches Handeln u.<br />
Existenzgründung, (W.), MEISEL,<br />
R. 4.001<br />
-Familientherapie und Systemische<br />
Therapie:…, (W.), FRIELE, R. 0.02<br />
-Tutorium: Vertiefung der päd.<br />
Module auf E-Learning-Basis-Prof.<br />
Broecher (W.), LEMME<br />
-Methoden im professionellen Feld II: …, (Pfl.),<br />
MINGERZAHN, 14-tgl. 4-std. f. Gr. 1 bzw. Gr.<br />
2, Start: 8.04. f. Gr. 1 u. 15.04. f. Gr. 2, R. 1.20<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle Entwicklungen…:<br />
Kindheit der Zukunft – Einf. in d. Diversity<br />
Studies aus erziehungswissenschaftlicher Sicht,<br />
(W’Pfl.), EGGERS, 14-tgl. 4-std. (f. Gr. 2),<br />
Start: 08.04., R. 2.01<br />
-Praxisreflexionen u. aktuelle<br />
Entwicklungen…:(W’Pfl.)<br />
Außerschulische Angebote der Zukunft –<br />
Konzeptentwicklung auf Basis von<br />
Antragsstellung, (W’Pfl.), KNEIP, 14-tgl. 4-std.<br />
(f. Gr. 1), Start: 15.04., R. 4005<br />
-Planung u. Diskussion v. qualitativen<br />
Forschungsarbeiten/-projekten zu<br />
entwicklungspsych. Themen, (W.), 14-tägl. 4-std.<br />
(f. Gr. 2), MEY, Start: 08.04. (gemeinsam mit<br />
Rehas), R. 1.08<br />
s.o.<br />
GREMIENZEIT<br />
GREMIENZEIT<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 1, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v.<br />
18-20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
-Einf. in die Theorie u. Praxis der<br />
Erlebnispädagogik, (W.), SEIDEL,<br />
Gr. 2, 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1<br />
WE, Einführung (!!!) am 08.04. v.<br />
18-20 Uhr im R. 0.03, danach R. 1.20<br />
12
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
6. SEMESTER – SoSe 2009<br />
08.00 –<br />
10.00<br />
10.00 –<br />
12.00<br />
12.00 –<br />
14.00<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
16.00 –<br />
18.00<br />
DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG<br />
-Kinderleben und Architektur…,<br />
(W’Pfl.), LOHSS,<br />
14-tägl. 4-std., R. 2.01, Start 02.04.<br />
-Kinderleben und Spiel, (W’Pfl.),<br />
NICOLAUS,<br />
14-tägl. 4-std., R. 2.01, Start 09.04.<br />
-Children’s Literature-Great Britain,<br />
(W.), ZIERENBERG, R. 0.02<br />
-Kinderleben und Architektur…,<br />
(W’Pfl.), LOHSS,<br />
14-tägl. 4-std., R. 2.01, Start 02.04.<br />
-Kinderleben und Spiel, (W’Pfl.),<br />
NICOLAUS,<br />
14-tägl. 4-std., R. 2.01, Start 09.04.<br />
-Children's Literature-Russia and<br />
Scandinavia, (W.), ZIERENBERG,<br />
R. 1.20<br />
Aktualisierte Stunden- und Raumpläne siehe LSF<br />
Wahlangebote in Form von Wochenendangeboten<br />
-Sozialraumorientierung u<br />
Partizipation, (Pfl.), BRAUN,<br />
17./18.04. (R. 0.21) u. 05./06.06. (R.<br />
2.16), 10-18 Uhr<br />
-Management II: Sozial- und<br />
Personalmanagement, SPIER,<br />
15./16.05. u. 19./20.06., 10-18 Uhr,<br />
R. 0.21<br />
s. Fr.<br />
s.o. s. Fr.<br />
s.o. s. Fr.<br />
- „Ästhetische Bildung und ästhetische Erfahrung in der Praxis“ - Fortsetzungsseminar für Sem. 4 und 6,<br />
(W.), mit Prof. Dr. J. BROECHER, Termine: Fr., den 24.04 (R. 0.22), Sa., den 09.05 (R. 0.21) und Fr. u.<br />
Sa. 05.-06. 06 (R. 0.21) jeweils von 10-16 Uhr<br />
- „Musiktherapeutische Selbsterfahrung“ (W.) mit Prof. Dr. Susanne METZNER (FB SGW). Workshop<br />
am 03./04. Juli. UND 17./18. Juli. Zeit: Fr. von 14-20:30 Uhr und Sa. von 10-14 Uhr. Ort:<br />
<strong>Magdeburg</strong>/Herrenkrug, Haus 1 (FB SGW), Raum 2.69<br />
- „Lektürekurs Bourdieu: Männliche Herrschaft - als paradigmatische Form der symbolischen Gewalt“<br />
(W.) mit Prof. Dr. Maisha EGGERS. Block am 12./13. Juni (R. 2.16) + 10./11. Juli (R. 2.16), Fr 10-16<br />
Uhr u. Sa 11-17 Uhr<br />
- „Lebendige und authentische Beziehungen gestalten – Gewaltfreie Kommunikation im beruflichen und<br />
persönlichen Alltag“, (W.), mit Barbara Leitner am 08/09.05 (R. 2.16) und 26./27.06. (R. 0.09 und 0.22)<br />
jeweils von 10-18 Uhr<br />
- „Geburt und Übergang Elternschaft“ (W.) mit Ines Brock. Freitags 4-stündig von 10-14 Uhr (24. April,<br />
08. Mai, 12. Juni (weitere Termine werden direkt mit den TeilnehmerInnen vereinbart)), R. N.N.<br />
Einschreibung in die Fremdsprachenkurse mit Ausnahme der KiWi-spezifischen Englischangebote erfolgt ab<br />
31.03. ausschließlich Online.<br />
s. Fr.<br />
13
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Modulkatalog für das Semester 2<br />
TITEL DES MODULS<br />
KINDER UND KINDHEIT IM GESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT – SOZIOLOGIE II<br />
Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
2.1<br />
180h 6<br />
2. Sem. Sommersemester 1 Semester<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Kontaktzeit Selbststudium geplante<br />
1.) Kinder und Kindheit im<br />
Gruppengröße<br />
gesellschaftlichen Kontext<br />
2.) Einführung in soziologische<br />
Theorien der Sozialisation und<br />
der Kindheit<br />
4 SWS / 60h<br />
120h 35 Studierende<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden erarbeiten sich in diesem Modul – anknüpfend an die im Modul 1.2 erworbenen<br />
sozialwissenschaftlichen Grundbegrifflichkeiten – einen vertieften Zugang zu differenzierten<br />
soziologischen Konzepten von „Kind“ und „Kindheit“. Sie bekommen einen ersten Einblick in<br />
ausgewählte soziologische Theorien und reflektieren die Standpunkte und Perspektiven, welche die<br />
jeweiligen Theorien einnehmen. Sie erwerben erweiterte Kenntnisse über spezifische Lebenslagen von<br />
Kindern in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten, über die Vielfalt ihrer sozialen<br />
Beziehungsverhältnisse und der institutionellen Einbindung. Die Studierenden sollen in die Lage<br />
versetzt werden, Gesellschaft „vom Kind her“ zu denken, als Grundvoraussetzung für die spätere<br />
Übernahme anwaltlicher Tätigkeiten für Kinder.<br />
SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN:<br />
• Erfassen thematischer Grundlagen und Erschließung anwendungsbezogener Aspekte<br />
• Argumentieren über gegebene Inhalte und Erkennen von Zusammenhängen<br />
• Kompetenz kritischen und reflektierenden Denkens, Fähigkeit zu problembezogener<br />
Gruppendiskussion<br />
• Mündliche Präsentation ausgewählter Inhalte in Referatsform<br />
• Schriftliche Darstellung von Zusammenhängen in Form von Ausarbeitungen oder<br />
Hausarbeiten<br />
• Wissenschaftliche Arbeitsformen und Argumentationsweisen<br />
• Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken „vom Kind aus“<br />
• Teamarbeit, Moderieren von Seminarsitzungen<br />
3 Inhalte<br />
Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung soziologischer Theorie und Empirie in Bezug auf<br />
Kindheit. Über das Konzept der „Sozialisation“ wird ein Zugang zu ausgewählten basalen<br />
soziologischen Theorien eröffnet. Diese werden kontrastiert mit empirischen<br />
Sozialisationserfahrungen von Kindern in verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten.<br />
Daraus resultierend sollen kritische Reflexionen zur soziologischen Beschäftigung mit Kindern und<br />
Kindheit angestoßen werden. Ergänzend werden die wichtigsten Annahmen der internationalen<br />
Soziologie der Kindheit vorgestellt. Darin werden insbesondere die soziale Konstruktion(en) des<br />
gesellschaftlichen Musters Kindheit sowie die Akteursperspektive von Kindern behandelt. Kinder<br />
werden als „Experten ihrer selbst“ vorgestellt, die eine eigenständige Gestaltung ihrer Lebenswelt<br />
vornehmen (wollen) und ein Recht darauf haben, als Subjekte wahrgenommen zu werden.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar / Tutorium<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Erfolgreicher Abschluss des Moduls<br />
„Kinder und Kindheit im gesellschaftlichen Kontext – Soziologie I“<br />
14
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 mündliche Prüfung, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 6 von 97 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Es handelt sich hier um ein Pflichtmodul. Alle angebotenen Seminare sind zu besuchen. Die<br />
Prüfungsleistung für das Modul kann wahlweise in einem der beiden Seminare abgelegt werden.<br />
Jede LV kann von max. von 5 Reha-Studierenden besucht werden.<br />
15
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinder und Kindheit im gesellschaftlichen Kontext<br />
KennWork- Credits Studiensemester<br />
nummerload Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
2.1.1 90h - 2. Semester Sommersemester 1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Seminar<br />
Gr. 1: Mo 10-12 Uhr, R. 2.17<br />
Gr. 2: Mo 12-14 Uhr, R. 2.17<br />
Tutorium<br />
Mi 8-10 Uhr, R. 2.16<br />
2 SWS / 30h<br />
60h<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden sollen in der Lehrveranstaltung mit theoretischen Konzepten und empirischen<br />
Ergebnissen vertraut gemacht werden, die ihnen ein differenziertes soziologisches Verständnis<br />
von Kindern und Kindheiten ermöglichen. Sie können den gesellschaftlichen Status von Kindern<br />
in der Bezogenheit auf Erwachsene, ihre soziale Lage und die Besonderheiten der kindlichen<br />
Lebensphase im Generationenverhältnis analysieren. Vor allem erwerben sie in einem<br />
Perspektivenwechsel Kenntnisse über die soziale Konstruktion von Kindheit sowie zur<br />
Eigenständigkeit der Kinder als Akteure in ihrer Lebenswelt.<br />
Die Kenntnisse des Fachenglisch werden in der Veranstaltung vertieft<br />
3 Inhalte<br />
Die Lehrveranstaltung erfasst in einem breiten Zugang Kinder und Kindheit unter verschiedenen<br />
theoretischen Aspekten: Kinder als Individuen und als Altersgruppe, ihr Alltag und ihre sozialen<br />
Beziehungen; Kindheit als differenzielle Soziallage, institutionalisierte Lebensphase und<br />
soziokulturelles Muster. Der Schwerpunkt liegt in einer soziologischen Betrachtung von Kindheit,<br />
die einerseits das gesellschaftliche Konstrukt Kindheit, zum anderen die Kinder selbst als Akteure<br />
fokussiert. Das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Institutionen, die kindliches<br />
Alltagsleben entscheidend prägen (Familie, Schule, Arbeit u.a.) wird in seiner kulturellen und<br />
historischen Vielfalt und Ausprägung betrachtet und in seinen Auswirkungen diskutiert.<br />
Das Seminar orientiert sich schwerpunktmäßig an den Themen des englischsprachigen Lehrbuchs:<br />
„Childhoods in Contexts“ und wird durch weitere Texte sowie Filme ergänzt.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 mündliche Prüfung, benotet<br />
5 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Maybin, J. & Woodhead, M. (eds.) (2003): Childhoods in Context. Vol 2, Chichester:<br />
Wiley/Open University<br />
7 Sonstige Angaben<br />
Die Prüfungsleistung für das Modul kann wahlweise in einem der beiden Seminare abgelegt<br />
werden.<br />
Zu dieser Veranstaltung wird ein Tutorium angeboten, in dem die englischsprachigen Texte<br />
begleitet erarbeitet werden: Mittwoch von 8-10 Uhr, R. 2.16<br />
Die LV kann von max. 5 Reha-Studierenden besucht werden.<br />
16
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Einführung in soziologische Theorien der Sozialisation und der Kindheit<br />
KennWork- Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
nummerload Angebots<br />
2.1.2 90h -<br />
1 Zeit und Ort<br />
Seminar<br />
Gr. 1: Di 12-14 Uhr, R. 2.16<br />
Gr. 2: Mi 12-14 Uhr, R. 2.16<br />
Tutorium<br />
Mo 14-16 Uhr, R. 1.03<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden erwerben:<br />
2. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30h<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
60h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
• Kenntnisse über das Konzept der Sozialisation<br />
• einen Einblick in soziologische Theorien<br />
• einen Einblick in die Funktionalität des gesellschaftlichen Musters „Kindheit“<br />
• eine kritische Haltung gegenüber einem Konzept ausschließlich auf „Sozialisation“<br />
fokussierter Kindheit<br />
• Kenntnisse über die zentrale Einsichten und Annahmen der Soziologie der Kindheit<br />
3 Inhalte<br />
Die Lehreinheit vermittelt grundlegende Wissensbestände aus der Soziologie, insbes. der<br />
Sozialisationstheorie und der Kindheitssoziologie. Vorgestellt werden im ersten Teil des Seminars<br />
klassische soziologische sozialisationstheoretische Ansätze und ihre Antwort auf die Frage nach<br />
der Wirkung von Natur und Umwelt auf die Persönlichkeitsentwicklung. Theorien zum Verhältnis<br />
von Individuum und Gesellschaft steht hier im Mittelpunkt und werden durch Untersuchungen zu<br />
zentralen Instanzen (Familie, Peer Group, Kindergarten/Schule u.a.) und Dimensionen der<br />
Sozialisation (soziale Rolle, Sprache, u.a.) ergänzt. Die Standpunkte und Perspektiven, die die<br />
jeweiligen Theorien einnehmen sollen auf konkrete Probleme kindlicher Lebenswelten angewandt<br />
werden. Anschließend werden Grundfragen einer Soziologie der Kindheit mit Erkenntnissen aus<br />
den angelsächsischen Childhood Studies verbunden.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 mündliche Prüfung, benotet<br />
5 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
Verpflichtend für alle:<br />
− Baumgart, F. (Hg.) (2004). Theorien der Sozialisation. Erläuterungen, Texte,<br />
Arbeitsaufgaben. Verlag Julius Klinkhardt: Bad Heilbronn/Obb.<br />
Zusätzlich:<br />
− Hengst, H. & Zeiher, H. (Hg.) (2005): Kindheit soziologisch. Wiesbaden: VS Verlag<br />
für Sozialwissenschaften<br />
− Woodhead, M. & Montgomery, H. (eds.) (2003): Understanding Childhood. An<br />
Interdisciplinary Approach. Vol. 1, Chichester: Wiley/Open University<br />
− Zeiher, H.; Büchner, P. & Zinnecker, J. (Hg.) (1996): Kinder als Außenseiter?<br />
Umbrüche in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Kindern und Kindheit.<br />
Weinheim u.a.: Juventa.<br />
7 Sonstige Angaben<br />
Die Prüfungsleistung für das Modul kann wahlweise in einem der beiden Seminare abgelegt<br />
werden. Zu dieser Veranstaltung wird ein Tutorium angeboten. Darin werden die Theorien vorund<br />
nachbereitet sowie Hilfen für die Erstellung der Referate angeboten: Mo 14-16 Uhr, R. 1.03<br />
Die LV kann von max. 5 Reha-Studierenden besucht werden.<br />
17
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
VERHALTEN, ERLEBEN, ENTWICKLUNG: PSYCHOLOGIE II<br />
Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
2.2<br />
180h 6<br />
2. Sem. Sommersemester 1 Semester<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Kontaktzeit Selbststudium geplante<br />
1. Vertiefung der<br />
Gruppengröße<br />
Entwicklungspsychologie (Pfl.)<br />
2. Vertiefung der Allgemeinen<br />
Psychologie (W’Pfl.)<br />
3. Einführung in die<br />
Persönlichkeitspsychologie<br />
(W’Pfl.)<br />
4. Einführung in die<br />
Sozialpsychologie (W’Pfl.)<br />
4 SWS / 60h<br />
120h 35 Studierende<br />
2 Prüfungsformen<br />
• 1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 Klausur (benotetet) im Seminar „Vertiefung der<br />
Entwicklungspsychologie“<br />
• 1 Seminarbeitrag (bestanden/nicht bestanden) in einem der anderen Wahlpflichtseminare<br />
3 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ sowie eine mit „bestanden“ bewertete Prüfungsleistung<br />
4 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 6 von 97 in die Endnote ein<br />
6 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. habil. Wolfgang Maiers<br />
7 Sonstiges<br />
Dieses Modul beinhaltet insgesamt vier Veranstaltungen. Die Lehrveranstaltung „Vertiefung der<br />
Entwicklungspsychologie“ ist zu belegen und mit einer eigenständigen Prüfungsleistung<br />
abzuschließen. Unter den weiteren drei Lehrveranstaltungen ist eine zu wählen und mit einem<br />
Seminarbeitrag abzuschließen.<br />
18
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Vertiefung der Entwicklungspsychologie<br />
Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
2.2.1.<br />
90h 3 2. Semester Sommersemester 1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Do, 10-12 Uhr, Gr. 1, R. 0.22<br />
Do, 12-14 Uhr, Gr. 2, R. 0.22<br />
2 SWS / 30h<br />
60h<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden erwerben auf Basis von theoretischen Ansätzen und empirischen Studien<br />
Kenntnisse über die zentralen Entwicklungsphänomene der Präadoleszenz und Adoleszenz;<br />
zudem dienen integrierte Übungen und Gruppenarbeiten der selbstreflexiven Auseinandersetzung<br />
mit den behandelten Themen.<br />
3 Inhalte<br />
Die Transition von Kindheit zur Adoleszenz bringt eine Reihe an Änderungen und<br />
Herausforderungen mit sich, die mit sehr unterschiedlichen "Umgehensweisen" korrespondieren.<br />
Im Seminar werden – nach einer Rekapitulation von Themen aus dem letzten Semester und einer<br />
allgemeinen Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung – insbesondere die in diesen<br />
Entwicklungsabschnitten körpernahen Phänomene sowie der Wandel (in) der Sozialwelt<br />
diskutiert:<br />
Dazu gehören auf der einen Seite Fragen der veränderten (Selbst-/Fremd-) Wahrnehmung von mit<br />
der Pubertät verbundenen körperlichen Entwicklungen; darüber hinaus werden mit Blick auf<br />
Körperausdruck und Körpererleben ausgewählte Themen wie z.B. Aggressivität/Gewalt,<br />
Essstörungen, Drogengebrauch und das Erleben von chronischen Krankheiten behandelt.<br />
Dazu gehört auf der anderen Seite, da Entwicklung immer in Kontexte eingebettet ist, eine<br />
Betrachtung der sich verändernden und zu gestaltenden Sozialwelt; hier werden Themen wie<br />
Familie/Eltern-Kind-Beziehungen, Peergroups und Jugendkulturen für die Phase von Prä- bis<br />
Post-Adoleszenz besonders herausgehoben.<br />
Fluchtpunkt für alle Darlegungen und Diskussionen bieten das Konzept der<br />
Entwicklungsaufgaben und identitätstheoretische Ansätze.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 Klausur, benotet<br />
5 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Günter Mey<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
Entsprechende Kapitel aus:<br />
− Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). Entwicklungspsychologie. Weinheim: PVU.<br />
Weitere Literatur wird auf WEB-CT bereitgestellt.<br />
7 Sonstiges<br />
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung.<br />
19
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Vertiefung Allgemeine Psychologie<br />
Kennnummer Workload Credits<br />
2.2.2.<br />
90h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Gr. 1: MAIERS, R. 0.03<br />
(wöchentlich)<br />
Gr. 2: MESSING, 08./09.05. u.<br />
19./20.06., Fr 14-19 Uhr u. Sa<br />
09-16 Uhr, R. 2.01 (08./09.05)<br />
u. R. 1.20 (19./20.06)<br />
Gr. 3: KAINDL,<br />
05./06.06. u. 19./20.06., Fr 16-<br />
20 Uhr u. Sa 10-18 Uhr, R. 0.02<br />
(05./06.05.) u. R. 1.22<br />
(19./20.06.)<br />
3<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
60h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Anknüpfend an die Einführung in die Allgemeine Psychologie I, zielt die Lehreinheit darauf ab,<br />
(1.) den Überblick über wesentliche Fragestellungen, Begriffe, Theorieansätze und Befunde der<br />
empirischen allgemein-psychologischen Forschung zu vervollständigen und (2.) exemplarisch<br />
ausgewählte einzelne Themen eingehender zu behandeln und den erzielten Wissensstand der<br />
Allgemeinen Psychologie kritisch zu erörtern. Die Studierenden sollen sowohl einen Fundus<br />
gesicherter empirischer Ergebnisse und bewährter theoretischer Erklärungen erwerben als auch ein<br />
Verständnis für die Vorannahmengeleitetheit und offenen Kontroversen allgemeinpsychologischer<br />
Theoriebildung entwickeln. Die Vorlesung soll so Voraussetzungen für eigene kritisch-reflexive<br />
Aneignungen psychologischer Erkenntnisse im weiteren Studium schaffen.<br />
3 Inhalte<br />
Nach einem Überblick über die allgemeinpsychologischen Gegenstandsbereiche Motivation und<br />
Volition, Sprechen, Sprachverstehen und verzerrte Kommunikation sowie Lernen und Gedächtnis<br />
(Behalten – Erinnern – Vergessen) und einer kritischen Diskussion zentraler theoretischer<br />
Richtungen der (allgemein-) psychologischen Erforschung menschlichen Handelns sollen in<br />
Absprache mit den Teilnehmerinnen ausgewählte Themen vertieft werden. Indem insbesondere<br />
Problemstellungen, die – historisch wie aktuell – kontrovers diskutiert werden, Beachtung finden,<br />
soll dabei auch die theoretische Standpunktgebundenheit/Perspektivität allgemeinpsychologischen<br />
Wissens sich verdeutlichen.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden.<br />
5 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. habil. Wolfgang Maiers, N.N. (Lehrende WE noch nicht bekannt)<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
Allgemeine Textgrundlage:<br />
− Zimbardo, P.G. & Gerrig, R.J. (2004) Psychologie. München: Pearson.<br />
− Zimbardo, P.G. & Gerrig, R.J. (1999). Psychologie. Berlin: Springer.<br />
Eine ausführliche Literaturliste wird zu Beginn des Semesters vorgelegt<br />
7 Sonstiges<br />
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Wahlpflichtveranstaltung. Sie können aus drei<br />
Angeboten wählen.<br />
Die Lehre erfolgt in drei Gruppen gemeinsam mit den Rehas. Maximal 10 KiWi-Studierende<br />
können sich jeder Gruppe anschließen. Hinsichtlich inhaltlicher Fokussierung siehe bitte LSF.<br />
20
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Einführung in die Persönlichkeitspsychologie<br />
Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
2.2.3<br />
90h 3 2. Semester Sommersemester 1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Mi, 12-14 Uhr, R. 1.22<br />
Start 15.04.<br />
2 SWS / 30h<br />
60h<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die wichtigsten Theorien zur Erklärung,<br />
Beschreibung und Vorhersage der menschlichen Persönlichkeit. Für jede Theorie werden das<br />
zugrunde liegende Menschenbild, die zentralen Strukturen und Prozesse dargestellt sowie der<br />
Anwendungsbezug jeder Theorie untersucht. Im Rahmen der einzelnen Theorien werden<br />
außerdem die bedeutsamen Merkmale zur Charakterisierung und Unterscheidung von Menschen<br />
thematisiert. Ein weiteres Lernziel der Veranstaltung liegt in der Befähigung der Studierenden, ihr<br />
eigenes Menschenbild vor dem Hintergrund der erarbeiteten psychologisch-wissenschaftlichen<br />
Theorien zu prüfen und zu konkretisieren.<br />
3 Inhalte<br />
Die Strukturen und Prozesse der Persönlichkeit werden aus psychoanalytischer, neoanalytischer,<br />
behavioristischer, sozial-kognitiver, humanistischer und eigenschaftstheoretischer Perspektive<br />
vorgestellt und diskutiert.<br />
4 Prüfungsform<br />
1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden.<br />
5 Lehrender:<br />
Prof. Dr. Christel Salewski<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Pervin, L.A., Cervone, D. & John, O.P. (2005). Persönlichkeitstheorien. München: Reinhardt.<br />
− Salewski, C. & Renner, B. (2009). Differentielle Psychologie. München: UTB.<br />
− Weber, H. & Rammsayer, T. (Hrsg.) (2005). Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und<br />
Differentiellen Psychologie. Göttingen: Hogrefe.<br />
7 Sonstige Informationen<br />
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Wahlpflichtveranstaltung. Sie können aus drei<br />
Angeboten wählen.<br />
21
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Einführung in die Sozialpsychologie<br />
Kennnummer Workload Credits Studiensemester Häufigkeit des Dauer<br />
Angebots<br />
2.2.4<br />
90h 3 2. Semester Sommersemester 1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Do, 14-16 Uhr<br />
2 SWS / 30h<br />
60h<br />
Wahlpflicht<br />
R. 0.02<br />
2 Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Wechselwirkung von Individuum, Gruppe und<br />
Gesellschaft. Sie reflektieren über die Verhaltenswirksamkeit von Intergruppenbeziehungen, die<br />
Wirkung von Massen und Massenmedien sowie die Abhängigkeit individuellen Verhaltens und<br />
Gruppenverhaltens von makro-sozialen gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie verwenden<br />
Beispiele sozialer Interaktion und Kommunikation aus ihrer eigenen Lebenswelt und Praxis-<br />
Erfahrung zum besseren Verständnis sozialpsychologischer Theorien, lernen sozialpsychologische<br />
Experimente kennen und arbeiten Anwendungsaspekte für Praxisfelder heraus, in denen<br />
Menschen in Gruppen agieren, Gruppen beeinflussen zu versuchen und in ihrem eigenen<br />
Verhalten durch Gruppen beeinflusst werden.<br />
3 Inhalte<br />
Ausgehend von der spezifischen sozialpsychologischen Sichtweise auf den Menschen –<br />
psychische Sachverhalte als Wirkungen sozialer Bedingungen und Beziehungen,<br />
zwischenmenschliche Beziehungen als Grundlage für soziale Strukturen und Prozesse – erfolgt<br />
eine Abgrenzung des Faches zu anderen Grundlagen-Fächern der Psychologie. Es erfolgt ein<br />
Überblick über die experimentelle Orientierung und die wichtigsten theoretischen Versatzstücke<br />
des Faches. Insbesondere wird die psychologische Bedeutung von Gruppen und<br />
Interaktionsstrukturen für das Verhalten und Erleben des Individuums diskutiert. Dabei werden<br />
neben den Bedürfnissen nach sozialem Anschluss und befriedigenden Beziehungen insbesondere<br />
Prozesse des sozialen Vergleichs eigener Meinungen und Fähigkeiten mit denen anderer<br />
Gruppenmitglieder erörtert und der Stellenwert der Gruppe beim Aufbau des Selbstkonzepts<br />
sowie der Entwicklung einer sozialen und kulturellen Identität thematisiert. Die eigene<br />
Beteiligung an Integrations-Leistungen und Ausgrenzungs-Prozessen wird reflektiert.<br />
4 Prüfungsform<br />
1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden.<br />
5 Lehrender:<br />
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Forgas, J.P. (1995). Soziale Interaktion und Kommunikation. Eine Einführung in die<br />
Sozialpsychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union.<br />
− Frey, D. & Irle, M. (Hrsg.) (1998). Theorien der Sozialpsychologie. Band I: Kognitive<br />
Theorien. - Band II: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien. -Band III: Motivations-,<br />
Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien. Bern: Huber.<br />
− Keupp, H. (Hrsg.) (1998). Der Mensch als soziales Wesen. Sozialpsychologisches Denken im<br />
20. Jahrhundert. München/Zürich: Piper<br />
− Aronson, E. (1994): Sozialpsychologie. Menschliches Verhalten und gesellschaftlicher<br />
Einfluss. Heidelberg/Berlin/Oxford: Spektrum Akademischer Verlag.<br />
7 Sonstige Informationen<br />
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Wahlpflichtveranstaltung. Sie können aus drei<br />
Angeboten wählen.<br />
22
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPROZESSE AUS PÄDAGOGISCHER SICHT II<br />
Kennnnummer<br />
2.3<br />
Workload<br />
180h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. Ansätze der Frühpädagogik in<br />
Deutschland, Italien und den<br />
USA (Bröcher), (W´Pfl.)<br />
2. Produktiv Umgehen mit Lern-<br />
und Verhaltensproblemen<br />
(Bröcher), (W´Pfl.)<br />
3. Theorie und Praxis der<br />
Sozialpädagogik (Geene/Lubke),<br />
(W´Pfl.)<br />
6<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 60h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
120h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 bzw. 15<br />
Studierende<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Ziel dieses Moduls ist die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Vertiefung des im Modul<br />
"Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht I" Erarbeiteten. Im Zentrum steht das<br />
Entwickeln von Maßstäben und das Aneignen von Unterscheidungskriterien bezüglich der<br />
historisch gewordenen und gegenwärtig gesellschaftlich realisierten Erziehungs- und<br />
Bildungskonzeptionen sowie Bildungsideale, die zwischen Funktionalisierung/ Anpassung und<br />
ganzheitlicher Selbstentfaltung/Selbstbestimmung variieren können. Es soll die Fähigkeit<br />
aufgebaut werden, Bildungskonzeptionen kritisch zu evaluieren sowie eigenständige<br />
Bildungskonzeptionen im kindheitswissenschaftlichen Sinne zu entwerfen und zu entwickeln.<br />
3 Inhalte<br />
Innerhalb dieses Moduls sind eingehendere Untersuchungen von Strömungen in der Geschichte<br />
der Pädagogik unter der Fragestellung ihrer kindheitswissenschaftlichen Relevanz genauso<br />
möglich wie Schwerpunktsetzungen und tiefergehende Erarbeitungen in den<br />
kindheitswissenschaftlich relevanten Teilgebieten der Pädagogik wie Frühpädagogik,<br />
Schulpädagogik, Sonderpädagogik, Sozialpädagogik u.a. Möglich sind ebenso Vertiefungen in<br />
Spezialdisziplinen der Pädagogik wie z.B. Medienpädagogik, Sexualpädagogik, interkulturelle<br />
Pädagogik, Umweltpädagogik oder Genderpädagogik. Die exemplarisch vorgenommenen<br />
Vertiefungen sollen stets in Zusammenhang mit kindheitswissenschaftlich relevanten Leitmotiven,<br />
etwa dem aktiven und selbstreflexiven Handeln von Kindern und Jugendlichen oder dem<br />
Anspruch, angemessene Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen, gesehen und diskutiert<br />
werden.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar und Übung<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Abschluss des Moduls „Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht I“<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat oder 1 Klausur, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 6 von 97 in die Endnote ein.<br />
23
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Sie können unter drei verschiedene Seminare auswählen. Die Lehrinhalte werden in jeweiligen<br />
Lehrforschungsprojekten bzw. einem Tutorium vertieft. Der Abschluss dieses Moduls umfasst 4<br />
SWS.<br />
Wenn Sie sich für das Seminar „Theorie und Praxis der Sozialpädagogik“ entscheiden, müssen Sie<br />
eines von den beiden angebotenen Tutorien ebenfalls besuchen.<br />
Wenn Sie sich für die Thematiken entscheiden, die Herr Bröcher anbietet, haben Sie die<br />
Möglichkeit entweder (i) ein Seminar plus das dazugehörige Lehrforschungsprojekt oder (ii) beide<br />
Seminare (ohne Lehrforschungsprojekt) zu besuchen.<br />
24
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Ansätze der Frühpädagogik in Deutschland, Italien und den USA<br />
Kenn- Workload Credits Studien- Häufigkeit des<br />
nummersemester<br />
Angebots<br />
2.3.1 180h<br />
6 2. Semester Sommersemester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium<br />
Do, 10-12 Uhr (Seminar), R. 2.16 4 SWS / 60h 120h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2<br />
Do, 12-14 Uhr (Lehrforschungsprojekt/Übung),<br />
R. 2.08 (PC-Pool)<br />
Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Es sollen führende Handlungsansätze der Frühpädagogik aus Deutschland, Italien und den USA<br />
erarbeitet werden, dies zum einen mit Blick auf die geplanten internationalen Kooperationen<br />
zwischen den <strong>Stendal</strong>er Kindheitswissenschaften und <strong>Hochschule</strong>n in Italien und USA sowie im<br />
Hinblick auf eine mögliche Beratungstätigkeit seitens Angewandter<br />
Kindheitswissenschaftler/innen an Kindertagesstätten und Familienzentren. Das Seminar gibt<br />
Überblick. Im Rahmen der Übung soll zum einen recherchiert, zum anderen angewendet werden,<br />
im internationalen Feld und im Rahmen eines Praxisforschungsprojektes mit einer integrativen<br />
Kindertagesstätte bzw. einem Familienzentrum der AWO.<br />
3 Inhalte<br />
• der situationsorientierte Ansatz (Deutschland), Reggio-Pädagogik-Pädagogik (Italien),<br />
High/Scope-Pädagogik (USA) u.a.m.<br />
• Recherchen bezüglich frühpädagogischer Studiengänge an möglichen Partneruniversitäten<br />
in USA und Italien, ggf. Erfahrungsaustausch mit Studierenden dort via E-Learning/<br />
Weblog<br />
• Vorbereitung von Auslandsemestern in frühpädagogischen Studiengängen in USA und/<br />
oder Italien<br />
• Erfahrungsaustausch/ Praxisforschungsprojekt mit der frühpädagogischen Praxis<br />
(AWO-Familienzentrum, integrative Kindertagesstätte, auf E-Learning-Basis)<br />
4 Prüfungsformen<br />
Lerntagebuch auf E-Learning-Basis und Kurz-Referat/ Durchführung einer aktivierenden<br />
Seminarübung (benotet)<br />
5 Arbeitsformen<br />
Erarbeitung von Texten im Selbststudium, Gruppenarbeit, Kurz-Präsentationen, aktivierende<br />
Übungen, E-Learning, Prozessreflexionen, Internetrecherchen, Praxisforschung, Praxisstudien<br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Fthenakis, W.E. & M.R.Textor: Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Beltz Verlag,<br />
Weinheim & Basel 2000 (= Basis-Studien-Text, s. Infos zur Textbeschaffung unter Bröcher-<br />
Scripte)<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Die Teilnehmerzahl bei dem Lehrforschungsprojekt ist begrenzt auf 15. Es sollte möglichst von<br />
Studierenden besucht werden, die ein Auslandssemester in einem frühpädagogischen Studiengang<br />
in USA oder Italien in Betracht ziehen.<br />
Es wird gebeten, sich per E-Mail bei Prof. Dr. Bröcher zu dieser Übung anzumelden.<br />
Falls Sie an diesem Lehrforschungsprojekt nicht teilnehmen, besuchen Sie bitte das ebenfalls von<br />
Herrn Bröcher angebotene Seminar „Produktiv Umgehen mit Lern- und Verhaltensproblemen“<br />
(Mi von 10-12 Uhr, R. 2.17).<br />
Am Seminar können maximal 5 Studierende aus dem Reha-Studiengang teilnehmen.<br />
25
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Produktiv Umgehen mit Lern- und Verhaltensproblemen<br />
Kenn- Workload Credits Studien- Häufigkeit des<br />
nummersemester<br />
Angebots<br />
2.3.2 180h<br />
6 2. Semester Sommersemester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium<br />
Mi, 10-12 Uhr (Seminar), R. 2.17 4 SWS / 60h 120h<br />
Di, 10-12 Uhr<br />
(Lehrforschungsprojekt/Übung:<br />
„Individuelle Förderung aus<br />
sonderpädagogischer Sicht“), R. 2.16<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Es sollen wesentliche Komponenten der Entstehung von Lern- und Verhaltensproblemen in ihrer<br />
Komplexität nachvollzogen und Ansatzpunkte für Veränderung durch pädagogische<br />
Interventionen herausgearbeitet werden, dies auch mit Blick auf eine mögliche Beratungstätigkeit<br />
seitens Angewandter Kindheitswissenschaftler/innen an Schulen. Das Seminar gibt Überblick, im<br />
Rahmen der Übung soll angewendet werden, an der Sekundarschule Comenius in <strong>Stendal</strong>-<br />
Stadtsee und auf dem SkyLight-Campus in NRW.<br />
3 Inhalte<br />
Immer mehr pädagogische Einrichtungen, insbesondere Schulen, stehen vor der Herausforderung,<br />
adäquat mit Lern- und Verhaltensproblemen umzugehen. Studien sprechen dafür, an dieser Stelle<br />
eine Beziehungspädagogik ins Werk zu setzen, die daran orientiert ist, die Lebenswelten der<br />
jungen Menschen verstehend zu rekonstruieren, ihre existenziellen Erfahrungen zu bearbeiten,<br />
verschüttete Lerninteressen frei zu legen, somit eine solide Basis für sachbezogenes Lernen und<br />
persönliche Weiterentwicklung zu schaffen. Die schulischen (oder vorschulischen) Lehr-Lern-<br />
Prozesse orientieren sich am Prinzip der didaktischen Variation, um den Lernenden Mitgestaltung<br />
zu ermöglichen und ihrer Heterogenität gerecht zu werden. Laterales Denken, lösungsorientiertes<br />
Arbeiten und Coaching-Techniken werden einbezogen. Zugleich werden die Koordinaten für<br />
grundlegende Veränderungsprozesse in der pädagogischen Wirklichkeit entworfen. Die Ebenen<br />
der übergreifenden Schulkultur, des Schulklimas, der Schulprogrammarbeit sowie der<br />
Kommunikation und Kooperation mit der Welt außerhalb der Schule werden stets mitgedacht und<br />
etwa im Rahmen einer „Lerngeschichte“ bearbeitet. Es schließt sich die Frage an, wie sich die im<br />
Kontext Schule gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse z.B. auf frühpädagogische<br />
Arbeitsfelder übertragen lassen.<br />
4 Prüfungsformen<br />
Lerntagebuch auf E-Learning-Basis und Kurz-Referat/ Durchführung einer aktivierenden<br />
Seminarübung (benotet)<br />
5 Arbeitsformen<br />
Erarbeitung von Texten im Selbststudium, Gruppenarbeit, Kurz-Präsentationen, aktivierende<br />
Übungen, E-Learning, Prozessreflexionen, Internetrecherchen, Praxisforschung, Praxisstudien,<br />
Planen, Durchführen und Auswerten von Lernförderaktivitäten an unserer Partnerschule in<br />
<strong>Stendal</strong><br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Bröcher, J.: Anders unterrichten, anders Schule machen. Beiträge zur Schul- und<br />
Unterrichtsentwicklung im Förderschwerpunkt Lernen (und der emotionalen und sozialen<br />
Entwicklung). Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2006 (= Basis-Studientext, über den<br />
Autor zum gesponsorten Studierendenvorzugspreis von 18,00 Euro statt 36,00 Euro zu<br />
beziehen).<br />
26
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
8 Sonstige Informationen<br />
Die Teilnehmerzahl bei dem Lehrforschungsprojekt ist begrenzt auf 15. Es sollte von<br />
Studierenden belegt werden, die an praktischer Förderarbeit an der Comenius-Schule <strong>Stendal</strong>-<br />
Stadtsee oder auf dem SkyLight-Campus interessiert sind.<br />
Es wird gebeten, sich per E-Mail bei Prof. Dr. Bröcher zur Übung anzumelden.<br />
Falls Sie an diesem Lehrforschungsprojekt nicht teilnehmen, besuchen Sie bitte das ebenfalls von<br />
Prof. Dr. Bröcher angebotene Seminar „Ansätze der Frühpädagogik in Deutschland, Italien und<br />
den USA“ (Do von 10-12 Uhr, R. 2.16).<br />
Am Seminar können maximal 5 Studierende aus dem Reha-Studiengang teilnehmen.<br />
27
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Theorie und Praxis der Sozialpädagogik<br />
Kennnummer<br />
Workload Credits<br />
2.3.3 180h<br />
6<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mo, 12-14 Uhr (Seminar), R. 0.22<br />
Gr. 1: Mi, 08-10 Uhr<br />
(Tutorium/Übung), R. 0.20<br />
Gr. 2: Do, 08-10 Uhr<br />
(Tutorium/Übung), R. 0.20<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 60h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
120h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Soziale Arbeit (als Sammelbegriff von Sozialpädagogik und Sozialarbeit) gilt als eine<br />
Mutterdisziplin der Sozial- und Humanwissenschaften, wenngleich mit geringerer<br />
Ausdifferenzierung als die Pädagogik, Psychologie, Soziologie oder Politologie. Die historische<br />
Aufschlüsselung der Sozialen Arbeit und eine Reflektion der stark praxisorientierten<br />
Theoriebildung des Faches ermöglicht einen umfassenden Einblick und eine Kategorisierung der<br />
verschiedenen Disziplinen der Sozialwissenschaften und insbesondere der verschiedenen<br />
Handlungsfelder und Methoden der Sozialen Arbeit.<br />
3 Inhalte<br />
Der Einstieg erfolgt über aktuelle Fallbeispiele aus der Sozialpädagogik, hier: Sozialpädagogische<br />
Familienhilfe und Frühe Hilfen. Mittels Fallbeispielen und Referaten werden im 2. Schritt<br />
Lebenslagen, Handlungsfelder und Methoden beleuchtet. Schwerpunkte liegen dabei in den<br />
Lebenswelten insbesondere von Kindern und Jugendlichen und ihren jeweiligen kollektiven<br />
Bewältigungsstrategien, den sozialpädagogischen Möglichkeiten in der Familie (primäre<br />
Sozialisationsebene), der schulischen (sekundäre) und der außerschulischen Jugendsozialarbeit<br />
(tertiäre Sozialisationsebene).<br />
Im Sinne eines Lehrforschungsprojektes werden anschließend die drei groben Linien der<br />
Soziallagenorientierung<br />
• Sozialraumansatz,<br />
• Gemeinwesen- bzw. Community-Ansatz<br />
• Setting-Ansatz<br />
an Hand von Fallbeispielen, Recherchen und Gruppendiskussionen erarbeitet. Im Vordergrund<br />
stehen dabei kindheitsbezogene Strategien der Aktivierung und Partizipation sowie<br />
geschlechtsspezifische Ansätze für Soziale Arbeit und Gesundheitsförderung. Das Seminar endet<br />
mit der kritischen Bilanzierung von Macht und Ohnmacht des sozialpädagogischen Ansatzes.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1. Anfertigung einer Rezension; 2. Präsentation von Ergebnissen der Gruppenarbeit, abschließend<br />
mündend in 3. Hausarbeiten (Einzelanfertigung)<br />
5 Arbeitsformen<br />
Die Überblicksveranstaltung am Montag wird begleitet von zwei Tutorien am Mittwoch und<br />
Donnerstag, in denen die studienbegleitenden Arbeiten unterstützt werden: Schreiben von<br />
Buchrezensionen, Recherchearbeiten, Gruppenarbeit, Kurz-Präsentationen, aktivierende Übungen,<br />
Praxisforschung, Praxisstudien, abschl. Verfassen einer wissenschaftlichen Hausaufgabe.<br />
6 Lehrende:<br />
Prof. Dr. Raimund Geene, Melanie Lubke (KiWi-Studentin)<br />
28
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Bauer U (2005): Das Präventionsdilemma. Potenziale schulischer Kompetenzförderung im<br />
Spiegel sozialer Polarisierung. Wiesbaden: VS.<br />
− Baric C, Conrad G (2000): Der Setting-Ansatz. Gamburg: Verlag für Gesundheitsförderung.<br />
− Böhnisch, L (2005). Sozialpädagogik der Lebensalter. Weinheim: Juventa<br />
− Böhnisch L, Schröer W, Thiersch H (2005): Sozialpädagogisches Denken. Wege zu einer<br />
Neubestimmung. Weinheim: Juventa.<br />
− Budde W, Früchtel F, Hinte W (Hg) (2006): Sozialraumorientierung. Wege zu einer<br />
veränderten Praxis. Wiesbaden: VS.<br />
− Chassé KA, von Wensierski HJ (1999): Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Eine Einführung.<br />
Weinheim: Juventa<br />
− Deutsche Bundesregierung (2008), Lebenslagen in Deutschland, Der 3. Armuts- und<br />
Reichtumsbericht der Bundesregierung, BMAS: Berlin, online verfügbar unter:<br />
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/einkommen-berichte.html<br />
− Engelke E (2002): Theorien der Sozialen Arbeit. Freiburg: Lambertus.<br />
− Erler M (2000): Soziale Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch zu Geschichte, Aufgaben und<br />
Theorie. Weinheim: Juventa<br />
− Fehren Oliver (2008): Wer organisiert das Gemeinwesen? Zivilgesellschaftliche Perspektiven<br />
Sozialer Arbeit als intermediärer Instanz, Berlin Edition Sigma.<br />
− Franzkowiak P (2006): Präventive Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. München: Reinhardt<br />
− Galuske M (2007). Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim: Juventa.<br />
− Geene R, Halkow A (Hg.) (2005). Armut und Gesundheit. Frankfurt: Mabuse.<br />
− Geene R (2009): Vielfalt und Lebensstile - Herausforderungen in komplexen Lebenswelten.<br />
www.bkk-bv.de<br />
− Geene R, Gold C (Hg.) (2009): Kinderarmut und Kindergesundheit. Bern: Huber.<br />
− Grunwald K, Thiersch H (Hg.) (2004): Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit.<br />
Handlungszugänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Weinheim: Juventa.<br />
− Helfrich H, Dakhin A, Hölter E, Arzhenovskiy (Hg.) Impact of Culture on Human<br />
Interaction: Clash od Challange? Göttingen: Hogrefe<br />
− Herringer N. (1997): Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Stuttgart:<br />
Kohlhammer.<br />
− Hinte W, Treeß H (2007) : Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe : Theoretische<br />
Grundlagen, Handlungsprinzipien und Praxisbeispiele einer kooperativ-integrativen<br />
Pädagogik Basistexte Erziehungshilfen;<br />
Weinheim: Juventa.<br />
− Hinte W, Lüttringhaus M, Ollschlägel D (2007): Grundlagen und Standards der<br />
Gemeinwesenarbeit : Ein Reader zu Entwicklungslinien und Perspektiven.<br />
− Kolip P, Altgeld T (Hg.) (2006): Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und<br />
Prävention. Theoretische Grundlagen und Modell guter Praxis. Weinheim: Juventa.<br />
− Krafeld FJ (2004): Grundlagen und Methoden aufsuchender Jugendarbeit. Wiesbaden: VS.<br />
− Merchel J (2006): Sozialmanagement. Einführung in Hintergründe, Anforderung und<br />
Gestaltungsperspektiven des Managements in Einrichtungen der Sozialen Arbeit. Weinheim:<br />
Juventa.<br />
− Ministerium für Gesundheit und Soziales, Armut und Reichtum in Sachsen-Anhalt, Berlin<br />
2003, siehe: http://www.empirica-institut.de/kufa/empi075rbmtk.pdf<br />
− Mohrlock Marion, Neubauer Michaela, Neubauer Rainer, Schönfelder Walter (1993): Let's<br />
Organize!, Gemeinwesenarbeit und Community Organizing im Vergleich. München.<br />
− Obama B (2008): Why organize? Problems and Promise in the Inner City. In: Rundbrief 2,<br />
44 Jg. Verband für soziokulturelle Arbeit. Berlin<br />
− Ortmann KH, Waller, H (2000) (Hg.): Sozialmedizin in der Sozialarbeit. Forschung für die<br />
Praxis. Berlin:. VWF<br />
− Pauls, H (2004): Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer<br />
Behandlung. Weinheim: Juventa.<br />
− Richter M, Hurrelmann K (2006): Gesundheitliche Ungleichheit. Wiesbaden: VS.<br />
29
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
− Schilling, J (2005) Soziale Arbeit, Geschichte, Theorie, Profession, München, Ernst<br />
Reinhardt Verlag.<br />
− Rosenbrock R, Bellwinkel M, Schröer A (Hg.) (2004) Primärprävention im Kontext sozialer<br />
Ungleichheiten. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW.<br />
− Spiegel Hv (2004) Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. München: Ernst Reinhardt<br />
Verlag.<br />
− Stuber M (2004): Diversity. Das Potenziale von Vielfalt nutzen – den Erfolg durch Offenheit<br />
steigern. München: Luchterhand.<br />
− Zander M (Hg.) (2005). Kinderarmut. Wiesbaden: VS<br />
8 Sonstige Informationen<br />
Scheinerwerb möglich nur bei gleichzeitigem Besuch eines der beiden ergänzenden Tutorien.<br />
Zugelassen nur für max. 20 Studierende der Angewandten Kindheitswissenschaften.<br />
30
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
PRAKTISCHES STUDIENPROJEKT I<br />
Kennnummer<br />
2.5<br />
Workload<br />
210h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. Vorbereitungsgruppe 1<br />
2. Vorbereitungsgruppe 2<br />
3. Vorbereitungsgruppe 3<br />
Credits<br />
7<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
1 SWS / 15h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
35h +<br />
160h Praktikum<br />
2 Zeit und Ort<br />
Vorbereitungsgruppe 1 mit Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
Fr./Sa. 15./16.05.09 (Fr 10-18 Uhr und Sa 11-17 Uhr, Raum 1.22 (Wochenendseminar)<br />
Vorbereitungsgruppen 2 und 3 mit Prof. Dr. Raimund Geene<br />
Di 12-14 Uhr, Raum 0.20 (Gr. 2 bzw. Gr. 3 14-tgl. im Wechsel)<br />
3 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
• bekommen einen Überblick über Arbeitsfelder der Kindheitswissenschaften<br />
• lernen Praxiseinrichtungen und Praktikumsmöglichkeiten kennen<br />
• lernen eine Tätigkeitsbeschreibung in einer Institution anzufertigen<br />
• lernen einen Praktikumsbericht zu verfassen<br />
• üben Möglichkeiten der Selbsteinschätzung hinsichtlich Praktika<br />
• machen Erfahrung mit Bewerbungstraining<br />
• befassen sich mit Auswahlkriterien für ein Tätigkeitsfeld.<br />
4 Inhalte<br />
Das erste Studienprojekt ist ein Hospitationspraktikum und dient dem Kennenlernen und der<br />
ersten Orientierung in einer für die kindheitswissenschaftliche Praxis relevanten Institution.<br />
Dieses Modul besteht aus drei Hauptteilen: (i) Theoretische und praktische Vorbereitung des<br />
Praktikums (Pflicht), (ii) Exkursionen zu Praxiseinrichtungen in SDL und Umgebung sowie<br />
Vorträgen von Praxisvertretern (Pflicht, sofern im zeitlichen Rahmen der LV, ansonsten Wahl)<br />
und (iii) (mindestens) 4-wöchiges Praktikum á 40 h/Woche (Pflicht).<br />
Inhalte “Vorbereitungsgruppe 1“:<br />
Die erste Vorbereitungsgruppe findet in Form eines Wochenendseminars statt. Der Schwerpunkt<br />
liegt auf einer Erarbeitung von Personalen- und Beratungskompetenzen in den<br />
Kindheitswissenschaften. Es geht darum Kompetenzen für professionelles Handeln in<br />
Tätigkeitsfeldern der Kindheitswissenschaften im Überblick gemeinsam zu erarbeiten. Einerseits<br />
soll eine erste Orientierung in die Trägervielfalt, Auftrag von Einrichtungen, Wertvorstellungen<br />
und Profile von Praxiseinrichtungen erfolgen. Andererseits wird die Beschaffenheit von<br />
Praxisfeldern thematisiert. Zu den Inhalten gehören der Praxisschock, das Verhältnis von Theorie<br />
und Praxis und Professionalisierung in sozialen Berufen. Notwendige Schlüsselkompetenzen<br />
werden in der Auseinandersetzung mit eigenen Praxisbildern Praxisvorstellungen und<br />
Praxisfragen entwickelt. Durch die Thematisierung von Praxisproblemen (Burnout etc.)<br />
bekommen die Studierenden die Gelegenheit über Praxisqualität und Praxisreflexion zu<br />
diskutieren.<br />
(Die Teilnehmenden der ersten Vorbereitungsgruppe belegen die Teile (i) und (iii) des Moduls.<br />
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit zusätzlich – nach Absprache – an Teil (ii)<br />
teilzunehmen)<br />
31
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Inhalte „Vorbereitungsgruppen 2 und 3“:<br />
Nach der Einführung in die vorläufige Praktikumsordnung und einer allgemeinen Erarbeitung von<br />
Praktikumszielen wird gruppenbezogen am Profiling (Stärken und Schwächen) der<br />
5<br />
Modulteilnehmer/innen gearbeitet. Ergänzende Besuche von und bei Praxisanbietern und von<br />
Praktikumsberichten der 1. KiWi-Matrikel werden auf dem Hintergrund der getroffenen<br />
Zielbildung reflektiert. Schließlich werden die Teilnehmer/innen in ihrer Kontaktaufnahme mit<br />
den ausgewählten Einrichtungen unterstützt und abschließend auf ihre Praktikumstätigkeit<br />
vorbereitet.<br />
Lehrformen<br />
Übung<br />
6 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
7 Prüfungsformen<br />
1 Praxisprojektbericht, bestanden/ nicht bestanden<br />
8 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Erfolgreiche Absolvierung eines 4-wöchigen Praktikums und ein mit „bestanden“ bewerteter<br />
Praxisbericht.<br />
9 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
10 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung fließt nicht in die Endnote ein.<br />
11 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers, Prof. Dr. Raimund Geene<br />
Literatur<br />
− Keller, H., Nöhmaier, N., Praktikumsknigge, Der Leitfaden zum Berufseinstieg, München,<br />
clash 2005 (www.praktikumsknigge.de) – (dieses Buch begleitet die LV und sollte bitte<br />
angeschafft werden - für 9.95 € erhältlich im Buchhandel).<br />
− Burnout: http://www.arbeitskreis-gender-diversity.de/foerderer/index.php<br />
− Ellermann, Walter (2002): Das sozialpädagogische Praktikum, Weinheim<br />
− Püttjer, C., Schnierda, U., Bewerben um ein Praktikum, Frankfurt, Campus 2006 (tb, € 9,90)<br />
− Praktikumsberichte der 1. KiWi-Matrikel sowie von Studierenden der<br />
12<br />
Rehabilitationspsychologie, einzusehen im Praktikumsbüro bei Frau Falke (Osterburger Str.<br />
25, Raum 202).<br />
Sonstige Informationen<br />
Ein vierwöchiges praktisches Studienprojekt am Ende des 2. Semesters (siehe Studien- und<br />
Prüfungsordnung § 8)<br />
Es handelt sich hier um ein Pflichtmodul. Aus den drei Gruppen ist eine zu besuchen.<br />
32
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Modulkatalog für das Semester 4<br />
TITEL DES MODULS<br />
EINFÜHRUNG IN FORSCHUNGSMETHODEN I: EINFÜHRUNG IN DIE METHODEN<br />
DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG<br />
Kennnummer<br />
SB2/M14<br />
Workload<br />
150h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Do 8-10 Uhr (Seminar), Raum<br />
1.08<br />
Lehrtermine für Übungsgruppen<br />
siehe LSF<br />
5<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 60h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
90h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden erhalten einen exemplarischen Überblick über empirische und experimentelle<br />
Forschungsmethoden der Sozialwissenschaften. Sie werden befähigt, die methodischen Inhalte<br />
sozialwissenschaftlicher Studien zu verstehen sowie die Aussagekraft der Studien kritisch zu<br />
würdigen. Darüber hinaus lernen sie, forschungsrelevante Fragestellungen im späteren Berufsfeld<br />
zu verfolgen und in entsprechende Untersuchungsdesigns umzusetzen. Die Studierenden werden<br />
befähigt, empirische Daten auf deskriptiver Ebene zu erfassen und darzustellen. Darüber hinaus<br />
wird ihnen ein Grundverständnis wahrscheinlichkeitstheoretischer Grundlagen der Statistik in<br />
Vorbereitung auf inferenzstatistische Modelle vermittelt.<br />
Die Studierenden lernen exemplarisch die Entwicklung eines Beobachtung- oder Fragebogens und<br />
begreifen so den Zusammenhang zwischen Theorie, Hypothese und Operationalisierung. Durch<br />
die Erprobung dieser Instrumente begreifen sie die Möglichkeiten und Grenzen quantitativer<br />
Erhebung, Darstellung und Auswertung von Daten.<br />
3 Inhalte<br />
Wissenschaftstheoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Forschung, exemplarische<br />
Einführung in empirische und experimentelle Forschungsmethoden der Sozialwissenschaften. U.a.<br />
werden Feld- und Laborforschung verglichen, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher<br />
Untersuchungsdesigns erarbeitet sowie die unterschiedlichen Einsatzbedingungen und Methoden<br />
qualitativer und quantitativer Forschung. Einführung in die Theorie des Messens und der<br />
Datenerhebung, Bedeutung der Skalenniveaus für die Aussagekraft und Auswertung der<br />
gemessenen Daten. Deskriptive Auswertungs- und Darstellungsmethoden der Statistik.<br />
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie.<br />
Anhand einer kleinen Untersuchung (Beobachtung o. Befragung) erproben die Studierenden<br />
quantitative Forschungs- und Auswertungsstrategien in einem Forschungsbereich angewandter<br />
Kindheitswissenschaften.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminaristische Vorlesung mit vertiefenden Übungen<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Klausur, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung<br />
33
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 5 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Michael Kraus<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Michael Kraus, N.N.<br />
12 Studienmaterial / Literatur<br />
− Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.<br />
− Bortz, J., Döring, N. (2001). Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin: Springer.<br />
− Ebner, G., Ebner, H. (1995): Grundlagen der Statistik für Psychologen, Pädagogen und<br />
Soziologen. Frankfurt/M.: Harry Deutsch.<br />
13 Sonstige Informationen<br />
-<br />
34
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
GRUNDLAGEN DER ÖKONOMIE DES BILDUNGS- UND GESUNDHEITSWESEN<br />
Kennnummer<br />
SB3/M2<br />
Workload<br />
90h<br />
Credits<br />
1 Zeit und Ort<br />
Do, 16-18 Uhr, Gr. 1, R. 0.21<br />
Do, 18-20 Uhr, Gr. 2, R. 0.21<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Basiskenntnisse zu den Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft erwerben<br />
• Verständnis für die Angebots- und Nachfrageseite des Marktes sowie den Preismechanismus<br />
entwickeln<br />
• Staatliche Eingriffe in die Marktpreisbildung kennen lernen<br />
• Gegenstand und Methoden der Betriebswirtschaftslehre kennen lernen<br />
• Basiskenntnisse in der Gesundheitsökonomie und Bildungsökonomie erwerben<br />
3 Inhalte<br />
• Definitorische Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft<br />
• Bedürfnisse und Güter<br />
• Produktionsfaktoren<br />
• Das ökonomische Prinzip<br />
• Wirtschaftssubjekte<br />
• Produktionsfaktoren und betriebliche Funktionen<br />
• Markt und Marktmechanismus / Geld und Kapital<br />
• Die Rolle des Staates in der Wirtschaft<br />
• Nachfrage, Angebot und Marktgleichgewicht<br />
• Störungen des Gleichgewichts<br />
• Staatliche Eingriffe in die Marktpreisbildung<br />
• Grundlagen der Gesundheitsökonomie und Bildungsökonomie<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Klausur oder 1 Hausarbeit, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Jürgen Maretzki<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Helene Kneip<br />
12 Studienmaterial / Literatur:<br />
− Jean-Paul Thommen/Ann-Kristin Achleitner (1998): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2.<br />
Auflage, Gabler, Wiesbaden<br />
− Knorr/Offer (1999): Betriebswirtschaftslehre: Grundlagen für die soziale Arbeit,<br />
Luchterhand, Neuwied<br />
Weitere Literatur wird im Seminar bekanntgegeben<br />
35
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
KINDHEITSWISSENSCHAFTLICHE REFLEXIONEN II: THEMATIKEN DER<br />
KINDHEITSWISSENSCHAFTEN IM SELBSTBEZUG<br />
Kennnummer<br />
SB1/M4<br />
Workload<br />
120h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Mo, 10-14 Uhr, 14-tgl. für Gr. 1<br />
bzw. Gr. 2, R. 4001/4005<br />
4<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
90h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Es soll der eigene Studienweg reflektiert, die eigenen berufsbezogenen Interessen, Kompetenzen<br />
und Ressourcen genauer erkundet und die Weichen für eine erfolgreiche Positionierung auf dem<br />
Arbeitsmarkt bzw. ein anschließendes Master-Studium gestellt werden.<br />
3 Inhalte<br />
• Coaching-Elemente wie z.B. Ressourcenanalyse<br />
• Techniken des Selbstmanagements und der Selbstsorge<br />
• Recherchieren und Analysieren vorhandener, individuell geeigneter Master-Studiengänge<br />
bzw. Arbeitsfelder<br />
• Übungen zu Bewerbung und Vorstellungsgesprächen<br />
• Individuelle Beratung in verschiedenen Formationen<br />
4 Lehrformen<br />
Übung (Einzel-, Kleingruppen- und Großgruppenarbeit; Lernwerkstatt, E-Learning,<br />
Internetrecherchen)<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Seminarbeitrag / Beiträge auf E-Learning-Basis, bestanden/nicht bestanden<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit „bestanden“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung fließt nicht in die Endnote ein<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Doreen Beer<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher, Hertha Schnurrer (im Team – Co-Teaching)<br />
12 Literatur<br />
Wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.<br />
36
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Terminübersicht Modul<br />
Kindheitswissenschaftliche Reflexionen II: Thematiken der<br />
Kindheitswissenschaften im Selbstbezug<br />
Termin<br />
6.4.09 10-12 Uhr: Gruppe 1; 12-14 Uhr: Gruppe 2<br />
13.04.09 Ostermontag<br />
20.04.09 Gruppe 1<br />
27.04.09 E-Learning, spezielle Aufgaben in Weblogs, zur Vertiefung, keine<br />
Präsenzphase<br />
4.05.09 Gruppe 2<br />
11.05.09 Gruppe 1<br />
18.05.09 Gruppe 2<br />
25.05.09 Gruppe 1<br />
1.06.09 Pfingstmontag<br />
8.06.09 Gruppe 2<br />
15.06.09 Gruppe 1<br />
22.06.09 Gruppe 2<br />
29.06.09 Gruppe 1<br />
6.07.09 Gruppe 2<br />
13.07.09 Gruppe 1<br />
20.-31.07.09 Fertigstellung der studienbegleitenden Leistungen<br />
(= 7 fundierte Blog-Beiträge), keine Präsenz mehr<br />
37
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
KINDERLEBEN UND KINDERKULTUREN<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13<br />
Workload<br />
270h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. Kinderleben u. Spiel<br />
(Nicolaus)<br />
2. Kinderleben u. Religion<br />
(Vogel)<br />
3. Kinderleben u.<br />
Architektur, Städtebau,<br />
Verkehr (Lohss)<br />
4. Kinderleben u. Umwelt:<br />
Arbeitende Kinder<br />
(Hungerland)<br />
5. Kinderleben u. Umwelt:<br />
Begleitung u. Evaluation<br />
der 3. <strong>Stendal</strong>er Kinder-<br />
Uni (Geene)<br />
6. Kinderleben u. Umwelt:<br />
Frühförderung u. frühe<br />
Hilfen (Geene/Wolf-<br />
Kühn)<br />
9<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
6 SWS / 90h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
180h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden sollen über den bislang erhaltenen Überblick hinaus vertiefte Kenntnisse<br />
einzelner Bereiche kindlicher Lebenswelten erhalten. Nach den bislang erfolgten<br />
Überblicksveranstaltungen sollen sie nun nach Wahl spezifische Interessen vertiefen können, die<br />
zugleich die Möglichkeit bieten, sich hinsichtlich des angestrebten Berufsfelds zu spezialisieren.<br />
Die Kenntnis spezifischer Kinderkulturen ist eine Grundlage des Verständnisses von Kindern<br />
sowie der späteren Arbeit bei der Gestaltung kindlicher Lebenswelten.<br />
3 Inhalte<br />
Die Veranstaltungen fokussieren auf spezielle Bereiche kindlichen Lebens, die zuvor im Studium<br />
bereits behandelt wurden und an dieser Stelle vertieft werden sollen. Dabei sollen die<br />
Erkenntnisse neuerer kindheitswissenschaftlicher Forschung vermittelt werden, welche die<br />
Eigenwelten von Kindern zum Gegenstand haben.<br />
Dies umfasst zum einen speziell geschaffene Kulturen für Kinder sowie zum anderen Kulturen<br />
von Kindern. Ein Schwerpunkt soll dabei auf den eigenen Umgangsweisen der Kinder in ihrer<br />
Lebenswelt liegen und den ggf. daraus resultierenden spezifischen Kinderkulturen.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Referat oder 1 Hausarbeit (benotet), 1 Seminarbeitrag (bestanden/nicht bestanden)<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Es sind insgesamt drei Lehrangebote als Wahlpflichtveranstaltungen zu besuchen. Die zwei<br />
benoteten Prüfungsleistungen müssen mit mindestens „ausreichend“ und eine weitere<br />
Veranstaltung als „bestanden“ bewertet worden sein.<br />
38
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
In die Modulnote gehen die benoteten Prüfungsleistungen, somit 6 Credits (á 3) von 119 in die<br />
Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene, Prof. Dr. Beatrice Hungerland, Astrid Lohss, Claudia Nicolaus, Mirco<br />
Vogel, Prof. Dr. Nicola Wolf-Kühn<br />
12 Sonstige Informationen<br />
Das Modul setzt sich aus verschiedenen Wahlpflichtveranstaltungen zusammen. Aus diesem<br />
Angebot sind drei Veranstaltungen zu wählen. Zwei von den belegten LVs sind mit einem<br />
benoteten Referat oder einer Hausarbeit abzuschließen. Eine weitere Veranstaltung muss mit<br />
einem als „bestanden“ bewerteten Seminarbeitrag abgeschlossen werden. Die verbindliche<br />
Anmeldung für die Wahlpflichtveranstaltungen erfolgt in der dritten Woche des Semesters.<br />
Die einzelnen Lehrveranstaltungen sind im Grundsatz auch für KiWi-Studierende des zweiten<br />
Semesters geöffnet. Sie können diese vorab abschließen.<br />
Ebenso können Studierende aus dem StG Rehabilitationspsychologie diese belegen und<br />
abschließen (jeweils max. 5 Studierende in jedem Angebot).<br />
Bei hoher Nachfrage haben die Studierenden des StG KiWi aus dem vierten Semester Vorrang.<br />
39
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Spiel<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13–LE1<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
1 Zeit und Ort<br />
Do 10-14 Uhr, 14-tgl.,<br />
Start: 9. April (immer in den<br />
ungeraden Kalenderwochen)<br />
Raum 2.01<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Begriff „Spiel“ und dessen Bedeutung klären<br />
• Kenntnisse über die Spielentwicklung im Kindesalter<br />
• Spielprozesse initiieren, unterstützen und begleiten<br />
• Spielräume/Spielaktionen für Kinder zu planen<br />
• Fähigkeiten in der Rolle des Spielleiters zu erwerben<br />
3 Inhalte<br />
Spiel ist nicht irgendeine Technik, sondern vielmehr zunächst zweckfreie Tätigkeit, welche die für<br />
die Persönlichkeitsentwicklung wichtigen Prozesse der Selbstfindung unterstützt. Es durchzieht<br />
alle Bereiche, von der frühen Förderung bis zur Arbeit mit Menschen mit schwerster Behinderung.<br />
Im Seminar wird die Spielentwicklung betrachtet, die Möglichkeiten Spiel zu unterstützen und im<br />
Lebensalltag von Kindern zu begleiten, und es werden Spielräume beleuchtet. Ebenso sollen sich<br />
die Studierenden in der Rolle des Spielleiters bzw. der Spielleiterin üben.<br />
Ein Besuch des 18.Spielmarkts in Potsdam auf dem Werder am 8/9.05.2009 ist angedacht.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit o. 1 Referat, benotet bzw. 1 Seminarbeitrag, „bestanden/nicht bestanden“<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Claudia Nicolaus<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
- Scheuerl, H. 1997: Das Spiel. Band I und II. Beltz Pädagogik<br />
- Fritz, J. 1993: Theorie und Pädagogik des Spiels. Juventa Verlag<br />
- Mogel, H. 2008: Psychologie des Spiels. Springer Verlag<br />
- Behnken, I. 2006: Urbane Spiel-und Straßenwelten. Juventa Verlag<br />
- Richter, K. / Trautmann, T. 2001: Kindsein in der Mediengesellschaft. Beltz Wissenschaft<br />
- u.a.<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Die Lehrveranstaltung kann von maximal 20 Studierenden besucht werden. Sie kann auch von den<br />
KiWi-Studierenden des 2. Semesters und von max. 5 Reha-Studierenden belegt und abgeschlossen<br />
werden (siehe auch Anmerkung im Punkt 12 weiter vorne).<br />
40
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Religion<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13–LE2<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mi 10-12 Uhr, R. 1.20,<br />
(Lehre startet pünktlich um 10<br />
Uhr und endet um 11:30 Uhr)<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Übersicht über Kindheitserfahrungen und Erziehung in den drei monotheistischen Weltreligionen.<br />
3 Inhalte<br />
• Übersicht über Kindheitserfahrungen und Erziehung in den drei monotheistischen<br />
Weltreligionen, Christentum, Islam, Judentum, incl. Überblick zu wesentlichen religiösen<br />
Inhalten der drei abrahamitischen Glaubensrichtungen.<br />
• Das Gottesbild im Wandel von der Kindheit bis zur Jugend.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Referat, benotet bzw. ein Seminarbeitrag, „bestanden/nicht bestanden“<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Mirco Vogel<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Michael Wermke (Hrsg.), Aus gutem Grund: Religionsunterricht, Göttingen 2002<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Dieses Lehrangebot kann auch von den KiWi-Studierenden des 2. Semesters und von max. 5<br />
Reha-Studierenden belegt und abgeschlossen werden (siehe auch Anmerkung im Punkt 12 weiter<br />
vorne).<br />
41
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Architektur, Städtebau und Verkehr<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13–LE3<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
1 Zeit und Ort<br />
Do 10-14 Uhr, 14-tgl.,<br />
Start: 2. April (immer in den<br />
geraden Kalenderwochen)<br />
R. 2.01<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Die Studierenden lernen Institutionen der Architekturvermittlung bzw. Einrichtungen für<br />
Kinder und Architekturvermittlungsprojekte für Kinder kennen.<br />
• Grundkenntnisse kindheitsrelevanter Inhalte aus den Bereichen Architektur, Städtebau<br />
und Verkehr werden vermittelt, wobei ästhetische, historische, ökologische, soziologische<br />
und konstruktiv-technische Aspekte von gebauter und geplanter Umwelt<br />
•<br />
Berücksichtigung finden sollen.<br />
Erfahrungen des eigenen Lebensumfeldes werden reflektiert und mit dem Lebensräumen<br />
von Kindern heute in Bezug gesetzt.<br />
• Die Studierenden sollen befähigt werden, didaktisch angemessen ein<br />
3<br />
Architekturvermittlungsprojekt für Kinder zu konzipieren, das konstruktivistische<br />
Lernmodelle berücksichtigt und Grundlagen der Wahrnehmungspsychologie einfließen<br />
lässt.<br />
Inhalte<br />
Anfangspunkt des Seminars ist ein schwedisches Sprichwort, zitiert auf der Website des<br />
Bundesministeriums für Forschung und Bildung http://www.ganztagsschulen.org/563.php: „Ein<br />
Kind hat drei Lehrer: Der erste Lehrer sind die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist der Lehrer.<br />
Der dritte Lehrer ist der Raum.“<br />
Die Annäherung an den „dritten Lehrer“, den Raum erfolgt auf theoretischer Ebene anhand von<br />
Literatur, Internetrecherche und Präsentationen. Es werden ausgewählte Einrichtungen für Kinder,<br />
Institutionen der Architekturvermittlung und Praxisprojekte betrachtet und analysiert. Die<br />
theoretische Erarbeitung von relevanten Inhalten wird durch Architekturspaziergänge in <strong>Stendal</strong><br />
ergänzt. Hier lernen die Studierenden unterschiedliche Methoden des „Stadtlesens“ kennen und<br />
untersuchen sie auf ihre Anwendbarkeit für die Zielgruppe Kinder.<br />
Im zweiten Teil des Seminars werden auf Basis der im ersten Teil des Seminars erworbenen<br />
Grundkenntnisse in Gruppen eigene Ideen zur Konzeption von Architekturvermittlungsprojekten<br />
für Kinder unter Berücksichtigung von Erkenntnissen kindheitswissenschaftlicher Forschung zur<br />
Raumwahrnehmung diskutiert und ausgearbeitet.<br />
Geplant ist eine Exkursion in eine Einrichtung oder eine Architekturvermittlungsinstitution für<br />
Kinder.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat, benotet bzw. 1 Seminarbeitrag, „bestanden/nicht bestanden“<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Dipl. Ing. Astrid Lohss, Architekturvermittlung M.Sc.<br />
42
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Baukultur und Schule e.V. (Hg.): Überall Architektur. Schülerprojekte zur Berliner<br />
Baukultur. Berlin 2007<br />
− Reicher/Edelhoff/Kataikko/Uttke/LBS-Initiative Junge Familien (Hg.): KINDER_SICHTEN.<br />
Bildungsverlag EINS. Troisdorf 2006<br />
− Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.<br />
München/ Hanser. Wien 2003<br />
− Rambow, Riklef: Experten-Laien-Kommunikation in der Architektur. Waxmann. Münster/<br />
New York/ München/ Berlin 2000<br />
− Goldstein, Bruce E.: Wahrnehmungspsychologie: Eine Einführung. Spektrum Akademischer<br />
Verlag. Heidelberg, Berlin, Oxford 2002<br />
− Boon/Bergkemper/Bednar: Augen auf! Wir entdecken Hamburg. Stadtbegleiter für Klein und<br />
Groß. Boyens. Hamburg 2006<br />
− Kleines Wörterbuch der Architektur. Reclam. Stuttgart 2006<br />
− Koepf/Binding: Bildwörterbuch der Architektur. Kröner. Stuttgart 2004<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Dieses Lehrangebot kann auch von den KiWi-Studierenden des 2. Semesters und von max. 5<br />
Reha-Studierenden belegt und abgeschlossen werden (siehe auch Anmerkung im Punkt 12 weiter<br />
vorne).<br />
43
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Umwelt: Arbeitende Kinder<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13–LE4<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
1 Zeit und Ort<br />
Selbststudium<br />
Mo 16-18 Uhr, R. 2.16<br />
60 h<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Differenzierte Wahrnehmung von Arbeit als Verhinderung von bzw. Möglichkeit für<br />
gesellschaftliche Partizipation von Kindern<br />
• Einblick in internationale Kindheiten und Kinderkulturen<br />
• Möglichkeiten der Unterstützung arbeitender Kinder<br />
• Vertiefte Kenntnis über außerschulische Lernprozesse<br />
• Auseinandersetzung mit Vorstellungen von Kindheit und Erwachsensein<br />
3 Inhalte<br />
Nach Schätzungen der ILO (International Labour Organisation) arbeiten weltweit 317 Millionen<br />
Kinder zwischen 5 und 17 Jahren. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand, denn ein Großteil der<br />
Arbeit von Kindern findet im Verborgenen statt. Vor allem im Süden und in Osteuropa ist Armut<br />
das zentrale Motiv für Kinder zu arbeiten, doch dies ist nicht der ausschließliche Grund: vielen<br />
Kindern ist es wichtig, ein eigenes Einkommen zu haben und dadurch nicht abhängig zu sein. Und<br />
auch im Norden jobben Kinder, um sich selbstständig und unabhängig eigene Wünsche erfüllen<br />
zu können. Arbeit von Kindern wird zumeist im Gegensatz zu Bildung diskutiert. Aber unter<br />
bestimmten Bedingungen kann Arbeit die Aneignung von Kompetenzen ermöglichen oder durch<br />
das eigene Einkommen den Besuch einer Schule erst ermöglichen. Das Seminar befasst sich<br />
differenziert mit den verschiedenen Formen kindlicher Arbeit. Es gibt darüber hinaus Einblick in<br />
die Aktivitäten der Bewegungen arbeitender Kinder in Lateinamerika, Asien und Afrika und ihre<br />
Bemühungen um würdige Arbeit als Chance für gesellschaftliche Partizipation.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat, benotet bzw. 1 Seminarbeitrag, „bestanden/nicht bestanden“<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Hengst, H. & Zeiher, H. (Hg.) (2000): Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und<br />
Arbeitsteilung zwischen den Generationen. Juventa, Weinheim & München<br />
− Hungerland, B., Liebel, M., Milne, B., Wihstutz, A. (Hg.) (2007): Working to Be Someone.<br />
Child Focused Research and Practice with Working Children. Jessica Kingsley Publishers,<br />
London, New York<br />
− Liebel, M. (2001): Kindheit und Arbeit. Wege zum besseren Verständnis arbeitender Kinder<br />
in verschiedenen Kulturen und Kontinenten. IKO Verlag, Frankfurt, London<br />
− ProNATs e.V. & CIR e.V. (Hg.) (2008): "'Wir sind nicht das Problem, sondern Teil der<br />
Lösung!' - Arbeitende Kinder zwischen Ausbeutung und Selbstbestimmung" (Broschüre wird<br />
gegen einen Unkostenbeitrag von 4,- € gestellt)<br />
Weitere Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Dieses Lehrangebot kann auch von den KiWi-Studierenden des 2. Semesters und von max. 5 Reha-<br />
Studierenden belegt und abgeschlossen werden (siehe auch Anmerkung im Punkt 12 weiter vorne).<br />
44
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Umwelt: Begleitung und Evaluation der 3. <strong>Stendal</strong>er Kinder-Uni<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13-LE5<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mi 12-14 Uhr, R. 3.01<br />
(Winkelmann)<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Begleitung der Organisation und Durchführung der 3. <strong>Stendal</strong>er Kinder-Uni<br />
• Dokumentation und Evaluation<br />
3 Inhalte<br />
Als Kooperationsveranstaltung der <strong>Hochschule</strong> mit dem Kindermuseum der Winckelmann-<br />
Gesellschaft findet im Sommersemester die 3. <strong>Stendal</strong>er Kinder-Uni statt. In dem Seminar werden<br />
die pädagogischen und kindheitswissenschaftlichen Überlegungen zur Kinder-Uni<br />
herausgearbeitet und die jeweils Samstags (25.04., 09.05., 30.05., 20.06.) von 10 bis 14 Uhr<br />
stattfindenden Veranstaltungen begleitet, dokumentiert und evaluatorisch begleitet.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit (im Nachgang) oder 1 Referat (während der Seminartermine), benotet bzw. 1<br />
Seminarbeitrag (Dokumentation und Evaluationsauswertung), „bestanden/nicht bestanden“<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
www.die-kinder-uni.de, Evaluation der 1. <strong>Stendal</strong>er Kinder-Uni<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Dieses Lehrangebot kann auch von den KiWi-Studierenden des 2. Semesters und von max. 5<br />
Reha-Studierenden belegt und abgeschlossen werden (siehe auch Anmerkung im Punkt 12 weiter<br />
vorne).<br />
45
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kinderleben und Umwelt: Frühförderung und frühe Hilfen<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13-LE6<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
Studiensemester<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Dauer<br />
3<br />
4. Semester<br />
SoSe<br />
1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Mo 14-16 Uhr, Raum 4.001<br />
2 SWS / 30 h<br />
60 h<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Kenntnisse über die pädiatrischen Kinderrichtlinien, frühkindliche Regulationsstörungen<br />
und Präventionsstrategien aus dem Bereich der Frühen Hilfen<br />
• Entwicklung und Anwendung von Methoden der qualitativen Sozialforschung<br />
• Empathische Interviewführung<br />
• Strukturanalyse der Angebote der Frühen Hilfen und der Frühförderung<br />
3 Inhalte<br />
In den vergangenen Semestern haben KiWi- und Reha-Studierende Expert/innen und junge<br />
Mütter interviewt, um verschiedene Perspektiven auf die Versorgungssituation in den ersten<br />
Lebensmonaten und –jahren zu ermitteln, insbesondere auf die Wahrnehmung der sog. ’U’-<br />
Untersuchungen. Die Ergebnisse werden in diesem Lehrforschungsseminar systematisch<br />
ausgewertet und um weitere Interviews ergänzt. Dabei geht es einerseits um die<br />
Anbieterperspektive, wobei hier insbesondere nach der Schnittstellenproblematik gefragt wird.<br />
Andererseits wird die Erforschung von Nutzerinteressen im Mittelpunkt stehen, wobei hier<br />
insbesondere innovative Ansätze der qualitativen Sozialforschung zur Anwendung kommen.<br />
Diese entwickeln die Seminarteilnehmer/innen gemeinsam und vollziehen so in kleinteiligen<br />
Schritten Aufbau und Logik eines Forschungsprojektes.<br />
Zentrales Erkenntnisinteresse ist dabei die Frage, wie die verschiedenen Angebote, Projekte und<br />
Maßnahmen systematisch an den Interessen junger Eltern ausgerichtet und besser aufeinander<br />
abgestimmt werden können.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit (für benotete Scheine nach alter Prüfungsordnung) und ein Seminarbeitrag in Form<br />
eines leitfadengestützten und transkriptierten Interviews („bestanden/nicht bestanden“)<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht bei einer benoteten Prüfungsleistung entsprechend der Creditzahl des Moduls<br />
mit 3 von 119 in die Endnote ein. Falls ein Seminarbeitrag als Prüfungsleistung gewählt wurde,<br />
fließt die Prüfungsleistung nicht in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene und Prof. Dr. Nicola Wolf-Kühn<br />
46
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
PROBLEMATIKEN KINDLICHER UND JUGENDLICHER LEBENSFÜHRUNG<br />
Kennnummer<br />
SB2/M12<br />
Workload<br />
180 h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. Drogen, Sucht,<br />
Suchtprävention<br />
2. Devianz und Delinquenz<br />
3. Erfahren von Gewalt<br />
6<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 60 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
120 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Nichtgelingende Entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist die Ausnahme. Für das junge<br />
Erwachsenen-Alter wird die Belastung mit Problemen (psychische Störungen, Suchtverhalten,<br />
Delinquenz, Sektierertum, politischer Extremismus) auf ca. 20% geschätzt. Die Studierenden<br />
sollen über frühe Gefährdungen und frühe Anzeichen solcher Probleme Kenntnisse erwerben:<br />
• Suchtgefährdung und –verhalten im Kindes- und Jugendalter;<br />
• Kinder-Delinquenz und Jugendkriminalität;<br />
• Erfahrungen mit Gewalt und sexueller Gewalt.<br />
Aus diesen Kenntnissen sollen Ableitungen für die Prävention von Suchtverhalten, Devianz und<br />
Gewalt möglich werden<br />
3 Inhalte<br />
• Entwicklungspsychologie und Suchtverhalten, Formen und Stadien von Suchtkarrieren,<br />
Ursachen süchtigen Verhaltens, Prävalenz von Suchtproblemen in der Region, Prävention und<br />
Therapie süchtigen Verhaltens;<br />
• Formen von kindl. Devianz; Anomie-Theorien; Prävalenz der K.- u. J.-Delinquenz in der<br />
Region; Prävention delinquenten Verhaltens, Philosophie und Maßnahmen des Jugendrechts;<br />
• Erscheinungsformen v. Gewalt gegen K. u. J.: physische, sexuelle, psychische Gewalt,<br />
Prävalenz von Gewalterfahrungen, Strafverfolgung und Prävention, Hilfsangebote<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
LV 1, LV2, LV3: 1 Hausarbeit oder 1 Referat, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Aus dem Veranstaltungsangebot sind zwei zu wählen. Beide Prüfungsleistungen müssen mit<br />
mindestens „ausreichend“ bewertet worden sein.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 6 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers, Dr. Boris Friele, Prof. Dr. Wolfgang Heckmann<br />
12 Sonstige Informationen<br />
Aus drei Wahlpflichtveranstaltungen sind zwei Lehrveranstaltungen auszuwählen. Das Lehrangebot steht<br />
auch Studierenden aus dem Studiengang Rehabilitationspsychologie offen (max. 5 TeilnehmerInnen in<br />
jedem Angebot).<br />
47
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Drogen/Sucht/Suchtprävention<br />
Kennnummer<br />
SB2/<br />
M12–LE1<br />
Zeit und Ort<br />
Do, 16- 18 Uhr<br />
R. 1.03<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Veranstaltung dient der Qualifizierung für die praktische Arbeit in einem der Felder der<br />
Suchtkrankenhilfe:<br />
• primäre Prävention in Vorschule/Schule und im außerschulischen Bereich<br />
• niedrigschwellige Arbeit mit Gefährdeten und Abhängigen<br />
• Beratung und Betreuung der Angehörigen von Suchtgefährdeten<br />
• Betreuung der Kinder von Suchtkranken als Therapie-Begleitung<br />
• spezielle SPFH für suchtgefährdete/-belastete Familien<br />
Inhalte<br />
• Vielfalt der Süchte: legal, illegal, nicht stoffgebunden, Manien<br />
• Ursachen-Modelle süchtigen Verhaltens<br />
• Theoretische Entwürfe I: Tiefenpsychologie, Individualpsychologie<br />
• Theoretische Entwürfe II: Existenzanalyse, Lerntheorie, Systemik<br />
• Geschlechtspezifische Aspekte: Frauen und Sucht (Gastdozentin)<br />
• Epidemiologie der Sucht in der Welt, Europa, BRD, S.-A., MD, FH...<br />
• Drogenpolitik als Teil der Jugend-, Sozial-, Sicherheitspolitik etc.<br />
• System der Suchtkrankenhilfe<br />
• Studien zur Suchtproblematik in Sachsen-Anhalt, weiterer Forschungsbedarf<br />
• Grundsatzdiskussion: Legalisierung von Drogen<br />
• Grundsatzdiskussion: Zwangstherapie<br />
• Grundsatzdiskussion: Ersatzdrogen, Originalstoff-Abgabe<br />
• Betäubungsmittelrecht<br />
Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat, benotet<br />
Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Wolfgang Heckmann<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Bartsch, N., Knigge-Illner (Hrsg.): Sucht und Erziehung. Sucht und Schule. Sucht und Jugendarbeit.<br />
(2 Bände), Weinheim und Basel 1988<br />
− Fleisch, E., Haller, R., Heckmann, W. (Hrsg.): Suchtkrankenhilfe. Lehrbuch zur Vorbeugung,<br />
Beratung und Therapie, Weinheim und Basel 1997<br />
− Heckmann, W. (Hrsg.): Drogentherapie in der Praxis, Weinheim und Basel 1991<br />
− Kaufmann, H.: Suchtprävention in der Praxis, Weinheim und Basel 1996<br />
− Kreft/Mielenz (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit, Weinheim und Basel 2007<br />
Sonstige Angaben<br />
Das Lehrangebot steht auch für 5 Studierenden aus dem Studiengang Rehabilitationspsychologie offen.<br />
48
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Devianz und Delinquenz<br />
Kennnummer<br />
SB2/<br />
M12–LE2<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 16-18 Uhr<br />
Raum 0.04<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Für Kinder und Jugendliche, die von der Normalität abweichen – die Devianten bzw.<br />
Delinquenten, hält unsere Gesellschaft ein großes Arsenal an Anpassungsmaßnahmen bereit. In der<br />
Veranstaltung sollen die TeilnehmerInnen Kenntnisse über pädagogische Konzepte im Umgang<br />
mit Kinder- und Jugenddelinquenz kennenlernen. Vor allem geht es aber darum, einen kritischen<br />
Umgang mit dem Diskurs über Norm und Abweichung, wie er in der Öffentlichkeit und in der<br />
Wissenschaft gepflegt wird, zu erlernen.<br />
3 Inhalte<br />
Themenfokus des Seminars ist die Kinder- und Jugendkriminalität, insbesondere gewalttätiges<br />
Verhalten in dieser Altersgruppe. Neben Beiträgen vom Dozenten über die Verbreitung von<br />
Kinder- und Jugendgewalt, Praxisbeispielen u.a.m. gibt es Referatsthemen u.a. zur Problematik<br />
von Verhaltensnormen bzw. dem Begriff der Abweichung, mediale Darstellung von Kindergewalt,<br />
Kriminalitätstheorien, Studien zur Erklärung von Kinder- und Jugendgewalt sowie<br />
Präventionsprojekte. Auf Wunsch der TeilnehmerInnen können auch Referate zu anderen Themen<br />
eingebracht werden.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Referat mit Thesenpapier und Diskussionsprotokoll, benotet<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Dr. Boris Friele<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
Wird in der ersten Sitzung bekannt gegeben.<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Das Lehrangebot steht auch für 5 Studierenden aus dem StG Rehabilitationspsychologie offen.<br />
49
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Erfahren von Gewalt<br />
Kennnummer<br />
SB2/<br />
M12–LE3<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Do 14-16 Uhr<br />
R. 2.16<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Kenntnisse über Gewaltbegriffe, Verständnisse von Gewalt und deren Implikationen<br />
• Erkennen von Ursachen von Gewalt in den Lebenswelten von Kindern<br />
• Kenntnisse über gesellschaftliche Zusammenhänge von Gewalt gegen Kinder<br />
• Kenntnisse über kindliche Verarbeitungsversuche von Gewalterfahrungen<br />
• Beurteilung von Interventionsmöglichkeiten und Interventionsansätzen<br />
3 Inhalte<br />
Die Veranstaltung bietet einen Überblick über verschiedene Gewalterfahrungen, denen Kinder<br />
ausgesetzt sein können: sexualisierte Gewalt, körperliche und seelische Misshandlung,<br />
Vernachlässigung innerhalb und außerhalb der Familie, aber auch Mobbing und Peer-Gewalt<br />
werden aufgezeigt und diskutiert. Verschiedene Erklärungsmodelle der Gewalt gegen Kinder und<br />
Gewalt in den Lebenswelten von Kindern werden ebenso behandelt wie der<br />
gesamtgesellschaftliche Kontext und Einbettung von Gewalthandlungen. Es werden jeweils<br />
Interventionsmöglichkeiten, Ansätze und Vorbeugungsmaßnahmen vorgestellt und besprochen.<br />
Im Fokus stehen kindliche Verarbeitungsformen von Gewalterfahrungen. Dabei gilt es<br />
insbesondere die Rolle von Erziehungsformen in einer Erziehung zur (Nicht-) Wahrnehmung von<br />
Gewalt zu reflektieren. Die Frage wie Gewalt thematisierbar gemacht werden kann ohne Kinder<br />
zu überfordern wird als ein zentrales Anliegen formuliert.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Hausarbeit oder 1 Referat, benotet<br />
5 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
6 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
7 Studienmaterial/Literatur<br />
− Brockhaus Ulrike und Kolshorn, Maren (2005): Die Ursachen sexueller Gewalt. In: Gabriele<br />
Amann und Rudolf Wipplinger (Hrsg.) Sexueller Missbrauch: Überblick zu Forschung,<br />
Beratung und Therapie. Ein Handbuch, DGVT, Tübingen<br />
− Meuser, Michael (2003): Gewalt als Modus von Distinktion und Vergemeinschaftung. Zur<br />
ordnungsbildenden Funktion männlicher Gewalt. In: Siegfried Lamnek, Manuela Boatca<br />
(Hrsg.) Geschlecht, Gewalt, Gesellschaft, Opladen.<br />
− Ott, Cornelia (2000): Zum Verhältnis von Geschlecht und Sexualität unter<br />
machttheoretischen Gesichtspunkten. In: Christiane Schmerl, Stefanie Soine, Marlene Stein-<br />
Hilbers und Birgitta Wrede (Hrsg.) Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und<br />
Sexualität in modernen Gesellschaften, Opladen<br />
− Purchert, Ralf und Jungnitz, Ludger (2005) Gewalt gegen Männer: Die verborgene Seite der<br />
Geschlechterhierarchien. In: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Heft<br />
4/2005, Bielefeld<br />
− Ziegler, Franz (1990): Kinder als Opfer von Gewalt. Ursachen und<br />
Interventionsmöglichkeiten. Verlag Franz Huber, Freiburg, Schweiz<br />
8 Sonstige Angaben<br />
Das Lehrangebot steht auch für 5 Studierenden aus dem Studiengang Rehabilitationspsychologie<br />
offen.<br />
50
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
SEXUALITÄT IM KINDES- UND JUGENDALTER<br />
Kennnummer<br />
SB2/M11<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Di, 10-12 Uhr (Gr. 1)<br />
Di, 12-14 Uhr (Gr. 2)<br />
R. 3.02 (Winkelmannstr.)<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Grundlagen der psychischen und biologischen Grundlagen von kindlicher und jugendlicher<br />
Sexualität. Wir unterstützen die Fähigkeiten von Familien, professionell Erziehenden und<br />
Lehrer_innen, angemessen mit Kindern und Jugendlichen über Sexualität zu sprechen. Wir proben<br />
Moderationstechniken für Kommunikationstrainings zum Thema.<br />
3 Inhalte<br />
Den Studierenden werden eingangs Kenntnis über die psychische und biologische<br />
Entwicklungsgeschichte kindlicher Sexualität vermittelt. Dazu zählen auch schwierige und<br />
krisenhafte Entwicklungen. (Benjamin/Chodorow/Freud, Bindung, primäre und sekundäre<br />
Geschlechtsmerkmale, sexualisierte Gewalt)<br />
Die zweite Hälfte des Kurses wird durch das Erlernen der Kommunikation über Sexualität, ggfs.<br />
auch die eigene gefüllt. Dabei stehen die Hauptfragen Kinder und Jugendlicher im Vordergrund<br />
(Sexarbeit, AIDS, Poly-, Bi-, Hetero- und Homosexualität, Teenageschwangerschaften).<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit „bestanden“ bewertete Prüfungsleistung<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung fließt nicht in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
51
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
12 Studienmaterial/Literatur<br />
− Benjamin, Jessica (1990): Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das<br />
Problem der Macht, Basel<br />
− Chodorow, Nancy (1985): Das Erbe der Mütter: Psychoanalyse und Soziologie der<br />
Geschlechter, München<br />
− Lautmann, Rüdiger (1985): Sexualität als Politikfeld. In: Wulf, Christoph (Hrsg.) Lust und<br />
Liebe: Wandlungen der Sexualität, München/Zürich<br />
− Lerner, Harriet Goldhor: Was Frauen verschweigen. Warum wir täuschen, heucheln, lügen<br />
müssen. Zürich 1993<br />
− Wrede, Birgitta (2000): Was ist Sexualität? Sexualität als Natur, als Kultur und als<br />
Diskursprodukt. In: Christiane Schmerl, Stefanie Soine, Marlene Stein-Hilbers und Birgitta<br />
Wrede (Hrsg.) Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen<br />
Gesellschaften, Opladen<br />
− Timmermanns, Stefan/Tuider, Elisabeth (2008): Sexualpädagogik der Vielfalt.<br />
Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und<br />
Jugendarbeit, Weinheim<br />
− Zimmermann, Susanne (1999): Sexualpädagogik in der BRD und in der DDR im Vergleich,<br />
Gießen<br />
− Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Sexualerziehung, die ankommt. Ein<br />
Leitfaden für Schule und außerschulische Jugendarbeit zur Sexualerziehung von Mädchen<br />
und Jungen in 3. – 6. Klassen. Reihe: Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und<br />
Familienplanung, Bd. 15, (Autor_innen: Milhoffer, Gluszczynski, Krettmann), Köln 1999:<br />
http://www.sexualaufklaerung.de/cgi-sub/fetch.php?id=434<br />
13 Sonstige Informationen<br />
Das Lehrangebot steht auch 5 Studierenden aus dem Studiengang Rehabilitationspsychologie<br />
offen.<br />
52
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Modulkatalog für das Semester 6<br />
TITEL DES MODULS<br />
MANAGEMENT AUF KINDHEITSWISSENSCHAFTLICH RELEVANTEN<br />
ARBEITSFELDERN II<br />
Kennnummer<br />
SB1/M6<br />
Workload<br />
120 h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. Strategisches Management<br />
(Prof. Dr. Burkhard v. Velsen)<br />
2. Sozialmanagement für<br />
Kindertagesstätten:<br />
Organisations- und<br />
Personalentwicklung<br />
(Sven Spier)<br />
4<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 60 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
2 Zeit und Ort<br />
Strategisches Management<br />
• Di 08-10 Uhr, Raum 0.02<br />
Sozialmanagement für Kindertagesstätten: Organisations- und Personalentwicklung<br />
• 2 WE-Termine: 15./16.05. u. 19./20.06., 10-18 Uhr, Raum 0.21<br />
3 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
LV „Strategisches Management“:<br />
Folgende Fähigkeiten und Kenntnisse soll der Studierende erlangen:<br />
• Notwendigkeit strategischen Denkens und Handelns erkennen<br />
• Zentrale Begriffe des strategischen Managements erklären<br />
• Instrumente der strategischen Situationsanalyse anwenden<br />
• Funktionen und Grenzen von Leitbildern erklären und kritisch anwenden<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
LV „Sozialmanagement für Kindertagesstätten: Organisations- und Personalentwicklung“<br />
Folgende Fähigkeiten und Kenntnisse soll der Studierende erlangen:<br />
• Organisations- und Personalentwicklung sollen in das Gefüge des Sozialmanagements<br />
eingeordnet werden können.<br />
• Grundlegenden Begriffe, Methoden und Zielsetzungen der Organisations- und<br />
•<br />
Personalentwicklung sollen erlernt und anhand von Beispielen angewandt werden<br />
Verschiedene Ansätze, Umsetzungsformen und Instrumente der Organisations- und<br />
Personalentwicklung werden vorgestellt, diskutiert und kritisch auf ihre Anwendbarkeit im<br />
Bereich der Kindertagesstätten hin analysiert<br />
4 Inhalte<br />
LV „Strategisches Management“:<br />
Strategisches Management wird oft als „Königsdisziplin“ der Betriebswirtschaftslehre angesehen.<br />
Die Vorlesung enthält eine Übersicht des strategischen Managements mit dem Ziel, ausgewählte<br />
Praxisprobleme des strategischen Managements systematisch zu entwickeln und mit aktuellen<br />
Beispielen aus der Praxis darzustellen.<br />
Themen:<br />
• Grundlagen (Begriffe, Geschichte, strategischer Planungsprozess, Beispiele)<br />
• Situationsanalyse (SWOT-, Stakeholder- und Wettbewerbsanalyse, Beispiele)<br />
53
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
• Leitbild (Leitidee, Leitlinien, Leitspruch, Beispiele, Case Study)<br />
• Gesamtunternehmensstrategie (Wertketten-Analyse, Kostenführerschaft, Qualitätsstrategie,<br />
Differenzierung, No-Frills-Strategie, Beispiele)<br />
LV „Sozialmanagement für Kindertagesstätten: Organisations- und Personalentwicklung“<br />
Kindertagesstätten und deren Träger finden sich zunehmend in einem Marktgeschehen wieder:<br />
Immer neue Anbieter suchen ihre Nischen, höhere Anforderungen an die Arbeit werden von allen<br />
Seiten gestellt und letztlich soll und die Arbeit wirtschaftlich erbracht werden. In diesem Seminar<br />
sollen die theoretischen Konzepte und das praktische Handwerkszeug vermittelt werden, um mit<br />
einer zeitgemäßen Organisations- und Personalentwicklung diesen Anforderungen zu begegnen,<br />
bzw. sogar auf kommende vorbereitet zu sein.<br />
5 Lehrformen<br />
Seminaristische Vorlesungen<br />
6 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Module „Grundlagen der Ökonomie des Bildungs- und Gesundheitswesens“ und „Management I“<br />
sollten abgeschlossen sein.<br />
7 Prüfungsformen<br />
1 Klausur oder 1 Referat, benotet<br />
8 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
9 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
10 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 4 von 119 in die Endnote ein.<br />
11 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Burkhard von Velsen<br />
12 Lehrende/r<br />
Sven Spier, Prof. Dr. Burkhard von Velsen<br />
13 Literatur<br />
LV „Strategisches Management“<br />
Basislektüre:<br />
− Bea/Haas: Strategisches Management. 4.A. ISBN: 978-3-8252-1458-6<br />
Weitere empfohlene Lektüre:<br />
− Bieger: Dienstleistungsmanagement. 4.A., insb. 4.-5. Kap. Haupt.<br />
− Elbling/Kreuzer: Handbuch der strategischen Instrumente. Ueberreuther.<br />
− Eschenbach/Kunesch: Strategische Konzepte. Schäffer-Poeschel.<br />
− Hungenberg/Meffert: Handbuch Strategisches Management. Gabler.<br />
− Simon: Das große Handbuch der Strategiekonzepte. Campus.<br />
− Thommen/Achtleitner: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 4.A., insb. 3. Kap. Gabler.<br />
„Sozialmanagement für Kindertagesstätten: Organisations- und Personalentwicklung“<br />
Basislektüre:<br />
− Moos/Peters: BWL für soziale Berufe – Eine Einführung, UTB Stuttgart, 2008<br />
Weitere Literatur wird durch den Dozenten benannt.<br />
14 Sonstige Informationen<br />
Es handelt sich hier um ein Pflichtmodul. Alle angebotenen Lehrveranstaltungen und -termine<br />
sind zu besuchen.<br />
54
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
FORSCHUNGSMETHODEN III: METHODEN DER EVALUATION<br />
Kennnummer<br />
SB12/M17<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mo 10-12, Gruppe 1<br />
Mo 12-14, Gruppe 2<br />
R. 1.11<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Kenntnisse der Vielfalt epidemiologischer und sozialwissenschaftlicher<br />
Forschungsmethoden in ihrer Anwendung in der Evaluation<br />
• Anwendung dieser Kenntnisse auf spezifische kindheitswissenschaftliche<br />
Fragestellungen, auch im Hinblick auf die Bachelorarbeit;<br />
• Erkennen eines Studiendesigns und die Fähigkeit geeignete Designs für vorgegebene<br />
Fragestellungen entwickeln<br />
• Kritische Reflektion der Möglichkeiten und Grenzen von Evaluation<br />
3 Inhalte<br />
• Wiederholung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden<br />
• Evaluationsdesigns<br />
• Perspektiven der Evaluation (ökonomische, experimentelle, entwicklungsorientierte und<br />
managementorientierte<br />
• Planung und Durchführung von Evaluationen<br />
• Einsatzgebiete kindheitswissenschaftlicher Evaluation (Evaluation von Policies,<br />
Organisationen; Programmen, Projekten und Maßnahmen<br />
• Strategien partizipativer Evaluation<br />
• Auseinandersetzungen mit Evidenzklassen<br />
4 Lehrform<br />
Übung<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Abschluss der Module des 1.-4. Semesters<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Klausur, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene<br />
11 Lehrende/r<br />
Dr. Arnd Hofmeister<br />
12 Literatur<br />
− Flick, U. (2006):Qualitative Evaluationsforschung: Konzepte- Methoden- Umsetzungen:<br />
Reinbek: rowohlt.<br />
− Övretveit, J. (2002): Evaluation gesundheitsbezogener Interventionen. Bern: Huber.<br />
− Wottawa, H., Thierau, H. (1990): Evaluation. Lehrbuch. Bern: Huber<br />
55
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
METHODEN IM PROFESSIONELLEN FELD II. ZUSAMMENARBEIT MIT<br />
FAMILIEN UND PROFESSIONELLEN INSTANZEN<br />
Kennnummer<br />
SB4/M6<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Mi 10-14 Uhr, R. 1.20<br />
Credits<br />
14-tgl. Gruppe 1 bzw. Gruppe 2<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Da Beratung als personenbezogene Dienstleistung, die subjekt-, aufgaben- und kontextbezogen<br />
ist, verstanden wird, müssen die professionellen Akteure Anliegen (z.B. psychosoziale,<br />
gemeinwesenorientierte, gesundheitsbezogene, bildungsbezogene, sozialpädagogische), Settings<br />
(Beratung, Coaching, Mediation) und Adressaten (Einzelpersonen, Gruppen und Familien)<br />
beachten. Die Studierenden lernen zwischen den verschiedenen Konzepten zu differenzieren.<br />
Die Begleitung von Familien erfordert Können bei der Bearbeitung konkreter Krisen und<br />
Belastungssituationen. Je nach Tätigkeitsfeld können Situationen besser beurteilt und bewertet<br />
werden. Im Umgang mit diesen Schlüsselkompetenzen wird Sicherheit erworben.<br />
Es werden Katagorien wie Vertrauen und Datenschutz, Wert- und Zielorientierung,<br />
Qualitätssicherung und Evaluation eingeführt bzw. vertieft.<br />
Funktionen beratungsübergreifender Angebote, Anlässe und Problemkonstellationen bei Klienten<br />
werden vermittelt, wobei das Konzept der Kundenorientierung einbezogen wird.<br />
Die Studierenden werden vertraut mit fallspezifischer Kooperation und Koordination von<br />
Einrichtungen der Familienhilfe (z.B. Helferkonferenzen). Dabei wird unterschieden zwischen<br />
Informieren, Empfehlen und Vermitteln. Sowohl personen- als auch sachbezogene Kompetenzen<br />
sind bei der Zusammenarbeit mit Familien notwendig. Die Studierenden lernen die systematische<br />
Zusammenführung diagnostischer, theoretischer und handlungsorientierter Kernkompetenzen und<br />
deren konkrete Anwendung.<br />
Die Regeln fachlichen Könnens für die institutionelle Familienhilfe sind an personale Offenheit,<br />
reflektiertes Engagement bei der Arbeit, eine selbstbestimmte Balance von Nähe und Distanz,<br />
Methodenerfahrung und die Fähigkeit, Rahmenbedingungen zu analysieren und zu<br />
berücksichtigen, geknüpft. Dabei spielt auch der individuelle und fallspezifische Nutzen von<br />
Supervision eine Rolle.<br />
3 Inhalte<br />
Die fachliche Fundierung und Qualitätssicherung in Beratungs- und Betreuungsprozessen von<br />
Familien steht im Mittelpunkt des Moduls. Da sich Beratung von Familien in einem umfassenden<br />
Sinn sowohl als Begleitung durch die Instanzen der Jugendhilfe und des Bildungswesens als auch<br />
beim Übergang zwischen den Sektoren Jugendhilfe, Gesundheitswesen und Arbeitswelt definieren<br />
lässt, wird ein Beratungsverständnis nötig, dass den Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten<br />
der in diesem Bereich tätigen Organisationen angemessen ist. Lebens- und arbeitsweltliche<br />
Bezüge durchdringen den Alltag von Familien, dabei wird für eine professionelle Tätigkeit ein<br />
interdisziplinär ausgerichtetes Handlungskonzept zu Grunde gelegt. Kooperation und Vernetzung<br />
unterschiedlicher Berufsgruppen und Einrichtungen ist Bestandteil einer solchen Tätigkeit.<br />
Spezialisierungen der unterschiedlichen Institutionen müssen für die Ratsuchenden transparent<br />
werden, deshalb muss ein Fachverständnis entwickelt werden, dass auf der Kenntnis der<br />
psychosozialen Versorgung in Deutschland beruht.<br />
Der Prozess der Entwicklung einheitlicher Standards in der Betreuung und Beratung von Familien<br />
ist Gegenstand der Seminare. Außerdem wird Fallmanagement praxisnah vermittelt. Die<br />
unterschiedlichen Leistungserbringer für Familien werden charakterisiert, dabei wird auch auf die<br />
Etablierung geeigneter präventiver Maßnahmen eingegangen. Bei der Zusammenarbeit mit<br />
Familien kommt Professionellen außerdem die Rolle zu, Zuständigkeiten zu erkennen und<br />
56
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Weitervermittlung zu plausibilisieren.<br />
Um sicherzustellen, dass Ratsuchende ein optimales Angebot erhalten, ist eine qualifizierte<br />
Gesamteinschätzung der Situation notwendig. Darauf werden die Studierenden vorbereitet. Die<br />
Methodenvielfalt in den verschiedenen Instanzen wird kennengelernt und exemplarisch eingeübt.<br />
Anliegen und Grundlagen von praxisbegleitender Supervision werden verstanden. Die<br />
Grundqualifikationen aus dem Bachelor-Studiengang werden aufgenommen und vertieft.<br />
4 Prüfungsformen<br />
1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden<br />
5 Lehrform<br />
Übung<br />
6 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Abschluss des Moduls „Bedeutung von Beratung und Kommunikation von/mit Familien“<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit „bestanden“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung fließt nicht in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
11 Lehrende/r<br />
Dr. Frauke Mingerzahn<br />
12 Literatur<br />
Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.<br />
13 Sonstige Informationen<br />
Es handelt sich hier um ein Pflichtmodul.<br />
57
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
SOZIALRAUMORIENTIERUNG UND MITWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN VON<br />
KINDERN UND JUGENDLICHEN<br />
Kennnummer<br />
SB4/M8<br />
Workload<br />
90h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
17./18 April und 5./6. Juni jeweils<br />
von 10-18 Uhr, R. 0.21 (17./18.4.) u.<br />
R. 2.16 (05./06. 06.)<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Fähigkeit, Orientierungswissen in Form der klassischen und neueren Methoden der Sozialen<br />
Arbeit anzuwenden;<br />
• Fähigkeit, Erklärungswissen in Bezug auf Sozialraum bezogene Sachverhalte heranzuziehen<br />
und in diesem Zusammenhang methodische Handlungsanleitungen zu erschließen;<br />
• Fähigkeit, die Bedeutung der jeweiligen politischen und fachlichen Diskussionen bezogen auf<br />
das Arbeitsfeld zu erfassen und in Fachdiskussionen einzubringen;<br />
• Fähigkeit zur Reflexion der unterschiedlichen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen;<br />
• Fähigkeit, adressatenbezogen kommunizieren und kooperieren zu können<br />
3 Inhalte<br />
• Anwendung und Vertiefung von Handlungskompetenzen in Theorie und Praxis (Zielgruppen<br />
Kinder und Jugendliche, Vereine, Institutionen im Gemeinwesen);<br />
• Öffentlichkeitsarbeit als Möglichkeit der Gestaltung von sozialraumorientierten Konzepten;<br />
• Kennen lernen von Prozessen und Mechanismen der Interaktion von Individuum und<br />
Gesellschaft in der Sozialraumorientierung;<br />
• Kennen lernen der GWA als spezifische Herangehensweise, um Menschen in ihrer Lebenswelt<br />
zu aktivieren;<br />
• Einschlägige Rechtsvorschriften kennen lernen<br />
• Bei der empirischen Herangehensweise an die Inhalte wird die Fotografie als Forschungs- und<br />
Handlungsmethode exemplarisch zur Anwendung kommen<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Klausur oder 1 Referat, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Modulnote geht entsprechend der Creditzahl des Moduls mit 3 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Ramona Stirtzel<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Braun<br />
12 Literatur<br />
Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.<br />
13 Sonstige Informationen<br />
Bitte bringen Sie einen Fotoapparat mit.<br />
58
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
PRAXISREFLEXION UND MITWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN IN<br />
KINDHEITSWISSENSCHAFTLICH RELEVANTEN BEREICHEN<br />
Kennnummer<br />
SB2/M13<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
1. „Kindheit der Zukunft:<br />
Gesundheitsförderung –<br />
Zukunftsvision oder<br />
programmatisches<br />
Modernisierungskonzept“, GEENE,<br />
(W`Pfl.)<br />
2. „Familie der Zukunft: JuMKi – Junge<br />
Mütter und Kinder“,<br />
HUNGERLAND, (W`Pfl.)<br />
3. „Familie der Zukunft:<br />
Familienfreundliche <strong>Hochschule</strong> –<br />
Das Familienzimmer“,<br />
HUNGERLAND, (W`Pfl.)<br />
4. „Kindheit der Zukunft: Kinder- und<br />
Jugendbeteiligung in SDL“, GEENE,<br />
(W`Pfl.)<br />
5. „Kindheit der Zukunft:<br />
Informationskompetenzen“, EGGERS,<br />
(W`Pfl.)<br />
6. „Schule der Zukunft“, BEER, (W`Pfl.)<br />
7. „Kindheit der Zukunft: Einführung in<br />
die Diversity Studies aus<br />
erziehungswissenschaftlicher Sicht“,<br />
EGGERS, (W`Pfl.)<br />
8. „Kindheit der Zukunft: Frühe Hilfen<br />
und Schreibbabyambulanz“,<br />
PÖRSCHKE, (W’Pfl.)<br />
9. „Außerschulische Angebote der<br />
Zukunft: Konzeptentwicklung auf<br />
Basis von Antragstellung“, KNEIP,<br />
(W’Pfl.)<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
SoSe<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Die Studierenden sollen ihr im Studium erworbenes Wissen in kreativer Weise nutzen und in die<br />
Lage versetzt werden, Defizite kinderbezogener Institutionen zu erkennen und Lösungsstrategien<br />
zu entwickeln. Sie sollen Entwicklungen skizzieren können und eigenständig Ideen für eine<br />
lebenswerte kindergerechte (Um-)Welt formulieren.<br />
3 Inhalte<br />
Die einzelnen Veranstaltungen fokussieren auf verschiedene kinderrelevante soziale und<br />
wissenschaftliche Bereiche. Dabei werden die Entwicklungsprozesse der jeweiligen<br />
Schwerpunktthematiken betrachtet, der gegenwärtige status quo analysiert, Visionen formuliert<br />
und in umsetzbarer Form festgeschrieben. Besonders Zukunftsweisende Modelle werden<br />
exemplarisch vorgestellt und auf ihre flächendeckende Realisierung hin überprüft und ggf.<br />
modifiziert.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminar<br />
59
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
1 Referat oder 1 Klausur, bestanden/nicht bestanden<br />
Siehe auch bei den einzelnen Lehrveranstaltungen.<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Eine Lehrveranstaltung aus dem Lehrangebot muss gewählt und die Prüfungsleistung muss mit<br />
„bestanden“ bewertet worden sein.<br />
8 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung fließt nicht in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
11 Lehrende/r<br />
Doreen Beer, Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers, Prof. Dr. Raimund Geene, Prof. Dr. Beatrice<br />
Hungerland, Dr. Helene Kneip, Gerd Poerschke<br />
12 Sonstige Informationen<br />
Es handelt sich um ein Pflichtmodul. Aus dem Angebot an verschiedenen<br />
Wahlpflichtveranstaltungen muss eine Lehrveranstaltung gewählt werden.<br />
Die einzelnen Lehrveranstaltungen sind auch für Viertsemester geöffnet (Ausnahme LV mit Frau<br />
Kneip und Herrn Pörschke). Bei Interesse wenden Sie sich bitte persönlich an den Lehrenden oder<br />
die Lehrende.<br />
60
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kindheit der Zukunft: Gesundheitsförderung – Zukunftsvision oder pragmatisches<br />
Modernisierungskonzept<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV1<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mo,16-18 Uhr<br />
R. 1.19<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Einführung in die Trend- und Zukunftsforschung<br />
• Identifikation aktueller und zukünftiger Determinanten gesundheitlicher und sozialer<br />
Entwicklung, Vertiefung gesundheits- und sozialpolitischer Kenntnisse und Kompetenzen<br />
• Analyse von Entwicklungstendenzen und Erarbeitung eigener Entwicklungsszenarien<br />
3 Inhalte<br />
Deutschland befindet sich auf dem Weg in eine Dienstleistungsgesellschaft, schon heute stellt<br />
dieser Wirtschaftsbereich einen großen Teil des Bruttosozialprodukts. Eine zentrale Rolle nimmt<br />
in diesem Zukunftsblick das Gesundheitswesen ein, wobei es weniger um Wachstum des<br />
Medizin- und Versorgungssystems geht als vielmehr um die Expansion des Gesundheitssektors,<br />
der von Wellness und Fitness über Verhaltensprävention bis zur gesundheitsförderlichen<br />
Gestaltung von Lebenswelten reicht – eine durchaus ambivalente Entwicklung, die einerseits als<br />
Chance für ein menschenfreundliche / humane Zivilgesellschaft begriffen werden kann, aber auch<br />
als Normierung und „Zwangsbeglückung“, wie es beispielsweise Schmidt/Kolip (2007), Bauer<br />
und andere (2006) Kritiker des „New Public Managements“ (z.B. Dingeldey 2006)<br />
herausarbeiten. In ihrem Buch „Die Gesundheitsgesellschaft“ hat die frühere WHO-Direktorin<br />
Ilona Kickbusch (2007) diese Zukunftsvision umfassend skizziert, bereits zuvor hat Ellis Huber<br />
(2001) eine ähnliche Visionsskizze vorgelegt. Diese Thesen werden im Seminar kontrastiert mit<br />
den Überlegungen der Zukunftsforscher Horst Opaschowski (2008) und Matthias Horx (2006)<br />
und pragmatischen Entwicklungsszenarien von Rolf Rosenbrock und Claus Michel (2007) und<br />
auch von Barack Obama (2008). Abschließend entwickeln die Seminarteilnehmer/innen eigene<br />
Zukunftsprojektionen.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene<br />
5 Prüfungsformen<br />
Projektbeiträge in Form von Protokollen, Referaten bzw. Präsentation von Arbeitsrecherchen.<br />
Intensives Literaturstudium und Literaturrecherche<br />
61
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Bauer, Ulrich / Rosenbrock, Rolf / Schaeffer, Doris 2006: Stärkung der Nutzerposition im<br />
Gesundheitswesen – gesundheitspolitische Herausforderung und Notwendigkeit. In: Olaf<br />
Iseringhausen / Bernhard Badura (Hg.): Wege aus der Krise der Versorgungsorganisation.<br />
Bern: Huber.<br />
− Dingeldey, Irene 2006: Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung. In:<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte, 8/9.<br />
− Horx, Matthias 2006: Wie wir leben werden. Unsere Zukunft beginnt jetzt. Frankfurt:<br />
Campus.<br />
− Huber, Ellis 2001: Gesundet nach Radikalkur. Gesundheit 2007 – eine Vision. In: Geene,<br />
Raimund/ Denzin, Christian: Berlin – Gesunde Stadt? Berlin: Schmengler.<br />
− Kickbusch, Ilona 2006: Die Gesundheitsgesellschaft. Megatrends der Gesundheit und deren<br />
Konsequenzen für Politik und Gesellschaft. Gamburg: Verlag für Gesundheitsförderung.<br />
− Obama, Barack 2008: Hoffnung wagen: Gedanken zur Rückbesinnung auf den American<br />
dream. München: Riemann.<br />
− Opaschowski, Horst W 2008: Deutschland 2008: Wie wir in Zukunft leben werden.<br />
Gütersloh: Güterloher Verlagshaus.<br />
− Rosenbrock, Rolf / Michel, Claus 2007: Primäre Prävention. Bausteine für eine systematische<br />
Gesundheitssicherung. Berlin: MWV.<br />
− Schmidt, Bettina / Kolip, Petra (Hg.) 2007: Gesundheitsförderung im aktivierenden<br />
Sozialstaat. Präventionskonzepte zwischen Public Health, Eigenverantwortung und Sozialer<br />
Arbeit. Weinheim: Juventa.<br />
7 Sonstige Angaben:<br />
KiWi-Studierende des vierten Semester und Studierende aus dem Reha-Studiengang sind sehr<br />
willkommen<br />
62
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Familie der Zukunft: JuMKi – Junge Mütter und Kinder<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV2<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 10-12 Uhr<br />
R. 1.02<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Einsatz theoretischen erworbenen Wissens in konkretem Praxisbezug (Pädagogik,<br />
Familiensoziologie/-politik/-beratung, Lebensweltgestaltung für Kinder und Jugendliche)<br />
• Auseinandersetzung mit Vorstellungen von Familie, Kindgerechtheit, Genderfragen<br />
• Projektdesign und Durchführung<br />
3 Inhalte<br />
Die Veranstaltung setzt die im WiSe 08/09 begonnene Arbeit mit Teenagermüttern und ihren<br />
Kindern in <strong>Stendal</strong> fort.<br />
Rund 13 000 Teenager werden in Deutschland jährlich schwanger, davon entscheiden sich etwa<br />
40 Prozent für das Kind. Minderjährige Mütter müssen nicht nur die Vereinbarkeit von Schule<br />
oder Ausbildung und Kind bewältigen. Darüber hinaus haben sie mehr noch als andere mit<br />
besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen: häufig akzeptieren die Familie die Austragung der<br />
Schwangerschaft nicht und verweigern ihre Unterstützung, drücken sich die Kindsväter um die<br />
Verantwortungsübernahme, sehen sich die jungen Müttern mit gesellschaftlicher Missbilligung<br />
und sozialer Ausgrenzung konfrontiert. Dennoch sind die jungen Mütter nicht nur Opfer: oft<br />
haben sie bewusst die Mutterschaft als Lebensmodell für sich gewählt, das für sie eine Alternative<br />
zu elterlicher Bevormundung, der Aussichtslosigkeit des Berufswunsches und drohender<br />
Arbeitslosigkeit bietet. Mit der Entscheidung, das Kind auszutragen und zu versorgen setzen sie<br />
ein Zeichen autonomer Lebensgestaltung, vom Kind gebraucht und geliebt zu werden verspricht<br />
neuen Lebenssinn.<br />
Die KiWi-Projektgruppe JuMKi hat mit sechs jungen Müttern, die mit ihren Kindern in <strong>Stendal</strong> in<br />
einem betreuten Wohnprojekt des DPWV leben, Kontakt aufgenommen und spiel- und<br />
erlebnispädagogische Angebote gemacht. Diese sollen im Sommersemester fortgesetzt werden,<br />
ggf. unter Einbeziehung der Kinder.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
5 Prüfungsformen<br />
1 Projektbericht (unbenotet)<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− www.gruene-fraktion-sachsen.de/termine/ausstellung-kinderleicht.html<br />
− http://forum.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=501<br />
7 Sonstige Angaben<br />
In der Veranstaltung sind Studierende des vierten Semesters sehr willkommen.<br />
63
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Familie der Zukunft: Familienfreundliche <strong>Hochschule</strong> – Das Familienzimmer<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-<br />
LV3<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 10-12 Uhr<br />
R. 1.02<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Einsatz theoretischen erworbenen Wissens in konkretem Praxisbezug (Pädagogik,<br />
•<br />
Familiensoziologie/-politik/-beratung, Lebensweltgestaltung für Kinder)<br />
Auseinandersetzung mit Vorstellungen von Familie, Kindgerechtheit, Genderfragen<br />
• Projektdesign und Durchführung<br />
• Praktische Umsetzung eines visionären Entwurfs der (eigenen) <strong>Hochschule</strong> als Lebensort für<br />
junge Familien<br />
3 Inhalte<br />
Die Zukunftsvision, die dieser Veranstaltung zugrunde liegt, ist Sachsen-Anhalt als Land, in dem<br />
Studium, Arbeit und Familiengründung parallel möglich, gar erwünscht sind.<br />
Die Veranstaltung setzt die im WiSe 07/08 begonnene Arbeit an der Leitfrage fort: Wie kann unsere<br />
<strong>Hochschule</strong> zu einem familienfreundlichen Ort gestaltet werden, an dem sich Studium, Karriereplanung<br />
und Erwerbstätigkeit mit Kindern und Familienpflichten vereinbaren lassen? Nach einer Reflexion der<br />
bisher erreichten Ziele in Bezug auf die Zukunftsvision einer familiengerechten <strong>Hochschule</strong> werden<br />
weitere Schritte geplant und durchgeführt. Dabei steht die Realisierung des Familienzimmers (FaZi) im<br />
Vordergrund, d.h. pädagogische und praktische Konzeptualisierung, Einrichtung, Zeitplanung,<br />
Betreuung und Beratung. Dazu soll in diesem Semester die Außendarstellung des Familienzimmers<br />
vorangetrieben werden, d.h. Erstellung eines Flyers, Präsenz im Internet etc.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
5 Prüfungsformen<br />
1 Projektbericht (unbenotet)<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− www.studium-mit-kind.de<br />
− www.familie-im-studium.de/Abschlussbericht.pdf<br />
− www.studentenkind.de<br />
− www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1959<br />
− www.beruf-undfamilie.de/system/cms/data/dl_data/85c5582358fbbb812581ed4262970183/BMFSFJ_Monitor_Ho<br />
chschule_2008.pdf<br />
7 Sonstige Angaben<br />
In der Veranstaltung sind Studierende des vierten Semesters willkommen.<br />
Die Mitarbeit im „Familienzimmer“ kann auf Antrag als studienbegleitendes Praktikum anerkannt<br />
werden.<br />
64
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kindheit der Zukunft: Kinder- und Jugendbeteiligung in SDL<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV4<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 10-12 Uhr<br />
R. 0.03<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
Tutorium: Mo 16-18 Uhr, R. 0.20<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Bartscher, Matthias 1998: Partizipation v. K. in der Kommunalpolitik. Freiburg: Lambertus.<br />
− Böhm, Birgit / _anssen, Michael / Legewie, Heiner 1999: Zusammenarbeit professionell<br />
gestalten, Praxisleitfaden für Gesundheitsförderung, Sozialarbeit und Umweltschutz. Freiburg:<br />
Lambertus.<br />
− Deutscher Bundestag (Hrsg.) 2002: Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft.<br />
Endbericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements”. Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
− Engelmann, Fabian 2005: Kiezdetektive – Kinderbeteiligung für eine gesunde und<br />
zukunftsfähige Stadt. In: Geene, Raimund / Luber, Eva/ Engelmann, Fabian (Hg.): Gesunde<br />
Lebenswelten für Kinder und Eltern – Chancengleichheit durch Gesundheitsförderung. Berlin:<br />
Gesundheit Berlin.<br />
− Fatke, Reinhard/ Schneider, Helmut 2005: Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland.<br />
Daten, Fakten, Perspektiven. Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung.<br />
− NAKOS (Nationale Kontakt- u. Informationsstelle z. Anregung u. Unterstützung v.<br />
Selbsthilfegruppen) (Hg.) 2006: Selbsthilfe unterstützen. Fachl. Grundl. f. d. Arbeit in<br />
Selbsthilfekontaktstellen u. a. Unterstützungseinrichtungen. Ein Leitfaden. Berlin: NAKOS.<br />
− Olk, Thomas / Roth, Roland 2007: „Ihr nennt uns Zukunft, wir sind aber auch die Gegenwart“.<br />
Begründung für eine verstärkte Partizipation von K. u. J. Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung.<br />
http://www.aba-fachverband.org/fileadmin/user_upload/user_upload_2006/volksinitiative/<br />
Positionspapier_Partizipation.pdf<br />
− Wright, Michael T / Block, Martina / von Unger Hella 2007: Stufen d. Partizipation in d.<br />
65<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Problemorientierte Forschung und Praxisfelderschließung<br />
• Eigenständige theoretische (Partizipationsforschung) und praktische Durchdringung von<br />
Fragen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen<br />
• Konzeptionsentwicklung, Strukturierung eines Handlungsfeldes, Entwicklung nachhaltiger<br />
Organisationsstrukturen<br />
3 Inhalte<br />
In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl von Partizipationsprojekten mit Kindern und<br />
Jugendlichen in <strong>Stendal</strong> entwickelt. Neben den Aktivitäten von KiWi-Studierenden gab es hier auch<br />
kommunalpolitische Maßnahmen, die jedoch nicht immer erfolgreich verliefen. Mit der Gründung<br />
des Vereins „KinderStärken“ ist für künftige Aktivitäten eine strukturelle Basis geschaffen.<br />
In der Lehrveranstaltung werden verschiedene Formen der Partizipation von Kindern und<br />
Jugendlichen zunächst auf Grundlage a) der Literatur und b) konkreter Erfahrungsberichte erarbeitet,<br />
um dann an der Bündelung und Perspektive von zukünftigen Partizipationsformen von Kindern und<br />
Jugendlichen in <strong>Stendal</strong> zu arbeiten. Im Ergebnis wird im Seminar an der Umsetzung eines<br />
praxistauglichen und nachhaltig wirkenden Modells („Dach-Konzept“) für Partizipation in <strong>Stendal</strong><br />
gearbeitet.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Raimund Geene<br />
5 Prüfungsformen<br />
Projektbeiträge in Form von Protokollen, Referaten bzw. Präsentation von Arbeitsrecherchen sowie<br />
gemeinsame Konzeptionsentwicklung und –formulierung.
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Gesundheitsf. In: Info_Dienst f. Gesundheitsförderung. Zeitschrift v. Gesundh. Berlin 2007,<br />
7(3): 4-5.<br />
7 Sonstige Angaben:<br />
Studierende des 4. Semesters sind willkommen.<br />
Die Veranstaltung wird begleitet durch ein studentisches Tutorium (Mo von 16-18 Uhr, R. 0.20.<br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kindheit der Zukunft: Informationskompetenzen als Teil kindheitswissenschaftlicher<br />
Kompetenzen<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV5<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 18-20 Uhr<br />
R. 2.03<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
• Die Studierenden erwerben multimediale Kompetenzen, sie lernen verschiedene<br />
Möglichkeiten von Social Software kennen.<br />
• Die Studierenden machen erste Erfahrung mit dem Publizieren in multimediale Formate.<br />
• Studierenden verfassen Wiki-Beiträge und sammeln Erfahrungen mit Online-Editing.<br />
• Studierenden erproben verschiedene Möglichkeiten, die betroffene Öffentlichkeit zu<br />
informieren und den Austausch mit der Öffentlichkeit zu gestalten durch Blogs und<br />
Internetforen.<br />
• Die Studierenden entwerfen Ziele einer kritischen pädagogischen Arbeit mit Kindern und<br />
Jugendlichen als Nutzer_innen und Mitgestalter_innen von Neuen Medien.<br />
3 Inhalte<br />
Die Studierenden erarbeiten einen Überblick zu den Schnittstellen zwischen<br />
kindheitswissenschaftlicher Fragestellungen und der Einfluss von Neuen Medien in der Kindheit.<br />
Das Projektziel ist einerseits die Kommunikation aktueller kindheitswissenschaftlicher<br />
Auseinandersetzungen und Debatten an die betroffene Öffentlichkeit durch Neue Medien und<br />
andererseits die Erarbeitung eines Überblicks über Ziele einer kritischen multimedialen Arbeit mit<br />
Kindern und Jugendlichen.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
5 Prüfungsformen<br />
Erarbeiten eines Wiki-Beitrags.<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Moodlekurs Informationskompetenzen: http://moodle.hs-magdeburg.de/moodle/<br />
− GenderWiki der Humboldt Universität Berlin:<br />
http://www.genderwiki.de/index.php/Hauptseite<br />
− WiesnerWiki: http://www.heike-wiesner.de/wiki/index.php/Kategorie:Gender<br />
7 Sonstige Angaben:<br />
Studierende des vierten Semesters sind sehr willkommen.<br />
66
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Schule der Zukunft<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV6<br />
1 Zeit und Ort<br />
Di 12-14 Uhr<br />
R. 1.02<br />
Workload<br />
90 h<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Analyse schulischer Bedeutungsstrukturen<br />
• Problematisierung von Lernen vom Standpunkt der Lernsubjekte<br />
• Auseinandersetzung mit reformpädagogischen Forderungen und des neuen<br />
Bildungsverständnisses im Bereich der frühkindlichen Bildung<br />
• Identifikation<br />
Veränderungen<br />
verschiedener Ebenen von Schulkritik und Ansatzpunkten für<br />
3 Inhalte<br />
Die Veränderung der Produktionsverhältnisse im Zuge der Industrialisierung veränderte das<br />
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Da innerhalb der Familien nicht mehr produziert wurde,<br />
mussten die Kinder außerhalb dieses Zusammenhangs für die Produktion vorbereitet werden. Mit<br />
diesen Veränderungen waren auch pädagogische Probleme verbunden. Vor diesem Hintergrund<br />
entstand die Idee einer Bildung für alle Kinder. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden<br />
flächendeckend allgemein bildende Schulen; 1920 wurde die Schulpflicht durchgesetzt. Und<br />
genauso lange wie es Schule gibt, gibt es auch Kritik an Schule. Um die Frage zu beantworten,<br />
wie eine Schule der Zukunft aus einer kindheitswissenschaftlicher Perspektive vom<br />
subjektwissenschaftlichen Standpunkt der Kinder aussehen müsste, werden wir uns mit der<br />
„Schule der Gegenwart“ in ihrer historischen Entstehung und ihrer „disziplinären“ Grundstruktur<br />
auseinandersetzen, uns einen subjektwissenschaftlichen Zugang zum Thema Lernen verschaffen<br />
und vor diesem Hintergrund reformpädagogische Forderungen diskutieren. In die<br />
4<br />
Auseinandersetzung mit der Frage nach der Organisation von Lernprozessen werden wir darüber<br />
hinaus die Diskussion um Bildungsprozesse aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung und die<br />
aktuellen Veränderungen von Kindertageseinrichtungen in Bezug auf Lernprozesse einbeziehen.<br />
Die theoretischen Auseinandersetzungen sollen mit forschungspraktischen Übungen, die die<br />
Praxisanalyse ermöglichen sollen, verbunden werden.<br />
Lehrende/r<br />
Doreen Beer<br />
5 Prüfungsformen<br />
Beiträge in Form von Literaturstudium, Referaten / Seminarbeiträgen und / oder<br />
forschungspraktischen Übungen<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− K.-H.Braun, H.-H.Krüger, J.-H.Olbertz, Ch.Hoffmann, H.-G.Hofmann (Hg) ( 1998): Schule<br />
mit Zukunft. Bildungspolitische Empfehlungen und Expertisen der Enquete-Kommission des<br />
Landtages von Sachsen-Anhalt, Opladen<br />
− M.Foucault (1994): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M.<br />
− K.Holzkamp (1993): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung, Frankfurt/M-New York<br />
− K.Klemm, H.-G.Rolff, K.-J.Tillmann (1985): Bildung für das Jahr 2000. Bilanz der Reform,<br />
Zukunft der Schule, Reinbek bei Hamburg<br />
− Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt (Hg.) (2004): Bildung:<br />
elementar – Bildung von Anfang an. Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Weitere Literatur wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.<br />
7 Sonstige Angaben:<br />
Studierende des vierten Semesters sind herzlich willkommen.<br />
67
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Familie der Zukunft: Einführung in die Diversity Studies aus erziehungswissenschaftlicher<br />
Perspektive<br />
Kennnummer<br />
SB4/M9-LV7<br />
Workload<br />
90 h<br />
1 Zeit und Ort<br />
Mi 12-14 Uhr, 14-tgl.<br />
R. 2.01<br />
Credits<br />
3<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
Kontaktzeit<br />
30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
-<br />
Selbststudium<br />
60 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
• Studierenden lernen die verschiedenen theoretischen Modelle der Sozialisation von<br />
Differenz, insbesondere jene der geschlechtsspezifischen Sozialisation kennen.<br />
• Studierenden erforschen, wie im Alltag und in der Schule Differenz am Bsp. Von<br />
Geschlecht als soziale Kategorie konstruiert und durch Inszenierung hergestellt wird;<br />
• Studierenden lernen Erklärungsansätze zu eigenen Erfahrungen und Einstellungen in<br />
Verbindung setzen.<br />
3 Inhalte<br />
Dieses Seminar vermittelt im Grundlagen zentraler erziehungs- und sozialwissenschaftlichen<br />
Begriffen unter besonderer Berücksichtigung der Kategorie Differenz am Bsp. von Geschlecht. Im<br />
Anschluss daran werden erkenntnistheoretische Positionen und Bedeutungsaspekte der Kategorie<br />
Geschlecht im Gleichheits- und Differenzansatz sowie in der Konstituierung der Diversity Studies<br />
nachgezeichnet.<br />
4 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
5 Prüfungsformen<br />
Textvorstellung, Seminarpräsentation<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Bitzan, Maria/Daigler, Claudia: Eigensinn und Einmischung. Einführung in die Grundlagen<br />
und Perspektiven parteilicher Mädchenarbeit. Weinheim (Juventa) 2001<br />
− .Gieseke, Wiltrud: Erziehungswissenschaft. In: Braun, Christina von/Stephan, Inge (Hrsg.):<br />
Gender Studien. Eine Einführung. Stuttgart und Weimar 2000, 328-343.<br />
− Doris Lemmermöhle/ Dietlind Fischer/ Dorle Klika/ Anne Schlüter (Hrsg.): Lesarten des<br />
Geschlechts. Zur De-Konstruktionsdebatte in der erziehungswissenschaftlichen<br />
Geschlechterforschung. Leske + Budrich, Opladen: 2000<br />
− Rendtorff, Barbara / Moser, Vera: Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der<br />
Erziehungswissenschaft, Opladen 1999<br />
7 Sonstige Angaben:<br />
Studierende des 4. Semesters sind sehr willkommen.<br />
68
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Kindheit der Zukunft: Frühe Hilfen und Schreibabyarbeit<br />
KennWork- Credits Studiensemester Häufigkeit des<br />
nummerload Angebots<br />
SB4/M9-LV8 90 h 3<br />
6. Semester<br />
-<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium<br />
Di 10-12 Uhr<br />
R. 0.09<br />
30 h<br />
60 h<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Nach Abschluss dieses Seminars kennen/können die Studierenden:<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Wahlpflicht<br />
• verschiedene praktische Ansätze der Frühen Hilfen, insbesondere aus der Psycho- und<br />
Körpertherapie, die die Grundlage des Konzeptes „Schreibabyambulanz“ bilden<br />
• Körperpsychotherapeutische/ bioenergetische Konzepte, angelehnt an Wilhelm Reich<br />
• Konzeptentwicklung, denn sie begleiten den Aufbau der Schreibabyambulanz und des<br />
Netzwerks Frühe Hilfen in <strong>Stendal</strong><br />
• Erlernen Basiskenntnisse des Projektmanagements<br />
• Erlernen Basiskenntnisse einer Erfolgsmessung / Evaluation als Teil des Projektkonzeptes<br />
Im Ergebnis haben die Studierenden modellhaft den Aufbau eines neuen Versorgungsangebotes<br />
der Frühen Hilfen in <strong>Stendal</strong> in allen Projektschritten begleitet.<br />
Inhalte<br />
Als wesentliche Ursachen frühkindlicher Entwicklungsproblematik werden Regulations- und<br />
Interaktionsstörungen in der Mutter-Kind-Beziehung betrachtet. Dies geschieht häufig schon<br />
unmittelbar an Schwierigkeiten im Geburtsprozess anknüpfend. Die SchreiBabyAmbulanz bietet<br />
hier einen sinnvollen Ansatz der Frühen Hilfe, in dem sie mit Formen der<br />
körperpsychotherapeutischen Arbeit Eltern und ihren Babys bzw. Kleinkindern bis 3 Jahren bei<br />
der Krisenbewältigung hilft.<br />
Ziel des Projektes ist es, diesen Ansatz selbst zu erfahren und kritisch zu reflektieren, und<br />
zeitgleich den Aufbau, die Führung und die Inbetriebnahme eines entsprechenden Angebotes in<br />
<strong>Stendal</strong> zu unterstützen. Dabei geht es darum die Akzeptanz des Angebotes bei den<br />
Kooperationspartnern und den Eltern zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, die<br />
Vernetzung der Kooperationspartner mit zu organisieren und die Nachhaltigkeit der Finanzierung<br />
sichern zu helfen. Hier kann auf die Erfahrungen der SchreiBabyAmbulanzen in Berlin<br />
zurückgegriffen werden.<br />
Die Teilnehmerinnen werden ausführlich in die praktische Arbeit in den SchreiBabyAmbulanzen<br />
eingeführt und können in Form von Selbsterfahrungen wie Massageübungen, Partnerübungen und<br />
Rollenspielen die Wirkung einzelner Interventionen teilweise erfahren und auch überprüfen.<br />
Dafür sind bequeme und lockere Kleidung und Decken nötig. Es besteht die Möglichkeit, auf<br />
Basis der gemachten Erfahrungen Weiterbildungsangebote für Kooperationspartner bzw. Eltern<br />
zu erstellen Die Ausgestaltung und Planung der Weiterbildung, ihr Ablauf, der Sinn der<br />
Selbsterfahrung, die Dauer und die Inhalte werden besprochen.<br />
Dabei soll durch die inhaltliche Gestaltung von Praxis und Weiterbildung eine Verbindung von<br />
Theorie und Praxis erkennbar werden, insbesondere durch den Aufbau eines entsprechenden<br />
Kompetenzfeldes bzw. Netzwerks für Frühe Hilfen in <strong>Stendal</strong>.<br />
4 Lehrende/r<br />
Dipl.Psych. Gerd Poerschke<br />
5 Prüfungsformen<br />
Aktive Teilnahme, Seminarbeiträge<br />
69
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
− Ainsworth, M, Blehar, M., Wall, S. ( 1978): Patterns of attachment. A Psychological Study of<br />
the Strange Situation. Hillsdale, NJ.: Erlbaum<br />
− Armbruster, M. (2006): Eltern-AG. Das Empowermentprogramm für mehr Elternkompetenz<br />
in Problemfamilien. Heidelberg: Carl Auer.<br />
− Arnold, J. (2006): Die Super Nannys und ihr Publikum: Ergebnisse einer Wiener Studie.<br />
Medienheft. Verfügbar unter<br />
http://www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k26_ArnoldJudith.html.<br />
− Boadella, David (1998). Wilhelm Reich, Der Pionier des neuen Denkens. München: Knaur.<br />
− Brisch, K.-H. (1999): Bindungsstörung: von der Bindungstheorie zur Therapie. Stuttgart:<br />
Klett-Cotta.<br />
− Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2007): Aktionsprogramm<br />
„Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“. Berlin: BMFSFJ.<br />
Verfügbar unter: http://bmfsfj.de/Politikbereiche/kinder-und-jugend/fruehehilfen,did=86930.html.<br />
− Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2006): Früherkennungsuntersuchungen für<br />
Kinder im europäischen Ausland. Köln: BZgA. Verfügbar unter:<br />
http://www.kindergesundheit-info.de/1937.98.html.<br />
− Cierpka, M, Stasch, M, Groß, S. (2007): Expertise zum Stand der<br />
Prävention/Frühintervention in der frühen Kindheit in Deutschland. Reihe ‚Forschung und<br />
Praxis der Gesundheitsförderung’ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Band<br />
34. Köln: BZgA. Verfügbar unter: www.bzga.de.<br />
− Diederichs u. Olbricht (2002): Unser Baby schreit soviel. Kösel.<br />
− Dornes, Martin (2000): Die emotionale Welt des Kindes, Frankfurt: Fischer<br />
Taschenbuchverlag.<br />
− Dornes, M. (2000): Die Fremde Situation. In: Enders, Hauser: Bindungstheorie und<br />
Psychotherapie. München: Ernst Reinhard Verlag.<br />
− Ellsäßer, G., Böhm, A., Kuhn, J., Lüdecke, K., Rojas, G. (2002): Soziale Ungleichheit und<br />
Gesundheit bei Kindern. Ergebnisse und Konsequenzen aus den Brandenburger<br />
Einschulungsuntersuchungen. Kinderärztliche Praxis, 4, 248-257.<br />
− Geene, Raimund u. Gold, Carola (Hg.) (2009): Kinderarmut und Kindergesundheit. Bern:<br />
Huber.<br />
− Gemeinsamer Bundesausschuss (2007): Screening auf Kindesmisshandlung/<br />
Kindesvernachlässigung/ Kindermissbrauch. Teilabschlussbericht des Beratungsthemas<br />
„Inhaltliche Überarbeitung der Kinder-Richtlinien“. Siegburg.<br />
− Gemeinsamer Bundesausschuss (2008): Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und<br />
Krankenkassen über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des<br />
6. Lebensjahres („Kinder-Richtlinien“). Bundesanzeiger 2008, Nr. 57, S. 1344.<br />
− sowie die Diplom- bzw. Bachelor-Arbeiten zum Thema von .Bernhild Pfautsch, Cornelia<br />
Bela und Maria Stichowski<br />
7 Sonstige Angaben<br />
-<br />
70
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Titel der Lehrveranstaltung<br />
Außerschulische Angebote der Zukunft: Konzeptentwicklung auf Basis von Antragsstellung<br />
KennWork- Credits Studiensemester Häufigkeit des Dauer<br />
nummerload Angebots<br />
SB4/M9-LV9 90 h 3<br />
6. Semester<br />
-<br />
1 Semester<br />
1 Zeit und Ort<br />
Kontaktzeit Selbststudium Status<br />
Mi 10-14 Uhr, 14-tgl.<br />
Start 15.04.<br />
R. 4005<br />
30 h<br />
60 h<br />
Wahlpflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
-<br />
Inhalte<br />
-<br />
4 Lehrende/r<br />
Dr. Helene Kneip<br />
5 Prüfungsformen<br />
Seminarbeitrag/Projektantrag<br />
6 Studienmaterial/Literatur<br />
-<br />
7 Sonstige Angaben<br />
Es handelt sich hier um die Fortsetzung des im Modul „Projektstudium“ behandelten<br />
Themenstellungen. Dieses Angebot können nur Studierende belegen, die im vorherigen Semester<br />
ebenfalls das Angebot bei Frau Kneip besuchten. Bitte wenden Sie sich direkt an Frau Kneip<br />
hinsichtlich weiteren Informationen.<br />
71
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
TITEL DES MODULS<br />
BACHELOR-ARBEIT<br />
Kennnummer<br />
-<br />
Workload<br />
420h<br />
Credits<br />
14<br />
1 Lehrveranstaltungen, Zeit u.<br />
Ort<br />
„Begleitveranstaltung zur<br />
Bachelor-Arbeit“<br />
Di 16-18 Uhr<br />
BROECHER, R. 0.21<br />
EGGERS, R. 0.07<br />
GEENE, R. 1.19<br />
HUNGERLAND, R. 1.20<br />
Studiensemester<br />
6.Semester<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 30 h<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
Sommersemester<br />
Selbststudium<br />
390 h (davon 360 h<br />
für Anfertigung der<br />
Bachelor-Arbeit)<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Status<br />
Pflicht<br />
2 Lernergebnisse / Kompetenzen<br />
Durch die Bachelor-Arbeit erwerben die Studierenden die Fähigkeit selbständigen<br />
wissenschaftlichen Arbeitens. Sie zeigen, dass sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen<br />
Frist eine Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet selbständig wissenschaftlich zu bearbeiten. Sie<br />
lernen, ein Thema zu definieren, analytisch aufzuarbeiten, wissenschaftliche Literatur zu ermitteln<br />
und auszuwerten sowie ggf. die Konzeption einer empirischen Untersuchung zu entwickeln,<br />
wissenschaftliche Methoden konkret anzuwenden und eine Untersuchung durchzuführen. Die<br />
Studierenden werden in die Lage versetzt, die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Text<br />
darzustellen sowie hinsichtlich ihrer theoretischen Bedeutung und praktischen Relevanz zu<br />
bewerten. Im Kolloquium weisen die Studierenden nach, dass sie in der Lage sind, die<br />
Arbeitsergebnisse aus der selbständigen wissenschaftlichen Bearbeitung des Fachgebiets in einem<br />
Fachgespräch zu verteidigen.<br />
3 Inhalte<br />
Das Modul besteht aus zwei Teilen. Durch die Begleitveranstaltung zur Bachelor-Arbeit werden<br />
die Studierenden bei der selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit unterstützt. In der BA-Arbeit<br />
führen sie selbstständig eine Untersuchung zu einem selbst gewählten Thema durch.<br />
Die Lehrenden stellen in der Veranstaltung und in Einzelkonsultationen ihren Rahmen für die BA-<br />
Arbeitsthemen vor und entwickeln mit den Studierenden die konkreten Themenstellungen für jede<br />
einzelne BA-Arbeit. In Kleingruppen- und Einzelkonsultationen besprechen die Lehrenden mit<br />
den Studierenden den Fortschritt der Arbeit, geben Hinweise für die Durchführung und für<br />
weiterführende Aspekte und begleiten so den Prozess des Schreibens individuell.<br />
In der ersten Hälfte des Moduls präsentieren und diskutieren die Studierenden ihre Arbeitsansätze.<br />
Nach Bedarf werden für die Bachelor-Arbeit wichtige Teilaspekte wissenschaftliche Arbeitens in<br />
einem wissenschaftlichen Kolloquium aufgegriffen und vertieft (z.B. Entwicklung einer<br />
Forschungsfrage und einer analytischen Fragestellung, Gestaltung der Gliederung,<br />
Literaturrecherche und -auswertung, Entscheidungskriterien für die Methodik empirischer<br />
Untersuchungen, Stil wissenschaftlicher Texte, Form wissenschaftlicher Arbeiten,<br />
Schreibblockaden und ihre Überwindung).<br />
In der zweiten Hälfte des Moduls stellen alle TeilnehmerInnen ihren Arbeitsprozess und<br />
Zwischenergebnisse während des wissenschaftlichen Kolloquiums vor und diskutieren sie<br />
gemeinsam.<br />
Die Studierenden schreiben selbständig eine BA-Arbeit von mind. 45 Seiten Umfang (Textseiten<br />
ohne Anhang).<br />
4 Lehrformen<br />
Begleitung der Bachelor-Arbeit durch<br />
• Kleingruppen- und Einzelkonsultationen;<br />
• wissenschaftliches Kolloquium<br />
72
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Abschluss der für die Semester 1 bis 5 vorgesehenen Module. In begründeten Ausnahmefällen<br />
entscheidet auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden der Prüfungsausschuss.<br />
6 Prüfungsformen<br />
• 1 Seminarbeitrag, bestanden/nicht bestanden (Begleitveranstaltungen zur Bachelor-<br />
Arbeit)<br />
• 1 Bachelor-Arbeit und 1 Kolloquium, benotet<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Ein mit „bestanden“ bewerteter Seminarbeitrag und eine mit mindestens „ausreichend“ bewertete<br />
Bachelor-Arbeit mit Kolloquium.<br />
8 Verwendung des Moduls<br />
Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Die Prüfungsleistung des „Seminarbeitrags“ fließt nicht in die Endnote ein. Die Prüfungsleistung<br />
der „Bachelor-Arbeit und Kolloquium“ fließt mit 12 von 119 in die Endnote ein.<br />
10 Modulbeauftragte/r<br />
Hertha Schnurrer<br />
11 Lehrende/r<br />
Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher, Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers, Prof. Dr. Raimund Geene,<br />
Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
12 Literatur<br />
Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.<br />
13 Sonstige Informationen<br />
Es handelt sich um ein Pflichtmodul. Die Begleitveranstaltung ist regelmäßig zu besuchen. Es<br />
wird empfohlen, dass Sie die Lehrende bzw. den Lehrenden, die/der Ihre Bachelor-Arbeit als<br />
Erstprüferin bzw. Erstprüfer betreuen soll, wählen.<br />
73
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Lehrangebote zur Wahl<br />
Wahlveranstaltung Jean-Monnet-Modul – Unser Europa sozial?<br />
Voraussetzung: Keine<br />
Lehrende/r: Dr. Arnd Hofmeister<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften, Rehabilitationspsych. u. BWL<br />
Lehrformen: Seminarvortrag, Gruppendiskussionen und Referate<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Raum: Mo 16-18 Uhr, Raum 1.11<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Nach Abschluss dieses Seminars:<br />
• kennen die Studierenden die geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Konstitution der<br />
Europäischen Union,<br />
• sind die Studierenden mit gegenwärtigen insbesondere sozialpolitischen Herausforderungen der EU<br />
vertraut und können dazu kritisch Position beziehen,<br />
• können die Studierenden systematisch aktuelle Informationen auch zu Detailfragen europäischer<br />
Politiken recherchieren,<br />
• kennen die Studierenden grundlegende europäische Aktionsprogramme und Fördermöglichkeiten,<br />
deren Zielrichtung und grundlegende Antragsstrategien,<br />
• haben sich die Studierenden kritisch mit dem / ihrem Status der / als EU-Bürger/in<br />
auseinandergesetzt,<br />
• können die Studierenden die europäische Dimension ihres Studienganges reflektieren.<br />
Inhalte<br />
Es werden Grundlagen der Geschichte und Struktur der Europäischen Union vermittelt und diskutiert,<br />
welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Praxis der sozialen und gesellschaftlichen Arbeit in<br />
Deutschland haben.<br />
1. Die Geschichte der europäischen Integration (I) - historischer Hintergrund, Erfahrungen aus dem 2.<br />
Weltkrieg, verschiedene Konzepte der Integration<br />
2. Die Geschichte der europäischen Integration (II) - Schritte zum Vertrag von Rom, die<br />
Weiterentwicklung der Verträge, der Gemeinsame Markt<br />
3. Europa wird größer- die Osterweiterung und eine einheitliche europäische Verfassung<br />
4. Felder der europäischen Politik (I) - wirtschaftliche Integration und deren Einfluss auf die<br />
gesellschaftliche Entwicklung der Mitgliedsstaaten.<br />
5. Themen der Europapolitik (II) - Sozialpolitik<br />
6. Themen der Europapolitik (III) - Öffentliche Gesundheitspflege<br />
7. Themen der Europapolitik (IV) - Social Inclusion<br />
8. Themen der Europapolitik (V) - Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
9. Themen der Europapolitik (VI) – Spannungsfeld zwischen europäischer Wirtschafts- und<br />
Sozialpolitik<br />
10. Herausforderungen für das „Europäische Gesellschaftsmodell“<br />
11. Abschlussdiskussion „Meine Vision von Europa“<br />
- Wie sollte das zukünftige Europa aussehen?<br />
- Welches Modell von Gesellschaft und Wirtschaft sollte es vertreten?<br />
- Welche Sicht vertritt Europa gegenüber den Ausgegrenzten?<br />
- Meine Arbeit als ein Beitrag zu dieser Vision von Europa<br />
Hinweise<br />
In Absprache mit den Studierenden wird diese Veranstaltung in Englisch oder Deutsch durchgeführt. Die<br />
Vergabe der Teilnahmebescheinigung setzt eine regelmäßige Teilnahme voraus. Angebot steht auch den<br />
Reha- und BWL-Studierenden offen.<br />
74
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Vor- u. Nachbereitung der Genf-Exkursion (24.-29. Mai)<br />
Voraussetzung: Teilnahme an der Exkursion zur UN-Kinderrechtskommission in Genf<br />
- ausreichende Englisch- oder Französischkenntnisse<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. Beatrice Hungerland<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrformen: Seminar<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Raum: Mo 18-20 Uhr, 14-tgl., Raum 2.16, Beginn: 06.04.2009<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
• Kenntnis der UN-Kinderrechtskonvention<br />
• Einblick in die praktische Umsetzung der Konvention und deren Schwierigkeiten<br />
• Kenntnis über Struktur und Organisation der Kinderkommission der Vereinten Nationen<br />
• Einblick in die Praxis der Berichterstattung der Länder und deren Begutachtung durch die UN<br />
Kinderrechtskommission<br />
Inhalte<br />
Mit der Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 1989 wurde Kindern erstmalig<br />
eigene Rechte zugesprochen, die mit Ausnahme von Somalia und den USA von allen Staaten ratifiziert<br />
wurden. Die Regierungen sind verpflichtet, alle fünf Jahre der UN-Kinderrechtskommission in Genf Bericht<br />
zu erstatten. Diese Sitzungen sind teilweise für ein begrenztes Publikum geöffnet. Die Teilnehmerinnen der<br />
Exkursion haben die Gelegenheit, an einem vollen Sitzungstag die Berichterstattung vor Ort zu verfolgen<br />
und damit Kinderpolitik „auf Weltniveau“ live zu erleben.<br />
Die Veranstaltung dient der Vor- und Nachbereitung dieses Tages. Sie soll insbesondere einen Einblick in<br />
die Struktur und Organisation der Kinderkommission, die Tätigkeiten der LändergutachterInnen, die<br />
Bedeutung der NGO-BerichterstatterInnen sowie in die Strukturen von Unicef und deren Rolle bei der<br />
Umsetzung der Kinderrechte vermitteln. Außerdem werden wir uns intensiv mit dem Regierungsbericht aus<br />
Schweden befassen, der an „unserem“ Sitzungstag behandelt werden wird.<br />
Hinweise<br />
In der ersten Veranstaltung am 6.4. wird der Zweck und das Programm der Exkursion erläutert. Ab diesem<br />
Termin werden verbindliche Anmeldungen angenommen. Es stehen 28 Plätze zur Verfügung, die vorrangig<br />
an die Studierenden des 4. Semesters vergeben werden. Grundsätzlich steht die Teilnahme an der Exkursion<br />
allen Studierenden offen.<br />
Die Übernahme eines Kurzreferates ist verpflichtend.<br />
75
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung ‘We don’t need no education…’ – Zum Verhältnis von Lernen und<br />
schulischen Lernbedingungen II<br />
Voraussetzung: Keine<br />
Lehrende/r: Doreen Beer<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie<br />
Lehrformen: Seminar<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Raum: Di 14-16 Uhr, Raum 1.02<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
• Auseinandersetzung mit der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie von Klaus Holzkamp<br />
• Subjektwissenschaftliche Problematisierung von Lernwiderstand, Lernverweigerung und<br />
lebenslangem Lernen<br />
Inhalte<br />
Im zweiten Teil dieser Veranstaltung werden wir die Frage nach dem Verhältnis von Lernen und schulischen<br />
Lernbedingungen aus subjektwissenschaftlicher Perspektive vertiefen. Dabei werden wir uns in diesem<br />
Semester vor dem Hintergrund der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie von Klaus Holzkamp insbesondere<br />
mit der Frage nach der Entstehung von Lernwiderstand und Lernverweigerung auseinandersetzen. In diesem<br />
Kontext werden wir uns auch mit den Widersprüchen der Forderung nach lebenslangem Lernen und mit dem<br />
Zusammenhang von Lernverhältnissen und Generationenverhältnissen beschäftigen. Die Veranstaltung ist<br />
außerdem offen für die Interessen der Teilnehmenden. Themenwünsche können zu Beginn des Semesters<br />
eingebracht werden.<br />
Prüfungsformen<br />
Wahlkurs, bestanden bei regelmäßiger Teilnahme, Literaturstudium und Beteiligung am Kurs<br />
Studienmaterial / Literatur<br />
Literatur wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.<br />
Sonstige Angaben<br />
Alle Kiwi-Studierenden und Reha-Studierenden sind herzlich willkommen.<br />
76
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Einführung in die Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik<br />
Voraussetzung: Keine<br />
Lehrende/r: Katja Seidel<br />
Umfang: Gruppe 1: Mittwoch: 16-18 Uhr ; Gruppe 2: Mittwoch 18-20 Uhr<br />
Lehrtage: 15.04, 22.04., 29.04., 06.05 + 1 WE, R. 1.20<br />
gemeinsame Einführungsveranstaltung am<br />
Mittwoch, den 08.04 von 18-20 Uhr (beide Gruppen!) Raum 0.03<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen und Inhalte<br />
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Erlebnispädagogik? Dieser Frage soll hier in zweierlei Hinsicht<br />
nachgegangen werden. Zum einen durch einführende geschichtliche und theoretische Hintergründe, zum<br />
anderen durch umfassende Praxis.<br />
Wichtige Stichworte sind dabei:<br />
• Selbsterfahrung - Reflexion - Selbstreflexion<br />
• Erfahrungen mit und in der Natur<br />
• Interaktionsspiele<br />
• Ganzheitliches Lernen<br />
• Soziales Lernen in der Gruppensituation<br />
• „Sich selbst und seine Grenzen austesten“ – Grenzerfahrungen machen<br />
In der Veranstaltung werden grundlegende theoretische und geschichtliche Aspekte der Erlebnispädagogik<br />
vorgestellt, bevor es in die umfassenden Praxiseinheiten geht. Hier darf jede/r TeilnehmerIn seine<br />
Erfahrungen machen, seine eigenen Grenzen austesten und in geschütztem Rahmen lernen. Ziel ist es, einen<br />
intensiven Einblick in die erlebnispädagogische Arbeit zu geben, verschiedene interaktions- und<br />
erlebnispädagogische Spiele kennen zu lernen, durchzuführen und zu reflektieren. Auch der Frage, wie<br />
Spiele altersgruppenspezifisch modifiziert werden können, wird nachgegangen.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.<br />
Hinweise<br />
Für beide Gruppen findet eine Informationsveranstaltung zu dieser Veranstaltung am Mittwoch, den 8. April<br />
von 18-20 Uhr statt. Hier wird eine Zuordnung zu den jeweiligen Gruppen vorgenommen.<br />
In jeder Gruppe können 12 bis maximal 14 Studierende teilnehmen. Das Veranstaltungsangebot findet ab<br />
sechs TeilnehmerInnen statt. Teilnahme wird nur bei Besuch der Einführungseinheiten (5 Termine) und dem<br />
WE-Workshop bestätigt.<br />
77
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Musiktherapeutische Selbsterfahrung<br />
Voraussetzung: Keine<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. Susanne Metzner<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie<br />
Zeit und Ort: 2 Wochenendblocks 03./04.07.2009 und 17./18.07.2009.<br />
Freitag: 14 - 20.30 Uhr und Samstag 10-14 Uhr<br />
am Hochschulstandort <strong>Magdeburg</strong>, Campus Herrenkrug, Haus 1 Raum 2.69<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen/Inhalte<br />
Musiktherapie ist eine Form der Psychotherapie, bei der die musikalische Improvisation oft Ausgangspunkt<br />
für das Gewahrwerden und Betrachten von Bedürfnissen, Strebungen und Empfindungen ist, denen im<br />
anschließenden Gruppen-Gespräch weiter auf den Grund gegangen wird. In den beiden aufeinander<br />
aufbauenden Blockseminaren werden eigene Erfahrungen mit dem Medium Musik und der freien<br />
Improvisation gesammelt und reflektiert. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wohl aber ein<br />
offenes Ohr für neue (und alte) Erfahrungen bei sich und anderen. Die Teilnahme an nur einem<br />
Blockseminar ist nicht möglich.<br />
Hinweise<br />
Die Wahlveranstaltung „Musiktherapeutische Selbsterfahrung“ kann von maximal 10 TeilnehmerInnen<br />
besucht werden. Die verbindliche Anmeldung erfolgt zu Beginn des Semesters direkt bei Prof. Metzner<br />
(Susanne.Metzner@hs-magdeburg.de) – Anmeldeschluss Fr., 11. April.<br />
Es sind beide Wochenendblocks zu besuchen, die Teilnahme an nur einem Blockseminar ist nicht möglich.<br />
78
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Geburt und Übergang Elternschaft<br />
Voraussetzung: Keine<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrende/r: Inés Brock<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Freitags 4-stündig von 10-14 Uhr, R. N.N.<br />
24. April, 08. Mai und 12. Juni (weitere Termine werden direkt mit den<br />
TeilnehmerInnen vereinbart)<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Neben der Einführung in psychosoziale Aspekte von Schwangerschaft und Geburt wird insbesondere auf die<br />
Interaktionsmechanismen und Besonderheiten von prä-, peri- und postnataler Phase in Bezug auf die Mutter-<br />
Kind-Dyade eingegangen. Die acht Phasen des Übergangs zur Elternschaft werden vermittelt. Die<br />
Teilnehmenden bekommen einen Überblick über Methoden und Wirkungen pränataler Diagnostik, der<br />
Schwangerenvorsorge und pränataler Psychologie. Die verschiedenen Geburtsmodi werden vorgestellt.<br />
(Videos)<br />
Die Geburt eines Kindes ist ein zentrales Erlebnis für jede Frau und für die jungen Eltern - als Paar, das sich<br />
neu erfinden muss. Das Wissen um den Lebensbeginn und die frühe Prägung des Neugeborenen bildet die<br />
Basis für eine kompetente Ansprache junger Eltern. Die wichtigsten Ergebnisse der Säuglingsforschung<br />
werden vermittelt und das Konzept des Geburtstraumas wird kritisch diskutiert.<br />
Inhalte<br />
Ob das Leben für ein Kind mit einem Geburtstrauma beginnt, oder alle Voraussetzungen für die Entwicklung<br />
von Urvertrauen und Primärgesundheit geschaffen sind, ist in der sozialen Arbeit mit Menschen relevant<br />
aber auch sehr persönlich und individuell. Die Verknüpfung von Forschungsergebnissen der Fachdisziplinen<br />
rund um die Geburt kann die Teilnehmer/innen für den Blick auf die Phase des Lebensbeginns<br />
sensibilisieren. Frühkindliche Prävention kann auf dieser Sensibilität aufbauen. Jedes fünfte Baby wird als<br />
Schreikind wahrgenommen, Eltern zeigen sich in der Anpassungsphase des Wochenbettes der Mutter oft<br />
überfordert und verunsichert. Der Säuglingsforschung seit Stern ist es zu danken, dass heute niemand mehr<br />
ernsthaft die Kompetenzen von Säuglingen und Kleinstkindern anzweifelt. Aber welche Konsequenzen hat<br />
dieses Wissen?<br />
Neben dem interdisziplinären Wissen rund um die Geburt wird sich auf unterschiedlichen Zugangswegen<br />
dem Thema Geburt und Übergang zur Elternschaft genähert, dabei spielen auch spirituelle, rituelle,<br />
anthropologische und ethische Fragen eine Rolle.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Geisel, Elisabeth. (1997). Tränen nach der Geburt. Wie depressive Stimmungen bewältigt werden<br />
können. München, Kösel.<br />
− Odent, Michel. (1986). Von Geburt an gesund. Was wir tun können, um lebenslange Gesundheit zu<br />
fördern. München<br />
− Petzold, Hilarion G. (Hrsg.) (1993). Frühe Schädigungen - späte Folgen? Psychotherapie und<br />
Babyforschung. Paderborn. Bd. 1 und 2 [einige ausgewählte Aufsätze]<br />
− Grossmann, Karin (Hrsg.) (2003). Bindung und menschliche Entwicklung. Stuttgart.<br />
− Ernst, Cécile; v. Luckner, Nikolaus (1987). Stellt die Frühkindheit die Weichen? Stuttgart.<br />
Hinweise<br />
Maximal können 25 Studierende teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt verbindlich zu Beginn des Semesters.<br />
79
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Planung und Diskussion von qualitativen Forschungsarbeiten/ -<br />
projekten zu entwicklungspsychologischen Themen<br />
Voraussetzung: Sem. 4 oder 6<br />
Grundkenntnisse von qualitativer Forschung und Forschungsplanung<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. Günter Mey<br />
Umfang: Mi von 10-14 Uhr, 14-tgl. - Start 08.04.<br />
R. 1.08<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Logik qualitativer Forschung und deren Angemessenheit für<br />
die Bearbeitung von Fragestellungen innerhalb der (entwicklungs-) psychologischen Forschung und im<br />
Rahmen von Studien zu Kindheit(-swissenschaften). Im Einzelnen geht es um ein Grundverständnis von<br />
Strategien der Forschungsplanung, der Gegenstandsangemessenheit von Methoden und der Reichweite von<br />
Interpretationen sowie die Beurteilung der Güte von Transkriptionen, Protokollen, Prä- und Postskripten.<br />
Inhalte<br />
Die Veranstaltung ist ein Vorläufer für das ab Wintersemester 2009/10 geplante feste Angebot einer<br />
"Projektwerkstatt Qualitativen Arbeitens" (PW_QA). PW_QA versteht sich als eine Kombination aus einem<br />
"klassischem" Kolloquium, gemeinsamen Arbeitssitzungen im Sinne von Interpretationsgemeinschaften<br />
sowie Ansätzen von (Forschungs-/Fall-) Supervision unter Einbezug aller Teilnehmenden. Angelehnt an das<br />
Modell der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn steht im Mittelpunkt das gemeinsame Arbeiten<br />
entlang eines (moderierten) Peer-to-peer-Vorgehens. Besprochen werden – je nach Anliegen und<br />
Arbeitsstand der Teilnehmenden – Exposes, Fragesammlungen/Leitfäden, Protokolle, Transkripte,<br />
Auswertungs- und Ergebnisdarstellungen. Zudem werden bei Bedarf Übungen zu Interviewführung (mit<br />
Videofeedback), Protokollierung und andere für qualitative Forschung zentrale Themen in die Treffen<br />
integriert.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Mey, Günter (2005). Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie. Köln: Kölner Studienverlag.<br />
− Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von & Steinke, Ines (2008). Qualitative Forschung. Ein Handbuch (3.<br />
Auflage). Reinbek: Rowohlt.<br />
Weitere Literatur wird auf WEB-CT bereitgestellt<br />
Hinweise<br />
Das Seminar richtet sich an Studierende aus den Studiengängen Rehabilitationspsychologie und<br />
Kindheitswissenschaften. Sollten mehr als 15 Interessierte beim ersten Termin anwesend sein, wird nach<br />
Vorstellung der Themen, Arbeitsstand und Anliegen der Kreis der Teilnehmenden (gemeinsam) festgelegt.<br />
80
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Vertiefung - Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik<br />
Voraussetzung: Teilnahme ist nur möglich, wenn die Einführungsveranstaltung belegt wurde (Sem.<br />
4 u. 6)<br />
Lehrende/r: Katja Seidel<br />
Umfang: 1 Gruppe Dienstag 14-16 Uhr, Raum 0.22<br />
Termine 14.04, 21.04., 28.04., 05.05 + 1 WE<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen und Inhalte<br />
In diesem Aufbaukurs geht es um die Frage: „Warum geht der Mensch Wagnisse und Risiken ein?“<br />
Dem wird auf Grundlage der erlebnispädagogischen Arbeitsmöglichkeiten nachgegangen. Neben<br />
entsprechenden theoretischen Ausführungen wird die praktische Umsetzung natürlich wieder eine große<br />
Rolle spielen. Weiterführende Fragen aus dem Grundkurs, neue Inhalte und Zielvorgaben werden<br />
gemeinsam geplant und umgesetzt.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.<br />
Hinweise<br />
Der Kurs ist für alle offen, die im SoSe 2008 am Grundkurs teilgenommen haben. Die Anmeldung erfolgt<br />
verbindlich bis 3. April direkt per Mail an Katja Seidel (katja.seidel@gast.hs-magdeburg.de).<br />
Wahlveranstaltung Fachenglisch II<br />
Voraussetzung: Eintritt ins Sem. 2<br />
Lehrende/r: Sieglinde Lühe<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Zeit und Raum: Mo 10-12 Uhr, Raum 1.03<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen und Inhalte<br />
Auffrischen solider Grundkenntnisse der engl. Sprache in mündlicher und schriftlicher Form<br />
Inhalte<br />
• Bearbeitung von Texten und Diskussion in der englischen Sprache zu verschiedenen Themen<br />
• Wiederholung grammatikalischer Schwerpunkte<br />
• Aufarbeitung landeskundlicher Themen<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
Zeitschrift „Spotlight“ oder andere interessante aktuelle Texte aus englischen oder amerikanischen Zeitungen<br />
Hinweise<br />
Bitte ein Wörterbuch mitbringen. Das Veranstaltungsangebot findet ab sechs TeilnehmerInnen statt. Die<br />
Vergabe der Teilnahmebescheinigung setzt eine regelmäßige Teilnahme voraus.<br />
81
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Fachenglisch IV<br />
Voraussetzung: Eintritt ins Sem. 4<br />
Lehrende/r: Sieglinde Lühe<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Zeit und Raum: Mi 08-10 Uhr, Raum 1.03<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
• Vertiefung der Englischkenntnisse, um eigene Meinung in mündlicher und schriftlicher Form<br />
überzeugend darzustellen<br />
• Die Abfassung von Briefen und die Einführung von typischen Wendungen beim Telefonieren<br />
gehören neben der Wiederholung grammatischer Strukturen ebenfalls zu den Lehrgangszielen bzw. -<br />
ergebnissen<br />
Inhalte<br />
• Briefe schreiben, telefonieren, diskutieren<br />
• Texte analysieren<br />
• komplexe Satzstrukturen wiederholen und anwenden<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
Aktuelle Zeitungsartikel, Zeitschrift „Spotlight“, etc.<br />
Hinweise<br />
Bitte ein Wörterbuch mitbringen. Das Veranstaltungsangebot findet ab sechs TeilnehmerInnen statt. Die<br />
Vergabe der Teilnahmebescheinigung setzt eine regelmäßige Teilnahme voraus.<br />
Wahlveranstaltung Children’s literature - Great Britain<br />
Voraussetzung: gute Englischkenntnisse und Interesse an Literatur<br />
Lehrende/r: Angret Zierenberg<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Raum: Do 8-10 Uhr (Gr. 1, für Sem. 4), Do 10-12 Uhr (Gr. 2, für alle Semester), Raum<br />
0.02<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Die Veranstaltung vermittelt Kenntnisse aus dem Bereich der englischen Kinderliteratur mit dem Ziel, die<br />
Studierenden zu befähigen, gesellschaftliche und literarische Zusammenhänge zu erkennen und diese bei der<br />
Diskussion und Interpretation von Kinderliteratur anzuwenden.<br />
Inhalte<br />
• Geschichtlicher Überblick zu Kinderbüchern in England<br />
• Märchen und traditionelle Erzählweisen<br />
• Politik und Kinderliteratur<br />
• Kinderliteratur im Viktorianischen England – u.a. Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis<br />
Carroll<br />
• Moderne englische Kinderliteratur – Beatrix Potter, Roald Dahl<br />
Literatur<br />
− Roald Dahl: ein Buch „Pflichtliteratur“<br />
82
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltug Children’s Literature – Russia and Scandinavia<br />
Voraussetzung: Good command of English; 4 th and 6 th semester students<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrende/r: Angret Zierenberg<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Thursday, 2 – 4 p m, room 1.20<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
The students gain knowledge about children’s literature/folktales in Scandinavian countries as well as Russia<br />
and learn about differences and common ground of this specific field of literature in these countries.<br />
Inhalte<br />
Beginning with some historical developments in Russia and the Nordic countries, the students get to know<br />
Alexander Pushkin and his writings for children, learn and read about Russian and Ukrainian folktales, the<br />
role of specific characters (baba yaga) and discuss examples of contemporary children’s literature of Russia.<br />
The main aspects of the literature of the Scandinavian countries include the stories of Hans Christian<br />
Andersen (Denmark), Astrid Lindgren (Sweden), contemporary children’s authors and folktales dealing with<br />
the specific nature of the Nordic culture.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
All necessary information will be given in class!<br />
Wahlveranstaltung Children’s Literature – Western and Southern Europe<br />
Voraussetzung: Good command of English and interest in literature; 4 th and 6 th semester students<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrende/r: Angret Zierenberg<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Wednesday, 12-2 p m, room 0.22<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
The students gain knowledge about children’s literature/folktales of Western and Southern European<br />
countries – especially France and Italy- and learn about differences and common ground of this specific field<br />
of literature in these countries.<br />
Inhalte<br />
Beginning with some historical developments in European countries, the students will get to know<br />
Lafontaine, Perrault, Saint-Exupéry, Collodi and others with their writings for children, learn and read about<br />
folktales and discuss examples of contemporary children’s literature.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
All necessary information will be given in class!<br />
83
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Unternehmerisches Handeln & Existenzgründung<br />
Voraussetzung: Sem. 4 und Sem. 6<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. Christian Meisel<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Di 18-20 Uhr, Breite Straße 63, R. 4.001<br />
eventuell zusätzlich ein Wochenendblock<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen und Inhalte<br />
Inhalte:<br />
• Wesentliche Aspekte des Unternehmensaufbaus<br />
• Wege in die Selbständigkeit<br />
• Relevanz und Inhalte eines Existenzgründungskonzeptes<br />
• Erstellung eines Businessplans<br />
Ziele:<br />
• Vermittlung eines fundierten Überblicks über ökonomische, rechtliche sowie betriebswirtschaftliche<br />
Zusammenhänge, wie sie im Kontext des Handelns von Unternehmen in der Gründungs- und<br />
Frühentwicklungsphase typische sind<br />
• Klärung der inhaltlichen und begrifflichen Grundlagen sowie der wesentlichen Elemente und<br />
Zusammenhänge ausgewählter Themenfelder des Gründungsmanagements<br />
• Integrative Anwendung dieses erworbenen Wissens am Beispiel eines selbständig zu entwickelnden<br />
Businessplan<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− BPW-Handbuch, Wöhe<br />
Weitere Literatur wird noch bekannt gegeben.<br />
Hinweise<br />
Die verbindliche Anmeldung zu diesem Wahlangebot findet am Anfang des Semesters statt. Bitte kommen<br />
Sie zu der ersten Session und melden sich direkt beim Dozenten an.<br />
Maximal können am Block 15 Studierende teilnehmen. Das Seminar findet ab sechs Teilnehmer/innen statt.<br />
Die Vergabe der Teilnahmebescheinigung setzt voraus, dass Sie an allen Terminen teilnehmen.<br />
84
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Familientherapie und Systemische Therapie: Theorie und Konzepte<br />
Voraussetzung: 4. Sem. und 6. Sem.<br />
Lehrende/r: Dr. Boris Friele<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie<br />
Zeit und Raum: Di 18-20 Uhr, Raum 0.02<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Ziel des Seminars ist es, pädagogische bzw. psychologische Probleme von Kindern in einer<br />
familientherapeutischen Perspektive sehen zu lernen. Dieses Verständnis wird in der Auseinandersetzung mit<br />
Fällen aus der Praxis und der Literatur erarbeitet. Dabei geht es vor allem auch um psychoanalytisches<br />
Verständnis von Familienbeziehungen. Im Verlauf des Seminars werden verschiedene<br />
familientherapeutische Ansätze besprochen. Dabei soll auch die systemische Theorie thematisiert werden,<br />
die nicht nur in der Familientherapie, sondern für die Human- und Sozialwissenschaften insgesamt zu einem<br />
Paradigma geworden ist.<br />
Das Seminar ist also Colloquium organisiert. Referate brauchen nicht gehalten werden, aber Lust auf<br />
vorbereitende Lektüre und intensiver Diskussion solltet ihr mitbringen.<br />
Inhalte<br />
Die Seminarschwerpunkte richten sich stark nach den Teilnehmerinteressen. Bisher vorgesehene Themen<br />
sind: Fallbesprechungen aus der Praxis des Dozenten, humanistische Familientherapie, psychoanalytische<br />
Denkweisen in der Familientherapie bzw. Psychoanalyse, Systemtheorie, feministische Familientherapie,<br />
Familienaufstellungen nach Hellinger.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Freud, Sigmund (1909/2000). Analyse eines fünfjährigen Knaben. [›Der kleine Hans‹]. In: Zwei<br />
Kinderneurosen. Sigmund Freud Studienausgabe, Band VIII. Frankfurt/M. (Fischer.)<br />
− Friele, Boris (2008). Psychotherapie, Emanzipation und Radikaler Konstruktivismus. Eine kritische<br />
Analyse des systemischen Denkens in der klinischen Psychologie und sozialen Arbeit. Gießen<br />
(Psychosozial-Verlag).<br />
− Ludewig, Kurt (2005). Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie.<br />
Heidelberg (Carl-Auer).<br />
− Minuchin, Salvador (1979). Familie und Familientherapie. Theorie und Praxis struktureller<br />
Familientherapie. Freiburg i. Breisgau (Lambertus).<br />
− Pfitzer, F.; Hargrave, T. D. (2005). Neue Kontextuelle Therapie. Wie die Kräfte des Gebens und<br />
Nehmens genutzt werden können. Heidelberg (Carl Auer).<br />
− Satir, Virginia; Baldwin, Michele (1988). Familientherapie in Aktion. Die Konzepte von Virginia Satir<br />
in Theorie und Praxis. (=Reihe Innovative Psychotherapie und Humanwissenschaften Bd. 37).<br />
Paderborn (Junfermann).<br />
− Walters, Marianne; Carter, Betty; Papp, Peggy; Silverstein, Olga (1995). Unsichtbare Schlingen. Die<br />
Bedeutung der Geschlechterrollen in der Familientherapie. Eine feministische Perspektive. Stuttgart<br />
(Klett-Cotta).<br />
Hinweise<br />
Es hat sich bewährt, dieses Seminar 14-tägig in doppelten Einheiten (ca. 18 bis 21 Uhr) stattfinden zu lassen.<br />
Näheres zur Organisation wird in der ersten Sitzung besprochen.<br />
Sie müssen sich zu diesem Seminar verbindlich bis zur 17. KW anmelden. Einschreibelisten hängen an der<br />
Bürotür von Frau Schnurrer aus. Das Veranstaltungsangebot findet ab sechs TeilnehmerInnen statt.<br />
Teilnahme wird nur bei regelmäßigem Besuch bestätigt. Angebot steht auch den Reha-Studierenden offen.<br />
85
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung „Lektürekurs Bourdieu:<br />
Männliche Herrschaft – als paradigmatische Form der<br />
symbolischen Gewalt“<br />
Voraussetzung: 4. Sem. und 6. Sem.<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. Maureen Maisha Eggers<br />
Umfang: Blockveranstaltung<br />
Zeit und Ort: 2 WE-Blocks (Fr./Sa.) 12./13.06.09 und 10./11.07.09, R. 2.16<br />
Fr von 10-16 Uhr und Sa von 11-17 Uhr<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Aus Sicht der Kindheitswissenschaften werden wir erarbeiten inwiefern Bourdieu’s herrschaftskritische<br />
Analyse zum Verständnis der Krisenhaftigkeit der Lebensphase Adoleszenz beitragt. Wir werden die<br />
Erklärungskraft einer verstrickenden (Selbst-) Vergesellschaftung diskutieren anhand biographischer und<br />
medialer Beispiele.<br />
Inhalte<br />
In diesem Kompaktseminar werden wir uns mit Bourdieu’s „Männliche Herrschaft“ auseinandersetzen. Wir<br />
werden grundlegende Begriffe und Konzepte aus Bourdieu’s Analyse des Geschlechterverhältnisses (die<br />
Doxa, das Unbewusste, die somatisierte Herrschaft, die sanfte Gewalt) darlegen und diskutieren. Dabei<br />
werden wir vor allem die herausragende Rolle des Körpers in Bourdieu’s Arbeit ergründen und<br />
konkretisieren. Zwei Aspekte werden im Fokus stehen; erstens, die Frage nach der Mittäterschaft von Frauen<br />
und zweitens, Bourdieu’s Fokus auf die Bürde von Männlichkeit (das Gefangensein in der eigenen<br />
Herrschaft und der Zwang zur Beteiligung an männlichen Spielen).<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Bourdieu, Pierre. 2005. Die männliche Herrschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp<br />
− Bourdieu, Pierre. 1997b. Eine sanfte Gewalt. Pierre Bourdieu im Gespräch mit Irene Dölling und<br />
Margareta Steinrücke. In: Dölling, Irene und Beate Krais (Hg.). Ein alltägliches Spiel.<br />
Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S.218-230.<br />
− Dölling, Irene. 2004. Männliche Herrschaft als paradigmatische Form der symbolischen Gewalt. In:<br />
Steinrücke, Margareta (Hg.). Pierre Bourdieu. Politisches Forschen, Denken und Eingreifen. Hamburg:<br />
VSA. S. 74-90.<br />
Hinweise<br />
Die verbindliche Anmeldung zu diesem Wahlangebot findet am Anfang des Semesters statt. Maximal<br />
können 25 Studierende (15 KiWis und 10 Rehas) teilnehmen. Melden Sie sich bitte bis Mitte April an.<br />
Die Vergabe der Teilnahmebescheinigung setzt voraus, dass Sie an beiden Wochenendterminen teilnehmen.<br />
Eine Eintragung ins Moodle der <strong>Hochschule</strong> ist für alle Teilnehmer_innen verbindlich:<br />
http://moodle.hs-magdeburg.de/moodle/<br />
86
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Ästhetische Bildung und ästhetische Erfahrung in der Praxis<br />
Voraussetzung: Teilnahme am ersten Kurs (Ausnahmen möglich)<br />
Lehrende/r: Prof. Dr. habil. Joachim Bröcher<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Blockveranstaltung<br />
Fr., 24.04. (R. 0.22), Sa., 09.05. (R. 0.21) sowie Fr./Sa. 05./06.06 (R.0.21) jeweils<br />
von 10-17 Uhr<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen/Inhalte<br />
Kinder drücken sich spontan über Gestaltungen und Bildnereien aus. Auch im Spiel verarbeiten sie, was sie<br />
erleben, was sie beflügelt oder was sie bedrückt und ihre Entwicklung mitunter vor Herausforderungen stellt.<br />
Prozesse des Spiels, der Imagination und Gestaltung lassen sich in pädagogisch-bildenden, präventiven<br />
sowie in therapeutisch-rehabilitativen Kontexten nutzen, um die persönliche Entwicklung von Kindern zu<br />
fördern. Im Zentrum des Seminars steht der Erwerb von Kenntnissen zur bildnerischen Entwicklung,<br />
Sonderentwicklungen und kulturelle Unterschiede eingeschlossen, sowie zu kindzentrierten und<br />
lebensweltorientierten Ansätzen und Verfahren ästhetischer Bildung.<br />
Nach dem Erarbeiten von theoretischen Grundlagen im Wintersemester 2008/2009 geht es nun um die<br />
ästhetische Selbst-Erfahrung, d.h. um Malen, Collagieren, das Herstellen von Objekten u.a.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Bröcher, J.: Kunsttherapie als Chance. Erfolgreiche ästhetisch-gestalterische Verfahren in (sonder-)<br />
pädagogischen Handlungsfeldern. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2006<br />
− Richter-Reichenbach, K.-S.: Identität und ästhetisches Handeln. Präventive und rehabilitative<br />
Funktionen ästhetischer Prozesse. Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1992 (Auswahl)<br />
Hinweise<br />
Auch wenn es sich um eine Fortsetzungsveranstaltung handelt, können dennoch maximal 5 neue<br />
TeilnehmerInnen aufgenommen werden. Bei Interesse, bitte Prof. Bröcher direkt kontaktieren.<br />
87
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Lebendige und authentische Beziehungen gestalten -<br />
Gewaltfreie Kommunikation im beruflichen und persönlichen Alltag<br />
Voraussetzung: Sem. 4 und Sem. 6<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrende/r: Barbara Leitner<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: 2 WE-Termine: 08./09. Mai und 26./27. Juni jeweils von 10-17 Uhr<br />
R. 2.16 (08./09. Mai) und R. 0.09 u. 0.22 (26./27. Juni)<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Das Seminar bietet eine erste Einführung in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Sich<br />
selbst und die anderen zu schätzen – das ist die Voraussetzung für Verbindung und damit erfolgreiches<br />
Handeln. In Konflikt- oder Krisensituation allerdings verlieren wir schnell den Kontakt, weil es in unserer<br />
Kultur viel vertrauter ist, den anderen oder uns selbst abzuwerten.<br />
Die wertschätzende Kommunikation konzentriert sich auf das, was uns wichtig ist: Wir werden uns unserer<br />
Werte bewusst, kommunizieren sie ehrlich und öffnen uns für die Werte der anderen. Auf dieser Basis kann<br />
Verständnis erreicht und können Vereinbarungen getroffen werden – zur Zufriedenheit aller. Damit<br />
bekommen die Studierenden ein Instrumentarium an die Hand, um sich sowohl im beruflichen als auch<br />
persönlichen Alltag authentischer und erfolgreicher zu verhalten.<br />
Inhalte<br />
• Die Grundannahmen und das Herangehen der GFK werden anschaulich und spielerisch dargestellt<br />
und der Unterschied zur herkömmlichen, oft nicht als gewaltvoll wahrgenommenen Sprache der<br />
Wertung und Urteile erläutert.<br />
• Wir üben, wie man beobachtet ohne zu werten, welche Rolle Gefühle und Bedürfnisse für die GFK<br />
spielen und wie man eine Bitte formuliert – als Grundlage dafür, empathisch mit uns selbst und mit<br />
anderen zu sein.<br />
• Wir lernen, Ärger vollständig auszudrücken, Schuld und Scham zu verwandeln und die<br />
Gedankenmuster dahinter wahrzunehmen. Dann ist es möglich, sich auch im Konfliktfall klar<br />
auszudrücken, zu sagen, was wir brauchen und worum wir bitten, ohne Abwehr und<br />
Feindseeligkeiten zu wecken.<br />
• Zugleich ist die GFK ein Weg, um Kritik und Vorwürfe empathisch zu hören und dadurch auch mit<br />
Andersdenken oder „Feinden“ in Verbindung zu bleiben.<br />
Während der vier Seminartage wechseln sich Input, Rollenspiele und Kleingruppenarbeit ab.<br />
Eine Einladung für alle, die lernen wollen, das Ja hinter einem Nein zu hören.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Junfermann Verlag<br />
− Marshall B. Rosenberg: Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation. Ein Gespräch mit Gabriele<br />
Seils. Herder Verlag<br />
Hinweise<br />
Es können maximal 16 Studierende teilnehmen.<br />
88
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Wahlveranstaltung Einführung in SPSS<br />
Voraussetzung: Sem. 4 oder Sem. 6<br />
Verwendbarkeit: StG Angewandte Kindheitswissenschaften<br />
Lehrende/r: André Strahl<br />
Umfang: 2 SWS<br />
Zeit und Ort: Dienstag, 14-16 Uhr, Raum 2.12 (PC-Pool)<br />
Lernergebnisse/Kompetenzen<br />
Die Studierenden erlernen ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit SPSS. Ziel ist es, dass sie in<br />
der Lage sind eigenständig Datenmasken zu erstellen, Daten zu analysieren und die Ergebnisse zu<br />
interpretieren. Dabei werden den Studenten ausgewählte Verfahren aus der deskriptiven und der<br />
Inferenzstatistik näher gebracht. Darüber hinaus werden die Methoden der Datenauswahl sowie<br />
Datentransformierung näher vermittelt.<br />
Inhalte<br />
Aufbau des Programmsystems, Anlage von Variablen- und Datenmasken, Datenauswertungen auf<br />
deskriptiver Ebene, Erstellen von Graphiken, Bearbeitung von Datensätzen, wie Auswahl von Fällen,<br />
Umkodierungen und berechnen neuer Variablen und inferenzstatistische Analysen.<br />
Studienmaterial/Literatur<br />
− Bühl, A. & Zöfel, P. (2005). SPSS 12. Einführung in die Datenanalyse unter Windows. Pearson<br />
Studium: New York<br />
− Brosiusm, F. (2007). SPSS fürDummies - Statistische Analyse statt Datenchaos. WILEY-VCH:<br />
Weinheim<br />
− Janssen, J., Laatz, W. (2007). Statistische Datenanalyse mit SPSS für Windows. Heidelberg: Springer.<br />
Hinweise<br />
An dieser Wahlveranstaltung können maximal 20 Studierende teilnehmen.<br />
89
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
1. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M1 Zugang zum Studium der Kindheitswissenschaften<br />
LE1: Einführung in das Hochschulstudium<br />
LE2: Biographiearbeit: Das Kind, das ich mal war<br />
LE3: Gesundheitspraxis – Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung<br />
LE4: Fachenglisch<br />
SB2/M1 Grundlagen sozialwissenschaftlicher Kindheitsforschung I<br />
LE1: Geschichte der Kindheit<br />
LE2: Einführung in die Sozialisationstheorie, Soziologie und Anthropologie der Kindheit<br />
SB2/M2 Grundlagen des Verhaltens und Erlebens und deren Entwicklung I<br />
LE1: Einführung in die Allgemeine Psychologie<br />
LE2: Entwicklung in der frühen Kindheit und im Vorschulalter<br />
SB2/M3 Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht I<br />
LE1: Theorie und Geschichte von Bildung und Erziehung<br />
LE2: Pädagogik der frühen Kindheit<br />
SB2/M4 Gesundheitswissenschaften und Kindergesundheit<br />
LE1: Das Kind unter gesundheitswissenschaftlichen Aspekten<br />
LE2: Kindliche Entwicklung, Krankheit und Behinderung<br />
SB3/M1 Grundlagen der Sozial- und Familienpolitik<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M1 8 Ü 8 1 SeB b/nb<br />
SB2/M1 4 S 3 1 K o. 1 HA bnt<br />
SB2/M2 4 S 5 1 K o. 1 HA bnt<br />
SB2/M3 4 S 5 1 K o. 1 HA bnt<br />
SB2/M4 4 S 5 1 K o. 1 MP bnt<br />
SB3/M1 4 S 4 1 K bnt<br />
Legende zum Regelstudienplan:<br />
HA = Hausarbeit S = Seminar bzw. Seminare<br />
K = Klausur SB = Studienbereich<br />
LE = Lehreinheit SeB = Seminarbeitrag<br />
LV = Lehrveranstaltung(en) SWS = Semesterwochenstunde<br />
MP = Mündliche Prüfung Ü = Übung bzw. Übungen<br />
P = Projekt V = Vorlesung bzw. Vorlesungen<br />
PraxBe = Praxisbericht bnt = benotet<br />
ProjBe = Projektbericht b/nb = bestanden / nicht bestanden<br />
R = Referat u. = und<br />
o. = oder (Bekanntgabe der Prüfungsleistung am Anfang des Moduls)<br />
90
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
2. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M2 Wissenschaftliches Schreiben und Vortragen<br />
SB2/M5 Grundlagen sozialwissenschaftlicher Kindheitsforschung II<br />
LE1: Kinder und Kindheit im gesellschaftlichen Kontext<br />
LE2: Stabilität und Wandel familiarer Lebensformen<br />
SB2/M6 Grundlagen des Verhaltens und Erlebens und deren Entwicklung II<br />
Von den nachfolgenden LE sind eine LE aus LE 1 bis LE 2 und LE 3 zu wählen:<br />
LE1: Einführung in die Sozialpsychologie<br />
LE2: Einführung in die Persönlichkeitspsychologie<br />
LE3: Entwicklung im Schulalter und in der Adoleszenz<br />
SB2/M7 Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht II<br />
LE1: Pädagogische Aspekte der mittleren und späten Kindheit und des Jugendalters<br />
LE2: Sozialpädagogische Theorie und Praxis<br />
SB2/M8 Humanbiologische Aspekte kindlicher Entwicklung<br />
LE1: Einführung in die Neurowissenschaften<br />
LE2: Einführung in die Genetik<br />
SB4/M1 Institutions- und Praxisanalyse I: Organisation von Erziehungs-, Bildungs- und<br />
Gesundheitsinstitutionen und deren Praxis<br />
inkl. 4-wöchiges Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M2 4 Ü 4 1 SeB b/nb<br />
SB2/M5 4 S 4 1 K o. HA bnt<br />
SB2/M6<br />
4 5 bnt<br />
LE1 (2) S (1 K o. 1 HA)<br />
LE2 (2) S (1 K o. 1 HA)<br />
LE3 2 S 1 K o. 1 HA<br />
SB2/M7 4 S 5 1 K o. 1 R bnt<br />
SB2/M8 4 S 5 1 K bnt<br />
SB4/M1 2 S<br />
(u. praktisches<br />
Studienprojekt)<br />
7 1 PraxBe b/nb<br />
91
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
3. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M3 Kindheitswissenschaftliche Reflexionen I: Begegnungen mit der Praxis<br />
SB2/M9 Bedeutung von Beratung und Kommunikation von/mit Familien<br />
LE1: Theoretische Grundlagen von Beratung<br />
LE2: Familienbildung und –beratung<br />
SB2/M10 Kindheit? Kindheiten! Einschluss der Differenz<br />
Von den nachfolgenden LE sind LE 1 und LE 2 und eine LE aus LE 3 bis LE 4 zu wählen:<br />
LE1: „Diversity Studies“ am Beispiel von sozialer und ethnischer Herkunft sowie der<br />
Geschlechterverhältnisse<br />
LE2: Soziale Inklusion<br />
LE3: „Diversity Studies“ am Beispiel der Gesundheit im Kindes- und Jugendalter<br />
LE4: „Diversity Studies“ am Beispiel der Bildungsungleichheiten<br />
SB3/M3 Rechtsgrundlagen kindheitswissenschaftlichen Handelns<br />
LE1: Einführung in das Recht unter besonderer Berücksichtigung<br />
kindheitswissenschaftlich relevanter Bereiche<br />
LE2: Nationale und internationale Kinderrechte und deren Umsetzung in die Kinder-/<br />
Jugendpolitik<br />
SB4/M3 Institutions- und Praxisanalyse II: Systeme im internationalen Vergleich<br />
Aus den folgenden LE ist eine auszuwählen:<br />
LE1: Erziehungs- und Bildungssysteme im intern. Vergleich<br />
LE2: Gesundheitssysteme für Kinder im intern. Vergleich<br />
inkl. 4-wöchiges Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M3 4 Ü 4 1 SeB b/nb<br />
SB2/M9 4 S 5 1 HA o. 1 R bnt<br />
SB2/M10<br />
6 9 bnt<br />
LE1 2 S 3 gemeinsame<br />
LE2 2 S 3 PL in LE 1 u. LE<br />
2:<br />
1 HA o. 1 R<br />
LE3 (2) S (3) 1 HA o. 1 R<br />
LE4 (2) S (3) 1 HA o. 1 R<br />
SB3/M3 4 S 5 1 K o. 1 HA bnt<br />
SB4/M3 2 7 b/nb<br />
LE1 (2) S 1 SeB u.<br />
1 PraxBe<br />
LE2 (2) S 1 SeB u.<br />
1 PraxBe<br />
92
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
4. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M4 Kindheitswissenschaftliche Reflexionen II: Thematiken der Kindheitswissenschaften im<br />
Selbstbezug<br />
SB2/M11 Sexualität im Kindes- und Jugendalter<br />
SB2/M12 Problematiken kindlicher und jugendlicher Lebensführung<br />
Von den nachfolgenden LE sind zwei auszuwählen:<br />
LE1: Drogen/Sucht/Suchtprävention<br />
LE2: Devianz und Delinquenz<br />
LE3: Erfahren von Gewalt<br />
SB2/M13 Kinderleben und Kinderkulturen<br />
Von den nachfolgenden LE sind LE 1 und LE 2 und eine LE aus LE 3 bis LE 8 zu wählen:<br />
LE1: Kinderleben und Spiel<br />
LE2: Kinderleben und Sprache, Kommunikation, Schriftkultur<br />
LE3: Kinderleben und Medien<br />
LE4: Kinderleben und Kunst, Musik und Literatur<br />
LE5: Kinderleben und Ernährung/Bewegung/Sport<br />
LE6: Kinderleben und Religion<br />
LE7: Kinderleben und Architektur/Städtebau/Verkehr<br />
LE8: Kinderleben und Umwelt<br />
SB2/M14 Forschungsmethoden I:<br />
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung<br />
SB3/M2 Grundlagen der Ökonomie des Bildungs- und Gesundheitswesens<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M4 4 Ü 4 1 SeB b/nb<br />
SB2/M11 2 S 3 1 SeB b/nb<br />
SB2/M12<br />
4 6 bnt<br />
LE1 (2) S (3) 1 HA o. 1 R<br />
LE1 (2) S (3) 1 HA o. 1 R<br />
LE1 (2) S (3) 1 HA o. 1 R<br />
SB2/M13<br />
6 9<br />
LE1 2 S 3 1 R o. 1 HA bnt<br />
LE2 2 S 3 1 R o. 1 HA bnt<br />
LE3 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
LE4 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
LE5 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
LE6 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
LE7 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
LE8 (2) S (3) 1 SeB b/nb<br />
SB2/M14 4 S u. Ü 5 1 K bnt<br />
SB3/M2 2 S 3 1 K o. 1 HA bnt<br />
93
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
5. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M5 Management auf kindheitswissenschaftlich relevanten Arbeitsfeldern I: Finanzierung,<br />
Controlling, Personal<br />
SB2/M14 Projektstudium<br />
SB2/M16 Forschungsmethoden II:<br />
Methoden kindheitswissenschaftlicher Handlungsforschung<br />
SB4/M4 Institutions- und Praxisanalyse III: 3. praktisches Studienprojekt<br />
6-wöchiges Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
SB4/M5 Methoden im professionellen Feld I: Methoden der Konfliktmediation<br />
SB4/M7 Gesundheitsförderung und Prävention im Kinder- und Jugendalter<br />
LE1: Sozialkompensatorische Interventionen<br />
LE2: Kindergesundheitsziele, deren Umsetzung und Evaluation auf lokaler, nationaler und<br />
internationaler Ebene<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M5 4 S 4 1 K bnt<br />
SB2/M14 4 P 5 1 ProjBe b/nb<br />
SB2/M16 4 S u. Ü 5 1 K o. 1 HA bnt<br />
SB4/M4 - - 9 1 PraxBe b/nb<br />
SB4/M5 2 Ü 2 1 SeB b/nb<br />
SB4/M7 4 S 5 1 K o. 1 R bnt<br />
94
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für die Jahrgänge 2 und 3<br />
6. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
SB1/M6 Management auf kindheitswissenschaftlich relevanten Arbeitsfeldern II: Leitung, Strategie<br />
und Projekte<br />
SB2/M17 Forschungsmethoden III: Methoden der Evaluation<br />
SB4/M6 Methoden im professionellen Feld II: Zusammenarbeit mit Familien und professionellen<br />
Instanzen<br />
SB4/M8 Sozialraumorientierung und Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen<br />
SB4/M9 Praxisreflexion und aktuelle Entwicklungen in kindheitswissenschaftlich relevanten<br />
Bereichen<br />
Von den nachfolgenden LE ist eine auszuwählen :<br />
LE1: Kindheit der Zukunft<br />
LE2: Familie der Zukunft<br />
LE3: Schule der Zukunft<br />
LE4: Außerschulische Angebote der Zukunft<br />
LE5: Naturwissenschaftliche Perspektiven der Zukunft<br />
- Bachelor-Arbeit<br />
Teilmodul 1: Begleitveranstaltungen zur Bachelor-Arbeit<br />
Teilmodul 2: Bachelor-Arbeit und Kolloquium<br />
Code LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
SB1/M6 4 S 4 1 K bnt<br />
SB2/M17 2 Ü 3 1 K bnt<br />
SB4/M6 2 Ü 3 1 SeB b/nb<br />
SB4/M8 2 S 3 1 K o. 1 R bnt<br />
SB4/M9<br />
2 3 b/nb<br />
LE1 (2) Ü (3) 1 R o. 1 K<br />
LE2 (2) Ü (3) 1 R o. 1 K<br />
LE3 (2) Ü (3) 1 R o. 1 K<br />
LE4 (2) Ü (3) 1 R o. 1 K<br />
LE5 (2) Ü (3)<br />
14<br />
1 R o. 1 K<br />
2 Ü (2) 1 SeB b/nb<br />
- - (12) 1 Bachelor-<br />
Arbeit und 1<br />
Kolloquium<br />
bnt<br />
95
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
1. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
1.1 Zugang zum Studium der Kindheitswissenschaften<br />
Aus den folgenden Angeboten sind drei zu wählen:<br />
LV1: Einführung in das Hochschulstudium<br />
LV2: Biographische Arbeit<br />
LV3: Gesundheitspraxis<br />
LV4: Fachenglisch<br />
1.2 Kinder und Kindheit im gesellschaftlichen Kontext – Soziologie I<br />
1.3 Verhalten, Erleben, Entwicklung: Psychologie I<br />
LV1: Einführung in die Allgemeine Psychologie<br />
LV2: Einführung in die Entwicklungspsychologie<br />
1.4 Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht I<br />
1.5 Gesundheitswissenschaften und Kindergesundheit I<br />
1.6 Politik I: Sozial- und Familienpolitik<br />
Nr. LV SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
1.1<br />
6 Ü 6 1 SB b/nb<br />
LV1 (2) (2)<br />
LV2 (2) (2)<br />
LV3 (2) (2)<br />
LV4 (2) (2)<br />
1.2 4 S 6 1 H/R/M bnt<br />
1.3<br />
4 S 6 bnt<br />
LV1 2 3 1 K/R/H<br />
LV2 2 3 1 SB<br />
1.4 2 S 3 1 SB bnt<br />
1.5 4 S 6 1 K/H/R bnt<br />
1.6 2 S 3 1 K/M/R bnt<br />
∑ 22 30<br />
Legende zum Regelstudienplan:<br />
H = Hausarbeit S = Seminar bzw. Seminare<br />
K = Klausur SB = Studienbereich<br />
LV = Lehrveranstaltung SB = Seminarbeitrag<br />
LV = Lehrveranstaltung(en) SWS = Semesterwochenstunde<br />
M = Mündliche Prüfung Ü = Übung bzw. Übungen<br />
P = Projekt V = Vorlesung bzw. Vorlesungen<br />
PPB = Praxisprojektbericht bnt = benotet<br />
PB = Projektbericht b/nb = bestanden / nicht bestanden<br />
R = Referat u. = und<br />
/ = oder (Bekanntgabe der Prüfungsleistung am Anfang des Moduls)<br />
96
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
2. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
2.1 Kinder und Kindheit im gesellschaftlichen Kontext – Soziologie II<br />
2.2 Verhalten, Erleben, Entwicklung: Psychologie II<br />
LV1: Vertiefung Entwicklungspsychologie (Pfl.)<br />
Aus den folgenden Angeboten ist eines zu wählen.<br />
LV2: Vertiefung Allgemeine Psychologie<br />
LV2: Einführung in die Persönlichkeitspsychologie<br />
LV3: Einführung in die Sozialpsychologie<br />
2.3 Bildungs- und Erziehungsprozesse aus pädagogischer Sicht II<br />
2.4 Politik II: Kinderpolitik und Kinderrechte<br />
2.5 Praktisches Studienprojekt I<br />
inkl. 4-wöchiges Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
Nr. LV SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
2.1 4 S 6 1 H/R/M bnt<br />
2.2<br />
4 6<br />
LV1 2 S 3 1 K/R/H bnt<br />
LV2 (2) S (3) (1 SB) (b/nb)<br />
LV3 (2) S (3) (1 SB) (b/nb)<br />
LV4 (2) S (3) (1 SB) (b/nb)<br />
2.3 4 S u. Ü 6 1 H/R/K bnt<br />
2.4 4 S u. Ü 5 1 R/H/M bnt<br />
2.5 1 Ü 7 1 PPB b/nb<br />
∑ 17 30<br />
97
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
3. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
3.1 Kinderleben und Kinderkulturen I<br />
3.2 Forschungsmethoden I: Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung<br />
3.3 Kindheitswissenschaftliche Reflexionen<br />
3.4 Gleichheit und Differenz in der Kindheit – Einführung in Diversity Studies<br />
3.5 Gesundheitswissenschaften und Kindergesundheit II<br />
3.6 Internationale Bildungs- und Sozialsysteme<br />
3.7 Politik III: Rechtsgrundlagen kindheitswissenschaftlichen Handelns<br />
Nr. LV SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
3.1 4 Ü 4 1 SB b/nb<br />
3.2 4 S 6 1 SB b/nb<br />
3.3 4 S u. Ü 5 1 SB b/nb<br />
3.4 4 S u. Ü 6 1 M/H/R bnt<br />
3.5 2 S 3 1 SB b/nb<br />
3.6 2 S 3 1 R/H/K bnt<br />
3.7 2 S 3 1 R/H/K bnt<br />
∑ 22 30<br />
98
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
4. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
4.1 Kinderleben und Kinderkulturen II<br />
4.2 Projektstudium I<br />
4.3 Management auf kindheitswissenschaftlich relevanten Arbeitsfeldern I: Generalmanagement<br />
u. Projekt- und Konzeptionsentwicklung<br />
4.4 Diversität und Sexualität in der Kindheit und im Jugendalter<br />
4.5 Humanbiologische Aspekte kindlicher Entwicklung<br />
Aus den folgenen Angeboten ist eines zu wählen:<br />
LV1: Das kindliche Gehirn: Ausgewählte Aspekte der Entwicklung, Funktionsfähigkeit und<br />
Intervention<br />
LV2: Die Neue Genetik und Public Health<br />
4.6 Politik IV: Partizipation<br />
4.7 Praktisches Studienprojekt II<br />
inkl. 4 Wochen Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
Nr. LE SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
4.1 2 Ü 2 1 SB b/nb<br />
4.2 4 Ü 6 1 PB b/nb<br />
4.3 4 S 5 1 M/R/K bnt<br />
4.4 2 Ü 3 1 SB b/nb<br />
4.5<br />
2 S 3 1 R/M/H bnt<br />
LV1 (2) (3)<br />
LV2 (2) (3)<br />
4.6 4 S u. Ü 4 1 H/R/M bnt<br />
4.7 1 Ü 7 1 PPB b/nb<br />
∑ 19 30<br />
99
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
5. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
5.1 Kinderleben und Kinderkulturen III<br />
5.2 Projektstudium II<br />
5.3 Management auf kindheitswissenschaftlich relevanten Arbeitsfeldern II: Sozialmanagement<br />
5.4 Forschungsmethoden II: Methoden der Kinder-/Kindheitsforschung<br />
5.5 Möglichkeitsräume der Adoleszenz<br />
5.6 Praktisches Studienprojekt III<br />
inkl. 6-wöchiges Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit<br />
Nr. LV SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
5.1 2 Ü 2 1 SB b/nb<br />
5.2 4 Ü 6 1 PB b/nb<br />
5.3 2 S 3 1 K/M/R bnt<br />
5.4 4 S u. Ü 4 1 H/R/M b/nb<br />
5.5 4 S u.Ü 6 1 SB b/nb<br />
5.6 1 Ü 9 1 PPB b/nb<br />
∑ 17 30<br />
100
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Regelstudienplan B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“<br />
für den Jahrgang 4 (und folgende)<br />
6. Semester (B.A. „Angewandte Kindheitswissenschaften“)<br />
6.1 Kinderleben und Kinderkulturen IV<br />
6.2 Schwerpunkte und Anwendungsfelder kindheitswissenschaftlichen Handelns<br />
Aus diversen Angeboten sind jeweils eines mit 4 SWS und eines mit 2<br />
SWS zu wählen.<br />
6.3 Differenz als Herausforderung und Überforderung<br />
6.4 Reflexion und Veränderung pädagogischer Praxis<br />
6.5 Bachelor-Arbeit<br />
-Begleitveranstaltungen zur Bachelor-Arbeit<br />
-Bachelor-Arbeit und Kolloquium<br />
Nr. LV SWS Art d. LV Credits Prüfungs-<br />
Leistung<br />
Bewertung<br />
6.1 2 Ü 4 1 SB b/nb<br />
6.2 6 S 6 2 SB b/nb<br />
6.3 2 Ü 3 1 H/K/R bnt<br />
6.4 4 S u. Ü. 5 1 H/R/M bnt<br />
6.5<br />
14<br />
2 Ü (2) 1 SB b/nb<br />
- - (12) 1 Bachelor-<br />
Arbeit und 1<br />
Kolloquium<br />
bnt<br />
∑ 16 30<br />
101
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Verwaltung / zentrale Einrichtungen<br />
Prorektorat<br />
Prorektor: Prof. Dr. Wolfgang Patzig<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Büro: 1.07<br />
Telefon: (03931) 2187-4840<br />
Telefax: (03931) 2187-4870<br />
eMail: wolfgang.patzig@hs-magdeburg.de<br />
Mitarbeiterin: Katrin Hlawati<br />
Büro: 2.22<br />
Telefon: (03931) 2187-4813<br />
Telefax: (03931) 2187-4870<br />
eMail: katrin.hlawati@hs-magdeburg.de<br />
Dekanat<br />
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang Maiers<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Büro: 1.21<br />
Telefon: (03931) 2187-4811<br />
Telefax: (03931) 2187-4870<br />
eMail: dekan@hs-magdeburg.de<br />
Mitarbeiterinnen: Heike Müller Katrin Hlawati<br />
Büro: 2.21 2.22<br />
Telefon: (03931) 2187-4811 (03931) 2187-4813<br />
Telefax: (03931) 2187-4870 (03931) 2187-4870<br />
eMail: heike.mueller@hs-magdeburg.de<br />
eMail: katrin.hlawati@hs-magdeburg.de<br />
Öffnungszeiten: 8.00 – 14.00 Uhr<br />
102
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Immatrikulations- und Prüfungsamt<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Ansprechpartnerin: Antje Dierschke (KiWi und Reha)<br />
Büro: 2.23<br />
Telefon: (03931) 2187-4863<br />
Telefax: (03931) 2187-4870<br />
eMail: antje.dierschke@hs-magdeburg.de<br />
Öffnungszeiten: in der Vorlesungszeit:<br />
Dienstag: 09.30 – 12.00 Uhr<br />
14.00 – 16.00 Uhr<br />
Mittwoch: 14.00 – 16.00 Uhr<br />
Donnerstag: 09.30 – 12.00 Uhr<br />
Freitag: 09.30 – 12.00 Uhr<br />
in der vorlesungsfreien Zeit:<br />
Dienstag: 09.30 – 12.00 Uhr<br />
14.00 – 16.00 Uhr<br />
Donnerstag: 09.30 – 12.00 Uhr<br />
Praktikumsangelegenheiten<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Ansprechpartnerin: Doreen Falke<br />
Büro: 2.02<br />
Telefon: (03931) 2187-4829<br />
eMail: doreen.falke@hs-magdeburg.de<br />
Akademisches Auslandsamt<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Ansprechpartnerin: Franziska Heinrich<br />
Büro: 2.02<br />
Telefon: (03931) 2187-4831<br />
eMail: franziska.heinrich@hs-magdeburg.de<br />
Zentrum für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI)<br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Ansprechpartnerin: Kerstin Seela<br />
Büro: 2.11<br />
Telefon: (03931) 2187-4839<br />
eMail: kerstin.seela@hs-magdeburg.de<br />
Öffnungszeiten: während der Vorlesungszeit:<br />
Montag – Donnerstag: 07.30 – 20.00 Uhr<br />
Freitag:<br />
während der vorlesungsfreien Zeit:<br />
07.30 – 18.00 Uhr<br />
Montag – Donnerstag: 07.30 – 16.00 Uhr<br />
Freitag:<br />
Arbeitstage vor Feiertagen bis 16.00 Uhr<br />
07.30 – 15.00 Uhr<br />
103
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Bibliotheken<br />
Hochschulbibliothek <strong>Stendal</strong><br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH), Osterburger Str. 25<br />
39576 <strong>Stendal</strong><br />
Ansprechpartnerin: Petra Beier<br />
Telefon: (03931) 21 87 48 21<br />
eMail: petra.beier@hs-magdeburg.de<br />
Telefon: (03931) 21 87 48 80<br />
eMail: bibliothek@hs-magdeburg.de<br />
Öffnungszeiten der Ausleihtheke:<br />
während der Vorlesungszeit:<br />
Montag – Donnerstag: 09.00 - 16.00 Uhr<br />
Freitag: 09.00 - 14.00 Uhr<br />
während der vorlesungsfreien Zeit:<br />
Montag: geschlossen<br />
Dienstag – Donnerstag: 09.00-12.00 Uhr<br />
13.00-16.00 Uhr<br />
Freitag: 09.00-12.00 Uhr<br />
Erweiterte Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit:<br />
Montag – Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr<br />
Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr<br />
104
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Hochschulbibliothek <strong>Magdeburg</strong><br />
Anschrift: <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)<br />
Haus 1<br />
Breitscheidstr. 2<br />
39114 <strong>Magdeburg</strong><br />
Telefon: (0391) 886 4182 / 4333<br />
Telefax: (0391) 886 4185<br />
eMail: bibliothek@hs-magdeburg.de<br />
Öffnungszeiten der Ausleihtheke:<br />
während der Vorlesungszeit:<br />
Montag: 11.00 – 18.00 Uhr<br />
Dienstag und Donnerstag: 09.00 – 18.00 Uhr<br />
Mittwoch: 09.00 – 16.00 Uhr<br />
Freitag: 09.00 – 14.00 Uhr<br />
während der vorlesungsfreien Zeit:<br />
Montag: geschlossen<br />
Dienstag und Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr<br />
Mittwoch: 10.00 – 18.00 Uhr<br />
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr<br />
Erweiterte Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit:<br />
Montag – Donnerstag: 18.00 - 19.00 Uhr<br />
Universitätsbibliothek <strong>Magdeburg</strong><br />
Anschrift: Universitätsplatz 2<br />
Gebäude 30<br />
39106 <strong>Magdeburg</strong><br />
Telefon: (0391) 6 71 86 40<br />
Telefax: (0391) 6 71 11 35<br />
eMail: bibliothek@ovgu.de<br />
Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 09.00 – 21.00 Uhr<br />
Sonnabend: 09.00 – 15.00 Uhr<br />
Hausmeisterdienst<br />
Herr Hintzke, Herr Knope, Herr Skopp<br />
Telefon: 03931. 2187-4842<br />
105
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Notizen<br />
106
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Notizen<br />
107
Studienführer des Studiengangs Angewandte Kindheitswissenschaften SoSe 2009 <strong>Hochschule</strong> <strong>Magdeburg</strong>-<strong>Stendal</strong> (FH)/Standort <strong>Stendal</strong><br />
Terminplan für das Sommersemester 2009<br />
Semesterbeginn: 01.04.2009<br />
Vorlesungsbeginn: 01.04.2009<br />
Lehrveranstaltungsfreie Zeit in Verbindung<br />
mit Feiertagen:<br />
Ostern: 10.04.-14.04.2009<br />
Maifeiertag: 01.05.2009<br />
Christi Himmelfahrt: 21.05.-22.05.2009<br />
Pfingsten: 01.06.2009<br />
Ende der Vorlesungszeit: 24.07.2009<br />
Semesterende: 30.09.2009<br />
Rückmeldung für das WiSe 2009/2010: 06.07.2009 - 31.07.2009<br />
Prüfungstermine werden durch Aushang und im Internet bekannt gegeben.<br />
Kalender 2009<br />
108