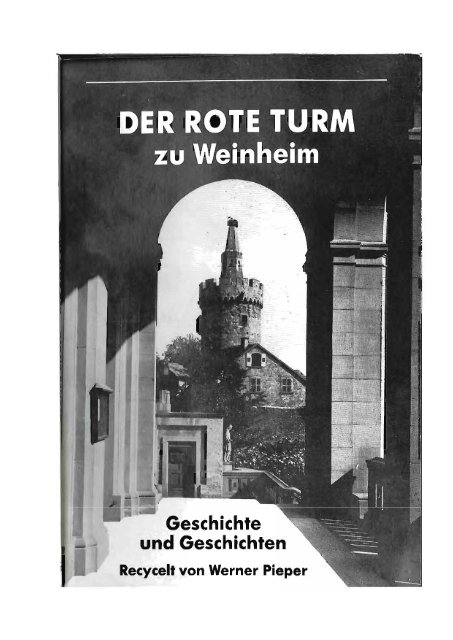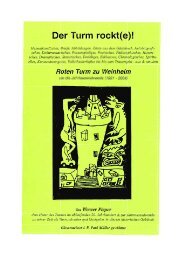Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim
Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim
Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschichte<br />
unld Geschichten<br />
Recycelt von Werner Pieper
DER ROTE TURM<br />
<strong>zu</strong> Wein11eim<br />
Geschichte & Geschichten<br />
Recycelt von Werner Pieper
Inhalt<br />
7 Das Steinheim von <strong>Weinheim</strong>: bautechnische Daten<br />
9 Vorwort<br />
12 Zum Namen des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />
14 Kopf runter, Augen auf: eine <strong>Turm</strong>besteigung<br />
17 <strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> im Laufe der Zeit<br />
27 Um den <strong>Turm</strong> herum:<br />
Wachsen und Werden <strong>Weinheim</strong>s, eine Stadtchronik<br />
31 <strong>Weinheim</strong> als Spielball der Mächte<br />
33 <strong>Weinheim</strong>er <strong>Turm</strong>lied<br />
34 Das Leben im <strong>Turm</strong><br />
39 Jonathan Wolrab und der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, erzählt von Micky Remann<br />
56 Zur Geschichte der Gerichte<br />
62 Gauner, Gott und Galgen<br />
65 Flora und Fauna im, am und auf dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />
69 Künstler erobern den <strong>Turm</strong><br />
76 Quellen- und Literaturliste<br />
76 Commercials<br />
78 Lesetips
Bilder - und Faksimile Verzeichnis<br />
Stadtarchiv <strong>Weinheim</strong>: Umschlagfoto, S. 17, 19, 22, 35, 59, 68<br />
Manfred Maser, Fotos S. 1, 67 oben<br />
Norika Nienstedt: S. 2, 43 (mit Bertram Jesdinsky), 71 (Marken), 73<br />
<strong>Der</strong> Rodensteiner, S. 6<br />
Oona Leganovic: S. 8<br />
Werner Pieper: S. 11, 13, 15, 16, 37, 67 unten<br />
Paul Müller: S. 20<br />
Merian Stick: S. 27<br />
R. Rippchen Archiv: S. 30, 63<br />
Weiß: 57<br />
Gästebuch Galerie "<strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>": Gedicht S. 71,73,74<br />
örtliche Zeitung (?): S. 72<br />
Unbekannt: S. 75 (Montage W. P.)<br />
Faksimile S. 70 von Lothar Griesbach<br />
Faksimile 71- 75, Archiv "Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>"<br />
Impressum<br />
DER ROTE TURM<br />
Redaktion: Werner Pieper<br />
Inhaltliche Mithelfer: siehe Vorwort<br />
Satz: Petra Petzo1d, Heidelberg<br />
Gestaltung Umschlag & Inhalt: Petra Petzold & Werner Pieper<br />
Druck: Maro, Augsburg<br />
Verlegt durch:<br />
Werner Pieper's Medienexperimente<br />
Alte Schmiede<br />
D-6941 Lährbach<br />
AUe Rechte bei den jeweiligen Autoren<br />
ISBN 3 -922708 - 11 - 0
Das Steinheim von <strong>Weinheim</strong>:<br />
Bautechnische Daten<br />
Höhe: 30 m<br />
Umfang unten: 22 m<br />
Umfang oben innerhalb der Zinnen: 21 m<br />
Alter des Urturms: ca. 700 Jahre<br />
Grundriß: kreisfönnig<br />
Durchmesser der Stockwerke innen: ca. 3 m<br />
Gänge: ca. 70 cm breit, 1,57- 2.15 m hoch<br />
Baurnaterial: roter Sandstein, wahrscheinlich aus dem Odenwald<br />
Eigenart: die Wendeltreppe führt innerhalb der dicken Mauern nach oben<br />
Neigung: der <strong>Turm</strong> beugt sich ca. 40 cm gen Westen<br />
7
TUrm m il Taube.
Vorwort<br />
Im Andenken an Wilhelm Fabricius<br />
Wer, wie ich, nicht mehr am Ort seiner Kindheit wohnt, tut gut daran,<br />
<strong>zu</strong>r ltneuen Heimat« einen persönlichen Be<strong>zu</strong>g her<strong>zu</strong>stellen. »The sense of<br />
place«, das Gefühl eines Ortes <strong>zu</strong> erspÜIen, kann eine sehr faszinierende<br />
Angelegenheit werden, wenn man sich da<strong>zu</strong> aufrafft, den ver paßten Heimatlcundeunterricht<br />
auf eigene Faust nach<strong>zu</strong>holen.<br />
Mich hat es vor 25 Jahren in die Gegend zwischen Ulfenbach, Neckar<br />
und Weschnitz verschlagen. Aus meinem Interesse für die Heidelberger<br />
Geschichte wuchsen zwei Bücher (siehe Anzeigenteil des Buches). Nun,<br />
<strong>Turm</strong> sei Dank, ergab sich die Möglichkeit, auch im Fluß der <strong>Weinheim</strong>er<br />
Geschichte fischen <strong>zu</strong> gehen.<br />
Norika Nienstedt und Sharon Levinson vom »Freundeskreis <strong>Rote</strong>r<br />
<strong>Turm</strong>« überließen mir temporär den Schlüssel <strong>zu</strong> selbigem <strong>Turm</strong>, damit ich<br />
mich dort als <strong>Turm</strong>schreiber versuchen könne, so wie es sie auch in anderen<br />
vergleichbaren Türmen gibt, oft gar von der jeweiligen Stadt bezahlt.<br />
Wie es Schreiberlingen so eigen ist, griff ich sofort <strong>zu</strong> und fing an <strong>zu</strong><br />
recherchieren. Schnell wurde mir klar, daß man so ein Bauwerk nicht isoliert<br />
von Stadtgeschichte und Umgebung kennenlernen und verstehen<br />
kann. So befragte ich kundige Freunde und Einheimische, schloß mich<br />
einige Zeit im <strong>Turm</strong> ein, stöberte im Stadtarchiv und im Museum, las mich<br />
durch die Heimatbücher und machte mir einen Reim draus. Das Ergebnis<br />
liegt hiermit vor. Alie Texte des Buches, auch der von Micky Remann, sind<br />
im <strong>Turm</strong> entstanden.<br />
Hauptsächlich richtet sich dieses Buch natürlich an <strong>Weinheim</strong>erinnen<br />
und <strong>Weinheim</strong>er, ist es doch ihr <strong>Turm</strong>, ihr »Liebling«, wie es in der einschlägigen<br />
heimatkundlichen Literatur immer wieder <strong>zu</strong> lesen steht.<br />
Aber auch aUSWärtige Besucher sollen mit dieser Schrift angesprochen<br />
werden, daher hier noch ein paar Worte über <strong>Weinheim</strong> als Ort. <strong>Weinheim</strong><br />
an der Bergstraße ist dank der dünnen Erdschicht der Rheinebene (und<br />
der zeitgenössischen AufheizW1g der Ebene durch die Industrie vor allem<br />
in Mannheim und Ludwigshafen) einer der wärmsten Orte Deutschlands.<br />
Lieblich liegt die Stadt »amphitbeatrisch am Busen eines Berges«, notierte<br />
schon ein Heimatforscher vor vielen Jahren. In einer großen Untersuchung<br />
in den 80er Jahren, welche wohl die attraktivste deutsche Stadt zwischen<br />
40 - 100000 Einwohnern sei, belegte <strong>Weinheim</strong> Platz eins. <strong>Der</strong> Name hat<br />
nichts mit Wein <strong>zu</strong> tun, sondern stammt vom Wortstamm »win« = Freund.<br />
9
Im 17. Jahrhundert, als die Stadt das Salzmonopol und die Universität ihr<br />
eigen nannte, schien <strong>Weinheim</strong> auf dem Weg <strong>zu</strong> einer großen Metropole<br />
<strong>zu</strong> sein; niemand würde heute von Heidelberg und Mannheim reden.<br />
Glücklicherweise ging dieser Kelch an uns vor bei.<br />
So verbauen keine Wolkenkratzer den Blick von und auf den <strong>Rote</strong>n<br />
<strong>Turm</strong>, jenen Tower of Power inmitten der Weinheirner Altstadt (die eigentlich<br />
die Neustadt ist, aber da<strong>zu</strong> mehr weiter hinten im Buch).<br />
Altersschät<strong>zu</strong>ngen den <strong>Turm</strong> betreffend schwanken zwischen 750 und<br />
650 Jahren. Vor ca. 250 Jahren wurde er letztmals als Stadtbefestigungsanlage<br />
genutzt, vor genau 150 Jahren wurde er als Kerker geschlossen. Damals<br />
schrieb der <strong>Weinheim</strong>er Heimatforscher A. L. Grimm folgende, auch<br />
heute noch beherzigenswerte Worte über den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>:<br />
»Möge nur ein guter Geist die städtische Verwaltung leiten, damit die<br />
unserer Zeit eigene Sucht nach temporärem materiellem Gewinne oder<br />
nichtsachtende Gleichgültigkeit nicht auch in dieses schöne Denkmal der<br />
Vorzeit die zerstörende oder entstellende Hand legen. Denn so, wie er ist,<br />
ist dieser <strong>Turm</strong> die schönste Zierde der Gegend, und der Eingang in die<br />
Stadt gewinnt durch ihn seinen eigentümlichen Reiz, was schon manche<br />
Künstler darum auch veranlaßte, ihr Talent daran <strong>zu</strong> versuchen.« (10)<br />
Seit 1970 versuchen immer wieder Künstler, mit dem düsteren Karma<br />
des ehemaligen Kerkers <strong>zu</strong>recht<strong>zu</strong>kommen. Die <strong>Weinheim</strong>er Bevölkerung<br />
hatte in all den Jahrhunderten selten Gelegenheit, den <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> erklimmen,<br />
ohne Kerkerhaft oder <strong>zu</strong>mindest Kunst ertragen <strong>zu</strong> müssen. Das lag sicherlich<br />
mehr an den fast immer verschlossenen Türen als am guten Willen,<br />
wie es auch 1986 in der »Communale« nachlesbar war:<br />
»Die kommen, wenn die Tür offen steht. Die jungen - und die Alten. Um<br />
den <strong>Turm</strong>, den sie zeitlebens verschlossen vor Augen hatten, jetzt von<br />
innen kennen<strong>zu</strong>lernen. Und welch ein Erlebnis. Notgedrungen wird hier<br />
>Raum< als Wahrnehmungsdimension bewußt. Von außen unübersehbar ein<br />
phallisches Symbol, geht's drinnen in engen, weiß getünchten, leicht gewundenen<br />
Röhren - den Geburtskanal? - rauf und runter. Ein Überblick ist<br />
nicht möglich, die dicken Mauem schirmen fast jedes Geräusch, auch Licht<br />
ab. Sich bis <strong>zu</strong>r nächsten Nische vor tasten, zwischen Neugierde und Platzangst:<br />
spannend. «<br />
Ab sofort wird der Forderung der Bürger und dem Wunsch der Kinder<br />
nachgekommen und der <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>r Sommerszeit an einigen Wochenenden<br />
<strong>zu</strong>gänglich gemacht. Um den immer wiederkehrenden Fragen aus<strong>zu</strong>weichen,<br />
habe ich nun die Ergebnisse meiner Recherche in Buchform darniedergelegt.<br />
Getreu dem Motto von Theo Pinkus »Grab wo du stehst«<br />
habe ich während der Arbeit an dieser Schrift über die <strong>Weinheim</strong>er Stadtgeschichte,<br />
das Leben und Leiden der Bevölkerung durch die jahrhunderte,<br />
schröcldiche Geschichten über die Rechtsbarkeit und die Kerkerzeit<br />
des <strong>Turm</strong>es und vieles andere gelernt. Möge die Lektüre dieses Buches<br />
einiges davon vermitteln.<br />
Micky Remann, der vor jahren schon einmal bei Veranstaltungen des<br />
10
Zum Namen<br />
des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />
Urkundlich wird der <strong>Turm</strong> erstmals 1504 als »Neuer <strong>Turm</strong>« erwähnt. Nicht<br />
klar allerdings ist, ob mit dem »Alten <strong>Turm</strong>« ein Vorläufer an selber Stelle<br />
oder der Blaue Hut gemeint war.<br />
<strong>Der</strong> Blaue Hut hat seinen Namen nach dem dunklen Schieferdach - das<br />
er mal hatte. Kaum einem <strong>Weinheim</strong>er, den ich darauf ansprach, war bislang<br />
aufgefallen, daß auch dieser <strong>Turm</strong> irgendwann rot gedeckt worden ist.<br />
Da war das Denkmalschutzamt wohl auf Betriebsausflug.<br />
<strong>Der</strong> Volksmund bietet zwei Namenserklärungen <strong>zu</strong>m <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>:<br />
1.: · der <strong>Turm</strong> hatte früher ein rotes Dach (jenes, das 1708 abgedeckt wurde;<br />
2.: der Name bezieht sich auf die roten Sandsteinquader, aus denen der<br />
<strong>Turm</strong> erbaut wurde.<br />
Bemerkenswert eine Parallele <strong>zu</strong> Bensheim, wo es auch einen blauen<br />
und einen roten <strong>Turm</strong> gab:<br />
»Wir gelangen <strong>zu</strong> dem vorhin bereits erwähnten > Bürgerturm< , früher auch<br />
>Rotherturm< genannt. ( ... ) Er befindet sich noch in gutem Zustand. Neben<br />
seinem Verteidigungswert hatte er auch die Aufgabe, Bürger und Bürgerinnen,<br />
die sich gegen das Gesetz vergangen hatten, als Häftlinge in seine<br />
Mauern auf<strong>zu</strong>nehmen. Sie sollten während ihrer <strong>Turm</strong>strafe nicht mit >anderem<br />
Gesindel< <strong>zu</strong>sammenkommen, das anderswo untergebracht war.<br />
Damit ist für die Bezeichnung des 'furrnes eine einwandfreie Erklärung gefunden.«<br />
(4)<br />
Nach allen Unterlagen, die ich einsehen konnte, war die Gefangenenverteilung<br />
in <strong>Weinheim</strong> ebenso: die Bürger in den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, »minderes<br />
Volk« in das dumpfe tiefe Loch im Blauen <strong>Turm</strong>.<br />
Da sich nicht mehr eruieren läßt, wann der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> seinen Namen<br />
von wem bekam, müssen wir auf Forschungsergebnisse <strong>zu</strong>rückgreifen, um<br />
einer Wahrheit näher<strong>zu</strong>kommen:<br />
»Wann damit begonnen wurde, Friedhöfe und Gerichtsplätze, aber<br />
auch Spielplätze als >rote Orte< <strong>zu</strong> bezeichnen und durch rote Farbe <strong>zu</strong><br />
kennzeichnen, wissen wir nicht. Die Spuren führen in die vorgeschichtliche<br />
Zeit. Bis <strong>zu</strong>m heutigen Tag wird die rote Farbe mit der RechtsprechWlg in<br />
Zusammenhang gebracht. Ln manchen mittelalterlichen Städten waren Gefängnisse<br />
und Stätten der Gerichtsbarkeit rot bemalt oder wenigstens als<br />
>roter Ort< benannt. In der Schweiz, in Österreich, Bayern und Sachsen gab<br />
es zahlreiche rote Türme oder rote Tore, die mit der Gerichtsbarkeit <strong>zu</strong> tun<br />
hatten." (24)<br />
12
Vormals wurden Gerichtsveranstaltungen im Freien durchgefiihIt, auf<br />
Rothügeln, Rotbergen und in Rotgärten (wortverwandt <strong>zu</strong> »Rosengärten«).<br />
Später, als man in Gerichtsgebäude umzog I übernahmen diese auch den<br />
roten Namen. so z. B. in Wien, wo es noch heute eine <strong>Rote</strong>nturmstraße gibt.<br />
»Im roten <strong>Turm</strong> befand sich auch die Haupt-Mautstelle der Residenzstadt.<br />
Maut und Strafe waren schon immer beisammen. In einem alten<br />
Werk über die historisch bedeutsamen Häuser Wiens lesen wir: ><strong>Der</strong> Rotheturm<br />
hatte etwas Feierliches, weil Roth damals die Farbe der Gerechtigkeit,<br />
<strong>zu</strong>mal der hochnothpeinlichen Straf justiz war.
Kopf runter, Augen auf:<br />
eine <strong>Turm</strong>besteigung<br />
Etwa um 1800 wurde die Tür, durch die man den <strong>Turm</strong> heute ebenerdig<br />
betritt, eingebaut. Vorher war der Eingang rückseitig, also von der Stadtseite<br />
aus, im 1. Stock nur über die Stadtmauer <strong>zu</strong> erreichen. Das Erdgeschoß<br />
war <strong>zu</strong> jener Zeit das Kerkerverlies, in das man nur durch ein Loch<br />
im Boden des 1. Stockwerks am Seil hinunter kam. <strong>Der</strong> alte Eingang ist hinter<br />
dem Hausgiebel der Metzgerei Odenwälder von der Institutsstraße aus<br />
noch sichtbar.<br />
Schon beim Durchschreiten der Eingangstür kann man erkennen, wie<br />
dick die Mauern des <strong>Turm</strong>es sind: 2,30 bis 2,80 m.<br />
Das Erdgeschoß war <strong>zu</strong> Kerkerzeiten wahrscheinlich etwas tiefer ausgehoben.<br />
Licht fiel nur durch eine kleine Schießscharte, die heute mit vier<br />
Glasbausteinen abgedichtet ist, in den Raum. In der Mitte der Gewölbedecke<br />
erkennen wir das ehemalige Einstiegsloch. Eine neunstufige Holztreppe<br />
führt uns in den Wendelgang. Nach weiteren zehn Steinstufen im<br />
Wendelgang erreichen wir den 1. Stock.<br />
Das Fenster im Gang zeigt links nach Norden. Das Zimmer im 1. Stock<br />
ist als einziges im <strong>Turm</strong> kein Durchgangszimmer und hat ein nach Süden<br />
zeigendes Fenster. In eine Wand ist ein Regal eingebaut worden.<br />
Im 22stufigen Gang <strong>zu</strong>m 2. Stock befindet sich ein weiteres Fenster, die<br />
Fenster im Raum selber zeigen nach Westen und nach Osten. Zum weiteren<br />
Aufstieg muß man den Raum durchqueren und kann dabei ein weiteres<br />
ehemaliges Loch in der Decke entdecken. Wo<strong>zu</strong> dieses diente, ist heute<br />
nicht mehr nachvollziehbar.<br />
. Im Aufgang <strong>zu</strong>m 3. Stock wieder eine mit Glasbausteinen <strong>zu</strong>gemauerte<br />
Sichtluke. Auch dieser Abschnitt der Wendeltreppe hat 22 Stufen. Die Fensteranordnung<br />
im 3. Stockwerk ist identisch mit der im 2. Stock, Hier sind<br />
allerdings die Wände seit 1971 mit Holz vertäfelt.<br />
Vor dem Eingang <strong>zu</strong>m Raum befindet sich links der Aborterker, oder im<br />
Volksmund: das Plumpsklo, das man ja auch von außen sehen kann, von wo<br />
es wie ein Schwalbennest an den <strong>Turm</strong> geklatscht erscheint. Nutzbar ist<br />
dieses Klo allerdings nicht mehr, da der früher darunter verlaufende Stadtgraben<br />
<strong>zu</strong>geschüttet wurde und sich der heutige Eingang unter dem Erker<br />
befindet. Im Kloraum befindet sich auch noch ein <strong>zu</strong>zementiertes Ofenrohrloch.<br />
Unklar ist jedoch, wie und von wo aus der <strong>Turm</strong> früher beheizt<br />
wurde.<br />
Auch im Durchgangsraum des 3. Stockwerks können wir drei nachträg-<br />
14
lieh <strong>zu</strong>gemauerte Stellen<br />
erkennen: an der Decke<br />
und rechts vom Eingang<br />
sowohl in der Wand wie<br />
auch am Boden.<br />
Noch zwanzig Stufen,<br />
und man hat den Dachrundgang<br />
erreicht. Man<br />
betritt ihn durch einen<br />
erst im letzten Jahrzehnt<br />
installierten Blechtüraufsatz,<br />
ein potthäßliches<br />
Ding. das einen ungehinderten<br />
Rundgang innerhalb<br />
der Zinnen unmöglich<br />
macht. Zudem setzt<br />
ihm die Taubenscheiße<br />
arg <strong>zu</strong>. Vormals war hier<br />
eine Falltür. Zukünftig bitte<br />
auch wieder, alle<br />
Tunnbesteiger werden<br />
dankbar sein.<br />
OK. Es ist vollbracht.<br />
Wir sind oben angelangt.<br />
und nun eröffnet sich uns<br />
ein wundervoller Rundblick:<br />
von den »neuen Tür<br />
<strong>Der</strong> Aufgang.<br />
men« (Kirche und Schloßturm)<br />
über die ehrwürdige Libanon-Zeder, dann in die Rheinebene. Unter<br />
uns der Staudengarten Hermannshof und die Altstadt. Dann die nördliche<br />
Bergstraße und schließlich. ungewöhnlich nah erscheinend, Hirschkopf,<br />
Wachenberg und die Windeck. Weiter schweift der Blick ins Gorxheimer<br />
Tal. dahinter der Odenwald. Über den Dächern Wipfel des Exotenwaldes<br />
und schließlich wieder die Türme. Vom Marktplatz hört man geschäftiges<br />
Treiben, vom Minigolfplatz schallt ab und an ein Triumphgeschrei.<br />
Man ist von zwölf Zinnen umgeben. die zwischen 1,70 und 1,80 m hoch<br />
sind. Von den vier Wasserspeiern sind drei erst im 19. Jahrhundert angebaut<br />
worden. auf alten Bildern ist nur der in Richtung Osten <strong>zu</strong> erkennen.<br />
Vor wenigen Jahren wurden zwei der Wasserspeier unerklärlicherweise<br />
<strong>zu</strong>zementiert. Da der Boden uneben ist, stehen nach jedem Regen große<br />
Pfützen auf dem Rundgang, deren Feuchtigkeit auch ins Gemäuer übergreift.<br />
<strong>Der</strong> Zinnenumgang ist außen mit einem Fries geschmückter Spitzbogensteine<br />
gefaßt. Als sich 1952 einige der Steine lösten. erneuerte man<br />
den ganzen Umgang, faßte die Tunnspitze mit einem Eisenreifen und<br />
brachte rundum ein neues Fries an.<br />
16
Oben auf dem <strong>Turm</strong> thront eine sechseckige Spitzpyramide, in der Tauben<br />
hausen. Diese Pyramide trug vor l708 das ehemalige Runddach, das<br />
damals verrottete und nie wieder erneuert wurde. Oben auf der Pyramide<br />
ist noch das Storchennest <strong>zu</strong> erkennen, das aber nun seit 40 Jahren verwaist<br />
ist.<br />
Die meisten Tunnbesteiger atmen erst einmal tief durch, wenn sie des<br />
<strong>Turm</strong>es Spitze erklommen haben. Wobei sich nicht immer sagen läßt, ob<br />
dies der schönen Aussicht oder des rotierenden Kreislaufs wegen geschieht.<br />
So manchem scheinen Zivilisationsmoden wie das Rauchen wie ein<br />
Ballast die ungeübte Beinmuskulatur <strong>zu</strong> lähmen. Die Kinder sind immer als<br />
erste oben. Nicht nur mißmutige Besteiger stoßen sich beim Abstieg häufig<br />
den Kopf: der enge und niedrige Gang zwingt vor allem beim Abstieg <strong>zu</strong><br />
einer demütigen Haltung.<br />
Das Gurren der Tauben, die aus den ehemaligen Schießscharten<br />
Scheißscharten gemacht haben, klingt bei jedem Kopfstoß an die Gangdecke<br />
wie ein höhnisches Gelächter. Angesteckt davon reimte der Poet<br />
Ronald Rabchen, <strong>Weinheim</strong> aus der Taubenperspektive der <strong>Turm</strong>spitze<br />
betrachtend, spontan:<br />
<strong>Der</strong> Mensch<br />
vom <strong>Turm</strong><br />
sieht aus<br />
wie'n Wurm.<br />
Daß der <strong>Turm</strong> nicht immer nur als Inspiration genutzt wurde, davon zeugt<br />
das folgende Kapitel.<br />
16<br />
Blick von der Zinne.
Etwa 1800 wurde die ebenerdige Tür eingebaut, die bis heute als Eingang<br />
benutzt wird. Wahrscheinlich war der alte Eingang durch den Abbruch<br />
der Stadtmauer un<strong>zu</strong>gänglich geworden. 1m Jahr 1807 durchbrachen<br />
Napoleons Truppen die Stadtmauer am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, um Platz für die heutige<br />
»<strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Straße« <strong>zu</strong> schaffen.<br />
Wurde der <strong>Turm</strong> nun auch nicht mehr <strong>zu</strong>m Schutz gegen den äußeren<br />
Feind benötigt, so diente er doch noch bis <strong>zu</strong>m Jahr 1841 und darüber hinaus<br />
als Gefängnis für die inneren Feinde.<br />
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> als Gefängnis unmodern<br />
geworden. 1841 war deshalb in unmittelbarer Nachbarschaft das<br />
neue Gefängnis gebaut worden, das die <strong>Weinheim</strong>er, wie das alte, »die<br />
Heck« nannten. Den Namen hatten beide Kerker vom Kerkermeister Heck,<br />
der seinen Dienst in beiden Gefängnissen leistete. <strong>Der</strong> Neubau war bei<br />
den <strong>Weinheim</strong>ern nicht wohl gelitten.<br />
}) Über 50 Jahre lang kämpften <strong>Weinheim</strong>s Bürger gegen den rötlichen<br />
Sandstein-Koloß bei der Einmündung der Grabengasse in die <strong>Rote</strong>-<strong>Turm</strong><br />
Straße: Schon 1912 äußerten die Stadtväter in einem Schreiben an das<br />
Großherzogliehe Amtsgericht den Wunsch, daß das Amtsgefängnis, das<br />
mitten in der neu entstehenden Gartenstadt ein Schandfleck sei, >in den<br />
nächsten fünf Jahren beseitigt wirddie Heckdie Heckdie Heck< <strong>zu</strong> kommen, aus der<br />
1927 schon die letzten echten Gefangenen nach Mannheim umgesiedelt<br />
worden waren.« (7)<br />
Zu den »unbequemen Bürgern« gehörte 1945 auch Oberforstmeister<br />
Wilhelm Fabricius, der hier ohne Anklage und ohne Urteil einige Tage und<br />
Nächte verbrachte.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> hingegen wurde vermehrt <strong>zu</strong>m Lieblingsmotiv vieler<br />
Künstler, wie eine kleine Bilderauswahl in diesem Buch und folgende Zeitungsnotiz<br />
aus dem» <strong>Weinheim</strong>er Anzeiger« vom 8.11.1864 beweist:<br />
»November 8. - Wir lesen: Ein Kunstfreund dankt von der ungarischen<br />
Grenze seinen <strong>Weinheim</strong>er Verwandten für die >schönen Kunstprodukte<<br />
die Photographien von W. Den, die sich, lsowohl durch Feinheit der Ausführung<br />
als durch gelungene Wahl der Aufnarunepunkte auszeichnen und<br />
ähnliches in Breslau Angefertigtes in den Hintergrund stellen.< Namentlich<br />
wird die >vielberufene Ansicht des rothen Thurmes< als vollendet bezeichnet.<br />
<strong>Der</strong>selbe schreibt außerdem, daß er die Gesundheit seiner <strong>Weinheim</strong>er<br />
>Leute< dort in Lützelsachsener Rothen, der neben dem Burgunder<br />
18
Gemälde des Heidelberger Malers Philip Fohr. ca. 1820.<br />
servirt wurde, getrunken. habe. Also Pflege auf unseren Rothen verwandt,<br />
beim Bau und der Behandlung!«<br />
Immer wieder mußte die Stadt dafür sorgen, daß die Zähne der Zeit<br />
nicht <strong>zu</strong> arg am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> nagten:<br />
30. Oktober 1909: <strong>Der</strong> obere Aufbau des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>s wurde renoviert<br />
und neu verputzt. Eventuell sind die drei <strong>zu</strong>sätzlichen Wasserspeier damals<br />
installiert worden. Mit Sicherheit wurden die Holztreppe und die untere<br />
Tür erneuert.<br />
1929: Die Stadt gab nochmals 2.147 Mark für die <strong>Turm</strong>renovierung an<br />
den Gipser Kari Bander aus.<br />
Auch die Denkmalspflege kümmert sich um ihn: 1911 wird von höherer<br />
Stelle um eine Auflistung der Baudenkmäler der Stadt gebeten, unter denen<br />
sich folglich auch der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> befand; 1919 erging die Warnung und<br />
Bitte, auch »in diesen schweren Zeiten« die Baudenkmäler <strong>zu</strong> schützen, <strong>zu</strong><br />
erhalten und nicht etwa die Steine derselben für andere Bauvorhaben alternativ<br />
<strong>zu</strong> benützen.<br />
Aber auch die Bürger trugen Sorge um ihren Liebling. So erregte man<br />
sich schon 1913 über angebrachte Graffitti (»Wände verkritzeln«).<br />
19
Zu Anfang der Nazizeit traf sich die Hitlerjugend im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, jedoch nur<br />
für kurze Zeit. Wurden sie <strong>zu</strong> zahlreich oder wollten sie nicht als »<strong>Rote</strong><br />
<strong>Turm</strong> Zelle« gelten? Aber auch in der Braunen Zeit hatte der <strong>Turm</strong> seinen<br />
Stellenwert. Hier zwei Dokumente von 1938 und aus dem Kriegsjahr 1943<br />
mit tröstlichen Formulierungen wie: »Seine dicken Mauern dürften auch im<br />
heutigen Krieg noch mancher Bombe standhalten.«<br />
Die unerschütterliche Wehrhaftigkeit wurde entsprechend genutzt:<br />
»Im 2. Weltlaieg hat der leicht schräge <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> die wertvollsten<br />
Stücke des Heimatmuseums beherbergt, vor allem die Fresken aus der<br />
alten Peterskirche: Sie sollten vor den Luftangriffen bewahrt werden.« (7)<br />
Die nächsten Überlieferungen stammen aus dem Jahr 1952:<br />
Mauerabsturz vom <strong>Rote</strong>n Tunn.<br />
Am Mittwoch abend glaubte man im Odenwäldersehen Anwesen unterhalb<br />
des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es nicht anders, es sei eine Bombe in das Nebengebäude<br />
gefallen. Es war etwa 19.30 Uhr, also schon bei Dunkelheit, so daß<br />
der Hof glücklicherweise von Kindern frei war, die sonst dort <strong>zu</strong> spielen<br />
pflegen. Als man der Ursache des plötzlichen schweren Schlages und Gepolters<br />
nachging, stellte man fest, daß vom <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> zentnerschwere<br />
Steinbrocken herabgefallen waren. Die Vermutung lag nahe, daß dies im<br />
Zusammenhang mit der Erneuerung des Storchennestes geschehen sein<br />
könnte. Es war jedoch nicht so. Das Mauerwerk war unterhalb des Kranzes,<br />
bis <strong>zu</strong> dem man hinaufsteigen kann, losgebröckelt und hatte das Dach des<br />
darunterstehenden Speichers von Odenwälder durchschlagen. Auch in<br />
den Hof waren Steinbrocken gefallen. Das <strong>Turm</strong>zimmer war früher einmal<br />
für Jugend<strong>zu</strong>sammenkünfte benutzt worden. Möglicherweise hängt der<br />
Gesteinsabsturz damit <strong>zu</strong>sammen. Die Steine lösten sich unmittelbar über<br />
dem Ofenrohr, das vom genannten Raum aus ins Freie geführt wurde. (12)<br />
<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, einer unserer ältesten »Bewohner«'.<br />
Die alarmierende Nachricht vom Absturz schwerer Mauerbrocken des <strong>Rote</strong>n<br />
<strong>Turm</strong>s wird viele veranlaßt haben, sich einmal die Bescherung <strong>zu</strong> betrachten,<br />
die uns dieser fast älteste »Bewohner« unserer Stadt bereitet hat.<br />
Es ist nicht das erste Mal, daß sich Steine losgelöst haben, und es wird wohl<br />
jetzt ganz energisch gegen die Gefahrenquellen vorgegangen werden<br />
müssen. Vor allem wird <strong>zu</strong> untersuchen sein, ob der Mauerkranz unterhalb<br />
der <strong>Turm</strong>byüstung altersschwach geworden ist. Wenn sich die Blicke der<br />
an dem Vorfall Interessierten über das eiserne Hoftor in der Institutsstraße<br />
nach dem Giebel des beschädigten Hauses richten, nimmt man etwas unterhalb<br />
davon in der <strong>Turm</strong>mauer den oberen Teil eines <strong>zu</strong>gemauerten Törchens<br />
wahr, das in früheren Zeiten einmal eine große Rolle gespielt hat. Es<br />
war, so seltsam es auch klingen mag, bis in das letzte Jahrhundert hinein<br />
der einzige Zugang in den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> gewesen. Von hier aus führte wie<br />
23
auch auf der Windeck eine Brüstung aus Holz, die auf steinernen Konsolen<br />
ruhte, im Halbkreis, um den der Stadt <strong>zu</strong>gewandten Teil des <strong>Turm</strong>es herum.<br />
Um <strong>zu</strong> diesem Törchen und <strong>zu</strong> der einstigen Brüstung <strong>zu</strong> gelangen,<br />
mußte man <strong>zu</strong>erst auf die Brustwehr hinaufsteigen, die oben auf der alten<br />
Stadtmauer um die ganze Stadt herumführte. In alten Ratsakten ist gelegentlich<br />
von einer Staffel die Rede, auf der in diesem Winkel der Stadt der<br />
Aufstieg <strong>zu</strong>r alten Brustwehr möglich war. Bestimmt konnte man auch beim<br />
Niedertor, das zwischen der Engelapotheke und dem Pflaum'schen Hause<br />
stand, die Brustwehr besteigen, die dann zweifellos um den <strong>Rote</strong>n Tunn<br />
herum auf der Stadtmauer <strong>zu</strong>m alten übertor geführt hat. So konnten in der<br />
»guten alten Zeit« die einstigen Stadtsoldaten auf der Mauer, geschützt<br />
durch die Brustwehr herumpatrollieren und von hier oben aus die Stadt bewachen.<br />
Eines ihrer Wach lokale dürfte sich im ersten Stock des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />
befunden haben, <strong>zu</strong> dem sie ebenen Fußes durch das jetzt <strong>zu</strong>gemauerte<br />
Törchen gelangten. Man könnte annehmen, daß sich der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong><br />
durch seine gewaltsamen Aktionen das vom Giebel des Odenwäldersehen<br />
Hauses verdeckte, einst so wichtige Törchen wieder freikämpfen möchte.<br />
Und es wäre vielleicht <strong>zu</strong> erwägen, ob man dem alten Gesellen den Gefallen<br />
tun und den erneuerungsbedürftigen Giebel etwas vom <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>rückstellen<br />
und den Blick auf das interessante Tor freigeben sollte. (11)<br />
Erstaunlich, daß selbige Hausbewohner, die Metzgerei Odenwälder, heut<strong>zu</strong>tage<br />
keine Geschichte, keine Anekdote über wen steinernen Nachbarn<br />
<strong>zu</strong> erzählen haben.<br />
Einige Jahre war es ruhig um den <strong>Turm</strong>, bis im Herbst 1969 Hans Albrecht<br />
Pflästerer im Auftrag der Deutsch-evangelischen Jungenschaft beim<br />
damaligen Bürgermeister Engelbrecht nachfragte, ob die Jungen den<br />
<strong>Turm</strong> nicht <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt bekommen könnten. <strong>Der</strong> Bürgermeister<br />
unternahm mit dem Stadtbaumeister Kleefoot eine <strong>Turm</strong>besichtigung und<br />
antwortete am 28.10.1969 wie folgt<br />
»Es liegt mir nunmehr der Bericht des Herrn Stadtbaumeisters vor, wonach<br />
dann, wenn an eine Überlassung der drei übereinander liegenden<br />
Räumlichkeiten, die durch schmale in der Umfassungsmauer liegende steinerne<br />
Treppen verbunden sind, gedacht ist, nachstehende Arbeiten erforderlich<br />
wären:<br />
1. Wandputz erneuern und weißeln.<br />
2. Fensterinstandset<strong>zu</strong>ng.<br />
3. Elektrische Beleuchtung einschl. Verkabelung (Es sind bis jetzt nur<br />
die Treppenaufgänge notdürftig beleuchtet).<br />
4. Elektr. Bezei<strong>zu</strong>ng, da Kohle- oder Kokshei<strong>zu</strong>ng nicht einbebaut werden<br />
kann.<br />
6. Erneuerung der Fußböden in den einzelnen Räumen.<br />
6. Ausbesserung von Treppenstufen aus Sicherheitsgrunden sowie Anbringung,<br />
auch aus Sicherheitsgründen, eines Handlaufs, was jedoch die<br />
engen Verhältnisse auf den Treppen noch verschlechtern würde.<br />
24
Die gesamten Kosten für alle diese Maßnahmen schätzt das Stadtbauamt<br />
auf DM 5 000.-, insbesondere deshalb, weil die für diese Herstellungsarbeiten<br />
erforderlichen Materialien nur von außen her durch Auf<strong>zu</strong>g in das<br />
Gebäude eingebracht werden können.<br />
Zu meinem großen Bedauern konune ich bei dieser Sachlage da<strong>zu</strong>, daß<br />
leider der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> doch nicht als durchaus geeignet für die Unterbringung<br />
einer Jugendgruppe erscheint und auch die entsprechenden Aufwendungen<br />
als <strong>zu</strong> erheblich angesehen werden müssen.<br />
Ich weiß, daß in einer ganzen Anzahl von Städten alte <strong>Turm</strong>- oder Stadtwehr-<br />
und Stadtmauergebäude für solche Zwecke bereitgestellt wurden<br />
und habe auch volles Verständnis für die darin liegende Romantik. Es ist <strong>zu</strong><br />
schade, daß aber unsere beiden noch einigermaßen erhaltenen Türme,<br />
Blauer Hut und <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>, wie die Untersuchung ergibt, sich nicht als geeignet<br />
erweisen.<br />
Ich hoffe, daß Sie und Ihre jungen Freunde Verständnis hierfür zeigen.«<br />
(25)<br />
Die jungen Freunde gaben sich mit des Bürgermeisters Antwort nicht <strong>zu</strong>frieden.<br />
Hans-Albert Pflästerer, heute Chef vom Dienst beim angesehenen<br />
»Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt« da<strong>zu</strong> heute: »Vor dem massiven<br />
Hintergrund dieses historischen Bauwerks sind vier Jahre ja in der Tat<br />
lächerlich. Aber die Akten [des damaligen Briefverkehrs] spiegeln doch<br />
etwas wieder von der Möglichkeit, auch Bürokratie in ihrem Beharrungsvermögen<br />
<strong>zu</strong> erschüttern. wenn man nur dranbleibt.« Er blieb dran. Am<br />
26.1.1961 wurde ein Vertrag geschlossen, in zwei Jahren bauten die jungs<br />
weitgehend mit Eigenmitteln den <strong>Turm</strong> in Hunderten von Arbeitsstunden<br />
gemäß der Erfordernisse und amtlichen Vorgaben um. H. A. Pflästerer in<br />
einem Brief an den Autor:<br />
11 Wir mußten den <strong>Turm</strong> gründlich hernehmen. Die Fenster mußten erneuert<br />
werden, sie fehlten <strong>zu</strong>m Teil. Den Handlauf gab es auch nicht. Es<br />
war keinerlei Elektrizität im <strong>Turm</strong>, wir mußten alle Leitungen neu verlegen.<br />
Die Treppe mußte gefestigt und gesichert werden, ein Handlauf mußte her.<br />
Dann mußte der <strong>Turm</strong> ganz geweißelt werden. die Wände hatten wir teilweise<br />
abriebfest mit Ölfarbe gestrichen. Schließlich war das Dach undicht.<br />
Damals schloß eine Luke den Aufgang ab, ohne diesen häßlichen Aufbau<br />
jetzt. Die Gruppe hat den <strong>Turm</strong> bis . 68 noch beseelt. «<br />
Genutzt wurde der <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> Gruppenabenden der jungenschaft und gelegentlich<br />
auch als Übernachtungsmöglichkeit, wenn auswärtige Gruppen<br />
nach <strong>Weinheim</strong> kamen. Die Einweihung wurde feierlich im Mai 1963 vorgenommen.<br />
Nachmieter waren dann im jahr 1971 die Künstler der Gruppe »Spirale«.<br />
über die mehr im Kapitel »Kunst im <strong>Turm</strong>« <strong>zu</strong> lesen ist. Sie renovierten den<br />
<strong>Turm</strong> und bauten ihn <strong>zu</strong> einer Galerie um. Lange hielt sich die »Spirale« jedoch<br />
nicht im <strong>Turm</strong>, der nach ein paar ungenutzten Jahren schließlich 1980<br />
einer jüngeren Künstlergeneration <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt wird. <strong>Weinheim</strong>s<br />
25
Puppenmacherin Norika Nienstedt veranstaltet einige schillernde Ausstellungen<br />
mit aus- und einheimischen Künstlern. Da sie wegen ihrer künstlerischen<br />
Tätigkeiten viel unterwegs ist, übernimmt ein neu gegründeter<br />
Y>Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>« die Aufsicht und Organisation der <strong>Turm</strong>-Veranstaltungen.<br />
Mehr über »Kunst im <strong>Turm</strong>« im entsprechenden Kapitel dieses<br />
Buches.<br />
Eine vorerst letzte Renovierung erlebte der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Mitte der BOer<br />
Jahre.<br />
Im Jahre 1991 durfte der Chronist <strong>zu</strong> seiner großen Freude und Inspiration<br />
die Räumlichkeiten des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es <strong>zu</strong>m Verfassen dieses Buches<br />
nutzen, wie auch Micky Remann seine Geschichte innerhalb des alten Gemäuers<br />
dem Freundeskreis erzählte.<br />
Zum Erscheinen des Buches ist geplant, den <strong>Turm</strong> an einigen Wochenenden<br />
für die Öffentlichkeit begehbar <strong>zu</strong> machen, auch ohne die »Pflicht«,<br />
drei Stockwerke Kunst in Kauf nehmen <strong>zu</strong> müssen, um einmal den Rundblick<br />
von den Zinnen genießen <strong>zu</strong> können.<br />
Und ab 1991 müssen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, diese <strong>Turm</strong>chronik<br />
eigenhändig fortführen ...<br />
Natürlich freut sich der Autor über jede ihm neue Geschichte über den<br />
<strong>Turm</strong>, die man ihm einfach unter der <strong>Turm</strong>tür durchschieben oder direkt<br />
an den Verlag senden kann.<br />
Danke.<br />
26
Um den <strong>Turm</strong> herum:<br />
Wachsen und Werden <strong>Weinheim</strong>s<br />
Merian-Slich mit noch erhaltener Windeck.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, links, trägt noch sein altes Dach.<br />
2000 v. Z. Erste Funde.<br />
1000 v. Z. Die Gallier in der Gegend.<br />
100 n. Z. Römer genießen die Gegend.<br />
? Das Dorf Winenheim entsteht an der Weschnitz, in der Gegend der<br />
Peterskirche.<br />
755 Erste urkundliche Erwähnung <strong>zu</strong>r Zeit Pippins des Kurzen.<br />
1000 <strong>Weinheim</strong> erhält das Marktrecht, hat 660 Einwohner.<br />
1065 Münzrecht.<br />
1100 Bau der Burg Windeck.<br />
1114 Schleifung derselben, da ohne Baugenehmigung erbaut.<br />
1130 Wiederaufbau der Windeck, Grundstückstausch mit dem Probst von<br />
Michelstadt: Windeck-Gebiet gegen Murnbach.<br />
1228 Erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde, die damals auch eine<br />
eigene Gerichtsbarkeit hatte. <strong>Der</strong> ]udenturm war ihr Gefängnis.<br />
27
1232 Die Region wird von den Äbten von Lorsch an den Erzbischof von<br />
Mainz übereignet. Die Pfälzer protestieren und gründen einen zweiten<br />
Ort mit dem Namen <strong>Weinheim</strong>: die heutige Altstadt, um den<br />
Marktplatz. Zwischen den beiden »<strong>Weinheim</strong>« verläuft der Steinweg,<br />
die heutige Hauptstraße.<br />
Damals wurde der Grundstein für den heutigen Ländergrenzenverlauf<br />
Hessen-Baden gelegt.<br />
1264 Neu-<strong>Weinheim</strong> erhält die Stadtrechte und baut im Anschluß daran<br />
die Stadtbefestigung inklusive dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> aus.<br />
1298 Erste ]udenvertreibung.<br />
1364 Vereinigung beider <strong>Weinheim</strong>s <strong>zu</strong>, ahem, <strong>Weinheim</strong>.<br />
1475 Die erste Schule, neben dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> und dem Kloster.<br />
1504 Erste urkundliche Erwähnung des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>s.<br />
1537 Mit dem Schloßbau wird begonnen.<br />
1547 Die Pest.<br />
1556 Großer Stadtbrand.<br />
1557 Das Kaufhaus und spätere Rathaus am Markt wird gebaut.<br />
1599 Misthaufen vor den Häusern werden verboten.<br />
1600 24 Gerberbetriebe in der Stadt, 2000 Einwohner.<br />
1601 <strong>Der</strong> Stadt wird das Salzmonopol übertragen, das Wirtschaftsleben<br />
steht in voller Blüte.<br />
1620 Merian sticht <strong>Weinheim</strong>.<br />
1622 Tilly erobert <strong>Weinheim</strong>.<br />
1648 Nur noch 1000 Einwohner, der 30jährige Krieg hat die Bevölkerung<br />
halbiert.<br />
1652 Die Stadt wirbt Neubfuger an, es werden Gastarbeiter gesucht, die<br />
mit allen Bürgerrechten geködert werden.<br />
1666 Totale Pest.<br />
1674 Die Franzosen schleifen die Burg Windeck, die tn Aufzeichnungen<br />
aus dem Jahr<br />
1685 als Ruine beschrieben wird.<br />
1719 Betteln wird verstaatlicht. Zwei »Bettelvögte« sammeln -und verteilen<br />
Nahrung für die Armen. Dabei sollen sie aufpassen, daß lIInicht Unwürdige<br />
bedacht« werden.<br />
1748 Einführung der Kartoffel, im Volksmund »Gequollene«.<br />
1760 Das Kaufhaus wird <strong>zu</strong>m Rathaus am Markt.<br />
1775 Goethe schwärmt über <strong>Weinheim</strong>: »Sieh, ein Eckchen, wo sich die<br />
Natur in gedrungener Einfalt uns mit Lieb und Fillie um den Hals<br />
wirft!«<br />
1803 <strong>Weinheim</strong> gehört <strong>zu</strong> Baden.<br />
1806 Durchbruch der Stadtmauer am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> durch napoleonische<br />
Einheiten. Bau der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Straße.<br />
1812 Gründung der <strong>Weinheim</strong>er Lesegesellschaft.<br />
Raubüberfälle und Hinrichtung des Hölzerlips und seiner Bande.<br />
Auch Wölfe machen die Gegend unsicher.<br />
28
1816 Mißernte.<br />
1817 »Böses HWlgerjahr, das denen, die es erlebten, Wlauslöschlich im Gedächtnis<br />
bleibt. « Jean Pau! <strong>zu</strong> Gast.<br />
1818 Zar Alexander aus Rußland <strong>zu</strong> Gast.<br />
1829 Die erste Lederfabrik der Stadt wird gegründet.<br />
1832 Das Fest der »Preßfreiheit« wird gefeiert. »Dem freien Wort« ist die<br />
Devise. Hat <strong>Weinheim</strong> deshalb heute so viele Verlage?<br />
183S SOOO Einwohner, Balzac <strong>zu</strong> Besuch.<br />
1836 Die Buchbinderei und Buchhandlung Schäffner wird eröffnet - am<br />
selben Platz, an dem sie heute noch besteht.<br />
1838 Eisenbahnlinie Frankfurt-Heidelberg mit Bahnhof<strong>Weinheim</strong> eröffnet.<br />
1841 Das neue Gefangnis, die »Heck«, wird erbaut. <strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> wird jedoch<br />
auch weiterhin als Knast genutzt.<br />
1843 Hoffmann von Fallersleben Wld sein Freund, der Revoluzzer Hecker,<br />
<strong>zu</strong> Gast.<br />
1844 Gründung des Weinheirner Frauenvereins.<br />
1846 Gründung der Dürre Schule. Am 28.7. wird die Main-Neckar-Eisenbahn<br />
eingeweiht.<br />
1848/49 Ein Schicksalsjahr. Die Revolution hat in <strong>Weinheim</strong> viele tatkräftige<br />
Heller. Marx und Engels kommen gemeinsam <strong>zu</strong> Besuch. <strong>Der</strong><br />
Mühlenbesitzer Fuchs, Friedrich Diesbach und andere einheimische<br />
Terroristen unternehmen Anschläge auf die Bahnlinie und lösen damit<br />
revolutionäre Kämpfe aus. (In jener Keimzelle des Aufruhrs, der<br />
Fuchs'schen Mühle, haben in den vergangenen Jahren die Bundespräsidenten<br />
Heinemann und Carstens, Willy Brandt, Lothar Späth und<br />
viele andere Prominente ihr Haupt <strong>zu</strong>r Ruh' niedergelegt.)<br />
Zurück in die Revolutionsjahre. Es wird berichtet, daß es »viele Tote«<br />
gab. Danach saßen die Reaktionäre fester irn Sattel als <strong>zu</strong>vor ...<br />
1849 Die Firma Freudenberg wird gegründet.<br />
l8S9 Die Straßenbeleuchtung wird eingeführt.<br />
1860 Freiherr von Berckheim legt den Exotenwald an, der später von Wilhelm<br />
Fabricius weiter gehegt und gepflegt wird.<br />
1863 Gründung der Diesbach Medien.<br />
1884 3-Glocken Nudeln werden erfunden.<br />
1887 Einweihung der OEG nach Mannheim (1890 nach Heidelberg).<br />
1888 Diesterwegschule wird gebaut.<br />
1891 Bau der Kanalisation.<br />
1895 Errichtung des legendären Silos der Hildebrandtschen Mühle im Birkenauer<br />
Tal, dern nun arg zerfallenden Zinnenturrn.<br />
1896 Das Telefonnetz hat 13 Anschlüsse.<br />
1900 11.167 Einwohner.<br />
1907 Erste Volksbücherei.<br />
1907 -1913 Bau der Wachenburg durch vereinigte Studentenbünde (WSC).<br />
Pachtgebühren rnüssen jährlich an der Besitzer des Wachenbergs,<br />
die Gemeinde Leutershausen, gezahlt werden: 500 DM, auf 99 Jahre.<br />
29
1910 Bau der OEG-Brücke am Galgenbuckel.<br />
1913 Theodore Bertolini, Vorfahr des Speiseeis- und Gemüsehandels der<br />
Stadt, kommt aus Italien nach <strong>Weinheim</strong> und verkauft im Winter Maroni<br />
und im Sommer Eis aus seinem mobilen Verkaufsstand am Dürreplatz.<br />
(<strong>Der</strong> erste italienische Mitbürger hieß da Plazzo und wird im<br />
Jahr 1613 registriert.)<br />
1914 Das erste Kino, das heutige »Apollo«, wird eröffnet.<br />
1923 Inflationszeit: ein Kalb kostet 810 Milliarden Mark.<br />
1926 Das »Moderne Theater« wird eröffnet.<br />
1926 Erste Schlägereien von Nazis in der Stadt.<br />
1933 <strong>Weinheim</strong> braun.<br />
1939 - 45 2. Weltkrieg. 1168 <strong>Weinheim</strong>er Krieger sterben, plus 7 Zivilisten.<br />
1942 20.000 Einwohner.<br />
1945 Am 28.3. rücken die Amerikaner ein. Im August besucht Ike Eisenhower<br />
seinen Bruder in <strong>Weinheim</strong> (<strong>zu</strong> jener Zeit auch: »Heidelberg <strong>zu</strong>r<br />
Stunde Null«, siehe Anzeigenanhang!)<br />
1963 Die letzten Störche auf dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>.<br />
1964 9,6% der Bevölkerung sind Flüchtlinge aus dem Osten.<br />
1965 Die »Studenten« kaufen das Wachenburg-Gelände von Leutershausen.<br />
1970 Im Zuge des neuen Autobahnbaus Darmstadt-Heidelberg entsteht<br />
der Waidsee.<br />
1988 Wilhelm Fabricius t.<br />
1990 Bayern München wird im Pokalspiel von <strong>Weinheim</strong> 09 geschlagen.<br />
30<br />
Alte Postkarte.
<strong>Weinheim</strong> als<br />
Spielball der Mächte<br />
War der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> auch als Teil der Befestigungsanlage <strong>Weinheim</strong>s gebaut<br />
worden, so scheint diese ihren Zweck nur selten erfüllt <strong>zu</strong> haben.<br />
Immer wieder gelang es fremden Truppen, die Stadt <strong>zu</strong> erobern und <strong>zu</strong><br />
besetzen.<br />
Ganz extrem waren die Zustände im 17. Jahrhundert, vor allem während<br />
des Dreißigjährigen Krieges. 1621 waren die Pfälzer die Stadtherren, 1622<br />
übernahmen Tilly und die Bayern die Macht, um 1631 von den Schweden<br />
abgelöst <strong>zu</strong> werden. 1632 waren dann die Bayern wieder tonangebend<br />
etc. pp.<br />
Jeder dieser Herrenwechsel bedeutete für die Bevölkerung schwere<br />
Not. Die Besatzer wollten einquartiert und verpflegt werden und sprachen<br />
vor allem dem Wein sehr <strong>zu</strong>. Plünderungen, Vergewaltigungen und ähnliche<br />
Übel waren an der Tagesordnung.<br />
Die Stadt war. wenn der auf uns gekommene Bericht nicht übertreibt, so stark belegt,<br />
daß mancher Bürger eine ganze oder halbe Kompagnie <strong>zu</strong> beherbergen hatte.<br />
Es war Menscherunaterial aus aller Herren Länder; unter allen Truppen sollen aber<br />
Neapolitaner und Kroaten sich mit Gewalttaten jeder An hervorgetan haben. Von<br />
Raub, Brand und Weiberschändung wird uns berichtet. Die Vorräte, die die Einwohnerschaft<br />
vor den Schweden noch <strong>zu</strong> verbergen gewußt, oder seither wieder<br />
eingetan hatte, gingen natürlich in kurzer Zeit auf. Viel wurde auch mutwillig verdorben;<br />
insbesondere Wein, den die Soldaten, wenn sie betrunken waren, im Keller<br />
auslaufen ließen. Leider sind es nur allgemeine Schilderungen, die uns überliefert<br />
sind, und keine Aufzeichnungen über einzelne Fälle, so daß es nicht möglich ist,<br />
über Zahl und Umfang der vorgekommenen Gewalttätigkeiten ein Urteil <strong>zu</strong> gewinnen.<br />
Daß es aber eine sehr schlimme Zeit und alles außer Rand und Band war, ist<br />
auch daraus ersichtlich, daß die ganze Gemeindeverwaltung ins Stocken kam. Das<br />
Ratsprotokoll zeigt eine Lücke vom Spätherbst 1634 bis in den Herbst 1636, und nur<br />
einzelnes aus der fehlenden Zeit ist nachher in Unordnung nachgetragen. ( ... )<br />
Schlimmere Feinde als alle bis jetzt dagewesenen brachte das Jahr 1635. Hunger<br />
und sonstiges Elend aller Art hatten die Bevölkerung aufs äußerste erschöpft und<br />
ihre Widerstandslcraft gebrochen. So konnten sich ansteckende Krankheiten, die<br />
von den Truppen von Ort <strong>zu</strong> Ort geschleppt wurden, überall leicht einnisten, und<br />
auch <strong>Weinheim</strong> entging dem Schicksal nicht. Pest und Ruhr wüteten in der Stadt,<br />
ganze Familien wurden hingerafft; ein großer Teil der Bevölkerung ging <strong>zu</strong>grunde.<br />
Was von der Einwohnerschaft übrig blieb, versank in stumpfe Gleichgültigkeit. Handel<br />
und Wandel stockte, Häuser und Straßen kamen in Verlall. Das Niedertor, das<br />
man einmal <strong>zu</strong>r Abwehr eines Angriffes mit Holz und Mist <strong>zu</strong>gesetzt hatte, ließ man<br />
in diesem Zustande und verzichtete auf seine Benut<strong>zu</strong>ng Jahr und Tag. Man unterließ<br />
31
es, Wächter für die Türme und Tore <strong>zu</strong> bestellen oder sonst etwas für die Sicherheit<br />
von Gut und Leben <strong>zu</strong> tun, denn gegenüber den ab- und <strong>zu</strong>ziehenden feindlichen<br />
Truppen war man ja ohnmächtig, und was sonst Schlimmes <strong>zu</strong> befürchten gewesen<br />
wäre, wog leicht in diesen Zeiten. (1)<br />
Besonders schrecklich waren die Plünderungen der Franzosen unter Turenne<br />
1674. Ab 1676 war Weinheirn wieder pfälzisch, aber 1688 brach<br />
wieder ein für die Bevölkerung verheerender Krieg aus. Die Franzosen<br />
erpreßten große Lieferungen von Wein, Fleisch und Fisch, so daß der Bevölkerung<br />
kaum das »liebe Brot« blieb. Immerhin wurde die Stadt nicht<br />
zerstört, wie all die Ortschaften in der Umgebung. Heidelberg war so abgebrannt<br />
und ausgeblutet, daß 1698 die Universität kurzfristig nach <strong>Weinheim</strong><br />
verlegt wurde.<br />
Zurück <strong>zu</strong> den Franzosen im Jahr 1694, die <strong>zu</strong>r Abwechslung wieder einmal<br />
draußen vor dem Tore standen und Einlaß begehrten.<br />
Sie schickten einen Trompeter vor die Stadt, der den Ab<strong>zu</strong>g der Besat<strong>zu</strong>ng verlangen<br />
sollte, widrigenfalls sie ausgetrieben und die Stadt geplündert werden sollte.<br />
Es war pfälzische Miliz, die derzeit in der Stadt lag, und der Kommandant war ein<br />
Oberst Sandraski. Mit großer Entschiedenheit lehnte dieser das Ansinnen ab und<br />
erklärte, daß er sich bis auf den letzten Mann wehren werde. Bald aber merkte die<br />
Bürgerschaft, daß er seine und seiner Musketiere Bagage heimlich fortschaffen ließ;<br />
sie wurde natürlich unruhig darüber, und manche machten Anstalten <strong>zu</strong>r Flucht.<br />
Sandraski ließ sie festnehmen und verhängte Strafen über sie; <strong>zu</strong>gleich ließ er die<br />
ganze Bürgerschaft auf dem Marktplatz versammeln und forderte sie auf, <strong>zu</strong> den GewehIen<br />
<strong>zu</strong> greifen und sich <strong>zu</strong>r Verteidigung bereit <strong>zu</strong> machen. Jeder, der sich weigere,<br />
werde totgeschossen. Dabei renorrunierte er herzhaft mit den Taten, die er<br />
vorhabe. Aber in der Nacht wich er mit seinen Musketieren heimlich aus der Stadt,<br />
ließ sogar eine Schildwache im Stiche und das Tor, durch das er ausgezogen war,<br />
J>spenweit« offen. Den Schlüssel des Tores fand man im Kaufhause, und der Schlüssel<br />
<strong>zu</strong>r Munition war im Eselsstall einem Esel angehängt. Als man dann nachsah,<br />
fand sich ein reichlicher Vorrat von Granaten, Pechkränzen, Pulver und Kugeln, den<br />
man im ROTEN TURM unterbrachte. Man glaubte, damit hätte die Besat<strong>zu</strong>ng schon<br />
etwas ausrichten können, aber nach ihrer feigen Flucht hielt man einen Widerstand<br />
nicht mehr für möglich. (10)<br />
Kriegsbesatzer kamen <strong>zu</strong>m letzten Mal am 28.3.1945, die US-Armee. Bemerkenswert,<br />
daß <strong>Weinheim</strong> und HeideJberg weitgehend von Bombardierungen<br />
verschont blieben. Verblüffend der Besuch des Chefs der alliierten<br />
Streitkräfte, Ike Eisenhower, in <strong>Weinheim</strong>, wollte er hier doch seinen Bruder<br />
besuchen (der auch bei der US-Armee diente). Warum verblüffend?<br />
Nun, stammten die Eisenhowers doch ursprünglich aus Eiterbach, wo der<br />
Schweinehirt Eisenhauer 1741 seine Siebensachen packte und nach Amerika<br />
auswanderte.<br />
Heut<strong>zu</strong>tage wird die Stadt einmal jährlich von weitgehenst friedlichen<br />
Besatzern beherrscht. Wenn sie am Himmelfahrtstag von ihrer Burg in die<br />
Stadt kommen, gehört diese quasi ihnen. Die Polizeistunde wird aufgehoben,<br />
das Bier wird in männerbündischen Massen verdrückt und so ganz<br />
32
friedlich geht es auch nicht ab, die Polizei vermeldet regelmäßig mehr Keilereien<br />
als sonst. Naja, bei Festen der Einheimischen muß die Polizeistunde<br />
ja auch immer eingehalten werden. Aber das ist ja nichts Neues, schon<br />
früher hatten die Burgherren das Sagen, auch wenn es sich damals noch<br />
um echte Fürsten handelte und nicht um jene fechtbaren Herren mit<br />
Schmiß, farbigem Bändchen und Käppi, die, teils wie im Mittelalter mit<br />
Degen bewaffnet, durch die Stadt gockeln.<br />
<strong>Weinheim</strong>er<br />
<strong>Turm</strong>lied<br />
Aus: »Ein Strauß frischer Heidelberger Liedlein« anno 1624,<br />
verständlicher übertragen von U Freise<br />
<strong>Der</strong> Wächter auf dem <strong>Turm</strong>e saß<br />
Und rief mit heller Stimmen:<br />
»Die Nacht ging voller Fried' fürbaß,<br />
Laßt uns den Tag gewinnen!<br />
Auf Bürgersmann, auf Handwerksknecht,<br />
Die Vöglein tun schon schlagen,<br />
So macht ihrs unserem Herren recht:<br />
Frisch auf und ohn' Verzagen!<br />
Ihr braven Frauen voller Fleiß,<br />
Die Wäsche steht in Kübeln,<br />
Mariens Lächeln ist euch Preis,<br />
Hofart nur ist von Übeln!<br />
<strong>Der</strong> Wingert prangt in vollem Rot,<br />
Laßt uns die Beeren schneiden,<br />
So hat der Winter keine Not:<br />
Wollt nicht im Bette bleiben.<br />
Und wenn die Landsknecht dräuen<br />
Kommt aIl in blanker Wehr,<br />
Wir werden uns nicht beugen,<br />
Sei denn des Kaisers Heer.«<br />
33
Das Leben<br />
im <strong>Turm</strong><br />
Verständlicherweise mangelt es an Berichten über das Leben im <strong>Turm</strong>,<br />
denn <strong>zu</strong> den Zeiten, als er »belebt« war, gab es außerhalb der Kirche und<br />
des Adels kaum des Schreibens und Lesens kundige Menschen - vor allem<br />
nicht unter <strong>Turm</strong>wärtern und Kerkerinsassen. So müssen wir auf Sekundärliteratur<br />
<strong>zu</strong>rückgreifen, um uns aus verschiedenen Puzzleteilchen ein Bild<br />
<strong>zu</strong> machen.<br />
Die Befestigungsanlagen der benachbarten Städte ähnelten sich, so daß<br />
wir davon ausgehen können, daß der folgende Absatz aus der Bensheirner<br />
Geschichte auch für <strong>Weinheim</strong> übertragbar ist:<br />
Die Wächter.<br />
An den Pforten hatten 4 Pförtner das Aus- und Eingehen der Fremden <strong>zu</strong> beobachten,<br />
Bettler ab<strong>zu</strong>weisen und nachts abwechselnd <strong>zu</strong> wachen. Abends, nach dem<br />
Ave-Maria-Läuten, mußten sie die Tore schließen und die Schlüssel beim GemeindebUrgermeister<br />
abliefern, wo sie morgens <strong>zu</strong>m Öffnen der Tore wieder abgeholt<br />
wurden.<br />
Nachts hatten 6, später 8 <strong>Turm</strong>wächter vom Abend- bis <strong>zu</strong>m Frühläuten abwechselnd<br />
die halbe Nacht <strong>zu</strong> wachen, auf ausbrechendes Feuer und in Fehdezeiten auf<br />
anruckende Feinde <strong>zu</strong> achten. Außer dem <strong>Turm</strong>wächtern wachten noch mehrere<br />
Gassenwächter (Nachtwächter). Sie waren durch ihren Eid verpflichtet, jede Nacht<br />
nach dem Ave-Maria-Läuten die Stunden <strong>zu</strong> blasen, den <strong>Turm</strong>wächtern und Pförtnern<br />
<strong>zu</strong><strong>zu</strong>rufen und sie <strong>zu</strong>r Wacht <strong>zu</strong> ermahnen und auf etwa entstehende Feuersbrünste<br />
<strong>zu</strong> achten. Außerdem hatten sie" Junggesellen und andere über gebührende<br />
Zeit auf der Gasse Betroffene heim<strong>zu</strong>weisen«, ebenso in den Wirtshäusern die<br />
Spieler, Trinker und Gotteslästerer und die Widerspenstigen dem Schultheiß oder<br />
BUrgermeister an<strong>zu</strong>zeigen (K. Henkelmann 1920). (4)<br />
Sehr im Vordergrund stund die Sorge für Sicherheit in Stadt und Markung. Jedes<br />
der Tore hatte seinen Pförtner; <strong>zu</strong>r Nachtzeit waren auch Wächter bestellt. Zur Annahme<br />
dieser Dienste, die gleich allen andern jährlich neu besetzt wurden, waren<br />
alle Bürger wechselweise verpflichtet, und wer sich der Annahme entziehen wollte,<br />
mußte sich mit Geld abfmden. Zum Sicherheitsdienst gehörte teilweise auch das<br />
Amt des Glöckners, das mit dem des Pförtners am oberen Tor verbunden war. Denn<br />
der Glöckner hatte bei auftretenden Gefahren, allerdings nur auf Befehl, Sturm <strong>zu</strong><br />
läuten. Auch sollte er die Glocke hüten, daß sie nicht <strong>zu</strong>r Beunruhigung der Bürger<br />
von Unberufenen mißbraucht wurde. Mehr in Anspruch genommen wurde der<br />
Glöckner natürlich durch die sonstigen Zwecke, denen die Glocke diente, und von<br />
denen vielleicht nur das Läuten der "Zeitglocke« und der» Weinglocke« noch ge-<br />
34
Das Gebäude links: die »Heck«, erkennbar noch die Gitter vor dem Fenster.<br />
35
wisse Beziehungen <strong>zu</strong>m Sicherheitsdienst hatte. Die Altstadt hatte, auch nachdem<br />
sie der Neustadt angegliedert war, noch ihren besonderen Glöckner, ebenso wie<br />
ihren besonderen Wachtdienst. Umfangreichere Vorkehrungen als für Friedenszeiten<br />
mußten natürlich für Kriegszeiten getroffen sein. ( ... ) <strong>Der</strong> abwechselnde Wachtdienst<br />
der Bürger wurde Ende des 17. Jahrhunderts abgeschafft, und wir finden von<br />
da ab ständige bezahlte Wächter, <strong>zu</strong> deren Entlohnung die Bürger ein" Wachtgeld«<br />
<strong>zu</strong> entrichten hatten. (1)<br />
An den besonderen Nacht- und Wachdienst in der ehemaligen Altstadt<br />
erinnert heute noch das Nachtwächtergässchen. <strong>Der</strong> <strong>Turm</strong> war vorrangig<br />
Teil der Befestigungsanlage, wobei im Laufe der Zeit aber auch das Verlies<br />
mehr und mehr als Kerker benutzt wurde. Auch wenn es <strong>zu</strong> damaligen<br />
Zeiten eine Freiheitsstrafe wie unter heutigem Recht nicht gab, saßen oftmals<br />
Bürger für Wochen und Monate ein, bis die nächste GerichtsvE:: [handlung<br />
durchgeführt wurde.<br />
Oberhalb des Verliesraums beginnt dann eine in die Außenmauer eingelassene<br />
Wendeltreppe, die die vier Geschosse des <strong>Turm</strong>s miteinander verbindet. In den<br />
Stockwerken sind einzelne Räume vorhanden, in denen in älteren Zeiten <strong>Turm</strong>wächter<br />
und später ebenfalls Gefangene hausten. Beim Emporsteigen kommt man<br />
auch an einem kleinen Erker vorbei, der aus dem <strong>Turm</strong> hinausragt. Nur wenige wissen,<br />
daß er der <strong>Turm</strong>besat<strong>zu</strong>ng als luftiger Abort gedient hat. Unmittelbar darunter<br />
befand sich früher der Stadtgraben. ( ... ) Die Gefangenen, die <strong>zu</strong>m »<strong>Turm</strong>« verurteilt<br />
wurden, wurden an Stricken von oben heruntergelassen. Hier im Verlies wartete<br />
z. B. im Jahre 1662 fünf Wochen lang ein Pferdedieb auf seine Verurteilung. Er rief<br />
mehreremale seinen Wächtern hinauf, er bekomme nicht genug Luft, da über die<br />
Einfahrtluke ein eiserner Deckel gelegt worden war. Er wurde dann mit anderen<br />
Pferdedieben auf der Gerichtsstätte an der heutigen Eisenbahnüberführung beim<br />
Hauptbahnhof gehenkt, während einem anderen das Bild eines Galgens mit glühend<br />
erhitztem Prägestück auf die Stirn gebrannt wurde. (16)<br />
Die Eingekerterten.<br />
Freiheitsstrafen wurden erst <strong>zu</strong>r Zeit des Dreißigjährigen Krieges eingeführt.<br />
Diese wurden aber <strong>zu</strong>meist in den Gefängnissen in Heidelberg und<br />
Mannheim abgesessen. Aus Heppenheim ist uns folgendes überliefert:<br />
In den Stadttürmen und Toren befanden sich sogenannte »Block- oder Stockhäusera<br />
bei den Wachstuben der Wächter, in denen die Gefangenen im Block oder Stock<br />
gefesselt waren, damit sie nicht entweichen konnten. 1751 wurde ein solches Blockhaus,<br />
ein Bretterverschlag, im »Odenwälder Tor« errichtet. Es war 9 Schuh lang,<br />
8 Schuh breit und B 112 Schuh hoch. Daß man nicht durchsehen konnte, wurden die<br />
eichenen Bohlen übereinander gefalzt. ( ... )<br />
Auf Frauen. die in Haft gehalten wurden, nahm man offensichtlich Rücksicht. Sie wurden<br />
bei Bürgern und Handwerkern inhaftiert. Die Zentkostenrechnung von 1772 überliefert<br />
einen solchen Fall: »Specification deren an die Arrestantin, welche bey hiesigem<br />
Bürger und Schuhmachermeister Georg Johann gesessen, abgegebene Medicamente.«<br />
36
Das obere <strong>Turm</strong>zimmer als Arbeitsplatz für d1eses Buch.<br />
37
Die Gefangenen lagen auf Stroh. Hierfür wurden wöchentlich zwei Gebund geliefert.<br />
Um ein Entweichen <strong>zu</strong> verhindern, waren sie mit "Sprengem" , einer Art HandscheUen,<br />
die aber auch für die Füße und den Hals verwendet wurden, gefesselt. Die<br />
Ketten, an denen diese Sprenger hingen, waren entweder in der Wand befestigt<br />
oder mit Gewichten beschwert.<br />
Die Verpflegung der Eingekerkerten erfolgte meist durch den ZentwUt. Sie bestand<br />
aus Wasser und zwei Pfund Brot im Tag. Eine warme Mahlzeit wurde wöchentlich<br />
zweimal verabreicht.<br />
Mit Arrest belegte Frauen, die Kinder hatten, nahmen diese in die Gefängnisse, ja<br />
sogar in das Zuchthaus nach Mainz mit. (5)<br />
In jener Zeit hießen Gefängnisse »fast regelmäßig« Narrenhäuser, was die<br />
Vermutung nahelegt, daß auch Geisteskranke dort weggeschlossen wurden.<br />
Wer Geldstrafen nicht bezahlen konnte oder wollte, mußte Arbeiten verrichten.<br />
1m 2. Quartal 1835 wurden 33 Personen <strong>zu</strong> Straßenarbeiten herangezogen. Und<br />
wer nicht zwn Abarbeiten der Strafe erschien, wurde ins Gefängnis geworfen. Alle<br />
4 Tage gab es dort warme Kost, sonst nur Wasser und Brot.<br />
Grauenhaft mußte eine Zigeunerin für einen Lebensmitteldiebstahl büßen. Sie wurde<br />
1804 am Galgen in Beerlelden gehenkt, weil sie ein Huhn und zwei Laib Brot<br />
gestohlen hatte. (Speis + Trank im Odenwald)<br />
<strong>Der</strong> Um<strong>zu</strong>g des Knasts vom <strong>Turm</strong> in die neuerbaute »Heck« brachte anscheinend<br />
keine grundlegende Änderung für die Inhaftierten. Ja, es<br />
scheint so, als ob der <strong>Turm</strong> auch noch Jahre danach als Knast gedient hat,<br />
wie aus Aufzeichnungen der Familie Diesbach <strong>zu</strong> entnehmen ist:<br />
Gleiches Ungemach Wa1. Friedrich Diesbach widerfahren. Auch ihm starb die Frau,<br />
während er noch in <strong>Weinheim</strong> im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> in Untersuchungshaft saß. Die »Erinnerungen«<br />
seines Sohnes Wilhelm (geh. 1831) überliefern die unerfreulichen Umstände<br />
dieses Todesfalls und seine Folgen für die Familie; <strong>zu</strong>gleich verraten sie<br />
einiges von der Bitternis, die die Betroffenen angesichts ilu'es doppelten Unglücks<br />
erlüllte.<br />
"Um diese Zeit brach die Revolution aus, wobei mein Vater sich ebenfalls betheiligte;<br />
er mußte in Untersuchungshaft wegen der Eisenbahndemolirung (1848); da<br />
erl:aankle meine liebe Mutter schwer; mein Vater durfte sie mit 4 Mann Wacht besuchen;<br />
es wurden ihm zwei Stunden erlaubt; als diese um waren, wollte man wieder<br />
mit ihm zUlÜck in den >rothen Thurm,; er bat, laßt mich doch hier, bis meine<br />
Frau besser oder bis sie ihrem Leiden erlegen ist; - es half Alles nichts. Befehl. Da<br />
brauste mein Vater auf; er wurde vom Sterbebette meiner lieben Mutter weggerissen;<br />
- eine halbe Stunde später hatte ich keine Mutter mehr! - Es Wa1.en badische<br />
Soldaten, die so grausam handelten; - den Befehl gab ein ebenfalls anwesender Brigadier;<br />
ein Mensch ohne Gefühl, der jedenfalls weiter ging, als die Staatsbehärde<br />
verlangte. ( ... ) Meine Mutter wurde beerdigt; mein Vater konnte von dem oberen<br />
AU8schauloch des rolhen Thurrnes den Leichen<strong>zu</strong>g mit ansehen. - In späteren Jahren<br />
noch, als ich mit ihm allein war, sprach er mir mit gewaltigem Schluchzen und<br />
Seelenschmerz von diesem Tag; - >er war der fürchterlichste in meinem Leben!,« (3)<br />
38
Jonathan Wolrab<br />
und der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong><br />
Eine erstaunliche Geschichte und wie sie ans Licht kam ...<br />
»Ich bin da auf etwas gestoßen, das euch vielleicht interesssieren wird". «<br />
Mit dieser Bemerkung, die sich bald als Understatement herausstellte,<br />
meldete sich Micky Remann beim Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>, nachdem er<br />
von einer Neuseeland-Reise <strong>zu</strong>rückgekehrt war. Er warnte uns jedoch sogleich,<br />
es handele sich um ein kompliziertes Epos. Am einfachsten wäre<br />
es, sagte er, wenn wir seinen Bericht gleich auf Kassette aufzeichneten, solange<br />
er noch frisch sei. <strong>Der</strong> Bitte kamen wir gerne nach, versammelten<br />
uns aus naheliegenden Gründen im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> selbst und lauschten mit<br />
großen Ohren und laufendem Tonband der Geschichte vom ungewöhnlichen<br />
Schicksal des <strong>Weinheim</strong>ers Jonathan Wolrab.<br />
Was folgt, ist eine Abschrift von Micky Remanns mündlich vorgetragenem<br />
Bericht:<br />
Unlängst bin ich in Neuseeland auf eine Geschichte gestoßen, von der ich<br />
nicht nur den inneren Drang, sondern auch den expliziten Auftrag habe, sie<br />
mit<strong>zu</strong>teilen. Es trifft sich gut, daß ihr gerade Material über den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />
sanunelt. Ihr werdet die Zusammenhänge im Lauf der Erzählung schon verstehen,<br />
habt nur etwas Geduld. Eigentlich könnte ich aber auch sagen: die<br />
Sache ist ein echter Hammer.<br />
Meine Reisekasse war knapp, und so entschloß ich mich, mir etwas<br />
Geld bei der Kiwiernte <strong>zu</strong> verdienen Auf der Red Tower Plantation bei<br />
Motoueka wurden für den Ernte-Endspurt noch Leute gesucht, bei guter<br />
Bezahlung versteht sich. Also eine Woche tüchtig ranklotzen und anschließend<br />
mit vollem Geldbeutel die Reise fortsetzen, dachte ich.<br />
Wir waren eine Gruppe von sieben Hilfskräften. Nachdem wir in die<br />
Arbeit eingewiesen waren, und ich mein Zelt aufgestellt hatte, fragte ich<br />
den Besitzer, lohn Barlow, nach dem Hintergrund des Namens seiner Red<br />
Tower Plantation. Schließlich war da weit und breit kein <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> sehen.<br />
Statt einer Antwort fragte er forschend, woher ich denn käme. Ich antwortete:<br />
»Frankfurt, Germany«, wurde dabei aber das Gefühl nicht los, daß ihm<br />
meine Nachfrage irgendwie unangenehm war. Er erzählte mir dann, daß<br />
der Name wohl etwas mit dem Gründer dieser Plantage <strong>zu</strong> tun hätte,<br />
irgend einem europäischen Einwanderer, von dem er aber auch nichts<br />
weiter wisse. Die Plantage sei jetzt seit drei Generationen im Besitz der<br />
39
Barlows. Freundlich aber bestimmt bat er uns dann, an die Arbeit <strong>zu</strong> gehen,<br />
wir seien ja schließlich <strong>zu</strong>m Kiwiernten hier, und damit hatte er zweifellos<br />
recht.<br />
Ich wurde irgendwann in den alten Geräteschuppen geschickt, um<br />
Draht <strong>zu</strong> holen. Ihr wißt, die Kiwis sind solche Windenpflanzen, die wie<br />
Hopfen gezogen werden, und da gab es etwas am Gestänge aus<strong>zu</strong>bessern.<br />
Beim Suchen nach dem Draht bemerkte ich einen verstaubten Koffer, der<br />
fast aus dem Regal <strong>zu</strong> fallen drohte. Als ich ihn näher betrachtete, fiel mir<br />
eine Lederprägung auf dem Kofferdeckel auf: es sah aus wie eine altdeutsche<br />
Stadtansicht mit einem <strong>Turm</strong> im Vordergrund. Das machte mich neugierig<br />
und ich nahm mir die Freiheit, den Koffer <strong>zu</strong> öffnen. Einige Wäschestücke<br />
und Anzüge waren drin, alle schon recht mitgenommen und angeschimmelt,<br />
aber weiter unten stieß ich auf eine Kladde mit handgeschriebenen<br />
Aufzeichnu.ngen. Sie waren in altdeutscher Schrift verfaßt! Glücklicherweise<br />
konnte ich das entziffern, weil mir meine Großmutter so immer<br />
<strong>zu</strong>m Geburtstag gratuliert hat. Ich wollte mich schon in die Lektüre vertiefen,<br />
aber von draußen riefen sie nach dem Draht, also schnell wieder alles<br />
<strong>zu</strong>geklappt und raus an die Arbeit. Mir war aber klar, daß ich da später<br />
nochmal nachforschen würde. Die Gelegenheit da<strong>zu</strong> ergab sich erst<br />
abends. Mir ächzten zwar die Knochen und ich war todmüde von dem harten<br />
Job, aber irgendetwas trieb mich wie von einem Magneten gezogen<br />
wieder in den Schuppen. Das war also meine Lage, als ich, mit einer Taschenlampe<br />
bewaffnet, diese alte Schrift aufschlug. Ich werde euch jetzt<br />
ohne Umschweife und ohne Vorerklärungen einfach vorlesen, was da auf<br />
der ersten Seite stand, denn das habe ich mir abgeschrieben:<br />
Entsetzlicher noch als die körperliche Gefangenschaft sind mir jene Lücken der Sinne<br />
<strong>zu</strong> ertragen, mit welchen ein jeglicher bestraft wird, der in diesem Kerker<br />
schmachtet. In diesen Lücken droht schier alles <strong>zu</strong> verschwinden, was das Leben<br />
als solches kenntlich macht. In ihrem schwarzen Sog verglimmt mein Geist, dem es<br />
doch lieb und gewohnt ist. allseits im Tausch <strong>zu</strong> stehen mit Gottes Natur und den<br />
Menschen. Denn Mensch ist nur. wessen Auge. Ohr. Nase. Zunge und Hände teilhaftig<br />
ist am unendlichen Strom der Empfindungen. aus denen unsere Welt besteht.<br />
Nun lieget dieser Geist brach und lahm, umzingelt von den Lücken, die ein Kerker<br />
innerhalb des Kerkers sind. ein namenloser und unsichtbarer <strong>zu</strong>mal, und daher um<br />
vieles grausamer als der gemauerte.<br />
Diese verzweifelten Zeilen kann ich nur schreiben. da ich mich im alles verschlingenden<br />
Meer der Lücken auf einem seltenen Eiland tummele. Einem Eiland, da mir<br />
die Sinne soweit <strong>zu</strong> Diensten sind. daß ich meine Feder führen und mit meinem<br />
Schreibblock Zoll um Zoll jenem schmalen, mit der Sonne wandernden Lichtschein<br />
folgen kann. der durch die Schießscharte hindurch meine Gruft ein wenig erhellt.<br />
Doch Erbarmen, wenn dieses Eiland wieder versinkt! Wenn die Dunkelheit von<br />
außen sich in mein Inneres gräbt, und eine randlose Schwärze sich gänzlich auf<br />
mich stülpt. Weh mir, es gibt keine Hoffnung auf Entrinnenl <strong>Der</strong> unsichtbaren<br />
Unendlichkeit dieser Lücken bin ich gnadenloser ausgeliefert als jedem weltlichen<br />
Gericht.<br />
Die Torheit meines Bruders. der mich um der Habgier willen, und um in den alleinigen<br />
Genuß des elterlichen Erbes <strong>zu</strong> kommen denunziert hat, diese Torheit offenbart<br />
40
zwaJ. bösen, aber doch menschlichen Charakter<strong>zu</strong>g. Denn so manches wunde Menschenherz<br />
erkennt sich nur in der Grausamkeit gegen andere wieder. Die Lücken<br />
aber, die mich ohne Halt <strong>zu</strong> erwürgen trachten, sind gänzlich unmenschlicher Herkunft<br />
und Natur. Das heillose Gespinst, dem ich <strong>zu</strong>m Opfer fiel - meines Bruders<br />
Niedertracht, die Taubheit der fuchter und das lügnerische Schweigen der Nachbarn<br />
- es kann mich schmerzen, quälen und erzürnen, allein, es zerstört mich nicht.<br />
Zerstören tun mich jene Dämonen, die meine Seele mit ihren namenlosen Lücken<br />
umzingeln, und auch jetzt an mir nagen wollen, da ich meine Pein dem Papier<br />
anvertraue. Schon höre ich ihr bleiernes Wispern: »Bald wird deine Hand wieder<br />
erlahmen", sagen die Dämonen, »bald werden sich deine Gedanken wieder trüben,<br />
bald wird dein Geist wieder nach Eindrücken greifen, die er aus sich selbst nimmer<br />
schaffen kann, bald wird er sich aufgeben müssen und ertrinken in unserem Reich<br />
der sinnes toten Lücke, aus der kein Gott und kein Gebet dich erettet!"<br />
Das schlimmste Entsetzen ist jenes, dessen Form niemand kennt. Mein Gott, hilf mirl<br />
Die schwarze Lücke zwischen allen Formen will sich auf mein letztes Licht, den innigsten<br />
Docht meines Herzens senken. Nun schwinde ich dahin, selbst die fahle<br />
Sonnenuhr hinter der Scharte entzieht mir ihren Schein ... es wird Nacht um mich<br />
her ...<br />
Jetzt müßt ihr euch vorstellen, wie ich völlig überdreht und übermüdet mit<br />
meiner kleinen Taschenlampe in diesem SChuppen sitze und unter großer<br />
Mühe diesen erschütternden Aufschrei lese! Anfangs blickte ich überhaupt<br />
nicht durch über das Wie, Wo, Wer und Was, aber die Sache wurde Blatt<br />
für Blatt immer erstaunlicher. Ich will es Euch jetzt etwas einfacher machen,<br />
als ich es damals hatte, deswegen werde ich Inhalt und Rahmen dieser Geschichte,<br />
so wie ich sie nach und nach begriff, im Überblick erzählen:<br />
<strong>Der</strong> Verfasser dieser Schriften war ein gewisser Jonathan Wolrab, ein<br />
<strong>Weinheim</strong>er Bürger, der im Jahre 1841 als junger Mann im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong><br />
<strong>Weinheim</strong> einsaß. Er war von seinem älteren Bruder, dem Zimmermann<br />
Wilhelm Feter Wolrab beschuldigt worden, dessen zwölf jährige Tochter<br />
Hedwig <strong>zu</strong>r »Blutschande« verführt <strong>zu</strong> haben, was immer damit gemeint<br />
sein soll<br />
Jonathan beteuert im Tagebuch jedoch seine Unschuld und fühlt sich als<br />
Opfer einer Intrige, die ihn als Miterben ausschalten soll. Dieser Jonathan<br />
Wolrab scheint ein feinsinniger Mann gewesen <strong>zu</strong> sein, und obwohl mir, je<br />
später es wurde, die Augen immer schwerer wurden, war ich doch blitzgespannt<br />
auf seine unglückliche Geschichte, und wieso die ausgerechnet hier<br />
in einem Geräteschuppen in Neu Seeland herumlag. Da saß ich also am anderen<br />
Ende der Welt auf der Red Tower Plantation, sollte eigentlich Kiwis<br />
pflücken, und wurde in dieses herzzereißende Schicksal hineingezogen,<br />
von einem, der vor ISO Jahren im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> gesessen hat! Ich kann euch<br />
sagen: Sehr seltsam!<br />
Wolrab hat mit dem Eingesperrtsein schwer <strong>zu</strong> kämpfen, mit den »Lükken<br />
der Sinne«, wie er den Angriff des Nichts auf seine sensible Psyche<br />
nennt.<br />
Allmählich beginnt er aber, sich mit eigener Nahrung <strong>zu</strong> versorgen, er<br />
meditiert, stellt sich Sachen vor, und versucht mit allen möglichen Mitteln,<br />
41
seine Sinne an<strong>zu</strong>regen. Beim Kauen seiner spärlichen Nahrung malt er sich<br />
wahre Festessen aus, Braten und Torten, dann drückt er auf seine Augenlider,<br />
um Visionen <strong>zu</strong> bekommen, USW. Er macht so<strong>zu</strong>sagen das Beste aus<br />
seinen romantischen Anfälligkeiten. Und er entdeckt seine Ohren ganz<br />
neu. Er geht daran, den <strong>Turm</strong>, in dem er eingesperrt ist. regelrecht <strong>zu</strong> erlauschen.<br />
Zoll um Zoll schreitet er das dicke Mauerwerk ab und versucht,<br />
in die Steine hinein<strong>zu</strong>horchen, so wie man in einer Muschel dem Meeresrauschen<br />
<strong>zu</strong>hört. <strong>Der</strong> Kontakt <strong>zu</strong> den Steinen hat eine heilende Wirkung auf<br />
Wo lrab , er erhält ihn am Leben, <strong>zu</strong>mindest aber bei Sinnen.<br />
Das beschreibt er auch alles sehr schön und mit bewegenden Worten,<br />
und es ist wirklich schade, daß ich euch nicht seine Originaltexte zeigen<br />
kann. Ich war eben nur in der Lage, hier und da einen besonders spannenden<br />
Abschnitt in mein Notizbuch <strong>zu</strong> kopieren, den Rest muß ich so gut wie's<br />
eben geht aus der Erinnerung <strong>zu</strong>sammeruaamen.<br />
Wolrab wandelt also Tage und Nächte im Kreis, schärft sein Hörvermögen,<br />
bis jeder Stein des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>s ihm eine andere Geschichte erzählt,<br />
oder vielleicht halluziniert er sie, wie auch immer. Mit der Zeit scheint sich<br />
der ganze Raum um ihn auf<strong>zu</strong>lösen, und dann hört er in dem einen Stein<br />
fremdländische, orientalische Frauengesänge, ein anderer wiederum gibt<br />
ein zartes Klopfen frei, aus einem dritten hört er Urwaldgeräusche.<br />
Eines Tages dann hört er besonders intensiv in einen bestimmten Stein<br />
hinein, der seine Aufmerksamkeit an sich zieht. Dieser Stein enthält einen<br />
neuartigen Unterton, ein Schwingen, das er in dieser Art noch nicht wahrgenommen<br />
hat. Immer wieder kommt er <strong>zu</strong> diesem Stein <strong>zu</strong>rück. Ja, und<br />
dann fällt ihm auf, daß der Stein deswegen so besonders klingt, weil er lokker<br />
sitztl<br />
Nun, auch in Neuseeland sind die Nächte begrenzt. Inzwischen fingen<br />
die altdeutschen Buchstaben vor meinen Augen schon <strong>zu</strong> tanzen an, deshalb<br />
beschloß ich, mich für den kleinen Rest der Nacht schlafen <strong>zu</strong> legen.<br />
<strong>Der</strong> nächste Tag wurde verdammt hart. Während der schweißtreibenden<br />
Arbeit auf den Kiwifeldern mußte ich allerdings immer wieder an die<br />
Schriften in diesem alten Lederkoffer denken, und an Jonathan Wolrabs<br />
Gefangsnisaufenthalt im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>. Nach einem kurzen Imbiss am Abend<br />
war ich völlig durcheinander, aufgeregt, neugierig, aber auf jeden Fall<br />
wieder hundemüde. Ich hätte mich ausruhen sollen, aber ich mußte einfach<br />
<strong>zu</strong>rück in den Schuppen, Die Einladung meiner Pflücker-Kollegen auf einen<br />
gesellig-feuchten Abend im Pub lehnte ich dankend ab. Bald saß ich<br />
also im fahlen Licht dieses Schuppens und ich brauchte nur dieses alte<br />
Tagebuch an<strong>zu</strong>fassen, da war ich wieder eingetaucht in der Welt des eingesperrten<br />
Romantikers Jonathan Wolrab, der sich in seiner Hoffnungslosigkeit<br />
in die Welt der klingenden Steine begeben hatte.<br />
Gut, es gelingt ihm also, diesen lockeren Stein aus der Wand <strong>zu</strong> lösen.<br />
Durch eine kleine Schießscharte in der Mauer fällt etwas Licht, und in diesem<br />
Schein erkennt er im Hohlraum hinter dem Stein etwas, das wie ein<br />
Stapel steifer, verkrumpelter Papiere aussieht. Ganz vorsichtig geht er dar-<br />
42
an, den Schatz <strong>zu</strong> heben, der sich ihm offenbart. Die vermeintlichen Papiere<br />
fühlen sich komisch an, beim näheren Hinsehen stellen sie sich als<br />
gegerbte Lederstücke, genauergesagt: Rattenhäute heraus. Jede dieser<br />
Häute ist beschrieben und da wird Wolrab klar, daß er in der <strong>Turm</strong>mauer<br />
auf eine versteckte Bibliothek gestoßen ist!<br />
Die Schriftensammlung ist in lateinisch, griechisch und hebräisch verfaßt<br />
- was Wolrab, der in Heidelberg studiert hatte, glücklicherweise lesen<br />
kann. Er findet bald heraus, daß die »Rattenbibliothek«, wie er sie in seinem<br />
Tagebuch jetzt nennt, offenbar im Jahre 1391 von dem jüdischen Alchimisten<br />
Rabbi Norach angelegt worden war. Dieser Rabbi Norach war viele<br />
Jahre vorher von Kurfürst Ruprecht I. an den Hof geholt worden, und zwar<br />
um <strong>zu</strong> sehen, ob er als »Goldmacher« taugte. <strong>Der</strong> Kurfürst hatte damals den<br />
<strong>zu</strong>vor verfolgten Juden Wohnrecht gewährt, aber jeweils hohe Kautionen<br />
von ihnen gefordert. Er wunderte sich, daß die Juden dies alle zahlen konnten<br />
und vermutete, daß sie im Besitz von heimlichen Künsten waren. Es<br />
kursierten ja so allerhand Gerüchte. Wußten sie, wie man Gold macht? Um<br />
das heraus<strong>zu</strong>finden, richtete er dem gebildeten Rabbi Norach einen Alchimistenkeller<br />
ein, wo er herumlaborieren konnte. Damit das aber bei der<br />
Kirche durchging, mußte sich der Rabbi erst taufen lassen. was er auch der<br />
Form halber tat. Aber es war klar, daß er diese Maske nur aufsetzte, um<br />
ungestört arbeiten <strong>zu</strong> können.<br />
<strong>Der</strong> nächste Kurfürst aber, Ruprecht 11, war wieder ein strikter Judengegner,<br />
er vertrieb die Juden, und den Ex- oder wie auch immer Rabbi Norach,<br />
der ihm persönlich sehr suspekt war, ließ er wegen Scharlatanerie<br />
sang und klanglos im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> verschwinden, nachdem der <strong>zu</strong>vor sein<br />
Labor und alle seine umfangreichen Schriften zerstört hatte. Soweit läßt<br />
sich das jedenfalls anhand der von Wolrab übertragenen Texte Norachs<br />
rekonstruieren, die ich mir in Neu Seeland, wie gesagt hundemüde aber<br />
aufgeregt, nächtens einverleibte.<br />
Dieser Rabbi war, ebenso wie »unser« Jonathan Wolrab, ein sehr reger<br />
Geist. Für ihn waren die »Lücken der Sinne« während der Gefangenschaft<br />
wohl ebenso unerträglich, und auch er schuf sich einen genialen Weg,<br />
ihnen <strong>zu</strong> entfliehen, auch wenn uns der jetzt schon etwas schwarzhumorig<br />
vorkommt. Ich meine, Ihr müßt euch mal ganz konkret diese Frage stellen:<br />
Wenn Du in einem mittelalterlichen Gefängnisturm eine Bibliothek anlegen<br />
willst - wie machst du das? Zuerst einmal mußte sich der Rabbi ja Schreibmaterial<br />
verschaffen, das in die Knäste damals nicht mitgeliefert wurde.<br />
Norach kam <strong>zu</strong>gute, daß er mit seinen <strong>Weinheim</strong>er Glaubensbrüdern aus<br />
dem Gerberviertel bekannt war, die dort ihrem Gerberhandwerk nachgingen.<br />
Denen hatte er er einiges abgeguckt. Er fing sich also eine der im <strong>Rote</strong>n<br />
<strong>Turm</strong> recht zahlreichen Ratten, tötete sie mit bloßen Händen, und zog<br />
ihr die Haut ab. Er wußte, das im Urin bestimmte Substanzen enthalten<br />
sind, die <strong>zu</strong>m Gerben benutzt werden können, also behandelte er die<br />
Rattenhaut, indem er immer wieder draufpinkelte, bis er eine Art Leder<br />
Pergament gewonnen hatte, auf dem er tatsächlich schreiben konnte. <strong>Der</strong><br />
44
Oberschenkelknochen der Ratte ließ sich als Schreibfeder <strong>zu</strong>spitzen, und<br />
das Rattenblut diente ihm als Tinte. Am Rattenblut schient es ihm nicht gemangelt<br />
<strong>zu</strong> haben, was ein bezeichnendes Licht auf die Zustände im <strong>Turm</strong><br />
wirft. Somit konnte der Rabbi seinen Geist engagieren, und <strong>zu</strong>gleich sein<br />
immenses alchimistisches Wissen aufschreiben. Ungefähr achtzig beidsei -<br />
tig eng beschriebene Rattenhäute kommen so <strong>zu</strong>sammen. Er stellte lange<br />
kabbalistische Formeltafeln auf, auch astrologische Daten und Zeichen,<br />
vermischt mit spirituellen Exkursionen, Zaubersprüchen und magisch-philosophischen<br />
Anleitungen. Er muß sich in seinem Loch sehr sicher gefühlt<br />
haben, denn er verzichtete auf die sonst üblichen Verschlüsselungen, und<br />
schrieb Alchimie im Klartext. Schließlich brauchte er jetzt auf keine weltlichen<br />
Auftraggeber mehr Rücksicht nehmen, die sein Wissen mißverstanden<br />
oder gar nicht haben wollten, stattdessen vertraute er sich einer unbekannten<br />
Zukunft an. Indem er die Rattenbibliothek in der Mauer vorn <strong>Rote</strong>n<br />
<strong>Turm</strong> versteckte, schickte er seine gesammelten Erinnerungen und Forschungen<br />
auf eine lange, lange Zeitreise.<br />
Und Jonathan Wolrab sollte der Empfänger dieser Zeitpost sein. Als er<br />
da im Jahr 1841 mit zitternden Händen die beschriebenen Rattenhäute entdeckt,<br />
kann er nicht gleich alles lesen, geschweige denn verstehen, aber<br />
er spürt instinktiv, daß er einen Jahrhundertfund gemacht hat. Etwas von<br />
dieser Erregung färbte natürlich auch auf mich ab, der ich in diesem neuseeländischen<br />
Schuppen saß und die ganze Geschichte als Überflieger<br />
nacherlebte. Wenn die da ein Fax gehabt hätten, hätte ich euch gerne ein<br />
paar Blätter im Original rübergeschickt, dann hätten wir die brisanten Sachen<br />
später mal in Ruhe untersuchen können. Aber da gab es da zwar jede<br />
Menge Werkzeug, das man als Kiwi-Farmer braucht, aber kein Fax. Und<br />
natürlich auch keine altgriechischen und hebräischen Wörterbücher, so<br />
daß mir viele der verwendeten Begriffe unverständlich blieben. <strong>Der</strong> gebildete<br />
Rabbi beherrschte mehrere Sprachen, was hohe Anforderungen ans<br />
Studium seiner Aufzeichnungen stellt. In Wolrabs Falle kommt noch hin<strong>zu</strong>,<br />
daß es ihm immer nur <strong>zu</strong> bestimmten Tageszeiten möglich ist, <strong>zu</strong> lesen,<br />
dann nämlich, wenn der schmale Lichtstrahl durch die Schießscharte fällt<br />
und den feuchten Raum etwas erhellt. Bei mir war es umgekehrt: ich konnte<br />
nur nachts lesen.<br />
Wann immer es Wolrab irgend möglich ist, saugt er das umfangreiche<br />
Geheimwissen in sich auf, schreibt es ab wie ein Mönch und macht sich<br />
seine Gedanken da<strong>zu</strong>. Es wird sein Lebenselexier, dem er sich mit Haut<br />
und Haaren verschreibt. Das ist schließlich das Einzige, was er in seinem<br />
Loch machen kann. Er will die Rattenbibliothek unter allen Umständen bewahren,<br />
<strong>zu</strong>gleich aber auch schützen. Deswegen verbirgt er seinen Schatz<br />
immer sorgsam vor dem <strong>Turm</strong>wächter Heck, dessen Kontrollroutine er natürlich<br />
kennt.<br />
Und irgendwann, als Wolrab mal wieder knietief in der mittelalterlichen<br />
Alchimie des Rabbi Norach steckt, und er alle Zeit um ihn herum vergessen<br />
hat, kam ich in Neuseeland über seinen Tagebüchern wieder <strong>zu</strong> mir,<br />
45
und merkte, wie spät es war. Ich dachte an Barlow, der kein Pardon kannte,<br />
wenn es um seine Kiwis ging. Es fiel mir natürlich schwer, mich mitten<br />
in der Geschichte von den Wolrab'schen Aufzeichnungen los<strong>zu</strong>reißen,<br />
aber noch schwerer fiel es mir, mich überhaupt wach<strong>zu</strong>halten. Außerdem<br />
hielt ich es erstmal für unverzichtbar, meiner Rolle als Erntehelfer gerecht<br />
<strong>zu</strong> werden. Draußen dämmerte schon der Morgen, und so trottete ich dann<br />
mit brummendem Kopf und schmerzenden Muskeln in mein Zelt, um ein<br />
paar Stunden traumlosen Schlaf <strong>zu</strong> finden.<br />
Tagsüber auf dem Feld war ich natürlich keineswegs der Herkules. Ich<br />
konnte mich nach den zwei aufwühlenden Nächten kaum noch auf den Beinen<br />
halten, und so manche Kiwi glitt mir aus den Händen. Barlow warf mir<br />
gelegentlich Blicke <strong>zu</strong> und ließ einige unpassende Bemerkungen fallen. Ich<br />
war jedoch nicht gewillt, ihm irgendetwas <strong>zu</strong> verraten, sondern entschuldigte<br />
meine Blässe und den mangelnden Mumm bei der Arbeit mit erfundenen<br />
Wehwehchen. Barlow hatte ja schon <strong>zu</strong> Anfang gezeigt, daß er sich<br />
für Historisches nicht interessierte, warum sollte ich ihm dann von dem<br />
Dornröschen-Schatz in seinem Schuppen erzählen? Vermutlich war ich ja<br />
der Erste und Einzige, der diese unglaublichen Aufzeichnungen <strong>zu</strong> Gesicht<br />
bekam, von daher wollte ich den Inhalt nicht verplappern, ehe ich nicht<br />
wußte, wohin der Hase läuft. Ich hatte natürlich, wie ihr jetzt wahrscheinlich<br />
auch, den Kopf voller Fragen, aber igendwie fühlte ich mich verantwortlich<br />
für das Geheimnis der Rattenbibliothek, und wollte damit genauso behutsam<br />
umgehen wie Rabbi Norach und Jonathan Wolrab. Also hielt ich den<br />
Korken auf der Flasche und biß beim Kiwipflücken die Zähne <strong>zu</strong>sammen.<br />
Statt mich nach dem nächsten Arbeitstag mit einer guten durchgeschlafenen<br />
Nacht endlich wieder fit <strong>zu</strong> machen, tauchte ich gleich wieder in die<br />
magische Lektüre ab. Kein Wunder, denkt ihr jetzt, was denn sonst? Aber<br />
Leute, ich schlurfte tatsächlich auf dem Zahnfleisch und war total gerädert<br />
...<br />
O.K. Wie geht es weiter? Wolrab hat mittlerweile die meisten Aufzeichnungen<br />
Norachs gelesen und kopiert, auch die jener Insassen im <strong>Turm</strong>, die<br />
später den Zugang <strong>zu</strong>r Rattenbibliothek gefunden hatten - was übrigens<br />
nur wenigen der über fünf Jahrhunderte hinweg einsitzenden <strong>Turm</strong>häftlinge<br />
gelang. Da<strong>zu</strong> notiert Wolrab, jetzt wieder in seinen eigenen Worten, die<br />
ich abgeschrieben habe, folgendes:<br />
Nicht jedes Geheimnis ist für alle bestimmt. oder es wäre keines. Nur wessen Ohr.<br />
durch die Stille bis <strong>zu</strong>r Übersinnlichkeit geschärft, es unternahm, in jeden Zoll der<br />
Kerkermauer hinein<strong>zu</strong>horchen, bis daß er ihre hohlen Räume singen hörte, konnte<br />
dort jenen Schatz fmden, der mir kostbarer dünkt als alle Juwelen: die von Rabbi<br />
Norach begonnene und von mit ähnlich traurigem Schicksal geschlagenen Leidensgenossen<br />
fortgesetzte Rattenbibliothek. Wie glücklich darf ich mich schätzen, bei<br />
aUer Qual meines Daseins, dieser erlauchten Bruderschaft an<strong>zu</strong>gehören!<br />
Rabbi Norach hatte insofern vorgesorgt, als er seinen Nachfolgern eine detaillierte<br />
Gebrauchsanweisung <strong>zu</strong>r Herstellung von Rattenpergamenten<br />
46
hinterlassen hatte. Aber nicht alle hatten sie sorgfältig befolgt. Einige der<br />
späteren Rattenmanuslaipte zerfielen schon, andere waren verblaßt, so<br />
daß man die Schrift kaum mehr erkennen konnte. So war es dummerweise<br />
auch mit ein paar Bögen geschehen, die pornographische Zeichnungen<br />
enthielten. Leider ist Wolrab in dieser Hinsicht selbst seinem Tagebuch<br />
gegenüber äußerst einsilbig und hat die sicher sehr interessanten Zeichnungen<br />
eines phantasiegeplagten Häftlings aus dem 18. Jahrhundert nicht<br />
mitkopiert, so sehr ich das auch bedauert habe.<br />
In gewisser Weise habe ich euch übrigens erst den Anfang der Geschichte<br />
erzählt, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, jetzt kommt die<br />
Action. Daß etwas Dramatisches eingetreten sein muß, merkte ich daran,<br />
daß im Tagebuch plötzlich eine deutliche Zäsur auftrat. Mitten in einer<br />
penibel abgeschriebenen Liste mit kabbalistischen Traumsymbolen des<br />
Rabbi Norach klaffte eine Lücke in Wolrabs Tagebuch. Nach zwei leeren<br />
Blättern ging es mit anderer Feder und Tinte weiter. Was war geschehen?<br />
Mir lief eine Gänsehaut über den Rücken, als ich es in den folgenden Seiten<br />
nach und nach herausfand.<br />
Ich erwähnte bereits, daß Wolrab immer genau die Zeiten des Wärters<br />
Heck beachtet. um einer unliebsamen Entdeckung vor<strong>zu</strong>beugen, Doch er<br />
wiegt sich in falscher Sicherheit: urplötzlich fällt ein greller Lichtschein auf<br />
den Gefangenen. als der gerade über der Rattenbibliothek gebeugt sitzt.<br />
Es ist das Schlimmste eingetreten: sein Geheimnis ist entdecktl An jenem<br />
unglücklichen Tag ist nämlich der Gefängniswärter Heck erkrankt und hat<br />
die Turrnschlüssel vertretungsweise einem Verwandten aus dem Odenwald<br />
ausgehändigt, der eben <strong>zu</strong> Besuch war. <strong>Der</strong> hält sich natürlich nicht<br />
an den Heck'schen Zeitplan und ist auch sonst neugierig genug. in den Gefängnisräurnen<br />
rum<strong>zu</strong>schnüffeln. <strong>Der</strong> völlig überraschte Wolrab bangt um<br />
seinen Schatz, Alles, was ihn in dieser Gruft am Leben gehalten hat, was<br />
ihm wertvoll war, das Erbe der alchimistischen Bruderschaft aus fünf Jahrhunderten,<br />
für das er sich verantwortlich fühlt - all das droht jetzt in die<br />
Hände eines vorwitzigen Odenwälder Bauern <strong>zu</strong> fallen, <strong>Der</strong> laiegt natürlich<br />
auch spitz, daß Wolrab irgendetwas Ungewöhnliches in der Hand hat, und<br />
will nachsehen, was es ist. Er seilt sich also nach unten ins Turrnloch ab.<br />
Wolrab gerät in Panik. Entschlossen, die wertvollen Aufzeichnungen <strong>zu</strong><br />
schützen. macht er etwas, wo<strong>zu</strong> er sonst unter keinen Umständen je fähig<br />
gewesen wäre: Er hebt den Stein, hinter dem die Rattenbibliothek so lange<br />
in der Mauer verborgen war. und erschlägt damit den Bauern, der <strong>zu</strong>r falschen<br />
Zeit an den falschen Ort gekommen war.<br />
Die Passage, in der Wolrab dieses Drama beschreibt, habe ich wieder<br />
wörtlich abgeschrieben, mit flatterndem Kuli. erstens weil ich seine Agonie<br />
nachempfand, zweitens, weil ich ja darauf brannte, <strong>zu</strong> erfahren, wie es<br />
weitergeht. Aber ihr solltet ja schließlich auch etwas im O-Ton mitbekommen,<br />
Folgendes also schreibt Wolrab:<br />
Welch ein Hohnl Welch ein Elend! Ich, der unsChuldig Eingekerkerte ein Mörder?<br />
47
Die Neugier eines Ahnungslosen gereichte diesem <strong>zu</strong>m Verhängnis und verhalf mir<br />
<strong>zu</strong>r Flucht.<br />
<strong>Der</strong> Himmel ist Zeuge, daß ich nicht anders handeln konnte! Jener Gehilfe des alten<br />
Heck betral <strong>zu</strong>r Unzeit die Zelle, er überraschte mich beim Studium meiner Bibliothek,<br />
er ließ sich naseweis hinab, um den kostbaren Schatz an sich <strong>zu</strong> raffen, dessen<br />
Bewahrer <strong>zu</strong> sein das Schicksal mich erwählt hat. Nein, das durfte ich niemals <strong>zu</strong>lassen!<br />
Schrie es in mir. Ich nahm den Stein, der sein Geheimnis a11 die Jahrhunderte so<br />
sicher verwahrt hatte, nahm ihn und schlug von hinten mit aller Kraft auf den Kopf<br />
des Gehülfen ein, schlug, bis er strauchelte und auf dem modrigen Boden fiel.<br />
Mein Herz dröhnte wie eine Kriegstrammel. Als sei ich im Traum, und doch <strong>zu</strong>gleich<br />
mit panisch gereizten Nerven, zog ich dem Leblosen seine Beinkleider, seinen groben<br />
Odenwälder Kittel aus, um sie mir schnell über<strong>zu</strong>ziehen. Mit der einen Hand ergriff<br />
ich die Rattenbibliothek, mit der anderen die Schlüssel des unbedachten Wärters,<br />
dann hangelte ich mich am Seil nach oben dem Loche <strong>zu</strong>, einer plötzlichen und<br />
erschreckenden Freiheit entgegen. Doch weh mir! Halb war ich schon draußen, da<br />
hör te ich den Totgeglaubten unter mir ein weiteres Mal laut ächzen und stöhnen. Erneut<br />
ließ ich mich schaudernd hinab und schlug wie von Sinnen auf den Leib des<br />
Unglückseligen ein, bis er ganz verstummte und nur noch mein rasender Atem die<br />
Stille der Gruft durchschnitt.<br />
War es Nebel draußen oder hatte der Wahnsinn meine Sicht getrübt? leh wußte es<br />
nicht. Ich schloß den <strong>Turm</strong> hinter mir ab. Sollte die arme Leiche des Erschlagenen<br />
auch ein wenig von der Ruhe kosten, die <strong>zu</strong> erleiden ich bald ein Jahr gezwungen<br />
war. Ich torkelte von dannen, durch das einst geliebte <strong>Weinheim</strong>, dessen Häuser<br />
und Bewohner mir jetzt verschwommen waren wie in einem üblen Nachtmahr. Es<br />
mag sein, daß Menschen mich sahen, doch sie erkannten mich nicht. Mein Erscheinen<br />
muß so schreckeinflößend gewesen sein, daß niemand meinen Weg <strong>zu</strong> verstellen<br />
wagte. Den Schlüssel <strong>zu</strong>m <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> warf ich in die Weschnitz. Mit aller Macht<br />
hielt ich nur den alten und geheimen Schatz an mich gedrückt, um dessen Bewahrung<br />
ich <strong>zu</strong>m Mörder werden mußte, und stob wie von Sinnen davon. So glückte mir<br />
die Flucht.<br />
Ich kann mir das immer noch ganz plastisch vorstellen, wie der arme Jonathan<br />
in dieser Schocksituation mit klopfendem Herzen durch <strong>Weinheim</strong> irrt.<br />
Mit der Rattenbibliothek und seinem Tagebuch in der Tasche flieht er dann<br />
über die Pfalz und Flandern nach Ostende, von wo es ihm gelingt, sich nach<br />
England ein<strong>zu</strong>schiffen. Wie er sich bis dahin durchschlägt, ist noch mal eine<br />
Geschichte für sich. Er hat sehr lebendig und blumig beschrieben, wie er<br />
unter die Fahrenden gerät, sich einer Räuberbande anschließt, eine Postkutsche<br />
überfällt und dabei einen Paß ergattert. Von London heuert er auf<br />
einem Frachtschiff nach Amerika an. Dort macht aber die Einwanderungsbehörde<br />
wegen seiner falschen Papiere Probleme. Irgendwie wird er dann<br />
von einem zwielichtigen Schlepper, der die Auswegslosigkeit seiner Lage<br />
ausnutzt, auf ein Walfangschiff verkauft, wo er wie ein Sklave schuften muß.<br />
Wie ihr seht, bietet Wolrabs Story im Grunde Stoff für mehrere Romane,<br />
aber ich will versuchen, mich auf die Hauptlinie <strong>zu</strong> konzentrieren, und die<br />
führt ihn jetzt erstmal nach Australien, wo er sich endlich absetzen kann.<br />
Gut, ich überspringe einige Stationen in Sydney und den Blue Mountains;<br />
entscheidend ist, daß Wolrab in Victoria ein unwahrscheinliches Gespür<br />
an den Tag legt, Gold <strong>zu</strong> finden. Wo immer er schürft und gräbt, ist<br />
48
auch prompt eine Goldader getroffen! Diese bemerkenswerte Fähigkeit, so<br />
schreibt er in seinem Tagebuch, hat er niemand anderem <strong>zu</strong> verdanken als<br />
dem Rabbi Norach und dessen alchimistischen Lehren! Das müßt ihr euch<br />
mal vorstellen, daß da ein entflohener Häftling und Mörder aus <strong>Weinheim</strong><br />
jetzt in Australien <strong>zu</strong>m Glückspilz wird, weil er in einem Geheirnmanuskript<br />
aus dem 14. Jahrhundert etwas über die Zusammenhänge zwischen den<br />
Schätzen der Seele und den Schätzen der Erde erfahren hat, und wie man<br />
sich beide <strong>zu</strong>nutze macht! Es ist schon eine faustdicke Ironie, daß die Vermutung<br />
von Ruprecht 1., jener jüdische Rabbi könne vielleicht Gold machen,<br />
Jahrhunderte später in Australien Wirklichkeit wird. Wolrab, das habe ich<br />
jetzt wieder wörtlich aufgeschrieben, spricht da nämlich ... :<br />
... mit Erdgeistern, Faunen und Elfen, jenen Meistern der Transmutation und Hütern<br />
aller Schätze der Erde. Nun sollte es sich als nützlich erweisen, daß mich der alte<br />
Rabbi so gewissenhaft in der Anrufung jener Geister unterwiesen hatte, gleichwohl<br />
er nicht ahnen konnte, daß diese auch in einem Kontinente heimisch sind, von dessen<br />
Existenz ihm jede Kenntnis fehlte. Allein, ich befolge die Anleitungen seiner<br />
märchenhaften Wissenschaft und sehe mich mit ihren Früchten reichlich belohnt.<br />
Wie Ihr an diesem Schreibstil seht, bleibt Wolrab im Grunde immer noch<br />
der zarte, etwas knotige Romantiker, der er schon in <strong>Weinheim</strong> war. Das<br />
Dumme ist, daß er sich als solcher in der rauben Gesellschaft der australisehen<br />
Goldgräber nicht behaupten kann. Seine unglaubliche Findigkeit auf<br />
den Goldfeldern erregt mehr Aufsehen, als er verkraften kann. Irgendwann<br />
wird er überfallen, halbtot geprügelt, alles Gold wird ihm abgenommen.<br />
Wieder steht er mit nichts da als dem nackten Leben und der Rattenbibliothek<br />
Die wird ihm von den Räubern - es sind Analphabeten - tröstlicherweise<br />
gelassen.<br />
Danach notiert Wolrab über die eigenartige Symbiose, die er mit seinem<br />
Schatz eingegangen ist:<br />
Das Leben des seltenen Manuskripts aus dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> und mein eigenes scheinen<br />
eine schicksalhafte Bindung eingegangen <strong>zu</strong> sein: das eine rettet sich Dm, indem<br />
es das andere dmch alle Fährnisse bewahrt, in die beide verstrickt sind. Ohne<br />
den Trost und die geheimen Ratschläge jener alten Weisheit wäre mein Dasein an<br />
seiner blanken Noth längst zerbrochen - und ohne meine Noth läge die Rattenbibliothek<br />
noch immer in jenem dunklen Kerker verborgen, der uns einst gemeinsam<br />
beherbergte, und dem wir nur gemeinsam entkommen durften.<br />
Nachdem seine Wunden verheilt sind, setzt er sich auf die Südinsel Neu<br />
Seelands ab, wo neue Goldfunde gemeldet werden.<br />
Wie gesagt, auch das ist alles erst der Anfang. Ich bin längst noch nicht<br />
durch mit der Nacherzählung, obwohl ich vieles der Einfachheit halber<br />
übersprungen habe. Allerdings war ich in meinem alchimistischen Geräteschuppen<br />
jetzt wieder an einem Punkt der Müdigkeit angelangt, der mir<br />
schon krankenhausreif vorkam. In Wolrabs Text ging es immer spannender<br />
<strong>zu</strong>, aber draußen auf der Red Tower Plantation wurde es bereits hell, und<br />
außerdem warteten noch jede Menge Kiwis darauf, gepflückt <strong>zu</strong> werden.<br />
49
die höhere Schule der Alchimie, die das Metall Gold ja als Symbol nimmt,<br />
um den Prozeß der feinstofflichen Vergoldung der Seele <strong>zu</strong> beschreiben.<br />
Aber wie gesagt, je weiter Wolrab in die Bereiche der esoterischen Transmutationen<br />
vordringt, und das hat er offensichtlich getan, desto schweigsamer<br />
wird er auch. Unter den gegebenen Umständen konnte ich auch<br />
nicht all<strong>zu</strong> sehr in die Feinheiten gehen, erstmal mußte ich mir ja einen<br />
Überblick verschaffen.<br />
Am 11. Mai 1863 jedenfalls schreibt Wolrab <strong>zu</strong>m letzten Mal etwas in<br />
sein Tagebuch. Er rekapituliert noch einmal sein Leben und verweist auf<br />
seine noch immer offenen seelischen Wunden. Ich habe diesen letzten Abschnitt<br />
wieder wörtlich abgeschrieben:<br />
Die Schmach, die ich in der Heimat erfuhr, ist nicht getilgt, aber doch gemildert<br />
durch die Schönheit der blühenden Gärten und den Wohlstand, den mir mein krauses<br />
Schicksal <strong>zu</strong> guter Letzt beschert hat. Gleichwohl die Umstände, unter denen ich<br />
<strong>zu</strong>m Siegelbewahrer der Rattenbibliothek wmde, schwer auf meiner Seele lasten,<br />
sehe ich in ihr den kostbarsten aller Schätze. Diese Bibliothek hat mir in den<br />
schwersten Zeiten das Leben gerettet, indem sie meinen Geist, der sonst schier<br />
verhungert und irre geworden wäre, mit steter Nahrung versorgt hat. Nahrung, die<br />
mich aus der tiefsten Kerkergruft heraus mit der Weisheit des Himmels versorgt hat,<br />
sowie mit dem Gold der Erde, welches jener entspringt, und welches nach dem<br />
göttlichen Plan einst alle Menschen durchdringen wird. Diesen Schatz in mehrfacher<br />
Hinsicht durfte ich nicht in die Hände der Häscher fallen lassen, auf daß sie<br />
sich eine billige Belohnung holen bei den Engherzigen und den Bösartigen. Nur daduzch,<br />
daß ich um des Geheimnisses dieser Kostbarkeit willen <strong>zu</strong>m Mörder wurde,<br />
fand meine unschuldig erlittene Kerkerzeit ein Ende. Gebe Gott, daß die Zeit kommen<br />
mag, wo auch die Rattenbibliothek unbesorgt an den Tag korrunen darf, damit<br />
die große und goldene Kunde meines unsichtbaren Freundes Rabbi Norach so munter<br />
wachsen kann wie meine Apfelbäume.<br />
Allein ich spüre, daß diese Zeit nicht die meine sein wird. Wohin kann ich meinen<br />
schweren Schatz betten? Mein Gemüt ist voller Pein und es sehnt sich nach mildem<br />
Zuspruch und Zärtlichkeit. Ich bin alt und ratlos, jede Freude scheint mir so fern wie<br />
das <strong>Weinheim</strong> meiner arglosen jugend. Kann ich <strong>zu</strong> Lebzeiten je vor einem menschlichen<br />
Wesen den Schleier lüften, mit dem eine grausame Vergangenheit meine<br />
Seele verhüllt?<br />
Meine Nachbarn und Gehilfen, in ihrer freundlichen Ahnungslosigkeit, ermuntern<br />
mich, heute <strong>zu</strong>m Tanz nach Motueka <strong>zu</strong> gehen. Es ist mir der Gedanke schwer, den<br />
Unbekümmerten Gesellschaft <strong>zu</strong> leisten. Aber schwerer noch ist mir der Gedanke,<br />
bis ans Ende meiner Tage Gefangener meines Kummers <strong>zu</strong> bleiben ...<br />
Tja, das ist nun eigentlich kein Schlußwort, aber danach gab es nur noch<br />
weiße Seiten in Wolrabs Tagebuch. Was nun? Meine Begleitung von Wolrabs<br />
Abenteuern, meine nächtliche Reise über die Horizonte der Vergangenheit<br />
war <strong>zu</strong> einem Abschluß gekommen, der kein richtiges Ende war.<br />
Obendrein war die Kiwiernte fast vollständig eingebracht und mit Ablauf<br />
des nächsten Tages würde es keinen Grund mehr geben, länger auf der<br />
Red Tower Plantation <strong>zu</strong> bleiben. Eigentlich hätte ich mich freuen sollen,<br />
denn ich konnte nun meine Fahrt durch Neu Seeland mit aufgebesserter<br />
Reisekasse fortsetzen und ich wußte, daß noch einige schöne Plätze auf<br />
51
mich warteten. Aber wie ich da mit roten Augen über der letzten Seite des<br />
Tagebuchs im Schuppen saß, kam <strong>zu</strong> meiner notorischen Übermüdung<br />
noch ein Gefühl von ... ich möchte sagen: von Unvollständigkeit. Ich wußte<br />
nun Einiges, und zwar Erstaunliches über Jonathan Wolrab, aber es fehlten<br />
doch ein paar Glieder in der Kette. Was geschah mit Wolrab nach diesem<br />
letzten Eintrag? Außerdem gab es viele Details in seiner Geschichte, die<br />
ich mir gern genauer angeschaut hätte, als es mir während dieser klandestinen<br />
Eil-Lektüre möglich war. Soviel stand fest: Dieser Schatz, den ich<br />
mittlerweile schon als meinen Schatz betrachtete. sollte nicht in diesem<br />
Geräteschuppen neben allerlei Unrat vermodern. Gesagt, getan. Trotzdem<br />
wurde mir reichlich flau im Magen, als ich die Kladde mit Wolrabs Schriften<br />
an mich nahm, den Lederkoffer aufs Regal <strong>zu</strong>rückstellte, und mich dann<br />
mit dem heißen Fund unterm Arm auf den Weg <strong>zu</strong> meinem Zelt machte. Ich<br />
fühlte mich inzwischen ganz als Mitglied dieser verschworenen Bruderschaft<br />
von Rabbi Noarch, Jonathan Wolrab und den anderen Teilnehmern<br />
an dieser erstaunlichen Bibliothek. Sie alle waren meine geistigen Komplizen,<br />
meine Begleiter. davon war ich überzeugt.<br />
Peng! In dem Moment ging die Tür auf. John Barlow versperrte mir den<br />
Weg! Au verdammt, dachte ich, jetzt ist alles aus. Nachts um vier, am letzten<br />
Tag vor der Abreise, mit offensichtlichem Diebesgut in der Hand angetroffen<br />
<strong>zu</strong> werden, macht nicht nur auf der Red Tower Plantation einen verdammt<br />
schlechten Eindruck. Ich blickte wild um mich und wußte nicht wohin<br />
mit mir. Überraschenderweise fragte Barlow nur ganz kurz und trokken:<br />
»So what did you find?« Was hast du gefunden? Es war mir in der Situation<br />
unmöglich, ihm irgend eine glaubhafte Lüge auf<strong>zu</strong>tischen. also entschloß<br />
ich mich kurzerhand, mein Heil in der Wahrheit <strong>zu</strong> suchen. Das<br />
heißt, ich mußte ihn um Geduld bitten. damit er sich die ganze, lange, krause<br />
Geschichte anhörte. Und dann holte ich tief Luft und erzählte 'lohn Barlow<br />
ungefcihr dasselbe, was ich euch eben erzählt habe. Er hörte sich auch<br />
alles aufmerksam an und schaute mir nur ab und <strong>zu</strong> prüfend in die Augen.<br />
Wie es nun weitergehen würde, wußte ich natürlich nicht, aber nachdem<br />
ich die Geschichte das erste Mal mit einem anderen Menschen geteilt<br />
hatte, fühlte ich eine tiefe Erleichterung, obwohl ich gerade mehr oder weniger<br />
als Dieb entlarvt worden war. John Barlow stand dann auf und bat<br />
mich <strong>zu</strong> warten. Hmm. Was sollte das nun wieder heißen? Er kam kurze<br />
Zeit später mit einer Holzschachtel unterm Arm wieder, setzte sich mir gegenüber<br />
auf einen Schemel und sagte: »So, ich glaube. jetzt hab ich dir etwas<br />
<strong>zu</strong> erzählen« . - Rhetorische Pause. in der der nur der neuseeländische<br />
Nachtwind über dem Schuppen <strong>zu</strong> hören war, - bis er dann sagte: »Ich bin<br />
der Urenkel von Jonathan Wolrab - und in dieser Kiste ist die Original-Rattenbibliothek<br />
aus dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>. «<br />
Mein Staunen war grenzenlos. Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr.<br />
Wie sollte das noch <strong>zu</strong>sammenhängen? Geistig streckte ich alle Viere von<br />
mir. Aber jetzt war Barlow mit dem Erzählen dran. Er sagte. daß er vom ersten<br />
Tag an wußte, womit ich meine nächtliche Freizeit verbrachte. Nach-<br />
52
dem er erfahren hatte, daß ich Deutscher war, hatte er alles so eingerichtet,<br />
daß es mir unmöglich war, den Koffer nicht <strong>zu</strong> finden. Und sobald er<br />
merkte, daß ich angebissen hatte, ließ er mich einfach still gewähren. Die<br />
ganze Zeit, während ich meine erschütternden Forschungen machte, stand<br />
ich gewissermaßen unter Observierung. Und warum hatte er erst jede Verbindung<br />
<strong>zu</strong>r Grundergeschichte der Red Tower Plantation abgestritten?<br />
Barlow wollte schlicht und ergreifend wissen, was in dieser Kladde stand,<br />
die ihm ein Geheimnis war, und deren altdeutsche Schriftzüge er nicht entziffern<br />
konnte. Er wußte, daß es sich bei dem Kofferinhalt um ein brisantes<br />
Familiendokurnent handelte, aber er wußte nicht, wie er seinen Inhalt<br />
gleichzeitig kennenJernen und geheim halten konnte. Deswegen hielt er es<br />
für taktisch klüger, ganz im Hintergrund <strong>zu</strong> bleiben und war froh, daß ich<br />
prompt in die Falle tappte, mich unbeobachtet fühlte und mich schließlich<br />
noch in eine Situation manövrierte, wo ich völlig in seiner Hand lag. »So<br />
konnte ich sicher sein, daß du mich nicht verkohlst.« Das sagte er alles<br />
ganz offen und freundlich, und daß er dankbar sei, daß alles so gut geklappt<br />
hatte. Er schien überhaupt nicht sauer.<br />
Es war völlig verrückt: eben noch dachte ich, Barlow würde mich in<br />
Neu Seeland hinter Gitter bringen, und jetzt saßen wir wie zwei Komplicen<br />
über einem Abenteuer, das wir gemeinsam bestanden hatten. Allmählich<br />
klingelte es bei mir und ich erwachte soweit aus meiner Käferstarre, daß<br />
ich mich schon wieder traute, Fragen <strong>zu</strong> stellen. Zum Beispiel, warum er<br />
denn Barlow heißt, wenn er doch der Urenkel von Wolrab ist, und warum<br />
er diese Verbindung erst abgestritten hatte?<br />
»Das ist einfach«, sagte er mit einem Grinsen, »mein Großvater ließ sich<br />
umbenennen. Und zwar wörtlich: Er buchstabierte den Namen Wolrab einfach<br />
rückwärts und heraus kam Barlow, was sehr englisch klingt. Gleichzeitig<br />
mit dieser Namensänderung verhängte mein Großvater eine Art Tabu<br />
über die Vorgeschichte der Familie, die ihm als Erbe eines Obstbauem in<br />
Neu Seeland offensichtlich nicht ganz geheuer war. Niemand sollte über<br />
seine Vorfahren das Geringste wissen, schon danach <strong>zu</strong> fragen war uns<br />
strengstens verboten. Mein Vater hielt sich auch daran, aber mich hat es<br />
doch nach und nach gereizt, heraus<strong>zu</strong>laiegen, was hinter dem Familientabu<br />
verborgen ist. Dank deiner heimlichen Lektüre weiß ich es jetzt. Thanks!<br />
Übrigens, mit dem wenigen, was ich über den Vater meines Großvaters<br />
weiß, kann ich dir sagen, wie es mit Jonathan Wolrabs Leben nach seiner<br />
letzten Tagebucheintragung weiterging: <strong>Der</strong> alte Jonathan hat sich damals<br />
tatsächlich aufgerafft, <strong>zu</strong>m Tanz <strong>zu</strong> gehen und hat da seine <strong>zu</strong>künftige Frau<br />
gefunden, eine Maorifrau, die ihm den ersehnten »milden Zuspruch und<br />
Zärtlichkeit« gegeben hatte, meine Urgroßmutter. Er muß sehr glücklich<br />
mit ihr gewesen sein, deswegen hat er wohl einen Schlußstrich unter seine<br />
Vergangenheit gezogen und auch das Tagebuch nie mehr angerührt. In<br />
welchem Maße mein Großvater, also Wolrabs Sohn, in die ganzen Geheimnisse<br />
eingeweiht war, kann ich nicht sagen. Aber wieviel er auch wußte, er<br />
sorgte dafür, daß alle Erinnerungen unter striktem Verschluß blieben.<br />
64
Aber jetzt, nach aB den Jahren, wo ich endlich etwas über das wirkliche<br />
Leben meines Urgroßvaters, über seine Herkunft, sein Schicksal weiß,<br />
kann ich sagen: ich bin stolz, ein Barlow-Wolrab <strong>zu</strong> sein!«<br />
Sprachs, und schlug mir anerkennend auf die Schulter.<br />
Ihr könnt euch denken, in welchem Wechselbad der Gefühle ich mich<br />
befand. Aber dann fiel mein Blick doch auf das Holzkästchen neben John.<br />
Meine brennende Neugier war erwacht, die mittelalterliche Rattenbibliothek<br />
nun endlich im Original <strong>zu</strong> sehen. John bemerkte meine Blicke. Ohne<br />
ein Wort <strong>zu</strong> sagen, nahm er die Kiste und klappte sie auf. Sie war leer! Bis<br />
auf ein paar kleine Krümel in den Ecken, die allerdings nach einer sehr<br />
merkwürdigen Art von Leder rochen. »Maden, eine verdammte Plage!«<br />
sagte John, und fuhr fort: »Als ich nach dem Tode meines Vaters vor einem<br />
Jahr die alten Truhen öffnete und auch in diese Kiste schaute, war schon<br />
alles zerstört. Bis jetzt wußte ich nicht, was die Maden da weggefressen<br />
haben. Unsere Schaffelle behandeln wir natürlich alle dagegen, aber wer<br />
hätte ahnen können, daß altdeutsche Rattenhäute für neuseeländische Maden<br />
so ein Leckerbissen sein würde?«<br />
Barlow holte dann den Koffer vom Regal, öffnete ihn und legte die leere<br />
Holzkiste <strong>zu</strong> den alten Klamotten. Dann sagte er »Darf ich?« und streckte<br />
seine Hände in meine Richtung aus. Wortlos reichte ich ihm das Tagebuch<br />
Jonathan Wolrabs, das ich bis dahin fest umklammert gehalten hatte, ohne<br />
es <strong>zu</strong> merken. Augenzwinkernd legte Barlow es in den Koffer <strong>zu</strong>rück,<br />
klappte ihn <strong>zu</strong>, stand er auf und ging mit dem Koffer in der Hand <strong>zu</strong>r Tür.<br />
Beim Rausgehen sagte er noch, ich brauchte heute keine Kiwis pflücken<br />
und sollte mich mal richtig ausschlafen. Überflüssig <strong>zu</strong> eIWähnen, daß ich<br />
die Aufforderung befolgte; den halben Tag hab ich geratzt wie ein Stein.<br />
Am Nachmittag sollten die Erntehelfer mit einem Pickup-Truck <strong>zu</strong>r Hauptstraße<br />
nach Motueka gefahren werden. Ich sammelte meine Siebensachen<br />
<strong>zu</strong>sammen, immer noch leicht benommen. Als es losging, nahm mich John<br />
Barlow nochmal kurz kurz <strong>zu</strong>r Seite: »Wir müssen rauslaiegen, wo der alte<br />
Wolrab sein Gold vergraben hat. Mir ist da eine Idee gekommen, für die<br />
ich deine Hilfe brauche. Hast du Lust?« - »Ähm, ähm, ja!« Stammelte ich.<br />
»Gut, dann komm in einem Jahr wieder«, sagte er. Ich war natürlich wieder<br />
voller Fragen, aber mit mehr wollte Barlow nicht herausrücken. Keine<br />
Ahnung, wie der alte Fuchs das gemeint hat. War das nun die endgültige<br />
Finte, um mich von dem Tagebuch weg<strong>zu</strong>kriegen? Hat er bei meiner Geschichte<br />
irgend einen Hinweis kombiniert, der mir entgangen ist? Vielleicht<br />
hat er auch ganz einfach die Wahrheit gesagt und er sitzt über einem<br />
Geheimnis mit einjähriger Karenzzeit. Wie auch immer, ilu könnt sicher<br />
sein, daß ich nächstes Jahr wieder runterfahre.<br />
Als wir dann auf dem Truck saßen und losfuhren, winkte mir Barlow<br />
nochmal nach und rief: » Wenn du nach <strong>Weinheim</strong> kommst, grüß mir den<br />
<strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>. - Und wenn du daheim in eine Kiwi beißt, denk an die Red<br />
Tower Plantation!«<br />
55
Zur Geschichte<br />
der Gerichte<br />
»Die zjvilisiertesten Völker sind für das Gift<br />
der Barbarei so anfällig wie das blanke Eisen<br />
für den Rost. Völker und Stahl, beide<br />
glänzen nur an der Oberfläche.« (Riv8rol)<br />
Rechtssprechung war immer eine Auslegungssache der Obrigkeit. Und sie<br />
war bis vor relativ kurzer Zeit immer vom »reinen Rachegedanken« beseelt.<br />
Merkwürdig der alte Name für »Galgen«: Hochgericht. <strong>Der</strong> <strong>Weinheim</strong>er<br />
Galgen stand außerhalb der Stadtmauern und war ein gemiedener<br />
Platz. Nur <strong>zu</strong> Hinrichtungen strömten die Leute aus den umliegenden Ortschaften.<br />
um sich das schaurige Schauspiel nicht entgehen <strong>zu</strong> lassen. Aber<br />
schließlich hatten sie ja auch noch keine Bild-Zeitung und kein TV.<br />
Sehr eigenartig jedoch dünkt es mir, daß jener ehemals verrufene Platz<br />
heute jener Ort in <strong>Weinheim</strong> ist, der nie <strong>zu</strong>r Ruhe kommt. Täglich fluchen<br />
Weinheirner und Durchreisende hier. als ob sie von den unruhigen Geistern<br />
ehemals Erhängter verfolgt würden.<br />
Wo dieser Platz ist? Bitte weiterlesen ...<br />
Das von König Ruprecht im Jahre 1404 der Stadt verliehene Recht, »daß die <strong>Weinheim</strong>er<br />
vor kein Landgericht oder königliches Hofgericht, noch vor irgend ein anderes<br />
Gericht geladen werden, sondern nur vor Bürgermeister und Rat ihrer Stadt <strong>zu</strong><br />
Gericht stehen sollen«, ging im Laufe der Jahrhunderte nach und nach verloren. (. .. )<br />
Als im Jahre 1561 entschieden wurde, daß in allen" Jurisdictionalibus et Judicialibus«<br />
nichts ohne Mitwirkung des landesherrlichen Beamten (des Stadtschultheißen) unternommen<br />
werden dÜIfe, WaI dem Stadtrat das einst verliehene Recht völlig aus<br />
der Hand genommen. Das Stadtgericht war <strong>zu</strong>r Rolle eines Untergerichts herabgesunken;<br />
nur kleinliche Beleidungssachen und Besitzstreiligkeiten blieben ihm übrig.<br />
Alles Wichtigere, insbesondere, wenn es um Leib und Leben ging, wurde nach Heidelberg<br />
weitergegeben.<br />
Als einzige Erinnerung an den einst der Stadt <strong>zu</strong>stehenden Blutbann blieb der Galgen<br />
stehen, der außer halb der Stadt nach der Ebene errichtet war. Das Gewann, auf<br />
dem der Galgen stand, heißt heute noch das Hochgericht und wird im Volksmund<br />
der Galgenbuckel genannt. Dabei lag das sogenannte Freigeding, d. h. Gerichtsplatz.<br />
Die heutige Gewannbezeichnung Freitag (Freidig) deutet noch darauf hin.<br />
Daß es an diesem Platz nicht geheuer war, konnte man vor wenigen Jahren noch<br />
hören. Einmal sah man einen Soldaten ohne Kopf dort wandeln, ein andermal war es<br />
ein Reiter, der auf einem Schimmel mit langer Mähne und Schwanz sich tummelte.<br />
Auch will man bis Milte des vorigen Jahrhunderts dort nachts zwischen 11 und<br />
12 Uhr öfters den Ruf gehört haben: »Ach Gott, ach Gott, hili.o: (9)<br />
56
<strong>Der</strong> Galgen bestand, wie heute an einem ähnlichen Bauwerk in Beerfelden<br />
noch <strong>zu</strong> sehen ist, aus drei steinernen Säulen, die etwa vier bis fünf Meter<br />
hoch auf einem dreieckigen Fundament aufgemauert waren. Diese Säulen<br />
waren mit dicken Holzbalken belegt, an denen Eisenketten befestigt waren.<br />
Über die Benüt<strong>zu</strong>ng des Galgens, der als Wahrzeichen des alten Rechts immer<br />
wieder von der Stadt aufgerichtet wurde, haben wir aus der früheren Zeit keine<br />
Nachricht. Auch über Hexenprozesse ist uns keine Nachricht überliefert. Aber wie<br />
überall, so dürften auch vor dem 17. Jahrhundert hier Hexen abgeurteilt und hingerichtet<br />
oder verbrannt worden sein. <strong>Der</strong> Hexenturm ist ein Zeuge jener dunklen<br />
Zeit. Stark benutzt wurde der Galgen in späterer Zeit nicht, höchstens wohl durch<br />
die hier fast ohne Unterbrechung vorbeiziehenden und einquartierten Truppen.<br />
Auch dürfte gelegentlich ein Todesurteil durch die Landesherrschaft hier vollstreckt<br />
worden sein. (9)<br />
Es ist auch nicht bekannt, wo genau die vielen <strong>Weinheim</strong>er Bürger, die einstens <strong>zu</strong>r<br />
»Turrnstrafe« verurteilt worden waren, ihre Strafe verbüßt haben. Im allgemeinen<br />
wurde der Name des <strong>Turm</strong>s bei Bekanntgabe der Strafe nicht genannt; wenn er<br />
aber genannt wurde, handelte es sich um den ROTEN TURM oder den Blauen Hut.<br />
Nur in einem einzigen Falle wurde im Jahre 1634 ein <strong>Weinheim</strong>er Bürger wegen Beleidigung<br />
eines Bürgermeisters und wegen übler Nachrede in den »Diebsturrn« gesetzt.<br />
(10)<br />
Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden erhebliche Bemühungen unternommen,<br />
wieder Ruhe, Sitte und Ordnung im Lande her<strong>zu</strong>stellen.<br />
Man darf wohl sagen, daß die Bevölkerung <strong>zu</strong>m erstenmale eine nachdrücklich gehandhabte<br />
Polizei kennen lernte. ( .. . ) Die Bierglocke sollte des Abends schon 8 Uhr<br />
geläutet werden, das Saitenspiel in den Wirtshäusern wurde verboten, Prasserei<br />
bei Hochzeiten und sonstigen Festlichkeiten wurden durch strenge Vorschriften<br />
bekämpft, namentlich aber wurden geschlechtliche Vergehungen mit überaus<br />
schweren Strafen bedroht. Es konnte nicht ausbleiben, daß da ein widerliches<br />
Hexenturm<br />
13 m<br />
Blauer<br />
Hut<br />
27 m<br />
Rathausturm<br />
39 m<br />
67<br />
Wlndedt<br />
2B m<br />
WadIenburg<br />
32 rn<br />
<strong>Rote</strong>r<br />
<strong>Turm</strong><br />
30m
Denunziantentum sich breit machte, und man hat gelegentlich auch den Eindruck,<br />
daß die langatmigen Protokolle, die man über einen Spinnstubenunfug oder über<br />
den Fehlhitt einer Bauernmagd aufnahm, ihren Gegenstand mit einem gewissen Behagen<br />
behandeln, so daß man billig zweifeln mag, ob die berufenen Sittenwächter<br />
und Sittenrichter im Grunde viel besser waren, als die armen Sünder, die ihnen unter<br />
die Hände kamen. Trotz alledem ist nicht <strong>zu</strong> zweifeln, daß die Strenge, mit der<br />
man der Sittenlosigkeit der Bevölkerung entgegentrat, im ganzen eine bessernde<br />
Wirkung doch allmählich ausübte. (1)<br />
Über im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> inhaftierte Missetäter berichten uns die drei nun folgenden<br />
Zeitungsberichte: über die verfolgten Straftaten, die Rechts-Zustände,<br />
die Strafen und die legendären Hinrichtungen aus dem Jahr 1662:<br />
Dunkle jagdgeschichten. - Die Ausübung der Jagd im Hemsbacher Bann war im<br />
16. und 17. Jahrhundert ein ständiges Streitobjekt. Im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> wurde manche<br />
Wilddieberei verhandelt. Niemand respektierte die Grenzen, die damals zwischen<br />
Pfalz, Mainz und Worms gezogen waren. Als ein Jäger von jenseits der Grenze einer<br />
Vorladung vor den Kadi in <strong>Weinheim</strong> nicht Folge leistete, erging von Heidelberg<br />
der Befehl, ihn »beim Kopf« <strong>zu</strong> nehmen. Als der Wormser Oberjäger Hans Schäfer<br />
auf <strong>Weinheim</strong>er Jagd ertappt wurde, ließ ihn der <strong>Weinheim</strong>er Keller Reineck durch<br />
vier Mann nach dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> bringen und hielt ihn 14 Tage in Gewalusam. Er<br />
mußte 20 Gulden Strafe zahlen, eine Kaution stellen und sein Schießgewehr <strong>zu</strong>rücklassen.<br />
Als Vergeltung wurde ein anderesmal der Hofbauer Hans Kraus aus Oberlaudenbach<br />
als ]agdhüter des <strong>Weinheim</strong>er Kellers vierzehn Tage in Heppenheim in<br />
den <strong>Turm</strong> gesetzt und mußte sein Pferd und Schießprügel <strong>zu</strong>rücklassen. (13)<br />
Ein dickköpfiger Nachbar. - Unweit des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es hatte im 17. Jahrhundert der<br />
Junker von Schmidtberg, ein hochfahrender Adliger, seinen Herrschaftssitz. Nach<br />
einem <strong>Weinheim</strong>er Ratsprotokoll vom Jahre 1654 hatte sich folgendes <strong>zu</strong>getragen.<br />
Am 1. März 1664 lag vor dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> ein »verreckter« Bock, der nach den Aussagen<br />
der »Fischersgret« aus dem Schmidtbergschen Anwesen geworfen wurde.<br />
Da sich der Adlige weigerte, das Aas <strong>zu</strong> entfernen, wurde der Rat der Stadt beauftragt,<br />
mit dem Junker gütlich <strong>zu</strong> verhandeln, da er als grober und aufurausender<br />
Mensch bekannt war. Führer der Delegation war der damalige Apotheker der<br />
Engelapotheke, Jost Christof Heinemann, der ab 1652 Ratsherr und ab 1655 Ratsbürgermeister<br />
war. Es gab lange Verhandlungen wegen dem toten Bock, aber beseitigen<br />
mußte ihn die Stadt. (13)<br />
Doch ist weiteres nicht unternommen worden. <strong>Der</strong> Vater des Junkers, der schon um<br />
1618 auf dem Hof beim <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> saß, war nach Aussage von Zeugen ein unruhiger,<br />
gottloser Mann und ließ oft mehr Vieh, als gestattet war, auf die Gemeindeweide<br />
treiben. Die, mit denen er <strong>zu</strong> tun hatte, besonders das Gesinde, das Lohn forderte,<br />
tractierte er mit einem Knobelspieß. Damals wurde von der Obrigkeit den<br />
Bürgern gestaltet, sich gegen ihn <strong>zu</strong> wehren und Hand an ihn <strong>zu</strong> legen, werm er den<br />
einen oder anderen schlage. (<strong>Der</strong> Rodensleiner 17/1950)<br />
Von der Hinrichtung direkt ist uns nichts überliefert. Im Jahr darauf mißlang<br />
ein Fluchtversuch aus dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>:<br />
58
Vom <strong>Turm</strong>e aus versuchte z, B. im jahre 1663 ein festgenommener <strong>Weinheim</strong>er Dieb<br />
und Ehebrecher, mit Hilfe eines langen Strohseiles in den Stadtgraben <strong>zu</strong> entkommen.<br />
Im letzten Augenblick konnte er aber von der Wache an der Flucht gehindert<br />
werden. Er bekam als Strafe ein halbes Jahr Zwangsarbeit in der Festung Mannheim.<br />
(16)<br />
Diese Geschichte war wohl auch die Grundlage jener netten Legende, die<br />
<strong>zu</strong> unserer Zeit in der <strong>Weinheim</strong>er Zeitung nach<strong>zu</strong>lesen war:<br />
Aus dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> ragt ein kleines steinernes Gebilde, das sicherlich manches<br />
aus der <strong>Turm</strong>geschichte erzählen könnte. Es war allerdings nicht der Platz, von dem<br />
aus auf Angreifer siedendes Pech gegossen wurde, sondern ganz einfach das Aborthäuschen<br />
der <strong>Turm</strong>wächter und der im <strong>Turm</strong> Eingesperrten. Wer im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />
seine Strafe abbüßte, hatte sich schon Schweres <strong>zu</strong>schulden kommen lassen. Das<br />
Alt-<strong>Weinheim</strong>er Protokollbuch berichtet. daß im 17. Jahrhundert ein der Blutschande<br />
angeklagter Bürger saß, ehe er ins Mannheimer Gefcingnis gebracht wurde. Als<br />
er eines Tages in dem kleinen <strong>Turm</strong>anbau verweilte, um einem eben auch für Gefangene<br />
menschlichen Drängen nach<strong>zu</strong>geben, ging unten auf der Straße ein Musikant<br />
vorbei. Seine Lieder gingen dem Häftling so <strong>zu</strong> Herzen, daß er schnell ein Seil<br />
aus Stroh knüpfte, sich durch die Abortlücke zwängte und schon halb im Freien war,<br />
als er entdeckt und in den <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>rückgezogen wurde. (17)<br />
Pranger, Geige und Schnappkorb. - Die alten Ratsprotokolle berichten indessen<br />
auch von zahlreichen anderen Strafen als dem Tod am Galgen, der im 17. Jahrhundert<br />
in <strong>Weinheim</strong> mehrfach vollstreckt wurde. Als die Kurfürsten für ihre Bauten Arbeitskräfte<br />
brauchten, wurde die Todesstrafe meist in Zwangsarbeit verwandelt.<br />
Zum Zeichen dafür, daß ein Verbrecher gerade noch dem Henker entgangen war,<br />
wurde ihm das Henkersmal auf den Körper gebrannt. 1662 traf in <strong>Weinheim</strong> einen<br />
Dieb diese Strafe, aber es war kein geeignetes Galgen-Klischee <strong>zu</strong>r Hand: Ein<br />
Schlosser mußte es erst fertigen. Frevler, Diebe und Verleumder wurden »mit den<br />
Ruten ausgehauen« oder »gesteupt«, am Lästerstein, wie er in Birkenau und Schriesheim<br />
noch <strong>zu</strong> sehen ist, wurden Diebstahl, üble Nachrede und Vergehen gegen die<br />
Sittlichkeit mit stundenlangem Anketten gebüßt. Wegen .. greulicher Schmähworte<br />
gegen den Landesherrn .. wurde ein junges Mädchen mit Kopf und Händen in die<br />
Geige, ein eigenartiges Brett, eingespannt. Die Strafe des Schnappkorbs wurde vor<br />
allem am Stauwehr beim Hexenturm vollzogen, während die Daumenschraube und<br />
die Anwesenheit des Scharfrichters Geständnisse herbeiführen sollten. Die häufigste<br />
Strafe war Gefängnis in einem der Türme der Stadtmauer, Hier wurden allerdings<br />
nur Männer eingesperrt: Verurteilte Frauen kamen in die Betzenkammer im<br />
ersten Rathaus am oberen Marktplatz. Das Wort Betzen- oder Bötzenkammer kommt<br />
von der Dialektform Bötze und das bedeutete Hexe. Man darf annehmen, daß, wie in<br />
Mannheim, auch in der <strong>Weinheim</strong>er Betzen- oder Hexenkammer die in der Zeit der<br />
Hexenprozesse gebräuchlichen Folterinstnunente untergebracht waren. Besonders<br />
schwere Strafen waren die Landesverweisung oder auch nur die Ausweisung aus<br />
der Stadt. (<strong>Weinheim</strong>er Nachrichten)<br />
Um so länger mußten die» UntersuchungshäfUinge« im <strong>Turm</strong> ausharren.<br />
Inzwischen stand immer noch das Hochgericht als Wahrzeichen der Stadt einst<br />
wirklich <strong>zu</strong>gestandenen, dem Namen nach ihr immer noch <strong>zu</strong>stehenden Blutbannes.<br />
Ein einquartiertes Regiment erbat sich einmal im Jahre [712 den Galgen <strong>zu</strong>m<br />
60
Hängen zweier Deserteure. <strong>Der</strong> Rat wagte nicht, auf eigene Verantwortung <strong>zu</strong> verfügen,<br />
und fragte beim Oberamt um Erlaubnis: dem Regimentskommandeur aber<br />
war das <strong>zu</strong> langweilig, und er hängte die zwei Leute an einen beliebigen Pfahl, wo<br />
er sie beim Abmarsch hängen ließ. Nun beschwerte sich der Rat beim Oberarnt, indem<br />
er meinte, die Hunde würden die Leichen anfressen und toll davon werden.<br />
Was weiter daraus wurde, ist nicht ersichtlich. Vermutlich wußte auch das Oberamt<br />
keinen andem Rat, als die armen Sünder herunter<strong>zu</strong>nehmen und <strong>zu</strong> begraben.<br />
Aus dem Jahre 1787 stammt die erste und <strong>zu</strong>gleich auch die letzte Nachricht einer<br />
Hinrichtung an diesem Galgen. Im März wurde eine Maria Eva Paul(in) exekutiert.<br />
Was dieselbe verbrochen hatte, ist aus den vorliegenden Aufzeichnungen nicht ersichtlich.<br />
Wir sehen nur aus einern späteren Eintrag, daß diese Hinrichtung eine<br />
große Zahl Neugierige angezogen hatte, die in den angrenzenden Weinbergen großen<br />
Schaden verursachten. Einem der Eigentümer, dem Landwirt Peter Müller, bewilligte<br />
der Rat 12 Gulden als Entschädigung, eine für die damalige Zeit ansehnliche<br />
Summe, die auf den angerichteten Schaden und weiter auf das große Gedränge<br />
während der Hinrichtung schließen läßt. Was wir später über diesen Galgen hören.<br />
bezieht sich auf gelegentliche Wiederherstellung und auf Reparaturen an demselben.<br />
Meistens scheint er durch Mutwillen vorbeiziehender Truppen beschädigt<br />
worden <strong>zu</strong> sein. Die Einwohner hielten sich von dem verrufenen Platz fern. (00')<br />
Außer diesem, außerhalb der Stadt gelegenen Galgen wurde von Fall <strong>zu</strong> Fall, insbesondere<br />
in Kriegszeiten. ein zweiter in der Stadt errichtet und zwar aus Holz. <strong>Der</strong>selbe<br />
stand unten am Marktplatz beim Marktbrunnen. (I)<br />
Die letzte Hinrichtung arn Marktplatz war wohl die Enthauptung der Verbrecherin<br />
Anna Maria Günther im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts.<br />
Bis <strong>zu</strong> seinem Abbruch im Jahre 1807 wurde der Galgen notdürftig unterhalten.<br />
Dann wünschte das badische Amt <strong>Weinheim</strong>, daß der Platz, auf dem Ddie dem jetzigen<br />
Zeitgeist nicht mehr angemessenen Säulen eines Galgens« stehen. "in eine andere<br />
Gestalt gebracht werden möge." (WN)<br />
In der Tat fand man eine dem heutigen Zeitgeist angemessene Nut<strong>zu</strong>ng für<br />
den ehemaligen Standplatz des Hochgerichts - um auf die anfangs gestellte<br />
Frage <strong>zu</strong>rück <strong>zu</strong> kommen.<br />
Er stand an der höchsten Stelle der Straßenkreu<strong>zu</strong>ng B 3/Mannhei.mer<br />
Straße, an der OEG-Brücke. Dort, wo tägliche Staus Autofahrern die Zornesfalten<br />
auf der Stirn tiefer furchen. Dort, wo Bremsen quietschen, Gaspedale<br />
durchgedrückt und Punkte für Flensburg gesammelt werden.<br />
Vielleicht beruhigt es Autofahrer im Stau und vor der roten Ampel <strong>zu</strong><br />
wissen, daß ihre Situation, wo es doch meist nur um Minuten geht, ungleich<br />
besser ist als die jener Menschen damals, die dort Kopf & Kragen ließen.<br />
Merkwürdig sind diese städtebaulichen Methoden der Karma-Aufarbeitung<br />
allemal.<br />
61
Gauner, Gott und Galgen<br />
Beispiele christlicher Rechtssprechung aus drei Jahrhunderten<br />
»Wir sind nOlhwendig. Gott gibt uns das Dasein,<br />
schickt uns in die Weil, auf daß wir die Geizigen,<br />
die ungerechten Reichen bestrafen: wir gestalten<br />
uns <strong>zu</strong> einer von Gott ausgehenden Plage. Wo<strong>zu</strong><br />
soUten auch die Richter dienen, wenn wir nicht<br />
wären? (Damian Hesse1, ein 1809 verurteilter<br />
Ri!luber, im Gespräch mit dem lnsfructionsrichler)<br />
Die folgenden Urteile und Strafen stammen aus der Zeit zwischen 1500 und<br />
1800, also der Zeit, in der der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> als Kerker diente. Diese Urteile<br />
sind <strong>zu</strong>m größten Teil aus Reichelsbach und Heppenheim, da ich entsprechende<br />
Unterlagen <strong>zu</strong>r <strong>Weinheim</strong>er Gerichtsbarkeit nicht finden konnte.<br />
1569: Dietterich Weyrich von Neckar-Wimmersbach, früher <strong>zu</strong>m Landesverweis<br />
verurteilt, wm:de in Hambach aufgegrüfen. Er entschuldigte sich, daß er nicht gewußt<br />
habe, daß Hambach pfalzisch sei. Zur Strafe wurden ihm wegen seines Eidbruchs<br />
die beiden »vorderen Finger der rechten Hand" (die Schwurfinger) abgehauen.<br />
1571: Valtin Bauß von Ellrich, angeklagt des Siegeldiebstahls und der Fälschung,<br />
wurde <strong>zu</strong>r Strafe das rechte Auge ausgestochen. Da<strong>zu</strong> erhielt er obendrein Landesverweis.<br />
1573: Jacob Mewrer, Bürger <strong>zu</strong> Heppenheim, angeklagt der Not<strong>zu</strong>cht an einigen<br />
jungen »Mägdlein«, wurde geköpft.<br />
1574: Hanß Metzler von Heiligkreuzsteinach, angeklagt des Diebstahls von acht<br />
Gulden und einiger geringer Sachen, erhielt beide Ohren ganz abgeschnitten und<br />
wurde des Landes und der Bistümer Wonns und Speyer verwiesen.<br />
1594: Ungenannte Täter (der Prozeß ist nicht ganz überliefert) wurden, weil sie <strong>zu</strong>viel<br />
Unrecht wider die göttlichen Gebote und die Gesetze begangen hatten, streng<br />
bestraft. Sie sollten auf der Richtstätte lebendig in vier Teile geteilt werden. Auf ihre<br />
Bitten wurde das Urteil gemildert. Sie wm:den mit dem Schwert enthauptet und<br />
dann gevierteilt und die Leiber auf vier Straßen <strong>zu</strong>m abschreckenden Beispiel aufgehängt.<br />
(5)<br />
Die Urteile wurden zwar im Namen Gottes gefällt, aber die Ausführenden<br />
gehörten selbst in der Kirche beim Gottesdienst lIin die Eck«.<br />
Die Scharfrichter zählten an erster Stelle <strong>zu</strong> den unehrlichen Leuten. Die Grunde<br />
hierfür mögen darin liegen, daß dieses Amt urspIiinglich von Unfreien ausgeübt<br />
wm:de. Dann aber war mit diesem Amt die verhaßte Folter verbunden, und endlich<br />
waren sie <strong>zu</strong>gleich auch Abdecker und Schinder.<br />
So waren die Scharfrichter weitgehend von dem Verkehr mit der Bevölkerung abgeschnitten.<br />
Jede Berührung mit ihnen galt als schimpflich. Sie trugen daher auch<br />
62
esondere Kleidung und selbst in der Kirche hatten sie einen besonders abgelegenen<br />
Platz inne. Selbst das Abendmahl genossen sie allein und <strong>zu</strong>letzt. So auf ihresgleichen<br />
angewiesen, bildeten sich Scharfrichterfamilien oder SchelmenzÜIlfte, die<br />
über ein größeres Gebiet verbreitet waren. Seine frau nahm ein Scharfrichter nur<br />
aus einer Scharfrichterfamilie, die Söhne heirateten Töchter von Scharfrichtern<br />
oder, wenn es möglich war, noch lieber eine Scharfrichterswitwe, um so wieder in<br />
eine Scharfrichterei hinein<strong>zu</strong>korrunen. (S)<br />
Auch der Scharfrichter war rot gekleidet. Ursprünglich war er ein "Opfernder«,<br />
Stellvertreter einer Gottheit, die ein solches Opfer verlangt. Daher trug der Scharfrichter<br />
wie viele andere Darsteller von Göttergestalten eine Maske. In roter Maske<br />
war er ein »anderer«. Erst in später Zeit war Henker <strong>zu</strong> sein ein verabscheUlmgswürdiger<br />
Beruf. Besonders sinnwidrig ist die Deutung, der Henker habe eine Maske<br />
getragen, damit er »unerkannt bleibe«. Dies wäre in sehr großen Städten möglich<br />
gewesen, von denen es im Mittelalter nur wenige gab. In kleineren Orten blieben<br />
sehr oft die Namen der Scharfrichter bekannt bis auf den heutigen Tag. Es gab<br />
sogar ganze Geschlechter, die diesen schaurigen Beruf ausübten. Es war im Mittelalter<br />
allgemeine Anschauung, daß der Scharfrichter nicht als einfacher Bürger den<br />
Spruch des Gerichtes vollzog, sondern als ein besonderes, über persönliches Wesen<br />
handelte, das den Delinquenten <strong>zu</strong> »opfern« hatte, damit der Gerechtigkeit Genüge<br />
geschah.<br />
Bis in die Zeit der Aufklärung war der »rote Henker« ein Mensch »jenseits von Gut<br />
und Böse«. Er blieb furchterregend, ehrfurchtgebietend und verabscheuungswürdig<br />
<strong>zu</strong>gleich.<br />
Wir sollten nicht vergessen, daß z. B. bei den Germanen Priester opferten und Wodan<br />
der Gott der Gehenkten war. Jungmännerbünde trafen sich oft unter dem Galgen.<br />
Noch im 20. Jahrhundert wurde für den Strick des Gehenkten eine hohe Summe geboten;<br />
das Todesrequisit sollte Glück bringen. (24)<br />
Eine Vierteill1I1g im 16. Jahrhundert.<br />
63
Aus Bensheim ist uns eine Beschreibung der Aufgaben des Wasenmeisters<br />
aus dem Jahr 1746 überliefert:<br />
»Er hat demnach bei Examinierung der MaliflZpersonen nach denen gradibus mit<br />
Binden, Daumeisen und Beinschrauben, auch wirklichen Foltern unparteiisch <strong>zu</strong> torpuieren,<br />
und was er bei solchen Fragen oder mündlichen SChreckungen hören und<br />
erfahren wird, bei sich geheim <strong>zu</strong> halten und niemand etwas davon <strong>zu</strong> offenbaren,<br />
noch den Seinigen solches <strong>zu</strong> gestatten. Ferner soll er nach gefälltem Urteil die Malefizpersonen<br />
seinem Amt und Nachrichtendienst gemäß mit Ruten ausstäupen, mit<br />
dem Schwert hinrichten, henken, rädern, vierteilen, verbrennen, mit glühenden<br />
Zangen zwicken, und wie dergleichen Urteile gefaUtet werden möchten, dabei aber<br />
niemand verkürzen, sondern sein Amt verrichten, als sich gebühret.«<br />
"Als Belohnung fUr die Nachrichterdienste soll er vom Zentschultheiß erhalten:<br />
1. von dem Daumenstock an<strong>zu</strong>legen 111. (= Gulden) 30 kr(euzer); 2. die Beinschrauben<br />
an den Fuß <strong>zu</strong> legen 3 0.; 3. vom Zug 3 0.; 4. wann er die peinlichen Instrumente<br />
mu vorlegt und damit terriert 1 fl. 30 kr.; 6. wann der Delinquent <strong>zu</strong>gleich gezwickt<br />
und gebrannt wird 3 fl; 6. von einem an das Halseisen oder den Pranger mit der Ruten<br />
in der Hand <strong>zu</strong> stellen I 11. 30 kr.; 7. mit Ruten aus<strong>zu</strong>stäupen oder das Zeichen<br />
auf<strong>zu</strong>brennen 3 11; 8. <strong>zu</strong> köpfen oder <strong>zu</strong> erhenken 611.; 9. auf das Rad <strong>zu</strong> legen und<br />
<strong>zu</strong> rädern 3 fl.; 10. für einen, der sich selbst ums Leben gebracht, 5 11.; 1 1. von einem<br />
<strong>zu</strong> verbrennen 5 11.; 12. vom Strangulieren S fl.; 13. von einem Justifizierten wieder<br />
vom Gericht ab<strong>zu</strong>nehmen 6 0.; 14. einem Nase oder Ohren ab<strong>zu</strong>schneiden 3 fl.;<br />
15. einem die Hand ab<strong>zu</strong>hauen 3 11.; annehst er aber, wann er dergleichen Exekution,<br />
absonderlich zwn Tod, verrichten tut, für sich und diejenigen, so ilun helfen,<br />
die freie Zehrung <strong>zu</strong> empfangen hat.«<br />
»Im Domhof« <strong>zu</strong> Heppenheim »war in neueren Zeiten noch eine Folterkammer mit<br />
der Jungfrau <strong>zu</strong> sehen.« Hier wurde auch noch ein altes »Frevel-Protokoll« gefunden.<br />
Wer die oben angeführten, gerade<strong>zu</strong> unmenschlichen Arten der Tortur, Bestrafung<br />
und Hinrichtung liest, fühlt sich unmittelbar vom finsteren Mittelalter wngeben. Dabei<br />
fanden gerade Hinrichtungen gewöhnlich unter großem Andrang des Volkes<br />
statt. Berichtet doch das Bensheimer Kirchenbuch, daß im Oktober 1682 bei der<br />
Hinrichtung eines Ehepaares aus Auerbach, das Straßenraub getrieben hatte, ein<br />
junger Mann aus Bensheim im Gedränge totgedliickt wurde. (5)<br />
Natürlich gab es auch eine Palette leichterer Strafen. Sehr beliebt war der<br />
Landesverweis. Sollten doch die Nachbarn mit den Missetätern fertig werden.<br />
Im 19, Jahrhundert Willde manche lebenslange Haftstrafe umgewandelt:<br />
bei guter Führung wurde der Häftling mit der Bedingung entlassen,<br />
nach Amerika aus<strong>zu</strong>wandern. Für die Heimatgemeinde war so eine Ausweisung<br />
das billigste; man sparte Gefängnisse und Personal und brauchte<br />
keine Angst vor Wiederholungstaten <strong>zu</strong> haben. Dies führte allerdings im<br />
19. Jahrhundert <strong>zu</strong> diplomatischen Verwicklungen zwischen Hessen und<br />
Amerika.<br />
64
Flora und Fauna im, am<br />
und auf dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />
Im 18. Jahrhundert war der Stadtmauer am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> ein Zwinger vorgelagert,<br />
in dem seltene Tiere wie Bären und Wölfe gehalten wurden. So bot<br />
man der WelIlhelmer Jugend eine Art Zoo, den man von der Stadtmauer<br />
aus einsehen konnte. Daher heißt der dem <strong>Turm</strong> vorgelagerte Platz auch<br />
heute noch im Volksmund »Bärenzwinger«.<br />
Bald nach der »Entvölkerung« des ehemaligen Kerkers ließ die Stadt<br />
auf <strong>Turm</strong>es Spitze ein Storchennest bauen, das für fast 100 Jahre gerne von<br />
Familie Adebar genutzt wurde. Auf 300 Jahre alten Bildern können wir erkennen,<br />
daß es schon vorher ein Storchennest auf einem Nachbarhaus gab.<br />
Als vor vielen Jahren das Nest leer blieb, untersuchte man es, fand eine<br />
Mäusefamilie darinnen und siedelte diese um. Worauf die Störche wieder<br />
<strong>zu</strong>rückkehrten. 1946 kamen sie <strong>zu</strong>rück, ohne das Nest <strong>zu</strong> beziehen (14).<br />
Im Jahr darauf, <strong>zu</strong>m ersten Nachkriegs-Sommer<strong>zu</strong>g, beglückten sie<br />
dann alle <strong>Weinheim</strong>er: pünktlich <strong>zu</strong>m Frühlingsfest-Um<strong>zu</strong>g nisteten sie sich<br />
nach einer Ehrenrunde über die Stadt wieder ein. Das Storchenglück<br />
währte jedoch nur noch fünf weitere Jahre, danach mieden sie das Nest auf<br />
dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> und die Umgebung; sie fanden wegen der <strong>zu</strong>nehmenden<br />
Landerschließung nicht mehr genug <strong>zu</strong> fressen. Wohin sie wohl emigriert<br />
sind? Sie waren die Botschafter <strong>Weinheim</strong>s, die alljährlich nach Kleinasien,<br />
über den Nil bis nach Afrika reisten.<br />
Auf Veranlassung Wilhelm Fabricius' hin wurde das Storchennest 1952<br />
inspiziert und erneuert. So berichtet der »Rodensteiner« 1/1953:<br />
»<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> 'TUrm hat in der letzten Zeit viel von sich reden gemacht. Zuerst<br />
wurde allgemein bekannt, daß sich kein Storch mehr da<strong>zu</strong> entschließen<br />
wollte, auf seiner Spitze sein Quartier auf<strong>zu</strong>schlagen. Infolge davon<br />
mußte man, wohl oder übel. das alte und sehr änderungsbedürftige Nest<br />
herunternehmen und den reichlichen >Inhalt< wegschaffen. Ferner hat man<br />
den gar <strong>zu</strong> üppig ins Kraut geschossenen Hollunderbaum, der auf der Höhe<br />
gewachsen war, absägen müssen, damit seine Wurzeln das Mauerwerk<br />
nicht auseinander sprengten.«<br />
Auch die Tagespresse berichtete interessiert:<br />
»Die in der letzten Zeit durchgeführte Erneuerung des Storchennestes<br />
ist übrigens <strong>zu</strong> Ende geführt. Ein ganzer Wagen voll Dreck mußte aus dem<br />
Nest entfernt und fortgebracht werden. Die <strong>Turm</strong>fläche vom Kranz bis <strong>zu</strong>m<br />
Nest, immerhin noch nahe<strong>zu</strong> zehn Meter, wurde glatt zementiert, so daß<br />
das Nest also auch nicht von Ungeziefer erreicht werden kann. Bekanntlich<br />
66
wurde das Nest in den letzten Jahren von Störchen nicht mehr angenommen.<br />
Hoffen wir, daß darin nach der gründlichen Reinigung eine Änderung<br />
eintritt und daß Freund Adebar im kommenden Frühjahr das Nest wieder<br />
bezieht.« (12)<br />
Am 9. März 1969 bemühte sich die Freiwillige Feuerwehr <strong>Weinheim</strong><br />
noch einmal mit der Erneuerung des Storchennestes, wie ein Foto aus ihrer<br />
Jubiläumsschrift dokumentiert. Aber die Störche blieben fern.<br />
Was geblieben ist, sind die Tauben, im Volksmund auch »Fliegende<br />
Ratten« genannt. Schon 1829 wurde behördlich angeordnet, diese ab<strong>zu</strong>schießen,<br />
aber bis auf den heutigen Tag sind sie die wahren Beherrscher<br />
des <strong>Turm</strong>es. So war es dem Chronisten vergönnt, fünf Müllsäcke mit Taubenkot<br />
aus dem oberen Turrnbereich <strong>zu</strong> schaufeln, der sich durch die<br />
defekte Tür im Laufe von Monaten angesammelt hatte, bevor er mit dem<br />
Schreiben anfangen konnte.<br />
Dafür gibt es aber keine Ratten & Mäuse mehr, wie <strong>zu</strong> Kerkerzeiten. Im<br />
<strong>Turm</strong> spinnen ein paar Spinnen und in jedem Stockwerk scheinen ein Dutzend<br />
schwarzer Käfer <strong>zu</strong> hausen.<br />
Selten ergänzt sich rot/grün so harmonisch wie der wilde wuchernde<br />
Wein an der Südseite des <strong>Turm</strong>s. Das Grün rankt sich sommertags inzwischen<br />
bis <strong>zu</strong>m Klohäuschen empor.<br />
66
<strong>Der</strong> WeinWllchs am <strong>Turm</strong>, von l1Ilten und von oben (durchs Kloloch).<br />
67
Künstler erobern<br />
den <strong>Turm</strong><br />
Entledigt seiner Aufgaben als Befestigungsanlage und Kerker, stand der<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> lange Jahre ungenutzt und leer. In der Tat ist es nicht einfach,<br />
solch ein dickmauriges Gebäude mit steilen, engen Treppen und ohne<br />
Wasseranschluß & Toilette mit Leben <strong>zu</strong> erfüllen.<br />
Was liegt da näher, als Künstler mit der Beseelung solch eines Ortes <strong>zu</strong><br />
beauftragen?<br />
Im Laufe von zwanzig Jahren haben nun viele Künstler ihre Werke im<br />
<strong>Turm</strong> ausgestellt, mit unterschiedlichem Erfolg. Manche haben bleibende<br />
Spuren hinterlassen, für andere war es nur eine Sprosse auf der Erfolgsleiter.<br />
Aus der .A.rchivkiste hier nun einige Zeitungsmeinungen <strong>zu</strong>r Kunst im<br />
<strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>. Angefangen bei der Künstlergruppe »Spirale« im Jahr 1971,<br />
über die Reaktivierung des <strong>Turm</strong>s durch Norika Nienstedt hin bis <strong>zu</strong> den<br />
Aktivitäten des »Freundeslaeises <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>«, auf galeristischer Ebene<br />
vertreten durch Sharon Levinson und Elgin Holtey.<br />
Ein großer Wurf gelang 1987 Norika Nienstedt mit ihrer Ausstellung<br />
»BLAU«, Im Jahr <strong>zu</strong>vor war ihre Ausstellung mit Bertram Jesdinsky schon<br />
bemerkenswert gewesen, nicht nur wegen der <strong>Turm</strong>-Briefmarken und -<br />
Stempel sowie dem bemerkenswerten Bild vom <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>. Die Ausstellung<br />
»BLAU« zog jedoch solche Kreise, daß die Stadt Heidelberg sich davon<br />
zwei Jahre später für eine eigene Großschau »BLAU« inspirieren ließohne<br />
Frau Nienstedt da<strong>zu</strong> offiziell ein<strong>zu</strong>laden. Aber so is1's wohl leider meistens,<br />
wenn die Großen von den Kleinen abkupfern.<br />
Weiterhin noch herausragend multimediale Ereignisse wie im Jahr 1987<br />
Susanne KlippeIs Ausstellung von Zeichnungen und Objekten mit dem Titel<br />
"Zion Fire«, <strong>zu</strong> der im Modernen Theater ihr Film »Die Reise des Pilgrim<br />
No. 1« Welturaufführung hatte. Es geht dabei um eine Voodoo-Initiation in<br />
Grenada.<br />
Die Künstler hatten jedoch nicht nur Erfolgserlebnisse im <strong>Turm</strong>. Michel<br />
Meyer erzählte dem Chronisten, wie es ihm bei seiner Ausstellung erging.<br />
»Erst fand ich das ja ganz toll, daß so viele Leute <strong>zu</strong>r Ausstellung kamen.<br />
Aber dann stellte ich fest, daß die meisten an meinen Bildern gar nicht interessiert<br />
waren, sondern einfach mal den Twm besteigen wollten.« <strong>Der</strong><br />
Frust der jungen Jahre.<br />
69
WEINHEIM<br />
Rundblick über die Altstadt wieder möglich:<br />
Kunst gab <strong>Weinheim</strong>em ihren <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>rück<br />
Neue Galerie öffnete im reXJovierten <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> Ihre Pforten<br />
Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>: Gästebuch der Galerie; 1/1980-88.<br />
74
Hauptstraße 6/<br />
6940 WemfleIm<br />
1it 0620 { /52 155<br />
Alfred<br />
BUCHHANDLUNG<br />
<strong>Weinheim</strong>· Fußgängerzone<br />
Tel. 06201/12207<br />
77
Lieferbare Bücher<br />
von Werner Pieper<br />
Heidelberg <strong>zu</strong>r Stunde Null<br />
Dokumente, Fotos und Augenzeugenberichte über eine unzerstörte Stadt 1945<br />
Warum wurde Heidelberg nicht bombardiert? Warum wurden die Headquarters der<br />
US-Streitkräfte nach Heidelberg verlegt? Stammen Eisenhowers Vorfahren wirklich aus<br />
dem Odenwald? Wie verlief das tägliche Leben 1945?<br />
Auf 140 Seiten ist Herausgeber Wemer Pieper diesen und anderen Fragen nachgegangen.<br />
Ein lokaler Bestseller. 15,80 DM<br />
Mark Twain . Ein Amerikaner in Heidelberg<br />
Twain's Bummel durch Deutschland 1878.<br />
Mit Dokumenten, Kommentaren und Illustrationen versehen von Werner Pieper.<br />
DER GRÜNE ZWErG lO2<br />
Mark Twain verbrachte mehrere Jahre in Europa, besuchte Berlin, München, Frankfurt<br />
und lebte mehrere Monate in Heidelberg (wo er am »Huckleberry Finn« arbeitete).<br />
Hier finden sich erstmals (fast) alle Texte, die er über seinen Deutschlandaufenthalt<br />
geschrieben hat. Die berühmte »Floßfahrt auf dem Neckar« ebenso wie seine brillante<br />
Abhandlung über die deutsche Sprache, seine Beobachtungen von »schlagenden Verbindungen«<br />
ebenso wie einen Bierabend beim Kaiser. Das ganze reichhaltig mit erklärenden<br />
Randbemerkungen und einer Vieizahl Illustrationen versehen. Im Anhang<br />
finden sich Beiträge von Helen Keller und Karl Kraus über Twain. »Eine hervorragend<br />
editierte Ausgabe ... für all die Leute, die witzige Bemerkungen über unser Volk schätzen«<br />
(Hologramm). "So viel Witz und Lust und Laune wie Werner Pieper bringen Herausgeber<br />
für ein Buch selten auf ... « (RNZ). 220 stark illustrierte Seiten 24 DM/SFR<br />
Das Stempel Buch Von der Demokratisierung eines Mediums.<br />
Ernährung & Bewußtsein <strong>Der</strong> Naturkost Klassiker.<br />
WeitBeat Über zeitgenössische Klänge aus aller Welt.<br />
Widersteh' Dlchl Das Buch der Handlungen.<br />
Das Scheiss Buch Entstehung, Nut<strong>zu</strong>ng & Entsorgung von Fäkalien.<br />
Brain Tech Über Mind Machines & Bewußtsein.<br />
Helen Keller Blind, taub und optimistisch.<br />
Ene Mene Mopel - die Nase & der Popel Das Nasenbohrerbuch - u. a. m.<br />
Diese und weitere Bücher, Motivstempel & Cassetten findet<br />
man im kostenlosen )j Wundertüten-Katalog«, <strong>zu</strong> beziehen durch<br />
Medienexperimente . Alte Schmiede· 6943 Löhrbach<br />
Telefon (06201) 2 12 78 . Fax (06201) 2 25 85<br />
78
Lieferbare Bücher<br />
von Wilhelm Fabricius:<br />
Wilhelm Fabricius . Die Liebe Gottes<br />
Vom Träger der <strong>Weinheim</strong>er Bürgermedaille, Ober-Forstmeister<br />
Wilhelm Fabricius: Schwierige Stellen des Neuen Testaments, durch<br />
Überset<strong>zu</strong>ng des griechischen Urtextes einleuchtend.<br />
DER GRÜNE ZWEIG 96<br />
Bislang war das Neue Testament nur wörtlich übersetzt worden, hier wird nun auch die<br />
Symbolik mit entschlüsselt, und plötzlich schwindet der »göttliche Druck« - Mitverantwortung<br />
statt Strafe.<br />
»Ein alter Förster liest auf seine Weise die Bibel. Viele Theologen können da manches<br />
für ihre Predigten lernen. Theologen haben aber meist schon früh ausgelernt. Andere<br />
lernen nie aus. Für diese Sorte Mensch ist das Bändchen. « (Erde + Kosmos)<br />
ISBN 3-922708-96-X 80 Seiten 9,80DMlSFR<br />
Wilhelm Fabricius . Geister und Abergeister<br />
Eine PSYChologie der Einheit des Lebens,<br />
des fröhlichen Miterlebens und der Mitverantwortung.<br />
DER GRÜNE ZWEIG 58<br />
Die Einheit allen Lebens, die Rückbesinnung und Wachrüttelung des Menschen auf seinen<br />
Ursprung, mH dem Ziel, eine höhere Evolutions- und Bewußtseinsslufe <strong>zu</strong> erreichen,<br />
daran ist dem Forstmeister Fabricius in der Tat gelegen. Das religiös-magische Weltbild<br />
alter Völker mit ihren Naturgeistwesen aus den vier Elementen Luft, Wasser. Feuer<br />
und Erde wird ebenso lebendig wie phantastische TIergestalten als uralte Bilder<br />
menschlicher Denkweise. Mit 10 Holzritzbildern des Autors.<br />
ISBN 3-922708-58-7 156 Seiten 17.50 DM/SFR<br />
Wilhelm Fabrlclus . Die Rappenreiter<br />
Erzählungen von berühmten Pferden und ihren Reitern aus Sage und Geschichte.<br />
"<strong>Der</strong> passionierte Forstmann blieb hier seinem Metier treu und bietet ein Paradestück<br />
seiner Fahulierkunst. Mit sechs Erzählungen von berühmten Pferden und ihren Reitern<br />
filhrt er den Leser in eine wundersame Welt. Pegasos, Bukephalas und Alexander. der<br />
Rappe des Arm in ius, Weg1am, das Botenroß zwischen Altertum und Mittelalter. Bajart<br />
und die Haimonssöhne. die abenteuerliche Bußfahrt des Herrn von Zollern.<br />
Jeder Erdverhaftete fühlt sich in höhere Sphären versetzt, wenn so gekonnt wie hier der<br />
Phantasie Schwingen verliehen werden." (<strong>Weinheim</strong>er Nachrichten)<br />
Restauflage, Hardcover. 144 Seiten 20 DMlSFR<br />
Medienexperimente . Alte Schmiede· 6943 Löhrbach<br />
Telefon (06201) 2 1278· Fax (06221) 2 25 85<br />
79
Bel uns wird niemand<br />
im Regen fotografiert.<br />
Wir haben Immer Sonne<br />
im Studio.
»<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> - die schönste<br />
Zierde der Gegend. «<br />
Heimatforscher A L. Grimm<br />
Seit gut 700 Jahren wacht der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> über die Stadt, aber<br />
nur wenige Bürger wissen Näheres über seine Geschichte,<br />
sein Inneres und seine Insassen im Laufe der Jahrhunderte:<br />
• Wie erfolgreich war der <strong>Turm</strong> als Stadtbefestigung?<br />
• Wer wurde im dortigen Kerker inhaftiert?<br />
• Wie sieht es heute im <strong>Turm</strong> aus?<br />
• Woher kommt der Name?<br />
• Wer war Jonathan Wolrab?<br />
• Wie lange wohnten Störche auf dem <strong>Turm</strong>?<br />
• Was trieben die Hitlerjugend, die ev. Jungenschaft<br />
und die Künstler im <strong>Turm</strong>?<br />
Antworten auf diese und andere Fragen finden sich in diesem<br />
Buch. Außerdem eine Stadtchronik über das "Wachsen<br />
und Werden <strong>Weinheim</strong>s« , ein Kapitel über "Götter, Gauner<br />
& Galgen« (wo stand der <strong>Weinheim</strong>er Galgen?); viele Dokumente,<br />
über 30 Abbildungen u. v. a. m.<br />
»So viel Witz und Lust und Laune wie Werner Pieper<br />
bringen Herausgeber für ein Buch selten auf . . «<br />
ISBN 3-922708-11-0<br />
Rhein-Neckar-Zeitung<br />
10DM