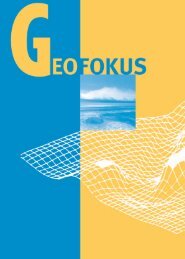Heft 51 lesen und PDF-Download hier - GMIT
Heft 51 lesen und PDF-Download hier - GMIT
Heft 51 lesen und PDF-Download hier - GMIT
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>GMIT</strong>Geowissenschaftliche Mitteilungen<strong>Heft</strong> Nr. <strong>51</strong> (MÄRZ 2013)Das gemeinsame Nachrichtenheft vonBerufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG)Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG)Deutsche Mineralogische Gesellschaft (DMG)Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA)Geologische Vereinigung (GV)Paläontologische GesellschaftISSN 1616-3931Redaktion:Klaus-Dieter Grevel (kdg., Deutsche Mineralogische Gesellschaft)Michael Grinat (mg., Deutsche Geophysikalische Gesellschaft)Sabine Heim (sh., Geologische Vereinigung)Christian Hoselmann (ch., Deutsche Quartärvereinigung)Hermann Rudolf Kudraß (hrk., Geologische Vereinigung)Jan-Michael Lange (jml., Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften)Alexander Nützel (an., Paläontologische Gesellschaft)Birgit Terhorst (bt., Deutsche Quartärvereinigung)Hans-Jürgen Weyer (hjw., Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler)Abbildung auf der Titelseite: Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt von Tongesteinen der Oberkreideaus einer Bohrung im niedersächsischen Becken. Die Abfolge besteht aus dunklen, organikreichen<strong>und</strong> fein laminierten Ton-Mergel Schichten. Diese Sedimentabfolge wurde in einem Schelfmeer unterAbschluss von Sauerstoff abgelagert. Unter diesen Bedingungen kann das im Sediment eingelagerteorganische Material erhalten bleiben <strong>und</strong> sich unter bestimmten geologischen Bedingungen inKohlenwasserstoffe umwandeln. Solche organikreichen Gesteine werden auch als Muttergesteinefür Erdöl <strong>und</strong> Erdgas bezeichnet.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 1
EDITORIALLiebe Leserinnen <strong>und</strong> liebe Leser,auf dem Weg zum Umbau der Stromsysteme,weg von der Gr<strong>und</strong>versorgung durch fossileBrennstoffe <strong>und</strong> mit dem bewussten Ausstiegaus der Atomenergie, hin zur Deckung desEnergiebedarfs durch erneuerbare Energien,auch unter Berücksichtigung des Klimaschutzes,wurden im letzten Jahr weitere Schritte inRichtung Energiewende durch die B<strong>und</strong>esregierungherbeigeführt.Deutschland deckt aktuell seinen Energiebedarfzu etwa dreiviertel aus fossilen Energieträgern,der Anteil der erneuerbaren Energien liegt mit11 % heute bereits geringfügig über der Nutzungvon Kernbrennstoffen. Angestrebt ist einerseitsdie Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung,also die Verringerung der Nutzung vonÖl, Gas <strong>und</strong> Kohle auf dem Weg dorthin, aberauch die Verringerung der ImportabhängigkeitDeutschlands von einem Anteil von derzeit etwa87 %. Eine Eigenversorgung im Bereich fossilerPrimärenergieträger erfolgt in Deutschland nurfür die Nutzung von Braunkohle (zu einem geringenAnteil auch für die Steinkohle), der Bedarfan Erdgas wird nur zu etwa 14 % aus eigenerFörderung gedeckt.Die abnehmenden Erdgas-Vorräte ließen sichdurch neue unkonventionelle Verfahrenstrecken, die aber in Deutschland in der Öffentlichkeitkontrovers diskutiert werden. Begründetsind die Bedenken unter anderem in derProblematik um Explorations- <strong>und</strong> Produktionsverfahrenvon Schiefergas durch das sogenannteFracking <strong>und</strong> die möglichen Umweltrisikendurch den Einsatz von gewässer- bzw. ges<strong>und</strong>heitsgefährdendenZusatzstoffen.In der vorliegenden <strong>51</strong>. Ausgabe von <strong>GMIT</strong> widmetsich der GEOFOKUS-Artikel dem Potenzialunkonventioneller Erdgasvorkommen in Deutschland.Im Rahmen des NiKo-Projektes (NichtkonventionelleKohlenwasserstoffe), ausgearbeitetan der B<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften<strong>und</strong> Rohstoffe in Hannover, erfolgtdie Abschätzung des heimischen Nutzungspotenzialsvon Erdgas aus dichten Tonsteinen,dem sogenannten Schiefergas. Erste Ergebnisselieferten Informationen zur überregionalen Verbreitungverschiedener Tongesteine in Deutschlandsowie zu den hydrogeologischen <strong>und</strong> geologischenRahmenbedingungen, auch im Bezugauf mögliche Umweltauswirkungen. Der aktuelleBericht geht darauf ein, erläutert das Prinzipdes Fracking-Verfahrens <strong>und</strong> stellt die potenziellenSchiefergasvorkommen in den europäischenSedimentbecken vor.Mit diesem Artikel zeigt sich wieder einmal, welchewichtigen Beiträge die Geowissenschaftenfür die Entscheidungen der Politik, der Wirtschaft<strong>und</strong> der Gesellschaft leisten können. Indiesem Zusammenhang sei auch auf die aktuellenInformationen zum Stand des geplantenDachverbandes hingewiesen. Lesen Sie in derGEOLOBBY das Vorwort der Vorsitzenden der fünfbeteiligten Gesellschaften <strong>und</strong> den Entwurfeiner Satzung für den Dachverband. InGEOREPORT finden Sie zu diesem Thema einenoffenen Brief der Fachschaftsvertreter zahlreichergeowissenschaftlicher Studienfächer andie Vorstände der geowissenschaftlichen Gesellschaften,die darin ihr eindeutiges Votum zurGründung eines Dachverbandes <strong>und</strong> denWunsch nach besserer Zusammenarbeit <strong>und</strong>effektiverer Nachwuchsförderung ausdrücken.Informationen aus den Gesellschaften, Berichtezu Studium <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit in SachenGeowissenschaften, Buchbesprechungen sowieAnkündigungen <strong>und</strong> Berichte über Tagungen<strong>und</strong> Workshops r<strong>und</strong>en die aktuelle Ausgabe ab.Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüredieser Ausgabe von <strong>GMIT</strong>,Ihre Sabine Heim2 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
INHALTInhaltSeiteEditorial 2Geofokus 5Schiefergas – Potenzial in Deutschland 6Geoaktiv – Wirtschaft, Beruf, Forschung <strong>und</strong> Lehre 17Schiefergas spaltet Europa 16Interdisziplinarität aus Sicht des geowissenschaftlichen Nachwuchses 17Verlorene Generation? 19Neue Studiengänge für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie in Südchile 20Update des Datenbanksystems GONIAT online 21Geolobby – Gesellschaften, Verbände, Institutionen 23BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler 26DEUQUA Deutsche Quartärvereinigung 34Seite der Vorsitzenden von DGG (Geophysik) , DGG (Geologie) , DMG, GV <strong>und</strong> PalGes 43Satzung des Geo-Dachverbandes (Entwurf – Fassung vom 30.11.2012) 44DGG Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften 50DMG Deutsche Mineralogische Gesellschaft 57GV Geologische Vereinigung 62Paläontologische Gesellschaft 67Geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit 73GONDWANA – Das Praehistorium – Phase II 73Zwo7fünF: Expeditionen, Köpfe & Staubfänger 74Tag der Steine in der Stadt 2012 76Georeport 77Neue Bücher 78Neue Karten 81Personalia 82Nachrufe 84Tagungsberichte 90International German Ostracodologist’s Meeting (IGOM) Köln 2012 – „The Recentand Fossil meet Kempf Database“ 9022. Sächsisches Altlastenkolloquium am 8. <strong>und</strong> 9. November 2012 in Dresden 91Selen2012 – Workshop am Karlsruher Institut für Technologie 94<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 3
INHALTLeserbriefe 96Geokalender 98Ankündigungen 99Mein Fre<strong>und</strong> der Kieselstein 100Internationaler Geokalender 102Impressum 89Adressen 1044 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 5
GEOFOKUSSchiefergas – Potenzial in DeutschlandRoberto Pierau, Stefan Ladage, Dieter Franke, Harald Andruleit, Ulf Rogalla*EinleitungSchiefergas (engl. Shale Gas) wird weltweit alsbedeutende neue Erdgasressource angesehen.Auslöser <strong>hier</strong>für war die wirtschaftliche Erschließungzahlreicher Schiefergas-Vorkommen in Nordamerika.Mittelfristig werden die USA deswegenihren Erdgasbedarf voraussichtlich aus eigenenQuellen decken können. Deutschland hingegenversorgt sich derzeit zu über 80 % aus Importenmit Erdgas. Aufgr<strong>und</strong> der fortschreitenden Erschöpfungder konventionellen heimischenErdgas-Lagerstätten kann mit einem weiterenAnstieg der Erdgasimporte gerechnet werden.Die B<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong>Rohstoffe (BGR) untersucht derzeit im Projekt„NiKo“ (Nicht-konventionelle Kohlenwasserstoffe)das heimische Nutzungspotenzial von Erdgasaus Tongesteinen. Neben den ersten Ergebnissender Ressourcenabschätzung für Deutschlandwerden im vorliegenden Beitrag möglicheSchiefergasvorkommen in anderen europäischenSedimentbecken dargestellt sowiekurz auf das Fracking-Verfahren <strong>und</strong> möglicheUmweltauswirkungen eingegangen.Überblick über nicht-konventionelle KohlenwasserstoffeBei Kohlenwasserstoffen (Erdöl & Erdgas) isteine Unterscheidung nach konventionellen <strong>und</strong>nicht-konventionellen Vorkommen üblich(Abb. 1). Nicht-konventionelles Erdöl ist nichteinheitlich definiert. Nach BGR-Definition handeltes sich um Kohlenwasserstoffe, die nichtmit konventionellen Methoden gefördert werdenkönnen, sondern aufwändigerer Technik bedürfen,um sie zu gewinnen. In der Lagerstättesind sie nur bedingt oder nicht fließfähig miteinem spezifischen Gewicht über 1 g pro cm 3(Schwerstöl, Bitumen) oder liegen als Leichtölvor, das auf Gr<strong>und</strong> der Dichtheit des Speichergesteinsnicht fließfähig ist (Schieferöl, Erdöl indichten Gesteinen). Im Fall von Ölschiefer liegtErdöl erst in einem Vorstadium als Kerogen vor.Beim nicht-konventionellen Erdgas ist die Definitionklarer <strong>und</strong> bezieht sich auf den Typ des Vorkommensbzw. der Lagerstätte <strong>und</strong> wird daherauch in korrekter Weise als Erdgas aus nichtkonventionellenVorkommen bezeichnet. Esströmt einer Förderbohrung nicht ohne weiteretechnische Maßnahmen (Fracking-Verfahren) inausreichender Menge zu, weil es entweder nichtin freier Gasphase im Gestein vorkommt oderdas Speichergestein nicht ausreichend durchlässigist. Beim Einsatz des Fracking-Verfahrenswird unter hohem Druck eine Flüssigkeit durchdas Bohrloch über Perforationen im Bohrstrangin die Zielformation gepresst. Dabei werdenkünstliche Risse in der Zielformation erzeugt,die als Wegsamkeiten für den Zustrom von Gasoder Öl zum Bohrloch dienen. Nach Definitionder BGR kann man bei nicht-konventionellemErdgas unterscheiden zwischen Schiefergas,Tight Gas <strong>und</strong> Kohleflözgas, die bereits zurErdgasproduktion genutzt werden sowieAquifergas <strong>und</strong> Erdgas aus Gashydrat, die bislangnicht wirtschaftlich gewonnen werdenkönnen (Abb. 2).Schiefergas ist natürlich vorkommendes Erdgasin dichten Tongesteinen <strong>und</strong> unterscheidet sichin seiner Zusammensetzung nicht vom Gas auskonventionellen Vorkommen. Tongesteine entstehendurch die Ablagerung von feinkörnigenMineralkomponenten in Gewässern mit geringerStrömung (z.B. in Meeren <strong>und</strong> tiefen Seen).Unter bestimmten Bedingungen, wie etwa massivenAlgenblüten, können in diesen Ablagerungenauch größere Mengen an organischemMaterial eingebettet werden. Durch die Absenkungüber geologische Zeiträume gelangen Tongesteinein Tiefenbereiche mit erhöhten Temperaturen,wodurch die organische Substanz soverändert wird, dass sich daraus Erdöl <strong>und</strong> Erdgasabspalten. Solche Tongesteine werden alsMuttergesteine für Erdöl <strong>und</strong> Erdgas bezeichnet.Aus dem enthaltenen organischen Material6 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOFOKUSAbb. 1: Schematische Übersichtvon konventionellen <strong>und</strong>nicht-konventionellen Erdgas-VorkommenAbb. 2: Gebräuchliche Einteilungfür konventionelle <strong>und</strong>nicht-konventionelle Erdgasvorkommenaber mittlerweile vielfach nur noch gemeinsammit dem konventionellen Erdgas ausgewiesen.Kohleflözgas (Coalbed Methane – CBM) istErdgas, das in Kohleflözen adsorbiert ist bzw. inMikroklüften <strong>und</strong> -poren vorhanden ist. AlsAquifergas wird im tiefen salinaren Gr<strong>und</strong>wassergelöstes <strong>und</strong> dispers verteiltes Erdgas bezeichnet,das bei der Förderung des Wassers durchDruckentlastung freigesetzt wird. Gashydrat isteine feste, eisförmige Verbindung aus Methan<strong>und</strong> Wasser, das unter niedriger Temperatur<strong>und</strong> hohen Druckbedingungen stabil ist. ImWeiteren fokussieren sich die Ausführungen aufSchiefergas.Nicht-konventionelle Vorkommen besitzen aufgr<strong>und</strong>ihrer großen räumlichen Ausdehnung einhohes Potenzial für Erdöl- <strong>und</strong> Erdgas-Lagerstätbildensich mit der Temperaturerhöhung die verschiedenenKohlenwasserstoffe, zunächst überwiegendErdöl. Mit zunehmender Subsidenzkann bereits entstandenes Erdöl zu Erdgasumgebildet werden. Das Endprodukt der chemischenUmwandlung des organischen Materialsist u.a. Methan, das bis zu relativ hohen Temperaturenstabil ist. Anteile der gebildeten Kohlenwasserstoffekönnen aus diesen Muttergesteinenentweichen <strong>und</strong> konventionelle Erdöl- <strong>und</strong>Erdgaslagerstätten bilden, jedoch verbleiben immernoch große Mengen im Muttergestein, dieals Schiefergas bezeichnet werden.Erdgasvorkommen aus gering durchlässigenSand- <strong>und</strong> Karbonatgesteinen werden als TightGas bezeichnet. Tight Gas stellt einen Sonderfalldar. Es ist als nicht-konventionell definiert, wird<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 7
GEOFOKUSten. Dieses Potenzial wird auch als „In-Place-Ressource“ bezeichnet <strong>und</strong> umfasst die Gesamtmengeder in einem Vorkommen enthaltenenKohlenwasserstoffe. Als Ressourcen werdennachgewiesene, aber derzeit technisch oderwirtschaftlich nicht gewinnbare sowie nichtnachgewiesene, aber geologisch mögliche,künftig gewinnbare Rohstoffmengen bezeichnet.Reserven hingegen sind nachgewiesene, zuheutigen Preisen <strong>und</strong> mit heutiger Technik wirtschaftlichgewinnbare Energierohstoffmengen.Angaben zu Ressourcen aus nicht-konventionellenVorkommen sind oft sehr hoch. Allerdings istdie technisch <strong>und</strong> wirtschaftlich förderbareMenge (Reserve) aus diesen Vorkommen aufgr<strong>und</strong>der geologischen Verhältnisse wesentlichgeringer.Schiefergas als „game changer“Die wirtschaftliche Erschließung von Schiefergasvorkommenin den USA hat zu einer Neuordnungdes nordamerikanischen Erdgasmarktesgeführt. Nicht-konventionelles Erdgas(inklusive Schiefergas, Tight Gas <strong>und</strong> Flözgas)hat in den USA mittlerweile einen Anteil vonr<strong>und</strong> 60 % an der Gesamtproduktion an Erdgaserreicht (EIA 2012). Ein Ende dieses Booms istderzeit nicht absehbar. Eine ähnliche Entwicklungwird für die Produktion von Erdöl aus Tongesteinen(Shale Oil) postuliert. Durch die Förderungdieser heimischen Vorkommen sind dieErdgaspreise in den USA stark gefallen. DieserTrend wird nach heutigem Kenntnisstand auchlängerfristig Bestand haben, da enormeRessourcen an nicht-konventionellem Erdgas inden USA nachgewiesen sind. Außerhalb der USAfindet derzeit noch keine kommerzielle Produktionvon Schiefergas statt. Allerdings wirdSchiefergas weltweit ein hohes Potenzial mitderzeit r<strong>und</strong> 157 Bill. m 3 an technisch gewinnbarenRessourcen zugerechnet (BGR 2012a).Die Entwicklung der USA hin zu einem Netto-Erdgasexporteur hat bedeutende Auswirkungenauf die globalen Energiemärkte. Der einstprognostizierte Importbedarf der USA von Flüssiggas(liquefied natural gas – LNG) könntebeispielsweise nach Europa <strong>und</strong> Asien umgeleitetwerden <strong>und</strong> dort die Versorgungssituationverbessern bzw. günstigere Preise für Erdgas ermöglichen.Vorkommen nicht-konventioneller Erdgas-Lagerstätten in EuropaIn Europa steckt die Erk<strong>und</strong>ung <strong>und</strong> Entwicklungvon Schiefergasvorkommen noch in einem frühenStadium. Die intensivsten Aktivitäten gibt esbisher in Polen, das derzeit zu ca. 60 % vonErdgasimporten aus Russland abhängig ist <strong>und</strong>durch die Erschließung von Schiefergasvorkommendie Erdgasversorgung zu diversifizierenversucht. In verschiedenen Abschätzungen<strong>und</strong> Studien wurden Bewertungen der Ressourcenvon organik-reichen ordovizischen <strong>und</strong> silurischenSchiefern in der Polnisch-UkrainischenSenke durchgeführt – mit zum Teil sehr unterschiedlichenErgebnissen. Der GeologischeDienst der Vereinigten Staaten (USGS) in Zusammenarbeitmit dem Geologischen DienstPolen (PGI) wies in den aktuellsten Studien einPotenzial von ca. 0,56 Bill. m 3 (PGI) sowie von0,038 Bill. m 3 (USGS) aus. Eine Abschätzung derU.S. Energy Information Administration (EIA) imJahr 2010 hatte die polnischen Vorkommen hingegenmit ca. 5,3 Bill. m 3 bewertet. Dieses Beispielzeigt die erhebliche Unsicherheit derPotenzialabschätzungen in Gebieten, in denenes bislang keine praktischen Erfahrungen zurwirtschaftlichen Gewinnung von Schiefergasgibt. Die Potenzialangaben zu Schiefergasvorkommenin den USA gelten als vergleichsweisegesichert, da sich die Ermittlung der Potenzialeauf Zahlen aus der Förderung stützt (BGR2012a).Prinzipiell könnten alle bekannten europäischenKohlenwasserstoff-Provinzen ein Schiefergas-Potenzial besitzen (Abb. 3). In einer ersten, allerdingsnicht vollständigen Studie der EIA wurdefür verschiedene Regionen außerhalb der USAdas Potenzial für Schiefergas bewertet (EIA2011). In Osteuropa gibt es mehrere Sedimentbeckenmit einem möglichen Schiefergasvorkommen.Diese liegen im Polnisch-UkrainischenBecken, im Lublin-Becken in der Ukraine, imPannonischen Becken in Ungarn <strong>und</strong> Rumänien,8 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOFOKUSAbb. 3: Übersichtskarte europäischer Sedimentbecken, die ein mögliches Schiefergaspotenzialbesitzen könnten (vereinfacht nach EIA 2011)im Karpaten-Balkan-Becken in Rumänien <strong>und</strong>Bulgarien sowie im Baltischen Becken (Abb. 3).Weitere große Vorkommen an Schiefergas werdenin Frankreich im Pariser Becken vermutet.Dort ist der jurassische Schwarzschiefer, ähnlichdem in Deutschland bekannten Posidonienschiefer,ein möglicher Zielhorizont. Neben demPariser Becken könnten auch die liassischenSchwarzschiefer aus dem „Südost-Becken“ einSchiefergaspotenzial besitzen. In Frankreichwurde allerdings vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Besorgnissemöglicher Umweltgefahren ein gesetzlichesVerbot der Fracking-Technologie verhängt,was die Exploration auf Schiefergas praktischzum Erliegen kommen ließ.Erste Arbeiten zur Erk<strong>und</strong>ung von Schiefergasvorkommensind in Großbritannien angelaufen,eine kommerzielle Förderung ist aber bishernicht absehbar. Hier sind insbesondere derBowland Shale aus dem Namur in Mittelengland<strong>und</strong> die liassischen Sedimente des Wessex-Weald-Beckens von Interesse (Abb. 3). In Großbritannienwurde Ende 2012 angekündigt, dassdas hydraulische Fracking-Verfahren wieder ein-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 9
GEOFOKUSgeführt werden könne, wenn definierte Regelnzur Verminderung des seismischen Risikos eingehaltenwerden.Eine Abschätzung zum Schiefergas-Potenzialwurde ebenfalls in den Niederlanden durchgeführt.Dort gibt es eine Reihe von Teilbecken, dieein Schiefergaspotenzial besitzen können(Abb. 3). Explorationstätigkeiten sind derzeitjedoch nicht bekannt. Untersuchungen vonExplorationsfirmen zum Schiefergaspotenzialliefen auch in Schweden (Alaun Schiefer), inÖsterreich (Posidonienschiefer, Wiener Becken)sowie in geringem Umfang in Spanien <strong>und</strong> Portugal.In Schweden <strong>und</strong> Österreich finden gegenwärtigkeine Explorationsaktivitäten statt.Schiefergas-Ressourcen in DeutschlandEine erste vorläufige Abschätzung zum möglichenSchiefergaspotenzial in Deutschland wurdevon der BGR Mitte 2012 vorgelegt (BGR2012b). Gr<strong>und</strong>lage der Studie sind Auswertungenvon frei zur Verfügung stehenden Daten wieAtlanten, Veröffentlichungen <strong>und</strong> offizielle Berichte.In dieser ersten Abschätzung wurdendie Tongesteine des Unterkarbon, des jurassischenPosidonienschiefers sowie des Wealden(Bückeburg-Formation; Unterkreide) bewertet.Zur Abschätzung des Potenzials wurde ein volumetrischerAnsatz gewählt, um die „In-Place“Menge an Erdgas berechnen zu können (Gas-in-Place, GIP).Eine Übersicht der Verbreitung der möglichenprospektiven Gebiete ist in Abb. 4 dargestellt. Inder Abbildung sind alle Sedimentbecken eingezeichnet,die gr<strong>und</strong>sätzlich die Voraussetzungfür die Bildung von Schiefergas besitzen. DieFlächen zeichnen im Wesentlichen die bekanntenKohlenwasserstoff-Provinzen in den großenSedimentbecken nach. Potenziale für Schiefergasfinden sich demnach am Südrand <strong>und</strong> imöstlichen Teil des Nordwestdeutschen Beckens,in Nordostdeutschland sowie im mittleren Bereichdes Oberrheingrabens.Die insgesamt vorhandenen Schiefergasmengenin den untersuchten Formationen liegen zwischen6,7 Bill. m 3 <strong>und</strong> 22,7 Bill. m 3 mit einemMittel von ca. 13 Bill. m 3 GIP (Abb. 5). Die Ergebnisseder probabilistischen Abschätzung (angegebenin Perzentilen p05, p25, p50, p75 <strong>und</strong> p95)geben die Wahrscheinlichkeit an, dass ein bestimmterWert nicht unter- bzw. überschrittenwird (Minimum p05 – mit 95 % Wahrscheinlichkeitnicht unterschrittener Wert; Mittel p50 –durchschnittlicher (Median-) Wert; Maximump95 – zu 95 % Wahrscheinlichkeit nicht überschrittenerWert).Die Tongesteine des Unterkarbon weisen miteinem Mittelwert von etwa 8 Bill. m 3 dabei dasgrößte Potenzial auf. Die Menge liegt damitdeutlich über denen des Posidonienschiefers(Unterjura) <strong>und</strong> des Wealden (Unterkreide) mitjeweils r<strong>und</strong> 2 Bill. m 3 GIP. Allerdings stehen fürdas Unterkarbon gegenwärtig nur wenige Datenzur Verfügung, was die Genauigkeit der Aussagestark einschränkt. Das Potenzial für Schiefergasim Posidonienschiefer wird in Norddeutschlandaufgr<strong>und</strong> der geochemischen Parameter <strong>und</strong> derrelativ homogenen Ausbildung der Sedimenteals relativ hoch eingeschätzt. Potenziale imPosidonienschiefer befinden sich am Südranddes Nordwestdeutschen Beckens sowie im mittlerenBereich der Oberrheingrabens. Die Tongesteinedes Wealden besitzen ebenfalls ein relativhohes Schiefergaspotenzial <strong>und</strong> finden sichim Süden des Nordwestdeutschen Beckens.In Deutschland wurde bereits seit 2008 mitExplorationstätigkeiten auf Schiefergas begonnen,aber bislang gibt es keine Schiefergasförderung<strong>und</strong> deshalb auch keine Erfahrungswertezum technisch gewinnbaren Anteil ausden GIP-Mengen. Produktionsdaten aus denUSA zeigen, dass der Gewinnungsfaktor zwischen10 % <strong>und</strong> 35 % der GIP-Mengen schwankenkann. Im Sinne einer konservativen Abschätzungwird in dieser Studie von einemtechnischen Gewinnungsfaktor von 10 % derGIP-Mengen ausgegangen. Entsprechend würdesich die technisch gewinnbare Erdgasmenge auf0,7 bis 2,3 Bill. m 3 belaufen. Diese Menge liegtdamit deutlich über Deutschlands konventionellenErdgasressourcen mit 0,15 Bill. m 3 <strong>und</strong> Erdgasreservenmit 0,146 Bill. m 3 .Weltweit gibt es inzwischen für eine Reihe vonLändern Angaben zu den dortigen Schiefergas-10 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOFOKUSAbb. 5: Gas-in-Place-Mengen(GIP) an Erdgas in den untersuchtenTongesteinen sowiedie GesamtmengeDas Fracking-Verfahren wurde erstmalig in denUSA 1949 eingesetzt <strong>und</strong> seitdem kontinuierlichweiterentwickelt. In Deutschland wurde das Verfahrenerstmals 1961 angewendet. Seither wurdenr<strong>und</strong> 300 Fracking-Maßnahmen, vor allem intiefen <strong>und</strong> dichten Erdgasspeichern (Tight Gas)durchgeführt. Gr<strong>und</strong>wasserverunreinigungendurch diese Fracking-Maßnahmen sind inDeutschland nicht bekannt.Die eingepressten Flüssigkeiten bestehen auseiner Mischung von Wasser, einem Stützmittel(meist Quarzsand) zum Offenhalten der Rissesowie chemischen Begleitstoffen (Abb. 7). DieVerwendung von Begleitstoffen, wie z.B. Bioziden<strong>und</strong> Lösungsmitteln, die in die Wassergefährdungsklassen1–3 eingestuft werden <strong>und</strong>die zum Teil nach Gefahrstoffrecht als ges<strong>und</strong>heitsschädlichoder giftig einzustufen sind, hatin der Öffentlichkeit zu großer Besorgnis geführt.Eine Kontamination von gr<strong>und</strong>wasserführendenSchichten <strong>und</strong> des Trinkwassers wirdbefürchtet. Weithin bekannt sind auch die Bilder„brennender Wasserhähne“ aus dem Film „Gasland“,die eine Kontamination des Trinkwassersmit Erdgas auf Gr<strong>und</strong> von Gasbohrungen <strong>und</strong>Fracking suggerieren. In dem geschilderten Fallwar bereits vor den Bohraktivitäten bekannt,dass Methan auf Gr<strong>und</strong> natürlicher Einträge inden Gr<strong>und</strong>wasserleitern vorhanden ist. Auch inDeutschland gibt es vergleichbare Phänomene,wie etwa natürliche Gasaustritte in offenen Gewässerndes Münsterländer Beckens. Trotzdem12 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOFOKUSAbb. 7: Übersicht zur Zusammensetzung von Fracking-Flüssigkeiten (Beispiel)gen unrealistisch, Deutschland könnte für mehrals 10 Jahre durch heimisches Schiefergas vonErdgasimporten unabhängig werden. Vielmehrkönnten die Schiefergasressourcen über einenlängeren Zeitraum zur Diversifizierung <strong>und</strong>Energieversorgungssicherheit Deutschlandsbeitragen. Eine breite gesellschaftliche Akzeptanzist allerdings Voraussetzung für dieNutzung dieser Ressource. Hierzu müssen dieBesorgnisse der Gesellschaft von den Geowissenschaftenaufgegriffen <strong>und</strong> mit Hilfe vonInformation <strong>und</strong> Transparenz zur Meinungsfindungbeigetragen werden.LiteraturB<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe(BGR) (2009): Energierohstoffe 2009 –Reserven, Ressourcen, Verfügbarkeit. - 284 S.,HannoverB<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe(BGR) (2012a): Energiestudie 2012. Reserven,Ressourcen <strong>und</strong> Verfügbarkeit von Energierohstoffen2012. - 92 S., HannoverB<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe(BGR) (2012b): Abschätzung des Erdgaspotenzialsaus dichten Tongesteinen (Schiefergas)in Deutschland. - 56 S., HannoverU.S. Energy Information Administration (EIA)(2011): World Shale Gas Resources: an initialassessment of 14 Regions outside the UnitedStatesU.S. Energy Information Administration (EIA)(2012): Annual Energy Outlook 2012 withProjection to 2035. - 239 S., ParisWeiterführende LiteraturUmweltb<strong>und</strong>esamt (2012): Umweltauswirkungenvon Fracking bei der Aufsuchung <strong>und</strong> Gewinnungvon Erdgas aus unkonventionellenLagerstätten – Risikobewertung, Handlungsempfehlungen<strong>und</strong> Evaluierung bestehender rechtlicherRegelungen <strong>und</strong> Verwaltungsstrukturen:www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4346.pdfNeutraler Expertenkreis im InfoDialog Fracking(2012) „Risikostudie Fracking“: http://dialogerdgas<strong>und</strong>frac.de/risikostudie-frackingRisikogutachten des Landes Nordrhein-Westfalen(2012) „Fracking in unkonventionellen Erdgas-Lagerstättenin NRW“, www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gutachten_fracking_nrw_2012.pdfStudien der EU-Kommission (DG Environment)http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/uff_studies_en.htmlStudie der EU-Kommission (DG Energy)http:/ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdfInternational Energy Agency (2012) „GoldenRules for a Golden Age of Gas“www.worldenergyoutlook. org/goldenrules/14 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 15
GEOAKTIV – WIRTSCHAFT, BERUF, FORSCHUNG UND LEHRESchiefergas spaltet Europahjw. Folgende Aussagen sind einem Artikel derFAZ vom 3. Januar 2013 entnommen.Großbritannien will in Westeuropa Vorreiter beider Ausbeutung sogenannter unkonventionellerErdgasvorkommen werden. Kurz vor Weihnachtenhat Energieminister Edward Davey ein zeitweiligesVerbot für das nicht nur auf der Inselumstrittene Fracking aufgehoben. Bei dieserFördermethode werden durch das Bohrloch mithohem Druck <strong>und</strong> in großen Mengen Wasser<strong>und</strong> Chemikalien in das Schiefergesteingepresst, um es aufzusprengen <strong>und</strong> das Gaszum Fließen zu bringen. Ohne Fracking ist derSchiefergasschatz nicht zu heben. In den VereinigtenStaaten hat diese Methode bereits denEnergiemarkt revolutioniert.Fracking-Gegner befürchten, dass der Chemiecocktaildas Gr<strong>und</strong>wasser vergiften könnte. 2011verursachten zudem erste Probebohrungen inder Nähe des englischen Seebads Blackpool einleichtes Erdbeben. Doch die Regierung in Londonhofft vier Jahrzehnte nach dem Beginn desNordsee-Ölrauschs auf eine zweite Energie-Bonanza. Geologische Gutachten deuten daraufhin, dass im englischen Boden große Schiefergasvorkommenschlummern. Binnen wenigerJahre könnten Dutzende von Bohrlizenzen vergebenwerden. Finanzminister George Osbornehat „großzügige steuerliche Rahmenbedingungen“für Investoren angekündigt.Mit ihrer Unterstützung für die Schiefergasindustriesetzt sich die britische Regierung vonvielen anderen europäischen Ländern ab. InDeutschland ist die Skepsis groß, Frankreich hatein Fracking-Verbot erlassen. Bulgarien <strong>und</strong> Rumänenhaben zumindest zeitweilige Moratorienverhängt <strong>und</strong> damit den amerikanischen EnergiekonzernChevron ausgebremst. Fracking-Befürworter warnen, die Europäer liefen Gefahr,eine der größten Umwälzungen im globalenEnergiegeschäft seit Jahrzehnten zu verpassen.Mit womöglich weitreichenden Folgen.Vor allem Nordamerika ist dank niedrigerErdgaspreise zum Schlaraffenland für Industrieunternehmenmit hohem Energiekostenanteilgeworden. Auch deutsche Konzerne wie BASF<strong>und</strong> Bayer blicken bei Investitionsentscheidungenstärker nach Amerika als noch vor wenigenJahren. Die Vereinigten Staaten sind das ersteLand der Welt, in dem Schiefergasvorkommenim großen Stil ausgebeutet werden. Die Energiekostensind dadurch drastisch gefallen: Der Erdgas-Spotpreisin Nordamerika liegt heute ummehr als 70 % unter dem deutschen Gasimportpreis.Inzwischen werden in Amerika mit ähnlichenFördermethoden auch bislang unerreichbareÖlvorkommen ausgebeutet. Im Novemberprognostizierte die Internationale Energieagentur(IEA), die Vereinigten Staaten könnten in denkommenden Jahrzehnten weitgehend unabhängigvon Öl- <strong>und</strong> Gasimporten werden.In Deutschland <strong>und</strong> anderen europäischenLändern geht es dagegen in der Debatte um dasSchiefergas bisher nicht um den Wirtschaftsstandort,sondern um den Umweltschutz. DasUmweltb<strong>und</strong>esamt fordert unter anderem einFracking-Verbot in Wasserschutzgebieten. DieB<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe(BGR) bilanzierte zwar im Mai letzten Jahresin einem Gutachten, die Umweltrisiken desFracking seien „gering“ <strong>und</strong> bei gründlicher Planunggut beherrschbar. In Nordrhein-Westfalengenehmigt die rot-grüne Landesregierung dennochkein Fracking. Auch in Schleswig-Holsteinbeschloss der Landtag Mitte Dezember 2012einen Fracking-Bann. In Niedersachsen, woschon heute fast das gesamte deutsche Erdgasmit konventionellen Methoden gefördert wird,ist die Politik dagegen aufgeschlossener. Deramerikanische Energieriese ExxonMobil hat geradegemeinsam mit Shell einen Antrag auf eineweitere Bohrung eingereicht. Auch Wintershall<strong>und</strong> andere Unternehmen wollen das Potentialin Deutschland ausloten.Der britische Energieökonom Dieter Helm vonder Universität Oxford hält die europäischenUmweltschutzvorbehalte gegenüber dem Schiefergasfür widersinnig. „Wir brauchen in Europaein striktes Aufsichtsregime, sonst wird dieSchiefergasförderung <strong>hier</strong> keine Akzeptanz fin-16 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOAKTIV – WIRTSCHAFT, BERUF, FORSCHUNG UND LEHRErendenzahlen bei gleichzeitigem Stellenschw<strong>und</strong>,sowie ein stark bürokratisiertes BSc-Studium führen zu stärkerer Auslastung als zuvor,so dass die ach so gewünschte Forschunghäufig auf der Strecke bleibt. Erschreckend istauch die Tatsache, dass bei der Ausrichtung desBSc-Studiengangs die zukünftig wegfallendenStellen – welche Professoren gehen als erste inPension – eine wichtige Rolle gespielt haben. Diereguläre Lehre wird außerdem durch Mittelkürzungfür HiWis <strong>und</strong> Lehrmittel immer weiterbehindert. So kann man noch so engagiertenHochschullehrern die letzte Lust an der Lehrenehmen.Auf Seiten des Studiums muss man leider eineteilweise massive Einschränkung der Geländeausbildungbeobachten. Es gibt sogar vereinzeltBSc-Studiengänge in Geowissenschaften, beidenen Kartierkurse nicht mehr zu den Pflichtmodulengehören. Hier wird die Kernkompetenzeines geowissenschaftlichen Studiums aufgegeben.Was vielleicht doch nicht so verw<strong>und</strong>erlichist, wenn man bedenkt, dass an vielen InstitutenGeländeausbildung nur noch von einem kleinenTeil der Dozenten gelehrt wird. Warum sollteman noch betreuungsintensive Zeit im Geländeverschwenden, gibt es doch vielfältige Modellierungs-<strong>und</strong> GIS-Programme? Damit kämen wirwieder zur Überschrift zurück. Vielleicht handeltes sich bei der verlorenen Generation auch umdie heutigen Studenten. Ich möchte nicht mitihnen tauschen müssen.Nach langer Durststrecke werde auch ichDeutschland den Rücken kehren, um eine Stellean der University of Alaska in Fairbanks anzunehmen.Eine meiner Hauptaufgaben wird dieLeitung eines Field Camps sein, der Schwerpunktliegt also in der Geländeausbildung. Ehrlichgesagt, ich habe kaum noch daran geglaubt.Das <strong>hier</strong> Geschilderte ist meine persönlicheErfahrung <strong>und</strong> Einschätzung, die vielleicht nichtfür alle geowissenschaftlichen Institute zutrifft,aber doch den Gr<strong>und</strong>tenor aller, die ich kenne.Mancher Hochschullehrer der Geowissenschaftenmag die Situation für Studierende <strong>und</strong>Lehrende positiv einschätzen. Meine Erfahrungnach 9 Jahren Lehre ist leider negativ, <strong>und</strong> ichsehe die Tendenz für geowissenschaftliche Lehrean deutschen Hochschulen deutlich pessimistisch.Da mein politischer Einfluss gering ist,bleibt mir nichts anderes als die Emigration. Wenigstensbin ich schon weg, bevor der B<strong>und</strong>estagswahlkampfbeginnt <strong>und</strong> manche Politikerwieder die Bildungsrepublik ausrufen – eine dergroßen Lügen der letzten Jahre.Jochen Mezger (Fairbanks, Alaska, ehemalsHalle/Saale)Neue Studiengänge für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie in SüdchileIn diesem Jahr wird an der südchilenischenUniversidad Austral de Chile in Valdivia der ersteJahrgang des neugeschaffenen StudiengangsGeologie mit dem Studium beginnen. DieserStudiengang ist federführend von dem französischenKollegen Alexandre Corgne ausgearbeitetworden, der auch Direktor der neuen Escuela deGeología ist (www. geologiauach.cl). Zusätzlichzu diesem 5-jährigen Vollstudium, vergleichbarunserem alten Diplom, wird es einen 2-jährigenMagister in Paläontologie geben, vergleichbaretwa einem aufbauenden Master für Absolventeninsbesondere der Geologie <strong>und</strong> der Biologie.Während die Geologie im Laufe der nächstenJahre noch sukzessiv Zuwachs von vier weiterenKollegen bekommen wird, ist die Paläontologiemit drei Stellen voll besetzt <strong>und</strong> damit auch daspersonell stärkste Zentrum für Paläontologiein ganz Chile. Neben den Kolleginnen KarenMoreno (Wirbeltiere) <strong>und</strong> Ana Abarzúa (Palynologie),beide von Haus aus Biologinnen, wird dernoch-Kieler Geologe Sven Nielsen das Team mitden Schwerpunkten Stratigraphie <strong>und</strong> fossileWirbellose vervollständigen.Die Geologie an der Universität in Valdivia isttraditionell stark mit Deutschland verb<strong>und</strong>enbzw. von deutschen Geologen geprägt worden.Im Jahr 1957 wurde das Institut für Geologie <strong>und</strong>20 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOAKTIV – WIRTSCHAFT, BERUF, FORSCHUNG UND LEHREGeographie in Valdivia gegründet <strong>und</strong> wurde bis1976 von Deutschen geleitet. Wichtige Namendieser Zeit sind Wolfgang Weischet (anschließendProfessor in Freiburg), Wilhelm Lauer (anschließendProfessor in Kiel), Henning Illies (anschließendProfessor in Karlsruhe) <strong>und</strong> KarlKlohn (blieb unter dem Namen Carlos Klohn inChile). 1981 wurde das Institut im Zuge einerUmstrukturierung in Institut für Geowissenschaften(Instituto de Geociencias) umbenannt,behielt aber seine Aufgaben in der Forschung<strong>und</strong> unterstützenden Lehre für verschiedeneStudiengänge. Im Jahr 2011 wurde das Institutdurch eine weitere Strukturreform mit dem Institutfür Botanik <strong>und</strong> dem Institut für Ökologie<strong>und</strong> Evolution in dem neu geschaffenen Institutfür Umwelt- <strong>und</strong> Evolutionswissenschaftenzusammengelegt.Beherbergt wird die Geologie in einem neuenGebäude der Naturwissenschaftlichen Fakultätmit ausreichend Büros, Laboren <strong>und</strong> Hörsälen<strong>und</strong> auch Raum für die auszubauenden Sammlungenist vorhanden. Einiges an Gerät ist auchvorhanden, anderes muss noch beschafft werden.Internationale Kooperationen werden angestrebt<strong>und</strong> ich möchte an dieser Stelle alle Interessierteneinladen, Ideen <strong>und</strong> Vorschläge fürgemeinsame Projekte mit uns zu entwickeln.Sven Nielsen (Kiel <strong>und</strong> Valdivia)Update des Datenbanksystems GONIAT onlineWir möchten darüber informieren, dass wir, aufbauendauf der früheren Sachbeihilfe „Diversität“,die Beantragung einer Sachbeihilfe bei derDFG im LIS-Förderprogramm eingereicht haben.Bei dem geplanten Projekt geht es um die Erweiterungdes Online-Systems GONIAT (www.goniat.org), so dass die Pflege <strong>und</strong> Nutzbarkeitder Daten auf Dauer sichergestellt werden kann.GONIAT ist eine umfassende taxonomische <strong>und</strong>morphologische Datenbasis über paläozoischeAmmonoideen mit geographischen <strong>und</strong> zeitlichenBezügen <strong>und</strong> deckt derzeit ca. 7.000 Taxa,7.700 F<strong>und</strong>orte <strong>und</strong> 2.000 Publikationen ab. DieRecherchemöglichkeit über das Internet wurdemit Hilfe einer Sachbeihilfe der DFG im Jahr 2007realisiert. Das Online-System soll nun dahingehenderweitert werden, dass nicht nur dieRecherche, sondern auch die Pflege der Datenbrowserbasiert durchgeführt werden kann. DasWindows-basierte Programm, das bisher dazuverwendet wurde, ist veraltet <strong>und</strong> wird in absehbarerZeit durch die aktuellen Betriebssystemversionennicht mehr unterstützt werden. Einweiterer großer Vorteil, der sich aus diesemAnsatz ergibt, ist die Möglichkeit, alle interessiertenWissenschaftler <strong>und</strong> Wissenschaftlerinnenortsunabhängig an der Pflege der Daten zubeteiligen.Svetlana V. Nikolaeva (London <strong>und</strong> Moskau),Peter S. Kullmann (Stuttgart-Möhringen)& Jürgen Kullmann (Mössingen)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 21
22 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
Berufsverband Deutscher GeowissenschaftlerDeutsche Geophysikalische GesellschaftDeutsche Gesellschaft für GeowissenschaftenDeutsche Mineralogische GesellschaftDeutsche QuartärvereinigungGeologische VereinigungPaläontologische Gesellschaft<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 23
BDGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENSeminarprogramm 2013Thema: Baugr<strong>und</strong>untersuchung <strong>und</strong> geotechnischer BerichtTermin: 12. April 2013Ort: NeuwiedThema: Abfallprobenahme nach LAGA PN 98 mit Zertifikat <strong>und</strong> ExkursionTermin: 19. April 2013Ort: BonnThema: Bohrtechnik in der Geothermie <strong>und</strong> Verhalten des bohrbegleitenden GeologenTermin: 17. Mai 2013Ort: HannoverThema: Probenahme von Trinkwasser mit Sachk<strong>und</strong>enachweisTermin: 7. Juni 2013Ort: BonnThema: Geothermie I – Einführung in das Betätigungsfeld für GeowissenschaftlerTermin: 13. September 2013Ort: Bonn oder KoblenzThema: Beprobung von Boden, Probenahme mit Zertifikat <strong>und</strong> ExkursionTermin: 19. September 2013Ort: WesselingThema: Beprobung von Bodenluft, Probenahme mit Zertifikat <strong>und</strong> ExkursionTermin: 20. September 2013Ort: WesselingThema: Lagerstättenbewertung nach internationalen KriterienTermin: 27. September 2013Ort: EssenThema: Geothermie II – Erschließung Geothermischer Energie durchErdwärmesondenanlagenTermin: 8. November 2013Ort: Bonn oder KoblenzBitte beachten Sie die detaillierten Seminarankündigungen in den BDG-Mitteilungen sowie imInternet unter www.geoberuf.de. Anmeldungen zu den o. g. Seminaren sind jederzeit in der Geschäftsstelledes Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler, Bildungsakademie e.V.,Lessenicher Str. 1, 53123 Bonn, möglich. Telefon: 0228 69 66 01, Fax: 0228 69 66 03, E-Mail:ba@geoberuf.de 10 % Frühbucherrabatt bei Anmeldung 2 Monate vor Anmeldeschluss.Stand 31.01.201324 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENBDGSeminarankündigungen der BDG-BildungsakademieBohrtechnik in der Geothermie <strong>und</strong> Verhalten des bohrbegleitenden Geologen17. Mai 2013; Veranstaltungsort: Hannover. Anmeldeschluss: 19. April 2013.Bohrungen auf geothermische Energie unterscheiden sich zunächst nicht gr<strong>und</strong>sätzlich von Bohrungenauf andere Ziele. Jedoch werden seit Jahren in Deutschland die weitaus meisten Bohrmeter aufGeothermie abgeteuft. Daher treten auch die meisten Störfälle im Zusammenhang mit Geothermiebohrungenauf. Unfälle wie in Wiesbaden oder Staufen sind dabei besonders spektakuläre Havarien.Die meisten Störfälle verlaufen jedoch weit weniger unter öffentlicher Anteilnahme, sind jedochebenso ärgerlich für Auftragnehmer, Auftraggeber <strong>und</strong> Bohrunternehmen.Diese Seminarveranstaltung behandelt die Praxis von Bohrungen für Erdwärmesondenanlagen <strong>und</strong>beschreibt die unterschiedlichen, vom Gebirge abhängigen Bohrverfahren. Es werden mögliche Störfälle<strong>und</strong> das richtige Verhalten des bohrbegleitenden Geowissenschaftlers erörtert. Ein weitererSchwerpunkt ist die Präsentation von Bohranlagen. Die Teilnehmer haben Gelegenheit, im Rahmeneines konkreten Bohrvorhabens in der Region Hannover ein Bohrgerät im Einsatz zu sehen <strong>und</strong> zulernen, worauf beim Einsatz zu achten ist.Zielgruppe: Geowissenschaftler, die insbesondere im Rahmen von Geothermieerschließung mit Bohrungenzu tun haben.Referent: Dipl.-Geologe Uwe Schriefer, BauGr<strong>und</strong> Süd Ges. für Geothermie mbHTeilnehmerbetrag: 258,00 €; BDG-Mitglieder: 209,00 €; Mitglieder der DGG, GV, Pal. Ges., DMG,DEUQUA, ITVA, VGöD, DGG(Geophysiker): 234,00 €.Anmeldungen an: BDG-Bildungsakademie, Lessenicher Straße 1, 53123 Bonn, Tel.: 0228/696601,Fax: 0228/696603, E-Mail: BA@geoberuf.deProbenahme von Trinkwasser mit Sachk<strong>und</strong>enachweis nach Trinkwasserverordnung 2001/20117. Juni 2013; Veranstaltungsort: Bonn. Anmeldeschluss: 10. Mai 2013Seit dem 1. Januar 2003 ist b<strong>und</strong>esweit die novellierte Trinkwasserverordnung in Kraft. Gemäß § 15Abs. 4 der neuen Trinkwasserverordnung dürfen Trinkwasseruntersuchungen einschließlich derProbenahme nur noch von nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Untersuchungsstellen durchgeführtwerden. Am 11. Mai 2011 verkündete der B<strong>und</strong>esrat die erste Verordnung zur Änderung derTrinkwasserverordnung, welche am 1. November 2011 in Kraft getreten ist.In dieser Veranstaltung kann der notwendige Qualifikationsnachweis für Probenehmer nach neuerTrinkwasserverordnung erworben werden. Die Schulung umfasst einen theoretischen <strong>und</strong> einenpraktischen Teil <strong>und</strong> schließt mit einem schriftlichen Test ab, mit dem die Teilnehmer Kenntnisse fürdie Probenahme von Trinkwasser nachweisen. Diese Gr<strong>und</strong>schulung kann auch als Auffrischung des„Sachk<strong>und</strong>enachweises Probenahme Trinkwasser“ genutzt werden, wobei dann keine Prüfung notwendigist.Zielgruppe: Probennehmer von Wasserversorgungsunternehmen, Prüflaboratorien; Umwelt- <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heitsinstitute, Ges<strong>und</strong>heits- u. Umweltbehörden sowie die freie WirtschaftReferent: Dr. Thorsten Spirgath, BerlinTeilnehmerbetrag: 350,00 €; BDG-Mitglieder: 299,00 €; Mitglieder der DGG, GV, DMG, DEUQUA,ITVA , Pal. Ges., DGG (Geophys.) oder VGöD: 324,00 €.Anmeldungen an: BDG-Bildungsakademie e.V., Lessenicher Straße 1, 53123 Bonn, Tel. 0228 69 6601, Fax 0228 69 66 03, ba@geoberuf.de<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 25
BDGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENAuf ein WortLiebe Mitglieder <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e des BDG,Absolventen in Technik-Fächern haben inDeutschland gr<strong>und</strong>sätzlich gute Berufsaussichten– allerdings gibt es in diesen Studiengängenauch viele Abbrecher. Oft haben Bewerber einbestimmtes Berufsbild vor Augen, das der Praxisdann nicht standhält. Studieninteressierte für„MINT“-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften<strong>und</strong> Technik) müssen daherfrühzeitig klären, ob sie den spezifischen Anforderungendes Studiums gewachsen sind. DiesesThema stand im Mittelpunkt des ersten ASIIN-Dialogs, der im Oktober 2012 in Bonn stattfand.Acht Referentinnen <strong>und</strong> Referenten beleuchtetenin Beiträgen, die nachfolgend in Podiumsdiskussionenangeregt erörtert wurden, den Übergangvon der Schule zur Hochschule aus dertheoretischen <strong>und</strong> praktischen Perspektive. Insbesonderemit Hilfe moderner Kommunikationsmedien<strong>und</strong> in enger Zusammenarbeit von Schulen<strong>und</strong> Hochschulen sollten bedarfsgerechteBeratungsangebote für die Übergangsphase vonSchule <strong>und</strong> Hochschule gestaltet werden. Als Ergebniswurden spezielle Unterrichtsmaterialien,Vorlesungen auf Probe, Tutoren-Programme,Vorkurse <strong>und</strong> konkrete Kooperationsprojektevorgeschlagen, um Jugendliche über Ziele <strong>und</strong>Inhalte eines naturwissenschaftlichen Studiumsaufzuklären <strong>und</strong> sie für die Naturwissenschaftenzu begeistern.Aber auch der Übergang von der Hochschule inden Beruf ist der Beginn eines wichtigen Lebensabschnitts,den es sorgfältig vorzubereiten gilt –<strong>und</strong> der trotzdem Überraschungen bereithält.Obwohl nach einer neuen Studie der B<strong>und</strong>esagenturfür Arbeit nur 2,4 % der Akademiker inDeutschland arbeitslos sind, erfahren vieleHochschulabsolventen nach ihrem Studiumetwas anderes: statt die lange geschmiedetenZukunftspläne nun in die Realität umsetzen zukönnen, landen sie in prekären Beschäftigungsverhältnissenoder rutschen zunächst in dieArbeitslosigkeit. An diesem Problem setzt diekonkrete Arbeit unseres Berufsverbandes – vorallem des Ausschusses Hochschulen <strong>und</strong>Forschungseinrichtungen – an: so wird im Rahmendes 5. Studienforums, das am 3. Mai 2013in Halle stattfindet, die wichtige Frage „Ist derBachelor berufsqualifizierend?“ behandelt. Wieimmer wird der BDG diese Ergebnisse – wie auchdie anderer Gremienarbeit – weiter verfolgen,mit konkreten Maßnahmen umsetzen <strong>und</strong> darüberberichten.Insgesamt lässt sich feststellen, dass der BDGmit seinen Angeboten auf dem richtigen Weg ist:Studienberatung über moderne Medien – wiedie demnächst vollständig auf der BDG-Homepage verfügbare deutschlandweite Erhebungzu MSc- <strong>und</strong> BSc-Studiengängen –, aberauch das Engagement einzelner Mitglieder oderRegionalgruppen, den Beruf des Geowissenschaftlersan Hand ganz praktischer Beispiele inden Schulen vorzustellen sowie das Mentoring-Programm für den Start in den Beruf <strong>und</strong> dieVeröffentlichung „Geowissenschaftler im Beruf“sind nur einige erfolgreiche Projekte aus unseremIdeenpool. Für die Umsetzung dieser Vorhabenstehen nicht zuletzt unsere Geschäftsstellenin Bonn <strong>und</strong> Berlin – letztere feiert in diesemJahr ihr 10-jähriges Bestehen.Besonders hinweisen möchte ich Sie noch aufden 8. Deutschen Geologentag, der anlässlich<strong>und</strong> in Kooperation mit der neuen Messe GECGeotechnik – Expo & Congress am 17. <strong>und</strong> 18.Oktober 2013 in Offenburg stattfindet. Nebeninteressanten Beiträgen im BDG-Themenblock26 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENBDG„Beitrag der Geowissenschaften zur Energiewende“bietet sich Ihnen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch<strong>und</strong> zur Vernetzung im Plenumsowie bei den Gremiensitzungen. Darüberhinaus wird im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungder Preis „Stein im Brett“ verliehen – lassenSie sich überraschen. Ich würde mich sehrfreuen, Sie dort begrüßen zu können!IhreUlrike MattigForum Junge GeowissenschaftlerZehn Jahre BDG in BerlinAuf dem 7. Deutschen Geologentag 2011 wurdedas Forum Junge Geowissenschaftler (FJG) gegründet.Das FJG beschäftigt sich als Einrichtungdes BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftlermit Fragen zum Geo-Studium <strong>und</strong>Berufseinstieg. Es dient dem Erfahrungsaustauschauf Augenhöhe, der aktiven <strong>und</strong> dauerhaftenVernetzung über Unigrenzen hinweg <strong>und</strong>bietet Raum für Diskussion zwischen jungenGeowissenschaftlern (Studenten <strong>und</strong> Absolventen)<strong>und</strong> erfahrenen BDG-Mitgliedern.Innerhalb des ersten Jahres seit Bestehen konntendie vier gewählten Koordinatoren mit Unterstützungdes BDG ein geschlossenes <strong>und</strong> unabhängigesOnline-Forum aufbauen, das mitverschiedenen thematisch organisierten Unterrubrikenden nötigen Raum für Austausch <strong>und</strong>Diskussion bereitstellt.Das Forum Junge Geowissenschaftler möchteneben BDG-Mitgliedern auch Nicht-BDG-Mitgliederansprechen. Für BDG-Mitglieder ist dasForum frei. Nicht-BDG-Mitglieder können dasOnline-Forum kostenlos aber eingeschränkt fürdrei Monate testen.Die Themen im Forum umfassen u.a. Informationenzu Geostudium, Berufseinstieg, fachlichenInformationsaustausch, Job- <strong>und</strong> Praktikumsangebote,Erfahrungsberichte, Arbeiten im Ausland,sowie Weiterbildungsangebote, Geo-Webpages<strong>und</strong> Geo-Events (Tagungen, Exkursionenetc.). Alle Nutzer können interessante <strong>und</strong> nützlicheBeiträge oder Links posten. Auch weiterenGruppierungen des BDG bietet das Forum Struktur<strong>und</strong> Raum für Diskussion <strong>und</strong> Austausch.Das Online-Forum des FJG ist unter http://forum.geoberuf.de/ oder über die BDG-Page(www.geoberuf.de) zu finden. Bei der Anmeldungim Forum wird auf einige FormalitätenWert gelegt, welche die Gr<strong>und</strong>lage für eine seriöseDiskussionskultur bilden sollen. So registriertman sich z.B. gr<strong>und</strong>sätzlich mit seinemVor- <strong>und</strong> Nachnamen <strong>und</strong> trifft einige kurze Auskünftezum Studium <strong>und</strong> Berufsfeld. Dennochbeträgt die Anmeldedauer nicht länger als zweiMinuten. Dabei bleiben persönliche Daten geschützt.Nur registrierte Mitglieder im Forumhaben Zugriff auf Kontaktdaten oder den Berufsstatusanderer Mitglieder.Das Forum Junge Geowissenschaftler ist nichtnur online vertreten, sondern trifft sich regelmäßigeinmal im Jahr an wechselnden Orten inDeutschland, so etwa am 13.10.2012 in Göttingenzum ersten Mal nach dem Gründungstreffen2011 in Köln.Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein,mit uns zu diskutieren <strong>und</strong> Erfahrungen auszutauschen.Koordinatoren Forum JungeGeowissenschaftler (Johannes Großmann,Lena Jaumann, Mathias Köster & MartinZiegler (junge_geos@geoberuf.de))hjw. Seit zehn Jahren ist der BDG in Berlin vertreten.Seine Niederlassung dort ist untrennbar mitdem Namen Tamara Fahry-Seelig verb<strong>und</strong>en. Anfang2003 trat Tamara Fahry-Seelig in die Dienstedes BDG <strong>und</strong> bildet seitdem das Standbeindes Berufsverbandes in der Hauptstadt. Tamara<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 27
BDGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENTamara Fahry-Seelig auf dem7. Deutschen Geologentag imGespräch mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Gursky (TU Clausthal)Fahry-Seelig, studierte Volkswirtin, war vorherbei der GeoAgentur Berlin-Brandenburg beschäftigt,die ihre Arbeit jedoch einstellte. Durchdie Übernahme von Frau Fahry-Seelig konnteder BDG auf ihre vielfältigen Kontakte <strong>und</strong> Verbindungeninsbesondere im Berlin-BrandenburgerRaum aufbauen, so dass diese gerade fürden geowissenschaftlichen Bereich nicht verlorengingen.Tamara Fahry-Seelig hat sich in der Geoszenedurch die Betreuung des BDG-Mentoring-Programms<strong>und</strong> der BDG-Homepage einen Namengemacht. Innerhalb des BDG arbeitet sie u.a.verschiedenen Ausschüssen <strong>und</strong> Foren zu, wobeidie Hochschularbeit <strong>und</strong> die Betreuung derStudierenden zwei ihrer Schwerpunkte sind. Wirgratulieren herzlich zum kleinen Dienstjubiläum,danken Tamara Fahry-Seelig sehr für ihre zehnjährigeerfolgreiche Tätigkeit im BDG <strong>und</strong> freuenuns auf die weitere Zusammenarbeit für den Berufsstandder deutschen Geowissenschaftler.Erster ASIIN-Dialog „Der Sprung ins kalte Wasser: Von der Schulean die Hochschule – Wo stehen wir in den MINT-Wissenschaften?“Am 29. Oktober 2012 fand im WissenschaftszentrumBonn der erste ASIIN-Dialog zum Thema„Der Sprung ins kalte Wasser: Von der Schulean die Hochschule – Wo stehen wir in denMINT-Wissenschaften?“ statt. Acht Referentinnen<strong>und</strong> Referenten beleuchteten in Beiträgen,die nachfolgend in Podiumsdiskussionen angeregterörtert wurden, den Übergang von derSchule zur Hochschule aus der theoretischen<strong>und</strong> praktischen Perspektive.„Lost in Transition? – Viele Wege führen zurHochschule!“. Lange Zeit galt das Abitur als der„Königsweg“ beim Zugang zur Hochschule.Auch wenn dieser traditionelle <strong>und</strong> im Gr<strong>und</strong>erestriktive Weg zur Hochschule in den letztenJahren verbreitert wurde, zeigt sich bisher kaumder bildungspolitisch gewünschte Erfolg. DasZiel, die soziale Selektivität dieses Wegs zudurchbrechen, um mehr junge Menschen für einStudium zu gewinnen <strong>und</strong> der wachsendenNachfrage nach Akademikern gerecht zu werden,ist nur schwer zu erreichen. Dabei stehenden ergänzenden Maßnahmen – Zugang überFachhochschulen, den zweiten Bildungswegoder Begabtenprüfungen – Zugangsbeschränkungenwie allgemeiner oder örtlicher Numerus28 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENBDGclausus entgegen. Auch gibt das Abitur heutekeinen hinreichenden Aufschluss mehr über diefachliche Qualifikation <strong>und</strong> persönliche Kompetenzdes Bewerbers. Vielmehr muss den „alternativen“Hochschulzugangsarten – wie Fachhochschulreife,„Dritter Bildungsweg“ etc. –mehr Bedeutung beigemessen <strong>und</strong> das Beratungsangebotfür die Studienbewerber frühzeitigauf deren spezifische Bedürfnisse ausgerichtetwerden. Ergänzend dazu muss Lehrern <strong>und</strong>Hochschullehrern aber auch der nötige Freiraumgeboten werden, sich für die heutigen Bewerber-<strong>und</strong> Studierendengruppen mit dem erforderlichenpädagogischen Werkzeug zu rüsten<strong>und</strong> passende Beratungsangebote einzurichten.Eine Möglichkeit könnte sein, schul- <strong>und</strong>hochschulübergreifend von existierenden Übergangsmodellenzu lernen <strong>und</strong> wechselseitigenNutzen daraus zu ziehen.Wie also soll der Übergang zwischen den beidenBildungssystemen praktisch optimiert werden?Wie können Schüler verstärkt für MINT-Fächerbegeistert werden – trotz des Phänomens hoherAbbrecherquoten? Eine geeignete Maßnahmekönnten Aktivitäten <strong>und</strong> Angebote im Rahmeneiner verstärkten Interaktion zwischen Schule<strong>und</strong> Hochschule sein, denn häufig werden dieStudienbefähigung <strong>und</strong> Studierfähigkeit vonbeiden Akteuren gleichermaßen vernachlässigt.So geht es um die Frage, mit welchen Arbeitsweisen<strong>und</strong> -techniken speziell naturwissenschaftlicheThemen behandelt werden, <strong>und</strong> ob<strong>hier</strong> ein Anknüpfungspunkt für ein gemeinsamesVorgehen besteht.Darüber hinaus sind stärkere politische Aktivitätenzur Steigerung der Attraktivität von MINT-Studiengängen erforderlich. Auch seitens derHochschulleitungen könnten Anreizsysteme effizientereingesetzt werden, z.B. durch Rückbesinnungauf den ursprünglichen Bildungsauftragvon Hochschulen: die Lehre, <strong>und</strong> damit alle unterstützendenMaßnahmen – wie Beratungsangebotefür Studieninteressierte –, die der Erreichungder jeweiligen Studienziele dienen. AmBeispiel der TU München (TUM) wurde deutlich,dass das Zusammenspiel von Schule <strong>und</strong> Hochschulekein Wunschdenken bleiben muss, sondernmit viel Engagement <strong>und</strong> der erforderlichenstaatlichen Unterstützung konkrete Realitätwerden kann. Der Gr<strong>und</strong>gedanke der Vernetzung<strong>und</strong> Kooperationsbereitschaft durchziehtdie vorgestellten Projekte <strong>und</strong> Angebote derTUM, z.B. die 50 Referenzgymnasien, die unteranderem den Aufbau von Mentorenschaftenzwischen Studierenden, Lehrenden <strong>und</strong> Alumniverfolgen. Im TUMKolleg diskutieren benachbarteSchulen <strong>und</strong> örtliche Wirtschaftsunternehmenberufs- <strong>und</strong> ausbildungsbezogene Themen,so dass die Ergebnisse als wichtige Impulse fürdie Ausbildung <strong>und</strong> Forschung an der Universitätgenutzt werden können. Im Mittelpunkt allerProjekte steht dabei, den Schülern ein Gefühlvon „studieren“, „forschen“, „ausprobieren“ zugeben <strong>und</strong> der Frage nachzugehen „Was bedeuteteigentlich studieren?“.Nicht zu vernachlässigen sind auch die mit derUmstellung von Diplom- auf Bachelor- <strong>und</strong> Master-Studiengängevermeintlich erhöhten Startschwierigkeitenvon Studienanfängern. Oft unterliegenStudierende dem Leistungsdruck enggeschnürter Curricula <strong>und</strong> vieler Prüfungen.Zwar gehören Beratungsangebote in Schulen<strong>und</strong> Hochschulen schon heute zum Standard,diese könnten aber durch einen effizienterenMitteleinsatz noch optimiert werden, z.B. dasStudium auf Probe oder die Verbindlichkeit vonVorkursen oder Beratungsgesprächen, die unabhängigvon etwaigen späteren Auswahlgesprächenim Rahmen der Studienzulassung angebotenwerden. Eine weitere große Herausforderungsind die prognostizierbaren demografischenEntwicklungen <strong>und</strong> damit der erwarteteRückgang der Studienbewerberzahlen in Deutschland.In diesem Kontext wurde auf die Notwendigkeitgeschlechterspezifischer <strong>und</strong> individualisierterBeratung <strong>und</strong> Förderung hingewiesen,um den potenziellen Nachwuchs im MINT-Bereichnachhaltig gewinnen zu können. Im Fokusdes Nachmittagsblocks der Veranstaltung standdann die Präsentation von Praxisbeispielen, dieden Übergang zwischen Anspruch <strong>und</strong> Wirklichkeitpragmatisch illustrieren sollten.Ein Schwerpunkt waren die Studienabbruchquotenin den Bereichen Maschinenbau <strong>und</strong><strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 29
BDGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENElektrotechnik. Nach einer Studie der Hochschul-Informations-SystemGmbH (HIS) ist dieStudienabbrecherquote im Bachelorstudium mitr<strong>und</strong> 35 % an Universitäten deutlich höher alsan Fachhochschulen mit „nur“ 19 %. KonkreteHürden, die von den befragten Studierendenspeziell in der Studieneingangsphase identifiziertwurden, sind insbesondere Leistungsdefizite<strong>und</strong> finanzielle Probleme. An ebenfallsprominenter Stelle standen mangelnde Studienmotivation<strong>und</strong> unzureichende Studienbedingungen.Von Hochschulseite wurden die erhöhtenStudienabbruchzahlen überwiegend mitdem fehlenden Mittelbau, der Überlastung derHochschullehrer, unzureichenden finanziellenMitteln <strong>und</strong> der fehlenden Zeit zum Selbststudiumbegründet. Darüber hinaus wurde deutlich,dass es von Studienbeginn an der Tutoren<strong>und</strong>Mentoren-Programme sowie praxisbezogenerLehrinhalte <strong>und</strong> Projektarbeiten bedarf,flankiert von einer klaren Zuordnung der Verantwortlichkeitfür die Qualitätssicherung.Auf großes Interesse stieß ein Beitrag der DeutschenPhysikalischen Gesellschaft (DPG) zu denimmer wieder angeführten Versäumnissen inder Schulausbildung in der Mathematik. Demnachmüssen Rahmenvorgaben eingehaltenwerden, nach denen das Ausbildungsniveau derStudien-Absolventen bei festgelegter Länge <strong>und</strong>Arbeitslast des Studiums nicht gesenkt werdendürfe. Die DPG vertritt deshalb die Position, dassdie Hochschulen, basierend auf den in den Bildungszielenfestgelegten Kompetenzen, lückenlosan die Schule anschließen müssen. In diesemKontext interessant ist auch das nochlaufende Projekt eines internetbasiertendeutschlandweiten Vorkurses, der den Studierendennoch vor der Wahl des Studienortes bzw.des Studienfaches mehr Zeit zur Vorbereitung inMathematik gibt.Die große Bandbreite an Projekten, die zum Zielhaben, Jugendliche über die konkreten Ziele <strong>und</strong>Inhalte eines Ingenieurstudiums aufzuklärenoder sich den Unterrichtsmaterialien speziell fürMINT-Unterricht widmen sowie auch Projekte,um Mädchen für die Naturwissenschaften zubegeistern, zeigen, dass <strong>und</strong> wie dasSchnittstellenproblem praktisch angegangenwird. Akzeptanz, Resonanz <strong>und</strong> nachweislicheLeistungssteigerungen zeigen, dass diese Projektevielversprechende Ansätze zur Bewältigungdes Problems „Übergang Schule/Hochschule“darstellen.Auch wenn die Rahmenbedingungen für geowissenschaftlicheStudiengänge nur bedingt mitdenen der klassischen MINT-Fächer vergleichbarsind – die Vorträge <strong>und</strong> die Diskussionsergebnissezeigen jedenfalls, dass der BerufsverbandDeutscher Geowissenschaftler auf dem richtigenWeg ist: Beratung über moderne Medien –wie die demnächst vollständig auf der Homepageverfügbare deutschlandweite Erhebung zuMSc- <strong>und</strong> BSc-Studiengängen – aber auch dasEngagement einzelner Mitglieder oder Regionalgruppen,den Beruf des Geowissenschaftlers anHand ganz praktischer Beispiele in den Schulenvorzustellen, sind nur zwei konkrete Maßnahmen.Weitere werden entwickelt.Am Ende der Tagung stand folgendes Fazit: Solangeder Funke nicht überspringt <strong>und</strong> die Begeisterungfür MINT-Fächer nicht geweckt wird,bleibt es schwer, den Bezug zwischen persönlicher<strong>und</strong> fachlicher Weiterentwicklung <strong>und</strong> demspannenden alltäglichen, schließlich praktischenErleben von MINT-Wissenschaften herzustellen.So war die erste Dialog-Veranstaltung der ASIINein Erfolg. Sowohl der große Teilnehmerzuspruchals auch das positive Feedback bek<strong>und</strong>en,dass die Einrichtung eines Forums zurDiskussion aktueller bildungspolitischer Themenein zukunftsfähiges Konzept ist, dieBeteiligung <strong>und</strong> das Engagement aller Akteuresowie Interessierten anzuregen <strong>und</strong> zu fördern.Weitere Informationen unter www.asiinconsult.de.ASIIN gehört zu den führenden AkkreditierungsagenturenDeutschlands <strong>und</strong> hat sich auf dieFächer der Ingenieur- <strong>und</strong> Naturwissenschaftenkonzentriert. Der BDG ist seit vielen Jahren Mitgliedin der ASIIN <strong>und</strong> vertritt dort die Belangeder geowissenschaftlichen Berufe bei der Zulassungneuer Studiengänge.Ulrike Mattig (Wiesbaden)30 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENBDG5. Studienforum des BDG – EinladungFür den 3. Mai 2013 lädt der BDG die Studiengangskoordinatoren<strong>und</strong> Studiendekane geowissenschaftlicherStudiengänge zum 5. Malzum Erfahrungsaustausch ein. Diskutiert werdensollen die Erfahrungen von Studierenden,von Studienplangestaltern an den Universitäten<strong>und</strong> von Arbeitgebern mit den Bachelorstudiengängen.Im Fokus steht dabei die Berufsqualifizierungdes BSc.weiten Treffen, Konzepte <strong>und</strong> Inhalte der Ausbildungsowie deren Bezug zur geowissenschaftlichenPraxis in Deutschland zu diskutieren <strong>und</strong>praktische Erfahrungen in der Lehre auszutauschen.Ein wichtiges Produkt der Studienforen ist dieDatenbank des BDG über die 69 geowissenschaftlichenStudiengänge in Deutschland mitDas Geo-Institut in Halle –Gastgeber des 5. Studienforumsdes BDG“In engem Zusammenhang damit steht auch dascareer tracking – das Verfolgen der Berufslaufbahnender Absolventen. Hierzu soll beim 5.Studienforum ebenfalls ein Erfahrungsaustauscheingeleitet werden.Gastgeber des diesjährigen Studienforums wirddie Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbergsein.Das Studienforum wird veranstaltet vomAusschuss Hochschule <strong>und</strong> Forschung (AHF)des BDG <strong>und</strong> startete 2009 in Potsdam, weitereGastgeber seitdem waren Erlangen, Darmstadt<strong>und</strong> Bremen. Es ist das Anliegen der b<strong>und</strong>es-Studierendenzahlen, Zulassungsvoraussetzungensowie einer inhaltlichen Bewertung etlicherStudiengänge. Diese Datenbank wird regelmäßigaktualisiert <strong>und</strong> erfreut sich bei den Studierendengroßer Beliebtheit – sie ist eine dermeistbesuchten Seiten auf der Homepage desBDG www.geoberuf.de.Weitere Informationen erhalten Sie über Prof.Helmut Heinisch, Sprecher des AHF, unterhelmut.heinisch@geo.uni-halle.de oder dieBerliner Niederlassung des BDG unter fahryseelig@geoberuf.de.Tamara Fahry-Seelig (Berlin)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 31
BDGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDGFZ, BDG-BA <strong>und</strong> BDG kooperierenG E C <strong>und</strong> 8. Deutscher Geologentaghjw. Die Messe Offenburg richtet am 17. <strong>und</strong> 18.Oktober 2013 eine neue Messe mit Kongressaus, die sich der Geotechnik widmet: G E C –Geotechnik expo & congress (www.gecoffenburg.de).Diese Möglichkeit nutzt der BDG,um den 8. Deutschen Geologentag mit der 15.ordentlichen BDG-Mitgliederversammlungdurchzuführen. Wir versprechen uns davon einegrößere Aufmerksamkeit <strong>und</strong> möchten neue zusätzlicheMitgliedergruppen ansprechen. Wiebei den früheren Veranstaltungen auch bestehtder Deutsche Geologentag auch diesmal auseiner Fülle von Veranstaltungen. Obwohl nochnicht alle Einzelheiten feststehen, gebe ich <strong>hier</strong>schon einmal einen vorläufigen Ablaufplan bekannt.Donnerstag, 17. Oktober 2013– 10 Uhr: Eröffnung der Messe <strong>und</strong> des Kongressesmit Verleihung des Preises „Stein imBrett“– 11 Uhr: Beginn der Kongressvorträge– ab 11 Uhr: Sitzungen von BDG-Gremien *– 16 Uhr: BDG-Mitgliederversammlung– abends: Gesellschaftsabend für Aussteller<strong>und</strong> Teilnehmer der BDG-Mitgliederversammlung.Die BDG-Mitgliederversammlung findetin einem separaten Raum um 17 Uhr statt <strong>und</strong>ist nicht an das Messeende geb<strong>und</strong>en.hjw. Ende letzten Jahres unterzeichneten derPräsident der BDG-Bildungsakademie, Prof. Dr.Helmut Heinisch, der geschäftsführende Vorstanddes BDG, Dr. Ulrike Mattig, Dr. AndreasSchuck <strong>und</strong> Markus Rosenberg, sowie derGeschäftführer des Dresdner Gr<strong>und</strong>wasserforschungszentrumse.V. (DGFZ), Dr. ThomasSommer, eine Kooperationsvereinbarung. Diesesieht eine Zusammenarbeit beim Seminarwesenvor. Die Mitglieder beider Einrichtungen erhaltenZugang zu den Angeboten jeweils zuMitgliederkonditionen (wie schon durch die Vereinbarungmit dem Duisburger BEW). Durch dieseVereinbarung ergänzen beide Einrichtungenihr Angebot auf dem Gebiet der Fortbildung, wasinsbesondere durch die räumlich weit entfernten<strong>und</strong> zum großen Teil unterschiedlichen Angebotezum Tragen kommt (siehe auchwww.dgfz.de <strong>und</strong> www.geoberuf.de). Die Vereinbarungist bereits in Kraft getreten. Das DGFZwar vor einem Jahr Gastgeber für eine Sitzungvon Vorstand <strong>und</strong> Beirat des BDG, was zu einemAustausch <strong>und</strong> gegenseitigen Kennenlernen genutztworden ist.Freitag, 18. Oktober 2013– 10 Uhr: Vortragsblock „Energiewende – Aufgabenfür die Geowissenschaftler“ als Bestandteildes 8. Deutschen Geologentages(bis 12:30 Uhr)– Vormittags: Sitzungen von BDG-Gremien *– 17 Uhr: Ende von Messe <strong>und</strong> Kongress* Nach bisherigem Stand tagen folgende BDG-Gremien:• Mitgliederversammlung der BDG-Bildungsakademie• Forum Junge Geowissenschaftler• Forum Rohstoffgeologen• Arbeitskreis Umweltgeologie <strong>und</strong> AusschussFreiberufler <strong>und</strong> Geobüros (ggf. zusammen)• Vorstand <strong>und</strong> Beirat des BDG (weitere Sitzungenwerden noch folgen).Das komplette Programm wird in der kommendenAusgabe der BDG-Mitteilungen Ende Juli2013 veröffentlicht.Wir bitten schon jetzt alle BDG-Mitglieder, sichdiese Termine freizuhalten, an den BDG-Veranstaltungenteilzunehmen <strong>und</strong> die Messe mitKongress zu besuchen.32 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENBDGStatistische Angaben zur BDG-Mitgliedschaft<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 33
DEUQUAGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDEUTSCHE QUARTÄRVEREINIGUNGEhrungen <strong>und</strong> Preisverleihungen anlässlich der DEUQUA-Tagungin BayreuthBei der DEUQUA-Tagung im September 2012wurden folgende Ehrungen vorgenommen:Verleihung der Albrecht-Penck-Medaille, Verleihungder Ehrenmitgliedschaft <strong>und</strong> des Woldstedt-Preises.Die Albrecht-Penck-Medaille wird als besondereEhrung für hervorragende wissenschaftlicheVerdienste um die Quartärforschung verliehen<strong>und</strong> wurde 2012 an zwei Wissenschaftler vergeben.Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden,wer die Quartärforschung oder die DeutscheQuartärvereinigung sehr gefördert hat.Der Woldstedt-Preis wird für hervorragendeAbschlussarbeiten <strong>und</strong> Dissertationen verliehen.Es waren vier Dissertationen eingereichtworden, die von drei Gutachtern bewertetwurden.Albrecht-Penck-Medaille an Prof. Dr. ChristianSchlüchterChristian Schlüchter ist ein vielseitiger Quartärforscher<strong>und</strong> akademischer Lehrer. Darüber hinauswar er in zahlreichen Wissenschaftsorganisationentätig. Geboren im Schweizer Emmental,studierte er Geologie an der Universität Bern.Seine Dissertation zu einem quartärgeologischsedimentologischenThema schloss er 1973unter der Betreuung von Prof. Dr. R. F. Rutschab. Nach zwei Jahren in Kanada kehrte er alsForscher <strong>und</strong> Lehrer an die ETH Zürich in dieSchweiz zurück, wo er 1990 die Lehrbefugnis erwarb.1993 folgte er dem Ruf an die UniversitätBern. Seine Forschungsarbeiten führten ihn wiederholtin die Antarktis, nach Neuseeland, aufdas Tibetplateau sowie in die Gebirge der nördlichenTürkei. Darüber hinaus initiierte er vieleForschungsaktivitäten in den Alpen. Vergletscherungs-<strong>und</strong> Klimageschichte sind seineThemen, seine Resultate verteidigte er auch ggf.gegen die „offizielle“ Meinung des IPCC. Er hieltauch zu Vertretern in Politik <strong>und</strong> Baustoffindustriegute Kontakte, was seinen Schülern beiGeländearbeiten zugute kam. Er betreute weitmehr als 100 Qualifikationsarbeiten. Aktiv war erin Vorständen von Datierungslabors in Zürich(Surface Exposure Dating), in Bern (OpticallyStimulated Luminescence), <strong>und</strong> er pflegte u.a. dieZusammenarbeit mit Dr. Nicolussi (Innsbruck)zur Dendrochronologie an fossilen Hölzern, dieihm in den letzten Jahren durch den Klimawandelgeradezu aus den Gletschern entgegengewachsensind <strong>und</strong> eine seiner großen Leidenschaftenwurden. Christian Schlüchter war auchaktiv in internationalen Gremien: 1975–1987 als34 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDEUQUAChristian Schlüchter Charles Turner; Foto: H. KoschykSekretär der „Dreimanis-Kommission“: INQUA-Commission on Genesis and Lithology ofQuaternary Deposits, 1981–1982 als AssistantTreasurer der INQUA, 1982–1991 als SecretaryTreasurer der INQUA. 1987 entwickelte er maßgeblichdie Idee einer eigenen Publikationsreiheder INQUA, was mit der Zeitschrift QuaternaryInternational realisiert wurde. Er wirkte seit1995 als Mitglied <strong>und</strong> von 1999 bis 2003 als Präsidentin der INQUA Commission on Stratigraphyand Chronology. Als Meilenstein seiner Kommissionstätigkeitorganisierte er im Jahr 2011den INQUA-Kongress in Bern. In der DEUQUA ister schon seit 1971 Mitglied <strong>und</strong> war in den Jahren1998 bis 2002 deren Vizepräsident. In dieser Zeitfand die DEUQUA-Tagung im Jahr 2000 unterseiner Leitung in Bern statt. Von 2002 bis 2006wirkte er als DEUQUA-Präsident.Christian Schlüchter hat sich sehr vielen Aspekteneiner facettenreichen Quartärforschung <strong>und</strong>auch der themenbezogenen Öffentlichkeitsarbeitgewidmet, wovon u.a. seine sehr umfangreichePublikationsliste zeugt.Wir danken ihm für sein vielfältiges Engagement,die Treue zur DEUQUA <strong>und</strong> freuen uns,ihn für seine herausragenden wissenschaftlichenLeistungen mit der Albrecht-Penck-Medailleauszeichnen zu dürfen. Wir hoffen, dass er imRuhestand nach seinen Wünschen die Forschungsarbeitenerfolgreich fortführen kann.Albrecht-Penck-Medaille an Dr. CharlesTurnerGeboren in Kent <strong>und</strong> in Dorset zur Schule gegangen,studierte Charles Turner zunächst amQueen’s College Deutsch <strong>und</strong> Französisch. Erwechselte dann nach Cambridge <strong>und</strong> dort auchgleich die Disziplinen. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Botanik, mit den NebenfächernGeologie, Petrologie <strong>und</strong> Invertebraten-Zoolo-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 35
DEUQUAGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENgie. Danach begann seine wissenschaftlicheLaufbahn mit der Bearbeitung eines Themas zuInterglazialen, ein Forschungsgegenstand, demer von da an treu blieb. In seiner Dissertation„Middle Pleistocene Vegetational History andGeology in East Anglia“ ist die Bearbeitung derersten vollständigen Interglazialsequenz inGroßbritannien enthalten. Der Supervisor warRichard West, großen Einfluss auf die Arbeit hatteaber auch Prof. Sir Harry Godwin. Nach beruflicherTätigkeit am British Museum, Abt. fürPaläolithik, ging Charles Turner für zwei Jahreals Lecturer für Geographie an die University ofLondon. Er wechselte an die Universität in MiltonKeynes, wo er bis 2005 vielfältige Aufgabenwahrnahm. Seine Forschungen einschließlichder Laborarbeiten wurden aber an der Universityof Cambridge durchgeführt. Mit Hilfe vonPollen <strong>und</strong> Pflanzen-Makrofossilien widmet ersich der Analyse der Paläoumwelt <strong>und</strong> derPaläogeographie. Er arbeitete mit Richard Westzusammen, aber vor allem mit Phil Gibbard, mitdem er gemeinsam in das Department of Geographyging. Charles Turner führte dort alsVisiting Lecturer die Botanik-Kurse für das Quartärdurch, während Phil Gibbard die Quartärgeologielehrte. Nach Aufgabe seiner Positionals Lecturer bleibt Charles Turner in der Forschungsehr aktiv. Seine Arbeitsgebiete liegenvornehmlich in East Anglia <strong>und</strong> Irland, Russland(Don Becken), Griechenland (Epirus) sowie inZentral-Spanien. Aktuell liegt sein wissenschaftlicherFokus auf Cromer, Holstein- sowieDömnitz-Warmzeit in Deutschland. In diesemKontext beschäftigt er sich intensiv mit denquartären warmzeitlichen Ablagerungen in derGrube Schöningen. Charles Turner hat sich auchin internationalen Gremien engagiert: 12 Jahreleitete er als Präsident die INQUA-Subcommissionon Quaternary Stratigraphy <strong>und</strong> gabden Band „The Early Middle Pleistocene inEurope“ heraus. In der Subcommission onQuaternary Stratigraphy, <strong>hier</strong> die WorkingGroup on the Middle/Pleistocene Bo<strong>und</strong>ary, warer aktives Mitglied. Charles Turner hat seit langemfre<strong>und</strong>schaftliche Kontakte zu renommiertenPollenanalytikern in Deutschland <strong>und</strong> mitseinen Anfragen zu Eem-Vorkommen hat er auchdie Eem-Verteilungskarte des Landes Brandenburgindirekt initiiert.Die DEUQUA freut sich, einen herausragendeninternationalen Wissenschaftler <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong> derdeutschen Quartärforschung mit der Albrecht-Penck-Medaille ehren zu dürfen.Ehrenmitgliedschaft an Prof. Dr. Erhard BibusErhard Bibus ist Hochschullehrer i. R. an derEberhard Karls Universität Tübingen. Geborenzu Kriegszeiten im Sudentenland, studierte er inFrankfurt/Main Geographie, Geologie, Bodenk<strong>und</strong>e<strong>und</strong> Germanistik. Seine Dissertation imJahr 1971 befasste sich mit der Geomorphologiedes südöstlichen Taunus (Betreuer Prof. Dr. H.Lehmann <strong>und</strong> Prof. Dr. A. Semmel). Die Habilitation(1979) im Fach Physische Geographie beinhalteteine Untersuchung zur Relief-, Boden<strong>und</strong>Sedimententwicklung am unteren Mittelrhein.Es folgten temporäre Lehrtätigkeiten inFrankfurt, Basel, Bonn <strong>und</strong> Tübingen. 1981 wurdeErhard Bibus auf die Professur für PhysischeGeographie (Geoökologie <strong>und</strong> Quartärforschung)an die Universität in Tübingen berufen. Fernerwar er langjährig freiwilliger <strong>und</strong> ständiger Mitarbeiterfür Quartärgeologie <strong>und</strong> Bodenk<strong>und</strong>eam Landesamt für Geologie, Rohstoffe <strong>und</strong> Bergbauvon Baden-Württemberg. Seine Forschungsschwerpunktelagen in den Bereichen Geoökologie,quartäre Relief-, Boden- <strong>und</strong> Sedimententwicklungin Südwest-Deutschland sowie in derPaläopedologie. Erhard Bibus führte u.a. imRahmen von Projekten Forschungstätigkeiten inBrasilien durch. Sein besonderer Schwerpunktlag auf der Forschung in Deutschland. Besondershervorzuheben sind seine Studien anLössprofilen <strong>und</strong> Terrassensedimenten, fernerbeschäftigte er sich mit Hanginstabilität, vornehmlichan der Schwäbischen Alb. Immer imBlickfeld hatte er dabei das gesamte Quartär,wo ihn stratigraphische Fragen <strong>und</strong> die paläoökologischeForschung besonders interessierten.Zu diesen Forschungsthemen gibt es zahlreicheAbschlussarbeiten von Studierenden, diedurch eine weit gestreute Thematik gekennzeichnetsind. Einige seiner Schüler sind heute36 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDEUQUAErhard Bibus; Foto: B. TerhorstManfred Löscher; Foto: D. van Husenebenfalls bekannte Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen inder Geographie <strong>und</strong> den Quartärwissenschaften.Damit hat Erhard Bibus auch in der Ausbildungwesentlich zur Verbreitung der Quartärforschungbeigetragen, renommierte Nachwuchswissenschaftlerin ihren Anfängen gefördert <strong>und</strong>wesentliche Anstöße gegeben. Für diese Verdienstehat der DEUQUA-Vorstand Erhard Bibuszum Ehrenmitglied ernannt.Ehrenmitgliedschaft an Dr. Manfred LöscherManfred Löscher hat in Heidelberg Geologie,Geographie, Chemie <strong>und</strong> Sport studiert <strong>und</strong> dortauch 1968 sein erstes Staatsexamen abgelegt.Nach der Referendarzeit erhielt er von 1970 bis1972 ein DFG-Stipendium; die Promotion zumThema „Die präwürmzeitlichen Schotterablagerungenin der nördlichen Iller-Lech-Platte“erfolgte 1974. Von 1972 bis 1978 war er wissenschaftlicherAssistent bei Prof. Graul. Danach istManfred Löscher in den Schuldienst zurückgekehrt,<strong>und</strong> zwar an das Friedrich-Ebert-Gymnasiumin Sandhausen, unweit von Heidelberg.Manfred Löscher blieb jedoch der DEUQUA <strong>und</strong>der Quartärforschung treu, was bis heute seinerege Publikationstätigkeit belegt. Zwischen 1978<strong>und</strong> 2012 sind 48 Veröffentlichungen über dennördlichen Oberrheingraben <strong>und</strong> dessen östlichesRandgebiet erschienen. Er befasst sich darinmit fluvialen Sedimenten, Dünen, Löss <strong>und</strong>paläontologischen Untersuchungen <strong>und</strong> wiederholtmit Rahmenuntersuchungen zum Homoheidelbergensis. Sein zweites Untersuchungsgebietlag im Alpenvorland, vornehmlich auf derRiß-Iller-Lech-Platte. Die 22 Publikationen zudiesem Raum entstanden häufig in Kooperationmit anderen namhaften Quartärforschern. ManfredLöscher zeichnete sich in der Wissenschaftauch durch seine Kooperationsfähigkeit aus.Hinzu kommt seine berufliche Tätigkeit im Gym-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 37
DEUQUAGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENnasium in Sandhausen, wo er die Schüler intensivin seine Arbeiten mit einbezog. Er gestaltetenicht nur einen anschaulichen Unterricht zuQuartärthemen, sondern begeisterte seineSchüler mit praktischen Geländearbeiten, wiez.B. mit Grabungsarbeiten, mit der Aufnahmevon Bodenprofilen <strong>und</strong> mit der Anfertigung vonLackprofilen. Weiterhin führte er die Schüler anarchäologische Grabungen heran <strong>und</strong> verfolgtedamit gleichzeitig auch pädagogische Ziele. Erverhalf nicht selten schwierigen Jugendlichen zuneuen Perspektiven <strong>und</strong> bot mit den Geländearbeitenauch Halt in der Freizeit. Er stellte eineSymbiose zwischen Pädagogik <strong>und</strong> Wissenschafther, die bei einigen seiner Schüler auchim Studium <strong>und</strong> bei der späteren Berufswahlnachhaltig wirkte. Im Rahmen der Lehrerfortbildungvermittelte Manfred Löscher vorallem bodenk<strong>und</strong>liche Ansätze <strong>und</strong> Fertigkeiten.Wir möchten Manfred Löscher im Namen derDEUQUA für seine vielfältigen Aktivitäten in derQuartärforschung <strong>und</strong> deren Vermittlung anjunge Leute danken, indem wir ihm die Ehrenmitgliedschaftverleihen.Woldstedt-Preis an Dr. Björn BuggleBjörn Buggle stammt aus Kempten/Allgäu, woer auch zur Schule ging. Das Studium derGeoökologie absolvierte er an der Universität inBayreuth, wozu ein Auslandsemester an der ETHZürich gehörte. Seine Diplomarbeit befasste sichmit dem Thema „Stratigraphy and GeochemicalCharacterization of Southeastern EuropeanLoess Paleosol Sequences“. Nach dem sehr erfolgreichenStudienabschluss war Björn Bugglevon 2005 bis 2006 Stipendiat der Studienstiftungdes Deutschen Volkes. Für einen Tagungsbeitragerhielt er 2011 den Young Scientists OralPresentation Award auf der Konferenz „Landscape& Soils through Time“, Joint Conference ofIUSS, Commission on Paleopedology and IUSSand Commission on Soil Geography. Von September2007 bis Juli 2011 widmete er sich seinemPromotionsvorhaben im Rahmen einesDFG-Projektes. Hierbei wurden vertiefte Kenntnissein paläopedologisch-sedimentologischenMethoden erworben <strong>und</strong> angewandt.Björn Buggle; Foto: S. SchimmelpfennigDie Promotion schloss er im Juli 2011 ab, dieDissertation zum Thema „Reconstruction of Lateand Mid-Pleistocene climate and landscapehistory in SE-Central Europe“. Die Promotionsleistungwurde mit der Gesamtnote summa cumlaude bewertet. Erstgutachter war Prof. Dr. B.Glaser (früher Bayreuth, jetzt Halle, Bodenbiochemie),Zweitgutachter Prof. Dr. L. Zöller (Bayreuth).Diese Arbeit wurde von drei Gutachternals preiswürdig für den Woldstedt-Preis bef<strong>und</strong>en,da sie einen gr<strong>und</strong>legenden Beitrag zurLöss-Paläobodenforschung darstellt. Die Vielfaltder angewendeten etablierten Methoden (Geochemie,Biomarker, Mikromorphologie/Paläopedologie,Spektroskopie, Isotopie) ermöglichtedie Etablierung einer verlässlichen Chronostratigraphie<strong>und</strong> die Rekonstruktion der regionalenKlima- <strong>und</strong> Landschaftsgeschichte derletzten 700.000 Jahre. Die umfassende Studiefür den Untersuchungsraum stellt einen deutlichenForschungsfortschritt dar.38 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDEUQUAWir wünschen Björn Buggle, der jetzt als DAAD-Postdoc-Stipendiat an der ETH Zürich tätig ist,viel Erfolg für seine weitere wissenschaftlicheLaufbahn.Woldstedt-Preis an Dr. Christopher LüthgensChristopher Lüthgens hat sein Studium an derFreien Universität Berlin mit dem 1. wissenschaftlichenStaatsexamen in Geographie <strong>und</strong>Anglistik abgeschlossen. Im Rahmen des DFG-Projektes „Datierung der weichselzeitlichenHaupteisrandlagen in Nordostdeutschland mitHilfe von physikalischen Methoden (OSL <strong>und</strong> IR-RF)“, das von Margot Böse gemeinsam mit demunlängst verstorbenen Dr. Matthias Krbetschekdurchgeführt wurde, war Christopher Lüthgensein sehr erfolgreicher Mitarbeiter. Er arbeitetesich intensiv <strong>und</strong> zielstrebig in die OSL-Methodeein <strong>und</strong> knüpfte rasch Kontakte in die „Lumineszenz-Community“,was ihm auch ergänzendeMessungen in anderen Laboratorien ermöglichte.Er war maßgeblich an der Organisation einesinternationalen Workshops zum Thema „Exploratoryworkshop on the frequency and timing ofglaciations in northern Europe (includingBritain) during the Middle and Late Pleistocene“,unter der Leitung von M. Böse <strong>und</strong> J. Rose beteiligt,<strong>und</strong> ist Mitherausgeber von Themenbändenin internationalen Fachzeitschriften. SeinePromotion zum Thema „The age of Weichselianmain ice marginal positions in north-easternGermany inferred from Optically StimulatedLuminescence (OSL) dating“ schloss er 2011 mitsumma cum laude ab.In dieser Arbeit konnten durch detaillierte Analysender Messergebnisse solide Modellalter ermitteltwerden. Besonders hervorzuheben ist,dass es Christopher Lüthgens im Gegensatz zuzahlreichen Datierungsstudien in seiner Arbeitnicht nur bei der Präsentation seiner Altersdatenbelässt, sondern einen Vergleich mit anderenChronologien unternimmt. Darüber hinaus unterziehter seine Daten einer kritischen Diskussionim Kontext mit weiteren, neuen chronologischenStudien (z.B. Surface Exposure Dating)unter Berücksichtigung des morphodynamischenProzessgeschehens. Er beleuchtet das ThemaChristopher Lüthgens; Foto: J. L. Garcíaaus der geomorphologischen <strong>und</strong> der methodischenPerspektive. In diesem Kontext wird deutlich,dass einer robusten Datierung neben derEntwicklung <strong>und</strong> Wahl der Methodik auch immerder Blick für den geomorphologischen Prozesssowie den quartärgeologischen Kontext zuGr<strong>und</strong>e liegen sollte. Mit seiner Erkenntnis derZweiphasigkeit des LGM (Brandenburger Stadium,Pommersches Stadium) im Untersuchungsraumwird eine Wissenslücke geschlossen, die vorheraufgr<strong>und</strong> des Mangels an verlässlichengeochronologischen Daten bestanden hat.Auf einer Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgabenhielt es den Preisträger nicht lange. EinePost-Doc-Stelle mit „tenure track-Möglichkeit“an der BOKU in Wien, verknüpft mit der Führungdes dortigen OSL-Labors, eröffnete ihm eineZukunft als Wissenschaftler. Wir wünschen ChristopherLüthgens viel Erfolg für seine persönlicheZukunft <strong>und</strong> seine wissenschaftliche Karriere.Margot Böse (Berlin)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 39
DEUQUAGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDie Zerstörung <strong>und</strong> sedimentäre Überdeckung Olympias (Westpeloponnes,Griechenland) – ein interdisziplinäres ProjektDie antike Kultstätte Olympia liegt am Zusammenflussvon Kladeos <strong>und</strong> Alpheios etwa 19 kmvom Golf von Kyparissia entfernt. Seit 1875 wirddie Stätte am Fuß des Kronos-Hügels systematischaus der 7–8 m hohen Olympia-Terrasseausgegraben. Aktuelle geomorphologischeStudien zeigen, dass die Olympia-Terrasse vorwiegendauf das Kladeos-Tal <strong>und</strong> untere Laufabschnittedes Alpheios beschränkt ist. Sie lässtsich bis 5,5 km Kladeos-aufwärts verfolgen, istmaximal 500 m breit <strong>und</strong> von einer bis zu 200 mbreiten Rinne zerschnitten. Da die FließgewässerKladeos <strong>und</strong> Alpheios auch heute ungefährauf ihrem antiken Niveau fließen, muss die VerschüttungOlympias mit außergewöhnlichstarken Sedimentations- <strong>und</strong> Erosionsvorgängeninnerhalb von nur wenigen Jahrtausenden inZusammenhang stehen. Bislang wird die ZerstörungOlympias mit Auswirkungen von Erdbebenim 6. Jahrh<strong>und</strong>ert n. Chr. in Verbindung gebracht,die Überdeckung als Folge von anthropogenerBodenerosion, Klimaschwankungenoder karsthydrologisch gesteuerten katastrophenartigenAbflüssen gedeutet. Keine dieserHypothesen ist jedoch mit stichhaltigen Gelände-oder Laborbef<strong>und</strong>en belegt. Das bislang ungelösteRätsel der Zerstörung <strong>und</strong> VerschüttungOlympias hängt unmittelbar mit der Tal- <strong>und</strong>Landschaftsentwicklung im Kladeos- <strong>und</strong> unterenAlpheios-Tal sowie mit der paläogeographischenKüstenentwicklung zusammen. Daherwerden im <strong>hier</strong> vorgestellten Projekt erstmalssystematische geomorphologische, sedimentologische,paläoseismologische <strong>und</strong> geoarchäologischeUntersuchungen der Olympia-Terrassezwischen dem Kladeos-Oberlauf <strong>und</strong> derheutigen Küste durchgeführt. Hauptziel des Projektesist, die Ursachen <strong>und</strong> die damit zusammenhängendengeomorphologischen Prozesseder Zerstörung sowie der sedimentären ÜberdeckungOlympias zu erfassen <strong>und</strong> zu datieren.Seit 2010 wurden insgesamt r<strong>und</strong> 50 Rammkernsondierungennach vorheriger intensiver geophysikalischerUntergr<strong>und</strong>erk<strong>und</strong>ung abgeteuft.Auf der Gr<strong>und</strong>lage detaillierter sedimentologischer,geochemischer <strong>und</strong> mikropaläontologischerAnalysen der Bohrkerne können für dieunmittelbare Umgebung von Olympia fünf Hochenergie-Ereignissefestgestellt werden, die füreinen großen Teil der mächtigen Sedimentablagerungender Olympia-Terrasse verantwortlichsind. Die bislang vorliegenden geochronologischenDaten legen nahe, dass diese Ereignissemit mehreren Erdbeben seit dem 3. Jahrtausendv. Chr. zusammenhängen, dieHochenergie-Sedimente also einen klarenpaläoseismologischen Hintergr<strong>und</strong> aufweisen.Außerdem deuten zahlreiche geomorphologische<strong>und</strong> sedimentologische Bef<strong>und</strong>e auf dieMöglichkeit einer mehrfachen Ereignis-geb<strong>und</strong>enenÜberschwemmung Olympias im Zuge weitenlandseitigen Eindringens von Tsunami-Wassermassenaus dem Golf von Kyparissia in dasAlpheios- <strong>und</strong> Kladeos-Tal hin, wie dies imRahmen der Olympia-Tsunami-Hypothese (OTH)diskutiert wird. Diesbezügliche Belege für einemehrfache, höchstwahrscheinlich jeweils anErdbeben geknüpfte Tsunami-geb<strong>und</strong>ene Überflutungliegen für den antiken Hafen Pheia amGolf von Kyparissia bereits vor. NumerischeSimulationen extremer Tsunami-Ereignisse fürden Golf von Kyparissia, die von der heutigenKüstenkonfiguration ausgehen, zeigen, dassdas untere Alpheios-Tal hinsichtlich der Tsunami-Wellenausbreitungeine Sonderrolle einnimmt.Für dieses Gebiet wurden die weitesten,bis 15 km landeinwärts reichenden Tsunami-Überflutungsdistanzen berechnet, die auf einemstarken Trichtereffekt beruhen. Die Simulationsergebnissestimmen überdies gut mit den vorliegendenGeländebef<strong>und</strong>en überein.Die OTH basiert auf dem größten bislang erhobenenGelände- <strong>und</strong> Labordatensatz <strong>und</strong> stelltdie bis dato plausibelste Erklärung für dieVerschüttung Olympias dar. Nichtsdestotrotzmuss sie weiteren Überprüfungen standhalten.40 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDEUQUATsunami-Überflutungshöhen in m über dem heutigen Meeresspiegel auf der Gr<strong>und</strong>lage numerischerSimulationen für ein extremes Starkwellenereignis aus westlicher Richtung nach Ankunftder dritten Welle eines dreiteiligen Tsunami-Wellenzugs. Abbildung verändert nach Röbke et al.(2012).Zu diesem Zweck sind für die folgende Projektphasebis 2016 verstärkt mikrofossilanalytischeAnalysen an Hochenergiesedimenten im Umfeldvon Olympia, interdisziplinäre archäologische<strong>und</strong> kombinierte geomorphologische Detailstudienim zentralen Kultstättenbereich sowiehochauflösendegeochronologischpaläoseismologischeUntersuchungen an Hochenergiesedimentender Olympia-Terrasse vorgesehen,mit deren Hilfe die Auflösung der bislangvorliegenden Ereignis-Geochronostratigraphiedeutlich verbessert werden kann.Die Projektarbeiten werden im interdisziplinärenVerb<strong>und</strong> zusammen mit Althistorikern, Archäologen,Geomorphologen <strong>und</strong> Ingenieurwissenschaftlernder Universitäten Aachen, Darmstadt, Freiburg<strong>und</strong> Heidelberg durchgeführt. Sie sind in dasvom Deutschen Archäologischen Institut initiierteProjekt „Olympia <strong>und</strong> seine Umwelt“ eingebettet<strong>und</strong> an Untersuchungen zu Tsunami-Ereignissenan Küsten des Ionischen Meeres im Rahmeneines von der DFG geförderten Projektes angegliedert.Andreas Vött, Peter Fischer& Björn Röbke (Mainz)Die DEUQUA auf der GeoHannover 2012Die DEUQUA war bei der GeoHannover zum Thema„GeoRohstoffe für das 21. Jahrh<strong>und</strong>ert“, dievom 1. bis 3. Oktober 2012 in Räumen der UniversitätHannover stattfand, mit einem Stand<strong>und</strong> einer eigenen wissenschaftlichen Sitzungvertreten. An dem Stand wurde vor allem unse-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 41
DEUQUAGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENre Zeitschrift „E&G Quaternary Science Journal“präsentiert <strong>und</strong> es konnten neue Mitglieder fürdie DEUQUA geworben werden. Ein unerwarteterErfolg war die von Herrn Prof. Dr. Ralf Niedermeyer<strong>und</strong> mir geleitete, ausgesprochen gutbesuchte Sitzung zum Thema: „Das Quartär:Klima, Sedimente, Mensch“. Die Sitzung, die mitvier Vorträgen <strong>und</strong> zahlreichen Postern, v.a.landschaftsgenetische <strong>und</strong> angewandte Themenumfasste, bot die Möglichkeit zu interessantenDiskussionen. Obwohl die DEUQUA (immernoch) eine der kleineren Vereinigungen ist, hatsie ihren festen Platz in der Gemeinschaftsveranstaltunggeowissenschaftlicher Vereinigungengef<strong>und</strong>en. Margot Böse (Berlin)An die Bezieher von <strong>GMIT</strong>Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,viele Bezieher der Geowissenschaftlichen Mitteilungen <strong>GMIT</strong> sind Mitglied in mehreren Gesellschaften,die an der Herausgabe von <strong>GMIT</strong> beteiligt sind. Beim Zusammenführen derAdressdateien stehen wir vor der Aufgabe, das mehrfache Versenden von <strong>Heft</strong>en zu vermeiden.Hierzu prüft ein PC-Programm die Dateien auf Doppelmitgliedschaften. Leider sind bei denverschiedenen Gesellschaften die Adressen unterschiedlich angegeben, so dass das PC-Programmdiese Aufgabe nur unvollständig lösen kann. Wir bitten Sie daher, uns unbedingt eindeutige<strong>und</strong> bei den unterschiedlichen Gesellschaften identische Angaben zu Ihrer Adresse zugeben:Wollen Sie <strong>GMIT</strong> an die Privat- oder an die Dienstadresse gesendet haben (bitte korrekteAdresse mitteilen)?Sind auf dem Adressetikett von <strong>GMIT</strong> Fehler enthalten (Zahlendreher bei Postleitzahlen oderHausnummern, falsche Schreibweise von Namen, Vornamen, Straße, Ort etc.)?Fehlen Bindestriche, sind Straßenabkürzungen falsch? Sind Doppelnamen falsch geschriebenoder abgekürzt (Vor- <strong>und</strong> Nachname, Umlaute)?Bitte geben Sie uns die von Ihnen gewünschte Adresse fehlerfrei an, damit wir sicherstellenkönnen, dass den verschiedenen Gesellschaften Ihre korrekte Adresse in gleicher Form vorliegt.Auch dann, wenn Sie trotz kleiner Fehler das <strong>Heft</strong> bisher immer zugestellt bekommenhaben.Benutzen Sie für Ihre Nachricht am besten die E-Mail des BDG Berufsverband DeutscherGeowissenschaftler, da dieser die Aufgabe der Versandabwicklung übernommen hat(BDG@geoberuf.de). Natürlich können Sie uns auch brieflich (BDG, Lessenicher Straße 1,53123 Bonn), telefonisch (0228/696601) oder per Fax erreichen (0228/696603).Wir bedanken uns für Ihre Mühe. Sie helfen uns, einen einwandfreien Versand zu garantieren<strong>und</strong> den teuren <strong>und</strong> aufwendigen Doppelversand zu minimieren.Ihre Redaktion42 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
Seite der Vorsitzenden von DGG (Geophysik) , DGG (Geologie) , DMG, GV<strong>und</strong> PalGesLiebe Mitglieder,in früheren Ausgaben von <strong>GMIT</strong> <strong>und</strong> auf denMitgliederversammlungen der oben genanntenGesellschaften haben Sie sicherlich vernommen,dass die geowissenschaftlichen Gesellschaftenin Deutschland bewegte Zeiten erleben. DieUmbruchphase, in der wir uns gegenwärtig befinden,resultiert aus der seit langer Zeit bestehendenZersplitterung der Fachgesellschaften,die es schwer macht, effiziente Problemlösungsstrategienzu erarbeiten, um damit in der Öffentlichkeit<strong>und</strong> auf der politischen Schaubühnesichtbar <strong>und</strong> schlagkräftig aufzutreten. Vor demHintergr<strong>und</strong> dieser ungünstigen Situation fandim Oktober 2011 eine erste gemeinsame Sitzungder Vorstände von DGG (Geophysik) , DGG (Geologie) ,DMG, GV <strong>und</strong> PalGes statt. Die Anwesendenstimmten darin überein, dass eine engere Kooperation<strong>und</strong> Vernetzung dringend geboten ist.Um diesem Gebot Rechnung zu tragen, wurdebeschlossen, einen neuen Dachverband mit Sitzin Berlin zu gründen. Dieser soll von den viergeowissenschaftlichen Gr<strong>und</strong>säulen Geologie,Geophysik, Mineralogie <strong>und</strong> Paläontologie getragen<strong>und</strong> von einer professionellen Geschäftsstellegeleitet werden. Die Beteiligten einigtensich darauf, dass sich der Dachverband nicht aufdie feste Erde beschränken, sondern die gesamteBreite der Geowissenschaften berücksichtigensoll. Als vorläufiger Name wurde „Dachverbandder GeowissenschaftlichenGesellschaften“ (DVGeo) gewählt. Da nicht alleFachgesellschaften wegen eines befürchtetenIdentitätsverlustes eine Vollfusion befürworten,kann dieser Dachverband ausschließlich nichtpersönlicheMitglieder – also Fachgesellschaften– umfassen. Neben den o.g. wissenschaftlichenGesellschaften sollen auch Großforschungseinrichtungenin den Dachverband eingeb<strong>und</strong>enwerden.Während drei weiterer Sitzungen im vergangenenJahr wurde ein Satzungsentwurf für denneuen Dachverband ausgearbeitet, der im Folgendenabgedruckt ist.Die Mehrheit der Beteiligten hält es für ausgeschlossen,dass die GeoUnion mit mehr als 30Trägereinrichtungen, 50.000 Mitgliedern <strong>und</strong>begrenztem Budget die vom neuen Dachverbanderwarteten Leistungen erbringen kann.Gleichzeitig wird betont, dass der neue Dachverbandkeine Konkurrenz-Institution zur GeoUniondarstellen soll, sondern dass sich beide Institutionenin ihrem Wirken ergänzen sollen.Die DFG-Fachkollegien <strong>und</strong> die Vertreter derDFG-Geschäftsstelle begrüßen die Einrichtungeines neuen Dachverbandes. Dies betrifft vorallem seine Rolle als Ansprechpartner bei derForschungsförderung, seine Funktion bei derEtablierung der Nachfolge der Senatskommissionfür Zukunftsaufgaben der Geowissenschaften(SK-ZAG) sowie die Koordinierung <strong>und</strong>Bündelung von Fachtagungen.Die Mitgliederversammlungen der o.g. Gesellschaftenhaben die Einrichtung eines neuenDachverbandes ebenfalls durchweg mit positivenVoten unterstützt. Ziel ist es nun, den untenabgedruckten Satzungsentwurf auf den bevorstehendenMitgliederversammlungen zu beschließen,um so den Weg für die Gründung desneuen Dachverbandes frei zu machen. Die Mitgliederversammlungenwerden wie üblich währendder nächsten Jahrestagungen stattfinden.Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.Mit herzlichem GlückaufAstrid Holzheid (DMG)Michael Korn (DGGeophysik)Ralf Littke (GV)Joachim Reitner (PalGes)Gernold Zulauf (DGGeologie)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 43
Satzung des Geo-DachverbandesEntwurf (Fassung vom 30.11.2012)PräambelModerne geowissenschaftliche Forschung <strong>und</strong>Lehre erfordern einen hohen Grad an Interdisziplinarität.Gleichzeitig verlangt die GesellschaftAntworten auf drängende Zukunftsfragen. DieBeantwortung dieser Fragen bedarf eines kontinuierlichenAustausches zwischen angewandter<strong>und</strong> gr<strong>und</strong>lagenorientierter Forschung. Um diesenAnforderungen gerecht zu werden, gründendie Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, dieDeutsche Gesellschaft für Geowissenschaften,die Deutsche Mineralogische Gesellschaft, dieGeologische Vereinigung <strong>und</strong> die PaläontologischeGesellschaft den Dachverband der Geowissenschaften.Der Dachverband der Geowissenschaften vertrittFachthemen, die sich mit den Prozessen derBildung, der Veränderung <strong>und</strong> der Nutzung derfesten Erde <strong>und</strong> ihrer Materialien <strong>und</strong> Ressourcenbefassen. Dies schließt atmosphärische,biologische, hydrologische <strong>und</strong> ozeanographischeProzesse ein.Ziel des Dachverbandes ist die Förderung derGeowissenschaften <strong>und</strong> deren Anwendung inder Ausbildung, deren Vertretung in Politik <strong>und</strong>Gesellschaft <strong>und</strong> der Transfer von Wissen.§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr(1) Der Dachverband der Geowissenschaften, imWeiteren Verband genannt, ist ein Zusammenschlussvon geowissenschaftlichen Fachgesellschaften.Der Verband soll als Verein in das Vereinsregisterbeim Amtsgericht eingetragen werden. Nach erfolgter Eintragungins Vereinsregister trägt er den Namen Dachverbandder Geowissenschaften e. V. Die Abkürzunglautet DVGeo.(2) Sitz des Verbandes ist Berlin.(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.§ 2 Vereinszweck(1) Der Verband verfolgt ausschließlich <strong>und</strong>unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne desAbschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.(2) Der Verband ist insbesondere auf dem Gebietder Geowissenschaften tätig.(3) Der Verband stellt sich insbesondere folgendeKoordinationsaufgaben:• Förderung der fachlichen Zusammenarbeit<strong>und</strong> Forschung;• Diskussion <strong>und</strong> Definition geowissenschaftlicherZukunftsthemen;• Vertretung der fachwissenschaftlichen, wissenschaftsorganisatorischen<strong>und</strong> institutionellenInteressen der Geowissenschaften <strong>und</strong>ihrer Einzeldisziplinen gegenüber der Öffentlichkeit<strong>und</strong> staatlichen Stellen;• Aktive Mitwirkung in öffentlichen Gremien<strong>und</strong> Institutionen bei der Förderung der geowissenschaftlichenForschung <strong>und</strong> Anwendung;• Initiierung <strong>und</strong> Begleitung koordinierter geowissenschaftlicherForschungsprogramme;• Förderung der Zusammenarbeit mit anderennationalen sowie internationalen Fachgesellschaften<strong>und</strong> Verbänden, die die Belange derGeowissenschaften oder angrenzender Wissenschaftenvertreten;• Organisation <strong>und</strong> Durchführung wissenschaftlicherVeranstaltungen;• Mitgestaltung <strong>und</strong> Förderung der geowissenschaftlichenAusbildung an Schulen <strong>und</strong>Hochschulen;• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.(4) Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgtnicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.44 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft(1) Die Mitgliedschaft kann als Vollmitglied oderals assoziiertes Mitglied erworben werden.(2) Vollmitglieder des Verbandes können juristischePersonen (Gesellschaften, etc.) werden,deren satzungsgemäße Zwecke mit denen des§ 2 in Einklang stehen <strong>und</strong> die in Forschung,Lehre oder Unterricht auf dem Gebiet der Geowissenschaftentätig sind.(3) Assoziierte Mitglieder des Verbandes könnenu.a. Forschungseinrichtungen, Institutionen,Unternehmen, Verbände <strong>und</strong> Vereine werden,die im Bereich der Geowissenschaften tätig sind.(4) Die Mitgliedschaft im Verband ist schriftlichbeim Vorstand zu beantragen. Über die Aufnahmeentscheidet die Mitgliederversammlung desVerbandes mit einfacher Mehrheit.(5) Mitglieder des Verbandes heißen nachfolgendVollmitglieder bzw. assoziierte Mitglieder.§ 4 Rechte der Mitglieder(1) Die Vollmitglieder üben ihre Rechte in derMitgliederversammlung durch Delegierte aus.(2) Jedes Vollmitglied kann Delegierte benennen,die für die Dauer der Mitgliederversammlungals gesetzliche Vertreter Stimmrecht für diesie entsendende Mitgliedsgesellschaft ausüben.(3) Die Zahl der Stimmen eines Vollmitgliedsrichtet sich nach der Zahl seiner Mitglieder:50–500 Mitglieder 1 Stimme,501–1.000 Mitglieder 3 Stimmen,>1.000 Mitglieder 5 Stimmen.Maßgebend ist der Mitgliederstand des Vollmitgliedsam 1. Januar des Jahres, in dem die Mitgliederversammlungstattfindet; spätere Änderungenbleiben außer Betracht.(4) Kein/e Delegierte/r darf mehr als ein Vollmitgliedvertreten.(5) Es ist ausschließlich Sache des jeweiligenVollmitglieds, seine/n Delegierte/n zu bestimmen.(6) Ein/e Delegierte/r kann mehrere Stimmeneines Vollmitglieds wahrnehmen.(7) Darüber hinaus hat jedes ordentliche Vorstandsmitgliedeines Vollmitglieds Rede- <strong>und</strong>Antragsrecht in der Mitgliederversammlung.(8) Sämtliche Korrespondenz des DVGeo-Vorstandes,die an ein Vollmitglied gerichtet ist, istan diejenige Anschrift des Mitglieds zu senden,die der jeweilige Vereinsvorstand als Postanschriftfestlegt. Dies gilt insbesondere für Einladungenzu Mitgliederversammlungen.(9) Jedes Vollmitglied sowie dessen Mitgliederhaben das Recht, Anträge, Anfragen, Vorschlägeoder Beschwerden den Verband betreffend beimVorstand des Verbandes einzureichen. Fernerkönnen die Genannten Auskunft über Angelegenheitendes Verbandes verlangen.(10) Jedes Mitglied eines Vollmitglieds hat dasRecht an der Mitgliederversammlung des Verbandesals Gast teilzunehmen.(11) Assoziierte Mitglieder des Verbandes könnenmit maximal drei Delegierten ohne Stimmrechtan der Mitgliederversammlung des Verbandesteilnehmen.§ 5 Finanzielle Mittel des Verbandes(1) Jedes Vollmitglied hat bis zum 31. März einesjeden Jahres an den Verband einen Jahresbeitragzu entrichten. Die Mitgliederversammlung entscheidetüber die betreffende Beitragsordnung.(2) Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäßeZwecke verwendet werden. DieMitglieder erhalten keine Zuwendungen ausMitteln des Verbandes.(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, diedem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 45
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigtwerden.§ 6 Sonstige Pflichten der Mitglieder(1) Die Vollmitglieder sind verpflichtet, Änderungenihrer Satzung oder des Vorstandes sowieden Beschluss über die Auflösung des Vereinsinnerhalb einer Frist von vier Wochen dem Vorstanddes Verbandes anzuzeigen. In der gleichenFrist ist auch jede Änderung des Status derGemeinnützigkeit mitzuteilen.(2) Vollmitglieder, die ihrer finanziellen Beitragspflichttrotz Mahnung nicht nachkommen, könnenbis zur Pflichterfüllung keine Rechte (vgl.§ 4) ausüben. Das Ruhen der Rechte wird vomVorstand des Verbandes festgestellt <strong>und</strong> den betroffenenMitgliedern schriftlich mitgeteilt.§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft(1) Die Mitgliedschaft endet mit dema) Austrittb) Ausschlussc) Verlust der Rechtsfähigkeiteines Mitglieds.(2) Der Austritt eines Mitglieds muss durch seinenVorstand oder rechtlichen Vertreter schriftlichmit einer Kündigungsfrist von sechs Monatenzum Jahresende gegenüber dem Vorstanddes Verbandes erklärt werden. Innerhalb derKündigungsfrist ist die Rücknahme der Austrittserklärungzulässig.(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand desVerbandes mit Zwei-Drittel-Mehrheit aus demVerband ausgeschlossen werden, wenn esdurch zurechenbares schuldhaftes Verhalteneines seiner Organe in besonders schwerwiegenderWeise gegen die Satzung des Verbandesverstoßen hat. Ein solcher Verstoß ist vor allemdann anzunehmen, wenn ein Mitglied seine Verpflichtungengegenüber dem Verband trotzzweimaliger schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzungvon sechs Wochen nicht erfüllt. DerAusschluss bedarf der Bestätigung durch dieeinfache Mehrheit der Mitgliederversammlung.§ 8 OrganeOrgane des Verbandes sind die Mitgliederversammlung,der Vorstand <strong>und</strong> der Beirat.§ 9 Mitgliederversammlung(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wirdeinmal im Jahr vom Vorstand des Verbandes einberufen.Die Vorstandsmitglieder des Verbandeshaben bei den MitgliederversammlungenRede- <strong>und</strong> Antragsrecht. Der Vorstand kannnach seinem Ermessen weitere Mitgliederversammlungeneinberufen. Er hat eine außerordentlicheMitgliederversammlung einzuberufen,wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder diesverlangt.(2) Die Mitgliederversammlung ist schriftlich untergleichzeitiger Bekanntgabe einer vorläufigenTagesordnung – mindestens vier Wochen vordem Tag der Sitzung – einzuberufen. Die Vorstandsmitgliederdes Verbandes sind zu jederMitgliederversammlung einzuladen. Die Tagesordnungkann zu Beginn der Mitgliederversammlungdurch Mehrheitsbeschluss der anwesendenDelegierten der Mitglieder erweitert,verkürzt oder umgestellt werden. Lediglich dieTagesordnungspunkte «Satzungsänderungen»<strong>und</strong> «Auflösung des Vereins» bedürfen vorheriger,fristgerechter Ankündigung.(3) Über den Ort der Mitgliederversammlungentscheidet der Vorstand.(4) Der Präsident – bei dessen Verhinderungeiner seiner Stellvertreter – leitet die Mitgliederversammlung.(5) Anträge können unmittelbar auf der Mitgliederversammlungvon jedem Antragsberechtigteneingebracht werden, sofern entsprechendeTagesordnungspunkte vorhanden sind.46 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
DGGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDeutsche Gesellschaft für Geowissenschaften2004 entstanden durch Fusion von Deutscher Geologischer Gesellschaft(DGG, gegründet 1848) <strong>und</strong> Gesellschaft für Geowissenschaften (GGW)Fachsektion Hydrogeologie der DGGFortbildungsveranstaltungen der FH-DGG 2013Termin Titel Ort Organisation21.–22.3. Beschaffenheit des Gr<strong>und</strong>- Hotel Betz PD. Dr. Traugott Scheyttwassers Bad Soden-Salmünster (TU Berlin)15.4.–16.4. Alterung, Regenerierung <strong>und</strong> Hotel Betz Dr. Georg HoubenSanierung von Brunnen Bad Soden-Salmünste (BGR Hannover)Prof. Dr. Christoph Treskatis(Bieske u. Partner GmbH, Lohmar)29.5.–1.6. Angewandte Gr<strong>und</strong>wasser- Hotel Betz Dr. Johannes Riegger (Inst. f.modellierung III Bad Soden-Salmünster Wasserbau, Uni Stuttgart)22.–25.7. Mathematik für Hydrogeologen Greifswald PD. Dr. W. Gossel (MLU Halle)Prof. Dr. Maria-Th. Schafmeister(Universität Greifswald)30.9.–1.10. Hydraulische Methoden Bochum Prof. Dr. Stefan Wohnlich (RUB)PD. Dr. Traugott Scheytt (TU Berlin10.10. Hydrogeologie der Fest- Karlsruhe Prof. Dr. IngridStobergesteine(Regierungspräsidium Freiburg)20.–23.11. Angewandte Gr<strong>und</strong>wasser- Hotel Betzmodellierung I Bad Soden-Salmünster Dr. Johannes Riegger(Inst. f. Wasserbau, Uni Stuttgart)Herbst 2013 Planung <strong>und</strong> Bemessung von Münster Dr. Sven Rumohr (HLUG)ErdwärmesondenanlagenDipl.-Geol. Ingo Schäfer(Geologischer Dienst NRW)In Planung Trinkwasserschutzgebiete PD. Dr. W. Gossel (MLU Halle)Anmeldungen über die Geschäftsstelle der FH-DGG: Frau Dr. R. Kaufmann-KnokeTelefon: +49 6321-484-784, Telefax: +49 6321-484-783, E-Mail: geschaeftsstelle@fh-dgg.deDetaillierte Informationen zu den Veranstaltungender Fachsektion Hydrogeologie entnehmenSie bitte den Internetseiten der FH-DGG(www.fh-dgg.de).50 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDGGAngewandte Gr<strong>und</strong>wassermodellierung III – Wärmetransport imUntergr<strong>und</strong>Der Fortgeschrittenenkurs findet vom 29.5.–1.6.2013 in Bad Soden-Salmünster statt. Er bieteteinen einfachen Zugang zur numerischenModellierung von advektivem <strong>und</strong> konduktivemWärmetransport im Untergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> im Gr<strong>und</strong>wasser– unter Vernachlässigung von Dichteeffekten– auf der Basis des freiverfügbaren ProgrammsystemsPMWin (Modflow, mt3dms).Besonderer Schwerpunkt ist dabei die Übertragungder für den Stofftransport konzipiertenVerfahren <strong>und</strong> Parameter auf den konduktiven<strong>und</strong> advektiven Wärmetransport, die notwendigeräumliche <strong>und</strong> zeitliche Diskretisierung <strong>und</strong>die anzuwendenden Stabilitätskriterien bei denunterschiedlichen numerischen Lösungen. Fürden Wärmetransport in Kluftaquiferen werdenDoppel-porositätsansätze zur Beschreibung desSystems im thermischen Nichtgleichgewichtbehandelt.Übungen am PC vertiefen das Verständnis derModellansätze <strong>und</strong> der Haupteinflussfaktorenbeim Wärmetransport <strong>und</strong> bieten praktische Erfahrungmit dem Aufbau <strong>und</strong> der Bewertung vonkomplexen Modellen. Anwendungsbeispieleumfassen Erdwärmesonden, Thermal-Response-Tests, hydrogeothermische Anlagen <strong>und</strong> derenOptimierung.Teilnahmevoraussetzung für den Kurs sindGr<strong>und</strong>kenntnisse in der Strömungsmodellierung.Für den Einstieg in PMWin <strong>und</strong> den Stofftransportmit mt3dms sowie als Gr<strong>und</strong>lage fürden Wärmetransport wird optional eine eintägigeEinführung in die Programmsysteme <strong>und</strong>die numerischen Methoden <strong>und</strong> Stabilitätskriterienfür den Stofftransport angeboten. DieTeilnehmer erhalten ein Zertifikat.Angesprochen sind Hydrogeologen, Ingenieurein Wasserwirtschaft <strong>und</strong> Umweltschutz, Gr<strong>und</strong>bauer,Ingenieurbüros, Behörden für Umweltschutz,Wasserwirtschaft <strong>und</strong> Geologie, sowieWasserversorgungsunternehmen. Referent istDr. Johannes Riegger (Institut für Wasser- <strong>und</strong> Umweltsystemmodellierung,Universität Stuttgart).Anmeldeschluss ist der 26. April 2013. Die Teilnehmerzahlist auf 14 Personen begrenzt. DieVeranstaltung wird nur durchgeführt, wenn mindestens8 Anmeldungen vorliegen.Die Teilnahmegebühr beträgt 990,– € (für Mitgliederder FH-DGG 850,– €). Diese Gebührenbeinhalten die Kursgebühr, Veranstaltungsunterlagen,Übernachtungen in einem Tagungshoteleinschließlich Vollpension. Beim Vorbereitungstag,der zusätzlich zur Hauptveranstaltungangeboten wird <strong>und</strong> gesondert gebucht werdenkann, ist die Teilnehmerzahl ebenso auf 14 Personenbegrenzt. Diese Veranstaltung wird ab4 Anmeldungen durchgeführt. Die Teilnahmegebührfür den Vorbereitungstag beträgt300,– € (für Mitglieder der FH-DGG 260,– €).Die Gebühren beinhalten die o.g. Leistungenentsprechend für einen Tag. Wir bitten dieKursteilnehmer unbedingt einen eigenen Laptopmitzubringen.Mathematische Verfahren für HydrogeologenUni- <strong>und</strong> multivariate statistische Methoden <strong>und</strong>Zeitreihenanalyse sowie geostatistische <strong>und</strong> numerischeVerfahren stehen im Mittelpunkt dieserFortbildungsveranstaltung der FH-DGG, dievom 22.–25.7.2013 in Greifswald stattfindet. DieReferenten stellen zusätzlich Perspektiven <strong>und</strong>Weiterentwicklungen der jeweiligen Methodenvor, die in Nachbarwissenschaften z.T. schoneingesetzt werden. AnwendungsbezogeneAspekte werden trotz des hohen theoretischenAnteils ebenfalls berücksichtigt.Im Einzelnen sind folgende Themen geplant:1. Uni- <strong>und</strong> multivariate Statistik, die in weitenBereichen der Messdatenbeschreibung <strong>und</strong>-auswertung bei hydrodynamischen <strong>und</strong> hydrochemischenProzessen besonders wichtig ist.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 <strong>51</strong>
DGGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONEN2. Zeitreihenanalysen einschließlich der zugehörigenTests zur Beschreibung <strong>und</strong> Auswertungzeitabhängiger Gr<strong>und</strong>wasserdaten, insbesondereder Gr<strong>und</strong>wasserstände, aberauch hydrochemischer Messwerte.3. Geostatistische Verfahren zur Analyse <strong>und</strong>räumlichen Prognose von hydrodynamischenoder hydrochemischen Messdaten.4. Numerische Verfahren als Gr<strong>und</strong>lagen derGr<strong>und</strong>wasserströmungs- <strong>und</strong> -transportmodellierung.Hieraus ergibt sich die Gr<strong>und</strong>gliederung des Seminars,das an jedem der vier Tage vormittagsaus Referaten/Vorträgen/Beiträgen der Kollegenbestehen soll. Jeder der vier mathematischenAufgabenbereiche wird zunächst anhandvon Kurzbeispielen aus der Hydrogeologie eingeleitet,um die Tragweite der Anwendung deutlichzu machen. Die Verfahren selbst werdenverständlich <strong>und</strong> anwendungsorientiert vermittelt,wobei die praxisorientierte mathematischsaubere Formulierung im Vordergr<strong>und</strong> steht.Am jeweiligen Nachmittag ist eine umfangreicheÜbung zum Training des Gelernten anhand realerDatensätze geplant. Die z.T. als Gruppenarbeitauszuführenden Übungen werden fachlichbegleitet. Hierbei wird mit wissenschaftlicher Softwaregearbeitet, die zum großen Teil als Freewarevorliegt <strong>und</strong> damit auch von den Teilnehmern fürihre Projekte weiter genutzt werden kann.Referenten der Veranstaltung sind Prof. Dr. Maria-TheresiaSchafmeister (Geostatistik, UniversitätGreifswald), Dr. Heinz Burger (Statistik <strong>und</strong>Teile Geostatistik, Freie Universität Berlin), PDDr. Wolfgang Gossel (Zeitreihenanalyse, UniversitätHalle) sowie Dr. Falk Heße (Numerik, Helmholtz-Institutfür Umweltforschung Leipzig).Anmeldeschluss ist der 21. Juni 2013. Die Teilnehmerzahlist auf 20 Personen begrenzt. DieTeilnahmegebühr für den viertägigen Kurs beträgt770,– € (Mitglieder der FH-DGG 650,– €).Studentische Mitglieder zahlen 450,– € (Mitgliederder FH-DGG 390– €). Diese Teilnahmegebührbeinhaltet die Kursgebühr, Veranstaltungsunterlagen,Pausenverpflegung, Mittagessensowie eine Abendveranstaltung.Hydraulische MethodenIm Rahmen dieser Veranstaltung, die vom 30.9.–1.10.2013 in Bochum stattfindet, werden hydraulischeBrunnenversuche (Pumpversuche, Slug-& Bail-Tests, Infiltrationsversuche) im Geländedurchgeführt <strong>und</strong> anschließend ausgewertet.Hydraulische Versuche sind eines der wichtigstenHilfsmittel zur gr<strong>und</strong>legenden Charakterisierungdes Gr<strong>und</strong>wasserleiters. Der bekanntesteVertreter hydraulischer Versuche ist derPumpversuch; andere Versuche, u.a. Auffüllversuche<strong>und</strong> Slug- & Bail-Versuche, werdenzwar häufig genannt, aber deutlich seltenerdurchgeführt. Zusammen genommen stellendiese Versuche für den Praktiker die wesentlichenUntersuchungen zur Bestimmung vonIn-situ-Parametern dar. Die Fortbildungsveranstaltungist so ausgelegt, dass jeder Teilnehmerdie Versuche von der praktischen Durchführungbis zur Auswertung Schritt für Schritt kennenlernt.Der Lehrgang gliedert sich in folgende Einheiten:Einführung in die Gr<strong>und</strong>lagen hydraulischer Versuche(Anwendbarkeit, Grenzen, Berechnungsmethoden),praktische Durchführung der Versucheim Gelände (Aufbau als „Parcour“ mita) Pumpversuch, b) Slug- & Bail-Test, c) Infiltrationsversuch)sowie Auswertung der praktischenVersuche mittels analytischer Methoden<strong>und</strong> Computerprogrammen.Referenten sind Prof. Dr. Stefan Wohnlich, Ruhr-Universität Bochum <strong>und</strong> PD Dr. TraugottScheytt, Technische Universität Berlin.Anmeldeschluss ist der 30. August 2013. DieTeilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.Die Teilnahmegebühr beträgt 490,– € (Mitgliederder FH-DGG 410,– €). Studentische Mitgliederzahlen 280,– € (Mitglieder der FH-DGG230,– €). Diese Teilnahmegebühr beinhaltetVeranstaltungsunterlagen <strong>und</strong> Pausenverpflegung.52 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDGG4. Workshop „Harzgeologie“ in Roßla (Südharz)Arbeitskreis Regionale Geologie der DGGAm 19. <strong>und</strong> 20.10.2012 trafen sich im Rahmendes Workshops „Harzgeologie“ zum viertenMal über 30 Fachkollegen aus mehrerenB<strong>und</strong>esländern. Die zweitägige Vortrags- <strong>und</strong>Exkursionstagung zur Geologie der Harzregionfand diesmal in Roßla, Südharz statt. Eingeladenhatte der Arbeitskreis RegionaleGeologie der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften,unterstützt durch die geowissenschaftlichenInstitute der UniversitätenClausthal <strong>und</strong> Halle, den Geopark Harz · BraunschweigerLand · Ostfalen <strong>und</strong> die Verwaltungdes Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz,in deren Räumen die Tagung durchgeführtwurde.Auch bei diesem Treffen ging es wieder umgr<strong>und</strong>legende Fragen zur Entstehung des Harzes<strong>und</strong> dessen Entwicklung seit 400 MillionenJahren. Die Themen umfassten den Aufbau destiefen Untergr<strong>und</strong>es des Harzes, die Genese <strong>und</strong>paläogeographische Position der Sedimente <strong>und</strong>deren spätere Faltung in Tiefen bis über 15 km,die Entstehung der Lagerstätten <strong>und</strong> die jungeHebungsgeschichte des Harzes sowie Informationenzum aktuellen Stand der geologischenKenntnisse des Leinetalgrabens als möglicherGeothermiestandort. Außerdem wurde eineneue geologische Karte vom Elbingeröder Komplexpräsentiert <strong>und</strong> die Genauigkeit der geologischenKarten am Beispiel von Blatt Benneckensteinbewertet.Am zweiten Tag fand bei idealen Wetterbedingungendie Exkursion statt. Sie führte zurBasis der Ostharzdecke, zu den Aufschlüssen imBesucherbergwerk Büchenberg, in das HüttenröderOlisthostrom, zum DiabassteinbruchHuneberg (s. Bild) <strong>und</strong> zur Harzaufrichtungszonebei Göttingerode.Erfreulich war, dass nicht nur „alte Hasen“, sondernauch einige junge Kollegen an dieser Veranstaltungteilgenommen <strong>und</strong> das Programmaktiv mitgestaltet haben. Allen sei dafür nochmalsherzlich gedankt. Besonderer Dank gebührtden Mitarbeitern der Verwaltung desBiosphärenreservats Karstlandschaft Südharzfür die hervorragende Organisation.Der Tagungsband zum 4. Workshop ist im„Halleschen Jahrbuch für Geowissenschaften“Frau Chr. Hoffmann (rechts)erläutert im DiabassteinbruchHuneberg der Firma KEMNAdie Ergebnisse ihrer Diplomarbeit.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 53
DGGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENals Beiheft 28 erschienen. Die Beiträge desWorkshops können kostenlos über www.geo.uni-halle.de/forschung/hjgw/Beihefte <strong>und</strong>noch bis Ende Mai auch über die Tagungshomepagewww.harzgeologie2012.de abgerufenwerden.Bei diesem Treffen wurde erneut deutlich, dasses noch eine Vielzahl offener Fragen zur Geologiedes Harzes gibt, von denen einige nicht nurvon lokalem Interesse sind, sondern für die GeologieDeutschlands eine ganz wesentlicheBedeutung haben. C.-H. Friedel (Leipzig)Fachsektion Geoinformatik der DGGWahl des Vorstandes der FGI-DGGAm 21.12.2012 fand in Darmstadt die turnusmäßigeMitgliederversammlung der FachsektionGeoinformatik statt. Im Rahmen der Versammlungfanden auch die Vorstandswahlen statt.Herr Dr. Rouwen Lehné (TU Darmstadt) wurdeeinstimmig in seinem Amt als Vorsitzender derFachsektion bestätigt, ebenso wie Prof. Dr.Helmut Schaeben (TU Freiberg) als stellvertretenderVorsitzender <strong>und</strong> Dr. Dirk Arndt(Böhringer Consult GmbH, Schweiz) als Mitglieddes erweiterten Vorstandes. Frau Marie LuiseMayer-Reitz, die bisher als Mitglied des erweitertenVorstandes die Geschäftsstelle leitete,schied auf eigenen Wunsch aus. Für Ihr großesEngagement bedankt sich der Vorstand herzlich<strong>und</strong> wünscht Frau Mayer-Reitz für den zukünftigenLebensweg alles Gute. Neu in den erweitertenVorstand gewählt wurde einstimmig FrauHannah Budde (TU Darmstadt), die von nun anu.a. die Geschäftsstelle betreuen wird.Der neugewählte Vorstand hat seine Arbeit umgehendaufgenommen <strong>und</strong> noch während derVersammlung im Konsens mit den anwesendenMitgliedern die Ziele für die nächsten 2 Jahre definiert.So ist beabsichtigt, mit den verfügbarenMitteln einen jährlichen Preis auszuloben, derherausragende studentische Abschlussarbeiten(BSc. + MSc.) würdigt, die das Feld Geoinformationmethodisch oder inhaltlich adressieren.Weiterhin hat sich die Fachsektion zum Ziel gesetzt,die Internetpräsenz aufzuwerten, dieAnzahl der Mitglieder weiter zu erhöhen <strong>und</strong> dasWeiterbildungsprogramm auszubauen.Rouwen Lehné (Darmstadt)Arbeitskreis Geschichte der GeowissenschaftenGeohistorische Blätter <strong>Heft</strong> 22 erschienendann über Jena als Drei<strong>und</strong>vierzigjähriger nachDresden kam, wo er 2 ½ Jahrzehnte erfolgreichtätig war.Gleich zwei Arbeiten drehen sich um AlfredWegener. H. W. Flügel (Graz) publiziert einenBrief von Eduard Brückner (1862–1927) anWegener vom 26. Mai 1925, <strong>und</strong> U. Wutzke(Ahrensfelde) informiert über die jetzt bekanntgewordenen Übersetzungen von Wegenerswichtigstem Buch „Die Entstehung der Kontiuw.Im Mittelpunkt der Titelgeschichte desneuen <strong>Heft</strong>es steht Ernst Kalkowsky (18<strong>51</strong>–1938),ein Wegbereiter der modernen mikroskopischenMineral- <strong>und</strong> Gesteinsuntersuchung, der im Jahre1908 die Begriffe „Stromatolith“ <strong>und</strong> „Ooid“in der Wissenschaft etablierte. N. Hauschke(Halle) et al. stellen Leben <strong>und</strong> Lebenswerk desim ostpreußischen Tilsit geborenen Wissenschaftlersvor, der in Leipzig bei Zirkel (1838–1912) <strong>und</strong> Credner (1841–1913) studierte <strong>und</strong>54 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDGGStromatolith innerhalb einer oolithischen Schichtenfolge,Heeseberg bei JerxheimFoto: H.-G. Röhlingnente <strong>und</strong> Ozeane“ ins Chinesische <strong>und</strong> Japanische.Anlässlich von dessen 140. Geburtstagerinnert A. Galkin (Bonn) an Ivan Strizov, einenhervorragenden Erdölgeologen, der von ungebildetenParteifunktionären in den Gulag verbanntwurde <strong>und</strong> selbst dort noch – unveröffentlichtgebliebene – Arbeiten zur Erdölhöffigkeit Sibiriensverfasste. Zur bevorstehenden Wiederkehrdes Todestages Leopold von Buchs (1774–1853)am 4. März 2013 veröffentlicht Ch. Schubert(Biederitz) eine geologiegeschichtliche Betrachtungzu dessen Werk. Interessant zu <strong>lesen</strong> sinddie postum veröffentlichten Aufzeichnungenvon F. Ahlfeld zu Begebenheiten vom XV. InternationalenGeologenkongress (1929 in Pretoria).M. Guntau (Rostock) äußert sich „Zu einigenZielen <strong>und</strong> Wegen der Geologiegeschichte in derzweiten Hälfte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts“, R. Daber(Berlin) erinnert an den Berliner Botaniker HenryPotonié (1857–1913) <strong>und</strong> V. Mende (Berlin) andie unpubliziert gebliebenen Manuskripte vonHerbert Hardt (1914–1993).Das neue <strong>Heft</strong> (124 S. mit 36 Abb. u. 6 Tafeln)kann über info@geohistorische-blaetter.de oderbei der Geschäftsstelle der DGG (geschaeftsstelle@dgg.de) zum Preis von 19,95 € plus Versandkostenbestellt werden. Wer ein Festabonnement(ein <strong>Heft</strong> pro Jahr) wünscht, kann die Zeitschriftzum Vorzugspreis von 14,95 € plusVersandkosten beziehen.Workshop in Eichstättuw. Bestens organisiert von Martina Kölbl-Ebertfand vom 1.–2.2.2013 im Bischöflichen Seminarin Eichstätt der diesjährige Workshop desArbeitskreises statt. Es wurden fünf Vorträgepräsentiert: Kathrin Polenz (Jena): „Der geognostischeLehrkurs bei Abraham Gottlob Werner –methodisch-methodologische Ansätze“, BernhardFritscher (München): „Geologische Gesellschaft<strong>und</strong> soziale Klassen: Zur gesellschaftlichenAkzeptanz der Geologie in Deutschland<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 55
DGGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDie Teilnehmer des Workshops in Eichstätt; Foto: Ch. Lüdecke<strong>und</strong> England im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert“, CorneliaLüdecke (München): „Von der Antarktis nachMünchen – Über die verpassten Chancen desErich von Drygalski“, Martina Kölbl-Ebert (Eichstätt):„Vom Ries-Vulkan zum Mondlabor: Diegeologische Riesforschung im Wandel der öffentlichenWahrnehmung (1945–1975)“, GottfriedHofbauer (Erlangen): „Die Rolle der Geologiein der ,global change‘-Diskussion“. Am zweitenTag standen eine Führung durch das Jura-Museum, die Besichtigung der naturk<strong>und</strong>lichenSammlung des Eichstätter Priesterseminars <strong>und</strong>eine Kurzexkursion zum PlattenkalksteinbruchWintershof-West auf dem Programm.56 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDMGSeite der VorsitzendenLiebe Mitglieder der DMG,mit dem Jahreswechsel haben sich einige Veränderungenim Vorstand unserer Gesellschaft ergeben,die Sie durch die letzten Vorstandswahlenim Herbst 2011 veranlasst haben. Nicht nurhat Rainer Altherr nach zwei Jahren als Vorsitzenderden Staffelstab an mich weitergereicht<strong>und</strong> alle vier Sektionen der DMG werden seitJahresbeginn von neuen Vorsitzenden geleitet(siehe <strong>GMIT</strong> Nr. 50), sondern auch bei den Wahlmitgliederndes Beirats gab es Veränderungen<strong>und</strong> ich darf Monika Koch-Müller (Wahlmitglieddes Beirats) <strong>und</strong> Christopher Giehl (studentischesWahlmitglied des Beirats) recht herzlichim erweiterten Vorstand der DMG begrüßen.Rainer <strong>und</strong> allen scheidenden Vorsitzenden derSektionen <strong>und</strong> Beiratsmitgliedern möchte ich imNamen der DMG für ihren Einsatz für die Gesellschaftganz herzlich danken.Der sicherlich guten Zusammenarbeit mit unserem<strong>GMIT</strong>-Redakteur Klaus-Dieter Grevel (Klaus-Dieter.Grevel@rub.de) sehe ich freudig entgegen.Gleichzeitig hoffe ich natürlich auch aufIhre künftigen Beiträge für dieses für uns sowichtige gemeinsame Nachrichtenheft. Auchdas Journal „Elements“, das von der MineralogicalSociety of America zusammen mit einerganzen Reihe weiterer mineralogischer Gesellschaftenpubliziert wird, hat sich längst einenNamen gemacht <strong>und</strong> viele von uns sehen allezwei Monate dem Empfang des neuen <strong>Heft</strong>es erwartungsfrohentgegen. Wie bislang dürfen SieIhre Beiträge für Elements an Michael Burchardrichten (michael.burchard@geow.uni-heidelberg.de).Der DMG als Redakteur unserer Homepagesteht Ralf Milke (milke@zedat.fu-berlin.de) wei-terhin zur Verfügung. Über die Mailingliste„DMG Diskussion“ werden elektronisch über1.500 Listen-Abonnenten erreicht. Ich kanndaher nur den Aufruf Ralf Milkes unterstützen,die Liste auch zu anderen Zwecken denn alsAnkündigungs- <strong>und</strong> Ausschreibungs-Medium zunutzen. Ich wünsche mir, dass lebhafte Diskussionennach dem Vorbild zum Beispiel der Listen„MSA talk“ oder „geo-metamorphism“ auchüber die DMG-Plattform stattfinden.Was plant nun die DMG im Jahr 2013?Zum einen sollen das Ausbildungsprogramm<strong>und</strong> die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchsesausgebaut werden.In diesem Jahr werden acht Doktorandenkurseangeboten. Studentische Mitglieder können wieüblich von der DMG einen Reisekostenzuschusserhalten. Auch möchte ich auf die Reisebeihilfenfür jüngere Wissenschaftler der DMG (Doktoranden,Post-Docs) zur Präsentation ihrer Forschungsergebnisseauf renommierten internationalenKongressen aufmerksam machen.Zum anderen möchten wir sowohl die nationaleals auch internationale Vernetzung <strong>und</strong> Sichtbarkeitder DMG stärken.In dieser <strong>GMIT</strong>-Ausgabe finden Sie einen Artikelüber die letzten Aktivitäten der Vorsitzenden dergeowissenschaftlichen Fachgesellschaften <strong>und</strong>den Vorschlag der Satzung der geplanten Dachgesellschaft,in den Ihre Änderungs- <strong>und</strong> Ergänzungswünscheeingeflossen sind <strong>und</strong> der Ihnenbei der nächsten Mitgliederversammlung in Tübingenzur Abstimmung vorgelegt werden wird.International sichtbar ist die DMG durch Sie!Auf den kommenden internationalen Tagungenwerden zahlreiche „sessions“ von DMG-Mitglie-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 57
DMGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENdern organisiert <strong>und</strong> mitgestaltet. Ich dankeIhnen für diesen Einsatz.Abschließend möchte Sie auf einige für uns bedeutendeTagungen hinweisen, die im Jahr 2013stattfinden werden:07.04.–12.04.2013: EGU General Assembly, Wien(Österreich),22.05.–23.05.2013: Aims 2013 - Mineral Resourcesand Mine Development, Aachen,20.08.–30.08.2013: 23 rd Annual GoldschmidtConference in Florenz (Italien),16.09.–20.09.2013: Gemeinsame Jahrestagungder GV <strong>und</strong> DMG „GEOFLUIDS: Lubricants of theDynamic Earth“, Tübingen,09.12.–13.12.2013: AGU Fall Meeting, San Francisco(USA).Ich freue mich, Sie bei der einen oder anderenGelegenheit persönlich zu treffen.IhreAstrid HolzheidDMG-Doktorandenkurse 2013Petrologentreffen 2013In diesem Jahr werden die Bonner das DMG-Sektionstreffen der Sektion Petrologie <strong>und</strong>Petrophysik im Poppelsdorfer Schloss organisieren.Der Termin ist Freitag bis Samstag, 7. bis 8.Juni 2013. Wie gewöhnlich besteht am Freitagabenddie Möglichkeit zu einem Besuch einesRestaurants in Poppelsdorf, dessen Adresserechtzeitig bekannt gegeben wird. Das Programmstartet dann am Samstagmorgen um 9Uhr <strong>und</strong> geht bis ca. 17 Uhr, je nachdem wie vieleBeiträge angemeldet werden. Die Länge der2013 finden 8 Doktorandenkurse mit Unterstützungder Deutschen Mineralogischen Gesellschaftstatt. Studentische DMG-Mitglieder erhalteneinen Zuschuss von 50 €. Weitere Hinweise <strong>und</strong>Links finden sich auf der DMG-Homepage (www.dmg-home.de/kurse). Zu folgenden Kursen werdennoch Anmeldungen entgegengenommen:Anwendungen der Festkörper-NMR-Spektroskopiein der mineralogischen <strong>und</strong> geowissenschaftlichenForschung (21.05.–24.05.2013);keine Gebühren; max. 16 Teilnehmer; KursspracheDeutsch; 3 ECTS; Institut für Geologie,Mineralogie <strong>und</strong> Geophysik, Ruhr-UniversitätBochum; Kontakt: Dr. Michael Fechtelkord,Michael.Fechtelkord@rub.deLuminescence spectroscopy and imaging in theEarth sciences (01.07.–03.07.2013, pre-conferenceshort course of the CORALS-2013 conference);Teilnahmegebühr 90 €, stud. Teilnehmer60 €; max. 25 Teilnehmer; KursspracheEnglisch; Institut für Mineralogie, UniversitätWien; Kontakt: Prof. Lutz Nasdala, lutz.nasdala@univie.ac.atSIMS Short Course (Oktober 2013, 5 Tage); keineTeilnahmegebühr; max. 15 Teilnehmer; KursspracheEnglisch; Helmholtz-Zentrum Potsdam;Kontakt: Dr. Michael Wiedenbeck, Michael.Wiedenbeck@gfz-potsdam.deStudentische Mitglieder der DMG erhalten beider Teilnahme an Kursen der GV oder DGK diegleiche Reisebeihilfe wie bei Kursen aus demDMG-Programm.Marcus Nowak (Tübingen)Wortbeiträge ist 15 Min. + Diskussion. Es bestehtauch die Möglichkeit der Poster-Präsentation.Am Samstag gegen 19 Uhr klingt das Treffendann aus mit einem BBQ auf der Empore desPoppelsdorfer Schlosses.Anmeldungen per E-Mail an Chris.Ballhaus@unibonn.de(Steinmann-Institut, Universität Bonn)werden ab sofort entgegengenommen. StudentischeDMG-Mitglieder erhalten einenReisekostenzuschuss von 50 €.Chris Ballhaus & Raul Fonseca (Bonn)58 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDMGDiffusionsmodellierung zur Bestimmung von Zeitskalen in Geochemie<strong>und</strong> PetrologieVom 1. bis 5. Oktober 2012 fand am Institut fürGeologie, Mineralogie <strong>und</strong> Geophysik (IGMG)der Ruhr-Universität Bochum der DMG-Shortcourse/MSA-Workshop„Application of diffusionstudies to the determination of timescales ingeochemistry and petrology“ statt. Organisiert<strong>und</strong> geleitet wurde der Kurs von einem 7-köpfigenTeam der Arbeitsgruppe Petrologie desIGMG, die in zahlreichen veröffentlichten ArbeitenDiffusionsmodellierungen zur Bestimmungvon Zeitskalen in Geochemie <strong>und</strong> Petrologie eingesetzthaben. Hauptorganisatoren des Kurseswaren Sumit Chakraborty, Ralf Dohmen <strong>und</strong>Thomas Müller. Zudem halfen MassimilianoTirone, Maren Kahl (University of Leeds), KathrinFaak <strong>und</strong> Sascha Borinski bei der wissenschaftlichenBetreuung der Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmerin einzelnen Übungsgruppen (s.u.).R<strong>und</strong> 40 Wissenschaftler – mit unterschiedlichstenForschungsschwerpunkten – aus 17 Ländern(!) lernten von diesem Expertenteam fürDiffusionsprozesse, wie Diffusionsmodellierun-gen verwendet werden können, um die Dauergeologischer Prozesse abzuschätzen. Ein großerVorteil der Diffusionsmodellierung besteht darin,dass sie unabhängig vom Alter der Probe eingesetztwerden kann. Zudem funktioniert siein unterschiedlichsten Zeitskalen, je nachdem,welches System betrachtet wird. Beispielsweisediff<strong>und</strong>iert Lithium in Plagioklas so schnell, dassüber die Modellierung dieser Diffusion die Dauervon Prozessen bestimmt werden kann, die innerhalbweniger St<strong>und</strong>en passieren. Im Gegensatzdazu läuft der diffusive Austausch vonNa-Si <strong>und</strong> Ca-Al in Plagioklas so langsam ab,dass <strong>hier</strong> Zeitskalen von mehreren Millionen Jahrenmittels der Modellierung bestimmt werdenkönnen.Zahlreiche Vorlesungen, denen man stets gutfolgen konnte, spannten einen weiten Bogen:von den theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen der Diffusion,über das Definieren eines Diffusionsmodells,analytische <strong>und</strong> numerische Lösungsansätze,hin zu praktischen Anwendungen in geowissen-Organisatoren, Betreuerinnen <strong>und</strong> Betreuer, Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer des DMG-Shortcourse/MSA-Workshop„Application of diffusion studies to the determination of timescales ingeochemistry and petrology“<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 59
DMGGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENschaftlichen Fragestellungen. Auf Rückfragenseitens der Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmerging das Team des IGMG immer geduldig ein, sodass während der Vorlesungen sowie in denPausen stets eine entspannte Atmosphäreherrschte, die zu konstruktiven Diskussioneneinlud. Ein besonders wertvoller <strong>und</strong> lehrreicherBestandteil des 5-tägigen Workshops waren dieÜbungen, in denen die Teilnehmerinnen <strong>und</strong>Teilnehmer in kleinen Gruppen eigene Erfahrungenbei Diffusionsmodellierungen sammelnkonnten. Bei den Übungsaufgaben handelte essich stets um Anwendungen mit realitätsnahemgeowissenschaftlichem Bezug, z.B. die Abschätzungder Verweilzeit von Olivinkristallen insubvulkanischen Magmakammern. Eine Postersessionsowie eine Vortragssession im Rahmendes Workshops bot den Teilnehmerinnen <strong>und</strong>Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen aktuellenProjekte vorzustellen <strong>und</strong> darzulegen, wieDiffusionsmodellierungen wesentlicher Bestandteildieser Projekte werden könnten.Ein erstes Feedback der Teilnehmerinnen <strong>und</strong>Teilnehmer am Ende des Kurses ergab, dassTreffen mit dem Themenschwerpunkt Diffusionsmodellierungalle zwei Jahre sicherlich großenAnklang finden würden. Zudem würdenzahlreiche Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer dieEinrichtung eines Online-Forums begrüßen,über welches Tipps zur Diffusionsmodellierungausgetauscht, Probleme diskutiert <strong>und</strong> Kontaktegepflegt werden könnten. Abschließend sollan dieser Stelle noch Thomas Fockenberg <strong>und</strong>den studentischen Helfern Tim Küsters, SvenKuthning, Sabrina Hall, Katharina Marger <strong>und</strong>Holm Klimke gedankt werden, die zur Organisationdieses sehr gelungenen Workshops beitrugen.Alle Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer desKurses gingen sicherlich mit dem Gefühl nachHause, in diesen fünf Tagen viel gelernt <strong>und</strong> einbesseres Verständnis von diffusiven Prozessen<strong>und</strong> deren Modellierung erlangt zu haben.Martin Oeser (Hannover)Nominierungsaufruf – Vergabe der IMA-Exzellenz-MedailleDavid H. Green, 2011 Forschungspreisträger derInternational Mineralogical Association (IMA),wurde anlässlich der Europäischen MineralogischenKonferenz emc 2012 in Frankfurt mit derIMA-Exzellenz-Medaille ausgezeichnet. Davefolgt Charles Prewitt <strong>und</strong> Frank C. Hawthorne alsder dritte hervorragende Wissenschaftler, dessenArbeit auf diese Weise internationale Anerkennungfindet.Die IMA-Medaille wird alle zwei Jahre für herausragendeForschungsarbeiten auf dem Gebiet derMineralogie verliehen <strong>und</strong> zählt zu den angesehenstenPreisen in dieser Disziplin. Hauptkriteriumfür die Vergabe des Preises ist langjährigehervorragende wissenschaftliche Arbeit imBereich der Mineralogie, die durch Publikationstätigkeitin hoch angesehenen internationalenFachzeitschriften belegt ist. Mit der IMA-Medaillesoll das wissenschaftliche Lebenswerk einerForscherin oder eines Forschers ausgezeichnetwerden; die Stärkung des Faches durch Lehre<strong>und</strong> administrative Aufgaben nehmen eine untergeordneteRolle bei der Preisvergabe ein.Als Vorsitzender des Preiskomitees erbitte ichnun Nominierungsvorschläge für die Vergabeder IMA-Exzellenz-Medaille 2013, die spätestensbis zum 1. April 2013 bei mir eingegangen seinsollten (Ausschlussfrist). Details zur Preisvergabe,der Zusammensetzung des Preiskomitees<strong>und</strong> den Unterlagen, die mit einem Nominierungsvorschlageingereicht werden sollen, findenSie auf der neu gestalteten Internetseite derIMA: www.ima-mineralogy.org.Die wichtigsten Kriterien können wie folgtzusammengefasst werden:– Die Mineralogie ist ein breit angelegtes Fach<strong>und</strong> die Kandidatin/der Kandidat muss keinMineraloge im engeren Sinne sein. Hingegensollte ihre/seine Publikationsliste einen herausragendenBeitrag zu den mineralogischenWissenschaften erkennen lassen. Hierzu zählengleichermaßen Mineralogie, Geochemie,60 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENDMGPetrologie, Kristallographie oder angewandteMineralogie.– Der Preis wird unabhängig von der Nationalitätder vorgeschlagenen Kandidatinnen <strong>und</strong>Kandidaten vergeben.– Die Mitgliedschaft in einer nationalen mineralogischenGesellschaft ist nicht erforderlich,um den Preis zu erhalten.– Vorschläge, die entweder von einzelnen Mitgliederneiner nationalen mineralogischenGesellschaft oder Vereinigung oder von derenRepräsentanten bei der IMA eingereichtwerden können, müssen vollständige Unterlagenenthalten <strong>und</strong> bis zum 1. April eingereichtwerden.– Die Preisträgerin/der Preisträger wird einenPlenarvortrag bei einer internationalen Tagunghalten, der in einer internationalen mineralogischenFachzeitschrift publiziert wird.Die Auszeichnung mit der IMA-Exzellenz-Medaillestellt eine große Ehre dar <strong>und</strong> ich möchte Sieals Mitglieder der Deutschen MineralogischenGesellschaft dazu aufrufen, entsprechendePreisvorschläge zu machen. Bitte denken Sie dabeiinternational! Wir freuen uns über Nominierungsvorschlägevon Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegenaus jedem Land der Erde, die den Weg in dieMineralogie gef<strong>und</strong>en haben.Walter V. Maresch, Präsident der IMA <strong>und</strong>Vorsitzender des IMA-Exzellenz-Medaillen-Komitees (Bochum)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 61
GVGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENSeite des VorsitzendenLiebe Mitglieder der Geologischen Vereinigung,im Oktober 2012 erschien in der Zeitschrift„Geoscientist“, einem Magazin der GeologicalSociety of London, ein Artikel unseres MitgliedesWolfgang Jacoby mit dem Titel „Alfred Wegener– 100 years of mobilism“. Wolfgang Jacoby,lange Jahre Professor für Geophysik an der UniversitätMainz, berichtet <strong>hier</strong> in packender Art<strong>und</strong> Weise über die Forschungen von Wegenerim frühen 20. Jahrh<strong>und</strong>ert. Er beginnt seinen Artikelmit den Sätzen „One h<strong>und</strong>red years ago, inthe German city of Frankfurt, a young man whoat Marburg University worked as a physicist andmeteorologist told at a meeting of the recentlyfo<strong>und</strong>ed Geologische Vereinigung (GV) how theEarth functions. He shocked the meeting of eminentgeologists with an outrageous idea – thatsince the Late Palaeozoic the continents andoceans were not fixed – and that they had oncebeen grouped together in one vast supercontinent,Pangaea, and one even larger ocean. Thecontinent had fragmented and the fragmentsdrifted apart, five modern oceans formingbetween them.“In dem Artikel entwirft Jacoby ein Bild der Situationder Geowissenschaften vor 100 Jahren <strong>und</strong>insbesondere der Forschungsarbeiten, welcheWegener durchführte. Er beschreibt, wie Wegeneram 6. Januar 1912 auf einer Konferenz derGeologischen Vereinigung in Frankfurt das ersteMal sein Konzept mit einem Vortrag über „DieHerausbildung der Großformen der Erdrinde(Kontinent <strong>und</strong> Ozean) auf geophysikalischerGr<strong>und</strong>lage“ vorstellte – ein folgender Artikelwurde 1912 in Band 3, <strong>Heft</strong> 4 (Seiten 276–292)unter dem Titel „Die Entstehung der Kontinente“in unserer Zeitschrift Geologische R<strong>und</strong>schauabgedruckt, mit dem Hinweis „Dieser Teil ist besondersstark gekürzt. Es sei ein für allemal aufdie ausführlichere Darstellung in Petermann’sMitt. hingewiesen.“ In der Geologie blieb seinKollege Hans Cloos, einer der führenden Geowissenschaftlerdieser Zeit, zwar skeptisch, aberkonstruktiv <strong>und</strong> unterstützte ihn bei seinen Recherchen– nach ihm ist einer der beiden Preiseder GV benannt! Trotz zunehmendem Enthusiasmusblieb ein Großteil der damalig führendenGeophysiker <strong>und</strong> Geologen gegenüber WegenersIdeen zurückhaltend, auch nach Publikationdes klassischen Textes „Die Entstehung derKontinente <strong>und</strong> Ozeane“ im Jahre 1915. Den Antriebsmechanismusder Kontinentaldrift konnteWegener nicht erklären, da die Ozeane weißeFlecken auf der geologischen Weltkarte waren.Die Erk<strong>und</strong>ung der Ozeanböden, vor allem durchdie internationalen Bohrprogramme <strong>und</strong> das damiterreichte Verständnis der Prozesse, blieb anderenForschern überlassen. In seinem Vorwortzur vierten Auflage schreibt Wegener: „Nur62 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENGVdurch Zusammenfassung aller Geo-Wissenschaftendürfen wir hoffen, die Wahrheit zuermitteln, d.h. dasjenige Bild zu finden, das dieGesamtheit der bekannten Tatsachen in derbesten Ordnung darstellt <strong>und</strong> deshalb den Anspruchauf größte Wahrscheinlichkeit hat.“Wir sprechen zurzeit auch viel über eine engereZusammenarbeit geowissenschaftlicher Disziplinen,insbesondere von Geophysikern, Mineralogen,Paläontologen <strong>und</strong> Geologen in Deutschland.In diesem Zusammenhang möchte ich anregen,dass wir aus Anlass des 100-jährigenGeburtstages des Buches „Die Entstehung derKontinente <strong>und</strong> Ozeane“ im Jahre 2015 eine gemeinsameTagung zu Ehren von Alfred Wegenerdurchführen.Mit den beste WünschenIhr Ralf LittkeB<strong>und</strong>esfachschaftstagung Berlin, WiSe 2012Vom 8.–11.11.2012 fand am Geocampus Lankwitzdie B<strong>und</strong>esfachschaftstagung (BuFaTa) der Geologendes Wintersemesters 2012 statt. Mit insgesamtca. 150 Teilnehmern von 21 Universitäten,darunter die Uni Wien, ist diese BuFaTadie größte ihrer Art bisher gewesen.Nach der Begrüßung <strong>und</strong> einem Campusr<strong>und</strong>gangdurch die FU Berlin startete die Veranstaltungam Donnerstag traditionell mit einem Grillabendin lockerer Atmosphäre. Am Freitagstanden verschiedene Exkursionen an. BerlinerBausteine in der Stadt, deren Abbaugebiete,Energieversorgung, wie z.B. der TagebauJänschwalde (Fa. Vattenfall), eine Bunkerführungmit den Berliner Unterwelten, das Museumfür Naturk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> die Rieselfelder im NordenBerlins. Eine Führung zum GFZ <strong>und</strong> zur CO 2 -Verpressungsanlage Ketzin r<strong>und</strong>ete das vielfältigeProgramm ab.Nach den Exkursionen wurden die Teilnehmer indas bunte Kiezleben r<strong>und</strong> um das Ostkreuz <strong>und</strong>die berühmte Simon-Dach-Straße, sowie imAnschluss noch vom Alexanderplatz zum BrandenburgerTor geführt. Auf dieser kleinen Stadttourwurde unter Würdigung des besonderenDatums, des 9.11., insbesondere auf die spezielleSituation der Stadt zur Zeit des kalten Kriegeshingewiesen.Am Samstag bildeten die Fachvorträge derDozenten das Herzstück der BuFaTa. KonradHammerschmidt leitete die Vortragsreihe miteiner wissenschaftsphilosophischen Betrachtungdes Themenkomplexes „Zeit <strong>und</strong> Alter“ ein,gefolgt von Kamil Ustaszewski, der über dieSubduktionszone zwischen China <strong>und</strong> Japan<strong>und</strong> deren regionalpolitische Auswirkungsprach. Ralf Milke schilderte eindrucksvoll, wieein langfristig erfolgreiches Projekt sich auseiner einfachen Idee entwickeln kann, währendFriedhelm von Blanckenburg demonstrierte,warum Dreck (namentlich Boden) manchmalauch für „Hard-Rock-Geologen“ überaus interessantist. Den Abschluss der Vortragsreihe bildeteMichael Schudack mit einer Übersichtseiner aktuellen Arbeit. Dabei wurde die Vortragsreiheauch von Studenten <strong>und</strong> Interessiertendes Fachbereichs als willkommenes Zusatzprogrammgenutzt.Neben dem fachlichen <strong>und</strong> sozialen Austauschist die dritte Säule, auf der die BuFaTa ruht, dieuniversitäts- <strong>und</strong> wissenschaftspolitische Arbeit.Dazu wurden am Nachmittag Workshops zuverschiedenen Themen veranstaltet, darunterz.B. der Umgang mit minderjährigen Kommilitonenbei Veranstaltungen der Fachschaft, ein Vergleichder bestehenden Mentorenprogramme<strong>und</strong> die aktuelle Diskussion um den zu gründendenDachverband. Des Weiteren wurden die festintegrierten Workshops zum Thema Geländesicherheitsowie der Vergleich der deutschenMasterprogramme weitergeführt. Der EUGENe.V., der den Austausch von geowissenschaftlichenStudenten auf europäischer Ebene ermöglicht,hat in einem weiteren Workshop über denaktuellen Stand der Organisation aufgeklärt.Im abschließenden Plenum wurden die Ergebnisseder Workshops dargestellt <strong>und</strong> die Punkteausgewiesen, bei denen noch Handlungsbedarf<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 63
GVGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENAbschlussfoto im Vorlesungssaal des Geocampus Lankwitz - FU BerlinFoto: R. Kapannuschbesteht. So ist gewährleistet, dass die Fachschaftsvertretungenan den jeweiligen Universitätenfür die Themen sensibilisiert sind <strong>und</strong>weiter an den Fragestellungen arbeiten können.Studentische Vertreter haben, soweit vorhanden<strong>und</strong> anwesend, Berichte aus den geowissenschaftlichenVereinigungen vorgebracht.Zum Abschluss wurde Jena zum Austragungsstandortder Sommer-BuFaTa gewählt: HerzlichenGlückwunsch!Nach dem Plenum <strong>und</strong> dem anschließendenAbendessen haben Teilnehmer <strong>und</strong> Organisatorendie Veranstaltung gemeinsam ausklingenlassen, bevor die Teilnehmer am Sonntagmorgenwieder aufgebrochen sind.Die FSI Geologische Wissenschaften der FreienUniversität dankt allen Teilnehmern, dem Institutfür Geologische Wissenschaften, der FirmaFossilienwelt.net, dem Berufsverband DeutscherGeowissenschaftler, sowie den vielen helfendenHänden für die tatkräftige Unterstützung.Manuel Quiring & Sascha Zertani (Berlin)GV-Kurs-/Tagungszuschuss für Studierende 2013Die Geologische Vereinigung (GV) zahlt studierendenGV-Mitgliedern einmal jährlich bei Teilnahmean einer Veranstaltung der Unterstützungslisteeinen Zuschuss in Höhe von 75,– €.Der Beitritt zur GV ist während oder direkt nachder Veranstaltung möglich. Bei kostenfreienKursen/Tagungen wird die Unterstützung nichtan Studierende der ausrichtenden Universitätgezahlt. Der Zuschuss wird nach Zusendungeiner Teilnahmebescheinigung, eines Studiennachweises<strong>und</strong> der Bankverbindung anstudierende Mitglieder <strong>und</strong> Neumitglieder überwiesen.Kurs- <strong>und</strong> Tagungsunterstützung abApril 2013:64 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENGVBuFaTa Geowissenschaften 2013CoDaWork 2013, Workshop onCompositional Data AnalysisCompositional Data AnalysisEinführung in die GeomechanikIntroduction to physical volcanology andvolcanic texturesIsotopengeoch. Bestimmung von Altern<strong>und</strong> Raten i.d. ProzessgeomorphologieMelts, Glasses, MagmasPhysische VulkanologieSedimentary Provenance AnalysisSeveral GLOMAR-CoursesSummer School SequenzstratigraphieVorau, AustriaGironaPotsdamFreibergBerlinMünchenMendigGöttingenBremenHamburgB<strong>und</strong>esfachschaft GeowissenschaftenUniversity of Vienna/Universitat de GironaUniversitat de GironaG. DresenC. BreitkreuzF. v. BlanckenburgD. DingwellA. Fre<strong>und</strong>t/S. KutterolfH. v. Eynatten/I. Dunkl/G. MeinholdGLOMARC. BetzlerTermine <strong>und</strong> aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.g-v.de, Rubrik „SponsoredShort Courses and Events“.GV-Jubilare 2012 <strong>und</strong> 2013Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Jubiläum der GV-Mitgliedschaft, bedanken uns herzlich fürdie jahrzehntelange Treue <strong>und</strong> wünschen alles erdenklich Gute.Unsere Jubilare 201250 JahreGünther Brandl, Polokwane, SüdafrikaEbhardt Götz, DarmstadtHeinrich Felser, SalzgitterHans-Dietrich Maronde, BonnManfred Müller, SchongauNazario Pavoni, Adliswil, SchweizWynfrith Riemer, TrierHerbert Voßmerbäumer, WürzburgUnsere Jubilare 201370 JahreKarl Thome, Krefeld60 JahreRudolf Hüttner, WaldkirchJohannes Stets, Bonn50 JahreEberhart Berger, LaudenbachF. Wolfgang Eder, GräfelfingUdo Jürgens, WathlingenFriedrich E. Renger, Nova LimaPaul-Friedrich Schenck, Gettorf<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 65
GVGEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONEN66 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENPALÄONTOL. GESELL.Liebe Mitglieder, liebe StudentInnen,Seite des PräsidentenLiebe Mitglieder, liebe Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>innender Paläontologie,zunächst möchte ich Ihnen ein erfolgreiches <strong>und</strong>ges<strong>und</strong>es Jahr 2013 wünschen, verb<strong>und</strong>en mitdem Wunsch, dass neue Ideen <strong>und</strong> Aktivitätenunserer Fachrichtung einen weiteren nachhaltigenEntwicklungsschub verleihen.Für mich ist es das erste Mal, dass ich diePräsidentenseite verfasse, <strong>und</strong> ich möchte meinemVorgänger Michael Wuttke für sein außerordentlichesEngagement für das Fach <strong>und</strong> fürdie Gesellschaft danken. Die Situation der paläontologischenWissenschaften ist seit Jahrennicht einfach. Die Sparzwänge an den Universitäten<strong>und</strong> anderen akademischen Einrichtungensowie Sammlungen <strong>und</strong> Museen haben zueinem erheblichen Rückgang an Stellen <strong>und</strong> Forschungsmittelngeführt. Michael Wuttke ist eszusammen mit dem Vorstand <strong>und</strong> Beirat derPaläontologischen Gesellschaft dennoch gelungen,das Interesse an der Paläontologie zu stärken.Die erfreulich hohe Beteiligung von Mitgliedernanlässlich der Jubiläumstagung inBerlin 2012 <strong>und</strong> die Mitgliederzahl der Gesellschaft,die sich gut über der Zahl 1.000 bewegt,zeigen dies in exzellenter Weise. Auch der Anteilan jungen Mitgliedern, die für die Weiterentwicklung<strong>und</strong> Zukunft des Faches essentiellsind, steigt erfreulich.Die sehr erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong>der gelungene Internetauftritt haben zu einer erheblichverbesserten Sichtbarkeit der PaläontologischenGesellschaft geführt. Man denke <strong>hier</strong>an die Aktionen zum „Fossil des Jahres“, an dieBegleitung von Ausstellungen <strong>und</strong> die für diebreite Öffentlichkeit interessanten Publikationen,wie das Buch zum 100-jährigen Jubiläumder Gesellschaft. In diesem Zusammenhangmöchte ich unserem Schatzmeister MichaelGudo <strong>und</strong> seiner Mitarbeiterin Tina Schlüter fürihre professionelle operative Geschäftsführung<strong>und</strong> Mitgliederbetreuung herzlich danken. Es istmir ein besonderes Anliegen, die Geschäftsstelleweiterzuentwickeln – ich sehe darin großePotenziale für die Zukunft unserer Gesellschaft.Allerdings ist dies leider nicht umsonst zu haben.Es ist wie überall: Es gibt viele Baustellen, diebetreut werden müssen. Die Paläontologie (<strong>und</strong>ihre verwandten Fächer) ist ein kleines Fach,<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 67
PALÄONTOL. GESELL.GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENwelches im Vergleich mit den anderen geowissenschaftlichen<strong>und</strong> biologischen Fachrichtungenleider nur eine schwache Lobby hat. Einwichtiges Ziel für die nächsten Jahre ist es, inden Gremien der DFG, vor allem in den Fachkollegien,wieder besser vertreten zu sein. DieSituation an den Hochschulen ist nicht optimal,ebenfalls ein typisches Problem eines kleinenFaches. In den Bachelor- <strong>und</strong> Masterstudiengängenspielt unser Fach an vielen Universitätennur noch eine untergeordnete Rolle, abgesehenvon wenigen Standorten. Vielleicht ist es möglich,über verschiedene Standorte hinweg, einenqualitativ herausragenden Paläontologie/GeobiologieMaster- bzw. Promotionsstudiengang,eventuell auch international, zu etablieren, umdem Fach wieder eine größere Attraktivität zuverschaffen. Ideen dazu sind willkommen – mankönnte dazu in mittlerer Zukunft ein speziellesSymposium abhalten, mit dem Ziel eine Machbarkeitsstudiezu erstellen.Den paläontologischen Wissenschaften fehlt imAugenblick auch ein größeres integrierendesVerb<strong>und</strong>projekt, mit dem die herausragende Bedeutungdes Faches gegenüber den anderengeowissenschaftlichen <strong>und</strong> biologischen Fachgebietenherausstellt wird. Ideen dazu sindebenfalls herzlich willkommen. Auch wenn dieErfahrungen in der Vergangenheit gezeigt haben,dass solche Initiativen nicht immer Erfolghaben, ist die Dringlichkeit etwas zu unternehmenzwingend. Ich denke vor allem an ein DFGSchwerpunktprogramm, an dem sich viele Gruppenbeteiligen könnten <strong>und</strong> in dem die interdisziplinäreZusammenarbeit gefördert wird. Auchzu diesem Themenfeld sollte man in naher Zukunftein kleines Symposium abhalten, um Thema<strong>und</strong> Machbarkeit zu erk<strong>und</strong>en.Die Querbeziehungen zu den anderen deutschengeowissenschaftlichen Fachgesellschaftenkönnten in einer Dachgesellschaft besserkoordiniert werden. Eine solche Dachgesellschaftist geplant <strong>und</strong> es liegen auch schon dieStatuten vor. Durch ein Votum der Mitgliederwurde die Gründung einer Dachgesellschaftauch gestützt. Im Augenblick gibt es jedochvon einigen anderen Fachgesellschaften einenerheblichen Diskussions- <strong>und</strong> Klärungsbedarf.Die „Paläontologische Zeitschrift“ hat sich in derletzten Zeit unter Oliver Rauhut als verantwortlichemSchriftleiter wieder zu einem internationalrenommierten Journal entwickelt. Der jetzterreichte Qualitätsstandard muss weiterentwickeltwerden, um noch mehr exzellente Manuskripteweltweit einwerben zu können. Die Zeitschrift„Fossilien“ bietet eine weitere sehrattraktive Möglichkeit für unsere Mitglieder,ihre Aktivitäten <strong>und</strong> Erfahrungen einem breiterenPublikum vorzustellen. Unsere Beiträgewerden dort von Günter Schweigert <strong>und</strong> MichaelMaisch redaktionell <strong>und</strong> wissenschaftlich inexzellenter Weise betreut <strong>und</strong> ein hoher Qualitätsstandardist somit gesichert. Wir sollten dieseMöglichkeit intensiv nutzen; dieser Appellrichtet sich nicht nur an die nicht-professionellenMitglieder unserer Gesellschaft, sondernauch an die hauptberuflich tätigen Wissenschaftler.Die von uns mit dem Logo der Gesellschaftversehenen Beiträge erhöhen die Sichtbarkeitunserer wissenschaftlichen Arbeit <strong>und</strong>natürlich auch der Gesellschaft. Dies gilt gleichermaßenauch für unser Mitteilungsblatt <strong>GMIT</strong>,das jetzt für uns von Alex Nützel redaktionellbetreut wird. Wir können als Gesellschaft abernoch mehr tun – ich denke da an die Gründungeines „Newsletter – Paläontologie-online“ oderähnliches, um interessante Vorhaben, Forschungsergebnisse,Ideen, Diskussionsbeiträge<strong>und</strong> Aktivitäten zeitnah zu präsentieren.Ich verspreche mir aus einer zunehmendenSichtbarkeit unserer Aktivitäten in der Öffentlichkeitauch eine größere Chance, Spenden einzuwerben<strong>und</strong> auch Sponsoren zu gewinnen, dieunsere Arbeit unterstützen könnten. Für die notwendigenAktivitäten, z.B. zur Förderung deswissenschaftlichen Nachwuchses, exzellenteWissenschaft, spezielle Publikationen, Tagungen,Symposien, Investitionen zur Verbesserungder Infrastruktur der Paläontologischen Gesellschaft<strong>und</strong> vieles mehr, haben wir leider nur wenigeRessourcen. Unsere Einnahmen aus Spendensind leider nur sehr gering. Aber vielleichtlässt sich das ja ändern – jedes Mitglied kanndazu etwas beitragen.68 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENPALÄONTOL. GESELL.Trotz der bekannten Probleme sehe ich das Fach<strong>und</strong> unsere Gesellschaft auf einem sehr gutenWeg. Wichtig ist allerdings, dass alle Mitgliedersich für die Ziele der Gesellschaft <strong>und</strong> der paläontologischenWissenschaften aktiv einsetzen<strong>und</strong> diese tatkräftig unterstützen.In diesem Sinne freue ich mich auf eine erfolgreicheZusammenarbeit mit Ihnen!IhrJReitnerInternationale Regeln für die Zoologische Nomenklatur: wichtigeÄnderungenDie Änderungen betreffen die Erweiterung <strong>und</strong>ebenso die Verbesserung der nach den Regelnzulässigen Publikationsweisen, vor allem in Hinsichtauf elektronische Verfahren. Mit den Änderungenwird ein Official Register of ZoologicalNomenclature eingeführt (mit ZooBank als Online-Version).Danach ist elektronische Publikationnach 2011 unter bestimmten Voraussetzungenzulässig; demgegenüber ist Publikation aufoptischen Speicherplatten [optical discs] ab2013 unzulässig. Für elektronisches Publizierengelten folgende Bedingungen: Vor der Veröffentlichungmuss die Arbeit bei ZooBank registriertwerden; in der Arbeit muss das Publikationsdatumangegeben <strong>und</strong> darauf hingewiesen sein,dass die Registrierung erfolgt ist. Die Registrierungbei ZooBank muss den Namen des elektronischenArchivs enthalten, in dem die Arbeit verwahrtist, ebenso die jeweilige ISSN- oder ISBN-Nummer. Die Registrierung neuer wissenschaftlicherNamen <strong>und</strong> nomenklaturischer Handlungenist nicht erforderlich. Die Kommission hatsich vergewissert, dass ZooBank in der Lage ist,den durch die Änderungen erforderlichen Anforderungengerecht zu werden.Die Entscheidung ist zuerst publiziert in: Bulletinof Zoological Nomenclature, 69 (3) 2012: 161–169. London: Amendment of Articles 8, 9, 10, 21and 78 of the International Code of ZoologicalNomenclature to expand and refine methods ofpublication. Die aktuelle offizielle englische Fassungist online verfügbar: iczn.org/code.Die 4. Auflage der Internationalen Regeln für dieZoologische Nomenklatur ist weiterhin gültig.Der offizielle Deutsche Text ist 2000 bei dem NaturwissenschaftlichenVerein in Hamburg veröffentlichtworden (Abhandlungen des naturwissenschaftlichenVereins Hamburg, Band (NF) 34,232 S.). Bezug über den Buchhandel oder direktbei dem Kommissionsverlag Goecke & Evers,Sportplatzweg 5, 75210 Keltern-Weiler, E-Mail:books@insecta.de.Bei der jetzigen Publikation handelt es sich umein Supplement zu diesen Regeln. Sonderdruckekönnen auch bei dem Berichterstatter direkt angefordertwerden (E-Mail: otto.kraus@ zoologie.uni-hamburg.de). Otto Kraus (Hamburg)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 69
PALÄONTOL. GESELL.GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENGemeinsame Tagung der Paläontologischen Gesellschaft <strong>und</strong> derChinesischen Paläontologischen Gesellschaft – Göttingen,23.–27. September 2013„Paläobiologie & Geobiologie von Fossillagerstättenin der Erdgeschichte“/„Palaeobiology &Geobiology of Fossil Lagerstätten through EarthHistory“Veranstalter• Paläontologische Gesellschaft (PG)• Paläontologische Gesellschaft von China (PSC)• Georg-August-Universität Göttingen, GeowissenschaftlichesZentrum (GZG)• Institut für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie derChinesischen Akademie der Wissenschaftenin Nanjing (NIGPAS)• Institut für Wirbeltierpaläontologie <strong>und</strong> Paläoanthropologieder Chinesischen Akademieder Wissenschaften in Peking (IVPP)Gefördert durch:• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)• Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft<strong>und</strong> Kultur (MWK)• Georg-August-Universität Göttingen, GeowissenschaftlichesZentrum (GZG)• China Association for Science and Technology(CAST)• National Natural Science Fo<strong>und</strong>ation of China(NSFC)• China Fossil Protection Fo<strong>und</strong>ation (CFPF)• Chinesische Akademie der Wissenschaften(CAS)70 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENPALÄONTOL. GESELL.Organisationskomitee• Professor Dr. Joachim Reitner (PG, GZG) –1. Tagungsleiter• PD Dr. Michael Gudo (PG) – Tagungsleitungs-Mitglied• Dr. Mike Reich (PG, GZG) – Tagungsleitungs-Mitglied• Professor Dr. Qun Yang (PSC) – 2. Tagungsleiter• Professor Dr. Yongdong Wang (PSC) –Tagungsleitungs-Mitglied• n. n. (PSC) – Tagungsleitungs-Mitglied• n. n. (NIGPAS) – Tagungsleitungs-Mitglied• n. n. (IVPP) – Tagungsleitungs-MitgliedLokales Organisationskomitee:• Professor Dr. Joachim Reitner – Tagungsleitung• Dr. Mike Reich – stellv. Tagungsleitung• Gabriele Schmidt – Sekretariat• Ines Ringel – Sekretariat• Thomas Bode – Logistik, IT• Dorothea Hause-Reitner – Logistik• Cornelia H<strong>und</strong>ertmark – Logistik, Werbung• Gerhard H<strong>und</strong>ertmark – Logistik, Photographie• Birgit Röhring – Logistik• Tanja R. Stegemann – Logistik, ExkursionenTagungsspracheEnglisch <strong>und</strong> DeutschWissenschaftliches KomiteeAnkündigung im zweiten ZirkularVorläufiges Tagungsprogramm:• 20. September 2013 (Freitag)Ankunft der (internationalen) Tagungsteilnehmer• 21. September 2013 (Samstag)Exkursionen• 22. September 2013 (Sonntag)Exkursionen• 23. September 2013 (Montag)Exkursionen (vormittags), Ankunft der Tagungsteilnehmer<strong>und</strong> Registrierung, Vorstandssitzungder Paläontologischen Gesellschaft(nachmittags), Workshops (nachmittags),(voraussichtlich) Eröffnung einer gemeinsamenSonderausstellung (abends),Empfang & Icebreaker-Party (abends)• 24. September 2013 (Dienstag)Registrierung, Eröffnung (vormittags), Tilly-Edinger-Symposium (vormittags), wiss.Vorträge (vormittags & nachmittags), Poster-Session (nachmittags), Gruppenphoto (mittags),öffentl. Abendvortrag (in dt.) & Empfang• 25. September 2013 (Mittwoch)Vorträge (vormittags), Begleitprogramm(nachmittags), Kongress-Dinner (abends)• 26. September 2013 (Donnerstag)wiss. Vorträge (vormittags & nachmittags),Mitgliederversammlung Paläontologische Gesellschaft(nachmittags), MitgliederversammlungPaläontologische Gesellschaft von China(nachmittags), Poster-Session (früher Abend)• 27. September 2013 (Freitag)Extra-Session „Future of Chinese and GermanPalaeontology“ (vormittags), Workshops(vormittags), Abschlusszeremonie, Verleihungder Posterpreise (mittags), Abreise(nachmittags), Abfahrt zu den Exkursionen(nachmittags)• 28. September 2013 (Samstag) Exkursionen• 29. September 2013 (Sonntag) Exkursionen,AbreiseVorläufiges wiss. ProgrammDas zentrale Thema der gemeinsamen Tagungsind „Fossillagerstätten“. Das detaillierte Programmmit den Symposien, Keynote-Vorträgen,Workshops sowie dem öffentlichen Abendvortragwird im zweiten Zirkular bekannt gegeben.Wiss. Vorträge <strong>und</strong> Poster-PräsentationenDetails werden im zweiten Zirkular bekannt gegeben.Kurzfassungen <strong>und</strong> TagungsbandDetails werden im zweiten Zirkular bekannt gegeben.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 71
PALÄONTOL. GESELL.GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENExkursionenTagungsortAn den Wochenenden vor <strong>und</strong> nach der Tagungsollen verschiedene Exkursionen zu klassischen<strong>und</strong> neuen Fossillagerstätten in Deutschlandstattfinden. Details werden im zweiten Zirkularbekannt gegeben.Begleitprogramm (abhängig vom Interesse)• „Stadtführung“ – Göttingen• „Stadtführung (Untergr<strong>und</strong>)“ – Göttingen• „(Aktiver) Besuch einer Bierbrauerei“ – Einbeck• „(Aktiver) Besuch einer Schnapsbrennerei“ –Nörten-Hardenberg• „Besuch der „alten“ Kaiserstadt Goslar“ –UNESCO-WeltkulturerbeTagungspreise• „Poster awards“• „Tilly-Edinger award“ der PaläontologischenGesellschaft• „Young Scientist award“ der beiden Präsidentender Paläontologischen Gesellschaft<strong>und</strong> der Chinesischen Paläontologischen Gesellschaftfür zwei junge Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen (Deutschland & VolksrepublikChina). Des Weiteren sollen voraussichtlich20 Reisestipendien an deutsche <strong>und</strong>chinesische (aktiv teilnehmende) Studierendevergeben werden. Details werden im zweitenZirkular bekannt gegeben.Die gemeinsame Tagung wird im GeowissenschaftlichenZentrum (GZG) der Georg-August-Universität Göttingen stattfinden. Göttingen isteine alte Universitätsstadt im Herzen Deutschlands.Weitere Informationen unter:www.goettingen-tourismus.de/www.uni-goettingen.de/www.gzg.uni-goettingen.de/www.geomuseum.uni-goettingen.de/AnreiseDetails werden im zweiten Zirkular bekannt gegeben.Registrierung & TagungsgebührenDetails werden im zweiten Zirkular bekannt gegeben.Fristen <strong>und</strong> wichtige Termine• Erstes Zirkular: 15. Dezember 2012• Tagungs-Webseite: 01. Januar 2013• Zweites Zirkular: 15. April 2013• Drittes Zirkular: 01. Juli 2013• Kurzfassungen: 01. Juli 2013• Frühregistrierung: 01. Juli 2013• Spätregistrierung: 01. September 2013• Finales Zirkular: 15. September 201372 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENGeowissenschaftliche ÖffentlichkeitsarbeitGONDWANA – Das Praehistorium – Phase IIDas „Erlebnis Erdgeschichte <strong>und</strong> Evolution“ im Saarland baut anEs ist eine einzigartige Mischung aus modernermusealer Einrichtung, Freizeitpark <strong>und</strong> Bildungszentrum:In GONDWANA – Das Praehistorium,Ende 2008 in Schiffweiler/Landsweiler-Reden(Landkreis Neunkirchen, Saarland) eröffnet,haben die naturgetreuen, lebendigen <strong>und</strong> wissenschaftlichkorrekt nachempf<strong>und</strong>enen „Erdzeitlandschaften“schon H<strong>und</strong>erttausende vonBesuchern angelockt. Staunen, Landschaftserlebnis,Information, manchmal ein bisschenSchreck <strong>und</strong> etwas Furchtsamkeit vor allem beiden Jüngeren – das wird erreicht durch äußerstdetailgetreue <strong>und</strong> realistische Landschaftsnachbautender Erdgeschichte. Präkambrium, Silur,Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura <strong>und</strong> Kreide –alles ist in Phase I dieses Projekts mit hohemAnspruch mit mindestens einer Landschaft zumDurchgehen <strong>und</strong> Erleben vertreten. Getextetwird wenig, das meiste ist zum Sehen, Staunengeschaffen – man lernt am Weg, ohne es wirklichzu merken. Die Fachwelt der Geologie/Paläontologie,anfangs manchmal skeptisch <strong>und</strong> etwasauf Abstand zu einer mutmaßlich „Funpark“-orientiertenEinrichtung bedacht, fand dann bald,dass <strong>hier</strong> alles korrekt <strong>und</strong> „mit rechten Dingen“zugehe. Geo-Studentenexkursionen ziehen mittlerweiledurch die Erdgeschichte in Landsweiler-Reden, weniger sicherlich, um die Gr<strong>und</strong>zügeder Erdgeschichte <strong>und</strong> der biologischen Evolutionzu lernen, als vielmehr um zu erfahren, wieWissenschaft lebendig <strong>und</strong> zugleich ohne unzulässigeVerflachung einem breiten Publikum wirkungsvollgezeigt werden kann.Stets galt seit Eröffnung der Phase I im Dezember2008 der Plan, nicht mit dem Aussterben derDinosaurier aufzuhören, sondern in einer „PhaseII“ noch die Erdneuzeit <strong>und</strong> dann speziell dieMenschheitsgeschichte bis in die Moderne hineinzu liefern. Dieses Versprechen, das weiteredesignerische, filmische <strong>und</strong> animatronischeHöhepunkte bringt, wird nun gerade realisiert.In der Halle, die mindestens ebenso groß wie dieder Phase I ist, brummen die Arbeiten an den unterschiedlichstenEnden: Kunstfelsen werdenmodelliert, Pflanzen vorbereitet, animatronischeModelle programmiert <strong>und</strong> getestet, Rohr-GONDWANA – Das Praehistorium,Phase I (seit 2008): Zeitreisevon den Stromatolithendes Präkambriums, „Karbonwald“GONDWANA – Das Praehistoriumumfasst bisherLandschaftshallen der ganzenErdgeschichte bis zum Endeder Kreide.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 73
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENGONDWANA – Das Praehistorium, Phase II (2013): Vom Raumfahrtzeitalter zurück bis zur Kreide.Noch herrscht Baustellen-Stress bei den Großen der patagonischen Dinosaurier-Szene, Giganotosaurus(links) <strong>und</strong> Titanosaurus (rechts). In einer effektvollen Show werden sich die weltweit bishergrößten animatronischen Dinosaurier lebensecht bewegen.gerüste geschweißt, Mauern <strong>und</strong> Treppen gebaut.Ende März 2013 wird alles fertig sein,wenn die Arbeiten planmäßig weiterlaufen. MancheLandschaften wie „Messel“, die Savanne mitAustralopithecus oder die eiszeitliche Taiga sindschon im Gr<strong>und</strong>riss fertig, andere, wie der Raumüber die Industrialisierung oder die Konquistadoren-Szene,nehmen erst langsam Gestalt an.Wenn alles fertig <strong>und</strong> eröffnet ist, dann werdendie Erdgeschichte, die Menschheitsgeschichte<strong>und</strong> die Evolution in einer weltweit bisher einmaligenKonzeption, Vollständigkeit <strong>und</strong> Realitätsnähenachgebaut sein – als Ziel für Besuchervon 3 bis 99, für Kindergärten <strong>und</strong> Schulklassenjeder Jahrgangsstufe <strong>und</strong> für Busreisen, Touristengruppen<strong>und</strong> Exkursionen jeder Art.Weitere Infos unter 06821/9316325; Internet:www.gondwana-praehistorium.de.Andreas Braun (Bonn, wissenschaftlicherLeiter GONDWANA – Das Praehistorium)Zwo7fünF: Expeditionen, Köpfe & StaubfängerWer ist nicht fasziniert beim Anblick von Gold<strong>und</strong> „edlen Steinen“ oder historischen Objekten?Wer kennt sie nicht – die Momente derSpannung beim Freilegen verborgener Dingeoder aufsteigende Glücksgefühle bei einemBernstein-Strandf<strong>und</strong>? Die Georg-August-Uni-74 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONENversität Göttingen beherbergt zahlreiche ungehobeneSchätze verschiedenster Expeditionen<strong>und</strong> naturk<strong>und</strong>licher Forschungsfahrten seitdem frühen 18. Jahrh<strong>und</strong>ert: so unter anderemvon der (Deutsch/)Dänischen Arabienexpedition(1761–1767), den Cookschen Südseereisen(1769–1780), verschiedensten akademischenForschungsreisen nach Sibirien <strong>und</strong> Alaska(1785–1806), der ersten russischen Weltumsegelung(1803–1806), den ersten deutschen <strong>und</strong>schwedischen Nordpolarexpeditionen (1868,1869–1870, 1872), der Deutschen AtlantischenExpedition mit dem Forschungsschiff „Meteor“(1925–1927), der Deutschen Himalaya-Expedition(1934) <strong>und</strong> vielen anderen mehr. Ob Briefe,Tagebücher, Photographien, Medaillen, unbekannte<strong>und</strong> bekannte fossile Tiere <strong>und</strong> Pflanzen,Mineralien, Gesteine, Meteoriten, Edelsteine<strong>und</strong> anderes Material – oft war die erste Ausbeuteder Geologen, Mineralogen, Paläontologen<strong>und</strong> anderer Naturforscher auf solchen„Fahrten ins Ungewisse“ sehr zahlreich <strong>und</strong>auch wertvoll, entsprechend abenteuerlichmanchmal der Transport.Anlässlich des 275jährigen Jubiläums der Gründungder Göttinger Universität <strong>und</strong> der Etablierungder Göttinger Geowissenschaften vor 200Jahren präsentiert die Sonderausstellung„Zwo7fünF: Expeditionen, Köpfe & Staubfänger.Göttinger Mineralogie, Geologie & Paläontologie“am Geowissenschaftlichen Museum in GöttingenZeitzeugen aus mehr als vier Jahrh<strong>und</strong>erten.Eine „Tauchfahrt“ von der Vergangenheitbis in die Gegenwart – ein Gang durch die Geschichteder Göttinger Geowissenschaften,unter anderem anhand von Expeditionsmaterial<strong>und</strong> -f<strong>und</strong>en, Zeichnungen, Photographien sowieanderen Dokumenten jener Zeiten. DasProjekt wurde fre<strong>und</strong>licherweise durch den„Universitätsb<strong>und</strong> Göttingen e. V.“ <strong>und</strong> die<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 75
GEOLOBBY – GESELLSCHAFTEN · VERBÄNDE · INSTITUTIONEN„Fre<strong>und</strong>e der Geowissenschaften der UniversitätGöttingen e. V.“ gefördert.Die Sonderausstellung wird noch bis Ende Oktober2013 im Geowissenschaftlichen MuseumGöttingen (Goldschmidtstr. 1–5) zu sehen sein.Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–17 Uhr, jeden 1. So imMonat 10–16 Uhr. Der Eintritt ist frei! WeitereInformationen unter www.geomuseum.unigoettingen.deMike Reich, Tanja Stegemann, AlexanderGehler & Thomas Daniel (Göttingen)Tag der Steine in der Stadt 2012Nunmehr zum fünften Mal fanden deutschlandweitVeranstaltungen zu dem vom gleichnamigenNetzwerk initiierten Aktionstag statt. ImJahre 2012 gruppierten sich 36 Aktivitäten in 18Städten um den 13. Oktober. Ein umfangreichesProgramm gab es wie schon in den vergangenenJahren in Berlin, diesmal mit sieben Veranstaltungenan vier Tagen unter dem verbindendenThema „Naturwerksteine als Gestaltungselementstädtischer Freiräume“. Erstmals beteiligtesich Uelzen in Niedersachsen <strong>und</strong> dasgleich mit fünf Aktionen von gemeinsamer lebendigerWerkstatt der Uelzener Steinmetzbetriebebis zur Ausstellung Bücher <strong>und</strong> Steineder Stadtbibliothek. Außerdem konnte man denTag der Steine in Berlin-Buch, Bünde (Westfalen),Burghausen (Bayern), Cottbus, Dresden,Halle, Hannover, Herford (Westfalen), Hof,Königslutter (Niedersachsen), Krickenbach(Rheinland-Pfalz), Leipzig, Ludwigshafen amRhein, Lübeck, Magdeburg <strong>und</strong> Vlotho (Westfalen)erleben. Über Teilnehmerrekorde freutensich besonders Mathias Polster auf seiner Führungzur St. Marienkirche in Herford mit 70 Interessenten<strong>und</strong> das Steinmetzzentrum Königsluttermit etwa 200 Besuchern.2013 findet der Aktionstag um den 19. Oktoberstatt. Wie man 2012 wiederum erfahren hat,empfehlen sich für Aufmerksamkeitserfolg <strong>und</strong>entsprechende Resonanz: Zusammenarbeit mitörtlichen Vereinen, Ankündigungen in der Lokalpresse<strong>und</strong> das gemeinsame Auftreten vonengagierten Aktivisten aus verschiedenen Berufsgruppenfür bereichernd vielfältige Blickwinkelauf die Steine in der Stadt.Gerda Schirrmeister (Berlin)Seniorparkmanagerin für die Gärten der Welt,Beate Reuber, im italienischen Renaissance-Garten (Giardino della Bobolina) vor dernamengebenden Skulptur aus Carrara-MarmorFoto: G. Schirrmeister76 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
MultimediaPersonaliaTagungsberichteAnkündigungenLeserbriefe<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 77
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENNeue BücherReise in die ErdgeschichteGerth, A.: Reise in die Erdgeschichte der Oberlausitz,des Elbsandsteingebirges <strong>und</strong> Nordböhmens(Teil 1: Proterozoikum bis Kreide). - 528 S.mit 764 Fotos <strong>und</strong> 181 Karten, Diagrammen <strong>und</strong>Abbildungen. Spitzkunnersdorf (OberlausitzerVerlag Frank Nürnberger) 2011ISBN 978-3-941908-22-2 · Preis: 24,95 €Das Werk, von dem <strong>hier</strong> zunächst der erste Teilvorgelegt wird, ist mit dem Untertitel als „geologischerExkursionsführer zu 304 ausgewähltenZielen“ in Ostsachsen charakterisiert. Vorangestelltist eine geographisch-geologische Einführung(60 S.). Im Hauptteil werden die einzelnenExkursionsziele nach ihrer stratigraphischenZuordnung behandelt: Proterozoikum <strong>und</strong> Kam-brium (60 Ziele; 182 S.), Ordovizium (2 Ziele;12 S.), Silur (2 Ziele; 8 S.), Devon (9 Ziele; 18 S.),Karbon (17 Ziele; 25 S.), Perm/Trias/Jura (8 Ziele;21 S.), Kreide (41 Ziele; 142 S.). Die känozoischenExkursionsziele (86 Tertiär; 80 Quartär)werden in Teil 2 beschrieben. Ein Anhang voninsgesamt 40 Seiten enthält ein Stichwortverzeichnis,ein Glossar von Fachbegriffen, das Literaturverzeichnisfür beide Bände sowie tabellarischeÜbersichten. Die Behandlung der einzelnenExkursionsziele umfasst jeweils eine sehrausführliche textliche Beschreibung sowiereichliches Bildmaterial in Form von farbigenKartenskizzen <strong>und</strong> Graphiken. Dabei werdennicht nur die geologischen Aufschlüsse beschrieben,sondern auch ausführliche Zusatzinformationenzur Gewinnung <strong>und</strong> Verwendungvon Gesteinen sowie anderen, mit dem Gestein<strong>und</strong> der geologischen Situation im Zusammenhangstehenden Phänomenen gegeben.Auch kulturelle Sehenswürdigkeiten wie Museen,Schlösser oder Stadtensembles mit Bezug zuGesteinen oder geologischen Erscheinungenwerden berücksichtigt.Hinsichtlich der inhaltlichen Darbietung gibt es –soweit das bei einer stichprobenartigen, aberdoch sehr umfangreichen Prüfung möglich ist –keinerlei Defizite festzustellen. Eher überraschtdie auf einer umfangreichen Detailkenntnis desVerfassers basierende große Stofffülle. Wennman jedoch bedenkt, dass das zweibändigeWerk mit insgesamt wahrscheinlich mehr als800 Seiten als Exkursionsführer deklariert ist,ergibt sich für den Rezensenten ein gewissesDilemma für die bestimmungsgemäße Benutzung.Für diesen Zweck ist auch die Gliederungdes Stoffes nach stratigraphischen Aspekteneinigermaßen ungewöhnlich. Eine Exkursionauch nach regionalen <strong>und</strong> logistischen Aspektenzusammenzustellen, ist durch die sehr gute Aufbereitungdes Stoffes mittels Piktogrammen,Kartenskizzen <strong>und</strong> Tabellen selbstverständlichproblemlos möglich, erfordert jedoch etwaszusätzlichen Aufwand.Zusammenfassend ist festzustellen, dass demVerfasser <strong>und</strong> dem Verlag eine sehr eindrucksvolleBuchveröffentlichung über eine Region78 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENgelungen ist, die in dieser Vollständigkeit <strong>und</strong>Detailtiefe noch niemals dargestellt worden ist.Die unkonventionelle Darbietung des Stoffes<strong>und</strong> die Ergänzung mit instruktiven Abbildungen,Graphiken <strong>und</strong> Kartenskizzen sind für dengeologisch interessierten Laien wie für den geowissenschaftlichenFachmann gleichermaßenlehrreich <strong>und</strong> wertvoll. Gemessen an Papier- <strong>und</strong>Druckqualität sowie der üppigen Ausstattungmit farblichen Darstellungen ist der Preis rechtmoderat. Werner Pälchen (Halsbrücke)MeteoriteSchultz, L. & Schlüter, J.: Meteorite. - 96 S., Hardcover,Darmstadt (Primus Verlag ) 2012ISBN: 978-3-86312-012-2 · Preis: 19,90 €Deutschsprachige Bücher über Meteorite, „dieSteine, die vom Himmel fallen“, sind eher Mangelware.Das nun in der Erstauflage erschieneneBuch „Meteorite“ ist eine gelungene deutschsprachigeEinführung in die Meteoritenk<strong>und</strong>e,die sich an ein breites Publikum wendet.Die beiden Autoren Ludolf Schultz <strong>und</strong> JochenSchlüter erklären in acht Kapiteln auf allgemeinverständliche Weise, was Meteorite eigentlichsind, woher sie kommen, woraus sie bestehen,welche Arten von Meteoriten es gibt, welche einzigartigenInformationen sie über die Entstehungdes Sonnensystems <strong>und</strong> den Ursprung derErde liefern <strong>und</strong> vieles mehr. Das Buch spanntden Bogen von den historischen Wurzeln bis hinzu den wichtigsten Ergebnissen der Meteoritenforschung.Der Text ist dabei immer wieder aufgelockertdurch unterhaltsame Geschichten <strong>und</strong>Begebenheiten über Meteoritenf<strong>und</strong>e <strong>und</strong> wissenschaftlicheEntdeckungen. Die reichhaltigehochwertige Bebilderung komplettiert das Buch.Der Anhang enthält eine Aufstellung der inDeutschland, Österreich <strong>und</strong> der Schweiz gef<strong>und</strong>enenMeteorite sowie den wichtigen Hinweisauf deutsche Museen, in denen man Meteoritein eigenen Augenschein nehmen kann.Mit 19,90 € ist dieses empfehlenswerte Werkerschwinglich <strong>und</strong> wird sowohl dem Geowissenschaftlerals auch dem interessierten Laien einwertvoller Einstieg in das Thema der Meteoritensein.Falko Langenhorst (Jena)Fossilien sammeln in England •Wales • SchottlandWulf, H.: Fossilien sammeln in England • Wales •Schottland. - 176 S., 340 farb. Abb. Wiebelsheim(Quelle & Meyer Verlag) 2013ISBN 978-3-494-01526-2 · Preis: 19,95 €In der Edition Goldschneck im Quelle & MeyerVerlag ist das Buch „Fossilien sammeln in England,Wales <strong>und</strong> Schottland“ von Herwig Wulferschienen. Beim ersten Durchblättern des imhandlichen DIN-A5-Format gedruckten Buchesfielen die in großer Zahl vorhandenen farbigenAbbildungen der Fossilien auf. Diese sind ausreichenddetailliert wiedergegeben. Es mussteallerdings, aufgr<strong>und</strong> des Buchformates, einKompromiss eingegangen werden zwischen derGröße der Fossilfotos <strong>und</strong> dem Bestreben, möglichstviele repräsentative Fossilien abbilden zukönnen. Das Layout wirkt fre<strong>und</strong>lich <strong>und</strong> modern.In Vorwort <strong>und</strong> Einleitung wird auf die Besonderheitendes Landes <strong>und</strong> der Geologie, dienicht zu unterschätzenden SchutzbestimmungenGroßbritanniens (S.S.S.I.) <strong>und</strong> auf die persönlicheSicherheit (Tidenkalender) hingewiesen.Abger<strong>und</strong>et wird die Einleitung durchpraktische Hinweise, verwendetes Kartenmaterial,eine geologische Übersichtskarte <strong>und</strong> entsprechendeHinweise zu Internetseiten, die sehrzu empfehlen sind.Inhaltlich beginnt die Reise im Süden Englands.Entsprechend der Stratigraphie mit Tertiär, Kreide<strong>und</strong> dem Jura entlang der Küste. Der meisteRaum wird dabei der Isle of Wight eingeräumt.Mit 115 Seiten liegt der Schwerpunkt der F<strong>und</strong>stellenbeschreibungenauf dem Süden Englands.Anschließend folgt ein Sprung an dieKüste Yorkshires. Allerdings werden mit zehnSeiten lediglich die bekanntesten Jura-F<strong>und</strong>stellenbeschrieben. Danach folgen das Paläo-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 79
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENzoikum in Wales mit knapp fünf Seiten, Paläozoikum<strong>und</strong> Jura Schottlands sowie der Isle of Skyemit 19 Seiten. Die Beschreibung der einzelnenF<strong>und</strong>orte ist recht umfangreich <strong>und</strong> umfassterfreulicherweise nicht nur die Anfahrt, sondernauch die Parkmöglichkeiten <strong>und</strong> den eigentlichenWeg zur F<strong>und</strong>stelle. Diese werden vielfachnoch um Informationen zu Sehenswürdigkeitenim Umfeld des F<strong>und</strong>ortes, zur Gastronomie oderauch zu historischen Besonderheiten, wie z.B.die der namensgebenden Sammler, ergänzt. DieHinweise zu F<strong>und</strong>möglichkeiten sind ausführlich<strong>und</strong> praxisnah. Allerdings haben sich einige kleineFehler eingeschlichen. So ist die Ortsangabeauf Seite 130 zur F<strong>und</strong>stelle Blockley falsch; esmuss statt „Richtung Paxton“ – „Richtung Paxford“heißen. Die Abbildung 284 auf Seite 133zur F<strong>und</strong>stelle Ravenscar zeigt nicht die Küstebei Ravenscar, sondern das Nordkliff bei derOrtschaft Robin Hood’s Bay. Der Sammler muss<strong>hier</strong> nämlich beachten, dass die Küste beiRavenscar sehr stark zerklüftet <strong>und</strong> bei auflaufenderFlut äußerst gefährlich ist. Sicherlichwären für einige Kapitel, gerade zu den abgelegenen<strong>und</strong> manchmal schwer zugänglichenF<strong>und</strong>stellen mehr Informationen wünschenswert.Aber das kann der Überblick über ein ganzesLand auf 176 Seiten natürlich nicht wiedergeben.Doch mit dem vorliegenden Buch hat derLeser einen schönen Überblick über wichtigeFossilf<strong>und</strong>stellen mit sehr schönen Fotos <strong>und</strong>genügend Informationen, um eine erfolgreicheExkursion an Englands Küsten zu starten.Thomas Rymer (Gauting)War alles im Eimer!Collinson, M. E., Manchester, St. R., Wilde, V.: FossilFruits and Seeds of the Middle Eocene Messelbiota, Germany. - Abhandlungen der SenckenbergGesellschaft für Naturforschung 570: 2<strong>51</strong>S., 2 Abb., 3 Tab., 76 Tafeln; Frankfurt a.M. 2012ISBN 978-3-<strong>51</strong>0-61400-4 · Preis: 49,80 €Der Messeler Ölschiefer enthält sehr viel Wasser.Trocknet dieses Gestein, blättert es auf <strong>und</strong>zerfällt in kleine Stücke. Fossilf<strong>und</strong>e müssendeshalb bis zur Präparation feucht gehaltenwerden. Größere Ölschieferplatten mit Fossilienwandern in Kunststofftüten, die beschriftet <strong>und</strong>mit Paketband verklebt werden. Für die vielenKleinf<strong>und</strong>e wäre diese Prozedur zu aufwändig.Deshalb stehen an jeder Grabungsstelle in derGrube Messel Eimer mit Wasser. Die Stücke werdeneinfach ins Wasser geworfen, sortiert nachBlättern, Früchten <strong>und</strong> Samen sowie Insekten.Was im Laufe der vielen Grabungskampagnen inden „Früchteeimern“ landete, wurde präpariert,fotografiert <strong>und</strong> in „Schneewittchensärgen“(durchsichtige Plexiglasschachteln) mit Glycerin<strong>und</strong> Thymol gegen Austrocknen <strong>und</strong> Pilzbefallaufbewahrt. Über Jahrzehnte sammelten sichZigtausende von F<strong>und</strong>en an.Der Stand der wissenschaftlichen Bearbeitungdieser Früchten <strong>und</strong> Samen aus Messel wurdenun von den Paläobotanikern Collinson, Man-80 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENchester <strong>und</strong> Wilde in einer umfangreichen Monographiepubliziert. Bei 140 Gattungen aus 36Familien gelang ihnen die taxonomische Zuordnung.Viele Arten werden zum ersten Mal beschrieben.65 Fossiltypen können derzeit nochkeiner bestimmten Pflanzenfamilie zugeordnetwerden: Arbeit für die Zukunft. Auf 76 Tafelnwerden die anatomischen Einzelheiten <strong>und</strong> dieVariationsbreite der Fossilien abgebildet.Messel ist mit dieser Diversität einer der weltweitwichtigsten F<strong>und</strong>punkte alttertiärerPflanzen.Es wäre wünschenswert, wenn das vorhandeneWissen zur Messelflora auch der „breiten Öffentlichkeit“zugänglich wäre, z.B. in einempopulärwissenschaftlichen Buch.Kurt Goth (Dresden)dem nicht nur die Oberflächengeologie, sondernauch der Boden, die Hydrogeologie, die Rohstoffeinsgesamt erläutert werden. Das Beiheftzum jüngst erschienenen Doppelblatt Eisenhüttenstadt<strong>und</strong> Eisenhüttenstadt Ost/Cybinkaumfasst immerhin informative 186 Seiten.Bezogen werden können die Karten u.a. überden Vertrieb des LBGR in Cottbus (www.lbgr.brandenburg.de; oder per E-Mail: lbgr@lbgr.de)zum Preis von 15,– €.Und wer sich erst einmal generell <strong>und</strong> umfassendinformieren will, dem wird der Atlas zurGeologie von Brandenburg empfohlen, der angleicher Stelle für eine Gebühr von 25,– € zubeziehen ist. Werner Stackebrandt (Potsdam)Neue KartenNeue geologische Karten imGrenzraum Brandenburg – PolenGeologie ist grenzenlos – dieses alte Tagungsmottoder GGW/DGG könnte auch über den vonden geologischen Diensten von Brandenburg(LBGR) <strong>und</strong> Polen (PIG/PGI) erarbeiteten grenzüberschreitendengeologischen Karten im Maßstab1 : 50.000 stehen. Die Karten fußen auf umfangreichenGeländearbeiten <strong>und</strong> stellen somit‚echte‘ Neukartierungen dar. Der gemeinsamenBlatterarbeitung gingen intensive Diskussionen<strong>und</strong> Abstimmungen zu den Kartierungseinheiten<strong>und</strong> grenzüberschreitenden geologischenModellen voraus, die die regionalgeologischenVorstellungen an der Nahtstelle beider Länderwesentlich befruchteten. Neben den hochauflösendenZweischichtdarstellungen der Oberflächengeologiezeigen Profile den Bau desUntergr<strong>und</strong>s. Allen Karten ist ein zweisprachigesBeiheft in Deutsch <strong>und</strong> Polnisch beigegeben, in<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 81
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENPersonaliaAlberti-Preis 2012 geht an Wolfgang Sippel aus EnnepetalZum 10. Mal wurde am 9. November in Ingelfingen(Baden-Württemberg) der mit 10.000,- €dotierte Friedrich von Alberti-Preis derHohenloher Muschelkalkwerke verliehen, <strong>und</strong>zwar an den Privatpaläontologen WolfgangSippel aus Ennepetal. Die 1997 von 20 Unternehmenbegründete Stiftung würdigt mit demWissenschaftspreis herausragende Leistungenauf dem Gebiet der Paläontologie. Geehrt werdenim Wechsel Berufspaläontologen <strong>und</strong> Amateure.Der Preisträger wurde ausgezeichnet für seinejahrzehntelange ehrenamtliche Grabungstätigkeitin Sedimenten des Devons <strong>und</strong> Karbons inNordrhein-Westfalen <strong>und</strong> seine Mithilfe bei derPopularisierung der Ausgrabungsergebnisse.Die Laudatio hielt Dr. Lothar Schöllmann vomWestfälischen Landesmuseum Münster, mitdem der Preisträger seit Jahren vertrauensvollkooperiert. Urk<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Scheck überreichtender Vorsitzende des Vorstands der Alberti-Stiftung,Dr. Martin Westermann, <strong>und</strong> Frank Hippelein,der Vorsitzende des Kuratoriums.Wolfgang Sippel, 1947 in Northeim bei Göttingengeboren, zog es schon seit der Kindheit zurNatur <strong>und</strong> ihren Dingen, besonders zu den Fossilien.Zunächst sammelte er in den Kalkmuldender Eifel, dann auch im Solnhofener lithographischenPlattenkalk, im Richelsdorfer Kupferschiefer<strong>und</strong> an vielen weiteren F<strong>und</strong>stellen, insbesondereim Karbon von Hagen-Vorhalle.Schon frühzeitig suchte Wolfgang Sippel denKontakt zu Wissenschaftlern wie Prof. CarstenBrauckmann, der damals am Fuhlrott-Museumin Wuppertal tätig war, <strong>und</strong> – noch zu Zeiten derDDR – zu Dr. Wolfgang Zessin in Schwerin. Fürderen Veröffentlichungen fertigte WolfgangSippel Rekonstruktionszeichnungen <strong>und</strong> Fotografiender Vorhaller Insekten. Seit 1985 sammelteer dort in einer aufgelassenen Ziegeleitongrubein den Vorhaller Schichten (Namur B).Dieser Aufschluss im flözleeren Karbon war langeschon für seine reichen F<strong>und</strong>e von Pflanzenfossilien<strong>und</strong> bestens erhaltenen Reste vonSpinnentieren <strong>und</strong> Insekten bekannt, stammenvon <strong>hier</strong> doch die ältesten vollständig erhalte-Frank Hippelein (links) <strong>und</strong>Martin Westermann (rechts)überreichen Wolfgang Sippeldie Urk<strong>und</strong>e.Foto: C. Burkert-Ankenbrand82 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENnen Fluginsekten der Welt. Zu den F<strong>und</strong>en WolfgangSippels gehören absolute Seltenheiten wiedie bis 32 cm große Libelle Namurotypus sippelioder das 24 cm große Insekt Homoiopterahagenensis. Herr Sippel arbeitet seit 1990 alsehrenamtlicher Mitarbeiter der paläontologischenBodendenkmalpflege des Landes Nordrhein-Westfalen<strong>und</strong> war während der Grabungskampagnendes LWL-Museums in denJahren 1990 bis 1997 fast jedes Wochenende inHagen-Vorhalle auf der Ausgrabung <strong>und</strong> hieltdie Raubgräber fern. Seine durchweg von ihmselbst präparierten F<strong>und</strong>e werden inzwischen imLWL-Museum aufbewahrt.Der Laudator stellte den Preisträger als einenabenteuerlustigen <strong>und</strong> vielgereisten Mann vor,der Prof. Hans-Joachim Schweitzer auf eine dreimonatigeSpitzbergen-Expedition begleitete,wo er die Verzweigung eines mitteldevonischenBaumes fand <strong>und</strong> so ganz wesentlich zum Gelingender Expedition beitrug. Wolfgang Sippel hatbislang elf neue Arten entdeckt, die bereits publiziertsind, <strong>und</strong> drei weitere, deren Publikationim Gange ist. Seine von der Mutter ererbtekünstlerische Begabung nutzte er, um die Ausgrabungsergebnisseeinem breiten Publikumzugänglich zu machen, <strong>und</strong> malte auf wissenschaftlicherGr<strong>und</strong>lage großformatige Rekonstruktionsbildervorzeitlicher Landschaften inÖl. Die Bilder wurden in Ausstellungen u.a. inMünster, Detmold, Köln <strong>und</strong> Mannheim im Originalgezeigt <strong>und</strong> in dem Band „VersteinerteSchätze“ reproduziert.Bürgermeister Michael Bauer hatte die 160Besucher in der voll besetzten Ingelfinger Stadthallewillkommen geheißen; Grußworte sprachenfür die Paläontologische Gesellschaft ihrPräsident Dr. Michael Wuttke <strong>und</strong> für denIndustrieverband Steine <strong>und</strong> Erden Baden-Württemberge.V. Geschäftsführer Dipl.-Biol. ThomasBeißwenger. Mit seinem brillanten Festvortrag„Chimärenflügler – eine neue fossile Insektenordnung“führte Dr. Günter Bechly vom StaatlichenMuseum für Naturk<strong>und</strong>e Stuttgart seinegespannten Zuhörer in die Welt der kreidezeitlichenInsekten <strong>und</strong> zeigte auf, welche Konsequenzendie spektakuläre Entdeckung ausder Crato-Formation Brasiliens für die Stammesgeschichte<strong>und</strong> Systematik der artenreichstenTiergruppe hat. Mit klassischen Liedern desGesangsduetts Con Anima <strong>und</strong> Klavierbegleitungdurch Leyla Kristesiashwili fand die ganzeVeranstaltung einen würdigen Rahmen.Hans Hagdorn (Ingelfingen)Winfried & Renate Remy Award 2012 für Christian PottDer Preis wurde 1996 anlässlich der InternationalOrganisation of Palaeobotany Conference inSanta Barbara (USA) auf Betreiben der PaleobotanicalSection of the Botanical Society ofAmerica etabliert, um Leben <strong>und</strong> wissenschaftlichesWerk von Winfried <strong>und</strong> Renate Remy zuehren. Der deutsche Paläobotaniker WinfriedRemy war Ehrenmitglied der paläobotanischenSektion der Gesellschaft <strong>und</strong> KorrespondierendesMitglied der Botanical Society of America. InKo-Autorenschaft mit seiner Frau Renate publizierteer unzählige international beachtete wissenschaftlicheBeiträge, darunter jene zu denfossilen Pflanzen des Rhynie Chert. Seit derPreis ins Leben gerufen worden ist, haben weltweitPaläobotaniker zur Stiftung des Preisgeldesbeigetragen. Der Winfried & Renate Remy Awardwird jährlich auf dem Bankett der BotanicalSociety of America für die beste Publikation ausden Bereichen Paläobotanik <strong>und</strong> Palynologiedes vergangenen Jahres vergeben (Quelle:www.botany.org/awards_grants/detail/remy.php).Preisträger 2012 war Christian Pott (SwedishMuseum of Natural History, Department ofPalaeobotany) für den Artikel Christian Pott,Stephen McLoughlin, Anders Lindstrom, WuShunqing, Else Marie Friis: Baikalphyllumlobatum and Rehezamites anisolobus: TwoSeed Plants with „Cycadophyte“ Foliage fromthe Early Cretaceous of Eastern Asia. InternationalJournal of Plant Sciences 173 (2), 192–208.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 83
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENChristian PottDie Mitglieder des Arbeitskreises für Paläobotanik<strong>und</strong> Palynologie der Paläontologischen Gesellschaftgratulieren Christian Pott <strong>und</strong> seinenKo-Autoren für diese Auszeichnung.Lutz Kunzmann (Dresden)NachrufeMatthias R. Krbetschek 1956-2012Am 15. Oktober 2012 verstarb unser lieberFre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Kollege Matthias Krbetschek nachlängerer Krankheit zu Hause in Freiberg/Sachsen.Matthias R. Krbetschek wurde am 22. März 1956in Frankenberg (DDR) geboren. Nach Erwerb derallgemeinen Hochschulreife (Beruf des Fahrzeugschlossersmit Abitur) studierte Matthiasdas Fach Geologie an der Bergakademie Freiberg<strong>und</strong> schloss sein Diplom 1982 mit einerArbeit zum Thema „Lagerstätten, paragenetischeBearbeitung des NW-Feldes der ZinnerzlagerstätteEhrenfriedersdorf/Erzgebirge“ ab.Anschließend arbeitete Matthias fünf Jahre alsGeologe beim VEB Braunkohlenkombinat Senftenberg<strong>und</strong> entwickelte sein Interesse für Quartärstratigraphie<strong>und</strong> Geochronologie, was ihnbewog, für eine Doktorarbeit an die Bergakademiezurückzukehren. Im Rahmen des Projekts„Beiträge zur Umwelt- <strong>und</strong> Klimaforschung mittelsnatürlicher Radioaktivität <strong>und</strong> Geochronologie“baute er dort das erste Lumineszenzdatierungslaborder früheren DDR am Institutfür Angewandte Physik mit Mitteln der SächsischenAkademie der Wissenschaften (SAW) auf.Seine Arbeiten begann Matthias mit einemForschungsaufenthalt im Labor der EstnischenAkademie der Wissenschaften bei Prof. GalinaHütt in Tallin <strong>und</strong> datierte Sedimentablagerungenin Ostdeutschland mittels Lumineszenz.Nach der Wiedervereinigung suchte Matthiasbereits im Frühjahr 1990 den Kontakt zu internationalen<strong>und</strong> westdeutschen Kollegen, vor allemzur Forschungsstelle Archäometrie der Heidel-84 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENLumineszenzmessgeräts – lexsyg. Er erkranktewährend dieser Zeit <strong>und</strong> konnte 2012 seine neueArbeitsstelle in Freiberg für das DresdnerSenckenberg-Museum für Mineralogie <strong>und</strong> Geologienicht mehr aufnehmen.Matthias bleibt bei allen, die ihn kannten, als einherausragender Kollege in Erinnerung <strong>und</strong> beivielen auch als lieber Fre<strong>und</strong>.Daniel Richter & Ludwig Zöller (Bayreuth)Stefan Götz 1964 – 2012Am 30.7.2012 verstarb Privat-Dozent Dr. StefanGötz im Alter von nur 48 Jahren an einem Krebsleiden.Er verließ uns inmitten eines erfüllten<strong>und</strong> sehr aktiven Lebens.Stefan Götz wurde am 27.6.1964 in Soyen beiMünchen geboren, wo er auch seine Jugendverbrachte. Er gehörte zu den Menschen, dieihre spätere Bestimmung erst nach Umwegenerreichten. So schloss er zuerst eine Schreinerlehreim väterlichen Betrieb ab, bevor er dasAbitur nachholte. Mit diesem konnte er dann seinereigentlichen Berufung folgen <strong>und</strong> studiertevon 1989–1995 an der Ludwig-Maximilians-Universitätin München. Bereits seine mit sehr gutbewertete Diplomarbeit über die „Fazielle Entwicklung,paläogeographische Situation <strong>und</strong>Palökologie der Miozänen Serien von Mogente,Prov. Valencia/SE Spanien“ enthält zweiSchwerpunkte seiner späteren Forschungen:das Interesse an paläoökologischen Fragestellungen<strong>und</strong> an Spanien. Es folgte eine Zeit alswissenschaftlicher Angestellter <strong>und</strong> Assistent inMünchen, wo er 1999 ebenfalls am Institut fürPaläontologie <strong>und</strong> Historische Geologie mit demThema „Rudisten-Assoziationen der keltiberischenOberkreide SE-Spaniens: Paläontologie,Palökologie <strong>und</strong> Sediment-Organismus-Wechselwirkung“promovierte. Die Rudisten solltenihn gleichfalls sein ganzes Leben begleiten. AlsAngestellter für Datenverarbeitung war Stefanzunächst am Museum <strong>und</strong> der BayerischenStaatssammlung für Paläontologie beschäftigt<strong>und</strong> arbeitete dort an der Entwicklung einerTypus-Datenbank. Im Jahr 2000 wechselte erStefan Götzdann auf eine Assistentenstelle an das GeologischeInstitut der Universität Karlsruhe (TH),wo er 2005 über das Thema „OberkretazischeRudistenriffe beiderseits des Atlantiks – Akkumulationspotenzial<strong>und</strong> quantitative Paläontologie“im Fach Geologie <strong>und</strong> Paläontologie habilitierte.2007 kam er an das Institut für Geowissenschaftender Universität Heidelberg, woer als Akademischer Rat auf Zeit seit 2009 seineeigene Forschungsgruppe „Quantitative Paläobiologie<strong>und</strong> Karbonatsedimentologie“ leitete<strong>und</strong> seit 2009 die Professur Sedimentgeologievertrat.Zu den vielfältigen Forschungsinteressen vonStefan, die in zahlreichen Forschungsprojektenihren Niederschlag fanden, gehörten die Paläontologievon Rudisten <strong>und</strong> Biodiversität kreide-86 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENzeitlicher Riff- <strong>und</strong> Küstenökosysteme, paläoklimatischeFragen zur globalen Erwärmung <strong>und</strong>ihre Auswirkung auf die Versauerung vonkreidezeitlichen Ozeanen, sowie die Entwicklungeiner Internet-basierten stratigraphischenDatenbank. Im Rahmen dieser Arbeitenentwickelte er auch eine innovative schleiftomographischeMethode zur 3D-Visualisierungfossiler Schalenreste.Stefan war kein Einzelkämpfer, sondern ein sehrkommunikativer <strong>und</strong> anderen gegenüber offenerMensch. Deswegen waren in seine Forschungsarbeitenimmer zahlreiche in- <strong>und</strong> ausländischeKollegen eingeb<strong>und</strong>en. Durch seineaufgeschlossene Art war er ein überall gern gesehenerKollege <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>.Stefan war vielfältig in die Lehre eingeb<strong>und</strong>en.Neben zahlreichen Vorlesungen gehörte er zuden heute leider seltener werdenden Kollegenaus den Geowissenschaften, die noch viel Wertauf eine f<strong>und</strong>ierte <strong>und</strong> umfangreiche Geländeausbildunglegen. Zahlreiche Diplom-, Bachelor<strong>und</strong>Master- sowie erste Doktorarbeiten zeigendie Wertschätzung der Studierenden für seineAusbildung.Außerhalb seines fachlichen Umfelds hatte Stefanvielseitige Interessen, die neben seiner Liebezur Musik aktuelle wissenschaftliche, kulturelle,politische <strong>und</strong> gesellschaftliche Themenumfassten <strong>und</strong> häufig zu anregenden Diskussionenführten.Stefan hinterlässt eine Ehefrau <strong>und</strong> zwei Kinder.Seine Angehörigen sowie zahlreiche Fre<strong>und</strong>e,Kollegen <strong>und</strong> Studenten verlieren mit ihm einensehr liebenswerten <strong>und</strong> geschätzten Menschen.Wir werden unseren Fre<strong>und</strong> ebenfalls vermissen<strong>und</strong> in bester Erinnerung behalten.Werner Fielitz& Wolfgang Stinnesbeck (Heidelberg)Manfred Wünsche 1925 – 2013Nach kurzer schwerer Krankheit ist der BodengeologeProf. Dr. rer. silv. habil. Manfred Wünscheam 15. Januar 2013 in Freiberg/Sa. verstorben.Manfred Wünsche wurde am 1. Mai 1925 inThekla bei Leipzig geboren. Nachhaltig prägendfür seine Charaktereigenschaften, wie Hartnäckigkeit,Willensstärke <strong>und</strong> Disziplin, waren seineKriegserlebnisse als noch nicht Zwanzigjährigerin Kurland <strong>und</strong> zuletzt im Harzvorland. Nachkurzer Gefangenschaft <strong>und</strong> Hilfstätigkeiten inder Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft absolvierte er bis19<strong>51</strong> in Tharandt ein Studium an der FakultätForstwirtschaft der TH Dresden <strong>und</strong> war danachals forstlicher Standortkartierer sowie Revierleiterim Osterzgebirge <strong>und</strong> im Elbsandsteingebirgetätig.Das Jahr 1956 brachte für Manfred Wünscheeine gravierende berufliche Veränderung. Dieprekäre Situation ständig brennender Haldendes Steinkohlenbergbaus im Stadtgebiet vonZwickau veranlasste den damaligen Chefgeologendes Geologischen Dienstes in Sachsen, Prof.Kurt Pietzsch, den standort- <strong>und</strong> bodenk<strong>und</strong>lichbeflissenen Forstwirt nach Freiberg zu holen <strong>und</strong>ihn mit der Lösung dieses Problems zu beauftragen.Mit einer unkonventionellen methodischenHerangehensweise <strong>und</strong> fachlichem Geschick gelangihm dies, was 1961 schließlich auch in seinerPromotion zum Dr. rer. silv. seinen Niederschlagfand. In der Folgezeit waren es vor allemdie sächsischen Braunkohlenreviere im mitteldeutschenRaum <strong>und</strong> in der Lausitz, deren ständigwachsende Devastierungsflächen einerwissenschaftlich begründeten <strong>und</strong> gleichzeitigökonomisch praktikablen Konzeption für dieRekultivierung bedurften. Auch <strong>hier</strong>für fandManfred Wünsche in Kooperation mit Fachwissenschaftlernaus anderen Institutionen<strong>und</strong> mit Unterstützung der Deckgebirgsgeologen<strong>und</strong> einer leistungsfähigen FachabteilungBodengeologie im eigenen Hause Lösungen, diein etwa 140 Gutachten niedergelegt wurden.Derartig umfassende <strong>und</strong> komplexe geochemisch-bodenk<strong>und</strong>licheVorfelduntersuchungenwaren bis dahin neu. Damit wurden dieLeistungspotenziale der tertiären <strong>und</strong> quartärenDeckgebirgssubstrate für die Rekultivierungdetailliert ermittelt, Klassifikationen entwickelt,spezielle Kippbodenkarten erstellt <strong>und</strong> Leitlinienfür die Wiedernutzbarmachung abgeleitet. Die1976 abgeschlossene Habilitation „Die boden-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 87
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENManfred Wünschephysikalischen, -chemischen <strong>und</strong> -mineralogischenEigenschaften der Abraumschichten <strong>und</strong>ihre Eignung für die Wiederurbarmachung imBraunkohlenrevier südlich von Leipzig“ war einErgebnis dieser langjährigen systematischenTätigkeit.Zum Zeitpunkt der politischen <strong>und</strong> ökonomischenWende in der DDR hätte Manfred Wünscheeigentlich in den beruflichen Ruhestandtreten können. Die mit diesen gravierenden Veränderungenoffenbar gewordenen Anforderungenan eine umweltgerechte Sanierung <strong>und</strong>Revitalisierung von Altstandorten <strong>und</strong> Bergbaufolgelandschaftenmachte ihn auf Gr<strong>und</strong> seinereinschlägigen Erfahrungen <strong>und</strong> Kenntnisse zueinem begehrten <strong>und</strong> gesuchten Berater. Er warfür die Geologische Landesuntersuchung SachsenGmbH tätig <strong>und</strong> war gleichzeitig wesentlichan der Konzipierung des neu zu gründendenGeologischen Dienstes in Sachsen beteiligt. Die1993 erschienene Bodenübersichtskarte vonSachsen (BÜK 400) ist sichtbares Ergebnisdieser Tätigkeit.Nach mancher Karrierebremse in früherenJahren nun wieder gebraucht <strong>und</strong> anerkannt zuwerden, war eine späte, aber nachhaltige Genugtuungfür ihn. Ausdruck dafür war auch die1992 erfolgte Berufung zum Professor an der TUBergakademie Freiberg. Außerdem war er in denletzten Lebensjahrzehnten immer wieder Ansprechpartner<strong>und</strong> fachlicher Betreuer für Diplomanden<strong>und</strong> Doktoranden. Damit <strong>und</strong> mit seinezahlreichen Fachpublikationen sowie der Mitwirkungin hochrangigen Beratungsgremien <strong>und</strong> anBerufungsverfahren erfüllte sich das Wissenschaftlerlebenvon Manfred Wünsche in beneidenswerterWeise, was durch eine harmonischeFamilie, aus der zwei Söhne hervorgegangensind, glücklich ergänzt wurde.Werner Pälchen (Halsbrücke)& Klaus Hoth (Freiberg)88 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
IMPRESSUMImpressum© <strong>GMIT</strong> – Geowissenschaftliche Mitteilungen<strong>Heft</strong> <strong>51</strong>, März 2013<strong>GMIT</strong> dient dem Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG), der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft(DGG), der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG), der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft(DMG), der Deutschen Quartärvereinigung (DEUQUA), der Geologischen Vereinigung (GV) <strong>und</strong> der PaläontologischenGesellschaft als Nachrichtenorgan. Die Zeitschrift ist für die Mitglieder der genannten Gesellschaftenbestimmt. Der Bezug des <strong>Heft</strong>es ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.Herausgeber: ARGE <strong>GMIT</strong> c/o BDG-Bildungsakademie, Lessenicher Straße 1, 53123 BonnSatz <strong>und</strong> Layout: Dipl.-Geol. U. WutzkeAuflage: 8.000 · ISSN: 1616-3931Redaktion: Klaus-Dieter Grevel (DMG; klaus-dieter.grevel@rub.de; kdg.), Michael Grinat (DGG; michael.grinat@liag-hannover.de; mg.), Sabine Heim (GV; heim@lek.rwth-aachen.de; sh.), Christian Hoselmann (DEUQUA;christian.hoselmann@hlug.hessen.de; ch.), Hermann Rudolf Kudraß (GV; kudrass@gmx.de; hrk.), Jan-MichaelLange (DGG; geolange@uni-leipzig.de; jml.), Alexander Nützel (Paläontologische Gesellschaft; a.nuetzel@lrz.unimuenchen.de;an.), Birgit Terhorst (DEUQUA; birgit.terhorst@uni-wuerzburg.de; bt.), Hans-Jürgen Weyer (BDG;BDG@geoberuf.de; hjw.), Ulrich Wutzke (uw.).Die Redaktion macht darauf aufmerksam, dass die unter einem Namen oder einem Namenszeichen erscheinendenArtikel persönliche Meinungen <strong>und</strong> Ansichten enthalten können, die nicht mit der Meinung <strong>und</strong> Ansicht derHerausgeber übereinstimmen müssen. Für den Inhalt der Artikel sind die Autoren verantwortlich. Die Autorenerklären gegenüber der Redaktion, dass sie über die Vervielfältigungsrechte aller ihrer Fotos <strong>und</strong> Illustrationenverfügen <strong>und</strong> übertragen diese sowohl für die Print- wie für die Online-Ausgabe an <strong>GMIT</strong>.Bitte senden Sie Beiträge – am besten per E-Mail mit angehängten Windows-lesbaren Formaten – nur an einender <strong>GMIT</strong>-Redakteure (Adressen in diesem <strong>Heft</strong>). Textbeiträge sind deutschsprachig <strong>und</strong> haben folgenden Aufbau:Überschrift (fett, Arial 12 Punkt); Leerzeile; Textbeitrag (Arial 11 Punkt, Blocksatz, keine Trennung, Absätzefortlaufend <strong>und</strong> nicht eingerückt, Zahlenangaben mit einem Punkt zwischen den Tausenderstellen); ausgeschriebenerVor- <strong>und</strong> Nachname sowie Wohn- oder Arbeitsort des Autors. Für die Länge der Textbeiträge geltenfolgende Richtwerte: Berichte zu aktuellen Entwicklungen in Forschung, Lehre, Beruf, Tagungsberichte der beteiligtenGesellschaften, Meldungen aus den Sektionen, Arbeitsgruppen etc.: max. 2 Seiten (inkl. Fotos); Tagungsberichtenicht beteiligter Gesellschaften: max. 1 Seite (inkl. Fotos); Rezensionen, Nachrufe: max. 1 Seite. Sindfür einen Beitrag Abbildungen vorgesehen, so markieren Sie bitte im Manuskript die gewünschte Position <strong>und</strong>senden die Abbildungen separat zu. Es können jpg-, pdf-, tif-Dateien o.ä. eingereicht werden. Achten Sie bitteunbedingt auf eine ansprechende Qualität der Abbildungen. Auf Literaturzitate bitte verzichten.Einsender erklären sich mit der redaktionellen Bearbeitung <strong>und</strong> eventuellen Kürzung ihrer Zuschrift einverstanden<strong>und</strong> treten die Rechte an die Herausgeber ab. Für unverlangt eingereichte Einsendungen übernimmt dieRedaktion keine Verantwortung. Eingesandte Fotos <strong>und</strong> sonstige Unterlagen werden nur auf ausdrücklichenWunsch zurückgesandt.Angaben zu Preisen, Terminen usw. erfolgen ohne Gewähr.<strong>GMIT</strong> Nr. 52 erscheint im Juni 2013. Redaktionsschluss ist der 15. April 2013. Anzeigenschluss ist der 30. April2013. Auskunft erteilt die BDG-Geschäftsstelle, Lessenicher Straße 1, 53123 Bonn; Tel.: 0228/696601, Fax: 0228/696603; E-Mail: BDG@geoberuf.de; Internet: www.geoberuf.de.Personenbezogene Angaben der Mitglieder werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung <strong>und</strong> des Versandesvon <strong>GMIT</strong> gespeichert. Die Datei zum Versand von <strong>GMIT</strong> wurde aus verschiedenen Einzeldateien zusammengesetzt.Bei unterschiedlicher Schreibweise oder verschiedenen Anschriften (z.B. Dienst- <strong>und</strong> Privatanschrift)kann es vorkommen, dass ein Mitglied das <strong>Heft</strong> doppelt erhält. Für entsprechende Hinweise ist die Redaktiondankbar. Die Redaktion dankt den Inserenten <strong>und</strong> bittet die Leser, diese zu berücksichtigen.<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 89
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENTagungsberichteInternational German Ostracodologist’s Meeting (IGOM) Köln2012 – „The Recent and Fossil meet Kempf Database“Die Treffen der deutschsprachigen Ostrakodologensind in der Regel eher kleinere Konferenzen,die jährlich stattfinden, um das Netzwerk derteilnehmenden Forscher zu stärken. Besondersfür Neulinge in der Ostrakodenforschung sinddie kleineren Treffen hervorragend geeignet, umin informellen Kontakt mit „alten Hasen“ zu treten.Allen Ostrakodentagungen ist der interdisziplinäreCharakter gemeinsam. Paläontologen<strong>und</strong> Biologen verschiedenster Arbeitsgebietepräsentieren <strong>und</strong> diskutieren <strong>hier</strong> gemeinsamihre aktuellen Untersuchungen.Das diesjährige Treffen war schon das 14. seinerArt <strong>und</strong> wurde dieses Mal von der DFG als InternationaleTagung gefördert. Finn Viehberg(Univ.zu Köln) <strong>und</strong> Renate Matzke-Karasz (LMUMünchen) hatten zusammen mit dem jungenFörderverein für die International ResearchGroup on Ostracoda e. V. zum InternationalGerman Ostracodologist’s Meeting (IGOM) vom11.–14.10.2012 in Köln eingeladen. Anlass warder 80. Geburtstag des Nestors der deutschenOstrakodenforschung, Eugen Kempf. Der Jubilarist unter Ostrakodenforschern bestens bekanntals Begründer <strong>und</strong> Motor der Kempf-Databaseon Ostracoda, einer nahezu kompletten Sammlungder publizierten Fachliteratur zu fossilen<strong>und</strong> rezenten Ostrakoden (http://support-irgo.de/KDO). Nutzer des Listservers OSTRACON(www.irgo.uni-koeln.de/OSTRACON) kennendarüber hinaus seine fachk<strong>und</strong>igen <strong>und</strong> hilfreichenKommentare <strong>und</strong> Antworten, die auf dieserDatenbank <strong>und</strong> seinen Kenntnissen beruhen.Übrigens wurde das erste Treffen der deutsch-Die Teilnehmer des IGOM 2012 vor Schloss Wahn, dem Veranstaltungsort in Köln; Foto: R. Matzke-Karasz90 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENsprachigen Ostrakodenforscher 1988 von EugenKempf ebenfalls in Köln veranstaltet. Das diesjährigeMotto der Tagung lautete: „Fossil andRecent meet Kempf Database“. So waren dennDatenbanken, insbesondere ein Zusammenführenvon Verbreitungs- <strong>und</strong> taxonomischen Datenbeiderseits des Atlantiks ein Schwerpunkt derVorträge <strong>und</strong> Workshops. Drei Plenarvorträgedurch Brandon Curry (USA), Dave Horne (Großbritannien)<strong>und</strong> Alison Smith (USA) beschäftigtensich mit Datenbanken, die anderen beidenvon Koen Martens <strong>und</strong> Isa Schön (Belgien)mit Modellen zur Artbildung in alten Seen<strong>und</strong> molekularbiologischen Untersuchungen anOstrakoden. Insgesamt 22 Vorträge <strong>und</strong> 18Poster stellten Ergebnisse taxonomischer,molekularbiologischer, ökologischer <strong>und</strong> paläoökologischerUntersuchungen vor. Der Schwerpunktlag <strong>hier</strong>bei klar auf quartären Ostrakoden.64 Personen nahmen an der Tagung teil, dabeifast die Hälfte aus dem Ausland.Finn Viehberg <strong>und</strong> Burkhard Scharf (Bremen)führten die Exkursion zum Laacher See, welchedas Treffen abr<strong>und</strong>ete. Neben der Geologie diesesGebietes wurden die Probenahme auf lebendeOstrakoden, Wasseranalytik <strong>und</strong> Kurzkernbeprobungdemonstriert.Das IGOM 2012 war ein großer Erfolg – informativ<strong>und</strong> innovativ in sehr angenehmer Atmosphäre.Erweiterte Kurzfassungen der Tagungsbeiträgesind in einem Band (21/2012) des KölnerForums für Geologie <strong>und</strong> Paläontologie zu finden.Ein geplanter Tagungsband soll einigeEugen Kempf auf der Exkursion zum LaacherSee während des IGOM 2012Foto: R. Matzke-KaraszBeiträge in der Zeitschrift CRUSTACEANA vereinen<strong>und</strong> wird im kommenden Jahr erscheinen.Hier schon mal erwähnt: 2013 ist auch das Jahrdes 17. International Symposium on Ostracodain Rom (http://www.iso17.unipr.it/).Peter Frenzel (Jena)22. Sächsisches Altlastenkolloquium am 8. <strong>und</strong> 9. November2012 in Dresdenhjw. Folgende Angaben zum 22. SächsischenAltlastenkolloquium fußen auf Angaben vonHeidemarie Wagner (Sächsisches Staatministeriumfür Umwelt <strong>und</strong> Landwirtschaft, SMUL,Dresden).Der Einladung des Landesverbandes Sachsendes B<strong>und</strong>es der Ingenieure für Wasserwirtschaft,Abfallwirtschaft <strong>und</strong> Kulturbau e. V. alsVeranstalter <strong>und</strong> des Dresdner Gr<strong>und</strong>wasserforschungszentrumse. V. (DGFZ) als Partner zum22. Sächsischen Altlastenkolloquium am 8. <strong>und</strong>9. November 2012 in Dresden sind wieder fast200 Teilnehmer <strong>und</strong> 18 Aussteller gefolgt, dievom Vorsitzenden des BWK-LandesverbandesSachsen Dr. Andreas Eckardt begrüßt wurden.Als Vertreter des SMUL, das auch diesmal die<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 91
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENSchirmherrschaft über die Veranstaltung übernommenhatte, richtete Ulrich Kraus, AbteilungsleiterWasser, Boden, Wertstoffe, ein Grußwortan die Teilnehmer.Zu Beginn erinnerte er an die Konferenz „Sanierungkontaminierter Standorte – Schlüssel fürein effizientes Flächenmanagement in der EU“vor ziemlich genau einem Jahr im Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel. Hier hatte sich dasSMUL aktiv eingebracht <strong>und</strong> diese Veranstaltunggemeinsam mit der Generaldirektion Umweltder EU-Kommission organisiert. Als Rednerhatten der Sächsische Staatsminister FrankKupfer, der EU-Umweltkommissar JanezPotocnik, der Generaldirektor der GeneraldirektionUmwelt Karl Falkenberg <strong>und</strong> weitere Vertreteraus Deutschland, Frankreich <strong>und</strong> Dänemarkteilgenommen.Ulrich Kraus erläuterte das sächsische Anliegenauf dieser gemeinsamen Konferenz, das in derDarstellung der Altlastensanierung als beherrschbaresProblem bestand. Wichtig seiendabei eine systematische Vorgehensweise, eineflächendeckende Erfassung der Standorte, diePriorisierung der Maßnahmen <strong>und</strong> die Schaffungeines (ausreichenden) Finanzierungsrahmens.Zu der von der EU-KOM vorgeschlagenen Boden-Rahmenrichtlinie bliebe Sachsen weiterhin beiseiner ablehnenden Haltung, da auch ohne eineEU-Richtlinie ein effizienter Bodenschutz möglichist. Wichtig sei die weitere Förderung vonSanierungsmaßnahmen auch in der neuen EU-Strukturfondsperiode 2014–2020.Zur Situation in Sachsen stellte er fest, dassnach umfangreichen Änderungen der Verwaltungspraxisder Altlastenfreistellung, bedingtdurch die Pauschalierung <strong>und</strong> die Verwaltungsreform,das Geschäft in ruhigem Fahrwasserlaufe. Stellvertretend für die vielen Sanierungsmaßnahmenim Rahmen der Altlastenfreistellungnannte er zwei umfangreiche Projekte, diein diesem Jahr beendet wurden:Für die BAUFELD MINERALÖLRAFFINERIEChemnitz-Klaffenbach sei 2012 die Sanierungvon fünf Säureharzteichen <strong>und</strong> einer Feststoffdeponieabgeschlossen worden. 400.000 tflüssige <strong>und</strong> pastöse Säureharzrückstände miteinem hochaggressiven Schadstoffpotenzialsowie sonstige Abfälle seien überwiegend thermischverwertet worden. Die Kosten dieserSanierung beliefen sich auf ca. 120 Mio. €. Zukünftigsei noch der Betriebsstandort der Altölraffineriein Klaffenbach selbst zu sanieren.Auch beim ökologischen Großprojekt DresdenCoschütz-Gittersee sei 2012 die Sanierung derehemaligen Uranerzaufbereitungsanlage „Uranfabrik95“ mit der Verwahrung der letzten derbeiden Absetzanlagen abgeschlossen worden.Damit sei ein 76 ha großes Areal von radioaktiven<strong>und</strong> sonstigen Schadstoffkontaminationenbefreit <strong>und</strong> unter Einbeziehung angrenzenderFlächen in ein modernes Gewerbegebiet umgestaltetworden. <strong>51</strong> neue Ansiedlungen haben ca.2.200 Arbeitsplätze geschaffen. Damit sei derStandort Coschütz-Gittersee ein besonders gelungenesBeispiel, wie Altlastensanierung auchzur Reduzierung des Flächenverbrauchs beitragenkönne. Die Gesamtkosten dieser Altlastensanierungbeliefen sich auf ca. 45 Mio. €.Zum Schluss ging Ulrich Kraus auf die Nachhaltigkeitim Rahmen der Altlastensanierung ein.Dabei sei es zwingend notwendig, die Verhältnismäßigkeitder geplanten Maßnahme zu prüfen<strong>und</strong> die bereitgestellten Mittel effektiv einzusetzen.Das Notwendige für die Abwehr vonGefahren müsse getan werden, nicht das Machbare.Auch das sei Nachhaltigkeit, denn die Mittelzur Altlastensanierung seien begrenzt <strong>und</strong>könnten nur einmal ausgegeben werden.Wolf-Dieter Dallhammer, der ReferatsleiterGr<strong>und</strong>satzfragen, Recht der Abteilung Wasser,Boden, Wertstoffe des SMUL, übernahm den erstenFachbeitrag des Kolloquiums mit dem Titel„Verkehrsfähigkeit der Altlastenfreistellung –Änderung der sächsischen Verwaltungspraxisim Licht der Rechtsprechung“.Ausgangspunkt des Vortrags war ein Urteil desB<strong>und</strong>esverwaltungsgerichtes (BVerwG) zurÜbertragbarkeit eines Freistellungsantrages<strong>und</strong> somit zu Verkehrsfähigkeit der Altlastenfreistellung.Sinn <strong>und</strong> Zweck der Altlastenfreistellungsei demnach nicht jede Investitionzu fördern, sondern nur Investitionen, die ineinem Zusammenhang mit dem Investitions-92 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENhemmnis ökologische Altlasten im Freistellungsantraghinreichend beschrieben sind. Die Antragsabtretungkäme nur dann in Betracht,wenn der Rechtsnachfolger das vom ursprünglichenAntragsteller bezeichnete Vorhaben fortführenwill.Der Beschluss des BVerwG vom 25. Juli 2011(Az.: 7 B 25/11) zu einem sächsischen Fall hättezu einer Änderung der hiesigen Verwaltungspraxisder Altlastenfreistellung geführt. Die bisherigePraxis des „Ruhend stellen zur späterenAbtretung“ würde aufgegeben. Das beträfenoch ca. 1.000 Anträge, die derzeit einer Entscheidungzugeführt, d. h. regelmäßig abgelehntwerden. Mit diesem Vorgehen sei absehbar,dass die lange <strong>und</strong> erfolgreiche Ära derAltlastenfreistellung auslaufen wird. Für künftigeneue Investitionen müsse – wie bei Investorenohne Altlastenfreistellung auch – auf andereFinanzierungs- oder Förderinstrumente zurückgegriffenwerden.Im anschließenden ersten Themenblock standenThemen der B<strong>und</strong>esrechtssetzung im Mittelpunkt.Dr. Jens Utermann (Umweltb<strong>und</strong>esamt)stellte die Ableitung der Prüfwerte für denWirkungspfad Boden-Gr<strong>und</strong>wasser im Rahmender Novelle der B<strong>und</strong>es-Bodenschutzverordnungsehr anschaulich dar <strong>und</strong> erläuterte dieEinführung methodenspezifischer Prüfwerte.Zur Anwendung der Werte sollen Einmischprozesseam Ort der Beurteilung Berücksichtigungfinden. Im anschließenden Vortrag stellteJörn Fröhlich (MLUR, Schleswig-Holstein) alsObmann der LABO-Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Erstellungeiner Arbeitshilfe für den Ausgangszustandsberichtderen Inhalte vor. Hintergr<strong>und</strong> ist,dass in Umsetzung der EU-Richtlinie überIndustrieemissionen in deutsches Recht bisAnfang 2013 für bestimmte Fälle die Erstellungeines Ausgangszustandsberichts für Boden <strong>und</strong>Gr<strong>und</strong>wasser vorzusehen ist.Im zweiten Themenblock ging es um länderbezogeneAnsätze der Altlastenbehandlung. DieThemenpalette der Vorträge reichte von Bauplanungen<strong>und</strong> -maßnahmen an Altlastenstandorten,über das Bodenplanungsgebiet im RaumFreiberg, bis hin zur Erfassung <strong>und</strong> Bewertungdes Einflusses von Punktquellen bei der EuropäischenWasserrahmenrichtlinie (WRRL).Im letztgenannten Vortrag erläuterte ConstanzeFröhlich (ARCADIS) das Vorgehen bei der Identifizierungder Punktquellen (Altlasten), die entsprechendder WRRL für den schlechten chemischenZustand des Gr<strong>und</strong>wasserleiters EL1-1+2im Raum Dresden zuständig sind. Im Rahmen einerMachbarkeitsstudie wurde eine Methodikentwickelt, um Schadstoffquellen zu lokalisieren<strong>und</strong> die Schadensbereiche in Anzahl <strong>und</strong>Ausbreitung zu präzisieren. Auf dieser Gr<strong>und</strong>lagekonnten erste Prognosen für die Erreichungder Qualitätsnormen nach WRRL erarbeitetwerden. Insbesondere durch die aktuelle Fortführungvon gezielten Gr<strong>und</strong>wasseruntersuchungenwurden erhebliche Reduzierungen vonFlächen mit Schwellenwertüberschreitungennachgewiesen, die z.T. zu einer Neubewertung<strong>und</strong> -einstufung des chemischen Zustandes desGr<strong>und</strong>wasserkörpers führten.Der dritte Themenblock stand unter der Überschrift„Verhältnismäßigkeit bei Sanierungsentscheidungen“.Die Beiträge umfassten nebeneinem Beispiel für verhältnismäßigeSanierung aus dem Landkreis Meißen <strong>und</strong> derVerhältnismäßigkeitsbetrachtung bei der Entscheidungüber die Durchführung von MNAauch die Verantwortung <strong>und</strong> Haftung des Gutachters.Praxisbeispiele standen im vierten <strong>und</strong> fünftenThemenblock im Mittelpunkt. Dabei ging es sowohlum die Flächenrevitalisierung als auch umSanierungstechniken.Im Rahmen des Blockes Flächenrevitalisierungstellte Dr. Erik Nowak (SMUL) das sächsischeHandlungsprogramm zur Reduzierung derFlächeninanspruchnahme vor. Bei den anschließendvorgestellten Einzelfällen ging es um dieGroßprojekte in BUNA <strong>und</strong> Böhlen sowie um dieBergbausanierungen im alten SteinkohlenrevierFreital.Der Block Sanierungstechniken begann mit derDarstellung eines etablierten Verfahrens zurmikrobiologischen On-site-Behandlung vonorganisch belastetem Material. Dr. KarstenMenschner (CDM Consult GmbH) erläuterte ein<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 93
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENForschungsprojekt zur sequenziellen Direktgasinjektionzur Steuerung anaerober <strong>und</strong> aeroberReaktionsräume zur effektiven mikrobiologischenIn-situ-Sanierung am Beispiel einesLCKW-Schadens. Im letzten Vortrag wurde übereinen realmaßstäblichen Feldversuch zur Injektionalkalischer Lösungen in die Grube Königsteinberichtet.Das Schlusswort war dem Vorsitzenden desBWK-Landesverbandes Sachsen, Dr. AndreasEckardt, vorbehalten. Er dankte den Referenten<strong>und</strong> Moderatoren für ihre Beiträge <strong>und</strong> den Teilnehmernfür ihr reges Interesse sowie für dieinteressanten Diskussionen. Für das kommendeJahr kündigte er die Dresdner Gr<strong>und</strong>wassertagean, die am 18. <strong>und</strong> 19. Juni 2013 in der DreikönigskircheDresden unter dem Thema „Entwicklung<strong>und</strong> Applikation innovativer GW-Schutz- <strong>und</strong> GW-Behandlungsmaßnahmen“stattfinden werden.Selen2012 – Workshop am Karlsruher Institut für TechnologieIn den letzten Jahren ist die Forschung zum Verhaltenvon Selen in der Umwelt immer mehr inden Fokus der Wissenschaft gerückt, da Selensowohl ein essentielles als auch ein (radio-) toxischesElement ist. Ein großes Problem stellt diehohe Variabilität der Selenkonzentration in derErdkruste dar. Die meisten Regionen der Erdeweisen Selen-arme Böden auf <strong>und</strong> die Versorgungder betroffenen Bevölkerung erfolgt dannweitestgehend durch importiertes Getreide miterhöhtem Selengehalt. Daher ist es auch nichtverw<strong>und</strong>erlich, dass der Getreidepreis stark vomSelengehalt abhängt. Andererseits gibt es Gebiete,wie in Punjab-Indien, in denen es durchhohe Selenkonzentrationen im Boden zu Vergiftungserscheinungenbei Tieren <strong>und</strong> Menschenkommt. Um ein detailliertes Prozessverständnisüber das Vorkommen, die Verfügbarkeit <strong>und</strong> dasVerhalten von Selen in der Umwelt zu erlangen,ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischenWissenschaftlern verschiedener Fachgebietenötig, einschließlich Mineralogie/Geochemie,Geologie, Hydrochemie, Biochemie,Mikrobiologie, Agrarwissenschaften, Bodenk<strong>und</strong>esowie auch Ernährungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften.Im Rahmen des Workshops „Selen2012 – Seleniumin geological, hydrological and biologicalsystems“, der vom Institut für Mineralogie <strong>und</strong>Geochemie des Karlsruher Instituts für Technologievom 8.–9. Oktober 2012 ausgerichtetwurde, sollte eine Plattform für den Austausch,die Kommunikation <strong>und</strong> die Zusammenarbeitzwischen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen,die an Selen arbeiten, geschaffen werden.Neben der fachübergreifenden Kommunikationzielte der Workshop auch darauf ab,Nachwuchswissenschaftlern aus Deutschland<strong>und</strong> anderen europäischen Ländern die Möglichkeitzu geben, erste Ergebnisse ihrer Arbeitenzu präsentieren <strong>und</strong> Kontakte zu erfahrenenWissenschaftlern der „Selen-Community“ zuknüpfen.Dazu reisten gut 30 Teilnehmer aus Deutschland,der Schweiz, Frankreich, Dänemark <strong>und</strong>den Niederlanden an. Das attraktive Tagungsprogrammumfasste 13 Vorträge inklusive zweiKeynote Talks <strong>und</strong> neun Posterbeiträge. DieBeiträge waren breit gefächert <strong>und</strong> reichten vonAspekten aus der Mineralogie/Geochemie bishin zu Themen der Ernährungs- <strong>und</strong> Biowissenschaften.Am ersten Tag wurde der Workshop mit einemÜbersichtsvortrag von Prof. Laurent Charlet(ISTerre/Uni Grenoble) <strong>und</strong> Prof. Lenny Winkel(ETH Zürich/EAWAG) über die Mobilität vonSelen in der Umwelt eröffnet. Die weiteren Beiträgedes ersten Tages widmeten sich Aspektender Mineral-Wasser-Wechselwirkungen <strong>und</strong> derBeeinflussung von Selenspeziationen durchRedoxprozesse.Am nächsten Morgen ging es mit einem Impulsvortragvon Prof. Olivier Rouxel (IFREMER Brest)zur Massenspektrometrie <strong>und</strong> den natürlichenVariationen stabiler Selenisotope weiter, an densich Vorträge <strong>und</strong> Posterpräsentationen zur94 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENDie Teilnehmer des Selenkolloquiums in KarlsruheSelenisotopenfraktionierung, neuen analytischenMethoden, Selen im Boden-Pflanze-System <strong>und</strong> dem menschlichen Selenmetabolismusanschlossen. Den Abschluss des Workshopsbildete eine Exkursion zur Synchrotron-Strahlenquelle ANKA des KIT, bei der interessierteTeilnehmer sowohl einen Einblick in dengr<strong>und</strong>legenden Aufbau eines Teilchenbeschleunigerserhielten, als auch spezielle Beamlines(XAS, FLUO, SUL-X, Nano etc.) besichtigenkonnten, die für das Verständnis des Umweltverhaltensvon Elementen eingesetzt werden.Da es bei den Teilnehmern großes Interessegab, diese Art von Workshop nun regelmäßig zuveranstalten, ist es beabsichtigt, in zwei Jahreneinen weiteren Selen-Workshop abzuhalten.Elisabeth Eiche, Monika Stelling& Thomas Neumann (Karlsruhe)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 95
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENLeserbriefeOffener Brief an die Vorstände der deutschen geowissenschaftlichenVereinigungenWer heute das Studium der Geologie, Paläontologie,Mineralogie oder Geophysik aufnimmt, immatrikuliertsich meist in einen Studiengang, derden Titel Geowissenschaften trägt. Seit die geowissenschaftlichenStudiengänge in den neunzigerJahren an nahezu allen deutschen Universitätenreformiert wurden, hat in der Folge aucheine Änderung in der Selbstwahrnehmung derStudenten stattgef<strong>und</strong>en, die traditionellenGräben, die zwischen den einzelnen Disziplinenexistierten, werden mehr <strong>und</strong> mehr eingeebnet.Heutige Absolventen identifizieren sich mehrdenn je mit dem Begriff Geowissenschaftler. DieserTrend ist nicht nur in der Ausbildung zu verzeichnen,auch in der Forschung wird mehr <strong>und</strong>mehr Interdisziplinarität verlangt.National erschwert die Vielfalt der geowissenschaftlichenVereinigungen die Übersicht <strong>und</strong>Zuordnung für den Nachwuchs. In der Folge sindviele Studenten schlecht über deutsche Vereinigungeninformiert, finden ihre wissenschaftlicheHeimat in internationalen Organisationen wie EGU,AGU oder GSA <strong>und</strong> suchen national höchstensnoch die Vereinigung mit den meisten Vorteilen.Auf der B<strong>und</strong>esfachschaftstagung vom 8.–11.11.2012 an der Freien Universität Berlin wurdediese Thematik in einem Workshop <strong>und</strong> im anschließendenPlenum diskutiert. An der Veranstaltungnahmen 150 Vertreter von 20 nationalenUniversitäten teil. Mit deutlicher Mehrheitempfand es die Studierendenschaft als begrüßenswert<strong>und</strong> lange überfällig, dass ein gemeinsamerWissenschaftsdachverband der Geowissenschafteneingerichtet wird. Dabei wurdeallerdings großer Wert darauf gelegt, dass dieserDachverband nicht unsichtbar als übergeordnetesGremium agiert, sondern die persönlicheMitgliedschaft ermöglicht.Gestützt wird diese Forderung durch folgendeArgumente:(1) Die Mitgliedschaft in einem GeowissenschaftlichenDachverband macht Mehrfachmitgliedschaften<strong>und</strong> einen Wechsel zwischen den Vereinigungenüberflüssig.(2)Fachschaften <strong>und</strong> Dozenten können diesenVerband sehr viel besser bewerben <strong>und</strong> somitStudenten der Geowissenschaften effektiv einegemeinsame Heimat schaffen <strong>und</strong> die Identifikationmit dem Fach erleichtern.(3)Gemeinsame Tagungen <strong>und</strong> eine breitereAuswahl an Publikationen, wie bei internationalenVerbänden längst üblich, erleichtern denÜberblick über die Vielfalt des Faches <strong>und</strong> dieintensivere Auseinandersetzung mit fremdenThemengebieten.(4)Themen, wie Forschungsförderung, Öffentlichkeitsarbeitzu geowissenschaftlichen Themen,Lehre <strong>und</strong> Nachwuchsförderung, könnenmit gebündelten Kräften viel effektiver gestaltetwerden.(5)Die Kommunikation unter Studentengruppen<strong>und</strong> zwischen Studenten <strong>und</strong> Wissenschaftlernverschiedener Institute sowie aller Gruppen mitdem Verband könnte mit einer gemeinsamenPlattform auf ein ganz neues Niveau gehobenwerden.Dabei ist nicht gefordert, dass die bestehendenStrukturen komplett aufgelöst werden, auch wirsehen einen Bedarf für Fachgruppen, die wie inanderen Dachverbänden als Sektionen geführtwerden.Der Wunsch nach besserer Zusammenarbeit<strong>und</strong> effektiverer Nachwuchsförderung wird inden letzten Jahren immer deutlicher <strong>und</strong> funktioniertauf studentischer Ebene immer besser, wiedas breite Programm der eigenständig organisiertenBuFaTa zeigt. Leider wird dieses Bemühennur sehr begrenzt gefördert, weshalb sichan einigen Universitäten in den letzten JahrenStudent Chapter internationaler Vereinigungen96 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENetabliert haben, die ein Vakuum füllen, dasdeutsche Vereinigungen in der Nachwuchsförderunghinterlassen haben.Wir wünschen uns, dass deutsche Vereinigungenden Handlungsbedarf erkennen <strong>und</strong> dieNachwuchsförderung nicht nur in der Präambelder Satzung stehen haben, sondern auch aktivbetreiben.Wir wünschen uns eine starke Lobby, die esermöglicht, im Kontakt mit den Mitgliedernlösungsorientiert neue Wege einzuschlagen,<strong>und</strong> bitten nachdrücklich darum, auch denNachwuchs in die Strukturdiskussion der Organisationder Geowissenschaften in Deutschlandaktiv mit einzubeziehen, um die Nachhaltigkeitder neu zu schaffenden Struktur zu stärken.Auf der B<strong>und</strong>esfachschaftstagung im Wintersemester2012 an der Freien Universität Berlin imPlenum mehrheitlich beschlossen von Vertreternder Fachschaften der geowissenschaftlichenStudiengänge:RWTH AachenFreie Universität BerlinRuhr-Universität BochumRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität BonnUniversität BremenTechnische Universität DarmstadtTechnische Universität DresdenGoethe-Universität Frankfurt am MainTechnische Universität Bergakademie FreibergAlbert-Ludwigs-Universität FreiburgGeorg-August-Universität GöttingenErnst-Moritz-Arndt-Universität GreifswaldUniversität HamburgFriedrich-Schiller-Universität JenaChristian-Albrechts-Universität zu KielUniversität zu KölnLudwig-Maximilians-Universität MünchenWestfälische Wilhelms-Universität MünsterUniversität PotsdamEberhard-Karls-Universität TübingenLeserbrief zum Geofokus, <strong>GMIT</strong> Nr. 50 Dez. 2012: „Sind die Geowissenschaftenim Anthropozän angekommen?“Unsere Gesellschaft leidet an irrationaler Übertreibung.Und zwar in allen Belangen: Finanzen,Terror, Umwelt, Klima, Epidemien, … <strong>und</strong> nunauch in den Geowissenschaften. Medien <strong>und</strong>Politik reagieren extrem, willkürlich <strong>und</strong> selektiv.Die Massen werden zur Gleichschaltung inAngst <strong>und</strong> Schrecken versetzt, um die jeweiligenInteressen (scheinbar) demokratisch durchzusetzen.Schließlich muss die Welt gerettetwerden. Leider ist Panik ein schlechter Ratgeber,wie die desolate Umsetzung der überhasteten„Energiewende“ derzeit eindrucksvoll zeigt.Die Gesellschaft steht sich nur noch selbst imWeg. Verständnis <strong>und</strong> Verhältnismäßigkeit gehenverloren, naheliegende Umweltproblemewerden verdrängt <strong>und</strong> Großprojekte jedwederCouleur sind kaum noch realisierbar. Der „Wutbürger“wird hin- <strong>und</strong> hergerissen <strong>und</strong> siehtsozusagen den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr. Alles ist schädlich <strong>und</strong> belastend.Aus geowissenschaftlicher Sicht läuft einigesaus dem Ruder: Der globale Klimawandel, einTsunami in Japan, ein Vulkanausbruch auf Island,ein Erdbeben in Italien, die Havarie im Golfvon Mexiko, die Endlagersuche, CCS oderFracking in Deutschland. Das Urteil von L’Aquilaist auch eine Folge von fachlichem Hochmut <strong>und</strong>entsprechend angepasster Information. DenMenschen wird seit Jahren suggeriert, dasskomplexe Natur- <strong>und</strong> Georisiken modellierbar,prognostizierbar, ja sogar steuerbar <strong>und</strong> damitbeherrschbar sind. Über die großen Unsicherheitensowie Lücken unseres Wissens <strong>und</strong> überdie weitreichenden Interpolationen wird nichthinreichend aufgeklärt. Die in der Öffentlichkeitstehenden Experten <strong>und</strong> politischen Beraterdrücken sich gerne ambivalent aus. VernunftbasierteKonzepte <strong>und</strong> Lösungen bleiben so aufder Strecke. Stattdessen verfestigen sich Meinungenals einzige Wahrheit <strong>und</strong> politische Ent-<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 97
GEOREPORT – MULTIMEDIA · PERSONALIA · VERANSTALTUNGENscheidungen werden als alternativlos odersystemrelevant dargestellt. Sodann verbietetsich jede Kritik – die wenigen mutigen Kritikerwerden teils diffamiert, diskreditiert <strong>und</strong> ausgegrenzt.Ein Dilemma für die reine Wissenschaft!Dass <strong>hier</strong>zu ausgerechnet ein angesehener Geologe<strong>und</strong> Paläontologe beiträgt, ist ernüchternd.Sind es doch gerade die Geologen, die sich derDimensionen von Raum, Zeit <strong>und</strong> Energie sowieder natürlichen Zyklizitäten zumindest annäherungsweisebewusst sind. Aufgabe der Geowissenschaftensollte es insoweit sein, die Gesellschaftsachlich aufzuklären, zu beruhigen <strong>und</strong>Übertreibungen auszugleichen. Ein anthropozentrischesWeltbild aufzubauen, welches dieAuswirkungen menschlicher Eingriffe über dieKräfte der Plattentektonik <strong>und</strong> kosmischer Gewaltenstellt, ist für einen Geologen befremdlich.Es ist in der Sache leider auch nicht zielführend.Viele der nur kurz angerissenen konkretenProbleme, die zu lösen sind, wie der Welthunger,die Verfügbarkeit von Trinkwasser oderdie Vermüllung der Meere, gehen im Konzeptunter, da abstrakte <strong>und</strong> spekulative Themen wieanthropogene Klimaveränderungen <strong>und</strong> -folgenoder vermeintliche Kipppunkte dominieren. DieBeliebigkeit der Aussagen kennt <strong>hier</strong> keineGrenzen mehr. Dies entspricht wiederum demaktuellen Zeitgeist.Das sogenannte Anthropozän kann durchauseine zweckmäßige, interdisziplinäre <strong>und</strong> internationaleWissenschafts- <strong>und</strong> Informationsplattformfür Umweltschutz <strong>und</strong> Ressourcenschonungsein. Daraus jedoch ein Erdzeitalterzu definieren, ist absurd <strong>und</strong> anmaßend zugleich.Ulrich Wöstmann (Selm)98 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 99
GEOKALENDER – TERMINE · TAGUNGEN · TREFFENAnkündigungenMein Fre<strong>und</strong> der KieselsteinDas Mineralogische Museum der UniversitätBonn zeigt seit dem 16. Dezember 2012 eineSonderausstellung über Kieselsteine: Unterdem Titel „Mein Fre<strong>und</strong> der Kieselstein – Botschafteraus Jahrmillionen“, wird ein Konzeptder Museumsleiterin Dr. Renate Schumacher inZusammenarbeit mit dem Münchner Museum„Reich der Kristalle“ umgesetzt.Kieselsteinf<strong>und</strong> am Rhein beiNiederdollendorf, ein Quarzsandsteinaus dem RheinischenSchiefergebirge.Foto: R. SchumacherAmphibolit-Kieselstein ausden Alpen, gef<strong>und</strong>en an derIsar. Foto: R. Schumacher100 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOKALENDER – TERMINE · TAGUNGEN · TREFFENKieselsteinturm am Strand von Porto auf Korsika.Foto: R. SchumacherMit dem Kieselstein verbinden sich kindlicheErfahrung <strong>und</strong> Urlaubserinnerung ebenso wiemoderne Geowissenschaften. So wie KinderFormen <strong>und</strong> Gestalten ihrer Phantasie im Kieselsteinerkennen, vermittelt er als geologischerBotschafter Informationen zu geologischen Prozessen,zur Eiszeit oder zu globalen Klimaänderungen.Kieselsteine sind Gesteinsbruchstücke<strong>und</strong> werden von Bächen <strong>und</strong> Flüssen oder in derMeeresbrandung transportiert. Auf ihrer Reisereiben einzelne Steine aneinander <strong>und</strong> werdenabger<strong>und</strong>et, bis schließlich ein Kieselstein entstandenist, im Fachjargon als Kies oder Geröllbezeichnet.Gerade der Bonner Raum befindet sich aufmächtigen Kiesablagerungen, die der Rhein inden letzten Eiszeiten abgelagert hat. Ein Spaziergangbei Niedrigwasser zeigt Kieselstein-Schätze vieler Millionen Jahre aus dem Siebengebirge,aus dem Nahegebiet, auch aus demOdenwald, dem Schwarzwald <strong>und</strong> sogar aus denAlpen.Die neue Sonderausstellung des Bonner MineralogischenMuseums veranschaulicht Themenvon der Geologie über den Schmuck bis zur Ökonomiemit seltenen Objekten aus Rhein <strong>und</strong> Isar,aus dem Norden Deutschlands sowie auch ausNamibia <strong>und</strong> Island. Ohne Kies gäbe es keinenBeton oder Asphalt, deshalb auch keine Straßen,modernen Gebäude oder Flachdächer.Das Mineralogische Museum der UniversitätBonn im Poppelsdorfer Schloss zeigt die Sonderausstellungvom 16. Dezember 2012 bis zum13. Oktober 2013. Weitere Information, auch zuÖffnungszeiten <strong>und</strong> Führungen, unter www.steinmann.uni-bonn.de/museen/mineralogisches-museum.Renate Schumacher (Bonn)<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 101
GEOKALENDER – TERMINE · TAGUNGEN · TREFFENInternationaler GeokalenderDer Internet-Auftritt www.gmit-online.de führteinen Tagungskalender, so dass dort Ankündigungeneingeben werden können. Die folgenden Einträgesind eine Kopie der eingestellten Tagungseinträge.2013April 20137.–2.4.: Wien – EGU General Assembly. - www.egu2013.eu21.–24.4.: St. Julian’s (Malta) – Borehole GeophysicsWorkshop II: 3D VSP – Benefits, Challengesand Potential. - www.eage.org23.–26.4: Berlin – Wasser Berlin International -www.wasser-berlin.de24.–28.4.: Görlitz – Basalt 2013, Cenozoic Magmatismin Central Europe. - Senckenberg Museum ofNatural History Görlitz25.4.: Berlin – The 4th International GeosciencesStudent Conference. - http://www.igsc-2013.com/Mai 20139.–11.5.: Klink (bei Waren/Müritz) – Tagung des ArbeitskreisesPaläopedologie 2013. – Sitzung <strong>und</strong>Exkursion. - kaiserk@gfz-potsdam.de9.–12.5.: Prenzlau – 17. Internationale Jahrestagungder Fachsektion GeoTop. - projektbuerogeopark@t-online.de13.–16.5.: Leipzig – Novel Methods for SubsurfaceCharacterization and Monitoring: From Theory toPractice – NovCare 2013. - www.novcare.org19.5.: Pittsburgh – AAPG 2013 Annual Convention& Exhibition. - http://www.aapg.org/pittsburgh2013/index.cfm21.–23.5.: Krefeld – 78. Tagung der ArbeitsgemeinschaftNorddeutscher Geologen. - www.gd.nrw.de22.–23.5.: Aachen – AIMS 2013 Aachen InternationalMining Symposia. - Mineral Resources andMine Development. – aims.rwth-aachen.de23.5.: Dresden – Messtechnik in Boden, Gr<strong>und</strong><strong>und</strong>Oberflächenwasser. - chelling@dgfz.de; www.dgfz.deJuni 201310.–13.6.: London – 75th EAGE Conference & Exhibitionincorporating SPE EUROPEC 2013. - www.eage.org17.–18.6.: Dresden – Dresdner Gr<strong>und</strong>wassertage. -www.gwz-dresden.deJuli 20132.–5.7.2013: Stavanger – 2nd EAGE Workshopon Permanent Reservoir Monitoring. - www.eage.org3.–6.7.: Wien – Corals 2013 - www.univie.ac.at/Mineralogie/Corals2013/22.–26.7.: Gothenburg (Schweden) – IAHS-IAPSO-IASPEI Joint Assembly „Knowledge for theFuture“. - iahs-iapso-iaspei2013.com/index. aspAugust 201310.–15.8.: Kursk <strong>und</strong> Voronezh Region (Russland) –XIIth International Symposium and Field Workshopon Paleopedology (ISFWP). - paleopedology.msu. ru/paleopedology2013102 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013
GEOKALENDER – TERMINE · TAGUNGEN · TREFFEN28.–30.8.: Wien – Vienna Congress on RecentAdvances in Earthquake Engineering and StructuralDynamics & 13. D-A-CH-Tagung. - http://veesd2013.conf.tuwien.ac.at/September 20131.–6.9.: Barcelona-Sitges (Spain) – The 11th InternationalConference on Paleoceanography. - www.icp2013.cat, icp2013@mondial-congress.com2.–6.9.: Madrid (Spain) – 15th Annual Conferenceof the International Association for MathematicalGeosciences. - http://www.igme.es/internet/iamg2013/default.htm8.–11.9.: Bochum – Near Surface Geoscience 2013.- http://www.eage.org9.–11.9.: Schladming, Austria – 7th EuropeanSymposium on Fossil Algae. - http://www.schladming-dachstein.at/de/aktuell/veranstaltungen/7th-european-symposium-onfossil-algae_e81498#f_1378677600; Chairperson:Hans-Juergen Gawlick9.–12.9.: Schladming, Austria – 11th Workshop onAlpine Geological Studies. - http://alpineworkshop2013.uni-graz.at/Libraries – Archives - Museums.www. naturmuseum.itbenno.baumgarten@naturmusuem.it30.9.–4.10.: Ulm – „Soils in Space and Time“Divisional Conference of all Commissions andWorking Groups of the International Union of SoilScience (IUSS) Division I. - iuss-division1.unihohenheim.deOktober 20137.–11.10.: Mpumalanga (Südafrika) – 13th SouthAfrican Geophysical Association’s (SAGA) BiennialConference & 6th International Conference onAirborne Electromagnetics 2013. - www. sagaaem2013.co.za17.10.: Dresden – Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung im Bauwesen– DGFZ e.V., Dr. Claudia Helling www.gwzdresden.de27.–30.10.: Denver (Colorado, USA) – The GeologicalSociety of America Annual Meeting 2013. -www.geosociety.org/meetingsNovember 201315.–16.11.: Lausanne (Schweiz) – 11th Swiss GeoscienceMeeting. - www.geoscience-meeting.scnatweb.ch16.–20.9.: Tübingen – Joint Annual Meeting DMGand GV. - www.dmg-gv2013.de23.–25.9.: Sedimentary Basins Jena 2013 –Research, Modelling, Exploration. - http://www.sedbas2013.uni-jena.de/25.–27.9.: Weimar – 10th International Conferenceon Electromagnetic Wave Interaction with Waterand Moist Substances. - www.truebnerinstruments.com/isema2013/home26.–27.09.: Dresden – Anwenderschulung OpenGIS. - www.gwz-dresden.de30.9.–4.10.: Bozen/Südtirol (Italien) – 12th InternationalSymposium/12. „Erbe“-Symposium - CulturalHeritage in Geosciences, Mining and Metallurgy<strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013 103
ADRESSENAdressenBDGVorsitzende: Dr. Ulrike Mattig, WiesbadenBDG-Geschäftsführer <strong>und</strong> <strong>GMIT</strong>-Redaktion: Dr.Hans-Jürgen Weyer; BDG-Geschäftsstelle, LessenicherStraße 1, 53123 BonnTel.: 0228/696601BDG@geoberuf.de; www.geoberuf.deDie BDG-Geschäftsstelle ist gleichzeitig Ansprechpartnerfür die Publikationsorgane <strong>GMIT</strong><strong>und</strong> BDG-Mitteilungen sowie zuständig für derenAnzeigengestaltung <strong>und</strong> für die Rubrik „Stellenmarkt“.DEUQUAPräsidentin: Prof. Dr. Margot Böse, Berlin<strong>GMIT</strong>-Redaktion: Prof. Dr. Birgit Terhorst, GeographischesInstitut der Universität Würzburg,Am Hubland, 97074 WürzburgTel.: 0931-888-5585birgit.terhorst@uni-wuerzburg.deDr. Christian Hoselmann, Hessisches Landesamtfür Umwelt <strong>und</strong> Geologie, Postfach 320965022 WiesbadenTel.: 0611-6939-928christian.hoselmann@hlug.hessen.deDGG (Geophysik)Präsident: Prof. Dr. Eiko Räkers, EssenGeschäftsstelle: Birger-Gottfried Lühr, DeutschesGeo-ForschungsZentrum – GFZ, Telegrafenberg,14473 Potsdam; Tel.: 0331/288-1206ase@gfz-potsdam.de, www.dgg-online.de<strong>GMIT</strong>-Redaktion: Michael Grinat, Leibniz-Institutfür Angewandte Geophysik, Stilleweg 2, 30655Hannover; Tel.: 0<strong>51</strong>1/643-3493michael.grinat@liag-hannover.deDGG (Geologie)Vorsitzender: Prof. Dr. Gernold Zulauf, FrankfurtDGG-Geschäftsstelle: Karin Sennholz, BuchholzerStr. 98, 30655 Hannover; Tel.: 0<strong>51</strong>1/89805061geschaeftsstelle@dgg.de<strong>GMIT</strong>-Redaktion:; Tel.: 03<strong>51</strong>/7958414414geolange@uni-leipzig.deDMGVorsitzende: Prof. Dr. Astrid Holzheid, Kiel<strong>GMIT</strong>-Redaktion: PD Dr. Klaus-Dieter Grevel,Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut fürGeowissenschaften, Bereich Mineralogie, Carl-Zeiss-Promenade 10, D-07745 Jena; Tel. 03641/9 48713; klaus-dieter.grevel@rub.deGVVorsitzender: Prof. Dr. Ralf Littke, AachenGV-Geschäftsstelle: Rita Spitzlei, Vulkanstraße23, 56743 Mendig; Tel.: 02652/989360geol.ver@t-online.de<strong>GMIT</strong>-Redaktion: Dr. Hermann-Rudolf Kudraß,B<strong>und</strong>esanstalt für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe,Stilleweg 2, 30655 HannoverTel.: 0<strong>51</strong>1/312133; kudrass@gmx.deDr. Sabine Heim, Lehrstuhl für Geologie, Geochemie<strong>und</strong> Lagerstätten des Erdöls <strong>und</strong> derKohle, RWTH Aachen, Lochnerstr. 4–20, 52056Aachen, Tel.: 0241/80-95757heim@lek.rwth-aachen.dePaläontologische GesellschaftPräsident: Prof. Dr. Joachim Reitner, Göttingen<strong>GMIT</strong>-Redaktion: Dr. Alexander Nützel; BayerischeStaatssammlung für Paläontologie <strong>und</strong> Geologie,Richard-Wagner-Straße 10, 80333 München;Tel.: 089/2180-6611a.nuetzel@lrz.uni-muenchen.de104 <strong>GMIT</strong> · NR. <strong>51</strong> · MÄRZ 2013