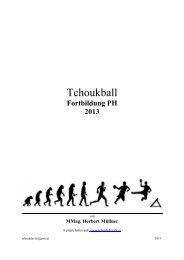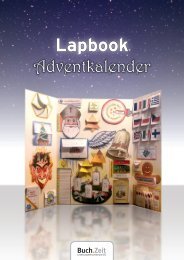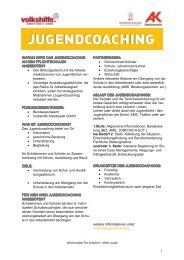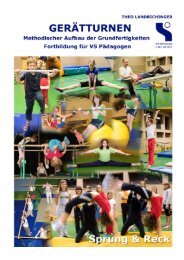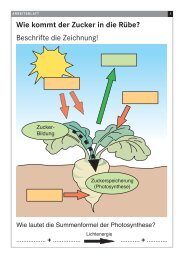wirtschafts- und sozialgeographie wirtschaftsinformationen
wirtschafts- und sozialgeographie wirtschaftsinformationen
wirtschafts- und sozialgeographie wirtschaftsinformationen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lung etablieren. Drittens schließlich war die zeitgenössische<br />
intellektuelle Kommunikation zutiefst von räumlichen<br />
Schemata, wie z. B. der Nationalstaatsdiskussion<br />
<strong>und</strong> der Kolonialismusfrage durchsetzt <strong>und</strong> bot damit<br />
auf der alltagsweltlichen Ebene geeignete Anknüpfungspunkte<br />
für das von Geographen produzierte<br />
raumbezogene Wissen, das nicht zuletzt der Homogenisierung<br />
<strong>und</strong> Stereotypisierung von Subjekten diente<br />
<strong>und</strong> die Aneignung von Welt unter der Perspektive eines<br />
spezifisch deutschen Großmachtstrebens betrieb.<br />
Mit dem Einbau des Landschaftskonzeptes in die<br />
Hochschulgeographie verfestigten sich in der Zwischenkriegszeit<br />
die raumbezogenen Denkfiguren weiter.<br />
Entlang des vorwissenschaftlich-ästhetisch geprägten<br />
Wortumfeldes wurde in zahlreichen methodologischen<br />
Abhandlungen der Begriff „Landschaft" als Zentralbegriff<br />
einer neuen Geographie bestimmt, deren<br />
„höchste Aufgabe", „Endzweck", „Kern" die Regionale<br />
Geographie betrachtet wurde. „Landschaft" galt von<br />
nun an als das „eigentliche" <strong>und</strong> „ureigenste" Forschungsobjekt<br />
der Geographie, das, wie die Zeitgenossen<br />
glaubten, ihre keine andere Wissenschaft streitig<br />
machen konnte. Wie schon in der Geographie des Kaiserreichs<br />
wurden im Denkschema der Landschaftsgeographie<br />
„Räume" in der Regel auch als in „der" Realität<br />
vorgegebene Behälter (container) betrachtet, in denen<br />
bereits alles vorfindbar enthalten war: der Gesteinsuntergr<strong>und</strong>,<br />
die Oberflächenformen <strong>und</strong> Böden, das Klima,<br />
die Gewässer, die Pflanzen <strong>und</strong> Tiere sowie der<br />
Mensch selbst einschließlich seiner Siedlungen, Verkehrswege,<br />
Wirtschaftsflächen etc. Jeder einzelne dieser<br />
Räume bildete für den Landschaftsgeographen eine<br />
real existierende Ganzheit, wobei ihm die Aufgabe zufiel,<br />
diese Ganzheit in ihrer unverwechselbaren Einmaligkeit<br />
zu beschreiben <strong>und</strong> zu erklären.<br />
3. Der Prozess der Ablösung vom Denken<br />
in „Container-Räumen":<br />
die Raumstrukturforschung<br />
Das für die Geographie überaus erfolgreiche, in der<br />
Zwischenkriegszeit dem intellektuellen zeitgenössischen<br />
Milieu in höchstem Maße angepasste Landschaftskonzept,<br />
geriet vor dem Hintergr<strong>und</strong> eines ständig<br />
wachsenden Krisen- <strong>und</strong> Veränderungsbewusstseins<br />
schon im Laufe der 1950er <strong>und</strong> 1960er Jahre zusehends<br />
unter Beschuss, weil festgestellt werden musste,<br />
dass die Landschaftsgeographie weder den Anforderungen<br />
der internationalen Geographie <strong>und</strong> internationalen<br />
Wissenschaft genügte, noch zeitgemäße Antworten<br />
auf die sich in der Nachkriegszeit rasch modernisierende<br />
Welt finden konnte. Im Gefolge der auf dem<br />
Kieler Geographentag geäußerten Kritik, die bei der<br />
etablierten Geographenschaft vor dem Hintergr<strong>und</strong> der<br />
Studentenunruhen wie eine Bombe einschlug, wurden<br />
die bislang durch das container-Konzept definierten<br />
disziplinären Außengrenzen des Faches zugunsten einer<br />
nun immer stärker werdenden Rezeption von Ansätzen<br />
gelockert, die entweder aus den Nachbarwissenschaften<br />
stammten <strong>und</strong> / oder in der zeitgenössischen<br />
angloamerikanischen Geographie intensiv diskutiert<br />
wurden. Unter Umgehung des mit der Landschaftsgeographie<br />
verb<strong>und</strong>enen Begriffsarsenals wie z. B. Schau,<br />
Ganzheit, Integration, Komplex, entwickelte sich in der<br />
deutschsprachigen Hochschulgeographie unter dem<br />
Einfluss des spatial approach seit den 1970er Jahren die<br />
„Raumstrukturforschung" (vgl. hierzu Arnreiter/Weichhart<br />
1998, S. 65). Sie nahm mit ihren statistisch gestützten<br />
Regionalisierungsbemühungen die im spatial approach<br />
verwendeten neuen Methoden zwar auf <strong>und</strong><br />
thematisierte insofern „Räume" als Systeme von Lagebeziehungen<br />
materieller Objekte, wobei sie den Akzent<br />
der Fragestellung besonders auf die Bedeutung von<br />
Standorten, Lage-Relationen <strong>und</strong> Distanzen für die<br />
Schaffung gesellschaftlicher Wirklichkeit legte. Sie<br />
suchte jedoch nicht - wie der spatial approach - als nomologisches<br />
Forschungsprogramm nach' Raumgesetzen,<br />
sondern tendierte immer wieder dazu, die ausgegrenzten<br />
Raumeinheiten zu hypostasieren <strong>und</strong> sie, wie<br />
das in der Landschaftsgeographie üblich gewesen war,<br />
als in der Realität vorkommende Raumganzheiten zu<br />
behandeln. Dennoch stieß die „Raumstrukturforschung"<br />
seit den 1970er Jahren eine neue Differenzierung<br />
an, die spätestens seit den 1980er Jahren dann als<br />
die Differenz von „realistischen" versus „konstruktivistischen"<br />
Ansätzen diskutiert wurde.<br />
9 •<br />
4. Die allmähliche Ablösung<br />
von realistischen Forschungskonzepten<br />
in den 1980er Jahren<br />
Innerhalb der traditionellen Geographie wurde in<br />
der Regel ein realistisches Forschungsprogramm vertreten.<br />
Die Mehrheit der Hochschulgeographen teilte die<br />
Auffassung, dass es ihre Aufgabe sei, die in der Realität<br />
vorgegebene Kammerung der Erde mittels regionalgeographischer<br />
Forschung erklären zu können. Bei entsprechend<br />
„wahren" Forschungsergebnissen, so glaubte<br />
man ganz im naturwissenschaftlichen Positivismus<br />
befangen, könnte die Geographie eines Tages eine absolute<br />
Regionalisierung der Erde aufstellen, auf deren<br />
Basis dann nur noch, quasi wie auf einer Registrierplatte,<br />
die aktuell stattfindenden Veränderungsprozesse zu<br />
erklären seien. Mit dieser Denkfigur war ein wahrscheinlich<br />
aus der frühmodernen Kartographie stammender<br />
horror vacui verb<strong>und</strong>en: kein Gebiet der Erde,<br />
<strong>und</strong> sei es noch so winzig, durfte aus der Regionalisierung<br />
herausfallen. Andererseits sollten Grenzen aber<br />
möglichst als Linien ausgebildet sein, so dass keine<br />
Überlappungen zustande kamen, die womöglich ein<br />
Gebiet als zu zwei Raumeinheiten gehörig definiert<br />
hätten.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der empirischen Forschungsergebnisse<br />
wurde schon im Laufe des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts deutlich,<br />
dass an diesem Absolutheitsmodell nicht festgehalten<br />
werden konnte. Das veranlasste z. B. Alfred Hettner zu<br />
der Auffassung, dass Regionalisierungen immer in Relation<br />
zu den Kriterien der Regionalisierung betrachtet<br />
werden sollten <strong>und</strong> deshalb niemals „wahr" oder<br />
„falsch", sondern nur „zweckmäßig" oder „unzweckmäßig"<br />
sein konnten (vgl. Hettner 1927 <strong>und</strong> Wardenga<br />
1995). In der Landschaftsgeographie dagegen schienen<br />
derartige Überlegungen als hypertrophe Spielereien eines<br />
in die Fachmethodologie verliebten Dogmatikers,<br />
weil in der Semantik des Landschaftsbegriffs die Begrenztheit<br />
des individuellen Erdraums bereits aufgehoben<br />
war, so dass die Problematik der Regionalisierung<br />
<strong>und</strong> die in ihr notwendig implizierte Tendenz der Kritik<br />
Wissenschaftliche Nachrichten Nr. 120 • November/Dezember 2002 49