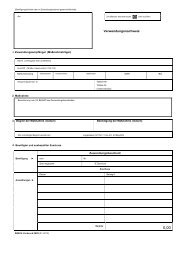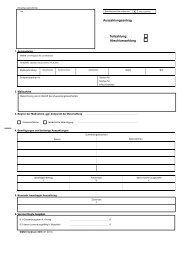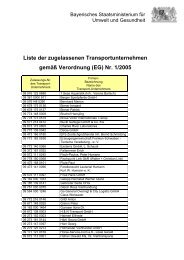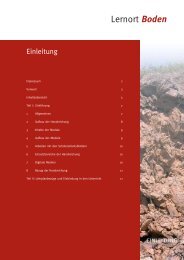Untersuchung von Einschleppungs - Bayerisches Staatsministerium ...
Untersuchung von Einschleppungs - Bayerisches Staatsministerium ...
Untersuchung von Einschleppungs - Bayerisches Staatsministerium ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Bericht<br />
zum Forschungsprojekt<br />
<strong>Untersuchung</strong> <strong>von</strong> <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswegen<br />
der Beifuß-Ambrosie in Bayern<br />
Im Auftrag des<br />
Bayerischen <strong>Staatsministerium</strong>s für Umwelt, Gesundheit und<br />
Verbraucherschutz<br />
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst<br />
Tel. 06031/1609233, Fax: 0721-151234886<br />
projektgruppe@online.de<br />
61169 Friedberg<br />
Mai 2008<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Inhalt<br />
1 Einführung .................................................................................................................. 6<br />
2 Methode....................................................................................................................... 6<br />
3 Bedeutsamste <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege........................................ 7<br />
3.1 Straßenverkehr ...................................................................................................... 7<br />
3.2 Erdmaterial / Baumaßnahmen.............................................................................. 14<br />
3.3 Schnittblumenfelder ............................................................................................. 23<br />
3.4 Wildäcker ............................................................................................................. 30<br />
3.5 Weitere Zweckentfremdung / Verwendungen <strong>von</strong> Vogelfutter .............................. 34<br />
3.5.1 Aussaat <strong>von</strong> Sonnenblumen zur Landschaftsbildverschönerung ................. 34<br />
3.5.2 Aussaat <strong>von</strong> Sonnenblumen zur Gründüngung ........................................... 36<br />
3.5.3 Tierfütterungen............................................................................................ 36<br />
3.5.4 Entsorgung <strong>von</strong> Futterresten ....................................................................... 37<br />
4 Möglicherweise oder potenziell bedeutsame <strong>Einschleppungs</strong>- und<br />
Ausbreitungswege................................................................................................... 38<br />
4.1 Sonnenblumenfelder zur Biogaserzeugung.......................................................... 38<br />
4.2 Grüngutverwertung: Kompost und Grüngutdünger ............................................... 42<br />
4.3 Binnenschifffahrt .................................................................................................. 46<br />
5 Nicht oder weniger bedeutsame <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege......... 49<br />
5.1 Bahnverkehr......................................................................................................... 49<br />
5.2 Topf- und Containerpflanzen aus Gartencentern / Gärtnereien ............................ 54<br />
5.3 Buntbrachen......................................................................................................... 57<br />
5.4 Sonnenblumenfelder zur Ölgewinnung................................................................. 58<br />
6 <strong>Einschleppungs</strong>wege der großen Bestände in Bayern.......................................... 59<br />
7 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.................................................. 62<br />
8 Literatur..................................................................................................................... 64<br />
9 Anhang ...................................................................................................................... 66<br />
9.1 <strong>Untersuchung</strong>sergebnisse in tabellarische Zusammenstellung ............................ 66<br />
9.2 Danksagung......................................................................................................... 74<br />
9.3 Muster der Erfassungsbögen ............................................................................... 75<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
2
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Verzeichnis der Abbildungen<br />
Abb. 1: Große Bestände der Beifuß-Ambrosie an bayerischen Autobahnen. Links: A8<br />
Ost bei Bad Reichenhall (25.08.06). Rechts: A3-Ost bei Bichlberg (24.08.06) ........... 8<br />
Abb. 2: Auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie kontrollierte Bundesfernstraßen und<br />
größere Nebenstrecken in Bayern.............................................................................. 8<br />
Abb. 3: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie an Bundesfernstraßen und größeren<br />
Nebenstrecken...........................................................................................................9<br />
Abb. 4: Beifuß-Ambrosie vom Rand der A8-Ost bei Rasthof Bad Reichenhall...................... 11<br />
Abb. 5: Beifuß-Ambrosie am Straßenrand der Bundesstraße B20. ...................................... 12<br />
Abb. 6: Foto eines auf Futtermittel spezialisierten LKW Kipper-Aufliegers für Schüttgut.<br />
Die oben offene Ladefläche ist mit einer Plane abgedeckt. ...................................... 13<br />
Abb. 7: LKW-Unfall mit Kipper-Auflieger zum Schüttguttransport (in diesem Fall kein<br />
Vogelfutter) an der A8 bei Autobahn-km 119.95....................................................... 14<br />
Abb. 8: Beifuß-Ambrosie auf Erdmieten im Gewerbegebiet GADA A8 Bergkirchen.............. 16<br />
Abb. 9: Beifuß-Ambrosie auf Erdzwischenlager nahe dem Bahnhof Augsburg..................... 17<br />
Abb. 10: Lage der untersuchten Großbaumaßnahmen, Abgrabungen, Gewerbebrachen,<br />
Zwischenlager (Erde, Baustoffe). ............................................................................. 17<br />
Abb. 11: Stauden-Ambrosie auf der Baustelle der neuen Autobahn-Anschlussstelle<br />
Alzenau-Mitte der A45 bei Alzenau (Unterfranken, Foto: 10.09.07).......................... 18<br />
Abb. 12: Stauden-Ambrosie auf Recycling-Werk nahe der A45 bei Alzenau<br />
(Unterfranken).......................................................................................................... 18<br />
Abb. 13: Beifuß-Ambrosie auf einer Erdmiete die im Zuge <strong>von</strong> Straßenbauarbeiten<br />
nördlich <strong>von</strong> Emmerting aufgeschüttet wurde (Foto: 27.07.07)................................. 19<br />
Abb. 14: Große Bestände der Beifuß-Ambrosie im Baugebiet Fasanenfeld in Eging am<br />
See. ......................................................................................................................... 20<br />
Abb. 15: Erdzwischenlager der Gemeinde Burghausen (LKR Altötting) als Ursprung<br />
mehrerer großer Bestände der Beifuß-Ambrosie im Stadtgebiet. ............................. 21<br />
Abb. 16: Die Hybrid-Sorten (links) der Sonnenblumen unterscheidet sich durch ihre<br />
dunklere Mitte <strong>von</strong> den Blüten des Vogelfutter-Typus (rechts)(Foto: 01.07.07 und<br />
29.06.07).................................................................................................................. 25<br />
Abb. 17: Lage der untersuchten Schnittblumenfelder. ............................................................ 26<br />
Abb. 18: Zur Einsaat der Pflückfelder verwendete Sonnenblumen-Typen/Sorten................... 26<br />
Abb. 19: 25 kg-Großpackungen <strong>von</strong> Sonnenblumenkernen im Praktiker-Baumarkt für<br />
24,95 € (Foto: 12.10.07)........................................................................................... 28<br />
Abb. 20: Lage der untersuchten Wildäcker/ Wildwiesen und Buntbrachen. ............................ 31<br />
Abb. 21: Wildacker (Nr. 11) nördlich <strong>von</strong> Alzenau (Unterfranken) mit einem Bestand <strong>von</strong><br />
ca. 70 Exemplaren der Beifuß-Ambrosie (Foto: 24.09.07)........................................ 32<br />
Abb. 22: Sonnenblumenfelder aus Vogelfutter zur Markierung zukünftiger Wohngebäude<br />
im Baugebiet Mitte <strong>von</strong> Regensburg-Burgweinting (Code BY8). .............................. 34<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
3
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 23: Informationen auf der Homepage der Stadt Regensburg zum neuen Baugebiet<br />
im Ortsteil Burgweinting. Das Foto zeigt die zur Markierung der geplanten<br />
Gebäude angelegten Sonnenblumenfelder. ............................................................. 35<br />
Abb. 24: Großer Bestand der Beifuß-Ambrosie am Ortseingang <strong>von</strong> Georgensgmünd. ......... 35<br />
Abb. 25: Großer Bestand der Beifuß-Ambrosie auf einer Bauparzelle in Schwanstetten........ 37<br />
Abb. 26: Großer Bestand der Beifuß-Ambrosie nahe Herpersdorf (Landkreis Erlangen-<br />
Höchstadt) am Rand eines Ackers, der vermutlich auf die Ablagerung <strong>von</strong><br />
Futtermittelresten zurückzuführen ist. ...................................................................... 38<br />
Abb. 27: Verkauf <strong>von</strong> stark mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastetem Vogelfutter im<br />
BayWa-Baumarkt..................................................................................................... 39<br />
Abb. 28: Beifuß-Ambrosie auf einem abgeernteten Biogas-Sonnenblumenfeld bei<br />
Minderoffingen (LKR Donau-Ries). .......................................................................... 40<br />
Abb. 29: Massenbestand der Beifuß-Ambrosie in einem Biogasfeld in Emmerting (LKR<br />
Altötting)................................................................................................................... 41<br />
Abb. 30: Kompostwerk in Chieming-Weidboden, das Ambrosia-haltiges<br />
Autobahnschnittgut verarbeitet hat........................................................................... 43<br />
Abb. 31: Hafen Ochsenfurt mit Verladeanlagen. .................................................................... 47<br />
Abb. 32: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie am Main-Donau-Kanal bei Wendelstein-<br />
Neusses (LKR Roth). ............................................................................................... 48<br />
Abb. 33: Wuchsort der Beifuß-Ambrosie nahe der Gleisanbindung zum Hafen und dem<br />
Agrarlager der BayWa Ochsenfurt (Unterfranken) neben einem Pappel-Stumpf...... 50<br />
Abb. 34: Wuchsort der Beifuß-Ambrosie am Schweinfurter „Stadtbahnhof“ auf einer<br />
Brachfläche nahe dem Zollhof.................................................................................. 51<br />
Abb. 35: Würzburg Hauptbahnhof auf einer Parkfläche zwischen (ungenutzter) Güterhalle<br />
und Parkhaus eine Pflanze in Pflasterfuge (Foto: 16.10.07)..................................... 51<br />
Abb. 36: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie im Hafen Aschaffenburg (Unterfranken).............. 52<br />
Abb. 37: Lage der untersuchten Bahnhöfe und Bahnanlagen. ............................................... 52<br />
Abb. 38: Stillgelegte Güterhalle und ausgedehnte Brachflächen am Bahnhof Würzburg<br />
(Foto 16.10.07). ....................................................................................................... 53<br />
Abb. 39: Unkrautbewuchs in Topfpflanzen des Dehner Gartencenters Nürnberg................... 55<br />
Abb. 40: Lage der untersuchten Gartencenter und Gartenbaubetriebe. ................................. 56<br />
Abb. 41: Links: Gärtnereigelände und angrenzende Randflächen. Rechts: Baumschule<br />
mit intensiver Unkrautbekämpfung........................................................................... 56<br />
Abb. 42: Buntbrache bei Obernburg-Eisenbach (Unterfranken, Fläche Nr. 9). ....................... 57<br />
Abb. 43: Sonnenblumenfeldern zur Ölgewinnung östlich Knetzgau (Unterfranken)................ 59<br />
Abb. 44: <strong>Einschleppungs</strong>wege der 68 großen Bestände der Beifuß-Ambrosie....................... 60<br />
Abb. 45: Ursprünglicher Verwendungszweck der auf Sonnenblumen-Vogelfutter<br />
zurückgehenden großen Bestände in Bayern. ......................................................... 60<br />
Abb. 46: Aufschlüsselung der <strong>Einschleppungs</strong>wege über Erdmaterial der bislang aus<br />
Bayern bekannten großen Bestände der Beifuß-Ambrosie. ..................................... 61<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
4
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Verzeichnis der Tabellen<br />
Tab. 1: Top 10 der in Deutschland beliebtesten Schnittblumen im Jahr 2006 nach<br />
Marktanteilen (ZMP 2007). Die Beliebtheit der Sonnenblume hat in den letzten<br />
Jahren stark zugenommen....................................................................................... 24<br />
Tab. 2: Verteilung der untersuchten Schnittblumenfelder auf die Regierungsbezirke. .......... 27<br />
Tab. 3: Übersicht über Größe der befallenen Wildäcker und Individuenzahl der<br />
Ambrosia-Vorkommen. ............................................................................................ 32<br />
Tab. 4: Untersuchte Großbaumaßnahmen, Abgrabungen, Gewerbebrachen,<br />
Zwischenlager.......................................................................................................... 66<br />
Tab. 5: Untersuchte Schnittblumenfelder. ............................................................................ 68<br />
Tab. 6: Untersuchte Wildäcker und Buntbrachen. ................................................................ 70<br />
Tab. 7: Untersuchte Gartencenter und Gärtnereibetriebe..................................................... 72<br />
Tab. 8: Untersuchte Bahnhöfen/Bahnanlagen...................................................................... 73<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
5
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
1 Einführung<br />
Ziel der <strong>Untersuchung</strong> ist es, Kenntnislücken zur Einschleppung und Ausbreitung der Beifuß-<br />
Ambrosie in Bayern zu schließen. Da sich die Beifuß-Ambrosie aus eigener Kraft durch ihre<br />
nicht flugfähigen und relativ großen Samen nur geringfügig ausbreitet, findet der derzeitige<br />
Ausbreitungsprozess im wesentlichen durch menschliche, zumeist unbeabsichtigte Aktivitäten<br />
statt. Die bisherigen Kenntnisse zu den <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswegen waren noch<br />
sehr lückenhaft bzw. basierten auf einer relativ kleinen Zahl <strong>von</strong> Beobachtungen. Die mög<br />
lichst genaue Kenntnis der <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege ist aber eine wesentliche<br />
Grundlage, um Gegenmaßnahmen gezielt zu steuern. Eine Bekämpfung der Beifuß-Ambrosie<br />
kann nur dann erfolgreich sein, wenn keine Einschleppung mehr stattfindet.<br />
Ziel der Studie ist:<br />
a) die Relevanz bereits bekannter <strong>Einschleppungs</strong>wege für Bayern zu ergründen (Stra<br />
ßen, Erdmaterial / Baumaßnahmen, Schnittblumenfelder, Wildäcker)<br />
b) potenzielle <strong>Einschleppungs</strong>wege zu überprüfen (Topf- Containerpflanzen <strong>von</strong> Garten<br />
centern/Gärtnereien, Bahnverkehr), und<br />
c) unspezifisch nach weiteren <strong>Einschleppungs</strong>wegen zu suchen.<br />
In die <strong>Untersuchung</strong> wurden auch Ergebnisse der Parallelstudie „Evaluierung <strong>von</strong> Maßnahmen<br />
der Eradikation der Beifuß-Ambrosie in Bayern“ einbezogen, sofern sie sich auf die Einschlep<br />
pungswege der 68 bislang bekannten großen bayerischen Bestände beziehen.<br />
Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich nach ihrer Bedeutung für Einschleppung und<br />
Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie in drei Gruppen:<br />
a) die bedeutsamsten,<br />
b) die möglicherweise oder potenziell bedeutsamen,<br />
c) und die nicht oder weniger bedeutsamen <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege.<br />
2 Methode<br />
Die umfangreichen Geländeerhebungen der <strong>Untersuchung</strong>en umfassen weite Teile der baye<br />
rischen Landesfläche in allen sieben Regierungsbezirken. Schwerpunkte wurden in den fol<br />
genden drei Regionen gebildet: Region Aschaffenburg (Unterfranken), Region Erlan<br />
gen/Nürnberg (Mittelfranken) und Region Südostbayern (Oberbayern).<br />
Die Erhebungen erfolgten <strong>von</strong> Juli bis Oktober 2007, da dies die günstigste Zeit zur Untersu<br />
chung der Beifuß-Ambrosie ist. Zwar keimt ein großer Teil der Ambrosia-Samen bereits im<br />
April/Mai, doch sind die Pflanzen aufgrund ihrer langsamen Wuchsentwicklung im Frühjahr<br />
erst ab Anfang Juli gut im Pflanzenbestand zu erkennen.<br />
Alle untersuchten Flächen wurden digital fotografiert und die geographischen Koordinaten mit<br />
einem GPS (Garmin geko 201) erfasst. Die Angabe der geographischen Koordinaten erfolgte<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
6
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie 7<br />
als Gauß-Krüger-Koordinaten im Potsdam-Datum oder als geographische Längen- und Brei<br />
tengrade im WGS84-Datum (in dezimaler Notation). Teilweise wurden geographische Koordi<br />
naten mittels googleearth ermittelt. Eine Umrechnung zwischen den geographischen Systemen<br />
erfolgte mittels eines Internet-online-Pogramms (LABONDE 2006). Luftbildrecherchen erfolgten<br />
unter Zuhilfenahme des BayernViewers (LVG 2007).<br />
Im Gelände angetroffene kleinere Bestände der Beifuß-Ambrosie wurden in den meisten Fäl<br />
len <strong>von</strong> den Autoren selber ausgerissen und über den Restmüll entsorgt.<br />
3 Bedeutsamste <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege<br />
Die wichtigsten <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege werden nachfolgend erläutert. Nach<br />
derzeitiger Erkenntnislage sind dies der Straßenverkehr, Erdtransporte und die unsachgemä<br />
ße Verwendung <strong>von</strong> mit Samen der Beifuß-Ambrosie verunreinigtem Sonnenblumen-<br />
Vogelfutter, beispielsweise zur Anlage <strong>von</strong> Schnittblumenfeldern, Wildäckern und Sonnenblu<br />
menfeldern zur Verschönerung oder als Gründüngung.<br />
3.1 Straßenverkehr<br />
Aus Südost-Frankreich, Nord-Italien und Ost-Österreich ist bekannt, dass sich die Beifuß-<br />
Ambrosie entlang der Straßenränder auszubreiten vermag. Dort kommt die Art an den Rän<br />
dern <strong>von</strong> Fernstraßen in ausgedehnten Beständen vor. Über größere Vorkommen der Beifuß-<br />
Ambrosie an Straßenrändern in Deutschland war bis vor wenigen Jahren nach unserer Kennt<br />
nis nichts bekannt. Im Jahr 2005 wurden erstmalig an Bundesstraßen und 2006 auch an Auto<br />
bahnen große Vorkommen in Bayern, Südhessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und<br />
Brandenburg festgestellt. In Bayern gab es bereits Hinweise auf ein Vorkommen auf dem Mittelstreifen<br />
der A3-Ost nahe der Landesgrenze nach Österreich <strong>von</strong> HOHLA (2002). Im Jahr<br />
2006 ergaben Beobachtungen <strong>von</strong> W. Zalheimer (email August 2006) und Kartierungen <strong>von</strong><br />
Nawrath (24.08.06), dass bereits größere Abschnitte der A3-Ost <strong>von</strong> Österreich bis Iggens<br />
bach Vorkommen der Beifuß-Ambrosie aufweisen (mit Lücken auf 45 km). Das größte bayeri<br />
sche Autobahnvorkommen wurde aber am 25.08.06 <strong>von</strong> S. Nawrath an der A8-Ost <strong>von</strong> der<br />
österreichischen Landesgrenze bis Weyarn festgestellt (mit Lücken auf 90 km).<br />
Da die Straßen bedeutende Ausbreitungswege der Beifuß-Ambrosie darstellen, waren die Fra<br />
gen zu klären, ob noch weitere Straßenrandvorkommen existieren, wie und wann die Bestän<br />
de an die Autobahnen gelangten und wie der Prozess der weiteren Ausbreitung entlang der<br />
Straßen bzw. <strong>von</strong> den Straßen in die Umgebung erfolgt.<br />
Methode<br />
In Verbindung mit dem weiteren Forschungsvorhaben „Evaluierung <strong>von</strong> Maßnahmen der Era<br />
dikation der Beifuß-Ambrosie in Bayern“ wurden 2007 insgesamt ca. 20000 km auf bayeri<br />
schen Straßen zurückgelegt. Sofern es Licht- und Witterungsverhältnisse zuließen, wurde hier<br />
bei auch auf Ambrosia-Vorkommen an Straßenrändern geachtet. Eine systematische Erhe<br />
bung der Straßen erfolgte allerdings nicht (war auch nicht Bestandteil des <strong>Untersuchung</strong>spro-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
gramms). Abb. 2 zeigt die auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie kontrollierten Bundesfernstra<br />
ßen und größeren Nebenstrecken.<br />
Abb. 1: Große Bestände der Beifuß-Ambrosie an bayerischen Autobahnen. Links: A8-Ost<br />
bei Bad Reichenhall (25.08.06). Rechts: A3-Ost bei Bichlberg (24.08.06)<br />
Kontrollierte Streckenabschnitte auf<br />
Bundesfernstrassen und größeren<br />
Nebenstrecken im Zeitraum vom<br />
01.07. bis 23.10.2007<br />
Abb. 2: Auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie<br />
kontrollierte Bundesfernstraßen und<br />
größere Nebenstrecken in Bayern.<br />
Die Erhebungen erfolgten aus dem fahrenden Auto bei ca. 90 bis 100 km/h. Die Positionsbe<br />
stimmung wurde mittels Pocket-PC mit GPS und der Navigationssoftware Navigator 5.0 <strong>von</strong><br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
8
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Navteq vorgenommen. Da es oftmals nicht leicht ist, die überwiegend nur um die 20 cm hohen<br />
Pflanzen vom fahrenden Auto zu erkennen, ist nicht auszuschließen, dass auch Bestände<br />
übersehen wurden. Zudem spielt der aktuelle Pflegezustand für die Erkennbarkeit eine große<br />
Rolle. Vor der ersten Bankettpflege gehen die Pflanzen oft in der höherwüchsigen Begleitvege<br />
tation unter. In den ersten Wochen nach den Schnittmaßnahmen sind die Ambrosien nicht<br />
erkennbar, bis sie wieder aufgewachsen sind. Auch die Witterung (Lichtverhältnisse, Regen)<br />
spielt für die Erkennbarkeit eine wichtige Rolle. Da die Mittelstreifen vom fahrenden Auto nur<br />
schwer zu erheben sind, beschränken sich die Beobachtungen auf die Bankette. Die Stre<br />
ckenabschnitte wurden teils nur in einer Fahrtrichtung abgesucht. Die Autobahn-Spuren wei<br />
sen aber je nach Fahrtrichtung eine oft abweichende Besiedlung auf.<br />
Bereits im August und September 2006 hat die Projektgruppe die Verbreitung der Beifuß-<br />
Ambrosie an der A8-Ost und der A3-Ost erfasst (NAWRATH & ALBERTERNST 2007) und die Er<br />
gebnisse der Obersten Baubehörde zu internen Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Im Rahmen der Recherchen wurde die Autobahnmeisterei Siegsdorf besucht und im Gespräch<br />
mit dem Leiter die Betriebsabläufe hinsichtlich der <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege<br />
analysiert.<br />
Ergebnisse<br />
Vorkommen der Beifuß-Ambrosie an bayerischen Straßen<br />
Längere Autobahnabschnitte mit Vorkommen<br />
der Beifuß-Ambrosie<br />
(Erhebung 2006 und 2007: Bänder,<br />
Gruppen und Einzelpflanzen)<br />
Kleinere Vorkommen der Beifuß-<br />
Ambrosie (Erhebung 2006 und 2007:<br />
Bänder bis 20 m, Gruppen und Einzelpflanzen;<br />
inkl. einer Meldung der<br />
OBB)<br />
Abb. 3: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie an<br />
Bundesfernstraßen und größeren Nebenstrecken<br />
Im Jahr 2007 wurden weitere sehr große Bestände an der A8-West (4 km) und A99 (8 km)<br />
festgestellt. An der A9 und A70 wurden Bestände auf jeweils ca. 20 m Länge (deutlich >100<br />
Pflanzen) neu entdeckt (siehe NAWRATH & ALBERTERNST 2008). Kleinere Bestände aus Einzelpflanzen<br />
und Gruppen wurden an der A92, B20, St2239 und St2107 beobachtet. Die Bestände<br />
an Bundesstraßen und Staatsstraßen wurden gleich ausgerissen und entsorgt, sofern Haltemöglichkeiten<br />
für das Auto bestanden. Neben den <strong>von</strong> den Autoren entdeckten Vorkommen<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
9
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
wurde <strong>von</strong> Mitarbeitern der Straßenverwaltung ein weiterer Bestand zwischen 10 und 100<br />
Pflanzen an der B11 gemeldet. Abb. 3 zeigt eine Übersicht der Vorkommen an Bundesfern<br />
straßen und größeren Nebenstrecken. Hinsichtlich der Ausdehnung sind die Bestände an den<br />
bayerischen Autobahnen die größten derzeit in Deutschland bekannten.<br />
Zeitpunkt der Einschleppung<br />
Die Entdeckung der ausgedehnten Autobahn-Vorkommen der Beifuß-Ambrosie in den Jahren<br />
2006 und 2007 war ausgesprochen überraschend. Entweder ist die Ansiedlung und Ausbreitung<br />
sehr schnell erfolgt oder die Vorkommen der Beifuß-Ambrosie wurden lange Zeit übersehen.<br />
Es ist aber sehr unwahrscheinlich, das derart große Bestände über viele Jahre <strong>von</strong> bayerischen<br />
(und anderen) Botanikern übersehen wurden, zumal das Phänomen der an Straßenrändern<br />
einwandernden Pflanzenarten Botanikern bekannt ist. Nahe der A8 in Laufen liegt die<br />
Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) mit botanisch geschulten<br />
Mitarbeitern, denen die Vorkommen bestimmt nicht entgangen wären. Anlässlich einer <strong>von</strong><br />
den Autoren im Jahr 2005 durchgeführten email-Recherche gaben Mitarbeiter der ANL (S.<br />
Heringer, W. Joswig, P. Sturm) keine Hinweise auf die Autobahnvorkommen an der A8. Vermutlich<br />
hat sich die Ausbreitung sehr schnell vollzogen, wie auch W. Zahlheimer (email vom<br />
13.09.06) annimmt. Auch die Entwicklung weiterer, im Jahr 2006 außerhalb Bayerns bekannt<br />
gewordener großer Vorkommen an Fernstraßen, ist <strong>von</strong> Botanikern weitgehend unbemerkt<br />
erfolgt: So die großen Vorkommen der Beifuß-Ambrosie an der B9 südlich <strong>von</strong> Ludwigshafen<br />
(MAZOMEIT 2006) und an der A13/15 im südöstlichen Brandenburg (BRANDES mündl. Mitt.<br />
2006).<br />
<strong>Einschleppungs</strong>wege der großen Autobahnvorkommen<br />
Wie ist es zu einer derartig schnellen und starken Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie gekommen?<br />
Autobahnen stellen ausgesprochen wirksame Ausbreitungsachsen für Pflanzen dar, wie<br />
in den letzten Jahren anhand verschiedener Arten wie beispielsweise dem Klebrigen Aland<br />
(Ditrichia graveolens) oder dem Schmalblättrigen Greiskraut (Senecio inaequidens) zu beobachten<br />
war. Da die Samen der Beifuß-Ambrosie allerdings nicht flugfähig sind, können sie<br />
ohne fremde Hilfe nur geringe Distanzen überwinden. An den Autobahnen entstehen allerdings<br />
durch vorbeifahrende PKW und LKW starke Luftströmungen und Luftverwirbelungen,<br />
sogenannte Wirbelschleppen. Diese Wirbelschleppen erzeugen erhebliche Kräfte, die auch die<br />
relativ großen Samen der Beifuß-Ambrosie weitertransportieren können. Die Kraft der Wirbelschleppen<br />
nimmt mit zunehmendem Abstand vom Straßenrand ab. Da an der A8-Ost größtenteils<br />
keine Standstreifen vorhanden sind, wirken sich die Kräfte besonders stark aus. Ob aber<br />
durch die Wirbelschleppen eine Verbreitung über einen Bereich <strong>von</strong> 90 km, wie beispielsweise<br />
an der A8-Ost, möglich ist, ist fraglich. Hier scheint ein Ferntransport durch an Fahrzeugen<br />
anhaftendes samenhaltiges Erdmaterial bzw. anhaftende Samen <strong>von</strong> Bedeutung zu sein. Möglicherweise<br />
erfolgt auch eine Ausbreitung über die an den Mähfahrzeugen anhaftenden Samen<br />
oder die Auffüllung beschädigter Bankette mit samenhaltigem Erdmaterial.<br />
Einschleppung durch an Fahrzeugen anhaftende Samen<br />
Für einen Ferntransport <strong>von</strong> an Fahrzeugen anhaftenden Samen der Beifuß-Ambrosie sprechen<br />
mehrere Ambrosiafunde an der B20, die nicht durch Baumaßnahmen oder Windtransport<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
10
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
durch Wirbelschleppen zu erklären sind. Die B20 wird als Teil einer Ausweichroute des die<br />
östlichen Alpen querenden Fernverkehrs mit einer weiträumigen Umgehung Münchens („Blaue<br />
Route“) sehr stark <strong>von</strong> Fahrzeugen, insbesondere dem Güterverkehr, aus Salzburg kommend<br />
genutzt. Denkbar ist, das die durch Fahrzeuge im Raum Salzburg aufgenommene Samen der<br />
Beifuß-Ambrosie auf den folgenden 40-50 km-Abschnitt der B20 wieder abgefallen sind.<br />
Die Ausbreitung entlang der Autobahnen A8-Ost und A3-Ost erfolgt nicht in Form einer <strong>von</strong><br />
Osten kommenden „geschlossenen“ Ausbreitungsfront in Richtung Westen, sondern in Form<br />
mehrerer Abschnitte, die teils durch größere Lücken <strong>von</strong> mehreren Kilometern <strong>von</strong>einander<br />
getrennt sind. Diese Abschnitte sind vermutlich auf mehrere, <strong>von</strong>einander unabhängige An<br />
siedlungsprozesse zurückzuführen.<br />
Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, auf welche Weise Samen <strong>von</strong> den Fahrzeugen<br />
transportiert werden: Die Samen selber oder zusammen mit Erdmaterial im Reifenprofil, in<br />
Radkästen oder an anderen Stellen der Fahrzeuge. Auf Autobahnen mit Abschnitten ohne<br />
Standstreifen oder an Baustellen kommt es vor, dass schlingernde LKW über die Bankette<br />
fahren und über die Räder und Radkästen Erde aufnehmen. Darüber, wie weit der Transport<br />
<strong>von</strong> Samen der Beifuß-Ambrosie über anhaftende Erde oder Samen erfolgen kann, bestehen<br />
Kenntnislücken. Nicht auszuschließen ist, dass auch ein Transport über sehr große Distanzen<br />
aus Ländern mit großen Ambrosia-Vorkommen wie Ungarn oder Rumänien erfolgt.<br />
Abb. 4: Beifuß-Ambrosie vom Rand der A8-Ost bei Rasthof Bad Reichenhall.<br />
Links: Regeneration nach Mahd ca. Mitte Juni (Foto: 30.06.07). Rechts: Weiteres<br />
Wachstum und erste geöffnete Blüten einen Monat später (Foto: 27.07.07).<br />
Ist die Beifuß-Ambrosie an der A8 aus Österreich eingewandert?<br />
Da die Beifuß-Ambrosie auch in Fortsetzung auf österreichischer Seite an den Autobahnen<br />
vorkommt, ist eine Einwanderung ausgehend <strong>von</strong> Österreich denkbar. Doch sind die Bestandsdichten<br />
im österreichischen Grenzgebiet um Salzburg geringer als in Deutschland. Zudem<br />
nimmt die Besiedlung der Autobahn in ihrer weiteren Fortsetzung Richtung Wien bald<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
11
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
stark ab. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Herkunft der Beifuß-Ambrosie an der A8 eher<br />
in Deutschland, als in Österreich zu suchen ist. Möglicherweise sind sogar die deutschen Vor<br />
kommen als die Quelle für die österreichischen Pflanzen anzusehen. Die geringere Bestands<br />
dichte könnte aber auch an einer anderen Bewirtschaftung der dortigen Straßenränder liegen.<br />
Einschleppung über Erdmaterial und Bankettpflege<br />
Ein weiterer <strong>Einschleppungs</strong>weg ist die Verwendung <strong>von</strong> mit Samen der Beifuß-Ambrosie belasteter<br />
Erde für Baumaßnahmen im Straßenbereich, u.a. zur Auffüllung <strong>von</strong> beschädigten<br />
Banketten. Das Abschälen der Bankette zur besseren Ableitung <strong>von</strong> Regenwasser (Bankettfräse)<br />
schafft Offenboden und begünstigt damit die Entwicklung der Beifuß-Ambrosie. An der<br />
A8-Ost sind derartige Maßnahmen aber nach Auskunft der Autobahnmeisterei Siegsdorf eher<br />
<strong>von</strong> geringer Bedeutung bzw. seit vielen Jahren nicht erfolgt.<br />
Abb. 5: Beifuß-Ambrosie am Straßenrand der Bundesstraße B20.<br />
Links: Bei Tittmoning-Ranharting. Rechts: Bei Fridolfing-Nilling (beide 18.09.07).<br />
Zunahme der Bestände durch die Bankettpflege<br />
Eine Ursache für die starke Zunahme der Individuenzahlen ausgehend <strong>von</strong> einzelnen Pflanzen<br />
ist möglicherweise der sehr „Ambrosia-freundliche“ Pflegerhythmus an den meisten der befallenen<br />
bayerischen Autobahnabschnitten. Ein erster Schnitt der Bankette erfolgt üblicherweise<br />
im Frühsommer und verbessert die Wuchsbedingungen der Beifuß-Ambrosie durch die Verminderung<br />
des Konkurrenzdrucks der Begleitvegetation. Bereits ausgetriebene und durch die<br />
Mahd abgeschnittene Ambrosien regenerieren sich schneller als die Begleitvegetation. Der<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
12
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
zweite Schnitt erfolgt meist sehr spät <strong>von</strong> September bis Oktober, wenn die Beifuß-Ambrosie<br />
bereits reife Samen ausgebildet hat. Dies war auch im Jahr 2007 der Fall. Vermutlich wurde<br />
vor der Mahd bereits der größte Teil der Samen ausgestreut.<br />
Einschleppung über LKW-Unfälle<br />
Abb. 6: Foto eines auf<br />
Futtermittel spezialisierten<br />
LKW Kipper-<br />
Aufliegers für Schüttgut.<br />
Die oben offene Ladefläche<br />
ist mit einer Plane<br />
abgedeckt.<br />
Das Foto stammt <strong>von</strong> der<br />
einer auf Agroprodukte<br />
wie Sonnenblumensamen<br />
spezialisierten Export-ImportGrosshandelsfirma<br />
(SUNFLOWER<br />
2008).<br />
Der Transport <strong>von</strong> Agrarprodukten erfolgt heute zu einem bedeutenden Anteil über die Straße.<br />
Futtermittel werden meist als lose Schüttware mit speziellen oben offenen bzw. mit einer Plane<br />
abgedeckten LKW über Agrarspeditionen transportiert. Abb. 6 zeigt als Beispiel ein Foto eines<br />
derartigen Fahrzeugtyps einer auf Agrarprodukte spezialisierten Export-Import-<br />
Grosshandelsfirma, die unter anderem auch Sonnenblumensamen transportiert. Wenn bei<br />
Unfällen die Schüttgut-LKW umfallen, tritt nicht selten Ladung aus. Abb. 7 zeigt einen auf der<br />
A8-Ost umgefallenen Schüttgut-LKW mit ausgetretener Ladung (in diesem Falle aber kein<br />
Vogelfutter). Nach dem Unfall wird die Ladung <strong>von</strong> der Fahrbahn entfernt, wobei aber Reste<br />
auf dem Mittel- und Randstreifen verbleiben. Falls mit Ambrosiasamen belastete Futtermittel<br />
geladen waren, ist <strong>von</strong> einer sehr massiven Einbringung der Samen der Art auszugehen. Interessanterweise<br />
deckt sich der LKW-Unfallschwerpunkt auf der A8 mit dem Bereich der stärksten<br />
Ambrosie-Besiedlung entlang der Autobahn. Möglicherweise sind derartige Unfälle ein<br />
Startpunkt für die Ausbreitung an Straßenrändern.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
13
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Abb. 7: LKW-Unfall mit<br />
Kipper-Auflieger zum<br />
Schüttguttransport (in<br />
diesem Fall kein Vogelfutter)<br />
an der A8 bei Autobahn-km<br />
119.95.<br />
Fotoquelle:<br />
Herr Götz, Autobahnmeisterei<br />
Siegsdorf, 24.05.05<br />
Straßen sind vermutlich <strong>von</strong> erheblicher Bedeutung für die weitere Ausbreitung der Beifuß-<br />
Ambrosie in Bayern. Ausgehend <strong>von</strong> den Autobahn-Beständen im unmittelbaren Bankettbe<br />
reich ist eine Ausdehnung der Vorkommen auf die angrenzenden Flächen und die weiter ent<br />
fernt liegenden untergeordneten Staats- und Gemeindestrasse möglich. Der derzeitige Pflege<br />
rhythmus der <strong>von</strong> der Beifuß-Ambrosie bewachsenen Autobahnabschnitte fördert die Entwick<br />
lung und Samenproduktion der Beifuß-Ambrosie erheblich und damit die Ausbreitung der Art.<br />
Daher sollte dringend weiter nach Möglichkeiten gesucht werden, praktikable und nachhaltige<br />
Pflegemaßnahmen durchzuführen. Hierbei ist auch der Einsatz <strong>von</strong> Herbiziden in Erwägung zu<br />
ziehen. Die letzte Mahd sollte möglichst vor dem Beginn der Fruchtreife der Beifuß-Ambrosie,<br />
in der Regel Mitte September, abgeschlossen sein. Zwar können sich die Pflanzen nach einer<br />
Mahd regenerieren, doch wird die Samenbildung dadurch erheblich reduziert.<br />
Falls es bei LKW-Unfällen zu einem Austritt <strong>von</strong> Futtermitteln kommt, sind die Flächen in den<br />
Folgejahren einer besonderen Kontrolle auf sich entwickelnde Ambrosia-Pflanzen zu unterzie<br />
hen (Monitoring).<br />
3.2 Erdmaterial / Baumaßnahmen<br />
Mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastetes Erdmaterial stellt nach bisherigem Kenntnisstand<br />
einen der wichtigsten <strong>Einschleppungs</strong>wege der Art dar. So gehen 18 der 68 bislang bekannten<br />
Großvorkommen (= 26%) auf Einbringung mit Erdmaterial zurück (siehe Kap. 6 ab S. 59).<br />
Baumaßnahmen im Rahmen <strong>von</strong> Neubau/Erweiterung <strong>von</strong> Straßen, Eisenbahntrassen und<br />
Industrieanlagen schaffen große offene Bodenflächen, die für die Beifuß-Ambrosie optimale<br />
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Gelangen Samen auf diese Flächen, können sich in kurzer<br />
Zeit Großbestände bilden, die erhebliche Pollenmengen und umfangreiche Samenvorräte frei<br />
setzen können. Durch die oft im engeren Siedlungsbereich befindliche Lage solcher Bestände<br />
können Allergiker unmittelbar mit den Pollen in Kontakt kommen. Durch intensive Verkehrsbe<br />
wegungen und Transport <strong>von</strong> Baustoffen auf und <strong>von</strong> Baustellen kann eine weitere Ausbrei<br />
tung stattfinden. Durch an Baufahrzeugen anhaftendes mit Samen der Beifuß-Ambrosie be-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
14
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
lastetes Erdreich kann eine Verschleppung der Art <strong>von</strong> Baustelle zu Baustelle erfolgen. Eine<br />
Ausbreitung kann auf diesem Wege über weite Distanzen erfolgen. Mit diesem Ausbreitungs<br />
weg hat die Beifuß-Ambrosie bereits einen weiteren Schritt im Ausbreitungsprozess erreicht:<br />
Nach der Einschleppung <strong>von</strong> Futtermitteln aus in der Regel anderen Ländern oder Regionen,<br />
breitet sie sich mit Hilfe des Menschen nun auch innerhalb des Landes aus. Durch Transport<br />
mit Erdmaterial, Baustoffen und Baumaschinen können große Bestände auch in Regionen<br />
auftauchen, in denen man die Beifuß-Ambrosie nicht erwartet hätte, so beispielsweise in aus<br />
gesprochen ländlichen, dünn besiedelten Gebieten.<br />
Wenige Kenntnisse lagen bislang darüber vor, wie häufig die Beifuß-Ambrosie bereits auf<br />
Baustellen auftritt und wie die Zusammenhänge des Ausbreitungsprozesses über Erdmaterial<br />
sind. Daher wurden im Rahmen der Studie Großbaustellen und damit in Zusammenhang ste<br />
hende Flächen ohne Vorinformationen auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie untersucht. Fer<br />
ner wurden ausgewählte, bereits bekannte große Bestände der Beifuß-Ambrosie im Hinblick<br />
auf <strong>Einschleppungs</strong>- / Ausbreitungsprozesse hin überprüft.<br />
Methode<br />
Insgesamt wurden 41 Baustellen und damit in Zusammenhang stehende Flächen mit einem<br />
Schwerpunkt in Unter- und Mittelfranken auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie untersucht und<br />
die Ergebnisse in standardisierte Erfassungsbögen eingetragen (siehe Anhang ab S. 75). Die<br />
einzelnen untersuchten Flächen sind in Tab. 4 ab S. 66 aufgelistet. Die Flächen wurden über<br />
das Internet recherchiert oder nach dem Zufallsprinzip gefunden. Sie wurden einmal aufge<br />
sucht und gezielt nach Ambrosia-Vorkommen abgesucht. Die <strong>Untersuchung</strong> beschränkte sich<br />
dabei auf die zugänglichen bzw. einsehbaren Teilbereiche. Die Grundstücke waren unter<br />
schiedlich gut zugänglich – teils waren sie ganz offen, teils hermetisch eingezäunt und nur mit<br />
Erlaubnis der Eigentümer begehbar. Neben den Baustellen für Wohnen und Gewerbe<br />
(10 Flächen) und Straßenbaumaßnahmen (9 Flächen) wurden auch mit Baustellen in Zusam<br />
menhang stehende Abgrabungen (8 Flächen), Gewerbebrachen (8 Flächen) und Erd-<br />
Zwischenlager (6 Flächen) untersucht. Es bestanden fließende Übergänge zwischen diesen<br />
Typen, d.h., dass beispielsweise auf Baustellen meist auch Erdlager vorhanden waren oder<br />
auf Gewerbebrachen in Teilbereichen schon Bauarbeiten erfolgten und/oder Erde und Bau<br />
stoffe abgelagert waren. Alle Flächen wiesen sehr gute Wuchsbedingungen für die Beifuß-<br />
Ambrosie durch einen hohen Offenbodenanteil auf. Die Baumaßnahmen waren unterschied<br />
lich weit fortgeschritten. Auf einzelnen Baustellen wurde gerade mit dem Bau begonnen, auf<br />
anderen standen die Baumaßnahmen kurz vor ihrem Abschluss. Es wurden gezielt Großbau<br />
maßnahmen ausgewählt. Kleinbaumaßnahmen wie beispielsweise Baustellen für Einzelhäuser<br />
fanden keine Berücksichtigung. Für die untersuchten Flächen lagen keine Vorinformationen<br />
über eine Besiedlung mit der Beifuß-Ambrosie vor.<br />
Die <strong>Untersuchung</strong>sflächen verteilen sich wie folgt auf die Regierungsbezirke:<br />
Unterfranken 18<br />
Mittelfranken 13<br />
Oberbayern 8<br />
Schwaben 2<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
15
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Um die Zusammenhänge des <strong>Einschleppungs</strong>- / Ausbreitungsprozesses anhand ausgewählter<br />
Beispiele zu ergründen, wurden in Burghausen (Landkreis Altötting) und Wonsees-Kleinhül<br />
(Landkreis Kulmbach) weitere Recherchen durchgeführt. Die Kommune bzw. der Landkreis<br />
waren kooperativ.<br />
Ergebnisse<br />
Vorkommen der Beifuß-Ambrosie auf den untersuchten Großbaustellen<br />
Auf zwei der untersuchten 41 Flächen wurden fruchtende und gut ausgebildete Pflanzen der<br />
Beifuß-Ambrosie festgestellt:<br />
a) Gewerbegebiet GADA A8 in Bergkirchen nahe der A8 (Fläche Nr. 31): Auf hohen Erdmieten<br />
an mehreren Stellen ca. 20 Pflanzen (siehe Abb. 8).<br />
b) Erdlager südöstlich des Augsburger Hauptbahnhofs (Fläche Nr. 40): Eine Pflanze (siehe<br />
Abb. 9).<br />
In beiden Fällen wuchsen die Pflanzen auf Erdablagerungen. An den Örtlichkeiten ist es bislang<br />
noch zu keiner Vermehrung der Beifuß-Ambrosie gekommen. Es handelt sich also vermutlich<br />
um das erste Auftreten der Pflanze. Da die Pflanzen erst Mitte Oktober gefunden wurden,<br />
hatten sie bereits zahlreiche Samen ausgestreut. Alle Pflanzen wurden ausgerissen und<br />
entsorgt. Das Auftreten der Pflanzen in Bergkirchen geht evtl. auf die Autobahnvorkommen an<br />
der nahegelegenen A8 zurück, die dort auf einem Abschnitt <strong>von</strong> ca. 4 km in großer Zahl die<br />
Autobahnränder besiedeln.<br />
Abb. 8: Beifuß-Ambrosie auf Erdmieten im Gewerbegebiet GADA A8 Bergkirchen.<br />
Auf den Erdmieten wuchsen ca. 20 große fruchtende Pflanzen (Foto: 18.10.07).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
16
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 9: Beifuß-Ambrosie auf Erdzwischenlager nahe dem Bahnhof Augsburg.<br />
Auf dem Erdhaufen wuchs eine große, bereits fruchtende Pflanze (Foto:<br />
18.10.07).<br />
Großbaumaßnahme, Abgrabungen u. a.<br />
(37 Flächen)<br />
Vorkommen der Beifuß-Ambrosie (2 Flächen)<br />
Vorkommen der Stauden-Ambrosie (2 Fl.)<br />
Abb. 10: Lage der untersuchten Großbaumaßnahmen,<br />
Abgrabungen, Gewerbebrachen,<br />
Zwischenlager (Erde, Baustoffe).<br />
Auf zwei der untersuchten 41 Flächen wurde die Stauden-Ambrosie festgestellt:<br />
a) Neubau Autobahn-Anschlussstelle Alzenau-Mitte der A45 bei Alzenau (Unterfranken, Flä<br />
che Nr. 5): eine Pflanze an Grabenrand auf Baustellengelände (siehe Abb. 11).<br />
b) Recycling-Werk nahe der A45 bei Alzenau (Unterfranken, Fläche Nr. 24): auf ca. 150 m 2<br />
mehrere 100 Pflanzen an Böschungsrand (siehe Abb. 12).<br />
Die Stauden-Ambrosie kommt in Bayern neben einem Einzelvorkommen bei Nürnberg bislang<br />
nur im Landkreis Aschaffenburg vor. Dort tritt die Art auch in mehreren überraschend großen<br />
Beständen auf. Die Stauden-Ambrosie hat eine andere Biologie als die Beifuß-Ambrosie: sie<br />
verbreitet sich überwiegend durch Wurzelausläufer bzw. Wurzel-/Rhizombruchstücke bei Erd<br />
verfrachtungen. Ihre Pollen sind ähnlich allergen wie jene der Beifuß-Ambrosie. Das Gefah-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
17
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
renpotenzial hinsichtlich der weiteren Ausbreitung ist aber vermutlich deutlich geringer einzu<br />
schätzen als bei der Beifuß-Ambrosie.<br />
Abb. 11: Stauden-Ambrosie auf der Baustelle der neuen Autobahn-Anschlussstelle Alzenau-Mitte<br />
der A45 bei Alzenau (Unterfranken, Foto: 10.09.07).<br />
Abb. 12: Stauden-Ambrosie auf Recycling-Werk nahe der A45 bei Alzenau (Unterfranken).<br />
Auf ca. 150 m 2 wuchsen mehrere 100 Pfl. am Böschungsrand (Foto: 24.09.07).<br />
Bodenverwendung bei Baumaßnahmen<br />
Häufig wird zu Beginn einer Baumaßnahmen der Oberboden abgeschoben, z. B. im Rahmen<br />
<strong>von</strong> Erschließungsarbeiten, zu Mieten aufgeschichtet und diese im Bereich der Baustelle (aber<br />
abseits vom Baubetrieb) gelagert, sofern der Platz vorhanden ist. Ist kein Platz vorhanden,<br />
wird der Boden abgefahren. Bei den Erschließungsarbeiten anfallendes, nicht als Oberboden<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
18
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
geeignetes überschüssiges Bodenmaterial wird abgefahren, in einem Zwischenlager unterge<br />
bracht oder für verschiedene weitere Baumaßnahmen bautechnisch verwendet. Gegen Ende<br />
der Bauarbeiten erfolgt der Bodeneinbau lagenweise, so dass der Oberboden wieder an die<br />
Oberfläche gelangt. Zwischen Erschließung und Fertigstellung erstrecken sich meist mehrere<br />
Jahre. In der Zwischenzeit bieten die Boden-Zwischenlager oft sehr günstige Bedingungen für<br />
eine Vielzahl <strong>von</strong> Unkräutern. Falls beim Transportprozess des Erdmaterials über Baumaschi<br />
nen Samen der Beifuß-Ambrosie in das Substrat gelangen bzw. schon vorher im Boden vor<br />
handen waren, so können sich auf den oftmals nährstoffreichen und anfänglich vegetations<br />
freien Böden sehr große Pflanzen der Beifuß-Ambrosie entwickeln. Werden diese Pflanzen<br />
nicht bekämpft und gelangen zur Fruchtreife, können sie erhebliche Samenmengen freisetzen.<br />
Abb. 13 zeigt ein Ambrosia-Vorkommen auf einer Erdmiete in Emmerting.<br />
Abb. 13: Beifuß-Ambrosie auf einer Erdmiete die im Zuge <strong>von</strong> Straßenbauarbeiten nörd<br />
lich <strong>von</strong> Emmerting aufgeschüttet wurde (Foto: 27.07.07).<br />
Der Bestand umfasste ca. 200 Ambrosia Pflanzen auf 300 m 2 .<br />
Neben der Zwischenlagerung <strong>von</strong> Oberboden in Erdmieten im Zusammenhang mit größeren<br />
Baumaßnahmen betreiben Bauunternehmen und Gemeinden oft Erdzwischenlager, <strong>von</strong> denen<br />
sie sich bei Bedarf Erdmaterial auch für kleinere Maßnahmen wie beispielsweise Wegeaus<br />
besserung entnehmen.<br />
<strong>Einschleppungs</strong>prozess<br />
In den meisten Fällen war nicht mehr ermittelbar, wie der <strong>Einschleppungs</strong>prozess bei den Bau<br />
maßnahmen im Detail erfolgt ist. Herkunft und Verbleib der Erde werden <strong>von</strong> den Baufirmen<br />
nicht dokumentiert und auf Nachfrage waren die Wege der Erde bzw. möglicherweise beige<br />
mischten Substrate nicht mehr nachvollziehbar.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
19
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Die Beifuß-Ambrosie kann grundsätzlich auf unterschiedlichem Weg auf Baustellen gelangen:<br />
• Mit eingebrachtem Erdmaterial aus Erd-Zwischenlagern.<br />
• Mit belastetem Kompost als Bodenbeimischung.<br />
• Durch an Fahrzeuge anhaftende Samen (evtl. <strong>von</strong> Straßenrandvorkommen).<br />
• Durch verunreinigte Einsaaten.<br />
Nicht auszuschließen ist auch, dass die Beifuß-Ambrosie schon vor Beginn der Baumaßnah<br />
men auf den Flächen vorhanden war und mit Beginn der Baumaßnahmen günstige Vermeh<br />
rungsmöglichkeiten erhielt. Bei größeren Baumaßnahmen liegen zwischen Baubeginn und<br />
Entdeckung großer Bestände oft mehrere Jahre. Was in der Zwischenzeit passiert war, ließ<br />
sich in den meisten Fällen nicht mehr ermitteln, da der Bewuchs in Unkenntnis der Art nicht<br />
bemerkt wurde. So könnte ausgehend <strong>von</strong> wenigen Einzelpflanzen eine Vermehrung auf der<br />
Baustelle stattgefunden haben, oder es wurden bereits stark mit Samen der Beifuß-Ambrosie<br />
belastete Substrate eingebracht.<br />
Der Fall Eging am See<br />
Im ländlich gelegenen Eging am See wurden im September 2006 umfangreiche Ambrosia-<br />
Vorkommen im 0,5 ha umfassenden Baugebiet Fasanenfeld <strong>von</strong> Anwohnern festgestellt (siehe<br />
Abb. 14). Es ist der bislang größte Bestand, der in einem bayerischen Baugebiet beobachtet<br />
wurde. Vor Beginn der Baumaßnahme hat sich an der Stelle eine Grünlandfläche befunden.<br />
Nachfragen bei Anwohnern und Gemeinde ergaben keine Hinweise auf den <strong>Einschleppungs</strong>prozess.<br />
Vor September 2006 war der Bewuchs nicht aufgefallen.<br />
Abb. 14: Große Bestände der Beifuß-Ambrosie im Baugebiet Fasanenfeld in Eging am See.<br />
Die erstmals im September 2006 beobachteten Bestände bedeckten große Anteile<br />
des 0,5 ha umfassenden Baugebietes (Foto: 01.07.07).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
20
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Der Fall Burghausen<br />
Gute Kenntnisse über den <strong>Einschleppungs</strong>prozess liegen hingegen für die Stadt Burghausen<br />
vor. Dort sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet spontan großer Bestände der Beifuß-<br />
Ambrosie auftreten, ohne dass eine Vermehrung auf der Fläche stattgefunden hätte. Alle Bestände<br />
gingen auf die Verwendung <strong>von</strong> Erde eines gemeindeeigenen Erdzwischenlagers zurück<br />
(siehe Abb. 15), wo auch die Erde abgeräumter Beete der Landesgartenschau 2004 abgelagert<br />
wurden, die mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastet war. Mehrere Botaniker berichteten<br />
<strong>von</strong> Ambrosia-Beobachtungen auf den Beeten der Landesgartenschau im Jahr 2004<br />
(email S. Heringer, W. Joswig, P. Sturm 2005). Offensichtlich hat eine der für die Landesgartenschau<br />
tätigen Firmen mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastete Substrate verwendet (Erde,<br />
Kompost, Mulch?). Da im Rahmen der Landesgartenschau zahlreiche Firmen für die Stadt<br />
tätig waren, konnte die Stadt keine spezielle Firma ermitteln.<br />
Der Fall Wonsees-Kleinhül<br />
Abb. 15:<br />
Erdzwischenlager der<br />
Gemeinde Burghausen<br />
(LKR Altötting) als Ursprung<br />
mehrerer großer<br />
Bestände der Beifuß-<br />
Ambrosie im Stadtgebiet.<br />
Die Erde ging auf abgeräumte<br />
Beete der Landesgartenschau<br />
2004<br />
zurück. Zur Kontrolle des<br />
Unkrautbewuchses erfolgte<br />
eine Abdeckung<br />
mit einer Kunststoffplane.<br />
(Foto: 08.10.07)<br />
In dem sehr ländlich gelegenen Wonsees-Kleinhül (Landkreis Kulmbach) sind bei Baumaßnahmen<br />
im Rahmen der Dorferneuerung große Bestände der Beifuß-Ambrosie kurz nach Fertigstellung<br />
der Maßnahmen aufgetaucht. Auch hier wurden also stark mit Samen belastete<br />
Substrate eingebracht, da keine Vermehrung auf der Fläche selber erfolgte. Ermittlungen der<br />
Flurbereinigungs- und Naturschutzbehörde ergaben keine weiteren Erkenntnisse über den<br />
<strong>Einschleppungs</strong>prozess.<br />
Einschleppung durch Straßenbaumaßnahmen<br />
Mit Ausnahme des Fundes einer Pflanze der Stauden-Ambrosie auf der Baustelle der neuen<br />
Autobahn-Anschlussstelle Alzenau-Mitte (Fläche Nr. 24) wurden keine Exemplare der Beifuß-<br />
Ambrosie im Bereich der untersuchten neun Straßenbaumaßnahmen festgestellt. Im Rahmen<br />
der Autofahrten (siehe Kap. 3.1 ab S. 7) wurden diverse weitere Straßenbaustellen vom fah-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
21
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
renden Auto aus angeschaut, jedoch ohne die Flächen gezielt zu begehen. Trotz der Erhe<br />
bungsdistanz wären größere Vorkommen der Beifuß-Ambrosie wahrscheinlich aufgefallen.<br />
Hier wurden auch keine Pflanzen der Stauden-Ambrosie gefunden. Es scheint, dass über die<br />
in den letzten Jahren durchgeführten Straßenbaumaßnahmen i. d. R. keine Pflanzen der Bei<br />
fuß-Ambrosie eingeschleppt wurden.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Die <strong>Untersuchung</strong>en der 41 Flächen haben gezeigt, dass die Beifuß-Ambrosie noch keine all<br />
gemeine Verbreitung auf Baumaßnahmen gefunden hat und die beobachteten Bestände zu<br />
dem individuenarm waren. Allerdings belegen die 18 bislang bekannten auf Baumaßnahmen<br />
zurückgehenden Großvorkommen (= 26%) der Beifuß-Ambrosie, dass dieser Einschlep<br />
pungsweg <strong>von</strong> besonderer Relevanz ist und auch zu sehr großen Beständen führen kann.<br />
Auch die an den zwei Fundstellen wachsenden Pflanzen waren zur Fruchtreife gelangt. Ohne<br />
Maßnahmen ist in den Folgejahren mit einer Ausdehnung der Bestände zu rechnen.<br />
Handlungsempfehlung: „Vermehrungskulturen“ der Beifuß-Ambrosie verhindern<br />
Die Zwischenlagerung <strong>von</strong> Erdmaterial im Rahmen <strong>von</strong> Baumaßnahmen ist <strong>von</strong> höchster Re<br />
levanz für die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie in Bayern. Erdzwischenlager stellen oft unge<br />
wollten Vermehrungskulturen der Beifuß-Ambrosie dar. Neben der Beifuß-Ambrosie können<br />
sich auf den Erdmieten noch weitere Problemarten entwickeln (z.B. Solidago canaden<br />
sis/gigantea, Impatiens glandulifera), die bei einer weiteren Verwendung des Erdmaterials<br />
bzw. einer Ausbreitung nicht unerheblichen Bekämpfungsaufwand verursachen können. Alle<br />
Firmen und Behörden, in deren Zuständigkeitsbereich der Umgang mit Erdzwischenlagern<br />
liegt, sollten auf eine Kontrolle des Pflanzenbewuchses hingewiesen werden. Die Kontrolle der<br />
Erdmieten sollte fester Bestandteil der Kontrollen im Rahmen der Bauüberwachung sein.<br />
Schon jetzt gehört die Unkrautbekämpfung auf den Boden-Mieten eigentlich zu den Standards<br />
der guten Bauausführung bei Hochbaumaßnahmen. So ist die „Freihaltung <strong>von</strong> Unkraut“ in der<br />
standardisierten Leistungsbeschreibung LB-Hochbau BMWA explizit genannt. Doch wird in der<br />
Praxis in den meisten Fällen keine Unkrautbekämpfung durchgeführt. Falls unerwünschte Ar<br />
ten auftauchen, ist bezogen auf die Beifuß-Ambrosie das gezielte Ausreißen der Pflanzen die<br />
einfachste und preisgünstigste Bekämpfungsform. Auch aus Naturschutzsicht wäre diese Be<br />
kämpfungsform die zu bevorzugende. Diese Form der Bekämpfung setzt aber die Kenntnis der<br />
Art und den richtigen Begehungszeitpunkt voraus. In der Praxis vermutlich praktikabler ist die<br />
generelle Unterdrückung des Unkrautbewuchses. Methoden sind die Abdeckung mit einem<br />
Vlies, eine regelmäßige Mahd oder Bodenbearbeitung. Auch durch Einsaat einer den Boden<br />
gut deckenden Zwischenfrucht wird die Entwicklung <strong>von</strong> Unkräutern reduziert. Allerdings sind<br />
dann trotzdem noch Kontrollen erforderlich, bei denen geprüft werden muss, ob alle uner<br />
wünschten Arten unterdrückt wurden.<br />
Sind Beifuß-Ambrosien auf einer Fläche aufgetaucht, ist anzunehmen, dass Bodenmaterial<br />
bereits einen Vorrat an Samen der Pflanze enthält. Dies gilt insbesondere, wenn die Pflanzen<br />
zur Samenreife gekommen sind. In diesen Fällen sollte eine weitere Verwendung bzw.<br />
Verbringung des Erdreiches außerhalb des Baugebietes unbedingt vermieden werden. Es ist<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
22
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
allerdings zu bedenken, dass bei jeder Bearbeitung des belasteten Bodens durch Baumaschi<br />
nen auch ohne Erdverbringung eine Verschleppung mit anhaftender Erde erfolgen kann.<br />
In der Schweiz wurde vom Kanton Graubünden ein Merkblatt zum Umgang mit Erdmaterial,<br />
das mit Ambrosia oder anderen Problempflanzen belastet ist, erarbeitet (AMT FÜR NATUR UND<br />
UMWELT 2007).<br />
3.3 Schnittblumenfelder<br />
Die Aussaat <strong>von</strong> Vogelfutter zur Anlage <strong>von</strong> Schnittblumenfeldern ist in Bayern ein bedeuten<br />
der <strong>Einschleppungs</strong>weg der Beifuß-Ambrosie. So gehen 16 der 68 bislang bekannten Groß<br />
vorkommen auf Schnittblumenfelder zurück (siehe Kap. 6 ab S. 59). Unbekannt war allerdings,<br />
in welchem Umfang diese Zweckentfremdung <strong>von</strong> Vogelfutter durchgeführt wird, wie hoch der<br />
Anteil der mit Ambrosia besiedelten Schnittblumenfelder ist und ob die Pflanze auch zur Ver<br />
mehrung gelangt. Hierzu wurden Schnittblumenfelder in allen Regierungsbezirken Bayerns<br />
untersucht, ohne dass vorherige Informationen über eine mögliche Besiedlung mit der Beifuß-<br />
Ambrosie vorlagen. Die Einschleppung der Beifuß-Ambrosie über Schnittblumenfelder ist be<br />
sonders gravierend, da die Art dadurch direkt in Agrarflächen gelangt und sich hier möglicher<br />
weise weiter ausbreiten kann.<br />
In den letzten Jahren hat die Zahl der Schnittblumenfelder zum Selberschneiden erheblich<br />
zugenommen. Die Schnittblumenfelder sind typischerweise mit einem Hinweisschild mit Preis<br />
angaben und einer diebstahl- und einbruchsicheren Kasse zum Geld-Selbsteinwurf ausgestat<br />
tet. Der Preis pro Schnittblume liegt meist bei 50 bis 60 Cent, im Extrem zwischen 30 und 80<br />
Cent. Die Felder werden wohl in vielen Fällen nicht nur <strong>von</strong> der Laufkundschaft beerntet, son<br />
dern auch <strong>von</strong> den Feldbetreibern selber, die die Blumen weiter verkaufen. Teilweise sind die<br />
Schnittblumenfelder auch nur zur alleinigen Nutzung durch die Feldbetreiber vorgesehen. In<br />
diesen Fällen handelt sich dann um reine Sonnenblumenfelder.<br />
Nach unserer Schätzung gibt es in Bayern mindestens 2500 Schnittblumenfelder. Diese Zahl<br />
ergibt sich, wenn man annimmt, dass in den großen Städten (kreisfreie Städte bzw. große<br />
Kreisstätte = 53) jeweils 10 und in den restlichen Gemeinden (= 2003) jeweils ein Pflückfeld<br />
vorkommt. Vermutlich ist die Zahl aber noch erheblich größer. Die Zunahme der Schnittblu<br />
menfelder zum Selberpflücken resultiert daraus, dass neben der Entdeckung des „Selbstbe<br />
dienungsprinzips“ Sonnenblumen-Schnittblumen bei den Verbrauchern zunehmend beliebter<br />
werden. Der Umsatz mit Sonnenblumen ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen<br />
und kletterte im Jahr 2006 auf Platz sieben der Hitliste der am meisten verkauften Schnittblu<br />
men (siehe Tab. 1). Im Jahr 2006 betrug das Marktvolumen aller Schnittblumen ca. 3,15 Mrd.<br />
EUR was je Einwohner Ausgaben in Höhe <strong>von</strong> etwa 38,- EUR entspricht. Damit sind Schnitt<br />
blumen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor (ZMP 2007).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
23
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Tab. 1: Top 10 der in Deutschland beliebtesten Schnittblumen im Jahr 2006 nach Marktanteilen<br />
(ZMP 2007). Die Beliebtheit der Sonnenblume hat in den letzten Jahren stark zugenommen.<br />
1. Rose 35% 5. Lilie 9. Orchidee<br />
2. Tulpe 10% 6. Nelke 10. Narzisse<br />
3. Gerbera 7% 7. Sonnenblume<br />
4. Chrysantheme 6% 8. Amaryllis<br />
Methode<br />
Insgesamt wurden 77 Schnittblumenfelder untersucht. Die einzelnen untersuchten Flächen<br />
sind in Tab. 5 ab S. 68 aufgelistet. Die Felder wurden nach dem Zufallsprinzip gesucht, d.h. es<br />
wurden ohne Vorinformation potenziell geeignete Straßen befahren und nach Feldern Aus<br />
schau gehalten. 52 der 77 Schnittblumenfelder wurden erst ab dem 16. September erhoben<br />
um Auskunft über einen potenziellen Fortpflanzungserfolg der Beifuß-Ambrosie zu erhalten, da<br />
ab diesem Zeitpunkt mit reifen Früchten zu rechnen ist. Es gibt Schnittblumenfelder mit der<br />
Möglichkeit zum Selberschneiden (mit Schild und Kasse) und jene ohne Selberschneiderlaub<br />
nis (ohne Kasse). Auf den Blumenfeldern zum Selberschneiden wurden i. d. R. verschiedene<br />
Blumenarten kultiviert, während auf dem anderen Typ meist nur Sonnenblumen kultiviert wur<br />
den. Zwischen beiden Typen bestanden Übergänge, d.h. dass auch die Felder zum Sel<br />
berschneiden <strong>von</strong> den Eigentümern beerntet und die Blumen verkauft wurden. Daher wurden<br />
die beiden Typen hier zusammengefasst.<br />
Schnittblumenfelder zum Selberschneiden sind typischerweise dort angelegt, wo eine Halte<br />
möglichkeit für PKW besteht. Autobahnen und autobahnartige Bundesstrassen sind damit<br />
ausgeschlossen. Bevorzugt liegen sie an stark frequentierten Straßen, die eine ausreichende<br />
Zahl <strong>von</strong> Laufkundschaft versprechen. Im Umfeld größerer Städte sind die Felder oft in hoher<br />
Dichte vorhanden, in ländlichen Bereichen sind sie deutlich seltener.<br />
Gefundene Felder wurden in Erfassungsbögen standardisiert erfasst (siehe Anhang ab S. 75).<br />
Notiert wurden Art und Größe der Anbaufläche der verschiedenen Schnittblumen und deren<br />
Entwicklungszustand. Bei den Sonnenblumen wurde notiert, ob es sich bei den angepflanzten<br />
Sonnenblumensorten um den „Vogelfutter-Typus“ handelt oder um einen „Hybrid-Typus“. Die<br />
Hybrid-Sorten sind i. d. R. durch das dunklere Zentrum der Blütenköpfe (siehe Abb. 16) vom<br />
Vogelfutter-Typus unterschieden. Auch gefärbte Kronblätter und verzweigte Wuchsformen sind<br />
Merkmale <strong>von</strong> Zuchtsorten der Sonnenblumen. Die Hybrid-Sorten sind i. d. R. pollenfrei, d.h.<br />
sie Verschmutzen nicht das Umfeld der Vase durch herab fallende Pollen. Darauf wird bei<br />
manchen Schnittblumenfeldern gesondert hingewiesen. Da die Hybrid-Sorten auf zertifiziertes<br />
Saatgut zurückgehen, werden bei ihrer Verwendung vermutlich keine Ambrosia-Samen einge<br />
schleppt. Die Sonnenblumen vom Vogelfutter-Typus können auf Vogelfutter oder Saatgut für<br />
Öl-Sonnenblumen zurückgehen. Die beiden sich sehr ähnlich sehenden Sorten konnten bei<br />
der Erhebung nicht unterschieden werden. Teilweise werden auch verschiedene Sonnenblu<br />
mensorten gemeinsam auf den Feldern ausgesät. Hinweise auf die Verwendung <strong>von</strong> Vogelfut-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
24
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
ter geben die Anwesenheit weiterer oft im Vogelfutter enthaltener Unkräuter wie beispielsweise<br />
Spitzklette (Xanthium spec.), Stechapfel (Datura stramonium), Samtpappel (Abutilon theoph<br />
rasti) und Mohrenhirse (Sorghum halepense).<br />
Abb. 16: Die Hybrid-Sorten (links) der Sonnenblumen unterscheidet sich durch ihre dunklere<br />
Mitte <strong>von</strong> den Blüten des Vogelfutter-Typus (rechts)(Foto: 01.07.07 und 29.06.07).<br />
In der Regel wurden die untersuchten Felder nur einmal zwischen Juli und Oktober aufge<br />
sucht. Eine Besiedlung mit der Beifuß-Ambrosie ist damit nicht immer sicher nachzuweisen.<br />
So sind möglicherweise zum Zeitpunkt des Besuches Pflanzen der Beifuß-Ambrosie schon<br />
durch allgemeine Pflanzenschutzmaßnahmen (Jäten, Mahd, Herbizide) oder gezieltes Ausrei<br />
ßen entfernt bzw. abgetötet worden. Dies trifft für ein Feld (Nr. 25) in Regensburg zu, wo wir<br />
nach Abschluss der Erhebungen noch die Information über einen Befall mit Ambrosia erhiel<br />
ten. Dort wurden zwei Wochen vor der Erhebung Ambrosia-Pflanzen durch das Stadtgarten<br />
amt entfernt. Ferner ist es möglich, dass die Pflanzen zum Zeitpunkt des Besuches noch nicht<br />
gekeimt bzw. noch nicht hinreichend genug entwickelt waren. Ambrosia kann auch im Ju<br />
li/August/September noch keimen und bei günstigem Witterungsverlauf zur Blüte und Frucht<br />
reife gelangen.<br />
Ergebnisse<br />
Von den 77 untersuchten Sonnenblumen-Feldern wiesen 9 Felder Bestände der Beifuß-<br />
Ambrosie auf, die alle mit Sonnenblumen des „Vogelfutter-Typus“ bepflanzt waren, d. h. in ca.<br />
11,7 % der Sonnenblumen-Felder führt die Verwendung <strong>von</strong> Sonnenblumensamen zu Futter<br />
zwecken nachweislich zu einem Auftreten der Beifuß-Ambrosie. Rechnet man diesen Pro<br />
zentwert auf die geschätzte Anzahl <strong>von</strong> 2500 bayerische Pflückfelder hoch, müsste man auf<br />
293 Pflückfelder mit Vorkommen der Beifuß-Ambrosie rechnen. Bei 7 der mit Ambrosia befal<br />
lenen Felder war die Individuenzahl mit 1 bis 6 Pflanzen gering. Nur in einem Fall waren<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
25
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
50 Pflanzen vorhanden, was vermutlich auf eine vorjährige Vermehrung zurückzuführen ist.<br />
Auf 7 Feldern sind die Ambrosia-Pflanzen nachweislich auch zur Fruchtreife gelangt. Auf dem<br />
Großteil der Felder wird Saatgut spezieller Sonnenblumen-Hybridsorten verwendet, das nach<br />
bisheriger Kenntnis frei <strong>von</strong> Ambrosia-Samen ist. Auf ca. 40 % der Felder wurden Sonnenblu<br />
mensamen vom „Vogelfutter-Typus“ alleinig oder gemischt mit Hybrid-Sorten angebaut.<br />
15; 19%<br />
16; 21%<br />
4; 5%<br />
Schnittblumenfeld (69 Flächen)<br />
Schnittblumenfeld mit Beifuß-Ambrosie<br />
(9 Flächen)<br />
Abb. 17: Lage der untersuchten Schnittblumenfel<br />
der.<br />
42; 55%<br />
Hybrid-Sorten<br />
"Vogelfutter-Typ"<br />
und Hybrid-Sorten<br />
"Vogelfutter-Typ"<br />
keine Aussage<br />
Abb. 18: Zur Einsaat der Pflückfelder verwendete Sonnenblumen-Typen/Sorten.<br />
Die Schnittfelder zum Selberschneiden weisen einen relativ einheitlichen Aufbau auf: Zur<br />
Grundausstattung aller 77 Felder zählen Sonnenblumen und Gladiolen. Durch zeitversetzte<br />
Aussaat bzw. Pflanzung der Zwiebeln stellen die Felder bis in den Herbst hinein blühende<br />
Pflanzen bereit. Weitere häufig kultivierte Arten sind Dahlien und seltener Lilien, Zinnien und<br />
Chrysanthemen. Die Gladiolen nehmen in der Regel größere Flächenanteile ein als die Son<br />
nenblumen.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
26
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Tab. 2: Verteilung der untersuchten Schnittblumenfelder auf die Regierungsbezirke.<br />
Regierungsbezirk Zahl untersuchter<br />
Felder<br />
27<br />
Befallene Felder Ambrosia zur<br />
Fruchtreife gelangt?<br />
Oberbayern 20 ein befallenes Feld: 1 Pflanze ja<br />
Mittelfranken 18 zwei befallene Felder: 1 / 2 Pflanzen ja / ja<br />
Niederbayern 13 drei befallene Felder: 1 / 2 / 2 Pflanzen nein / ja / ja<br />
Schwaben 9 - -<br />
Unterfranken 9 ein befallenes Feld: 50 Pflanzen ja<br />
Oberpfalz 6 ein befallenes Feld: 14 Pflanzen nein<br />
Oberfranken 2 ein befallenes Feld: 6 Pflanzen ja<br />
Die Bewirtschaftung der Schnittblumenfelder wird <strong>von</strong> den Landwirten in sehr unterschiedlichem<br />
Umfang und Intensität betrieben. Manche Landwirte haben nur wenige Felder in der<br />
Nähe ihrer Höfe, andere zahlreiche, über einen größeren Raum verteilte Felder. So erstrecken<br />
sich beispielsweise die Schnittblumenfelder des im Südosten <strong>von</strong> Bayern ansässigen Reichenspurner<br />
Hofes über fünf Landkreise (Traunstein, Berchtesgadener Land, Rottal-Inn, Passau<br />
LKR, Altötting). Die Pflegeintensität wird je nach Anbieter sehr unterschiedlich betrieben.<br />
Manche Betreiber führen einen intensiven Pflanzenschutz durch, bei anderen kommt es zu<br />
erheblichen Verunkrautungen. Manche verwenden nur Hybrid-Sorten, andere nur Vogelfutter.<br />
Großbetreiber <strong>von</strong> Schnittblumenfeldern führen nicht grundsätzlich eine intensivere Unterhaltung<br />
der Felder durch als Landwirte, die nur wenige Felder betreiben.<br />
Weitere Hinweise auf Ambrosia-Vorkommen in Pflückblumenfeldern erhielten wir vom Landkreis<br />
Dachau (Joachim Schmidt: nördlicher Stadtrand <strong>von</strong> München), der Stadt Amberg (Florian<br />
Haas: Stadtgebiet <strong>von</strong> Amberg), dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt (Paul Rothmund)<br />
und Stadtgartenamt der Stadt Regensburg (Herrn Höß). In der Literatur sind Vorkommen der<br />
Beifuß-Ambrosie im Raum Regensburg <strong>von</strong> KLOTZ (2006) genannt.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Zahl befallener Schnittblumenfelder<br />
Nicht jeder Fall der Verwendung <strong>von</strong> Futter-Sonnenblumensamen führt zu einem Auftreten der<br />
Beifuß-Ambrosie. Voraussetzung sind belastete Chargen der Sonnenblumensamen und die<br />
Intensität der Unkrautbekämpfung (Jäten, Mähen, Herbizid). Der Anteil <strong>von</strong> 11,7 % mit der<br />
Beifuß-Ambrosie befallener Schnittblumenfelder zeigt, dass auf dem ganz überwiegenden Teil<br />
der Felder durch die Verwendung <strong>von</strong> gereinigtem Saatgut und durch eine wirksame Unkrautbekämpfung<br />
das Aufkommen der Beifuß-Ambrosie verhindert wird. Dass in 88 % der Sonnenblumen-Felder<br />
keine Beifuß-Ambrosie gefunden wurde heißt nicht, dass dort in der Vergangenheit<br />
nicht auch Vogelfutter verwendet wurde und möglicherweise eine Samenbank der Beifuß-Ambrosie<br />
im Boden vorliegt, die zu einem späteren Zeitpunkt zur Entwicklung <strong>von</strong> Pflan-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
zen führt. Möglicherweise wurden auch vor der Erhebung bereits Ambrosia-Pflanzen ausgeris<br />
sen.<br />
Abb. 19: 25 kg-Großpackungen <strong>von</strong> Sonnenblumenkernen im Praktiker-Baumarkt für<br />
24,95 € (Foto: 12.10.07).<br />
Schwierige Unkrautkontrolle<br />
Auf Schnittblumenfeldern ist aufgrund der oft großen Entfernung <strong>von</strong> den Höfen, der eingeschränkten<br />
maschinellen Bewirtschaftbarkeit, der kleinteiligen Anordnung der verschiedenen<br />
Kulturen und der eingeschränkten Nutzbarkeit <strong>von</strong> Herbiziden in den Sonnenblumenfeldern<br />
zur Bekämpfung der Beifuß-Ambrosie die Unkrautkontrolle nicht einfach durchzuführen. So<br />
zeigen manche Felder eine starke Verunkrautung, wodurch sich für die Beifuß-Ambrosie gute<br />
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Allerdings führen viele Betreiber auch eine vorbildliche Unkrautkontrolle<br />
durch.<br />
Größe der Ambrosia-Bestände<br />
Größere Bestände können sich nur bilden, wenn die Beifuß-Ambrosie auch zur Samenreife<br />
kommt. Dass es auf Schnittblumenfeldern prinzipiell zu einer starken Vermehrung der Beifuß-<br />
Ambrosie kommen kann, belegen die 16 großen, auf Schnittblumenfelder zurückzuführenden<br />
Bestände (siehe Kap. 6 ab S. 59). Auf den meisten der 9 befallenen Schnittblumenfeldern war<br />
die Zahl der nachgewiesenen Pflanzen relativ gering. Allerdings gelangte mit 7 Pflanzen der<br />
Großteil <strong>von</strong> ihnen zur Fruchtreife, d. h. dass es zu einer Vermehrung gekommen wäre, wären<br />
sie nicht ausgerissen worden. Auf ganz Bayern übertragen ist aber zu befürchten, dass die<br />
Zahl der Ambrosia-Pflanzen auf den Schnittblumenfeldern zunehmen wird.<br />
Verunreinigungsgrad des Vogelfutters<br />
<strong>Untersuchung</strong>en <strong>von</strong> ALBERTERNST & al. (2006) und BOHREN & al. (2005) ergaben, dass etwa<br />
70% der Packungen <strong>von</strong> Winterstreufutter für Wildvögel Samen der Beifuß-Ambrosie enthielten.<br />
Jüngere (unveröffentlichte) <strong>Untersuchung</strong>en der Projektgruppe Biodiversität im Winter<br />
2007/08 ergaben mit 72% einen ähnlich hohen Wert. Insgesamt enthielten 31 der jüngst untersuchten<br />
43 Futterproben Ambrosia-Samen. Die zunehmende Medienaufmerksamkeit seit 2006<br />
hat nicht zu einer Reduktion der Samengehalte durch die Hersteller geführt. Die mittlere Samenzahl<br />
der Proben vom Winter 2007/08 betrug 234. Die Zahlen variieren aber sehr stark zwi-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
28
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
schen 1 und 1964 Samen/kg. Der Wert <strong>von</strong> 1964 Samen pro kg ist der nach unserer Kenntnis<br />
in Deutschland bislang höchste ermittelte Wert. Die Vogelfutterpackung wurde am 17.10.2007<br />
in der BayWa in Nördlingen gekauft. Nicht nur im Winterstreufutter für Wildvögel sind Samen<br />
der Beifuß-Ambrosie vorhanden, sondern auch in verschiedenen Geflügel-Futtermitteln (z. B.<br />
für Rassegeflügel, Legehennen, Tauben, Sittiche, Papageien, Kanarienvögel) und Kleintier-<br />
Futtermitteln (z.B. für Hamster) enthalten (siehe auch BMELV 2008).<br />
Risiko<br />
Wenn auch durch eine intensive Pflege der Felder ein Aufkommen der Beifuß-Ambrosie zunächst<br />
verhindert wird, so birgt die Verwendung <strong>von</strong> Vogelfutter wegen der langen Überdauerungsfähigkeit<br />
der Samen im Boden ein unkalkulierbares Risiko. So können zu einem späteren<br />
Zeitpunkt, wenn am ehemaligen Ort des Schnittblumenfeldes eine andere Nutzung stattfindet,<br />
wieder Beifuß-Ambrosien aus der Samenbank aktiviert werden und eine Chance zur Vermehrung<br />
erhalten. Wenn auf Flächen einmal Vogelfutter ausgebracht wurde, oder Ambrosia-<br />
Pflanzen aufgetaucht sind, sollten diese Felder in den Folgejahren auf Vorkommen der Beifuß-<br />
Ambrosie kontrolliert werden.<br />
Neben der Beifuß-Ambrosie sind auch die Samen anderer unerwünschter Arten regelmäßig im<br />
Vogelfutter enthalten, wie beispielsweise Samtpappel (Abutilon theophrasti), Stechapfel (Datura<br />
stramonium), Wilde Mohrenhirse (Sorghum halepense), Spitzklette (Xanthium spec.). Die<br />
Arten verursachen als schwer zu bekämpfende Problemunkräuter in zahlreichen Ländern der<br />
Erde große wirtschaftliche Schäden.<br />
Gründe für die Zweckentfremdung des Vogelfutters<br />
Der wesentliche Grund für die Aussaat <strong>von</strong> Sonnenblumensamen zu Futterzwecken<br />
(= Vogelfutter) sind die gewaltigen Preisunterschiede gegenüber dem zertifizierten Saatgut:<br />
Bei einem der großen Sonnenblumen-Saatguthändler „Premium Sunflowers“ (GAUWEILER<br />
2008) beträgt der Preis für Sonnenblumen-Saatgut für Schnittblumen je nach Sorte und Qualität<br />
etwa zwischen 100 und 332 € je kg. Das Saatgut ist damit im Vergleich zu den ab 0,72 € je<br />
kg angebotenen Sonnenblumensamen zu Futterzwecken um den Faktor 139 bis 461 teurer.<br />
Die leichte Verfügbarkeit preiswerter Großpackungen animiert dazu, Futter-Sonnenblumensamen<br />
als Saatgut zu verwenden. So werden beispielsweise 25 kg-Säcke <strong>von</strong> der Baumarkt-<br />
Handelskette Praktiker für 24,95 € angeboten (Abb. 19), und <strong>von</strong> der BayWa für 17,99 € (Bay-<br />
Wa Prospekt 20.-31. Dez. 2007). Hinweise, die die ausschließliche Zweckbestimmung als Futtermittel<br />
betonen, fehlen.<br />
Maßnahmenempfehlung: Information<br />
Die Zweckentfremdung <strong>von</strong> Vogelfutter geht zu einem hohen Anteil auf eine fehlende Information<br />
über die Tragweite der Handlung zurück. Vielen Personen, die Sonnenblumensamen zu<br />
Futterzwecken aussäen ist nicht bewusst, dass in dem Saatgut auch Samen unerwünschter<br />
Pflanzen enthalten sind. Hier besteht noch ein hohes Potenzial die Zweckentfremdung zu reduzieren.<br />
Zielgruppe sind insbesondere Landwirte, Gartenbauer, Kleintierhalter, Gärtner, Jäger.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
29
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Maßnahmenempfehlung: Reinigung der Futtermittel<br />
Die wirksamste Gegenmaßnahme wäre die Reinigung der Futtermittel <strong>von</strong> Samen unerwünschter<br />
Arten, wie dies für Saatgut nach dem Saatgutverkehrsgesetz vorgeschrieben ist.<br />
Das derzeitige Futtermittelrecht bietet keine Handhabe, gegen die Verunreinigung mit Ambrosia-Samen<br />
vorzugehen. In der Schweiz gilt hingegen seit Mai 2007 für die Beifuß-Ambrosie<br />
der verbindliche Interventionswert <strong>von</strong> 0,005 % für Futtermittel für freilebende Vögel, was einer<br />
Menge <strong>von</strong> ca. 10 Samen/kg Futtermittel entspricht. In Deutschland ist eine derartige rechtliche<br />
Regelung nur auf längere Sicht hin durchsetzbar. Im Mai 2008 ist ein Merkblatt des Bundesministeriums<br />
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erschienen (BMELV<br />
2008), das sich an die mit Futtermitteln betrauten Berufs- und Fachverbände richtet. Das<br />
Merkblatt informiert über die Ambrosia-Problematik und gibt Empfehlungen zur Verringerung<br />
des Verunreinigungsgrades <strong>von</strong> Futtermitteln. In einer ersten Stufe wird ein Gehalt <strong>von</strong> 0,02%<br />
(ca. 40 Samen/kg) empfohlen. In einer zweiten Stufe wir empfohlen, einen Gehalt <strong>von</strong> 0,005%<br />
(ca. 10 Samen/kg) anzustreben.<br />
Da es auch auf den Transportwegen bzw. der Umladung <strong>von</strong> Vogelfutter zu einer Ausbringung<br />
der Samen kommen kann, sollte auch schon der Import <strong>von</strong> belastetem Vogelfutter verboten<br />
werde, d.h. die Reinigung sollte schon vor dem Grenzübertritt, möglichst im Herkunftsland,<br />
erfolgen. Dadurch wird zugleich auch die Problematik der Verwendung <strong>von</strong> belasteten Reinigungsabgängen<br />
vermieden. Derartige Vorschriften sind aber vermutlich nur im Rahmen einer<br />
EU-weite Regelung zu erreichen.<br />
Maßnahmenempfehlung: Unterhaltung der Schnittblumenfelder<br />
Bei der Unterhaltung <strong>von</strong> Schnittblumenfeldern ist der Unkrautkontrolle eine besondere Aufmerksamkeit<br />
zu widmen. Manche Betreiber wechseln jährlich den Ort der Pflückfelder, was für<br />
den Pflanzenschutz eine Erleichterung bedeutet, allerdings auch dazu führt, dass im Falle der<br />
Verwendung <strong>von</strong> Vogelfutter immer neue Flächen mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastet<br />
werden können. Bei einer Verlagerung des Feldes sind in den Folgejahren auch die vormaligen<br />
Flächen auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie zu kontrollieren.<br />
Maßnahmenempfehlung: Rechtliche Schritte und Kennzeichnungspflicht<br />
Als eine Lücke im Rechtssystem ist aufzufassen, dass die Zweckentfremdung <strong>von</strong> Futtermitteln<br />
als Saatgut keine verbotene Handlung ist. Sehr wichtig wäre es, wenn die Hersteller dazu<br />
verpflichtet würden auf den Futtermittelpackungen einen deutlich sichtbaren Hinweis anzubringen,<br />
der die ausschließliche Nutzung als Futtermittel betont und auf die Gefahr hinweist, dass<br />
Samen unerwünschter Pflanzen enthalten sein können. Ferner sollten auch Hinweise auf die<br />
sinnvolle Beseitigung der Reststoffe gegeben werden.<br />
3.4 Wildäcker<br />
Die Anlage <strong>von</strong> Wildäckern ist eine Maßnahme zur Wildhege. Wildäcker dienen der Bereitstellung<br />
<strong>von</strong> Äsungsflächen und Deckung für das jagdbare Wild. Wildäcker werden ähnlich wie<br />
landwirtschaftliche Ackerflächen bewirtschaftet, d. h. es erfolgen Bodenbearbeitung, Düngung,<br />
Einsaat, Mahd und gegebenenfalls Unkrautbekämpfung. Werden Wildäcker längere Zeit nicht<br />
neu bestellt, sondern nur gemäht, entwickeln sie sich zu Wildwiesen. Wildwiesen sind grün-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
30
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
landartige, <strong>von</strong> Gräsern dominierte Flächen, die überwiegend nur gemäht/gemulcht werden.<br />
Auf Wildäckern kommen viele verschiedene Arten und Sorten zur Aussaat. Die Händler <strong>von</strong><br />
Wildacker-Saatgut bieten eine Vielfalt <strong>von</strong> unterschiedlich zusammengesetzten Mischungen<br />
für verschiedene Hegeziele an.<br />
Wildäcker und Wildwiesen gelten nicht als die klassischen Wuchsorte der Beifuß-Ambrosie. In<br />
der älteren Literatur finden sich hierzu kaum Hinweise. Seit wenigen Jahren häufen sich aber<br />
Beobachtungen aus Baden-Württemberg (mündl. Mitt. H. Gebhardt) und Rheinland-Pfalz (z. B.<br />
MAZOMEIT 2006) über Vorkommen der Art auf Wildäckern mit zum Teil großer Individuenzahl.<br />
Auch aus Bayern wurden bereits <strong>von</strong> Funden aus Wildäckern / Wildwiesen berichtet, so <strong>von</strong><br />
KLOTZ (2006) aus der Region Regensburg, wenn auch nur mit geringen Individuenzahlen. Die<br />
Frage ist, ob die Beifuß-Ambrosie auf Wildäckern auch in Bayern häufiger vertreten ist, wie sie<br />
dorthin gelangt ist und ob diese Bestände Relevanz für eine weitere Ausbreitung der Art ha<br />
ben. Aufgrund der meist abgeschiedenen Lage der Wildäcker können die Ambrosien bei der<br />
Einsaat in siedlungsferne Gebiete gelangen.<br />
Methode<br />
Es wurden 29 Wildäcker und Wildwiesen im Landkreis Aschaffenburg untersucht. Die einzel<br />
nen untersuchten Flächen sind in Tab. 6 ab S. 70 aufgelistet. Es lagen keine Vorinformationen<br />
über etwaige Ambrosia-Vorkommen auf den Flächen vor. Die Auffindung der meist versteckt<br />
im Wald liegenden Wildäcker erfolgte mit tatkräftiger Hilfe des Umweltamtes bzw. der Forst<br />
verwaltung der Stadt Alzenau. Ohne Hilfe <strong>von</strong> Forstverwaltung oder Jägervereinigungen ist die<br />
Auffindung <strong>von</strong> Wildäckern sehr beschwerlich. Die Ergebnisse der Felduntersuchungen wur<br />
den in einem standardisierten Erhebungsbogen eingetragen.<br />
Ergebnisse<br />
Wildacker/ Wildwiese (24 Flächen)<br />
Wildacker/ Wildwiese mit Beifuß-Ambrosie<br />
(5 Flächen)<br />
Buntbrache (11 Flächen)<br />
Abb. 20: Lage der untersuchten Wildäcker/ Wildwiesen<br />
und Buntbrachen.<br />
Auf 5 der 29 untersuchten Wildäcker und Wildwiesen wurden Exemplare der Beifuß-Ambrosie<br />
festgestellt. Tab. 3 gibt einen Überblick über Größe der Wildäcker und Individuenzahl der<br />
Ambrosia-Vorkommen. Die Individuenzahlen lagen zwischen einer und ca. 200 Pflanzen. Auf<br />
vier der fünf Wildäcker hat sich die Beifuß-Ambrosie bereits mehrere Jahre halten können. Die<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
31
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
letzte Einsaat lag dort schon mehrere Jahre zurück. Auf zwei Flächen waren überhaupt keine<br />
Reste einer ursprünglichen Einsaat mehr vorhanden. Auf einem Wildacker (Nr. 22) wuchs eine<br />
Ambrosia-Pflanze inmitten einer hochwüchsigen Brennnessel-Staudenflur. Diese Wuchssitua<br />
tion ist für die Beifuß-Ambrosie ungewöhnlich, da sie offenen Boden bevorzugt und hochwüch<br />
sige Begleitvegetation nicht verträgt. Auf drei der Wildäcker hat sich die Beifuß-Ambrosie ver<br />
mehrt (Nr. 1, 4, 5).<br />
Nach Auskunft der örtlichen Forstverwaltung wurde zur Einsaat nur Saatgut eines namhaften<br />
Händlers für Wildackersaatgut verwendet. Auch aus Baden-Württemberg liegen Erkenntnisse<br />
vor, dass eine Einschleppung durch Verwendung <strong>von</strong> Wildackersaatgut eines Saatgut-<br />
Händlers erfolgte.<br />
Abb. 21: Wildacker (Nr. 11) nördlich <strong>von</strong> Alzenau (Unterfranken) mit einem Bestand <strong>von</strong><br />
ca. 70 Exemplaren der Beifuß-Ambrosie (Foto: 24.09.07).<br />
Tab. 3: Übersicht über Größe der befallenen Wildäcker und Individuenzahl der Ambrosia-<br />
Vorkommen.<br />
Merkmal 1 2 3 4 5<br />
Wildacker-Nr. 11 22 23 32 42<br />
Größe des Wildackers in m 2<br />
2500 500 600 750 17000<br />
Individuenzahl der Beifuß-Ambrosie 70 1 1 200 90<br />
Mehrjähriges Vorkommen? ja ja ja ja nein<br />
Vermehrung? ja nein nein ja Ja<br />
Nach Erkenntnissen aus Hessen und Bayern werden auf Wildäckern neben Saatgut auch<br />
Sonnenblumensamen zu Futterzwecken und auch andere Futtermittel ausgesät bzw. Mi<br />
schungen aus den Komponenten. Einer der 68 großen, bislang bekannten Bestände der Bei-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
32
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
fuß-Ambrosie (siehe NAWRATH & ALBERTERNST 2008) geht auf die Anlage eines Wildackers<br />
aus Vogelfutter zurück. Die Preise für Wildacker-Mischungen schwanken etwa zwischen 2 €<br />
und 6 € (max. 18,50 € ) je kg und sind damit teurer als Vogelfutter, das im Handel ab 0,72 € je<br />
kg erhältlich ist.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass auch das Saatgut namhafter Anbieter <strong>von</strong> Wild<br />
ackersaatgut teilweise mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastet ist. Auch in Baden-<br />
Württemberg wurden Ambrosia-Samen im Wildackersaatgut gefunden (mündl. Mitt. H. Geb<br />
hardt). Da sich die Wildackersaatgut-Mischungen oft aus vielen verschiedenen Arten und Sor<br />
ten zusammensetzen, könnte es sein, dass die Verunreinigungen über ungenügend gereinigte<br />
Einzelkomponenten in die Mischung gelangt sind.<br />
Die in Bayern untersuchten Vorkommen der Beifuß-Ambrosie konnten sich auf den Wildäckern<br />
über mehrere Jahre halten und teilweise sogar vermehren. Bodenstörungen durch den Wild<br />
einfluss (z. B. Bodenumbruch) und zumindest sporadische Bodenbearbeitung durch die Neu<br />
einsaat der Wildäcker schaffen offensichtlich geeignete Standortbedingungen. Da auf Wild<br />
äckern keine Unkrautbekämpfung in der Intensität betrieben wird, wie sie auf Ackerflächen<br />
üblich ist, haben Problemarten wie die Beifuß-Ambrosie oft gute Entwicklungsmöglichkeiten.<br />
Waldstandorte sind nicht die bevorzugten Lebensräume der Licht und offene Böden bevorzu<br />
genden Art. Nach eigenen Beobachtungen aus Baden-Württemberg kann sich die Beifuß-<br />
Ambrosie aber grundsätzlich auch in Wäldern dauerhaft ansiedeln und auch ausbreiten, so auf<br />
Waldschneisen und Waldwegen aber auch innerhalb <strong>von</strong> lichten Waldbeständen. Da Wild<br />
äcker häufig vom Wild besucht werden, ist eine Ausbreitung über die Hufe, das Fell oder auch<br />
die Darmpassage denkbar. Da Wildäcker mehr oder weniger regelmäßig zur Bewirtschaftung<br />
<strong>von</strong> Fahrzeugen aufgesucht werden (Mähen, Mulchen, Pflügen, Fräsen, Grubbern, Eggen,<br />
Düngen) kann eine Ausbreitung über anhaftende Erde erfolgen. Den Autoren sind Fälle aus<br />
Baden-Württemberg bekannt, in denen ausgehend <strong>von</strong> den Wildäckern eine erhebliche Aus<br />
breitung entlang umliegender Wege stattgefunden hat. Bei den in Bayern untersuchten Be<br />
ständen war dies noch nicht zu beobachten. Die Einschleppung der Beifuß-Ambrosie über<br />
Wildäcker ist bedenklich, da hierdurch eine direkte Einbringung in ansonsten anthropogen we<br />
niger beeinträchtigte Lebensräume, den Wäldern, erfolgt.<br />
Die <strong>von</strong> Wildäckern aus nur einem Landkreis gewonnenen Ergebnisse müssen nicht grund<br />
sätzlich auch für das restliche Bayern gelten, doch lassen die Ergebnisse befürchten, dass die<br />
Situation im Landkreis Aschaffenburg keinen Einzelfall darstellt.<br />
Um die Einschleppung der Beifuß-Ambrosie auf Wildäckern zu stoppen, sollten die Anbieter<br />
<strong>von</strong> Wildackersaaten unbedingt die Reinheit ihres Saatgutes sicherstellen. Die Betreiber der<br />
Wildäcker sollten die Aussaatflächen regelmäßig auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie kontrol<br />
lieren. Wichtig ist es, für die Einsaat <strong>von</strong> Wildäckern nur Saatgut <strong>von</strong> seriösen Saatgutherstel<br />
lern zu verwenden und keinesfalls Futtermittel zur Aussaat zu verwenden. Möglicherweise<br />
bietet die Verwendung <strong>von</strong> Einzelsaaten mehr Sicherheit als die der Mischungen. Der direkten<br />
Information der Jagdpächter über die Jagdverbände und Forstverwaltungen kommt eine be<br />
sondere Bedeutung zu.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
33
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
3.5 Weitere Zweckentfremdung / Verwendungen <strong>von</strong> Vogelfutter<br />
Neben der Zweckentfremdung des Vogelfutters bzw. <strong>von</strong> Futtermitteln als Saatgut für Schnitt<br />
blumenfelder und Wildäcker, gibt es noch eine Reihe weiterer Verwendungen. So wird Son<br />
nenblumen-Vogelfutter zur Landschaftsbildverschönerung und zur Gründüngung ausgesät.<br />
Wesentlicher Auslöser der Zweckentfremdung ist der hohe Preisunterschied zwischen Saatgut<br />
und Vogelfutter. Auch die Verwendung als Futtermittel im eigentlichen Sinn kann problema<br />
tisch sein, wenn dies außerhalb <strong>von</strong> Gärten stattfindet. Auch die Entsorgung der Futtermittel<br />
reste in der freien Landschaft ist sehr kritisch zu sehen.<br />
3.5.1 Aussaat <strong>von</strong> Sonnenblumen zur Landschaftsbildverschönerung<br />
Aufgrund der besonderen ästhetischen Qualitäten der Sonnenblume, werden gerne Sonnen<br />
blumenfelder zur Verschönerung des Landschaftsbildes ohne landwirtschaftlichen Hintergrund<br />
angesät. Als Saatmaterial wird oft Sonnenblumen-Vogelfutter verwendet. Sechs der 68 großen<br />
bislang bekannten Bestände (siehe NAWRATH & ALBERTERNST 2008) gehen auf diesen Ein<br />
schleppungsweg zurück. In Regensburg-Burgweinting wurden beispielsweise Sonnenblumen<br />
felder zur Markierung zukünftiger Wohngebäude mit Vogelfutter angesät (Abb. 22 und Abb.<br />
23). Nach Baubeginn sind im gesamten Baustellenbereich große Bestände der Beifuß-<br />
Ambrosie aufgetreten. Auf den Internet-Seiten der Stadt werden in der Information für das ge<br />
plante Neubaugebiet die Sonnenblumenfelder werbewirksam dargestellt.<br />
Abb. 22: Sonnenblumenfelder aus Vogelfutter zur Markierung zukünftiger Wohngebäude<br />
im Baugebiet Mitte <strong>von</strong> Regensburg-Burgweinting (Code BY8).<br />
Links: Älteres Luftbild (schwarzweiß) vom 24.06.01 mit den heller gefärbten<br />
Sonnenblumenfeldern. Rechts: Aktuelleres Luftbild (farbig) vom 21.04.07. Die<br />
Beifuß-Ambrosie besiedelte den gesamten Baustellenbereich (Orthofoto: © LVG<br />
Bayern, 1284/08).<br />
Da keine landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht, haben Pflanzenschutzmaßnah<br />
men auf den Sonnenblumenfeldern einen geringen Stellenwert. Die Beifuß-Ambrosie hat da-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
34
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
her gute Entwicklungsmöglichkeiten. Ein großer Bestand mit über 10000 Pflanzen der Beifuß-<br />
Ambrosie hat sich beispielsweise bei Georgensgmünd (LKR Roth) auf einem Acker am<br />
Ortseingang entwickelt, der zur Zierde <strong>von</strong> der Gemeinde mit Sonnenblumen angesät wurde.<br />
Abb. 23: Informationen auf der Homepage der Stadt Regensburg zum neuen Baugebiet<br />
im Ortsteil Burgweinting. Das Foto zeigt die zur Markierung der geplanten<br />
Gebäude angelegten Sonnenblumenfelder.<br />
Abb. 24: Großer Bestand der Beifuß-Ambrosie am Ortseingang <strong>von</strong> Georgensgmünd.<br />
Der Bestand ist aus einem zur Zierde angelegten Sonnenblumenfeld hervorgegangen<br />
ist. Links: Noch junge Ambrosia-Pflanzen kurz vor der ersten Bekämpfung<br />
(Foto Haberacker LKR Roth, 27.06.07). Rechts: Regeneration nach<br />
erster Bekämpfung (Foto: 07.07.07).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
35
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
3.5.2 Aussaat <strong>von</strong> Sonnenblumen zur Gründüngung<br />
Sonnenblumenfelder als Zwischenfrucht erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie dienen<br />
als Sommerzwischenfrüchte zur Begrünung <strong>von</strong> Ackerflächen und werden nach der Ernte der<br />
Hauptfrucht im Juli bis Anfang August ausgesät. Mit ihren bis zu einem Meter langen Wurzeln<br />
holen die Sonnenblumen Nährstoffe aus dem Boden und verhindern dadurch die Auswa<br />
schung dieser. Die Überreste der Sonnenblumen überwintern und werden im Frühjahr unter<br />
gepflügt. Neben dem Wert als Zwischenfrucht erhoffen sich die Landwirte durch die bei der<br />
Bevölkerung beliebten Sonnenblumen einen Imagegewinn für ihre Tätigkeit. Vogelfutter-<br />
Sonnenblumen sind für die Gründüngung grundsätzlich genauso geeignet wie Saatgut, aber<br />
um ein vielfaches preisgünstiger. Einer der 68 großen bislang bekannten Bestände (siehe<br />
NAWRATH & ALBERTERNST 2008) geht auf diesen <strong>Einschleppungs</strong>weg zurück. Durch die feh<br />
lende herbstliche Bodenbearbeitung haben aufwachsende Beifuß-Ambrosien ausreichend<br />
Zeit, um zur Fruchtreife zu gelangen.<br />
3.5.3 Tierfütterungen<br />
Auch die Verwendung <strong>von</strong> Sonnenblumensamen zur Tierfütterung im eigentlichen Sinne kann<br />
zur Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie in die freie Landschaft führen. Sonnenblumensamen<br />
gelten wegen ihres hohen Ölgehaltes als sehr hochwertiges Futter und werden daher an di<br />
verse Tierarten verfüttert, neben Geflügel auch an Pferde, Nagetiere (z. B. Hamster), Schwei<br />
ne, etc. Manche dieser Tierarten werden auch direkt im Freiland gefüttert, wodurch die Samen<br />
der Beifuß-Ambrosie unmittelbar in die Landschaft gelangen. Daneben kann der Weg über die<br />
organischen Reststoffe wie Tiermist, indirekt über die landwirtschaftliche Verwertung als Dün<br />
gemittel auf die Ackerflächen führen.<br />
Bei der Verwendung <strong>von</strong> Sonnenblumen-Vogelfutter zur Wildvogelfütterung kann es zur Ein<br />
schleppung und Ausbreitung der Art kommen, wenn die Futterplätze nicht regelmäßig auf das<br />
Auftreten unerwünschter Pflanzen kontrolliert werden bzw. nicht mehr gepflegt werden. Be<br />
sonders problematisch ist dies bei Futterstellen, die in der freien Landschaft eingerichtet wer<br />
den. Teilweise wird in Medien oder Infobroschüren gezielt für die Fütterung in der freien Land<br />
schaft geworben, um heimische Tierarten zu fördern. In einer Broschüre des Komitees gegen<br />
den Vogelmord e.V. zur „Fachgerechten Winterfütterung“ (KGDV 2007) wird beispielsweise<br />
zur Förderung <strong>von</strong> Eulen empfohlen „nahe landwirtschaftlichen Gebäuden, am Waldrand oder<br />
auf Wiesen“ Vogelfutter auszustreuen um Mäuse als Beutetiere anzulocken.<br />
In Gärten, wo die Beifuß-Ambrosie bundesweit sehr häufig auftritt, wird sie normalerweise un<br />
bewusst oder bewusst als „Unkraut“ ausgerissen, bevor sie zur Blüte und Fruchtreife gelangt.<br />
Manche Pflanzenliebhaber lassen aber auch in ihren Gärten ihnen nicht bekannte Wildpflan<br />
zen aus Interesse bewusst stehen. Zu einer starken Vermehrung der Beifuß-Ambrosie kann es<br />
kommen, wenn Gärten und Grünanlagen, in denen die Art vorkommt, nicht mehr gepflegt wer<br />
den. In einem Fall, in Schwanstetten (LKR Roth) kam es beispielsweise zur Entwicklung eines<br />
großen, mehrere 1000 Individuen umfassenden Bestandes in einem Hausgarten, nachdem<br />
bedingt durch einen Besitzerwechsel längere Zeit keine Pflege des Gartens erfolgte.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
36
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Problematisch sind Futterstellen in Grünanlagen <strong>von</strong> Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen<br />
Parkanlagen, da hier oftmals eine weniger aufmerksame Unkrautkontrolle durchgeführt wird. In<br />
vielen Städten wurde in den letzten Jahren aus Kostengründen der Aufwand der Unkautbe<br />
kämpfung reduziert, was die Entwicklungsmöglichkeit der Beifuß-Ambrosie verbessert.<br />
Abb. 25: Großer Bestand der Beifuß-Ambrosie auf einer Bauparzelle in Schwanstetten.<br />
Der Bestand hat sich vermutlich nach Abriss eines Wohnhauses aus einem Gartenvorkommen<br />
entwickelt (Foto 17.09.07).<br />
Da neben dem Vogelfutter für Wildvögel auch die Futtermittel für Vögel in Käfig- und Volieren<br />
haltung bzw. für Geflügelhaltung (Hühner, Gänse, Puten etc.) mit Samen der Beifuß-Ambrosie<br />
belastet sind, können sind um Umfeld der Tierhaltung Ambrosia-Bestände entwickeln.<br />
3.5.4 Entsorgung <strong>von</strong> Futterresten<br />
Neben der Ausbringung <strong>von</strong> Vogelfutter bzw. anderen Futtermitteln ist auch die Entsorgung<br />
deren Überreste für die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie <strong>von</strong> Bedeutung. Bei Tierfütterung,<br />
insbesondere bei Kleintierhaltern (Papageien, Sittiche, Kanarienvögel, Hühner, Tauben,<br />
Hamster etc.) aber auch gewerblichen Tierhaltern (Geflügel) fallen oft größere Mengen <strong>von</strong><br />
Futterresten an. Da die Samen der Beifuß-Ambrosie <strong>von</strong> Vögeln offensichtlich nicht gerne ge<br />
fressen werden (BRANDES mündl. Mitt 2006) sind die Futterreste vermutlich oft mit Samen der<br />
Beifuß-Ambrosie belastet. In Unkenntnis der Problematik, werden diese Futterreste auch über<br />
den Kompost, den Bioabfall, Grünabfall oder über den Gartenzaun entsorgt oder werden auf<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
37
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
landwirtschaftlichen Flächen untergepflügt. Drei der in Bayern aufgetretenen großen Bestände<br />
(siehe NAWRATH & ALBERTERNST 2008) gehen vermutlich auf eine derartige Resteentsorgung<br />
zurück. Abb. 26 zeigt einen Bestand nahe Herpersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) der<br />
sich vermutlich aus Ablagerung <strong>von</strong> Futterresten entwickelt hat.<br />
Die Reststoffe sollten so entsorgt werden, dass darin enthaltene Samen abgetötet werden. Im<br />
privaten Bereich empfiehlt sich die Entsorgung über den Restmüll. Hinsichtlich der Aufklärung<br />
der Vogelhalter besteht noch erheblicher Informationsbedarf.<br />
Abb. 26:<br />
Großer Bestand der Beifuß-<br />
Ambrosie nahe Herpersdorf<br />
(Landkreis Erlangen-<br />
Höchstadt) am Rand eines<br />
Ackers, der vermutlich auf<br />
die Ablagerung <strong>von</strong> Futtermittelresten<br />
zurückzuführen<br />
ist.<br />
Eine Ausbreitung ist bereits<br />
durch die landwirtschaftliche<br />
Nutzung erfolgt. Die<br />
Schmutzspuren im Vordergrund<br />
veranschaulichen, wie<br />
eine Bodenverlagerung<br />
durch Traktorräder erfolgt.<br />
(Foto: 27.09.07).<br />
4 Möglicherweise oder potenziell bedeutsame <strong>Einschleppungs</strong>-<br />
und Ausbreitungswege<br />
Neben den nachgewiesenen <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswegen über Straßenverkehr,<br />
Erdmaterial und Futtermittel sind auch die im Folgenden besprochenen Biogas-<br />
Sonnenblumenfelder, die Grüngutverwertung und die Binnenschifffahrt möglicherweise bzw.<br />
potenziell für die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie <strong>von</strong> Bedeutung. Für eine abschließende<br />
Bewertung der Relevanz liegen aber noch nicht genügend Daten vor.<br />
4.1 Sonnenblumenfelder zur Biogaserzeugung<br />
Es gibt Hinweise, dass auch für den Anbau <strong>von</strong> Sonnenblumenfeldern zur Biogaserzeugung<br />
Vogelfutter zur Einsaat verwendet wurde. Da bei der Biogasnutzung im Gegensatz zur Ölgewinnung<br />
keine spezifischen Anforderungen an die Inhaltstoffe der Sonnenblumensamen gestellt<br />
werden, kann auch Vogelfutter als Saatgut verwendet werden.<br />
Die Preise für Sonnenblumensaatgut liegen nach Auskunft <strong>von</strong> Monsanto, einem der großen<br />
Hersteller <strong>von</strong> Sonnenblumensaatgut, bei etwa 17 bis 19 € je kg. Vogelfutter ist hingegen ab<br />
0,72 € pro kg erhältlich. Das Saatgut ist damit gegenüber dem Futtermittel um den Faktor 24<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
38
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
bis 26 teurer. Die Nachteile des Vogelfutters hinsichtlich fehlender Samenbehandlung (Bei<br />
zung) und nicht garantierter Keimfähigkeiten (verm. um 10 bis 20% reduziert) wiegen den<br />
Preisvorteil nicht auf.<br />
Methode<br />
Der Befund, dass auch für die Anlage <strong>von</strong> Sonnenblumen-Biogasfeldern Vogelfutter verwendet<br />
wird, war eine Zufallsentdeckung und nicht Bestandteil des engeren <strong>Untersuchung</strong>spro<br />
gramms. Die <strong>Untersuchung</strong> einer größeren Zahl <strong>von</strong> Sonnenblumen-Biogasfelder erfolgte da<br />
her nicht, zumal die Beobachtung erst am 17.10.07 erfolgte.<br />
Ergebnisse<br />
Ein Landwirt aus dem Donau-Ries-Kreis bestätigte, dass er Vogelfutter zur Aussaat verwendet<br />
hat. Bei der Nachsuche auf den angegebenen Anbauflächen wurde auch eine Pflanze der Bei<br />
fuß-Ambrosie nachgewiesen (siehe Abb. 28). Auch der örtliche Agrarhandel bestätigt den Ver<br />
kauf <strong>von</strong> Vogelfutter an Biogas-Landwirte. Ein im Landkreis erworbener, auf die Verunreini<br />
gung mit Samen der Beifuß-Ambrosie untersuchter Sonnenblumen-Futtersack, wies den<br />
höchsten uns bislang aus Deutschland bekannten Gehalt <strong>von</strong> 1964 Ambrosia-Samen/kg Vo<br />
gelfutter auf (siehe Abb. 27). Bei einer üblichen Aussaatmenge <strong>von</strong> etwa 10kg Sonnenblumensamen<br />
pro ha ergäbe dies zwei Ambrosia-Samen pro m 2 .<br />
Abb. 27: Verkauf <strong>von</strong> stark mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastetem Vogelfutter im Bay-<br />
Wa-Baumarkt.<br />
Der rechts abgebildete Vogelfutter-Sack wies den höchsten uns bislang aus<br />
Deutschland bekannte Gehalt <strong>von</strong> 1964 Ambrosia-Samen/kg auf (Foto: 17.10.07).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
39
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Große Bestände der Beifuß-Ambrosie auf Biogas-Feldern sind bislang aber nur in einem Fall<br />
aus Emmerting (LKR Altötting) bekannt (siehe Abb. 29). Dort soll nach Auskunft des Landwir<br />
tes jedoch kein Vogelfutter verwendet worden sein.<br />
Abb. 28: Beifuß-Ambrosie auf einem abgeernteten Biogas-Sonnenblumenfeld bei Minderoffingen<br />
(LKR Donau-Ries).<br />
Hier wurde Vogelfutter als Saatgut verwendet (Foto: 17.10.07).<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Die Verwendung <strong>von</strong> Vogelfutter zur Einsaat <strong>von</strong> Biogas-Sonnenblumenfeldern ist ausgespro<br />
chen bedenklich. Die Beifuß-Ambrosie gelangt damit direkt in jene Kultur, in der die landwirt<br />
schaftliche Problemart mit den derzeit üblichen Herbiziden nur schwer zu bekämpfen ist. Der<br />
Bewirtschaftungsrhythmus der Sonnenblumenfelder kommt der Entwicklung der Beifuß-<br />
Ambrosie sehr zugute. Zum üblichen Erntetermin der Sonnenblume Mitte Oktober hat die Bei<br />
fuß-Ambrosie i. d. R. schon reife Samen ausgebildet. Aufgrund der langjährigen Keimfähigkeit<br />
der Beifuß-Ambrosie können auch Jahre nach der Ausbringung noch Pflanzen auftauchen. Die<br />
zukünftig zu erwartende Ausdehnung der Sonnenblumen-Anbaufläche begünstigt die Ausbrei<br />
tung der Beifuß-Ambrosie als Ackerunkraut.<br />
Die Biogas-Sonnenblumenfelder bergen ein riesiges Potenzial für die Zweckentfremdung <strong>von</strong><br />
Vogelfutter als Saatgut. Durch eine intensive Aufklärung sollten die Landwirte und der Agrar<br />
handel auf die Risiken der Zweckentfremdung <strong>von</strong> Vogelfutter hingewiesen werden. Nähere<br />
Ausführungen siehe Kapitel 3.3 ab S. 23.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
40
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 29:<br />
Massenbestand der Beifuß-Ambrosie<br />
in einem<br />
Biogasfeld in Emmerting<br />
(LKR Altötting).<br />
Hier erfolgte ein Mischanbau<br />
<strong>von</strong> Sonnenblume<br />
und Mais. Nach Auskunft<br />
des Landwirtes wurde<br />
kein Vogelfutter verwendet.<br />
(Foto: 27.07.07)<br />
Entwicklung der zukünftigen Anbaufläche <strong>von</strong> Biogas-Sonnenblumen<br />
Eignung der Sonnenblume für die Biogasproduktion<br />
Sonnenblumen sind geeignete Gärsubstrate für eine Beschickung <strong>von</strong> Biogasanlagen. Der<br />
hohe Ölgehalt erlaubt hohe Gasausbeuten aus dem Erntegut und sichert hohe Energieerträge<br />
pro Fläche. Die Saatguthersteller werben für diese Nutzung in ihren Katalogen (z.B. MONSAN<br />
TO 2006, EURALIS 2007). Durch neue Sonnenblumen-Sorten und bedingt durch den Klimawandel<br />
haben sich die Anbaubedingungen verbessert. Der Anbau <strong>von</strong> Biogas-Sonnenblumen<br />
erfolgt meist im Mischanbau mit Mais oder als gesonderte Kultur. Der Mischanbau, der beispielsweise<br />
<strong>von</strong> Euralis-Saaten empfohlen wird (EURALIS 2007), bereitet aber ackerbauliche<br />
Schwierigkeiten in der aufwändigeren Bestellung, dem problematischen Herbizidmanagement<br />
und der ungleichen Abreife der Kulturen. MONSANTO (2006) empfiehlt daher die gesonderte<br />
Kultivierung. Die Saatguthersteller bieten spezielles Sonnenblumensaatgut für Biogasanlagen<br />
an, auch als „Biogas-Doppelpack“ zusammen mit Mais.<br />
Bisherige Entwicklung der Anbaufläche der Sonnenblume<br />
Mit dem Ausbau der Biogasnutzung im letzten Jahrzehnt hat die Anbaufläche der Sonnenblume<br />
zugenommen. Sie stieg <strong>von</strong> 24500 ha im Jahr 2001 auf rund 31500 ha im Jahr 2004 an<br />
(MONSANTO 2006). In Deutschland hat sich die Anzahl der Biogasanlagen zwischen 1995 und<br />
2007 mehr als verzehnfacht. Bayern ist das Bundesland mit den meisten Biogasanlagen in<br />
Deutschland. Ende 2007 gab es etwa 1350 Biogasanlagen (Fachverband Biogas e.V.). Einer<br />
der Landkreise mit den meisten Biogasanlagen (70 Stück) ist der Donau-Ries-Kreis. Weitere<br />
Schwerpunkte liegen in Ostbayern, im Allgäu und im Raum Landshut-Erding.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
41
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Zukünftig zu erwartende Anbaufläche der Sonnenblume<br />
Es ist anzunehmen, dass die Anbaufläche der Sonnenblume in Bayern weiter ansteigen wird.<br />
Folgende Faktoren sprechen hierfür:<br />
• Ziel des Aktionsprogramms „Biogas in Bayern“ ist es, mittelfristig eine Zahl <strong>von</strong> 2 000<br />
Biogasanlagen zu erreichen.<br />
• Durch den Klimawandel und neue Zuchtsorten werden sich die klimatischen Anbaubedingungen<br />
der Sonnenblume weiter verbessern.<br />
• Die Sonnenblume kann auch auf Standorten angebaut werden, die für Mais weniger<br />
geeignet sind (trockenere, leichtere Böden).<br />
• Da eine Ausdehnung der Anbaufläche „monotoner“ Maisfelder im Zusammenhang mit<br />
der Zunahme <strong>von</strong> Biogasanlagen in der Öffentlichkeit zunehmend kritisiert wird, könnte<br />
es hinsichtlich des Marketings und der Imagepflege vermehrt zu einem Anbau <strong>von</strong><br />
Sonnenblumen kommen. Die Sonnenblume ist wegen ihrer ästhetischen Qualität ein<br />
positiver Imageträger und soll die Akzeptanz für Biogasanlagen erhöhen.<br />
• Die Sonnenblume ist geeignet, um in „Biogaslandschaften“ eine Fruchtfolge sicherzustellen.<br />
4.2 Grüngutverwertung: Kompost und Grüngutdünger<br />
In zahlreichen Presseberichten und Mitteilungen der Behörden wird ausdrücklich vor der Entsorgung<br />
der Beifuß-Ambrosie über den Kompost und die Biotonne gewarnt. In der Schweiz<br />
wird eine weitere Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie durch den Kompost auch in Ackerflächen<br />
befürchtet (BOHREN & al. 2006). Als Wuchsorte der Beifuß-Ambrosie werden u. a. Kompostplätze<br />
genannt. Im Kanton Solothurn (STAATSKANZLEI SOLOTHURN 2007) wurde die Beifuß-<br />
Ambrosie auf einer Kompostmiete beobachtet. Der vom Kanton Zürich im Jahr 2006 beschlossene<br />
Maßnahmenplan sieht vor, dass Personen die mit Kompost umgehen, gezielt auf die<br />
Beifuß-Ambrosie achten sollen. Aus Deutschland ist ein Fall aus Baden-Württemberg bekannt<br />
(Ortenaukreis), bei dem auf Felder ausgebrachtes Kompostmaterial einer Grüngut-<br />
Kompostieranlage vermutlich die Ursache für die Vorkommen in mehreren Maisfeldern war<br />
(mündl. Mitt. A. Braun, Aug. 2007). Neben der Verwertung über die Kompostierung erfolgt in<br />
Bayern auch die direkte Verwertung als Grüngutdünger auf landwirtschaftlichen Flächen. Falls<br />
in Bayern keimfähige Ambrosia-Samen in den Kompost oder den Grüngutdünger gelangen,<br />
wäre dies <strong>von</strong> erheblicher Bedeutung für die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie. Daher wurde<br />
im Rahmen dieser Studie untersucht, ob in Bayern eine Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie<br />
durch Grüngut potenziell möglich oder bereits nachweisbar ist.<br />
Methode<br />
Neben einer Literaturrecherche zur Praxis der Grüngutverwertung und dessen Hygienisierung<br />
wurden die <strong>Einschleppungs</strong>wege der derzeit bekannten 68 großen Ambrosia-Bestände auf<br />
den möglichen <strong>Einschleppungs</strong>weg Kompost und Grüngutdünger hin überprüft. Ferner wurde<br />
überprüft, wie mit dem mit Ambrosia-Samen belasteten Grüngut verfahren wird, das insbeson-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
42
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
dere bei der Mahd <strong>von</strong> Autobahn-Rändern anfällt. Ein Biomasse- und Kompostwerk in Chie<br />
ming-Weidboden (LKR Traunstein) wurde am 18.09.07 besichtigt.<br />
Ergebnisse<br />
Literaturrecherche: Praxis der Grüngutverwertung in Bayern<br />
Grüngut stellt in Bayern mit 1,015 Mio. t/a (bzw. 83,3 t/Ea) im Jahre 2000 mittlerweile die größte<br />
Abfall- bzw. Wertstofffraktion (KRUIS 2002). Die Verwertung <strong>von</strong> Grüngut erfolgt in Bayern<br />
vorwiegend in Kompostierungsanlagen. Der zweitwichtigste Weg der Grüngutentsorgung ist<br />
der der direkten Grüngutdüngung ohne vorherige Kompostierung. Das Grüngut wird dabei<br />
nach Zwischenlagerung und Häckseln <strong>von</strong> Landwirten als Grüngutdünger auf den landwirtschaftlichen<br />
Flächen untergepflügt. Die direkte landwirtschaftliche Verwertung umfasst in Bayern<br />
etwa 23% des gesamten Grünguts.<br />
Literaturrecherche: Hygienisierung <strong>von</strong> Samen der Beifuß-Ambrosie bei der Grüngutverwertung<br />
Beim Vergleich der beiden Verwertungswege <strong>von</strong> Grünschnitt bietet nur die Kompostierung<br />
eine Hygienisierung <strong>von</strong> Samen der Beifuß-Ambrosie. Ob die Samen der Beifuß-Ambrosie<br />
beim Kompostierungsprozess abgetötet werden, hängt <strong>von</strong> der Dauer der Kompostierung und<br />
den dabei erreichten Temperaturen ab. Es wird bislang da<strong>von</strong> ausgegangen, dass wenn die<br />
Temperatur- und Zeitvorgaben der aktuellen Bioabfallverordnung (BioAbfV) hinsichtlich der<br />
Behandlung zur Hygienisierung eingehalten werden (2 Wochen 55 °C oder 1 Woche 65°C<br />
bzw. 60°C) unerwünschte Unkräuter abgetötet werden. Eine 2007 im Auftrag der Bundesgütegemeinschaft<br />
Kompost durchgeführte <strong>Untersuchung</strong> zur Überlebensfähigkeit <strong>von</strong> Samen der<br />
Beifuß-Ambrosie ergab, dass auch diese Art unter den Bedingungen der Bioabfallverordnung<br />
vollständig abgetötet wird (BUNDESGÜTEGEMEINSCHAFT KOMPOST 2007, INFU 2007). Zur gleichen<br />
Einschätzung kommt FUCHS (2006).<br />
Abb. 30:<br />
Kompostwerk in Chieming-Weidboden,<br />
das<br />
Ambrosia-haltiges Autobahnschnittgutverarbeitet<br />
hat.<br />
Es handelt sich um eine<br />
offene Anlage. Im Hintergrund<br />
Lagerung der Kompostfertigware<br />
unter einer<br />
Überdachung.<br />
(Foto: 18.09.07)<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
43
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Bei der Praxis der Grüngutdüngung ohne vorherige Kompostierung ist da<strong>von</strong> auszugehen,<br />
dass die Keimfähigkeit der Beifuß-Ambrosie erhalten bleibt. PERETZKI & al. (2003) stellten bei<br />
Versuchen auf 8 Ackerstandorten nach vier Jahren allerdings keine problematische Ver<br />
unkrautung fest, ohne aber die Beifuß-Ambrosie im speziellen untersucht zu haben.<br />
Verwertung <strong>von</strong> mit Ambrosia-Samen belastetem Grüngut<br />
Einer Relevanz für die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie ist nur bei Grüngut gegeben, das ab<br />
Anfang September anfällt, da die Beifuß-Ambrosie vorher keine reifen Samen bildet.<br />
Mit Ambrosia-Samen belastetes Grüngut nennenswerter Menge fällt derzeit vermutlich nur bei<br />
der Mahd <strong>von</strong> Autobahn-Rändern an. So wird der zweite Schnitt der Rand- und Mittelstreifen<br />
<strong>von</strong> mehreren Autobahnabschnitten in den letzten Jahren erst zur Reifezeit der Beifuß-<br />
Ambrosie im September und Oktober über den Saugmäher aufgenommen, so an der A8-Ost,<br />
A99, A8-West und A3-Ost. Es ist anzunehmen, dass das Schnittgut hoch mit Samen der Beifuß-Ambrosie<br />
belastet ist. An der A3-Ost ist allerdings im Jahr 2007 vor dem Schnitt eine intensive<br />
Bekämpfung der Beifuß-Ambrosie durchgeführt worden. Das Autobahnschnittgut der<br />
am stärksten mit der Beifuß-Ambrosie bewachsenen Autobahn A8-Ost wurde in den letzten<br />
Jahren durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf bei zwei Kompostwerken in Chieming-<br />
Weidboden und in Bad Reichenhall entsorgt.<br />
Nach Auskunft des Kompostwerkes in Chieming-Weidboden erfolgt die Abgabe des fertigen<br />
Kompostes an (a) Kleinabnehmer/Privatpersonen/Gartenbaubetriebe, (b) Landwirte, (c) als<br />
Kulturmaterial bei Rekultivierungen (d) zur weiteren Verarbeitung im Betrieb Rosenheim (z.B.<br />
Blumenerde). Teilweise wird angenommenes Grünmaterial auch unkompostiert an Landwirte<br />
abgegeben.<br />
Eine Belastung <strong>von</strong> in Gärten anfallendem Grüngut mit fruchtenden Pflanzen der Beifuß-<br />
Ambrosie ist vermutlich sehr gering, da in den Medien auf die Wichtigkeit der Restmüll-<br />
Entsorgung sehr eindringlich hingewiesen wurde.<br />
Neben dem Grüngut werden auch andere organische Reststoffe kompostiert bzw. über die<br />
Grüngutdüngung entsorgt, bei denen eine Belastung mit Samen der Beifuß-Ambrosie zu befürchten<br />
ist, so beispielsweise Reinigungsabgänge <strong>von</strong> Körnerfuttermitteln oder Reststoffe <strong>von</strong><br />
Tierzuchtbetrieben. Auch bei diesen Stoffen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.<br />
Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie mit Kompost oder Grüngutdünger<br />
Ob in Bayern über den Kompost oder die Grüngutdüngung eine Ausbreitung der Beifuß-<br />
Ambrosie erfolgt, ist bislang nicht eindeutig nachgewiesen. Allerdings ist die Beweisführung<br />
nicht leicht zu erbringen. Bei Baumaßnahmen werden oft Gemische mit Erdmaterial eingesetzt,<br />
die eine Nachverfolgung der Herkünfte erschweren. Von den bislang aus Bayern bekannten<br />
großen Beständen (NAWRATH & ALBERTERNST 2008) ist in keinem Fall die Einschleppung<br />
eindeutig auf die Verwendung <strong>von</strong> Kompost oder Grüngutdünger zurückzuführen. Da der<br />
Kompost zu einem Anteil durch Landwirte und Kleinabnehmer in der Region um die Kompostwerke<br />
verwendet wird, wäre bei einer Belastung des Komposts mit Ambrosia-Samen eigentlich<br />
mit einer erhöhten Zahl <strong>von</strong> befallenen Flächen zu rechnen. Dies ist aber im Falle der Kompostwerke<br />
Chieming-Egerer und Bad Reichenhall bislang nicht eindeutig belegt, was eher für<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
44
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
eine geringe Belastung des Kompostes spricht. Allerdings stellte der Mitarbeiter Peter Sturm<br />
der Akademie für Naturschutz in Laufen (Mitt. email 17.8.05) im Jahr 2004 für Südostbayern<br />
eine „sehr starke Zunahme und häufiges Auftreten der Beifuß-Ambrosie entlang <strong>von</strong> Straßen<br />
und Neubaugebieten“ fest. Evtl. führt die Verwendung <strong>von</strong> belastetem Kompost nicht direkt zu<br />
einem Auftreten der Pflanze, sondern zu einem Samenvorrat im Boden, der erst zu einem spä<br />
teren Zeitpunkt bei Erdbewegungen aktiviert wird. Auch beim Transport bzw. der Verarbeitung<br />
des Grüngutes im Kompostwerk können Samen in die Umgebung gelangen. Auf dem Gelän<br />
de, und den zuführenden Straßen des Kompostwerkes in Chieming wurden aber keine Beifuß-<br />
Ambrosien festgestellt.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Zuverlässigkeit der Hygienisierung bei Kompostierung <strong>von</strong> belastetem Grüngut<br />
Bei einem fachgerechten Kompostiervorgang ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass die Samen der Beifuß-Ambrosie<br />
durch Temperatur, der chemischen Wirkung <strong>von</strong> Zwischenabbaustoffen und der<br />
biologischen Aktivität der Kompostmikroorganismen zerstört werden. Allerdings ist die Kompostierung<br />
ein äußerst komplexer Prozess, der <strong>von</strong> vielen Faktoren beeinflusst wird, wie Rotteführung<br />
(Temperatur, Dauer), Zusammensetzung, Homogenität und Struktur der Rohmaterialien<br />
und Witterungsbedingungen.<br />
Bei einem nicht optimalen Kompostierungsprozess ist es nicht auszuschließen, dass Samen<br />
der Beifuß-Ambrosie überleben. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die Betriebsabläufe<br />
Samen der Beifuß-Ambrosie weiter verbreitet werden, so beispielsweise beim Transport, Abladen<br />
und Schreddern des Rohmaterials (FUCHS 2006). Ferner muss besonders darauf geachtet<br />
werden, dass der Reifkompost nicht in Kontakt mit angeliefertem Rohmaterial kommt. Nach<br />
Erfahrungen aus der Schweiz (email Mitt. G. Poppow) ist bei der Kompostierung eine Abtötung<br />
der Samen der Beifuß-Ambrosie nicht immer sichergestellt. Besser als in offenen Anlagen<br />
lässt sich der Kompostierungsprozess in geschlossenen Anlagen kontrollieren. Bundesweit<br />
(alte Länder) sind nur 1 % der Kompostanlagen für Grünabfälle geschlossene Anlagen, bei<br />
den Kompostanlagen für gemischte Bioabfälle (d.h. mit mehr oder weniger großen Anteilen<br />
aus der Biotonne) sind 46 % der Kompostanlagen geschlossen (Bundesgütegemeinschaft<br />
Kompost e.V.).<br />
Empfehlungen zur Verwertung <strong>von</strong> belastetem Grüngut<br />
Falls ein Verdacht besteht, dass eine Belastung des Grüngutes mit Samen der Beifuß-<br />
Ambrosie vorliegt, wird <strong>von</strong> einer Verwertung durch die Kompostierung oder Grüngutdüngung<br />
dringend abgeraten. Am problematischsten ist die Grüngutdüngung oder andere Verwendung<br />
ohne vorherige Kompostierung (z.B. als Mulchabdeckung) zu bewerten. Doch auch die Kompostierung<br />
bietet keine abschließende Sicherheit, dass nicht möglicherweise doch eine weitere<br />
Verbreitung der Beifuß-Ambrosie erfolgt. Alternativen könnte die Vergärung mit vorgeschalteter<br />
Sterilisierung darstellen oder die thermische Verwertung.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
45
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Durch eine Optimierung der Betriebsführung <strong>von</strong> Kompostanlagen können mögliche Risiken<br />
reduziert werden, durch:<br />
• Einhaltung der Temperatur- und Zeitvorgaben bei der Rotte gemäß der aktuellen Bio<br />
abfallverordnung.<br />
• Keine Samenverbreitung beim Transport, Abladen und Schreddern des Rohmaterials.<br />
• Ausschließen eines Kontaktes des Reifkompost mit angeliefertem Rohmaterial.<br />
• Verwertung in geschlossenen Kompostierungs-Anlagen.<br />
Auch bei der Sammlung <strong>von</strong> privatem Grüngut durch die Kommune kann die Gefahr einer Ein<br />
bringung <strong>von</strong> möglicherweise mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastetem Grüngut durch eine<br />
Annahmekontrolle bei der Anlieferung des privaten Grüngutes reduziert werden.<br />
Die öffentliche Empfehlung der Entsorgung grundsätzlich über die Restmülltonne vorzuneh<br />
men ist grundsätzlich zu begrüßen, da ansonsten keine Sicherheit gegeben ist. Dieser Emp<br />
fehlung stehen allerdings die Abfallverordnungen mancher Gemeinden entgegen, die eine<br />
Entsorgung <strong>von</strong> Grüngut in der Restmülltonne ausschließen.<br />
4.3 Binnenschifffahrt<br />
Die Binnenschifffahrt ist ein wichtiger Transportweg für Futtermittel und Ölsaaten, die mit Sa<br />
men der Beifuß-Ambrosie belastet sein können. Beim Entladen der Schiffe und Beladen <strong>von</strong><br />
Fahrzeugen fallen häufig kleinere Anteile auf den Boden oder ins Wasser und gelangen so an<br />
das Ufer oder auf andere Flächen im Hafenbereich. Der Warenumschlag an Binnenhäfen gilt<br />
als einer der klassischen <strong>Einschleppungs</strong>wege der Beifuß-Ambrosie (WAGENITZ 1979).<br />
Aus Hafenanlagen werden in der botanischen Literatur regelmäßig über Funde der Beifuß-<br />
Ambrosie berichtet. Meist sind es unbeständige Vorkommen, die nur in wenigen Binnenhäfen<br />
eingebürgerte Bestände bilden, so beispielsweise in Ludwigshafen (HEINE 1952). In Bayern<br />
werden seit 1982 am Regensburger West- und Osthafen regelmäßig Pflanzen der Beifuß-<br />
Ambrosie auf Ruderalfluren beobachtet, wohl aber ohne große Bestände zu bilden (KLOTZ<br />
2006).<br />
Von den Uferbereichen <strong>von</strong> Flüssen und Kanälen lagen bislang kaum Hinweise auf eine Besiedlung<br />
der Beifuß-Ambrosie vor. Allerdings nennt WAGENITZ (1979) eine Reihe <strong>von</strong> kleineren<br />
Beobachtungen. In jüngerer Zeit häufen sich allerdings Fundbeobachtungen vom Rhein und<br />
der Elbe (mündl. Mitt./email: K. Graeber, R. Schatz, U. Schmitz, N. Grimbach). Flussufer werden<br />
wegen der dortigen typischerweise starken Wasserstandsschwankungen als eher ungeeignete<br />
Lebensräume der Beifuß-Ambrosie angesehen. Tatsächlich wurden in den meisten<br />
Fällen nur geringe Individuenzahlen festgestellt. An den Ufern der Kanäle stellt sich die Situation<br />
anders dar, da dort nur geringe Wasserstandsschwankungen vorkommen. Ausgangspunkt<br />
für eine nähere Beachtung <strong>von</strong> Ufern lieferte die Beobachtung <strong>von</strong> Horst Schäfer vom<br />
19.08.2007 (email-Mitt.), der mehrere 100 Pflanzen am Ufer des Main-Donau-Kanals bei<br />
Wendelstein-Neusses entdeckte. Daraufhin wurde der Kanalabschnitt näher betrachtet und ein<br />
weiterer Streckenabschnitt und mehrere Häfen entlang des Main-Donau-Kanals auf Ambrosia-<br />
Bewuchs untersucht.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
46
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Methode<br />
Abb. 31:<br />
Hafen Ochsenfurt mit<br />
Verladeanlagen.<br />
Binnenhäfen sind Umschlagsplätze<br />
für Futtermittel.<br />
In ihrem Umfeld<br />
finden sich Verladeanlagen,<br />
Freilagerflächen,<br />
Lagerhallen, Silos, Gleisanschluss.<br />
Am Verladegleis<br />
nahe dem Hafen<br />
wurde eine Pflanze der<br />
Beifuß-Ambrosie gefunden<br />
(siehe Abb. 33).<br />
(Foto: 16.09.07)<br />
Neben dem Befallsabschnitt bei Wendelstein-Neusses wurde ein Kanalabschnitt bei Menkenlohe<br />
auf ca. 1 km auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie abgesucht. Ferner wurden insgesamt<br />
6 der 25 bayerischen Binnenhäfen aufgesucht (siehe Liste der Binnenhäfen unter<br />
www.binnenhafen.info/; 120108). Im Einzelnen handelte es sich um die Häfen Aschaffenburg,<br />
Bamberg, Ochsenfurt, Nürnberg, Roth und Schweinfurt. In der Regel wurde nicht das ganze<br />
Hafengelände abgesucht.<br />
Ergebnisse<br />
Main-Donau-Kanal bei Wendelstein-Neusses<br />
Das Vorkommen der Beifuß-Ambrosie bei Wendelstein-Neusses (Mittelfranken, Kreis Roth)<br />
erstreckte sich über eine Länge <strong>von</strong> 500 m und umfasste mehrere 100 Pflanzen. Die Pflanzen<br />
besiedeln den Abschnitt <strong>von</strong> der Wasserlinie bis zur Oberkante der Böschung zum angrenzenden<br />
Wirtschaftsweg. Die Uferlinie, Steinschüttung und angrenzenden Uferbereiche bieten<br />
geeignete Wuchsbedingungen mit offenen Böden an, die eine dauerhafte Besiedlung ermöglichen.<br />
Die Samen der Beifuß-Ambrosie gelangen vermutlich beim Transport bzw. Verladen <strong>von</strong><br />
Agrarprodukten <strong>von</strong> Binnenschiffen ins Wasser. Für die Herkunft aus Futtermittel sprechen<br />
auch einzelne, am Ufer wachsende Sonnenblumen. Nicht auszuschließen ist, dass die Einbringung<br />
auch durch ausgestreutes Vogelfutter erfolgte. Da auch mehrere 100 Meter vom<br />
Hauptbestand noch weitere Pflanzen an der Uferlinie wuchsen, hat möglicherweise eine Ausbreitung<br />
über schwimmende Samen der Beifuß-Ambrosie stattgefunden. Das Verbreitungsmuster<br />
könnte aber auch durch den <strong>Einschleppungs</strong>vorgang über schwimmendes Vogelfutter<br />
erfolgt sein.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
47
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 32: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie am Main-Donau-Kanal bei Wendelstein-Neusses<br />
(LKR Roth).<br />
Die Pflanzen besiedeln die Uferlinie, die Steinschüttung und den unteren Teil der<br />
angrenzenden Böschung (Foto: 17.09.07).<br />
Main-Donau-Kanal bei Menkenlohe<br />
Bei der etwa 8,5 km südlich <strong>von</strong> Wendelstein-Neusses liegenden Menkenlohe (Mittelfranken,<br />
Kreis Roth) wurden keine Beifuß-Ambrosien festgestellt. Eine überwiegend sehr intensive Pflege<br />
der Ufervegetation erschwert hier die Entwicklung der Beifuß-Ambrosie.<br />
Binnenhäfen<br />
Im Bereich <strong>von</strong> drei der sechs untersuchten Binnenhäfen wurden Exemplare der Beifuß-<br />
Ambrosie nachgewiesen: Ochsenfurt, Schweinfurt und Aschaffenburg. Da sich die Wuchsorte<br />
in der Nähe der Gleisanbindungen bzw. Bahnhöfe befinden, wurden die beiden Bestände im<br />
Kapitel Bahnverkehr ab S. 49 aufgeführt. Es handelte sich um Bestände <strong>von</strong> geringem Ausbreitungspotenzial.<br />
Von anderen Binnenhäfen, beispielsweise aus Regensburg, werden Pflanzen<br />
genannt (KLOTZ 2006; siehe oben).<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Eine Bedeutung der Binnenhäfen als <strong>Einschleppungs</strong>wege der Beifuß-Ambrosie besteht auch<br />
heute noch, doch scheint ihre Relevanz für die weitere Ausbreitung eher gering zu sein. Große<br />
Bestände der Beifuß-Ambrosie aus bayerischen Binnenhäfen sind nach unserer Kenntnis bislang<br />
nicht bekannt.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
48
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie 49<br />
Für die Uferbereiche stellt sich die Situation anders dar: Auch wenn für diesen Standort nur<br />
wenige Fundangaben vorliegen, so könnte dessen Bedeutung zukünftig erheblich zunehmen.<br />
Dies gilt insbesondere für die Ufer des Main-Donau-Kanals, der am Ufer und im Bereich der<br />
Uferböschungen geeignete Lebensräume bereitstellt. Das große Vorkommen in Wendelstein-<br />
Neusses ist ein erstes Indiz hierfür. Allerdings wirkt die teils sehr intensive Pflege der Uferve<br />
getation entlang der Kanäle einer Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie entgegen.<br />
Auch individuenarme Vorkommen der Beifuß-Ambrosie an Flussufern mit stärkeren Wasser<br />
standsschwankungen können <strong>von</strong> Bedeutung für die weitere Ausbreitung der Art sein. Was<br />
serläufe sind ähnlich wie Straßen Ausbreitungsachsen für Pflanzenarten. In Frankreich wird<br />
dem Wassertransport der Ambrosia-Samen eine große Bedeutung für den Invasionsprozess<br />
beigemessen (FUMANAL & al. 2007).<br />
Zukünftig sollten die Uferbereiche der Kanäle aber auch der Flussufer unter besonderer Beob<br />
achtung stehen. Beim Transport und der Verladung <strong>von</strong> Futtermitteln sollten keine Anteile der<br />
Ladung in das Wasser gelangen.<br />
5 Nicht oder weniger bedeutsame <strong>Einschleppungs</strong>- und<br />
Ausbreitungswege<br />
Zu den weniger bedeutsamen <strong>Einschleppungs</strong>wegen zählt der Bahnverkehr. Vermutlich ohne<br />
Bedeutung sind Topf- und Containerpflanzen aus Gartencentern / Gärtnereien, Buntbrachen<br />
und Sonnenblumenfelder zur Ölgewinnung.<br />
5.1 Bahnverkehr<br />
Bahnanlagen gelten als typische Wuchsorte der Beifuß-Ambrosie (z. B. WAGENITZ 1979, HEINE<br />
1952, HOHLA 2005). Die Einschleppung erfolgt mit verunreinigten Futtermittelimporten, die an<br />
den Bahnhöfen umgeschlagen werden. Früher waren es Importe aus Amerika, dem Heimat<br />
land der Beifuß-Ambrosie, später Importe aus Osteuropa. Bahnlinien werden zudem als Ausbreitungsachsen<br />
angesehen. So gibt beispielsweise HOHLA (2005) für Österreich an: Ambrosia<br />
artemisiifolia „wandert entlang der Bahnstrecken“. Bahnanlagen weisen meist für die Entwick<br />
lung der Beifuß-Ambrosie günstige Wuchsbedingungen auf: lückige Bodenbereiche mit schüt<br />
terem Bewuchs bei meist ungestörter Pflanzenentwicklung. Durch Nutzungsaufgabe umfang<br />
reicher Bahnflächen im Zuge des Strukturwandels im Bahnverkehr haben sich die potenziellen<br />
Wuchsbedingungen in den letzten Jahren deutlich verbessert. Vor diesem Hintergrund wurde<br />
im Rahmen des Forschungsvorhabens die aktuelle Rolle der Bahnanlagen hinsichtlich der<br />
Einschleppung und Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie untersucht.<br />
Methode<br />
Insgesamt wurden 32 Bahnanlagen auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie untersucht und die<br />
Ergebnisse in standardisierte Erfassungsbögen eingetragen. Die untersuchten Flächen sind in<br />
Tab. 8 ab S. 72 aufgelistet. Neben den engeren Bahnanlagen (Gleisflächen, Verladegleisen,<br />
Bahnsteige, Bereich der Bahnhofsgebäude) wurden auch angrenzende Flächen untersucht<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
(z. B. Parkplätze/ P&R, Silos/Getreidemühlen, Gewerbe, Lagerflächen). Neben Großstadt<br />
bahnhöfen (Augsburg, Würzburg, Schweinfurt) wurden auch Bahnhöfe <strong>von</strong> Kleinstädten und<br />
Bahntrassen aufgesucht. Es wurden nur jene Teile der Bahnanlagen untersucht, die ohne Ri<br />
siko begehbar waren. Teilweise konnten sie nur <strong>von</strong> den Rändern aus eingesehen werden.<br />
Neben den Begehungen wurden Streckenabschnitte der offiziell am 28. Mai 2006 dem Ver<br />
kehrsbetrieb übergebenen 170 km langen ICE-Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Mün<br />
chen (Baubeginn 1998) vom fahrenden Auto aus auf Bewuchs der Beifuß-Ambrosie kontrol<br />
liert. Zwischen Nürnberg und Ingolstadt führt die Bahnstrecke in geringem Abstand parallel zur<br />
Autobahn A9 und war daher recht gut einsehbar. Die ausgedehnten Böschungen mit oft lücki<br />
ger Pioniervegetation weisen potenziell gute Wuchsbedingungen für die Beifuß-Ambrosie auf.<br />
Wenn auch eine detaillierte Erhebung vom Auto aus nicht möglich ist, so wären großwüchsige<br />
Bestände der Beifuß-Ambrosie wahrscheinlich aufgefallen.<br />
Ergebnisse<br />
Eine Aufstellung aller untersuchten Bahnhöfe ist Tab. 8 ab S. 73 zu entnehmen (siehe An<br />
hang). Auf vier der 32 untersuchten Bahnanlagen wurden Bestände der Ambrosie festgestellt:<br />
(a) Neben Gleisanschluss zum Hafen Ochsenfurt und Silo/Agrarlager der BayWa neben<br />
Baumscheibe einer gefällten Pappel: eine große Pflanze (Fläche Nr. 3, siehe Abb. 33).<br />
(b) Am Schweinfurter „Stadtbahnhof“ auf Brachflächen nahe dem Zollhof: ca. 80 Pflanzen auf<br />
20 qm (Fläche Nr. 14, siehe Abb. 34).<br />
(c) In Würzburg Hauptbahnhof auf einer Parkfläche zwischen Güterhalle und Parkhaus: eine<br />
Pflanze (Fläche Nr. 24, siehe Abb. 35).<br />
(d) Neben Gleisanschluss im Hafen Aschaffenburg auf Gleisschotter eines stillgelegten Glei<br />
ses: eine 70 cm hohe, weit ausladende Pflanze (Fläche Nr. 32, siehe Abb. 36).<br />
Auf den <strong>von</strong> der Autobahn einsehbaren Abschnitten der ICE-Neubaustrecke zwischen Nürn<br />
berg und München wurden keine größeren Bestände der Beifuß-Ambrosie gesichtet.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
50<br />
Abb. 33:<br />
Wuchsort der Beifuß-<br />
Ambrosie nahe der Gleisanbindung<br />
zum Hafen und<br />
dem Agrarlager der BayWa<br />
Ochsenfurt (Unterfranken)<br />
neben einem Pappel-<br />
Stumpf.<br />
(Foto: 16.09.07)
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 34: Wuchsort der Beifuß-Ambrosie am Schweinfurter „Stadtbahnhof“ auf einer Brachfläche<br />
nahe dem Zollhof.<br />
Der Bestand umfasste ca. 80 Pflanzen auf 20 qm (Foto: 26.09.07).<br />
Abb. 35: Würzburg Hauptbahnhof auf einer Parkfläche zwischen (ungenutzter) Güterhalle<br />
und Parkhaus eine Pflanze in Pflasterfuge (Foto: 16.10.07).<br />
KLOTZ (2006), der für den Raum Regensburg Fundorte der Beifuß-Ambrosie aus den letzten<br />
30 Jahren zusammengetragen hat, nennt zwei Vorkommen <strong>von</strong> Bahnhöfen aus den Jahren<br />
1996 und 2004 ohne Nennung größerer Individuenzahl.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
51
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 36: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie im Hafen Aschaffenburg (Unterfranken).<br />
Eine Pflanze auf Gleisschotter einer stillgelegten Gleisanbindung (Foto: 04.09.07).<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Bahnhöfe und Bahnanlagen ohne Vorkommen<br />
der Beifuß-Ambrosie (28 Flächen)<br />
Mit Vorkommen der Beifuß-Ambrosie<br />
(4 Flächen)<br />
Abb. 37: Lage der untersuchten Bahnhöfe und<br />
Bahnanlagen.<br />
Der Anteil <strong>von</strong> 12,5 % der mit der Beifuß-Ambrosie bewachsenen Flächen zeigt, dass die<br />
Bahnanlagen für die Einschleppung der Beifuß-Ambrosie <strong>von</strong> Bedeutung sind. Die Wuchsorte<br />
<strong>von</strong> drei der vier nachgewiesenen Bestände (Ochsenfurt, Schweinfurt, Aschaffenburg) sind<br />
Umschlags-Orte <strong>von</strong> Futtermitteln, die zudem in der Nachbarschaft <strong>von</strong> Binnenhäfen liegen.<br />
Bis auf Schweinfurt handelt es sich nur um Einzelpflanzen, was zeigt, dass <strong>von</strong> den Beständen<br />
offensichtlich noch keine erhebliche Ausbreitung ausgeht. Eine Ausbreitung entlang der Gleis<br />
strecken, beispielsweise durch Windschleppen der Züge, wurde nicht beobachtet. Das ca. 80<br />
Pflanzen umfassende Vorkommen in Schweinfurt besteht vermutlich schon mehrere Jahre und<br />
hat sich lokal vermehrt, doch geht auch <strong>von</strong> ihm kein deutliches Ausbreitungsrisiko aus. Von<br />
den derzeit bekannten 68 großen Vorkommen gehen keine auf den Bahnverkehr zurück bzw.<br />
befinden sich auf Bahnanlagen. Durch den Strukturwandel entstandene, teils ausgedehnte<br />
Brachflächen bieten potenziell sehr gute Ausbreitungsbedingungen für die Beifuß-Ambrosie<br />
und sollten daher im Auge behalten werden.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
52
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 38: Stillgelegte Güterhalle und ausgedehnte Brachflächen am Bahnhof Würzburg (Foto<br />
16.10.07).<br />
Auswirkung des Strukturwandels der Bahn auf die Einschleppung der Beifuß-Ambrosie<br />
Die Bahn war ehemals der bedeutendste Transportweg für Güter. Aufgrund der fortschreitenden<br />
Verlagerung des Eisenbahngüterverkehrs auf die Straße wurden viele Güterbahnhöfe und<br />
Rangierbahnhöfe stillgelegt. Der Stückgutverkehr wurde nahezu vollständig auf die Straße<br />
verlagert, was die Stilllegung der Güterhallen zur Folge hatte, und im Wagenladungsverkehr<br />
wurden die meisten öffentlichen Ladestraßen und -rampen der Güterbahnhöfe für Kleinkunden<br />
aufgegeben (siehe Abb. 38). Dieser Strukturwandel steht auch im Zusammenhang mit der<br />
Schließung zahlreicher Nebenstrecken der Bahn. An Bedeutung gestiegen ist der Transport<br />
<strong>von</strong> Gütern in Containern. Dabei erfolgt auf den Bahnhöfen keine Be- oder Entladung mehr,<br />
sondern nur ein Umschlag der Container, beispielsweise vom Schiff auf die Bahn und weiter<br />
auf den LKW. Da die Container geschlossen sind, gelangen auf dem Transportweg keine Bestandteile<br />
der Ladung nach außen. Zum Umschlag der Ladung dienen wenige große Containerterminals.<br />
Wenn auch die Bedeutung der Bahnanlagen für den Umschlag <strong>von</strong> Gütern gesunken ist, so<br />
sind Bahnhöfe auch heute noch Verkehrsknotenpunkte des Schienen-Personenverkehrs und<br />
des damit zusammenhängenden Autozubringerverkehrs (P&R-Plätze). Über die PKW der Berufspendler<br />
könnte eine weiträumige Verteilung anhaftender Samen in ganze Region erfolgen<br />
bzw. eine Einschleppung in die Bahnanlagen. Zudem besteht bei den meisten Bahnhöfen eine<br />
historisch bedingte enge Nachbarschaft zu Industrieanlagen, Agrarhandel, Getreidesilos/mühlen<br />
und Binnenhäfen mit eigener, oft intensiver Verkehrstätigkeit (LKW, Traktor, Binnenschifffahrt).<br />
Potenzial des Bahnverkehrs, bzw. der Bahnflächen für Einschleppung und Ausbreitung<br />
Aufgrund ihrer Verkehrsknotenfunktion und angrenzenden Anlagen sind Bahnanlagen auch<br />
heute noch für eine Einschleppung bzw. Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie <strong>von</strong> potenzieller<br />
Bedeutung. Begünstigend kommt hinzu, dass durch den Rückgang des Güterumschlages die<br />
meisten Bahnhöfe mehr oder weniger ausgedehnte ungenutzte Flächen aufweisen, die durch<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
53
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
ihre vorwiegend lückig bewachsenen Substrate potenziell günstige Wuchsvoraussetzungen für<br />
die Beifuß-Ambrosie bieten (siehe Abb. 38). Es wäre also denkbar, dass aus dem vormaligen<br />
Warenumschlag noch vorhandene Beifuß-Ambrosien bzw. aktuelle Einschleppungen durch<br />
PKW-, LKW-, Traktor-Verkehr sich auf den Brachflächen stark vermehren und dann wiederum<br />
durch die Verkehrsbewegungen weiter verbreiten. Dafür liegen aber derzeit keine Beobach<br />
tungen vor.<br />
Die engeren Gleisflächen sind für eine Besiedlung der Beifuß-Ambrosie weniger geeignet. So<br />
werden die Schotterflächen mit Herbiziden weitgehend frei <strong>von</strong> Vegetation gehalten. Die an die<br />
Gleistrassen angrenzenden Flächen außerhalb der Bahnhöfe sind oftmals <strong>von</strong> starkwüchsigen<br />
nitrophytischen Staudenfluren bewachsen, die kaum Entwicklungsmöglichkeiten für die Beifuß-<br />
Ambrosie bieten.<br />
5.2 Topf- und Containerpflanzen aus Gartencentern / Gärtnereien<br />
Pflanzenware wird über große Entfernungen transportiert und über das Vertriebsnetz des Gar<br />
tenhandels zur Verwendung in Gärten, auf Friedhöfen, in Parkanlagen, Blumenrabatten usw.<br />
verkauft. In den letzten Jahren hat der Handel durch die wachsende Zahl <strong>von</strong> Gartencenter<br />
großer Handelsketten (Dehner, Obi, Max Bahr, Globus, Toom, Hornbach, Praktiker) stark zu<br />
genommen. Vermutlich werden Topfpflanzen auch aus Regionen Europas geliefert (z. B. Ita<br />
lien, Osteuropa ), die stark mit Pflanzen der Beifuß-Ambrosie verunkrautet sind. Über den<br />
Handel mit Topfware erfolgt möglicherweise eine Verbreitung über Samen-Verunreinigungen<br />
des verwendeten Bodenmaterials. Da sich in den letzten Jahren Beobachtungen der Beifuß-<br />
Ambrosie auch aus Gärten und neu angelegten Grünanlagen gehäuft haben, war die Frage,<br />
ob der Handel <strong>von</strong> Topfpflanzen (Stauden und Gehölze) für die Verbreitung der Beifuß-<br />
Ambrosie <strong>von</strong> Bedeutung ist. Bemerkenswert war beispielsweise ein gehäuftes Auftreten der<br />
Beifuß-Ambrosie in Beeten der Landesgartenschau in Burghausen 2004 (email S. Heringer,<br />
W. Joswig, P. Sturm 2005). Möglicherweise gelangen Samen der Beifuß-Ambrosie auch über<br />
Bodenmaterial oder Kompost in die Töpfe der Pflanzen. Denkbar wäre auch, dass die Beifuß-<br />
Ambrosie als schwer zu bekämpfendes Unkraut in den Gärtnereien wächst und über sich aus<br />
streuende Samen in die Blumentöpfe gelangt.<br />
Methode<br />
Töpfe und Container <strong>von</strong> Stauden und Gehölzen <strong>von</strong> 25 Gartencentern wurden auf einen Be<br />
wuchs mit der Beifuß-Ambrosie untersucht. Dabei wurden die Märkte aufgesucht und die zum<br />
Verkauf angebotenen Töpfe und Container auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie abgesucht.<br />
Die untersuchten Gartencenter sind in Tab. 7 ab S. 72 aufgelistet. Falls eine Belastung der<br />
Erde mit Samen der Beifuß-Ambrosie vorliegt, so müssten zur Haupt-Wuchszeit der Beifuß-<br />
Ambrosie <strong>von</strong> Juli bis Oktober Pflanzen als Keimlinge oder Jungpflanzen festzustellen sein.<br />
Die Art ist anhand ihrer Keim- und Jungpflanzen deutlich zu identifizieren.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
54
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Neben den Gartencentern wurden auch elf Gärtnereien und eine Baumschule hinsichtlich ei<br />
nes Bewuchses mit der Beifuß-Ambrosie untersucht. Untersucht wurden die Betriebsgelände<br />
(soweit zugänglich) und, falls vorhanden, die Verkaufsräume. Die Gärtnereien wurden darin<br />
unterschieden, ob sie nur Pflanzen aus Eigenproduktion verkaufen, oder auch zugekaufte<br />
Topfpflanzen. Die Ergebnisse wurden in standardisierten Erfassungsbögen eingetragen (siehe<br />
Anhang ab S. 75).<br />
Ergebnisse<br />
Abb. 39:<br />
Unkrautbewuchs in Topfpflanzen<br />
des Dehner<br />
Gartencenters Nürnberg.<br />
Zu sehen sind: Schaumkraut,<br />
Weidenröschen<br />
und Einjähriges Rispengras.<br />
Die Beifuß-Ambrosie<br />
wurde in keinem Fall<br />
nachgewiesen.<br />
(Foto: 17.09.07)<br />
In keinem der 25 untersuchten Gartencenter und 11 Gärtnereien bzw. Baumschulen wurden<br />
Pflanzen der Beifuß-Ambrosie gefunden. Die Verunkrautung der Topfpflanzen und Gartenbauflächen<br />
war überwiegend gering. Nur vereinzelt waren Topfpflanzen etwas stärker bewachsen,<br />
insbesondere wenn es sich um Topfpflanzenware handelt, die offensichtlich längere Verweilzeiten<br />
beim Händler hatte. Am häufigsten sind Moose anzutreffen, die oft nicht als Unkraut<br />
angesehen werden und daher geduldet werden. Etwas häufiger beobachtete Blütenpflanzen<br />
waren: Behaartes Schaumkraut (), Vogelmiere (Stellaria media), Sauerklee (Oxalis spec.),<br />
Gänsedistel (Sonchus spec.), Gemeines Greiskraut (Senecio vulgaris), Weidenröschen (Epilobium<br />
spec.) Einjähriges Rispengras (Poa annua) und Keimlinge <strong>von</strong> Birke (Betula pendula)<br />
und Sal-Weide (Salix caprea). Abb. 39 zeigt beispielhaft einen etwas stärkeren Befall mit typischen<br />
Unkrautarten.<br />
Bei Gesprächen mit Gartenbaubetrieben war die Problematik der Beifuß-Ambrosie oftmals<br />
schon bekannt und manche Gärtner hatten die Pflanze auch schon bekämpft.<br />
HOHLA (2006), der in Oberösterreich zahlreiche Baumschulen auf unbewusst kultivierte bzw.<br />
verbreitete Pflanzenarten untersucht hat, nennt die Beifuß-Ambrosie nicht.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
55
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Gartencenter (25 Flächen)<br />
Gärtnerei mit Verkauf (6 Flächen)<br />
Gärtnerei ohne Verkauf (5 Flächen)<br />
Baumschule (2 Flächen)<br />
Abb. 40: Lage der untersuchten Gartencenter und<br />
Gartenbaubetriebe.<br />
Abb. 41: Links: Gärtnereigelände und angrenzende Randflächen. Rechts: Baumschule<br />
mit intensiver Unkrautbekämpfung.<br />
Bei keinem der insgesamt 11 untersuchten Betriebe wurden Pflanzen der Beifuß-Ambrosie<br />
festgestellt. (Beide Fotos: bei Obernburg/Unterfranken, 14.09.07).<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Die Verbreitung der Beifuß-Ambriosie über in Gartencentern verkaufte Topfpflanzen ist derzeit<br />
<strong>von</strong> geringer Bedeutung. In Gartenbaubetrieben und Baumschulen wird i. d. R. eine intensive<br />
Unkrautbekämpfung/ Pflanzenschutz betrieben. Erdmaterial wird vor seiner Verwendung in der<br />
gartenbaulichen Nutzung oft hygienisiert. Gleichwohl ist in Gärtnereien und Baumschulen teil<br />
weise ein nicht unerheblicher Unkrautbewuchs zu beobachten und die Verschleppung diver<br />
ser, nicht heimischer Pflanzenarten zu verzeichnen (z. B. HOHLA 2006). Es ist nicht auszuschließen,<br />
dass in Zukunft dieser Ausbreitungsweg für die Beifuß-Ambrosie noch an Bedeu-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
56
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
tung gewinnen könnte. Gärtnereien und Baumschulen sollten daher in besonderem Maße auf<br />
die Ausbreitung unerwünschter Pflanzenarten achten.<br />
5.3 Buntbrachen<br />
Buntbrachen sind mit einer wildtiergerechten Samenmischung eingesäte landwirtschaftliche<br />
Stilllegungsflächen, die zur Förderung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft dienen. Im Rahmen<br />
eines <strong>von</strong> der Bundesstiftung Umwelt finanzierten Projektes wurden unter Federführung<br />
der Landesjagdverbände in Hessen und Bayern alleine in Bayern 3000 ha Buntbrachen angelegt.<br />
Das Saatgut wurde vom Landesjagdverband kostenfrei zur Verfügung gestellt, alle weiteren<br />
Kosten mussten die Landwirte/Revierinhaber übernehmen. Als Saatgutmischung wurde<br />
überwiegend die Mischung „Lebensraum I“ verwendet. Diese umfasst 19 Kulturarten und 36<br />
Wildarten. Größere Mengenanteile haben beispielsweise 18,0% Esparsette, 8,0% Sonnenblume,<br />
7,5% Luzerne, 5,5% Buchweizen, 5,0% Fenchel, 5,0% Winterwicke, 4,0% Wiesenkümmel,<br />
2,0% Wegwarte, 6.0% Kleiner Wiesenknopf (BÖRNER 2007). Die Buntbrache dieser<br />
Mischung ist auf eine 3- bis 5-jährige Standzeit ausgelegt, d.h. eine mehrjährige Zeitspanne<br />
ohne Nutzung. Danach werden die Flächen wieder ackerbaulich genutzt. Die Frage ist, ob auf<br />
Buntbrachen Bestände der Beifuß-Ambrosie vorkommen, die möglicherweise auf eine Verunreinigung<br />
des Saatguts zurückzuführen sind.<br />
Falls Samen der Beifuß-Ambrosie auf derartige Flächen gelangen würden, hätte die Art durch<br />
die lange Zeit der Brache und die meist reich vorhandenen Offenbodenflächen potenziell gute<br />
Entwicklungs- und Vermehrungsmöglichkeiten und könnte innerhalb weniger Jahre zu individuenreichen<br />
Beständen heranwachsen. Da die Flächen i. d. R. mitten in den Agrarlandschaften<br />
liegen, wäre dadurch eine unmittelbare Einschleppung in die Ackerflächen gegeben.<br />
Abb. 42:<br />
Buntbrache bei Obernburg-Eisenbach(Unterfranken,<br />
Fläche Nr. 9).<br />
Typische Arten der in<br />
Bayern verwendeten<br />
Saatgutmischungen sind<br />
Sonnenblume, Fenchel,<br />
Esparsette und Luzerne.<br />
Die Beifuß-Ambrosie<br />
wurde auf keiner der<br />
Buntbrachen festgestellt.<br />
(Foto: 14.09.07)<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
57
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Methode<br />
Insgesamt wurden 11 Buntbrachen auf Vorkommen der Beifuß-Ambrosie untersucht und in<br />
standardisierten Erfassungsbögen eingetragen (siehe Anhang ab S. 75). Die einzelnen unter<br />
suchten Flächen sind in Tab. 6 ab S. 70 aufgelistet. Die untersuchten Flächen lagen recht weit<br />
über Bayern verstreut. In den meisten Flächen (aber nicht allen) war vermutlich Saatgutmi<br />
schung „Lebensraum I“ ausgesät worden. Die einzelnen untersuchten Flächen sind in Tab. 6<br />
aufgelistet.<br />
Ergebnisse<br />
Es wurden keine Vorkommen der Beifuß-Ambrosie auf den untersuchten Buntbrachen gefun<br />
den.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Das verwendete Saatgut entsprach den Kriterien der Saatgutreinheit. Günstig war die zentrale<br />
Vergabe des Saatgutes über den Landesjagdverband, der dadurch eine Qualitätssicherung<br />
gewährleisten konnte. Da die mehrjährigen Buntbrachen durch ihren hohen Anteil <strong>von</strong> Boden<br />
lücken günstige Etablierungsvoraussetzungen für die Beifuß-Ambrosie und andere Problemar<br />
ten bieten, sollten sie unter regelmäßiger Beobachtung stehen. Eine Schweizer <strong>Untersuchung</strong><br />
zu Problempflanzen in über 200 Buntbrachen (BOHREN & al. 2007) stellten in 60% der Flächen<br />
einen Befall mit der unerwünschten Goldrute (Solidago canadensis/ gigantea) fest. Die Beifuß-<br />
Ambrosie wurde in der Schweiz ebenso wie in Deutschland nicht festgestellt.<br />
5.4 Sonnenblumenfelder zur Ölgewinnung<br />
In den letzten Jahren hat die Anbaufläche <strong>von</strong> Sonnenblumen zugenommen. Welche Anteile<br />
dabei jeweils auf die Sonnenblumenfelder zur Ölgewinnung oder zur Biogasproduktion entfal<br />
len, ist den Autoren nicht bekannt. Durch Züchtungsarbeit sind seit zwei Jahrzehnten frühreife<br />
Sorten auf dem Markt, die auch unter hiesigen Klimabedingungen eine Ausreifung der Samen<br />
ermöglichen. Vorher war ein Anbau in Deutschland kaum möglich. Anbauschwerpunkt der<br />
Sonnenblumen-Ölsaat ist mit Abstand Brandenburg (18427 ha), gefolgt <strong>von</strong> Bayern (4331 ha),<br />
Sachsen-Anhalt (2942 ha), Sachsen und Thüringen (1933 ha) (DEKALB 2008; Zahlen aus dem<br />
Jahr 2004). Eine Zweckentfremdung <strong>von</strong> Vogelfutter für die Sonnenblumensamenproduktion<br />
zur Ölerzeugung ist unwahrscheinlich, da die Ölmühlen spezifische Anforderungen an die In<br />
haltsstoffe der Sonnenblumensamen stellen. Eine Kontrolle <strong>von</strong> 8 Sonnenblumenfeldern öst<br />
lich Knetzgau (Unterfranken), bei Thüngen (Unterfranken), bei Kitzingen (Unterfranken), nörd<br />
lich Minderoffingen (Schwaben), östlich Wallerstein (Schwaben), 2x südlich Großsorheim<br />
(Schwaben) und nördlich Erlingen (Schwaben) ergaben keinen Befall mit der Beifuß-Ambrosie.<br />
Paul Rothmund vom LKR Erlangen-Höchstadt kontrollierte ebenfalls ca. 10 Felder, ohne die<br />
Beifuß-Ambrosie gefunden zu haben. Wenn auch das Sonnenblumensaatgut zur Ölgewinnung<br />
vermutlich für die Einschleppung ohne Bedeutung ist, so könnte sich die Beifuß-Ambrosie we<br />
gen ihrer schweren Bekämpfbarkeit in der Sonnenblume zum Problemunkraut entwickeln, falls<br />
die Art auf anderem Wege in die Flächen gelangt.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
58
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Abb. 43:<br />
Sonnenblumenfeldern zur<br />
Ölgewinnung östlich Knetzgau<br />
(Unterfranken).<br />
In den untersuchten Sonnenblumenfeldern<br />
zur Ölgewinnung<br />
wurden keine<br />
Beifuß-Ambrosien gefunden.<br />
(Foto: 07.07.07)<br />
6 <strong>Einschleppungs</strong>wege der großen Bestände in Bayern<br />
Nachfolgend wird ein Überblick über die <strong>Einschleppungs</strong>wege der derzeit bekannten 68 großen<br />
Vorkommen der Beifuß-Ambrosie in Bayern gegeben (näheres siehe NAWRATH & ALBERT<br />
ERNST 2008). Die Ergebnisse bezogen auf die einzelnen <strong>Einschleppungs</strong>wege wurden schon<br />
in der Darstellung der jeweiligen Kapitel berücksichtigt. Hier erfolgt eine zusammenfassende<br />
Darstellung bezogen auf alle <strong>Einschleppungs</strong>wege.<br />
Methode<br />
Die <strong>Einschleppungs</strong>wege wurden durch den Geländebefund bei der Felduntersuchung der<br />
Befallsgebiete und die Befragung der zuständigen kommunalen Ambrosia-Beauftragten bzw.<br />
der Eigentümer /Nutzer ermittelt. Für 25% der Bestände ließen sich keine <strong>Einschleppungs</strong>wege<br />
ermitteln, was verschiedene Gründe hatte. Teilweise handelt es sich um erst gegen das<br />
Jahresende 2007 gemeldete Bestände, die nicht mehr im Gelände aufgesucht werden konnten,<br />
teils lag der <strong>Einschleppungs</strong>vorgang schon so lange zurück, dass keine Aussage hierzu<br />
getroffen werden konnte. Da bis vor wenigen Jahren, mit Ausnahme weniger Personen (Botaniker<br />
und Floristen), niemand die Beifuß-Ambrose kannte und sie zudem <strong>von</strong> eher unscheinbarer<br />
Erscheinung ist, ist ihre Zunahme oftmals unbemerkt geblieben.<br />
Ergebnisse<br />
Der häufigste <strong>Einschleppungs</strong>weg der 68 großen Ambrosia-Bestände in Bayern (Stand<br />
21.01.08) ist die Verwendung <strong>von</strong> mit Samen der Beifuß-Ambrosie verunreinigtem Sonnenblumen-Vogelfutter<br />
(siehe Abb. 44). Insgesamt sind es 31 der derzeit bekannten 68 großen<br />
Bestände. Zweitwichtigster <strong>Einschleppungs</strong>weg sind Erdtransporte. Den kleinsten Anteil nimmt<br />
das Saatgut ein.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
59
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
17; 25%<br />
18; 26%<br />
2; 3%<br />
31; 46%<br />
Sonnenblumen-<br />
Vogelfutter<br />
Erde<br />
unbekannt<br />
Saatgut<br />
Abb. 44: <strong>Einschleppungs</strong>wege der 68 großen Bestände der Beifuß-Ambrosie.<br />
Verwendungszweck <strong>von</strong> Sonnenblumen-Vogelfutter<br />
Das folgende Diagramm (Abb. 45) schlüsselt die Verwendung des Sonnenblumen-Vogelfutters<br />
nach seinem Verwendungszweck auf. Am häufigsten ist die Verwendung als Saatgut für<br />
Schnittblumenfelder (siehe Kapitel 3.3 ab S. 23), gefolgt <strong>von</strong> der Verwendung als Saatgut für<br />
Sonnenblumenfeldern zur Landschaftsbildverschönerung (siehe Kapitel 3.5.1 ab S. 34). Von<br />
Bedeutung ist ferner die Verwendung zur Fütterung <strong>von</strong> Vögeln als dem eigentlichen Zweck<br />
des Vogelfutters (siehe Kapitel 3.5.3 ab S. 36) und die Entsorgung <strong>von</strong> Futterresten in die offene<br />
Landschaft (siehe Kapitel 3.5.4 ab S. 37).<br />
1; 3%<br />
3; 10%<br />
3; 10%<br />
6; 19%<br />
1; 3%<br />
1; 3%<br />
16; 52%<br />
Schnittblumen<br />
Verschönerung<br />
Vogelfütterung<br />
Reste-Entsorgung<br />
Binnenschiffahrt<br />
Wildacker<br />
Gründüngung<br />
Abb. 45: Ursprünglicher Verwendungszweck der auf Sonnenblumen-Vogelfutter zurückgehenden<br />
großen Bestände in Bayern.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
60
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Aufschlüsselung des <strong>Einschleppungs</strong>weges Erde<br />
Die Einschleppung über Erdmaterial ist in Abb. 46 in drei Rubriken aufgeschlüsselt: „Baumaßnahmen“<br />
umfassen Bestände, die auf aktuelle oder zurückliegende Bautätigkeiten zurückzuführen<br />
sind; „Erdzwischenlager“ sind vorübergehende Ablagerungen im Rahmen einer Baumaßnahme,<br />
entweder bei der Baustelle (z.B. Abb. 13 auf S. 19) oder auf einem der Zwischenlagerung<br />
dienenden Gelände; „Erdablagerungen“ stehen nicht unmittelbar mit Baumaßnahmen<br />
in Zusammenhang bzw. der Zusammenhang ist bislang noch nicht belegt (näheres siehe Kapitel<br />
3.2 ab S. 14). Ein Beispiel ist die Einbringung <strong>von</strong> Boden zum Zwecke der land- oder forstwirtschaftlichen<br />
Bodenverbesserung. Die „Baumaßnahmen“ stellen die mit Abstand größte<br />
Rubrik der Einschleppung über Erdmaterial dar.<br />
4; 22%<br />
2; 11%<br />
12; 67%<br />
Baumaßnahmen<br />
Erdablagerung<br />
Erdzwischenlager<br />
Abb. 46: Aufschlüsselung der <strong>Einschleppungs</strong>wege über Erdmaterial der bislang aus Bayern<br />
bekannten großen Bestände der Beifuß-Ambrosie.<br />
Diskussion / Handlungsempfehlungen<br />
Dass für den überwiegenden Teil der großen Bestände der Beifuß-Ambrosie in Bayern ein<br />
<strong>Einschleppungs</strong>weg ermittelt werden konnte, spricht für den noch nicht allzu weit fortgeschrittenen<br />
Einbürgerungsprozess der jeweiligen Ambrosia-Vorkommen. In Regionen, in denen sich<br />
die Beifuß-Ambrosie schon länger ausgebreitet hat, treten die Pflanzen oftmals spontan ohne<br />
konkretes Einbringungsereignis auf. Sie sind dort als Samenbank schon im Boden vorhanden<br />
und treten bei Bodenverletzung auf.<br />
Da der Mensch der wesentliche Ausbreitungsvektor der Beifuß-Ambrosie ist, bestehen auch<br />
Möglichkeiten Einfluss auf diesen Ausbreitungsprozess zu nehmen. Da die Ausbreitung weitgehend<br />
unbewusst durch den Menschen erfolgt, besteht ein erhebliches Potenzial zur Aufklärung,<br />
insbesondere was die Risiken der Zweckentfremdung <strong>von</strong> Sonnenblumen-Vogelfutter<br />
betrifft. Adressaten sind alle Nutzer <strong>von</strong> Vogelfutter bzw. Futtermitteln wie Landwirte, Gartenbauer,<br />
Hobby-Tierhalter, Jäger. Auf den Futtermittelpackungen sollte vermerkt sein, dass die-<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
61
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie 62<br />
se nicht als Saatgut verwendet werden sollen, da ggf. Ambrosia-Samen enthalten sein kön<br />
nen.<br />
7 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse<br />
Die bedeutsamsten <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia<br />
artemisiifolia) sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Straßenverkehr, Erdtransporte und<br />
die Aussaat <strong>von</strong> mit Samen der Beifuß-Ambrosie verunreinigten Sonnenblumen-Futtermitteln,<br />
beispielsweise zur Anlage <strong>von</strong> Schnittblumenfeldern, Wildäckern, Sonnenblumenfeldern zur<br />
Landschaftsbildverschönerung oder als Gründüngung. Möglicherweise bzw. potenziell bedeut<br />
sam für die Einschleppung sind Biogas-Sonnenblumenfelder, die Grüngutverwertung und die<br />
Binnenschifffahrt. Nicht oder weniger bedeutsam sind Bahnverkehr, Topf- und Containerpflan<br />
zen aus Gartencentern / Gärtnereien, Buntbrachen und Sonnenblumenfelder zur Ölgewin<br />
nung.<br />
• Der Straßenverkehr ist einer der bedeutsamsten <strong>Einschleppungs</strong>- und Ausbreitungswege<br />
der Beifuß-Ambrosie. Im Jahr 2007 wurden neben den bereits aus 2006 bekannten Amb<br />
rosia-Vorkommen an weiteren Autobahnabschnitten neue Bestände der Art gefunden.<br />
Große Bestände kommen an der A3-Ost (45 km mit großen Lücken), A8-Ost (90 km mit<br />
großen Lücken), A8-West (4 km) und A99 (8 km) vor. Kleinere Bestände besiedeln die A9,<br />
A70, A92 und weitere Bundes- und Staatsstraßen. Ausgehend <strong>von</strong> den Banketten der Au<br />
tobahnen ist eine Ausbreitung auf die angrenzenden Flächen und die weiter entfernt lie<br />
genden untergeordneten Staats- und Gemeindestrassen möglich. Der derzeitige Pflege<br />
rhythmus der <strong>von</strong> der Beifuß-Ambrosie bewachsenen Autobahnabschnitte fördert die Ent<br />
wicklung und Samenproduktion der Beifuß-Ambrosie erheblich und damit die Ausbreitung<br />
der Art. Eine Ausbreitung erfolgt neben dem Fahrtwind vermutlich durch an Fahrzeugen<br />
anhaftende Ambrosia-Samen bzw. samenhaltige Erde.<br />
• Mit Samen belastetes Erdmaterial ist einer der wichtigsten <strong>Einschleppungs</strong>wege der Bei<br />
fuß-Ambrosie, der in kurzer Zeit zu sehr großen Beständen führen kann. Die Untersuchun<br />
gen haben gezeigt, dass die Beifuß-Ambrosie noch keine allgemeine Verbreitung auf<br />
Baumaßnahmen gefunden hat. Es ist aber damit zu rechnen, dass es in Zukunft zu einer<br />
Zunahme der Fälle und Ausdehnung der Bestände kommt. Von höchster Relevanz ist die<br />
Praxis der Zwischenlagerung <strong>von</strong> Erdmaterial im Rahmen <strong>von</strong> Baumaßnahmen, da die<br />
Erdhaufen oft ungewollte Vermehrungskulturen der Beifuß-Ambrosie darstellen. Auch im<br />
Baustellenbereich kann es zu einer Vermehrung der Art kommen.<br />
• Die Zweckentfremdung <strong>von</strong> Sonnenblumenvogelfutter als Saatgut ist einer der bedeut<br />
samsten <strong>Einschleppungs</strong>wege der Beifuß-Ambrosie. Sonnenblumensamen zu Futterzwe<br />
cken werden verwendet als Saatgut für Schnittblumenfelder, Wildäcker und zur Anlage <strong>von</strong><br />
Sonnenblumenfeldern zur Landschaftsbildverschönerung, Biogasproduktion und Gründün<br />
gung. Hierdurch gelangen die Samen der Beifuß-Ambrosie direkte in die Ackerflächen. Ur<br />
sache der Zweckentfremdung ist der gegenüber Sonnenblumen-Saatgut erheblich niedri<br />
gere Preis. Auch 2007 enthielten ca. 70 % der untersuchten Vogelfutter-Proben Samen der<br />
Beifuß-Ambrosie, teils mit sehr hohen Samenzahlen.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
• Der größte Teil der Schnittblumenfelder ist aufgrund der Verwendung <strong>von</strong> gereinigtem<br />
Sonnenblumen-Saatgut oder Unkrautbekämpfung frei <strong>von</strong> der Beifuß-Ambrosie. Auf den<br />
betroffenen Feldern muss hingegen mit einer weiteren Zunahme der Besiedlungsdichte ge<br />
rechnet werden.<br />
• Auch auf bayerischen Wildäckern sind Vorkommen der Beifuß-Ambrosie zu verzeichnen.<br />
Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass auch das Saatgut namhafter Anbieter <strong>von</strong><br />
Wildackersaatgut teilweise mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastet ist.<br />
• Auch bei der Verfütterung <strong>von</strong> Sonnenblumenkernen zu Futterzwecken (z. B. Wildvögel,<br />
Geflügel, Pferde, Schweine) kann es zu einer Ausbreitung kommen, wenn die Futterplätze<br />
im Freiland liegen. Auch die Entsorgung <strong>von</strong> Futtermittelresten im Freiland, beispielswei<br />
se zur Bodenverbesserung in der Landwirtschaft, kann zu einer Ausbreitung führen.<br />
• Bei der Verwertung <strong>von</strong> mit Samen der Beifuß-Ambrosie belastetem Grüngut durch Kom<br />
postierungsanlagen ist eine Verbreitung der Beifuß-Ambrosie nicht auszuschließen. Dies<br />
gilt in noch höherem Maße für die Verwertung über die Grüngutdüngung.<br />
• Uferbereiche der Flüsse, insbesondere des Main-Donau-Kanals könnten zukünftig für die<br />
Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie an Bedeutung gewinnen.<br />
• Der Bahnverkehr ist aktuell für die Einschleppung und Ausbreitung weniger bedeutsam.<br />
Zwar kommt die Beifuß-Ambrosie regelmäßig auf Bahnanlagen vor, doch ist deren weitere<br />
Ausbreitung eher unwahrscheinlich.<br />
• Eine Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie über Topf- und Containerpflanzen aus Garten<br />
centern / Gärtnereien ist vermutlich <strong>von</strong> geringer Bedeutung.<br />
• Buntbrachen und Sonnenblumenfelder zur Ölgewinnung sind für die Einschleppung<br />
der Beifuß-Ambrosie vermutlich <strong>von</strong> geringer Bedeutung.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
63
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
8 Literatur<br />
ALBERTERNST, B., NAWRATH, S., KLINGENSTEIN, F. (2006): Biologie, Verbreitung und <strong>Einschleppungs</strong>wege<br />
<strong>von</strong> Ambrosia artemisiifolia in Deutschland und Bewertung aus Naturschutzsicht. – Nachrichtenbl.<br />
Deut. Pflanzenschutzd. 58(11): 279-285.<br />
AMT FÜR NATUR UND UMWELT (2007): Merkblatt zum Umgang mit Erdmaterial, das mit Ambrosia oder<br />
anderen Problempflanzen belastet ist. September 2007. - Amt für Natur und Umwelt im Kanton<br />
Graubünden (Schweiz), Chur (URL: www.umwelt-gr.ch/dienste/pdfdaten/merkblaetter/2007/nm001.pdf;<br />
30.1.08)<br />
BMELV Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2008): Merkblatt zur<br />
Verringerung der Verunreinigung <strong>von</strong> bestimmten Futtermitteln mit Samen <strong>von</strong> Ambrosia artemisiifolia<br />
L. Stand: 17.03.2008 URL: www.bvl.bund.de/cln_027/DE/02__Futtermittel/00__doks__download/merkblatt__ambrosia,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/<br />
merkblatt_ambrosia.pdf<br />
BOHREN, C., DELABAYS, N., MERMILLOD, G. KEIMER, C. KÜNDIG, C. (2005): Ambrosia artemisiifolia in der<br />
Schweiz – eine herbologische Annäherung. AgrarForschung 12 (2): 71-78.<br />
BOHREN, C, MERMILLOD, G., DELABAYS, N. (2006): Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Switzerland:<br />
development of a nationwide concerted action. – Journal of Plant Diseases and Protection<br />
Special issue XX 497 – 503.<br />
BOHREN, C., MERMILLOD, G. & DELABAYS, N. (2007): Unerwünschte Pflanzen in Buntbrachen: eine Bestandsaufnahme.<br />
– Agrarforschung 14(9): 388-393.<br />
BÖRNER, M. (2007): Endbericht des Projektes „Lebensraum Brache“ – Wildtierfreundliche Maßnahmen<br />
im Agrarbereich. – unveröff. Bericht. Zusammengestellt <strong>von</strong> der Deutschen Wildtierstiftung,<br />
Hamburg (URL: www.lebensraum-brache.de/_downloads/service/downloads/eigene/<br />
2007_Endbericht_Lebensraum_Brache.pdf?PHPSESSID=54feb1c57814bcccbe2f7130d055<br />
9ba6; 30.01.08)<br />
BUNDESGÜTEGEMEINSCHAFT KOMPOST (2007): Seuchen- und phytohygienische Wirkung des Kompostierungsprozesses<br />
bestätigt. - Humuswirtschaft & Kompost aktuell 12/2007: 3-4. 2007. (URL:<br />
www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/HUKaktuell12_07_S3.pdf; 30.01.08)<br />
DEKALB (2008): Homepage <strong>von</strong> Dekalb, der Saatgutmarke <strong>von</strong> Monsanto Agrar Deutschland. (URL:<br />
http://www.dekalb.de/index.html; 16.01.08)<br />
EURALIS (2007): Biogas-Ratgeber. – Euralis Saaten GmbH, Norderstedt, 24 S.<br />
FUCHS, J.G. (2006): Kompostierung <strong>von</strong> Problemunkräutern. Biophyt AG, interne Publikation, 1p. (URL:<br />
www.biophyt.ch/documents/Unkrautkompostierung_2006.pdf; 30.01.08)<br />
FUMANAL, B., CHAUVEL, B., SABATIER, A., BRETAGNOLLE, F. (2007): Variability and cryptic heteromorphism<br />
of Ambrosia artemisiifolia seeds: What consequences for its invasion in France? - Ann Bot<br />
(Lond) 2007 Aug; 100(2): 305-13.<br />
GAUWEILER, T. (2008): Preisliste “2008” des Saatguthandels Premium Sunflowers seeds & more e. K.<br />
(URL: www.premium-sunflowers.de/cgi-bin/contray1/contray.cgi?DATA=&ID=000006 &GRO<br />
UP=010; 16.01.08).<br />
HEINE, H., 1952: Beiträge zur Kenntnis der Ruderal- und Adventivflora <strong>von</strong> Mannheim, Ludwigshafen<br />
und Umgebung. Jber. Ver. Naturkde. Mannheim 117/118, 85–132.<br />
HOHLA, M. (2002): Agrostis scabra WILLD. neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis<br />
der Flora des Innviertels und Niederbayerns. Beitr. Naturk. Oberösterreichs 11: 465-505.<br />
HOHLA, M. (2005): Mais & Co. Aufstrebende Ackerbegleiter im Portrait. – Öko L 27(3): 10-20.<br />
HOHLA, M. (2006): (Über-) Lebensräume: Baumschulen & Gärtnereien. – Öko L 28(1): 3-13.<br />
INFU Ingenieurgesellschaft für Umweltplanung (2007): Überprüfung der seuchen- und phytohygienische<br />
Wirkungsweise des Kompostierungsprozesses unter festgelegten Temperaturbedingungen.<br />
– Gutachten im Auftrag der Bundesgütegemeinschaft Kompost.<br />
KLOTZ, J. (2006): Zur Verbreitung <strong>von</strong> Ambrosia artemisiifolia bei Regensburg. – Hoppea 67: 471-484.<br />
KGDV Komitees gegen den Vogelmord e.V. (2007): Fachgerechten Winterfütterung. – Broschüre 12 S.<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
64
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
KRUIS, U. (2002): Grüngut zwischen Abfallvermeidung und -verwertung. – Tagungsband Abfallvermeidung<br />
und -verwertung bei der Landschafts- und Gartenpflege – 01/02. Okt. 2002. S. 3-14<br />
(URL: www.abfallratgeber-bayern.de/arba/allglfu.nsf/389C394E1FF48457C1256EC8002 A99<br />
21/$file/gruengut.pdf; 30.01.08).<br />
LABONDE, O. (2006): Umrechnung der Gauß-Krüger-Notation (Potsdamm-Datum) in geographisch Längen-<br />
und Breitengrade (WGS84–Datum). (URL: www.ottmarlabonde.de/L1/Pr2.Applet1.html;<br />
13.01.08).<br />
LVG Landesamt für Vermessung und Geoinformation (2007): BayernViewer [Viewer für Karten und<br />
Luftbilder mit Ortssuche] (URL: www.geodaten.bayern.de/BayernViewer; 20.01.08)<br />
MAZOMEIT, J. (2006): Aktuelle Ausbreitung <strong>von</strong> Ambrosie artemisiifolia in der Pfalz. - Pollichia-Kurier<br />
22(4): 6-8. [Informationsblatt des Vereins für Naturforschung u. Landespflege]<br />
MONSANTO (2006): Sortenprogramm 2006 - Mais und Sonnenblume. 65 S.<br />
NAWRATH, S. & ALBERTERNST, B. (2007): Vorkommen der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) an<br />
den bayerischen Autobahnen A3 und A8 – Kurzfassung. Stand 18.04.2007. - Projektgruppe<br />
Biodiversität und Landschaftsökologie, 2 S.<br />
NAWRATH & ALBERTERNST (2008): 2. Zwischenbericht zum Forschungsprojekt Evaluierung <strong>von</strong> Maßnahmen<br />
der Eradikation der Beifuß-Ambrosie in Bayern. – unveröff. Studie im Auftrag des<br />
Bayerischen <strong>Staatsministerium</strong>s für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.<br />
PERETZKI, F., BAUCHHENß, J., BECK, R. BRANDHUBER, R. & CAPRIEL, P. (2003): Auswirkungen <strong>von</strong> Grüngut<br />
auf Ertrag und Bodeneigenschaften. - Tagungsband der Fachtagung vom 25.3.2003: Verwertung<br />
<strong>von</strong> Grüngut aus der Landschaftspflege. - Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft 1(4): 25-63 (URL: www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/schriftenreihe_url_1_2.pdf;<br />
30.01.08).<br />
STAATSKANZLEI SOLOTHURN (2007): Der Kampf gegen Ambrosia wird im Kanton Solothurn verstärkt. <br />
Pressemitteilung des Kanton Solothurn vom Juni 2007 (URL: www.so.ch/staatskanzlei/ medienmitteilungen/archiv/2007/juni/der-kampf-gegen-ambrosia-wird-im-kanton-solothurnverstaerkt/drucken.html;<br />
30.01.08).<br />
SUNFLOWER (2008): Homepage der Sunflower GmbH. (URL: www.sunflower-ds.sk/firma_ge.html;<br />
16.01.08).<br />
WAGENITZ, G. (1979): Ambrosia. - in Hegi (Begr.): Illustrierte Flora <strong>von</strong> Mitteleuropa.<br />
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (2007):Top Ten Listen für den deutschen Zierpflanzenmarkt<br />
2006. Bonn (URL: www.g-net.de/download/daten_faken/Top10_Grafiken2006.pdf; 160107).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
65
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie 66<br />
9 Anhang<br />
9.1 <strong>Untersuchung</strong>sergebnisse in tabellarische Zusammenstellung<br />
Im Folgenden sind die untersuchten Flächen tabellarisch aufgelistet. Für jede Fläche liegt eine<br />
ausführliche Erhebung und i. d. R. eine Bilddokumentation vor. Falls die Beifuß-Ambrosie an<br />
getroffen wurde, ist die Zeile rot unterlegt.<br />
Tab. 4: Untersuchte Großbaumaßnahmen, Abgrabungen, Gewerbebrachen, Zwischenlager.<br />
Rot unterlegt: Vorkommen der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia).<br />
Grün unterlegt: Vorkommen der Stauden-Ambrosie (Ambrosia coronopifolia).<br />
Nr. Regierungs Kreis Gemeinde Datum Beschreibung G-K-Wert Typ der<br />
bezirk<br />
Baustelle<br />
1 Unterfranken Aschaffen Aschaffenburg 04.09.2007 Neubau der Ebertbrücke 3509222 Straßenbau<br />
burg Stadt<br />
(Zweite Fahrbahn) 5538006<br />
2 Unterfranken Aschaffen Aschaffenburg 04.09.2007 Erweiterungsgelände der 3507940 Baustelle<br />
burg Stadt<br />
Firma Kaub; daneben<br />
umfangreiche Erdablagerungen<br />
5537109 Gewerbe<br />
3 Unterfranken Aschaffen- Stockstadt am Main 04.09.2007 Gewerbebrache im Ge 3506097 Gewerbebraburg<br />
LKR werbegebiet; vorher Gebäude<br />
abgerissen und<br />
eingeebnet; Erdhaufen<br />
5536286 che<br />
4 Unterfranken Aschaffen- Kahl am Main 10.09.2007 Straßenneubau Unterfüh 3500739 Straßenbau<br />
burg LKR rung Bahnlinie auf 1,2 km<br />
noch bis 2010<br />
5548537<br />
5 Unterfranken Aschaffen- Alzenau 10.09.2007 Neubau Autobahn 3502664 Straßenbau<br />
burg LKR Anschlusstelle der A45:<br />
Alzenau-Mitte: umfangreiche<br />
Bautätigkeit mit viel<br />
Offenboden<br />
5549916<br />
6 Unterfranken Aschaffen- Mainaschaff 10.09.2007 Umfangreiche baumaß 3506644 Straßenbau<br />
burg LKR nahmen mit vielen Ruderalgesellschaften<br />
5539397<br />
7 Unterfranken Miltenberg Niedernberg 14.09.2007 Baustelle und Betriebsge 3508870 Baustelle<br />
lände des Bauunternehmens<br />
Stix<br />
5530842 Gewerbe<br />
8 Unterfranken Miltenberg Niedernberg 14.09.2007 Gewerbegebiet, Wohnge 3509353 Baustelle<br />
biet teils fertig<br />
5530754 Wohnen,<br />
Baustelle<br />
Gewerbe<br />
9 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt OT Groß 16.09.2007 Umfangreiche Erdauf 3575023 Straßenbau<br />
LKR mannsdorf schüttungen ; Anfang der<br />
Baumaßnahmen<br />
5505276<br />
10 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt OT Groß 16.09.2007 Resteverwertung, Lager 3574643 Zwischenla-<br />
LKR mannsdorf für div. Baustoffe 5505429 ger Erde,<br />
Baustoffe etc<br />
11 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt OT Groß 16.09.2007 Ortsumfahrung und Neu 3574784 Straßenbau<br />
LKR mannsdorf bau Mainbrücke: Große<br />
Erdablagerung<br />
5505074<br />
12 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt 16.09.2007 Gelände BayWa/Agrar, 3576280 Gewerbebra<br />
LKR<br />
Lagerflächen, Brachen: in<br />
Nachbarschaft Bahnanschluß,<br />
Hafen<br />
5503904 che<br />
13 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt 16.09.2007 Zuckerrübenfabrik, Wa 3578681 Gewerbebra-<br />
LKR renannahmestelle, große<br />
Ruderalfluren<br />
5504020 che<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr. Regierungs Kreis Gemeinde Datum Beschreibung G-K-Wert Typ der<br />
bezirk<br />
Baustelle<br />
14 Mittelfranken Erlangen- Heßdorf 16.09.2007 Gewerbepark Hessdorf, 4422384 Baustelle<br />
Höchstadt<br />
große Ruderalfluren und<br />
Erdablagerungen, nahe<br />
der A3<br />
5499579 Gewerbe<br />
15 Mittelfranken Erlangen Erlangen Stadt 16.09.2007 Gewerbebrache mit mage 4429393 Gewerbebra-<br />
Stadt rer Ruderalvegetation 5495838 che<br />
16 Mittelfranken Erlangen Erlangen Stadt 16.09.2007 ausgedehnte schwach 4430012 Gewerbebra-<br />
Stadt bewachsene Ruderalfluren 5495459<br />
und Offenboden<br />
che<br />
17 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Weitgehend fertiggestell 4436422 Gewerbebra-<br />
Stadt tes Messeareal 5476197 che<br />
18 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Schwach bewachsene 4433391 Gewerbebra-<br />
Stadt magere Schuttflächen 5477382 che<br />
19 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Frische Baumaßnahmen 4431171 Baustelle<br />
Stadt entlang der Bahntrasse 5479389 Gewerbe<br />
20 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Neubau eines neuen 4431470 Baustelle<br />
Stadt Stadtteils 5478761 Wohnen<br />
21 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Industriebrache Cebal- 4430736 Gewerbebra<br />
Stadt<br />
Gelände, eingeebnete<br />
Fläche, Baustoffablagerungen<br />
5477594 che<br />
22 Oberbayern Traunstein Chieming 18.09.2007 Abgrabungs- und Auf 4540796 Abgrabung<br />
schüttungsflächen 4307479<br />
23 Oberbayern Berchtesga Ainring-Hausmoning 18.09.2007 Kiesgrube 4572528 Abgrabung<br />
dener Land<br />
5297749<br />
24 Unterfranken Aschaffen- Alzenau 24.09.2007 Zwischenlager für Erdma 3502604 Zwischenlaburg<br />
LKR terial, Kompost, Baustoffe 5550950 ger Erde,<br />
u.a. Baustoffe etc.<br />
25 Unterfranken Schwein- Zwischen Gochsheim 26.09.2007 Erdaufschüttung an der 3590350 Baustelle<br />
furth LKR und Schweinfurt OT A70, vermutlich Lärm 5544441 Gewerbe<br />
Sennfeld schutz<br />
26 Mittelfranken Erlangen- Eckental OT Esche 27.09.2007 Neubau Ortsumgehung 4441600 Straßenbau<br />
Höchstadt nau Eschenau frisch fertiggestellt,<br />
ca. 900 m<br />
5493877<br />
27 Mittelfranken Erlangen- Heroldsberg 27.09.2007 Beginn der Bauarbeiten 4438344 Baustelle<br />
Höchstadt zum Neubaugebiet mit<br />
überwiegend Offenbodenflächen<br />
5488128 Wohnen<br />
28 Mittelfranken Erlangen- Höchstadt 05.10.2007 Anfang der Baumaßnah 4416110 Straßenbau<br />
Höchstadt<br />
men; auf ca. 500 m Länge 5508229<br />
29 Oberbayern Freising, Freising 09.10.2007 Straßenrandbereiche des 4485819 Baustelle<br />
Erding Flughafengeländes frisch<br />
fertiggestellt<br />
5356986 Gewerbe<br />
30 Schwaben Donau-Ries Harburg (Schwaben) 17.10.2007 Neu fertiggestellte Straße 4399976 Straßenbau<br />
OT Heroldingen mit junger Begrünung;<br />
große Böschungsflächen<br />
5407906<br />
31 Oberbayern Dachau Bergkirchen 18.10.2007 Gewerbegebiet am Anfang 4451896 Baustelle<br />
der Erschließung<br />
5344769 Gewerbe<br />
32 Oberbayern Berchtesga Laufen 30.06.2007 Kiesabbauwerk 4570301 Abgrabung<br />
dener Land<br />
5309061<br />
33 Oberbayern Berchtesga Freilassing 30.06.2007 Kieswerk 4573735 Abgrabung<br />
dener Land<br />
5302299<br />
34 Unterfranken Main- Zellingen 07.07.2007 Fa. Erdbau Banermees 3559912 Abgrabung<br />
Spessart<br />
aus Thüngersheim 5532396<br />
35 Unterfranken Aschaffen- Mömbris OT Hems 23.10.2007 Steinbruch stillgelegt 3509227 Abgrabung<br />
burg bach aktuell Verfüllung 5549839<br />
36 Mittelfranken Erlangen Erangen OT Fraue 05.10.2007 Erdlager, Lager Baustoffe 4425063 Zwischenla-<br />
Stadt naurach 5491905 ger Erde,<br />
Baustoffe etc.<br />
37 Oberbayern Eichstätt Denkendorf OT Dörn 06.10.2007 Erd- und Sandlagergelän 4461378 Zwischenladorf<br />
de westlich Dörndorf 5423083 ger Erde,<br />
Baustoffe etc.<br />
38 Oberbayern Altötting Burgkirchen-Pirach 08.10.2007 Bauschuttdeponie, Kies 4552531 Abgrabung<br />
werk<br />
5337759<br />
39 Mittelfranken Ansbach Wilburgstetten 17.10.2007 Erdlager <strong>von</strong> Baufirma an 3600927 Zwischenla-<br />
LKR der B25 5433597 ger Erde,<br />
Baustoffe etc.<br />
40 Schwaben Augsburg Augsburg 18.10.2007 Erd- und Aushublager 4418095 Zwischenla-<br />
Stadt 5358530 ger Erde,<br />
Baustoffe etc.<br />
41 Unterfranken Aschaffen Großostheim 04.09.2007 Sandgrube und angren 3503578 Abgrabung<br />
burg LKR<br />
zende Erdmieten<br />
5533255<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
67
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Tab. 5: Untersuchte Schnittblumenfelder.<br />
Rot unterlegt: Schnittblumenfelder mit Vorkommen der Beifuß-Ambrosie.<br />
Nr<br />
Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum G-K-Wert Typus Anbieter laut Schild<br />
1 Unterfranken Aschaffenburg Kleinostheim 06.07.2007 3504079 Vogel Fau Wachsmann, Klein<br />
5541504<br />
ostheim<br />
6 Oberbayern Ebersberg Hohenlinden 29.06.2007<br />
4498642<br />
5335237<br />
4556075<br />
Hybrid Blumen Lang<br />
7 Oberbayern Altötting Burgkirchen 30.06.2007 5332925<br />
4555636<br />
V+S Ohnesorg 08633-500067<br />
8 Oberbayern Traunstein Tittmonig 30.06.2007 5326378<br />
4559407<br />
Hybrid Reichenspurner Hof<br />
9 Oberbayern Traunstein Tittmonig 30.06.2007 5321784 Hybrid Reichenspurner Hof<br />
Berchtesgade<br />
4570357<br />
10 Oberbayern ner Land Laufen 30.06.2007 5309381 Hybrid Reichenspurner Hof<br />
Berchtesgade<br />
4573852<br />
11 Oberbayern ner Land Freilassing 30.06.2007 5302075 Hybrid Reichenspurner Hof<br />
Wagub am<br />
4555760<br />
12 Oberbayern Traunstein See 30.06.2007 5311218<br />
4585305<br />
Hybrid Reichenspurner Hof<br />
13 Niederbayern Rottal-Inn Ering 30.06.2007 5352450<br />
4502818<br />
Hybrid Reichenspurner Hof<br />
14 Niederbayern Passau LKR Kirchham 30.06.2007 5357793 Hybrid Reichenspurner Hof<br />
15 Niederbayern Passau LKR Bad Füssing 30.06.2007 4597964<br />
5357520<br />
V+S 08633-500067<br />
16 Niederbayern Passau LKR Eging am 01.07.2007 4590736 Hybrid keine<br />
See<br />
5396074<br />
17 Niederbayern Landshut Arth 01.07.2007 4505049<br />
5382661<br />
noch zu jung Kügel 09433-3612<br />
18 Niederbayern Kelkeim Siegenburg 01.07.2007 4488043<br />
5402464<br />
Vogel Forstner 094441 10882<br />
20 Niederbayern Kelheim Kelheim 01.07.2007 4493223<br />
5418299<br />
Vogel Forstner 094441 10882<br />
23 Niederbayern Kelheim Kelheim 01.07.2007 4491592<br />
5420596<br />
Hybrid Lindlmeier 08636-315<br />
25 Oberpfalz Regensburg Burgweinting 01.07.2007 4511412 Vogel Habenschaden 0941<br />
Stadt<br />
5428041<br />
81736<br />
28 Unterfranken Haßberge Theres 07.07.2007 3603330<br />
5543235<br />
Vogel keine Angaben<br />
29 Mittelfranken Roth Roth 07.07.2007 4432897<br />
5452636<br />
Hybrid Rühl<br />
36 Oberbayern München Stadt Pasing 27.07.2007 4459221<br />
5332734<br />
Hybrid Blumen Lang<br />
37 Oberbayern Freising Freising 27.07.2007 4480687 V+S Obst und Blumen Rin<br />
5361130<br />
genberg<br />
40 Oberbayern Dachau Dachau 17.08.2007 4460792<br />
5346830<br />
V+S 0174-3118579<br />
42 Unterfranken Aschaffenburg Großostheim 04.09.2007 3506515<br />
5533094<br />
Hybrid Münkels Beerenhof<br />
44 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 09.09.2007 3509326<br />
5551186<br />
Hybrid (?) Simon 06023-8902<br />
45 Unterfranken Miltenberg Großwall 14.09.2007 3510748 Hybrid Münkels Beerenhof<br />
stadt<br />
5526870<br />
09371-2131<br />
46 Unterfranken Würzburg LKR Reichenberg 16.09.2007 3567274 Hybrid Spargelhof kuhn 09336<br />
5511043<br />
99852<br />
47 Mittelfranken Erlangen Stadt Erlangen 16.09.2007 4423950 Hybrid Niedermann 0911<br />
5499013<br />
762570<br />
48 Mittelfranken Erlangen- Bubenreuth 16.09.2007 4428773 Hybrid keine Angaben<br />
Höchstadt<br />
5499809<br />
49 Mittelfranken Erlangen- Möhrendorf 16.09.2007 4428258 Hybrid keine Angaben<br />
Höchstadt<br />
5500663<br />
50 Mittelfranken Roth Wendelstein 17.09.2007 4435651 Hybrid G.M. 09122-71605<br />
OT<br />
Großschwarzenlohe<br />
5467001<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
68
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr<br />
Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum G-K-Wert Typus Anbieter laut Schild<br />
51 Mittelfranken Roth Schwanstet 17.09.2007 4434503 Hybrid keine Angaben<br />
ten OT Mittelhembach<br />
5463272<br />
52 Mittelfranken Schwabach Schwabach 17.09.2007 4433000 Hybrid Rühl, Schaftnach<br />
Stadt OT Penzendorf<br />
5466185<br />
53 Oberbayern Traunstein Chieming 18.09.2007 4542244<br />
5306301<br />
Hybrid Reichenspurner Hof<br />
56 Unterfranken Schweinfurt LKR Bergrheinfeld 25.09.2007 3585331 Hybrid keine Angaben<br />
57 Oberfranken Kulmbach Wonsees OT<br />
Großenhül<br />
58 Oberfranken Kulmbach Wonsees OT<br />
Großenhül<br />
5543146<br />
27.09.2007 4450461<br />
5538569<br />
27.09.2007 4452449<br />
5539246<br />
Vogelfutter (?) keine Angaben<br />
69<br />
Vogelfutter (?) E. Bergmann, Großenhül<br />
4<br />
59 Mittelfranken Erlangen- Heroldsberg 27.09.2007 4439922 Hybrid Niedermann 0911<br />
Höchstadt OT Keinge 5491054 762570<br />
60 Mittelfranken Erlangen-<br />
Höchstadt<br />
schaidt<br />
Rückersdorf 27.09.2007 4444754<br />
5484125<br />
Hybrid keine Angaben<br />
61 Oberbayern Pfaffenhofen an Hohenwart 28.09.2007 4457046 Hybrid keine Angaben<br />
der Ilm OT Weichenried<br />
5384741<br />
62 Oberbayern Freising Freising 28.09.2007 4481449<br />
5363957<br />
Hybrid keine Angaben<br />
63 Oberbayern Freising Zolling 28.09.2007 4482954 Hybrid (?) keine Angaben<br />
64 Oberpfalz Regensburg<br />
LKR<br />
5368811<br />
Aufhausen 28.09.2007 4483792<br />
5386586<br />
? keine Angaben<br />
65 Niederbayern Kelheim Mainburg 28.09.2007 4483809<br />
5388492<br />
V+S Forstner 094441 10882<br />
66 Niederbayern Kelheim Mainburg 28.09.2007 4484321<br />
5390474<br />
V+S Forstner 094441 10882<br />
67 Mittelfranken Erlangen- Gremsdorf 05.10.2007 4417067 Hybrid Niedermann 0911<br />
Höchstadt<br />
5507554<br />
762570<br />
68 Mittelfranken Nürnberger Feucht 05.10.2007 4442488 Hybrid Gerner 0170-5613946<br />
Land<br />
5470064<br />
69 Mittelfranken Roth Allersberg 06.10.2007 4441647 Hybrid keine Angaben<br />
OT Guggenmühle<br />
5457490<br />
70 Oberbayern Eichstätt Denkendorf 06.10.2007 4460921<br />
5421791<br />
? keine Angaben<br />
71 Oberbayern Eichstätt Denkendorf 06.10.2007 4462571<br />
5422917<br />
V+S keine Angaben<br />
72 Oberpfalz Regensburg Pentling 06.10.2007 4505064 ? Lindlmeier 08636-315<br />
LKR<br />
5427062<br />
73 Oberpfalz Regensburg Pentling 06.10.2007 4504914 Hybrid Lindlmeier 08636-315<br />
LKR<br />
5427673<br />
74 Oberpfalz Regensburg Grass 06.10.2007 4505251 Vogelfutter verm Biohof Biersack<br />
LKR<br />
5427991<br />
75 Oberpfalz Regensburg Regensburg 06.10.2007 4507722 V+S Forstner 094441 10882<br />
Stadt<br />
5428072<br />
76 Niederbayern Passau LKR Ruhstorf an 07.10.2007 4597248 Hybrid Ohnesorg 08633-500067<br />
der Rott<br />
5366025<br />
78 Niederbayern Passau LKR Pocking 07.10.2007 4596322<br />
5364931<br />
Vogelfutter keine Angaben<br />
79 Oberbayern Altötting Altötting 08.10.2007 4551541<br />
5340651<br />
Hybrid keine Angaben<br />
80 Oberbayern Altötting Burgkirchen 08.10.2007 4554198<br />
5337430<br />
Hybrid Reichenspurner Hof<br />
81 Oberbayern Altötting Burgkirchen 08.10.2007 4554888<br />
5336544<br />
V+S Ohnesorg 08633-500067<br />
82 Niederbayern Landshut Gerzen 09.10.2007 4530496<br />
5373571<br />
V+S Kügel 09433-3612<br />
83 Unterfranken Würzburg LKR Eisingen OT 16.10.2007 3561587 V+S Krämer 09369-99352<br />
Erbachshof<br />
5514043<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr<br />
Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum G-K-Wert Typus Anbieter laut Schild<br />
84 Unterfranken Würzburg LKR Randers 16.10.2007 3571110 Hybrid (?) Spargelhof kuhn 09336acker<br />
5513388<br />
99852<br />
85 Mittelfranken Ansbach Rothenburg 16.10.2007 3587432 Vogelfutter Wiegener Blumen, Bren<br />
o.d.T.<br />
5471794<br />
nerei 09861-2159<br />
86 Mittelfranken Ansbach Neusitz OT 16.10.2007 3588044 Hybrid Leute aus dem Ort ge<br />
Schweinsdorf<br />
5473571<br />
sprochen<br />
87 Mittelfranken Ansbach Rothenburg 16.10.2007 3587038 Vogelfutter Wiegener Blumen, Bren<br />
o.d.T.<br />
5473847<br />
nerei 09861-2159<br />
88 Mittelfranken Ansbach Steinsfeld 16.10.2007 3587904<br />
5478456<br />
Hybrid Hain 09865-509<br />
89 Mittelfranken Ansbach Dinkelsbühl 17.10.2007 3594465<br />
5435557<br />
Vogelfutter Schneider 09851-7624<br />
90 Mittelfranken Ansbach Dinkelsbühl 17.10.2007 3595180<br />
5438431<br />
Vogelfutter Schneider 09851-7624<br />
91 Schwaben Donau-Ries Harburg OT 17.10.2007 4401141 Hybrid keine Angaben<br />
Hoppingen<br />
5407546<br />
92 Schwaben Donau-Ries Harburg 17.10.2007 4405956 V+S keine Angaben<br />
Ebermergen<br />
5403076<br />
93 Schwaben Augsburg LKR Meitigen 17.10.2007 4414890<br />
5378810<br />
V+S keine Angaben<br />
94 Schwaben Augsburg LKR Meitingen 18.10.2007 4415803<br />
5376691<br />
Hybrid keine Angaben<br />
95 Schwaben Aichach- Mering 18.10.2007 4422619 Hybrid (?) keine Angaben<br />
Friedberg<br />
5348390<br />
96 Schwaben Aichach- Friedberg 18.10.2007 4422820 V+S 0172-8985795 Nr. 1802<br />
Friedberg<br />
5356147<br />
97 Schwaben Aichach- Friedberg 18.10.2007 4423365 V+S 0172-8985795 Nr. 107,<br />
Friedberg<br />
5358216<br />
1351<br />
98 Schwaben Aichach- Friedberg 18.10.2007 4426352 V+S Riemensperger Nr. 3319<br />
Friedberg<br />
5359871<br />
99 Schwaben Aichach- Dasing 18.10.2007 4430602 Vogelfutter Info-Tel. 0174-3118579<br />
Friedberg<br />
5361752<br />
10 Oberbayern Pfaffenhofen an Schweiten 17.08.2007 4469535 Vogelfutter keine Angaben<br />
2 der Ilm kirchen OT<br />
Großarreshausen<br />
5379723<br />
Tab. 6: Untersuchte Wildäcker und Buntbrachen.<br />
Rot unterlegt: Wildäcker und Buntbrachen mit Vorkommen der Beifuß-Ambrosie.<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum Ortsbeschreibung G-K Typ Einsaat<br />
3 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 09.09.2007 Wildwiese Kälberau 3507448<br />
5550592<br />
Wildacker<br />
4 Unterfranken Aschaffenburg Mömbris OT 09.09.2007 Wildwiese nördlich Hems 3509141 Wildwiese<br />
Hemsbach<br />
bach<br />
5549244<br />
5 Unterfranken Aschaffenburg Mömbris OT 09.09.2007 Wildackermischung Offen 3509700 Wildacker<br />
Hemsbach<br />
land nordöstl. Hemsbach 5548977<br />
6 Unterfranken Aschaffenburg Kleinostheim 10.09.2007 Waldwiese östlich der Orts 3506618 Wildwiese<br />
lage<br />
5540571<br />
7 Unterfranken Aschaffenburg Krombach 09.09.2007 Buntbrache nw Ober 3514526 Buntbrache<br />
(Unterfranken)<br />
Krombach 5551302<br />
8 Unterfranken Aschaffenburg Geiselbach 09.09.2007 Buntbrache nordöstlich 3514830 Buntbrache<br />
Geiselbach<br />
5554577<br />
9 Unterfranken Miltenberg Obernburg 14.09.2007 Buntbrache am Ortsrand 3507998 Buntbrache<br />
am Main OT<br />
Eisenbach Ferienstraße 5522179<br />
Eisenbach Ecke Mühlstraße neben<br />
Getreidemühle<br />
10 Oberbayern Traunstein Sondermo 18.09.2007 Buntbrache in Sondermo 4541877 Buntbrache<br />
ningning<br />
Ortslage am Esterweg 5308290<br />
11 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 24.09.2007 Wildacker Mühlmark nörd 3505142 Wildacker<br />
Michelbach lich Alzenau, Abteilung<br />
Rupprich<br />
5551552<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
70
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum Ortsbeschreibung G-K Typ Einsaat<br />
12 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 24.09.2007 Wildacker westlich Michel 3505177 Wildacker<br />
Michelbach bach an Hochspannungstrasse<br />
Abt Somporner Höhe<br />
5553407<br />
13 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 24.09.2007 Wildwiese westlich Michel 3505337 Wildacker<br />
Michelbach bach unter Hochspannungstrasse<br />
Abt Somporner Höhe<br />
5553441<br />
14 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 24.09.2007 Wildwiese nördlich Alzenau 3505700 Wildwiese<br />
Michelbach<br />
„Alzenauer Bocksgrund“ 5551629<br />
15 Mittelfranken Erlangen- Höchstadt 05.10.2007 Blühbrache neben Kläranla 4416622 Buntbrache<br />
Höchstadt an der Aisch ge östlich Höchstadt 5508307<br />
16 Mittelfranken Erlangen- Höchstadt 05.10.2007 Wildackermischung Offen 4416734 Buntbrache<br />
Höchstadt<br />
land an B470<br />
5507430<br />
17 Niederbayern Passau LKR Bad Füssing 07.10.2007 Buntbrache nordöstlich Bad 4597942 Buntbrache<br />
Füssing bei Pension Feutschöchlöd<br />
5358961<br />
18 Niederbayern Altötting Burghausen 07.10.2007 Buntbrache an der St 2108 4560615 Buntbrache<br />
nordwestlich <strong>von</strong> Burghausen<br />
5338910<br />
19 Mittelfranken Ansbach LKR Rothenburg 16.10.2007 Buntbrache nördöstlich 3587068 Buntbrache<br />
ob der Tauber<br />
Rothenburg 5473206<br />
20 Mittelfranken Ansbach LKR Dinkelsbühl 17.10.2007 Buntbrache nördlich Wol 3592562 Buntbrache<br />
OT Wolfertsbronn<br />
fertsbronn 5436461<br />
21 Mittelfranken Ansbach LKR Dinkelsbühl 17.10.2007 Buntbrache östlich Wol 3593514 Buntbrache<br />
OT Wolfertsbronn<br />
fertsbronn 5435943<br />
22 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3503296 Wildwiese<br />
Schwemmbogen südwestlich<br />
Alzenau<br />
5548806<br />
23 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3503171 Wildwiese<br />
Schwemmbogen südwestlich<br />
Alzenau<br />
5548535<br />
24 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3503551 Wildwiese<br />
Am Trieb südwestlich Alzenau<br />
5547979<br />
25 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3502882 Wildwiese<br />
Seewald südwestlich Alzenau<br />
5547055<br />
26 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3503895 Wildacker<br />
Gerichtsplatz südwestlich<br />
Alzenau<br />
5547273<br />
27 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Unterwald Abt. 3503850 Wildacker<br />
Gerichtsplatz südwestlich<br />
Alzenau<br />
5547476<br />
28 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Mühlmark Abt. 3504626 Wildacker<br />
Ruhberg nördlich Alzenau 5551862<br />
29 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Mühlmark Abt. 3503349 Wildacker<br />
Schäferheide nördlich Alzenau<br />
5551870<br />
30 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Mühlmark Abt. 3504151 Wildwiese<br />
Kaler Schäferberg nördlich<br />
Alzenau<br />
5553315<br />
31 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Mühlmark Abt. 3504551 Wildwiese<br />
Alzenauer Schäferberg<br />
nördlich Alzenau<br />
5553087<br />
32 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau 23.10.2007 Wildacker Mühlmark Abt 3505284 Wildacker<br />
Neuweid nördlich Alzenau 5552472<br />
33 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3506632 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5546869<br />
34 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3507228 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5546194<br />
35 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3506893 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5546079<br />
36 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3507670 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5547205<br />
37 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3508012 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5547965<br />
38 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3508674 Wildacker<br />
Hörstein<br />
Wald östlich Hörstein 5549570<br />
39 Unterfranken Aschaffenburg Mömbris OT 23.10.2007 Wildacker Hahnenkamm im 3508902 Wildacker<br />
Hemsbach<br />
Wald nordöstlich Hemsbach 5549439<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
71
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum Ortsbeschreibung G-K Typ Einsaat<br />
40 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker wegbegleitend 3508263 Wildacker<br />
Hörstein Hahnenkamm im Wald<br />
östlich Hörstein<br />
5549977<br />
41 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker wegbegleitend 3506979 Wildacker<br />
Hörstein Hahnenkamm im Wald<br />
östlich Hörstein<br />
5549094<br />
42 Unterfranken Aschaffenburg Alzenau OT 23.10.2007 Wildacker am Waldrand 3506655 Wildacker<br />
Albstadt<br />
westlich Albstadt<br />
5553367<br />
Tab. 7: Untersuchte Gartencenter und Gärtnereibetriebe.<br />
Nr. Regie- Kreis Gemeinde Datum Beschreibung WGS84 Typ<br />
rungsbezirk<br />
1 Unter- Aschaffen- Aschaffen 04.09.2007 sw Aschaffenburg-Nilkheim 49,9449971 Gärtnerei ohne<br />
franken burg Stadt burg 9,0879901 Verkauf<br />
2 Unter- Aschaffen- Maina 10.09.2007 Dehner-Gartenmarkt, Im 49,990524 Gartencenter<br />
franken burg schaff Trauenloh 3 9,082360<br />
3 Unter- Miltenberg Eisenbach 14.09.2007 Gärtnereibetrieb, Mühl 49,8353626 Gärtnerei ohne<br />
franken bei Obern strasse 9,1118108 Verkauf<br />
4 Unterfranken<br />
5 Mittelfranken<br />
burg<br />
Miltenberg Zwischen<br />
Mömlingen<br />
und Eisenbach<br />
Roth Schwans<br />
tetten<br />
14.09.2007 Baumschule Geissler, nahe<br />
der B426<br />
49,8415452<br />
9,0950729<br />
17.09.2007 Gärtnerei (nur Anbau) 49,3005589<br />
11,1036540<br />
Baumschule<br />
Gärtnerei ohne<br />
Verkauf<br />
Mittelhembach<br />
6 Mittel- Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Praktiker Gartencenter, 49,434366 Gartencenter<br />
franken Stadt Geisseestr. 65 11,041740<br />
7 Mittel- Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Gartencenter Max Bahr, 49,433074 Gartencenter<br />
franken Stadt Geisseestr. 89 11,039472<br />
8 Mittel- Nürnberg Nürnberg 17.09.2007 Gartencenter Dehner, Gus 49,434577 Gartencenter<br />
franken Stadt tav-Adolf-Str. 51a 11,039219<br />
9 Ober- Traunstein Sondermo 18.09.2007 Bioland-Gärtnerei, Chie 47,911424 Gärtnerei mit Zukauf<br />
bayern ning minger Str. 8, Gärtnerei mit 12,561071<br />
10 Ober Traunstein Traunstein 18.09.2007<br />
Verkauf<br />
Gärtnerei mit Verkauf, 47,883394 Gärtnerei mit Zukauf<br />
bayern<br />
Kotzinger Str. 1, an B304 12,632993<br />
11 Ober Traunstein Traunstein 18.09.2007 Gärtnerei mit Verkauf, 47,878377 Gärtnerei mit Zukauf<br />
bayern<br />
Wasserburger Str., an B304 12,636955<br />
12 Unter- Aschaffen- Alzenau 24.09.2007 Toom-Baumarkt, Garten 50,088964 Gartencenter<br />
franken burg center, Daimlerstr. 1 9,046391<br />
13 Unter- Aschaffen- Alzenau 24.09.2007 Fundgrube-Resteposten mit 50,0904322 Gartencenter<br />
franken burg Gartencenter, Industriestr. 3 9,0476476<br />
14 Unter- Bad Kissin- Bad Brü 25.09.2007 Sonderpostenmarkt mit 50,317741 Gartencenter<br />
franken gen ckenau Gartencenter, Industriegebiet,<br />
Römershager Str. 5<br />
9,805223<br />
15 Unter Schweinfurt Bergrhein 25.09.2007 nördlich der Ortslage an der 50,018296 Gärtnerei ohne<br />
franken Stadt feld<br />
B26 nahe Autobahn, Gärtnerei<br />
(nur Anbau), Floristik<br />
Werth, Würzburger Str.<br />
10,190577 Verkauf<br />
16 Unter- Schweinfurt Schweinfurt 26.09.2007 Gartencenter Max Bahr, 50,034878 Gartencenter<br />
franken Stadt Dieselstr. 33 10,234972<br />
17 Unter- Schweinfurt Schweinfurt 26.09.2007 Globus Gartencenter, Ru 50,033646 Gartencenter<br />
franken Stadt dolf-Diesel-Str. 24 10,240333<br />
18 Unter- Schweinfurt Schweinfurt 26.09.2007 Dehner Gartencenter, Fried 50,029221 Gartencenter<br />
franken Stadt rich-Rätzer-Str. 5 10,236230<br />
19 Ober- Bamberg Bamberg 26.09.2007 Obi-Gartencenter, Am 49,910669 Gartencenter<br />
franken Stadt Laubanger 14 10,875907<br />
20 Ober- Bamberg Bamberg 26.09.2007 Gärtnerei (nur Anbau), 49,914957 Gärtnerei ohne<br />
franken Stadt Kronacherstr. 10,895747 Verkauf<br />
21 Mittel- Erlangen- Eckental 27.09.2007 Gärtnerei Landgraf, Brander 49,576753 Gärtnerei mit Zukauf<br />
franken Höchstadt Hauptstr. 58 a 11,188354<br />
22 Mittel- Nürnberger Röthen 27.09.2007 Blumen Werner, Rückerdor 49,486617 Gärtnerei mit Zukauf<br />
franken Land bach fer Str. 50, Gärtnerei mit<br />
Verkauf<br />
11,247742<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
72
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Datum Beschreibung WGS84 Typ<br />
23 Mittel- Nürnberger Röthen 27.09.2007 Obi Röthenbach Gartencen 49,479982 Gartencenter<br />
franken Land bach ter, Am Gewerbepark 1 11,227957<br />
24 Nieder Kelheim Abensberg 27.09.2007 Obi Abensberg Gartencen 48,809999 Gartencenter<br />
bayernter,<br />
Straubinger Str. 42-44 11,860657<br />
25 Mittel Fürth LKR Fürth 05.10.2007 Garten/Blumen-Geschäft, 49,479648 Gartencenter<br />
franken<br />
Hans-Vogel-Str.<br />
11,010574<br />
26 Mittel- Nürnberger Feucht 05.10.2007 Hagebau-Gartencenter, 49,365034 Gartencenter<br />
franken Land Schwarzenbruckerstr. 1 11,205469<br />
27 Mittel Roth Roth 06.10.2007 Praktiker-Gartenmarkt, 49,245725 Gartencenter<br />
franken<br />
Gildestr. 1<br />
11,116140<br />
28 Nieder Passau LKR Pocking 07.10.2007 BayWa-Gartenmarkt, 48,405425 Gartencenter<br />
bayern<br />
Schmiedweg 14<br />
13,300730<br />
29 Nieder Passau LKR Pocking 07.10.2007 Obi-Gartenmarkt, Bürger 48,392358 Gartencenter<br />
bayernmeister<br />
Schönbauer Str. 8 13,309707<br />
30 Ober Altötting Altötting 08.10.2007 Hornbach-Gartencenter, 48,222068 Gartencenter<br />
bayern<br />
Burghauser Str., 83-85 12,691369<br />
31 Ober Altötting Altötting 08.10.2007 Praktiker-Gartencenter, 48,220728 Gartencenter<br />
bayern<br />
Daimlerstr. 3<br />
12,689685<br />
32 Ober- Altötting Burghau 08.10.2007 Gärtnerei Henker, Mehrin 48,166865 Gärtnerei mit Zukauf<br />
bayern sen ger Str. 3-9 12,829595<br />
33 Ober- Altötting Burghau 08.10.2007 BayWa-Gartenmarkt, Klau 48,175167 Gartencenter<br />
bayern sen senstr. 34 12,826922<br />
34 Ober- Traunstein Tittmoning 08.10.2007 Baumschule Kreuzer, 48.051265 Baumschule<br />
bayern Schmerbach Ecke Laufener 12776310<br />
Strasse<br />
35 Nieder- Stadt Lands- Landshut 09.10.2007 Bauhaus-Gartencenter, 48,553902 Gartencenter<br />
bayern hut Porschestr. 24-28 12,158090<br />
36 Nieder- Stadt Lands- Landshut 09.10.2007 Obi-Gartenmarkt, Neiden 48,55371 Gartencenter<br />
bayern hut burger Str. 1 12,153405<br />
37 Nieder- Stadt Lands- Landshut 09.10.2007 Praktiker-Gartenmarkt, 48,557402 Gartencenter<br />
bayern hut Industriestrasse 41 12,156799<br />
38 Schwa- Augsburg Königs 18.10.2007 Dehner Gartencenter, Hun 48,284049 Gartencenter<br />
ben LKR brunn nenstr. 45 10,880159<br />
Tab. 8: Untersuchte Bahnhöfen/Bahnanlagen.<br />
Rot unterlegt: Bahnhöfen/Bahnanlagen mit Vorkommen der Beifuß-Ambrosie.<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Ortsbezeichnung Datum G-K. Kordinaten<br />
1 Unterfranken Würzburg<br />
LKR<br />
Ochsenfurt Bahnhof Ochsenfurt 16.09.2007 3577367 5503451<br />
2 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt- Abchnitt einer Gleistrasse 16.09.2007 3574657 5505203<br />
LKR Großmannsdorf<br />
3 Unterfranken Würzburg Ochsenfurt Gleisanschluss zum Hafen Ochsen 16.09.2007 3576577 5503857<br />
LKR furt und Agrarlager der BayWa:<br />
eine Pflanze<br />
4 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg Bahnhof Nürnberg, Rothenbur 17.09.2007 4431597 5579139<br />
stadt<br />
gerstr.<br />
5 Mittelfranken Nürnberg Nürnberg Güterbahnhof Nürnberg, Koheln 17.09.2007 4432110 5478969<br />
stadt<br />
hofstr.<br />
6 Oberbayern Traunstein Traunstein Bahnhof Traunstein, stillgelegte<br />
Gleise, bei BayWa<br />
18.09.2007 4547652 5303528<br />
7 Oberbayern Berchtesga Bad Reichen Bahnhof Bad Reichenhall, Bahn 18.09.2007 4566320 5288498<br />
dener Land hallhofsgelände<br />
8 Oberbayern Berchtesga- Ainring- Bahnübergang Hammerau, Rei 18.09.2007 4571180 5296057<br />
dener Land Hammerau chenhaller Str., angrenzend Raiffeisen-Lagerhalle<br />
9 Unterfranken Aschaffen Alzenau Bahnübergang, Ortseinfahrt Alze 24.09.2007 3505366 5550166<br />
burgnau<br />
10 Unterfranken Aschaffen Alzenau „Hauptbahnhof“ Alzenau, Bahnge 24.09.2007 3504750 5550193<br />
burglände<br />
11 Unterfranken Bad Kissin Bad Brückenau Bahngelände Bad Brückenau, an 25.09.2007 3556713 5575165<br />
gen<br />
der B27, ehemaliger Ostbahnhof<br />
12 Unterfranken Schweinfurt Schweinfurt Gleise parallel der Hafenstr., Hafen 26.09.2007 3587971 5544711<br />
Stadt<br />
Schweinfurt<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
73
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Nr. Regierungsbezirk<br />
Kreis Gemeinde Ortsbezeichnung Datum G-K. Kordinaten<br />
13 Unterfranken Schweinfurt Schweinfurt Bahnhof Schweinfurt-Sennfeld, 26.09.2007 3588924 5545427<br />
Stadt<br />
gegenüber BayWa<br />
14 Unterfranken Schweinfurt Schweinfurt „Stadtbahnhof“ Schweinfurt, Am 26.09.2007 3588998 5546205<br />
Stadt<br />
Zollhof/Hafen: ca. 80 Pflanzen<br />
15 Unterfranken Schweinfurt<br />
Stadt<br />
Schweinfurt Hauptbahnhof Schweinfurt 26.09.2007 3587339 5545204<br />
16 Unterfranken Bamberg<br />
Stadt<br />
Bamberg Verladegleise, Bamberg Hafen 26.09.2007 4418441 5531125<br />
17 Mittelfranken Erlangen-<br />
Höchstadt<br />
Heroldsberg Bahnhof Heroldsberg 27.09.2007 4438549 5488374<br />
18 Mittelfranken Nürnberger Röthenbach Röthenbach, Bahnhofsplatz mit 27.09.2007 4444368 5482785<br />
Land<br />
zahlreichen Ruderalfluren<br />
19 Mittelfranken Nürnberger<br />
Land<br />
Feucht Bahnhof Feucht 05.10.2007 4442197 5472081<br />
20 Mittelfranken Roth Georgensgmünd<br />
Bahnhof Georgensgmünd 06.10.2007 4428311 5449958<br />
21 Mittelfranken Roth Allersberg- Bahnhof Allersberg (Rothsee) an 06.10.2007 4442783 5458495<br />
Altenfelden der Schnellfahrstrecke Nürnberg-<br />
Ingolstadt-München<br />
22 Oberbayern Altötting Burgkirchen Bahnhof Burgkirchen 08.10.2007 4554110 5336995<br />
23 Oberbayern Altötting Burgkirchen-<br />
Pirach<br />
Bahnhof Pirach 08.10.2007 4556650 5334494<br />
24 Unterfranken Würzburg Würzburg Hauptbahnhof Würzburg: eine 16.10.2007 3567688 5518687<br />
Stadt<br />
Pflanze 40 cm hoch<br />
25 Mittelfranken Ansbach Rothenburg o. Bahnhof Rothenburg o. d. T. 16.10.2007 3586553 5471780<br />
LKR d. T.<br />
26 Mittelfranken Ansbach<br />
LKR<br />
Feuchtwangen Bahnhof Feuchtwangen 16.10.2007 3596535 5449096<br />
27 Mittelfranken Ansbach<br />
LKR<br />
Dinkelsbühl Bahnhof Dinkelsbühl 16.10.2007 3597179 5437681<br />
28 Schwaben Donau-Ries Nördlingen Bahnhof Nördlingen 17.10.2007 3609931 5413680<br />
29 Schwaben Donau-Ries Möttingen Bahnhof Möttingen 17.10.2007 4397120 5408632<br />
30 Schwaben Augsburg<br />
LKR<br />
Meitingen Bahnhof Meitingen 17.10.2007 4415029 5379310<br />
31 Schwaben Augsburg<br />
Stadt<br />
Augsburg Bahnhof Augsburg 18.10.2007 4417811 5358929<br />
32 Unterfranken Aschaffen Aschaffenburg Gleisanbindung im Hafen Aschaffe 04.09.2007 3507126 5537306<br />
burg Stadt<br />
burg<br />
9.2 Danksagung<br />
Dem Bayerischen <strong>Staatsministerium</strong> für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz danken<br />
wir für die Finanzierung der Studie.<br />
Umfangreiche Auskünfte und Hinweise erhielten wir <strong>von</strong> den Ambrosia-Ansprechpartnern auf<br />
Eben der Landkreise und Gemeinden, <strong>von</strong> mehreren Autobahnmeistereien, sowie <strong>von</strong> der<br />
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Freisingen-Weihenstephan.<br />
Hinweise erhielten wir weiterhin <strong>von</strong>: Prof. Dr. Brandes (Univ. Braunschweig), A. Braun (Freiburg),<br />
Dr. H. Gebhardt (LUBW, Baden Württemberg), K. Gehring (LfL), K. Graeber (Bad Oldesloe),<br />
N. Grimbach (Dormagen), Dr. S. Heringer (ANL), Dr. W. Joswig (ANL), G. Poppow<br />
(Schweiz), R. Schatz (Dresden), Dr. J. Schächtl (LfL), H. Schäfer, Dr. U. Schmitz (Univ. Düsseldorf),<br />
P. Sturm (ANL), Dr. W. Zahlheimer (Regierung Niederbayern).<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
74
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
9.3 Muster der Erfassungsbögen<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
75
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
76
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
77
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
78
Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie<br />
Dr. Stefan Nawrath & Dr. Beate Alberternst Mai 2008<br />
79